Verzeichnis der verkauften Gemälde im deutschsprachigen Raum vor 1800 9783110948554, 9783598244902
264 39 272MB
German Pages 2401 [2416] Year 2002
Polecaj historie

Table of contents :
Band 1
Vorwort und Danksagung
Einleitung
Das Auktionswesen des 18. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum
Hinweise zur Benutzung der Verzeichnisse
Literaturverzeichnis und Sigel
Verzeichnis der Kataloge
Verzeichnis der Gemälde nach Künstlern A-Hi
Band 2
Verzeichnis der Gemälde nach Künstlern Ho-S
Band 3
Verzeichnis der Gemälde nach Künstlern T-Z und Anonyme
Index der Besitzer
Index der Vorbesitzer
Citation preview
Das Verzeichnis der verkauften Gemälde im deutschsprachigen Raum vor 1800 ist ein Gemeinschaftsprojekt von: HAMBURGER KUNSTHALLE Hamburg THE PROVENANCE INDEX GETTY RESEARCH INSTITUTE Los Angeles Weitere Mitglieder des Provenance Documentation Collaborative: UNIVERSITE MICHEL DE MONTAIGNE DOMAINE UNIVERSITAIRE Bordeaux MUSEES ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE Bruxelles RIJKSBUREAU VOOR KUNSTHISTORISCHE DOCUMENTATIE Den Haag PIETER BIESBOER Haarlem THE PAUL MELLON CENTRE FOR STUDIES IN BRITISH ART London ARCHIVES NATIONALES Paris INSTITUT NATIONAL D'HISTOIRE DE L'ART Paris ISTITUTO NAZIONALE DI ARCHEOLOGIA Ε ARTE Roma SOPRINTENDENZA PER I Β ENI ARTISTICIΕ STORICI Roma HERMITAGE MUSEUM St. Petersburg UNIVERSITÄ DEGLI STUDI DI SlENA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ARCHEOLOGIA Ε STORIA DELL'ARTE Siena FONDAZIONE DELL' ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO Torino THE NATIONAL GALLERY OF ART Washington, D.C.
The Index of Paintings Sold in German-speaking Countries before 1800 Volume 1: A - H i Thomas Ketelsen Tilmann von Stockhausen Edited by Burton B. Fredericksen Julia I. Armstrong Assisted by Michael Müller
The Provenance Index of the Getty Research Institute K G · Saur München 2002
Verzeichnis der verkauften Gemälde im deutschsprachigen Raum vor 1800 Band 1: A - H i Thomas Ketelsen Tilmann von Stockhausen Herausgegeben von Burton Β. Fredericksen Julia I. Armstrong Unter Mitarbeit von Michael Müller
The Provenance Index of the Getty Research Institute K G · Saur München 2002
Die Deutsche Bibliothek - CIP -Einheitsaufnahme Ketelsen, Thomas: The index of paintings sold in german-speaking countries before 1800 : the provenance index of the Getty Research Institute = Verzeichnis der verkauften Gemälde im deutschsprachigen Raum vor 1800 / Thomas Ketelsen ; Tilmann von Stockhausen. Hrsg. von Burton Β. Fredericksen ; Julia I. Armstrong. Unter Mitarb. von Michael Müller. - Munich : Saur ISBN 3-598-24490-8 Band 1. A - Hi. - 2002
® Printed on acid-free paper © 2002 by K.G. Saur Verlag GmbH, München Printed in the Federal Republic of Germany All rights strictly reserved. No part of this publication maybe reproduced without permission in writing from the publisher. Digiset data preparation and automatic data processing by bsix GmbH, Braunschweig Printed and Bound by Strauss Offsetdruck, Mörlenbach ISBN 3-598-24490-8 (3 Volumes)
Inhalt Band 1 Vorwort und Danksagung Einleitung Das Auktionswesen des 18. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum Hinweise zur Benutzung der Verzeichnisse Literaturverzeichnis und Sigel Verzeichnis der Kataloge Verzeichnis der Gemälde nach Künstlern A-Hi
Band 2 805 Verzeichnis der Gemälde nach Künstlern Ho-S
Band 3 1587 Verzeichnis der Gemälde nach Künstlern T-Z und Anonyme 2311 Index der Besitzer 2401 Index der Vorbesitzer
Vorwort und Danksagung Burton B. Fredericksen
Für den deutschen Sprachraum des 17. und 18. Jahrhunderts kann man nicht in derselben Weise von einem "Kunstmarkt" sprechen wie für andere Regionen nördlich der Alpen, Frankreich etwa, Großbritannien oder die Niederlande. Im allgemeinen ist davon auszugehen, daß es überall dort, wo Kunst hergestellt wurde, auch einen Kunstmarkt gab. Bis weit in das 17. Jahrhundert hinein wurde der Handel mit Kunstwerken hauptsächlich von einzelnen Händlern bestritten, die sich eine gewisse Kennerschaft angeeignet hatten. Sie kauften und verkauften Gemälde in einem recht überschaubaren Umkreis und versorgten eine relativ kleine Klientel. Doch früh schon bildeten andererseits die ambitioniertesten Händler ein lose geknüpftes Netzwerk gleichgesinnter Unternehmer, das dazu diente, die verschiedenen Teile des Kontinents zu verbinden. Dabei schufen sie nach und nach eine Art gesamteuropäischen Markt, der später die internationale Ausprägung annahm, die uns heute geläufig ist. In Deutschland war das prominenteste Beispiel für diesen Typus Everhard IV. Jabach (1607/12-1695), der aus Köln stammte, in großem Stil mit Gemälden und Zeichnungen handelte und in vielen Teilen Europas tätig war, vor allem in Frankreich, wo einige der größten Sammler zu seinen Kunden zählten, unter ihnen Ludwig XIV. Jabach und sein gleichnamiger Vater sind zugleich frühe Beispiele des außerordentlich erfolgreichen und kennerschaftlich gebildeten Kunsthändlers, dessen Unternehmen sich zu einem Familienbetrieb entwickelte, eine Vorform der Unternehmen, die später so wichtig für den Kunsthandel werden sollten. Eben zu dieser Zeit traten auch die charakteristischen äußeren Merkmale des professionellen Kunsthandels erstmals in Erscheinung, etwa die Kunstauktion oder öffentlich zugängliche Schauräume. Aus noch ungeklärten Gründen setzten sich solche Einrichtungen eher im Norden als im Süden durch, obwohl von den meisten Kennern, zumindest bis zum 16. Jahrhundert, Italien als die eigentliche Schatzkammer betrachtet wurde, in der man die begehrtesten Kunstwerke finden konnte. Zwar fanden in Italien und Spanien Auktionen und Ausstellungen statt, doch kam dies nur selten vor, und sie wurden weder von einem gedruckten Katalog begleitet, noch wurden sie, soweit wir wissen, von Personen veranstaltet, die man als Auktionatoren oder Experten bezeichnen könnte. Diese Praktiken etablierten sich zuerst in den Niederlanden, und von diesem Modell leiten sich die ersten Versuche in Frankreich, Großbritannien und Deutschland ab, dem Kunsthandel festere Formen zu geben. Das Aufkommen von Auktionen, die ursprünglich vorwiegend für den Verkauf von Büchern veranstaltet wurden, erlaubte es, eine größere Anzahl von Objekten zu einer festgelegten Zeit an einem bestimmten Ort zu verkaufen. Zunächst wurden bei der Versteigerung von Bibliotheken nur einige verstreute Drucke oder Gemälde beigefügt. Dann widmete man immer mehr Auktionen ganz dem Verkauf von Luxusgütem, zu denen auch Kunstwerke zählten. Man kann dies wahrscheinlich zum Teil auf eine Angebotsschwemme zurückführen, als die Händler von der Masse der zum Verkauf stehenden Kunstwerke überwältigt wurden. Auktionen boten zudem eine transparentere und in gewisser Weise auch eine weniger exklusive
Lösung für das gestiegene Handelsaufkommen und waren deshalb wohl der Kultur und wirtschaftlichen Mentalität der Niederländer angemessener als der anderer Völker dieser Epoche. Es ist auch zu berücksichtigen, daß in den Niederlanden der wirtschaftliche Modernisierungsprozeß schon früh einsetzte, was unter anderem dazu führte, daß die öffentliche Versteigerung der unterschiedlichsten Güter bereits im 17. Jahrhundert gängige Praxis war. Jedenfalls setzte sich das Auktionswesen in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts zunächst in Den Haag, Leiden, Antwerpen und schließlich in Amsterdam durch, um sich dann zügig in Frankreich, Großbritannien und Deutschland auszubreiten. Da die Tätigkeit der Kunsthändler bei Auktionen öffentlich vonstatten ging und deshalb für den Historiker am besten greifbar ist, können Versteigerungen als ein leicht zu handhabender Indikator für die Ausdehnung des Kunstmarktes insgesamt dienen. Im Vergleich zu anderen Regionen war der Kunstmarkt in den nördlichen Niederlanden zugleich dezentraler und konzentrierter. Das lag vor allem an der geringen Größe der Provinz Holland, in der die wichtigsten Kunstzentren angesiedelt waren. Auch wenn Amsterdam schließlich den dortigen Kunstmarkt dominieren sollte, so vollzog sich diese Konzentration auf eine Stadt doch langsam, und der Erfolg Amsterdams hinderte die anderen Städte nicht, ihre eigenen lokalen Kunstmärkte auszubilden, die gelegentlich durchaus in der Lage waren, mit dem der größeren Stadt in Konkurrenz zu treten. Entsprechendes gilt für die südlichen Provinzen, wo Antwerpen anfänglich die Vorherrschaft hatte, sich aber einer sehr regen Konkurrenz anderer Städte, in erster Linie Brüssels, gegenübersah. Andererseits erlaubten die geringen Entfernungen zwischen den einzelnen Städten einem Besucher oder Käufer ohne großen Aufwand, Waren an mehr als einem Ort zu kaufen, was zusätzlich Fremde anlockte, die nach aus diesen Regionen stammenden Kunstwerken Ausschau hielten. Die Märkte in England und Frankreich unterschieden sich notwendigerweise von dem holländischen Vorbild, obwohl sie unter dessen Einfluß standen. London und Paris entwickelten sich schon sehr früh zu außerordentlich wichtigen Zentren für derartige Aktivitäten und überflügelten damit bei weitem ihre Konkurrenten. Während aber im Verlauf des 18. Jahrhunderts die Franzosen einen extrem kultivierten und geradezu gelehrten Kunstmarkt aufbauten, der sich in anspruchsvollen Auktionskatalogen niederschlug, die ebenso verfeinert waren, wie die in dieser Zeit entstandene französische Kunst, folgte der britische Markt einfacheren Prinzipien. Diese Beschränkung auf das Wesentliche entsprach vielleicht einer geringeren Neigung, den gehandelten Objekten eine herausragende Stellung einzuräumen, vielleicht war aber auch einfach eine stärkere Orientierung an der geschäftlichen Seite des Kunsthandels ausschlaggebend. Im Vergleich zu diesen regionalen Märkten waren die Kunstmärkte Mitteleuropas, dessen Kem das Mosaik der deutschen Fürstentümer und Reichsstädte bildete, von vornherein zu zersplittert, um ein entsprechendes organisatorisches Niveau erreichen zu 7
können. Erst in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts trat die dominierende Stellung von Frankfurt am Main und Hamburg als Kunsthandelszentren in Erscheinung, und so scheint es sich anzubieten, die Entwicklung in den wichtigsten Städten getrennt zu beschreiben, obwohl sich die in den unterschiedlichen Gegenden Deutschlands angebotenen Kunstwerke in ihrem Charakter nicht grundsätzlich unterschieden. Erwartungsgemäß wurden die Werke zeitgenössischer deutscher Künstler in den Städten angeboten, in denen sie tätig waren. Offensichtlich gab es aber einen regeren Austausch zwischen den deutschen Städten und auswärtigen Kunstmärkten, etwa zwischen Hamburg und den Niederlanden oder Frankfurt und Paris, als unter den verschiedenen deutschen Städten selbst. So wurde beispielsweise der Hamburger Markt vorwiegend aus Amsterdamer Quellen und durch die lokalen Künstler gespeist, während nur spärliche Verbindungen zu anderen deutschen Märkten, etwa Berlin oder Leipzig, bestanden. Allerdings läßt sich in der gesamten Region ein vorherrschender Geschmack für holländische und flämische Kunst beobachten, so daß es letztendlich wohl doch sinnvoll ist, die verschiedenen lokalen Märkte als eine Gruppe und nicht als getrennte Einheiten zu betrachten.
grenzte internationale Nachfrage, die meisten waren außerhalb ihrer Heimatregion kaum bekannt. Im Kunsthandel verliefen die Warenströme meist von West nach Ost, und deutsche Sammler nahmen seit jeher einen erheblichen Teil der aus den Niederlanden exportierten Werke auf, wenn es sich dabei auch nicht unbedingt um die teuersten und geschätztesten handelte, da diese zum Großteil zum Wiederverkauf auf die größeren Handelsplätze in Paris oder London gelangten. Aber gerade weil der deutsche Markt im Vergleich zu Amsterdam, Paris oder London so schlecht dokumentiert ist, sollte man mit großen, umfassenden Charakterisierungen der deutschen Sammlungen vorsichtig umgehen. Verhältnismäßig wenige der in den vorliegenden Bänden verzeichneten Gemälde konnten identifiziert werden, und obwohl ein Verzeichnis der bei öffentlichen Verkäufen und Auktionen verkauften Bilder einen großen Schritt für das Verständnis der Aktivitäten in dieser Region darstellt, ist doch ebenso gewiß, daß eine große Zahl von Versteigerungskatalogen für immer verloren sind und daß unsere Zahlen weiterhin sehr unvollständig bleiben.
Selbstverständlich fand schon deutlich vor dem 15. Jahrhundert ein Austausch von Kunstwerken auf den Handelsrouten zwischen Deutschland und den Niederlanden statt, und angesichts der kulturellen und historischen Verbindungen zwischen den beiden Regionen ist verständlich, daß im 17. und den nachfolgenden Jahrhunderten der deutsche Geschmack die niederländische Kunst mehr schätzte als die anderer Länder. In geringem Umfang fanden auch Werke der italienischen Kunst ihren Weg nach Mitteleuropa, vorwiegend über Wien oder Bayern, doch überrascht es kaum, daß bei deutschen Auktionen nur eine geringe Zahl von italienischen Bildern anzutreffen war. Italienische Kunst wurde normalerweise von Fürstenhäusern durch Agenten in Italien erworben, und es kam nicht häufig vor, daß solche Sammlungen durch einen öffentlichen Verkauf zerstreut wurden. Spanische Bilder waren im nordalpinen Raum nahezu unbekannt.
* * *
Weniger vorhersehbar war die doch recht geringe Anzahl von französischen Gemälden, die in Mitteleuropa - ebenso wie in den Niederlanden - vor dem 19. Jahrhundert in Umlauf waren. Obwohl der französische Geschmack während des 18. Jahrhunderts in den meisten Regionen des nördlichen Europa vorherrschte, wurden französische Bilder nicht in größerem Umfang gesammelt, wenn man von wenigen Höfen absieht, etwa dem preußischen, dem des polnischen Königs in Dresden oder in geringerem Umfang dem badischen Hof. Es wäre zu erwarten gewesen, daß Frankfurt aufgrund seiner Nähe zu Paris einen Zufluß von Kunstwerken der Nachbarn aufzuweisen hätte, und einiges weist darauf hin, daß tatsächlich einige Sammlungen nach Frankfurt gebracht wurden, um hier veräußert zu werden. Die Auswertung der Statistik wird aber ergeben, daß dabei nicht sehr viele Werke französischer Künstler umgesetzt wurden. Und obwohl die meisten französischen Bilder vor 1770 offensichtlich über Frankfurt nach Deutschland gelangten, findet man bei späteren Hamburger Versteigerungen eine sehr viel größere Anzahl französischer Werke. Für Gemälde aus den Niederlanden war selbstverständlich Hamburg der naheliegendste Umschlagplatz, und es ist wahrscheinlich auch seiner Lage und dem Hafen zu verdanken, daß Hamburg sich zum aktivsten Kunsthandelsplatz unter den deutschen Städten entwickelte. Nach Hamburg kamen zudem zahlreiche Werke aus Dänemark und Schweden. Trotz der immer noch schwierigen Quellenlage besteht kaum ein Zweifel, daß einzelne Händler und Sammler aus dem mitteleuropäischen Raum regelmäßige Streifzüge in Amsterdam und anderen holländischen Städten unternahmen, um Gemälde zu erwerben, die schließlich auf den Hamburger Markt gelangten, manchmal direkt, häufig erst zu einem späteren Zeitpunkt. Es ist besonders offensichtlich, daß die deutschsprachigen Staaten in erster Linie Kunstwerke ein- und nicht ausführten. Von einigen sehr berühmten Künstlern wie Dürer, Holbein und Elsheimer abgesehen, gab es für die Werke deutscher Künstler nur eine sehr be-
8
Die vorliegenden drei Bände setzen die Tradition unserer Publikationen zur Inhaltserschließung von Auktionskatalogen aus Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden fort, doch unterscheiden sie sich zugleich von früheren Publikationen in einigen wichtigen Punkten. Ihr Umfang erreicht mehr als das Doppelte jedes der vorangehenden Verzeichnisse, und sie sind erstmals Verkäufen des 17. und 18., nicht des 19. Jahrhunderts gewidmet. Eigentlich sollte die Entscheidung, nur die älteren Kataloge zu behandeln, den Umfang und die Dauer des Projekts in Grenzen halten, doch führte es im Laufe seiner Entwicklung zu unerwarteten Ergebnissen, und es dauerte schließlich länger, zu einem Abschluß zu kommen, als wir ahnen konnten. Ein erster Vorschlag, ein Projekt zur Auswertung von deutschen Auktionskatalogen in Angriff zu nehmen, wurde vom Verfasser dieser Zeilen zwei Kollegen in Berlin und München unterbreitet, die umgehend darauf hinwiesen, daß der größte Bestand früher Versteigerungskataloge in der Hamburger Kunsthalle verwahrt werde. Dies führte im Frühjahr 1992 zu einem Treffen mit dem damaligen Leiter der Gemäldesammlung, Helmut R. Leppien, der mit dem ihm eigenen Enthusiasmus sein Interesse an einem solchen Projekt zum Ausdruck brachte. Er beantragte Mittel bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die eine großzügige Unterstützung für zweieinhalb Jahre zusagte. So konnte Thomas Ketelsen, der über die landgräflichen Sammlungen in Kassel geforscht hatte und über beachtliches Fachwissen zur Geschichte des Kunstsammelns verfügte, mit der Arbeit am Projekt beginnen, indem er zunächst die Hamburger Kataloge in einer Datenbank erfaßte. Gleichzeitig suchten wir in einschlägigen Bibliotheken und Archiven nach weiteren Versteigerungskatalogen. Dem Direktor der Hamburger Kunsthalle, Uwe M. Schneede, der das Projekt von dieser frühen Phase an mit großer Begeisterung begleitet und nach Kräften unterstützt hat, sind wir zu besonderem Dank verpflichtet. Ursprünglich sollte das Projekt ganz Skandinavien und Mitteleuropa abdecken, einschließlich Polen und Tschechien, wobei das Hauptaugenmerk selbstverständlich dem deutschen Raum gelten sollte. Dies hätte uns erlaubt, alle nordalpinen Kataloge zu behandeln, die nicht von unseren anderen Projekten zu den größeren Kunstmärkten in Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden und Belgien erschlossen wurden. Die Auswertung des ersten Bandes von Frits Lugts Repertoire des catalogues de ventes (1938) ergab eine Liste von etwa 150 Katalogen, von denen rund 120 aus Deutschland stammten. In vielen von ihnen war nur eine geringe Anzahl von Gemälden verzeichnet. Die Einbeziehung der erhaltenen polnischen und tschechischen Kataloge brachte keine Überraschungen. Lugt kannte lediglich die Versteigerung der Sammlung Potocki in Warschau; dem hatten wir nur zwei Kataloge aus Prag hinzuzufügen.
Dagegen übertrafen die Kataloge aus Dänemark und Schweden, wo Frits Lugt offensichtlich einen nur halbherzigen Streifzug unternommen hatte, bei weitem unsere Erwartungen. Wir fanden hier 79 Kataloge, von denen fast nur die Hälfte bei Lugt nachgewiesen ist. Noch überraschender war die Zahl der deutschen Kataloge, die an verschiedenen, oft unerwarteten Orten ermittelt werden konnten. Insgesamt wurden 177 Kataloge aus diesem Zeitraum nachgewiesen, die bei Lugt nicht erwähnt sind. Damit hatte sich der Umfang des Projekts seit seinen bescheidenen Anfängen mehr als verdoppelt. So haben wir uns entschlossen, die skandinavischen Kataloge bei diesem Projekt nicht mit aufzunehmen. Sie wurden allerdings katalogisiert und sind über die Website des Provenance Index zugänglich. Das berücksichtigte Material repräsentiert also alle deutschsprachigen Länder, wie es nun auch im Titel heißt, sowie Warschau, das traditionell eher auf den französischen als auf den deutschen Kulturkreis ausgerichtet war. Durch den Ausschluß der skandinavischen Länder reduzierte sich die Zahl der behandelten Kataloge auf 298, wobei es sich in zwei Fällen lediglich um Varianten zur selben Versteigerung handelt. Es brauchte die gesamten neun Jahre, die seit Beginn des Projekts vergangen sind, um die zusätzlichen Kataloge ausfindig zu machen, und selbst jetzt konnten nicht alle eingesehen werden. Thomas Ketelsen hat in besonderem Maße dazu beigetragen, die meisten von ihnen nachzuweisen. Bedingt durch den dezentralen Charakter des deutschen Kulturkreises und des damaligen Kunstmarkts in seinen Territorien war die Erfassung ein schwieriges und langwieriges Unterfangen, das unvollkommen bleiben muß. Zwar stellte sich bald heraus, daß sich das deutsche Auktionswesen auf Hamburg und Frankfurt konzentrierte, doch fanden sich zahlreiche Kataloge auch in kleineren Städten und Archiven, manchmal nur in Form eines handschriftlichen Protokolls einer Versteigerung, für die nie ein Katalog gedruckt worden war. Aus Erwähnungen von Versteigerungen in Akten und Zeitungen läßt sich schließen, daß viele Kataloge ganz verloren gingen, und selbst Kataloge, die noch in den 1930er Jahren erwähnt wurden, sind nicht mehr aufzufinden. Zweifellos werden weitere Kataloge und weitere Exemplare uns bekannter Kataloge identifiziert werden. Die Suche hätte endlos fortgesetzt werden können. Wir haben zwar bis zur letzten Minute neu gefundene Kataloge berücksichtigt, doch wurde 1997 beschlossen, die Nachforschungen zu einem Abschluß zu bringen. Die folgenden Phasen des Projekts waren nicht weniger schwierig als das Zusammentragen des Materials. Das Verständnis der Kataloge wurde durch ihren uneinheitlichen Charakter und die in ihnen verwendete Sprache erschwert. Da einige Kataloge nur in handschriftlicher Form vorlagen, ergab sich eine weitere Fehlerquelle. Man kann allgemeine Aussagen über den französischen Kunstmarkt treffen, wenn man sich auf Paris, über den englischen, wenn man sich auf London konzentriert. Generalisierende Aussagen über Deutschland und Mitteleuropa sind demgegenüber sehr viel schwieriger zu gewinnen. Festzustellen, welche Währung an einem der vielen Orte dieses Territoriums verwendet wurde, ist nur eine der vielfältigen Schwierigkeiten, denen sich ein solches Projekt gegenübersieht. Außerdem wurde zu deutschen Auktionen dieser Zeit sehr viel weniger publiziert, und die Dokumentationen von Kunstsammlungen sind spärlicher und schwerer zugänglich. Der vorliegenden Publikation sind nur wenige Aufsätze und Bücher vorangegangen, und obwohl hier Material in großem Umfang erstmals zugänglich gemacht wird, ist doch unverkennbar, daß noch sehr viel Arbeit zu leisten ist, bevor man zu einem ähnlichen Grad der Vollständigkeit gelangt, der für den englischen Kunstmarkt erreicht wurde. Es hat zum Erfolg unseres Projekts wesentlich beigetragen, daß Tilmann von Stockhausen zur rechten Zeit zu uns gestoßen ist. Er wurde eingeladen, 1998/99 als Volontär an den Provenance Index zu kommen und arbeitete ursprünglich in einem Team, das für die redaktionelle Bearbeitung der gewaltigen Datenmengen verantwortlich war. Doch auf Grund seiner umfassenden Kenntnisse über die deutschen Quellenbestände und die Berliner Sammlungsgeschichte begann er schon bald, einzelne Versteigerungen zu analysieren und
zusammen mit Thomas Ketelsen die entsprechenden Texte zu verfassen. Später wurde er angestellt, um diese Arbeit in Deutschland fortzusetzen, und er blieb dem Projekt auch dann mit ganzem Engagement verbunden, als wir längst nicht mehr in der Lage waren, ihn weiter zu beschäftigen. Thomas Ketelsen und ich haben immer wieder Informationen beigesteuert, die dazu beigetragen haben, viele Sammler und Händler zu identifizieren, die in diesem Zeitraum tätig waren, und den Verbleib zahlreicher Kunstwerke zu ermitteln. Ein großer Teil der Dokumentation wurde jedoch von Herrn von Stockhausen fertiggestellt. Es ist fraglich, ob das Projekt ohne seine Mitwirkung überhaupt hätte abgeschlossen werden können. Für das große Engagement, mit dem er das Projekt angegangen ist, sind wir ihm außerordentlich dankbar. Wie bei allen unseren bisherigen Publikationen, die der Auswertung von Versteigerungskatalogen gewidmet sind, liegt die Verantwortung für die Redaktion der Datenbestände und der begleitenden Texte bei mir, doch konnte ich mich erneut auf Julia Armstrong stützen, die für die Standardisierung der Erfassung und die Verläßlichkeit der Daten sorgte. Frau Armstrong konnte zahlreiche Fehler und Schwachstellen beseitigen, die die Benutzbarkeit der Bände erheblich vermindert hätten. Da wir es mit einem extrem umfangreichen und komplexen Datenbestand zu tun hatten, waren zahllose Probleme während der zwei- bis dreijährigen Phase zu bewältigen, die für die sorgfältige Redaktion all dieser Daten notwendig war. Ohne ihre rigorosen und systematischen Überprüfungen wäre die vorliegende Publikation ohne Zweifel eine sehr viel weniger zuverlässige Quelle geworden. Während des letzten Jahres der Redaktionsphase hatten wir zudem das Glück, Michael Müller in unserem Team zu haben. Er arbeitete nicht nur an der Redaktion der deutschen Texte mit, sondern steuerte auch Vorschläge und Empfehlungen inhaltlicher Art bei. Über die weite Distanz hinweg arbeitete er mit Tilmann von Stockhausen zusammen und leitete den abschließenden Korrekturvorgang, der bei einem solchen Projekt unausweichlich ist. Seine Mitarbeit erleichterte die letzten Arbeitsschritte erheblich und führte zu einer Verläßlichkeit, die sonst nicht möglich gewesen wäre. Bei der Korrektur der Texte wurde er von Hans J. Schacht unterstützt. Die Identifizierung und Namensansetzung der Künstler wurde auch dieses Mal hauptsächlich von unserer Spezialistin Patricia Teter geleistet, die sich zwischenzeitlich der Aufgabe gegenüber sah, etwa 35.000 neue Varianten von Künstlernamen zu identifizieren. Bei diesem Unterfangen stießen wir auf größere Probleme als bei vorangegangenen Projekten. Das lag zunächst an der mangelhaften Orthographie und Typographie, die man in älteren Versteigerungskatalogen antrifft, aber auch daran, daß viele Künstler ähnliche Namen hatten oder zu derselben Familie gehörten, was es oft unmöglich machte, sie mit Sicherheit zu identifizieren. So war es nicht zu vermeiden, daß ein ungewöhnlich großer Anteil unidentifiziert blieb, doch die überwiegende Mehrheit der erwähnten Künstler wurde von Patricia Teter, die diese Aufgabe in wenigen Jahren fast ganz allein bewältigte, dingfest gemacht und in der Schreibweise standardisiert. Die technische Aufgabe, die Datensätze zusammenzustellen, zu übertragen und in verschiedenen Formaten aufzubereiten, wurde auch bei diesem Projekt von unserer Leiterin der Technischen Systeme, Elizabeth Spatz, übernommen. Deutsche Dokumente des 18. Jahrhunderts zu digitalisieren und aus unterschiedlichen Quellen ein in sich schlüssiges und abfragbares Ganzes zu bilden, stellte eine Herausforderung dar, die über das gewöhnliche Maß hinausging. Frau Spatz hat sie stets mit großer Souveränität gemeistert, und wir sind ihr für das gezeigte Durchhaltevermögen zu Dank verpflichtet. Viele der Korrekturen am Datenbestand wurden von Maria Gilbert ausgeführt. Sie wurde dabei von A. Alexa Schnitzler-Sekyra und Anne Merrem unterstützt, die beide lange Monate damit zubrachten, Daten gegenzulesen, um Fehler zu entfernen. Frau Sekyra gilt unser besonderer Dank für ihr Geschick bei der Entzifferung bestimmter Manuskripte, besonders der Versteigerung der Sammlung des Kurfürsten Clemens August (1764), sowie der Ermittlung der
9
richtigen Schreibweise vieler Namen und Titel. Daran hatte bereits Philipp Gollner gearbeitet, bevor er seine Ausbildung an der Universität fortsetzte. Wie immer hat sich Carol Togneri als organisatorische Leiterin der Abteilung von Zeit zu Zeit eingeschaltet, um sicherzustellen, daß die Arbeit so effizient wie möglich vonstatten ging und das gesamte Unternehmen reibungslos vorankam. Ihr Name erscheint, wie der vieler der zuvor genannten Personen, nicht auf der Titelseite, doch war ihr Beitrag von unzweifelhaftem Wert für uns alle. Die vorliegenden Bände hätten ohne die Hilfsbereitschaft und die tatkräftige Unterstützung zahlreicher Kollegen und Freunde nicht fertiggestellt werden können. Wir möchten deshalb den folgenden Personen unseren besonderen Dank aussprechen: Dr. Norbert Andernach, Nordrhein-Westfälisches Hauptstaatsarchiv; M. Bähr, Sächsisches Staatsarchiv Leipzig, Zentralstelle für Genealogie; Dr. Ulrich Barth, Staatsarchiv des Kantons Basel-Stadt; Dr. Karl Ferdinand Beßelmann, Universitäts- und Stadtbibliothek Köln; Dr. Claudia Brink, Dresden; Carla Calov, Stadtarchiv Leipzig; Gerd Dethlefs, Stadtmuseum Münster; Dr. Christian Dittrich, Staatliche Kunstsammlungen Dresden; Dr. Armgard Gräfin zu Dohna, Rheden; Dr. Robert Dünki, Stadtarchiv Zürich; Ulrike Dura, Stadtgeschichtliches Museum Leipzig; Dr. Hans-Wilhelm Eckhardt, Staatsarchiv Hamburg; Dr. Konrad Elmshäuser, Staatsarchiv Bremen; Dr. Manfred Garzmann, Stadtarchiv Bamberg; Prof. Dr. Bodo Gotzkowsky, Fulda/New Orleans; Dr. Uta Grund, Köln; Dr. Eberhard Iiiner, Historisches Archiv der Stadt Köln; Günther Handel, Stadtarchiv Regensburg; Volker Harms-Ziegler, Institut für Stadtgeschichte, Frankfurt am Main; Dr. Klaus Heller, Zwischenstaatliche Kommission für deutsche Rechtschreibung; Irmgard Hofmann, Staatsbibliothek Bamberg; Dr. Karsten Hommel, Leipzig; Wendelin Graf von Kage-
10
neck, Freiburg im Breisgau; Dr. Peter Königfeld, Hannover; Marianne Küffner, Kunsthandlung Börner, Düsseldorf; Gerhard Loh, Leipzig; Dr. K. Malinovski, St. Petersburg; Dr. Bernd M. Mayer, Wolfegg; Prof. Dr. Michael North, Greifswald; Eberhard Patzig, Museum für Kunsthandwerk im Grassimuseum Leipzig; Dr. Hans Puchta, Bayerisches Hauptstaatsarchiv; Dr. Bernhard Reichel, Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main; Dr. Alheidis von Rohr, Historisches Museum der Stadt Hannover; Prof. Dr. Bernhard Schemmel, Staatsbibliothek Bamberg; Tilo Schoefbeck, Berlin; Dr. Sally Schöne, Düsseldorf; Dr. Gero Seelig; Dr. Lothar Sickel, Hamburg; Dr. Ulrich Simon, Archiv der Hansestadt Lübeck; Prof. Dr. H. M. Schwarzmaier, Verwaltung des Großherzogl. Familienbesitzes, Karlsruhe; Prof. Dr. Karl-Ludwig Selig, New York; Giesela Stübler, Staats- und Stadtbibliothek Augsburg; Dr. Horst Vey, Karlsruhe; Dr. Werner Wagenhöfer, Staatsarchiv Würzburg; Gerrit Walczak, Hamburg; Dr. Claudia Wedepohl, Hamburg; Dr. Siegfried Wenisch, Bayerisches Hauptstaatsarchiv; Dr. Kurt Wettengl, Historisches Museum; Katharina Witter, Thüringisches Staatsarchiv Meiningen; Prof. Dr. Carsten Zelle, Bochum; Dr. Jürgen Zimmer, Kunstbibliothek SMB-PK; Dr. Erdmann Weyrauch, Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel. Es gilt schließlich Herrn Dr. K.G. Saur dafür zu danken, die Publikation der vorliegenden Bände übernommen zu haben. Sein Team war für diese Aufgabe besonders gut gerüstet; ihre Vorschläge zu Herstellung und Format haben beträchtlich dazu beigetragen, den Umfang der Bände auf das gegenwärtige Maß zu beschränken. Burton B. Fredericksen Brentwood, Los Angeles, im Februar 2001
Einleitung
Das Auktionswesen des 18. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum Mit Gerard Hoets Catalogus ofNaamlyst van Schilderyen (1752) war im Umriß erstmals ein Projekt skizziert, das knapp zweihundert Jahre später von Frits Lugt in seinem vierbändigen Repertoire des catalogues de ventes zu seinem Abschluß geführt wurde. Der Künstler und Sammler Gerard Hoet hatte damit begonnen, niederländische Auktionskataloge zu sammeln und mit den Angaben der auf den Auktionen in Amsterdam und Den Haag erzielten Preise wiederabzudrucken. Seine Publikation richtete sich an einen speziellen Interessentenkreis, sie war gedacht "für die Sammler, Kenner, Liebhaber und Händler", wie Hoet in seiner Einleitung zu dem zweibändigen Catalogus schreibt. Hoets Katalog der Kataloge steht damit am Anfang der Frage nach der Herkunft eines Gemäldes, seiner Provenienz. Bis heute ist der Catalogus zusammen mit dem 18 Jahre später von dem Maler Pieter Terwesten herausgegebenen dritten Band eine unerschöpfliche Quelle beim Aufspüren der Herkunft vor allem niederländischer Gemälde geblieben. Unter den mehr als 200 abgedruckten Katalogen befinden sich auch zwei Kataloge von Sammlungen aus Deutschland, die nicht in Amsterdam oder Den Haag, den Zentren des holländischen Kunsthandels, sondern in Frankfurt am Main und Bonn öffentlich versteigert worden sind.1 Bei den beiden Katalogen handelt es sich um Verzeichnisse der Sammlung Johann Matthäus Merian d.J. (Kat. 8)2 und der Sammlung des am Kurfürstlichen Hof in Bonn als Arzt tätigen Johann Heinrich von Gise. 3 Der Vergleich mit dem 1742 gedruckten Auktionskatalog der Sammlung Gise (Kat. 14 und Kat. 14a) mit seinen über 600 Losen zeigt, daß Hoet nur einen 46 Lose umfassenden Auszug abgedruckt hatte. Hoets und Terwestens dreibändiger Katalog der Kataloge bildete, was die niederländischen Auktionskataloge betraf, die Grundlage für Lugts ersten Band des Repertoire des catalogues de ventes, der 1938 erschien.4 Neben den holländischen, englischen, französischen, dänischen und sonstigen Auktionskatalogen wurden auch die deutschen Auktionskataloge des 18. und frühen 19. Jahrhunderts so vollständig wie nie zuvor mit ihrem jeweiligen Standort erfaßt. Für den Zeitraum von 1700 bis 1800 verzeichnet Lugt 114 Kataloge, in denen ausschließlich oder zu einem wesentlichen Teil Gemälde zum Verkauf angeboten wurden. Der früheste
Katalog, den Lugt mit Hinweis auf Hoet als einziger Quelle erwähnt, ist der Katalog der Sammlung Merian (Kat. 8). Lugts Repertoire war der Ausgangspunkt für die neuerliche Erfassung der deutschen Auktionskataloge, mit dem Ziel, über den bibliographischen Nachweis der Kataloge hinaus, dem Benutzer des vorliegenden Handbuchs alle Katalogeinträge nach Künstlern geordnet zugänglich zu machen. Die meisten der 114 Kataloge konnten in den bei Lugt als Standort angegebenen Bibliotheken aufgefunden werden. Unter den wenigen Katalogen, die sich nicht mehr lokalisieren ließen, sind einige im Zweiten Weltkrieg vernichtet worden, andere, wie beispielsweise die Kataloge des Dresdener Kupferstichkabinetts, lagem wahrscheinlich noch heute in Archiven in Rußland. Die meisten Kataloge finden sich weiterhin in der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz in Berlin,5 in der Hessischen Landesbibliothek in Darmstadt,6 in der Bibliothek des Städelschen Kunstinstituts in Frankfurt, in der Universitätsbibliothek Frankfurt, in der Bibliothek des Historischen Museums Frankfurt, in der Bibliothek der Hamburger Kunsthalle und in der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln. Die im Repertoire unter "Börner/Leipzig" verzeichneten Kataloge des Leipziger Auktionshauses Rost werden heute im Archiv der Firma Börner in Düsseldorf aufbewahrt. Die Spuren Frits Lugts aufnehmend, wurde die Suche auf weitere Bibliotheken und Archive erweitert. Im Verlauf des Projekts konnte der rein zahlenmäßige Umfang von 114 im Repertoire verzeichneten Auktionskatalogen auf knapp 298 Kataloge erhöht werden. Bereits Niels von Holst hatte in seiner Besprechung des ersten Bandes des Repertoire auf "rund achtzig Hamburger, drei Lübecker, zwanzig Danziger, vier Königsberger und sechs Rigaer Versteigerungskataloge" hingewiesen, die bei Lugt fehlen. 7 Holst vermutete zugleich, daß derartige Nachträge "u.a. noch besonders für Berlin, Breslau, Stettin, ferner auch wohl für Braunschweig, Münster, Kassel, Mainz, Karlsruhe usf. zu erwarten (sind), ferner für Petersburg, wo seit etwa 1760 das Versteigerungswesen blühte." 8 Hoists Vermutungen scheinen zu stimmen, wie Gero Seelig für die Situation in Berlin hat nachweisen können. Bei der Sichtung zweier Berliner Zeitungen konnte Seelig allein bei Durchsicht eines Neuntels der Zeitschriftennummern zwischen 1730 und 1800 insgesamt 16 angekündigte Auktionen verzeichnen, zu denen ein eigener Katalog erschienen war. Keiner dieser Kataloge ist bei Lugt verzeichnet.9
1
Hoet/Terwesten 1752/70, Bd. 2, S. 63-66 und 344—357. Zwei weitere Sammlungen, Plettenberg und Schönborn, wurden in Amsterdam verkauft; vgl. ebd., Bd. 1, S. 495506.
2
Hoet/Terwesten 1752/70, Bd. 2, S. 344-357.
3
Hoet/Terwesten 1752/70, Bd. 2, S. 63-66.
4
Lugt 1938/87.
5
Die Auktionskataloge sind unter der Signatur NS 8920ff. als eigene Rubrik aufgeführt.
6
Die Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt besitzt drei gebundene Bände, in denen deutsche Auktionskataloge des 18. und frühen 19. Jahrhunderts zusammengefaßt sind (Signatur 41/1256; 41/1257; 41/1258).
7
Siehe die Rezension in: Zeitschrift für Kunstgeschichte 8 (1939), S: 221-223, hier 222. Vgl. auch Holst 1939, S. 125, Anm. 7: "Lugts Inventaire ... des ventes ..., Haag 1938, verzeichnet leider nur etwa ein Zehntel der Versteigerungen in Städten östlich der Elbe ...".
8
Ebd.
9
Seelig 1997, S. 27, 38, Anm. 6; die bei Seelig angeführten Auktionen fanden statt: 3.7.1730; 9.3.1750 (Philipp Gerlach); 4.11.1750; 27.10.1755; 20.1.1756; 18.1.1779;
11
Bei weitem nicht alle der von Holst erwähnten, geschweige denn vermuteten Kataloge konnten im Rahmen des Projekts wieder aufgefunden oder neu entdeckt werden. Die umfangreichste Gruppe an neu entdeckten Katalogen bildete das von Holst hervorgehobene Konvolut in der Hamburger Kunsthalle; es handelt sich um mehr als 50 Kataloge von Auktionen, die ausschließlich in Hamburg durchgeführt wurden. Hinzu kommen weitere Auktionskataloge aus dem norddeutschen Raum, die bisher unbekannt waren. Weitere 16 Hamburger Auktionskataloge, zumeist aus den 1740er und 1750er Jahren, die sich ehemals im Besitz der Hamburger Staatsbibliothek befanden, konnten leider nur noch bibliographisch nachgewiesen werden. Einige von ihnen fanden sich jedoch im Staatsarchiv Schleswig. 10 Dagegen konnten die von Holst erwähnten zwanzig Danziger und vier Königsberger Kataloge bisher nicht ausfindig gemacht werden." Andere Kataloge wiederum, die nicht bei Lugt aufgeführt sind, wie etwa vermißte Kataloge aus dem Kupferstichkabinett in Berlin, wurden in der Bibliothek der Eremitage wiederentdeckt. 12 Neben den oben genannten Bibliotheken wurden weitere Kataloge in den folgenden Einrichtungen nachgewiesen: Universitätsbibliothek Bamberg, Bibliothek der Hochschule der Künste in Berlin, 13 Universitätsbibliothek Göttingen und Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. In Bamberg gelangten mit dem Nachlaß des Kunstschriftstellers Joseph Heller zusammen mit einer großen Zahl von Auktionskatalogen auch frühe Sammlungskataloge aus dem 18. Jahrhundert in den Besitz der Bibliothek. Als äußerst wichtige Fundorte erwiesen sich ferner die Staatsund Stadtarchive mit ihren angegliederten Familienarchiven. Neben einzelnen, bisher unbekannten Auktionskatalogen konnten in den Archiven entsprechende handschriftliche Taxierungslisten oder Auktionsprotokolle aufgefunden werden, die Aufschluß geben über den gesamten Verlauf der Versteigerungen, einschließlich der mitunter langwierigen, sich über Jahre hinziehenden Vorbereitungen. Das Niedersächsische Staatsarchiv in Wolfenbüttel bewahrt ein handschriftliches Protokoll der Auktion der Sammlung des Herzogs Friedrich von Holstein-Norburg im Jahre 1690 (Kat. 2); eine wahrscheinlich 1759 abgefaßte Verkaufsliste der Leipziger Sammlung Böttcher (Kat. 34) befindet sich zusammen mit weiteren Angebotslisten im Großfürstlichen Familienarchiv der Markgrafen in Karlsruhe (Nachlaß der Markgräfin Karoline Luise von Baden). Zu nennen sind u.a. auch die Verkaufsprotokolle der Sammlung des Kölner Kurfürsten Clemens August im Nordrhein-Westfälischen Hauptstaatsarchiv in Düsseldorf (Kat. 45), eine Taxierungsliste der Mannheimer Sammlung Castell im Stadtarchiv Mannheim (Kat. 186), ein handschriftliches Auktionsprotokoll der 1785 versteigerten Sammlung des Dompropstes Eitz im Staatsarchiv Würzburg (Nr. 157) sowie das Auktionsprotokoll der aus Zweibrücken stammenden Sammlung des Pfalzgrafen Carl II. August (Kat. 267) im Haupt-
staatsarchiv München. Auf Vollständigkeit mußte verzichtet werden; vermutlich lassen sich in den Nachlässen anderer fürstlicher oder königlicher Häuser sowie in Adelsarchiven, so beispielsweise im Archiv des Landgrafen Wilhelm VII. im Staatsarchiv Marburg oder im Nachlaß der Grafen von Schulenburg im Niedersächsischen Hauptstaatsarchiv in Hannover (vgl. Kat. 107), weitere Quellen aufspüren. Nicht berücksichtigt wurden handschriftliche Inventarlisten in Nachlässen, wenn diese nicht zu einer Auktionierung oder zu einem Verkauf der Sammlung benutzt wurden. Ihre Erfassung und Auswertung bleibt für die Sammlungsgeschichte im 18. Jahrhundert in Deutschland weiterhin ein Desiderat. Mit wenigen Ausnahmen liegt nun das ausgewertete Material zum Auktionswesen des 18. Jahrhunderts sowohl in gedruckter Form als auch in einer kostenlosen Online-Version 14 im Internet vor. Die meisten der 298 erfaßten Auktionskataloge 15 enthalten entweder ausschließlich Gemälde oder Gemälde zusammen mit Kupferstichen und Zeichnungen. In den Auktionskatalogen des frühen 18. Jahrhunderts spielen die Gemälde oft eine untergeordnete Rolle, oftmals wurden hier noch Kunstkammern auf den Markt gebracht, in denen nur vereinzelt Gemälde auftauchten. Auch in einer Vielzahl von Buchauktionskatalogen sind im Anhang Gemälde enthalten (vgl. beispielsweise Kat. 211). Einen Überblick gibt das mehrbändige Verzeichnis der Antiquariats-, Auktions- und Kunstkataloge von Gerhard Loh, Leipzig. Die bei Loh aufgeführten Buchauktionskataloge wurden nicht systematisch erfaßt, so daß nur eine geringe Zahl von ihnen bei der Auswertung berücksichtigt werden konnte. Jedoch sind diese Kataloge, wie die wenigen Beispiele zeigen, nicht so sehr sammlungsgeschichtlich, als vielmehr mentalitäts- oder sozialgeschichtlich von Interesse. In jedem Fall würde erst eine genaue Durchsicht der Bücherkataloge Aufschlüsse über den Status und die Akzeptanz der Malerei innerhalb der gelehrten Schichten in Deutschland erbringen. 16 Neben den reinen Auktionskatalogen wurde auch eine Reihe von Katalogen ausgewertet, die Gemäldelotterien ankünden (Kat. 1, 20, 39, 50 und 203). Bei einer geringen Anzahl von Katalogen handelt es sich um Verkaufskataloge, wohl die frühesten ihrer Art in Deutschland. Zum Ende des 18. Jahrhunderts, mit der Etablierung einzelner Kunsthandlungen, nimmt besonders im süddeutschen Raum auch die Zahl der Sortimentskataloge zu; einige von ihnen wurden bei der Auswertung mit eingeschlossen. Mitunter wurden auch private Sammlungskataloge zum Zwecke der späteren Versteigerung der Sammlung abgefaßt oder bei Auktionen als Versteigerungskataloge benutzt. Aus diesem Grund sind eine Reihe von privaten Sammlungskatalogen in das Verzeichnis mit aufgenommen worden, vor allem dann, wenn sie schon bei Lugt angeführt waren. Dagegen wurden Sammlungskataloge von privaten bürgerlichen oder adeligen Gemäldesammlungen nicht berücksichtigt.
17.3.1779 (Johann Gottlieb Glume); 12.4.1779; 19.4.1779; 10.7.1779 (Zacharias Veitel Ephraim); 5.6.1780; 12.10.1789; 9.1.1790; 2.8.1790 (Blaise-Nicolas Le Sueur); 9.8.1790; 23.8.1790. 10
Es handelt sich um die Kataloge 17 (6.4.1747), 20 (31.7.1747), 24 (April 1750), 25 (15.6.1750) und 26 (15.10.1750). Diese Kauloge wurden von Casten Zelle, Bochum, aufgefunden.
11
Holst 1934, S. 68, listet die folgenden Auktionen mit Angabe des Versteigerungsorts auf: 22.3.1762, Slg. v. Holmstädt; 12.5.1762, Slg. Peter Pott, Poggenpfuhl 37; 24.11.1763, Slg. Peter Pott, Hundegasse 63; 8.11.1764, Slg. Gabriel Schumann, Heil.=Geist=Gasse 116; 21.10.1765, Slg. Ernst Bogisl. v. Krockow, Poggenpfuhl 37; 10.4.1769, Slg. Christ. Hartmann Schroeder, Langer Markt; 10.10.(1769?), Anonym; 16.08.1770, Slg. Anton Friedrich Claßen, Schäferei; 03.06.1771, Anonym; Heil.=Geist=Gasse, unweit vom Glockentore; 23.5.1771, Slg. Christ.? Schumacher, Langer Markt 16; 22.5.(1772?), Anonym; Langer Markt; 22.5.1772, Slg. v. Woltrikow; 13.05.1773, Slg. Christ. Gottl. Mettner, Poggenpfuhl 10; 6.2.1776, Slg. Simon Christ. Haderschlieff, Langgasse 52; 08.07.1776, Slg. Joachim Gottl. Mey, Am Heilig=Geist=Tore; 12.8.1777, Slg. Gottf. Schwartz, ohne die Gemälde, Langgasse 42; 17.11.1777, Slg. J.C. Weinreich?, Heilig=Geist=Gasse 59; 26.2.1778, Anonym; Trägerzunfthaus, Jopengasse 65; 6.7.1778, Slg. J. C. Weinreich?, Heilig=Geist=Gasse 59 (Wdh.); 10.08.1778, Slg. v. Schwarzwald?, Langgasse 78; 18.08.1778, Slg. Ant. de Cuyper?, v. Helmskerk?, Hundegasse 101; 29.03.1780, Anonym, Trägerzunfthaus; 10.2.1781, Slg. Karl Ernst Groddeck, Petrikirchhof 3; 23.04.1781, Slg. Jakob Wessel, Töpfergasse; 2.9.1782, Slg. Abraham Muhl, Brotbänkengasse 28; 18.02.1783, Anonym, Trägerzunfthaus; 22.9.1783, Slg. Heinrich Jakob de la Motte; 21.3.1785, Anonym, Poggenpfuhl; 7.7.1785, Anonym, Trägerzunfthaus; 25.9.1786, Sammlung Brunatti; auf d. 1. Damm; 21.4.1789, Slg. Kositzki, Poggenpfuhl 7; 21.7.1789, Slg. Joh. Jak. Stelter, Heilig=Geist=Gasse 14; 24.9.1789, Slg. Joh. Heinrich Soermann?; Holzmarkt 1?; 18.8.1796, Anonym. 18.7.1799, Slg. Joh. Heinr. Soermann; Holzmarkt 1.
12
Vgl. beispielsweise Kat. 197 und 270.
13
Teile des Bestandes stammen aus der "ehem. Bibliothek der königlichen Academie der Künste zu Berlin".
14
Die Adresse lautet: http: //piedi.getty.edu.
15
Es wurden 296 Katalognummem vergeben; zusätzlich erscheinen noch die Katalogeinträge 14a und 157a.
16
Vgl. Loh 1995 und 1999.
12
Den bekannten und durch gedruckte Kataloge nachgewiesenen Kunstauktionen steht im 18. Jahrhundert in allen größeren Städten des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation eine erheblich größere Anzahl von Versteigerungen alltäglicher Haushaltsgegenstände im Rahmen von privaten Haushaltsauflösungen gegenüber. Das Frankfurter Institut für Stadtgeschichte bewahrt einen nicht erschlossenen Bestand von handschriftlichen Vergantungsprotokollen. Stichproben ergaben, daß im Verlauf dieser Auktionen auch immer wieder eine geringe Anzahl von Gemälden versteigert wurde. Die Protokolleinträge beinhalten jedoch keine Angaben des Künstlernamens oder Titels. Das umfangreiche Archivmaterial bedarf jedoch einer gesonderten, sozialhistorischen Untersuchung, wie sie von John Michael Montias für die Haushaltsinventare in Delft und von Rudolf Schlögl für rheinisch-westfälische Städte vom 18. bis zum beginnenden 19. Jahrhundert exemplarisch durchgeführt wurden. 17 Auch in Leipzig fanden seit den 1740er Jahren ununterbrochen Auktionen statt, auf denen neben Haushaltsgegenständen, Möbeln etc. auch Gemälde veräußert wurden. Diese Auktionen wurden in der Leipziger Zeitung öffentlich angekündigt. Gleiches läßt sich auch für viele andere Städte, etwa für Wolfenbüttel, nachweisen. Weitere Auktionen mit Gemälden sowie reine Kunstauktionen mit oder ohne gedruckten Katalog wird es in allen kleineren und größeren Städten im 18. Jahrhundert gegeben haben. Das größte Desiderat bilden vermutlich die Auktionen in Wien. Obwohl die Kaiserstadt seit dem 16. /17. Jahrhundert als Zentrum des Kunsthandels gilt, konnten im Rahmen dieser Untersuchung nur zwei Auktionskataloge aus Wien aufgefunden werden (Kat. 275 und 285). Eine systematische Auswertung der Wiener Tageszeitungen könnte wie im Fall von Leipzig oder Berlin das Bild vom Auktionswesen im 18. Jahrhundert sicherlich vervollständigen. Weitere Recherchen in den Archiven in Basel, Bern oder Zürich, sowie im französischen Sprachraum, in Straßburg oder Genf, aber auch in den polnischen Städten wie Warschau, Breslau, Posen, Krakau werden ebenfalls bisher verborgen gebliebenes Material zum Auktionswesen zu Tage fördern. Trotz der genannten Einschränkungen kann davon ausgegangen werden, daß die nahezu 300 erfaßten Kataloge mit ihren mehr als 50.000 Einträgen ein annähernd genaues Bild, wenn auch nicht vom Umfang, so doch von der Bedeutung des Auktionswesen für den Kunsthandel und für das Sammelwesen in Deutschland im 18. Jahrhundert vermitteln. Die erreichte Synopsis ermöglicht es erstmalig, die besondere Rolle, die die einzelnen Handelsstädte wie Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig oder Nürnberg für das Auktionswesen im 18. Jahrhundert besessen haben, einzeln hervorzuheben und im Vergleich untereinander auf die jeweilige Besonderheit der Märkte, auch was die Durchführung der Auktionen in diesen Städten betrifft, einzugehen. In allen Städten zeigt sich, daß in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Sammlungsgeschichte eng mit der des Auktionswesens verbunden ist, mitunter sind die Auktionskataloge die einzigen Zeugnisse von der Existenz der Sammlungen. Hinweise auf Auktionen, wie die inhaltliche Auswertung der entsprechenden Kataloge, finden sich daher vor allem in Studien zur lo17
kalen Sammlungsgeschichte einzelner Städte, zu lokalen Sammlern und Kunsthändlern. Hervorzuheben ist u.a. die in den 20er Jahren entstandene Studie von Andreas Ludwig Veit zu den Mainzer Domherren vom Ende des 16. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts.18 Veit gibt auf der Grundlage von Inventaren, handschriftlichen Versteigerungsprotokollen und weiterem Quellenmaterial aus dem Staatsarchiv in Würzburg einen Überblick über die Kunstsammlungen in Mainzer Domherrenhöfen. Ausführlich geht Veit auch auf die Sammlung des Dompropstes Hugo Franz Graf von Eitz ein. Im Anhang ist der deutsche Katalog der Auktion abgedruckt (Kat. 157). Zu den grundlegenden Arbeiten gehören immer noch die in den 30er Jahren entstandenen Studien von Niels von Holst über das Sammlungswesen in Frankfurt am Main, Hamburg, Danzig, Königsberg und im Baltikum (Riga, Reval). 19 An Hoists profunde Kenntnis des Archiv- und Quellenmaterials, einschließlich der historischen Reiseliteratur, und seine Denkmalkenntnis des osteuropäischen Raumes ist nur schwer anzuknüpfen. An Holst anschließend ist für Frankfurt auf die Arbeit von Ulrich Schmidt, Die privaten Kunstsammlungen in Frankfurt am Main von ihren Anfängen bis zur Ausbildung der reinen Kunstsammlung hinzuweisen. 20 Die Ausstellung Bürgerliche Kunstsammlungen in Frankfurt baut auf dieser Studie auf und enthält wertvolle Hinweise zum Auktionswesen in Frankfurt, ebenso die Studie Frankfurter Privatsammlungen. Stifter und Bestände - Eigenart und Umfang von Corinna Höffner, mit einem Katalogverzeichnis bekannter Frankfurter Privatsammlungen, das eine Vielzahl der Frankfurter Auktionskataloge mit aufführt. 21 Die frühen Hamburger Kataloge von 1700 bis 1757 sind zusammen mit den bisher bekannten deutschen Katalogen aus dieser Zeit bibliographisch in der Studie zu Barthold Heinrich Brockes und seiner Kunstsammlung von Thomas Ketelsen erfaßt. 22 Für den Kölner und Bonner Raum ist auf die Studie von Horst Vey zur Sammlung des Kurfürsten Clemens August hinzuweisen, deren Versteigerungskatalog nachgedruckt wurde. Vey wertet in seiner Studie die handschriftlichen Protokollisten mit Angaben der Käufer und Preise aus. 23 Rudolf Schlögl hat in einer auch methodisch wegweisenden Studie neben einer Vielzahl von in rheinischwestfälischen Städten aufgestellten Inventaren auch Kölner Auktionskataloge für die Untersuchung von Geschmack und Interesse der Sammler im 18. und frühen 19. Jahrhundert herangezogen. 24 Dieser Ansatz wurde auch in dem Kölner Ausstellungskatalog Lust und Verlust verfolgt. 25 Grundlegend für die Situation in Leipzig sind die älteren Studien von Julius Vogel und die Arbeit von Eduard Trautscholdt über das Sammelwesen in Leipzig. 26 Für Nürnberg ist auf die Arbeit von Wilhelm Schwemmer hinzuweisen, der die Geschichte der Kunstsammlungen der Stadt Nürnberg vom 16. bis ins 19. Jahrhundert erfaßt; für das 18. Jahrhundert zieht Schwemmer auch die Auktionskataloge zu Rate. 27 Die Studie von Edith Luther dagegen konzentriert sich auf den Kunsthändler und Verleger Johann Friedrich Frauenholz; im Anhang sind die Versteigerungskataloge von Frauenholz aufgeführt. 28 Die Prager Versteigerungen sind jüngst durch die Stu-
John Michael Montias, Artists and Artisans in Delft. Α Socio-Economic Study of the Seventeenth Century, Princeton 1982; Schlögl 2001 .
18
Veit 1924.
19
Vgl. Holst 1934; Holst 1939; Holst 1960; sowie ders., Frankfurter Kunst- und Wunderkammern des 18. Jahrhunderts, ihre Eigenart und ihre Bestände, in: Baltische Kunstsammlungen der Neuzeit. I. Vom barocken Raritätenkabinett zur Galerie Herzog Peters von Kurland, in: Baltische Monatshefte (1938), S. 561-577; ders., Deutsche Barockmalerei in den mittel-, nord- und osteuropäischen Sammlungen des 18. Jahrhunderts, in: Mitteilungen aus dem Baron Brukenthalischen Museum 7 (1938), S. 5-18; Sammlertum und Kunstgutwanderung in Ostdeutschland und den benachbarten Ländern bis 1800, in: Jahrbuch der preussischen Kunstsammlungen 60 (1939), S. 111-126.
20
Schmidt 1960.
21
Ausst.-Kat. Frankfurt 1988; Höffner 1992.
22
Ketelsen 1997; vgl. auch Zelle 1998.
23
Vey 1963.
24
Schlögl 2001.
25
Ausst.-Kat. Köln 1995.
26
Vogel 1891; Trautscholdt 1957.
27
Schwemmer 1949.
28
Luther 1988.
13
dien von Lubomir Slavicek erneut in den Blickpunkt des Interesses gerückt worden. 29 An die Studien zu bürgerlichen Kunst- und Naturaliensammlungen des 17. und 18. Jahrhunderts in Deutschland von Claudia Valter ist ein äußerst nützliches Verzeichnis von Katalogen bürgerlicher Kunstkammem angehängt. 30 Bei mehreren dieser Kataloge handelt es sich um Auktionskataloge, darunter befindet sich auch ein späterer Katalog aus dem Jahre 1780 mit Gemälden (Kat. 126). Über das Auktionswesen in Berlin scheinen keine grundlegenden Studien zu existieren. Seelig hat sich in dem bereits genannten Aufsatz wie Veit und Vey auf eine einzelne Auktion in Berlin konzentriert.31 Zu einzelnen Kunsthändlern ist hier, neben der Studie von Luther über den Nürnberger Kunsthändler Frauenholz 32 vor allem auf die Arbeit von Helmut Tenner über die Mannheimer Kunsthändler hinzuweisen. 33 In der Studie von Hans Peter Thum über die Wandlungen des Berufs des Kunsthändlers wird auf das Auktionswesen kaum eingegangen. Um so wichtiger ist der Hinweis auf Johann Heinrich Merck, der als Kunsthändler für den Hof in Weimar tätig war. 34 Eine Geschichte des Auktionswesens im 18. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum ist ein Desiderat. Einen ersten knappen Überblick über die Entwicklung gibt der Aufsatz Art Auctions in Germany during the Eighteenth Century von Thomas Ketelsen.35 Wie in so vielen Fällen gereicht die Literaturgeschichte in der Kenntnis und in der systematischen Auswertung der Buchauktionskataloge der Kunstgeschichte zum Vorbild. Jene hat die Bücherund Auktionskataloge bereits mit großem Gewinn für ihre historischen Studien zu Rate gezogen. Hervorzuheben sind der Wolfenbüttler Tagungsband Bücherkataloge als buchgeschichtliche Quellen in der frühen Neuzeit36 sowie die Studien von Hans Dieter Gebauer zum Buchauktionswesen im 17. Jahrhundert und von Gerd Quedenbaum zur Geschichte der Bücherlotterie im 18. Jahrhundert. 37 Bisher fehlte jedoch eine gründliche Studie zum Kunstmarkt in Deutschland im 17. und 18. Jahrhundert, wie sie Jan Marten Bok für Utrecht vorgelegt hat. 38 Auch was den ökonomischen Aspekt des Kunsthandels betrifft, liegen von Seiten der Wirtschaftshistoriker für den deutschen Sprachraum keine den Studien über den französischen und englischen Kunsthandel vergleichbare Untersuchungen vor. Eine Ausnahme bilden die Untersuchungen von Michael North, so beispielsweise der Aufsatz Dutch Paintings and the Emerging 18th-Century German Art Market?9 Von Michael North geht auch die Initiative aus, sich aus wirtschaftshistorischer Perspektive mit der Geschichte des Kunsthandels und Kunstauktionswesens in Deutschland zu beschäftigen. Im Herbst 2000 wurden hierzu erste Positionen auf einer Tagung im Forschungszentrum Europäische Aufklärung in Potsdam präsentiert, deren Beiträge in Kürze veröffentlicht werden sollen. 40 In einem ersten Kapitel möchten wir die damaligen Modalitäten der Kunstauktion näher beschreiben: Wo, an welchem Ort, zu welcher Zeit, von wem und in welcher Form wurden Gemäldeversteige29
Ausst.-Kat. Prag 1993; Slavicek 1995.
30
Valter 1995.
rungen durchgeführt? Im zweiten Teil der Einleitung sollen die Auktionskataloge als stumme Zeugen einer historischen Praxis wieder in den Raum der Geschichte zurückgeführt werden. Mit ihrer Hilfe sollen einzelne Sammlungen beschrieben werden, ihre Entstehung rekonstruiert und ihr Schicksal durch den Verkauf der Gemälde beleuchtet werden. Die Untersuchung des Kunstmarkts selbst, der einzelnen Händler, Auktionatoren, Käufer etc. erfordert dabei jeweils eine genauere Analyse der lokalen Begebenheiten, zu unterschiedlich sind die Vorgänge in den Städten, zu sehr zeitlich versetzt die Entwicklungslinien, als daß sie sich zu einer geschlossenen und kohärenten "Geschichte" des Kunstmarkts und des Auktionswesens im besonderen zusammenfassen ließen.
Die Auktion Die Begriffe Auktion, Versteigerung und Vergantung Der Ausdruck 'Auktion' ist erst im 16. Jahrhundert nachweisbar, das Verb 'verauctionieren' im Jahre 1700.41 Der Begriff 'Gant' oder 'Vergantung' bildete sich dagegen zur Bezeichnung der Versteigerung von Erb- und Konkursmassen, insbesondere von Immobilien, bereits im Spätmittelalter heraus. In Frankfurt am Main und im bayerischen Raum wurden auch die Kunstversteigerungen im 18. Jahrhundert noch Vergantungen genannt (Kat. 131). So sollte das Uchelsche "Mahlerey=Cabinet an den meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung öffentlich [...] vergantet werden" (Kat. 16). In Zediere Universal-Lexikon von 1746 heißt es: "Es kommt das Wort: Vergantung, aus dem Italienischen Incanto (Frantz. Encant) her. Denn bey den Italieniern ist gebräuchlich Vendere all'incanto, durch einen Ausruff verkaufen; weil der Ausruffer gleichsam cantando singend die Sachen ausruffet. Ist also Vergantung nichts anders als der öffentliche Verkauff an den Meistbietenden um baare Bezahlung." 42 Fechner hat für den Ausdruck 'Versteigerung' auf Kaspar Stilers Wörterbuch aus dem Jahr 1670 aufmerksam gemacht, in dem es heißt: "Steigern augere, auctionari, auctionem facere, praeconi bona subjicere. Ersteigern / Übersteigern / immoderate censere, digitö literi. Steigerung / die & das Steigern / sectio, auctio, publica venditio, emtio ab hasta, aestimatio dimidio carior. Ersteigerung / & Versteigerung / licitatio improba, aestimatio iniqua, & immoderata." 43 In dieser Erklärung läßt sich noch eine deutlich ablehnende Haltung gegenüber der Auktion als Form des Verkaufens herauslesen. Stiler verweist vor allen Dingen auf das unredliche Bieten (licitatio improba) und die "aestimatio iniqua & immoderata", das ungleiche, zügellose Schätzen einer Sache. Hier steht der Verdacht der Wucherei und der Unredlichkeit im Raum. Zediere Universal-Lexikon vermerkt unter dem Begriff der 'Subhastation': "Subhastation [...] ist eben so viel, als der öffentliche Anschlag, oder die Feilbietung, die Ausruffung, Gant, Vergantung, so geschieht, wenn obrigkeitliche Gefälle, der Unmündigen Erbstücke, der Falliten oder zum Tode verurtheileten Verlassenschafften, beschuldete Güter, oder wenn die
31
Seelig 1997.
32
Luther 1988.
33
Tenner 1966.
34
Hans Peter Thurm, Der Kunsthändler. Wandlungen eines Berufes, München 1994; Merck 1911.
35
Vgl. Ketelsen 1998. Der Studie liegen zwei Vorträge von Thomas Ketelsen in London und Greifswald zugrunde sowie eine Zusammenfassung in einem Zeitungsartikel: Thomas Ketelsen, Goethe weiß, was ein Bild vorstellt. Kenner aestimiren die Manier. Der deutsche Kunstmarkt im 18. Jahrhundert, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 3. Februar 1996 (Kunstmarkt-Beilage).
36
Reinhard Wittmann, Bücherkataloge als buchgeschichtliche Quellen in der frühen Neuzeit, Wiesbaden 1984 (Wolfenbütteler Schriften für das Buchwesen).
37
Hans Dieter Gebauer, Bücherauktionen in Deutschland im 17. Jahrhundert, Bonn 1981; Quedenbaum 1977.
38
Marten Jan Bok, Vraag en aanbod op de Nederlandse kunstmarkt, 1580-1700, Utrecht 1994.
39
Michael North, Dutch Paintings and the Emerging 18th-Century German Art Market (Manuskript), Drucklegung in Vorbereitung; vgl. zudem Michael North/David Ormrod, Ait Markets in Europe, 1400-1600, New Haven 1997.
40
Kunstsammeln und bürgerlicher Geschmack im 18. Jahrhundert, 17.-18. November 2000, Forschungszentrum Europäische Aufklärung, Potsdam.
41
Vgl. Fechner 1998, S. 65f.
42
Johann Heinrich Zedier, Grosses vollständiges Universal-Lexicon Aller Wissenschaften und Künste [...], Leipzig, Halle 1732-1754, Bd. 47 (1746), Sp. 627.
43
Zit. nach Fechner 1998, S. 66.
14
Erben über den Werth eines Guthes nicht vergleichen können." 44 Die Versteigerung oder Auktion war somit eine Rechtshandlung. Sie mußte daher in den meisten Fällen von der Obrigkeit genehmigt werden; gleiches gilt für das Verfahren der Lotterie. Sowohl die Ankündigung der Auktion als auch ihre Durchführung unterstand genauen Regeln.
Das Reglement In den meisten Städten gab es Auktionsordnungen, die das Ansetzen und den Ablauf der Versteigerungen regelten. Nicht jedermann war zur Durchführung von Auktionen legitimiert, vielmehr wurden in den meisten Städten öffentliche Ausrufer ernannt. In der Regel wurden die Auktionatoren von den örtlichen Gerichten berufen, da Versteigerungen zumeist nur bei Haushaltsauflösungen durchgeführt werden durften. Die Versteigerung selbst ist ein privatrechtlicher Vorgang, der im Zusammenhang mit einer Erbschaftsauflösung oder einer Zwangsversteigerung stand. Als maßgeblicher Leitfaden kann hier die preußische Auktionsordnung aus dem Novum corpus constitutionum marchicharum vom 12. April 175645 herangezogen werden, die sehr detailliert den Ablauf von Auktionen regelt. Dieses Reglement diente vor allem der Prävention von gerichtlichen Streitigkeiten im Rahmen von Auktionen und zur Zensur. Alle Auktionatoren waren deswegen gesetzlich verpflichtet, sorgfältige Verzeichnisse zusammenzustellen und vom Ablauf der Versteigerungen Protokolle anzufertigen. Vier Wochen vor dem Auktionstermin mußten die Versteigerungen durch öffentliche Aushänge und in den Zeitungen annonciert werden. Die Herstellung und Distribution eines Katalogs wurde als eine begleitende Maßnahme begriffen, die jedoch zur Durchführung einer Auktion nicht unbedingt notwendig war. Den Auktionatoren wurde ausdrücklich verboten, bei den von ihnen veranstalteten Auktionen in irgendeiner Form selbst als Käufer aufzutreten. Bei ihrer Ernennung mußten die Auktionatoren einen Eid ablegen, daß sie die Regeln der Auktionsordnung beachten und einhalten würden. Um einen finanziellen Zusammenbruch der Auktionshäuser zu vermeiden, mußte jeder Auktionator ein Deposit von immerhin 2.000 Talern bezahlen. Für die eigentliche Auktion sollte ein öffentlich bestellter Ausrufer engagiert werden, der ebenfalls auf die Auktionsordnung vereidigt werden mußte. Thematisiert wurde in der preußischen Auktionsordnung auch die notwendig zügige Durchführung einer Auktion. Dort hieß es: "Während der Auction soll er Niemand Sachen ausser der Ordnung zum Besehen darreichen, oder sich mit unnützen Discoursen aufhalten, als welches nur zum Aufenthalte und Confusion Anlaß giebt." Die Gebührensätze waren festgelegt, so erhielt der "Auctions-Commissarius" Christhelf Mylius für jede Stunde, in der auktioniert wurde, acht Silbergroschen. Die Ausrufer mußten sich dagegen mit 4 Silbergroschen an einem Vormittag begnügen, für jede weitere Stunde wurden 2 Silbergroschen bezahlt. Die Gewinne flössen vollständig an die Eigentümer, Verkaufsprovisionen waren zunächst nicht üblich. In den verschiedenen preußischen Regierungsbezirken wurde die Ernennung der Auktionatoren und die Gebührenregelungen sehr unterschiedlich gehandhabt, wie eine Umfrage der preußischen Regierung aus dem Jahre 1771 zeigt. 46 In der Regel wurden die Auk-
tionatoren von den jeweiligen Justiz-Departements für ihre lebenslange Aufgabe ernannt; Versteigerungen fanden meist nur im Zusammenhang von Erbschaftsfällen statt. In Leipzig spielte die Verauktionierung von Gemälden nur eine untergeordnete Rolle, im Vordergrund stand die Versteigerung von graphischer Kunst und von Büchern. Dies hängt mit der Tradition Leipzigs als Buchhandelszentrum zusammen. Von den Buchhändlern und Verlegern der Stadt gingen immer wieder Proteste gegen das Auktionswesen aus, da in der Durchführung von Buchauktionen eine starke Konkurrenz gesehen wurde 47 Um diesen Streit zu schlichten, erließ der sächsische Kurfürst am 12. Juli 1678 eine Verordnung, die den Verkauf von "rohen Büchern", noch nicht gebundenen Druckbögen, auf Auktionen verbot 4 8 Zwei Jahre später wurde für die Stadt Leipzig eine Auktionsordnung erlassen, die sich explizit auf das Verauktionieren von Büchern bezog, aber auch für Auktionen galt, in denen neben Büchern auch Kunstwerke versteigert wurden. Wie in Preußen verlangte auch die Leipziger Auktionsordnung von 1680 die Herstellung eines Verzeichnisses, das rechtzeitig vor der Auktion der Zensurbehörde vorgelegt werden mußte. Immer wieder wurde die Befürchtung geäußert, bei Auktionen könnten von den Zensurbehörden nicht zugelassene Bücher offeriert werden. Ähnlich wie in der späteren preußischen Verordnung wurde ein genaues Verzeichnis der zu versteigernden Gegenstände gefordert, Bücher mußten mit dem Vor- und Zunamen des Autors und mit dem vollen Titel publiziert werden. Alle angebotenen Objekte mußten durchnumeriert werden, um Verwechslungen auszuschließen. Auktionen durften nur im Erbfalle und bei Verschuldung des Eigners angesetzt und in Leipzig nur durch die vom Rat oder der Universität bestellten Ausrufer durchgeführt werden. Sowohl der Rat der Stadt als auch die Universität besaßen das Privileg, Auktionen durchzuführen und die entsprechenden Gebühren festzulegen. 49 So wurden die seit 1783 jährlich stattfindenden Auktionen der Kunsthandlung Rost in einem Gebäude der Leipziger Universität, dem sogenannten Roten Collegium, abgehalten. Auf den Titelseiten der Kataloge der Kunsthandlung Rost wird als Proklamator Christoph Gottlieb Weigel (1726-1794) genannt, der 1767 zum Kurator des Roten Collegiums ernannt wurde 50 und 1778 auch das Amt des Proklamators übernahm. 51 Wie schon sein Vorgänger Johann Andreas Häußer, der das Amt des Proklamators von 1755 bis 1778 ausübte, erhielt Weigel mit seiner Bestallungsurkunde genaue Instructiones für sein neues Amt. Da sich die Ernennungsurkunde Weigels anscheinend nicht erhalten hat, kann hier nur auf die Instruktionen seines Vorgängers Häußer zurückgegriffen werden. Verpflichtet wurde der Universitäts-Proklamator auf die Bestimmungen der Leipziger Auktionsordnung von 1680. Jeder Auktionskatalog mußte dem Rektor, dem Konzil und dem Zensor der Universität zur Genehmigung vorgelegt werden. Von den Erlösen der Auktion durften höchsten 3 Groschen je Taler abgeführt werden. An den Proklamator ging von diesen Einnahmen ein Groschen je Taler. Die Unkosten für den Druck des Katalogs und die Bezahlung der Mitarbeiter mußten von den restlichen zwei Groschen je Taler bestritten werden, die Überschüsse wurden der Kasse der Universitätsbibliothek angewiesen. 52
44
Ebd., S. 67.
45
No. XLIII. Reglement und Instruction für die Auctionatores. De Dato Berlin, den 12ten April 1756, in: Novum Corpus Constitutionum Prussico-Brandenburgensium Praecipue Marchicarum, oder Neue Sammlung Königl. Preußl. Und Churfürstl. Brandenburgischer, sonderlich in der Chur= und Marck=Brandenburg, wie auch andern Provintzien publicierten und ergangenen Ordnungen, Edicten, Mandaten, Rescripten &c. &c. Von 1756. 1757. 1758. 1759 und 1760, S. 58-68.
46
Vgl. u.a. "Auszug den aus Berichten der Königl. Regieningen und iudicat Justitz Collegionim [...] auf die im Circulare vom 3ten Oct. 1771 aufgegebne die Auctiones betreffenden Fragen", Geheimes Staatsarchiv - Preußischer Kulturbesitz, Akte HA Rep. 9 JJ13f., Paket 2, o.P.
47
In Frankfurt wurden Buchauktionen in der Regel verhindert, vgl. Dietz 1910/25, Bd. 3, S. 169-170.
48
Ihr. Churfurstl. Durchl. zu Sachsen Johann Georg des Andern Gnädigster Befehl, Die Auctionirer, Hausirer und Disputation-Crämer betreffend [vom 12.7.1678]; Nebst der Verordnung, Wie es mit der Ver=Auctionierung derer Bücher und Bibliothequen in Leipzig zu halten, Leipzig 1680.
49
Verordnung, Wie es mit Ver=Auctionierung derer Bücher oder Bibliotheken zu halten, Leipzig 1680.
50
Ernennungsurkunde Christoph Gottlieb Weigel vom 10.10.1767, Universitätsarchiv Leipzig, Akten der Philosophischen Fakultät zu Leipzig betr. Curatoren des Roten Collegs, A 3.31 (107), Bl. 4 1 ^ 5 v .
51
In der entsprechenden Akte zum Posten des Proklamators fehlen alle Dokumente, die Christoph Gottlieb Weigel betreffen, vgl. Universitätsarchiv Leipzig, Akten der Philosophischen Fakultät zu Leipzig betr. Proclamator, A 3.36 (123). Der Vorgang wird aber in einem Aufsatz über die Buchhandlung Weigel beschrieben, vgl. C. A. G, Buchhandlung Weigel 1797-1922. Bausteine zu einer Geschichte der Familie Weigel, ohne Ort und ohne Datum [vermutlich Leipzig 1922],
15
In Leipzig kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen der Krämerzunft und den Auktionatoren, so etwa bei einer Auktion des vom Rat der Stadt bestellten Ausrufers Johann Ludwig Berringer (Kat. 49); dieser habe nach den Behauptungen der Krämer auch zahlreiche neue Handelswaren auf seiner Auktion im November 1764 offeriert und nicht - wie die Handelsordnung es verlangte - ausschließlich Güter aus einem Nachlaß oder einer Konkursmasse.53 Allerdings wurde die strenge Auktionsordnung Leipzigs gegen Ende des 18. Jahrhunderts weniger rigide ausgelegt, so konnte der Kunsthändler Rost in seinen Auktionen Bestände verschiedener Einlieferer verauktionieren. In Frankfurt am Main mußten ebenfalls alle Auktionen durch den öffentlich bestellten Ausrufer durchgeführt werden, der meist nicht als Veranstalter auftrat. So übte Johann Heinrich Fayh von 1780 bis 1782 das Amt des Geschworenen Ausrufers bei Verganthungen aus, in den Jahren 1789 bis 1794 folgte ihm sein Sohn Heinrich Christian Fayh, der schon zuvor als Schreiber fungiert hatte. Von allen Versteigerungen mußten in Frankfurt im Gegensatz zur Leipziger Auktionsordnung Vergantungsprotokolle angefertigt werden, die sich im Institut für Stadtgeschichte erhalten haben.54 Auf den meisten Frankfurter Katalogen werden die vereidigten Ausrufer aufgeführt, jedoch meist nicht namentlich genannt. Teilweise traten wohl die öffentlichen Ausrufer auch als Auktionatoren auf, in den meisten Fällen wurde jedoch die Versteigerung von einem anderen Auktionator verantwortet. Als Veranstalter sind vor allem Johann Christian Kaller und Justus Juncker zu nennen, aber auch Andreas Benjamin Nothnagel, der zwei große Auktionen in den Jahren 1779 und 1784 durchführte. In Nürnberg war die Durchführung der Auktionen durch eine Ordnung von 1770 geregelt, die sich in erster Linie auf den Verkauf von Büchern bezog, aber auch für Kunstgegenstände galt. Genau vorgeschrieben war die Form des Auktionskatalogs, der vor Drucklegung der Zensurbehörde vorgelegt werden mußte. Die Kataloge hatten sechs Wochen vor der Auktion bereitzuliegen. Auch die Titelaufnahme war geregelt, ebenso die Gebührensätze.55 Die Auktionen durften nur von einem amtlich genehmigten Auktionator geleitet werden. Der Nürnberger Buchhändler Johann Eberhard Zeh, der 1785 zum Auktionator ernannt worden war, führte auch die Versteigerungen im Hause Frauenholz durch.56 In Hamburg war das Auktionsrecht weitgehend liberalisiert. Handelswaren und eben auch Kunstgegenstände konnten durch Makler, die hierzu privilegiert waren, öffentlich versteigert werden. Es gab zwar auch einen städtischen Ausrufer, die Kunstauktionen wurden jedoch im Unterschied zu den Auktionen in Frankfurt, Leipzig oder Köln von den Maklern übernommen.57 Mitte des 17. Jahrhunderts hatte sich in Hamburg eine sogenannte Maklerdeputation mit eigener Satzung gebildet. 1679 wurde eine bis auf das Jahr 1860 reichende Maklerordnung verabschiedet, die - überwacht von der Deputation - die Geschäfte der Zunft bestimmte. Seit 1660 wurde für alle vereidigten Makler ein Maklerzeichen nach niederländischem Vorbild eingeführt, eine Messingmünze mit Stadtwappen und Namen des Maklers sowie Zulassungsnummer und Jahr. Seit 1680 gab es den Maklerstock aus gedrechseltem Ebenholz mit graviertem Knauf; "der Stock mußte sichtbar in der Hand getragen werden". Verstärkt
wurde die Aufsicht über das Maklerwesen durch gedruckte Maklerlisten, die seit 1679 die jeweils zugelassenen Makler erfaßten.58 Bereits im 17. Jahrhundert waren einige Makler auf die Veräußerung von Kunstgegenständen spezialisiert, Servaes Paulsen am Kleinen Jungfernstieg bei der St. Katharinenkirche, der vermutlich aus Holland stammende Peter Groot, der seinen Sitz bei der Börse hatte, und der Niederländer Carl de Vlieger.59 In den 1770ern und 80ern wurden die meisten Auktionen in Hamburg von dem Makler Michael Bostelmann durchgeführt; mitunter arbeitete Bostelmann mit anderen Maklern wie Johann Hinrich Neumann oder Peter Texier zusammen. Des weiteren finden sich auf den Titelblättern der Kataloge die Namen Nicolas Wilhelm Boy, Hermann Friedrich Goverts, Benedix Meno von Hom, Hinrich Jürgen Köster, Johann David Reimarus und Johann Hinrich Schoen. Gegen Ende der 1780er Jahre wurden die Auktionen immer öfter von zwei oder mehreren Maklern gemeinsam durchgeführt. Mit Beginn der 90er Jahre des 18. Jahrhunderts wurde der Makler Peter Hinrich Packischefsky zum führenden Veranstalter von Auktionen. Die Ankündigung Wohl in den meisten Fällen wurden die Auktionen in den lokalen Wochen- oder Intelligenzblättem mittels kurzer Annoncen angekündigt. Die Annoncen erschienen gewöhnlich ein bis vier Wochen vor Auktionsbeginn und informierten über den genauen Zeitpunkt, den Ort und über den Charakter der zu versteigernden Sammlungen. Auch wurde vermerkt, ob es einen gedruckten Katalog zur Auktion gab. In den meisten Auktionsordnungen, so in der preußischen von 1756 oder der Leipziger von 1680, wurde die Ankündigung der Auktion in Zeitungen ausdrücklich gefordert. Der erste Versteigerungskatalog der Kunsthandlung Rost (Kat. 148) enthält den Vermerk: "Vier Wochen vor der Auction wird man noch in den Zeitungen bekannt machen, an welchem Orte zu Leipzig diese Sammlung verauctionirt werden soll". Nicht selten wurden die Auktionen mehrfach in den Zeitungen angekündigt; so die Sammlung des Hamburger Dichters Barthold Heinrich Brockes im Hamburger Relations Courier am 7. März, einen knappen Monat vor Auktionsbeginn, und ein zweites Mal am 6. April (Kat. 17).60 Die Auktionstermine in Hamburg hingen auch auf der Börse zur Information der Öffentlichkeit aus. In Frankfurt wurde die Sammlung Bögner vor der Auktion von Johann Heinrich Merck im Teutschen Merkur besprochen: "Die Behandlung könnte anders seyn", schrieb Merck an den Herausgeber des Merkurs, "Ich habe aber mit Fleiß einfältig seyn wollen, weil Einen sonst die Leute gar nicht verstehen. Schik mir auch ein Exemplar von diesem Monat, wo's drinne steht, für die Erben."61 Vermutlich hat es auch Aushänge gegeben, die auf Verkäufe hinwiesen. In einigen Fällen kann man annehmen, daß eine ganze Liste mit Gemälden in Form eines Anschlags ausgehängt worden ist, so beispielsweise bei einer Auktion in Schwerinsburg bei Anklam (Kat. 250). Es handelte sich um den Verkauf einer Adelssammlung in einer ländlichen Gegend in Vorpommern, in der Kunstauktionen vollkommen ungewöhnlich waren. Hier wurden alle zu verkaufenden Gemälde handzettelartig auf drei Seiten publiziert, die dann wahrscheinlich ausgehängt wurden.
52
Ernennungsurkunde für Johann Andreas Häußer vom 5.4.1755 mit Instructions und "Plan der Rechnung des Proclamtoris", Universitätsarchiv Leipzig, Akten der Philosophischen Fakultät zu Leipzig betr. Proclamator, A 3.36 (123), Bl. 13-21.
53
Acta Die sämmtlichen Cramer Meister Faust= und Handelsleute alhier contra Johann Ludewig Berringer, Anno 1764, Leipzig, Stadtarchiv, Tit. VII.C.139.
54
Des Heiligen Römischen Reichs freien Wahl= und Handels=Stadt Frankfurt am Main verbesserter Raths= und Stadt=Kalender, auf das Jahr nach Christi Geburt 1792. worinnen Ehren=Aemter und Bedienungen, Decreta publica, Posten und alles andere, so die Stadt Frankfurt betrift, befindlich, Frankfurt am Main 1780ff.
55
Auktionsordnung der Stadt Nürnberg von 1770, mitgeteilt von Ernst L. Hauswedell, in: Bibliothek. Buch. Geschichte. Festschrift für Kurt Köster zum 65. Geburtstag, hg. von Günther Pflug, Brita Eckert und Heinz Friesenhahn, Frankfurt am Main 1977, S. 241-248.
56
Luther 1988, S. 79.
57
Neue Verordnung wegen der öffentlichen Ausrüfe in der Stadt Hamburg, vom 2. Sept. 1757, in: Sammlung der Hamburgischen Gesetze und Verfassungen, Hamburg 1765.
58
Hess 1796, Bd. 2, S. 254-256, Rubrik "Mäckler".
59
Colshom 1980, S. A 262.
60
Zelle 1998, S. 44.
61
Merck 1911, S. 185.
16
Der Katalog Der Katalog war das wichtigste und wirksamste Werbemittel, um die Auktion auch überregional bekannt zu machen. An den meisten Orten wurde die Drucklegung eines Katalogs in der Auktionsordnung ausdrücklich gefordert, auch wurden oftmals besondere Qualitätsanforderungen an den Katalog gestellt. In Leipzig mußten alle Lose durchgehend numeriert, alle Objekte sorgfältig beschrieben und bei Büchern die Autoren mit Vor- und Nachnamen angegeben werden. Der Katalog informierte nicht nur über die jeweils öffentlich zum Verkauf gelangten Gemäldesammlungen, sondern im allgemeinen auch über den Ort und den Zeitpunkt der Auktion. Da jedoch die Kataloge mitunter bis zu einem halben Jahr vor dem Auktionstermin gedruckt wurden, mußte in vielen Fällen der genaue Termin der Auktion auf dem Titelblatt ausgespart bleiben. Der Leser des Katalogs wurde dann, wie im Fall des Katalogs der Sammlung Haeckel (Kat. 47), der zwei Jahre vor dem eigentlichen Auktionstermin bereits gedruckt worden war, auf die Tagespresse verwiesen. Der Katalog der Sammlung Bernus (Kat. 134), ohne Datum gedruckt, lag bereits im August 1780 druckfertig vor; die Auktion fand aber erst am 7. Mai des folgenden Jahres statt. Auf vielen Katalogen wurde der genaue Auktionstermin handschriftlich nachgetragen oder in manchen Fällen auch korrigiert. Die Rostsche Kunsthandlung in Leipzig war bedacht, ihre Kataloge für die jährlich im Januar durchgeführten Auktionen bereits auf der vorangehenden Herbstmesse, der sogenannten Michaelismesse, auszugeben. Die frühzeitige Auslieferung führte teilweise zu Beeinträchtigungen bei der Qualität der Kataloge. Der Kunsthändler Wilhelm Wolff aus Nürnberg entschuldigte sich, daß "das Maas der Gemähide hat in Eile nicht beygesetzt werden können" (Kat. 29); im Fall der Sammlung Obermaier (Kat. 196) konnte nur ein geringer Teil der über 2.000 angebotenen Gemälde bis zur Drucklegung des Katalogs einem Künstler zugeschrieben werden. Im allgemeinen dürften Zeitdruck und unzureichendes Wissen die Hauptursachen dafür gewesen sein, daß so viele Gemälde in den deutschen Auktionskatalogen des 18. Jahrhunderts keinem Künstler zugeschrieben wurden. Nur selten konnten die Katalogautoren auf Vorarbeiten der Sammler zurückgreifen. In der Regel mußten sie die Gemälde erstmals inventarisieren und so weit als möglich zuschreiben. Dabei bereitete schon die Entzifferung von Signaturen Schwierigkeiten, da den Bearbeitern die Künstlernamen oft überhaupt nicht; oder zumindest nicht in der verwendeten Variante vertraut waren, und entsprechende Nachschlagewerke weitgehend fehlten. In ihrer Unwissenheit produzierten die Autoren deshalb neue, von den geläufigen Schreibweisen stark abweichende Namensvarianten. Es ist auch anzunehmen, daß Signaturen beim Aufnehmen der Bilder nicht buchstabengetreu abgeschrieben, sondern einem Schreiber vorgelesen wurden, der dann fremdsprachige, vor allem niederländische oder französische Namen nach seinem Gutdünken, also in einer phonetischen, mehr oder weniger stark eingedeutschten Schreibweise verzeichnet hat. Außerdem wurden abgekürzte Signaturen oft nur abgeschrieben, weil sie von den Katalogbearbeitern nicht aufgelöst werden konnten. So erklärt sich der relativ hohe Anteil von "Monogrammisten" in unserem Datenbestand; ein Großteil von ihnen könnte nach heutigem Kenntnisstand sicher problemlos einem Künstler zugeordnet werden, wenn wir die Gemälde vorliegen hätten. Abgesehen von wenigen Ausnahmen, wurden die Kataloge von den einheimischen Druckereien produziert. In Frankfurt, Hamburg oder Leipzig bestanden mitunter feste Absprachen zwischen einzelnen Druckern und bestimmten Maklern oder Händlern. Die Auflagenhöhe war bei allen an der Universität Leipzig durchgeführten Auktionen festgeschrieben, sie mußte nach den Instruktionen für den Proklamator mindestens eine Höhe von 800 Exemplaren erreichen. In einer Auktion der Kunsthandlung Rost wurde ein schon vorabgedruckter Katalog übernommen, der zufolge einer beigefügten Nachrede eine Auflagenhöhe von 600 Exemplaren hatte. Zu ver-
muten ist, daß die meisten Auktionskataloge in den großen Städten in einer Auflage von 600 bis 1.000 Exemplaren publiziert wurden. Allein von den Frankfurter Katalogen haben sich bis heute mitunter acht Exemplare erhalten. Je nach geographischer Lage und Einzugsbereich, aber auch die historischen Umstände oder den angesprochenen Interessentenkreis berücksichtigend, wurden die Kataloge nicht nur in deutscher, sondern auch in französischer oder italienischer Sprache abgefaßt. Im Unterschied zu den Bücherkatalogen, die bis weit ins 18. Jahrhundert in Latein verfaßt wurden, konnte kein reiner Gemäldekatalog gefunden werden, der in lateinischer Sprache erschienen ist. Bei besonders wichtigen und umfangreichen Auktionen wurde in der Regel auch eine französische Ausgabe des Katalogs veröffentlicht, meistens handelt es sich um eine Übersetzung des deutschen Verzeichnisses ohne irgendwelche Veränderungen. Eine französische Ausgabe sollte auch ausländische Sammler und Kunsthändler ansprechen. Zudem war Französisch die vorherrschende Sprache an den deutschen Höfen und Residenzen. Der Vergleich mit den frühen privaten Sammlungskatalogen zeigt, daß diese, wie die meisten der fürstlichen Galeriekataloge auch, zumeist in deutscher und in französischer Sprache erschienen sind. Die frühen Kölner Kataloge sind in französischer Sprache veröffentlicht worden; ebenso der Katalog der Sammlung Clemens Augusts (Kat. 45). Auch nach der Besetzung Kölns durch die Franzosen wurden die Kataloge, nachdem sie zwischenzeitlich auf deutsch erschienen waren, wieder auf französisch gedruckt. Waren in Frankfurt die frühen Kataloge von Merian und Ucheln noch in deutscher Sprache erschienen, so wurden auch nach dem Abzug der französischen Besatzungstruppen 1762 die Verzeichnisse der Kunsthändler Johann Christian Kaller und Justus Juncker noch ausschließlich in französischer Sprache herausgegeben. Der Katalog der Sammlung Haeckel (Kat. 47) ist jedenfalls auf französisch abgefaßt, der Katalog von Christian Benjamin Rauschner ist bereits zweisprachig deutsch-französisch geschrieben (Kat. 51). Mit Beginn der 1770er Jahre finden wir in Frankfurt wieder vornehmlich deutsche Kataloge. Jedoch bleibt es üblich, bei bedeutenden Sammlungen den Katalog sowohl in deutscher als auch in französischer Sprache zu drukken. Die frühen Hamburger Kataloge aus den 1750er Jahren sind wie die Kataloge der 1770er Jahre in deutscher Sprache abgefaßt. Ab 1790 wurden einzelne Kataloge auch in französischer Sprache veröffentlicht, was vermutlich mit dem wachsenden Kreis französischer Emigranten zusammenhängt. Die Auktionskataloge von Kupferstichsammlungen sind hingegen häufiger in französisch publiziert worden. Die Rostschen Kataloge in Leipzig sind bis 1800 in deutscher Sprache gehalten. In seinem achten Verzeichnis fügte Rost auch einen in französisch abgefaßten "Vorbericht" ein (Kat. 197). Erst gegen Ende des Jahrhunderts finden wir in Leipzig Kataloge ausschließlich in französischer Sprache: etwa den der Versteigerung der Sammlung des Malers Christian Wilhelm Emst Dietrich im Jahre 1791 (Kat. 213). Ein Kuriosum ist ein Nürnberger Katalog aus dem Jahre 1752, der in deutsch und italienisch erschienen ist (Kat. 29).
Die Verbreitung Die Kataloge waren in den 70er Jahren in Hamburg entweder bei den Maklern, die die Auktionen durchführten, oder aber bei den Besitzern der Gemälde zu erhalten: So heißt es in einer Nachricht in einem Hamburger Katalog von 1777 (Kat. 98): " Dieser Catalogue ist bey dem Mackler, Benedix Meno von Horn beliebigst abzufordern [...]". Seit 1782 wurden Hamburger Kataloge nur gegen eine geringfügige Bezahlung herausgegeben. Der Preis pro Katalog betrug "2 Schilling, den Armen zum Besten", seit 1797 war der Katalog "den Armen zum Besten, für 4 Schillinge zu haben". In Frankfurt wurden die Kataloge von den Händlern Johann Christian Kaller und Justus Juncker gratis ausgeteilt, eine Praxis, die auch während der 70er und 80er Jahre des 18. Jahrhunderts anhielt. In Köln waren die Kataloge vor der Auktion bei den Buchbindern und Händlern zu 17
bekommen. In Nürnberg gab der Kunsthändler Johann Friedrich Frauenholz diese nur gegen eine Gebühr ab, die sich 1793 auf immerhin 36 Kreuzer belief (Kat. 238). Sollte nicht nur der lokale Markt informiert, sondern auch mögliche Interessenten im In- und Ausland frühzeitig angesprochen werden, war man bei der Verteilung der Kataloge auf ein dichtes Informations- und Verteilernetz angewiesen. Zu vermuten ist, daß die Kataloge bei vielen Händlern oder Agenten in den auswärtigen Städten zu beziehen waren, die sich zugleich für die Abwicklung der Geschäfte im Auftrag der Besteller jeweils anboten. Interessierte Sammler und Liebhaber hatten nach Auslieferung der Kataloge die Möglichkeit, bei den Händlern oder Maklern ihre Aufträge oder Angebote einzureichen. Dies trifft unterschiedslos für die Verkaufs- und Auktionskataloge zu: In Nürnberg wird 1743 der "Liebhaber" aufgefordert, "sich an Herrn Wilhelm Wolff, Kupferhändler in der Weisgerber=Gasse daselbst zu addressieren" (Kat. 29). Rauschner bittet den Leser seines Katalogs, Angebote "auf der Schäfer=Gaß zu Frankfurt am Mayn [zu] addressiren" (Kat. 51). Auch in anderen Katalogen werden die Kunsthändler genannt, die für Auswärtige Kommissionen annahmen. Seit den 60er Jahren des 18. Jahrhunderts bieten sich in Hamburg alle Kunsthändler an, für auswärtige Interessenten den Ankauf zu übernehmen. So ist dem Katalog von 19. Juni 1783 die Nachricht vorangestellt: "Ausser den vorgedachten Macklern - gemeint sind die Hamburger Makler Reimarus, Texier, von der Meeden und Brandt - nehmen folgende Personen Commissiones an: Herr Lilly, Senator, Anton Tischbein, Hofrath Ehrenreich, Johann Hinrich Schöen" (vgl. Kat. 147). Die Leser der Rostschen Kataloge wurden gebeten, ihre Aufträge an "Herr(n) C. G. Weigel, Herr Secretaire Thiele und die Rostische Kunsthandlung" zu schicken; auch der Kunsthändler Pfarr und ein Herr Thon nahmen Kommissionen an. Dieselben Adressen bietet in Leipzig auch Christian Friedrich Hecht seinen Kunden an: Gebote konnten an die Herren Rost, Pfarr (marchands de curiosites), Erhard (Professor des Rechts), Geyer (Kupferstecher an der Akademie), an den Sekretär Thiele und an ihn selbst als "proclamateur" gerichtet werden. In Dresden sollte man sich an den dortigen Galeriedirektor Riedel wenden. Auch wurde mitunter auf die Möglichkeit hingewiesen, vor Auktionsbeginn die angebotene Sammlung geschlossen zu erwerben: "Sollte sich, spätestens acht Tage vor dem Verkaufstermin ein Liebhaber zu der ganzen Sammlung finden, so ist man erbötig, darüber in Unterhandlung zu treten." 62 Die Sammlung Hagen in Nürnberg war vorab ebenfalls "im ganzen zu erstehen", zugleich versprach man, die auf 18.000 Gulden geschätzte Sammlung im Ganzen zu einem günstigeren Preise abzugeben (Kat. 164). In den meisten Fällen jedoch wurde darauf hingewiesen, daß die Gemälde einzeln zum Verkauf anstanden. Die gedruckten Auktionskataloge zirkulierten unter den damaligen Sammlern, Kennern und Händlern und wurden selbst bald zu gefragten Sammelobjekten. Mit ihrer Hilfe informierte man sich über das Angebot, über die Preise und orderte auch Gemälde. So war Christian Ludwig von Hagedorn trotz seiner Abwesenheit aus Hamburg mittels der von seinem Bruder zugeschickten Kataloge jederzeit über die Auktionen in seiner Heimatstadt informiert. Der Briefwechsel zwischen den beiden Brüdern ist ein eindrucksvoller Beleg für die Möglichkeiten des Auktionskatalogs. 63 Hagedorn erteilte mit Hilfe der Kataloge Weisungen, ausgesuchte Gemälde auf den Auktionen für das eigene Kabinett zu ersteigern. In einem Brief aus dem Jahre 1741 äußert er den Wunsch: "Pia desideria, ohne die welschen Matadoren zu begehren, wären aus dem Catalogo: Ein
Van Dyck. Ein Chev. van der Werff, ein Gerh. Dau, ein Franc. Mieris, ein Wouvermann und ein rechter Com. de Heem und HuysumIn Eugenii Catalogo ist Gerh. Dau ä 500, ä 200, ä 150 Rt taxiret, mithin wohl apparence, in einer Auction zu reussiren." 64 Nach Zusendung des "Tammischen Catalogo" im Jahre 1745 wird der Bruder wiederum genau angewiesen: "Brugel brauche ich unentbehrlich, daß ich, wenn mir Gott Leben und Gesundheit giebt, eine große Summe darinn verquackeln könte. Also vigilir ietzo. [...] Wohlfeiler komme ich wohl nicht darzu, da kein Hamburger leicht mehr giebt als ich. [...] Nicht minder bin ich auf die darinn befindl. Huyssums, 2 Caspar Poussin und 2 Salvator Rosa, ingl. des O. van der Heyden [...] verseßen." 65
Die Orte der Versteigerung Für die Durchführung von Auktionen, aber auch für die Vorbesichtigung der Gemälde, benötigte man ausreichende Räumlichkeiten. Die Kunstwerke mußten angemessen gezeigt werden, und die interessierte Kundschaft mußte sich in einem Saal versammeln können. Meistens wurden Versteigerungen in öffentlichen Sälen durchgeführt, die auch für andere Zwecke genutzt wurden. Bei Auktionen, auf denen Nachlässe zum Verkauf angeboten wurden, bot sich der ehemalige Wohnsitz des Verstorbenen als Ort der Versteigerung an, da die Kunstwerke dann nicht zuvor abtransportiert werden mußten und in ihrer ursprünglichen Umgebung besichtigt werden konnten. Auch in Hamburg fanden bis 1757 einige Auktionen in Privathäusern statt, alternativ boten sich das Eimbecksche Haus und die Börse an. Im Unterschied zu den reinen Kunstauktionen (Gemälde und Kupferstiche) wurden viele Versteigerungen von Münz- oder Naturaliensammlungen weiterhin in Privathäusern durchgeführt. In Reiseberichten des 17. Jahrhunderts wird immer wieder berichtet, daß einzelne Kunstausstellungen in Hamburg im Eimbeckschen Haus stattgefunden haben, vermutlich handelte es sich bereits um Verkaufsausstellungen. Seit 1325 existierte das Stadtbierhaus Eimbeck, wo das Eimbecksche Bier in Hamburg ausgeschenkt wurde. Im Jahre 1710 fand hier eine der frühesten durch einen Katalog nachgewiesenen Auktionen statt (Kat. 6). Nach Beendigung des Siebenjährigen Krieges wurde das Eimbecksche Haus nur noch selten für Kunstauktionen genutzt. Der Abbruch im Jahre 1769 führte schließlich zu einem Neubau nach Plänen von Johannes Kopp. Besaß bereits der Vorgängerbau einen eigenen Anatomiesaal, so hielt in dem neu eingerichteten Saal ab 1771/72 Paul Dietrich Gisecke seine Vorlesungen für Wundärzte. Man konnte dort einzelne Zimmer für Auktionen mieten; so fand am 10. September 1794 auf dem Zimmer No. 1 eine Auktion statt 6 6 Die Hamburger Börse etablierte sich bereits in den 1750er Jahren als Auktionsort und sollte bis zum Ende des Jahrhunderts der wichtigste Umschlagplatz für Gemälde in der Hansestadt werden. Architekt des zwischen 1577 und 1583 erbauten Gebäudes war der aus Amsterdam stammende Jan Andressen. Die Hamburger Börse war die erste ihrer Art in Deutschland überhaupt, vorausgegangen waren entsprechende Bauten in Antwerpen (1531), Toulouse (1549) und Rouen (1556). Ein Gemälde von Jurien Jacobs aus dem Jahre 1677 (Museum für Hamburgische Geschichte) sowie ein Stich von Jan Dircksen (1606) dokumentieren das 1583 fertiggestellte Gebäude, einem im Renaissancestil errichteten eingeschossigen Bau mit offener Vorhalle. Die Lage ist ebenfalls bezeichnend: Im Zentrum der Stadt, neben dem Rathaus und dem Kran gelegen, war die Börse Mittelpunkt des Handels in der Hansestadt. Im ersten Stock des zum Teil über dem Wasser erbauten und auf Holzpfählen abgestützten Gebäudes befanden sich zwei Börsensäle, in denen, wie es im Hamburger Adreßbuch von 1794 unter der Rubrik "Merkwürdigkeiten" heißt, "täglich Auctionen von allen möglichen Waaren, Gemählden,
62
Vgl. Kat. 147, Einleitung, S. 3.
63
Siehe die umfassende Studie von Cremer 1989, S. 18-102; auch Ketelsen 1997, S. 167-172.
64
Brief vom 8.3.1741; zit. nach Cremer 1989, S. 27.
65
Brief ohne Datum (evt. September 1745); zit. nach Cremer 1989, S. 75.
66
Das Gebäude wurde 1842 während des Großen Brandes zerstört; vgl. Heckmann 1990, S. 336.
18
Kunstsachen etc. gehalten (wurden). Der eine dieser Sähle dient auch der Kaufmannsschaft und dem Colonel zum Versammlungsort. Ueber diesem Gebäude befindet sich ein Thurm mit einer Uhr". Mehrere bauliche Veränderungen fanden im Zuge der Instandhaltung der Börse in den folgenden Jahrhunderten statt. Im Jahre 1842 fiel die alte Börse dem Großen Brand in Hamburg zum Opfer, nachdem sie schon 1837/38 in einen Neubau an einem anderen Standort umgezogen war. 67 Die Frankfurter Privatsammlungen wurden vor 1762 in den privaten Sterbehäusern der Besitzer verauktioniert. Die Sammlung Merian konnte "bey Herrn Jacob Heldewir" erworben werden, die Sammlung Ucheln wurde in des "Herrn Gerichts Substituti Friessen Behausung auf der kleinen Gallert Gasse" versteigert. Die nach Beendigung des Siebenjährigen Krieges von Johann Christian Kaller und Justus Juncker durchgeführten Auktionen fanden mit einer Ausnahme "in dem bekannten Scharffischen Saal" statt; 68 nur einmal wich man auf den "Zimmerhoff, rue dit le grand Hirschgraben Lra E. Nr. 7 0 " , aus (Kat. 40). Auch das Karmeliterkloster mit seinem "Bildersaal im Creutzgange" (Kat. 207) scheint als ein Ausweichquartier gedient zu haben. 1782 fand erstmals eine Auktion im Senckenbergschen Stiftungshaus statt, das sich in der Folge als öffentlicher Auktionsort etablierte. Der Arzt Johann Christian Senckenberg hatte eine Stiftung gegründet, zu der ein anatomisches Theater, ein Bürgerhospital, ein botanischer Garten sowie das "Stiftungs=Hause hinter der sogenannten schlimmen Mauer" gehörte. Dieser Ort, auch das "Arztische Haus hinter der schlimmen Mauer" genannt (Kat. 135), sollte in der Folgezeit zum zentralen Versteigerungsort für Gemälde in Frankfurt werden. Zwischen 1782 und 1797 fanden hier sechs umfangreiche Versteigerungen statt. 69 Dennoch wurde ein nicht unerheblicher Teil der Frankfurter Sammlungen weiterhin in Privathäusern verkauft. 70 Auch in Leipzig wurden einzelne Sammlungen in den privaten Häusern der Besitzer versteigert, wie etwa das "Museum Wolffianum" in dem Haus des Eigners auf dem Neuen Neumarkt. Die meisten Auktionen fanden jedoch "im rothen Collegio" statt, das der Universität unterstand. In diesem wegen seiner roten Fassade Rotes Collegium genannten Gebäude in der Ritterstraße 16 wurden nahezu alle Auktionen durchgeführt. Im Erdgeschoß des barocken Gebäudes befand sich der Hörsaal der philosophischen Fakultät, der für die Auktionen genutzt wurde. Wie wenig adäquat jedoch auch dieser Saal gewesen sein muß, macht ein Beschwerdeschreiben des Universitätsproklamators Johann August Gottlob Weigel aus dem Jahre 1812 deutlich. Weigel spricht von Feuchtigkeit und Modergeruch, erste Auktionen seien der Universität schon entgangen, weil man keine angemessenen Räumlichkeiten bieten konnte. 71 Nur im Jahre 1799 wurde für eine Auktion des Kunsthändlers Rauch (Kat. 283) der "Hörsaale des Herrn Prälaten D. Burschers im Paulino", einem anderen Universitätsgebäude, genutzt.
In Nürnberg fand die Versteigerung der Gemälde aus der Sammlung Hagen "auf dem Rathaus" statt, die der Kupferstichsammlung sollte "in der v. Hagenischen Bewohnung" durchgeführt werden (Kat. 164). Frauenholz führte seine Versteigerungen in der "Frauenholzischen Behausung" durch. Die Sammlung des Kunsthändlers und Gastwirtes Johann Hermann Wild wurde nach seinem Tode ebenfalls in der "Wildschen Kunsthandlung" durchgeführt (Kat. 232). 7 2
Der Zeitpunkt der Auktion In den Messestädten Leipzig und Frankfurt am Main wurden die Auktionen seit den 60er Jahren des 18. Jahrhunderts zeitlich so gelegt, daß sie mit den Frühjahrs- und Herbstmessen in den beiden Städten zusammenfielen. Der Leipziger Kunsthändler Rost war ebenfalls bedacht, seine Auktionen jährlich zu einem festen Zeitpunkt zu veranstalten. In den Jahren 1783 und 1784 wurden die Auktionen noch für den 1. August anberaumt, im Jahre 1785 mußte die Auktion jedoch wegen der Versteigerung einer großen Bibliothek auf den Oktober verschoben werden. Beginn war der "Montag nach der Zahlwoche der kommenden Michaelismesse". Wie in Frankfurt hatten die angereisten Messebesucher, darunter auch viele Liebhaber und Sammler, die Möglichkeit, "die Sachen selbst in Augenschein zu nehmen, oder durch ihre Freunde und Agenten, welche unsere Messe bereisen, in Augenschein nehmen zu lassen". 7 3 In der Folgezeit behielt Rost den frühen Messetermin im Januar bei, so daß seine Auktionen jeweils auf den ersten "Montag nach der Zahlwoche der leipziger Neujahrsmesse" fielen (Kat. 176). Zugleich bot Rost den Besitzern von umfangreichen Sammlungen an, auf andere Auktionstermine auszuweichen. 74 Mit der zeitlichen Festlegung der Auktion war verbunden, daß für die jeweiligen Versteigerungen die Verkäufer ihre Waren bis zu einem festen Termin eingereicht haben mußten. Bereits auf den Titelblättern früher Auktionskataloge findet sich der Hinweis, daß die zum Verkauf angebotenen Gemälde vor Auktionsbeginn zu besichtigen waren. In den großen Messestädten Leipzig und Frankfurt bot der Messetermin die Möglichkeit, die Gemälde über einen längeren Zeitraum dem Publikum zur Vorbesichtigung
In Bonn und Köln standen für Versteigerungen keine öffentlichen Räumlichkeiten zur Verfügung, die Auktionen fanden in der Regel im Haus des Verstorbenen statt. Die Versteigerungen der kurfürstlichen Sammlungen Joseph Clemens (Kat. 10) und Clemens August (Kat. 4 5 ) wurde im Bonner Stadtschloß abgehalten; die Versteigerung der Sammlung des Leibarztes Gise im "Sterb=Hauss zu Bonn" (Kat. 14). Auch in späterer Zeit hat es in Köln nie eine entsprechende Einrichtung wie das Senckenbergsche Stiftungshaus für die Abhaltung von Auktionen gegeben. 67
Ebd., S. 348-351.
68
In dem "Scharffischen" Saal fanden ebenfalls die Auktionen Kat. 40, 42 und 131 statt.
69
Vgl. Kat. 116, 125, 135, 152, 154 und 183.
zu unterbreiten. Die Sammlung Bernus, die im Mai 1781 versteigert wurde (Kat. 134), konnte sogar bereits ein Jahr zuvor auf der Herbstmesse besichtigt werden: "Auch können sämt. Gemälde in besagtem Saalhof, die bevorstehende Herbst= und Ostermessen, Sonntags Nachmittags von 2 bis 6 Uhr, den Monat October und Merz aber die Woche über, als Montags und Freytags, um besagte Zeit öffentlich besehen und in Augenschein genommen werden". So besichtigte etwa Johann Heinrich Merck die Sammlung, die im Bernusschen Hause aufgestellt war, bereits im Februar, um sich über eventuelle Ankäufe kundig zu machen. 75 Auch der Katalog der Sammlung war schon 1780 fertiggestellt. In Hamburg waren die Vorbesichtigungen kürzer angesetzt: So war eine "auserlesene Sammlung", die am Montag versteigert werden sollte, am Sonnabend zuvor zu besehen (Kat. 76). Wohl die meisten Sammlungen konnten "Tages vorher [...] in beliebigen Augenschein genommen werden" (Kat. 166). Auch in Leipzig war es möglich, die zu versteigernden Sammlungen während der Messezeit vorzubesichtigen.
70
In Privathäusern wurden die folgenden Auktionen abgehalten: vgl. Kat. 128, 133, 134, 143, 215 und 286.
71
Brief Johann August Gottlob Weigel an die Magnifizenz vom 25.9.1812, Universitätsarchiv Leipzig; Philosophische Fakultät, Akte A4/40, Bd. 2, Bl. 155-155v.
72
Meusel KUnstlerlexikon 1808/14, Bd. 3, S. 471—172.
73
Vgl. Kat. 159, Vorwort, S. IV.
74
Vgl. Kat. 209, S. XI.
75
Merck 1911, S. 83, Brief vom 30. [28?] Feb. 1781.
19
Ablauf der Auktion "Auction ist eine öffentliche Ausrufung und Feilbietung dieser oder jener Sachen, zu dem Ende, daß dem, der am meisten darauf bietet, solche zugeschlagen werden sollen." 76 Dieser Beschreibung im Supplementband zu Zediere Universal-Lexikon aus dem Jahre 1751 entspricht der auf einer Vielzahl der Titelblätter gedruckte Vermerk: "an den meistbietenden [...] öffentlich sollen vergantet werden". Damit ist das interne Reglement der Auktion beschrieben. War zum einen der freie Zugang zur Auktion gewährleistet, so wurde nach Ausruf jedes der zu versteigernden Gemälde in den meisten Fällen mit einem zuvor festgelegten Preis begonnen. Die Auktionskataloge enthalten nur in Ausnahmefällen Angaben zu den Preisen, so beispielsweise der Nürnberger Verkaufskatalog von 1752: "die taxe aber ist von einem der berühmtesten Maler gemacht worden" (Kat. 29). Die Sammlung Clemens August (Kat. 45) ist wie auch die Sammlung Castell (Kat. 186) von Lambert Krähe vor der Auktion geschätzt worden. Im Fall der Sammlung Castell mußten die zu hoch angesetzten Taxierungen wieder zurückgenommen werden und die Sammlung ein zweites Mal realistischer bewertet werden. Auch die in Hannover in Form einer Lotterie veräußerte Gemäldesammlung des Landdrosten Reden wurde vorher taxiert (Kat. 39). Merck berichtet aus Frankfurt, daß ein Gemälde von Rembrandt aus der Sammlung Moser für 100 Gulden angesetzt war; er selber gab vor Beginn der Auktion ein Gebot in Höhe von 7 Carolin. 77 Das Gemälde wurde auf der Auktion schließlich für 81 Gulden verkauft (vgl. Kat. 135, Nr. 9). Es lagen somit zu Beginn der Auktion entsprechende Preislimite vor, wie auch Gebote von einzelnen Interessenten. Über einzelne Bietgefechte sind wir nur unzureichend informiert, Augenzeugenberichte sind selten überliefert. Merck beschreibt eine Auktion des Frankfurter Kunsthändlers Johann Andreas Benjamin Nothnagel im Jahre 1779 folgendermaßen: "Für den Herzog hab' ich in der Auction wenig Gemälde kauffen können, weil auf alle die Stüke, worauf Er mir Commission gegeben, unsinnig ist geboten worden. Außer 2 de Heems hab' ich für ihn erwischt, die um ein Spottgeld [weggegangen] sind." 78 Merck erwarb die beiden erwähnten Gemälde von de Heem nicht selbst; vielmehr war wiederum ein Händler beauftragt, für ihn zu bieten. Obwohl nach den meisten Reglements nicht erlaubt, haben wahrscheinlich die Auktionatoren und Makler immer wieder mitgeboten, um die Preise anzutreiben und Rückgänge zu vertuschen. Hierzu bedienten sie sich vermutlich in der Regel Mittelsmänner. Im frühen 18. Jahrhundert konnten Versteigerungen meist noch an einem Tag durchgeführt werden, erst mit dem Anwachsen der Sammlungen wurden die Auktionen von einem auf mehrere Tage ausgedehnt. In vielen Fällen zogen sich die Auktionen über zwei oder mehr Tage hinweg. So wurden für 686 Losnummern etwa zwei Tage benötigt, wobei am Vormittag und am Nachmittag versteigert wurde (Kat. 164). Die Versteigerung der Sammlung Bernus in Frankfurt im Jahre 1781 (Kat. 134) dauerte von Montag Vormittag bis Freitag; der Verkauf der 441 Losnummern läßt sich aufgrund des Auktionskatalogs genau beschreiben. Ein handschriftliches Auktionsprotokoll der in Bonn durchgeführten Auktion der Sammlung Clemens August informiert uns, daß sich die Versteigerung der Gemälde vom 14. Mai bis zum 19. Juni 1764 hinzog. Die Auktion fand jeweils von montags bis freitags statt, samstags und sonntags wurde nicht verkauft. Das Auktionsprotokoll zeigt, daß die Abfolge der zum Verkauf gelangten Losnummern nicht der Anordnung der Einträge im Katalog entsprach. Darüber hinaus wurde während der gesamten Auktion der Verkauf der Gemälde mit dem des Porzellans und der kunstgewerblichen Gegen-
stände abwechselnd durchgeführt. Pro Tag kamen dadurch nur zwischen 30 und 55 Gemälde zum Verkauf (Kat. 45). Oftmals findet sich schon auf den Titelblättern die Forderung, daß die entsprechenden Zuschläge in bar und ohne große Zeitverzögerung gezahlt werden müssen, auch die akzeptierten Währungen werden in der Regel angegeben. Meist mußte in der regional üblichen Währung bezahlt werden. Neben einer Vielzahl von Katalogen, in denen die Besitzer handschriftliche Vermerke der erzielten Preise eingetragen haben, existieren eine große Anzahl von Frankfurter und Hamburger Katalogen mit eingebundenen Leerseiten, auf denen die Käufernamen und die erzielten Preise notiert wurden. Vermutlich handelt es sich in einigen Fällen um die Kataloge der Auktionatoren, die sehr genau Buch über den Verlauf der Versteigerung geführt haben. Von einigen Auktionen haben sich auch ganz genaue Protokolle erhalten, die von offizieller Seite angefertigt wurden, so vor allem bei den Frankfurter Auktionen (vgl. Kat. 217 und 218).
Exkurs: Die Lotterie Als Form des Kunstverkaufs hebt sich die Auktion von der älteren Form der Lotterie ab, die in Holland im 17. Jahrhundert eine bedeutende Rolle bei der Veräußerung von Kunstbesitz gespielt hatte. Der englische Ausdruck 'lot' (Los), der heute weiterhin bei Auktionen zur Bezeichnung der versteigerten Gemälde dient, erinnert noch an den Vorgang der Lotterie. Glückslotterien lassen sich im 17. Jahrhundert als Form des öffentlichen Verkaufs von Kunstbesitz in Frankfurt nachweisen, vor allem zur Auflösung von Nachlässen: "Im März 1651 bat Abraham de Neufville zwecks Befriedigung seiner Gläubiger um die Gestaltung einer Lotterie von Kunstgegenständen und 1658 kam aus dem gleichen Grunde die Witwe des Pelzhändlers Matthäus Moors um die Genehmigung ein, eine Lotterie von allerlei Pelzwaren und Gemälden veranstalten zu dürfen." 79 Auch in anderen Städten fanden im 17. Jahrhundert Lotterien statt. 80 Eine Lotterie bot sich an, wenn sich an einem Ort noch kein Kunstmarkt entwickelt hatte. So ist beispielsweise der Versuch zu erklären, 1670 in Wien die aus Köln stammende Sammlung Imstenraedt mittels einer Lotterie loszuschlagen (Kat. 1). Neben dieser Lotterie in Wien lassen sich für das ganze 18. Jahrhundert nur drei Gemäldelotterien durch Kataloge nachweisen, die dann auch tatsächlich durchgeführt wurden. Bei dem Verkauf der Sammlung Balthasar Denner in Hamburg im Jahre 1749 scheiterte dagegen die geplante Lotterie, die Sammlung wurde dann verauktioniert (Kat. 20). Ebenfalls nicht realisiert wurde eine von Friedrich Karl Lang 1798 geplante Lotterie, durch die der schwierige Verkauf seiner Sammlung beschleunigt werden sollte. Vermutlich erfolgreich abgewickelt wurden 1763 der Verkauf der Sammlung Wilhelm Johann von Reden in Hannover (Kat. 39), die Lotterie des Frankfurter Kunsthändlers Nothnagel 1765 in Frankfurt mit 163 verlosten Gemälden (Kat. 50) und eine Lotterie in Zürich (Kat. 203). Die Lotterien mußten vorab die Einwilligung der jeweiligen Stadtverwaltung einholen. Für den Gemäldeverkauf spielte die Form der Lotterie in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts in Deutschland keine Rolle mehr. Die Form des Glücksspiels war für den Kunsthandel unter mehreren Gesichtspunkten denkbar ungeeignet. Aus ökonomischer Sicht wurde das Spiel von Angebot und Nachfrage als preisgestaltendes Moment durch die Festlegung des Gesamtwertes der veräußerten Sammlung von vornherein ausgeschlossen. So sicherte die Lotterie bei Verkauf aller Lose zwar die Einnahme des vorab veranschlagten Wertes der zu veräußernden Gemälde, zugleich wurde aber jede offene Preisgestaltung, wie sie bei der Auktion möglich war, ausgeschlossen. Das eigentliche Risiko bestand darin, daß die Lose, wie
76
Johann Heinrich Zedier, Nöthige Supplemente zu dem Großen Vollständigen Universal-Lexicon, Bd. 2, Leipzig 1751, Sp. 717f.
77
Merck 1911, S. 81, Brief vom 16.1.1781.
78
Merck 1911, S. 24, Brief vom 27.10.1779.
79
Dietz 1910/1925, Bd. 3, S. 267, und Bd. 4.2, S. 697.
80
Nach Förster 1931, S. 57.
20
im Fall der Wiener Lotterie von 1670, nicht alle losgeschlagen werden konnten. Auch für den wirklichen Sammler, der ausgewählte Gemälde für seine Sammlung erwerben wollte, war die Lotterie ein reines Glücksspiel. In Städten, in denen noch keine und nur selten Kunstauktionen veranstaltet worden waren, konnte jedoch mit einer Lotterie die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gewonnen werden. Bezeichnend ist, daß in keinem Fall eine solche Lotterie wiederholt worden ist.
Das Auktionswesen in Deutschland im 18. Jahrhundert. Ein historischer Überblick Insgesamt lassen sich für das späte 17. und das 18. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum 298 Auktionen nachweisen, auf denen 50.236 Gemäldelose angeboten wurden. Da gelegentlich zwei oder mehrere Bilder in einem Los verzeichnet wurden, ist die Zahl der tatsächlich angebotenen Gemälde etwas höher anzusetzen. 81 Diese Abweichungen sind allerdings so gering, daß im folgenden aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht zwischen der Anzahl der Gemälde und der Anzahl der Gemäldelose unterschieden wird. Bei zwei Katalogen handelt es sich um nur leicht veränderte Varianten, hier kommt es also in einigen wenigen Fällen zu Überschneidungen. Mehr als 50.000 Bilder bieten jedenfalls eine ausreichende Basis für einige statistische Betrachtungen. Trotz der guten Ausgangslage muß daran erinnert werden, daß in diesem Projekt wahrscheinlich auch nur ein kleiner Teil der tatsächlich im deutschsprachigen Raum stattgefundenen Auktionen erfaßt werden konnte. Von einem Auktionswesen für Gemälde kann in Deutschland eigentlich erst seit den 60er Jahren des 18. Jahrhunderts mit Beendigung des Siebenjährigen Krieges gesprochen werden. Vor 1763 spielt die Kunstauktion in Deutschland - im Unterschied zu den Märkten in den internationalen Zentren Amsterdam, Den Haag, Paris oder London - nur eine untergeordnete Rolle. Für das 17. Jahrhundert lassen sich zwei Versteigerungen und eine Lotterie nachweisen. Bis zum Jahre 1750 fanden insgesamt nur 27 Auktionen statt, das sind rund 9 Prozent auf das ganze 18. Jahrhundert gerechnet. Mit dem Jahr 1763 ist jedoch eine deutliche Veränderung auszumachen. Von diesem Zeitpunkt an fanden in den größeren Handelsstädten wie Frankfurt am Main, Hamburg oder Köln wiederholt Auktionen statt, wobei es in Frankfurt und Hamburg zu einer stetigen Zunahme an öffentlichen Versteigerungen kam. Ihren ersten Höhepunkt hatte diese Entwicklung im Jahre 1778, als zum ersten Mal in einer einzigen Stadt (Hamburg) mehr als 10 Auktionen in einem Jahr durchgeführt wurden. In Leipzig setzte das Auktionswesen dagegen erst am Anfang der 1780er Jahre ein. Auch im letzten Jahrzehnt, mit Beginn der Französischen Revolution, fiel Hamburg eine gewichtige Rolle zu. Tabelle 1: Chronologische und geographische der Auktionen gesamt
gesamt bis 1750 1751-1760 1761-1770 1771-1780 1781-1790 1791-1800
298
Berlin 12
Frankfurt Hamburg 40
27 9 32
Verteilung Leipzig
sonstige
140
Köln
27
70
11 6
1 2 1
12
1
10
9
4
61
7
37
82
14
34
11
20
87
7
43
12
19
14
Auf den 140 in Hamburg durchgeführten Auktionen wurden 17.895 Gemälde verkauft, das sind 35,6 Prozent aller versteigerten Bilder. Auf den 40 in Frankfurt durchgeführten Auktionen kamen 10.153 Lose zum Verkauf, was ein prozentualer Anteil von 20,5 Prozent ist. Es sind somit in Frankfurt pro Auktion deutlich mehr Gemälde versteigert worden als in Hamburg. Während in Hamburg durchschnittlich nur 152 Gemälde je Versteigerung zum Ausruf kamen, waren es in Frankfurt 264 Gemälde. 82 In Leipzig betrug die durchschnittliche Anzahl der versteigerten Gemälde pro Auktion nur 79 Bilder, was vor allem damit zusammenhängt, daß in Leipzig oftmals Gemälde nur als Anhängsel zu Versteigerungen von graphischer Kunst erschienen. Einen Sonderfall stellt München dar: Auf den drei nachweisbaren Auktionen wurden insgesamt 3.685 Gemälde veräußert. In der Versteigerung der Sammlung Joseph Eucharius Freiherr von Obermayr standen allein 2.160 Bilder zur Disposition (vgl. Kat. 196). Tabelle 2: Chronologische und geographische der verkauften Gemälde gesamt
bis 1800 % bis 1750 1751-1760 1761-1770 1771-1780 1781-1790 1791-1800
Verteilung
Berlin Frankfurt Hamburg Köln
Leipzig sonstige
50.236
757
10.153
17.895
2.088
2.122
100
1,5
20,5
35,6
4,2
4,2
17.221 34,0
3.985
-
555
520
244
113
2.553
727
-
-
-
-
509
218
5.584
399
2.190
51
461
21
2.462
8.286
144
2.574
3.984
-
-
1.584
16.975
22
3.550
5.191
826
544
6.842
14.679
192
1.284
8.149
557
935
3.562
Unter den 50.236 Gemälden, die auf den 298 Auktionen zum Verkauf angeboten wurden, nimmt die holländische Schule mit 10.334 Bildern den größten Anteil ein, was einem Anteil von 20,6 Prozent entspricht (vgl. Tab. 3). Unter holländischer Schule wird hier die Kunst der protestantischen Niederlande im 17. und 18. Jahrhundert verstanden, während die Gemälde vor 1600 aus den gesamten Niederlanden als "niederländisch" eingestuft werden. Die deutsche Schule folgt mit 9.864 Gemälden, was 19,6 Prozent des Gesamtmarkts entspricht. Die größte Gruppe überhaupt stellen allerdings mit 14.447 Gemälden (28,8 Prozent) die anonymen Werke, die keiner Schule zuzuordnen sind. Die Werke flämischer Künstler verzeichnen einen Anteil von 11,7 Prozent. Deutlich abgeschlagen sind die Gemälde der italienischen Schule mit 7,5 Prozent und die der französischen Schule mit 2,5 Prozent. Kaum registrierbar sind die spanischen Werke in Deutschland im 18. Jahrhundert, sie schlagen nur mit 0,3 Prozent zu Buche. Während die Dominanz der holländischen und flämischen Schule im deutschen Sprachraum nicht überrascht, ist die geringe Präsenz französischer Gemälde auffällig. Nur vereinzelt weisen einzelne Sammlungen einen erhöhten Anteil auf. Relativ gering ist auch der Anteil der niederländischen Werke mit 334 Werken, was einem Anteil von 0,7 Prozent entspricht. Einige anonyme Werke werden zwar als niederländisch bezeichnet, hier sind aber vermutlich flämische oder holländische Werke nach 1500 gemeint. 83 Nicht genau differenzieren läßt sich in der Datenauswertung die deutsche Schule. Nach den Künstlernamen zu urteilen, ist der überwiegende Anteil der deutschen Schule Künstlern des 18. Jahrhunderts zuzuordnen, die je nach Auktionsort jeweils meist der regionalen Schule angehören.
81
In einigen Fällen haben wir den in einem Los verzeichneten Gemälden allerdings eigene Losnummern zugeordnet (vgl. die Hinweise zur Benutzung der Verzeichnisse in diesem Band).
82
Bei der Berechnung des Durchschnitts war zu beachten, daß die in Tabelle 1 angegebene Anzahl der Versteigerungen auch einige Kataloge enthält, die nur noch bibliographisch nachgewiesen sind und deshalb im Verzeichnis der versteigerten Gemälde nicht berücksichtigt werden konnten. Bezogen auf Hamburg waren dies 22 Kataloge, bezogen auf Frankfurt ein Katalog.
83
Alle anonymen Werke, die als "niederländisch" bezeichnet waren, wurden in der Quantifizierung der Kategorie "Sonstige" zugerechnet.
21
Tabelle 3: Geographische Verteilung der verkauften Gemälde nach Schulen Berlin Frankfurt Hamburg Köln Leipzig sonstige
%
gesamt
100,0
50.236
757
10.153
17.895
2.088
2.122
17.221
Holländisch
20,6
10.334
212
1.989
5.029
416
371
2.317
Flämisch
11,7
5.897
104
1.314
1.972
342
153
2.012
0,7
334
2
58
112
13
17
132
19,6
9.864
128
2.408
3.629
221
493
2.985 194
gesamt
Niederländisch Deutsch Österreichisch
0,7
371
3
80
73
2
19
Schweizerisch
0,5
252
1
114
36
1
3
97
Französisch
2,5
1.271
45
152
542
31
74
427
Italienisch
7,5
3.790
88
601
1.173
152
208
1.568
Britisch
0,4
223
2
19
168
3
10
21
Spanisch
0,3
160
1
30
42
11
5
71
sonstige*
6,6
3.293
46
850
994
100
160
1.143
28,8
14.447
125
2.538
4.125
796
609
6.254
unbekannt
* In dieser Gruppe befinden sich unter anderem auch alle Gemälde, die von zwei oder mehr Malern stammen, sowie Bilder von Malern, deren Nationalität nicht klar zugeordnet werden kann.
Innerhalb der Gruppe der in Deutschland verauktionierten holländischen Gemälde lassen sich territoriale Differenzen ausmachen. Die meisten holländischen Bilder wurden in Hamburg verkauft, insgesamt 48,7 Prozent aller holländischen Werke wurden hier im 18. Jahrhundert umgesetzt. Der größte Teil der holländischen Gemälde wurde nach 1770 in Hamburg verkauft, da sich in dieser Zeit der Kunstmarkt intensiv entwickelte und sich auch zahlreiche Kataloge aus dieser Zeit für Hamburg erhalten haben. Im Vergleich zum gesamten Markt im deutschsprachigen Raum läßt sich für Hamburg eine Präferenz für die holländische Malerei feststellen, die mit den engen Verbindungen Hamburgs zu den Niederlanden, aber auch mit den Geschmacksvorlieben Hamburger Sammler in Zusammenhang stehen könnte. Der Anteil der holländischen Malerei auf den Hamburger Markt bezogen betrug 28,1 Prozent und lag damit doch deutlich über dem Durchschnittswert von 20,6 Prozent. Als zweitwichtigster Marktplatz für holländische Kunst fungierte Frankfurt. Dennoch läßt sich hier im Vergleich zu Hamburg ein etwas niedrigerer Anteil holländischer Gemälde feststellen, der vor allem im Gegensatz zu Hamburg in den letzten 30 Jahren des 18. Jahrhunderts noch weiter leicht zurückging. Auf das ganze Jahrhundert gerechnet, lag der Anteil der holländischen Malerei in Frankfurt nur bei 19,6 Prozent. Dagegen läßt sich im Bereich der flämischen Malerei ein leicht höherer Anteil in Frankfurt beobachten. Warum der Anteil holländischer Bilder in Frankfurt geringer als in Hamburg ausfiel, mag mit den weniger engen Handelskontakten zu den holländischen Städten zusammenhängen. Auch diente die ausgeprägte Landschaftsmalerei der zeitgenössischen Frankfurter Schule als geeignetes Substitut. Diese Vermutung bestätigt sich bei der Betrachtung der Zahlenverhältnisse für die Werke der deutschen Schule. Ohne daß hier zwischen altdeutschen und zeitgenössischen Werken der deutschen Schule des 18. Jahrhunderts geschieden werden kann, lassen sich für die Stadt Frankfurt etwas höhere Werte ausmachen. Betrachtet man den Anteil der insgesamt im deutschsprachigen Raum verauktionierten Bilder deutscher Künstler, liegen die Zahlen für Hamburg zwar noch höher, bezogen auf die insgesamt in Frankfurt verkauften Bilder ergeben sich jedoch für Frankfurt höhere Werte. So beträgt der prozentuale Anteil in Frankfurt für das gesamte Jahrhundert 23,7 Prozent, für Hamburg dagegen nur 20,3 Prozent. In den letzten 20 Jahren des 18. Jahrhunderts nimmt der Anteil der deutschen Bilder in Frankfurt im Vergleich noch zu. Die Anteile der deutschen Schule sind in Frankfurt und Hamburg jedoch vergleichsweise nahe beieinander. Es kann auch eine Rolle gespielt haben, daß in Frankfurt die Kataloge tendenziell sorgfältiger erstellt wurden und deswegen weniger anonyme Werke auftauchen. Hiergegen sprechen allerdings die Zahlen. Der Anteil der anonymen Werke ist in Hamburg etwas geringer als in Frankfurt. 84
22
Vgl. Valter 1995.
Insgesamt gering bleibt der Anteil der italienischen Werke im deutschen Auktionshandel des 18. Jahrhunderts. Der Anteil beträgt nur 7,5 Prozent am gesamten Markt. Hamburg ist auch bei diesem kleinen Marktsegment rein zahlenmäßig mit 1.173 Gemälden der wichtigste Umschlagplatz, anteilig gerechnet an den insgesamt in Hamburg verkauften Bildern beläuft sich der Wert jedoch nur auf 6,6 Prozent, in Frankfurt liegt er mit 5,9 Prozent unbedeutend niedriger. Dagegen wird in Leipzig bei einer insgesamt geringen Anzahl von verkauften Bildern ein Anteil von 9,8 Prozent erreicht. Obwohl man vermuten könnte, daß in den bürgerlich protestantischen Städten wie Hamburg das Interesse für die vorwiegend religiöse Thematik italienischer Kunst gering war, liegt der Anteil der italienischen Malerei nur leicht unter den Durchschnittswerten. Für die sonstigen Standorte liegt der Anteil der italienischen Gemälde mit 9,1 Prozent etwas über dem Durchschnitt. Hier haben vor allem höhere Werte in den süddeutschen Städten München und Nürnberg den Ausschlag gegeben. Überraschend bei der Untersuchung des Kunstmarkts in Deutschland im 18. Jahrhundert ist die Bedeutungslosigkeit der französischen Malerei. Der Marktanteil beträgt lediglich 2,5 Prozent. Auf den jeweils lokalen Markt bezogen liegt der Anteil der französischen Malerei in Frankfurt bei nur 1,5 Prozent, in Hamburg dagegen immerhin bei 3,0 Prozent. Der Anteil der französischen Werke an den insgesamt in Hamburg in den letzten zehn Jahren des 18. Jahrhunderts verkauften Bilder steigert sich auf 4 Prozent. Ob sich in dieser nur sehr leichten Steigerung ein Zusammenhang mit der Französischen Revolution herstellen läßt, bleibt Spekulation. Der Anstieg ist insgesamt nur gering, dennoch verbessert sich der Anteil der französischen Werke in einer Zeit, in der die Gesamtzahlen der in Hamburg verkauften Bilder stark ansteigen. Da in vereinzelten Katalogen vermehrt Werke französischer Maler, auch zeitgenössischer Künstler, auftauchen, könnten dieses Sammlungen aus dem Besitz von französischen Emigranten stammen. Es ist zu vermuten, daß sich in den ersten 20 Jahren des 19. Jahrhunderts der Anteil der französischen Malerei bei Auktionen noch erhöhte.
Von 1700 bis zum Ende des Siebenjährigen Krieges (1762/63) In der Zeit von 1700 bis zum Ausbruch des Siebenjährigen Krieges lassen sich nur 21 Auktionen ausmachen, von denen sich ein gedruckter Katalog erhalten hat. Die meisten der veräußerten Sammlungen gehören nach Umfang und Charakter der aufgeführten Gegenstände zum Typus der bürgerlichen Gelehrten- oder Kunstkammer-Sammlung, der sich in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Auflösung befand. Zahlreiche Auktionskataloge von reinen Kunstkammern, ohne Angaben von Gemälden, lassen sich im 18. Jahrhundert ebenfalls nachweisen. 84 Zu diesen Kunstkammer-Auktionen zählen beispielsweise das Museum Wolffianum aus Leipzig (Kat. 7) und die Nürnberger Sammlung Viatis (Kat. 3). In beiden Sammlungen spielten die Gemälde nur eine unbedeutende Nebenrolle. Auch wurden bei diesen Kunstkammer-Verkäufen dem einzelnen Bild und seinem Autor nur eine geringe Bedeutung beigemessen; besonders zahlreich sind hier die anonymen Werke. Von den 113 Gemälden des Museum Wolffianum wurden 107 ohne Angabe eines Künstlers aufgeführt; in der Sammlung Viatis erschienen die Gemälde nur summarisch unter dem Eintrag "Dann verschiedene schöne Gemählte von allerhand Meistern". Kunstauktionen hat es im deutschsprachigen Raum bereits im 17. Jahrhundert gegeben. Nachweisen lassen sich jedoch nur zwei Auktionen und eine Lotterie in Wien. So wurde 1690 die Gemäldesammlung des Herzogs Friedrich von Holstein-Norburg in Wolfenbüttel versteigert (Kat. 2). Allerdings existiert von dieser Auktion nur eine handschriftlich abgefaßte Verkaufsliste. Wohl eine der ersten Kunstauktionen mit einem gedruckten Katalog fand 1705 in Hannover statt. Verkauft werden sollte des "Churfürstl. Braunschw. Lüneb. Hoff-Rath Herrn Anthon Lucio hinterlassenen groß- und
kleinen Gemählden und Schildereyen" (Kat. 4). Die 115 verzeichneten Gemälde bildeten jedoch, wie im Fall der Wolfenbüttler Versteigerung, nur einen Teil der Auktion, darüber hinaus wurden weitere "Kunst=Stückgen", "Porcelainen", "Statuen", "Raritäten" und "Meublen" angeboten. Weitere Auktionen dieser Art fanden 1706 in Dresden mit 51 Gemälden (Kat. 5) und 1710 in Hamburg statt; die dazugehörige "Specification" verzeichnet neben Tapisserien, Kleidern, Spitzen und Spiegeln sechzehn "Schildereyen" (vgl. Kat. 6). Eine der ersten reinen Gemäldeauktionen in Hamburg wurde 1731 durchgeführt, versteigert wurde die Sammlung des holländischen Arztes Anthon Verborcht (Kat. 11). Bis zum Ende des Siebenjährigen Krieges lassen sich, wenn auch nur bibliographisch, zwölf weitere Gemäldeauktionen in Hamburg nachweisen. 85 Von zwei Ausnahmen abgesehen, geben die Titelblätter dieser Kataloge keine Auskunft über die jeweiligen Besitzer der Sammlungen. Die neuerliche Auffindung von fünf Hamburger Katalogen aus den Jahren 1747 bis 1750, darunter die Kataloge der beiden Gemäldekabinette von Barthold Heinrich Brockes mit 108 Gemälden und Balthasar Denner mit 116 Gemälden, erlaubt es jedoch, den Kenntnisstand über das frühe Sammel- und Auktionswesen im 18. Jahrhundert in Hamburg erneut zu überprüfen. 86 Die Gemäldeauktionen in den alten Messeund Handelsstädten Frankfurt, Hamburg, Leipzig, Köln, Nürnberg oder Braunschweig konnten jedoch den damaligen Anforderungen der fürstlichen Sammler nicht genügen, weder nach qualitativen noch nach quantitativen Gesichtspunkten. Von Beginn des 18. Jahrhunderts bis zum Ausbruch des Siebenjährigen Krieges im Jahre 1757 wurden an beinahe allen deutschen Fürstenhöfen und Residenzen nach französischem Vorbild neue Bildergalerien begründet. Erstmals überhaupt wurden selbständige Gemäldegalerien in Salzdahlum (1701), Düsseldorf (1709-14), Kassel (1751) und Potsdam (1755-1763) errichtet. Auch in den neu erbauten Schlössern in Schleißheim (1701), Berlin (1707/10), Pommersfelden (1711/18), Ludwigsburg (1704/33) oder Mannheim (1720/51) wurden eigens Galerieräume zur Aufstellung der Gemäldesammlungen eingerichtet. Darüber hinaus wurden im Zuge der Reorganisation einzelner Sammlungen entweder bestehende Räume zu Galerien umgestaltet, wie im Dresdener Stadtschloß,87 oder ganze Gebäudekomplexe für den Zweck der Neuaufstellung der Sammlungen zu Galerien umgebaut, wie beispielsweise das alte Stallgebäude am Jüdenhof in Dresden (1745/47). Die Vielzahl der in der ersten Hälfte des Jahrhunderts entstandenen Gemäldegalerien weist nachdrücklich auf die wachsende Bedeutung der Galerie innerhalb des höfischen Zeremoniells hin. Vor allem aber geben die neu eingerichteten Galerien Auskunft über den riesigen Bestand an bereits vorhandenen Kunstwerken, die nur zu einem äußerst geringen Teil auf dem Kunstmarkt in Deutschland erworben worden waren. Der Ankauf
von Gemälden auf dem heimischen Markt zählte zu den seltenen Ausnahmen. So ist zwar bekannt, daß Wilhelm von der Pfalz, Franz Lothar Graf von Schönborn oder August der Starke auch in Frankfurt Gemälde erworben haben, 88 oder daß sich der Dresdener Hof auf den jährlich stattfindenden Messen in Leipzig nach Gemälden umsah, ebenso wie man in Braunschweig auf der dortigen Messe für die fürstlichen Sammlungen Gemälde erwarb. Dennoch fehlte es im Unterschied zu den Märkten in Holland, Frankreich oder Italien überhaupt an ansprechenden privaten Sammlungen, deren Verkauf oder Verauktionierung auch nur eine annähernd ausreichende Zahl von Gemälden für den damaligen Bedarf hätte bereitstellen können. Ausdrücklich wünschte August III. von Sachsen nur die erlesensten Werken von italienischen Künstlern für seine Galerie, und Friedrich II. kaufte für die Ausstattung seiner Bildergalerie in Potsdam großformatige italienische Gemälde. 89 Zu diesem Zweck war man an den deutschen Fürstenhöfen auf ein weit verzweigtes Netz von Gesandten, Agenten und Künstlern angewiesen, mit deren Hilfe der auswärtige Markt in den Kunstmetropolen Amsterdam, Den Haag, Paris, London, Venedig oder Rom für die eigenen Zwecke sondiert werden konnte. Im Vordergrund der Erwerbstätigkeit stand dabei der Ankauf ganzer Sammlungen oder wenigstens einzelner Teilbestände. Dies entsprach dem Wunsch vieler Sammler, die Gemälde nicht öffentlich, d.h. einzeln in Form einer Auktion zu verkaufen, was ein Auseinanderfallen der Sammlung in bedeutende und weniger bedeutende Gemälde verursacht und mit einer Wertminderung der letzteren verbunden gewesen wäre. In München erwarb Maximilian II. Emanuel (1662-1726) im Jahre 1698 insgesamt 101 Gemälde aus Antwerpen. Jacopo Tintorettos Gonzaga-Zyklus ist wahrscheinlich über Venedig nach Schleißheim gekommen. 90 Kurfürst Johann Wilhelm von der Pfalz (1658-1716) wurde aus Paris über eine umfangreiche Sammlung von Gemälden informiert, die zum Verkauf anstand. Seit 1709 befand man sich in Verhandlungen über den Ankauf der Sammlung Odescalchi in Rom. Eine Inventarliste der Gemälde, die sich früher im Besitz der Christine von Schweden befanden, wurde nach Düsseldorf geschickt. 1711 trat man in Verhandlung über Gemälde aus dem Nachlaß der Sammlung in Mantua. 91 1736 wurde unter dem württembergischen Herzog Karl Alexander für 24.000 Gulden die Sammlung des Grafen Gustav Adolf von Gotter angekauft, der als Gesandter am Wiener Hofe tätig war. Die Sammlung enthielt 411 Gemälde, zum größten Teil niederländische und deutsche Gemälde des 17. und 18. Jahrhunderts, darunter aber auch Hans Memlings Bathseba.92 Der Landgraf Wilhelm VIII. von Hessen-Kassel konnte 1750 unter dem Siegel größter Verschwiegenheit die aus Delft stammende Sammlung Valerius Rover nach Kassel holen. Mit Hilfe des Kunsthändlers Ge-
85
Diese Zahl bezieht sich auf die im alten Realkatalog der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, Bd. IV, S. 7f., verzeichneten "Gemähide u. Kupferstich-Cataloge". Keiner der Auktionskataloge ist heute mehr auffindbar, was die Vermutung nahelegt, daß diese im Zweiten Weltkrieg verbrannt sind. Es handelt sich um die Kat. 18, 19, 21, 22, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 38 und 41; vgl. auch Holst 1939, S. 253-288, hier bes. S. 271. Holst verzeichnet noch einen weiteren Katalog aus dem Jahre 1729, der sich in der Stadtbibliothek Lübeck befand, heute aber nicht mehr nachweisbar ist.
86
Es handelt sich um die Kat. 17 (6.4.1747), 20 (31.7.1747), 24 (April 1750), 25 (15.6.1750), 26 (15.10.1750). Nur der letzte dieser Kataloge ist auch bei Holst 1939, S. 271, verzeichnet. Die fünf Kataloge wurden von Carsten Zelle, Bochum, im Landesarchiv Schleswig-Holstein, Schleswig, entdeckt; vgl. Zelle 1998, S. 15-17, bes. Anm. 51 u. Anm. 56.
87
Im Jahre 1707 waren Gemälde aus der Kunstkammer herausgenommen worden und im Redoutensaal (vgl. das Vorbild Berlin) im Südflügel des Schlosses aufgestellt worden; dann seit 1730 im "Riesensaal" und den angrenzenden Räumen im Schloß; vgl. Harald Marx, Die Dresdener Gemäldegalerie. Geschichte, Ruhm und Wirkung, in: ders. und Heinrich Magirius, Gemäldegalerie Dresden. Die Sammlung Alte Meister. Der Bau Gottfried Sempers, Leipzig 1992, S. 8.
88
Hüsgen 1780, S. 309.
89
Stefan Voerkel, Zur Geschichte der Sammlung, in: Gerd Bartoschek, Die Königlichen Galerien in Sanssouci, Leipzig 1994, S. 18-38.
90
Martin Eidelberg/Eliot W. Rowlands, The Dispersal of the last Duke of Mantua's Paintings, in: Gazette des Beaux-Arts 123 (1994), S. 207-294, hier S. 215f.
91
Als Agenten waren für Johann Wilhelm tätig: Jan Frans van Douven, N. Tyssens (Holland); Matteo Alberti (Paris); Graf Antonio Maria Fede (Rom). Vgl. Möhlig 1993, S. 26-37; Eidelberg 1994, S. 212f. Während der Regierungszeit Johann Wilhelms entwickelte der Hofadel selbst keine größeren Ambitionen zum Sammeln. Unter dem Nachfolger Johann Wilhelms, Carl Philipp (reg. 1716-1742), wurde die Residenz nach Mannheim verlegt (siehe Gerson 1942, S. 244ff.). Für den Kunstmarkt selbst spielte Düsseldorf keine weitere Rolle mehr.
92
Erbauung des Ludwigsburger Schlosses durch Herzog Eberhard Ludwig (1704-1734); damit einhergehend die Verlagerung der Residenz von Stuttgart nach Ludwigsburg im Jahre 1724. Ein großer Teil der Stuttgarter Gemäldesammlung (aus der Kunstkammer, dem neuen Lusthaus, eingerichtet 1650 - es existiert ein Inventar vom Jahre 1675 - und aus dem alten Schloß) wird nach Ludwigsburg gebracht. Ein Inventar aus dem Jahre 1724 gibt Auskunft Uber die Anzahl und die Aufstellung der Gemälde. Beinahe 1.000 Gemälde, darunter nach Lange 376 Galeriebilder. 1734 werden die Gemälde vor den Franzosen wieder nach Stuttgart gebracht, von wo sie dann wieder nach Ludwigsburg gelangten; vgl. Konrad Lange, Einleitung, in: Verzeichnis der Gemälde-Sammlung im Königlichen Museum der bildenden Künste zu Stuttgart, Stuttgart 1903, V-LIV. bes. XII-XV.
23
rard Hoet erwarb der Landgraf 64 Gemälde von außerordentlicher Qualität, darunter allein acht Gemälde "aller Manier" von Rembrandt, die in dem neuen Galeriegebäude aufgestellt wurden. 93 Die wohl umfangreichsten Transaktionen fanden am sächsischen Hof in Dresden in der Zeit zwischen 1737 und dem Ausbruch des Siebenjährigen Krieges statt. Ein Inventar aus den Jahren 1722 bis 1728 verzeichnet bereits über 3.500 Gemälde. Unter der Regentschaft König Augusts III. (1696-1763), seit 1733 Kurfürst und König von Polen, erwarb 1738 der Agent Ventura Rossi 44 Gemälde aus der venezianischen Sammlung Duodo für die Galerie in Dresden. 1741 wurde ein Teil der Gräflich Wallensteinschen Sammlung in Duchov (Dux) für 22.000 Gulden nach Dresden verkauft. In Italien konnten im Jahr 1745 rund 100 Gemälde aus der bekannten Sammlung des Herzogs Francesco III. von Modena angekauft werden, 1754 folgte Raffaels Sixtinische Madonna.94 Auch am Brandenburgischen Hof in Berlin war man bemüht, im Ausland Gemälde im größeren Umfang zu erwerben. 95 Im Jahre 1742 waren 37 Gemälde aus der sogenannten Oranischen Erbschaft nach Berlin gelangt. 1754 schrieb Friedrich II. an seinen Kammerdiener Fredersdorf nach Paris: "Schreibe doch an Metra nach paris: wenn dortn Inventaires werden. Wöhr Tablos verkaufet werden, ob von Tisiens, Paul Veronesse, Jourdans und Corege vohr Honete preise Kaufen könte: hübsche, große, Tablau de galerie". 96 Bis zum November des nächsten Jahres gelang es Friedrich II., annähernd 100 Gemälde für die im Bau befindliche Galerie in Potsdam zu erwerben. 97 Erschwerend für die Ausbildung eines organisatorisch gefestigten Kunsthandels und Auktionswesens kam hinzu, daß nur wenige der adeligen Sammlungen, die in der ersten Hälfte des Jahrhunderts aufgelöst wurden, in Deutschland verkauft oder gar öffentlich verauktioniert wurden. Eine Ausnahme bildete die Sammlung des Herzogs Friedrich von Holstein-Norburg, die 1690 in Wolfenbüttel versteigert wurde (Kat. 2). Unter den Käufern befand sich auch Herzog Anton Ulrich, im Auktionsprotokoll "Serenissimus" genannt. Die qualitativ wertvollsten Sammlungen jedoch, wie etwa die beiden Kölner Sammlungen Everhard IV. Jabach und Franz von Imstenraedt, gelangten bereits gegen Ende des 17. Jahrhunderts auf direktem Wege nach Paris und nach Wien, um hier weiterverkauft zu werden (vgl. Kat. I). 98 Auch in der Folgezeit wurden immer wieder adelige Sammlungen ins Ausland gebracht, um auf den internationalen Märkten zu einem höheren Preis versteigert zu werden, so die beiden bei Hoet aufgeführten Sammlungen der Grafen Plettenberg und Schönborn, 99 die 1738 in Amsterdam verkauft wurden. Einzig in Prag und seit den 1740er Jahren auch im Umfeld des kurfürstlichen Hofes in Bonn und Köln gelangten einzelne adelige Sammlungen auf den Markt, in Prag 1723 die Sammlung Wrschowetz (Kat. 9) und 1739 die Sammlung Nostitz (Kat. 12), in Bonn die Sammlungen des Kurfürsten Clemens August (Kat. 45). Die Voraussetzung war in beiden Städten eine breite, in sich geschlossene Sammlerschicht, dort der böhmische Adel, hier die Mitglieder des kurkölnischen Hofes, die den Verkauf der angebotenen Werke sicherten. Prag war zudem für die adligen Sammler in Wien und Dresden von Interesse. Die Auktionen in den Messe- und Handelsstädten Frankfurt, Hamburg, Leipzig oder Nürnberg waren dagegen zu allererst für die
lokalen Sammler von Bedeutung. Hier konnten wohlhabende Bürger auf dem lokalen Markt Gemälde für ihre Bildersammlungen erwerben. Nur wenn das Angebot qualitativ und quantitativ herausragte, konnten sich auch in der kommenden Sammlergeneration qualitätvolle Sammlungen herausbilden. Von entscheidender Bedeutung war deswegen ein Kunsttransfer von außen in den Kreislauf eines lokalen Markts. Nur mit einer solchen Initialzündung konnte eine Angebotslage geschaffen werden, die überhaupt erst das Sammeln möglich machte. Im Unterschied zu den großen Residenzstädten Dresden, Berlin, Düsseldorf, Mannheim oder München kamen unterschiedliche handelspolitische, fiskalische und organisatorische Voraussetzungen hinzu, die einen öffentlichen Kunstmarkt erst allmählich entstehen ließen. Für die oben genannten Auktionsorte ergeben sich unterschiedliche Ausgangssituationen, die es notwendig machen, die wichtigsten Städte einzeln zu betrachten.
Hamburg Nahm Hamburg auch keine Vorrangstellung in der Entwicklung des Auktionswesens ein, so etablierte sich hier doch seit den 1740er Jahren ein Kunstmarkt, in dem die Form der öffentlichen Auktion, im Unterschied zu den anderen Städten, bereits einen wesentlichen Bestandteil bildete. Zwischen 1743 und 1760 fanden 17 Gemäldeauktionen statt, von denen sich Kataloge erhalten haben. Für keine andere Stadt im Reich konnte bisher eine entsprechende Zahl von Gemäldeauktionen nachgewiesen werden. Eine Ausnahme bildet allenfalls Kopenhagen mit über 10 Auktionen bis zum Ende des Siebenjährigen Krieges. Der entscheidende Vorteil Hamburgs als Auktionsort gegenüber anderen Handelsstädten war, abgesehen von der wirtschaftlichen Bedeutung als führendem nordeuropäischen Zwischenhandels- und Umschlagplatz, die liberale Auktionsordnung. Gemälde durften wie alle anderen Güter ohne Einschränkung verauktioniert werden. Zudem konnte der Kunsthandel auf organisatorische Strukturen zurückgreifen, die bereits gegen Ende des 17. Jahrhunderts ausgeprägt waren. Hamburg hatte sich damals zum Mittelpunkt des Buchauktionswesens entwickelt und die alten Universitätsstädte Leipzig, Halle, Jena oder Halberstadt, was die Durchführung von Buchauktionen betrifft, überholt. 100 1676 fand hier eine der ersten Bücherauktionen in Deutschland statt. Für den Zeitraum bis 1700 lassen sich insgesamt über 110 Buchauktionen quellenkundlich nachweisen. Von den knapp 80 tatsächlich ermittelten Katalogen stammen allein 50 Kataloge aus Hamburg. 101 Zu den bibliophilen Großereignissen gehörte etwa der Verkauf der Bibliothek des Arztes und Professors Martin Fogels im Jahr 1678. Noch vor Beginn der angekündigten Auktion erwarb Gottfried Wilhelm Leibniz die gesamte Bibliothek für den Herzog Johann Friedrich von Hannover. 102 Sorgfältig edierte Kataloge, ein öffentlicher Auktionsort, wohl angekündigte Auktionen in der Tagespresse und ein breit gefächertes Kommissionsgeschäft weisen auf die komplex entwickelte Organisationsstruktur des damaligen Buchmarkts hin. Diese Errungenschaften sollten im 18. Jahrhundert für den Kunstmarkt Vorbildcharakter haben. In Hamburg war es zudem möglich, anonyme Büchersammlungen oder Teilbestände zu reinen Spekulationszwecken zu verkaufen. Dieses
93
Bernard Schnackenburg, Gemäldegalerie Alter Meister. Gesamtkatalog. Staatliche Museen Kassel, 2 Bde., Mainz 1996, Bd. 1, S. 16.
94
Vgl. Posse 1930; Harald Marx, Die Dresdener Gemäldegalerie. Geschichte, Ruhm und Wirkung, in: ders. und Heinrich Magirius, Gemäldegalerie Dresden. Die Sammlung Alte Meister. Der Bau Gottfried Sempers, Leipzig 1992, S. 9; Gregor J. M. Weber, Italienische Kunsteinkäufer im Dienst der Dresdener Galerie, in: Dresdener Hefte 12, Heft 40 (1996), S. 3 2 ^ 2 .
95
Vgl. Gerson 1942, S. 228-233.
96
Zit. nach Eckhardt 1986, S. 6; auch ders., Die Bildergalerie in Sanssouci. Zur Geschichte des Bauwerks und seiner Sammlungen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, 2 Bde., Phil. Diss. Halle-Wittenberg 1974.
97
Seidel 1892, S. 188: Brief Friedrich II. an seine Schwester, der Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth vom 30.11.1755, in dem Friedrich seine neue Ankaufspolitik darlegt.
98
Förster 1931, S. 57.
99
Die Auktion der Sammlung Plettenberg fand am 2. April 1738 (Lugt 480) und die des Barons "Schonborn" am 16. April 1738 in Amsterdam statt (Lugt 480 und 482). Ein handschriftliches Verzeichnis der Sammlung Plettenberg befindet sich im Stadtmuseum Münster (freundlicher Hinweis Gerd Dethlefs).
100
Hans Dieter Gebauer, Bücherauktionen in Deutschland im 17. Jahrhundert, Bonn 1981, S. 54-61.
101
Ebd., S. 139-184.
102
Ebd., S. 58.
24
Vorgehen war in anderen Städten verboten, wo nur bei Auflösung eines Besitzstandes der Verkauf mittels der Auktion möglich war. Der Kunstmarkt in Hamburg fand somit Anschluß an eine Entwicklung, die im Bereich des Buchwesens bereits im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts ihren Anfang genommen hatte. Die organisatorischen Strukturen machte man sich sehr schnell zu eigen. Dementsprechend heißt es 1748 im Neu=eröffneten Kaufmanns-Magazin·. "Gemähide [...] lauffen so weit in der Kauff=Leute ihren Handel hinein, als solche zur Auszierung gewisser Oerter oder von gewissen Personen, ihrer Profession, Stand und Inclination nach, gesuchet werden." 103 Fanden in den ersten Jahrzehnten noch viele Auktionen in den Privathäusern der Sammler statt, wie die Versteigerungen der Sammlungen Verborcht oder Denner (Kat. 11 und 20), so existierten mit dem Eimbeckschen Haus und der Börse bereits zwei öffentliche Lokalitäten, in denen Auktionen abgehalten wurden. Die wesentliche Voraussetzung für die Durchführung von reinen Gemäldeauktionen war die Existenz privater bürgerlicher Gemäldekabinette, die nach dem Tode ihrer Besitzer veräußert werden konnten. Folgt man der neueren Kunst- und Sozialgeschichtsschreibung der Aufklärung in Hamburg, so spielten die privaten Gemäldekabinette für den Fortgang der bürgerlichen Aufklärung in Hamburg im 18. Jahrhundert jedoch keine Rolle: Als Bestandteil einer städtischbürgerlichen Kultur sind sie schlichtweg nicht existent. 104 Das Fehlen einer zusammenhängenden Vorstellung vom Sammelwesen in Hamburg mag sich zum einen aus der Tatsache herleiten, daß es in Hamburg zwar "an Kunst= und Raritäten=Kammem nicht fehlet", wie es in der 1723 erschienenen Schrift "Die Geöffnete Raritätenund Naturalien-Kammer" heißt, 105 diese "aber gar zu geheim gehalten und den Reisenden selten kund worden". 106 Bereits Karel van Mander berichtet in seinem "Schilder-Boeck" (1617), daß der aus Antwerpen wegen Religionsverfolgung nach Hamburg geflüchtete Sammler Dominicus van Uffele ein Gemälde von Cornells Ketel "in einer Truhe dem Tageslicht und den kunstbegierigen Augen nur zu viel entzogen" habe. 107 Im 18. Jahrhundert ist die Unzugänglichkeit bereits sprichwörtlich, gleichwohl sich in der älteren Reiseliteratur einzelne Sammlungen nachweisen lassen. Zacharias Conrad von Uffenbach führt etwa die Gemäldesammlung des Ratsherrn Henning Lochau an, die er im Jahre 1710 zusammen mit seinem Bruder Johann Friedrich während eines Aufenthaltes in Hamburg gesehen hatte. 108 Dagegen zerschlug sich der Besuch der Sammlung des "Herrn de Flüger [...], der viele Gemälde haben, und damit handeln soll." 109 In Caspar Friedrich Neickelius' "Raritäten=Kammern" wird die Situation in Hamburg lakonisch zusammengefaßt: "Ein Liebhaber 103
der Gemähide wird sein vollkommenes Vergnügen in Besehung (so ferne erlaubt) der vortrefflichen Cabinetten, bey einigen hiesigen berühmten Kauffleuten, und vielen andern darinn bekandten Personen finden."110 In der Folge zählt Neickelius nur zwei Gemäldekabinette auf, die Sammlungen Marcus Friedrich Stenglin und Matthias Lütken; 111 eine bescheidene Zahl angesichts der vielen von ihm erwähnten Raritätenkammern. Der in Weimar als "Hochfürstlicher Hof=Mahler" tätige Johan Anton Klyher dagegen hat während seines Aufenthaltes in Hamburg mehrere Privatsammlungen besuchen können. Zu den "lobwürdig ausgeschmückte[n] Cabinette[n]" der Stadt zählt er die bereits erwähnte Sammlung Stenglin sowie die Sammlungen des "Hrn Colldorps" [Joachim Coldorf?], Barthold Heinrich Brockes, Martin Tamm und Peter Schier. 112 Keine Erwähnung fand, weder bei Klyher noch bei Uffenbach, der Sammler Jacob de le Boe Sylvius, dessen Sammlung bereits in der "Teutschen Academie" (1675) von Joachim van Sandrart beschrieben wurde. 113 Neben den Kunsttraktaten und Reisebeschreibungen aus dem 17. und 18. Jahrhundert gehören auch die Auktionskataloge zu jenen Quellen, die nachhaltig Zeugnis ablegen von der Existenz privater bürgerlicher Gemäldekabinette in Hamburg. Wichtige Impulse erhielt das Sammelwesen in Hamburg immer wieder von außen. So brachte etwa Marcus Friedrich Stenglin bei seiner Übersiedlung von Augsburg nach Hamburg vermutlich auch den Grundstock seiner Sammlung mit. 114 Im frühen 17. Jahrhundert gab es neben Dominicus van Uffele zwei weitere Sammler aus den Niederlanden, Mathis Bode und Jan van de Wonner. 115 Gegen Ende des 17. Jahrhunderts gelangte dann eine große Anzahl holländischer Emigranten und Künstler, die aus politischen, religiösen oder ökonomischen Gründen ihre Heimatstädte verlassen mußten, nach Norddeutschland. Zu diesen Emigranten gehörten auch die Ärzte Jacob de le Boe Sylvius und Anthon Verborcht (1658-1724), der bis 1692 in Utrecht lebte und wegen seiner anatomisch-medizinischen Sammlung bekannt war. 116 Neickelius berichtet, daß dieses Kabinett "der hochgelehrte Herr Theodoras Kerkring angefangen, und in seinem zu Amsterd. An. 1670. edirten Spicilegio Anatomico schon damals beschrieben" habe. 117 Sowohl Verborcht wie auch der erwähnte Arzt, Anatomiker und Chemiker Theodor Kerckring ließen sich in Hamburg nieder. Kerckrings Stadtpalais am Neuen Wandrahm 17, nach Plänen des holländischen Architekten Philipp Vingboons errichtet, gehörte zu den eindrucksvollsten barocken Häusern in der Hansestadt. 118 Auch Philipp Heinrich Stenglin residierte in seinen Stadthäusern am Neuen Wall (Nrn. 26-28 und Nrn. 70-74); Verborcht war "beym Theerhof' wohnhaft. Rohde, der sich noch auf den Auktionskatalog von 1731 beziehen konnte, vermutet, daß Ver-
Paul Jacob Marpergers, Neu=eröffnetes Kaufmanns=Magazin, Hamburg 1748, Bd. 3, S. 635.
104
Kopitzsch 1990, S. 247-327; Plagemann 1995, S. 183. Siehe hingegen Rohde 1922, S. 47-54; Colshom 1968, S. 3197-3207.
105
Die Geöffnete Raritaeten- und Naturalien-Kammer, worin Der Galanten Jugend so wohl als andern Curieusen und Reisenden gewiesen wird / wie sie Galerien, Kunst= und Raritaeten-Kammem mit Nutzen besehen und davon raisonieren sollen. Wobey eine Anleitung / wie ein vollständiges Raritaeten-Haus anzuordnen und einzurichten sey; Samt angehängten sehr nützlichen Observationibus vor die Anfänger dieses Studii, verfertiget von einem Liebhaber Curieuser Sachen, Hamburg 1707; Ausst.-Kat. Amsterdam 1992, S. 26f., Nr. 19.
106
Des Geöffneten Ritter=Platzes Dritter Theil [...]. Hamburg 1723, S. 142f.
107
Carel van Mander, Das Leben der niederländischen und deutschen Maler, hg. von Hanns Floerke, 2 Bde., München, Leipzig 1906, Bd. 2, S. 185. Zu Uffele siehe J. M. Lappenberg, Die Reisen des Herrn Johann Arnold von Uffele und dessen Anverwandte, in: Zeitschrift des Vereines für Hamburgische Geschichte 3 (1851), S. 273f.
108
Uffenbach 1988.
109
Ebd., 122f.; de Flüger wohnte "auf der Mühren".
110
Neickelius 1727, S. 54.
111
Neickelius 1727, S. 199: "der Hr. Marcus Friedr. Stenglien hat ein Gemach voller auserlesener und kostbarer Gemähide vieler berühmter Meister. [...] Der selig=verstorbene Hr. Matth. Lütgens hat sowol in seiner Behausung, als auch auf seinem Garten eine auserlesene Anzahl köstlicher Gemähide hinterlassen."
112
Klyher 1729, Vorrede [nicht paginiert].
113
Joachim von Sandrarts Academie der Bau-, Bild- und Mahlerey-Künste von 1675. Leben der berühmten Maler, Bildhauer und Baumeister, hg. von A. R. Peltzer, München 1925, S. 350f.
114
Siehe Rohde 1922, S. 52.
" 5 Gerson 1942, S. 217; als einheimischer Sammler wird zudem der Bankier Schmidt genannt. 116
Für Auskünfte über die Familie Verborcht danken wir Marten Jan Bok, Utrecht.
" 7 Neickelius 1727, S. 199. 118
Lexikon 1851/83, Bd. 3 (1857), S. 564. Kerckring, aus einer alten lübeckischen Familie stammend, besaß die Häuser Neuer Wandrahm Nrn. 5, 17 sowie vermutlich die Nr. 6. Freundlicher Hinweis von Herrn Rose, Staatsarchiv Hamburg. Zu den Bauten siehe Heckmann 1990, S. 33-37. S.A.C. Dudok van Heel, Gemeentearchif Amsterdam, bereitet eine Studie über Kerckring vor.
25
borcht auch weiterhin Gemälde erwarb: "Seinen Hintz, Waterloo, Glauber hat er vermutlich in Hamburg gekauft, während er seine Lucas von Leyden, Ostade, Vonck, Tewyck u.a. aus seiner Heimat mitgebracht haben wird." 119 Die umfangreiche Bibliothek Verborchts wurde am 19. Juni 1724 versteigert.120 Im Jahre 1727 berichtete Neickelius, daß auch das anatomische Kabinett von den Erben zum Verkauf angeboten worden sei.121 Anregungen erhielten die Hamburger Kaufmannssöhne, Juristen und Mediziner auch auf ihren Bildungsreisen durch die Niederlande oder während ihres Studiums an den dortigen Universitäten. In Amsterdam, Den Haag oder Leiden wurden sie mit einer Form des Sammeins konfrontiert, die den eigenen repräsentativen Ansprüchen und Erwartungen zu entsprechen schien. Die prunkvollen Stadtpaläste der Kaufleute, Politiker und Gelehrten an der Heren-, Keizers- und Prinzen-Gracht in Amsterdam oder auf der Rapenburg in Leiden waren Ausdruck des gesellschaftlichen Status' dieser Klasse, der sich auch in den Bilderkabinetten manifestierte. Von dem Sammler Henning Lochau ist bekannt, daß er 1688 durch die Niederlande gereist war. Barthold Heinrich Brockes hielt sich 1704 längere Zeit in Leiden auf. Brockes' Sammlung zeigt, wie nachhaltig das Vorbild der privaten Kabinette in den Niederlanden das hiesige Sammelverhalten prägen konnte. Wie die Sammlungen Brockes, Coldorf, Denner, Flüger, Lütken, Lochau, Schier, Stenglin, Tamm, De le Boe Sylvius und Verborcht zusammen mit den anonym versteigerten Gemäldesammlungen zeigen, hat es in Hamburg bereits in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine ausgeprägte bürgerliche Sammelkultur gegeben. In öffentlicher Hand befand sich einzig eine Sammlung von Gemälden im alten Rathaus, die am 16. und 17. April 1789 veräußert wurde (Kat. 189). Diese bürgerlichen Bilderkabinette setzten sich deutlich von dem traditionellen Typus der gelehrten Kunst- und Raritätenkammer ab, der im Laufe des 18. Jahrhunderts, wie eine Vielzahl von weiteren Auktionen belegt, allmählich verschwand.122 Einzelne der oben genannten Sammler gehörten zu den zentralen Figuren der Frühaufklärung in Hamburg. Barthold Heinrich Brockes (1680-1747) 123 und Michael Richey (1678-1761), der eine Sammlung von Kupferstichen besaß (Kat. 41), 124 waren bereits Mitglieder der Teutsch-übenden Gesellschaft (1715-1717), bevor sie 1724 an der Herausgabe der moralischen Wochenschrift "Der Patriot" federführend mitwirkten. Zu den Mitgliedern der Patriotischen Gesellschaft von 1724 gehörte auch der Privatgelehrte und Kaufmann Johann Adolf Hoffmann (1676-1731), der weniger mit Gemälden, denn "mit Juwelen, geschnittenen Steinen und ähnlichen Kunstsachen" handelte.125 Marcus Friedrich Stenglin (1652-1736) war Mitglied einer traditionsreichen Bank- und Kaufmannsfamilie, die ihr Stammhaus in Augsburg besaß. 126 Nach dem Tode Stenglins gelangte die Sammlung in den Besitz seines Sohnes, des späteren Oberalten Philipp Heinrich Stenglin (1688-1757), der einer der
wohlhabendsten und einflußreichsten Männer der Stadt war. 127 Henning Lochau (1664-1722) 128 gehörte wie Brockes und [Joachim?] Coldorf 129 zu den "Raths=Verwandten der hochlöblichen Hamburgischen Republic". Lochau, mit der Tochter des Bürgermeisters Johann Dietrich Schaffhausen verheiratet, war 1710, Brockes 1720 zum Ratsherrn gewählt worden. Die genannten Sammler lassen sich somit jener kleinen, aber äußerst einflußreichen Gruppe von Markmillionären, Politikern und Gelehrten zuordnen, die das städtische Gemeinwesen, das im Jahre 1710 bereits 75.000 Einwohner umfaßte und nach Wien die zweitgrößte Stadt im Heiligen Römischen Reich war, nach holländischem Vorbild oligarchisch regierte und verwaltete. Der Maler Balthasar Denner (1685-1749), selbst Sammler, war der bevorzugte Portraitist dieser Schicht.130 Einige Bemerkungen des Kunstschriftstellers und Sammlers Christian Ludwig von Hagedorns werfen jedoch ein kritisches Licht auf das Auktions- und Sammelwesen in der Hansestadt. Seinen Bruder weist er an, die Sammlung auf keinen Fall in Hamburg zu verkaufen, "wohl aber meinen Catalogum in Wien und Prag bekannt zu machen". 131 Seine Befürchtungen gingen dahin, daß die Gemälde im Einzelfall auf kein ausreichendes Interesse bei den Hamburger Sammlern stoßen würden und unter Wert veräußert werden könnten. Auch Brockes' Sohn hatte sich anläßlich der Versteigerung der Gemälde seines Vaters in Hamburg gegenüber Hagedorn äußerst negativ "über den hiesigen Gusto" geäußert.132 Frankfurt am Main Die Sammlung Johann Matthäus Merians, eines Enkels des Verlegers und Kupferstechers Johann Matthäus Merian d.Ä., gehörte zu den ältesten Sammlungen in der Freien und Reichsstadt Frankfurt. Johann Matthäus Merian war 1624 von Basel nach Frankfurt übergesiedelt, wo er zwei Jahre später den Verlag seines Schwiegervaters Theodor de Bry übernahm und zu einem internationalen Großverlag ausbaute. Nach seinem Tode übernahm Johann Matthäus d.J. das Geschäft des Vaters, das wiederum an seine Söhne übertragen wurde. Die unter ungünstigen Umständen zum Verkauf angebotene Sammlung Johann Matthäus' enthält zum großen Teil Werke des Vaters und Großvaters, darüber hinaus viele Gemälde von niederländischen Künstlern (vgl. Kat. 8); einige von ihnen hatten im 17. Jahrhundert die Niederlande verlassen und waren nach Deutschland übergesiedelt. Auch die Sammlerfamilien de Neufville, Schelkens und Lersner waren aus anderen Regionen Europas nach Frankfurt am Main gezogen. Die Familie Ucheln stammte aus den Niederlanden, die Familie Behagel aus Flandern, die Familie Bemus aus Lüttich, die Städels aus Straßburg oder die Familie Brentano vom Comer See. Die Gemäldesammlung Heinrich von Ucheln wurde 1744 öffentlich verauktioniert (Kat. 16). Sie war gut bestückt mit Gemälden von Mitgliedern der Familie Merian, der ebenfalls in Frankfurt an-
119
Rohde 1922, S. 51.
120
Des seel Hm D. Anthoni Verborgs, bei seinem Leben Hoch=berühmt und erfahreren Medici, auserlesene Bibliothec, [...], welche den 19. Juni 1724 in Hamburg [...] verkaufft werden sollen. Hamburg [o.J.] (Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, Signatur A/302669).
121
Neickelius 1727, S. 199.
122
Versteigerangen von Kunst- und Raritätenkammern fanden in Hamburg am 20.4.1758, 20./21.4.1774, 30.5.1775, 21.8.1775 und am 24./25.9.1800 statt. Die entsprechenden Kataloge befinden sich in der Bibliothek der Hamburger Kunsthalle.
123
Zu Brockes siehe die Aufsätze in: Barthold Heinrich Brockes (1680-1747). Dichter und Ratsherr in Hamburg. Neue Forschungen zu Persönlichkeit und Wirkung, hg. von Hans-Dieter Loose, Hamburg 1980.
124
Die Sammlung wurde am 27.7.1763 versteigert, siehe Realkatalog der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, S. 73. Zu Richey siehe Kopitzsch 1990, Bd. 1, S. 264.
125
Lexikon 1851/83, Bd. 3 (1857), S. 316-319; Kopitzsch 1990, Bd. 1, S. 270-271. Hoffmanns Sammlung von Gemmen und Edelsteinen wurde 1732 versteigert.
126
Zur Herkunft der Familie siehe Genealogische Sammlungen, Staatsarchiv Hamburg, Teil 2, S. 282: "Stenglin: ist ein sehr altes, ansehnliches in den schwäbischen Reichsstädten sehr bekanntes Geschlecht [...]. Seiner Elternhaus in Augsburg hatte das seltene Glück gehabt, 200 Jahr lang eine Handlung fortzuführen, die Bildniße von seinen Vorfahren konte derselbige fast vom Anfang des 15ten Seculi an in seinem höchst berühmten Cabinet aufweisen."
127
Zur Familie Stenglin siehe Rohde 1922, S. 52. Zu Daniel Stenglin (1735-1801), der die Sammlung seines Vaters übernahm, siehe Lexikon 1851/83, Bd. 7 (1879), S. 302.
128
Lexikon 1851/83, Bd. 4 (1866), 517f.; Lochau wohnte auf dem "alten Wantram".
129
Ebd., Bd. 1 (1851), S. 565, s.v. Joachim Friedrich Coldorf.
130
Nach Klyher 1729, Vorrede, war Peter Schier von Beruf Kaufmann, Martin Tamm dagegen Schiffskapitän.
131
Brief vom Juli 1748; zit. nach Cremer 1989, S. 80. Zur Sammlung Hagedom siehe jetzt Rolf Wiecker, Das Schicksal der Hagedomschen Gemäldesammlung, (Phil Diss. Hamburg) Kopenhagen/München 1993.
132
Brief vom 26. Juni 1747, zit. nach Zelle 1998, S. 20, Anm. 68.
26
sässigen Künstlerfamilie Roos, der Nürnberger Künstlerfamilie Bemmel, aber auch Gemälde von Adam Elsheimer und Georg Flegel lassen sich nachweisen. Stark vertreten waren vor allem Werke der holländischen und flämischen Schule. Unter den 236 Nummern fanden sich dagegen nur zwei italienische Bilder. Der Bankier Ucheln besaß darüber hinaus eine bekannte Kunst- und Wunderkammer, die in der Reiseliteratur stets erwähnt und in Gedichten gepriesen wurde. Daß die "kostbahren Gemähide" als selbständiger Posten verkauft wurden, zeigt, daß der Typus der Kunstkammer dem Sammlungsideal der Zeit nicht mehr restlos entsprach. In der Zeit zwischen den Versteigerungen der Sammlungen Merian und Ucheln von 1716 bis 1744 bildete sich in Frankfurt innerhalb der Schicht der reichen Patrizier, gewerbe- und handeltreibenden Kaufleute, Bankiers und Gelehrten eine neue Sammlergeneration heraus. Diese Gruppe trat durch gemeinsame wissenschaftliche, soziale und kulturelle Aktivitäten hervor. Im Zentrum standen die Brüder Friedrich und Zacharias Uffenbach mit ihren weitläufigen, auf ausgedehnten Reisen in den Niederlanden und England gewonnenen Kenntnissen und Erfahrungen. Die Brüder besuchten in Holland die bekanntesten Gemäldekabinette in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Leiden.133 Zacharias war durch seine bibliophilen Interessen bekannt, Friedrich Uffenbach durch seine Sammlungen von Gemälden, Zeichnungen und Skulpturen. Zu dem Kreis gehörten neben den beiden Uffenbachs Johann Georg Kißner, die Kaufleute Behagel und Johann Friedrich Ettling. Als Gäste verkehrten in diesem Zirkel der Arzt Johann Christian Senckenberg, Heinrich Jacob von Haeckel und Johann Noe Gogel. In der ersten Jahrhunderthälfte spielte das Auktionswesen in Frankfurt am Main noch keine große Rolle. Vermutlich wurden Kunstwerke auf den zweimal jährlich stattfindenden Messen angeboten. Neben einzelnen lokalen Händlern kamen auch Kunsthändler aus dem Ausland nach Frankfurt, um auf der Frühjahrs- oder Herbstmesse große Bestände an Druckgraphik und an Gemälden anzubieten. Zwischen den Messen entwickelte sich ein florierender Markt, wie eine Bemerkung von Heinrich Sebastian Hüsgen dokumentiert. August der Starke, Wilhelm von der Pfalz, die Grafen von Schönborn sowie der hessische Landgraf Wilhelm VIII. hätten in Frankfurt Gemälde für ihre Sammlungen erworben.134 Gleiches ist somit auch für die privaten bürgerlichen Sammler anzunehmen, wenn auch zu vermuten ist, daß viele der sich im 18. Jahrhundert in den Privatsammlungen befindlichen Gemälde in Holland mit Hilfe von Händlern erworben worden sind. Als Form des öffentlichen Verkaufs von Kunstbesitz diente in Frankfurt - vor allem bei Nachlässen - auch die Glückslotterie: "Im März 1651 bat Abraham de Neufville zwecks Befriedigung seiner Gläubiger um die Gestaltung einer Lotterie von Kunstgegenständen und 1658 kam aus dem gleichen Grunde die Witwe des Pelzhändlers Matthäus Moors um die Genehmigung ein, eine Lotterie von allerlei Pelzwaren und Gemälden veranstalten zu dürfen." 135 Bis weit ins 18. Jahrhundert hinein wurden auf diesem Wege vor allem private Mobilien, Handelswaren, aber auch Kunstgegenstände wie Gemälde veräußert, und noch 1765 veranstaltete der Kunst- und Tapetenmaler Nothnagel eine "Mahlerey=Lotterie" (Kat. 50). Die Verauktionierung einer Gemäldesammlung blieb zunächst die Ausnahme. Erst nach dem Ende des Siebenjährigen Krieges blühte das Auktionswesen in Frankfurt auf. 133
Uffenbach 1988; Ausst.-Kat. Amsterdam 1992, S. 27, Nr. 20.
134
Hüsgen 1780, S. 309.
135
Dietz 1910/1925, Bd. 4.2, S. 697 (Hinweis auf Bd. 3, S. 267).
136
Posse 1930, S. XX.
137
Vgl. Loh 1999.
Leipzig Wie in Frankfurt, so wurden auch in Leipzig auf der jährlich stattfindenden Oster- und Michaelismesse Kunstwerke verkauft. Kein geringerer als August der Starke besuchte hier Händler, um für die Dresdener Sammlung Gemälde zu erwerben; 1727 erwarb die Königin Eberhardine auf der Ostermesse Arent de Gelders Selbstbildnis mit Hellebarde (Dresden, Gemäldegalerie, Inv.-Nr. 1792). 1742 wurden auf der Oster- und Michaelismesse neun, das folgende Jahr gar 34 Gemälde für die Dresdener Sammlung gekauft. 136 Neben der Messe herrschte in Leipzig bereits seit Anfang des 18. Jahrhunderts ein reges öffentliches Auktionswesen. Im Vordergrund standen die Versteigerungen von "allerhand [...] Hausrath und Mobilien" bei der Auflösung von privaten Haushalten. Auf vielen dieser Auktionen, die in der "Leipziger Zeitung" angekündigt waren, wurden auch Gemälde und Bücher mit angeboten. Im Jahre 1742 fanden zwei, in den beiden folgenden Jahren jeweils fünf und vier Auktionen mit Gemälden statt.137 Reine Gemäldeauktionen blieben jedoch eher selten. Nach der Versteigerung des Museums Wolffianum im Jahre 1714 (Kat. 7) wurde, soweit sich das an den erhaltenen Katalogen nachvollziehen läßt, erst 1752 wieder eine Gemäldesammlung zusammen mit kunstgewerblichen Gegenständen und Hausrat verauktioniert. Obwohl mehr als zwei Drittel der Bilder dieser Auktion anonym bleiben, handelt es sich insgesamt um eine wohlsortierte Sammlung mit Gemälden aller Schulen. Unter den Käufernamen finden sich auch einige der renommierten Leipziger Sammler, so vor allem Johann Thomas Richter, der mehrere Bilder übernahm. Auch der Leipziger Sammler Böttcher muß Bilder übernommen haben, denn einige dieser Gemälde tauchten 1759 in seiner Verkaufsliste auf (Kat. 34). Für Leipzig sind im Vergleich zu Frankfurt nur einige wenige, aber bedeutende Sammlungen nachgewiesen, so Dr. Zacharias Richter, dessen Naturalienkabinett durch das von D. Johann Ernst Hebenstreit 1743 herausgegebene Museum Richterianum publik geworden war. Hervorzuheben ist auch die Sammlung Böttcher, eine reine Gemäldesammlung von außerordentlicher Qualität, die in den Wirren des Siebenjährigen Krieges verkauft wurde (Kat. 34). Im Vergleich zu Frankfurt läßt sich bei den wenigen wichtigen Kunstsammlungen Leipzigs eine größere Kontinuität beobachten. Die im frühen 18. Jahrhundert begründeten Sammlungen Richter und Winckler gingen jeweils in die nächste Generation über, letztere wurde erst 1819 in Leipzig verauktioniert,138 das Kabinett Richter im Jahre 1810 verkauft. 139 Darüber hinaus fand das Kunstsammeln in Leipzig keinesfalls eine so weite Verbreitung im Kreise des wohlhabenden Bürgertums wie beispielsweise in Hamburg oder Frankfurt. Braunschweig und Wolfenbüttel Im Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel gingen wichtige Impulse für den Kunstmarkt vor allem von Seiten des Hofes in Wolfenbüttel aus. Bei der Auktion der Sammlung des Herzogs Friedrich von Holstein-Norburg in Wolfenbüttel trat Herzog Anton Ulrich von Braunschweig bei zahlreichen Bildern als Käufer auf (Kat. 2), 140 dessen Sammlung in der schon 1702 eingerichteten Galerie in Salzdahlum einen würdigen Platz fand und sicherlich auch eine Vorbildfunktion auf Mitglieder des Hofstaats ausübte. So errichtete auch Johann Friedrich von Alvensleben in seinem Schloß Hundisburg eine Galerie ein.141 Auch bei der Versteigerung der Sammlung des Herzogs
138
Die Sammlung Johann Gottfried Winckler wurde am 18. Oktober 1819 versteigert (Lugt 9669).
139
Meusel Künstlerlexikon 1808/14, Bd. 3, S. 440; Trautscholdt 1957, S. 226.
140
Gerkens 1974, S. 104, die "Designation" befindet sich im Niedersächsischen Staatsarchiv Wolfenbüttel. Als Geschenk gelangte ein Gemälde von Adrian van der Werff nach Braunschweig. Udo von Alvensleben, Die Braunschweigischen Schlösser der Barockzeit und ihr Baumeister Hermann Korb, Berlin 1937, S. 32^Φ4; Udo von Alvensleben-Wittenmoor, Alvenslebensche Burgen und Landsitze, Dortmund 1960, S. 44-46.
141
27
Friedrich von Holstein-Norburg läßt sich Alvensleben als eifriger Käufer feststellen. Wie in Leipzig oder Frankfurt fand der Bilderhandel in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zunächst im Rahmen der regelmäßig durchgeführten Messen statt. Kaufleute aus den Niederlanden brachten neben ihren Waren auch einige Gemälde mit, die sie auf der Messe feil boten. Als Messestadt konnte Braunschweig jedoch nicht mit Frankfurt und Leipzig konkurrieren. In Braunschweig traten weitere Mitglieder des Hofes als Sammler auf: 1729 werden der erste Minister Hieronymus von Münchhausen, 142 der Rath Oldekopp und der Rath von Mattenberg als Sammler genannt.143 Unter der Regierungszeit Herzog Karl I. (reg. 1736/71780) vermutet Fink ebenfalls Ankäufe für die Salzdahlumer Galerie auf dem Braunschweiger Markt. 144 Neben Ankäufen auf dem lokalen Markt wurden zahlreiche Bilder auch auf den Reisen Herzogs Karl I. erworben, so auf der Reise 1732 in die Niederlande. Dennoch entwickelte sich in Braunschweig kein schwungvoller Auktionshandel. Aus den adeligen Sammlungen kamen in der Regel keine Bilder auf den Markt, da diese an die nächste Generation weitergegeben wurden. Ausnahmen stellen hier einige bürgerliche Nachlaßauktionen in Wolfenbüttel dar, in denen Gemälde als Teil einer Hinterlassenschaft verauktioniert wurden. Eine reine Gemäldesammlung wurde 1743 in einem in Braunschweig erschienenen Verkaufskatalog angeboten, der eine Sammlung von 211 Gemälde verzeichnet (Kat. 15). Die Identität des Besitzers konnte bisher nicht ermittelt werden. Der Verfasser dieses Katalogs ist der Braunschweiger Hofmaler Anton Friedrich Harms, der seit 1740 als Galerieintendant in Diensten Herzog Karls I. tätig war und zu den frühen Kunstkennern des 18. Jahrhunderts zählt.145 Hervorzuheben ist sein Versuch, die vorhandene Vitenliteratur systematisch zu sichten und mit Hilfe eines Index zugänglich zu machen. 146 Nürnberg Im Vergleich zu den anderen Städten blieb in der alten Handelsstadt Nürnberg, die im 16. und 17. Jahrhundert zu den Zentren der Kunst zählte, das Kunstauktionswesen relativ bedeutungslos. Erst am Ende des 18. Jahrhunderts machte Johann Friedrich Frauenholz mit seinen regelmäßigen Versteigerungen Nürnberg zu einem Zentrum des Kunsthandels. Für das gesamte 18. Jahrhundert konnten nur sieben Auktionen in Nürnberg nachgewiesen werden. Der Beginn wurde 1690 mit dem Verkauf einer bedeutenden Kunstkammer gemacht, in deren Anhang auch ein Gemälde auftauchte. Es handelte sich um die Sammlung Johann Andreas Viatis (1625-1698), die noch zu den Patrizier-Sammlungen des 17. Jahrhunderts zählte (Kat. 3). Im 18. Jahrhundert wurden allerdings mehrere wichtige Sammlungen verkauft. Schon 1752 wurde die Sammlung des Hofrats Lorenz Wilhelm Neubauer durch den Kunsthändler Wilhelm Wolff verauktioniert (Kat. 29). Diese Sammlung setzte sich in erster Linie aus Werken zeitgenössischer Künstler aus dem Nürnberger Raum sowie flämischen und holländischen Gemälden zusammen. Der Verkauf dieser Sammlung bot vermutlich für andere Nürnberger Sammler eine Gelegenheit, auf dem heimischen Markt Bilder zu erwerben und eigene Sammlungen zu begründen. Vermutlich war auch Johann Georg Friedrich von Hagen (1723-1783) unter den Käufern, dessen umfangreiche Sammlung 1786 verauktioniert wurde (Kat. 164). Einen Teil der Sammlung hatte er schon von seinem Vater Justus Jakob von Hagen übernommen, der 1727 die bei Nürnberg gelegene Oberbürg geerbt und dort eine Gemäldesammlung angelegt hatte.
Köln, Bonn und Mainz In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts spielte der kurkölnische Hof für den Kunsthandel eine eminent wichtige Rolle. Seit 1583 stellte das Haus Wittelsbach den Kölner Erzbischof und Kurfürsten. Die enge Beziehung zum Münchner Hof sollte für die Sammelleidenschaft von Joseph Clemens und Clemens August prägend werden. Joseph Clemens war von 1688 bis 1723 geistlicher Kurfürst von Köln. Sein Bruder Max II. Emanuel wurde 1679 Kurfürst von Bayern; dessen Sohn Clemens August erhielt nach dem Tode Joseph Clemens' die Kölner Kurwürde. Eine zwei Jahre nach dem Tode Joseph Clemens' erschienene "Designatio" verzeichnet einige Gemälde aus dem Besitz des Kurfürsten, die zum Verkauf anstanden (Kat. 10). Aber erst der Neffe Clemens Augusts sollte wie sein Vater in München im großen Stil sammeln. Hinzu kamen der Hofadel und einzelne Hofbeamte, die sich ebenfalls Sammlungen zugelegt hatten. Prominenteste Beispiele sind der Graf von Plettenberg und der als "Hoff-Rathen-und Leib-Medici" tätige Jan von Gise, dessen 624 Nummern umfassende Sammlung 1742 in Bonn versteigert wurde (Kat. 14 und 14a). Des weiteren wurde 1750 die Sammlung des Grafen Ferdinand Leopold Anton von Hohenzollern-Sigmaringen (1692-1750) verkauft, der erster Staatsminister und Obersthofmeister am kurkölnischen Hof gewesen war. Der in französischer Sprache abgefaßte Auktionskatalog umfaßt 244 Nummern. Unter den Käufern ist auch Clemens August, der bereits auf der Auktion Gise u.a. Rembrandts "Verlorenen Sohn" (Kat. 14, Nr. 37) für seine Sammlung erwerben konnte.147 Clemens August gehörte zu den Sammlern großen Stils. Für die Ausstattung der Residenz und für Schloß Poppelsdorf in Bonn, für Schloß Augustusburg in Brühl und für die Jagdschlösser Herzogsfreude und Falkenlust erwarb Clemens August bis zu seinem Tode über 1.000 Gemälde. Auch wenn er auf die versteigerten Sammlungen in seinem nächsten Umfeld zurückgreifen konnte, so hat er doch den größten Bestand seiner Sammlung in den Niederlanden erworben. Andere Gemälde wurden bei den Künstlern selbst bestellt. Wie die Sammlung seines Amtsvorgängers mußte die Sammlung Clemens August sofort nach seinem Tode zur Deckung der anfallenden Schuldenlast verkauft werden. Die Auktion der Gemälde war für den Mai 1762 vorgesehen, fand jedoch erst zwei Jahre später statt (Kat. 45). Ähnlich wie am Köln-Bonner Hof entwickelte sich auch in Mainz im Kreis der Domherren und Hofbeamten eine eigene Sammelkultur. Vorbild dort war der Kurfürst und Erzbischof von Mainz, Franz Lothar von Schönborn (1655-1729). Seit 1693 Fürstbischof von Bamberg, 1695 zum Kurfürst und Erzbischof von Mainz ernannt, trat Franz Lothar von Schönborn nach dem Ausbau des Schlosses in Gaibach und der Residenz in Bamberg als Bauherr seines Schlosses in Pommersfelden in Erscheinung. In dem nach Plänen von Johann Dientzenhofer und Johann Lucas von Hildebrand 1711 bis 1718 errichteten Schloß Weißenstein war eine eigene Gemäldegalerie eingerichtet worden.148 Auch auf dem Schönbornschen Schloß Gaibach bei Volkach waren Gemälde aufgestellt. Die Sammlung wurde dort von Jan van Cossiau betreut, die in Pommersfelden von dem Maler Johann Rudolf Bys (1660-1738), der seit 1713 für Franz Lothar als Hofmaler wirkte. Bys hatte zuvor beim Grafen Czernin in Prag gearbeitet.149 Aus Prag erhielt Franz Lothar auch eine Angebotsliste von Gemäl-
142
Fink 1954, S. 50.
143
Klyher 1729, O.P.; Fink 1954, S. 50. Der Nachfolger Anton Ulrichs, August Wilhelm (reg. 1714-1731), errichtete 1718 ein neues Stadtschloß "Der graue Hof', in dem sich auch ein umfangreicher Gemäldebestand befand. Hauptorganisator der Sammlung war Konrad Detlef Graf von Dehn (siehe Fink 1954, S. 48).
144
Fink 1954, S. 58.
145
Fink 1954, S. 50-59.
146
Anton Friedrich Harms, 'Tables historiques et chronologiques des plus fameux peintres anciens et modernes," Braunschweig 1742.
147
Das Gemälde befindet sich heute in der Eremitage (Inv.-Nr. 742).
148
Quellen zur Geschichte des Barocks in Franken unter dem Einfluß des Hauses Schönborn, bearb. von P. Hugo Hantsch u.a. (Veröffentlichung der Gesellschaft für fränkische Geschichte), 2 Halbbände, Augsburg 1931 und Würzburg 1955; zur Galerie Bd. 2.
149
Mayer 1994, S. 28.
28
den der Sammlung Wrschowitz, die 1723 versteigert wurde. Gemälde der italienischen Schule wurden mitunter direkt von den Künstlern gekauft, u.a. von Trevisani, Solimena, Balestra und Pellegrini. 150 1719 erschien mit dem von Bys abgefaßten Galerieführer der Gemälde in Pommersfelden einer der frühesten gedruckten Sammlungskataloge des 18. Jahrhunderts.151 1721 erschien ein entsprechender Katalog für die Galerie in Gaibach mit 505 Gemälden, abgefaßt von Cossiau. Zusammen befanden sich 975 Gemälde im Besitz des Kurfürsten, 152 dessen Sammlung mit denen in Düsseldorf und Dresden konkurrieren konnte. Der Besitz ging an den Neffen Friedrich Karl über, der in der Nähe von Wien, in Göllersdorf, in seinem Schloß Schönborn residierte. 1746 wurde ein neues Bilderinventar gedruckt, das auch Bilder in anderen Schönbornschen Schlössern mit einbezog.153 Bereits 1738 fand in Amsterdam eine Versteigerung von 194 Gemälden eines "Baron Schonborn" statt, unklar bleibt, ob es sich um Gemälde aus dem Besitz Karl Friedrichs handelte. Prag In der königlichen Stadt Prag und in den umliegenden böhmischen Ländereien hatte sich seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts eine breite adlige Sammlerschicht herausgebildet, die zum großen Teil ihre Gemälde über den Wiener Kunsthandel erworben hatte. Bekannt sind die umfangreichen Transaktionen der Kunsthandlung Forchondts mit den Sammlern Graf Franz Anton Berka von Duba (1645-1706) und Johann Hartwig Nostitz (1610-1683). Auf diesem Wege gelangten qualitativ hochwertige Gemälde der flämischen Schule nach Böhmen.154 Die Achse Wien-Prag gehörte zu den wichtigen Verbindungswegen des Kunsthandels, die günstige geographische Lage zwischen den Kunstmetropolen Wien und Dresden ließ Prag zu einem wichtigen Umschlagplatz für Gemälde werden. Neben dem Dresdener Hof hatten auch die Grafen von Schönborn sehr früh ihr Augenmerk auf die Prager Sammlungen gerichtet, wie etwa eine Angebotsliste von Gemälden der Sammlung Wrschowitz an Franz Lothar von Schönbom oder der Kauf von Gemälden auf der Auktion von Nostitz (1739) durch Friedrich Karl von Schönbom belegen.155 Franz Lothar hatte zugleich bei seinem Hofmaler Johann Rudolf Bys, der zuvor in Prag tätig war, Kopien nach Gemälden aus Prager Sammlungen in Auftrag gegeben. Seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts nahmen die Transaktionen auf dem Präger Kunstmarkt zu, eine Entwicklung, die durch die ökonomische Rezession zwischen 1720 und 1740 verstärkt wurde. Sammlungen wurden entweder vererbt, verkauft oder verauktioniert. Die Sammlung Berka von Duda ging 1706 in den Besitz des Grafen Anton Nostitz über, dessen Sammlung in Prag zusammen mit anderen Bilderkabinetten zu den Sehenswürdigkeiten in der Stadt gehörte. 1723 wurde die Sammlung des Grafen Wrschowetz öffentlich in Prag verkauft. Anton Johann Nostitz hatte bereits vor der angekündigten Auktion Gemälde aus der Sammlung erworben. Ein gedruck-
ter Katalog mit 373 Positionen informiert über die zum Verkauf gelangten Gemälde.156 Unter den Käufern auf der Auktion befanden sich der Architekt Graf Raymond Le Plat, der als Agent des Dresdener Hofes 21 Gemälde vornehmlich der flämischen Schule erwarb, u.a. Rubens' Leda mit dem Schwan}51 In der Folgezeit (1732 und 1736) wurden weitere Gemälde aus der Sammlung Wrschowetz an den Sammler Franz Josef Georg von Waldstein (1709-1771), seßhaft in Duchov (Dux), verkauft. 158 Im Jahre 1741 vermittelte Johann Gottfried Riedel den Verkauf von 268 Gemälden aus der Sammlung Dux an den Dresdener Hof für die Summe von 22.000 Florin.159 Riedel stand zuvor im Dienst von Anton Johann Nostitz, war aber auch als Restaurator auf dem Duxer Schloß tätig. Zwei Jahre zuvor, im Jahre 1739, wurde die Sammlung Nostitz verauktioniert. Der gedruckte Auktionskatalog der Sammlung umfaßt 261 Losnummern mit 323 Bildern, deren "Wert mit der Summe von 5.546 Gulden beschrieben wurde" (Kat. 12).160 Unter den Käufern auf der Auktion war Friedrich Karl von Schönbom (1674— 1746).161 In Prag kamen zwei wesentliche Bedingungen für die Ausbildung eines lokalen Markts zusammen: eine interessierte Käuferschicht und eine Vielzahl von adeligen Sammlungen, die aus wirtschaftlichen oder politischen Gründen aufgelöst wurden. Die verauktionierten und verkauften Gemälde gingen in erster Linie nicht in den lokalen Kreislauf zurück, sondern wurden in andere Kunstzentren verlagert. In Prag standen ausschließlich adelige Sammlungen zur Disposition, die den Verfallsprozeß dieser Häuser und die wirtschaftlich schwierige Lage der Stadt dokumentieren. Wien Im Mittelpunkt des Kunsthandels in Wien stand die Kunsthandlung der Brüder Alexander und Gilliam Forchondt, die seit 1664 dort tätig waren. Bereits der Vater Wilhelm Forchondt hatte Kontakte zum Wiener Handel, besonders zu Johan Vlooitz, den er mit Gemälden beschickt hatte. Mit Beginn der 70er Jahre des 17. Jahrhunderts waren auch die beiden anderen Brüder Marcus und Melchior in der Kaiserstadt tätig. Die Kunsthandlung "Den Großen Jordan" (später: "Die Goldnen Säulen") wurde mit Gemälden direkt aus Antwerpen beliefert, wo sie auf Auktionen erworben worden waren. Als Käufer der Forchondts traten vor allem adelige Sammler in Erscheinung, so Prinz Karl Eusebius von Liechtenstein, Prinz Raimund Montecuccoli, Prinz Max und Adam Trautmannsdorf, Ludwig und Hermann von Baden, Graf Jan Balthasar Hoyos und die Gräfin von Harrach. Von Böhmen kamen immer wieder adelige Sammler in die Kaiserstadt, um Bilder zu erwerben. Hierzu zählten Jan Hartwig Nostitz, Graf Humprecht Jan Graf Czernin, Ferdinand Emst Graf Herberstein, Franz Anton Berka Graf Duba, Jan Kristian von Eggenberg, Prinz Jan Adolf Schwarzenberg, Graf Lobkovic, Graf Wallenstein, Jan Graf Rottal und Baron Jan Antonin Questenberg. Die meisten Bildergeschäfte wurden im Kunsthandel abgewickelt, ein florierendes Auktionswesen hat sich anscheinend in Wien nie-
150
Bott 1989, mit weiterer Literatur.
151
Fürtrefflicher Gemähld= und Bilder=Schatz / So In denen Gallerie und Zimmern / des Churfürstl. Pommersfeldischen neu=erbauten fürtrefflichen Privat-Schloß zu finden ist, Bamberg 1719.
152
Bott 1989, S. 117-118.
153
Beschreibung des Fürtrefflichen Gemähld- und Bilderschatzes, Welcher in denen Hochgräflichen Schlössern und Gebäuen Deren Reichs-Grafen Von Schönborn, Buchheim, Wolfsthal, Sowohl In dem Heil. Rom. Reich, als in dem Ertz-Herzogthum Oesterreich zu ersehen und zu finden [...] Gedruckt zu Wirtzburg, bey Marco Antonio Engmann, Hof-Buchdrucker 1746.
154
Zu den Brüdern Alexander und Wilhelm Forchondt und ihrer Tätigkeit in Wien siehe Ausst.-Kat. Prag 1993, S. 367-371.
155
Diese Liste ist abgedruckt bei Frimmel 1892, S. 22-26; vgl auch Toman 1887, S. 14-24; Machytka 1987.
156
Freundlicher Hinweis von Bernd M. Mayer. Zur Sammlung und Katalog siehe Toman 1887, S. 14-24; Frimmel 1892, S. 22-26; Slavicek 1995, S. 14f.
157
"Nach dem Hübner'schen Katalog zur Dresdner Galerie hat Baron Raymond de Leplat am 15. Juni 1723 eine Reihe von Gemälden aus der Sammlung der Gräfin Wrschowetz in Prag erworben." Siehe Toman 1887, S. 14.
158
Auf seinen Aufenthalten in Wien war Franz Josef Georg weiter bedacht, Gemälde zu erwerben, so im Jahre 1733, als er "an der Versteigerung Buquoyscher Gemälde im November 1733 im Wiener Schottenstift" teilnahm (Machytka 1987, S. 68). 1737 erscheint ein gedrucktes Verzeichnis dieser Sammlung mit 350 Gemälden: "Versammlung Deren Hochgrafl. Wallensteinischen Bildern in dero Residentz-Schloss Dux, wie solche 1737 sich befinden."
159
In den Jahren 1735 und 1737 hatte Johann Gottfried Riedel eine Vielzahl von Gemälden (im Jahre 1735 allein 60 Stück) der Sammlung restauriert.
160
Slavicek 1995, S. 17.
161
Ebd.
29
mals entwickelt. Allerdings lassen sich keine endgültigen Aussagen treffen, da die Quellenlage äußerst schlecht ist und im Rahmen dieses Projektes überhaupt nur drei Auktionen in Wien nachgewiesen werden konnten (Kat. 1, 275 und 285). Bei dem ersten Verkauf handelt es sich auch nicht um eine Auktion, sondern um den Versuch, mittels einer Lotterie die bedeutende Sammlung Franz von Imstenraedt zu verkaufen. Als dieser Versuch mißglückte, wurde die Kollektion später vollständig an den Bischof Karl von Liechtenstein weitervermittelt (Kat. 1). In der Literatur finden sich allerdings Hinweise auf vereinzelte Auktionen. So heißt es etwa über den Aufenthalt Franz Josef Georg von Dux' in Wien, daß er versucht habe, Gemälde zu erwerben, so im Jahre 1733, als er "an der Versteigerung Buquoyscher Gemälde im November 1733 im Wiener Schottenstift" teilgenommen habe. 162
Die Entstehung des Kunstmarkts. Von 1763 bis Anfang der 1780er Jahre Mit dem Jahre 1763 setzten in allen größeren Städten reine Kunstauktionen ein. Zwischen 1763 und 1772 fanden in Frankfurt zwölf Auktionen statt, deren Kataloge erhalten sind, zehn Auktionen in Hamburg, drei in Köln, und jeweils eine Auktion in Hannover, Bonn, Leipzig, München, Halle und Bremen. Der Verkauf der Frankfurter Sammlung des Barons von Haeckel oder die Versteigerung der Sammlung des Kölner Kurfürsten Clemens August in Bonn erregten nationales wie internationales Interesse. Bis zum Beginn der 1770er Jahre fanden alljährlich bis zu vier Auktionen statt, auffallend ist jedoch die Konzentration von Gemäldeauktionen in Frankfurt in den Jahren 1763 bis 1765. Nur vereinzelt wurden Lotterien zum öffentlichen Verkauf von Gemälden durchgeführt, so 1763 in Hannover (Kat. 39) oder 1765 in Frankfurt (Kat. 50). Für das Jahr 1775 lassen sich bereits neun Auktionen nachweisen; die Anzahl der Auktionen stieg bis 1778 weiter an. In diesem Jahr wurden wenigstens 15 Gemäldeauktionen veranstaltet, von denen allein 12 Auktionen in Hamburg durchgeführt wurden, eine in Frankfurt, Berlin und Hannover. Im Vergleich jedoch zu den bei Lugt verzeichneten Auktionen in Paris und London handelte es sich um einen bescheidenen ersten Höhepunkt des Auktionswesens in Deutschland. Wurden bereits während des Siebenjährigen Krieges private Sammlungen wie die Leipziger Sammlung Böttcher aufgelöst, so ist zu vermuten, daß auch nach Beendigung des Siebenjährigen Krieges verstärkt private Sammlungen aus rein ökonomischen Gründen auf den Markt gelangten. Der große Börsenkrach in Amsterdam und Hamburg war etwa die Ursache dafür gewesen, daß der Bankier Jean Henri Eberts, der langjährige Berater der Markgräfin Karoline Luise, seine Sammlung verkaufen mußte. 163 Auch die Berliner Sammlungen Gotzkowsky, Eimbke und Stein mußten aus ökonomischen Gründen verkauft werden. Leider fehlen für Hamburg in vielen Fällen Informationen über die Besitzer der verauktionierten Sammlungen, so daß sich über deren wirtschaftliche Situation wenig sagen läßt. Die meisten der in den 1770er Jahren in Hamburg zur Auktion gelangten Sammlungen wurden ohne Angabe eines Grundes und ohne Nennung des Namens des vormaligen Besitzers angeboten. Hin und wieder könnten auch Insolvenzen eine Rolle gespielt haben. Oftmals handelte es sich auch um ein aus verschiedenen Quellen zusammengesetztes Konvolut an Gemälden, die auf der Börse versteigert wurden. Mehrere der frühen Frankfurter Auktionskataloge verzeichnen Privatsammlungen ohne Angabe des Sammlers. Vermutlich handelt es sich um auswärtige Sammlungen, die von den Auktionatoren Johann Christian Kaller und Justus Juncker dem lokalen Markt in Frankfurt zugeführt wurden (vgl. Kat. 40, 42 und 44). Der Frankfurter Händler Rauschner bot 1765 über 200 Gemälde zum Verkauf an, 162
die ein Jahr zuvor auf der Bonner Auktion des Kurfürsten Clemens August versteigert worden waren (Kat. 51). Der Frankfurter Markt wurde dadurch nicht nur für die lokalen bürgerlichen Sammler, sondern auch für die kleineren Fürstenhöfe in Kassel, Mannheim, Darmstadt oder Karlsruhe interessant. In den Fällen jedoch, wo auf den Titelblättern der Frankfurter Kataloge der Name des Besitzers der Sammlung genannt wird, war es der Tod des Sammlers, der die Erben veranlaßte, die Sammlungen öffentlich zu versteigern. Im Unterschied zu den freien Reichsstädten Frankfurt und Hamburg oder zum kurkölnischen Hof in Bonn und dem angrenzenden Köln spielten die alten Handelsstädte Nürnberg oder Augsburg für das Auktionswesen zwischen 1763 und 1780 eine untergeordnete Rolle. Nur vereinzelt lassen sich Auktionen nachweisen: in Würzburg 1776, in Regensburg 1782 und in Nürnberg erst wieder 1785. Gleiches gilt auch für die Residenzstädte Berlin, Dresden oder München. Zu bemerken ist, daß weiterhin wichtige adelige Sammlungen zum Verkauf ins Ausland transferiert wurden, so die Sammlung des Grafen Brühl nach St. Petersburg. Auch begann man nach Beendigung des Siebenjährigen Krieges an den Höfen wieder verstärkt mit dem Kauf von Gemälden auf ausländischen Auktionen. In Dresden konnte man bereits im September 1763 durch den Legationssekretär von Kaudersbach Gemälde aus dem Kabinett Lormier erwerben. Dieser Kauf mußte aber wegen des Todes von August III. storniert werden. Später gelangten nur einzelne Bilder aus dieser Sammlung nach Dresden.164 Frankfurt am Main Sofort nach Beendigung der mehrere Jahre dauernden Besetzung der Stadt durch die französischen Truppen fanden in den Jahren 1763 und 1764 eine Reihe von wichtigen Gemälde-Versteigerungen statt (Kat. 40, 42,44,47, 51, 52). Hinzu kam eine von Johann Andreas Benjamin Nothnagel durchgeführte Bilderlotterie (Kat. 50). Erstmals in der Geschichte des Sammelwesens erhielt die Form des öffentlichen Kunstverkaufs für die privaten bürgerlichen Sammler in Frankfurt am Main als auch für die umliegenden fürstlichen Kabinette eine wichtige Bedeutung. Die wohl bekannteste dieser Auktionen war die der Sammlung des Barons von Haeckel am 25. August 1764 (Kat. 47), die ihren literarischen Niederschlag in der Beschreibung Johann Wolfgang von Goethes in "Dichtung und Wahrheit" fand: "Ich erinnere mich seiner [Haeckels] kaum, aber doch dunkel als eines freundlichen wohlgebildeten Mannes. Desto deutlicher aber seiner Auktion, der ich beiwohnte und theils auf Befehl meines Vaters, teils aus eigenem Antrieb manches erstand."165 Mit vielen Frankfurter Sammlern, die ebenfalls auf den Auktionen Gemälde ersteigerten, war Goethe persönlich bekannt, so mit Friedrich Ettling, Johann Andreas Benjamin Nothnagel und Johann Matthias Ehrenreich. Vier der oben genannten Auktionen wurden gemeinsam von dem Händler Johann Christian Kaller und dem Maler Justus Juncker durchgeführt. Juncker war wie viele andere Künstler in Frankfurt auch im Kunsthandel tätig. Über die vormaligen Besitzer der Sammlungen geben die Titelblätter der Kataloge keine Auskunft, es wird jeweils nur auf ein "magnifique cabinet de tableaux" hingewiesen. Der größte Teil der angebotenen Sammlungen bestand aus Gemälden der niederländischen und flämischen Schule, darunter Bilder von Rembrandt, Pieter Lastman, Peter Paul Rubens oder Anton van Dyck. Vermutlich stammten die Gemälde aus den Niederlanden. Das hohe Qualitätsniveau dieser Auktionen sollte das Interesse der Frankfurter Sammler an den Kunstauktionen weiter wachsen lassen. So konnten der Frankfurter Sammler und Zahnarzt Johann Matthias Ehrenreich (ca. 1700-1785)166 und der Händler Benjamin Rauschner ihre Beziehungen zum Hof in Karlsruhe weiter ausbauen.
Machytka 1987, S. 68.
163
Es existiert eine handschriftliche Abschrift eines Katalogs seiner Sammlung in den Unterlagen Karoline Luises, vgl. Kircher 1933, S. 138.
164
Posse 1930, S. XXII.
165
Goethe, Dichtung und Wahrheit, 1986, S. 860.
166
Friederichs/Wiegel 1953.
30
Karoline Luise von Baden wurde fortan gewissenhaft über jede Veräußerung auf dem Frankfurter Markt informiert. In einem Brief vom 7. Dezember 1762 berichtet Ehrenreich von der bevorstehenden Auktion eines "Holländischen Mahlerey-Cabinets unter der Direction der Alten H. Junkers und H. Haller". Den Auktionskatalog der Versteigerung vom 19. Januar 1763 (Kat. 40) hatte Ehrenreich dem Brief beigelegt, zugleich versicherte er: "Ich habe sie [die Gemälde] alle sehr genau betrachtet und examiniert, auch besonders solche Stücke darunter gefunden, von dem vollkommensten Gout von Eurer hoch=fürstl. Durchlaucht welcher mit sehr wohl bekannt." 167 Die im Katalog verzeichneten Gemälde wurden von Ehrenreich mit Sternchen kommentiert, wobei ein Stern "gut", zwei Sterne "besser" und drei Steme "vollkommen" bedeuteten. Ehrenreich erwartete daraufhin den Auftrag Karoline Luises zum Ankauf einzelner Gemälde zusammen mit den entsprechenden Preisvorstellungen. Ein Gemälde von Jan van Goyen, Holländische Flachlandschaft mit Schlittschuhläufern, gelangte auf diesem Wege nach Karlsruhe (Inv.-Nr. 325). In einem weiteren Brief, datiert vom 22. November 1763, bot Ehrenreich wiederum seine Dienste an. Diesmal handelt es sich um die am 9. November 1763 in Frankfurt durchgeführte Auktion (Kat. 42). Wieder wurde der gedruckte Katalog dem Brief beigefügt. Auf dieser Auktion erwarb Ehrenreich drei Gemälde für die Markgräfin: jeweils ein Gemälde von Quiringh Gerritsz. van Brekelencam, Adriaen Brouwer und Cornells Saftleven für zusammen 375 Reichstaler und 8 Kreuzer, die sich heute in der Kunsthalle Karlsruhe befinden. Ehrenreich besaß selbst eine eigene Sammlung von rund 800 Gemälden, die von Heinrich Sebastian Hüsgen beschrieben wurde.168 Wahrscheinlich hat ihm sein Sohn, Johann Benjamin Ehrenreich (1733-1806), bei einzelnen Ankäufen für Karoline Luise geholfen, denn auch er wird als Agent erwähnt und erhielt 1763 den Titel eines Hofrats. Oftmals sind Vater und Sohn nicht zweifelsfrei zu scheiden. Im Jahre 1767 siedelt Johann Benjamin nach Hamburg über, um dort als Gemäldehändler und Restaurator zu arbeiten.169 Von Johann Benjamin Ehrenreich sind auch eine Vielzahl von Radierungen bekannt.170 Als weitere Käufer traten auf den Frankfurter Auktionen neben dem Sammler Johann Matthias Ehrenreich und dessen Schwiegersohn Johann Christian Kaller vor allem Frankfurter Sammler auf. Auf den Auktionen vom 9. November 1763 (Kat. 42) und 12. März 1764 (Kat. 44) erwarb etwa Johann Friedrich Städel einzelne Gemälde für seine Sammlung, aber auch die bekannten Sammler Georg Wilhelm Bögner, Johann Boltz, Johann Karl Brönner, Friedrich Ettling, Carl Geyß und Peter Pasquay sind neben weiteren Namen in den Auktionsprotokollen als Käufer festgehalten. Für die umliegenden fürstlichen Höfe in Kassel oder Darmstadt wurden ebenfalls Gemälde in Frankfurt angekauft. Ein weiteres Anzeichen für die Ausbildung eines lokalen Markts ist, daß eine nicht unerhebliche Anzahl von Gemälden, die auf der Auktion vom 9. November 1763 verkauft wurden, bereits auf der Folgeauktion wieder zum Verkauf anstanden. Dabei scheinen sich vor allem die Händler die Gemälde gegenseitig abgekauft zu haben. Nur in wenigen Fällen wurden die von Johann Christian Kaller, Jacob Andreae oder Johann Matthias Ehrenreich erworbenen Gemälde auf der Folgeauktion an tatsächliche Sammler weiterverkauft. So erwarb Kaller Gemälde von Pieter Jansz. Quast oder Jacob Willemsz.
de Wet, um diese beim zweiten Anlauf an Städel oder Uffenbach zu verkaufen.171 Daß nach 1763 eine große Menge von Gemälden von auswärts nach Frankfurt zum Zwecke des Weiterverkaufs gelangte, beweist der Verkaufskatalog des Händlers Christian Benjamin Rauschner aus dem Jahre 1765 (Kat. 51). Bereits im Januar 1765 hatte Rauschner der Markgräfin Karoline Luise mittels einer handschriftlichen Liste 27 Gemälde angeboten, die er kurz zuvor in den Niederlanden gekauft habe. 172 Rauschner selbst vermerkt auf dem Titelblatt des Katalogs, daß es sich um die "Sammlung eines großen Herrns" handele, die Gemälde aber aus den Niederlanden stammten. Eine große Anzahl der Gemälde war ein Jahr zuvor in Bonn auf der Versteigerung der Sammlung des Kurfürsten Clemens August verkauft worden. Als Käufer traten der Hofkammerrat Broggia und der Hoffinanzier Simon Baruch auf. Durch den Weiterverkauf gelangten über 200 qualitätsvolle Gemälde vor allem der flämischen und holländischen Schule auf den Frankfurter Markt, um hier weiterverkauft zu werden. Bis 1780 fanden in Frankfurt kontinuierlich Gemäldeauktionen statt. Die bekannteste Auktion war 1771 die Versteigerung der Sammlung von Johann Friedrich Armand von Uffenbach (Kat. 68). Der größte Teil der Gemälde wurde vier Jahre später auf der Versteigerung des Besitzes der verstorbenen Witwe noch einmal zum Verkauf angeboten (Kat. 87). Uffenbach gehörte noch jener Generation von Frankfurter Gelehrten und Sammlern an, die das Sammelwesen in der Stadt seit den 1730er Jahren an geprägt hatten. Verständlich ist es daher, wenn Hüsgen im 9. Brief seiner 1776 erschienenen Verrätherischen Briefe von Historie und Kunst resignativ vom "traurigen Schicksale" der älteren Frankfurter Sammlungen zu berichten weiß: "Sie werden in öffentlichen Verganthungen in Geld verwandelt, und hernach zu allen den treflichen Dingen angewendet, die dem feinen Geschmack der Erben angemessen sind."173 Es waren jedoch gerade die in den 1770er Jahren auf den Kunstmarkt gelangten Sammlungen, die wiederum die Voraussetzung für das Entstehen privater neuer Sammlungen waren. Dieser Umschichtungsprozeß wurde erstmals vollständig vom Kunstmarkt in Frankfurt gelenkt. Hüsgen verzeichnete im Jahr 1774 insgesamt 24 Frankfurter Privatsammlungen. Ein Gemälde von Christian Stöcklin gibt einen Eindruck von der im Stadthaus "Zur Goldenen Kette" aufgestellten Sammlung des Kaufmanns Johann Noe Gogel. Gezeigt ist, wie der Sammler Hüsgen empfängt. 174 Die von Hüsgen beklagte Entwicklung, infolge der die meisten alten Sammlungen aufgelöst wurden, sollte zu Beginn der 1780er Jahre noch einen weiteren Höhepunkt erreichen, der sich wiederum in der steigenden Anzahl von Gemäldeauktionen niederschlug. Köln und Bonn Auch in Köln fanden seit den 1760er Jahren Kunstauktionen statt. Für die Jahre 1766, 1767 und 1768 liegen mehrere Auktionskataloge von privaten Kunstsammlungen vor,175 u.a. der Sammlung des Freiherrn Wilhelm Friedrich Wolfgang von Kaas zu Reventlau (Kat. 61). Für den Kölner Kunstmarkt spielte der kurkölnische Hof in Bonn eine wichtige Rolle, waren doch viele Mitglieder des Hofadels Sammler. 1764 fand die Versteigerung der Sammlung des Kurfürsten von Köln, Clemens August, im Bonner Stadtschloß statt, die durch den Einspruch der bayerischen Wittelsbacher um zwei Jahre
167
Brief Johann Matthias Ehrenreich an Karoline Luise von Baden vom 7.12.1762 und vom 19.1.1763, Landesarchiv Karlsruhe, Nachlaß Karoline Luise von Baden.
168
Hüsgen 1780, S. 316-317.
169
Ebd., S. 410.
170
Gerson 1942, S. 320.
171
Vgl. zu Quast Kat. 42, Nr. 159, und Kat. 44, Nr. 95; zu Wet Kat. 42, Nr. 24, und Kat. 44, Nr. 130.
172
Im Nachlaß Karoline Luises befinden sich weitere Listen von Gemäldesammlungen. Außerdem bestanden Kontakte zum Mannheimer Hof durch den dortigen Galeriedirektor Lambert Krähe, dessen Katalog aus dem Jahre 1770 sich ebenfalls als Abschrift in den Archivunterlagen befindet, Landesarchiv Karlsruhe, Nachlaß Karoline Luise von Baden.
173
Hüsgen, Veir. Briefe 1776/83, S. 75.
174
Vgl. Ausst.-Kat. Frankfurt 1988, S. 120.
175
Ein Versteigerungskatalog vom 23.11.1767 wird vermißt (vgl. Kat. 41).
31
hatte verschoben werden müssen (Kat. 45). Der gedruckte Katalog, Liste D'une Partie des Peintures provenantes de la Succession de S.A.S. Electorate de Cologne enthält 715 Nummern, darunter eine große Anzahl von Miniaturen, Pastellen, Aquarellen und Arbeiten aus Elfenbein. Der Verkauf dieser Sammlung erbrachte Einnahmen von 25.000 Gulden. Unter den Käufern finden wir den gesamten kurkölnischen Hofadel und die führenden Beamten: hervorzuheben sind der Geheime Hofrat Nicolaus Augustin Anton Schildgen, Caspar Anton Freiherr Belderbusch sowie Hofkammerrat Friedrich Franz Adam Freiherr von Breidbach. Am Bonner Hof scheinen die meisten Hofbeamten im Sammeln von Bildern dem Vorbild Clemens Augusts gefolgt zu sein. Auch aus Köln sind einzelne Käufer angereist, so der Bankier Guaita, der bereits den Verkauf der Sammlung des Grafen Ferdinand von Hohenzollern-Sigmaringen (Kat. 23) geleitet hatte. Vertreter des nationalen sowie internationalen Kunsthandels waren ebenfalls auf der Auktion anwesend: aus Paris der Händler Neveu, aus Köln die "Herren Gebrüder Herstatt", die eine Vielzahl der ersteigerten Gemälde unmittelbar nach Kopenhagen oder Berlin verkauft haben. Nach Berlin gingen eine Vielzahl von venezianischen Prospekten und Adriaen van der Werffs St. Marguerite (Kat. 45; Nr. 38). Die Finanzierung dieser Ankäufe wurde von den Bankiers Splitgerber und Daum in Berlin abgewickelt. 176 Den größten Anteil der Gemälde erwarben jedoch der Hofbankier Simon Baruch und der als Kriegskommissar und Hofkammerrat ausgewiesene Broggia. Baruch war einer der wichtigsten Finanziers am kurkölnischen Hofe, der Erwerb der Gemälde konnte somit zum großen Teil mit ausstehenden Schulden verrechnet werden. Broggia selbst hatte die Aufsicht über die Auktion, auf der er allein über 180 Losnummern ersteigerte. Baruch und Broggia hatten jedoch nicht aus eigenem Sammelinteresse gekauft, sondern einzig zum Zwecke der Spekulation. Ein Großteil der von ihnen erworbenen Gemälde wurde nur ein Jahr später von dem Händler Rauschner in Frankfurt erneut zum Verkauf angeboten (Kat. 51). Die von Neveu erworbenen Gemälde gelangten bereits im Dezember desselben Jahres auf den Pariser Kunstmarkt und wurden dort versteigert (Lugt 1413). Ausdrücklich wird auf dem Titelblatt des Pariser Katalogs vermerkt: "La plus grande partie venant de la Vente de Feu S. A. Elect, de Cologne". 177
Hamburg Das Jahr 1763 war für die Freie und Hansestadt Hamburg ökonomisch wie finanzpolitisch eine Zäsur. Große Teile der Hamburger Wirtschaft konnten während des Siebenjährigen Krieges als Spekulanten und Kriegsgewinnler große finanzielle Erfolge verbuchen, "die werten Herren Blutsauger" waren damals in aller Munde. Während dieser Zeit entstanden bedeutende Privatsammlungen oder aber bestehende Sammlungen konnten durch Ankäufe auf dem Kunstmarkt im Ausland weiter ausgebaut werden. Die Kataloge der Sammlung Stenglin und Schwalb legen Zeugnis davon ab. Nach Beendigung des Krieges wurde Hamburg von einer Finanzkrise erfaßt, die ihren Ausgang von Amsterdam nahm. Viele Unternehmen mußten Bankrott anmelden. Die ökonomische Krise scheint jedoch keine nachweisbaren Spuren auf dem Kunstmarkt hinterlassen zu haben, denn keine der großen Hamburger Privatsammlungen gelangte auf den Kunstmarkt. Eine vergleichbare Häufigkeit von Gemäldeauktionen wie in Frankfurt läßt sich für die 1760er Jahre in Hamburg nicht nachweisen. Zwischen 1764 und 1769 fanden zwar kontinuierlich einzelne Auktionen statt, jedoch scheint sich das Auktionswesen erst von 1770 an richtig entfaltet zu haben. Von anfänglich drei Auktionen 1770 stieg ihre Anzahl auf sechs Auktionen in den Jahren 1775 und 1776 an, um 1778 auf zwölf Auktionen hochzuschnellen. Ein Jahr später fanden nur noch drei Auktionen statt, in den Jahren 1780/81 lassen sich überhaupt keine Versteigerungen mehr nachweisen. Das 176
Seidel 1894, S. 54.
177
Vey 1963, S. 223-226.
32
Jahr 1778 bildete somit einen gewissen Schnitt- oder Scheitelpunkt in der Entwicklung des deutschen und Hamburger Kunstmarkts. Der größte Teil der in diesem Jahr veräußerten Gemälde stammte aus Privatsammlungen, in vier Fällen ist nach Auskunft des Titelblatts der Tod ihrer Besitzer der unmittelbare Anlaß für die Auktion gewesen. Keiner der Namen wird jedoch auf dem Titelblatt erwähnt, nur einmal wird im Vorwort zum Katalog (Kat. 111) die Initiale des Namens genannt: "S.H.W.G. der selige Herr Doctor F[riederici]". Auf den übrigen Katalogen finden sich einzig die Hinweise "aus einer gewissen Verlassenschaft" (Kat. 106) und "so von einem alten Kenner seit vielen Jahren mit Mühe und Fleiß gesammelt worden" (Kat. 110). Im Vorwort zur Sammlung Friederici (Kat. 111) wird von einem "Nachlaß" gesprochen; und in einem weiteren Katalog heißt es: "so durch einen bekannten Liebhaber mit Fleiß gesammelt" (Kat. 113). Zwei Sammlungen stammen mit Sicherheit aus Hamburg, da beide Auktionen in "einem wohlbekannten Sterbehause" stattfanden. Beide Auktionen (Kat. 118 und 119) wurden von dem Hamburger Auktionator Jürgen Hinrich Köster durchgeführt. Zu vermuten ist daher, daß auf einer weiteren von Köster durchgeführten Auktion ebenfalls eine Privatsammlung veräußert wurde (Kat. 109). Der Umfang der veräußerten Sammlungen schwankt zwischen 54 und 197 Gemälden pro Auktion, liegt aber meist bei etwa 100 Gemälden. Wie zehn Jahre zuvor in Frankfurt scheinen einige der verauktionierten Sammlungen von auswärts zum Zwecke ihres Weiterverkaufs auf den Hamburger Markt gelangt zu sein. Wurden jedoch in Frankfurt die Gemälde von sachverständigen Händlern wie Rauschner oder Kaller selbst im Ausland oder auf auswärtigen Auktionen erworben, so wurden in Hamburg die Sammlungen von den dortigen Maklern vermutlich als Handelsware in Empfang genommen und ebenso schnell wieder veräußert. Allein der Makler Michael Bostelmann hat in den Jahren 1774 bis 1778 zwölf Auktionen durchgeführt. Der anonyme Zwischenhandel war ein Grund, daß immer wieder Sammlungen auf den Markt gelangten, die sich von ihrer Qualität und dem Charakter her von den lokalen Sammlungen in den anderen Städten unterscheiden lassen. Am interessantesten ist die Auktion einer "auserlesenen Sammlung der besten Italienischen Cabinet=Mahlereyen", die am 11. April 1778 stattfand (Kat. 107). Diese Sammlung umfaßte 76 Gemälde, vor allem von Malern der venezianischen Schule des 16., 17. und frühen 18. Jahrhunderts, etwa von Piazzetta, Pittoni oder Solimena, darunter auch zwei Porträts des Feldmarschalls Johann Matthias von der Schulenburg (1661-1747). Die beiden Porträts legen den Schluß nahe, daß es sich um einen Teil der berühmten Sammlung des Marschalls handelt. Im Dienste der Republik Venedig stehend, hatte sich Schulenburg durch die Verteidigung der Insel Korfu gegen die türkischen Truppen (1716) hohe militärische Ehren erworben. In den annotierten Hamburger Katalogen findet man wie in Frankfurt überwiegend die Namen von Händlern und Sammlern. Unter den meistgenannten Händlern fällt der Name Johann Benjamin Ehrenreich auf, der Sohn des Frankfurter Sammlers und Händlers Johann Matthias Ehrenreich. Es bestand somit eine Verbindung zwischen dem Hamburger und dem Frankfurter Kunsthandel. Als weitere Käufer werden auf den Auktionen dieser Jahre die Kunsthändler Johann Jobst Eckhardt, Johann Dietrich Lilly jun. und sen., Michael Bostelmann genannt sowie Hamburger Sammler, von denen viele bisher nicht identifiziert werden konnten. In den 60er und 70er Jahren des 18. Jahrhunderts hatte sich in Hamburg durch die Gründung von Institutionen und Gesellschaften ein neues kulturelles Milieu herausgebildet und etabliert. Dieses besaß auch für das Sammelwesen eine wichtige Bedeutung. Zu den bedeutendsten und wohl auch bekanntesten Privatsammlungen in Deutschland gehörten die beiden Hamburger Sammlungen Stenglin
und Schwalb. Schwalb besaß familiäre Beziehungen zu dem Ökonomen Büsch,178 der zu den Gründern der 1765 entstandenen "Hamburgischen Gesellschaft zur Beförderung der Künste und nützlichen Gewerbe" gehörte. Zu diesem Kreis zählte auch der Sohn des Gelehrten Hermann Samuel Reimarus, J. Α. H. Reimarus. Der fünfzehnjährige Sulpiz Boisseree, der später durch seine bedeutende Sammlung altdeutscher Kunst bekannt geworden ist, kam 1798 als Lehrling eines Kaufmannshauses nach Hamburg und gelangte in den Kreis um Reimarus.179 Kurz nach 1770 wurde die KlopstockBüschsche Lesegesellschaft gegründet.180 Für diese Gesellschaft, die ein eigenes Versammlungszimmer hatte, schuf Johann Heinrich Tischbein 1772 sein Gemälde Polyhymnia in einem Museum,181 Schwalb besaß wiederum Kontakte zu Gotthold Ephraim Lessing, der während seines Hamburg-Aufenthaltes mit Schwalb verkehrte. Zusammen mit den Hamburger Gemäldesamlungen von Bertheau, Hasperg, Loffhagen, von Sienen, Paulsen und Janssen wurde die Sammlung Stenglin bei Meusel in der zweiten Auflage seines Künstlerlexikons verzeichnet.182 Die Gemäldesammlung wurde ebenfalls von Johann Heinrich Wilhelm Tischbein (1751-1829) lobend herausgestellt, der während seines kurzen Aufenthaltes Kontakt zu einzelnen Hamburger Sammlern und Kunsthändlern aufnahm. Einzelne Gemälde der Sammlung Stenglin sind von Tischbein nach eigenen Angaben kopiert worden.183 Wie Johann Gottfried Winckler, Johann Georg Eimbke und Johann Ernst Gotzkowsky in Berlin hat Stenglin wohl zu Kriegszeiten auf dem internationalen Markt Gemälde gekauft. Der Katalog von Matthias Oesterreich von 1763 mit Angaben zur Herkunft einzelner Bilder belegt dies. Vergleichbare repräsentative Sammlungskataloge mit kennerschaftlichem Anspruch hat es in Frankfurt oder Köln auch für die 70er und 80er Jahre des 18. Jahrhunderts nicht gegeben. Oesterreich weist zugleich darauf hin, daß er nur eine Auswahl der Gemälde erfaßt hat. Insgesamt verzeichnet der Katalog 148 Nummern. Neben der Vorstellung des Themas gibt Oesterreich für jeden Künstler biographische Angaben, die er aus der damals geläufigen kunsthistorischen Literatur zusammengestellt hat. Von ähnlicher Qualität ist der Katalog der Sammlung Schwalb (Kat. 120), der erst posthum erschienen ist. Dieser Katalog wird von einem Vorwort von Adam Friedrich Oeser eingeleitet, bei dem es sich um einen Brief an Christian Ludwig von Hagedorn, dem Generaldirektor aller sächsischen Kunstakademien, handelt.184 Im Auftrag Hagedoms war Oeser nach Hamburg und Hannover gereist, um die Sammlungen Schwalb und Wallmoden (Kat. 117) zu begutachten. Der größte Teil der Sammlung Schwalb wurde in die Niederlande transferiert und dort 1785 versteigert. Die Sammlung Stenglin verblieb bis 1801 in Hamburg und wurde dann erstmals zum Verkauf angeboten. 178
Kopitzsch 1990, S 370, 374.
179
Förster 1931, S. 86.
Bremen, Hannover, Braunschweig und Wolfenbüttel Neben Hamburg lassen sich von 1763 an auch in allen größeren Städten Norddeutschlands Kunstauktionen nachweisen, sowohl in der Hansestadt Bremen als auch in den kleineren Residenzstädten Hannover, Braunschweig und Wolfenbüttel. In allen diesen Städten hat es private Sammlungen gegeben, darunter die von Friedrich Emst von Wallmoden in Hannover (Kat. 117) und die des Freiherrn (später Grafen) Friedrich Moritz von Brabeck in Söder bei Hildesheim, die 1808 durch ein Galeriewerk mit Wandaufrissen dokumentiert wurde.185 Fand bereits im Jahre 1705 in Hannover eine der frühesten Auktionen statt (Kat. 4), so setzte der Kunstverkauf 1763 mit einer spektakulären Lotterie ein. Verkauft werden sollte die Sammlung Reden, die auf 20.000 Taler geschätzt worden war. Zu den Interessenten gehörte auch die Markgräfin Karoline Luise von Baden. 186 Der in Hannover ansässige Graf Friedrich Emst von Wallmoden erwarb Gemälde aus der Sammlung Reden.187 Die Sammlung Wallmoden zählte zu den damals bekanntesten Sammlungen im norddeutschen Raum. Sie ging, worauf Adam Friedrich Oeser im Katalog der Sammlung Schwalb einleitend hinweist, zum Teil auf die Sammlung des Grafen von Bülow zurück; der wohl wichtigste Teil jedoch war durch "des Besitzers Bruder, der Herr General, Graf von Wallmoden, in Italien angeschaffet". 188 Ein Teil der Sammlung Wallmoden, in der Hauptsache Kupferstiche sowie 173 Künstlerporträts von La Bonte nach Originalen und Kupferstichen, wurde im Jahr 1778 in dem "Wallmodenschen Hause" in Hannover versteigert. Die eigentliche Sammlung des Grafen Johann Ludwig von Wallmoden (1736-1811) wurde erst 1818 versteigert. 189 Für Wolfenbüttel lassen sich seit den 1770er Jahren einige Auktionen mit gedruckten Katalogen nachweisen, auf denen neben Möbeln, Edelmetallen oder Pretiosen auch zwischen 30 und 40 Gemälde öffentlich versteigert wurden. 190 In Bremen fanden Kunstauktionen von privaten Sammlungen mit gedruckten Katalogen in den Jahren 1772 und 1781 statt (Kat. 71 und 137). In Flensburg wurden ebenfalls im Zusammenhang mit der Auflösung von Bibliotheken oder Haushalten kleinere Bestände von Gemälden verkauft (Kat. 194 und 276). Berlin Nach Beendigung des Siebenjährigen Krieges nahm Friedrich II. verstärkt den Ankauf von Gemälden für seine neuerbaute Galerie in Potsdam auf. Er wurde hierbei durch seine Agenten in Frankreich und Holland mit Gemälden versorgt. Auch die Berliner Sammler und Händler Johann Emst Gotzkowsky und Jacques Triebel belieferten den König wieder mit Gemälden.191 Friedrich erwarb auch Gemälde auf der Bonner Auktion von Clemens August im Jahre 1764. Bezahlt wurden diese Ankäufe von den Bankiers Splitgerber und
180
Kopitzsch 1990, S. 386.
181
Ausst.-Kat. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. 200 Jahre Französische Revolution in Deutschland, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, Nürnberg 1989, S. 234, Nr. 47.
182
Meusel Künstlerlexikon 1808/14, Bd. 3, S. 417.
183
Tischbein 1861, Bd. 1, S. 66f.
184
Oeser 1779.
185
Catalogue de la Galerie de Soeder, par le proprietaire de Comte de Brabeck, 1808; vgl. auch den früheren Katalog: Friedrich Wilhelm Basil, von Ramdohr, Beschreibung der Gemaelde-Gallerie des Freih. v. Brabeck, Hannover 1792. Die Sammlung wurde am 31.10.1859 verauktioniert (Lugt 25060).
186
Ein Exemplar des Katalogs befindet sich im Nachlaß Karoline Luises von Baden.
187
Oeser 1779.
188
Ebd.; es muß ein älteres Verzeichnis geben, da Oeser sich in diesem Schreiben auf ältere Katalognummer bezieht.
189
Bilder aus der Sammlung Wallmoden (Wallmoden'schen Gallerie), die im Jahre 1818 in Hannover versteigert wurde (Lugt 9433), gelangten in den Besitz des Oberbaurates Bernhard Hausmann (1784-1873) aus Hannover. Dessen Sammlung wurde dann 1857 von Georg V. übernommen und gelangte später in den Bestand der Landesgalerie. Vgl. Verzeichniss der Hausmann'schen Gemählde-Sammlung in Hannover, Hannover 1831, S. V-VI sowie Anmerkung 5 sowie die Kat.-Nm. 1 bis 44; 245 bis 250 und 256 bis 269. Dort finden sich auch Hinweise auf die weiter zurückreichende Provenienz der Bilder aus der Sammlung Wallmoden, so wurde beispielsweise die Sammlung des "Herrn Girod le jeune in Genf' von Wallmoden angekauft. Niedersächsisches Staatsarchiv Wolfenbüttel, Findbuch 34 Ν Stadt Wolfenbuttel, Bd. 1 (LFD.-Nr. 1-1284), 6.8, Auktionen: Nm. 419, 420, 433.
190 191
Siehe Seidel 1894, S. 54f.
33
Daum in Berlin: "So liquidieren sie am 21. Juni 1764 über die auf der Versteigerung der Sammlung des Erzbischofs von Köln in Bonn gemachten Ankäufe von 30 'Schildereien' mit Ansichten von Venedig, Rom und Paris, zusammen für 369 Thaler (Katalog No. 405411) und der Darstellung einer heiligen Margarete (Katalog No. 38) zu 192 Thalem." 192 Die Sammlung wurde erstmals 1764 von Matthias Oesterreich katalogisiert, der seit 1757 Inspektor der Potsdamer Bildergalerie war. Eine vergleichbare Entwicklung auf dem Kunstmarkt wie sie in Frankfurt, Hamburg oder Leipzig nach Beendigung des Siebenjährigen Krieges stattgefunden hat, läßt sich für Berlin nicht nachweisen. Bisher konnten für das 18. Jahrhundert lediglich zwölf Auktionskataloge nachgewiesen werden, darunter drei reine Gemäldekataloge. 193 Insgesamt gelangten im 18. Jahrhundert nach den Angaben der vorhandenen Kataloge durch öffentliche Auktionen nur 757 Gemälde auf den lokalen Markt. Die geringe Anzahl der Kataloge gibt jedoch keinen Aufschluß über das tatsächliche Sammelwesen in Berlin oder Potsdam. Nicolai listet in seiner Beschreibung Berlins aus dem Jahre 1769 noch einige Gemäldesammlungen auf, von denen in den späteren Auflagen einige nicht mehr erwähnt werden. Als erstes führt Nicolai die Sammlung im Gräflich Schulenburgischen Palast in der Wilhelmstraße sowie die Sammlung im "Berlinischen Gymnasium" auf; es werden dann die Kabinette einzelner Privatpersonen genannt: Baudirektor Boumann ("schöne Sammlung Malereien"), der Hofmaler Herr Böhme, Hofrat Buchholz, Direktor Cäsar, Daniel Chodowiecki, Friedrich Carl Daum, Maler Falbe, Herr Glume, Großkanzler Herr von Jariges, Graf von Ranck, der Maler Le Sueur, Direktor der Akademie, F. W. Meil, Geheimrat de la Motte, der Arzt D. Möhsen, die Maler Reclam und Bernhard Rode, der Hofstecher Schmidt und der Kommerzienrat Tribble. In der zweiten und dritten Auflage der Beschreibungen Nicolais kommen u.a. folgende Sammler hinzu: Benjamin Veitel Ephraim, Joseph Flies, Staatsminister Freiherr von Heinitz, Daniel Itzig und Freiherr von Knyphausen.194 Zu nennen ist noch die Sammlung des Grafen Henri Reuss (Kat. 139). Abgesehen von wenigen Ausnahmen, gelangte keine dieser Sammlungen bei ihrer Auflösung im 18. Jahrhundert auf den einheimischen Markt. Die Sammlung des Getreidelieferanten Johann Gottlieb Stein ist vermutlich en bloc verkauft worden (Kat. 37). Die Sammlung Gotzkowsky wurde, nachdem die Verhandlungen mit Friedrich II. erfolglos blieben, nach St. Petersburg verkauft; ein kleiner Teil war bereits zwischen 1757 und 1761 in die Berliner Sammlung Eimbke gelangt. Die Sammlung des Grafen Schulenburg war eine der wichtigsten privaten Sammlungen italienischer Gemälde in Deutschland. Die Gemälde waren nach ihrer Überführung von Venedig nach Berlin im Palais des Grafen in der Wilhelmstraße aufgestellt gewesen. Die Sammlung blieb jedoch nicht in Berlin, noch wurde sie in Berlin selbst verkauft. Ein Teil der italienischen Gemälde wurde 1775 in London, ein anderer 1778, wie schon beschrieben, in Hamburg öffentlich versteigert (Kat. 107). Die im Familienbesitz gebliebenen Bilder gelangten zum großen Teil nach Hehlen auf das Familienschloß. Nur "wenige Stücke", so Nicolai, blieben im "Gräflich Schulenburgischen Pallaste".195
Leipzig In Leipzig lassen sich nur wenige Kunstauktionen für die Zeit nach dem Siebenjährigen Krieg nachweisen. Jedoch wurden im Zusammenhang mit der Auflösung von Haushalten auch jeweils kleinere Bestände von Gemälden angeboten. Diese Auktionen wurden in der "Leipziger Zeitung" angekündigt, ein gedruckter Katalog konnte bisher nicht nachgewiesen werden. Erstaunlich ist jedoch die hohe Anzahl der Leipziger Haushalte, in denen sich Gemälde befunden haben. Die Auktionen wurden von den Ratsproklamatoren Johann Ludewig Berringer und Christian Friedrich Hecht durchgeführt. Als Privatsammlungen sind, nachdem die Sammlung Böttcher während des Siebenjährigen Krieges aufgelöst worden war, an erster Stelle die schon erwähnten Sammlungen Richter und Winckler zu nennen. Johann Thomas Richter hatte die Sammlung von seinem Vater geerbt. Seine Sammlung soll über 400 Gemälde und über 1.000 Zeichnungen umfaßt haben. Die Sammlung war aufgestellt im Bosehaus am Thomaskirchhof.196 Das Bosehaus war zugleich Mittelpunkt einer "Societät von schönen Geistern, Künstlern, Kennern und Kunstliebhabern"; zu diesem Kreis gehörten auch Franz Kreuchauf, der Verfasser des Katalogs der Sammlung Winckler, und Michael Huber.197 Nach dem Tode von Thomas Richter ging die Sammlung an seinen Bruder Johann Friedrich Richter. Die Graphik, einschließlich der Zeichnungen, wurde von Rost 1786/1787 in zwei Auktionen versteigert (Kat. 169); die Gemälde wurden jedoch erst 1810 veräußert.198
Das Jahrzehnt vor der Französischen Revolution Frankfurt Für die weitere Entwicklung des deutschen Kunstmarkts war mit den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts bereits eine wichtige Tendenz vorgezeichnet. Konnte sich der Frankfurter Kunstmarkt mit seinen Auktionen auch zu Beginn der 80er Jahre für kurze Zeit noch einmal an der Spitze behaupten, so entwickelte sich Hamburg bald darauf zum eigentlichen Zentrum des Auktionshandels in Deutschland. In den 1780 erschienenen Nachrichten von Frankfurter Künstlern und Kunstsachen markiert Hüsgen noch deutlicher als bereits vier Jahre zuvor die große Zäsur in der Frankfurter Sammlungsgeschichte. Zum einen weist er in der "Vorrede" retrospektiv auf die im 18. Jahrhundert entstandenen Sammlungen hin, deren Besitzer in der Zwischenzeit verstorben waren. Hierbei erinnert er an die Namen Klock, Ucheln (Kat. 16), Kißner (Kat. 144), Ochs, Disterweg, Pfeiff, Bernus (Kat. 134), Baron Haeckel (Kat. 47), Uffenbach (Kat. 68 und 87), Pasquay (Kat. 133) und Bögner (Kat. 116), "die Kunst, Naturalien und Antiquitäten=Cabineter aufs neue anlegten, und edles Gefühl für diese Schöne Gegenstände blicken liessen: Sie leben aber nun alle nicht mehr." 199 Zugleich verweist er auf über 80 Personen in Frankfurt, "die meistens vortreffliche Gemähide der drei bekannten Schulen hieselbsten besitzen."200 Davon werden mehr als zehn Kabinette eingehend beschrieben: die Sammlung der Prinzessin Henriette Charlotte von Anhalt-Dessau in ihrem Lustschloß zu Bokkenheim und die Sammlungen des Bankiers Remigius Bansa, des geheimen Rates Franz Ludwig Freiherr von Berberich, von Andreas Joseph Chandelle, Kaspar Thorhorst (Dorhorst), Hofrat Matthias d'Orville, Johann Matthias Ehrenreich, Friedrich Ettling, Carl Geyß, Johann Christian Gerning, Johann Noe Gogel sowie Johann Christian Kaller; auch seine eigene Sammlung erwähnt Hüsgen.201
192
Zitiert nach Seidel 1894, S. 54.
193
Es handelt sich um die Kataloge 37, 43, 46, 59, 72, 80, 104, 132, 139, 234, 289 und 291. Vgl. auch Wilhelm 1990, S. 56.
194
Siehe Nicolai 1779, Bd. 2, S. 615-625; Nicolai 1786, Bd. 2, S. 833-849.
195
Nicolai 1779, Bd. 2, S. 623; Nicolai 1786, Bd. 2, S. 849.
196
Susanne Heiland, Anmerkungen zur Richterschen Sammlung, in: Das Bosehaus am Thomaskirchhof, eine Leipziger Kulturgeschichte, Leipzig 1989, S. 139-174.
197
Goethe, Dichtung und Wahrheit, 1986, S. 344.
198
Trautscholdt 1957, S. 226.
199
Hüsgen 1780, S. XXII.
200
Ebd., S. 310.
201
Ebd., S. 310-340.
34
Von diesen Sammlungen wurden zwischen 1778 und 1784 selbst wieder einige zusammen mit anderen bedeutenden Privatsammlungen verkauft. Die sieben Jahre markierten für den Kunstmarkt in Frankfurt einen weiteren Höhepunkt. Versteigert wurden so namhafte Sammlungen wie die Sammlung Stöcklin (Kat. 128), Bernus (Kat. 134), Geyß (Kat. 138), Thorhorst (Kat. 143), Gogel (Kat. 146), Berberich (Kat. 154) oder die Sammlung Moser aus Darmstadt (Kat. 127). Den meisten dieser Namen war man auf früheren Auktionen bereits als Käufer begegnet. Ein gewaltiger Umlauf von Gemälden ist somit für die 1780er Jahre in Frankfurt zu verzeichnen. Den Anforderungen entsprechend wurde auch in Frankfurt zum Zwecke der Versteigerungen ein eigenes Domizil geschaffen. So konnte erstmals im Jahre 1778 die Sammlung Georg Wilhelm Bögners (Kat. 116) in der "Senkenbergischen Stiftung hinter der sogenannten schlimmen Mauer" versteigert werden. Die Sammlung Bögner wurde eigens vor der Auktion von Johann Heinrich Merck im Teutschen Merkur besprochen, "weil das Capital von Kunstsachen es würkl. meritiert, das hier circulieren wird." 2 0 2 Im Senckenbergischen Stiftungshaus veranstaltete u. a. Johann Andreas Benjamin Nothnagel (1729-1804) 1779 und 1784 zwei Auktionen, die zu den umfangreichsten Versteigerungen in Frankfurt zählten. Nothnagel spielte eine wichtige Rolle auf dem Frankfurter Kunstmarkt. 2 0 3 Bereits 1765 hatte er, wie schon erwähnt, eine Lotterie veranstaltet (Kat. 51), auch trat er öfters als Käufer auf. Nothnagel war als erfolgreicher Tapetenproduzent und Künstler so angesehen, daß Goethe bei ihm Malunterricht nahm. "Damit ich mich auch mit diesen Dingen (der Malerei) werktätig bekannt machen möchte, räumte mir Nothnagel ein Kabinett ein, wo ich alles vorfand, was zur Ölmalerei nötig war." 2 0 4 Der Katalog von 1779 (Kat. 125) umfaßt über 1.000 Losnummern, der von 1784 (Kat. 152) noch 735 Nummern; da bei vielen Losnummern zwei Gemälde verzeichnet sind, wurden ebenfalls mehr als 1.000 Gemälde verauktioniert. Auch die Zahl der Gemälde auf den übrigen Auktionen näherte sich der Tausendergrenze. Die Sammlungen haben im einzelnen einen stark regional ausgeprägten Charakter. Viele der Frankfurter Maler wie Justus Juncker, Georg Trautmann, Franz Schütz oder Johann Conrad Seekatz waren mit ihren Werken vertreten. Die Sammlung Casper Goethes bestand aus programmatischen Gründen vorwiegend aus Gemälden von Frankfurter Malern. 2 0 5 U m eine Ausnahme handelt es sich bei der Sammlung Bemus, in der sich nicht nur über 50 Gemälde von Melchior Roos, sondern auch Bilder und Altäre der altdeutschen Malerei befanden. In den meisten Frankfurter Sammlungen sind ansonsten Gemälde der niederländischen und flämischen Schule stark vertreten, die italienische und französische Schule ist kaum repräsentiert. Eine Ausnahme ist die Sammlung Bernus mit einer Vielzahl von Gemälden italienischer Künstler. Die Auktionen der 1780er Jahre boten den Sammlern der zweiten und dritten Generation die Möglichkeit, neue Sammlungen aufzubauen oder vorhandene zu vervollständigen. Die beiden Auktionen von Nothnagel oder die der Sammlung von Bernus waren Großereignisse. Neben den bereits bekannten Kunsthändlern Kaller und Ehrenreich finden sich die N a m e n der folgenden Sammler in den annotierten Katalogen: Friedrich Ettling, Carl Traugott Berger, Heinrich Joseph Burger, Friedrich Wilhelm Hoynk und Valentin Prehn. Neben den bürgerlichen Sammlern war auch der Adel mit Agenten 202
Merck 1911, S. 185, Brief vom 8.6.1778.
203
Ausst.-Kat. Frankfurt 1988, S. 112f. Zit. nach Friederichs/Wiegel 1953, S. 66.
204 205
Merck 1911, S. 185, Brief vom 8.6.1778.
207
Ebd., S. 24, Brief vom 27.10.1779.
208
Ebd., S. 105, Brief vom 23.6.1781. Httsgen 1780, S. 310f. Gwinner I 1862, S. 533.
210 211
Auch auf dem freien Markt konnte Merck Gemälde erwerben. So bemerkt er in einem Brief nach Weimar, daß noch "ein herrlicher Elsheimer, so groß wie ein Octav Blatt, in Frankfurt aus der Hand zu verkauffen [sei]. Er ist allerliebst, und man könnte ihn für 3 Vi Carolin haben." 2 0 7 Er selbst kaufte in Frankfurt Gemälde von Allart van Everdingen, Abraham Hondius, Rembrandt, Johann Heinrich Roos und Anthonie Waterloo, wohl immer mit dem Zweck, die Bilder nach Weimar weiterzuverkaufen. Zugleich versuchte Merck, einzelne Gemälde des Herzogs, die dieser wieder verkaufen wollte, in Frankfurt abzusetzen, gegebenenfalls zu tauschen. 2 0 8 Die Frankfurter Auktionen dienten auch der Prinzessin HenrietteAmalie von Anhalt-Dessau (1720-1793) als reiche Quelle für den Aufbau ihrer Bildersammlung. 1750 hatte Henriette-Amalie in Bokkenheim bei Frankfurt ein Schloß erworben. Hüsgen beschreibt die Sammlung der Prinzessin 2 0 9 Ihr N a m e taucht als Käuferin bei den Versteigerungen der Sammlung Bögner (Kat. 116), Gogel (Kat. 146) und Nothnagel (Kat. 152) auf. Im Jahre 1778 erwarb die Prinzessin auf der Versteigerung der Sammlung Bögner allein 93 Gemälde und auf der Nothnagelschen Auktion 1784 sogar 110 Bilder. Diese Gemälde gingen 1907 als Teil der Amalienstiftung in den Besitz der Anhaltinischen Gemäldegalerie in Dessau über. Auch auf der Auktion des Grafen von Eitz zu Mainz 1785 (Kat. 157) trat sie als Käuferin auf. Die Agenten der großen fürstlichen Sammlungen in Dresden, Berlin oder München scheinen dagegen auf dem Frankfurter Markt immer weniger gekauft zu haben. Mit der Etablierung eines eigenen Auktionsortes erfolgte verstärkt die öffentliche Zurschaustellung der angebotenen Sammlungen. Nach Gwinner war die Sammlung Bögner über ein halbes Jahr im Senckenbergischen Stiftungshaus zu sehen. 2 1 0 Die Sammlung von Kaller und Michael, die 1790 öffentlich versteigert wurde (Kat. 207), soll vor ihrer Versteigerung (1790) zwölf Jahre im "öffentlichen Frankfurter Bildersaal" im Kreuzgang des Barfüßerklosters zu besichtigen gewesen sein. 2 1 1 Vermutlich handelte es sich um den Lagerbestand der Kunsthändler. Waren die Privatsammlungen zu Lebzeiten ihrer Besitzer für Freunde oder auswärtige Besucher zugänglich, so entstand im Zusammenhang mit dem Auktionswesen der 1780er Jahre ein öffentliches Ausstellungswesen, das durch finanzielle Interessen motiviert war, aber dennoch eine große Zahl von Gemälden in regelmäßigen Abständen einer bürgerlichen Öffentlichkeit zugänglich machte. Damit war in Frankfurt mit den Besichtigungen im Senckenbergischen Stiftungshaus eine öffentliche Gegeninstitution zu den Gemäldegalerien in den benachbarten Resi-
Beutler 1949, bes. S. XXmff.
206
209
vertreten. Der Hof in Weimar war etwa durch Johann Heinrich Merck bei vielen Versteigerungen präsent. Merck war am Darmstädter Hof tätig, besaß aber persönliche Kontakte zur der Herzogin Anna Amalia und ihrem Sohn, Herzog Karl August. Merck erwarb entweder im Auftrag des Fürsten oder auf eigene Rechnung Gemälde, Zeichnungen und Kupferstiche sowohl auf dem inländischen als auch auf dem ausländischen Markt. Über zehn Jahre sondierte er den Frankfurter Markt sehr genau. 1778 erscheint im "Teutschen Merkur" seine Besprechung der Sammlung Bögner, die im September des Jahres von den Erben versteigert wurde. An den Herausgeber der Zeitschrift in Weimar schrieb Merck: "Der Herzog solte da kauffen, da wäre für 10/m Thl. ein fonds vor eine herrliche Galerie anzulegen." 2 0 6
Ausst.-Kat. Frankfurt 1991, Bd. 3, S. 235, Nr. 1.26.53.
35
denzen und Fürstenhöfen in Kassel, Mannheim, Darmstadt, Braunschweig oder Weimar geschaffen worden.
Hamburg Gegen Ende der 1780er Jahre wurde die Hansestadt Hamburg von einem wirtschaftlichen Aufschwung erfaßt, der alle Bereiche der Wirtschaft mit sich zog. Für die Jahre 1780/81 lassen sich noch keine Gemäldeauktionen nachweisen, jedoch stieg, wie bereits ein Jahrzehnt zuvor, in den folgenden Jahren die Zahl der Kunstauktionen wieder an. Von zwei Auktionen im Jahre 1782 kletterte ihre Zahl 1785 auf vier, im Jahre 1787 auf sechs Auktionen, eine Zahl, die sich bis 1790/91 stabilisierte. In den 1780er Jahren wurden, soweit sich anhand der Kataloge nachvollziehen läßt, 5.191 Gemälde in Hamburg verauktioniert. Den größten Anteil nehmen wiederum die Gemälde der holländischen Schule ein, dicht gefolgt von Werken deutscher Künstler. Auch in der weiteren Abfolge der Schulen fand kein Wechsel statt. Die Anzahl der veräußerten Gemälde pro Auktion schwankte zwischen 38 und 472 Gemälden. Um eine Ausnahme handelte es sich bei der Versteigerung einer Sammlung von Gemälden mit 756 Katalogeinträgen (Kat. 168). Insgesamt jedoch scheint der Umfang der zur Versteigerung gelangten Sammlungen in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts zuzunehmen, so finden sich immer mehr Versteigerungskataloge mit über 200 Gemälden (vgl. Kat. 216, 218, 228, 260, 261, 287). Vermutlich werden hier teilweise Angebote verschiedener Einlieferer zusammengefaßt. Unter den angebotenen Beständen scheinen wie in Frankfurt anfänglich auch private Sammlungen veräußert worden zu sein, etwa die Hamburger Sammlungen Thielcke (Kat. 142) und Moddermann im Jahre 1782 (Kat. 145). Im Jahre 1784 fand eine Auktion in einem Hamburger "Sterbehaus" statt (Kat. 149), eine zweite Sammlung wird auf dem Titelblatt als "Nachlaß" bezeichnet (Kat. 153). Ein Jahr später wurde die Sammlung des in Hamburg tätigen Malers Johann Anton Tischbein veräußert (Kat. 158), eine andere Sammlung wird mit dem Hinweis charakterisiert, daß sie von einem "Liebhaber" gesammelt worden sei (Kat. 163). Von den fünf im Jahre 1786 durchgefühlten Versteigerungen wird eine Auktion in der Pilsterstraße, in der sogenannten "Ober=Gesellschaft" durchgeführt (Kat. 165), möglicherweise gelangte ebenfalls eine Privatsammlung zum Verkauf wie im Fall eines veräußerten "Nachlasses", der fünf Monate später auf der Börse verkauft wurde (Kat. 166). Von auswärts gelangte eine Sammlung von "Cabinet-Mahlereyen auf Glas", ursprünglich zum Verkauf nach Rußland bestimmt, durch einen "unglücklichen Zufall" auf den Hamburger Markt (Kat. 162). In einem weiteren Katalog aus dem Jahr 1786 teilt das Titelblatt mit, daß der größte Teil der zur Auktion gelangten Gemälde "in Neapolis gesammelt worden" sei (Kat. 167). Der Katalog enthält allerdings selbst nur relativ wenige Gemälde der italienischen Schule des 17. und 18. Jahrhunderts. Im Jahre 1787 wird eine Sammlung "so aus einer hiesigen bekannten Verlassenschaft, auch theils aus der Fremde entstehen" (Kat. 174) veräußert. Immer mehr Sammlungen gelangten von auswärts auf den Hamburger Kunstmarkt, um auf der Börse verkauft zu werden. Ausdrücklich wird auf einem der Titelblätter hervorgehoben, daß es sich um eine Sammlung "zum Theil seltener, und von den entfernsten Orten her, aus vielen Cabinettern, Sammlungen und Auctionen ausgehobener und ausgesuchter Gemählde" handelt. Gemeint ist hier die bereits hervorgehobene Auktion mit insgesamt 756 Losnummern (Kat. 168). Von den insgesamt 335 versteigerten Gemälden der italienischen Schule in den 1780er Jahren stammten allein 126 Bilder aus dieser Auktion. Ein Anzeichen für den Import der Gemälde ist auch der prozentual geringer ausfallende Anteil von Gemälden der deutschen Schule. Erstmals
wurden bei einem Hamburger Katalog auch spanische Gemälde im Titelblatt mit aufgeführt (vgl. Kat. 270). In einem Auktionskatalog von 1787 (Kat. 174) ist eine kleine Anzahl von Gemälden der französischen Schule des 18. Jahrhunderts verzeichnet, darunter Werke von Charles Francois Lacroix, Baptiste Lallemand und Jean Baptiste Monnoyer. Die Gemälde stammten "aus der Fremde", wie es auf dem Titelblatt heißt. Immer mehr Kunstgegenstände scheinen in den folgenden Jahren aus französischem Privatbesitz in die Hansestadt gelangt zu sein. So wird auf einer 1788 durchgeführten Auktion eine vermutlich aus Frankreich nach Hamburg gebrachte Kupferstichsammlung veräußert (Kat. 184). Die Einträge sind überwiegend in französischer Sprache, auch die Schreibweise der Künstlernamen entspricht französischer Sprachregelung. Die wenigen auf dieser Auktion angebotenen Gemälde (42 Stück) stammen hingegen vermutlich aus einer anderen Sammlung. Auf einer weiteren Auktion in diesem Jahr wurden zwölf Gemälde der französischen Schule veräußert, darunter Gemälde von Francois Boucher, Benoit Coffre und zwei auf das Jahr 1771 datierte Bilder von Pierre Labartie. Zu vermuten ist, daß diese Gemälde zeitgenössischer Künstler von Emigranten aus Frankreich mitgebracht wurden. Im Revolutionsjahr 1789 fanden fünf Auktionen, ein Jahr später sechs Auktionen in Hamburg statt, die alle auf der Börse durchgeführt wurden. Auf drei Versteigerungen wurden in der Hauptsache Kupferstichsammlungen veräußert, die Gemälde bildeten hier nur einen Anhang (Kat. 190, 195 und 206). Bei vier Auktionen handelt es sich laut Titelblatt um die Veräußerungen von Nachlässen, in einem Fall ist der Name des Besitzers im Titelblatt genannt (der Maler Waerdigh). Im April 1789 wurde eine öffentliche Sammlung, die seit 100 Jahren auf dem Rathaus aufbewahrt gewesen war, versteigert (Kat. 189).212
Leipzig Neben der Hennewarthischen Kunsthandlung, die Johann Hennewarth (gest. 1775) leitete, war Carl Christian Heinrich Rost (17411798) der wichtigste Kunsthändler der Stadt. Ihm folgten Johann August Weigel (1773-1846) und Carl Gustav Boerner (1790-1855), der seit 1826 im Auktionsgeschäft tätig war. 213 In Leipzig fanden auch in den 80er und 90er Jahren des 18. Jahrhunderts Auktionen von Bibliotheken und Kupferstichsammlungen statt, in denen u.a. auch kleine Bestände von Gemälden verkauft wurden. Mit Beginn der regelmäßig angesetzten Auktionen der Kunsthandlung Rost nahmen vermutlich die übrigen Auktionen ab. Im Jahre 1783 fand die erste Auktion der Rostschen Kunsthandlung in Leipzig unter der Leitung des "Universitäts-Proclamatore C. G. Weigel" statt. Die Rostsche Kunsthandlung wurde geleitet durch Carl Christian Heinrich Rost und lag in der Katharinenstraße, im Zentrum der Stadt. Von Beginn an war die Rostsche Kunstsammlung auf den Graphikhandel spezialisiert. In den Jahren 1796-1809 erschien in neun Bänden das Handbuch für Kunstliebhaber und Sammler über die vornehmsten Kupferstecher und ihre Werke. Daneben war Rost auch mit dem Vertrieb von Gipsabgüssen aus der Dresdener Antikensammlung beschäftigt; 1794 erschien ein umfangreiches Verzeichnis dieser Abgüsse. Trotz der Spezialisierung Rosts auf den Graphikhandel wurden auf den meisten Versteigerungen auch Gemälde zum Verkauf angeboten. Auf der ersten Auktion im Jahre 1783 waren es 100 Losnummern, auf der zweiten knapp 30 Nummern und auf der dritten Auktion im Jahre 1785 wieder über 100 Nummern. Diese Zahl sollte auch in den folgenden Jahren nicht weiter steigen. In den 1790er Jahren wurden auf den Jahresauktionen am Ende der Michaelismesse überhaupt keine Gemälde mehr verkauft. Rost bot seinen Kunden an, Auktionen größerer Sammlungen getrennt von den Jahresauktio-
212
Karl Koppmann, Die Gemäldegalerie auf dem alten Rathhause, in: Mitteilungen des Vereins für Hamburgische Geschichte 1 (1978), S. 124-126; D.B, Die Bildwerke im alten Rathause, in: Mitteilungen des Vereins für Hamburgische Geschichte 2 (1880), S. 2-6.
213
C.A.G., Buchhandlung Weigel 1797-1922. Bausteine zu einer Geschichte der Familie Weigel, ohne Ort und ohne Datum [vermutlich Leipzig 1922]; Dieter Gleisberg, Carl Gustav Boerner. Ein Kunsthändler der Biedermeierzeit, in: Leipziger Blätter, H. 24, 1990, S. 33-37.
36
nen durchzuführen. 214 Über die Herkunft der Gemälde wird der Käufer im Katalog nicht informiert; allerdings verweisen Initialen als Zwischenüberschriften auf einzelne Einlieferer. Auf der ersten Auktion der Kunsthandlung Rost (Kat. 148) wurden noch auffallend viele italienische Gemälde angeboten, darunter Werke von Giorgione, Bassano, Luca Giordano oder Giuseppe Nogari, die vermutlich aus einer geschlossenen Sammlung stammten. Auch finden wir hier Gemälde der älteren deutschen Schule, u.a. zwei Gemälde von Georg Flegel. Unter den deutschen Malern des 18. Jahrhunderts fallen Gemälde von Alexander Thiele und Georg Trautmann auf. Bereits ein Jahr später schränkte sich das Angebot sehr ein, vor allem Gemälde von Johann Christian Klengel, Johann Adam Fassauer und Justus Juncker wurden angeboten. Einige dieser Bilder wurden auf der dritten Auktion (Kat. 159) noch einmal offeriert. Zugleich versicherte Rost in seinem Vorwort, daß die "folgende schöne Sammlung von Gemählden [...] aus dem hinterlassenen Cabinette eines Kenners" stamme (Kat. 159, S. 160). Auffallend ist die große Anzahl von Landschaftsgemälden, allein drei Gemälde von Paul Brill wurden aufgeführt. In den beiden folgenden Auktionen (Kat. 169)215 wurde die Graphik des "Richterischen Cabinets" verkauft, im Anhang der zweiten Auktion wurden wiederum 50 Gemälde zum Verkauf angeboten. Die Gemälde stammten vermutlich aus drei verschiedenen Sammlungen, darunter wieder interessante Gemälde von italienischen Meistern. Dem Richterischen Kabinett folgte ein Jahr später der Verkauf der "von Hagenschen Kupferstich-Sammlung" (Kat. 176). Ein weiterer Teil der Hagenschen Sammlung wurde auf der sechsten Auktion angeboten (Kat. 187). Die Gemälde aus der Hagenschen Sammlung waren bereits zwei Jahre zuvor in Nürnberg versteigert worden (Kat. 164). Außer der Reihe fand im Anschluß an die Neujahrsauktion die Versteigerung einer separat aufgeführten Sammlung "von alten Kupferstichen, Handrissen und Mahlereyen" statt. Der Besitzer der Sammlung hatte aus eigenem Anlaß ein Verzeichnis drucken lassen (Kat. 177).
Nürnberg, Augsburg, München und Regensburg Im Jahre 1778 erschien Christoph Gottlieb von Murrs umfangreiche Beschreibung der vornehmsten Merkwürdigkeiten in des H. R. Reichs freyen Stadt Nürnberg. Murr gibt einen Überblick über die älteren Sammlungen in der Stadt sowie über den damaligen Kunsthandel. Als Gemäldesammlungen zählt er die folgenden Kollektionen auf: die Ebnerische Bibliothek mit Museum, die 1752 als öffentliche Stiftung entstanden war, das Praunsche Kunstkabinett, die Kunst- und Naturaliensammlung von Johann Georg Friedrich von Hagen, eine Sammlung von Gemälden "im weißen Pellerischen Vorschickungshause bey St. Aegidien", die "Volkamerische Naturalien= und Kunstsammlung" von Karl Forster, die Kunstsammlung von Johann Gustav Silberrad, die Dietzsche Kunstsammlung sowie die Gemäldesammlung von Friedrich Birkner, deren 806 Gemälde Murr vollständig auflistet. 216 Einzelne dieser umfangreichen Sammlungen, wie die Hagenschen Sammlungen oder das Praunsche Kabinett, wurden in der Folgezeit von den Erben verkauft. Im Jahre 1785 fand die Versteigerung der umfangreichen Gemäldesammlung Hagens in Nürnberg statt (Kat. 164); ein Jahr später wurde die Kupferstichsammlung angeboten, die jedoch dann erst im Januar 1788 von Rost in Leipzig veräußert wurde. Auch das Praunsche Kabinett wurde von den Erben verkauft, allerdings erst 1801. Murr verweist darauf, daß er bereits seit acht Jahren an einer ausführlichen französischen Beschreibung dieses
Kabinetts arbeite. 217 Unter den Kunsthandlungen, die auch Gemälde verkauften, nennt Murr die "Frau Lindnerinn", Johann Jakob Hermann Wild und den "Futteralmacher Kraft" 2 1 8 Auf der Hagenschen Auktion traten als Käufer u.a. der Nürnberger Händler Wild auf. Auch Frauenholz wird aufgeführt, der 1787 seine eigene Kunsthandlung in Nürnberg gegründet hat.
Das Zeitalter der Revolution Durch die uns bekannten Versteigerungskataloge sind für den Zeitraum von 1791 bis 1800 in Deutschland 87 Auktionen nachweisbar. Fast ein Drittel der für das 18. Jahrhundert belegten Auktionen fanden somit im letzten Jahrzehnt statt. Insgesamt wurden auf diesen Auktionen 14.679 Gemälde zum öffentlichen Verkauf angeboten, das sind 29,2 Prozent aller verkauften Gemälde. In Hamburg fanden davon 43 Auktionen statt, in Leipzig zwölf, in Frankfurt sieben und in Nürnberg und Köln jeweils drei Auktionen. Weitere Versteigerungen lassen sich in Berlin und Hannover nachweisen. Auf den zwölf Auktionen in Leipzig wurden insgesamt nur 935 Gemälde veräußert; dagegen gelangten auf den sieben Auktionen in Frankfurt 1.284 Gemälde zum Verkauf. Die Anzahl der in den 1790er Jahren in Hamburg auf Versteigerungen zum Verkauf gelangten Gemäldelose betrug 8.149. Insgesamt scheint der Anstieg der Auktionen in den 1790er Jahren und die allmähliche Konzentration auf Hamburg im wesentlichen durch die politischen Ereignisse in Frankreich und den südlichen Niederlanden sowie durch die Besetzung der Niederlande durch die französischen Truppen im Jahre 1795 beeinflußt worden zu sein. Mit Beginn der 1790er Jahre wurden immer öfter französische Privatsammlungen an Händler verkauft und gelangten im Ausland auf den Kunstmarkt. Auch flohen zahlreiche Holländer nach der Besetzung ihres Landes durch die Franzosen nach England. 219 Viele der aus Frankreich geflohenen Emigranten scheinen jedoch ihre Sammlungen - oder Teile davon - mit nach Deutschland genommen zu haben. So gelangte vermutlich die Sammlung des Hofrats Fran^oisXavier de Burtin, der in Brüssel für die österreichische Regierung tätig war, nach Braunschweig. Burtin war nach der Französischen Revolution nach Braunschweig geflohen. 220 Seine Sammlung scheint dann nach Brüssel zurückgebracht worden zu sein, wo sie 1819 zur Versteigerung kam (Lugt 9640); Restbestände wurden schließlich 1820 und 1822 in London verkauft (Lugt 9854 und 10281). Andere Sammlungen oder Gemälde wurden von deutschen Händlern direkt in Frankreich oder den südlichen Niederlanden erworben und als Kunstware auf den deutschen Markt nach Hamburg gebracht. In unmittelbaren Zusammenhang mit den politischen Ereignissen stand auch der Verkauf der Sammlung Carl II. August von der Pfalz. Dessen Sammlung wurde vor den französischen Truppen von Zweibrücken nach Mannheim in Sicherheit gebracht, um nach dem Tod des Herzogs (1795) zu einem Teil nach München transferiert, zum anderen Teil aber in Mannheim versteigert zu werden (Kat. 267). Das Auktionswesen in den rheinischen Städten Köln und Bonn, aber auch in Frankfurt wurde aufgrund der militärischen Operationen und durch die Besetzungen durch französische Truppen früh behindert. In Köln lassen sich für die 1790er Jahre drei gedruckte Auktionskataloge nachweisen. In Frankfurt fand 1790 eine Auktion statt, im darauffolgenden Jahr waren es schon vier Auktionen. Danach wurde erst wieder 1797 eine Auktion durchgeführt. Erstmals wurde Frankfurt in Hinsicht auf die Zahl der Auktionen von Leipzig übertroffen, wo bis 1795 kontinuierlich Versteigerungen durchgeführt wurden.
214
Vgl. Kat. 159, Vorwort, S. XHIf.
215
Erfaßt ist hier nur der 5. Katalog der Kunsthandlung Rost, da im 4. Katalog keine Gemälde enthalten sind.
216
Murr 1778, S. 460-550; vgl. auch Ausst.-Kat. Nürnberg 1994, S. 23.
217
Ebd., S. 461.
218
Ebd., S. 554-555.
219
Baumeister 1926/27, S. 217.
220
Fink 1954, S. 86: Es existiert ein kritischer Katalog von Burtin Uber das Kupferstichkabinett sowie ein Gutachten über die Galerie in Salzdahlum. Er tauschte Bilder der eigenen Galerie mit Gemälden aus Salzdahlum. Die Sammlung Burtin wird in einem gedruckten Katalog von 1808 beschrieben.
37
Wie Leipzig war auch Hamburg von den politischen Veränderungen bis zum Ende des Jahrhunderts nicht betroffen.
Hamburg Die wirtschaftliche Entwicklung in Hamburg wurde durch die politischen Ereignisse in Frankreich entscheidend mitgeprägt und beschleunigt. Schon seit langer Zeit war Frankreich der wichtigste Handelspartner Hamburgs, gefolgt für die Jahre 1789 bis 1791 von England, Holland, Spanien und Portugal, Amerika und Dänemark. Ein Drittel des französischen Exports wurde während der Französischen Revolution über Hamburg abgewickelt. Vor allem Luxusgüter konnten zu verhältnismäßig niedrigen Preisen in Frankreich erworben werden. 221 Der französische Markt war aufgrund niedriger Wechselkurse für ausländische Kapitalinteressen besonders lukrativ. So erteilte der Hamburger Kaufmann Georg Heinrich Sieveking einem Freund in Paris im Januar 1795 den Auftrag, für 50.000 bis 100.000 Louis d'or Luxuswaren zu erwerben. Ein Jahr später wurden neben Modewaren, Möbeln, Büchern auch Gemälde aus Rouen eingeführt. Insgesamt standen dem Hamburger Kaufmann Sieveking nahezu 6 Millionen Louis d'or für seine Ankäufe zur Verfügung. Begünstigt wurde dieses Exportgeschäft von der Annexion Hollands durch die französischen Armeen im Jahre 1795, so daß "Hollands Handel nach Hamburg über(siedelte)". 222 "Durch die Ausschaltung der holländischen Konkurrenz - 1795 wurde die Batavische Republik errichtet - entwickelte sich Hamburg binnen kurzem zum führenden kontinentalen Umschlagplatz und Finanzzentrum." 223 Aufschlußreich ist der Hinweis eines damaligen Hamburger Augenzeugen, der berichtet, daß "diese Luxuswaren [...] zumeist auf dem Börsensaal versteigert" wurden. 2 2 4 Dieser Exploit führte im Jahre 1799 zu einer Finanzkrise, die durch Spekulationen, Überproduktion und zu große Lagerhaltung verursacht worden war. Der politische Machtkampf zwischen Frankreich und England wirkte sich nun ebenfalls negativ auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung aus. 1806 wurden Hamburg und Köln von den Franzosen besetzt. Die seit Mitte der 1780er Jahre kontinuierlich ansteigende Zahl der reinen Kunst- und Gemäldeauktionen hielt auch in den 1790er Jahren an. Bemerkenswert ist dabei, daß die Zahl der Auktionen im Vergleich zu den anderen Messe- und Handelsstädten überdurchschnittlich zunahm. Hamburg stand mit Abstand an der Spitze des Auktionswesens in Deutschland. Hinzu kam eine große Zahl von Kupferstichsammlungen, die auf der Börse in Hamburg veräußert wurden. Wie bereits vermerkt, fanden im Revolutionsjahr fünf Gemäldeauktionen statt, ein Jahr später waren es sechs Auktionen. In den folgenden Jahren schwankte ihre Zahl zwischen drei bis sechs Auktionen pro Jahr. Dieser Stand konnte bis zum Jahre 1806 gehalten werden, aber auch nach der französischen Besetzung der Stadt fanden weiterhin jedes Jahr Kunstauktionen statt. Ein rein quantitativer Sprung ist für das Jahr 1794 festzustellen, in dem erstmals wieder über 1.000 Gemälde versteigert wurden. Die meisten Gemälde wurden zwei Jahre später auf sechs Auktionen veräußert, nämlich mehr als 1.300 Gemälde. Bei den zwischen 1791 und 1793 verauktionierten Sammlungen handelt es sich in vielen Fällen noch um Hamburger Privatsammlungen, die anläßlich des Todes ihres Besitzers zur Versteigerung gelangten. Meist wurde von einer "hiesigen Verlassenschaft" gesprochen (vgl. Kat. 220, 223, 227). Für das Jahr 1794 läßt sich besonders deutlich erkennen, daß Gemälde als bloße Handelswaren erworben und zum Weiterverkauf nach Hamburg gebracht wurden. So heißt es auf einem der Titelblätter: "Verzeichniß einer aus Braband eingesandte höchstseltene Gemählden=Sammlung [...]" (Kat. 245). Aus dem Ausland dürfte auch eine zweite Sammlung von Galerie- und Kabinett-Bildern stammen, "die im südlichen Theil Europas schon im sechzehnhunderten Seculi 221
Sieveking 1913, S. 370f.
222
Zit. nach ebd., S. 372.
223
Kopitzsch 1990, S. 183.
224
Vgl. Genius der Zeit: ein Journal, 1795, Nr. 6, S. 57.
38
meistens zusammengebracht worden" (Kat. 246). Im zuerst genannten Katalog überwiegt der Anteil der Gemälde der flämischen Schule und eine große Anzahl von nicht weiter namentlich aufgeführten Gemälden der italienischen Schule. Im zweiten Katalog sind vor allem Werke der italienischen und flämischen Schule verzeichnet. Am 17. und 18. Februar 1796 gelangte eine "ganz vortrefliche Sammlung italienischer, französischer und niederländischer Cabinets=Gemählde" zur Versteigerung auf die Börse. Erstmals nahmen in einer Versteigerung die Gemälde der französischen Schule den größten Anteil ein: Knapp 100 Gemälde von Malern des 17. und 18. Jahrhunderts waren vertreten, darunter Werke von Charles Francois Grenier de la Croix, Nicolas Guy Brenet oder Pierre Antoine Machy. Zwei Gemälde von Pierre Etienne Le Sueur aus dem Jahre 1793 stammten sozusagen direkt aus der Werkstatt des Künstlers. Auch in den folgenden Katalogen tauchten vermehrt Bilder französischer Künstler auf. In einem anderen Katalog aus dem Jahre 1796 wurden acht Gartenprospekte von Antoine Watteau zum Verkauf angeboten (Kat. 262). Insgesamt wurden im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts 338 Gemälde der französischen Schule auf den Hamburger Auktionen angeboten, ein immer noch geringer Anteil im Vergleich zu der italienischen Schule mit 519 Gemälden. Die Gemälde verteilten sich jedoch nicht gleichmäßig auf alle Versteigerungen, sondern waren auf wenige Auktionen beschränkt. Das breite Spektrum der angeführten Namen läßt darauf schließen, daß die Gemälde aus Frankreich auf den Hamburger Kunstmarkt gelangten und möglicherweise aus dem Kreis französischer Emigranten stammten. Bei den übrigen Katalogen ist es schwer, Aussagen über die Herkunft der veräußerten Gemälde zu machen. Zur Versteigerung kamen in der Regel Sammlungen mit bis zu 300 Gemälden. Die Kataloge geben jedoch keine Auskunft über die Herkunft der Sammlungen. Bis zur Besetzung durch die napoleonischen Truppen im Jahre 1806 konnte der Hamburger Kunstmarkt seine führende Stellung behaupten. Kataloge mit über 800 Nummern, summarisch aufgelisteten Einträgen ohne jede Information zu den Bildern, aber auch die niedrigen Preise sowie das Verschleudern ganzer Kupferstichsammlungen ließen das Auktionswesen bald in Verruf geraten. Aufgrund des nicht abreißenden Zustroms ganzer Sammlungen wurde auf Fragen der Zuschreibung häufig kein Wert mehr gelegt. Zu den wichtigsten Maklern gehörten weiterhin Peter Hinrich Packischefsky und Michael Bostelmann, aber auch der Kunsthändler Johann Noodt sollte eine immer größere Rolle spielen.
Frankfurt am Main In Frankfurt gelangten im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts vornehmlich Privatsammlungen auf den Markt. Im Jahre 1791 wurden die Sammlungen Bansa (Kat. 215), eine nicht weiter zu identifizierende Sammlung, von der sich nur das Protokoll erhalten hat (Kat. 217), und die Kollektion des Fabrikanten Johann Friedrich Müller (Kat. 219) verauktioniert. Diese Versteigerungen müssen in den lokalen Zeitungen angekündigt gewesen sein. Mannlich berichtet in seinen Memoiren, daß der Pfalzgraf Carl II. August "in einer Zeitung von einer Gemäldeversteigerung in Frankfurt" gelesen hatte. Mannlich mußte auf Weisung Carls nach Frankfurt reisen. Seine Beschreibungen geben ein eindrucksvolles Bild von der damaligen Situation: "Die Straßen waren dicht gedrängt von einer unabsehbaren Menge von Wagen mit französischen Edelleuten und ihren Familien. Sie trugen die beste Laune und eine seltene Anmaßung zur Schau, die man nicht bei obdachlosen Flüchtlingen zu finden vermeint. [...] In ihrer Flucht sahen sie nur einen vorübergehenden Besuch, mit dem sie das Ausland zu beehren geruhten [...]." 2 2 5 Mannlich erwarb auf der Versteigerung drei Gemälde für die herzogliche Galerie. 2 2 6
Die meisten der in den 70er und 80er Jahren des 18. Jahrhunderts in Frankfurt entstandenen oder übernommenen Sammlungen wurden spätestens im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts wieder verkauft, so die Sammlungen der Kaufleute Jacob Friedrich Ettling (1820)227 und Friedrich Wilhelm Hoynck (1801) 228 Wie in Hamburg wurden somit alle bedeutenden Frankfurter Sammlungen des 18. Jahrhunderts - abgesehen von wenigen Ausnahmen - in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wieder aufgelöst. Die seit den 90er Jahren auch öffentlich zu besichtigende Sammlung des Bankiers Johann Friedrich Städel (1728-1816) im "Goldenen Bär" am Roßmarkt wurde durch Bestrebungen ihres Gründers nicht veräußert und bildete den Grundstock für das "Städelsche Kulturinstitut".229 Köln In rascher Folge wurden in Köln noch vor der französischen Besetzung der Stadt im Jahre 1794 einzelne Sammlungen öffentlich versteigert. 1788 kündigte ein in Köln gedruckter Katalog der Sammlung des Duftwasserproduzenten Johann Anton Farina an, daß die Gemälde am 1. September 1788 im Stammsitz der Firma, im Haus Mayland, verkauft werden sollten (Kat. 182). Es folgten 1792 der Verkauf der Sammlungen Caspar Philip Kox (Kat. 226) und Moureaux (Kat. 229). Die Sammlung des Kanonikus Johann Matthias von Bors wurde nach dem Tode ihres Besitzers 1798 in Köln verauktioniert (Kat. 271). In Köln entwickelte sich im letzten Jahrzehnt des Jahrhunderts ein reger Kunstmarkt, der nur zu einem kleinen Teil in den Kunstauktionen spürbar wurde. Eine wichtige Rolle spielte hierbei Ferdinand Wallraf, der u.a. mit dem Baseler Kupferstecher und Händler Christian von Mechel, dem Bankier Herstatt oder dem Sammler Freiherr von Leykam 230 freundschaftlich verbunden war. Aus der Sammlung Bors wurde 1791 ein Familienbild der Familie Everhard III. Jabach von Le Brun nach Holland verkauft. Der Verkauf kam durch Mechel mit Hilfe Wallrafs zustande, der mit Bors eng befreundet war. Bors war 1778 in den Besitz des Jabacher Hofes in der Sternengasse gelangt, in dem sich neben dem Gemälde von Le Brun eine weitere Anzahl von Bildern aus dem ehemaligen Besitz Everhard III. Jabach und dessen Sohn Everhard IV. befunden hat. Der kennerschaftliche Blick Mechels hatte bei seinem Besuch noch andere Gemälde im Sinn, wie ein Schreiben an Wallraf zeigt: "Apropos, von dem Grümpel, der dann nun sicher aller veräußert wird, was ist noch gutes unter jenen Stücken? Sind die beeden Jagdstücke neben der Eingangsthür nicht von Weeninx? Was ist sonst noch gutes da? eine kl(eine) Liste mit den Preisen würde mich verbinden, oder wird es licitando verkauft? Es stunden und lagen die Menge im Saal auf dem Boden herum."231 Nürnberg und Würzburg Im Jahre 1787 begann Johann Friedrich Frauenholz (1758-1822) als Kunsthändler in Nürnberg tätig zu werden. Das eigene Geschäft befand sich im Hause Obstmarkt 1, seit 1794 in der Winklerstraße 3. Im Zentrum der kaufmännischen wie verlegerischen Arbeit stand der Handel mit Druckgraphik. Daneben war Frauenholz bedacht, Gemälde für sein Lager zu erwerben. Einen Teil seines Sortiments hatte er 1785 auf der Auktion der Sammlung Johann Georg von Hagen (Kat. 164) erwerben können. Seit 1791 führte Frauenholz regelmäßig Auktionen in Nürnberg durch, auf denen in der Hauptsache 225
jedoch Druckgraphik angeboten wurde. Auf den ersten Auktionen in den Jahren 1791 und 1792 kamen überhaupt keine Gemälde zum Verkauf, auf der vierten Auktion im Jahre 1793 nur ein einziges (Kat. 238). Auch in den folgenden Auktionen bis 1800 fehlten meist Gemälde, nur 1798 tauchten auf einer Aktion 25 Bilder auf (Kat. 258). Der Leipziger Kunsthändler Rost hat die "Nebenentstehung", wie er das Nürnberger Konkurrenzunternehmen genannt hat, keinesfalls mit "neidischen Blicken" beobachtet, vielmehr versicherte er: "Mit Vergnügen habe ich daher auch die Verzeichnisse des Herrn Frauenholz zu Nürnberg erhalten, und versichere auch diesem Unternehmer meinen herzlichen Wunsch für die nützliche Ausbreitung seines angefangenen guten Werkes." Sogleich bot sich Rost an, "die Aufträge meiner Freunde auch für diese Auctionen in Zukunft [zu] überneh„
„232
men. In den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts fanden weitere Auktionen in Nürnberg statt. Im Jahre 1793 wurde die Sammlung des Kunsthändlers Johann Jacob Hermann Wild verkauft. Der Katalog umfaßt 575 Nummern (Kat. 223); viele der Gemälde stammten aus der Sammlung Hagen. Am 1. August 1796 fand eine Bücherauktion statt, auf der auch einige Gemälde zum Verkauf standen (Kat. 258). Die Situation auf dem Kunstmarkt in Nürnberg beschreibt etwa Karl Ludwig von Knebel 1797, der berichtet, daß "in Nürnberg zahlreiche Gemälde zum Verkauf standen, weil viele in Nürnberg ansässige Familien ihren Kunstbesitz veräußerten."233 In der Zeit von 1796 bis 1800 war Nürnberg von französischen Truppen besetzt. Im Jahre 1801 wurde schließlich die Sammlung Praun von Frauenholz für 36.000 Gulden vollständig übernommen. Erst 1797 war der lange angekündigte Katalog der Sammlung, abgefaßt von dem Kunstgelehrten Christoph Gottlieb Murr, erschienen: "Description du Cabinet de Monsieur Praun ä Nuremberg". Der Katalog diente als "Inventar für den Kaufvertrag", der am 20. April 1801 abgeschlossen wurde.234 Die Graphik, Teile der Zeichnungssammlung, Manuskripte und Bücher wurden bereits im Februar 1802 von Frauenholz in Wien versteigert. Im Jahre 1804 erwarb Fürst Miklos Esterhäzy Zeichnungen und Gemälde für seine Sammlung, die sich heute überwiegend im Museum für Bildende Künste in Budapest befinden. Die Gemälde sind zum Teil in Nürnberg geblieben. 1804 erschien in der laufenden Folge der Kataloge als Nr. 10 ein Katalog der Praunschen Zeichnungen und Gemälde, die sich in der Kunsthandlung befanden. Der Verkauf der Praunschen Sammlung vollzog sich jedoch nur sehr schleppend. Im Jahre 1811 veranstaltete Frauenholz sogar eine Lotterie, um das Interesse an der Sammlung zu 235
steigern. In den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts wurden auch in den anderen süddeutschen Städten private Gemäldesammlungen aufgelöst. In Würzburg stand die Sammlung des Geheimrates, Kreisgesandten und Hofkammerdirektors Anton Hartmann, dem Schwiegersohn Balthasar Neumanns, zum Verkauf. Einige der Bilder, so beispielsweise Mucius Scaevola vor Porsenna und Coriolan vor den Mauern Roms von Giovanni Battista Tiepolo, stammten vermutlich aus der Sammlung von Balthasar Neumann (Kat. 279). In Freiburg im Breisgau mußte die Kollektion von Heinrich Graf von Kageneck verkauft werden (Kat. 239), da dessen Witwe in Finanzschwierigkeiten geraten war.
Mannlich 1910, S. 410.
226
Um welche Versteigerung es sich handelte, ließ sich nicht erschließen; vgl. Mannlich 1910, S. 412.
227
Beutler 1949, S. XXIX.
228
Schmidt 1960 o.P.
229
Hans-Joachim Ziemke, Das Städelsche Kunstinstitut - die Geschichte einer Stiftung, Frankfurt am Main 1980; Ausst.-Kat. Frankfurt 1991, S. 11-13.
230
Leykam war der Schwiegersohn des Stimmeisters Everhard Zum Pütz, einem Erben des ehem. Jabachschen Besitzes in Köln.
231
Zit. Baumeister 1926/27, S. 214.
232
Vorwort zu Kat. 222.
233
Zit. nach Luther 1988, S. 71.
234
Ebd., S. 72f.
235
Rainer Schoch, "Die kostbarste unter allen nümbergischen Kunstkammem." Glanz und Ende des Praunschen Kabinetts, in: Ausst.-Kat. Nürnberg 1994, S. 25-34, bes. S. 32.
39
Leipzig In Leipzig führte der Kunsthändler Rost seine Kunstauktionen bis 1795 im "Roten Collegio" mit Hilfe des Universitätsproklamators Weigel regelmäßig durch. In jeder graphischen Auktion tauchten auch einige Gemälde auf, die meist von verschiedenen Einlieferern stammten. In manchen Katalogen verweisen Initialen in den Überschriften auf die einliefernden Besitzer. Von dem Ratsproklamator Christian Friedrich Hecht wurde die Kunstsammlung des sächsischen Landkammerrats Karl Friedrich von Sternbach, in der sich jedoch nur elf Gemälde befanden (Kat. 199), verauktioniert, sowie die Sammlung des Dresdener Hofmalers Christian Wilhelm Ernst Dietrich mit 76 Gemälden (Kat. 213). Anläßlich der Versteigerung des "Huberschen Cabinets" erschien in der Reihe der Rostschen Kataloge auch ein Katalog mit einem französischen Titelblatt und einer entsprechenden Einleitung (Kat. 197). Im Anhang wurde nur ein einziges Gemälde von Antoine Pesne angeboten. Im selben Jahr fand im Oktober eine weitere Auktion mit knapp 50 Nummern für die Gemälde statt. Die obligatorische Frühjahrsauktion verzeichnete wiederum nur zehn Gemälde. Auf den folgenden Auktionen (Kat. 222 und 233) stieg die Anzahl der Gemälde wieder auf über 100 Losnummern an. Viele der angebotenen Gemälde waren schon auf den vorausgegangenen Auktionen offeriert worden. Auch aus anderen Städten in der Umgebung, wie etwa Dresden, wurden Sammlungen nach Leipzig gebracht, um sie hier zu verkaufen, so 1791 die Sammlung des Malers Christian Wilhelm Ernst Dietrich (Kat. 213). Die Sammlung des Akademiedirektors Adam Friedrich Oeser wurde im Januar 1800 in Leipzig versteigert (Kat. 290). Die beiden wirklich bedeutenden Sammlungen Winckler und Richter standen erst am Anfang des 19. Jahrhunderts zur Disposition. Wie auch in Frankfurt, Hamburg und Köln setzten sich die Aktivitäten auf dem Leipziger Kunstmarkt am Anfang des 19. Jahrhunderts fort, und viele Sammlungen, die im 18. Jahrhundert entstanden waren, wurden in dieser Zeit wieder aufgelöst. Im Kunstauktionswesen läßt sich trotz der politischen Umwälzungen und der französischen Besatzung in weiten Teilen des Landes eine Kontinuität feststellen, die Voraussetzung für die Expansion des Kunstmarkts im deutschsprachigen Raum während des 19. Jahrhunderts gewesen ist. Hamburg bewahrte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts seine herausragende Stelle im Auktionswesen. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts trat Berlin als der wohl wichtigste Kunsthandelsplatz hervor.
40
Hinweise zur Benutzung der Verzeichnisse
Verzeichnis der Kataloge
Verzeichnis der Gemälde nach Künstlern
In diesem Abschnitt sind alle bekannten, vor 1800 erschienenen Versteigerungskataloge aufgeführt, sofern sie Gemälde enthalten und sich wenigstens ein Exemplar oder ein Verkaufsprotokoll erhalten hat. Es wurden auch einige Kataloge aufgenommen, deren einziges erhaltenes Exemplar in jüngster Zeit verloren ging oder zerstört wurde, die aber in Frits Lugts Repertoire des catalogues de ventes (1938ff.) oder in anderen Quellen erwähnt sind. Die Kataloge sind in chronologischer Folge verzeichnet; maßgeblich ist der erste Tag der Versteigerung. Wurde die Auktion verschoben, haben wir den Katalog unter dem Datum eingeordnet, an dem der Verkauf tatsächlich stattfand. Bei unvollständigen Datumsangaben wurden die Kataloge an den Anfang des angegebenen Monats oder Jahres gestellt. Die Einträge enthalten die Namen der Personen, die für die Durchführung der Versteigerung verantwortlich waren. Die Namen der Verkäufer können auf vier verschiedene Weisen angegeben werden: erstens so, wie der Name auf dem Titelblatt erscheint; zweitens so, wie ihn der Auktionator handschriftlich vermerkte, falls ein solches annotiertes Exemplar vorhanden ist; drittens durch Übernahme einer Schreibweise aus anderen Quellen, bei denen es sich meist um handschriftliche Notizen in verschiedenen Exemplaren handelt (eine weniger verläßliche Quelle); viertens in der standardisierten Form unserer Namensansetzung, was die umfassendste und verläßlichste Namensangabe darstellt. Die Kommentare am Ende der Einträge enthalten Informationen zur Identifizierung des Verkäufers und geben einen allgemeinen Überblick über Aufbau und Geschichte der betreffenden Sammlung. Die Anzahl der Lose, die Gemälde enthalten, gibt Aufschluß über die Größe des Verkaufs. Sie stimmt nicht immer mit der Anzahl der angebotenen Gemälde überein, da manche Lose mehr als ein Gemälde enthalten. Als "Gemälde" wurden alle Werke aufgenommen, die in Öl auf Leinwand, Holz, Glas, Metall oder Papier ausgeführt wurden. Die Kategorie umfaßt außerdem Malereien in Tempera, nicht aber in Wasserfarben und Gouache. Pastelle wurden ebensowenig berücksichtigt wie Emails. Portraitminiaturen und Miniaturkopien nach größeren Gemälden wurden ausgeschlossen, nicht jedoch Gemälde, die einfach nur ein besonders kleines Format aufweisen. Es folgt die Angabe aller bekannten erhaltenen Exemplare des Katalogs, wobei die wichtigsten Exemplare zuerst genannt werden. Am Anfang der Liste erscheinen die am vollständigsten annotierten Kataloge, am Ende die Exemplare, die die wenigsten oder keine handschriftlichen Eintragungen enthalten. Eine Liste der für die Angabe der Exemplare verwendeten Sigel findet sich auf Seite 48 ff. Exemplare, aus denen Preisangaben in den Datenbestand übernommen wurden, sind durch ein Sternchen (*) gekennzeichnet. In der Regel wurden ein oder zwei Exemplare, die am verläßlichsten schienen, herangezogen, da die Annotationen in den einzelnen Exemplaren sich oft widersprechen.
In dieser Abteilung werden, geordnet nach Künstlernamen, alle Gemälde aufgeführt, die in den ausgewerteten Katalogen verzeichnet sind. Angegeben werden das Datum, an dem das Gemälde verkauft wurde, gefolgt von einem Sigel, das sich aus Abkürzungen des Verkaufsortes (die ersten beiden Buchstaben) und des Auktionators (dritter bis fünfter Buchstabe) sowie aus der Losnummer zusammensetzt. Viele Versteigerungen fanden an mehreren Tagen statt. Wenn der Tag bekannt ist, an dem das betreffende Los verkauft wurde, geben wir diesen, nicht den ersten Tag der Versteigerung an. Wenn das genaue Datum des Verkaufs nicht bekannt ist oder sich die Versteigerung über einen langen Zeitraum erstreckte, fügen wir ein Pluszeichen (+) bei, was bedeutet, daß das Gemälde möglicherweise lange nach dem angegebenen Termin verkauft wurde. Die in den Sigel verwendeten Abkürzungen für die Städte und Auktionatoren sind auf Seite 48 ff. aufgelöst. Da viele Lose mehr als ein Gemälde betreffen, war es oftmals notwendig, sie aufzuteilen. Dies geschah, wenn die Gemälde von unterschiedlichen Künstlern stammten, in den Maßen oder Formaten nicht übereinstimmten, getrennte Preise erzielten oder von unterschiedlichen Käufern erworben wurden. Der Losnummer folgt dann zur Unterscheidung ein Buchstabe in eckigen Klammern, z.B. 0024[a]. Im Katalog handschriftlich hinzugefügte Lose sind durch ein [M] für "Manuskript" gekennzeichnet. Es folgen die Namen der Künstler, wie sie im Katalog angegeben sind, sowie die vollständigen Titel der Gemälde. Wir haben versucht, den Künstler zu identifizieren, den der Verfasser des Katalogs nach unserer Auffassung meinte; es muß dies nicht notwendig auch der tatsächliche Urheber des Gemäldes sein. So kann man beispielsweise annehmen, daß eine E. (also Eglon) van der Neer zugeschriebene Landschaft im Mondschein tatsächlich von Aert van der Neer stammt, da Eglon keine Mondscheinlandschaften gemalt hat. Solche Irrtümer haben wir nicht korrigiert. Wenn dagegen als Autor der Mondscheinlandschaft R. van der Neer angegeben wäre, also ein Künstler, den es nicht gegeben hat, gehen wir davon aus, daß es sich um einen Druckfehler handelt, und verzeichnen das Gemälde unter Aert van der Neer, nicht unter R. van der Neer. Die einzige Ausnahme von dieser Regel ist David Teniers, dessen Bilder im 17. und 18. Jahrhundert gemeinhin zwischen David Teniers dem Älteren und David Teniers dem Jüngeren aufgeteilt wurden. Wir haben sie insgesamt unter David Teniers dem Jüngeren verzeichnet.
41
Beispiel eines Eintrags mit Erläuterungen Heist, Bartholomew van der 1790/08/13
HBBMN 0003
B. van der Heist, 16581 Ein Hol-
länder in schwarzer Kleidung sitzt am Tische, und hält mit der Linken ein auf demselben liegendes Papier; hinten wird man durch eine Oefnung ein See=Prospect gewahr. Das Gegenstück: Dessen Frau, in einem Lehnstuhl sitzend, ist im Begrif, einen kleinen Hund, der sich vor ihr befindet, aufzuheben; hinten gleichfalls eine Oefnung mit einem See=Prospect. Zwey besonders schöne Gemähide. Auf 10
Leinw. schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Dessen Frau, in einem Lehnstuhl sitzend, ist im Begrif, einen kleinen Hund, 11 der sich vor ihr befindet, aufzuheben; Pendant zu Nr. 2 Annotat.: 12
13
14
Hintergrund von Backkuysen (KH I) Mat.: auf Leinwand Format: 15
16
Hochformat Maße: Hoch 55 Zoll, breit 45 Zoll Inschr.: 1658 (da17
tiert?) Anm.: Die Lose 2 und 3 wurden zusammen katalogisiert. Es 18 ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Waerdigh 19
20
21
Transakt.: Verkauft (25 Μ für die Nrn. 2 und 3) Käufer: Eckhardt
Dem Titel folgen, jeweils durch einen senkrechten Strich getrennt, die Angaben handschriftlicher Annotationen, des Materials, des Formats, der Maße und der Inschriften sowie unsere Anmerkungen. Soweit bekannt, haben wir auch den gegenwärtigen Aufbewahrungsort angegeben. Allerdings konnte bislang nur ein kleiner Anteil der Standorte ermittelt werden. In der vorletzten Spalte erscheinen, sofern sie bekannt sind, die Namen der Verkäufer. Sie stammen aus den gedruckten Katalogen oder handschriftlichen Anmerkungen und werden genau in der Form wiedergegeben, in der sie dort erscheinen. Der vollständige Name und einige biographische Informationen finden sich im Besitzerindex am Ende des dritten Bandes. Es folgt die Kennzeichnung der Transaktion als "verkauft", "nicht verkauft", "zurückgezogen" oder "unbekannt", dann der Preis, wenn er bekannt ist. Wie bereits erwähnt, wurde die Preisangabe immer nur aus den Katalogen entnommen, die uns am verläßlichsten erschienen; sie kann in Widerspruch zu den Preisangaben in anderen Katalogen stehen. Die letzte Spalte enthält schließlich, sofern bekannt, den Namen des Käufers, der fast immer aus handschriftlichen Eintragungen stammt. Wie bei den Verkäufern wird der Name des Käufers unverändert wiedergegeben. Der vollständige Name ist im Besitzerindex am Ende des dritten Bandes nachzuschlagen.
Index der Besitzer
22
[mit] Β Gegenw. Standort: Bruxelles, Belgique. Musees royaux des Beaux-Arts de Belgique. (2942) 1. Künstler 2. Jahr 3. Monat 4. Tag 5. Sigel für den Ort der Versteigerung 6. Sigel für den Auktionator 7. Losnummer 8. Künstler nach dem Katalogeintrag 9. Bildtitel 10. Zusatz zum Bildtitel 11. Handschriftliche Annotation 12. Quelle der Annotation 13. Material 14. Format 15. Maße 16. Inschrift 17. Anmerkungen 18. Verkäufer 19. Transaktion 20. Preis 21. Käufer 22. Gegenwärtiger Standort
42
In diesem Abschnitt werden die Namen aller Käufer und Verkäufer in einer gemeinsamen Liste zusammengestellt und so weit wie möglich vereinheitlicht und vervollständigt. Teilweise sind auch die Lebensdaten und einige kurze biographische Informationen angegeben. Abweichende Schreibweisen, die im Verzeichnis der Gemälde verwendet werden, sind als Verweise aufgenommen.
Index der Vorbesitzer In dieser Liste werden alle Fälle verzeichnet, bei denen der Name eines früheren Besitzers bekannt ist, sei es durch den Titel des Gemäldes, durch eine handschriftliche Anmerkung oder eine andere Quelle. Wir haben die letztgenannten Fälle, bei denen die Information über den Vorbesitzer nicht im Gemäldeverzeichnis auftaucht, mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.
Literaturverzeichnis
ADB
Ausst.-Kat. Nürnberg 1994
Allgemeine Deutsche Biographie, hg. von der Historischen Commission der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 56 Bde., Leipzig 1875-1912
Ausst.-Kat. Das Praunsche Kabinett. Kunst des Sammeins. Meisterwerke von Dürer bis Carracci, bearb. von Kathrin Achilles-Syndram und Rainer Schoch, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg 1994
Ausst.-Kat. Amsterdam 1992
Ausst.-Kat. Saarbrücken 1989
Ausst.-Kat. De wereld binnen handbereik. Nederlandse kunst- en rariteitenverzamelingen 1585-1735, Amsterdams Historisch Museum 1992, Amsterdam 1992
Ausst.-Kat. Kunstschätze aus Schloß Carlsberg. Die Sammlungen der Herzöge von Pfalz-Zweibrücken, hg. von Ernst-Gerhard Güse, Saarland Museum, Saarbrücken 1989
Ausst.-Kat. Braunschweig 1983
Ausst.-Kat. Schloß Clemenswerth 1987
Ausst.-Kat. Herzog Anton Ulrich von Braunschweig. Leben und Regieren mit der Kunst. Zum 350. Geburtstag am 4. Oktober 1983, bearb. von Rüdiger Klessmann, Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig 1983
Ausst.-Kat. Clemens August, Fürstbischof, Jagdherr, Mäzen. Katalog zu einer kulturhistorischen Ausstellung des 250jährigen Jubiläums von Schloß Clemenswerth, hg. vom Landkreis Emsland, Meppen/Sögel 1987
Ausst.-Kat. Köln 1995
Baumeister 1926/27
Ausst.-Kat. Lust und Verlust. Kölner Sammler zwischen Trikolore und Preußenadler, hg. von Hiltrud Kier und Frank Günter Zehnder, Leipzig 1995
Wilhelm Baumeister, Zur Geschichte des Le Brunschen Jabachbildes, in: Wallraf-Richartz-Jahrbuch 3 und 4 (1926/27), S. 211-221
Berckenhagen 1967 Ausst.-Kat. Frankfurt 1988 Ausst.-Kat. Bürgerliche Sammlungen in Frankfurt 1700-1830, bearb. von Viktoria Schmidt Linsenhoff, Kurt Wettengl, Historisches Museum, Frankfurt 1988
Ausst.-Kat. Frankfurt 1991 Ausst.-Kat. Brücke zwischen den Völkern - Zur Geschichte der Frankfurter Messe, Bd. 3: Ausstellung zur Geschichte der Frankfurter Messe, hg. von Patricia Stahl unter Mitarbeit von Roland Hoede und Dieter Skala, Frankfurt 1991
Ausst.-Kat. Hannover 1991 Ausst.-Kat. Venedigs Ruhm im Norden. Die großen venezianischen Maler des 18. Jahrhunderts, ihre Auftraggeber und ihre Sammler, hg. von Meinolf Trudzinski und Bernd Schälicke, Niedersächsisches Landesmuseum Hannover/Kunstmuseum Düsseldorf am Ehrenhof, Hannover 1991
Ekhart Berckenhagen, Anton Graff. Leben und Werk, Berlin 1967
Beutler 1949 Bilder aus dem Frankfurter Goethe Museum, hg. von Ernst Beutler und Josefine Rumpf, Frankfurt a. Main 1949
Bott 1989 Katharina Bott, La mia galleria Pommersfeidiana. Die Geschichte der Gemäldesammlung des Lothar Franz von Schönborn, in: Ausst.Kat. Die Grafen von Schönbom. Kirchenfürsten, Sammler, Mäzene, hg. von Gerhard Bott, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg 1989, S.112-128
Calov 1969 Gudrun Calov, Museen und Sammler des 19. Jahrhunderts in Deutschland, Berlin 1969 (Museumskunde 1969)
Colshorn 1968 Ausst.-Kat. Prag 1993 Ausst.-Kat. Artis Pictoriae Amatores, hg. von Lubomir Slavicek, Närodni Galerie, Prag 1993
Hermann Colshom, Vom Kunsthandel in Hamburg. Ein geschichtlicher Rückblick, in: Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel (Frankfurter Ausgabe), 1968, S. 3197-3207
Ausst.-Kat. Nürnberg 1989
Colshorn 1980
Ausst.-Kat. Die Grafen von Schönbom. Kirchenfürsten, Sammler, Mäzene, hg. von Gerhard Bott, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg 1989
Vom Kunsthandel in Hamburg IV: Die Kunsthändler seit 1842, in: Aus dem Antiquariat. Beilage zum Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel (Frankfurter Ausgabe), 1980, S. A 257-A 262 43
Cremer 1989
Gürsching 1949
Claudia Susannah Cremer, Hagedorns Geschmack. Studien zur Kunstkennerschaft in Deutschland im 18. Jahrhundert, Bonn 1989 (Phil. Diss)
Heinrich Gürsching, Nürnberg und der Stahlstich, in: Mitteilungen des Vereins für die Stadt Nürnberg 4 0 (1949), S. 2 0 7 - 2 3 5
Dietz 1910/25 Alexander Dietz, Frankfurter Handelsgeschichte, 4 Bde., Frankfurt am Main 1 9 1 0 - 1 9 2 5 , Reprint 1970
Dürr 1879 Alphons Dürr, Adam Friedrich Oeser. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte des 18. Jahrhunderts, Leipzig 1879
Gwinner 11862 und II 1867 Friedrich Gwinner, Kunst und Künstler in Frankfurt am Main vom dreizehnten Jahrhundert bis zur Eröffnung des Städel'sehen Kunstinstituts, 2 Bde., Frankfurt a.M. 1862/67
Hamburgische Künstlernachrichten 1794 Hamburgische Künstlernachrichten. Supplemente zu Füessli's Künstlerlexicon, Hamburg 1794
Eckhardt 1986 Götz Eckhardt, Die Gemälde in der Bildergalerie in Sanssouci, Potsdam 1986
Fechner 1998 Jörg-Ulrich Fechner, Bücher unterm Hammer. Eine auktionsgeschichtliche Einführung in den Verkaufskatalog der Brockes-Bibliothek, in: Hans-Georg Kemper, Uwe-K. Ketelsen und Carsten Zelle (Hg.), Barthold Heinrich Brockes ( 1 6 8 0 - 1 7 4 7 ) im Spiegel seiner Bibliothek und Bildergalerie, 2 Bde., Wiesbaden 1998 (Wolfenbütteler Forschungen 80), S. 6 3 - 8 1
Fink 1954 August Fink, Geschichte des Herzog-Anton-Ulrich-Museums in Braunschweig, Braunschweig 1954
Hampe 1904 Theodor Hampe, Kunstfreunde im alten Nürnberg und ihre Sammlungen, in: Mitteilungen des Vereins für die Stadt Nürnberg 16 (1904), S. 5 7 - 1 2 4
Hausmanns 1989 Barbara Hausmanns, Das Jagdschloß Herzogsfreude in Bonn-Röttgen ( 1 7 5 3 - 1 7 6 1 ) : eine baumonographische Untersuchung zum letzten Schloßbau des Kurfürsten Clemens August von Köln, Bonn 1989
Heckmann 1990 Hermann Heckmann, Barock und Rokoko in Hamburg. Baukunst des Bürgertums, Stuttgart 1990
Förster 1931 Otto H. Förster, Kölner Kunstsammler vom Mittelalter bis zum Ende des bürgerlichen Zeitalters. Ein Beitrag zu Grundfragen der neueren Kunstgeschichte, Berlin 1931
Friederichs/Wiegel 1953 Heinz F. Friederichs und Paul Wiegel, Der Frankfurter Kunstfreund Ehrenreich und seine Familie. Richtigstellung eines Irrtums der Goethe-Forschung, Frankfurt am Main 1953 (Forschungen zur hessischen Familien- und Heimatkunde 5)
Frimmel 1913/14 Theodor von Frimmel, Lexikon der Wiener Gemäldesammlungen, 2 Bde., München 1 9 1 3 - 1 9 1 4
Frimmel 1892 Theodor von Frimmel, Zur Geschichte der Wrschowetz'schen Gemälde-Sammlung in Prag, in: Mitteilungen der k.k. Zentral Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale, N.F. 17 (1892), S. 2 2 - 2 6
Gerkens 1974 Gerhard Gerkens, Das fürstliche Lustschloß Salzdahlum und sein Erbauer Herzog Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel, Braunschweig 1974 (Quellen und Forschungen zur Braunschweigischen Geschichte 2 2 )
Gerson 1942 Horst Gerson, Ausbreitung und Nachwirkung der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts, Haarlem 1942
Hess 1796 Jonas Ludwig von Hess, Hamburg topographisch, politisch und historisch beschrieben, Hamburg 1796 (2. Auflage)
Hirsching 1786/92 Nachrichten von sehenswürdigen Gemälde- und Kupferstichsammlungen. Münz- Gemmen- Kunst und Naturalienkabineten, Sammlungen von Modellen, Maschinen, physikalischen und mathematischen Instrumenten, anatomischen Präparaten und botanischen Gärten in Teutschland nach alphabetischer Ordnung der Städte, hg. von Friedrich Karl Gottlob Hirsching, Erlangen 1 7 8 6 - 1 7 9 2
Hoet/Terwesten 1752/70 Gerard Hoet/Peter Terwesten, Catalogus of Naamlyst van Schilderyen, met derzelver Pryzen. Zedert een langen reeks van Jaaren zoo in Holland als op andere Piaatzen in het openhaar verkogt, 3 Bde., s'Gra venhage 1 7 5 2 - 1 7 7 0
Hofstede de Groot 1907/27 C. Comelis Hofstede de Groot, A Catalogue Rai sonne of the Works of the Most Eminent Dutch Painters of the Seventeenth Century, 8 Bde., London 1 9 0 7 - 2 7
Hoist 1931 Niels von Hoist, Frankfurter Kunst- und Wunderkammern des 18. Jahrhunderts, ihre Eigenart und ihre Bestände, in: Repertorium für Kunstwissenschaft 52 (1931), S. 3 4 - 5 8
Goethe, Dichtung und Wahrheit, 1986
Holst 1934
Johann Wolfgang von Goethe, Aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit, hg. von Klaus-Detlef Müller, Frankfurt a.M. 1986 (Sämtliche Werke, I. Abteilung, Bd. 14)
Niels von Holst, Danziger Kunstkabinette und Kunsthandelsbeziehungen im 18. Jahrhundert, in: Mitteilungen des Westpreußischen Geschichtsvereins 33 (1934), S. 5 9 - 6 9
44
Holst 1931
Klyher 1729
Niels von Holst, Beiträge zur Geschichte des Sammlertums und des Kunsthandels in Hamburg von 1700 bis 1840, in: Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte 38 (1939), S. 253-288
Johann Anton Klyher, Ausführliche und gruendliche Specification deren kunstreich, kostbahren und sehenswuerdigen Gemaehlden, welche auf der Schilderey-Cammer der ... Residenz Wilhelms-Burg zu Weimar anzutreffen sind, Weimar 1729
Holst 1960 Niels von Holst, Künstler, Sammler, Publikum. Ein Buch für Kunstund Museumsfreunde, Darmstadt 1960
Höffner 1992 Corinna Höffner, Frankfurter Privatsammlungen. Stifter und Bestände - Eigenart und Umfang, Wissenschaftliche Hausarbeit (masch.), Frankfurt 1992
Kopitzsch 1990 Franklin Kopitzsch, Grundzüge einer Sozialgeschichte der Aufklärung in Hamburg und Altona, 2 Bde., Hamburg 1990 (Beiträge zur Geschichte Hamburgs 21)
Kreuchauf 1768 [Franz W. Kreuchauf], Historische Erklaerungen der Gemaeide welche Herr Gottfried Winckler in Leipzig gesammelt, Leipzig 1768
Hüsgen 1780 Heinrich Sebastian Hüsgen, Nachrichten von Frankfurter Künstlern und Kunst=Sachen enthaltend das Leben und die Wercke, aller hiesigen Mahler, Bildhauer, Kupfer= und Pettschier=Stecher, Edelstein=Schneider und Kunst=Gieser. Nebst einem Anhang von allem was in öffentlichen und Privat=Gebäuden, merckwürdiges von Kunst=Sachen zu sehen ist. Mitgeteilt und durch vieljährigen Fleiß gesammelt von Heinrich Sebastian Hüsgen, Frankfurt am Main 1780
Lappenberg 1847 Johann Martin Lappenberg, Selbstbiographie des Senator Barthold Heinrich Brockes, in: Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte 2 (1847), S. 167-229
Lauts 1980 Jan Lauts, Karoline Luise von Baden. Ein Lebensbild aus der Zeit der Aufklärung, Karlsruhe 1980
Hüsgen, Art. Magazin 1790
Lauts 1984
Heinrich Sebastian Hüsgen, Artistisches Magazin. Enthaltend das Leben und die Verzeichnisse der Werke hiesiger und anderer Künstler. Nebst einem Anhang von allem, was in öffentlichen und Privat=Gebäuden der Stadt Frankfurt Merkwürdiges von Kunstsachen, Naturalien=Sammlungen, Bibliotheken und Müntz-Cabinetten zu sehen ist. Wie auch einem Verzeichniß aller hiesigen Künstler Portraiten. Mit einer Menge historischer Nachrichten, so aus ächten OriginaI=QuelIen geschöpft sind. Von Heinrich Sebastian Hüsgen, Mitglied verschiedener patriotischer Gesellschaften, Frankfurt am Main 1790
Jan Lauts, Studien zum Kunstbesitz der Markgräfin Karoline Luise von Baden, in: Jahrbuch der staatlichen Kunstsammlungen in Baden-Württemberg 21 (1984), S. 108-136
Lexikon 1851/83 Lexikon der hamburgischen Schriftsteller bis zur Gegenwart, 8 Bde., Hamburg 1851-1883
Loh 1995
Heinrich Sebastian Hüsgen, Verrätherische Briefe von Historie und Kunst, Frankfurt am Main 1776/1783
Gerhard Loh, Verzeichnis der Kataloge von Buchauktionen und Privatbibliotheken aus dem deutschsprachigen Raum, Teil 1: 16071730, Leipzig 1995 (Internationale Bibliographie der Antiquariats-, Auktions- und Kunstkataloge, Sonderband 1)
Kemper 1998
Loh 1999
Hans-Georg Kemper, Uwe-K. Ketelsen und Carsten Zelle (Hg.), Barthold Heinrich Brockes (1680-1747) im Spiegel seiner Bibliothek und Bildergalerie, 2 Bde., Wiesbaden 1998 (Wolfenbütteler Forschungen 80)
Gerhard Loh, Verzeichnis der Kataloge von Buchauktionen und Privatbibliotheken aus dem deutschsprachigen Raum, Teil 2: 17311760, Leipzig 1999 (Internationale Bibliographie der Antiquariats-, Auktions- und Kunstkataloge, Sonderband 2)
Ketelsen 1997
Lugt 1938/87
Thomas Ketelsen, Barthold Heinrich Brockes' "irdisches Vergnügen" in Gemälden und Zeichnungen. Ein Beitrag zum Sammlungsund Auktionswesen im frühen 18. Jahrhundert, in: Das Achtzehnte Jahrhundert. Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für die Erforschung des Achtzehnten Jahrhunderts 21 (1997), S. 153-175
Frits Lugt, Repertoire des Catalogues de ventes publiques interessant l'art ou la curiosite, tableaux, dessins, estampes, miniatures, sculptures, 1600-1925, 4 Bde., Den Haag/Paris 1938-1987
Hüsgen, Verr. Briefe 1776/83
Kircher 1933 Gerda Kircher, Karoline Luise von Baden als Kunstsammlerin. Schilderungen und Dokumente zur Geschichte der Badischen Kunsthalle, Karlsruhe 1933
Klötzer 1994/96 Wolfgang Klötzer (Hg.), Frankfurter Biographien. Personengeschichtliches Lexikon. Im Auftrag der Historischen Kommission, bearbeitet von Sabine Hock und Reinhard Frost, 2 Bde., Frankfurt am Main 1994/96 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission XIX/1)
Luther 1988 Edith Luther, Johann Friedrich Frauenholz (1758-1822). Kunsthändler und Verleger in Nürnberg, Nürnberg 1988 (Schriftenreihe des Stadtarchivs Nürnberg 41)
Machytka 1987 Lubor Machytka, Zum Verkauf Waldsteinischer Bilder nach Dresden im Jahre 1741, in: Jahrbuch der staatlichen Kunstsammlungen Dresden 18 (1987), S. 67-73
Mannlich 1910 Johann Christian von Mannlich, Ein deutscher Maler und Hofmann, München 1910 45
Mayer 1994
Nicolai 1779
Bernd Μ. Mayer, Johann Rudolf Bys. Studien zu Leben und Werk, München 1994
Friedrich Nicolai, Beschreibung der Koeniglichen Residenzstaedte Berlin und Potsdam und aller daselbst befindlicher Merkwürdigkeiten: nebst Anzeige der jetztlebenden Gelehrten, Kuenstler und Musiker, und einer historischen Nachricht von allen Kuenstlern, welche vom dreyzehnten Jahrhunderte an, bis jetzt in Berlin gelebt haben, oder deren Kunstwerke daselbst befindlich sind, 2 Bde., Berlin 1779
Merck 1911 Johann Heinrich Mercks Briefe an die Herzogin-Mutter Anna Amalia und an den Herzog Carl August von Sachsen Weimar, hg. von Hans Gerhard Gräf, Leipzig 1911
Meusel Künstlerlexikon 1808/14 Johann Georg Meusel, Teutsches Künstlerlexikon oder Verzeichniss der jetztlebenden Teutschen Künstler. Nebst einem Verzeichniss sehenswürdiger Bibliotheken, Kunst-Münz- und Naturalienkabinete in Teutschland und in der Schweiz, 3 Bde., Lemgo 1 8 0 8 - 1 8 1 4 , Bd. 3, S. 417
Meyer 1801/1803 Friedrich Johann Lorenz Meyer, Skizzen zu einem Gemälde von Hamburg, 2 Bde., Hamburg 1 8 0 1 - 1 8 0 3
Möhlig 1993 Kornelia Möhlig, Die Gemäldegalerie des Kurfürsten Johann Wilhelm von der Pfalz-Neuburg ( 1 6 5 8 - 1 7 1 6 ) in Düsseldorf, Köln 1993
Miscellaneen 1779-1787 Miscellaneen artistischen Inhalts, hg. von Johann Georg Meusel, Erfurt 1 7 7 9 - 1 7 8 7
Murr 1778 Christoph Gottlieb von Murr, Beschreibung der vornehmsten Merkwürdigkeiten in des H. R. Reichs freyen Stadt Nürnberg und auf der hohen Schule zu Altdorf. Nebst einem chronologischen Verzeichnisse der von Deutschen, insonderheit Nürnbergern, erfundenen Künste, vom XIII Jahrhunderte bis auf jetzige Zeiten, Nürnberg 1778
Museum 1787-1792 Museum für Künstler und für Kunstliebhaber, hg. von Johann Georg Meusel, Mannheim 1 7 8 7 - 1 7 9 2
Nagel 1949 Friedrich August Nagel, Eine Gemäldeauktion im Jahre 1785, (maschinenschriftlich) Nürnberg 1949 [Exemplar in SBN]
NDB Neue Deutsche Biographie, hg. von der der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1953ff.
Neickelius 1727 C[aspar] F[riedrich] Neickelius, Museographia oder Anleitung zum rechten Begriff und nützlicher Anlegung der Museorum oder Raritäten-Kammern in beliebter Kürtze zusammen getragen, und curiösen Gemüthem dargestellet von C. F. Neickelio. Mit Zusätzen und dreyfachem Anhang vermehret von D. Johann Kanold, Leipzig/Breslau 1727
Nicolai 1769 Friedrich Nicolai, Beschreibung der Koeniglichen Residenzstaedte Berlin und Potsdam und aller daselbst befindlicher Merkwürdigkeiten, Berlin 1769
46
Nicolai 1786 Friedrich Nicolai, Beschreibung der Koeniglichen Residenzstaedte Berlin und Potsdam und aller daselbst befindlicher Merkwürdigkeiten, und der umliegenden Gegend, Berlin 1786
Oeser 1779 Adam Friedrich Oeser, Schreiben an Herren von Hagedorn, Churfürstlich Sächsischen geheimen Legationsrath und Generaldirektor der Akademien der bildenden Künste, in: Verzeichniß der Gemälde, welche sich in der Sammlung des verstorbenen Herrn Schwalbe in Hamburg befinden, nebst beygefügter Nachricht von deren Inhalte, Leipzig 1779
Quedenbaum 1977 Gerd Quedenbaum, Glücksspiel und Buchhandel. Die Bücher-Lotterien des 18. Jahrhunderts, Düsseldorf 1977
Plagemann 1995 Volker Plagemann, Kunstgeschichte der Stadt Hamburg, Hamburg 1995
Posse 1930 Hans Posse, Geschichte der Gemäldegalerie, in: ders., Die Staatliche Gemäldegalerie zu Dresden. Katalog der Alten Meister, Dresden/ Berlin 1930, S. I X - X X X
Rachel/Wallich 1967 Hugo Rachel/Paul Wallich, Berliner Großkaufleute und Kapitalisten, Bd. 2, Die Zeit des Merkantilismus, 1 6 4 8 - 1 8 0 6 , neu hg. von Johannes Schultze, Henry C. Wallich und Gerd Heinrich, Berlin 1967 (Veröffentlichungen des Vereins für Geschichte der Mark Brandenburg)
Rhode 1922 Alfred Rhode, Kunstsammlungen und Raritätenkammern Hamburgs im 17. und 18. Jahrhundert, in: Jahrbuch für Kunstsammler 2 (1922), S. 4 7 - 5 4
Richel 1929 Stadtbibliothek Frankfurt am Main. Katalog der Abteilung Frankfurt, Bd. 2. Literatur zur Familien und Personengeschichte, bearb. von Arthur Richel, Frankfurt 1929
Schmidt 1960 Ulrich Schmidt, Die privaten Kunstsammlungen in Frankfurt am Main von ihren Anfängen bis zur Ausbildung der reinen Kunstsammlung, Göttingen (Phil. Diss.) 1960
Schlögl 2001 Rudolf Schlögl, Geschmack und Interesse. Privater Bildbesitz in rheinisch-westfälischen Städten vom 18. Jahrhundert bis zum beginnenden 19. Jahrhundert, in: Hans-Ulrich Thamer (Hg.), Bürgertum und Kunst, Köln/Wien 2001, Drucklegung in Vorbereitung
Schönberger 1982
Uffenbach 1988
Guido Schönberger, Kunst und Kunstleben in Frankfurt am Main, in: Die Stadt Goethes. Frankfurt am Main im XVIII. Jahrhundert, hg. von Heinrich Voelcker, Frankfurt 1932, Reprint 1982, S. 2 8 9 324
Zacharias Konrad von Uffenbach, Merkwürdige Reisen durch Niedersachsen, Holland und Engelland, Frankfurt/Leipzig 1 7 5 3 - 1 7 5 4 , Nachdruck Hamburg 1988
Valter 1995 Schwemmer 1949 Wilhelm Schwemmer, Aus der Geschichte der Kunstsammlungen der Stadt Nürnberg, in: Mitteilungen des Vereins für die Stadt Nürnberg 40 (1949), S. 9 7 - 2 0 6
Seelig 1997 Georg Seelig, Eine Auktion "entbehrlicher Kunstsachen" durch die Berliner Akademie im Jahr 1800, in: Der Bär von Berlin 4 6 (1997), S. 27^10
Seidel 1892 Paul Seidel, Friedrich der Große als Sammler von Gemälden und Skulpturen, in: Jahrbuch der preußischen Kunstsammlungen 13 (1892), S. 1 8 3 - 2 1 2
Seidel 1894 Paul Seidel, Friedrich der Große als Sammler. Fortsetzung und Nachtrag, in: Jahrbuch der preußischen Kunstsammlungen 15 (1894), S. 4 8 - 5 7 und 8 1 - 9 3
Claudia Valter, Studien zu bürgerlichen Kunst- und Naturaliensammlungen des 17. und 18. Jahrhunderts in Deutschland, Aachen (Phil. Diss.) 1995
Veit 1924 Andreas Ludwig Veit, Mainzer Domherren vom Ende des 16. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts in Leben, Haus und Habe. Ein Beitrag zur Geschichte der Kultur der Geistlichkeit, Mainz 1924
Vey 1963 Horst Vey, Die Gemälde des Kurfürsten Clemens August, in: Wallraf-Richartz-Jahrbuch 20 (1963), S. 1 9 3 - 2 2 6
Vogel 1891 Julius Vogel, Leipziger Kunstsammlungen des vorigen Jahrhunderts, in: Zeitschrift für Bildende Kunst 2 (1891), S. 1 2 3 - 1 2 7 und 1 4 5 149
Weber 1987
Sieveking 1913
Wilhelm Weber, Schloß Karlsberg, Legende und Wirklichkeit. Die Wittelsbacher Schloßbauten im Herzogtum Pfalz-Zweibrücken, Homburg-Saarpfalz 1987
Georg Heinrich Sieveking, Lebensbild eines Hamburgischen Kaufmanns aus dem Zeitalter der französischen Revolution, Berlin 1913
Wiecker 1993
Slavicek 1995
Rolf Wiecker, Das Schicksal der Hagedomschen Gemäldesammlung, Kopenhagen/München 1993 (Phil. Diss. Hamburg)
Lubomir Slavicek, Delitae imaginum, oder Gemähide und BilderLust. Die Nostitz als Kunstsammler, in: Ausst.-Kat. Barocke Bilderlust. Holländische und flämische Gemälde der ehemaligen Sammlung Nostitz aus der Prager Nationalgalerie, bearb. von Lubomir Slavicek, Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig 1995, S. 8 25
Stübel 1912
Wilhelm 1990 Karl Wilhelm, Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Kunstauktionswesens in Deutschland vom 18. Jahrhundert bis 1945, München 1990
Winterling 1986
Moritz Stübel, Christian von Hagedorn. Ein Diplomat und Sammler des 18. Jahrhunderts, Leipzig 1912
Aloys Winterling, Der Hof der Kurfürsten von Köln, 1688-1774. Eine Fallstudie zur Bedeutung "absolutistischer" Hofhaltung, Bonn 1986
Tenner 1966
Winterling 1990
Helmut Tenner, Mannheimer Kunstsammler und Kunsthändler bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, Heidelberg 1966
Aloys Winterling, Der Hof des Kurfürsten Clemens August von Köln ( 1 7 2 3 - 1 7 6 1 ) , in: Rheinische Vierteljahrsblätter 54 (1990), S. 123-141
Tischbein 1861 Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, Aus meinem Leben, hg. von Carl G. W. Schiller, 2 Bde., Braunschweig 1861
Toman 1887 Hugo Toman, Das Verzeichnis der gräflichen Wrschowetz'schen Bildersammlung in Prag vom Jahre 1723, in: Repertorium für Kunstwissenschaft 10 (1887), S. 1 4 - 2 4
Trautscholdt 1957 Eduard Trautscholdt, Zur Geschichte des Leipziger Sammelwesens, in: Festschrift Hans Vollmer, Leipzig 1957, S. 2 1 7 - 2 5 2
Woermann 1887 Karl Woermann, Die Bilder aus der Prager Sammlung Wrschowetz in der Dresdener Galerie, in: Repertorium für Kunstwissenschaft 10 (1887), S. 1 5 3 - 1 5 9
Zelle 1998 Carsten Zelle, "Ein klein Cabinett von Gemählden". Zum Versteigerungskatalog von Barthold Heinrich Brockes' Bildersammlung, in: Hans-Georg Kemper, Uwe-K. Ketelsen und Carsten Zelle (Hg.), Barthold Heinrich Brockes ( 1 6 8 0 - 1 7 4 7 ) im Spiegel seiner Bibliothek und Bildergalerie, 2 Bde., Wiesbaden 1998 (Wolfenbütteler Forschungen 80), S. 6 3 - 8 1
47
Sigel für die Standorte
???
Standort unbekannt
AAP
Bibliotheque d'Art et d'Archeologie de l'Universite, Paris, France
ADu
Nordrhein-Westfälisches Hauptstaatsarchiv, Düsseldorf, Deutschland
AK
Badisches Generallandesarchiv, Karlsruhe,
HABW
Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, Deutschland
HAMW
Herzogin Amalia Bibliothek, Weimar, Deutschland
HKB
Hochschule der Künste, Berlin, Deutschland
Hoet
Gerard Hoet, Catalogue of Naamlijst van Schilderten met derselver Prijsen, 3 Bde., s'Graven-
Deutschland Akademie der bildenden Künste, Wien, Österreich Institut für Stadtgeschichte, Frankfurt am Main, Deutschland
HWH
Hauswedell, Hamburg, Deutschland
IFP
Bibliotheque de l'Institut de France, Paris,
Stätni oblastni archiv, Plzen, Ceskä republika
KBH
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, Nederland
APr
Stätni ustredni archiv, Praha, Ceskä republika
KBK
Kongelige Bibliothek, K0benhavn, Danmark
BBK
Arcibiskupska knihovna, Kromeriz, Ceskä re-
KH
Hamburger Kunsthalle, Hamburg, Deutschland
publika
KKBa
Kupferstichkabinett, Kunsthaus Basel, Basel,
KKD
Kupferstichkabinett, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Dresden, Deutschland Landesarchiv, Schleswig, Deutschland Johann Caspar Lavater, Eine Gemälde-Lotterie in Zürich 1790, in: Museum für Künstler und für Kunstliebhaber 12 (1789), S. 572-577 Hessische Landesbibliothek, Darmstadt, Deutschland
AKW AMF API
BDu
Bibliotheque de l'Universite, Gent, Belgique
BHAM
Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München, Deutschland
BMB
BML BMPL
France
Schweiz
C. G. Boerner, Düsseldorf, Deutschland
BG
BL
hage 1752-1770
C. G. Boerner, Leipzig, Deutschland (übernommen von BDu) Museumsbibliothek der Staatlichen Museen, Berlin, Deutschland (bis 1945, heute Bestandteil von M B B ) British Library, London, England, UK British Museum, Print Room, London, England, UK
LAS Lavater
LBDa MA
Bibliotheek, Koninklijk Museum voor Schone Künsten, Antwerpen, Belgique
MBB
Kunstbibliothek der Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz, Berlin, Deutschland
BNP
Bibliotheque nationale, Departement des Imprimes, Paris, France
MPA
Musee Plantin-Moretus, Antwerpen, Belgique
BPG
Bibliotheque Publique et Universitaire, Gene-
MS
Württembergische Landeskunstsammlungen,
Bibliotheque Royale, Bruxelles, Belgique Bayerische Staatsbibliothek, München, Deutschland
NGL
National Gallery, London, England, UK
Marquess of Bute, Mount Stuart, Rothesay, Isle
RBZ
of Bute, England, UK
RKDH
ve, Schweiz BRB BSBM Bute EBNP
Stuttgart, Deutschland NSAW
Niedersächsisches Staatsarchiv, Wolfenbüttel, Deutschland Ratsschulbibliothek, Zwickau, Deutschland Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag, Nederland
Cabinet des Estampes, Bibliotheque Nationale, Paris, France
RMA
Rijksmuseum, Amsterdam, Nederland
Ermitazh, Sankt-Peterburg, Rossiya
SABo
Stadtarchiv, Bonn, Deutschland
FLNY
Frick Art Reference Library, New York, NY,
SAF1
Stadtarchiv, Flensburg, Deutschland
SAM
Stadsarchief, Mechelen, Belgique
GMN
USA Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, Deutschland
SARL
Stadtarchiv, Leipzig, Deutschland
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin, Deutschland Staatliche Graphische Sammlung, München, Deutschland
SAW
Hauptstaatsarchiv, Würzburg, Deutschland
SBA
Staats- und Stadtbibliothek, Augsburg,
SBB
Deutschland Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Berlin, Deutschland
ESP
GSAB GSM 48
SBBa
Staatsbibliothek, Bamberg, Deutschland
TSMe
SBF
Stadtbibliothek, Frankfurt am Main, Deutschland
Thüringisches Staatsarchiv, Meiningen, Deutschland
UBAg
Universitätsbibliothek, Augsburg, Deutschland
SBH
Staats- und Universitätsbibliothek, Hamburg, Deutschland
UBH
Universitätsbibliothek, Heidelberg, Deutschland
SBN
Stadtbibliothek, Nürnberg, Deutschland
UBK
SGML
Stadtgeschichtliches Museum, Leipzig, Deutschland
Universitäts- und Stadtbibliothek, Köln, Deutschland
UBLg
Universitätsbibliothek, Leipzig, Deutschland
Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie, Frankfurt am Main, Deutschland
UBM
Universitätsbibliothek, München, Deutschland
ÜBT
Universitätsbibliothek, Tübingen, Deutschland
SKK
Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe, Deutschland
ULBH
SMF
Stadtgeschichtliches Museum, Frankfurt am Main, Deutschland
Universitäts- und Landesbibliothek, Halle, Deutschland
VAL
National Art Library, Victoria and Albert Museum, London, England, UK
WRK
Wallraf-Richartz-Museum, Köln, Deutschland
ZBZ
Zentralbibliothek, Zürich, Schweiz
SIF
SRP
Seymour de Ricci, Paris, France
SUBG
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, Göttingen, Deutschland
49
Sigel für die Städtenamen
AA AB AN AU BL BN BO BS BW DA DR EI FG FL FR GA HA HB HL HN KA
50
Aachen Amberg Anklam (Mecklenburg-Vorpommern) Augsburg Berlin Bremen Bonn Basel Braunschweig Darmstadt Dresden Eisleben Freiburg Flensburg Frankfurt am Main Gera Halle Hamburg Heilbronn Hannover Kassel
KO LB LG LZ MM MN MU MZ NG OG PR RG SC SG WF WG WN WR WW WZ ZH
Köln Lübeck Ludwigsburg, Württemberg Leipzig Mannheim Meiningen München Mainz Nürnberg Offenburg Praha [Prag] Regensburg Schöningen Schleswig Wolfenbüttel Wernigerode Wien Warszawa [Warschau] Wroclaw [Breslau] Würzburg Zürich
Sigel für die Auktionatoren
AN
Anonym
LIE
Lienau (Heinrich Christian)
BER
Berringer (Johann Ludwig)
LOT
Lötz (Georg Christoph)
BMN
Bostelmann (Michael)
MFD
Matfeld (August Wilhelm)
BOE
Boettcher (J.H.)
NEU
Neumann (Johann Hinrich)
BOH
Böhme
NGL
Nothnagel (Johann Andreas Benjamin)
BOY
Boy (Nicolas Wilhelm)
BRF
Brockdorff (Carl Friedrich von)
PAK
Packischefsky (Peter Hinrich)
BZN
Bolzmann (Johann Friedrich)
PLK
Plinck (Alexander)
DEN
Denecken (Matthias)
PRI
Prillwitz
DKR
Decker (Johann Heinrich)
RAD
Rademin (Hinrich)
EBT
Eberts (Jean-Henri)
RAU
Rauschner (Christian Benjamin)
FAY
Fayh
FRE
Frey (Hans Jakob)
FRZ
Frauenholz (Johann Friedrich)
GOV
Goverts (Hermann Friderich)
GRA
Gräfe
HCT
Hecht (Christian Friedrich)
HDR
Heidevier (Jacob)
HEG
Henningk
HLM
Hillmann (J.G.)
HRG
Haring (Christian Andreas)
HRN
Horn (Benedix Meno von)
HTG HTZ
RCH
Rauch (J.F.)
RMS
Reimarus (Johann David)
RST
Rost (Carl Christian Heinrich)
RUF
Ruffini
SCM
Schaumann
SCN
Schoen (Johann Hinrich)
SCT
Schiphorst (Johann Gerhard)
SDT
Schmidt (Gerhard Joachim)
SOE
Schroeder (Christian Friedrich)
STE
Steinhauss (Otto Joseph)
STK
Stöcklin (Christian)
Härtung (Alexander)
TEX
Texier (Peter)
Hintz (Caspar)
TOU
Toussaint (C. Ulrich)
HUS
Hüsgen (Heinrich Sebastian)
TRU
Treu (Christoph)
JUN
Juncker (Justus)
WDR
Werdmüller (Johann Heinrich) Weigel (Christoph Gottlieb)
KAL
Kaller (Johann Christian)
WGL
KIP
Kipp (Matthias Eberhard)
WID
Wild (Johann Jacob Hermann)
KOS
Köster (Hinrich Jürgen)
WOL
Wolff (Wilhelm)
51
Abkürzungen für Währungseinheiten
Carol fl Gr Kr Louis Μ rh fl Rt Sch Sgr St Th
52
Karolin Gulden Groschen Kreuzer Louis d'or Mark rheinische Gulden Reichstaler Schilling Silbergroschen Stüber Taler
Verzeichnis der Kataloge
1 1670/04/21 Alexander Härtung; Wien Verkäufer nach Titelblatt: Keine Verkäufer nach anderer Quelle: [Franz von Imstenraedt] Verkäufer: Imstenraedt, Franz von Lose mit Gemälden: 143 Standorte: BBK Nicht annotiert. Kommentar: Bei dieser Lotterie in Wien im Jahre 1670 handelt es sich um den ersten nachweisbaren Lotterieverkauf im deutschsprachigen Raum. Mittels einer Lotterie sollte die bedeutende Sammlung des Kölner Kaufmanns Franz von Imstenraedt veräußert werden. Schon im Jahre 1667 hatte dieser versucht, die Kollektion Leopold I. zu verkaufen. Er überreichte dem Kaiser eine Beschreibung der Sammlung, die in lateinischen Versen abgefaßt war (Iconophylacium sive Artis Apellae Thesaurarium, Wien 1667; nachgedruckt durch Antonin Breitenbacher, Dejiny arcibiskupske obrazärny ν Kromerizi, Olmiitz 1932). Dem Kaiser war jedoch der geforderte Preis zu hoch. Nach diesem erfolglosen Versuch, die Sammlung zu verkaufen, sah Imstenraedt eine Lotterie als Ausweg. Vermutlich war die Sammlung von Köln nach Wien gebracht worden, um sie Leopold I. vorzuführen. Wegen finanzieller Schwierigkeiten bemühte sich Imstenraedt, die Sammlung noch in Wien zu veräußern. Er wurde hierbei von seinem in Wien lebenden Bruder Bernhard unterstützt, doch scheiterte auch der Lotterieverkauf, da nicht ausreichend Lose abgenommen wurden. Die Sammlung wurde vermutlich im Jahre 1673 komplett an Karl von Liechtenstein verkauft, der die Bilder in seinen Galerien in Olomouc (Olmütz) und Kromeriz (Kremsier) aufstellte. Bei einem Feuer im Palast von Kromeriz im Jahre 1752 wurde ein Großteil der Gemälde vernichtet, darunter auch die berühmten Holbein-Bilder Thomas Morus und seine Familie, Triumph des Reichtums und Triumph der Armut (Nrn. 1 bis 3), die aus dem Staalhof in London stammten. Weitere Bilder wurden später veräußert, so beispielsweise 1830 Der Hl. Sebastian von Antonello da Messina, der in der Lotterie-Liste als Bellini bezeichnet wird (Nr. 12; seit 1873 in der Dresdener Gemäldegalerie). Verkauft wurden ebenfalls die beiden Portraits der Katharina Fürlegerin von Albrecht Dürer (Nrn. 63 und 63), die sich heute im Städelschen Kunstinstitut in Frankfurt und in der Berliner Gemäldegalerie befinden (Inv.-Nm. 937; 77.1). Auf die Lotterie wurde mit einem zweiseitigen Flugblatt hingewiesen, das eine komplette Liste der als Gewinn zur Verfügung stehenden Bilder enthielt. Nach den Angaben von Theodor von Frimmel hat sich in der fürstbischöflichen Bibliothek in Kromeriz ein Exemplar dieser Liste erhalten. Frimmel publizierte diese Bilderliste in einem Aufsatz in der Beilage der Blätter für Gemäldekunde (5. Lieferung, Nov. 1909, S. 141 bis 148). Diese Veröffentlichung wurde hier der Auswertung zugrunde gelegt. Nochmals abgedruckt wurde die Liste von Antonin Breitenbacher. In dem Flugblatt für die geplante Lotterie wurden auch die Konditionen erläutert. Der Gesamtwert der Sammlung wurde mit 50.400 Talern angesetzt. Insgesamt sollten 420 Lose zu je 120 Talern verkauft werden, wovon 152 als Gewinne markiert werden sollten, denn die Sammlung umfaßte insgesamt 152 Objekte. Überwiegend waren dies Gemälde, nur bei fünf Losen handelte es sich vermutlich um Zeichnungen (Nm. 86 bis 90). Die Durchführung der Lotterie war dem Bilderhändler Alexander Härtung übertragen worden. Die Bilderliste ist in italienischer Sprache verfaßt, vermutlich weil auf ein älteres, in italienischer Sprache abgefaßtes Inventar zurückgegriffen wurde. Möglicherweise wurde auch mit italienischen Kaufleuten als potentiellen Käufern gerechnet. Alle Beschreibungen sind knapp gehalten und mit Maßangaben versehen. Im Gegensatz zu späteren im deutschsprachigen Raum verauktionierten Sammlungen liegt bei dieser Kollektion das Schwergewicht auf Werken der italienischen Schulen. Hinzu kommen einige flämische, deutsche und französische Arbeiten. Auffälli-
gerweise findet sich kein einziges holländisches Werk in der Sammlung, dafür jedoch 17 altniederländische Werke, darunter vermutlich drei Gemälde von Geertgen tot sin Jans (Nrn. 135, 150 und 151). Die drei großen Temperabilder von Holbein stammten wie eine Reihe weiterer Werke aus der Sammlung von Thomas Howard, Earl of Arundel. Von dessen Witwe hatte Imstenraedt beispielsweise 1655 in Amsterdam Die Schindung des Marsyas von Tizian (Nr. 15) erworben, die sich heute noch im erzbischöflichen Palast in Kromeriz befindet. Mit erheblichem finanziellen Aufwand hatte Franz Imstenraedt auf seinen Reisen durch Europa Gemälde gekauft. Nicht ohne Einfluß ist sein Onkel Everhard IV. Jabach geblieben, der eine der bedeutendsten Barocksammlungen aufbaute und 1670 an den französischen König verkaufte. Jabachs Sammlung bildet heute noch den Kembestand des Louvre. Mit ihm reiste Imstenraedt vermutlich auch nach London, um am Verkauf der Sammlung des Königs Charles I. teilzunehmen. Vermutlich erwarb er hier das Doppelportrait König Charles I. und Königin Henrietta Maria von Anthonie van Dyck (Nr. 37), heute ebenfalls im erzbischöflichen Palast von Kromeriz. In dem Iconophylacium von 1667 berichtet Franz Imstenraedt von seinen Bemühungen, eine bedeutende Sammlung aufzubauen. Er habe zahlreiche Künstlerateliers aufgesucht und alle wichtigen Gemäldesammlungen besucht. Lit.: Antonin Breitenbacher, Dejiny arcibiskupske obrazärny ν Kromerizi. Archivni Studie, 2 Bde., Kromeriz 1925-1927; Eduard A. Safarik, The Origin and Fate of the Imstenraed Collection, in: Sbornik praci filosoficke fakulty brnenske university (1964), S. 171-182; Jutta Seyfarth, Die Bildersammlung der Familie Imstenraedt. Ein Barockkabinett in Köln, in: Ausst.-Kat. Köln 1995, S. 31-35.
2 1690/10/30 [Anonym]; Wolfenbüttel Verkäufer nach Titelblatt: Aus der Frstl: Holst. Inventariis Verkäufer: Holstein-Norburg, Friedrich, Herzog von Lose mit Gemälden: 219 Standorte: *NSAW Annotiert mit allen Käufernamen und Preisen. HABW Nicht eingesehen. Titelblatt: Designation der Jenigen Sachen welche von Gemälden, Büchern, Gewehr, Silber, und anderen Gerähte. Aus der Frstl: Holst. Inventariis 1690 in Wolfenbüttel zu Gelde gemacht und die Summe davon wieder in Einnahme gebracht worden. Kommentar: Das Verkaufsprotokoll ist Teil einer umfangreichen Akte über den Verkauf der Sammlung Norburg (NSWA, Akte 1 Alt 5, Nr. 186). Diese Akte trägt den Titel: "Verschiedene Geld= und Rechnungs=Sachen des am 14. November 1688 auf seinem Gute Fürstenau verstorbenen Herzogs Rudolf Friedrich zu Holstein Norburg, des gleichen deßen, zum Theil - auf Anordnung des Oheims und Vormundes der hinterbliebenen Kinder, Hrzg. Anton Ulrich z[u] Β [raunschweig] W[olfenbüttel] L[üneburg], - in Wolfenbüttel versteigerten Nachlaß betr., 1677-1690." In diesen Protokollinventaren wird der Besitz des Herzogs Friedrich von Holstein-Norburg (1645-1688) verzeichnet, dessen Nachlaß zugunsten der hinterbliebenen Kinder auf Veranlassung von Herzog Anton Ulrich von Braunschweig in Wolfenbüttel versteigert wurde. In einer dreiseitigen Gemäldeliste (Bl. 129 und 130) werden insgesamt 303 Losnummern aufgeführt. Einige Lose wurden zurückgezogen. Teilweise ist dies vermerkt, teilweise werden Losnummern auf der Liste ausgelassen. Neben sehr kurz gehaltenen Titeln sind die Namen der Käufer und die Preise angegeben. Bis auf zwei Tafeln mit Darstellungen von Adam und Eva von Albrecht Dürer (Nrn. 45 und 46), einem Bild von Rubens (Nr. 230) und einem Bild von Jacques Callot (Nr. 229) werden keine Künstlernamen genannt. Die Versteigerung erbrachte für die Gemälde lediglich 443 Reichstaler und 34 Groschen. Unter den Käufern befanden sich Herzog Anton KATALOGE
55
Ulrich von Braunschweig (1633-1714), sein Sohn August Wilhelm, sowie der Hofmaler Tobias Querfurt und Johann Friedrich von Alvensleben. Mit 23 Talern erzielten die beiden Dürer-Tafeln, die August Wilhelm erwarb, einen überdurchschnittlich hohen Preis. Die meisten Gemälde blieben deutlich unter 10 Talern. Lit.: Gerkens 1974, S. 104f.
3 1699/00/00
Daten unbekannt
[Anonym]; Nürnberg, Haus des Sammlers Verkäufer nach Titelblatt: Des seel. Verstorbenen Herrn Joh. Andreas Viatis Verkäufer: Viatis, Johann Andreas Lose mit Gemälden: 1 Standorte: SBF Nicht annotiert. Titelblatt: Kurtze Beschreibung der Armatur-Cammer und Kunst= Cabinets des seel. Verstorbenen Joh. Andreas Viatis in Nürnberg, als welche beede Cabinets vor Liebhabere (jedoch ein jedes unzertheilt) zu Kauff stehen. Kommentar: Bei diesem Katalog handelt es sich nicht um einen Auktionskatalog, sondern um einen Verkaufs- und Angebotskatalog der Kunstkammer-Sammlung Johann Andreas Viatis (1625-1698). Die Erben beabsichtigten, die beiden Kabinette der Kunstkammer jeweils geschlossen zu verkaufen, was jedoch nicht gelang, so daß Gegenstände einzeln verkauft werden mußten. Nach der typographischen Aufmachung des Katalogs zu urteilen, ist dieser nach dem Tod von Viatis um 1699 gedruckt worden und nicht "ca. 1742", wie eine handschriftliche Notiz auf dem Titelblatt des Katalogs aus der Universitätsbibliothek Frankfurt angibt. Die Kunstkammer war durch Wolfgang Viatis (1588-1655) begründet worden, der aus einer wohlhabenden Bankiersfamilie stammte. Das Bankhaus der Familie war durch den aus Venezien eingewanderten Bernardo Viatis (1504—1574) begründet worden. Interessenten wurden aufgefordert, sich an Viatis' Schwiegersohn, Andreas Benedict Richter, und an die "gesamte Viatischen Erben allhier in Nürnberg" zu wenden, um die Bedingungen des Verkaufs zu erfragen. In der "Armatur-Kammer" befanden sich vorwiegend Waffen, "in dem kleinen Kunst=Cabinet" überwiegend Münzen sowie "verschiedene schöne Gemählte von allerhand guten Meistern und Künstlern", die nicht weiter spezifiziert werden. Lit.: Hampe 1904, S. 94-97; Gerhard Seibold, Die Viatis und Peller. Beiträge zur Geschichte ihrer Handelsgesellschaft, Köln, Wien 1977 (Forschungen zur internationalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Bd. 12), S. CXII-XX.
4 1705/06/25
und folgende Tage
[Anonym]; Hannover, Auf der Neustadt in der Frau Commissariin von Windheim Behausung Verkäufer nach Titelblatt: Churfürstl. Braunschw. Lüneb. Hoff= Rath Herrn Anthon Lucio Verkäufer: Lucius, Anthon Lose mit Gemälden: 100 Standorte: HABW Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichnüß Der von Weyl. Dem Churfürstl. Braunschw. Lüneb. Hoff=Rath / Herrn Anthon Lucio, Hinterlassenen groß= und kleinen Gemählden und Schildereyen / verschiedener aus Bernstein wie auch aus Helffenbein verfertigten Kunst=Stückgen; Porcelainen auch Serpentinen säubern Gefässen und Geschirren: Allerhand Statuen und Figuren / auch Portraiten aus Alabaster / Gips / Wachs und Holz: Allerhand absonderlich außländischen Raritäten und Curiositäten / propre und curieuse Meublen; Auch letzlich eine grosse An56
KATALOGE
zahl / der schönsten / und von den berühmtesten Meistern verfertigten Kupfferstücken: Welches alles auf der Neustadt Hannover in der Frau Commissariin von Windheim Behausung am 25. Junij und folgenden Tagen / Morgens umb 9. und Nachmittags umb 3. Uhr / öffentlich an den Meistbietenden soll verkaufft / und gegen baare Bezahlung verabfolget werden. Hannover MDCCV. Kommentar: In diesem frühen Versteigerungskatalog wird der gesamte Hausstand des braunschweigischen Hofrates Anthon Lucius angeboten, der in Kurhannover als Advokat tätig gewesen war. In der ersten Abteilung (S. 1 bis 11) wurden in 115 Losen "Gemähide und Schildereyen" aufgeführt. Teilweise handelte es sich wohl um Miniaturen; insgesamt wurden 100 Lose als Gemälde erfaßt. Nur bei besonders großen Bildern wurden die Maße angegeben. Bis auf zwei Bilder von Lucas Cranach d.Ä., ein Portrait von Martin Luther und als Gegenstück das Portrait seiner Frau aus dem Jahre 1526 (Nrn. 17 und 18), sind nahezu alle Bilder anonym. Bei der Mehrzahl der Gemälde handelt es sich um Portraits.
5 1706/03/02
und folgende Tage
[Anonym]; Dresden, E.E. Raths sogenannten Breyhahn Hause Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 50 Standorte: BSBM Nicht annotiert. Titelblatt: Catalogue Mannichfaltiger Kunst=Sachen und Kupfferstiche / Worunter Contrefaits hoher Potentaten und fürnehmer Persohnen Geist=und Weltlichen Standes / deren hoher und niederer Civilund Militair-Bediente / gelehrter Leute / berühmter Künstler und anderer Privat-Personen beyderley Geschlechts, Landschafften / Gärten/ Seehäfen / Belagerungen / Bataillen / Geist= und Weltliche Historien / Leben der Heiligen / auch allerhand Inventiones. Mancherley Thiere und Vieh=Stücken / Jagten / Thier=Streite / Blumen / Grotesquen, Städte in Geometr. Grunde und Perspectiv, Kirchen, Palatia, Clöster / Thürme und andere Architectonische auch Theatralische Stücke. Inventiones zu Disputationen/ Moden und und dergleichen. Nicht weniger viele Handrisse und Miniatur-Bilder / ec. ec. Alles von denen fürtrefflichsten / berühmtesten Meistern und Künstlern / In grosser Menge und sehr wohl conditioniret / auch in säubern Bänden nach der Ordnung / wie die Nummern anzeigen befindlich; Welche auf nechst künfftigen [2 Martij in E.E. Raths sogenannten Breyhahn Hause; handgeschriebene Ergänzung] Allhier in Neu= Dreßden more consueto Stückweise zertheilet / an den meist Biethenden / um baares Geld verlassen werden sollen. Alt=Dreßden / druckts Jacob Harpeter / Anno 1706. Kommentar: Dieser Versteigerungskatalog enthält vorwiegend Zeichnungen und Kupferstiche. Ganz am Ende befindet sich die Abteilung "Schildereyen" mit insgesamt 51 Nummern. Die meisten Gemälde sind anonym, nur zwei Bilder werden einem Künstler zugeordnet. Da die Künstlernamen kursiv angegeben und bei den Zeichnungen teilweise mit Zusätzen wie "fee." wiedergegeben werden, ist davon auszugehen, daß die betreffenden Bilder bezeichnet waren. Unter der Abteilung "Kunstbuecher" werden Zeichnungen, Pastelle und auch Miniaturen zusammengefaßt. Möglicherweise handelt es sich bei einigen dieser Werke auch um Gemälde. Die Versteigerung fand in dem 1646 vom Rat der Stadt erbauten und seit 1699 von der Stadt für verschiedene Zwecke verpachteten Haus der Bierbrauer, dem sogenannten Breihahnhaus, in der Breiten Gasse in Dresden statt.
6 1710/05/21 [Anonym]; Hamburg, Embeckschen Hause Verkäufer nach Titelblatt: Keine
Lose mit Gemälden: 13 Standorte: BML Nicht annotiert. Titelblatt: Specification der köstlichen Tapisserien, Kleidern / Spitzen / Schildereyen und Spiegeln / So auf dem Embeckschen Hause den 21. Maji Anno 1710 sollen verkauffet werden. Hamburg / gedruckt bey Johann Niclas Gennagel auf St. Jacobi Kirchhof. Kommentar: Insgesamt wurden in diesem Versteigerungskatalog nur 13 Gemälde angeboten. In der Mehrzahl kamen Spiegel, Kleider, "güldene Touren und Fransen" sowie Tapisserien zum Verkauf. Die "Schildereyen" (Nrn. 10 bis 19 und 23 bis 25) sind überwiegend italienischen oder flämischen Ursprungs, darunter eine Kopie von Domenichinos Daniel mit der Harfe (Nr. 18) aus dem Versailler Schloß. Vermutlich stammte der Besitzer der Sammlung aus Frankreich, da mehrere Bilder und auch Skulpturen französische Könige darstellen. Insgesamt bietet der Katalog ein gutes Bild eines französischen Hausstandes, der aus Frankreich nach Hamburg transferiert wurde. 7 1714/05/07
und folgende Tage
[Anonym]; Leipzig, Haus des Sammlers, auf den Neuen Neumarkt Verkäufernach Titelblatt: Herr Christian Wolff, Weyland Philos. & Medicinae Doctor, und berühmter Practicus Verkäufer: Wolff, Christian, Dr. Lose mit Gemälden: 113 Standorte: SBBa Nicht annotiert. Aus dem Besitz von Joseph Heller. Titelblatt: Museum Wolffianum oder Verzeichnis von allerhand Insectis, Papilionibus, Ossibus und Partibus von mancherley Thieren, Mineralibus, Petrefactis, pretieusen und configurirten Steinen, Inn= und Ausländischen Artefactis, Mathematischen und andern Instrumenten, Müntzen, in Wachs poussireten Portraits, Schildereyen, Kupffer=Stichen und Hand=Rissen von denen besten Maitres, worunter sonderlich 2 kostbare Bände, ec. Welche Herr Christian Wolff, Weyland Philos. & Medicinae Doctor, und berühmter Practicus allhier mit sonderbaren Fleiß vormals colligiret, und nach der Oster= Messe 1714 den 7 Maji, und folgende Tage in dessen Hause auf den Neuen Neumarckt durch öffentliche Auction an die meistbietenden sollen verkauffet werden. Leipzig, gedruckt bey Gottfried Rothen, 1714. Kommentar: Im Museum Wolffianum zeigt sich die für eine Kunstkammer charakteristische Vielfalt der Sammelgebiete. Neben Kunstobjekten umfaßte die Sammlung des Philosophen Christian Wolff zoologische Präparate, Mineralien und naturwissenschaftliche Instrumente. Auf den Seiten 93 bis 100 des Versteigerungskatalogs sind die "Schildereyen" verzeichnet. In den knappen Einträgen werden in der Regel die Sujets vorgestellt, die meisten Bilder werden keinem Künstler zugeordnet. Unter anderem finden sich jedoch drei Gemälde von Cranach und eines von Dürer. Im Exemplar des Katalogs aus der Bamberger Universitätsbibliothek sind die Cranach-Bilder und das Dürer-Gemälde angestrichen. Diese Ausgabe befand sich im Besitz des Bamberger Kunstschriftstellers Joseph Heller (1758-1849), der unter anderem die Werke "Versuch über das Leben und die Werke Luc. Cranachs" und "Das Leben und die Werke Albrecht Dürer's" (1827) publiziert hat.
8 1716/00/00 Daten unbekannt [Lugt 231] Jacob Heldewir; Frankfurt am Main Verkäufer nach Titelblatt: Hern van Merian Verkäufer: Merian, Johann Matthäus von Lose mit Gemälden: 322
Standorte: *Hoet In der publizierten Version des Katalogs bei Hoet werden alle Preise angegeben. Kommentar: Der Verkaufskatalog ist wiederabgedruckt bei Hoet/ Terwesten 1752/72, S. 344 bis 357, mit dem Titel "Catalogue deijenigen Mahlereyen / so in Hem van Merian seel. Cabinet gefunden worden / nunmehro bey Herrn Jacob Heldewir in Franckfurt im Verkauff zu haben sind". Bei Hoet sind auch die Preise angegeben. Lugt bezweifelte die Existenz eines gedruckten Katalogs. Gwinner I 1862, S. 165, spricht von einem gedruckten Preiskatalog, bezieht sich aber wahrscheinlich hierbei auf Hoet. Vermutlich handelt es sich bei der von Hoet abgedruckten Verkaufsliste um ein Nachlaßinventar der Sammlung des Johann Matthäus von Merian (1659-1716), einem Mitglied der seit 1624 in Frankfurt ansässigen Verleger- und Kupferstecherfamilie Merian. Matthäus von Merian d.Ä. hatte den Verlag seines Schwiegervaters Theodor de Bry im Jahre 1626 übernommen. Nach seinem Tode wurde der Verlag von seinem Sohn Matthäus Merian weitergeführt, der die Geschäfte an Johann Matthäus übertrug. Dieser war wie sein Vater als Portraitist tätig, arbeitete aber ausschließlich in Pastell. Er wurde geadelt und erhielt den Titel eines Geheimen Rates in Mainz. 1684 heiratete er Johanna Maria Heidevier. Er verstarb am 4. Mai 1716, seine Frau vier Jahre später. Für dieses Verkaufsinventar ist kein Datum überliefert. Lugt hatte mit der Angabe "Dezember 1711" nur eine Schätzung vorgenommen, Hoet spricht aber von dem "seel. Merian". Wahrscheinlich wurde es nach dem Tode des Johann Matthäus im Jahre 1716 oder nach dem Tode seiner Frau Johanna Maria Heldeviers von den Erben zusammengestellt. Bei dem als Verkäufer genannten Jacob Heidevier handelt es sich wohl um einen Verwandten von Johanna Maria Heidevier. Insgesamt wurden 237 Nummern mit 326 Gemälden zum Verkauf angeboten. Hinzu kamen noch die Portraits, die eine eigene Zählung (Nm. 1 bis 71) erhielten, sowie die "Historien stuck" (16 Nm.) und die "Creyons Contrefaits vom Herrn Johann Matt, von Merian" (19 Nrn.), die als Zeichnungen hier nicht mit ausgewertet wurden. Merians Sammlung setzte sich überwiegend aus Werken holländischer und flämischer Künstler des 17. Jahrhunderts zusammen, darunter vermutlich von Joachim Wtewael Perseus und Andromeda (Nr. 153; heute im Louvre in Paris, Inv.-Nr. R.F. 1982-51). Im Verkaufsinventar finden sich auffallend viele Seestücke von Jan Porcellis und der Van de Velde-Familie. Insgesamt sechs Gemälde werden Cornells van Poelenburg zugeschrieben, acht Jan van Huysum. Einen weiteren Schwerpunkt bildeten deutsche Gemälde des 18. Jahrhunderts, darunter allein acht Bilder von Georg Flegel, die bisher nicht zweifelsfrei zu identifizieren sind. Außerdem befanden sich unter den Gemälden zahlreiche Werke von der Hand Johann Matthäus Merians und Matthäus Merian d.J., aber auch einzelne Werke von Johann Matthäus d.Ä. (Nr. 237). Die höchsten Preise erzielten das Michelangelo zugeschriebene Bild Drei Sibyllen mit 1.500 und das ehemals Jan Liss zugesprochene Stiergefecht auf dem Markusplatz (Kurt Steinbart, Johannes Liss. Der Maler aus Holstein, Berlin 1940, S. 176f.) mit 1.120 Währungseinheiten (Hoet nennt die betreffende Währung nicht). Die durchschnittlich erzielten Preise bewegen sich im allgemeinen zwischen 30 und 150 Einheiten. Lit.: Hoet/Terwesten 1752/70, Bd. 2, S. 344-357; Gwinner I 1862, S. 164f.; Gerson 1942, S. 265.
9 1723/00/00 Daten unbekannt [Anonym]; Praha, Haus des Sammlers Verkäufer nach Titelblatt: Herr Graff von Werschowitz Verkäufer: Vräovec, Felix, Graf von Lose mit Gemälden: 368 Standorte: APr Nicht annotiert. KATALOGE
57
Titelblatt: Catalogue Deijenigen rahren / und kostbahren Mahlereyen / und Bildern / von denen besten alt= und neuen Meistern / deßgleichen schöner Venetianischen Spiegeln / und künstlich=gewürckten Niederländischen Spalier / wie auch allerhand kostbahren Geschosses / als Pistohlen / Flinthen / Stutzen / ec. Welche (Tit:) Ihro Excell. der Gottseelige Herr Graff von Werschowitz hinterlassen / und nunmehro allhier in der Königl. Neuen Stadt Prag / in dem Werschowitzischen Hauß in billichem Preiß / Stückweise zu verkauffen stehen. Kommentar: Die Sammlung Felix Graf von Vrsovec (1654-1720) wurde drei Jahre nach dessen Tod 1723 durch seine Witwe verauktioniert. Im 17. Jahrhundert erlangte diese Familie großen Wohlstand, wurde in den Grafenstand erhoben und erhielt den Namen und Titel des altböhmischen Geschlechts der Vräovec (Wrschowetz). In dem 1683 errichteten barocken Palais der Familie in der Prager Neustadt war die umfangreiche Gemäldesammlung untergebracht, die neben der Nostitzschen Sammlung zu den bedeutenden Barocksammlungen Böhmens zählte. Da der Auktionskatalog wie eine Inventarliste angelegt und nach Räumen sortiert ist, läßt sich die Hängung noch nachvollziehen. Weil die Gemälde nach Räumen verzeichnet werden, kommt es zu mehreren, immer neu ansetzenden Zählungen im Katalog: Die Reihe Α verzeichnet etwa die Gemälde in der "Gallerie", die Reihe D die "Cabinet=Stücklein". Die Angaben sind im einzelnen sehr knapp, enthalten aber für die erste Nummernfolge auch Hinweise auf die Rahmen. Die Sammlung umfaßte sowohl holländische als auch italienische Bilder sowie deutsche Gemälde des 17. und 18. Jahrhunderts, darunter allein sechs Bilder von Johann Heinrich Schönfeld. Insgesamt 21 Bilder wurden von Baron Raymond de Leplat für die Dresdener Galerie erworben, andere gelangten in die Waldsteinsche Sammlung im Schloß Duchov (Dux) und wurden dort 1741 für die Dresdener Galerie erworben. Schon 1723 wurde beispielsweise die Leda mit dem Schwan angekauft, eine niederländische Kopie eines verlorenen Bildes Michelangelos (Nr. A5), während die Musikalische Unterhaltung am Spinett von Johann Heinrich Schönfeld (Nr. A4) und die Wiederholung des Bildes von Oswald Onghers (Nr. 103) erst 1741 mit den Bildern aus der Sammlung Waldstein nach Dresden gelangten. Einige der von der Dresdener Gemäldegalerie angekauften Bilder wurden später wieder abgegeben oder im Zweiten Weltkrieg vernichtet. 1859 wurde zum Beispiel mit zahlreichen anderen Bildern der Dresdener Galerie durch Karl Gotthelf Bautzmann in Dresden Schönfelds Hannibal schwört den Römern ewige Feindschaft (Nr. A6) versteigert. Das Bild gelangte schließlich 1934 in das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg. Zwei Gemälde, Ein Fuchs von Hamilton (Nr. A87) und Meeresgötter und Meeresgöttinen (Nr. Al 12; heute Hendrick van Baien d.Ä. zugeschrieben) werden heute in der Prager Nationalgalerie aufbewahrt (Inv.-Nrn. DO 4283-Z 483; Ο 16246). Lit.: Slavicek 1995, S. 14f.; Toman 1887, S. 14-24; Woermann 1887, S. 153- 159; Frimmel 1892, S. 22-26.
10 1725/01/24 [Anonym]; Bonn Verkäufer nach Titelblatt: Keine Verkäufer nach anderer Quelle: Joseph Clemens, Kurfürst von Köln Verkäufer: Joseph Clemens, Kurfürst von Köln Lose mit Gemälden: 12 Standorte: ADu Nicht annotiert. Es existieren vier Exemplare dieser Liste im Hauptstaatsarchiv Düsseldorf (Aktenbestand Kurköln 11-78, Bl. 26, 28, 29 und 31). Titelblatt: Designatio Der vornehmeren Mahlereyen und sonderlich deren berühmteren Mahleren / welche den [24. Jan. 1725; hand58
KATALOGE
schriftliche Ergänzung] in der Churfürstl. Residentz=Statt Bonn dem meist=bietenden öffentlich verkaufft werden. Getruckt in der Churfürstl. Residentz=Statt Bonn Bey Johann Egid Constantin Müller Churfürstl. Hof-Buchtrucker 1724. Kommentar: Auf diesem einseitig bedruckten Auktionszettel werden überwiegend summarisch Gemälde, Kupferstichwerke und Münzen aus dem Nachlaß des Kurfürsten Joseph Clemens (1671-1723) angeboten. Von insgesamt wohl kaum mehr als 30 Gemälden werden nur einige wenige italienischen Künstlern wie Bassano, Giordano oder Lanfranco zugeschrieben. Es erschienen auch noch weitere Verkaufszettel, so die "Specification daßjenigen Silberwerks", die "Designatio Deijenigen Spiegeln" sowie das "Verzeichnus Derjenigen Kirchen-Ornaten", auf die jeweils das Datum des Verkaufs handschriftlich eingetragen wurde. Mitglieder aus dem Hause der Wittelsbacher waren seit 1583 Erzbischöfe und Kurfürsten von Köln. Die kurkölnische Residenz befand sich in Bonn. Joseph Clemens, Sohn des bayerischen Kurfürsten Ferdinand Maria und der Henriette Adelheid von Savoyen, war von 1688 bis 1723 Kurfürst und Erzbischof in Köln. Sein Bruder Max Emanuel wurde 1679 Kurfürst von Bayern, dessen Sohn Clemens August erlangte nach dem Tode Joseph Clemens' die Kurwürde. Lit.: Ausst.-Kat. Schloß Clemenswerth 1987. 11 1731/05/00
Daten unbekannt
[Anonym]; Hamburg Verkäufer nach Titelblatt: Dr. Antony Verborcht Verkäufer: Verborcht, Antony, Dr. Standorte: SBH Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Titelblatt: Specificatio Einiger Schildereyen von berühmten Meistern, welche - Dr. Antony Verborcht hinterlassen, und nach Ostern d. 1731 Jahres - in Hamb. - verkauffet werden sollen. Kommentar: Der Auktionskatalog der Sammlung Verborcht ist nur bibliographisch nachweisbar (Realkatalog der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg KD III., Hanseatica Hamburgensia IV, S. 73). Holst 1939, S. 270, führt ihn ebenfalls in seiner Liste. Bei der Sammlung Verborcht sind wir größtenteils auf Hypothesen angewiesen. Der Arzt Anthon Verborcht (1658-1724), der 1682 zum Doktor der Medizin promoviert wurde, lebte bis 1692 in Utrecht und war wegen seiner anatomisch-medizinischen Sammlung bekannt (für Auskünfte über die Familie Verborcht danken wir Marten Jan Bok, Utrecht). C. F. Neickelius berichtet, daß dieses Kabinett "der hochgelehrte Herr Theodorus Kerckring angefangen, und in seinem zu Amsterdfam] An. 1670 edirten Spicilegio Anatomico schon damals beschrieben habe" (Neickelius 1727, S. 199). Sowohl Verborcht wie auch der erwähnte Arzt, Anatom und Chemiker Theodor Kerckring ließen sich in Hamburg nieder. Kerckrings Stadtpalais am Neuen Wandrahm 17, nach Plänen des holländischen Architekten Philipp Vingboons errichtet, gehörte zu den eindrucksvollsten barocken Häusern in der Hansestadt; Verborcht war "beym Theerhof' wohnhaft. Rohde, der sich auf den Auktionskatalog von 1731 bezieht, vermutet, daß Verborcht auch in Hamburg weiterhin Gemälde erwarb: "Seinen Hintz, Waterloo, Glauber hat er vermutlich in Hamburg gekauft, während er seine Lucas von Leyden, Ostade, Vonck, Tewyck u.a. aus seiner Heimat mitgebracht haben wird" (Rhode 1922, S. 51). Die umfangreiche Bibliothek Verborchts wurde am 19. Juni 1724 versteigert: "Des seel Hrn D. Anthoni Verbergs, bei seinem Leben Hoch=berühmt und erfahreren Medici, auserlesene Bibliothec, [...], welche den 19. Juni 1724 in Hamburg [...] verkaufft werden sollen. Hamburg [o.J.]" (Exemplar SBH, Signatur A/302669). Im Jahre 1727 berichtete Neickelius, daß auch das anatomische Kabinett von den Erben zum Verkauf angeboten worden sei. Die Gemäldesammlung sollte somit zuletzt "beym Theerhof in der Frau
Wittwen ihrer Behausung", wie zuvor die Bibliothek, verauktioniert werden. Angeblich hat Marcus Friedrich Stenglin auf dieser Auktion einzelne Gemälde, darunter eine "Bataille von Weyer", erworben (Gerson 1942, S. 218). Lit.: Neickelius 1727, S. 199; Rhode 1922, S. 51f.; Ketelsen 1997, S. 156.
12 1739/00/00
Daten unbekannt
[Anonym]; Praha, Haus des Sammlers, Majoratshaus Verkäufer nach Titelblatt: Graf=Nostitzisches Prager=Majorat-Hauß Verkäufer: Nostitz-Rhienek, Franz Wenzel, Graf von Lose mit Gemälden: 261 Standorte: *AP1 Annotiert mit zahlreichen Preisen. Titelblatt: Specification Verschiedener Mahlereyen/ Welche in dem Graf=Nostitzischen Prager=Majorat-Hauß auf der Klein=Seithen an den Meistbietenden gegen bare Bezahlung verkauffet werden. Kommentar: Die Sammlung Nostitz, die zu den bedeutendsten Gemäldekollektionen Böhmens zählt, geht zurück auf Johann Hartwig Graf Nostitz (1610-1683). Systematisch erweitert wurde die Sammlung durch Anton Johann Nostitz (1652-1736), der 1706 auch die Sammlung seines Stiefbruders, Franz Anton Berka Graf von Duba (1645-1706), übernahm. Als Franz Wenzel Graf von Nostitz (1697-1765) die Sammlung seines Onkels erbte, zählten die Inventare mehr als 1.400 Gemälde, davon insgesamt 841 im Palais der Familie auf der Prager Kleinseite. Aus finanziellen Gründen ließ Nostitz dann 1739 einen beträchtlichen Teil der Sammlung versteigern. Die 261 Lose umfaßten 323 Gemälde, die alle mit ihren Taxen angegeben wurden. Insgesamt addiert sich deren Wert auf 5.546 Gulden. In dem Versteigerungskatalog werden die Bilder nur knapp in Tabellen ohne die Angabe der Künstler angeführt. Nach den Angaben eines annotierten Exemplars des Katalogs im Nostitzschen Familienarchiv wurden insgesamt 165 Bilder verkauft. Die Preise entsprachen überwiegend den Taxen oder lagen nur geringfügig höher. In dem Versteigerungskatalog werden die Bilder nach Gattungen gegliedert. Insgesamt 72 Gemälde fallen unter die Rubrik "Geistliche Bilder" und 113 werden als "Historien" rubriziert. Die 57 Portraits werden unter dem Titel "Unterschiedliche Köpffe" zusammengefaßt. Als "Landschafften" werden 64 Bilder bezeichnet, darunter auch vier Schlachtenbilder. Außerdem finden sich am Ende des Katalogs sieben "Thier= und Gefliegl=Stücke" sowie vier "Blumen= Stuck". Da die Gemälde ohne Künstlernamen aufgeführt werden, ist eine Identifizierung schwierig. Von den nicht verkauften Gemälden der Auktion gelangten einige Bilder 1945 in die Nationalgalerie Prag, so etwa die Personifikation der Jahreszeiten und des Menschenalters von Simon de Vos (Nr. 108). Lit.: Theodor von Frimmel, Von der Galerie Nostitz in Prag, in: Blätter für Gemäldekunde 5 (1910), Heft 1, S. 1-9; Lubomir Slavicek, Paralipomena k dejinäm berkovske a nosticke obrazove sbirky (Materiälie k 5eskemu baroknimu sberatelstvi II.), in: Umeni 43 (1995), S. 445-471; Lubimir Slavicek, Delitiae Imaginum - The Nostitzes as Collectors and Patrons of the Arts, in: Ausst.-Kat. Prag 1993, S. 386-400; Slavicek 1995, S. 8-25.
13 1740/00/00
Daten unbekannt
[Anonym]; Augsburg Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 90 Standorte: *SBA Nicht annotiert.
Titelblatt: Specification der in Augspurg sich befindlichen Mahlereyen / So von einigen Peritis in arte / auf das genaueste / und wie es unter Geschwistern zu haben / Eestimiert worden. Kommentar: Dieser Augsburger Versteigerungskatalog ist nicht datiert, jedoch läßt sich nach der Typographie vermuten, daß der Katalog um 1740 erschienen ist. Im Katalog der SB Α wurde dieser bisher mit dem Erscheinungsjahr 1770 geführt; hierbei handelte es sich auch nur um eine Schätzung. In einer Nachbemerkung heißt es: "Vorstehende Mahlereyen sind alle auf das beste conservirt und meistens mit gut vergoldten etliche auch von Β ildhauer=Arbeit künstlich verfertigten Rahmen versehen." Die Beschreibungen sind kurz und in einem Satz zusammengefaßt, in dem auch der Künstlername und die Maße in Schuh und Zoll angegeben werden. Teilweise sind die Titel wenig aussagekräftig, dort heißt es unter anderem "2 Stuck von Berentz." Zahlreiche Künstlernamen sind in der Schreibweise stark eingedeutscht worden, Wouwerman wird beispielsweise "Wabermann" geschrieben. Unter zahlreichen Losen werden zwei oder mehr Bilder offeriert. Alle Lose sind mit Schätzpreisen versehen, die sich durchweg auf hohem Niveau bewegen. Es handelt sich hier möglicherweise um einen Lagerkatalog und keinen eigentlichen Auktionskatalog. Insgesamt beläuft sich der geschätzte Wert der Sammlung auf die hohe Summe von 11.108 Gulden.
14 1742/08/01
und folgende Tage
[Lugt 560]
[Anonym]; Bonn, Haus des Sammlers Verkäufer nach Titelblatt: Der verstorbene Chur-Cöllnische Herr Hoff-Rath und Leib-Medici von Gise Verkäufer: Gise, Johann Heinrich von Lose mit Gemälden: 623 Standorte: UBK Annotiert in Bleistift auf eingebundenen Leerseiten mit einigen ganz wenigen Preisen (deutsche Ausgabe). RKDH Nicht annotiert mit Ausnahme einiger Unterstreichungen bei den Künstlernamen und einigen jüngeren Notizen zur Zuschreibung der Bilder (deutsche Ausgabe). Titelblatt: Catalogue Deren in des verstorbenen Chur-Cöllnischen Herren Hoff-Rathen und Leib-Medici von Gise seeligen Behausung zu Bonn erfindlicher Mahlereyen und Statuen. Kommentar: In diesem umfangreichen Katalog wurde die Sammlung von Johann Heinrich von Gise (auch Giese geschrieben) versteigert, der am Hof des Kurfürsten Clemens August (1700-1761) als Leibarzt diente (vgl. ADu, Akte Kurköln II 491, Bl. 2-5). Clemens August war 1723 zum Kurfürsten und Erzbischof von Köln ernannt worden und entfaltete als Mäzen der Künste ein aufwendiges Hofleben. In seinem Umkreis wurden auch zahlreiche Hofbeamte zu Kunstsammlern, zu denen auch Gise zählte. Als Termin für die Versteigerung wurde der 1. August angesetzt, worauf in einer Nachbemerkung am Ende des Katalogs hingewiesen wird. Der Versteigerungskatalog umfaßt 624 Losnummern für Gemälde sowie einige Skulpturen. Unter den ersten 100 Nummern werden teilweise mehrere Bilder unter einem Los verzeichnet. In sprachlicher Hinsicht haben die Einträge den Charakter von Inventareinträgen. Es fehlen Maßangaben, und die Bildtitel sind sehr knapp gehalten. In der Reihenfolge der Lose läßt sich keinerlei Ordnung erkennen. Bei den meisten Einträgen wird klar zwischen Original, Schulbild und Kopie unterschieden. Auch bei den anonymen Gemälden wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß es sich um Originale handelt. Auffallend ist die verdeutschte Schreibweise zahlreicher Künstlernamen, wie beispielsweise "Rheinbrand", "Hemskirchen", "Thenthoretto". Unter den 690 Gemälden finden sich rund 250 Arbeiten holländischer und flämischer Künstler des 17. und 18. Jahrhunderts, darunter neun Werke Rembrandts und 31 Bilder aus dem Van-Dyck-UmKATALOGE
59
kreis. Mit insgesamt über hundert Werken sind auch die italienischen Schulen stark repräsentiert, während deutsche Künstler nur mit 60 Gemälden vertreten sind. Vermutlich ist die Auktion erfolglos verlaufen oder gar ganz verschoben worden, denn am 30. August fand erneut eine Versteigerung statt, von der sich ein französischsprachiger Katalog erhalten hat (Kat. 14a), in dem immerhin noch 398 Gemälde sowie rund 100 summarisch zusammengefaßte Gemälde aufgeführt werden. Zahlreiche Bilder wurden vom Kurfürsten Clemens August schon bei dieser oder aber bei der zweiten Auktion am Ende des Monats erworben und tauchen in der Versteigerung seines Nachlasses 1764 wieder auf. Darunter befand sich beispielsweise auch der Verlorene Sohn von Rembrandt (Nr. 37 in Kat. 14; Nr. 770 in Kat. 45). Dieses Bild ist heute in der Eremitage in St. Petersburg (Inv.-Nr. 742). Lit.: Holst 1960, S. 165; Vey 1963, S. 199, 223.
14a 1742/08/30
und folgende Tage
[Lugt 560]
[Anonym]; Bonn, Haus des Sammlers Verkäufer nach Titelblatt: Feu Jean Henri de Gise, Conseiller Aulique & Premier Medecin de S.A.S.E. de Cologne
neu gruppiert. Hoet übernahm die Maßangaben aus dem französischen Katalog der Sammlung Gise. Außerdem kann Hoet auch die erzielten Preise nennen. Lit.: Hoet/Terwesten 1752/70, Bd. 2, 1752, S. 63-66; Holst 1960, S. 165; Vey 1963, S. 199,223.
15 1743/00/00
Daten unbekannt
Gräfe; Braunschweig, In der Burg alhier nechst der Dohm=Kirche Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 211 Standorte: SUBG Nicht annotiert. Titelblatt: Catalogue von einer sehr wol conditionierten und ausnehmenden Gallerie, bestehend in künstlichen und schönen Mahlereyen von Italiänischen, Franzö=Niederländ= und Teutschen maitres, welche in vielen Jahren mit grosser Mühe und Unkosten von einem Kenner und Liebhaber gesamlet, anjetzo aber um einen billigen Preis verkauffet werden sollen. Braunschweig, gedruckt bey Friedrich Wilhelm Meyer. 1743.
Verkäufer: Gise, Johann Heinrich von Lose mit Gemälden: 400 Standorte: *BNP Annotiert mit den Preisen für die Lose 1, 3-5, 7-9 und 13 (französische Ausgabe). BG Nicht annotiert (französische Ausgabe). *Hoet Auszug von 46 Lose mit Preisen und Maßangaben. Titelblatt: Catalogue D'un tres grand & tres beau cabinet de tableaux, Contenant les plus belles, les plus achevees, & les plus choisies Pieces de presque tous les Maitres les plus renommes le l'Europe, ainsi qu'un grand nombre d'Estampes, de Statues & Figures, recueillis pendant plusieurs annees par feu Jean Henri de Gise Conseiller Aulique & Premier Medecin de S.A.S.E. de Cologne; dont toutes les pieces, sans exception, seront vendues publiquement & au plus offrant ä Bonne, le 30. Aoüt 1742. & les jours suivans ä la maison mortuaire. On pourra voir le Cabinet, & tous les Tableaux quatre jours avant la Vente. On a emploie le pied de France pour designer la grandeur des Tableaux. Kommentar: In diesem französischsprachigen Katalog wurde die Sammlung Johann Heinrich von Gise angeboten. Es handelt sich aber nicht um eine französischsprachige Version des Katalogs vom 1. August 1742 (Kat. 14), sondern um eine völlig neu organisierte Zusammenstellung der Kollektion, deren Verkauf für den 30. August angesetzt wurde. Auch finden sich hier nur 398 Lose im Vergleich zu den 624 Losen des deutschen Katalogs. Hinzu kommen allerdings bei dieser Versteigerung noch 82 summarisch aufgeführte Landschaften und 28 Stilleben. Vermutlich ist nach einer wenig erfolgreichen Auktion am 1. August ein erneuter Auktionstermin angesetzt worden, zu dem dann ein Katalog in französischer Sprache erschien, der eine höhere Verbreitung versprach und vermutlich vor allem nach Frankreich und in die Niederlande versandt wurde. Die Beschreibungen sind auch in der französischen Ausgabe sehr knapp gehalten. In einigen Fällen wurden Werke, die in dem deutschsprachigen Katalog als Schulbilder oder Kopien vorgestellt wurden, nunmehr als eigenständige Gemälde bezeichnet. Bei einigen wenigen Bildern wurde die Zuschreibung verändert, so beispielsweise bei einem Bild aus der Schule von Mieris, das nunmehr als Werk von Frans Hals galt. Im Exemplar BNP sind einige wenige Lose mit Preisangaben annotiert. Ein Auszug des französischen Katalogs wurde in niederländischer Übersetzung bei Hoet veröffentlicht, dort unter dem Titel: "Catalogue van Schilderyen, van de Heer Jan de Gise, verkogt den 30. Augustus 1742. in Bon." Insgesamt werden bei Hoet 46 Gemälde aus dem Katalog herausgezogen und 60
KATALOGE
Kommentar: In einer Einführung ("Avertissement") des Katalogs, wird der "Intendant" Harms als Verfasser genannt. Es handelt sich hierbei um den Braunschweiger Maler Anton Friedrich Harms (1695-1745), der 1737 zum braunschweigischen Hofmaler und 1740 zum Intendanten der Galerie in Salzdahlum ernannt wurde. Für die Salzdahlumer Galerie verfaßte er das erste Inventar, zudem publizierte er 1742 das Werk "Tables historiques et chronologiques des plus fameux peintres anciens et modernes," in dem er rund 1.500 Künstlernamen listenartig aufführt und deren Erwähnung in den wichtigsten biographischen Werken wie Karel van Mander, Ridolfi oder Vasari systematisch nachweist. In der Einführung des Katalogs betont Harms seinen kennerschaftlichen Anspruch, der sich in dem sorgfältig zusammengestellten Katalog widerspiegelt. Die Sammlung sollte geschlossen veräußert werden. Falls sie jedoch keine "Liebhaber finden" sollte, beabsichtigte man, sie in "einzelnen Stücken zu distrahiren." Der Preis der Gemälde mußte bei "Herrn Secretarium Gräfe, in der Burg alhier nechst der Dohm=Kirche" erfragt werden. Dort konnten die Bilder auch besichtigt werden. Wie in der Einführung angegeben, waren alle Bilder mit goldenem oder schwarzem Rahmen versehen. Alle Maßeinheiten beziehen sich auf die Bilder ohne Rahmen. Neben zahlreichen holländischen und flämischen Werken des 17. Jahrhunderts sowie einigen italienischen Bildern lag der Schwerpunkt der Sammlung vor allem auf zeitgenössischer Kunst des 18. Jahrhunderts. Insgesamt finden sich in dem Katalog allein 25 Bilder von Balthasar Denner, drei Werke seines Schülers Domenicus van der Smissen sowie 15 Werke von Christian Wilhelm Emst Dietrich. Zwei Bilder stammten auch von dem Verfasser des Katalogs, Anton Friedrich Harms. Über den Verbleib der Gemälde läßt sich wenig sagen, da sich kein annotiertes Exemplar des Katalogs erhalten hat. Das Gemälde Mars und Venus von Palma Giovane (Nr. 2) befindet sich heute im J. Paul Getty Museum, Los Angeles (71.PA.50). Eine Darstellung mit Adam und Eva im Paradies von Cornells van Haarlem und Roelandt Savery (Nr. 16) wurde am 18. Juni 1785 in einer Versteigerung in Antwerpen (Lugt 3923) als Nr. 323 erneut angeboten. Lit.: Fink 1954, S. 50-52; Ketelsen 1997, S. 169f.
16 1744/05/20
und folgende Tage
[Lugt 706]
[Anonym]; Frankfurt am Main, Auf der kleinen Gallen Gasse Verkäufer nach Titelblatt: von Ucheln Verkäufer: Ucheln, Heinrich von Lose mit Gemälden: 233
Standorte: SBF Nicht annotiert. Titelblatt: Specification derjenigen kostbahren Gemählden welche allhier den 20ten May Anno 1744 Nachmittags und folgende Tage In des Herrn Gerichts Substituti Fließen Behausung auf der kleinen Gallen Gaße aus dem beriimten von Uchelischen Mahlerey=Cabinet an den meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung öffentlich sollen vergantet werden. Franckfurt am Mayn, gedruckt mit Waldowischen Schrifften. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog wurde die Sammlung des Frankfurter Bankiers Heinrich von Ucheln (1682-1746) angeboten. Ucheln widmete sich neben dem Bankgeschäft zunehmend seiner Sammelleidenschaft. Seine Kollektion umfaßte Bücher, Münzen, graphische Blätter und Gemälde. 1744 geriet sein Bankunternehmen in Konkurs. Die Sammlung wurde vermutlich als Teil der Konkursmasse versteigert, denn die Auktion fand im Hause des "Gerichts Substituti Frießen" statt. Bei Lugt wird das Datum der Auktion irrtümlich mit 1749 angegeben. In dem in Tabellenform angelegten Katalog sind die Bilder nur sehr knapp und zumeist schlagwortartig beschrieben. In zwei Spalten der Tabelle werden die Maße angegeben. Insgesamt umfaßt die Kollektion 233 Gemälde, von denen nahezu die Hälfte der holländischen und flämischen Schule zuzurechnen ist. Darunter finden sich jeweils mehrere Bilder von Cornells van Haarlem, Jan van Huysum, Rembrandt und Frans Snyders. Unter den 34 Werken deutscher Künstler finden sich sieben Werke von Adam Elsheimer. Ohne Angabe eines Künstlernamens werden 40 Werke aufgeführt. Lit.: Gwinner I 1862, S. 532; Schmidt 1960, o.P.
17 1747/04/06 [Anonym]; Hamburg Verkäufer nach Titelblatt: Herrn Raths-Herrn Brockes Verkäufer: Brockes, Barthold Heinrich Lose mit Gemälden: 108 Standorte: *LAS Annotiert mit allen Preisen. Titelblatt: Verzeichniß einiger Schildereyen und auserlesener Zeichnungen von den berühmtesten Meistern, so von dem seel. Herrn Raths=Herrn Brockes gesammelt worden, und allhier im April dieses Jahres öffentlich an den Meistbietenden verkaufet werden sollen. Hamburg, gedruckt bey Georg Christian Grund, 1747. Kommentar: Der Dichter Barthold Heinrich Brockes (1680-1747) zählte zu den zentralen Figuren der Frühaufklärung in Hamburg. Er war Mitglied der "Teutsch-übenden Gesellschaft" (1715-1717) und wirkte an der Herausgabe der seit 1724 erscheinenden Wochenschrift "Der Patriot" mit. 1720 wurde Brockes Ratsherr "der hochlöblichen Hamburgischen Republic". Eine "Selbstbiographie" informiert darüber, daß Brockes sich 1704 in Leiden aufhielt, um an der Universität sein juristisches Abschlußexamen zu absolvieren (Lappenberg 1847). Während dieses Aufenthaltes lernte er den Maler Willem van Mieris d.J. kennen. Zugleich hatte er mit dem sehr wohlhabenden Tuchfabrikanten Pieter de la Court van der Voort, einem der bedeutendsten Sammler in Leiden, persönlichen Kontakt. Brockes wird die in dem herrschaftlichen Stadtpalais auf der Rapenburg aufgestellte Sammlung De la Court gekannt haben. Die Errichtung seines eigenen Kabinetts nach der Rückkehr nach Hamburg beschreibt er wie folgt: "[Ich] verschaffte mir ein klein Cabinett von Gemählden ec. und gedachte auf solche Weise mich in Estime zu setzen und beliebt zu machen, welches mir denn eben nicht mißriehte" (Lappenberg 1847, S. 199). Das Exemplar des Auktionskatalogs in Schleswig, von Carsten Zelle (Bochum) entdeckt, befindet sich im Nachlaß von Brockes' ältestem Sohn, Barthold Heinrich Brockes jr. Der Katalog verzeichnet
108 Gemälde, 26 gerahmte und 59 ungerahmte Handzeichnungen sowie einzelne Mappen und vier Lose mit insgesamt 22 Kupferstichen. Unter den verzeichneten Gemälden waren vier Werke von Willem van Mieris (Nrn. 26, 27, 40 und 70) aufgeführt. Darüber hinaus besaß Brockes ein großes Konvolut von Zeichnungen des Leidener Künstlers, darunter die Vorzeichnung für den Titelkupfer zu dem vierten Teil von Brockes' "Irdisches Vergnügen in Gott", ein Indiz für die Fortsetzung des persönlichen Kontakts zwischen Maler und Dichter. Zur Feinmalerei gehören auch ein Selbstbildnis Adriaen van der Werffs und seiner Frau. Neben Werken der flämischen und holländischen sowie der deutschen Schule war Brockes im Besitz von wenigen italienischen Werken (Annibale Carracci, Guercino). Unter den Kennern stand Brockes' Gemäldesammlung bereits zu Lebzeiten in hohem Ansehen. "Lebhaft schwebt mir noch, durch das gütige Accueil dieses würdigen Kenners der Mahlerey (denn unter die Gestalt eigne ich ihn jetzt mir zu), die eigne artige Collection des Hrn. Brockes im Gedächtnis" (Briefe über die Kunst von und an Christian Ludwig von Hagedorn, hg. von Torkel Baden, Leipzig 1797, S. 92, Brief vom 29. Oktober 1750). Die Wertschätzung des Kunstkenners Christian Ludwig von Hagedorn (17 Π Ι 780), kurz nach dem Tode Brockes' geäußert, erscheint um so aussagekräftiger, als er selbst seit Mitte der 30er Jahre mit dem Sammeln von Gemälden begonnen hatte: "Der Beifall eines Dichters und Kunstliebhabers, wie Hr. Brockes, ist mir wirklich nicht gleichgültig" (ebd., S. 93, Brief vom 29. Oktober 1750). Hagedorn gelang es, zwei Gemälde von Willem van Mieris aus der Sammlung Brockes für das eigene Bilderkabinett zu erwerben, wovon eines, laut Eintrag im Auktionskatalog von 1747, "Paris und Venus, das andere eine schlafende Venus, nebst dem Cupido vorstellet". Die beiden Gemälde befinden sich heute in der Gemäldegalerie in Dresden. Lit.: Lappenberg 1847; Barthold Heinrich Brockes (1680-1747). Dichter und Ratsherr in Hamburg. Neue Forschungen zu Persönlichkeit und Wirkung, hg. von Hans-Dieter Loose, Hamburg 1980; Carsten Zelle, Ein klein Cabinett von Gemählden. Zum Versteigerungskatalog von Barthold Heinrich Brockes' Bildersammlung, in: Kemper 1998, S. 29-61; Fechner 1998, S. 73f.; Ketelsen 1997, S. 153174.
18 1748/07/09 [Anonym]; Hamburg? Verkäufer nach Titelblatt: Keine Standorte: SBH Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Kommentar: Dieser anonyme Auktionskatalog ist nur bibliographisch nachweisbar (Realkatalog der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg KD III., Hanseatica Hamburgensia IV, S. 74); Holst 1939, S. 271, führt ihn ebenfalls in seiner Liste. Über den Umfang der Sammlung und den Besitzer liegen keine Informationen vor; nach den Angaben des Realkatalogs enthielt der Katalog Gemälde.
19 1748/10/23 [Anonym]; Hamburg? Verkäufer nach Titelblatt: Keine Standorte: SBH Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Kommentar: Dieser anonyme Auktionskatalog ist nur bibliographisch nachweisbar (Realkatalog der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg KD III., Hanseatica Hamburgensia IV, S. 73); Holst 1939, S. 271, führt ihn ebenfalls in seiner Liste. Über den Umfang der Sammlung und den Besitzer liegen keine Informationen vor. KATALOGE
61
20 1749/07/31 Henrich Rademin; Hamburg, Im Dennerischen Hause, am Gänsemarkt Verkäufer nach Titelblatt: Denner Verkäufer: Denner, Balthasar Lose mit Gemälden: 117 Standorte: *LAS Annotiert mit allen Preisen. Titelblatt: Catalogus einer Sammlung auserlesener Kunst=Mahlereyen, welche am Donnerstage, den 31 Julii, Vormittags um 10 Uhr, im Dennerischen Hause am Gänsemarkt öffentlich an die Meistbietende verkauft werden sollen durch den Auctionarium Henrich Rademin. Hamburg, Anno 1749. Gedruckt mit Piscators Schriften. Kommentar: In dieser Auktion wurden insgesamt 116 Gemälde angeboten, die - dem annotierten Exemplar im Landesarchiv Schleswig zufolge - auch überwiegend verkauft worden sind. Die Sammlung wurde von dem Hamburger Portraitmaler Balthasar Denner (1685-1749) zusammengestellt und nach dessen Tod im ehemaligen Wohnhaus des Künstlers am Hamburger Gänsemarkt durch Hinrich Rademin verauktioniert. Ein Teil der im Auktionskatalog von 1749 verzeichneten 116 Gemälde sollte zuvor in einer Lotterie zusammen mit fünf auf Kupfer gemalten Köpfen von der Hand des Künstlers, einem sog. "Cabinett", veräußert werden. Ein besonderes Titelblatt zur "Einrichtung der Schildereyen=Lotterie" gibt als Grund für die Lotterie an: "Da nun dieses Cabinet nicht wohl kann getrennet werden, und seines Preises wegen nicht so gleich seinen Absatz findet; so ist der Entschluß gefaßt, dasselbe, nebst neun und vierzig andern schönen Gemälden, theils von Denners eigener Hand, theils von andern berühmten Meistern, den Liebhabern in einer Lotterie darzulegen." Den insgesamt 1.000 Losen im Werte zu je 2 Dukaten standen 50 Gewinne in Form von Gemälden im Werte von 2.000 Dukaten gegenüber. Der Hauptgewinn war Denners sog. "Cabinet" im Werte von 1.200 Dukaten, gefolgt von einer Andächtige(n) Frauens=Person (Nr. 1), ebenfalls von Denner im Werte von 450 Dukaten. Die Gemälde konnten wie bei der nachfolgenden Auktion im Hause Denners am Gänsemarkt vorbesichtigt werden, wo auch die Lose erworben werden konnten. Nach dem Verkauf aller Lose sollte mit der Ziehung begonnen und der Termin hierzu in den Tageszeitungen angekündigt werden. Die Lotterie wurde vermutlich nicht durchgeführt. An ihrer Stelle wurde die Sammlung am 31. Juli 1749 in Hamburg öffentlich versteigert. Die knappen Katalogeinträge in dem Auktionskatalog geben nur einen Kurztitel und den Künstlernamen, eine Ordnung ist nicht erkennbar. Überwiegend handelt es sich um holländische Werke des 17. Jahrhunderts sowie um Gemälde deutscher Künstler des 17. und 18. Jahrhunderts wie Christian Wilhelm Ernst Dietrich oder Franz Werner von Tamm. Von Denner selbst standen insgesamt 16 Bilder zum Verkauf, die überdurchschnittliche Preise erzielten und die Popularität des erfolgreichen Künstlers dokumentieren. Nur neun Gemälde wurden italienischen Künstlern zugeschrieben, darunter angebliche Werke von Michelangelo, Veronese und Tintoretto, die jedoch nur zu geringen Preisen zwischen 4 und 15 Talern verkauft wurden. Einen höheren Preis erzielte nur das Parmigianino zugeschriebene Bild Der Raub der Proserpina (Nr. 2). Lit.: Ketelsen 1997.
21 1749/10/04 [Anonym]; Hamburg? Verkäufer nach Titelblatt: Keine Standorte: SBH Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. 62
KATALOGE
Kommentar: Dieser anonyme Auktionskatalog ist nur bibliographisch nachweisbar (Realkatalog der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg KD III., Hanseatica Hamburgensia IV, S. 74); Holst 1939, S. 271, führt ihn ebenfalls in seiner Liste. Über den Umfang der Sammlung und den Besitzer liegen keine Informationen vor; nach den Angaben des Realkatalogs enthielt der Katalog Gemälde und Kupferstiche.
22 1750/00/00
Daten unbekannt
[Anonym]; Hamburg? Verkäufer nach Titelblatt: Keine Standorte: SBH Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Kommentar: Dieser anonyme Auktionskatalog ist nur bibliographisch nachweisbar (Realkatalog der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg KD III., Hanseatica Hamburgensia IV, S. 74); Holst 1939, S. 271, führt ihn ebenfalls in seiner Liste. Über den Umfang der Sammlung und den Besitzer liegen keine Informationen vor; nach den Angaben des Realkatalogs enthielt der Katalog Gemälde und Kupferstiche.
23 1750/00/00
Daten unbekannt
[Lugt 651]
[Anonym]; Köln Verkäufer nach Titelblatt: Delaisse par feu S.E. Möns, le Comte Ferdinand de Hohenzollern, Grand Maitre de la Maison de S.A.S.E. de Cologne, son Premier Ministre, Grand Doien de l'Eglise Metropolitaine de Cologne, Grand Chanoine de Strasbourg &c. Verkäufer: Hohenzollern, Ferdinand Leopold Anton, Graf von Lose mit Gemälden: 244 Standorte: BNP Nicht annotiert. Titelblatt: Catalogue D'un Cabinet de Tableaux, Tres bien conserves, partie de Maitres Italiens, partie de maitres Flamands, le tout en cadres, proprement dores, & artistement travailles dans le gout Francois, delaisse par feu S.E. Möns, le Comte Ferdinand de Hohenzollern, Grand Maitre de la Maison de S.A.S.E. de Cologne, son Premier Ministre, Gran Doien de l'Eglise Metropolitaine de Cologne, Grand Chanoine de Strasbourg &c. La mesure est du ρίέ de Rhin, & la qualite est determinee sans exageration, & dans l'estimation la plus sincere. Cologne, chez Schauberg. Kommentar: Bei diesem Versteigerungskatalog handelt es sich um den Verkauf der Sammlung von Ferdinand Leopold Anton Graf von Hohenzollern (1692-1750). Er diente am Hofe des Kurfürsten Clemens August als erster Staatsminister und war zudem Probst der Erzbistümer Köln und Straßburg sowie Kanzler der Universität Bonn. Im Umkreis des als Mäzen der Künste auftretenden Kurfürsten engagierten sich mehrere Hofbeamten als Kunstsammler, so dessen Bruder Franz Heinrich Christoph Anton Graf von Hohenzollern (Kat. 54), der Leibarzt Johann Heinrich von Gise (Kat. 14 und 14a) und Ferdinand Graf von Plettenberg, dessen Sammlung 1738 und 1744 in Amsterdam versteigert wurde (Lugt 480 und 578). Es ist nicht ganz klar, wann und wo die Auktion stattfand. Auf der Titelseite des französischsprachigen Katalogs ist kein Datum angegeben, jedoch ist auf dem Exemplar BNP handschriftlich das Jahr 1746 eingetragen. Da Ferdinand von Hohenzollern jedoch erst 1750 verstarb und auf der Titelseite von "feu" die Rede ist, kann die Auktion erst nach dessen Tod im Jahre 1750 stattgefunden haben. In der Einleitung zum Katalog ("Avis") wird darauf hingewiesen, daß Interessenten ihre Anfragen an "Sr. Martin Guaita, Banquier ä Cologne" richten können, "sur le Marche au soin". Die Sammlung setzt sich zu rund zwei Dritteln aus niederländischen und flämischen Werken des 17. und 18. Jahrhunderts zusam-
men, die größtenteils prominenten Künstlern zugeordnet werden. So finden sich allein sieben Gemälde von Peter Paul Rubens, sieben Werke von Jan Brueghel d.Ä. und vier Bilder von Jan Fyt. Insgesamt ist das Spektrum der vertretenen Künstler weit gefächert. Unter den rund 30 Bildern deutscher Provenienz fallen fünf Hans Holbein d.J. zugeschriebene Portraits auf, wobei Holbein hier wahrscheinlich nur als Sammelname für altdeutsche Portraits fungiert. Unter den deutschen Zeitgenossen ragt vor allem Franz Werner von Tamm mit vier Werken hervor. Ebenfalls mit vier Gemälden vertreten ist der Kölner Maler Johann Hulsman, der in der ersten Hälfte des 17. Jahrhundert tätig war. In den knappen Beschreibungen wird öfters auf den ausgezeichneten Zustand der Gemälde hingewiesen; auch finden sich durchgängig ästhetische Beurteilungen. Interessant ist der Hinweis auf "le jeune Douven", der ein Gemälde von Dou (Nr. 132) beendet habe. Der Bruder des Sammlers, Franz Heinrich Christoph Anton Graf von Hohenzollern (1699-1767), scheint 119 Gemälde übernommen zu haben, denn sie tauchen in der Versteigerung von dessen Sammlung erneut auf (Kat. 54). Lit.: Stübel 1912, S. 115-119, 210.
24 1750/04/00 [Anonym]; Hamburg, Hinter den Bleichen, in einem wolbekannten Hause, dem Apothecker=Hofe gegen über
Kommentar: In diesem anonymen Versteigerungskatalog des Auktionators Hinrich Rademin wurden insgesamt 104 Bilder angeboten, die mit knappen Texten beschrieben sind. Nahezu die Hälfte der offerierten Bilder ist anonym. Von den zugeschriebenen Bildern ist der größte Teil den holländischen und flämischen Schulen zuzurechnen. Zwölf Gemälde werden der deutschen Schule zugeschrieben, weitere zwölf gehören zu einem Apostelzyklus von der Hand eines nicht weiter zu bestimmenden Künstlers "Krafft" (Nrn. 73 bis 84). Kein einziges Bild ist italienischen Ursprungs. Insgesamt zeigt sich hier das Bild einer auf den norddeutschen Raum ausgerichteten, wenig umfangreichen bürgerlichen Sammlung, die thematisch vor allem auf Genrebilder und Landschaften ausgerichtet war. Lit.: Ketelsen 1997.
26 1750/10/15 [Anonym]; Hamburg Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 92 Standorte: *LAS Annotiert in Bleistift mit allen Preisen, die sich allerdings in der uns zur Verfügung stehenden Kopie nicht alle eindeutig entziffern ließen; sie wurden deshalb nur teilweise in den Datenbestand aufgenommen. SBH Im Zweiten Weltkrieg vernichtet.
Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 87 Standorte: LAS Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß rarer und sauberer auf Kupfer, Leinwand und Holtz gemahlten Schildereyen, von den besten Meistern verfertiget; wie auch eine nombreuse Anzahl schöner Kupferstiche, und Zeichnungen von Statuen, Brust=Bildern, das Theatrum Doloris Christi, complet, nebst andern säubern Rissen ec. welche den [Zwischenraum zur handschriftlichen Ergänzung des Datums] April, hinter den Bleichen, in einem wolbekannten Hause, dem Apothecker=Hofe gegen über, in öffentlichem Ausrufe sollen verkaufet werden. Anno 1750. Kommentar: In dieser anonymen Hamburger Versteigerung gelangten insgesamt 87 Gemälde zum Verkauf. Außerdem wurden Zeichnungen und Kupferstiche in Konvoluten angeboten. Die meisten Gemälde sind Künstlernamen zugeordnet, davon der größte Teil holländischen Künstlern des 17. Jahrhunderts. Fünf Gemälde sind italienischen Ursprungs, darunter ein Hl. Hieronymus von Caravaggio (Nr. 3). Einige wenige Bilder stammen von deutschen Künstlern des 18. Jahrhunderts, so etwa von Balthasar Denner oder von dem Hamburger Maler Hans Hinrich Rundt. Die Grablegung Christi von Lucas van Leyden (Nr. 87) wird als "extra rare Antiquitaet" angepriesen.
25 1750/06/15 Hinrich Rademin; Hamburg, Börsensahl Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 103 Standorte: LAS Nicht annotiert. Titelblatt: Catalogue einer Sammlung mehrentheils Holländischer und Niederländischer Mahlereyen die Montags den 15ten Junii a.c. auf hiesigen Börsensahl öffentlich verkauft werden sollen, durch den Auctionarium Hinrich Rademin. Gedruckt im güldenen ABC. bey der Börse. Hamburg, Anno 1750.
Titelblatt: Verzeichnis auserlesener, schöner und köstlicher Schildereyen, welche von denen berühmtesten Teutschen, Italiänischen, Französischen und Holländischen Meistern in ihren besten Zeiten gemahlet, und allesamt wohl conditioniret, auch theils in vergüteten, theils in schwartzen mit goldenen Leisten versehenen Rähmen eingefasset sind, welche, nebst einer Sammlung vortrefflicher Kupferstiche, wovon das Verzeichnis mit diesem zugleich ausgegeben wird, in Hamburg den [15; handschriftliche Ergänzung] October 1750. in öffentlicher Auction an den meistbietenden verkauffet werden sollen. Gedruckt mit Spieringischen Schriften. Kommentar: In diesem anonymen Versteigerungskatalog wurden insgesamt 92 Gemälde offeriert. Gebote sollten an "Doctor Altmann" gerichtet werden, vermutlich ein Nachfahre des verstorbenen Sammlers. Verkaufsort und genauer Verkaufstermin sollten in der Zeitung annonciert werden. Alle Beschreibungen sind kurz gehalten, für alle Bilder werden die Maße angegeben. Obwohl es sich nur um eine kleine Sammlung handelt, ist das breite Spektrum auffallig. Neben einigen holländischen und flämischen Werken des 17. Jahrhunderts finden sich in dieser Sammlung mit insgesamt 35 Arbeiten auch ungewöhnlich viele italienische Werke, darunter zwei Bilder von Giorgione sowie je drei Arbeiten von Tizian und Veronese. Drei Gemälde werden Niederländern des 15. und 16. Jahrhunderts zugeschrieben (Gillis van Coninxloo, Karel van Mander und Jan van Eyck). Rund 20 Bilder werden als anonyme Werke geführt.
27 1751/10/25 [Anonym]; Hamburg? Verkäufer nach Titelblatt: Keine Standorte: SBH Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Kommentar: Dieser anonyme Auktionskatalog ist nur bibliographisch nachweisbar (Realkatalog der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg KD III., Hanseatica Hamburgensia IV, S. 74); Holst 1939, S. 271, führt ihn ebenfalls in seiner Liste. Über den Umfang der Sammlung und den Besitzer liegen keine Informationen vor; nach den Angaben des Realkatalogs enthielt der Katalog Gemälde und Kupferstiche. KATALOGE
63
Verkäufer nach Titelblatt: Keine
28 1751/11/11
Lose mit Gemälden: 297
[Anonym]; Hamburg? Verkäufer nach Titelblatt: Keine Standorte: SBH Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Kommentar: Dieser anonyme Auktionskatalog ist nur bibliographisch nachweisbar (Realkatalog der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg KD III., Hanseatica Hamburgensia IV, S. 74); Holst 1939, S. 271, führt ihn ebenfalls in seiner Liste. Über den Umfang der Sammlung und den Besitzer liegen keine Informationen vor; nach den Angaben des Realkatalogs enthielt der Katalog Gemälde.
29 1752/00/00
Verkäufer nach Titelblatt: Keine Verkäufer nach anderer Quelle: Hofrat Neubauer Verkäufer: Neubauer, Lorenz Wilhelm Lose mit Gemälden: 218 Standorte: *SBN Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß einer kostbarn Gemählde=Sammlung / welche in Nürnberg verkauft wird. Die Resp. Liebhabere belieben sich an Herrn Wilhelm Wolff, Kupferhändler in der Weisgerber=Gasse das selbst zu addressiren, und von den Verkäufern alle Billigkeit zu erwarten. Das Maas der Gemähide hat in Eile nicht beygesetzt werden können; die Taxe aber ist von einem der berühmtesten Maler gemacht worden. Die Gemähide sind sauber conseviret, und fast alle in kostbare wenigstens saubere Rahmen eingemachet. Kommentar: In diesem anonymen Auktionskatalog wurde die Gemäldesammlung des Nürnberger Gelehrten und Hofrates Lorenz Wilhelm Neubauer (1701-1752) verzeichnet, wie sich aus den Angaben des Nürnberger "Gelehrten=Lexicon" erschließen läßt. Der Auktionskatalog erschien zweisprachig. Im Exemplar SBN folgt einem deutschen Teil eine Wiederholung in italienischer Sprache mit einer neuen Seitenzählung. Das Vorhandensein einer italienischen Ausgabe dokumentiert die engen Handelsbeziehungen Nürnbergs mit den oberitalienischen Städten, deren Handelsvertreter sich regelmäßig in Nürnberg aufhielten und auch Kunstwerke für den italienischen Markt erwarben. Erstaunlicherweise finden sich dennoch nur zwei italienische Bilder. Neben 46 holländischen und flämischen Gemälden des 17. Jahrhunderts lag der Schwerpunkt der Sammlung auf Nürnberger Kunst des 18. Jahrhunderts. Allein 35 Bilder stammen von dem Nürnberger Künstler Georg Eisenmann. Ebenso zahlreich sind Mitglieder der Nürnberger Künstlerfamilien Dietzsch und Bemmel vertreten. Alle Bilder des Katalogs wurden durch einen "der berühmtesten Maler taxiert", vermutlich durch Georg Eisenmann selbst oder einen Vertreter der Künstlerfamilien Dietzsch oder Bemmel. Die höchsten Preise wurden für die holländischen Bilder verlangt, so beispielsweise 350 Taler für ein Gesellschaftsstück von Mieris (Nr. 1), während die Werke der Nürnberger Künstler meist für weniger als 10 Taler angeboten wurden. Eine Darstellung des Hl. Hieronymus mit Löwe und Hund von Albrecht Dürer (Nr. 46) wurde auf 8 Taler taxiert. Lit.: Georg Andreas Will, Nürnbergisches Gelehrten=Lexicon oder Beschreibung aller Nürnbergischen Gelehrten beyderley Geschlechtes nach Ihrem Leben / Verdiensten und Schrifften zur Erweiterung der gelehrten Geschichtskunde und Verbesserung vieler darinnen vorgefallenen Fehler aus den besten Quellen in alphabetischer Ordnung, Nürnberg/Altdorf 1755-1758, Bd. 3, S. 25-28.
und folgende Tage
[Lugt 786]
[Anonym]; Leipzig, Im rothen Collegio 64
Titelblatt: Verzeichniß einer schönen Sammlung von guten Schildereyen ingleichen Pretiosis, Silberwerck, Zinn, Kupfer, Messing, Wäsche, Spiegeln, Kleidern, Tisch- und Bettzeug, Federbetten und andern brauchbaren Mobilien, welche auf Anordnung E. Hochl. Universität zu Leipzig den 8. May und folgende Tage 1752. von 10. bis 12. und 3. bis 6. Uhr gerichtlich im rothen Collegio an die Meistbiethenden gegen baare Bezahlung in tüchtiger Müntze sollen überlaßen werden. Leipzig, gedruckt bey Johann Christian Langenheim.
Daten unbekannt
Herr Wilhelm Wolff; Nürnberg, Weisgerber=Gasse [?]
30 1752/05/08
Standorte: *BDu Annotiert mit den meisten Käufernamen und den meisten Preisen.
KATALOGE
Kommentar: In diesem frühen Versteigerungskatalog aus Leipzig sind 271 Losnummern mit Gemälden verzeichnet (Seiten 3 bis 22). Teilweise wurden zwei Bilder unter einer Nummer zusammengefaßt. Außerdem wurden noch zwei Elfenbeinskulpturen (Nrn. 197 und 198) und einige Zeichnungen und Miniaturen (Nrn. 200 und 201, 251) zwischen den Gemälden aufgeführt. Rund zwei Drittel der Gemälde bleiben jedoch unbestimmt, in anderen Fällen weicht die Schreibweise der Künstlernamen von der gebräuchlichen Schreibweise stark ab (Paul Brühlen; Bregel oder Anton de Dück). Von den bezeichneten Gemälden gehören rund 30 der holländischen oder flämischen Schule des 17. Jahrhunderts an, eine etwas geringere Anzahl den italienischen Schulen und der deutschen Schule. Von den deutschen Bildern werden insgesamt drei Gemälde "Martin Schön" (Schongauer) und sechs Bilder "Carl Lotten" (Johann Carl Loth) zugesprochen. Im Exemplar des Katalogs bei Börner in Düsseldorf sind die Namen der Käufer und Preisangaben in Talern und Groschen vermerkt. Die Preise sind überwiegend niedrig, nur einzelne Bilder erzielten mehr als 10 Taler, die meisten deutlich weniger. Ein Bild von Jan van Eyck mit Maria und Hl. Barbara und Hl. Catharina (Nr. 170) wurde bei dem relativ hohen Preis von 17 Talern und 20 Groschen zugeschlagen. Einige der Gemälde tauchen in der Protokolliste der Sammlung Böttcher aus dem Jahre 1759 (Kat. 34) wieder auf (Nrn. 52, 54, 93). Unter den Käufern findet sich auch der kursächsische Sammler Johann Thomas Richter (Nrn. 120, 166, 205,179a). Lit.: Trautscholdt 1957, S. 219f., Abb. 2 (Titelblatt) und Abb. 3 (S. 15 des Katalogs); nach Anm. 3 erschien am 9.3.1933 ein Artikel über diese Auktion in der Neuen Leipziger Zeitung.
31 1755/08/21 [Anonym]; Hamburg? Verkäufer nach Titelblatt: Keine Standorte: SBH Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Kommentar: Dieser anonyme Auktionskatalog ist nur bibliographisch nachweisbar (Realkatalog der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg KD III., Hanseatica Hamburgensia IV, S. 74); Holst 1939, S. 271, führt ihn ebenfalls in seiner Liste. Über den Umfang der Sammlung und den Besitzer liegen keine Informationen vor; nach den Angaben des Realkatalogs enthielt der Katalog Gemälde.
32 1756/05/18 [Anonym]; Hamburg? Verkäufer nach Titelblatt: Keine Standorte: SBH Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Kommentar: Dieser anonyme Auktionskatalog ist nur bibliographisch nachweisbar (Realkatalog der Staats- und Universitätsbiblio-
thek Hamburg KD III., Hanseatica Hamburgensia IV, S. 74); Hoist 1939, S. 271, führt ihn ebenfalls in seiner Liste. Über den Umfang der Sammlung und den Besitzer liegen keine Informationen vor; nach den Angaben des Realkatalogs enthielt der Katalog Gemälde. 33 1758/05/24 [Anonym]; Hamburg? Verkäufer nach Titelblatt: Keine Standorte: SBH Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Kommentar: Dieser anonyme Auktionskatalog ist nur bibliographisch nachweisbar (Realkatalog der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg KD III., Hanseatica Hamburgensia IV, S. 74); Holst 1939, S. 271, führt ihn ebenfalls in seiner Liste. Über den Umfang der Sammlung und den Besitzer liegen keine Informationen vor; nach den Angaben des Realkatalogs enthielt der Katalog Gemälde.
cher-Liste identifizieren läßt. In einer vierten und letzten Sendung im Juni 1760 kaufte Karoline Luise ein weiteres Bild, eine Schlafende Venus von Sandrart (Nr. 191). In der Sammlung Böttcher waren vor allem holländische und flämische Werke des 17. Jahrhunderts sowie deutsche Gemälde vertreten, jedoch auch 25 italienische Bilder. Unter den deutschen Werken finden sich allein 15 Gemälde Alexander Thieles sowie fünf Werke von Christian Wilhelm Emst Dietrich. An diesem Schwerpunkt läßt sich auch die sächsische Herkunft der Sammlung ablesen. Über den Verbleib der übrigen Bilder der Sammlung Böttcher ist bisher nichts bekannt; vermutlich wurden sie von Eberts an verschiedene Interessenten verkauft. Alle Bilder in der Böttcher-Liste sind mit Preisen versehen, wobei es sich vermutlich um Schätzpreise handelt. Das Preisniveau lag sehr hoch und orientierte sich an Preiserwartungen des Kunstmarkts in Paris und London. Lit.: Kreuchauf 1768; Kircher 1933, S. 113-115; Trautscholdt 1957; Lauts 1980, S. 155-164. 35 1760/06/02
34 1759/00/00
Daten unbekannt
Eberts; Leipzig Verkäufer nach Titelblatt: Böttcher Verkäufer: Böttcher Lose mit Gemälden: 212 Standorte: *AK Handschriftliche Liste mit Schätzpreisen. Kommentar: Bisher ließ sich kein Katalog der Leipziger Sammlung Böttcher auffinden. Als eine bedeutende Leipziger Sammlung wird diese in dem Vorwort Kreuchaufs zum Katalog der Sammlung Winckler erwähnt. Da ansonsten kein weiteres gedrucktes Zeugnis erhalten ist, bleibt auch die Identität Böttchers im Dunkeln. Möglicherweise handelt es sich um Johann Zacharias Böttiger (get. 1701), der 1753 als Leipziger Bürger und Kaufmann erwähnt wird. Im Archiv der Markgrafen von Baden ist eine handschriftliche Angebotsliste mit insgesamt 212 Nummern erhalten, die hier der Auswertung zugrunde gelegt wird. Diese Liste wurde von dem Kunsthändler Jean-Henri Eberts 1759 an Karoline Luise von Baden geschickt. Mit Hilfe von Eberts baute Karoline Luise von Baden in wenigen Jahren eine beachtliche Gemäldesammlung auf. Zahlreiche Werke aus ihrem "Malerey-Cabinet" befinden sich heute in der Kunsthalle Karlsruhe. Karoline Luise bemühte sich besonders um holländische und flämische Werke des 17. und 18. Jahrhunderts. Aus der Angebotsliste der Sammlung Böttcher ließ sich die Markgräfin acht Bilder zur Ansicht schicken, von denen sie fünf Gemälde auswählte. Sie erwarb ein Blumenstilleben von Rachel Ruysch (Nr. 44), eine Landschaft von Nicolaes Pietersz. Berchem (Nr. 163), zwei Adriaen Brouwer zugeschriebene Bauernstücke (Nrn. 64 und 65) und einen Blumenstrauß in Vase von Jacob Campo Weyerman (Nr. 208). Nur das Bild von Weyerman befindet sich heute in der Kunsthalle Karlsruhe (Inv.-Nr. 382). Karoline Luise erbat noch eine zweite Ansichtssendung mit insgesamt vier Bildern, von denen sie zwei erwarb. Es handelt sich um eine Nächtliche Feuersbrunst in einer holländischen Stadt von Egbert van der Poel und den Der Zusammenstoß (le pot au lait) von Philips Wouwerman. Für beide Bilder sollte Karoline Luise 600 Taler zahlen, sie bot dagegen nur 400. Sie einigte sich schließlich mit Eberts auf den Preis von 500 Talern. Der Wouwerman stellte sich jedoch später als eine Kopie von Pieter Wouwerman nach einem Bild seines Bruders Philips heraus, das die Dresdener Gemäldegalerie 1742 erworben hatte. Sowohl das Bild von Pieter Wouwerman als auch der Egbert van der Poel befinden sich heute in der Kunsthalle Karlsruhe. In zwei weiteren Ansichtssendungen im Jahre 1760 erwarb Karoline Luise nochmals zwei Frucht- und Blumenstücke von Nicolaes van Gelder (Nrn. 80 und 81) sowie ein Stilleben von Jan Davidsz. de Heem, das sich jedoch nicht zweifelsfrei in der Bött-
[Anonym]; Hamburg? Verkäufer nach Titelblatt: Keine Standorte: SBH Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Kommentar: Dieser anonyme Auktionskatalog ist nur bibliographisch nachweisbar (Realkatalog der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg KD III., Hanseatica Hamburgensia IV, S. 74); Holst 1939, S. 271, führt ihn ebenfalls in seiner Liste. Über den Umfang der Sammlung und den Besitzer liegen keine Informationen vor; nach den Angaben des Realkatalogs enthielt der Versteigerungskatalog Kupferstiche. Es ist nicht sicher, ob sich darunter auch Gemälde befanden. 36 1762/08/02
[Lugt 1234]
[Anonym]; Frankfurt am Main, Haus des Sammlers Verkäufer nach Titelblatt: Vir Illustris ac Doctissimus Hieronimus von der Lahr, J.U.L. pie defunctus Verkäufer: Lahr, Hieronimus von der Lose mit Gemälden: 1 Standorte: SBBa Nicht annotiert. Aus dem Besitz von Joseph Heller. SBF Nicht eingesehen. Nach Lugt nicht annotiert. KBH Nicht eingesehen. Nach Lugt nicht annotiert. Titelblatt: Catalogue Pulcherrimae Collectionis Imaginum aere excusarum, maxime ä Clarissimis Artificibus inuentarum, (cui praefixa sunt quaedam Mscripta.) Quas dum viueret prouida cura, maximisque sumtibus Collegit, Vir Illustris ac Doctissimus Hieronimus von der Lahr, J. U. L. pie defunctus. Consueris publicae auctionis legibus, finita Bibliothecae Mscriptorum, ac tam antiquorum quam modernorum numismatum licitatione publica, cuius terminus ad 2. Aug. 1762. praefixus est, aedibus Lahrianis Francofurti ad Moenum distrahendarum. Hanoviae, Typis Bachmannianis. Kommentar: In erster Linie werden in diesem Versteigerungskatalog der Sammlung Hieronimus von der Lahr graphische Blätter und Kupferstiche angeboten. Auf der Rückseite des Titelblattes wird ein einziges anonymes Gemälde (Götterstück) aufgeführt. Im Jahre 1775 wurde erneut eine Sammlung von der Lahr angeboten, die vor allem Gemälde enthielt (vgl. Kat. 81). Lit.: Gwinner I 1862, S. 533; Schmidt 1960, o.P. 37 1763/00/00
Daten unbekannt
[Lugt 1338]
[Anonym]; Berlin KATALOGE
65
Verkäufer nach Titelblatt: Herr Johann Gottlieb Stein Verkäufer: Stein, Johann Gottlieb Lose mit Gemälden: 66 Standorte: SBB Nicht annotiert. SRP Heutiger Aufbewahrungsort unbekannt. Nach Lugt nicht annotiert. HKB Nicht annotiert. JPGM Nicht annotiert. HABW Nicht eingesehen. Titelblatt: Beschreibung des Cabinets von Gemählden verschiedener berühmten Mahler, des Herrn Johann Gottlieb Stein. Berlin, gedruckt bey Friedrich Wilhelm Birnstiel, Königl. privileg. Buchdrukker. 1763. Kommentar: Es handelt sich um keinen Auktionskatalog, sondern um das Verzeichnis der Sammlung Johann Gottlieb Stein, verfaßt von Matthias Oesterreich, der seit 1757 das Amt des Galerieinspektors in Sanssouci ausübte. Stein hatte als Getreidehändler ein größeres Vermögen zusammengebracht und mit Hilfe von Johann Ernst Gotzkowsky (vgl. Kat. 43) auch eine Gemäldesammlung aufgebaut. Nachdem Stein im Zuge der Wirtschaftskrise 1763/64 in finanzielle Schwierigkeiten geraten war, entzog er sich zunächst seinen Gläubigern durch eine Flucht nach Amsterdam, wurde dann aber nach Berlin ausgeliefert. Vermutlich übernahmen seine Gläubiger, zu denen auch Johann Emst Gotzkowsky, Martin Schultze und das Bankhaus Leveaux zählten, seine Gemäldesammlung. Stein wurde 1766 schließlich wegen betrügerischen Bankrotts zu vier Jahren Festungshaft verurteilt. In der Einleitung des Katalogs ("An die Liebhaber der Mahlerey", datiert: "Berlin den 22sten May Ao.1763") führt Oesterreich aus, daß er bereits zwei andere "Beschreibungen" geschrieben habe. Es handelt sich um die Kataloge der Sammlung Gotzkowsky von 1757 (französische Ausgabe; die deutsche Ausgabe stammt aus dem Jahre 1759; vgl. Kat. 43) sowie der Sammlung Eimbke aus dem Jahre 1761 (vgl. Kat. 46). Im selben Jahr wie der Katalog der Sammlung Stein erschien noch ein weiteres von Oesterreich verfaßtes Verzeichnis, in dem die Sammlung Stenglin dokumentiert wird. In der Losnummer 23 (S. 54) verweist Oesterreich auf die Sammlung Gotzkowsky (vgl. auch Nrn. 52/53, S. 106) und auf die Sammlung Eimbke (vgl. auch S. 119, Nr. 65). Oesterreich vergleicht seine Arbeit mit denjenigen von Johan van Gool, J. B. Decamps (La Vie des Peintres Flamands) sowie Gerard Hoet; letzteren kannte er auch als Bilderhändler aus Den Haag. Mit seinen Beschreibungen will Oesterreich potentiellen Kunstsammlem eine Anleitung geben und "die verschiedenen Mahlerarten der Meister bekannt" machen. Seine Beschreibung der Sammlung Stein hat denn auch zuweilen enzyklopädischen Charakter und ist in ihrem Anspruch wissenschaftlich. Am Ende des Katalogs findet sich ein Index der Künstlernamen. Der Katalog selbst ist nach Schulen gegliedert (Italiener, Niederländer etc.). Zu den einzelnen Gemälden werden zunächst reine Sachinformationen gegeben: Künstlername, Gegenstand, Material, Maßangaben. Es folgt eine längere Beschreibung der jeweiligen Darstellung, in der Oesterreich die jeweiligen Ausdrucksqualitäten hervorzuheben sucht. Anschließend gibt Oesterreich einen Abriß über die Vita des jeweiligen Künstlers, der sich in einzelnen Fällen, etwa bei Salvator Rosa (Nr. 1, S. 1 bis 11), zu einer regelrechten Biographie entwickeln kann. Im Text und in den Anmerkungen verweist Oesterreich auf die Vitenliteratur (Baglione, Passeri, D'Argenville, van Mander etc.). Außerdem macht Oesterreich Angaben zur Provenienz zahlreicher Bilder. Viele der italienischen Gemälde stammten aus der Sammlung Carl Heinrich von Heinecken, die 1757 in Paris durch Pierre Remy zusammen mit Bildern anderer Sammler versteigert wurde (Lugt 979). Oesterreich erwähnt zwar in seinen Anmerkungen diesen Versteigerungskatalog, doch wurden diese Bilder in Paris vermutlich nicht verkauft und gelangten daraufhin in die Sammlung Stein. In dem Pariser Versteige66
KATALOGE
rungskatalog finden sich die Flucht nach Ägypten von Niccolö Berrettoni (Nr. 5; Lugt 979, Nr. 5), das Opfer an der Bildsäule von Sebastiano Ricci (Nr. 6; Lugt 979, Nr. 20), Eine Nymphe und ein Satyr von Michele Rocca (Nr. 7; Lugt 979, Nr. 10), eine Circe von Cignaroli (Nr. 9; Lugt 979, Nr. 18) und von Tiepolo Die Göttin Flora (Nr. 8; Lugt 979, Nr. 25). Oesterreich verweist nur bei dem BerrettoniGemälde darauf, daß dieses Bild aus der Sammlung Heinecken stammt. In manchen Fällen wird die Provenienz noch weiter zurückverfolgt: Das Bild Tiepolos (Nr. 8) entstand nach den Aussagen Oesterreichs im Auftrag des Grafen Francesco Algarotti, der für August III. von Sachsen in Venedig als Kunstagent unterwegs war und in engem Kontakt zu Tiepolo stand. Die Circe (Nr. 9) wurde im Auftrag des Grafen Accoramboni von Cignaroli gemalt. Zu einzelnen Gemälden werden Vergleichsbeispiele genannt. So erwähnt Oesterreich bei einem Gemälde von J. Buck (Nr. 47) auch zwei andere Bilder des Malers, von denen sich das eine in der Berliner Sammlung Christian Christoph Engel befinde, das andere in der Sammlung des Grafen Heinrich IX. von Reuß. Bei dem Stilleben mit Vögeln (Nr. 43) von Melchior d'Hondecoeter führt Oesterreich an: "Der Herr Johann Ernst Gotzkowsky hat ohnstreitig drey der besten Gemähide von diesem Meister" (S. 88). Hin und wieder werden auch Vergleichsbeispiele in den Sammlungen des Herzogs von Pfalz-Zweibrücken (vgl. Kat. 267), der braunschweigischen Sammlung in Salzdahlum oder der Kollektion im Schloß Schleißheim angeführt. Der größte Teil der insgesamt 66 Gemälde der Sammlung Stein stammt von holländischen und flämischen Künstlern des 17. Jahrhunderts. Neun Arbeiten sind italienischen Künstlern zugeschrieben, zehn Bilder stammen von deutschen Malern, vorwiegend aus dem 18. Jahrhundert. Lit.: Rachel/Wallich 1967, Bd. 2, S. 437-441.
38 1763/01/03 [Anonym]; Hamburg? Verkäufer nach Titelblatt: Keine Standorte: SBH Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Kommentar: Dieser anonyme Auktionskatalog ist nur bibliographisch nachweisbar (Realkatalog der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg KD III., Hanseatica Hamburgensia IV, S. 74); Holst 1939, S. 271, führt ihn ebenfalls in seiner Liste. Über den Umfang der Sammlung und den Besitzer liegen keine Informationen vor; nach den Angaben des Realkatalogs enthielt der Versteigerungskatalog Kupferstiche. Es ist nicht sicher, ob sich darunter auch Gemälde befanden.
39 1763/01/17 [Anonym]; Hannover, Haus des Sammlers Verkäufer nach Titelblatt: Feu Mr. le Grand Drossart de Reden Verkäufer: Reden, Wilhelm Johann von Lose mit Gemälden: 218 Standorte: RKDH Nicht annotiert. AK Nicht annotiert. KH Nicht eingesehen. Titelblatt: Catalogue d'une rare Collection de Tableaux, d'ont on va faire une Lotterie, selon le Plan de ce meme date, & qui se trouve ä Hannovre dans la maison de feu Mr. le Grand Drossart de Reden. Imprime ä Hannovre le 17me Janv. 1763. Kommentar: Bei diesem Katalog handelt es sich um das Verzeichnis einer Lotterie, mit der die Sammlung von Wilhelm Johann von Reden (1688-1760) verkauft wurde. Reden stand als Landdrost in kur-
hannoverischen Diensten. Die Gemälde wurden in zwei Sektionen zu 84 und 136 Stück angeboten. Ein "Avertissement" vom 17.1.1763, das sich im Bestand der Markgräfin Karoline Luise von Baden im Landesarchiv Karlsruhe erhalten hat, macht mit dem Reglement der Lotterie vertraut. Die Lotterie wurde unter der Direktion der Erben und des "Berghandlungs=Buchhalters" von Rönne durchgeführt. Insgesamt wurden 4.000 Lose verkauft, von denen die Hälfte gewinnberechtigt war. Der Gesamteinsatz betrug 15 Reichstaler, wobei sich der Einsatz auf Anteile in drei verschiedenen Klassen verteilte. Der Losanteil für die erste Klasse betrug 2 Vi Taler, für die zweite Klasse 5 und für die dritte Klasse 7 Taler. In der Kalkulation für die Lotterie wurde jedoch nur der Verkauf von 3.500 Losen in der 5-Taler-Klasse und von 3.000 Losen in der 7,5-Taler-Klasse berechnet, so daß die Gesamteinnahmen sich nur auf 50.000 statt 60.000 Taler beliefen. Dies hängt vermutlich damit zusammen, daß nach dem Reglement Teilnehmer, die den vollen Einsatz von 15 Talern auf einmal bezahlt hatten und in der ersten oder zweiten Klasse gewannen, den zuviel bezahlten Einsatz wieder zurückerhalten konnten. Der Wert der Gewinne entsprach dem Einsatz der Teilnehmer der Lotterie. Die einzelnen Bilder wurden abgestuften Schätzwerten zugeordnet, die von 1.500 Talern bis zu 30 Talern reichten. Zahlreiche Gewinne wurden nicht in Bildern, sondern in Geld ausgezahlt. Die erste Ziehung für die erste Klasse war auf den 2. Mai festgelegt worden, die beiden weiteren Ziehungen sollten erst sechs Wochen später stattfinden. In dem "Avertissement" wird die Sammlung unter Punkt 12 folgendermaßen angepriesen: "Die Schildereyen sind auserlesen schön, von den besten Mahlem verfertigt, und von den Herrn Moreel, Heiderix und mehreren Kennern über 20.000 Rthlr. werth taxiret, mithin über 4.000 Rthr. mehr werth, als wozu sie im Plan angeschlagen worden, welches Kennere aus dem bey einem jeden Collecteur umsonst zu erhaltenden Catalogo derselben, mit mehrern ersehen werden." Alle Bildbeschreibungen des französisch abgefaßten Lotteriekatalogs sind kurz gehalten, zumeist in einem Satz, allerdings mit Angabe des Künstlers. Die Maße der einzelnen Bilder werden tabellarisch angegeben. Alle Beschreibungen sind nach den Angaben des "Avertissement" von einem zwei Jahre zuvor gedruckten Katalog übernommen, der bisher nicht aufgefunden werden konnte. Die insgesamt 218 Gemälde der Sammlung Reden setzten sich vorwiegend aus Werken der holländischen und flämischen Schule zusammen, allerdings sind fast 30 Werke der italienischen Schule zugeordnet. Fünf Gemälde stammen von altniederländischen Künstlern, so von Hugo van der Goes (Nr. 81) und Lucas van Leyden (Nr. 61). In der zweiten Sektion des Katalogs finden sich zudem fast 40 anonyme Arbeiten. Nach den Aussagen Adam Friedrich Oesers im Vorwort des Katalogs der Sammlung Schwalb (Nr. 120) wurde ein Teil der Sammlung von Friedrich Ernst von Wallmoden übernommen. Ein Bild von Rottenhammer (Nr. 50) gelangte nachweislich in die Wallmoden-Sammlung, wurde 1818 versteigert und befindet sich heute in der Landesgalerie Hannover (Inv-Nr. PAM 858).
40 1763/01/19
[Lugt 1260]
Mr. Junker le pere peintre; Frankfurt am Main, Grande Sale de Mr. Scharff Verkäufer nach Titelblatt: Monsieur ***. Lose mit Gemälden: 150 Standorte: *SIF Annotiert mit rotem Farbstift mit allen Preisen. Einige Annotationen sind schwer lesbar. Titelblatt: Catalogue d'un magnifique cabinet de tableaux des plus grands maitres, Flamands, Hollandais &c. Rassembles avec beaucoup de Soin & grande Depense Par un Fameux connoisseur & Amateur Monsieur ***. La Vente se fera ä Francfort Mecredi 19 janvier 1763 dans la grande Sale de Mr. Scharff par les personnes juries aux ventes publiques & sous la Direction de Mr. Junker le
pere peintre & Mr. Kaller negotiant, chez qui Γ on peut avoir le Catalogue gratis. On pourra voir toute la Collection huit jours avant la vente, tous les matins de dix heures jusqu'a midi & Γ apres midi de deux heures jusqu'a quatre. Α Francfort sur le Main, MDCCLXII. Kommentar: Bei diesem Katalog handelt es sich um den ersten nachweisbaren Versteigerungskatalog des Frankfurter Kunsthändlers Johann Christian Kaller, der in Zusammenarbeit mit dem Frankfurter Maler Justus Juncker den Katalog der anonymen Sammlung zusammenstellte. Da in der Sammlung keine Werke von Frankfurter Künstlern vorkommen, ist zu vermuten, daß es sich um eine auswärtige Kollektion handelt. Wahrscheinlich stammt die Sammlung aus den Niederlanden, da die Dimensionen in Amsterdamer Maßeinheiten angegeben werden. Möglicherweise handelt es sich um die Sammlung Schermer aus Rotterdam, denn das Bild Adam und Eva von Adriaen van der Werff wird 1751 von Van Gool erwähnt (Johan van Gool, De Nieuwe Schouburg der Nederlantsche Kunstschilders en Schilderessen, 1751, II, S. 397). Im Vergleich zu Hamburger oder Leipziger Katalogen der Zeit ist dieser nach französischem Vorbild graphisch besonders übersichtlich gestaltet. Die Künstlernamen sind jeweils als Überschriften in Großbuchstaben angegeben. Die Beschreibungen sind knapp aber prägnant. Materialangaben fehlen, jedoch sind für alle Bilder die Maße angegeben. Mehr als zwei Drittel dieser qualitätvollen Sammlung gehören der holländischen Schule an. Hinzu kommen 16 flämische Bilder, fünf deutsche und vier italienische Werke, sowie je ein französisches und ein spanisches Bild. In dem annotierten Exemplar SIF sind keine Käufernamen, sondern nur die Preise überliefert. Das Preisniveau bewegte sich zwischen 10 und 50 Gulden, doch bei einer ganzen Reihe von Losnummern wurde erst bei noch wesentlich höheren Preisen der Zuschlag erteilt. Ein Damenportrait von Rembrandt erzielte 141 Gulden, ein Historienbild von Cornells Troost sogar 207 Gulden.
41 1763/06/24 [Anonym]; Hamburg? Verkäufer nach Titelblatt: Michael Richey Verkäufer: Richey, Michael Standorte: SBH Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Kommentar: Der Katalog der Gemäldesammlung von Michael Richey ist nur bibliographisch nachweisbar (Realkatalog der Staatsund Universitätsbibliothek Hamburg KD III., Hanseatica Hamburgensia IV, S. 74); Holst 1939, S. 269, führt ihn ebenfalls in seiner Liste. Über den Umfang und den Charakter der Sammlung sind keine weiteren Zeugnisse bekannt. Nach den Angaben des Realkatalogs enthielt der Versteigerungskatalog Kupferstiche. Es ist nicht sicher, ob sich darunter auch Gemälde befanden. Michael Richey (1678-1761) gehörte zu den zentralen Figuren der Frühaufklärung in Hamburg. Er war Mitglied der Teutsch-übenden Gesellschaft (1715-1717), bevor er 1724 zusammen mit dem Dichter und Sammler Barthold Heinrich Brockes (Kat. 17) an der Herausgabe der moralischen Wochenschrift "Der Patriot" mitwirkte. Richey war im Besitz einer der umfangreichsten deutschen Dichterbibliotheken, die 1762 in Hamburg versteigert wurde. Die Auktion erstreckte sich über ein Jahr. Die Bücher wurden zu diesem Zweck in einem vierteiligen Verkaufskatalog erfaßt. Richeys Münz- und Medaillensammlung wurde am 1. November 1762 verauktioniert. Lit.: Kopitzsch 1990, S. 262-267; Ketelsen 1997, S. 157; Fechner 1998, S. 63f.
42 1763/11/09
[Lugt 1325]
Mr. Junker le Pere; Frankfurt am Main, La grande Sale de Mr. Scharff KATALOGE
67
Verkäufer nach Titelblatt: Monsieur *** Lose mit Gemälden: 236 Standorte: SIF Annotiert mit allen Käufern und Preisen (französische Ausgabe). *SBF Annotiert mit allen Käufern und Preisen auf eingebundenen Leerseiten. Aus dem Besitz von Johann Valentin Prehn (französische Ausgabe). Titelblatt: Catalogue d'un magnifique cabinet de tableaux de plusieurs grands maitres, Italiens, Flammands, Allemans & Hollandois. Recueillis avec beaucoup de soins & de fraix Par Monsieur ***. Les quels seront vendus publiquement ä Francfort Mecredi 9 Novembre 1763 dans la grande Sale de Mr. Scharff par les personnes jurees aux ventes publiques & sous la Direction de Mr. Junker le Pere, peintre & Mr. Kaller Negotiant chez qui Ton peut avoir le Catalogue gratis. On pourra voir toute la Collection trois jours avant la vente, tous les matins de dix heures jusqu'a midi & l'aprfes-midi de deux heures jusqu'ä quatre. Α Francfort sur le Meyn, MDCCLXIII. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog, dem zweiten Katalog des Frankfurter Kunsthändlers Johann Christian Kaller, wird erneut eine anonyme Sammlung offeriert. Kaller organisierte auch diese Auktion gemeinsam mit dem Maler Justus Juncker. Der Katalog ist in französischer Sprache verfaßt und gleicht in der Aufmachung dem ersten Kallerschen Katalog (Kat. 40). Im Gegensatz zu diesem sind die Losnummern hier alphabetisch nach Künstlernamen sortiert. Die Beschreibungen sind knapp und prägnant. Zu allen Bildern werden die Maße angeführt, es werden jedoch keine Angaben zum Material gemacht. Vermutlich handelt es sich ebenfalls um eine aus Holland importierte Sammlung, da die Dimensionen nach Amsterdamer Maßeinheiten berechnet werden. Im Exemplar SIF findet sich auf der Titelseite die handschriftliche, später vermutlich von Rudolf Schrey hinzugefügte Notiz: "Scheint aus dem Besitz von Boltz zu stammen. R. S." Hiermit ist wahrscheinlich der Kammerrat Johann Boltz gemeint, der von Hüsgen als Frankfurter Sammler erwähnt wird. Schmidt vermutet in seiner Dissertation zu Frankfurter Sammlungen, daß hier die Sammlung Boltz zum Verkauf angeboten wurde. Die Struktur der Sammlung, die Verwendung des Amsterdamer Maßes und die Tatsache, daß Boltz selbst als Käufer aufgetreten ist, sprechen gegen diese Annahme. Vielmehr scheint mit dieser Notiz gemeint zu sein, daß dieses Katalogexemplar aus dem Besitz von Boltz stammt. Es handelt sich um eine qualitätvolle Sammlung mit insgesamt 236 Gemälden, die überwiegend von holländischen und flämischen Künstlern des 17. Jahrhunderts stammen. Außerdem lassen sich noch vier französische Arbeiten, zehn italienische und 20 Arbeiten deutscher Künstler zählen. Anonym bleiben 22 Gemälde, die am Ende des Katalogs unter dem Stichwort "Maitres inconnus" zusammengestellt sind. Nach den Angaben des annotierten Exemplars SIF bewegten sich die Preise zwischen 5 und 50 Gulden auf mittlerem Niveau. Einzelne Bilder erzielten höhere Preise, so beispielsweise Die Anbetung der Hirten von Rembrandt mit 75 Gulden. Unter den Käufern finden sich nach den Angaben der annotierten Exemplare SIF und SBF zahlreiche Namen von Frankfurtern Sammlern, so beispielsweise Johann Matthias Ehrenreich sowie Carl Geyß, dem allein fünfzehn Bilder zugeschlagen wurden. Ebenfalls werden Jacob Andreae (sechs Gemälde), Georg Wilhelm Bögner (sechs Gemälde), Johann Boltz (zwölf Gemälde), Johann Carl Brönner (vierzehn Gemälde), Peter Pasquay (drei Gemälde) und Johann Friedrich Städel (zwei Gemälde) als Käufer genannt. Im annotierten Exemplar SIF wird der Gesamterlös mit 3.932 Gulden und 16 Kreuzern angegeben. Eines der teuersten Bilder der Auktion, eine Boutique de chirugien de village von Comelis Saftleven, wurde bei 141 Gulden "Dr. Ehrenreich" (wahrscheinlich Johann Matthias Ehrenreich) zugeschlagen, der das Bild für die Markgräfin Karoline Luise von Baden erwarb (heute 68
KATALOGE
Kunsthalle Karlsruhe, Inv.-Nr. 250). Außer dem Bild von Saftleven vermittelte Ehrenreich auch das Gemälde Kücheninterieur mit einem Orangenverkäufer von Quiringh Gerritsz. van Brekelencam (Nr. 38; heute Kunsthalle Karlsruhe, Inv.-Nr. 256) und vermutlich ein Bild von Adriaen Brouwer (Nrn. 26 oder 27) an Karoline Luise (Kircher 1934, S. 163). Im Exemplar SIF wird "Rath Ehrenreich" als Käufer der beiden Bilder genannt. Es handelt sich vermutlich ebenfalls um Johann Matthias Ehrenreich, der 1762 zum gothaisch-sächsischen Hofrat ernannt worden war. Da sein Sohn Johann Benjamin Ehrenreich 1763 ebenfalls den Hofratstitel am badischen Hof erhalten hat, ist die Zuordnung hier jedoch nicht ganz eindeutig. Sowohl der Vater als auch der Sohn arbeiteten für Karoline Luise von Baden. Wahrscheinlich hatte diese Auktion, wie auch die vorangehende erste Auktion von Kaller, einen wichtigen Einfluß auf die Entstehung zahlreicher Sammlungen unter den Frankfurter Bürgern. Lit.: Kircher 1933, S. 79-81 und 162f.; Schmidt 1960, o.P.
43 1764/00/00
Daten unbekannt
[Anonym]; Berlin Verkäufer nach Titelblatt: Keine Verkäufer nach anderer Quelle: Gotzkowski Verkäufer: Gotzkowsky, Johann Ernst Lose mit Gemälden: 226 Standorte: GSAB Handschriftliche Liste mit Schätzpreisen. *BMB Handschriftliche Kopie des Exemplars GSAB mit allen Schätzpreisen. Kommentar: Von der bedeutenden Sammlung des Berliner Kaufmanns und Unternehmers Johann Ernst Gotzkowsky (1710-1775) haben sich mehrere Sammlungskataloge erhalten, jedoch kein eigentlicher Auktionskatalog. Der Verkauf eines Teils der Sammlung im Jahre 1764 wird nur durch eine handschriftliche Liste dokumentiert, die den folgenden Titel trägt: "Specification Meiner allerbesten und Schönsten original gemählden bestehen in 317 Stück nebst denen allergenauesten Preisen." Diese 24 Seiten umfassende Liste hat sich in einer Akte des Geheimen Staatsarchivs (Akte I. HA Rep. 11, Nrn. 171-175 Rußland D Interzessionalia 1751-1765) erhalten, zudem existiert eine Abschrift aus dem späten 19. Jahrhundert in der Bibliothek der Alten Nationalgalerie in Berlin, die hier der Auswertung zugrunde gelegt wurde. Gotzkowsky arbeitete als Juwelier und investierte in die aufblühende Seidenindustrie. Im Jahre 1761 gründete er auf Anregung von Friedrich II. nach dem Meißner Vorbild eine Porzellanmanufaktur, aus der später die Königliche Porzellanmanufaktur (KPM) hervorging. In der Wirtschaftskrise des Jahres 1763 geriet Gotzkowsky wegen seiner umfangreichen Finanztransaktionen in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten und mußte im Rahmen eines Vergleichs seinen Besitz veräußern. Die Porzellanfabrik wurde von Friedrich II. für 225.000 Taler übernommen. Schon seit den 1750er Jahren handelte Gotzkowsky auch mit Gemälden. Im Auftrage Friedrich II. erwarb er Bilder in den Niederlanden, Frankreich und Italien für die Galerie in Sanssouci und arbeitete im Auftrag des sächsischen Hofes als Bilderagent. Außerdem baute er selbst eine umfangreiche Sammlung auf, die in Berlin neue Maßstäbe setzte. Gotzkowskys Sammlung ist durch insgesamt drei gedruckte Kataloge dokumentiert. Schon im Jahre 1757 erschien in französischer Sprache der von Matthias Oesterreich verfaßte Katalog "Description de quelques tableaux de differrens maitres" (Exemplar in der Yale University Library), der 108 Gemälde aufführt. Möglicherweise erschien von diesem Katalog im gleichen Jahr eine deutsche Fassung, die sich bisher aber nicht nachweisen ließ (erwähnt in Thieme-Becker, Bd. 26, S. 467). Bei der zwei Jahre später erschienenen "Specification über eine Sammlung verschiedener Original=Gemählde von italienischen, holländischen, französischen und deutschen Meistern, Berlin, gedruckt bey Friedrich Wilhelm
Birnstiel, Königl. privil. Buchdrucker. 1759" handelte es sich nicht um eine Übersetzung des französischen Katalogs, sondern um eine erweiterte und veränderte Fassung. Dieser Katalog führt insgesamt 182 Gemälde auf. Gotzkowsky verkaufte Anfang 1764 einen großen Teil seiner Bildersammlung. Zu diesem Zweck wurde die hier ausgewertete "Specification" angefertigt. Da Gotzkowsky vor allem der russischen Regierung Geld schuldete, wurden die in dieser Liste aufgeführten Bilder als Abzahlung der Schulden mit 316.650 Talern angerechnet und gingen vermutlich vollständig in den Besitz Katharina der Großen über. Der Ankauf der Gotzkowsky-Sammlung im Jahre 1764 gilt seither als das eigentliche Gründungsdatum der Eremitage. Insgesamt umfaßt die "Specification" 226 Einzelbilder und 90 nicht weiter spezifizierte Bilder, die in einer Losnummer zusammen mit einem Bild von Hans von Aachen aufgeführt werden (Nr. 1000). Im Gegensatz zu den gedruckten, von Osterreich zusammengestellten Katalogen sind die Beschreibungen der handschriftlichen "Specification" nur sehr kurz und oftmals auffallend ungelenk formuliert. Zusätzlich werden die Maße angegeben und die jeweiligen Schätzpreise genannt, die sich auf einem sehr hohen Niveau bewegen und von 100 bis zu 8.000 Talem für eine Kreuzabnahme von Rubens (Nr. 491) reichen. Die einzelnen Losnummern sind nicht durchgezählt, sondern tragen Nummern, die von eins bis 1.000 reichen. Wahrscheinlich handelt es sich hierbei um Inventar- oder Akzisenummern, die auch einen Hinweis auf den Gesamtumfang der Sammlung geben. Nur zwei Jahre nach dem Verkauf der Bilder aus der "Specification" erschien 1766 nochmals ein Katalog der Gotzkowsky-Sammlung, der immerhin noch 230 Nummern enthielt (Catalogue d'une tres-belle collection de tableaux de differens maitres Italiens, flamands, allemands et fran^is laquelle se trouve dans la maison de Mr. Ernest Gotzkowsky. Α Berlin, Imprimi chez George Jacques Decker, imprimeur de la cour.). Im Bestand der "Specification" finden sich vor allem holländische und flämische Gemälde des 17. Jahrhunderts, darunter allein 13 Werke Rembrandts, acht Werke von Peter Paul Rubens und sieben Jacob Jordaens zugesprochene Bilder. An italienischen Gemälden weist diese Liste immerhin 44 Werke auf, darunter fünf Bilder, die Veronese zugeschrieben werden. Mit rund 20 Gemälden ist die deutsche Abteilung vergleichsweise klein, die französische Schule ist mit nur elf Werken vertreten. Unter den deutschen Werken findet sich die großformatige Friedensallegorie von Hans von Aachen (Nr. 1000), die heute zum Bestand der Eremitage zählt (Inv.-Nr. 695). Insgesamt lassen sich in russischen Museen nach den Hinweisen von Konstantin Malinowsky noch rund 90 Gemälde der Gotzkowsky-Sammlung nachweisen, davon allein 84 in der Sammlung der Eremitage und drei im Puschkin-Museum. Zahlreiche Bilder wurden bei einer 1854 durchgeführten Versteigerung von Beständen der Eremitage verauktioniert. Zuletzt wurden 1917 Bilder veräußert, als einige besonders wertvolle Werke an den amerikanischen Sammler Andrew Mellon verkauft wurden, darunter auch Potiphar und Joseph (Nr. 468) von Rembrandt, das sich heute in der National Gallery in Washington befindet. Mehrere Bilder aus der GotzkowskySammlung werden heute anderen Künstlern zugeschrieben, so galt Das Konzert von Dirck van Baburen (Eremitage, Inv.-Nr. 772) bei Gotzkowsky als Frans Hals. Von den unter Rembrandt firmierenden Bildern werden heute mehrere Schülern oder Zeitgenossen des Meisters zugeordnet, so etwa Der Prophet Elisha und Naaman des Rubens-Schülers Lambert Jacobsz. (Nr. 379; Eremitage, Inv.-Nr. 8677). Lit.: Rachel/Wallich 1967, Bd. 2, S. 443^67; Bodo Gotzkowsky, Der Berliner Kaufmann Johann Emst Gotzkowsky (1710-1775), seine Familie und seine Nachkommen, in: Der Herold. Vierteljahresschrift für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften 8 (1975), S. 45-77; Ausst.-Kat. Von Gotzkowsky zur KFM. Aus der Frühzeit des friderizianischen Porzellans, bearb. von Winfried Baer, Ilse Baer und Suzanne Grosskopf-Knaack, Staatliche Schlösser und Gärten Berlin, Staatliche Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM), Berlin 1986; Emmanuel Starcky, La Grande Catherine: un collection-
neur passionnd de tableaux flamands et hollandais, in: Ausst.-Kat. L'age d'or flamand et hollandais. Collections de Catherine II. Musee de rErmitage, Saint-Pitersbourg, Musee de Beaux-Arts Dijon, Dijon 1993, S. 19-27. 44 1764/03/12
[Lugt 1358]
Jean Chretien Kaller; Frankfurt am Main, Chez monsieur Juncker le Pere, Peintre, au Zimmerhoff, rue dit le grand Hirschgraben Lrn. E. No. 70 Verkäufer nach Titelblatt: Monsieur *** Lose mit Gemälden: 293 Standorte: *RKDH Annotiert mit allen Käufemamen und den Preisen. Photokopien: NGL und FLNY (beide aus RKDH) Titelblatt: Catalogue d'un magnifique cabinet de tableaux des plus celebres maitres Italiens, Flammands, Allemands & Hollandois, Recueillis avec beaucoup de soins & de fraix Par Monsieur ***. La Vente se fera Lundi 12 Mars 1764. Chez monsieur Juncker le Pere, Peintre, demeurant au Zimmerhoff, rue dit le grand Hirschgraben LrnN E. No. 70. Sous la Direction de Mr. Jean Chretien Kaller Νέgociant & par les personnes jurees aux ventes publiques chez qui Ton peut avoir le Catalogue gratis. On pourra voir la Collection trois jours avant la vente, tous les matins de 9 heures jusqu'ä midi & l'apres-midi de 2 heures jusqu'ä quatre. Α Francfort sur le Meyn, MDCCLXIIII. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog offerierte der Frankfurter Kunsthändler Johann Christian Kaller eine anonyme Sammlung, die vermutlich wie die beiden 1763 verauktionierten Sammlungen (Kat. 40 und 42) aus Holland stammte. Insgesamt 28 Bilder standen schon in der Auktion am 9. November 1763 (Kat. 42) zum Verkauf und wurden überwiegend von Kaller selbst ersteigert. Den Katalog für diese Auktion stellte Kaller wiederum mit dem Maler Justus Juncker zusammen. Die Losnummern sind alphabetisch nach Künstlern sortiert (wie in Kat. 42). Alle Beschreibungen sind kurz, aber prägnant und durch Maßangaben ergänzt. Es fehlen jedoch Angaben zum Material. In einem Appendix werden nochmals rund 30 Bilder (Nrn. 151 bis 182) aufgelistet, deren Beschreibungen nur äußerst knapp gehalten sind und Künstler und Titel in einem Satz vorstellen. In einem weiteren Anhang werden zudem Gemälde einer zweiten Sammlung angeboten. Dieser Teil des Katalogs ist auf deutsch abgefaßt und typographisch anders gestaltet. Vermutlich wurde er dem französischen Katalog beigebunden. Insgesamt werden 101 Losnummern in diesem zweiten Teil der Versteigerung offeriert, darunter 66 Gemälde und 14 Arbeiten auf Pergament. Im annotierten Exemplar RKDH sind zudem noch einige Losnummern handschriftlich ergänzt. Es überwiegen holländische und flämische Gemälde des 17. Jahrhunderts, darunter fünf Arbeiten von Rembrandt. Im zweiten Teil der Auktion finden sich allerdings zahlreiche anonyme Bilder, so daß der Anteil der anonymen Werke mit knapp 100 Arbeiten sehr hoch liegt. In der deutschen Schule sticht eine Folge von Werken eines Mitglieds der Malerfamilie Dietsch hervor, das als "Fräulein Dietsch" geführt wird. In der kleinen Gruppe der italienischen Werke finden sich vier Gemälde von Giovanni Battista Tiepolo (Nrn. A2 bis A5) sowie vier Arbeiten von Jacopo Tintoretto (Nrn. 121, 164, A6 und A7). Unter den Käufern treten vor allem Frankfurter Sammler und Kunsthändler hervor. Justus Juncker und Johann Christian Kaller ersteigerten selbst einige Bilder, möglicherweise im Auftrag von anderen Kunden. Der Bankier Carl Geyß erwarb insgesamt elf Arbeiten, darunter zwei Gemälde von dem zeitgenössischen Landschaftsmaler Johann Gustav Hoch für zusammen 50 Gulden und 15 Kreuzer. Auch Georg Wilhelm Bögner, Johann Friedrich Ettling, Johann Matthias Ehrenreich, Peter Pasquay und Johann Daniel Bender kaufKATALOGE
69
ten jeweils mehrere Bilder. Das Preisniveau bewegte sich in moderatem Rahmen. Die Zuschläge lagen meist zwischen 10 und 50 Gulden, bei anonymen Arbeiten noch deutlich darunter, oftmals erreichten sie kaum mehr als einen Gulden. Relativ hohe Preise erzielten deutsche zeitgenössische Maler. Für eine Folge von vier Landschaften von Alexander Thiele mußten 70 Gulden und 15 Kreuzer bezahlt werden (Nrn. 114 bis 117). Der höchste Einzelpreis wurde für das Bild Jupiter und Callisto von Gerrit van Honthorst (Nr. 55) erzielt, das bei 101 Gulden Kaller selbst zugeschlagen wurde. Ein pastorales Genrebild von Aelbert Cuyp (Nr. 30) befindet sich heute im Ferdinandeum in Innsbruck (Inv.-Nr. 634).
45 1764/05/14
und folgende Tage
[Lugt 1386]
[Anonym]; Bonn Verkäufer nach Titelblatt: La succession de son Altesse Serenissime Electorale de Cologne Verkäufer: Clemens August, Kurfürst von Köln Lose mit Gemälden: 697 Standorte: *ADu I Protokoll mit allen Käufernamen und den Preisen. ADu II Protokoll mit allen Käufernamen und den Preisen. ADu III Protokoll mit Schätzpreisen. ADu IV Protokoll mit Schätzpreisen, wahrscheinlich kopiert von Exemplar ADu III. BHAM Handschriftliche Verkaufsliste mit Schätzpreisen und später angemerkten Preisen für die wenigen tatsächlich verkauften Bilder. BNP Nicht annotiert. Der Katalog ist an Comte de Caylus geschickt worden (französische Ausgabe). LBDa Nicht annotiert. RKDH Nicht annotiert (französische Ausgabe). BMPL Nicht gefunden (1994). SABo Nicht eingesehen. AAP Nicht annotiert. BMB Heutiger Aufbewahrungsort unbekannt. Nach Lugt nicht annotiert. Photokopien: NGL (aus RKDH?) Titelblatt: Liste D'une Partie des Peintures provenantes de la Succession de Son Altesse Serenissime Electorale de Cologne de trfesglorieuse Memoire, qu'on a intention de vendre publiquement ä Bonn, le Lundi 14 May 1764 & jours suivants. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog wurde die Gemäldegalerie des Kurfürsten Clemens August (1700-1761) angeboten. Clemens August wurde 1723 als Nachfolger seines Onkels Josef Clemens zum Kurfürsten und Erzbischof von Köln ernannt. An seinen Residenzen in Bonn und Brühl entfaltete sich ein aufwendiger Hofstaat. Als Mäzen der Künste ließ er die teilweise schon von seinen Vorgängern begonnenen Schloßbauten Augustusburg, Poppelsdorf und Clemenswerth vollenden. Für seine Schlösser ließ Clemens August Gemälde ankaufen, die in erster Linie als Dekoration dienen sollten. Als Genre bevorzugte der Kurfürst Jagdstücke, die seine eigene Jagdleidenschaft dokumentierten und die in den als Jagdschlössem konzipierten Bauten Herzogsfreude und Clemenswerth als dekorativer Schmuck dienen konnten. Im Gegensatz zum Hof der Pfalz-Neuberger in Düsseldorf oder dem sächsischen Hof in Dresden ließ Clemens August keine eigentliche Galerie einrichten. Er dokumentierte seine Sammlung auch nicht durch die in dieser Zeit aufkommenden Galeriewerke, wie beispielsweise das Album "Recueil d'Estampes d'apres les plus cilebres tableaux de la Galerie de Dresde" von Carl Heinrich von Heinecken aus den Jahren 1753 und 1757, das als Vorbild hätte dienen können. Da kein Verzeichnis die Sammlung des Kurfürsten beschreibt, kommt dem Versteigerungskatalog eine besonders wichtige Rolle als Dokument der Sammlungsgeschichte zu. 70
KATALOGE
Im Umkreis des Kurfürsten traten Hofbeamten als Sammler und Kunstförderer hervor, so beispielsweise Ferdinand Graf von Plettenberg (1690-1737) und sein Leibarzt Johann Heinrich von Gise (vgl. Kat. 14). Auch die Fürsten von Hohenzollern-Sigmaringen (vgl. Kat. 23 und 54) bauten eigene Sammlungen auf. Bei dem Katalog handelt es sich um ein französischsprachiges listenartiges Verzeichnis, das Interessenten einen Eindruck von der umfangreichen Sammlung vermitteln sollte. Insgesamt umfaßt diese Gemäldeliste 715 Losnummern, wobei in einigen Fällen mehrere Bilder unter einer Nummer aufgeführt werden. Teilweise werden auch Skulpturen und Elfenbeinreliefs miteingeschlossen. In den Titeln wird der Bildgegenstand kurz beschrieben, zudem werden die Maße in deutschen Fuß angegeben, wobei die Rahmen vermutlich mitgemessen wurden. Diese Liste wurde nach einem von dem Düsseldorfer Galerieinspektor Lambert Krähe verfaßten Gesamtinventar der Gemälde erstellt, in dem auch der Wert aller Bilder geschätzt worden war ("Protocollum Taxationis deren Von Sr Churfürstl. Dhlt zu Cöln hertzogen Clementis Augusti glorreichen Andenkens nachgelaßenen Mahlereyen"; Du, Akte Kurköln II, 258 II). Es wurde am 12. September 1761 begonnen und am 26. September abgeschlossen. Die jeweiligen Daten sind am Rande des Protokolls vermerkt. Bei der Erstellung der "Taxation" konnte Krähe schon auf frühere Inventare zurückgreifen, die den Inhalt der einzelnen kurfürstlichen Schlösser auflisteten und von den Erben in Auftrag gegeben worden waren. Im Vergleich zu diesen früheren Inventaren gelang es Krähe jedoch, zahlreiche Bilder neu zuzuschreiben. Laut dem Testament Clemens Augusts vom 6. Februar 1761 wurden der kölnische Kurnachfolger und die erzstiftliche Hofkammer in Bonn mit der Verpflichtung zu Universalerben eingesetzt, auch für die hinterlassenen Schulden aufzukommen. Nach dem Tode von Clemens August begann man deshalb sofort mit der Aufstellung von Besitzinventaren und der Wertschätzung aller beweglichen Güter in den fürstlichen Schlössern zum Zwecke des Verkaufs. Die Gemälde waren auf die einzelnen Schlösser in und um Bonn verteilt. So befanden sich umfangreiche Bestände im Jagdschloß Herzogsfreude, wie das Inventar belegt (zusammengestellt vom Maler Johann Matthias Schild vom 20.2. bis 4.4.1761; vgl. Hausmanns 1989, S. 209 bis 224). Es umfaßt 476 Losnummern mit Gemälden (einschließlich der Miniaturen und Aquarelle), darunter vor allem Jagdstilleben. Weitere Bestände befanden sich im Schloß Brühl und Schloß Falkenlust. Die Inventare der Schlösser geben teilweise den genauen Standort einzelner Kunstwerke an. Zahlreiche Gemälde wurden beispielsweise in dem Inventar des Poppelsdorfer Schlosses erfaßt. Im Krönungssaal des Poppelsdorfer Schlosses werden allein 136 Gemälde aufgeführt, darunter auch der Verlorene Sohn von Rembrandt, den Clemens August 1742 auf der Versteigerung der Sammlung Johann Heinrich von Gise (vgl. Kat. 14 und 14a) erworben hatte und der sich heute in der Eremitage befindet (Inv.-Nr. 794). Im Inventar heißt es: "Oben dem Camin der Verlohrne Sohn, in einer verguldeten Rahmen. Von bildschöner Arbeit. Von Rembrand." (Du, Kurköln II 268, fol. 18v bis 19r). Auch in den übrigen Sälen des Schlosses waren zahlreiche Gemälde angebracht, so in der grünen Galerie vorwiegend Portraits des europäischen Hofadels, im Schreibkabinett vor allem Bilder religiösen Inhalts. Im März 1761 begann man, den gesamten Besitz von Clemens August öffentlich zu versteigern. Zuerst wurde das lebende Inventar, die Jagdhunde und die Pferde verkauft; es folgte eine erste Versteigerung der Juwelen. Der Verkauf der Gemälde und der Porzellansammlung war für 1762 geplant. Zu diesem Zweck wurde die schon erwähnte Liste gedruckt sowie eine weitere, die die Porzellanbestände vorstellte. Wegen eines Einspruchs der Erben verzögerte sich jedoch die Auktion. Erst am 14. Mai 1764 wurde mit dem Verkauf der Gemälde begonnen, die Auktion erstreckte sich dann bis zum 19. Juni. Die Gemälde wurden nach einer ganz anderen Reihenfolge und im Wechsel mit anderen Kunstgegenständen aufgerufen. Die Auktion stand unter der Leitung des Hofkammerrats Broggia und des Geheimen Rates Neesen. Über den Verlauf der Auktion gibt ein detailliertes Verkaufsprotokoll in deutscher Sprache (Du, Kurköln II
289) Auskunft, das hier zusammen mit der französischsprachigen Liste ausgewertet wurde. Zudem existiert noch eine Reinschrift des Auktionsprotokolls (ebd., Kurköln II 276). Bei vielen Bildem lassen sich erst mittels des Verkaufsprotokolls genauere Aussagen zum Material machen. Teilweise handelte es sich bei einzelnen Losen nicht um Gemälde, sondern um Zeichnungen und Aquarelle, die somit bei der Auswertung nicht berücksichtigt wurden. Andererseits kamen noch zusätzliche Bilder zum Aufruf, die nicht in dem französischsprachigen Versteigerungskatalog aufgeführt wurden. Bei den Gemälden überwogen Arbeiten von flämischen und holländischen Künstlern des 17. bis 18. Jahrhunderts, darunter finden sich besonders zahlreiche Werke von Künstlern wie Jan Fyt, Rembrandt, Frans Snyders und David Teniers d.J. Als Genre überwiegt das Jagdstilleben. Italienische Gemälde waren mit rund 70 Arbeiten vertreten, darunter vor allem Werke des 18. Jahrhunderts, so 14 Werke von Francesco Londonio, zehn Bilder von Giovanni Battista Piazzetta und acht Gemälde von der von Clemens August besonders geschätzten Rosalba Carriera. Gemälde deutscher Künstler bildeten mit rund 80 Werken eine eher kleine Gruppe; allein 39 Bilder stammten von dem Hofmaler Johann Matthias Schild. Von den ansonsten selten auftretenden spanischen Gemälden finden sich immerhin sechzehn in der Sammlung des Kurfürsten, darunter allein elf Bilder von Murillo und fünf Gemälde, die Velazquez zugeschrieben wurden. Zu den Werken von Murillo gehört eine Folge der Fünf Sinne (Nr. 376). Unter den Käufern befanden sich zahlreiche Vertreter des Hofstaats, so etwa der Geheime Hofrat Nicolaus Augustin Anton Schildgen, Caspar Anton Belderbusch sowie Hofkammerrat Friedrich Franz Adam Freiherr von Breidbach. Zahlreiche Bilder erwarb auch der Mainzer Bankier Simon Baruch, der Clemens August in Finanzgeschäften beraten hatte und zu den Gläubigern zählte. Neben den Beamten des Hofstaats traten auf dieser Auktion auch einige Kunsthändler auf, die teilweise aus anderen Staaten angereist waren - ein weiterer Hinweis auf die Bedeutung dieser Auktion. Aus Paris kamen beispielsweise die Kunsthändler Chyrogt und Neveu, dem Kölner Kunsthändler Pick wurden 23 Bilder zugeschlagen; Neveu kaufte 37 Gemälde. Zahlreiche Bilder gingen auch an den Hofrat Broggia, der von den Erben mit der Durchführung der Auktion betraut worden war. Vermutlich gingen diese Bilder zurück, denn rund zwei Drittel der insgesamt 178 von Broggia angekauften Bilder tauchen in einem Frankfurter Verkaufskatalog des Jahres 1765 wieder auf (Kat. 51). Da jedoch in dem Frankfurter Katalog noch Bilder anderer Käufer wieder erscheinen, ist zu vermuten, daß mehrere Bieter im Auftrage der Veranstalter mitboten, um Rückgänge zu vermeiden. Von dem nicht weiter zu identifizierenden Käufer Doussetti tauchen bis auf zwei Gemälde alle in Bonn ersteigerten Bilder in dem Frankfurter Katalog wieder auf, so auch mehr als die Hälfte der von Simon Baruch erworbenen Gemälde. Insgesamt wurden rund 200 Gemälde in dem Frankfurter Katalog erneut offeriert. In zahlreichen Fällen wurde die Zuschreibung modifiziert, oftmals wurden Bilder nunmehr nur noch als Schülerarbeiten klassifiziert. Die erzielten Preise bewegen sich wie bei anderen Versteigerungen in Deutschland auf niedrigem Niveau. Meist wurden nicht mehr als 50 Reichstaler je Gemälde bezahlt. Einzelne Werke erzielten jedoch sehr hohe Ergebnisse. So wurden beispielsweise für den Verlorenen Sohn von Rembrandt von dem Kunsthändler Neveu 753 Reichstaler geboten. Sogar 1.250 Taler investierte Simon Baruch für eine Folge von vier Jagdszenen von Jan Fyt (Nr. 589). Dabei handelt es sich vermutlich um vier Bilder, die dem Pfalzgrafen Karl Theodor 1767 von der Stadt Solingen geschenkt wurden und sich heute in der Alten Pinakothek in München befinden (Inv.-Nrn. 199, 203, 255 und 259). Auch diese vier Bilder tauchten in der Frankfurter Auktion von 1765 als einzelne Lose wieder auf und sind in dem dortigen Katalog detailliert beschrieben (Kat. 51; Nrn. 57, 135, 136 und 158). Auf einer Versteigerung am 10. Dezember 1764 in Paris (Lugt 1413) wurden 34 Gemälde, die der Kunsthändler Neveu aus dem Nachlaß Clemens Augusts erworben hatte, erneut angeboten. In Paris wurde auch Rembrandts Hanum kniet vor Esther versteigert, das
in Bonn noch nicht zum Verkauf stand (heute im Nationalmuseum Bukarest, Inv.-Nr. 8187/221). Lit.: Edmund Renard, Clemens August. Kurfürst von Köln. Ein rheinischer Mäzen und Weidmann des 18. Jahrhunderts, Bielefeld/Leipzig 1927; Erich Depel, Bemerkungen zur Gemäldesammlung des Kurfürsten Clemens August, in: Ausst.-Kat. Kurfürst Clemens August. Landesherr und Mäzen des 18. Jahrhunderts, Schloß Augustusburg zu Brühl, Köln 1961, S. 103-105; Vey 1963 (mit Nachdruck des Versteigerungskatalogs); Winterling 1986; Hausmanns 1989.
46 1764/05/18
[Lugt 1174]
[Anonym]; Berlin Verkäufer nach Titelblatt: Johann Georg Eimbke Verkäufer: Eimbke, Johann Georg Lose mit Gemälden: 56 Standorte: *EBNP Nicht annotiert, aber auf der letzten Seite befindet sich eine Liste mit allen Käufemamen und den Preisen. HKB Nicht annotiert. Nicht annotiert. KH SBB I Nicht annotiert. SBB II Nicht annotiert. BML Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Titelblatt: Beschreibung deijenigen Sammlung verschiedener Original=Gemählde von italienischen, holländischen, französischen und deutschen Meistern, welche das Cabinet ausmachen von [Johann Georg Eimbke; handschriftliche Ergänzung in SBB I]. Berlin, gedruckt bey Fr. Wilh. Birnstiel, Königl. priv. Buchdrucker 1761. Kommentar: Dieser 1761 erschienene Sammlungskatalog wurde nach den Angaben des annotierten Exemplars BNP drei Jahre später als Versteigerungskatalog für eine Auktion am 18. Mai 1764 verwendet, die auch von Lugt erwähnt wird. Der Name des Sammlers Johann Georg Eimbke wurde auf dem Exemplar SBB I handschriftlich ergänzt. Das Exemplar SBB II weist ein leicht verändertes Titelblatt auf, in dem zudem die Initialen des Sammlers "J G E" und der Zusatz "Banquier in Berlin" eingedruckt sind. Es handelt sich bei dem Sammler um den aus Braunschweig stammenden Johann Georg Eimbke (1714-1793), der in Berlin bis 1759 als Münzdirektor wirkte und dann ein Bankhaus gründete. Wie auch Johann Gottlieb Stein und Johann Ernst Gotzkowsky war Eimbke von der Wirtschaftskrise Berlins im Jahre 1763/64 stark betroffen und ging bankrott. Wegen wissentlich herbeigeführter Insuffizienz wurde Eimbke 1764 kurzzeitig in Haft genommen. Um seine Gläubiger befriedigen zu können, wurde schließlich seine Gemäldesammlung im Mai 1764 verauktioniert. Statt der veranschlagten 12.000 Taler wurden bei dieser Versteigerung nur 4.011 Taler erzielt. Zusammengestellt wurde das ausführliche Verzeichnis von Matthias Oesterreich, der 1757 das Amt des Galerieinspektors in Sanssouci übernommen hatte. In seinem Aufbau ähnelt dieser Katalog dem der Sammlung Stein aus dem Jahre 1763, der ebenfalls von Oesterreich verfaßt worden war (Kat. 63). Im Vorwort des Katalogs der Sammlung Stein erwähnt Oesterreich, daß er auch die Kataloge der Sammlung Gotzkowsky aus dem Jahre 1757 und 1759 (vgl. Kat. 43) und den Eimbke-Katalog zusammengestellt habe. Da letzterer anonym erschien, ist dies ein wichtiger Hinweis auf Oesterreich als Autor. Im gleichen Jahr erschien der ebenfalls von Oesterreich zusammengestellte Katalog der Hamburger Sammlung Stenglin (Des Herrn D. Stenglin [...] Sammlung von Italienischen, Holländischen und Deutschen Gemählden beschrieben von M. Oesterreich, Berlin 1763). Oesterreichs Kataloge können als eine frühe Form des wissenschaftlichen Katalogs angesehen werden. Im Vorwort zum Katalog der Sammlung Stein vergleicht er seine Bemühungen mit denjenigen von Johan van Gool, J. B. Decamps (La vie des Peintres Flamands) KATALOGE
71
sowie Gerard Hoet. Im Katalog der Sammlung Eimbke wird jedes Bild ausführlich beschrieben und vor allem bewertet und in das Gesamtwerk des jeweiligen Künstlers eingeordnet. In einem abgesetzten Abschnitt wird zudem die Vita jedes Künstlers dargelegt, wobei Oesterreich seine Quellen in Anmerkungen offenlegt (diese Informationen zu den Künstlern konnten nicht in den Datenbestand aufgenommen werden). Der Katalog nimmt daher den Charakter einer wissenschaftlichen Studie an, die in ihrer Qualität und Detailliertheit über den Standard von Museumskatalogen wie dem ersten Verzeichnis der Berliner Gemäldegalerie von Gustav Friedrich Waagen aus dem Jahre 1830 hinausgeht. Auch bemüht sich Oesterreich, die Provenienz der Bilder anzuführen. Insgesamt umfaßt der Katalog nur 56 Gemälde. Allein 14 Bilder lassen sich in den Katalogen der Sammlung Gotzkowsky nachweisen und waren vermutlich von diesem direkt erworben worden. Aus dieser Sammlung stammte beispielsweise Hamann und Mardachai von Rembrandt (Nr. 10). Bei den Bildern aus der GotzkowskySammlung zitiert Oesterreich den von ihm selbst verfaßten Katalog (Specification über eine Sammlung verschiedener Original=Gemählde [...], Berlin 1759). Obwohl die Sammlung Eimbke nur einen geringen Umfang hatte, waren alle Schulen mit einigen Malern vertreten. Am stärksten präsentierten sich die holländischen und flämischen Werke mit Bildern von Abraham Bloemaert, Gerard Dou, Gerrit van Honthorst und Peeter Neeffs d.Ä. In der kleinen Gruppe der insgesamt acht italienischen Gemälde waren Veronese, Guercino und Giuseppe Nogari vertreten. Unter den deutschen Bildem überwogen zeitgenössische Werke, so sechs Gemälde von Christian Wilhelm Emst Dietrich und drei Bilder von Balthasar Denner. Zwei Bilder von Ottmar Elliger (Nrn. 38 und 39) befinden sich heute in der Hamburger Kunsthalle (Inv.-Nrn. 359 und 360). Sie kamen in den Besitz des Agenten Nathan Meyer in Altona und gelangten über O. C. Gaedechsen an die Kunsthalle. Über den Verkauf und das weitere Schicksal der Sammlung ist bis auf die von Lugt gegebenen Informationen nichts bekannt. Der Soldat von Gerrit van Honthorst (Nr. 18) tauchte in der Auktion der Sammlung J. Vliet am 12. Oktober 1774 in Amsterdam (Lugt 2327, Nr. 106) wieder auf und befindet sich heute im Rijksmuseum (Inv.Nr. A 180). Das Bild Die Mittagsstunden von Abraham Bloemaert (Nr. 17), ebenfalls aus dem Besitz von Gotzkowsky, befindet sich heute im Besitz des Museum of Fine Arts in Montreal (Inv.-Nr. 1971.26). Nach den Angaben des annotierten Exemplars BNP schwankten die Preise der Gemälde stark. Einige Bilder erzielten weniger als 10 Taler, fast zwanzig aber auch Preise deutlich über 100 Taler. Der höchste Preis wurde mit 480 Taler für zwei als Pendants angebotene Landschaften von Christian Wilhelm Ernst Dietrich bezahlt (Nrn. 52 und 53). Unter den Käufern fanden sich vor allem die Gläubiger Eimbkes, so Christian Christoph Engel, Nathan Veitel Ephraim und Nicolaus Heinrich Willmann. Auch Gotzkowsky taucht als Käufer auf und übernahm insgesamt fünf Bilder (Nrn. 15, 16, 23,31 und 32). Lit.: Rachel/Wallich 1967, Bd. 2, S. 437-441.
47 1764/08/25
[Lugt 1403]
[Anonym]; Frankfurt am Main, Haus des Sammlers, Antoniusgasse Verkäufer nach Titelblatt: Feu Monsieur le baron de Haeckel Verkäufer: Haeckel, Heinrich Jakob, Baron von
Kommentar: Nach einer handschriftlichen Notiz auf der Titelseite des Katalogs aus dem Städelschen Kunstinstitut in Frankfurt soll die Versteigerung der Sammlung Heinrich Jacob von Haeckel (1682— 1760) am 25. August 1764 stattgefunden haben. Auch Johann Wolfgang Goethe nahm auf Veranlassung seines Vaters an dieser Auktion teil und erwarb mehrere Kunstwerke. In Dichtung und Wahrheit schreibt Goethe: "Ferner erinnere ich mich eines Barons von Hackel, eines reichen Edelmanns, der verheiratet aber kinderlos ein schönes Haus in der Antoniusgasse bewohnte, mit allem Zubehör eines anständigen Lebens ausgestattet. Auch besaß er gute Gemälde, Kupferstiche, Antiken und manches andre, wie es bei Sammlern und Liebhabern zusammenfließt". Haeckel galt als Kunstkenner und Experte. Immer wieder diente er auch dem Landgrafen Wilhelm VIII. von Hessen-Kassel. Schon vor dem Tod Haeckels übernahm Karoline Luise von Baden zwei Werke seiner Sammlung von Rachel Ruysch, die sich heute in der Kunsthalle Karlsruhe befinden (Inv.-Nrn. 376 und 377). Da sich jedoch anscheinend kein annotiertes Exemplar des Versteigerungskatalogs erhalten hat, fehlen weitere Informationen zu Käufern und Preisen. Der Versteigerungskatalog ist in französischer Sprache verfaßt. Die Beschreibungen sind nur sehr kurz gehalten und oft wenig aussagekräftig, jedoch mit Maßangaben versehen. Bei einem Rembrandt zugeschriebenen Bild heißt es beispielsweise "Une histoire de la bible". Die meisten Bilder sind mit den Künstlernamen bezeichnet. Im Gegensatz zu den drei Versteigerungskatalogen der Frankfurter Kunsthandlung Johann Christian Kaller ist dieser Katalog weitaus weniger sorgfältig gestaltet, Beschreibung und Künstlernamen sind in einem Satz zusammengefaßt. Gedruckt wurde dieser Katalog allerdings schon 1762, also noch bevor Kaller mit den Auktionen dreier vermutlich importierter Sammlungen neue Maßstäbe setzte (vgl. Kat. 40, 42, 44). Am stärksten vertreten sind die holländische und flämische Schule des 17. Jahrhunderts, darunter zehn Werke von Peter Paul Rubens, sieben Rembrandt zugeschriebene Gemälde und fünf Arbeiten von Jan Fyt. Zahlenmäßig ist die deutsche Schule mindestens ebenso stark im Angebot, wobei der Schwerpunkt auf den Zeitgenossen des 18. Jahrhunderts liegt und sich auf wenige Künstler konzentriert. Haeckel trat vor allem auch als Mäzen von zeitgenössischen Künstlern aus dem Frankfurter Raum auf, so finden sich allein 36 Arbeiten von Justus Juncker, elf Gemälde von dem Darmstädter Hofmaler Johann Conrad Seekatz, dreizehn Bilder von Johann Georg Trautmann und allein 43 Bilder von Christian Georg Schütz d.Ä. Auch Johann Heinrich Tischbein d.Ä. wurde von Haeckel durch Ankäufe unterstützt bevor er durch dessen Vermittlung vom Landgrafen zum Hofmaler ernannt wurde. Im Versteigerungskatalog Haeckel finden sich allein neun Arbeiten von Tischbein. Bei den rund 50 italienischen Gemälden bleiben viele Bilder unbestimmt und sind nur als italienische Arbeiten eingestuft. Hoch ist auch der Anteil der keinem Künstler zugeschriebenen Werke. Es lassen sich 118 anonyme Werke zählen. Auffällig unter den vier frühniederländischen Werken ist eine Tafel mit einer Verkündigungsszene, die "Rogier van Brugge" (Rogier van der Weyden) zugeschrieben wird. Lit.: Hüsgen 1780, S. 183; Kircher 1933, S. 158; Schmidt 1960, o.P.; Lauts 1980, S. 165; Goethe, Dichtung und Wahrheit, 1986, S. 84 und 860.
48 1764/11/19
Lose mit Gemälden: 502
[Anonym]; Hamburg?
Standorte: SIF Nicht annotiert.
Verkäufer nach Titelblatt: Keine
Titelblatt: Catalogue d'un fameux cabinet de tableaux des meilleurs maitres, receuilli, avec beaucoup de choix et d'exactitude pendant plusieurs annees et delaisse par feu monsieur le baron de Haeckel dont la vente se fera publiquement a Francfort sur le Mein, Dans un terme qu'on annoncera par les Gazettes. 1762. 72
KATALOGE
Standorte: SBH Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Kommentar: Dieser anonyme Auktionskatalog ist nur bibliographisch nachweisbar (Realkatalog der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg KD III., Hanseatica Hamburgensia IV, S. 74); Holst 1939, S. 271, führt ihn ebenfalls in seiner Liste. Über den Umfang
der Sammlung und den Besitzer liegen keine Informationen vor; nach den Angaben des Realkatalogs enthielt der Versteigerungskatalog Kupferstiche. Es ist nicht sicher, ob sich darunter auch Gemälde befanden.
49 1764/11/26 und folgende Tage Johann Ludewig Berringer; Leipzig, Auf dem neuen Neu=Marckte Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 21 Standorte: SARL Nicht annotiert. Titelblatt: Catalogue von allerhand nutz= und brauchbaren Meubles bestehend in Uhren, Silbersachen, Meißner Porcellain, Gemählden, Spiegeln, Coffee, Kupffer, Meßing, Zinn, Kleidern, Wildschuren, Wäsche, guten Federbetten, Tremon=Tischen mit Marmor=Platten, Plüsch=Stühlen, seiden behängten Bettstellen, Kothen und dergl. auch Büchern welche Ε. E. Hochw. Raths Woll=Waage, auf dem neuen Neu=Marckte, Montags den 26. Nov. 1764. und folgende Tage, früh von 9. bis 12. Uhr, und Nachmittags von 3. bis 6. Uhr, gegen gleich baare Bezahlung, in Sächsischen Müntz=Sorten verauctioniret werden sollen, durch Johann Ludewig Berringern, Ε. E. Hochweisen Raths verpflichteten Proclamatorem. Leipzig, 1764. Der Catalogus wird ausgegeben unterm Rathhause bey Hrn. Friedrich Köhlen. Kommentar: In diesem umfangreichen Versteigerungskatalog wurde ein gesamter Hausstand aufgelöst, der vermutlich einer Leipziger Kaufmannsfamilie gehörte. Auf den Seiten 92 und 93 des Katalogs finden sich auch 21 Losnummern mit Gemälden. Die Bilder sind nur mit kurzen Sätzen beschrieben. Maßangaben fehlen, und es werden bis auf eine Ausnahme (Nr. 18) keine Informationen zum Material gemacht. Nur bei acht Bildern werden Künstlernamen angegeben, deren Schreibweise eingedeutscht wurde. Beispielsweise wird Abraham Bloemaert als "Blömant" (Nr. 16) bezeichnet. 50 1765/00/00
Daten unbekannt
Johann Andreas Benjamin Nothnagel; Frankfurt am Main Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 163 Standorte: *SMF Annotiert mit allen Schätzpreisen. Titelblatt: Plan einer wohleingerichteten Mahlerey-Lotterie so mit gnädigsten Erlaubniß eines Hochedlen und Hochweisen Magistrats alhier, von dem dahiesigen Bürger Kunst und Tapeten Mahler Johann Andreas Benjamin Nothnagel um Plaz zu gewinnen errichtet worden, und in einer einzigen Classe bestehet, wie folget, [handschriftliche Liste] Kommentar: Es handelt sich um einen Lotterieverkauf, der 1765 von dem Maler Johann Andreas Benjamin Nothnagel (1729-1804) organisiert worden war. Nothnagel lebte seit 1747 in Frankfurt, um dort in der Tapetenfabrik von Johann Gabriel Kiesewetter und Johann Nikolaus Lentzner zu arbeiten. Nach dem Tod von Lentzner heiratete Nothnagel dessen Witwe und wurde Teilhaber der Firma, die er dann von 1753 an allein führte. Die "Kaiserliche privilegierte Nothnagelsche Fabrik" entwickelte sich zu einem international renommierten Betrieb. Neben der Tapetenfabrikation baute Nothnagel eine Kunsthandlung auf. In den Jahren 1779 und 1784 führte er noch zwei weitere Auktionen durch (Kat. 125 und 152). Nothnagels eigene Sammlung wurde nach seinem Tod 1818 in Frankfurt versteigert (Lugt 9426). Insgesamt wurden für diese Lotterie 489 Lose verkauft, die jeweils 4 Gulden und 30 Kreuzer kosteten. Der Wert jeden Loses be-
trug 4 Gulden 18 Kreuzer, die Differenz wurde zur Begleichung verschiedener Unkosten verwendet. Als Gewinne wurden 163 Gemälde zusammengestellt, die einen Gesamtwert von 2.099 Gulden ausmachten. Die Bilderpreise wurden in einer handschriftlichen tabellarischen Liste aufgeführt und unterschiedlichen Wertkategorien zugeordnet. Als erster Preis war ein Bild von Johann Georg Trautmann ausgeschrieben, das mit 100 Gulden angesetzt wurde. Als zweiten Preis bestimmte Nothnagel zwei Jagdstücke von einem Vertreter der Malerfamilie Querfurth, die zusammen auf 80 Gulden eingeschätzt wurden. Der dritte Preis waren zwei Geflügelstücke von Jakob Samuel Beck zu einem Schätzpreis von 60 Gulden. Für die übrigen Gemälde bestimmte Nothnagel Werte, die zwischen 6 und 500 Gulden je Bild lagen, wobei in die billigste Kategorie allein 65 Bilder fielen. Bei den als Preisen angesetzten Gemälden handelt es sich überwiegend um Werke zeitgenössischer Künstler aus dem Frankfurter Raum. Lit.: Gwinner I 1862, S. 356-361; Gwinnerll 1867, S. 59-70; Schmidt 1960, o.P. (Nothnagel); Ausst.-Kat. Frankfurt 1988, S. 112; Rudolf Rieger, Graphikhandel im 18. Jahrhundert: Die Firma Artaria und Johann Gottlieb Prestel, in: Ausst.-Kat. Frankfurt 1991, Bd. 3, S. 203-207; siehe auch im Katalogteil S. 236-239.
51 1765/00/00
Daten unbekannt
[Lugt 1490]
Christian Benjamin Rauschner; Frankfurt am Main, Schäffer=Gaß Verkäufer nach Titelblatt: Aus den Niederlanden Lose mit Gemälden: 242 Standorte: AAP Nicht annotiert. Titelblatt: Catalogus der Sammlung eines grossen Herrns verschiedener ausnehmender Schildereyen von den grösten Italienischen, Französischen, Niederländischen, Holländischen und Deutschen Meistern, welche aus den Niederlanden nacher Frankfurt am Mayn gebracht worden, Dabey auch andere Kostbarkeiten in Helffenbein, Porcelain und Bernstein, ec. ec. ec. nebst sechs Stück Landschafften Mosaischer Arbeit in Orientalischen Steinen. Alle diese Stücke werden aus der Hand verkaufft, und kan man sich deswegen an Christian Benjamin Rauschner, Stucator und Portrait=Poßierer auf der Schäffer=Gaß zu Frankfurt am Mayn addressiren, und sich eines raisonnablen Preises auch reeller Bedienung und Einpackung versichern. Frankfurt am Mayn 1765. Kommentar: In dieser von dem Frankfurter Stukkateur Christian Benjamin Rauschner organisierten Auktion wurden insgesamt 242 Gemälde angeboten, von denen 219 aus der Sammlung des Kurfürsten Clemens August stammten (vgl. Kat. 45). Vermutlich handelt es sich bei den restlichen, nicht nachweisbaren Bildern auch um Gemälde aus der Sammlung Clemens August, denn sie sind nicht separiert und tauchen zufällig in der Folge der Losnummern auf. Der Nachlaß des Kurfürsten wurde vom 14. Mai bis 19. Juni 1764 in Bonn versteigert. Im Titel wird von der Sammlung eines "grossen Herrns" gesprochen sowie erwähnt, daß diese aus den Niederlanden nach Frankfurt gebracht worden sei. Die eigentliche Herkunft der Sammlung sollte ganz offensichtlich verschleiert werden, eine niederländische Provenienz galt als leichter vermarktbar. Alle in Frankfurt erneut offerierten Gemälde waren in Bonn von verschiedenen Käufern ersteigert worden. Es läßt sich daher annehmen, daß mehrere Bieter bei der Bonner Versteigerung im Auftrag der Veranstalter mitgeboten hatten. Rund zwei Drittel der dem Hofkammerrat Broggia zugeschlagenen Gemälde wurden in der Frankfurter Auktion erneut angeboten. Broggia war von den Nachlaß-Erben mit der Durchführung der Bonner Versteigerung betraut worden. Bis auf zwei Bilder erschienen die insgesamt 20 von dem Käufer Doussetti ersteigerten Gemälde erneut, zudem mehr als die Hälfte der von dem Bankier Simon Baruch erworbenen Bilder. Da Baruch zu den Gläubigem des Kurfürsten zählte, läßt sich annehmen, daß KATALOGE
73
Baruch beabsichtigte, die in Bonn erworbenen Bilder wieder zu verkaufen. In Frankfurt etablierte sich in jenen Jahren ein florierender Kunstmarkt mit einem großen Kreis von Sammlern und Interessenten, so daß hier die Verkaufsaussichten wesentlich günstiger waren als in Bonn. Der Katalogtext ist im Paralleldruck sowohl in deutscher als auch in französischer Sprache verfaßt. Es erschien auch ein französisches Titelblatt, das vorgebunden werden konnte. Der Künstlername ist der Losnummer vorangestellt; es folgen die Angaben zu den Maßen, dann, allerdings nur in einigen Fällen, zum Material und schließlich der Hinweis, ob das Gemälde mit oder ohne Rahmen verkauft wird. Die zuweilen längeren Bildbeschreibungen sind häufig mit Urteilen über die "Gefälligkeit" der Malerei verbunden. Im Vergleich zu den knappen Angaben im Versteigerungskatalog der Sammlung des Kurfürsten Clemens August sind die Bildbeschreibungen wesentlich detaillierter. In mehreren Fällen wurde auch die Zuschreibung geändert oder ein Gemälde nur noch als Schulbild deklariert. So wurde in dem Frankfurter Katalog das von Broggia für 80 Reichstaler in Bonn zurückgekaufte Gemälde Jesus segnet die Kinder von "Pierre Entewahl" (Peter Wtewael) nunmehr "J.P. Wtewall" (Joachim Antonisz. Wtewael) zugeschrieben (Kat. 45, Nr. 597; Kat. 51, Nr. 161). Heute befindet sich dieses Bild in der Eremitage in St. Petersburg (Inv.-Nr. 709). Mit fast 200 Bildern stammte die überwiegende Mehrheit der angebotenen Gemälde von holländischen und flämischen Künstlern des 17. Jahrhunderts, darunter allein noch 16 Werke von Jan Fyt und sieben Bilder von Frans Snyders. Der Schwerpunkt der Sammlung des Kurfürsten Clemens August läßt sich auch an dem Frankfurter Katalog noch klar erkennen, so z.B. am hohen Anteil der Jagdstücke. Von den spanischen Bildern aus der kurfürstlichen Sammlung tauchten in dem Frankfurter Katalog nochmals sieben Gemälde Murillos wieder auf, darunter die Folge der Fünf Sinne (Kat. 45, Nr. 376). Über den Verlauf der Auktion liegen keine Erkenntnisse vor, da sich bisher kein annotiertes Exemplar des Katalogs auffinden ließ. Eine Folge von vier großformatigen Jagdstücken von Jan Fyt, die auch aus der Sammlung Clemens August stammten und in dem Frankfurter Katalog viel anschaulicher beschrieben sind, wurden von der Stadt Solingen erworben und 1767 dem Pfalzgrafen Karl Theodor geschenkt. Heute befinden sich diese Bilder in der Alten Pinakothek in München (Inv.-Nrn. 159, 199, 203, 255).
52 1765/03/27
[Lugt 1441]
Jean Chretien Kaller; Frankfurt am Main, La grande Sale de Mr. Schaerff Verkäufer nach Titelblatt: Monsieur *** Lose mit Gemälden: 240 Standorte: *RKDH Annotiert mit den meisten Käufernamen und den meisten Preisen auf eingebundenen Leerseiten; wahrscheinlich Exemplar des Auktionators (französische Ausgabe). SBF Nicht annotiert (französische Ausgabe). Titelblatt: Catalogue d'un magnifique cabinet de tableaux des plus celebres maitres Italiens, Flamands, Allemands & Hollandois, Recueillis avec beaucoup de soins & de fraix par Monsieur ****. Dont la vente se fera a Francfort Mecredi 27. Mars 1765. dans la grande Sale de Mr. Schaerff Par les Personnes jurees aux ventes publiques & sous la Direction de Mr. Jean Chretien Kaller Negotiant Chez qui Ton peut avoir le Catalogue gratis. On puorra voir toute la Collection quatre jours avant la vente dans la dite sale savoir le 22, 23, 25 & 26 Mars le matin de dix heures jusqu'ä midi l'apres-midi de deux heures jusqu'ä quatre. MDCCLXV. Kommentar: In diesem französischsprachigen Versteigerungskatalog des Frankfurter Kunsthändlers Johann Christian Kaller wird eine anonyme Sammlung mit insgesamt 198 Losen angeboten, wobei un74
KATALOGE
ter zahlreichen Nummern zwei Gemälde zusammengefaßt werden. Wie in zwei früheren Katalogen der Kunsthandlung Kaller (Kat. 42 und 44) sind die Gemälde alphabetisch geordnet, wobei wiederum die Künstlernamen als Überschrift über dem Titel gesetzt sind. Die Beschreibungen sind kurz gehalten, jedoch meist mit Maßangaben versehen. Dagegen fehlen Angaben zum Material. In einem Anhang werden nochmals rund vierzig Bilder aufgeführt, die jeweils nur mit einem kurzen Satz ohne Maßangaben vorgestellt werden (Nrn. 199 bis 240). Der Schwerpunkt dieser Auktion lag erneut auf der flämischen und holländischen Schule des 17. Jahrhunderts. Mit 18 Arbeiten schwach vertreten ist die deutsche Schule, darunter zwei Gemälde von Johann Heiß (Nrn. 77 und 78). Die italienischen Schulen sind mit 21 Gemälden sogar etwas besser vertreten, darunter vier Bilder von Giuseppe Nogari (Nrn. 117 bis 120). Nach den Angaben des nur unvollständig annotierten Exemplars RKDH scheint es, daß sich die Frankfurter Sammler auf dieser Auktion sehr zurückgehalten haben. Erwähnt werden Peter Pasquay mit zwei Ankäufen und Johann Carl Brönner mit ebenfalls zwei Zuschlägen. Insgesamt 27 Bilder gingen an einen Käufer namens Hoch, möglicherweise den Maler Johann Gustav Hoch. Allein 43 Gemälde wurden von Johann Christian Kaller selbst ersteigert; vermutlich handelt es sich hier um Rückgänge. Das Preisniveau bewegte sich auf deutlich niedrigerem Niveau als in den vorhergehenden Auktionen Kallers. Die Preise lagen meist zwischen 5 und 20 Gulden, oftmals jedoch noch darunter.
53 1766/07/28
[Lugt 1554]
Ottonem Josephum Steinhaus; Köln, Auf dem Altenmark in der Ritterzunft Windeck Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 215 Standorte: UBKI Annotiert mit vielen Käufernamen und zahlreichen Preisen sowie den Schätzungen. *UBK II Annotiert mit einigen Käufernamen und allen Preisen sowie den Schätzungen. Titelblatt: Catalogue librorum pulcherrime compactorum et picturarum Oder Verzeichnus deren wohleingebundenen raren und außerlesenen Bucheren, in Theologischen, Canonischen, Juristischen, Feudistischen, Publicistischen, Medicinischen, Poetischen, Geographischen, Scholasticalischen, Philosophischen, Italiänischen, Hollandischen, und in der Menge außerlesene Französischen, wie auch schöne Anaßen und Kupferstichen bestehende Bucheren, nach vollendeter dieser Bucher=Auction wird gleich der Anfang gemacht werden von einer großen Schilderey=Collection von unterschiedlichen großen Meisteren, wie nicht weniger auch einiges Silberwerk. Welche den 28ten Julii 1766 des Nachmittags praecise von 3. bis 8. Uhren und folgenden Tagen, dahier in der freyen Reichs=Stadt Collen am Rhein durch den Buchhändler Ottonem Josephum Steinhaus dahier in Cölln auf dem Altenmark in der Ritterzunft Windeck genannt, den Mehristbiethenden gegen gleich baare Zahlung in gangbarer Münz den Rthlr. zu 60 Stub, gerechnet, Stückweiß verkauft und zugeschlagen werden sollen. Dieser Catalogus ist bey obgemeldtem Buchhändler Steinhauss gratis zu bekommen. Kommentar: In diesem umfangreichen Versteigerungskatalog des Buchhändlers Otto Joseph Steinhauss wurden in erster Linie Bücher angeboten. Unter der Überschrift "Catalogus deren Schildereyen" sind am Ende des Katalogs insgesamt 210 Lose mit Gemälden aufgelistet (Seiten 65 bis 76). Die Gemälde sind in zwei Abschnitte aufgeteilt, in denen die Losnummern jeweils neu durchgezählt werden. In dem ersten Abschnitt werden 186 Lose aufgeführt (Seiten 65 bis 74) und im zweiten 26 (Seiten 75 und 76). Vermutlich stammten die Bilder dieser beiden Nummernfolgen von zwei verschiedenen Einlieferern. Im Exemplar UBK sind zudem am Ende noch vier weitere
Lose handschriftlich hinzugefügt worden. Die meisten Bilder sind kurz in einem Satz beschrieben. Nur bei wenigen Bildern werden die Maße genannt, meist jedoch Angaben zum Material gemacht. Nur etwa ein Drittel der Gemälde wird keinem Künstler zugeordnet. Unter den zugeschriebenen Bildern überwiegen flämische und holländische Arbeiten des 17. Jahrhunderts. Ansonsten finden sich noch zehn deutsche Bilder und zwei Kopien nach italienischen Werken.
zusammengefaßt. (Nr. 1). Das Bild Ein heidnisches Opfer von Gerard de Lairesse (Nr. 42) befindet sich heute möglicherweise im Centraal Museum in Utrecht (als J. Hortons, Inv.-Nr. 20289). Lit.: Stübel 1912, S. 115-119, 210.
55 1767/10/15
[Lugt 1641]
[Anonym]; Frankfurt am Main, Roßmarckt Lit. Ε. Nro. 41 Verkäufer nach Titelblatt: Keine
54 1767/00/00
Daten unbekannt
[Anonym]; Köln Verkäufer nach Titelblatt: Aus der Verlassenschaft Weyland des Hochwürdig= und Hochgebohrnen Herrn, Herrn Antonii, des H. Rom. Reichs Grafen von Hohenzölleren &c. &c. der Ertz= und Hohen Domkirchen zu Cölln Zeit Lebens gewesenen Probsten Verkäufer: Hohenzollern, Franz Heinrich Christoph Anton, Graf von Lose mit Gemälden: 134 Standorte: UBK Nicht annotiert. LBDa I Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. LBDa II Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Titelblatt: Catalogue eines Auserlesenen, wohl conditionirten, insgesamt mit schönen, nach neuer Französischen Manier geschnittenen, und fein vergoldeten Rahmen gezierten Mahlerey=Cabinets Vornehmer, theils Niederländischen, theils Italiänischen Meistern, Aus der Verlassenschaft Weyland des Hochwürdig= und Hochgebohrnen Herrn, Herrn Antonii, des H. Rom. Reichs Grafen von Hohenzölleren &c. &c. der Ertz= und Hohen Domkirchen zu Cölln Zeit Lebens gewesenen Probsten (Tit.pl.). Kommentar: In dieser Auktion wurde die Gemäldesammlung von Franz Heinrich Christoph Anton Graf von Hohenzollern (16991767) versteigert. Auf der Titelseite ist kein Datum angegeben. Es ist jedoch anzunehmen, daß die Auktion kurz nach dessen Tod im Jahre 1767 durchgeführt wurde. Auch wird kein Ort genannt, so daß nicht sicher ist, ob die Auktion in Köln oder Bonn durchgeführt wurde. Im Umkreis des Kurfürsten Clemens August (1700-1761) sammelten auch zahlreiche Hofbeamte Kunst, so beispielsweise der Leibarzt Johann Heinrich von Gise (Kat. 14 und 14a) und Ferdinand Graf von Plettenberg, dessen Sammlung 1737 in Amsterdam versteigert wurde (Lugt 480 und 578). Auch der 1750 verstorbene Ferdinand Leopold Anton Graf von Hohenzollern (vgl. Kat. 23), der Bruder von Franz Heinrich Christoph Anton, zählte zu diesem Kreis von Kunstinteressierten. In dem Katalog werden die durchnumerierten Lose in knappen Beschreibungen vorgestellt. Die Maße werden in tabellarischer Form in kölnischen Fuß und Zoll genannt. Bis auf 16 Gemälde stammen alle Bilder aus der Sammlung von Ferdinand Leopold von Hohenzollern. Die 16 neu hinzugekommenen Gemälde sind sämtlich von weniger bedeutenden Künstlern oder anonym. Franz Heinrich Christoph Anton Graf von Hohenzollern hat wahrscheinlich nur die Bilder aus dem Erbe seines Bruders übernommen und die Sammlung nicht nennenswert erweitert. Als Vorlage für den Katalog diente offensichtlich das französischsprachige Verzeichnis der Sammlung Ferdinand Leopold Graf von Hohenzollern. Die Bildtitel sind nur in freier Form ins Deutsche übersetzt worden. Auch die Schreibweise der Künstlernamen wurde eingedeutscht. Nur in wenigen Fällen änderte sich die Zuschreibung, manche Bilder sind in dem Katalog von 1767 nur noch als "Schule des" oder "Gusto von" bezeichnet. Rund zwei Drittel der Bilder stammen von holländischen und flämischen Malern des 17. Jahrhunderts, hinzu kommen 14 deutsche Arbeiten und sieben italienische Werke. Auch die vier spanischen Gemälde aus der Sammlung des Bruders, alle von Guillermo Mesquida, wurden erneut zum Verkauf angeboten, allerdings in einer Losnummer
Lose mit Gemälden: 112 Standorte: SBF Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß einer auserlesenen Sammlung von Gemählden, welche zu Franckfurt am Mayn auf dem Roßmarckt Lit. Ε. Nro. 41 den 15. Oct. 1767. mittelst öffentlicher Versteigerung verkauft werden sollen. Nebst einem Anhang von Französischen, Englischen und Italiänischen Kupferstichen in schwartz gebeizten und mit vergoldeten Stäben versehenen Rahmen unter Glas. Gedruckt, bey Phil. Wilh. Eichenberg, Sen. Kommentar: In diesem anonymen Versteigerungskatalog wurden insgesamt 114 Losnummern mit Gemälden angeboten, in einem Anhang (S. 11 bis 15) werden zudem in 74 Losen Kupferstiche aufgeführt. Die meisten Beschreibungen sind sehr knapp und recht allgemein gehalten; Maßangaben ergänzen die Beschreibungen. Bildtitel wie Zwey vortrefflich gemahlte Italiänische Thier Stücke machen eine Identifizierung der Gemälde unmöglich. Insgesamt 43 Gemälde werden keinem Künstler zugeschrieben. Es überwiegen Werke der deutschen Schule des 18. Jahrhunderts, insbesondere von Künstlern der Frankfurter Schule wie beispielsweise von Justus Juncker und Johann Georg Trautmann. Dagegen finden sich nur drei holländische Gemälde des 17. Jahrhunderts, zudem eine Folge von sechs Lucas van Leyden zugeschriebenen Landschaften (Nrn. 16 bis 21). Die sechs italienischen Werke bleiben bis auf ein Gemälde von Jacopo Tintoretto anonym.
56 1767/10/26 [Anonym]; Hamburg? Verkäufer nach Titelblatt: Keine Standorte: SBH Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Kommentar: Dieser anonyme Auktionskatalog ist nur bibliographisch nachweisbar (Realkatalog der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg KD III., Hanseatica Hamburgensia IV, S. 74); Holst 1939, S. 271, führt ihn ebenfalls in seiner Liste. Über den Umfang der Sammlung und den Besitzer liegen keine Informationen vor; nach den Angaben des Realkatalogs enthielt der Versteigerungskatalog Kupferstiche und Zeichnungen. Es ist nicht sicher, ob sich auch Gemälde darunter befanden.
57 1767/11/23
und folgende Tage
[Lugt 1648]
Otto Joseph Steinhauss; Köln Verkäufer nach Titelblatt: Keine Standorte: LBDa Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Titelblatt: Catalogue oder Verzeichnis einer schönen Collection von Mahlereyen welche den 23. Nov. 1767 [...] verabfolgt werden sollen. Kommentar: Otto Joseph Steinhauss wird in einem Auktionskatalog aus dem Jahr 1766 (Kat. 53) als Buchhändler bezeichnet. Vermutlich betrieb er außerdem eine Kunsthandlung. Möglicherweise hanKATALOGE
75
delt es sich um zwei Auktionen, da bei Lugt als Daten der 23. und der 27. November genannt werden. Nach Lugt enthielt der Katalog 220 Gemälde auf insgesamt 16 Seiten. Da das einzige bisher nachweisbare Exemplar dieses Katalogs vernichtet worden ist, lassen sich keine weiteren Angaben machen. 58 1768/00/00
Daten unbekannt
[Anonym]; Hamburg? Verkäufer nach Titelblatt: Keine Standorte: SBH Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Kommentar: Dieser anonyme Auktionskatalog ist nur bibliographisch nachweisbar (Realkatalog der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg KD III., Hanseatica Hamburgensia IV, S. 74); Holst 1939, S. 271, führt ihn ebenfalls in seiner Liste. Über den Umfang der Sammlung und den Besitzer liegen keine Informationen vor; nach den Angaben des Realkatalogs enthielt der Katalog Gemälde. 59 1768/05/02 [Anonym]; Berlin Verkäufer nach Titelblatt: D. Joannes Petrus Süssmilch Verkäufer: Süssmilch, Johann Peter Lose mit Gemälden: 49 Standorte: UBK Nicht annotiert. Titelblatt: Catalogue prsestantissimi thesauri exquisitissimorum et rariorum in omni studiorum et linguarum genere librorum, quos magno labore ac sumtu collegit, dum superabat, D. Joannes Petrus Süssmilch, Supremi Dicasterii ecclesiastici, quod Berolini est, Consiliarius, Coloniensium ad Spream finitimaeque diceceseos Praepositus, Su[unleserlich] ad /Edem S. Petri Antistes, Directorii Eleemosynarum Commissarius, Gymnasii Coloniensis Inspector, & Academic Scientiarum Berolinensis Membrum; public» auctionis lege d. 2 Maj. 1768, horis consuetis, in aedibus D. Propositi ad d. Petri, parata pro pecunia divendendi: secundum materias ordine digessit, notasque litterario-criticas nonnullis libris addidit D. Joannes Georgius Krüniz. Berolini Typis Ge. Lud. Winteri. Kommentar: In diesem umfangreichen Versteigerungskatalog der Sammlung des Theologen und Ökonomen Johann Peter Süssmilch (1707-1767) wurden vor allem Bücher angeboten. Auf den Seiten 500 bis 503 sind auch 72 Lose unter der Rubrik "Gemähide" aufgeführt. Darunter finden sich allerdings auch einige Arbeiten auf Papier sowie Gipsplastiken (Nrn. 27 und 28), so daß in die Datenbank nur 49 Gemälde aufgenommen werden konnten. Die Bildbeschreibungen sind kurz gehalten, Maßangaben fehlen ganz, teilweise wird jedoch das Material angegeben. Die meisten Gemälde bleiben anonym. Wenn Künstlernamen erwähnt sind, handelt es sich überwiegend um Kopien nach holländischen Meistern, wie beispielsweise bei Nr. 63, einer Kopie nach Rembrandt. Die Bildersammlung ist sehr heterogen und diente wohl als dekorative beziehungsweise illustrative Ergänzung der Bibliothek. Bei auffällig vielen Bildern handelt es sich um Portraits preußischer Herrscher. Lit.: ADB 37 (1894), S. 188-195.
60 1768/07/00
Daten unbekannt
[Anonym]; München Verkäufer nach Titelblatt: Franciscus Ignatius von Dufresne, Ihro churfürstl. Durchl. in Baiern u. ebenfalls bestellten Hofkammer= und Commercienrath Verkäufer: Dufresne, Franz Ignaz von Lose mit Gemälden: 906 76
KATALOGE
Standorte: BSBM Künstlerindex mit den entsprechenden Losnummern. Der Katalog fehlt jedoch und wurde wahrscheinlich im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Nicht annotiert. Titelblatt: Kurzer Begriff jener Gemälde, welche aus der Verlassenschaft des im Monat May abhin zu München gestorbenen churfürstl. baierischen Hofkammer= und Commercienrath, Josephus von Dufresne, seinem Herrn Bruder, Franciscus Ignatius von Dufresne, Ihro churfürstl. Durchl. in Baiern ec. ebenfalls bestellten Hofkammer= und Commercienrath erblich zugekommen sind, wovon selber einen Theil, weil er die Menge derselben nicht zu verwenden vermag, nach selbstiger Auswahl der vorkommenden Liebhabern zu verkauffen gedenket. Herausgezogen aus einer von dem seligen Herrn von Dufresne in seinen Lebzeiten verfaßt, und nach seinem Hinscheiden erst bekannt gewordenen Beschreibung. Zu München in den Heumonat des 1768. Jahrs. Kommentar: Es handelt sich bei diesem Katalog nicht um einen Versteigerungskatalog, sondern nur um eine gedruckte Liste mit den Namen der Künstler, die als Index zu einem bereits vorhandenen Verzeichnis der Sammlung Joseph von Dufresne diente. Dieses Verzeichnis wurde 1766 nur für den Sammler selbst angefertigt und war wahrscheinlich nicht gedruckt, wie im Vorwort eines weiteren Katalogs der Dufresne-Sammlung aus dem Jahre 1769 erwähnt wird (vgl. Kat. 62). Nach dem Tod von Joseph von Dufresne, der vermutlich im Mai 1768 verstorben war, plante dessen Bruder Franz Ignaz große Teile der umfangreichen Gemäldesammlung zu veräußern. Da sich das zu der Liste zugehörige beschreibende Verzeichnis bisher nicht auffinden ließ, konnte hier nur die Künstlerliste ausgewertet werden, die als Ankündigung des Verkaufes und gleichzeitig als Index für das Verzeichnis diente. Nach den Erläuterungen der kurzen Einführung wurde diese "Beschreibung" von Joseph von Dufresne selbst angefertigt und war niemandem bekannt. In der vorliegenden Indexliste fehlen alle Angaben über den Bildgegenstand, das Material und die Dimensionen. Fast alle Künstlernamen werden mit dem jeweiligen Vornamen in Klammern angegeben. In einer zweiten Spalte sind die jeweiligen Katalognummem des beschreibenden Verzeichnisses von 1766 aufgelistet und in einer dritten Spalte die Anzahl der Gemälde des betreffenden Künstlers. Insgesamt 285 Gemälde sind summarisch am Ende der Liste aufgeführt, bei denen es sich teilweise um Originale, teilweise um Kopien handeln soll. Vermutlich wurden hier anonyme Werke des beschreibenden Verzeichnisses zusammengefaßt. Da die in der zweiten Spalte angegebenen Katalognummern bis 1.194 reichen, läßt sich annehmen, daß die summarisch zusammengefaßten 285 Werke in dem beschreibenden Verzeichnis einzeln aufgeführt und in die Nummernfolge eingestreut waren. In der Tabelle wird zwar die Anzahl von 258 für diese summarisch zusammengefaßte Gruppe genannt, nach dem Ergebnis der Zwischensumme, auf der noch vier weitere Gemälde aufgeführt werden, muß es sich hier um einen Zahlendreher handeln: statt 258 ist 285 gemeint. Nach Angabe der Liste handelt es sich um insgesamt 1.200 Werke, wobei die Zwischensummen allerdings nur eine Anzahl von 1.193 Gemälde ergeben. Am Ende der Indexliste wird Interessenten angezeigt, daß sie sich hinsichtlich näherer Angaben zu Format und Preis "bey dem Eingangs gedachten von Dufresne, welcher in dem Churfürstl. weißen Bräuhauß wohnet, zu melden belieben". Auch Erkundigungen zum Preis und zu den Dimensionen der Bilder sollten an dieser Stelle eingeholt werden, da sie anscheinend in dem beschreibenden Verzeichnis nicht erwähnt waren oder dieses Verzeichnis den Interessenten nicht zugänglich war. Nach dem Umfang der Verkaufstabelle und den darin aufgeführten Namen zu schließen (es wurden allein 22 Gemälde Rubens zugeschrieben), handelte es sich um eine sehr bedeutende Sammlung. Der Einleitung zufolge wurde nur ein Teil der gesamten Sammlung zum Verkauf angeboten. Wahrscheinlich wurden nach dieser Index-
liste schon vereinzelt Gemälde verkauft, denn im Jahr 1769 erschien ein französischsprachiger Versteigerungskatalog, in dem mit 619 Gemälden rund zwei Drittel der 908 in der Liste einzeln aufgeführten Bilder (darunter als Nr. 511 ein Pastell) auftauchen. In diesem Katalog aus dem Jahr 1769 (vgl. Kat. 62) wird in den meisten Fällen auf die Nummern der Liste von 1768 bzw. des nicht mehr existierenden beschreibenden Verzeichnisses verwiesen, insgesamt lassen sich sogar 515 Bilder nachweisen. Einige Bilder waren dem bayerischen König geschenkt worden. Wegen der Differenzen des Versteigerungskatalogs von 1769 und der Liste von 1768 wurden beide in die Datenbank aufgenommen. Mit Restbeständen der Sammlung wurde zudem 1770 in Amsterdam eine weitere Auktion durchgeführt (Lugt 1862), bei der auch Gemälde aus der Liste von 1768 versteigert wurden, die nicht in dem Katalog von 1769 auftauchten.
61 1768/08/16
und folgende Tage
[Lugt 1705]
[Anonym]; Köln, Haus des Sammlers, Reiler-Heff auf St. Marcellen=Straß Verkäufer nach Titelblatt: Freyherr von Kaas Verkäufer: Kaas zu Reventlau, Wilhelm Friedrich Wolfgang, Freiherr von Lose mit Gemälden: 104 Standorte: UBK Nicht annotiert. LBDa Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Titelblatt: Catalogue oder Verzeichniß einer schöner Collection von Mahlereyen bestehende in Niederländischen wie auch Italiänischen Meistern von unterschiedlichen Vorstellungen Geist= und weltlichen Historien, Fabeln, Landschaften, Bataillien, Frucht= und Blumen=Stücker. Welche den 16ten August 1768. und folgende Tägen in des verstorbenen Tit. Freyherm von Kaas Behansung [sie] im Reiler-Heff auf St. Marcellen=Straß aus freyer Hand verkauft und dem Meistbiethenden gegen gleich baare in guter dahier gängiger Gold= und Silber=Müntz=Sorten leistende Zahlung den Rthlr. zu 60. Stüb. gerechnet, stuckweiß zugeschlagen, und verabfolget werden sollen. Kommentar: In diesem zwölfseitigen Versteigerungskatalog mit insgesamt 105 Losnummern wurde der Nachlaß des Amtmanns Wilhelm Friedrich Wolfgang von Kaas zu Reventlau (gest. 1768) versteigert. Die Auktion fand im Privathaus des Sammlers statt, dem sogenannten Rilerhof in der Marzellen-Straße, den Kaas 1738 erworben hatte. Es wurden fast ausschließlich Gemälde angeboten, nur die Losnummer 105 erfaßt zwei Folianten mit "wohlgemachten Brenten, von Christlichen Potentaten und Fürsten" von Johan Engelberten Nyose van Campenhouten und Antonio Albizco. Die Katalogeinträge beinhalten zwar Titel und Künstlernamen, beschränken sich aber im allgemeinen auf einen Satz. Dazu werden in tabellarischer Form die Maßangaben angeführt. Viele Bilder werden als anonyme Werke verzeichnet. Neben holländischen und flämischen Gemälden des 17. und 18. Jahrhunderts enthält die Sammlung auch einige italienische Werke. Kaas hatte vermutlich einige Gemälde aus der Versteigerung von Clemens August erworben (vgl. Kat. 45). Lit.: Förster 1931, S. 59f.
62 1769/00/00
Daten unbekannt
[Anonym]; München Verkäufer nach Titelblatt: Le Sieur Francois Ignace de Dufresne, Conseiller des Finances et du Commerce de S.A.S.E. de Baviere Verkäufer: Dufresne, Franz Ignaz von Lose mit Gemälden: 619 Standorte: MA Nicht annotiert.
Titelblatt: Catalogue des tableaux qui sont ä vendre chez le sieur Francois Ignace de Dufresne, conseiller des Finances et du Commerce de S.A.S.E. de Baviere. ä Munich 1769. Kommentar: In diesem französischsprachigen Katalog wurde ein großer Teil der Sammlung Joseph von Dufresne zum Kauf angeboten, die vermutlich schon ein Jahr zuvor von dem Bruder des Sammlers, Franz Ignaz von Dufresne, offeriert worden war (vgl. Kat. 60). Im Jahre 1768 war jedoch nur eine Indexliste mit Künstlernamen erschienen, die als eine Übersicht zu einem schon existierenden beschreibenden Verzeichnis der Sammlung diente. Dieses beschreibende, wahrscheinlich nicht gedruckte Verzeichnis wurde 1766 nur für den Sammler selbst angefertigt, wie es im Vorwort des Katalogs von 1769 heißt. Die Indexliste des Jahres 1768 verzeichnet 1.200 Gemälde, von denen jedoch 285 unter einer Nummer summarisch zusammengefaßt worden waren. In dem Verkaufskatalog des Jahres 1769 sind dagegen nur 619 Gemälde verzeichnet, es handelt sich also nur um eine Auswahl aus den ursprünglich noch umfangreicheren Beständen der Sammlung Joseph von Dufresne, denn schon in der Indexliste wird von einer Auswahl gesprochen. Bei mehr als der Hälfte der Bilder des Katalogs von 1769 wird auf die jeweiligen Nummern hingewiesen, die in der Indexliste genannt werden und die auf die Nummernfolge des beschreibenden Verzeichnisses von 1766 hinweisen. Insgesamt lassen sich 515 Bilder des Katalogs von 1769 in der Liste von 1768 nachweisen. Es handelt sich bei diesem Katalog nicht um einen Versteigerungskatalog, sondern um einen Verkaufskatalog, der interessanterweise nach Themen sortiert ist. In einer ersten Abteilung werden Früchte- und Blumenstücke, Stilleben und Küchenszenen angeboten (Nrn. 1 bis 51), in einer zweiten alle übrigen Kabinettstücke (Nrn. 52 bis 214) und in der dritten alle "Grands et moiens tableaux". In dieser umfangreichsten Abteilung sind die Gemälde alphabetisch nach Künstlern sortiert. Alle Beschreibungen sind bis auf wenige Ausnahmen relativ knapp gehalten, werden jedoch durch Materialund Maßangaben ergänzt. Kein einziges Gemälde bleibt anonym. Teilweise werden mehrere Bilder in einem Eintrag zusammengefaßt, in einem Fall werden insgesamt 70 Landschaften von Joachim Franz Beich, Jacopo Amigoni und Wentzel summarisch katalogisiert (Nrn. 248 bis 317). Mit insgesamt 221 Gemälden überwiegen die Arbeiten holländischer und flämischer Künstler des 17. Jahrhunderts, darunter eine Folge von 16 Szenen aus dem Leben Christi von Arent de Gelder (Nrn. 389 bis 414), die auch summarisch im Katalog aufgeführt werden (Nm. 389 bis 404) und sich jetzt größtenteils als Bestandteil der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen im Schloß Aschaffenburg befinden. Zwei Werke von Peter Paul Rubens (Nrn. 521 und 524) sind heute Bestandteil der Eremitage in St. Petersburg (Inv.-Nrn. 494 und 1703). Im Vergleich zu anderen deutschen Sammlungen ist auch die französische Schule mit 36 Werken außergewöhnlich gut vertreten, dazu kommen noch zwölf Landschaften von Gaspard Dughet, der wegen seines jahrelangen Aufenthaltes in Rom sowohl der französischen als auch der italienischen Schule zugeordnet werden kann. Unter den französischen Bildem finden sich vier Bilder von Nicolas Poussin, von denen sich zwei Gemälde in der Eremitage befinden und das Bild Moses auf dem Berg (Nr. 493) im Moskauer Puschkin-Museum verwahrt wird. Bei den deutschen Künstlern dominieren die Landschaften von Joachim Franz Beich. Ansonsten finden sich auch noch neun Arbeiten von Johann Carl Loth, je sechs von Joachim von Sandart und von Georg Philipp Rugendas. Insgesamt fällt auf, daß sich die Kollektion gerade bei den deutschen und italienischen Künstlern auf die Werke einiger weniger Künstler konzentriert und diese breit präsentiert. Bei den Italienern sind zahlreiche Gemälde von Jacopo Amigoni, zwölf Werke von Jacopo Bassano sowie 13 von Canaletto aufgeführt. Von Antonio Domenico Triva, der als bayerischer Hofmaler gearbeitet hatte, stammen allein 25 Werke, die größtenteils auch summarisch aufgelistet werden. Restbestände dieses Verkaufs wurden ein Jahr später auf einer Auktion in Amsterdam angeboten (Lugt 1862). Dort tauchen auch KATALOGE
77
einige Gemälde der Indexliste von 1768 auf, die nicht in dem Katalog von 1769 enthalten waren. Viele Bilder der Amsterdamer Versteigerung können jedoch in dem Katalog von 1769 nicht identifiziert werden.
63 1769/03/30 C. Ulrich Toussaint; Hamburg, Dem ABC gegen über neben den Heern Lanz Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 51 Standorte: *KH Annotiert mit allen Käufernamen und Preisen auf eingebundenen Leerseiten. Titelblatt: Catalogue einer Sammlung auserlesener Kabinet=Gemählde und Kupferstiche, insbesondere von denen Rembrandtischen, so alle nach dem Catalogue von Gersaint colligirt, und Naturalien, wobey alle Sorten Ertze, als Gold, Silber, Bley, Kupfer, Eisen, und Halb=Metalle, wovon die Beschreibung bey einer jeden Stuffe ist, nebst einer Parthey von unterschiedenen der feinsten Farben, und Sorten Tafel=Service von der neuen Stralsunder FayanceFabrik, dabey auch vier ganze Fayance-Ofens, nebst einen Aufsatz auf einen eisernen Ofen befindlich, desgleichen Eine Parthey Pastell Farben und feine Bleystiffte, welche den 30sten März dem ABC gegen über neben den Herrn Lanz durch den Mäckler C. Ulrich Toußaint öffentlich verkauft werden sollen. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog des Hamburger Maklers C. Ulrich Toussaint wurden insgesamt 51 Gemälde angeboten. Neben den Gemälden standen noch graphische Arbeiten, Mineralien und Fayencen zum Verkauf. Auf der Titelseite sind die Ortsangabe und das Jahr der Auktion handschriftlich nachgetragen. Das Datum findet sich handschriftlich nochmals auf Seite 3: "Hamburg, den 30 Mertz Ao 1769, Vormittags." Alle Beschreibungen sind sehr kurz gehalten, die Materialien und die Maße werden jedoch angegeben. Mehrere Einträge enthalten kennerschaftliche Urteile zur Ausführung wie "ausführlich gemahlt" oder "meisterhaft gemahlen". Die meisten Gemälde waren mit einem vergoldeten oder mit einem schwarz gebeizten Rahmen mit goldener Leiste versehen, wie es in einem Nachsatz zur Abteilung der Gemälde heißt. Nahezu die Hälfte der offerierten Gemälde gehört der holländischen oder flämischen Schule an. Neben zwei Bildern von Nicolas Poussin (Nrn. 4 und 28) finden sich acht deutsche Werke sowie zwei italienische Gemälde, darunter Der Leichnam Christi von Annibale Carracci (Nr. 6). Nur vier Gemälde bleiben anonym. Das Exemplar KH enthält auf eingebundenen Leerseiten die handschriftlichen Einträge der Käufernamen und der Preise. Das Preisniveau lag bei 10 bis 50 Mark. Den höchsten Preis erzielten zwei als Pendants angebotene Gemälde von Sebastian Vrancx, Die Geburt Christi und die Gefangennahme Christi (Nrn. 13 und 14) für 165 Mark und 8 Schilling, gefolgt von einem Jan Brueghel d.Ä. zugeschriebenen Gemälde (Nr. 9) für 75 Mark. Ein Historiengemälde von Jan Steen, Die Versuchung des Hl. Antonius (Nr. 20), wurde für 49 Mark und 8 Schilling verkauft. Zwei kleine Bildnisse von Rembrandt (Vater und Mutter des Künstlers) wurden bei 36 Mark zugeschlagen. Dem Katalogeintrag zufolge befanden sich die beiden Gemälde zuvor in dem Lormischen Cabinet in Den Haag. Die Sammlung Willem Lormier wurde am 4. Juli 1763 versteigert (Lugt 1307). Die beiden Bildnisse von Rembrandt lassen sich allerdings im Versteigerungskatalog der Sammlung Lormier nicht nachweisen. Zahlreiche Gemälde gingen nach den Angaben des annotierten Exemplars KH an den Käufer "Hofrath", dessen Namen später durchgestrichen wurde. Möglicherweise handelt es sich hier um Rückgänge und der Titel "Hofrath" gibt einen Hinweis auf den Besitzer der Sammlung. Wahrscheinlicher ist jedoch, daß es sich hier 78
KATALOGE
um den Maler und Kunsthändler Johann Benjamin Ehrenreich handelt, der 1767 nach Hamburg kam und sich seitdem als Kunsthändler engagierte. Als Agent der Markgräfin Karoline Luise von Baden trug er den Titel "Hofrat" und wurde so auch in anderen Auktionen betitelt, dann aber zusammen mit seinem Namen. Durchgestrichen wurde auch der Name des Käufers "Post Meyer" (Nrn. 10, 11,21 und 22). Vermutlich deuten diese Streichungen darauf hin, daß ein Bild bezahlt wurde. Bei einem Gemälde des Monogrammisten A.S wurde ausdrücklich vermerkt "Nicht verkauft". Hier handelt es sich um einen offensichtlichen Rückgang. Bei den Losnummern 1, 24 und 51 fehlt jeder Hinweis auf eine Transaktion. Von den verkauften Gemälden übernahmen die Kunsthändler Johann Dietrich Lilly Senior und Junior allein acht, bei sechs Bildern erhielt der Käufer Duve den Zuschlag.
64 1770/06/21 [Anonym]; Hamburg? Verkäufer nach Titelblatt: Keine Standorte: SBH Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Kommentar: Dieser anonyme Auktionskatalog ist nur bibliographisch nachweisbar (Realkatalog der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg KD III., Hanseatica Hamburgensia IV, S. 74); Holst 1939, S. 271, führt ihn ebenfalls in seiner Liste. Über den Umfang der Sammlung und den Besitzer liegen keine Informationen vor; nach den Angaben des Realkatalogs enthielt der Katalog Gemälde.
65 1770/10/06 [Anonym]; Hamburg? Verkäufer nach Titelblatt: Keine Standorte: SBH Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Kommentar: Dieser anonyme Auktionskatalog ist nur bibliographisch nachweisbar (Realkatalog der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg KD III., Hanseatica Hamburgensia IV, S. 74); Holst 1939, S. 271, führt ihn ebenfalls in seiner Liste. Über den Umfang der Sammlung und den Besitzer liegen keine Informationen vor; nach den Angaben des Realkatalogs enthielt der Katalog Gemälde.
66 1770/10/26 [Anonym]; Hamburg? Verkäufer nach Titelblatt: Keine Standorte: SBH Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Kommentar: Dieser anonyme Auktionskatalog ist nur bibliographisch nachweisbar (Realkatalog der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg KD III., Hanseatica Hamburgensia IV, S. 74); Holst 1939, S. 271, führt ihn ebenfalls in seiner Liste. Über den Umfang der Sammlung und den Besitzer liegen keine Informationen vor; nach den Angaben des Realkatalogs enthielt der Katalog Gemälde und Kuriositäten.
67 1770/10/29
[Lugt 1866]
[Anonym]; Frankfurt am Main, In dem Carmeliter=Kloster auf dem Speicher Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 250
Standorte: SBFI Nicht annotiert. Aus dem Besitz von Johann Valentin Prehn. SBF II Nicht annotiert. Titelblatt: Catalogus von einem schönen Cabinet künstlicher Mahlereyen von denen berühmtesten Italiänischen, Französischen, Niederländischen und Teutschen Meistern alle von einem vornehmen Liebhaber gesamlet welche durch die geschwohme Herren Ausrüfere den 29. October 1770 zu Frankfurt am Mayn in dem Carmeliter= Kloster auf dem Speicher öffentlich an den Meistbiethenden sollen verkauft werden. Die ganze Sammlung kan von denen Herrn Liebhabern täglich Vormittags von 10. bis 12. und Nachmittags von 2. bis 4. Uhr in Augenschein genommen werden. Die Catalogi nebst weiteren Bericht sind bey gemeldeten Ausrufern zu bekommen. MDCCLXX. Kommentar: In diesem anonymen Frankfurter Versteigerungskatalog wurden insgesamt 250 Gemälde offeriert. Im Gegensatz etwa zu den Auktionskatalogen Johann Christian Kallers (Kat. 42 und 44) listet der Katalog die Gemälde ungeordnet auf. Wahrscheinlich wurde er von dem von der Stadt Frankfurt bestallten Ausrufer zusammengestellt, der im Gegensatz zu Kaller über keine kennerschaftliche Kompetenz verfügte. Oftmals werden zwei oder mehrere Bilder unter einer Losnummer zusammengefaßt. Die Beschreibungen sind sehr knapp gehalten, der Bildtitel und der Künstlername werden meist in einem Satz vorgestellt. Beispielsweise heißt es unter Nr. 1: "Abraham opffert seinen Sohn Isaac, von Spaniolet"; es folgen die Maßangaben in rheinischen Fuß. Angaben zum Material fehlen gänzlich. Gegen Ende des Katalogs finden sich zahlreiche anonyme Werke, insgesamt bleibt mit 127 Bildern nahezu die Hälfte der aufgeführten Werke ohne Zuschreibung. Unter den zugeschriebenen Werken dominieren Gemälde der holländischen und flämischen Schule des 17. Jahrhunderts, darunter fünf Werke von Peter Paul Rubens und seiner Schule sowie drei Gemälde Rembrandts. Nur schwach vertreten sind die deutschen Künstler, darunter keine Vertreter der Frankfurter Schule. Die italienischen Schulen besitzen dagegen mit 30 Gemälden weit mehr Gewicht, zumal auch einige prominente Namen genannt werden, so Raffael (Geburt Christi; Nr. 66), Caravaggio CSchlafender Cupido\ Nr. 19) oder Michelangelo (Philosoph; Nr. 104). Da sich kein annotiertes Exemplar des Katalogs erhalten hat, läßt sich über den Ausgang der Auktion keine Aussage machen.
68 1771/05/06
und folgende Tage
[Lugt 1929]
[Anonym]; Frankfurt am Main, Haus des Sammlers, auf der Zeil Lit. D. Nro. 26 Verkäufer nach Titelblatt: Johann Friederich Armand von Uffenbach Verkäufer: Uffenbach, Johann Friedrich Armand von
Kommentar: In dieser Versteigerung wurde die Sammlung Johann Friedrich Armand von Uffenbach (1687-1769) verkauft. Der Sammler dilettierte selbst als Zeichner, Glasschleifer und Musiker. Er war außerdem als Baumeister tätig. So leitete er beispielsweise den Umbau der alten Mainbrücke in Frankfurt in den Jahren 1740 bis 1744. Nach 1744 gehörte Uffenbach dem Rat an, dem wichtigsten politischen Gremium der Stadt Frankfurt, und wurde schließlich 1762 Erster Bürgermeister der Stadt. Nach Hüsgen zählten vor allem technische Instrumente, die Bibliothek und die Kupferstichsammlung zu den Höhepunkten seiner Sammlung. Diese Bestände vermachte Uffenbach 1736 der Universität Göttingen. Der umfangreiche Katalog der Sammlung Uffenbach ist in drei Abschnitte unterteilt, wie in einem "Vorbericht" detailliert erläutert wird. Der erste Abschnitt verzeichnet die Zeichnungen (S. 1 bis 27), der zweite die 163 zum Verkauf angebotenen Gemälde (S. 27 bis 31), die Miniaturen, Pastelle, Aquarelle, die Glasmalerei (S. 37 bis 40) und die Emaillemalerei (S. 41). Der dritte Abschnitt führt u.a. die Statuen, Reliefs und Naturalien auf (S. 42 bis 63). Bei den graphischen Arbeiten handelte es sich nur um Restbestände, da Uffenbach den größten Teil seiner Kupferstichsammlung - wie bereits erwähnt - schon zu seinen Lebzeiten der Universitätsbibliothek Göttingen gestiftet hatte. Unter den Gemälden finden sich vor allem holländische und flämische Werke des 17. und 18. Jahrhunderts, darunter vier der Rembrandt-Schule zugeschriebene Arbeiten sowie fünf Landschaften von David Vinckeboons. Unter den Flamen fallt die große Zahl von Bildern auf, die "Franck" zugesprochen werden und daher nicht zweifelsfrei zu identifizieren sind. Bei den deutschen Bildern überwiegen die Arbeiten von Künstlern des 18. Jahrhunderts, wobei mit Johann Conrad Seekatz, Justus Juncker oder Georg Flegel Künstler aus dem Raum Frankfurt und Darmstadt stark vertreten sind. Es finden sich jedoch auch fünf Tafeln Cranachs und sechs kleinere Bilder des Nürnberger Malers Bartholomäus Wittig. Sehr viele Gemälde sind nur pauschal als Bilder einer bestimmten Schule ausgewiesen, besonders in der italienischen Abteilung (zwei von acht Werken). 37 Gemälde werden keinem Künstler und keiner Schule zugordnet. Weitaus bedeutender waren die Sammlungen der Zeichnungen und der Skulpturen. Der größte Teil der Sammlung blieb wohl unverkauft, denn nach dem Tod der Ehefrau des Sammlers wurden am 15. Mai 1775 in einer erneuten Auktion 115 Bilder angeboten (Kat. 87). In diesem zweiten Katalog der Sammlung Uffenbach finden sich bis auf 49 Bilder alle Gemälde wieder. Losnummer 1 entspricht Losnummer 7 im späteren Katalog, Nummer 2 der Nummer 34; von da an bis zum Ende der Gemäldeabteilung ist die Abfolge der Werke des älteren Katalogs im großen und ganzen übernommen. Ansonsten wurden nur in wenigen Fällen Veränderungen vorgenommen. In dem annotierten Exemplar AMF sind die Käufernamen und Preise nur für die Lose 1 bis 33 angegeben. Alle Ergebnisse blieben auf niedrigem Niveau. Lit.: Hüsgen 1780, S. 173; Gwinnerl 1862, S. 265f.; Schmidt 1960, o.P.; Goethe, Dichtung und Wahrheit, 1986, S. 83f.
Lose mit Gemälden: 164 Standorte: *AMF Annotiert mit einigen Käufemamen und Preisen für die Gemäldelose 1 bis 33. SBF I Nicht annotiert. SBF II Nicht annotiert. SUBG Nicht eingesehen. Titelblatt: Catalogus von Original-Handzeichnungen, Gemählden und Statuen, nebst einigen Naturalien, wie auch optischen und technischen Maschinen welche der wohlseel. Herr Johann Friedrich Armand von Uffenbach, gewesener Schöff und des Raths, wie auch Kayserlicher würklicher Rath ec. hinterlassen, und durch öffentlichen Verkauf an den Meistbiethenden in desselbigen Behaußung auf der Zeil Lit. D. Nro. 26. den 6ten May 1771 und folgende Tage gegen gleich baare Bezahlung überlassen werden sollen. Frankfurt am Mayn, gedruckt bey Johann Ludwig Eichenberg seel. Erben.
69 1771/10/22
und folgende Tage
[Anonym]; Halle, In dem in der grossen Ulrichstrasse gelegenen von Dreyhauptischen Hause Verkäufer nach Titelblatt: Johann Christoph von Dreyhaupt Verkäufer: Dreyhaupt, Johann Christoph von Lose mit Gemälden: 90 Standorte: UBLg Nicht annotiert. BSBM Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Titelblatt: Verzeichniße der von dem Königl. Preußl. Geheimden Regierungs=Krieges= und Domainen=Rath im Herzogthum Magdeburg, wie auch Stadt=Schultheissen und Salz=Gräfen zu Halle, Comitis Pal. Caes., Mitgliedes der Römisch=Kayserl. Academie derer KATALOGE
79
Naturforscher und der Königl. Preußl. Academie derer Wissenschaften zu Berlin, auch Ehren=Mitglied der Churfürstl. Maynzischen Societät derer Wissenschaften und freyen Künste zu Erfurth ec. ec. Herrn Johann Christoph von Dreyhaupt hinterlassenen Bibliothec, Naturalien= und Münz=Cabinetter auch Gemählden, welche den 22sten October 1771. und folgende Tage Nachmittags von 2 bis 4 Uhr in dem in der grossen Ulrichstrasse gelegenen von Dreyhauptischen Hause gegen baare Bezahlung verauctioniret werden sollen. Halle, gedruckt mit Grunertischen Schriften. Kommentar: In der umfangreichen Versteigerung der Sammlung von Johann Christoph von Dreyhaupt (1699-1768) wurden auch 90 Gemälde verauktioniert, die am Ende des Katalogs aufgeführt werden (S. 458 bis 460). Dreyhaupt arbeitete als Jurist in Halle und beschäftigte sich außerdem mit naturwissenschaftlichen Fragen und Heimatgeschichte. Er sammelte Naturalien, Urkunden, Bücher und graphische Arbeiten. In dem Versteigerungskatalog sind alle Bilder knapp beschrieben und bleiben anonym. Es handelt sich um Gemälde verschiedener Gattungen. Neben einigen Portraits überwiegen Landschaften und Stilleben. Lit.: ADB 5 (1877), S. 407f.
70 1772/00/00
Daten unbekannt
[Lugt 2091]
S r Jean Jaques de Rodolphe Frey; Basel Verkäufer nach Titelblatt: Un Amateur & Connoisseur Lose mit Gemälden: 198 Standorte: KKBa Nicht annotiert mit Ausnahme einiger Anstreichungen. Titelblatt: Catalogue d'une Collection choisie, de Peintures, Sculptures &c. de differentes Ecoles, receuillie par un Amateur & Connoisseur qui se trouvent ä vendre ä juste prix, dans la Ville de Bäle, & pour lesquels on peut s'adresser au S r Jean Jaques de Rodolphe Frey du dit Lieu. A Basle, Chez Jean Schweighauser 1772. Kommentar: Es handelt sich vermutlich um den Versteigerungskatalog des Baseler Weinhändlers Hans Jakob Frey (1718-1790), der die Auktion einer anonymen Sammlung mit 198 Gemälden organisierte. Der sorgfältig zusammengestellte französischsprachige Katalog ist alphabetisch nach Künstlern geordnet, wobei die Künstlernamen als Überschriften vorangestellt sind. Die Beschreibungen sind präzise und oftmals mit Wertungen versehen. Die Maße sind in französischen Fuß angegeben, wobei in einer Vorbemerkung darauf hingewiesen wird, daß alle Bilder ohne Rahmen gemessen worden sind. Auch die Rahmen der einzelnen Gemälde sind in der Regel beschrieben. Da in dieser Sammlung auch 23 Werke von Künstlern aus der Schweiz anzutreffen waren, handelt es sich vermutlich um eine Basier Sammlung. Vermutlich stammte zumindest ein Teil der Bilder aus dem Besitz Freys. Das unter dem Titel L'Amy de Rembrandt bekannte Portrait Rembrandts (Nr. 120) wurde, wie der Katalog eigens vermerkt, von Antoine Louis Romanet gestochen; es soll sich 1765 nach Hofstede de Groot 1907/27, Bd. 6, S. 237, in dessen Sammlung befunden haben. Romanet war zu dieser Zeit bei Christian von Mechel in Basel beschäftigt. Zwar wird im Titel des Katalogs von einem unbekannten "Amateur & Connoisseur" gesprochen, es kann sich hier jedoch auch um eine bloße Redewendung handeln, die Frey als eigentlichen Besitzer verschleiern sollte. Einen großen Teil der Gemäldesammlung machen holländische und flämische Meister des 17. Jahrhunderts aus. Unter den 38 holländischen Bildern werden sechs Werke Rembrandt zugeschrieben. Bei drei Gemälden sind zwei Künstlernamen genannt, da man sich der Autorenschaft nicht sicher war. Zwei dieser Bilder werden sowohl Adriaen Brouwer als auch Joos van Craesbeeck zugeschrieben (Nrn. 22 und 23). Ebenfalls nicht sicher war man sich bei einem Bild von Johann Franz Nepomuk Lauterer. Hier wird Van Bioemen 80
KATALOGE
als zweite Möglichkeit genannt (Nr. 89). Die stärkste Gruppe bilden mit 76 Arbeiten die deutschen Gemälde. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Frankfurter Schule. Allein je fünf Gemälde von Johann Georg Trautmann und Johann Conrad Seekatz waren im Angebot. Mit neun Landschaften ist Christian Georg Schütz vertreten, wobei sechs Arbeiten in Zusammenarbeit mit Friedrich Wilhelm Hirt entstanden waren, der die Staffagefiguren übernommen hatte. Vermutlich hatte der Sammler regelmäßig auf dem Frankfurter Kunstmarkt Bilder erworben. Aller Wahrscheinlichkeit nach engagierte sich dieser ebenfalls in Amsterdam, denn mehrere Bilder der Kollektion wurden nur wenige Jahre zuvor auf holländischen Versteigerungen erworben. Die Hinweise auf die jeweiligen Vorbesitzer sind in den Bildtexten des Katalogs enthalten. Fünf Bilder (Nrn. 31, 53, 60, 100 und 107) wurden auf der Versteigerung der Sammlung Joan Hendrik van Heemskerk am 29. März 1770 (Lugt 1818) von de Winter erworben. Auf der Auktion des Grafen Jean Henri de Wassenaar wurden am 25. Oktober 1769 (Lugt 1784) vier Gemälde von verschiedenen Käufern ersteigert (Nrn. 42, 67, 156 und 174). Ein Gemälde (Nr. 129) läßt sich in der Versteigerung der Sammlung J. G. Cramer am 13. bis 15. November in Amsterdam (Lugt 1786) nachweisen. Eine Genreszene von Gabriel Metsu (Nr. 94) und eine Darstellung von Vertumnus und Pomona von Caspar Netscher (Nr. 105) wurden auf einer anonymen Auktion am 26. April 1769 in Amsterdam erworben. Über den weiteren Verbleib der Gemälde aus der von Frey verauktionierten Sammlung ist bisher wenig bekannt. Bei einer Landschaft von Jacob van Ruisdael (Nr. 129) handelt es sich wohl um ein Bild, das sich heute in der National Gallery in Ottawa befindet (Inv.-Nr. 5878).
71 1772/09/15 Joh. Gerh. Schiphorst; Bremen, Im dem großen Kramer Amtshause Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 131 Standorte: *KH Annotiert in Bleistift mit allen Preisen. Die Annotationen sind schwer zu lesen. Titelblatt: Verzeichniß unterschiedlicher von berühmten italiänischen, deutschen, französischen und niederländischen Mahlern verfertigten Schildereyen, worunter viele schöne Original=Stücke, nebst einige von Elfenbein mit großem Fleiß und Kunst ausgearbeitete Abbildungen, Statüen, und Brustbilder, welche am 15ten Septembr. 1772. in dem großen Kramer Amtshause hieselbst, durch den Ausmiener Joh. Gerh, Schiphorst öffentlich denen Höchstbietenden verkauft werden sollen. Der Anfang ist Vormittags um 9 Uhr. Bremen, gedruckt bey Friedrich Meier. Kommentar: In diesem 135 Lose umfassenden Versteigerungskatalog des Bremer Auktionators Johann Gerhard Schiphorst wurden 131 Gemälde angeboten. Bei den Nummern 38 und 39 handelt es sich um Miniaturen, bei den Nummern 124 und 125 um Zeichnungen. Außerdem standen noch einige Elfenbein-Arbeiten zum Verkauf (Nrn. 136 bis 148; S. 14 bis 16). Alle Bilder sind kurz beschrieben, wobei oftmals spezifische Details den Beschreibungen beigegeben werden; durchgängig sind die Maße und das jeweilige Material angegeben. Mit 55 Gemälden bleibt nahezu die Hälfte der Gemälde anonym. Diese Bilder befinden sich vor allem im hinteren Teil des Katalogs. Unter den zugeschriebenen Bildern dominieren mit 44 Werken die Arbeiten holländischer und flämischer Künstler. Oftmals werden die Bilder als "Manier" oder "Kopie" bezeichnet, so finden sich beispielsweise sieben Gemälde in der Art bzw. nach Nicolaes Pietersz. Berchem. Sechs Darstellungen der Apostel werden als Arbeiten nach Abraham Bloemaert vorgestellt. Die italienische Schule ist in dieser Sammlung nicht vertreten, dafür sind mit einem Bild von Silvestre nach Rembrandt (Nr. 35) und einem Gemälde in der Manier
von Jean Antoine Watteau (Nr. 87) zwei französische Werke vorhanden. Unter den acht deutschen Bildern werden vier als Kopien nach Lucas Cranach beschrieben. Bei elf Gemälden werden die Künstler nur mit ihren Initialen vorgestellt und sind deshalb als Monogrammisten eingeordnet worden. Nach den Angaben des annotierten Exemplars KH bewegten sich die Preise auf sehr niedrigem Niveau und spiegeln die Tatsache wieder, daß in dieser Auktion kaum Originale im Angebot waren. Die meisten Gemälde wurden für weniger als 10 Gulden verkauft, oftmals zu Preisen von kaum mehr als einem Gulden, manchmal sogar noch darunter. Allerdings sind die Preisangaben im Exemplar KH nur schwer lesbar und es ist nicht immer zweifelsfrei zu entscheiden, ob es sich um Kreuzer oder Gulden handelt.
72 1773/03/01 und folgende Tage [Lugt 2129] Böhme; Berlin, Haus des Sammlers, Unter den Linden Verkäufer nach Titelblatt: Hofrath und Doct. Med. Herrn Georg Ernst Stahl Verkäufer: Stahl, Georg Ernst, Dr. Lose mit Gemälden: 2 Standorte: ULBH Annotiert mit einigen Preisen und einigen Randbemerkungen. LBDa Nach Lugt war in der LBDa ein Exemplar vorhanden; es konnte jedoch nicht aufgefunden werden. Titelblatt: Verzeichniß des Naturalien=Cabinets, der Bibliothek, Kupferstiche und Musikalien, ingleichen der mathematischen, physikalischen und optischen Instrumente des seligen Hofraths und Doct. Med. Herrn Georg Ernst Stahl, welche den 1. März 1773 und folgende Tage Nachmittags gegen baare Bezahlung verauctioniret werden sollen. Berlin, gedruckt bey C. M. Vogel, priv. Buchdr.
Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß einer Sammlung Italiänischer und Niederländischer Cabinet=Mahlereyen welche am Sonnabend den 18. Decemb. Vormittags um 10 Uhr auf dem hiesigen Börsensaal öffentlich an die Meistbietenden verkauft werden sollen durch den Mackler Nicolas Wilhelm Boy woselbst diese Designation beliebigst abzufordern. Gedruckt bey Johann Philipp Christian Reuß. Hamburg 1773. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog des Maklers Nicolas Wilhelm Boy werden 106 Gemälde summarisch aufgelistet. Die Bildtitel sind kurz gehalten, Angaben zu den Maßen und dem Material fehlen ganz. Unter den insgesamt 108 Losnummern findet sich auch eine Metallplastik (Nr. 75) sowie eine Mappe mit Kupferstichen (Nr. 81). Rund ein Viertel der Bilder wird ohne Angabe eines Künstlers aufgeführt. Neben wenigen flämischen Künstlern, u.a. je zwei Gemälden von Paul Bril und Jan Brueghel d.Ä., sowie vereinzelten Werken der italienischen Schule, verzeichnet der Katalog hauptsächlich Gemälde von holländischen Malern, darunter drei Werke von Rembrandt. Unter den 17 identifizierbaren Gemälden von deutschen Künstlern befinden sich Werke der Hamburger Maler Georg Hinz, Jacob Weyer und Otto Wagenfeld. Hinsichtlich der Bildthemen überwiegen Landschaften und Genrestücke.
75 1774/02/21
und folgende Tage
[Anonym]; Meiningen Verkäufer nach Titelblatt: Johann Nadler Verkäufer: Nadler, Johann Lose mit Gemälden: 15
Kommentar: In der Nachlaßversteigerung der Sammlung des Berliner Arztes Georg Ernst Stahl kamen vor allem Bücher und graphische Arbeiten sowie technische Instrumente zum Verkauf. Nach einem kurzen Einleitungstext, der auf der Titelseite abgedruckt ist, fand die Auktion im ehemaligen Wohnhaus des Verstorbenen Unter den Linden statt. Ein Teil der Büchersammlung sollte im Haus Schräder am Molkenmarkt verauktioniert werden. Hierbei handelt es sich möglicherweise um einen zweiten Sammlungsbestand (S. 74ff.). In der Abteilung "Gemälde und Zeichnungen" werden insgesamt 21 Lose aufgeführt, von denen jedoch nur die fünf unter Los 12 angeführten Bilder sowie ein "Gemähide in Rothstein Ixion" als Gemälde eingestuft werden können.
Standorte: TSMe Nicht eingesehen. Protokoll, wahrscheinlich mit Preisen. SUBG Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichnis der ehehin dem Herzogl. Sachsen=Coburg= Meiningischen Geheimen Rath und Consistorial Präsidenten, Herrn Johann Nadler, seel. Andenkens, zuständigen Bücher, Gemähide und Antiquitäten, welche den 21. Febr. 1774 und die folgenden Tage Nachmittags von 2 bis 6 Uhr allhier in Meiningen durch eine öffentliche Versteigerung an den Meistbietenden gegen baare Bezahlung in Sorten nach dem Frankfurter Cours überlassen werden sollen. Meiningen, gedruckt bey F. C. Hartmann, H. S. Hofbuchdrucker.
73 1773/08/25 [Anonym]; Hamburg? Verkäufer nach Titelblatt: Keine Standorte: SBH Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Kommentar: Dieser anonyme Auktionskatalog ist nur bibliographisch nachweisbar (Realkatalog der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg KD III., Hanseatica Hamburgensia IV, S. 74); Holst 1939, S. 271, führt ihn ebenfalls in seiner Liste. Über den Umfang der Sammlung und den Besitzer liegen keine Informationen vor; nach den Angaben des Realkatalogs enthielt der Katalog Gemälde und Kuriositäten. 74 1773/12/18 Nicolas Wilhelm Boy; Hamburg, Börsensaal
Kommentar: In dieser umfangreichen Versteigerung des Nachlasses von Johann Nadler (gest. 1762) aus Meiningen wurden vorwiegend Bücher angeboten. Nadler war 1728 von Herzog Anton Ulrich von Sachsen-Meiningen (1687-1763) zum Hofbibliothekar und Antiquar ernannt worden. Auf den Seiten 97 und 98 des Katalogs werden auch 15 Gemälde angeführt, die alle anonym bleiben. Alle Bildtitel sind knapp gehalten, die Maße sind angegeben. Wahrscheinlich dienten diese Bilder nur der dekorativen Ausschmückung der Bibliothek. Neben einigen Stilleben und Blumenstücken finden sich christliche und mythologische Szenen unter den Gemälden, so etwa Ein Italienisch Stück, stellt den Prometheus vor, dem ein Adler das Herzfrißt (Nr. 1).
76 1774/03/28 Michael Bostelmann; Hamburg, Börsen=Saal
Verkäufer nach Titelblatt: Keine
Verkäufer nach Titelblatt: Keine
Lose mit Gemälden: 106
Lose mit Gemälden: 88 KATALOGE
81
Standorte: *KH Annotiert mit einigen Preisen; wahrscheinlich handelt es sich um Limitpreise. Titelblatt: Catalogue einer auserlesenen Sammlung Holländischer und Brabandischer Cabinet=Mahlereyen, welche am Sonnabend, den 26sten März zu besehen, und am Montage darauf, als den 28sten ejusdem, auf dem hiesigen Börsen=Saal öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden sollen durch den Mackler Michael Bostelmann, bey welchem diese Designation beliebigst abzufordern. Hamburg, gedruckt bey Heinrich Christian Grund. Hamburg Anno 1774. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog des Maklers Michael Bostelmann sind insgesamt 88 Gemälde aufgeführt, die alle bezeichnet sind. Die Beschreibungen in den Bildtiteln sind kurz gehalten, die Maße in tabellarischer Form angegeben. Auch wird mehrfach auf den Rahmen eines Bildes hingewiesen. Ergänzt werden diese Hinweise noch durch eine Bemerkung am Ende des Katalogs: "Diese allhier specifizierte Gemähide sind durchgängig gut conditioniert; die Glanz=vergoldete Rähme und Leisten sind alle acht Gold, und die schwarzen Rahmen nach dem Holländischen Geschmack." Die knappen Einträge enthalten häufig Wertungen wie beispielsweise bei drei Portraits von Balthasar Denner: "von ihm selbst mit ungeheurem Fleiß gemahlt" (Nrn. 31 bis 33). In dem annotierten Exemplar KH sind auch einige wenige Preise vermerkt. Wie im Titel eigens erwähnt, handelt es sich um eine Sammlung von holländischen und flämischen (brabantischen) Gemälden, darunter allein fünf Landschaften von Aert van der Neer (Nrn. 1 bis 5) und eine Frans Hals zugeschriebene Serie allegorischer Darstellungen der Fünf Sinne (Nrn. 17 bis 21). Unter den flämischen Werken fallt ein Gemälde von Jacob Fopsen van Es auf, von dem heute nur wenige Blumenstücke bekannt sind. Bei den deutschen Künstlern finden sich u.a. drei Bilder von Balthasar Denner, Portraits seiner Frau, seines Sohnes und ein Selbstportrait sowie zwei Gemälde von Georg Hinz und fünf Gemälde von Dominicus Gottfried Waerdigh. Bei den wenigen angegebenen Preisen handelt es sich wahrscheinlich um Limitpreise, da es sich um runde Summen handelt. Eine Landschaft von Jacob van Ruisdael (Nr. 39) wurde mit 120 Mark angesetzt.
77 1774/08/13 Michael Bostelmann; Hamburg, Börsen=Saal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 160 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Catalogus einer Sammlung schöner Mahlereyen, worunter einige sehr schöne Cabinet=Stücke von Italienischen und Niederländischen Meistern, welche am Sonnabend, den 13ten August, auf dem hiesigen Börsen=Saal öffentlich verkauft werden sollen durch den Mackler Michael Bostelmann. Hamburg Anno 1774. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog des Hamburger Maklers Michael Bostelmann wurden 160 Gemälde angeboten. Alle Einträge enthalten sehr knappe Angaben. In einem Satz werden das Bildthema und der Künstlername vorgestellt, beispielsweise heißt es unter Nr. 77: "Eine Landschaft, von Emanuel Murant". Eine große Anzahl von Gemälden, insgesamt 37 Stück, ist anonym verzeichnet. Bei den im Titel erwähnten italienischen Gemälden handelt es sich vor allem um Werke von Künstlern des 17. Jahrhunderts. Zu den genannten Künstlern zählen u.a. Guido Cagnacci, Rosalba Carriera, Lanfranco, Molinari, Solimena oder Innocenzo Tacconi. Die Nennung dieser Namen setzt eine solide Kenntnis der italienischen Kunst des 17. und frühen 18. Jahrhunderts voraus. Den größten Anteil machen mit rund 40 Werken die Gemälde der holländischen 82
KATALOGE
Schule aus, darunter vier alttestamentliche Szenen von Jacob Willemsz. de Wet (Nm. 30, 37, 85, 137). Als Losnummer 1 ist ein Gemälde von Peter Paul Rubens verzeichnet, das eine Friedensallegorie mit einer Darstellung der Maria de Medici zeigt. Unter den Malern der deutschen Schule ist ein Gemälde von Adam Elsheimer Die Geißelung Christi ("ein rares Bild"; Nr. 152) hervorzuheben. Ansonsten dominieren Bilder Hamburger Maler wie Balthasar Denner, Hans Hinrich Rundt und Johann Georg Stuhr, von dem allein fünf Seestücke angeboten wurden.
78 1774/10/05 Johann Hinrich Neumann; Hamburg, Börsen=Saal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 112 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Catalogus einer schönen Sammlung auserlesener Cabinet=Mahlereyen, welche mehrentheils von den besten Niederländischen und Italienischen Meistern verfertiget sind, und auf dem hiesigen Börsen=Saal den 6ten [handschriftlich korrigiert in: 5ten] October a.c öffentlich an die Meistbietende verkauft werden sollen, durch den Mackler Johann Hinrich Neumann. Bey welchem diese Designation belieblich abzufordern, auch können besagte Gemähide, am Mittewochen, als den Tag vorher, gefällig besehen werden. Hamburg, 1774. Kommentar: In kurzen Beschreibungen werden in diesem Versteigerungskatalog des Maklers Johann Hinrich Neumann insgesamt 112 Gemälde vorgestellt. Meist werden Bildthema und Künstlername in einem Satz genannt, Maße und Materialangaben fehlen. Das Datum der Auktion wurde auf dem Exemplar KH handschriftlich korrigiert. Die Auktion fand nicht am 6. Oktober, sondern schon am 5. des Monats statt. Wie in den meisten Hamburger Auktionen überwiegen die Arbeiten holländischer und flämischer Künstler, von denen insgesamt 50 Gemälde angeboten wurden. Besonders zahlreich vertreten ist David Teniers d.J. mit fünf Gemälden. Vier Bilder werden als "Manier", "Gusto" oder "Kopie" des Ostade benannt. Auch einige Seestücke werden ähnlich beschrieben und mit van der Velde in Verbindung gebracht, ohne daß genauer angegeben wäre, um welchen Vertreter dieses Namens es sich handelt. Bei den deutschen Werken dominieren Künstler des 18. Jahrhunderts, so aus Hamburg Jacob Weyer und Johann Georg Stuhr sowie die sächsischen Landschaftsmaler Johann Christian Vollerdt und Ernst Wilhelm Christian Dietrich. Aber auch andere deutscher Maler sind vertreten, so etwa der Frankfurter Justus Juncker mit zwei Bildern. Insgesamt zehn Gemälde werden keinem Künstler zugeschrieben.
79 1774/11/03 Johann Hinrich Neumann; Hamburg, Haus des Sammlers, Hinter den Bleichen Verkäufer nach Titelblatt: Keine Verkäufer nach anderer Quelle: Senator Ritter Verkäufer: Ritter (Hamburg) Lose mit Gemälden: 54 Standorte: *KH Annotiert mit allen Käufernamen und Preisen. Titelblatt: Catalogus einer Sammlung von Cabinet=Gemählden, wie auch großer Herren Portraits, nebst verschiedenen auserlesenen Miniatur=Stücken, und einer Parthey Kupferstiche, als Wouvermann, D. Tennier und anderer berühmten Meister, wobey auch etliche und siebenzig in Glas und Rahm gefaßte Kupferstiche und Vestungs= Plane befindlich, welche in einem bekannten Hause, hinter den Blei-
chen, [handschriftlich ergänzt: Senator Ritter], den 3ten Novemb. 1774. öffentlich an die Meistbietenden sollen verkauft werden durch den Mackler Johann Hinrich Neumann. Hamburg, gedruckt bey Heinrich Christian Grund. Kommentar: Im ersten Abschnitt dieses Versteigerungskatalogs des Hamburger Maklers Johann Hinrich Neumann wurden 55 Gemälde angeboten (S. 3 bis 5). Im zweiten Teil des Katalogs werden Miniaturen und graphische Arbeiten aufgeführt. Alle Beschreibungen sind kurz gehalten und zusammen mit der Angabe des Künstlernamens in einem Satz zusammengefaßt. Die Materialien sind teilweise angegeben, Maße fehlen jedoch vollständig. Hinter den Bildtiteln sind in dem Katalog noch drei freie Spalten abgedruckt, in die die Interessenten Käufernamen und Preise eintragen konnten. Im Exemplar KH sind diese Annotierungen vorhanden. Insgesamt zwölf Arbeiten werden keinem Künstler zugeschrieben. Nicht identifizierbar sind außerdem eine Reihe von Künstlernamen, die nur mit Abkürzungen vorgestellt werden und als Monogrammisten erfaßt wurden. Ein Monogrammist "N." taucht allein sechsmal auf. Im allgemeinen überwiegen mit 20 Arbeiten die holländischen und flämischen Arbeiten des 17. Jahrhunderts. Oftmals werden die Bilder aber nur als im "Gusto" eines Künstlers gemalt beschrieben. So heißt es bei den Losnummern 9 und 10: "Zwey See=Prospecte, auf Leinewand gemahlt, so schön wie von Backhuysen." Nach den Angaben des annotierten Exemplars KH blieben die Preise auf niedrigem Niveau, in den meisten Fällen unter zehn Mark. Einzelne Bilder wurden jedoch höher eingeschätzt. So ersteigerte der Kunstagent Johann Benjamin Ehrenreich für 111 Mark eine Arkadische Landschaft mit der Flucht nach Ägypten von Cornells van Poelenburgh (Nr. 19). Ehrenreich erwarb noch vier weitere Bilder. Auch andere Kunsthändler wie Johann Jobst Eckhardt und Johann Diedrich Lilly Senior kauften mehrere Gemälde. Den höchsten Preis erzielte ein Seestück von Willem van der Velde (Nr. 25), das dem Käufer Wohlers aus Altona bei 116 Mark zugeschlagen wurde. 80 1775/00/00
Daten unbekannt
[Anonym]; Berlin Verkäufer nach Titelblatt: George Friedrich Schmidt Verkäufer: Schmidt, Georg Friedrich Lose mit Gemälden: 85 Standorte: ULBH Nicht annotiert. HWH Nicht annotiert. SBB Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Photokopien: SBB (aus ULBH) Titelblatt: Verzeichniß der von dem Königlich Preußischen Hofkupferstecher und Mitglied der Königl. Mahlerakademien zu Berlin und Paris wie auch der Rußischkayserlichen zu St. Petersburg Herrn George Friedrich Schmidt nachgelassenen Sammlung von Kupferstichen, Zeichnungen und Gemählden, wovon der Verkauf durch die Berliner Intelligenzblätter, auch Berliner, Altonaer und Holländischen Zeitungen bekandt gemacht werden soll. Berlin, gedruckt bey George Ludewig Winters Wittwe. Kommentar: In diesem Auktionskatalog wurde der Nachlaß des Kupferstechers Georg Friedrich Schmidt (1712-1775) verauktioniert. Das genaue Datum der Auktion wird nicht genannt. Nach den Angaben der Titelseite sollte es erst in den Zeitungen annonciert werden. Die Versteigerung fand vermutlich kurz nach dem Tod des Künstlers im Jahre 1775 statt. Nach Studienjahren in Paris wurde Schmidt 1743 in Berlin zum Hofkupferstecher ernannt. Von 1757 bis 1762 arbeitete er am russischen Zarenhof in St. Petersburg. Neben Chodowiecki zählte er zu den wichtigsten Kupferstechern des
18. Jahrhunderts. Schmidts Wirken als Kupferstecher spiegelt sich in dem Versteigerungskatalog wieder, in dem vor allem graphische Arbeiten angeboten werden. In der "Sectio I" sind in 111 Losnummern Kupferstiche Schmidts aufgeführt, teilweise verbergen sich ganze Kupferstichserien hinter einer Nummer. In der "Sectio II" kamen 421 Lose mit Kupferstichen anderer Künstler zum Aufruf (meist Reproduktionen italienischer Gemälde). In der "Sectio III" waren es 299 Lose mit Stichen nach französischen Meistern und in der "Sectio IV" 582 Lose mit niederländischen Arbeiten, wobei vor allem Arbeiten nach Rembrandt häufig vorkommen. In einer 5. Abteilung werden 532 Losnummern mit Portraits, in einer sechsten Abteilung gebundene Werke aufgeführt, von denen oftmals mehrere Exemplare vorhanden waren. Neben den in der "Sectio VII" angeführten Losen mit Zeichnungen wurden in einem neu paginierten Anhang unter dem Titel "Schildereyen und in Glas und Rahm gefaßte Kupferstiche" (Anhang, S. 1 bis 4) auch einige Gemälde angeboten, insgesamt ließen sich 80 Bilder feststellen, darunter acht Werke Rembrandts bzw. Kopien nach Rembrandt. Neben eigenen Werken Schmidts dominieren zeitgenössische Künstler wie Antoine Pesne, Jacob Philipp Hackert oder Christian Wilhelm Ernst Dietrich die Sammlung. Lit.: Paul Dehnert, Georg Friedrich Schmidt, der Hofkupferstecher des Königs, in: Jahrbuch Preußischer Kulturbesitz 16 (1979), S. 321-339.
81 1775/02/13
und folgende Tage
[Lugt 2362]
[Anonym]; Frankfurt am Main, Haus des Sammlers, auf dem Markt, Lit. Μ. Num. 196 Verkäufer nach Titelblatt: von der Lahr Verkäufer: Lahr, von der Lose mit Gemälden: 97 Standorte: SBF Nicht annotiert. LBDa Nicht gefunden (1993). Titelblatt: Verzeichniß einer Sammlung von Gemählden, Kupferstichen, Porcellain, und Optischen Sachen, welche, nebst einem Conchylien= und Naturalien=Cabinet, durch öffentliche Verkauffung, in dem von der Lahrischen Hauß, auf dem Markt, Lit. Μ. Num. 196 den 13. February 1775. und folgende Tage, gegen baare Bezahlung, dem Meistbiethenden überlassen werden sollen. Frankfurt am Mayn. 1775. Gedruckt bey Joh. Bayrhoffer, auf der kleinen Gallengaß. Kommentar: In dem elfseitigen Versteigerungskatalog der Sammlung von der Lahr werden überwiegend Gemälde aufgeführt (S. 3 bis 7). Bei dem Sammler handelt es sich vermutlich um einen Nachkommen von Hieronymus von der Lahr, dessen Sammlung 1762 verkauft wurde (vgl. Kat. 36). Außerdem wurden Arbeiten in Wasserfarben, Kupferstiche und optische Geräte angeboten. Auch in der Rubrik "Gemähide" finden sich einige graphische Arbeiten. So handelt es sich bei den Nrn. 100 bis 105 um Aquarelle, Federzeichnungen sowie kolorierte Zinnstiche. Los 63 ist ein Bild auf Marmor, die Nrn. 94 und 97 sind Pastell- bzw. Tuschbilder. Die Beschreibungen der Gemälde, von denen viele anonym bleiben, sind knapp gehalten. Sie enthalten Maßangaben, jedoch meist keine Information zum Material. Bei den angegebenen Künstlern handelt es sich zumeist um niederländische und deutsche Meister, darunter Die Heiligen drei Könige von Lucas van Leyden. Lit.: Schmidt 1960, o.P.
82 1775/02/25 Michael Bostelmann; Hamburg, Börsen=Saal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 100 KATALOGE
83
Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Catalogue einer auserlesenen Sammlung Holländischer und Italienischer Cabinet=Mahlereyen, welche am Sonnabend, den 25sten Februar, auf dem hiesigen Börsen=Saal öffentlich an die Meistbietenden verkauft werden sollen durch den Mackler Michael Bostelmann, bey welchem diese Designation beliebigst abzufordern. Hamburg, gedruckt bey Heinrich Christian Grund. Hamburg Anno 1775. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog des Hamburger Maklers Michael Bostelmann werden insgesamt 100 Lose mit Gemälden angeboten. Die Beschreibungen sind sehr knapp, Material- und Maßangaben fehlen vollkommen. In den meisten Fällen werden die Künstlernamen genannt, es bleiben jedoch 29 Gemälde anonym. Teilweise werden Wertungen wie "sehr fleißig ausgeführt" oder "extra schön gemahlt" den Beschreibungen beigegeben. Obwohl im Titel ausdrücklich auf Gemälde der italienischen Schule verwiesen wird, sind im Katalog selbst nur drei entsprechende Werke verzeichnet, ein überlebensgroß dargestellter Johannes von Tizian (Nr. 65; möglicherweise eine Kopie nach Tizians Gemälde in der Galleria dell'Accademia, Venedig), die Kopie eines Mädchenkopfes nach Piazzetta sowie ein weiterer anonym verzeichneter Kopf eines italienischen Malers. Vermutlich hatte der Makler Bostelmann die Titelseite seines letzten Katalogs erneut als Vorlage verwendet (vgl. Kat. 78), in dem deutlich mehr italienische Gemälde zum Verkauf standen. Unter den 20 Gemälden der holländischen und den zwölf Werken der flämischen Schule befinden sich interessante Werke von Karel Dujardin, Dirck Hals oder Esaias van de Velde. Der Pythagoras von Jan Lievens ist möglicherweise eine Kopie nach einem damals in der kurfürstlichen Sammlung in Düsseldorf aufbewahrten Gemälde (vgl. H. Schneider, Jan Lievens. Sein Leben und seine Werke, mit einem Supplement von R. E. O. Ekkart, Amsterdam 1973, S. 173f., als Pendant zu einem Bildnis des Diogenes). Den größten Anteil nehmen mit fast 30 Losnummern die Gemälde deutscher Maler ein, darunter vor allem Hamburger Künstler des späten 17. und des 18. Jahrhunderts wie beispielsweise Joachim Luhn, Jacob Stockmann und Johann Jacob Tischbein. Ein Gemälde von Johann Georg Stuhr bildet die Hamburger Börse ab, den Ort, wo in Hamburg die meisten Kunstauktionen stattfanden.
83 1775/04/12 Johann Hinrich Neumann; Hamburg, Sterbehause in der Neustädter Fuhlentwiete, Ecke Neustrasse Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 112 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Catalogue einer schönen Sammlung auserlesener Cabinet=Mahlereyen und Portraits, welche in einem bekannten Sterbehause in der Neustädter Fuhlentwiete, an der Ecke der Neustraße, den 12ten April 1775 an die Meistbietenden verkauft werden sollen durch den Makler Johann Hinrich Neumann. Hamburg, gedruckt bey Heinrich Christian Grund. Kommentar: In diesem anonymen Versteigerungskatalog werden 112 Gemälde sowie ein Relief in Elfenbein (Nr. 113) verzeichnet. Wahrscheinlich handelt es sich um die Kollektion eines Hamburger Sammlers, da die Auktion im ehemaligen Haus des Besitzers stattfand. Die Bildbeschreibungen sind kurz gehalten und meist mit Wertungen verbunden. In der Regel wird das Material angegeben, es fehlen jedoch die Maße. Im Katalog sind hinter den Bildbeschreibungen noch drei Spalten angefügt, in welche die Interessenten die Käufernamen und die Preise notieren konnten (vgl. auch Kat. 79). 84
KATALOGE
Jeweils oben in den Spalten steht als Überschrift "Käufer" bzw. Mark und Schilling für den erzielten Preis. Trotz dieser Vorgaben hat sich bisher kein annotiertes Exemplar des Katalogs auffinden können. Gemessen an den aufgeführten Künstlernamen handelt es sich um eine sehr gut bestückte Sammlung. Die Zuschreibungen hören jedoch schlagartig mit der Nr. 39 auf. Mit vier Ausnahmen (Nrn. 42, 44, 68 und 90) bleiben alle nachfolgenden Gemälde ohne Angabe eines Künstlernamens. Die Mehrheit der insgesamt 42 bezeichneten Werke stammt von Künstlern der holländischen und flämischen Schule, darunter Werke der Maler Hendrik van Baien d.Ä., Cornells Pietersz. Bega und Abraham Bloemaert. Ein Jan Lievens zugeschriebenes Gemälde, Ein sitzender Officier mit einem Glas Genever in der rechten Hand, vor ihm ein Tisch, worauf eine Tobacks=Pfeife liegt (Nr. 16) wurde vermutlich von August Gottfried Schwalb erworben, denn es erscheint 1779 in dessen Katalog (Kat. 120, Nr. 271). Heute befindet sich dieses Gemälde unter dem Titel der Fröhliche Trinker in der Berliner Gemäldegalerie (Kat.-Nr. 1808). Die deutsche Schule ist mit insgesamt zwölf Gemälden vertreten, darunter je ein Bild von Albrecht Altdorfer und Hans Sebald Beham sowie drei Gemälde von Lucas Cranach. Hinzu kommen zwei italienische Bilder und von Pierre Depuis ein Stilleben mit Früchten und Federwild. Zwei Gemälde dieser Versteigerung tauchen in einer späteren Auktion wieder auf. Es handelt sich um Maria Magdalena von Hendrick Goltzius (Nr. 31; Kat. 88, Nr. 53) und eine Predigt des Johannes von Abraham Bloemaert (Nr. 8; Kat. 88, Nr. 19).
84 1775/04/20
und folgende Tage
[Anonym]; Hannover, Haus des Sammlers Verkäufer nach Titelblatt: Avgvsti Rvdolphi Iesaiae Bvenemanni Verkäufer: Bünemann, August Rudolph Jesaias Lose mit Gemälden: 184 Standorte: UBLg Nicht annotiert. BSBM Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. SIJBG Nicht eingesehen. ÜBT Nicht eingesehen. Titelblatt: Bibliotheca Avgvsti Rvdolphi Iesaiae Bvenemanni ivr. vtr. Doctoris comitis Palatini electori palatino a consiliis avlicis cavssarvm patroni apvd Hannoveranos celeberrimi pie defvncti ordine degesta et literariis obversationibvs instrvcta Io. Friderico Gottfr. Grvpen in nosocomio Hannover, verbi div. ministro et lycei maioris conrectore. Pars I. Hannoverae D. IUI. [handschriftlich korrigiert in: XX] Aprilis MDCCLXXV in Bvenemannianis aedibvs pvblice divendetvr. Hannoverae, ex prelo Schlveteriano. Kommentar: Die umfangreiche Versteigerung der Sammlung des Advokaten und Rechtsgelehrten August Rudolph Jesaias Bünemann (1716-1774) erstreckte sich über ein halbes Jahr, von April bis Dezember 1775. Bünemann wirkte in verschiedenen Ämtern, so seit 1740 als Advokat am Oberappellationsgericht in Celle. 1753 promovierte er zum Doktor jur. und wurde zum kurpfalzischen Hofrat ernannt. Von Bünemann stammen zahlreiche juristische Publikationen. Der Versteigerungskatalog wurde in insgesamt drei Teilen publiziert. Der Verkauf des zweiten Teils begann am 18. September, der des dritten am 4. Dezember. In einem 23 Seiten umfassenden Anhang des 1. Teils wurden auch 184 Gemälde aufgeführt. Dieser Anhang trägt den deutschen Titel: "Samlung verschiedener Münzen, optischer, mathematischer und musikalischer Instrumente, Schach und anderer Spiele, Kupferstiche, Gemähide, Schreibsachen, Studiertische und Bücherschränke, welche nach verkauften ersten Theile der Bünemannischen Bibliothek in derselben Auction verkauft werden sollen." Nach der Formulierung des Katalogs ist es nicht eindeutig, ob
diese Gegenstände einschließlich der Gemälde ebenfalls aus dem Besitz Bünemanns stammten. Die Gemälde werden in diesem Anhang auf den Seiten 16 bis 22 aufgeführt. Die Bildbeschreibungen sind sehr kurz gehalten, meist fehlen die Maßangaben. Nur 14 Bilder werden einem Künstler zugeschrieben, darunter drei Bilder des britischen Malers Godfrey Kneller. Die übrigen 170 Gemälde bleiben anonym. 85 1775/05/08
[Lugt 2407]
Alexander Plinck; Hamburg, Sterbehaus auf dem Hamburger Stadt= Deiche Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 179 Standorte: KH Annotiert mit allen Preisen für die Losnummern 1 bis 54. Titelblatt: Catalogus einer auserlesenen Sammlung von Cabinet= Mahlereyen der berühmtesten Niederländischen und Deutschen Meister, wie auch eine Parthey Miniatur= und Wasserfarbene Gemählde, wobey einige Curiosa, Porcellain=Figuren und Gruppen, nebst einer ziemlichen Anzahl gebundener historischen und anderer Bücher, welche in einem wohlbekannten Sterbehause, auf dem Hamburger Stadt=Deiche, den 8ten May 1775. öffentlich an den Meistbietenden sollen verkauft werden durch den Land=Voigt Alexander Plinck. Hamburg, gedruckt bey Heinr. Christ. Grund. Kommentar: Neben einer umfangreichen Sammlung von insgesamt 179 Gemälden verzeichnet dieser Auktionskatalog einer Hamburger Sammlung auch Miniaturen, graphische Arbeiten, Curiosa, Bücher und Porzellan. Organisiert wurde diese Auktion durch den Landvogt Alexander Plinck. Die Gemälde werden auf den ersten acht Seiten des nicht paginierten Katalogs angeführt. Die Bildtitel enthalten sehr knappe, aber recht genaue Angaben über die Gemälde, Bemerkungen zur künstlerischen Ausführung ("meisterhaft gemahlt", "mit freyem Pinsel gemahlt") sowie Angaben zum Material. In einer eigenen Spalte sind die Namen der Künstler und die Maße eingetragen. Das Exemplar KH des Katalogs enthält, allerdings nur für die Nrn. 1 bis 54, handschriftliche Preisangaben. Die zur Versteigerung gelangte Sammlung war sehr gut mit Gemälden der holländischen und flämischen Schule bestückt, darunter sechs arkadische Landschaften mit mythologischen Szenen von Abraham van Cuylenborch. Auch von Malern wie Hans Rottenhammer, Daniel Vertangen, Johann Liss (wohl eher Dirck van der Lisse) finden sich Landschaften mit mythologischer oder religiöser Staffage verzeichnet. Bei einer Vielzahl von Gemälden sind nur die Initialen angegeben. Sie konnten nicht aufgelöst werden und werden als Monogrammisten gefuhrt. Bei 22 Werken ist das Monogramm "A.S." angegeben. Hierbei handelt es sich möglicherweise um den in Hamburg geborenen Maler Andreas Scheits (gest. 1735). Nach den Angaben des teilweise annotierten Exemplars KH bewegten sich die Preise der ersten 20 Losnummern meist unter 10 Mark. Bei den Losnummern 21 bis 54 erzielten einzelne Bilder auch deutlich höhere Ergebnisse, so erreichte etwa Die Flucht nach Ägypten von Daniel Vertangen (Nr. 50) einen Preis von 406 Mark. 86 1775/05/08
und folgende Tage
[Lugt 2408]
[Anonym]; Offenburg, Königs-Hof Verkäufer nach Titelblatt: Marggräfinn Augusta Sibylla von Baaden=Baaden Verkäufer: Baden-Baden, Sibylla Augusta, Markgräfin von Lose mit Gemälden: 13 Standorte: *BNP I Annotiert mit allen Preisen (deutsche Ausgabe). BNP II Annotiert mit einigen Randbemerkungen (französische Ausgabe).
AAP Nicht annotiert (französische Ausgabe). KKBa Nicht annotiert. BNP III Unvollständig. Die Seiten 1 bis 34 sind vorhanden, es fehlen jedoch die Seiten mit den Gemälden. Nicht annotiert (französische Ausgabe). Titelblatt: Verzeichniß deijenigen seltenen Edelgesteinen, künstlichen Uhren, kostbaren Malereyen, Silbers, und andern Kabinet= Stücken, aus der Verlassenschaft weyland der verwittibten Frauen Marggräfinn Augustina [handschriftlich verbessert: Augusta] Sibylla von Baaden=Baaden, geb. Herz, von Sachsen=Lauenburg herrührend, welche in dem Königs=Hof zu Offenburg den 8. May und an folgenden Tagen 1775 zur öffentlichen Versteigerung ausgesetzet werden. Straßburg, bey Jonas Lorenz, Buchdrucker. 1775. Specification des pierres precieuses pendules, peintures, argenterie et autres pifeces de cabinet, ci-devant appartenantes a feue Madame la Margrave Auguste Sibylle de Bade-Bade nee duchesse de Saxe-Lauenbourg. Qui seront vendues par enchere ä Offenbourg ä l'Hötel du Bailli, appell6 le Koenigs-Hof, le 8 May & les jours suivans de l'annee courante 1775. Α Strasbourg, Chez Jonas Lorenz, Imprimeur. 1775. Kommentar: In dieser Versteigerung der Sammlung der Markgräfin Sibylla Augusta von Baden-Baden (1675-1733) wurden in erster Linie Schmuck, Uhren, Möbel und Silberwaren verkauft. Sibylla Augusta, geb. Prinzessin von Lauenburg-Sachsen, heiratete 1690 den Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden-Baden (1655-1707), der wegen seines Einsatzes in den Türkenkriegen berühmt geworden ist. Sybilla Augusta lebte zumeist in der Residenz Schlackenwerth in Böhmen und in dem von ihr errichteten Schloß Favorite bei Rastatt. Das Schloß Schlackenwerth stammte aus lauenburgisch-sächsischem Besitz. Ihrem Wunsch entsprechend ging die von ihr aufgebaute Kunstsammlung nach ihrem Tod in einen Familien-Fideikommiß ein. Als diese Linie der Familie jedoch erlosch, fiel der Kunstbesitz an das Kaiserhaus und wurde 1775 versteigert. Die Versteigerung fand in Offenburg im "Hotel du Bailli, apelle le Koenigs-Hof' statt, wie es auf dem Titelblatt des französischen Katalogs heißt. Die verschiedenen Kunstgegenstände sind nicht sortiert. Die insgesamt 13 Gemälde beziehungsweise Altäre finden sich unter den Losnummern 251 bis 263. Ausdrücklich wird bei einigen Bildern darauf hingewiesen, daß es sich um Originale handelt. So auch bei einem Mutter=Gottes=Bild von Albrecht Dürer aus dem Jahre 1523, das nach den Angaben eines annotierten Exemplars aus der BNP mit dem sehr hohen Preis von 550 Währungseinheiten (vermutlich Gulden) bezahlt worden ist. Ein Madonnenbild Dürers aus dem Jahre 1523 läßt sich nicht mehr nachweisen. Lit.: Sachsen-Lauenburg. Böhmen und Baden. Katalog der Sonderausstellung anläßlich der 300. Wiederkehr des Geburtstages von Sibylla Augusta, Markgräfin von Baden-Baden, geb. Prinzessin von Sachsen-Lauenburg, Lauenburg 1975, bes. S. 162. 87 1775/05/15
und folgende Tage
[Lugt 2410]
[Anonym]; Frankfurt am Main, Haus des Sammlers, Zeil Lit. D. No. 26 Verkäufer nach Titelblatt: Johann Friedrich Armand von Uffenbach Verkäufer: Uffenbach, Johann Friedrich Armand von Lose mit Gemälden: 115 Standorte: SBFI Nicht annotiert. SBF II Nicht annotiert. Titelblatt: Catalogvs von Original=Handzeichnungen, Gemählden, Pretiosis und Silbergeschirr, welche des wohlseel. Herrn Johann Friedrich Armand von Uffenbachs gewesenen Schöffs und des Raths, wie auch Kayserlichen würkl. Raths letztlich wohlseel. verstorbene Frau Wittib hinterlassen und durch öffentlichen Verkauf an den Meistbietenden in der Behausung auf der Zeil Lit. D. No. 26 KATALOGE
85
den 15ten May 1775 und folgende Tage gegen gleich baare Bezahlung überlassen werden sollen. Frankfurt am Mayn, bey den Eichenbergischen Erben. Kommentar: In dieser Versteigerung wurde der Nachlaß des Frankfurter Sammlers Johann Friedrich Armand von Uffenbach (16781769) erneut angeboten, nachdem seine Witwe ebenfalls verstorben war. Der Katalog entspricht im Aufbau dem vier Jahre zuvor erschienenen Katalog (vgl. Kat. 68; dort auch Angaben zur Biographie Uffenbachs). Im ersten Abschnitt wird dasselbe Konvolut an Handzeichnungen angeboten, im zweiten Teil insgesamt 115 Gemälde (S. 29 bis 36), die sämtlich schon vier Jahre zuvor zum Verkauf standen. 49 Losnummern des Katalogs des Jahres 1771 tauchen in dieser Auktion nicht mehr auf. Für diesen Katalog wurden die Einträge des vier Jahre zuvor erschienenen Katalogs übernommen. Die Losnummer 1 ist die ehemalige Losnummer 7 in dem 1771 erschienenen Katalog. Die folgenden Losnummern 2 bis 73 entsprechen den alten Nummern 34 bis 109. Bei der Nummer 32 (Nr. 64 in Kat. 68) wird auf die Nummer 57 als Pendant verwiesen. Dieser Verweis bezieht sich jedoch auf die Nummernfolge des Katalogs von 1771. Die Titelbeschreibungen sind bis auf eine Ausnahme nicht verändert. Korrigiert wurde nur die Beschreibung bei Nummer 14, einem Bild von Cornells van Harlem (ehemals Nr. 46). In dem Katalog von 1771 wurde die Szene noch als eine Darstellung der Eva angesehen, 1775 dagegen als Cleopatra gedeutet. Zu der Gemäldesammlung vergleiche auch Kat. 68, dort auch die entsprechenden Literaturangaben.
88 1775/09/09 Bostelmann; Hamburg, Börsen=Saal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 67 Standorte: *KH Annotiert in Bleistift mit den meisten Käufernamen und den meisten Preisen. Die Annotationen sind schwer zu lesen. Titelblatt: Catalogue einer auserlesenen Sammlung Cabinet=Mahlereyen der besten Italienischen, Holländischen und Deutschen Meister, welche den 9ten September 1775 durch die Mackler Bostelmann und Neumann auf dem hiesigen Börsen=Saal an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden sollen. Hamburg, gedruckt bey Heinrich Christian Grund. Kommentar: In diesem anoymen Versteigerungskatalog der Hamburger Makler Michael Bostelmann und Johann Hinrich Neumann werden 67 Losnummern verzeichnet. Die Beschreibungen sind sehr präzise und enthalten neben den Künstlernamen (nur bei drei Loseinträgen findet sich kein Name) auch die Transkription der Datierung einzelner Gemälde. Kurios ist der Hinweis auf ein 1680 datiertes Gemälde von Jan Wijnants mit Staffagefiguren von Johannes Lingelbach, der bereits 1674 gestorben ist (Nr. 8). Alle Bilder sind "ohne die Rahmen" nach dem rheinländischen Maß gemessen, wie es in der Vorbemerkung heißt. Ein Teil der Rahmen sei "ganz modern und schön vergoldet, die übrigen aber schwarz mit vergoldeten Leisten, außer 7 Stück, die doch mit säubern Pack=Leisten montiret sind." Überwiegend handelt es sich um Gemälde der holländischen und flämischen Schule sowie eine kleine Gruppe von Gemälden der italienischen und deutschen Schule. Es finden sich auffallend viele Landschaften von sogenannten Italianisanten wie Nicolaes Berchem, Pieter van Bioemen, Willem de Heusch, Johannes Lingelbach, Isaac Moucheron und anderen, wobei sorgfältig zwischen dem Maler der Landschaft und der Staffage unterschieden wird (vgl. Nrn. 20, 21). Unter den insgesamt elf italienischen Gemälden befindet sich eine vierteilige Serie mit mythologischen Darstellungen von Sebastiano Ricci. Zwei Gemälde sind bereits in einem früheren Auktionskatalog des Maklers Neumann (Kat. 83) verzeichnet, Hendrick Goltzius' 86
KATALOGE
Maria Magdalena (Nr. 53; Kat. 84, Nr. 31) und Abraham Bloemaerts Predigt des Johannes (Nr. 19; Kat. 83, Nr. 8). Nach den Angaben des annotierten Exemplars KH traten als Käufer vor allem die beiden Kunstagenten Johann Diedrich Lilly und dessen Vater Johann Diedrich Lilly Senior auf, die zusammen allein fünfzehn Gemälde erwarben. Der Domherr Heinrich Wilhelm Hasperg ersteigerte für seine Sammlung zwei Portraits von Luca Giordano (Nrn. 33 und 34) sowie noch zehn weitere Bilder. Die Preise lagen durchschnittlich zwischen 10 bis 50 Mark, nur einzelne Bilder erzielten deutlich höhere Werte. Eine Entführung der Europa von Gerbrand van den Eeckhout erzielte mit 200 Mark und 4 Schilling den höchsten Preis. Auch der Hamburger Sammler August Gottfried Schwalb erwarb zwei Gemälde. Bei dem für 100 Mark und 4 Schilling von Schwalb angekauften Bildnis einer Dame von Michiel Jansz. van Miereveld handelt es sich wahrscheinlich um das Portrait, das beim Verkauf der Schwalb-Sammlung (Kat. 120) als Nr. 299 angeboten wurde. Lit.: Hamburgische Künstlernachrichten 1794, S. 122.
89 1775/10/07 Michael Bostelmann; Hamburg, Börsen=Saale Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 81 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Catalogue einer Sammlung schöner Cabinet=Mahlereyen, welche am Sonnabend g.G. den 7. October auf dem hiesigen Börsen=Saale öffentlich an den Meistbietenden verkaufet werden sollen durch den Makler Michael Bostelmann. Hamburg, gedruckt bey Dietrich Anton Harmsen. Hamburg 1775. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog des Hamburger Maklers Michael Bostelmann werden 82 Gemälde aufgelistet. Die Bildbeschreibungen beschränken sich auf ein Minimum, Material- und Maßangaben fehlen ganz. Insgesamt 28 Gemälde bleiben anonym, zahlreiche Bilder werden nur als "Manier" oder "Schule" bezeichnet. Bei den bezeichneten Werken überwiegen Arbeiten der holländischen und flämischen Schule. Hinzu kommen zwei Arbeiten in der Manier von Salvator Rosa sowie 19 deutsche Gemälde, darunter allein sechs Bilder des Hamburger Malers Johann Georg Stuhr, sowie drei Portraits von Balthasar Denner. Eines dieser Portraits (Nr. 3) zeigt den Hamburger Sammler und Dichter Barthold Heinrich Brockes (vgl. Kat. 17).
90 1775/11/18 Michael Bostelmann; Hamburg, Börsen=Saal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 94 Standorte: *KH Annotiert mit einigen wenigen Preisen. Titelblatt: Catalogue einer schönen Sammlung mehrentheils Niederländischer Cabinet=Mahlereyen, welche am Sonnabend, den 18ten November, auf dem Börsen=Saal öffentlich an die Meistbietenden verkauft werden sollen durch den Mackler Michael Bostelmann, bey welchem dieses Verzeichniß beliebig abzufordern. Hamburg, gedruckt bey Heinrich Christian Grund. Hamburg Anno 1775. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog des Hamburger Maklers Michael Bostelmann wurden 91 Losnummern angeboten. Am Ende des Exemplars KH sind noch drei Losnummern mit Gemälden handschriftlich angefügt (Nrn. 105 bis 107). Die einzelnen Lose sind listenartig und ohne Material- und Maßangaben aufgeführt. Meist sind Bildbeschreibung und Künstlername in einem Satz zusammen-
gefaßt. Nahezu die Hälfte der Bilder bleibt anonym. Unter den zugeschriebenen Bildern überwiegen, wie schon im Titel angedeutet, die holländischen und flämischen Gemälde. Fast gleich stark vertreten ist die deutsche Schule mit insgesamt 19 Bildern, wobei es sich zumeist um Hamburger Künstler des 18. Jahrhunderts handelt, so beispielsweise Jacob Stockmann, Jacob Weyer und Johann Georg Stuhr. Ein einzelnes Bild von Guido Reni repräsentiert die italienische Schule (Nr. 33). In einem annotierten Exemplar KH sind vereinzelt Preise angegeben. Die genannten Preise bewegen sich bis auf eine Ausnahme auf niedrigem Niveau, meist deutlich unter 10 Mark. Nur für ein Seestück von Stoop mußten immerhin 53 Mark und 4 Schilling bezahlt werden.
91 1776/00/00
Daten unbekannt
Holbein"; Nr. 265). Bei den Preisen werden vor allem die holländischen Gemälde mit Werten zwischen 50 und 600 Gulden hoch eingeschätzt. Auch drei Arbeiten von Johann Heinrich Roos sind mit einer Forderung von je 200 Gulden hoch veranschlagt (Nrn. 23 bis 24 und 55). Da alle Gemälde dieser Sammlung in einem anonymen Würzburger Katalog des Jahres 1781 erneut auftauchen (vgl. Kat. 130), ist 1776 anscheinend kein einziges Bild verkauft worden. Vermutlich wurde der Verkauf der Sammlung zunächst ausgesetzt. Nach der Vorbemerkung des Katalogs von 1781 sollten sich die Interessenten an Christoph Fesel wenden, der mittlerweile das Amt des fürstbischöflichen Galeriedirektors übernommen hatte.
92 1776/04/15
und folgende Tage
Christoph Treu; Würzburg, Haus des Sammlers
Michael Bostelmann; Hamburg, Börsen=Saale
Verkäufer nach Titelblatt: Herr Stadtrath Johann Peter Mohr Verkäufer: Mohr, Johann Peter
Verkäufer nach Titelblatt: Keine
Lose mit Gemälden: 443 Standorte: *SBBa Nicht annotiert, aber im Katalog mit gedruckten Schätzpreisen. Titelblatt: Verzeichniß einer beträchtlichen und wohlconditionirten Malerey-Collection, worunter nicht allein von florentinischen, römischen, lambardischen, venetianischen, französischen, flamentischen, und von den beßten deutschen Meistern wahre Originalien zu finden, und welche sämtlich bey Herrn Stadtrath Johann Peter Mohr in Wirzburg zu haben sind. Der Catalogue ist verfertigt von Herrn Christoph Treu, kuhrfürstl. köllnischen Hofmaler, und hochgräfl. schönbornischen Galerie-Director. Wirzburg, gedruckt bey David Christian Blank, 1776. Kommentar: Bei diesem umfangreichen Katalog handelt es sich vermutlich um einen Lagerkatalog, da keinerlei Termin genannt wird und von einer Auktion auch nicht die Rede ist. Zudem sind alle Gemälde mit Schätzpreisen versehen, was in der Regel im 18. Jahrhundert nur bei Lagerkatalogen der Fall war. Wahrscheinlich ist der im Titel genannte Stadtrat Johann Peter Mohr der Besitzer der Sammlung. Insgesamt werden 446 Gemälde aufgelistet, die vom Verfasser, dem Maler Christoph Treu, nach Wertschätzung sortiert wurden. Zu Beginn des Katalogs beschreibt Treu die Bilder sehr ausführlich, so beispielsweise ein Historienstück von Bartholomäus Spranger mit einer Darstellung Alexanders des Großen (Nr. 1), das auf 800 rheinische Gulden geschätzt wurde. Im hinteren Teil des Katalogs sind die Beschreibungen sehr viel kürzer, dennoch fehlen auch dort die Maßangaben nicht. Das Preisniveau ist hier jedoch deutlich geringer, bei den letzten sieben Bildern werden nur ein bis zwei Gulden verlangt. Den größten Teil der Kollektion machen die 161 holländischen und flämischen Gemälde des 17. Jahrhunderts aus. Mit sechs Jagdstücken ist Jan Fyt besonders stark vertreten. Von Peeter Snayers sind vier Tierstücke mit Jagdszenen vorhanden. Die deutschen Schulen machen mit 115 Arbeiten etwas ein Viertel der Sammlung aus. Unter den wenigen altdeutschen Bildern finden sich eine Mutter Gottes von Albrecht Dürer (Nr. 113), drei Bilder aus der Schule Dürers, zwei Portraits von Hans Holbein d.J. sowie zwei Arbeiten von Hans Grünewald. Treu äußert bei dem mit "HP. 1527" bezeichneten Männerportrait die Vermutung, es handle sich nur um ein Bild eines Schülers Holbeins. Bei den Gemälden der deutschen Schule überwiegen die süddeutschen Maler des 18. Jahrhunderts, darunter allein 26 Arbeiten der Malerfamilie Treu und neun Arbeiten von Johann Nikolaus Grooth sowie je sechs Bilder von Johann Georg Kraer und Maximilian Joseph Schinnagel. Auch die italienischen Schulen sind mit 51 Gemälden gut vertreten. Auch hier liegt der Schwerpunkt auf dem 18. Jahrhundert. Nur 19 Gemälde bleiben anonym. Eine ganze Reihe von Künstlern läßt sich nicht zweifelsfrei identifizieren, weil offensichtlich mehrfach Vornamen verwechselt wurden ("Bruno
Lose mit Gemälden: 178 Standorte: *KH I Annotiert in Bleistift mit den meisten Käufernamen und den meisten Preisen. KH II Unvollständig, nur die ersten acht Seiten sind vorhanden. Annotiert mit den meisten Käufernamen und den meisten Preisen. Titelblatt: Catalogue einer auserlesenen Sammlung der schönsten Holländischen, Niederländischen und Italienischen Cabinet=Mahlereyen, welche am Montage, den 15ten April, und folgende Tage, auf dem hiesigen Börsen=Saale, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden sollen; imgleichen eine schöne Sammlung Wasserfarben= und Miniatur=Gemählde, wie auch eine auserlesene Sammlung der besten Französischen, Englischen und Niederländischen, mit saubere Rähmen und Glas eingefaßte Kupferstiche, durch den Mackler Michael Bostelmann, bey welchem diese Designation beliebigst abzufordern. Auch können vorbesagte Kunstsachen zwey Tage vor der Verkaufung am bestimmten Orte öffentlich besehen werden. Gedruckt bey J. J. C. Bode. Hamburg, Anno 1776. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog des Hamburger Maklers Michael Bostelmann wurden 178 Bilder angeboten, die im ersten Teil des Verzeichnisses unter dem Titel "Vorstellung der Gemählde" aufgelistet werden. In einem zweiten Teil folgen graphische Arbeiten und Miniaturen (S. 14 bis 16). Alle Beschreibungen sind kurz gehalten, geben aber durchaus einige Detailinformationen. In tabellarischer Form sind die Maße angeführt. Nur 22 Gemälde bleiben anonym. Oftmals werden einzelnen Künstlernamen kurze Erläuterungen hinzugefügt. So heißt es etwa bei Simon Kick "Discipel von Tenirs". Eine Notiz am Ende des Katalogs informiert darüber, daß die Gemälde "sämmtlich gut conditioniert, theils mit verguldeten Leisten, auch schwarz gebeizten, mit verguldeten Leisten, versehenen Rahmen gezieret." Den größten Anteil der verzeichneten Gemälde bildet die Gruppe der insgesamt 83 Werke holländischer Maler von Asselyn bis Zeemann. Eine Plünderung von Pieter van Laer wird als "eines der schönsten Gemähide" im Katalog angepriesen. Es dominieren vor allem Landschaften und Genredarstellungen. Unter den 36 flämischen Gemälden ist ein Zyklus der Zwölf Monate von Pieter Bruegel d.Ä. hervorzuheben. Die deutsche Schule ist mit vierzehn Bildern nur schwach vertreten, darunter finden sich drei Werke des holsteinischen Malers Dominicus Gottfried Waerdigh. Unter den deutschen Bildem sticht eine Kupfertafel von Adam Elsheimer mit der Darstellung des Hl. Laurentius hervor, die für 205 Mark als teuerstes Gemälde der Auktion von Gottfried August Schwalb erworben wurde und in dem Verzeichnis der Schwalbschen Sammlung wieder auftaucht (Kat. 120, Nr. 183). Bei diesem Bild handelt es sich wahrscheinlich um eine gute Kopie des Hl. Laurentius in der Londoner National Gallery (Inv.-Nr. 1014). Ebenfalls hoch bezahlt wurde eine KATALOGE
87
Landschaft von Alexander Keirincx (Nr. 55) mit 203 Mark sowie mit 173 Mark ein Gemälde mit der Darstellung des Auszug Loths und seiner Töchter aus Sodom von Pieter Bruegel (Nr. 19). Beide Bilder wurden dem Käufer Petersen zugeschlagen. Die beiden Exemplare KH des Katalogs enthalten unterschiedliche handschriftliche Einträge zu den Gemälden. Die in dem Exemplar KH I durchgestrichenen Einträge sind in dem Exemplar KH II mit Angabe des Käufers und der erzielten Preise versehen. Hingegen finden sich im Exemplar II keine Käuferangaben bei den Einträgen, die im Exemplar I mit dem Namen der Käufer und der Preise versehen sind. Die erzielten Preise bewegen sich abgesehen von den schon erwähnten hohen Ergebnissen auf niedrigem Niveau und bleiben meist unter 50 Mark, in zahlreichen Fällen deutlich unter 10 Mark. Unter den Käufern traten vor allem die Kunstagenten Johann Benjamin Ehrenreich mit sechs Ankäufen, Johann Jobst Eckhardt mit drei Erwerbungen und Johann Diedrich Lilly Senior mit insgesamt 19 Zuschlägen hervor. Allein 20 Gemälde wurden von dem Auktionator Hinrich Jürgen Köster übernommen, wobei hier nicht klar ist, ob diese Bilder zurückgingen oder möglicherweise im Auftrag anderer Kunden gekauft wurden.
93 1776/06/21 Neumann; Hamburg, Börsen=Saale Verkäufer nach Titelblatt: Eine gewisse Verlassenschaft Lose mit Gemälden: 149 Standorte: *KH Annotiert mit einigen Käufernamen und Preisen. Titelblatt: Catalogue einer auserlesenen Sammlung der schönsten Holländischen, Niederländischen, auch Italiänischen Cabinet=Mahlereyen, welche am Freytage, den 21sten Juny, auf dem hiesigen Börsen=Saale, öffentlich aus einer gewissen Verlassenschaft, abseiten des Löbl. Zehnten=Ampts, verkauft werden sollen, und Tages zuvor daselbst zu besehen sind; durch den Mackler Neumann und Auctionarium Köster, bey welchem diese Designation beliebigst abzufordern. Gedruckt bey J. J. C. Bode. Hamburg Anno 1776. Kommentar: Bei dieser Versteigerung des Maklers Johann Hinrich Neumann und des Auktionators Hinrich Jürgen Köster wurden insgesamt 150 Losnummern mit 149 Gemälden angeboten. Dem Titelblatt zufolge handelt es sich um eine Hamburger Privatsammlung, die nach dem Tode des anonym bleibenden Sammlers veräußert wurde. Alle Katalogeinträge sind sehr kurz gehalten und oft mit Wertungen wie "lebhaft gemahlt" oder "meisterhaft gemahlt" versehen. Das Material wird in der Regel mit angegeben; Künstlernamen und Maße sind in tabellarischer Form beigefügt. Zwei großformatige Gemälde werden als "Gallerie=Stücke" bezeichnet und damit besonders hervorgehoben: Es handelt sich um ein Blumen- und Früchtestilleben mit Figuren von Gaspar Peeter de Verbruggen und Frans Ijkens (Nr. 49) sowie eine Darstellung des Narciss von Abraham Janssens (Nr. 70). Die Sammlung umfaßt zu etwa gleichen Teilen Gemälde der holländischen und deutschen Schule sowie eine kleine Anzahl von Gemälden flämischer und italienischer Künstler. Bei den großen Künstlernamen handelt es sich zumeist um Kopien, so beispielsweise nach Anthonie van Dyck, und um Gemälde, die im Gusto von Poussin oder Rembrandt gemalt wurden. Unter den deutschen Werken sind die Hamburger Künstler Balthasar Denner, Johann Georg Stuhr und A. Videbant häufig vertreten. Anonym bleiben nur 16 Arbeiten, jedoch kann eine ganze Reihe von Gemälden, in denen nur die Initialen der Künstler angegeben sind, nicht aufgelöst werden. Diese werden daher als Monogrammisten geführt. Aus dem überwiegend annotierten Exemplar KH läßt sich entnehmen, daß die Preise sich auf durchweg niedrigem Niveau bewegten. Nahezu alle Lose wurden bei deutlich weniger als 20 Mark zugeschlagen. Ein Gemälde von Faistenburger erzielte mit nur 30 Mark 88
KATALOGE
den höchsten Preis. Unter den Käufern traten vor allem die Kunsthändler Peter Sieberg, Johann Diedrich Lilly Senior und Johann Jobst Eckhardt hervor.
94 1776/06/28 Bostelmann; Hamburg, Börsen=Saale Verkäufer nach Titelblatt: Eine gewisse Verlassenschaft Lose mit Gemälden: 72 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Catalogus einer auserlesenen Sammlung der schönsten Holländischen, Niederländischen und Italienischen Cabinet=Mahlereyen, welche am Freytage, den 28sten Junii, auf dem hiesigen Börsen=Saale aus einer gewissen Verlassenschaft durch die Mackler Bostelmann und Neumann, bey welchen diese Designation beliebigst abzufordern, öffentlich verkauft werden sollen. Gedruckt bey Heinrich Christian Grund. Hamburg, Anno 1776. Kommentar: Insgesamt 72 Gemälde wurden in diesem Versteigerungskatalog der Makler Michael Bostelmann und Johann Hinrich Neumann angeboten. Nach der Numerierung handelt es sich nur um 70 Lose, jedoch wurden zwei Nummern doppelt belegt (Nrn. 47 und 48). Dem Titelblatt zufolge handelt es sich um eine Privatsammlung, die nach dem Tode des anonym bleibenden Sammlers veräußert wurde. Alle Bildbeschreibungen sind kurz gehalten. Die Namen der Künstler und die Maße werden in tabellarischer Form angeführt. Bis auf ein Bild sind alle Gemälde einem Künstler zugeschrieben. Mit 32 Arbeiten überwiegen die Werke der holländischen und flämischen Künstler, wobei die letzteren nur mit vier Bildern vertreten sind. Von deutschen Künstlern stammen 19 Gemälde, wobei die altdeutsche Schule mit vier Arbeiten Lucas Cranachs und zwei Hans Holbein d.J. zugeschriebenen Werken gut vertreten ist. Nur ein Gemälde des Monogrammisten H.C. wird als italienisch eingestuft (Nr. 67). Bei einer Vielzahl der Einträge findet sich nur die Angabe eines Künstlermonogramms. Eine Darstellung des Ecce-Homo gilt als ein Werk Jan van Eycks. Eine Historie von Adriaen van der Werff wird als "extra fleißiges Cabinet=Gemälde" angeboten, das in einem "kleinen Nußbaumen Schrank aufbehalten" wird (Nr. 46). Neben einzelnen Historienbildern finden sich unter den verauktionierten Gemälden vor allem Landschaftsdarstellungen.
95 1776/07/19 Michael Bostellmann; Hamburg, Börsen=Saale Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 123 Standorte: *KH Annotiert mit allen Käufemamen und Preisen. Titelblatt: Catalogus einer schönen Sammlung Italiänischer und Niederländischer Cabinet=Mahlereyen, so allhier zum Verkauf eingesandt, welche am Freytage, den 19ten Julii, auf dem hiesigen Börsen=Saale, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden sollen, durch den Mackler Michael Bostellmann, bey welchem dieser Catalogus beliebig abzufo[r]dern, auch können besagte Gemähide, den Tag vorhero, am besagten Orte gefällig besehen werden. Gedruckt bey J.J. C. Bode. Hamburg Anno 1776. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog des Hamburger Maklers Michael Bostelmann wurden 120 Losnummern mit Gemälden angeboten. Drei weitere Bilder wurden im Exemplar KH handschriftlich hinzugefügt (Nrn. 121 bis 123). Im Titel des Katalogs findet sich kein Hinweis darauf, daß es sich um eine Sammlung aus Hamburg handelt. Alle Beschreibungen sind kurz gefaßt, meist werden Bildgegenstand und Künstlername in einem Satz vorgestellt.
Die Maße sind in tabellarischer Form beigefügt. Nur 15 Gemälde bleiben anonym. Mit insgesamt 49 Werken überwiegen die holländischen Gemälde. Hinzu kommen 17 Bilder flämischer Künstler, darunter drei Werke von Paul Bril. In der kleinen Gruppe der 16 deutschen Gemälde dominiert Daniel du Verdion mit fünf Landschaften, ansonsten sind vor allem Hamburger Künstler wie Jacob Weyer, Matthias Scheits und Joachim Luhn vertreten. Bei den neun italienischen Bildern findet sich ein Folge von mythologischen Bildern von Francesco Solimena (Nrn. 54 bis 57). Nach den Angaben des annotierten Exemplars KH bewegten sich die Preise auf überwiegend niedrigem Niveau. Die meisten Bilder wurden für weniger als 20 Mark, oft sogar unter 10 Mark verkauft. Den höchsten Preis erzielte das Jagdbild eines italienischen Malers in der Manier von "Schneyers", das 36 Mark erbrachte (Nr. 107). Ein Bildnis eines jungen Mädchens von Caspar Netscher (Nr. 102) erzielte 30 Mark. Dafür erlöste eine als "ungemein rar" beschriebene Landschaft auf Kupfer von Jan Brueghel d.Ä. nur 4 Mark (Nr. 9). Dagegen fanden zwei Landschaften von Alexander Keirincx mit Staffagefiguren von Adriaen van de Velde den Zuschlag bei zusammen 40 Mark (Nm. 52 und 53). Unter den Käufern traten vor allem Hamburger Kunsthändler wie Johann Jobst Eckhardt, Hinrich Jürgen Köster sowie besonders Johann Diedrich Lilly und sein Vater hervor, die gemeinsam 49 Gemälde erwarben. Insgesamt 20 Gemälde wurden dem Käufer Ohman zugeschlagen.
96 1776/11/09 Hinrich Jürgen Köster; Hamburg, Catharinenstrasse Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 151 Standorte: *KH Annotiert mit den meisten Käufemamen und den meisten Preisen. Titelblatt: Catalogue einer auserlesenen Sammlung der besten Niederländischen, Holländischen und Italiänischen Cabinet=Mahlereyen, welche in einem wohlbekannten Hause in der Catharinenstrasse am 9ten November a.c. Morgens um 10 Uhr in öffentlicher Auction verkauft werden sollen durch den Auctionarium Hinrich Jürgen Köster, bey welchem wie auch bey dem Mahler Johann Diedrich Lilly Sen. diese Designation beliebig abzufordern. Auch können besagte Schildereyen zwey Tage vorhero in beliebigem Augenschein genommen werden. Hamburg. Anno 1776. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog des Hamburger Maklers Hinrich Jürgen Köster wurden insgesamt 151 Gemälde angeboten. Der Katalog umfaßt 166 Lose. Die Nm. 155 bis 166 und 140 bis 143 verzeichnen graphische Arbeiten, die Nm. 145 und 146 antike römische Vasen. Vier Lose wurden handschriftlich im Exemplar KH hinzugefügt (Nm. 168 bis 171). Köster arbeitete hier mit dem Maler Johann Dietrich Lilly Senior zusammen. Es handelt sich nach den Angaben des Titelblatts um die Kollektion eines Hamburger Sammlers, denn die Auktion fand in dessen Haus in der Catharinenstraße statt. Die Gemälde sind etwas sorgfältiger und ausführlicher beschrieben als in den Katalogen des Maklers Michael Bostelmann, der in jenen Jahren in Hamburg zahlreiche Auktionen durchführte (vgl. z.B. Kat. 95). In den Katalogeinträgen werden der Künstlername angeführt sowie Angaben zum Material und zum Rahmen gemacht. In tabellarischer Form sind die Maße beigefügt. Wie bei den meisten Hamburger Versteigerungen überwiegen mit 46 Bildern die holländischen Künstler des 17. Jahrhunderts. Ebenfalls zahlreich vertreten ist mit 29 Werken die flämische Schule, darunter allein vier Arbeiten von Hendrik van Baien. Ebenfalls vier Gemälde werden als Gemeinschaftsarbeiten von Peeter Bout und Adriaen Boudewyns vorgestellt. Bei den deutschen Werken überwiegen neben einigen altdeutschen Bildern Vertreter der Hamburger Schule. Von Johann Georg Stuhr sind allein 13 Bilder vorhanden.
Anonym bleiben insgesamt nur zwölf Gemälde. Das Preisniveau liegt deutlich höher als der Durchschnitt vergleichbarer Auktionen. Ein ganze Reihe von Gemälden erzielte Preise von über 100 Mark. Das Urteil Salomons von Gerard Hoet (Nr. 1) wurde erst bei 400 Mark zugeschlagen. Ein Seestück von Ludolf Backhuysen (Nr. 41) erzielte 341 Mark. Unter den Käufern traten vor allem die Sammler Greetz und Wilhelm Hasperg hervor. Hasperg ersteigerte mehr als 25 Gemälde, darunter eine Folge von fünf Ansichten Hamburgs von Johann Georg Stuhr (Nm. 133 bis 136 und 139) für 30 Mark und 4 Schilling. Zahlreiche Bilder erwarb der Kunsthändler Johann Benjamin Ehrenreich, der bei 35 Bilder den Zuschlag erhielt. Die beiden Ausrichter der Auktion, Hinrich Jürgen Köster und Johann Dietrich Lilly Senior, übernahmen zusammen rund 40 Gemälde. Es ist nicht klar, ob es sich hier eventuell um Rückkäufe oder um Kommissionsaufträge handelt.
97 1776/12/21 Michael Bostelmann; Hamburg, Börsensaal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 85 Standorte: *KH Annotiert mit allen Käufemamen und Preisen auf eingebundenen Leerseiten. Titelblatt: Catalogue von einer auserlesenen Sammlung Cabinet= Mahlereyen Miniatur= und Wasserfarben=Stücken, eingefaßte Kupferstiche mit Glas, ec. Naturalien, Insecten in Spiritus, Schnecken, Muscheln, Corallen, Stern=Fische, einheimische und ausländische ausgestopfte Vögel ohne und mit Kästen, so mit Rahmen und Glas, unterschiedliche Mineralien, Späth und Quarz=Drusen, ec. wie auch marmorne Tisch=Blätter, welche Sonnabend vor Weichnachten, den 21. Dec. 1776 öffentlich auf dem Börsensaal verkaufet werden sollen durch den Mackler Michael Bostelmann. Gedruck bey Johann Philipp Christian Reuß. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog des Hamburger Maklers Michael Bostelmann werden auf den Seiten 4 bis 7 insgesamt 85 Gemälde aufgeführt, die nur einen Teil der auf der Auktion veräußerten Gegenstände ausmachen. Der Katalog von 24 Seiten Umfang verzeichnet darüber hinaus Miniaturen und Wasserfarben sowie naturkundliche Präparate und Mineralien. Es ist anzunehmen, daß es sich bei dem nicht genannten Besitzer der Sammlung um einen Naturwissenschaftler handelt. Alle Gemälde sind relativ ausführlich beschrieben und teilweise mit Wertungen wie "meisterhaft gemahlt" versehen. Das Material wird genannt und die Maße sind angegeben. Bei den 13 Bildern der holländischen und flämischen Schule des 17. Jahrhunderts werden einige Gemälde als "Schule", "Manier" oder "Kopie" beschrieben. Unter den Gemälden der deutschen Schule befinden sich überwiegend Werke von Hamburger Malem wie Matthias Scheits, Johann Georg Stuhr oder Johann Jacob Tischbein. Vermutlich handelt es sich bei dem Monogrammisten "A.S." um Andreas Scheits, den Sohn von Matthias Scheits. Wegen der vielen Gemälde Hamburger Künstler ist anzunehmen, daß es sich um die Kollektion eines Hamburger Sammlers handelt. Nach dem annotierten Exemplar KH des Katalogs blieben die Preise auf niedrigem Niveau: Fast alle Bilder kosteten weniger als 20 Mark, meistens sogar deutlich unter 10 Mark. Den höchsten Preis von 48 Mark erzielte die Darstellung eines Hl. Petrus, die als "Schule von Rubens" verzeichnet ist (Nr. 66). Unter den Käufern befanden sich nach den Angaben des annotierten Exemplars ICH neben den Kunsthändlern Johann Benjamin Ehrenreich und Peter Sieberg vor allem der Hamburger Sammler Johann Berenberg. Berenberg erwarb allein zwölf Gemälde. Einige Bilder gingen auch an den Auktionator Michael Bostelmann, wobei die mit einem großen "R" markierten Gemälde vermutlich zurückgingen. KATALOGE
89
98 1777/02/21
[Lugt 2645]
100 1777/03/03
und folgende Tage
Benedix Meno von Horn; Hamburg, Börsen=Saale
[Anonym]; Augsburg, Dacanat=Hof zu St. Moritzen Collegiat=Stift
Verkäufer nach Titelblatt: Keine
Verkäufer nach Titelblatt: Bibliotheca Bassiana Verkäufer: Bassi, Johann Baptist
Lose mit Gemälden:
102
Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Catalogue einer schönen Sammlung Niederländischer und Italienischer Cabinet=Mahlereyen imgleichen alte Niederländische, Französische und Italienische Kupferstiche wie auch in Helfenbein und Holz geschnittene Figuren ec.ec. welches am Freytage, den 21. Febr. Vormittags um 10 Uhr, auf dem hiesigen Börsen=Saale öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden sollen durch Mackler Benedix Meno von Horn. Gedruckt bey Dieterich Anton Harmsen. Hamburg, Anno 1777. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog des Maklers Bendix Meno von Horn wurden insgesamt 109 Losnummern mit 102 Gemälden angeboten. Bei den Losnummern 1 bis 104 handelt es sich bis auf die Lose 35 und 36 um Gemälde, die Nummern 105 und 107 verzeichnen Skulpturen. Bei der Losnummer 108 handelt es sich um eine bearbeitete Kupferplatte und bei der Nummer 109 um einen Porzellanaufsatz. Die im Titel mit aufgeführten Kupferstiche wurden "wegen der Menge nicht specificirt", wie in einer Nachbemerkung mitgeteilt wird. Die Bildbeschreibungen enthalten in einem Satz kurze Angaben über die Bildthemen, mitunter auch ästhetische Urteile wie "ungemein natürlich", sowie die Künstlernamen. Die Maße werden in tabellarischer Form hinzugefügt. Insgesamt 13 Gemälde sind anonym verzeichnet. In der Hauptsache werden Gemälde der holländischen Schule, darunter j e zwei Bilder von Abraham Bloemaert, Michiel Jansz. van Miereveld und Rembrandt angeboten. Die Flamen sind mit elf Arbeiten vertreten, die deutsche Schule mit 19 Gemälden, wobei das Schwergewicht auf dem 18. Jahrhundert liegt und die meisten Künstler aus dem Hamburger Raum stammen, was darauf hindeutet, daß es sich um den Verkauf einer Hamburger Sammlung handelt.
Lose mit Gemälden:
120
Standorte: UBM Nicht annotiert. BSBM Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Titelblatt: Bibliotheca Bassiana. Kommentar: In einem einleitenden "Avertissement" werden die Konditionen der Versteigerung ausgeführt. Die Auktion sollte am 3. März und den folgenden Tagen im "Dacanat=Hof zu St. Moritzen Collegiat=Stift in Augsburg" stattfinden. Am Stift St. Moritz hatte Johann Baptist Bassi (gest. 1776) als Dekan gewirkt. Neben den Gemälden wurden auch Kupferstiche, Münzen und Naturalien angeboten. Alle Kunstgegenstände konnten zuvor besichtigt werden. Gebote sollten bei den Anwälten der Nachlaßversteigerung oder bei Caspar Wesseli, dem Augsburger Pfandhaus-Taxator eingereicht werden. Die Gemälde sind nur in kurzen Bildtiteln vorgestellt, die durch Maßangaben ergänzt werden. Im Gegensatz zu den meisten Sammlungen im deutschsprachigen Raum überwiegen unter den insgesamt 120 Gemälden die italienischen Schulen, die mit allein 48 Arbeiten vertreten sind. Bei den italienischen Gemälden handelte es sich in der Mehrzahl um Werke des späten 17. und des 18. Jahrhunderts. Mehrfach vertreten waren Guido Reni, Pietro Antonio Rotari und Jacopo Amigoni. Anonym bleiben nur acht Bilder. Unter den wenigen deutschen Gemälden sind neben zwei Bildern von Johann Heinrich Schönfeld und Johann Heiss mehrere altdeutsche Werke bemerkenswert. Darunter befindet sich auch ein Christus am Ölberg von Hans Burgkmair, der sich heute in der Hamburger Kunsthalle befindet (Inv.-Nr. 394). Nach den Angaben des Katalogs der Hamburger Kunsthalle wurde dieses Bild auf der Auktion für 60 Gulden verkauft. Lit.: Katalog der Alten Meister der Hamburger Kunsthalle, Hamburg 1966, S. 39.
99 1777/02/26 Hinrich Jürgen Köster; Hamburg, In dem Königlich=Dänisch=Holsteinischen Posthause auf den Bleichen
101 1777/04/11 Joh. Hinr. Neumann; Hamburg, Börsen=Saale
Verkäufer nach Titelblatt: Keine
Verkäufer nach Titelblatt: Keine
Lose mit Gemälden: 55
Lose mit Gemälden:
Standorte: KH Nicht annotiert.
Standorte: KH Nicht annotiert.
Titelblatt: Verzeichniß von Gemählden und Kupferstichen und einigen Kunst=Sachen welche am 26. Februar in dem Königlich=Dänisch=Holsteinischen Posthause auf den Bleichen in öffentlicher Auction verkauft werden sollen durch den Auctionarium Hinrich Jürgen Köster. Hamburg 1777.
Titelblatt: Catalogue über Mahlereyen verschiedner Meister, welche am Freytage, den 1 lten April, 1777 durch den Mackler Joh. Hinr. Neumann öffentlich auf dem Börsen=Saale verkauft werden sollen. Hamburg, gedruckt bey Gottlieb Friedrich Schniebes.
Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog des Hamburger Auktionators Hinrich Jürgen Köster wurden neben Kupferstichen und Züricher Porzellan 55 Gemälde angeboten. Außerdem stand noch ein illuminierter Stich von William Hogarth (Nr. 56) sowie eine Zeichnung von Rembrandt (Nr. 57) zum Verkauf. Alle Beschreibungen sind sehr kurz gehalten und in der Regel wenig aussagekräftig. Allein 30 Bilder bleiben anonym. Neben sieben holländischen Gemälden handelt es sich vor allem um Arbeiten deutscher Künstler des 18. Jahrhunderts, darunter zwei Landschaften von Christian Wilhelm Ernst Dietrich und zwei Gemälde des Hamburger Malers Hans Heinrich Rundt. Bei den wenigen Gemälden der holländischen Schule ist keines als Original ausgewiesen. Stattdessen werden die Bilder als "Manier" oder als "so gut wie Rembrandt" beschrieben. 90
KATALOGE
102
Kommentar: Dieser Versteigerungskatalog des Hamburger Maklers Johann Hinrich Neumann enthält insgesamt 102 Losnummern mit ebenso vielen Gemälden. Alle Bilder sind nur sehr knapp und wenig aussagekräftig beschrieben. Angaben zum Material und zu den Maßen fehlen. Rund zwei Drittel der Gemälde werden keinem Künstler zugeschrieben. Unter den zugeschriebenen Werken überwiegen Gemälde der holländischen und deutschen Schule. Bei den deutschen Gemälden finden sich neben Werken der sächsischen Landschafter Christian Wilhelm Ernst Dietrich und Heinrich Leichner vor allem Hamburger Maler. Unter den insgesamt sieben italienischen Gemälden fällt eine Folge von Portraits von Giovanni Battista Piazzetta auf (Nrn. 44 bis 49).
102 1777/05/26-1777/05/27
[Lugt 2704]
[Anonym]; Frankfurt am Main, Haus des Sammlers, in der Goldnen Federgasse Lit. F. Nro. 112 Verkäufer nach Titelblatt: Herrn Finsterwalder Verkäufer: Finsterwalder Lose mit Gemälden: 193 Standorte: *SBF Annotiert mit allen Käufemamen und Preisen auf eingebundenen Leerseiten. Aus dem Besitz von Johann Valentin Prehn. Titelblatt: Catalogue einer schönen Sammlung Mahlereyen, von Italienischen, Niederländischen und Teutschen guten Meistern, welche den [Auslassung] 1777 zu Frankfurt in der Goldnen Federgasse Lit. F. Nro. 112 bey dem Vergulder Herrn Finsterwalder, durch die geschwome Hrn. Ausrufer öffentlich gegen bahre Zahlung verkauft werden sollen. 1772. Kommentar: Auf der Titelseite des Exemplars des Exemplars SBF, das aus dem Besitz von Johann Valentin Prehn stammt, ist handschriftlich ergänzt: "Notiz. Diese Gemälde wurden den 26 & 27 May 1777 versteigert, und die beygefügte Preiße sind aus dem im Original besizenden Versteigerungs=Protocoll gezogen, woraus auch die Namen der Ersteigerer genommen sind. Auser denen im Catalog erwähnten werden noch 16 Gemälde mit versteigert, welche am Ende desselben nachgetragen sind." Vermutlich handelt es sich daher bei dem unten auf der Titelseite gedruckten Erscheinungsjahr 1772 um einen Druckfehler. Es ist nicht eindeutig, ob es sich bei dem auf der Titelseite erwähnten Finsterwalder um den Besitzer der Sammlung oder um den ausführenden Kunsthändler handelt. Insgesamt werden in diesem Katalog 193 Gemälde (einschließlich der 16 handschriftlich hinzugefügten) angeboten, die nicht durchnumeriert sind. Stattdessen ist jedem Los eine Nummer zugeordnet, die ohne erkennbare Ordnung aufeinander folgen. Vermutlich handelt es sich um Nummern eines früher erschienenen Katalogs oder um Inventamummem. Die Bilder werden mit Schlagworten wie "Landschaft" oder "Vanitas-Stück" bezeichnet oder knapp beschrieben. Angaben zum Material und zu den Maßen werden in der Regel nicht gemacht, nur auf Seite 13 erscheint ein Hinweis auf die folgenden Bilder: "Diese Mahlereyen sind zum Theil auf Kupfer, auf Holz und Leinwand gemahlt, von Größe eines Schuhes, auch einige darunter, anderthalbe, zwey bis dritthalbe Schuh groß mit Rahmen, auch viele mit guten Gold vergüteten brauchbaren Rahmen versehen." Rund ein Viertel der Gemälde bleibt anonym. Der flämischen und holländischen Schule lassen sich 66 Arbeiten zuordnen, der deutschen Schule gehören nur 23 Werke an. Als italienisch werden 14 Gemälde eingestuft. Bei den deutschen Arbeiten sind nur sehr vereinzelt Frankfurter Künstler zu finden. Für die insgesamt 193 Gemälde wurde ein Gesamtbetrag von 1781 Gulden und 50 Kreuzern erzielt. Der größte Teil der Bilder wurde zu niedrigen Preisen zwischen 2 und 20 Gulden zugeschlagen. Höhere Ergebnisse erbrachten nur ein Bild von Pieter Wouwerman mit 44 Gulden (Nr. 90) und ein Werk von Annibale Carracci mit 48 Gulden (Nr. 455), das Georg Friedrich Moevius zugeschlagen wurde. Den höchsten Preis erzielte ein Raffael zugeschriebenes Werk (Nr. 86), das von Johann Matthias Ehrenreich für 78 Gulden und 30 Kreuzer erstanden wurde. Als Käufer traten nach den Angaben des annotierten Exemplars besonders Frankfurter Kunsthändler wie Heinrich Sebastian Hüsgen und der bereits erwähnte Georg Friedrich Moevius auf. Moevius erwarb allein 31 Bilder. Zahlreiche Bilder gingen auch an den Frankfurter Sammler Christian Carl Eichhorn und einen Vertreter der Hanauer Familie Cotrel.
103 1777/11/11-1777/11/13 von Brockdorf; Wolfenbüttel, Auf der Neuen-Strasse in den von Ditfurthschen Hause Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 33 Standorte: *NSAW Handschriftliches Protokoll mit allen Käufernamen und Preisen. Ein Katalog ist nicht vorhanden. Kommentar: Bei dieser Versteigerung erschien wahrscheinlich kein Katalog. Erhalten hat sich das nach der braunschweigischen Auktionsordnung vorgeschriebene Auktionsprotokoll (NSAW, Akte Ν 34, Nr. 3080), das mit folgender Überschrift betitelt ist: "Nro. 1. Auctions-Protocoll über einige den Herrn von Brockdorf zugehörige Meublen und Effecten abgehalten d. 11.12.13.ten Nov. 1777". Die Versteigerung wurde von dem Auktionator Carl Friedrich von Brockdorff durchgefühlt, der 1768 in Wolfenbüttel zum Auktionator berufen worden war (vgl. NSAW, Akte 34 N, Nr. 3711). Es ist nicht ganz ersichtlich, ob es sich um Brockdorffs eigene Sammlung oder den Verkauf einer Sammlung eines anderen Eigentümers handelt. Da die Auktion nach Aussagen des Protokolls "auf der Neuen=Straße in dem von Ditfurthschen Hause" stattfand, spricht jedoch vieles dafür, daß Brockdorff diese Auktion lediglich durchführte. In einer Einführung des Protokolls heißt es: "Nachdem der Herr von Brockdorf nachstehendes Verzeignis einiger Mobilien und Effecten einreichen laßen, um solche per modum auctionis zu versteigern: So ist Terminus dazu auf heute durch die braunschw. Anzeigen und heute Morgens durch den öffentlichen Straßen Ausruf nochmals bekannt gemachet und darauf die Sachen den Meistbietenden zugeschlagen als: [hier folgt das Verkaufsprotokoll]." Neben Möbeln wurden auch insgesamt 34 Lose mit "Gemälden und Kupferstichen" angeboten, von denen sich 33 als Gemälde identifizieren ließen; es werden keine Künstlernamen genannt. Nach den Angaben des Protokolls wurden alle Gemälde zu Preisen von 5 bis 10 Talern veräußert. Unter den Käufern finden sich die Namen Hantelmann, Hofrat von Blum und Meibom. Da bei 16 Bildern Brockdorff selbst als Käufernamen notiert ist, läßt sich annehmen, daß zahlreiche Bilder zurückgingen. 104 1778/03/02
und folgende Tage
[Anonym]; Berlin, Haus des Sammlers, Rue de Frere Verkäufer nach Titelblatt: Monsieur de Conseiller De Cour Quintin Verkäufer: Quintin, Karl Albrecht Lose mit Gemälden: 57 Standorte: *SBB Annotiert mit allen Preisen. Titelblatt: Catalogue de livres choisis la plupart historiques, geographique et physiqves et relatifs aux belle lettre qui avec une belle collection d'estampes de desseins et de tableaux se vendront aux plus offrans encherisseur [Endung handschriftlich korrigiert] argent comptant Lundi 2. Mars 1778. Prochain et jours suivant dans la rue de Frere en la maison de monsieur de conseiller de cour Quintin. La catalogue se distribuent ä la Ville Neuve sous les arbre, au Coiln de la Rue Charlotte, dans la Maison du Sieur Menn, Patisser, che l'Huissier Maire. Berlin 1778. Kommentar: In dieser Versteigerung der Sammlung Karl Albrecht Quintin wurden in erster Linie Bücher und graphische Arbeiten angeboten. In dem kleinen Abschnitt "Tableaux" des französischsprachigen Katalogs werden auch insgesamt 57 Losnummern mit Gemälden aufgeführt (S. 85 bis 87). Bei den meisten Nummern werden nur in knapper Form die Bildtitel erwähnt, Angaben zu den Maßen oder zum Material fehlen vollständig. Bis auf wenige Ausnahmen bleiben die Künstler anonym. Unter den zugeschriebenen Werken finden sich vier Landschaften des in Berlin arbeitenden Nürnberger KATALOGE
91
Malers Johann Hieronymus Hirschmann. Vier italienische Gemälde werden als Werke bedeutender Maler wie Guido Reni (Nr. 3), Carlo Maratti (Nr. 4), Guercino (Nr. 5) und Leonardo da Vinci (Nr. 7) geführt. Nach den Angaben des annotierten Exemplars SBB wurden die meisten Bilder für Preise unter 2 Talern abgegeben. Höhere Ergebnisse erzielten nur die zugeschriebenen Werke. So wurde beispielsweise mit 17 Talem für eine Darstellung der Musen von Theodor van Thulden (Nr. 6) der mit Abstand höchste Preis bezahlt. 105 1778/03/23
und folgende Tage
[Anonym]; Wolfenbüttel, In dem auf der breiten Herzog-Strasse sub. Nro.685 belegenen Hause Verkäufer nach Titelblatt: Obrist-Lieutenant Karl Gustav von Redecken Verkäufer: Redecken, Karl Gustav von, Oberst-Leutnant Lose mit Gemälden: 18 Standorte: *NSAW Eingebunden in ein handschriftliches Auktionsprotokoll mit allen Käufernamen und Preisen. Titelblatt: Verzeichniß von Pretiosis, Gold, Silber, Porcellain, Fayance und anderen Sorten, Gläsern, Zinn, Kupfer, Meßing, Betten, Spiegeln, Kleidungs=Stücken, Schränken, Tischen, Stühlen, Commoden, Bettsponden, und allerhand Hausgeräthe, wie auch einer Sammlung von Büchern, welche den 23sten März 1778 u. folgende Tage, Nachmittages von 2 bis 5 Uhr, zu Wolfenbüttel in dem auf der breiten Herzog=Straße sub Nro. 685. belegenen Hause öffentlich an den Meistbiethenden verkaufet werden sollen. 1778.
nige Kunstsachen welche am Sonnabend, den 28. März auf dem hiesigen Börsen=Saale aus einer gewissen Verlassenschaft durch die Mäckler Schaumann und Wolters, jun. bey welche diese Designation beliebigst abzufordern, öffentlich verkauft werden sollen. Hamburg, gedruckt bey Christian Simon Schröders Wittwe. Hamburg, Anno 1778. Kommentar: In dieser Versteigerung der Hamburger Makler Schaumann und Wolters kam vermutlich eine Hamburger Privatsammlung zum Verkauf, deren Besitzer zuvor verstorben war. In dem Katalog wurden 108 Losnummern mit 104 Gemälden sowie einige Kupferstiche und Kleinskulpturen angeboten. Bei den Losen 33 und 35 bis 37 handelt es sich um Wasserfarben bzw. Aquarelle. Am Ende des Katalogs wird vermerkt, daß noch weitere Gemälde und Kupferstiche "untern Verfolg von Nummern verkauft werden sollen". Alle Beschreibungen sind kurz gehalten, Maß- und Materialangaben fehlen. Oftmals werden Wertungen vorgenommen, beispielsweise "so schön wie Schneiers" (Nr. 71). Die Sammlung besteht aus Gemälden der holländischen und einigen Gemälden der flämischen Schule. Unter den 18 deutschen Werken überwiegen Arbeiten Hamburger Maler wie beispielsweise Johann Georg Stuhr und Otto Wagenfeldt. Anonym bleiben 22 Gemälde. Mitunter finden sich Angaben wie "alte niederländische Mahlerey" oder "Niederländische Mahlerey". Die größte Aufmerksamkeit im Katalog erfährt ein Galeriebild von einem unbekannten Meister, auf dem "derer größesten Italiener, und Niederländischen Meistern" zu erkennen seien (Nr. 59).
107 1778/04/11 Michael Bostelmann; Hamburg, Börsen=Saal
Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog wird ein gesamter Hausstand zum Verkauf angeboten. Die Auktion fand im Hause des Eigentümers in der Wolfenbütteler Herzogstraße statt. Nach den Notizen des annotierten und in eine Akte eingebundenen Exemplars NSAW (Signatur 34 N, Nr. 3113) handelt es sich um den Besitz des Obrist-Lieutenants Karl Gustav von Redecken (1719-1796), der seinen Hausstand wegen seinem "Abzüge von hier" versteigern ließ. In der Regel durften Auktionen nur nach dem Tode des Besitzers durchgeführt werden. Da Redecken jedoch verpflichtet wurde, seine Pensionszeit außerhalb Braunschweigs zu verbringen, wurde die Versteigerung seines Besitzstandes gestattet. Neben Hausratsgegenständen und Büchern wurden in dem Abschnitt "Schildereyen und Kupferstiche" 39 Lose aufgeführt, von denen etwas weniger als die Hälfte als Gemälde identifiziert werden können (Seiten 35 und 36). Es handelt sich ausschließlich um anonyme Werke, darunter Portraits europäischer Herrscher und des Landesherm Herzog Friedrich Ulrich von Braunschweig. Nach den Angaben des annotierten Exemplars NASW wurden alle Bilder zu niedrigen Preisen zwischen zwei und acht Silbergroschen verkauft. Vermutlich gingen jedoch einige Bilder zurück, so die mit "ego" gekennzeichnete Nr. 28, ein Portrait Martin Luthers, und vermutlich auch die von dem Advokaten Wäterling ersteigerten Bilder, der nach den Angaben des annotierten Exemplars die Interessen Redeckens vertrat. Lit.: NSAW, Personalkartei der braunschweigischen Offiziere vor 1806 (Signatur 35 Slg), Bl. 173.
106 1778/03/28 Schaumann; Hamburg, Börsen=Saale Verkäufer nach Titelblatt: Eine gewisse Verlassenschaft Lose mit Gemälden: 104 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Catalogue einer auserlesenen Sammlung der schönsten Holländischen, Niederländischen und Italienischen Cabinet=Mahlereyen, wie auch gefaßte Kupferstiche mit Glas und Rahmen, und ei92
KATALOGE
Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 74 Standorte: *KH Annotiert in der Abteilung der Gemälde mit den meisten Käufernamen und den meisten Preisen. Titelblatt: Catalogue einer auserlesenen Sammlung der besten Italienischen Cabinet=Mahlereyen, imgleichen eine dito Collection seltener, nach den größesten Meistern verfertigten Kupferstiche, mithin eine große Collection Special=Prospecte, Land= und See=Charten, auch andere Sachen mehr, welche am Sonnabend, den 1 lten April a.c. Vormittags um 10 Uhr, auf dem hiesigen Börsen=Saal öffentlich an die Meistbietenden verkauft werden sollen durch den Mackler Michael Bostelmann, bey welchem dieses Verzeichniß beliebig abzufordern. Auch können obbenannte Kunst=Sachen am Tage vorher gefälligst besehen werden. Hamburg, gedruckt bey Heinrich Christian Grund. Hamburg, Anno 1778. Kommentar: Dieser Versteigerungskatalog des Hamburger Maklers Michael Bostelmann verzeichnet 72 Gemälde. Außerdem werden je zwei Zeichnungen von Rembrandt (Nm. 73 und 74) und Piazzetta (Nrn. 75 und 76), eine Sammlung von Kupferstichkonvoluten (Nm. 77 bis 94), "Risse, Plane und Special-Charten" (Nrn. 95 bis 117) und drei Portraitbüsten des Grafen von Schulenburg aus Gips (Nrn. 118 bis 121) aufgeführt. Die drei Büsten sowie zwei weitere Bildnisse des Feldmarschalls von Schulenburg von Domenichino (Nr. 8) und Nazario Nazari (Nr. 19) lassen den Schluß zu, daß die fast ausschließlich der italienischen Schule zugehörigen Gemälde aus der bedeutenden Sammlung des General-Feldmarschalls Johann Matthias von der Schulenburg (1661-1747) stammen. Neben einigen Gemälden aus dem 16. Jahrhundert handelt es sich bei den meisten Gemälden um Werke des 17. und 18. Jahrhunderts (Luca Giordano, Antonio Zanchi, Giovanni Battista Piazzetta, Francesco Simonini, Francesco Solimena oder Giovanni Battista Pittoni). Im Dienste der Republik Venedig stehend, hatte sich Schulenburg durch die Verteidigung der Insel Korfu gegen die türkischen Truppen 1715/1716 hohe militärische Ehren erworben. Unter der Num-
mer 107 im Katalog werden zwei Exemplare des Plan du Siege de Corfu, avec la Situation de deux Flottes Venetiennes verzeichnet. Die Studien von Alice Binion zeigen, daß Schulenburg 1724 in Venedig begonnen hatte, Gemälde zu erwerben. Bis kurz vor seinem Tode wuchs die Sammlung auf über 900 Gemälde an. Zu seinen Beratern gehörten die Maler Pittoni und Piazzetta. Noch zu Lebzeiten plante Schulenburg, die Sammlung nach Berlin zu überführen und sie in seinem Stadtpalais zur Aufstellung zu bringen. Tatsächlich gelangten die Gemälde von 1735 an in mehreren Transporten nach Deutschland. Ein um 1750 in Berlin gedruckter Katalog erfaßt die gesamte Sammlung, die in den Besitz von Adolph Friedrich, einem Neffen Schulenburgs, übergegangen war. Seit den 60er Jahren wurden Gemälde aus der Sammlung verkauft, u.a. an den König von Preußen. Am 12. und 13. April 1775 gelangten 130 Gemälde in London bei Christie's zur Versteigerung (Lugt 2395). Im Katalog dieser Versteigerung finden sich bereits die Findung Mosis von Luca Giordano (Nr. 10) sowie ein Portrait des General-Feldmarschalls von Schulenburg von Nazario Nazari (Nr. 19). Der größte Teil der nicht veräußerten Gemälde Schulenburgs wurde in Berlin und in Hehlen aufgestellt. Die einzelnen Einträge des Katalogs sind sehr kurz gehalten und enthalten keine Angaben zu den Materialien oder Maßen. Ein verhältnismäßig großer Teil der Gemälde, insgesamt 34 Werke, bleiben ohne Angabe eines Künstlernamens. Neben den italienischen Arbeiten wurden noch zwei Bilder von Pieter Jansz. Quast und eine Kreuztragung Christi nach Anthonie van Dyck angeboten. Das Exemplar KH enthält handschriftliche Angaben zu den Käufern und zu den erzielten Preisen. Den höchsten Preis erzielte eine "im Gusto von Piacetto" gemalte Darstellung zweier Jäger mit einem Hunde (Nr. 7) für 57 Mark, gefolgt von einem Hl. Rochus von Piazzetta (Nr. 13) für 46 Mark. Unter den Käufern befanden sich vor allem Kunsthändler wie Johann Benjamin Ehrenreich, Johann Jobst Eckardt und Johann Dietrich Lilly Senior. Insgesamt 21 Gemälde erwarb der Hamburger Domherr und Kunstsammler Heinrich Wilhelm Hasperg. Lit.: Alice Binion, From Schulenburg's Gallery and Records, in: The Burlington Magazine 112 (1970), S. 297-303; Alice Binion, Von Venedig gen Norden: Schulenburgs unstete Galerie, in: Ausst.Kat. Hannover 1991, S. 16-22.
108 1778/05/16 Michael Bostelmann; Hamburg, Börsen=Saal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 116 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Catalogue einer schönen Sammlung der besten Italienischen, Französischen und Niederländischen Cabinet=Mahlereyen, welche am Sonnabend, den löten May a. c. auf dem hiesigen Börsen=Saal öffentlich an die Meistbietenden verkauft werden sollen durch den Mackler Michael Bostelmann, bey welchem dieses Verzeichniß beliebig abzufordern. Auch können obbenannte Gemähide den Tag vorher gefälligst besehen werden. Hamburg, gedruckt bey Heinrich Christian Grund. Hamburg, 1778. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog werden 116 Lose aufgeführt. Am Schluß der Liste heißt es: "Auch sollen in der Continuation von Gemählden einige schöne Stücke von Raphael Mencks zum Verkauf kommen." Nach der Losnummer 24 findet sich die Erläuterung: "Diese Stücke (Nrn. 1 bis 24) sind alle gut gefaßt, theils schwarze Rähmen mit goldenen Leisten, theils goldene Rähmen; auch ist die Höhe und Breite ohne Rahmen gemessen." Es handelt sich bei diesem Verzeichnis um den ersten Hamburger Katalog, auf dessen Titelblatt neben Gemälden der niederländischen und italienischen Schule auch Gemälde der französischen Schule angeführt
werden. Der Katalog verzeichnet fünf Gemälde französischer Maler: eine Landschaft von Claude Lorrain (Nr. 61), eine Allegorie von Benoit Coffre (Nr. 98), eine Maria Magdalena von Charles Le Brun (Nr. 68), ein Kopfbild von Mignard (Nr. 30), eine Mariendarstellung mit Christus und Johannes (Nr. 47) sowie eine Allegorie der Poesie von Jean Baptiste Vanloo (Nr. 59). Den größten Anteil unter den 116 verzeichneten Gemälden haben die Gemälde der holländischen Schule mit 36 Werken, gefolgt von Werken flämischer, italienischer und deutscher Künstler. Außerdem sind zwei Gemälde spanischer Maler, Juseppe de Ribera und Francisco Preciado de la Vega, aufgeführt (Nrn. 50 und 66). Insgesamt 17 Gemälde bleiben anonym. In der Sammlung befanden sich sechs kleine Landschaften von Jan Savery (Nrn. 102 bis 105, 109 bis 110), sowie - zu Beginn des Katalogs unter den Nummern 1 bis 4 aufgeführt - vier Historiengemälde mit religiösen Sujets des Hamburger Malers Hans Hinrich Rundt.
109 1778/05/21 Hinrich Jürgen Köster; Hamburg, Börsensaal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 70 Standorte: ICH Nicht annotiert. Titelblatt: Catalogue einer Sammlung Niederländischer und Deutscher Cabinet=Mahlerey, imgleichen einige gefaßte und ungefaßte Kupferstiche, welche Donnerstage, den 21. May a. c. auf dem hiesigen Börsensaal öffentlich an die Meistbietende durch dem Auctionario Hinrich Jürgen Köster verkauft werden sollen. Gedruckt bey David Christoph Eckermann. Hamburg, 1778. Kommentar: Dieser Versteigerungskatalog des Hamburger Auktionators Hinrich Jürgen Köster umfaßt 70 Einträge. Wahrscheinlich wurden noch mehr Bilder verkauft, denn am Ende des Katalogs wird vermerkt: "Nebst in Verfolg der Nummern noch einige andere mehr; imgleichen gefaßte und ungefaßte Kupferstiche." Nahezu die Hälfte der Gemälde ist ohne Angabe eines Künstlernamens verzeichnet, bei bekannteren Namen wie Rembrandt, Godfried Schalcken oder Jacob Willemsz. de Wet finden sich Zusätze wie "Kopie nach" oder "Schule". Einzig die Gemälde der deutschen Maler sind ohne weitere Einschränkungen verzeichnet. Insgesamt 25 Gemälde bleiben anonym. Es handelt sich vermutlich um eine kleine bürgerliche Sammlung aus Hamburg, da unter den deutschen Gemälden vor allem Werke von Hamburger Künstlern wie Balthasar Denner, Ottmar Eiliger und Jacob Weyer vertreten sind.
110 1778/05/23 Köster; Hamburg, Börsen=Saale Verkäufer nach Titelblatt: Ein alter Kenner Lose mit Gemälden: 89 Standorte: *KH Annotiert mit einigen Preisen; wahrscheinlich handelt es sich um Limitpreise. Titelblatt: Catalogue einer sehr auserlesenen Sammlung von Italienischen, Französischen und Niederländischen Cabinet=Mahlereyen, so von einem alten Kenner seit vielen Jahren mit Mühe und Fleiß gesammelt worden; welche, nebst einigen zur Kunst gehörigen Büchern, an den Meistbietenden auf dem hiesigen Börsen=Saale den 23ten May durch den Auctionarium Köster öffentlich verkauft werden sollen. Gedruckt bey Johann Jacob Sülau. Hamburg, Ao 1778. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog des Hamburger Auktionators Hinrich Jürgen Köster wurden 90 Gemälde aus der Sammlung eines Privatsammlers angeboten. Die Versteigerung fand im Börsensaal statt. Im Anschluß wurde Kunstliteratur verkauft. DarunKATALOGE
93
ter findet sich beispielsweise die "Teutsche Academie" Joachim von Sandrarts (2 Bde. 1675, 1679) sowie Kunstliteratur des 18. Jahrhunderts (Arnold Houbraken, De groote Schouburgh, Johann van Gool, De nieuwe Schouburgh u.a.). Die Gemälde sind im Katalog kurz beschrieben, der Künstlername und die Maßangaben in tabellarischer Form beigefügt. Auch das Material wird genannt. In der Sammlung überwiegen Werke der holländischen Schule von Abraham Bloemaert bis Jacob Willemsz. de Wet, gefolgt von Gemälden der flämischen, italienischen und deutschen Schule sowie fünf Gemälden der französischen Schule, darunter drei Nicolas Poussin zugeschriebene Gemälde. Das Exemplar KH des Katalogs ist teilweise annotiert. Da es sich bei den Preisen durchgehend um runde Beträge handelt, ist anzunehmen, daß sie die Höchstpreise bezeichnen, die der Besitzer des Katalogs zu zahlen bereit war. Die höchste Wertschätzung erfuhr ein Bildnis des Bischofs von Malines von Abraham Janssens (Nr. 90), für das dieser Besitzer bis zu 125 Mark bezahlt hätte. Für Rembrandts Jacobs Segen (Nr. 2) ist nach den Annotationen die Summe von 120 Mark veranschlagt worden.
111 1778/05/30 Hr. Köster; Hamburg, Börsen=Saal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Verkäufer nach anderer Quelle: Dr. Friederici Verkäufer: Friederici, Dr. Lose mit Gemälden: 150 Standorte: *KH Annotiert mit allen Käufemamen und Preisen. Titelblatt: Catalogus eines Nachlasses auserlesener Cabinet=Mahlereyen, Kupferstiche unter Glas und Rahm, desgleichen auf Glas gemahlte und mit Rahmen garnirte wie auch eines der schönsten Microscop, von dem berühmten T. G. Hoffmann aus Leipzig, wobey einige Mathematische Stücke, Barometer und Thermometer, welche den 30sten May auf dem Börsen=Saal an den Meistbietenden durch den Auctionarium Hrn. Köster verkauft werden sollen. Gedruckt bey Dietrich Anton Harmsen. Kommentar: Auf dem Titelblatt dieses Versteigerungskatalogs des Hamburger Auktionators Hinrich Jürgen Köster sind die Jahreszahl "1778" sowie der Name "von Dr. Friederici" handschriftlich hinzugefügt. Bei Friederici handelt es sich wohl um den Sammler, denn in einem Vorwort zum Katalog heißt es (S. 2) ι "Dieser Nachlaß — hätte wohl einer der größten werden können. Wann S... H. W. G. der selige Herr Doctor F... uns nicht so geschwind wäre entrissen worden, welcher die wahre Einsicht der Kenntnisse, in allen Wissenschafts= Fächer, (ohne der Natur=Kunde zu gedenken) vollkommen inne gehabt. Dabey auch selbsten die so wenig abgemessene Stunden, zum Fleiß, dieser und anderen Wissenschaften, werkthätig ausgeführet, daß ein mancher Künstler beym Anblick derselben beschämt werden müssen." Am Ende des Katalogs wird vermerkt: "Diese Gemähide sind alle mittlere Grösse, können also an alle Plätze gebraucht werden - dieweilen keine Theilen=Stück, dabey befindlich." Die zur Versteigerung gelangte Sammlung umfaßt 150 Gemälde sowie auf "Glas gemalte Englische, und in Rahmen gefaßte Stücke". In der nach den Angaben des Titelblatts nicht weiter spezifizierten Sammlung überwiegen mit 33 Arbeiten die Gemälde der holländischen Schule. Unter den 29 deutschen Werken finden sich vor allem Werke des 18. Jahrhunderts, darunter zahlreiche Gemälde Hamburger Künstler wie Johann Georg Stuhr, Otto Wagenfeldt und Jacob Weyer, jedoch auch fünf Arbeiten der Dresdener Landschaftsmaler Christian Wilhelm Ernst Dietrich und Johann Christian Klengel. Ein Großteil der Einträge (insgesamt 68) bleibt jedoch ohne Angabe eines Künstlernamens. Einen Schwerpunkt der Sammlung bilden Darstellungen arkadischer Landschaften mit oder ohne genrehafter oder religiöser Staffage.
Nach den Angaben des annotierten Exemplars KH blieben die erzielten Preise auf niedrigem Niveau, meist zwischen 5 und 20 Mark. Auffällig ist, daß mit einer Ausnahme kein Zuschlag die Schwelle von 20 Mark überschritt. Nur ein Winterstück von Klaes Molenaer (Nr. 17) wurde bei 60 Mark zugeschlagen. Unter den Käufern trat erstmals der Kunsthändler Francois Didier Bertheau auf, der 13 Gemälde ersteigerte. Mit insgesamt 61 Zuschlägen kaufte Johann Benjamin Ehrenreich nahezu die Hälfte der Sammlung auf. Ansonsten finden sich noch der Kunsthändler P. Sieberg sowie die Sammler Gaje, Greve und Johann Loffhagen unter den Käufern. 112 1778/06/02 [Anonym]; Hamburg? Verkäufer nach Titelblatt: Keine Standorte: SBH Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Kommentar: Dieser anonyme Auktionskatalog ist nur bibliographisch nachweisbar (Realkatalog der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg KD III., Hanseatica Hamburgensia IV, S. 74); Holst 1939, S. 271, führt ihn ebenfalls in seiner Liste. Über den Umfang der Sammlung und den Besitzer liegen keine Informationen vor; nach den Angaben des Realkatalogs enthielt der Katalog Gemälde und Kuriositäten. 113 1778/07/11 Peter Texier; Hamburg, Börsensaale Verkäufer nach Titelblatt: Ein bekannter Liebhaber Lose mit Gemälden: 90 Standorte: *KH Annotiert mit einigen wenigen Preisen. Titelblatt: Catalogus einer schönen Sammlung Italienischer und Niederländischer Cabinet=Mahlereyen so durch einen bekannten Liebhaber mit Fleiß gesammlet am Sonnabend, den 11 Juli, a.c. auf dem hiesigen Börsensaale öffentlich an die Meistbietende verkauft werden sollen durch den Maakler Peter Texier, bey welchem diese Designation beliebig abzufordern ist. Gedruckt bey Dietrich Anton Harmsen. Hamburg, Anno 1778. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog des Hamburger Maklers Peter Texier findet sich kein Hinweis auf den Besitzer der Sammlung, die insgesamt 90 Gemälde umfaßt. Am Ende des Katalogs wird darauf hingewiesen, daß weitere Gemälde, "so allhier nicht specificirt sind", zum Verkauf angeboten werden sollen. Alle Eintragungen sind sehr knapp in einen Satz gefaßt, es fehlen Material- und Maßangaben. Mit 30 Arbeiten machen die Gemälde der holländischen Schule den größten Teil der Sammlung aus; hingegen finden sich entgegen der Ankündigung auf dem Titelblatt nur vier Gemälde der italienischen Schule verzeichnet. Dabei handelt es sich um zwei Land- und Wasserprospekte "in dem Gusto von Canaletto" (Nrn. 1 und 2) sowie zwei anonym verzeichnete Fruchtstücke der italienischen Schule. Zu den Besonderheiten der Sammlung zählen acht Gemälde von Cornells Schut, sechs religiöse Historien sowie Darstellungen des Hl. Johannes und des Hl. Hieronymus (Nrn. 3 bis 8, 37 und 38). Im Exemplar KH finden sich bei neun Gemälden Preisangaben. Vermutlich handelt es sich um Preise, die der Annotator jeweils zu zahlen bereit war, denn es kommen nur runde Beträge vor. Bei zwei Bildern von Schut (Wie Moses die Schlange erhöhet und Wie derselbe das Wasser aus dem Felsen hervorgehen lässet; Nrn. 3 und 4) ist als Preislimit 30 Mark notiert.
114 1778/07/21 Caspar Hintz; Hamburg, Börsen=Saal Verkäufer nach Titelblatt: Keine
94
KATALOGE
Lose mit Gemälden: 91 Standorte: *KH Annotiert mit einigen wenigen Käufernamen und einigen Preisen. Titelblatt: Catalogue einer vortrefflichen Sammlung Cabinet=Mahlereyen und Kupferstiche, so unter Glas und Rahmen, nebst einigen losen Kupferstichen; so durch das hochlöbliche Zehnten=Amt an den Meistbietenden auf dem Börsen=Saal den 21. July 1778. von dem Mackler Caspar Hintz verkaufet werden sollen. Diese Sammlung ist, wie gewöhnlich, einen Tag vorhero zu besehen, und die Catalogi gratis zu haben: bey der Wittwe Tramburg, neben dem güldenen ABC, wie auch bey dem Mackler Caspar Hintz. Hamburg, gedruckt bey Nicolaus Conrad Wörmer. Kommentar: In diesem Katalog des Hamburger Maklers Caspar Hintz werden 90 Losnummern mit Gemälden verzeichnet. Die Losnummer 88 wurde im Katalog vergessen und ohne weitere Angaben in dem annotierten Exemplar KH nachgetragen. Ein weiteres Los ist am Ende handschriftlich ergänzt. Alle Beschreibungen sind kurz gehalten und oft mit ästhetischen Wertungen verbunden. Bei den meisten Bildern werden die Maße angegeben. Insgesamt 13 Gemälde bleiben anonym. Es überwiegen die Arbeiten holländischer und flämischer Künstler des 17. und 18. Jahrhunderts mit insgesamt 39 Werken, darunter allein drei Bilder von Leonard Bramer (Nrn. 32, 53 und 54). Unter den 23 deutschen Werken sind, wie bei den meisten Hamburger Sammlungen, die lokalen Künstler gut vertreten. Es lassen sich allein vier Arbeiten von Johann Georg Stuhr zählen. In dem teilweise annotierten Exemplar KH des Katalogs sind zu insgesamt 47 Gemälden die Preise und zum Teil auch die Käufer genannt. Da es sich bei diesen Preisen fast ausschließlich um runde Summen handelt, ist zu vermuten, daß hier Preise genannt werden, die der Annotator höchstens bereit war zu zahlen. Sie liegen, außer bei einer Winterlandschaft von Jan Brueghel d.Ä. (Nr. 60), die für 30 Mark verkauft wurde, unter 20 Mark. Wahrscheinlich wurde nur bei den Losen ein Käufer vermerkt, wo der Annotator nicht selbst zum Zuge gekommen war. Bei den Losen mit Käufernamen finden sich zudem teilweise zwei Preisangaben, beispielsweise das Limit von 9 Mark für die zwei Genreszenen von Fargue (Nrn. 57 und 58) und der letztendlich erzielte Preis, in diesem Fall 10 Mark. Insgesamt acht Bilder gingen an den Kunsthändler Francois Didier Bertheau, drei an den Auktionator Hinrich Jürgen Köster.
115 1778/08/29 Peter Texier; Hamburg, Börsensaale Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 100 Standorte: *KH Annotiert in Bleistift mit einigen wenigen Preisen; wahrscheinlich handelt es sich um Limitpreise. Titelblatt: Verzeichnis eines mühsam gesammleten Gemählde=Cabinets, welches am 29. August 1778 auf dem hiesigen Börsensaale durch den Maakler Peter Texier verkauft werden soll. Hamburg, gedruckt bey Dietrich Anton Harmsen. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog des Hamburger Maklers Peter Texier wurden 75 Losnummern mit Gemälden angeboten. In einem Anhang ("Appendix einiger Original=Gemählde") werden die Nummern 76 bis 100 aufgeführt. Trotz der durchgehenden Numerierung der Einträge ist zu vermuten, daß es sich bei dem veräußerten Gemäldekabinett um die ersten 75 Einträge handelt. Eine "Nachricht" zu Beginn des Katalogs informiert über den Zustand der Gemälde, die "weder repariret, noch aufgeputzet, oder mit Firnisse verdorben; sondern so, wie sie von den Pinsel des Mahlers gekommen, conserviret" seien. Die Gemälde waren zum Teil mit goldenen, zum Teil mit schwarzen Rahmen mit goldenen Leisten verse-
hen. Die verauktionierte Sammlung wird in einer Vorbemerkung wie folgt beschrieben: "Obgleich diese Sammlung nur klein ist, so kann sie doch für eine ausgesuchte Collection, die selten vorkommt, gehalten werden." Die meisten Einträge sind kurz gehalten, oft mit ästhetischen Wertungen versehen und durch Maßangaben in tabellarischer Form ergänzt. Ein Selbstbildnis von Frans van der Myn wird folgendermaßen charakterisiert: "so fleißig wie Mieris, von ihm selbst gemahlt" (Nr. 20). Zu einem Stilleben Jan Davidsz. de Heem heißt es: "alles sehr natürlich" (Nr. 57). Zwei Gemälde von Adriaen Pietersz. van de Venne werden durch folgenden Hinweis hervorgehoben: "überhaupt Bilder, die den besten Platz in einer Gallerie verdienen" (Nrn. 18 und 19). Ein Historienbild von Michelangelo, Der Jacob segnende Abraham wird als "Ein gar seltenes Stück dieses Meisters, welches mit Recht den ersten Platz in ein vorzügliches Cabinet verdienet" angepriesen (Nr. 54). Bei drei Einträgen wird ein Vorbesitzer genannt. So stammt ein Gemälde von Bartholomaeus Spranger aus der Brühischen Galerie (Nr. 13), und ein Theodor van Thulden zugeschriebenes Gemälde war zusammen mit einen Jagdstück von Weenix (Nr. 33) ehemals in der "Schildenschen Sammlung" in Hannover. Unter den Gemälden befinden sich insgesamt 79 Werke der holländischen und flämischen Schule, darunter Gemälde von Rembrandt (Nrn. 4 und 44) und Ferdinand Bol (Nr. 23). Die deutsche Schule ist mit 14 Werken vertreten, darunter drei Portraits und ein Blumenstück des Portraitisten Balthasar Denner. Die französische Schule wird repräsentiert durch eine Landschaft von Claude Lorrain (Nr. 1) und eine Darstellung des Englischen Grußes von Simon Vouet (Nr. 88). Schließlich listet der Katalog noch sieben Arbeiten der italienischen Schulen auf. Anonym bleiben nur drei Gemälde. Der Anhang verzeichnet wieder Gemälde verschiedener Schulen. Die Form der Einträge unterscheidet sich in ihrer Kürze von denen des Hauptkatalogs. Eine Skizze von Anthonie van Dyck (Nr. 66) wird als Vorlage zu einem Gemälde des Künstlers beschrieben, das von Lord Bolingbroke ("Bullingbrock") für 24.000 Rthr erworben worden, jedoch auf seinem Transport auf See verloren gegangen sei. Bei einigen wenigen Einträgen des annotierten Exemplars KH finden sich Preisangaben. Es handelt sich vermutlich um die Summen, die der Annotator jeweils höchstens bieten wollte.
116 1778/09/28
und folgende Tage
[Lugt 2892]
[Anonym]; Frankfurt am Main, Senkenbergischen Stiftung hinter der sogenannten schlimmen Mauer Verkäufer nach Titelblatt: Georg Wilhelm Bögnerische Erben Verkäufer: Bögner, Georg Wilhelm Lose mit Gemälden: 857 Standorte: *SBF II Annotiert mit allen Käufernamen und Preisen auf eingebundenen Leerseiten. Aus dem Besitz von Johann Valentin Prehn (deutsche Ausgabe). SBF III Annotiert mit rotem Farbstift mit allen Käufernamen und Preisen auf eingebundenen Leerseiten. Die Annotationen sind schwer zu lesen. Aus dem Besitz von Johann Valentin Prehn (deutsche Ausgabe). SBF I Annotiert mit allen Preisen. Das Titelblatt ist beschädigt (deutsche Ausgabe). BPG Nicht annotiert. Aus dem Besitz von J.B.P. Lebrun (französische Ausgabe). BNP Nicht annotiert (französische Ausgabe). EBNP Nicht annotiert (französische Ausgabe). FLNY Nicht annotiert (französische Ausgabe). IFP Nicht annotiert (französische Ausgabe). LBDa Nicht annotiert (deutsche Ausgabe). SBBa Nicht annotiert. Aus dem Besitz von Joseph Heller (deutsche Ausgabe). SIF Nicht annotiert. KATALOGE
95
Titelblatt: Verzeichniß von Gemälden der besten und berühmtesten Italiänischen, Französischen, Deutschen und Niederländischen Meister, welche die Georg Wilhelm Bögnerische Erben zu Frankfurt am Mayn durch öffentliche Versteigerung an den Meistbietenden zu überlassen gesonnen sind. Frankfurt am Mayn, 1778. Catalogue de tableaux des meilleurs maitres Italiens, frangois, allemands et flamands, recueillis par feu Mr. George Guillaume Bögner ä Francfort sur le Mein et qui y seront mis en vente au plus offrant par les heritiers du defunt. Francfort sur le Mein, 1778. Kommentar: Die umfangreiche Sammlung des Weinhändlers Georg Wilhelm Bögner (gest. 1778) wurde 1778 von den Erben des Sammlers verkauft. Bögner stammte aus Bischofsheim und erwarb 1742 das Frankfurter Bürgerrecht. Als Frankenweinhändler lebte Bögner in einem Haus in der alten Mainzergasse 34. Der Kunstschriftsteller Heinrich Sebastian Hüsgen überliefert, daß Bögner mehr als 40 Jahre Gemälde gesammelt habe, jedoch habe er "aber die Marotte gehabt, sie schichtenweise umgekehrt an die Wände zu stellen und sobald ein Zimmer angefüllt war, es für immer zu verschließen. Kein Kunstfreund, ja nicht einmal seine Kinder konnten sich rühmen, ein Stück dieser Sammlung gesehen zu haben. Erst nach dem Tode dieses wunderlichen Liebhabers öffnete sich die Schatzkammer" (Hüsgen, Verr. Briefe 1776/83, Teil 2, S. 17). Da die umfangreiche Sammlung niemals zugänglich gewesen war, lockte die Versteigerung besonders viele Interessenten an. Nach einem handschriftlichen Eintrag auf dem Titelblatt der französischen Ausgabe sollte die Auktion am 28. September beginnen, "in oder gleich nach geendigter Frankfurter Herbstmesse", wie die Vorbemerkung erläutert. Zweimal wöchentlich, Dienstag und Freitag Nachmittag zwischen 2 und 5 Uhr, konnten die Bilder zuvor besichtigt werden. Dem Katalogteil vorangestellt ist eine alphabetische Zusammenstellung der Künstlernamen (S. III-VIII), die allerdings keine Verweise auf die betreffenden Losnummern enthält. In der Vorbemerkung heißt es: "In unsern Gegenden wird nie oder wenigstens sehr selten eine so ausgesuchte und zahlreiche Sammlung von Gemälden zum Verkauf aufgestellet worden seyn. Man urtheile nach folgenden Namen der in diesem Verzeichnisse enthaltenen Meister." Die Beschreibungen des Katalogs sind kurz gehalten und beschränken sich meist auf einen Satz, in dem auch der Künstlername und die Maße angegeben werden. Der Verkauf der 873 Lose erbrachte nach den Angaben des annotierten Exemplars SBF II die hohe Summe von insgesamt 28.015 Gulden. Es handelt sich fast ausschließlich um Gemälde, nur vereinzelt tauchen zwischen den Gemälden graphische Blätter auf. Nicht ausgewertet wurden hier die Losnummern 32 und 677 (mit Seiden gestickt oder genäht), Nummer 73 und 74 (gemalte spanische Wand von Seekatz) sowie die Lose 238, 239, 316, 159, 303, 397, 398,405, 710, 790 bis 792 und 798. Die Sammlung setzte sich zum größten Teil aus Gemälden der holländischen und flämischen Schule des 17. und 18. Jahrhunderts zusammen, darunter eine große Sammlung von Früchte-Stilleben (Jan Davidsz. de Heem, Jacob Marrel, Rachel Ruysch). Unter den 186 flämischen Werken sind Arbeiten von Jan Fyt, Peter Paul Rubens und David Teniers d.J. besonders gut vertreten. Interessant ist eine Gemeinschaftsarbeit von Lucas van Uden, Hendrik Baien und Frans Snyders (Diana mit den Nymphen·, Nr. 673). Bei den 61 italienischen Gemälden werden 27 Bilder nur als italienische Schule bezeichnet. Von den 171 deutschen Werken sind vor allem die Frankfurter Künstler des 18. Jahrhundert gut vertreten, etwa Justus Juncker, Franz Lippold, Christian Georg Schütz sowie der Darmstädter Johann Conrad Seekatz. Gut repräsentiert sind auch die altdeutschen Werke, so werden fünf Gemälde Albrecht Dürer und neun Hans Holbein d.J. zugeschrieben. Anonym bleiben 127 Gemälde. Unter den Nummern 817 bis 862 ist eine Serie von Portraits des österreichischen Kaiserhauses und anderer Fürstenhöfe verzeichnet. Nach den Angaben des annotierten Katalogs SBF II bewegten sich die Preise auf teilweise recht hohem Niveau. Georg Joseph Göntgen zahlte beispielsweise für zwei biblische Landschaften von Johann Heinrich Roos 508 Gulden und 50 Kreuzer (Nrn. 147 und 96
KATALOGE
148). Die Durchschnittspreise bewegten sich zwischen 10 bis 100 Gulden. Unter 10 Gulden blieben meist nur unbezeichnete Werke. Unter den Käufern finden sich nahezu alle Frankfurter Kunsthändler und Sammler, die teilweise zahlreiche Bilder ersteigerten. So wurden Johann Andreas Benjamin Nothnagel 49 Gemälde zugeschlagen, Heinrich Sebastian Hüsgen übernahm 54 Bilder. Erstmals trat auf einer Frankfurter Auktion die Prinzessin Henriette Amalie von Anhalt-Dessau auf. Sie übernahm gleich 93 Bilder. Diese Gemälde gingen 1907 als Teil der Amalienstiftung in den Besitz der Anhaltischen Gemäldegalerie Dessau über. Auch Johann Noe Gogel erwarb auf dieser Auktion erstmals im großen Stil Gemälde, sein Name findet sich als Käufer bei mehr als 50 Losen. Dem Kanonikus Heinrich Joseph Burger wurden mehr als 30 Bilder zugeschlagen. Lit.: Hüsgen, Verr. Briefe 1776/86, Teil II, 1783, S. 17; Hüsgen, Art. Magazin 1790, S. XV, S. 253; Gwinner 1 1862, S. 533; Dietz 1910/25, Bd. 4.II, S. 533f.; Holst 1931, S. 54-57; Holst 1960, S. 162f.; Schmidt 1960, o.P.; Wilhelm 1990, S. 45f.
117 1778/10/09
und folgende Tage
[Anonym]; Hannover, In dem von Wallmodenschen Hause auf der Köbelinger Strasse Verkäufer nach Titelblatt: Keine Verkäufer nach anderer Quelle: Von Wallmoden Verkäufer: Wallmoden, Franz Ernst von Lose mit Gemälden: 174 Standorte: SUBG Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß der Kupferstiche, auch Gemähide in Wasser=Farben und in Pastel, auch anderer Kunst=Sachen, welche am 9ten Octobr. und folgenden Tagen des gegenwärtigen Jahrs 1778 in dem von Wallmodenschen Hause auf der Köbelinger Strasse in Hannover, in öffentlicher Auction verkauft werden sollen. Hannover, gedruckt bei Η. E. C. Schlüter. Kommentar: In diesem umfangreichen Katalog der Sammlung des Kammerherrn Franz Ernst von Wallmoden (1728-1776) aus Hannover werden im "Cap. XII" insgesamt 173 Gemälde angeboten (S. 54 bis 56). Ein kleiner Teil der Sammlung wurde 1778 vermutlich vom Erben des Sammlers, seinem Halbbruder Johann Ludwig Graf von Wallmoden Gimborn (1736-1811) verkauft, der größere und bedeutendere Teil der Kollektion wurde erst 1818 (Lugt 9433) verauktioniert. Bei den 1778 versteigerten Gemälden handelt es sich ausschließlich um Portraits von Malern, die der bisher nicht identifizierte Künstler La Bonte "nach Original=Gemählden und Kupferstichen" kopiert hatte. Alle Bilder sind, wie in einer einführenden allgemeinen Bemerkung festgehalten wird, in Öl gemalt und von gleicher Größe (jeweils 1 Fuß und 1 Zoll hoch und 10 Zoll breit). Auf den Rahmen waren die Namen der jeweiligen Maler angebracht. Die Numerierung der Bilder beginnt mit der Nr. 346 und endet mit der Nr. 519. Unter den portraitierten Künstlern finden sich vor allem holländische, deutsche und einige französische Maler, jedoch - bis auf eine Ausnahme (Piazzetta; Nr. 472) - keine italienischen Meister. Lit.: Joachim Lampe, Aristokratie, Hofadel und Staatspatriziat in Kurhannover. Die Lebenskreise der höheren Beamten an den kurhannoverschen Zentral- und Hofbehörden 1714—1760, 2 Bde., Göttingen 1963, Bd. 1, S. 166, 188f„ 392.
118 1778/10/23 J.H. Köster; Hamburg, Im Sterbehause im alten Wandrahm bey der Pockenmühle Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 53
Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Catalogue einer auserlesenen Sammlung Cabinet=Mahlereyen, wie auch Kupfer=Stiche, unter Glas und Rahmen, welche in einem wohlbekannten Sterbhause im alten Wandrahm bey der Pokkenmühle, den 23sten Octobris h.a. an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden sollen, durch den Auctionarium J. H. Köster. Die Gemälde können wie gewöhnlich einen Tag vor der Verkaufung gesehen werden. Hamburg, gedruckt bey Nicolaus Conrad Wörmer. 1778. Kommentar: In diesem achtseitigen Versteigerungskatalog des Auktionators Hinrich Jürgen Köster werden 53 Losnummern mit Gemälden angeführt. Bei der Losnummer 54 handelt es sich um ein Pastell. Auf der letzten Seite sind zudem noch einige gerahmte Kuferstiche aufgelistet (Nrn. 55 bis 61). Alle Beschreibungen sind kurz gehalten und durch Materialangaben ergänzt. Als Ort der Auktion wird ein "wohlbekanntes Sterbhaus im alten Wandrahm bey der Pockenmühle" angegeben, der Name des Besitzers wird jedoch nicht genannt. Möglicherweise handelt es sich um einen Theologen, denn in der Sammlung befinden sich zwei Bildnisse des Pastors Neumeister (Nr. 34 sowie Nr. 54, ein Pastell); die Nr. 37 verzeichnet "des Pastor Ulbers Portrait". Unter den 53 Gemälden befinden sich überwiegend Landschaften und Historiengemälde mit religiösen Themen. Insgesamt sechs Gemälde bleiben anonym. Der holländischen und flämischen Schule sind 22 Bilder zuzurechnen, zu den deutschen Werken zählen 14 Arbeiten. Bei den deutschen Gemälden überwiegen Werke Hamburger Künstler wie Joachim Luhn, Matthias Scheits und Jacob Stockmann. 119 1778/10/30 J.H. Köster; Hamburg, Im Sterbehause auf dem Nicolai Kirchhofe Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 198 Standorte: *KH Annotiert mit einigen wenigen Preisen; wahrscheinlich handelt es sich um Limitpreise. Titelblatt: Catalogue einer auserlesenen Sammlung Cabinet=Mahlereyen, einiger Miniatur=Stücke, wie auch Kupfer=Stiche, unter Glas und Rahmen, welche in einem wohlbekannten Sterbhause auf dem Nicolai Kirchhofe, den 30sten Octobris h.a. an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden sollen, durch den Auctionarium J. H. Köster. Die Gemälde können wie gewöhnlich einen Tag vor der Verkaufung gesehen werden. Hamburg, gedruckt bey Nicolaus Conrad Wörmer. 1778. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog des Hamburger Auktionators Hinrich Jürgen Köster wurden insgesamt 198 Gemälden angeboten. Im Anhang sind außerdem Miniaturen (Nrn. 199 bis 206), "Gemähide in Wasserfarben" (Nm. 207 bis 214), "Illuminirte Englische schwarze Kunst=Stücke" (Nrn. 215 bis 226) sowie Kupferstiche (Nrn. 227 bis 255) aufgelistet. Die Auktion wurde im Wohnhaus eines anonymen Hamburger Sammlers am Nicolaikirchhof durchgeführt. Die Gemälde sind mitunter sehr ausführlich beschrieben und unterscheiden sich daher stark von den Einträgen in anderen Katalogen Kösters aus diesem Jahr (Kat. 109 und 110). Oftmals werden auch ästhetische Wertungen vorgenommen, Material und Maße sind angegeben. Anonym bleiben 17 Werke. Neben einer kleinen Sammlung von altdeutschen Gemälden (Heinrich Aldegrever, Albrecht Altdorfer, Lucas Cranach d.Ä., Albrecht Dürer, Hans Holbein d.Ä., Hans Holbein d.J.) befanden sich in dieser Kollektion auch mehrere niederländische Gemälde des 15. und 16. Jahrhunderts, darunter eine Mariendarstellung, vermutlich von Jan van Eyck (Nr. 76), fünf Gemälde von Frans Floris sowie eine Betende Maria mit Joseph von dem "Niederländischen Ra-
phael" (Nr. 87); vermutlich ist Michael Coxie gemeint, von dem nur ein einziges weiteres Gemälde im 18. Jahrhundert in Deutschland verauktioniert wurde (vgl. Kat. 182, Nr. 386, Elias mit einer Frau u. Kind). Ansonsten dominieren mit insgesamt 68 Werken die holländische und flämische Schule des 17. Jahrhunderts. Die deutsche Schule ist mit insgesamt 76 Arbeiten vertreten, darunter neben den altdeutschen Bildern vor allem Werke Hamburger Künstler. Hervorzuheben sind 21 Gemälde von Carl Timotheus Friedrich Kreutzfeld (1757-1791), der aus Hamburg stammte. Ein persönlicher Kontakt Kreutzfelds, der von 1776 bis 1784 als Fayencenmaler an der Manufaktur Stockelsdorf bei Lübeck tätig war, mit dem anonymen Sammler ist wahrscheinlich. Die meisten Gemälde Kreutzfelds sind, wie ein großer Anteil der übrigen Gemälde der Sammlung, sogenannte Gegenstücke (Pendants). Bei einzelnen Einträgen des annotierten Exemplars KH finden sich Preise, wobei es sich angesichts der runden Beträge vermutlich um die Preise handelt, die der Annotator höchstens für ein Werk zahlen wollte. Insgesamt sind 17 Lose mit Preisen ausgezeichnet, darunter befinden sich allein vier Werke von Lucas Cranach, von denen drei Bilder mit je 60 Mark sehr hoch angesetzt wurden (Nrn. 1, 2, 14 sowie 15 für 30 Mark). Lit.: Ulrich Pietsch, Stockelsdorfer Fayencen. Geschichte und Leistung einer holsteinischen Manufaktur im 18. Jahrhundert, Lübeck 1987.
120 1779/00/00
Daten unbekannt
[Anonym]; Hamburg? Verkäufer nach Titelblatt: Herr Schwalbe Verkäufer: Schwalb, August Gottfried Lose mit Gemälden: 356 Standorte: KH I Nicht annotiert (deutsche Ausgabe). KH II Nicht annotiert (französische Ausgabe). SBB Nicht annotiert (deutsche Ausgabe). SBBa Nicht annotiert. Aus dem Besitz von Joseph Heller (deutsche Ausgabe). Titelblatt: Verzeichniß der Gemälde, welche sich in der Sammlung des verstorbenen Herrn Schwalbe in Hamburg befinden, nebst beygefügter Nachricht von deren Inhalte. Leipzig, 1779. Catalogue des tableaux qui se trouvent dans la collection de feu Μ. Schwalb, a Hambourg. Avec une notice des sujets. A Leipzig, MDCCLXXX. Dem deutschen Exemplar der KH ist ein gedruckter Brief von Adam Friedrich Oeser an Christian Ludwig von Hagedorn (17131780) beigebunden: Schreiben an Herren von Hagedorn, Churfürstlich Sächsischen geheimen Legationsrath und Generaldirektor der Akademien der bildenden Künste. Leipzig, 1779. Kommentar: Dieses Verzeichnis der Sammlung des Hamburger Kaufmanns August Gottfried Schwalb (1741-1777) ist zwei Jahre nach dem Tod des Sammlers abgefaßt worden. Dem Titelblatt und der Aufmachung des 356 Einträge umfassenden Katalogs zufolge handelt es sich um einen Sammlungs-, nicht um einen Auktionskatalog. Vermutlich ist aber der erst zwei Jahre nach dem Tode Schwalbs publizierte Katalog gedruckt worden, um die Sammlung zu verkaufen. Das von Adam Friedrich Oeser verfaßte und dem Exemplar KH beigefügte "Schreiben an Herrn von Hagedorn" enthält weitere Informationen über die Sammlung und die Person des Sammlers. In der französischen Ausgabe des Katalogs, die ein Jahr später erschien, geht der Brief dem Katalog als Einleitung voran. Außerdem wird schon berücksichtigt, daß Hagedorn 1780 verstarb. In zahlreichen Beschreibungen äußerte sich Oeser schwärmerisch über die Gemälde der Schwalbschen Kollektion und auch über die Sammlung Wallmoden aus Hannover (vgl. Kat. 117), die Oeser ebenfalls in diesem Brief an Hagedorn bespricht. Beide SammlunKATALOGE
97
gen hatte Oeser im Auftrage Hagedorns begutachtet. In seinen Verweisen nennt Oeser andere Nummern als die im anschließenden Katalog benutzten, vermutlich lag ihm ein älteres Verzeichnis vor, das er an Hagedorn schickte. Ob möglicherweise auch der Katalog von Oeser verfaßt wurde, bleibt Spekulation. Daß der Katalog in Leipzig gedruckt worden ist, mag für die Autorschaft Oesers sprechen. Die Bilder sind überwiegend detailliert beschrieben, es fehlen jedoch jegliche kennerschaftliche Äußerungen. In einer Nachbemerkung wird darauf hingewiesen (S. 92), daß alle Bilder sehr "wohl erhalten" seien und in "gute Rähmen gefaßt" sind, "die großentheils ganz vergoldet und theils ganz schwarz gebeizet, oder mit goldenen Leisten versehen sind." Wenn Bilder statt auf Leinwand auf Holz oder Kupfer gemalt seien, werde dies nach den Worten der Nachbemerkung jeweils angemerkt. In seinem einleitenden Brief äußerte Oeser über den Sammler: "Er übte sich selbst im Zeichnen, forschte und prüfte unermüdet und mit feiner Empfindung; aber bey allem Enthusiasmus für die schönen Künste waren seine Urtheile gründlich, bescheiden, und nie im ermächtigten Richtertone gesprochen." Als Kaufmann habe Schwalb regelmäßig die Messe in Leipzig besucht, von wo aus er jeweils "eine Reise nach Dresden zu Fortsetzung seiner Studien in der Churfürstlichen Gemäldegallerie und Antikensammlung" unternahm. "Eben da er im Begriffe stand, seinen eigenen schätzbaren Vorrath von Gemälden unter seinen Mitbürgern gemeinnütziger werden zu lassen, wurde er durch seinen allzu frühzeitigen Tod, [...], seiner würdigen Familie und einer Menge Freunden entrissen" (S. 6f.). Schwalb war Sohn des Kaufmanns August Wilhelm Schwalb und seiner Frau Augustine Wiedemann. Er war seit 1766 verheiratet mit Dorothea Elisabeth, geb. Busse (1745-1799). Von Anton Graff existieren Bildnisse von Schwalb und seiner Frau (Berckenhagen 1967, S. 333f., Nrn. 1259 und 1261). Daniel Chodowiecki berichtet in einem Brief an Graff vom 4. März 1782: "Die Schwalbische Colection Gemähide hab ich auch besucht, sie ist sehr schätzbaar, unter andern fand ich auch ein Paar Bildniss von Ihnen da und eine Magdalena nach Battoni" (zit. nach Berckenhagen 1967, S. 333). Dem Schreiben Chodowieckis ist zu entnehmen, daß die Sammlung noch 1782 in Hamburg aufgestellt war. Dürr zufolge wurde sie 1782 für 6.000 Ducaten an den Maler und Kunsthändler Jan Wubbels in Amsterdam verkauft (Dürr 1879, S. 162, Anm. 1). Nach den Angaben von Friedrich Johann Lorenz Meyer hingegen soll die Sammlung 1780 an den Bankier Hope in Amsterdam für 33.000 Gulden verkauft worden sein. Der Besitzer sei mit der Sammlung nach England ausgewandert (Meyer 1801/1803, Bd. 2, 6. Heft, S. 290f.). Für die Annahme Dürrs spricht, daß ein großer Teil der Sammlung am 10. August 1785 auf einer Auktion in Amsterdam zum Verkauf gelangte (Lugt 3932). Auf dieser Auktion hat der Kunsthändler Jan Wubbels vermutlich zahlreiche Bilder erstanden. Insgesamt lassen sich in dem 356 Lose umfassenden Versteigerungskatalog in Amsterdam 197 Bilder aus der Sammlung Schwalb nachweisen, von denen zahlreiche Werke ihre Zuschreibung veränderten. Oftmals waren diese Veränderungen jedoch ein Rückschritt, der ausführliche Hamburger Katalog zeugte von einem besseren kennerschaftlichen Standard. In dem Amsterdamer Katalog wurde beispielsweise aus Alexander Thiele ein Maler namens Thielen (Nrn. 243 und 244). Gemälde der holländischen Schule bildeten den umfangreichsten Teil der Sammlung, darunter vor allem Gemälde der "Italianisanten" (Jan Asselyn, Nicolaes Berchem, Abraham Begeyn, Jan Both, Karel Dujardin). Außerdem befanden sich auch sechs Landschaften von Allart van Everdingen in der Schwalbschen Kollektion. Ein Jan Lievens zugeschriebenes Gemälde (Nr. 271) hatte Schwalb 1775 auf einer Hamburger Auktion erworben (Kat. 83, Nr. 16). Heute befindet sich dieses Bild mit dem Titel Der Fröhliche Trinker in der Berliner Gemäldegalerie (Kat.-Nr. 1808). Auffallend ist der relativ hohe Anteil der italienischen Gemälde, gefolgt von Werken der deutschen und flämischen Schule. Aus der kleinen Gruppe der französischen Bilder sind vier Werke von Claude Lorrain hervorzuheben. Ein großformatiges Gemälde von Aelbert Cuyp, die Nr. 1 des Katalogs, befindet sich heute in der National Gallery, London (Inv.-Nr. 961). 98
KATALOGE
Bei dem Gemälde Die Taufe Christi von Joachim Wtewael handelt es sich wahrscheinlich um das Original in der Eremitage in St. Petersburg (Inv.-Nr. 5187). Lit.: Meyer 1801/1803, Bd. 2, Heft 6, S. 290f.; Dürr 1879, S. 1861f.; Rohde 1922. 121 1779/03/05-1779/03/06 Reimarus; Hamburg, Börsen=Saale Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 205 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Catalogue einer auserlesenen Sammlung Italienischer und Niederländischer Cabinet=Mahlereyen, wie auch Bilder in Wasserfarben und Miniaturgemähide, imgleichen eine grosse Collection alte und moderne Kupferstiche, worunter viele berühmte Männer= Portraits, wie auch einige eingefaßte dito, welche am Freytag und Sonnabend, den 5ten und 6ten März a. c. auf dem hiesigen Börsen= Saale öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden sollen, durch die Mackler Reimarus und von Horn, bey welchem diese Designation beliebigst abzufo[r]dem. Auch können besagte Sachen den Tag vorher daselbst gefälligst besehen werden. Gedruckt bey Johann Matthias Michaelsen. Hamburg, Anno 1779. Kommentar: In dieser gemeinschaftlich von den Maklern Johann David Reimarus und Bendix Meno von Horn durchgeführten Auktion wurden 226 Losnummern mit 205 Gemälden angeboten. Zwischen den Gemäldelosen finden sich vereinzelt auch Bilder in Wasserfarben (Nrn. 105 bis 110, 112 bis 118, 171 bis 173), Seidenstikkereien (126 bis 129) und ein Gipsrelief (Nr. 111). Im Anschluß an die Gemäldeabteilung folgen Wasserfarben und Miniaturen (Nrn. 227 bis 242) sowie Kupferstiche (Nrn. 243 bis 357). Die Nr. 1 verzeichnet ein sog. "Comptoir", einen Kunstkammerschrank. Dieser war mit zwei größeren eingefaßten Kupfertafeln aus der RubensSchule sowie an den Schubladen mit zehn kleineren bemalten Kupfertafeln versehen. Bis auf den Text für den Kunstkammerschrank sind alle Beschreibungen sehr kurz gehalten, die Maße und Materialien werden nicht angegeben. Unter den ersten 188 Einträgen finden sich 42 Arbeiten holländischer und flämischer sowie 17 Werke deutscher Künstler, darunter sieben Gemälde von Georg Hinz. Viele der holländischen und flämischen Bilder werden mit der Redewendung "im Gusto von" nur als Schulbilder oder Kopien vorgestellt. Anonym bleiben insgesamt 107 Gemälde. Unter den Losnummern 189 bis 226 wird eine Folge von italienischen Landschaften angeführt, die wie folgt beschrieben werden: "Hier folget eine rare Sammlung von Italienischen Gemählden, bestehend in Bataillen, Landprospecte und Venetianischen Perspectiven, welche zu einem Zimmer mit verguldeten Rahmen als eine Tapete rangiret sind, wovon die Meister unbekannt."
122 1779/04/12
und folgende Tage
[Anonym]; Gera, Haus des Sammlers, in der Wydaischen Gasse Verkäufer nach Titelblatt: Bürgermeister Schöber Verkäufer: Schober, David Gottfried Lose mit Gemälden: 38 Standorte: SBB Nicht annotiert. HAMW Nicht eingesehen. SBBa Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichnis, verschiedener, zum Theile sehr prächtiger Manuscripte, dergleichen biblischer Ausgaben, auch theologischer, philologischer, historischer, medicinischer und anderer, theils sehr kostbarer Werke und Bücher, schöner Kupferstiche, Gemähide und
anderer Seltenheiten, ingleichen einiger schöner Kupferstiche, Gemählde und anderer Seltenheiten, ingleichen einiger schöner und seltener Medaillen, Thaler und anderer alter und neuer Münzsorten in Golde und Silber: welche Montags den 12. April 1779. in Gera in des seel. Bürgermeister Schöbers daselbst in der Wydaischen Gasse gelegenem Hause Nachmittags von 2. bis 6. Uhr den Meistbietenden gegen baare Bezahlung überlassen werden sollen. Gera, gedruckt mit Rothischen Schriften. Kommentar: In dieser Versteigerung des Nachlasses des Bürgermeisters David Gottfried Schöber (1696-1778) wurden vorwiegend graphische Arbeiten und Münzen angeboten. Schöber betrieb einen Wollwarenhandel und beschäftigte sich nebenher noch mit wissenschaftlichen Studien. Unter anderem veröffentlichte Schöber eine Studie über Dürer (Albrecht Dürer's, eines der größten Meister und Künstler seiner Zeit, Leben, Schriften und Kunstwerke, auf Neue und viel vollständiger, als von anderen ehemals beschrieben, Leipzig und Schleiz 1769). Am Ende des umfangreichen Katalogs sind auf den Seiten 166 bis 168 auch noch 50 Losnummern unter der Abteilung "An Gemälden Kupferstichen u.s.w." angeführt. Darunter befinden sich auch Arbeiten auf Elfenbein sowie graphische Arbeiten. Insgesamt können 38 Lose als Gemälde eingestuft werden, wobei unter manchen Nummern auch mehrere Bilder zusammengefaßt werden, so unter der Losnummer 50 allein neun Porträts. Die meisten Gemälde bleiben anonym, doch mehrere Bilder werden altdeutschen Meistern zugeschrieben, so etwa Lucas Cranach (Nr. 6), Albrecht Dürer (Nr. 24), und Michael Wohlgemut (Nr. 15). Lit.: Κ. Brodale, David Gottfried Schöber (1696-1778), in: Wohin in Gera?, Gera 1998. 123 1779/04/19 [Anonym]; Hamburg, In der Neustädter Fuhlentwiete Verkäufer nach Titelblatt: Keine Verkäufer nach anderer Quelle: Johann Klefacker Verkäufer: Klefacker, Johann Lose mit Gemälden: 3 Standorte: SUBG Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß einiger theologischen, juristischen, medicinischen, philosphischen, historischen, chymischen Bücher und Manuscripte, in deutscher, lateinischer, spanischer, französischer, holländischer, italiänischer und englischer Sprache, welche den 19ten April, 1779, in einem wohlbekannten Hause in der Neustädter Fuhlentwiete öffentlich an die Meistbietenden sollen verkauft werden. Hamburg, gedruckt bey Diet. Ant. Harmsen. Kommentar: In dieser Versteigerung wurde die Bibliothek des Hamburger Syndicus Johann Klefacker verauktioniert. Unter der Rubrik "Landcharten, Kupferstiche und Gemähide" werden auch vier Gemälde unbekannter Künstler aufgeführt, darunter zwei Portraits Klefackers. Auf der Titelseite des Exemplars SUBG ist handschriftlich ergänzt: "Syndicus Klefacker".
124 1779/05/08
[Lugt 2997]
Meno von Hoorn; Hamburg, Börsensaal Verkäufer nach Titelblatt: Keine
gen Börsen=Saale öffentlich an die Meistbietende verkauft werden sollen durch den Maakler Meno von Hoorn, bey welchem der Catalogue beliebigst abzufordern. Auch können besagte Sachen an benanntem Orte den Tag vorher gefälligst besehen werden. Gedruckt bey Dieterich Anton Harmsen. Hamburg, Anno 1779. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog des Hamburger Maklers Benedix Meno von Horn sind 139 Losnummern verzeichnet, von denen 114 als Gemälde angesehen werden können. Bei den Losnummern 135 bis 138 handelt es sich um Elfenbeinreliefs bzw. bei Nummer 139 um eine Holzskulptur, bei den Losen 44 bis 47 und 49 bis 64 um Wasserfarben und Aquarelle. Alle Beschreibungen sind sehr kurz gehalten, es fehlen Angaben zum Material und zu den Maßen. Die meisten Gemälde bleiben anonym. Von den wenigen zugeschriebenen Werken der holländischen und flämischen Schule wird der größte Teil als Schülerarbeiten oder Kopien bezeichnet. Auch die Bildthemen sind nur selten genauer benannt ("Zwey historische Stücke; Zwey dito"). Am Ende des Katalogs werden noch einige Gemälde und Kupferstiche summarisch erwähnt: "Nebst noch verschiednen nicht specificirten Gemählden, wie auch auch Parthey eingefaßte Kupferstiche". 125 1779/09/27
und folgende Tage
[Lugt 3043]
Nothnagel; Frankfurt am Main, In dem Senckenbergischen Stiftungs-Hauss Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 1079 Standorte: *SBF I Annotiert mit allen Käufernamen und Preisen auf eingebundenen Leerseiten. Aus dem Besitz von Johann Valentin Prehn. SIF Annotiert mit allen Käufernamen und Preisen. BNP Nicht annotiert (französische Ausgabe). LBDa Nicht annotiert. RKDH Nicht annotiert (deutsche Ausgabe). SBF II Nicht annotiert (französische Ausgabe). ZBZ Nicht eingesehen. KKD Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Nach Lugt nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß einer beträchtlichen Sammlung von Gemälden derer berühmtesten Niederländischen, Französischen, Italiänischen und Deutschen Meister, welche zu Frankfurt am Mayn in dem Senckenbergischen Stiftungs=Hauß nach der nächstbevorstehenden Herbst=Messe, Montags den 27ten Septembr. und die darauf folgende Täge, öffentlich an den Meistbietenden gegen baare Bezahlung überlassen werden sollen, auch können sämtliche Gemälde welche in dem besagten Senckenbergischen Stiftungs=Hauß hinter der sogenanten Schlimm=Mauer in Neun großen Zimmern aufgestellt allwöchentlich zweymahl, als Dienstags und Freytags von zwei bis fünf Uhr besehen werden. Frankfurt am Mayn, 1779. Catalogue d'une collection considerable de tableaux des meilleurs maitres flamands, franfois, Italiens et allemands, qui seront mis en vente au plus offrant Lundi le 27 septembre et les jours suivants 1779. dans la maison de fondation de feu Mr. Senckenberg rue dite Schlimme Mauer a Francfort sur le Mein. Exposes en attendant en neuf grandes chambres dans la dite maison, ou les amateurs peuvent les voir deux fois par semaine, savoir mardi et vendredi depuis 2. heures apres midi jusqu'a 5. heures du soir. Francfort sur le Mein, 1779.
Lose mit Gemälden: 114 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Specification einer schönen Sammlung mehrentheils Niederländischer Cabinet=Mahlereyen, Wasserfarben und Miniatur= Gemähide, welche am Sonnabend, den 8ten May a. c. auf dem hiesi-
Kommentar: In dieser umfangreichen Versteigerung des Frankfurter Malers und Kunsthändlers Johann Benjamin Andreas Nothnagel (1729-1804) wurden 1.096 Losen verauktioniert, wovon 1.079 Gemälde verzeichnen. Es handelte sich um Bestände aus verschiedenen Sammlungen. Nothnagel, Besitzer einer renommierten Tapetenfabrik, hatte schon 1765 eine Lotterie durchgeführt (vgl. Kat. 50). In KATALOGE
99
einem "Vorbericht" heißt es: "verschiedene auswärtige und hiesige Familien, welche mir hierinnen Ihr Vertrauen zugewendet, und diesen Vorrath abzugeben gesonnen, haben mir zugleich die Direction aufgetragen." An dem Ausmaß dieser Auktion läßt sich erkennen, wie optimistisch Nothnagel die Möglichkeiten des Frankfurter Kunstmarkts einschätzte. Anfang der 1780er Jahre entwickelte sich der Kunstmarkt so günstig, daß es kein Problem darstellte, mehr als 1.000 Bilder auf einen Schlag zu veräußern. Zahlreiche Frankfurter Bürger sammelten Kunst in großem Stil, zudem zog die Messe Interessenten aus ganz Europa an. In seiner Einführung betont Nothnagel, daß es sich durchgehend um Originale handle. Kopien seien als solche eindeutig ausgewiesen. Auch seien alle Bilder gut erhalten und gerahmt. Die Auktion war für einen Montag direkt nach der Herbstmesse angesetzt, die Gemälde wie üblich vorher zu besichtigen. Alle Beschreibungen sind recht kurz gehalten, enthalten jedoch meist ein beschreibendes Detail und stets Maße, allerdings keine Materialangaben. Bei insgesamt 107 Gemälden ist kein Künstlername angegeben. Eine bestimmte Ordnung ist nicht erkennbar, auch eine Scheidung der einzelnen Einlieferer ist nicht möglich, da die Numerierung durchgehend ist. Mit insgesamt 347 Arbeiten liegt der Schwerpunkt auf Werken deutscher Künstler, hier ganz besonders auf der Frankfurter Schule. Dies deutet darauf hin, daß die meisten Gemälde aus Sammlungen aus dem Frankfurter Raum stammten. So finden sich beispielsweise allein 50 Werke von Johann Georg Trautmann, 23 Gemälde von Johann Conrad Seekatz und zwölf Bilder von Justus Juncker. Auch die sächsischen Landschafter sind häufig vertreten, so lassen sich von Christian Wilhelm Ernst Dietrich zehn Werke und von Johann Christian Klengel sieben Gemälde zählen. Hinzukommen auch einige Werke altdeutscher Meister, so ein als Dürer geführter Altar (Nr. 1089), der heute als Werk des Meisters von Frankfurt gilt, sowie ein Altar von Hans Grünewald (Nr. 1088), der nunmehr Jörg Ratgeb zugeschrieben wird. Beide Altäre befinden sich heute im Städelschen Kunstinstitut. Zwei biblische Szenen von Seekatz (Nrn. 321 und 322) befinden sich heute im Martin von Wagner Museum in Würzburg (Inv.-Nrn. F 553 und F554). Unter den 31 Bildern österreichischer Maler finden sich zwölf Werke von Franz Christoph Janneck und sechs von Johann Franz Nepomuk Lauterer. Stark vertreten ist auch die holländische Schule mit fast 200 Arbeiten, darunter 13 Bilder von Rembrandt, die teilweise jedoch als Kopien oder Schulbilder vorgestellt werden. Die flämische Kunst ist mit 162 Kunstwerken repräsentiert, darunter mehrere Bilder von Balthasar Beschey, Peter Paul Rubens und David Teniers d.J. Die italienische Schule ist zwar mit 82 Gemälden relativ gut vertreten, die allerdings in vielen Fällen nur pauschal als "italienisch" bezeichnet werden. Ansonsten überwiegen hier Arbeiten von Künstlern des 18. Jahrhunderts und von Künstlern, die zeitweise in Deutschland gearbeitet haben, wie beispielsweise Francesco Zuccarelli, von dem 14 Gemälde angeboten wurden. Nach den Angaben des annotierten Exemplars wurden bis auf drei zurückgezogene Lose (Nrn. 60, 1087 und 1088) alle Bilder verkauft. Möglicherweise auch aufgrund des großen Angebots blieben die Preise in der Regel auf relativ niedrigem Niveau (zwischen 2 und 30 Gulden), teilweise auch noch deutlich unter 2 Gulden. Der Gesamterlös betrug 15.649 Gulden und 41 Kreuzer, also durchschnittlich etwas mehr als 14 Gulden je Los. Einzelne Gemälde wurden zu hohen Preisen zugeschlagen. Das gilt vor allem für einige italienische Bilder, so mußten für ein Frauenportrait von Carlo Dolci (Nr. 926) 300 Gulden bezahlt werden. Auch mehrere Gemälde von Rubens erzielten Werte von 100 bis 200 Gulden. Unter den Käufern traten neben Frankfurter Sammlern und Kunsthändler erwartungsgemäß auch auswärtige Käufer auf, beispielsweise der Kunsthändler Artaria aus Wien und Mainz sowie der Nürnberger Kunsthändler Johann Jacob Hermann Wild. Im großem Stil kaufte auch Sebastian Heinrich Hüsgen Bilder auf dieser Versteigerung: ihm wurden insgesamt 120 Gemälde zugeschlagen. Vermutlich erwarb er nicht nur für seine eigene Sammlung, sondern führte auch Kommissionsaufträge aus. Hüsgen 100
KATALOGE
erwarb auf verschiedenen Frankfurter Auktionen mindestens 255 Bilder. Nahezu die Hälfte der vom ihm nachweislich angekauften Gemälde stammte also von der Versteigerung Nothnagel im Jahre 1779. Zahlreiche Bilder ersteigerten auch Johann Wilhelm Becker, Heinrich Joseph Burger, Johann Christian Kaller, Georg Friedrich Moevius und Johann Samuel Mund. Lit.: Gwinner 1 1862, S. 356-361; Gwinner II 1867, S. 59-70; Schmidt 1960, o.P (Nothnagel); Ausst.-Kat. Frankfurt 1988, S. 122; Rudolf Rieger, Graphikhandel im 18. Jahrhundert: Die Firma Artaria und Johann Gottlieb Prestel, in: Ausst.-Kat. Frankfurt 1991, Bd. 3, S. 203-207; s. auch im Katalogteil S. 236-239.
126 1780/00/00
Daten unbekannt
[Anonym]; Augsburg Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 34 Standorte: BSBM Nicht annotiert. Titelblatt: Catalogue einer auserlesenen Kunst= und Naturaliensammlung welche aus allen dreyen Reichen der Natur sowohl, als an treflichen Gemälden, schätzbaren Kunststücken, seltenen Alterthümern, raren Büchern und andern Merkwürdigkeiten einen wohl geordneten Vorrath hat und allhier zu Augsburg aus freyer Hand oder an den Meistbietenden zu verkauffen ist. Augsburg, gedruckt mit Lotterischen Schriften, 1780. Kommentar: In diesem anonymen Augsburger Katalog wurden vor allem Naturalien und kunstgewerbliche Gegenstände angeboten, darunter eine Gesteinssammlung sowie eine Sammlung von NautiliArbeiten und anderen Schnecken-Artefakten. Da kein Datum angegeben ist und die Gegenstände nicht nur an den Meistbietenden, sondern auch "Aus freyer Hand" zu verkaufen waren, handelt es sich möglicherweise um einen Verkaufskatalog. Unter der Rubrik "Mahlereyen" finden sich in 38 Losnummern 34 Gemälde (S. 48). Alle Bilder sind sehr kurz beschrieben, Maßangaben fehlen vollkommen, Materialangaben sind selten. Insgesamt sechs Gemälde bleiben anonym, drei Arbeiten werden als Niederländisch eingestuft. Unter den acht deutschen Arbeiten finden sich zwei Gemälde von Johann Heiss, darunter die Darstellung Amilcar und der junge Hannibal (Nr. 6). Im Rahmen der hier offerierten Kunstkammer hatte die kleine Gemäldesammlung wohl nur eine dekorative Funktion. Nach den Angaben von Valter 1995, S. 139, ist dieser Versteigerungskatalog nahezu identisch mit einem Katalog des Jahres 1768 (Elendus Pinacothecae). Lit.: Valter 1995, S. 139.
127 1780/08/21 [Anonym]; Darmstadt Verkäufer nach Titelblatt: Keine Verkäufer nach anderer Quelle: [Friedrich Karl Ludwig, Freiherr von Moser] Verkäufer: Moser, Friedrich Karl Ludwig, Freiherr von Lose mit Gemälden: 92 Standorte: AK Nicht annotiert. RKDH Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichnis einer Sammlung von Gemählden, Hand= Zeichnungen, Kupferstichen, Land=Charten und Gyps=Büsten, von Deutschen, Französischen und Italienischen Meistern, so den 21. August. 1780 in Darmstadt an den Meistbietenden verkauft werden sollen. 1780.
Kommentar: In diesem anonymen Dannstädter Versteigerungskatalog wurden 92 Gemälde angeboten. Wahrscheinlich handelt es sich um die Sammlung von Friedrich Carl Freiherr von Moser (17231798), da bis auf zehn alle Gemälde ein Jahr später auf einer Frankfurter Auktion erneut auftauchten und dort Moser als Besitzer überliefert ist. Johann Heinrich Merck berichtet in einem Brief, daß sich die Gemälde auf der Versteigerung schlecht verkauften: "seine Bücher und Kupferstiche sind verkaufft. Mit den Gemälden hat es aber nicht gehen wollen" (Merck 1911, S. 62). Zu Beginn des Katalogs werden unter der Überschrift "Verzeichnis von Gemählden" 90 Lose aufgeführt (S. 3 bis 7). Es folgen vier "Gemahlte Portraite", zwei Gemälde und zwei Pastelle. Des weiteren wurden Gips- und Wachsmedaillions (S. 8), Handzeichnungen (S. 9 und 10), große Gipsbüsten (S. 10 und 11), Kupferstiche (S. 11 bis 27) und zuletzt einige Landkarten offeriert (S. 27). Einer kurzen Vorbemerkung zufolge konnten Aufträge für die Auktion an den Fürstlichen "Regierungs=Assessor Mayer" und den Fürstlichen "Bau=Schreiber Rosenberger" gerichtet werden. Alle Beschreibungen sind kurz gehalten, jedoch durch die Maße in rheinischem Schuh ergänzt, meist wird auch in abgekürzter Form das Material angegeben. Insgesamt sieben Gemälde bleiben anonym. Neben einigen wenigen flämischen Bildern finden sich vor allem Werke deutscher Künstler des 18. Jahrhunderts, darunter überwiegend Bilder Frankfurter Maler. Sechs Gemälde werden als italienisch eingestuft. Bei dem einzigen zugeschriebenen italienischen Gemälde handelt es sich um eine Anbetung der Hirten von Jacopo Tintoretto (Nr. 4). Es wurde vermutlich nicht als Original angesehen, da es bei der Frankfurter Auktion der Sammlung nur 4 Gulden erlöste (Kat. 135, Nr. 4). Eine Folge von Darstellungen der zwölf Monate wird Lucas van Leyden oder einem verwandten niederländischen Künstler zugeschrieben (Nrn. 25 bis 37; Kat. 135, Nrn. 19 bis 30).
128 1780/10/02
[Lugt 3177]
Stöcklein; Frankfurt am Main, Haus des Sammlers, auf der Bockenheimer=Gasse hinter dem Kaysers=Brunnen befindlichen kleinen Gäßgen im Stöckleinischen Gärtgen Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 69 Standorte: *SBF Annotiert mit allen Preisen. Aus dem Besitz von Johann Valentin Prehn. LBDa
Nicht annotiert.
Titelblatt: Verzeichniß eines wohl nicht zahlreichen, jedoch mit vielem Geschmack, und guter Wahl, seit geraumen Jahren gesammelten Mahlereyen=Cabinets. Von berühmten Deutschen, Italiänischen, und Niederländischen Meistern, welche von denen Erben des seel. Herrn Eigenthümers, allhier in Franckfurt am Mayn, auf der Bokkenheimer=Gasse hinter dem Kaysers=Brunnen befindlichen kleinen Gäßgen im Stöckleinischen Gärtgen Littra E. No 136. Montags Vormittags um halb 9. Uhr, den 2. Octob. a.c öffentlich an den Meistbietenden für baare Bezahlung im 24. fl. Fuß überlassen werden sollen. So aber allenfalls der Herbst auf diesen Tag allhier bestimmt werden sollte, so wird nicht ermangelt werden, den anderweits hierzu gewählten Tag, durch das hiesige Nachrichts=Blatt anzuzeigen. Besagte schöne kleine Sammlung stehet wie bereits gemeldet, auf der Bockenheimer=Gasse in dem angezeigten Garten, in jeziger Messe Sonntags Nachmittags von 2. bis 5. Uhr zu besehen, und die Catalogen davon sind auf der kleinen Eschenheimer=Gasse Littra D. No. 127 gratis zu erhalten. Sämmtliche Gemähide sind besonders gut conservirt, und mit schönen Rahmen versehen, aber ohne Rahmen nach dem Französischen Fußmaas gemessen worden. Franckfurt am Mayn 1780. Gedruckt mit Diehlischen Schriften.
Kommentar: In dieser Versteigerung wurde der Nachlaß eines anonymen Frankfurter Sammlers durch den Maler und Kunsthändler Christian Stöcklin (1741-1795) verauktioniert. Sie fand im "Stöckleinischen Gärtgen" statt. Auf dem Exemplar SBF findet sich der handschriftliche Hinweis "Stöckleinischer Ausruf'. Stöcklin stammte aus Genf, hatte in Bologna bei Antonio Galli da Babiena Architekturmalerei studiert und ließ sich 1764 in Frankfurt am Main nieder. 1766 bewarb er sich um das Frankfurter Bürgerrecht, das ihm kurz darauf auch zugesprochen wurde. Wie andere Frankfurter Maler auch - beispielsweise Justus Juncker oder Johann Andreas Benjamin Nothnagel - betätigte sich Stöcklin auch als Kunsthändler. Alle Beschreibungen sind kurz gehalten, enthalten Maß-, aber keine Materialangaben. Von den 69 Gemälden unter den 71 Losen bleiben nur zwei anonym. Bei den Losnummern 68 und 69 handelt es sich um Porzellanmalereien. Der Gemäldeliste folgt eine Aufstellung kunstgewerblicher Gegenstände, ein Trumeaux-Spiegel, zwei Konsoltische und vier Vasen. In dieser kleinen Sammlung überwiegen Arbeiten deutscher Künstler, darunter neben Frankfurter und Darmstädter Künstlern wie Johann Georg Trautmann und Christian Ludwig Freiherr von Löwenstern vor allem Landschaftsmaler aus dem sächsisch-thüringischen Raum. Allein 13 Gemälde stammen von Maria Dorothea Wagner, der Schwester Christian Wilhelm Ernst Dietrichs, von dem ebenfalls zwei Werke vorhanden waren. Nach den Angaben des annotierten Exemplars SBF bewegten sich die Preise durchschnittlich zwischen 5 und 30 Gulden. Für einzelne holländische Bilder wurden auch deutlich höhere Preise bezahlt, so für zwei Landschaften von Jan Wijnants 192 Vi Gulden (Nrn. 37 und 38). Relativ hohe Preise erzielten zwei Arbeiten von Christian Wilhelm Ernst Dietrich und Thiele (Nrn. 31 und 32), die gemeinsam verkauft und bei 72 Ϊ4 Gulden zugeschlagen wurden. Die Gemälde von Wagner wurden zu Preisen zwischen 13 und 30 Gulden verkauft. Lit.: Gwinner 1 1862, S. 329-331. 129 1781/00/00
Daten unbekannt
[Lugt 3343]
[Anonym]; Warszawa Verkäufer nach Titelblatt: Comte Vincent Potocki Verkäufer: Potocki, Vincent, Graf Lose mit Gemälden: 263 Standorte: RKDH Annotiert in Bleistift auf Französisch mit einigen wenigen Preisen sowie einigen Randbemerkungen und Anstreichungen. Photokopien: NGL und FLNY (beide aus RKDH) Titelblatt: Catalogue des dessins, tableaux, miniatures, estampes, marbres, porcelaines, instrument de phisique et de mathematique, et autres curiosites, contenues dans le cabinet de S.E. Mr. le Comte Vincent Potocki, Due de Zharaz, Seigneur de Brody, Lefzniow, Stanistawczyk, Radziwilow, Otenia, Oboduwka, Niemirow, & autres Lieux. Grand Chambellan de Pologne. Lieutenant General des Armies & premier Colonel des Gardes du Corps a cheval de S. M. Staroste, Gouverneur de Lublin, Krempiec, Chrzczonow, Zemborzyce, Poitrkow &c. Chevalier des ordres de l'Aigle Blanc, & de St. Stanislas. Mis en ordre par Henri Amiet, son Secretaire & Bibliothecaire en sa Bibliotheque ä Varsovie. / A Varsovie. Chez P. Dufour Imprimeur du Roi & de la Republique. / M.DCC.LXXX. Kommentar: In diesem Warschauer Katalog wurde die Kollektion des Grafen Vincent Potocki angeboten. Insgesamt werden 263 Gemälde aufgeführt. Es ist nicht klar, ob es sich um einen Sammlungskatalog oder um einen Versteigerungskatalog handelt. Alle Angebote sollten an Henri Amiet, den Sekretär und Bibliothekar des Grafen gerichtet werden. Im ersten Teil des Katalogs sind 495 Zeichnungen nach Schulen unterteilt und in der jeweiligen Schule alphaKATALOGE
101
betisch geordnet aufgelistet (S. 1 bis 31). Es folgt der "Catalogue des tableaux", der mit einer Folge von 31 Nummern mit Miniaturen (S. 1 bis 11) eingeleitet wird. Anschließend werden die Gemälde angeführt, die wie die Zeichnungen nach Schulen sortiert sind. Der Künstlername wird nur einmal angegeben, danach werden die ihm zugeschriebenen Gemälde aufgelistet. Die Aufstellung beginnt mit der italienischen Schule (Nm. 32 bis 35), es folgt die holländische, flämische und deutsche Schule (Nrn. 36 bis 182), abschließend die französische Schule (Nrn. 183 bis 260). Anonym bleiben 71 Bilder, die jeweils am Ende der einer Schule gewidmeten Abteilung unter dem Stichwort "par differents maitres" zusammengefaßt werden (Nrn. 148 bis 182 für die nordischen Schulen sowie 260 bis 294 für die französische Schule). Unter Losnummer 295 findet sich noch ein Werk von Francesco Casanova, das wohl zuvor vergessen worden war. Im Exemplar RKDH des Katalogs sind am Ende noch einige Lose handschriftlich nachgetragen. Die Beschreibungen der Gemälde sind in der Regel recht detailliert, doch betont sachlich. Sie werden durch die Angabe des Materials und der Maße abgeschlossen. Signaturen und Datierungen werden ebenso vermerkt wie Reproduktionsstiche nach den aufgeführten Gemälden. Gelegentlich werden minutiöse Händescheidungen vorgenommen; etwa bei einem Bild von Peter Paul Rubens (Nr. 98), bei dem drei Figuren Anthonie van Dyck, eine Jacob Jordaens zugeschrieben werden. Am Ende sind handschriftlich noch einige Portraits aufgeführt. Mit insgesamt 81 Arbeiten überwiegen die holländischen und flämischen Künstler, darunter allein neun Landschaften von Alexander Keirincx. Nachweislich erwarb Potocki einige dieser Bilder in Flandern, so stammten neun Gemälde (Nrn. 43,45, 67, 90, 98-100, 131 und 132) aus der Sammlung Schorel in Antwerpen, die am 7. Juni 1774 versteigert wurde. Auffallend stark vertreten ist die französische Schule mit 57 Werken. Dies dokumentiert, wie sehr sich polnische Adelige an Frankreich orientierten. In kaum einer deutschen Sammlung finden sich so viele französische Gemälde wie in der Sammlung Potocki. Unter den französischen Bildern stammen allein acht Werke von Francois Boucher (Nrn. 189 bis 196). Joseph Marie Viens Verwundete Venus (Nr. 253) befindet sich in einer Privatsammlung in New York (1988). Mit nur vier Beispielen bleibt die deutsche Schule marginal, auch die Italiener sind mit 13 Werken, darunter fünf Bilder von Francesco Casanova, nur mäßig repräsentiert. Im Katalog werden nur fünf Bilder als italienisch eingestuft, da Casanova, Filippo Napoletano sowie Paolo de Matteis bei der französischen Schule eingeordnet sind. Insgesamt 14 Gemälde tauchen später in einer Auktion am 9.2.1820 in Paris (Lugt 9728) wieder auf, in der vor allem graphische Arbeiten aus der Sammlung Vincent Potocki verkauft wurden. Bei diesen 14 Gemälden wurde 1820 oftmals die Zuschreibung verändert. Viele Bilder galten nur noch als Schulbilder, ein Bild von Nicolaes Pietersz. Berchem wurde nun Dirk van Bergen zugeschrieben (Nr. 46; Lugt 9728, Nr. 828).
130 1781/00/00
Daten unbekannt
[Anonym]; Würzburg Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 443 Standorte: SBBa Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß einer beträchtlichen und wohlkonditionirten Mahlerey=Sammlung, worunter viele wahre Originalien von den besten florentinischen, römischen, lombardischen, venetianischen, französischen, flammändischen, und deutschen Meistern zu sehen sind. 1781. Kommentar: Bei diesem anonymen Würzburger Katalog handelt es sich um eine Neuauflage eines Verkaufskatalogs aus dem Jahre 1776 (Kat. 91). Da in diesem Katalog alle Lose in der gleichen Reihenfolgen wieder auftauchen, ist der Verkauf im Jahre 1776 vermutlich ausgesetzt worden. Die Bildtexte unterscheiden sich nur margi102
KATALOGE
nal. Insgesamt wurden erneut 446 Gemälde zum Verkauf angeboten. Interessenten konnten sich nach den Angaben einer Vorbemerkung bei dem fürstbischöflichen Galeriedirektor, dem Maler Christoph Fesel melden. Nach den Angaben von Mayer handelt es sich bei dieser Sammlung um den ehemaligen Besitz von Hans Georg Graf von Rotenhan (1675-1746), da ein Gemälde von Johann Rudolf Bys aus dessen Besitz stammen soll. In der ausführlichen Biographie Rotenhans wird jedoch nur die Möbelkollektion Rotenhans erwähnt. Rotenhan beschäftigte den bedeutenden Möbelschreiner und Ebenisten Ferdinand Plitzner, der immer wieder auch für Lothar Franz Graf von Schönborn arbeitete und der in Schloß Weißenstein in Pommersfelden das Spiegelkabinett geschaffen hat. Zu weiteren Angaben vgl. Kat. 91. Lit.: Julius Freiherr von Rotenhan, Geschichte der Familie Rotenhan älterer Linie, Bd. 1, Würzburg 1865, S. 345-355 und bes. S. 364; Mayer 1994, S. 256. 131 1781/02/17
[Lugt 3218]
[Anonym]; Frankfurt am Main, In dem bekannten Scharffischen, modö Bäurischen obern Saal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 65 Standorte: SMF Nicht annotiert. *SBF Annotiert in Bleistift mit allen Preisen und nochmals in Tinte auf eingebundenen Leerseiten. Aus dem Besitz von Johann Valentin Prehn. Titelblatt: Verzeichniß einer kleinen, aber mit vieler Käntnis, Geschmack und Ordnung seit langer Zeit zusammen gewählten Gemählde=Sammlung von Italienischen, Niederländischen, und Teutschen meinst alten, sehr guten Meistern. Welche den 17.ten Febr. dieses Jahres allhier, öffentlich an den Meinstbietenden für baare Bezahlung im 24 fl. Fuß überlassen werden sollen. Besagte Gemählde können drey Tage lang vor der Versteigerung Morgens von 9. bis 12. Uhr, und Nachmittags von 2. bis 5. Uhr, in dem bekannten Scharffischen, modö Bäurischen obern Saal allhier, allwo auch alsdann obenbemerckten Tag die Verganthung geschiehet, in Augenschein genommen werden. Sämmtliche Stücke sind besonders gut conservirt, auch mit schönen Rahmen versehen, und nach dem Franckfurter Werckschuh gemessen. Die Cataloge sind bey denen Herren geschworenen Ausrüfer, und auf der kleinen Eschenheimer Gaße Lit. D. Num. 54. gratis zu erhalten. Gedruckt mit Diehlischen Schriften, 1781. Kommentar: In diesem anonymen Frankfurter Versteigerungskatalog wurde eine kleine Sammlung von insgesamt 65 Gemälden angeboten. Nach der Aufmachung des Titelblatts gleicht dieses Verzeichnis einem Katalog für eine Versteigerung, die im Oktober 1780 von Christian Stöcklin durchgeführt wurde (Kat. 128). Alle Beschreibungen sind kurz gehalten und oftmals mit ästhetischen Wertungen verbunden und durch Maßangaben ergänzt. Es bleiben nur drei Gemälde anonym. Neben 31 holländischen und flämischen Werken wurden insgesamt 16 Gemälde deutscher Künstler angeboten, darunter vier Arbeiten von Christian Georg Schütz. Die Pendants Der büßende Petrus von Theodor Roos und Die büßende Magdalena von Johann Georg Trautmann (Nm. 31 und 32) gelangten in das Historische Museum Frankfurt (Pr.60/M429 und M432). Unter den sechs italienischen Bildern finden sich zwei kleine Veduten von Canaletto (Nrn. 9 und 10). Nach den Angaben des annotierten Exemplars SBF des Katalogs lagen die erzielten Preise überwiegend recht hoch. Für ein Seestück von Ludolf Backhuysen (Nr. 46) wurden beispielsweise 100 Gulden bezahlt, für zwei Landschaften von Moucheron zusammen 200 Gulden (Nrn. 63 und 64). Die meisten Preise bewegten sich zwischen 5 und 30 Gulden. Dem annotierten Exemplar SBF zufolge wurden alle Bilder verkauft.
132 1781/03/26
und folgende Tage
[Lugt 3242]
Haring; Berlin, Au coin de la rüe Francis et Charlotte Verkäufer nach Titelblatt: Keine
bungen ist auch dies nicht sicher. Lit.: Hüsgen, Art. Magazin 1790, S. XV; Gwinner I 1862, S. 533; Schmidt 1960, o.P.
Lose mit Gemälden: 22 Standorte: *IFP Annotiert in Bleistift mit einigen Preisen, die stark abgerieben sind. Titelblatt: Catalogue d'une collection de tableaux dessins et d'Estampes choisies qui se vendront au plus offrant et dernier encherisseur a Berlin le 26 Mars et Jours suiv. 1781 chez Haring, commissaire de ventes publiques au coin de la rüe Fransoise et Charlotte depuis neuf heures du Matin jusqu'a midi et de deux heures apres midi jusqu'a cinq. Α Berlin. Kommentar: In diesem französischsprachigen Versteigerungskatalog des Berliner Auktionators Christian Andreas Haring wurde eine anonyme Sammlung angeboten, die sich in erster Linie aus Zeichnungen und Kupferstichen zusammensetzte. Nur in einer kleinen Abteilung am Ende des Katalogs (S. 117 und 118) sind insgesamt 22 Gemälde verzeichnet (Nrn. 2367 bis 2388). Einige Lose umfassen zwei Gemälde. Die Beschreibungen sind knapp und beinhalten Maßangaben. Nur bei Gemälden auf Kupfer oder Holz wird das Material angegeben. Sechs Werke bleiben anonym. Ansonsten finden sich unter anderem vier Landschaften von Christian Wilhelm Ernst Dietrich, zwei Gemälde von Adriaen Brouwer und ein Madonnenbild auf Kupfer von Carlo Dolci. Im Exemplar IFP sind einige Preise notiert, wobei nicht klar ist, um welche Währung es sich handelt. Einen relativ hohen Preis erzielte das Gemälde von Dolci mit 122 Währungseinheiten.
133 1781/05/00
Daten unbekannt
[Anonym]; Frankfurt am Main, Auf dem Roßmarkte in dem De Rom Campoingschen Hause Verkäufer nach Titelblatt: Aus der Verlassenschaft weyl. Herrn Johannes Pasquay Verkäufer: Pasquay, Johannes Lose mit Gemälden: 33 Standorte: UBK
Nicht annotiert.
Photokopien: UBLg (aus UBK) Titelblatt: Verzeichniß einer Sammlung von Büchern, Kupferstichen, Gemählden, physikalischen Instrumenten aus der Verlassenschaft weyl. Herrn Johannes Pasquay worunter vornehmlich eine sehr grosse vollständige Elektrisiermaschine und mehrere Curiosa befindlich, welches alles den [Auslassung] May 1781 dahier zu Frankfurt am Mayn auf dem Roßmarkte in dem De Ron Campoingschen Hause öffentlich an den Meistbiethenden gegen baare Bezahlung verkauft werden wird. Frankfurt am Mayn, mit Eichenbergischen Schriften 1781. Kommentar: In dieser Versteigerung wurde vermutlich der Nachlaß des Frankfurter Sammlers und Arztes Peter Pasquay (1719-1777) verauktioniert. Wahrscheinlich gelangte dessen Sammlung 1777 in den Besitz von Johannes Pasquay, der auf dem Titelblatt des Katalogs erwähnt wird. Neben Büchern, Kupferstichen und zahlreichen physikalischen Apparaturen findet sich auch eine Abteilung (S. 22 und 23) mit 33 Gemälden. Überwiegend handelt es sich um anonyme Werke, nur insgesamt neun Gemälde werden einem Künstler zugeschrieben, darunter ein Gemälde des dänischen Malers Bernhard Grodtschilling mit einer Genreszene aus Grönland. Von den Gemälden, die Peter Pasquay 1763 auf einer Auktion (Kat. 44) ersteigert hat, lassen sich nur zwei Landschaften wiedererkennen (Nrn. 1 und 2; Kat. 44, Nr. A43). Wegen der sehr knappen Beschrei-
134 1781/05/07
und folgende Tage
[Lugt 3263]
Hüsgen; Frankfurt am Main, Haus des Sammlers, zum grosen Saalhof Verkäufer nach Titelblatt: Jacob Bernusische Beneficial=Erben Verkäufer: Bernus, Jacob; Jassoy; Kleinau Lose mit Gemälden: 434 Standorte: *SIF Annotiert mit allen Käufernamen und Preisen auf eingebundenen Leerseiten. Nicht annotiert. LBDa Nicht annotiert. SMF SBF Nicht gefunden (1993). KKD Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Nach Lugt nicht annotiert. BSBM Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Titelblatt: Verzeichnis einer beträchtlichen Sammlung von Gemälden der besten und berühmtesten Teutschen, Italiänischen und Niederländischen Meister, nebst einem Anhang von einigen Kupferstichen. Welche die Jacob Bernusische Beneficial=Erben in ihrem Haus zum grosen Saalhof allhier in Frankfurt am Mayn, gleich nach hiesiger Ostermeß, Montag den [7 May; handschriftlich ergänzt] 1781. und die folgende Tage, durch öffentliche Versteigerung den Meistbiethenden zu überlassen gesonnen sind. Auch können sämtl. Gemälde in besagtem Saalhof, die bevorstehende Herbst= und Ostermessen, Sonntags Nachmittags von 2. bis 6. Uhr, den Monat October und Merz aber die Woche über, als Montags und Freytags, um besagte Zeit öffentlich besehen und in Augenschein genommen werden. Frankfurt am Mayn 1780. Kommentar: Der umfangreiche Versteigerungskatalog der Sammlung Jacob Bernus wurde von dem Kunsthändler und Kunstschriftsteller Sebastian Heinrich Hüsgen (1745-1807) zusammengestellt. Jacob Bernus (1681-1749) zählte als Bankier zu den reichsten Bürgern Frankfurts. Seine Familie war im 17. Jahrhundert aus Piacenza nach Hanau eingewandert und hatte sich schließlich in Frankfurt niedergelassen. Zunächst engagierte sich die Familie im Tuchhandel, Jacob Bernus wechselte dann ins Bankgeschäft. Als Kreditgeber des Landgrafen Emst Ludwig von Darmstadt geriet Bernus in Schwierigkeiten, als dieser seine Kredite nicht zurückzahlte. Seit 1696 residierte die Familie in dem ehemaligen Saalhof, der 1717 neu aufgebaut wurde und 1724 in den Besitz von Jacob Bernus überging. Dort fand auch die Auktion statt. Wahrscheinlich wurde die Sammlung nach dem Tod seines Sohnes Heinrich (gest. 1781) veräußert. Hüsgen berichtet im Artistischen Magazin von einem "großen Zimmer voller Gemälde bey Wittib Bernus im Saal-Hoff'. Schon ein halbes Jahr vor der Auktion konnten die Gemälde besichtigt werden. Man hatte geradezu ein Museum auf Zeit eingerichtet, um das Interesse an der Sammlung zu steigern. Insgesamt sind 441 Losnummern mit 434 Gemälden verzeichnet, wobei nur die Lose 1 bis 416 aus der Sammlung Bernus stammten. Im Anschluß an die Sammlung Bernus wurden noch einige Bilder aus dem Nachlaß des Rats Jassoy versteigert, zu dessen Besitz auch die am Ende aufgelisteten Kupferstiche gehörten (Nrn. 1 bis 13, S. 44 bis 45). Die Losnummern 430 bis 441 stammten aus einem weiteren Nachlaß, der in den Notizen des Exemplars SIF benannt wird, aber nicht zweifelsfrei zu lesen ist; vermutlich heißt es "Kleinaus Erben". Alle Beschreibungen sind kurz gehalten, oft mit Wertungen verbunden. Die Maße sind stets angegeben, es fehlen jedoch Angaben zum Material. In der Sammlung Bernus überwiegen die holländischen und flämischen Gemälde des 17. Jahrhunderts, darunter acht Werke von Egbert van Heemskerck. Stark vertreten ist aber auch die KATALOGE
103
deutsche Schule, vorwiegend mit Bildern Frankfurter Künstler des 18. Jahrhunderts. Allein 59 Werke stammen von dem zeitweise in Frankfurt lebenden Johann Melchior Roos. Auch Georg Flegel ist mit acht Arbeiten breit repräsentiert. Etwas besser als in den meisten Frankfurter Sammlungen ist die italienische Schule mit insgesamt 37 Arbeiten vertreten, wobei es sich jedoch in vielen Fällen um Kopien handelt. Anonym blieben 94 Gemälde. Bei den zusätzlich angebotenen Bildern handelt es sich fast ausschließlich um anonyme Werke. Nach den Angaben des annotierten Exemplars SIF blieben die erzielten Preise durchgehend auf relativ niedrigem Niveau, der Gesamterlös betrug 4.490 Gulden und 33 Kreuzer für die Gemälde, also etwas mehr als 10 Gulden je Bild. Nur wenige Bilder erzielten Preise über 100 Gulden, so etwa eine Darstellung des Verlorenen Sohnes von "Franck" (Nr. 209), die bei 156 Gulden den Zuschlag erhielt. 30 Gulden kostete ein Selbstportrait von Barent Fabritius, das sich heute im Städelschen Kunstinstitut in Frankfurt befindet (Inv.Nr. 736) und damals als das Bildniß eines Quackers galt (Nr. 201). Unter den Käufernamen finden sich Mitglieder der Familie Bemus mit fast 80 Zuschlägen, wobei es nicht klar ist, ob es sich um Rückkäufe oder zurückgegangene Bilder handelt. Die Frankfurter Kunsthändler hielten sich bei dieser Auktion auffallend zurück. An Johann Christian Kaller gingen 23 Gemälde, Hüsgen selbst übernahm 14 Bilder. Besonders viele Bilder erstand der Käufer Hauser mit mehr als 100 Zuschlägen sowie mit 62 ersteigerten Gemälden der Sammler Ehrmann, bei dem es sich möglicherweise um den Medizinalrat Johann Christian Ehrmann handelt (1749-1827). Lit.: Hüsgen, Art. Magazin 1790, S. XVI, 615; Hirsching 1786/92, Bd. 3, S. 58-64; Gwinner I 1862, S. 534; Dietz 1910/25, Bd. IV, S. 306-309, 388—404; Holst 1931; Schmidt 1960, o.P.; Ausst.-Kat. Frankfurt 1991, Bd. 3, S. 235; Klötzer 1994/96, Bd. 1, S. 61.
135 1781/07/14
[Lugt 3289]
[Anonym]; Frankfurt am Main, Arztischen Hause hinter der schlimmen Mauer Lit. D. Nrs. 93 Verkäufer nach Titelblatt: Keine
ließ sich Moser im württembergischen Ludwigsburg nieder, wo er eine zweite, mit 66 Gemälden bescheidenere Kollektion aufbaute (vgl. Kat. 243). In einer Vorbemerkung werden die Interessenten an den "geschworenen Ausrufer", zu jener Zeit Johann Heinrich Fayh, sowie den "Fürstl. Heßen=Caßelichen Legations= und Crans=Cancellisten, Herrn Cordier, ingleichen bey dem ebenfalls daselbst wohnenden Mahler, Herrn Morgenstern" verwiesen. Außerdem wird betont, daß sich alle Bilder in einem guten Zustand befanden und "die Rahmen theils von Bildhauer=Arbeit und ganz vergoldt, theils schwarz gebeizt, mit vergoldten Stäben" seien. Die Bildbeschreibungen sind knapp gehalten und durch Maß- und Materialangaben ergänzt. Insgesamt werden 112 Gemälde aufgelistet. Am Ende des Exemplars SBF ist ein Los handschriftlich nachgetragen. Anonym bleiben 20 Bilder, einige Bilder werden nur einer Schule zugeordnet. Es überwiegen die Arbeiten zeitgenössischer Künstler aus Frankfurt und Darmstadt wie Franz Hochecker, Justus Juncker, Johann Conrad Seekatz und Johann Georg Trautmann, dessen Taufe des Kämmerers aus dem Mohrenland (Nr. 56) sich heute im Warschauer Nationalmuseum befindet (Wil. 1542). Bei den wenigen holländischen und flämischen Werken handelt es sich oftmals um Kopien. Nach den Angaben des annotierten Exemplars SBF blieben die Preise auf niedrigem Niveau. Für das Bild Sterbender Franciscaner von Rembrandt (Nr. 9) wurden allerdings 81 Gulden bezahlt, zwei Landschaften von Schütz (Nm. 11 und 12) erhielten erst bei 180 Gulden den Zuschlag. Das Gemälde Rembrandts und die beiden Landschaften von Schütz werden auch von dem Weimarer KunstAgenten Johann Christian Merck in einem Brief vom 29.8.1780 erwähnt. Insgesamt 70 Gulden erzielten die Folge der Zwölf Monate aus der Schule von Lucas van Leyden (Nrn. 19 bis 30). Der Gesamterlös betrug 1198 Gulden und 41 Kreuzer, also durchschnittlich 10,6 Gulden je Bild. Lit.: ADB 22 (1885), S. 576-783; Merck 1911, S. 62, Brief vom 29.8.1780; NDB 18 (1997), S. 178-181; Walter Gunzert, Zwischen Spätabsolutismus und Bürgerzeit, Jugend und Frankfurter Jahre von Friedrich Carl von Moser, in: Frankfurt, lebendige Stadt. Vierteljahreshefte für Kultur, Wirtschaft und Verkehr, Heft 1 (1961), S. 4449, 60.
Verkäufer nach anderer Quelle: Presidenten von Moseris Verkäufer: Moser, Friedrich Karl Ludwig, Freiherr von Lose mit Gemälden: 113 Standorte: *SBF Annotiert mit allen Preisen. Aus dem Besitz von Johann Valentin Prehn. Titelblatt: Verzeichnis einer Sammlung von Gemählden, von deutschen, niederländischen, französischen und italiänischen Meistern, so den [14 Julius: handschriftlich ergänzt] 1781. in Frankfurt am Mayn in dem Arztischen Hause hinter der schlimmen Mauer Lit. D. Nro. 93. an den Meistbiethenden verkauft werden sollen. 1781. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog wurde die Sammlung Friedrich Carl Freiherr von Moser (1723-1798) angeboten. Der Hinweis auf den Besitzer findet sich in einer handschriftlichen Notiz auf dem Exemplar SBF aus dem Besitz von Johann Valentin Prehn: "Des Darmstädtischen Name Präsidenten von Moserischen Ausruf." Moser stand viele Jahre in Diensten des Landgrafen von HessenDarmstadt und war 1772-1780 Kanzler und Minister unter Ludwig IX. Moser handelte im Auftrag des Landgrafen mit Frankfurter Banken einen Schuldenvergleich aus und bewahrte die Landgrafschaft vor einem Staatsbankrott. Nach einem Zerwürfnis mit dem Darmstädter Hof wurde Moser 1782 des Landes verwiesen. Aus diesem Grunde veräußerte er vermutlich auch seine umfangreiche Sammlung. Schon 1780 war der größte Teil seiner graphischen Sammlung sowie die Gemäldesammlung in einer anonymen Darmstädter Auktion verkauft worden (vgl. Kat. 127). Wahrscheinlich gingen jedoch die meisten Gemälde zurück, denn sie tauchen fast alle in dieser Frankfurter Auktion erneut auf. Nach seiner Rehabilitierung 1790 104
KATALOGE
136 1781/07/18 [Anonym]; Frankfurt am Main, Scharfischen Saal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 149 Standorte: SBF Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß verschiedener Malereyen, von theils unbekannten, theils bekannten berühmtesten Holländischen, Brabändischen und Französischen Meistern, welche Mittwochs, den 18. des Monats Julii in dem bekannten Scharfischen Saal dahier an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung öffentlich verkauft werden sollen. Frankfurt am Mayn, 1781. Kommentar: In diesem anonymen Frankfurter Versteigerungskatalog wurden insgesamt 149 Gemälde angeboten. Zum Abschluß des Katalogs werden noch zwölf Elfenbeinreliefs anführt (S. 8). Alle Beschreibungen sind sehr kurz und in der Regel nur schlagwortartig gehalten. Die Maße sind angegeben, es fehlen jedoch meist Hinweise zum Material. Bei insgesamt 96 Gemälden wird kein Künstlername genannt. Unter den wenigen zugeschriebenen Bildern finden sich vor allem Arbeiten flämischer Meister, darunter vier Werke von Pieter Bruegel d.Ä. Der deutschen Schule lassen sich nur vier Gemälde zuordnen. Einige Künstlernamen lassen sich nicht identifizieren.
137 1781/09/10 [Anonym]; Bremen, Ohnfern dem Osternthore Verkäufer nach Titelblatt: Keine
37). Da das Exemplar HKB seit 1951 als Verlust geführt wird, können keine weitere Aussagen zum Charakter der Sammlung gemacht werden. Der Katalog ist nachgewiesen im Zettelkatalog HKB (Signatur GB 4013).
Lose mit Gemälden: 160 Standorte: KH Nicht annotiert.
140 1782/01/28
und folgende Tage
[Anonym]; Leipzig, In aedibvs Schvbarthianis Titelblatt: Verzeichnis einer ausgesuchten Sammlung meist Niederländischer Gemähide welche am [lOten Sept. d.J.; handschriftliche Ergänzung] ohnfern dem Osternthore verkaufet werden sollen, Bremen 1781. gedruckt bey Friedrich Meier, E. Hochedlen Hochw. Raths Buchdrucker. Kommentar: In diesem anonymen Versteigerungskatalog wird die Sammlung eines Bremer Bürgers angeboten, der nach den Angaben des Vorworts im 74. Lebensjahr verstorben war und als Kunstkenner bezeichnet wird. Alle Bilder seien gut erhalten und in "verguldeten Rahmen, oder in schwarzen mit verguldeten Leisten" gefaßt. Als Währung wurde der Taler angesetzt. Alle Bilder sind nach ihrem Standort im Haus des Sammlers verzeichnet. Somit läßt sich die Aufstellung dieser Bremer Sammlung sehr gut rekonstruieren. Es werden das Vorhaus, das erste Zimmer, das zweite Zimmer, der obere Vorplatz und der Saal genannt. Alle Beschreibungen sind sehr ausführlich, oftmals handelt es sich um literarische Texte. Zusätzlich werden die Maße und in der Regel das Material angegeben. Bei den meisten Bildern ist ein Künstlername genannt, 27 Gemälde bleiben anonym. Die Sammlung setzt sich fast ausschließlich aus Werken der holländischen und flämischen Schule des 17. Jahrhunderts zusammen, wobei nur vereinzelt ein Maler mit mehr als einem Werk vertreten ist. Von Rembrandt sind allerdings mehrere Arbeiten aufgeführt, darunter Saul und die Hexe von Endor (Hofstede de Groot 1907/27, Bd. 6, Nr. 37a). Die deutsche Schule ist nur mit 13 Arbeiten repräsentiert, der italienischen Schule sind vier Bilder zuzuordnen.
138 1781/10/01
und folgende Tage
[Lugt 3305]
[Anonym]; Frankfurt am Main Verkäufer nach Titelblatt: Carl Geyss Verkäufer: Geyß, Carl Standorte: KKD Seit 1945 verschollen. Nach Lugt nicht annotiert. Kommentar: Dieser Katalog des Frankfurter Bankiers Carl Geyß (1697-1768) enthielt nach den Angaben Lugts insgesamt 747 Gemälde. Das einzige bisher nachweisbare Exemplar des Katalogs aus dem Kupferstichkabinett in Dresden ist seit 1945 verschollen. Die Sammlung wurde erst nach dem Tod der Witwe, Sofie Elisabeth Geyß (gest. 1780), verauktioniert. Lit.: Gwinner 1 1862, S. 533; Dietz 1910/25, Bd. IV.2, S. 684f.; Schmidt 1960, o.P.; Höffner 1992, S. 37.
139 1782/00/00
Daten unbekannt
[Anonym]; Berlin Verkäufer nach Titelblatt: Le comte Henri IX Reuss Verkäufer: Reuß-Köstritz, Heinrich IX. Graf von Standorte: HKB Vermißt seit 1951. Titelblatt: Catalogue de la belle collection de tableaux de feu S.G. Möns, le comte Henri IX Reuss, qui se vendre ä Berlin [1782], Kommentar: Bei dieser Versteigerung wurde die Sammlung des Grafen Heinrich IX. von Reuß-Köstritz (1711-1780) verkauft. Der Sammler wird auch von Matthias Oesterreich im Katalog der Sammlung Johann Gottlieb Stein als Berliner Sammler erwähnt (vgl. Kat.
Verkäufer nach Titelblatt: Caroli Ferdinandi Hommelii domini Zweennavendorf, Quesitz Groszschepe Verkäufer: Hommel, Karl Ferdinand Lose mit Gemälden: 40 Standorte: BRB Nicht annotiert. Titelblatt: Bibliotheca viri quondam svmme venerandi et illustris Caroli Ferdinandi Hommelii domini Zweennavendorf, Qvesitz, Groszschepe. Ecclesiae cathedralis mars bvrgicae capitvlaris Ser. Electori Saxoniae a consiliis avlae et ivstitiae cvriae svpremae provinc. assessoris facvltatis ivridicae ordinarii ac decret alivm professoris academiae decemviri et consiliarii etc. exhibens apparatvm librorvm ex omni doctrinarvm genere cum copia dissertationvm mstis diplomat imaginibus aere expressis cataphracta scriniis librorum etc. qvibus in aedibus Schvbarthianis licitationis lege distrahendis constitvta est dies XXVIII ianvar. cloloccLXXXII. Lipsiae ex officina Loeperia. Kommentar: In dieser Auktion wurde in erster Linie die umfangreiche Bibliothek des Juristen Karl Ferdinand Hommel (1722-1781) versteigert. Hommel praktizierte erst als Anwalt und wurde 1750 als außerordentlicher Professor an die juristische Fakultät der Leipziger Universität berufen. Hommels zahlreiche Publikationen beschäftigen sich mit der Reform des Strafrechts. Unter den insgesamt 5.999 Losnummern befinden sich nur 40 "Schildereyen". Die meisten Bilder sind anonym, die wenigen zugeschriebenen stammen zumeist von flämischen Künstlern, so beispielsweise vier Bilder von Jan Breughel d.Ä. und Hendrik van Baien d.Ä. Lit.: ADB9(1972), S. 592.
141 1782/02/18
und folgende Tage
[Lugt 3367]
Bolzmann; Regensburg, in der Bolzmannischen Behausung, in der Spiegelgaße Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 65 Standorte: *BNP Annotiert mit allen Preisen. KKBa Nicht annotiert. UBAg Nicht eingesehen. Titelblatt: Catalogue von alten und neuen zum Theil sehr raren und fürtreflichen Kupferstichen aus der Teutschen, Niederländischen, Französischen und Italienischen Schule, nebst einigen schönen Gemählden und Kunstbüchern, welche den 18ten Febr. 1782. und folgende Täge Nachmittgas um 2 Uhr in der Bolzmannischen Behausung, in der Spiegelgaße, an dem Meistbiethenden durch öfentliche Versteigerung, gegen baare Bezahlung in Conventions=Geld abgegeben werden. NB. Dieses Verzeichnis wird in der Boltzmannischen Behausung gratis ausgetheilt. Regensburg, gedruckt mit Breitfeldischen Schriften. Kommentar: In diesem umfangreichen Versteigerungskatalog des Regensburger Kunsthändlers Johann Friedrich Boltzmann wurden vor allen Dingen graphische Arbeiten angeboten, insgesamt 4.096 Nummern. Auf den Seiten 266 bis 269 des Katalogs sind auch 65 Losnummern mit Gemälden aufgeführt. Alle Beschreibungen sind KATALOGE
105
kurz gehalten, Maßangaben fehlen. Bis auf neun anonyme Arbeiten sind alle einem Künstler zugeschrieben. Die kleine, aber homogene Sammlung präsentiert alle Schulen, wobei die Gemälde der deutschen Schule einen Schwerpunkt bilden. Bei den meisten Werken handelt es sich um Kopien. Es findet sich u.a. ein Werk von Lucas van Leyden (Nr. 38) und eine Kopie nach Jusepe de Ribera (Nr. 7). Nach den Angaben des annotierten Exemplar BNP wurden fast alle Bilder verkauft. Die Preise bewegten sich auf niedrigem Niveau zwischen einer und zehn Währungseinheiten (vermutlich Gulden). Nur wenige Gemälde erzielten deutlich höhere Preise wie beispielsweise Die drey Weisen aus dem Morgenland von Pietro Testa (Nr. 15), das bei 50 Einheiten zugeschlagen wurde.
Watteau (Nr. 196) sowie weitere sechs Bilder im Gusto Watteaus, darunter zwei Werke eines Monogrammisten D. (Nrn. 291 bis 292). Auch die italienischen Schulen sind nur mit neun Arbeiten vertreten. Bei den insgesamt 118 deutschen Bildern überwiegen Werke der sächsischen Landschaftsmaler, so ist Christian Wilhelm Ernst Dietrich allein mit 15 Bildern, Heinrich Leichner mit 14 und Johann Christian Klengel mit sechs Arbeiten vertreten. Aber auch Hamburger Maler wie Balthasar Denner, Johann Georg Stuhr und Johann Christian Vollerdt wurden mehrfach aufgeführt. Möglicherweise hatte der Sammler gute Kontakte nach Leipzig und Dresden, wo Leichner und Dietrich tätig waren.
143 1782/05/29-1782/05/31 142 1782/03/18
und folgende Tage
[Lugt 3391]
Peter Texier; Hamburg, Haus des Sammlers, auf dem großen Bleichen Verkäufer nach Titelblatt: Joachim Hinrich Thielcke Verkäufer: Thielcke, Joachim Hinrich Lose mit Gemälden: 485 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Catalogus einer vortrefflichen Sammlung Cabinet=Mahlereyen, welche vor fünfzig und mehreren Jahren mit vielem Gusto und Kenntniss gesammelt worden, und sich unter dem Nachlass des seel. Herrn Joachim Hinrich Thielcke befinden, in dessen Sterbehause auf den grossen Bleichen selbige auch den 18 Merz, 1782, und folgende Tage durch Mackler Peter Texier an den Meistbietenden, gegen baare Bezahlung in grob Courant, öffentlich verkauft werden sollen. Acht Tage vorher können solche in beliebigen Augenschein genommen werden. Catalogi sind bey benannten Mackler und Wittwe Tramburgen a 2 Sch. den Armen zum Besten zu haben. Gedruckt bey D.A. Harmsen. Kommentar: Dieser Auktionskatalog des Hamburger Maklers Peter Texier verzeichnet die umfangreiche Gemäldesammlung von Joachim Hinrich Thielcke, die nach dem Tode des Besitzers in dessen Sterbehause Auf den großen Bleichen versteigert wurde. Insgesamt wurden 485 Gemälde angeboten. Unter den Losnummern 470 und 471 werden außerdem zwei Pastelle auf Pergament aufgeführt, bei den Nummern 473 bis 475 handelt es sich um Federzeichnungen. Die Nummern 476 bis 485 verzeichnen Malereien auf Glas. Abschließend werden noch "Kupferstiche unter Glas und Rahmen" (Nrn. 487 bis 502) aufgeführt; als Nr. 497 findet sich jedoch ein weiteres Gemälde. Unter den beiden letzten Nummern (503 und 504) werden je zwei Gegenstücke von Hendrick Bogaert angeboten. Drei Nummern des Katalogs sind doppelt belegt (Nrn. 95, 285 und 304). Alle Beschreibungen sind kurz gehalten und oft mit ästhetischen Wertungen verbunden. Das Material ist in der Regel angegeben. In tabellarischer Form werden die Maße angeführt. Die Künstlernamen gehen den Bildbeschreibungen als Überschriften voraus. Insgesamt 106 Einträge weisen keine Künstlernamen auf und werden als "Unbekannt" vorgestellt. Den größten Anteil nehmen Gemälde der holländischen und flämischen Schule mit insgesamt 139 Bildern ein, darunter allein 19 Gemälde, die entweder als Arbeiten der Rembrandt-Schule oder seiner Nachahmer ("im Geschmack von") vorgestellt werden. Kein Bild Rembrandts wird als Original bezeichnet. Dies mag als Indiz dafür dienen, wie sehr Rembrandt in dieser Zeit geschätzt wurde und wie möglichst viele Bilder als Manier Rembrandts offeriert wurden. Unter den 49 flämischen Gemälden fällt eine Gruppe von Landschaften von Bredael auf. Zu den Besonderheiten gehören zwei Gemälde des flämischen Malers Laureys Goubau (Nrn. 236 und 237), von dem nur noch ein weiteres Gemälde versteigert wurde und dessen Werk heute nahezu unbekannt ist. Unter den wenigen französischen Bildem findet sich eine Karnevalsszene von Jean Antoine 106
KATALOGE
[Lugt 3449]
Fey; Frankfurt am Main, Anwesen, Hochgräfl. von Schönbornischen Hof Verkäufer nach Titelblatt: Keine Verkäufer nach anderer Quelle: Dorhorst Verkäufer: Thorhorst, Caspar Lose mit Gemälden: 153 Standorte: *SBF Annotiert mit allen Preisen auf am Ende des Katalogs eingebundenen Leerseiten. Aus dem Besitz von Johann Valentin Prehn. Titelblatt: Verzeichniß von guten Gemälden, welche Im Monat Junii 1782 in Frankfurt durch den öffentlichen Ausruf an den Meistbiethenden überlassen werden sollen. Kommentar: Nach einer handschriftlichen Notiz am Ende des Exemplars SBF aus dem Besitz von Johann Valentin Prehn wurde mit dieser Versteigerung der Nachlaß des Frankfurter Sammlers Caspar Thorhorst verauktioniert. Dort heißt es: "Dieses ist das Verzeichnis der Gemälde des seel. H. Dorhorst. Er war kayserl. Post Secretair hieselbsten und starb ledigen Standes. Seine Hinterlassenschaft erhielten die nechsten auswärtigen Erben, 5 an der Zahl. NB Die Versteigerung ging schon d. 29 und 31 ten May für sich." In einer kurzen Vorbemerkung wird von dem von der Stadt Frankfurt bestellten Ausrufer bei Auktionen, Johann Heinrich Fayh, mitgeteilt, daß die Gemälde täglich morgens und nachmittags im Schönbornschen Hof besichtigt werden können. Der Termin der Auktion werde in den öffentlichen Wochenblättern angekündigt. Die Bildbeschreibungen sind kurz gehalten und jeweils in nur einen Satz gefaßt, in dem auch der Künstlername und die Maße angegeben werden. In einem Nachwort wird erwähnt, daß sich alle Bilder in einem neu vergoldeten Rahmen befänden. Insgesamt wurden 153 Gemälde angeboten, von denen 80 anonym bleiben. Bei den Losnummern 154 und 155 handelt es sich um Pastelle, Nummer 156 ist eine Rötelzeichnung unter Glas. Unter den zugeschriebenen Werken sind insgesamt 28 Bilder der holländischen und flämischen sowie 25 der deutschen Schule zuzuordnen. Bei den deutschen Werken überwiegen Bilder von Künstlern aus dem Frankfurter Raum. Mit insgesamt elf Werken vertreten ist Jeremias Paul Schweyer, der 1782 zum Hofmaler in Zweibrücken ernannt worden war und 1790 nach Frankfurt übersiedelte. Nach den Angaben des annotierten Exemplars SBF blieben die Preise auf niedrigem Niveau, meist unter 10 Gulden, oftmals sogar unter einem Gulden. Vereinzelt erzielten Bilder höhere Preise, vor allem Holländer, aber auch ein Gemälde Annibale Carraccis (Nr. 35) mit 44 Gulden. Verglichen mit anderen Frankfurter Verkäufen hielten sich aber auch die Höchstpreise in bescheidenem Rahmen. Insgesamt wurden 1148 Gulden und 50 Kreuzer umgesetzt, was einen Durchschnittspreis von etwas mehr als 7 Gulden ausmacht. Lit.: Hüsgen 1780, S. 315; Hüsgen, Art. Magazin 1790, S. VI; Gwinner I 1862, S. 534; Schmidt 1960, o.P.
144 1782/07/00
Daten unbekannt
[Lugt 3455]
[Anonym]; Frankfurt am Main, Senkenbergischen Stiftungshause auf der grossen Eschenheimergasse Verkäufer nach Titelblatt: Der Selige Herr Hofrath und Doctor Medicinae Practicus zu Frankfurt am Mayn, Joh. Christian Kißner Verkäufer: Kißner, Johann Christian, Dr. Lose mit Gemälden: 218 Standorte: SIF Annotiert mit allen Preisen. Am Ende des Katalogs befindet sich eine längere handschriftliche Bemerkung. *SBF Annotiert in Bleistift mit allen Preisen. Aus dem Besitz von Johann Valentin Prehn. Titelblatt: Verzeichniß von Gemälden welche der Selige Herr Hofrath und Doctor der Medicinae Practicus zu Frankfurt am Mayn, Joh. Christian Kißner mit vieler Mühe und langer Zeit gesammelt und die im Monat Julii 1782 durch öffentliche Versteigerung an den Meistbietenden überlassen werden sollen. Frankfurt am Mayn, gedruckt mit Brönnerischen Schriften. Kommentar: In der Versteigerung der Sammlung des Frankfurter Arztes Johann Christian Kißner (1717-1781) wurden 228 Lose angeboten, von denen 218 Gemälde verzeichnen. Schon dessen Vater Johann Georg Kißner (1673-1735) besaß ein berühmtes Naturalienkabinett (Herbarium), das von Uffenbach beschrieben wurde. In einer kurzen Vorbemerkung wird im Hinblick auf die Gemälde darauf hingewiesen, daß "diese Sammlung nicht von den zahlreichsten ist," jedoch vor dem Auge des Kenners Bestand haben würde. Daß eine Sammlung mit mehr als 200 Gemälden im Frankfurt jener Zeit nicht mehr als eine umfangreiche Sammlung verstanden wurde, zeigt wie sehr sich die Sammelkultur in kurzer Zeit entfaltet hatte und daß es durchaus auch darum ging, möglichst viele Bilder sein eigen zu nennen. Für alle Interessierten war die Sammlung während der Ostermesse an drei Tagen im Senckenbergischen Stiftungshaus zu besichtigen. Der genaue Termin der Versteigerung sollte durch die Presse angekündigt werden. Die Beschreibungen sind kurz gefaßt, aber detailliert und mit Maßangaben versehen. Ohne die Angabe eines Künstlernamens bleiben 45 Gemälde. Es überwiegen Arbeiten flämischer und holländischer Künstler, darunter zahlreiche Jan Breughel d.Ä. zugeschriebene Bilder. Eine Reihe von Bildern werden als "Franck" bezeichnet und sind daher nicht genau zuzuordnen. Die deutsche Schule ist mit insgesamt 39 Werken vertreten, darunter vor allem Werke Frankfurter Künstler wie Johann Daniel Bager, Johann Georg Trautmann und Georg Flegel, von dem fünf Bilder angeboten wurden. Die italienischen Schulen sind nur mit sieben Werken vertreten. Nach den Angaben des annotierten Exemplars blieben die Preise auf niedrigem Niveau, meist unter 10 Gulden, oftmals sogar unter einem Gulden. Zahlreiche Preisangaben sind jedoch nicht zweifelsfrei lesbar. Insgesamt wurden 1.015 Gulden und 56 Kreuzer erlöst, also 4,5 Gulden je Losnummer. Lit.: Gwinner 1 1862, S. 533; Schmidt 1960, o.P.
145 1782/08/21
und folgende Tage
Hinrich Jürgen Köster; Hamburg, Haus des Sammlers, zu Ende des Kehrwieders Verkäufer nach Titelblatt: Herrn Moddermann Verkäufer: Moddermann Lose mit Gemälden: 88 Standorte: *KH Annotiert mit allen Käufernamen und Preisen mit Ausnahme der Bücher. Titelblatt: Catalogue einer vortreflichen Sammlung Cabinet=Mahlereyen, welche mit vielem Gusto seit langen Jahren gesammelt worden, und sich unter dem Nachlaß des sei. Herrn Moddermann befin-
den, in dessen Sterbehause zu Ende des Kehrwieders selbige auch den Auctionarium Hinrich Jürgen Köster den 21 August 1782 und folgende Tage verkauft werden sollen, auch einen Tag vor der Verkaufung in beliebigem Augenschein zu nehmen; dabey befindet sich eine Parthey Naturalien und verschiedene Kun[st]stücke, nebst einem Appendix von Mignatur=Gemählden, und einen Anhang von mehrentheils theologischen und historischen Büchern. Hamburg, gedruckt von C. W. Meyn, E. Hochedl. und Hochw. Raths Buchdrukker. Kommentar: In dieser Versteigerung des Hamburger Auktionators Hinrich Jürgen Köster gelangte die Sammlung Moddermann mit 88 Gemälden zum Verkauf. Die gesamte Gemäldeabteilung umfaßte 96 Losnummern, bei den Nummern 89 bis 96 handelt es sich jedoch um Wasserfarben. In einer zweiten Abteilung wurden unter der Überschrift "Kunst=Stücke" verschiedene technische Instrumente und Kuriosa verkauft, so beispielsweise ein grönländischer Kahn (Nrn. 97 bis 184; S. 10 bis 15). Anschließend werden noch Kupferstiche, Miniaturen und Bücher aufgeführt (S. 15 bis 38). Unter den Büchern finden sich auffallend viele theologische Werke niederländischer Sprache. Die Beschreibungen sind kurz aber detailliert. Zu allen Bildern werden Angaben zum Material und zu den Maßen gemacht. Unter den Gemälden überwiegen Werke der holländischen und flämischen Schule. Die deutsche Schule ist mit 32 Arbeiten vertreten, darunter vor allem Hamburger Künstler wie Johann Georg Stuhr, Anton Tischbein und Jacob Weyer. Hinzu kommen noch einige Werke, bei denen nur die Initialen der Künstler angegeben sind und die als Monogrammisten erfaßt wurden. Bei dem Monogrammisten A.S. handelt es sich möglicherweise um den Hamburger Maler Andreas Scheits. Anonym bleiben nur fünf Gemälde. Nach den Angaben des annotierten Exemplars bewegten sich die Preise auf niedrigem Niveau zwischen 5 und 30 Mark. Nur vereinzelt erzielten einzelne Bilder deutlich höhere Summen, so bezahlte Johann Benjamin Ehrenreich für zwei Stilleben von Johann Baptist Hälszel 178 Mark. Nach einem handschriftlichen Vermerk im Exemplar KH (S. 2) wurden alle rot unterstrichenen Gemälde von Johann Benjamin Ehrenreich erworben, insgesamt sind dies 19 Bilder. Unter den sonstigen Käufern finden sich die Kunsthändler Francois Didier Bertheau ("Bertow"), Johann Jobst Eckhardt und Peter Sieberg.
146 1782/09/30
und folgende Tage
[Lugt 3465]
[Anonym]; Frankfurt am Main, Haus des Sammlers, Zur goldenen Kette, Lit. F. Nr. 104 Verkäufer nach Titelblatt: Johann Noe Gogelschen Erben zu Frankfurt am Mayn Verkäufer nach Exemplar des Auktionators: Johann Noe Gogel; Jacob Bernus; Heinrich Dominicus von Heyden; und Matthias d'Orville Verkäufer: Gogel, Johann Noe; Bernus, Jacob; Heyden, Heinrich Dominicus von; Orville, Johann Matthäus d' Lose mit Gemälden: 479 Standorte: SBFI Annotiert mit allen Käufernamen und Preisen auf eingebundenen Leerseiten. *SIF I Annotiert mit allen Käufernamen und Preisen auf eingebundenen Leerseiten. SIF II Annotiert in Bleistift mit allen Käufernamen und Preisen auf eingebundenen Leerseiten. SBF II Nicht vollständig, es fehlen die Seite 41 bis 46. Annotiert mit allen Käufernamen und Preisen. Am Ende des Katalogs befindet sich eine handschriftliche Bemerkung über die Eigentümer. Aus dem Besitz von Johann Valentin Prehn. NGL Annotiert mit allen Preisen auf eingebundenen Leerseiten. KATALOGE
107
SBB SBBal
Nicht annotiert. Nicht annotiert. Aus dem Besitz von Joseph Heller (deutsche Ausgabe). SBBa II Nicht annotiert (französische Ausgabe). ZBZ Nicht annotiert. SBH Nicht eingesehen, und vielleicht im Zweiten Weltkrieg vernichtet. UBH Nicht eingesehen. Titelblatt: Verzeichnis von Gemählden der besten und berühmtesten italienischen, französischen, teutschen und niederländischen Meister, welche die Johann Noe Gogelschen Erben zu Frankfurt am Mayn durch öffentliche Versteigerung an die Meistbietenden zu überlassen gesonnen sind. Frankfurt am Mayn, gedruckt mit Eichenbergischen Schriften 1781. Catalogue de tableaux des meilleurs maitres Italiens, Francois, Allemands & Flamands, que les H6retiers de feu Mr. Jean Noe Gogel ä Francfort sur le Mein mettent en vente au plus offrant. Francfort sur le Mein. Imprim6 chez les Heritiers de J. L. Eichenberg. 1781. Kommentar: In diesem umfangreichen Versteigerungskatalog wurde die Sammlung des Frankfurter Bankiers Johann Noe Gogel angeboten (1715-1781). Seine Familie stammte aus den Niederlanden und war im 17. Jahrhundert nach Frankfurt gekommen, um dort zunächst einen Tabakhandel zu betreiben. Später wurde auch ein Bankhaus begründet, das der Familie beträchtlichen Reichtum zuführte. Die im Haus der Familie, dem Stadthaus "Zur goldenen Kette", aufgestellte Sammlung war über mehrere Generationen hinweg aufgebaut worden. In einem Gemälde von Christian Stöcklin aus dem Jahre 1776 wird ein Besuch des Kunstschriftstellers Heinrich Sebastian Hüsgen bei Gogel dargestellt. Auch liefert Hüsgen in seinen "Nachrichten" eine genaue Beschreibung der Gogelschen Sammlung, die in vier großen Galerieräumen ausgestellt waren. Neben den 404 Gemälden aus der Gogelschen Sammlung wurden am Ende des Katalogs noch einige Gemälde aus anderen Sammlungen hinzugefügt, wie aus einer handschriftlichen Vorbemerkung in dem von Johann Valentin Prehn annotierten Exemplar SBF II hervorgeht. Hier ist auch das Datum für die Auktion festgehalten. Bei den Losnummern 409 bis 488 handelte es sich um Restbestände aus der Sammlung Jacob Bernus (vgl. Kat. 134), bei den Nummern 489 bis 494 um Bilder aus der Sammlung des Hofrates Heinrich Domenicus von Heyden, bei den Nummern 495 bis 501 um Bilder aus dem Besitz von Matthias d'Orville. Nach einer kurzen Vorbemerkung folgt ein alphabetisches Verzeichnis der im Katalog aufgeführten Künstler, das allerdings keine Verweise auf Seiten oder Losnummern enthält. Da auch ein Verzeichnis in französischer Sprache hergestellt wurde, erhofften sich die Erben wohl auch Käufer aus dem Ausland. Die Bildbeschreibungen sind kurz gehalten und durch Maßangaben ergänzt. Es überwiegen Werke der holländischen und flämischen Schule des 17. Jahrhunderts, besonders zahlreich sind jedoch die Arbeiten deutscher Künstler des 18. Jahrhunderts, die im Frankfurt-Darmstädter Raum gewirkt haben. Von Christian Georg Schütz waren allein 21 Werke im Angebot und der Darmstädter Hofmaler Johann Conrad Seekatz war mit 20 Bildern vertreten. Die italienische Schule wurde mit 30 Werken repräsentiert, darunter sieben Tugendbildnisse und eine Darstellung der Hochzeit von Kanaa von Jacopo Tintoretto. Anonym blieben nur 35 Gemälde. Nach den Angaben des annotierten Exemplars aus dem Besitz von Prehn bewegten sich die Preise zwischen 5 und 50 Gulden, es wurden jedoch in zahlreichen Fällen noch deutlich höhere Preise erzielt. Insgesamt wurden auf der Auktion mit dem Verkauf der Gogelschen Bilder 15.458 Gulden umgesetzt, was einen sehr hohen Durchschnittspreis von etwas mehr als 38 Gulden je Bild ergibt. Unter den Käufern engagierte sich vor allem Henriette Amalie von Anhalt-Dessau, die insgesamt 43 Gemälde erstand, darunter der nur für neun Gulden erworbene Ölberg von Johann Melchior Roos (Nr. 132, heute Anhaltische Ge108
KATALOGE
mäldegalerie Dessau, Inv.-Nr. 1434). Die von Henriette Amalie angekauften Gemälde waren 1877 Teil der Amalienstiftung und gingen an die Anhaltische Gemäldegalerie Dessau. Zahlreiche Gemälde wurden auch von den Sammlern Friedrich Wilhelm Hoynck und Johann Friedrich Müller sowie den Kunsthändlern Heinrich Sebastian Hüsgen, Georg Friedrich Moevius und dem Nürnberger Johann Jacob Wild erworben. Lit.: Hüsgen 1780, S. 24, 37, 64, 185f„ 334; Gwinner I 1862, S. 534; Schmidt 1960, o.P. 147 1783/06/19
[Lugt 3594]
Reimarus; Hamburg, Börsen=Saal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 229 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß und kurzgefaßte Beschreibung einer Gemälden=Sammlung, welche den 19. Juni 1783. auf dem Börsen=Saal in Hamburg öffentlich an die Meistbietende verkauft werden sollen, durch die Mackler Reimarus, Texier, von der Meeden und Brandt. Gedruckt bey Gottl. Friedr. Schniebes, 1783. Kommentar: Diese Versteigerung wurde von den vier Hamburger Maklern Reimarus, Peter Texier, von der Meden und Johann Wilhelm Brandt zusammen organisiert. In einer "Nachricht" zu Anfang des Katalogs werden neben den Maklern vier weitere Personen aufgeführt, die Aufträge zu Geboten auf die Bilder angenommen haben: Johann Dietrich Lilly Senior, Anton Tischbein, Johann Benjamin Ehrenreich und Johann Hinrich Schön. Zudem findet sich der Hinweis: "Sollte sich, spätestens acht Tage vor dem Verkaufstermin ein Liebhaber zu der ganzen Sammlungen finden, so ist man erbötig, darüber in Unterhandlung zu treten." Insgesamt umfaßt dieser Katalog 229 Nummern. Alle Beschreibungen sind kurz gefaßt aber durch die Maßangaben ergänzt. Die Künstlernamen werden neben den Losnummern als Überschriften gegeben, was den Katalog im Gegensatz zum gedrängten Druck früherer Hamburger Kataloge wesentlich übersichtlicher macht. Wie in den meisten Hamburger Sammlungen überwiegen die Werke der holländischen und flämischen Schule, darunter fünf Peter Paul Rubens zugeschriebene Werke. Etwas besser als in den meisten Hamburger Sammlungen ist die französische Schule mit 16 Arbeiten vertreten, darunter sechs Bilder von Pierre Labatie. Verglichen mit anderen Hamburger Sammlungen ist der Anteil der deutschen Werke mit 32 Beispielen nur relativ klein. Die meisten deutschen Gemälde stammen von Hamburger Malern des 18. Jahrhunderts. Die italienischen Schulen sind mit 13 Werken vertreten. Das Exemplar KH der Kunsthalle enthielt vereinzelte Angaben der Preise, die jedoch nicht mehr lesbar sind, weil die Ränder abgeschnitten wurden.
148 1783/08/01
und folgende Tage
[Lugt 3608]
Rost; Leipzig Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 100 Standorte: *RKDH Annotiert mit allen Käufernamen und Preisen. Photokopien: NGL und FLNY (beide RKDH) Titelblatt: Verzeichniss einer ansehnlichen Kupferstich-Sammlung gröstentheils seltener und meisterhafter Blätter von Deutschen, Niederländischen, Französischen, Italiänischen alten und neuen Meistern nebst einer Sammlung von Handzeichnungen, Gemählden, Kupferstichwerken und Kunstbüchern welche nach der unterm 30ten Nov. 1782. bekannt gemachten Ankündigung, von dem ver-
pflichteten Universitäts-Proklamatore C. G. Weigel, den lten August 1783. zu Leipzig an die Meistbiethenden gegen baare Bezahlung in Louis d'ors ä 5 Rthlr. oder Sächs. Conventions-Gelde, überlassen werden sollen. Leipzig, gedruckt bey Gotthelf Albrecht Friedrich Löper. Kommentar: Dieser Katalog kündigt die erste Versteigerung der Leipziger Kunsthandlung Rost an, deren einmal jährlich stattfindende Auktionen zu einer Institution werden sollten. Der Leipziger Kunsthändler Carl Christian Heinrich Rost (1741-1798) hatte sich zunächst durch die Herstellung von Gipsabgüssen einen Namen gemacht. Mit einer Proklamation vom 30. November 1782 forderte er Anbieter auf, Kunstwerke für eine erste Auktion einzuliefern, die dann am 1. August 1783 durchgeführt wurde. In der Einführung des Katalogs bittet Rost um Verständnis für eventuelle Fehler, denn der "Liebhaber und Sammler kennt gewiss die Schwierigkeiten, welche der Anfang eines jeden Unternehmens dieser Art mit sich führt". Die angebotenen Gemälde stammen von verschiedenen Anbietern, die jedoch nicht namentlich erwähnt werden. In erster Linie enthält dieser Katalog Kupferstiche, Zeichnungen und Bücher, jedoch auch 100 Gemälde (S. 217 bis 233). Ein Künstlerregister erleichtert den Zugang zu den einzelnen Losnummern. Alle Gemälde des Katalogs sind kurz, aber detailliert beschrieben und mit Maßangaben versehen. Die meisten Bilder gehören der deutschen Schule des 18. Jahrhunderts an, darunter vier Arbeiten des Leipziger Malers Johann Adam Fassauer und zehn Bilder von Alexander Thiele. Zwölf Bilder sind der holländischen und flämischen Schule zuzurechnen, insgesamt 25 den italienischen Schulen. Unter den italienischen Bildern überwiegt ebenfalls das 18. Jahrhundert, wobei allein drei Bilder von Giuseppe Nogari und vier Viehstücke von Francesco Londonio stammen. Der Zuschreibung an Nogari liegt eine stilistische Einschätzung zugrunde, denn im Katalog heißt es: "scheint von Nogari zu seyn" (Nr. 59). Vermutlich kannte Rost die Bilder Nogaris in der Dresdener Gemäldegalerie. Auch die Zuschreibung des Bildes Zwey Liebende an Giorgione (Nr. 51) beruht wahrscheinlich auf einer stilistischen Einschätzung. Nach den Angaben des annotierten Katalogs RKDH bewegten sich die erzielten Preise auf niedrigem Niveau. Einzelne Bilder erzielten höhere Preise, so beispielsweise ein Viehstück von Londonio, das bei 14 Talern zugeschlagen wurde. Einige Bilder wurden vermutlich von einem Vertreter der Kunsthandlung Rost namens Korn zurückgekauft, da diese in der folgenden Auktion erneut angeboten wurden. Lit.: Trautscholdt 1957.
149 1784/05/11 Herr Köster; Hamburg, Sterbehaus im Jungfernstieg Verkäufer nach Titelblatt: Ein beträchtlicher Nachlass Lose mit Gemälden: 124 Standorte: *KH Annotiert sowohl in Bleistift als auch in Tinte auf eingebundenen Leerseiten mit den meisten Käufernamen und zahlreichen Preisen. Titelblatt: Catalogue eines beträchtlichen Nachlasses von Cabinet= Mahlereyen und Kupferstichen, wovon einige unter Glas und mit Rahmen garnirt wie auch eine zahlreiche Naturaliensammlung von verschiedenen Erz= und Steinarten, worunter sehr viele Edle, welche angeschliffen, auch theils zu Ringen aptirte, befindlich; sehr schön faconirte Pretiosa, als: Ringe von Edelsteinen in Gold gefaßt, Haarnadeln, Petschiere, goldene und silberne Uhren, Tabatieren, Spanische Röhre mit goldenen Knöpfen, wie auch Damen=Etuits mit Haken, Berlocks, und verschiedene optische als auch andere dergleichen Kunststücke, Porcellainene Gruppen und Figuren, welche von Gips und vergoldet, nebst dergleichen metallene, besonders moderne Cabinetten, eine süperbe Wasa=Uhr mit Flöten von spielenden
plaisanten Stücken, ein Bureaux, alles von dem schönsten Mahagoniholtz und feinsten Verzierungen und gleicher Vergoldung; ein Trimo=Spiegel und Consol=Tisch mit Italienischem Marmor und neuesten Facon, ec. welche den 11. May in einem bekannten Sterbhause im Jungfernstieg durch den Auctionarium Herrn Köster, öffentlich an den Meistbietenden gegen baare Bezahlung in grob Cour, verkauft werden sollen. [1784], Kommentar: Neben Naturalien und Schmuckgegenständen wurden in dieser von dem Hamburger Auktionator Hinrich Jürgen Köster durchgeführten Versteigerung auch 124 Gemälde verkauft (S. 1 bis 8). Da das Exemplar HK des Katalogs am unteren Rand beschnitten worden ist, läßt sich dort das Datum der Auktion nicht mehr lesen. Die fehlende Angabe des Jahres "1784" wurde bei der Bindung jedoch außen angebracht. Die Angaben zu den Bildgegenständen und den Künstlernamen sind in den ersten zehn Gemäldeeinträgen auf französisch abgefaßt. Alle Beschreibungen sind knapp gehalten, Materialien und Maße werden angegeben. Bei den ersten zehn Losen handelt es sich fast ausschließlich um Gemälde französischer Künstler, so von Louis Simon Tiersonnier de Quennefer, Charles de Lafosse und Antoine Boizot. Ab der Losnummer 11 werden vor allem Werke der holländischen, flämischen und deutschen Schule verzeichnet. Bei den deutschen Bildern überwiegen Hamburger Künstler. 26 Bilder bleiben anonym. Nach den Annotationen des Exemplars KH blieben die Preise auf niedrigem Niveau, meist unter 20 Mark und oftmals noch deutlich darunter. Unter den Käufern finden sich die Namen Adler, Effinger, Feindt sowie der Kunsthändler Francis Didier Bertheau. Die ersten, in französischer Sprache abgefaßten Losnummern, tauchen wenige Jahre später in einem anderen Hamburger Katalog wieder auf und werden dort in derselben Reihenfolge und ebenfalls in Französisch aufgelistet (Kat. 198, Nrn. 1 bis 10). Da diese Nummern in dem Katalog von 1784 nicht annotiert sind, wurden sie vermutlich nicht verkauft.
150 1784/06/07
und folgende Tage
[Lugt 3737]
Bolzmann; Regensburg, In der Bolzmannischen Behausung an der Spiegelgaße Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 4 Standorte: *BNP Annotiert mit allen Preisen. KKD Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Nach Lugt annotiert und mit Preisen versehen. KKBa Nicht annotiert. RKDH Nicht annotiert. Titelblatt: Catalogue von alten und neuen zum Theil sehr raren und fürtreflichen Kupferstichen aus der Teutschen, Niederländischen, Englischen, Französischen und Italienischen Schule, nebst einer Verzeichniß von Künstler=Portraiten und ganzen Werken, welche den 7ten Junii 1784 und folgende Täge unausgesetzt Nachmittags um 2 Uhr in der Bolzmannischen Behausung an der Spiegelgaße, an dem Meistbiethenden durch öffentliche Versteigerung gegen baare Bezahlung in Conventionsmäßigen Geld verkauft werden. NB. Dieser Catalog wird in der Bolzmannischen Behausung gratis ausgetheilt und die jeden Tag vorkommende Kupferstiche können eine Stunde vor der Auction in Augenschein genommen werden. Regensburg, gedruckt mit Breitfeldischen Schriften. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog des Regensburger Kunsthändlers Johann Friedrich Boltzmann wurde erneut (vgl. Kat. 141) eine umfangreiche Sammlung graphischer Arbeiten mit insgesamt 3.643 Losen angeboten, die größtenteils aus der Nürnberger Sammlung Silberrad stammten, wie im Vorwort angeführt wird. Auf den Seiten 290 bis 292 sind unter der Rubrik "Ganze Werke und eiKATALOGE
109
nige Catalogue und Gemähide" neben Büchern und einer Sammlung von ausgestopften Vögeln auch vier Gemälde angeboten, darunter ein Türkenkopf in Rembrandtscher Manier.
151 1784/08/01
und folgende Tage
[Lugt 3762]
C.C.H. Rost; Leipzig Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 25 Standorte: *BDu Annotiert mit allen Käufemamen und Preisen. RKDH Annotiert mit den meisten Käufemamen und Preisen. Die Käufemamen sind oft nur als Initialen angegeben. SBBa Nicht annotiert. Aus dem Besitz von Joseph Heller. RMA Nicht eingesehen. Nach Lugt nicht annotiert. UBAg Nicht eingesehen. Titelblatt: Verzeichniss einer ansehnlichen Kupferstich-Sammlung gröstentheils seltener und meisterhafter Blätter von Deutschen, Niederländischen, Englischen, Französischen, Italiänischen alten und neuen Meistern nebst einer Sammlung von Handzeichnungen, Gemählden, Kupferstichwerken, Kunstbüchern und Musicalien welche nach der unterm 30ten Nov. 1782. bekannt gemachten Ankündigung, von dem verpflichteten Universitäts-Proclamatore C. G. Weigel, den lten August 1784. zu Leipzig an die Meistbiethenden gegen baare Bezahlung in Louis d'ors ä 5 Rthlr. oder Sächs. ConventionsGelde, überlassen werden sollen. Leipzig, gedruckt bey Gotthelf Albrecht Friedrich Löper. Kommentar: Nach dem Erfolg einer ersten Auktion im Jahre 1783 führte die Rostsche Kunsthandlung 1784 erneut eine Versteigerung durch. Die Versteigerungen fanden von nun an bis zur Jahrhundertwende jährlich statt. Anbieter konnten für diese Auktion seit dem 30. November 1783 Kunstwerke einliefern. Erstmals erwähnte Carl Christian Heinrich Rost (1741-1798) im Anhang seiner Einführung die von ihm verwendete Literatur. Wie in der ersten Auktion wurden vor allem graphische Arbeiten und Bücher verkauft. Die graphischen Blätter waren nach den einzelnen Einlieferern zu Partien sortiert; nur innerhalb dieser versuchte Rost, eine Ordnung nach Künstlern einzurichten. Der Katalog ist allerdings durch ein Register erschlossen. Im letzten Teil des Katalogs werden insgesamt 27 Losnummern mit Gemälden aufgeführt, von denen einige schon in der ersten Auktion auftauchten und vermutlich von einem Vertreter der Kunsthandlung Rost zurückgekauft wurden, der im annotierten Exemplar des Katalogs aus der Kunsthandlung Boemer als "Korn" bezeichnet wird. Zu den erneut angebotenen Bildern zählten beispielsweise sechs Geflügelstücke des Leipziger Malers Johann Adam Fassauer (Nm. 156 bis 159). Die meisten Bilder gehörten der deutschen Schule des 18. Jahrhunderts an. Die Preise bewegten sich auf niedrigem Niveau. Den höchsten Preis erbrachte ein Viehstück von Johann Christian Klengel mit 3 Talern und 4 Groschen (Nr. 138), während beispielsweise zwei Tafeln von Lucas Cranach mit Adam und Eva (Nr. 160) nur einen Taler und 15 Groschen erzielten. Lit.: Trautscholdt 1957.
SBBa SBF II SIF
Annotiert mit Schätzpreisen. Aus dem Besitz von Joseph Heller. Nicht annotiert. Nicht annotiert.
Titelblatt: Verzeichnung einer schönen Sammlung guter Gemähide von berühmten Niederländischen, Italiänischen und Deutschen Meistern, welche zu Frankfurt am Mayn in dem Senckenbergischen Stifftungs=Hauße den 2ten August dieses Jahrs, und die darauf folgende Tage öffentlich an den Meistbietenden gegen baare Bezahlung überlassen werden sollen, welche bereits allwöchentlich, zweymahl, als Dienstags und Freytags Nachmittags von 2 bis 5 Uhr in Fünf großen Zimmern in besagtem Senckenbergischen Stiftungs= Hauße hinter der sogenannten schlimmen Mauer besehen werden können. Verzeichnisse hiervon werden Littera D. Nro. 127. auf der kleinen Eschenheimer Gasse gratis ausgegeben. Frankfurt am Mayn 1784. Kommentar: In diesem umfangreichen Versteigerungskatalog wurden insgesamt 734 Losnummern mit 703 Gemälden angeboten. Vermutlich hatte der Frankfurter Kunsthändler Johann Benjamin Nothnagel für diese Auktion Gemälde verschiedener Einlieferer zusammengestellt, denn in der kurzen Vorbemerkung heißt es: "Sowohl auswärtige als hiesige Familien, die in mich ihr Vertrauen gesetzet, haben mir wiederum die Direction über dieses Geschäfte in Auftrag gegeben." In dem Exemplar SBF I ist vor den Losnummern 1 bis 436 handschriftlich jeweils einer der Buchstaben Α bis F eingetragen, die auf verschiedene Anbieter verweisen. Bei dem Anbieter "B" handelt es sich vermutlich um Johann Philipp Mergenbaum, da einige der angebotenen Bilder von ihm auf einer Frankfurter Auktion am 27. September 1779 (Kat. 125) ersteigert worden waren. Alle Bilder sind kurz in einem Satz beschrieben, wobei die Maße immer, die Materialien jedoch nur in Einzelfallen angegeben werden. Wie bei den meisten Frankfurter Auktionen stammten die meisten Gemälde von zeitgenössischen Künstlern des Frankfurter Raums, so von Johann Andreas Herrlein, Johann Albrecht Friedrich Rauscher und Johann Conrad Seekatz. Von dem vornehmlich in Fulda tätigen Johann Andreas Herrlein wurden allein 23 Gemälde angeboten. Neben den deutschen Bildern standen vor allem Werke flämischer und holländischer Künstler auf der Angebotsliste. Anonym blieben 118 Werke, zahlreiche Künstlernamen ließen sich zudem nicht eindeutig zuordnen. Nach den Angaben des annotierten Exemplars SBF I bewegten sich die erzielten Preise auf durchgehend niedrigem Niveau und erreichten selten mehr als 10 Gulden je Gemälde. Unter den Käufern finden sich vor allem Frankfurter Sammler und Kunsthändler wie Carl Traugott Berger, Georg Friedrich Moevius und Friedrich Samuel von Schmidt, aber auch Henriette Amalie von Anhalt-Dessau, die allein 110 Bilder erwarb. Lit.: Schmidt 1960, o.P., (Nothnagel); Rudolf Rieger, Graphikhandel im 18. Jahrhundert: Die Firma Artaria und Johann Gottlieb Prestel, in: Ausst.-Kat. Frankfurt 1991, Bd. 3, S. 203-207; s. auch im Katalogteil S. 236-239.
153 1784/08/13 152 1784/08/02
und folgende Tage
[Lugt 3763]
Johann Andreas Benjamin Nothnagel, der Aeltere; Frankfurt am Mayn, in dem Senckenbergischen Stifftungs-Hauße Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 703 Standorte: *SBF I Annotiert mit allen Käufernamen und Preisen auf eingebundenen Leerseiten am Ende des Katalogs. Bei den Losen 1 bis 436 sind auch die Initialen der Verkäufer vermerkt. 110
KATALOGE
Denecken; Hamburg, Börsensaal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Verkäufer nach anderer Quelle: Pasche; Flügge Verkäufer: Pasche; Flügge Lose mit Gemälden: 130 Standorte: *KH Annotiert mit den meisten Käufemamen und Preisen. Am Ende des Katalogs wurden noch einige Lose handschriftlich hinzugefügt. Titelblatt: Nachlaß theils Italienischer, Französischer, Niederländischer und Deutscher Cabinet=Gemählde, welche mit vieler Kennt-
niß gesammelt werden, wobey einige auf Glas ganz seltene, wie auch Migniatur-Stücke und Kupferstiche, unter Glas und Rahmen, befindlich, und werden solche am Freytage, den 13ten August, 1784, auf dem Börsensaal, durch die Mackler Deneken & Hagedorn gegen baare Zahlung in grob Courant, öffentlich an den Meistbietenden verkauft. Diese Mahlereyen sind, wie gewöhnlich, Tages vorher auf dem Börsen=Saal in beliebigem Augenschein zu nehmen. Catalogi sind bey benannten Macklern gratis zu haben. Hamburg, gedruckt bey Johann Matthias Michaelsen. Kommentar: In dieser Versteigerung wurden durch die Hamburger Makler Matthias Denecken und Hagedorn wahrscheinlich die Sammlungen Pasche und Flügge verauktioniert, da diese beiden Namen auf dem Titelblatt des Exemplars KH handschriftlich ergänzt worden sind. Der Katalog verzeichnet 106 Gemälde sowie Miniaturen und Kupferstiche (Nrn. 107 bis 137). Im Anhang befinden sich zwei von Hand geschriebene Listen mit weiteren Einträgen zu Gemälden, darunter neun Bilder von Dubuisson. Insgesamt umfaßt das Exemplar KH 130 Losnummern mit Gemälden. Die unter den ersten 33 Losnummern aufgeführten Gemälde wurden ungerahmt angeboten, die übrigen waren hingegen gerahmt. Zum größten Teil (Nrn. 34 bis 95) handelt es sich um "fein vergoldete Rahmen, nur wenige sind im Holz gebeitzte". Fast alle Bildbeschreibungen sind kurz gehalten, jedoch oft mit Wertungen versehen. Wie das Titelblatt des Katalogs ankündigt, handelt es sich um eine Sammlung von Gemälden der italienischen, französischen, niederländischen und deutschen Schule, darunter jeweils eine größere Anzahl von Gemälden von einem Künstler (neun Werke von Dubuisson, acht Werke von Orazio Grevenbroeck, fünf bzw. sechs von Christian Wilhelm Ernst Dietrich und Alexander Thiele). Nach den Angaben des annotierten Exemplars KH erzielte ein Jagdstilleben von Jan Fyt (Nr. 54) mit 100 Mark den höchsten Preis, gefolgt von einer Historie aus der Schule von Rubens für 76 Mark (Nr. 55). Den gleichen Preis erzielte eine Darstellung Maria mit dem Christkind (Nr. 62). Überwiegend bleiben die Preise jedoch auf niedrigem Niveau. Unter den Bildern der deutschen Schule erreichte ein Musizierender Bauer von Dietrich in der Manier von David Teniers (Nr. 20) mit 42 Mark das höchste Ergebnis. Unter den Käufemamen finden sich vor allem die Kunsthändler Francois Didier Bertheau, Johann Benjamin Ehrenreich und Dietrich Lilly Senior.
154 1784/09/27
und folgende Tage
[Lugt 3776]
[Anonym]; Frankfurt am Main, In dem Senckenbergischen Stiftungs=Hause Verkäufer nach Titelblatt: Freyherrl. von Berberichschen Erben Verkäufer: Berberich, Franz Ludwig, FreiheiT von Lose mit Gemälden: 226 Standorte: SBF II Annotiert mit allen Käufernamen und Preisen auf eingebundenen Leerseiten; wahrscheinlich handelt es sich um das Exemplar des Auktionators. Die Annotationen sind schwer zu lesen (deutsche Ausgabe). *SBF I Annotiert mit allen Käufernamen und Preisen auf eingebundenen Leerseiten. Aus dem Besitz von Johann Valentin Prehn (deutsche Ausgabe). SIF Annotiert mit einigen Käufernamen und allen Preisen, meistens in Bleistift (deutsche Ausgabe). BNP Nicht annotiert. LBDa I Nicht annotiert (deutsche Ausgabe). SBBa Nicht annotiert. Aus dem Besitz von Joseph Heller (französische Ausgabe). LBDa II Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Titelblatt: Verzeichniß von Gemälden der berühmtesten Niederländischen, Französischen, Italiänischen und Deutschen Meister, welche von den Freyherrl. von Berberichschen Erben zu Frankfurt am
Mayn in dem Senckenbergischen Stiftungs=Hause nach der nächstbevorstehenden Herbst=Messe, Montags den 27. September und die darauf folgenden Täge, öffentlich überlassen werden sollen; auch können sämtliche Gemälde, welche in dem besagten Senkenbergischen Stiftungs=Hause hinter der sogenannten schlimmen Mauer aufgestellt sind, wöchentlich zweymal, als Dienstags und Freytags von zwey bis fünf Uhr besehen werden. Frankfurt am Mayn, 1784. Gedruckt bey Heinrich Ludwig Brönner. Catalogue d'une collection de tableaux des meilleurs maitres flamands, fran^ois, Italiens et allemands, que les heritiers de feu Mr. le Baron de Berberich mettront en vente au plus offrant Lundi le 27. Septembre et les jours suivants dans la maison de fondation de feu Mr. Senkenberg rue dite Schlimme Mauer ä Francfort sur le Mein exposes en attendant dans la dite maison, oü les amateurs peuvent les voir deux fois par semaine savoir Mardi & Vendredi depuis 2 heures aprfes midi jusqu'ä 5 heures du soir. Imprime en 1784 par Henri Louis Broenner. Kommentar: In dieser umfangreichen Auktion wurde die Gemäldesammlung aus dem Nachlaß des Freiherrn Franz Ludwig von Berberich (gest. 1784) versteigert. Berberich leitete von 1768 bis 1784 das Thurn-und-Taxissche Postwesen in Frankfurt, das schon sein Vater Georg Friedrich von Berberich (1722-1768) verwaltet hatte. Die kaiserliche Hauptpost befand sich seit 1766 im Berberichschen Haus auf der Südseite der Zeil (Nr. 31). Nach der Versteigerung der Gemäldesammlung 1784 wurde ein Jahr später die Bibliothek verauktioniert, die "nicht weniger als 17.236 Werke aus allen Wissenschaften in schönen, guten und dauerhaften Einbänden" enthielt (Schönberger 1982, S. 270). Die meisten Lose werden nur knapp beschrieben. Oftmals sind mehrere Bilder unter einer Losnummer verzeichnet, meist zwei, jedoch in Einzelfällen bis zu fünf. Unter den insgesamt 284 Losnummern finden sich eine große Zahl von Miniaturgemälden und Pastellen, Aquarellen sowie Wachsbildnissen und Glasbildern, so daß sich insgesamt nur eine Gesamtzahl von 226 Gemälden ergibt. Unter ihnen überwiegen Werke holländischer und flämischer Meister sowie Bilder zeitgenössischer deutscher Künstler, vorwiegend aus dem Frankfurter Raum. Viele dieser Glasbilder stammen von dem Maler Spengler, von dem auch eine Reihe von Kopien am Ende des Katalogs aufgelistet werden. Im annotierten Exemplar SBF sind alle Käufemamen und Preise vermerkt. In einer handschriftlichen Vorbemerkung dieses Katalogs heißt es: "Die Preisse und Namen der Ersteigerer sind nach einem vom Maler Wüst ausgefüllten Cataloge bemerkt." Femer wird in dieser Vorbemerkung notiert, daß es sich bei den Preisangaben vor einigen Losnummern (Nrn. 1, 11, 22,42, 50, 52, 64, 84, 85) um Höchstgebote handle, die der Maler Johann Caspar Wüst bei der Auktion beachten mußte. Vermutlich hat Wüst im Auftrag eines Sammlers geboten. Bei zwei Bildern von Christian Heinrich Schütz (Nr. 64a) reichte sein Limit von 160 Gulden nicht aus, so daß hier ein anderer Käufer zum Zuge kam. Diese Gemälde wurden erst bei 181 Gulden zugeschlagen und waren damit die teuersten Bilder der Auktion. Unter den Käufemamen finden sich neben einigen auswärtigen zahlreiche Frankfurter Kunsthändler wie Heinrich Sebastian Hüsgen, Johann Christian Kaller und Johann Andreas Benjamin Nothnagel. Hinzu kommen Sammler wie Johannes Barensfeld, Johann Georg Huth, Carl Traugott Berger und Johann Friedrich Müller sowie Henriette Amalie von Anhalt-Dessau. Eine Landschaft mit Ruinen von Pierre van der Borcht (Nr. 47) und eine Serie von drei Türkischen Großherren von Johann Heinrich Tischbein (Nr. 76) befinden sich heute in der Anhaltischen Gemäldegalerie in Dessau (Inv.-Nrn. 450, 129, 660 und 670). Die erzielten Preise lagen durchschnittlich zwischen einem und 20 Gulden. Der Gesamterlös belief sich auf 2.799,45 Gulden. Lit.: Gwinner I 1862, S. 534; Dietz 1910/25, Bd. 3, S. 367; Schmidt 1960, o.P.; Schönberger 1982.
KATALOGE
111
155 1785/03/14
und folgende Tage
J.G. Hillmann; Dresden, In dem Waltherischen Hause, auf der großen Bruder-Gasse Verkäufer nach Titelblatt: Aus dem Nachlaß Hrn. Christian Gotthold Crußius, weil. Churfl. Sächß. Hofraths Verkäufer: Crußius, Christian Gotthold Lose mit Gemälden: 40 Standorte: *SBBa Annotiert mit allen Preisen. Aus dem Besitz von Joseph Heller. Titelblatt: Verzeichniß einer Kupferstich=Sammlung von Deutschen, Italiänischen, Französischen, Englischen, Niederländischen alten und neuen Meistern und radirten Blättern, wie auch einigen Hand=Zeichnungen und Gemählden, aus dem Nachlaß Hrn. Christian Gotthold Crußius, weil. Churfl. Sächß. Hofraths, welche den 14. März 1785 und folgende Tage von dem verpflichteten Churfürstl. Bücher=Auctionator J. G. Hillmann zu Dreßden in dem Waltherischen Hause, auf der großen Brüder=Gasse, an die Meistbiethenden, gegen baare Bezahlung, überlassen werden sollen. Friedrichstadt, gedruckt mit Gerlachschen Schriften. Kommentar: In diesem umfangreichen Katalog des Dresdener Bücher-Auktionators J. G. Hillmann wurden vor allem graphische Arbeiten aus der Sammlung von Christian Gotthold Crußius angeboten. Auf den Seiten 193 bis 206 enthält der Katalog die Abteilung "Original=Handzeichnungen und Gemälde", die die Losnummern 3370 bis 3668 umfaßt. Die Beschreibungen sind zum Teil auf deutsch, zum Teil auf französisch abgefaßt und sehr knapp gehalten. Auf die Benennung des Gegenstands folgt die Angabe des Künstlernamens, auch werden Signaturen und Datierungen verzeichnet. Zeichnungen, die den Großteil dieser Abteilung ausmachen, sind zwar zumeist als solche ausgewiesen, sie werden aber nicht klar von den Gemälden unterschieden. In den meisten Fällen war es deshalb nicht eindeutig zu klären, ob es sich um ein Gemälde oder um eine Zeichnung handelt. Wahrscheinlich dienten die wenigen Gemälde oder einige gerahmte Zeichnungen, die als Gemälde aufgefaßt wurden, zur Dekoration der Wände in Crußius' Kupferstichkabinett. Unter den insgesamt 40 hier aufgenommenen Losnummern überwiegen deutsche Arbeiten des 18. Jahrhunderts, darunter allein fünf von dem Dresdener Landschaftszeichner und Maler Friedrich Christian Klaß. Nach den Angaben des annotierten Exemplars SBBa lagen fast alle Preise auf niedrigstem Niveau, zumeist deutlich unter einem Taler.
156 1785/04/22 Texier; Hamburg, Börsen=Saale
handelt es sich um Gemälde, darunter vereinzelt Arbeiten "hinter Glas" (Nr. 137) oder "von Stein ausgelegt" (Nr. 128). Die Beschreibungen sind zumeist knapp gehalten, neben der Angabe der Künstlernamen finden sich einzelne Datierungen verzeichnet. In der Sammlung überwiegen Bilder der holländischen und flämischen Schule. Es folgt eine große Anzahl von Gemälden der deutschen Schule des 18. Jahrhunderts, darunter fünf Werke des sächsischen Landschaftsmalers Johann Christian Vollerdt und sechs Portraits von Balthasar Denner. Unter den holländischen Gemälden fällt eine Gruppe von fünf Stilleben von Willem Claesz. Heda auf, von Cornells de Heem wurden vier Gemälde zum Verkauf angeboten. Klaes Molenaer ist ebenfalls mit vier Werken vertreten. Anonym bleiben in dieser Versteigerung nur elf Gemälde.
157 1785/05/17
und folgende Tage
[Lugt 3884]
[Anonym]; Mainz, In dem freyherrlichen von Fürstenbergischen Hofe in der sogenannten goldnen Lust Verkäufer nach Titelblatt: Sr. Excellenz des verstorbenen Hrn. Grafen von Elz, weiland Domprobstes zu Mainz und Minden... Verkäufer: Eitz, Hugo Franz Karl, Graf von Lose mit Gemälden: 1131 Standorte: *SAW Protokoll mit allen Käufemamen und den Preisen. IFP Nicht annotiert (französische Ausgabe). KH Nicht annotiert (deutsche Ausgabe). LBDa Nicht annotiert (deutsche Ausgabe). Bute Nicht annotiert (französische Ausgabe). Photokopien: VAL (aus Bute) Titelblatt: Verzeichnis der Gemäldesammlung Sr. Excellenz des verstorbenen Herrn Grafen von Elz, weiland Domprobstes zu Mainz und Minden, Kapitular des Domstiftes zu Trier und St. Albanstifts zu Mainz, Probstes des Kaiserl. Königl. Stifts zu Pechwarad in Niederhungarn, Sr. Kaiserl. Königl. Majestät und Sr. Kurfürstl. Gnaden zu Mainz geheimen Raths und Statthalters im Eichsfeld ec. welche den 17. May zu Mainz öffentlich versteigert wird. Mainz, gedruckt in der Kurfürstl. privil. Hof= und Universitätsbuchdruckerey bey I. I. Alef, Häfner sei. Erben 1785. Catalogue d'une collection de tableaux de feu son excellence Mr. le comte d'Elz, grand prevöt de l'eglise metropolitaine de Mayence et de la cathedrale de Minden, chanoine capitulaire des eglises metropolitaine de Treves et de l'equestre de S. Alban ä Mayence, prevöt de l'eglise royale de Pechwarad en Basse Hongrie, conseiller intime de S.M. I. et de S. Α. I. de Mayence, Statthalter des pays d'Eichsfeld &c. qui seront mis en vente au plus offrant le 17 May ä Mayence. Mayence l'Imprimerie de la Cour & de l'Universite par J. J. Alef, Heretier Haeffner, 1785.
Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 147 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Catalogue einer ansehnlichen Sammlung Niederländischer und Italiänischer Cabinet=Mahlereyen nebst einigen Kunst= Sachen von Bernstein, Elfenbein ec. von einem Liebhaber gesammelt, welche am Freytag, den 22 April, auf dem hiesigen Börsen= Saale an die Meistbietenden verkauft werden sollen durch die Mackler Texier, J.W. Brandt & von der Meden, bey welchen der Catalogue beliebigst abzufordern. Besagte Gemähide und Kunst=Sachen sind am obgenannten Orte den Tag vor dem Verkaufen gefälligst in Augenschein zu nehmen. Gedruckt bey Dietrich Anton Hansen. Hamburg, Anno 1785. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog der Hamburger Makler Johann Wilhelm Brandt, von der Meden und Peter Texier sind insgesamt 177 Losnummern aufgeführt. Bei den Nummern 1 bis 147 112
KATALOGE
Kommentar: In dieser Versteigerung der Sammlung des Mainzer Dompropstes Hugo Franz Karl Graf von Eitz (1701-1779) gelangten mehr als 1.100 Gemälde zum Verkauf. Eitz hatte in rund 30 Jahren eine der umfangreichsten Sammlungen in Deutschland zusammengetragen, die in der Mainzer Dompropstei und in den Eltzschen Anwesen in Eltville und Ettersheim ausgestellt wurde. Insgesamt umfaßte die Kollektion mehr als 2.000 Bilder. Auf Wunsch des Dompropstes wurde eine Auswahl von 1.100 Gemälden in dem Versteigerungskatalog erfaßt. In einer zweiten Auktion im September 1785 wurden dann nochmals fast 900 Bilder verkauft (vgl. Kat. 157a). Schon im September 1779 wurden Möbel und andere Kunstgegenstände verauktioniert (vgl. die Verkaufsprotokolle im Würzburger Staatsarchiv). Nach dem letzten Willen des Grafen von Eitz sollte dessen Sammlung nach seinem Tode wieder zerstreut werden, nur 100 Bilder dachte er seiner Familie zu. Im Testament des Verstorbenen wurde verfügt, daß der Auktionskatalog zusammengestellt und "nach Rußland, England und Amsterdam geschickt werde, da er von da occasionaliter kostbare Stücke bekommen habe und da dort der
innere Wert am besten erkannt und bezahlt werde" (zitiert nach Veit 157a 1785/09/22 und folgende Tage 1924, S. 140). [Anonym]; Mainz Die Bildbeschreibungen des Versteigerungskatalogs sind kurz geVerkäufer nach Titelblatt: Graf von Elz halten und ohne erkennbare Ordnung zusammengestellt worden. Die Verkäufer: Eitz, Hugo Franz Karl, Graf von Maße werden nach dem Pariser Schuh angegeben. Der Beginn der Auktion wurde auf den 17. Mai 1785 festgelegt, zuvor war die Lose mit Gemälden: 860 Sammlung zweimal wöchentlich zu besichtigen. Der "Anzeige" des Standorte: Katalogs zufolge fand die Auktion an allen folgenden Tagen von 9 *SAW Protokoll mit allen Käufernamen und allen Preisen. bis 10.30 Uhr und nachmittags von 2.30 bis 6 Uhr statt. DurchgeKommentar: Zu dieser Auktion wurde kein Katalog gedruckt. Es hat führt wurde die Versteigerung im freiherrlich von fürstenbergischen sich aber im Staatsarchiv Würzburg ein Auktionsprotokoll erhalten Hof in der sogenannten "goldnen Lust". Zusammen mit den Gemäl(Aschaffenburger Archivreste, Fase. 79/XVII, Nr. 13, 289 bis 310), den wurden auch einige Marmorbüsten ("Köpfe von Marmeln") sodas unter folgendem Titel geführt wird: "Versteigerungs Protocoll wie Münzen und Muscheln angeboten. Deren zur Verlassenschafts Masse des hochseligen Tit: Herrn DomEitz hatte vermutlich systematisch Auktionen in den Niederlanden probstes Grafen von Elz gehörigen geringeren Mahlereyen". besucht, um dort Gemälde einzukaufen, so beispielsweise zehn BilEs handelt sich bei dieser Auktion um den Verkauf des zweiten, der eines Passionszyklus' von Arert de Gelder (Nrn. 205 bis 214), als weniger bedeutend eingestuften Teils der Sammlung des Mainzer die Eitz vermutlich 1770 auf der Amsterdamer Auktion des DuDompropstes Hugo Franz Karl Graf von Eitz (1701-1778). Eitz fresne-Nachlasses (Lugt 1862; vgl. auch Kat. 60) erworben hatte. hatte in rund 30 Jahren eine umfangreiche Sammlung zusammengeHeute sind diese Bilder als Bestandteil der Bayerischen Staatsgetragen, die in der Mainzer Dompropstei und in den Eltzschen Anwemäldesammlungen im Schloß Johannisburg in Aschaffenburg ausgesen in Eltville und Ettersheim ausgestellt wurde. Insgesamt umfaßte stellt. Dem Verkaufsprotokoll zufolge wurden diese zehn Bilder die Kollektion mehr als 2.000 Bilder. Auf Wunsch des Dompropstes nicht verkauft. Sie gelangten vermutlich später in die Sammlung des wurde zunächst eine Auswahl von 1.100 Gemälden in einem geErzbischofs von Mainz, Friedrich Karl Joseph Freiherr von Erthal druckten Versteigerungskatalog erfaßt und im Mai 1785 verauktio(1719-1802), der sie in seine Residenz nach Aschaffenburg brachte. niert (vgl. Kat. 157). In der hier vorgestellten zweiten Auktion im Noch rund 20 weitere Bilder der Eltzschen Sammlung finden sich September 1785 wurden dann nochmals fast 900 Bilder verkauft, im Aschaffenburger Schloß, darunter auch ein als Pieter Lastman die insgesamt 2.400 Gulden erbrachten. bezeichnetes Bild (Nr. 145), das heute als Antiveduto della GramIn dem Verkaufsprotokoll sind die Bildtitel nur sehr knapp angematica gilt (Inv.-Nr. 6289). Ansonsten überwiegen in der Sammlung geben, meist reduziert sich die Beschreibung auf Schlagworte wie Eitz Arbeiten flämischer und holländischer Künstler. Gut vertreten Landschaft mit Vieh. Künstlernamen werden kaum genannt. Versind aber auch die italienischen Schulen. In der kleinen Gruppe der mutlich waren die Bilder nicht ausschließlich anonym, jedoch hat französischen Werke finden sich 16 Werke eines Passionszyklus' in man bei der Vorbereitung dieser Auktion mit den Restbeständen der der Manier von Nicolas Poussin. Sammlung Eitz wenig Mühe darauf verwandt, die Künstlernamen zu Im Staatsarchiv Würzburg hat sich ein handschriftliches Versteidokumentieren. Die Gemälde werden nicht in ihrer Reihenfolge aufgerungsprotokoll mit Preisen und Käufernamen erhalten (Aschaffengeführt, sondern tauchen in wahlloser Folge auf. Nach den Angaben burger Archivreste, Fase. 79/XVII, Nr. 13, fol. 237 bis 286). Statt des Protokolls blieben die Preise auf sehr niedrigem Niveau, viele der veranschlagten 43.000 Gulden wurden nur 30.000 Gulden erlöst. Bilder erreichten nicht einmal den Preis von einem Gulden. Unter In der zweiten Auktion wurden im September 1785 nochmals 890 den Käufern finden sich andere Namen als bei der Auktion im Mai Lose für 2.400 Gulden versteigert (vgl. Kat. 157a). Die Gewinne der 1785 (Kat. 157). Wiederum stammten die Interessenten fast ausVersteigerung gingen nach dem Wunsch des Verstorbenen an das schließlich aus dem Umkreis des Mainzer Hofes, jedoch bei diesem Priesterhaus in Marienborn. Unter den Käufern finden sich nach AnVerkauf eher aus den niedrigen Rängen sowie aus dem Bürgertum. gaben des handschriftlichen Protokolls einige Händler, so etwa JoLit.: Veit 1924, S. 140-199; Tenner 1966, S. 116-118; Cremer hann Nikolaus Leutzgen, der vor allem an den Pfalzgrafen Carl II. 1989, S. 359, Anm. 312. August (vgl. Kat. 267) lieferte und schließlich Hofkunsthändler wurde. Die von dem Mainzer Kurfürsten Friedrich Karl Joseph Freiherr von Erthal erworbenen Bilder wurden überwiegend durch den Maler 158 1785/07/07-1785/07/08 Georg Joseph Melber angekauft. In dem Inventar sind bei einigen Michael Bostelmann; Hamburg, Börsen=Saal Bildern, die später nach Aschaffenburg gelangten, die Preise durchgestrichen. Wahrscheinlich handelt es sich hier um Rückgänge, die Verkäufer nach Titelblatt: Herrn Anthon Tischbein zunächst an das Stift in Marienborn gelangten und erst nach der SäVerkäufer: Tischbein, Johann Anton kularisation nach Aschaffenburg kamen. Der größte Teil der Käufer Lose mit Gemälden: 32 stammte aus dem Kreis des Mainzer Klerus' und den Beamten des Standorte: kurfürstlichen Hofes. Vereinzelt traten auch Frankfurter Sammler KH Nicht annotiert. auf. So beispielsweise Johann Friedrich Ettling und Friedrich Wilhelm Hoynk. Das Preisniveau lag relativ hoch, die meisten Bilder Titelblatt: Catalogue einer großen und schönen Sammlung Französiwurden zu 10 bis 100 Gulden verkauft, vereinzelt jedoch auch zu scher, Italienischer und Niederländischer Kupferstiche, Historische sehr hohen Preisen, so wurden beispielsweise zwei Landschaften mit und Academische Zeichnungen, wie auch einige schöne Gemähide, Vieh von Johann Melchior Roos (Nrn. 98 und 99) dem Kunsthändler welches alles aus der Verlassenschaft des sei. Herrn Anthon TischJohann Nikolaus Leutzgen bei 501 Gulden zugeschlagen. In den beins, welcher am hiesigen Gymnasio als Zeichenmeister rühmlich Bayerischen Staatsgemäldesammlungen in Aschaffenburg befinden gestanden, und am Donnerstage und Freytage, den 7 und 8ten Julius, sich heute 51 der in dieser Auktion versteigerten Gemälde, ein mya.c. auf dem hiesigen Börsen=Saal öffentlich an den Meistbietenden thologisches Historienbild von Dirck van Baburen (Nr. 717) ist im verkauft werden soll durch den Makler Michael Bostelmann, bey Rijksmuseum in Amsterdam (Inv.-Nr. A 1606). welchem diese Designation beliebig abzufordern. Dieses alles kann Lit.: Veit 1924, S. 140-199 (mit Abdruck des gesamten Katalogs, S. des Morgens vor der Verkaufung an besagtem Orte gefällig besehen 145-197); Holst 1960, S. 164f.; Tenner 1966, S. 116-118; Cremer werden. Gedruckt bey Dietrich Anton Harmsen. Hamburg, Anno 1989, S. 359, Anm. 312. 1785. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog wurde die Kunstsammlung des Malers Johann Anton Tischbein (1720-1784) veraukKATALOGE
113
tioniert. Anton Tischbein ging 1749 mit seinem Bruder Johann Heinrich Tischbein d.Ä. nach Italien (1750/51 in Rom), 1753 war er als Lehrling an der Akademie in Den Haag eingeschrieben. Seit 1766 lebte er in Hamburg, gründete dort eine eigene Zeichenschule und war seit 1780, worauf im Titelblatt Bezug genommen wird, an der Gelehrtenschule des Johanneums als Zeichenlehrer tätig. 1771 erschien seine Schrift "Unterricht zu gründlicher Erlernung der Malerey." Anton Tischbein malte vor allem Landschaften, meist mit Staffagefiguren aus der römischen oder biblischen Geschichte, und Bildnisse. In dem insgesamt 505 Einträge umfassenden Katalog werden die "Schildereyen" unter den Nrn. 474 bis 505 verzeichnet. Es handelt sich fast ausschließlich um Arbeiten von Tischbein selbst, die ohne Angabe der dargestellten Themen aufgeführt sind: "Eine römische Geschichte, von Ant. Tischbein"; "Zwo dito von demselben"; "Zwo Landschaften von dito" etc. Ein weiteres Gemälde ist Ottmar Elliger zugeschrieben (Nr. 504), acht Gemälde bleiben anonym oder werden als "unbekannt" verzeichnet. Am Ende der Einträge findet sich der Hinweis: "Und andre [Gemälde] mehr, so hier nicht benannt sind."
159 1785/10/17
und folgende Tage
[Lugt 3942]
C.C.H. Rost; Leipzig, Im rothen Collegio
binette eines Kenners, verdienen also von Kennern bemerkt zu werden." Da nach Nr. 84 ein dicker Balkenstrich die folgenden Losnummern separiert, ist anzunehmen, daß hier die oben erwähnte Sammlung ihren Abschluß findet. Anschließend folgen vermutlich Gemälde verschiedener Anbieter, die ebenfalls durch Balkenstriche voneinander getrennt werden. Der größte Teil der Gemälde ist der deutschen Schule des 18. Jahrhunderts zuzurechnen. So enthält der Katalog zahlreiche Arbeiten von Jakob Samuel Beck, der niederländische Genrestücke imitierte. Nach den Angaben des annotierten Exemplars BDu bewegten sich die gezahlten Preise auf niedrigem Niveau; die meisten Bilder wurden für weniger als 3 Taler zugeschlagen. Etwas höher lagen einige holländische Gemälde des 17. Jahrhunderts, so beispielsweise eine anonyme Landschaft für immerhin 13 Taler. Wahrscheinlich hat der ehemalige Besitzer des Exemplars BDu Aufträge für zwei Kunden entgegengenommen, denn die Namen "Buch" und "Weis" finden sich handschriftlich vermerkt auf der linken Seite unterhalb der Losnummer, die Limite sind am Ende der Bildbeschreibungen notiert. Für Buch sind 18 Aufträge festgehalten (Nrn. 7, 13, 14, 22, 35, 36, 37, 38, 47,48, 59, 75,76, 77, 85, 86, 87, 88), von denen jedoch nur die Nummern 75 bis 77 erfolgreich ausgeführt werden konnten. In den übrigen Fällen lagen die Limite geringfügig unter dem schließlich erzielten Preis. Lit.: Trautscholdt 1957.
Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 103 Standorte: *BDu Annotiert mit allen Käufemamen und Preisen. SBBa Nicht annotiert. Aus dem Besitz von Joseph Heller. KKD Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Nach Lugt nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniss einer ansehnlichen Kupferstich-Sammlung gröstentheils seltener und meisterhafter Blätter von Deutschen, Niederländischen, Englischen, Französischen, Italienischen alten und neuen Meistern nebst einer Sammlung von Handzeichnungen, Gemählden, Kupferstichwerken, Kunstbüchern und Kunstsachen, welche nach der unterm 30ten Nov. 1782. bekannt gemachten Ankündigung, von dem verpflichteten Universitäts-Proclamatore C. G. Weigel, den 17ten Octob. 1785 zu Leipzig im rothen Collegio an die Meistbiethenden gegen baare Bezahlung in Louisd'ors ä 5 Rthlr. oder Sächs. Conventions-Gelde, überlassen werden sollen. Leipzig, gedruckt bey Gotthelf Albrecht Friedrich Löper. Kommentar: Bei dieser Versteigerung handelt es sich um die dritte der seit 1783 jährlich stattfindenden Auktionen der Rostschen Kunsthandlung in Leipzig. Die Kunstwerke stammten von verschiedenen Einlieferern. Im Gegensatz zu den ersten beiden Auktionen wurde diese Versteigerung nicht am 1. August, sondern erst am 17. Oktober, kurz nach der Michaelismesse, durchgeführt, da im Juli und August eine größere Bibliothek in Leipzig verauktioniert wurde. Während der Messe konnten die Kunstwerke im Rothen Collegio, einem Universitätsgebäude in der Ritterstraße 16, besichtigt werden. Wie in den ersten beiden Katalogen informiert Rost die Kunstinteressierten in einer ausführlichen Einführung und stellt die Künstlernamen in einem Register zusammen. Alle Beschreibungen sind recht ausführlich und mit Wertungen ausgestattet. Bei Landschaftsbildern wird differenziert zwischen Vorder-, Mittel- und Hintergrund. Oftmals stellt Rost Mutmaßungen über den Urheber eines bezeichneten Bildes an, so heißt es etwa: "scheint von A. Waterloo zu sein" (Nr. 23). In erster Linie werden wiederum graphische Arbeiten und Bücher angeboten, jedoch auch 112 Losnummern mit Gemälden, die eine eigene Numerierung aufweisen. Die Losnummern 92 bis 97 verzeichnen jedoch Kopien in Wasserfarben nach Gemälden, die Losnummer 101 eine Bleistiftzeichnung. Insgesamt enthält der Katalog 104 Gemälde. In einer kurzen Einführung wird betont: "Folgende schöne Sammlung von Gemählden sind aus dem hinterlassenen Ca114
KATALOGE
160 1785/12/03
[Lugt 3957]
Michael Bostelmann; Hamburg, Börsen=Sahl Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 68 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Catalogue einer schönen Sammlung Niederländischer und Italiänischer Cabinet=Mahlereyen, desgleichen eine Collection mit französischen auch englischen Kupferstichen, hinter Rahmen und Glaas sauber eingefast, imgleichen uneingefaste dito, Prospecte und Land=Karten, welche am Sonnabend, den 3 December, a.c. auf dem hiesigen Börsen=Sahl öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden soll durch den Maakler Michael Bostelmann bey welchem der Catalogue beliebig abzufo[r]dern. Auch können benannte Sachen den Tag vor der Verlaufung [sie] an besagten Ort gefällig besehen werden. Gedruckt bey Dieterich Anton Harmsen. Hamburg 1785. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog des Hamburger Maklers Michael Bostelmann wurde eine kleine Sammlung mit insgesamt 68 Gemälden sowie 44 Kupferstichen angeboten. Zum Ende der Auktion wurden noch einige summarisch erwähnte, ungefaßte Kupferstiche aufgeführt. Die Bildbeschreibungen sind knapp gehalten und beinhalten keine Maßangaben. Außer vier italienischen und drei französischen Gemälden bestand die Sammlung überwiegend aus Werken flämischer und holländischer Maler des 17. Jahrhunderts. Bei den insgesamt 13 deutschen Bildern handelt es sich in der Mehrzahl um Werke Hamburger Künstler. Neun Gemälde bleiben anonym. Vermutlich stammte die Sammlung aus dem Hamburger oder dem niedersächsischen Raum. Ein Portrait des Herzogs August Wilhelm von Hyacinthe Rigaud (Nr. 32) könnte ein Indiz dafür sein, daß der Sammler Beziehungen zum Hof in Braunschweig und Wolfenbüttel hatte.
161 1785/12/21
[Lugt 3966]
Hinrich Jürgen Köster; Hamburg, Börsen=Saal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 97 Standorte: KH Nicht annotiert.
Titelblatt: Catalogus einer schönen Sammlung mehrentheils Niederländischer Cabinet=Mahlereyen, und diverses Silberzeug ec. welche am Mittewochen, den 21 December, a.c. auf dem hiesigen Börsen= Saal öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden sollen durch den Auctionarius Hinrich Jürgen Köster. Die Gemähide sind am besagten Ort den Tag vorhero beliebig zu besehen. Gedruckt bey D. A. Harmsen. Hamburg 1785. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog des Hamburger Auktionators Hinrich Jürgen Köster wurden insgesamt 101 Lose angeboten. Bis auf vier Wachsreliefs (Nrn. 11,12, 35 und 36) handelt es sich ausschließlich um Gemälde in goldenen oder schwarzen Rahmen. Die Beschreibungen sind knapp gehalten, es fehlen Angaben zu den Maßen. In zahlreichen Fällen wurden die Gemälde als Pendants angeboten. Es überwiegen holländische und flämische Werke des 17. und 18. Jahrhunderts. Bei den insgesamt 26 deutschen Werken stammen allein neun Landschaften von Johann Jacob Tischbein. Anonym bleiben 26 Bilder. Viele der Gemälde werden als Kopien bezeichnet, bei den meisten Bildern handelt es sich um Landschaften. Ohne Losnummern werden am Ende des Katalogs einige Arbeiten aus Silber zum Verkauf angeboten.
162 1786/01/24
[Lugt 3977]
nen am benannten Ort den Tag vor der Verkaufung gefällig besehen werden. Gedruckt bey D. A. Harmsen. Hamburg, Anno 1786. Kommentar: In dieser Auktion der Hamburger Makler Peter Texier und Michael Bostelmann wurde die Sammlung eines "bekannten Liebhaber[s]" veräußert. Wahrscheinlich wurde die Versteigerung vom 20. auf den 21. April verschoben, da im Exemplar KH I das Datum handschriftlich entsprechend korrigiert ist. Insgesamt verzeichnet der Katalog 120 Lose. Am Ende des Katalogs sind noch 32 Losnummern mit Kupferstichen verzeichnet. Alle Beschreibungen sind knapp, ohne Angaben des Materials und der Maße, Signaturen und Datierungen sind jedoch in einzelnen Fällen mit aufgeführt. Zahlreiche Werke werden als Pendants angeboten. Es überwiegen holländische und flämische Landschaftsbilder und Stilleben sowie Arbeiten deutscher Künstler wie Anton Tischbein und Johann Jacob Tischbein. Die meisten der 15 italienischen Gemälde sind anonym verzeichnet, unter den namentlich aufgeführten Malern findet man Jacopo [?] Bassano, Mario Nuzzi, Tizian sowie ein "rares Gemählde" von Parmigianino, eine Hl. Familie in einer Landschaft (Nr. 13). Insgesamt bleiben 25 Gemälde ohne Angabe eines Künstlernamens. Im Exemplar KH II finden sich einige handschriftliche Einträge mit Preisangaben, wahrscheinlich handelt es sich um die erzielten Preise. Alle Preise bewegen sich auf niedrigem Niveau und überschreiten nicht die Grenze von 10 Mark je Gemälde.
Johann Hinrich Decker; Hamburg, Börsen-Saale Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 110 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichnis von einer auserlesenen Sammlung englischer Cabinet-Mahlereyen auf Glas in sauber gearbeiteter und vergoldeter Einfassung welche am Dienstage, den 24 Jan. 1786 des Vormittags um 10 Uhr auf dem hiesigen Börsen-Saale in Auction verkauft werden sollen durch den Makler Johann Hinrich Decker. Diese Gemählde sind Tages vorher daselbst beliebigst zu besehen. Hamburg. Gedruckt mit Harmsens Schriften. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog wurden in 110 Losnummern englische Glasmalereien angeboten. Unter jeder Losnummer sind zwei thematisch zusammenhängende Arbeiten aufgeführt. Alle Beschreibungen sind knapp gehalten, Maßangaben fehlen. Es handelt sich überwiegend um allegorische Darstellungen, deren "figürliche oder satyrische Bedeutung" auf der Rückseite jeden Gemäldes in englischer Sprache erklärt ist. Einige von ihnen zeigen englische Landschaften. Eine "Nota" am Ende des Katalogs informiert darüber, daß die Glasmalereien von einem berühmten Maler in England gefertigt worden und für "Russland bestimmt gewesen" seien. "Bloss ein unvorhergesehener unglücklicher Zufall ist Ursache, dass selbige [Sammlung] hier in Auction veräussert wird".
163 1786/04/21 Texier; Hamburg, Börsen=Saal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 120 Standorte: *KH II Annotiert mit einigen Preisen. KH I Nicht annotiert. Titelblatt: Catalogus einer auserlesenen Sammlung mehrentheils Italiänischer und Niederländischer Cabinet=Mahlereyen, so durch einen bekannten Liebhaber allhier gesammelt, und öffentlich auf dem hiesigen Börsen=Saal am Donnerstage, den 20 April a.c. verkauft werden sollen durch die Mackler Texier und Bostelmann; bey welchen dieses Verzeichnis beliebigst abzufordern. Diese Gemälde kön-
164 1786/05/02
und folgende Tage
[Lugt 4038]
[Anonym]; Nürnberg, Auf dem Rathhaus Verkäufer nach Titelblatt: Von Hagenischer Gemähld=Sammlung Verkäufer: Hagen, Johann Georg Friedrich von Lose mit Gemälden: 715 Standorte: GMN Annotiert mit allen Käufernamen und den erzielten Preisen. *SBN I Annotiert mit allen Käufernamen und den erzielten Preisen auf eingebundenen Leerseiten. Die handschriftlichen Notizen wurden von Friedrich August Nagel 1949 nach einer anderen Vorlage dem Katalog beigegeben, wahrscheinlich GMN. SBN II Nicht annotiert. KKD Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Nach Lugt nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß von Hagenischer Gemähld=Sammlung, der besten und berühmtesten Teutschen, Niederländisch, Italiänisch und Französischen Meister, welche die zur v. Hagenischen Verlassenschaft niedergesetzte Raths=Commißion zu Nürnberg, entweder an einen Liebhaber in Ganzen, oder durch öffentliche Versteigerung an die Meistbietenden überlassen wird. Nürnberg gedruckt mit Sirischen Schriften im Monath März 1785. Kommentar: In dieser Auktion wurde die Gemäldekollektion des Nürnberger Sammlers Johann Georg Friedrich von Hagen (17231783) versteigert. Seine umfassende graphische Sammlung wurde zu großen Teilen im Januar 1788 durch den Leipziger Kunsthändler Carl Christian Heinrich Rost verkauft (Kat. 176). Im vorliegenden Katalog werden in 686 Losnummern 688 Gemälde aufgelistet. Es folgen noch fast 200 Lose mit Wasserfarben-Malereien und Miniaturen (Nrn. 687 bis 869). Hagen hatte die Sammlung von seinem Vater Justus Jakob von Hagen übernommen, der 1727 die bei Nürnberg gelegene Oberbürg geerbt und dort eine Gemäldesammlung angelegt beziehungsweise den schon vorhandenen Kunstbesitz ausgebaut hatte. Sein Sohn Johann Georg Friedrich von Hagen erweiterte die Sammlung, förderte die lokalen Künstler und stattete auch sein Stadthaus mit Gemälden aus. Als Hagen kinderlos und hochverschuldet starb, setzte die Stadt Nürnberg eine Kommission ein, die den Nachlaß verwerten sollte. Zunächst sollte die Gemäldesammlung en bloc für 18.000 Gulden verkauft werden, was jedoch nicht KATALOGE
115
gelang. Bei der daraufhin angesetzten Auktion wurden nur 4.133 Gulden und 31 Kreuzer umgesetzt. Die Beschreibungen der Bilder sind kurz gehalten, alle Maße werden in Schuh angegeben. Unter den Gemälden überwogen Werke der deutschen Schule mit insgesamt 239 Arbeiten, wobei vor allem Künstler aus Franken und dem Nürnberger Raum stark vertreten waren. Es finden sich beispielsweise 50 Gemälde von Karl Johann Reuss, 28 von Magnus Prasch. Von dem aus Utrecht stammenden Wilhelm von Bemmel, dem Stammvater der Malerfamilie Bemmel, lassen sich 39 Gemälde zählen. Die italienischen Schulen waren mit insgesamt 23 Werken vertreten, darunter vier Bilder von Caravaggio. Anonym blieben insgesamt 237 Gemälde. Im Exemplar GNM sind Annotationen mit allen Käufemamen, den Schätzpreisen und den erzielten Preisen vorhanden. Diese Angaben hat Friedrich August Nagel 1949 auf eingebundenen Leerseiten auf das Exemplar SBN übertragen. Diesen Angaben zufolge erwarb der Nürnberger Kunsthändler Johann Jakob Hermann Wild (gest. 1792) die meisten Bilder, ihm wurden 54 Gemälde zugeschlagen. 45 Gemälde gingen an einen Vertreter der Nürnberger Patrizierfamilie Holzschuher. Der Nürnberger Kunsthändler und Kupferstecher Andreas Leonhard Möglich übernahm 34 Bilder, der Kunsthändler Johann Friedrich Frauenholz 14 Gemälde. Nahezu alle Käufer stammten aus Nürnberg und der näheren Umgebung. Zwei biblische Historien von Johann König (Nrn. 41 und 42) befinden sich heute im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg (Inv.-Nrn. 969 und 970). Von rund 30 Gemälden, die vermutlich nicht verkauft wurden, lagen die notierten Schätzpreise so hoch, daß sich hierfür keine Käufer fanden. So wurden für einige Bilder von Kupezky Ergebnisse von 250 bis 600 Gulden erhofft. Lit.: Murr 1778, S. 500-512; Hampe 1904, S. 105; Gürsching 1949, S. 216f.; Nagel 1949; Schwemmer 1949, S. 130f.
165 1786/05/12-1786/05/13 P. Texier; Hamburg, In der Pilsterstrasse, in der sogenannten Obern=Gesellschaft Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 60 Standorte: *KH Annotiert mit den meisten Käufemamen und den meisten Preisen auf eingebundenen Leerseiten. Titelblatt: Catalogue einer vortreflichen Sammlung von Mignaturund Wasser=Farben=Gemählden, als auch von einigen Cabinet= Mahlereyen in Oel=Farben, nebst auserlesenen Kupferstichen, unter Glas mit Rähmen garnirt, welche von den besten Abdrücken, desgleichen gebundene geheftete einzelne lose Kupferstiche und zur Architectur und Perspectiv gehörige Werke, welche den 12 und 13ten May 1786. in der Pilsterstraße, in der sogenannten Obern=Gesellschaft, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden sollen durch den Mackler P. Texier, bey welchem, wie auch in obgedachter Ober=Gesellschaft, der Catalogue unentgeldlich zu bekommen: auch können die benannten Sachen Tages vorhero allda in beliebigen Augenschein genommen werden. Hamburg, gedruckt bey D. A. Harmsen. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog des Hamburger Maklers Peter Texier sind die zur Versteigerung gelangten Kunstgegenstände in getrennten Abteilungen aufgeführt. In der ersten Abteilung ("Litt. A") werden 64 Losnummern mit Miniaturen und Wasserfarben aufgeführt, in der zweiten Abteilung folgen die Gemälde ("Lit. Β."; S. 11 bis 18). Die Beschreibungen der insgesamt 60 Bilder sind kurz, aber prägnant abgefaßt: "Piazzetta. Abraham, mit einer Hand auf der Brust haltend" (Nr. 1); es folgen die Angabe des Materials und der Maße. Sehr oft finden sich Bemerkungen zur Malweise in den Einträgen, wie "vortreflich gemahlt", "mit Force gemahlt", "plaissant gemahlt". Es handelt sich in der Hauptsache um Gemälde 116
KATALOGE
der holländischen Schule des 17. Jahrhunderts und deutsche Werke des 18. Jahrhunderts, darunter Bilder von Johann Heinrich Tischbein d.Ä. und Alexander Thiele. Auf den eingeschossenen Leerseiten des Exemplars KH sind die Käufernamen und die erzielten Preise eingetragen. Der Gesamterlös der Auktion betrug 732 Mark und 14 Schilling, davon entfielen auf die Gemälde 205 Mark. Den Spitzenpreis erzielte mit 24 Mark ein Gemälde von Jan Jacobsz. van der Stoffe (Nr. 12). Unter den Käufern dominierten die Kunstagenten Johann Heinrich Schoen und Johann Benjamin Ehrenreich. Schoen wurden 24 Bilder zugeschlagen, Ehrenreich erwarb insgesamt 21 Gemälde.
166 1786/10/18
und folgende Tage
[Lugt 4087]
Texier; Hamburg, Börsensaal Verkäufer nach Titelblatt: Ein Nachlass Lose mit Gemälden: 264 Standorte: *KH Annotiert mit zwei Schätzpreisen. Titelblatt: Catalogue eines Nachlasses von Cabinet=Gemählden, welche mit Kenntniß gesammelt worden, nebst einigen Mignatur= Stücken und Kupferstichen unter Glaß mit Rahmen, welche auf dem Börsensaal den 18 October 1786 und folgende Tage öffentlich an den Meistbietenden gegen baare Bezahlung in grob Courant verkauft werden sollen durch die Makler Texier und Goverts. Tages vorher können dieselben in beliebigen Augenschein genommen werden: und Catalogi sind bey obgenannten Maklern für 2 Schilling, den Armen zum Besten, zu haben. Hamburg, gedruckt mit Harmsens Schriften. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog der Hamburger Makler Peter Texier und Hermann Friderich Goverts werden insgesamt 332 Losnummern mit 264 Gemälden aufgeführt. Die Bilder sind in drei Abteilungen verzeichnet, die sich nur in der unterschiedlichen Art der Rahmung der Bilder begründen: "Erste Abtheilung. Vorstellung derer Gemähide, welche theils in holländischen, theils in ordinairen schwarz=gebeitzten Rahmen, mit vergoldeten Massa=Stäben eingefaßt" (Nm. 1 bis 75); "Zweyte Abtheilung. Cabinet=Gemählde in fein vergoldeten Rahmen" (Nm. 76 bis 142); "Dritte Abtheilung. Gemähide in schwarz gebeitzten Rahmen mit fein vergoldeten Leisten" (Nm. 143 bis 208). Es folgen dann "noch vorgefundene Stükke" (Nm. 210 bis 235), ein großer Posten an Miniaturen, Aquarellen, Pastellen und Kupferstichen sowie einzelne Gemälde (Nm. 236 bis 332). Die Beschreibungen der Gemälde sind mitunter sehr ausführlich und enthalten Urteile zur malerischen Ausführung wie "voller Expression", "mit Affekt vorgebildet", "ganz excellent gemahlt" und "die Natur ins Kleine auf das lebhafteste vorgestellet". Dem allgemeinen Standard der Kataloge entsprechend enthält jeder Eintrag Angaben zum Material und zu den Maßen. Den verzeichneten Künstlernamen zufolge handelt es sich um eine qualitätvolle, sehr gut bestückte Sammlung von Gemälden der holländischen, flämischen und deutschen Schule. Den größten Teil machen Landschaften, Historien oder Genrebilder aus, die oft als Pendants oder "Compagnons" geführt werden. Unter den flämischen Künstlern ist Jan Brueghel d.Ä. mit neun Gemälden vertreten, darunter ein Vier-Jahreszeiten-Zyklus auf Kupfer (Nm. 92 bis 95), von Alexander Keirincx sind vier sogenannte "Holzungen" verzeichnet. Aus der Gruppe der holländischen Maler ist auf Jan van Gool zu verweisen, von dem sechs Gemälde aufgeführt werden.
167 1786/11/11
[Lugt 4091]
Johann David Reimarus; Hamburg, Börsen=Saale Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 127 Standorte: KH Nicht annotiert.
Titelblatt: Catalogue raisonne oder: erklärendes Verzeichniß einer ansehnlichen Sammlung aufrichtiger und wohl conditionirter Italienischer und Niederländischer Cabinet=Mahlereyen, (davon der mehrste Theil in Neapolis gesammelt worden) welche den 11 November, 1786, präcise um 10 Uhr, durch die Makler Johann David Reimarus und Pieter Texier, gegen baare Bezahlung auf dem hiesigen Börsen=Saale verkauft werden sollen. Obbenannte Gemähide können Tags vor dem Verkaufe auf dem Börsen=Saale in Augenschein genommen werden, und Catalogi sind bey den benannten Maklern gratis zu bekommen. Hamburg, gedruckt bey Dieterich Anton Harmsen. Kommentar: Im Unterschied zu den anderen hier ausgewerteten Auktionskatalogen wird der Katalog als "Catalogue raisonni" bezeichnet. Das Titelblatt vermerkt zudem, daß der größte Teil der Gemälde in Neapel gesammelt worden sei. Die Gemälde der italienischen Schule machen mit zwölf Werken unter den insgesamt 127 verzeichneten Gemälden jedoch nur einen geringen Teil aus. Unter den identifizierbaren Namen finden sich Maler des 17. und 18. Jahrhunderts wie Paolo de Matteis, Tommaso Realfonso, Salvator Rosa und Candido Vitali. Mehrere Künstlernamen ließen sich bisher nicht weiter nachweisen, so etwa Joan Raitz, Autor zweier Seeprospekte von Neapel (Nrn. 3 und 4). Außer einem Gemälde von Canaletto finden sich die Werke der italienischen Schule in dem "Authentischen Verzeichnis folgender Italiänischer und Niederländischer Cabinet= Mahlereyen" zu Beginn des Katalogs aufgeführt (Nrn. 1 bis 78). Es wird eigens angemerkt, daß alle Gemälde, sofern nicht Holz als Material angegeben wird, auf Leinwand gemalt seien. In einer zweiten Abteilung (Nm. 79 bis 133) werden vor allem Gemälde der deutschen Schule versteigert, gefolgt von Werken der holländischen und flämischen Schule. Hier fehlen die Maßangaben der Bilder. Die Beschreibungen sind vor allem im vorderen Teil mitunter sehr detailliert und mit ästhetischen Wertungen zur Ausführung ("vortreflich gemahlt"; "sehr kräftig und meisterhaft ausgedrückt") versehen, oder auch mit Hinweisen wie "Capitalstücke, für Kenner von hohem Wert".
168 1787/00/00
Daten unbekannt
[Lugt 4239]
[Anonym]; Hamburg Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 757 Standorte: *KH I Annotiert mit allen Käufernamen und Preisen. KH II Nicht annotiert. Titelblatt: Zuverläßige Beschreibung mehrerer zum Theil seltner, und von den entfernsten Orten her, aus vielen Cabinettern, Sammlungen und Auctionen ausgehobener und ausgesuchter Gemähide, von den berühmtesten Meistern der Deutschen, Niederländischen, Französischen, Englischen, Spanischen und Italienischen Schulen, gesammlet von einem in diesem Fache unermüdeten und paßionirt gewesenen Liebhaber. Hamburg, 1787. gedruckt bey David Christoph Eckermann. Kommentar: Der 756 Einträge umfassende Katalog ist vom Titelblatt her nicht als Auktionskatalog ausgewiesen. Es fehlt jeglicher Hinweis auf einen öffentlichen Verkauf, den Ort einer Auktion oder den Namen eines Auktionators. Das Exemplar KH I enthält jedoch handschriftliche Annotationen zu Käufernamen und zu den Preisen, so daß vermutet werden kann, daß dieser Katalog als Versteigerungskatalog benutzt wurde. Möglicherweise wurden die Gemälde auch, wie das Titelblatt feststellt, "von den entfernsten Orten her, aus vielen Cabinettern, Sammlungen und Auctionen" ausgehoben und nach Hamburg zur Auktion gebracht. Alle Beschreibungen sind sehr ausführlich. Der Katalog ist übersichtlich gestaltet, die Künstlernamen werden jeweils als Überschriften vorangestellt. Bei allen Bildern sind die Maße und Materialien
angegeben, sowie die Rahmen beschrieben. Oftmals werden ästhetische Wertungen in den Text eingeflochten, dort heißt es beispielsweise "herrlich gemalt" oder "sehr fleißig und schön gemalt". Mit insgesamt 247 Werken gehört der größte Teil der Gemälde der holländischen Schule an, gefolgt von Gemälden der deutschen, italienischen und flämischen Schule mit jeweils über 100 Gemälden. Allein die italienische Schule war mit 126 Bildern im Vergleich zu anderen deutschen Sammlungen des 18. Jahrhunderts sehr stark vertreten. Auch 25 Gemälde der französischen Schule wurden versteigert. Die meisten bedeutenden Künstlernamen sind verzeichnet. Eine umfangreiche Gruppe bilden die Werke Rembrandts und seines Kreises: von Rembrandt werden sechs Gemälde aufgeführt, je zwei weitere Gemälde sind "im Gusto" bzw. "in der Manier" von Rembrandt bezeichnet; von Ferdinand Bol werden drei, von Gerbrand van den Eeckhout vier, von Jan Lievens fünf Gemälde und von Govaert Flinck ein Werk angeführt. Bei diesem handelt es sich wahrscheinlich um das Bildnis eines Orientalen, das sich heute in der Walker Art Gallery in Liverpool (Inv.-Nr. 960) befindet. Weitere Schwerpunkte bilden die Landschaften von Cornells van Poelenburgh, Gemälde der Italianisanten (Andries Dirksz. Both, Johannes Lingelbach und vor allem Nicolaes Pietersz. Berchem mit 13 Gemälden) sowie der Leidener Feinmaler Gerard Dou oder Frans und Willem van Mieris. Bei den flämischen Bildern sind vor allem Jan Brueghel d.Ä., Peter Paul Rubens und David Teniers d.J. zahlreich vertreten. Unter den deutschen Bildern finden sich allein 24 Werke von Balthasar Denner. Auch andere Hamburger Maler sind mehrfach vorhanden, nicht jedoch in einer so ausgeprägten Dominanz wie in anderen Hamburger Sammlungen. Bei den Italienern überwiegen Maler des späten 17. und des 18. Jahrhunderts, allerdings werden Tizian drei Bilder zugeschrieben und weitere fünf als Manier von oder Kopie nach Tizian bezeichnet. Auch die spanische Schule ist mit acht Werken von Bartolome Esteban Murillo und zwei Bildern von Juseppe de Ribera vertreten. Anonym bleiben insgesamt 38 Gemälde. Unter den Käufern engagierten sich vor allem die Hamburger Kunsthändler, so Francois Didier Bertheau mit 164 Zuschlägen und Johann Hinrich Schoen mit 69 Ankäufen. 142 Gemälde übernahm der Käufer Fesser, der bisher noch nicht identifiziert werden konnte. Die Preise bewegten sich auf relativ hohem Niveau, einzelne Bilder erzielten deutlich mehr als 100 Mark, so bezahlte Johann Hinrich Schoen für ein Viehstück von Paulus Potter (Nr. 300) sogar den hohen Betrag von 2.000 Mark. Dieses Gemälde hatte sich möglicherweise bis etwa 1760 in der Sammlung des Genfer Pastellisten Jean-Etienne Liotard befunden und war am 15. April 1774 bei Christie's in London von Lebrun erworben worden. 1834 findet es sich wieder in England, in der Sammlung von Lady Mildmay, Dogmersfield. Das Bild wechselte noch mehrfach den Besitzer und wurde zuletzt am 26. Januar 2001 bei Christie's in New York (Los 168) versteigert. 24 Bilder unserer Versteigerung tauchten erneut in einer Auktion am 13. April 1790 auf (Kat. 200). Diese Bilder waren 1787 vor allem von Fesser und Johann Hinrich Schoen übernommen worden. Darunter befand sich auch eine Ölskizze Rubens' für ein Altargemälde in der Chiesa Nuova in Rom. Dargestellt ist der Hl. Gregor, umgeben von der Hl. Domitilla und dem Hl. Georg. Die Skizze befindet sich heute im Courtauld Institute in London (Nr. 71; vgl. Kat. 200, Nr. 21). 169 1787/01/15 und folgende Tage [Lugt 4122] C.C.M. Rost; Leipzig, Im rothen Collegio Verkäufer nach Titelblatt: Richterisches Cabinet Verkäufer: Richter, Johann Friedrich Lose mit Gemälden: 50 Standorte: SBB Nicht annotiert. SBBa Nicht annotiert. Aus dem Besitz von Joseph Heller. HKB Nicht vollständig, nur der erste Teil ist vorhanden. Nicht annotiert. KATALOGE
117
Titelblatt: Richterisches Cabinet von Kupferstichen, Handzeichnungen, Kunstbüchern und Kupferstichwerken. Zweyter Theil, enthaltend die Blätter von englischen Meistern gestochen und in schwarzer Kunst; eine ansehnliche Portrait- und Prospectsammlung; eine Sammlung von Handzeichnungen, meistens alter berühmter Meister; Kunst- und Kupferstichwerke. Zum Anhange folgen die verschiedenen Beyträge von Kupferstichen aus allen Schulen, Gemähide berühmter Meister, Kunst- und Kupferstichwerke, nebst andern Kunstsachen, für die Rostische jährlich festgesetzte Auction. Der öffentliche Verkauf davon an die Meistbiethenden ist den 15. Januar 1787 durch den verpflichteten Universitäts-Proclamator Herrn C. G. Weigel, im rothen Collegio zu Leipzig, gegen baare Bezahlung in Louisd'or ä 5 Thl. oder Sächs. Convent. Münze. No. V. Leipzig, gedruckt bey Gotthelf Albrecht Friedrich Löper. Kommentar: Im fünften Versteigerungskatalog der Kunsthandlung Rost wurde der zweite Teil der graphischen Sammlung des "Richterischen Cabinets" angeboten. Neben der Sammlung von Gottfried Winckler zählte das Kabinett Richter zu den bedeutendsten Sammlungen Leipzigs. Begründet wurde das Kabinett von Zacharias Richter (gest. 1764). Dessen Sohn Johann Thomas Richter (1728-1773) baute die Kollektion aus und kaufte u.a. auf Reisen nach Paris und Italien Gemälde. Nach dessen Tod übernahm sein Bruder Johann Friedrich Richter die Sammlung. Dessen Ehefrau veranlaßte 1786/ 87 den Verkauf der graphischen Sammlung durch die Kunsthandlung Rost (vgl. den Vorbericht im Rostschen Auktionskatalog Nr. 4). Die Gemälde wurden erst 1810 versteigert (Trautscholdt 1957, S. 226). In einem zweiten Abschnitt der Versteigerung wurden graphische Arbeiten verschiedener Einlieferer angeboten. Zum Schluß des Katalogs sind zudem insgesamt 50 Losnummern mit Gemälden aufgeführt, die ebenfalls von verschiedenen Anbietern stammten. Vermutlich dienen doppelte Querbalken im Katalog dazu, die verschiedenen Einlieferer voneinander zu trennen. Die Losnummern 7 bis 15 werden mit der Zwischenüberschrift "Folgende Sammlung Gemälde werden für Originale von Kennern gehalten" eingeleitet. Die Losnummern 18 bis 33 werden eingeführt mit den Worten: "Folgende Sammlung enthält sehr gute Gemälde, nur wagt man sich nicht, den Namen des Künstlers zu bestimmen." Dem vorletzten Abschnitt mit den Losnummern 34 bis 46 geht ebenfalls eine Einführung voran: "Folgende Sammlung von Gemählden enthält die vortrefflichsten und meisterhaftesten Originale, verdienen daher jedes Kenners und Sammlers Aufmerksamkeit, um ihre Cabinette und Sammlungen zu vermehren." Mit diesen Zwischenüberschriften werden drei Teile der Gemäldesammlung deutlich voneinander geschieden und unterschiedlich charakterisiert. Mit der letzten Überschrift versuchte Rost vermutlich auch Sammler wie Gottfried Winckler anzusprechen, die sonst eher in Paris oder Holland Bilder erwarben. Alle Bildbeschreibungen sind kurz gehalten, jedoch mit Wertungen versehen. Außerdem werden die Maße und die Art der Rahmung angegeben. Oftmals wird auch auf den Erhaltungszustand der Bilder hingewiesen. Lit.: Trautscholdt 1957, bes. S. 226.
170 1787/02/12
und folgende Tage
Christian Friedrich Schroeder; Wernigerode, Haus des Sammlers Verkäufer nach Titelblatt: Herrn Rath und Ober=Amtmann Johann Georg Schroeder Verkäufer: Schroeder, Johann Georg
den 12ten Februar 1787. Vormittags von 8 Uhr an, so wie auch denselben Tag Nachmittgas von 2 Uhr an, die folgenden Tage aber des Nachmittgas von 2 Uhr an, in Dessen Erben Hause zu Wernigerode durch eine freiwillige der Theilung halber beliebte Auction öffentlich gegen baare Bezahlung an die Meistbietenden überlassen werden sollen. Wernigerode, gedruckt mit Struckischen Schriften. Kommentar: In der Nachlaßversteigerung des Amtmannes Johann Georg Schroeder aus Wernigerode wurden in erster Linie Münzen, Landkarten, Bücher und graphische Arbeiten angeboten. Unter der Rubrik "An Gemählden" werden neben einer Arbeit in Wasserfarben und einem Kupferstich zehn Lose mit Gemälden angeboten, wobei es sich um insgesamt rund 40 Bilder in 10 Losen handelt. Unter Losnummer 5 sind allein 18 Bildnisse adeliger Personen und unter Losnummer 7 acht Gemälde geistlicher Herren zusammengefaßt. Alle Gemälde bleiben anonym; Maßangaben fehlen. Die Gemälde dienten in dieser bürgerlichen Sammlung offensichtlich nur zur dekorativen Ausstattung der Räumlichkeiten des Sammlerkabinetts.
171 1787/03/01 Georg Christoph Lötz; Hamburg (Altona), Vom Fisch=Markt linker Hand der Raths=Waage gegenüber in der Stadt London Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 102 Standorte: *KH II Annotiert in Bleistift mit einigen Preisen. KHI Nicht eingesehen. Titelblatt: Catalogue einer Sammlung Niederländischer, Italienischer, Französicher und Deutscher Cabinet=Mahlereyen, welche allhier vom Fisch=Markt linker Hand der Raths=Waage gegen über in der Stadt London, am Donnerstag, als den lsten März 1787, Vormittags um halbzehn Uhr öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden sollen durch den Mackler Georg Christoph Lötz, bey welchem der Catalogue gratis abzufordern ist. Tages vorher können die Gemähide am obbenannten Ort gefälligst besehen werden. Altona. Gedruckt bey Caspar Christoph Eckstorff, könig. privil. Buchdrukker. Altona 1787. Kommentar: Diese Auktion fand in dem Hamburger Stadtteil Altona statt, der im 18. Jahrhundert zu Dänemark gehörte. Zur Versteigerung gelangte eine Sammlung von insgesamt 102 Gemälden der holländischen, flämischen und deutschen Schule. Obwohl eigens auf dem Titelblatt angekündigt, werden im Katalog nur zwei Gemälde der französischen und eines der italienischen Schule verzeichnet. Die einzelnen Bildbeschreibungen sind sehr kurz und enthalten keine Angaben zu den Maßen und zum Material. Es überwiegen holländische und flämische Maler des 17. und 18. Jahrhunderts. Bei den 38 deutschen Bildern sind vor allem Hamburger Maler stark vertreten. Anonym bleiben nur vier Gemälde, mehrere Künstlernamen konnten jedoch bisher nicht identifiziert werden. Nach den Notizen des annotierten Exemplars KH betrug der Gesamterlös der Auktion rund 260 Mark. Die Preise bewegten sich auf niedrigem Niveau und überstiegen selten die Schwelle von 10 Mark. Den höchsten Betrag erzielte ein Brustbild von Jean Baptiste Henri Deshays (Nr. 7) mit 26 Mark, gefolgt von zwei religiösen Gemälden von Christian Wilhelm Ernst Dietrich (Christi im Tempel·, Erweckung der Tochter des Jairus; Nrn. 1 und 2), die für zusammen 22 Mark verkauft wurden.
Lose mit Gemälden: 10 Standorte: UBLg Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß der von dem Herrn Rath und Ober= Amtmann Johann Georg Schroeder nachgelaßenen Münz= Landkarten= Siegel= Kupferstich= Gemälde= und Bücher=Sammlungen, welche 118
KATALOGE
172 1787/04/03-1787/04/04 Henningk; Hamburg, Börsensaale Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 125
Standorte: *KH Annotiert mit allen Käufernamen und Preisen auf eingebundenen Leerseiten. Titelblatt: Verzeichniß einer vortreflichen aus Oelfarben bestehenden Gemähidesammlung; imgleichen ausserordentlich schöne schwarze und couleurte, unter Glas mit Rahmen gefaßte Kupferstiche; wie auch Zeichnungen und einige kleine Naturaliencabinette; welche auf dem Börsensaale am 3ten und 4ten April 1787 an den Meistbietenden gegen baare Bezahlungen öffentlich verkauft werden sollen durch die Makler Henningk und Packischefsky. Hamburg, gedruckt mit Harmsens Schriften. Kommentar: In diesem Katalog der Makler Henningk und Peter Hinrich Packischefsky wurden insgesamt 270 Lose angeboten. Unter den Nummern 1 bis 125 sind die Gemälde verzeichnet (S. 3 bis 9), gefolgt von einem Konvolut von Pastellen und teilweise illuminierten Kupferstichen (S. 10 bis 16). Die Beschreibungen sind knapp, Maßangaben fehlen. Die Bildtitel sind teilweise nur schlagwortartig; "Zwey türkische Reuter, von J. Weyer besten Zeit" (Nr. 12). Es überwiegen Gemälde der holländischen und flämischen Schule. Die insgesamt 26 Gemälde der deutsche Schule stammen vorwiegend von Hamburger Künstlern, darunter je fünf von Johann Georg Stuhr und Jacob Weyer. Anonym bleiben 17 Werke. Im Exemplar KH ist eine Liste der Käufer und der erzielten Preise eingebunden. Die Preise bewegten sich auf niedrigem Niveau, nur wenige Gemälde erzielten mehr als 10 Mark. Den höchsten Preis erreichte eine Landschaft von Jan van Goyen (Nr. 59) mit 20 Mark und 8 Schilling. Unter den Käufern traten wie bei den meisten Hamburger Auktionen vor allem die Kunsthändler hervor, so wurden Johann Heinrich Ehrenreich allein 25 Gemälde zugeschlagen, neun übernahm Francois Didier Bertheau und zwölf der Maler und Kunsthändler Peter Sieberg.
173 1787/04/19 Pieter Texier; Hamburg, Börsen=Saal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 117 Standorte: *KH Annotiert mit allen Käufernamen und Preisen. Titelblatt: Catalogue einer auserlesenen Sammlung Holländischer und Niederländischer, von denen vorzüglichsten und besten Meistern verfertigter Cabinet=Mahlereyen, welche am Donnerstage, als den 19 April, auf dem hiesigen Börsen=Saal öffentlich an die Meistbiethende verkauft werden sollen durch den Makler Pieter Texier; bey welchem diese Designation beliebigst abzufo[r]dern. Auch können benannte Gemähide den Tag vor der Verkaufung am benannten Ort gefällig besehen werden. Gedruckt bey Dieterich Anton Harmsen. Hamburg, Anno 1787. Kommentar: Dieser Versteigerungskatalog des Hamburger Maklers Peter Texier verzeichnet 117 Gemälde, vorwiegend von Malern der holländischen, flämischen und deutschen Schule, die mit wenigen Ausnahmen alle zugeschrieben sind. Nur fünf Bilder bleiben anonym. Es handelt sich um eine sehr gut bestückte Sammlung mit Werken von Jan Asselyn bis Reinier Zeemann, vorwiegend Landschaftsdarstellungen. Alle Beschreibungen sind knapp gehalten und konzentrieren sich auf den Bildgegenstand und den Künstler. Angaben zu den Maßen und dem Material fehlen jedoch. Im Exemplar KH sind die Käufemamen und die erzielten Preise verzeichnet. Die Preise bewegten sich auf relativ hohem Niveau, einzelne holländische Landschaften wie beispielsweise eine Waldigte Landschaft von Jacob van Ruisdael (Nr. 10) und zwei Gemälde von Eglon Hendrik van der Neer (Nrn. 48 und 49) erreichten Preise von rund 100 Mark. Unter den Käufern befanden sich die Hamburger Kunsthändler Fran5ois Didier Bertheau, Johann Jobst Eckhardt und Peter Sieberg. Ins-
gesamt 20 Gemälde wurden von dem bisher nicht identifizierbaren Käufer Tietjen erworben.
174 1787/10/06
[Lugt 4209]
P. Texier; Hamburg, Börsen=Saal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 152 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Catalogue einer auserlesenen Sammlung Italienischer, Niederländischer und Französischer Cabinet=Mahlereyen, so aus einer hiesigen bekannten Verlassenschaft, auch theils aus der Fremde entstehen, sollen sämmtlich am Sonnabend, den 6ten October a.c. auf dem hiesigen Börsen=Saal öffentlich an die Meistbietende verkauft werden, durch die Makler P. Texier und M. Bostelmann, bey welchem die Designation beliebigst abzufordern. Auch sind besagte Gemähide den Tag vor der Verkaufung, als den 5ten October, am benannten Orte gefälligst zu besehen. Gedruckt bey Dietrich Anton Harmsen. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog der Makler Peter Texier und Michael Bostelmann wurde in erster Linie eine Hamburger Sammlung verauktioniert. Nach den Angaben des Titelblatts wurde der Verkauf noch durch einige von auswärts nach Hamburg gebrachte Bilder erweitert. Vermutlich stammten die Losnummern 1 bis 26 von einem Einlieferer, denn 21 von diesen Gemälden tauchen als geschlossenes Konvolut in einer Hamburger Auktion am 21. Oktober 1791 wieder auf (Kat. 221). Alle Beschreibungen sind kurz in einem Satz gefaßt, in dem der Bildtitel und der Künstlername genannt werden. Oftmals wurden ästhetische Wertungen angeführt. Bei den insgesamt 152 Gemälden, die zum Verkauf auf der Börse angeboten wurden, handelt es sich überwiegend um Werke der holländischen Schule, anteilsmäßig gefolgt von Bildern der flämischen und deutschen Schule. Auch elf Gemälde der französischen Schule sind verzeichnet, darunter Werke von zeitgenössischen Malern wie Jean Baptiste Henri Deshays, Charles Francois Lacroix, Jean Baptiste Monnoyer und Jean Baptiste Lallemand, von dem insgesamt vier Gemälde angeboten wurden. Diese Bilder befanden sich mit großer Wahrscheinlichkeit in französischem Privatbesitz und gelangten somit "aus der Fremde", wie es auf dem Titelblatt heißt, nach Hamburg; es ist aber auch nicht auszuschließen, daß sie durch französische Emigranten nach Hamburg gelangten. Bei den insgesamt 22 deutschen Gemälden überwogen Hamburger Künstler, so enthielt der Katalog fünf Arbeiten von Hinrich Stravius. Zwischen den Gemälden sind einige Aquarelle verzeichnet (Nrn. 48, 66, 67 und 71). Bei der Nummer 66 handelt es sich um König David vor den Götzen von Lucas van Leyden.
175 1787/12/03 [Anonym]; Hamburg? Verkäufer nach Titelblatt: Keine Standorte: SBH Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Kommentar: Dieser anonyme Auktionskatalog ist nur bibliographisch nachweisbar (Realkatalog der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg KD III., Hanseatica Hamburgensia IV, S. 74); Holst 1939, S. 271, führt ihn ebenfalls in seiner Liste. Über den Umfang der Sammlung und den Besitzer ist nichts weiter bekannt. Im Realkatalog werden keinerlei Angaben zur Art des Versteigerungskatalogs gemacht. Es ist daher nicht sicher, ob auch Gemälde angeboten wurden. KATALOGE
119
176 1788/01/15
und folgende Tage
[Lugt 4245]
C.C.H. Rost; Leipzig, Im rothen Collegio Verkäufer nach Titelblatt: von Hagen Verkäufer: Hagen, Johann Georg Friedrich von Lose mit Gemälden: 81 Standorte: *BDu Annotiert mit den meisten Käufernamen und den meisten Preisen. SBBa Nicht annotiert. Aus dem Besitz von Joseph Heller. GSM Nicht eingesehen. Nach Lugt unvollständig und nicht annotiert; es fehlen die Seiten 225 bis 240. Titelblatt: Von Hagensche Kupferstich-Sammlung alter, neuer und seltener Blätter aus allen Schulen, auch einer beträchtlichen Anzahl von Kupferstichwerken und Handzeichnungen. Zum Anhange folgen: Die verschiedenen Beyträge für die Rostische jährlich festgesetzte Auction, an Kupferstichen aus allen Schulen, Handzeichnungen, Gemählden, Kupferstichwerken und Kunstsachen, worunter Ein sehr wohlerhaltener Silbermannischer Flügel. Im Ianuar 1788. den Montag nach der Zahlwoche der Leipziger Neujahrsmesse, wird davon in den gewöhnlichen Vor- und Nachmittagsstunden, von dem verpflichteten Universitäts-Proclamator Herrn Weigel, im rothen Collegio zu Leipzig, gegen gleich baare Bezahlung in Louisd'or ä 5 Rthl. oder Sächs. Conv. Münze, der öffentliche Verkauf gehalten werden. No. VI. Leipzig, gedruckt bey Gotthelf Albrecht Friedrich Löper. Kommentar: In ihrem sechsten Versteigerungskatalog offerierte die Kunsthandlung Rost erstmals die graphische Kollektion eines einzigen Sammlers, der auch namentlich genannt wird. Es handelt sich um den Hofrat Johann Georg Friedrich von Hagen aus Nürnberg (1723-1783). Dessen umfangreiche Gemäldesammlung war im Mai 1786 in Nürnberg versteigert worden (Kat. 164). Der von Carl Christian Heinrich Rost zusammengestellte Katalog enthält sowohl ein Literaturverzeichnis als auch ein Register. Im Anhang werden noch einige Kunstwerke anderer Einlieferer aufgeführt. Der gesamte Bestand an graphischen Arbeiten umfaßt 3.902 Losnummern. Vermutlich stammten die Gemälde (Nm. 3903 bis 3984) aus dem Besitz anderer Anbieter. Der größte Teil der Bilder ist der deutschen Schule des 17. und 18. Jahrhunderts zuzurechnen; darunter befinden sich sechs Gemälde von Alexander Thiele sowie sechs religiöse beziehungsweise mythologische Werke des sächsischen Malers Johann Heinrich am Ende. Es wurden auch drei Werke von Lucas Cranach bzw. seiner Schule angeboten, von denen das Bild Christus unter den Kindern (Nr. 3903) zu einem Preis von 10 Talern und 13 Groschen zugeschlagen wurde. Neben einigen holländischen Bildern des 17. Jahrhunderts finden sich in diesem Katalog auch 16 italienische Gemälde, darunter eine Andrea del Sarto zugeschriebene Tafel (Nr. 3978), die jedoch nur einen Taler und 16 Groschen erzielte. Für ein Bild von P. Wouwerman (Nr. 3974) wurde mit 27 Talern und einem Groschen der höchste Preis erlangt. Insgesamt bewegten sich die Preise auf niedrigem Niveau, die meisten Bilder erzielten deutlich weniger als 10 Taler. Lit.: Nagel 1949; Schwemmer 1949, S. 130f.; Trautscholdt 1957.
177 1788/01/31
[Lugt 4201, 4251]
C.C.H. Rost; Leipzig Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 33 Standorte: *BDu Annotiert mit den meisten Käufernamen und den meisten Preisen. Bei den Gemälden ist nur bei drei Bildem die Initiale "L" und ein Preis vermerkt. SBN Nicht annotiert. 120
KATALOGE
GSM
Nicht eingesehen. Nach Lugt nicht annotiert.
Titelblatt: Verzeichnüß von alten Kupferstichen, Handrissen, und Malereyen. Leipzig 1787. Kommentar: Wahrscheinlich wurde diese Versteigerung im Januar 1788 im Anschluß an die jährlich stattfindende Auktion der Kunsthandlung Rost durchgeführt. In der Vorbemerkung des 1787 gedruckten Katalogs nennt der Besitzer der Sammlung als Auktionstermin den 1. August desselben Jahres. Es ist jedoch anzunehmen, daß dieser Termin verschoben wurde, da Rost seit 1787 seine jährliche Auktion im Januar durchführte. Eine zweite kurze Vorbemerkung stammt von Carl Christian Heinrich Rost selbst und wurde dem Katalog vorangestellt. Dort heißt es: "Folgendes Verzeichniss einer Kupferstich-Sammlung, wird auf Verlangen des Eigenthümers gleich nach Beendigung meiner Auction, proclamiert." Die Exemplare BDu und SBN sind mit dem sechsten Versteigerungskatalog der Kunsthandlung Rost (Kat. 176) in einem Band zusammengebunden. Die bereits erwähnte Vorbemerkung findet sich auf der letzten Seite des Katalogs 176 (S. 315). Die Typographie und die wenig sorgfältige Ausführung dieses Katalogs sind ungewöhnlich und entsprechen nicht dem hohen Standard der Kunsthandlung Rost. So fehlen beispielsweise Maßangaben. Wie sehr dies dem Kunsthändler Carl Christian Heinrich Rost widerstrebte, wird in seiner kurzen Vorrede deutlich. Das Verzeichnis war vom Besitzer der Sammlung zusammengestellt und gedruckt worden, ohne Rost zuvor zu konsultieren. Nur aus Gefälligkeit hatte sich Rost bereit erklärt, die Auktion mit dem schon vorgefertigten Katalog durchzuführen. Wahrscheinlich stammt die Sammlung aus Stuttgart, da die Gemälde betreffende Anfragen an die "Mäntlerische Buchdruckerey" in Stuttgart gerichtet werden sollten. In der vom Vorbesitzer formulierten Einleitung wird das Angebot unterbreitet, die komplette Sammlung für 200 Carolin, oder auch die Gemälde allein für 50 Carolin zu kaufen. Neben der umfangreichen graphischen Sammlung mit 2.000 Losnummern wurden auch 33 Gemälde angeboten, die am Ende des Katalogs aufgelistet werden und nicht numeriert sind. Die Titelbeschreibungen sind sehr knapp und wenig aussagekräftig. Die meisten Gemälde stammten von deutschen Künstlern des 18. sowie von holländischen Malern des 17. Jahrhunderts. Lit.: Trautscholdt 1957.
178 1788/04/07
und folgende Tage
[Lugt 4296]
Fayh; Frankfurt am Main, Auf dem Barfüsser Plätzschen Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 250 Standorte: *AMF Annotiert mit allen Käufemamen und Preisen. Wahrscheinlich handelt es sich um das Exemplar des Auktionators. Titelblatt: Verzeichniß einer Sammlung von Gemälden der berühmtesten Meister, welche zu Frankfurt am Mayn in der Behausung des geschwomen Ausrufers Herrn Fayh auf dem Barfüßer Plätzchen, Montags den 7. April dieses Jahrs und die darauf folgende Tage, öffentlich an den Meistbietenden gegen baare Bezahlung losgeschlagen werden sollen. Sämmtliche Gemälde sind in angezeigter Fayhischen Behausung zum Ansehen aufgestellt, und können daselbst wöchentlich zweymal, als Dienstags und Freytags Nachmittags von zwey bis vier Uhr in Augenschein genommen werden. Frankfurt am Mayn, 1788. Kommentar: Diese Frankfurter Versteigerung wurde durch den amtlich bestellten Ausrufer Heinrich Christian Fayh ausgeführt und fand auch in dessen Haus statt. In früheren Jahren waren die ernannten Ausrufer nicht als Veranstalter in Erscheinung getreten (vgl. Kat. 134), hier ist Fayh erstmals auch der Organisator der Auktion.
Sie dauerte von Montag, den 7. April, bis Dienstag, den 8. April; Interessenten wurde die Vorbesichtigung ermöglicht. Alle Bildbeschreibungen sind durchweg sehr kurz gehalten, die Maße und die Materialien sind jedoch immer angegeben. Unter den insgesamt 250 Gemälden sind vor allem holländische und flämische Künstler des 17. und 18. Jahrhunderts gut vertreten. Die meisten Gemälde stammen jedoch von deutschen Künstlern. Hierbei handelt es sich in erster Linie um zeitgenössische Künstler aus dem Frankfurter Raum, so lassen sich von dem Darmstädter Hofmaler Johann Georg Seekatz allein 21 Werke zählen, Christian Georg Schütz I ist mit 25 und Justus Juncker mit acht Bildern vertreten. Ohne jeden Künstlernamen werden 27 Bilder aufgeführt, drei dieser Bilder sind im Exemplar AMF noch handschriftlich hinzugefügt. Nach den Angaben des annotierten Exemplars AMF bewegten sich die Preise auf relativ niedrigem Niveau zwischen 5 und 30 Gulden. Für eine Waldlandschaft von Jacob van Ruisdael (Nr. 135) bezahlte Friedrich Wilhelm Hoynk den hohen Preis von 215 Gulden. Der Gesamterlös der Auktion betrug 2.968 Gulden und 19 Kreuzer, durchschnittlich also etwas weniger als 12 Gulden. Unter den Käufern engagierte sich vor allem der Mannheimer Kunsthändler David Levi, der mehr als die Hälfte der Bilder übernahm. Ansonsten finden sich unter den Käufern vorwiegend die Namen Frankfurter Sammler wie Johannes Barensfeld, Friedrich Wilhelm Hoynk und Johann Georg Huth.
179 1788/06/12
[Lugt 4329]
180 1788/08/01-1788/08/06 [Anonym]; Hannover, In des weil. Cammer-Secretarii Seip Wohnung am Egidien Thore Verkäufer nach Titelblatt: Seip Verkäufer: Seip Lose mit Gemälden: 21 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniss der Kupferstiche, Zeichnungen, Gemälde, auch Kunstsachen, welche, in so fem sich dazu nicht Käufer im Ganzen vor Ende des Junii Monaths finden, am lten August 1788. u.f. Tagen in des weil. Cammer-Secretarii Seip Wohnung am Egidien-Thore, Stückweise meistbietend verkauft werden sollen. Eine vorzügliche Dactyliothec findet sich auf der 31sten Seite. Hannover 1788. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog wurde die Kunstsammlung des Kammersekretärs Seip aus Hannover verauktioniert. In erster Linie wurden graphische Arbeiten angeboten. Unter der Abteilung "Gemälde mit Oelfarbe" (S. 25 und 26) finden sich 21 Gemälde, die nur schlagwortartig beschrieben sind. Angaben zu den Maßen oder dem Material sind in tabellarischer Form beigefügt, auch die Rahmen werden beschrieben. Bis auf zwei Bilder, einem Historienbild von Thielo und einem Porträt von Tischbein (Nrn. 4 und 10), bleiben alle Gemälde anonym.
Reimarus; Hamburg, Börsen=Saal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 216 Standorte: *KH Annotiert mit einigen Preisen, bei denen es sich wahrscheinlich um Schätzungen handelt. Titelblatt: Verzeichniß und kurzgefaßte Beschreibung einer Gemälden=Sammlung, welche den 12 Junii 1788 auf dem Börsen=Saal in Hamburg öffentlich an die Meistbietenden verkauft werden sollen, durch die Mackler Reimarus, Texier und von der Meeden. Gedruckt bey Carl Wilhelm Meyn, E. Hochedlen und Hochweisen Raths Buchdrucker. Kommentar: Dieser Katalog der Hamburger Makler Johann David Reimarus, Peter Texier und von der Meden verzeichnet insgesamt 216 Gemälde, die in zwei Abteilungen aufgeführt werden. Auf die Nummern 1 bis 166 (S. 3 bis 33) folgt ein 56 Nummern umfassender "Anhang einiger Cabinet=Gemälde" (S. 34 bis 40). Wahrscheinlich stammten diese Bilder aus einer anderen Sammlung. Die Beschreibungen sind zumeist sehr ausführlich und enthalten oftmals ästhetische Wertungen. Es handelt sich überwiegend um Gemälde der holländischen Schule, darunter vier Seestücke von Ludolf Backhuysen und fünf Landschaften von Jan van Goyen. Neben einer gleich großen Anzahl von flämischen und deutschen Gemälden werden auch zwölf Gemälde der französischen Schule verzeichnet, darunter Werke von Künstlern des 18. Jahrhunderts wie Pierre Labatie (Nrn. 61 und 62). Unter den insgesamt 36 deutschen Werken ist Christian Wilhelm Ernst Dietrich mit 13 Bildern vertreten. Gemälde Hamburger Maler tauchen nur vereinzelt und zwar vor allem im zweiten Teil des Katalogs auf. Auch eine Folge der vier Jahreszeiten des Berliner Hofmalers Daniel du Verdion wurde im zweiten Teil der Auktion offeriert (Nm. A30 bis A33). Am Rand des Exemplars KH finden sich bei 14 Gemälden handschriftliche Notizen zu Preisen. Die runden Beträge waren vermutlich die Preise, die sich ein Interessent als Limit gesetzt hatte. Alle 14 Preisangaben sind sehr hoch angesetzt, eine Landschaft mit einer Kutsche von Philips Wouwerman (Nr. 149) wurde sogar mit 600 Mark veranschlagt.
181 1788/08/21 Reimarus; Hamburg, Börsen=Saale Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 137 Standorte: *KH Annotiert sowohl in Bleistift als auch auf eingebundenen Leerseiten mit den meisten Käufernamen und den meisten Preisen. Titelblatt: Verzeichniß einer schönen Gemählde=Sammlung, imgleichen Wasserfarben=Stücke; uneingefaßte Kupferstiche und Handzeichnungen, verschiedne der Kunst betreffende Bücher; alte in Gips abgegoßne Antiquen und Portraits, einige Kunst=Sachen und Naturalien ec. wie auch Optische Sachen und Mathematische Instrumente. Dieses alles soll am Donnerstage, als den 21 August, 1788, auf dem hiesigen Börsen=Saale öffentlich verkauft werden durch den Mackler Reimarus, bey welchem dieses Verzeichniß zu haben ist. Tages vor dem Verkauf können die sämmtlichen Sachen, wie gewöhnlich, am benannten Orte besehen werden. Gedruckt bey Dietrich Anton Harmsen. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog des Hamburger Maklers Johann David Reimarus sind insgesamt 158 Losnummern verzeichnet. Noch im Anschluß sollten einer Notiz am Ende des Katalogs zufolge ungefaßte Kupferstiche und Handzeichnungen verauktioniert werden. Die Gemälde sind im ersten Teil des Katalogs unter den Nummern 1 bis 139 verzeichnet, bei den Nummern 138 und 139 handelt es sich allerdings um Aquarelle. Unter den versteigerten Gemälden befindet sich neben einer kleinen Anzahl von holländischen und flämischen Gemälden eine Gruppe von zwölf Bildern, die unter dem Namen "Gehrmann" aufgeführt sind; weitere 16 Gemälde werden dem dänischen Maler Jens Juel zugeschrieben. Möglicherweise handelt es sich um die Sammlung des Hamburger Malers Franz Octavio Gehrmann, der ein Jahr zuvor verstorben war. Gehrmann war wie Jens Juel Schüler seines Vaters Johann Michael Gehrmann, von dem nachweislich eines der unter dem Namen "Gehrmann" verzeichneten Gemälde stammt (Nr. 115). Die Beschreibungen im Katalog sind knapp gehalten; vorangestellt werden der Künstlername und die Maßangaben, es folgen die Bildbeschreibungen und die AnKATALOGE
121
gaben zum Material und zur Rahmung. Anonym bleiben insgesamt 17 Bilder, weitere werden nicht zu identifizierenden Monogrammisten zugeschrieben. Im Exemplar KH sind die Käufemamen und die erzielten Preise eingetragen; auch ist eine Liste mit der Angabe aller Namen und Preise dem Katalog beigefügt. Die Preise bleiben fast ausschließlich unter der Schwelle von 10 Mark, höhere Ergebnisse erzielten nur die Gemälde von Jens Juel. So wurden die Bildnisse von zwei spielenden Mädchen erst bei 160 Mark und 8 Schilling zugeschlagen. Unter den Käufern finden sich Hamburger Kunsthändler wie Johann Jobst Eckhardt, Johann Benjamin Ehrenreich und Johann Dietrich Lilly sowie die Namen Schröder, Seegel, Staamer und Westphalen, bei denen es sich vermutlich um Sammler handelt.
182 1788/09/01
und folgende Tage
[Lugt 4345]
Sammler zwischen der französischen Besetzung Kölns und dem Vormärz, in: Ausst.-Kat. Köln 1995, S. 149-162, bes. S. 152.
183 1788/10/01
und folgende Tage
[Anonym]; Frankfurt am Main, In dem Senckenbergischen Stiftungshauss Verkäufer nach Titelblatt: Keine Verkäufer nach Exemplar des Auktionators: Spitalmeister Maas Verkäufer: Maas, Otto Wilhelm Lose mit Gemälden: 185 Standorte: *SMF Annotiert mit allen Käufernamen und Preisen auf eingebundenen Leerseiten. Wahrscheinlich handelt es sich um das Exemplar des Auktionators.
[Anonym]; Köln, In der Stadt Mayland auf der hohe Straß Verkäufer nach Titelblatt: Johann Anton Farina Verkäufer: Farina, Johann Anton Lose mit Gemälden: 826 Standorte: LBDa I Nicht annotiert (deutsche Ausgabe). LBDa II Nicht annotiert (französische Ausgabe). UBK Nicht annotiert (deutsche Ausgabe). Titelblatt: Verzeichniß einer auserlesenen Sammlung von Gemählderen Deren ältesten und berühmtesten Meistern, taxirt von einem sehr erfahren und geschicktesten Meister, und hinterlassen durch den verstorbenen Herrn Johann Anton Farina, wovon der Verkauf an den Meistbietenden ge[gen] baare Zahlung den Rtlr zu 60 Stüber den lten 7bris 1788. in der Stadt Mayland auf der hohe Straß vor sich gehen wird. Diese Sammlung kann ein Monat vorher täglich in Augenschein genommen werden, Morgens von 8 bis 11, Nachmittags von 2 bis 5 Uhr. Kölln, gedruckt bey Christian Everaerts. Catalogue d'une belle collection de tableaux. Des Maitres les plus anciennes & celebres Taxe d'un des Meilleurs Maitres, delaisse par feu le Sieur Jean Antoine Farina, dont la vente se fera au plus offrant contre Argent comptant, l'Ecus d'Empire a 60 Sols le 1. 7bre 1788 a la Ville de Milan a la haute Rue. Cette Collection pourra etre vue un Mois avant la vent fixe depuis 8 heures jusqu'a 11 heures du matin, & depuis 2 heures apres midi jusqu'a 5 heures. A Cologne. De l'Imprimerie de Christian Everaerts. Kommentar: In dieser Versteigerung wurde die Gemäldesammlung des Kölner Kaufmanns Johann Anton Farina (1718-1787) verauktioniert. Johann Anton war ein Neffe von Johann Maria Farina, der 1709 die Duftwasserfirma "Kölnisch Wasser" gegründet hatte. Von Johann Anton Farina wurde eine eigene Parfümerie aufgebaut, die den Namen "Johann Anton Farina zur Stadt Mailand" trug. In dem 34seitigen Katalog werden insgesamt 834 Losnummern aufgeführt. Alle Bildbeschreibungen dieses Katalogs sind sehr kurz gehalten, meist auf ein Schlagwort reduziert. Alle Maße werden in tabellarischer Form neben den Bildtiteln aufgeführt. Das Material des Bildträgers wird mit Abkürzungen wie "L" oder "H" angegeben. Im Vergleich zu Frankfurter Versteigerungskatalogen der Zeit ist die Zusammenstellung wenig sorgfältig. Fast die Hälfte der Einträge weist keine Künstlernamen auf. Bei den zugeschriebenen Bildern überwiegen Gemälde der holländischen und flämischen Schule. Nach den Angaben des Katalogs handelt es sich bei den zahlreichen Bildern von Nicolaes Pietersz. Berchem, Jacob Jordaens und Peter Paul Rubens ausschließlich um Schulbilder oder Kopien. Bei den insgesamt 90 Werken deutscher Künstler sind vor allem die Kölner Maler stark repräsentiert, darunter Andreas Greiss mit 16, Johann Hulsmann mit 15 und Dietrich Pottgiesser mit elf Gemälden. Auch die italienischen Schulen sind mit 67 Bildern im Vergleich zu anderen deutschen Sammlungen relativ zahlreich zu finden. Lit.: Gregor Berghausen, Wirtschaftliche Verflechtungen der Kölner 122
KATALOGE
Titelblatt: Verzeichniß einer Samlung von Gemälden derer berühmtesten Flammändischen, Niederländischen und Holländischen Meister, welche zu Frankfurt am Mayn in dem Senckenbergischen Stiftungshauß den lten Oktober 1788. und die darauffolgende Täge öffentlich an den Meistbietenden gegen baare Bezahlung überlassen werden sollen. Sämtliche Gemälde sind nach dem Französischen Maas=Stab gemessen, und können alle Tag Nachmittags von 2 bis 4 Uhr in besagtem Stifthauß hinter der sogenännten Schlimmen=Mauer besehen werden. Gedruckt mit Brönnerischen Schriften. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog wurden insgesamt 164 Lose mit Gemälden angeboten. Möglicherweise handelt es sich um die Sammlung des Kaufmanns Johann Heinrich Mettenius 17101770), da im Exemplar SMF der Hinweis notiert ist: "Mettenius Oelgemälde". Am Ende des Katalogs sind noch 21 Lose mit Gemälden handschriftlich angefügt, die nach dem annotierten Exemplar SMF "von Spital-Meister Maas gegeben" worden seien. Die meisten Bildbeschreibungen sind kurz in einen Satz gefaßt und werden durch die Angabe der Maße und des Materials ergänzt. Bei zahlreichen Bildtiteln finden sich ästhetische Wertungen. Die Sammlung setzt sich fast ausschließlich aus Werken der holländischen und flämischen Schule des 17. und 18. Jahrhunderts zusammen. Die deutsche Schule ist mit acht Gemälden im Vergleich zu anderen Frankfurter Verkäufen ungewöhnlich schwach vertreten, so daß nicht unwahrscheinlich ist, daß diese Sammlung nach Frankfurt importiert wurde. Hierfür würde auch sprechen, daß alle Maße in französischen Fuß angegeben sind. Anonym bleiben nur acht Bilder des gedruckten Katalogs sowie die 21 handschriftlich angefügten Gemälde aus dem Besitz des Spitalmeisters Otto Wilhelm Maas. Nach den Angaben des annotierten Exemplars SMF bewegten sich die Ergebnisse der Auktion auf einem relativ niedrigen Preisniveau, zumeist erzielten die Gemälde zwischen 5 und 30 Gulden. Der höchste Preis wurde mit 46 Gulden und 15 Kreuzern für eine Landschaft von Johann Franz Meskens bezahlt (Nr. 81). Insgesamt wurden für die 164 Bilder des gedruckten Katalogs 2.204 Gulden und 30 Kreuzer erreicht, also durchschnittlich fast 14 Gulden je Bild. Unter den Käufernamen finden sich die Frankfurter Kunstsammler Johann Daniel Heusei, Otto Wilhelm Maas (vermutlich der handschriftlich erwähnte Einlieferer), Johann Friedrich Müller, Johann Georg Schneidewind und Friedrich Samuel Freiherr von Schmidt. Auch der Kunstschriftsteller und Kunsthändler Heinrich Sebastian Hüsgen erwarb acht Bilder, der ebenfalls als Kunsthändler agierende Maler Johann Peter Trautmann erhielt den Zuschlag bei sieben Gemälden. Lit.: Schmidt 1960, o.P.
184 1788/12/13 Peter Texier; Hamburg, Börsen=Saal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 42
Standorte: *KH Annotiert mit allen Käufernamen und Preisen auf eingebundenen Leerseiten. Titelblatt: Verzeichniß einer vortreflichen Kupferstich=Sammlung, wobey besonders seltene Stücke sich befinden, alle unter Glas mit Rahmen; nebst einem Anhang von Cabinet=Gemählden, welches alles am 13ten December, 1788, auf dem Börsen=Saal öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden sollen durch den Mackler Peter Texier, bei welchen die Catalogi zu bekommen sind. Tages vor dem Verkauf können sämmtliche Sachen am benannten Orte besehen werden. Hamburg, gedruckt bey Dietrich Anton Harmsen. Kommentar: Als Anhang zu einer Kupferstichsammlung wurden in diesem Versteigerungskatalog des Hamburger Maklers Peter Texier unter den Losnummern 140 bis 178 Gemälde angeboten. Drei Lose wurden im Exemplar KH noch handschriftlich hinzugefügt, so daß insgesamt 42 Gemälde zum Aufruf kamen. Wahrscheinlich stammte die Kupferstichsammlung aus Frankreich, da die französische Schule ungewöhnlich stark vertreten ist und die meisten Bildtitel in französischer Sprache angegeben werden. Da sich unter den Gemälden jedoch kein Werk der französischen Schule findet, kommen diese vermutlich aus einer anderen Sammlung. Die Beschreibungen der Gemälde, die vorwiegend der holländischen, flämischen oder deutschen Schule angehören, sind knapp gehalten, Angaben des Formats fehlen. Anonym bleiben elf Gemälde. Das Exemplar KH enthält die Namen der Käufer und Angaben zu den erzielten Preisen. Nahezu alle Gemälde wurden von den Kunsthändlern Michael Bostelmann, Johann Benjamin Ehrenreich und Johann Dietrich Lilly angekauft. 185 1789/00/00
Daten unbekannt
Ruffini; Amberg, Haus des Sammlers Verkäufer nach Titelblatt: Keine Standorte: BSBM Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Titelblatt: Verzeichniss einer Gemäldesammlung im Ruffinischen Hause. Amberg 1789. Kommentar: Das Exemplar BSBM wurde im Zweiten Weltkrieg vernichtet (Sig. Art. 290). 186 1789/00/00
Daten unbekannt
[Anonym]; Mannheim Verkäufer nach Titelblatt: F. von Castellischen Mahlereien (Monsieur le Baron de Castell) Verkäufer: Castell, Joseph Sebastian, Freiherr von Lose mit Gemälden: 403 Standorte: *SAM II Protokoll mit allen Preisen. In der Akte mit dem Protokoll ist eine deutsche und eine französische Ausgabe des Katalogs eingebunden, die jeweils nicht annotiert sind. SAM I Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß der zum Verkaufe ausgebottenen F. von Castellischen Mahlereien zu Mannheim in der Pfalz. Gedruckt, in der Hof= und akadem. Buchdruckerei 1789. Specification des Peintures ä vendre appartenantes ä Monsieur le baron de Castell a Mannheim, en Palatinat. 1789. Kommentar: In diesem Katalog wurde die Sammlung des Mannheimer Hofbeamten Joseph Sebastian Freiherr von Castell (1714—1791) zusammengestellt. Es handelt sich vermutlich um einen reinen Verkaufskatalog, da sich auf dem Titelblatt keinerlei Angaben zu einem Auktionstermin finden. Castell war in verschiedenen Positionen am Hofe des Kurfürsten Carl Theodor von der Pfalz beschäftigt, zu-
nächst als Hofgerichtsrat, als Oberappellationsgerichtsrat und schließlich seit 1779 als Finanzminister auch am Münchener Hof. Wegen dieser neuen Stellung mußte Castell Mannheim verlassen und nach München übersiedeln. Vermutlich wurde in diesem Zusammenhang eine Schätzung der Sammlung in dessen Mannheimer Haus durchgeführt, die vom Düsseldorfer Galerieinspektor Lambert Krähe vorgenommen wurde. Im Jahre 1787 ist dann der Bestand der Castellschen Sammlung erneut inventarisiert und taxiert worden. Die Gemälde wurden nach der Raumfolge des Castellschen Hauses aufgelistet. Zunächst sind in 125 Nummern die Gemälde des Erdgeschoßbereiches aufgelistet, anschließend folgen die Bilder der Bildergalerie und der anliegenden Räumlichkeiten im ersten Stock (Nm. 1 bis 347). Bei der Taxierung nahm man Bezug auf die von "Herrn Hofkammerrahte Krohe [sie] vorgenommene Abschätzung". Die Gesamtsumme belief sich auf 44.877,37 Gulden. Nach diesem Verkaufsinventar erschien dann der gedruckte Verkaufskatalog, in der über die Nummern 1 bis 347 aus dem zweiten Teil des Inventars hinaus noch einige zusätzliche Bilder aufgeführt wurden. Insgesamt geht die Zählung bis Losnummer 441. Im Vorbericht des Katalogs wird auf die Taxierung durch Lambert Krähe in Höhe von 43.634 Gulden hingewiesen. Die Sammlung sollte "entweder zusammen oder auch parthie= und stückweise käuflich abgegeben" werden. Von einer Auktion ist weder auf dem Titelblatt noch im Vorbericht die Rede. Als Beauftrager des Verkaufes wird der "Kurpfälzische Stadtgerichts=Assessor" Rütinger angeben. Tenner vermutet, es sei tatsächlich zu einer Auktion gekommen und gibt an, diese sei in den Zeitungen angekündigt worden, ohne jedoch Belege angeben zu können (Tenner 1966, S. 50). Stattdessen wurde die Sammlung 1791 nach dem Tod Castells erneut taxiert. Dieses neue Inventar folgt der Zählung und den Bildbeschreibungen des Katalogs von 1789. Einzelne Gemälde sind jedoch in diesem Inventar nicht mehr erwähnt, vermutlich wurden diese Bilder verkauft. Im Vergleich zu dem Inventar von 1789 lagen die Preisschätzungen weit niedriger, insgesamt beschränkten sie sich nun auf die Summe von 9.041 Gulden statt der noch kurz zuvor angesetzten 43.634 Gulden. Allerdings muß berücksichtigt werden, daß ein Teil der Bilder bereits veräußert worden war. Am 6. Dezember 1793 beantragt Rütinger im Auftrag der Erben die Versteigerung der Sammlung, da nun auch das Mannheimer Stadthaus verkauft werden sollte und die Bildersammlung aufgelöst werden mußte. Obwohl dem Antrag am 28. Februar 1794 stattgegeben wurde, kam es auch diesmal nicht zu einer Auktion. Stattdessen wurde die Sammlung auf das Castellsche Anwesen in Bedernau (bei Mindelheim in Süd-Bayern) verlagert. Erst im Jahre 1823 wurden 303 Bilder zum Verkauf angeboten und 1824 nochmals 348 Gemälde aus der Sammlung von Joseph Leopold Gabriel Freiherr von Castell in Hamburg versteigert (Lugt 10717), in der nach Angaben des Exemplars KH 51.776,33 Gulden erzielt wurden. Laut Tenner waren nur einige wenige Bilder dieser Auktion schon in dem Katalog von 1789 erwähnt worden. Im gedruckten Katalog der Castellschen Sammlung von 1789 überwogen Werke der holländischen und flämischen Schule. Stark vertreten war jedoch auch die deutsche Schule, in der neben zeitgenössischen Mannheimer Künstlern auch zahlreiche Bilder altdeutscher Künstler vertreten waren, so elf Bilder von Christoph Schwartz sowie Gemälde von Albrecht Altdorfer, Albrecht Dürer, Hans Holbein d.J. und d.Ä. und von Martin Schongauer. Unter den 44 italienischen Bildern standen Werke des späten 17. und des frühen 18. Jahrhunderts im Vordergrund. Anonym blieben 43 Gemälde. Nach den Angaben des Schätzungsprotokolls von 1789 lagen die Preise auf einem überdurchschnittlich hohen Niveau, variierten allerdings auch stark. Einzelne italienische Bilder wurden sehr hoch eingestuft. So wurde beispielsweise ein Bild mit dem Hl. Domenicus von Ludovico Carracci (Nr. 187) auf 400 Gulden geschätzt. Lit.: Tenner 1966, S. 49-59.
KATALOGE
123
187 1789/01/19
und folgende Tage
[Lugt 4379]
C.C.H. Rost; Leipzig, Im rothen Collegio Verkäufer nach Titelblatt: Keine
Lit.: Christian Gottlieb Jöcher, Allgemeines Gelehrten-Lexicon. Fortsetzungen und Ergänzungen von Johann Christoph Adelung, 7 Bde., Leipzig 1784-1897, Bd. 1, Sp. 1374f.
Lose mit Gemälden: 49 Standorte: *BDu Annotiert mit allen Käufernamen und Preisen. SBBa Nicht annotiert. Aus dem Besitz von Joseph Heller. Titelblatt: Anzeige einer ansehnlichen Kupferstich-Sammlung alter, neuer und seltener Blätter aus allen Schulen, auch einer beträchtlichen Anzahl von Kupferstichwerken und Handzeichnungen. Zum Anhange folgen: Die verschiedenen Beyträge für die Rostische jährlich festgesetzte Auction, an Kupferstichen aus allen Schulen, Handzeichnungen, Gemählden, Kupferstichwerken und Kunstsachen, worunter Ein sehr wohlerhaltener Flügel von Z. Hildebrandt, nebst einem guten Claviere. Den 19ten Ianuar 1789 wird davon, in den gewöhnlichen Vor- und Nachmittagsstunden, von dem verpflichteten Universitäts-Proclamator, Herrn Weigel, im rothen Collegio zu Leipzig, gegen gleich baare Bezahlung in Louisd'ors ä 5 Rthlr. oder Sächs. Conv. Münze, der öffentliche Verkauf gehalten werden. No. VII. Leipzig, gedruckt bey Gotthelf Albrecht Friedrich Löper. Kommentar: In der siebten Versteigerung der Kunsthandlung Rost wurden erneut überwiegend graphische Arbeiten verschiedener Einlieferer (Nrn. 1 bis 3922) sowie Kunstbücher und Kupferstichwerke angeboten. Insgesamt enthält der Katalog 55 Gemälde (Nrn. 3923 bis 3972). Wie die übrigen Kataloge des Kunsthändlers Carl Christian Heinrich Rost (1741-1798) ist dieses Verzeichnis sorgfältig zusammengestellt und mit Einführung und Literaturverzeichnis ausgestattet. Es wurden überwiegend deutsche Gemälde des 18. Jahrhunderts angeboten, darunter allein elf Arbeiten des Leipziger Malers Johann Adam Fassauer, der vermutlich kurz zuvor verstorben war. Nach den Angaben des annotierten Exemplars BDu wurden die meisten Bilder bei geringen Preisen von weniger als einem Taler zugeschlagen. Den höchsten Preis erzielten zwei Landschaften von Franz Edmund Weirotter (Nr. 3937) mit 6 Talern und 9 Groschen. Lit.: Trautscholdt 1957.
188 1789/03/05
und folgende Tage
[Anonym]; Schöningen, Haus des Sammlers Verkäufer nach Titelblatt: M. loan. Arnold. Ballenstadii rectoris qvondam Schoeningensis Verkäufer: Ballenstedt, Johann Arnold Lose mit Gemälden: 5 Standorte: HABW Nicht annotiert. Titelblatt: Catalogvs librorvm M. Ionan. Arnold. Ballenstadii rectoris qvondam Schoeningensis. Accedvnt mvsevm rervm natvralivm atqve artifcialivm, tabvlarum pictarvm atqve aenearvm nec non manvscripta divendvntvr Schoeningae D. V. Mart. DDCCLXXXIX. Helmstadii typis Io. Henric. Kühnlin. Kommentar: In der Versteigerung der Sammlung des Theologen und Pädagogen Johann Arnold Ballenstedt (1705-1788) wurden überwiegend Bücher, Landkarten und Naturalien angeboten. Ebenfalls standen zahlreiche Kupferstiche zum Verkauf, die in 40 Bänden eingebunden waren. Ballenstedt wurde nach dem Studium in Helmstedt Konrektor in Wolfenbüttel und 1747 Rektor der Schule in Schöningen. Zahlreiche Veröffentlichungen reflektieren über schulpädagogische Themen, wie beispielsweise die Abhandlung "Von der Einrichtung einer Schulbibliothek" aus dem Jahre 1765. In dem Versteigerungskatalog von 179 Seiten finden sich auch fünf nicht numerierte Losnummern mit Gemälden in einer eigenen kleinen Abteilung (S. 155), darunter zwölf Portraitminiaturen des Salzdahlumer Hofmalers Ludwig Wilhelm Busch (Nr. 5). 124
KATALOGE
189 1789/04/16-1789/04/17 P. Texier; Hamburg, Börsensaal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 140 Standorte: *KH Annotiert mit allen Käufernamen und Preisen auf eingebundenen Leerseiten. Titelblatt: Catalogue einer auserlesenen Sammlung Cabinet= und Gallerie=Gemählde, welche, von mehr den hundert Jahren, auf dem hiesigen hochlöblichen Rathhause aufbewahrt worden, nebst einer vortreflichen Anzahl Kupferstiche unter Glas und Rahmen, wie auch Uneingefaßte, und noch einiger ausgesuchten Erzstuffen=Sammlungen, mit Steinarten systematischer Abtheilung, und besonders schöne Conchilien=Kästen, soll auf dem Börsensaal, am löten und 17ten April, h.a. durch die Mackler, P. Texier & M. Bostelmann, gegen contante Bezahlung an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden; wann solche Tages vorher in Augenschein genommen worden sind. Catalogen sind bey obgenannten Macklern für 2 schl. den Armen zum Besten, zu haben. Hamburg, 1789. Kommentar: Dem Titelblatt des Katalogs zufolge war die 140 Gemälde umfassende Sammlung seit dem 17. Jahrhundert im Hamburger Rathaus aufbewahrt worden. Unklar ist, ob es sich bei dieser Sammlung um öffentliches Eigentum handelte, ob die Sammlung nur in den Rathausräumen deponiert worden war und ob sie ausgestellt war. Calov sieht hierin jedoch eine Vorform der öffentlichen Kunstsammlung. Die Gemälde wurden zusammen mit einem Konvolut von Kupferstichen und einer mineralogischen Sammlung auf dem Börsensaal durch die Hamburger Makler Peter Texier und Michael Bostelmann versteigert. Die Bildbeschreibungen sind knapp gehalten, Losnummern, Maßangaben und der Künstlername werden dem Bildtitel als Überschrift vorangestellt. Oftmals werden in die Beschreibungen Wertungen zur Qualität eines Bildes eingeflochten. In der Rathaus-Sammlung überwogen Werke holländischer und flämischer Meister des 17. Jahrhunderts, darunter mehrere Arbeiten von Jan Josephsz. van Goyen und Jacob Willemsz. de Wet. Bei den deutschen Bildern finden sich auch zahlreiche Gemälde zeitgenössischer Künstler, die keinesfalls - wie im Titel behauptet wird - schon hundert Jahre verwahrt worden sein konnten. Wahrscheinlich stammten nicht alle Bilder aus der Rathaus-Sammlung, denn ein Gemälde von dem jahrelang in Frankfurt lebenden Giovanni Battista Innocenzo Colombo (Nr. 64) ist beispielsweise mit dem Enstehungsdatum 1755 verzeichnet. Das Exemplar KH enthält auf den eingeschossenen Leerseiten die Angaben der Käufer und die der erzielten Preise. Die höchsten Preise erreichten mehrere Gemälde von Otto Wagenfeldt, die als Pendants angeboten wurden (Nm. 127 und 128 für 80 Mark und 4 Schilling; Nrn. 125 und 126 für 68 Mark). Das Bildnis eines Philosophen von Peter Paul Rubens (Nr. 15) wurde bei 15 Mark zugeschlagen und mit diesem niedrigen Ergebnis wohl kaum als Original angesehen. Zwei Seestücke von Ludolf Backhuysen blieben mit je 20 Mark (Nrn. 65 und 66) ebenfalls auf eher niedrigem Niveau. Unter den Käufern engagierte sich vor allem der Hamburger Kunsthändler Johann Jobst Eckhardt stark, ansonsten waren die Zuschläge unter Hamburger Sammlern breit gestreut. Allein sechs der insgesamt acht Gemälde von Otto Wagenfeldt wurden durch einen Käufer namens Biene erworben, der ansonsten bei Hamburger Auktionen nicht in Erscheinung getreten ist. Lit.: Calov 1969, S. 42, Anm. 106, mit Hinweisen auf ältere Literatur.
190 1789/06/06
[Lugt 4456]
Packischefsky; Hamburg, Börsensaal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 23 Standorte: *KH I Annotiert mit allen Käufernamen und Preisen. KH II Nicht annotiert. Das Titelblatt fehlt. Titelblatt: Verzeichniß einer vortreflichen Sammlung Englischer Kupferstiche, unter Glas, in schwarzen Rahmen, mit goldenen Leisten, sauber gefaßt, nebst einigen Gemählden, welche den 6ten Junius, 1789, auf dem Börsensaale in Hamburg, durch den Mackler Packischefsky, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden sollen. Dies Verzeichniß ist bey obbenanntem Mackler für 2 schl. den Armen zum Besten, zu bekommen. Kommentar: In dieser Versteigerung einer Sammlung von Kupferstichen wurden auch 22 Lose mit Gemälden angeboten, die auf den Seiten 20 bis 24 verzeichnet sind. Ein weiteres anonymes Gemälde wurde handschriftlich im annotierten Exemplar KH I ergänzt. Alle Beschreibungen sind kurz, aber prägnant und durch Angaben zu den Maßen und den Materialien ergänzt. Losnummern und Künstlernamen werden in dem übersichtlich gestalteten Katalog als Überschriften gesetzt. Unter den Gemälden finden sich Beispiele aus allen Schulen, teilweise handelt es sich um Kopien, so beispielsweise nach Rembrandt (Nr. 10) oder Anthonie van Dyck (Nr. 2). Nach den Angaben des annotierten Exemplars KH wurden die meisten Bilder von den Käufern Ruprecht und Schmeichel übernommen. Der ansonsten auf anderen Hamburger Auktionen nicht nachweisbare Schmeichel erwarb allein zehn Gemälde. Die Preise lagen alle unter 10 Mark je Los. 191 1789/06/12-1789/06/13 Texier; Hamburg, Börsensaal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 217 Standorte: *KH Annotiert mit den meisten Käufernamen und allen Preisen bis zum Los 201. Im Appendix sind alle Käufemamen und Preise vermerkt. Titelblatt: Verzeichniß sehr schöner Gemähide, wie auch Wasserfarben=Stücke, unter Rahmen und Glas, Englische und Französische Kupferstiche, und einige auf Glas abgezogene Englische Stücke, welche theils aus einer hiesigen Verlassenschaft, theils aus der Fremde eingesandt sind, und den 12ten und 13ten Junius, 1789, auf dem hiesigen Börsensaal öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden sollen, durch die Mackler Texier, Bostelmann & Schoen. Bey obgedachten Macklern ist auch dieses Verzeichniß, den Armen zum Besten, für 2 schl. zu haben. Hamburg, gedruckt bey J.M. Michaelsen. Kommentar: In dieser gemeinschaftlich von den Maklern Peter Texier, Michael Bostelmann und Johann Hinrich Schoen organisierten Versteigerung kamen insgesamt 217 Gemälde zum Aufruf. In dem 32 Seiten umfassenden Katalog sind die Gemälde auf den Seiten 3 bis 10 (Nrn. 1 bis 65) und 15 bis 30 (Nrn. 113 bis 243) verzeichnet, dazwischen werden die auf Glas gemalten Bilder und Kupferstiche aufgeführt. Am Ende des Katalogs verzeichnet ein eigener unpaginierter "Appendix" unter den Nrn. 268 bis 290 weitere Gemälde. Dem Titelblatt zufolge stammen die auf der Börse versteigerten Gemälde zu einem Teil aus einem Hamburger Nachlaß, zum anderen wurden sie "aus der Fremde" eingesandt; die Abfolge der Einträge erlaubt jedoch keine entsprechende Zuordnung der Bilder. Der Katalog ist übersichtlich gestaltet, indem die Losnummern und die Künstlernamen als Überschriften gesetzt sind. Alle Be-
schreibungen sind kurz, aber prägnant und schließen oftmals mit einer Beurteilung über die Qualität des Bildes wie beispielsweise "fleißig und schön gemahlt", "sehr kräftig und meisterhaft gemahlt" oder "stark gemahlt" ab. Viele Gemälde sind als Pendants zusammengefaßt. Anonym bleiben 19 Bilder, zahlreiche Werke werden nicht zu identifizierenden Monogrammisten zugeordnet. Der größte Teil der Bilder gehört der deutschen und der holländischen Schule an, gefolgt von einer Gruppe flämischer und italienischer Gemälde, darunter ein Giorgione zugeschriebenes Bild (Nr. 280). Bei den deutschen Bildern handelte es sich in erster Linie um Werke Hamburger Künstler, so Hans Hinrich Rundt, Matthias Scheits und der zeitweise in Hamburg lebende Tobias Stranovius. Im Exemplar KH sind Zwischenblätter mit handschriftlichen Verzeichnissen der Käufernamen und der Preise eingebunden. Die erzielten Ergebnisse blieben auf niedrigem Niveau, meist erfolgte der Zuschlag bei Preisen unter 10 Mark. Unter den Käufern traten vor allem die Hamburger Kunsthändler Francis Didier Bertheau, Johann Jobst Eckhardt und Peter Sieberg auf. Eckhardt übernahm allein 26 Gemälde. 192 1789/08/00
Daten unbekannt
[Anonym]; Hannover, Im Arenholdschen Hause auf der Aeg. Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 158 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniss der Gemälde, Kupferstiche auch Gypssachen, welche im August 1789. im Arenholdschen Hause auf der Aeg. Neust, einzeln verauctionirt werden. Hannover, gedruckt bey I. T. Lamminger. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog einer Sammlung aus Hannover handelt es sich wahrscheinlich um die Sammlung Arenhold, da die Versteigerung im "Arenholdschen Haus" durchgeführt wurde. Alle Bildbeschreibungen sind sehr kurz, meist nur schlagwortartig, da der Katalog in tabellarischer Form angelegt ist und nur wenig Platz für die Bildtitel bleibt. Auch die Maße und Angaben zum Rahmen werden in abgekürzter Form in den Spalten der Tabelle angeführt. Von den insgesamt 158 Gemälden bleiben 119 anonym, darunter sind aber - wie die einleitende "Nachricht" vermerkt - "viele vorzüchliche Stücke befindlich". Unter den zugeschriebenen Werken überwiegen Gemälde der holländischen und flämischen Schule des 17. Jahrhunderts. Bei den drei deutschen Bildern ist auch ein Werk von "Thilo" verzeichnet (Nr. 142). Vermutlich handelt es sich hier um ein Gemälde des in Hannover tätigen Malers Johann Anton Wilhelm Thielo, der im Vorwort des Katalogs auch als Ansprechpartner für Kaufinteressierte genannt wird. Neben Thielo übernahmen auch Juris Strohmeier und Johann Caspar Maslow Kommissionen. 193 1789/08/18-1789/08/20
[Lugt 4471]
Goverts; Hamburg, Börsen=Saal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 118 Standorte: *KH Unvollständig; vorhanden sind die Seiten 1 bis 16. Annotiert mit einigen ganz wenigen Preisen. Titelblatt: Catalogue einer vortreflichen Sammlung von Gallery=Cabinet= und Mignatur=Gemählde, als auch eingefaßte und unter Glas befindliche Handzeichnungen, benebst verschiedener seltenen kleinen Kupferstiche in fein vergoldeten Rahmen und einige mit Copenhagner Vergoldung unter Glas, welche öffentlich an den Meistbiethenden gegen Bezahlung in grob Courant auf dem Börsen=Saal verkauft werden sollen, wann solche vorher in beliebigen AugenKATALOGE
125
schein genommen worden. Die Makler Goverts und P. Lapoterie sind die Verkäufer dieser wohlausgesuchten Sammlung von so vielen großen Künstlern verfertigten Stücke. Die meisten davon sind wohl conservirt, und mit w.c. bezeichnet. Der 18, 19 und 20 Aug. ist dazu bestimmt. Der Catalogus ist zu haben bey benannte Makler für 2 Schill, den Armen zum Besten, Hamburg, gedruckt bey D. A. Harmsen 1789. Kommentar: Das einzige bisher nachweisbare Exemplar dieses Versteigerungskatalogs der Hamburger Makler Hermann Friderich Goverts und Pierre Laporterie aus der Hamburger Kunsthalle ist unvollständig, worauf schon Lugt hingewiesen hat. Erhalten geblieben sind nur die ersten 16 Seiten mit 118 Einträgen. Zu den letzten erhaltenen Losnummern 117/118 ist nur noch der Anfang des Eintrags erhalten. Da die Auktion auf drei Tage angesetzt war, dürfte die Anzahl der zur Versteigerung gelangten Gemälde weit größer gewesen sein. Den umfangreichsten Teil bilden Werke der holländischen und deutschen Schule, gefolgt von einer kleinen Anzahl von flämischen und italienischen Gemälden. Auf den als Überschrift vorangestellten Künstlernamen folgt durchweg eine knappe Beschreibung, die von der Angabe des Materials und der Maße abgeschlossen wird. Bei anonym verzeichneten Gemälden werden stilistische Zuordnungen wie "so schön wie Miris" (Nr. 108) oder "wie van der Velden" (Nr. 111) vorgenommen. Oftmals wird auch auf die "beste" oder die "erste Zeit" eines Künstlers verwiesen. Bei den italienischen Bildern handelt es sich um eine Folge von Kopien nach Giovanni Battista Piazzetta (Nrn. 69 bis 72, 77 und 78) sowie Christus mit der Dornenkrone von Carlo Dolci (Nr. 34). Im Exemplar KH finden sich am Rand vereinzelt handschriftliche Notizen mit Preisen.
194 1789/08/24
und folgende Tage
[Anonym]; Flensburg Verkäufer nach Titelblatt: Keine Verkäufer nach anderer Quelle: [Joachim Wasserschiebe] Verkäufer: Wasserschiebe, Joachim Lose mit Gemälden: 24 Standorte: KBK Nicht annotiert. Titelblatt: Catalogus einer ansehnlichen Samlung französischer Kupferstiche, von den berühmtesten Meistern, in verschiedenen Formaten, dem am Ende beigefüget wird ein Verzeichniß verschiedener schöner Kupferstiche und andere Zeichnungen in vergoldeten Rahmen mit Glas, nebst Portraits und andere Malereien von Oel=Farbe, welche den 24ten August d.J. zu Flensburg öffentlich an die Meistbietende gegen baare Bezahlung verkaufet werden sollen. Schleswig, gedruckt mit Serringhausenschen Schriften, 1789. Kommentar: In diesem anonymen Flensburger Versteigerungskatalog wurden vor allem graphische Arbeiten angeboten. Sie gehörten zur Sammlung Joachim Wasserschlebes (1709-1787), der nach einem längeren Aufenthalt in Paris 1752 in den Dienst des dänischen Königs getreten war. Er baute eine bedeutende Kupferstichsammlung auf, in der die zeitgenössischen französischen Künstler außergewöhnlich stark vertreten waren. Nach dem Sturz seines Protektors, des dänischen Außenministers Bernstorff, kehrte er in seine Heimat bei Flensburg zurück. Den größten Teil seiner Kupferstichsammlung konnte Wasserschiebe 1783 an die Königliche Bibliothek in Kopenhagen verkaufen. Aus dem Nachlaß wurde am 24. August 1789 die Bibliothek des Sammlers in Flensburg versteigert. Die Übereinstimmung von Ort und Datum läßt darauf schließen, daß in dem vorliegenden Katalog die Restbestände der Graphiksammlung Wasserschlebes angeboten wurden. Dafür spricht auch, daß die Sammlung auf die französische Schule ausgerichtet ist und ein Porträtgemälde von Wasserschlebes ehemaligem Dienstherrn Bernstorff enthält (Nr. 22).
Die 24 Gemälde, offensichtlich Ausstattungsstücke von Wasser126
KATALOGE
schlebes Palais, sind auf den Seiten 29 und 30 als Anhang verzeichnet. Die Beschreibungen sind denkbar knapp, in der Regel ohne Angabe des Materials und der Maße; auch die Künstlernamen bleiben bis auf zwei Ausnahmen ungenannt. Der Künstler der beiden bezeichneten Bilder, "Heitmann", konnte nicht eindeutig identifziert werden. Lit.: Η. Jorgensen, in: Dansk Biografisch Leksikon, Bd. 15, 1984, S. 302; Palle Birkelund, Über Joachim Wasserschiebe und seine Kupferstichsammlung. Ein Beitrag zur Geschichte der Königlichen Bibliothek zu Kopenhagen, in: Schleswig-Holstein und der Norden. Festschrift für Olaf Klose zum 65. Geburtstag, hg. von Alfred Kamphausen, Neumünster 1968, S.148-168. 195 1789/11/06-1789/11/07
[Lugt 4487]
Denecken; Hamburg, Börsensaal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 3 Standorte: KH Unvollständig; vorhanden sind die Seiten 1 bis 16. Nicht annotiert. Titelblatt: Catalogus einer besonders schönen Sammlung wohl conditionirter Englischer und Französischer Eingefaßter Kupferstiche unter Glas, nebst Gemähide in Oelfarbe, Wasserfarbe, Migniatür, Pastel, und auf Glas illuminirte englische Stücke, welche öffentlich durch die Mackler Denecken & Hagedorn, auf dem Börsensaal, den 6. u. 7. Nov. 1789, an den Meistbietenden verkauft werden sollen, wenn solche Tages vorher in beliebigen Augenschein genommen worden. Catalogi sind bey benannte Mackler und in No. 33. bey der großen Michaeliskirche gratis zu bekommmen. Hamburg, gedruckt bey Dieterich Anton Harmsen. Kommentar: In dieser Versteigerung wurden vor allem graphische Arbeiten verauktioniert. Wahrscheinlich haben sich von dem einzigen bisher bekannten Exemplar des Katalogs aus der Hamburger Kunsthalle nur die ersten 16 Seiten erhalten, denn nach Losnummer 301 endet der Katalog ziemlich unvermittelt (vgl. auch Kat. 193). Auf der letzten Seite beginnen die Einträge für die Gemälde, die die Nummernfolge der graphischen Arbeiten (beginnend mit Nr. 299) fortsetzen. Dort finden sich unter den Losnummern 299 bis 301 nur zwei anonyme italienische Fruchtstücke und ein Genrebild von Heinrich Leichner. Über den tatsächlichen Umfang der zur Versteigerung gelangten Gemälde liegen keine weiteren Informationen vor. Auf einer vergleichbaren Auktion im Juni 1790 (Kat. 190), auf der ebenfalls im wesentlichen eine Sammlung von Kupferstichen veräußert wurde, kamen insgesamt nur 22 Gemälde zum Verkauf.
196 1790/01/07
und folgende Tage
[Anonym]; München [oder Amberg?], In der Baron von Russinischen Behausung im Krotten=Thale im zweyten Stock Verkäufer nach Titelblatt: Churbaierische geheime Rath Freyherr von Obermaier Verkäufer: Obermayr, Joseph Eucharius, Freiherr von Lose mit Gemälden: 2160 Standorte: RKDH Nicht annotiert. SBA Nicht eingesehen. Titelblatt: Verzeichniß einer beträchtlichen Gemäldesammlung von den berühmtesten niederländischen, französischen, italiänischen, und deutschen Meistern, welche unter der einstigen Dultzeit zu heil. 3 Königen, den 7. Jänner 1790, und die folgenden Täge, zu München, in der Baron von Rusinischen Behausung im Krotten=Thale im zweyten Stock öffentlich an den Meistbiethenden gegen baare Bezahlung überlassen werden. Amberg, mit kochischen Schriften.
Kommentar: In dieser Versteigerung wurde die Sammlung des bayerischen Staatsrechtlers Joseph Eucharius Freiherr von Obermayr (1724—1789) verauktioniert. Obermayr wirkte seit 1748 als Hofkammerrat und Fiskal in München und wurde 1751 zum Kurfürstlichen Revisionsrat ernannt. Als ein Vertreter der bayerischen Eigenstaatlichkeit wurde er schließlich nach Amberg strafversetzt. Bei der Sammlung Obermayr handelte es sich um die umfangreichste in Deutschland im 18. Jahrhundert verauktionierte Gemäldesammlung. Insgesamt kamen 2.170 Nummern zum Aufruf. In ihrem Umfang ist diese Sammlung allenfalls noch mit der Kollektion des englischen Holzhändlers Edward Solly vergleichbar, die 1821 vom preußischen König angekauft wurde und die den Grundstock für die Berliner Gemäldegalerie bildete. Im Vorwort des Katalogs wird denn auch bedauert, daß diese Sammlung nicht vollständig von einem Fürstenhaus angekauft werden konnte. Obermayr erwarb zeit seines Lebens Gemälde und übernahm auch ganze Sammlungen, so die Kollektion des Fürstbischofs von Eichstätt. Allerdings veräußerte Obermayr schon vor der Auflösung der Sammlung Bilder, so auch mehrere Gemälde an den Kurfürsten Carl Theodor von Bayern. Die komplette Sammlung konnte acht Tage vor der Versteigerung besichtigt werden. Neben den Gemälden sollte auch die Bibliothek, das Naturalienkabinett und das Kupferstichkabinett zum Verkauf kommen. Zu diesen Anlässen sollten ebenfalls Kataloge zusammengestellt werden. Zur besseren Übersicht wurde dem Katalog ein alphabetisches Verzeichnis der Künstler vorangestellt. Da die Künstlernamen im Katalog nicht erwähnt werden, muß auf jeden Fall diese Liste herangezogen werden. Allerdings tauchen die anonymen Werke in ihr nicht auf. Nach den Erläuterungen des Vorworts seien nur die schon bezeichneten oder über Inventare eindeutig zugeschriebenen Bilder mit Künstlernamen versehen worden, da man bei der Herstellung des Katalogs unter Zeitdruck gestanden habe. Der hohe Anteil der anonymen Werke sei daher nach Aussage des Katalogvorworts kein Zeichen für mangelnde Qualität. Insgesamt bleiben mehr als die Hälfte der Werke anonym. Bei den zugeschriebenen Gemälden überwiegen die flämischen und niederländischen Werke mit zusammen 223 Bildern, darunter neunzehn Zuschreibungen an Peter Paul Rubens. Unter den insgesamt 175 deutschen Arbeiten dominiert das späte 17. Jahrhundert, darunter allein acht Werke von Johann Heinrich Schönfeld und zwölf von Georg Philipp Rugendas d.Ä. Zeitgenössische Arbeiten des 18. Jahrhunderts sind dagegen kaum vertreten. Besonders stark sind auch Gemälde der italienischen Schulen mit insgesamt 163 Arbeiten repräsentiert. Von zahlreichen Künstlern sind mehrere Werke vorhanden, so allein elf Tizian zugeschriebene Werke. Bis auf ein Werk von Jan Gossaert wurden keine frühniederländischen Werke zum Verkauf angeboten. Von spanischen Meistern finden sich insgesamt sechs Arbeiten. Über den Verlauf der Auktion sind leider keine Details bekannt. Lit.: Karl Bosl, Bosls Bayerische Biographie. 8.000 Persönlichkeiten aus 15 Jahrhunderten, Regensburg 1983, S. 556. 197 1790/01/18-1790/02/08
[Lugt 4512]
C.C.H. Rost; Leipzig, Im rothen Collegio Verkäufer nach Titelblatt: Huber Verkäufer: Huber, Michael Lose mit Gemälden: 1 Standorte: *BDu Annotiert mit allen Käufemamen und Preisen. RMA Nicht eingesehen. Nach Lugt annotiert mit Käufernamen und Preisen. RKDH Annotiert mit allen Preisen. ESP Nicht eingesehen, aber anscheinend annotiert mit Preisen. Wahrscheinlich ehemals im KKB. KKD Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Nach Lugt annotiert mit Preisen. MS Nicht eingesehen. Nach Lugt nicht annotiert.
Titelblatt: Huberisches Cabinet einer ansehnlichen KupferstichSammlung alter, neuer und seltener Blätter aus allen Schulen, in einer Folge der Künstler von der ersten bis auf gegenwärtige Zeit. Zum Anhange folgen: Gemähide, Handzeichnungen, Kupferstichwerke und Kunstsachen. Den 18ten Januar 1790 wird davon in den gewöhnlichen Vor- u. Nachmittagsstunden, von dem verpflichteten Universitäts-Proclamator, Herrn Weigel, im rothen Collegio zu Leipzig, gegen gleich baare Bezahlung, in Louisd'ors ä 5 Rthl. oder Sächs. Conv. Münze, der öffentliche Verkauf gehalten werden. No. Vni. Leipzig, gedruckt bey Gotthelf Albrecht Friedrich Löper. Kommentar: In seinem achten Versteigerungskatalog offerierte der Leipziger Kunsthändler Carl Christian Heinrich Rost unter anderem die Kollektion eines einzelnen Sammlers. Es handelt sich um die umfangreiche graphische Sammlung des Leipziger Professors Michael Huber (1727-1804), die insgesamt 5.651 Losnummern umfaßte. Huber verfaßte auch eine wissenschaftliche Studie zur graphischen Kunst (Notices generales des Graveurs), in der er von seiner eigenen Sammlung ausgehend einen Überblick über die Kupferstechkunst entwickelt. Der Bedeutung der Sammlung entsprechend und auch den Erfolg der Rostschen Kunsthandlung widerspiegelnd, wurde die Einführung zu diesem Katalog in französisch und deutsch abgedruckt. Das Verzeichnis der Kupferstiche ist nach der Vorlage der "Notices generales" in französischer Sprache abgefaßt. Im Anhang wurden Blätter und Bücher anderer Einlieferer angeboten sowie ein Ölgemälde von Antoine Pesne (Preußische Prinzessin mit ihrer Tochter; Nr. 307), das nach den Angaben des annotierten Exemplars Β Du für einen Taler verkauft wurde. Lit.: Trautscholdt 1957. 198 1790/02/04-1790/02/05
[Lugt 4519]
Johann Hinrich Decker; Hamburg, Börsen=Saal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 147 Standorte: *KH I Annotiert mit allen Käufernamen und Preisen auf eingebundenen Leerseiten. KH II Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß eines ansehnlichen Nachlasses von den vortreflichsten Cabinet=Mahlereyen, welche zum Theil von großen Künstlern verfertigt worden, als: Italiener, Franzosen, Niederländischen und Altdeutschen, nebst verschiedenen Englischen, Französischen eingefaßten und losen Kupferstichen, wie auch Handzeichnungen, welche auf dem Börsen=Saal den 4 & 5 Februar 1790. öffentlich gegen baare Zahlung in grob Courant an den Meistbietenden verkauft werden sollen, durch den Mackler Johann Hinrich Decker, bey welchem das Verzeichniß, wie auch in No. 33, bey der großen Michaeliskirche für 2 Schil. den Armen zum Besten, beliebigst abzufordern ist. N.B. Diese Gemähide und Kupferstiche können Tages vorher in beliebigen Augenschein genommen werden. Hamburg, gedruckt bey D. A. Harmsen. Kommentar: Dieser umfangreiche Versteigerungskatalog des Hamburger Maklers Johann Hinrich Decker umfaßt auf 40 Seiten 280 Einträge. Die Gemälde werden unter den Nummem 1 bis 150 aufgeführt. Darunter befinden sich auch zwei Pastelle (Nrn. 148 und 149) und ein Aquarell (Nr. 150). Die Beschreibungen sind teilweise recht detailliert. In übersichtlicher Gestaltung werden die Künstlernamen als Überschrift vorangestellt. Oftmals wird die künstlerische Ausführung der Gemälde beurteilt. Zu Beginn des Katalogs wird vermerkt: "Sehr viele Gemähide haben feine Französisch vergoldete Rähme, die übrigen aber fast alle schwarz gebeizte, mit goldenen Leisten". Den größten Teil der Sammlung machen die Gemälde der holländischen und flämischen Schule aus. Die deutsche Schule ist mit 40 Werken vertreten, darunter in erster Linie Hamburger Künstler wie KATALOGE
127
Johann Marcus David, Balthasar Denner und Johann Georg Stuhr. Zwölf Gemälde zählen zur französischen Schule, darunter Werke von Künstlern des 18. Jahrhunderts wie Francois Boucher, Jean Baptiste Feret, Claude Gillot oder Louis Simon Tiersonnier de Quennefer. Im Exemplar KH I sind auf eingeschossenen Leerseiten die Käufernamen und die Preise verzeichnet. Der Gesamterlös für die 150 Nummern betrug 908 Mark 6 Schilling, der Durchschnittspreis lag also nur bei etwas mehr als 6 Mark je Bild. Unter den Käufern trat besonders der als "Ego" notierte Bieter hervor, also vermutlich der nicht bekannte Autor der Annotationen. Insgesamt wurden diesem Käufer 52 Gemälde zugeschlagen. Den höchsten Preis erzielte ein Gemälde von Le Clerc mit 101 Mark sowie eine Allegorische Vorstellung vom Apollo von Tiersonnier (Nr. 1), die bei 50 Mark den Zuschlag erhielt. Beide Bilder gingen in den Besitz des Kunsthändlers Johann Jobst Eckhardt über. Die ersten zehn Gemälde wurden schon 1784 in einer Auktion in der gleichen Reihenfolge als Losnummern 1 bis 10 angeboten (vgl. Kat. 149), vermutlich jedoch zurückgezogen, da bei diesen Bildern jegliche Annotation fehlt. 199 1790/02/08
und folgende Tage
Christian Friedrich Hecht; Leipzig, Haus des Sammlers, Catharinenstrasse in der Demoiselle Kees Hause Verkäufer nach Titelblatt: Aus dem Nachlasse des seel. verstorbenen Herrn Landkammerraths Kregel v. Sternbach Verkäufer: Kregel von Sternbach, Karl Friedrich Lose mit Gemälden: 10 Standorte: SBBa Nicht annotiert. Aus dem Besitz von Joseph Heller. SGML Unvollständig; es fehlen die Seiten 3 bis 4 mit den Losen 1 bis 20. Nicht annotiert. ULBH Nicht eingesehen. Titelblatt: Auserlesene Sammlung von Büchern, Kupferstichen, Zeichnungen und Gemälden, ingl. von den schönsten mathematischen und physical. Instrumenten, auch einem vollständigen Holzcabinet nebst allem Zubehör, welche aus dem Nachlasse des seel. verstorbenen Herrn Landkammeraths Kregel von Sternbach in dessen innegehabten Wohnung auf der Catharinenstraße in der Demoiselle Kees Hause Montags den 8. Februar. 1790. und folgende Tage früh von 9 bis 12 Uhr und Nachmittags von 3 bis 6 Uhr gegen baare Bezahlung in Chursächs. Münzsorten verauctioniert werden sollen von Christian Friedrich Hecht, S. E. Hochweisen Rats verpflichtetem Proklamator. Leipzig, 1789. Im Durchgange des Rathhauses bey C. P. Dürr. Kommentar: In dieser Versteigerung des Nachlasses des sächsischen Landkammerrates Karl Friedrich Kregel von Sternbachs (17 Π Ι 789) wurden vor allem Bücher und Kupferstiche angeboten. Nur elf Gemälde finden sich in diesem Katalog (Nrn. 460 bis 470), bei denen es sich überwiegend um Kopien handelt. Sechs Bilder sind Kopien nach Alexander Thiele, die wahrscheinlich von dem als Maler dilettierenden Karl Friedrich Kregel von Sternbach selbst stammen. Weitere vier Gemälde sind ebenfalls von Kregel. Nur eine Kopie von Jacob Gotthelf Schiele nach Marco Ricci ist von einer anderen Hand. 200 1790/04/13-1790/04/14 [Lugt 4564] H.C. Lienau; Hamburg, Börsen=Saal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 261 Standorte: *KH I Annotiert mit allen Käufernamen und Preisen auf eingebundenen Leerseiten. KH II Nicht annotiert. 128
KATALOGE
Titelblatt: Catalogue einer ganz vortreflichen Sammlung Cabinet= und Gallerie=Gemählden, die zum Theil von den größten Italiänischen, Französischen, Niederländischen und alt=deutschen Künstlern verfertiget worden. Diese besonders ausgewählten Stücke nebst einigen in Rahm und unter Glas befindlichen Kupferstiche, sollen den 13 und 14ten April 1790 auf dem hiesigen Börsen=Saal, wann solche Tages vorher in beliebigen Augenschein genommen worden, durch die Makler H. C. Lienau & J. H. Schöen öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Das darüber beschriebene Verzeichniß ist bey benannten Maklern und in No. 33 bey der großen Michaelis Kirche den Armen zum Besten für 2 Schi, zu bekommen. Kommentar: Dieser Katalog der Hamburger Makler Heinrich Christian Lienau und Johann Hinrich Schoen verzeichnet 261 Gemälde sowie ein kleines Konvolut von Kupferstichen (Nrn. 262 bis 295). Die Beschreibungen des Katalogs sind anfangs recht detailliert, werden zum Ende jedoch zunehmend knapper. Die Künstlernamen und die Maßangaben sind vorangestellt, zuletzt wird das Material angegeben. Den größten Anteil machen Bilder der holländischen Schule aus, darunter Gemälde von allen namhaften Künstlern von Jan Asselyn bis Reinier Zeemann. Fünf Gemälde sind Jacob de Wet zugeschrieben. Werke der flämischen und der deutschen Schule sind nahezu gleichgewichtig vertreten, gefolgt von sechs Gemälden der französischen Schule. Unter den deutschen Malern sind Carl Timotheus Friedrich Kreutzfeld und Matthias Scheits mit je sechs Werken sowie Johann Georg Stuhr mit acht Gemälden am häufigsten vertreten. Im Exemplar KH I sind Zwischenblätter mit handschriftlichen Verzeichnissen der Käufer und Preise eingebunden. Den höchsten Preis erzielte ein als Friedensallegorie bezeichnetes Gemälde von Rubens, das für 121 Mark verkauft wurde (Nr. 21) und schon einige Jahre zuvor in einer großen Hamburger Auktion offeriert worden war (Kat. 168, Nr. 71). Es handelt sich um eine vorbereitende Ölskizze zu dem Altargemälde für die Chiesa Nuova in Rom. Dargestellt ist der Hl. Gregor, umgeben von der Hl. Domitilla und dem Hl. Georg. Das Altarblatt befindet sich heute in Grenoble im Mus£e des Beaux-Arts (Inv.-Nr. 97). Die auf der Auktion versteigerte Ölskizze wird heute im Courtauld Institute, London, aufbewahrt. Den zweithöchsten Preis erzielte eine Lucretia von Guido Reni mit 55 Mark und 4 Schilling (Nr. 6). Ein Gemälde von Rembrandt, ein Junger Holländer mit einer Pfeife (später heißt es: mit einer Flöte) in seiner Hand (Nr. 32), ging für 3 Mark und 4 Schilling an "Ego". Es tauchte im August erneut in einer Auktion auf (Kat. 204, Nr. 91). Vermutlich handelte es sich bei diesem Käufer um einen der Auktionatoren. Insgesamt wurden "Ego" die große Zahl von 52 Bildern zugeschlagen. Auch die ersten 24 Gemälde dieser Auktion wurden im Jahre 1787 schon einmal offeriert (vgl. Kat. 168). Die erzielten Preise bewegen sich bis auf wenige Ausnahmen auf niedrigem Niveau. Sie wurden in drei Zwischensummen festgehalten: Die Nummern 1 bis 75 erbrachten 782 Mark 5 Schilling, die Nummern 76 bis 132 erreichten 214 Mark und 5 Schilling und die Nummern 133 bis 254 nochmals 142 Mark 5 Schilling. Bei diesen ersten drei Abteilungen lag der Durchschnittspreis also bei unter 5 Mark je Gemälde. Die ersten 75 Bilder erzielten mit einem Durchschnittspreis von etwas mehr als 10 Mark noch ein relativ hohes Ergebnis. Nicht addiert wurden im Exemplar KH die Preise für die Nummern 255 bis 261.
201 1790/05/20-1790/05/21
[Lugt 4598]
Johann Hinrich Schön; Hamburg, Börsen=Saal Verkäufer nach Titelblatt: Dominicus Gottfried Waerdigh Verkäufer: Waerdigh, Dominicus Gottfried Lose mit Gemälden: 264 Standorte: *KH I Annotiert mit allen Käufernamen und Preisen. KH II Nicht annotiert.
Titelblatt: Verzeichniß des in Plön verstorbenen Herrn Dominicus Gottfried Waerdigh Unterlassenen vortreflichen Gemählden=Sammlung, wovon die mehresten von des gedachten Künstlers eigener Hand, als auch von andern berühmten Meistern verfertigt worden, und in sauberen Rahmen gefaßt, welche den 20sten und 21sten May 1790, auf dem Börsen=Saal öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden sollen, durch den Mackler Johann Hinrich Schöen. Tages vorher, als den 19ten May, sind oberwähnte Gemähide an benannten Orte zu besehen. Hamburg, gedruckt bey Gottl. Friedr. Schniebes. Kommentar: Zur Versteigerung gelangte die Gemäldesammlung des in Hamburg geborenen Malers Dominicus Gottfried Waerdigh (1700-1789). Waerdigh war Schüler von Christian Johann Norwic und seit 1734 in Hamburg tätig. Seit 1766 lebte er in Plön in Holstein. Waerdigh malte vor allem Landschaften, die einen großen Anteil an den von ihm versteigerten Gemälden ausmachen. Daneben verzeichnet der Katalog eine Reihe von topographischen Stadtansichten Waerdighs (Paris, Amsterdam, Trier etc.) sowie mehrere Gemälde, die mit Hinweis auf die Manier anderer Künstler beschrieben werden ("in der Manier von Netscher", "in der Manier von de Winter"). Der Katalog verzeichnet auch vier Gemälde von Waerdighs Frau Catharina Elsabe (Nrn. 6, 150, 151 und 160). Neben Waerdighs eigenen Werken kamen vor allem Arbeiten holländischer und deutscher Künstler zum Verkauf. Eine Kuriosität stellt ein 1766 gemalter Bilderzyklus des mexikanischen Malers Jose Paez dar. Auf 15 Kupfertafeln ist gezeigt, "wie die Geschlechter durch Vermischung mancherley Nationen, in den von ihnen gebohrnen Kindern sich verändern und wiederum ausarten" (Nr. 179). Alle Einträge des Katalogs sind knapp gehalten, aber übersichtlich gestaltet. Auf den Künstlernamen und die Maßangabe folgt die Bildbeschreibung, die durch die Angabe des Materials und der Rahmung abgeschlossen wird. Datierungen sind nach dem Künstlernamen verzeichnet. Im Exemplar der Hamburger Kunsthalle sind handschriftlich die Käufernamen und Preise verzeichnet. Der Gesamterlös der Auktion betrug 3.790 Mark und 2 Schilling, lag also mit durchschnittlich etwas mehr als 14 Mark je Gemälde auf einem relativ hohem Niveau. Als Käufer traten vor allem die Herren Ranzow und Richardi hervor. An Ranzow gingen allein 60 Gemälde, Richardi erhielt bei 30 Bildern den Zuschlag. Zahlreiche Gemälde übernahm auch der Kunsthändler Johann Jobst Eckhardt sowie der Makler Johann Hinrich Schoen, der die Auktion ausrichtete. Am 8. Juni 1790 wurde die Kupferstichsammlung Waerdighs im Eimbeckschen Haus ebenfalls durch den Makler Johann Hinrich Schoen versteigert. Er war auch der Veranstalter einer weiteren Auktion am 28. Juli 1792, auf der die nicht verkauften Gemälde der Sammlung Waerdigh erneut angeboten wurden (Kat. 225).
202 1790/06/00
Daten unbekannt
[Anonym]; Schleswig, Haus des Sammlers, Auf den Holm Verkäufer nach Titelblatt: Zu dem Nachlaß des selig=verstorbenen Kunstmalers Geewe gehöret Verkäufer: Geve, Nicolaus Georg Lose mit Gemälden: 151 Standorte: ICH Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß über eine große und sehr schöne Sammlung von Gemälden, samt einer starken Samlung von Kupferstichen und Landcharten, worunter sich viele seltene Stücke befinden, wie auch eine Parthey Bücher in verschiedenen Wissenschaften, besonders aber in die Malerey und Kunstwerke einschlagend, samt Nachrichten von verschiedenen großen Künstlern und Malern, Abbildungen von Schnecken und Beschreibung derselben, benebst eine ziemliche Parthey von Mal=Tücher, Rahmen mit und ohne Glas, und dazu gehörigen Brettern, welches alles zu dem Nachlaß des selig=verstorbe-
nen Kunstmalers Geewe gehöret, und in öffentlicher Auction, am [Auslassung] Junii d.J., allhier in dem auf den Holm belegenen Sterbhause, an den Meistbietenden verkaufet werden sollen. Schleswig 1790. Gedrukt in der Königl. privil. Serringhausenschen Buchdrukkerei. Kommentar: In dieser Schleswiger Versteigerung wurde der Nachlaß des Malers Nicolaus Georg Geve (1712-1789) angeboten. Geve hatte seine Ausbildung am Kopenhagener Hof bei Johann Salomon Wahl erhalten und lebte nach 1770 in Schleswig. Im Auftrag des Landgrafen Karl entstanden zahlreiche Portraits, zudem lehrte er als Zeichenlehrer an der dortigen Domschule. Bekannt wurde er durch die Herausgabe des vierbändigen illustrierten Werks "Nicolaus Georg Gevens Belustigung im Reiche der Natur, eine Arbeit über hartschalige Tiere und Seegewächse". In dem Versteigerungskatalog werden die Gemälde in der Abteilung "Schildereyen und Gemälde" aufgeführt (S. 3 bis 10). Es folgen Kupferstiche und Bücher (S. 10 bis 15). Alle Gemälde sind nur sehr kurz und schlagwortartig beschrieben, Angaben zu den Maßen fehlen vollkommen. Alle Bilder bleiben anonym, wahrscheinlich handelt es sich aber bei fast allen Gemälden um Werke von Nicolaus Georg Geve selbst.
203 1790/07/28 Herr Werdmüller; Zürich Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 81 Standorte: Lavater Gedruckter Bericht über die Auktion mit Kommentaren zu einzelnen Gemälden. Kommentar: Zu dieser Zürcher Gemäldelotterie erschien vermutlich nur eine handschriftliche Liste, die bisher noch nicht aufgefunden werden konnte. In der Zeitschrift "Museum für Künstler und Kunstliebhaber" hat sich jedoch ein ausführlicher Bericht erhalten. Einer allgemeinen, mit dem Kürzel "M" gezeichneten Einleitung, die vermutlich vom Herausgeber der Zeitschrift, Johann Georg Meusel verfaßt wurde, folgt die kommentierte Auflistung der offerierten Bilder durch den Philosophen und Theologen Johann Caspar Lavater (1741-1801), die hier der Auswertung zugrunde gelegt worden ist. In einer Fußnote zu Eintrag Nr. 43 verweist Lavater auf eine "Handschrift" als Vorlage. Insgesamt standen 100 Gemälde als Gewinne zur Verfügung. Ausgerichtet wurde die Lotterie durch den Maler Werdmüller. Vermutlich handelte es sich hierbei um den Maler und Radierer Johann Heinrich Werdmüller (1741- nach 1813), der sich wie Johann Andreas Benjamin Nothnagel in Frankfurt auch als Kunsthändler engagierte und mit einer Lotterie die Veräußerung einer ganzen Sammlung realisieren wollte. Zum Verkauf angeboten wurden 960 Lose. Ihnen standen 250 Gewinne gegenüber, von denen 21 mit einem Wert von 100 bis 1.000 Gulden als Hauptgewinne eingestuft waren. Als Mittelpreise galten 82 Gewinne im Wert von 30 bis 80 Gulden, zur geringsten Kategorie zählten 147 Lose, für die ein Wert von 12 bis 25 Gulden angegeben wurde. Da in der der Einführung folgenden Liste nur 100 Nummern angeführt werden, läßt sich annehmen, daß die übrigen Preise nicht als erwähnenswert galten und es sich möglicherweise auch nicht mehr um Gemälde handelte. Bis zum Tag der Ziehung zeigten die Veranstalter die Bilder in einer Ausstellung im Zunftsaal zu Meisen. Nach dem Urteil Lavaters diente die Verlosung mit der vorangehenden Ausstellung der Gemälde dazu, das Interesse an Kunst in Zürich zu steigern. Auch habe man in Zürich nach seinen Worten "noch nie so viele gute Gemälde beisammen gesehen". In seiner Auflistung der ersten hundert Hauptpreise läßt sich Lavater ganz von seinem persönlichen Urteil leiten. Seine subjektiven Kommentare setzen die Kenntnis der Bilder oder KATALOGE
129
der Bilderliste voraus. Lavater bezieht sich auf Preistaxierungen, die er vermutlich dieser gedruckten Liste entnahm. Oftmals kommentierte er diese Preiseinschätzungen mit Sätzen wie "Der Preis ist zu hoch angesetzt" (Nr. 13). In der Auswertung wurden deswegen diese Kommentare nicht dem Bildtitel hinzugefügt, sondern unter der Rubrik "Handschriftliche Annotationen" als persönliche Anmerkungen Johann Caspar Lavaters kenntlich gemacht. Als Kunstkenner thematisiert Lavater auch die Originalität und Qualität einzelner Gemälde. Vor allem stellt er Rubens' Aeskulap heraus, den er einer königlichen Galerie für würdig befindet (Nr. 101). Wenig Gnade findet dagegen ein Bild Rembrandts, das Lavater zwar als Original, aber als ein wenig eindrucksvolles Werk beschreibt. In weniger als 30 Einträgen erwähnt Lavater auch den Namen des Künstlers, der Rest der Bilder bleibt anonym. Lit.: Lavater, Gemälde=Lotterie in Zürich, in: Museum für Künstler und für Kunstliebhaber, hg. von Johann Georg Meusel, Mannheim 1789, 12. Stück, S. 572-577.
204 1790/08/13
[Lugt 4618]
M. Bostelmann; Hamburg, Börsensaal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 110 Standorte: *KH I Annotiert mit allen Käufernamen und Preisen auf eingebundenen Leerseiten. KH II Nicht annotiert. Titelblatt: Catalogus einer Parthey sehr schöner Gemähide, zum Theil von den berühmtesten Holländischen Meistern; einiger wenigen Englischen, Französischen ec. Kupferstichen, Handzeichnungen; in Perlmutter, Elfenbein gearbeitete und in Glas getriebene Sachen. Dieses alles soll am 13. August 1790 auf dem hiesigen Börsensaal öffentlich verkauft werden durch die Makler M. Bostelmann & Pakischefski. Sämmtliche Sachen können Tages vor den Verkauf am benannten Orte besehen werden: und die Catalogi sind bey den obgenannten Maklern zu erhalten. Hamburg, 1790. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog der Hamburger Makler Michael Bostelmann und Peter Hinrich Packischefsky sind 110 Losnummern mit Gemälden verzeichnet. Alle Beschreibungen sind knapp und nach dem üblichen Schema abgefaßt: Dem als Überschrift vorangestellten Künstlernamen und den Angaben der Maße folgt die Vorstellung des Bildgegenstandes. Oftmals wurden Wertungen in den Text eingeflochten. Es überwiegen Werke der holländischen und flämischen Schule des 17. Jahrhunderts. Die deutsche Schule ist mit 27 Gemälden vertreten, die italienische mit sieben Arbeiten. Im Katalog KH I sind auf eingeschossenen Leerseiten die Namen der Käufer und die erzielten Preise verzeichnet. Den höchsten Preis erzielte ein Gemälde von Dominicus Gottfried Waerdigh für 33 Mark 12 Schilling, gefolgt von dem einzigen Bildnis von Christian Wilhelm Ernst Dietrich auf dieser Auktion, das für 15 Mark versteigert wurde. Zwei auf das Jahr 1658 datierte Bildnisse von Bartholomeus van der Heist wurden für 25 Mark verkauft. Bei dem Damenbildnis mit Hund von Bartholomeus van der Heist (Nr. 3) handelt es sich um das datierte Portrait in den Musees royaux des Beaux-Arts in Brüssel (Inv.-Nr. 2942). Das Pendant ist heute verschollen. Rembrandts Holländischer Herr mit Flöte (Nr. 91) war bereits auf der Auktion im April (Kat. 200, Nr. 32) zum Verkauf angeboten worden wie auch ein Blumenstilleben von Abraham Begeyn (Nr. 78; Kat. 200, Nr. 29). Ein Junge, der Seifenblasen pustet von Govaert Flinck (Nr. 86; Kat. 198, Nr. 71) war ebenfalls kurz zuvor verkauft worden. Unter den Käufern finden sich vor allem die Namen der Hamburger Kunsthändler Johann Jobst Eckhardt und Francois Didier Bertheau, Peter Sieberg und der Makler Peter Hinrich Packischefsky selbst. An Eckhardt gingen allein 30 Bilder. Da Michael Bostelmann als 130
KATALOGE
mitausführender Auktionator nicht unter den Käufernamen auftaucht, läßt sich vermuten, daß er sich hinter dem mit "Ego" bezeichneten Käufer verbirgt, dem insgesamt 28 Gemälde zugeschlagen wurden.
205 1790/08/16
und folgende Tage
[Anonym]; Kassel, Auf hiesigem französischen Rathhauß Verkäufer nach Titelblatt: Johann Heinrich Tischbein Verkäufer: Tischbein, Johann Heinrich (der Ältere) Lose mit Gemälden: 147 Standorte: KH Nicht annotiert. ??? Nicht eingesehen. Photokopien: SKK (Standort des Originals nicht bekannt) Titelblatt: Nachlaß des im September vorigen Jahrs alhier verstorbenenen Raths und Professoris auch Directoris der hiesigen Maler Academie Herrn Johann Heinrich Tischbein, an Tableaux, Portraits, Kupferstichen und Zeichnungen, so Montags den löten August und die folgende Tage, jedesmalen Nachmittags von 2 bis 6 Uhr an die Meistbietende verkauft werden sollen. Cassel 1790. Kommentar: In der Versteigerung des Nachlasses des Kasseler Malers Johann Heinrich Tischbein (1722-1789) wurden fast ausschließlich dessen eigene Werke angeboten. Insgesamt umfaßt die Versteigerung 147 Gemälde. Tischbein wurde nach Studienreisen nach Paris und Italien 1752 vom Landgrafen Wilhelm VIII. von HessenKassel zum Hofmaler ernannt. Zehn Jahre später wurde er vom Landgrafen Friedrich II. von Hessen-Kassel zum Professor für Malerei und Zeichenkunst am Collegium Carolinum berufen; 1776 übernahm er die Leitung der Kunstakademie. Tischbein konzentrierte sich vor allem auf die Historienmalerei, deren Anteil auch in der Nachlaßversteigerung überwiegt. In dem Katalog sind die Bildbeschreibungen sehr knapp gehalten, meist werden sie durch Maßangaben ergänzt. Neben den Werken Tischbeins tauchen noch zwei Gemälde von Maria Dorothea Wagner auf (Nrn. 49 und 50), ein Bild von Anton Wilhelm Tischbein (Nr. 106), zwei Gemälde des französischen Malers Jean Baptiste Frederic Desmarais (Nrn. 91 und 93), ein Bild von dem nicht zu identifizierenden Maler Huber (Nr. 94) sowie ein Gemälde von Canaletto (Nr. 74). Bei einigen Gemälden Johann Heinrich Tischbeins handelt es sich um Kopien nach älteren Meistern, so beispielsweise nach Rembrandt (Nr. 30). Neben historischen und mythologischen Darstellungen Tischbeins finden sich auch zahlreiche Modelli für Portraits adeliger Auftraggeber wie beispielsweise das Bildnis von Herzog Karl I. und Herzogin Philippine Charlotte von Braunschweig-Wolfenbüttel und ihre Familie im Schloßpark von Salzdahlum (Nr. 88). Das großformatige Original des Modello befindet sich heute im Schloß Wilhelmshöhe (Inv.-Nr. GKI 11036). Unter den Portraits im Nachlaß Tischbeins ist auch das Selbstbildnis mit beiden Töchtern im Atelier (Nr. 41), bei dem es sich wahrscheinlich um das Bild aus dem Landesmuseum Hannover handelt (Inv.-Nr. PAM 976). Zwei Historienbilder (Nrn. 17 und 18) befinden sich heute im Marburger Universitätsmuseum (Inv.-Nr. 7625) und im Busch-Reisinger Museum in Cambridge, Massachusetts (Inv.-Nr. 1962.27). Lit.: Joseph Friedrich Engelschall, Johann Heinrich Tischbein, ehem. Fürstlich-Hessischer Rath und Hofmaler, als Mensch und Künstler dargestellt, Nürnberg 1797; Ausst.-Kat.: Johann Heinrich Tischbein d.Ä. (1722-1789), Neue Galerie, Staatliche und Städtische Kunstsammlungen Kassel, Kassel 1989; Anna-Charlotte Flohr, Johann Heinrich Tischbein d.Ä. (1722-1789) als Portraitmaler, mit einem kritischen Werkverzeichnis, München 1997; Petra TiegelHertfelder, Historie war sein Fach: Mythologie und Geschichte im Werk Johann Heinrich Tischbeins d.Ä. (1722-1789), Worms 1996.
206 1790/08/20-1790/08/21 Hermann Friderich Goverts; Hamburg, Börsensaal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 19 Standorte: *KH Annotiert in Bleistift mit allen Käufernamen und Preisen auf eingebundenen Leerseiten. Titelblatt: Verzeichniß einer auserlesenen Sammlung Englischer, Französischer und Italienischer zum Theil seltener Kupferstiche von den besten Abdrücken in Rahmen und Glas, nebst einigen noch Uneingefaßten, welche von einem Freund und Kenner der Kunst gesammelt worden: nun aber nach dessen Absterben den 20sten und 21sten August 1790 in Hamburg auf dem Börsensaal öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden soll durch den Makler Hermann Friderich Goverts, bey welchem der Catalogus beliebigst abzufordern. Diese Sachen können den Tag vor dem Verkauf an bemeldtem Ort gefälligst in Augenschein genommen werden. Kommentar: In dieser Versteigerung des Hamburger Maklers Hermann Friderich Goverts wurden in erster Linie graphische Arbeiten angeboten. Nach den Angaben des Titelblatts sollte die Sammlung nach dem Tod des Besitzers öffentlich auf der Börse veräußert werden. Es handelte sich vermutlich um einen Hamburger Sammler. In einem Anhang des Katalogs (S. 25 bis 32) sind insgesamt 19 Gemälde verzeichnet. Die Beschreibungen sind detailliert, bei allen Bildern werden die Künstlernamen als Überschriften vorangestellt. Maße und Materialien sind angegeben. Vier Bilder bleiben anonym, ansonsten sind von jeder Schule einige wenige Beispiele vertreten. Drei Künstlernamen ließen sich bisher nicht identifizieren. Nach den Angaben des annotierten Exemplars KH wurden alle Bilder verkauft, der Gesamterlös betrug 143 Mark und 4 Schilling, durchschnittlich also 7,5 Mark je Gemälde.
207 1790/08/25
und folgende Tage
[Lugt 4622]
[Anonym]; Frankfurt am Main, Bildersaal Verkäufer nach Titelblatt: Kaller; Michael Verkäufer: Kaller, Johann Christian; Michael, Friedrich Christian Lose mit Gemälden: 538 Standorte: *SMF Annotiert mit allen Käufernamen und Preisen auf eingebundenen Leerseiten; wahrscheinlich handelt es sich um das Exemplar des Auktionators. Vier Lose wurden handschriftlich hinzugefügt. UBK Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichnis einer beträchtlichen Gemäldesammlung von den berühmtesten Italiänischen, Deutschen und Niederländischen Meistern, welche von den Eigenthümern Kaller und Michael in dem allhiesigen Bildersaal im Creuzgange, Mittwochs den 25ten August durch die geschwornen Herrn Ausrufer an die Meistbietende gegen baare Bezahlung im 24 fl. Fuss losgeschlagen und überlassen werden sollen; und welche täglich in gedachtem Bildersaal Vormittags von 10 bis 12 Uhr und Nachmittags von 2 bis 4 Uhr in Augenschein genommen werden können. Frankfurt am Mayn, gedruckt mit Brönnerischen Schriften, 1790. Kommentar: Wahrscheinlich wurde in dieser Auktion die Sammlung des Frankfurter Kunsthändlers Johann Christian Kaller (1725-1794) zusammen mit der des Kunsthändlers Friedrich Christian Michael (1754-1813) angeboten. Michael war mit Anna Elisabeth Katharina Kaller verheiratet, dies wahrscheinlich die Tochter des Kunsthändlers. Im Vorwort des Katalogs heißt es, daß die Bilder schon seit zwölf Jahren zu besichtigen waren. Vermutlich handelt es sich hier um den kompletten Lagerbestand des Kunsthändlers. Insgesamt umfaßt diese umfangreiche Auktion 538 Losnummern mit Gemälden,
von denen vier Lose im Exemplar SMF handschriftlich ergänzt worden sind. In den 1760er Jahren hatte der Kunsthändler Johann Christian Kaller mehrere Kunstauktionen durchgeführt (vgl. Kat. 40, 42, 44, 52), war dann aber nicht mehr in Erscheinung getreten. Möglicherweise war er jedoch bei einigen anonymen Frankfurter Versteigerungen als Organisator im Hintergrund tätig. Alle Bildbeschreibungen sind sehr knapp, Maße werden in der Regel angegeben. Es überwiegen Werke deutscher Künstler, darunter vor allem zeitgenössische Bilder von Künstlern aus dem Frankfurter Raum. Von Franz Hochecker finden sich beispielsweise 17 Gemälde. Umfangreich vertreten sind auch die holländische und die flämische Schule, wobei fast alle wichtigen Künstler aufgeführt sind. Rund 100 Gemälde bleiben anonym. Nach den Angaben des annotierten Exemplars SMF lagen die Preise überwiegend auf relativ niedrigem Niveau, nur wenige Gemälde erreichten Ergebnisse über 10 Gulden. Die insgesamt erlöste Summe betrug nur 2.854 Gulden, also durchschnittlich 5,3 Gulden je Bild. Bei zahlreichen Losen ist Kaller selbst als Käufer notiert, auch Michael taucht häufiger auf. Vermutlich handelt es sich hier um Rückgänge, da Kaller hin und wieder explizit als Käufer im Auftrag eines anderen erwähnt wird, so beispielsweise "Kaller modo Trautman" (Nm. 66 und 67). Unter den Käufern finden sich ansonsten alle wichtigen Frankfurter Sammler wie beispielsweise Johann Daniel Bender, Heinrich Sebastian Hüsgen, Johann Georg Scheidewind oder Johann Peter Trautmann. Lit.: Hirsching 1786/92, Bd. 3, S. 86; Schmidt 1960, o.P.
208 1790/09/10-1790/09/11
[Lugt 4624]
M. Bostelmann; Hamburg, Börsensaal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 143 Standorte: *KH I Annotiert mit allen Käufemamen und Preisen auf eingebundenen Leerseiten. KH II Nicht annotiert. Titelblatt: Catalogus einer beträchtlichen Sammlung von Gemählden, nebst einer großen Anzahl, unter Glas und in Rahmem gefaßten, englischen, französischen und andrer Arten Kupferstichen, wie auch eine Parthey Loose, welche auf dem Börsensaal den 10 & 11 September 1790. öffentlich gegen baare Zahlung in grob Courant an den Meistbietenden verkauft werden sollen, durch die Makler M. Bostelmann & Pakyschefski, bey welchen der Catalogus, wie auch in No. 33 bey der großen St. Michaelis Kirche, für 2 sch den Armen zum Besten zu bekommen ist. NB. Selbige Gemähide und Kupferstiche können Tages vorher, am benannten Ort, in beliebigen Augenschein genommen werden. Hamburg, 1790. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog der Hamburger Makler Michael Bostelmann und Peter Heinrich Packischefsky werden insgesamt 507 Lose aufgeführt, wobei die Gemälde unter den ersten 120 Katalogeinträgen verzeichnet sind, gefolgt von Miniaturen ovalen Formats, Pastellen und Glasmalereien. Insgesamt lassen sich 143 Gemälde zählen. Den umfangreichsten Teil nehmen die Kupferstiche ein. Die auf den Künstlernamen und die Maßangaben folgenden Beschreibungen sind knapp und werden durch die Angabe des Materials abgeschlossen. Viele der Bilder sind als Pendants aufgeführt. Ein großer Teil der Gemälde ab Nummer 104 bleibt anonym, während unter den zugeschriebenen Werken die Gemälde holländischer Künstler dominieren. Nur klein ist der Anteil flämischer Werke, die deutsche Schule ist mit insgesamt 26 Werken vertreten, darunter auch mehrere Gemälde Hamburger Künstler. Nach den Angaben des annotierten Exemplars KH I lagen die Preise überwiegend auf niedrigem Niveau und blieben fast ausschließlich unter der Schwelle von 10 Mark je Bild. Unter den Käufern traten vor allem die Hamburger KATALOGE
131
Kunsthändler Johann Jobst Eckhardt und Peter Sieberg sowie ein Käufer namens Kesten in Erscheinung.
209 1790/10/18
und folgende Tage
[Lugt 4631]
C.C.H. Rost; Leipzig, Im rothen Collegio Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 44 Standorte: *SBBa Annotiert mit allen Preisen. Aus dem Besitz von Joseph Heller. RKDHI Nicht annotiert. RKDH II Unvollständig; vorhanden sind die Seiten 1 bis 220. Das Titelblatt fehlt. Im RKDH irrtümlich als Lugt 4653 katalogisiert. Nicht annotiert. Titelblatt: Anzeige einer ansehnlichen Kupferstich-Sammlung alter, neuer und seltener Blätter berühmter Meister, vorzüglich von No. 1 bis No. 666. nebst einer schönen Sammlung von Handzeichnungen und Gemählden auch verschiedenen Kupferstichwerken und einem wohlerhaltenen Claviere. Den 18ten October 1790. wird der Verkauf davon gehalten, in den gewöhnlichen Vor- und Nachmittagsstunden, von dem verpflichteten Universitäts-Proclamator Herrn Weigel, im rothen Collegio zu Leipzig, gegen gleich baare Bezahlung, in Louisd'ors ä 5 Rthl. oder Sächs. Conv. Gelde. No. IX. Leipzig, gedruckt bey Gotthelf Albrecht Friedrich Löper. Kommentar: In der neunten Auktion der Rostschen Kunsthandlung wurden überwiegend graphische Blätter angeboten. Unter der Rubrik "Gemaehlde" sind 44 Bilder aufgelistet (Nrn. 1854 bis 1899), die von verschiedenen Anbietern stammten. Wie die übrigen Kataloge von Carl Christian Heinrich Rost (1741-1798) ist auch dieser sorgfältig zusammengestellt und mit Register und Literaturverzeichnis ausgestattet. Die Sammlung konnte während der Michaelismesse im Roten Collegio, einem Universitätsgebäude in der Ritterstraße 16, besichtigt werden. Unter den Gemälden findet sich das Bild Hercules und Omphale von Johann Heiss (Nr. 1861; heute Stadtmuseum Memmingen), das in zwei folgenden Auktionen der Rostschen Kunsthandlung erneut offeriert wurde (Kat. 222, Nr. 4795 und Kat. 233, Nr. 7001). Neben einigen deutschen Gemälden des 18. Jahrhunderts wurden vier italienische Bilder angeboten, darunter zwei Landschaften von Francesco Zuccarelli (Nrn. 1854 und 1855), die vermutlich zurückgingen und in der elften Versteigerung der Rostschen Kunsthandlung erneut zum Verkauf standen (Kat. 222, Nrn. 4797 und 4798). Im annotierten Exemplar SBBa werden zwar Preise von jeweils rund 21 Talern für die beiden Zuccarelli notiert, vermutlich wurden diese jedoch von Rost zurückgekauft. Auch zwei Landschaften von Dirk van Bergen (Nrn. 1856 und 1857) wurden zu Preisen knapp über 20 Talem zurückgekauft und ebenfalls in der elften Auktion der Kunsthandlung Rost erneut angeboten (Kat. 222, Nrn. 4801 und 4802). Die Preise der vermutlich verkauften Bilder bewegten sich auf niedrigem Niveau, zumeist unter 5 Talern. Lit.: Trautscholdt 1957.
210 1791/01/05
Kommentar: In diesem Katalog der Hamburger Makler Michael Bostelmann und Peter Hinrich Packischefsky wird unter den Losnummern 1 bis 257 eine Sammlung von Kupferstichen verzeichnet, unter den Nummern 258 bis 309 folgt eine kleine Gruppe von "Oelfarben=Gemählden". Die Beschreibungen sind sehr kurz abgefaßt, so heißt es beispielsweise: "Eine biblische Historie aus dem alten Testament, sehr schön gemahlt, von Ferdinand Boll" (Nr. 258). Es folgt jeweils die Angabe des Materials und der Maße. Neben einigen Gemälden der holländischen und flämischen Schule werden größtenteils Bilder der deutschen Schule zum Verkauf angeboten, darunter zahlreiche Werke Hamburger Künstler wie Hans Hinrich Rundt und Johann Georg Stuhr. Im Exemplar KH ist eine handschriftlich abgefaßte Liste der Käufernamen und der Preise eingebunden. Den höchsten Preis erzielte ein Damenbildnis von Jacob van Loo, das für 51 Mark versteigert wurde (Nr. 280). Die übrigen Preise weichen stark davon ab und bewegen sich durchschnittlich auf niedrigem Niveau zwischen 2 und 5 Mark.
211 1791/01/10
und folgende Tage
[Anonym]; Hannover, Haus des Sammlers Verkäufer nach Titelblatt: Obergerichts=Procurator Meier Verkäufer: Meier (Hannover) Lose mit Gemälden: 48 Standorte: ÜBT Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß einer Sammlung größtentheils juristischer Bücher wie auch Landcharten Risse, Musicalien und Gemählden welche den [Auslassung] Decbr. 1790 und folgende Tage in des Obergerichts=Procurator Meiers Wohnung meistbietend verkauft werden soll. Hannover, gedruckt in der Lammingerschen Buchdrukkerei. Kommentar: Das Datum dieser Auktion wurde im Exemplar ÜBT handschriftlich eingetragen beziehungsweise korrigiert. Die Auktion fand nicht im Dezember 1790, sondern erst am 10. Januar 1791 statt. Die Sammlung des Obergerichts-Prokurators Meier bestand vor allem aus Büchern und Notenpartituren. Auf den Seiten 153 bis 155 werden auch 51 Losnummern mit "Schildereyen" aufgeführt, wobei es sich bei zwei Arbeiten (Nrn. 46 und 47) um Wasserfarben und bei einem Bild (Nr. 48) um eine Miniatur handelt. Alle Bildbeschreibungen sind sehr knapp gehalten. Angaben zu Maßen und Rahmen werden in tabellarischer Form gemacht. Die meisten Gemälde bleiben anonym, jedoch werden drei Arbeiten Rembrandt und zwei Bilder Adriaen van der Werff zugeschrieben. Neben fünf flämischen Werken tauchen auch zwei italienische Arbeiten auf, wobei ein Bild Tizian zugesprochen wird.
[Lugt 4647]
M. Bostelmann; Hamburg, Börsen=Saal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 52 Standorte: *KH Annotiert mit allen Käufernamen und Preisen auf eingebundenen Leerseiten. Titelblatt: Verzeichnis einer sehr schönen Sammlung eingefaßter Englischer, Französischer und Italiänischer Kupferstiche; desgleichen auch verschiedene Hefte und einzelne ungefaßter Blätter, eine Partey besonders schöne Cabinet=Gemählde und andere Sachen 132
mehr, sollen am Mittwoch den 5 Januar 1791 auf dem hiesigen Börsen=Saal öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden durch die Makler M. Bostelmann & Packischefsky, bey welchen das Verzeichniß fur 1 k. den Armen zum Besten zu haben ist. Tages vor dem Verkauf können benannte Sachen am obgedachten Ort gefalligst besehen werden. Hamburg, 1791.
KATALOGE
212 1791/01/15
und folgende Tage
[Lugt 4653]
C.C.H. Rost; Leipzig, Im rothen Collegio Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 8 Standorte: *BDu Annotiert mit den meisten Käufernamen und allen Preisen. SBBa Annotiert mit allen Preisen. Aus dem Besitz von Joseph Heller. UBLg Nicht eingesehen.
RKDH
Lugt erwähnt ein Exemplar an diesem Standort, aber es handelt sich um ein Exemplar des Katalogs vom 18. Oktober 1790 (Lugt 4631), der falsch katalogisiert worden ist.
Titelblatt: Anzeige einer ansehnlichen Kupferstich-Sammlung alter, neuer und seltener Blätter berühmter Meister, nebst einigen Handzeichnungen, Gemählden, Kupferstichwerken und einem wohlerhaltenene Flügel von Zacharias Hildebrandt. Den 15ten Januar 1791. wird der Verkauf davon gehalten, in den gewöhnlichen Vor- und Nachmittagsstunden, von dem verpflichteten Universitäts-Proclamator Herrn Weigel, im rothen Collegio zu Leipzig, gegen gleich baare Bezahlung, in Louisd'ors ä 5 Rthlr. oder Sächs. Conv. Gelde. No. X. Leipzig, gedruckt bey Gotthelf Albrecht Friedrich Löper. Kommentar: Im zehnten Versteigerungskatalog der Kunsthandlung Rost wurden wiederum fast ausschließlich graphische Arbeiten angeboten (Nrn. 1 bis 2868), die alphabetisch nach Künstlern geordnet sind. In der Einführung wird daraufhingewiesen, daß die Blätter von verschiedenen Anbietern stammen. Wie die früheren Kataloge des Kunsthändlers Carl Christian Heinrich Rost (1741-1798) wurde auch dieser sorgfältig zusammengestellt und mit Register und Literaturverzeichnis versehen. Zusätzlich standen acht Gemälde zum Verkauf (Nrn. 2869 bis 2878), die wahrscheinlich ebenfalls von verschiedenen Anbietern stammen. Als Überschriften wurden die Kürzel "Ο. ο.", "M. i." und "St. z." angeführt, die vermutlich auf die Eigentümer der Bilder verweisen. Bei den Gemälden handelt es sich vorwiegend um deutsche und österreichische Landschaftsbilder des 18. Jahrhunderts, so beispielsweise von Alexander Thiele und Johann Georg Platzer. Nach den Angaben des annotierten Exemplars aus der Kunsthandlung Boemer erzielte nur eine Landschaft von Alexander Thiele (Nr. 2869) mit 10 Talern und 20 Groschen einen ansehnlichen Preis; die übrigen Bilder wurden für 2 bis 4 Taler verkauft. Lit.: Trautscholdt 1957. 213 1791/05/15
und folgende Tage
[Lugt 4733]
Chretien Frediric Hecht; Leipzig Verkäufer nach Titelblatt: Chr£t. Guill. Ernest Dietrich, dit Dietricy Verkäufer: Dietrich, Christian Wilhelm Ernst Lose mit Gemälden: 76 Standorte: MBB Nicht annotiert. RBZ Nicht eingesehen. RKDH Nicht annotiert. SBBa Nicht annotiert. Aus dem Besitz von Joseph Heller (französische Ausgabe). KKD Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Nach Lugt nicht annotiert. Titelblatt: Catalogue des süperbes tableaux originaux du cabinet du c61febre Chret. Guill. Ernest Dietrich dit Dietricy de nom vivant peintre d'Auguste II d'Auguste ΠΙ rois de Pologne et de Fred6ric Auguste III. electeur de Saxe, professeur de peinture a l'Academie des Arts a Drisde, membre des Acaddmie d'Augsbourg, de Bologne &c. La vente s'en fera publiquement a Leipzig la foire prochaine de paques le 15. Mai et les jours suivants 1791. Par Chretien Fr6d6ric Hecht proclamateur jur6 Magistrat de la ville de Leipzig. Α Leipzig 1791. Kommentar: In dieser Versteigerung des Leipziger Auktionators Christian Friedrich Hecht wurde der Nachlaß des Dresdener Hofmalers Christian Wilhelm Ernst Dietrich (1712-1774) verauktioniert. Dietrich wurde 1731 zum sächsischen Hofmaler ernannt und übernahm 1748 als Inspektor auch die Verantwortung für die Dresdener Gemäldegalerie. Seit 1764 lehrte Dietrich Landschaftsmalerei an der Dresdener Akademie und leitete gleichzeitig die neubegründete Zeichenakademie in Meißen. In dem ausführlichen und sorgfältig zu-
sammengestellten Katalog werden insgesamt 76 Losnummern vorgestellt. Unter den ersten 53 Einträgen finden sich Gemälde von Dietrich selbst. Im "Avis" werden alle Interessenten angehalten, Anfragen und Angebote an die Kunsthändler Rost, Pfarr oder an Hecht selbst zu richten. Auch an den Kupferstecher an der Leipziger Akademie, Christian Gottlieb Geyser, oder den Professor der Rechtswissenschaften, Erhard, konnten sich Interessenten wenden. In der Einführung stellt Johann Anton Riedel, Dietrichs Nachfolger als Inspektor der Gemäldegalerie, die Sammlung vor. Neben dem umfangreichen (Euvre Dietrichs enthält der Katalog unter anderem zwei Landschaften von Salvator Rosa, zwei Stilleben von Willem van Aelst sowie drei altdeutsche Bilder, zwei Portraits von Lucas Cranach d.Ä. und eines von Hans Holbein d.J. Zusätzlich wurden Kopien Dietrichs nach Gerard Dou und Adriaen Brouwer sowie einige Werke seiner Schwester Maria Dorothea Wagner angeboten. Lit.: Petra Michel, Christian Wilhelm Ernst Dietrich (1714-1774) und die Problematik des Eklektizismus, München 1984. 214 1791/05/28 Gerhard Joachim Schmidt; Hamburg, Börsensaal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 136 Standorte: *KH Annotiert mit dem Preis für Los 75. Titelblatt: Verzeichniß einer ganz vortreflichen Sammlung Italienischer und Deutscher, mehrentheils aber Holländischer Cabinet= Gemählde, größtentheils in den feinsten Französischen und Holländischen vergoldeten Rähmen, so wie auch Gemähide in Wasserfarbe u. s. m. Englische, Holländische und Deutsche und zum Theil seltne Kupferstiche. Dieses alles soll am 28ten May 1791 auf dem hiesigen Börsensaal öffentlich verkauft werden durch den Mackler Gerhard Joachim Schmidt, bey welchem die Catalogii, so wie auch bey der Wittwe Rehländer am Brodschrangen, den Armen zum Besten für 2 sch zu haben sind. Hamburg, gedruckt von Conrad Müller. Kommentar: In dem insgesamt 188 Losnummern umfassenden Katalog des Hamburger Maklers Gerhard Joachim Schmidt sind die Gemälde unter den Losen 1 bis 136 aufgeführt; es folgen Wasserfarben und Kupferstiche. Ein Vorwort zum Katalog informiert, daß die Bilder "alle wohl conserviret" und "ohne Eigennutz beschrieben" sind. Die Beschreibungen in den Einträgen sind größtenteils knapp gehalten; nur in wenigen Ausnahmen, so bei Gemälden von Anthonie van Dyck, Frans van Mieris, Jan Brueghel d.Ä. und Jacob Toorenvliet (Nrn. 119 bis 122), sind die Bildtexte sehr ausführlich. Den aufgeführten Künstlernamen zufolge handelt es sich um eine sehr gut bestückte Sammlung von holländischen, flämischen sowie deutschen und italienischen Gemälden. Dies gilt besonders für die sogenannten Kleinmeister. So finden sich Werke von Willem Gillisz. Kool (Nr. 32), Hendrik de Meijer d.Ä. (Nr. 87) und Jan Christaensz. Micker (Nm. 96 und 97). Unter den Gemälden der italienischen Schule ist auch ein Gitarrenspieler verzeichnet, der Mattia Preti zugeschrieben wird (Nr. 80). Nur drei Einträge weisen keinen Künstlernamen auf. In einigen Fällen weicht die Schreibweise der Künstlernamen von der sonst üblichen stark ab (Jann van Sonn, Abelgrummer). Nur bei einem Bild ist im Katalog KH ein Preis von 12 Schilling überliefert. Wahrscheinlich handelt es sich um das Limit eines Interessenten.
215 1791/05/30-1791/05/31
[Lugt 4745]
[Anonym]; Frankfurt am Main, Haus des Sammlers, Auf der Zeil Lit. D. Nro. 209 Verkäufer nach Titelblatt: Remigius Bansa Verkäufer: Bansa, Remigius Lose mit Gemälden: 196 KATALOGE
133
Standorte: *AMF Annotiert mit allen Käufernamen und Preisen. SIF Nicht annotiert mit Ausnahme einige Anstreichungen mit rotem Farbstift. SMF Nicht gefunden. Nach Lugt nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniss einer Sammlung von Gemälden der berümtesten Meister welche zu Frankfurt am Mayn in der Bansaischen Behausung auf der Zeil Lit. D. Nro. 209. Montags den 30. May dieses Jahres und die darauf folgende Tage öffentlich an den Meistbietenden gegen baare Bezahlung losgeschlagen werden sollen. Sämtliche Gemälde sind in angezeigter Behausung zum Ansehen aufgestellt, und können daselbst wöchentlich zweymal, als Montags und Freytags von Zwey bis Vier Uhr in Augenschein genommen werden. Frankfurt am Mayn, 1791. Kommentar: In diesem 228 Nummern umfassenden Katalog wurde die Sammlung des Bankiers Remigius Bansa (1715-1788) angeboten. Neben den Gemälden wurden auch vereinzelt Kupferstiche und Wachsbildnisse offeriert, insgesamt lassen sich 196 Gemälde zählen. Die Bildbeschreibungen sind unterschiedlich ausführlich, teils knapp gehalten, teils aber auch detaillierter mit Beschreibungen des Hintergrunds oder einzelner Gestaltungsmerkmale, etwa der Lichtgebung. Jedem Bildtext sind der Künstlername, wenn bekannt die Datierung des Gemäldes sowie die Maßangaben vorangestellt; am Ende stehen die Angaben zum Material. Unter den Künstlern sind einige prominente Namen wie Giorgione und Bassano verzeichnet. Es überwiegen jedoch Werke zeitgenössischer Meister aus dem Frankfurter Raum. Von Johann Georg Trautmann lassen sich allein 31 Werke zählen. Vier von ihnen (Nrn. 174, 175, 211 und 212) befinden sich heute im Städelschen Kunstinstitut in Frankfurt am Main. Nach den Angaben des annotierten Exemplars AMF bewegten sich die erzielten Preise auf niedrigem Niveau und erreichten selten mehr als 20 Gulden. Unter den Käufernamen finden sich vor allem Frankfurter Sammler, wie beispielsweise Johann Daniel Bender, Johann Georg Grambs, Johann Georg Scheidewind und Georg Friedrich Moevius. Lit.: Hirsching 1786/92, Bd. 3, S. 75f.; Schmidt 1960, o.P.
216 1791/07/29 M. Bostelmann; Hamburg, Börsensaal
sche Schule ist gut vertreten, darunter vor allem Hamburger Maler wie Johann Georg Stuhr, von dem allein zwölf Bilder aufgeführt sind. Ein großer Teil ist zudem ohne Angaben eines Künstlernamens verzeichnet oder nur mit der Angabe eines Monogramms. Die Gemälde im "Anhang" (S. 19f.), der eine eigene Zählung aufweist, werden nur summarisch mit kurzer Nennung des Themas und ohne Maßangaben aufgenommen. Dagegen sind die Beschreibungen im Katalogteil sehr präzise, auch werden Material- und Maßangaben mitgeteilt. Im Exemplar KH sind handschriftlich die erzielten Preise eingetragen, die sich durchgehend auf niedrigem Niveau bewegen. Bei einigen wenigen Bildern sind auch die Käufemamen verzeichnet.
217 1791/09/15-1791/09/17 [Anonym]; Frankfurt am Main Verkäufer nach Titelblatt: H. Schösser [?] im Ritter [?] Verkäufer: Schösser [?] Lose mit Gemälden: 186 Standorte: *AMF Handschriftliche Liste mit allen Käufemamen und Preisen; der Katalog fehlt jedoch. Kommentar: Von diesem Katalog hat sich kein Exemplar erhalten. Als Hinweis auf die Versteigerung und einen wahrscheinlich gedruckten Katalog dazu ist nur ein handschriftliches Versteigerungsprotokoll aus dem AMF überliefert, das den folgenden Titel trägt: "Gemähide von H. Schösser [?] im Ritter [?] d. 15t. Sbr 1791." Hier sind zwar die Katalognummem angegeben, jedoch weder Bildtitel noch Künstlernamen. Der im Titel angegebene, nur schwer lesbare Name "Schösser" läßt sich nicht als ein Frankfurter Sammler nachweisen. Insgesamt werden in dieser Liste 186 Lose aufgeführt. Die Versteigerung wurde nicht in der Reihenfolge der Losnummern durchgeführt, da diese im Versteigerungsprotokoll in wahlloser Anordnung folgen. Oftmals wurden ganz unterschiedliche Nummern paarweise verkauft. Vermutlich handelte es sich hier um Pendants, die bei der Zusammenstellung des Katalogs auseinandergerissen worden waren. Die erzielten Preise bewegen sich auf niedrigem Niveau, insgesamt wurden 868 Gulden und 46 Kreuzer umgesetzt, also durchschnittlich nur etwas weniger als fünf Gulden je Gemälde. Unter den Käufemamen findet sich von den bekannten Frankfurter Sammlern nur Johannes Barensfeld. Zahlreiche Bilder gingen an einen Käufer namens Lorion aus Mainz.
Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 182 Standorte: *KH Annotiert mit einigen ganz wenigen Käufemamen und allen Preisen. Titelblatt: Verzeichnis einer besonders schönen Gemählden=Sammlung von Italienischen, Französischen, und Teutschen Künstlern verfertiget, welche alle wohl conserviret, daß solche ohne Kosten aufgehangen werden können; und am Freytage, den 29 Julii 1791 auf dem hintern Börsensaal, wann sie benannten Datum, den Tag vorhero in beliebigen Augenschein genommen worden sind, durch den Mackler M. Bostelmann öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden sollen. Hamburg 1791. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog des Hamburger Maklers Michael Bostelmann werden 183 Gemälde angeboten. Die Aufstellung der Gemälde erfolgt in zwei Abteilungen. Dem eigentlichen Katalog (Nm. 1 bis 145) ist ein 45 Nummern umfassender "Anhang" beigefügt, der am Ende Kupferstiche und Rahmen aufführt (Nrn. 44 und 45). Im eigentlichen Katalog werden auch drei Statuen des schweizerischen Bildhauers Emanuel Bardou (1744-1818) zum Verkauf angeboten (Nrn. 119 bis 121). Die Sammlung umfaßt vor allem Gemälde der holländischen und flämischen Schule. Auch die deut134
KATALOGE
218 1791/09/21
[Lugt 4810]
[Anonym]; Frankfurt am Main, In dem Scharfischen Saal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 152 Standorte: *AMF Annotiert mit allen Käufemamen und Preisen auf eingebundenen Leerseiten am Ende des Katalogs; wahrscheinlich handelt es sich um das Protokoll des Ausrufers. Titelblatt: Verzeichnis einer kostbaren Sammlung von Gemälden derer besten und berühmtesten italienischen, französischen, teutschen und niederländischen Meister, welche zu Frankfurt am Main in dem Schärfischen Saal allhier Mittwoch den 21. Sept. 1791 öffentlich an den Meistbietenden gegen baare Bezahlung überlassen werden. Sämtliche Gemälde können alle vier Tage vorher Vormittags von 9 bis 12 Uhr in besagtem Saal besehen werden. Kommentar: In dieser anonymen Frankfurter Versteigerung wurden 151 Losnummern mit Gemälden angeboten. Teilweise werden unter einzelnen Losnummern auch zwei Bilder zusammengefaßt, in einem Fall (Nr. 147) sogar drei. Die Bildtexte sind ausführlich und deskriptiv, Angaben zum Material und zu den Maßen fehlen. Auf der letz-
ten Seite findet sich jedoch folgende Notiz: "Nota. Man berichtet die Liebhaber und Künstler, daß alle diese Gemälde im besten Stande, alle auf Leinwand mit neuen Rahmen eingefaßt und der größte Theil mit schönen reichlich vergoldeten Einfassungen gezieret sind." Jede Nummer beginnt mit der Nennung des Künstlers, gefolgt von mitunter längeren Beschreibungen des Gemäldes. Des öfteren wird auf die Qualität oder die Seltenheit eines Bildes verwiesen, so beispielsweise bei dem Bild von Jan Asselyn (Nr. 7), denn "die Werke dieses Meisters sind sehr schwer zu bekommen". Im Bildtitel des Gemäldes eines nur mit P.G. vorgestellten Künstlers (Nr. 80) heißt es: "Wir überlassen den Kennern, den Künstler zu entscheiden." Auch finden sich Angaben zum Entstehungsort einzelner Gemälde, so wird bei zwei Bildern (Nrn. 38 und 39) erwähnt: "dieses und das folgende Gemälde sind von Vernet in Italien gemalt worden." Bei einigen Bildern wird auf die spanische Provenienz hingewiesen: "dieses [Nr. 10] sowohl als verschiedene andere [...] sind durch einen Bothschafter von Spanien gebracht." Dieser Hinweis wird wiederholt bei einem Gemälde Tintorettos (Nr. 12), einem Werk von Mateo Cerezo d.J. (Nr. 55), zwei Arbeiten Rubens' (Nrn. 58 und 61), einer Kopie Salvator Rosas nach Tizian (Nr. 64), dem Monogrammisten P.G. (Nrn. 80 und 81), Luca Giordano (Nr. 83) und zwei Gegenstücken von Rubens und Snyders (Nrn. 70 und 71) sowie bei einem Bild von Guido Reni (Nr. 109). Der größte Teil der Sammlung gehört der holländischen und flämischen Schule des 17. und 18. Jahrhunderts an. Aber auch französische Künstler sind mit 16 Gemälden vertreten, die italienischen Schulen mit 21 Bildern. Auffällig ist die geringe Anzahl der deutschen Gemälde. Insgesamt finden sich nur vier deutsche Werke, ein Bild von Adam Elsheimer, zwei Werke von Hans Holbein d.J. und ein Bild von Georg Philipp Rugendas d.Ä. Statt dessen ist die spanische Schule mit sechs Werken ungewöhnlich stark vertreten. Dies hängt vermutlich damit zusammen, daß ein Teil der Sammlung aus Spanien stammte. Allerdings ist es zweifelhaft, ob diese Werke tatsächlich von spanischen Meistern gemalt worden sind. In einem Stilleben von Weenix und Anthonie van Dyck sollen beispielsweise die Figuren von Velazquez stammen. Wegen der geringen Anzahl der deutschen Bilder und dem völligen Fehlen von Gemälden Frankfurter Künstler liegt die Vermutung nahe, daß es sich um eine aus Holland importierte Sammlung handelt. Im Exemplar AMF findet sich im Anschluß an den Katalog ein Verkaufsprotokoll mit Käufernamen und Preisen. Der Verkauf erfolgte nicht nach Losnummern und erstreckte sich über zwei Tage, von Mittwoch, den 21. September, Vormittag, bis Donnerstag, den 22. September, Nachmittag. Der Gesamterlös belief sich auf 8.576,30 Gulden. Zahlreiche Bilder wurden zu hohen Preisen von über 100 Gulden verkauft. Den höchsten Preis erzielte mit 460 Gulden die Losnummer 10, die angeblich von Weenix, Anthonie van Dyck und Velazquez gemeinsam gemalt worden ist. Unter den Käufern finden sich ungewöhnlich viele Personen, die nicht aus Frankfurt stammten. So erwarb ein Käufer namens Hindt, der nach einer handschriftlichen Notiz aus England stammte, insgesamt acht Bilder, darunter auch die 460 Gulden teure Losnummer 10. Mehr als 30 Bilder erstand der Agent Levy. Viele Käufernamen lassen sich nicht zweifelsfrei identifizieren.
219 1791/09/26
und folgende Tage
Titelblatt: Verzeichniß einer beträchtlichen Sammlung von Gemälden berühmter Italiänischer, Niederländischer und deutscher Meister welche nebst vielerley Pastell= Wasserfarb= Glasgemälden und eingerahmten Englischen und Französischen Kupferstichen, der kürzlich verstorbene Herr Johann Friedrich Müller hinterlassen hat, und zu Frankfurt am Mayn in dem Senckenbergischen Stiftungs=Haus nächst bevorstehende Herbst=Messe, Montags den 26ten September und die darauf folgende Täge, öffentlich an den Meistbietenden gegen baare Bezahlung überlassen werden sollen, auch können sämmtliche Gemälde und Kupferstiche, welche in dem besagten Senckenbergischen Stiftungshaus hinter der sogenannten Schlimm=Mauer in Sechs grosen Zimmern aufgestellt, allwöchentlich zweimal, als Sonntags und Mittwochs, von 2 bis 5 Uhr besehen werden. Gedruckt bei H. L. Brönner 1791. Kommentar: In diesem umfangreichen Versteigerungskatalog wurde die Sammlung des Textilfabrikanten Johann Friedrich Müller (1729-1791) angeboten, in dem 723 Lose aufgeführt werden. Die Gemälde sind unter den Nummern 1 bis 482 und 579 bis 660 verzeichnet, insgesamt lassen sich 564 Gemälde und Glasmalereien zählen. Außerdem umfaßt der Katalog noch Kupferstiche, optische Instrumente und Waffen. Die Bildbeschreibungen sind nicht sehr ausführlich, jedoch oft mit Wertungen versehen. So heißt es beispielsweise bei einem Bild von Gerrit van Honthorst: "Der kleine Johannes und die Elisabeth beten das Kind Jesu beym Schein eines Lichtes an, meisterhaft und in einem grosen Styl gemalt von Hondhorst" (Nr. 30); es folgen die Maßangaben. In der Sammlung finden sich einige Pendants, die als solche ("Gegenbild") gekennzeichnet sind. Es werden Datierungen angegeben. Vorwiegend handelt es sich um Arbeiten weniger prominenter deutscher und niederländischer Künstler. Unter den deutschen Malern finden sich zahlreiche Werke von zeitgenössischen Künstlern aus dem Frankfurter Raum, so beispielsweise allein 25 Werke von Franz Hochecker, zehn Bilder von Georg Heinrich Hergenröder und 24 Bilder von Johann Melchior Roos. Anonym bleiben 65 Werke. Über den Verlauf der Auktion haben sich keine Details erhalten. Lit.: Hirsching 1786/92, Bd. 3, S. 80; Schmidt 1960, o.P.
220 1791/10/21 J.D. Reimarus; Hamburg, Börsensaal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 99 Standorte: *KH Annotiert in Bleistift mit einigen Käufernamen und Preisen. Titelblatt: Verzeichniß einer vortreflichen und ansehnlichen Gemählde=Sammlung von vorzüglichen Italienischen, Holländischen, und Deutschen Meistern aus einer hiesigen bekannten Verlassenschaft, welche am Freytage den 21 October 1791 auf dem hiesigen Börsensaal öffentlich verkauft werden soll durch die Makler J. D. Reimarus und v. d. Meden. Tages vor den Verkauf, als den 20sten October, können sämmtliche Gemähide wie gewöhnlich an obbenanntem Orte besehen werden. Die Catalogi sind für 2 sch den Armen zum Besten bey dem Makler Reimarus zu haben. Hamburg, 1791.
[Lugt 4789]
[Anonym]; Frankfurt am Main, In dem Senckenbergischen Stiftungs-Haus Verkäufer nach Titelblatt: Herr Johann Friedrich Müller Verkäufer: Müller, Johann Friedrich Lose mit Gemälden: 564 Standorte: SBF Annotiert in Bleistift mit einigen Preisen. SIF Nicht annotiert.
Kommentar: Dem Titelblatt dieses Katalogs zufolge handelt es sich um eine Hamburger Sammlung, die von den Maklern Johann David Reimarus und von der Meden auf der Börse verauktioniert wurde. Der Katalog umfaßt insgesamt 105 Losnummern, bei den Nummern 100 bis 105 handelt es sich jedoch um Kupferstiche, Arbeiten auf Pergament oder Drucke. Die Beschreibungen sind unterschiedlich ausführlich, mitunter sehr detailliert mit Bemerkungen über die malerische Behandlung. Vorangestellt sind jeweils der Künstlername, hin und wieder werden Datierungen sowie die Maße angegeben. Den Abschluß bilden zuweilen Angaben zur Größe der dargestellten KATALOGE
135
Figuren (halb- oder ganzfigurig, Lebensgröße) sowie stets die Angabe des Materials. Vorwiegend sind Werke von niederländischen Künstlern aufgeführt, darunter ein Gemälde von Rembrandt (Taufe des Kämmeres\ Nr. 64). Aufgrund des Formats kann das Gemälde nicht mit einem der beiden heute bekannten Versionen dieses Themas von Rembrandt (Utrecht, Rijksmuseum Het Catharijneconvent, bzw. Hannover, Landesgalerie) identifiziert werden. Die Gemälde der deutschen Schule bilden den zweitgrößten Anteil der zur Versteigerung gelangten Bilder, gefolgt von wenigen Werken der flämischen und italienischen Schule. Anonym bleiben nur vier Werke. Von dem Schweizer Maler Felix Meyer werden vier Landschaftsgemälde angeführt (Nrn. 22 bis 25). Im Exemplar KH finden sich vereinzelt handschriftliche Eintragungen mit Kaufpreisen und Käufernamen, darunter die Kunsthändler Johann Benjamin Ehrenreich und Peter Sieberg, an den die vier Bilder von Felix Meyer für je 2 Mark und 2 Schilling gingen.
221 1791/10/21 J.D. Reimarus; Hamburg, Börsensaal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 21 Standorte: *KH Annotiert mit einigen Käufernamen und Preisen. Titelblatt: Verzeichniß einiger wenigen, aber ganz vortreflichen Italienischen, Französischen, und Holländischen Gemählden alle in den feinsten breiten vergoldeten Rahmen gefaßt, welche bey der Auction vom 21 October 1791 auf dem Börsensaal in Hamburg mit verkauft werden sollen durch die Makler J.D. Reimarus und v. d. Meden. Hamburg, 1791. Kommentar: Dieser Katalog der Hamburger Makler Johann David Reimarus und von der Meden gleicht in der Aufmachung dem Kat. 220. Beide Auktionen fanden am selben Tag auf der Hamburger Börse statt. Auf acht Seiten sind 21 Gemälde verzeichnet und ausführlich beschrieben, die alle schon in einer Hamburger Auktion am 6. Oktober 1774 angeboten worden waren (Kat. 174) und dort am Anfang des Katalogs unter den Losnummern 1 bis 26 aufgeführt wurden. In dem Katalog von 1787 wird von verschiedenen Einlieferern gesprochen. Vermutlich stammten die im Katalog von 1791 wieder aufgetauchten Bilder von einem Sammler. Insgesamt konnten 1787 fünf Gemälde verkauft werden, die restlichen 21 wurden 1791 erneut angeboten. In einigen Fällen änderte sich die Zuschrei bung, auch sind die Beschreibungen in dem Katalog von 1791 wesentlich ausführlicher. So wurde beispielsweise ein Werk von Ruisdael in dem Katalog von 1791 als Roelof van Vries vorgestellt (Nr. 21). Bei den offensichtlich durchweg qualitätvollen Gemälden handelt es sich um Werke von bekannten holländischen Malern wie Jan van Goyen, Frans Hals oder Gabriel Metsu. Eine gebirgige Landschaft mit Wasserfällen wird als gemeinsame Arbeit von Paul Bril und Annibale [?] Carracci ausgewiesen (Nr. 17). Nach den Angaben des annotierten Exemplars KH gingen einige Bilder an den Kunsthändler Johann Jobst Eckhardt. Ein Gemälde von Paulus Moreelse (Nr. 13) ist 1906 in der Sammlung des Baron Koussof in St. Petersburg nachweisbar.
222 1792/02/01
und folgende Tage
[Lugt 4845]
KKD
Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Nach Lugt nicht annotiert.
Titelblatt: Anzeige einer ansehnlichen Kupferstich-Sammlung alter, neuer und seltener Blätter berühmter Meister, nebst einigen Handzeichnungen, Gemählden, Kupferstichwerken und vielen Kupferstichen unter Glas und Rahm. Den lsten Februar 1792. wird der Verkauf davon gehalten, in den gewöhnlichen Vor- und Nachmittagsstunden, von dem verpflichteten Universitäts-Proclamator Herrn Weigel, im rothen Collegio zu Leipzig, gegen gleich baare Bezahlung, in Louisd'ors ä 5 Rthlr. oder Sachs. Conv. Gelde. No. XI. Leipzig, gedruckt bey Gotthelf Albrecht Friedrich Löper. Kommentar: Im elften Versteigerungskatalog der Kunsthandlung Rost wurden erneut überwiegend graphische Arbeiten angeboten, die von verschiedenen Einlieferern stammten (Nrn. 1 bis 4784). In der anschließenden Rubrik "Gemälde" werden 106 Bilder aufgeführt (Nm. 4785 bis 4892). Wie die übrigen Kataloge des Kunsthändlers Carl Christian Heinrich Rost (1741-1798) ist auch dieser sorgfältig zusammengestellt. Im Vorwort äußert Rost seine Freude darüber, daß auch in Regensburg und in Nürnberg ähnliche Kunstauktionen nach dem Vorbild der Leipziger Versteigerungen durchgeführt wurden. Namentlich erwähnt wird etwa Johann Friedrich Frauenholz aus Nürnberg. Außerdem versucht Rost, die Kritik am Auktionswesen auszuräumen. Keinesfalls minderten häufig durchgeführte Auktionen den Wert von Kunstwerken, vielmehr würden hierdurch mehr Bürger zum Sammeln von Kunst angeregt. In der Gemäldeabteilung des Katalogs finden sich Nummern als Zwischenüberschriften, ohne daß ein Ordnungsprinzip erkennbar wäre. Wahrscheinlich verweisen diese Nummern auf die verschiedenen Einlieferer. Auffällig viele Gemälde dieser Auktion wurden von Rost als Kopie oder als Manier bezeichnet. Die meisten Bilder können der deutschen Schule des 18. Jahrhunderts zugerechnet werden. Es wurden aber in dieser Versteigerung auch fünf Tafeln von Lucas Cranach d.Ä. und eine Kopie nach Hans Holbein d.J. angeboten, die nur äußerst geringe Preise erzielten. So wurden für die vier Tafeln eines Cranach-Altars (Nr. 4834) nur 17 Groschen bezahlt. Dagegen erzielten einige der insgesamt 15 italienischen Werke höhere Preise, so zwei Landschaften von Francesco Zuccarelli (Nm. 4797 und 4798), die schon in der neunten Auktion der Rostschen Kunsthandlung angeboten worden waren und vermutlich zurückgingen (Kat. 209, Nrn. 1854 und 1855), mit 48 beziehungsweise 46 Talem. Einen mit 40 Talem relativ hohen Preis erzielte ebenfalls Abigail und David von Pietro da Cortona (Nr. 4796). Neben den deutschen Bildern machten die holländischen Werke des 17. Jahrhunderts die größte Gruppe aus, darunter zwei Landschaften von Dirk van Bergen (Nm. 4801 und 4802), die auch schon in der neunten Auktion der Rostschen Kunsthandlung offeriert worden waren (Kat. 209, Nm. 1856 und 1857). Das Bild Herkules und Omphale (Nr. 4795) von Johann Heiss, das bereits zum zweiten Mal offeriert wurde, ging zurück und wurde in der zwölften Auktion der Rostschen Kunsthandlung (Kat. 233, Nr. 7001) wiederum angeboten. Die meisten Bilder, die in der zwölften Auktion emeut auftauchen, sind in dem annotierten Exemplar des Katalogs der elften Versteigerung mit einem "R" bezeichnet. Vermutlich ist hier ein Vertreter der Kunsthandlung Rost selbst als Bieter aufgetreten. Wahrscheinlich ist daher der größte Teil der Gemälde wieder zurückgegangen, denn insgesamt 66 Lose sind handschriftlich mit einem "R" markiert. Lit.: Trautscholdt 1957.
C.C.H. Rost; Leipzig, Im rothen Collegio Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 107 Standorte: *BDu Annotiert mit allen Käufemamen und Preisen. HKB Nicht annotiert. SBBa 136
Nicht annotiert. Aus dem Besitz von Joseph Heller. KATALOGE
223 1792/04/19-1792/04/21
[Lugt 4903]
M. Bostelmann; Hamburg, Börsen=Saale Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 170
Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß eines Nachlasses von Cabinet=Gemählden, imgleichen Englischer und Französischer Kupferstiche, welche sauber unter Glas und in Rahmen gefaßt. Nebst einer sehr schönen Sammlung loser Kupferstiche und Original=Handzeichnungen. Welches alles den 19, 20 und 21 April auf dem hiesigen Börsen=Saale durch die Mackler M. Bostelmann & Pakischefsky öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden soll. Hamburg, 1792. Kommentar: In dieser Versteigerung der Hamburger Makler Michael Bostelmann und Peter Heinrich Packischefsky gelangten 170 Gemälde zum Verkauf. Dem Vorwort zum Katalog ist zu entnehmen, daß die Gemälde, Kupferstiche und Zeichnungen am 19. April ab 10 Uhr auf der Börse besichtigt werden konnten. Um welchen Nachlaß es sich handelt, wird leider nicht erwähnt. Die Beschreibungen sind von unterschiedlicher Länge. Sie werden jeweils mit der Angabe des Künstlernamens, des Materials und der Maße beschlossen. Gelegentlich finden auch Details Erwähnung; Signaturen und Datierungen sind ebenfalls verzeichnet. Auch finden sich des öfteren Angaben zur Malweise wie beispielsweise "mit vieler Force gemahlt" (Nrn. 47 und 48), "mit großem Affect vorgestellet" (Nr. 52). Viele Gemälde sind, auch wenn sie von zwei verschiedenen Künstlern stammen - z.B. Johannes Lingelbach und Jan van der Vinne (Nrn. 3 und 4) - , zu Pendants zusammengefaßt. Vorwiegend handelt es sich um Werke der holländischen und deutschen Schule, gefolgt von einer kleineren Anzahl von flämischen und italienischen Gemälden. Anonym bleiben 18 Bilder, einige Künstlernamen und auch einige Monogrammisten lassen sich nicht identifizieren. Die Bilder der holländischen Schule sind breit gestreut, nur von wenigen Künstlern treten mehrere Werke auf.
224 1792/07/05 Kipp; Lübeck, In der untem Johannisstraße Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 132 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Am zweyten Tage nach der Auffahrt des Hrn. Blanchard wird eine Sammlung von Gemälden in einem bekannten Hause in der untern Johannisstraße verkauft werden, wovon ein Verzeichniß beym Auctionarius Kipp zu haben ist. Kommentar: Dieses Verzeichnis ist nicht im eigentlichen Sinne ein Auktionskatalog, sondern ein dreiseitiger listenartiger Handzettel, der die Versteigerung einer anonymen Sammlung ankündigt. Vermutlich handelte es sich um eine in Lübeck stadtbekannte Kaufmannsfamilie, da von einem Haus in der unteren Johannisstraße gesprochen wird, einer Gegend, wo vor allem die Häuser wohlhabender Familien anzutreffen waren. Als Termin der Versteigerung wurde der zweite Tag der "Auffahrt des Hm. Blanchard" gewählt. Dies bezieht sich auf den Ballonfahrer Jean Pierre Blanchard (17501809), der sich seit Januar 1792 in Lübeck aufhielt. Am 3. Juli 1792, also zwei Tage vor der Auktion, absolvierte Blanchard seinen 44. Ballonaufstieg. Vermutlich war diese Ballonfahrt eine besondere Attraktion, die Besucher und damit potentielle Käufer aus der näheren und weiteren Umgebung in die Stadt führte. Die Auktion wurde von Matthias Eberhard Kipp (1742-1797) durchgeführt, der seit 1783 in Lübeck das Amt des Ausrufers ausübte. In der Handliste sind die Bildbeschreibungen nur sehr kurz und in einen Satz gefaßt, Material- und Maßangaben fehlen. Unter den 131 Losnummern finden sich überwiegend holländische und flämische Bilder des 17. und 18. sowie deutsche Gemälde des 18. Jahrhunderts. Lit.: Johann Rudolph Becker, Umständliche Geschichte der kaiserli-
chen und des Heiligen Römischen Reichs freyen Stadt Lübeck, Lübeck 1805, Bd. 3, S. 381-385.
225 1792/07/28 Johann Hinrich Schöen; Hamburg, Börsen=Saal Verkäufer nach Titelblatt: Dominicus Gottfried Waerdigh Verkäufer: Waerdigh, Dominicus Gottfried Lose mit Gemälden: 201 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß des in Plön verstorbenen Herrn Dominicus Gottfried Waerdigh hinterlassenen vortreflichen Gemählden=Sammlung, wovon die mehresten von des gedachten Künstlers eigener Hand, als auch von anderen berühmten Meistern verfertigt worden, und in sauberen Rahmen gefaßt, und eine kleine Sammlung Kupferstiche welche den 28sten July 1792 auf dem Börsen=Saal öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden sollen, durch den Mackler Johann Hinrich Schoen. Tages vorher, als den 27sten July, sind oberwähnte Gemähide an benannten Orte beliebigst zu besehen, und um 11 Uhr werden die Kupierst, verauctioniert werden. Hamburg, gedruckt bey Gottl. Friedr. Schniebes. Kommentar: Die Gemäldesammlung des Malers Dominicus Gottfried Waerdigh (1700-1789) wurde bereits zwei Jahre zuvor, am 20./21. Mai 1790 (Kat. 201) durch den Makler Johann Hinrich Schoen öffentlich zum Verkauf angeboten. Für die neuerliche Auktion wurde dasselbe Titelblatt verwendet, einzig das Datum mußte korrigiert werden. Mit wenigen Ausnahmen handelt es sich bei den Gemälden der holländischen und flämischen Schule um Werke, die bereits auf der Auktion von 1790 angeboten und die damals zum größten Teil von dem Makler Schoen selbst gekauft worden, also zurückgegangen waren. Hierzu gehören die Gemälde von Willem van Aelst (Nrn. 80 und 81), Cornells Pietersz. Bega (Nr. 94), Jan van de Capelle (Nr. 28), Abraham van Cuylenborch (Nrn. 74 und 75, Jan Davidsz. de Heem (Nr. 87), Hendrik Heerschop (Nrn. 43, 44 und 46), Johannes Lingelbach (Nr. 45), Hendrik de Meijer (Nr. 25), Mieris (Nr. 31) und Caspar Netscher (Nm. 50 und 59). Bei den Katalogeinträgen griff man ebenfalls auf die aus dem vorhergehenden Katalog vorliegenden Beschreibungen zurück. Auch die meisten Bilder von Waerdigh selbst wurden schon zwei Jahre zuvor angeboten und waren auf der Auktion vom 20./21. Mai 1790 nicht verkauft worden. Auch bei diesen Werken ist Schoen im annotierten Exemplar KH der folgenden Auktion als Käufer ausgewiesen. Im Unterschied zur Auktion von 1790 findet sich neben den Gemälden Waerdighs auch eine große Anzahl von Bildern von Jakob Samuel Beck verzeichnet. Der in Erfurt und Ansbach tätige Beck war 1778 verstorben. Möglicherweise handelt es sich bei den 32 zum Verkauf gelangten Gemälden um einen Teil seines Nachlasses. Über den Verlauf dieser zweiten Auktion des Waerdigh-Nachlasses liegen keine Angaben vor.
226 1792/08/20
und folgende Tage
[Anonym]; Köln, nechst bey der ehemaligen Jesuiten Kirch Verkäufer nach Titelblatt: Kaspar Philipp Kox Verkäufer: Kox, Kaspar Philipp Lose mit Gemälden: 400 Standorte: LBDa Nicht annotiert. UBK Nicht annotiert. Titelblatt: Katalog des von Herrn Kaspar Philipp Kox seel. viele Jahren hindurch gesammelten großen Mahlerey=Kabinet von den besten und berühmtesten, Italiänischen, Franzößischen, Teutschen und Niederländischen Meisteren. Welche in einer öffentlicher VerKATALOGE
137
Steigerung an die mehristbiethende aus freyer Hand zu überlassen beschlossen ist. Zu Kölln am Rhein, gedruckt bei Johan Joseph Franz Rüttgers auf der Stolkgassen Eck im halben Monde. 1792. Kommentar: In diesem umfangreichen Katalog mit 32 Seiten wurden 401 Gemälde angeboten. Es handelte sich um den Nachlaß des Kölner Sammlers Kaspar Philipp Kox; ein Auktionshaus tritt wie bei den meisten Kölner Versteigerungen nicht in Erscheinung. Die Bildbeschreibungen sind in der Regel knapp gehalten und zusammen mit den Künstlernamen in einem Satz zusammengefaßt. Auch die Maße werden genannt, es werden jedoch bis auf wenige Ausnahmen keine Angaben zum Material gemacht. In einer kurzen Vorbemerkung ("Anzeige") findet sich der Hinweis: "Die Stücke seynd beständig wohl gehalten worden, und meistens mit ganz= oder doch wenigst an den inwendigen Listen vergoldeten Rahmen versehen." Überwiegend handelt es sich um Werke flämischer und holländischer Künstler, darunter auch berühmte Namen wie Peter Paul Rubens und Rembrandt, von dem allein sechs Bilder aufgeführt sind. Gut vertreten ist auch die deutsche Schule, darunter 26 Werke des Kölner Landschaftsmalers Andreas Greiss. 100 Bilder bleiben anonym. Über den Verlauf der Auktion liegen keine Informationen vor. Lit.: Förster 1931, S. 60.
227 1792/09/07
[Lugt 4944]
M. Bostelmann; Hamburg, Börsen=Saal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 39 Standorte: *KH I Annotiert in Bleistift mit einigen Käufernamen und Preisen. ICH II Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichnis einer vortrefflichen aus einer hiesigen ansehnlichen Verlassenschaft entstehenden, in Rahm und Glas gefaßten Kupferstich=Sammlung von Englischen und Französischen Meistern, worunter sich fast alle die seltensten und vorzüglichsten Stükke befinden; so wie auch einige wenige uneingefaßte dito Kupferstich=Werke und einige Gemähide. Dieses alles soll am Freytage, als den 7 Sept. d.J. auf den hiesigen Börsen=Saal öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, durch die Mackler M. Bostelmann & Packischefsky. Tages vor der Auction können die sämmtlichen Sachen am benannten Verkaufs=Orte, wie gewöhnlich, öffentlich besehen werden: und diese Catalogi sind bey die benannten Makler zu haben. Hamburg, 1792. Kommentar: In dieser Auktion wurde durch die Makler Michael Bostelmann und Peter Hinrich Packischefsky eine Hamburger Sammlung verauktioniert. Der Name des Besitzers der am 7. September zur Auktion gelangten Kupferstichsammlung ist nicht bekannt. In einem Anhang wurden unter den fortlaufenden Nummern 153 bis 198 noch insgesamt 39 Gemälde der holländischen, flämischen und deutschen Schule angeboten, wovon allein acht Gemälde dem in Berlin und Hamburg tätigen Maler A. Videbant zugeschrieben werden. Bei der Nr. 145 handelt es sich um ein Pastell. Alle Beschreibungen sind knapp, so heißt es beispielsweise: "Perspectivische Bogengänge mit einigen Figuren; stark gemahlt, von de Vries." (Nr. 156). Es folgt die Angabe des Materials, Maßangaben fehlen hingegen. Im Exemplar KH sind handschriftlich einige Kaufpreise und Käufernamen verzeichnet. Insgesamt 13 Bilder wurden dem Hamburger Kunsthändler Johann Jobst Eckhardt zugeschlagen. Die Preise blieben auf niedrigem Niveau. Den Höchstpreis erzielte eine Landschaft mit einer Gesellschaftsszene von David Vinckeboons.
228 1792/09/28-1792/10/01
[Lugt 4947]
M. Bostelmann; Hamburg, Börsensaal 138
KATALOGE
Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 113 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichnis eines Nachlasses von sehr schönen Gemählden in Oel= und Wasser=Farben; eingefaßter und uneingefaßter Kupferstiche, wie auch Kupferstich=Werke, imgleichen Optische und Musicalische Instrumente, einige Kunstsachen, Naturalien ec. ec. welches alles am Freytage, den 28 Sept., und am Montage den 1 October 1792, auf dem hiesigen Börsensaal öffentlich an den Meistbiethenden verkauft werden soll, durch die Makler M. Bostelmann & Packischefsky, bey welchen dieses Verzeichniß zu haben ist. N.B. Es werden die uneingefaßten Kupferstiche, die optischen und musicalischen Instrumente, Kunstsachen ec. am Freytage den 28 September verkauft, und sind am nehmlichen Tage die Gemähide und eingefaßte Kupferstiche beliebigst in Augenschein zu nehmen. Kommentar: In dieser Auktion wurde durch die Makler Michael Bostelmann und Peter Hinrich Packischefsky eine Sammlung versteigert, die wahrscheinlich aus Hamburg stammte. Der Name des Besitzers, dessen Sammlung nach seinem Tode zur Auktion gelangte, wird jedoch nicht genannt. Dem Titelblatt ist zu entnehmen, daß die Gemälde am Samstag, den 29. September, auf dem Börsensaal zu besichtigen waren, die Auktion folglich am Montag, den 1. Oktober durchgeführt wurde. Zur Versteigerung gelangten 113 Gemälde, v.a. Werke aus der deutschen und holländischen Schule. Die Beschreibungen im Katalog sind in der Regel sehr knapp, so heißt es beispielsweise: "Die Creutzschleifung Christi, von Dieppenbeck" (Nr. 12). Es folgen jeweils die Angaben des Materials und der Maße. Der Katalog verzeichnet zahlreiche Pendants. Anonym bleiben 30 Gemälde, mehrere Bilder werden Monogrammisten zugeschrieben, die sich nicht identifizieren lassen. Die zu Beginn des Katalogs aufgeführten Bildnisse von Kaiser Leopold und dessen Gemahlin, von Franz I. und Kaiserin Maria Theresia sowie von Prinz Eugen von Savoyen und Feldmarschall Graf Daun deuten darauf hin, daß der anonyme Besitzer in Beziehung zum kaiserlichen Hof in Wien gestanden hatte.
229 1792/10/12 [Anonym]; Köln, Aufm Malzbüchel nächst beim Henmarkt Verkäufer nach Titelblatt: Herrn Moureaux aufm Malzbüchel Verkäufer: Moureaux, Philipp Jacob Lose mit Gemälden: 100 Standorte: LBDa Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichnis einer mit Geschmack und Kenntniss gesammelter Parthie gut Konservierter Original-Gemälde, welche am 12ten October dieses Jahres, zu Kölln am Rhein in der Behausung des Herrn Moureaux aufm Malzbüchel nächst beim Henmarkt, öffentlich versteigert werden sollen. 1792. Kölln, gedruckt in der Langenschen Buchhandlung 1792. Kommentar: In diesem achtseitigen Versteigerungskatalog gelangte die Sammlung des Offiziers Philipp Jacob Moureaux zum Verkauf, der vermutlich in der Kölner Altstadt in der Gasse Malzbüchel in der Nähe des Heumarktes lebte. Ein Auktionshaus tritt wie bei den meisten Kölner Auktionen nicht in Erscheinung. Unter den 158 Losnummern lassen sich 100 Gemälde zählen. Teile der Sammlung werden nicht eigens spezifiziert: Von Nummer 63 bis Nummer 125 sind "verschiedene große und kleine Minaturstücke, Tuschen ec" verzeichnet. Auch die Folge der Nummern 37 bis 65 wird summarisch offeriert, wobei darunter einzelne Gemälde als Einzelnummer angeführt werden. Alle Beschreibungen sind knapp gehalten. Unter den zugeschriebenen Werken dominieren Werke holländi-
scher und flämischer Künstler. Deutschen Künstlern werden fünf Bilder zugeschrieben, von italienischen Malern stammen acht Werke, darunter zwei von Benedetto Luti mit Darstellungen der Hl. Magdalena und dem Hl. Johannes (Nr. 138). Anonym bleiben 36 Werke. Über den Verlauf der Auktion liegen keine Informationen vor.
230 1793/00/00
Daten unbekannt
[Anonym]; Aachen Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 1 Standorte: *UBK Nicht annotiert mit Ausnahme der einzigen Losnummer mit einem Gemälde am Ende des Katalogs, bei dem der Preis angegeben und der Künstlername durchgestrichen worden ist. Titelblatt: Verzeichniß über ein Kunst= und Naturalien=Cabinet und mehrere Bücher, von Gerichtswegen zum öffentlichen Verkauf ausgeboten in Aachen 1793. Gedruckt mit Müllerschen Schriften. Kommentar: In diesem anonymen Versteigerungskatalog wurden fast ausschließlich graphische Arbeiten und Naturalien verkauft. Am Ende des Katalogs wurde ein Gemälde mit einer Darstellung von Christus am Kreuz angeboten, das Luca Giordano zugeschrieben wurde (Nr. 1). Im Exemplar UBK wurde jedoch der Künstlername durchgestrichen und die Bemerkung hinzugefügt: "allenfallß 1 Carol. für den Christum".
231 1793/00/00
Daten unbekannt
[Lugt 5142]
mälde, denen eine Liste der Künstlernamen sowie ein Vorwort von Laporterie vorangestellt wurde. In dem Auktionskatalog von 1793 folgt den Angaben des Künstlernamens, des Materials und der Maße zunächst eine Beschreibung des Bildgegenstandes. Anschließend wird das Gemälde kennerschaftlich beurteilt, sowohl hinsichtlich des Stils ("Gemähide vom ersten Stile des Meisters"; Nr. 27), als auch hinsichtlich der Seltenheit mancher Stücke ("Die Gemälde des Casanova [...] sind sehr theuer und höchst selten"; Nr. 23). Die Beschreibungen zu den einzelnen Losnummern sind je nach Rang des Künstlers unterschiedlich ausführlich. Gelegentlich werden Informationen zum kunstgeschichtlichen Zusammenhang gegeben. So heißt es zu einer Skizze von Mengs: "ist der Gedanke zu einem großen Gemälde, welches Herr Thomas Jenkins, ein in Rom wohnender Engländer, von Mengs für die Summa von 6000 Reichsthaler, kaufte" (Nr. 30). In den 1794 erschienenen "Hamburgische[n] Künstlemachrichten" von Georg Ludwig Eckhardt wird die Sammlung Laporterie nicht mehr aufgeführt. Nach Aussage des Auktionskatalogs hat Laporterie die Gemälde der italienischen Schule auf seinen Reisen in Italien selbst erworben. Zu diesen Werken gehören möglicherweise die im Katalog aufgeführten Bilder von Jacopo Amigoni, Giovanni Antonio Canal, gen. Canaletto, Carlo Cignani. Die Sammlung der holländischen Gemälde setzt sich aus Werken bekannter Künstler zusammen, von Adriaen Beeldemaker bis zu Jan Wijnants und Pieter Wouwerman. Die Gruppe der flämischen Gemälde ist vom Umfang her nur wenig größer als die der französischen Bilder, worunter sich vier Werke von Jean Baptiste Monnoyer befinden. Den eigentlichen Mittelpunkt jedoch bildeten die sechs Anton Raphael Mengs zugeschriebenen Gemälde (Nm. 1, 2, 30, 31, 32 und 84). Eine Himmelfahrt Christi (Nr. 2) befindet sich heute in einer deutschen Privatsammlung (Steffi Roettgen, Anton Raphael Mengs, 1728-1779, München 1999, Nr. 68).
August Wilhelm Matfeld; Hamburg, Sterbehaus auf dem Drehbahn, Nro. 318 Verkäufer nach Titelblatt: Der ohnlängst verstorbne Pierre Laporterie Verkäufer: Laporterie, Pierre Lose mit Gemälden: 137 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Beschreibung der Gemälde-Sammlung von Italienischen, Französischen, Holländischen und Deutschen Meistern, des ohnlängst verstorbnen Herrn Pierre Laporterie, welche am [Auslassung] dieses Jahrs öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden soll durch den Mackler August Wilhelm Matfeld. Hamburg, gedruckt bey Gottlieb Friedrich Schniebes. 1793. Kommentar: Auf dem Titelblatt dieses Hamburger Katalogs findet sich weder ein genaues Datum für den bevorstehenden Verkauf der Gemäldesammlung des Hamburger Maklers Pierre Laporterie (vgl. Kat. 193), noch wird der Leser über die Form der Transaktion informiert. Vermutlich sollte die Sammlung im "Sterbehaus auf dem Drehbahn, Nro 318", wo auch der Katalog zu bekommen war, veräußert werden. In einer dem Katalog vorangestellten "Nachricht" heißt es: "Commissions übernehmen der Mackler: August Wilhelm Matfeld und Herr J. J. Eckhardt." Die 137 zum Verkauf stehenden Gemälde waren "fast alle in goldnen oder schwarzen holländischen Rähmen mit goldenen Leisten" gefaßt. Der Nachricht folgt eine Art Vorwort, das Auskunft über den Besitzer der Sammler gibt. Laporterie wird als Verehrer von Anton Raphael Mengs und als Schüler Winkelmanns beschrieben. Weiter wird darauf hingewiesen, daß Laporterie bereits im Juni 1783 ein Verzeichnis seiner Sammlung in französischer Sprache drucken ließ mit dem Titel: "Description des Tableaux precieux, qui forment la Collection du Sr. Pierre Laporterie. Citoyen de la Republique de Hambourg. a Hambourg, 1783". Dieser 49 Seiten umfassende Katalog verzeichnet lediglich 49 Ge-
232 1793/00/00
Daten unbekannt
Wild; Nürnberg, Im Römischen Kayser untern Hutern Verkäufer nach Titelblatt: Die Wildische Kunsthandlung zu Nürnberg Verkäufer: Wild, Johann Jacob Hermann Lose mit Gemälden: 573 Standorte: SBBa Nicht annotiert. Aus dem Besitz von Joseph Heller. Titelblatt: Verzeichniß einer beträchtlichen Sammlung von Gemälden der berühmtesten Niederländischen, Französischen, Italiänischen und Deutschen Meister welche in der Wildischen Kunsthandlung zu Nürnberg im Römischen Kayser untem Hutern zu haben. Gedruckt mit Stiebner'sehen Schriften. 1793. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog wurde der Nachlaß des Nürnberger Kunsthändlers und Sammlers Johann Jacob Hermann Wild (gest. 1792) angeboten, wie in dem zweiseitigen Vorbericht erläutert wird. Wild betrieb eine Gaststube und zeigte gegen einen Gulden Eintritt sein Kunstkabinett. Auf verschiedenen Frankfurter Kunstauktionen läßt sich Wild als Käufer nachweisen, so beispielsweise auf der Auktion von Johann Andreas Nothnagel am 27. September 1779 (Kat. 125) oder bei der Versteigerung der Sammlung von Johann Noe Gogel am 30. September 1782 (Kat. 146). Insgesamt 54 Gemälde erwarb Wild auf der großen Versteigerung der Sammlung von Johann Friedrich von Hagen in Nürnberg (Kat. 164). Auf die kurze Beschreibung der Gemälde folgen die Angabe des Künstlernamens und der Maße. Wahrscheinlich wurden die Bilder mit Rahmen gemessen, da sich einige Bilder, die Wild auf anderen Auktionen kaufte, identifizieren lassen, aber jeweils etwas größere Maße aufweisen. Unter den insgesamt 573 Gemälden überwiegen Werke der flämiKATALOGE
139
sehen und holländischen Schule mit fast 200 Bildem, zu denen auch sieben Arbeiten von Peter Paul Rubens zählen. Gut vertreten ist auch die deutsche Schule, wobei die meisten Bilder von Künstlern aus dem süddeutschen Raum oder von österreichischen Malern stammen. 13 Werke werden dem spätbarocken österreichischen Kirchenmaler Matthias Schiffer zugeschrieben. Relativ gut präsentiert sind mit 39 Werken die italienischen Schulen, darunter sechs Gemälde von Guilio Romano. Anonym bleiben nur 27 Gemälde, jedoch lassen sich noch rund 60 Bilder zählen, deren Künstlernamen oder Monogramme sich nicht identifzieren lassen. Unter den versteigerten Gemälden finden sich zahlreiche Pendants. Lit.: Museum 1787, Heft 6, S. 92; Gürsching 1949, S. 217.
233 1793/01/15
und folgende Tage
[Lugt 4979]
C.C.H. Rost; Leipzig, Im rothen Collegio Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 96 Standorte: *BDu Annotiert mit allen Käufernamen und Preisen. RKDH Nicht annotiert. SBBa Nicht annotiert. Aus dem Besitz von Joseph Heller. VAL Nicht annotiert. Titelblatt: Anzeige einer ansehnlichen Kupferstich-Sammlung alter, neuer und seltener Blätter berühmter Meister, nebst einigen Handzeichnungen, Gemählden, und Kupferstichwerken. Den 15ten Januar 1793. wird der Verkauf davon gehalten, in den gewöhnlichen Vorund Nachmittagsstunden, von dem verpflichteten Universitäts-Proclamator Herrn Weigel, im rothen Collegio zu Leipzig, gegen gleich baare Bezahlung, in Louisd'ors ä 5 Rthlr. oder Sächs. Conv. Gelde. No. XII. Leipzig, gedruckt bey Andreas Ephraim Leberecht Löper.
Verkäufer nach Titelblatt: Der verstorbene Krieges=Rath Herr Spikker Verkäufer: Spicker Lose mit Gemälden: 4 Standorte: SBB Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß der vom verstorbenen Krieges=Rath Herrn Spicker hinterlaßenen, größtentheils aus der Verlaßenschaft des wohlseel. Königl. Etats=Ministre von Fürst Excellence ererbten schätzbaren Bibliothek, juristischen, historischen, philosophischen, mathematischen, physikalischen, medizinischen, philologischen, schönwissenschaftlichen, theologischen, genealogischen und heraldischen Inhalts; imgleichen einer ansehnlichen Samlung von goldenen und silbernen Medaillen, Kupferstichen, Gemählden, Landcharten, Rissen, Zeichnungen und mechanischen Instrumenten, welche den 21sten Januar 1793 und folgende Tage Nachmittgas um 2 Uhr im Hause des Mauermeisters Wend am Kupfergraben durch den Königl. Auctions=Commissarius Prillwitz öffentlich gegen baare Bezahlung in Courant verauktioniret werden soll. Kommentar: In dieser umfangreichen Versteigerung des Nachlasses des Kriegsrats Spicker wurden vor allem Bücher angeboten. In der Abteilung VII. werden im Katalog auch 51 Lose mit Kupferstichen und Gemälden aufgeführt (S. 115 bis 118), wobei es sich wahrscheinlich nur bei vier Losen tatsächlich um Gemälde handelt. Alle Bilder bleiben anonym. Vermutlich dekorierten sowohl die gerahmten Kupferstiche als auch die Gemälde die Bibliothek des Sammlers. 235 1793/04/06 Johann Hinrich Schöen; Hamburg, Börsensaal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 26
Kommentar: Auf der zwölften Auktion der Kunsthandlung Rost wurden erneut in erster Linie Zeichnungen und Kupferstiche verschiedener Einlieferer angeboten. In einer ausführlichen Einleitung rechtfertigt Carl Christian Heinrich Rost sein Engagement als Kunsthändler und Auktionator. Versteigerungen führten seiner Ansicht nach nicht zu Preissteigerungen, sondern würden immer wieder preiswerte Gelegenheiten offerieren und seien deswegen gut geeignet, Kunstinteressierte zum Sammeln anzuregen. Mehrfach beklagt sich Rost, wie mühevoll das Kunsthandelsgeschäft in Leipzig sei. Die 96 Gemälde machten nur einen kleinen Teil der Auktion aus, die insgesamt mehr als 7.000 Nummern umfaßte. Neben holländischen Gemälden des 17. Jahrhunderts finden sich insbesondere zeitgenössische Werke der deutschen Schule, so von Ernst Gottlob, Johann Heiss und Alexander Thiele. Rund die Hälfte der Losnummern war schon in der elften Auktion angeboten worden (Nm. 7001 bis 7049). Einige Bilder wurden sogar schon zum dritten Mal in einer Auktion der Kunsthandlung Rost offeriert, so beispielsweise das Bild Hercules und Omphale (Nr. 7001) von Johann Heiss (Kat. 209, Nr. 1861 und Kat. 222, Nr. 4795). Wahrscheinlich ging dieses Bild erneut zurück, denn die Abkürzung "R" im annotierten Exemplar des Katalogs aus der Kunsthandlung Boerner läßt darauf schließen, daß hier ein Vertreter der Kunsthandlung Rost selbst als Bieter auftrat. Auch die übrigen, in der zwölften Auktion erneut angebotenen Werke waren im annotierten Exemplar der elften Auktion mit einem "R" markiert worden. Vermutlich wurde daher der größte Teil der Gemälde wieder zurückgekauft, denn insgesamt 51 Lose sind in diesem Katalog mit einem "R" handschriftlich markiert. Lit.: Trautscholdt 1957.
Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß einer auserlesenen Sammlung englischer und französischer Kupferstiche, unter Glas, mehrentheils in vergoldeten Rahmen sauber gefaßt, und von berühmten Meistern verfertiget, imgleichen einer kleinen Sammlung Gemählden in Oel= und Wasser= Farben, aus einer Verlassenschaft, welche Sonnabend, den 6 April 1793 auf dem Börsensaal öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden sollen durch den Mackler Johann Hinrich Schöen. Tages vorher, als den 5ten April, sind obige Sachen am Verkaufsorte beliebigst zu besehen. Hamburg, gedruckt bey Gottlieb Friedrich Schniebes. Kommentar: In dem insgesamt 16 Seiten umfassenden Versteigerungskatalog einer Kupferstichsammlung des Hamburger Maklers Johann Hinrich Schoen ist der kleine Bestand der Gemälde auf den Seiten 14 und 15 verzeichnet. Die 26 Gemälde sind nur summarisch, zumeist mit ihren Bildgegenständen aufgeführt. Je ein Gemälde ist den Malern J. Breuningk, Paul Vredeman de Vries und A. Videbant zugeschrieben, die übrigen Bilder sind überwiegend anonym. 236 1793/06/07-1793/06/08
[Lugt 5080]
Bostelmann; Hamburg, Börsen=Saal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 249 Standorte: KH Nicht annotiert.
234 1793/01/21
und folgende Tage
Prillwitz; Berlin, im Hause des Mauermeisters Wend am Kupfergraben 140
KATALOGE
Titelblatt: Verzeichniß einer schönen Gemählde=Sammlung, von Italienischen, Holländischen und Deutschen Meistern, größtenteils in sehr saubem Rähmen, aus einer hiesigen bekannten Verlassen-
Schaft entstehend, welche den 7ten Juny 1793 auf dem Börsen=Saal öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden soll, durch die Mackler: Bostelmann & Pakischefski. Tages vorher können sämmtliche Sachen, an benannten Orte, besehen werden; und Catalogi sind bey obige Mackler für zwey Schillinge, den Armen zum Besten, zu haben. Gedruckt bey Gottlieb Friedrich Schniebes. Kommentar: In diesem Auktionskatalog der Hamburger Makler Michael Bostelmann und Peter Hinrich Packischefsky werden 249 Gemälde in 262 Losen angeboten, die vermutlich größtenteils Bestandteil einer Hamburger Sammlung waren. Aus einer anderen Sammlung stammten vermutlich die Losnummern 162 bis 262, die vorgestellt werden als "Anhang einer schönen Gemählde=Sammlung, welche unter denjenigen, aus einer Verlassenschaft, am 7ten und 8ten Juny auf dem Börsen=Saal mit verkauft werden sollen, durch die Mackler M. Bostelmann & Packischefsky". In einigen Einträgen werden Kupferstiche (Nrn. 113, 260 und 261) und Aquarelle (Nrn. 114, 115, 160, 161, 254 und 257) angeboten. Alle Beschreibungen sind knapp gehalten, aber sehr genau gefaßt: "Seestücke mit großen und kleinen Schiffen und Fischerböthen. Sehr natürlich vorgestellt, von J. Bellevois 1653" (Nr. 3). Die zur Auktion gelangten Gemälde gehörten zum größten Teil der deutschen und holländischen Schule an, gefolgt von einer kleinen Gruppe von Gemälden flämischer und italienischer Künstler. Unter den deutschen Künstlern des 18. Jahrhunderts ist Friedrich Schoenemann im "Anhang" mit einer Gruppe von 15 Bildern vertreten. Erstmals finden sich mit Werken von Lorens Lönsberg auch einige Gemälde eines schwedischen Künstlers verzeichnet.
237 1793/09/18 Johann Hinrich Schöen; Hamburg, Börsensaale Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 166 Standorte: *KH Annotiert in Bleistift mit einigen ganz wenigen Preisen. Titelblatt: Verzeichniß einer auserlesenen und höchstseltenen Gemählden=Sammlung von den vorzüglichsten niederländischen, italienischen und deutschen Meistern mit Zuverläßigkeit angegeben, mehrentheils in säubern ganz vergoldeten Rahmen, welche den Mittewochen den 18ten Sept. 1793 auf dem Börsensaale öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden sollen, durch den Mackler Johann Hinrich Schöen. Tages vorher als am Dienstag den 17ten September sind vorbenannte Gemähide am Verkaufs=Orte beliebigst zu sehen. Hamburg, gedruckt bey Gottl. Friedr. Schniebes. Kommentar: In diesem Hamburger Versteigerungskatalog des Maklers Johann Hinrich Schoen wurde eine Sammlung von 166 Gemälden offeriert. Allen Einträgen vorangestellt sind jeweils der Künstlername, teilweise eine Datierung, die Maße und die Materialangabe. Nach den im Katalog aufgeführten Namen zu urteilen, handelt es sich um eine sehr gut bestückte Sammlung von holländischen, flämischen und deutschen Gemälden. Unter den holländischen Malern sind alle namhaften Künstler von Jan Asselyn bis Thomas Wyck vertreten. Im Gegensatz zur Ankündigung auf dem Titelblatt findet sich nur ein einziges Gemälde der italienischen Schule, eine Kopie nach Piazzetta (Nr. 145), unter den Einträgen verzeichnet. Von den Themen her überwiegen Landschaften und Genrebilder (Jan Steen, Gabriel Metsu). Einen weiteren Schwerpunkt der Sammlung bilden fünf Gemälde von Jan Brueghel d.Ä., Darstellungen von Dörfern und Landstraßen mit Staffage (Nrn. 60 bis 64 und 97). Die einzelnen Gemälde sind sehr sorgfältig beschrieben, so daß eine Identifizierung mit bekannten Kompositionen Breughels nicht ausgeschlossen ist. Auch die übrigen Gemälde sind bis zur Losnummer 97 ausführlich erfaßt, danach werden die Bilder nur noch summarisch aufge-
führt. Im Exemplar KH finden sich vereinzelt handschriftliche Eintragungen der Preise.
238 1793/09/30
und folgende Tage
[Lugt 5109]
Jean Frederic Frauenholz; Nürnberg Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 1 Standorte: BMPL Annotiert mit allen Preisen bis auf das eine Gemälde am Ende des Katalogs. EBNP Annotiert mit allen Preisen bis auf das eine Gemälde am Ende des Katalogs. RKDH Annotiert mit allen Preisen bis auf das eine Gemälde am Ende des Katalogs. SBBa Annotiert mit allen Preisen bis auf das eine Gemälde am Ende des Katalogs. Aus dem Besitz von Joseph Heller. SIF Annotiert in Bleistift mit Preisen bis auf das eine Gemälde am Ende des Katalogs. ESP Nicht eingesehen, aber vermutlich annotiert mit Preisen. BL Heutiger Aufbewahrungsort unbekannt. Vielleicht bei BDu; dort aber nicht aufzufinden. Nach Lugt annotiert mit Preisen. HKB Nicht annotiert. Titelblatt: Catalogue d'un cabinet tres considererable en estampes et desseins de toutes les ecoles en livres d'estampes, et de l'art, dont la vente publique se fera au plus offrant et ä deniers comptans vers la fin mois de Septembre et les jours suivans ä 300 Nro. par jour dans cette annee 1793. au Magasin des arts de Jean Frederic Frauenholz. No. IV. Nuremberg 1793. Verzeichnis einer beträchtlichen Kupferstichsammlung, alter und neuer groestentheils seltener Blaetter aus allen Schulen, nebst Handzeichnungen, Kupferstich-Werken und Kunstsachen, welche den 30. September 1793 und den folgenden Tagen in der Frauenholzischen Behausung in den Nachmittags-Stunden oeffentlich gegen baare Bezahlung in Conventionsgelde sollen versteigert werden. Nro. IV. Nürnberg 1793 (Preis 8 ggl. oder 36 kr.). Kommentar: Bei dieser Versteigerung handelt es sich um die vierte Auktion des Nürnberger Kunsthändlers Johann Friedrich Frauenholz. Seit dem 21. März 1791 führte Frauenholz in jährlichem Rhythmus Versteigerungen durch und knüpfte damit an die Tradition von Carl Christian Heinrich Rost in Leipzig an. Ähnlich wie Rost konzentrierte sich Frauenholz ganz auf den Verkauf graphischer Kunst. In seinem vierten Katalog, der für 36 Kreuzer zu haben war, wurden fast ausschließlich graphische Arbeiten und Bücher angeboten und zwar in zwei Teilen. Dem Katalog sind ein französisches und ein deutsches Titelblatt sowie eine kurze französische und eine ausführliche deutsche Einleitung vorangestellt. Der erste Teil ist in französischer Sprache abgefaßt und umfaßt 410 Seiten mit 5.357 Nummern. Der zweite ist Teil ist auf Deutsch erschienen und verzeichnet auf 84 Seiten ebenfalls nahezu ausschließlich graphische Arbeiten (1.208 Nummern) sowie eine Gemmensammlung. Außerdem wird als letztes Objekt unter der Rubrik "Gemähide" ein Altar von Nicolaus Alexander Mair von Landshut angeboten (Nr. 1), der ausführlich beschrieben wird. Auch in den annotierten Exemplaren des Katalogs findet sich jedoch kein Hinweis auf den Verkauf dieses Altars. Lit.: Gürsching 1949, S. 217-220; Luther 1988.
239 1794/00/00
Daten unbekannt
[Anonym]; Freiburg, Haus des Sammlers Verkäufer nach Titelblatt: Aus der gräflich Heinrich von Kageneckischen Verlassenschaft Verkäufer: Kageneck, Heinrich Hermann Euseb, Graf von KATALOGE
141
Lose mit Gemälden: 174 Standorte: *SBBa Annotiert mit fast allen Preisen. Aus dem Besitz von Joseph Heller. Titelblatt: Verzeichniß von Gemälden der berühmtesten niederländischen, französischen und deutschen Meister, welche aus der gräflich Heinrich von Kageneckischen Verlassenschaft in Freyburg gegen baare Bezahlung zu verkaufen sind. Freyburg, gedruckt mit Satron'schen Schriften, 1794. Kommentar: Es handelt sich im strengen Sinne um keinen Auktions-, sondern um einen Verkaufskatalog der Sammlung Heinrich Hermann Euseb Graf von Kageneck (1738-1790). Kageneck arbeitete als Jurist und Regierungsrat in vorderösterreichischen Diensten in Freiburg im Breisgau. Im Vorwort dieses Katalogs der Sammlung Heinrich von Kageneck (S. 3 bis 4, nicht paginiert) wird daraufhingewiesen, daß die zum Verkauf angebotenen Gemälde "in dem gräfl. von Kageneckischen Hause, wo sie aufgestellt sind" zu besehen waren. Das Kageneckische Haus befand sich in der Salzstraße 5 in Freiburg. Wegen finanzieller Schwierigkeiten war die Witwe des Sammlers gezwungen, die Gemäldesammlung nach dem Tod Kagenecks zu veräußern. Alle Gemälde waren "mit zierlichen goldnen Rahmen versehen". Interessenten wurden aufgefordert, sich wegen der Preise "an das gräfl. Heinrich von Kageneckische Amt in Freyburg" zu wenden. Die Gemälde sind in drei Gruppen aufgeführt, wobei die Numerierung jedesmal von neuem ansetzt, jedoch nicht vollständig ist: Nm. 1 bis 72; Nrn. 3 bis 12; Nrn. 3 bis 238. Vermutlich waren die Gemälde in drei verschiedenen Räumen aufgestellt. Die Einträge enthalten eine knappe Beschreibung der Gemälde mit Angaben der Künstlernamen oder Monogramme, der Maße sowie des Materials. Einige Pastellarbeiten wurden ebenfalls angeboten (Nrn. 214, 216 und 224); die Nr. 215 ist auf Seide gemalt, bei den Nummern 228 und 236 bis 238 handelt es sich um Miniaturen. Insgesamt wurden 174 Gemälde zum Verkauf angeboten. Auf der Innenseite des Einbands befindet sich eine handschriftliche Liste mit Künstlernamen. Vermutlich hat der Besitzer des Katalogs die von ihm ausgewählten Gemälde mit den entsprechenden Katalognummern verzeichnet. Unter den insgesamt 177 Gemälden zählen die meisten Werke zur deutschen Schule, darunter vier Bilder von Johann Heiss, die gleich am Anfang der ersten Folge aufgeführt wurden. Häufig vertreten sind vor allem die süddeutschen Künstler Johann Sigmund Keller und Josef Marcus Hermann. Auch die holländische und flämische Schule ist mit zahlreichen Werken präsent. Anonym bleibt nur ein Werk, allerdings lassen sich einige Monogrammisten nicht entschlüsseln. Nach den Angaben des annotierten Exemplars SBBa bewegten sich die Preise auf relativ hohem Niveau, meist zwischen 10 und 50 Gulden je Gemälde.
240 1794/00/00
Daten unbekannt
[Anonym]; Hamburg, Eimbeckisches Hause Verkäufer nach Titelblatt: Herr Leoneiii Verkäufer: Leonelli, Niccolö Lose mit Gemälden: 157 Standorte: ICH Nicht annotiert. Titelblatt: Katalogus der Gemähldesammlung des Herrn Leonelli die auf dem Eimbeckischen Hause ausgestellt ist. Hamburg, 1794. Kommentar: Bei diesem Katalog handelt es sich vermutlich um einen Verkaufskatalog des venezianischen Kunsthändlers Niccolö Leonelli (gest. 1816), dessen Lagerbestand am 4. Mai 1817 in St. Petersburg versteigert wurde. Im Vorwort des Katalogs von 1817 wird Leonelli als Kunsthändler beschrieben, der aus Holland, Eng142
KATALOGE
land, Frankreich und Italien Gemälde nach Rußland transferiert hatte. In dem Vorwort des Hamburger Katalogs, der insgesamt 157 Einträge umfaßt, heißt es: "Eine hochtönende Beschreibung von Werken großer Meister zu verfertigen ist bekanntlich sehr leicht. Diese Werke beysammen zu haben ist wesentlicher, und nicht so leicht geschehen." Über den Eigentümer selbst werden keine Angaben gemacht, auch der genaue Zeitpunkt des Verkaufs bleibt unklar. Leonelli hatte aber nachweislich kurz zuvor auf Auktionen in Amsterdam einige der in Hamburg zum Verkauf stehenden Bilder erworben. Zu den kurz zuvor in Amsterdam gekauften Bildern zählt beispielsweise ein Nachtstück von Jacob van Ruisdael, das auf einer Versteigerung am 13. Juli 1790 (Lugt 4619, Nr. Β 94) erworben wurde. Zwei andere Bilder des Hamburger Verkaufs wurden erst am 9. Juli 1794 in Amsterdam angekauft, was darauf hinweist, daß der Hamburger Verkauf erst nach diesem Zeitpunkt, also gegen Ende des Jahres 1794 stattgefunden haben kann. Die Beschreibungen zu den einzelnen Gemälden sind zum Teil sehr ausführlich. Vorangestellt ist jeweils der Künstlername sowie die Maßangaben, dagegen fehlen die Angaben zum Material. In der Sammlung finden sich überwiegend Werke der holländischen Schule. Die Taufe des Kämmerers von Rembrandt (Nr. 1) wurde bereits am 21. Oktober 1791 in Hamburg versteigert (Kat. 220) und wahrscheinlich von Leonelli erworben. Es dominieren Landschaften von Jan van Goyen, Meindert Hobbema, Klaes Molenaer, Aert van der Neer oder Jacob van Ruisdael sowie die "Italianisanten" Jan Asselyn, Nicolaes Berchem, Jan Both, Karel DuJardin, de Heusch oder Moucheron. Unter den flämischen Malern sind Pieter van Bioemen, Cornells Huysmans und David Teniers mit mehreren Werken vertreten; auch elf Gemälde des Antwerpener Malers Peter van Regemorter werden angeführt. Eine kleine Gruppe von Bildern der italienischen Schule beschließt die Sammlung. Inwiefern tatsächlich Bilder dieser Sammlung in Hamburg verkauft worden sind, ist nicht bekannt.
241 1794/01/20-1794/02/04
[Lugt 5150]
C.C.H. Rost; Leipzig, Im rothen Collegio Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 16 Standorte: *BDu Annotiert mit allen Käufernamen und Preisen. HKB Nicht annotiert. RKDH Nicht annotiert. Das Titelblatt und die Seiten 501 und 502 fehlen. Titelblatt: Anzeige einer ansehnlichen Kupferstichsammlung alter, neuer und seltener Blätter berühmter Meister, nebst einigen Handzeichungen, Gemählden, und Kupferstichwerken. Den 20sten Januar 1794. wird der Verkauf davon abgehalten, in den gewöhnlichen Vor- und Nachmittagsstunden, von dem verpflichteten UniversitätsProclamator Herrn Weigel, im rothen Collegio zu Leipzig, gegen gleich baare Bezahlung, in Louisd'ors ä 5 Rthlr. oder Sächs. Conv. Gelde, No. XIII. Leipzig, gedruckt bey Andreas Ephraim Leberecht Löper. Kommentar: Im 13. Versteigerungskatalog der Kunsthandlung Rost wurden emeut überwiegend graphische Arbeiten und einige Bücher angeboten (Nrn. 1 bis 5854). Im letzten Teil des Katalogs sind insgesamt 16 Ölgemälde verzeichnet (Nrn. 5855 bis 5870). Nummern als Zwischenüberschriften verweisen vermutlich auf die verschiedenen Einlieferer. Unter den Gemälden finden sich zwei Arbeiten von Christian Wilhelm Emst Dietrich, von denen das eine für 9, das andere für 16 Groschen verkauft wurde. Die Mehrzahl der Bilder ist der deutschen Schule zuzurechnen, die übrigen Bilder gehören der flämischen und der holländische Schule an. Alle Gemälde wurden zu niedrigen Preisen zugeschlagen, meistens zu weniger als einem Taler. Es ist anzunehmen, daß insgesamt sieben Losnummern an ei-
nen Vertreter der Rostschen Kunsthandlung zurückgingen, da sie im annotierten Exemplar des Katalogs mit einem "R" markiert sind. Lit.: Trautscholdt 1957.
242 1794/02/21-1794/02/22
[Lugt 5160]
Henningk; Hamburg, Börsen=Saale Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 173 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Beschreibung einer schönen Gemählde=Sammlung, worunter viele ganz vorzügliche Stücke, welche von den berühmtesten Meistern verfertiget worden; und eine beträgliche Anzahl englischer, französischer, italiänischer, holländischer und teutscher Kupferstiche, alle unter Glas und in Rahmen gefaßt, soll den 21 und 22sten Febr. d. J. als am Freytage und Sonnabend, auf dem hiesigen Börsen=Saale öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden durch die Makler Henningk & Packischefsky, bey welchen diese Beschreibung, wie auch hinter der großen St. Michaelis Kirche, in No. 33, für 2 sch., den Armen zum Besten, zu haben ist. Am Donnerstage, als den 20 Februar, sind obbenannte Gemähide und Kupferstiche am Verkaufs=Ort beliebigst in Augenschein zu nehmen. Hamburg, 1794. Kommentar: In dieser Versteigerung der Hamburger Makler Henningk und Packischefsky gelangte eine Sammlung mit 173 Gemälden zum Verkauf. In einem "Anhang verschiedener Original=Gemählde" sind weitere 17 Werke mit eigener Zählung (A bis R) aufgeführt. Desweiteren wird eine Kupferstichsammlung zum Verkauf angeboten. Im Gegensatz zu den nur summarisch aufgelisteten Gemälden im Anhang sind die Beschreibungen im ersten Teil des Katalogs sehr ausführlich. Bis zur Losnummer 43, einem Bildnis von Frans Pourbus, sind jedem Eintrag Angaben zur Biographie der Künstler beigefügt. Von den Künstlernamen her zu schließen handelt es sich um eine sehr gut bestückte Sammlung. Bei einem Gerrit van Honthorst zugeschriebenen Gemälde eines Musikanten mit einer Violine unter dem linken Arm (Nr. 40) handelt es sich vermutlich um eine der vielen Wiederholungen oder Kopien von Honthorsts Gemälde in der Thyssen-Sammlung (J. Richard Judson, Rudolf E. O. Ekkart, Gerrit van Honthorst, Doornspijk 1999, S. 191f., Nr. 242). Insgesamt überwiegen die Werke der holländischen und flämischen Schule. Gut vertreten ist auch die deutsche Schule, vor allem mit Gemälden Hamburger Künstler. Hinzu kommen einige Arbeiten der französischen und italienischen Schule. Keinem Künstler zugeschrieben werden 31 Gemälde.
243 1794/09/00
Daten unbekannt
[Anonym]; Ludwigsburg, Württemberg Verkäufer nach Titelblatt: Keine Verkäufer nach anderer Quelle: [Friedrich Karl Ludwig Freiherr von Moser] Verkäufer: Moser, Friedrich Karl Ludwig, Freiherr von Lose mit Gemälden: 66
Heilbronner Kunstverleger Friedrich Karl Lang (vgl. Kat. 255) angekauft wurde und Moser als Vorbesitzer in der Literatur erwähnt wird. Moser stand viele Jahre in Diensten des Landgrafen von Hessen-Darmstadt und war 1772-1780 als Kanzler und Minister unter dem Landgrafen Ludwig IX. tätig. Im Auftrage seines Dienstherrn handelte Moser mit Frankfurter Banken einen Schuldenvergleich aus und bewahrte den hessisch-darmstädtischen Staat vor dem Bankrott. Nach einem Zerwürfnis mit dem Darmstädter Hof wurde Moser 1782 des Landes verwiesen. Aus diesem Grunde veräußerte er auch seine umfangreiche Gemäldesammlung (vgl. Kat. 135). Nach seiner Rehabilitierung 1790 ließ sich Moser im württembergischen Ludwigsburg nieder, wo dann auch 1794 seine zweite, mit 66 Gemälden bescheidenere Sammlung veräußert wurde. In einer Vorbemerkung wird darauf hingewiesen, daß der Besitzer die Sammlung in mehr als 30 Jahren zusammengetragen habe. Vermutlich stammten einige Werke noch aus der ersten Kollektion Mosers. In der Einleitung wird die Möglichkeit angedeutet, daß ein Interessent auch die komplette Sammlung kaufen könnte. Vermutlich hat Karl Friedrich Lang noch vor der Versteigerung die gesamte Sammlung übernommen. Die Beschreibungen der 66 Losnummern sind nicht sehr ausführlich, unter einigen Losen sind auch mehrere Bilder aufgeführt. Meist wird nur der Bildgegenstand beschrieben und der Künstlername genannt sowie das Material und die Maße angegeben. Bei einzelnen Gemälden, beispielsweise bei Ulicia mit dem Sieb von einem italienischen Meister (Nr. 37), wird angeführt, daß es sich um eine Kopie eines nicht weiter bestimmten Bildes in Rom handelte. Jede Losnummer ist mit einem festen Preis versehen. Im Vorwort wird das Verfahren in acht Einzelpunkten erläutert. Man sei interessiert, einen "Liebhaber" zu finden, dem die Sammlung hinsichtlich des Preises "mit höchster Billigkeit" überlassen werden soll. Interessenten wird eine Frist bis zum Ende des Jahres 1794 eingeräumt. Ansonsten gedenkt man, die Sammlung "zu einzelnen Stüken" zu verkaufen, wobei derjenige den Zuschlag erhalten sollte, der sein Kaufgebot zuerst einreicht. Die im Katalog gedruckten Preise gelten als Festpreise; sie variieren von 15 bis 4.000 Rheinischen Gulden. Rubens' Die Frauen am Grabe Christi (Nr. 1) ist mit 4.000 Gulden am höchsten eingeschätzt. Heute befindet sich dieses Bild im Norton Simon Museum in Pasadena (Inv.-Nr. F.1972.51.P). Die Gemälde sind nach Angaben des Verfassers "von drei berühmten Künstlern gemeinschaftlich besehen, untersucht und resp. geschätzt worden". Auch hafte "man mit Ehre und Treue vor die Originalität und Wahrheit der benannten Meister". Ob zu den drei Gutachtern auch die nachstehend im Zusammenhang der Versendung der Gemälde genannten "Herr Professor und Hofbildhauer Scheffauer (Stuttgart) und Herr Hof= und Theatral=Mahler Holzhey (Ludwigsburg)" zählten, bleibt unklar. Bei den Gemälden überwiegen Arbeiten deutscher und niederländischer Künstler des 17. bis 18. Jahrhunderts. Bei den deutschen Werken liegt der Schwerpunkt bei Künstlern des 18. Jahrhunderts. Lit.: ADB 22 (1885), S. 576-783; NDB 18 (1997), S. 178-181; Gustav Lang, Friedrich Karl Lang. Leben und Lebenswerk eines Epigonen der Aufklärungszeit (Darstellungen aus der württembergischen Geschichte, Bd. 5), Stuttgart 1911; Walter Gunzert, Zwischen Spätabsolutismus und Bürgerzeit, Jugend und Frankfurter Jahre von Friedrich Carl von Moser, in: Frankfurt, lebendige Stadt. Vierteljahreshefte für Kultur, Wirtschaft und Verkehr 1 (1961), S. 44-49, 60.
Standorte: *HAMW Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichnis einer auserlesenen Sammlung verkäuflicher Original=Gemählde von berühmten Meistern. Nebst beigesetzten Preisen. Ludwigsburg im Wirtembergischen, im Monat September 1794. Kommentar: In diesem Katalog wurde die Sammlung von Friedrich Karl Ludwig Freiherr von Moser (1723-1798) angeboten. Der Besitzer läßt sich identifizieren, da die komplette Sammlung von dem
244 1794/09/06 Bostelmann; Hamburg, Börsen=Saal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 180 Standorte: ICH Nicht annotiert. KATALOGE
143
Titelblatt: Verzeichnis einer Sammlung schöner Gemählden, von den berühmtesten Meistern; ferner: eine Anzahl schön gemahlter ausländischen Vögel; desgleichen ein Englischer Telescop mit Kästgen; welches zusammen den 6ten Sept. 1794. öffentlich an den Meistbietenden auf dem hiesigen Börsen=Saal verkauft werden soll, durch die Mäckler Bostelmann & Packischefsky. Am Tage vor dem Verkauf können diese Gemähide, an dem benannten Orte, in Augenschein genommen werden, und sind die gedruckten Catalogi, bey vorbesagte Mackler, für 2 sch. den Armen zum Besten, zu haben. Hamburg, 1794. Kommentar: In diesem Katalog der Hamburger Makler Peter Hinrich Packischefsky und Michael Bostelmann sind auf 16 Seiten 181 Lose verzeichnet, von denen die Losnummern 1 bis 180 die Gemälde betreffen. Die Nummer 181 führt das auf dem Titelblatt erwähnte Teleskop an. Unter den Nummern 161 bis 180 wird eine Sammlung von "schön gemaltefn] ausländische[n] Vögel[n]" angeführt. Obwohl die Gemälde "von den berühmtesten Meistern" stammen sollen, sind nur die wenigsten von ihnen einem holländischen oder deutschen Künstler zugeschrieben, der überwiegende Teil bleibt anonym. Die Beschreibungen sind sehr knapp gehalten und kommen ohne Angabe der Maße und des Materials aus.
245 1794/09/09 Packischefsky; Hamburg, Börsensaale Verkäufer nach Titelblatt: Aus Braband Lose mit Gemälden: 188 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß einer aus Braband eingesandte höchstseltene Gemählden=Sammlung von den besten italienischen, niederländischen und französischen Meistern, mehrentheils in Glanzgoldenen oder vergoldeten Rähmen sauber gefaßt, welche Dienstag, den 9ten September 1794 auf dem Börsensaale öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden sollen, durch die Mackler Packischefsky und Schöen. Tages vorher als am Montag den 8ten September sind die Gemälde am Verkauf=Orte beliebigst zu besehen. Hamburg, gedruckt bey Gottl. Friedr. Schniebes. Kommentar: Auf dem Titelblatt dieses Katalogs der Hamburger Makler Peter Hinrich Packischefsky und Johann Hinrich Schoen wird darüber informiert, daß es sich um eine "aus Braband eingesandte höchstseltene" Gemäldesammlung handelt. Die Beschreibungen sind zumeist recht knapp gehalten. Vorangestellt sind der Künstlername oder das Monogramm (ggf. mit Datierung) sowie die Maße, am Ende steht jeweils die Materialangabe. Die Gemälde der flämischen Schule machen den größten Anteil der insgesamt 188 aufgeführten Bilder aus. Im Gegensatz zu anderen in Hamburg versteigerten Sammlungen bleibt der Anteil der deutschen Bilder marginal. Neben den Gemälden wurden auch zwei Reliefs angeboten (Nrn. 106 und 114). Unter den Bildern finden sich Werke von namhaften Künstlern wie Jan Brueghel d.Ä., Anthonie van Dyck, Alexander Keirincx oder Peter Paul Rubens. Zugleich sind auffallend viele Gemälde als Kopien vermerkt. Im Unterschied zu der kleinen Gruppe der Gemälde der holländischen Schule (darunter drei Werke von Roelandt Savery), sind die der italienischen überwiegend ohne Angabe eines Namens verzeichnet. Insgesamt 20 Gemälde bleiben ohne jede Angabe zur Autorschaft. Eine Landschaft mit Jakob und Rebecca [i.e. Rahel] beim Brunnen von Claude Lorrain (Nr. 137) ist ebenfalls aufgeführt.
246 1794/09/10
und folgende Tage
KATALOGE
Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Catalogue einer vortreflichen Sammlung von Gallery= und Cabinet=Gemählden, die im südlichen Theil Europa schon im sechszehnthunderten Seculi meistens zusammengebracht worden. Die allermehrsten bestehen aus der ersten Classe der Italienischen Schule, als Römischen, Florentinischen und Venetianischen, auch einiger Französischen, Brabandischen, Niederländischen und Deutschen Künstlern; darunter befindet sich eine seltene Collection von mehr denn vierhundert kleinen, besonders schöne Stücke, welche meistens Portraits großer Herren vorstellen; größtentheils sind selbige in Oel=Farbe, und die übrigen in Mignatur, wie auch etliche emaillirt. Alle diese vorbenannte Gallery=Cabinet=Mignatur= und Emaille=Gemählde sollen am Mittwochen den 10 September d.J. und folgende Tage, des Vormittags von 10 bis 1 Uhr, öffentlich an den Meistbietenden auf dem Eimbeckischen Hause in dem Zimmer No.l verkauft werden durch die Mackler Goverts & Packischefsky. NB. Catalogi sind beliebigst für 4 sch. den Armen zum Besten bey benannten Maklern und bey der großen St. Michaelis Kirche auf dem Kreyenkamp in No. 33 abzufordern. Hamburg, 1794. Kommentar: Die Auktion fand über mehrere Tage verteilt im Eimbeckschen Haus statt, vermutlich weil am selben Tag der Börsensaal bereits durch eine weitere Auktion belegt war (vgl. Kat. 245). In einer ersten Liste werden insgesamt 159 Lose aufgeführt (S. 3 bis 16). Eine zweite Liste, die wieder mit der Nr. 1 beginnt, verzeichnet auf den Seiten 16 bis 24 die kleineren Kabinettgemälde und die Portraits (Nm. 1 bis 278), die Miniaturen und die "Wasser=Farben Gemählde" (Nm. 279 bis 414) sowie einige Emaillearbeiten (Nrn. 415 bis 426). Die Angaben zu den Galeriegemälden im ersten Teil sind etwas ausführlicher als die zu den Kabinettbildern, Maße und Material sind jedoch durchgängig angegeben. Im ersten Teil des Katalogs wird u.a. eine größere Gruppe von Gemälden der italienischen Schule verzeichnet, darunter vier religiöse Historien von Correggio (Johannes der Täufer in der Wüste; Nr. 10; Die Findung Moses; Nr. 32; Moses schlägt Wasser aus dem Felsen; Nr. 33; Flucht nach Ägypten; Nr. 36). Darüber hinaus werden Werke von Jacopo Bassano, Palma Vecchio, Tizian und Jacopo Tintoretto sowie von Jacopo Amigoni, Guercino, Pietro da Cortona und Sebastiano Ricci angeführt. Unter den Bildern der deutschen Schule fallen fünf Gemälde von Christoph Schwartz - im Katalog als "deutscher Raphael" betitelt - heraus, darunter vier Darstellungen aus dem Leben Christi (Nrn. 101 bis 104). Der überwiegende Teil der Gemälde im zweiten Teil des Katalogs ist ohne Angabe eines Künstlernamen verzeichnet. Unter den namentlich aufgeführten Werken befinden sich mehrere Bilder von Stefano della Bella, Bibiena und vier nicht weiter beschriebene mythologische Darstellungen von Johann Heinrich Schönfeld sowie knapp 20 Gemälde von Brand. Das prominenteste Bild der französischen Schule ist ein Selbstbildnis von Nicolas Poussin (Nr. 9) aus dem Jahre 1649, das sich heute in der Berliner Gemäldegalerie (Kat.-Nr. 1488) befindet. Es wurde für Jean Pointel gemalt, gelangte dann in die Sammlung Jacques Ceresier und wurde vermutlich anschließend nach Italien verkauft. Über die genaue Herkunft der Sammlung - die mit großer Wahrscheinlichkeit aus Italien stammt liegen keine weiteren Dokumente vor. Schon im Titel des Katalogs findet sich jedoch der Hinweis auf das südliche Europa. Für Neapel spricht eine Gruppe von 12 neapolitanischen Land= und Seeprospekten von Charles Leopold van Grevenbroeck, gen. Oratio Grevenbroeck, der sich laut Mariette gegen Ende seines Lebens in Neapel aufgehalten haben soll; aber auch Venedig oder Mailand sind nicht ausgeschlossen.
[Lugt 5238]
Goverts; Hamburg, Auf dem Eimbeckischen Hause, in dem Zimmer No. 1 144
Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 437
247 1795/01/21
und folgende Tage
[Lugt 5272]
C.C.H. Rost; Leipzig, Im rothen Collegio
Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 1 Standorte: *BDu Annotiert mit allen Käufernamen und Preisen. RKDH Nicht annotiert. Das Titelblatt fehlt. VAL Nicht annotiert. Titelblatt: Anzeige einer ansehnlichen Kupferstich-Sammlung alter, neuer und seltener Blätter berühmter Meister nebst einigen Handzeichnungen, Kunstbüchern, und Kupferstichwerken. Den 21sten Januar 1795 wird der Verkauf davon gehalten, in den gewöhnlichen Vor- und Nachmittagsstunden, von dem verpflichteten UniversitätsProclamator Herrn Weigel, im rothen Collegio zu Leipzig, gegen gleich baare Bezahlung, in Louisd'ors ä 5 Rthlr. oder Sächs. Conv. Gelde. No. XIV. Leipzig, gedruckt bey I. G. H. Richter. Kommentar: In der 14. Versteigerung der Kunsthandlung Rost wurden fast ausschließlich graphische Arbeiten und Kunstbücher verschiedener Einlieferer (Nrn. 1 bis 5945) sowie Kunstbücher und Kupferstichwerke angeboten. Wie die anderen Kataloge des Kunsthändlers Carl Christian Heinrich Rost (1741-1798) ist auch dieser sorgfältig zusammengestellt und sowohl mit einer Einführung als auch einem Literaturverzeichnis ausgestattet. Die Kupferstiche werden nach Einlieferern gruppiert, die allerdings nur durch Nummern kenntlich gemacht werden. Die einzelnen Konvolute sind jeweils alphabetisch sortiert. Der Katalog enthält nur zwei Gemälde von Egbert van Heemskerck (Nr. 5946), die zusammen für 16 Groschen vermutlich an einen Vertreter der Kunsthandlung Rost zurückgingen, da im annotierten Exemplar des Katalogs aus der Kunsthandlung Boerner der Käufer mit dem Kürzel "R" bezeichnet wird. Diese Abkürzung verweist in anderen Versteigerungen auf den Kunsthändler Rost. Lit.: Trautscholdt 1957.
248 1795/03/12-1795/03/13 G.J. Schmidt; Hamburg, Börsen=Saale Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 225 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß einer schönen Gemählde=Sammlung von Italienischen, Holländischen und Deutschen Meistern; wie auch schwarze, und auf Glas gezogene colorirte englische eingefaßte Kupferstiche, welche den 12ten und 13ten März, 1795, auf dem Börsen=Saale öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden sollen, durch die Mackler G. J. Schmidt, Bostelmann & Packischefsky. Tages vorher können sämmtliche Sachen am benannten Orte besehen werden; und Catalogi sind bey obigen Macklern für 2 Schillinge, den Armen zum Besten, zu haben. Hamburg, 1795. Kommentar: Bei dieser Hamburger Auktion der Makler Michael Bostelmann, Peter Hinrich Packischefsky und G. J. Schmidt wurden insgesamt 248 Gemälde angeboten. Die Beschreibungen der Gemälde sind unterschiedlich ausführlich. Ab Nr. 165 wird auf die Angabe des Materials verzichtet, ab Nr. 180 auch auf die Maße, die sonst zusammen mit dem Künstlernamen oder dem Künstlermonogramm (ggf. mit Datierung) den Beschreibungen vorangestellt sind. Zur Versteigerung gelangte eine umfangreiche, insgesamt 225 Gemälde umfassende Sammlung von holländischen, deutschen und einer kleineren Gruppen von flämischen sowie italienischen Gemälden. Die französische Schule ist durch zwei Werke von Nicolas Poussin (Nrn. 34 und 35) und vier Bilder von Jean Baptiste Monnoyer (Nrn. 123 bis 126) vertreten. Anonym bleiben 31 Bilder, mehrere Gemälde werden nicht zu identifizierenden Monogrammisten zugeschrieben. Die Gemälde werden auf den Seiten 3 bis 33 verzeich-
net, die Nr. 289 ist eine Seidenstickerei, die Nrn. 133 bis 135 beziehen sich auf Zeichnungen und Bücher. Außerdem wird eine Sammlung von 200 Originalzeichnungen von Joachim von Sandrart angeboten, die als Vorlagen für die Stichserie Das neue Testament gedient haben. Die im Titel angekündigten Kupferstiche werden auf den Seiten 34 bis 46 aufgeführt.
249 1795/05/27
und folgende Tage
[Anonym]; Wolfenbüttel, Haus des Sammlers, in dem auf dem kleinen Zimmerhofe sub Nro. 68 belegenen Hause Verkäufer nach Titelblatt: Keine Verkäufer nach Exemplar des Auktionators: Johann Heinrich Fricke Verkäufer: Fricke, Johann Heinrich Lose mit Gemälden: 19 Standorte: *NSAW Eingebunden in ein handschriftliches Auktionsprotokoll mit allen Käufernamen und Preisen. Titelblatt: Verzeichniß von Gold, Silber, Zinn, Kupfer, Messing, Eisen, Blech, Porcellain, Steingut, Spiegeln, Glas, Tischen Stühlen, Schränken, Commoden, Kleidungstücken, Linnen, Drell, Betten, Bettstellen, Gemälden, Kupferstichen und Variis, welche den 27 [handschriftlich eingefügt] May u. f. T. Nachmittags von 2-5 Uhr auf dem kleinen Zimmerhofe sub Nro. 68. belegenen Hause meistbietend verkauft werden sollen. Wolfenbüttel, 1795. Kommentar: In dieser Versteigerung wurde nach den Angaben des Verkaufsprotokolls der Hausstand des Grenzrats Johann Heinrich Fricke (gest. am 27. Februar 1795) verauktioniert. Der Katalog umfaßt insgesamt 30 Seiten. Unter der Rubrik "Gemälde und Kupferstiche" (S. 19f.) werden 30 Lose aufgeführt, von denen sich 19 als Gemälde identifizieren lassen. Alle Werke bleiben anonym, es überwiegen Arbeiten mit Portraitdarstellungen von Mitgliedern des braunschweigisch-wolfenbütteler Hofes sowie Landschaftsbilder. Nach den Angaben des annotierten und in eine Akte eingebundenen Exemplars NSAW (Signatur 34 N, Nr. 3092) blieben die Preise sehr niedrig, kein Gemälde erreichte den Preis von einem Reichstaler. Meist lag das erzielte Ergebnis bei ungefähr einem Silbergroschen. Unter den Käufern befanden sich aller Wahrscheinlichkeit nach nur Bürger Wolfenbüttels, darunter die Namen Lippel, Schröder, Sattler und Wasmus.
250 1795/07/24 [Anonym]; Bei Anklam (Mecklenburg-Vorpommern), Schloß Schwerinsburg Verkäufer nach Titelblatt: Graf von Schwerin Verkäufer: Schwerin, Graf von Lose mit Gemälden: 142 Standorte: *KH Katalog mit gedruckten Schätzpreisen. Titelblatt: Gemählde=Verkauf. Folgende zu dem Nachlaß des verstorbenen Herrn General=Landschafts=Raths Grafen von Schwerin gehörige sehr schöne Gemählde-Sammlung soll am 24 ten Juli d. J. 1795 [das Datum ist handschriftlich ergänzt, wohl später wurde hinzugefügt "Schwerinsburg"] hieselbst einzeln öffentlich an den Meistbietenden gegen baare Bezahlung in Preuß. Courant verkauft werden. Kommentar: Dieser Versteigerungskatalog besteht aus einem dreiseitigen Handzettel. Ein handschriftlicher Hinweis auf dem Exemplar KH verweist auf das Schloß Schwerinsburg bei Anklam in Mecklenburg-Vorpommern, das sich im Besitz der Grafen von Schwerin befand. Die Sammlung wurde vermutlich von Kurt Christoph Graf von Schwerin (1684-1757) aufgebaut, der in preußischen KATALOGE
145
Diensten stand und das barocke Landschloß in Schwerinsburg errichten ließ (1945 abgebrannt). Nach seinem Tode wurde der Besitz von einem anderen Zweig der Familie übernommen, der vermutlich den Gemäldebestand veräußerte, um die Räumlichkeiten neu ausstatten zu können. Die Verkaufsliste ist im Vergleich zu den Versteigerungskatalogen der städtischen, bürgerlichen Sammlungen sehr einfach gehalten. Kein einziges Bild wird einem Künstler zugeschrieben, oftmals werden Portraits nur summarisch aufgeführt. Bei einem großen Teil der Bilder handelt es sich um Familienportraits oder Portraits von Potentaten und adeligen Herren. Insgesamt vermittelt dieser Katalog ein gutes Bild einer umfangreichen, aber in ihrer Qualität beschränkten Sammlung eines nordostdeutschen Herrenhauses. Gemälde wurden hier in erster Linie als historische Erinnerungen oder als Dekorationsstücke verstanden.
Hamburger Nachlaß verauktioniert. Der Name des Besitzers wird jedoch nicht mitgeteilt. Zum Verkauf kamen 75 Gemälde und eine Kupferstichsammlung, die im zweiten Teil des Katalogs auf den Seiten 14 bis 30 verzeichnet sind. Alle Beschreibungen sind knapp gehalten, vorangestellt sind der Künstlername, die Maße sowie die Materialangaben. Die Sammlung umfaßt Gemälde der holländischen, flämischen, deutschen und italienischen Schule. Die deutsche Schule ist mit elf Werken relativ schwach vertreten. Anonym bleibt nur ein einziges Bild (Nr. 46).
253 1795/12/02-1795/12/04
[Lugt 5383]
P.H. Packischefsky; Hamburg, Börsensaal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 9
251 1795/11/14
[Lugt 5378]
Peter Hinrich Packischefsky; Hamburg, Börsen=Saale Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 147 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß einer schönen und sehr gut gewählten Gemählde=Sammlung theils von Deutschen, Italiänischen und Holländischen Meistern, wie auch einer auserlesenen Sammlung schwarzer und colorirter, in vergoldeten Rähmen sehr sauber eingefaßte, Kupferstiche, welche den 14ten November dieses Jahres auf dem hiesigen Börsen=Saale verkauft werden soll, durch den Mackler Peter Hinrich Packischefsky. Tages vorher, als den 13ten November, können sämmtliche Sachen daselbst in Augenschein genommen werden, und Catalogi sind bey benanntem Mackler für 2 Schillinge, den Armen zum Besten, zu haben. Hamburg 1795. Kommentar: In dieser Versteigerung des Hamburger Maklers Peter Hinrich Packischefsky wurden insgesamt 147 Gemälde angeboten. Alle Bildbeschreibungen sind knapp gehalten, jedoch mit Angaben der Maße und des Materials versehen. Es überwiegen Werke der deutschen Schule, darunter auch zahlreiche altdeutsche Bilder. Der Katalog verzeichnet allein neun Gemälde von Lucas Cranach d.Ä, drei Gemälde von Albrecht Dürer und zwei Bilder von Hans Holbein d.J. Die Mehrheit machen jedoch die Gemälde von Künstlern des 17. und 18. Jahrhunderts aus, darunter sechs Werke von Alexander Thiele und acht Bilder von Christian Wilhelm Ernst Dietrich.
Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichnis einer auserlesenen Sammlung Englischer und Französischer Kupferstiche von den ersten und besten Abdrücken, in schwarzen und colorirten Blättern, vortreflicher Gemälde in Wasserfarben, oder sogenannte Gouachen und Aquareles, auch großer und kleiner Oelgemälde, größtentheils sehr sauber unter Glas gefaßt in den geschmackvollsten französischen Rahmen, femer in Kupfer gestochene Handzeichnungen, die Gallerie du Palais Royal, die Werke des berühmten Vouvermens, und endlich eine niedliche Sammlung der besten Stücke aus den berühmtesten Cabinetten in Europa in Gypsabdrücken, welches alles auf dem Börsensaal am 2, 3 und 4ten December 1795 durch den Makler P.H. Packischefsky öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden soll. Den 2ten December sind obige Sachen 2 Stunden vor der Auction daselbst zu besehen, und der Catalogue bey gedachten Makler für 2 Schillinge, den Armen zum Besten, zu haben. Hamburg, gedruckt bey C. W. Weyn, E. Hochedl. und Hochw. Raths Buchdrucker. Kommentar: In diesem 23 Seiten umfassenden Katalog des Hamburger Maklers Peter Hinrich Packischefsky wird eine umfangreiche Sammlung von Kupferstichen angeboten. Auf Seite 8 werden auch neun Gemälde auf Holz verzeichnet. Diese Einträge sind auf französisch abgefaßt und enthalten neben der Nennung des Bildthemas keine weiteren Angaben zu den Maßen, mit Ausnahme der Nr. 1, ein Gemälde von Sebastien Bourdon. Als Nummer 2 ist ein Gemälde von Rogier van der Weyden aufgeführt. Es handelt sich um das Portrait Philips des Schönen, eines von zwei im 18. Jahrhundert in Deutschland versteigerten Werken, die diesem Künstler zugeschrieben werden (vgl. Kat. 47, Nr. 196).
252 1795/11/17-1795/11/18 Packischefsky; Hamburg, Börsen=Saale Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 75 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß einer vortreflichen, aus einer bekannten hiesigen Verlassenschaft entstehenden, Gemählde=Sammlung von Italiänischen, Holländischen und Deutschen Meistern, wie auch einer Collection englischer und französischer Kupferstiche, die zum Theil unter Glas und in Rähmen gefaßt sind; welche, nebst einem anatomischen Werke und der in Kupfer gestochenen Dresdener Gallerie, den 17ten und 18ten November 1795 auf dem Börsen=Saale öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden sollen, durch den Mackler Packischefsky. Tages vorher können obige Sachen in beliebigen Augenschein genommen werden, und der Catalogue ist, den Armen zum Besten, für 2 Schilling zu haben. Hamburg. Kommentar: In dieser Auktion des Hamburger Maklers Peter Hinrich Packischefsky wurde nach den Angaben des Titelblatts ein 146
KATALOGE
254 1796/00/00
Daten unbekannt
[Anonym]; Basel Verkäufer nach Titelblatt: Mr. Merian l'aine Verkäufer: Merian (Basel) Lose mit Gemälden: Ti Standorte: *LBDa Annotiert mit allen Preisen (französische Ausgabe). Titelblatt: Catalogue d'une collection de tableaux de differentes ecoles, appartenant ä Mr. Merian l'aine ä Basle. Cette Collection composee en grande partie, de Tableaux du premier merite, est ä vendre en bloc ou en detail, ä des prix fixes, que les amateurs pourront apprendre du proprietaire, en s'adressant directement ä lui. 1796. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog aus Basel wurden insgesamt 73 Gemälde angeboten. Nach den Angaben des Titels sollen diese Bilder aus einer Sammlung Merian stammen. Die Beschreibungen der einzelnen Gemälde in dem in französischer Sprache abgefaßten Katalog sind mitunter detailliert und recht
ausführlich; gelegentlich wird auch der Hintergrund der Darstellung angesprochen. Die meisten Bildtexte, denen der Künstlername sowie die Angaben des Materials und des Formats vorangestellt sind, enden mit einer knappen Charakterisierung des malerischen Ausdrucks oder des künstlerischen Werts: "un morceau capital/precieux". Signaturen und Aufschriften werden sorgfältig am Ende jeder Katalognummer vermerkt, auch sind mehrere Pendants als solche verzeichnet. Der Katalog ist nach Schulen geordnet. Die französische Schule bildet mit 30 Nummern den Hauptteil der Sammlung; einige französische Künstler wie Poussin (Nr. 3) wurden der italienischen Schule zugeordnet. Werke deutscher Künstler fehlen vollkommen. Im Exemplar LBDa steht bei jeder Katalognummer ein handschriftlicher Zahlenvermerk, der offenbar den erzielten Kaufpreis angibt. Den Spitzenwert erzielte mit 500 Währungseinheiten ein Gemälde von David Teniers (Nr. 20), ansonsten bewegen sich die Preise zwischen 8 und 100 Währungseinheiten.
255 1796/00/00
Daten unbekannt
Preise sowohl in Reichstalem als auch in Gulden angegeben. Alle Schätzungen bewegen sich auf sehr hohem Niveau. Die Preisforderungen erinnern an die Limite, die im Verzeichnis der Sammlung Johann Ernst Gotzkowsky (Kat. 43) angeführt wurden. Der erwähnte Bassano ist mit 1.500 Gulden das teuerste Einzelstück. Im Vorwort zum Katalog heißt es, daß man für die Originalität der Gemälde und Zeichnungen "hafte". Wie bei dem Berliner Unternehmer Gotzkowsky wurde hier eine Kunstsammlung vor allem aus spekulativen Gründen aufgebaut. Unter den insgesamt rund 120 Gemälden finden sich allein rund 50 Arbeiten deutscher Künstler überwiegend des 18. Jahrhunderts, darunter drei Arbeiten von Johann Christian Mannlich, vier Bilder von Christian Georg Schütz und drei Werke von Johann Georg Pforr. Ähnlich stark vertreten sind die holländische und flämische Schule, hier liegt der Schwerpunkt auf dem 17. Jahrhundert. Insgesamt elf Gemälde stammen von italienischen Künstlern, darunter zwei von Jacopo Tintoretto. Lit.: Gustav Lang, Friedrich Karl Lang. Leben und Lebenswerk eines Epigonen der Aufklärungszeit (Darstellungen aus der württembergischen Geschichte, Bd. 5), Stuttgart 1911.
[Anonym]; Heilbronn, Im dem Industrie-Comtoir Verkäufer nach Titelblatt: Keine Verkäufer nach anderer Quelle: [Friedrich Karl Lang] Verkäufer: Lang, Friedrich Karl Lose mit Gemälden: 124 Standorte: *UBK Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichnis der Kupferstiche, Mahlereyen, Handzeichnungen und andrer Kunstsachen. Von ausländischen und einheimischen Meistern, welche zu Heilbronn am Nekar in dem IndustrieComtoir vorräthig und um beigesezte Preise zu haben sind. 1796. Kommentar: In diesem Katalog wurde die Sammlung des Schriftstellers, Verlegers und Kunstgelehrten Friedrich Karl Lang (17661822) angeboten. Es handelt sich nicht um einen Auktionskatalog, sondern um ein Lagerverzeichnis. Lang hatte 1793 einen Kunstverlag begründet und richtete in Heilbronn ein Atelier für Kupferdruck ein, in dem u.a. Heinrich Schweizer gearbeitet hat. 1795 erwarb Lang die komplette, seit 1794 zum Verkauf stehende Sammlung des Reichshofsrats Friedrich Karl von Moser (vgl. Kat. 243), dessen Gemälde alle wieder in dem Katalog der Sammlung Lang auftauchen. Darunter auch Rubens' Die Frauen am Grabe Christi (Nr. 1), das sich heute im Norton Simon Museum in Pasadena befindet (Inv.-Nr. F. 1972.51.P). Im Jahre 1797 gründete Lang das "Industrie-Comtoir", in das seine Kunstverlagsanstalt einging und durch einen Großhandel für Künstlerutensilien erweitert wurde. Auch die Kunstsammlung Langs stand vermutlich von Anfang an zum Verkauf. Jedenfalls erschien schon 1796 das hier besprochene Verzeichnis. Als sich jedoch kaum etwas von dem umfangreichen Bestand absetzen ließ, beantragte Lang am 8. März 1798, seinen Kunstbesitz mittels einer Lotterie zu veräußern. Als auch der Losverkauf wenig erfolgreich verlief, wurde die Ziehung zunächst auf den 1. Januar 1799 verschoben, jedoch mußte Lang noch vor Jahresende Konkurs anmelden. Die meisten Kunstwerke wurden erst im Laufe der Zeit als Konkursmasse veräußert. Das Gemälde Rubens' soll sich noch bis 1804 in Langs Haus befunden haben und wurde dann von Dominik Artaria für die Sammlung Johann Rudolf Graf Czernin erworben. Das umfangreiche Verzeichnis umfaßt in erster Linie graphische Arbeiten. Die insgesamt 122 Lose mit Gemälden sind auf den Seiten 77 bis 88 verzeichnet und nicht numeriert. Unter einem Eintrag werden teilweise mehrere Bilder zusammengefaßt, in einem Fall sogar zwölf Gemälde, verschiedentlich auch Pendants. Die Beschreibungen sind sehr knapp. So heißt es beispielsweise auf Seite 78: "Die Anbetung der Hirten, von J. Bassano." Es folgen die Angaben zum Material und die Maße. In einer Tabelle sind zu jedem Posten die
256 1796/02/17-1796/02/18 Packischefsky; Hamburg, Börsen=Saal Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 247 Standorte: *KH Annotiert mit den meisten Käufemamen und den meisten Preisen. Titelblatt: Verzeichniß einer ganz vortreflichen Sammlung italienischer, französischer und niederländischer Cabinets=Gemählde, welche meistens unter der ersten Classe gehören. Es sind auch diese kostbaren Stücke mehrentheils in fein vergoldeten, und von der schönsten französischen modernen Arbeit, verfertigten Rahmen; nur einige Wenige sind mit rogaille geschnittener Verziehrung. Diese Gemähide sollen den 17. und 18. Februar 1796 auf dem hiesigen Börsen=Saal durch die Mäckler Packischefsky und Kreuter öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Catalogi sind bey benannten Mäcklern für 4 Schillinge, den Armen zum Besten, zu haben. N.B. Die Gemähide können zwey Tage, nämlich den 15. und 16. Februar, vor dem Verkaufe in Augenschein genommen werden. Hamburg, bey P. F. Fauche. Kommentar: In diesem 24 Seiten umfassenden Hamburger Katalog werden 247 Gemälde aufgeführt. Oftmals sind zwei Bilder unter einer Losnummer verzeichnet. Die Beschreibungen sind teilweise sehr ausführlich und kommen zumeist ohne ästhetische Wertungen aus. Ausdrücklich wird zu Beginn des Kataloges vermerkt: "Da die, in diesem Verzeichnisse beschriebenen Gemähide, wegen ihrer auszeichnenden Schönheit, keinen Ruhm bedürfen: so ist die gewöhnliche Lobeserhebung hier weggelassen." Datierungen werden nach dem Künstlernamen angegeben. Der größte Teil von ihnen gehört der französischen Schule an, gefolgt von Werken der flämischen, italienischen und holländischen Schule. Im Vergleich dazu ist der Anteil der deutschen Maler fast ebenso gering (darunter vier Gemälde von Goffredo Wals), wie der der spanischen Maler (je ein Gemälde von Jusepe de Ribera und Veläzquez). Die Vielzahl der Bilder aus der französischen Schule läßt schließen, daß die Sammlung direkt aus Frankreich nach Hamburg transferiert wurde, um auf der Börse verauktioniert zu werden. Alle bekannten französischen Künstlernamen des 17. und 18. Jahrhunderts sind im Katalog aufgeführt, von Jacques Blanchard bis Claude Joseph Vernet und Jean Antoine Watteau. Drei Gemälde sind unter dem Namen "Le Nain" aufgelistet. Bei den Italienern dominieren ebenfalls Maler des 17. und 18. Jahrhunderts, bei den flämischen Bildern Künstler des 17. Jahrhunderts. David Teniers d.J. ist mit sechs, Sebastien Bourdon KATALOGE
147
mit fünf Gemälden vertreten. Unter den holländischen Werken herrschen Landschaften mit religiöser oder mythologischer Staffage vor, etwa von Bartholomeus Breenbergh und Comelis van Poelenburgh; auch sind zwei Landschaften von Frans Post verzeichnet (Nrn. 100 und 132). Im Exemplar KH sind Blätter mit handschriftlichen Verzeichnissen der Käufemamen und der erzielten Preise eingebunden. Für ein Conversations=Stück von Le Nain (Nr. 231), das zehn Jahre zuvor am 3. Mai 1786 auf einer Pariser Auktion (Lugt 4040) verkauft worden war, wurden 645 Mark erzielt, der höchste Preis auf der Auktion. Eine Zitier spielende Dame mit Künstler von Le Nain (Nr. 7) befindet sich heute in der Vassar College Gallery in Poughkeepsie, New York. Ein Gemälde des Malers "Bernard" erbrachte die Summe von 515 Mark. Überdurchschnittlich hoch sind auch die Preise für die Gemälde von David Teniers, für die u.a. 311 (Nr. 96) bzw. 305 Mark (Nr. 157) geboten wurden. Die Preise für die meisten Gemälde bewegten sich jedoch unter 100 Mark.
257 1796/08/00
Daten unbekannt
[Lugt 5493]
Packischefsky; Hamburg, Börsen=Saal
Kommentar: Im Vergleich zu den früheren Auktionskatalogen der Nürnberger Kunsthandlung Frauenholz, die seit 1791 regelmäßig zu den jährlich stattfindenden Auktionen erschienen, ist dieser mit 126 Seiten von relativ geringem Umfang. Wahrscheinlich wurde hier der Nachlaß eines einzelnen Einlieferers angeboten. Das Angebot setzte sich vorwiegend aus Büchern und graphischen Arbeiten zusammen. Auf den Seiten 113 und 114 werden auch 25 Losnummern mit Gemälden aufgeführt, wobei teilweise unter einer Losnummer zwei Gemälde verzeichnet werden. Unter der Losnummer 8 werden elf Landschaftsbilder von Johann Friedrich Weitsch zusammengefaßt. Interessenten sind laut der Vorrede gehalten, ihr Angebot bei der Frauenholzischen Kunsthandlung oder einer von fünf weiteren Stellen abzugeben. Die Auktion war auf mehrere Tage angesetzt. Die Beschreibungen sind durchweg sehr kurz gehalten, beispielsweise heißt es zu Nr. 3: "2 Landschaften von P. Bemmel, aus seiner besten Zeit auf Leinwand"; es folgen die Maßangaben. Vorwiegend werden Gemälde von zeitgenössischen Malern aus dem Nürnberger Raum offeriert, so von Peter und Wilhelm von Bemmel oder Georg Eisenmann. Eine Darstellung der Stadt Nürnberg von einem anonymen Künstler ist auf Florentiner Marmor gemalt. Lit.: Luther 1988.
Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 111 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß einer ganz vortreflichen Sammlung Cabinets=Gemählde, von Italienischen, Französischen und Niederländischen Meistern, welche in höchst seltnen und auserlesenen Stücken bestehen und im Monat August 1796 auf dem hiesigen Börsen=Saal durch den Mackler Packischefky öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden sollen. Catalogi sind bey benanntem Mackler für 2 Schillinge, den Armen zum Besten, zu haben. Hamburg. Kommentar: In dieser Versteigerung des Maklers Peter Hinrich Packischefsky auf der Hamburger Börse wurden 111 Gemälde verauktioniert. Die tabellarisch aufgelisteten Beschreibungen der Bilder sind durchweg sehr genau und kommen ohne jede Wertung aus. In der anonymen Sammlung dominieren die Werke der holländischen Schule, darunter Werke von allen namhaften Künstlern. Es handelt sich größtenteils um Landschaften und Genredarstellungen, darunter drei Gemälde von Jan Steen. Unter den Bildern der deutschen Schule fällt ein Gemälde von Albrecht Altdorfer mit der Darstellung Der Riese Roland, der das Christ-Kind durchs Wasser trägt auf (Nr. 88). Ansonsten finden sich überwiegend Werke von Malern des 17. und 18. Jahrhunderts wie Balthasar Denner, Christian Wilhelm Ernst Dietrich oder Dominicus van der Smissen verzeichnet. Ein Priester, von verschiedenen Personen umgeben von Gerbrand van den Eeckhout (Nr. 4) wird heute von der New York Historical Society aufbewahrt. Nur fünf Werke bleiben anonym.
258 1796/08/01
und folgende Tage
Frauenholz; Nürnberg Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 25 Standorte: SBBa Die S. 97-112 fehlen. Nicht annotiert. Aus dem Besitz von Joseph Heller. Titelblatt: Verzeichnis von Büchern, aus allen Fächern der Gelehrsamkeit; Kupferstichen; Handzeichnungen; Landkarten; Gemälden; Naturalien; Musikalien; mathematischen und musikalischen Instrumenten; Abgüssen; gestochenen und gemahlten Wappen u.s.w. welche den 1. August 1796 zu Nürnberg öffentlich an die Meistbietenden verkauft werden. Nürnberg, 1796. 148
KATALOGE
259 1796/09/08-1796/09/10
[Lugt 5494]
Packischefsky; Hamburg, Börsensaale Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 197 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß einer Sammlung Italienischer, Niederländischer und Deutscher Gemähide, von den berühmtesten Meistern; nebst eingefaßten Englischen und Französischen Kupferstichen, der besten Abdrücke; welche den 8ten, 9ten und lOten September 1796, auf dem Börsensaale, durch den Mackler Packischefsky öffentlich an den Meistbietenden in grob Dänisch Courant verkauft werden sollen. Den 8ten September sind die Gemähide daselbst zu besehen, und Catalogo, bey obigem Mackler, den Armen zum besten, für 2 Schillinge zu haben. Kommentar: In diesem 24 Seiten umfassenden Katalog des Hamburger Maklers Peter Hinrich Packischefsky wurden insgesamt 201 Lose angeboten. Am Ende des Katalogs sind die Kupferstiche mit eigener Numerierung (Nrn. 1 bis 77) verzeichnet. Den Bildbeschreibungen sind die Künstlernamen und die Maßangaben vorangestellt. Bis auf zwei Ausnahmen (Nm. 54 und 55, zwei Gemälde des Monogrammisten "A.L.C.") sind alle Bildtitel knapp abgefaßt. Datierungen werden ebenfalls angegeben, das Material nur, wenn es sich um Gemälde auf Holz handelt. Die auf der Börse zur Auktion gelangte Sammlung bestand überwiegend aus Gemälden der holländischen, deutschen und flämischen Schule. Unter den holländischen Künstlern finden sich viele sogenannte Kleinmeister, die mit zwei oder mehreren Gemälden aufgeführt sind (etwa Jan van Baden, Elias van den Broeck, Adrian van der Cabel und Barend Gael). Der Flame Jan Carel van Eyck ist mit sechs Landschaften vertreten. Von den deutschen Malern sind Heinrich Berichau, Balthasar Denner und Johann Martin Schuster am häufigsten verzeichnet.
260 1796/10/17-1796/10/20
[Lugt 5503]
Peter Hinrich Packischefsky; Hamburg, Börsensaale Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 329 Standorte: KH Nicht annotiert.
Titelblatt: Verzeichniß einer Sammlung Italiänischer, Niederländischer und Deutscher Gemähide, von den berühmtesten Meistern; nebst eingefaßten Englischen und Französischen Kupferstichen, welche den 17ten, 18ten, 19ten und 20sten October 1796, auf dem Börsensaale, durch den Mackler Peter Hinrich Packischefsky öffentlich an den Meistbietenden in grob Dänisch Courant verkauft werden sollen. Das Verzeichniß ist bey obigem Mackler, den Armen zum Besten, für 2 Schillinge zu haben. Hamburg. Kommentar: In diesem umfangreichen Auktionskatalog des Hamburger Maklers Peter Hinrich Packischefsky sind über 300 Gemälde verzeichnet. Die Auktion war auf vier Tage angesetzt, sie dauerte vom 17. bis 20. Oktober. Das Titelblatt und der Aufbau des Katalogs entsprechen der vorangegangenen Auktion Packischefskys, die im September des gleichen Jahres stattfand (Kat. 259). Insgesamt 74 Gemälde sind ohne Angabe eines Künstlernamens verzeichnet, zahlreiche weitere werden nur mit Initialien aufgeführt, die sich nicht auflösen lassen. Den umfangreichsten Teil der insgesamt 331 verauktionierten Gemälden bilden die Werke der holländischen und deutschen Schule, darunter mehrere Gemälde von Hans Hinrich Rundt, Friedrich Schoenemann sowie Anton und Johann Jacob Tischbein. Drei Gemälde sind Albrecht Dürer zugeschrieben. Die Gemälde wurden zumeist nur mit der Angabe des dargestellten Themas aufgeführt, mitunter fehlen die Angaben zum Material.
261 1796/11/02-1796/11/03 Peter Hinrich Packischefsky; Hamburg, Börsensaale Verkäufer nach Titelblatt: Keine
Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß einer recht guten Sammlung Kabinets= und anderer Gemähide in Oelfarbe aus einer Verlassenschaft von den berühmtesten italienischen, französischen, niederländischen ec. Meistern, welche am Montage und Dienstage, den 7ten und 8ten December d.J. auf dem hiesigen Börsensaale durch den Mackler Peter Hinrich Packischefsky öffentlich an den Meistbietenden in grob Dänisch Courant verkauft werden sollen. Der Anfang des Verkaufs ist des Morgens um 11 Uhr. Hamburg, gedruckt in der Börsen=Halle von Conrad Müller. Kommentar: Den Angaben des Titelblatts zufolge stammen die nahezu 250 zur Versteigerung gelangten Gemälde aus dem Nachlaß eines Sammlers. Die Gemälde sind unter Angabe des Künstlernamens und des Bildgegenstands listenartig aufgeführt, auch fehlen jegliche Angaben zu den Maßen und zum Material. Die Sammlung setzt sich vor allem aus Werken namhafter Künstler der holländischen, flämischen und deutschen Schule zusammen. Von auffallend vielen Künstlern sind mehrere Werke verzeichnet. Von Gerard ter Borch und Gerbrand van den Eeckhout werden jeweils fünf Werke aufgeführt, von Michiel Jansz. Miereveld acht Portraits. Von Jean Antoine Watteau sind zehn Gemälde aufgelistet, darunter acht Gartenprospecte mit Figuren. In der kleinen Gruppe der italienischen Gemälde ragt Piazzetta mit fünf Werken heraus. Von den deutschen Malem sind Ludwig Wilhelm Busch, Christian Wilhelm Emst Dietrich, Joachim Luhn, Matthias Scheits, Johann Georg Stuhr und G.D. Waerdigh mit mehreren Werken vertreten.
Lose mit Gemälden: 203 Standorte: KH Nicht annotiert.
263 1797/02/27-1797/02/28
Titelblatt: Verzeichniß einer ganz vortreflichen Sammlung Cabinet= Gemähide, von den berühmtesten Italiänischen, Französischen, Niederländischen und Deutschen Meistern; wie auch eine Electrisir= Maschine mit dazu gehörigen Aparat, und eine Dollandsche Luft= Pumpe mit vielem Zubehör; welches alles am Mittewochen und Donnerstage, den 2ten und 3ten November, 1796, auf dem Börsensaale, durch den Mackler Peter Hinrich Packischefsky öffentlich an den Meistbietenden in grob Dänisch Courant verkauft werden soll. Obgedachte Gemähide sind daselbst, am Dienstage den lsten November, in beliebigen Augenschein zu nehmen; und das Verzeichniß bey besagtem Mackler, den Armen zum Besten, für 4 Schillinge zu haben. Hamburg, gedruckt bey D. A. Harmsen. Kommentar: Ein Vorbericht zum Katalog informiert darüber, daß die Gemälde nach Hamburger Maß gemessen wurden und mit goldenen Rahmen "nach den feinsten Pariser Geschmack" versehen sind. Die Beschreibungen, die zum Ende des Katalogs hin immer knapper werden, sind sehr genau und mit Urteilen zur künstlerischen Ausführung verbunden. Der größte Anteil der knapp über 200 zur Auktion gelangten Gemälde sind Werke der holländischen Schule, darunter vier Hendrick Goltzius zugeschriebene Werke mit Darstellungen aus der Vita der Hl. Katharina (Nm. 171 bis 174). Unter der Gruppe der flämischen Maler ragt David Teniers mit acht Gemälden heraus, gefolgt von fünf Peter Paul Rubens zugeschriebenen Gemälden. Zum Verkauf gelangten weiter Werke der deutschen, französischen und italienischen Malerei. Unter den Nm. 208 und 209 werden die im Titelblatt angesprochene "Electrisir=Maschine" sowie die "Dollandsche Luft=Pumpe" verzeichnet.
262 1796/12/07-1796/12/08
[Lugt 5542]
Packischefsky; Hamburg, Auf dem Vorder=Börsensaal
[Lugt 5514]
Peter Hinrich Packischefsky; Hamburg, Börsensaale Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 246
Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 102 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß einer ganz vortreflichen Sammlung Gemählde, von den berühmtesten Italienischen, Französischen, Niederländischen und Deutschen Meistern, welche am Montage und Dienstage, den 27sten und 28sten Februar 1797 auf dem Vorder=Börsensaal durch den Mackler Packischefsky öffentlich an den Meistbietenden in grob Dänisch Courant verkauft werden sollen. Obgedachte Gemählde sind daselbst am Sonnabend, den 25sten Februar, im beliebigen Augenschein zu nehmen; und das Verzeichniß bey besagten Mackler, den Armen zum Besten, für 4 Schillinge zu haben. Hamburg. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog des Hamburger Maklers Peter Hinrich Packischefsky werden auf 15 Seiten insgesamt 102 Gemälde verzeichnet, die an zwei aufeinander folgenden Tagen versteigert werden sollten. Die Beschreibungen sind unterschiedlich ausführlich, enthalten durchgehend die Angabe des Künstlernamens, der Maße, des Bildgegenstands, des Materials und der Rahmung. Es kamen überwiegend Bilder der holländischen und flämischen Schule zum Verkauf. Einen Schwerpunkt bildet eine Gruppe von sechs Gemälden von David Teniers. Auch Jan van Goyen ist mit sechs Landschaften stark vertreten. Die Schreibweise der Künstlernamen weicht in vielen Fällen von denen der anderen Kataloge ab.
264 1797/04/20-1797/04/21
[Lugt 5578]
Packischefsky; Hamburg, Auf dem Vorder=Börsensaale Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 268 KATALOGE
149
den nur vier Gemälde der deutschen Schule angeboten, darunter ein Werk von Albrecht Dürer (Nr. 207).
Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß einer ganz vortreflichen Sammlung Cabinets=Gemählde, aus den Italienischen, Niederländischen und Deutschen Schulen, von den berühmtesten Meistern. Der größte Theil dieser Gemähide ist in guten goldnen Rähmen gefaßt, und sollen selbige am Donnerstage und Freytage, den 20. und 21. April 1797 auf dem Vorder=Börsensaale, durch den Mackler Packischefsky öffentlich an den Meistbietenden, in grob Dänisch Courant, verkauft werden. Obgedachte Gemähide sind daselbst, am Mittewochen, den 19ten April, in beliebigen Augenschein zu nehmen, und das Verzeichniß ist bey besagten Mackler, den Armen zum Besten, fur 4 Schillinge zu haben. Hamburg, gedruckt bey Dietrich Anton Harmsen Wittwe. Kommentar: In diesem Katalog des Hamburger Maklers Peter Hinrich Packischefsky sind insgesamt 268 Lose verzeichnet. Teilweise sind auch zwei Gemälde unter einer Losnummer aufgeführt. Das Exemplar KH ist in einen Sammelband integriert (Kat. Hbg. 17751811). Zwischen den Seiten 16 und 17 ist dort noch ein anderer Katalog eingebunden. Die Beschreibungen sind teilweise sehr ausführlich und mit zahlreichen positiven Wertungen der einzelnen Bilder verbunden. Zur Versteigerung gelangte eine umfangreiche und vielseitige Sammlung, in der vor allem die holländische und flämische Schule gut vertreten war. Allein fünf Gemälde sind Rembrandt zugeschrieben; laut Katalogeintrag stammte eine Zigeunerfamilie von Rembrandt "aus einem der ersten Cabinetter in Amsterdam" (Nr. 29). Unter den fast 60 deutschen Werken ragte Christian Wilhelm Ernst Dietrich mit 28 Bildern hervor. Die italienischen Schulen blieben mit rund 30 Gemälden weniger bedeutend, hier überwogen Werke von Canaletto, Carlo Maratti und Giovanni Battista Piazzetta.
265 1797/04/25-1797/04/26
[Lugt 5580]
Packischefsky; Hamburg, Börsensaale Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 268 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß einer wohlgewählten Sammlung Cabinets= Gemähide von den berühmtesten Italiänischen, Französischen, Niederländischen und Deutschen Meistern, welche alle am Dienstage und Mittewochen, den 25sten und 26sten April 1797 auf dem Börsensaale durch die Mackler Packischefsky, Dencken, Hagedorn und Kraeuter öffentlich an den Meistbietenden in grob Dänisch Courant verkauft werden sollen. Obgedachte Gemähide sind daselbst, am Montage, den 24sten April in beliebigen Augenschein zu nehmen; und das Verzeichniß bey besagten Macklern den Armen zum Besten, für 4 Schillinge zu haben. Hamburg, 1797, gedruckt, bey Gottlieb Friedrich Schniebes. Kommentar: Dieser Katalog der Hamburger Makler Packischefsky, Denecken, Hagedorn und Kräuter umfaßt auf 32 Seiten insgesamt 269 Losnummern. Die Nummern 266 und 267 verzeichnen zwei runde Miniaturen, die Nummer 268 ein Pastell und die letzte Nummer 269 ein "Bas relief in weißen Marmor". Die Beschreibungen im Katalog sind teilweise sehr detailliert, angegeben werden der Künstlername, die Maße, der Bildgegenstand, das Material sowie die Rahmung. Versteigert wurden überwiegend Gemälde der holländischen Schule. Namhafte Künstler von Jan Asselyn bis Reinier Zeemann sind mit einem oder mehreren Gemälden vertreten. Von Jan Wijnants und Johannes Janson werden je sieben Landschaften aufgeführt. Neben kleinen Gruppen von flämischen, französischen und italienischen Gemälden, die ebenfalls zur Auktion gelangten, wer150
KATALOGE
266 1797/06/13-1797/06/14 Packischefsky; Hamburg, Auf dem Vorder=Börsen=Saale Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 229 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß einer auserlesenen Sammlung Original= und wohl conservirter Cabinet=Gemählde, von den berühmtesten Künstlern verfertiget, welche am Dienstage den 13ten und 14 ten Junii 1797 auf dem Vorder=Börsen=Saale durch die Mackler Packischefsky, von der Meden und Kräuter öffentlich an den Meistbietenden, in grob dänisch Courant, verkauft werden sollen. Am Montage, den 12ten Junii, sind obgedachte Gemähide, nebst einem Anhange von dergleichen, daselbst zu besehen, und das Verzeichniß bey besagten Macklern, den Armen zum besten, für 4 Schillinge zu haben. Hamburg, gedruckt von C. W. Meyn, E. Hochedl. Und Hochw. Raths Buchdrucker. Kommentar: Dieser Katalog der Hamburger Makler Packischefsky, von der Meden und Kräuter enthält auf 28 Seiten 231 Losnummern, die ausschließlich Gemälde verzeichnen (die Nrn. 97 und 98 sind kaustische Malereien). In dem letzten Katalogeintrag, der ein Gemälde von Isaac de Moucheron verzeichnet (Nr. 231), wird auf den sehr guten konservatorischen Zustand der Gemälde hingewiesen, die dadurch "dem gehabten Besitzer ein unvergleichliches Andenken bleiben wird". Der Eintrag endet mit dem holländischen Sprichwort: "Dat Schilderey is sonder Ferf geschildert." Möglicherweise stammte diese Sammlung ursprünglich aus den Niederlanden, denn im Katalog werden überwiegend Gemälde der holländischen Schule zum Verkauf angeboten, darunter vier Landschaften von Jan van Goyen sowie auffallend viele Stilleben von namhaften Malern wie Balthasar van der Ast oder David und Jan Davidsz. de Heem, außerdem eine Vielzahl von Genrebildern. Unter der kleinen Gruppe der deutschen Gemälde finden sich zahlreiche Werke der sächsischen Landschaftsmaler Christian Wilhelm Ernst Dietrich und Heinrich Leichner; stark vertreten ist auch der Hamburger Maler Johann Georg Stuhr, von dem allein 12 Werke verzeichnet sind. Die Beschreibungen sind mitunter sehr ausführlich; so wird ein Stilleben mit den Leidenswerkzeugen Christi von Cornells Saftleven (Nr. 112) durch eine außerordentlich umfangreiche Beschreibung besonders hervorgehoben. 267 1797/08/10-1797/09/22 [Anonym]; Mannheim, Kurfürstliches Schloss Verkäufer nach Titelblatt: Herzog Carl von Zweibrücken Hochfürstlicher Durchlaucht Verkäufer: Pfalz-Zweibrücken, Carl II. August, Herzog von Lose mit Gemälden: 435 Standorte: *BHAM Handschriftliches Protokoll; annotiert mit allen Preisen. Kommentar: Bei dieser Versteigerung wurde wahrscheinlich kein Katalog gedruckt, sondern nur ein handschriftliches Inventar erstellt, das dann auch als Verkaufsprotokoll diente. Es handelt sich um die Sammlung Carl II. Augusts (1746-1795), der seit 1775 das kleine Herzogtum Pfalz-Zweibrücken regierte. Da sein Vetter Carl Theodor von der Pfalz keine legitimen Erben hatte, galt Carl II. August als sein potentieller Nachfolger und wurde schon frühzeitig von allen europäischen Herrscherhäusern umworben. Nach der Besetzung des Herzogtums Zweibrücken durch die Franzosen floh Carl II. August am 3. Februar 1793 nach Mannheim. Es gelang ihm, den größ-
ten Teil der Ausstattung seines Schlosses Carlsberg nach Mannheim mitzunehmen. Darunter befand sich auch die Gemäldesammlung, die von dem Zweibrückener Hofmaler Johann Christian von Mannlich (1741-1822) für das neu errichtete Schloß Carlsberg bei Homburg (Saar) zusammengestellt worden war. Mannlich war schon 1771 von Christian IV. von Pfalz-Zweibrücken zum Hofmaler und gleichzeitig zum Inspektor der Herzoglichen Gemäldesammlung ernannt worden. Unter Carl II. August wurde Mannlich dann auch 1776 zum Direktor des gesamten herzoglichen Bauwesens und 1788 zum Direktor über sämtliche Schönen Künste berufen. Mannlich verfaßte auch einen Gesamtkatalog der Galerie (Catalogue de la Galerie), der in zwei gesonderte Kataloge aufgeteilt war: Gemälde, die vorsätzlich wegen ihrer Qualität nicht verkauft werden sollten, und solche, die zum Verkauf anstanden (Catalogue rouge). Die Carlsberger Gemäldesammlung wurde von Carl II. August in nur wenigen Jahren zusammengestellt, nachdem die Sammlung seines Vorgängers Christian IV. am 6. April 1778 durch Remy in Paris versteigert worden war (Lugt 2825). Zunächst erwarb der Herzog 1778 Mannlichs eigene Sammlung, darunter Claude Lorrains Hagar und Ismael in der Wüste und Die Verstoßung der Hagar (heute beide in der Alten Pinakothek, München). Noch im selben Jahr erbte Carl II. August die im Schloß Schleißheim untergebrachte Sammlung des Herzogs Clemens Franz von Paula. Im März 1783 wurde gegen eine jährliche Leibrente die Sammlung des kurpfälzischen Baudirektors Nicolas Pigage erworben. Die hektische Erwerbungstätigkeit des Herzogs von Zweibrücken lockte Kunsthändler und Agenten aus ganz Europa an. Der Bilderhändler Johann Nikolaus Leuzgen wurde 1786 zum "privilegierten Hofmalerey Händler ernannt". Graphische Arbeiten wurden überwiegend über den Wiener Kunsthändler Dominik Artaria bezogen, der sich schließlich auch in Mannheim ansiedelte. Im Jahre 1785 wurde damit begonnen, am Schloß Carlsberg einen Galerieanbau zu errichten, der die immer weiter anwachsende Sammlung aufnehmen sollte. In weniger als 15 Jahren waren mehr als 2.000 Gemälde angeschafft worden. Nach der Flucht des Herzogs aus Carlsberg wurde zunächst ein Teil der Sammlung in den leeren Galerieräumen des Mannheimer Schlosses wieder aufgestellt. Nach dem Tod des Pfalzgrafen am 1. April 1795 setzte eine sofortige Inventarisierung der gesamtem Verlassenschaft ein, einschließlich der Kunstsammlungen. Diese Inventarlisten werden heute im Bayerischen Hauptstaatsarchiv (Fürstensachen 1294-1300) aufbewahrt. Darunter befinden sich auch mehrere Versionen eines handschriftlichen Inventars der zum Kauf stehenden Gemälde. Der Auswertung wurde die handschriftliche Liste "Gemählde" aus dem Bestand Fürstensachen (Nr. 1300; Specification deijenigen Effecten von der Verlassenschaft Herrn Herzogs Carl von Zweibrücken Hochfürstlichen Durchlaucht) zugrunde gelegt. Diese Liste mit insgesamt 434 Gemälden wurde wahrscheinlich nach der Versteigerung dazu benutzt, die nicht verkauften Bilder an die Schlösserverwaltung abzugeben. In ihr werden die Bilder kurz beschrieben, meist auch das Material angegeben, nicht jedoch die Maße. Zahlreiche Werke bleiben anonym. Alle Bilder sind auf dieser Liste taxiert worden. Es ergibt sich ein geschätzter Gesamtwert von 5.927 Gulden, wie auf dem letzten Blatt der "Designation derer aus der Herzogl. Gallerie abgegebenen Gemähide" angegeben wird. Bei der "Designatio" handelte es sich um eine nahezu identische Liste der insgesamt 434 Gemälde. Der Verkauf der Gemälde machte im Rahmen des Verkaufs des gesamten Nachlasses des Fürsten Carl II. August nur einen kleinen Bestandteil aus. Die gesamte Kollektion wurde auf 635.618 Gulden geschätzt (Fürstensachen, Nr. 1296, Detaillirte Verzeichnis der zu der Inventur Commission gekommenen Herzogl Carlischen Mobiliar Verlassenschafts-Stücken mit den angezeigten Taxationen bei jeder Rubrik, Bl. 2v). Dazu zählten Möbel, Waffen, Bücher und ein breites Spektrum kunstgewerblicher Gegenstände sowie Münzen. Es wurden 47 verschiedene Abteilungen gebildet, den Bereich Nr. 45 machten die Gemälde aus. Da in dieser Versteigerung das Inventar eines gesamten Schlosses offeriert wurde, zog sich die Versteigerung des Bestandes mehr als drei Jahre hin (6. Juli 1795 bis 1. Au-
gust 1798), wobei die Gemälde vom 10. August bis 22. September 1797 angeboten wurden (vgl. die Aufstellung in Fürstensachen 1298, Steigregister, Bl. 1). Statt der veranschlagten knapp 650.000 Gulden wurden nur 350.217 Gulden erlöst. Noch schlechter war die Bilanz bei den Gemälden. Es wurde nur ein Bruchteil der Sammlung für insgesamt 524 Gulden verkauft, nämlich nur rund 40 Bilder, wie das Auktionsprotokoll vermerkt (Fürstensachen Nr. 1298, B. 246). Wahrscheinlich hatte sich der Galeriedirektor Mannlich bemüht, möglichst viele Bilder vor dem Verkauf zu retten. Der wertvolle Teil der Zweibrückener Sammlung war ohnehin vorab ausgesondert worden. Ungefähr 1.200 Bilder aus den Beständen der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen stammen aus der Galerie in Schloß Carlsberg. Unter den 434 zur Auktion bereitgestellten Werken finden sich überwiegend anonyme oder als Arbeiten einer Schule deklarierte Gemälde. Auch zahlreiche Werke lokaler zeitgenössischer Künstler wie Daniel Hien wurden offeriert. Unter den Motiven dominieren Stilleben, Jagdstücke und Landschaften. Die Taxierungen bewegen sich überwiegend auf niedrigem Niveau und gehen kaum über 50 Gulden hinaus. Aber auch diese Preislimite waren vermutlich für die meist nicht als erstklassig angesehenen Gemälde viel zu hoch. Bei den wenigen zugeschlagenen Werken wurde in der Regel gerade eben das Limit erreicht. Der größere Bestand von 387 Bilder ging bei der Versteigerung zurück. Die verbliebenen Gemälde kamen danach nach Würzburg und gelangten in der Folge nach Bamberg und schließlich auf die Burggalerie in Nürnberg. Im Jahre 1811 wurde vermutlich ein großer Teil dieser Bilder in einer Auktion verschleudert, weitere Bilder aus dem Zweibrückener Bestand wurden 1852 veräußert. Lit.: NDB, Bd. 11, Berlin 1977, S. 258-260; Meinrad Maria Grewenig, Zur Struktur der Sammlungen von Schloß Carlsberg, in: Ausst.Kat. Saarbrücken 1989, S. 57-62; Bertold Roland, Johann Christian von Mannlich und die Kunstsammlungen von Schloß Carlsberg, in: Ausst.-Kat. Saarbrücken 1989, S. 25-56.
268 1797/09/13
[Lugt 5650]
[Anonym]; Frankfurt am Main, Im Dr. Senkenbergischen Stift, hinter der schlimmen Mauer Lit. D. No. 104 Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 58 Standorte: *SBF Annotiert in Bleistift mit allen Preisen. Aus dem Besitz Johann Valentin Prehn. Titelblatt: Verzeichniß einer Sammlung von Gemählden von verschiedenenen guten Meistern, welche den 13ten September 1797 im Dr. Senkenbergischen Stift, hinter der schlimmen Mauer Lit. D. No. 104 durch die geschwomen Herren Ausrufer öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden sollen. Frankfurt am Mayn 1797. Kommentar: In diesem anonymen Versteigerungskatalog wurden insgesamt 59 Lose mit 58 Gemälden angeboten. Die Bildbeschreibungen sind knapp gehalten, aber durch Maßangaben in Zoll und Schuh ergänzt. Die Künstlernamen sind als Überschriften vor die Losnummern gestellt, fast alle Bilder werden einem Künstler zugeschrieben. Mehr als ein Drittel der Bilder gehört der holländischen und flämischen Schule an. Auch die deutsche Schule ist mit 16 Arbeiten stark vertreten, so finden sich allein vier Werke von Johann Melchior Roos. Nach den Angaben des annotierten Exemplars SBF aus dem Besitz von Johann Valentin Prehn erzielten einige Bilder relativ hohe Preise, so eine Tafel von Hans Holbein d.J. 164 Gulden (Nr. 9). Für zwei Gemälde von Pietro Liberi wurden zusammen 91 Gulden bezahlt. Die Mehrzahl der Preise bewegte sich zwischen 10 und 20 Gulden. KATALOGE
151
269 1797/12/08-1797/12/09
[Lugt 5676]
P.H. Packischefsky; Hamburg, Börsensaale Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 163 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß einer ganz vortreflichen Sammlung Cabinets=Gemählde, aus den Niederländischen, Französischen und Italiänischen Schulen, welche am Freytage und Sonnabend, den 8ten und 9ten December 1797, öffentlich auf dem Börsensaale, durch den Mackler P. H. Packischefsky, gegen baare Zahlung in grob Danisch Courant verkauft werden sollen. Am 7ten December sind die Gemählde daselbst zu besehen; und das Verzeichniß ist bey gedachtem Mackler, den Armen zum Besten, für 4 Schillinge zu haben. Hamburg, gedruckt bey Dietrich Anton Harmsen Wittwe. Kommentar: In diesem Katalog des Hamburger Maklers Peter Hinrich Packischefsky werden insgesamt 167 Lose mit Gemälden aufgeführt. Die zumeist knappen Bildbeschreibungen sind verbunden mit Werturteilen zur Ausführung wie "kräftig und gut gemahlt", "brav gemahlt", "sehr gut gemahlt". Unter den angebotenen Gemälden überwiegen die Werke der holländischen und flämischen Schule. Bei den holländischen Gemälden dominieren Landschaften von Jan van Goyen, Meindert Hobbema und Aert van der Neer. Einen großen Anteil nehmen auch die Werke deutscher Maler ein, darunter vor allem Gemälde Hamburger Künstler. Als einziges Bild der spanischen Schule wird ein Werk von Murillo (Mars und Venus werden von Vulkan gefangen·, Nr. 113), angeboten. Vermutlich gingen in dieser Auktion einige Werke zurück, da 20 Bilder in einer Auktion am 4. Juni 1798 (Kat. 272) wieder auftauchen. 270 1798/01/19-1798/01/20 Peter Hinrich Packischefsky; Hamburg, Börsensaale Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 221 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß einer ganz vortreflichen Sammlung Cabinets=Gemählde, von Italienischen, Niederländischen, Französischen und Spanischen Meistern, in goldnen und schwarzen Rahmen; nebst einer kleinen Sammlung Wasserfarbenstücke und Kupferstiche, in Rahmen, unter Glas und lose; welche am Freytage und Sonnabend, den 19ten und 20sten Januar 1798, öffentlich auf dem Börsensaale, durch den Mackler Peter Hinrich Packischefsky, gegen baare Zahlung in grob Dänisch Courant, verkauft werden sollen. Am 18ten Januar sind die Gemähide ec. daselbst zu besehen; und das Verzeichniß ist bey gedachten Mackler, den Armen zum Besten, für 4 Schillinge zu haben. Hamburg. Kommentar: Dieser 28 Seiten umfassende Katalog des Hamburger Maklers Peter Hinrich Packischefsky verzeichnet unter den Losnummern 1 bis 222 die Gemälde, die auf den Seiten 3 bis 15 (Nrn. 1 bis 116) und 21 bis 26 (Nrn. 117 bis 222) aufgelistet sind. Unter den Nummern 111 bis 115 werden Kleinskulpturen aus Elfenbein angeführt, unter der Nummer 116 wird eine Sammlung von 78 Medaillen zusammengefaßt. Auf der Seite 16 werden in einem gesonderten Anhang fünf sogenannte große "Meisterstücke" erwähnt: zwei Jagddarstellungen von Casanova, ein Deckengemälde von Carpioni sowie zwei Historien von Tintoretto. In einem zweiten Anhang (S. 17 bis 20) sind die Kupferstiche verzeichnet, am Ende des Katalogs (S. 27 und 28) die "Wasserfarbenstücke" und mehrere gerahmte Kupferstiche. Die Beschreibungen in den einzelnen Katalogeinträgen sind mitunter sehr ausführlich und voller Lobpreisungen. 152
KATALOGE
Erstmals wird auf dem Titelblatt neben den italienischen, niederländischen und französischen auch eine Gruppe von spanischen Gemälden zum Verkauf angekündigt. Im Katalog ist jedoch nur ein einziges Gemälde einem spanischen Maler zugeschrieben, die Darstellung eines Bischofs von Jusepe de Ribera, der laut Katalog einen "jungen Prinzen" unterrichtet (Nr. 1). In der zwei Tage andauernden Auktion dominierten Werke der deutschen und italienischen Schule, die holländischen und flämischen Schulen waren ungewöhnlich schwach vertreten. Bei den italienischen Schulen zeigt sich ein breites Spektrum mit Werken vom Ende des 15. bis zum 18. Jahrhundert. So werden drei Gemälde von Andrea Mantegna genannt, zwei Gemälde von Giorgione sowie fünf Bilder von Domenichino. Unter den deutschen Künstlern ist der Hamburger Maler Elias Pietsch mit über zwanzig Landschaften vertreten. Vermutlich stammen die zur Auktion gelangten Gemälde aus verschiedenen Sammlungen. Viele der italienischen Gemälde, aber auch Riberas Prinzenerziehung, wurden auf einer Auktion im November desselben Jahres (Kat. 274) wieder zum Verkauf angeboten.
271 1798/05/14
[Lugt 5760]
[Anonym]; Köln, Chapitre de Ste. Marie au Capitole Verkäufer nach Titelblatt: Feu Mr de Bors d'Overen Verkäufer: Bors, Johann Matthias von Lose mit Gemälden: 57 Standorte: LBDa Nicht annotiert. UBK Nicht annotiert. Photokopien: WRK (aus LBDa) Titelblatt: D'une belle Collection de Tableaux, Estampes Reliees & en feuilles, & de quelque pifeces Rares en ivoire en marbre & en Cristal, ainsi que d'une grande Collection de Mineraux, petrifications & productions marines et instruments de physique delaissfees par feu Mr de Bors D'overen, en son vivant chanoine de l'illustre chapitre de St. Gereon ä Cologne; Qui se vendront au plus offrant, a sa mortuaire vis avis du Chapitre de Ste Marie au Capitole le 14 Mai 1798 le matin depuis 9 heures jusqu'a 12 & Γapres midi depuis 3 jusqu'a 6 heures, Argent comptant; L'ecu ä 60 Sols de Cologne. Kommentar: In der ersten Abteilung dieses umfangreichen Katalogs (30 Seiten) der Sammlung Johann Matthias von Bors (gest. um 1793) werden die Gemälde unter den Nrn. 1 bis 61 aufgelistet (S. 3 bis 9). Ansonsten umfaßt der Katalog Kupferstiche, Elfenbeinschnitzereien, eine Mineraliensammlung sowie technische Instrumente. Bors war Kanonikus des adeligen Stiftes St. Gereon. Im Jahre 1778 fiel ihm ein Teil des Nachlasses der Jabachischen Sammlung sowie der Jabachische Hof in Köln zu. Aus der Sammlung Bors wurde 1792 durch Vermittlung des Baseler Kunsthändlers Christian Mechel und Ferdinand Wallrafs ein Familienbild der Familie Everhard III. Jabach von Charles Le Brun in die Niederlande verkauft (Baumeister 1926/27, S. 21 Iff.). Lit.: Hirsching 1786/92, Bd. 2, S. 77; Förster 1931, S. 32, 54, 97. 272 1798/06/04
und folgende Tage
[Lugt 5772]
Packischefsky; Hamburg, Börsensaale Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 413 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß einer ganz vortreflichen Sammlung Cabinets=Gemählde, aus den Niederländischen, Französischen und Italiänischen Schulen, welche den 4ten Juny und folgende Tage öffentlich auf dem Börsensaale, durch die Mäckler Packischefsky und
Lucht, gegen baare Zahlung, in grob Dänisch Courant, verkauft werden sollen. Am 4 Juny sind diese Gemähide zwey Stunden vor dem Verkaufe daselbst zu besehen; und das Verzeichniß ist bey gedachten Mäcklem, den Armen zum Besten, für 4 Schillinge zu haben. Hamburg, 1798. Gedruckt bey Dietrich Anton Harmsen Wittwe. Kommentar: In diesem 48 Seiten umfassenden Katalog der Hamburger Makler Peter Hinrich Packischefsky und Lucht sind 413 Gemälde aufgeführt, denen in eigener Numerierung die Lose für die "Wasserfarbenstücke" und Kupferstiche folgen. Die Einträge reichen von stichwortartigen Angaben des Themas bis zu ausführlichen Beschreibungen der Komposition, verbunden mit kennerschaftlichen Urteilen. Zur Versteigerung gelangte eine umfangreiche Sammlung von Gemälden der holländischen und flämischen Schule, darunter vor allem viele Landschaftsbilder und Genrestücke. So werden Landschaften von den Italianisanten wie Jan Asselyn, Johannes van der Bent, Nicolaes Berchem, Pieter van Laer, Herman van Swanevelt oder Jan Wijnants verzeichnet ebenso wie bäuerliche Szenen von Egbert van Heemskerck oder Jan Miense Molenaer. Des weiteren ist eine große Gruppe von Gemälden der französischen und deutschen Schule aufgelistet, gefolgt von einer kleinen Anzahl italienischer Bilder. Unter den deutschen Künstlern sind Christian Wilhelm Ernst Dietrich und Johann Georg Stuhr mit zahlreichen Werken vertreten. Zwanzig Gemälde wurden bereits in einer Auktion am 8. Dezember 1797 angeboten (Kat. 269).
273 1798/08/10-1798/08/11
[Lugt 5798]
Packischefsky; Hamburg, Börsensaale Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 178 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß einer vortreflichen Sammlung Cabinets=Gemählde, von Niederländischen, Französischen und Italiänischen Meistern, nebst einigen säubern Kupferstichen, der berühmtesten Künstler, welche am Freytage und Sonnabend, den lOten und 1 lten August 1798, öffentlich auf dem Börsensaale, durch die Mäckler Packischefsky und Lucht, gegen baare Zahlung, in grob Dänisch Courant, verkauft werden sollen. Am Donnerstage, den 9. August, sind diese Gemähide daselbst in beliebigen Augenschein zu nehmen; und das Verzeichniß ist bey gedachten Mäcklern, den Armen zum Besten, für 4 Schillinge zu haben. Hamburg, gedruckt bey Dietrich Anton Harmsen Wittwe. Kommentar: In dem 26 Seiten umfassenden Katalog der Makler Peter Hinrich Packischefsky und Lucht sind die Gemälde auf den Seiten 3 bis 17 (Nrn.l bis 145) und 23 bis 26 (Nrn. 214 bis 246) verzeichnet. Dazwischen werden Miniaturen, Aquarelle und Kupferstiche aufgeführt. Eine ähnliche Unterteilung des Katalogs findet sich in Kat. 270. Die Beschreibungen sind zu Beginn des Katalogs ausführlicher als bei den zum Ende hin aufgeführten Gemälden. Verzeichnet sind jeweils der Künstlername, die Bildmaße, der Bildgegenstand, das Material und die Rahmung. Zur Versteigerung gelangten in der Hauptsache Gemälde der holländischen und deutschen Schule, gefolgt von einer kleinen Gruppe von Gemälden der flämischen Schule. Eine große Anzahl der Bilder ist ohne Angabe eines Künstlernamens. Die Losnummer 1 verzeichnet Abraham und Hagar von Rembrandt.
274 1798/11/14-1799/11/16
[Lugt 5819]
Packischefsky; Hamburg, Börsensaale Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 182
Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß einer sehr guten Gemählde=Sammlung aus den Niederländischen, Französischen und Italiänischen Schulen, nebst einigen loosen und sauber eingefaßten Kupferstichen, und Kupferstichwerken, der berühmtesten Künstler, welche am Mittwochen, Donnerstage und Freytage, den 14ten, 15ten und 16ten November 1798, öffentlich auf dem Börsensaale, durch die Mäckler Packischefsky und Lucht, gegen baare Zahlung, in grob Dänisch Courant, verkauft werden sollen. Am 14ten November, wenn die loosen Kupferstiche verkauft werden, sind die Gemähide und eingefaßten Kupferstiche daselbst zu besehen. Das Verzeichniß hiervon ist bey gedachten Mäcklern, den Armen zum Besten, für 4 Schillinge zu haben. Hamburg, gedruckt bey Dietrich Anton Harmsen Wittwe. Kommentar: In diesem Katalog der Hamburger Makler Peter Hinrich Packischefsky und Lucht wurde neben 182 Losnummern mit Gemälden auch eine Sammlung von gerahmten und losen Kupferstichen, Kupferstichwerken, Gouachen und anderen "Kunst=Sachen" verzeichnet, darunter ein Münzkabinett. Die Gemälde ab Losnummer 146 werden als "Cabinets=Gemählde" bezeichnet. Die Einträge sind in der Regel knapp gehalten. Dem jeweiligen Künstlernamen und den Maßen folgt zumeist eine sehr genaue Beschreibung des Bildgegenstands; die Angaben zum Material und der Hinweis auf den Rahmen beschließen den Eintrag. Mehrere Bilder der Sammlung gelangten bereits im Januar desselben Jahres zur Versteigerung, so etwa die Nr. 146, Ein alter ehrwürdiger Bischof, einen jungen Prinzen unterrichtend, ein Gemälde Riberas, das sich heute in Posen befindet (vgl. Kat. 270, Nr. 1). Auch die beiden Ecce-Homo-Darstellungen von Giorgione stammen, wie andere Gemälde der italienischen Schule, darunter auch ein Mantegna zugeschriebenes Gemälde, aus der vorausgegangenen Auktion (Kat. 270, Nm. 3 und 4). Zur Versteigerung gelangten vor allem Gemälde der holländischen, flämischen, deutschen und italienischen Schule, dagegen finden sich nur wenige französische Werke. Die angegebenen Maße der Gemälde schließen den Rahmen mit ein, wie ein Vergleich mit den Angaben in Katalog 270 ergibt.
275 1798/12/10
[Lugt 5832]
[Anonym]; Wien, In der obern Pfarrgasse, ob der Wien Nro.53 Verkäufer nach Titelblatt: Aus der Verlassenschaft des Herrn Prof. Adam in Wien. Neustadt Verkäufer: Adam, Prof. (Wien) Lose mit Gemälden: 71 Standorte: AKW Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniss der aus der Verlassenschaft des Herrn Prof. Adam in Wien, Neustadt hinterlassenen beträchtlichen Anzahl von Gemählden, Kupferstichen, Zeichnungen, mannigfaltigen physischen und mathematischen Instrumenten, Landcharten und anderen Kunststücken, welche den [Auslassung] December dieses Jahrs in der obern Pfarrgasse, ob der Wien Nro. 53, im ersten Stocke, an den Meistbiethenden öffentlich veräussert werden. Wien 1798. Kommentar: In diesem anonymen Wiener Versteigerungskatalog wurde der Nachlaß des Wiener Professors Adam verauktioniert. Im Exemplar AKW wurde der Tag, an dem die Auktion stattfand (der 10. des Monats), handschriftlich in der Auslassung eingetragen. Neben zahlreichen Kupferstichen und technischen Instrumenten umfaßte die Kollektion auch 70 Gemälde. Numeriert sind nur die ersten 68 Lose, dann folgt summarisch der Hinweis auf eine Vielzahl von zweitrangigen Bildern, von denen nur noch das erste ausführlich und mit Wertungen durchmischt beschrieben wird. Es handelt sich um eine Diana-Szene von Hendrik van Baien und Jan Brueghel d.Ä. KATALOGE
153
(Nr. [70]). Ansonsten sind die Beschreibungen kurz gehalten. In der Sammlung sind alle Schulen vertreten, der größte Teil der Bilder zählt jedoch zur österreichischen und deutschen Schule. Anonym bleibt rund ein Drittel der Gemälde.
276 1799/00/00
Daten unbekannt
[Anonym]; Flensburg, In dem Hause der Witwe des verstorbenen Verkäufer nach Titelblatt: Controlleur Benzon
enthält die Kollektion nur sechs deutsche Gemälde, darunter zwei Tafeln von Hans Holbein d.J. Rund zwei Drittel der Bilder sind der flämischen und holländischen Schule zuzurechnen. Auch die italienischen Schulen sind mit 19 Bildern relativ stark vertreten.
278 1799/00/00
Daten unbekannt
J.F. Rauch; Leipzig, In der Grimmischen Gasse, No. 579
Verkäufer: Benzon (Flensburg)
Verkäufer nach Titelblatt: J.F. Rauch Verkäufer: Rauch, J.F.
Lose mit Gemälden: 89
Lose mit Gemälden: 100
Standorte: SAF1 Nicht annotiert.
Standorte: BNP Nicht annotiert. SBBa Nicht annotiert. KKD Im Zweiten Weltkrieg vernichtet.
Titelblatt: Verzeichniß einer auserlesenen und sehr schönen Gemälden= und Kupferstichen=Samlung, von den beßten Italienischen, Französischen, Englischen und Deutschen Meistern verfertiget, durchgängig in säubern Rahmen gefaßt, welche am [Auslassung] und folgende Tage in dem Hause der Witwe des verstorbenen Herrn Controlleur Benzon in Flensburg öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden sollen. Gedruckt bey Christoph Jäger 1799. Kommentar: In diesem Flensburger Versteigerungskatalog wird die Sammlung Benzon angeboten. In den durchweg knappen Beschreibungen der Gemälde werden bis auf wenige Ausnahmen keine Künstlernamen genannt, doch scheint es sich nicht um anonyme Werke zu handeln. Als Künstler erwähnt wird nur der dänische Maler Jes Jessen. Aufschluß könnte ein zweibändiges "Verzeichnis der dem [...] Controlleur Benzon zugehörigen Bücher dito Gemäldenund Kupferstich-Sammlung" (Flensburg 1799) geben, das im Stadtarchiv Flensburg verwahrt wird (Stadtarchiv Flensburg, HS 708, Bd. 2,3).
277 1799/00/00
Daten unbekannt
[Anonym]; Leipzig Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 145 Standorte: *ESP Katalog mit gedruckten Schätzpreisen und Annotationen in Bleistift mit einigen erzielten Preisen, die jedoch bei einer Beschneidung des Katalogs verloren gegangen sind. Titelblatt: Catalogue d'une collection de deux cent tableaux originaux actuellement a vendre a Leipzig. 1799. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog wurde vermutlich eine nach Leipzig importierte französische Sammlung verkauft. Im kurzen "Avis" wird darauf hingewiesen, daß alle Maßangaben nach altem französischen Maß (pouce de Roi) gemacht werden. Die Schätzpreise sind in Louis ausgestellt. Vermutlich war der Eigentümer der Sammlung darauf bedacht, möglichst viele Bilder zu verkaufen. Mit einem abgestuften Rabattsystem sollten Interessenten zum Kauf angeregt werden. Wer 100 Louis investierte, sollte 5 Prozent Rabatt erhalten, bei höherem Einsatz erhöhte sich der Rabattwert jeweils stufenweise. Die gesamte Sammlung konnte für 1.900 Louis erworben werden. Daß tatsächlich die ganze Sammlung versteigert wurde, deuten die Preisangaben des Exemplars ESP an, die jedoch nicht mehr lesbar sind, weil der Katalog stark beschnitten wurde. Insgesamt werden 145 Lose aufgeführt und nicht zweihundert, wie der Titel des Katalogs verspricht. Die Bildbeschreibungen sind sehr ausführlich und mit Wertungen wie "Ce tableau est d'une belle ordonnance" versehen. Der Künstlername wird jeweils als Überschrift vorangestellt. Auch das Profil der Sammlung spricht für eine Herkunft aus Frankreich. Der Anteil der deutschen Bilder ist gering, insgesamt 154
KATALOGE
Titelblatt: Catalogue de Tableaux precieux des ecoles d'Italie, de Flandre, de Hollande, D'Allemagne et de France, provenant de plusieurs cabinets du premier rang appartenants ä J. F. Rauch. Leipzig 1799. Kommentar: Bei diesem Verzeichnis der Kunsthandlung J. F. Rauch handelt es sich vermutlich ebenfalls um einen Versteigerungskatalog, auch wenn er in der handschriftlichen Vorbemerkung eines anderen Katalogs (Kat. 283) als Lagerkatalog bezeichnet wird. In einem kurzen Vorwort ist von dem Angebot als von einer "reunion d'un nombre de tableaux choisis" die Rede, die jederzeit ihren Platz in Sammlungen ersten Ranges hätten. Insgesamt umfaßt der Katalog 24 Seiten und 98 Losnummern, wobei die Nummern 51 und 55 zweimal vergeben wurden. In einigen Losen werden unter einer Nummer zwei Pendants offeriert. Der Katalog ist nach Schulen geordnet. Der Schwerpunkt liegt bei den Niederländern. Eine letzte Gruppe sind die "Tableaux de divers ecoles", in der offenbar die unsicheren Zuschreibungen versammelt sind, denn eigentlich wären ein Bassano (Nr. 91) oder ein Jan van Goyen (Nr. 94) der italienischen bzw. niederländischen Schule zuzuordnen, oder es handelt sich hier um Bilder, die noch nachträglich hinzugefügt wurden. Die Beschreibungen der Darstellung sind nicht sehr ausführlich. Vergleichsweise detailliert sind hingegen die Angaben zum Stil und Effekt der Bilder. Zu einem Gemälde von G.M. Crespi (Nr. 6) heißt es etwa: "c'est une production du meilleur temps de l'artiste, digne d'entrer dans le plus beau cabinet", und zu Philipp Peter Roos (Nr. 7): "on y distingue la touche Savante et une belle vigueur de couleur". Das unter dem Namen Rembrandt verzeichnete Gemälde Diana und Endymion (Nr. 18) ist möglicherweise mit einem Govert Flinck zugeschriebenen Bild in der Sammlung des Fürsten von und zu Liechtenstein in Vaduz identisch.
279 1799/00/00
Daten unbekannt
[Anonym]; Würzburg, Haus des Sammlers Verkäufer nach Titelblatt: Herr geheim Rath, Kreisgesandt und Hofkammer-Directeur Hartmann Verkäufer: Hartmann, Anton Lose mit Gemälden: 1256 Standorte: SBBa Einzelne Lose mit unleserlichen Buchstaben markiert. Aus dem Besitz von Joseph Heller. Titelblatt: Verzeichniß sämmtlicher des seligen hochfürstl. Würzburg. Herrn geheimen Raths, Kreisgesandten und Hofkammer=Directors Hartmann hinterlassenen Gemälde mit angemerkten Meistern, der Höhe und Breite, welche in der Behausung des gedachten Herrn geheimen Rathes in Augenschein zu nehmen, und an Liebhaber um billige Preise zu verkaufen sind. Würzburg 1799.
Kommentar: In diesem mit 1.256 Gemälden sehr umfangreichen Katalog wird der Nachlaß des Würzburger Hofkammer-Direktors Anton Hartmann aufgelistet. Wahrscheinlich handelt es sich nicht um einen Auktionskatalog, sondern nur um einen Verkaufskatalog. Hartmann war der Schwiegersohn Balthasar Neumanns und erbte einige Bilder aus dessen Sammlung, so wahrscheinlich die Bilder Mucius Scaevola vor Porsenna und Coriolan vor den Mauern Roms von Giovanni Battista Tiepolo (Nrn. A243 und A244). Sie befinden sich heute wie zwei weitere auf dieser Auktion angebotene Werke (A160 und A448) im Martin-von-Wagner-Museum in Würzburg. Erst im Jahre 1834 wurde die Sammlung mit dem Nachlaß des Sohnes, David Hartmann, in Würzburg versteigert. Vermutlich wurden jedoch schon vorher einzelne Bilder verkauft, denn der Katalog von 1834 unterscheidet sich deutlich von dem Verzeichnis von 1799. Die einzelnen Bildbeschreibungen sind kurz gehalten, so heißt es beispielsweise bei der Losnummer 2: "Die drey Grazien, von Julius Pipi, genannt Romano. Auf Holz mit Kreidegrunde." Die Maßangaben sind neben den Beschreibungen in einer Tabelle aufgeführt. Signaturen und Datierungen werden angegeben. Sofern die einzelnen Zuschreibungen gültig sind, handelt es sich quantitativ wie qualitativ um eine bedeutsame Sammlung. Die Gemälde sind in zwei Abteilungen aufgeführt. Nach dem Los 759 beginnt auf Seite 45 eine zweite Folge von Gemälden, "welche nicht aufgehangen sind", deren Losnummern von Al bis A497 reichen. Gut vertreten sind neben der holländischen und flämischen Schule vor allem die Werke deutscher Künstler. Einzelne süddeutsche Maler sind mit zahlreichen Gemälden präsent, so Peter von Bemmel mit 38 Bildern und Lorenz Strauch mit 54 Werken. Bei den italienischen Schulen liegt das Schwergewicht auf Malern des Barock, so Luca Giordano, Giovanni Battista Piazzetta und Giovanni Antonio Pellegrini und Giovanni Battista Tiepolo. Bei rund 130 Gemälden wird kein Künstlername genannt, hier bleiben die Werke anonym. Das Exemplar SBBa stammt aus dem Besitz des Bamberger Kunstschriftstellers Joseph Heller, der einzelne Bilder, die ihn interessierten, erst in Bleistift mit einem nicht zu identifizierenden Zeichen markierte, anschließend in Tinte mit einem Häkchen versah und in einem handschriftlichen Index im inneren Buchdeckel aufnahm. Außerdem sind einzelne Werke von Monogrammisten mit einem Zeichen in Bleistift hervorgehoben.
280 1799/01/07
und folgende Tage
[Anonym]; Wroclaw [Breslau], Königl. Oberamts=Haus Verkäufer nach Titelblatt: Kriegsrath Frandorff Verkäufer: Frandorff Lose mit Gemälden: 91 Standorte: ESP Nicht annotiert. Ehemals BMB. Titelblatt: Verzeichniß der zu der Kriegsrath Frandorffschen Verlassenschaft gehörigen großen Theils seltenen goldenen u. silbernen Medaillen, auch Friedrichs= und Louisd'or, Ducaten, Taler, Gulden und anderer Münzen, auch diverser Gemähide und Zeichnungen welche auf den 7ten Januar 1799 und folgende Tage, jedoch mit Ausnahme der Sonnabende und Sonntage, auf dem Königl. Oberamts=Hause zu Breslau täglich Vormittag von 9 bis 12 Uhr und Nachmittag von 3 bis 6 Uhr öffentlich gegen baare Bezahlung in Königl. Preußischem Courant an den Meistbietenden versteigert werden sollen. Breslau, gedruckt bei Wilhelm Gottlieb Korn. Kommentar: In diesem mit 80 Seiten umfangreichen Katalog wurde in erster Linie die Münzsammlung des Kriegsrats Frandorff angeboten. Am Schluß des Kataloges werden in 93 Losnummern auch "Gemählde, Zeichnungen und Kupferstiche" aufgeführt. Da bis auf wenige Ausnahmen keine Materialangaben gemacht werden, läßt sich nicht eindeutig erkennen, ob es sich um Gemälde oder graphische Arbeiten handelt. Die Beschreibungen der Bilder sind kurz gehalten,
meist nur schlagwortartig. Wahrscheinlich wurde als Vorlage für den Katalog ein Inventar verwendet. Bei rund 20 Gemälden wird ein Künstlername genannt. Unter den zugeschriebenen Werken finden sich vor allem holländische und flämische Bilder des 17. sowie deutsche Kunst des 18. Jahrhunderts. Mehrfach werden Bilder als Kopien nach einem anderen Künstler vorgestellt. Als "sehr schön" wird ein datiertes Seestück von Jan van Goyen (Nr. 27) hervorgehoben.
281 1799/08/09-1799/08/10
[Lugt 5963]
Packischefsky; Hamburg, Börsensaale Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 150 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß einer Sammlung vorzüglich schöner Cabinets=Gemählde, von den ersten Niederländischen, Italienischen und Deutschen Meistern, welche am 9ten und lOten August 1799 öffentlich auf dem Börsensaale, durch die Mackler Packischefsky und Lucht, gegen baare Zahlung in grob Dänisch Courant verkauft werden sollen. Am 8ten August sind diese Gemähide daselbst zu besehen; und das Verzeichniß ist bey gedachten Macklern, den Armen zum Besten, für 4 Schillinge zu haben. Hamburg, gedruckt bey D. A. Harmsen Wittwe. Kommentar: In dieser Versteigerung der Hamburger Makler Peter Hinrich Packischefsky und Lucht gelangten 150 Gemälde zum Verkauf. Neben den Gemälden wurden auch eine Sammlung Kupferstiche sowie "48 Stück vergoldete Rähmen" verauktioniert. Im Unterschied zu anderen Hamburger Katalogen werden die Gemälde eines Malers in vielen Fällen nacheinander verzeichnet, wie die Mieris und Anthonie Palamedesz. zugeschriebenen Gemälde zu Beginn des Katalogs (Nrn. 3 bis 5 und 7 bis 9). Die Gemälde gehörten überwiegend der holländischen und flämischen Schule an. Es handelt sich zum größten Teil um Landschaften - so beispielsweise von Jan Both oder Jacob van Ruisdael - sowie um Genreszenen, darunter mehrere Gemälde von Joost Droochsloot oder Anthonie Palamedesz. Darüber hinaus verzeichnet der Katalog eine kleine Gruppe von Gemälden der flämischen und deutschen Schule sowie vier Werke von italienischen Künstlern. 282 1799/10/10-1799/10/11
[Lugt 5974]
Packischefsky; Hamburg, Börsensaale Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 100 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß einer vorzüglich schönen Sammlung Cabinets=Gemählde, von den ersten Niederländischen, Italienischen, Französischen und deutschen Meistern, wie auch gefaßte und ungefaßte Kupferstiche, welche am lOten und Ilten October 1799 öffentlich auf dem Börsensaale, durch die Mackler Packischefsky und Lucht, gegen baare Zahlung in grob Dänisch Courant verkauft werden sollen. Am 9ten October sind obige Sachen daselbst zu besehen; und das Verzeichniß ist bey vorbesagten Macklern, den Armen zum Besten, für 4 Schillinge zu haben. Hamburg, gedruckt bey D. A. Harmsen Wittwe. Kommentar: In dieser Versteigerung der Hamburger Makler Peter Hinrich Packischefsky und Lucht gelangten 100 Gemälde zum Verkauf, die auf den Seiten 3 bis 10 verzeichnet sind. Die Kupferstiche folgen auf den Seiten 10 bis 12. Insgesamt 30 Gemälde bleiben anonym, die zugeschriebenen Werke stammen aus allen Schulen. Die Werke der italienischen Schule sind so namhaften Künstlern wie KATALOGE
155
Francesco Albani, Correggio, Carlo Dolci oder Guercino zugeschrieben. Bei den deutschen Gemälden ist der Landschaftsmaler Christian Wilhelm Ernst Dietrich mit neun Werken gut vertreten.
283 1799/10/17-1799/10/18
[Lugt 5976]
[Anonym]; Leipzig, Hörsaale des Heern Prälaten D. Burschers, im Paulino Verkäufer nach Titelblatt: Keine Verkäufer nach anderer Quelle: Rauch Verkäufer: Rauch, J.F. Lose mit Gemälden: 106 Standorte: *BDu Annotiert mit allen Käufernamen und Preisen. %
Titelblatt: Verzeichniss einer vortrefflichen Gemälde-Sammlung von den berühmtesten Italienischen, Flamändischen, Teutsch und Französischen Meistern. Welche Donnerstags den 17ten Oct. und folgende Tage im Hörsaale des Herrn Prälaten D. Burschers, im Paulino öffentlich versteigert werden sollen. Leipzig, 1799. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog wurden ausschließlich Gemälde offeriert. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Verkauf der Kunsthandlung J. F. Rauch, denn im Exemplar BDu findet sich der handschriftliche Hinweis: "Diese Gemälde gehörten dem Bilderhändler Rauch." In diesem Exemplar wurde in späterer Zeit zudem auf einen Lagerkatalog der Kunsthandlung Rauch (Kat. 278) verwiesen, der in französischer Sprache verfaßt ist. Auch wird in einer handschriftlichen Vorbemerkung festgehalten: "Dresd. Lagerkat. enthält anderes Material als unser Verst.Kat." In dem übersichtlich und großzügig gestalteten Katalog von 26 Seiten werden die 106 Lose in knappen Texten beschrieben, in einigen Fällen aber auch sehr ausführlich. Auf der letzten Seite werden die Losnummern 99 bis 106 nur mit schlagwortartigen Titeln und ohne Maß- oder Materialangaben abgehandelt. Vermutlich handelt es sich hier um Bilder, die nachträglich in die Versteigerung genommen wurden und nicht mehr ausführlich bearbeitet werden konnten. Vor jeder Losnummer wird der Künstlername als Überschrift abgedruckt, wobei zwischen Original, Kopie und "in der Manier von" differenziert wird. Es tauchen nur wenige anonyme Bilder auf, die als "unbekannter Meister" vorgestellt werden. Im Gegensatz zu anderen Leipziger Auktionen konzentriert sich das Angebot dieser Auktion auf ältere Kunst, zeitgenössische deutsche Werke des 18. Jahrhunderts wurden überhaupt nicht angeboten. Statt dessen erscheinen mehrere altdeutsche Gemälde, so von Albrecht Altdorfer, Lucas Cranach und Hans Holbein d.J. Der Schwerpunkt der Sammlung lag auf holländischen und flämischen Bildern des 17. Jahrhunderts, darunter allein sechs Werke von David Teniers. Aber auch französische Bilder, etwa von Claude Lorrain und Nicolaus Poussin, sowie rund zwanzig italienische Arbeiten sind vertreten. Unter den italienischen Werken sind allerdings zahlreiche Bilder, die als Kopien bezeichnet werden. Nach den Angaben des annotierten Exemplars blieben die Preise überwiegend auf niedrigem Niveau und überstiegen kaum 10 Taler. Einzelne Gemälde erzielten jedoch relativ hohe Preise, so wurde die Versuchung des Hl. Antonius von David Teniers d.J. (Nr. 95) von dem Leipziger Kunsthändler Pfarr mit 72 Talern und 8 Groschen bezahlt und eine Mondscheinlandschaft von Aert van der Neer (Nr. 101) erreichte sogar ein Ergebnis von 85 Talern und 12 Groschen. Claude Lorrains Landschaft an der See (Nr. 49) wurde bei 39 Talern zugeschlagen und ging an den Käufer Blümner. Lit.: Trautscholdt 1957.
284 1799/12/04-1799/12/06
[Lugt 5989]
Packischefsky; Hamburg, Börsensaale Verkäufer nach Titelblatt: Keine 156
KATALOGE
Lose mit Gemälden: 241 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß einer vorzüglich schönen Sammlung Cabinets=Gemählde, von den ersten Niederländischen, Italienischen, Französischen und Deutschen Meistern, wie auch gefaßte und ungefaßte Kupferstiche, welche am 4ten, 5ten und 6ten December 1799 öffentlich auf dem Börsensaale, durch die Mackler Packischefsky und Lucht, gegen baare Zahlung in grob Dänisch Courant, verkauft werden sollen. Am 4ten December werden die Kupferstiche verkauft, und die Gemähide zum Besten aufgestellt. Das Verzeichnis ist bey vorbesagten Macklem, den Armen zum besten, für 4 Schillinge zu haben. Kommentar: In dieser Versteigerung der Hamburger Makler Peter Hinrich Packischefsky und Lucht gelangten 241 Gemälde zum Verkauf. Die Beschreibungen in den Einträgen sind knapp gehalten, mitunter wird nur der Titel des Bildes mit den Angaben der Maße und des Rahmens angegeben. Die Schreibweise der Künstlernamen weicht in vielen Fällen von der in den anderen Katalogen ab (Drogschlod für Droochsloot, Muscherong für Moucheron, Pusseng für Poussin). Der Schwerpunkt dieser Auktion lag auf Werken der flämischen und holländischen Schule, nur wenige Bilder stammen von französischen, deutschen oder italienischen Künstlern. Unter den flämischen Künstlern ist Jan Brueghel d.Ä. mit zehn, David Teniers mit neun Gemälden vertreten, weitere fünf Landschaften sind von Joos de Momper d.J.
285 1799/12/23-1799/12/31
[Lugt 5996]
[Anonym]; Wien, Leopoldstadt, a la Jägerzeil No. 511 Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 87 Standorte: *MPA Annotiert in Bleistift und Tinte mit einigen Preisen. Von dem unbekannten Autor der Annotationen wurden zwei Lose markiert, die er für sich selbst gekauft hat. Titelblatt: Desription [sic] d'une magnifique collection de tableaux des plus celebres Peintres, qui seront expose a une Vente publique le 23. 24. 28. 30. 31. du mois de Decembre 1799. dans la Leopoldstadt, a la Jägerzeil No. 511. au premier Etage. Vienne 1799. Kommentar: In diesem anonymen Wiener Katalog sind 87 Lose mit Gemälden verzeichnet. Der in französischer Sprache abgefaßte Katalog ist nicht paginiert. Die Beschreibungen sind knapp und ohne Maßangaben, beispielsweise heißt es zu Losnummer 1: "Une Venus de Grandeur naturelle, peint, sur Bois par Giorgione maitre de Titien." Die Angabe des Materials fehlt verschiedentlich, vor allem bei den niederländischen Künstlern. Die Gemälde sind unterteilt in die "Peintres Italiens" (Nrn. 1 bis 47) und die "Peintres flamands" (Nm. 48 bis 87). Unter einzelnen Nummern sind gelegentlich bis zu vier Gemälde verzeichnet. Im Vergleich zu anderen Sammlungen aus dem deutschsprachigen Raum ist vor allem die italienische Schule mit einem breiten Spektrum vom Ende des 16. bis zum 18. Jahrhundert vertreten. Nach den im Katalog angegebenen Künstlernamen zu urteilen, handelt es sich um eine bedeutendere Sammlung. So finden sich beispielsweise vier Werke von Tizian. Anonym bleiben nur vier Gemälde. Im Exemplar MPA sind einige wenige Lose mit Preisangaben versehen. Da hier runde Beträge genannt werden, handelt es sich vermutlich um Preise, die ein Bieter zu zahlen höchstens bereit war. Bei zwei Bildern von Gerard ter Borch steht noch zusätzlich "moi". Diese Bilder sind vermutlich dem Besitzer dieses Exemplars zugefallen.
286 1800/00/00
Daten unbekannt
[Anonym]; Frankfurt am Main, Im Braunfels Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 127 Standorte: SBFI Nicht annotiert. SBF II Nicht annotiert. SIF Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichnis einer Sammlung von Hundert und Dreißig theils kostbaren Gemälden aus den drei Schulen welche die zweite Meßwoche im Braunfels zu Frankfurt am Main sollen versteigert werden. 1800. Kommentar: In diesem anonymen Frankfurter Versteigerungskatalog wurden in 130 Losen 127 Gemälde angeboten. Die Auktion fand im Haus Braunfels in Frankfurt statt. Im Vergleich zu früheren Frankfurter Auktionskatalogen ist die Gestaltung des Titelblatts sehr zurückhaltend, ähnelt jedoch einem weiteren anonymen Versteigerungskatalog desselben Jahres aus Frankfurt, in dem auch sechs Bilder dieser Auktion wieder auftauchen (Kat. 287). Die meisten Beschreibungen sind knapp gehalten, vereinzelt jedoch sehr ausführlich und mit Wertungen versehen. Bei einem Bild von Comelis Norbertus Gysbrechts (Nr. 46) wird beispielsweise ein Vergleich mit zwei anderen Gemälden des Meisters aus der Galerie in Schleißheim angestellt. Die Bilder sind alphabetisch nach Künstlern aufgelistet. In der Sammlung überwiegen Werke holländischer und flämischer Künstler. Relativ gut vertreten ist auch die französische Schule, während die deutsche Schule des 18. Jahrhunderts nur sehr schwach repräsentiert war.
287 1800/00/00
und folgende Tage
[Anonym]; [Frankfurt am Main] Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 153 Standorte: *ESP I Annotiert mit einigen wenigen Preisen. Ehemals BMB. ESP II Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß einer Sammlung von kostbaren Gemählden aus den drey Schulen. 1800. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog wird kein Erscheinungsort angegeben, er ähnelt jedoch in Typographie und Aufbau einem Frankfurter Versteigerungskatalog aus demselben Jahr (Kat. 286). In beiden Katalogen werden die Bilder zunächst alphabetisch aufgelistet, wobei bei dem hier besprochenen Katalog diese Folge im hinteren Teil nicht konsequent durchgehalten ist. Außerdem tauchen insgesamt sechs Bilder der früheren Versteigerung in dieser Auktion erneut auf. Auf dem Titelblatt des Katalogs aus der Eremitage (vermutlich ehemals BMB) finden sich die handschriftlichen Verweise "13 October" und "Leipzig". Es ließe sich daher auch die Vermutung anstellen, daß es sich hier um die bei Frits Lugt erwähnte Auktion der Leipziger Kunsthandlung Hecht vom 13. Oktober 1800 handeln könnte (Kat. 294). Doch stimmt die bei Lugt angegebene Anzahl der Gemälde nicht mit der dieses Katalogs überein. Die Versteigerung Hecht soll 182 Bilder umfaßt haben, der hier vorliegende Katalog enthält jedoch nur 155 Gemälde. Der Katalog verzeichnet bis auf eine Ausnahme ausschließlich Gemälde. Als Losnummern 116 und 117 werden zwei Pastelle aufgeführt, die auf Elfenbein gemalt sind. Unter der letzten Losnummer 155 wird eine unbekannte Anzahl nicht näher beschriebener Gemälde zusammengefaßt. Ansonsten sind die einzelnen Gemälde ausführlich beschrieben; jeweils am Ende stehen die Angaben der Maße und des Materials. In die Bildbeschreibungen fließen Anmerkungen zur stilistischen Einordnung mit ein. So malt Dirk van Bergen (Nr.
10) "im Geschmack von Adrian van de Velde", während der Verfasser bei einem Gemälde von Crayer (Nr. 16) anhand der "Manieren" die Mitarbeit von Rubens für wahrscheinlich hält. Auch wird verschiedentlich die malerische Wirkung angepriesen, etwa wenn ein Gemälde Van de Veldes (Nr. 72) "vieles die Empfindung erregendes Durchdringende" aufweise; ein Veronese (Nr. 83) "macht einen pikanten Effekt, ist fett, und sehr leicht gemahlt". Gelegentlich wird auch auf den guten Erhaltungszustand eines Gemäldes hingewiesen (Nr. 148, Federico Barocci, "vollkommen konservirt").
288 1800/00/00
Daten unbekannt
Rost; Leipzig Verkäufer nach Titelblatt: Rostischen Kunsthandlung Verkäufer: Rost, Carl Christian Heinrich Lose mit Gemälden: 121 Standorte: SBBa Nicht annotiert. Aus dem Besitz von Joseph Heller. Titelblatt: Originalgemählde alter und neuer Meister aus allen Schulen, welche in der Rostischen Kunsthandlung zu Leipzig zu verkaufen sind. Kommentar: Im Gegensatz zu den früheren Veröffentlichungen der Kunsthandlung Rost ist dieser Katalog weit weniger sorgfältig zusammengestellt. Er wurde nicht in die Reihenzählung der Kataloge der Leipziger Kunsthandlung aufgenommen. Auch die einzelnen Lose sind nicht numeriert, sondern alphabetisch geordnet. Schließlich weicht auch die Typographie von den sonstigen Katalogen dieses Auktionshauses ab. Es ist deshalb anzunehmen, daß dieser Katalog erst nach dem Tod des Kunsthändlers Carl Christian Rost (1741-1798) zusammengestellt wurde, als die Kunsthandlung von den Erben noch einige Jahre weitergeführt wurde. Wahrscheinlich handelt es sich nicht um einen Auktions-, sondern um einen Lagerkatalog, da keine Angaben zum Versteigerungsort und zum Termin gemacht werden. Es ist anzunehmen, daß dieser Katalog um 1800 publiziert wurde. Im Vergleich zu früheren Verkäufen fällt die hohe Qualität der angebotenen Werke auf. In den vorhergehenden Auktionen dieser Kunsthandlung wurden Gemälde meist nur als Zugabe zu den graphischen Arbeiten offeriert. Bei den Gemälden überwogen deutsche Arbeiten des 18. Jahrhunderts und Kopien. Der Katalog beginnt mit einem kurzen Vorwort, in dem der Aufbau des Katalogs erläutert wird. Die durchgängig knapp abgefaßten Beschreibungen enthalten Künstlernamen, Material- und Maßangaben. Selbst bei bekannteren Künstlern, wie etwa Jacob Jordaens, bleibt die Bildbeschreibung auf reine Sachangaben beschränkt; Qualitätsurteile über Stil und Malweise fehlen fast vollständig. Allerdings wird Roelof van Vries mit Ruisdael verglichen. Bei Rubens' Meleager bringt der Atalanta den Kopf des Ebers (Nr. [83]), eine kleine Kopie des Gemäldes im Kunsthistorischen Museum in Wien (Inv.-Nr. 523), werden Angaben zur Provenienz gemacht: "Rubens mahlte es für eine angesehene Familie, Namens Ville, bey der es bis zu dem Todte des letzten derselben, der Pensionarius der Stadt Harlem war, gewesen ist." Unter den insgesamt 121 Gemälden ist die Mehrzahl der holländischen und flämischen Schule des 17. Jahrhunderts zuzurechnen. Nur 19 Werke lassen sich der deutschen und zehn der italienischen Schule zuordnen. Kein einziges Werk ist anonym. Angesichts der homogenen Struktur der Sammlung mit starkem Schwerpunkt auf der niederländischen Schule läßt sich vermuten, daß hier die Kollektion eines einzigen Sammlers angeboten wurde. In den früheren Verkäufen der Rostschen Kunsthandlung wurden zumeist Kunstwerke verschiedener Einlieferer verkauft. Lit.: Trautscholdt 1957.
KATALOGE
157
289 1800/00/00
Daten unbekannt
J.H. Böttcher; Berlin? Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 153 Standorte: ESP Nicht annotiert. Ehemals BMB. Titelblatt: Verzeichniß einer auserlesenen Sammlung vorzüglicher Original=Oel=Gemälde von berühmten Meistern aus mehreren Schulen, welche zu verkaufen sind bei J. H. Böttcher, Gemäldehändler. Preis 2 Groschen. Kommentar: Zu diesem Auktionskatalog des Kunsthändlers J. H. Böttcher lassen sich kaum Angaben machen. Weder ein Ort noch ein Datum sind hier angegeben. Die Einordnung in das Jahr 1800 ist daher nur das Ergebnis einer ungefähren Schätzung nach der Aufmachung und dem Charakter des Katalogs. Nach dem angegebenen Preis von 2 Groschen zu urteilen, handelt es sich hier vermutlich um einen Katalog aus dem preußischen Raum. Ursprünglich wurde das Exemplar ESP auch in einer Berliner Bibliothek verwahrt und gelangte erst nach 1945 nach St. Petersburg. Wahrscheinlich diente dieser Katalog als eine Lagerliste und nicht als Auktionskatalog. Es werden insgesamt 153 Gemälde verzeichnet. Die meisten Einträge beschreiben das jeweilige Gemälde detaillierter. Maßangaben fehlen meist, das Material wird nur manchmal angegeben. In dieser kleinen, qualitätvollen Sammlung überwiegen holländische und flämische Bilder des 17. Jahrhunderts. Hinzu kommen auch einige italienische, französische, deutsche und altdeutsche Werke, darunter eine Maria auf dem Sterbebette von Albrecht Altdorfer (Nr. 121).
290 1800/01/00
Daten unbekannt
[Anonym]; Leipzig Verkäufer nach Titelblatt: A. F. Oeser, Director und Professor der Churfürstl. Sächs. Akademie der bildenden Künste zu Leipzig Verkäufer: Oeser, Adam Friedrich Lose mit Gemälden: 157 Standorte: BDu Nicht annotiert. UBH Nicht eingesehen. Titelblatt: Verzeichnis von Original-Gemälden aus der Verlassenschaft des verstorbenen A. F. Oeser, Directors und Professors der Churfürstl. Sächs. Akademie der bildenden Künste zu Leipzig. So aus freyer Hand verkauft werden. Leipzig, im Monat Januar 1800.
Fassung des Bildes Saul bei der Hexe von Endor (Nr. 1), das zunächst von Gottfried Winkler gekauft wurde. In der zweiten Abteilung werden unter dem Titel "Fremde Meister" insgesamt 102 Werke anderer Künstler notiert, darunter aber auch einige Kopien von Oeser und seinem Sohn Friedrich Ludwig nach Werken anderer Künstler. Unter den wenigen späten italienischen Arbeiten finden sich zwei Werke von Alessandro Magnasco, zwei Arbeiten des von Oeser besonders geschätzten Giulio Carpioni und ein als Leonardo da Vinci bezeichnetes Bild (Vier Reiter, Nr. A74), das von Gerard Edelinck gestochen wurde. Rund zwanzig Arbeiten können der holländischen Schule des 17. Jahrhunderts zugerechnet werden, der überwiegende Teil der Bilder stammt von deutschen Zeitgenossen Oesers, so von Christian Wilhelm Emst Dietrich, Alexander Thiele und Franz Werner von Tamm. Da in deutschen Sammlungen des 18. Jahrhunderts nur höchst selten spanische Werke auftauchen, ist das Portrait eines Mannes (Nr. A58) von Jusepe de Ribera erwähnenswert. Die Gemälde sind alphabetisch nach Künstlernamen geordnet. Den oftmals recht ausführlichen Beschreibungen der einzelnen Gemälde sind der jeweilige Künstlername sowie die Maßangaben vorangestellt, teilweise werden auch biographische Hinweise zu den Künstlern in die Beschreibung eingeflochten. Die Materialangabe erfolgt nur bei Arbeiten, die nicht auf Leinwand gemalt sind. Vermutlich wurde der Katalog von Oesers Schwiegersohn Christian Gottlieb Geyser zusammengestellt, der auch als Lehrer für die graphischen Künste an der Leipziger Akademie wirkte. An Geyser sollten Interessenten auch ihre Anfragen richten, die in Pfarrs Kunsthandlung in Leipzig abgegeben werden konnten. Wahrscheinlich kam es zu keiner Versteigerung, vielmehr diente das Verzeichnis als Verkaufskatalog. Die graphische Sammlung des Künstlers wurde von der Rostschen Kunsthandlung am 3. Februar 1800 versteigert. Nach Angaben von Meusels Künstlerlexikon wurden "fast sämtliche Gemähide, die Öser nachgelassen (ungefähr 100), von dem Kaufmann Bachmann übernommen." Lit.: Meusel Künstlerlexikon 1808/14, Bd. 3, S. 439; Alphons Dürr, Adam Friedrich Oeser. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte des 18. Jahrhunderts, Leipzig 1879; Ausst.-Kat. Adam Friedrich Oeser. Freund und Lehrer Winckelmanns und Goethes, Winckelmann-Museum Stendal, Stendal 1976 (Beiträge der Winckelmann-Gesellschaft Stendal, Bd. 6); Calov 1969, S. 41; Goethe, Dichtung und Wahrheit, 1986, S. 338-345.
291 1800/06/03
und folgende Tage
[Lugt 6096]
[Anonym]; Berlin, Auf der Königlichen Akademie der Künste und mechanischen Wissenschaften Verkäufer nach Titelblatt: Keine
Kommentar: In diesem Katalog wurde der Gemälde-Nachlaß des Leipziger Künstlers Adam Friedrich Oeser (1717-1799) angeboten. Oeser leitete seit 1764 die Leipziger Zeichnungs-, Mahlerey- und Architektur-Akademie, die 1763 als Filiale der Dresdener Akademie auf Betreiben von Christian Ludwig von Hagedorn begründet worden war. Oeser war eng mit Johann Heinrich Winckelmann befreundet, dessen Theorien er anregte und an der Kunstakademie seinen Schülern vermittelte. Als Student der Leipziger Universität nahm auch Johann Wolfgang von Goethe bei Oeser Zeichenunterricht. In "Dichtung und Wahrheit" hat Goethe eine genaue Beschreibung von Oesers Akademie und seiner privaten Sammlung überliefert. Die Akademie und Oesers private Wohnung fanden 1765 Quartier in der nicht mehr genutzten Pleißenburg. In seiner Drei-Zimmer-Wohnung ordnete Oeser die Bilder nach Schulen. So hingen im ersten Raum nach Goethes Beschreibungen die italienischen Werke. Vermutlich nutzte Oeser seine Gemälde- und Zeichnungssammlung als Lehrmaterial für seine Studenten, die nach diesen Vorbildern kopierten.
Lose mit Gemälden: 35 Standorte: *GSAB Protokoll mit allen Käufernamen und Preisen auf eingebundenen Leerseiten. HKB Nicht annotiert; mit einer handschriftlichen Vorbemerkung des Kupferstechers Gerhard Siegried Henne vom 5. Mai 1826. BMB Heutiger Aufbewahrungsort unbekannt. Nach Lugt nicht annotiert.
Der Katalog ist in zwei Gruppen unterteilt. Zunächst werden unter den Losnummern 1 bis 55 Oesers eigene Arbeiten aufgeführt, darunter eine auf Papier (Nr. 14). Einige dieser Bilder werden heute im Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig verwahrt, so etwa die zweite
Kommentar: In dieser Versteigerung wurden Bestände der Akademie der Künste in Berlin verauktioniert. Neben den Gemälden standen vor allem Kupferstiche, Zeichnungen und Gipsmodelle zum Verkauf. Aus den Einnahmen sollten Ausstellungen der Akademie
158
KATALOGE
Titelblatt: Verzeichniß einiger Gemähide, Kupferstiche, Zeichnungen, Gipsmodelle und verschiedener Kunstsachen und Geräthschaften welche den 3ten Juny und folgende Tage Nachmittags um 3 Uhr auf der Königlichen Akademie der Künste und mechanischen Wissenschaften gegen gleich baare Bezahlung in Courant, dem Meistbietenden verkauft werden sollen. / Berlin, 1800.
der Künste finanziert werden. Vermutlich geht die Idee einer Auktion auf den 1786 als Kurator ernannten Staatsminister Friedrich Anton von Heinitz zurück (Seelig 1997, S. 28). Die Gemälde sind auf den Seiten 3 bis 5 aufgelistet, anschließend folgen die insgesamt 994 Losnummern mit Kupferstichen, 275 Zeichnungen, 66 Gipsmodellen und 19 Kunstwerken unterschiedlichen Charakters, die in tabellarischer Form aufgelistet sind. Die durchweg knappe Beschreibung der Bildgegenstände, des Materials und der Rahmung wird - in jeweils eigenen Spalten - durch die Angabe der Maße sowie der Namen der Künstler ergänzt. Unter den Künstlernamen ist auch verzeichnet, daß es sich in vielen Fällen um Kopien nach bekannten Vorbildern handelt. Die Maler sind ausschließlich Zeitgenossen und Akademieangehörige, deren Namen heute kaum noch geläufig sind. Im Geheimen Staatsarchiv in Berlin hat sich der Katalog sowie ein Auktionsprotokoll mit Preisen und Käufernamen erhalten (Signatur: I. HA. Rep. 76, III. 249), das von dem Akademiemaler Johann Christian Frisch und dem Zeichenlehrer Gottlieb Eckert angefertigt worden ist. Von Eckert war auch der gedruckte Katalog zusammengestellt worden. Der Gesamterlös der Gemälde einschließlich der insgesamt 11 graphischen Arbeiten betrug 192 Taler und 21 Silbergroschen. Diese Summe blieb weit hinter den Erwartungen zurück, denn nach den Taxierungen hatte man sich ungefähr das dreifache erhofft. Unter den 32 Gemälden wurden insgesamt vier Arbeiten nicht verkauft (Nrn. 3, 11, 30 und 31), weil die Höchstgebote nicht den Erwartungen entsprachen. Den höchsten Preis erzielte ein Gemälde von Johann Gottlieb Puhlmann (Nr. 29) mit 85 Talern, das von Leutnant Christian Friedrich Wilhelm von Werder ersteigert wurde. Zwei Landschaften von Peter Ludwig Lütke waren mit je 200 Talern am höchsten eingeschätzt worden, blieben jedoch bei Geboten des Geheimen Kriegsrats Johann Friedrich Moelter von nur 150 bzw. 160 Talern unverkauft. Wahrscheinlich versuchte Moelter ohnehin nur, die Gebote hochzutreiben, ohne ein Interesse an den Bildern zu besitzen, denn er war bei der Akademie Kassenkurator (Seelig 1997, S. 37). Unter den Käufern finden sich vor allem Namen von Mitgliedern der Akademie, so die Maler Joseph Friedrich August Darbes oder Johann Gottlob Samuel Rösel. Außerdem trat der Kunsthändler J. Lesser als Käufer auf. Lit.: Seelig 1997, S. 27-40.
292 1800/07/09-1800/07/11
[Lugt 6118]
Packischefsky; Hamburg, Auf dem Vorder=Börsensaale Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 87 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß einer ganz vortreflichen Sammlung Cabinets= und anderer Gemähide, von Italiänischen, Niederländischen und Deutschen Meistern, nebst einer beträchtlichen Anzahl eingefaßter Englischer und Französischer Kupferstiche, welche theils in schwarzen und theils in couleurten Abdrücken, wie auch Kupferstiche=Werken und losen Kupferstichen, und endlich einer schönen Parthey französischen kostbaren Porcelain. Dieses alles soll den 9ten, lOten und Ilten Julius 1800, auf dem Vorder=Börsensaale in Hamburg, durch die Mackler Packischefsky und Lucht, gegen baare Bezahlung in grob Dänisch Courant, öffentlich verkauft werden. Hamburg. Gedruckt bey D. A. Harmsen Wittwe. Kommentar: In diesem Katalog der Hamburger Makler Packischefsky und Lucht sind 87 Gemälde verzeichnet, die zusammen mit einer großen Kupferstichsammlung und diversen Porzellan-Servicen an drei aufeinander folgenden Tagen zur Auktion gelangten. Das Titelblatt des Katalogs ist in deutscher Sprache abgefaßt, die Einträge für die Gemälde hingegen auf Französisch. Eine Art Vorwort informiert darüber, daß die Gemälde "inwendig nach dem Hamburger Fuss gemessen" worden sind und mit Rahmen "in dem neuesten Ge-
schmack" versehen seien. Vermutlich wurde die Sammlung aus Frankreich nach Hamburg zum Verkauf auf der Börse überführt; sie stammte wahrscheinlich aus dem Besitz eines französischen Emigranten, der nach Hamburg geflohen war. Dafür spricht auch, daß die Gemälde der französischen Schule den größten Anteil an den versteigerten Gemälden ausmachen. Darüber hinaus wurden Bilder der holländischen und flämischen Schule zum Verkauf angeboten sowie einige wenige italienische Gemälde.
293 1800/08/20-1800/08/22
[Lugt 6131]
Packischefsky; Hamburg, Börsensaale Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 222 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß einer sehr guten Sammlung Cabinets= und anderer Gemähide, von den bekanntesten Italiänischen, Französischen, Niederländischen und Deutschen Meistern; wie auch gefaßter Kupferstiche, nebst einer vortreflichen Sammlung loser, sowohl schwarzer als colorirter Kupferstiche von den berühmtesten Meistern; und auch Kupferstiche=Werke und Collectiones aller berühmtester Künstler, Rembrandt, Breughel, Merian und anderer, alles aus einer hiesigen Verlassenschaft, welche den 20sten, 21sten und 22sten August 1800, öffentlich auf dem Börsensaale, durch die Mackler Packischefsky und Lucht, gegen baare Bezahlung, in grob Dänisch Courant, verkauft werden sollen. Hamburg. Gedruckt bey D. A. Harmsen Wittwe. Kommentar: Der Katalog der Hamburger Makler Packischefsky und Lucht verzeichnet eine umfangreiche Sammlung von 222 Gemälden und ein großes Konvolut an Kupferstichen. Die Versteigerung fand an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf der Hamburger Börse statt. In dem 39 Seiten umfassenden Katalog sind die Gemälde auf den Seiten 3 bis 20 verzeichnet, gefolgt von den Einträgen für die Kupferstiche. Die einzelnen Beschreibungen sind knapp gehalten und mit Urteilen zur künstlerischen Ausführung versehen. Zu einem Gemälde von Adam Elsheimer heißt es: "Christus im Grabe; zwey Engel sehen mit anbetender Bewunderung ihn in der Gruft liegen. Aufs schönste gemahlt. Auf Kupfer, goldn. Rahm." (Nr. 26). Die Gemälde der holländischen und der flämischen Schule machen den größten Anteil aus, gefolgt von Arbeiten der deutschen und italienischen Schule. Bei den Holländern finden sich allein zehn Werke von Simon de Vlieger. Bei den deutschen Werken sind zahlreiche Bilder von Hamburger Künstlern aufgeführt, so beispielsweise von Matthias Scheits, Johann Georg Stuhr und Anton Tischbein.
294 1800/10/13
und folgende Tage
[Lugt 6142]
Hecht; Leipzig Verkäufer nach Titelblatt: Keine Standorte: BMB Heutiger Aufbewahrungsort unbekannt. Nach Lugt nicht annotiert. KKD Im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Nach Lugt mit einigen Preisen annotiert. Kommentar: Dieser Katalog ist nur im Verzeichnis von Frits Lugt nachgewiesen (Lugt 6142). Die beiden dort aufgeführten Exemplare konnten nicht mehr ausfindig gemacht werden. Möglicherweise hat Lugt jedoch das Exemplar BMB verwechselt, denn es hat sich in der Eremitage ein aus der BMB stammender Auktionskatalog erhalten, der die handschriftlichen Hinweise "13 October" und "Leipzig" trägt. Bei diesem Katalog handelt es sich jedoch um einen anonymen Frankfurter Katalog, der 155 Losnummern aufweist und nicht 182, wie bei Lugt beschrieben (vgl. Kat. 287). KATALOGE
159
295 1800/10/20
und folgende Tage
[Anonym]; Eisleben, Bergamtshause Verkäufer nach Titelblatt: Keine Standorte: ULBH Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß der Bücher und Landcharten, welche auf den 20sten Oktober 1800 und folgende Tage Nachmittags von 2 bis 5 Uhr in dem Bergamtshause zu Eisleben gegen gleich baare Bezahlung in Chursächs. Gelde öffentlich an den Meistbietenden verauktionniret werden sollen. 1800. Kommentar: In diesem Versteigerungskatalog werden überwiegend Bücher und Landkarten aus dem sächsischen Raum sowie naturgeschichtliche Tafelwerke angeboten. Eine Rubrik am Ende des Katalogs lautet "An Gemälden, Zeichnungen, Kupferstichen und Landcharten", es kann aber keine Losnummer eindeutig als Gemälde identifiziert werden.
296 1800/11/12-1800/11/14
[Lugt 6153]
Packischefsky; Hamburg, Börsensaale Verkäufer nach Titelblatt: Keine Lose mit Gemälden: 801 Standorte: KH Nicht annotiert. Titelblatt: Verzeichniß auserlesener Gemähide und verschiedener Kupferstiche aus einer bekannten Verlassenschaft, welche am 12ten, 13ten und 14ten November a.c. auf dem hiesigen Börsensaale an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden sollen durch die Mackler Packischefsky, Lucht und Lust. Hamburg, gedruckt bei D. A. Harmsen Wittwe, 1800. Kommentar: In diesem Katalog der Hamburger Makler Packischefsky, Lucht und Lust sind 801 Einträge enthalten, in denen die Gemälde nur mit der knappen Angabe des Bildgegenstandes aufgelistet werden ("Zwey Stücke mit Figuren."). Unter einigen Losnummern sind bis zu fünf Gemälde verzeichnet. Am Ende des Katalogs (S. 24) werden abschließend noch einige Kupferstiche angeboten (Nrn. 804 bis 815). Vermutlich ist der Katalog in großer Eile abgefaßt worden, um die überaus umfangreiche Sammlung an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf der Börse in Hamburg veräußern zu können. Nahezu die Hälfte der Gemälde ist ohne Angabe eines Künstlernamens aufgeführt. Der größte Teil der zugeschriebenen Gemälde gehört der holländischen Schule an, darunter eine Vielzahl von Kopien nach Nicolaes Berchem, Hendrick Goltzius, Jacob de Wet oder nach Wouwerman. Zur Auktion gelangten außerdem Gemälde der flämischen, deutschen und italienischen Schulen. Über 40 Gemälde sind allein dem Hamburger Maler Johann Georg Stuhr zugeschrieben; aber auch von den Malern Georg Hinz, Joachim Luhn oder Hans Hinrich Rundt wurden mehrere Bilder angeboten.
160
KATALOGE
Verzeichnis der Gemälde nach Künstlern A-Hi
Beispiel eines Eintrags mit Erläuterungen 1 Heist, Bartholomeus van der 1790/08/13
HBBMN 0003
B. van der Heist, 16581 Ein Hol-
länder in schwarzer Kleidung sitzt am Tische, und hält mit der Linken ein auf demselben liegendes Papier; hinten wird man durch eine Oefnung ein See=Prospect gewahr. Das Gegenstück: Dessen Frau, in einem Lehnstuhl sitzend, ist im Begrif, einen kleinen Hund, der sich vor ihr befindet, aufzuheben; hinten gleichfalls eine Oefnung mit einem See=Prospect. Zwey besonders schöne Gemähide. Auf 10
Leinw. schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Dessen Frau, in einem Lehnstuhl sitzend, ist im Begrif, einen kleinen Hund, 11 der sich vor ihr befindet, aufzuheben; Pendant zu Nr. 2 Annotat.: 12
13
14
Hintergrund von Backkuysen (KH I) Mat.: auf Leinwand Format: 15
16
Hochformat Maße: Hoch 55 Zoll, breit 45 Zoll Inschr.: 1658 (da17
tiert?) Anm.: Die Lose 2 und 3 wurden zusammen katalogisiert. Es 18
ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Waerdigh 19
20
21
Transakt.: Verkauft (25 Μ für die Nrn. 2 und 3) Käufer: Eckhardt 22
[mit] Β Gegenw. Standort: Bruxelles, Belgique. Musees royaux des Beaux-Arts de Belgique. (2942)
1. Künstler 2. Jahr 3. Monat 4. Tag 5. Sigel für den Ort der Versteigerung 6. Sigel für den Auktionator 7. Losnummer 8. Künstler nach dem Katalogeintrag 9. Bildtitel 10. Zusatz zum Bildtitel 11. Handschriftliche Annotation 12. Quelle der Annotation 13. Material 14. Format 15. Maße 16. Inschrift 17. Anmerkungen 18. Verkäufer 19. Transaktion 20. Preis 21. Käufer 22. Gegenwärtiger Standort
Aachen, Hans von 1670/04/21 WNHTG 0080 Giovanni di Aken I Un Ritratto. I Maße: Alto palmi due, e mezzo, largo uno, e dieci diti Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt 1670/04/21 WNHTG 0081 Giovanni di Aken I Due Ritratti in un pezzo. I Maße: Alto uno, e 10. largo uno, e mezzo Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt 1670/04/21 WNHTG 0082 Giovanni di Aken I Christo orante nel Monte Oliveto. I Maße: Alto uno, e sette, largo uno, e uno Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN [AJ0071 Hanß von Aach I Neun Musä vom Hanß von Aach. I Maße: Höhe 3 Vi Schuh 1 Vi Zoll, Breite 4 Vi Schuh 1 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1763/01/17 HNAN 0014 Hans von Aaken I Le Roy boit, ou Compagnie se rejouissant la veille des Rois, par Hans von Aaken, sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hauteur 4 pieds 8 pouces, Largeur 6 pieds Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt 1764/00/00 BLAN 1000 Hans von Acken \ Gleichfalls ein prächtiges Gallerie Stück, stellend durch ein schönes frauenzimmer abgebildet, den frieden vor. Dieses Stück ist von vielen Schriftstellern sehr gerühmt worden. I Maße: 6 Fuß 3 Zoll hoch, 4 Fuß 8 Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (900 Rt Schätzung) Gegenw. Standort: Sankt-Peterburg, Rossiya. Ermitazh. (N 695)
1773/12/18 HBBOY 0049 Jean v. Aachen I Venus, so den Cupido küsset. I Transakt.: Unbekannt 1774/08/13 Unbekannt
HBBMN
0093
J. van Aachen I Lucretia. I Transakt.:
1776/00/00 WZTRU 0035 Johann von Achen I Ein Stück, vorstellend eine Judenschule von 1 Schuhe, 10 Zoll hoch, 2 Schuhe breit, worauf 7 in ihrer Schule zu seyn scheinende Juden in ausgesuchten Act studirend sich befinden, verfertigt von Johann von Achen. Diese zwar seltene Auswahl eines Conversationsstückes ist viel zu treflich, als daß man nicht Kennern und Liebhabern eine besondere Anmerkung hievon mache; es zeiget sich nämlich in der schwächeren und zweyten Gruppo ein Deputirter, welcher eine große Schrift vorzeiget, woselbst die im Vordergrunde sitzende Juden mit großer Aufmerksamkeit vernehmen, was hier abgelesen wird. Die vielfältigen Coloriten, das wohlbeobachtete Feuer in den Köpfen, die schöne Zeichnung geben diesem Stücke einen beträchtlichen Vorzug. I Maße: 1 Schuhe 10 Zoll hoch, 2 Schuhe breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (100 fl Schätzung) 1778/05/23 HB KOS 0046 H.v. Aacken I Christus am Kreuz, mit umstehenden Figuren, zur rechten Johannes und Maria, zur linken der Maler und seine Frau, sehr schön gemalet, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 35 Zoll, Breite 30 Zoll Transakt.: Unbekannt (30 M) 1779/09/27 FRNGL 0481 Hanns von Aachen I Die Geburt Christi. [La naissance de Jesus-Christ.] I Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 9 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (12.30 fl) Käufer: Cotrell 1781/00/00 WZAN 0035 Johann von Achen I Ein Stück, 1 Schuhe, 10 Zoll hoch, 2 Schuhe breit, welches eine Judenschule vorstellet, wo sich sieben Juden in ausgesuchtesten Akt studirend befinden, ist von Johann von Achen verfertiget. Diese zwar seltene Auswahl eines Konversationsstückes ist viel zu trefflich, als daß man nicht Kennern und Liebhabern keine besondere Anmerkung hievon mache; es zeiget sich nämlich in der schwächeren und zweyten Gruppo ein Deputirter, welcher eine große Schrift vorzeiget, woselbst die im Vorgrunde sitzenden Juden mit großer Aufmerksamkeit vernehmen, was hier abgelesen wird. Die vielfältigen Koloriten,
das wohl beobachtete Feuer in den Köpfen, die schöne Zeichnung geben diesem Stücke einen beträchtlichen Vorzug. I Maße: 1 Schuhe 10 Zoll hoch, 2 Schuhe breit Transakt.: Unbekannt 1788/12/13 HB TEX 0159 Joh. v. Achen I Das Urtheil Paris, alte Mahlerey. I Transakt.: Verkauft (2 M) Käufer: Lillie 1789/00/00 MM AN 0063 Hanns von Achen I Zwei Architektur Stücke mit Figuren, auf Leinw. [Deux pieces d'Architecture avec figure, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 4 Fuß 8 Zoll hoch, 3 Fuß 2 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (30 fl) 1789/00/00 MM AN 0191 Hanns von Achen I Die Kreuztragung Christi, auf Kupfer. [Iesus portant lacroix, sur cuivre.] I Mat.: auf Kupfer Maße: 1 Fuß 1 Zoll hoch, 1 Fuß 7 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (60 fl) 1789/00/00 MMAN 0357 Hanns von Achen I Christus cum parvulis, auf Holz. [Iesus avec des Enfans, sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 3 Fuß 1 Zoll hoch, 2 Fuß breit [3 pieds 1 pouce de haut, 1 pied 10 pouces de large] Anm.: Die Dimensionen unterscheiden sich in der deutschen und französischen Fassung des Katalogs. Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (22 fl) 1790/01/07 MUAN 0003 Johann van Aachen I Ein Frauenzimmerkopf, auf Holz in einer vergoldeten Ram. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 6 Zoll, Breite 1 Schuh Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0772 Johann van Aachen I Eine Maria mit dem Kinde, mit der Innschrift, Charitas, auf Holz, in einer geschnittenen, und vergoldeten Ram. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 4 Zoll, Breite 1 Schuh Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0775 Johann van Aachen I Die Hoffnung, auf Holz, in einer geschnittenen und vergoldeten Ram. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 4 Zoll, Breite 1 Schuh Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1262 Johann van Aachen I Eine Magdalena, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 2 Schuh 3 Zoll, Breite 1 Schuh 10 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1333 Johann van Aachen I Die Geburt Christi, auf Holz, in einer geschnittenen und metallisirten Ram. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 2 Schuh 10 Zoll, Breite 2 Schuh Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1400 Johann van Aachen I Die Auferstehung der Todten, auf Holz, in einer derlei [geschnittenen und metallisirten] Ram. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 7 Zoll, Breite 2 Schuh Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1418 Johann van Aachen I Der griechische Cimon, welchen seine Tochter säugt, auf Leinwat, in einer eben dergleichen [geschnittenen und vergoldten] Ram. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 6 Zoll, Breite 2 Schuh 1 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 2139 Johann van Aachen I Iustitia et Pax, auf Holz, in einer metallisirten Ram. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 6 Zoll, Breite 1 Schuh 1 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0183 Hans von Achen I Wie Christus der Herr in seinem Leiden das Kreuz trägt mit vielen Kriegsknechten und Volk umgeben, von Hans von Achen. I Maße: 4 Schuh hoch, 3 Schuh 4 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/09/18 HBSCN 0133 Jan ab Achän I Die heilige Familie, dem Heiland wird von Engeln Früchte gebracht sehr kräftig gemahlt. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 29 Zoll, breit 20 Zoll Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
163
1794/09/09 HBPAK 0149 /. van Achen I Die Geburth Christi, nebst den Hirten und eine Menge musicirenden Engeln. I Maße: Hoch 25 Zoll, breit 20 Zoll Transakt.: Unbekannt
wand Maße: 2 Schuh 5 Vi Zoll hoch, 2 Schuh breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt
1798/06/04 HBPAK 0181 Von Acten I Zwey Figuren in halber Lebensgröße; die Eine Judith, mit dem Haupte Holofernis, und einem Schwerdte in der rechten Hand, und die Andere Lukretia vorstellend. Ganz kräftig und gut gemahlt. Auf Holz, goldner Rahm. I Diese Nr.: Judith mit dem Haupte Holofemis Mat.: auf Holz Maße: Hoch 25 Zoll, breit 36 Zoll Anm.: Die Lose 181 und 182 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Achen, Peter von [Nicht identifiziert]
1798/06/04 HBPAK 0182 Von Acten I Zwey Figuren in halber Lebensgröße; die Eine Judith, mit dem Haupte Holofernis, und einem Schwerdte in der rechten Hand, und die Andere Lukretia vorstellend. Ganz kräftig und gut gemahlt. Auf Holz, goldner Rahm. I Diese Nr.: Lukretia Mat.: auf Holz Maße: Hoch 25 Zoll, breit 36 Zoll Anm.: Die Lose 181 und 182 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0390 Transakt.: Unbekannt
von Acken I Die drey Grazien. I
Aachen, Hans von (Manier) 1774/08/13 HBBMN 0106 J. van Aachen I Lucretia, in der Manier von J. van Aachen. I Transakt.: Unbekannt
Abel 1776/04/15 HBBMN 0061 Abell I Zwey Pohlnische Juden. I Diese Nr.: Ein Pohlnischer Jude Maße: Höhe 2 Fuß 8 Zoll, Breite 2 Fuß 2 Zoll Anm.: Die Lose 61 und 62 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (55 Μ für die Nrn. 61 und 62) Käufer: [unleserlich] 1776/04/15 HBBMN 0062 Abell I Zwey Pohlnische Juden. I Diese Nr.: Ein Pohlnischer Jude Maße: Höhe 2 Fuß 8 Zoll, Breite 2 Fuß 2 Zoll Anm. : Die Lose 61 und 62 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (55 Μ für die Nrn. 61 und 62) Käufer: [unleserlich]
Aberli, Johann Ludwig 1772/00/00 BSFRE 0001 Aberli (Jean Louis) I Deux Payssages, l'un representant une vüe du Lac de Brienz, & l'autre la Vallie d'Oberhasli du Canton de Berne, trfes finis & fraix 1769. C'est apres ces originaux, que l'Auteur a graves [sic] ces vues, qu'il donne enlumines, au Public. Cadres sculptes & d'ores. I Diese Nr.: Un Payssage, representant une vüe du Lac de Brienze Mat.: auf Holz Maße: haut de 9 Ά, large de 13 'Λ pouces Inschr.: 1769 (datiert?) Anm.: Die Lose 1 und 2 wurden zusammen katalogisiert. Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt 1772/00/00 BSFRE 0002 Aberli (Jean Louis) I Deux Payssages, l'un representant une vüe du Lac de Brienz, & l'autre la Vallee d'Oberhasli du Canton de Berne, tres finis & fraix 1769. C'est apres ces originaux, que l'Auteur a grav6s [sic] ces vues, qu'il donne enlumines, au Public. Cadres sculptes & d'ores. I Diese Nr.: Un Payssage, representant la Vall6e d'Oberhasli du Canton de Berne Mat.: auf Holz Maße: haut de 9 Ά, large de 13 V4 pouces Inschr.: 1769 (datiert?) Anm.: Die Lose 1 und 2 wurden zusammen katalogisiert. Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt 1788/01/31 LZRST [0014] Aberli I 6 Schweizerprospekte, colorirte Handrisse von Aberli en cadre. I Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 FGAN [B]0074 Aberli I Ein Frauenzimmer=Portrait, mit einem rothen Gewände, auf Tuch gemalt. I Mat.: auf Lein164
GEMÄLDE
1776/00/00 WZTRU 0197 Peter von Achen I Ein Stück 1 Schuhe, 3 Zoll hoch, 1 Schuhe, 1 Zoll breit von Peter von Achen, stellet vor eine waldigte Landschaft mit einem Kleinen auf einem Berge liegenden Schloß, die Manier hierinn ist Albert von Goib nicht viel ungleich, ist warm und angenehm, und mit einer guten Practic ausgeführet. I Maße: 1 Schuhe 3 Zoll hoch, 1 Schuhe 1 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (2 fl Schätzung) 1781/00/00 WZAN 0197 Peter von Achen I Ein Stück 1 Schuhe, 3 Zoll hoch, 1 Schuhe, 1 Zoll breit von Peter von Achen, stellet eine waldigte Landschaft mit einem kleinen auf einem Berge liegenden Schloß vor; die Manier hierinn ist jener des Alberts von Goib nicht viel ungleich, ist warm, angenehm, und mit einer guten Praktik ausgeführet. I Maße: 1 Schuhe 3 Zoll hoch, 1 Schuhe 1 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Achtschellinck, Lucas 1799/00/00 WZAN A0118 Lucas Achtschellings I Zwey Landschaften, von Lucas Achtschellings. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 3 Zoll breit 1 Schuh 9 Zoll Anm.: Die Lose Al 18 und Al 19 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN AO 119 Lucas Achtschellings I Zwey Landschaften, von Lucas Achtschellings. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 3 Zoll breit 1 Schuh 9 Zoll Anm.: Die Lose Al 18 und Al 19 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Achtschellinck, Lucas (und Teniers) 1764/05/21 BOAN 0056 Ascheling: Tennier I Un beau Paisage de trois pieds de hauteur, quatre pieds deux pouces de largeur, peint par Ascheling, les Figures & les Animaux par Tennier. [Ein stück Vorstellend Eine schöne Landschaft Von Ascheling, die figuren und thieren Von Tennier.] I Maße: 3 pieds de hauteur, 4 pieds 2 pouces de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (25 Rt) Käufer: Cammer-Praesidenten von Belderbusch
Adriaens, Jan 1778/07/21 HBHTZ 0031 de Maan I Das Scheevelinger Ufer, mit dem Dorf=Prospect, auf dito [Holz]. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0206 Adrians I Zwey Land= und Wassergegenden mit Figuren. Kräftig und stark gemahlt. Auf Holz, goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine Land=und Wassergegend mit Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 17 Zoll, breit 14 Zoll Anm.: Die Lose 206 und 207 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0207 Adrians I Zwey Land= und Wassergegenden mit Figuren. Kräftig und stark gemahlt. Auf Holz, goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine Land=und Wassergegend mit Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 17 Zoll, breit 14 Zoll Anm.: Die Lose 206 und 207 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Adriaenssen, Alexander 1764/06/06 BOAN 0616 Alex. Andriansen I Deux Tableaux d'un pied six pouces de larg. d'un pied deux pouces de hauteur, representants l'un des poissons & des oiseaux, l'autre un harang, du pain, & autres choses, peintes par Alex. Andriansen. [Zwey stück
Vorstellend eins Vögel und fische, andertes Einen hering, brod, und sonsten gemahlt Von Alexanderen Adriansen.] I Maße: 1 pied 6 pouces de larg. 1 pied 2 pouces de hauteur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (20.20 Rt) Käufer: Fraw geh rathin Uphoff 1764/08/25 FRAN 0257 Alexandre Andriansen I Une piece de cuisine. I Maße: haut 1 pied 1 pouce sur 1 pied 6 pouces de large Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1778/09/28 FRAN 0070 Alexander Adriansen I Ein Küchenstück mit Geflügel. [Une piece de cuisine avec de la volaille par Alexandre Adriansen.] I Maße: 2 Schuh 9 Zoll breit, 1 Schuh 8 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (30.30 fl) Käufer: Canonicus Burger 1778/09/28 FRAN 0574 Adriansen I Ein Stück mit todtem Federvieh. [Une piece reprisentante de la volaille tuie.] I Maße: 1 Vi Schuh breit, 1 Schuh 2 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (15 fl) Käufer: Schweitzer [...?] 1779/09/27 FRNGL 0289 Adrian Adriansen I Ein Still=Leben mit Fischen und Früchten, sehr natürlich und fleißig ausgearbeitet. [Des poissons & des fruits trfes bien peints d'aprös nature], I Maße: 10 Zoll hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "Adrian Adriansen", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Verkauft (6 fl) Käufer: Stoeber Wien 1781/05/07 FRHUS 0369 Alexander Adriansen I Vielerley mit vielem Fleiß ausgeführte Fische, von dem bekannten Meisterpinsel des Alexander Adriansen, A. 1639 gemahlt. I Maße: 1 Schuh 6 Zoll hoch und 2 Schuh 3 Zoll breit Inschr.: A. 1639 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (25 fl) Käufer: Heusser 1781/07/18 FRAN 0095 Alexander Adriansen I Ein sehr schönes Speiß= und Früchten=Stück, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Schuh 7 Zoll hoch, 2 Schuh 6 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1785/05/17 MZAN 0291 Alexander Adriansen I Ein Stück das Fische vorstellt von Alexander Adriansen. [Des poissons.] I Pendant zu Nr. 292 Maße: 10 Zoll hoch, 1 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (41 fl für die Nrn. 291 und 292) Käufer: Tischbein 1785/05/17 MZAN 0292 Alexander Adriansen I Das Gegenbild, welches Seekrebse und Muscheln vorstellt, von eben dem Meister [Alexander Adriansen] und von eben der Höhe und Breite. [Le pendant, des homards & des moules par le meme [Alexandre Adriansen], meme hauteur & mSme largeur.] I Pendant zu Nr. 291 Maße: 10 Zoll hoch, 1 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (41 fl für die Nm. 291 und 292) Käufer: Tischbein 1786/05/02 NGAN 0323 Alex. Adrianszen I Ein Fischstück. An dem Tisch stehet der Name Alex. Adrianszen fecit. 1644. I Maße: 1 Schuh 11 Zoll hoch, 2 Schuh 10 Zoll breit Inschr.: Alex. Adrainszen fecit. 1644 (signiert und datiert) Anm.: Dieses Los wurde zusammen mit den Nrn. 324 und 325 (Corn. Biltius) verkauft. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (4.8 fl für die Nrn. 323-325) Käufer: Resid Grüner 1788/04/08 FRFAY 0189 Adrians I Ein Stilleben wobey die Natur sehr wol nachgeahmt ist. Von Adrians. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: 12 Zoll hoch, und 17 Zoll breit Transakt.: Verkauft (10.30 fl) Käufer: Bass6 1788/04/08 FRFAY 0192 Adrians I Ein Stilleben todte Fische vorstellend, von Adrians. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: 14 Zoll hoch und 19 Zoll breit Transakt.: Verkauft (9.30 fl) Käufer: Levi ν M[annheim] 1790/01/07 MUAN 0307 Alex. Adriansen I Ein Stück mit Fischen, und Austern, auf Leinwat. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe
2 Schuh 1 Zoll, Breite 2 Schuh 10 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0308 Alex. Adriansen I Ein Fischstück, auf Holz, in einer schwarzen Ram mit metallisirten Leisten, mit der Jahrzahl 1649. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 10 Zoll, Breite 2 Schuh 9 Zoll Inschr.: 1649 (datiert) Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0342 Alex. Adriansen I Ein Stück mit Fischen, Vögeln, und Früchten, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 4 Zoll, Breite 1 Schuh 11 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/04/13 HBLIE 0060 A. Aurianssenfec. 16501 Einiges hängendes und liegendes Federwild nebst verschiedenen Fischen, welche in Stücken geschnitten auf einer Schüssel liegen, und etliche ganze, wie auch einen Kalbskopf und Gefäße liegen und stehen, auf einem überdecktem Tische. Zur rechten stehet ein Windhund, der an die Fische richet; sehr schön gemahlt. Auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 29 Zoll, breit 59 Zoll Inschr.: A. Aurianssen fee. 1650 (signiert und datiert) Transakt.: Verkauft (3.10 M) Käufer: Confr R Grill 1797/06/13 HBPAK 0060 Allex. Adrieanssen 16441 Todtes Federvieh, Gartenfrüchte ec. lieget auf einem halbüberdeckten Tisch. Sehr schön und fleißig gemahlt. Auf Holz. I Mat. : auf Holz Maße: Hoch 19 Vi Zoll, breit 16 Vi Zoll Inschr.: 1644 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0217 Adriansen I Ein Stilleben. Auf einem Tische liegen Stöhr, welche in Stücken zerschnitten, Schellfische, Hechte und Austem; vorne an demselben ein Kessel mit einer Karpe. Sehr gut und kräftig gemahlt. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 25 Zoll, breit 35 Zoll Transakt.: Unbekannt
Aels, D.H. [Nicht identifiziert] 1778/09/28 FRAN 0275 D.H. Aels I Der Compagnon, eine gleiche Vorstellung [ein Holländisches Gastmahl] mit D.H. Aels bezeichnet. [Le pendant du precedent, representant le meme objet, marque D. H. Aels.] I Pendant zu Nr. 274 von A. Noort Maße: 2 Schuh breit, 1 Schuh 8 Zoll hoch Inschr.: D.H. Aels (bezeichnet) Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (102 fl für die Nrn. 274 und 275) Käufer: Jos Brentano
Aelst, Evert van 1799/00/00 WZAN 0098 Evert van Aelst I Ein Stück mit todten Vögeln auf einem Tische mit einem Teppiche, von Evert van Aelst. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 11 Zoll breit 1 Schuh 3 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Aelst, Willem van 1750/06/15 HB RAD 0087 G. van Aelst I G. van Aelst, zwey mit Früchten und andern still liegenden Sachen, sehr rar Stück. I Transakt.: Unbekannt 1763/11/09 FRJUN 0002 Guilleaume van Aalst I Un tres beau tableau avec des fleurs & des fruits parfaitement peint. I Maße: hauteur 16 pouces, largeur 13 pouces Transakt.: Verkauft (20.30 fl für die Nrn. 2 und 3) Käufer: Dick 1763/11/09 FRJUN 0003 Guilleuame van Aalst I Un pareil representant plusieurs fruits & Insectes, aussi bien peint que le pr£cedent & de la meme grandeur. I Maße: hauteur 16 pouces, largeur 13 pouces Transakt.: Verkauft (20.30 fl für die Nm. 2 und 3) Käufer: Dick GEMÄLDE
165
1768/07/00 MUAN 0301 Van Aelst (Wilhelmus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
1791/05/15 LZHCT 0065a Guillaume van Aelst I Une li£vre mort avec du gibier et des oiseaux places dans une niche de pierre. I Pendant zu Nr. 66b Maße: haut de 28 % pouces, large de 26 pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt
1768/07/00 MUAN 0302 Van Aelst (Wilhelmus) I [Ohne Titel] Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
1791/05/15 LZHCT 0066b Guillaume van Aelst I Pendant. De la volaille tuee. En haut pendent deux beccasses ä 1'embrasure d'une fenetre. De la meme grandeur que precedent. I Pendant zu Nr. 65a Maße: haut de 28 % pouces, large de 26 pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt
1769/00/00 MUAN 0022 Wilhelm van Aelst 16511 Sur une table de marbre couverte d'un tapis de velours, sont posees quelques figues, peches & abricots, sur le coin de la ditte table il y a un peroquet. Peint sur bois. I Pendant zu Nr. 23 Mat.: auf Holz Maße: 1. p. 4 Vi. p. de haut sur 1. pied de large Inschr.: 1651 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt
1792/07/28 HBSCN 0080 Guomo van Aelst I Früchte, Trauben und Insecten, auf einem überdeckten Tische. Zum Compag. ein schönes Blumenstück. Auf Lfeinwand]. S.R.G.L. [Schwarzen Rahm Goldne Leisten] I Diese Nr.: Früchte, Trauben und Insecten, auf einem überdeckten Tische; Pendant zu Nr. 81 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 19 Vi Zoll, breit 18 Zoll Anm.: Die Lose 80 und 81 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt
1769/00/00 MUAN 0023 Van Aelst I Le Compagnon, a aussi une table de marbre, couverte d'un tapis bleu sur laquelle est posee une assiette remplie d'huitres, un couvercle de Verre, & une coupe ä boire, de bronze, qui a pour couvercle un Neptune ä cheval sur un dauphin. Peint sur bois. I Pendant zu Nr. 22 Mat.: auf Holz Maße: 1. p. 4 Vi. p. de haut sur 1. pied de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1784/08/02 FRNGL 0203 van der Alst I Ein Früchtenstück mit schönen fleißig ausgeführten Insecten. I Maße: 21 Vi Zoll breit, 28 Zoll hoch Verkäufer: Α Transakt.: Verkauft (4.30 fl) Käufer: Böser [?] 1784/08/02 FRNGL 0365 van der Alst I Ein schön ausgeführtes Blumenstück, wobey Baumfrüchte und Seemuscheln angebracht worden. I Maße: 37 Zoll breit, 26 Zoll hoch Verkäufer: Α Transakt.: Verkauft (18.30 fl) Käufer: von Dessau 1785/05/17 MZAN 0295 Wilhelm van Aelst I Ein Blumenstück von Wilhelm van Aelst. [Le meine objet [des fleurs].] I Maße: 1 Schuh 6 Zoll hoch, 1 Schuh 5 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Unverkauft 1785/05/17 MZAN 0732 van Aelst I Ein Blumentopf von van Aelst. [Un pot ä fleurs.] I Maße: 1 Schuh 5 Zoll hoch, 1 Schuh 10 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (11 fl) Käufer: ν Loquowitz 1788/09/01 KOAN 0144 van Aelst I Obststück, von van Aelst. [1 p[iece], de Fruits devan Aelst.] I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Fuß 5 Zoll, Breite 1 Fuß 1 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1790/05/20 HBSCN 0119 Guomo. van Aelst. 1715. I Früchte, Trauben und Insecten, auf einem überdeckten Tische. Zum Comp, ein schönes Blumenstück. Auf L[einwand], S.R.G.L. [Schwarzen Rahm, goldne Leisten] I Diese Nr.: Früchte, Trauben und Insecten, auf einem überdeckten Tische; Pendant zu Nr. 120 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 19 Vi Zoll, breit 18 Zoll Inschr.: 1715 (datiert?) Anm.: Die Lose 119 und 120 wurden zusammen katalogisiert. Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (3 Μ für die Nrn. 119 und 120) Käufer: Ranzow 1790/05/20 HBSCN 0120 Guomo. van Aelst. 1715. I Früchte, Trauben und Insecten, auf einem überdeckten Tische. Zum Comp, ein schönes Blumenstück. Auf L[einwand], S.R.G.L. [Schwarzen Rahm, goldne Leisten] I Diese Nr.: Ein schönes Blumenstück; Pendant zu Nr. 119 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 19 Vi Zoll, breit 18 Zoll Inschr.: 1715 (datiert?) Anm.: Die Lose 119 und 120 wurden zusammen katalogisiert. Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (3 Μ für die Nrn. 119 und 120) Käufer: Ranzow 166
GEMÄLDE
1792/07/28 HBSCN 0081 Guomo van Aelst I Früchte, Trauben und Insecten, auf einem überdeckten Tische. Zum Compag. ein schönes Blumenstück. Auf Lfeinwand]. S.R.G.L. [Schwarzen Rahm Goldne Leisten] I Diese Nr.: Ein schönes Blumenstück; Pendant zu Nr. 80 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 19 Vi Zoll, breit 18 Zoll Anm.: Die Lose 80 und 81 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0096 G. van Aolst I Eine schöne Festone, von sehr vielen Blumen. I Maße: Hoch 20 Zoll, breit 26 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0305 Willhelm van Aelst I Zwey Früchtenstücke mit Insecten und Schmetterlingen, von Willhelm van Aelst. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Früchtenstück mit Insecten und Schmetterlingen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 2 Zoll breit 1 Schuh 2 Zoll Anm.: Die Lose 305 und 306 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0306 Willhelm van Aelst I Zwey Früchtenstücke mit Insecten und Schmetterlingen, von Willhelm van Aelst. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Früchtenstück mit Insecten und Schmetterlingen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 2 Zoll breit 1 Schuh 2 Zoll Anm.: Die Lose 305 und 306 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Aenvanck, Theodoor (Theodore) 1799/00/00 WZAN 0344 Aenranick I Ein Früchtenstück mit einem Korbe voll Trauben, von Aenranick. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 19 Zoll breit 1 Schuh 6 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Aertsen, Pieter 1776/00/00 WZTRU 0012 Petrus Aertsens I Ein Akademiestück, stellet vor den an einem Baum angebundenen Sebastianum, von Petrus Aertsens, 1 Schuhe, 11 Zoll hoch, 1 Schuhe, 4 Zoll breit. Ein Stück, welches der Natur Trotz biethet sowohl in der richtigen Zeichnung, als der angenehmen Verständniß der Schatten, Lichts und Colorit, und das hintere sammt dem Hauptwerke, zeiget die Wahrheit und dem Geiste dieses vortreflichen Meisters wahrhaft ausgedrückt zu haben an. I Maße: 1 Schuhe 11 Zoll hoch, 1 Schuhe 4 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (100 fl Schätzung) 1781/00/00 WZAN 0012 Petrus Aertsens I Ein Akademiestück, stellet den an einem Baume gebundenen h. Sebastian vor. Es ist von Petrus Aertsens, 1 Schuh, 11 Zoll hoch, 1 Schuh, 4 Zoll breit, ein Stück, welches der Natur sowohl in der richtigen Zeichnung, als der
angenehmen Verständniß des Schattens, Lichts und Kolorit Trotz bietet; das hintere sammt dem Hauptwerke zeiget die Wahrheit und den Geist dieses vortreflichen Meisters wirksam ausgedrückt. I Maße: 1 Schuhe 11 Zoll hoch, 1 Schuhe 4 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1785/05/17 MZAN 0587 Langepier I Ein Mädchen mit einem Korb voll Obst und einem todten Haase, nebst todtem Geflügel. [Une fille portante une corbeille pleine de fruits & un lievre tue, entouree de volaille tuee.] I Pendant zu Nr. 588 Maße: 3 Schuh 8 Zoll hoch, 4 Schuh 4 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (9 fl für die Nrn. 587 und 588) Käufer: Strecker 1785/05/17 MZAN 0588 Langepier I Das Gegenbild, ein Mann mit einem todten Haase in der Hand, nebst todtem Geflügel, beide Stücke von Langepier. [Le pendant, un homme ayant un lievre tue dans la main, & entoure de volaille tue.] I Pendant zu Nr. 587 Maße: 3 Schuh 8 Zoll hoch, 4 Schuh 4 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (9 fl für die Nrn. 587 und 588) Käufer: Strecker 1785/05/17 MZAN 0721 Langepier I Eine Küche mit zwey Mädchen, Wildprete, todtem Geflügel und Küchengeschirre ec. sodann mit einem Manne der Fleisch bringt von Langepier. [Deux Alles dans une cuisine entourees de gibier, de volaille tuee & de vaiselle de cuisine &c. & un homme, qui aporte de la viande.] I Maße: 5 Schuh 6 Zoll hoch, 7 Schuh 10 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (18 fl) Käufer: Strecker
Aevert [Nicht identifiziert] 1788/09/01 KOAN 0082 Aevert I 2 Conversationsstücker. [2 p[ieces]. des pieces de conversations.] I Diese Nr.: 1 Conversationsstuck Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Fuß 1 Zoll, Breite 1 Fuß 6 Zoll Anm.: Die Lose 82 und 83 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0083 Aevert I 2 Conversationsstücker. [2 p[ieces]. des pieces de conversations.] I Diese Nr.: 1 Conversationsstuck Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Fuß 1 Zoll, Breite 1 Fuß 6 Zoll Anm.: Die Lose 82 und 83 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt
Agallaz, Josepha de [Nicht identifiziert] 1783/06/19 HBRMS 0075 Josepha de Agallaz, 16541 Dieselbe Geschichte [die Verehrung Christi von den Weisen], Eine seltene spanische Malerey, hinter Glas verwaret. K[upfer], s.R. [schwarzer Rahm] I Mat.: auf Kupfer Maße: 1 Fuß hoch, 1 Fuß 2 Zoll breit Inschr.: 1654 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt
Agressi [Nicht identifiziert] 1798/01/19 HBPAK 0097 Agressi I Zwey Gemähide, mit vieler Phantasie gezeichnet, und von vortreflichem Colorit. Das erste stellt den Herbst vor, Flora sizt mit Garben und Früchten umgeben. Das zweyte ist eine reiche Gruppe von Weibern, Kindern und Männern, die mit Früchten und Thieren spielen. Gleicher Grösse. 1 Fuß 7 Zoll hoch, 2 Fuß 4 Zoll breit. Goldn. Rahm. I Diese Nr.: Der Herbst; Flora sizt mit Garben und Früchten umgeben Maße: 1 Fuß 7 Zoll hoch, 2 Fuß 4 Zoll breit Anm.: Die Lose 97 und 98 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/01/19 HBPAK 0098 Agressi I Zwey Gemähide, mit vieler Phantasie gezeichnet, und von vortreflichem Colorit. Das erste stellt den Herbst vor, Flora sizt mit Garben und Früchten umgeben. Das zweyte ist eine reiche Gruppe von Weibern, Kindern und Männern, die mit Früchten und Thieren spielen. Gleicher Grösse. 1 Fuß 7 Zoll hoch, 2 Fuß 4 Zoll breit. Goldn. Rahm. I Diese Nr.: Eine reiche Gruppe von Weibern, Kindern und Männern, die mit Früchten und
Thieren spielen Maße: 1 Fuß 7 Zoll hoch, 2 Fuß 4 Zoll breit Anm.: Die Lose 97 und 98 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Agricola, Christoph Ludwig 1744/05/20 FRAN 0190 Agricola I 2 Extra schöne Landschafften. I Diese Nr.: 1 Extra schöne Landschafft Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 6 Zoll, Breite 2 Schuh 1 Zoll Anm.: Die Lose 190 und 191 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1744/05/20 FRAN 0191 Agricola I 2 Extra schöne Landschafften. I Diese Nr.: 1 Extra schöne Landschafft Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 6 Zoll, Breite 2 Schuh 1 Zoll Anm.: Die Lose 190 und 191 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1749/07/31 HBRAD 0070 Agricola I Eine Landschaft. I Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (7.12) 1768/07/00 MUAN 0516 Agricola (Christian Ludwig) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0517 Agricola (Christian Ludwig) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0215 Agricola (Chretien Louis) I Deux Paysages avec figures. Marques des N o s 516. & 517. peints sur toile. I Diese Nr.: Un Pay sage avec figures Mat.: auf Leinwand Maße: 1. p. 3 Vi p. de haut sur 1. p. 10 p. de large Anm.: Die Lose 215 und 216 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0216 Agricola (Chretien Loüis) I Deux Paysages avec figures. Marques des N o s 516. & 517. peints sur toile. I Diese Nr.: Un Paysage avec figures Mat.: auf Leinwand Maße: 1. p. 3 Vi p. de haut sur 1. p. 10 p. de large Anm.: Die Lose 215 und 216 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Fran5ois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1770/10/29 FRAN 0202 Agricola I Eine Landschaft von Agricola. Maße: Hoch 15 Zoll. Breit 18 Zoll. Transakt.: Unbekannt 1777/05/26 FRAN 0306 Agricola I 2 Landschaften. I Verkäufer: Finsterwalder Transakt.: Verkauft (12.30 fl) Käufer: Noort Ziegelgass 1778/07/21 HBHTZ 0068 Agrickula I Zwey extra fleißige Landschaften, auf Leinwand, auf der einen ein Wasser=Fall, und auf der andern wie ein Regenbogen zu sehen. I Diese Nr.: Eine extra fleißige Landschaft, mit einem Wasser=Fall Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 20 Zoll, breit 26 Zoll Anm.: Die Lose 68 und 69 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (9 M) 1778/07/21 HBHTZ 0069 Agrickula I Zwey extra fleißige Landschaften, auf Leinwand, auf der einen ein Wasser=Fall, und auf der andern wie ein Regenbogen zu sehen. I Diese Nr.: Eine extra fleißige Landschaft, mit einem Regenbogen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 20 Zoll, breit 26 Zoll Anm.: Die Lose 68 und 69 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (9 M) 1781/09/10 BNAN 0125 Agricola I Ein stilles Wasser fließt zwischen dicken Gebüschen hervor, und scheidet den Vordergrund von der dahinter liegenden kahlen gebirgigten Landschaft; dieseit des Ufers lehnt sich der Fischer, neben seinem Reusen, an dem hohen ausgestorbenen Baum; ihm gegenüber ruhen ein paar andere im dunkeln Eichenschatten; und fernerhin schwimmen einige Nachen GEMÄLDE
167
auf dem hellen Wasser; am jenseitigen mit niederem Gebüsche eingefaßten Ufer, erblickt man einige Schiffchen, Kühe und Menschen; von Agricola, mit einer unvergleichlichen Farbenschmelzung, auf Kupfer. g.L. [im schwarzen Rahm mit verguldeten Leisten] I Mat.: auf Kupfer Maße: 11 Zoll hoch, 14 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1783/06/19 HBRMS 0114 Agricola I Land=Gegenden mit Gebäuden, Gehölze, und wandernden Leuten auf der Landstraße. H[olz], g.R. [verguldete Rahmen] I Diese Nr.: Eine Land=Gegend mit Gebäuden, Gehölze und wandernden Leuten auf der Landstraße Mat.: auf Holz Maße: 9 Zoll hoch, 15 Zoll breit Anm.: Die Lose 114 und 115 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1783/06/19 HBRMS 0115 Agricola I Land=Gegenden mit Gebäuden, Gehölze, und wandernden Leuten auf der Landstraße. H[olz]. g.R. [verguldete Rahmen] I Diese Nr.: Eine Land=Gegend mit Gebäuden, Gehölze und wandernden Leuten auf der Landstraße Mat.: auf Holz Maße: 9 Zoll hoch, 15 Zoll breit Anm.: Die Lose 114 und 115 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1784/08/02 FRNGL 0294 Agricola I Eine Landschaft im Ruysdaelischen Geschmack. I Maße: 28 Zoll breit, 21 Zoll hoch Verkäufer: Β Transakt.: Verkauft (2 fl) Käufer: Berger 1786/05/02 NGAN 0022 Agricola I Zwo Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 2 Schuh breit Anm.: Die Lose 22 und 23 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (40.30 fl für die Nrn. 22 und 23) Käufer: Kleinknecht 1786/05/02 NGAN 0023 Agricola I Zwo Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 2 Schuh breit Anm.: Die Lose 22 und 23 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (40.30 fl für die Nm. 22 und 23) Käufer: Kleinknecht 1786/05/02 NGAN 0671 Agricola I Zwey Landschäftgen auf Holz. I Diese Nr.: Ein Landschäftgen Mat.: auf Holz Maße: 5 Zoll hoch, 7 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 671 und 672 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (5 fl für die Nm. 671 und 672) Käufer: Pfann 1786/05/02 NGAN 0672 Agricola I Zwey Landschäftgen auf Holz. I Diese Nr.: Ein Landschäftgen Mat.: auf Holz Maße: 5 Zoll hoch, 7 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 671 und 672 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (5 fl für die Nrn. 671 und 672) Käufer: Pfann 1786/10/18 HBTEX 0085 Agricola I Zwey Arkadische Land= Gegenden, vortreflich gemahlt. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Eine arcadische Land=Gegend Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 8 Zoll 6 Linien, breit 10 Zoll 6 Linien Anm.: Die Lose 85 und 86 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/10/18 HBTEX 0086 Agricola I Zwey Arkadische Land= Gegenden, vortreflich gemahlt. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Eine arcadische Land=Gegend Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 8 Zoll 6 Linien, breit 10 Zoll 6 Linien Anm.: Die Lose 85 und 86 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/10/18 HBTEX 0157 Agricola I Die vier Tagszeiten, in ländlichen Vorstellung. Extra fleißig und plaisant gemahlt auf Kupfer. I Diese Nr.: Eine der vier Tagszeiten, in ländlicher Vorstellung Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 4 Zoll 6 Linien, breit 5 Zoll 9 Linien Anm.: Die Lose 157 bis 160 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/10/18 HBTEX 0158 Agricola I Die vier Tagszeiten, in ländlichen Vorstellung. Extra fleißig und plaisant gemahlt auf Kupfer. I Diese Nr.: Eine der vier Tagszeiten, in ländlicher Vorstellung Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 4 Zoll 6 Linien, breit 5 Zoll 9 Linien Anm.: Die Lose 157 bis 160 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 168
GEMÄLDE
1786/10/18 HBTEX 0159 Agricola I Die vier Tagszeiten, in ländlichen Vorstellung. Extra fleißig und plaisant gemahlt auf Kupfer. I Diese Nr.: Eine der vier Tagszeiten, in ländlicher Vorstellung Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 4 Zoll 6 Linien, breit 5 Zoll 9 Linien Anm.: Die Lose 157 bis 160 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/10/18 HBTEX 0160 Agricola I Die vier Tagszeiten, in ländlichen Vorstellung. Extra fleißig und plaisant gemahlt auf Kupfer. I Diese Nr.: Eine der vier Tagszeiten, in ländlicher Vorstellung Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 4 Zoll 6 Linien, breit 5 Zoll 9 Linien Anm.: Die Lose 157 bis 160 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0136 Agricola I Zwo Landschaften mit Figuren im Bade, auf Leinwat. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren im Bade Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 6 Zoll, Breite 1 Schuh 8 Zoll Anm.: Die Lose 136 und 137 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0137 Agricola I Zwo Landschaften mit Figuren im Bade, auf Leinwat. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren im Bade Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 6 Zoll, Breite 1 Schuh 8 Zoll Anm.: Die Lose 136 und 137 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/07/28 ZHWDR 0024 Agricola I [Ohne Titel] I Annotat.: Gut und des Preises werth. (LAVATER) Transakt.: Unbekannt 1790/08/25 FRAN 0332 Agricola I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: hoch 22 Zoll, breit 17 Zoll Anm.: Die Lose 332 und 333 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (6 fl für die Nrn. 332 und 333) Käufer: Kaller 1790/08/25 FRAN 0333 Agricola I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: hoch 22 Zoll, breit 17 Zoll Anm.: Die Lose 332 und 333 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (6 fl für die Nrn. 332 und 333) Käufer: Kaller 1794/09/10 HBGOV 0038 Agricola I Gebürgigte Land= und Wasser=Gegenden mit Wasser=Fälle, Rudera und vielen Landleuten. Von der besten und feinsten Bearbeitung des benannten Künstlers. I Diese Nr.: Eine gebürgigte Land= und Wasser=Gegend mit Wasserfall, Rudera und vielen Landleuten Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 21 Zoll Anm.: Die Lose 38 und 39 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV 0039 Agricola I Gebürgigte Land= und Wasser=Gegenden mit Wasser=Fälle, Rudera und vielen Landleuten. Von der besten und feinsten Bearbeitung des benannten Künstlers. I Diese Nr.: Eine gebürgigte Land= und Wasser=Gegend mit Wasserfall, Rudera und vielen Landleuten Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 21 Zoll Anm.: Die Lose 38 und 39 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV 0050 Agricola I Römische Gegenden, mit Jagd= und Hirten=Tristen. I Diese Nr.: Eine Römische Gegend, mit Jagd= und Hirten=Tristen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 24 Zoll Anm.: Die Lose 50 und 51 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV 0051 Agricola I Römische Gegenden, mit Jagd= und Hirten=Tristen. I Diese Nr.: Eine Römische Gegend, mit Jagd= und Hirten=Tristen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 24 Zoll Anm.: Die Lose 50 und 51 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0020 Louis Agricola I Zwey sehr fleißig gemahlte Landschaften im Herzischen Styl. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine sehr fleißig gemahlte Landschaft Maße: Hoch 8 Vi Zoll,
breit 11 Zoll Anm.: Die Lose 20 und 21 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0021 Louis Agricola I Zwey sehr fleißig gemahlte Landschaften im Herzischen Styl. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine sehr fleißig gemahlte Landschaft Maße: Hoch 8 Vi Zoll, breit 11 Zoll Anm.: Die Lose 20 und 21 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0144 Agricola I Zwey waldigte Landschaften, mit Ruinen und vielen Figuren. Zwey sehr auserlesene Stücke. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine waldigte Landschaft, mit Ruinen und vielen Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 19 Zoll, breit 22 Zoll Anm.: Die Lose 144 und 145 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0145 Agricola I Zwey waldigte Landschaften, mit Ruinen und vielen Figuren. Zwey sehr auserlesene Stücke. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine waldigte Landschaft, mit Ruinen und vielen Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 19 Zoll, breit 22 Zoll Anm.: Die Lose 144 und 145 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0419 Christian Ludwig Agricola I Zwey felsigte Landschaften, von Christian Ludwig Agricola. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine felsigte Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 3 Zoll breit 1 Schuh 9 Zoll Anm.: Die Lose 419 und 420 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0420 Christian Ludwig Agricola I Zwey felsigte Landschaften, von Christian Ludwig Agricola. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine felsigte Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 3 Zoll breit 1 Schuh 9 Zoll Anm.: Die Lose 419 und 420 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0177 Christian Ludwig Agricola I Zwey Landschaften, von Christian Ludwig Agricola. Auf Leinwand. Sehr schön. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 7 Zoll breit 3 Schuh 4 Zoll Anm.: Die Lose A177 und A178 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0178 Christian Ludwig Agricola I Zwey Landschaften, von Christian Ludwig Agricola. Auf Leinwand. Sehr schön. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 7 Zoll breit 3 Schuh 4 Zoll Anm.: Die Lose A177 und A178 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1800/01/00 LZAN [A]0001 Chr. L. Agricola I Eine schöne Landschaft v. Chr. L. Agricola. Ein dicker Wald deckt fast gänzlich den Horizont, der Vorgrund ist ein unebenes Erdreich, auf welchem zur Linken ein steinerner Brunnen steht, woraus 3 weibl. Figuren Wasser schöpfen. Die eigene leichte Manier dieses Meisters im Baumschlage, nebst einer glücklichen Haltung des Ganzen, ist zur Gnüge bekannt. Auf Holz. I Pendant zu Nr. 43 von A.F. Oeser Mat.: auf Holz Maße: Höhe 7 Vi Zoll, Breite 10 Vi Zoll Verkäufer: A F Oeser Transakt.: Unbekannt
Agricola, Christoph Ludwig (Manier) 1799/12/23 WNAN 0080 Agricola I Deux payssages dans la maniere d'Agricola. I Transakt.: Unbekannt
Aickmann [Nicht identifiziert] 1785/05/17 MZAN 0140 Aickmann I Ein Jäger mit Hünden, Jagdzeug und todtem Geflügel von Aickmann. [Un chasseur, des chiens, de Γ equipage de chasse & de la volatile tuee.] I Maße: 3 Schuh 1 Zoll hoch, 4 Schuh 7 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (11.30 fl) Käufer: Zitz
Aigen, Karl Josef 1765/03/27 FRKAL 0001 Aigen I Deux beaux tableaux Tun τέpresentant la naissance de JEsus Christ, & l'autre sa Sepulture bien peint. I Maße: hauteur 16 pouces, largeur 22 pouces Transakt.: Verkauft (20 fl) Käufer: Hoch 1785/04/22 HBTEX 0140 Aigree I Die Verstoßung der Hagar und die Findung Mosis. Sehr schön und mit einem überaus freyen Pinsel auf Leinewand gemahlt. Schwarze Rahmen und goldne Leisten. I Diese Nr.: Die Verstossung der Hagar Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 19 Zoll, breit 31 Zoll Anm..· Die Lose 140 und 141 wurden zusammen katalogisiert. Der Name des Künstlers ist angegeben als "Aigree", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt 1785/04/22 HBTEX 0141 Aigree I Die Verstoßung der Hagar und die Findung Mosis. Sehr schön und mit einem überaus freyen Pinsel auf Leinewand gemahlt. Schwarze Rahmen und goldne Leisten. I Diese Nr.: Die Findung Mosis Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 19 Zoll, breit 31 Zoll Anm.: Die Lose 140 und 141 wurden zusammen katalogisiert. Der Name des Künstlers ist angegeben als "Aigree", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt 1786/11/11 HBRMS 0058 Carl Aei I Zwey Landschaften mit Gebäuden und reich von Figuren, sehr gut conditionirt. Aei war Directeur bey der Mahler=Academie zu Wien; seine Arbeit wird sehr geschätzt, und wie Ferg bezahlt. Goldne Rähme. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Gebäude und reich von Figuren Maße: Höhe 15 Zoll, Breite 18 Zoll Anm.: Die Lose 58 und 59 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/11/11 HBRMS 0059 Carl Aei I Zwey Landschaften mit Gebäuden und reich von Figuren, sehr gut conditionirt. Aei war Directeur bey der Mahler=Academie zu Wien; seine Arbeit wird sehr geschätzt, und wie Ferg bezahlt. Goldne Rähme. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Gebäude und reich von Figuren Maße: Höhe 15 Zoll, Breite 18 Zoll Anm.: Die Lose 58 und 59 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Ajo, de [Nicht identifiziert] 1796/10/17 HBPAK 0055 De Ajo I Eine Attaque in einer Landschaft. Sehr kräftig gemahlt. Auf Holz. Schwarzer Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 20 Zoll Transakt.: Unbekannt
Agricola, Christoph Ludwig (und Querfurt) Aken, A. van 1782/09/30 FRAN 0167 Agricola; Querfurth I Eine sehr warm und angenehm ausgeführte Landschaft von Agricola, und schönem Jagdwesen von Querfurth staffirt. [Un beau paysage riant, par Agricola, avec de beaux attribute de chasse par Querfurth.] I Pendant zu Nr. 168 von I. Moucheron Maße: 2 Schuh 3 Zoll hoch, 2 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (61 fl für die Nrn. 167 und 168) Käufer: Grahe
1775/02/13 FRAN 0098 A. van Aken I Venus nackend sitzende, und von etlichen Cupidons oder Gratien umgeben, im Prospect stehet man Bachum und Cerem aus dem Wald kommen, von A. van Aken. I Maße: Höhe 16 % Zoll. Breite 20 % Zoll Anm.: Der Künstler ist vermutlich Hans von Aachen und nicht A. van Aken. Verkäufer: von der Lahr Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
169
Aken, Francois van 1798/05/14 KOAN 0036 F. Van Aken I La peche miraculeuse de St. Pierre, & la Samaritaine, peint sur toile & encadree sous glace. I Mat.: auf Leinwand Maße: Η. 1 pied 4 pouc. L. 1 pied 6. p. Verkäufer: de Bors d'Overen Transakt.: Unbekannt
Albani 1742/08/01 BOAN 0205 der Junge Albano I Zwey Ovidische Historien. Originalien von dem Jungen Albano. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0228 Albano le jeune I Deux Fables d'Ovide, par Albano le jeune. I Maße: Haut 9. pouces, large un pied Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt
Albani, Francesco 1750/10/15 HB AN 0001 Albano I Dianen=Bad, auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: 1 Fuß 3 3/4 Zoll hoch 1 Fuß 10 Vi Zoll breit Transakt.: Unbekannt (50) 1750/10/15 HB AN 0002 Albano I Ein schlaffendes Kind, auf Lapis Lazuli. I Mat.: auf Lapislazuli Maße: 3 Ά Zoll hoch, 4 Vi Zoll breit Transakt.: Unbekannt (60) 1763/11/09 FRJUN 0001 Albano I Une Compagnie de Meridians parfaitement dessine & peint. I Maße: hauteur 15 Vi pouces, largeur 22 pouces Transakt.: Verkauft (6 fl) Käufer: Kaller 1768/07/00 MUAN 0788 Albani (Franciscus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0822 Albani (Franciscus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0217 Albani (Francois) I Persee qui delivre Andromede. Marque du No. 822. I Maße: 1. p. 1. p. de haut sur 1. p. 4 % p. de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0218 Albani (Fran$ois) 1 La Vierge avec l'enfant Jesus. Peinte sur bois, marquee du No. 788. I Mat.: auf Holz Maße: 1. p. 4 Vi p. de haut sur 1. p. Vi p. de large Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1770/10/29 FRAN 0018 Albani I Die Zeit. I Maße: Hoch 60 Zoll. Breit 48 Zoll. Transakt.: Unbekannt 1771/05/06 FRAN 0135 Albano I Ein Dianen=Baad, auf dito [Tuch]. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 11 Zoll, breit 15 Zoll Verkäufer: Johann Friederich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt
1787/00/00 HB AN 0351 Franciscus Albani I Bachus sitzt in einem Walde unter einer rothen Decke zur rechten, und läßt sich von einem Satyr Trauben in ein Gefäß drücken. Vor ihm liegt eine Nymphe auf einem purpurnen Bette, und unterredet sich mit zweyen andern, die sich neben ihr mit dem Horn des Ueberflusses beschäfftigen, woraus zwey Liebesgötter etliche Früchte nehmen. In der Feme eine Landschaft. Von richtiger Zeichnung und schönen Mahlerey. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 22 Vi Zoll, breit 28 Zoll Transakt.: Verkauft (43 M) Käufer: Fesser 1787/00/00 HB AN 0360 Franciscus Albani I Zur linken erhebet sich ein dicker Wald. Im Vordergrunde sind Kräuter und Mooß, hinter welchem im Mittelgrunde bey einem Fluße sich badende Kinder byfmden. Einige Gebäude und Berge schließen den Hintergrund. Sehr frey und meisterhaft gemahlt, und von einem angenehmen Colorit. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 46 Zoll, breit 31 Zoll Transakt.: Verkauft (15 M) Käufer: Schoen 1787/00/00 HB AN 0634 Francisc. Albani I Ein Dianen=Bad, wo die Diana am Fuße eines Springbrunnen steht, mit einer befehlenden Miene und Stellung; neben ihr verschiedene Nymphen, so sich baden, und sich mit einander unterreden. In der Ferne eine angenehme Landschaft. Dieses schöne Gemähide ist von richtiger Zeichnung, natürlichem Colorit und von einer vortrefflichen Mahlerey. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 27 Zoll, breit 23 Zoll Transakt.: Verkauft (100 M) Käufer: Schoen 1790/01/07 MUAN 1446 Albani I Leda, auf Leinwat, in einer geschnittenen und vergoldeten Ram. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 6 Zoll, Breite 2 Schuh 11 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/08/20 HBGOV 0002 Albano I Venus und Adonis. Venus liegt auf einem blauen Gewand, auf rothem Polster, und wird von Adonis überfallen, ein neben ihr fliegender Cupido schießet mit seinem Pfeil nach ihm, ein anderer Genius hält seinen Hund; auf einem Baum=Ast sitzen zwo Tauben, die sich schnäbeln. In einer Landschaft auf Kupfer. Goldener Rahm. I Mat.: auf Kupfer Maße: 20 Vi Zoll hoch, und 24 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (20 M) Käufer: Ego 1791/05/28 HBSDT 0086 Frans Albano I Cleopatra sitzt aufm Ruhebette und hält in jeder Hand eine Schlange, derjenige in der Linken hält sie auf der Brust. Halbe Figur in Lebensgrösse. Ein vortrefliches Gemähide, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 49 Zoll, breit 36 Zoll Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 HB AN 0047 Albano I Im Schatten eines überhangenden Felsen halten Hirten ihr Mittagsmahl; neben ihnen stehen einige Kühe. Eine anziehende Darstellung, voll patriarchalischer Einfalt. I Maße: Höhe 25 Zoll, Breite 31 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt
1777/03/03 AUAN 0091 Albanni I Ein Tauf Christi auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 2 Sch. 1 Vi Zoll, Breite 1 Sch. 7 Vi Zoll Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt
1797/04/20 HBPAK 0046 Albani I Eine vortrefliche Landschaft. Im Vordergründe ein Römer, auf der Jagd begriffen, der einen Brunnen entdeckt; ohnweit von ihm sein Hund und sein Diener, der ermüdet auf der Erde sitzt, und nach seinem Herrn blickt. Sehr gut gezeichnet, und im sehr angenehmen Colorite. Auf Leinwand, mit schwarzen Rahm und vergoldeten Stäben. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 17 Zoll, breit 22 Zoll Transakt.: Unbekannt
1787/00/00 HB AN 0145 Franciscus Albani I Auf dem Vorplatz eines prächtigen Gebäudes sitzt die Venus, blau gekleidet, und wird von vielen Nymphen mit Blumen bedient. Im Hintergrunde wird man außer verschiedenen Gebäuden eine angenehme Aussicht gewahr, welches alles ins Kleine aufs vortrefflichste gemahlt, gezeichnet und ausgeführt ist. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 10 % Zoll, breit 7 V* Zoll Transakt.: Verkauft (15.12 M) Käufer: Bertheau
1797/04/25 HBPAK 0023 Albani I Zwey biblische Geschichten, die eine aus dem alten Testament, wie Johannes zu den Schriftgelehrten sagt, wahrlich es wird einer nach mir kommen, dem ich nicht werth bin seine Schuhriemen aufzulösen. Das andere aus dem neuen Testament, wie der Heiland denen Schriftgelehrten und Pharisäern sagt: gebt Gott was Gottes ist, und dem Kaiser was des Kaisers ist. Zwey schöne Gemähide. Auf Leinwand, goldenen Rahm. I Diese Nr.: Wie Johannes zu den Schriftgelehrten sagt, wahrlich es wird ei-
170
GEMÄLDE
ner nach mir kommen, dem ich nicht werth bin seine Schuhriemen aufzulösen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 30 Vi Zoll, breit 39 Zoll Anm.: Die Lose 23 und 24 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0024 Albani I Zwey biblische Geschichten, die eine aus dem alten Testament, wie Johannes zu den Schriftgelehrten sagt, wahrlich es wird einer nach mir kommen, dem ich nicht werth bin seine Schuhriemen aufzulösen. Das andere aus dem neuen Testament, wie der Heiland denen Schriftgelehrten und Pharisäern sagt: gebt Gott was Gottes ist, und dem Kaiser was des Kaisers ist. Zwey schöne Gemähide. Auf Leinwand, goldenen Rahm. I Diese Nr.: Wie der Heiland denen Schriftgelehrten und Pharisäern sagt: gebt Gott was Gottes ist, und dem Kaiser was des Kaisers ist Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 30 Vi Zoll, breit 39 Zoll Anm.: Die Lose 23 und 24 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/01/19 HBPAK 0042 Albani I Adonis auf der Jagd, wird von Amor zu der schlafenden Venus geführt. Eine Menge Liebesgötter gaukeln um sie her. I Maße: 3 Fuß 5 Zoll hoch, 4 Fuß 11 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1798/11/14 HBPAK 0092 Franciscus Albani I Zwey Stücke aus den Ovidius; das eine die Europa, von Jupiter übers Meer getragen, und von Liebesgöttern umgaukelnd begleitet; das andere, Amphitrite in einer Muschel, von Delphinen gezogen. Auf das schönste gezeichnet und gemahlt. Auf Leinwand, im schw. Rahm. I Diese Nr.: Die Europa, von Jupiter übers Meer getragen, und von Liebesgöttern umgaukelnd begleitet Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 34 Zoll, breit 43 Zoll Anm.: Die Lose 92 und 93 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/11/14 HBPAK 0093 Franciscus Albani I Zwey Stücke aus den Ovidius; das eine die Europa, von Jupiter übers Meer getragen, und von Liebesgöttern umgaukelnd begleitet; das andere, Amphitrite in einer Muschel, von Delphinen gezogen. Auf das schönste gezeichnet und gemahlt. Auf Leinwand, im schw. Rahm. I Diese Nr.: Amphitrite in einer Muschel, von Delphinen gezogen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 34 Zoll, breit 43 Zoll Anm.: Die Lose 92 und 93 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0269 Franz Albani I Venus und Cupido, der ihr liebkoset, und sie küsset, von Franz Albani. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 4 Schuh 10 Zoll breit 3 Schuh 5 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/10/10 HBPAK 0080 Albane I Juno und Venus. Zwey Pendants. Meisterhaft gemahlt. Auf Leinwand, schw. und goldn. Rahm. I Diese Nr.: Juno; Pendant zu Nr. 81 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 28 Zoll Anm.: Die Lose 80 und 81 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/10/10 HBPAK 0081 Albane I Juno und Venus. Zwey Pendants. Meisterhaft gemahlt. Auf Leinwand, schw. und goldn. Rahm. I Diese Nr.: Venus; Pendant zu Nr. 80 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 28 Zoll Anm.: Die Lose 80 und 81 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN2 0002 Albane (Franz)! Zwey prächtige Stück, deren eines eine Aussicht auf das Meer, und das Andere Ovids Verwandlungen vorstellet. Eines wie das andere dieser beyden Gemälden verdienen wegen ihrer Schönheit einen vorzüglichen Platz in einer Gallerie, oder in einem schönen Cabinet. I Diese Nr.: Ein prächtiges Stück, eine Aussicht auf das Meer vorstellend Mat.: auf Holz Maße: 9 Zoll hoch, 11 Zoll breit Anm.: Die Lose 2 und 3 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN2 0003 Albane (Franz) I Zwey prächtige Stück, deren eines eine Aussicht auf das Meer, und das Andere Ovids Verwandlungen vorstellet. Eines wie das andere dieser beyden Gemälden verdienen wegen ihrer Schönheit einen vorzüglichen Platz in einer Gallerie, oder in einem schönen Cabinet. I Diese Nr.: Ein prächtiges Stück, Ovids Verwandlungen vorstellend Mat.:
auf Holz Maße: 9 Zoll hoch, 11 Zoll breit Anm.: Die Lose 2 und 3 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN2 0004 Albane (Franz) I Ein kostbares Stück, welches einen Tanz vom kleinen Amor'n vorstellet. Die Zusammensetzung dieses Gemäldes, ist von bewunderender Schönheit. I Mat.: auf Holz Maße: 19 Zoll hoch, 24 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Albani, Francesco (Geschmack von) 1787/00/00 HB AN 0439 Von einem unbekannten Meister. Im Gusto von Albani I Danae sitzt auf einem weißen Bette unter einer rothen Gardine, und empfängt den von oben herabfallenden güldenen Regen. Im Hintergrunde eine alte Frau, welche mit ihr zu sprechen scheint. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 13 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (2.8 M) Käufer: Grunwald
Albani, Francesco (Kopie nach) 1742/08/01 BOAN 0426 Alban I Venus und Endimion mit einem Cupido, nach Alban. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0325 Alban I St. Jeröme au desert d'aprfes Alban. I Maße: Haut 1. pie 8. pouces, large 1. pied 2. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0373 Albain I Venus & Endimion avec Cupidon, d'aprfes Albain [sic]. I Maße: Haut 2. p. 6. pou., large 4. pies Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0126 Albani I Les quatre Ellements, representee par Emblemes, copies sur l'original du Grand Albani, par un maitre Italien, sur toile. I Diese Nr.: Un des quatre Ellements Mat.: auf Leinwand Maße: Largeur 3 Pies 7 Vi Pouces, Haut 3 Pies 1 Pouces Anm.: Die Lose 126 bis 129 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0127 Albani I Les quatre Ellements, representee par Emblemes, copies sur l'original du Grand Albani, par un maitre Italien, sur toile. I Diese Nr.: Un des quatre Ellements Mat.: auf Leinwand Maße: Largeur 3 Pies 7 Vi Pouces, Haut 3 Pies 1 Pouces Anm.: Die Lose 126 bis 129 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0128 Albani I Les quatre Ellements, representee par Emblemes, copies sur l'original du Grand Albani, par un maitre Italien, sur toile. I Diese Nr.: Un des quatre Ellements Mat.: auf Leinwand Maße: Largeur 3 Pies 7 Vi Pouces, Haut 3 Pies 1 Pouces Anm.: Die Lose 126 bis 129 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0129 Albani I Les quatre Ellements, representes par Emblemes, copies sur l'original du Grand Albani, par un maitre Italien, sur toile. I Diese Nr.: Un des quatre Ellements Mat.: auf Leinwand Maße: Largeur 3 Pies 7 Vi Pouces, Haut 3 Pies 1 Pouces Anm.: Die Lose 126 bis 129 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0155 Albani I Spielende Nymphe, nach Albani. [1 pfiece]. de musiciens des nimphes, selon Albani.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 4 Zoll, Breite 1 Fuß 11 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1799/10/17 LZAN 0001 Nach Albani I Der englische Gruss; zwey Figuren, hoch 12 Zoll, breit 9 Zoll. Auf Holz; vergoldeter Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 12 Zoll, breit 9 Zoll Verkäufer: Rauch Transakt.: Verkauft (2 Th) Käufer: Geist GEMÄLDE
171
Albani, Francesco (Manier) 1799/12/23 WNAN 0030 Albano I Une Vierge, avec l'enfant Jesus dans la maniere de l'Albano. I Transakt.: Unbekannt
Albani, Francesco (Schule) 1742/08/01 BOAN 0008[b] Alban I S. Hieronymus in der Wüsten mit verguldetem Rahm, von der Schuhle von Alban. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0377 Albano I Zwey Historien-Stuck aus dem Alt- und Newem [sie] Testament von der Schuhle von Albano. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1796/02/17 HBPAK 0021 Aus der Albanischen Schule I Christus am Oelberge, mitten unter den Engeln sitzend, da er das Brodt segnet. Auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 16 Vi Zoll, Breite 13 % Zoll Transakt.: Verkauft (37.8 M) Käufer: Packischefsky 1796/02/17 HBPAK 0022 Aus der Albanischen Schule I In einer waldigten Gegend liegen zwey schlafende Genien auf Polster. Diana, welche gebückt hinter ihnen steht, nimmt Amorn sachte den Bogen aus seiner Hand. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 13 % Zoll, Breite 17 VA Zoll Transakt.: Verkauft (38 M) Käufer: W 1796/02/17 HBPAK 0219 Aus der Albanschen Schule I Johannes in der Wüsten predigend. Zum Compagnon, wie Christus die Käufer und Verkäufer aus den Tempel treibt. Auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 9 Zoll, Breite 11 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (142 M) Käufer: Packi [für] C 1800/08/20 HBPAK 0024 Franciscus. (aus Albanin's Schule) I Die Taufe Christi am Jordan. Zwey Engel wollen ihn mit weissen Tüchern umhüllen. Treflich vorgestellt und gemahlt. Auf Leinwand, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 26 Zoll, breit 20 Zoll Transakt. : Unbekannt
Albrecht 1789/00/00 MMAN 0198 Albrecht I Die Familia sacra, auf Kupfer. [La famille sacree, sur cuivre.] I Mat.: auf Kupfer Maße: 1 Fuß hoch, 1 Fuß 6 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (30 fl) 1789/00/00 MMAN 0229 Albrecht I Zwei Stücke mit vielen Kindern, die spielend das Jesu Kind umgeben, auf Leinw. [Deux morceaux avec plusieurs enfans qui dansent auteur de Iesus, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 7 Zoll hoch, 3 Fuß 10 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (50 fl)
Albrecht, Balthasar Augustin 1768/07/00 MUAN 1070 Albrecht (Balthasar Augustin) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1077 Albrecht (Balthasar Augustin) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1079 Albrecht (Balthasar Augustin) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 172
GEMÄLDE
1768/07/00 MUAN 1080 Albrecht (Balthasar Augustin) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1099 Albrecht (Balthasar Augustin) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1780 Albrecht von München I Das Portrait des Hofmalers Albrecht von München, auf Leinwat, in einer metallisirten Ram. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 6 Zoll, Breite 2 Schuh Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
Aldegrever, Heinrich 1723/00/00 PRAN [B]0023 Aldegraff I Fischung Petri / vom Aldegraff. I Maße: Höhe 1 Schuh 6 Vi Zoll, Breite 1 Schuh 5 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1770/10/29 FRAN 0102 Altengraff \ Die Leda von Altengraff. Maße: Hoch 40 Zoll. Breit 30 Zoll. Transakt.: Unbekannt 1778/10/30 HBKOS 0138 Altegraf I Ein Philosoph, die Vergänglichkeit betrachtend, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 13 Zoll, breit 16 Zoll Transakt.: Unbekannt 1779/04/12 GAAN 0018 Altgrafl Maria mit dem Kinde Jesu nebst Joseph und kleinen Engeln, vom Altgraf. Ein ganz auserordentlich schönes Stück. I Maße: 19 Vi Zoll hoch und 15 Zoll breit Verkäufer: Schöber Transakt.: Unbekannt 1789/00/00 MMAN 0051 Heinrich Aldegraf I Zwei biblische Geschichten, auf Holz. [Deux morceaux tirfs de la Bible, sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 2 Fuß 6 Zoll hoch, 11 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (66 fl) 1789/00/00 MMAN 0144 Heinr. Aldegraf \ Portrait eines Fürsten, auf Holz. [Le portrait d'un prince, sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 2 Fuß 1 Zoll hoch, 1 Fuß 7 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (66 fl) 1789/00/00 MMAN 0366 Hein. Aldegraf I Ein Mann halbe Figur, auf Holz. [Un homme de demie figure, sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 9 Zoll hoch, 1 Fuß 2 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (2.24 fl) 1791/09/26 FRAN 0288 Heinrich Aldegraf \ Der Judaskuß und Christus am Oelberg, überaus fleißig und fromm gemalt von Teutschlands altem Meister, Heinrich Aldegraf. I Diese Nr.: Der Judaskuß Maße: 12 Zoll breit, 18 Zoll hoch Anm.: Die Lose 288 und 289 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0289 Heinrich Aldegraf \ Der Judaskuß und Christus am Oelberg, überaus fleißig und fromm gemalt von Teutschlands altem Meister, Heinrich Aldegraf. I Diese Nr.: Christus am Oelberg Maße: 12 Zoll breit, 18 Zoll hoch Anm.: Die Lose 288 und 289 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 FGAN [A]0010 Altengräfer I Die heiligen 3 Könige mit vielen Figuren, auf Holz gemalt. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 1 Schuh 4 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt 1795/11/14 HBPAK 0062 Aldegraf] Ein altes Kloster=Gemählde. Maria mit dem Crucifix und dazu gehörigen Attributen. Ein sehr seltenes Stück mit der Ueberschrift: Maria optimam partem elegit, qua non anferetur ab ea. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 2 Fuß 2 Zoll, breit 1 Fuß 9 Zoll Transakt.: Unbekannt
Alenwyn, Anton [Nicht identifiziert] 1799/00/00 WZAN 0612 Anton Alenwyn I Eine bergige Landschaft, von Anton Alenwyn. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 6 Zoll breit 2 Schuh Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
auf Leinwand Maße: 25 pouces de hauteur. Sur 35 pouces de largeur Transakt.: Unbekannt 1800/07/09 HBPAK 0057 Algrin I Percee dans une foret qui laisse voir dans le lointain un village et des maisons dans un Chemin eclaire par le soleil. Plusieurs figures. Sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: 11 pouces de hauteur. Sur 15 pouces de largeur Transakt.: Unbekannt
Alkofer, Georg Zacharias [Nicht identifiziert] 1796/09/08 HBPAK 0142 Marq. G.Z.A. Georg Zach. Alkofer I Zwey Stücke mit allerhand Federvieh, Canienchen, Pfauen ec. Auf dem einen lauert ein Fuchs, dem sich der Hahn und die Henne widersetzt. auf Kupfer. I Diese Nr.: Ein Stück mit allerhand Federvieh, Canienchen, Pfauen ec. Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 18 Zoll, breit 20 Zoll Inschr.: G.Z.A. (bezeichnet) Anm.: Die Lose 142 und 143 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0143 Marq. G.Z.A. Georg Zach. Alkofer I Zwey Stücke mit allerhand Federvieh, Canienchen, Pfauen ec. Auf dem einen lauert ein Fuchs, dem sich der Hahn und die Henne widersetzt. auf Kupfer. I Diese Nr.: Ein Stück mit allerhand Federvieh, Canienchen, Pfauen ec. Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 18 Zoll, breit 20 Zoll Inschr.: G.Z.A. (bezeichnet) Anm.: Die Lose 142 und 143 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0198 Georg Zacharias Alkofer I Zwey Stück mit allerley Geflügel, als Pfauen, Hühner, Caninchen, Meerschweinen ec. Auf dem einen kämpfen zwey Hähne mit einander in einer Landschaft. Auf Kupfer. I Diese Nr.: Ein Stück mit allerley Geflügel, als Pfauen, Hühner, Caninchen, Meerschweinen ec. Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 17 Zoll, breit 21 Zoll Anm.: Die Lose 198 und 199 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0199 Georg Zacharias Alkofer I Zwey Stück mit allerley Geflügel, als Pfauen, Hühner, Caninchen, Meerschweinen ec. Auf dem einen kämpfen zwey Hähne mit einander in einer Landschaft. Auf Kupfer. I Diese Nr.: Ein Stück mit allerley Geflügel, als Pfauen, Hühner, Caninchen, Meerschweinen ec. Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 17 Zoll, breit 21 Zoll Anm.: Die Lose 198 und 199 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Allard 1777/04/11 HB NEU akt. : Unbekannt
0063
Allard I Ein Blumenstück. I Trans-
Alleer, G.V. [Nicht identifiziert]
Allemand 1800/00/00 FRAN1 0002 Allemand I Zwei schöne Landschaften mit Vieh staffirt. I Diese Nr.: Eine schöne Landschaft mit Vieh staffirt Mat.: auf Holz Maße: 9 Zoll hoch, 11 Zoll breit Anm.: Die Lose 2 und 3 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN1 0003 Allemand I Zwei schöne Landschaften mit Vieh staffirt. I Diese Nr.: Eine schöne Landschaft mit Vieh staffirt Mat.: auf Holz Maße: 9 Zoll hoch, 11 Zoll breit Anm.: Die Lose 2 und 3 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Allmacher 1716/00/00 FRHDR 0062 Allmacher I Von Allmacher eine dito [Landschafft] mit einem Edelman zu Pferd. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (75)
Alsloot, Denis van 1785/05/17 MZAN 0026 Daniel van Alsloot I Eine Landschaft die den Winter vorstellet von Daniel van Alsloot. [Un paysage representant l'hiver.] I Maße: 1 Schuh 6 Zoll hoch, 2 Schuh 7 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (133 fl) Käufer: Rmus D Cantor L Β äl Hoheneck
Altdorfer, Albrecht 1775/04/12 HBNEU 0042 Altdorf er I Eine Maria mit dem Christkindlein, auf Holz. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt 1778/05/30 HBKOS 0109 Aldörffer I Wie ein Bischof einen Prinzen tauft, mit den dabey befindlichen Taufpathen, von Aldörffer, auf Holz. [Diese Gemähide sind alle mittlere Grösse, können also an alle Plätze gebraucht werden - dieweilen keine Theilen=Stück, dabey befindlich] I Mat.: auf Holz Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 150 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 150. Verkäufer: Dr Friederici Transakt.: Verkauft (5.10 M) Käufer: Bertheau
1789/04/16 HBTEX 0029 G.v. Alleer I Ein Blumen-Bouquet von verschiedenen Blumen, in ein Glas auf dem Tisch; nach der Natur gemahlt auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 20 Zoll, breit 15 Zoll Transakt.: Verkauft (1 M) Käufer: Ego
1778/10/30 HBKOS 0004 Alldörfer I Venus und Cupido, in einem Gehölze vorgestellet; fleissig gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 20 Vi Zoll, breit 14 Zoll Transakt.: Unbekannt
Allegrain
1789/00/00 MM AN 0319 Albrecht Altdorfer I Der englische Gruß, uralt auf Holz. [La Salutation angelique, tres ancien, sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 2 Fuß 9 Zoll hoch, 2 Fuß 4 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (100 fl)
1791/09/21 FRAN 0138 Halgrin, Maler von der Französischen Akademie I Eine bergigte Landschaft mit Wasserfällen und Schlössern gezieret, vorne sind zwey Frauen, die eine sitzet und die andere stehet. I Transakt.: Verkauft (5 fl) Käufer: Kissner 1799/10/17 LZAN 0015 Allgrain I Eine Landschaft mit Figuren; hoch 16 Zoll, breit 22 Zoll. Auf Holz; vergoldeter Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 16 Zoll, breit 22 Zoll Verkäufer: Rauch Transakt.: Verkauft (2 Th) Käufer: Schwarz 1800/07/09 HBPAK 0003 Algrin I Un paysage, ou l'on voit le Cours d'une riviere dans la quelle des femmes se baignent. A l'autre bord sont des moissoneurs, et des Campagnes avec des Village. Sur le Devant un cavalier qui s'enfonce dans une foret. Sur toile. I Mat.:
1789/06/12 HBTEX 0026 Atdörfer, wie Holbein I St Paulus. Von großem Affect, besonders fleißig und schön gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 27 Zoll, breit 23 Zoll Transakt.: Verkauft (12.12 M) Käufer: Ego 1792/04/19 HBBMN 0136 A. Altorfer I Eine waldigte Landschaft mit vielerley Vorstellungen, im Vordergründe die Flucht nach Egypten; ausnehmend fleißig, von A. Altorfer. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Zoll, breit 19 Zoll Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0172 Albrecht Alldorfer I Ein vollkommen geharnischter Mohrenprinz, von Albrecht Alldorfer. I Maße: 10 Zoll hoch, 1 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
173
1793/06/07 HBBMN 0109 A. Altorfer I Land und Wasser mit kleinen Figuren. Unnachahmlich ausführlich gemahlt von A. Altorfer. I Format: rund Maße: Hoch 4 Zoll, breit 4 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/08/00 HBPAK 0088 Albr. Altorfer I Der Riese Roland, der das Christ=Kind durchs Wasser trägt. Sehr ausführlich gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 12 Vi Zoll, Breite 11 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0148 Albrecht Altorffer I Die Ausführung Christi, mit einigen 100 Figuren. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Zoll, breit 22 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0402 Althofer I Drey Philosophen. Eben so alt wie das vorhergehende, und gut conservirt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 17 Zoll, breit 14 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0144 Albert Altorfer I Das Jesuskind mit dem Kreuze, mit einem Fuße auf einen Todtenkopf und mit dem anderen auf den Teufel tretend, dann Johannes mit dem Lamme, von Albert Altorfer. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 3 Zoll breit 9 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0162 Albert Altorfer I Die Anbethung der drey Könige, und die Auferstehung Christi, von Albert Altorfer. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 7 Vi Zoll breit 5 Vi Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0375 Albert Altorfer I Die Grablegung Christi, von Albert Altorfer. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Zoll breit 1 Schuh 2 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0025 Albert Altorfer I Die Versuchung des h. Antonius, von Albert Altorfer. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 7 Zoll breit 5 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/10/18 LZAN 0084 Altorffer I Drey theologische Sujets; die Geburt Christi, die Anbetung der Hirten, und jene der drey Könige vorstellend; hoch 38 Zoll, breit 28 Zoll. Auf Leinw., in einem grauen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 38 Zoll, breit 28 Zoll Verkäufer: Rauch Transakt.: Verkauft (16.12 Th) Käufer: Blümner 1800/00/00 BLBOE 0121 Alttorfer I Maria auf dem Sterbebette. Viele Umstehende scheinen ihren Segen und ihre letzten Worte zu erwarten. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt
Altomonte, Martino 1798/01/19 HBPAK 0032 Altomondi I Ein Christuskopf mit der Dornen=Krone. Ein Ideal voll Ausdruck und Schönheit. 1 Fuß 8 Zoll hoch, 1 Fuß 3 Zoll breit. Goldn. Rahm. I Maße: 1 Fuß 8 Zoll hoch, 1 Fuß 3 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1798/01/19 HBPAK 0037 Altomonti I Eine Madonna. Das Kind ist vorzüglich meisterhaft gezeichnet, die Färbung des Ganzen voll Harmonie, und schön. 3 Fuß 2 Zoll hoch, 2 Fuß 8 Zoll breit. Goldn. Rahm. I Maße: 3 Fuß 2 Zoll hoch, 2 Fuß 8 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Amama, Franz von 1787/04/19 HB TEX 0037 Amama I Eine Landschaft mit Figuren. I Transakt.: Verkauft (3.4 M) Käufer: Böhmer
hoch, 7 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (4 fl für die Nrn. 389 und 390) Käufer: Dehnhardt 1779/09/27 FRNGL 0390 der alte Ammann I Der Compagnon zu obigem, von nemlichem Meister [vom alten Ammann] und Maas. [Le pendant du precedant, par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 389, "Eine warme und fleissig ausgeführte Landschaft" Maße: 6 Zoll hoch, 7 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (4 fl für die Nrn. 389 und 390) Käufer: Dehnhardt 1779/09/27 FRNGL 0493 der alte Ammann I Eine warm und gut ausgeführte Landschaft, vom alten Ammann. [Un trfes beau paysage, par le vieux Amman.] I Pendant zu Nr. 494 Maße: 10 Zoll hoch, 1 Schuh 1 % Zoll breit Transakt.: Verkauft (2.45 fl für die Nrn. 493 und 494) Käufer: Frey Maler 1779/09/27 FRNGL 0494 der alte Ammann I Der Compagnon zu obigem, eine dergleichen Landschaft, von neml. Meister [vom alten Ammann] und Maas. [Le pendant du precedant, meme objet [un tres beau paysage], par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 493 Maße: 10 Zoll hoch, 1 Schuh 1 % Zoll breit Transakt.: Verkauft (2.45 fl für die Nrn. 493 und 494) Käufer: Frey Maler 1782/07/00 FRAN 0014 Amman I Zwey kleine Landschaften. I Diese Nr.: Eine kleine Landschaft Maße: 5 Zoll hoch, 5 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 14 und 15 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] fl für die Nm. 14 und 15) 1782/07/00 FRAN 0015 Amman I Zwey kleine Landschaften. I Diese Nr.: Eine kleine Landschaft Maße: 5 Zoll hoch, 5 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 14 und 15 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] fl für die Nm. 14 und 15) 1782/07/00 FRAN 0022 Amman I Zwo fleißig ausgeführte Landschaften. I Diese Nr.: Eine fleißig ausgeführte Landschaft Maße: 8 Zoll hoch, 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 22 und 23 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] fl für die Nrn. 22 und 23) 1782/07/00 FRAN 0023 Amman I Zwo fleißig ausgeführte Landschaften. I Diese Nr.: Eine fleißig ausgeführte Landschaft Maße: 8 Zoll hoch, 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 22 und 23 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] fl für die Nrn. 22 und 23) 1791/09/26 FRAN 0008 Amann I Zwey angenehme Landschaften mit Architektur, schönen Blumen und anmuthiger Ferne über klares Wasser hin. I Diese Nr.: Eine angenehme Landschaft mit Architektur, schönen Blumen und anmuthiger Ferne über klares Wasser hin Maße: 2 Schuh 10 Zoll hoch, 3 Schuh 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 8 und 9 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0009 Amann I Zwey angenehme Landschaften mit Architektur, schönen Blumen und anmuthiger Ferne über klares Wasser hin. I Diese Nr.: Eine angenehme Landschaft mit Architektur, schönen Blumen und anmuthiger Ferne über klares Wasser hin Maße: 2 Schuh 10 Zoll hoch, 3 Schuh 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 8 und 9 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt
Aman (Amann, Amman, Ammann)
1791/09/26 FRAN 0108 Amann I Eine anmuthige Landschaft mit weiter Ferne. I Maße: 22 Zoll hoch, 29 Zoll breit Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt
1779/09/27 FRNGL 0389 der alte Ammann I Eine warm und fleißig ausgeführte Landschaft, vom alten Ammann. [Un trfes beau paysage par le vieux Ammann.] I Pendant zu Nr. 390 Maße: 6 Zoll
1791/09/26 FRAN 0337 Amann I Ein Seeufer mit prächtigen Gebäuden, besetzt von Amann. I Maße: 32 Zoll hoch, 42 Zoll breit Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt
174
GEMÄLDE
Amazoni, Anton [Nicht identifiziert] 1768/08/16 KOAN 0096 Anton Amazoni I Die Geburth Christi von Anton Amazoni in Rahm. I Maße: Höhe 10 Zoll, Breite 10 Zoll Verkäufer: Freyherr von Kaas Transakt.: Unbekannt
Amberger, Christoph 1764/08/25 FRAN 0469 Christofte Amberger I Herodias avec la tete de St Jean. I Maße: haut 1 pied 7 pouces sur 1 pied 5 pouces de large Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1789/00/00 MMAN 0309 Christoph Amberger! Zwei Türken Büsten, auf Holz. [Deux bustes de Turcs, sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 2 Fuß 3 Zoll hoch, 1 Fuß 8 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (66 fl) 1799/00/00 WZAN 0341 Christoph Amberger I Ein Kopf mit einem rothen Barte, weissen Kragen und goldener Kette, von Christoph Amberger. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh breit 1 Schuh 6 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0745 Christoph Amberger I Ein Weibskopf mit einem Krösse, von Christoph Amberger. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 11 Zoll breit 8 Zoll Anm.: Die Lose 744 und 745 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0011 Christoph Amberger I Ein Mannskopf mit einer goldenen Kette und Kröße, von Christoph Amberger. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 9 Zoll breit 1 Schuh 5 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0206 Christoph Amberger I Ein Manns= und ein Weibs=Portrait mit Händen, von Christoph Amberger. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Manns=Portrait mit Händen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh breit 2 Schuh 5 Zoll Anm.: Die Lose A206 und A207 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0207 Christoph Amberger I Ein Manns= und ein Weibs=Portrait mit Händen, von Christoph Amberger. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Weibs=Portrait mit Händen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh breit 2 Schuh 5 Zoll Anm.: Die Lose A206 und A207 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0209 Christoph Amberger I Ein Manns= Portrait mit Händen und einem Blumenkruge, von Christoph Amberger. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh 5 Zoll breit 2 Schuh 11 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0210 Christoph Amberger I Ein Weibs= Portrait mit Händen, Kröße und einem Hündchen, von Christoph Amberger. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh 10 Zoll breit 2 Schuh 11 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Am Ende, Johann Heinrich 1764/11/26 LZBER 0013 Am=Ende I Der heil. Hyeronymus vor den Creuz Christi von Am=Ende. I Transakt.: Unbekannt 1788/01/15 LZRST 3904 am Ende I Simson und Delila, ein grosses meisterhaftes Bild, von am Ende, 48 Zoll hoch, 62 Zoll breit, in vergold. Rahm. I Maße: 48 Zoll hoch, 62 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (4.14 Th) Käufer: C R 1788/01/15 LZRST 3905 am Ende I Josephs blutiger Mantel von 4 Figuren, von am Ende, von eben dem Maasse, eben so schön
in vergold. Rahm. I Maße: 48 Zoll hoch, 62 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (7 Th) Käufer: C R 1788/01/15 LZRST 3906 am Ende I Susanna und die beiden Alten, eben so schön, von am Ende, von eben dem Maasse in verg. Rahm. I Maße: 48 Zoll hoch, 62 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (7.13 Th) Käufer: C R 1788/01/15 LZRST 3907 am Ende I Johannes in der Wüsten, eben so schön, von am Ende, von eben dem Maasse, in vergold. Rahm. I Maße: 48 Zoll hoch, 62 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (8.4 Th) Käufer: Act [?] 1788/01/15 LZRST 3912 am Ende I Venus in einer schönen Halbfigur, von am Ende. 42 Zoll hoch, 35 Zoll breit, in schw. gebeitzten Rahm mit verg. Leiste. I Maße: 42 Zoll hoch, 35 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (2.8 Th) Käufer: C R 1788/01/15 LZRST 3913 am Ende I Vulkan, Halbfigur von am Ende eben so schön von gleichem Maass, und gleichem [schw. gebeitzten] R[ahm]. I Maße: 42 Zoll hoch, 35 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (3 Th) Käufer: C R
Amigoni, Jacopo 1742/08/01 BOAN 0004[a] Amiconi I Ein Ovidisches Stuck mit fein verguldetem Rahmen. Ein Exquise d'Amiconi. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0013 Amiconi I Ein Stuck, das SchweisTuch Christi mit einigen Engels-Köpffen repraesentirend. Original von Amiconi. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0262 Amiconi I Eine Mater Dei mit dem Kindlein. Original von Amiconi. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0293 Amiconi I Ein Ovidisches Stuck mit Diana und Endimion. Original von Amiconi. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0481 Amiconi I Vier Exquise vom Amiconi, worauff Kindere gemahlet seynd. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0010 Amiconi I Le S. Suaire, soütenu par des Anges, par Amiconi. [De Zweetdoek gedraage door Engelen door Amiconi.] I Maße: haut 3. p. 8. pou. large 5. p. 3. pou. [h. 5 v. 8 d., br. 5 v. 3 d.] Anm.: Die Dimensionen, die bei Hoet angegeben sind, unterscheiden sich von denen des Katalogs. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt (121) 1742/08/30 BOAN 0048 Amiconi I Diana avec Endymion & quelques autres Figures, par Amiconi. [Diana en Endimion en meer beeiden door Amiconi.] I Maße: Haut 4. p. 6. pou. large 5. p. 5. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt (92.10) 1742/08/30 BOAN 0053 Amiconi I La S. Vierge avec l'Enfant Jesus, par Amiconi. I Maße: Haut 3. p. 2. pou. large 3. p. 7. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0184 Amiconi I Quatre esquises, par Amiconi, representant des enfans. I Maße: Haut 1. pie 9. pouces, larges 1. pie 3. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0169 Amigoni I Zween Engels=Köpfe, von Amigoni. I Maße: hoch 1 Fuß 2 Zoll, breit 1 Fuß 1 Zoll Transakt.: Unbekannt 1764/05/17 BOAN 0118 Amiconi I Un Tableau de six pieds de largeur, quatre pieds deux pouces de hauteur, representant le Suaire de Jesus-Christ avec cinq Anges pleurants, peint par Amiconi. [Ein stück Vorstellend das schweißtuch Christi mit fünf weinenden Engelen, von Amiconi gemahlt.] I Maße: 6 pieds de largeur, 4 pieds 2 pouces de hauteur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (70 Rt) Käufer: Can Meyer GEMÄLDE
175
1764/06/06 BOAN 0591 Amiconi I Un Tableau de de six pieds de hauteur, cinq pieds de hauteur, representant Venus endormie. Adonis venant de la Chasse, & les trois graces avec des petits enfants, peints par Amiconi. [Ein stück Vorstellend die Eingeschlafene göttin Venus, nebst dem Adonis, so Von der jagd, und die drey gratien, so dan mit Vielen Kindlein, gemahlt Von Amiconi.] I Maße: 6 pieds de hauteur, 5 pieds de hauteur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (170 Rt) Käufer: Hof C Rath Broggia 1764/06/07 BOAN 0649 Amiconi I Un Tableau representant St. Sebastien avec deux Anges en figure entiere d'un pied six pouces de hauteur, d'un pied de largeur, peint par Amiconi. [Ein stück Vorstellend den mit pfeil zerschoßenen h. Sebastianum mit zwey Engelein in gantzer figur, gemahlt Von Amiconi.] I Maße: 1 pied 6 pouces de hauteur, 1 pied de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (15.25 Rt) Käufer: Hof C Rath Kugelgen 1765/00/00 FRRAU 0112 Amiconi I Vorstellend eine schlafende Venus, neben ihr ein Triumph=Wagen; Einige Kinder beschäftigen sich mit einer an einem Faden haltenden fliegenden Taube. Die Gratien in den Wolcken streuen Blumen auf die Venus. Adonis mit zwey Hunden kommt von der Jagd, mit Betrachtung auf die Venus blickend. Viele Genii mit Köchern und Pfeilen machen das Stück lustig. Hintenaus stehen etwas Bäume, und eine schöne Luft machen alles plaisant. Im Colorit hat das Bild vielen französischen Gusto, und das angenehme Fleisch des zarten Geschlechts, besonders war die Force von des Meisters Pinzel. Representant une Venus dormante, & un char ä cöti d'elle; Quelques enfans s'occupent ensembles tenans ä un fil un pigeon volant. Les Graces qui sont dans les nues jettent des fleurs sur Venus. Adonis qui revient de la chasse avec deux chiens jette un regard sur Venus pour la contempler. Plusieurs Genies avec des fleches & des carquois rendent ce tableau agreable. Quelques arbres qui sont derrifere & un air doux rendent le tout ravissant. Ce tableau est dans son coloris beaucoup dans le goüt franijois & a beaucoup de la chair agreable du tendre sexe; La force du pinfeau du Maitre est toute particuliere. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 5 Schuh, breit 6 Schuh Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRRAU 0225 Amiconi I Das Schweiß=Tuch der Heil. Veronica, von fünff Engeln gehalten. Auf Tuch gemahlt. Le suaire de Sainte Veronique, soutenu par cinq Anges. Peint sur de la toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 4 Schuh 2 Zoll, breit 6 Schuh Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0017 Amigoni (Jacobus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0041 Amigoni (Jacobus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0057 Amigoni (Jacobus) I [Ohne Titel] Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0066 Amigoni (Jacobus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0073 Amigoni (Jacobus) I [Ohne Titel] Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog 176
GEMÄLDE
wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0074 Amigoni (Jacobus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0077 Amigoni (Jacobus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0078 Amigoni (Jacobus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0108 Amigoni (Jacobus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0123 Amigoni (Jacobus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0126 Amigoni (Jacobus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0129 Amigoni (Jacobus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0475 Amigoni (Jacobus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0476 Amigoni (Jacobus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0504 Amigoni (Jacobus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0688 Amigoni (Jacobus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0696 Amigoni (Jacobus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
1768/07/00 MUAN 0743 Amigoni (Jacobus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0776 Amigoni (Jacobus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0777 Amigoni (Jacobus) I [Ohne Titel] Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0792 Amigoni (Jacobus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0936 Amigoni (Jacobus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0937 Amigoni (Jacobus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0938 Amigoni (Jacobus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1106 Amigoni (Jacobus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1173 Amigoni (Jacobus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1174 Amigoni (Jacobus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1175 Amigoni (Jacobus) I [Ohne Titel] Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1176 Amigoni (Jacobus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0219 Amigoni (Jacques) I La vierge avec l'enfant Jesus. Peinte sur toile, marqu6e du No. 17. I Mat.: auf Lein-
wand Maße: 2. p. 4 p. de haut sur 1. p. 8 p. de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0220 Amigoni (Jacques) I La vierge monte au ciel. Peinte sur toile, marquee du No. 41. I Mat.: auf Leinwand Maße: 4. pieds de haut sur 2. p. 5 Vi p. de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0221 Amigoni (Jacques) I La bienheureuse vierge Marie, avec l'enfant Jesus qui dort. Peinte sur toile, marquee du No. 57. I Mat.: auf Leinwand Maße: 2. p. 8. p. de haut sur 1. p. 11 p. de large Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0222 Amigoni (Jacques) I Le saint suaire, ou voile, oü est represente le visage de nötre Seigneur Jesus Christ. Peint sur toile, marque du No. 66. I Mat.: auf Leinwand Maße: 2. p. 8. p. de haut sur 2. p. 1 p. de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0223 Amigoni (Jacques) I Le sacrifice d'Abraham. Marque du No. 73. [tous les deux peints sur toile]. I Mat.: auf Leinwand Maße: 4. p. 10 p. de haut sur 3. p. 8. p. de large Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 224 und beziehen sich auf die Nrn. 223 und 224. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0224 Amigoni (Jacques) I Betsabe dans le bain. Marque du No. 74. tous les deux peints sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: 4. p. 10 p. de haut sur 3. p. 8. de large Anm.: Die Angaben zum Material im Bildtitel beziehen sich auf die Nrn. 223 und 224. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0225 Amigoni (Jacques) I La fuite en Egypte. Marquee du No. 77. [tous les deux peints sur toile], I Mat.: auf Leinwand Maße: 2. p. 9 p. de haut sur 4. p. 10. p. de large Anm. : Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 226 und beziehen sich auf die Nrn. 225 und 226. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0226 Amigoni (Jacques) I Eleazar & Rebecca, proche de la fontaine. Marquee du No. 78. tous les deux peints sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: 2. p. 9 p. de haut sur 4. p. 10. p. de large Anm.: Die Angaben zum Material im Bildtitel beziehen sich auf die Nrn. 225 und 226. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0227 Amigoni (Jacques) I Le sacrifice d'Abraham. Peint sur toile, marque du No. 108. I Mat.: auf Leinwand Maße: 1. p. 4. p. de haut sur 1. p. 1 p. de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0228 Amigoni (Jacques) I Sainte Therese avec un ange. Peinte sur toile, marquee du No. 123. I Mat.: auf Leinwand Maße: 3. p. 3. p. de haut sur 2. p. 3 lh p. de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0229 Amigoni (Jacques) I Jesus Christ en Croix. Peint sur toile, marque du No. 126. I Mat.: auf Leinwand Maße: 2. p. 10 Vi p. de haut sur 1. p. 9. de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0230 Amigoni (Jacques) I La vierge avec l'enfant Jesus debout. Peint sur toile, marquee du No. 129. I Mat.: auf Leinwand Maße: 2. p. 7. p. de haut sur 2. p. 1. de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0231 Amigoni (Jacques) I Un Paysage dans lequel on voit la vierge qui alaite l'enfant Jesus, en presence de St. Joseph, pendant que le petit St. Jean mene un Agneau par le cordon. Peint sur toile de grandeur naturelle, marque du No. 475. I Mat.: auf Leinwand Maße: 5 pieds de haut sur 4. p. 2. p. de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
177
1769/00/00 MUAN 0232 Amigoni (Jacques) I Saint Jean Nepomucene, demie figure. Peint sur toile, marque du No. 476. I Mat.: auf Leinwand Maße: 3 p. 2. p. de haut sur 2. p. 6. p. de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0233 Amigoni (Jacques) I Le Dieu Pan badine avec une Nymphe en la prenant par le milieu du corps, pour l'enlever de terre, figures entieres. Peint sur toile marque du No. 688. I Mat.: auf Leinwand Maße: 6. p. 7. p. de haut sur 4. p. 10 Vi. p. de large Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0234 Amigoni (Jacques) I Deux morceaux, dans chacun il y a deux enfants, qui representent dans l'un la sculpture, & la peinture, & dans l'autre le dessein & l'ecriture. Peints sur toile marques des N o s 937 & 938. I Diese Nr.: Un morceau avec deux enfants, qui representent la sculpture, & la peinture Mat.: auf Leinwand Maße: 1. p. 5. p. de haut sur 1. p. 9. p. de large Anm.: Die Lose 234 und 235 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0235 Amigoni (Jacques) I Deux morceaux, dans chacun il y a deux enfants, qui representent dans Tun la sculpture, & la peinture, & dans l'autre le dessein & l'ecriture. Peints sur toile marques des N o s 937 & 938. I Diese Nr.: Un morceau avec deux enfants, qui representent le dessein & l'ecriture Mat.: auf Leinwand Maße: 1. p. 5. p. de haut sur 1. p. 9. p. de large Anm.: Die Lose 234 und 235 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt
sus en Sommeil.] I Maße: 3 Schuh 4 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 8 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (66 fl) Käufer: Geh R ν Koch 1785/05/17 MZAN 0620 Amiconi I Die Mutter Gottes mit dem Jesukind von Amiconi. [La S. Vierge avec l'enfant Jesus.] I Pendant zu Nr. 621 Maße: 2 Schuh 10 Zoll hoch, 2 Schuh 2 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (51 fl für die Nrn. 620 und 621) Käufer: Becker Glöckner 1785/05/17 MZAN 0621 Amiconi I Das Gegenbild, der H. Joseph mit dem Jesukind, von eben der Höhe und Breite. [Le pendant S. Joseph avec l'enfant Jesus.] I Pendant zu Nr. 620 Maße: 2 Schuh 10 Zoll hoch, 2 Schuh 2 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (51 fl für die Nrn. 620 und 621) Käufer: Becker Glöckner 1785/05/17 MZAN 0797 Amiconi I Die Mutter Gottes mit dem Jesukind und der H. Joseph von Amiconi. [La S. Vierge avec l'enfant Jesus & S. Joseph.] I Maße: 3 Schuh 2 Zoll hoch, 2 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (45 fl) Käufer: Neüss 1790/01/07 MUAN 0984 Amiconi I Abrahams Opfer, auf Leinwat. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 3 Schuh 8 Zoll, Breite 2 Schuh 11 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
1770/10/29 FRAN 0150 Amigoni I Die 4 Elementen 4 Stück. I Maße: Hoch 8 Zoll. Breit 13 Zoll. Transakt.: Unbekannt
1790/01/07 MUAN 1411 Amiconi I Joseph mit dem Jesuskinde, auf Leinwat, in einer geschnittenen und vergoldten Ram. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 1 Zoll, Breite 7 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
1777/03/03 AUAN 0016[a] Amigoni I Zwey Madonna, und Compag. St. Joseph. I Diese Nr.: Madonna; Pendant zu Nr. 16[b] von Bergmüller Maße: Höhe 1 Sch. 8 Vi Zoll, Breite 1 Sch. 4 Zoll Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt
1790/01/07 MUAN 1493 Amiconi I Diana auf einem Ruhebett, auf Leinwat, in einer metallisirten Ram. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 1 Zoll, Breite 1 Schuh 3 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
1777/03/03 AUAN 0045 Amigoni I Zwey St. Cajetan und St. Ignatius. I Maße: Höhe 1 Sch. 1 Zoll, Breite 1 Sch. Vi Zoll Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt
1793/00/00 HBMFD 0114 Amiconi I Loth zwischen seinen beyden Töchtern sitzend, hält mit beyden Händen ein Trinkgeschirr; über ihnen hängt eine Gardiene. Zur Linken im Vordergrunde Gefässe &c. In der Ferne das in Flammen stehende Sodom und Gommorra. I Pendant zu Nr. 115 Mat.: auf Leinwand Maße: 3 Fuss hoch, 3 Fuss 7 Zoll breit Verkäufer: Pierre Laporterie Transakt.: Unbekannt
1778/05/16 HBBMN 0062 Amiconi I Wie die Venus ihren unglücklichen Adonis beweint, extra schön. I Transakt.: Unbekannt 1778/05/23 HBKOS 0058 Aminconi I Bathseba im Bade, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 38 Vi Zoll, Breite 29 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0178 J. Amigoni I Eine Madonna, halbes Profil, drückt zärtlich das Christkind an ihren Busen. [La Vierge Marie, en demi-profil, presse affectueusement l'enfant Jesus contre son sein.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 4 Zoll hoch, 1 Fuß 9 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0245 Amiconi I Eine heilige Familie, Lebens=Größe=Figuren, mit Affect gemahlt, in der Manier von Raphael, ohnfehlbar von Amiconi, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 59 Zoll 6 Linien, Breite 47 Zoll 6 Linien Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/07/00 FRAN 0209 Jacob Amiconi I Jupiter in Gestalt eines schönen Jünglings, an der Seite Diana vorgestellt, nebst schönen Kindern und ein paar Windhunden. I Maße: 1 Schuh 5 Zoll hoch, 1 Schuh 9 Zoll breit Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] fl) 1784/08/02 FRNGL 0345 Amicony I Drey nackende Kinder, welche mit einem Vogel spielen, fürtreflich nach dem Leben abgebildet, von der geschickten Meisterhand des Amicony. I Maße: 31 Zoll breit, 39 Zoll hoch Verkäufer: Α Transakt.: Verkauft (48 fl) Käufer: von Dessau 1785/05/17 MZAN 0260 Amiconi I Die Mutter Gottes mit dem schlafenden Jesukind von Amiconi. [La S. Vierge tenant l'enfant Je178
GEMÄLDE
1793/00/00 HBMFD 0115 Amiconi I Das Gegenstück. Der Hain Mamre. Abraham kniet vor den dreyen Engeln nieder und will ihr Knie umfassen. Zur rechten wird man die Hütte gewahr, und in der Thür steht die lauschende Sarah. Diese beyden Gemälde sind auf das richtigste und edelste gezeichnet. Die Gewänder von grossen Styl. Die Composition einfach und sehr gefällig, die Färbung frisch und doch äusserst natürlich. Der Pinsel leicht und fertig. Der Farbenauftrag stark. I Pendant zu Nr. 114 Mat.: auf Leinwand Maße: 3 Fuss hoch, 3 Fuss 7 Zoll breit Verkäufer: Pierre Laporterie Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 FGAN [B]0036 Jokob Amiconi I Eine liegende Venus, auf Holz gemalt. I Mat.: auf Holz Maße: 9 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 2 Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt (20 fl) 1794/09/10 HB GOV 0073 Amiconi I Franziscus mit dem Kinde Jesu, und zu dessen Comp. Johannes der Täufer. I Diese Nr.: Franziscus mit dem Kinde Jesu Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 50 Vi Zoll, breit 36 Zoll Anm.: Die Lose 73 und 74 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HB GOV 0074 Amiconi I Franziscus mit dem Kinde Jesu, und zu dessen Comp. Johannes der Täufer. I Diese Nr.: Johannes der Täufer Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 50 Vi Zoll, breit 36 Zoll Anm.: Die Lose 73 und 74 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1797/04/25 HBPAK 0142 Amiconi I Maria, mit dem Christkinde, ganz mit Engeln umgeben; ein schönes Bild. Auf Leinwand, goldenen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 24 Vi Zoll, breit 17 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0169 Amiconi I Ein Thorweg eines Nonnenklosters, im Thore stehen drey Nonnen vor denen ein Pater, durch das Thor sieht man mehrere Nonnen, ihre Zellen, Garten, und Kirche. Sehr fein gemahlt. Auf Holz, goldenen Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 17 Vi Zoll, breit 13 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0243 Amiconi I Ein alter bärtiger Greis, noch seinen Dolch zuckend. Die Leidenschaft des Zorns ist unvergleichlich ausgedrückt. Auf Leinw., goldenen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 34 Vi Zoll, breit 28 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/08/10 MMAN 0319 Amiconi I Die H. Jungfrau, das Jesuskind und den H: Johannes. Von Amiconi, auf Tuch. I Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (30 fl Schätzung) 1798/06/04 HBPAK 0249 Amiconi I Die Aussicht eines Klosters nach der Strasse, worauf sich verschiedene Figuren befinden. Goldner Rahm. I Maße: Hoch 20 Zoll, breit 17 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0410 Amiconi I Die Heyrath der heiligen Catharina, mit vielen Figuren äusserst schön vorgestellt, und von herrlicher Composition und sanftem Colorit. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 30 Vi Zoll, breit 22 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0109 Jacob Amigoni \ Die Mutter Gottes mit dem Kinde, so einen Rosenkranz in den Händen hat, von Jacob Amigoni. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 2 Schuh 3 Zoll breit 1 Schuh 7 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Amigoni, Jacopo (oder Beich, J.F. oder Wentzel (Wenzel)) 1769/00/00 MUAN 0248 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de Γ hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francis Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0249 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils reprisentent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de 1'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francis Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0250 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen
katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0251 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0252 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils repräsentent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de ['hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0253 Beich (Joachim Francois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0254 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0255 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0256 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0257 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres GEMÄLDE
179
d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le pay sage, parnii ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de Γ hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0258 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de Γ hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0259 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0260 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0261 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de Γ hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0262 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0263 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prts de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen 180
GEMÄLDE
katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0264 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacrie, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de Γ hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0265 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de Γ hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0266 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0267 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0268 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils reprisentent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0269 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0270 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres
d'Amigoni & Wenzel, ils reprisentent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0271 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils repfesentent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francis Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0272 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils repfesentent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0273 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de diffirentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils reprisentent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0274 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils reprfsentent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0275 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacr£e, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: F r a n c i s Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0276 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen
katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0277 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de Γ hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Lein wand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francis Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0278 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de diffirentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Franfois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0279 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0280 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacr£e, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0281 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prös de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anw..· Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0282 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacrfie, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0283 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de diff6rentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres GEMÄLDE
181
d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie 1'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le pay sage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0284 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel! Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0285 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de 1'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0286 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0287 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de difförentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacrfie, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0288 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de diff6rentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacrfe, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0289 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen 182
GEMÄLDE
katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0290 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0291 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0292 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de diff6rentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0293 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacr£e, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0294 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de 1'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0295 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de 1'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.; Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0296 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres
d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0297 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0298 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francis Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0299 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de Γ hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0300 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0301 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0302 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen
katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0303 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francis Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0304 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0305 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0306 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0307 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0308 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0309 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres GEMÄLDE
183
d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacrtie, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la viie de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0310 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacr6e, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Franiois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0311 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de diff£rentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacrie, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: F r a n c i s Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0312 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pr£s de Gran & la vüe de 1'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: F r a n c i s Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0313 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de diffirentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de Γ hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0314 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0315 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen 184
GEMÄLDE
katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0316 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils repräsentent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0317 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de 1'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt
Amigoni, Jacopo (Geschmack von) 1782/02/18 RGBZN 0029 Amiconi I Ein Stück mit Kindern, in Geschmack von Amiconi. I Transakt.: Unbekannt (2 fl)
Amigoni, Jacopo (Kopie nach) 1786/05/02 NGAN 0233 Dir. Ihle; Amiconi I Eine Venus nach Amiconi von Dir. Ihle. I Kopie von J.E. Ihle nach J. Amigoni Maße: 1 Schuh 1 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (10.48 fl) Käufer: ν Holzschuher 1787/00/00 HB AN 0435 Nach Amiconi I Eine weinende Magdalena hält mit ihrer linken einen weißen Tuch vor das Gesicht, welches sie nach der rechten Schulter wendet, um mit einem neben ihr stehenden Engel zu sprechen. [Halbe Figure Lebensgröße] A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Transakt.: Verkauft (6 M) Käufer: Eckhard [mit] Η 1788/08/21 HB RMS 0042 Nach Amiconi I Die Mahlerey; durch Kinder vorgestellt. Auf Leinewand, ohne Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 28 Zoll, breit 34 Zoll Transakt.: Verkauft (2.10 M) Käufer: Seegel 1797/08/10 MM AN 0216 Amiconi I Eine H: Familie und mehrere Engel. Nach Amiconi auf Tuch. I Mat.: auf Leinwand Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (15 fl Schätzung) 1797/08/10 MMAN 0217 Amiconi I Die Heil: Jungfrau und das Jesuskind. Nach Amiconi auf Tuch. I Mat.: auf Leinwand Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (10 fl Schätzung) 1797/08/10 MMAN 0218 Amiconi I Der H. Joseph das Kind Jesus auf seinen Armen haltend. Nach Amiconi auf Tuch. I Mat.: auf Leinwand Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (9 fl Schätzung)
Amigoni, Jacopo (Manier) 1778/09/28 FRAN 0426 Amiconi I Eine Gesellschaft nackender Kinder, in der Manier von Amiconi. [Une troupe d'enfans nuds, dans le gout d'Amiconi.] I Pendant zu Nr. 427 Maße: 14 Zoll breit, 1
Schuh hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (23.30 fl für die Nrn. 426 und 427) Käufer: Schrintz 1778/09/28 FRAN 0427 Amiconi I Ein Compagnon, in der nemlichen Manier [von Amiconi], [le pendant du pr£c6dent, dans le meme gout [d'Amiconi].] I Pendant zu Nr. 426, "Eine Gesellschaft nackender Kinder" Maße: 14 Zoll breit, 1 Schuh hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (23.30 fl für die Nrn. 426 und 427) Käufer: Schrintz
Ammon, Konrad 1799/00/00 WZAN 0321 Conrad Ammon I Die Eitelkeit durch einen Todtenkopf vorgestellt, von Conrad Ammon. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 9 Vi Zoll breit 1 Schuh 7 Vi Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Andre, Jean (Frere Andre)
Amigoni, Jacopo (Schule)
1799/00/00 LZRCH 0087 Frere Andre I St. Dominique recevant l'ordre du rosaire, bell'esquisse. I Mat.: auf Leinwand Maße: h. 30. 1. 24. pouces Verkäufer: J F Rauch Transakt.: Unbekannt
1742/08/01 BOAN 0053[b] Amiconi I Mater Dei mit dem Kindlein von der Schuhle von Amiconi. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt
Andrea del Sarto
1777/03/03 AUAN 0061 Amigoni I Vier die vier Jahrszeiten Frauenzimmerkopf, aus der Schull Amigoni. I Maße: Höhe 11 Zoll, Breite 8 Vi Zoll Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt 1777/03/03 AUAN 0110 Amiconi Schull I Ein Frauenbild. I Maße: 3 Zoll hoch, 2 V* Zoll breit Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt 1789/00/00 MMAN 0289 Amiconi I Zwey Stücke den Appollo und Daphne, dann den Bachus und die Ariadne vorstellend, auf Leinw. 3 Fuß 3 Zoll hoch und 4 Fuß 8 Zoll breit, aus der Schule des Amiconi. [Deux morceaux representant Appollon et Daphne, Bachus et Adriadne, sur toile, de 3 pieds 4 po. de haut, sur 4 po. de large, de l'cole d'Amiconi.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 3 Fuß 3 Zoll hoch, 4 Fuß 8 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (5 fl)
Amigoni, Ottavio 1799/00/00 WZAN 0203 Octavius Amigoni I Die Mutter Gottes mit dem Kinde, von Octavius Amigoni. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 10 Zoll breit 2 Schuh 2 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Ammon (Amon, Amonn) 1793/00/00 NGWID 0214 Ammon I Eine kleine Landschaft mit einigen Figuren, von Ammon. I Maße: 6 Zoll hoch, 8 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0316 Ammon I Eine reizende Landschaft mit sehr artigen Figuren, nebst einer Wassermühle, von Ammon. I Pendant zu Nr. 317 Maße: 6 Vi Zoll hoch, 8 Vi Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0317 Ammon I Zum Compagnon, eine nicht minder schöne Landschaft, von obigem Meister [Ammon] und Maaß. I Pendant zu Nr. 316 Maße: 6 Vi Zoll hoch, 8 Vi Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0509 Ammon I Eine felsigte mit Ruinen staffierte Landschaft, mit Figuren und fließendem Wasser, nebst angenehmer Entfernung, von Ammon. I Pendant zu Nr. 510 Maße: 1 Schuh 5 Zoll hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0510 Ammon I Zum Gegenstück, eine nicht minder schöne Landschaft, mit vielen Figuren und einer alten Burg, nebst fliessenden Wasser und überaus schönem Baumschlag durchgehende staffiert, von obigem Meister [Ammon] und Maaß. I Pendant zu Nr. 509 Maße: 1 Schuh 5 Zoll hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
1787/01/15 LZRST 0012 Andr. del Sarto I Das Füssewaschen, ein grosses schönes componirtes Gemälde, von Andr. del Sarto auf Holz gemalt, etwas weniges ausgebessert, 27 Zoll hoch, 20 Z. breit in schw. gebeizt. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: 27 Zoll hoch, 20 Zoll breit Verkäufer: Richter Transakt.: Unbekannt 1788/01/15 LZRST 3978 Andr. del Sardo I Christus wäscht den Jüngern die Füsse, ein grosses schön komponirtes Gemähide, von Andr. del Sardo auf Holz gemahlt, etwas weniges ausgebessert, 27 Z. hoch, 20 Z. breit, in schw. gebeitzten Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: 27 Zoll hoch, 20 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt. : Verkauft (1.16 Th) Käufer: Act 1794/00/00 HB AN 0032 Andr. Vannucchi, genannt del Sarto I Auf dem Einen ruhen und schlummern einige Räuber, neben dem Piedestal einer gestürzten Pyramide, hinter welcher sich eine Palme hervorbiegt; ein zu ihnen gehöriges Frauenzimmer badet ihr Bübchen in einem unter Burgruinen fortrieselnden Wasser, im Vorgrunde rechter Hand. Auf dem Andern plündern sie einen Reiter vor einer Felsenhöhle; Einer reitet auf dessen Schimmel davon. Im Vorgrunde kämpfen die Doggen mit einander. I Diese Nr.: Einige Räuber ruhen und schlummern, neben dem Piedestal einer gestürzten Pyramide Maße: Höhe 25 Zoll, Breite 35 Zoll Anm.: Die Lose 32 und 33 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 HB AN 0033 Andr. Vannucchi, genannt del Sarto I Auf dem Einen ruhen und schlummern einige Räuber, neben dem Piedestal einer gestürzten Pyramide, hinter welcher sich eine Palme hervorbiegt; ein zu ihnen gehöriges Frauenzimmer badet ihr Bübchen in einem unter Burgruinen fortrieselnden Wasser, im Vorgrunde rechter Hand. Auf dem Andern plündern sie einen Reiter vor einer Felsenhöhle; Einer reitet auf dessen Schimmel davon. Im Vorgrunde kämpfen die Doggen mit einander. I Diese Nr.: Einige Räuber plündern einen Reiter vor einer Felsenhöhle Maße: Höhe 25 Zoll, Breite 35 Zoll Anm.: Die Lose 32 und 33 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 LZRCH 0005 Andrea Del Sarto I C16opätre vue nüe jusqu'aux genoux, de grandeur natur. tenante les deux serpents, on reconnoit dans ce tableau, la belle couleur de ce grand peintre. I Mat.: auf Holz Maße: h. 44.1. 27. pouces Verkäufer: J F Rauch Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0365 Andreas del Sarto I Die heilige Familie Christi, von Andreas del Sarto. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh 6 Zoll breit 6 Schuh Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/12/23 WNAN 0007 Andre del Sarto I Une Madelaine offrant une Vase de Parfüms a l'enfant Jesus par Andre del Sarto sur Bois. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt 1799/12/23 WNAN 0035 Andre Del Sarto I La Parabole du Vigueron, d'Andre del Sarto de sa premiere maniere. I Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
185
1800/00/00 FRAN1 0104 Sarte (And. del) I Eine heilige Familie mit zwei Kinder, ein schönes Stück. Der Kopf des alten Mannes und beide Kinder sind ungemein fleißig gearbeitet. I Mat.: auf Holz Maße: 13 Zoll hoch, 25 Vi Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 2 Zoll breit 2 Schuh 6 Zoll Anm.: Die Lose 453 und 454 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1800/00/00 FRAN1 0105 Sarte (And. del) I Maria mit dem Kind. I Mat.: auf Holz Maße: 15 Zoll hoch, 12 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Angermayer, Johann Adalbert
Andrea del Sarto (Kopie von)
1723/00/00 PRAN [A]0019 Angermejer I Ein Blumen=Stuck/ vom Angermejer/ Compagnion No [A] 14. I Pendant zu Nr. [A]14 von Veerendael Maße: Höhe 2 Vi Schuh 4 Vi Zoll, Breite 4 Schuh 1 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt
1799/00/00 LZAN 0007 Andre del Sarto; Raphael I Trois Tableaux, d'apres les cartons de Raphael, dont les sujets sont trois martyres, reunissans ä la plus riche composition une tres-belle ordonnance. Une immense quantite de figures, toutes variees, fait un effet tres-pittoresque. Les fonds sont en architecture dont nombre d'accessoires augmentent le merite. I Kopie von Andrea del Sarto nach Raffaello Santi Mat.: auf Leinwand Maße: Hauteur 30 pouces, largeur 22 pouces Transakt.: Unbekannt (30 Louis Schätzung)
1723/00/00 PRAN [A]0099 Angermejer I Ein Blumen=Stuck / vom Angermejer. I Pendant zu Nr. [A]100 Maße: Höhe 1 Schuh, Breite Vi Schuh 1 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt
Andrea del Sarto (Kopie nach) 1750/04/00 HB AN 0069 Andrea del Sarte ! Eine heilige Familie, nach Andreo del Sarte. I Transakt.: Unbekannt
1723/00/00 PRAN [B]0006 Angermejer I Blumen Festonen / vom Angermejer. I Pendant zu Nr. [B]7 Maße: Höhe 2 Schuh 3 Zoll, Breite 1 Vi Schuh 3 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt
1788/09/01 KOAN 0300 Andre del Sarto I Eine Mutter mit 4 Kindern, nach Andre del Sarto. [une mere avec 4 enfans, selon Andre del Sato.] I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 4 Fuß 8 Zoll, Breite 3 Fuß 9 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt
1723/00/00 PRAN [B]0007 Angermejer I Compagnion von eben diesem [Angermejer]. I Pendant zu Nr. [B]6, "Blumen Festonen" Maße: Höhe 2 Schuh 3 Zoll, Breite 1 Vi Schuh 3 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt
Andrea del Sarto (Schule) 1782/02/18 RGBZN 0049 Andr. del Sarto I Joseph mit Potiphars Frau, aus der Schule des Andr. del Sarto. I Transakt.: Unbekannt (16 fl)
Andriessen, Hendrik 1764/05/22 BOAN 0081 Andrissens I Un grand Tableau de six pieds de largeur & quatre pieds six pouces de hauteur, representant Vanite du Monde ä demi figure de grandeur naturelle, peint par Andrissens. [Ein großes stück Vorstellend die Eitelkeit der weld mit halben figuren in Lebensgröße Von Ardriesseens.] I Maße: 6 pieds de largeur & 4 pieds 6 pouces de hauteur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (60 Rt) Käufer: Beckering
Angel, Philips 1794/00/00 HB AN 0145 P. Arget I Ein Knabe füttert seine Hüner im Hünerstalle. I Maße: Höhe 9 Zoll, Breite 10 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt
Angeli, Cesare 1799/00/00 WZAN A0426 Caesar Angeli I Die heilige Magdalena, von Caesar Angeli. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 8 Zoll breit 6 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Angelini, Scipione 1799/00/00 WZAN 0453 Scipio Angelini I Zwey Bauemstücke, von Scipio Angelini. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Bauemstück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 2 Zoll breit 2 Schuh 6 Zoll Anm.: Die Lose 453 und 454 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0454 Scipio Angelini I Zwey Bauernstücke, von Scipio Angelini. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Bauernstück 186
GEMÄLDE
1723/00/00 PRAN [A]0100 Angermejer I Compagnion von eben diesem [Angermejer]. I Pendant zu Nr. [A]99, "Ein Blumen= Stuck" Maße: Höhe 1 Schuh, Breite Vi Schuh 1 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt
1723/00/00 PRAN [B]0042 Angermejer I Vogel stuck / vom Angermejer. I Pendant zu Nr. [B]43 Maße: Höhe 1 Vi Schuh 1 Vi Zoll, Breite 1 Schuh 2 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN [B]0043 Angermejer I Compagnion / von eben diesem [Angermejer]. I Pendant zu Nr. [B]42, "Vogelstuck" Maße: Höhe 1 Vi Schuh 1 Vi Zoll, Breite 1 Schuh 2 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN [B]0044 Angermejer I Zwey Vogelstuck / vom Angermejer. I Pendant zu Nr. [B]45 Maße: Höhe 1 Vi Schuh 1 Vi Zoll, Breite 1 Schuh 2 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN [B]0045 Angermejer I Compagnion / von dieser Hand [Angermejer]. I Pendant zu Nr. [B]44, "Zwey Vogelstuck" Maße: Höhe 1 Vi Schuh 1 Vi Zoll, Breite 1 Schuh 2 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN 0143 Angermejer I Compagnion darzu [Ein Blumen=Stuck] vom Angermejer. I Pendant zu Nr. 142 von J.R. Bys Maße: Höhe 1 Vi Schuh 2 Zoll, Breite 1 Schuh 1 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN 0147 Angermejer I Compagnion / vom Angermejer. I Pendant zu Nr. 146, "Blumen=Stuck" von R. Savery Maße: Höhe 1 Vi Schuh 2 Zoll, Breite 1 Schuh 2 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0192 Angermeyer I Deux pieces admirables, sur toile, & bien conservees, le plus beau travail d'Angermeyer. I Diese Nr.: Une piece admirable Mat.: auf Leinwand Maße: Largeur 11 1/3 Pouces, Haut 1 Pies 2 % Pouces Anm.: Die Lose 192 und 193 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0193 Angermeyer I Deux pieces admirables, sur toile, & bien conservees, le plus beau travail d'Angermeyer. I Diese Nr.: Une piece admirable Mat.: auf Leinwand Maße: Largeur 11 Va Pouces, Haut 1 Pies 2 % Pouces Anm.: Die Lose 192 und 193 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt
1767/00/00 KOAN 0115 Angermeyer I Zwey bewunderens würdig=fleissige Insecten Stück auf Leinwand wohl conserviret, die beste Arbeit von Angermeyer. I Mat.: auf Leinwand Maße: Breite 1 Fuß 7 Vi Zoll, Höhe 1 Fuß 10 % Zoll Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0165 Angermeyer I Ein Tafel=Stück mit Früchten und Wein auf Holz von Angermayer 1705. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Schuh 4 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 11 Vi Zoll breit Inschr.: 1705 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt
Ant, Jan van [Nicht identifiziert] 1779/00/00 HB AN 0134 Jean van Ant I Die stürmische See mit etlichen Schiffen. Auf Holz gemahlt. [Marine. Une mer orageuse & quelques vaisseaux. Sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 9 Zoll hoch, 1 Fuß breit Anm.: Der Bildtitel bezieht sich nur auf ein Gemälde, es werden aber zwei Losnummern angegeben. Wahrscheinlich handelt es sich um zwei Gemälde. Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0135 Jean van Ant I Die stürmische See mit etlichen Schiffen. Auf Holz gemahlt. [Marine. Une mer orageuse & quelques vaisseaux. Sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 9 Zoll hoch, 1 Fuß breit Anm.: Der Bildtitel bezieht sich nur auf ein Gemälde, es werden aber zwei Losnummern angegeben. Wahrscheinlich handelt es sich um zwei Gemälde. Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1789/06/12 HBTEX 0020 J.v. Ant I Ein stiller und ein stürmischer Seeprospect, mit vielen Schiffen. Sehr frey gemahlt, auf Holz. I Diese Nr.: Ein stiller Seeprospect Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 20 Zoll Anm.: Die Lose 20 und 21 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (4.12 Μ für die Nrn. 20 und 21) Käufer: Schmidt 1789/06/12 HBTEX 0021 J.v. Ant I Ein stiller und ein stürmischer Seeprospect, mit vielen Schiffen. Sehr frey gemahlt, auf Holz. I Diese Nr.: Ein stürmischer Seeprospect, mit vielen Schiffen Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 20 Zoll Anm.: Die Lose 20 und 21 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (4.12 Μ für die Nrn. 20 und 21) Käufer: Schmidt 1792/04/19 HBBMN 0039 J. van Anth I Zwey See=Prospecte mit großen und kleinen Schiffen, sehr fleißig gemahlt, von J. van Anth. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein See=Prospect mit großen und kleinen Schiffen Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 22 Zoll Anm.: Die Lose 39 und 40 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1792/04/19 HBBMN 0040 J. van Anth I Zwey See=Prospecte mit großen und kleinen Schiffen, sehr fleißig gemahlt, von J. van Anth. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein See=Prospect mit großen und kleinen Schiffen Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 22 Zoll Anm.: Die Lose 39 und 40 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Anthonissen, Hendrick van 1763/01/19 FRJUN 0118 van Antem I Perspective d'une reviere avec des Bateaux. I Maße: hauteur 19 pouces, large 25 pouces Transakt.: Unbekannt (15 fl)
Anting [Nicht identifiziert] 1798/06/04 HBPAK 0191 Anting I Ein Land= und Wasserprospect bey Mondlicht. Im Vordergrunde Bauern, die sich am Feuer wärmen; zur Rechten eine Ueberfahrt. Gut gemahlt. Auf Holz, goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Zoll, breit 16 Zoll Transakt.: Unbekannt
Anto, Peter [Nicht identifiziert] 1793/00/00 NGWID 0395 Peter Anto I Eine sehr fleißig ausgeführte Landschaft mit verfallenen Ruinen eines alten Schlosses, nebst einigen Figuren und schönen Vieh ausgeführt, von Peter Anto. I Pendant zu Nr. 396 Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 9 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0396 Peter Anto I Zum Gegenstück, eine eben so angenehme Landschaft, mit verfallenen Ruinen und übrigen Beywesen, von nemlichem Meister [Peter Anto] und Maaß. I Pendant zu nr. 395 Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 9 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
Antoni, M. [Nicht identifiziert] 1790/09/10 HBBMN 0059 M. Antoni I Eine biblische Geschichte aus dem neuen Testament, ganz vortreflich und ausnehmend fleißig gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 % Zoll, breit 16 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (3 M) Käufer: Ego
Antoniani, Pietro 1789/04/16 HBTEX 0060 Pietro Antoniano Milanais I Sieben Stück Stadt- Land- und Wasser-Prospecte, wobey die Stadt Neapel und Messina, wie auch der Vesuv und andere herrliche umliegende Gegenden, in dem Königreich Neapolis; welche auf das vortreflichste gemahlt. Alle diese sieben Stücke sind mit der regelmäßigsten Art der Bauordnung und perspectivischen Vorstellung besonders schön abgebildet, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 13 Zoll, breit 20 Zoll Transakt.: Verkauft (110.04 M) Käufer: Bostelmann
Antoniano 1792/02/01 LZRST 4872 Antoniano I Eine grosse Bataille der Sarazenen, von Antoniano gemahlt. [Alle vier Stücke sind mit vieler Kühnheit auf Leinwand gemahlt, und in allen herrscht der Tumult der Feldschlacht.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 49 Zoll hoch, 63 Zoll breit Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 4875 und beziehen sich auf die Nm. 4872 bis 4875. Transakt.: Verkauft oder Unverkauft (3 Th) Käufer: R[ost] 1792/02/01 LZRST 4873 Antoniano \ Eine andere Bataille der Sarazenen, vom nehmlichen Meister [Antoniano], [Alle vier Stücke sind mit vieler Kühnheit auf Leinwand gemahlt, und in allen herrscht der Tumult der Feldschlacht.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 49 Zoll hoch, 63 Zoll breit Anm.: Die ersten Angaben in eckigen Klammem im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 4875 und beziehen sich auf die Nrn. 4872 bis 4875. Transakt.: Verkauft oder Unverkauft (1.12 Th) Käufer: R[ost] 1792/02/01 LZRST 4874 Antoniano I Eine andere Bataille der Sarazenen, vom nehmlichen Meister [Antoniano]. [Alle vier Stücke sind mit vieler Kühnheit auf Leinwand gemahlt, und in allen herrscht der Tumult der Feldschlacht.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 49 Zoll hoch, 63 Zoll breit Anm.: Die ersten Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 4875 und beziehen sich auf die Nrn. 4872 bis 4875. Transakt.: Verkauft oder Unverkauft (3 Th) Käufer: R[ost] 1792/02/01 LZRST 4875 Antoniano I Eine andere Bataille der Sarazenen, vom nehmlichen Meister [Antoniano], Alle vier Stücke sind mit vieler Kühnheit auf Leinwand gemahlt, und in allen herrscht der Tumult der Feldschlacht. I Mat.: auf Leinwand Maße: 49 Zoll hoch, 63 Zoll breit Anm. : Die Angaben im Bildtitel beziehen sich auf die Nrn. 4872 bis 4875. Transakt.: Verkauft oder Unverkauft (2 Th) Käufer: R[ost] GEMÄLDE
187
Antonissen, Henricus Josephus
Apshoven
1781/00/00 WRAN 0036 Antonissen (H.I.) I Unjeune Berger appuie sur son baton; on voit ä sa gauche un Boeuf; devant lui deux Moutons, un de bout & 1'autre couche, & ä sa droite deux Boeufs couchis, ä la gauche du tableau un gros tronc d'arbre sec; un peu sur le milieu on lit Η. I. Antonissen F. 1776. Ce superbe Pay sage est peint sur toile. I Pendant zu Nr. 37 Mat.: auf Leinwand Maße: 25 pouces de haut, sur 34 pouces 5 lignes de large Inschr.: Η. I. Antonissen F. 1776 (bezeichnet und datiert) Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt
1723/00/00 PRAN [A]0059 Apshoffen I Holländische Bauern Hochzeit / vom Apshoffen. Compag. No [A]69. I Pendant zu Nr. [A]69 Maße: Höhe 1 Schuh 4 Vi Zoll, Breite 1 Vi Schuh 5 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt
1781/00/00 WRAN 0037 Antonissen (H.I.) I Pendant du precedent, oü se voit une jeune Bergfere assise, travaillant ä Γ aiguille, ä cote d'elle un panier & un Mouton, derriere, sur le haut, un autre Mouton, & devant eile ä droite du Tableau trois Boeufs, un est couche, au milieu est un vieux arbre sec, sur la gauche au pied d'un tronc d'arbre: on lit Η. I. Antonissen F. 1776, meme grandeur que l'autre. I Pendant zu Nr. 36 Mat.: auf Leinwand Maße: 25 pouces de haut, sur 34 pouces 5 lignes de large Inschr.: Η. I. Antonissen F. 1776 (bezeichnet und datiert) Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0038 Antonissen (H.I.) I Un Paysage oü se voit un Rocher, sur la gauche un jeune Homme assis, les deux mains sur un panier, un couteau dans une, & du pain dans l'autre; derrifcre lui trois Vaches, deux sont couchies, & prfes de lui ä sa droite un Mouton la gueule belante: on lit sur la droite Η. I. Antonissen F. 1773. Tableau peint sur toile. I Pendant zu Nr. 39 Mat.: auf Leinwand Maße: haut 24 pouces 10 lignes, large 33 pouces 6 lignes Inschr.: Η. I. Antonissen F. 1773 (bezeichnet und datiert) Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0039 Antonissen (H.I.) I Pendant du prec£dent, oü se voit un jeune Berger de bout, tenant un baton des deux mains, devant lui un chien couchi: plus loin un Mouton dormant et trois vaches, deux sont couchees, & tout sur la droite un Belier belant, au dessous de lui on lit, H.I. Antonissen F. 1773. peint sur toile, & meme grandeur que celui ci dessus. I Pendant zu Nr. 38 Mat.: auf Leinwand Maße: haut 24 pouces 10 lignes, large 33 pouces 6 lignes Inschr.: Η. I. Antonissen F. 1773 (bezeichnet und datiert) Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0040 Antonissen (H.I.) I Un Paysage, oü se voit un Berger couche, la tete appuie sur son coude; ä sa droite une Vache & deux ä sa gauche, une est couchie: en bas sur la droite on lit H.I. Antonissen F. 1771. Beau Tableau peint sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: 30 pouces de haut, sur 46 pouces 6 lignes de large Inschr.: Η. I. Antonissen F. 1771 (bezeichnet und datiert) Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt
Anyhoff [Nicht identifiziert] 1782/08/21 HB KOS 0017 Anyhoff] Eine holländische ländliche Küche, zur Linken scheuert eine Frau Teller, um derselben her liegen und stehen häusliche Geräthschaften, fleißig gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Zoll 4 Linien, breit 16 Zoll 7 Linien Verkäufer: Moddermann Transakt.: Verkauft (15 M) Käufer: Iven
Appelius (Apel) 1742/08/01 BOAN 0009[b] Happelius I Zwey Ruinen Stuck mit verguldeten Rahmen beyde Originalien, eines von Natalie und das andere von Happelius. I Diese Nr.: Ein Ruinen Stuck; Nr. 9[a] von Natali Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0291 Happelius I Ein Ovidisches Stuck. Original von Happelius. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0602 Happelius I Zwey Ruinen Stuck. Orig. von Happelius. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 188
GEMÄLDE
1723/00/00 PRAN [A]0069 Apshoffen I Holländische Bauern / vom Apshoffen. Compagnion No [A]59. I Pendant zu Nr. [A]59 Maße: Höhe 1 Schuh 4 Vi Zoll, Breite 1 Vi Schuh 5 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN [A]0145 Apshofen I Holländische Baurern Kirchweyh / vom Apshofen. Comp. No [A] 148. I Pendant zu Nr. [A]148 von Francken oder Vrancx Maße: Höhe 1 Vi Schuh 4 Zoll, Breite 2 Vi Schuh 3 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1797/02/27 HBPAK 0029 Abshöven I Vor einem Bauernhause ziehet ein Bauer Wasser aus einem Brunnen, hinter ihm eine Frau, welche gebückt Wasser ausgiesset; zur Rechten einige Baijen mit Krücken ec. Zur Linken ein wandernder Bauer, welcher nach einem Kirchdorfe gehet. Dieses Stück ist ganz vortreflich gemahlt, und kann mit einen Tennier verglichen werden. Auf Leinwand. Im goldn. Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 34 Zoll, breit 47 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/02/27 HBPAK 0075 Aishoven I Zwey Landschaften; das Eine, wo der Hirte blaset und Vieh hütet; das Andere, wo zwey Bauern ihr Vieh treiben. Ganz kräftig gemahlt, in des Tenniers Manier. Im goldnen Rahm. I Diese Nr.: Eine Landschaft, wo der Hirte bläset und Vieh hütet Maße: Hoch 9 Zoll, breit 13 Zoll Anm.: Die Lose 75 und 76 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/02/27 HBPAK 0076 Aishoven I Zwey Landschaften; das Eine, wo der Hirte bläset und Vieh hütet; das Andere, wo zwey Bauern ihr Vieh treiben. Ganz kräftig gemahlt, in des Tenniers Manier. Im goldnen Rahm. I Diese Nr.: Eine Landschaft, wo zwey Bauern ihr Vieh treiben Maße: Hoch 9 Zoll, breit 13 Zoll Anm.: Die Lose 75 und 76 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0152 Absoven I Eine Landschaft. Im Vordergrunde Fischer, welche mit ihren Netzen im Wasser fischen. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Vi Zoll, breit 13 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0208 Absoven I Eine Dorf= und Wassen= Gegend. In der Mitte eine hohe Brücke über das Wasser. Im Vordergründe, vor einem Wirthshause, ein Reuter zu Pferde, welcher dem Wirth seine Zeche bezahlt. Sehr gut gemahlt. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 14 Zoll, breit 20 Zoll Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN1 0001 Abshoven I Ein inneres Bauernhaus, im ersten Plan sitzt eine schlafende Frau, vor ihr sind mehrere Küchengeräthschaften. I Mat.: auf Leinwand Maße: 22 Zoll hoch, 27 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN2 0001 Abshoven I Ein Inneres von einem Bauernhaus. Im vordem Grund sitzt ein auf der Zither spielender Mann, welchem ein Glas Wein von einer Frau gebracht wird. In der Tiefe des Zimmers nahe beym Kamin, spielen mehrere Bauern mit Karten. Dieses Stück hat einen kecken Pinsel, und ist von schöner Farbemischung I Mat.: auf Leinwand Maße: 10 Zoll hoch, 13 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Ar. [Nicht identifiziert] 1763/01/19 FRJUN 0144 Par Ar. I Une femme assise tenant un pot ä biere dans la main. I Maße: hauteur 8 Vi pouces, large 6 % pouces Transakt.: Unbekannt (2.40 fl)
Arens, R. [Nicht identifiziert] 1792/08/20 KOAN 0315 R. Arens I Ein See=Fährtchen auf Holz von R. Arens. I Mat.: auf Holz Maße: 5 Zoll hoch, 7 Vi Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt
Arentsz., Arent (Arent van der Cabel) 1790/08/25 FRAN 0404 Arenseen I Zwey Landschaften mit vielen Figuren. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit vielen Figuren Maße: hoch 15 Zoll, breit 22 Zoll Anm.: Die Lose 404 und 405 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (12 fl für die Nm. 404 und 405) Käufer: Waigel [?] 1790/08/25 FRAN 0405 Arenseen I Zwey Landschaften mit vielen Figuren. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit vielen Figuren Maße: hoch 15 Zoll, breit 22 Zoll Anm.: Die Lose 404 und 405 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (12 fl für die Nrn. 404 und 405) Käufer: Waigel [?]
Aretusi, Pellegrino (Munari) 1779/00/00 HB AN 0236 Pellegrini de Modena I Die Heimsuchung der Maria. Eine Skizze auf Papier gemalt und auf Leinwand gezogen. [La visitation de la Vierge. Esquisse peinte sur papier & tendue sur toile.] I Mat.: Papier auf Leinwand Maße: 1 Fuß 3 Zoll hoch, 11 breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt
Arrietino [Nicht identifiziert] 1798/01/19 HBPAK 0091 L'Arrietino I Zwey sitzende Bauern, von L'Arrietino. Treue Copien der Natur. 1 Fuß 9 Zoll hoch, 1 Fuß 3 Zoll breit. Goldn. Rahm. I Maße: 1 Fuß 9 Zoll hoch, 1 Fuß 3 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
lend eine der angenehmsten Aussicht. Die Luft hierinn ist glänzend, die abwechselnde Absätze natürlich, die Veränderung von Schatten und Licht Übertrift in einigen Gegenständen seinen Lehrmeister Johann Wildens, und man bemerket überhaupt an diesem Stücke die seyn sollende Jahreszeit, und alles das, was zu einer schönen Landschaft und dessen Studium gehöret, ist nicht allein im Vordergründe von Disteln und Kräutern, sondern auch mit den schönsten Figuren belebet. I Maße: 2 Schuhe 8 Zoll hoch, 3 Schuhe 2 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (40 fl Schätzung) 1781/00/00 WZAN 0063 Jakob von Artoy I Ein Stück 2 Schuhe, 8 Zoll hoch, 3 Schuhe, 2 Zoll breit von Jakob von Artoy, vorstellend eine der angenehmsten Aussicht. Die Luft hierinn ist glänzend, die abwechselnde Absätze natürlich, die Veränderung von Schatten und Licht Übertrift in einigen Gegenständen seinen Lehrmeister Johann Wildens, und man bemerket überhaupt an diesem Stücke die seyn sollende Jahreszeit, und alles das, was zu einer schönen Landschaft und dessen Studium gehöret, ist nicht allein im Vorgrunde von Disteln und Kräutern, sondern auch mit den schönsten Figuren belebet. I Maße: 2 Schuhe 8 Zoll hoch, 3 Schuhe 2 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1787/10/06 HBTEX 0024 Artois I Eine extra rare Landschaft, mit schönen Figuren, von Artois, mit dito [vergoldeten] Rahm. I Transakt.: Unbekannt 1788/10/01 FRAN 0018 Jacob von Arthois I Eine Landschaft mit Figuren, sehr angenehm und von großer Aehnlichkeit von Jacob von Arthois. I Maße: 18 Zoll hoch, 22 Zoll breit Transakt.: Verkauft (22 fl) Käufer: Spitalmeister 1788/10/01 FRAN 0028 Jacob von Arthois I Eine sehr angenehme Landschaft mit Figuren und Pferden. I Maße: 14 Vi Zoll hoch, 19 Zoll breit Transakt.: Verkauft (18.15 fl) Käufer: von Schmid
Art, J. van [Nicht identifiziert]
1788/10/01 FRAN 0053 Jacob von Arthois I Ein Winterstück mit Figuren, von Jacob von Arthois, 9 Zoll hoch, 12 Vi Zoll breit. Dieses Stück ist eines der schönsten dieses Meisters. I Maße: 9 Zoll hoch, 12 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (6.15 fl) Käufer: von Schmid
1788/06/12 HBRMS 0075 J. van Art I Der Strand bey Schevelingen, wo einige Herrn und Damen Schiffe ankommen und abfahren sehen. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 26 % Zoll, breit 28 Zoll Transakt.: Unbekannt
1788/10/01 FRAN 0054 Jacob von Arthois I Eine Landschaft, eben so fein wie die vorige [Nr. 53], das Gewitter macht einen auffallenden und sehr natürlichen Effect. I Maße: 5 Zoll hoch, 7 Zoll breit Transakt.: Verkauft (8.15 fl) Käufer: Boy
1789/04/16 HBTEX 0017 I. v. Art I Ein Seeprospect mit Schiffen, an einem gebürgigten Ufer mit Holzung; sehr schön gemahlt auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 23 Zoll, breit 29 Zoll Transakt.: Verkauft (2 M) Käufer: Ego
1789/00/00 MMAN 0058 Jakob von Artois I Eine Landschaft, auf Leinw. [Un paysage, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 10 Zoll hoch, 3 Fuß breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (44 fl)
Arthois, Jacques d'
1789/00/00 MMAN 0136 Jacob von Artois I Eine Landschaft, auf Leinw. [Un paysage, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 4 Zoll hoch, 2 Fuß breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (18 fl)
1723/00/00 PRAN 0042 Artois I Ein Bacchus vom Artois, in Metalliner Rahm. I Maße: Höhe 6 Schuh 5 Zoll, Breite 9 Schuh 2 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0310 Artois I Eine Landschafft. Original von Artois. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0158 Artois I Paisage, par Artois. I Maße: Haut 1. pie 4. pouces. large 1. pie 9. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1764/05/21 BOAN 0055 Artoas I Un Paisage de deux pieds un pouce de l'argeur, d'un pied six pouces de hauteur, representant des Bergers avec leurs Troupeaux, peints par d'Artoas. [Ein stück Vorstellend Eine Landschaft mit hirthen und Viehe Von artoas.] I Maße: 2 pieds 1 pouce de l'argeur, 1 pied 6 pouces de hauteur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (31.30 Rt) Käufer: Frantzen 1776/00/00 WZTRU 0063 Jakob von Artoy I Ein Stück 2 Schuhe, 8 Zoll hoch, 3 Schuhe, 2 Zoll breit von Jakob von Artoy, vorstel-
1789/00/00 MMAN 0298 Jacob van Artois I Ein königl. Baad, auf Holz. [Un bain royal, sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Zoll hoch, 10 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (5 fl) 1789/00/00 MMAN 0322 Jacob van Artois I Zwei Landschäftchen, auf Holz. [Deux petits paysages, sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 10 Zoll hoch, 1 Fuß 2 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (50 fl) 1789/00/00 MMAN 0389 Jacob van Artois I Eine Landschaft, auf Kupfer. [Un paysage, sur cuivre.] I Mat.: auf Kupfer Maße: 1 Fuß 3 Zoll hoch, 1 Fuß 6 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt 1791/09/21 FRAN 0053 Van Artois I Eine kleine Landschaft mit Bäumen, Häusem und Flüssen gezieret, und eine Brücke, wo die Reisenden übergehen. I Transakt.: Verkauft (6.45 fl) Käufer: C Burger GEMÄLDE
189
1791/10/21 HBRMS2 0018 Arboise I Eine vortrefliche gebürgigte und waldigte Landschaft, im Vordergrunde befinden sich drey Figuren in griechischer Kleidung auf der Landstraße, welche sich im dicken Walde zur Rechten verlieret; im Mittelgrunde Hirten und Vieh. Dieses Gemähide ist in einer besonders großen Mannier auf das meisterhafteste gemahlt. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 46 Zoll, breit 60 Zoll Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "Arboise", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 FGAN [B]0048 Jakob van Artois I Eine Landschaft, mit Vieh stafiert, auf Tuch gemalt. I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Schuh 3 Zoll hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt (10 fl) 1797/08/10 MMAN 0314 van Artois I Eine Landschaft von van Artois auf Tuch. I Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (15 fl Schätzung) 1799/10/18 LZAN 0092 Van Artois I Eine Landschaft; rechts beym Eingang in einen Wald stehen drey männliche Figuren, ein Ochs und zwey Schaafe, links eine Aussicht in eine prächtige Gegend, in dem lieblichsten Geschmack gemahlt; hoch 9 Zoll, 11 Vi Zoll. Auf Holz, in einem reichen Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 9 Zoll, 11 Vi Zoll Verkäufer: Rauch Transakt.: Verkauft (15 Th) Käufer: Geist 1799/12/04 HBPAK 0105 Hans Artois I Zwey bergigte Land= und Wasser=Gegenden mit Figuren und Vieh. Ganz kräftig und brav gemahlt. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine bergigte Land= und Wasser=Gegend mit Figuren und Vieh Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 32 Zoll, breit 46 Zoll Anm.: Die Lose 105 und 106 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0106 Hans Artois I Zwey bergigte Land= und Wasser=Gegenden mit Figuren und Vieh. Ganz kräftig und brav gemahlt. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Diese Nr. : Eine bergigte Land= und Wasser=Gegend mit Figuren und Vieh Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 32 Zoll, breit 46 Zoll Anm.: Die Lose 105 und 106 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
blauen Ferne Gebirge. Die Figuren sind von P. Bout. I Mat.: auf Leinwand Maße: 30 Vi Zoll breit 24 Zoll hoch Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Rost Transakt.: Unbekannt
Arthois, Jacques d' (und Meulen, A.F.) 1781/07/18 FRAN 0007 Möhlen; Artos I Eine Landschaft mit einer Bataille auf Holz, von Möhlen, Landschaft von Artos. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Schuh 10 Zoll hoch, 2 Schuh 8 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Arthois, Jacques d' (und Michau) 1788/10/01 FRAN 0042 Jacob von Artois; T. Michau I Eine waldigte Landschaft, von Jacob von Artois, die Figuren sind von T. Michau. I Maße: 16 Zoll hoch, 21 Zoll breit Transakt.: Verkauft (15 fl) Käufer: Schneidewind 1788/10/01 FRAN 0112 Jacob von Artois; Theobald Michau I Eine unvergleichliche Landschaft von Jacob von Artois, worinnen die Figuren von Theobald Michau. I Maße: 23 Zoll hoch, 30 Zoll breit Transakt.: Verkauft (11 fl) Käufer: Heussel 1800/00/00 FRAN2 0005 Artois (Joh. van); Michouy I Zwey schöne Landschaften, mit vielem Fleiß und in der besten Zeit dieses Künstlers verfertiget. Die Figuren und das Vieh sind von Michouy. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: 22 Zoll hoch, 30 Zoll breit Anm.: Die Lose 5 und 6 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN2 0006 Artois (Joh. van); Michouy I Zwey schöne Landschaften, mit vielem Fleiß und in der besten Zeit dieses Künstlers verfertiget. Die Figuren und das Vieh sind von Michouy. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: 22 Zoll hoch, 30 Zoll breit Anm.: Die Lose 5 und 6 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Arthois, Jacques d' (und Teniers) Arthois, Jacques d' (und Bout, P.) 1788/10/01 FRAN 0047 Jacob von Arthois; Baut I Eine Landschaft sehr natürlich, von Jacob von Arthois, 9 Vi Zoll hoch, 12 Zoll breit, die Figuren sind von Baut. I Maße: 9 Vi Zoll hoch, 12 Zoll breit Transakt.: Verkauft (7 fl) Käufer: von Schmid 1788/10/01 FRAN 0065 Jacob van Arthois; Baut I Eine ganz unvergleichliche Landschaft, von Jacob van Arthois, die Figuren von Baut. Man kann keine schönere natürliche Vorstellung sehen, als auf diesem Stück. I Maße: 21 Zoll hoch, 27 Zoll breit Transakt.: Verkauft (31.15 fl) Käufer: Hoynk 1788/10/01 FRAN 0101 Arthois; Bauth I Eine waldigte Landschaft, von Arthois, mit Figuren von Bauth. I Maße: 19 Zoll hoch, 25 Zoll breit Transakt.: Verkauft (18.15 fl) Käufer: Huth modo Hüsgen 1794/09/09 HBPAK 0076 Bout; Artois I In einem dicken Gehölze werden Reisende von Räuber überfallen und geplündert. In der Entfernung noch mehrere Personen, mit vielen Fleiß entworfen. Auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Zoll, breit 27 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/09/13 FRAN 0021 Jacob van Artois; staffirt v. Bauth I Eine angenehme Landschaft. I Maße: 1 Schuh 2 Zoll hoch 1 Schuh 7 Zoll breit Transakt.: Unbekannt (41 [?] fl) 1800/00/00+ LZRST [0001] Jacob van Artois; P. Bout I Eine Landschaft, zur Rechten auf einer Anhöhe ein Birkengehölz, zur Linken ein alter Stamm und schlanke Bäume mit grossen Blättermassen; ein grasreicher Vordergrund mit grossen Pflanzen, in der 190
GEMÄLDE
1788/04/08 FRFAY 0213 Arthois; Teniers I Eine von Mondschein sehr natürlich beleuchtete Landschaft von Arthois und Teniers. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: 11 Zoll hoch und 13 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (12 fl) Käufer: Levi ν M[annheim]
Arts, Hendrick 1790/01/07 MUAN 0219 H. Aertsen I Ein schwedisches Architekturstück, den innern Prospect des Münsters in Stockholm mit dem Portrait des Königs Gustav Adolph vorstellend, auf Kupfer, in einer geschnittenen und vergoldeten Ram. I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 1 Schuh 1 Zoll, Breite 1 Schuh 4 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0236 H. Aertsen I Ein Architekturstück, auf Holz, in einer geschnittenen und vergoldeten Ram. I Mat.: auf Holz Maße: Breite 7 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
Asam, Cosmas Damian 1776/00/00 WZTRU 0421 Cosm. Damian. Asam I Ein Stück 1 Schuhe, 6 Zoll hoch von Cosm. Damian. Asam, stellet vor einen Franciscuskopf von sehr schön ausgedruckten Geist, wie auch angenehmer Colorit. I Pendant zu Nr. 422 Maße: 1 Schuhe 6 Zoll hoch Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (5 fl Schätzung) 1776/00/00 WZTRU 0422 Cosm. Damian. Asam I Compagnion zu Nro. 421 ein von nämlichen Meister vorgestellter Petruskopf von
obigen Gusto. I Pendant zu Nr. 421 Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (5 fl Schätzung) 1781/00/00 WZAN 0421 Kosmas Damian Asam I Ein Stück 1 Schuhe, 6 Zoll hoch von Kosmas Damian Asam, stellet den Kopf des heil. Franciscus von sehr schön ausgedrucktem Geiste und angenehmer Kolorit vor. I Pendant zu Nr. 422 Maße: 1 Schuhe 6 Zoll hoch Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0422 Kosmas Damian Asam i Der Kompagnon zu Nro 241 [sie] ist ein von nämlichen Meister [Kosmas Damian Asam] vorgestellter Petruskopf im obigen Geschmack. I Pendant zu Nr. 421 Transakt.: Unbekannt
Asch, Pieter Jansz. van 1779/09/27 FRNGL 0311 Peter van Asch I Eine fleißig ausgearbeitete niederländische Landschaft, mit schönen kleinen Figuren. [Un paysage Flamand avec des petites figures, peint avec beaueoup d'exactitude], I Maße: 1 Vi Schuh hoch, 1 Schuh 10 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (11.30 fl) Käufer: Le Reauz 1799/00/00 WZAN 0156 Peter Johann van Asch I Zwey Landschäftchen, von Peter Johann van Asch. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Landschäftchen Mat.: auf Holz Maße: hoch 4 Zoll breit 5 Zoll Anm.: Die Lose 156 und 157 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0157 Peter Johann van Asch I Zwey Landschäftchen, von Peter Johann van Asch. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Landschäftchen Mat.: auf Holz Maße: hoch 4 Zoll breit 5 Zoll Anm.: Die Lose 156 und 157 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Ascione, Aniello 1799/00/00 WZAN A0441 Angelus Ascione I Zwey Früchtenstücke, von Angelus Ascione. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Früchtenstück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 3 Zoll breit 2 Schuh 1 Zoll Anm.: Die Lose A441 und A442 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0442 Angelus Ascione I Zwey Früchtenstücke, von Angelus Ascione. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Früchtenstück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 3 Zoll breit 2 Schuh 1 Zoll Anm.: Die Lose A441 und A442 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Ascione, Aniello (zugeschrieben) 1799/00/00 WZAN A0032 Angelus Ascione I Zwey Früchtenstücke, von einem italienischen Meister, vermuthlich von Angelus Ascione. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Früchtenstück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 1 Zoll breit 2 Schuh 3 Zoll Anm.: Die Lose A32 und A33 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0033 Angelus Ascione \ Zwey Früchtenstücke, von einem italienischen Meister, vermuthlich von Angelus Ascione. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Früchtenstück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 1 Zoll breit 2 Schuh 3 Zoll Anm.: Die Lose A32 und A33 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Zoll Anm.: Die Lose 707 und 708 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Asper, Hans (I) 1796/00/00 HLAN [0090] Asper I Bild eines Alten. 20. 15. auf Holz, von Asper 15.25. hat einen Riss I Mat.: auf Holz Maße: 20. 15. [oder] 15. 25. Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: [Friedrich Karl Lang] Transakt.: Unbekannt (18.8 Rt; 33 fl Schätzung) 1799/00/00 WZAN 0307 Johann Asper I Ein Mannskopf, von Johann Asper. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 2 Zoll breit 1 Schuh 2 V2 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Asselyn, Jan 1744/05/20 FRAN 0152 Asselge vulgo Crabattje I 1 Schön See Stück Asselge vulgo Crabattje. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 11 Zoll, Breite 1 Schuh 2 Zoll Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1749/07/31 HBRAD 0008 Crabatje I Eine Landschaft. I Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (13.8) 1750/06/15 HBRAD 0103 Jean Asselin I Adrian van der Velden, und Jean Asselin, zwey schöne Viehstücke. I Diese Nr.: Ein schönes Viehstück Anm.: Die Lose 102 und 103 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1763/01/17 HNAN [A]0019 Jan Asselin I Marche de Bestiaux qui se tient devant une Eglise, par Jan Asselin, sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hauteur 2 pieds 1 pouce, Largeur 2 pieds 3 pouces Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt 1766/07/28 KOSTE [A]0015 Asselin oder Crabye I Einen Kalck=ofen von Asselin oder Crabye. I Transakt.: Unbekannt (20 Rt) 1768/08/16 KOAN 0030 Krabetge I Ein Stück mit Vieh von Krabetge. I Maße: Höhe 1 Fuß 2 Zoll, Breite 1 Fuß 8 Zoll Verkäufer: Freyherr von Kaas Transakt.: Unbekannt 1776/04/15 HBBMN 0042 Jean Arselin, alias Krabbetje I Ein Krebsfang bey Nacht, ein rares Stück. I Maße: Höhe 2 Fuß 1 Zoll, Breite 1 Fuß 8 Zoll Transakt.: Verkauft (7.12 M) Käufer: Pauli 1776/04/15 HBBMN 0091 Jean Arselins I Ein holländischer Prospect, vermuthlich Scheevelingen. I Maße: Höhe 1 Fuß 2 Zoll, Breite 1 Fuß 6 Zoll Transakt.: Verkauft (43.8 M) Käufer: Köster 1776/06/21 HBNEU 0112 Asselin I Eine Landschaft mit Gebirge, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 F 10 Z, Breite 2 F 2 Ζ Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0045 Asselyn, genannt Crabettie I In einer bergichten Gegend sind zur Rechten einige Reisende unter Bäumen beym Feuer versammelt, um daselbst zu übernachten. Zur Linken spiegelt sich der Mond im stillen Wasser. [Dans une contree montagneuse quelques voyageurs places sur la droite sont assis sous des arbres, aupres du feu, pour y passer la nuit. Sur la gauche du tableau la lune reflechit son image dans une eau tranquille.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 9 Zoll hoch, 3 Fuß 9 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt
Aspach, Adam
1787/04/19 HBTEX 0050 J. Asselin I Eine Gegend mit einem alten Thurm und Mauerwerk, reich an Figuren. I Transakt.: Verkauft (30 M) Käufer: Eck
1799/00/00 WZAN 0707 Adam Asbach I Zwey Mannsköpfe. Der eine von Adam Asbach. Der andere von Jo'ana Leonhard Hirschmann. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Mannskopf von Adam Asbach Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh breit 1 Schuh 7
1788/06/12 HBRMS 0074 Asselyn I Eine gebürgichte Landschaft mit Wasser, im Vorgrunde viele Bauern und Hirten mit Pferden und Schaafen; der freye Pinsel und die besondere Beleuchtung in diesem Stück gereichen dem Künstler zur Ehre. Auf Leinewand. I GEMÄLDE
191
Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Vi Zoll, breit 31 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt (100 Μ Schätzung) 1788/06/12 HBRMS 0112 Asselien I Eine ländliche Gegend mit kleinen Seen und Hölzung, der niedrige Horizont sticht gegen einen großen runden Thurm schön und stark ab. Reisende zu Pferde und zu Fuß gehen durch das flache Wasser. Die Luft ist vortreflich, und das Ganze so gut als irgend eines von diesem Künstler. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 14 Vi Zoll, breit 12 % Zoll Transakt.: Unbekannt (100 Μ Schätzung) 1789/04/16 HBTEX 0025 Mahler Aslin Krabetje I Zwey Stücke mit americanischen Gegenden und Landleuten, theils zu Fuß als auch zu Pferde; sehr stark gemahlt auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 23 Zoll, breit 19 Zoll Transakt.: Verkauft (7 M) Käufer: Engel 1790/04/13 HBLIE 0031 Asselin Kraberge I Vor einem Wirths=Hause füttert ein reisender Fuhrmann sein Pferd, die Wirthin nebst ihr Kind stehet in der Thüre, nebenher noch einiges Vieh; sehr schön und stark gemahlt. Auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll, breit 20 Zoll Transakt.: Verkauft (3.1 M) Käufer: Steemann 1790/07/28 ZHWDR 0011 Asselin I [Ohne Titel] I Annotat.: Für das, was es seyn soll, recht schön. (LAVATER) Transakt.: Unbekannt 1791/09/21 FRAN 0007 Asselyn, Elias Crabet I Zur Linken ist ein Mann, so beschäftiget ist, das Feuer zu löschen, so seinen Ofen in Brand gesetzt, zur Rechten ist ein Fluß mit Schiffen gezieret und Matrosen jenseits des Flußes, zur Linken ist eine Festung, die Aussicht endiget sich mit sehr entfernten Gegenden und in sehr abgelegenen Plätzen wird man einige Gebirge gewahr; dieses Gemälde hat eine reizende Ausdrücklichkeit und eine große Deutlichkeit; die Werke dieses Meisters sind sehr schwer zu bekommen, und gehören zu dem Range der ungemein raren Sachen. I Transakt.: Verkauft (131 fl) Käufer: G R ν Döring 1791/09/21 FRAN 0122 Asselin dit Crabet I Vornen zur Rechten ist eine Schäferin, die unten an einem Felsen sitzet, ihr Hund liegt zu ihren Füßen und hinter ihr liegen Kühe, zur Linken auf einem grünen Wasen sind Ziegen; die Thiere sind mit Geiste gemalt. I Transakt.: Verkauft (3.45 fl) Käufer: Wust 1793/09/18 HBSCN 0019 Asselyn I Zwey sehr feine und zugleich kräftig gemahlte Landschaften, mit Vieh und Figuren. I Diese Nr.: Eine sehr feine und zugleich kräftig gemahlte Landschaft, mit Vieh und Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 4 Vi Zoll, breit 6 % Zoll Anm.: Die Lose 19 und 20 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1793/09/18 HBSCN 0020 Asselyn I Zwey sehr feine und zugleich kräftig gemahlte Landschaften, mit Vieh und Figuren. I Diese Nr.: Eine sehr feine und zugleich kräftig gemahlte Landschaft, mit Vieh und Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 4 Vi Zoll, breit 6 % Zoll Anm.: Die Lose 19 und 20 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1793/09/18 HBSCN 0053 Asselyn I Vorzügliches Licht und Schatten verursacht der scheinende Mond in einer Landschaft mit verfallenen Gebäuden, wo Hirten bey ihrem Vieh theils schlafen, theils wachen. Besonders schön. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 12 Zoll, breit 17 Zoll Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 HB AN 0018 Joh. Asselyn. genannt Crabettje I Zwischen flachen Ufern, an welchen Gebirge sich erheben, fliesset ein von der Abendsonne schön erhellter Strom still und ruhig hin; auf ihm werden in einem bedeckten, vom Abendglanze übergossenen, Fahrzeuge Heerden übergefahren; auf dem im Schifflein stehenden Karren sitzt eine Mutter, die mit ihrem Säugling in die sinkende Sonne sieht. Neben einer alten Burg wartet, mit ihrem Hirten, noch eine satte und müde Heerde auf die Ueberfahrt. I Maße: Höhe 31 Zoll, Breite 42 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 192
GEMÄLDE
1796/02/17 HBPAK 0131 Jean Asselin I Über eine steinerne Brücke, zwischen zwey alten Thürmen, werden Rinder von Hirten getrieben. Zur rechten im Flusse geht einiges Vieh und am Ufer wird gefischt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 10 Vi Zoll, Breite 14 Zoll Transakt.: Verkauft (171 M) Käufer: Τ 1797/04/25 HBPAK 0018 Asselyn I Ein Seehaven, zur rechten ein grosser Leuchthurm, im Vordergründe einige Schiffe, am Ufer verschiedene Personen und Thiere in Lebensgrösse. Auf Leinwand, schwarzen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 39 Zoll, breit 38 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0144 Asselyn I Eine gebirgigte Landschaft, mit einigen Wasserfällen, nebst verschieden Figuren: sehr fein gemahlt. Auf Holz, goldenen Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 11 Vi Zoll, breit 13 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0175 Asselyn I Ein Land= und Wasser= Prospect, zur rechten Wasser, worauf man einen Ewer mit Kaufmannsgütern sieht; im Vordergrunde am Ufer steht ein Mann mit Kühe und einem Esel; von da über das Wasser sieht man ein prächtiges großes Schloß; zur linken ein Reuter der mit einer Frau und einem Kinde spricht, nebst noch mehreren Figuren. Vortreflich gemahlt. Auf Holz, schwarzen Rahm goldene Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 14 Vi Zoll, breit 18 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0388 Asselyn, genannt Crabetje I Eine italiänische Landschaft mit Ruinen; ein Reuter von Hunden begleitet, scheint von der Jagd zu kommen. Vortreflich gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 21 Vi Zoll, breit 28 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/10/17 LZAN 0034 Asselin I Eine Landschaft; die Abenddämmerung mit Figuren vorstellend; mit einem leichten Pinsel gemahlt; hoch 12 Zoll, breit 10 Zoll. Auf Leinwand, in einem vergoldeten Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 12 Zoll, breit 10 Zoll Verkäufer: Rauch Transakt.: Verkauft (10 Th) Käufer: Seger 1800/00/00 FRAN1 0004 Asselyn I Ein abgebrochener Thurm mit einer Holzbrücke, im ersten Plan ist ein Reuter. I Mat.: auf Holz Maße: 10 Zoll hoch, 13 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1800/00/00+ LZRST [0002] Johann Asselyn I Eine Landschaft mit Hirten und Vieh. I Mat.: auf Holz Maße: 12 Vi Zoll breit 15 Zoll hoch Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Rost Transakt.: Unbekannt 1800/00/00+ LZRST [0076] /. Asselyn I Eine Landschaft mit antiken Ruinen, einem Brunnen, verschiedenen Figuren, Pferden und Kühen. I Mat.: auf Leinwand Maße: 17 Zoll breit 20 Zoll hoch Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Rost Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0158 Arsolin I Eine dito [Landschaft] mit Figuren. I Transakt.: Unbekannt
Asselyn, Jan (und Laer, P.) 1800/00/00+ LZRST [0003] Johann Asselyn; P. de Laer I Eine Landschaft mit schönen Bäumen im Mittelgrunde, in der Feme Felsen, vorn eine kleiner Wasserfall. Mit Figuren und Reutern von P. de Laer. I Mat.: auf Leinwand Maße: 33 Vi Zoll breit 27 Vi Zoll hoch Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Rost Transakt.: Unbekannt
Assen, Jan van 1799/00/00 WZAN 0634 Johann van Assen I Eine bergige Landschaft, von Johann van Assen. Auf Leinwand. I Mat.: auf Lein-
wand Maße: hoch 4 Schuh breit 5 Schuh 9 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Maße: Hoch 16 % Zoll, breit 12 Zoll Transakt.: Verkauft (0.08 M) Käufer: Ego
Assteyn, Bartholomews Abrahamsz.
1792/07/05 LBKIP 0078 van der Ast \ Ein Frucht und Blumenstück von van der Ast. I Transakt.: Unbekannt
1763/11/09 FRJUN 0004 Asskeyn I Une piece avec des fruits. I Maße: hauteur 18 pouces, largeur 21 pouces Transakt.: Verkauft (3 fl) Käufer: Kaller 1764/03/12 FRKAL 0151 Asskein I Une piece avec du fruit peint par Asskein. I Transakt.: Verkauft (2.20 fl) Käufer: Gr ν Dahlwitz 1765/03/27 FRKAL 0002 Asskein I Une pifcce avec des fruits. I Maße: hauteur 19 pouces, largeur 23 pouces Transakt.: Verkauft (2 fl) Käufer: Kaller
Ast, Balthasar van der 1768/07/00 MUAN 0092 Ast (B. von der) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0017 B. Van der Ast I Le Compagnon consiste en une piece ronde remplie de toutes fortes de fruits avec leurs branches, comme pommes, poires, peches, prunes, cerises, oranges &c. Sur la table, oü est posee cette piece, il y a aussi plusieurs coquillages de mer, & des pommes de grenades, sur une de ces dernieres est pose un oiseau des Indes, qui est occupe ä la manger, de plus sur cette meme table, on voit un lezard, & deux fauterelles. Peint sur toile. I Pendant zu Nr. 16 von R. Ruysch Mat.: auf Leinwand Maße: 3. p. 6. p. de haut sur 2. p. 9. p. de large Verkäufer: F r a n c i s Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1777/04/11 HB NEU 0042 von der Ass I Ein Blumenstück mit Insecten. I Transakt.: Unbekannt 1778/05/16 HBBMN 0012 B. von der Ast I Ein Desert=Stück. [Diese Stücke sind alle gut gefaßt, theils schwarze Rahmen mit goldenen Leisten, theils goldene Rahmen; auch ist die Höhe und Breite ohne Rähmen gemessen.] I Maße: 12 Zoll hoch, 19 Zoll breit Anm.: Die Angaben in eckigen Klammem im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 24 und beziehen sich wahrscheinlich auf die Nrn. 1 bis 24. Transakt.: Unbekannt 1778/05/16 HBBMN 0013 B. von der Ast I Ein Stück mit Früchten, Coquillen und Insekten. [Diese Stücke sind alle gut gefaßt, theils schwarze Rähmen mit goldenen Leisten, theils goldene Rähmen; auch ist die Höhe und Breite ohne Rähmen gemessen.] I Maße: 12 Zoll hoch, 19 Zoll breit Anm.: Die Angaben in eckigen Klammem im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 24 und beziehen sich wahrscheinlich auf die Nm. 1 bis 24. Transakt.: Unbekannt 1789/08/18 HBGOV 0082 B. van der Ast I Zwey Stillleben mit Blumen, Insekten und einigen Conchilien, wie die Natur selbsten gemahlt und colorirt. Eines ist vortreflich conservirt, der Compagnon ist etwas beschädiget. I Diese Nr.: Ein Stillleben mit Blumen, Insekten und einigen Conchilien; Pendant zu Nr. 83 Maße: Hoch 8 Zoll, breit 14 Vi Zoll Anm.: Die Lose 82 und 83 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1789/08/18 HBGOV 0083 B. van der Ast I Zwey Stillleben mit Blumen, Insekten und einigen Conchilien, wie die Natur selbsten gemahlt und colorirt. Eines ist vortreflich conservirt, der Compagnon ist etwas beschädiget. I Diese Nr.: Ein Stillleben mit Blumen, Insekten und einigen Conchilien; Pendant zu Nr. 82 Maße: Hoch 8 Zoll, breit 14 Vi Zoll Anm.: Die Lose 82 und 83 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1791/01/05 HBBMN 0289 B. v. Art I Ein stark gemahltes Blumen=Bouquet; von B. v. Art. Auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand
1797/06/13 HBPAK 0130 B. v. Ast I Tulpen, Rosen, Nelken und andere Blumen, in einem Glase aufm Tische stehend, wo noch zwey Insecten und drey Schnecken befindlich. Ganz besonders fleißig gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 17 Zoll, breit 11 % Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/06/13 HBPAK 0160 B. v. d. Ast I Ein mit Blumen angefüllter Korb stehet auf einem Gesimse. Zur linken Seite des Korbs ist ein Ast, woran vier Apricosen, bey welchen ein erbrochener Granat=Apfel liegt. Nebenher ist noch eine Eyder, Grashüpper, Schmetterling, Raupe und Spinne, wobey zur Rechten verschiedene Schnecken liegen. Alles auf das allervortreflichste gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 17 % Zoll, breit 26 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/06/13 HBPAK 0185 B. v. d. Ast I Vor einem länglichten Korbe, voll der schönsten Blumen, liegen Apricosen, Pfirschen, Weintrauben, Quitten, Melonen, Granat=Aepfel, Nüsse, Pflaumen, Kirschen, eine Eidechse nebst einem porcellainenen Caravin mit goldenem Fuß, worinnen ein Blumen=Bouquet. Alles auf einer marmornen Tisch=Tafel. Eines der allervortreflichsten Stilleben, so man sehen kann. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 19 V* Zoll, breit 35 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0253 Balthasar van der Ast I Eine Blume, worauf eine Heuschrecke sitzet, von Balthasar van der Ast. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 6 Zoll breit 7 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1800/00/00+ LZRST [0004] Van der Ast I Ein Fruchtstück mit Blumen, Insekten und Naturalien. I Mat.: auf Holz Maße: 15 Zoll breit 12 Vi Zoll hoch Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Rost Transakt.: Unbekannt
Aubry 1800/07/09 HBPAK 0047 Aubry \ Vache blanche dans une prairie. Un berger et une autre Vache sont couches aupres. Sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: 6 pouces de hauteur. 7 pouces de largeur Transakt.: Unbekannt
Auer, Johann Paul 1799/00/00 WZAN 0137 Joh. Paulus Auer I Zwey Stücke, Bachanalien vorstellend, von Joh. Paulus Auer. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Stück, Bachanalien vorstellend Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh breit 3 Schuh 2 Zoll Anm.: Die Lose 137 und 138 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0138 Joh. Paulus Auer I Zwey Stücke, Bachanalien vorstellend, von Joh. Paulus Auer. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Stück, Bachanalien vorstellend Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh breit 3 Schuh 2 Zoll Anm.: Die Lose 137 und 138 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Auerbach, Johann Gottfried 1743/00/00 BWGRA 0207 Auerbach I Das Portrait des Kaysers Carl VI. von Auerbach. I Maße: hoch 3 Fuß 2 Zoll, breit 2 Fuß 6 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
193
1743/00/00 BWGRA 0208 Auerbach I Seiner Gemahlin Portrait, auch gemahlt von Auerbach. I Maße: hoch 3 Fuß 2 Zoll, breit 2 Fuß 6 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0209 Auerbach I Das Portrait des Herzogs von Lothringen, vom vorigen maitre [Auerbach]. I Maße: hoch 3 Fuß 2 Zoll, breit 2 Fuß 4 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0210 Auerbach I Portrait der Königin von Ungarn, von Auerbach. I Maße: hoch 3 Fuß, breit 2 Fuß 4 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0211 Auerbach I Der Ertz=Herzogin Maria Anna Portrait, gemahlt von Auerbach. I Maße: hoch 3 Fuß, breit 2 Fuß 4 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt
Augustino [Nicht identifiziert] 1781/02/17 FRAN 0055 Augustino I Christus in der Herberge zu Emmahus, mit vielen andern Nebengästen von Augustino. I Maße: 1 Schuh 10 Zoll breit, 1 Schuh 5 Vi Zoll hoch Transakt.: Unbekannt (8.30 fl)
Auvert
pouces, largeur 27 Vi pouces Transakt.: Verkauft (20 fl) Käufer: Ohlenschlager 1777/04/11 HB NEU 0094 von Campen I Ein spanischer Soldat, der durch ein Mädgen mit einem Licht in die Thüre gelassen wird. I Transakt.: Unbekannt 1784/08/02 FRNGL 0225 van Campen I Eine Niederländische Winter=Landschaft. I Maße: 7 Zoll breit, 5 Zoll hoch Verkäufer: D Transakt.: Verkauft (2 fl) Käufer: Collomb 1785/05/17 MZAN 0462 van Campen I Ein Seestück von van Campen. [Une vue de mer.] I Maße: 10 Zoll hoch, 1 Schuh 8 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (17 fl) Käufer: Clausius 1785/05/17 MZAN 0855 van Campen I Ein Seehafen von van Campen. [Un port de mer.] I Maße: 1 Schuh 8 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 11 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (12 fl) Käufer: Rmus D Decanus L Β ä Fechenbach 1790/08/25 FRAN 0224 van Kampen I Der Seestrand von Scheflingen, darauf ein Wagen mit dem Hofstaat des Prinzen von Oranien mit Segeln gefahren, nebst vielen Figuren, vom stummen van Kampen. I Maße: hoch 28 Zoll, breit 64 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (5 fl) Käufer: [...?] Zöller
1788/09/01 KOAN 0827 Auvert I Militairstuck vorstellend ein Werbhaus. [1 p[i6ce]. de Militaire representant une Maison de recrus.] I Maße: Höhe 1 Fuß 7 Zoll, Breite 2 Fuß 4 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt
1791/07/29 HBBMN 0101 Kamp I Zwey See=Prospecte; auf Holz. I Diese Nr.: Ein See=Prospect Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Zoll, breit 15 Vi Zoll Anm.: Die Lose 101 und 102 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (2 Μ für die Nrn. 101 und 102)
Avemann, Wolf
1791/07/29 HBBMN 0102 Kamp I Zwey See=Prospecte; auf Holz. I Diese Nr.: Ein See=Prospect Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Zoll, breit 15 Vi Zoll Anm.: Die Lose 101 und 102 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (2 Μ für die Nrn. 101 und 102)
1790/08/20 HBGOV 0016 W. Aveman I Ein schönes perspektivisches Gemälde von richtiger Architektur und schöner Beleuchtung. Auf Holz, schwarzer Rahm und goldene Leiste. I Mat.: auf Holz Maße: 18 Vi Zoll hoch, und 24 Zoll breit Transakt.: Verkauft (6.8 M) Käufer: Tietjen 1799/00/00 WZAN A0410 Joh. Wolf. Aveman I Zwey Stücke mit Ruinen; auf einem die Versuchung Christi, und auf dem andern Christus und das Samaritanische Weib am Brunnen, von Joh. Wolf. Aveman. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Stück mit Ruinen, mit der Versuchung Christi Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh 4 Zoll breit 2 Schuh 10 Zoll Anm.: Die Lose A410 und A411 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1793/09/18 HBSCN 0004 Averkamp I Zwey Land= und Wasser=Gegenden, als Sommer= und Winterstücke: ersteres ist ein stillies Wasser mit liegenden Fahrzeugen und abgehenden Schiffen; letzteres eine Winterbelustigung auf dem Eise, von unzählbaren feinen und delicat gemahlte Figuren. I Diese Nr.: Eine Land= und Wasser=Gegend, als Sommerstück; ersteres ist ein stilles Wasser mit liegenden Fahrzeugen und abgehenden Schiffen Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Zoll, breit 21 Zoll Anm.: Die Lose 4 und 5 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1799/00/00 WZAN A0411 Joh. Wolf. Aveman I Zwey Stücke mit Ruinen; auf einem die Versuchung Christi, und auf dem andern Christus und das Samaritanische Weib am Brunnen, von Joh. Wolf. Aveman. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Stück mit Ruinen, mit Christus und dem Samaritanischen Weib Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh 4 Zoll breit 2 Schuh 10 Zoll Anm.: Die Lose A410 und A411 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1793/09/18 HBSCN 0005 Averkamp I Zwey Land= und Wasser=Gegenden, als Sommer= und Winterstücke: ersteres ist ein stillles Wasser mit liegenden Fahrzeugen und abgehenden Schiffen; letzteres eine Winterbelustigung auf dem Eise, von unzählbaren feinen und delicat gemahlte Figuren. I Diese Nr.: Eine Land= und Wasser=Gegend, als Winterstück; letzteres eine Winterbelustigung Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Zoll, breit 21 Zoll Anm.: Die Lose 4 und 5 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Aventin [Nicht identifiziert]
Averelz [Nicht identifiziert]
1790/01/07 MUAN 0104 Aventin I Ein Antonius, auf Leinwat. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 6 Zoll, Breite 1 Schuh 11 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
1781/05/07 FRHUS 0020 Averelz I Ein bethender alter Bauer mit seinem Weib und Kindern, geistreich componirt wohl und fleissig ausgeführt. I Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch und 1 Schuh 5 Zoll breit Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (29 fl) Käufer: Hüsgen
Avercamp, Hendrick 1752/05/08 LZAN 0225 Stomme I Ein See=Stück Holl, von Stomme ohne Rahmen. I Maße: 1 % Elle hoch, 2 Vi Elle breit Transakt.: Verkauft (23 Gr) Käufer: Loon 1763/11/09 FRJUN 0101 Kampen Le Muet I Un hiver avec plusieurs figures qui se divertissent sur la glace. I Maße: hauteur 21 Vi 194
GEMÄLDE
Avont, Peeter van 1781/05/07 FRHUS 0162 Peter von Avont I Ein Stück mit tanzenden Kindern, meisterhaft ausgeführt von Peter von Avont. I Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch und 1 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (1.48 fl) Käufer: Heusser
1782/07/00 FRAN 0181 Peter v. Avont I Eine sehr natürliche Vorstellung, wie sechs Kinder den kleinen berauschten Bacchus, der ein groses Weinglas in der Hand hält, auf den Händen tragen. I Maße: 1 Schuh 10 Zoll hoch, 2 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] fl) 1783/06/19 HBRMS 0035 Pit. ν. Avont I Die vier Elemente, durch spielende Kinder vorgestellt, in einer angenehmen Landgegend. H[olz], g.R. [verguldeter Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: 8 Zoll hoch, 12 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1787/04/03 HBHEG 0046 P. von Avont I Etliche Genien in ländlicher Gegend, von P. von Avont, auf Holz. I Mat.: auf Holz Transakt.: Verkauft (1.6 M) Käufer: Bluhm 1789/00/00 MMAN 0353 Peter Avont I Eine schlafende Nymphe, auf Holz. [Une Nimphe en dormie, sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 3 Zoll hoch, 1 Fuß 9 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0036 P. Avont I Christus am Creutz. Vortreflich gemahlt. Auf Holz. Schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Vi Zoll, breit 8 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt
Avont, Peeter van (und Vinckeboons, D.) 1764/05/18 BOAN 0654 Van Avont; Winckenboom I Un Paisage de deux pieds deux pouces de largeur, d'un pied huit pouces de hauteur, representant la Vierge avec l'enfant Jesus & des Anges, peint par van Avont, & le paisage par de Winckenboom. [Ein stück Vorstellend die mutter gottes mit Kindlein und Engelein von van Avont gemahlt, in Einer Landschaft gemahlt Von Winckenboom.] I Maße: 2 pieds 2 pouces de largeur, 1 pied 8 pouces de hauteur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (78 Rt) Käufer: Vogel
Avont, Peeter van (Kopie nach) 1794/09/09 HBPAK 0022 Nach v. d. Avond I Eine höchst vergnügte Gesellschaft von spielende Bacchanalen, besonders lebhaft von Farben und mit vielen Fleiß gemahlt. Auf Leine wand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 35 Zoll, breit 50 Zoll Transakt.: Unbekannt B*** 1789/08/18 HBGOV 0033 Β*** I Ein Manns=Portrait, ovalen Formats, sehr schön nach dem Leben gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Format: oval Maße: Hoch 7 Vi Zoll, breit 6 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0261 Β*** I Die Geschichte der Diana mit Acteon. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 37 Zoll 10 Lin., breit 42 Zoll 1 Lin. Transakt.: Unbekannt
B., Madame de [Nicht identifiziert] 1784/05/11 HBKOS 0025 Madame de Β. I Ein Conversations= Stück, von Madame de B., auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 8 Zoll, breit 6 Zoll Transakt.: Unbekannt (12 Sch)
B***, J J . 1784/08/13 HBDEN 0047 J.J.B*** I Zwey bergigte Holzungen mit Staffage, von J.J.B*** nach der Natur gemahlt, auf Leinwand. [Folgende Gemähide sind berahmt.] I Diese Nr.: Eine bergigte Holzung mit Staffage Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 15 Zoll. Breit 17 Vi Zoll. Anm.: Die Lose 47 und 48 wurden zusammen katalogisiert. Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen über der
Nr. 34 und beziehen sich auf die Nrn. 34 bis 53. Verkäufer: Pasche [oder] Flügge Transakt.: Verkauft (3 M) Käufer: Ehr[enreich] 1784/08/13 HBDEN 0048 J.J.B*** I Zwey bergigte Holzungen mit Staffage, von J.J.B*** nach der Natur gemahlt, auf Leinwand. [Folgende Gemähide sind berahmt.] I Diese Nr.: Eine bergigte Holzung mit Staffage Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 15 Zoll. Breit 17 Vi Zoll. Anm.: Die Lose 47 und 48 wurden zusammen katalogisiert. Die Angaben in eckigen Klammem im Bildtitel erscheinen über der Nr. 34 und beziehen sich auf die Nrn. 34 bis 53. Verkäufer: Pasche [oder] Flügge Transakt.: Verkauft (3 M) Käufer: Ehr[enreich]
B***, L. 1797/06/13 HBPAK 0153 L.B*** I Zwey See=Gegenden mit sehr vielen Schiffen, wovon das eine das Scheflinger Ufer vorstellet, wo viele Fischerfahrzeuge ankommen. Die lebhafte See machet einen reizenden Anblick wegen des heimfallenden Sonnenlichts. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Eine See=Gegend mit sehr vielen Schiffen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 23 Vi Zoll, breit 29 Zoll Anm.: Die Lose 153 und 154 wurden zusammen katalogisiert. Der Künstler ist vermutlich Ludolf Backhuysen. Transakt.: Unbekannt 1797/06/13 HBPAK 0154 L.B*** I Zwey See=Gegenden mit sehr vielen Schiffen, wovon das eine das Scheflinger Ufer vorstellet, wo viele Fischerfahrzeuge ankommen. Die lebhafte See machet einen reizenden Anblick wegen des heimfallenden Sonnenlichts. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Eine See=Gegend mit sehr vielen Schiffen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 23 Vi Zoll, breit 29 Zoll Anm.: Die Lose 153 und 154 wurden zusammen katalogisiert. Der Künstler ist vermutlich Ludolf Backhuysen. Transakt.: Unbekannt
Β***, M . 1796/10/17 HBPAK 0256 Μ. Β*** I Zwey historische Landschaften. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine historische Landschaft Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Zoll 6 Lin., breit 14 Zoll 6 Lin. Anm.: Die Lose 256 und 257 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0257 Μ. Β*** I Zwey historische Landschaften. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine historische Landschaft Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Zoll 6 Lin., breit 14 Zoll 6 Lin. Anm.: Die Lose 256 und 257 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Β***, N. 1792/07/28 HBSCN 0089 Ν. B-. I Hirten treiben ihre Heerde bey Sonnenuntergang in einem Thale durch ein kleines Wasser dem Vordergrunde zu. Von sanfter und schöner Mahlerey. Auf H[olz], S.R.G.L. [Schwarzen Rahm Goldne Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 18 Vi Zoll Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0286 Ν. B***, 16791 Landleute mit Kinder und Schaafe, als auch Ziegen, in gebürgigter Landschaft. Auf Holz. I Mal.: auf Holz Maße: Hoch 14 Zoll 6 Lin., breit 19 Zoll 3 Lin. Inschr.: 1679 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt
B***, R. von 1796/10/17 HBPAK 0298 R. von Β*** I Maria musicirt, und ein Chor Engel accompagnirt dazu; sehr schön gemahlt. I Maße: Hoch 7 Zoll 6 Lin., breit 10 Zoll 3 Lin. Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
195
Β., Seb. 1790/04/13 HBLIE 0260 Seb. Β. I Johannes und Maria sehr fleißig gemahlt. Auf Holz. I Diese Nr.: Johannes Mat.: auf Holz Maße: Hoch 19 Zoll, breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 260 und 261 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (8 Sch für die Nrn. 260 und 261) Käufer: Ego 1790/04/13 HBLIE 0261 Seb. Β. I Johannes und Maria sehr fleißig gemahlt. Auf Holz. I Diese Nr.: Maria Mat.: auf Holz Maße: Hoch 19 Zoll, breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 260 und 261 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (8 Sch für die Nrn. 260 und 261) Käufer: Ego
Β., T. de 1786/10/18 HBTEX 0146 T. de Β. I Eine allegorische Vorstellung von Mars, Venus und Amor. Sehr frey und plaisant gemahlt auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 20 Zoll 6 Linien, breit 16 Zoll 3 Linien Transakt.: Unbekannt
B.A., R. van den 1772/09/15 BNSCT 0060 R. van den Β. Α. I Verschiedene Seefische, Austern, und Schnecken, von R. van den Β. Α. I Maße: 2 Fuß 6 Zoll hoch, 3 Fuß breit Transakt.: Unbekannt (5 fl)
Baaden [Nicht identifiziert]
Zoll, breit 23 Zoll Anm.: Die Lose 222 und 223 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Backer 1764/00/00 BLAN 0367 Backer] Die geißelung Christi: auf Leinwand gemahlt. I Mat.: auf Leinwand Maße: 5 Fuß hoch, 3 Fuß 3 Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (800 Rt Schätzung) 1764/00/00 BLAN 0498 Backer I 1. Vordrefliches Crucifix. I Maße: 5 Fuß 1 Vi Zoll hoch, 3 Fuß 8 Vi Zoll breit Anm.: Es ist nicht sicher, ob es sich um ein Gemälde handelt. Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (600 Rt Schätzung) 1764/05/21 BOAN 0049 Backer I Un portrait d'un pied six pouces de hauteur, d'un pied trois pouces de largeur, reprisentant la tete d'un jeune homme en grandeur naturelle, peinte par Backer. [Ein stück Vorstellend portrait Kopf in Lebensgröße eines jungen mansbild, gemahlt Von Packer.] I Maße: 1 pied 6 pouces de hauteur, 1 pied 3 pouces de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (22.30 Rt) Käufer: Frantzen 1765/03/27 FRKAL 0004 Bakker I Un excellent tableau historique representant un Roi, en buste de grandeur naturelle, accompagne d'un soldat. I Maße: hauteur 45 pouces, largeur 61 pouces Transakt.: Verkauft (6 fl) Käufer: Kaller
1723/00/00 PRAN [B]0040 Baaden I Dianä Baad / vom Baaden. I Maße: Höhe 1 Schuh 2 Zoll, Breite 1 Vi Schuh 2 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt
1768/08/16 KOAN 0023 [b] Backer I Zwey Portraiten ein Mann von Mola, ein Jünglein von Backer. I Diese Nr.: Ein Jünglein; Nr. 23 [a] von P.F. Mola Maße: Höhe 2 Fuß 6 Zoll, Breite 2 Fuß Verkäufer: Freyherr von Kaas Transakt.: Unbekannt
Babou [Nicht identifiziert]
1770/10/29 FRAN 0060 Backer I Eine Vanitas. I Maße: Hoch 23 Zoll. Breit 26 Zoll. Transakt.: Unbekannt
1778/08/29 HBTEX 0009 Babou I Der heilige Hieronymus, von Babou, über Lebens Größe. I Maße: Höhe 3 Fuß 4 Zoll, Breite 4 Fuß 6 Zoll Transakt.: Unbekannt
1770/10/29 FRAN 0184 Backer I Ein Mannskopf. I Maße: Hoch 20 Zoll. Breit 15 Zoll. Transakt.: Unbekannt
Baburen, Dirck van 1766/07/28 KOSTE [A]0005 Theodor Baburen I Ein Korb mit einer Violin von Theodor Baburen. I Transakt.: Verkauft (10 Rt) Käufer: Frantz 1785/05/17 MZAN 0717 T.D. Baburen I Ein poetisches Stück bezeichnet T.D. Baburen 1623. [Un tableau, dont le sujet est poetique marque Τ. D. Baburen 1623.] I Maße: 6 Schuh 3 Zoll hoch, 5 Schuh 9 Zoll breit Inschr.: T. D. Baburen 1623 (bezeichnet und datiert) Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (8.30 fl) Käufer: Winterstein Gegenw. Standort: Amsterdam, Nederland. Rijksmuseum. (A 1606) als Prometheus und Vulkan
Bach 1785/03/14 DRHLM 3433 Bach I Eine Bergschacht mit Abieitern, von Bach, Hamb. I Anm.: Es ist unsicher, ob es sich um ein Gemälde oder um eine Zeichnung handelt. Verkäufer: Christian Gotthold Crußius Transakt.: Unbekannt (0.10 Rt)
1778/09/28 FRAN 0087 Baecker I Ein schöner Kopf in Holländischer Tracht, eine Tabackspfeife in der Hand haltend. [Une belle tete dans le costume Hollandois, tenante une pipe dans la main, par Baecker.] I Maße: 1 Schuh 10 Zoll breit, 2 Schuh 4 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (16 fl) Käufer: ν Frankenstein 1785/05/17 MZAN 0719 Backer I Mars und Venus von Backer. [Mars & Venus.] I Maße: 6 Schuh 9 Zoll hoch, 6 Schuh breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (8 fl) Käufer: Becker Glöckner 1789/00/00 MM AN 0003 Backer I Zwei Portraits auf Leinw. [Deux portraits, sur toile.] I Diese Nr.: Ein Portrait Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 3 Zoll hoch, 1 Fuß 10 Zoll breit [2 pieds 2 pouces de haut, 1 pied 10 pouces de large] Anm.: Die Lose 3 und 4 wurden zusammen katalogisiert. Die Dimensionen unterscheiden sich in der deutschen und französischen Fassung des Katalogs. Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (44 fl für die Nrn. 3 und 4)
1796/10/17 HBPAK 0222 Bach, jun. I Zwey gezeichnete Landschaften. Sehr gut gemahlt; mit Figuren. Unter Glas im goldnen Rahm. I Diese Nr.: Eine gezeichnete Landschaft Maße: Hoch 17 Zoll, breit 23 Zoll Anm.: Die Lose 222 und 223 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1789/00/00 MMAN 0004 Backer I Zwei Portraits auf Leinw. [Deux portraits, sur toile.] I Diese Nr.: Ein Portrait Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 3 Zoll hoch, 1 Fuß 10 Zoll breit [2 pieds 2 pouces de haut, 1 pied 10 pouces de large] Anm.: Die Lose 3 und 4 wurden zusammen katalogisiert. Die Dimensionen unterscheiden sich in der deutschen und französischen Fassung des Katalogs. Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (44 fl für die Nrn. 3 und 4)
1796/10/17 HBPAK 0223 Bach, jun. I Zwey gezeichnete Landschaften. Sehr gut gemahlt; mit Figuren. Unter Glas im goldnen Rahm. I Diese Nr.: Eine gezeichnete Landschaft Maße: Hoch 17
1792/09/28 HBBMN 0093 Backer I Ein Mannskopf im Provil, von Backer. Auf Hz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 3 [sie] Zoll, breit 15 Zoll Transakt.: Unbekannt
196
GEMÄLDE
Backer, Adriaen 1750/00/00 KOAN 0179 Adrian de Bakker I Une tete de Femme, avec une crepe, peinte en maitre, & hardiment. I Maße: Largeur 1 Ρίέβ 2 % Pouces, Haut 1 Pi6s 7 % Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1767/00/00 KOAN 0116 Adrian de Backer I Ein Weibs=Kopf mit Flor behangen, meisterhaft und kühn gemahlet von Adrian de Backer. I Maße: Breite 1 Fuß 11 Vi Zoll, Höhe 2 Fuß 4 V* Zoll Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt 1783/06/19 HBRMS 0184 A. Backer I Ein Mann, und eine Frau; die Frau zeiget mit lächelnder Miene auf das Bild des Mannes, welcher mit zusammen geschlagenen Händen über sie zu seufzen scheint. L[einwand]. g.R. [verguldete Rahmen] I Diese Nr.: Ein Mann Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 5 Zoll hoch, 1 Fuß 1 Zoll breit Anm.: Die Lose 184 und 185 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1783/06/19 HBRMS 0185 A. Backer I Ein Mann, und eine Frau; die Frau zeiget mit lächelnder Miene auf das Bild des Mannes, welcher mit zusammen geschlagenen Händen über sie zu seufzen scheint. L[einwand]. g.R. [verguldete Rahmen] I Diese Nr.: Eine Frau zeiget mit lächelnder Miene auf das Bild des Mannes Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 5 Zoll hoch, 1 Fuß 1 Zoll breit Anm.; Die Lose 184 und 185 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1787/00/00 HB AN 0112 Adrianus Backer I Das Brustbild eines Mannes mit einer nachdenkenden Miene, mit einer schwarzen Mütze, welche von einer goldenen Kette umwunden ist, auf dem Haupte, in einen schwarzen Mantel gehüllt, durch welchen man ein mit Gold brodirtes Unterkleid gewahr wird. Ein junges freundliches Mädchen in bloßem Kopf und rothem Kleide, welches mit vielen in Gold gefaßten Steinen und Perlen gezieret ist, en profil. Diese beyden Bilder sind mit einem sehr freyen und markigen Pinsel gemahlt. Oval und durch die goldenen Rahmen viereckigt gemacht. A.H. [Auf Holz] I Diese Nr.: Das Brustbild eines Mannes mit einer nachdenkenden Miene Mat.: auf Holz Format: oval Maße: Hoch 27 Zoll, breit 20 Zoll Anm.: Die Lose 112 und 113 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (22 Μ für die Nrn. 112 und 113) Käufer: Mathees 1787/00/00 HB AN 0113 Adrianus Backer I Das Brustbild eines Mannes mit einer nachdenkenden Miene, mit einer schwarzen Mütze, welche von einer goldenen Kette umwunden ist, auf dem Haupte, in einen schwarzen Mantel gehüllt, durch welchen man ein mit Gold brodirtes Unterkleid gewahr wird. Ein junges freundliches Mädchen in bloßem Kopf und rothem Kleide, welches mit vielen in Gold gefaßten Steinen und Perlen gezieret ist, en profil. Diese beyden Bilder sind mit einem sehr freyen und markigen Pinsel gemahlt. Oval und durch die goldenen Rahmen viereckigt gemacht. A.H. [Auf Holz] I Diese Nr.: Ein junges freundliches Mädchen in blossem Kopf und rothem Kleide Mat.: auf Holz Format: oval Maße: Hoch 27 Zoll, breit 20 Zoll Anm.: Die Lose 112 und 113 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (22 Μ für die Nrn. 112 und 113) Käufer: Mathees
Backer, Jacob Adriaensz. 1750/00/00 KOAN 0180 Jaques Bakker I Un jeune homme, avec un pigeon, sur bois, tres naturel. I Mat.: auf Holz Maße: Largeur 1 Pies 8 Pouces, Haut 2 Pies % Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt
Backhuysen, Ludolf 1750/04/00 HB AN 0067 L. Backhusen I Ein See=Sturm, von L. Backhusen. I Transakt.: Unbekannt
1752/00/00 NGWOL 0167 Packhuysen I Eine See=Caperey. Vna Zuffa di Corsari. I Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (8 Th) 1759/00/00 LZEBT 0049 Backhuysen I Ein Seestück auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh, Breite 1 Schuh 7 Vi Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (60 Th Schätzung) 1764/00/00 BLAN 0348 Backhuysen I 2. See=stücke. I Diese Nr.: Ein See=stück Maße: 3 Fuß hoch, 3 Fuß 7 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 348 und 349 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (300 Rt für die Nrn. 348 und 349, Schätzung) 1764/00/00 BLAN 0349 Backhuysen I 2. See=stücke. I Diese Nr.: Ein See=stück Maße: 3 Fuß hoch, 3 Fuß 7 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 348 und 349 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (300 Rt für die Nrn. 348 und 349, Schätzung) 1764/00/00 BLAN 0582 Backhuysen I 1. Extra schönes See Stück. I Maße: 1 Fuß 6 Zoll hoch, 2 Fuß 1 Vi Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (300 Rt Schätzung) Gegenw. Standort: Sankt-Peterburg, Rossiya. Ermitazh. (N 1018) 1764/00/00 BLAN 0686 Backhuysen I 1. Schönes See=stück. I Maße: 1 Fuß 9 Zoll hoch, 2 Fuß 3 Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (250 Rt Schätzung) Gegenw. Standort: SanktPeterburg, Rossiya. Ermitazh. (N 1038) 1764/03/12 FRKAL 0001 Ludolf Backhuysen I Un beau tableau, repr6sentant une mer agite avec des vaisseaux ä la voile. I Maße: hauteur 19 Vi pouces, largeur 24 pouces Transakt.: Verkauft (19 fl) Käufer: Schlundt 1769/03/30 HBTOU 0040 Backhuisen I Ein See Stückgen von Backhuisen auf Holz gemahlen. [Die Mehresten in fein verguldte Rahmen, und die übrigen in schwarz gebeizten mit goldenen Staber.] I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 8 Zoll, Breite 11 Zoll Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 51 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 51. Transakt.: Verkauft (3.4 M) Käufer: Lilie jun 1774/08/13 HBBMN Transakt.: Unbekannt
0150
Backhuysen I Ein See=Sturm. I
1776/04/15 HBBMN 0094 Ludolff Backheusen I Ein See= Sturm, mit besonders natürliches Wasser. I Maße: Höhe 1 Fuß 9 Vi Zoll, Breite 2 Fuß 1 Zoll Transakt.: Unverkauft 1776/04/15 HBBMN 0117 Ludolff Backheusen I Ein See=Prospect, besonders fleißig gemahlt. I Maße: Höhe 1 Fuß 7 Zoll, Breite 2 Fuß 4 Zoll Transakt.: Unverkauft 1776/07/19 HBBMN 0018 Lud. Backhysen I Ein kleiner See= Sturm. I Maße: Höhe 10 Vi Zoll, Breite 1 Fuß 1 Zoll Transakt.: Verkauft (13.4 M) Käufer: David 1776/11/09 HBKOS 0041 Ludolff Backhusen I Ein See=Sturm von Ludolff Backhusen, so schön wie von diesem Meister eines bekannt ist, auf Leinwand gemahlt, im schwarzen Rahm und verguldete Leisten. I Pendant zu Nr. 42 Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 3 Fuß 6 Zoll, Breite 4 Fuß 6 Zoll Transakt.: Unbekannt (361 M) 1776/11/09 HBKOS 0042 Ludolff Backhusen I Ein dito [See=] Sturm, so als Compagnion dienet, aber nicht von der Güte ist, auf Leinwand, mit dito [schwarzen] Rahm und verguldeten Leisten. I Pendant zu Nr. 41 Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 3 Fuß 8 Zoll, Breite 5 Fuß 3 Zoll Transakt.: Verkauft (54 M) Käufer: Lilie 1778/05/16 HBBMN 0087 Backhusen I Ein felsigter See= Sturm. I Transakt.: Unbekannt 1778/05/30 HBKOS 0129 Ludolph Backhuysen I Ein See= Stück, ganz besonders schön gemalt, von Ludolph Backhuysen, in langlicht ovalen Form, auf dito [Holz], [Diese Gemähide sind alle GEMÄLDE
197
mittlere Grösse, können also an alle Plätze gebraucht werden - dieweilen keine Theilen=Stück, dabey befindlich] I Mat.: auf Holz Format: oval Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 150 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 150. Verkäufer: Dr Friederici Transakt.: Verkauft (6.10 M) Käufer: Bertheau 1779/00/00 HB AN 0108 Ludolph Backhuysen ! Ein Seesturm mit etlichen Schiffen. [Vue de mer. Quelques vaisseaux battus par une tempete.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 3 Fuß 6 Zoll hoch, 4 Fuß 6 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0194 Ludoph Backhuysen I Eine Seeaussicht. Etliche Gewitterwolken stehen am Horizonte und drohen einen Sturm. [Vue de mer. De sombres nuages sur l'horizon annoncent une tempete.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 3 Fuß 6 Zoll hoch, 4 Fuß 6 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0199 Ludolph Backhuysen I Ein Seeprospekt mit etlichen Schiffen. In der Entfernung sieht man die Stadt Rotterdam. [Vue de mer avec quelques vaisseaux. Dans le lointain on voit la ville de Rotterdam.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 4 Fuß hoch, 6 Fuß 8 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HBAN 0324 Backhuysen 1 Einige Schiffe auf der See, mit dem Pinsel schwarz auf weiß schraffiret. Auf Holz. [Quelques vaisseaux en mer, morceau sur un fond blanc, rehausse de hachures noires. Sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 2 Fuß 1 Vi Zoll hoch, 2 Fuß 11 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/09/27 FRNGL 0540 Backhuysen I Ein Seesturm. [Un orage sur mer.] I Maße: 11 % Zoll hoch, 1 Schuh 3 % Zoll breit Transakt.: Verkauft (16.15 fl) Käufer: Kriegsrath Merck Darmstadt 1780/10/02 FRSTK 0003 Backhuysen I Ein schönes Seestück von Backhuysen. I Pendant zu Nr. 4 Maße: 11 Vi Zoll hoch, 1 Schuh und 1 Schuh 2 Vi Zoll breit Transakt.: Unbekannt (5 fl für die Nrn. 3 und 4) 1780/10/02 FRSTK 0004 Backhuysen I Der Compagnon zu obigen von nehmlicher Hand und Grösse. I Pendant zu Nr. 3, "Ein schönes Seestück" Maße: 11 Vi Zoll hoch, 1 Schuh und 1 Schuh 2 Vi Zoll breit Transakt.: Unbekannt (5 fl für die Nm. 3 und 4) 1781/02/17 FRAN 0046 Backhuysen I Ein derer meisterhaftesten und fleißig ausgeführter Seestürmen von Backhuysen. I Maße: 2 Schuh 11 Zoll breit, 2 Schuh 1 Zoll hoch Transakt.: Unbekannt (100 fl) 1781/05/07 FRHUS 0061 Backhuisen I Ein Seehafen mit vielen Schiffen und einer grosen Anzahl mancherley schöner Figuren, wovon sich viele in ein dicht am Bord liegendes grosses Schif begeben, mit einer unvergleichlichen Würckung gemahlt von dem bekannten Meisterpinsel des Backhuisen. I Maße: 2 Schuh 3 Zoll hoch und 5 Schuh 8 Zoll breit Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (55.30 fl) Käufer: Behr 1781/05/07 FRHUS 0260 Backhuisen I Zwey Seehäfen mit vielen Schiffen und Figuren, aus Backhuisens ersten Zeiten. I Diese Nr.: Ein Seehafen mit vielen Schiffen und Figuren Maße: 1 Schuh hoch und 1 Schuh 7 Zoll breit Anm.: Die Lose 260 und 261 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (5 fl für die Nrn. 260 und 261) Käufer: Heusser 1781/05/07 FRHUS 0261 Backhuisen I Zwey Seehäfen mit vielen Schiffen und Figuren, aus Backhuisens ersten Zeiten. I Diese Nr.: Ein Seehafen mit vielen Schiffen und Figuren Maße: 1 Schuh hoch und 1 Schuh 7 Zoll breit Anm.: Die Lose 260 und 261 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (5 fl für die Nrn. 260 und 261) Käufer: Heusser 1781/09/10 BNAN 0069 L. Backhuysen I Durch schäumende Wogen segelt ein großes Kriegsschiff vorwärts zur Rechten, und ein anderes neben aus der See hervorragenden Klippen mehr abwärts 198
GEMÄLDE
nach der linken Ferne; die Brandung an der Klippe und die über dem hellen Horizont aufsteigenden dunkeln Wolken verursachen herrliche Widerscheine. Ueberhaupt ist alles mit vieler Sorgfalt nach der Natur behandelt. I Mat.: auf Holz Maße: 17 Zoll hoch, 24 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/09/10 BNAN 0073 L. Backhuysen I Ein reich geziertes Jagdschiff fährt zur Rechten neben einem kleineren Schiff für den mit einigen Seeleuten staffierten Strand vorbey; zur Linken ein großer Kauffahrer; hinter ihm ein abgetackeltes Kriegesschiff; vorne ein ruderndes Boot; in der bewölkten Ferne siehet man eine Stadt. [Beide von L. Backhuysen] I Pendant zu Nr. 74 Mat.: auf Holz Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 74 und beziehen sich auf die Nrn. 73 und 74. Transakt.: Unbekannt 1781/09/10 BNAN 0074 L. Backhuysen I Das Nebenbild zeiget eine ebenfalls geschmückte Jagd, so auf der offenen See zu dem entfernt liegenden abgetackelten Kriegsschiffe segelt; ein anderes großes Schiff mit flatterndem Segel geht gegen dem Wind; einige andere mit verschiedenen Leuten beleben den Vorgrund. Beide von L. Backhuysen. I Pendant zu Nr. 73 Mat.: auf Holz Maße: 11 Zoll hoch, 30 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1782/09/30 FRAN 0274 Backheusen I Das Gegenbild hierzu, ein Ungewitter zur See, schön in Licht und Schatten ausgearbeitet von dem vortrefflichen Backheusen, nehmliche Grösse. [Le pendant du precedant, une vüe de mer en tems d'orage, le clair obscur tres bien exprime par l'excellent maitre Backheusen.] I Pendant zu Nr. 273 von B. Peeters (I) Maße: 1 Schuh Vi Zoll hoch, 1 Schuh 5 Vi Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (40 fl für die Nrn. 273 und 274) Käufer: Grahe 1783/06/19 HBRMS 0108 Lud. Backhuysen, 1707 \ Ein Seesturm; bey von Masten zerbrochenen und in der größten Gefahr gestellten Schiffe, treibenden Gefässen und Ballen abgebildet. Leinwand], g.R. [verguldeter Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: 13 Zoll hoch, 16 Zoll breit Inschr.: 1707 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt 1785/05/17 MZAN 0939 Backhuysen I Ein Prospect von Amsterdam von Backhuysen. [Une vue d'Amsterdam.] I Maße: 1 Schuh 6 Zoll hoch, 1 Schuh 11 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (29.30 fl) Käufer: ν Loquowitz 1787/04/03 HB HEG 0123 L. Backhysen I Zwey See=Prospecten mit vielen Schiffen, auf dem Einen wird eine See=Schlacht gehalten, von L. Backhysen, auf Ixinewand. I Diese Nr.: Ein See=Prospect mit vielen Schiffen, auf dem eine See=Schlacht gehalten wird Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 123 und 124 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (9.12 Μ für die Nm. 123 und 124) Käufer: Bertheau 1787/04/03 HB HEG 0124 L. Backhysen I Zwey See=Prospecten mit vielen Schiffen, auf dem Einen wird eine See=Schlacht gehalten, von L. Backhysen, auf Leinewand. I Diese Nr.: Ein See=Prospect mit vielen Schiffen Mo?.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 123 und 124 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (9.12 Μ für die Nrn. 123 und 124) Käufer: Bertheau 1788/06/12 HBRMS 0063 Lud. Backhuysen I Zwey wasserreiche Landschaften, mit Reisenden zu Wagen und zu Schiffe, und mit Landleuten: sehr schön. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine wasserreiche Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 13 Vi Zoll, breit 16 % Zoll Anm.: Die Lose 63 und 64 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1788/06/12 HBRMS 0064 Lud. Backhuysen I Zwey wasserreiche Landschaften, mit Reisenden zu Wagen und zu Schiffe, und mit Landleuten: sehr schön. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine wasserreiche Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 13 Vi Zoll, breit 16 % Zoll Anm.: Die Lose 63 und 64 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1788/06/12 HB RMS 0072 L. Backhuysen I Ein ganz vortreflich gemalter See=Prospect, zur Rechten eine gebürgichte Landschaft mit einer Stadt am Ufer, das Meer von Schiffen bedeckt. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 22 Vi Zoll, breit 29 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1788/06/12 HBRMS 0166 Backhuysen I Ein Seestück mit vielen Schiffen und unzählig viele Menschen im Gefechte mit Türken bey einer Landung am Ufer, von ausserordentlicher Schönheit. I Maße: Hoch 5 Fuß, breit 8 Fuß Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0232 Ludwig Backhuisen I Ein Seesturm, auf Holz, in einer vergoldeten Ram. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 2 Zoll, Breite 1 Schuh 6 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/05/20 HBSCN 0216 Backhuyen I See=Prospect mit Schiffen, am Ufer einige Figuren. Sehr schön gemahlt auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 20 Zoll, breit 30 Zoll Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (3 M) Käufer: Richardi 1791/07/29 HBBMN 0113 L. B. 1693. I Zwey See=Stürme mit Schiffe, wie v. der Velden; auf Leinen. I Diese Nr.: Ein See=Sturm mit Schiffe Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 42 Zoll, breit 56 Vi Zoll Inschr.: 1693 (datiert?) Anm.: Die Lose 113 und 114 wurden zusammen katalogisiert. Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt (10.8 Μ für die Nm. 113 und 114) 1791/07/29 HBBMN 0114 L. B. 1693 I Zwey See=Stürme mit Schiffe, wie v. der Velden; auf Leinen. I Diese Nr.: Ein See=Sturm mit Schiffe Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 42 Zoll, breit 56 Vi Zoll Inschr.: 1693 (datiert?) Anm.: Die Lose 113 und 114 wurden zusammen katalogisiert. Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt (10.8 Μ für die Nrn. 113 und 114) 1794/00/00 HB AN 0017 Lud. Barckhuysen I Ein Seestück. Auf offenem Meere manövriren drey Kriegsschiffe bey geringem Winde. Die zwey Vordem im Hintergrunde weichen hinter dem Letztern im Vordergrunde vortreflich zurück. Ein Lichtblick aus dunklen Wolken erleuchtet das Stück auf eine anziehende Weise. I Maße: Höhe 27 Zoll, Breite 34 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1796/00/00 BSAN 0033 Ludolphe Backhuysen I Marine. Mer brumeuse. Quelques vaisseaux plus ou moins eloignes. Une barque ä l'ancre, les voiles carguees, se charge de tonneaux, que des mariniers y roulent, depuis le rivage. Une chalouppe ä sec. Lointain menagant et orageux. Sur le tableau est: L. Β. I Mat.: auf Leinwand Maße: Haut de 1 pied 3 pouces; large de 1 pied 9 pouces Inschr.: L. B. (bezeichnet) Verkäufer: Merian l'aine Transakt.: Unbekannt (50) 1796/02/17 HBPAK 0232 L. Backhuysen I Eine stürmische See mit verschiedenen dreimastigen Schiffen, welche von den ungestümen Wellen sehr beunruhiget werden. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 17 Zoll, Breite 23 Zoll Transakt.: Verkauft (151 M) Käufer: Esnard [?] 1796/02/17 HBPAK 0233 L. Backhuysen I Eine stille See mit verschiedenen kleinen Schiffen. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 9 Zoll, Breite 10 Zoll Transakt.: Verkauft (158 M) Käufer: Τ 1796/12/07 HBPAK 0092 L. Backhuisen I Ein Seestück mit segelnden Böten. I Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0016 Backhuysen I Ein Seesturm mit zwey Schiffen, die dem Zertrümmern nahe sind. Ganz Natur, und mit vielem Fleiß ausgearbeitet. Auf Holz, mit goldnen Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Zoll, breit 13 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/20
HBPAK
0126
Backhausen
I Eine See=Gegend mit
verschiedenen Schiffen, wovon eins im Vordergründe im Seegein begriffen ist. Von einer starken und schönen Farbe. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 22 Zoll, breit 28 Zoll Transakt.: Unbekannt
1797/04/20 HBPAK 0136 L. Backhausen I Eine See=Gegend mit verschiedenen Kriegs=Schiffen, und andern Fahrzeugen. Von einer schönen Composition. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 16 Zoll, breit 20 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/12/08 HBPAK 0089 L. Bachoesen I Ein Seestück mit Schiffen. Auf das beste vorgestellt. Auf Leinwand, im schw. Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 41 Zoll, Breite 56 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0395 Backhuysen I Eine See mit Schiffen. Von der herrlichsten Zusammensetzung, Klarheit und Natur. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 36 Zoll, breit 48 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/08/10 HBPAK 0012 L. Backhuysen I Eine stürmische See mit vielen Schiffen und Böten. Die Klarheit des Wassers und die stürmenden Wellen sind auf das natürlichste vorgestellt. Auf Leinwand, im schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 23 Zoll, breit 32 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 LZAN 0077 Backuisen, Ludolf] Marine. Yacht vogant sur la Meuse avec la chaloupe remplie de passagers, encore dans l'ancien costume Espagnol. On voit en perspective les villes qui sont sur les bords de cette riviere; d'une touche vraie et moelleuse. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hauteur 22 pouces, largeur 28 pouces Transakt.: Unbekannt (12 Louis Schätzung) 1799/00/00 WZAN A0271 Ludolph Backhuysen i Zwey Landschaften mit Wasser, Schiffen und vielen kleinen Figuren, von Ludolph Backhuysen. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Wasser, Schiffen und vielen kleinen Figuren Mat.: auf Holz Maße: hoch 9 Zoll breit 1 Schuh Anm.: Die Lose 271 und 272 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0272 Ludolph Backhuysen I Zwey Landschaften mit Wasser, Schiffen und vielen kleinen Figuren, von Ludolph Backhuysen. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Wasser, Schiffen und vielen kleinen Figuren Mat.: auf Holz Maße: hoch 9 Zoll breit 1 Schuh Anm.: Die Lose A271 und A272 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/08/09 HBPAK 0132 Backhuysen I Ein Seestück mit Schiffen und Böten. Auf Leinwand, schw. Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 16 Zoll, breit 24 Zoll Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 BLBOE 0029 Backhuysen I Ein Seestück. Die schäumenden Wellen treiben Schiffe hin und her, und scheinen sie zu zertrümmern. Die Luft= und Wasservögel sind Vorbothen eines nahen Seesturms. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN1 0006 Backhuisen (Ludolff) I Eine Marine von aller Schönheit; ein Dreimaster mit holl. Flagge geht von einem Hafen unter Seegel, ein Boot mit gleicher Flagge rudert nahe, an einer Felucke nach demselben zu. Im zweiten Plan liegt eine Stadt mit einem Leuchtthurm am Fuß eines Berges auf welchem eine Festung ist. Mehr entfernt seegelt eine Speronara. Auf einem schwimenden Faß ist signirt LB. I Mat.: auf Leinwand Maße: 18 Zoll hoch, 25 Zoll breit Inschr.: LB (signiert) Transakt.: Unbekannt 1800/00/00+ LZRST [0005] Ludolph Backhuysen I Ein grosses Seestück mit vielen Schiffen und Fahrzeugen, Links im Vordergrunde männliche und weibliche Figuren von holländischen Fischern. I Mat. : auf Leinwand Maße: 51 Zoll breit 58 Zoll hoch Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Rost Transakt.: Unbekannt 1800/07/09 HBPAK 0087 Backnisem I Une belle marine par un tems orageux. Sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: 31 pouces de hauteur. Sur 42 pouces de largeur Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0607 N. Backhusen I Ein Seestück. \Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "N. Backhusen", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
199
Backhuysen, Ludolf (Geschmack von) 1782/02/18 RGBZN 0063 Backhuysen I Zwey Seestürme, in Backhuysen Geschmack. I Transakt.: Unbekannt (2.30 fl)
1796/10/17 HBPAK 0008 In der Manier von Backhusen I Zwey kleine See=Stücke. Auf Holz. Schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein kleines See=Stück Mat.: auf Holz Maße: Hoch 6 Zoll, breit 9 Zoll Anm.: Die Lose 7 und 8 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Backhuysen, Ludolf (Kopie nach) 1795/03/12 HBSDT 0141 Nach Backhuisen I Ein Seestück; brav und kühn gemahlt. Auf Leinwand, im schwarzen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 24 Zoll Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0165 Nach Backhuysen I Zwey Seestücke mit vielen segelnden Schiffen. Auf Holz, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein Seestück mit vielen segelnden Schiffen Mat.: auf Holz Maße: Hoch 21 Zoll, breit 28 Zoll Anm.: Die Lose 165 und 166 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0166 Nach Backhuysen I Zwey Seestücke mit vielen segelnden Schiffen. Auf Holz, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein Seestück mit vielen segelnden Schiffen Mat.: auf Holz Maße: Hoch 21 Zoll, breit 28 Zoll Anm.: Die Lose 165 und 166 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0116 Backhusen I Ein Seestück mit einer biblischen Historie, nach Backhusen. I Transakt.: Unbekannt
Backhuysen, Ludolf (Manier)
Baden, Jan Juriaensz. van 1774/10/05 HBNEU 0052 van Baaden I Zwey inwendige Kirchen, mit Figuren, oval. I Diese Nr.: Eine inwendige Kirche, mit Figuren Format: oval Anm.: Die Lose 52 und 53 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1774/10/05 HBNEU 0053 van Baaden I Zwey inwendige Kirchen, mit Figuren, oval. I Diese Nr.: Eine inwendige Kirche, mit Figuren Format: oval Anm.: Die Lose 52 und 53 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1775/11/18 HBBMN 0025 van Baaden I Eine kleine inwendige Kirche. I Transakt.: Unbekannt 1775/11/18 HBBMN 0046 van Baaden I Eine ungemein ausführliche Kirche. I Transakt.: Unbekannt 1776/04/15 HBBMN 0124 van Baaden I Eine inwendige extra ausführliche Kirche, mit schönen Figuren, von van Baaden, 1640. I Maße: Höhe 1 Fuß 4 Zoll, Breite 1 Fuß 8 Vi Zoll Inschr.: 1640 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Verkauft (30.4 M) Käufer: Lilli
1774/11/03 HBNEU 0009 Backhuysen I Zwey See=Prospecte, auf Leinewand gemahlt, so schön wie von Backhuysen. I Diese Nr.: Ein See=Prospect Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 9 und 10 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Ritter Transakt.: Verkauft (9.8 M) Käufer: Govers
1778/08/29 HBTEX 0077 Von Baden I Die Historie der Ehebrecherin, mit großem affect vorgestellt, von van Baden, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 9 Zoll, Breite 11 Zoll Transakt.: Unbekannt
1774/11/03 HBNEU 0010 Backhuysen I Zwey See=Prospecte, auf Leinewand gemahlt, so schön wie von Backhuysen. I Diese Nr.: Ein See=Prospect Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 9 und 10 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Ritter Transakt.: Verkauft (9.8 M) Käufer: Govers
1793/06/07 HBBMN 0090 van Baaden I Inwendige Tempel, von schöner Perspectiv mit einigen Figuren staffirt von van Baaden, lang oval. I Diese Nr.: Ein inwendiger Tempel, von schöner Perspectiv mit einigen Figuren staffirt Format: oval Maße: Hoch 12 Zoll, breit 17 Zoll Anm.: Die Lose 90 und 91 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1776/12/21 HBBMN 0081 Backhuysen I Zwey See=Prospecten, so schön als Backhuysen, auf Leinewand. I Diese Nr.: Ein See=Prospect Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 2 Fuß 4 Zoll, breit 2 Fuß 10 Zoll Anm.: Die Lose 81 und 82 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (4.6 M) Käufer: Rohlfs 1776/12/21 HBBMN 0082 Backhuysen I Zwey See=Prospecten, so schön als Backhuysen, auf Leinewand. I Diese Nr.: Ein See=Prospect Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 2 Fuß 4 Zoll, breit 2 Fuß 10 Zoll Anm.: Die Lose 81 und 82 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (4.6 M) Käufer: Rohlfs 1785/04/22 HBTEX 0080 In der Manier von Backhuysen I Zwey Seestücke mit vielen Schiffen. Plaisant gemahlt auf Leinewand. Schwarzer Rahm und goldene Leisten. I Diese Nr.: Ein Seestück mit vielen Schiffen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 25 Zoll, breit 30 Zoll Anm.: Die Lose 80 und 81 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1785/04/22 HBTEX 0081 In der Manier von Backhuysen I Zwey Seestücke mit vielen Schiffen. Plaisant gemahlt auf Leinewand. Schwarzer Rahm und goldene Leisten. I Diese Nr.: Ein Seestück mit vielen Schiffen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 25 Zoll, breit 30 Zoll Anm.: Die Lose 80 und 81 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0007 In der Manier von Backhusen I Zwey kleine See=Stücke. Auf Holz. Schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein kleines See=Stück Mat.: auf Holz Maße: Hoch 6 Zoll, breit 9 Zoll Anm.: Die Lose 7 und 8 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 200
GEMÄLDE
1793/06/07 HBBMN 0091 van Baaden I Inwendige Tempel, von schöner Perspectiv mit einigen Figuren staffirt von van Baaden, lang oval. I Diese Nr.: Ein inwendiger Tempel, von schöner Perspectiv mit einigen Figuren staffirt Format: oval Maße: Hoch 12 Zoll, breit 17 Zoll Anm.: Die Lose 90 und 91 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0014 H. S. van Baden I Zwey meisterhaft und sehr perspectivisch gemahlte Tempel, mit der Historie der Ehebrecherin auf dem einen, und vom Zins=Groschen auf dem andern. Oval. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein meisterhaft und sehr perspectivisch gemahlter Tempel, mit der Historie der Ehebrecherin Mat.: auf Holz Format: oval Maße: Hoch 17 Zoll, breit 22 Zoll Anm.: Die Lose 14 und 15 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0015 H. S. van Baden I Zwey meisterhaft und sehr perspectivisch gemahlte Tempel, mit der Historie der Ehebrecherin auf dem einen, und vom Zins=Groschen auf dem andern. Oval. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein meisterhaft und sehr perspectivisch gemahlter Tempel, mit der Historie vom Zins=Groschen Mat.: auf Holz Format: oval Maße: Hoch 17 Zoll, breit 22 Zoll Anm.: Die Lose 14 und 15 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/06/13 HBPAK 0071 J. G. Baden I Ein perspectivisches Gebäude mit vielen Säulen. In der Entfernung ein Portal. Hin und wieder einige Figuren. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Vi Zoll, breit 16 Zoll Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0311 che. I Transakt.: Unbekannt
von Baaden I Eine inwendige Kir-
Baden-Durlach, Karoline Luise, Markgräfin von 1790/08/25 FRAN 0427 Markgräfin von Baden-Durlach I Zwey Stück, jedes mit zwey jungen Frauenzimmer, welche ein Nest mit jungen Tauben in der Hand haben, von der Frau Markgräfin von Baden-Durlach. I Diese Nr.: Ein Stück mit einem jungen Frauenzimmer, welches ein Nest mit jungen Tauben in der Hand hat Maße: hoch 22 Zoll, breit 16 Zoll Anm.: Die Lose 427 und 428 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (8.30 fl für die Nm. 427 und 428) Käufer: Diehl 1790/08/25 FRAN 0428 Markgräfin von Baden-Durlach I Zwey Stück, jedes mit zwey jungen Frauenzimmer, welche ein Nest mit jungen Tauben in der Hand haben, von der Frau Markgräfin von Baden-Durlach. I Diese Nr.: Ein Stück mit einem jungen Frauenzimmer, welches ein Nest mit jungen Tauben in der Hand hat Maße: hoch 22 Zoll, breit 16 Zoll Anm.: Die Lose 427 und 428 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (8.30 fl für die Nrn. 427 und 428) Käufer: Diehl
Bähre [Nicht identifiziert] 1776/07/19 HBBMN 0091 Bähre I Zwey Stück, mit Meer= Schweinchen und Früchte. I Diese Nr.: Ein Stück, mit Meer= Schweinchen und Früchte Maße: Höhe 8 Vi Zoll, Breite 1 Fuß Vi Zoll Anm.: Die Lose 91 und 92 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (5.8 Μ für die Nrn. 91 und 92) Käufer: Ohman 1776/07/19 HBBMN 0092 Bähre I Zwey Stück, mit Meer= Schweinchen und Früchte. I Diese Nr.: Ein Stück, mit Meer= Schweinchen und Früchte Maße: Höhe 8 Vi Zoll, Breite 1 Fuß Vi Zoll Anm.: Die Lose 91 und 92 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (5.8 Μ für die Nrn. 91 und 92) Käufer: Ohman 1776/07/19 HBBMN 0093 Bähre I Ein Frucht=Stück. I Maße: Höhe 8 Vi Zoll, Breite 1 Fuß Vi Zoll Transakt.: Verkauft (1.12 M) Käufer: Ohman
Baen, Jan de 1759/00/00 LZEBT 0059 J. de Ban I Ein Mans Portrait auf Holtz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 9 Zoll, Breite 2 Schuh 3 Vi Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (50 Th Schätzung) 1794/02/21 HBHEG O l l i J. de Baan I Christian III. König von Dännemark und Norwegen. Nach dem Leben ganz vortreflich wie Rubens gemahlt. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 27 Zoll, breit 20 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt
Baer 1775/02/13 FRAN 0085 Beer I Einen alten Kopf mit weißem langen Bart vorstellend. I Maße: Höhe 15 Vi Zoll. Breite 12 % Zoll Verkäufer: von der Lahr Transakt.: Unbekannt
Bäume [Nicht identifiziert] 1793/00/00 NGWID 0425 Bäume I Eine angenehme Landschaft mit schönem Vieh staffiert, von Bäume. I Maße: 2 Schuh 2 Zoll hoch, 2 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
Bager, Johann Daniel 1780/08/21 DAAN 0048 Pager I Ein Mädgen mit einem Vogel auf dem Finger, dem es eine Kirsche bietet, nach einem Gemähide in der Gallerie zu Düsseldorf, von Pager L[einewand]. I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Schuh 3 Zoll breit, 1 Schuh 8 Zoll hoch Verkäu-
fer: [Friedrich Karl Ludwig, Freiherr von Moser] Transakt.: Unbekannt 1782/07/00 FRAN 0123 Johann Daniel Bager I Das Gegenbild, ein junger Mensch, der in Gegenwart eines Notarius und Zeugen an eine nicht gar schöne Weibsperson sich verheyrathen soll, und sich im Angesicht aller guten mütterlichen Versicherungen nach etwas anders umsieht, von Johann Daniel Bager, nemliches Maaß. I Pendant zu Nr. 122 von J. Steen Maße: 1 Schuh 5 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 1 Zoll breit Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt (56 fl für die Nrn. 122 und 123) 1782/07/00 FRAN 0145 Sager I Ein Weibsköpfchen, als Gegenbild, von Bager, nemliches Maaß. I Pendant zu Nr. 144 von Monogrammist F.V.K. (1751) Maße: 8 Zoll hoch, 7 Zoll breit Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt (2.24 fl für die Nm. 144 und 145) 1784/08/02 FRNGL 0214 Joh. Daniel Baager I Ein nach der Natur besonders fleißig und schön ausgearbeitetes Früchtenstück. I Maße: 10 Zoll breit, 9 Zoll hoch Verkäufer: D Transakt.: Verkauft (16.15 fl) Käufer: Hacker 1785/05/17 MZAN 1069 Bager I Ein Mädchen das Zwiebeln schält. [Une fille qui öte la peau d'oignons.] I Pendant zu Nr. 1070 Maße: 11 Zoll hoch, 9 Zoll breit Inschr.: Bager (signiert) Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (8 fl für die Nm. 1069 und 1070) Käufer: Jung Mahler 1785/05/17 MZAN 1070 Bager I Das Gegenbild, ein Jung mit einem Krug in der einen, und dem Glase in der andern Hand, beide Stücke sind bezeichnet Bager. [Le pendant, un garjon ayant une cruche dans l'une & un verre dans l'autre main, les deux pieces sont marquees Bager.] I Pendant zu Nr. 1069 Maße: 11 Zoll hoch, 9 Zoll breit Inschr.: Bager (bezeichnet) Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (8 fl für die Nm. 1069 und 1070) Käufer: Jung Mahler 1790/08/25 FRAN 0336 Daniel Bager I Venus und Cupido in einer Landschaft, zum Gegenbild Venus und Cupido in der Feme. I Diese Nr.: Venus und Cupido in einer Landschaft; Pendant zu Nr. 337 Maße: hoch 10 Vi Zoll, breit 8 Zoll Anm.: Die Lose 336 und 337 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Unbekannt (9.15 fl für die Nm. 336 und 337) 1790/08/25 FRAN 0337 Daniel Bager I Venus und Cupido in einer Landschaft, zum Gegenbild Venus und Cupido in der Feme. I Diese Nr.: Venus und Cupido in der Feme; Pendant zu Nr. 336 Maße: hoch 10 Vi Zoll, breit 8 Zoll Anm.: Die Lose 336 und 337 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Unbekannt (9.15 fl für die Nm. 336 und 337) 1791/05/30 FRAN 0110 Bager I Zwey Baurenstückcher von Bager. I Diese Nr.: Ein Baurenstückchen Maße: 7 Zoll hoch und 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 110 und 111 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Bansa Transakt.: Verkauft (1.20 für die Nm. 110 und 111) Käufer: Vogelburg 1791/05/30 FRAN O l l i Bager I Zwey Baurenstückcher von Bager. I Diese Nr.: Ein Baurenstückchen Maße: 7 Zoll hoch und 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 110 und 111 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Bansa Transakt.: Verkauft (1.20 für die Nm. 110 und 111) Käufer: Vogelburg 1791/05/31 FRAN 0195 Bager I Zwey Obststückcher. I Diese Nr.: Ein Obststückchen Maße: 4 Zoll hoch und 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 195 und 196 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Bansa Transakt.: Verkauft (2.04 für die Nm. 195 und 196) Käufer: Schneidewind 1791/05/31 FRAN 0196 Bager I Zwey Obststückcher. I Diese Nr.: Ein Obststückchen Maße: 4 Zoll hoch und 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 195 und 196 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Bansa Transakt.: Verkauft (2.04 für die Nm. 195 und 196) Käufer: Schneidewind GEMÄLDE
201
1794/09/00 LGAN 0021 Bager I Zwei fürtrefliche Früchten= Stiike von Bayer, auf Holz, in einer modernen verguldten Rahme. I Mat.: auf Holz Maße: breit 1 Schuh 4 Zoll, hoch 1 Schuh 8 Zoll Verkäufer: [Friedrich Karl Ludwig, Freiherr von Moser] Transakt.: Unbekannt (200 rh fl Schätzung)
Baidung, Hans (Hans Baidung Grien) 1777/04/11 HBNEU 0027 Hans Balduin I Zwey Portraits. Diese Nr.: Ein Portrait Anm.: Die Lose 27 und 28 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1796/00/00 HLAN [0022] Bager I Zvvey Früchtenstüke, 1 Sch. 8 Ζ. 1 Sch. 4 Z. auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Sch. 8 Ζ. 1 Sch. 4 Z. Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: [Friedrich Karl Lang] Transakt.: Unbekannt (222.5 Rt; 400 fl Schätzung)
1777/04/11 HBNEU 0028 Hans Balduin I Zwey Portraits. I Diese Nr.: Ein Portrait Anm.: Die Lose 27 und 28 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Bagge
1781/05/07 FRHUS 0024 Hans Baidung I Das Portrait eines Gelehrten, bezeichnet H.B. 1537 vielleicht Hans Baidung. I Maße: 2 Schuh hoch und 1 Schuh 6 Zoll breit Inschr.: H.B. 1537 (bezeichnet und datiert) Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (4.24 fl) Käufer: Fa Bernus
1792/10/12 KOAN 0050 Bagge I Ein Portrait von Bagge. Auf Leinwand. [Von 37 bis 65. sind verschiedene sogenannte Mobiliengemälde, von allerhand Gegenständen, theils Originalien, theils Kopien; deren Beschreibung zu weitläufig ist, unter.] I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Fuss 6 Zoll - breit 2 Fuss 6 Zoll Anm.: Diese Seite des Katalogs ist unvollständig; ein Teil des Bildtitels ist verlorengegangen. Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen über der Nr. 37 und beziehen sich auf die Nrn. 37 bis 65. Verkäufer: Moureaux Transakt.: Unbekannt
Baglione, Giovanni 1797/08/10 MMAN 0348 der Ritter Baglioni I Ein alter Mann mit einem Stock in der Hand, von dem Ritter Baglioni, auf Tuch. I Mat.: auf Leinwand Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (15 fl Schätzung)
Bainville, Nicol. [Nicht identifiziert] 1794/09/09 HBPAK 0143 Nicol. Bainville 1667\ Die Göttin Flora in der Mitten, umher einen Blumenkranz, lebhaft und mit vielen Fleiß gemahlt. Auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 50 Zoll, breit 38 Zoll Inschr.: 1667 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt
Baldi, Lazzaro 1789/00/00 MMAN 0293 Lazaro Balde I Ein Stück aus der Fabel, auf Leinw. [Une piece tiree de la fable, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 10 Zoll hoch, 2 Fuß 8 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (1 fl) 1789/00/00 MMAN 0368 Lazaro Balde I Eine biblische Geschieht, auf Leinw. [Un passage de la Bible, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 3 Fuß 2 Zoll hoch, 1 Fuß 6 Zoll breit [2 pieds 3 pouces de haut, 1 pied 9 pouces de large] Anm.: Die Dimensionen unterscheiden sich in der deutschen und französischen Fassung des Katalogs. Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (2 fl) 1789/00/00 MMAN 0383 Lazaro Balde I Die Brodbrechung Christi mit den jüngern zu Emaus, auf Leinw. [Iesus rompant le pain, avec les enfans d'Emaus, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 10 Zoll hoch, 4 Fuß 4 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (22 fl) 1789/00/00 MMAN 0392 Lazaro Balde I Eine Maria Magdaleua [sie], auf Leinw. [Marie Magdelaine, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 3 Fuß 1 Zoll hoch, 2 Fuß 6 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (1.30 fl) 1799/00/00 WZAN 0373 Lazarus Baldi I Die Krönung Maria, von Lazarus Baldi. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 8 Vi Zoll breit 1 Schuh 4 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 202
GEMÄLDE
Baidung, Hans (Hans Baidung Grien) (zugeschrieben)
Baien, Hendrik van (I) 1723/00/00 PRAN [C]0001 van der Paalen I Bachanal Stücklein / vom van der Paalen. I Maße: Höhe Vi Schuh 3 Zoll, Breite 1 Schuh Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN 0138 Paalen I Der Geschmack / vom Paalen, in Metalliner Rahm. I Maße: Höhe 1 Vi Schuh 5 Zoll, Breite 3 Schuh Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0313 van Ballen I Ein Tantz nackender Rinderen. Orig. von van Ballen. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0160 Van Ballen I Une danse d'enfans nus, par Van Ballen. I Maße: Haut 2. pies, large 3. pies 2 Vi pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1744/05/20 FRAN 0186 von Baalem I 1 Extra feine und schöne Jagd mit Diana. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 9 Zoll, Breite 2 Schuh 5 Zoll Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1763/01/17 HNAN 0028 van Baalen I Bileam arrete par l'Ange, de van Baalen, sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 2 pieds 10 pouces, Largeur 3 pieds 10 pouces Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt 1763/11/09 FRJUN 0009 van Baalen I La Tragedie de Jason & de Medee. I Maße: hauteur 20 Vi pouces, largeur 20 pouces Transakt.: Verkauft (5.30 fl) Käufer: Kamerrath Boltz 1763/11/09 FRJUN 0010 van Baalen I Marie avec l'Enfant delicatement peint. I Maße: hauteur 4 pouces, largeur 3 pouces Transakt.: Verkauft (7.80 fl) Käufer: Schorer 1764/06/15 BOAN 0683 Van Bahlen I Un Tableau d'un pied dix pouces de largeur, d'un pied trois pouces de hauteur, representant le Martyre des Innocents, peint par van Bahlen. [Ein stück Vorstellend das Martyr deren unschuldigen Kinderen, gemahlt Von van Baalen.] I Maße: 1 pied 10 pouces de largeur, 1 pied 3 pouces de hauteur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (17.10 Rt) Käufer: Hof C Rath Broggia 1765/00/00 FRRAU 0167 Van Bahlen I Wie Herodes die Kinder ermorden läßt. Die veste Zeichnung in den Figuren dieses Meisters, seine schöne Colorit und gute Haltung seiner Gemähide, sind eben die Tugenden bey dieser reichen Composition, wodurch der Meisters dieses Stück kanntbar machet. Herode faisant massacrer les enfans. Le ferme dessein des figures de ce maitre, son beau coloris & la belle ordonnance de ses tableaux, sont justement les avantages de cette riche composition, qui font reconnoitre le maitre de ce tableau. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 1 Schuh 3 Zoll, breit 2 Schuh Transakt.: Unbekannt
1766/07/28 KOSTE [A]0008 Baalen I Menschwerdung Christi auf Kupfer von Baalen. I Mat.: auf Kupfer Transakt.: Verkauft (22.30 Rt) Käufer: Schmitz [?]
1777/04/11 HB NEU 0040 von Bahlen I Zwey Prospecte von Kirchen. I Diese Nr.: Ein Prospect einer Kirche Anm.: Die Lose 40 und 41 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1768/07/00 MUAN 0265 Baien (van) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
1777/04/11 HBNEU 0041 von Bahlen I Zwey Prospecte von Kirchen. I Diese Nr.: Ein Prospect einer Kirche Anm.: Die Lose 40 und 41 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1774/03/28 HBBMN 0082 v. Baien I Die Auferweckung Lazari, besonders schön exprimirt, mit dito [schwarzen] Rahmen. I Maße: Höhe 1 Fuß 3 Zoll, Breite 1 Fuß 7 Zoll Transakt.: Unbekannt 1774/08/13 HBBMN 0086 van Baien I Der Bethlehemitische Kinder=Mord. I Transakt.: Unbekannt 1775/04/12 HB NEU 0010 Baalen I Zwey Historien=Stücke; auf einem David im Triumph mit dem Haupte Goliaths; auf dem andern Hercules am Spinnrocken bey der Ariadne unter vielen Nymphen, auf Holz. I Diese Nr.: Ein Historien=Stück; Hercules am Spinnrokken bey der Ariadne unter vielen Nymphen Mat.: auf Holz Anm.: Die Lose 10 und 11 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1775/04/12 HB NEU 0011 Baalen I Zwey Historien=Stücke; auf einem David im Triumph mit dem Haupte Goliaths; auf dem andern Hercules am Spinnrocken bey der Ariadne unter vielen Nymphen, auf Holz. I Diese Nr.: Ein Historien=Stück; David im Triumph mit dem Haupte Goliaths Mat.: auf Holz Anm.: Die Lose 10 und 11 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1775/05/08 HBPLK 0045 Baalen I Hieronymus in einer Höhle, welchen ein Löwe bewachet, aufs fleißigste gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 19 Zoll 4 Linie, Breite 14 Zoll 8 Linie Transakt.: Unbekannt (22 M) 1776/11/09 HBKOS 0013 van Baalen I Zwey mytheologische Stücke, die Entführung der Proserpina und der Eropa [sie], auf Holz gemahlt, im schwarzen Rahm mit verguldete Leisten. I Diese Nr.: Ein mytheolgisches Stück, die Entführung der Proserpina Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Fuß 7 Vi Zoll, Breite 2 Fuß 2 Vi Zoll Anm. : Die Lose 13 und 14 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (114 Μ für die Nrn. 13 und 14) 1776/11/09 HBKOS 0014 van Baalen I Zwey mytheologische Stücke, die Entführung der Proserpina und der Eropa [sie], auf Holz gemahlt, im schwarzen Rahm mit verguldete Leisten. I Diese Nr.: Ein mytheolgisches Stück, die Entführung der Europa Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Fuß 7 Vi Zoll, Breite 2 Fuß 2 Vi Zoll Anm.: Die Lose 13 und 14 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (114 Μ für die Nrn. 13 und 14) 1776/11/09 HBKOS 0031 van Baalen I Zwo Bachanalia mit Satyren und spielenden Kindern, auf Holz, in schwarzen Rahm und verguldete Leisten. I Diese Nr.: Eine Bachanalia mit Satyren und spielenden Kindern Mat.: auf Holz Maße: Höhe 9 Zoll, Breite 1 Fuß 1 Zoll Anm.: Die Lose 31 und 32 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (17 Μ für die Nrn. 31 und 32) Käufer: Köster [und] Ehrenr[eich] 1776/11/09 HBKOS 0032 van Baalen I Zwo Bachanalia mit Satyren und spielenden Kindern, auf Holz, in schwarzen Rahm und verguldete Leisten. I Diese Nr.: Eine Bachanalia mit Satyren und spielenden Kindern Mat.: auf Holz Maße: Höhe 9 Zoll, Breite 1 Fuß 1 Zoll Anm.: Die Lose 31 und 32 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (17 Μ für die Nrn. 31 und 32) Käufer: Köster [und] Ehrenr[eich] 1777/02/21 HBHRN 0014 v. Baalen I Ein perspectivisches Gebäude. I Maße: Höhe 1 Fuß 5 Zoll, Breite 1 Fuß 11 Zoll Transakt.: Unbekannt
1778/05/23 HBKOS 0054 v. Baalen I Die Geburt Christi sehr schön beleuchtet, und gemalet, auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 12 Vi Zoll, Breite 10 Zoll Transakt.: Unbekannt (25 M) 1778/10/30 HBKOS 0097 Baalen I Eine bergigte Land=Gegend, meisterhaft gemahlt. Im Vorgrunde einige Reisende, wie auch Hirten und Schaafe, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 20 Zoll, breit 30 Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/10/30 HBKOS 0098 Baalen I [Ohne Titel] I Maße: hoch 20 Zoll, breit 30 Zoll Transakt.: Unbekannt 1784/08/13 HBDEN 0071 van Baien I Die Flucht nach Egypten, wie die Engel Maria und das Christkindlein bedienen. Von großer Ordonence, von van Baien, auf Leinwand. [NB. Von No. 54 bis 95 sind diese Gemähide fast alle in sein vergoldete Rahmen, nur Wenige sind im Holz gebeitzte.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 26 Zoll. Breit 17 Vi Zoll. Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 95 und beziehen sich auf die Nm. 54 bis 95. Verkäufer: Pasche [oder] Flügge Transakt.: Verkauft (15.4 M) Käufer: Β 1785/05/17 MZAN 0085 H. van Baien I Moyses und Aaron wie sie von Pharao die Loslassung der Israeliten begehren von H. van Baien. [Moyse & Aaron demandans ä Pharaon la delivrance des Israelites.] I Maße: 2 Schuh 9 Zoll hoch, 2 Schuh 9 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (131 fl) Käufer: Rmus D Decanus L Β ä Fechenbach 1785/05/17 MZAN 0183 van Baien I Magdalena in der Einöde von van Baien. [S. Madelaine dans le desert.] I Maße: 1 Schuh 7 Zoll hoch, 2 Schuh breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (44 fl) Käufer: Geheim Rath ν Heüser 1785/05/17 MZAN 0380 van Baien I Bachus von van Baien auf Kupfer. [Bacchus.] I Mat.: auf Kupfer Maße: 1 Zoll hoch, 10 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (15 fl) Käufer: Geh R ν Koch 1785/05/17 MZAN 0489 van Baien I Das Sanctissimum welches von Engeln getragen wird von van Baien. [Le saint Sacrement porte par des anges.] I Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 8 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (5.30 fl) Käufer: Strecker 1785/05/17 MZAN 0503 van Baien I Die H. Familie von van Baien. [La S. Familie.] I Maße: 11 Vi Zoll hoch, 11 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (36 fl) Käufer: Hofr ν Leykam 1785/05/17 MZAN 0507 van Baien I Die Geburt Christi von van Baien. [L'adoration des pasteurs.] I Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 10 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (45 fl) Käufer: Rmus D Decanus L Β ä Fechenbach 1785/05/17 MZAN 0612 van Baien I Zwey Stücke, welche zusammen die 4 Elemente vorstellen von van Baien auf Kupfer. [Deux pieces qui representent ensemble les quatre elemens.] I Diese Nr.: Ein Stück, welches 2 der 4 Elemente vorstellt Mat.: auf Kupfer Maße: 2 Schuh 8 Zoll hoch, 3 Schuh 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 612 und 613 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (51 fl für die Nrn. 612 und 613) Käufer: Hofr Heimes 1785/05/17 MZAN 0613 van Baien I Zwey Stücke, welche zusammen die 4 Elemente vorstellen von van Baien auf Kupfer. [Deux pieces qui representent ensemble les quatre elemens.] I Diese Nr.: Ein Stück, welches 2 der 4 Elemente vorstellt Mat.: auf Kupfer MaGEMÄLDE
203
ße: 2 Schuh 8 Zoll hoch, 3 Schuh 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 612 und 613 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (51 fl für die Nrn. 612 und 613) Käufer: Hofr Heimes 1785/05/17 MZAN 0783 van Baien I Mariä Vermählung von van Baien. [Les nöces de la S. Vierge.] I Maße: 9 Zoll hoch, 6 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (17 fl) Käufer: Geh R ν Heuser 1785/05/17 MZAN 1009 van Baien I Die Mutter Gottes mit dem Jesukind, der kleine Johannes und Elisabeth. [La S. Vierge avec l'enfant Jesus, le petit S. Jean & Elisabeth.] I Pendant zu Nr. 1010 Maße: 1 Schuh 5 Zoll hoch, 1 Schuh 1 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Unverkauft 1785/05/17 MZAN 1010 van Baien I Das Gegenbild, die Mutter Gottes mit dem Jesukind und der H. Joseph, beide Stücke von van Baien. [Le pendant, la S. Vierge avec l'enfant Jesus & S. Joseph.] I Pendant zu Nr. 1009 Maße: 1 Schuh 5 Zoll hoch, 1 Schuh 1 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Unverkauft 1785/05/17 MZAN 1029 van Baien I Die Mutter Gottes mit dem Jesukind und der kleine Johannes von van Baien auf Kupfer. [La S. Vierge avec l'enfant Jesus & le petit S. Jean.] I Mat.: auf Kupfer Maße: 7 Zoll hoch, 5 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (7.30 fl) Käufer: Schwanck 1786/04/21 HBTEX 0104 von Baalen I Eine heilige Familie, auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Transakt.: Unbekannt 1786/11/11 HBRMS 0113 von Baalen I Die Europa, auf den Ochsen, mit Neben=Figuren, auf ein Spiegel=Glas gemahlt. I Mat.: auf Spiegelglas Transakt.: Unbekannt 1787/00/00 HB AN 0088 Henricus van Baien I In einer angenehmen Landschaft befindet sich im Vordergrunde eine Menge Figuren, als Männer, Weiber und Kinder, die sich mit Essen, Trinken, Spielen und Tanzen belustigen; andere musiciren, mit Vieh umgeben. Oben in der geöffneten Luft sitzt der Gott Saturn mit einer ernsthaften Miene, eine Sense in der Hand haltend, auf das Vergnügen, oder die sogenannte güldene Zeit herabsehend. Auf Holz, s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 22 Zoll Transakt.: Verkauft (25.12 M) Käufer: Mathees
todtes Wildbret von verschiedenerley Art, im Hintergrunde nimmt man noch ein mit todten Rehen schwer bepacktes Maulthier wahr, so von zwey weiblichen Figuren geleitet wird, alles dieses auf das Natürlichste, und mit dem größten Fleiß verfertigt, von Heinrich von Baien. I Maße: 2 Schuh 8 Zoll hoch, 3 Schuh 11 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0044 Von Baalen I Eine heilige Familie, Maria hat das Christkind an ihrer Brust, Johannes zur Linken mit der Siegesfahne; zur Linken Joseph, und auf beyden Seiten Engeln. Dieses Bild kann sowohl wegen Composition, Zeichnung und Colorit, dem schönsten Rubens an die Seite gestellt werden. I Maße: Hoch 13 Zoll, breit 19 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0145 V. Ballen I Eine Landschaft. Im Vordergrunde zwey sich umarmende artige Figuren, welche kostbar und meisterhaft gemahlt sind. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Zoll, breit 14 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/06/13 HBPAK 0203 H. v. Baalen I Ein Bachantenfest von ausserordentlich vielen Figuren, welche in voller Musik nach dem Tempel gehen. Sehr stark und schön gemahlt. Auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Zoll, breit 48 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/12/08 HBPAK 0053 Bahlen I Christus am Kreutze, wobey die Mutter Maria, Johannes, und andere Heilige mit gegenwärtig. Auf Holz, im goldnen Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 18 Zoll, Breite 15 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0338 Van Baalen (Rubens Schüler)] Eine heilige Familie; Maria mit dem Christkinde an der Brust; Johannes zur Linken mit der Siegesfahne, zur Rechten Joseph, und auf beyden Seiten Engel. Dieß Stück ist so gut wie von Rubens selbst. Auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 13 Zoll, breit 19 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 LZRCH 0065 Van Baien I Une fuite en Egypte, plusieurs anges y sont vus. I Mat.: auf Leinwand Maße: h. 30.1. 40 pouces Verkäufer: J F Rauch Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN1 0005 Baalen (van) I Diana mit Amor'η beschäftiget und Jagdnympfen umgeben. I Mat.: auf Kupfer Maße: 12 Zoll hoch, 17 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
1789/06/12 HBTEX 0027 Hindrick von Baalen I Johannes als Kind, mit dem Lamme und das Kreuz haltend. Vortreflich gemahlt, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Transakt.: Unbekannt (5.8 M)
Baien, Hendrik van (I) (und Brueghel, J. (I))
1791/09/21 FRAN 0016 Van Baalen I Ein kleines Stück von drei Figuren, so die Jungfrau mit dem Kinde Jesus in ihrem Schooße und eine Frau in der Anbetung vorstellet. I Transakt.: Verkauft (20 fl) Käufer: C Burger
1744/05/20 FRAN 0225 Van Baalem; Breugel I 2 Sehr feine und wohlgemachte Stück eines von Van Baalem & Breugel, das andere von Elsheimer. I Diese Nr.: 1 Sehr fein und wohlgemachtes Stück; Nr. 226 von A. Elsheimer Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 5 Zoll, Breite 8 Zoll Anm.: Die Lose 225 und 226 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt
1793/00/00 NGWID 0152 Heinrich van Baien I Ein Götter Banquett, von Heinrich van Baien. I Maße: 2 Schuh 4 Zoll hoch, 3 Schuh breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0345 Hinrich von Baien I Die Göttin Diana, in einer Landschaft mit sehr viel schönen Beywesen umgeben, von Hinrich von Baien. I Pendant zu Nr. 346 Maße: 1 Schuh 4 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 10 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0346 Hinrich von Baien I Zum Gegenstück, eine nicht minder schöne Landschaft, von nemlichen Inhalt und eben so schön ausgearbeitet, von obigem Meister [Hinrich von Baien] und Maaß. I Pendant zu Nr. 345 Maße: 1 Schuh 4 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 10 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0508 Heinrich von Baien I Die Zurückkunft der Diana, von der Jagd, im Gefolge ihrer Nymphen, indem eine, von einem Satyr verfolgt wird, und ein anderer ihn verhindert, seinen Plan auszuführen. Neben einem Baum liegt wohl gruppiertes 204
GEMÄLDE
1759/00/00 LZEBT 0112 Breugel; van Baalen I Eine Landschaft von Breugel und van Baalen auf Holtz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 2 Schuh 4 Zoll, Breite 2 Schuh 6 Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (200 Th Schätzung) 1763/01/19 FRJUN 0038 Van Baien; Breugel I La vierge avec l'Enfant Jesus bordee d'une Guirlande, trfes jolie piece, bien rangee & le tout parfaitement acheve. I Maße: hauteur 24 pouces, large 18 pouces Transakt.: Unbekannt (50 Vi fl) 1764/00/00 BLAN 0628 van Baelen; Brougel de felour I 1. sehr Capitales Gallerie gemählde stellet in natürlicher große, Venus und Cupido vor, in der ferne siehet man man den Vulcanus der waffen schmidet, die Früchte und bluhmen sind von Brougel de felour gemahlt. I Maße: 6 Fuß 3 Zoll hoch, 4 Fuß 8 Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (900 Rt Schätzung) Gegenw. Standort: Sankt-Peterburg, Rossiya. Ermitazh. (N 3256) als Hendrik van Baien
1768/07/00 MUAN 0051 Breughel; van Balem I [Ohne Titell I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
1784/08/02 FRNGL 0613 van Baalen; Breughell I Verschiedene Frauens=Personen, welche sich an einer Fontaine in einem Garten mit Baaden beschäftigen, von van Baalen & Breughell. I Maße: 23 Vi Zoll breit, 18 Zoll hoch Transakt.: Verkauft (27.15 fl) Käufer: Bäumer
1768/07/00 MUAN 0052 Breughel; van Balem I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
1785/05/17 MZAN 0781 Breughel; van Baien I Ein Blumenkranz, in dessen Mitte die Mutter Gottes mit dem Jesukind und der H. Joseph vorgestellet sind, auf Kupfer von Breughel, die Figuren von van Baien. [La S. Vierge avec l'enfant Jesus & S. Joseph representee au milieu d'une couronne de fleurs, les figures par van Baien, les fleurs par Breughel de velour.] I Pendant zu Nr. 782 Mat.: auf Kupfer Maße: 5 Vi Zoll hoch, 4 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (16 fl für die Nrn. 781 und 782) Käufer: Hofr ν Leykam
1768/07/00 MUAN 0053 Breughel; van Balem I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0054 Breughel; van Balem I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0890 Breughel; van Balem I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0056 Breughel; Van Baalen I Les Bains de Diane, avec le curieux Action dans un paysage. Peint sur cuivre. I Mat.: auf Kupfer Maße: 4. pouces de haut sur 7. pouces de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1778/09/28 FRAN 0245 van Baalen; Breughel I Ein sehr fleißig gemaltes Marienbild in einem schönen Blumenkranz, von van Baalen und Breughel. [Une S. Vierge tres bien peinte dans une belle couronne de fleurs, par van Baalen & Breughel.] I Maße: 1 Schuh 7 Zoll breit, 2 Schuh 1 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (60.30 fl) Käufer: Jos Brentano 1778/09/28 FRAN 0652 van Baalen; Breughell I Der Compagnon, ein Venusbad, von van Baalen, die Figuren und die Landschaft von Breughell. [Le pendant du precödent, un bain de Venus, les figures par van Baalen & le paysage par Breughell.] I Pendant zu Nr. 651 von Chr. Schütz (I) und G.M. Kraus Maße: 1 Schuh 4 Zoll breit, 10 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (70.30 fl) Käufer: Nothnagel 1778/10/30 HBKOS 0041 Breugel; Baalen I Venus und Diana in einem Gehölze, plaisant und fleißig gemahlt, auf Holz, von Breugel und Baalen. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0045 Van Bulen; Breughels de Velour I Alliance de Bacchus & de l'Amour. Bacchus est au milieu assis sur une tonne, le bras gauche eleve tenant un ver ä la main, comme pour marquer son triomphe, autour de lui plusieurs Personnages, comme Bacchantes portant des paniers de raisins, ä droite Venus assise & l'Amour ä ses pieds, lui tendant une main. Ce Tableau est peint sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: 14 pouces & 4 lignes, de large Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/07/18 FRAN 0055 Baalen; Brugell I Ein Marien=Bild im Blumenkranz auf Holz, von Baalen Brugell. I Mat.: auf Holz Maße: 2 Schuh hoch, 1 Schuh 6 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1782/01/28 LZAN 4151 Heinrich von Baalens; Joh. Breugel 14 Stück Landschaften, die 4 Elemente vorstellend. Sehr schön, schwarz und goldner Rahm, 1 Elle 7 Vi Zoll breit, 20 Zoll hoch, auf Holz. Die Figuren sind von Heinrich von Baalens, die Landschaft und das übrige von Joh. Breugel. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Elle 7 Vi Zoll breit, 20 Zoll hoch Verkäufer: Caroli Ferdinandi Hommelii Transakt.: Unbekannt
1785/05/17 MZAN 0782 Breughel; van Baien I Das Gegenbild, ein Früchtenkranz, in dessen Mitte Christus, wie er Magdalenen erscheint, vorgestellet ist, von eben denen beiden Meistern [Breughel und van Baien] auf Kupfer, und von eben der Höhe und Breite. [Le pendant, Jesus Christ apparoissant ä Madelaine represente au milieu d'une couronne de fruits par les meines Maitres [van Baien & Breughel de velour] sur cuivre, meme hauteur & largeur. I Pendant zu Nr. 781 Mat.: auf Kupfer Maße: 5 Vi Zoll hoch, 4 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (16 fl für die Nrn. 781 und 782) Käufer: Hofr ν Leykam 1785/05/17 MZAN 0798 Breughel; van Baien I Christus wie er Magdalenen als Gärtner erscheint, die Landschaft von Breughel, die Figuren von van Baien. [Jesus Christ en jardiner apparoissant ä Madelaine, le paysage par Breughel de velour, les figures par van Baien.] I Maße: 1 Schuh 8 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 5 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (26 fl) Käufer: Strecker 1786/10/18 HB TEX 0303 von Baalen; Breugel I Die heilige Familie, in einer Landschaft, von von Baalen ot [sie] Breugel. I Transakt.: Unbekannt 1788/06/12 HBRMS 0040 von Baalen; und Breugel I In einer angenehmen ländlichen Holzung sitzen im Vorgrunde Bacchus, Ceres und Venus mit Amor zur Linken, der dem Bacchus ein Trinkgefäß mit rothem Wein gereicht zu haben scheint. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 25 Zoll, breit 20 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1791/05/28 HBSDT 0121 Breughel; Henricus van Baalen I Dieses unschätzbare und gewiß eines der vorzüglichsten und fleißigsten Stücken dieses grossen Meisters, stellet einen dicken Wald vor; in der Mitte eine Oeffnung und zur Linken eine Aussicht über einer bergigten Gegend, welche von einen Fluß getheilt wird, an dessen Ufer man eine Menge Städte und Dorfe gewahr wird. - Im Vordergrunde ein kleines Gewässer. Dies Stück wird noch sehr verädelt durch die von H. van Baalen darin gemachte Staffage. Die Geschichte, wie die Latona dem Jupiter um Rache gegen die Bauren anflehet, der sie in Frösche verwandelt. In allen 15 Figuren mit Nebensachen. Kunst und Fleiß wetteifern gleichsam in diesem Stücke um die Wette. - Gemahlt auf Holz. In einen aparten Kasten. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Zoll, breit 23 % Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/09/13 FRAN 0018 Baalen; Breughel I Eine büssende Magdalena. I Maße: 8 Zoll hoch 10 Zoll breit Transakt.: Unbekannt (15 Viü) 1798/12/10 WNAN [0070] Van Baien; Breughls I Das erste stellt Diana vor, die nach geendigter Jagd ausruhet, neben und hinter ihr sind drey ihrer Gespielinnen, die theils ihre Jagdgeräthschaften, theils verschiedene erlegte Thiere tragen. Zwey Genien weiblichen Geschlechts, biethen der Göttinn aller Gattung Früchte dar - und im Hintergrunde sieht man noch einige ruhende und sich besprechende weibliche Figuren. Alles dieses ist in einer überaus angenehmen Landschaft vorgestellet. Die Figuren sind von Van Baien mit einer bewunderungswürdigen Wahrheit und Delicatesse gemahlt - und das vorkommende Gewilde nebst den Vögeln und Früchten sind auf GEMÄLDE
205
eine täuschende, ausserordentlich geistreiche und delicate Art behandelt. - Die Landschaft ist von Breughls, und in seiner besten Manier gemahlt, besonders schön sind in solcher die in dem Vorgrunde befindlichen Details von Gewächsen und Kräutern, die mit einer ausnehmenden Sorgfalt ausgeführet sind - die Zeichnung ist, ungeachtet man den niederländischen Geschmack daran nicht verkennet, edel und richtig, und die Färbung hat jenen freudigen Ton, der dieser Schule besonders eigen ist. I Anm.: Da dieses Los in diesem Katalog nicht numeriert ist, wurde die Nummer hinzugefügt. Verkäufer: Prof Adam Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0311 Paalen; Breughel I Fünf Stücke, das Paradies vorstellend. Die Figuren sind von Paalen, die Landschaft von Breughel. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Stück, das Paradies vorstellend Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 8 Zoll breit 2 Schuh 11 Zoll Anm.: Die Lose 311 bis 315 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0312 Paalen; Breughel I Fünf Stücke, das Paradies vorstellend. Die Figuren sind von Paalen, die Landschaft von Breughel. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Stück, das Paradies vorstellend Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 8 Zoll breit 2 Schuh 11 Zoll Anm.: Die Lose 311 bis 315 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0313 Paalen; Breughel I Fünf Stücke, das Paradies vorstellend. Die Figuren sind von Paalen, die Landschaft von Breughel. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Stück, das Paradies vorstellend Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 8 Zoll breit 2 Schuh 11 Zoll Anm.: Die Lose 311 bis 315 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0314 Paalen; Breughel I Fünf Stücke, das Paradies vorstellend. Die Figuren sind von Paalen, die Landschaft von Breughel. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Stück, das Paradies vorstellend Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 8 Zoll breit 2 Schuh 11 Zoll Anm.: Die Lose 311 bis 315 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0315 Paalen; Breughel I Fünf Stücke, das Paradies vorstellend. Die Figuren sind von Paalen, die Landschaft von Breughel. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Stück, das Paradies vorstellend Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 8 Zoll breit 2 Schuh 11 Zoll Anm.: Die Lose 311 bis 315 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Baien, Hendrik van (I) (und Francken oder Vrancx und Brueghel, P. (II)) 1785/05/17 MZAN 0506 van Baien; Franck; Hollenbreughel I Christus wie er die Altväter erlöset, zum Theil von van Baien, zum Theil von Franck und zum Theil vom sogenannten Hollenbreughel. [Jesus Christ delivrant les patriarches.] I Maße: 8 Vi Zoll hoch, 11 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Unverkauft Gegenw. Standort: Aschaffenburg, Deutschland. Bayerische Staatsgemäldesammlungen. (6408) (?) als Kopie nach J. Brueghel (I) und Rottenhammer
Baien, Hendrik van (I) (und Keirincx, Alex.) 1800/00/00 FRAN1 0058 Kierings (Alex.); van Baalen I Eine Landschaft, das Frühjahr vorstellend. Drei Amorn bringen der Göttin Flora Blumen. Die Figuren sind von van Baalen. Ein prächtiges Stück. I Mat.: auf Kupfer Maße: 19 Zoll hoch, 25 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Baien, Hendrik van (I) (und Kessel, J. (I)) 1794/09/10 HBGOV [A]0004 Hindrick van Baalen; Jean v. Kessel I Eine Frau mit ihrem Kinde. Von Hindrick van Baalen und 206
GEMÄLDE
Jean v. Kessel. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 6 Zoll, breit 5 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/02/17 HBPAK 0207 Van Baien; van Kessel I Eine Allegorie auf die vier Elemente. Sehr reich an Figuren und Thieren. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 27 Zoll, Breite 38 Zoll Transakt.: Verkauft (104 M) Käufer: Janssen 1799/00/00 LZRCH 0023 Van Baien; Van Kessel I Achilles reconnü parmis les femmes ä la cour de Nicomede, comp, de treize figures principales, et huit autres distribuees dans le fond: on remarque sur le devant aupres les diverses byoux [sic], qui servirent ä cette decouverte un singe et un chien; ce tableau nous pouvons Γ assurer, est de plus belles productions de ces deux maitres. I Mat.: auf Holz Maße: h. 17.1. 26 Ά pouces Verkäufer: J F Rauch Transakt.: Unbekannt
Baien, Hendrik van (I) (und Momper, J. (II)) 1785/05/17 MZAN 0025 Momper; Henrich van Baien I Christus, wie er vom Teufel in Versuchung geführet wird, die Landschaft von Momper, die Figuren von Henrich van Baien. [Jesus Christ tente par le Diable, le paysage par Momper, les figures par Henri van Baien.] I Maße: 1 Schuh 7 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 2 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (36 fl) Käufer: Rmus D Decanus L Β ä Fechenbach
Baien, Hendrik van (I) (und Neeffs, P. (I)) 1779/00/00 HB AN 0054 Peter Neefs; die Figuren von Baalen I Peter Neefs; die Figuren von Baalen. Aus dem entfernten Theile einer Kirche kömmt eine Proceßion und zieht zur Linken hinüber. Auf Holz. [Dans l'enfoncement d'une eglise on voit passer ä gauche une procession. Sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 3 Fuß hoch, 1 Fuß 9 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt
Baien, Hendrik van (I) (und Seghers, D.) 1785/05/17 MZAN 0240 Daniel Segers; van Baien I Ein Blumenkranz, in dessen Mitte die Mutter Gottes mit dem Jesukind von Daniel Segers, die Figuren von van Baien. [Une couronne de fleurs au Milieu de la quelle la S. Vierge avec l'enfant Jesus par Daniel Segers, les figures par van Baien.] I Maße: 2 Schuh 8 Zoll hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (130 fl) Käufer: Geistl Rath Rolandi Gegenw. Standort: Aschaffenburg, Deutschland. Bayerische Staatsgemäldesammlungen. (6305) (?)
Baien, Hendrik van (I) (und Seghers, G.) 1796/02/17 HBPAK 0004 v. Baien; Gerh. Segers I Ein Blumen=Kranz, in dessen Mitte die heilige Familie vorgestellt ist. Auf Holz. Die Figuren von v. Baien und die Blumen von Gerh. Segers. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 45 Zoll, Breite 51 Zoll Anm.: Der Künstler ist vermutlich Daniel Seghers und nicht Gerard Seghers. Transakt.: Verkauft (60 M) Käufer: Packi [für] D
Baien, Hendrik van (I) (und Uden, Lucas und Snyders, F.) 1778/09/28 FRAN 0673 Lucas van Uden; Snayers; van Baalen I Eine vortrefliche Diana mit etlichen Nymphen, vielen Hunden und Wildpret, die Landschaft von Lucas van Uden, das Wildpret von Snayers, und die Figuren von van Baalen. [Une excellente piece, τέpresentante Diane avec quelques Nymphes, beaueoup de chiens & de la venaison,le paysage par Lucas van Uden, la venaison par Snayers & les figures par van Baalen.] I Maße: 2 Schuh 8 Zoll breit,
1 Schuh 8 ιΛ Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (135 fl) Käufer: le Boux
und Liebhabern in diesem Fache sehr angenehm. I Maße: 3 Schuhe 2 Zoll hoch, 2 Schuhe 7 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (30 fl Schätzung)
Baien, Hendrik van (I) (Geschmack von)
1781/00/00 WZAN 0071 Antoni Palestra I Ein Stück 3 Schuhe, 3 Zoll hoch, 2 Schuhe, 5 Zoll breit von Antoni Palestra, die Geburt Christi vorstellend; man nimmt hier den venetianischen Gusto seines Lehrmeisters Anton Bellucci wahr; dieses Stücke ist wegen seiner gewissen Mischung und Auftragung der Colorit sehr viel Anton Allegri gleich, und die Komposition trefflich hier observiret. I Maße: 3 Schuhe 3 Zoll hoch, 2 Schuhe 5 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
1787/00/00 HB AN 0537 Von einem unbekannten Mahler. Im Geschmack von van Bahlen I Die heilige Familie, in einem Gebäude, durch welches man in eine Landschaft sieht. Ein Engel kömmt, und krönt die Maria, hinter welcher Joseph steht. A.H. [Auf Holz] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 26 Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Verkauft (3 M) Käufer: Cordes
Baien, Hendrik van (I) (Kopie nach) 1764/05/18 BOAN 0073 Peschay; Van Baien I Un dito [Tableau] d'un pied dix pouces de largeur & d'un pied cinq pouces de hauteur, peint par Peschay dans le gout de van Baien. [Ein stück Vorstellend die muttergottes Vielen Engelen nach van Baalen durch Beschay.] I Kopie von B. Beschey nach H. Baien (I) Maße: 1 pied 10 pouces de largeur & 1 pied 5 pouces de hauteur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (96 Rt) Käufer: Beckering 1793/00/00 NGWID 0454 Heinrich van Baien I Eine schattigte Landschaft in welcher eine schlafende Venus von einem Satyr umschlungen, und aus ihrer Ruhe gestöhrt wird, nach Heinrich van Baien. I Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 1 Vi Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1800/06/03 BLAN 0012 C. Kretschmer; nach v.d. Baalen I Die Großmuth des Scipio Africanus, mit Oel auf Leinwand in schwarzen Rahm mit vergoldetem Leistchen. I Kopie von J.C.H. Kretschmar nach H. Baien (I) Mat.: Öl auf Leinwand Maße: Höhe 31 Zoll, Breite 45 Zoll Transakt.: Verkauft (19 Rt) Käufer: Lesser 1800/06/03 BLAN 0016 L. Hoppe; nach v.d. Baalen I Esther und Ahasverus, mit Oel auf Leinwand mit brauner Holzleiste. I Kopie von L. Hoppe nach H. Baien (I) Mat.: Öl auf Leinwand Maße: Höhe 30 Zoll, Breite 44 Zoll Transakt.: Verkauft (9 Rt) Käufer: Schul tze
Baien, Hendrik van (I) (Manier) 1785/05/17 MZAN 1092 van Baien I Die Verkündigung Maria in der Manier des van Baien. [L'annonciation de la S. Vierge, dans le gout de van Baien.] I Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 10 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (10 fl) Käufer: Forstrath Keck
Balestra, Antonio 1776/00/00 WZTRU 0071 Antonius Palestra I Ein Stück 3 Schuhe, 3 Zoll hoch, 2 Schuhe, 5 Zoll breit von Antonius Palestra, vorstellend die Geburt Christi, man nimmt wahr hierin den venetianischen Gusto seines Lehrmeisters Anton Belucci, dieses Stücke ist wegen seiner gewiesen Mischung und Auftragung der Colorit sehr viel Antoni Allegri gleich, und ist treflich hierin die Composition Observiret. I Maße: 3 Schuhe 3 Zoll hoch, 2 Schuhe 5 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt. : Unbekannt (30 fl Schätzung) 1776/00/00 WZTRU 0076 Anton Balestra I Ein Stück, 3 Schuhe, 2 Zoll hoch, 2 Schuhe, 7 Zoll breit von Anton Balestra, stellet vor einen bey einem Tisch sitzend- und speisenden Mann, wo ein Faunus mit ihm zu sprechen scheinet, woselbsten drey Weiber und einige Kinder zu ersehen; in diesem Stücke ist ein großer Geschmack und sehr kräftige Färbung, er ließ seine Lichter hoch einfallen, und bemühete sich seine Gemähle durch starke Schatten reizend und vorzüglich zu machen, auch gab er seinen Farben durch rothlechten [sie] Schatten eine gewieße Harmonie, welche Kennnern
1781/00/00 WZAN 0076 Anton Balestra I Ein Stück 3 Schuhe, 2 Zoll hoch, 2 Schuhe, 7 Zoll breit von Anton Balestra, stellet einen bey einem Tische sitzenden und speißenden Mann vor, wo ein Faunus mit ihm zu sprechen scheint, und drey Weiber und einige Kinder zu sehen sind; in diesem Stücke ist ein großer Geschmack und eine sehr kräftige Färbung; er ließ seine Lichter hoch einfallen, und bemühte sich, seine Gemälde durch starke Schatten reizend und vorzüglich zu machen; auch gab er seinen Farben durch rothlichten Schatten eine gewisse Harmonie, welche Kennern und Liebhabern in diesem Fache sehr angenehm seyn wird. I Maße: 3 Schuhe 2 Zoll hoch, 2 Schuhe 7 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1789/00/00 MM AN 0242 Antonio Palestra I Zwei Stücke die Himmelfahrt Mariä und Auferstehung Christi vorstellend, auf Kupfer. [Deux pieces de la somption de Marie, et de la resurections de Iesus, sur cuivre.] I Mat.: auf Kupfer Maße: 6 Zoll hoch, 4 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0177 Ballestra I Das Scapullier Mariä, auf Leinwat, in einer metallisirten Ram. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 9 Zoll, Breite 1 Schuh 1 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0651 Ballestra I Maria mit dem Kinde, auf Leinwat. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh, Breite 1 Schuh 2 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
Balestra, Antonio (Kopie nach) 1788/09/01 KOAN 0808 Palestra I Abraham der sein Sohn Isaac opfert, nach Palestra. [Abraham qui sacrifie son fils Isaac, Selon Palestra.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Fuß 4 Zoll, Breite 1 Fuß 10 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0033 Balestro I Hercules bey der Venus, Cupido truckt den Bogen, auf Tuch sehr fein gemahlt nach Balestro. I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Schuh 4 Vi Zoll hoch, 3 Schuh Vi Zoll breit Anm.: Im Exemplar KH wurde der Name handschriftlich "nach Balestro" in "von Balestro" korrigiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0145 Palestra I Venus und Adones, Cupido stehet darneben mit dem Bogen und Pfeil in der Hand, nach Palestra. I Maße: 2 Schuh 3 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 10 Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt
Baltar [Nicht identifiziert] 1800/00/00+ LZRST [0006] Baltar I Eine italienische Landschaft, mit schönen Bäumen, einer reichen Feme, antiken Gebäuden auf einem Felsen, aus dem sich ein Quell stürtzt, nebst einem Schäfer, der auf der Flöte bläst, indess ihm zwey Schäferinnen zuhören, und verschiedenem Vieh. I Mat.: auf Leinwand Maße: 26 Zoll hoch 35 Zoll breit Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Rost Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0221 Baltar I Eine reiche Gegend, von vielen Bäumen beschattet, worunter Landleute sich nach einem Dorfe GEMÄLDE
207
begeben. Eine hölzerne Brücke über einen Bach, dessen helles Wasser die Bäume zurückscheinen läßt: vorne ein Jäger mit Hunden. Die Farbe durchsichtig, und die Art ganz nach der flämischen Schule. Auf Holz, goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 22 Zoll, breit 27 Zoll Transakt.: Unbekannt
mit einer Spindel. Von Nicolaus Bambini. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Weibsperson mit einer Spindel Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh 1 Zoll breit 2 Schuh 6 Zoll Anm.: Die Lose 508 und 509 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Balten, Pieter
Bamesbier, Hans
1785/05/17 MZAN 1022 van Balten I Ein Trommelschläger und ein Pfeifer von van Balten auf Kupfer. [Un homme battant le tambour, & un gargon jouant du fifre.] I Mat.: auf Kupfer Maße: 7 Vi Zoll hoch, 6 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt. : Verkauft (7 fl) Käufer: Schwanck
1750/10/15 HB AN 0003 Bamsbier (Hans) I Ein Stück von allerhand See=Fischen mit zwey Figuren, ohne Rahm. I Maße: 5 Fuß 5 Vi Zoll hoch, 6 Fuß 7 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Bambini, Nicolö 1783/08/01 LZRST 0039 Bambini I Eine Venus von Bambini, ein vortrefliches und meisterhaftes Bild, Venus sitzet nackend auf dem Vordergrunde leget sich mit dem linken Arm auf ein goldenes Gefäss; 2 Amors erzählen von einem linker Hand unter einem Baume schlafenden jungen Faune, bey welchem noch einer wachend sich befindet, das ganze Bild. Landschaft und Figuren sind gut colorirt und ist ausser einigen kleinen ausgebesserten Flecken ganz ohne Fehler, 1 Elle 16 Zoll hoch, 2 Elle 7 Zoll br. der Rahm ist gut vergoldet. I Maße: 1 Elle 16 Zoll hoch, 2 Elle 7 Zoll breit Transakt.: Verkauft (10 Th) Käufer: Zaar 1783/08/01 LZRST 0058 Bambini I Ein alter meisterhafter Mannskopf mit weissem Barte, vom Bambini, sehr gut erhalten, 1 Elle 3 Zoll hoch. 21 Zoll br. in Metallvergoldetem Rahm. I Maße: 1 Elle 3 Zoll hoch, 21 Zoll breit Transakt.: Verkauft (6 Th) Käufer: Otto 1799/00/00 WZAN 0308 Nicolaus Bambini I Zwey Stücke; auf einem eine Mannsperson, welche Fische feil hat, und Köchinnen dabey, die darum kaufen; auf dem andern eine Gesellschaft von Schiffsknechten, die mit Karten spielen; in dem Hintergründe Austern, und in der Ferne das Meer. Von Nicolaus Bambini. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Stück mit einer Mannsperson, welche Fische feil hat, und Köchinnen dabey, die darum kaufen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 4 Schuh 6 Zoll breit 6 Schuh 6 Zoll Anm.: Die Lose 308 und 309 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0309 Nicolaus Bambini I Zwey Stücke; auf einem eine Mannsperson, welche Fische feil hat, und Köchinnen dabey, die darum kaufen; auf dem andern eine Gesellschaft von Schiffsknechten, die mit Karten spielen; in dem Hintergrunde Austern, und in der Ferne das Meer. Von Nicolaus Bambini. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Stück mit einer Gesellschaft von Schiffsknechten, die mit Karten spielen; in dem Hintergrunde Austem, und in der Ferne das Meer Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 4 Schuh 6 Zoll breit 6 Schuh 6 Zoll Anm.: Die Lose 308 und 309 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0332 Nicolaus Bambini I Ein Mann mit einem Barte und einer Tabakspfeife im Munde, nebst einem lachenden Buben, der etwas schneidet, und einem Hunde, von Nicolaus Bambini. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh 1 Zoll breit 4 Schuh Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0508 Nicolaus Bambini I Zwey Stücke; eine Mannsperson mit einem Korbe voll Gemüße, und eine Weibsperson mit einer Spindel. Von Nicolaus Bambini. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Mannsperson mit einem Korbe voll Gemüße Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh 1 Zoll breit 2 Schuh 6 Zoll Anm.: Die Lose 508 und 509 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0509 Nicolaus Bambini I Zwey Stücke; eine Mannsperson mit einem Korbe voll Gemüße, und eine Weibsperson 208
GEMÄLDE
Bandinelli, Baccio 1785/05/17 MZAN 0534 Bartholomaus Bandinelli I Apollo und Hyacinth von Bartholomaus Bandinelli. [Apollon & Hyacinthe.] I Maße: 4 Schuh 1 Zoll hoch, 3 Schuh breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (19.30 fl) Käufer: R D ä Beyssel 1785/05/17 MZAN 0691 Bandinelli I Der betende H. Franziscus von Bandinelli. [S. Frangois Seraphique en prieres.] I Maße: 2 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 9 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (4.30 fl) Käufer: Dom vic Pingel
Bandinelli, Francesco (Francesco da Imola) 1785/05/17 MZAN 0539 Franciscus Bandinelli \ Ein allegorisches Stück die mütterliche Liebe vorstellend von Franciscus Bandinelli. [Une piece allegorique, qui represente l'amour matemelle.] I Maße: 3 Schuh 10 Zoll hoch, 4 Schuh 2 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Unverkauft
Barbieri, Paolo Antonio 1794/02/21 HB HEG 0054 Paulo. Ant. Barbieri de Cento \ Ein Hahn mit drey Hüner stehen vor einem Gartengehege. Lebhaft und stark gemahlt. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 29 Zoll, breit 39 Zoll Transakt. : Unbekannt
Barkhaus-Wieshütten, Charlotte (Veltheim) 1784/09/27 FRAN 0210 Charl de Veltheim I Eine nach der Natur gemahlte Anemonie vortrefflich von Charl de Veltheim 1752. [Une Anemone trfes bien peinte d'aprfes nature, par Charles de Veltheim 1752.] I Maße: 7 Vi Zoll hoch, 5 Zoll breit Inschr.: 1752 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Freyherr von Berberich Transakt.: Verkauft (1 fl) Käufer: Huth
Barocci, Federico 1750/10/15 HB AN 0004 Barozio I Wie Christus die Mutter GOttes gen Himmel führet, mit vielen Engeln umgeben, ohne Rahm. I Maße: 7 Fuß 8 Zoll hoch, 5 fuß 9 % Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1759/00/00 LZEBT 0069 Fried. Baroccio I Der Herr Christus der Maria im Garten sich zeigend auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 9 Zoll, Breite 2 Schuh 4 Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (60 Th Schätzung) 1763/01/17 HNAN 0056 Frederico Barroccio I L'Adoration des Mages, par Frederico Barroccio, sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hauteur 1 pied 7 pouces, Largeur 2 pieds 5 pouces Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt 1777/03/03 AUAN 0071 Barozzi I Eine St. Katharina auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 10 Vi Zoll, Breite 7 Vi Zoll Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt
1778/10/30 HBKOS 0013 L. Barotius I Die Liebe mit 3 Kindern vorgestellet, sehr lebhaft gemahlt, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 38 Zoll, breit 34 Zoll Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "L. Barotius", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0091 Barozio I Eine heilige Familie auf der Flucht nach Aegypten. Drey Engel schweben über ihnen in den Wolken. Auf Holz. [Fuite en Egypte. Trois anges dans les nues planent au-dessu de la Saint Familie. Sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 6 Zoll hoch, 1 Fuß 1 Vi Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1782/09/30 FRAN 0067 Friederico Barrozzio I Die Mutter Gottes mit dem Kind Jesu und der heiligen Anna von Friederico Barrozzio. [La S. Vierge avec l'enfant Jesus & S. Anne, par Fr6d6ric Barrozio.] I Maße: 4 Schuh 2 Zoll hoch, 2 Schuh 6 Vi Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (70 fl) Käufer: Will 1787/00/00 HB AN 0201 Frederico Barozio I Eine Ruhe auf der Flucht nach Egypten. Maria sitzt im Vordergrunde, und füllt mit einem kleinen Trinkgeschirr Wasser aus dem Bache, wobey sich eine kleine Bürde, ein Huth und ein Oelgefäß befindet. Zur Linken der Maria sitzt das kleine Christkindlein auf einem weißen Küssen, und langt mit vergnügter Miene nach Kirschen, welche der hintenstehende Joseph von einem neben sich befindenden Baume pflücket. Im Hintergrunde siehet man den gesattelten Esel. In der Ferne eine angenehme Landschaft. Die Composition in diesem Stücke ist sehr angenehm, die Zeichnung besonders regelmäßig und sorgfältig, die Haltung und Verbindung der Farben reizt das Auge des Kenners zur Bewunderung, auch verschafft der besondere Fleiß sowol in den Figuren, als in der Landschaft, den süßesten Anblick. A.K. [Auf Kupfer] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 16 Zoll, breit 11 % Zoll Transakt.: Verkauft (160 M) Käufer: Fesser 1787/00/00 HB AN 0729 Fredericus Barotzus Urbanus I Der Gruß Maria. Halbe Figuren, in einer Ovale gemahlt. A.H. [Auf Holz] I Mat.: auf Holz Format: oval Maße: Hoch 6 Zoll, breit 5 V* Zoll Transakt.: Verkauft (2 M) 1790/01/07 MUAN 1432 Frid. Baroccio I Maria mit dem Jesuskinde, und Joseph, auf Leinwat, in einer dergleichen [geschnittenen und metallisirten] Ram. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 3 Schuh 2 Zoll, Breite 2 Schuh 10 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/08/25 FRAN 0292 Fridrich Baroccio I Der Welt Heiland. I Maße: hoch 24 Zoll, breit 19 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (5.45 fl) Käufer: Β ν d Banckard 1793/00/00 NGWID 0009 Frederico Barozio I Eine Madonna mit dem Jesukindlein, welcher zur Seite eine noch etwas ältliche Figur steht, in Kniestück, von Frederico Barozio. I Maße: 4 Schuh 5 Zoll hoch, 3 Schuh 7 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN2 0148 Barochius (Fried.) I Die Abnehmung Christi vom Kreuz. Joseph von Arimathia und der heil. Johannes tragen den Leichnam Jesu auf einer Leinwand nach der Gruft zu. Vorne ist die heilige Magdalene kniend, und neben ihr eine männliche Figur, die den Sarg bereitet. Im Hintergrunde stehen die frommen Marien in größter Betrübniss. Dies bewundernswerthe Bild ist, außer dem daß es eines in seiner Größe sehr rares Stück von diesem Meister ist, vollkommen konservirt. I Mat.: auf Zederholz Maße: 19 Zoll hoch, 13 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Barocci, Federico (Kopie nach) 1788/09/01 KOAN 0477 Baroccio I Eine Abnehmung vom Kreuz nach Baroccio. [un ddtachement de la Croix, selon Barroccio.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 8 Zoll, Breite 1 Fuß 2 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt
1790/05/20 HBSCN 0106 Nach Barozzio I Eine Ruhe auf der Flucht nach Egypten. Ganze Figur, in einer plaisanten Landschaft vorgestellt. Von sehr sanften Colorit. Auf H[olz]. S.R.G.L. [Schwarzen Rahm, goldne Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 17 Zoll, breit 13 Zoll Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (8.4 M) Käufer: Schöen 1792/07/28 HBSCN 0067 Nach Barozzio I Eine Ruhe auf der Flucht nach Egypten. Ganze Figur, in einer plaisanten Landschaft vorgestellt. Von sehr sanften Colorit. Auf Holz, Schwarzer Rahm, mit goldnen Leisten I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 17 Zoll, breit 13 Zoll Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt
Barocci, Federico (zugeschrieben) 1799/00/00 WZAN 0049 Friederich Barozio I Die Diana, ein Bruststück, mit einem Hundskopfe, außen herum Arabesken, von einem alten italienischen großen Meister, vermuthlich von Friederich Barozio. Rund auf Holz. Sehr schön. I Mat.: auf Holz Format: rund Maße: hoch 2 Schuh 7 Zoll breit 2 Schuh 7 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Barpod [Nicht identifiziert] 1800/00/00 BLBOE 0110 Barpod I Ein Blumenstück. I Mat.: auf Leinwand Transakt.: Unbekannt
Bartels [Nicht identißziert] 1784/08/13 HBDEN 0060 Bartels I Ganz vortrefliche Blumen in einem Caraffin stehend. Gemahlt auf Glas von Bartels. [NB. Von No. 54 bis 95 sind diese Gemähide fast alle in sein vergoldete Rahmen, nur Wenige sind im Holz gebeitzte.] I Mat.: auf Glas Maße: Hoch 30 Zoll. Breit 23 Zoll. Anm.: Die Angaben in eckigen Klammem im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 95 und beziehen sich auf die Nrn. 54 bis 95. Verkäufer: Pasche [oder] Flügge Transakt.: Verkauft (21.8 M) Käufer: Möller 1784/08/13 HBDEN 0087 Bartels I Zwey nach dem Leben gemahlte Blumenstücke. Sehr natürlich dargestellt von Bartels. [NB. Von No. 54 bis 95 sind diese Gemähide fast alle in sein vergoldete Rahmen, nur Wenige sind im Holz gebeitzte.] I Diese Nr.: Ein nach dem Leben gemahltes Blumenstück Maße: Hoch 20 Vi Zoll. Breit 17 Vi Zoll. Anm.: Die Lose 87 und 88 wurden zusammen katalogisiert. Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 95 und beziehen sich auf die Nrn. 54 bis 95. Verkäufer: Pasche [oder] Flügge Transakt.: Verkauft (7.8 M) Käufer: Τ 1784/08/13 HBDEN 0088 Bartels I Zwey nach dem Leben gemahlte Blumenstücke. Sehr natürlich dargestellt von Bartels. [NB. Von No. 54 bis 95 sind diese Gemähide fast alle in sein vergoldete Rahmen, nur Wenige sind im Holz gebeitzte.] I Diese Nr.: Ein nach dem Leben gemahltes Blumenstück Maße: Hoch 20 Vi Zoll. Breit 17 Vi Zoll. Anm.: Die Lose 87 und 88 wurden zusammen katalogisiert. Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 95 und beziehen sich auf die Nrn. 54 bis 95. Verkäufer: Pasche [oder] Flügge Transakt.: Verkauft (7.8 M) Käufer: Τ 1784/08/13 HBDEN 0089 Bartels I Dergleichen [nach dem Leben gemahlte] Gebinde von Blumen, von nemlichen Bartels, auf hellgrauem Grunde. [NB. Von No. 54 bis 95 sind diese Gemähide fast alle in sein vergoldete Rahmen, nur Wenige sind im Holz gebeitzte.] I Diese Nr.: Ein Gebinde von Blumen Maße: Hoch 15 Zoll. Breit 17 Vi Zoll. Anm.: Die Lose 89 und 90 wurden zusammen katalogisiert. Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 95 und beziehen sich auf die Nrn. 54 bis 95. Verkäufer: Pasche [oder] Flügge Transakt.: Verkauft (3 M) Käufer: L GEMÄLDE
209
1784/08/13 HBDEN 0090 Bartels I Dergleichen [nach dem Leben gemahlte] Gebinde von Blumen, von nemlichen Bartels, auf hellgrauem Grunde. [NB. Von No. 54 bis 95 sind diese Gemähide fast alle in sein vergoldete Rahmen, nur Wenige sind im Holz gebeitzte.] I Diese Nr.: Ein Gebinde von Blumen Maße: Hoch 15 Zoll. Breit 17 Vi Zoll. Anm.: Die Lose 89 und 90 wurden zusammen katalogisiert. Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 95 und beziehen sich auf die Nrn. 54 bis 95. Verkäufer: Pasche [oder] Flügge Transakt.: Verkauft (3 M) Käufer: L
Haut 2. p. 1. pou. large 2. p. 7. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt
Barth
1752/05/08 LZAN 0092 Bassano I Christi Geburth ein Italiänisches Original-Stück von Bassano auf Schiefer gemahlt, 1 Vi Elle hoch 1 Vi Elle breit im vergoldeten Rahmen. I Mat.: auf Schiefer Maße: 1 Vi Elle hoch, 1 Vi Elle breit Transakt.: Verkauft (22 Th) Käufer: A [?]
1793/00/00 NGWID 0237 Barth I Ein Kober mit Seekrebsen und kleinen Fischen, von Barth. I Maße: 2 Schuh 1 Zoll hoch, 1 Schuh 7 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
Barthlome (de Saarbrughen) [Nicht identifiziert] 1772/00/00 BSFRE 0004 Barthlome (de Saarbrughen) I Le Portrait d'une vieille Femme, tenant un Livre en main. I Mat.: auf Leinwand Maße: haut de 24, & large de 19 14 pouces Transakt.: Unbekannt
Basea, Pirot [Nicht identifiziert] 1777/05/26 FRAN 0206 Pirot Basea I Architectur=Stück von Pirot Basea. I Verkäufer: Finsterwalder Transakt.: Verkauft (16.30 fl) Käufer: Ettling
Basincio [Nicht identifiziert]
1742/08/30 BOAN 0383 Bassans I Nativite de J.C. par Bassans. I Maße: Haut 3. p. 4. pou., large 3. p. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1752/00/00 NGWOL 0060 Pasano I Die Jünger zu Emaus mit Christo speisend in einem Kuchenstücke von Pasano. I discepoli d'Emaus, che stanno a mensa con Cristo. Pezzo di notte del Passano. I Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (16 Th)
1759/00/00 LZEBT 0147 Bassano I Die Firmung eines jungen Frauen Zimmers auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh, Breite 1 Schuh 4 Vi Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (100 Th Schätzung) 1759/00/00 LZEBT 0154 Bassano I Die Geisslung und Verspottung Christi auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 1 Schuh 5 Zoll, Breite 1 Schuh Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (100 Th Schätzung) 1759/00/00 LZEBT 0204 Bassano I Eine Landschaft mit Persohnen, Pferde und Vieh auf Holtz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 2 Schuh 2 Zoll, Breite 1 Schuh 9 Vi Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (100 Th Schätzung) 1763/01/19 FRJUN 0124 Bassano I Une Adoration de Bergers tres bien peinte. I Maße: hauteur 56 pouces, large 39 pouces Transakt.: Unbekannt (26.15 fl)
1778/04/11 HBBMN 0002 Basincio I Ein Blumen=Stück, mit einer Wasser=Melone und einem Caninchen. I Transakt.: Verkauft (11M) Käufer: Wolters
1764/03/12 FRKAL 0002 Bassano I La flagellation de Jesus Christ, tableau de plusieurs figures & parfaitement peint. I Maße: hauteur 12 pouces, largeur 17 pouces Transakt.: Verkauft (15.30 fl) Käufer: Kaller
Bassano
1764/08/25 FRAN 0356 Bassano I Une vierge avec Γ enfant Jesus. I Maße: haut 2 pieds 2 pouces sur 1 pied 11 pouces de large Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt
1716/00/00 FRHDR 0108 Pasan I Von Pasan eine Venus / wo ein jeder s. v. ein Licht anzündet. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (45) 1723/00/00 PRAN [A]0097 Bassano I Grablegung Christi / vom Bassano. I Maße: Höhe 2 Schuh 2 Zoll, Breite 1 Vi Schuh 2 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1725/01/24 BOAN [0001] Bassano I Die Geburt Christi von Bassano. I Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Joseph Clemens Transakt.: Unbekannt 1740/00/00 AUAN 0024 Bassan I 2. Stuck vom Bassan, eine Schmidte und die Arch Noä vorstellend. I Maße: 4. Schuh / 5. Zoll hoch / 5. Schuh / 9. Zoll breit Transakt.: Unbekannt (500 fl) 1742/08/01 BOAN 0109 Bassans I Christus als ein Gärtner begegnet der Magdalenas. Original von Bassans. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0116 Bassans I Ein klein Magdalen® Stuck mit einem Crucifix in der Hand von Bassans. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt
1770/10/29 FRAN 0178 Bassano I Noa schlafend und seine Söhne wie sie ihn zudecken. I Maße: Hoch 94 Zoll. Breit 96 Zoll. Transakt.: Unbekannt 1774/08/13 HBBMN 0143 Bassano I Wie die Engel den Hirten erscheinen. I Transakt.: Unbekannt 1775/00/00 BLAN 0048 Bassano I Eine Jagd in golden Rahm. I Verkäufer: George Friedrich Schmidt Transakt.: Unbekannt 1777/02/21 HBHRN 0099 Bassano I Die Geburt Christi. I Maße: Höhe 2 Fuß 11 Zoll, Breite 2 Fuß 5 Zoll Transakt.: Unbekannt 1777/05/26 FRAN 0079 Bassano I Kindermord. I Verkäufer: Finsterwalder Transakt.: Verkauft (9.30 fl) Käufer: Cotrel 1777/05/26 FRAN 0084[a] Bassano I 2 Stück, das erste die Geburt Christi von Bassano, das andere Jacob Meyer von Schönfeld. I Diese Nr.: Die Geburt Christi; Nr. 84[b] von Schönfeld Verkäufer: Finsterwalder Transakt.: Verkauft (8.30 fl) Käufer: Morgenstern 1777/05/26 FRAN 0195 Bassano I Kirchenbrand. I Verkäufer: Finsterwalder Transakt.: Verkauft (4.16 fl) Käufer: Hofrath Gerken
1742/08/01 BOAN 0462 Bassans I Ein Original von Bassans. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt
1778/04/11 HBBMN 0071 Bassano I Die Geburt Christi. I Transakt.: Verkauft (24 Sch) Käufer: Wolters
1742/08/01 BOAN 0463 Bassans I Noch ein Stuck die Geburth Christi praesentirend von Bassans. Orig. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt
1779/04/12 GAAN 0040 Passano I Eine Wirtschaft von Passano. I Maße: 10 Vi Zoll hoch, 15 Vi Zoll breit Verkäufer: Schöber Transakt.: Unbekannt
1742/08/30 BOAN 0028 Bassan I Jesus Christ sous la forme d'un Jardinier, apparoissant ä la Madeleine, par Bassan. I Maße:
1779/09/27 FRNGL 0017 Bassano I Eine Geschichte aus dem Neuen Testament, die Herberge der Jünger nach Emaus mit Christo
210
GEMÄLDE
dem HErrn. [Jesus-Christ allant avec ses disciples ä Emails.] I Maße: 11 Zoll hoch, 1 Schuh 3 Zoll breit Transakt.: Verkauft (3.28 fl) Käufer: Mentzinger 1782/03/18 HBTEX 0133 Basano I Eine Garten=Frucht Verkäufferin, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 40 Zoll 3 Linien, Breite 64 Zoll 5 Linien Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/05/29 FRFAY 0114 Bassano I Ein Viehestück. I Maße: 14 Zoll hoch, 17 Zoll breit Verkäufer: Kaspar Thorhorst Transakt.: Unbekannt (6.4 fl) 1782/09/30 FRAN 0439 Bassano I Natürlich abgebildete Hunde. [Des chiens peints d'aprfes nature, par Bassano.] I Maße: 2 Schuh 5 Zoll hoch, 2 Schuh 11 Vi Zoll breit Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (15.30 fl) Käufer: Prinz ν D[essau] Gegenw. Standort: Dessau, Deutschland. Anhaltische Gemäldegalerie. (645) als Jacopo Bassano 1783/08/01 LZRST 0014 Bassano I Eine sehr grosse Landschaft von Bassano im heroischen Styl, auf dem Vordergrunde links zwo schöne sitzende Figuren Merkur und ein sitzender Mann, welchen ersterer um sein Vieh zu betrügen sucht, und dieses auch seitwärts nach dem Mittelgrunde zutreiben lässt, rechts auf dem Mittelgrunde ein Tempel auf einen Hügel, 1 Elle 8 Zoll hoch 2 eilen 2 Zoll lang, in gut verg. Rahmen. I Pendant zu Nr. 15 Maße: 1 Elle 8 Zoll hoch, 2 Ellen 2 Zoll lang Transakt.: Verkauft (1.10 Th) Käufer: Buchs 1783/08/01 LZRST 0015 Bassano I Eine heroische Landschaft ebenfalls von Bassano, auf dem Vordergrunde besieht sich der in sich selbst verliebte Jäger Narcissus in einem Brunnen, neben ihm sein Bogen, Köcher und einige Hunde, links eine waldigte Gegend und Berge, im Mittelgrunde einige Ruinen, sie ist das Gegenbild von voriger [Nr. 14], hält gleiches Maass, und hat gleichen [gut verg.] Rahm. Beide sind wohlerhalten. I Pendant zu Nr. 14 Maße: 1 Elle 8 Zoll hoch, 2 Ellen 2 Zoll lang Transakt.: Verkauft (1.8 Th) Käufer: Buchs 1783/08/01 LZRST 0050 Bassano I Ein vor einem Crucifix andächtiger Jesuite, von Bassano, ein wohlerhaltenes Bild, 1 Elle 14 Zoll hoch und 1 Elle 5 Zoll br. vergoldeten Rahm. I Maße: 1 Elle 14 Zoll hoch, 1 Elle 5 Zoll breit Transakt.: Verkauft (12 Gr) Käufer: Buchs 1785/05/17 MZAN 0547 Da Ponte bassano I Das Begräbniß Christi von Da Ponte bassano auf Stein. [Jesus Christ mis au tombeau.] I Mat.: auf Stein Maße: 4 Zoll hoch, 4 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (3 fl) Käufer: Rmus Dmus Decanus L Β ä Fechenbach 1785/05/17 MZAN 0566 Da Ponte bassano I Christns [sie] am Oelberg von Da Ponte bassano. [Jesus Christ au mont Olivet.] I Maße: 2 Schuh 7 Zoll hoch, 3 Schuh 5 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (9 fl) Käufer: Hofr Mulzer 1785/05/17 MZAN 0618 Da Ponte bassano I Ein Bauer mit einem Krug in der einen, und dem Deckel in der andern Hand von Da Ponte bassano. [Un paysan tenant une cruche dans l'une main, & le couvercle dans l'autre.] I Maße: 3 Schuh 11 Zoll hoch, 2 Schuh 10 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (5.30 fl) Käufer: Winterstein 1785/05/17 MZAN 0711 Bassano I Esau der sein Erstgeburtrecht verkauft, ein Nachtstück von Bassano. [Esau vendant son droit d'ainesse, une nuit.] I Maße: 1 Schuh 3 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 5 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (3.30 fl) Käufer: Schwanck 1785/05/17 MZAN 0749 Bassano I Eine Zauberergesellschaft die Zauberey treibt. [Des sorciers occup^s ä exercer la magie.] I Maße: 2 Schuh hoch, 2 Schuh 7 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (10.30 fl) Käufer: Schwanck
1785/05/17 MZAN 0750 Bassano I Das Begräbniß Christi von eben demselben [Bassano], [Jesus Christ mis au tombeau par le meme [Du Pont le bassan].] I Maße: 2 Schuh 4 Zoll hoch, 3 Schuh 8 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (2 fl) Käufer: Schwanck 1785/05/17 MZAN 1114 Bassano I Christus mit seinen Jüngern zu Emaus von Bassano. [Jesus Christ & ses disciples Emaus.] I Maße: 2 Schuh 10 Vi Zoll hoch, 4 Schuh breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (5.30 fl) Käufer: Winterstein 1786/04/21 HBTEX 0001 Bassano I Die Creuzigung Christi, mit den beyden Schächem; unten im Vordergrunde die leidtragende Familie, mit Krieges=Knechten. Eine Original=Mahlerey von Bassano. I Transakt.: Unbekannt 1786/04/21 HBTEX 0050 Bessano I Eine Landschaft mit Figuren beym Feuer. I Transakt.: Unbekannt 1788/01/15 LZRST 3933 Ponte Passano I Eine Madonna mit dem Kinde Jesus, scheint von Ponte Passano zu seyn, auf Holz, 24 Zoll hoch, 19 Zoll breit, in verg. Rahmen. I Mat.: auf Holz Maße: 24 Zoll hoch, 19 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (4.16 Th) Käufer: Fried 1789/01/19 LZRST 3927 Ponte Bassano I Eine Madonna mit dem Kinde Jesus, von Ponte Bassano, auf Holz gemahlt. 24 Z. hoch 19 Z. br. in vergoldeten Rahm. R. I Mat.: auf Holz Maße: 24 Zoll hoch, 19 Zoll breit Verkäufer: R[ost] Transakt.: Verkauft (1.16 Th) Käufer: Keil 1790/07/28 ZHWDR 0031 Baßano I [Ohne Titel] I Annotat.: Auf einen Gang, oder in ein Vorzimmer, in kein Kabinet - könnte allenfalls 10 NLd'or angesetzt seyn. (LAVATER) Transakt.: Unbekannt 1790/08/25 FRAN 0232 Bassano I Die Geburt Christi. I Maße: hoch 60 Zoll, breit 56 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (6 fl) Käufer: Kaller 1790/10/18 LZRST 1858 Pont. Passano I Die Auferweckung des Iünglins zu Nain, ein Capitalbild mit vielen Figuren, von grosser Composition, scheint von Pont. Passano zu seyn. I Maße: 53 Zoll hoch, 76 Zoll breit Transakt.: Unbekannt (12.12 Rt) 1791/05/30 FRAN 0185 Bassano I Die Anbetung der Hirten, Ein Meisterhaftes Stück. I Maße: 4 Schuh 4 Zoll hoch und 3 Schuh breit Verkäufer: Bansa Transakt.: Verkauft (3) Käufer: Chamot 1791/09/21 FRAN 0079 Bassan I Eine Anbetung der Schäfer, ein Stück von 7 Figuren. I Transakt.: Verkauft (100 fl) Käufer: Artaria von Wien 1791/09/21 FRAN 0085 Bassan I Eine Weinlese mit vielen Umständen, so damit verknüpft sind, gezieret. I Pendant zu Nr. 86 Transakt.: Verkauft (6 fl) Käufer: Levy 1791/09/21 FRAN 0086 Bassan I Der Compagnon von eben demselben [Bassan]. Ein Hünerhof, verschiedene zahme Thiere und Bauern, so mit Trinken beschäftiget sind; die Entfernung stellet eine bergigte Landschaft vor. I Pendant zu Nr. 85 Transakt.: Verkauft (6 fl) Käufer: Levy 1792/02/01 LZRST 4816 Ponte Bassano I Die Auferweckung des Jünglings zu Nain, ein vortrefliches Bild mit vielen Figuren, scheint von Ponte Bassano zu seyn, 53 Zoll hoch, 76 Zoll breit, ohne Rahm. I Maße: 53 Zoll hoch, 76 Zoll breit Transakt.: Verkauft oder Unverkauft (46 Th) Käufer: R[ost] 1793/00/00 NGWID 0205 Bassano I Die drey Weisen aus Morgenland, wie selbige dem Kind Jesu die Verehrung bringen, von Bassano. I Maße: 1 Schuh 2 Zoll hoch, 1 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0050 Bassano I Die Historie vom reichen Mann und den armen Lazarus. Im Vordergrunde eine Menge beGEMÄLDE
211
schäftigte Köchinnen, und vielen Nebensachen, von einen der Bassano's. I Maße: Hoch 17 Zoll, breit 22 Zoll Transakt.: Unbekannt 1794/09/00 LGAN 0004 Baßano I Die Anbetung der Hirten von Baßano, auf Kupfer, in einer verguldten Rahme. I Mat.: auf Kupfer Maße: breit 1 Schuh 10 Vi Zoll, hoch 2 Schuh 8 Zoll Verkäufer: [Friedrich Karl Ludwig, Freiherr von Moser] Transakt.: Unbekannt (1000 rh fl Schätzung) 1797/04/25 HBPAK 0030 Bassan I Das Innere einer Küche, die Köchin steht beym Feuer und bereitet Essen, eine andere Magd scheuert und unterhält sich mit jemanden, noch andere Persohnen sind mit essen oder trinken beschäfftiget; alle in Lebensgröße. Auf Leinw. schwarzen Rahm goldene Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 25 Zoll, breit 34 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0156 Bassano I Eine vor einem Crucifix knieende betende Nonne, sehr gut gemahlt. Auf Leinw., goldenen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 33 Zoll, breit 25 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/06/13 HBPAK 0027 Bassano I Eine Köchin bereitet Essen in der Küche. Im Hintergrunde sitzen verschiedene am Tisch und speisen. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 46 Zoll, breit 35 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/08/10 MMAN O l l i Bassano I Die Arche Noä von Bassano, auf Tuch. I Mat.: auf Leinwand Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (10 fl Schätzung) 1797/08/10 MMAN 0288 Bassano I Eine Herde und der Hirth von Bassano, auf Tuch. I Mat.: auf Leinwand Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (8 fl Schätzung) 1798/01/19 HBPAK 0023 Da Ponte, genannt Bassano I Zwey Gesellschafts=Stücke mit italiänischen Bauern. Die Figuren sind 2 Fuß hoch; richtig und mit sprechenden Ausdruck gezeichnet. Das eine stellt ein belustigendes Spiel, das andere eine Mahlzeit vor, bey welcher ein Mann den Dudelsack bläst; diese Figur ist vorzüglich schön. 2 Fuß 5 Zoll hoch, 3 Fuß breit. Vergold. Rahm. I Diese Nr.: Ein Gesellschafts=Stück mit italiänischen Bauern Maße: 2 Fuß 5 Zoll hoch, 3 Fuß breit Anm.: Die Lose 23 und 24 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/01/19 HBPAK 0024 Da Ponte, genannt Bassano I Zwey Gesellschafts=Stücke mit italiänischen Bauern. Die Figuren sind 2 Fuß hoch; richtig und mit sprechenden Ausdruck gezeichnet. Das eine stellt ein belustigendes Spiel, das andere eine Mahlzeit vor, bey welcher ein Mann den Dudelsack bläst; diese Figur ist vorzüglich schön. 2 Fuß 5 Zoll hoch, 3 Fuß breit. Vergold. Rahm. I Diese Nr.: Ein Gesellschafts=Stück mit italiänischen Bauern Maße: 2 Fuß 5 Zoll hoch, 3 Fuß breit Anm.: Die Lose 23 und 24 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/01/19 HBPAK 0071 Bassano I Vier biblische Geschichten. a) Kain und Abel, b) Lazarus, c) Isaak der den Jacob segnet, d) Tobias der seinen Vater sehend macht. Von gleicher Grösse. I Diese Nr.: Kain und Abel Maße: 9 Zoll hoch, 1 Fuß breit Anm.: Die Lose 71 bis 74 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/01/19 HBPAK 0072 Bassano I Vier biblische Geschichten. a) Kain und Abel, b) Lazarus, c) Isaak der den Jacob segnet, d) Tobias der seinen Vater sehend macht. Von gleicher Grösse. I Diese Nr.: Lazarus Maße: 9 Zoll hoch, 1 Fuß breit Anm.: Die Lose 71 bis 74 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/01/19 HBPAK 0073 Bassano I Vier biblische Geschichten. a) Kain und Abel, b) Lazarus, c) Isaak der den Jacob segnet, d) Tobias der seinen Vater sehend macht. Von gleicher Grösse. I Diese Nr.: Isaak der den Jacob segnet Maße: 9 Zoll hoch, 1 Fuß breit Anm.: Die Lose 71 bis 74 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/01/19 HBPAK 0074 Bassano I Vier biblische Geschichten. a) Kain und Abel, b) Lazarus, c) Isaak der den Jacob segnet, d) 212
GEMÄLDE
Tobias der seinen Vater sehend macht. Von gleicher Grösse. I Diese Nr.: Tobias der seinen Vater sehend macht Maße: 9 Zoll hoch, 1 Fuß breit Anm.: Die Lose 71 bis 74 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/08/10 HBPAK 0036 Bassan I Zwey perspectivische inwendige Kirchen mit Figuren. Alles ganz auf das schönste ordinirt, und kräftig gemahlt. Diese Stücke können über Thüren als Trümors emploirt werden. Auf Leinwand, im goldnen Rahm. I Diese Nr.: Eine perspectivische inwendige Kirche mit Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 32 Zoll, breit 46 Zoll Anm.: Die Lose 36 und 37 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/08/10 HBPAK 0037 Bassan I Zwey perspectivische inwendige Kirchen mit Figuren. Alles ganz auf das schönste ordinirt, und kräftig gemahlt. Diese Stücke können über Thüren als Trümors emploirt werden. Auf Leinwand, im goldnen Rahm. I Diese Nr.: Eine perspectivische inwendige Kirche mit Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 32 Zoll, breit 46 Zoll Anm.: Die Lose 36 und 37 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/11/14 HBPAK 0151 Da Ponte, genannt Bassano I Zwey Gesellschaftsstücke mit italiänischen Bauern. Die Figuren sind 2 Fuß hoch, richtig, und mit sprechenden Ausdrücken gezeichnet. Das Eine stellt ein Blindekuh Spiel vor, und das Andere, eine Mahlzeit, bey welcher ein Mann auf dem Dudelsacke bläßt. Auf Leinwand, in 2 vergoldten Rähmen. I Diese Nr.: Ein Gesellschaftsstück mit italiänischen Bauern. Es stellt ein Blindekuh Spiel vor Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 35 Zoll, breit 43 Zoll Anm.: Die Lose 151 und 152 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/11/14 HBPAK 0152 Da Ponte, genannt Bassano I Zwey Gesellschaftsstücke mit italiänischen Bauern. Die Figuren sind 2 Fuß hoch, richtig, und mit sprechenden Ausdrücken gezeichnet. Das Eine stellt ein Blindekuh Spiel vor, und das Andere, eine Mahlzeit, bey welcher ein Mann auf dem Dudelsacke bläßt. Auf Leinwand, in 2 vergoldten Rähmen. I Diese Nr.: Ein Gesellschaftsstück mit italiänischen Bauern. Eine Mahlzeit, bey welcher ein Mann auf dem Dudelsacke bläßt Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 35 Zoll, breit 43 Zoll Anm..· Die Lose 151 und 152 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 LZAN 0145 Bassan I Une nuit; d'un effet tres Sombre I Transakt.: Unbekannt (8 Louis Schätzung) 1799/00/00 LZRCH 0008 Bassano I Une composition variee, et tres pitoresque, avec beaucoup de figures. I Mat.: auf Leinwand Maße: h. 38.1. 50. pouces Verkäufer: J F Rauch Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 LZRCH 0091 Bassano I Un forgeron. I Mat.: auf Leinwand Maße: h. 18.1. 21. pouces Verkäufer: J F Rauch Transakt.: Unbekannt 1799/10/10 HBPAK 0041 Bassano I Ein Viehstück. Auf Leinwand, schw. und goldn. Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 40 Zoll, breit 49 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0103 Bassana I Eine biblische Historie. Christus und Maria in dem Hause der Magdalena. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 31 Zoll, breit 45 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/12/23 WNAN 0028 Bassano I L'adoration des Bergers par Bassano sur Bois. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 BLBOE 0005 Bassano I Die Hirten stehen bei der Krippe und beten das Kind Jesu an, welches ihnen Maria zeigt. Joseph steht im Hintergrunde. I Mat.: auf Leinwand Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN1 0007 Bassan I 4 kleine sehr artige Stück die vier Jahrszeiten vorstellen. I Diese Nr.: Ein kleines sehr artiges Stück, eine der vier Jahrszeiten vorstellend Mat.: auf Kupfer Maße: 9 Vi Zoll hoch, 11 Zoll breit Anm.: Die Lose 7 bis 10 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1800/00/00 FRAN1 0008 Bassan I 4 kleine sehr artige Stück die vier Jahrszeiten vorstellen. I Diese Nr.: Ein kleines sehr artiges Stück, eine der vier Jahrszeiten vorstellend Mat.: auf Kupfer Maße: 9 Vi Zoll hoch, 11 Zoll breit Anm.: Die Lose 7 bis 10 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN1 0009 Bassan I 4 kleine sehr artige Stück die vier Jahrszeiten vorstellen. I Diese Nr.: Ein kleines sehr artiges Stück, eine der vier Jahrszeiten vorstellend Mat.: auf Kupfer Maße: 9 Vi Zoll hoch, 11 Zoll breit Anm.: Die Lose 7 bis 10 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN1 0010 Bassan I 4 kleine sehr artige Stück die vier Jahrszeiten vorstellen. I Diese Nr.: Ein kleines sehr artiges Stück, eine der vier Jahrszeiten vorstellend Mat.: auf Kupfer Maße: 9 Vi Zoll hoch, 11 Zoll breit Anm.: Die Lose 7 bis 10 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0268 Bassana I Ein Stück; die Weinkelter [sie] vorstellend. I Transakt.: Unbekannt
Bassano (Geschmack von) 1779/03/05 HBRMS 0019 Bassano I Die Anbetung der Hirten, in dem Gusto von Bassano. I Transakt.: Unbekannt 1797/08/10 MMAN 0168 Bassano I Ein Gemälde in Bassanos Geschmack, sehr beschädigt, mit Rahmen. I Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Verkauft (6.10 fl)
Bassano (Kopie nach) 1723/00/00 PRAN [A]0143 Teniers; Bassano I Moses schlagt mit dem Stab Wasser / vom Teniers=Bassano. I Kopie von Teniers nach Bassano Maße: Höhe 3 Schuh 5 Zoll, Breite 4 Vi Schuh Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0349 Bassans I Deux Tableaux d'aprfes Bassans. Couple. I Maße: Hauts 2. pieds 10. pou., larges 3. pieds 6. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1766/07/28 KOSTE 0039 Bassano I Ein stück auf leinwand nach Bassano. I Mat.: auf Leinwand Transakt.: Unbekannt (6 Rt) 1768/05/02 KOAN 0030 Bassano I Eine Grablegung Christi; nach Bassano auf Holz gemahlt; mit verg. Ramen. I Mat.: auf Holz Verkäufer: Joannes Petrus Süssmilch Transakt.: Unbekannt 1781/05/07 FRHUS 0130 van der Blom; Bassano I Die vier Jahrszeiten von van der Blom nach Bassano. I Diese Nr.: Eine der vier Jahrszeiten; Kopie von Blom nach Bassano Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch und 2 Schuh 7 Zoll breit Anm.: Die Lose 130 bis 133 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (50 fl für die Nrn. 130-133) Käufer: Heusser 1781/05/07 FRHUS 0131 van der Blom; Bassano I Die vier Jahrszeiten von van der Blom nach Bassano. I Diese Nr.: Eine der vier Jahrszeiten; Kopie von Blom nach Bassano Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch und 2 Schuh 7 Zoll breit Anm.: Die Lose 130 bis 133 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (50 fl für die Nm. 130-133) Käufer: Heusser 1781/05/07 FRHUS 0132 van der Blom; Bassano I Die vier Jahrszeiten von van der Blom nach Bassano. I Diese Nr.: Eine der vier Jahrszeiten; Kopie von Blom nach Bassano Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch und 2 Schuh 7 Zoll breit Anm.: Die Lose 130 bis 133 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (50 fl für die Nrn. 130-133) Käufer: Heusser 1781/05/07 FRHUS 0133 van der Blom; Bassano I Die vier Jahrszeiten von van der Blom nach Bassano. I Diese Nr.: Eine der vier Jahrszeiten; Kopie von Blom nach Bassano Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch und 2 Schuh 7 Zoll breit Anm.: Die Lose 130 bis 133 wur-
den zusammen katalogisiert. Verkäufer: Jacob Bemus Transakt.: Verkauft (50 fl für die Nrn. 130-133) Käufer: Heusser 1789/00/00 MMAN 0095 David Teniers der jüngere; Bassano I Der reiche Prasser, auf Kupfer, 10 Zoll hoch und 1 Fuß 1 Zoll breit, vom David Teniers dem jüngeren nach Bassano. [Le riche debauche, sur cuivre, de 10 pouces de haut, sur 1 pied 1 pouce de large, par David Teniers le jeune, däpres Bassaro [sic].] I Kopie von Teniers nach Bassano Mat.: auf Kupfer Maße: 10 Zoll hoch, 1 Fuß 1 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (12 fl) 1790/01/07 MUAN 0123 Nach Bassano I Ein Marktstück, auf Leinwat. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 6 Zoll, Breite 2 Schuh Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0207 Nach Bassano I Eine Landschaft, auf Leinwat, in einer geschnittenen und vergoldeten Ram. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 10 Zoll, Breite 1 Schuh 1 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/08/20 HBGOV 0013 Nach Bassano I Eine Landschaft mit vielen Thieren und einigen Figuren. Auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: 11 Vi Zoll hoch, und 13 '/i Zoll breit Transakt.: Verkauft (5.8 M) Käufer: Tietjen 1791/01/05 HBBMN 0298 Bassano I Zwey Hirten=Stücke nach Bassano. Auf Holz gemahlt. I Diese Nr.: Ein Hirten=Stück Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Vi Zoll, breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 298 und 299 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (2 Μ für die Nrn. 298 und 299) Käufer: Ego ä 1 [...?] 1791/01/05 HBBMN 0299 Bassano I Zwey Hirten=Stücke nach Bassano. Auf Holz gemahlt. I Diese Nr.: Ein Hirten=Stück Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Vi Zoll, breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 298 und 299 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (2 Μ für die Nrn. 298 und 299) Käufer: Ego ä 1[...?] 1791/05/30 FRAN 0025 Bassano I Christus und das Samaritische Weib, auf Glas gemalt, nach Bassano. I Mat.: auf Glas Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 9 Zoll breit Verkäufer: Bansa Transakt.: Verkauft (4 für die Nrn. 22-25) Käufer: Lorch 1791/05/30 FRAN 0048 Bassano I Zwey Landschaften auf Glas gemalt, nach Bassano. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Glas Maße: 1 Schuh hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Anm.: Die Lose 48 und 49 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Bansa Transakt.: Verkauft (1.42 für die Nrn. 48 und 49) Käufer: Streng 1791/05/30 FRAN 0049 Bassano I Zwey Landschaften auf Glas gemalt, nach Bassano. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Glas Maße: 1 Schuh hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Anm.: Die Lose 48 und 49 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Bansa Transakt.: Verkauft (1.42 für die Nrn. 48 und 49) Käufer: Streng 1791/05/30 FRAN 0059 Bassano I Zwey Landschaften auf Glas gemahlt mit vielen Figuren, nach Bassano. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Glas Maße: 1 Schuh hoch und 1 Schuh 4 Zoll breit Anm.: Die Lose 59 und 60 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Bansa Transakt.: Verkauft (2.02 für die Nrn. 59 und 60) Käufer: Streng 1791/05/30 FRAN 0060 Bassano I Zwey Landschaften auf Glas gemahlt mit vielen Figuren, nach Bassano. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Glas Maße: 1 Schuh hoch und 1 Schuh 4 Zoll breit Anm.: Die Lose 59 und 60 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Bansa Transakt.: Verkauft (2.02 für die Nm. 59 und 60) Käufer: Streng 1791/09/21 FRAN 0054 Teniers; Bassan I Vome auf diesem Gemälde siehet man Frauen, wovon eine scheint sich zum Essen zu bereiten; dieses Gemälde ist ein falsches von Teniers, so den Bassan nachahmet, es ist sehr schön zusammengesetzt, und der Gegenstand ist sehr angenehm. I Kopie von Teniers nach Bassano Transakt.: Verkauft (41.15 fl) Käufer: Trautmann GEMÄLDE
213
1791/09/26 FRAN 0405 Bassano I Eine Küche mit allerley Figuren und Speisen, nach Bassano. I Maße: 32 Zoll breit, 28 Zoll hoch Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0099 Passang I Die Geburt Christi auf Baneel nach Passang. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Schuh 11 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 11 Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1794/09/09 HBPAK 0031 Nach Bassano I Der auferweckte Lazarus, zum Gegenbild der lebendig geschundene Bartolomeus, beyde Bilder mit vielen Figuren und vortreflich ordinirt. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Der auferweckte Lazarus; Pendant zu Nr. 32 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 32 Zoll, breit 25 Zoll Anm.: Die Lose 31 und 32 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/09 HBPAK 0032 Nach Bassano I Der auferweckte Lazarus, zum Gegenbild der lebendig geschundene Bartolomeus, beyde Bilder mit vielen Figuren und vortreflich ordinirt. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Der lebendig geschundene Bartolomeus; Pendant zu Nr. 31 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 32 Zoll, breit 25 Zoll Anm.: Die Lose 31 und 32 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 LZAN 0079 Mola, Pierre Frangois; Bassan I Le nuit de Noel d'apres le Bassan, reunissant ä l'effet du clair-obscur la vigueur de la touche. I Kopie von P.F. Mola nach Bassano Mat.: auf Leinwand Maße: Hauteur 25 pouces, largeur 35 pouces Transakt.: Unbekannt (16 Louis Schätzung) 1800/11/12 HBPAK 0026 Bassano I Ein Kirchenstück mit Figuren. nach Bassano. I Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0027 Bassano I Ein dito [Kirchenstück] mit dito [Figuren], nach Demselben [Bassano], I Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0030 Bassano I Ein Kirchenstück mit Figuren. nach Bassano. I Transakt.: Unbekannt
Bassano (Manier) 1794/02/21 HBHEG 0083 So schön wie Bassano I Auf einer großen Tafel lieget verschiedenes Feder=Vieh und Wild, wobey ein Koch stehet, der die Hand auf einem Korb voll Garten=Früchte hält, indem er mit dem Küchen=Mädchen spricht; vor dem Tische stehet noch ein Korb mit gerupfte Hüner und Vögel. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 53 Zoll, breit 75 Zoll Transakt.: Unbekannt
Bassano (Schule) 1670/04/21 WNHTG 0094 Bassono I Christo, che scaccia fuori del Tempio gli Mercanti Ebrei, venuto fuori dalla Scuola del Bassono. I Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0255 Bassans I Zwey gute Stuck, von der Schuhle von Bassans. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt
Bassano, Francesco (II) (Francesco II da Ponte) 1743/00/00 BWGRA 0003 Francesco Bassano I Ein Stück worauf der Baurenstand vorgebildet wird von Francesco Bassano. I Pendant zu Nr. 4 Maße: hoch 4 Fuß 1 Zoll, breit 6 Fuß 6 Zoll Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0004 Francesco Basano I Der Compagnon von selbigem Meister [Francesco Bassano], worauf der Kaufhandel vorgestellet, von voriger Grösse. I Pendant zu Nr. 3 Maße: hoch 4 Fuß 1 Zoll, breit 6 Fuß 6 Zoll Transakt.: Unbekannt 1776/00/00 WZTRU 0260 Franciscus von Ponte genannt Bassano I Ein Stück 1 Schuhe, 2 Zoll hoch, 11 Zoll breit von Franciscus 214
GEMÄLDE
von Ponte genannt Bassano, stellet vor die Geburt Christi mit einigen anbethenden Hirten, ein Schize von diesem Meister, welche artig ausgeführet. I Maße: 1 Schuhe 2 Zoll hoch, 11 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (6 fl Schätzung) 1781/00/00 WZAN 0260 Franz von Ponte, genannt Bassano I Ein Stück 1 Schuhe, 2 Zoll hoch, 11 Zoll breit, vom Franz von Ponte, genannt Bassano, stellet die Geburt mit einigen anbethenden Hirten vor. Dieses ist eine Schizze von diesem Meister, welche aber artig ausgeführet ist. I Maße: 1 Schuhe 2 Zoll hoch, 11 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 LZAN 0003 Frangois Bassan I Un Tableau. L'histoire de Thamar paroissant en jugement devant Judas: riche par son ordonnance, par la beaute et la vigueur de sa touche. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hauteur 36 pouces, largeur 50 pouces Transakt.: Unbekannt (50 Louis Schätzung) 1799/00/00 LZAN 0105 Frangois Bassan I L' adoration des Bergers. I Maße: Hauteur 30 pouces, largeur 20 pouces environ Transakt.: Unbekannt (30 Louis Schätzung) 1800/01/00 LZAN [A]0002 Fr. Bassano I Eine Anbetung der Hirten: Maria kniet zur Rechten an der Krippe, und zeigt den ankommenden Hirten das Kind, ein zur linken Seite kniender Hirt reicht aus einem an seinem rechten Arm hangenden Korbe, einige Geschenke dar. Das übrige ist gut gruppirt, und das Gemälde eines der besten dieses Meisters. I Maße: Höhe 2 Fuß, Breite 2 Fuß 4 Zoll Verkäufer: A F Oeser Transakt.: Unbekannt
Bassano, Francesco (Π) (Francesco II da Ponte) (Manier) 1791/07/29 HBBMN 0019 In der Manier Fr. Basano I Maria und Joseph mit dem Christkindlein; auf Leinen. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 41 Zoll, breit 34 Zoll Transakt.: Unbekannt (12 Sch)
Bassano, Gerolamo (Gerolamo da Ponte) 1786/05/02 NGAN 0296 Hieron. de Ponto I Zwey Kirchenbegräbniße, im rechten untern Winkel des einen Gemähides ließt man F. Hieron. de Ponto ord. S.V. Franc. Seraph, fac. und in dem andern F. Hierom de Ponto. ord. ΠΙ. S. Franc. Seraph, inventavit et pinxit. I Diese Nr.: Ein Kirchenbegräbnis Maße: 11 Zoll hoch, 1 Schuh 2 Zoll breit lnschr.: F. Hieron. de Ponto ord. S.V. Franc. Seraph, fac. (signiert) Anm.: Die Lose 296 und 297 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (35.15 fl für die Nrn. 296 und 297) Käufer: Κ R ν Haller 1786/05/02 NGAN 0297 Hieron. de Ponto I Zwey Kirchenbegräbniße, im rechten untern Winkel des einen Gemähides ließt man F. Hieron. de Ponto ord. S.V. Franc. Seraph, fac. und in dem andern F. Hierom de Ponto. ord. III. S. Franc. Seraph, inventavit et pinxit. I Diese Nr.: Ein Kirchenbegräbnis Maße: 11 Zoll hoch, 1 Schuh 2 Zoll breit lnschr.: F. Hierom. de Ponto ord. III. S. Franc. Seraph, inventavit et pinxit (signiert) Anm.: Die Lose 296 und 297 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (35.15 fl für die Nrn. 296 und 297) Käufer: Κ R ν Haller 1791/07/29 HBBMN 0074 H. da Ponta I Die Unterredung Zoroaster mit Abuschalo, unter einem Baume bey einem Wasserstrom, stark und leicht gemahlt; auf Leinen. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 26 Zoll, breit 21 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt (12 Sch)
Bassano, Jacopo (Jacopo da Ponte) 1670/04/21 WNHTG 0032 Giacomo Bassano Vecchio I Quattro pezzi di Quadri dell'historia di Noe. II primo rappresenta l'edificatione dell'Arca. Sono tutti con innumerabili Animali riempiti. Le fi-
gure sono d'inferior statura, & ogni pezzo e alto quattro palmi, e nove dita, e largo palmi sei, e mezzo. I Maße: Alto quattro palmi, e nove dita, e largo palmi sei, e mezzo Anm.: Die Lose 32 bis 35 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt
1768/07/00 MUAN 0587 Bassano (Jacobus da Ponte) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
1670/04/21 WNHTG 0033 Giacomo Bassano Vecchio I Quattro pezzi di Quadri dell'historia di Noe. II secondo quando gli Animali entrarono in essa [l'Arca]. Sono tutti con innumerabili Animali riempiti. Le figure sono d'inferior statura, & ogni pezzo έ alto quattro palmi, e nove dita, e largo palmi sei, e mezzo. I Maße: Alto quattro palmi, e nove dita, e largo palmi sei, e mezzo Anm.: Die Lose 32 bis 35 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt
1768/07/00 MUAN 0704 Bassano (Jacobus da Ponte) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
1670/04/21 WNHTG 0034 Giacomo Bassano Vecchio I Quattro pezzi di Quadri dell'historia di Νοέ. II terzo quando l'Arca era inondata dal Diluvio. Sono tutti con innumerabili Animali riempiti. Le figure sono d'inferior statura, & ogni pezzo e alto quattro palmi, e nove dita, e largo palmi sei, e mezzo. I Maße: Alto quattro palmi, e nove dita, e largo palmi sei, e mezzo Anm.: Die Lose 32 bis 35 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt 1670/04/21 WNHTG 0035 Giacomo Bassano Vecchio I Quattro pezzi di Quadri dell'historia di Noe. II quarto quando Noe sacrificava dopo il Diluvio. Sono tutti con innumerabili Animali riempiti. Le figure sono d'inferior statura, & ogni pezzo e alto quattro palmi, e nove dita, e largo palmi sei, e mezzo I Maße: Alto quattro palmi, e nove dita, e largo palmi sei, e mezzo Anm.: Die Lose 32 bis 35 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt 1670/04/21 WNHTG 0036 Giacomo Bassano Vecchio I La Coronation di Christo dipinta al bruno, con 9. figure d'inferior statura. I Maße: Alto p. 4. d. 2. largo p. 3. Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0464 Jacob Bassans I Die Crönung Christi. Orig. vom Jacob Bassans. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0051 Jacomo Bassan I La Coronation de Jesus Christ, par Jacomo Bassan. I Maße: Haut 3. p. 8. pou. large 3. p. 3. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0052 Jacomo Bassan I Autre piece d'Histoire, par le meme [Jacomo Bassan]. I Maße: Haut 2. p. large 1. p. 6. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt
1768/07/00 MUAN 0705 Bassano (Jacobus da Ponte) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0755 Bassano (Jacobus da Ponte) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0758 Bassano (Jacobus da Ponte) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0759 Bassano (Jacobus da Ponte) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0760 Bassano (Jacobus da Ponte) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0763 Bassano (Jacobus da Ponte) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
1750/10/15 HB AN 0005 Bassano (Jacob) I Ein Venetianisch Vieh=Stück, mit Figuren. I Maße: 2 Fuß 9 Vi Zoll hoch, 5 Fuß 3 % Zoll breit Transakt.: Unbekannt (11.4 [?])
1768/07/00 MUAN 0899 Bassano (Jacobus da Ponte) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
1763/01/17 HNAN 0018 Giacomo Bassano I Voi'ageurs abreuvant leurs bestiaux ä une source, par Giacomo Bassano, sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hauteur 2 pieds 8 pouces, Largeur 5 pieds 3 pouces Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt
1768/07/00 MUAN 0907 Bassano (Jacobus da Ponte) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
1763/01/17 HNAN 0024 Giacomo Bassano I L'Entree des Betes dans l'Arche, par Giacomo Bassano, sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hauteur 3 pieds, Largeur 5 pieds 2 pouces Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt
1768/07/00 MUAN 0947 Bassano (Jacobus da Ponte) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
1763/11/09 FRJUN 0011 I. Bassano I Une tres jolie piece de cabinet representant Jesus dans le Palais entre deux soldats & S. Pierre pres du feu qui se chauffe; de l'autre cote la servante qui montre S. Pierre au doigt. Le tout tres bien peint. I Maße: hauteur 7 pouces, largeur 8 Vi pouces Transakt.: Verkauft (14.15 fl) Käufer: Schorer 1764/00/00 BLAN 0130 G. Bassano I Die anbäthung der Hirten, gantze Figuren, unstreitig eines der schönsten Stücke, so dieser Meister verfertigt hat. I Maße: 3 Fuß 4 Zoll hoch, 4 Fuß 4 Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (1200 Rt Schätzung)
1768/07/00 MUAN 0953 Bassano (Jacobus da Ponte) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0956 Bassano (Jacobus da Ponte) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger GEMÄLDE
215
Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0236 Bassano (Glacomo da Ponte) I L'Enfant Jisus dans la creche, & les bergers qui viennent Γ adorer. Peint sur toile marque du No.587. I Mat.: auf Leinwand Maße: 5. p. 7. de haut sur 7. p. 2 Vi p. de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0237 Bassano (Glacomo da Ponte) I Jesus Christ avec ses disciples, sur la montagne des oliviers. Peint sur toile marque du No. 704. I Mat.: auf Leinwand Maße: 3. p. 6. p. de haut sur 2. p. 10. p. de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0238 Bassano (Glacomo da Ponte) I La naissance de Jesus Christ, & les offrandes des bergers. Peint sur toile, marque du No. 705. I Mat.: auf Leinwand Maße: 3. p. 1. p. de haut sur 2. p. 8. p. de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0239 Bassano (Glacomo da Ponte) I Les anges annoncent aux pasteurs la naissance de J6sus Christ. Peints sur toile, marque du No. 755. I Mat.: auf Leinwand Maße: 1. p. 11p. de haut sur 1. p. 9. p. de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0240 Bassano (Glacomo da Ponte) I Le charitable Samaritain. Peint sur toile, marque du No. 758. I Mat.: auf Leinwand Maße: 1. p. 8 ιΔ p. de haut sur 2. p. 3. p. de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0241 Bassano (Glacomo da Ponte) I Un chaudronnier dans sa boutique, qui travaille. Peint sur toile, marque du No. 759. I Mat.: auf Leinwand Maße: 1. p. 11. p. de haut sur 2. p. 5. p. de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0242 Bassano (Glacomo da Ponte) I Un marechal tenant en main un marteau, & une tenaille. Peint sur bois marqui du No. 763. I Mat.: auf Holz Maße: 2. p. 2 14 p. de haut sur l . p . 11. p. de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0243 Bassano (Glacomo da Ponte) I La fuite en Egypte. Peint sur toile, marquie du No. 899. I Mat.: auf Leinwand Maße: 3. p. 9. p. de haut sur 2. p. 10. p. de large Verkäufer: Franfois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0244 Bassano (Glacomo da Ponte) I La chute de Simon le Magicien. Peinte sur toile, marqu6e du No. 907. I Mat.: auf Leinwand Maße: 2. p. 8. p. de haut sur 3. pieds de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0245 Bassano (Glacomo da Ponte) I La circoncision de Jesus Christ. Peinte sur toile, marqude du No. 947. I Mat.: auf Leinwand Maße: 4. p. 5 Vi p. de haut sur 3. p. 4 Vi p. de large Verkäufer: Franfois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0246 Bassano (Glacomo da Ponte) I Un Paysage dans lequel on voit des gens qui travaillent, avec leurs bestiaux, & qui se disposent ä prendre le repas de midi. Peint sur toile, marqu6 du No. 953. I Mat.: auf Leinwand Maße: 4. p. 2 p. de haut sur 3. p. 8 p. de large Verkäufer: Francis Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0247 Bassano (Glacomo da Ponte) \ Moise procure ä son peuple de l'eau, qu'il fait sortir d'un rocher. Peint sur toile marqu6 du No. 956. I Mat.: auf Leinwand Maße: 2. p. 11 p. de haut sur 4. pieds de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1775/09/09 HBBMN 0058 Jacob Bassano I Die Anbetung der Hirten; ein rares und hauptschönes capitales Bild, vom größesten Effect, und in allen Theilen vortrefflich, reich an Figuren, welche sich 216
GEMÄLDE
fast zu bewegen scheinen, auf Leinewand, mit vergoldeten Rahmen. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 4 F 2 Z, Breit 6 F 7 Ζ Transakt.: Verkauft (76 M) Käufer: Neum[ann] 1778/09/28 FRAN 0007 Jacobo Ponto Bassano I Eine biblische Historie, den schlafenden Noah mit seinen Söhnen vorstellend. [Noe dormant avec ses fils, par Jacques du Pont le Bassan.] I Maße: 7 Vi Schuh breit, 5 Schuh hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (4 fl) Käufer: Weitsch 1779/09/27 FRNGL 0257 Jacobo Ponte de Bassano I Die Verkündigung der Hirten. [L'annonciation des bergers.] I Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 11 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (2.15 fl) Käufer: Mund 1785/03/14 DRHLM 3514 Giacomo da Ponto Bassano I Eine Frau, so einen Korb mit Hünem in der linken Hand hält, von Giacomo da Ponto Bassano. I Anm.: Es ist unsicher, ob es sich um ein Gemälde oder um eine Zeichnung handelt. Dieses Los wurde zusammen mit der Nr. 3515 (J. Tintoretto) verkauft. Verkäufer: Christian Gotthold Crußius Transakt.: Unbekannt (0.3 Rt für die Nm. 3514 und 3515) 1785/04/22 HBTEX 0014 Jacob Ponto de Bassano I Die Geburt Christi, mit vielen Figuren. Auf Kupfer. Schwarzer Rahm und goldne Leisten. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 12 Zoll, breit 9 V2 Zoll Transakt.: Unbekannt 1787/00/00 HB AN 0171 Jacob, da Ponto. Bassano I Die vier Jahrszeiten, durch vieles Vieh und Figuren in Landschaften vorgestellt. Besonders schön, frey und kräftig gemahlt, und von richtiger Zeichnung. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Diese Nr.: Eine der vier Jahrszeiten Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Zoll, breit 26 Zoll Anm.: Die Lose 171 bis 174 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (112 Μ für die Nrn. 171-174) Käufer: Fesser 1787/00/00 HB AN 0172 Jacob, da Ponto. Bassano I Die vier Jahrszeiten, durch vieles Vieh und Figuren in Landschaften vorgestellt. Besonders schön, frey und kräftig gemahlt, und von richtiger Zeichnung. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Diese Nr.: Eine der vier Jahrszeiten Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Zoll, breit 26 Zoll Anm.: Die Lose 171 bis 174 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (112 Μ für die Nrn. 171-174) Käufer: Fesser 1787/00/00 HB AN 0173 Jacob, da Ponto. Bassano I Die vier Jahrszeiten, durch vieles Vieh und Figuren in Landschaften vorgestellt. Besonders schön, frey und kräftig gemahlt, und von richtiger Zeichnung. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Diese Nr.: Eine der vier Jahrszeiten Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Zoll, breit 26 Zoll Anm.: Die Lose 171 bis 174 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (112 Μ für die Nrn. 171-174) Käufer: Fesser 1787/00/00 HB AN 0174 Jacob, da Ponto. Bassano I Die vier Jahrszeiten, durch vieles Vieh und Figuren in Landschaften vorgestellt. Besonders schön, frey und kräftig gemahlt, und von richtiger Zeichnung. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Diese Nr.: Eine der vier Jahrszeiten Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Zoll, breit 26 Zoll Anm.: Die Lose 171 bis 174 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (112 Μ für die Nm. 171-174) Käufer: Fesser 1788/06/12 HBRMS 0106 J. Bassano I Eine schauerliche gebürgichte Landschaft, im Vorgrunde werden Schaafe geschoren. Meisterhaft gemalt. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 39 Zoll, breit 72 Zoll Transakt.: Unbekannt 1789/06/12 HBTEX 0028 J. Bassan I Ein ländliche Gegend, in welcher zur Rechten im Vordergrunde Christus den Blinden sehend macht, und seine Jünger mit Verwunderung um denselben herstehen. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Transakt.: Verkauft (2 M) Käufer: Cober
1789/06/12 HBTEX 0148 Jacobo d. P. Bassano I Petrus in einem blauen Gewand gehüllt, senket sein Haupt schmerzhaft gegen seiner rechten Seite. Sehr kräftig und meisterhaft gemahlt. Halbe Figuren. Auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 31 Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Verkauft (2.2 M) Käufer: Ego 1790/01/07 MUAN 0040 Jac. da Ponte Bassano I Die Taufe Joannis, auf Leinwat. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 10 Zoll, Breite 2 Schuh 1 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
Mat.: auf Kupfer Maße: hoch 8 Vi Zoll, breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 233 und 234 wurden zusammen katalogisiert. Transakt. : Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0422 Jacob da Ponte, genannt Bassano 1 Abraham ziehet wieder aus Egypten, von Jacob da Ponte, genannt Bassano. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh breit 5 Schuh 1 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Bassano, Jacopo (Jacopo da Ponte) (Kopie nach)
1790/01/07 MUAN 0069 Jac. da Ponte Bassano I Der reiche Prasser und Lazarus, ein biblisches Stück, auf Leinwat. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 10 Zoll, Breite 2 Schuh 3 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
1775/05/08 HBPLK 0140 J. Bassano I Die Geburt Christi, auf Leinewand, nach J. Bassano. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 20 Zoll 6 Linie, Breite 19 Zoll 8 Linie Transakt.: Unbekannt
1790/01/07 MUAN 0107 Jac. da Ponte Bassano I Ein Hirtenstück, auf Leinwat. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 10 Zoll, Breite 2 Schuh Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
Bassano, Jacopo (Jacopo da Ponte) (Schule)
1790/01/07 MUAN 0280 Jac. da Ponte Bassano I Eine Landschaft mit Figuren und Thieren, auf Leinwat. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 3 Schuh 1 Zoll, Breite 3 Schuh 8 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1443 Jac. da Ponte Bassano I Der Samaritan, auf Leinwat, in der nämlichen [geschnittenen und vergoldeten] Ram. I Mat.: auf Leinwand Format: rund Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1791/01/05 HBBMN 0274 Jacob Bassano I Die Geburth Christi, mit sehr vielen Figuren vorgestellet. Ein vortrefliches Gemähide; von Jacob Bassano. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 17 Zoll, breit 12 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (2.04 M) Käufer: Ego 1791/05/28 HBSDT 0052 Jacob da Ponto de Bassana I Venus bestellt bey den Vulcan Waffen. Die Ciclopen arbeiten unaufhörlich fort. Cupido ist im Vordergrunde. Mit sehr vielen andern Figuren und Nebensachen. Ein vortrefliches Original=Gemählde, so zum Gallerie=Stück dienlich, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 56 Zoll, breit 78 Zoll Transakt.: Unbekannt 1792/04/19 HBBMN 0074 J. Bassano I Ein angenehm und fleißig gemahltes Hirtenstück, von J. Bassano. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 Zoll, breit 9 Zoll Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HB GOV 0072 Jacobo Bassano I Wie Christus dem Volke dargestellt wird (Ecce Homo genannt). I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 50 Zoll, breit 57 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/00/00 HLAN [0004] J. Bassano I Die Anbetung der Hirten, von J. Bassano. auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: 2 Sch. 8 Ζ. 1 Sch. 10 Vi Z. Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: [Friedrich Karl Lang] Transakt.: Unbekannt (833.8 Rt; 1500 fl Schätzung) 1796/09/08 HBPAK 0154 J. da Ponte Bassano I Eine Köchin in der Küche, mit vielerley Gemüse und Eßwaren; hält in der rechten Hand eine Schaumkelle, und in der linken ein Messer. Im Hintergrunde sitzt Christus mit den Jüngern zu Emaus bey Tische. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 33 Zoll, breit 47 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0233 G. Bassan I Zwey Landschaften mit vielen Personen in Lebensgrösse, mit allerley Arten Früchte, und andern Gegenständen; sehr gut gemahlt. Auf Kupfer, goldenen Rahm. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit vielen Personen in Lebensgrösse Mat.: auf Kupfer Maße: hoch 8 Vi Zoll, breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 233 und 234 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0234 G. Bassan I Zwey Landschaften mit vielen Personen in Lebensgrösse, mit allerley Arten Früchte, und andern Gegenständen; sehr gut gemahlt. Auf Kupfer, goldenen Rahm. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit vielen Personen in Lebensgrösse
1776/00/00 WZTRU 0231 Jakob Bassano I Ein Stück 4 Schuhe, 2 Zoll hoch, 3 Schuhe, 1 Zoll breit, ein Stück aus der Schule von Jakob Bassano, vorstellend eine an einem Nagel hangende abgestochene, und eine auf einem Zinn liegende geropfte Ganse, wobey ein Zinn mit Bradwürsten, Speck und andern Würsten wohlausgeführter zu ersehen, und alles nach der Natur exprimirter zu erkennen ist. I Maße: 4 Schuhe 2 Zoll hoch, 3 Schuhe 1 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (4 fl Schätzung) 1781/00/00 WZAN 0231 Jakob Bassano I Ein Stück 4 Schuhe, 2 Zoll hoch, 3 Schuhe, 1 Zoll breit, aus der Schule von Jakob Bassano, stellet eine an einem Nagel hangende, abgestochene, und eine auf einem Zinn liegende geropfte Ganse vor, wobey ein Zinn mit Bradwürsten, Speck und andern Würsten recht gut ausgeführt zu sehen, und alles nach der Natur exprimirt zu erkennen ist. I Maße: 4 Schuhe 2 Zoll hoch, 3 Schuhe 1 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Bassano, Leandro (Leandro da Ponte) 1670/04/21 WNHTG 0037 Lionardo Bassano i L a C e n a d i Christo Nostro Signore con Ii Apostoli, d'inferior statura. I Maße: Alto pal. 3. d. 3. largo pal. 4. e mezzo Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt 1778/04/11 HBBMN 0001 Leander Bassano I Die Arche Noä, mit allen möglichen Creaturen. I Transakt.: Verkauft (28 M) Käufer: Krohn 1787/00/00 HB AN 0067 Leander Bassano I Christus zu Tische mit den Jüngern zu Emaus. Im Vordergründe beschäfftigen sich unterschiedliche Personen mit Kochen, mit vielen Küchengeschirren und Eßwaaren umgeben. Auf Holz, s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Zoll, breit 32 Zoll Transakt.: Verkauft (10.13 M) Käufer: Packy 1787/00/00 HB AN 0582 Leander Bassano I Eine Mahlzeit von einer zahlreichen Gesellschaft lustiger Männer und Weiber, mit vielen Nebensachen im Innern einer Stube. Sehr kräftig gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 17 Zoll, breit 24 Zoll Transakt.: Verkauft (16.8 M) Käufer: Mathus 1787/00/00 HB AN 0714 Leand. Bassano I Eine zahlreiche Gesellschaft von Männem und Weibern, welche sich bey der Mahlzeit uneinig geworden und schlagen. A.L. [Auf Leinewand] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Zoll, breit 32 Zoll Transakt.: Verkauft (1 M) Käufer: Berth[eau] 1789/00/00 MM AN 0015 Leandro Bassano I Ein Ecce Homo, halbe Figur, auf Holz. [Un Ecce homo, de mie figure, sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 10 Zoll hoch, 8 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (2 fl) 1790/01/07 MUAN 0014 Leandro da ponte Bassano I Ein Eremit auf Leinwat, in einer vergoldeten Ram. I Mat.: auf Leinwand GEMÄLDE
217
Maße: Höhe 3 Schuh 1 Zoll, Breite [?] Schuh 6 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0361 Leandro da ponte Bassano I Die Opferung Mariä im Tempel, auf Leinwat. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 5 Zoll, Breite 1 Schuh Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0612 Leandro da ponte Bassano I Ein Kopf des Kardinals Sebastian del Piombo, auf Leinwat. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 7 Zoll, Breite 1 Schuh 4 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1224 Leandro da ponte Bassano I Christus geht gen Emaus, auf Holz, in einer geschnittenen und vergoldeten Ram. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 3 Schuh 8 Zoll, Breite 4 Schuh 9 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1258 Leandro da ponte Bassano \ Ein Franciscus, auf Leinwat. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 10 Zoll, Breite 2 Schuh 4 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1392 Uandro da ponte Bassano I Die Geburt Christi, ein Nachtstück auf Leinwat, in einer geschnittenen und vergoldeten Ram. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 6 Zoll, Breite 2 Schuh 4 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1394 Leandro da ponte Bassano I Die Grablegung Christi, auf Leinwat, in einer dergleichen [vergoldeten] Ram. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 7 Zoll, Breite 2 Schuh 4 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
1778/03/28 HBSCM 0041 von Bassen I Eine Perspectivisch= Niederländische Kirche mit Figuren, ungemein schön. I Transakt.: Unbekannt 1778/09/28 FRAN 0694 van Bassen I Ein Architecturstück. [Une piece d'architecture.] I Maße: 1 Schuh breit, 11 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (40 fl) Käufer: Mertens 1779/00/00 HB AN 0062 Nicol. van Bassen I Die perspektivische Ansicht einer Kirche, worin eine Menge von Leuten versammelt sind. Auf Holz. [La vue perspective d'une eglise, oü est assemblee une quantite de monde. Sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 7 Zoll hoch, 1 Fuß 11 Zoll breit Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "Nicol. van Bassen", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/09/27 FRNGL 0999 van Bassen I Ein Architecturstück. [Une piece d'architecture.] I Maße: 11 Zoll hoch, 1 Schuh breit Transakt.: Verkauft (30 fl) Käufer: Trautmann 1785/05/17 MZAN 0825 B. van Basben I Das Inwendige einer Kirche, ist bezeichnet B. van Basben 1635. [Le dedans d'une eglise, la piece est marquee Β. van Basben 1635.] I Maße: 1 Schuh 5 Zoll hoch, 1 Schuh 9 Vi Zoll breit Inschr.: B. van Basben 1635 (bezeichnet und datiert) Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "B. van Basben", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (56.30 fl) Käufer: ν Loquowitz 1786/04/21 HBTEX 0097 Bassum I Ein inwendiges Gebäude mit Figuren. I Transakt.: Unbekannt
1790/01/07 MUAN 1435 Leandro da ponte Bassano I Moses, wie er das Wasser aus dem Felsen springend macht, auf Leinwat, in einer geschnittenen und metallisirten Ram. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 4 Zoll, Breite 1 Schuh 9 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
1786/10/18 HBTEX 0191 N. von Basse I Eine perspectivische Kirche mit historischen Vorstellungen in derselben. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Zoll 6 Linien, breit 17 Zoll 9 Linien Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "N. von Basse", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt
1790/01/07 MUAN 2133 Leandro da ponte Bassano I Zwey alte biblische Geschichten, auf Leinwat, in ungefaßten Ramen. I Diese Nr.: Eine alte biblische Geschichte Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 5 Schuh, Breite 7 Schuh Anm.: Die Lose 2133 und 2134 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
1790/02/04 HBDKR 0125 N.v. Bassen I Ein perspectivischer Prospect mit Figuren, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 'Λ Zoll, breit 15 Vi Zoll Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "N.v. Bassen", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einem Fehler. Transakt.: Verkauft (1.12 M)
1790/01/07 MUAN 2134 Leandro da ponte Bassano l Zwey alte biblische Geschichten, auf Leinwat, in ungefaßten Ramen. I Diese Nr.: Eine alte biblische Geschichte Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 5 Schuh, Breite 7 Schuh Anm.: Die Lose 2133 und 2134 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
Bassen, Bartholomeus van 1776/04/15 HBBMN 0142 van Bassen I Eine inwendige Kirche. I Maße: Höhe 11 Vi Zoll, Breite 9 Zoll Transakt.: Verkauft (7.12 M) Käufer: Eckhardt 1776/06/28 HBBMN 0044 J. v. Bassen I Ein Perspectiv in oval, auf Holz. I Mat.: auf Holz Format: oval Maße: Höhe 1 Fuß 3 Zoll, Breite 1 Fuß 11 Zoll Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "J. v. Bassen", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt 1776/11/09 HBKOS 0004 v. Bassen 1625 I Ein inwendiger Palais, wo ein Frauenzimmer sich im Springbrunnen badet, auf Holz gemahlt, mit sch[w]arzen Rahm und verguldete Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Fuß 11 Zoll, Breite 2 Fuß 8 Vi Zoll Inschr.: 1625 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt (19 M) 218
GEMÄLDE
1790/08/25 FRAN 0416 V. Bassen I Eine Kirch. I Maße: hoch 21 Zoll, breit 29 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (8.30 fl) Käufer: Baron von Sul ν M[annheim] 1790/09/10 HBBMN 0112 v. Bassen I Das Innere eines Tempels. Im Vordergrunde eine Vorstellung aus dem neuen Testament. Auf L. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 51 Zoll, breit 78 Zoll Transakt.: Verkauft (6.4 M) Käufer: Oetsmann 1796/10/17 HBPAK 0280 Nie. von Bassen I Eine perspectivische Brabantsche Kirche, mit sehr vielen Figuren, welche mit einem angenehmen Sonnen=Lichte beleuchtet; fleissig gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll 3 Lin., breit 22 Zoll 9 Lin. Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "Nie. von Bassen", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0068 Van Basse I Das Innere einer Kirche, mit verschiedenen schönen Figuren in Lebensgrösse. Ein sehr gutes Bild. Auf Holz, schwarzen Rahm, goldene Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 20 Zoll, breit 28 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0128 van Basse I Das Innere einer Kirche; in dem Augenblick wo der Geistliche vor dem Altar steht und Messe lieset, nebst verschiedenen Zuhörern. Auf Holz, goldene Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 10 Zoll, breit 17 Zoll Transakt.: Unbekannt
1797/04/25 HBPAK 0164 Van Basse I Das Innere einer Kirche, mit einigen Figuren: Auf Holz, schwarzen Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 10 Vi Zoll, breit 13 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/06/13 HBPAK 0010 Nicol. von Bassen I Das Innere eines Tempels, mit sehr vielen Säulen. Im Hintergründe kniet David vor dem Altar und spielet auf der Harfe, wozu ihm noch andere accompagniren. Sehr fleißig gemahlt. Auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 48 Zoll Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "Nicol. von Bassen", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt 1797/06/13 HBPAK 0054 N. v. Bassen I Ein perspectivisches Gebäude, mit vielen Säulen und einigen Figuren. Auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Zoll, breit 24 Vi Zoll Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "N. v. Bassen", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt
Bassen, Bartholomeus van (und Brueghel, J. (I)) 1763/01/17 HNAN 0010 van Bassen; Breugel I Vue Interieure & belle Perspective d'une Eglise Catolique avec nombre de figures 1625. L'architecture de van Bassen & les Figures de Breugel, sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 2 pieds 10 pouces, Largeur 4 pieds 2 pouces Inschr.: 1625 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt
Bassen, Bartholomeus van (Kopie nach) 1800/11/12 HBPAK 0729 N. Basse I Zwey perspektivische Schlösser mit Figuren, nach N. Basse. I Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "N. Basse", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt
Bassen, T.W. von [Nicht identifiziert] 1781/09/10 BNAN 0106 T. W. von Bassen I Eine mit Marmorsäulen, Gemählden, Epitaphien, Treppen und Geländern reich ausgezierte, mit vielen Personen staffierte Kirche; mit lebhaften Farben und pikantem Lichte, von T. W. von Bassen. 1657. I Mat.: auf Holz Maße: 15 Zoll hoch, 21 Zoll breit Inschr.: 1657 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt
Basso, Bartolomeo 1794/02/21 HBHEG 0017 Bartholomeus Bassi I Die Geschichte des Zinns=Groschens, im Tempel mit Collonaden Gänge. Sehr stark gemahlt. Er wurde zu Cremona Ao. 1640 gebohren. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 22 Vi Zoll, breit 35 Zoll Transakt.: Unbekannt
Basteil [Nicht identifiziert]
Batist, Johann [Nicht identifiziert] 1776/00/00 WZTRU 0098 Johann Batist I Ein alter Mannskopf, 2 Schuhe, 2 Zoll hoch, 1 Schuhe, 8 Zoll breit von Johann Batist, eine Art von Malerey, welche unter die beßte Classe der Portraiten kann gezählet werden, die Hand (mit welcher er ein Kreuz haltet) ist so, gleichwie der Kopf meisterlich gemahlet, und die Colorit mit dem einfallenden Lichte beßtens verstanden. I Pendant zu Nr. 99 Maße: 2 Schuhe 2 Zoll hoch, 1 Schuhe 8 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (16 fl Schätzung) 1776/00/00 WZTRU 0099 Johann Batist I Compagnion zu Nro. 98 ein Kopf von gleicher Güte und Stärke des obigen Meisters [Johann Batist], I Pendant zu Nr. 98 Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (16 fl Schätzung) 1781/00/00 WZAN 0098 Johann Baptist I Ein alter Mannskopf, 2 Schuhe, 2 Zoll hoch, 1 Schuhe, 8 Zoll breit von Johann Baptist, eine Art von Malerey, welche unter die beßte Klasse der Portraiten kann gezählet werden, die Hand, mit welcher er ein Kreuz hält, ist so, wie der Kopf meisterlich gemahlet, und die Kolorit mit dem einfallenden Lichte beßtens verstanden. I Pendant zu Nr. 99 Maße: 2 Schuhe 2 Zoll hoch, 1 Schuhe 8 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0099 Johann Baptist I Der Kompagnon zu Nro 98 ist ein Kopf von gleicher Güte und Stärke des obigen Meisters [Johann Baptist]. I Pendant zu Nr. 98 Transakt.: Unbekannt
Batoni, Pompeo Girolamo 1787/00/00 HB AN 0209 P. Battony I Delila sitzt zur linken auf einem Bette, hält mit ihrer Linken die Haare des vor ihr liegenden Simsons, welchen sie auf die Soldaten zeigt. Zur rechten sieht man verschiedene Krieger. Sehr kräftig gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 20 Zoll, breit 25 Zoll Transakt.: Verkauft (10.8 M) Käufer: Thomsen 1794/00/00 HB AN 0004 Pompeo Hieronym. Battoni I Der blinde Beiisar erhält von der schönen Artemisia, welche ein Waffenzögling des Helden begleitet, Almosen, die sein neben ihm sitzender Sohn in den Helm seines Vaters empfängt. Die Würde in den Gesichtszügen des edel hingelehnten Greises, das herzlich dankbare Auge des Sohns, der reine Ausdruck des Gefühls in der schönen weiblichen Engelsgestalt, der ehrfurchtsvolle mit Schaam untermischte Hinblick des zurükstehenden [sie] Kriegers, der mehr auf dem, für einen undankbaren Kaiser abgenutzten Helm als auf der Gabe verweilt: gewähren in dieser Darstellung, dem Anschauer, einen geistigen Genuss, der durch keinen Misston weder in der Komposition noch in der Zeichnung oder Haltung getrübt wird. Warmes Leben durchströmt den zum Theil entblössten Busen und den blossen Arm des holden Mädchens. I Maße: Höhe 41 Zoll, Breite 34 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt
1752/05/08 LZAN 0191 Basteil I Ein klein ouales Stück von Bastell gemahlt, im vergoldeten Rahmen. I Format: oval Transakt.: Verkauft (10 Gr) Käufer: Carol
Batoni, Pompeo Girolamo (Kopie nach)
Bastinelli, Stefano [Nicht identifiziert]
1786/05/02 NGAN 0355 Pompeio Battoni I Marcus Antonius und Cleopatra. Nach Pompeio Battoni. I Maße: 3 Schuh 4 Zoll hoch, 4 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (4.15 fl) Käufer: Ego
1670/04/21 WNHTG 0047 Stefano Bastinelli I Cinque pezzi di Battaglie, ogn'uno alto un pal. e 4. diti, largo 2.2. I Maße: Alto un pal. 3 4 diti, largo 2.2. Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt 1670/04/21 WNHTG 0048 Stefano Bastinelli I Cinque altri pezzi simili [Battaglie]. I Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt
1800/01/00 LZAN 0011 F.L. Oeser; Pomp. Balloni I Die bussfertige Magdalena, nach Pomp. Balloni von F.L. Oeser, (des verstorb. Direct, älterem Sohne) gemahlt, ist der Compagn. ein gut ausgeführtes Gemälde. I Kopie von F.L. Oeser nach Batoni; Pendant zu Nr. 10, von A.F. Oeser Maße: Höhe 1 Fuß 10 Zoll, Breite 4 Fuß 2 Zoll Verkäufer: A F Oeser Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
219
Batteler [Nicht identifiziert]
Bauer, Adam [Nicht identifiziert]
1723/00/00 PRAN 0013 Batteler I Ein Compagnion vom Batteler. I Pendant zu Nr. 12, "Frucht=Stuck" von Heem Maße: Höhe Vi Schuh, Breite 1 Schuh Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt
1752/05/08 LZAN 0245 Adam Bauer I Ein Holländer von Adam Brauer, im Holl. Rahmen. I Transakt.: Verkauft (1.15 Th) Käufer: Fleischer
Baugin, Lubin Battem, Gerrit van 1779/09/27 FRNGL 0815 van Battem I Eine sehr wohlausgeführte Landschaft mit vielen ausgearbeiteten Bauernfiguren, von van Battem, Schüler von David Tennier. [Un trfes beau pay sage avec beaucoup de figures tres bein peintes representantes des paysans, par van Battem, eleve de David Tennier.] I Maße: 1 Schuh hoch, 1 Schuh 2 Zoll breit Transakt.: Verkauft (40.15 fl) Käufer: Balke 1787/10/06 HBTEX 0093 Battem I Zwey Prospecte am Rhein mit Schiffe und Figuren, kräftig gemahlt. I Diese Nr.: Ein Prospect am Rhein mit Schiff und Figuren Anm.: Die Lose 93 und 94 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1798/06/04 HBPAK 0278 L. Bangin I Die Mutter Gottes mit dem Christkinde und dem heiligen Johannes. Ein ganz vortrefliches Gemähide. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 14 Zoll, breit 12 Zoll Transakt.: Unbekannt
Baumann 1789/00/00 MMAN 0013 Baumann I Zwei Blumenstücke, auf Holz. [Deux pieces en fleurs, sur bois.] I Diese Nr.: Ein Blumenstück Mat.: auf Holz Maße: 10 Zoll hoch, 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 13 und 14 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (5.30 fl für die Nm. 13 und 14)
1787/10/06 HBTEX 0094 Battem I Zwey Prospecte am Rhein mit Schiffe und Figuren, kräftig gemahlt. I Diese Nr.: Ein Prospect am Rhein mit Schiff und Figuren Anm..· Die Lose 93 und 94 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1789/00/00 MMAN 0014 Baumann I Zwei Blumenstücke, auf Holz. [Deux pieces en fleurs, sur bois.] I Diese Nr.: Ein Blumenstück Mat.: auf Holz Maße: 10 Zoll hoch, 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 13 und 14 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (5.30 fl für die Nrn. 13 und 14)
1790/04/13 HBLIE 0141 Bottem I Zwey ländliche Gegenden mit Staffage; so stark wie Rembrandt gemahlt. Auf Leinw. I Diese Nr.: Eine ländliche Gegend mit Staffage Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 22 Zoll, breit 19 Zoll Anm.: Die Lose 141 und 142 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (2.4 Μ für die Nrn. 141 und 142) Käufer: Steeman
1794/01/20 LZRST 5861 Baumann I 2 Stk. schöne venetianische Prospecte mit gut gemahlten Figuren, von Baumann, auf Leinw. 36 Zoll br. 25 Zoll hoch, in schw. Rahm mit vergold. Leiste. I Mat.: auf Leinwand Maße: 36 Zoll breit, 25 Zoll hoch Transakt.: Verkauft oder Unverkauft (1 Th) Käufer: R[ost]
1790/04/13 HBLIE 0142 Bottem I Zwey ländliche Gegenden mit Staffage; so stark wie Rembrandt gemahlt. Auf Leinw. I Diese Nr.: Eine ländliche Gegend mit Staffage Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 22 Zoll, breit 19 Zoll Anm.: Die Lose 141 und 142 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (2.4 Μ für die Nrn. 141 und 142) Käufer: Steeman
Baumgartner, Johann Wolfgang
1799/00/00 WZAN 0677 Gerard van Battum I Zwey Holländer Bauern=Stückchen von Gerard van Battum. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Holländer Bauern=Stückchen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 9 Zoll breit 1 Schuh Anm.: Die Lose 677 und 678 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0678 Gerard van Battum I Zwey Holländer Bauern=Stückchen von Gerard van Battum. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Holländer Bauern=Stückchen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 9 Zoll breit 1 Schuh Anm.: Die Lose 677 und 678 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1799/00/00 WZAN A0039 Johann Wolfgang Baumgartner I Zwey Stücke. Die Lehre im Tempel, und der Heiland, wie er die Kleinen zu sich kommen läßt, von Johann Wolfgang Baumgartner. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Die Lehre im Tempel Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 2 Zoll breit 1 Schuh 6 Zoll Anm.: Die Lose A39 und A40 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0040 Johann Wolfgang Baumgartner I Zwey Stücke. Die Lehre im Tempel, und der Heiland, wie er die Kleinen zu sich kommen läßt, von Johann Wolfgang Baumgartner. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Der Heiland, wie er die Kleinen zu sich kommen läßt Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 2 Zoll breit 1 Schuh 6 Zoll Anm.: Die Lose A39 und A40 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Baur, Johann Wilhelm Batyo (Batso) [Nicht identifiziert] 1742/08/01 BOAN 0339 Batyo I Zwey Ovidische Stuck. Orig. von Batyo. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0260 Batso I Deux Fables d'Ovide, par Batso. Couple. I Maße: Haut 1. ρίέ 2 Vi pouces, large 1. pie Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt
Baudermann [Nicht identifiziert] 1789/06/12 HBTEX 0279 Baudermann I Ein Bauer mit lächelnder Miene, hält einen Heering und ein Messer in beyden Händen. Halbe Figur. Mit vieler Wahrheit und Natur gemahlt. Auf Leinewand. Golden, Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 26 Zoll, breit 19 Zoll Transakt.: Verkauft (21.4 M) Käufer: Tietjen 220
GEMÄLDE
1723/00/00 PRAN [C]0004 Bauer I Bataglie / vom Bauer. Pendant zu Nr. [C]5 Maße: Höhe 6 Zoll, Breite 7 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN [C]0005 Bauer I Compagnion von eben diesem [Bauer]. I Pendant zu Nr. [C]4, "Bataglie" Maße: Höhe 5 Zoll, Breite 7 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1778/09/28 FRAN 0040 Wilhelm Bauer I Ein Prospectenstück von Wilhelm Bauer. [Une vue par Guillaume Bauer.] I Maße: 3 Schuh 11 Zoll breit, 3 Schuh 3 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (3.30 fl) Käufer: Obrist Belli 1778/09/28 FRAN 0041 Wilhelm Bauer I Ein Prospectenstück von einer Seegegend. [Une vue de marine par Guillaume Bauer.] I Maße: 4 Schuh breit, 3 Schuh 3 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (3 fl) Käufer: Obrist Belli
1791/09/26 FRAN 0253 Bauer I Eine Felsengegend mit einer Hirschjagd. I Maße: 5 Zoll hoch, 5 Zoll breit Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt
Baur, Paul [Nicht identifiziert] 1789/00/00 MMAN 0115 Paul Baur I Ein kleiner Seehafen, auf Holz. [Un petit port de Mer, sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 6 Zoll hoch, 7 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (24 Kr)
Beccenberg, B. [Nicht identifiziert] 1776/04/15 HBBMN 0106 B. Beccenberg I Ein See= und Land=Prospect, wo die Andromeda vorgestellet wird. I Maße: Höhe 1 Fuß 3 Vi Zoll, Breite 2 Fuß Vi Zoll Transakt.: Verkauft (21.4 M) Käufer: Pauly
Bechad [Nicht identifiziert] 1793/00/00 NGWID 0148 Bechad I Die Hochzeit zu Cana, mit wohl gruppierten Figuren, von Bechad. I Maße: 3 Schuh hoch, 3 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
Bautz [Nicht identifiziert] Bechtold 1797/02/27 HBPAK 0100 Bautz I Schäflingers Urne. Sehr gut gemahlt. Auf Holz, im goldnen Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 16 Zoll Transakt.: Unbekannt
Bayer 1782/01/28 LZAN 4156 Bayer I Zwey historische Bilder, von Bayer, 1 Elle 1 Vi Zoll hoch, 1 Elle, 9 Zoll breit, auf Leinwand. Schwarz und goldner Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Elle 1 Vi Zoll hoch, 11 Zoll breit Verkäufer: Caroli Ferdinandi Hommelii Transakt.: Unbekannt
Bayer, Hermann [Nicht identifiziert] 1790/08/25 FRAN 0343 Hermann Bayer I Zwey fleißige Früchtenstück. I Diese Nr.: Ein fleißiges Früchtenstück Maße: hoch 9 Zoll, breit 7 Zoll Anm.: Die Lose 343 und 344 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (5 fl für die Nrn. 343 und 344) Käufer: Kaller 1790/08/25 FRAN 0344 Hermann Bayer I Zwey fleißige Früchtenstück. I Diese Nr.: Ein fleißiges Früchtenstück Maße: hoch 9 Zoll, breit 7 Zoll Anm.: Die Lose 343 und 344 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (5 fl für die Nrn. 343 und 344) Käufer: Kaller
Bayer, Johann Christoffer 1778/10/30 HBKOS 0091 Joh. Bayer I Zwey Küchen=Stücke oder vielmehr Stilleben, mit Küchen Geschirr, sehr natürlich gemahlt, auf Holz. I Diese Nr.: Ein Küchen=Stück oder vielmehr Stillleben, mit Küchen Geschirr Mat.: auf Holz Maße: hoch 15 Zoll, breit 21 Zoll Anm.: Die Lose 91 und 92 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/10/30 HBKOS 0092 Joh. Bayer I Zwey Küchen=Stücke oder vielmehr Stilleben, mit Küchen Geschirr, sehr natürlich gemahlt, auf Holz. I Diese Nr.: Ein Küchen=Stück oder vielmehr Stillleben, mit Küchen Geschirr Mat.: auf Holz Maße: hoch 15 Zoll, breit 21 Zoll Anm.: Die Lose 91 und 92 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1790/04/13 HBLIE 0235 Bayer I Verschiedene Gartenfrüchte liegen auf einem überdecktem Tische. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 26 Zoll, breit 20 Zoll Transakt.: Verkauft (4 Sch)
1775/02/13 FRAN 0062 Bechtold I Kaiserin Maria Theresia. I Maße: Höhe 17 Vi Zoll. Breite 13 Zoll Verkäufer: von der Lahr Transakt.: Unbekannt
Bechtold (und Hagelgans, M.C.E.) 1775/02/13 FRAN 0078 Bechtold; Hagelgans I Der Prinz von Hildburgshausen nebst seiner Gemalin von Bechtold und Hagelgans. I Diese Nr.: Der Prinz von Hildburgshausen Maße: Höhe 30 Vi Zoll. Breite 24 Vi Zoll Anm.: Die Lose 78 und 79 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von der Lahr Transakt.: Unbekannt 1775/02/13 FRAN 0079 Bechtold; Hagelgans I Der Prinz von Hildburgshausen nebst seiner Gemalin von Bechtold und Hagelgans. I Diese Nr.: Seine Gemalin Maße: Höhe 30 Vi Zoll. Breite 24 Vi Zoll Anm.: Die Lose 78 und 79 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von der Lahr Transakt.: Unbekannt
Beck 1784/08/02 FRNGL 0261 Beck I Eines jungen Mannes Bildniß mit einem Schnurbart, im Rembrandts Geschmack. I Maße: 17 Vi Zoll breit, 21 Vi Zoll hoch Verkäufer: Α Transakt.: Verkauft (4.30 fl) Käufer: von Schmidt 1784/08/02 FRNGL 0420 Beck I Eines Mannes Bildniß, in Rembrands Manier, von Beck gemahlt I Maße: 16 Zoll breit, 21 Zoll hoch Verkäufer: Α Transakt.: Verkauft (3 fl) Käufer: de Schmidt 1785/10/17 LZRST 0037 Beck I Ein schönes Gemälde, von Beck, in der Man. des Terburgs. Ein holländischer Cavalier im Weinkeller, welchem eine junge Frau ein Glas Wein nebst Brodt bringt, vorne am Tisch ein Mops. Das ganze Bild ist schön behandelt, und hat ein lebhaftes Colorit. in schwarzen Rahm mit goldn. Leiste. I Pendant zu Nr. 38 Maße: 17 Zoll hoch, 14 Zoll breit Verkäufer: Buch Transakt.: Verkauft (4.18 Th) Käufer: Dante 1785/10/17 LZRST 0038 Beck I Ein anderes niederländisches Gemälde, von eben dem Meister [Beck], in eben der Manier [des Terburgs]. Das Gegenbild zum vorigen [Nr. 37]. Ein holländischer Bauer, welcher sich mit einer Frau sitzend unterredet, vome rechts im Grunde ein Korb mit Eyern, hinten im Hintergrunde Bauern, welche spielen, von gleichen Masse. I Pendant zu Nr. 37 Maße: 17 Zoll hoch, 14 Zoll breit Verkäufer: Buch Transakt.: Verkauft (2.20 Th) Käufer: Dante
1790/08/25 FRAN 0109 Bayer I Ein Küchenstück mit Fisch nach dem Leben. I Maße: hoch 41 Zoll, breit 51 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (8.15 fl) Käufer: Diehl
1785/10/17 LZRST 0039 Beck I Ein Gemälde, von Beck. Der verliebte Holländer, in dem Geschmack des Adr. Browers sehr fleissig gemalt und gut colorirt. 19 Z. h. 15 Z. breit, in schwarzen Rahm mit goldener Leiste. I Pendant zu Nr. 40 Maße: 19 Zoll hoch, 15 Zoll breit Transakt.: Verkauft (3.22 Th) Käufer: Cajus
1797/06/13 HBPAK 0111 Bayer I Ein dergleichen Stilleben mit einem angeschnittenen Schinken, verschiedenes Geschirr und Eßwaaren. Auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 23 Zoll, breit 30 Zoll Transakt.: Unbekannt
1785/10/17 LZRST 0040 Beck I Ein anderes Gemälde, von eben diesem Meister [Beck], das Gegenbild zum vorigen, in eben diesem Geschmack. Eine Bauerfrau, so ihr Kind säuget, hinter ihr ein kleiner Junge aus einem Napfe trinkend, von gleichem Masse. I GEMÄLDE
221
Pendant zu Nr. 39 Maße: 19 Zoll hoch, 15 Zoll breit Transakt.: Verkauft (3 Th) Käufer: Caj 1785/10/17 LZRST 0047 Beck I Ein kleines Gemälde, von Beck. Ein junges Bauermädchen, welches sich hinter einen umgefallenen Stamm lehnt, neben sich zur Linken hat sie einen Korb mit Eyern stehen, auf der Seite ist ein bewachsenes Felsenstück, 12 Z. h. 9 Vi Z. breit, in schwarzen Rahm mit goldener Leiste. I Pendant zu Nr. 48 Maße: 12 Zoll hoch, 9 Vi Zoll breit Verkäufer: Buch Transakt.: Verkauft (2.13 Th) Käufer: List
1779/09/27 FRNGL 0036 J.S. Beck I Ein natürlich und fleißig ausgearbeitetes Früchtenstück mit Insekten. [Une piece repr6sentante des fruits avec des insectes, peinte d'apres nature & travaillee soigneusement.] I Pendant zu Nr. 37 Maße: 1 Schuh 11 Zoll hoch, 2 Schuh 4 Zoll breit Transakt.: Verkauft (20 fl für die Nrn. 36 und 37) Käufer: Lindenlau 1779/09/27 FRNGL 0037 J.S. Beck I Das Gegenbild zu obigem, ebenfalls ein schönes Früchtenstück, von neml. Meister [J.S. Beck] und Maas. [Le pendant du precedant, fine avec la meme exactitude, par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 36 Maße: 1 Schuh 11 Zoll hoch, 2 Schuh 4 Zoll breit Transakt.: Verkauft (20 fl für die Nrn. 36 und 37) Käufer: Lindenlau
1785/10/17 LZRST 0048 Beck I Ein anderes Gemälde, von eben diesem Meister [Beck], das Gegenbild zum vorigen. Ein junges Obstmädchen, welche strickt, neben sich hat sie auf einer Bank Körbe mit Obst stehen, von gleichem Masse, beyde Gemälde sind von sehr schmeichelhaften Colorit. I Pendant zu Nr. 47 Maße: 12 Zoll hoch, 9 Vi Zoll breit Verkäufer: Buch Transakt.: Verkauft (2.21 Th) Käufer: List
1779/09/27 FRNGL 0052 J.S. Beck I Ein Fasanenhun, schön und natürlich gearbeitet. [Un faisan, tres bien peint d'apres nature.] I Maße: 1 Schuh 10 Zoll hoch, 1 Schuh 6 Zoll breit Transakt.: Verkauft (7.15 fl) Käufer: Rath Eichhorn
1785/10/17 LZRST 0064 Beck I Das Portrait eines lachenden niederländischen Bauers, von Beck, in der Manier des Mieris vortreflich ausgeführt, feuriges Colorit und lebhafter Ausdruck herrscht im ganzen Kopfe, in schw. Rahm mit goldn. Leiste. I Pendant zu Nr. 65 Maße: 26 Zoll hoch, 20 Zoll breit Transakt.: Verkauft (3 Th) Käufer: List
1779/09/27 FRNGL 0417 J.S. Beck I Ein nach der Natur gemalter Hahn, schön fleißig und lebhaft ausgeführt, vor demselben sitzet ein Frosch, hinter demselben ein Sperling. [Un coq tres bien peint d'apres nature, par devant une grenouille & par derriere un moineau.] I Maße: 1 Schuh 11 Zoll hoch, 2 Schuh 6 Zoll breit Transakt.: Verkauft (16 fl) Käufer: Becker
1785/10/17 LZRST 0065 Beck I Das Portrait eines betenden Alten, im Profil, von eben diesem Meister [Beck] in eben der Manier [von Mieris], von eben dem Fleisse und Ausdrucke, das Gegenbild zum vorigen, von gleich. Masse. I Pendant zu Nr. 64 Maße: 26 Zoll hoch, 20 Zoll breit Transakt.: Verkauft (4 Th) Käufer: List
1784/08/02 FRNGL 0002 Beck I Ein nach der Natur gemahltes Huhn mit jungen halb erwachsenen Hühnchen. I Pendant zu Nr. 3 Maße: 25 Zoll breit, 20 Zoll hoch Verkäufer: Α Transakt.: Verkauft (2.28 fl für die Nrn. 2 und 3) Käufer: Mevius
1785/10/17 LZRST 0069 Beck I 2 St. Köpfe, von Beck, in dem Geschmack des Greuze. Ein vortreflicher Kopf eines kleinen jungen Mädchens, sehr brilliant und schmelzend colorirt. und der Kopf eines kleinen Baueijungens, als Gegenbild, eben so schön und gut behandelt. in schwarzen Rahm mit goldener Leiste. I Maße: 13 Zoll hoch, 10 Zoll breit Transakt.: Verkauft (4.1 Th) Käufer: List
Beck, D.V.D. [Nicht identifiziert] 1796/12/07 HBPAK 0084 D. v. d. Beck I Zwey wald= und bergigte Landschaften mit Figuren. I Diese Nr.: Eine wald= und bergigte Landschaft mit Figuren Anm.: Die Lose 84 und 85 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0085 D. v. d. Beck I Zwey wald= und bergigte Landschaften mit Figuren. I Diese Nr.: Eine wald= und bergigte Landschaft mit Figuren Anm.: Die Lose 84 und 85 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Beck, David 1765/03/27 FRKAL 0008 David Beck I Deux beaux Portraits d'un jouaillien Hollandois avec sa femme. I Maße: hauteur 31 pouces, largeur 24 pouces Transakt.: Verkauft (25 fl) Käufer: Mevius 1785/05/17 MZAN 0661 David Beck I Die Geburt Christi von David Beck. [La naissance de Jesus Christ.] I Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 10 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (30 fl) Käufer: Dechant Pestel
Beck, Jakob Samuel 1765/00/00 FRNGL 0003 Beck I 2 Stück nach der Natur gemahlt. Feder=Vieh. I Transakt.: Unbekannt (60 fl Schätzung) 1765/00/00 FRNGL 0025 Beck I 1 nach der Natur gemahlter Hahn. I Transakt.: Unbekannt (20 fl Schätzung) 1765/00/00 FRNGL 0051 bekannt (15 fl Schätzung) 222
GEMÄLDE
Beck I 1 Feder=Vieh. I Transakt.: Un-
1784/08/02 FRNGL 0003 Beck I Das Gegenbild hierzu, zwey alte Tauben mit ihren jungen, vom nehmlichen Meister [Beck] und Maas. I Pendant zu Nr. 2 Maße: 25 Zoll breit, 20 Zoll hoch Verkäufer: Α Transakt.: Verkauft (2.28 fl für die Nrn. 2 und 3) Käufer: Mevius 1784/08/02 FRNGL 0007 Beck I Ein nach dem Leben gemahlter schöner Hahn. I Maße: 19 Vi Zoll breit, 25 Vi Zoll hoch Verkäufer: Α Transakt.: Verkauft (1.32 fl) Käufer: Mevius 1784/08/02 FRNGL 0197 Beck I Zwey Federvieh=Stücke mit alten und jungen Endten, Hahn und Hühnern, nach der Natur meisterhaft abgebildet von Beck. I Diese Nr.: Ein Federvieh=Stück mit alten und jungen Endten, Hahn und Hühnern Maße: 41 Zoll breit, 30 Zoll hoch Anm.: Die Lose 197 und 198 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Α Transakt.: Verkauft (8 fl für die Nrn. 197 und 198) Käufer: Pr von Dessau 1784/08/02 FRNGL 0198 Beck I Zwey Federvieh=Stücke mit alten und jungen Endten, Hahn und Hühnem, nach der Natur meisterhaft abgebildet von Beck. I Diese Nr.: Ein Federvieh=Stück mit alten und jungen Endten, Hahn und Hühnern Maße: 41 Zoll breit, 30 Zoll hoch Anm.: Die Lose 197 und 198 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Α Transakt.: Verkauft (8 fl für die Nrn. 197 und 198) Käufer: Pr von Dessau 1785/05/17 MZAN 1122 J.S. Beck I Todtes Wildpret und Geflügel, beide Stücke sind bezeichnet J.S. Beck. [Deux pieces qui represented du gibier & de la volatile tuee marquees J. S. Beck.] I Diese Nr.: Todtes Wildpret und Geflügel Maße: 2 Schuh 10 Zoll hoch, 4 Schuh 10 Zoll breit Inschr.: J.S. Beck (bezeichnet) Anm.: Die Lose 1122 und 1123 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (42.30 fl für die Nrn. 1122 und 1123) Käufer: Forstrath Keck 1785/05/17 MZAN 1123 J.S. Beck I Todtes Wildpret und Geflügel, beide Stücke sind bezeichnet J.S. Beck. [Deux pieces qui represented du gibier & de la volatile tuee marquees J. S. Beck.] I Diese Nr.: Todtes Wildpret und Geflügel Maße: 2 Schuh 10 Zoll hoch, 4 Schuh 10 Zoll breit Inschr.: J.S. Beck (bezeichnet) Anm.: Die Lose 1122 und 1123 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (42.30 fl für die Nrn. 1122 und 1123) Käufer: Forstrath Keck
1785/10/17 LZRST 0050 Beck I Ein sehr grosses fleissig ausgeführtes Fruchtstück, von Beck. Ein Piedestal mit einem rothen Tuch umhangen, auf welchem eine Schüssel mit Pflaumen, Birnen und einer Melone, nebenbey ein Blumentopf mit weis und rothen Nelken, in der Luft Fliegen und Schmetterlinge, alles meisterhaft gezeichnet und colorirt. 34 Z. hoch, 27 Z. br. in schwarz. Rahm und goldn. Leiste. I Pendant zu Nr. 51 Maße: 34 Zoll hoch, 27 Zoll breit Transakt.: Verkauft (4.12 Th) Käufer: Caj 1785/10/17 LZRST 0051 Beck I Ein anderes [Fruchtstück], von eben diesem Meister [Beck], eben so schön und meisterhaft ausgeführt, das Gegenbild zum vorigen. Eine Schüssel mit Wein und Pfirschen belegt, in der Mitte derselben ein Deckelglas mit rothem Wein, es steht auf einem Piedestal mit grünen Tuch behangen, von gleichem Masse. I Pendant zu Nr. 50 Maße: 34 Zoll hoch, 27 Zoll breit Transakt.: Verkauft (4.6 Th) Käufer: Caj 1785/10/17 LZRST 0052 Beck I Ein Küchenstück, von eben diesem Meister [Beck]. Ein roher Kälberstoss in einer Schüssel, darneben Spargel und Rattisgen, hinter ihm ein blauer Topf, worauf ein Teller mit sauern Gurken steht, ebenfalls fleissig und schön gemalt, 23 Zoll hoch, 31 Z. br. in schwarzen Rahm mit goldn. Leiste. I Pendant zu Nr. 53 Maße: 23 Zoll hoch, 31 Zoll breit Transakt.: Verkauft (1.20 Th) Käufer: Caj 1785/10/17 LZRST 0053 Beck I Ein anderes [Küchenstück], von eben diesem Meister [Beck], eben so schön, das Gegenbild zum vorigen. Ein in einer Schüssel liegender abgeschlachter Kapaun, dahinter ein Korb mit Zuckerschoten, vome ein Bund Zwiebeln, von gleichem Masse. I Pendant zu Nr. 52 Maße: 23 Zoll hoch, 31 Zoll breit Transakt.: Verkauft (2.14 Th) Käufer: Caj 1785/10/17 LZRST 0054 Beck I Ein Hühnerstück, von eben diesem Meister [Beck]. Eine schöne weisse Glucke, welche einige junge Hühner unter ihren Flügel hat, nebenbey sind noch 3 andere herumlaufende junge Hühner, meisterhaft colorirt. I Pendant zu Nr. 55 Maße: 21 Zoll hoch, 27 Zoll breit Transakt.: Verkauft (4 Th) Käufer: List 1785/10/17 LZRST 0055 Beck I Ein vortrefliches Federviehstück, von eben dem Meister [Beck], das Gegenbild zum vorigen [Nr. 54]. Ein Nest mit ganz jungen noch nicht befiederten Tauben, vor dem Neste die beyden Alten. 21 Z. hoch, 26 Z. br. in schw. Rahm mit goldener Leiste. I Pendant zu Nr. 54 Maße: 21 Zoll hoch, 26 Zoll breit Transakt.: Verkauft (4 Th) Käufer: List 1785/10/17 LZRST 0057 Beck I Ein Blumenstück, von Beck. Ein Bouquet von einigen Lefkoyen und gelben Lackstängeln in einer gläsernen Bouteille mit Wasser gesteckt 20 Zoll hoch, 15 Zoll breit, in schwarzen Rahm mit goldn. Leiste. I Pendant zu Nr. 58 Maße: 20 Zoll hoch, 15 Zoll breit Transakt.: Verkauft oder Unverkauft (1.20 Th) Käufer: Rost 1785/10/17 LZRST 0058 Beck I Ein anderes [Blumenstück], von eben diesem Meister [Beck], das Gegenbild zum vorigen. Ein Bouquet von Rosen und Tuberosen, in ein mit Wasser gefülltes Glas gesteckt, von gleichen Masse. I Pendant zu Nr. 57 Maße: 20 Zoll hoch, 15 Zoll breit Transakt.: Verkauft oder Unverkauft (20 Gr) Käufer: Rost 1785/10/17 LZRST 0061 Beck I Zwey fleissig ausgeführte Kaninchen, welche Kraut fressen, von Beck sehr schön gemalt, in schwarzen Rahm mit goldn. Leiste. I Maße: 19 Zoll hoch, 21 Zoll breit Transakt.: Verkauft (1 Th) Käufer: Haupt 1787/01/15 LZRST 0006 Beck I 2 schöne Bluhmenstücke von Beck, mit Lefkoyen und gelben Lackstängeln, Rosen &c. fleissig gemalt. 20 Z. hoch, 15 Z. br. in schw. Rahm mit gold. Leiste. I Maße: 20 Zoll hoch, 15 Zoll breit Verkäufer: Richter Transakt.: Unbekannt 1788/01/15 LZRST 3972 Beck I 2 schöne Bluhmenstücke, von Beck, mit Lefkoyen und halben Lackstengel, Rosen etc. fleissig gemahlt, 20 Z. hoch, 15 Z. breit, in schw. Rahm, mit goldn. Leiste. I
Maße: 20 Zoll hoch, 15 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (2 Th) Käufer: Hornel 1791/09/26 FRAN 0158 J. S. Beck I Hühner und Enten bey ihren Jungen, lebhaft und überaus fleißig gemalt von J. S. Beck 1764. I Maße: 27 Zoll hoch, 33 Zoll breit lnschr.: 1764 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0159 J. S. Beck I Hühner und Enten bey ihren Jungen, lebhaft und überaus fleißig gemalt von J. S. Beck 1764. I Maße: 27 Zoll hoch, 33 Zoll breit lnschr.: 1764 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0302 Beck I Ein überaus meisterhaft nach dem Leben gemalter Hahn. I Maße: 26 Zoll hoch, 20 Zoll breit Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0149 Beck I Zwey vortrefliche nach dem Leben gemahlte Thierstücke, mit mancherley wild und zahmes Vieh. L[einwand]. oh[ne]. R[ahm], I Diese Nr.: Ein vortrefliches nach dem Leben gemahltes Thierstück Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 39 Zoll, breit 66 Zoll Anm.: Die Lose 149 und 150 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0150 Beck I Zwey vortrefliche nach dem Leben gemahlte Thierstücke, mit mancherley wild und zahmes Vieh. L[einwand], oh[ne]. R[ahm]. I Diese Nr.: Ein vortrefliches nach dem Leben gemahltes Thierstück Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 39 Zoll, breit 66 Zoll Anm.: Die Lose 149 und 150 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0151 Beck I Zwey eben so schöne Viehstücke. L[einwand]. oh[ne]. R[ahm]. I Diese Nr.: Ein schönes Viehstück Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 151 und 152 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0152 Beck I Zwey eben so schöne Viehstücke. L[einwand]. oh[ne]. R[ahm]. I Diese Nr.: Ein schönes Viehstück Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 151 und 152 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0153 Beck I Zwey dergleichen [Viehstükke], eben so fleißig entworfen. Leinwand, ohne Rahm I Diese Nr.: Ein Viehstück Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 153 und 154 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0154 Beck I Zwey dergleichen [Viehstükke], eben so fleißig entworfen. Leinwand, ohne Rahm I Diese Nr.: Ein Viehstück Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 153 und 154 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0155 Beck I Zwey nicht minder schöne Viehstücke. L[einwand]. oh[ne]. R[ahm]. I Diese Nr.: Ein Viehstück Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 155 und 156 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0156 Beck I Zwey nicht minder schöne Viehstücke. L[einwand], oh[ne]. R[ahm]. I Diese Nr.: Ein Viehstück Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 155 und 156 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0157 Beck I Zwey dergleichen dito [Viehstücke], wie vorhergehende L[einwand], oh[ne]. R[ahm], I Diese Nr.: Ein Viehstück Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 157 und 158 wurden zusammen katalogiGEMÄLDE
223
siert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0158 Beck I Zwey dergleichen dito [Viehstücke], wie vorhergehende L[einwand]. oh[ne]. R[ahm], I Diese Nr.: Ein Viehstück Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 157 und 158 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0159 Beck I Zwey Tisch= oder Speisegesellschaften, sehr gut ordinirt. L[einwand]. oh[ne]. R[ahm]. I Diese Nr.: Eine Tisch= oder Speisegesellschaft Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 159 und 160 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0160 Beck I Zwey Tisch= oder Speisegesellschaften, sehr gut ordinirt. Lfeinwand], oh[ne]. R[ahm], I Diese Nr.: Eine Tisch= oder Speisegesellschaft Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 159 und 160 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0161 Beck I Zwey dergleichen [Tisch= oder Speisegesellschaften], eben so schön. L[einwand]. oh[ne], R[ahm]. I Diese Nr.: Eine Tisch= oder Speisegesellschaft Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 161 und 162 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0162 Beck I Zwey dergleichen [Tisch= oder Speisegesellschaften], eben so schön. L[einwand], oh[ne]. R[ahm]. I Diese Nr.: Eine Tisch= oder Speisegesellschaft Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 161 und 162 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0163 Beck I Zwey dito [Tisch= oder Speisegesellschaften] dito [eben so schön]. L[einwand]. oh[ne], R[ahm]. I Diese Nr.: Eine Tisch= oder Speisegesellschaft Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 163 und 164 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0164 Beck I Zwey dito [Tisch= oder Speisegesellschaften] dito [eben so schön]. L[einwand], oh[ne]. R[ahm]. I Diese Nr.: Eine Tisch= oder Speisegesellschaft Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 163 und 164 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0165 Beck I Zwey dito [Tisch= oder Speisegesellschaften] dito [eben so schön]. L[einwand]. oh[ne]. R[ahm]. I Diese Nr.: Eine Tisch= oder Speisegesellschaft Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 165 und 166 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0166 Beck I Zwey dito [Tisch= oder Speisegesellschaften] dito [eben so schön]. L[einwand]. oh[ne]. R[ahm], I Diese Nr.: Eine Tisch= oder Speisegesellschaft Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 165 und 166 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0167 Beck I Zwey dito [Tisch= oder Speisegesellschaften] dito [eben so schön], L[einwand]. oh[ne], R[ahm]. I Diese Nr.: Eine Tisch= oder Speisegesellschaft Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 167 und 168 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 224
GEMÄLDE
1792/07/28 HBSCN 0168 Beck I Zwey dito [Tisch= oder Speisegesellschaften] dito [eben so schön]. L[einwand], oh[ne]. R[ahm]. I Diese Nr.: Eine Tisch= oder Speisegesellschaft Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 167 und 168 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0169 Beck I Zwey sehr natürlich gemahlte Fruchtstücke. Leinw. ohne Rahm. I Diese Nr.: Ein sehr natürlich gemahltes Fruchtstück Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 169 und 170 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0170 Beck I Zwey sehr natürlich gemahlte Fruchtstücke. Leinw. ohne Rahm. I Diese Nr.: Ein sehr natürlich gemahltes Fruchtstück Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 169 und 170 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0171 Beck I Zwey eben so fleißig gemahlte dito [Fruchtstücke]. L[einwand], oh[ne], R[ahm]. I Diese Nr.: Ein fleißig gemahltes Fruchtstück Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 171 und 172 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0172 Beck I Zwey eben so fleißig gemahlte dito [Fruchtstücke]. L[einwand], oh[ne]. R[ahm], I Diese Nr.: Ein fleißig gemahltes Fruchtstück Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 171 und 172 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0173 Beck I Zwey dergleichen [fleißig gemahlte Fruchtstücke], eben so schön. L[einwand]. oh[ne]. R[ahm]. I Diese Nr.: Ein fleißig gemahltes Fruchtstück Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 173 und 174 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0174 Beck I Zwey dergleichen [fleißig gemahlte Fruchtstücke], eben so schön. L[einwand]. oh[ne]. R[ahm], I Diese Nr.: Ein fleißig gemahltes Fruchtstück Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 173 und 174 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0175 Beck I Ein in vorzüglich schöner Stellung entworfener Türk und Türkin. L[einwand]. ohne Rahm. I Diese Nr.: Ein in vorzüglich schöner Stellung entworfener Türk Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 175 und 176 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0176 Beck I Ein in vorzüglich schöner Stellung entworfener Türk und Türkin. L[einwand]. ohne Rahm. I Diese Nr.: Ein in vorzüglich schöner Stellung entworfener Türk Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 175 und 176 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0177 Beck I Zwey plaisante Landschaften mit Figuren. Leinw. blind Rahm I Diese Nr.: Eine plaisante Landschaft mit Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 177 und 178 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0178 Beck I Zwey plaisante Landschaften mit Figuren. Leinw. blind Rahm I Diese Nr.: Eine plaisante Landschaft mit Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 177 und 178 wurden zusammen katalogi-
siert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt
sammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt
1792/07/28 HBSCN 0179 Beck I Zwey nicht minder anmutige Landschaften mit dito [Figuren]. L[einwand]. blind R[ahm]. I Diese Nr.: Eine anmutige Landschaft mit Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 179 und 180 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt
1792/07/28 HBSCN 0190 Beck I Ein andächtig betender Einsiedler. L[einwand], oh[ne]. R[ahm]. \Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 189 und 190 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt
1792/07/28 HBSCN 0180 Beck I Zwey nicht minder anmutige Landschaften mit dito [Figuren], L[einwand], blind R[ahm]. I Diese Nr.: Eine anmutige Landschaft mit Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 179 und 180 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0181 Beck I Zwey dergleichen [anmutige Landschaften] mit dito [Figuren], L[einwand]. bl[inden]. R[ahmen]. I Diese Nr.: Eine anmutige Landschaft mit Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 181 und 182 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0182 Beck I Zwey dergleichen [anmutige Landschaften] mit dito [Figuren]. L[einwand]. bl[inden]. R[ahmen], I Diese Nr.: Eine anmutige Landschaft mit Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 181 und 182 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0183 Beck I Zwey dito [anmutige Landschaften], mit dito [Figuren]. L[einwand], bl[inden]. R[ahmen]. I Diese Nr.: Eine anmutige Landschaft mit Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 183 und 184 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0184 Beck I Zwey dito [anmutige Landschaften], mit dito [Figuren], L[einwand], bl[inden]. R[ahmen]. I Diese Nr.: Eine anmutige Landschaft mit Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 183 und 184 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0185 Beck I Ein natürlich vorgestellter Jude, zum Gegenbild eine Jüdin. L[einwand], bl[inden]. R[ahmen], I Diese Nr.: Ein natürlich vorgestellter Jude; Pendant zu Nr. 186 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 185 und 186 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0186 Beck I Ein natürlich vorgestellter Jude, zum Gegenbild eine Jüdin. L[einwand]. bl[inden]. R[ahmen]. I Diese Nr.: Eine Jüdin; Pendant zu Nr. 185 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 185 und 186 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt
1792/07/28 HBSCN 0191 Beck I Koch und Köchin als Nachtstücke vorgestellet. L[einwand], oh[ne]. R[ahm]. I Diese Nr.: Koch als Nachtstück vorgestellet Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 191 und 192 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0192 Beck I Koch und Köchin als Nachtstücke vorgestellet. L[einwand], oh[ne], R[ahm]. I Diese Nr.: Köchin als Nachtstück vorgestellet Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 191 und 192 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0193 Beck I Vasen mit lebhafte Blumen, ganz nach der Natur. L[einwand], ohne Rahm. I Diese Nr.: Vasen mit lebhafte Blumen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 193 und 194 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0194 Beck I Vasen mit lebhafte Blumen, ganz nach der Natur. L[einwand]. ohne Rahm. I Diese Nr.: Vasen mit lebhafte Blumen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 193 und 194 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0195 Beck I Zwey niederländis. Bauern Conversationsst. L[einwand]. o[hne]. R[ahm]. I Diese Nr.: Ein niederländis. Bauern Conversationsst Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 195 und 196 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0196 Beck I Zwey niederländis. Bauern Conversationsst. L[einwand]. o[hne], R[ahm]. I Diese Nr.: Ein niederländis. Bauern Conversationsst Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 195 und 196 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0197 Beck I Zwey derg. [niederländis. Bauern Conversationsst.] lustig und vergnüngt [sie] vorgestellet. L[einwand]. oh[ne]. R[ahm]. I Diese Nr.: Ein niederländis. Bauern Conversationsst. Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 197 und 198 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt
1792/07/28 HBSCN 0187 Beck I Holländischer Bauer und Bäuerin, ebenfalls sehr natürlich. L[einwand]. bl[inden]. R[ahmen]. I Diese Nr.: Holländischer Bauer Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 187 und 188 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt
1792/07/28 HBSCN 0198 Beck I Zwey derg. [niederländis. Bauern Conversationsst.] lustig und vergnüngt [sie] vorgestellet. L[einwand], oh[ne], R[ahm]. I Diese Nr.: Ein niederländis. Bauern Conversationsst. Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 197 und 198 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt
1792/07/28 HBSCN 0188 Beck I Holländischer Bauer und Bäuerin, ebenfalls sehr natürlich. L[einwand], bl[inden]. R[ahmen]. I Diese Nr.: Holländische Bäuerin Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 187 und 188 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt
1792/07/28 HBSCN 0199 Beck I Zwey niedliche Fruchtst. sehr natürlich. L[einwand]. oh[ne]. R[ahm]. I Diese Nr.: Ein niedliches Fruchtst Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 15 Zoll Anm.: Die Lose 199 und 200 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt
1792/07/28 HBSCN 0189 Beck I Ein andächtig betender Einsiedler. L[einwand]. oh[ne]. R[ahm]. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 189 und 190 wurden zu-
1792/07/28 HBSCN 0200 Beck I Zwey niedliche Fruchtst. sehr natürlich. L[einwand], oh[ne]. R[ahm]. I Diese Nr.: Ein niedliches Fruchtst Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 15 Zoll GEMÄLDE
225
Anm.: Die Lose 199 und 200 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1794/09/00 LGAN 0053 Beck I Zwei Stüke, ein paar todte Enten, mit Beiwerk und ein Phasan mit einem laurenden Fuchs, von Beck, auf Leinwand, in schwarz gebeizten Rahmen. I Mat.: auf Leinwand Maße: breit 2 Schuh 7 Zoll, hoch 2 Schuh Verkäufer: [Friedrich Karl Ludwig, Freiherr von Moser] Transakt.: Unbekannt (50 rh fl Schätzung) 1796/00/00 HLAN [0051] Bek I Eine todte Endte, nebst andern Vögeln. 2 Sch. 2 Sch. 7 Z. auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Sch. 2 Sch. 7 Z. Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: [Friedrich Karl Lang] Transakt.: Unbekannt (27.18 Rt; 50 fl Schätzung) 1796/00/00 HLAN [0052] Bek I Ein Fasan, den ein Fuchs aufscheucht. I Anm. : Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: [Friedrich Karl Lang] Transakt.: Unbekannt (27.18 Rt; 50 fl Schätzung)
Beck, Johann 1764/08/25 FRAN 0448 loh Beck I Un pientre [sie] et un sculpteur. I Diese Nr.: Un pientre Maße: haut 1 pied 4 pouces sur 1 pied de large Anm.: Die Lose 448 und 449 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1764/08/25 FRAN 0449 loh Beck I Un pientre [sie] et un sculpteur. I Diese Nr.: Un sculpteur Maße: haut 1 pied 4 pouces sur 1 pied de large Anm.: Die Lose 448 und 449 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt
Becken, J.Z. [Nicht identifiziert] 1791/09/26 FRAN 0047 J. Z. Becken I Eine musicalische Gesellschaft in einem ausgeschmückten Zimmer, gut gruppirt und mit Fleiß gemalt von J.Z. Becken. I Pendant zu Nr. 48 Maße: 1 Sch. 8 Zoll hoch, 2 Schuh breit Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0048 J. Z. Becken I Das Gegenstück, ein Gastmahl in einem Zimmer, von nemlichem Meister [J. Z. Becken] und Maas. I Pendant zu Nr. 47 Maße: 1 Sch. 8 Zoll hoch, 2 Sch. breit Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt
Becker, Johann Wilhelm 1779/09/27 FRNGL 0076 Becker I Eine wohl kroupirte und gut ausgearbeitete Landschaft, in der Manier des Huysmanns. [Un passage tres bien grouppe & parfaitement bien rendu, dans le gout de Huysmanns par Becker.] I Pendant zu Nr. 77 Maße: 1 Schuh hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Transakt.: Verkauft (15.30 fl für die Nrn. 76 und 77) Käufer: Hoym 1779/09/27 FRNGL 0077 Becker I Das Gegenbild zu obigem, eine dergleichen Landschaft, von neml. Meister [Becker] und Maas. [Le pendant du prfc6dant, meme objet [un passage], par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 76 Maße: 1 Schuh hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Transakt.: Verkauft (15.30 fl für die Nrn. 76 und 77) Käufer: Hoym 1779/09/27 FRNGL 0187 Becker I Eine baumigte Landschaft, in der Manier des Huysmanns. [Un pay sage parseme d'arbres, dans le gout de Huysmanns.] I Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 1 Schuh 7 Zoll breit Transakt.: Verkauft (7.15 fl) Käufer: Kaller 1779/09/27 FRNGL 0685 Becker I Eine Landschaft in niederländischer Manier. [Un paysage dans le gout Flamand.] I Pendant zu Nr. 686 Maße: 8 Vi Zoll hoch, 10 Zoll breit Transakt.: Verkauft (2.30 fl für die Nrn. 685 und 686) Käufer: Mergenbaum 226
GEMÄLDE
1779/09/27 FRNGL 0686 Becker I Der Compagnon zu obigem, von nemlichem Meister [Becker] und Maas. [Le pendant du precedent, par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 685, "Eine Landschaft" Maße: 8 Vi Zoll hoch, 10 Zoll breit Transakt.: Verkauft (2.30 fl für die Nrn. 685 und 686) Käufer: Mergenbaum 1779/09/27 FRNGL 0812 Becker I Eine angenehme kleine Landschaft mit Vieh. [Un joli petit paysage avec du betail.] I Maße: 7 Vi Zoll hoch, 9 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (3.45 fl) Käufer: Dr Siegler 1779/09/27 FRNGL 0846 Becker I Eine gebirgigte Landschaft mit einem Wasserfall und Vieh, staffirt von Becker. [Un paysage couvert de montagnes avec un cataracte & du betail, les figures par Becker.] I Maße: 1 Schuh 2 Zoll hoch, 1 Schuh 5 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (12 fl) Käufer: Dehnhard 1782/09/30 FRAN 0263 William Becker I Das Gegenbildchen, ein gar schön dazu acompagnirtes Landschäftchen mit artigen Figuren, von William Becker, nehmliches Maas. [Le pendant du precedant, tres beau paysage avec de jolies figures, par Guillaume Becker.] I Pendant zu Nr. 262 von Monogrammist B.P. Maße: 8 Vi Zoll hoch, 11 Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (22.30 fl für die Nrn. 262 und 263) Käufer: Schalck 1784/08/02 FRNGL 0178 Joh. Wilhelm Becker I Eine plaisant und meisterhaft verfertigte Landschaft. I Maße: 12 Zoll breit, 9 Vi Zoll hoch Verkäufer: D Transakt.: Verkauft (2.45 fl) Käufer: von Schmidt 1784/08/02 FRNGL 0246 Becker I Eine sehr natürlich gemahlte Landschaft, von Becker, im Wynands Geschmack. I Maße: 11 Zoll breit, 9 Zoll hoch Verkäufer: D Transakt.: Verkauft (2 fl) Käufer: Schäfer 1784/08/02 FRNGL 0387 J. Wilh. Becker I Zwey angenehme Landschaften. I Diese Nr.: Eine angenehme Landschaft Maße: 9 Zoll breit, 7 Vi Zoll hoch Anm.: Die Lose 387 und 388 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: D Transakt.: Verkauft (6 fl für die Nrn. 387 und 388) Käufer: Mövius 1784/08/02 FRNGL 0388 J. Wilh. Becker I Zwey angenehme Landschaften. I Diese Nr.: Eine angenehme Landschaft Maße: 9 Zoll breit, 7 Vi Zoll hoch Anm.: Die Lose 387 und 388 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: D Transakt.: Verkauft (6 fl für die Nrn. 387 und 388) Käufer: Mövius 1784/08/02 FRNGL 0524 Wilhelm Becker I Zwey meisterhaft ausgeführte Brandstücke. I Maße: 15 Zoll breit, 11 Vi Zoll hoch Transakt.: Verkauft (15 fl) Käufer: Leonhardi 1784/08/02 FRNGL 0541 Joh. Wilh. Becker I Zwey angenehme mit guten Licht und Schatten meisterhaft ausgeführte felsigte Landschaften. I Diese Nr.: Eine angenehme mit guten Licht und Schatten meisterhaft ausgeführte felsigte Landschaft Maße: 12 Vi Zoll breit, 10 Zoll hoch Anm.: Die Lose 541 und 542 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (5.45 fl für die Nrn. 541 und 542) Käufer: Nothnagel 1784/08/02 FRNGL 0542 Joh. Wilh. Becker I Zwey angenehme mit guten Licht und Schatten meisterhaft ausgeführte felsigte Landschaften. I Diese Nr.: Eine angenehme mit guten Licht und Schatten meisterhaft ausgeführte felsigte Landschaft Maße: 12 Vi Zoll breit, 10 Zoll hoch Anm.: Die Lose 541 und 542 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (5.45 fl für die Nrn. 541 und 542) Käufer: Nothnagel 1784/08/02 FRNGL 0572 Wilhelm Becker I Zwey meisterhafte Landschaften, die eine ein Gewitter und die andere einen Regenguß vorstellend. I Diese Nr.: Eine meisterhafte Landschaft, ein Gewitter vorstellend Maße: 9 Vi Zoll breit, 7 Zoll hoch Anm.: Die Lose 572 und 573 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (10.30 fl für die Nm. 572 und 573) Käufer: Hacker
1784/08/02 FRNGL 0573 Wilhelm Becker I Zwey meisterhafte Landschaften, die eine ein Gewitter und die andere einen Regenguß vorstellend. I Diese Nr.: Eine meisterhafte Landschaft, einen Regenguß vorstellend Maße: 9 lA Zoll breit, 7 Zoll hoch Anm.: Die Lose 572 und 573 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (10.30 fl für die Nrn. 572 und 573) Käufer: Hacker
Beeldemaker, Adriaen Cornelisz.
1784/08/02 FRNGL 0629 Wilhelm Becker I Ein angenehmes kleines Landschäftgen von Wilhelm Becker. I Maße: 7 Zoll breit, 5 Zoll hoch Transakt.: Verkauft (2 fl) Käufer: Mövius
1763/01/19 FRJUN 0076 Beeldemaaker I Un semblable representant une chasse d'un lievre pas moins bien achevee que le precedent & de la meme grandeur. I Maße: hauteur 13 pouces, large 18 pouces Transakt.: Unbekannt (46 [?] fl für die Nrn. 75 und 76)
1790/08/25 FRAN 0341 Becker I Eine Landschaft. I Maße: hoch 17 Zoll, breit 20 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Unbekannt (12 fl)
Beckers, J. de [Nicht identifiziert] 1771/05/06 FRAN 0047 J. de Beckers I Ein Landschäftgen, auf Tuch. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 10 Zoll, breit 12 Zoll Verkäufer: Johann Friederich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt 1775/05/15 FRAN 0015 J. de Beckers I Ein Landschäftgen auf Tuch. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 10 Zoll, breit 12 Zoll Verkäufer: Johann Friedrich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt
Beckhorst [Nicht identifiziert] 1783/06/19 HBRMS 0163 Beckhorst, 16801 Vorne ein Bauren Vorhof mit einer sterbenden Kuh und einigen liegenden Ziegen, eine Bäurin milcht ein Schaaf. H[olz], g.R. [verguldeter Rahm] I Pendant zu Nr. 162 von J.H. Roos Mat.: auf Holz Maße: 7 Zoll hoch, 8 Zoll breit Inschr.: 1680 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt
Beecq, Jan Karel Donatus van 1794/00/00 HB AN 0075 Beecq I Zwei Seestücke in der Manier wie Storch. Auf stillem Meere schwimmen Kriegs- und andere Schiffe. Das lachende Ufer der Themse mit dem Greenwich-Hospital ist auf dem Zweyten abgebildet. I Diese Nr.: Ein Seestück in der Manier wie Storch. Auf stillem Meere schwimmen Kriegs- und andere Schiffe Maße: Höhe 24 Zoll, Breite 37 Zoll Anm.: Die Lose 75 und 76 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 HB AN 0076 Beecq I Zwei Seestücke in der Manier wie Storch. Auf stillem Meere schwimmen Kriegs- und andere Schiffe. Das lachende Ufer der Themse mit dem Greenwich-Hospital ist auf dem Zweyten abgebildet. I Diese Nr.: Ein Seestück in der Manier wie Storch. Auf stillem Meere schwimmen Kriegs- und andere Schiffe. Das lachende Ufer der Themse mit dem GreenwichHospital ist auf diesem abgebildet Maße: Höhe 24 Zoll, Breite 37 Zoll Anm.: Die Lose 75 und 76 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt
Beeldemaker 1763/11/09 FRJUN 0012 Beltmaker\ L'Adoration des Bergers avec plusieurs figures. I Maße: hauteur 10 Vi pouces, largeur 8 pouces Transakt.: Verkauft (5.45 fl) Käufer: von Lauterbach 1778/08/29 HBTEX 0072 Beldemaacker I Ein mit seiner Frau am Tische sitzend und speisender Landmann. I Maße: Höhe 1 Fuß 5 Zoll, Breite 1 Fuß 2 Zoll Transakt.: Unbekannt
1763/01/19 FRJUN 0075 Beeldemaaker I Une chasse au renard avec plusieurs chiens, tres bien executee. I Maße: hauteur 13 pouces, large 18 pouces Transakt.: Unbekannt (46 [?] fl für die Nrn. 75 und 76)
1764/03/12 FRKAL [A]0027 Beltemaaker I Eine Fuchs=Hatz von Beltemaaker. I Transakt.: Verkauft (7.32 fl) Käufer: Pfr Bechthold 1764/05/14 BOAN 0324 Beldemacher I Un Tableau de cinq pieds neuf pouces de largeur, quatre pieds trois pouces de hauteur, representant des Brebis & des Chevres, peint par Beldemacher. [Ein stück Verschiedene geissen und schaaf in Lebensgröße Vorstellend von Beldemacher.] I Maße: 5 pieds 9 pouces de largeur, 4 pieds 3 pouces de hauteur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (34 Rt) Käufer: Doussetti 1765/00/00 FRRAU 0183 Beldenmacker I Ein Schaaf, zwey Ziegen, und ein Bock, natürlicher Grösse; Diese Figuren sind so geschickt verfertiget, als man solche in Natur nur sehen kan. Auf Tuch gemahlt. Une brebis, deux chevres & un bouc d'une grandeur naturelle. Ces figures sont si habilement faites, qu'il semble qu'on les voit vivantes. Peint sur de la toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 4 Schuh 3 Zoll, breit 5 Schuh 9 Zoll Anm.: Im Exemplar AAP wurde der Name "Beldenmacker" in "Beldemacker" korrigiert. Transakt.: Unbekannt 1765/03/27 FRKAL 0009 Beeldemaaker I Deux beaux tableaux representant, Tun la chasse du renard, l'autre celle d'un lievre, avec plusieurs chiens. I Maße: hauteur 24 pouces, largeur 34 pouces Transakt.: Verkauft (15 fl) Käufer: Kaller 1765/03/27 FRKAL 0010 Beeldemaaker I Deux autres pieces du meme Maitre [Beeldemaaker] avec des chiens. I Maße: hauteur 17 pouces, largeur 23 pouces Transakt.: Verkauft (7.15 fl) Käufer: Kaller 1776/00/00 WZTRU 0227 Beeidewacker I Ein Stück 1 Schuhe, 4 Zoll hoch, 2 Schuhe, 3 Zoll breit, bezeichnet mit dem Namen Beeidewacker, vorstellend eine angenehme Landschaft mit 3 verschiedenen Colorirten Windhunden: in diesem Stücke ist sowohl die correcte Zeichnung als angenehme Colorit best möglichst observiret worden. I Maße: 1 Schuhe 4 Zoll hoch, 2 Schuhe 3 Zoll breit Inschr.: Beeidewacker (bezeichnet) Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (16 fl Schätzung) 1779/03/05 HBRMS 0004 Beeldemaker I Zwey Landschaften mit Jäger, Hunde und geschossenes Wild, plaisante Mahlerey. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Jäger, Hunde und geschossenes Wild, plaisante Mahlerey Anm.: Die Lose 4 und 5 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1779/03/05 HBRMS 0005 Beeldemaker I Zwey Landschaften mit Jäger, Hunde und geschossenes Wild, plaisante Mahlerey. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Jäger, Hunde und geschossenes Wild, plaisante Mahlerey Anm.: Die Lose 4 und 5 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0227 Beeidewacker I Ein Stück 1 Schuhe, 4 Zoll hoch, 2 Schuhe, 3 Zoll breit, worauf der Name Beeidewacker stehet, zeiget eine angenehme Landschaft mit 3 verschiedenen kolorirten Windhunden: an diesem Stücke ist die beßte Zeichnung und angenehmste Färbung zu bewundern. I Maße: 1 Schuhe 4 Zoll hoch, 2 Schuhe 3 Zoll breit Inschr.: Beeidewacker (signiert) Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
227
1790/08/25 FRAN 0169 Beeldenmaker I Eine Landschaft mit einigen Hunden. I Maße: hoch 18 Zoll, breit 21 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (3.45 fl) Käufer: Secr Schulz 1790/08/25 FRAN 0440 BeeIdemaker I Zwey Stück mit Hunde. I Diese Nr.: Ein Stück mit Hunde Maße: hoch 22 Zoll, breit 33 Zoll Anm.: Die Lose 440 und 441 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (7 fl für die Nrn. 440 und 441) Käufer: Kaller 1790/08/25 FRAN 0441 Beeldemaker I Zwey Stück mit Hunde. I Diese Nr.: Ein Stück mit Hunde Maße: hoch 22 Zoll, breit 33 Zoll Anm.: Die Lose 440 und 441 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (7 fl für die Nrn. 440 und 441) Käufer: Kaller 1793/00/00 HBMFD 0005 Beeldemacker I Landschaft, mit Thiere beinah in der Grösse von ein viertheil der Natur. Im Vordergrunde eine Kuh von der Seite zu sehn, und von ihr ein Kalb, machen die Hauptparthie des Gemäldes; diese Gruppe ist durch einen schönen Lichtstrahl beleuchtet. Im Schatten dieser Thiere liegt eine zweyte Kuh. I Pendant zu Nr. 6 Mat.: auf Leinwand Maße: 4 Fuss 1 Zoll hoch, 3 Fuss 2 Zoll breit Verkäufer: Pierre Laporterie Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 HBMFD 0006 Beeldemacker I Das Gegenstück. Eine liegende Kuh wiederkäuet ihr genossenes Mittagsfutter. Neben ihr steht ein Stier en Profil, sein Kopf nach vorne herwendend, formiert den Hintergrund, und contrastirt vortreflich mit der starck beleuchteten Kuh. Im hintern noch drey Schaafe. Der Maler hat nicht vergessen, ganz im Vordergrunde einen Hund auf eine glückliche Art anzubringen der sein Liebling war, und der gewöhniglich auf den Bildern als sein Nähme diente. Dieser Meister wusste besonders die Ländliche Natur auf eine getreue und glückliche Art darzustellen. Obgleich er anfangs nur Jachten malte, so kann man doch weder von Berghem noch von Potter besser dargestellte Thiere sehen; gefällig und voller Leben. I Pendant zu Nr. 5 Mat.: auf Leinwand Maße: 4 Fuss 1 Zoll hoch, 3 Fuss 2 Zoll breit Verkäufer: Pierre Laporterie Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0046 Beeldemaker I Hirten und Vieh in einer waldigten Gegend. Hinten Rudera, von Beeldemaker. I Maße: Hoch 22 Zoll, breit 31 Zoll Transakt.: Unbekannt
Beeldemaker, Adriaen Cornelisz. (und Berchem, N.P.) 1794/00/00 HB AN 0143 J. Beeldemaker; Bergheem I Neben einem von Bäumen umschatteten Wasser reitet ein Frauenzimmer auf einem Esel und treibt einen zweyten neben sich her. I Maße: Höhe 9 Vi Zoll, Breite 10 Vi Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt
Beelt, Cornelis 1788/10/01 FRAN 0009 Κ. Beelt I Eine Weberwerkstatt, wohlausgeführt in der Art von Rembrant, von K. Beelt, die Gemälde dieses Meisters sind wenig bekannt. I Maße: 24 Zoll hoch, 29 Zoll breit Transakt.: Verkauft (22.30 fl) Käufer: Spitalmeister
Beer 1764/03/12 FRKAL [A]0045 Beer I Zwey Stück mit todten Vögel von Beer. I Transakt.: Verkauft (5.20 fl) Käufer: Bender
Beermann [Nicht identifiziert] 1774/11/03 HBNEU 0018 Beermann I Ein See=Stück mit vielen Schiffen, auf Leinewand gemahlt. I Mat.: auf Leinwand Verkäufer: Ritter Transakt.: Verkauft (10 M) Käufer: Lilye S
Beerstraten 1778/10/23 HBKOS 0005 Berstraten I Eine felsigte Italienische See=Küste, von Berstraten, auf dito [Leinwand]. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 32 Zoll, breit 46 Zoll Transakt.: Unbekannt 1787/03/01 HBLOT 0020 Berenstraten I Ein Winterstück, wo sich viele Personen belustigen, besonders plaisant gemahlt. I Transakt.: Unbekannt (6.2 M) 1798/06/04 HBPAK 0246 Beerestraten I Ein Winterstück, vorstellend den äussersten Prospect eines Amsterdammer Thors. Auf dem Canal laufen eine Menge Menschen Schrittschuh. Fleißig und meisterhaft gemahlt. Auf Leinwand, schw. Rahm mit goldner Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 32 Zoll, breit 43 Zoll Transakt.: Unbekannt
Beert, Osias (der Ältere) 1797/06/13 HBPAK 0165 Boeldemackere 1695 I Alle zur Jagd dienlichen Hunde sind im Vordergründe dunkler Waldung. Das dahin fallende Licht wirket sehr stark auf die Lebhaftigkeit dieser Thiere, welche so schön wie Hamilton gemahlt sind. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Alle zur Jagd dienlichen Hunde sind im Vordergrunde dunkler Waldung Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 19 Zoll, breit 25 Zoll Inschr.: 1695 (datiert?) Anm.: Die Lose 165 und 166 wurden zusammen katalogisiert. Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt 1797/06/13 HBPAK 0166 Boeldemackere 1695 I Alle zur Jagd dienlichen Hunde sind im Vordergrunde dunkler Waldung. Das dahin fallende Licht wirket sehr stark auf die Lebhaftigkeit dieser Thiere, welche so schön wie Hamilton gemahlt sind. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Alle zur Jagd dienlichen Hunde sind im Vordergrunde dunkler Waldung Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 19 Zoll, breit 25 Zoll Inschr.: 1695 (datiert?) Anm.: Die Lose 165 und 166 wurden zusammen katalogisiert. Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt 1799/08/09 HBPAK 0027 Beeldenmaaker I Eine Landschaft, welche eine Jagdparthie vorstellet, mit zwey Jäger und verschiedene Hunde mit Wild. Auf Leinwand, goldn. Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 19 Zoll, breit 25 Zoll Transakt.: Unbekannt 228
GEMÄLDE
1783/06/19 HBRMS 0138 O. Beert I Ein Blumenstück. K[upfer], g.R. [verguldeter Rahm] I Mat.: auf Kupfer Maße: 2 Fuß 3 Zoll hoch, 1 Fuß 9 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1787/00/00 HB AN 0438 O. Beert f . I Auf einem Tische stehen in einem Topfe eine Menge Blumen, Tulpen, Rosen, u.s.w. auch befinden sich sehr viele Insekten auf dem Tische. Sehr fleißig gemahlt. A.K. [Auf Kupfer] g.R. [in goldenem Rahm] ί Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 27 Zoll, breit 21 Zoll Inschr.: O. Beert f. (signiert) Transakt.: Verkauft (6.4 M) Käufer: Bertheau
Beest, Sybrand van 1790/09/10 HBBMN 0067 S. V. Beest I Ein holländischer Marktplatz, worauf mehr denn hundert zählbare Figuren; ein ganz ausnehmend schönes Gemähide. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 24 Vi Zoll, breit 41 Zoll Transakt.: Verkauft (40 M) Käufer: Ego
Bega, Cornelis Pietersz. 1716/00/00 FRHDR 0142 Bega I Von Bega ein Bauern Ausruff. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (45)
1716/00/00 FRHDR 0183 Bega I Von Bega ein Hollandisches Bauernstuck. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (90) 1744/05/20 FRAN 0205 Corn. Bega I 1 Schöne Bauern Compagnie. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 2 Zoll, Breite 1 Schuh 1 Zoll Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1764/08/25 FRAN 0261 Cornell Bega I Des Paisans. I Maße: haut 1 pied 3 pouces sur 1 pied 1 pouce de large Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1766/07/28 KOSTE 0035 Cornel. Bega I Ein conversations= stück. I Transakt.: Verkauft (13.15 Rt für die Nrn. 35 und 36) Käufer: Schmitz 1766/07/28 KOSTE 0036 Cornel. Bega I Dito eins [conversations=stück], beyde von Cornel. Bega. I Anm.: Der Titel bezieht sich auf die Nrn. 35 und 36. Transakt.: Verkauft (13.15 Rt für die Nrn. 35 und 36) Käufer: Schmitz 1768/07/00 MUAN 0242 Bega (Cornelius) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/08/16 KOAN 0024 Corlelius Rega I Zwey Conversations=Stücke von Corlelius Rega [sie] mit Rahmen. I Maße: Höhe 1 Fuß 5 Zoll, Breite 1 Fuß 3 Zoll Verkäufer: Freyherr von Kaas Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0166 ComeilBega en 16611 Un aveugle jouant du violon, acompagne de deux personnes qui chantent. Marque du No. 242. I Maße: 1. p. Vi. p. de haut sur 11. pouces de large Inschr.: 1661 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1775/04/12 HB NEU 0033 Bega I Eine alte Frau, die sich wärmet auf einer Feuer=Kieke, der Compagnon ein junges Weib mit Rose in der Hand, auf Holz. I Diese Nr.: Eine alte Frau, die sich wärmet auf einer Feuer=Kieke; Pendant zu Nr. 34 Mat.: auf Holz Anm.: Die Lose 33 und 34 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1775/04/12 HB NEU 0034 Bega I Eine alte Frau, die sich wärmet auf einer Feuer=Kieke, der Compagnon ein junges Weib mit Rose in der Hand, auf Holz. I Diese Nr.: Ein junges Weib mit einer Rose in der Hand; Pendant zu Nr. 33 Mat.: auf Holz Anm.: Die Lose 33 und 34 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/05/16 HBBMN 0008 v. Gege I Ein Niederländischer Bauer, in der einen Hand eine Kanne, und in der andern ein Glas haltend. [Diese Stücke sind alle gut gefaßt, theils schwarze Rähmen mit goldenen Leisten, theils goldene Rähmen; auch ist die Höhe und Breite ohne Rähmen gemessen.] I Maße: 33 Zoll hoch, 28 Zoll breit Anm.: Die Angaben in eckigen Klammem im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 24 und beziehen sich wahrscheinlich auf die Nrn. 1 bis 24. Transakt.: Unbekannt 1778/05/30 HB KOS 0132 Bega I Ein sitzendes Mädgen, so an einer Blumen riechet, und eine alte Frau, so sich über dem Feuer= Stof wärmet, sehr lebhaft gemalt von Bega, auf Holz. [Diese Gemählde sind alle mittlere Grösse, können also an alle Plätze gebraucht werden - dieweilen keine Theilen=Stück, dabey befindlich] I Diese Nr.: Ein sitzendes Mädgen, so an einer Blumen riechet Mat.: auf Holz Anm.: Die Lose 132 und 133 wurden zusammen katalogisiert. Die Angaben in eckigen Klammem im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 150 und beziehen sich auf die Nm. 1 bis 150. Verkäufer: Dr Friederici Transakt.: Verkauft (7.14 Μ für die Nrn. 132 und 133) Käufer: Ehrfenreich] 1778/05/30 HBKOS 0133 Bega I Ein sitzendes Mädgen, so an einer Blumen riechet, und eine alte Frau, so sich über dem Feuer= Stof wärmet, sehr lebhaft gemalt von Bega, auf Holz. [Diese Ge-
mählde sind alle mittlere Grösse, können also an alle Plätze gebraucht werden - dieweilen keine Theilen=Stück, dabey befindlich] I Diese Nr.: Eine alte Frau, so sich über dem Feuer=Stof wärmet Mat.: auf Holz Anm..· Die Lose 132 und 133 wurden zusammen katalogisiert. Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 150 und beziehen sich auf die Nm. 1 bis 150. Verkäufer: Dr Friederici Transakt.: Verkauft (7.14 Μ für die Nm. 132 und 133) Käufer: Ehr[enreich] 1778/10/30 HBKOS 0086 Bega I Eine Bäurinn, so ein Glas Genevre in der Hand hält, sitzend vor dem Tische, hinter derselben ihr Mann, der sie um den Hals hält, worüber sie lachet, auf Holz. I Mat. : auf Holz Maße: hoch 10 Zoll, breit 8 Zoll Transakt.: Unbekannt (15 M) 1778/10/30 HBKOS 0178 Bega I Ein Bördel, ebenfals sehr gut gemahlt, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 26 Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0184 Sega I Ein Bauer, auf einem Lehnstuhle sitzend und die Tabackspfeife in der Hand haltend, spricht mit seiner gegen über sitzenden Frau, die ihm aufmerksam zuhöret. Auf Holz. [Un paysan assis dans un fauteuil, parle la pipe ä la main ä sa femme, assise vis-ä-vis & attentive ä l'ecouter. Sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 9 Zoll hoch, 6 Vi Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/09/27 FRNGL 0264 Cornelius Bega, genannt Pequin I Ein sehr gut und wohl ausgeführtes Bauemstück. [Des paysans, piece trfes bien executee, par Cornelius, dit Pequin.] I Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 2 3 / 4 Zoll breit Transakt.: Verkauft (39.30 fl) Käufer: Schütz 1781/09/10 BNAN 0016 C. Bega I Bauern, die in Charten spielen; neben ihnen eine stehende Frau, deren Oberleib nur mit dem Hemde bedeckt ist. I Mat.: auf Holz Maße: 19 Zoll hoch, 15 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1782/09/30 FRAN 0071 Cornelius Bega I Ein bei einem Kaminfeuer schlafender Bauer. [Un paysan endormi pres d'une chemiηέβ, par Corneille Bega.] I Maße: 4 Vi Zoll hoch, 5 Vi Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (4 fl) Käufer: Prinz von D[essau] 1785/05/17 MZAN 0909 Cornelius Bega I Ein Bauer mit dem Glase in der Hand, und eine Bäuerinn welche ihm einschenket von Cornelius Bega. [Un paysan ayant un verre ä boire dans la main, & une paysanne qui luy remplit le verre.] I Maße: 1 Schuh 5 Zoll hoch, 1 Schuh 1 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (4 fl) Käufer: Becker Glöckner ex comissione 1787/00/00 HB AN 0377 Cornelius Bega I Ein singender Bauer sitzt an einem Tische, und hält einen leeren Weinrömer in der Hand; ein anderer rauchender steht daneben. Eine Frau kömmt von hinten zur Thür herein. Dieses ist ein sehr schönes kleines Cabinetstück, von einen sanften und leichten Pinsel voller Anmuth und Reiz, von angenehmem Colorit, richtiger Zeichnung und edler Wahl und Composition. A.K. [Auf Kupfer] s.R. [in schwarzem Rahm] I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 8 Vi Zoll, breit 6 Zoll Transakt.: Verkauft (9.4 M) Käufer: Ekhard 1787/00/00 HB AN 0657 Cornelius Bega I Verschiedene Bauern sitzen an einem Tische, und spielen Karten, davon einer einem neben ihm stehenden Bauermädchen seine Karten zeigt; zwey andere Toback rauchende Bauern sitzen am Ende des Tisches, und sehen dem Spiele zu. Im Vordergrunde ein Mädchen, das mit einem Krug spielt. Im Hintergrunde ein Bauer, welcher sich mit dem neben ihm stehenden Weibe unterredet. Alles empfängt sein Licht von einer geöffneten Thür. Die Composition ist reich und edel, die Zeichnung richtig, der Ausdruck natürlich, das Colorit zart und geschmolzen, der Pinsel sanft und meisterhaft, so daß dieses ein sehr schönes Cabinetstück für Kenner ist. A.H. [Auf Holz] s.R.g.L. [in schwarzem GEMÄLDE
229
Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 20 Zoll, breit 16 Zoll Transakt.: Verkauft (40 M) Käufer: Schoen
Holz, von Bega. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Zoll 3 Lin., breit 9 Zoll 6 Lin. Transakt.: Unbekannt
1788/06/12 HBRMS 0036 Bega I Eine ländliche Familienscene: die Mutter, neben welcher die Wiege steht, hält mit gefaltenen Händen ihr Kind an sich, hinter ihr lieset der Mann in einem Blatte, etwas entfernter sitzt ein Bauer, der sein Pfeifchen raucht. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Zoll, breit 13 Zoll Transakt.: Unbekannt
1793/09/18 HBSCN 0054 Bega I Das Innere einer Landschenke mit verschiedenen Personen, die sich mit Schmauchen und Reden unterhalten; ein alter Bauer careßiret mit der sich weigernden Aufwärterin, umher viele Nebensachen. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 21 Zoll, breit 19 Zoll Transakt.: Unbekannt
1788/06/12 HBRMS A0025 Bega I Eine Bauerfrau und zwey lustige Bauern, trinken und rauchen Toback. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Vi Zoll, breit 9 Ά Zoll Transakt.: Unbekannt 1788/10/01 FRAN 0052 Bega I Das Inwendige eines Haußes mit Figuren sehr schön. I Maße: 12 V2 Zoll hoch, 10 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (6.15 fl) Käufer: Prehn 1790/01/07 MUAN 0087 Cornel. Bega I Das Geräufe, ein niederländisches Stück, auf Holz, in einer vergoldeten Ram. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 8 Zoll, Breite 2 Schuh 2 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/05/20 HBSCN 0142 C. Bega I Lustige, Zechende und singende Bauern im Innern eines Landhauses. Sehr meisterhaft gemahlt auf H[olz], G.R. [Goldnen Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 20 Zoll, breit 15 Zoll Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (15.4 M) Käufer: Bostelmann mit L 1790/08/25 FRAN 0300 Cornel Bega I Eine Gesellschaft von gemeinem Volk. I Maße: hoch 21 Zoll, breit 24 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (8 fl) Käufer: Kaller 1790/08/25 FRAN 0374 Bega I Ein Bauer in einem Zimmer und seine Frau mit einem Kind auf dem Schoos an einem Tisch mit Essen sizend. I Maße: hoch 13 Zoll, breit 11 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (16.15 fl) Käufer: Hüsgen 1791/09/21 FRAN 0042 Bega I Eine deutsche Jüdinn, mit einem Pelz angekleidet, sitzt in einem Armstuhl vor einem Tische, welcher mit Gold und Silber bedeckt ist; dieses Gemälde, welches eben so wie das folgende gestochen worden, ist sehr wohl geendiget und macht eine wahre und reizende Wirkung. I Pendant zu Nr. 43 Transakt.: Verkauft (60 fl für die Nrn. 42 und 43) Käufer: G Η R Scheibler
1796/00/00 BSAN 0030 Corneille Bega I L'interieur d'un cabaret Flamand. On y voit un paysan qui tient d'une main un pot, et de l'autre un verre ä pied. Sa physionomie designe une joie bacchique Un autre paysan regarde par dessus ses epaules. A cote du buveur, est une table sur laquelle posent une pipe et une cassolette pleines de charbons allumes. I Mat.: auf Leinwand Maße: Haut de 10 pouces; large de 8 pouces. Verkäufer: Merian l'aine Transakt.: Unbekannt (4) 1796/08/00 HBPAK 0035 Corn. Bega I Zwey Bauern, welche Karten spielen, denen ein dritter danebenstehender zusieht. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 12 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/08/00 HBPAK 0036 Corn. Bega I Zechende und schon halb berauschte Landleute. Im Innern eines Hauses ein Capital=Gemählde von neun ganzen Figuren; mit vielen Nebenwerken. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 28 Zoll, Breite 23 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/02/27 HBPAK 0086 Bega I Eine Dame, welche bey Tische sitzet und trinket. Zur Rechten stehet ein Bauer. Ganz herrlich gemahlt. Auf Holz, im goldnen Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Zoll, breit 11 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/08/10 MM AN 0285 Cornel Bega I Eine alte Frau, wie sie ihr Geld zählt, von Comel Bega. I Mat. : auf Leinwand Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (30 fl Schätzung) 1799/00/00 LZAN 0025 Begua Corneille I Un Paysage rembruni dans le gout de Claude Lorrain; vaches et chevres sous la conduite d'une Bergere, tenant sur ses genoux le petit de sa chienne fidelle; le tout d'un tres-bon ton de couleur. Les animaux sont superieurement bien rendus. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hauteur 22 pouces, largeur 27 pouces Anm.: Der Künstler ist vermutlich Abraham Begeyn und nicht Cornells Bega. Transakt.: Unbekannt (30 Louis Schätzung)
1791/09/21 FRAN 0043 Bega I Der Compagnon von eben demselben [Bega]. Der Mann der obigen Frau mit einem Pelz und die Hände in der Muffe in einem Armstuhl sitzend und vor sich eine Sanduhr; es ist eben so wohl geendiget als das vorige. I Pendant zu Nr. 42 Transakt.: Verkauft (60 fl für die Nrn. 42 und 43) Käufer: G Η R Scheibler
1799/00/00 WZAN A0122 Cornelius Bega I Zwey Holländer Stückchen, von Cornelius Bega. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Holländer Stückchen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 2 Zoll breit 1 Schuh Anm.: Die Lose A122 und A123 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1791/09/26 FRAN 0116 Corn. Bega I Eine spielende Bauerngesellschaft, mit Ausdruck und Fleiß gemalt von der Meisterhand des Com. Bega. I Maße: 8 Zoll breit, 10 Zoll hoch Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt
1799/00/00 WZAN A0123 Cornelius Bega I Zwey Holländer Stückchen, von Cornelius Bega. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Holländer Stückchen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 2 Zoll breit 1 Schuh Anm.: Die Lose A122 und A123 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1791/09/26 FRAN 0268 Com. Bega I Die Jugend liebkoset das Alter beym Schein eines Lichts, ein würkend fleißiges Bild von Corn. Bega. I Maße: 24 Zoll hoch, 18 Zoll breit Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt
1800/00/00 BLBOE 0051 Bega I Ein Leyermann und ein Bänkelsänger vor einem Bauernhause. Einige Bauern hören zu. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt
1792/07/28 HBSCN 0094 C. Bega I Lustige, zechende und singende Bauern im Innern eines Landhauses. Sehr meisterhaft gemahlt. Auf H[olz], G.R. [Goldnen Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 20 Zoll, breit 15 Zoll Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0072 Bega I Einige lustige Bauren, im inneren ihres Hauses, ein schönes Gemähide von Bega. I Maße: Hoch 16 Zoll, breit 13 Zoll Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0246 Bega I Eine alte Frau auf dem Stuhl sitzend, welche eine Gans pflückt, sehr natürlich vorgestellt. Auf 230
GEMÄLDE
1800/00/00 FRAN2 0009 Begyn ? Comet.) I Eine schöne gebürgige Landschaft, welche mit einem Wasserfall durchschnitten ist; linker Seite im ersten Plan siehet man einen Mann, welcher über eine Holzbrücke geht, vor demselben ist mehreres Vieh auf der Weide. Dieses Stück ist von einem kecken Pinsel, und bestens behalten. I Mat.: auf Leinwand Maße: 24 Zoll hoch, 30 Zoll breit Anm.: Der Künstler ist vermutlich Abraham Begeyn und nicht Cornells Bega. Transakt.: Unbekannt 1800/00/00+ LZRST [0007] Com. Bega I Trinkende Bauern, nebst Musikanten. I Mat.: auf Leinwand Maße: 17 Zoll, breit, 20 Vi Zoll hoch Anm. : Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert
sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Rost Transakt.: Unbekannt
Bega, Cornells Pietersz. (Geschmack von) 1794/02/21 HB HEG 0132 Im Gusto von Bega I Ein Bauermädgen, welche vor einem sitzenden jungen Manne steht, reicht ihm ein Glas Genever hin indem er ihr die Hand auf der Achsel legt; ein Krug, Feuerfaß, Tobacksdose, Rauchtoback in Papier, und Pfeife; befinden sich auf dem nebenstehenden Tische. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 24 Zoll, breit 18 Zoll Transakt.: Unbekannt
Bega, Cornelis Pietersz. (Manier) 1778/10/30 HBKOS 0025 Bega I Einige discurirende Bauren, auf Holz, in der Manier von Bega. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 11 Zoll, breit 9 Zoll Transakt.: Unbekannt
Begeyn, Abraham 1764/03/12 FRKAL 0003 Bega I Une jolie piece avec des chardons & des Insectes bien peint. I Maße: hauteur 15 V2 pouces, largeur 12 pouces Transakt.: Unbekannt (22.30 fl) 1766/07/28 KOSTE [A]0019 Begein I Ein Viehe stücklein auf Holtz, worauf eine Frau so ihre Fuß waschet von Begein Schular [sie] von Berchem. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt (15 Rt) 1768/07/00 MUAN 0572 Begyn (Abraham) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0196 Begyn I Un Paysage dans lequel un homme est endormi, & ä l'entour duquel sont plusieurs singes, qui gambadent, & badinent. Peint sur bois marque du No. 572. I Mat.: auf Holz Maße: 1. p. 8 Vi. p. de haut sur 2. p. 2 Vi. p. de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1777/04/11 HB NEU 0014 M. Bega I Ein Frucht= und Blumenstück. I Diese Nr.: Ein Fruchtstück Anm.: Die Lose 14 und 15 wurden zusammen katalogisiert. Der Name des Künstlers ist angegeben als "M. Bega", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt 1777/04/11 HBNEU 0015 M. Bega I Ein Frucht= und Blumenstück. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Anm.: Die Lose 14 und 15 wurden zusammen katalogisiert. Der Name des Künstlers ist angegeben als "M. Bega", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt 1778/03/28 Unbekannt
HBSCM
0080
Bega I Ein Still=Leben. I Transakt.:
1778/08/29 HBTEX 0034 A. Begyn I Bäume und Gesträuche, vornemlich aber Disteln mit Vögel, Papilons und Insecten, durchdringend und ausführlich. I Maße: Höhe 3 Fuß 7 Zoll, Breite 3 Fuß Transakt.: Unbekannt 1778/10/30 HBKOS 0045 A. Beger I Ein Stilleben mit Früchten, sehr natürlich gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 12 Zoll, breit 20 Zoll Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0095 Begyn I Ein todter Seekrebs auf dem Rücken liegend. [Un homard mort, etendu sur le dos.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 7 Zoll hoch, 2 Fuß 2 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0096 Begyn I Eine Schildkröte kriecht unter einem Distelstocke und Mohnblumen hervor. [Une tortue fort d'entre des pavots & des chardons.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 7
Zoll hoch, 2 Fuß 2 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0292 Begyn I Ein Bauer mit seinem auf einem Esel reitenden Weibe halten mit einer Heerde Kühe, Ziegen und Schafe vor einem ländlichen Hause. Hohe Bäume stehen dahinter. Zur Linken sieht man die gebirgichte Ferne. [Un paysan & sa femme montee sur son äne s'arretent avec un troupeau de vaches, de chevres & de moutons devant une maison rustique, derriere laquelle sont de hauts arbres. A gauche on voit un lointain montagneux.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 1 Zoll hoch, 2 Fuß 7 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1786/10/18 HBTEX 0028 Begyn I Ein schwarz und weiss gefleckter Windhund, zur Rechten eine Disteltaube. Lebhaft gemahlt auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 23 Zoll 9 Linien, breit 29 Zoll Transakt.: Unbekannt 1787/00/00 HB AN 0335 Abraham Begyn I A m Fuße eines Berges bey einem kleinen Wasser stehen unterschiedliche Kräuter, wobei sich Frösche, Schlangen und andere Insecten befinden. Auf das allematürlichste und schönste gemahlt. A.H. [Auf Holz] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Zoll, breit 9 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (10.4 M) Käufer: Tietjen 1790/04/13 HBLIE 0029 Begyn I Auf einem grau marmornen Tische, stehet eine mit Figuren gezierte Vase, worin eine Klapp=Rose auf das lebhafteste vorgellet [sie], welche mit verschiedenen Schmetterlingen und Insekten umgeben ist; vortreflich gemahlt. Auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 31 % Zoll, breit 25 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (1.5 M) Käufer: Ego 1790/08/13 HBBMN 0078 Begyn I In einer Vase, welche mit Figuren geziert en Basrelief; ist eine Mond=Rose, nach der Natur sehr lebhaft abgebildet, um welche einige Schmetterlinge fliegen. Auf Leinwand, in schwarz gebeitzten Rahm mit vergoldeten Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 32 Zoll, breit 24 Zoll Transakt.: Verkauft (2.6 M) Käufer: Ego 1793/00/00 NGWID 0032 Abraham Beckin I Ein sehr fleißig ausgearbeitetes Diestelstück mit Schmetterlingen und andern Beywesen, von Abraham Beckin. I Maße: 4 Schuh 2 Zoll hoch, 3 Schuh 9 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1795/11/14 HBPAK 0092 Begayen I Einige Bäume mit Most bewachsen, unten am Fuße Schlangen, Schmetterlinge, Schampion, Blumen ec. Auf Leinwand. Schwarz. Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll, breit 20 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0160 Bega I Zwey ländliche Gegenden mit Architectur; im Vordergrunde weiden Hirten ihr Vieh, in Lebensgrösse. Diesteln so gut wie Otto Marseus; zwey sehr gute Bilder. Auf Leinwand. Schwarzer Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Eine ländliche Gegend mit Architectur; im Vordergrunde weiden Hirten ihr Vieh Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll, breit 33 Zoll Anm.: Die Lose 160 und 161 wurden zusammen katalogisiert. Transakt. : Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0161 Bega I Zwey ländliche Gegenden mit Architectur; im Vordergrunde weiden Hirten ihr Vieh, in Lebensgrösse. Diesteln so gut wie Otto Marseus; zwey sehr gute Bilder. Auf Leinwand. Schwarzer Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Eine ländliche Gegend mit Architectur; im Vordergrunde weiden Hirten ihr Vieh Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll, breit 33 Zoll Anm.: Die Lose 160 und 161 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0012 Begin I Eine bergigte und waldigte Landschaft, zur rechten sieht man zwey Reuter, und einen Fußgänger in der Ferne auf dem Berge, am Fusse desselben ist ein Wasser, worauf sich ein Kahn mit Fischen befindet; am Ufer desselben im Vordergrunde sind einige Jäger mit ihren Flinten und Hunde, zur linken bemerkt man einen Herrn der vom Pferde abgestiegen ist, um sich mit einer Dame zu unterhalten, nebst noch vielen andern FiguGEMÄLDE
231
ren, alle in Lebensgrösse. Ein sehr gutes Gemähide. Auf Leinwand, goldenen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 26 Zoll, breit 38 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0227 Begin I Eine bergigte und waldigte Landschaft; zur rechten zwischen den Gebirgen ein Schloß, weiter herunter verschiedene Personen und Schafe; im Vordergründe ein Mädgen auf einem Esel, neben ihr steht ein Mann; zur linken ein Hirte mit Kühe, Schafe und Ziegen. Sehr gut gemahlt. Auf Holz, goldene Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 13 Zoll, breit 16 ιΛ Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0658 Abraham Cornel Bega I Zwey Landschaften mit Schaafen und Rindviehe, von Abraham Comel Bega. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 4 Schuh 6 Zoll breit 5 Schuh Anm.: Die Lose 658 und 659 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0659 Abraham Comel Bega I Zwey Landschaften mit Schaafen und Rindviehe, von Abraham Cornel Bega. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 4 Schuh 6 Zoll breit 5 Schuh Anm.: Die Lose 658 und 659 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Beham, Hans Sebald 1775/04/12 HBNEU 0035 H.S. Boem I Ein Bauer und eine Bäuerinn, so musiciren, auf Holz. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt 1775/05/08 HBPLK 0014 H.S. Böhm I Die Geburt Christi, auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 7 Zoll 6 Linie, Breite 6 Zoll 1 Linie Transakt.: Unbekannt (3 M) 1789/08/18 HB GOV 0056 Seb. Bcehm I Mana, das Christkind mit beyden Händen haltend, welches einen Apfel mit der linken Hand am Munde nimmt, w. c. auf einer Kupfer=Tafel fleißig gemahlt. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 10 % Zoll, breit 7 % Zoll Transakt.: Unbekannt 1790/08/13 HBBMN 0016 Hans Böhm I Ein altes Manns=Portrait mit Kragen. Brustbild. Auf Holz. S.R. [Schwarzen Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 19 Zoll, breit 17 Zoll Transakt.: Verkauft (1.2 M) Käufer: Eckhardt 1794/02/21 HBHEG 0091 Sebald Boehm I An einem Tische sitzt ein alter Mann, welcher mit der Hand, in der er eine Feder hält, auf zwey Bücher ruhet; vor ihm lieget ein geschriebener Wechsel, Pettschaft und Federmesser; nebenbey wiegt sein Sohn Goldstücke ab. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 21 Zoll, breit 43 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt
Beich, Daniel 1764/05/23 BOAN 0157 Beich de Munique I Deux Pai'sages avec des figures peintes par Beich de Munique. [Zwey landschaften mit figuren Vom alten Beich aus München.] I Diese Nr.: Un Pai'sage avec des figures Maße: 3 pieds 9 pouc. de largeur, 3 pieds 2 pouces de hauteur Anm.: Die Lose 157 und 158 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (27.30 Rt für die Nrn. 157 und 158) Käufer: Excellence frhr von Belderbusch 1764/05/23 BOAN 0158 Beich de Munique I Deux Pai'sages avec des figures peintes par Beich de Munique. [Zwey landschaften mit figuren Vom alten Beich aus München.] I Diese Nr.: Un Pai'sage avec des figures Maße: 3 pieds 9 pouc. de largeur, 3 pieds 2 pouces de hauteur Anm.: Die Lose 157 und 158 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (27.30 Rt für die Nrn. 157 und 158) Käufer: Excellence frhr von Belderbusch 232
GEMÄLDE
Beich, Joachim Franz 1740/00/00 AUAN 0018 Beich I 2. Landschafften vom Beich. I Maße: 2. Schuh hoch / 2. Schuh / 5 Zoll breit Transakt.: Unbekannt (30 fl) 1740/00/00 AUAN 0023 Beicht I 1. Grosse Landschafft vom Beicht seine erste Manier. I Maße: 4. Schuh hoch / 6. Schuh / 8. Zoll breit Transakt.: Unbekannt (75 fl) 1740/00/00 AUAN 0036 Beich I 2. Ovalische Landschafften / vom Beich seiner ersten Manier. I Format: oval Maße: 3. Schuh / 2. Zoll hoch / 2. Schuh / 9. Zoll breit Transakt.: Unbekannt (30 fl) 1740/00/00 AUAN 0059 Beich I 2. Landschafften vom Beich. I Maße: 3. Schuh / 1 . Zoll hoch / 3. Schuh / 9. Zoll breit Transakt.: Unbekannt (30 fl) 1742/08/01 BOAN 0389 Peick I Zwey Original Landschafften von Peick. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0390 Peick I Noch fünff kleine Original Landschafften von Peick. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0437 Peick I Eine Landschafft, worauff ein Engel mit Tobia reysend gemahlet ist. Original vom Peick. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0166 Peick I Deux Pai'sages, par Peick. I Maße: Hauts 3. pies 6. pouces, larges 2. pies 7. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0180 Peick I Le Voiage de Tobie par Peick. I Maße: Haut 2. pies 2. pouces, large deux pies 6. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0271 Peick I Deux paysages, par Peick. Couple. [Twee stuks door F. Biech Landschappen.] I Maße: Haut 1. ρίέ 2. pouces. larges 1. pied 6. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt (30) 1742/08/30 BOAN 0272 Peick I Deux paysages par Peick. Couple. I Maße: Haut 1. ρίέ 10. pouces. large 2. pids 4. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0273 Peick I Autre paysage, par le meme [Peick]. I Maße: Haut 1. pied 10. pouces, large 2. pi6s 8. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1763/00/00 BLAN 0060 Johann Franz Beich I Zwo Landschaften. Auf Leinewand gemahlt, 2 Fuß 1 Zoll hoch, und 2 Fuß 6 Zoll breit. Die erste Landschaft ist sehr frey und mit vieler Haltung gemahlt. Was die Composition anbetrift, so hat sie Beich in dem Geschmacke des Glaubers, und mit eben dem Fleiße, den dieser arbeitsame Mann bey feinen Beschäftigungen anwendete, ausgedruckt. Faistenberger hat auch oft den flüchtigen Geschmack zu seiner Nachahmung gewählet. In der anderen hat der Meister die Abendröthe in ihrer ganzen Pracht, reitzend und mit vieler Anmuth vorgestellt. Die Figuren darinn sind von Poußin entlehnet. [Text hier gekürzt] I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 1 Zoll hoch, und 2 Fuß 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 60 und 61 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Gottlieb Stein Transakt.: Unbekannt 1763/00/00 BLAN 0061 Johann Franz Beich I Zwo Landschaften. Auf Leinewand gemahlt, 2 Fuß 1 Zoll hoch, und 2 Fuß 6 Zoll breit. Die erste Landschaft ist sehr frey und mit vieler Haltung gemahlt. Was die Composition anbetrift, so hat sie Beich in dem Geschmacke des Glaubers, und mit eben dem Fleiße, den dieser arbeitsame Mann bey feinen Beschäftigungen anwendete, ausgedruckt. Faistenberger hat auch oft den flüchtigen Geschmack zu seiner Nachahmung gewählet. In der anderen hat der Meister die Abendröthe in ihrer ganzen Pracht, reitzend und mit vieler Anmuth vorgestellt. Die Figuren darinn sind von Poußin entlehnet. [Text hier gekürzt] I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: 2
Fuß 1 Zoll hoch, und 2 Fuß 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 60 und 61 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Gottlieb Stein Transakt.: Unbekannt 1764/05/29 BOAN 0355 Beich I Deux Pai'sages en figures & animaux de quatre pieds deux pouces de largeur, deux pieds dix pouces de hauteur, peint par Beich. [Zwey Landschaften mit figuren und thieren Von Beich.] I Diese Nr.: Un Pai'sage en figures & animaux Maße: 4 pieds 2 pouces de largeur, 2 pieds 10 pouces de hauteur Anm.: Die Lose 355 und 356 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (31.10 Rt für die Nm. 355 und 356) Käufer: Spenner [für] a Auar[ius] 1764/05/29 BOAN 0356 Beich I Deux Pai'sages en figures & animaux de quatre pieds deux pouces de largeur, deux pieds dix pouces de hauteur, peint par Beich. [Zwey Landschaften mit figuren und thieren Von Beich.] I Diese Nr.: Un Pai'sage en figures & animaux Maße: 4 pieds 2 pouces de largeur, 2 pieds 10 pouces de hauteur Anm.: Die Lose 355 und 356 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (31.10 Rt für die Nrn. 355 und 356) Käufer: Spenner [für] a Auar[ius] 1765/00/00 FRRAU 0234 Beich I Eine Landschafft in bestem Gusto und wohl angebrachter Estavage. Auf Tuch gemahlt. Un pai'sage dans le meilleur goüt & dont l'etalage est tres-bien aplique. Peint sur de la toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 2 Schuh 3 Zoll, breit 4 Schuh 3 Zoll Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRRAU 0235 Beich I Eine Landschafft von eben der Achtung. Von obiger Höhe und Breite auf Tuch gemahlt. Un autre pai'sage, qui mdrite la meme attention. Peint sur de la toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 2 Schuh 3 Zoll, breit 4 Schuh 3 Zoll Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0020 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0021 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0022 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0064 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0065 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0069 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0070 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog
wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0071 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0145 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0146 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0183 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0184 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0358 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0359 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0366 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0410 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0483 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0484 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt. : Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0485 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
233
1768/07/00 MUAN 0486 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0579 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0613 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0635 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0636 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0637 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0638 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0639 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0640 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0641 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0642 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0643 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0644 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog 234
GEMÄLDE
wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0645 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0646 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0647 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0648 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0649 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0650 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0651 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0652 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0653 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0654 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0655 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0656 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
1768/07/00 MUAN 0657 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0658 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0659 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0660 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0661 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0662 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0663 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0664 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0665 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0666 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0667 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0668 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0669 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog
wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0670 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0671 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0672 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0680 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0683 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0684 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0941 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1012 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1013 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1014 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1015 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1162 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
235
1768/07/00 MUAN 1163 Beich (Joachim) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1770/10/29 FRAN 0024 Beich I Eine Landschaft. I Maße: Hoch 14 Zoll. Breit 20 Zoll. Transakt.: Unbekannt 1771/05/06 FRAN 0012 Beich I Eine kleine Landschaft auf Tuch. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 10 Zoll, breit 13 Zoll Verkäufer: Johann Friederich Armand von Uffenbach Transakt.: Verkauft (1.12 fl) Käufer: Movius 1776/00/00 WZTRU 0160 Johannes Franciscus Beuch I Ein Stück 1 Schuhe, 8 Zoll hoch, 2 Schuhe, 3 Zoll breit von Johannes Franciscus Beuch, stellet vor eine angenehme bergigte Abendlandschaft, worinn eine angenehme Colorit und Practic beobachtet ist. I Pendant zu Nr. 161 Maße: 1 Schuhe 8 Zoll hoch, 2 Schuhe 3 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (8 fl Schätzung) 1776/00/00 WZTRU 0161 Johannes Franciscus Beuch I Compagnion zu Nro. 160 von eben der Practic und angenehmen Colorit des obigen Meisters [Johann Franciscus Beuch]. I Pendant zu Nr. 160 Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (8 fl Schätzung) 1776/00/00 WZTRU 0330 Jakobus Beuch I Ein Stück 6 Zoll hoch, 8 Zoll breit von Jakobus Beuch, eine mit einem alten Schlosse auf einem Berge liegend und mit vielen wohlausgeführten Figuren verfertigte Landschaft vorstellend, welche sehr wohl colorirt und fleißig ausgeführet. I Maße: 6 Zoll hoch, 8 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (8 fl Schätzung) 1778/09/28 FRAN 0454 Beuch I Eine Landschaft mit Waldung. [Un paysage couvert de bois.] I Pendant zu Nr. 455 Maße: 13 Zoll breit, 12 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (10 fl für die Nm. 454 und 455) Käufer: Weitsch 1778/09/28 FRAN 0455 Beuch I Der Compagnon, von dito [Beuch], nemliches Maaß. [Le pendant du pricident, par le meme [Beuch], meme hauteur & meme largeur.] I Pendant zu Nr. 454, "Eine Landschaft mit Waldung" Maße: 13 Zoll breit, 12 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (10 fl für die Nrn. 454 und 455) Käufer: Weitsch 1778/09/28 FRAN 0457 Beuch I Der Compagnon, von Beuch, nemliches Maaß. [Le pendant du precedent, par Beuch, meme hauteur & meme largeur.] I Pendant zu Nr. 456, "Eine Landschaft mit Waldung und Figuren zu Pferd" von Niederländisch Maße: 13 Zoll breit, 12 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (15 fl für die Nrn. 456 und 457) Käufer: Tischbein 1779/09/27 FRNGL 0548 Beuch I Ein fürtr[e]fliches Viehstück, von Beuch, so schön wie Bergheem. [Une trfes belle piece representante du bitail, par Beuch, dans la force de Bergheem.] I Maße: 2 Schuh 7 Zoll hoch, 2 Schuh 1 Zoll breit Transakt.: Verkauft (67 fl) Käufer: Ettling 1781/00/00 WZAN 0160 Johann Franz Beug I Ein Stück, 1 Schuhe, 8 Zoll hoch, 2 Schuhe, 3 Zoll breit von Johann Franz Beug, stellet eine angenehme bergigte Abendlandschaft vor, worinn eine angenehme Kolorit und Praktik beobachtet ist. I Pendant zu Nr. 161 Maße: 1 Schuhe 8 Zoll hoch, 2 Schuhe 3 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0161 Johann Franz Beug I Der Kompagnon zu Nro 160 ist von eben der Praktik und angenehmen Kolorit des obigen Meisters [Johann Franz Beug]. I Pendant zu Nr. 160 Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0330 Jakob Beuch I Ein Stück 6 Zoll hoch, 8 Zoll breit vom Jakob Beuch, welches nebst einem alten auf einem Berge liegenden Schlosse eine mit vielen wohl ausgeführten Figuren 236
GEMÄLDE
verfertigte Landschaft vorstellet, ist sehr gut kolorirt und fleißig ausgeführet. I Maße: 6 Zoll hoch, 8 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1782/02/18 RGBZN Unbekannt (2.6 fl)
0011
Beich I Ein Viehstück. I Transakt.:
1782/03/18 HBTEX 0308 Beicht I Zwey Holzungen, meisterhaft gemahlt, auf Kupfer. I Diese Nr.: Eine Hölzung Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 12 Zoll, Breite 15 Zoll 6 Linien Anm.: Die Lose 308 und 309 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0309 Beicht I Zwey Holzungen, meisterhaft gemahlt, auf Kupfer. I Diese Nr.: Eine Hölzung Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 12 Zoll, Breite 15 Zoll 6 Linien Anm.: Die Lose 308 und 309 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1786/11/11 HBRMS 0005 J.F. Beich I Zwey Land= und Wasser=Prospecte mit Gebäuden und großen Bäumen, reich von Figuren und Vieh ausstaffirt. I Diese Nr.: Ein Land= und Wasser=Prospect mit Gebäuden und großen Bäumen, reich von Figuren und Vieh ausstaffirt Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 26 Zoll, Breite 31 Zoll Anm.: Die Lose 5 und 6 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/11/11 HBRMS 0006 J.F. Beich I Zwey Land= und Wasser=Prospecte mit Gebäuden und großen Bäumen, reich von Figuren und Vieh ausstaffirt. I Diese Nr.: Ein Land= und Wasser=Prospect mit Gebäuden und großen Bäumen, reich von Figuren und Vieh ausstaffirt Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 26 Zoll, Breite 31 Zoll Anm.: Die Lose 5 und 6 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0271 Peich I Landschaft, [un paysages.] I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Fuß 2 Zoll, Breite 2 Fuß 2 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0277 Peich I 2 Landschaften. [2 paysages.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Holz Maße: Höhe 6 Zoll, Breite 6 Zoll Anm.: Die Lose 277 und 278 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0278 Peich I 2 Landschaften. [2 paysages.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Holz Maße: Höhe 6 Zoll, Breite 6 Zoll Anm.: Die Lose 277 und 278 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0342 Peich I 2 Landschaften. [2 paysages.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 3 Fuß 2 Zoll, Breite 3 Fuß 6 Zoll Anm.: Die Lose 342 und 343 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0343 Peich I 2 Landschaften. [2 paysages.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 3 Fuß 2 Zoll, Breite 3 Fuß 6 Zoll Anm.: Die Lose 342 und 343 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1789/00/00 MMAN 0021 J. Franz Beich I Zwei Landschäftchen das Ringen Jakobs und Kundschafter vom gelobten Lande vorstellend, auf Holz. [Deux petits paysages, la Lutte de Jacob, et la relation de la terre promise, sur bois.] I Diese Nr.: Ein Landschäftchen das Ringen Jakobs vorstellend Mat.: auf Holz Maße: 6 Zoll hoch, 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 21 und 22 wurden zusammen katalogisiert. In der Taxierungsliste von 1787 ist die Nr. 21 einem unbekannten Meister zugeschrieben. Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (48 Kr für die Nrn. 21 und 22) 1789/00/00 MMAN 0022 J. Franz Beich I Zwei Landschäftchen das Ringen Jakobs und Kundschafter vom gelobten Lande vorstellend, auf Holz. [Deux petits paysages, la Lutte de Jacob, et la relation de la terre promise, sur bois.] I Diese Nr.: Ein Landschäftchen Kundschafter vom gelobten Land vorstellend Mat.: auf Holz Maße:
6 Zoll hoch, 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 21 und 22 wurden zusammen katalogisiert. In der Taxierungsliste von 1787 ist die Nr. 22 einem unbekannten Meister zugeschrieben. Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (48 Kr für die Nrn. 21 und 22) 1789/00/00 MMAN 0025 J. Franz Beich I Drei Landschäftchen den Propheten Elisäus von Knaben verspottet, dann von Raben gespeißt; und den Propheten Jsaias von einer Löwin getödtet vorstellend, auf Holz. [Trois petits paysages, le Prophete Elise la risee des enfans, puis nouri par des Corbeaux, le Prophete Isaie tue par une lionne, sur bois.] I Diese Nr.: Ein Landschäftchen den Propheten Elisäus von Knaben verspottet vorstellend Mat.: auf Holz Maße: 6 Zoll hoch, 8 Zoll breit Anm..· Die Lose 25 bis 27 wurden zusammen katalogisiert. In der Taxierungsliste von 1787 ist die Nr. 25 einem unbekannten Meister zugeschrieben. Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (1.12 fl für die Nm. 25-27) 1789/00/00 MMAN 0026 J. Franz Beich I Drei Landschäftchen den Propheten Elisäus von Knaben verspottet, dann von Raben gespeißt; und den Propheten Jsaias von einer Löwin getödtet vorstellend, auf Holz. [Trois petits paysages, le Prophete Elise la risee des enfans, puis nouri par des Corbeaux, le Prophete Isaie tue par une lionne, sur bois.] I Diese Nr.: Ein Landschäftchen den Propheten Elisäus von Raben gespeist vorstellend Mat.: auf Holz Maße: 6 Zoll hoch, 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 25 bis 27 wurden zusammen katalogisiert. In der Taxierungsliste von 1787 ist die Nr. 26 einem unbekannten Meister zugeschrieben. Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (1.12 fl für die Nrn. 25-27) 1789/00/00 MMAN 0027 J. Franz Beich I Drei Landschäftchen den Propheten Elisäus von Knaben verspottet, dann von Raben gespeißt; und den Propheten Jsaias von einer Löwin getödtet vorstellend, auf Holz. [Trois petits paysages, le Prophete Elise la risee des enfans, puis nouri par des Corbeaux, le Prophete Isaie tue par une lionne, sur bois.] I Diese Nr.: Ein Landschäftchen den Propheten Jsaias von einer Löwin getödtet vorstellend Mat.: auf Holz Maße: 6 Zoll hoch, 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 25 bis 27 wurden zusammen katalogisiert. In der Taxierungsliste von 1787 ist die Nr. 27 einem unbekannten Meister zugeschrieben. Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (1.12 fl für die Nrn. 25-27) 1789/00/00 MMAN 0038 Joach. Franz Beich t Eine Landschaft mit einer See, auf Leinw. [Un paysage maritime, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 6 Zoll hoch, 1 Fuß 10 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (20 Kr) 1789/00/00 MMAN 0047 Joachim Franz, Beich I Zwei Landschaften, auf Leinw. [Deux paysages, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 3 Fuß 4 Zoll hoch, 4 Fuß 10 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (100 fl) 1789/00/00 MMAN 0064 Johann Beich I Moyses in der Wüste macht Wasser aus den Felsen springen, auf Leinw. [Moyse dans le desert, faisant sortir l'eau d'un rocher, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 3 Fuß 5 Zoll hoch, 4 Fuß 3 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (55 fl) 1789/00/00 MMAN 0282 J. Franz Beich I Eine Landschaft, auf Leinwand. [Un paysage, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 11 Zoll hoch, 2 Fuß 7 Zoll breit [2 pieds 1 pouce de haut, 2 pieds 7 pouces de large] Anm.: Die Dimensionen unterscheiden sich in der deutschen und französischen Fassung des Katalogs. Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (22 fl) 1789/00/00 MMAN 0312 Joach. Beich I Zwei Landschaften mit historischen Figuren, auf Leinw. [Deux paysages, avec figures historiques, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 5 Zoll hoch, 3 Fuß 2 Zoll breit [2 pieds 5 pouces de haut, 3 pieds 5 pouces de large] Anm.: Die Dimensionen unterscheiden sich in der deutschen und französischen Fassung des Katalogs. Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (80 fl)
1789/00/00 MMAN 0313 Joach. Beich I Zwei Landschaften mit historischen Figuren, auf Leinw. [Deux paysages avec figures historiques, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 5 Zoll hoch, 2 Fuß 11 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (80 fl) 1789/00/00 MMAN 0320 Joach. Beich I Zwei Landschaften, auf Leinwand. [Deux paysages, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 11 Zoll hoch, 3 Fuß 11 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (100 fl) 1789/04/16 HBTEX 0039 Beich I Die Vorstellung eines Wasserfalles in gebürgigter Holzung; stark gemahlt auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 18 Zoll, breit 13 Zoll Transakt.: Verkauft (1.12 M) Käufer: Petti 1790/01/07 MUAN 0043 Beich I Eine Landschaft mit Figuren, und Thieren, auf Leinwat. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh, Breite 2 Schuh 10 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0240 Beich I Zwo Landschaften, auf Leinwat, in vergoldeten Ramen. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 9 Zoll, Breite 1 Schuh 2 Zoll Anm.: Die Lose 240 und 241 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0241 Beich I Zwo Landschaften, auf Leinwat, in vergoldeten Ramen. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 9 Zoll, Breite 1 Schuh 2 Zoll Anm.: Die Lose 240 und 241 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0277 Beich I Eine große Landschaft mit einem Wasserfalle, wobey die Schafe getranket werden, mit Figuren, auf Leinwat. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 3 Schuh 2 Zoll, Breite 4 Schuh 4 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0679 Beich I Zwo Landschaften mit kleinen Figuren, auf Leinwat. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit kleinen Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 7 Zoll, Breite 1 Schuh 1 Zoll Anm.: Die Lose 678 und 679 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0959 Beich I Eine Landschaft mit Thieren, auf Leinwat. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 1 Zoll, Breite 3 Schuh 6 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1205 Beich I Die Tochter Pharaons, wie selbe das Kind Moses findet, auf Leinwat, in einer vergoldeten Ram. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 11 Zoll, Breite 3 Schuh 6 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 2017 Beich I Die Stadt Braunau, auf Leinwat, in einer metallisirten Ram. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 3 Schuh 4 Zoll, Breite 5 Schuh 4 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/04/13 HBLIE 0113 Beich I Gebürge mit einem Wasserfall, sehr stark gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 Vi Zoll, breit 8 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (11 Sch) 1790/04/13 HBLIE 0217 Beicht I Zwey sehr lebhafte gebürgigte römische Landgegenden. Auf Leinw. I Diese Nr.: Eine sehr lebhafte gebürgigte römische Landgegend Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 14 Zoll, breit 12 Zoll Anm.: Die Lose 217 und 218 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (3.12 Μ für die Nrn. 217 und 218) Käufer: Ego [und] D 1790/04/13 HBLIE 0218 Beicht I Zwey sehr lebhafte gebürgigte römische Landgegenden. Auf Leinw. I Diese Nr.: Eine sehr lebhafte gebürgigte römische Landgegend Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 14 Zoll, breit 12 Zoll Anm.: Die Lose 217 und 218 wurden GEMÄLDE
237
zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (3.12 Μ für die Nrn. 217 und 218) Käufer: Ego [und] D 1790/05/20 HBSCN 0226 Beich I Römische gebürgigte Landgegenden, mit Vieh und Figuren. Sehr lebhaft vorgestellt, auf Leine w. I Diese Nr.: Eine römische gebürgigte Landgegend, mit Vieh und Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 13 Zoll, breit 10 Vi Zoll Anm.: Die Lose 226 und 227 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (4 Μ für die Nrn. 226 und 227) Käufer: Büsch 1790/05/20 HBSCN 0227 Beich I Römische gebürgigte Landgegenden, mit Vieh und Figuren. Sehr lebhaft vorgestellt, auf Leinew. I Diese Nr.: Eine römische gebürgigte Landgegend, mit Vieh und Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 13 Zoll, breit 10 Vi Zoll Anm.: Die Lose 226 und 227 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (4 Μ für die Nrn. 226 und 227) Käufer: Büsch 1791/05/28 HBSDT 0039 F. Beich I Eine Italienische Landschaft mit verfallnen Gebäuden und Grabmählern. Ein Hirtenjunge weidet einige Schaafe. Sehr stark und meisterhaft gemahlt, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 17 Zoll, breit 23 Zoll Transakt.: Unbekannt 1791/10/21 HBRMS1 0051 F. Beich I Landschaften mit vielen Bergen und Wasserfällen. In den Vordergründen Hirten mit Vieh, sehr dreist und meisterhaft gemahlt; auf Holz. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit vielen Bergen und Wasserfällen Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Zoll, breit 16 Zoll Anm.: Die Lose 51 und 52 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1791/10/21 HBRMS1 0052 F. Beich I Landschaften mit vielen Bergen und Wasserfällen. In den Vordergründen Hirten mit Vieh, sehr dreist und meisterhaft gemahlt; auf Holz. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit vielen Bergen und Wasserfällen Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Zoll, breit 16 Zoll Anm.: Die Lose 51 und 52 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1792/04/19 HBBMN 0105 F. Beich I Eine besonders schöne Landschaft mit Staffage, von F. Beich. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 36 Zoll, breit 52 Zoll Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0122 Beych I Eine feisichte Landschaft mit Wasser, von Beych. I Maße: 2 Schuh 6 Zoll hoch, 2 Schuh breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0390 Beuch I Eine schön belaubte Landschaft mit Figuren, und guter Tractation, von Beuch. I Pendant zu Nr. 391 Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 1 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0391 Beuch I Ein Gegenstück, von nemlichem Inhalt [eine schön belaubte Landschaft mit Figuren], Meisters [Beuch] und Maaß. I Pendant zu nr. 390 Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 1 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
1794/09/10 HBGOV 0002 Beich 17311 Die vier Tageszeiten, in Land= und Wassergegenden vorgestellet; mit Reisenden und Landleuten. Von großer Ordonence, Licht und Schatten, wie auch mit freyen Pinselszügen gemahlt. I Diese Nr.: Eine der vier Tageszeiten Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 35 Zoll, breit 28 Zoll lnschr.: 1731 (datiert?) Anm.: Die Lose 1 bis 4 wurden zusammen katalogisiert. Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV 0003 Beich 17311 Die vier Tageszeiten, in Land= und Wassergegenden vorgestellet; mit Reisenden und Landleuten. Von großer Ordonence, Licht und Schatten, wie auch mit freyen Pinselszügen gemahlt. I Diese Nr.: Eine der vier Tageszeiten Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 35 Zoll, breit 28 Zoll lnschr.: 1731 (datiert?) Anm.: Die Lose 1 bis 4 wurden zusammen katalogisiert. Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV 0004 Beich 17311 Die vier Tageszeiten, in Land= und Wassergegenden vorgestellet; mit Reisenden und Landleuten. Von großer Ordonence, Licht und Schatten, wie auch mit freyen Pinselszügen gemahlt. I Diese Nr.: Eine der vier Tageszeiten Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 35 Zoll, breit 28 Zoll lnschr.: 1731 (datiert?) Anm.: Die Lose 1 bis 4 wurden zusammen katalogisiert. Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV 0147 Beicht I Zwey felsigte Holzungen; mit Wasserfälle und Wanderer in denselben. Von der allerbesten Zeit des benannten B. gemahlt. I Diese Nr.: Eine felsigte Hölzung Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 19 Zoll, breit 2 4 Zoll Aran.: Die Lose 147 und 148 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV 0148 Beicht I Zwey felsigte Holzungen; mit Wasserfälle und Wanderer in denselben. Von der allerbesten Zeit des benannten B. gemahlt. I Diese Nr.: Eine felsigte Hölzung Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 19 Zoll, breit 24 Zoll Anm.: Die Lose 147 und 148 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/00/00 HLAN [0078] Franz Beich I Z w e y Landschaften. 30. 46. auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: 30. 46. Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: [Friedrich Karl Lang] Transakt.: Unbekannt (122.4 Rt; 220 fl Schätzung) 1796/00/00 HLAN [0107] Franz Beich I Landschaft. 12. 9. auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: 12. 9. Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: [Friedrich Karl Lang] Transakt.: Unbekannt (6.3 Rt; 11 fl Schätzung) 1796/09/08 HBPAK 0153 Beich I Eine angenehme Landschaft mit einem durchfließenden Gewässer. Im Schatten der Bäume sitzt ein Mann und angelt. I Maße: Hoch 13 Zoll, breit 17 Zoll Transakt.: Unbekannt
1794/00/00 FGAN 0030 Franz J. Beich ί Ein Felsenstück im Vorgrunde mit 3 Fischern, auf Tuch gemalt. I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Schuh 6 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 1 Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt (11 fl)
1797/04/20 HBPAK 0058 Baeich I Eine vortrefliche Landschaft mit Wasser; im Hintergrunde eine Stadt. Sehr wohl gehalten, und gut conditionirt. Auf Leinwand, mit schwarzen Rahm und vergoldeten Stäben. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 26 Zoll Transakt.: Unbekannt
1794/00/00 FGAN 0038 Joachim Franz Beich I Eine Landschaft mit einem Wasserfalle, stafiert mit einigen Figuren und einem Maulthiere, auf Tuch gemalt. I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt
1800/01/00 LZAN [A]0003 Beich I Eine gebürgigte Landschaft mit einem zur Linken im Vorgrunde stehenden sehr schönen Baume; eine Hirtin sitzt zur Rechten auf einem gefällten Stamme, und weidet ihr Vieh. I Pendant zu Nr. [A]4 Maße: Höhe 2 Fuß 1 Zoll, Breite 2 Fuß 7 Zoll Verkäufer: A F Oeser Transakt.: Unbekannt
1794/09/10 HBGOV 0001 Beich 17311 Die vier Tageszeiten, in Land= und Wassergegenden vorgestellet; mit Reisenden und Landleuten. Von großer Ordonence, Licht und Schatten, wie auch mit freyen Pinselszügen gemahlt. I Diese Nr.: Eine der vier Tageszeiten Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 35 Zoll, breit 28 Zoll lnschr.: 1731 (datiert?) Anm.: Die Lose 1 bis 4 wurden zusammen katalogisiert. Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt
1800/01/00 LZAN [A]0004 Beich I Der Compagnon [zu Nr. A3]. Von gleicher Grösse. Gebürge, Ruinen und Bäume, nebst einigen Wanderern, sind die Gegenstände dieser Landschaft. Beich studirte viel nach Sal. Rosa, welches Studium auch in diesen Landschaften zu sehen ist. I Pendant zu Nr. [A]3 Maße: Höhe 2 Fuß 1 Zoll, Breite 2 Fuß 7 Zoll Verkäufer: A F Oeser Transakt.: Unbekannt
238
GEMÄLDE
Beich, Joachim Franz (oder Amigoni, J. oder Wentzel (Wenzel)) 1769/00/00 MUAN 0248 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la viie de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0249 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Fran5ois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0250 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0251 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0252 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils reprdsentent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0253 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0254 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande
partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francis Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0255 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francis Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0256 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0257 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0258 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0259 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0260 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage GEMÄLDE
239
Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0261 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0262 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0263 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0264 Beich (Joachim Frangois); Amigoni: Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0265 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de Γ hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0266 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacr£e, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0267 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande 240
GEMÄLDE
partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0268 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0269 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0270 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0271 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0272 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm..· Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0273 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacrie, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de Γ hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage
Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0274 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils reprisentent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0275 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Franijois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0276 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Franfois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0277 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0278 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de Γ hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: F r a n c i s Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0279 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Franjois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0280 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande
partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Franjois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0281 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0282 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0283 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0284 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0285 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0286 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage GEMÄLDE
241
Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0287 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacr£e, avec d'autres faits pour diversifier le pay sage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de Γ hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0288 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Fran5ois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0289 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0290 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prts de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0291 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0292 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0293 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande 242
GEMÄLDE
partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0294 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0295 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0296 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0297 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0298 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0299 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage
Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0300 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prös de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0301 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0302 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille prfes de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francis Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0303 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0304 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0305 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0306 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande
partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0307 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0308 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0309 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0310 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.; Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0311 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm. : Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0312 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage GEMÄLDE
243
Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0313 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0314 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0315 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Fran5ois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0316 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de Γ hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francis Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0317 Beich (Joachim Frangois); Amigoni; Wenzel I Septante paysages de differentes grandeurs, la plus grande partie vont de paire, plusieurs sont de la main de Beich, & d'autres d'Amigoni & Wenzel, ils representent en partie l'histoire de la Bible, ou sacree, avec d'autres faits pour diversifier le paysage, parmi ces tableaux se trouvent la Battaille pres de Gran & la vüe de l'hermitage de Nymphenbourg. Peints sur toile. I Diese Nr.: Un paysage Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 248 bis 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt
Beich, Joachim Franz (Geschmack von) 1779/09/27 FRNGL 1060 Beuch I Zwey Landschaften, warm und meisterhaft gearbeitet, im Geschmack von Beuch. [Deux paysages, tres belles pieces, dans le gout de Beuch.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 10 Zoll hoch, 1 Schuh 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 1060 und 1061 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (2.48 fl für die Nrn. 1060 und 1061) Käufer: Becker 1779/09/27 FRNGL 1061 Beuch I Zwey Landschaften, warm und meisterhaft gearbeitet, im Geschmack von Beuch. [Deux paysages, tres belles pieces, dans le gout de Beuch.] I Diese Nr.: Eine 244
GEMÄLDE
Landschaft Maße: 10 Zoll hoch, 1 Schuh 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 1060 und 1061 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (2.48 fl für die Nrn. 1060 und 1061) Käufer: Becker
Beich, Joachim Franz (Schule) 1780/10/02 FRSTK 0023 Beuch I Eine keck gemahlte Landschafft von einer bergigten Gegend, aus der Schule vom Beuch. I Pendant zu Nr. 24 Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 1 Schuh 1 Vi Zoll breit Transakt.: Unbekannt (4 fl für die Nm. 23 und 24) 1780/10/02 FRSTK 0024 Beuch I Das Gegenbild hierzu eine dergleichen [keck gemahlt] Landschafft, von nehmlicher Hand [aus der Schule vom Beuch] und Maas. I Pendant zu Nr. 23 Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 1 Schuh 1 Vi Zoll breit Transakt.: Unbekannt (4 fl für die Nm. 23 und 24)
Beijer, Jan de 1790/01/07 MUAN 2164 Beyer, I. D. I Zwo in Brande stehende Städte, auf Leinwat, in ungefaßten Ramen. I Diese Nr.: Eine im Brande stehende Stadt Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 8 Zoll, Breite 4 Schuh Anm.: Die Lose 2164 und 2165 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 2165 Beyer, I. D. I Zwo in Brande stehende Städte, auf Leinwat, in ungefaßten Ramen. I Diese Nr.: Eine im Brande stehende Stadt Mai.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 8 Zoll, Breite 4 Schuh Anm.: Die Lose 2164 und 2165 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
Beitier, J.G. 1723/00/00 PRAN [A]0027 Beittler I Ein Vogelstuck / vom Beittler / Compagnion No [A]32 I Pendant zu Nr. [A]32 Maße: Höhe 1 Vi Schuh 1 Zoll, Breite 1 Vi Schuh 4 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN [A]0032 Beittler I Ein Vogel=Stuck / vom Beittler. I Pendant zu Nr. [A]27 Maße: Höhe 1 Vi Schuh 1 Zoll, Breite 1 Vi Schuh 4 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN [A]0124 Beittler I Haan mit der Hennen / vom Beittler. Compagnion No [A] 131. I Pendant zu Nr. [A]131 von Veerendael Maße: Höhe 1 Schuh, Breite 1 Schuh 4 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN 0089 BeUttler I Ein Blummen=Stuck / vom Beüttler. I Maße: Höhe 4 Schuh 1 Zoll, Breite 3 Schuh 2 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1797/08/10 MMAN 0252 Beittler I 2 Fruchtstücke, auf Tuch. I Diese Nr.: Ein Fruchtstück Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 252 und 253 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (24 fl für die Nrn. 252 und 253, Schätzung) 1797/08/10 MMAN 0253 Beittler I 2 Fruchtstücke, auf Tuch. I Diese Nr.: Ein Fruchtstück Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 252 und 253 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (24 fl für die Nrn. 252 und 253, Schätzung) 1797/08/10 MMAN 0343 Beittler I Ein Fruchtstück, wo man unter anderm einen Papagei und ein Eichhörnchen siehet, von Beittler auf Tuch. I Mat.: auf Leinwand Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (20 fl Schätzung)
1797/08/10 MMAN 0347 Beittler I Ein Fruchtstück, von Beittler, auf Tuch. I Mat.: auf Leinwand Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (20 fl Schätzung)
Beitier, J.G. (Kopie nach) 1797/08/10 MMAN 0219 Wirth; Beidler I Fische in einem Kübel. Nach Beidler durch Wirth copirt, auf Tuch. I Kopie von Wirth nach J.G. Beitier Mat.: auf Leinwand Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (3 fl Schätzung) 1797/08/10 MMAN 0220 Wirth; Beidler I [Unleserlich] und einige Aepfel, welche auf einem Faß liegen. Nach Beidler durch Wirth copirt, auf Tuch. I Kopie von Wirth nach J.G. Bei tier Afar.: auf Leinwand Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (3 fl Schätzung)
Bejart [Nicht identifiziert] 1742/08/01 BOAN 0510 Bejart I Eine Landschafft mit einer Perspective von Antwerpen. Orig. von Bejart. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0523 der Junge Bejart I Eine Landschafft und Jagd-Stuck. Original vom Jungen Bejart. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0305 Bejart I Paisage avec la perspective d'Anvers, par Bejart. I Maße: Haut 11. pouces, large 1. pied 11. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0394 Bejart le jeune I Paisage & chasse, par Bejart le jeune. I Maße: Haut 1. p. 3. pou. large 2. p. 2. pouc. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt
Belin, Jean Baptiste (I) (Blin de Fontenay) 1742/08/01 BOAN 0233 Monsieur Fontine I Zwey grosse Blumen Stuck. Originalien von Monsieur Fonrine. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0136 Fontaine I Des Fleurs, couple, par Fontaine. I Maße: Haut 2. p. 9. pouc. large 3. p. 6. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1764/05/29 BOAN 0354 Fontenar I Un Pot ä fleurs en oval de deux pieds neuf pouces de hauteur, deux pieds deux pouces de largeur, peint par Fontenar. [Ein stück Vorstellend Eine blumen vase in oval Von Fontenar.] I Format: oval Maße: 2 pieds 9 pouces de hauteur, 2 pieds 2 pouces de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (20 Rt) Käufer: Schild 1799/00/00 WZAN 0178 loh. Bapt. Blain de Fontenay I Ein Blumen= und Früchtenstückchen, von Joh. Bapt. Blain de Fontenay. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 1 Vi Zoll breit 1 Schuh 9 Zoll Anm.: Die Lose 177 und 178 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Bella, Stefano della 1790/05/20 HBSCN 0205 Stejfano I Sauls Bekehrung in einer waldigten Landschaft vorgestellt, wie Breughel. Auf Kupfer. S.R.G.L. [Schwarzen Rahm, goldne Leisten] I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 11 Vi Zoll, breit 15 Zoll Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (4.10 M) Käufer: Meyerhoff 1794/09/10 HBGOV [A]0012 Stephan della Bella I Sechs römische Land=Gegenden; theils mit Bachanten= und Hirten=Trifften. Ganz ausnehmend fleißig ausgeführt, von Stephan della Bella. Sind rund gemahlt. Auf Kupfer. I Diese Nr.: Eine römische Land=Gegend Mat.: auf Kupfer Format: rund Maße: Hoch 5 % Zoll, breit 5 % Zoll
Anm.: Die Lose [A]12 bis [A]17 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV [A]0013 Stephan della Bella I Sechs römische Land=Gegenden; theils mit Bachanten= und Hirten=Trifften. Ganz ausnehmend fleißig ausgeführt, von Stephan della Bella. Sind rund gemahlt. Auf Kupfer. I Diese Nr.: Eine römische Land=Gegend Mat.: auf Kupfer Format: rund Maße: Hoch 5 % Zoll, breit 5 % Zoll Anm.: Die Lose [A]12 bis [A] 17 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV [AJ0014 Stephan della Bella I Sechs römische Land=Gegenden; theils mit Bachanten= und Hirten=Trifften. Ganz ausnehmend fleißig ausgeführt, von Stephan della Bella. Sind rund gemahlt. Auf Kupfer. I Diese Nr.: Eine römische Land=Gegend Mat.: auf Kupfer Format: rund Maße: Hoch 5 % Zoll, breit 5 % Zoll Anm.: Die Lose [A]12 bis [A]17 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV [A]0015 Stephan della Bella I Sechs römische Land=Gegenden; theils mit Bachanten= und Hirten=Trifften. Ganz ausnehmend fleißig ausgeführt, von Stephan della Bella. Sind rund gemahlt. Auf Kupfer. I Diese Nr.: Eine römische Land=Gegend Mat.: auf Kupfer Format: rund Maße: Hoch 5 % Zoll, breit 5 % Zoll Anm.: Die Lose [A]12 bis [A]17 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV [A]0016 Stephan della Bella I Sechs römische Land=Gegenden; theils mit Bachanten= und Hirten=Trifften. Ganz ausnehmend fleißig ausgeführt, von Stephan della Bella. Sind rund gemahlt. Auf Kupfer. I Diese Nr.: Eine römische Land=Gegend Mat.: auf Kupfer Format: rund Maße: Hoch 5 % Zoll, breit 5 % Zoll Anm.: Die Lose [A] 12 bis [A]17 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV [A]0017 Stephan della Bella I Sechs römische Land=Gegenden; theils mit Bachanten= und Hirten=Trifften. Ganz ausnehmend fleißig ausgeführt, von Stephan della Bella. Sind rund gemahlt. Auf Kupfer. I Diese Nr.: Eine römische Land=Gegend Mat.: auf Kupfer Format: rund Maße: Hoch 5 % Zoll, breit 5 % Zoll Anm.: Die Lose [A]12 bis [A] 17 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/01/19 HBPAK 0052 Stejfani de la Bella \ Zwey Seestücke mit bebauten und hohen Ufern im Vordergründe. Eine Menge schön gezeichnete Figuren beleben dieselben in bunten Gruppen. Der Ton dieser Stücke ist vortreflich und wahr gehalten. Von gleicher Grösse. 1 Fuß 4 Zoll hoch, 1 Fuß 11 Zoll breit. Goldn. Rahm. I Diese Nr.: Ein Seestück mit bebauten und hohen Ufern im Vordergrunde Maße: 1 Fuß 4 Zoll hoch, 1 Fuß 11 Zoll breit Anm.: Die Lose 52 und 53 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/01/19 HBPAK 0053 Steffani de la Bella I Zwey Seestücke mit bebauten und hohen Ufern im Vordergrunde. Eine Menge schön gezeichnete Figuren beleben dieselben in bunten Gruppen. Der Ton dieser Stücke ist vortreflich und wahr gehalten. Von gleicher Grösse. 1 Fuß 4 Zoll hoch, 1 Fuß 11 Zoll breit. Goldn. Rahm. I Diese Nr.: Ein Seestück mit bebauten und hohen Ufern im Vordergrunde Maße: 1 Fuß 4 Zoll hoch, 1 Fuß 11 Zoll breit Anm.: Die Lose 52 und 53 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Bellan, Nikolaus Bruno 1768/05/02 KOAN 0024 Nie. Bruno Belau I Ein Thüren=Stück, worauf zwey bekleidete Kinder gemahlt sind; von Nie. Bruno Belau. I Verkäufer: Joannes Petrus Süssmilch Transakt.: Unbekannt
Bellange, Jacques 1790/01/07 MUAN 2097 Jac. Beilange I Zwey Bacchusfeste, auf Leinwat. I Diese Nr.: Ein Bacchusfest Mat.: auf Leinwand MaGEMÄLDE
245
ße: Höhe 2 Schuh 8 Zoll, Breite 4 Schuh 6 Zoll Anm.: Die Lose 2097 und 2098 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
Holz, goldenen Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 14 Zoll, breit 10 Zoll Transakt.: Unbekannt
1790/01/07 MUAN 2098 Jac. Bellange I Zwey Bacchusfeste, auf Leinwat. I Diese Nr.: Ein Bacchusfest Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 8 Zoll, Breite 4 Schuh 6 Zoll Anm.: Die Lose 2097 und 2098 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
Bellini, Giacinto 1670/04/21 WNHTG 0012 Bellino Cavalliero I Un San Sebastiano in prospettiva. I Maße: Alto sei palmi, largo tre Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt Gegenw. Standort: Dresden, Deutschland. Gemäldegalerie. (52) als Antonello da Messina
Bellekin, Cornells van 1772/09/15 BNSCT 0012 C. Bellekien I Ein Vogel=Stück, sehr gut, von C. Bellekien, 1663, auf Holz, 1 F. 6 Z. hoch, 1 Fuß 11 Z. br„ schw. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 6 Zoll hoch, 1 Fuß 11 Zoll breit Inschr.: 1663 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt (4.40 fl) 1791/10/21 HBRMS1 0079 Bellequin I Tische mit Früchten, Geschirre und Fische. Sehr natürlich und stark gemahlt; das eine auf Leinew. das andere auf Holz. I Diese Nr.: Ein Tisch mit Früchten, Geschirre und Fische Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 15 Zoll, breit 17 Zoll Anm.: Die Lose 79 und 80 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (30 Sch [?]) Käufer: Eck[hardt] [mit] S 1791/10/21 HBRMS1 0080 Bellequin I Tischc mit Früchten, Geschirre und Fische. Sehr natürlich und stark gemahlt; das eine auf Leinew. das andere auf Holz. I Diese Nr.: Ein Tisch mit Früchten, Geschirre und Fische Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Zoll, breit 17 Zoll Anm.: Die Lose 79 und 80 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (30 Sch [?]) Käufer: Eck[hardt] [mit] S
Bellini, Giovanni 1750/10/15 HB AN 0007 Bellini (Joh.) I Zins=Groschen. I Maße: 3 Fuß hoch, 4 Fuß 2 Vi Zoll breit Transakt.: Unbekannt (180 [?]) 1790/01/07 MUAN 0088 Joh. Bellino I Ein Mariabild mit dem Kinde, auf Holz, in einer geschnittenen und metallisirten Ram. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 2 Schuh 5 Zoll, Breite 1 Schuh 10 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0383 Joh. Bellino I Ein altes Frauenzimmerportrait mit rothen Haaren, und einer weißen Haube, auf Holz, in einer geschnittenen und metallisirten Ram. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 6 Zoll, Breite 1 Schuh 3 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0480 Joh. Bellino I Magdalena, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 2 Schuh 6 Zoll, Breite 2 Schuh Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
Bello, Giacomo Bellevois, Jacob Adriaensz. 1776/06/21 HBNEU 0114 Belleroy I Ein See=Sturm, meisterhaft gemahlt, auf dito [Holz], I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 F 8 Z, Breite 2 F 2 Ζ Transakt.: Unbekannt 1790/08/13 HBBMN 0022 J. Bellevois I Aussicht einer holländischen See mit vielen großen und kleinen Schiffen, ein plaisantes und schönes Gemähide. Auf H[olz]. S.R.G.L. [Schwarzen Rahm, goldne Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 32 Zoll, breit 45 Zoll Transakt.: Verkauft (5 M) Käufer: Eckhardt 1793/06/07 HBBMN 0003 J. Bellevois I Seestücke mit großen und kleinen Schiffen und Fischerböthen. Sehr natürlich vorgestellt, von J. Bellevois 1653. I Diese Nr.: Ein Seestück mit großen und kleinen Schiffen und Fischerböthen Maße: Hoch 39 Zoll, breit 31 Zoll Inschr.: 1653 (datiert?) Anm.: Die Lose 3 und 4 wurden zusammen katalogisiert. Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0004 J. Bellevois I Seestücke mit großen und kleinen Schiffen und Fischerböthen. Sehr natürlich vorgestellt, von J. Bellevois 1653. I Diese Nr.: Ein Seestück mit großen und kleinen Schiffen und Fischerböthen Maße: Hoch 39 Zoll, breit 31 Zoll Inschr.: 1653 (datiert?) Anm.: Die Lose 3 und 4 wurden zusammen katalogisiert. Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt
Bellin (Kopie nach) 1800/11/12 HBPAK 0240 lin. I Transakt.: Unbekannt
Bellin I Venus und Cupido. nach Bel-
Bellin, J. [Nicht identifiziert] 1797/04/25 HBPAK 0088 J. Bellin I Ein nakendes Frauenzimmer, auf ihren Knien, hinter ihr ein Herr, dessen Gewand sie ergreift, neben ihnen noch eine andere Person; sehr kräftig gemahlt. Auf 246
GEMÄLDE
1799/00/00 WZAN 0440 Jacob Bello I Christus am Kreuze, unten die h. Madgalena, von Jacob Bello. Auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: hoch 1 Schuh 6 Zoll breit 1 Schuh Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Belloni 1776/00/00 WZTRU 0188 Belloni I Ein Stück 1 Schuhe, 7 Zoll hoch, 2 Schuhe breit von Belloni, stellet vor den Patriarchen Abrahem, welche die drey zu ihm nahende Engeln mit Freuden aufzunehmen sich erbiethet; es ist zwar eine Schieze, aber jedannoch vor Kennern von großen Werth wegen der Practic, und des hierinn wohlverstandenen Schatten und Lichts. I Maße: 1 Schuhe 7 Zoll hoch, 2 Schuhe breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (8 fl Schätzung) 1781/00/00 WZAN 0188 Belloni I Ein Stück 1 Schuhe, 7 Zoll hoch, 2 Schuhe breit von Belloni, stellet den Patriarchen Abraham vor, welcher die drey zu ihm nahenden Engel mit Freuden aufzunehmen sich erbiethet; es ist zwar eine Schizze, jedannoch aber vor Kennern von großem Werth wegen der Praktik, und des hierinn wohl verstandenen Schatten und Lichtes. I Maße: 1 Schuhe 7 Zoll hoch, 2 Schuhe breit Transakt.: Unbekannt
Bellucci, Antonio 1781/05/07 FRHUS 0093 F. Beilud I Die Verläugnung Petri, meisterhaft ausgeführt von F. Belluci. I Maße: 6 Schuh 3 Zoll hoch und 5 Schuh 8 Zoll breit Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "F. Belluci", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (2.4 fl) Käufer: Heusser 1783/08/01 LZRST 0040 Beluzzi I Niobe, von Beluzzi gemahlt, Diane tödtet durch einen feurigen Pfeil, die an der Erde liegende Mutter, mit ihren Kindern, das Bild ist sehr gut colorirt und wohl erhalten, 1 Elle 8 Zoll hoch, 2 Ellen 2 Vi Zoll br. der Rahm gut vergol-
det aber etwas schadhaft. I Maße: 1 Elle 8 Zoll hoch, 2 Elle 2 Vi ZQII breit Transakt.: Verkauft (4 Th) Käufer: Zaar 1788/09/01 KOAN 0562 Bellucci I Mars und Venus, von Bellucci. [un mars & venus de Belucci.] I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Fuß 4 Zoll, Breite 1 Fuß 7 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0563 Bellucci I Venus und Adonis, von Bellucci. [une venus & adonis.] I Mat. : auf Holz Maße: Höhe 1 Fuß 4 Zoll, Breite 1 Fuß 7 Zoll Anm.: Im gedruckten französischen Katalog ist kein Künstlername angegeben. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0158 Anton Bellucci I Ein Mädchen mit einem Blumenkörbchen, von Anton Bellucci. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 6 Zoll breit 1 Schuh 10 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0372 Anton Bellucci I Der todte Christus, von Anton Bellucci. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 6 Zoll breit 1 Schuh 3 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0607 Antonius Bellucci I Rachel verbirgt die gestohlenen Götzen. Von Antonius Bellucci. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 4 Schuh 10 Zoll breit 6 Schuh 6 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0156 Anton Bellucci I Ein Mädchen mit einem Haasen, von Anton Bellucci. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 5 Zoll breit 1 Schuh 9 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Bellucci, Antonio (Kopie nach) 1792/08/20 KOAN 0300 Beilud I Vanitas Vanitatum, & omnia Vanitas nach Belluci. I Maße: 1 Schuh 5 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 2 Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt
Bembel [Nicht identifiziert] 1797/12/08 HBPAK 0093 Bembel I Eine Landschaft, wo Hirten ihr Vieh weiden. In der Bergheimschen Manier gut gemahlt. Auf Leinwand, im schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 27 Zoll, Breite 34 Zoll Transakt.: Unbekannt
Bembo, Bonifacio (Geschmack von) 1782/05/29 FRFAY 0021 In Bembionischen Gusto I Ein altes Weibsköpfgen, in Bembionischen Gusto. I Maße: 13 Zoll hoch, 12 Zoll breit Verkäufer: Kaspar Thorhorst Transakt.: Unbekannt (3.24 fl)
Bernden, Jacob van den
1716/00/00 FRHDR 0049 Bemmel I Von dito [Bemmel] 3. dito [Landschafften]. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (180 für jedes Gemälde) 1744/05/20 FRAN 0034 Bemmel I 1 Landschäfftgen. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 9 Zoll, Breite 1 Schuh 1 Zoll Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1744/05/20 FRAN 0208 Bremmel I 8 Schöne Landschäfftgen. I Diese Nr.: 1 Schönes Landschäfftgen Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 4 Zoll, Breite 6 Zoll Anm.: Die Lose 208 bis 215 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1744/05/20 FRAN 0209 Bremmel I 8 Schöne Landschäfftgen. I Diese Nr.: 1 Schönes Landschäfftgen Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 4 Zoll, Breite 6 Zoll Anm.: Die Lose 208 bis 215 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1744/05/20 FRAN 0210 Bremmel I 8 Schöne Landschäfftgen. I Diese Nr.: 1 Schönes Landschäfftgen Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 4 Zoll, Breite 6 Zoll Anm.: Die Lose 208 bis 215 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1744/05/20 FRAN 0211 Bremmel I 8 Schöne Landschäfftgen. I Diese Nr.: 1 Schönes Landschäfftgen Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 4 Zoll, Breite 6 Zoll Anm.: Die Lose 208 bis 215 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1744/05/20 FRAN 0212 Bremmel I 8 Schöne Landschäfftgen. I Diese Nr.: 1 Schönes Landschäfftgen Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 4 Zoll, Breite 6 Zoll Anm.: Die Lose 208 bis 215 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1744/05/20 FRAN 0213 Bremmel I 8 Schöne Landschäfftgen. I Diese Nr.: 1 Schönes Landschäfftgen Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 4 Zoll, Breite 6 Zoll Anm.: Die Lose 208 bis 215 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1744/05/20 FRAN 0214 Bremmel I 8 Schöne Landschäfftgen. I Diese Nr.: 1 Schönes Landschäfftgen Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 4 Zoll, Breite 6 Zoll Anm.: Die Lose 208 bis 215 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1744/05/20 FRAN 0215 Bremmel I 8 Schöne Landschäfftgen. I Diese Nr.: 1 Schönes Landschäfftgen Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 4 Zoll, Breite 6 Zoll Anm.: Die Lose 208 bis 215 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1747/04/06 HB AN 0043 Bemmel I Zwey Pferde=Stücke von Bemmel. I Diese Nr.: Ein Pferde=Stück Maße: 10 Zoll Breite und 8 l /2 Zoll Höhe Anm.: Die Lose 43 und 44 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Brockes Transakt.: Unbekannt (4.8 für die Nrn. 43 und 44) 1747/04/06 HB AN 0044 Bemmel I Zwey Pferde=Stücke von Bemmel. I Diese Nr.: Ein Pferde=Stück Maße: 10 Zoll Breite und 8 Vi Zoll Höhe Anm.: Die Lose 43 und 44 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Brockes Transakt.: Unbekannt (4.8 für die Nrn. 43 und 44)
1764/05/23 BOAN 0532 Van der Bembden I Deux Pieces Γ une representante un Chasseur avec des Chiens, l'autre un Cavalier, peints par van der Bembden. [Zwey stücklein, Vorstellend Eins Einen jäger mit jagdhund, andertes Einen reuther mit dem pferd Von van der Bemben.] I Maße: 6 pouces de hauteur, 5 pouces de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (18 Rt) Käufer: Neveu
1752/00/00 NGWOL 0056 Bommel I Ein Vieh=Stück, von Bommel, nach Rose Manier. Vn pezzo d'armenti del Bemmel, a guisa del Rosa. I Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (6 Th)
Bemmel 1716/00/00 FRHDR 0047 Bemmel I Von Bemmel eine dito [Landschafft]. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (45)
1752/00/00 NGWOL 0126 Bommel I Sechs Landschaften. Sei Paesaggi. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 125 bis 130 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (30 Th für die Nrn. 125-130)
1716/00/00 FRHDR 0048 Bemmel I Von dito [Bemmel] eine dito [Landschafft]. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (45)
1752/00/00 NGWOL 0127 Bommel I Sechs Landschaften. Sei Paesaggi. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 125 bis 130
1752/00/00 NGWOL 0125 Bommel I Sechs Landschaften. Sei Paesaggi. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 125 bis 130 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (30 Th für die Nrn. 125-130)
GEMÄLDE
247
wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (30 Th für die Nm. 125-130) 1752/00/00 NGWOL 0128 Bommel I Sechs Landschaften. Sei Paesaggi. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 125 bis 130 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (30 Th für die Nrn. 125-130) 1752/00/00 NGWOL 0129 Bommel I Sechs Landschaften. Sei Paesaggi. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 125 bis 130 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (30 Th für die Nrn. 125-130) 1752/00/00 NGWOL 0130 Bommel I Sechs Landschaften. Sei Paesaggi. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 125 bis 130 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (30 Th für die Nm. 125-130) 1752/00/00 NGWOL 0140 Bommel I Vier Landschaften. Quattro Paesaggi. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 140 bis 143 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (16 Th für die Nm. 140-143) 1752/00/00 NGWOL 0141 Bommel I Vier Landschaften. Quattro Paesaggi. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 140 bis 143 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (16 Th für die Nm. 140-143) 1752/00/00 NGWOL 0142 Bommel I Vier Landschaften. Quattro Paesaggi. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 140 bis 143 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (16 Th für die Nrn. 140-143) 1752/00/00 NGWOL 0143 Bommel I Vier Landschaften. Quattro Paesaggi. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 140 bis 143 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (16 Th für die Nm. 140-143) 1752/00/00 NGWOL 0144 Bommel I Zwo andere Landschafften. Due altri [Paesaggi], I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 144 und 145 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (6 Th für die Nm. 144-145) 1752/00/00 NGWOL 0145 Bommel I Zwo andere Landschafften. Due altri [Paesaggi]. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 144 und 145 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (6 Th für die Nm. 144-145) 1752/00/00 NGWOL 0179 Bommel I Drei Bataillen. Tre Battaglie. I Diese Nr.: Eine Bataille Anm.: Die Lose 179 bis 181 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (6 Th für die Nm. 179-181) 1752/00/00 NGWOL 0180 Bommel I Drei Bataillen. Tr£ Battaglie. I Diese Nr.: Eine Bataille Anm.: Die Lose 179 bis 181 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (6 Th für die Nm. 179-181) 1752/00/00 NGWOL 0181 Bommel I Drei Bataillen. Trt Battaglie. I Diese Nr.: Eine Bataille Anm.: Die Lose 179 bis 181 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (6 Th für die Nm. 179-181) 1752/00/00 NGWOL 0218 Bommel I Eine Landschaft. Vn Paesaggio. I Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (1.8 Th) 1764/03/12 FRKAL 0152 Bemmel I Un pai'sage par Bemmel. I Anm.: Dieses Los wurde zusammen mit der Nr. 153 (Bioemen) verkauft. Transakt.: Verkauft (2.8 fl für die Nm. 152 und 153) Käufer: R Ehrenreich 1764/08/25 FRAN 0188 Bemmel I Une cascade. I Maße: haut 8 Vi pouces sur 12 pouces de large Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 248
GEMÄLDE
1764/08/25 FRAN 0409 Bemmel I Un pai'sage. I Maße: haut 2 pieds 1 pouces sur 2 pieds 9 pouces de large Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRNGL 0089 Unbekannt (8 fl Schätzung)
Bemmel I 2 Landschaften. I Transakt.:
1765/00/00 FRNGL 0122 Unbekannt (6 fl Schätzung)
Bemmel I 2 Landschaften. I Transakt.:
1765/00/00 FRNGL 0152 Unbekannt (6 fl Schätzung)
Bemmel I 2 Landschaften. I Transakt.:
1765/00/00 FRNGL 0158 Unbekannt (6 fl Schätzung)
Bemmel I 2 Landschaften. I Transakt.:
1765/03/27 FRKAL 0201 Transakt.: Unbekannt
Bemmel I Un pai'sage par Bemmel. I
1767/10/15 FRAN 0035 Bemmel I Zwey Landschaften von Bemmel. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: Breit 1 Schuh 8 % Zoll. Höhe 1 Schuh 4 Zoll Anm.: Die Lose 35 und 36 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1767/10/15 FRAN 0036 Bemmel I Zwey Landschaften von Bemmel. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: Breit 1 Schuh 8 % Zoll. Höhe 1 Schuh 4 Zoll Anm.: Die Lose 35 und 36 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1776/11/09 HB KOS 0029 Bemmel I Zwo kleine Landschaften, auf Holz, mit dito [schwarzen] Rähmen und [verguldeten] Leisten. I Diese Nr.: Eine kleine Landschaft Mat.: auf Holz Maße: Höhe 6 Zoll, Breite 8 Zoll Anm.: Die Lose 29 und 30 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (8 Μ für die Nm. 29 und 30) Käufer: Peetz 1776/11/09 HBKOS 0030 Bemmel I Zwo kleine Landschaften, auf Holz, mit dito [schwarzen] Rähmen und [verguldeten] Leisten. I Diese Nr.: Eine kleine Landschaft Mat.: auf Holz Maße: Höhe 6 Zoll, Breite 8 Zoll Anm.: Die Lose 29 und 30 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (8 Μ für die Nm. 29 und 30) Käufer: Peetz 1776/11/09 HBKOS 0083 Bemmel I Eine plaisante Landschaft, zu Nr. 38 gehörig, auf Leinwand gemahlt, mit schwarzen Rahm und verguldete Leisten. I Pendant zu Nr. 38 von Peter Bemmel Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 8 Zoll, Breite 10 V2 Zoll Transakt.: Verkauft (18.8 Μ für die Nm. 38 und 83) Käufer: Peetz 1777/03/03 AU AN 0032 Bemmel I Vier Stück Landschaften. I Maße: Höhe 2 Sch. 2 Zoll, Breite 2 Sch. 9 Vi Zoll Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt 1777/03/03 AUAN 0033 Bemmel I Zwey Stücke Feuerbrunsten. I Maße: Höhe 2 Sch. 1 Vi Zoll, Breite 2 Sch. 2 Zoll Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt 1777/03/03 AUAN 0089 Bemmel I Vier kleine Landschaften. I Maße: Höhe 5 Vi Zoll, Breite 6 Zoll Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt 1778/10/30 HBKOS 0057 Bemmel I Zwey arcadische Landschaften, auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine arcadische Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 6 Vi Zoll, breit 13 Vi Zoll Anm.: Die Lose 57 und 58 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/10/30 HBKOS 0058 Bemmel I Zwey arcadische Landschaften, auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine arcadische Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 6 Vi Zoll, breit 13 Vi Zoll Anm.: Die Lose 57 und 58 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1779/09/27 FRNGL 0561 Bemmell I Eine fleißige Landschaft. [Un beau paysage.] I Pendant zu Nr. 562 Maße: 7 Vi Zoll hoch, 11 Zoll breit Transakt.: Verkauft (2.44 fl für die Nm. 561 und 562) Käufer: Mevius
1779/09/27 FRNGL 0562 Bemmell I Der Compagnon zu obigem, eine dergleichen Landschaft, von nemlichem Meister [Bemmell] und Maas. [Le pendant du precedent, meme objet [un beau paysage], par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 561 Maße: 7 Vi Zoll hoch, 11 Zoll breit Transakt.: Verkauft (2.44 fl für die Nrn. 561 und 562) Käufer: Mevius 1779/09/27 FRNGL 0680 Bemmel I Eine Dorfgegend wodurch Wasser fliesset. [Contree villageoise coupee par un ruisseau.] I Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 1 Schuh 7 Zoll breit Transakt.: Verkauft (2 fl) Käufer: Mevius 1781/03/26 BLHRG 2385 Bemel I Deux Paisages tir6 en Perspective avec des figures. I Transakt.: Unbekannt 1781/07/18 FRAN 0033 Boemell \ Ein See=Stück von Boemell. I Pendant zu Nr. 34 Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 2 Schuh 1 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
1784/08/02 FRNGL 0133 Bemmell I Vier schöne Landschaften. I Diese Nr.: Eine schöne Landschaft Maße: 23 Vi Zoll breit, 17 Vi Zoll hoch Anm.: Die Lose 132 bis 135 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: C Transakt.: Verkauft (3.2 fl für die Nrn. 132135) Käufer: Bäumer 1784/08/02 FRNGL 0134 Bemme« I Vier schöne Landschaften. I Diese Nr.: Eine schöne Landschaft Maße: 23 Vi Zoll breit, 17 Vi Zoll hoch Anm.: Die Lose 132 bis 135 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: C Transakt.: Verkauft (3.2 fl für die Nrn. 132135) Käufer: Bäumer 1784/08/02 FRNGL 0135 Bemmell I Vier schöne Landschaften. I Diese Nr.: Eine schöne Landschaft Maße: 23 Vi Zoll breit, 17 Vi Zoll hoch Anm.: Die Lose 132 bis 135 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: C Transakt.: Verkauft (3.2 fl für die Nrn. 132135) Käufer: Bäumer
1781/07/18 FRAN 0034 Boemell I dito [Ein See=Stück] Compagn. von dito [Boemell]. I Pendant zu Nr. 33 Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 2 Schuh 1 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
1784/08/02 FRNGL 0355 Bemmell I Ein Gewitterstück. I Maße: 10 Zoll breit, 7 Zoll hoch Verkäufer: Α Transakt.: Verkauft (1.44 fl) Käufer: Hacker
1781/07/18 FRAN 0058 Boemell I Eine Landschaft von Boemell. I Pendant zu Nr. 59 Maße: 1 Schuh 6 Zoll hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
1784/08/02 FRNGL 0428 Bemmel I Eine Landschaft mit einem Aufgang der Sonne. I Maße: 30 Zoll breit, 24 Zoll hoch Verkäufer: Α Transakt.: Verkauft (1 fl) Käufer: de Dessau
1781/07/18 FRAN 0059 Boemell I dito [Eine Landschaft] Compagn. I Pendant zu Nr. 58 Maße: 1 Schuh 6 Zoll hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
1784/08/02 FRNGL 0643 Bemmell I Zwey Landschaften von Bemmell. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 31 Zoll breit, 24 Zoll hoch Anm.: Die Lose 643 und 644 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (3.15 fl für die Nrn. 643 und 644) Käufer: Ehrenreich
1781/07/18 FRAN 0102 Boemell I Eine Landschaft. I Pendant zu Nr. 103 Maße: 2 Schuh 5 Zoll hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/07/18 FRAN 0103 Boemell I dito [Eine Landschaft] Comp. I Pendant zu Nr. 102 Maße: 2 Schuh 5 Zoll hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/07/18 FRAN 0141 Boemmel I Eine Landschaft. I Pendant zu Nr. 142 Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 2 Schuh 1 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/07/18 FRAN 0142 Boemmel I dito [Eine Landschaft] Compagn. I Pendant zu Nr. 141 Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 2 Schuh 1 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1782/02/18 RGBZN 0035 akt.: Unbekannt (8 fl)
Bemel I Zwey Landschaften. I Trans-
1782/05/29 FRFAY 0088 Bemel I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 13 Zoll hoch, 18 Zoll breit Anm.: Die Lose 88 und 89 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Thorhorst Transakt.: Unbekannt (2.28 fl für die Nrn. 88 und 89) 1782/05/29 FRFAY 0089 Bemel I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 13 Zoll hoch, 18 Zoll breit Anm.: Die Lose 88 und 89 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Thorhorst Transakt.: Unbekannt (2.28 fl für die Nrn. 88 und 89) 1782/05/29 FRFAY 0125 Bemel I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 20 Zoll hoch, 25 Zoll breit Anm.: Die Lose 125 und 126 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Thorhorst Transakt.: Unbekannt (3.12 fl für die Nrn. 125 und 126) 1782/05/29 FRFAY 0126 Bemel I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 20 Zoll hoch, 25 Zoll breit Anm.: Die Lose 125 und 126 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Thorhorst Transakt.: Unbekannt (3.12 fl für die Nm. 125 und 126) 1784/08/02 FRNGL 0132 Bemme« I Vier schöne Landschaften. I Diese Nr.: Eine schöne Landschaft Maße: 23 Vi Zoll breit, 17 Vi Zoll hoch Anm.: Die Lose 132 bis 135 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: C Transakt.: Verkauft (3.2 fl für die Nm. 132135) Käufer: Bäumer
1784/08/02 FRNGL 0644 Bemmell I Zwey Landschaften von Bemmell. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 31 Zoll breit, 24 Zoll hoch Anm.: Die Lose 643 und 644 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (3.15 fl für die Nrn. 643 und 644) Käufer: Ehrenreich 1784/08/13 HBDEN 0014 Bemmel I Eine bergigte Landschaft mit einem Schlosse. Sehr stark gemahlt von Bemmel, auf Leinwand. [NB. Alle Gemähide bis No. 33 haben keine Rahmen.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 13 Vi Zoll. Breit 16 Vi Zoll. Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 33 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 33. Verkäufer: Pasche [oder] Flügge Transakt.: Verkauft (1 M) Käufer: Ehr[enreich] 1784/09/27 FRAN 0078 Bemmel I Drey schöne Landschaften von Bemmel. [Trois beaux paysages par Bemmel.] I Maße: 1 Schuh 3 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 7 Zoll breit Verkäufer: Freyherr von Berberich Transakt.: Verkauft (3 fl) Käufer: Kessel 1784/09/27 FRAN 0083 Bemmel I Eine schöne Landschaft von Bemmel. [Un beau paysage par Bemmel.] I Maße: 2 Schuh 1 Zoll hoch, 2 Schuh 7 Zoll breit Verkäufer: Freyherr von Berberich Transakt.: Verkauft (1.45 fl) Käufer: Ignatz 1784/09/27 FRAN 0091 Bemel I Zwey Landschaften von Bemel. [Deux paysages, par Bemmel.] I Maße: 2 Schuh 10 Zoll hoch, 2 Schuh 5 Zoll breit Verkäufer: Freyherr von Berberich Transakt.: Verkauft (5.30 fl) Käufer: Moevius 1784/09/27 FRAN 0109 Bemmel I Zwey anmuthige Flußgegenden von Bemmel. [Deux vues agreables pres d'unes [sic] riviere.] I Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 1 Schuh 8 Zoll breit Verkäufer: Freyherr von Berberich Transakt.: Verkauft (5 fl) Käufer: Kessel 1784/09/27 FRAN 0118 Bemmel I Zwey schöne Landschaften vom Bemmel. [Deux beaux paysages par Bemmel.] I Maße: 2 Schuh 1 Zoll hoch, 2 Schuh 8 Zoll breit Verkäufer: Freyherr von Berberich Transakt.: Verkauft (4 fl) Käufer: Kessel 1784/09/27 FRAN 0154 Bemmel I Sieben Landschaften in Oehlfarb gemahlt von Bemmel. [Sept paysages peints ä l'huile.] I Mat.: Öl Maße: 5 Zoll hoch, 7 Zoll breit Verkäufer: Freyherr von Berberich Transakt.: Verkauft (3.15 fl) Käufer: Hanover GEMÄLDE
249
1785/05/17 MZAN 1119 Bemmel I Eine Landschaft von Bemmel. [Un paysage.] I Maße: 2 Schuh 11 Zoll hoch, 4 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (5 fl) Käufer: Forstrath Keck 1786/05/02 NGAN 0658 Bemmel I Zwey Landschäftlein auf Pappendeckel. I Diese Nr.: Ein Landschäftlein Maße: 6 Zoll hoch, 7 Zoll breit Anm.: Die Lose 658 und 659 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (49 Kr für die Nrn. 658 und 659) 1786/05/02 NGAN 0659 Bemmel I Zwey Landschäftlein auf Pappendeckel. I Diese Nr.: Ein Landschäftlein Maße: 6 Zoll hoch, 7 Zoll breit Anm.: Die Lose 658 und 659 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (49 Kr für die Nrn. 658 und 659) 1786/05/02 NGAN 0660 Bemmel I Item [Zwey Landschäftlein] auf Pappendeckel gemalt. I Diese Nr.: Ein Landschäftlein Maße: 6 Zoll hoch, 7 Zoll breit Anm.: Die Lose 660 und 661 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (50 Kr für die Nrn. 660 und 661) Käufer: Dr Leinkert 1786/05/02 NGAN 0661 Bemmel I Item [Zwey Landschäftlein] auf Pappendeckel gemalt. I Diese Nr.: Ein Landschäftlein Maße: 6 Zoll hoch, 7 Zoll breit Anm.: Die Lose 660 und 661 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (50 Kr für die Nm. 660 und 661) Käufer: Dr Leinker 1786/10/18 HBTEX 0167 Bemmel I Zwey bergigte Land= und Wassergegenden mit vielen Figuren. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Eine bergigte Land= und Wassergegend mit vielen Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 9 Zoll, breit 12 Zoll Anm.: Die Lose 167 und 168 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/10/18 HBTEX 0168 Bemmel I Zwey bergigte Land= und Wassergegenden mit vielen Figuren. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Eine bergigte Land= und Wassergegend mit vielen Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 9 Zoll, breit 12 Zoll Anm.: Die Lose 167 und 168 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1788/01/15 LZRST 3953 Bemmel I Zwey gute Landschaften, von Bemmel, 9 Z. hoch, 14 Z. breit, verg. Rahm. I Maße: 9 Zoll hoch, 14 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (3 Th) Käufer: Gottlob 1788/01/31 LZRST [0002] Bemmel I 2. Detti [Landschaften] von Bemmel auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Transakt.: Verkauft (1.8 Th) Käufer: L
breit, vom jungen Bemmel. [Donze [sic] petits paysages, sur toile.] I Diese Nr.: Zwei Landschäftchen Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 9 Zoll hoch, 2 Fuß 5 Zoll breit [1 pied 7 pouces de haut, 2 pieds 5 pouces de large] Anm.: Die Lose 372 bis 377 wurden zusammen katalogisiert. Die Dimensionen unterscheiden sich in der deutschen und französischen Fassung des Katalogs. Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (33 fl für die Nrn. 372-377) 1789/00/00 MMAN 0373 der junge Bemmel I Zwölf Landschäftchen, auf Leinw. jedes 1 Fuß 9 Zoll hoch und 2 Fuß 5 Zoll breit, vom jungen Bemmel. [Donze [sie] petits paysages, sur toile.] I Diese Nr.: Zwei Landschäftchen Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 9 Zoll hoch, 2 Fuß 5 Zoll breit [1 pied 7 pouces de haut, 2 pieds 5 pouces de large] Anm.: Die Lose 372 bis 377 wurden zusammen katalogisiert. Die Dimensionen unterscheiden sich in der deutschen und französischen Fassung des Katalogs. Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (33 fl für die Nrn. 372-377) 1789/00/00 MMAN 0374 der junge Bemmel I Zwölf Landschäftchen, auf Leinw. jedes 1 Fuß 9 Zoll hoch und 2 Fuß 5 Zoll breit, vom jungen Bemmel. [Donze [sie] petits paysages, sur toile.] I Diese Nr.: Zwei Landschäftchen Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 9 Zoll hoch, 2 Fuß 5 Zoll breit [1 pied 7 pouces de haut, 2 pieds 5 pouces de large] Anm.: Die Lose 372 bis 377 wurden zusammen katalogisiert. Die Dimensionen unterscheiden sich in der deutschen und französischen Fassung des Katalogs. Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (33 fl für die Nrn. 372-377) 1789/00/00 MMAN 0375 der junge Bemmel I Zwölf Landschäftchen, auf Leinw. jedes 1 Fuß 9 Zoll hoch und 2 Fuß 5 Zoll breit, vom jungen Bemmel. [Donze [sie] petits paysages, sur toile.] I Diese Nr.: Zwei Landschäftchen Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 9 Zoll hoch, 2 Fuß 5 Zoll breit [1 pied 7 pouces de haut, 2 pieds 5 pouces de large] Anm.: Die Lose 372 bis 377 wurden zusammen katalogisiert. Die Dimensionen unterscheiden sich in der deutschen und französischen Fassung des Katalogs. Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (33 fl für die Nrn. 372-377) 1789/00/00 MMAN 0376 der junge Bemmel I Zwölf Landschäftchen, auf Leinw. jedes 1 Fuß 9 Zoll hoch und 2 Fuß 5 Zoll breit, vom jungen Bemmel. [Donze [sie] petits paysages, sur toile.] I Diese Nr.: Zwei Landschäftchen Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 9 Zoll hoch, 2 Fuß 5 Zoll breit [1 pied 7 pouces de haut, 2 pieds 5 pouces de large] Anm.: Die Lose 372 bis 377 wurden zusammen katalogisiert. Die Dimensionen unterscheiden sich in der deutschen und französischen Fassung des Katalogs. Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (33 fl für die Nrn. 372-377)
1788/09/01 KOAN 0656 Bemmel I 2 Landschaften, [deux paysage.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 4 Zoll, Breite 2 Fuß Anm.: Die Lose 656 und 657 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt
1789/00/00 MMAN 0377 der junge Bemmel I Zwölf Landschäftchen, auf Leinw. jedes 1 Fuß 9 Zoll hoch und 2 Fuß 5 Zoll breit, vom jungen Bemmel. [Donze [sie] petits paysages, sur toile.] I Diese Nr.: Zwei Landschäftchen Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 9 Zoll hoch, 2 Fuß 5 Zoll breit [1 pied 7 pouces de haut, 2 pieds 5 pouces de large] Anm.: Die Lose 372 bis 377 wurden zusammen katalogisiert. Die Dimensionen unterscheiden sich in der deutschen und französischen Fassung des Katalogs. Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (33 fl für die Nm. 372-377)
1788/09/01 KOAN 0657 Bemmel I 2 Landschaften, [deux paysage.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 4 Zoll, Breite 2 Fuß Anm.: Die Lose 656 und 657 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt
1789/00/00 MMAN 0388 der junge Bemmel I Ein Landschäftchen, auf Leinw. 1 Fuß 3 Zoll hoch und 1 Fuß 9 Zoll breit, vom jungen Bemmel. [Un paysage, surtoile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 3 Zoll hoch, 1 Fuß 9 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt
1789/00/00 MMAN 0299 der junge Bemmel I Zwei Landschaften, auf Leinw. 10 Zoll hoch und 1 Fuß 3 Zoll breit, vom jungen Bemmel. [Deux pay sages, surtoile.] Mat.: auf Leinwand Maße: 10 Zoll hoch, 1 Fuß 3 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (2 fl)
1789/00/00 MMAN 0400 der junge Bemmel I Zwei kleine Landschäftchen, auf Leinw. jedes 1 Fuß hoch und 1 Fuß 6 Zoll breit, vom jungen Bemmel. [Deux petits paysages, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß hoch, 1 Fuß 6 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt
1789/00/00 MMAN 0372 der junge Bemmel I Zwölf Landschäftchen, auf Leinw. jedes 1 Fuß 9 Zoll hoch und 2 Fuß 5 Zoll
1790/08/25 FRAN 0134 Bemmel I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: hoch 9 Zoll, breit 11 Vi Zoll Anm.: Die
1788/04/08 FRFAY 0251[H] Bemel I 3 Bemel. I Anm.: Dieses Los wurde handschriftlich dem Exemplar AMF hinzugefügt. Transakt.: Verkauft (5.30 fl) Käufer: Bender
250
GEMÄLDE
Lose 134 und 135 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (2.15 fl für die Nrn. 134 und 135) Käufer: Müntzrath Dietz 1790/08/25 FRAN 0135 Bemmel I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: hoch 9 Zoll, breit 11 Vi Zoll Atim.: Die Lose 134 und 135 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (2.15 fl für die Nrn. 134 und 135) Käufer: Müntzrath Dietz 1792/08/20 KOAN 0245 Bemmel I Zwey große Landschaften mit Figuren, vielen Bäumen, und Viehe von Bemmel. I Diese Nr.: Ein große Landschaft mit Figuren, vielen Bäumen, und Viehe Maße: 4 Schuh 3 Zoll hoch, 6 Schuh breit Anm.: Die Lose 245 und 246 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0246 Bemmel I Zwey große Landschaften mit Figuren, vielen Bäumen, und Viehe von Bemmel. I Diese Nr.: Ein große Landschaft mit Figuren, vielen Bäumen, und Viehe Maße: 4 Schuh 3 Zoll hoch, 6 Schuh breit Anm.: Die Lose 245 und 246 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0354 Bemmel I Achtzehn kleine Landschäftcher neu verfertigt von Bemmel. I Diese Nr.: Ein kleines Landschäftchen neu verfertigt Anm.: Die Lose 354 bis 371 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0355 Bemmel I Achtzehn kleine Landschäftcher neu verfertigt von Bemmel. I Diese Nr.: Ein kleines Landschäftchen neu verfertigt Anm.: Die Lose 354 bis 371 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0356 Bemmel I Achtzehn kleine Landschäftcher neu verfertigt von Bemmel. I Diese Nr.: Ein kleines Landschäftchen neu verfertigt Anm.: Die Lose 354 bis 371 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0357 Bemmel I Achtzehn kleine Landschäftcher neu verfertigt von Bemmel. I Diese Nr.: Ein kleines Landschäftchen neu verfertigt Anm.: Die Lose 354 bis 371 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0358 Bemmel I Achtzehn kleine Landschäftcher neu verfertigt von Bemmel. I Diese Nr.: Ein kleines Landschäftchen neu verfertigt Anm.: Die Lose 354 bis 371 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0359 Bemmel I Achtzehn kleine Landschäftcher neu verfertigt von Bemmel. I Diese Nr.: Ein kleines Landschäftchen neu verfertigt Anm.: Die Lose 354 bis 371 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0360 Bemmel I Achtzehn kleine Landschäftcher neu verfertigt von Bemmel. I Diese Nr.: Ein kleines Landschäftchen neu verfertigt Anm.: Die Lose 354 bis 371 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0361 Bemmel I Achtzehn kleine Landschäftcher neu verfertigt von Bemmel. I Diese Nr.: Ein kleines Landschäftchen neu verfertigt Anm..· Die Lose 354 bis 371 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0362 Bemmel I Achtzehn kleine Landschäftcher neu verfertigt von Bemmel. I Diese Nr.: Ein kleines Landschäftchen neu verfertigt Anm.: Die Lose 354 bis 371 wurden zu-
sammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0363 Bemmel I Achtzehn kleine Landschäftcher neu verfertigt von Bemmel. I Diese Nr.: Ein kleines Landschäftchen neu verfertigt Anm.: Die Lose 354 bis 371 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0364 Bemmel I Achtzehn kleine Landschäftcher neu verfertigt von Bemmel. I Diese Nr.: Ein kleines Landschäftchen neu verfertigt Anm.: Die Lose 354 bis 371 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0365 Bemmel I Achtzehn kleine Landschäftcher neu verfertigt von Bemmel. I Diese Nr.: Ein kleines Landschäftchen neu verfertigt Anm.: Die Lose 354 bis 371 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0366 Bemmel I Achtzehn kleine Landschäftcher neu verfertigt von Bemmel. I Diese Nr.: Ein kleines Landschäftchen neu verfertigt Anm.: Die Lose 354 bis 371 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0367 Bemmel I Achtzehn kleine Landschäftcher neu verfertigt von Bemmel. I Diese Nr.: Ein kleines Landschäftchen neu verfertigt Anm.: Die Lose 354 bis 371 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0368 Bemmel I Achtzehn kleine Landschäftcher neu verfertigt von Bemmel. I Diese Nr.: Ein kleines Landschäftchen neu verfertigt Anm.: Die Lose 354 bis 371 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0369 Bemmel I Achtzehn kleine Landschäftcher neu verfertigt von Bemmel. I Diese Nr.: Ein kleines Landschäftchen neu verfertigt Anm.: Die Lose 354 bis 371 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0370 Bemmel I Achtzehn kleine Landschäftcher neu verfertigt von Bemmel. I Diese Nr.: Ein kleines Landschäftchen neu verfertigt Anm.: Die Lose 354 bis 371 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0371 Bemmel I Achtzehn kleine Landschäftcher neu verfertigt von Bemmel. I Diese Nr.: Ein kleines Landschäftchen neu verfertigt Anm.: Die Lose 354 bis 371 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0372 Bemmel I Eine angenehme Landschaft mit Wasser und einigen Figuren, nebst Vieh, von Bemmel. I Maße: 9 Zoll hoch, 1 Schuh breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1796/08/01 NGFRZ 0014 Bemmel I 3 Landschaften von Bemmel. [Gemälde in Oel in schönen Rahmen. (N.B. Die Größe ist ohne das Rahm gemessen.)] I Mat.: Öl Maße: Breite 10 Zoll, Höhe 8 Zoll. [Rheinisch Maaß] Anm.: Die Angaben in eckigen Klammem im Bildtitel erscheinen über der Nr. 1 und beziehen sich auf die Nm. 1 bis 25. Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0165 Van Bemmel I Eine Landschaft mit Ruinen, im Vordergründe ein Hirte mit Pferden, Eseln, Schaafen, Kühen, und ein kleiner Junge mit einem Hund. Auf Leinwand, schwarzen Rahm, goldene Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 18 '/i Zoll, breit 22 Zoll Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
251
1797/12/08 HBPAK 0101 Bemmel I Eine Landschaft mit Vieh. Auf Leinwand, im schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 12 Zoll, Breite 16 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/01/19 HBPAK 0077 Böhmel I Zwey vortrefliche Landschaften von Böhmel. Auf Holz gemahlt. Die Farben schmelzen sehr in einander und das Licht ist auf wenige Gegenstände isolirt, welches eine ausserordentliche Wirkung hervorbringt. Gleicher Grösse. 9 Zoll hoch, 1 Fuß breit. Goldn. Rahm. I Diese Nr.: Eine vortrefliche Landschaft Mat.: auf Holz Maße: 9 Zoll hoch, 1 Fuß breit Anm.: Die Lose 77 und 78 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/01/19 HBPAK 0078 Böhmel I Zwey vortrefliche Landschaften von Böhmel. Auf Holz gemahlt. Die Farben schmelzen sehr in einander und das Licht ist auf wenige Gegenstände isolirt, welches eine ausserordentliche Wirkung hervorbringt. Gleicher Grösse. 9 Zoll hoch, 1 Fuß breit. Goldn. Rahm. I Diese Nr.: Eine vortrefliche Landschaft Mat.: auf Holz Maße: 9 Zoll hoch, 1 Fuß breit Anm.: Die Lose 77 und 78 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0055 Bremmel I Eine Landschaft mit Vieh. Auf Leinwand, schwarzer Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 16 Zoll, breit 11 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/08/10 HBPAK 0046 Bemmel I Zwey bergigte Landschaften, wo Hirten ihr Vieh weiden. Gut und brav gemahlt. Auf Leinwand, im schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Eine bergigte Landschaft, wo Hirten ihr Vieh weiden Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 26 Zoll, breit 20 Zoll Anm.: Die Lose 46 und 47 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/08/10 HBPAK 0047 Bemmel I Zwey bergigte Landschaften, wo Hirten ihr Vieh weiden. Gut und brav gemahlt. Auf Leinwand, im schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Eine bergigte Landschaft, wo Hirten ihr Vieh weiden Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 26 Zoll, breit 20 Zoll Anm.: Die Lose 46 und 47 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/12/10 WNAN 0002 Bemmel I Zwey auf Kupfer gemahlte kleine Landschaften, nächtliche Vorstellungen. I Mat.: auf Kupfer Verkäufer: Prof Adam Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0522 Bemmel I Sechs Landschäftchen, von Bemmel. Auf Pappendeckel. I Diese Nr.: Ein Landschäftchen Mat.: auf Pappe Anm.: Die Lose 522 bis 527 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0523 Bemmel I Sechs Landschäftchen, von Bemmel. Auf Pappendeckel. I Diese Nr.: Ein Landschäftchen Mat.: auf Pappe Anm.: Die Lose 522 bis 527 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0524 Bemmel I Sechs Landschäftchen, von Bemmel. Auf Pappendeckel. I Diese Nr.: Ein Landschäftchen Mat.: auf Pappe Anm.: Die Lose 522 bis 527 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0525 Bemmel I Sechs Landschäftchen, von Bemmel. Auf Pappendeckel. I Diese Nr.: Ein Landschäftchen Mat.: auf Pappe Anm.: Die Lose 522 bis 527 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0526 Bemmel I Sechs Landschäftchen, von Bemmel. Auf Pappendeckel. I Diese Nr.: Ein Landschäftchen Mat.: auf Pappe Anm.: Die Lose 522 bis 527 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0527 Bemmel I Sechs Landschäftchen, von Bemmel. Auf Pappendeckel. I Diese Nr.: Ein Landschäftchen Mat.: auf Pappe Anm.: Die Lose 522 bis 527 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 252
GEMÄLDE
1799/00/00 WZAN 0669 Bemmel I Zwey Landschäftchen, von Bemmel. Auf Pappendeckel. I Diese Nr.: Ein Landschäftchen Mat.: auf Pappe Maße: hoch 6 Zoll breit 7 Zoll Anm.: Die Lose 669 und 670 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0670 Bemmel I Zwey Landschäftchen, von Bemmel. Auf Pappendeckel. I Diese Nr.: Ein Landschäftchen Mat.: auf Pappe Maße: hoch 6 Zoll breit 7 Zoll Anm.: Die Lose 669 und 670 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0693 Bemmel I Zwey Landschäftchen, von Bemmel. Auf Pappendeckel. I Diese Nr.: Ein Landschäftchen Mat.: auf Pappe Maße: hoch 6 Zoll breit 8 Zoll Anm.: Die Lose 693 und 694 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0694 Bemmel I Zwey Landschäftchen, von Bemmel. Auf Pappendeckel. I Diese Nr.: Ein Landschäftchen Mat. : auf Pappe Maße: hoch 6 Zoll breit 8 Zoll Anm.: Die Lose 693 und 694 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0126 Bemmel I Zwey Landschäftchen, von Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Landschäftchen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 9 Zoll breit 1 Schuh 1 Zoll Anm.: Die Lose A126 und A127 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0127 Bemmel I Zwey Landschäftchen, von Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Landschäftchen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 9 Zoll breit 1 Schuh 1 Zoll Anm.: Die Lose A126 und A127 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0162 Bemmel I Zwey Landschäftchen, von Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Landschäftchen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 9 Zoll breit 1 Schuh 1 Zoll Anm.: Die Lose A162 und A163 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0163 Bemmel I Zwey Landschäftchen, von Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Landschäftchen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 9 Zoll breit 1 Schuh 1 Zoll Anm.: Die Lose A162 und A163 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0217 Bemmel I Zwey Landschäftchen, ovalrund. Von Bemmel. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Landschäftchen Mat.: auf Holz Format: oval Maße: hoch 3 Zoll breit 5 Zoll Anm.: Die Lose A217 und A218 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0218 Bemmel I Zwey Landschäftchen, ovalrund. Von Bemmel. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Landschäftchen Mat.: auf Holz Format: oval Maße: hoch 3 Zoll breit 5 Zoll Anm.: Die Lose A217 und A218 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0340 Bemmel I Zwey Landschäftchen, das eine mit Ruinen, von Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Landschäftchen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 10 Zoll breit 1 Schuh 1 Zoll Anm.: Die Lose A340 und A341 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0341 Bemmel I Zwey Landschäftchen, das eine mit Ruinen, von Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Landschäftchen mit Ruinen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 10 Zoll breit 1 Schuh 1 Zoll Anm.: Die Lose A340 und A341 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Bemmel (und Murrer, Joh.) 1752/00/00 NGWOL 0047 Bommel; Morrer I Zwo Landschaften, von Bommel, mit Figuren von Morrer staffirt. Due paessaggi del Bemmel figurati dal Morrer. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 47 und 48 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (12 Th für die Nrn. 47 und 48) 1752/00/00 NGWOL 0048 Bommel; Morrer I Zwo Landschaften, von Bommel, mit Figuren von Morrer staffirt. Due paessaggi del Bemmel figurati dal Morrer. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 47 und 48 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (12 Th für die Nrn. 47 und 48)
Bemmel (und Querfurt) 1785/05/17 MZAN 0821 Bemmel; Querfurt I Das Gegenbild, ein Jagdstück, die Landschaft von Bemmel, die Figuren von Querfurt, von nämlicher Höhe und Breite. [Le pendant, une chasse, le paysage par Bemmel, les figures par Querfurt meme hauteur & largeur.] I Pendant zu Nr. 820 von Querfurt Maße: 1 Schuh 2 Zoll hoch, 1 Schuh 5 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (6 fl für die Nm. 820 und 821) Käufer: Pfaf Bildhauer
Bemmel (und Roos, J.H.) 1781/07/18 FRAN 0011 Boemell; Heinrich Roos I Eine Landschaft von Boemell mit Vieh von Heinrich Roos. I Pendant zu Nr. 12 Maße: 1 Schuh 10 Zoll hoch, 2 Schuh 5 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/07/18 FRAN 0012 Boemell; Heinrich Roos I dito [Eine Landschaft von Boemell mit Vieh von Heinrich Roos] Compagn. I Pendant zu Nr. 11 Maße: 1 Schuh 10 Zoll hoch, 2 Schuh 5 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Bemmel (Manier) 1784/08/02 FRNGL 0654 Bemmel I Eine in Bemmlischer Manier keck verfertigte Landschaft. I Maße: 29 Zoll breit, 24 Zoll hoch Transakt.: Verkauft (1 fl) Käufer: Nothnagel
Bemmel, C. von (und Trautmann, J.G.) 1772/00/00 BSFRE 0005 Bemmel (C.V.); Trautmann I Deux Payssages, representants des orages, les figures sont bien executes par Trautmann. Cadres noirs. I Diese Nr.: Un Payssage, representant un orage Mat.: auf Leinwand Maße: haut de 25 & large de 32 pouces Anm.: Die Lose 5 und 6 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1772/00/00 BSFRE 0006 Bemmel (C.V.); Trautmann I Deux Payssages, representants des orages, les figures sont bien executes par Trautmann. Cadres noirs. I Diese Nr.: Un Payssage, representant un orage Mat.: auf Leinwand Maße: haut de 25 & large de 32 pouces Anm.: Die Lose 5 und 6 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Bemmel, Georg von
Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (20 Th für die Nrn. 23 und 24) 1752/00/00 NGWOL 0034 G. Bommel I Zwo Landschaften. Due paesaggi. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 34 und 35 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (10 Th für die Nm. 34 und 35) 1752/00/00 NGWOL 0035 G. Bommel I Zwo Landschaften. Due paesaggi. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 34 und 35 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (10 Th für die Nrn. 34 und 35) 1752/00/00 NGWOL 0045 G. Bommel I Ein Husaren=Marsch. Vna marcia d'Vssari. I Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (10 Th) 1752/00/00 NGWOL 0115 G. Bommel I Eine kleine Bataille. Vna piccola Battaglia. I Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (2 Th) 1752/00/00 NGWOL 0121 G. Bommel I Eine Bataille. Vna Battaglia. I Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (10 Th) 1752/00/00 NGWOL 0164 G. Bommel I Eine Bataille und ein Postilion. Vna Battaglia ed un Postiglione. I Diese Nr.: Eine Bataille Anm.: Die Lose 164 und 165 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (2.16 Th für die Nrn. 164 und 165) 1752/00/00 NGWOL 0165 G. Bommel I Eine Bataille und ein Postilion. Vna Battaglia ed un Postiglione. I Diese Nr.: Eine Bataille Anm.: Die Lose 164 und 165 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (2.16 Th für die Nrn. 164 und 165) 1784/09/27 FRAN 0030 G.v. Bemel I Drey schöne Landschaften von G.v. Bemel. [Trois beaux paysages par G. v. Bemel.] I Maße: 1 Schuh 2 Zoll hoch, 1 Schuh 7 Zoll breit Verkäufer: Freyherr von Berberich Transakt.: Verkauft (2 fl) Käufer: Bender 1794/00/00 FGAN 0037 G. V. Bemmel I Zwo Landschaften mit Wasserfällen, im Hintergrunde mit einigen Figuren, auf Tuch gemalt. I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Schuh 1 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt (24 fl) 1797/09/13 FRAN 0012 Georg van Bemmel I Zwey Landschaften, die eine ein Tagstück, die andere ein Mondschein. I Diese Nr.: Eine Landschaft, ein Tagstück Maße: 1 Schuh 10 Zoll hoch 2 Schuh 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 12 und 13 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (27 fl für die Nrn. 12 und 13) 1797/09/13 FRAN 0013 Georg van Bemmel I Zwey Landschaften, die eine ein Tagstück, die andere ein Mondschein. I Diese Nr.: Eine Landschaft, ein Mondschein Maße: 1 Schuh 10 Zoll hoch 2 Schuh 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 12 und 13 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (27 fl für die Nm. 12 und 13) 1799/00/00 WZAN 0538 Georg von Bemmel I Vier Landschaften mit biblischen Geschichten, von Georg von Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 4 Zoll breit 3 Schuh 3 Zoll Anm.: Die Lose 538 bis 541 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1752/00/00 NGWOL 0023 Georg Bommel I Zwey überhöhete Bataillen. Due Battaglie sopralzate. I Diese Nr.: Eine überhöhete Bataille Anm.: Die Lose 23 und 24 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (20 Th für die Nrn. 23 und 24)
1799/00/00 WZAN 0539 Georg von Bemmel I Vier Landschaften mit biblischen Geschichten, von Georg von Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 4 Zoll breit 3 Schuh 3 Zoll Anm.: Die Lose 538 bis 541 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1752/00/00 NGWOL 0024 Georg Bommel I Zwey überhöhete Bataillen. Due Battaglie sopralzate. I Diese Nr.: Eine überhöhete Bataille Anm.: Die Lose 23 und 24 wurden zusammen katalogisiert.
1799/00/00 WZAN 0540 Georg von Bemmel I Vier Landschaften mit biblischen Geschichten, von Georg von Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch GEMÄLDE
253
2 Schuh 4 Zoll breit 3 Schuh 3 Zoll Anm.: Die Lose 538 bis 541 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0541 Georg von Bemmel I Vier Landschaften mit biblischen Geschichten, von Georg von Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 4 Zoll breit 3 Schuh 3 Zoll Anm.: Die Lose 538 bis 541 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0656 Georg Bemmel I Zwey Bataille=Stükke, von Georg Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Bataille= Stück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh 4 Zoll breit 2 Schuh 9 Zoll Anm.: Die Lose 656 und 657 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0657 Georg Bemmel I Zwey Bataille=Stükke, von Georg Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Bataille= Stück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh 4 Zoll breit 2 Schuh 9 Zoll Anm.: Die Lose 656 und 657 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0019 Georg Bemmel I Drey Landschaften, worauf reitende Soldaten sind, von Georg Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft, worauf reitende Soldaten sind Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh 3 Zoll breit 4 Schuh 4 Zoll Anm.: Die Lose A19 bis A21 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0020 Georg Bemmel I Drey Landschaften, worauf reitende Soldaten sind, von Georg Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft, worauf reitende Soldaten sind Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh 3 Zoll breit 4 Schuh 4 Zoll Anm.: Die Lose A19 bis A21 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0021 Georg Bemmel I Drey Landschaften, worauf reitende Soldaten sind, von Georg Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft, worauf reitende Soldaten sind Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh 3 Zoll breit 4 Schuh 4 Zoll Anm.: Die Lose A19 bis A21 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0109 Georg van Bemmel I Zwey Landschaften, von Georg van Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 4 Zoll breit 1 Schuh 8 Zoll Anm.: Die Lose A109 und Al 10 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN AO 110 Georg van Bemmel I Zwey Landschaften, von Georg van Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 4 Zoll breit 1 Schuh 8 Zoll Anm.: Die Lose A109 und Al 10 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0113 Georg van Bemmel I Zwey Bataille= Stücke, von Georg van Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Bataille=Stück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 4 Zoll breit 1 Schuh 10 Zoll Anm.: Die Lose Al 13 und Al 14 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0114 Georg van Bemmel I Zwey Bataille= Stücke, von Georg van Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Bataille=Stück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 4 Zoll breit 1 Schuh 10 Zoll Anm.: Die Lose Al 13 und Al 14 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0322 Georg Bemmel I Zwey Landschaften, von Georg Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 1 Vi Zoll breit 3 Schuh 3 Zoll Anm.: Die Lose A322 und A323 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 254
GEMÄLDE
1799/00/00 WZAN A0323 Georg Bemmel I Zwey Landschaften, von Georg Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 1 Vi Zoll breit 3 Schuh 3 Zoll Anm.: Die Lose A322 und A323 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Bemmel, Georg von (und Ermels, J.F.) 1752/00/00 NGWOL 0171 Ermels; G. Bommel I Ein paar Landschaften, von Ermels, von G. Bommel staffirt. Vna coppia di Paesi dell'Ermels figurate da G. Bemmel. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 171 und 172 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (6 Th für die Nrn. 171 und 172) 1752/00/00 NGWOL 0172 Ermels; G. Bommel I Ein paar Landschaften, von Ermels, von G. Bommel staffirt. Vna coppia di Paesi dell'Ermels figurate da G. Bemmel. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 171 und 172 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (6 Th für die Nm. 171 und 172) 1752/00/00 NGWOL 0173 Ermels; G. Bemmel I Zwo dergleichen Landsch[a]ften. Due simili [Paesi]. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 173 und 174 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (3 Th für die Nm. 173 und 174) 1752/00/00 NGWOL 0174 Ermels; G. Bemmel I Zwo dergleichen Landsch[a]ften. Due simili [Paesi]. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 173 und 174 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (3 Th für die Nrn. 173 und 174)
Bemmel, Johann Christoph von 1786/05/02 NGAN 0340 I.C. Bemmel I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 2 Schuh 5 Zoll hoch, 2 Schuh 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 340 und 341 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (6.20 fl für die Nrn. 340 und 341) Käufer: ν Pez 1786/05/02 NGAN 0341 I.C. Bemmel I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 2 Schuh 5 Zoll hoch, 2 Schuh 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 340 und 341 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (6.20 fl für die Nrn. 340 und 341) Käufer: ν Pez
Bemmel, Peter von 1752/00/00 NGWOL 0009 Peter Bommel I Fünf Landschaften. Cinque Paesi. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 9 bis 13 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (50 Th für die Nrn. 9-13) 1752/00/00 NGWOL 0010 Peter Bommel I Fünf Landschaften. Cinque Paesi. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 9 bis 13 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (50 Th für die Nm. 9-13) 1752/00/00 NGWOL 0011 Peter Bommel I Fünf Landschaften. Cinque Paesi. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 9 bis 13 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (50 Th für die Nm. 9-13) 1752/00/00 NGWOL 0012 Peter Bommel I Fünf Landschaften. Cinque Paesi. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 9 bis 13 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (50 Th für die Nm. 9-13) 1752/00/00 NGWOL 0013 Peter Bommel I Fünf Landschaften. Cinque Paesi. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 9 bis 13
wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Unbekannt (50 Th für die Nrn. 9-13)
Neubauer
Transakt.:
1752/00/00 NGWOL 0014 Pet. Bommel I Drey kleinere Landschaften. Tre piü piccoli. I Diese Nr.: Eine kleinere Landschaft Anm.: Die Lose 14 bis 16 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (18 Th für die N m . 14-16) 1752/00/00 NGWOL 0015 Pet. Bommel I Drey kleinere Landschaften. Tre piü piccoli. I Diese Nr.: Eine kleinere Landschaft Anm.: Die Lose 14 bis 16 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (18 Th für die Nrn. 14-16) 1752/00/00 NGWOL 0016 Pet. Bommel I Drey kleinere Landschaften. Tre piü piccoli. I Diese Nr.: Eine kleinere Landschaft Anm.: Die Lose 14 bis 16 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (18 Th für die Nrn. 14-16) 1752/00/00 NGWOL 0138 Peter Bommel I Zwo Landschaften. Due Paesaggi. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 138 und 139 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (8 Th für die Nrn. 138 und 139) 1752/00/00 NGWOL 0139 Peter Bommel I Z w o Landschaften. Due Paesaggi. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 138 und 139 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (8 Th für die N m . 138 und 139) 1776/00/00 WZTRU 0305 Peter Bemmel I Ein Stück 1 Schuhe, 2 Zoll hoch, 1 Schuhe breit von Peter Bemmel, eine bey Sonnenuntergang vorgestellte waldigte Landschaft. I Pendant zu Nr. 306 Maße: 1 Schuhe 2 Zoll hoch, 1 Schuhe breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (3 fl Schätzung) 1776/00/00 WZTRU 0306 Peter Bemmel I Compagnion zu Nro. 305 stellet vor einen Sonnenaufgang des obigen Meisters [Peter Bemmel]. I Pendant zu Nr. 305 Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (3 fl Schätzung) 1776/11/09 HBKOS 0038 P. von Bemmel I Eine schöne Landschaft, auf Leinwand, mit dito [schwarzen] Rahm und verguldeten Leisten. I Pendant zu Nr. 83 von Bemmel Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 8 Vi Zoll, Breite 10 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (18.8 Μ für die Nrn. 38 und 83) Käufer: Peetz 1781/00/00 WZAN 0305 Peter Bemmel I Ein Stück, 1 Schuhe, 2 Zoll hoch, 1 Schuhe breit von Peter Bemmel, zeiget eine bey Sonnenuntergang vorgestellte waldigte Landschaft. I Pendant zu Nr. 306 Maße: 1 Schuhe 2 Zoll hoch, 1 Schuhe breit Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0306 Peter Bemmel I Kompagnon zu Nro 305 ist vom obigen Meister [Peter Bemmel] und stellet einen Sonnenaufgang vor. I Pendant zu Nr. 305 Transakt.: Unbekannt 1782/02/18 RGBZN 0008 Pet. Bemel I Zwey schöne große Landschaften. I Transakt.: Unbekannt (10 fl) 1784/08/02 FRNGL 0319 Peter von Bemmell I Eine Winter und eine Sommer Landschaft. I Diese Nr.: Eine Winter Landschaft Maße: 30 Zoll breit, 24 Zoll hoch Anm.: Die Lose 319 und 320 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Α Transakt.: Verkauft (2.4 fl für die Nrn. 319 und 320) Käufer: von Schmidt 1784/08/02 FRNGL 0320 Peter von Bemmell I Eine Winter und eine Sommer Landschaft. I Diese Nr.: Eine Sommer Landschaft Maße: 30 Zoll breit, 24 Zoll hoch Anm.: Die Lose 319 und 320 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Α Transakt.: Verkauft (2.4 fl für die Nrn. 319 und 320) Käufer: von Schmidt
Zoll breit, 22 Zoll hoch Anm.: Die Lose 437 und 438 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (2.45 fl für die Nrn. 437 und 438) Käufer: von Dessau 1786/05/02 NGAN 0091 P. Bemmel I Eine Bataille. I Maße: 2 Schuh hoch, 2 Schuh 9 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (3.3 fl) Käufer: Hofrath Schüz 1786/05/02 NGAN 0095 P. Bemmel I Ein Camel auf Holz gemahlt. I Mat.: auf Holz Maße: 4 Zoll hoch, 5 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (48 Kr) Käufer: ν Führer 1786/05/02 NGAN 0103 P. Bemmel I Zwey Bataillenstück auf Holz. I Diese Nr.: Ein Bataillenstück Mat.: auf Holz Maße: 5 Zoll hoch, 6 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 103 und 104 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (1.48 fl für die Nrn. 103 und 104) Käufer: Kleinknecht 1786/05/02 NGAN 0104 P. Bemmel I Zwey Bataillenstück auf Holz. I Diese Nr.: Ein Bataillenstück Mat.: auf Holz Maße: 5 Zoll hoch, 6 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 103 und 104 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (1.48 fl für die N m . 103 und 104) Käufer: Kleinknecht 1786/05/02 NGAN 0106 P. Bemmel I Z w o Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 3 Schuh hoch, 3 Schuh 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 106 und 107 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (7.6 fl für die N m . 106 und 107) Käufer: Büttner 1786/05/02 NGAN 0107 P. Bemmel I Zwo Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 3 Schuh hoch, 3 Schuh 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 106 und 107 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (7.6 fl für die N m . 106 und 107) Käufer: Büttner 1786/05/02 NGAN O l l i P. Bemmel I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 6 Zoll hoch, 9 Zoll breit Anm.: Die Lose 111 und 112 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (4.15 fl für die N m . 111 und 112) Käufer: Cons ν Pez 1786/05/02 NGAN 0112 P. Bemmel I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 6 Zoll hoch, 9 Zoll breit Anm.: Die Lose 111 und 112 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (4.15 fl für die N m . 111 und 112) Käufer: Cons ν Pez 1786/05/02 NGAN 0114 P. Bemmel I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 11 Zoll hoch, 1 Schuh 2 Zoll breit Anm.: Die Lose 114 und 115 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (3.24 fl für die N m . 114 und 115) Käufer: Wild 1786/05/02 NGAN 0115 P. Bemmel I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 11 Zoll hoch, 1 Schuh 2 Zoll breit Anm.: Die Lose 114 und 115 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (3.24 fl für die N m . 114 und 115) Käufer: Wild 1786/05/02 NGAN 0196 P. Bemmel I Eine Landschaft. I Maße: 2 Schuh hoch, 1 Schuh 7 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (3.40 fl) Käufer: ν Scheurl 1786/05/02 NGAN 0217 P. Bemmel I Eine Brandschazung von P. Bemmel. I Maße: 7 Zoll hoch, 9 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (5.6 fl) Käufer: Kleinknecht
1784/08/02 FRNGL 0437 Peter Bemmel I Zwey meisterhafte Landschaften. I Diese Nr.: Eine meisterhafte Landschaft Maße: 30 Zoll breit, 22 Zoll hoch Anm.: Die Lose 437 und 438 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (2.45 fl für die Nrn. 437 und 438) Käufer: von Dessau
1786/05/02 NGAN 0226 P. Bemmel I Zwey Landschäftlein auf Kupfer von P. Bemmel. I Diese Nr.: Ein Landschäftlein Mat.: auf Kupfer Maße: 5 Vi Zoll hoch, 7 Zoll breit Anm.: Die Lose 226 und 227 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (2.6 fl für die N m . 226 und 227) Käufer: R Grüner
1784/08/02 FRNGL 0438 Peter Bemmel I Zwey meisterhafte Landschaften. I Diese Nr.: Eine meisterhafte Landschaft Maße: 30
1786/05/02 NGAN 0227 P. Bemmel I Zwey Landschäftlein auf Kupfer von P. Bemmel. I Diese Nr.: Ein Landschäftlein Mat.: auf GEMÄLDE
255
Kupfer Maße: 5 Vi Zoll hoch, 7 Zoll breit Anm.: Die Lose 226 und 227 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (2.6 fl für die Nrn. 226 und 227) Käufer: R Grüner 1786/05/02 NGAN 0231 P. Bemmel I Zwey Landschäftlein von P. Bemmel. I Diese Nr.: Ein Landschäftlein Maße: 5 Vi Zoll hoch, 7 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 231 und 232 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (2.1 fl für die Nrn. 231 und 232) Käufer: ν Holzschuher 1786/05/02 NGAN 0232 P. Bemmel I Zwey Landschäftlein von P. Bemmel. I Diese Nr.: Ein Landschäftlein Maße: 5 Vi Zoll hoch, 7 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 231 und 232 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (2.1 fl für die Nrn. 231 und 232) Käufer: ν Holzschuher 1786/05/02 NGAN 0338 P. Bemmel I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 2 Schuh 3 Zoll hoch, 2 Schuh 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 338 und 339 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (8.6 fl für die Nm. 338 und 339) 1786/05/02 NGAN 0339 P. Bemmel I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 2 Schuh 3 Zoll hoch, 2 Schuh 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 338 und 339 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (8.6 fl für die Nrn. 338 und 339) 1786/05/02 NGAN 0640 P. Bemmel I Eine Landschaft, i Maße: 11 Zoll hoch, 1 Schuh 3 Vi Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (1.15 fl) Käufer: ν Scheurl 1786/05/02 NGAN 0654 P. Bemmel I Item [Zwey Landschaften], I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 5 Vi Zoll hoch, 7 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 654 und 655 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (54 Kr für die Nrn. 654 und 655) 1786/05/02 NGAN 0655 P. Bemmel I Item [Zwey Landschaften], I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 5 Vi Zoll hoch, 7 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 654 und 655 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (54 Kr für die Nrn. 654 und 655) 1796/00/00 HLAN [0110] Peter Bemmel I Landschaft, Oval. Format: oval Maße: 28. 23. Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: [Friedrich Karl Lang] Transakt.: Unbekannt (18.8 Rt; 33 fl Schätzung) 1796/08/01 NGFRZ 0003 P. Bemmel I 2 Landschaften von P. Bemmel, aus seiner besten Zeit auf Leinwand. [Gemälde in Oel in schönen Rahmen. (N.B. Die Größe ist ohne das Rahm gemessen.)] I Mat.: Öl auf Leinwand Maße: Breite 12 Zoll, Höhe 10 Zoll. [Rheinisch Maaß] Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen über der Nr. 1 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 25. Transakt.: Unbekannt
1799/00/00 WZAN 0463 Peter Bemmel I Vier Landschaften, von Peter Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 3 Zoll breit 2 Schuh 9 Zoll Anm.: Die Lose 460 bis 463 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0072 Peter van Bemmel I Eine Landschaft und ein Garten mit Alleen, von Peter van Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 11 Zoll breit 2 Schuh 9 Zoll Anm.: Die Lose A72 und A73 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0073 Peter van Bemmel I Eine Landschaft und ein Garten mit Alleen, von Peter van Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Garten mit Alleen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 11 Zoll breit 2 Schuh 9 Zoll Anm.: Die Lose A72 und A73 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0074 Peter van Bemmel I Eine Gartenaussicht mit Statuen, von Peter van Bemmel. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 11 Zoll breit 2 Schuh 10 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0075 Peter van Bemmel I Eine Gartenaussicht mit Gebäuden und Statuen, von Peter van Bemmel. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 9 Zoll breit 2 Schuh 10 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0115 Peter Bemmel I Eine Landschaft, von Peter Bemmel. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 4 Zoll breit 1 Schuh 2 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0142 Peter Bemmel I Ein Landschäftchen, von Peter Bemmel. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 9 Zoll breit 10 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0196 Peter Bemmel I Vier Landschaften, von Peter Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 4 Zoll breit 2 Schuh 10 Zoll Anm.: Die Lose A196 bis A199 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0197 Peter Bemmel I Vier Landschaften, von Peter Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 4 Zoll breit 2 Schuh 10 Zoll Anm.: Die Lose A196 bis A199 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0198 Peter Bemmel I Vier Landschaften, von Peter Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 4 Zoll breit 2 Schuh 10 Zoll Anm.: Die Lose A196 bis A199 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1799/00/00 WZAN 0460 Peter Bemmel I Vier Landschaften, von Peter Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 3 Zoll breit 2 Schuh 9 Zoll Anm.: Die Lose 460 bis 463 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1799/00/00 WZAN A0199 Peter Bemmel I Vier Landschaften, von Peter Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 4 Zoll breit 2 Schuh 10 Zoll Anm.: Die Lose A196 bis A199 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1799/00/00 WZAN 0461 Peter Bemmel I Vier Landschaften, von Peter Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 3 Zoll breit 2 Schuh 9 Zoll Anm.: Die Lose 460 bis 463 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1799/00/00 WZAN A0235 Peter van Bemmel I Zwey Landschaften, von Peter van Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 6 Zoll breit 2 Schuh 3 Zoll Anm.: Die Lose A235 und A236 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1799/00/00 WZAN 0462 Peter Bemmel I Vier Landschaften, von Peter Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 3 Zoll breit 2 Schuh 9 Zoll Anm.: Die Lose 460 bis 463 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1799/00/00 WZAN A0236 Peter van Bemmel I Zwey Landschaften, von Peter van Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 6 Zoll breit 2 Schuh 3 Zoll Anm.: Die Lose A235 und A236 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
256
GEMÄLDE
1799/00/00 WZAN A0253 Peter van Bemmel I Zwey Landschaften, von Peter van Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 11 Zoll breit 2 Schuh 10 Zoll Anm.: Die Lose A253 und A254 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1799/00/00 WZAN A0305 Peter Bemmel I Vier Landschaften, von Peter Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh 2 Zoll breit 4 Schuh Anm.: Die Lose A302 bis A305 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1799/00/00 WZAN A0254 Peter van Bemmel I Zwey Landschaften, von Peter van Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 11 Zoll breit 2 Schuh 10 Zoll Anm.: Die Lose A253 und A254 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1799/00/00 WZAN A0342 Peter Bemmel I Eine Landschaft, von Peter Bemmel. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 2 Zoll breit 7 Schuh 7 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1799/00/00 WZAN A0269 Peter Bemmel I Zwey Landschaften, von Peter Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 9 Zoll breit 1 Schuh 4 Zoll Anm.: Die Lose A269 und A270 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0270 Peter Bemmel I Zwey Landschaften, von Peter Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 9 Zoll breit 1 Schuh 4 Zoll Anm.: Die Lose A269 und A270 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0294 Peter Bemmel I Eine Landschaft. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh 2 Zoll breit 5 Schuh 9 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0295 Peter Bemmel I Fünf Landschaften. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh 2 Zoll breit 5 Schuh 5 Zoll Anm.: Die Lose A296 bis A299 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0296 Peter Bemmel I Fünf Landschaften. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh 2 Zoll breit 5 Schuh 5 Zoll Anm.: Die Lose A296 bis A299 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0297 Peter Bemmel I Fünf Landschaften. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mai.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh 2 Zoll breit 5 Schuh 5 Zoll Anm.: Die Lose A296 bis A299 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0298 Peter Bemmel I Fünf Landschaften. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh 2 Zoll breit 5 Schuh 5 Zoll Anm.: Die Lose A296 bis A299 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0299 Peter Bemmel I Fünf Landschaften. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh 2 Zoll breit 5 Schuh 5 Zoll Anm.: Die Lose A296 bis A299 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0302 Peter Bemmel I Vier Landschaften, von Peter Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh 2 Zoll breit 4 Schuh Anm.: Die Lose A302 bis A305 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0303 Peter Bemmel I Vier Landschaften, von Peter Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh 2 Zoll breit 4 Schuh Anm. : Die Lose A302 bis A305 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0304 Peter Bemmel I Vier Landschaften, von Peter Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh 2 Zoll breit 4 Schuh Anm.: Die Lose A302 bis A305 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1799/00/00 WZAN A0343 Peter Bemmel I Eine Landschaft mit Ruinen, von Peter Bemmel. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 2 Vi Zoll breit 1 Schuh 8 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Bemmel, Wilhelm von 1752/00/00 NGWOL 0150 Wilh. Bommel I Zwo Landschaften Winter und Sommer. L'inverno e l'estä due Paesaggi. I Diese Nr.: Eine Landschaft Winter Anm.: Die Lose 150 und 151 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (6 Th für die Nrn. 150 und 151) 1752/00/00 NGWOL 0151 Wilh. Bommel I Zwo Landschaften Winter und Sommer. L'inverno e l'estä due Paesaggi. I Diese Nr.: Eine Landschaft Sommer Anm.: Die Lose 150 und 151 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (6 Th für die Nrn. 150 und 151) 1752/00/00 NGWOL 0170 W. Bommel I Eine Landschaft. Vn paesaggio. I Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (2.16Th) 1764/05/18 BLAN 0024 Wilhelm van Bemmel I Eine schöne Landschafft, welche eine bergichte Gegend vorstellet; nebst einigen Personen zu Pferde, auf Leinewand gemahlt. I Pendant zu Nr. 25 Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 5 Zoll hoch und 3 Fuß 3 Zoll breit Verkäufer: Johann Georg Eimbke Transakt.: Verkauft (6 Rt für die Nrn. 24 und 25) Käufer: Engel 1764/05/18 BLAN 0025 Wilhelm van Bemmel I Ein Gewitter, welches in einen Baum schlägt. In dieser Landschafft ist viel Natur und Kunst. Es ist der Compagnon zum vorigen Bild Stücke. I Pendant zu Nr. 24 Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 5 Zoll hoch und 3 Fuß 3 Zoll breit Verkäufer: Johann Georg Eimbke Transakt.: Verkauft (6 Rt für die Nm. 24 und 25) Käufer: Engel 1771/05/06 FRAN 0028 Bemmel, dem Aeltern I Eine Landschaft auf Tuch. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 16 Zoll, breit 12 Zoll Verkäufer: Johann Friederich Armand von Uffenbach Transakt.: Verkauft (1.20 fl) Käufer: [unleserlich] 1776/00/00 WZTRU 0326 Willhelmus Bemmel I Ein Stück 7 Zoll hoch, 9 Zoll breit von Willhelmus Bemmel, vorstellend eine Landschaft, wo der Hirt eintreibet; dieses Stücke ist ziemlich gut colorirt. I Pendant zu Nr. 327 Maße: 1 Zoll hoch, 9 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (4 fl Schätzung) 1776/00/00 WZTRU 0327 Willhelmus Bemmel I Compagnion zu Nro. 326 von nämlichem Meister [Willhelmus Bemmel]. I Pendant zu Nr. 326, "Eine Landschaft, wo der Hirt eintreibet" Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (4 fl Schätzung) 1777/03/03 AUAN 0052 Der ältere Bemmel I Ein große Landschaft. I Maße: Höhe 3 Sch. 1 Zoll, Breite 4 Sch. 6 Zoll Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt 1779/09/27 FRNGL 0012 Wilhelm von Bemmel I Eine beym Ungewitter und Regen abgebildete Landschaft. [Un paysage de tems d'orage & de pluye, par Guillaume de Bemmel.] I Pendant zu Nr. 13 Maße: 6 Zoll hoch, 8 Zoll breit Transakt.: Verkauft (4.30 fl für die Nrn. 12 und 13) Käufer: Hüsgen 1779/09/27 FRNGL 0013 Wilhelm von Bemmel I Das Gegenbild zu obigem, eine dergleichen Vorstellung [eine beym Ungewitter GEMÄLDE
257
und Regen abgebildete Landschaft], von nemlichem Meister [Wilhelm von Bemmel] und Maas. [Le pendant du precedent, meme objet [un paysage par tems d'orage & de pluye], par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 12 Maße: 6 Zoll hoch, 8 Zoll breit Transakt.: Verkauft (4.30 fl für die Nrn. 12 und 13) Käufer: Hüsgen 1779/09/27 FRNGL 0688 W.v. Bemmel I Ein sehr natürlich ausgeführtes Gewitterstück. [Un orage, tres belle piece.] I Maße: 8 Vi Zoll hoch, 11 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (1.52 fl) Käufer: Mevius 1779/09/27 FRNGL 0872 der alte Bemmel I Eine Landschaft mit Waldung, vom alten Bemmel. [Un paysage couvert de bois, par le vieux Bemmel.] I Pendant zu Nr. 873 Maße: 5 Zoll hoch, 7 Zoll breit Transakt.: Verkauft (5 fl für die Nrn. 872 und 873) Käufer: Mund 1779/09/27 FRNGL 0873 der alte Bemmel I Der Compagnon zu obigem, eine dergleichen schöne Landschaft, von neml. Meister [vom alten Bemmel] und Maas. Le pendant du precedant, meme objet [paysage], meme beaute, par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 872 Maße: 5 Zoll hoch, 7 Zoll breit Transakt.: Verkauft (5 fl für die Nm. 872 und 873) Käufer: Mund 1781/00/00 WZAN 0326 Willhelm Bemmel I Ein Stück, 7 Zoll hoch, 9 Zoll breit, von Willhelm Bemmel, zeiget eine Landschaft, wo der Hirt eintreibet; die[s]es Stück ist ziemlich gut in der Farbe ausgefallen. I Pendant zu Nr. 327 Maße: 7 Zoll hoch, 9 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0327 Willhelm Bemmel I Kompagnon zu Nro 326 vom nämlichem Meister [Willhelm Bemmel]. I Pendant zu Nr. 326, "Eine Landschaft, wo der Hirt eintreibet" Transakt.: Unbekannt 1784/08/02 FRNGL 0321 der alte Bemmell I Zwey ditto [eine Winter und eine Sommer Landschaft], vom alten Bemmell. I Diese Nr.: Eine Winter Landschaft Maße: 25 Zoll breit, 18 Vi Zoll hoch Anm.: Die Lose 321 und 322 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: C Transakt.: Verkauft (2 fl für die Nrn. 321 und 322) Käufer: Bäumer 1784/08/02 FRNGL 0322 der alte Bemmell I Zwey ditto [eine Winter und eine Sommer Landschaft], vom alten Bemmell. I Diese Nr.: Eine Sommer Landschaft Maße: 25 Zoll breit, 18 Vi Zoll hoch Anm.: Die Lose 321 und 322 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: C Transakt.: Verkauft (2 fl für die Nm. 321 und 322) Käufer: Bäumer 1784/08/02 FRNGL 0534 der alte Bemmell I Zwey kleine ovale Landschäftgen, vom alten Bemmell. I Diese Nr.: Ein kleines ovales Landschäftgen Format: oval Maße: 5 Vi Zoll breit, 4 Vi Zoll hoch Anm.: Die Lose 534 und 535 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (1 fl für die Nm. 534 und 535) Käufer: Reinhardt 1784/08/02 FRNGL 0535 der alte Bemmell I Zwey kleine ovale Landschäftgen, vom alten Bemmell. I Diese Nr.: Ein kleines ovales Landschäftgen Format: oval Maße: 5 ¥z Zoll breit, 4 Vi Zoll hoch Anm.: Die Lose 534 und 535 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (1 fl für die Nm. 534 und 535) Käufer: Reinhardt 1786/05/02 NGAN 0012 Wilhelm v. Bemmel I Zwey Landschaften von Wilhelm v. Bemmel. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 2 Schuh 4 Zoll hoch, 3 Schuh 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 12 und 13 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (25 fl für die Nm. 12 und 13) Käufer: Brixner 1786/05/02 NGAN 0013 Wilhelm v. Bemmel I Zwey Landschaften von Wilhelm v. Bemmel. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 2 Schuh 4 Zoll hoch, 3 Schuh 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 12 und 13 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (25 fl für die Nm. 12 und 13) Käufer: Brixner 258
GEMÄLDE
1786/05/02 NGAN 0087 W. Bemmel I Eine Landschaft. I Maße: 3 Schuh hoch, 2 Schuh breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (4.15 fl) Käufer: Kleinknecht 1786/05/02 NGAN 0200 W. Bemmel I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 1 Schuh 5 Zoll hoch, 1 Schuh 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 200 und 201 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (2.4 fl für die Nm. 200 und 201) Käufer: Scheurl 1786/05/02 NGAN 0201 W. Bemmel I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 1 Schuh 5 Zoll hoch, 1 Schuh 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 200 und 201 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (2.4 fl für die Nm. 200 und 201) Käufer: Scheurl 1786/05/02 NGAN 0221 W. Bemmel I Ein See von W. Bemmel. I Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 1 Schuh 6 Vi Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (1.30 fl) Käufer: ν Führer 1786/05/02 NGAN 0302 W. Bemmel I Eine Landschaft. I Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (5 fl) Käufer: Kleinknecht 1786/05/02 NGAN 0330 W. Bemmel I Ein Seehafen. I Maße: 2 Schuh hoch, 2 Schuh 10 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (3.6 fl) Käufer: ν Pez 1786/05/02 NGAN 0336 W. Bemmel I Eine Landschaft. I Maße: 1 Schuh 9 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 6 Vi Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (2.3 fl) Käufer: ν Holzschuher 1786/05/02 NGAN 0342 W. Bemmel I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 2 Schuh 7 Zoll hoch, 3 Schuh 2 Zoll breit Anm.: Die Lose 342 und 343 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (3 fl für die Nm. 342 und 343) Käufer: Κ R ν Haller 1786/05/02 NGAN 0343 W. Bemmel I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 2 Schuh 7 Zoll hoch, 3 Schuh 2 Zoll breit Anm.: Die Lose 342 und 343 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (3 fl für die Nm. 342 und 343) Käufer: Κ R ν Haller 1786/05/02 NGAN 0357 W. Bemmel I Eine Landschaft. I Maße: 2 Schuh hoch, 2 Schuh 10 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (1 fl) Käufer: Ego 1786/05/02 NGAN 0410 W. Bemmel I Eine Landschaft. I Maße: 1 Schuh 11 Zoll hoch, 2 Schuh 7 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (2.1 fl) Käufer: Fr Seng[in] 1786/05/02 NGAN 0429 W. Bemmel I Neun Landschaften von der besten Zeit des W. Bemmel und gut ausstaffirt. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 2 Schuh 1 Zoll hoch, 2 Schuh 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 429 bis 437 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (23.50 fl für die Nm. 429-437) Käufer: Kriegs Rath Weber 1786/05/02 NGAN 0430 W. Bemmel I Neun Landschaften von der besten Zeit des W. Bemmel und gut ausstaffirt. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 2 Schuh 1 Zoll hoch, 2 Schuh 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 429 bis 437 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (23.50 fl für die Nm. 429-437) Käufer: Kriegsrat Weber 1786/05/02 NGAN 0431 W. Bemmel I Neun Landschaften von der besten Zeit des W. Bemmel und gut ausstaffirt. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 2 Schuh 1 Zoll hoch, 2 Schuh 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 429 bis 437 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (23.50 fl für die Nm. 429-437) Käufer: Kriegsrat Weber 1786/05/02 NGAN 0432 W. Bemmel I Neun Landschaften von der besten Zeit des W. Bemmel und gut ausstaffirt. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 2 Schuh 1 Zoll hoch, 2 Schuh 3 Zoll breit Anm. :
Die Lose 429 bis 437 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (23.50 fl für die Nrn. 429-437) Käufer: Kriegsrat Weber 1786/05/02 NGAN 0433 W. Bemmel I Neun Landschaften von der besten Zeit des W. Bemmel und gut ausstaffirt. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 2 Schuh 1 Zoll hoch, 2 Schuh 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 429 bis 437 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (23.50 fl für die Nrn. 429-437) Käufer: Kriegsrat Weber 1786/05/02 NGAN 0434 W. Bemmel I Neun Landschaften von der besten Zeit des W. Bemmel und gut ausstaffirt. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 2 Schuh 1 Zoll hoch, 2 Schuh 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 429 bis 437 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (23.50 fl für die Nrn. 429-437) Käufer: Kriegsrat Weber 1786/05/02 NGAN 0435 W. Bemmel I Neun Landschaften von der besten Zeit des W. Bemmel und gut ausstaffirt. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 2 Schuh 1 Zoll hoch, 2 Schuh 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 429 bis 437 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (23.50 fl für die Nrn. 429-437) Käufer: Kriegsrat Weber 1786/05/02 NGAN 0436 W. Bemmel I Neun Landschaften von der besten Zeit des W. Bemmel und gut ausstaffirt. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 2 Schuh 1 Zoll hoch, 2 Schuh 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 429 bis 437 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (23.50 fl für die Nm. 429-437) Käufer: Kriegsrat Weber 1786/05/02 NGAN 0437 W. Bemmel I Neun Landschaften von der besten Zeit des W. Bemmel und gut ausstaffirt. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 2 Schuh 1 Zoll hoch, 2 Schuh 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 429 bis 437 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (23.50 fl für die Nrn. 429-437) Käufer: Kriegsrat Weber 1786/05/02 NGAN 0447 W. Bemmel I Eine Landschaft in welcher eine Rencontre mit Türken vorgestellt wird. I Maße: 3 Schuh 3 Zoll hoch, 4 Schuh 9 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (3 fl) Käufer: Κ R ν Haller 1786/05/02 NGAN 0458 W. Bemmel I Vier Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 1 Schuh 10 Zoll hoch, 2 Schuh 9 Zoll breit Anm.: Die Lose 458 bis 461 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (4.25 fl für die Nrn. 458-461) Käufer: Κ R Weber 1786/05/02 NGAN 0459 W. Bemmel I Vier Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 1 Schuh 10 Zoll hoch, 2 Schuh 9 Zoll breit Anm.: Die Lose 458 bis 461 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (4.25 fl für die Nrn. 458-461) Käufer: Κ R Weber 1786/05/02 NGAN 0460 W. Bemmel I Vier Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 1 Schuh 10 Zoll hoch, 2 Schuh 9 Zoll breit Anm.: Die Lose 458 bis 461 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (4.25 fl für die Nrn. 458-461) Käufer: Κ R Weber 1786/05/02 NGAN 0461 W. Bemmel I Vier Landschaften. Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 1 Schuh 10 Zoll hoch, 2 Schuh 9 Zoll breit Anm.: Die Lose 458 bis 461 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (4.25 fl für die Nrn. 458-461) Käufer: Κ R Weber 1786/05/02 NGAN 0462 W. Bemmel I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 1 Schuh 10 Zoll hoch, 2 Schuh 9 Zoll breit Anm.: Die Lose 462 und 463 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (1.30 fl für die Nrn. 462 und 463) Käufer: Pfann
1786/05/02 NGAN 0463 W. Bemmel I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 1 Schuh 10 Zoll hoch, 2 Schuh 9 Zoll breit Anm.: Die Lose 462 und 463 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (1.30 fl für die Nrn. 462 und 463) Käufer: Pfann 1786/05/02 NGAN 0464 W. Bemmel I Vier Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 1 Schuh 6 Zoll hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Anm.: Die Lose 464 bis 467 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (8.6 fl für die Nrn. 464-467) Käufer: Müller 1786/05/02 NGAN 0465 W. Bemmel I Vier Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 1 Schuh 6 Zoll hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Anm. : Die Lose 464 bis 467 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (8.6 fl für die Nm. 464-467) Käufer: Müller 1786/05/02 NGAN 0466 W. Bemmel I Vier Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 1 Schuh 6 Zoll hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Anm.: Die Lose 464 bis 467 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (8.6 fl für die Nrn. 464-467) Käufer: Müller 1786/05/02 NGAN 0467 W. Bemmel I Vier Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 1 Schuh 6 Zoll hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Anm.: Die Lose 464 bis 467 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (8.6 fl für die Nrn. 464-467) Käufer: Müller 1786/05/02 NGAN 0468 W. Bemmel I Fünf andere Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 1 Schuh 6 Zoll hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Anm.: Die Lose 468 bis 472 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (10.6 fl für die Nrn. 468-472) Käufer: Müller 1786/05/02 NGAN 0469 W. Bemmel I Fünf andere Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 1 Schuh 6 Zoll hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Anm.: Die Lose 468 bis 472 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (10.6 fl für die Nrn. 468-472) Käufer: Müller 1786/05/02 NGAN 0470 W. Bemmel I Fünf andere Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 1 Schuh 6 Zoll hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Anm. : Die Lose 468 bis 472 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (10.6 fl für die Nrn. 468-472) Käufer: Müller 1786/05/02 NGAN 0471 W. Bemmel I Fünf andere Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 1 Schuh 6 Zoll hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Anm.: Die Lose 468 bis 472 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (10.6 fl für die Nrn. 468-472) Käufer: Müller 1786/05/02 NGAN 0472 W. Bemmel I Fünf andere Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 1 Schuh 6 Zoll hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Anm.: Die Lose 468 bis 472 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (10.6 fl für die Nm. 468-472) Käufer: Müller 1786/05/02 NGAN 0676 W. Bemmel I Ein Landschäftgen. I Maße: 6 Zoll hoch, 5 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (48 Kr) 1789/00/00 MMAN 0201 Wilhelm Bemmel der alte I Eine Landschaft, auf Leinw. 1 Fuß 11 Zoll hoch und 2 Fuß 11 Zoll breit, vom Wilhelm Bemmel dem alten. [Un paysage, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 11 Zoll hoch, 2 Fuß 11 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (6 fl) 1790/01/07 MUAN 1047 Wilh. van Bemmel I Zwo Landschaften mit badenden, und schatzgrabenden Figuren, auf Leinw. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit badenden Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 11 Zoll, Breite 2 Schuh 6 Zoll Anm.: Die Lose GEMÄLDE
259
1047 und 1048 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1048 Wilh. van Bemmel I Zwo Landschaften mit badenden, und schatzgrabenden Figuren, auf Leinw. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit schatzgrabenden Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 11 Zoll, Breite 2 Schuh 6 Zoll Anm.: Die Lose 1047 und 1048 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1355 Wilh. van Bemmel I Eine bergigte Landschaft mit einem Wasserfall, auf Leinwat. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 2 Zoll, Breite 3 Schuh Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1375 Wilh. van Bemmel I Zwo Landschaften mit kleinen Figuren, auf Leinwat, in den nämlichen [metallisirten] Ramen. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit kleinen Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 4 Zoll, Breite 1 Schuh 8 Zoll Anm.: Die Lose 1375 und 1376 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1376 Wilh. van Bemmel I Zwo Landschaften mit kleinen Figuren, auf Leinwat, in den nämlichen [metallisirten] Ramen. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit kleinen Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 4 Zoll, Breite 1 Schuh 8 Zoll Anm.: Die Lose 1375 und 1376 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0260 Wilhelm Bemmel I Eine wolkigte Landschaft mit einigen Figuren, von Wilhelm Bemmel. I Pendant zu Nr. 261 Maße: 9 Zoll hoch, 11 Vi Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0261 Wilhelm Bemmel I Zum Gegenstück eine felsigte Landschaft, mit einbrechendem Gewitter, von obigem Meister [Wilhelm Bemmel] und Maaß. I Pendant zu Nr. 260 Maße: 9 Zoll hoch, 11 Vi Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0262 Wilhelm Bemmel I Noch eine dritte in nemlicher Manier, mit heiterer Luft, und stillstehenden Wasser, vom vorhergehenden Meister [Wilhelm Bemmel] und Maaß. I Maße: 9 Zoll hoch, 11 Vi Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0462 Wilhelm von Bemmel I Eine heitere Landschaft, mit einigen Figuren, von Wilhelm von Bemmel, ohne Rahmen. I Maße: 2 Schuh 2 Zoll hoch, 6 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1796/00/00 HLAN [0116] Wilh. Bemmel I 2 Landschaften. 12. 16. auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: 12. 16 .Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: [Friedrich Karl Lang] Transakt.: Unbekannt (12.15 Rt; 22 fl Schätzung) 1796/08/01 NGFRZ 0001 W. Bemmel I Eine schöne Landschaft von W. Bemmel. [Gemälde in Oel in schönen Rahmen. (N.B. Die Größe ist ohne das Rahm gemessen.)] I Mat.: Öl Maße: Breite 9 Zoll, Höhe 6 Vi Zoll. Rheinisch Maaß Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen über der Nr. 1 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 25. Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0082 Wilh. Bemmel I Eine ebene Landschaft mit Türkischen Reutern auf der Landstraße. I Maße: Hoch 18 Zoll, breit 24 Zoll Transakt.: Unbekannt
1799/00/00 WZAN 0120 Willhelm Bemmel I Zwey Landschaften; eine mit Viehe, von Nicolaus Berghem, und die andere von Willhelm Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft von Willhelm Bemmel Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 8 Zoll breit 1 Schuh 1 Zoll Anm.: Die Lose 119 und 120 wurden zusammen katalogisiert. Dieses Los wurde zusammen mit der Nr. 119 (N.P. Berghem) verkauft. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0159 Willhelm Bemmel I Zwey Landschäftchen, von Willhelm Bemmel. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 6 Zoll breit 8 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0168 Willhelm Bemmel I Zwey Landschäftchen, von Willhelm Bemmel. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Landschäftchen Mat.: auf Holz Maße: hoch 4 Zoll breit 5 Zoll Anm.: Die Lose 168 und 169 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0169 Willhelm Bemmel I Zwey Landschäftchen, von Willhelm Bemmel. Auf Holz. [ Diese Nr.: Ein Landschäftchen Mat.: auf Holz Maße: hoch 4 Zoll breit 5 Zoll Anm.: Die Lose 168 und 169 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0221 Willhelm Bemmel I Zwey Landschaften, von Willhelm Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 6 Zoll breit 3 Schuh 2 Zoll Anm.: Die Lose 221 und 222 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0222 Willhelm Bemmel I Zwey Landschaften, von Willhelm Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 6 Zoll breit 3 Schuh 2 Zoll Anm.: Die Lose 221 und 222 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0241 Willhelm Bemmel I Zwey Winterlandschäftchen mit vielen Figürchen, worunter sind, die auf Schlittschuhen laufen, von Willhelm Bemmel. Auf Blech. I Diese Nr.: Ein Winterlandschäftchen Mat.: auf Blech Format: oval Maße: hoch 1 Schuh breit 9 Zoll Anm.: Die Lose 241 und 242 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0242 Willhelm Bemmel I Zwey Winterlandschäftchen mit vielen Figürchen, worunter sind, die auf Schlittschuhen laufen, von Willhelm Bemmel. Auf Blech. I Diese Nr.: Ein Winterlandschäftchen Mat.: auf Blech Format: oval Maße: hoch 1 Schuh breit 9 Zoll Anm.: Die Lose 241 und 242 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0248 Willhelm Bemmel I Eine Landschaft, worauf eine Ebne und eine Stadt, von Willhelm Bemmel. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 2 Zoll breit 3 Schuh Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0250 Willhelm Bemmel I Eine Landschaft, von Willhelm Bemmel. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 10 Zoll breit 4 Schuh 3 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0267 Willhelm Bemmel I Eine Landschaft mit einem Wasserfalle, von Willhelm Bemmel. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 10 Zoll breit 3 Schuh 8 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1796/09/08 HBPAK 0144 Wilh. von Bemmel I Eine Landschaft mit zwey Reisenden zu Pferde. I Maße: Hoch 18 Zoll, breit 23 Zoll Transakt.: Unbekannt
1799/00/00 WZAN 0268 Willhelm Bemmel I Eine Landschaft, von Willhelm Bemmel. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh breit 3 Schuh 9 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1796/09/08 HBPAK 0180 Wilhelm von Bemmel I Eine Landschaft mit Türkischen Reutern auf der Heerstraße. I Maße: Hoch 18 Zoll, breit 24 Zoll Transakt.: Unbekannt
1799/00/00 WZAN 0425 W. Bemel I Eine Landschaft, von W. Bemel. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 9 Zoll breit 1 Schuh Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
260
GEMÄLDE
1799/00/00 WZAN 0469 Wilhelm Bemmel I Drey Landschaften, von Wilhelm Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 3 Zoll breit 3 Schuh 2 Zoll Anm.: Die Lose 469 bis 471 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0470 Wilhelm Bemmel I Drey Landschaften, von Wilhelm Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 3 Zoll breit 3 Schuh 2 Zoll Anm.: Die Lose 469 bis 471 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0471 Wilhelm Bemmel I Drey Landschaften, von Wilhelm Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 3 Zoll breit 3 Schuh 2 Zoll Anm.: Die Lose 469 bis 471 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0567 Willhelm Bemmel I Zwey Landschaften, von Willhelm Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 1 Zoll breit 1 Schuh 1 Zoll Anm.: Die Lose 567 und 568 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0568 Willhelm Bemmel I Zwey Landschaften, von Willhelm Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 1 Zoll breit 1 Schuh 1 Zoll Anm.: Die Lose 567 und 568 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0717 Willhelm Bemmel I Eine Landschaft, von Willhelm Bemmel. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 11 Zoll breit 1 Schuh 6 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0748 W. Bemmel I Vier Landschaften, mit vielen Bäumen, von W. Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft, mit vielen Bäumen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 4 Zoll breit 1 Schuh Anm.: Die Lose 748 bis 751 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0749 W. Bemmel I Vier Landschaften, mit vielen Bäumen, von W. Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft, mit vielen Bäumen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 4 Zoll breit 1 Schuh Anm.: Die Lose 748 bis 751 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0750 W. Bemmel I Vier Landschaften, mit vielen Bäumen, von W. Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft, mit vielen Bäumen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 4 Zoll breit 1 Schuh Anm.: Die Lose 748 bis 751 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0751 W. Bemmel I Vier Landschaften, mit vielen Bäumen, von W. Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft, mit vielen Bäumen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 4 Zoll breit 1 Schuh Anm.: Die Lose 748 bis 751 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0016 Willhelm Bemmel I Eine Landschaft, von Willhelm Bemmel. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 10 Zoll breit 3 Schuh 6 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0116 Wilhelm van Bemmel I Eine Landschaft, von Wilhelm van Bemmel. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 8 Zoll breit 1 Schuh 4 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN AO 131 Wilhelm Bemmel I Zwey Landschaften; auf einer eine besondere Aussicht mit einem Garten. Von Wilhelm Bemmel und von Johann Murrer staffirt. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 9 Zoll breit 3 Schuh 3 Zoll Anm.: Die Lose Al31 und A132 wurden zusammen katalogisiert. Dieses Los wurde zusammen mit
der Nr. A132 (Joh. Murrer) verkauft. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0135 Wilhelm van Bemmel I Eine Landschaft, von Wilhelm van Bemmel. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 8 Zoll breit 3 Schuh 4 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0222 Wilhelm Bemmel I Zwey Landschaften, von Wilhelm Bemmel. Auf Kupfer. Sehr schön. Auf Kupfer. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Kupfer Maße: hoch 1 Schuh Vi Zoll breit 1 Schuh 3 Zoll Anm.: Die Lose A222 und A223 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0223 Wilhelm Bemmel I Zwey Landschaften, von Wilhelm Bemmel. Auf Kupfer. Sehr schön. Auf Kupfer. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Kupfer Maße: hoch 1 Schuh Vi Zoll breit 1 Schuh 3 Zoll Anm.: Die Lose A222 und A223 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0259 Wilhelm Bemmel I Zwey Landschaften, von Wilhelm Bemmel. Auf Blech. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Blech Maße: hoch 11 Zoll breit 1 Schuh 4 Zoll Anm.: Die Lose A259 und A260 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0260 Wilhelm Bemmel I Zwey Landschaften, von Wilhelm Bemmel. Auf Blech. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Blech Maße: hoch 11 Zoll breit 1 Schuh 4 Zoll Anm.: Die Lose A259 und A260 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0266 Wilh. Bemmel I Zwey Landschaften, die eine von Cosiau, die andere von Wilh. Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft von Wilh. Bemmel Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 5 Zoll breit 1 Schuh 9 Zoll Anm.: Die Lose A259 und A266 wurden zusammen katalogisiert. Dieses Los wurde zusammen mit der Nr. A265 (Cossiau) verkauft. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0286 Wilh. Bemmel I Zwey Landschaften, von Wilh. Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 10 Zoll breit 5 Schuh 6 Zoll Anm.: Die Lose A286 und A287 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0287 Wilh. Bemmel I Zwey Landschaften, von Wilh. Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 10 Zoll breit 5 Schuh 6 Zoll Anm.: Die Lose A286 und A287 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0308 Wilh. Bemmel I Zwey Landschaften, ein Winterstück mit Schnee, und ein Sommerstück mit dem Bade der Diana, von Wilh. Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft, ein Winterstück mit Schnee Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 8 Zoll breit 3 Schuh 4 Zoll Anm.: Die Lose A308 und A309 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0309 Wilh. Bemmel I Zwey Landschaften, ein Winterstück mit Schnee, und ein Sommerstück mit dem Bade der Diana, von Wilh. Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft, ein Sommerstück mit dem Bade der Diana Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 8 Zoll breit 3 Schuh 4 Zoll Anm.: Die Lose A308 und A309 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0429 W. Bemmel I Zwey Landschäftchen, von W. Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Landschäftchen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 8 Zoll breit 1 Schuh 6 Zoll Anm.: GEMÄLDE
261
Die Lose A429 und A430 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0430 W. Bemmel I Zwey Landschäftchen. von W. Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Landschäftchen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 8 Zoll breit 1 Schuh 6 Zoll Anm.: Die Lose A429 und A430 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Bemmel, Wilhelm von (und Roos) 1771/05/06 FRAN 0080 der alte Bemmel; Roos I Zwey Landschaften vom alten Bemmel, auf Tuch, und vom Roos staffiret. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 28 Zoll, breit 35 Zoll Anm.: Die Lose 80 und 81 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friederich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt 1771/05/06 FRAN 0081 der alte Bemmel; Roos I Zwey Landschaften vom alten Bemmel, auf Tuch, und vom Roos staffiret. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 28 Zoll, breit 35 Zoll Anm.: Die Lose 80 und 81 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friederich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt 1775/05/15 FRAN 0045 der alte Bemmel; Roos I Zwey Landschaften vom alten Bemmel, auf Tuch, und vom Roos staffiret. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 28 Zoll, breit 35 Zoll Anm.: Die Lose 45 und 46 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt 1775/05/15 FRAN 0046 der alte Bemmel; Roos I Zwey Landschaften vom alten Bemmel, auf Tuch, und vom Roos staffiret. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 28 Zoll, breit 35 Zoll Anm.: Die Lose 45 und 46 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt
Bemmel, Wilhelm von (und Roos, J.H.) 1772/00/00 BSFRE 0122 Rooss (Jean Henry); Guillaume Bemmel I Un Tableau capital, sur lequel on voit au milieu une fontaine d'Hercule ; derriere ycelle [sic] une Elevation de terre, & de Rochers garnis de beaux Arbres & de Broussailles, au pied de cette fontaine est assise une femme, avec un Enfant, devant eile se trouve un garςοη, qui badine avec un Chien, en outre l'on voit une Vache, plusieurs brebis & Chevres ; le lointain represente un joli Paysage, orne de quelques Bätiments. Cadres noirs, avec Liteaux dores. [les Arbres de ces deux Tableaux sont peints par les mains de l'habile Guillaume Bemmel, qui a ete Contemporain du dit Rooss]. I Pendant zu Nr. 123 Mat.: auf Leinwand Maße: haut 37 large 31 pouces Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 123 und beziehen sich auf die Nm. 122 und 123. Transakt.: Unbekannt 1772/00/00 BSFRE 0123 Rooss (Jean Henry); Guillaume Bemmel I Sur le pendant de meme grandeur, l'on remarque, devant des Rochers, une femme debout, aupres d'elle un gargon qui grimpe sur une Chevre, au milieu un Taureau couche, & une Vache debout, dans le lointain quelques figures humaines, Betail, Brebis & Chevres, le Paysage, & les Arbres de ces deux Tableaux sont peints par les mains de l'habile Guillaume Bemmel, qui a ete Contemporain du dit Rooss. Cadres noirs, avec Liteaux dores. I Pendant zu Nr. 122 Mat.: auf Leinwand Maße: haut 37 large 31 pouces Transakt.: Unbekannt 262
GEMÄLDE
Bemmel, Wilhelm von (Manier) 1784/08/02 FRNGL 0415 der alte Bemmel I Zwey Landschaften, in der Manier vom alten Bemmel. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 15 Zoll breit, 12 Zoll hoch Anm.: Die Lose 415 und 416 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Α Transakt.: Verkauft (2 fl für die Nrn. 415 und 416) Käufer: Bender 1784/08/02 FRNGL 0416 der alte Bemmel I Zwey Landschaften, in der Manier vom alten Bemmel. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 15 Zoll breit, 12 Zoll hoch Anm.: Die Lose 415 und 416 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Α Transakt.: Verkauft (2 fl für die Nrn. 415 und 416) Käufer: Bender
Benard, Jean-Baptiste 1800/07/09 HBPAK 0079 Benard I Jeune femme dinant sur un fautenil [sie]. Un Chat aupres d'Elle joue avec un volan. I Transakt.: Unbekannt
Benda, Elias [Nicht identifiziert] 1793/00/00 NGWID O l l i Elias Benda I Ein reisender Fagabund Grau in Grau, nebst andern im Hintergrund wohl angebrachten Figuren, von Elias Benda. I Maße: 2 Schuh hoch, 1 Schuh 9 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
Bendeier, Christian Johann 1750/04/00 HB AN 0012 Bendeier I Eine Landschaft bey Nacht, ausführlich von Bendeier. I Transakt.: Unbekannt 1750/06/15 HBRAD 0098 Bendeier I Bendeier, zwey angenehme Landschaften, als Morgen und Abend. I Diese Nr.: Eine angenehme Landschaft, als Morgen Anm.: Die Lose 98 und 99 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1750/06/15 HBRAD 0099 Bendeier I Bendeier, zwey angenehme Landschaften, als Morgen und Abend. I Diese Nr.: Eine angenehme Landschaft, als Abend Anm.: Die Lose 98 und 99 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1775/05/08 HBPLK 0056 de Bendeier I Ein Gehölze, worinnen ein Herr auf die Jagd reitet, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 20 Zoll 3 Linie, Breite 26 Zoll 9 Linie Transakt.: Unbekannt 1776/04/15 HBBMN 0043 Bendeier I Zwo Landschaften, eines mit einen Regenbogen, sehr ausführlich. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit einem Regenbogen Maße: Höhe 1 Fuß 8 Zoll, Breite 2 Fuß 1 Zoll Anm.: Die Lose 43 und 44 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (10.4 M) Käufer: Ehr[enreich] 1776/04/15 HBBMN 0044 Bendeier I Zwo Landschaften, eines mit einen Regenbogen, sehr ausführlich. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: Höhe 1 Fuß 8 Zoll, Breite 2 Fuß 1 Zoll Anm.: Die Lose 43 und 44 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (10.4 M) Käufer: Ehr[enreich] 1782/08/21 HBKOS 0040 C. Bendeier 17211 Zwey vortreflich gemahlte Landgegenden, mit Holzungen und Flüssen, worinnen verschiedene arbeitsame Landleute befindlich, auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine vortreflich gemahlte Landgegend, mit Holzungen und Flüssen, worinnen verschiedene arbeitsame Landleute befindlich Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 25 Zoll 3 Linien, breit 21 Zoll 6 Linien Inschr.: 1721 (datiert?) Anm.: Die Lose 40 und 41 wurden zusammen katalogisiert. Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Moddermann Transakt.: Verkauft (40 Μ für die Nrn. 40 und 41) Käufer: Ehrenreich 1782/08/21 HBKOS 0041 C. Bendeier 17211 Zwey vortreflich gemahlte Landgegenden, mit Holzungen und Flüssen, worinnen ver-
schiedene arbeitsame Landleute befindlich, auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine vortreflich gemahlte Landgegend, mit Holzungen und Flüssen, worinnen verschiedene arbeitsame Landleute befindlich Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 25 Zoll 3 Linien, breit 21 Zoll 6 Linien Inschr.: 1721 (datiert?) Anm.: Die Lose 40 und 41 wurden zusammen katalogisiert. Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Moddermann Transakt.: Verkauft (40 Μ für die Nrn. 40 und 41) Käufer: Ehrenreich
Zeichnung ist meisterlich und bewundernswürdig; es ist angenehm colorirt, und sehr Verblasen gemahlt; so, daß es so schön und vollkommen ist, wie ein Gemähide von Carlo Maratt. [Text hier gekürzt]. I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 1 Zoll hoch, und 1 Fuß 5 Zoll breit Verkäufer: Johann Georg Eimbke Transakt.: Verkauft (147.12 Rt) Käufer: Ghk Eichel
Beni, Philippus [Nicht identifiziert]
1785/10/17 LZRST 0005 Bendeier I Eine meisterhafte Landschaft, auf Kupfer von Bendeier gemalt, aber noch nicht völlig ausgeführt, rechts im Vordergrunde ein sehr grosser Baum, an dessen Fuss 6 Figuren sitzend, links ein Fluss nebst Wasserfall, im Mittelgrunde ein kleiner Scharmützel, im Hintergrunde schöne Bäume und Bauerhütten, 33 Z. hoch, 26 Zoll. br. in schwarzem Rahmen. I Pendant zu Nr. 6 Mat.: auf Kupfer Maße: 33 Zoll hoch, 26 Zoll breit Transakt.: Verkauft (2.8 Th) Käufer: Wiegand
1768/07/00 MUAN 0181 Beni (Philippus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
1785/10/17 LZRST 0006 Bendeier I Eine andere schöne Landschaft, von eben diesem Meister, das Gegenbild zum vorigen, links im Vordergründe einige Bäume, unter welchen Jäger und Jägerinnen mit ihren Flinten ruhen, rechts ein kleiner Fluss und Anhöhen, im Mittelgrunde einige Fuhrmannswagen, welche ausgespannt werden, im Hintergrunde Bäume, Felsen und Figuren, so sich bey einem Feuer wärmen, von gleich. Masse [33 Z. hoch, 26 Z. br.] ist etwas beschäd. I Pendant zu Nr. 5 Maße: 33 Zoll hoch, 26 Zoll breit Transakt.: Verkauft (4 Th) Käufer: Wiegand
Bennix, W. [Nicht identifiziert]
1785/10/17 LZRST 0073 Bendeier I Ein schöner Kopf en face, mit einem Stutzbarte und übergeschlagenem Spitzenkragen, in einem braunen Mantel, von Bendeier fleissig ausgeführt und gut colorirt. von gleich. Masse [wie Nr. 72], in schw. Rahm mit goldn. Leiste. I Maße: 14 Zoll hoch, 11 Zoll breit Transakt.: Verkauft oder Unverkauft (23 Gr) Käufer: Rost 1787/01/15 LZRST 0005 Bendeier I Ein schöner Kopf en face mit dem Stutzbarte und übergeschlagenen Spitzenkragen in einem braunen Mantel, von Bendeier fleissig ausgeführt und gut colorirt, 14 Z. h. 11 Z. br. in schw. Rahm mit gold. Leiste. I Maße: 14 Zoll hoch, 11 Zoll breit Verkäufer: Richter Transakt.: Unbekannt 1789/01/19 LZRST 3933 Bendeier I Eine schöne Landschaft, scheint von Bendeier gemahlt zu seyn. 1 Elle 4 Vi Zoll breit, 1 Elle 2 Z. h. in goldenen Rahm, welcher aber etwas beschädigt ist. I Maße: 1 Elle 4 Vi Zoll breit, 1 Elle 2 Zoll hoch Verkäufer: Pf Transakt.: Verkauft (1.8 Th) Käufer: Schlag
Bendt [Nicht identifiziert] 1790/04/13 HBLIE 0251 Bendt I Christus und die Samariterinn beym Brunnen. Auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 26 Zoll Transakt.: Verkauft (11 Sch) Käufer: Schreiber
Bendt, D.V. [Nicht identifiziert] 1783/06/19
HBRMS
0195
D. v. Bendt I Z u r L i n k e n a n e i n e r
Hölzung ein Brunnen, wobey einige Wäscherinnen stehen, und Reisende ihre Pferde tränken; zur Rechten sind Berge und Thäler. H[olz]. s.R. [schwarzer Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: 2 Fuß hoch, 2 Fuß 11 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Benefial, Marco 1764/05/18 BLAN 0005 Marco Benefial I Maria mit dem Kinde Jesu, der heilige Joseph und Johannes der Evangelist. Ganze Figuren von 13 Zoll auf Leinewand gemahlt, 2 Fuß 1 Zoll hoch, und 1 Fuß 5 Zoll breit. Die Maria sitzet, und will das Kind Jesu dem heiligen Joseph überreichen; neben Ihr zur Rechten sitzet Johannes der Evangelist, der Hintergrund ist eine Landschaft, über Ihr sind zwey Engel die einen Blumenkorb tragen. Dieses Bild ist schön componirt, die
1769/00/00 MUAN 0318 Beni (Philipe) I La fuite en Egypte, prenant quelque repos. Peint sur toile, marquee du No. 181.1 Mat.: auf Leinwand Maße: 2. p. 4 V2. p. de haut sur 1. p. 11. p. de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt
1781/09/10 BNAN 0066 W. Bennix I Eine offene Landschaft; zur Linken Seite ein Kirchdorf im Gebüsch; auf dem Vorgrunde Wasser, worauf ein Schiffchen. [Beide von W. Bennix.] g.L. [im schwarzen Rahm mit verguldeten Leisten] I Mat.: auf Holz Anm.: Die ersten Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 67 und beziehen sich auf die Nrn. 66 und 67. Transakt.: Unbekannt 1781/09/10 BNAN 0067 W. Bennix I Eine dito [offene Landschaft] etwas hüglicht; auf dem Mittelgrunde ein Sumpf bey einem Gebüsche mit einigen leichtbelaubten hohen Bäumen. Beide von W. Bennix. g.L. [im schwarzen Rahm mit verguldeten Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: 9 Zoll hoch, 13 Zoll breit Anm.: Die Angaben im Bildtitel beziehen sich auf die Nm. 66 und 67. Transakt.: Unbekannt
Benschoni, A. [Nicht identifiziert] 1797/04/20 HBPAK 0042 A. Benschoni I Eine Landschaft mit Vieh. Im Vordergrunde eine Bäurin, die eine Ziege melkt; neben ihr ein Landmann, mit anderer Arbeit beschäfftiget. Vortreflich gezeichnet und ausgearbeitet. Auf Holz, mit schwarzen Rahm und vergoldeten Stäben. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Zoll, breit 17 Zoll Transakt.: Unbekannt
Bent, Johannes van der 1752/05/08 LZAN 0177a Bendten I Zwey Landschaften von Bendten, im Holl. Rahmen. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 2 Ellen hoch, 1 Ά Ellen breit Anm.: Die Lose 177a und 177b wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (3 Th für die Nrn. 177a und 177b) Käufer: Schenck 1752/05/08 LZAN 0177b Bendten I Zwey Landschaften von Bendten, im Holl. Rahmen. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 2 Ellen hoch, 1 14 Ellen breit Anm.: Die Lose 177a und 177b wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (3 Th für die Nrn. 177a und 177b) Käufer: Schenck 1772/09/15 BNSCT 0011 J. v. Bent I Ein dito [Viehstück] von J. v. Bent, 1 Fuß 4 Zoll hoch, 1 Fuß 8 Zoll br. schw. Rahm. I Maße: 1 Fuß 4 Zoll hoch, 1 Fuß 8 Zoll breit Transakt.: Unbekannt (5 fl) 1774/08/13 HBBMN 0007 J. van der Bend I Eine schöne Landschaft mit vielen Figuren staffirt. I Transakt.: Unbekannt 1776/07/19 HBBMN 0037 van der Bendt I Eine Landschaft mit Hirten und Vieh, so schön wie Berghem. I Maße: Höhe 1 Fuß 3 V2 GEMÄLDE
263
Zoll, Breite 1 Fuß 8 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (8.8 M) Käufer: Lilie 1781/02/17 FRAN 0014 Jean van Bent I Ein Reuter=Gefecht, bey Ueberfallung einiger Bagage-Wagen von Jean van Bent. I Maße: 3 Schuh 1 Zoll breit, 3 Schuh 7 Zoll hoch Transakt.: Unbekannt (37 fl) 1784/08/02 FRNGL 0042 van der Senf I Eine schöne Landschaft mit Pferden und vielen Figuren. I Maße: 41 Zoll breit, 31 Zoll hoch Verkäufer: D Transakt.: Verkauft (15 fl) Käufer: Böser [?] 1785/05/17 MZAN 0067 Johann van der Bent der junge \ Ein Paar Landschaften mit Schaafen und Ziegen von Johann van der Bent dem jungen. [Deux paysages avec des brebis & des chevres.] I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Schaafen und Ziegen Maße: 2 Schuh 6 Zoll hoch, 3 Schuh breit Anm.: Die Lose 67 und 68 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (200 fl für die Nm. 67 und 68) Käufer: Msr Robart 1785/05/17 MZAN 0068 Johann van der Bent der junge I Ein Paar Landschaften mit Schaafen und Ziegen von Johann van der Bent dem jungen. [Deux paysages avec des brebis & des chevres.] I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Schaafen und Ziegen Maße: 2 Schuh 6 Zoll hoch, 3 Schuh breit Anm.: Die Lose 67 und 68 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (200 fl für die Nrn. 67 und 68) Käufer: Msr Robart 1785/05/17 MZAN 0277 Johann van der Bent I Eine Falkenjagd von Johann van der Bent. [Une chasse au faucon.] I Maße: 2 Schuh 4 Zoll hoch, 3 Schuh 1 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (36.30 fl) Käufer: Rmus D Cantor L Β äl Hoheneck 1785/05/17 MZAN 0900 Johann van der Bent I Eine Landschaft von Johann van der Bent. [Un paysage.] I Maße: 2 Schuh hoch, 2 Schuh 4 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (14 fl) Käufer: Schwanck 1790/08/25 FRAN 0115 van der Bent I Eine Landschaft mit Vieh und Figuren. I Maße: hoch 36 Zoll, breit 28 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (11 fl) Käufer: Diehl 1791/09/21 FRAN 0121 Van der Bent, einer der besten Schüler des Berghems I Eine Landschaft mit Bäumen und Hügeln gezieret, wo vomen eine Schäferin ist, welche spinnet, neben ihr ist ein Hund, sie ist mit Schafen, Kühen und Eseln umgeben und hinten zur Rechten sind Ziegen; dieses Gemälde ist überaus verständlich und natürlich. I Transakt.: Verkauft (23 fl) Käufer: Emerich 1793/00/00 HBMFD 0059 v. d. Bent I Gebürge. Links fliesst ein Fluss im Thale bey einer Stadt vorbey. Zur Rechten attaquiren sich Cavalleristen, wovon einer bis in den Fluss verfolgt wird. Uebem Vordergrunde zur Linken galoppirt ein blasender Trompeter daher, vermuthlich den Sieg zu verkündigen den die eine Parthie davon zu tragen scheint. In der Landschaft sieht man den getreuen Schüler Berghems und dessen lichtes Colorit. Die Figuren hat der Künstler ganz im Geschmack und Geiste eines Wouwermanns gemalt. Dieses seltne Bild in seiner Art ist von dreister Ausführung und pikanter Würkung. I Mat.: auf Leinwand Maße: 3 Fuss 9 Zoll hoch, 3 Fuss 1 Zoll breit Verkäufer: Pierre Laporterie Transakt.: Unbekannt 1793/09/18 HBSCN 0067 F. v. d. Bent I Zwey gebürgigte Landschaften, zur Linken an und auf einer Anhöhe ruhendes Vieh, an ein verfallenes Gebäude steigt jemand die Treppe hinauf, unten ein Herr und Dame, neben ihnen ein Esel, über ein Wasserfall führet eine Brücke den Weg zur Stadt, worüber Vieh und ein bepackter Esel getriebin [sie] werden. Das Gegenbild gleichfals Schaafe, Ziegen, Hornvieh und ein Schwein, der Hirte sitzt im Pelz=Jacke auf einer Anhöhe und spricht mit der Hirtin, zur Rechten verfallene Gebäude. Zwey herrliche Bilder. I Diese Nr.: Eine gebürgigte Landschaft, zur Linken am und auf einer Anhöhe ruhendes Vieh, an ein verfallenes Gebäude steigt jemand die Treppe hinauf; Pendant zu Nr. 68 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 32 Vi Zoll, breit 44 Vi Zoll Anm.: Die Lo264
GEMÄLDE
se 67 und 68 wurden zusammen katalogisiert. Der Name des Künstlers ist angegeben als "F. v. d. Bent", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt 1793/09/18 HBSCN 0068 F. v. d. Bent I Zwey gebürgigte Landschaften, zur Linken an und auf einer Anhöhe ruhendes Vieh, an ein verfallenes Gebäude steigt jemand die Treppe hinauf, unten ein Herr und Dame, neben ihnen ein Esel, über ein Wasserfall führet eine Brücke den Weg zur Stadt, worüber Vieh und ein bepackter Esel getriebin [sie] werden. Das Gegenbild gleichfals Schaafe, Ziegen, Hornvieh und ein Schwein, der Hirte sitzt im Pelz=Jacke auf einer Anhöhe und spricht mit der Hirtin, zur Rechten verfallene Gebäude. Zwey herrliche Bilder. I Diese Nr.: Das Gegenbild gleichfals Schaafe, Ziegen, Hornvieh und ein Schwein, der Hirte sitzt im Pelz=Jacke auf einer Anhöhe und spricht mit der Hirtin; Pendant zu Nr. 67 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 32 Vi Zoll, breit 44 Vi Zoll Anm.: Die Lose 67 und 68 wurden zusammen katalogisiert. Der Name des Künstlers ist angegeben als "F. v. d. Bent", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt 1795/11/14 HBPAK 0136 V. Bent I Ein Nachtstück. Eine alte Frauensperson sitzt auf ihrem Stuhl vor ein Camin und wärmt sich. Auf Holz. Schwarz. Rahm mit gold. Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 12 Zoll Anm.: Der Künstler ist vermutlich Justus von Bentum und nicht Johannes van der Bent. Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0046 Von der Bent I Zwey Landschaften, die eine; bergigte Gegend, im Hintergrunde alte Ruinen; im Vordergrunde, wo Schäfer und Schäferinn in Lebensgröße ihr Vieh weiden. Das Gegenstück; auf einem Berge alte Gebäude, am Fusse desselben viel Vieh. Die beyden Bilder können mit den schönsten Berghems verglichen werden. Auf Leinw. Goldn. Rahm. I Diese Nr.: Eine Landschaft, eine bergigte Gegend, im Hintergrunde alte Ruinen; im Vordergrunde, wo Schäfer und Schäferinn in Lebensgröße ihr Vieh weiden; Pendant zu Nr. 47 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 31 Zoll, breit 45 Zoll Anm.: Die Lose 46 und 47 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0047 Von der Bent I Zwey Landschaften, die eine; bergigte Gegend, im Hintergrunde alte Ruinen; im Vordergrunde, wo Schäfer und Schäferinn in Lebensgröße ihr Vieh weiden. Das Gegenstück; auf einem Berge alte Gebäude, am Fusse desselben viel Vieh. Die beyden Bilder können mit den schönsten Berghems verglichen werden. Auf Leinw. Goldn. Rahm. I Diese Nr.: Eine Landschaft; auf einem Berge alte Gebäude, am Fusse desselben viel Vieh; Pendant zu Nr. 46 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 31 Zoll, breit 45 Zoll Anm.: Die Lose 46 und 47 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0042 van der Bent I Zwey bergigte Landschaften, mit Vieh und Figuren. I Diese Nr.: Eine bergigte Landschaft, mit Vieh und Figuren Anm.: Die Lose 42 und 43 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0043 van der Bent I Zwey bergigte Landschaften, mit Vieh und Figuren. I Diese Nr.: Eine bergigte Landschaft, mit Vieh und Figuren Anm.: Die Lose 42 und 43 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/02/27 HBPAK 0053 Van der Bendt I Eine Landschaft mit Figuren, Ochsen und Maulthieren ec. Auf Leinwand. Im goldnen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 20 Zoll, breit 27 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0011 v. d. Bent I Ein Seehaven im mitländischen Meere, worinnen Schiffe vor Anker liegen, am Ufer befinden sich Spanier, Franzosen, Türken und Mohren, von beyderley Geschlecht in Lebensgrösse; mit sehr vieler Kunst gemahlt. Auf Leinwand, goldenen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 38 Zoll, breit 50 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0112 v. d. Bent I Eine Strasse, welche nach einen Hafen führt, zur rechten eine grosse Treppe, oben auf dersel-
ben eine Gesellschaft, die von dort den Hafen übersieht, am Fusse derselben sitzt ein Mädgen mit Blumen zu verkaufen, etwas hinter ihr mehr am Ende sieht man einige Schiffe vor Anker liegen; im Vordergrunde einen Herrn und eine Dame zu Pferde, ein Mohr führt der letztern ihr Pferd, zur linken grosse Gebäude mit einem Monument, unten auf der Strasse eine Frau, welche etwas bratet, um ihr einige Personen, alle in Lebensgrösse, nebst noch andern Figuren. Auf Leinwand, schwarzen Rahm, goldene Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 26 Zoll, breit 34 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0149 V. d. Bent I Eine Landschaft, mit Schäfer und Schäferinnen, mit ihrer Herde nebst noch verschiedenen Figuren, und andern Gegenständen, sehr fleißig gemahlt. Auf Leinw., schwarzen Rahm, goldenen Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 32 Zoll, breit 26 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0020 Von der Bent I Zwey Landschaften; die eine, wo ein Mädchen eine Kuhe melkt, mit noch mehr nebenliegenden Kühen; die andere eine Dorfgegend, wo vor einem Hause ein Bauer Hüner füttert; im Vordergrunde sitzt eine Bauerfrau mit einem Kinde auf dem Schoosse, der Vater vor ihr sitzend mit dem Kinde spielend, neben ihnen steht und liegt das Vieh. Ganz im Geschmack des Berghems. Auf Leinwand, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Eine Landschaft, wo ein Mächen eine Kuhe melkt, mit noch mehr nebenliegenden Kühen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 37 Zoll, breit 35 Zoll Anm.: Die Lose 20 und 21 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0021 Von der Bent I Zwey Landschaften; die eine, wo ein Mädchen eine Kuhe melkt, mit noch mehr nebenliegenden Kühen; die andere eine Dorfgegend, wo vor einem Hause ein Bauer Hüner füttert; im Vordergrunde sitzt eine Bauerfrau mit einem Kinde auf dem Schoosse, der Vater vor ihr sitzend mit dem Kinde spielend, neben ihnen steht und liegt das Vieh. Ganz im Geschmack des Berghems. Auf Leinwand, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Eine Landschaft, eine Dorfgegend, wo vor einem Hause ein Bauer Hüner füttert; im Vordergrunde sitzt eine Bauerfrau mit einem Kinde auf dem Schoosse Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 37 Zoll, breit 35 Zoll Anm.: Die Lose 20 und 21 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0251 Johann van der Bent \ Ein Landschäftchen, worauf ein mit Pferden bespannter Wagen ist, von Johann van der Bent. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 7 Zoll breit 8 Vi Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Bent, Johannes van der (Kopie nach)
1776/04/15 HBBMN 0038 van Bentum I Eine Judith mit Holofernus Haupt, bey Nacht. I Maße: Höhe 10 Vi Zoll, Breite 8 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (6.8 M) Käufer: Pauly 1778/09/28 FRAN 0676 Benthum I Ein sehr schönes Nachtstück. [Un tres beau tableau ä nuit.] I Maße: 1 Schuh 2 Zoll breit, 18 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (41.30 fl) Käufer: Dr Hartzen 1779/09/27 FRNGL 0080 Benthum I Ein fein und fleißig ausgearbeitetes Nachtstück. [Une piece de nuit, achevee avec bien de l'exactitude.] I Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 1 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (9.15 fl) Käufer: Dehnhardt Post 1779/09/27 FRNGL 0865 Benthum I Eine Zigeunerinn, welche einem schönen jungen Frauenzimmer wahrsagt, mit verschiedenen Nebenfiguren, eines derer fein= und fleißigsten, in Schalckens Manier ausgearbeitetes Nachtstück. [Une Bohemienne, disante la bonne aventure ä une jeune belle Dame, avec plusieurs figures accessoires, une nuit, une des meilleures pieces dans le gout de Schalken.] I Maße: 1 Schuh 7 Zoll hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Transakt.: Verkauft (92 fl) Käufer: Hüsgen 1780/00/00 AUAN 0001 Benthem I Ein Nachtstück St. Hieronymum vorstellend. I Transakt.: Unbekannt 1780/00/00 AUAN 0002 Benthem I Ein Wucherer, beede sind Nachtstücke. I Anm.: Die Beschreibung im Titel bezieht sich auf die Nm. 2 und 3. Transakt.: Unbekannt 1780/00/00 AUAN 0003 Benthem I Ein altes Weib beym feuer, beede sind Nachtstücke. I Anm.: Die Beschreibung im Titel bezieht sich auf die Nrn. 2 und 3. Transakt.: Unbekannt 1781/05/07 FRHUS 0057 Bentum I Zwey Nachtstücke, das eine einen Gelehrten, der eine Feder schneidt, das andere eine Frau so Erdbeeren isset, mit vieler Würckung gemahlt von Bentum. I Diese Nr.: Ein Nachtstück, das eine einen Gelehrten, der eine Feder schneidt Maße: 1 Schuh 7 Zoll hoch und 1 Schuh 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 57 und 58 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (5.40 fl für die Nm. 57 und 58) Käufer: Jgf Bernus 1781/05/07 FRHUS 0058 Bentum I Zwey Nachtstücke, das eine einen Gelehrten, der eine Feder schneidt, das andere eine Frau so Erdbeeren isset, mit vieler Würckung gemahlt von Bentum. I Diese Nr.: Ein Nachtstück, eine Frau so Erdbeeren isset Maße: 1 Schuh 7 Zoll hoch und 1 Schuh 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 57 und 58 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (5.40 fl für die Nrn. 57 und 58) Käufer: Jgf Bernus
1776/06/28 HBBMN 0020 van der Bendt I Eine plaisante Landschaft, auf Leinewand, nach van der Bendt. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 11 Zoll, Breite 2 Fuß 10 Zoll Transakt.: Unbekannt
1781/05/07 FRHUS 0387 Benthum I Judith mit dem Haupt Holofernis, als ein Nachtstück vorgestellt, fleissig ausgeführt und meisterhaft in Licht und Schatten gehalten von Benthum. I Maße: 2 Schuh 7 Zoll hoch und 1 Schuh 11 Zoll breit Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (7.15 fl) Käufer: F Bernus
Bentum, Justus van
1782/07/00 FRAN 0021 Bentum I Ein fleißig gemalter Eremit in einer Höhle. I Maße: 8 Zoll hoch, 6 Zoll breit Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] fl)
1759/00/00 LZEBT 0144 Benthum I Maria mit dem Christ Kindlein und Joseph an einem Tisch sitzend das Christ Kindlein wird von Joseph gewartet und ihn zu trinken gegeben ein Nachtstück auf Holtz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 2 Zoll, Breite 1 Schuh 6 Vi Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (100 Th Schätzung) 1764/03/12 FRKAL 0004 Benthem I Un piice de nuit representant Joseph & Marie ä table avec l'enfant Jesus. I Maße: hauteur 18 Vi pouces, largeur 14 pouces Transakt.: Unbekannt (16 fl) 1765/03/27 FRKAL 0011 Bentum I Une piice de nuit representant une jolie femme qui chante ä la lumi£re. I Maße: hauteur 14 pouces, largeur 12 pouces Transakt.: Verkauft (5 fl) Käufer: Kaller
1782/07/00 FRAN 0052 Bentum I Ein Frauenzimmer, so sich von einer Zigeunerin wahrsagen lässt. I Maße: 2 Schuh 5 Zoll hoch, 1 Schuh 9 Zoll breit Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt (2 fl) 1784/08/02 FRNGL 0483 Benthum I Ein alter Gelehrter, welcher eine Feder bey einer Lampe schneidet. I Maße: 12 Zoll breit, 15 Zoll hoch Transakt.: Verkauft (6 fl) Käufer: Berger 1787/10/06 HBTEX 0036 Van Bentum I Ein Nachtstück bey brennender Kerze, mit zwey Figuren. I Transakt.: Unbekannt 1788/01/15 LZRST 3930 Bendun I Ein Nachtstück, zwey Figuren bey einer Lampe, von Bendun gemahlt, 17 Zoll hoch 14 Zoll breit, auf Holz in schw. Rahmen. I Mat.: auf Holz Maße: 17 Zoll GEMÄLDE
265
hoch, 14 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (3.2 Th) Käufer: C R 1788/01/15 LZRST 3965 Bendun I Ein Nachtstück mit Bauern und Bäuerinnen, von Bendun, vortreflich ausgeführt, 13 Vi Z. hoch, 11 Vi Z. breit, in schwarz. Rahm, mit verg. Leiste.n I Maße: 13 Vi Zoll hoch, 11 Vi Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (2.8 Th) Käufer: Gesser [?] 1791/05/30 FRAN 0135 Bentum I Ein Nachtstück, Ein Mann und eine Frau bey einer Lampe sitzend, von Bentum. Das Gegenbild, Ein schlafendes junges Mädchen bey Licht sehr natürlich vorgestellt, vom nemlichen Meister. I Diese Nr.: Ein Nachtstück, Ein Mann und eine Frau bey einer Lampe sitzend; Pendant zu Nr. 136 Maße: 1 Schuh 6 Zoll hoch und 1 Schuh 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 135 und 136 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Bansa Transakt.: Verkauft (3 für die Nrn. 135 und 136) Käufer: Chamot 1791/05/30 FRAN 0136 Bentum I Ein Nachtstück, Ein Mann und eine Frau bey einer Lampe sitzend, von Bentum. Das Gegenbild, Ein schlafendes junges Mädchen bey Licht sehr natürlich vorgestellt, vom nemlichen Meister. I Diese Nr.: Ein schlafendes junges Mädchen bey Licht sehr natürlich vorgestellt; Pendant zu Nr. 135 Maße: 1 Schuh 6 Zoll hoch und 1 Schuh 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 135 und 136 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Bansa Transakt.: Verkauft (3 für die Nrn. 135 und 136) Käufer: Chamot 1791/09/26 FRAN 0061 Bentum I Wie die Alten sungen, so pfiffen die Jungen, ein Nachtstück von Bentum. I Pendant zu Nr. 62 Maße: 3 Sch. 11 Zoll hoch, 4 Sch. 11 Zoll breit Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0062 Bentum I Das Gegenstück zu obigem, fünf handelnde Personen bey dem Schein eines Lichtes, von gleicher Schönheit, Meister [Bentum] und Maas. I Pendant zu Nr. 61 Maße: 3 Sch. 11 Zoll hoch, 4 Sch. 11 Zoll breit Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0123 Bentum I Zwey Nachtstück von guter Würkung. I Diese Nr.: Ein Nachtstück von guter Würkung Maße: 27 Zoll breit, 35 Zoll hoch Anm.: Die Lose 123 und 124 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0124 Bentum I Zwey Nachtstück von guter Würkung. I Diese Nr.: Ein Nachtstück von guter Würkung Maße: 27 Zoll breit, 35 Zoll hoch Anm.: Die Lose 123 und 124 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0210 Bentum I Eine Magd die Bier im Keller zapft, und sich beym Schein der Laterne mit ihrem Bursch wohl seyn lässt, fleißig und würkend ausgeführt von Bentum. I Maße: 14 Zoll hoch, 10 Zoll breit Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0341 Bentum I Zwey bei Licht spielende und arbeitende Mädchen. I Diese Nr.: Ein bey Licht spielendes Mädchen Maße: 32 Zoll hoch, 28 Zoll breit Anm.: Die Lose 341 und 342 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0342 Bentum I Zwey bei Licht spielende und arbeitende Mädchen. I Diese Nr.: Ein bey Licht arbeitendes Mädchen Maße: 32 Zoll hoch, 28 Zoll breit Anm.: Die Lose 341 und 342 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0389 Bentum I Zwey Nachtstücke, würkend ausgeführt von Bentum. I Diese Nr.: Ein Nachtstück Maße: 27 Zoll breit, 35 Zoll hoch Anm.: Die Lose 389 und 390 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 266
GEMÄLDE
1791/09/26 FRAN 0390 Bentum I Zwey Nachtstücke, würkend ausgeführt von Bentum. I Diese Nr.: Ein Nachtstück Maße: 27 Zoll breit, 35 Zoll hoch Anm.: Die Lose 389 und 390 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0630 Bentum I Der betende Petras. I Maße: 8 Zoll hoch, 7 Zoll breit Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/10/21 HBRMS1 0042 Van Bentum I Ein altes Mütterchen sitzt vor einem Kamin und wärmt ihre Hände übers Feuer. Halbe Figur. Im Geschmack von Schalken gemahlt; auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Zoll, breit 12 Zoll Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 HBMFD 0117 Van Bentum I Halbe Figur, fast Lebensgrösse. Ein alter Mann mit thränenden Auge schlägt beyde Hände betend zusammen. Vor ihm hängt eine brennende Lampe, welche eine schöne Beleuchtung verursacht. Dieses Bild macht den Schüler Schalkens Ehre. I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuss 6 Zoll hoch, 1 Fuss 8 Zoll breit Verkäufer: Pierre Laporterie Transakt.: Unbekannt 1793/09/18 HBSCN 0128 Jan van Bentum I Eine alte Frau die sich am Feuer wärmet, so schön als Schalken. I Mat. : auf Leinwand Maße: Hoch 36 Zoll, breit 27 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0063 Bentum I Eine jüdische Gemeine, Abends in der Synagoge, bey Verrichtung des Gottesdienstes. Schöne richtige Zeichnung, nebst den sprechendsten Ausdruck in den Gesichtern, hohes Colorit, mit einer vortreflichen Beleuchtung, zeichnen diese Arbeit ganz vorzüglich aus. Auf Leinwand, mit vergoldeten Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 22 Zoll, breit 27 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/08/10 MM AN 0291 Gustus Bentum I Gegenstücke auf dem ersten ein Mann, welcher lieset, auf dem anderen eine alte Frau, sich beim Feuer wärmend. Von Gustav Böntum auf Tuch. I Diese Nr.: Ein Gegenstück, auf dem ersten ein Mann, welcher lieset; Pendant zu Nr. 292 Anm.: Die Lose 291 und 292 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (35 fl für die Nrn. 291 und 292, Schätzung) 1797/08/10 MM AN 0292 Gustus Bentum I Gegenstücke auf dem ersten ein Mann, welcher lieset, auf dem anderen eine alte Frau, sich beim Feuer wärmend. Von Gustav Böntum auf Tuch. I Diese Nr.: Ein Gegenstück, auf dem ersten ein Mann, welcher lieset; Pendant zu Nr. 291 Anm.: Die Lose 291 und 292 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (35 fl für die Nrn. 291 und 292, Schätzung) 1799/01/07 WW AN 0001 Penthome I Zwei Vestalinnen, welche auf einem Altare das heilige Feuer unterhalten. I Verkäufer: Frandorff Transakt.: Unbekannt 1799/01/07 WW AN 0025 Penthome I Ein Bruststück; ein älter bärtiger Mann. I Verkäufer: Frandorff Transakt.: Unbekannt
Bentum, Justus van (Kopie von) 1785/12/21 HBKOS 0022 van Bentum; Gottfr. Schalck I Ein Mädgen mit ein brennend Licht, im schwarzen Rahm, von van Bentum, nach Gottfr. Schalck. I Kopie von Justus Bentum nach Schalcken Transakt.: Unbekannt
Bentum, Justus van (Kopie nach) 1797/08/10 MMAN 0206 Bentum I Eine H. Magdalena im Gebet. Nachtstück, nach Bentum, auf Tuch. I Pendant zu Nr. 207 Mat.: auf Leinwand Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (4 fl Schätzung) 1797/08/10 MMAN 0207 Bentum I Gegenstück vom vorigen, ein junges Mädchen mit einer Lampe. Nach dem nemlichen Meister
[Bentum]. auf Tuch. I Pendant zu Nr. 206 Mat.: auf Leinwand Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (4 fl Schätzung) 1799/01/07 WW AN 0013 Penthome I Zwei Nachtstücke, Petrus und Maria, nach Penthome. I Verkäufer: Frandorff Transakt.: Unbekannt
Bentum, Justus van (Manier) 1779/09/27 FRNGL 0936 Bentheum I Ein Nachtstück, ein alter Mann so eine Feder schneidet, in der Manier von Bentheum. [Une nuit, un vieillard qui taille une plume, dans le gout de Bentheum.] I Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh breit Transakt.: Verkauft (5.4 fl) Käufer: Mevius
Berch, Gillis Gillisz. de 1778/09/28 FRAN 0680 G. de Bergh I Ein sehr schönes Früchtenstück. [Une tres belle piece representante des fruits.] I Maße: 2 Schuh breit, 1 Schuh 7 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (16 fl) Käufer: Dr Hartzen 1787/00/00 HB AN 0615 de Bergh I Auf einem steinernen mit einer purpurnen Decke belegten Tische befinden sich unterschiedliche Früchte, Weintrauben, Aepfel, Pflaumen, Zitronen, ec. und ein Römer Wein. Sehr natürlich gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 19 Vi Zoll, breit 24 Zoll Transakt.: Verkauft (12 M) Käufer: Berth[eau]
Berchem, Nicolaes Pietersz. 1716/00/00 FRHDR 0178 Bergheim I Von Bergheim ein stuck mit Kuhe. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (45) 1742/08/30 BOAN 0135 Berchem I Un Pa'isage avec betes ä cornes, par Berchem. I Maße: Haut 1. p. 4 Vi pouces, large 1. p. 2. pouc. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1744/05/20 FRAN 0060 Berchem I 1 Landschafft von Berchem. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 2 Vi Zoll, Breite 1 Schuh 7 Zoll Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1747/04/06 HB AN 0045 Berghem I Ein klein Vieh=Stück von Berghem. I Maße: 1 Fuß 1 Zoll Breite und 11 Zoll Höhe Verkäufer: Brockes Transakt.: Unbekannt (2) 1749/07/31 HBRAD 0025 Berghem I Ein Vieh=Stück. I Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (9) 1749/07/31 HBRAD 0088 Berghem I Eine Landschaft, t Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (1.8) 1750/00/00 KOAN 0094 Nicolas Berghem I Un Paisage, ä animaux de divers genre, de bon gout, & du plus beau tems de Nicolas Berghem. I Maße: Largeur 1 Pies 7 Pouces, Haut 1 Pies 2 Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0095 Nicolas Berghem I Autre Paisage par le meme [Nicolas Berghem] rempli de chevaux, chiens, & autres Figures, dans le gout de Wauwermans. I Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0096 Nicolas Berghem \ Par le meme [Nicolas Berghem], un Soleil couchant, avec Personnages & animaux, sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: Largeur 10 Pouces, Haut 11 Vi Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1759/00/00 LZEBT 0163 Berghem I Eine Landschaft auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 4 Zoll, Breite 1 Schuh 11 Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (150 Th Schätzung)
1763/01/19 FRJUN 0012 Nicolas Berchem I Un tres beau & excellent pa'isage orne de figures & d'animaux, riche ordonance, bien dessine, & le tout delicatement peint dans son meilleur tems. I Maße: hauteur 27 pouces, large 32 pouces Transakt.: Unbekannt (61 V2 fl) 1763/01/19 FRJUN 0013 Nicolas Berchem I Un semblable süperbe paisage avec un Berger & une Bergere montes sur deux anes & encore une femme qui marche dans l'Eau, une Vache & deux Boues aussi dans l'Eau, le tout tres bien execute. I Maße: hauteur 18 pouces, large 15 pouces Transakt.: Unbekannt (65 fl) 1763/11/09 FRJUN 0013 N. Berchem I Un agreable paisage avec un Berger ä cheval & une Bergere ä pied & quelques animaux tres bien touches. I Maße: hauteur 16 Vi pouces, largeur 14 pouces Transakt.: Verkauft (14 fl) Käufer: Kaller 1763/11/09 FRJUN 0014 N. Berchem I Un autre petit pa'isage orne d'animaux aussi bien peint. I Maße: hauteur 9 pouces, largeur 11 pouces Transakt.: Verkauft (7 fl) Käufer: Kaller 1764/00/00 BLAN 0419 Berchem I 1. unvergleichliche schön landschaft. I Maße: 3 Fuß Vi Zoll hoch, 2 Fuß 10 Vi Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (700 Rt Schätzung) 1764/00/00 BLAN 0422 Berchem I 1. sehr artiges in grau gemahltes gemälde. I Maße: 11 % Zoll hoch, 1 Fuß 3 % Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (120 Rt Schätzung) Gegenw. Standort: Sankt-Peterburg, Rossiya. Ermitazh. (N 2037) 1764/00/00 BLAN 0533 N: Berchem I 1. sehr schöne Capital landschaft mit Figuren. I Maße: 2 Fuß 8 Vi Zoll hoch, 3 Fuß 5 Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (800 Rt Schätzung) 1764/03/12 FRKAL 0005 Berchem I Un petit paisage orne de quelques animaux. I Maße: hauteur 10 pouces, largeur 12 pouces Transakt.: Verkauft (10.15 fl) Käufer: Scherrer 1764/05/14 BOAN 0323 Berchem I Un Tableau de deux pieds trois pouces de hauteur, deux pieds deux pouces de largeur, representant un Paturage avec des figures & vaches ä lait, peint par Berchem. [Ein stück Vorstellend eine weyde mit melchender Kühe, auch figuren, von Berchem.] I Maße: 2 pieds 3 pouces de hauteur, 2 pieds 2 pouces de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (28 Rt) Käufer: Doussetti 1764/05/16 BOAN 0214 Bergheim I Un Pa'isage en clair de Lüne avec des Figures & du Betail de quatre pieds deux pouces de largeur, trois pieds deux pouces de hauteur, peint par Bergheim. [Ein große Landschaft mit Viehe und figuren im mondschein Von Bergheim.] I Maße: 4 pieds 2 pouces de largeur, 3 pieds 2 pouces de hauteur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (81 Rt) Käufer: Doussetti 1764/05/16 BOAN 0277 Berghem I Un Tableau de deux pieds neuf pouces de largeur, deux pieds deux pouces de hauteur, representant le coucher du soleil avec des figures & du Betail, peint par Berghem. [Ein stück Vorstellend den Sonnenuntergang mit figuren und Viehe von Berghem.] I Maße: 2 pieds 9 pouces de largeur, 2 pieds 2 pouces de hauteur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (117 Rt) Käufer: Neveu 1764/05/22 BOAN 0059 Pierre Berchem I Un Paisage representant la Chasse forcee de deux pieds deux pouces de largeur, d'un pied quatre pouces de hauteur, peint par Pierre Berchem. [Ein stück Vorstellend Eine parforce-jagd Von Peteren Berchem.] I Maße: 2 pieds 2 pouces de largeur, 1 pied quatre pouces de hauteur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (33 Rt) Käufer: Schild 1764/08/25 FRAN 0475 Nicolas Berghem I L'apparition des Anges aux bergers. I Maße: haut 2 pieds sur 2 pieds 7 pouces de large Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
267
1765/00/00 FRRAU 0143 Bergheim I Ein Nacht=Stück, vorstellend eine Landschafft mit alte Rudera, etwas Waldung, und auf dem Wasser einige Schiffe, dabey eine extra schöne Estavage von Menschen und Vieh. Der volle Mond, welcher sich halb unter den trüben Wolcken verstecket, wirfft die angenehmsten und wohlangebrachten Lichter auf die gehörige Subjecta, daß nichts natürlichers in der Natur zu sehen ist; Alles ist durch des Meisters glücklichen Pinzel in vollkommenstem Fleiß ausgeführt. C'est une piece de nuit, qui represente un pai'sage avec des masures, quelques brosailles & des vaisseaux dans l'eau, avec un etalage admirable de personnes & d'animaux. La pleine Lüne qui se cache ä demi sous les sombres nuages, jette des rai'ons resplendissans & agreables sur les sujets, qu'on doit voir, desorte qu'il n'y a rien de plus naturel; Le tout est tres-parfaitement represente par l'heureux pin^eau de ce brave maitre. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 3 Schuh 2 Zoll, breit 4 Schuh 2 Zoll Transakt.: Unbekannt
1768/07/00 MUAN 0202 Berghem (Nicolaus Klassen) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
1765/03/27 FRKAL 0012 Berchem I Un agreable paisage orne de figures & d'animaux bien peint. I Maße: hauteur 26 pouces, largeur 21 pouces Transakt.: Verkauft (15 fl) Käufer: Hoch
1768/07/00 MUAN 0825 Berghem (Nicolaus Klassen) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
1765/03/27 FRKAL 0013 Berchem I Un semblable petit pai'sage avec quelques figures & des animaux. I Maße: hauteur 10 Vi pouces, largeur 12 pouces Transakt.: Verkauft (5 fl) Käufer: Kaller 1767/00/00 KOAN 0005 Nicolaus Berghem I Eine Landschaft mit verschiedenem Viehe von Nicolaus Berghem. I Maße: Breite 2 Fuß 2 Vi Zoll, Höhe 1 Fuß 9 Vi Zoll Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt 1767/00/00 KOAN 0035 Berghem I Eine Landschaft mit Pferd, Hund und Figuren von Berghem. I Maße: Breite 2 Fuß 9 V* Zoll, Höhe 2 Fuß 2 V* Zoll Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt 1767/00/00 KOAN 0060 Berghem I Ein kleine Landschaft auf Holtz mit einem Pferd und Maulthier, von Berghem. I Mat.: auf Holz Maße: Breite 1 Fuß 7 Vi Zoll, Höhe 1 Fuß 4 V* Zoll Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt 1767/00/00 KOAN 0091 Berghem I Ein Sonnen Untergang mit Figuren und Vieh, von Berghem. I Maße: Breite 1 Fuß 8 Zoll, Höhe 1 Fuß 9 Vi Zoll Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt
1768/07/00 MUAN 0225 Berghem (Nicolaus Klassen) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0416 Berghem (Nicolaus Klassen) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
1769/00/00 MUAN 0085 Berchem I Deux pieces d'animaux. Peintes sur bois & marquees des Nos. 198 & 199. I Diese Nr.: Une piece d'animaux Mat.: auf Holz Maße: 1. p. 3. p. de haut sur 1. p. 7 Vi. p. de large Anm.: Die Lose 85 und 86 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0086 Berchem I Deux pieces d'animaux. Peintes sur bois & marquees des Nos. 198 & 199. I Diese Nr.: Une piece d'animaux Mat.: auf Holz Maße: 1. p. 3. p. de haut sur 1. p. 7 Vi. p. de large Anm.: Die Lose 85 und 86 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1771/05/06 FRAN 0156 Bergheim I Zwey dito [Landschaften], auf dito [Tuch]. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 10 Zoll, breit 13 Zoll Anm.: Die Lose 156 und 157 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friederich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt
1768/07/00 MUAN 0191 Berghem (Nicolaus Klassen) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
1771/05/06 FRAN 0157 Bergheim I Zwey dito [Landschaften], auf dito [Tuch]. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 10 Zoll, breit 13 Zoll Anm.: Die Lose 156 und 157 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friederich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt
1768/07/00 MUAN 0192 Berghem (Nicolaus Klassen) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
1774/03/28 HBBMN 0038 Nicolaus Berghem I Ein Scharmützel, oder Rencontre, desgleichen man wenig von diesem großen Meister siehet, mit schwarzem Rahm und verguldeten Leisten. I Maße: Höhe 1 Fuß 7 Zoll, Breite 2 Fuß 2 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt
1768/07/00 MUAN 0198 Berghem (Nicolaus Klassen) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0199 Berghem (Nicolaus Klassen) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0201 Berghem (Nicolaus Klassen) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 268
GEMÄLDE
1774/08/13 HBBMN akt.: Unbekannt
0157
Berghem I Ein Vieh=Stück. I Trans-
1775/09/09 HBBMN 0013 Nie. Berghem I Ein trinkender Reuter bey einem Wirtshause, nebst mehr andern Figuren, ein rares Bild, Leinewand auf Holz. I Mat.: Leinwand auf Holz Maße: Hoch 2 F 1 Z, Breit 1 F 7 Ζ Transakt.: Verkauft (23 M) Käufer: Hasb[erg] 1776/00/00 WZTRU 0025 Nikolaus Bergheim I Ein Stück von 1 Schuhe, 6 Zoll hoch, 1 Schuhe, 10 Zoll breit von Nikolaus Bergheim. Dieses Stück stellet vor eine unweit eines Waldes grünende Heyde, allwo unter einem Baume eine Hirtenfrau ihr Kind sitzend säuget, im zweyten Gruppo hinter ihr stehet eine Kuhe vor einer liegenden, wobey 3 Schafe beyeinander liegen; es wird in diesem Stükke des Lehrmeisters Manier nämlich Johann Baptista Weenix sowohl in der Färbung, Schatten und Licht, correcte Zeichnung und der Harmonie gar wohl erkennet werden: man versichert mit diesem Stücke ein wahres Original, worauf auch dessen Name sich vorfin-
det. I Maße: 1 Schuhe 6 Zoll hoch, 1 Schuhe 10 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (200 fl Schätzung) 1776/00/00 WZTRU 0102 Nikolaus Bergem I Ein Stück 2 Schuhe, 6 Zoll hoch, 2 Schuhe, 2 Zoll breit von Nikolaus Bergem, stellet vor einen Weisen Ochsen, welcher in schönster Wendung mit einer Geys und einigen Schafen in einer angenehmen Landschaft weidet; dieses Stücke ist ungemein annehmlich und wohl verstanden, und herrschet sowohl in einem als anderem Theile der Kunst ein vollkommener Ausdruck der Natur. I Maße: 2 Schuhe 6 Zoll hoch, 2 Schuhe 2 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (30 fl Schätzung) 1776/00/00 WZTRU 0202 Nikolaus Berghem I Ein Stück 10 Zoll hoch, 9 Zoll breit von Nikolaus Berghem, stellet vor einen Kalbskopf, welcher aus einem grünen Busch schauet, in diesem Stücke erkennet man die pure Natur, und ist ungemein gut gemalet. I Maße: 10 Zoll hoch, 9 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (24 fl Schätzung) 1777/05/26 FRAN 0197 Bergheim I Vieh=St. I Verkäufer: Finsterwalder Transakt.: Verkauft (9 fl) Käufer: Zimmer 1778/09/28 FRAN 0161 Nicolaus Berghem I Ein sehr schönes Viehstück. [Une tres belle piece representante du betail par Nicolas Berghem.] I Maße: 2 Schuh 5 Zoll breit, 2 Schuh hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (126 fl) Käufer: Weitsch 1778/09/28 FRAN 0552 Berghem I Eine vortrefliche Landschaft mit jagenden Reitern und Vieh vorstellend. [Un tres beau paysage representant des chasseurs ä cheval & du betail.] I Maße: 2 Schuh breit, 1 Schuh 4 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (140 fl) Käufer: Tischbein 1778/09/28 FRAN 0654 Berghem I Der Compagnon, das nemliche [ein Viehstück] vorstellend. [Le pendant du precedent, meme objet [piece representante du betail].] I Pendant zu Nr. 653 von A. Velde Maße: 1 Schuh 5 Zoll breit, 1 Schuh 3 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (100 fl für die Nrn. 653 und 654) Käufer: Can Burger 1779/00/00 HB AN 0042 N. Berghem I Ein Bauer, der auf einem Esel unter einem Baume hält, spricht mit einem ältem Manne, der hinter einem rothen Ochsen steht. Auf Holz. [Un paysan monte sur un äne s'arrete sous un arbre & parle ä un homme plus äge, qui est derriere un boeuf roussätre. Sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 2 Zoll hoch, 1 Fuß breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0057 N. Berghem I Etliche Hirten sitzen an einem Felsen unter lockern Bäumen in einer bergichten Gegend, und sehen einer Hirtinn zu, die vor ihnen tanzt, und sich selbst die Musik auf der Handpauke macht. Zur Rechten hinter ihnen ruhen einige Ziegen, und zur Linken zieht ein Hirt mit der Heerde vorüber. Auf Kupfer. [Quelques bergers sont assis dans un paysage montagneux, pr6s d'un rocher, sous des arbres d'un feuiller leger, & regardent danser une bergere qui s'accompagne eile meme d'un timpanon. Α droite derriere eux reposent quelques chfevres & ä gauche passe un pätre avec son troupeau. Sur cuivre.] I Mat.: auf Kupfer Maße: 1 Fuß 2 Zoll hoch, 1 Fuß 5 Vi Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0079 Berghem I Unter etlichen Bäumen zur Linken melkt eine Bäuerinn eine Kuh, neben der eine andere liegt. Eine Frau, die ein Gefäss zur Milch auf dem Kopfe trägt, kömmt herzu. Dahinter ruhet eine Ziege, und noch weiter zur Linken eine Kuh. In der ferne Berge und ein Dorf. Auf Holz. [Sur la gauche du tableau on voit sous quelques arbres une paysanne qui trait une vache, ä cöte de laquelle une autre est couchee. Une femme survient, portant sur sa tete un pot au lait. Derriere eile repose une chevre & plus loin ä gauche une vache. Sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß hoch, 9 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt
1779/00/00 HB AN 0080 Berghem I Eine Bäuerinn will aus einem durch hohle Felsen quillenden Wasser schöpfen. Dameben ruhen zwey Schafe und eine Ziege in moosichtem Grase. Weiter zurück sitzt der Hirte auf einem beraseten Felsen, seiner Wohnung gegen über, und blässt auf der Schallmey. Im Hintergrunde treibt ein Maulthiertreiber in die fernen Berge. Auf Holz. [Une paysanne veut puiser de l'eau, qui coule dans des creux de rochers. A cote d'elle reposent sur l'herbe & la mousse deux brebis & une chevre. Plus loin un berger, assis sur un rocher couvert de gazon, vis-ä-vis de sa cabane, joue de son chalumeau. Sur le dernier site on voit un muletier conduire ses mulets dans des montagnes eloignees. Sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß hoch, 9 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0225 Nicol. Berghem I Drey Schafe und zwo Ziegen ruhen im Vorgrunde. Drey Bauern tränken zur Rechten ihre Pferde. [Sur le devant reposent trois moutons & deux chevres. Trois paysans ä droite abreuvent leurs chevaux.] I Mat.: auf Holz Maße: 10 Zoll hoch, 8 Vi Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt. : Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0226 Nicol. Berghem I An einem gemauerten zierlichen Brunnen ruhet ein Hirte mit seiner kleinen Heerde. Beide Stücke [Nr. 225 und 226] auf Holz. [Un berger avec son petit troupeau repose aupres d'une fontaine d'une belle forme. Tous deux peints sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 10 Zoll hoch, 8 Vi Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/09/27 FRNGL 0670 Bergheem I Ein meisterhaftes, warm und fleißig ausgeführtes Viehstück. [Une piece representante du betail, superieurement bien peinte.] I Pendant zu Nr. 671 Maße: 1 Schuh hoch, 1 Schuh 3 Zoll breit Transakt.: Verkauft (63.30 fl für die Nrn. 670 und 671) Käufer: Meyer 1779/09/27 FRNGL 0671 Bergheem I Das Gegenbild zu obigem, eben so schön, von nemlichem Meister [Bergheem] und Maas. [Le pendant du precedant, meme beaute, par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 670, "Ein meisterhaftes, warm und fleissig ausgeführtes Viehstück" Maße: 1 Schuh hoch, 1 Schuh 3 Zoll breit Transakt.: Verkauft (63.30 fl für die Nrn. 670 und 671) Käufer: Meyer 1779/09/27 FRNGL 0802 Bergheem I Ein schön wohlausgeführtes Viehstück. [Une tres belle piece representante du betail.] I Pendant zu Nr. 803 von P. Bioemen Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 1 Schuh 5 Zoll breit Transakt.: Verkauft (20.30 fl für die Nrn. 802 und 803) Käufer: Mentzinger 1779/09/27 FRNGL 0881 Nicolas Bergheem I Eine geistreich und mit besonderm Verstand herrlich componirte Verkündigung derer Hirten. [L'annonciation de bergers, tres belle piece.] I Maße: 1 Schuh 11 Zoll hoch, 2 Schuh 6 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (231 fl) Käufer: Meyer Weinhändler 1779/09/27 FRNGL 0966 Bergheem I Ein fürtreflich ausgeführtes Viehstück. [Une tres belle piece representante du betail.] I Maße: 2 Schuh 1 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 8 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (116 fl) Käufer: Synd Hoffmann 1781/00/00 WRAN 0046 Berghem (Ν.) I Une Bergere assise, tenant ä son bras gauche un panier, devant eile une Vache & une Chevre traversent un ruisseau, plus loin sont les ruines d'un Chateau. Tableau peint sur bois. Ce Paysage porte 7 pouces 6 lignes de haut, sur 9 pouces 5 lignes de large. I Mat.: auf Holz Maße: 7 pouces 6 lignes de haut, sur 9 pouces 5 lignes de large Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0025 Nikolaus Bergheim I Ein Stück von 1 Schuhe, 6 Zoll hoch, 1 Schuh, 10 Zoll breit von Nikolaus Bergheim. Dieses stellet eine unweit eines Waldes grünende Heide vor, allwo unter einem Baume eine Hirtenfrau sitzend, ihr Kind säuget; im zweyten Gruppo sieht man hinter ihr eine stehende und eine liegende Kuhe, wobey drey Schafe neben einander liegen: es wird in diesem Stücke des Lehrmeisters nämlich Johann Baptist Weenixs MaGEMÄLDE
269
nier in der Färbung, Schatten und Licht, korrekten Zeichnung und der Harmonie gar wohl erkennet werden: man versichert mit diesem Stücke ein wahres Original, worauf auch dessen Name sich vorfindet. I Maße: 1 Schuhe 6 Zoll hoch, 1 Schuhe 10 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0102 Nikolaus Bergem I Ein Stück 2 Schuhe, 6 Zoll hoch, 2 Schuhe, 2 Zoll breit von Nikolaus Bergem, stellet einen Weisen Ochsen vor, welcher in schönster Wendung mit einer Geise und einigen Schafen in einer angenehmen Landschaft weidet; dieses Stück ist ungemein annehmlich und wohl verstanden, und herrschet so wohl in einem als dem andern Theile der Kunst ein vollkommener Ausdruck der Natur. I Maße: 2 Schuhe 6 Zoll hoch, 2 Schuhe 2 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0202 Nikolaus Berghem \ Ein Stück 10 Zoll hoch, 9 Zoll breit vom Nikolaus Berghem, stellet einen Kalbskopf vor, welcher aus einem grünen Busche schauet; in diesem Stücke erkennet man die pure Natur, und ist ungemein gut gemalet. I Maße: 10 Zoll hoch, 9 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1782/09/30 FRAN 0278 Nicolas Bergheem I Zwo wunderschöne Landschaften mit Ruinen und Vieh, von reicher Composition von Nicolas Bergheem. [Deux tres beaux paysages avec des ruines & du betail, piece excellente, par Nicolas Bergheem.] I Diese Nr.: Eine wunderschöne Landschaft mit Ruinen und Vieh Maße: 2 Schuh 11 Zoll hoch, 3 Schuh 9 Zoll breit Anm.: Die Lose 278 und 279 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (231.30 fl für die Nrn. 278 und 279) Käufer: Juncker 1782/09/30 FRAN 0279 Nicolas Bergheem I Zwo wunderschöne Landschaften mit Ruinen und Vieh, von reicher Composition von Nicolas Bergheem. [Deux tres beaux paysages avec des ruines & du betail, piece excellente, par Nicolas Bergheem.] I Diese Nr.: Eine wunderschöne Landschaft mit Ruinen und Vieh Maße: 2 Schuh 11 Zoll hoch, 3 Schuh 9 Zoll breit Anm.: Die Lose 278 und 279 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (231.30 fl für die Nrn. 278 und 279) Käufer: Juncker 1782/09/30 FRAN 0293 Nicolas Bergheem I Ein in der schönsten warmen Manier meisterhaft ausgeführtes Viehstück. [Une piece representante du betail, superieurement bien peinte par Nicolas Bergheem.] I Maße: 1 Schuh Vi Zoll hoch, 10 Vi Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (29.15 fl) Käufer: Hüsgen 1783/06/19 HBRMS 0022 N. Berghem I Eine angenehme Landschaft; im Hintergrunde eine bergigte Gegend, vorne ein stillfliessendes Wasser, am Ufer ein tränkendes Pferd, dabey Vieh und Landleute. H[olz]. s.R. [schwarzer Rahm] \Mat.: auf Holz Maße: 11 Zoll hoch, 12 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1783/06/19 HBRMS 0046 N. Berghem I Eine bergigte Gegend; in der Mitte altes Mauerwerk, vor demselben werden Rinder und Schaafe durchs Wasser getrieben. H[olz]. g.R. [verguldeter Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 11 Zoll hoch, 1 Fuß 6 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1786/11/11 HBRMS 0052 Nie. Berghem I Zwey Viehstücke mit verschiedenen Figuren, wahre Originalia von diesem großen Meister, ganz vortreflich ausgeführt, sowohl in der Zeichnung, Colorit und Fleis, zwey herrliche Bilder; sind auch in Kupfer heraus. Goldne Rähme. I Diese Nr.: Ein Viehstück mit verschiedenen Figuren Maße: Höhe 8 Zoll, Breite 12 Zoll Anm.: Die Lose 52 und 53 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/11/11 HBRMS 0053 Nie. Berghem I Zwey Viehstücke mit verschiedenen Figuren, wahre Originalia von diesem großen Meister, ganz vortreflich ausgeführt, sowohl in der Zeichnung, Colorit und Fleis, zwey herrliche Bilder; sind auch in Kupfer heraus. Goldne Rähme. I Diese Nr.: Ein Viehstück mit verschiedenen Figuren Maße: Höhe 8 Zoll, Breite 12 Zoll Anm.: Die Lose 52 und 53 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 270
GEMÄLDE
1787/00/00 HB AN 0083 Piter Clase Berghem I Auf einem kleinen Erdreich liegt ein ruhiger Esel. Ueberaus natürlich und vortrefflich gemahlt, und von besonderer Ausführung, wie auch richtigem Licht und Schatten. Auf Papier, aber auf Holz gelegt, s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: Papier auf Holz Maße: Hoch 7 Zoll, breit 9 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (10.8 M) Käufer: Bertheau 1787/00/00 HB AN 0220 Nicol. Berghem I Eine Hirtinn sitzt neben einem Berg, worauf sich ein Baurenhaus befindet, und nahe bey ihr steht ein Korb und ein Gefäß. Im Vordergrunde liegen zwey Schaafe und eine Ziege. Bey einigen abgehauenen Bäumen im Mittelgrunde ruhet sich der Hirte mit seinem Stabe in der Hand an einen rothgelben Ochsen, neben welchem sich noch ein liegendes Schaaf befindet. Im Hintergrunde wird man noch zwey Ochsen und etliche Schaafe gewahr. In der Ferne siehet man eine angenehme Landschaft. Die Haltung in diesem kleinen Gemähide ist vorzüglich schön, das Colorit sanft, Verblasen, und mit dem größten Fleiße ausgemahlt; die Gegend sehr schön gewählt, und die Figuren alle wohl gezeichnet. A.H. [Auf Holz] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 Zoll, breit 9 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (36 M) Käufer: Bertheau 1787/04/03 HBHEG 0055 Berghem I Ein sehr lebhaftes Hirten= Stück, fleißig und schön gemahlt, von Berghem, auf ditto [Holz], I Mat.: auf Holz Transakt.: Verkauft (4 M) Käufer: Hofr Ehrenreich 1788/06/12 HBRMS 0006 Nicolas Berghem I Der Kuhmarkt in Rom, mit Hirten, Rindem und Schaafen, alles mit der lebhaftesten Natur gemalt, worin dieser große Künstler von keinem andern hätte übertroffen werden können. Dies ist eine seiner reichsten Compositionen. Auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll, breit 33 Zoll Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0007 Nie. Bergheim I 4 Landschaften mit Viehen und Figuren, von der ersten Manier von Nie. Bergheim. [4 p[ieces]. de paysage avec des pres & figures, de la premiere Maniere de Nie. Bergheim.] I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Viehen und Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Fuß 6 Zoll, Breite 2 Fuß 9 Zoll Anm.: Die Lose 7 bis 10 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0008 Nie. Bergheim I 4 Landschaften mit Viehen und Figuren, von der ersten Manier von Nie. Bergheim. [4 p[ieces]. de paysage avec des pres & figures, de la premiere Maniere de Nie. Bergheim.] I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Viehen und Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Fuß 6 Zoll, Breite 2 Fuß 9 Zoll Anm.: Die Lose 7 bis 10 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0009 Nie. Bergheim I 4 Landschaften mit Viehen und Figuren, von der ersten Manier von Nie. Bergheim. [4 p[ieces]. de paysage avec des pres & figures, de la premiere Maniere de Nie. Bergheim.] I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Viehen und Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Fuß 6 Zoll, Breite 2 Fuß 9 Zoll Anm.: Die Lose 7 bis 10 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0010 Nie. Bergheim I 4 Landschaften mit Viehen und Figuren, von der ersten Manier von Nie. Bergheim. [4 pfieces], de paysage avec des pres & figures, de la premiere Maniere de Nie. Bergheim.] I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Viehen und Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Fuß 6 Zoll, Breite 2 Fuß 9 Zoll Anm.: Die Lose 7 bis 10 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1789/00/00 MM AN 0199 Nicolaus Berghem I Ein Hirtenstück mit Viehe, auf Leinw. [Des Bergers et leurs Bastiaux [sie], sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 2 Zoll hoch, 1 Fuß 6 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt 1789/08/00 HNAN 0091 Berghem I Zwei Ziegenköpfe a. H. [auf Holz] Schw.R.m.g.L. [Schwarze Rahmen mit goldenen Lei-
sten] I Diese Nr.: Ein Ziegenkopf Mat.: auf Holz Maße: Höhe 7 Vi Zoll, Breite 6 Zoll Anm.: Die Lose 91 und 92 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1789/08/00 HNAN 0092 Berghem I Zwei Ziegenköpfe a. H. [auf Holz] Schw.R.m.g.L. [Schwarze Rahmen mit goldenen Leisten] I Diese Nr.: Ein Ziegenkopf Mat.: auf Holz Maße: Höhe 7 Vi Zoll, Breite 6 Zoll Anm.: Die Lose 91 und 92 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1791/09/21 FRAN 0004 Nicolas Berghem I In einer Landschaft unten an einem Hügel sieht man Hammel und Ziegen, zur Linken auf den Felsen sieht man eine Menge Schäfer und andere allegorische Gegenstände; es ist kostbar ausgeführt und macht eine schöne Würkung. I Transakt.: Verkauft (55.15 fl) Käufer: Lindau ä Conto 33 f 1791/09/21 FRAN 0095 Nicolas Berghem I Eine bergigte Landschaft, wo vomen zur Rechten ein Fluß und eine alte steinerne Brükke ist, der Vordertheil ist mit Vieh gezieret, man sieht einen Bauer und eine Bäuerin auf einem Esel, zur Linken ist ein Schäfer, so aus seinem Hut trinkt, hinten sind Felder und grüne Wasen. I Pendant zu Nr. 96 Transakt.: Verkauft (33 fl) Käufer: Lorrion 1791/09/21 FRAN 0096 Nicolas Berghem I Der Compagnon von eben demselben [Nicolas Berghem]. Dieses Gemälde bietet vornen zur linken Hand eine Menge Kühe und Ziegen dar; hinten eine Schäferin, so sie führet, zur Rechen ist ein Bauer, so durch einen Sumpf gehet und vor ihm ist sein Hund, die Entfernungen bieten eine bergigte Gegend dar, so sehr angenehm ist. I Pendant zu Nr. 95 Transakt.: Verkauft (40 fl) Käufer: Lorrion 1791/09/26 FRAN 0454 Nicolas Berghem I Zwey angenehme Viehstück, von der Meisterhand des Nicolas Berghem. I Diese Nr.: Ein angenehmes Viehstück Maße: 12 Zoll breit, 8 Zoll hoch Anm.: Die Lose 454 und 455 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0455 Nicolas Berghem I Zwey angenehme Viehstück, von der Meisterhand des Nicolas Berghem. I Diese Nr.: Ein angenehmes Viehstück Maße: 12 Zoll breit, 8 Zoll hoch Anm.: Die Lose 454 und 455 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 HBMFD 0056 Berghem I An einem klar fliessenden Bache sieht man rechts die Rudera eines alten Gebäudes. Berge schliessen die Aussicht. Bey Untergang der Sonne. Reisende und Hirten gehen durch diesen kleinen Gewässer. Baurjungen reiten Pferde zur Tränke. Die Luft perspecktiv, und der leichte Pinsel - so wie die edle Einfalt der ländlichen Natur - ist besonders schön an diesem Bilde ausgedruckt. I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuss 2 Zoll hoch, 1 Fuss 5 Zoll breit Verkäufer: Pierre Laporterie Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0144 Berghem I Hirten und Vieh in einer Landschaft. I Maße: Hoch 5 Vi Zoll, breit 7 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1793/09/18 HBSCN 0058 N. Berghem I In einer gebürgigten Landschaft liegt die Hirtin auf den Knien um eine Ziege zu milchen, zu beyden Seiten ruhen Schafe, nebenher ein Esel. Die Größe dieses Meisters ist allgemein bekannt. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 12 Zoll Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 FGAN [B]0183 Nikola Bergheim I Eine Landschaft mit Vieh u. einem Manne auf einem Maulthier, auf Tuch gemalt. I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Schuh 2 Zoll hoch, 1 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 HB AN 0008 Nie. Bergheem I Eine warme Landschaft, in deren Vorgrunde, neben einer Baurenhütte, zu den Füssen der Hirtin, die an einer Birke gelehnt sitzt, ein Hirt schläft: um sie weidet und ruhet Vieh im fetten Grase am kühlenden Bache. I Maße:
Höhe 22 Zoll, Breite 26 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 HB AN 0013 Bergheem I Eine bergigte Landschaft, in deren Vorgrunde Hirt und Hirtin an einer Anhöhe ruhen; um sie ist ihr Vieh in einer schönen Gruppe gelagert. Im Vorgrunde zur Linken ist ein hoher Berg, in dessen Schatten Kühe vor den Sonnenstrahlen Schutz finden. Ein warmer Duft umschleiert die Ferne, wodurch der starkkolorirte Vorgrund sehr herausgehoben wird. I Maße: Höhe 22 Zoll, Breite 26 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 HB AN 0058 Bergheem I Ein Hirtenknabe führt seine Heerde, in einer sehr angenehmen Landschaft, auf seiner Flöte spielend zur Tränke. Am Wasser wartet sein an der Spindel spinnendes Mädchen auf ihn. I Maße: Höhe 17 Zoll, Breite 23 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1794/09/06 HBBMN 0064 Berghem I Eine Lantschaft [sie], wo vor einem Hause eine Frau sich mit dem Vieh=Hirten unterredet. I Transakt.: Unbekannt 1796/08/00 HBPAK 0039 Berghem I In einer niedem bergigten Gegend sitzt im Vordergründe ein Hirt mit verschiedenem Vieh umgeben, welcher mit Schaafscheeren sich beschäftigt; er unterredet sich mit einer Hirtin, die vor ihm steht, und ein Schaaf in den Arm hält. Ein kostbares Gemähide. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 22 Vi Zoll, Breite 27 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0185 Berghem I Eine Landschaft mit Hirten und Vieh. I Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0194 Nicolaus Berghem I Eine Landschaft mit Kühen und Figuren. Sehr artig verfertigt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Zoll, breit 9 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/12/08 HBPAK O l l i Nicol. Bergheem I In einer gebirgigten Landschaft führt ein Hirtenknabe, auf seiner Flöte spielend, die Heerde zur Tränke. Am Wasser wartet sein an der Spindel spinnendes Mädgen auf ihn. Auf Leinwand, im goldnen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 17 Zoll, Breite 23 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/01/19 HBPAK 0017 Berghem I Zwey kleine Landschaften mit Thieren. Wer kennt nicht Berghems bezaubernden Pinsel, die Wahrheit mit der er die Natur kopirt, und die Schönheit mit der er sie darstellt. Sein Ton und seine Färbung lassen gar nichts zu wünschen übrig. 11 Zoll hoch, 1 Fuß 2 Zoll breit. Goldn. Rahm. I Diese Nr.: Eine kleine Landschaft mit Thieren Maße: 11 Zoll hoch, 1 Fuß 2 Zoll breit Anm.: Die Lose 17 und 18 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/01/19 HBPAK 0018 Berghem I Zwey kleine Landschaften mit Thieren. Wer kennt nicht Berghems bezaubernden Pinsel, die Wahrheit mit der er die Natur kopirt, und die Schönheit mit der er sie darstellt. Sein Ton und seine Färbung lassen gar nichts zu wünschen übrig. 11 Zoll hoch, 1 Fuß 2 Zoll breit. Goldn. Rahm. I Diese Nr.: Eine kleine Landschaft mit Thieren Maße: 11 Zoll hoch, 1 Fuß 2 Zoll breit Anm.: Die Lose 17 und 18 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0213 Berghem I An einem Gartenhause sitzt ein Bauer und ruhet sich. Zwey Hunde stehen neben ihn. Gut gemahlt. Auf Holz, goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 14 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0319 N. Berghem I Ein Viehstück. Von der besten Zeit dieses Künstlers. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Vi Zoll, breit 17 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0377 N. Berghem I Eine sehr schöne bergigte Landschaft von diesem grossen Künstler, mit vielem Vieh und Figuren; die in Rücksicht der Zeichnung, des Colorits und Zusammensetzung das größte Lob verdienen. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
271
1799/00/00 LZAN 0118 Berghem, Nicolas I Un paysage avec animaux et figures; d'un precieux fini, genre, dans lequel cet artiste ayant peu travaille, est devenu aussi rare que recherche. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 12 pouces, largeur 18 pouces Transakt.: Unbekannt (12 Louis Schätzung) 1799/00/00 WZAN 0017 Nicolaus Berghem I Zwey Viehestükke, von Nicolaus Berghem. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Viehestiick Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 5 Vi Zoll breit 1 Schuh 2 Vi Zoll Anm.: Die Lose 17 und 18 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0018 Nicolaus Berghem I Zwey Viehestükke, von Nicolaus Berghem. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Viehestück Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 5 Vi Zoll breit 1 Schuh 2 Vi Zoll Anm.: Die Lose 17 und 18 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0119 Nicolaus Berghem I Zwey Landschaften; eine mit Viehe, von Nicolaus Berghem, und die andere von Willhelm Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Viehe, von Nicolaus Berghem Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 8 Zoll breit 1 Schuh 1 Zoll Anm.: Die Lose 119 und 120 wurden zusammen katalogisiert. Dieses Los wurde zusammen mit der Nr. 120 (W. Bemmel) verkauft. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0184 Nicolaus Berghem I Zwey Viehestükke, von Nicolaus Berghem. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Viehestück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh breit 2 Schuh 4 Zoll Anm.: Die Lose 184 und 185 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0185 Nicolaus Berghem I Zwey Viehestükke, von Nicolaus Berghem. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Viehestück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh breit 2 Schuh 4 Zoll Anm.: Die Lose 184 und 185 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/10/18 LZAN 0090 Berghem I Zwey Viehstücke. Auf einem Pferd sieht man einen Bauer vom Rüken, welcher mit einer links neben ihm im Wasser stehenden weiblichen Figur spricht; hinter derselben ist eine Kuh, ein Schaaf und eine Ziege; auf der rechten Seite stehen zwey Kühe und wieder eine Ziege, auf der andern hält ein Junge ein gesatteltes Pferd: links eine Dame zu Pferd, scheint mit einem Cavalier zu sprechen: auf dem zweyten Plan ist ein Reuter auf einem braunen Pferd; neben ihm steht ein Jäger und zwey Jagd-Hunde, im Grunde sind Ruinen. Diese Bilder sind mit reichen Farben und mit schöner Haltung gemahlt, hoch 17 Zoll, breit 23 Zoll. Auf Leinwand mit reichem vergoldeten Rahmen. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 17 Zoll, breit 23 Zoll Verkäufer: Rauch Transakt.: Verkauft (46.12 Th) Käufer: Seger 1799/10/18 LZAN 0099 Berghem I Ein dito [Ein Viehstück]. I Verkäufer: Rauch Transakt.: Verkauft (21 Th) Käufer: Schwarz 1799/12/04 HBPAK 0007 Berghem I Eine bergigte Landschaft mit Figuren und Vieh. Eine Hirtin sitzt auf einem Maulthiere, und hütet ihr Vieh. Sehr gut gemahlt. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 42 Zoll, breit 50 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0043 Berghem I Eine bergigte Landschaft, wo ein Hirte Ochsen und Schaafe weidet, nebst vielen Neben=Figuren. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 21 Zoll, breit 25 Zoll Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 BLBOE 0028 Berghem I Im ersten und zweiten Plan weiden Kühe und Schaafe. Im dritten und vierten ein Haus und Buschwerk. Rechts eine alte Burg und Gebirge. I Mat.: auf Leinwand Transakt.: Unbekannt 272
GEMÄLDE
1800/00/00 FRAN1 0011 Berghem! Eine Landschaft mit Vieh staffirt, linker Seite des Stücks ist eine Bauernhütte. I Mat.: auf Leinwand Maße: 17 Vi Zoll hoch, 24 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN1 0012 Berghem I Ein Feldmarschall zu Pferd mit dem Degen in der Hand anscheinend kommandirend. I Mat.: auf Holz Maße: 13 Zoll hoch, 9 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN2 0011 Berghem I Ein sehr schönes Stück in Italien verfertiget. Es stellet eine Bruke in der Gegend von Rom vor. Im vordem Grund siehet man einen Kavalier und mehrere Personen, welche sich zum Abgang auf die Vogeljagd anschicken; rechter Seite des Stücks und im Hintergeund [sie] sind mehrere Schiffe und Verkaufwaaren. Die künstliche Zusammensetzung dieser mehreren Gegenstände, ist so übereinstimmend, daß diesrs [sie] Gemälde als ein Meisterstück des Künstlers kann betrachtet werden. I Mat.: auf Leinwand Maße: 34 Zoll hoch, 36 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN2 0012 Berghem I Ditto [Berghem], Eine Landschaft. Im vordem Grund sind vier Stück Vieh, bey welchen ein Mädchen mit einer Gaise sich vorzüglich auszeichnen. Fleiß und Kunst eifern sich in diesem Stück um die Wette. I Mat.: auf Holz Maße: 12 Zoll hoch, 15 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1800/07/09
HBPAK
0009
Berghem
I L ' A n n o c i a t i o n [sie] aux
Bergers. Le Ciel entrouvert frape de ses rayons lumineux des patres effrayes. Un Ange du haut de la nue paroit leur parier. Le desordre et l'effroi que cette aparition fait naitre sont rendus avec beaueoup d'Art et l'effet de Nuit est des plus beaux. Sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: 27 pouces de hauteur. Sur 19 pouces de largeur Transakt.: Unbekannt 1800/07/09 HBPAK 0018 Berghem I Deux paysages pitoresques ornes de beaueoup de figures et de betail. Sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: 12 pouces de hauteur. Sur 13 pouces de largeur Transakt.: Unbekannt 1800/07/09 HBPAK 0021 Berghem I Joli paysage ou l'on voit plusieurs boeufs pres d'une fontaine, des moutons et une Chevre, plusieurs hommes occupes a soigner des Chevaux. La touche fine du maitre et sa Couleur se retrouvent dans ce Tableau. Sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: 9 pouces de hauteur. Sur 13 pouces de largeur Transakt. : Unbekannt
Berchem, Nicolaes Pietersz. (und Beeldemaker, A.C.) 1794/00/00 HB AN 0143 J. Beeldemaker; Bergheem I Neben einem von Bäumen umschatteten Wasser reitet ein Frauenzimmer auf einem Esel und treibt einen zweyten neben sich her. I Maße: Höhe 9 Vi Zoll, Breite 10 Vi Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt
Berchem, Nicolaes Pietersz. (und Moucheron) 1777/02/21 HBHRN 0081 Moucheron; N. Berghem I Eine extra schöne Landschaft, von Moucheron, die Figuren von N. Berghem. I Maße: Höhe 1 Fuß 8 Vi Zoll, Breite 2 Fuß Transakt.: Unbekannt
Berchem, Nicolaes Pietersz. (und Wijnants) 1796/11/02 HBPAK 0012 Johann Wynants; die Figuren von Berghem I Zwey Landschaften, die eine, zur Rechten auf einem hohen Berge ein Schloß, wo am Fusse desselben eine Höhle, wo sich eine von der Jagd kommende Gesellschaft ausruht; im Vordergrunde wird von hohen Bäumen die Landschaft beschattet, und unter denselben, befindet sich eine Herrschaft die sich mit einem Jäger unterreden. Das Gegenstück, ein hoher Berg mit einem Wasserfall; zur Rechten gleichfalls mit hohen Bäumen die Landschaft beschattet, und auf der Landstrasse in der Mitte der Landschaft, Reisende mit Maulthieren. Diese beyden Bilder sind wegen dem Fleisse, Licht und Schatten äusserst schätzbar. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine Landschaft. Zur Rechten auf einem hohen Berge ein
Schloß, wo am Fusse desselben eine Höhle, wo sich eine von der Jagd kommende Gesellschaft ausruht; Pendant zu Nr. 13 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 25 Zoll Anm.: Die Lose 12 und 13 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0013 Johann Wynants; die Figuren von Berghem I Zwey Landschaften, die eine, zur Rechten auf einem hohen Berge ein Schloß, wo am Fusse desselben eine Höhle, wo sich eine von der Jagd kommende Gesellschaft ausruht; im Vordergründe wird von hohen Bäumen die Landschaft beschattet, und unter denselben, befindet sich eine Herrschaft die sich mit einem Jäger unterreden. Das Gegenstück, ein hoher Berg mit einem Wasserfall; zur Rechten gleichfalls mit hohen Bäumen die Landschaft beschattet, und auf der Landstrasse in der Mitte der Landschaft, Reisende mit Maulthieren. Diese beyden Bilder sind wegen dem Fleisse, Licht und Schatten äusserst schätzbar. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Ein hoher Berg mit einem Wasserfall; Pendant zu Nr. 12 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 25 Zoll Anm.: Die Lose 12 und 13 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/10/18 LZAN 0103 Berghem; Wynants I Eine Landschaft mit Vieh. I Verkäufer: Rauch Transakt.: Verkauft (10 Th) Käufer: Schwarz
Berchem, Nicolaes Pietersz. (oder Berchem, N.P., Manier)
wand Maße: Höhe 3 F 8 Z, Breite 5 F 2 Ζ Transakt.: Verkauft (16 M) Käufer: L[illy] S 1776/07/19 HBBMN 0043 Berghem I Eine Landschaft mit Ruderibus, Vieh und Hirten, in dem Gusto wie Berghem. I Maße: Höhe 1 Fuß 6, Breite 1 Fuß 10 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (10 M) Käufer: Lilie 1779/03/05 HBRMS 0001 [b] Berchem I Ein Comptoir, mit Schwarzebenholz und Schildpatt fourniert, hat einen schwarzen gewundenen Fuß, enthält viele Schiebladen, so theils verborgen sind; in beyde Thüren sind zwey vortrefliche Gemähide; das eine stellet vor, wie Soldaten die Bauern mißhandeln, das zweyte ein Baccanal, mit viele Figuren. Diese zwey Gemähide gehen von Rubens in Kupfer aus, und sind ohne Zweifel von einen seiner besten Discipeln. Auf den auswendigen Schiebladen sind noch 10 Stück, mehrentheils Landschaften mit Vieh, in dem Berghemischen Gusto, eben so schön, alle auf Kupfer gemahlt und so conditionirt, als wenn sie heute gemahlt wären. I Diese Nr.: 10 Stück, mehrentheils Landschaften mit Vieh; Nr. l[a] ist Schule von Rubens Mat.: auf Kupfer Transakt.: Unbekannt 1779/03/05 HBRMS 0022 Berghem I Eine kleine Landschaft, in dem Gusto von Berghem. I Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0112 Im Gusto von Berghem I Eine Landgegend mit Hirten, Rinder und Schaafen, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 13 Zoll 6 Linien, Breite 20 Zoll 3 Linien Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt
1788/10/01 FRAN 0116 Berghem I Eine Landschaft mit Figuren und Thieren, sehr gut ausgearbeitet, von Berghem oder in seiner Manier. I Maße: 25 Zoll hoch, 36 Zoll breit Transakt.: Verkauft (20.15 fl) Käufer: Schneidewind
1782/05/29 FRFAY 0007 Bergheim I Zwey Viehestuck in Geschmack, von Bergheim. I Diese Nr.: Ein Viehestuck Maße: 21 Zoll hoch, 27 Zoll breit Anm.: Die Lose 7 und 8 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Thorhorst Transakt.: Unbekannt (14 fl für die Nrn. 7 und 8)
Berchem, Nicolaes Pietersz. (Geschmack von)
1782/05/29 FRFAY 0008 Bergheim I Zwey Viehestuck in Geschmack, von Bergheim. I Diese Nr.: Ein Viehestuck Maße: 21 Zoll hoch, 27 Zoll breit Anm.: Die Lose 7 und 8 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Thorhorst Transakt.: Unbekannt (14 fl für die Nrn. 7 und 8)
1750/00/00 KOAN 0236 Berchem I Deux pieces, avec des animaux, travailles eu laine, dans le gout de Berghem. I Diese Nr.: Une piece, avec des animaux Maße: Largeur 1 Pies 414 Pouces, Haut 1 Pies 3 Pouces Anm.: Die Lose 236 und 237 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0237 Berchem I Deux pieces, avec des animaux, travailles eu laine, dans le gout de Berghem. I Diese Nr.: Une piece, avec des animaux Maße: Largeur 1 Pies 4 V* Pouces, Haut 1 Pies 3 Pouces Anm.: Die Lose 236 und 237 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1771/05/06 FRAN 0010 Bergheim I Eine Landschaft mit vielen Figuren auf Tuch, in gousto von Bergheim. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 19 Zoll, breit 23 Zoll Verkäufer: Johann Friederich Armand von Uffenbach Transakt.: Verkauft (2.4 fl) Käufer: Movius 1776/06/21 HBNEU 0023 Berghun I Ein plaisante Landschaft, im Gusto von [Berghun]. I Maße: Höhe 11Z, Breite 1 F 3 Ζ Transakt.: Unbekannt 1776/06/21 HBNEU 0116 Berghem I Zwey plaisante und fleißige Jagd=Stücke, auf Holz, im Gusto von Berghem. I Diese Nr.: Ein plaisantes und fleißiges Jagd=Stück Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 F 2 Z, Breite 1 F 4 Ζ Anm.: Die Lose 116 und 117 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1776/06/21 HBNEU 0117 Berghem I Zwey plaisante und fleißige Jagd=Stücke, auf Holz, im Gusto von Berghem. I Diese Nr.: Ein plaisantes und fleißiges Jagd=Stück Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 F 2 Z, Breite 1 F 4 Ζ Anm.: Die Lose 116 und 117 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1776/06/21 HBNEU 0127 Berghem I Eine Landschaft, lebhaft gemahlt, auf dito [Leinwand], im Gusto [Berghem], I Mat.: auf Lein-
1787/00/00 HB AN 0359 Im Gusto von Berghem I Eine waldigte Landschaft. Im Vordergrunde sitzt ein Mädchen, und milcht eine Kuh, mit mehrerm Vieh umgeben; hinter ihr steht ein anderes Mädchen mit Eßwaaren in einem Korbe. A.H. [Auf Holz] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Zoll, breit 13 Zoll Transakt.: Verkauft (6.12 M) Käufer: Aberdieck 1787/00/00 HB AN 0388 Von einem unbek. Meister. Im Gusto von Berghem I Zwey Landschaften mit Ruinen und vielem Vieh und Hirten. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Ruinen und vielem Vieh und Hirten Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 35 Zoll, breit 51 Zoll Anm.: Die Lose 388 und 389 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (12.8 Μ für die Nrn. 388 und 389) Käufer: Bertheau 1787/00/00 HB AN 0389 Von einem unbek. Meister. Im Gusto von Berghem I Zwey Landschaften mit Ruinen und vielem Vieh und Hirten. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Ruinen und vielem Vieh und Hirten Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 35 Zoll, breit 51 Zoll Anm.: Die Lose 388 und 389 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (12.8 Μ für die Nm. 388 und 389) Käufer: Bertheau 1791/09/26 FRAN 0312 Berghem I Ein angenehmes Viehstück, in Gusto von Berghem. I Maße: 7 Zoll hoch, 10 Zoll breit Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0370 Berghem I Ein reich ordinirtes Viehstück, im beliebten Geschmack des Berghem. I Maße: 27 Zoll breit, GEMÄLDE
273
25 Zoll hoch Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt
choses. Sans la bordure. I Maße: Hoch 2 Schuh 4 Zoll, breit 1 Schuh 9 Zoll Transakt.: Unbekannt
1792/02/01 LZRST 4862 Berghem I Eine Landschaft mit Ruinen und Figuren, in Berghems Geschmack. Unbekannt. I Maße: 26 Zoll hoch, 22 Zoll breit Transakt.: Verkauft oder Unverkauft (8 Gr) Käufer: R[ost]
1766/07/28 KOSTE 0158 Berghem I Eine alte Landschaft nach Berghem. I Transakt.: Verkauft (1 Rt)
1792/04/19 HBBMN 0099 Berghem I Landschaften mit Vieh in Berghems Geschmack. Auf Leinw. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Vieh Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 22 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 99 und 100 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1792/04/19 HBBMN 0100 Berghem I Landschaften mit Vieh in Berghems Geschmack. Auf Leinw. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Vieh Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 22 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 99 und 100 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1792/10/12 KOAN 0024 N. Berchem I Ein Viehstuck mit Figuren, im Geschmacke des N. Berchem, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Fuss 9 Zoll - breit 4 Fuss 6 Zoll Verkäufer: Moureaux Transakt.: Unbekannt 1793/01/15 LZRST 7037 Berghem I Eine Landschaft mit Ruinen und Figuren, in Berghems Geschmack. I Maße: 26 Zoll hoch, 22 Zoll breit Transakt.: Verkauft (13 Gr) Käufer: Schwarz 1794/01/20 LZRST 5869 Berghem I Eine Landschaft mit Ruinen, und mit Figuren und Vieh in Berghems Geschmack staffirt, von einem guten unbekannten Meister, auf Leinwand, 26 Zoll breit, 23 Zoll hoch, in vergold. Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: 26 Zoll breit, 23 Zoll hoch Transakt.: Verkauft oder Unverkauft (14 Gr) Käufer: R[ost]
Berchem, Nicolaes Pietersz. (Imitation nach) 1789/06/12 HBTEX 0205 Imitation nach Berghem I Eine Gegend mit Vieh und Figuren. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Vi Zoll, breit 13 Zoll Transakt.: Unbekannt
Berchem, Nicolaes Pietersz. (Kopie nach) 1716/00/00 FRHDR 0086 Berckheim I Nach Berckheims Original ein stuck mit Kuhe. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (15) 1742/08/01 BOAN 0354 Berchem I Eine Landschafft, nach Berchem. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0438 Berchem I Noch eine Landschafft, nach Berchem. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0515 Berchem I Zwey Landschafften, nach Berchem. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0285 Berchem I Un Paysage d'Apres Berchem. I Maße: Haut 2. pies 1 Vi. pouces, large 2. pies 6. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRRAU 0003 Nach Bergheim I Vorstellend eine Landschafft mit alten Rudera, auf den Vorgrund etliche Stück Schaafe und eine Ziege, so von einer Frau gemelcket wird, wobey ein Mann und ein Bub stehet; dieses Stück hat eine angenehme und warme Lufft, und man kan hier in kleinen sehen, wie der Meister dergleichen Vorstellungen mit vieler Warheit Bewunderungs=würdig schön auszudrucken gewust hat in grösseren Sachen. Ohne Rahmen. Repräsentant un pa'isage avec des Rudera antiques, a'iant sur le premier terrein quelques brebis & une chevre, qu'une femme trait, aupres de la quelle il y a un gargon & un homme debout. Cette piece a un air doux & agreable, & on peu voir en petit, combien le maitre a su rendre de telles representations admirables en de plus grandes 274
GEMÄLDE
1772/09/15 BNSCT 0091 von Berghem I 4 Compagnons Viehstücke, nach von Berghem, 10 Z. h. 14 Z. br. schw. R[ahm]. I Diese Nr.: Ein Viehstück; Pendant zu den Nrn. 92 bis 94 Maße: 10 Zoll hoch, 14 Zoll breit Anm.: Die Lose 91 bis 94 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (2 fl) 1772/09/15 BNSCT 0092 von Berghem I 4 Compagnons Viehstücke, nach von Berghem, 10 Z. h. 14 Z. br. schw. R[ahm]. I Diese Nr.: Ein Viehstück; Pendant zu den Nrn. 91, 93 und 94 Maße: 10 Zoll hoch, 14 Zoll breit Anm.: Die Lose 91 bis 94 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (2 fl) 1772/09/15 BNSCT 0093 von Berghem I 4 Compagnons Viehstücke, nach von Berghem, 10 Z. h. 14 Z. br. schw. R[ahm]. I Diese Nr.: Ein Viehstück; Pendant zu den Nrn. 91, 92 und 94 Maße: 10 Zoll hoch, 14 Zoll breit Anm.: Die Lose 91 bis 94 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (2 fl) 1772/09/15 BNSCT 0094 von Berghem I 4 Compagnons Viehstücke, nach von Berghem, 10 Z. h. 14 Z. br. schw. R[ahm]. I Diese Nr.: Ein Viehstück; Pendant zu den Nrn. 91 bis 93 Maße: 10 Zoll hoch, 14 Zoll breit Anm.: Die Lose 91 bis 94 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (2 fl) 1773/12/18 HBBOY 0004 Viedebandt; Berghem I Zwo Vieh= Stücke, nach Berghem. I Diese Nr.: Ein Vieh=Stück, nach Berghem; Kopie von A. Videbant nach N.P. Berchem Anm.: Die Lose 4 und 5 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1773/12/18 HBBOY 0005 Viedebandt; Berghem I Zwo Vieh= Stücke, nach Berghem. I Diese Nr.: Ein Vieh=Stück, nach Berghem; Kopie von A. Videbant nach N.P. Berchem Anm..· Die Lose 4 und 5 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1774/08/13 HBBMN 0034 J.T.; Berghem I Eine Copie nach Berghem, von J.T. I Kopie von Monogrammist J.T. nach N.P. Berchem Transakt.: Unbekannt 1775/00/00 BLAN 0077 Berghem I Eine Landschaft mit Vieh ohne Rahm nach Berghem. I Verkäufer: George Friedrich Schmidt Transakt.: Unbekannt 1775/02/13 FRAN 0089 Bergheim I Ein Viehstück, nach Bergheim. I Maße: Höhe 16 Vi Zoll. Breite 20 Vi Zoll Verkäufer: von der Lahr Transakt.: Unbekannt 1775/05/08 HBPLK 0172 Berghem I Zwey Hirten=Stücke, nach [Berghem]. I Diese Nr.: Ein Hirten=Stück Maße: Höhe 8 Zoll 3 Linie, Breite 7 Zoll 4 Linie Anm.: Die Lose 172 und 173 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1775/05/08 HBPLK 0173 Berghem I Zwey Hirten=Stücke, nach [Berghem], I Diese Nr.: Ein Hirten=Stück Maße: Höhe 8 Zoll 3 Linie, Breite 7 Zoll 4 Linie Anm.: Die Lose 172 und 173 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1776/12/21 HBBMN 0085 Berghem I Eine Arkadische Landschaft, nach Berghem, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 1 Fuß 10 Zoll, breit 2 Fuß 1 Zoll Transakt.: Verkauft (4.6 M) Käufer: Sieberg 1779/05/08 HBHRN 0021 Berghem I Zwo Landschaften mit Vieh und Figuren; nach Berghem. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Vieh und Figuren Anm.: Die Lose 21 und 22 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1779/05/08 HBHRN 0022 Berghem I Zwo Landschaften mit Vieh und Figuren; nach Berghem. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Vieh und Figuren Anm.: Die Lose 21 und 22 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1779/09/27 FRNGL 0353 Bergheem I Ein Viehstück, nach Bergheem. [Une piece representante du betail, d'apres Bergheem.] I Maße: 1 Schuh 10 Zoll hoch, 2 Schuh 2 Zoll breit Transakt.: Verkauft (2.16 fl) Käufer: Mergenbaum Zigelgaß 1779/09/27 FRNGL 0451 Bergheem I Ein Viehstück, nach Bergheem. [Une piece representante du betail, d'apres Bergheem.] I Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Transakt.: Verkauft (3.15 fl) Käufer: Mund 1782/05/29 FRFAY 0117 Bergheim I Eine Copie nach Bergheim. I Maße: 23 Zoll hoch, 29 Zoll breit Verkäufer: Kaspar Thorhorst Transakt.: Unbekannt (2.40 fl) 1787/00/00 HB AN 0080 Nach Berghem I Ein Abendstück, wo eine Hirtinn durchs Wasser reitet, um ihr Vieh zu Hause zu führen. Auf Leinew. s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 13 Zoll, breit 15 Zoll Transakt.: Verkauft (3 M) 1787/00/00 HB AN 0089 Nach Berghem I Zur linken ein hoher Berg, bey welchem sich Hirt und Hirtinn mit ihrer Heerde ausruhen; ein Bauer ist im Begriff, auf ein weißes Pferd zu steigen. Auf Leinewand, s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 20 Zoll, breit 25 Zoll Transakt.: Verkauft (13 M) Käufer: Schmidt 1787/00/00 HB AN 0379 Nach Berghem I Ein reitender Hirte und Hirtinn treiben ihre Heerde durch ein Wasser. Bey Sonnen Untergang. Im Hintergrunde eine angenehme Landschaft. Ein Hirt und Hirtinn beschäfftigen sich mit ihrer Heerde neben einem Grabmaal in einer angenehmen Gegend. Sehr frey gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Diese Nr.: Ein reitender Hirte und Hirtinn treiben ihre Heerde durch ein Wasser Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Zoll, breit 25 Zoll Anm.: Die Lose 379 und 380 wurden zusammen katalogisiert. Es ist unsicher, ob sich der Preis jeweils nur auf ein Gemälde oder auf beide zusammen bezieht. Transakt.: Verkauft (3 Μ für die Nrn. 379 und 380 [?]) Käufer: Cober [?] 1787/00/00 HB AN 0380 Nach Berghem I Ein reitender Hirte und Hirtinn treiben ihre Heerde durch ein Wasser. Bey Sonnen Untergang. Im Hintergrunde eine angenehme Landschaft. Ein Hirt und Hirtinn beschäfftigen sich mit ihrer Heerde neben einem Grabmaal in einer angenehmen Gegend. Sehr frey gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Diese Nr.: Ein Hirt und Hirtinn beschäfftigen sich mit ihrer Heerde neben einem Grabmaal in einer angenehmen Gegend Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Zoll, breit 25 Zoll Anm.: Die Lose 379 und 380 wurden zusammen katalogisiert. Es ist unsicher, ob sich der Preis jeweils nur auf ein Gemälde oder auf beide zusammen bezieht. Transakt.: Verkauft (3 Μ für die Nrn. 379 und 380 [?]) Käufer: Cober [?] 1787/00/00 HB AN 0397 Nach Berghem I Ein Hirte, auf einem weißen Pferde reitend, treibt seine Heerde durch ein Wasser. Bey Untergang der Sonne. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 27 Zoll, breit 33 Zoll Transakt.: Verkauft (7.8 [?] M) Käufer: Texier
1788/04/07 FRFAY 0014 Pforr; Berghem I Eine Landschaft mit Vieh und Figuren staffirt, von Pforr nach Berghem. Auf Holz. I Kopie von J.G. Pforr nach N.P. Berchem Mat.: auf Holz Maße: 13 Vi Z. hoch, und 18 % Z. breit Transakt.: Verkauft (15 fl) Käufer: Levi ν Man[n]heim 1788/09/01 KOAN 0455 Bergheim I 2 Landschaften, nach Bergheim, [deux paysages, selon Bergheim.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Fuß 6 Zoll, Breite 1 Fuß 3 Zoll Anm.: Die Lose 455 und 456 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0456 Bergheim I 2 Landschaften, nach Bergheim, [deux paysages, selon Bergheim.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Fuß 6 Zoll, Breite 1 Fuß 3 Zoll Anm.: Die Lose 455 und 456 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0504 Berchem I 2 Landschaften mit Figuren und Vieh, nach Berchem. [deux paysages & figur. avec des bestiaux, de Berchem.] I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren und Vieh Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 6 Zoll, Breite 2 Fuß Anw.: Die Lose 504 und 505 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0505 Berchem I 2 Landschaften mit Figuren und Vieh, nach Berchem. [deux paysages & figur. avec des bestiaux, de Berchem.] I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren und Vieh Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 6 Zoll, Breite 2 Fuß Anm.: Die Lose 504 und 505 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0567 Berghem \ 2 Landschaften mit Vieh nach Berghem. [2 paysages avec des Bestiaux, selon Bergem.] I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Vieh Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 6 Zoll, Breite 1 Fuß 7 Zoll Anm.: Die Lose 567 und 568 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0568 Berghem I 2 Landschaften mit Vieh nach Berghem. [2 paysages avec des Bestiaux, selon Bergem.] I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Vieh Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 6 Zoll, Breite 1 Fuß 7 Zoll Anm.: Die Lose 567 und 568 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0665 Berghem I Viehstuck, nach Berghem. [1 p[iece], avec des bestiaux s[elon]. Berghem.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 4 Zoll, Breite 1 Fuß 9 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0766 Berghem I Landschaft mit Figuren und Thieren, nach Berghem. [un paysages avec des figures & des betes, selon Berghem.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Fuß 4 Zoll, Breite 2 Fuß 11 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0822 Bergheim I Mann zu Pferd mit Vieh, nach Bergheim, [un homme ä cheval avec des Bestiaux, selon Berghem.] I Maße: Höhe 1 Fuß 1 Zoll, Breite 9 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt
1787/00/00 HB AN 0516 Nach Berghem I Ein Hirt und Hirtinn, auf ihren Maulthieren reitend, treiben ihre Heerde durch ein mit Wasser durchflossenes Thal, bey Untergang der Sonne. Von überaus angenehmem Colorit und freyen Mahlerey. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 8 Vi Zoll, breit 12 Zoll Transakt.: Verkauft (9.12 M) Käufer: Sigberg
1789/06/12 HBTEX 0121 Nach Berghem I Hirten und Hirtinnen mit ihrem Vieh, in einer Landschaft, bey Mondschein. Auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 27 Zoll, breit 36 Zoll Transakt.: Verkauft (2.8 M) Käufer: Hernies
1787/00/00 HB AN 0701 Nach Berghem I Lustige tanzende und zechende Bauern im Innern eines alten Hauses. Sehr reich an Figuren und Nebensachen. A.L. [Auf Leinewand] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 29 Zoll, breit 46 Zoll Transakt.: Verkauft (2 M) Käufer: Berth[eau]
1791/09/26 FRAN 0126 Nie. Berghem I Zwey anmuthige Viehstücke, nach Nie. Berghem. I Diese Nr.: Ein anmuthiges Viehstück Maße: 30 Zoll hoch, 40 Zoll breit Anm.: Die Lose 126 und 127 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt
1787/10/06 HBTEX 0071 Berghem I Ein Hirtenstück, mit Wass e r f a r b e n gemahlt, nach Berghem. I Transakt.: Unbekannt
1791/09/26 FRAN 0127 Nie. Berghem I Zwey anmuthige Viehstücke, nach Nie. Berghem. I Diese Nr.: Ein anmuthiges Viehstück GEMÄLDE
275
Maße: 30 Zoll hoch, 40 Zoll breit Anm.: Die Lose 126 und 127 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt
1793/01/15 LZRST 7073 Berghem I Ein Viehstück nach Berghem, 13 Zoll breit, 9 Zoll hoch, in vergoldetem Rahm. I Maße: 13 Zoll breit, 9 Zoll hoch Transakt.: Verkauft (1.8 Th) Käufer: f
1791/09/26 FRAN 0172 Berghem I Zwey sehr artige Viehstück, nach Berghem. I Diese Nr.: Ein sehr artiges Viehstück Maße: 6 Zoll hoch, 5 Zoll breit Anm.: Die Lose 172 und 173 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt
1793/01/15 LZRST 7086 Gottlob; Berghem I Eine felsigte Landschaft mit Figuren und Vieh, nach Berghem, 22 Zoll hoch, 26 Zoll breit, auf Leinwand. [Folgende gemählde sind von der Hand des ohnlängst verstorbenen geschickten Malers Gottlob zu Leipzig. Sie sind grösstentheils noch nicht völlig beendigt, und einige davon blos angelegt.] I Kopie von Ernst Gottlob nach N.P. Berchem Mat.: auf Leinwand Maße: 22 Zoll hoch, 26 Zoll breit Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen über der Nr. 7074 und beziehen sich auf die Nrn. 7074 bis 7099. Transakt.: Verkauft oder Unverkauft (8 Gr) Käufer: R[ost]
1791/09/26 FRAN 0173 Berghem I Zwey sehr artige Viehstück, nach Berghem. I Diese Nr.: Ein sehr artiges Viehstück Maße: 6 Zoll hoch, 5 Zoll breit Anm.: Die Lose 172 und 173 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/10/21 HBRMS1 0095 Nach Berghem I Landschaft mit Rudera, Vieh und Figuren; auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 25 Zoll, breit 35 Zoll Transakt.: Unbekannt 1792/02/01 LZRST 4890 Berghem I Ein Viehstück, nach Berghem. I Maße: 19 Zoll hoch, 24 % Zoll breit Verkäufer: Wer Transakt.: Verkauft oder Unverkauft (10 Gr) Käufer: Wer 1792/07/05 LBKIP 0015 Berghem I Zwey kleine Viehstücke, nach Berghem. I Diese Nr.: Ein kleines Viehstück Anm.: Die Lose 15 und 16 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1792/07/05 LBKIP 0016 Berghem I Zwey kleine Viehstücke, nach Berghem. I Diese Nr.: Ein kleines Viehstück Anm.: Die Lose 15 und 16 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1792/07/05 LBKIP 0097 Berghem I Eine sehr schöne Landschaft nach Berghem, sehr fein und ausführlich gemahlt. Ein sehr gutes Gemähide. I Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0021 Berchem I Zwey kleine Hornviehe Stückelcher, worauf ein Bauren Mädchen zu Pferd, und ein Baur auf einem Ochsen reitet nach Berchem. I Diese Nr.: Ein kleines Hornviehe Stückelche, worauf ein Bauren Mädchen zu Pferd Maße: 9 Vi Zoll hoch, 1 Schuh Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 21 und 22 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0022 Berchem I Zwey kleine Hornviehe Stückelcher, worauf ein Bauren Mädchen zu Pferd, und ein Baur auf einem Ochsen reitet nach Berchem. I Diese Nr.: Ein kleines Hornviehe Stückelche, ein Bauer auf einem Ochsen reitet Maße: 9 Vi Zoll hoch, 1 Schuh V2 Zoll breit Anm.: Die Lose 21 und 22 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0133 Berchem I Zwey Stück, wovon eins eine Landschaft mit Pferd und Figuren nach Berchem, das andere eine Hirschjagd vorstellet, nach Philipp Wauermans, so gut, als von beyden Meisteren selbst. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Pferd und Figuren; Nr. 134 ist eine Kopie nach Ph. Wouwerman Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 2 Schuh 1 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 133 und 134 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0284 Berchem I Ein Viehe Stück mit Figuren schön gemahlt nach Berchem. I Maße: 1 Schuh 10 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 5 Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0538 Berchem I Eine fein und fleißig ausgeführte Landschaft mit Ruinen und Vieh, nach Berchem, in Packrahmen. I Pendant zu Nr. 539 Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch, 2 Schuh 2 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0539 Berchem I Zum Gegenstück, eine dergleichen schöne Landschaft, von obigem Meister [nach Berchem] und Maaß. I Pendant zu Nr. 538 Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch, 2 Schuh 2 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 276
GEMÄLDE
1793/01/15 LZRST 7094 Gottlob; Berghem I Eine Landschaft nach Berghem, 11 Vi Zoll hoch, 9 Zoll breit, auf Holz. [Folgende gemählde sind von der Hand des ohnlängst verstorbenen geschickten Malers Gottlob zu Leipzig. Sie sind grösstentheils noch nicht völlig beendigt, und einige davon blos angelegt.] I Kopie von Ernst Gottlob nach N.P. Berchem Mat.: auf Holz Maße: 11 Vi Zoll hoch, 9 Zoll breit Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen über der Nr. 7074 und beziehen sich auf die Nrn. 7074 bis 7099. Transakt.: Verkauft (2 Gr) Käufer: Schwarz 1795/03/12 HBSDT 0170 Nach Berghem I Landschaften mit Vieh. I Diese Nr.: Landschaft mit Vieh Maße: Hoch 93 [sie] Zoll, breit 12 Zoll Anm.: Die Lose 170 und 171 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1795/03/12 HBSDT 0171 Nach Berghem I Landschaften mit Vieh. I Diese Nr.: Landschaft mit Vieh Maße: Hoch 93 [sie] Zoll, breit 12 Zoll Anm.: Die Lose 170 und 171 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0150 Nach Berghem I Eine Landschaft; nach Berghem. Schw. Rahm. I Maße: Hoch 24 Zoll, breit 28 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0167 Nach Berghem I Eine Landschaft, mit einer Jagdparthie. Auf Leinwand. Schwarzer Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 32 Zoll, breit 46 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0002 Nach Berchem I Eine gebirgigte Landschaft mit Schäfer und Schäferin, welche ihr Vieh in Lebensgröße weiden, nebst noch vielen andern Figuren. Auf Leinw. schwarzen Rahm, goldenene Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 37 Zoll, breit 52 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0056 Nach Berghem I Eine Landschaft mit Hirten und Vieh. Auf Leinwand, schwarzer Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 14 Zoll, breit 17 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/11/14 HBPAK 0116 Nach Berghem I Eine bergigte Landschaft mit alte Rudera. Im Vordergrunde treiben Schäfer und Schäferinnen ihre Heerden. Auf Leinwand, im schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Mat. : auf Leinwand Maße: Hoch 23 Zoll, breit 27 Zoll Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0168 Nach Berghem I Ein Stück mit Figuren und Pferden. Auf Leinwand, schw. Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 22 Zoll Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0050 Berghem I Eine Landschaft, nach Berghem. I Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0064 Berghem I Eine dito [Landschaft] mit Figuren und Vieh, nach Berghem. I Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0098 Berghem I Eine Landschaft mit Figuren und Vieh, nach Berghem. I Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0103 Berghem I Vier Stücke; Landschaften mit Hirten und Vieh, nach Berghem. I Diese Nr.: Eine Landschaft
mit Hirten und Vieh Anm.: Die Lose 103 bis 106 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0104 Berghem I Vier Stücke; Landschaften mit Hirten und Vieh, nach Berghem. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Hirten und Vieh Anm.: Die Lose 103 bis 106 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0105 Berghem I Vier Stücke; Landschaften mit Hirten und Vieh, nach Berghem. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Hirten und Vieh Anm.: Die Lose 103 bis 106 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0106 Berghem I Vier Stücke; Landschaften mit Hilten und Vieh, nach Berghem. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Hirten und Vieh Anm.: Die Lose 103 bis 106 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0156 Berghem I Eine Landschaft mit Hirten und Vieh, nach Berghem. I Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0167 Berghem I Eine Landschaft mit Hirten und Vieh, nach Berghem. I Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0192 Berghem I Ein Stück mit Figuren und Pferden, nach Berghem. I Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0280 Berghem I Ein Stück mit Figuren und Pferden, nach Berghem. I Transakt. : Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0308 Berghem I Eine Landschaft mit Figuren und Vieh, nach Berghem. I Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0360 Berghem I Zwey Viehstücke, nach Berghem. I Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0462 Berghem I Sechs Landschaften mit Vieh, nach Berghem. I Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0612 Berghem I Drey Stücke mit Figuren, nach Berghem. I Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0700 Berghem I Zwey Stücke mit Hirten und Vieh, nach Berghem. I Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0701 Berghem I Zwey Stücke; Landschaften und Figuren, nach Demselben [Berghem], I Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0719 Berghem I Zwey Stücke mit Hirten und Vieh, nach Berghem. I Transakt.: Unbekannt
Berchem, Nicolaes Pietersz. (Manier) 1772/09/15 BNSCT 0023 von Berghem I Eine gute Landschaft mit Vieh, in der Manier von von Berghem, auf Holz, 1 Fuß 10 Zoll hoch, 2 Fuß 4 Zoll breit, schw. R[ahm], I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 10 Zoll hoch, 2 Fuß 4 Zoll breit Transakt.: Unbekannt (5.24 fl) 1772/09/15 BNSCT 0024 Berghem I Zwey schöne Compagnons Viehstücke, auf Landschaften, in selber Manier [Berghem], 1 Fuß 6 Z. hoch, 1 Fuß 1 Zoll breit, auf Holz, schw. Rahm. I Diese Nr.: Ein Viehstück auf einer Landschaft; Pendant zu Nr. 25 Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 6 Zoll hoch, 1 Fuß 1 Zoll breit Anm.: Die Lose 24 und 25 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (2 Vi fl) 1772/09/15 BNSCT 0025 Berghem I Zwey schöne Compagnons Viehstücke, auf Landschaften, in selber Manier [Berghem], 1 Fuß 6 Z. hoch, 1 Fuß 1 Zoll breit, auf Holz, schw. Rahm. I Diese Nr.: Ein Viehstück auf einer Landschaft; Pendant zu Nr. 24 Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 6 Zoll hoch, 1 Fuß 1 Zoll breit Anm.: Die Lose 24 und 25 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (2 Vi fl) 1777/02/26 HBKOS 0012 Bergheim I Zwey kleine dito [Landschaften] in der Manier, von Bergheim. I Diese Nr.: Eine kleine Landschaft Maße: Höhe 1 Fuß, Breite 1 Fuß 3 Zoll Anm.: Die Lose 12 und 13 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1777/02/26 HBKOS 0013 Bergheim I Zwey kleine dito [Landschaften] in der Manier, von Bergheim. I Diese Nr.: Eine kleine Landschaft Maße: Höhe 1 Fuß, Breite 1 Fuß 3 Zoll Anm.: Die Lose 12 und 13 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1779/09/27 FRNGL 0663 Bergheem I Eine bergigte Landschaft mit einer Jagd, in der Manier von Bergheem. [Un paysage couvert de montagnes, une chasse, dans le gout de Bergheem.] I Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Transakt.: Verkauft (6 fl) Käufer: Wild 1782/07/00 FRAN 0027 Berghem I Eine Landschaft, worauf eine weiß und braungefleckte Kuh und ein reitendes Weibchen zu sehen sind, in der Manier von Berghem. I Maße: 1 Schuh 11 Zoll hoch, 1 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt (1.40 fl) 1782/07/00 FRAN 0058 Berghem I Ein Viehstück in einer Landschaft, mit einem weis und braun gefleckten Ochs, nebst einem Kalb und Schaafen, in der Manier von Berghem. I Maße: 1 Schuh 5 Zoll hoch, 1 Schuh 10 Zoll breit Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt (2.4 fl) 1782/07/00 FRAN 0172 Berghem I Ein Viehstück, worauf eine schwarze im Wasser stehende und trinkende Kuh zu sehen ist, nebst einem Weibchen das die Füsse wäscht, in der Manier von Berghem. I Maße: 1 Schuh 6 Zoll hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] fl) 1782/07/00 FRAN 0190 Ν. Berghem I Eine Höhle, worinn ein sein Pferd abpackender Mann nebst noch andern Figuren und Schaafen sehr natürlich vorgestellt sind, in der Manier von N. Berghem. I Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 1 Schuh 5 Zoll breit Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt (2.24 fl) 1785/04/22 HBTEX 0096 In der Manier von Berghem, oder so schön wie von ihm selbst I Ein Land= und Wasser=Prospect bey Nacht und Mondenschein, allwo Hirten und Vieh vorüber gehen. Man wird Berge und Felsen gewahr. Vieh geht durchs Wasser. Auf Leinewand. Schwarzer Rahm und goldene Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 12 Vi Zoll, breit 16 Zoll Transakt.: Unbekannt 1785/05/17 MZAN 0672 Berghem I Eine Landschaft in Berghems Manier. [Un paysage dans le gout de Berghem.] I Maße: 10 Zoll hoch, 1 Schuh breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (5.30 fl) Käufer: Clausius 1785/10/17 LZRST 0103 Bergheim I Eine bergichte Gegend, von einer ungenannten Meisterinn, in Bergheims Manier, vorne im Grunde Ochsen, Kühe, Pferde, Schafe und Ziegen, im Mittelgrunde ein Bauer, Ochsen, Schafe und Hunde, in der Ferne Berge, Büsche und Dörfer, ohne Rahm. I Pendant zu Nr. 104 Maße: 26 Zoll hoch, 36 Zoll breit Transakt.: Verkauft (1.1 Th) Käufer: Fip [?] 1785/10/17 LZRST 0104 Bergheim I Eine andere Gegend, von eben dieser Hand [ungenannte Meisterinn], in eben der Manier [Bergheim], das Gegenbild zum vorigen, vorne im Vordergrunde Ochsen und Ziegen, welche bey einem Busche ruhen, in der Ferne Berge und Wälder, ohne Rahm von gl. Masse. I Pendant zu Nr. 103 Maße: 26 Zoll hoch, 36 Zoll breit Transakt.: Verkauft (20 Gr) Käufer: Fip [?] 1786/11/11 HBRMS 0076 In der Manier von Berghem I Eine Landschaft mit Vieh, wo sich im Vordergrunde eine weisse Kuh befindet, und eine braune daneben, mit Figur. I Transakt.: Unbekannt 1786/11/11 HBRMS 0091 Die Manier von Berghem I Zwey Landschaften mit vielem Vieh und Figuren, sehr fleißig gemahlt, goldne Rähme. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 91 und 92 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/11/11 HBRMS 0092 Die Manier von Berghem I Zwey Landschaften mit vielem Vieh und Figuren, sehr fleißig gemahlt, goldne Rähme. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 91 und 92 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
277
1787/00/00 HB AN 0583 Von einem unbekannten Meister. Wie Berghem I In einer bergigten Gegend befinden sich im Vordergrunde verschiedene Hirtinnen, die ihre Kühe milchen, mit mehrerm Vieh umgeben. A.H. [Auf Holz] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 25 Zoll, breit 35 Zoll Transakt.: Verkauft (6.12 M) Käufer: Ekhard 1788/10/01 FRAN 0037 Berghem I Eine sehr schöne Landschaft, sehr warm mit vortreflichen Figuren und Thieren, in der Manier von Berghem. I Maße: 16 Ά Zoll hoch, 24 Zoll breit Transakt.: Verkauft (17.30 fl) Käufer: von Schmid 1789/08/18 HBGOV 0087 So schön wie N. Berghem I Zwey Holzungen mit Schäfer und Hirtinnen, w. c. auf Holz. I Diese Nr.: Eine Holzung mit Schäfer und Hirtinnen Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 % Zoll, breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 87 und 88 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1789/08/18 HBGOV 0088 So schön wie N. Berghem I Zwey Holzungen mit Schäfer und Hirtinnen, w. c. auf Holz. I Diese Nr.: Eine Holzung mit Schäfer und Hirtinnen Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 'Λ Zoll, breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 87 und 88 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1790/09/10 HBBMN 0071 So schön wie Berghem I In einer ländlichen Gegend befinden sich auf der Weide Hirsche und Ziegen, ein kleines kostbares Gemähide. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 'Λ Zoll, breit 12 Zoll Transakt.: Verkauft (2 M) Käufer: Ego 1791/07/29 HBBMN 0020 Unbekannt, wie Berghem I Zwey Landschaften mit reisenden Gesellschaften und Vieh, schön gemahlt; auf Leinen. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit einer reisenden Gesellschaft und Vieh Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 40 Zoll, breit 54 Zoll Anm.: Die Lose 20 und 21 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (4.4 Μ für die Nrn. 20 und 21) 1791/07/29 HBBMN 0021 Unbekannt, wie Berghem I Zwey Landschaften mit reisenden Gesellschaften und Vieh, schön gemahlt; auf Leinen. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit einer reisenden Gesellschaft und Vieh Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 40 Zoll, breit 54 Zoll Anm.: Die Lose 20 und 21 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (4.4 Μ für die Nrn. 20 und 21) 1792/07/05 LBKIP 0040 Berghem I Ein sehr schönes Stück mit Vieh und Figuren, so schön wie Berghem, ein ganz vortrefliches ausgeführtes Gemähide. I Transakt.: Unbekannt 1792/09/28 HBBMN 0078 Berghem I Ein Hirtenstück, in der Manier von Berghem. Auf L[einwand]. I Mat. : auf Leinwand Maße: Hoch 26 Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Unbekannt 1794/02/21 HBHEG 0073 Wie N. Berghem I In einer Land=Gegend sitzet ein Hirthen=Junge neben dem Mädchen, welche eine Kuh melket; nebenbey am Wasser, ist ein Schaaf und Rind. Frey und schön gemahlt. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 14 Zoll, breit 9 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1794/09/00 LGAN 0035 Berghem I Eine in Berghems Manier mit Vieh trefflich stafirte Gebürg=Gegend, auf Holz, in einer antiken verguldten Rahme. I Mat.: auf Holz Maße: breit 1 Schuh 8 Vi Zoll, hoch 1 Schuh 4 Zoll Verkäufer: [Friedrich Karl Ludwig, Freiherr von Moser] Transakt.: Unbekannt (100 rh fl Schätzung) 1796/00/00 HLAN [0036] Berghems I Landschaft mit Vieh, in Berghems Manier 1 Sch. 4 Ζ. 1 Sch. 8 Vi Z. auf Holz. I Mat. : auf Holz Maße: 1 Sch. 4 Ζ. 1 Sch. 8 Vi Z. Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: [Friedrich Karl Lang] Transakt.: Unbekannt (55.13 Rt; 100 fl Schätzung) 1796/12/07 HBPAK 0005 Wie Berghem I Eine Landschaft mit Hirten und Vieh. I Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0020 Wie Berghem I Eine Landschaft mit Vieh. I Transakt.: Unbekannt 278
GEMÄLDE
1798/08/10 HBPAK 0033 In der Manier von Bercheml Zwey Viehstücke. Das eine, wo ein Hirte seine Schaafe weidet. Das andere, wo ein Hirte seine Heerde zur Tränke führt. Gut gemahlt. Auf Holz, im schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein Viehstück, worauf ein Hirte seine Schaafe weidet Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Zoll, breit 15 Zoll Anm.: Die Lose 33 und 34 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/08/10 HBPAK 0034 In der Manier von Bercheml Zwey Viehstücke. Das eine, wo ein Hirte seine Schaafe weidet. Das andere, wo ein Hirte seine Heerde zur Tränke führt. Gut gemahlt. Auf Holz, im schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein Viehstück, worauf ein Hirte seine Heerde zur Tränke führt Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Zoll, breit 15 Zoll Anm.: Die Lose 33 und 34 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/11/14 HBPAK 0062 In der Manier von Berghem! Eine bergigte Landschaft, wo im Vordergrunde Hirten ihr Vieh treiben. Auf das schönste gemahlt und gruppirt, ganz als von ihm selbst. Auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 26 Zoll, breit 31 Zoll Transakt.: Unbekannt
Berchem, Nicolaes Pietersz. (Schule) 1742/08/01 BOAN 0232[b] Berchem I Eine Landschafft mit Kühen von der Schuhle von Berchem. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1779/09/27 FRNGL 0038 Bergheem I Eine keck und meisterhafte Landschaft mit Vieh, aus der Schule von Bergheem. [Un pai'sage avec du betail, piece superieurement executee, de l'ecole de Bergheem.] I Maße: 11 Zoll hoch, 1 Schuh breit Transakt.: Verkauft (6.15 fl) Käufer: Rath Eichhorn 1787/04/03 HBHEG 0001 Berghem I Zwey bergigte Land= und Wassergegenden, aus der Schule Berghems, auf Holz. I Diese Nr.: Eine bergigte Land= und Wassergegend Mat.: auf Holz Anm.: Die Lose 1 und 2 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (14.4 Μ für die Nrn. 1 und 2) Käufer: Hofr Ehrenreich 1787/04/03 HBHEG 0002 Berghem I Zwey bergigte Land= und Wassergegenden, aus der Schule Berghems, auf Holz. I Diese Nr.: Eine bergigte Land= und Wassergegend Mat.: auf Holz Anm.: Die Lose 1 und 2 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (14.4 Μ für die Nm. 1 und 2) Käufer: Hofr Ehrenreich
Berckheyde, Gerrit Adriaensz. 1744/05/20 FRAN 0157 Ger. Berkhuys I 1 Schön Stück der Fischmarck zu Haarlem. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 5 Zoll, Breite 1 Schuh 10 Zoll Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1774/10/05 HBNEU 0101 Berckheyde I Ein perspectivischer Pallast, von aussen anzusehen, mit einer angenehmen Gegend. I Transakt.: Unbekannt 1775/05/08 HBPLK 0068 Bergheyden I Eine Landschaft mit einem adelichen Landhause, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 13 Zoll 11 Linie, Breite 16 Zoll 9 Linie Transakt. : Unbekannt 1778/10/30 HBKOS 0164 Bergheiden I Ein Prospect von Bergheiden, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 11 Zoll, breit 13 Zoll Transakt.: Unbekannt 1779/09/27 FRNGL 0373 Bergheyden I Eine Gegend eines Flusses in einer Landschaft, mit einem kleinen Schiff worinnen Vieh und Figuren. [Belle vue, pay sage pres d'une riviere sur la quelle nage un bateau rempli de betail & de figures.] I Maße: 2 Schuh 11 Zoll hoch, 3 Schuh 5 Zoll breit Transakt.: Verkauft (1.24 fl) Käufer: Mertens
1779/09/27 FRNGL 0856 Bargheyden I Eine gebirgigte meisterhafte Landschaft, mit einer Brücke und verschiedenen artigen Figuren. [Un tres beau paysage couvert de montagnes, avec un pont et plusieurs jolies figures.] I Maße: 2 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 10 Zoll breit Anm.: Dieses Los trägt im Katalog irrtümlicherweise die Nr. 865. Transakt.: Verkauft (3 fl) Käufer: Mund 1781/05/07 FRHUS 0047 Bergheyden I Zwey sehr schöne Viehstücke, mit Felsen und klarem Wasser von dem bekannten Meister Pinsel des Bergheyden. I Diese Nr.: Ein sehr schönes Viehstück, mit Felsen und klarem Wasser Maße: 1 Schuh hoch und 1 Schuh 3 Zoll breit Anm.; Die Lose 47 und 48 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (50 fl für die Nrn. 47 und 48) Käufer: Behr 1781/05/07 FRHUS 0048 Bergheyden I Zwey sehr schöne Viehstücke, mit Felsen und klarem Wasser von dem bekannten Meister Pinsel des Bergheyden. I Diese Nr.: Ein sehr schönes Viehstück, mit Felsen und klarem Wasser Maße: 1 Schuh hoch und 1 Schuh 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 47 und 48 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (50 fl für die Nrn. 47 und 48) 1781/05/07 FRHUS 0377 Bergheyden I Eine angenehme Landschaft mit sehr meisterhaft ausgeführtem Vieh von Bergheyden. I Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch und 1 Schuh breit Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (16.30 fl) Käufer: F Bernus 1784/08/02 FRNGL 0560 Berkheyden I Ein meisterhaft warm und fleißig ausgeführtes Viehstück. I Maße: 22 Zoll breit, 18 % Zoll hoch Transakt.: Verkauft (11 fl) Käufer: Knapper 1785/05/17 MZAN 0049 Berkheyde I Ein alter Mann der mit der Brille auf der Nase die Zeitung ließt, und eine Frau die ihm zuhört von Berkheyde. [Un vieillard, qui ayant les Lunettes sur le nez lit la Gazette, & une femme qui l'ecoute.] I Maße: 1 Schuh 7 Zoll hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (201 fl) Käufer: Giro
man ein Schloß gewahr, und auf dem Flusse und an den Ufern befinden sich verschiedene Schiffe und Fahrzeuge; sehr fleißig nach der Natur gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 24 Vi Zoll, breit 31 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (6.4 M) Käufer: Clasen 1791/09/21 FRAN 0099 Berkhyden I Aussicht der Börse zu Anvers, wo man Kaufleute und Magistratspersonen sieht, so nach der alten Flamändischen Tracht gekleidet sind; die Werke dieses Meisters sind sehr rar. I Transakt.: Verkauft (38 fl) Käufer: Trautmann 1791/09/26 FRAN 0263 Berckhyden I Ein Marktschreyer der seine Quacksalberbüchsen dem umstehenden Bauemvolk empfiehlet, natürlich und fleißig vorgestellt von Berckhyden. I Maße: 24 Zoll breit, 18 Zoll hoch Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0262 Berckheyden I Zwey Stück auf Tuch, eins ein Landschloß, das andere eine Landkartig mit Bäum und Stadtmauren vorstellend. I Diese Nr.: Ein Stück auf Tuch, ein Landschloß vorstellend Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Schuh hoch, 2 Schuh 11 Zoll breit Anm.: Die Lose 262 und 263 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0263 Berckheyden I Zwey Stück auf Tuch, eins ein Landschloß, das andere eine Landkartig mit Bäum und Stadtmauren vorstellend. I Diese Nr.: Ein Stück auf Tuch, eine Landkartig mit Bäum und Stadtmauren vorstellend Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Schuh hoch, 2 Schuh 11 Zoll breit Anm.: Die Lose 262 und 263 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/10/12 KOAN 0003 G. Berkheyden I Das Schloss von St. Germain von G. Berkheyden. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 4 Fuss 10 Zoll - breit 7 Fuss 2 Zoll Verkäufer: Moureaux Transakt.: Unbekannt
1785/05/17 MZAN 0273 Gerard Berkheyde I Die grose Kirche zu Harlem von Gerard Berkheyde. [La grand'eglise ä Harlem.] I Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 1 Schuh 7 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (89 fl) Käufer: Strecker
1793/09/18 HBSCN 0035 Berckheyde I Vor dem Thore der Stadt Dortrecht werden zwey mit Wein beladene Schiffe gelöschet und mit Schlitten verfahren; vor dem großen Thore liegen einige Fässer, Weinküser reichen den Umstehenden davon die Proben, hinter diesem Thore ragen die Masten von andern Schiffen hervor. [Ohne Rahmen.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 48 Zoll, breit 41 Zoll Transakt.: Unbekannt
1785/05/17 MZAN 0681 Gerard Berkheyde I Das Inwendige einer Kirche von Gerard Berkheyde. [Le dedans d'une eglise.] I Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch, 2 Schuh Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (72 fl) Käufer: Dechant Pestel
1794/00/00 HB AN 0127 Berckheyder I An dem Thore eines Kapuzinerklosters theilen Mönche, einer Schaar Arme und Krüppel, Almosen aus. I Maße: Höhe 14 Zoll, Breite 16 Zoll Verkäufer: Leonelli Transakt.: Unbekannt
1788/06/12 HBRMS A0037 Bergheyden I Ein Hirten=Stück, wie Berghem. Sehr fleißig gemalt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 VA Zoll, breit 10 % Zoll Transakt.: Unbekannt
1795/03/12 HBSDT 0014 Berkheide; in der Manier von Ferg I Ein Italienischer Marktplatz mit vielen Figuren, welcher durch das wohlvertheilte Licht dem Auge die größte Ruhe gewährt, und schön ausgeführt ist. Auf Holz, im schwarzen Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 14 Zoll, breit 17 Zoll Transakt.: Unbekannt
1788/12/13 HBTEX 0152 Berckheide I Zwey ausführliche Landschaften, mit dito Pferde, und vielen Figuren. I Diese Nr.: Eine ausführliche Landschaft, mit dito Pferde, und vielen Figuren Anm.: Die Lose 152 und 153 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (26 Μ für die Nrn. 152 und 153) Käufer: Lillie 1788/12/13 HBTEX 0153 Berckheide I Zwey ausführliche Landschaften, mit dito Pferde, und vielen Figuren. I Diese Nr.: Eine ausführliche Landschaft, mit dito Pferde, und vielen Figuren Anm.: Die Lose 152 und 153 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (26 Μ für die Nrn. 152 und 153) Käufer: Lillie 1789/06/12 HBTEX 0005 Berckheyde I Ein Holländisches Herrnhaus am Wasser, worüber eine Brücke gehet, nebst einer Holzung, mit Soffage. Vortreflich gemahlt auf Holz. I Mat.: auf Holz Transakt.: Verkauft (10 M) Käufer: Eckhardt mit F 1790/04/13 HBLIE 0028 Berkheyden I In einer angenehmen Land= und Wassergegend siehet man im Vorgrunde ein Dorf mit einer Kirche, nebst verschiedenen Reisenden und beschäftigten Landleuten, die sich auf der Landstrasse befinden, als auch einige welche nach ihren Wohnungen gehen, zur rechten in der Entfernung wird
1795/03/12 HBSDT 0037 Berkheide l Im Vorgrunde ein Fluß, worüber links eine Brücke zu einem Schlosse führt; rechts, ein Dorf, welches von Bäumen umgränzt ist. Auf Holz, im schwarzen Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 23 Zoll, breit 32 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0006 Berckhaide I Im Vordergrunde eine steinerne Brücke, worauf sich ein Bauer mit seiner Frau unterredet. Im Hintergrunde einige alte Gebäude, w o hinten, von einem Berge, Wasser durchfließt. Auf Leinwand. Schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0132 Berkheyde I Eine Landschaft mit Ruinen und vielen Figuren. Auf Leinw. schwarzen Rahm, goldene Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 18 Vi Zoll, breit 22 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0185 Berkheyde I Eine waldigte Landschaft, mit einem grossen Schlosse; zur rechten einige Cavaliers mit GEMÄLDE
279
einer Dame zu Pferde, denen folgt ein Jäger mit vielen Hunden; zur linken ein Wagen mit vier Pferde, und ein Reuter; schön gemahlt. Auf Holz, gold. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 16 Vi Zoll, breit 21 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0226 Berkheyde I Eine Landschaft, zur rechten drey Kühe, vor denen ein Mann der sein Pferd füttert; im Vordergrunde ein Mädgen mit einem Sack unter ihren Arm, neben ihr ein Mädgen auf einen Esel; zur linken ein grosses Schloß, am Eingange desselben ein Mädgen mit einem Korb mit Gartengewächse. Sehr gut gemahlt. Auf Leinwand, schwarzen Rahm, goldene Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 18 Vi Zoll, breit 22 Zoll Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0004 Gerh. Berkheiden I Ein grosses holländisches Waaren=Magazin am Wasser, an dem Seeschiffe löschen. Vor dem Kaufhause werden Weine probiert. Schön geordnet und gemahlt. Auf Leinwand, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 48 Zoll, breit 4 0 Zoll Transakt.: Unbekannt
Berckheyde, Gerrit Adriaensz. (geändert von Steenwyck) 1780/10/02 FRSTK 0052 Steewyks; Bergheijden I Ein herrlich ausgeführter Prospect von einem Theil der Stadt Amsterdam, von der berühmten Meisterhand des Steewyks. I Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 1 Schuh 9 Zoll breit Anm.: Im Exemplar SBF wurde der Name "Steewyks" handschriftlich durchgestrichen und in "Bergheijden" korrigiert. Transakt.: Unbekannt (81.1/2 fl)
Berckheyde, Gerrit Adriaensz. (Manier) 1778/08/29 HB TEX 0089 Berghuden I Zwey plaisante Landschaften, so schön gemahlt wie Berghuden, auf Leinewand. I Diese Nr.: Eine plaisante Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 2 Zoll, Breite 11 Zoll Anm.: Die Lose 89 und 90 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/08/29 HB TEX 0090 Berghuden I Zwey plaisante Landschaften, so schön gemahlt wie Berghuden, auf Leinewand. I Diese Nr.: Eine plaisante Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 2 Zoll, Breite 11 Zoll Anm.: Die Lose 89 und 90 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1792/09/28 HBBMN 0075 Berkheiden I Eine Land= und Seegegend, mit einer Stadt zur Linken, in der Manier von Berkheiden. Auf L[einwand]. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 19 Zoll, breit 22 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt
Berckheyde, Job Adriaensz. 1763/11/09 FRJUN 0015 I. Berkheyde I Deux paisans jouants aux cartes & deux autres fumants du tabac, tres bien peint. I Maße: hauteur 12 Vi pouces, largeur 15 Vi pouces Transakt.: Verkauft (15 fl) Käufer: Kaller 1763/11/09 FRJUN 0016 I. Berkheyde I Un autre du meme maitre [I. Berkheyde] representant des paisans qui se battent ä coups de couteau dans l'interieur d'une chambre pas moins bien peint. I Maße: hauteur 12 Vi pouces, largeur 15 Vi pouces Transakt. : Verkauft (15 fl) Käufer: Kaller 1765/03/27 FRKAL 0014 Berkhyde I Un soldat assis dans l'interieur d'une maison de pai'san, buvant & cherchant l'argant [sie] dans sa poche, l'argent pour payer l'hotesse qui est aupres de lui avec une chandfele trfes bien peint. I Maße: hauteur 23 pouces, largeur 25 pouces Transakt.: Verkauft (6.45 fl) Käufer: Schlundt 1779/09/27 FRNGL 0023 Hyob Bergheyden I Des Malers Hyob Bergheyden Bildniß, von ihm selbsten fleißig und schön gemalt. [Le 280
GEMÄLDE
portrait de Job Bergheyden, peint par lui-meme et trfes bien execute.] I Maße: 1 Schuh 5 Zoll hoch, 1 Schuh 2 Zoll breit Transakt.: Verkauft (3.30 fl) Käufer: Mentzinger 1782/07/00 FRAN 0219 Η Berkheiden I Das Inwendige eines Hofs, worinn verschiedene Soldaten die Wache halten, sehr natürlich und lieblich in Licht und Schatten vorgestellt, in der Manier des Slingeland. I Maße: 1 Schuh 5 Zoll hoch, 2 Schuh 2 Zoll breit Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt (30 fl) 1785/05/17 MZAN 0876 Job Berckheyde I Ein Mädchen das Trauben verkauft von Job Berckheyde. [Une fille vendante des raisins.] I Pendant zu Nr. 877 von J. Toorenvliet Maße: 1 Schuh 6 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (30.30 fl für die Nrn. 876 und 877) Käufer: Strecker 1786/10/18 HBTEX 0198 J. Berckheyden I Zwey Musicirende, vor einem Colonaden=Gebäude sitzend, lebhaft gemahlt und mit Affect vorgebildet. Auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 20 Zoll, breit 17 Zoll Transakt.: Unbekannt 1787/00/00 HB AN 0638 Job. Berkheyden I Ein Reuter hält im Vordergrunde bey einigen Gebäuden auf einem weißen Pferde, und hat ein Glas Branntewein in seiner Hand, mit der Wirthinn sprechend. Hinter denselben noch verschiedene von ihren Pferden abgestiegene Personen. Im Hintergründe kommt ein Herr, eine Dame führend, die Treppe eines Hauses herunter, an deren Fuße ein Thorweg ist, wo eine Frau mit einem Hunde zur Seite herein gucket. Durch diese Oeffnung siehet man in eine angenehme Landschaft. Alles von richtiger Zeichnung, kräftigen Mahlerey und Licht und Schatten. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Zoll, breit 26 Zoll Transakt.: Verkauft (32 M) Käufer: Fesser 1793/00/00 NGWID 0083 loh. Berckheyden I Reisende so bey einem ländlichen Wirthshause anhalten, von loh. Berckheyden. I Pendant zu Nr. 84 Maße: 2 Schuh 3 Zoll hoch, 2 Schuh 2 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0084 loh. Berckheyden I Zum Gegenstück, wie zwey Bettelstudenten vor einem Hause Musik machen, nebst mehreren Beywesen, in etwas kalter Manier tracktirt, von obigem Meister [loh. Berckheyden] und Maaß. I Pendant zu Nr. 83 Maße: 2 Schuh 3 Zoll hoch, 2 Schuh 2 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/09/18 HBSCN 0006 Breckheide I In einer Wohnstube steht ein Arzt mit einem Urin=Glas in der Hand, solches zu besehen; neben ihn eine Magd in sehr aufmerksamer Stellung, um seine Meinung zu erfahren, umher viele Nebensachen. Im Gusto von F. Miris, und eben so schön. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 16 Vi Zoll, breit 13 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/00/00 BSAN 0034 Job Berkheiden I Paysage Flamand. Une tour quarree, decouverte et en partie detruite, dont la voüte inferieure est une porte, sous laquelle passe un grand chemin; cette tour a d'un cöte une ferme, et de 1'autre des restes de fortifications. Des vaches, dont l'une menee par un paysan, des chfevres, des brebis, un ane que monte une paysanne, occupent le devant, qu'arrose une eau courante. Tous les animaux sont trfes bien faits et pleins de vie. I Mat.: auf Leinwand Maße: Haut de 1 pied 6 pouces; large de 1 pied 9 pouces Verkäufer: Merian l'aine Transakt.: Unbekannt (60) 1797/06/13 HBPAK 0186 J. Berckheide I Im Innern eines Hauses, vor der Luke, sitzet ein Mädchen am Tisch und macht einen Heering zurecht. An der andern Seite des Tisches sitzt ein junger Mann, der Brod schneidet. Das einfallende Licht macht einen vortreflichen Effect auf die ausnehmend schön gemahlten Figuren. Auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 11 Vi Zoll, breit 9 V* Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0065 Job Berckheyden I Eine Gesellschaft von zwey Frauenspersonen im Putze, und drey Herren, von welchen einer die Laute spielet, unter Bäumen, nebst einem, der Krüge put-
zet, von Job Berckheyden. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 7 Vi Zoll breit 1 Schuh 3 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Berentz, Christian 1740/00/00 AUAN 0089 Berentz I 2. Stuck vom Berentz. I Maße: 4. Schuh / 6. Zoll hoch / 3. Schuh /11. Zoll breit Transakt.: Unbekannt (200 fl)
Berg (Bergh) 1785/10/17
LZRST
0046
v. den Bergh
I Ein schönes
fleissiges
historisches Gemälde, von v. den Bergh 1744. fee, Es stellt eine Bauernstube vor, in welcher ein Spinnrad und verschiedenes Küchengeräth befindlich, vorne eine Frau, welche einen Teller scheuert, neben ihr ein kl. Junge mit einer Flasche, das ganze Bild ist brav gezeichnet und schön colorirt, 15 Zoll hoch, 10 Zoll br. in vergold. Rahm. I Maße: 15 Zoll hoch, 10 Zoll breit Inschr.: v. den Bergh 1744. fee. (signiert und datiert) Transakt.: Verkauft oder Unverkauft (4.12 Th) Käufer: Rost
Berg (Bergh) (Kopie von) 1778/09/28 FRAN 0371 Bergh; Meytens I Die Kayserinn Maria Theresia, nach Meytens von Bergh. [L'Imperatrice Marie-Therese d'aprös Meytens, par Bergh.] I Kopie von Berg (Bergh) nach Martin Mytens (II) Maße: 9 Vi Zoll breit, 10 % Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (3 fl) Käufer: Weitsch
Berg, Carl [Nicht identifiziert] 1791/07/29 HBBMN 0039 Carl Berg I Der göttliche Befehl an Abraham, aus seinem Vaterlande zu fliehen; auf Leinen. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 40 Vi Zoll, breit 45 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt (1.10 M)
Bergen, Dirk van 1772/09/15 BNSCT 0010 D. v. den Berge I Ein schönes Viehstück auf einer Landschaft stoffieret, von D. v. den Berge, 1 Fuß 4 Zoll hoch, 1 Fuß 9 Zoll breit, schw. Rahm. I Maße: 1 Fuß 4 Zoll hoch, 1 Fuß 9 Zoll breit Transakt.: Unbekannt (12.4 fl) 1783/06/19 HBRMS 0029 Dirck Bergen I Eine angenehme bergigte Gegend mit weidenden Rindern und anderm Vieh. H[olz], g.R. [verguldeter Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: 10 Zoll hoch, 18 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
guren und einigen Pferden. Auf Holz, in schwarz gebeitzten Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 21 Zoll Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "B. v. Bergen", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Verkauft (1.6 M) Käufer: Packischefsky 1790/10/18 LZRST 1856 Dirk van Bergen I Eine grosse meisterhafte Landschaft auf Holz gemahlt von Dirk van Bergen, im Vordergrunde Bäume mit holländischen Bauerhütten, im Hintergründe Prospect von einer holländischen Seestadt, nebst vielen Schiffen. 29 Zoll hoch, 39 Zoll breit, in schwarz ebenem Rahm mit goldner Leiste. I Mat.: auf Holz Maße: 29 Zoll hoch, 39 Zoll breit Transakt.: Unbekannt (23.3 Rt) 1790/10/18 LZRST 1857 Dirk van Bergen I Eine andere vortrefliche Landschaft von eben diesem Meister [Dirk van Bergen], ganz ähnlicher Gegenstand anders behandelt, von gleichem Maas und Rahm [schwarzem ebenem Rahm mit goldener Leiste], I Maße: 29 Zoll hoch, 39 Zoll breit Transakt.: Unbekannt (22.12 Rt) 1792/02/01 LZRST 4801 Dirk van Bergen I Eine grosse meisterhafte Landschaft auf Holz, von Dirk van Bergen. Im Vordergründe Bäume mit holländischen Bauerhütten, im Hintergrunde der Prospect einer holländischen Seestadt, nebst vielen Schiffen, 29 Zoll hoch, 39 Zoll breit, in schwarzem Rahm mit goldner Leiste. I Mat.: auf Holz Maße: 29 Zoll hoch, 39 Zoll breit Transakt.: Verkauft (26 Th) Käufer: Ζ 1792/02/01 LZRST 4802 Dirk van Bergen I Eine eben so vortrefliche Landschaft vom nehmlichen Meister [Dirk van Bergen], ähnlicher Gegenstand [Landschaft], aber anders behandelt, von gleichem Maass und Rahm I Mat.: auf Holz Maße: 29 Zoll hoch, 39 Zoll breit Transakt.: Verkauft (27 Th) Käufer: Ζ 1793/00/00 HBMFD 0128 D. v. Bergen I Landschaft. Im Prospect eine Stadt mit Vestungswerke. Im Vordergründe Staffage. Natürlich vorgestellt. I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuss 5 Zoll hoch, 3 Fuss 9 Zoll breit Verkäufer: Pierre Laporterie Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0030 D. v. Bergen I Gegend am Rhyn. Im Vordergrunde Pferde und Figuren, von D. v. Bergen. I Maße: Hoch 20 Zoll, breit 27 Zoll Transakt.: Unbekannt 1793/09/18 HBSCN 0093 Dirk v. Bergen I Gebürgigte Landschaft mit ein Wasserfall, im Thal Schafe, Ziegen, Ochsen, wovon einer vom Hunde angebellet wird, der Hirte steht bey ihnen mit den Dudelsack im Arm, im Hintergrund eine herrliche Aussicht mit Gebürge. Ein gar vortrefliches Bild. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Vi Zoll, breit 22 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1794/09/09 HBPAK 0160 Dirck von Bergen I Ein angenehmes Winterstück, mit vielen Figuren. I Transakt.: Unbekannt
1783/06/19 HBRMS 0042 D. v. Bergen I Ländliche Gegend bey Abendzeit, mit Hirten und einer milchenden Frau. L[einwand]. g.R. [verguldeter Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 3 Zoll hoch, 1 Fuß 7 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
1799/12/04 HBPAK 0071 v. Bergen I Eine Dorfgegend, wo sich Bauern und Bäuerinnen mit Tanzen belustigen. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 20 Zoll, breit 27 Zoll Transakt.: Unbekannt
1786/10/18 HBTEX 0145 Von der Bergen I Ein stark gemahltes Hirten=Stück, mit Rindern, Ziegen und Schafen. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 20 Zoll, breit 26 Zoll Transakt.: Unbekannt
1800/00/00 FRAN2 0010 Bergen (Theodor van) I Eine niedliche Landschaft im Geschmack von Adrian van de Velde. Im vordem Grund weidet mehreres Vieh, worunter eine rothe Kuh ist, die sich ungemein geschickt gearbeitet ist. I Mat.: auf Leinwand Maße: 12 Zoll hoch, 16 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
1790/04/13 HBLIE 0065 D. van Bergen I Eine plaisante Land= und Wasser=Gegend, mit Staffage; sehr schön gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 19 Zoll, breit 26 Zoll Transakt.: Verkauft (14 Sch) Käufer: Sieberg 1790/05/20 HBSCN 0243 D.v. Bergen I Die Aussicht eines Kirchdorfs mit Pferden und Figuren. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 21 Zoll Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft ( I M ) Käufer: Ego 1790/08/13 HBBMN 0100 B. v. Bergen I Die Aussicht eines Dorfes, wo die Kirche in der Mitte sehr natürlich vorgestellt, mit Fi-
1800/00/00 FRAN2 0139 Van Bergen (Drick) I Eine Landschaft mit Figuren. Von dieses Meisters besten Zeit. I Mat.: auf Leinwand Maße: 15 Zoll hoch, 21 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Bergen, Dirk van (Kopie nach) 1789/08/00 HNAN 0038 Bergen I Ein Viehstück nach Bergen a. H. [auf Holz] Schw.R.m.g.L. [Schwarzer Rahm mit goldenen LeiGEMÄLDE
281
sten] I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 11 Zoll, Breite 14 Zoll Transakt.: Unbekannt
Bergen, Hans [Nicht identifiziert] 1790/08/25 FRAN 0375 Hans Bergen I Eine Lucretia. I Maße: hoch 11 Zoll, breit 9 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (11 fl) Käufer: Diehl 1793/00/00 NGWID 0473 Hans Bergen I Eine Lucretia in Kniestück mit einem Dolch in ihrer Rechte haltend, von Hans Bergen. I Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 1 Schuh 2 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
Bergen, P.M.V. [Nicht identifiziert] 1790/08/13 HBBMN 0021 P.M. v. Bergen I Auf einem Tische befinden sich eine Menge Fische verschiedener Arten, Früchte, Geschirre, ein Korb mit Austern ec. von besonderer Natur. Auf L[einwand]. S.R.G.L. [Schwarzen Rahm, goldne Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 39 Zoll, breit 49 Zoll Transakt.: Verkauft (1.12 M) Käufer: Tietjen
Bergh, Matthys van den 1776/00/00 WZTRU 0052 Mathias von dem Weeg I Ein Stück 1 Schuhe, 5 Zoll hoch, 1 Schuhe, 8 Zoll breit mit dem Zeichen M.B.VB. welches heisset Mathias von dem Weeg, ein würdiger Discipel des Peter Paul Rubens. Es stellet vor eine bey dem Tische sitzende Frau sammt ihren Mann, welche ihr Mittagmahl zu geniessen beschäftiget ist. Die Art der Malerey, das einfallende Licht, die Verständniß der Coloriten geben David Teniers Geschmack zu erkennen, und überhaupt ist es sehr angenehm gehalten. I Maße: 1 Schuhe 5 Zoll hoch, 1 Schuhe 8 Zoll breit Inschr.: M.B.VB. (monogrammiert) Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "Mathias von dem Weeg", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (25 fl Schätzung) 1776/00/00 WZTRU 0425 Mathias von dem Berge I Ein Stück 1 Schuhe, 4 Zoll hoch, 1 Schuhe, Vi Zoll breit von Mathias von dem Berge, stellet vor einen Weibskopf in flammländischer Tracht und guter Harmonie der Colorit sowohl als angenehmen Schatten und Licht verfertiget. I Pendant zu Nr. 426 von G. Douffet Maße: 1 Schuhe 4 Zoll hoch, 1 Schuhe Vi Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (5 fl Schätzung) 1781/00/00 WZAN 0052 Mathias von dem Weeg I Ein Stück 1 Schuhe, 5 Zoll hoch, 1 Schuhe, 8 Zoll breit, mit dem Zeichen M.B.VB., welches Mathias von dem Weeg, der ein würdiger Schüler des Peter Paul Rubens war, heissen soll: stellet eine bey dem Tische sitzende Frau sammt ihrem Mann vor, welche ihr Mittagmahl zu geniessen beschäftiget sind. Die Art der Malerey, das einfallende Licht, die Verständniß der Koloriten geben David Teniers Geschmack zu erkennen, und es ist überhaupt sehr angenehm gehalten. I Maße: 1 Schuhe 5 Zoll hoch, 1 Schuhe 8 Zoll breit Inschr.: M.B.VB. (monogrammiert) Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "Mathias von dem Weeg", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0425 Mathias von dem Berge I Ein Stück 1 Schuhe, 4 Zoll hoch, 1 Schuhe, Vi Zoll breit, von Mathias von dem Berge, zeiget einen Weibskopf in flammändischer Tracht von und guter Harmonie der Kolorit sowohl, als des angenehmen Schatten und Lichts. I Pendant zu Nr. 426 von G. Douffet Maße: 1 Schuhe 4 Zoll hoch, 1 Schuhe Vi Zoll breit Transakt.: Unbekannt 282
GEMÄLDE
Bergler, Joseph (II) 1799/00/00 WZAN 0289 J. Bergler I Der heilige Franciskus Seraphikus, von J. Bergler. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Vi Zoll breit 2 [?] Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Bergmüller 1765/00/00 FRNGL 0077 Bergmüller I 2 unvergliche [sie] Köpfe. I Transakt.: Unbekannt (10 fl Schätzung) 1777/03/03 AUAN 0016[b] Bergmiller I Zwey Madonna, und Compag. St. Joseph. I Diese Nr.: St. Joseph; Pendant zu Nr. 16[a] von J. Amigoni Maße: Höhe 1 Sch. 8 Vi Zoll, Breite 1 Sch. 4 Zoll Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt 1771/03/03 AUAN 0029 Bergmiller I Zwey St. Peter und St. Paul. I Maße: Höhe 2 Sch. 11 Zoll, Breite 3 Sch. 7 Zoll Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt
Bergmüller, Johann Georg 1797/08/10 MM AN 0298 Georg Berkmüller I Gegenstücke, auf dem ersten die allerh. Jungfrau, auf dem anderen die H. Catharina. Vom Georg Berkmüller auf Tuch. I Diese Nr.: Ein Gegenstück, auf dem ersten die allerh. Jungfrau; Pendant zu Nr. 299 Anm.: Die Lose 298 und 299 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (110 fl für die Nrn. 298 und 299, Schätzung) 1797/08/10 MMAN 0299 Georg Berkmüller I Gegenstücke, auf dem ersten die allerh. Jungfrau, auf dem anderen die H. Catharina. Vom Georg Berkmüller auf Tuch. I Diese Nr.: Ein Gegenstück, auf dem andern die H. Catharina; Pendant zu Nr. 298 Anm.: Die Lose 298 und 299 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (110 fl für die Nrn. 298 und 299, Schätzung) 1800/01/00 LZAN [A]0005 Joh. Georg Bergmüller \ Die heil. Catharina mit einigen Engeln und der Religion umgeben; erstere tritt die Ketzerei unter ihre Füsse. I Pendant zu Nr. [A]6 Maße: Höhe 2 Fuß 2 Zoll, Breite 1 Fuß 6 Zoll Verkäufer: A F Oeser Transakt.: Unbekannt 1800/01/00 LZAN [A]0006 Joh. Georg Bergmüller iDerCompagnon. Von gleicher Grösse. Ein Schutzengel, welcher einen Wanderer zur Religion und Glückseligkeit führt, die durch allegorische Figuren vorgestellt sind. Beide Gemälde sind von den besten Arbeiten dieses Mstrs. [Joh. Georg. Bergmüller]. I Pendant zu Nr. [A]5 Maße: Höhe 2 Fuß 2 Zoll, Breite 1 Fuß 6 Zoll Verkäufer: A F Oeser Transakt.: Unbekannt
Berichau, Heinrich 1747/04/06 HB AN 0054 Berckau I Zwey länglichte Blumen= Stücke von Berckau ohne Rahmen. I Diese Nr.: Ein länglichtes Blumen=Stück Maße: 2 Fuß 3 Zoll Breite und 4 Fuß 4 Zoll Höhe Anm.: Die Lose 54 und 55 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Brockes Transakt.: Unbekannt (4.4 für die Nm. 54 und 55) 1747/04/06 HB AN 0055 Berckau I Zwey länglichte Blumen= Stücke von Berckau ohne Rahmen. I Diese Nr.: Ein länglichtes Blumen=Stück Maße: 2 Fuß 3 Zoll Breite und 4 Fuß 4 Zoll Höhe Anm.: Die Lose 54 und 55 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Brockes Transakt.: Unbekannt (4.4 für die Nrn. 54 und 55) 1747/04/06 HB AN 0073 Berckau I Ein groß Blumen=Stücke von Berckau, ohne Rahmen. I Maße: 2 Fuß 10 Zoll Breite und 3 Fuß 10 Zoll Höhe Verkäufer: Brockes Transakt.: Unbekannt (5.8)
1747/04/06 HB AN 0075 Berckau I Noch 2 Blumen=Stücke von Berckau. I Diese Nr.: Ein Blumen=Stück Maße: 2 Fuß 1 Zoll Breite und 3 Fuß 8 Zoll Höhe Anm.: Die Lose 75 und 76 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Brockes Transakt.: Unbekannt (6.4 für die Nrn. 75 und 76) 1747/04/06 HB AN 0076 Berckau I Noch 2 Blumen=Stücke von Berckau. I Diese Nr.: Ein Blumen=Stück Maße: 2 Fuß 1 Zoll Breite und 3 Fuß 8 Zoll Höhe Anm.: Die Lose 75 und 76 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Brockes Transakt.: Unbekannt (6.4 für die Nrn. 75 und 76) 1749/07/31
HBRAD
0048
Berkau I Ein dergleichen [Bluhmen=
Stück]. I Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (4.8) 1749/07/31 HBRAD 0101 Berkau I Zwey Bluhmen=Stücke. I Diese Nr.: Ein Bluhmen=Stück Anm.: Die Lose 101 und 102 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (4.4 für die Nrn. 101 und 102) 1749/07/31 HBRAD 0102 Berkau I Zwey Bluhmen=Stücke. I Diese Nr.: Ein Bluhmen=Stück Anm.: Die Lose 101 und 102 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (4.4 für die Nrn. 101 und 102) 1773/12/18 HBBOY 0025 Berkau I Zwo kleine Blumen=Stükke. Ungemein schön. I Diese Nr.: Ein kleines Blumen=Stück Anm.: Die Lose 25 und 26 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1773/12/18 HBBOY 0026 Berkau I Zwo kleine Blumen=Stükke. Ungemein schön. I Diese Nr.: Ein kleines Blumen=Stück Anm.: Die Lose 25 und 26 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1774/03/28 HBBMN 0062 Berckau I Zwey große Blumen= Stücke, mit schwarzen Rahmen und verguldeten Leisten. I Diese Nr.: Ein großes Blumen=Stück Maße: Höhe 3 Fuß 9 Zoll, Breite 2 Fuß 11 Zoll Anm.: Die Lose 62 und 63 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1774/03/28 HBBMN 0063 Berckau I Zwey große Blumen= Stücke, mit schwarzen Rahmen und verguldeten Leisten. I Diese Nr.: Ein großes Blumen=Stück Maße: Höhe 3 Fuß 9 Zoll, Breite 2 Fuß 11 Zoll Anm.: Die Lose 62 und 63 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1775/02/25 HBBMN Transakt.: Unbekannt
0038
Berkau I Ein Blumen=Stück. I
1775/10/07 HBBMN Transakt.: Unbekannt
0048
Bercau I Ein Blumen=Stück. I
1776/06/21 HB NEU 0077 Berkau I Die Flora, auf Leinw. Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 F 8 Z, Breite 2 F Transakt.: Verkauft (1.4 M) Käufer: W J[unior] 1778/03/28 HBSCM akt.: Unbekannt
0102
Berkau i Ein Blumenstück. I Trans-
1782/07/00 FRAN 0069 Η. Berichou I Die Königin Sophonisba, wie sie den Giftbecher getrunken hat, sehr natürlich vorgestellt von H. Berichou, 1696. I Maße: 2 Schuh 9 Zoll hoch, 2 Schuh 5 Zoll breit Inschr.: 1696 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] fl) 1785/12/03 HBBMN 0016 Berkau I Ein Blumen=Stück, von Berkau, mit dito [schwarzen] Rahm. I Transakt.: Unbekannt 1785/12/03 HBBMN 0057 Berkau I Zwey Blumen=Stücke. I Diese Nr.: Ein Blumen=Stück Anm.: Die Lose 57 und 58 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1785/12/03 HBBMN 0058 Berkau I Zwey Blumen=Stücke. I Diese Nr.: Ein Blumen=Stück Anm.: Die Lose 57 und 58 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1786/04/21 HBTEX 0114 Berkau I Zwey Blumen=Stücke. I Diese Nr.: Ein Blumen=Stück Anm.: Die Lose 114 und 115 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/04/21 HBTEX 0115 Berkau I Zwey Blumen=Stücke. I Diese Nr.: Ein Blumen=Stück Anm.: Die Lose 114 und 115 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1787/00/00 HB AN 0476 Bercau I Verschiedene Blumen und Kräuter in einem irdenen Topfe auf einem steinernen Tische. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 28 Zoll, breit 23 Zoll Transakt.: Verkauft (3 M) 1787/00/00 HB AN 0645 Bercau I Eine Versammlung der Götter, als ein Platfond vorgestellt. Jupiter sitzt mitten in den Wolken, und ihm zur Seite die Juno; neben dieser befindet sich Pallas. Mercur kömmt von oben, und spricht mit Jupiter. Um diese Gruppe sind alle andere Gottheiten. In einer Ovale gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Leinwand Format: oval Maße: Hoch 23 Vi Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Verkauft ( 1 1 M ) Käufer: Schoen 1787/03/01 HBLOT 0076 Bercan I Zwey Blumenstücke. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Anm.: Die Lose 76 und 77 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1787/03/01 HBLOT 0077 Bercan I Zwey Blumenstücke. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Anm.: Die Lose 76 und 77 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1787/04/19 HBTEX 0060 Berckau I Ein kleines Blumen= Stück. I Transakt.: Verkauft (2.12 M) Käufer: Sieberg 1788/08/21 HBRMS 0127 Berceaux I Vier ovale Blumen=Stükke. Auf Leinewand, ohne Rahmen. I Diese Nr.: Ein ovales Blumen= Stück Mat.: auf Leinwand Format: oval Maße: Hoch 48 Zoll, breit 36 Zoll Anm.: Die Lose 127 bis 130 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1788/08/21 HBRMS 0128 Berceaux I Vier ovale Blumen=Stükke. Auf Leinewand, ohne Rahmen. I Diese Nr.: Ein ovales Blumen= Stück Mat.: auf Leinwand Format: oval Maße: Hoch 48 Zoll, breit 36 Zoll Anm.: Die Lose 127 bis 130 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1788/08/21 HBRMS 0129 Berceaux I Vier ovale Blumen=Stükke. Auf Leinewand, ohne Rahmen. I Diese Nr.: Ein ovales Blumen= Stück Mat.: auf Leinwand Format: oval Maße: Hoch 48 Zoll, breit 36 Zoll Anm.: Die Lose 127 bis 130 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1788/08/21 HBRMS 0130 Berceaux: I Vier ovale Blumen=Stükke. Auf Leinewand, ohne Rahmen. I Diese Nr.: Ein ovales Blumen= Stück Mat.: auf Leinwand Format: oval Maße: Hoch 48 Zoll, breit 36 Zoll Anm.: Die Lose 127 bis 130 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1790/09/10 HBBMN 0076 H. Bercke I Auf einem Tische stehet eine en Basrelief gezierte Vase mit sehr vielen Blumen, besonders fleißig gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Zoll, breit 6 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (14 Sch) Käufer: Ego 1792/04/19 HBBMN 0166 H. Berckau I Einige nach der Natur sehr fleißig gemahlte Blumen, in einer en Basrelief verzierten Vase, von H. Berckau. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 Vi Zoll, breit 5 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1792/09/07 HBBMN 0146 Berckeau I Zwey dreist gemahlte Blumenstücke, von Berckeau. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Ein dreist gemahltes Blumenstück Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 146 und 147 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (2M)
1792/09/07 HBBMN 0147 Berckeau I Zwey dreist gemahlte Blumenstücke, von Berckeau. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Ein dreist gemahltes Blumenstück Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose GEMÄLDE
283
(2 M )
146 und 147 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Fuß 5 Zoll breit Anm.: Die Lose 127 und 128 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1795/03/12 HBSDT 0085 H. Berichau I Zwey schön gemahlte Blumenstücke. Auf Leinwand, im schwarzen Rahm. I Diese Nr.: Ein schön gemahltes Blumenstück Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 36 Zoll, breit 24 Zoll Anm.: Die Lose 85 und 86 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1798/01/19 HBPAK 0128 Berckow I Zwey ovale Blumenstükke. 1 Fuß 11 Zoll hoch, 1 Fuß 5 Zoll breit. Gold. Rahm. I Diese Nr.: Ein ovales Blumenstück Format: oval Maße: 1 Fuß 11 Zoll hoch, 1 Fuß 5 Zoll breit Anm.: Die Lose 127 und 128 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1795/03/12 HBSDT 0086 H. Berichau I Zwey schön gemahlte Blumenstücke. Auf Leinwand, im schwarzen Rahm. I Diese Nr.: Ein schön gemahltes Blumenstück Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 36 Zoll, breit 24 Zoll Anm.: Die Lose 85 und 86 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1798/01/19 HBPAK 0151 Berkow] Ein Blumenstück. 3 Fuß 3 Zoll hoch, 3 Fuß 10 Zoll breit. Auf Leinwand, goldn. Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: 3 Fuß 3 Zoll hoch, 3 Fuß 10 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
1795/03/12 HBSDT 0211 Berckow \ Ein Frauens=Portrait mit einem Blumen=Korb. I Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0012 Berckau I Ein Gefäß mit vielen sehr meisterhaft gemahlten Blumen. I Maße: Hoch 47 Zoll, breit 33 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0036 Barckau I Ein Korb mit Blumen auf einem Tische. Schön und practisch gemahlt. I Maße: Hoch 21 Zoll, breit 27 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0073 Berckau I Ein Glas mit vielen Blumen und Blüthen auf einem Tische; practisch und meisterhaft gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 21 Zoll, breit 14 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/09/08
HBPAK
0079
Berckau
1796/09/08 HBPAK 0080 Berckau I Zwey Vasen mit angefüllten Blumen. Fleißig gemahlt; in Wasser und unter Glas. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine Vase mit angefüllten Blumen Maße: Hoch 15 Zoll, breit 11 Vi Zoll Anm.: Die Lose 79 und 80 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0171 Berckau I Ein Korb mit verschiedenen Blumen auf einem Tische. I Maße: Hoch 31 Zoll, breit 26 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0208 Berkau I Zwey Blumenstücke. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Anm.: Die Lose 208 und 209 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0209 Berkau \ Zwey Blumenstücke. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Anm.: Dieses Los trägt im Katalog irrtümlicherweise die Nr. 109. Die Lose 208 und 209 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 0210
Berkau I Ein Blumenstück. I Trans-
1798/01/19 HBPAK 0121 Berkow I Zwey Stücke. Ein Stilleben, wo auf einem Tisch ein Glas Blumen stehen. 1 Fuß 10 Zoll hoch, 1 Fuß 6 Zoll breit. Auf Leinwand, schw. Rahm mit goldn. Leist. I Diese Nr.: Ein Stilleben, wo auf einem Tisch ein Glas Blumen stehen Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 10 Zoll hoch, 1 Fuß 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 121 und 122 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/01/19 HBPAK 0122 Berkow I Zwey Stücke. Ein Stilleben, wo auf einem Tisch ein Glas Blumen stehen. 1 Fuß 10 Zoll hoch, 1 Fuß 6 Zoll breit. Auf Leinwand, schw. Rahm mit goldn. Leist. I Diese Nr.: Ein Stück Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 10 Zoll hoch, 1 Fuß 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 121 und 122 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/01/19 HBPAK 0127 Berckow I Zwey ovale Blumenstükke. 1 Fuß 11 Zoll hoch, 1 Fuß 5 Zoll breit. Gold. Rahm. I Diese Nr.: Ein ovales Blumenstück Format: oval Maße: 1 Fuß 11 Zoll hoch, 1 284
GEMÄLDE
1798/01/19 HBPAK 0162 Berkow I Ein Blumenstück. 1 Fuß 9 Zoll hoch, 1 Fuß 7 Zoll breit. Auf Holz, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 9 Zoll hoch, 1 Fuß 7 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0060 Berkau I Eine Skizze des jüngsten Gerichts, wovon das ausgeführte Gemähide sich in der Bremer Domskirche befindet. Auf Leinwand, schw. Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll, breit 36 Zoll Transakt.: Unbekannt
I Z w e y Vasen mit angefüll-
ten Blumen. Fleißig gemahlt; in Wasser und unter Glas. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine Vase mit angefüllten Blumen Maße: Hoch 15 Zoll, breit 11 Vi Zoll Anm.: Die Lose 79 und 80 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1796/12/07 HBPAK akt.: Unbekannt
1798/01/19 HBPAK 0157 Berkow I Ein Glas mit verschiedenen Blumen. Ganz gut und kräftig gemahlt. 1 Fuß 9 Zoll hoch, 1 Fuß 3 Zoll breit. Auf Holz, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Mat. : auf Holz Maße: 1 Fuß 9 Zoll hoch, 1 Fuß 3 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
1800/11/12 HBPAK 0479 Transakt.: Unbekannt
Bercau \ Zwey Blumenstücke. I
1800/11/12 HBPAK 0559 Transakt.: Unbekannt
Bercau I Zwey Blumenstücke. I
Berkim, B.B. [Nicht identifiziert] 1781/05/07 FRHUS 0038 B.B. Berkim I Eine meisterhafte niederländische Landschaft mit einem alten Thum und einem Dorf in Prospect, das schöne Vieh und die nackende darauf vorkommende Figuren nehmen sich besonders gut dabey aus, bezeichnet B.B. Berkim. I Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch und 2 Schuh 3 Zoll breit Inschr.: B.B. Berkim (bezeichnet) Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (22.4 fl) Käufer: Küstner
Bermit [Nicht identifiziert] 1789/06/12 HBTEX 0052 Bermit I Zwey Land= und Wasserprospecte, auf Holz. I Diese Nr.: Ein Land= und Wasserprospect Mat.: auf Holz Maße: Hoch 3 Vi Zoll, breit 4 % Zoll Anm.: Die Lose 52 und 53 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (3.8 M) 1789/06/12 HBTEX 0053 Bermit I Zwey Land= und Wasserprospecte, auf Holz. I Diese Nr.: Ein Land= und Wasserprospect Mat.: auf Holz Maße: Hoch 3 Vi Zoll, breit 4 % Zoll Anm.: Die Lose 52 und 53 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (3.8 M)
Bernaerts, Nicasius 1742/08/01 BOAN 0369 Nicasio I Eine grosse Landschafft mit Flügel-Werck. Orig. von Nicasio. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0164 Nicasio I Grand Pai'sage avec oiseaux, par Nicasio. I Maße: Haut 6. pies, large 9. pi6s 8. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt
Bernard 1796/02/17 HBPAK 0012 Bernard I Eine sich schalkhaft umsehende junge Schöne, liebkost ihr weisses Täubchen, welches sie an ihre entblösste Brust hält. Auf Leinwand. Halbe Figur, beynahe Lebensgrösse. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 35 Zoll, Breite 27 Zoll Transakt.: Verkauft (515 M) Käufer: Τ
und Joseph stehet in einiger Entfernung. Der Hintergrund in diesem Gemähide ist eine Landschaft. Zeichnung, Colorit und Haltung sind schön darinn. [Text hier gekürzt] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 6 Zoll hoch, 1 Fuß breit Verkäufer: Johann Gottlieb Stein Transakt.: Unbekannt
1796/02/17 HBPAK 0215 Bernard I Ein italienischer Canal mit Castel und steinernen Brücke. Zur Linken, im Vordergründe, steht ein Thurm=Gebäude. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 12 Vi Zoll, Breite 16 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (11M) Käufer: Kreuter [und] Τ
1764/05/21 BOAN 0045 Nicolo Berretoni I Un Tableau d'un pied dix pouces de hauteur, d'un pied quatre pouces de largeur, representant l'Assomption de la Vierge, peinte par Nicolo Berretoni. [Ein stück Vorstellend die himmelfahrte Maria gemahlt von Nicoiao Perrettoni.] I Maße: 1 pied 10 pouces de hauteur, 1 pied 4 pouces de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (17 Rt) Käufer: Frantzen
Bernardi, Giovanni Battista
Bertin, Nicolas
1799/00/00 WZAN 0124 Johann Bapt. Bernardi I Allerley todte Fische, von Johann Bapt. Bernardi. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 9 Zoll breit 3 Schuh Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1768/07/00 MUAN 0589 Bertin (Nicolaus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
Bernardini, Francesco 1779/09/27 FRNGL 0152 Bemardiny \ Die Rückkehr des verlomen Sohns zu seinem Vater. [L'enfant prodigue retournant chez son pere.] I Maße: 3 Schuh 7 Zoll hoch, 2 Schuh breit Transakt.: Verkauft (8 fl) Käufer: Rath Ehrenreich 1788/09/01 KOAN 0555 Bernardini I Ein Mutter Gottes Kopf, [une tete de la Ste Vierge.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 2 Zoll, Breite 10 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt
Berner 1786/05/12 HBTEX 0018 Berner I Ein Fürstlich FamilienStück, die erste Epoche stark gemahlt, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 11 Zoll, breit 9 Zoll Anm.: Dieses Los wurde zusammen mit der Nr. 49 (H. Leichner) verkauft. Transakt.: Verkauft (14 Sch für die Nrn. 18 und 49) Käufer: Schoen
Bernini, Gian Lorenzo 1788/09/01 KOAN 0552 Bemini I Ein Kopf, [une tete.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 2 Zoll, Breite 1 Fuß Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt
Bernken, Magdalena [Nicht identifiziert] 1775/05/08 HBPLK 0116 Magdalena Bernken I Magdalena Bernken und Madame Terbusch, auf Leinewand, beyde von ihnen selbst gemahlt. I Diese Nr.: Magdalena Bernken Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 16 Zoll 6 Linie, Breite 13 Zoll 1 Linie Anm.: Die Lose 116 und 117 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Berr, de [Nicht identifiziert] 1788/09/01 KOAN 0089 de Berr I Herr und 1 Frauenzimmer, von de Berr. [1 p[iece]. un Sieur, & un demoiselle, de Deberr.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 3 Fuß 7 Zoll, Breite 5 Fuß Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt
1768/07/00 MUAN 0590 Bertin (Nicolaus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0591 Bertin (Nicolaus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0592 Bertin (Nicolaus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1138 Bertin (Nicolaus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0319 Bertin (Nicolas) I Hercule qui a vaincu dans deux combats le geant Antee. Marque du No.592. [toutes ces quatre pieces peintes sur toile]. I Mat.: auf Leinwand Maße: 3. p. 4 p. de haut sur 4. p. 3. p. de large Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 322 und beziehen sich auf die Nrn. 319 bis 322. Verkäufer: Francis Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0320 Bertin (Nicolas) I Neptune promene sur la mer, Venus & Cupidon. Marque du No. 590. [toutes ces quatre pieces peintes sur toile]. I Mat.: auf Leinwand Maße: 3. p. 4 p. de haut sur 4. p. 3. p. de large Anm.: Die Angaben in eckigen Klammem im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 322 und beziehen sich auf die Nrn. 319 bis 322. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt
Berrettoni, Niccolö
1769/00/00 MUAN 0321 Bertin (Nicolas) I Junon jalouse de Io. Marque du No. 589. [toutes ces quatre pieces peintes sur toile]. I Mat.: auf Leinwand Maße: 3. p. 4 p. de haut sur 4. p. 3. p. de large Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 322 und beziehen sich auf die Nrn. 319 bis 322. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt
1763/00/00 BLAN 0005 Nicolas Berettoni \ Die Ruhe auf der Flucht nach Egypten. Ganze Figuren, auf Leinewand gemahlt, 1 Fuß 6 Zoll hoch, und 1 Fuß breit. Maria sitzt und hat das Kind Jesus auf dem Schooße, welchem ein Engel einen Korb mit Blumen reichet;
1769/00/00 MUAN 0322 Bertin (Nicolas) I Pluton enleve Europe. Marque du No. 591. toutes ces quatre pieces peintes sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: 3. p. 4 p. de haut sur 4. p. 3. p. de large Anm.: Die Angaben zum Material im Bildtitel beziehen sich auf die GEMÄLDE
285
Nrn. 319 bis 322. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 LZRCH 0079 Bertin I Promethee attache au Rochet, peint avec facilite. I Mat.: auf Holz Maße: h. 12.1. 10. pouces Verkäufer: J F Rauch Transakt.: Unbekannt 1799/10/18 LZAN 0062 Bertin I Zwey Figuren, das Sujet ist aus der römischen Geschichte; hoch 34 Zoll, breit 39 Zoll. Auf Leinwand, ohne Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 34 Zoll, breit 39 Zoll Verkäufer: Rauch Transakt.: Verkauft (4 Th) Käufer: Schwarz
Beschai, Corneille [Nicht identifiziert] 1750/00/00 KOAN 0029 Corneille Beschai I Une sainte Familie, sur bois, joliment & delicatement peint par Corneille Beschai. I Mat.: auf Holz Maße: Largeur 10 Pouces, Haut 13 Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt
Beschey, Balthasar 1764/03/12 FRKAL 0006 Beschey I Un port de mer d'Italie rempli de figures & delicatement peint. I Maße: hauteur 8 Vi pouces, largeur 11 pouces Transakt.: Verkauft (20.30 fl) Käufer: R Ehrenreich 1764/05/30 BOAN 0389 Bejez I Un Tableau de deux pieds de hauteur, d'un pied six pouces de largeur, representant le bon Dieu avec ses disciples appellants les enfants, peints par Bejez. [Ein stück Vorstellend Christum mit seinen Jüngeren, so die Kindern zu sich berufet, gemahlt von Pejetz.] I Maße: 2 pieds de hauteur, 1 pied 6 pouces de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (40 Rt) Käufer: Broggia 1765/00/00 FRRAU 0100 Balthasar Beschey I Wie der Heyland mit seinen Jüngern die Kinder zu sich ruffet. Das gantze Bild ist zum sprechen gemahlt, und hat viel Genie und Gusto von dem Ritter van der Werff im Colorit; was aber die Zeichnung betrifft, so ist solche im Geschmack von Rubens. Representant notre Sauveur qui commande aux enfans de venir ä lui. II ne manque ä tout ce tableau, que la parole & a dans le coloris beaucoup de genie & du goüt du chevalier Van der Werff; mais quant au dessein, il est dans le goüt de Ruben. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 2 Schuh, breit 1 Schuh 6 Zoll Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0133 Beschey] Unmorceaurepresentant Tomiris, qui fait voir ä plusieurs personnes assemblees, la tete de Cyrus, qui est dans un vaisseau rempli de sang. [Peints sur cuivre, marques des N o s 397. & 398.] I Pendant zu Nr. 134 Mai.: auf Kupfer Maße: 1. p. 3. p. de haut sur 1. p. 7. p. de large. Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 134 und beziehen sich auf die Nrn. 133 und 134. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0134 Beschey I Le Compagnon represente Herode assis ä table, & Herodias vient lui aporter dans un plat la tete de saint Jean Baptiste. Peints sur cuivre, marques des N o s 397. & 398. I Pendant zu Nr. 133 Mat.: auf Kupfer Maße: 1. p. 3. p. de haut sur 1. p. 7. p. de large. Anm.: Die Angaben zum Material im Bildtitel beziehen sich auf die Nrn. 133 und 134. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt
ques des N o s 37. & 38. I Diese Nr.: Un Paysage, avec de tres belles figures Mat.: auf Kupfer Maße: 10 Vi. pouces de haut sur 1. p. 1. p. de large Anm.: Die Lose 181 und 182 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0183 Beschey \ Elevation de la croix aprfs que Jesus Christ y est attache. Peinte sur bois marquee du No. 120. I Mat.: auf Holz Maße: 1. p. 6. p. de haut sur 1. p. 1 Vi. p. de large Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0202 Beshey I Deux Paysages avec figures, dans le gout du dessein. Peints sur bois, marques des Ν os 432. & 433. I Diese Nr.: Un Paysage avec figures, dans le gout du dessein Mat.: auf Holz Maße: 1. p. 1. p. de haut sur 1. p. 1 %. p. de large Anm.: Die Lose 202 und 203 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0203 Beshey I Deux Paysages avec figures, dans le gout du dessein. Peints sur bois, marques des Ν os 432. & 433. I Diese Nr.: Un Paysage avec figures, dans le gout du dessein Mat.: auf Holz Maße: 1. p. 1. p. de haut sur 1. p. 1 %. p. de large Anm.: Die Lose 202 und 203 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1775/05/08 HBPLK 0103 Beschey I Bacchus belauscht die Venus im Schlaf; dessen Compagnon, wie Bacchus die Venus mit Sternen krönen siehet, auf Kupfer gemahlt. I Diese Nr.: Bacchus belauscht die Venus im Schlaf; Pendant zu Nr. 104 Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 9 Zoll 5 Linie, Breite 8 Zoll 4 Linie Anm.: Die Lose 103 und 104 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1775/05/08 HBPLK 0104 Beschey \ Bacchus belauscht die Venus im Schlaf; dessen Compagnon, wie Bacchus die Venus mit Sternen krönen siehet, auf Kupfer gemahlt. I Diese Nr.: Wie Bacchus die Venus mit Sternen krönen siehet; Pendant zu Nr. 103 Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 9 Zoll 5 Linie, Breite 8 Zoll 4 Linie Anm.: Die Lose 103 und 104 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1777/05/26 FRAN 0623 Beshey I Kirch, von Beshey, sehr schön staviert. I Verkäufer: Finsterwalder Transakt.: Verkauft (36.30 fl) Käufer: Zimmer 1778/09/28 FRAN 0334 Beschey \ Ein alter Mann mit einem jungen Knaben. [Un vieillard avec un jeune gargon.] I Maße: 10 Zoll breit, 13 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (51 fl) Käufer: Dr Hartzberg 1778/09/28 FRAN 0340 Beschey I Abraham und sein Sohn Isaac. [Abraham & son fils Isaac.] I Pendant zu Nr. 341 Maße: 1 Schuh breit, 14 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (82 fl für die Nrn. 340 und 341) Käufer: Canonicus Burger 1778/09/28 FRAN 0341 Beschey \ Der Compagnon, Jacob mit seinen Söhnen, von dito [Beschey]. [Le pendant du precedent, Jacob avec ses fils, par le meme [Beschey].] I Pendant zu Nr. 340 Maße: 1 Schuh breit, 14 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (82 fl für die Nrn. 340 und 341) Käufer: Canonicus Burger 1778/09/28 FRAN 0362 Beschey I Eine Landschaft mit einer Windmühle. [Un paysage avec un moulin ä vent.] I Pendant zu Nr. 363 Maße: 1 Schuh breit, 10 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (27 fl für die Nrn. 362 und 363) Käufer: Prß ν Dessau
1769/00/00 MUAN 0181 Beschey \ Deux Paysages, avec de tres belles figures, d'apres la maniere de Brüghel. Peints sur cuivre marques des Ν os 37. & 38. I Diese Nr.: Un Paysage, avec de tres belles figures Mat.: auf Kupfer Maße: 10 Vi. pouces de haut sur 1. p. 1. p. de large Anm.: Die Lose 181 und 182 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt
1778/09/28 FRAN 0363 Beschey I Der Compagnon, eine Wiese mit weidendem Vieh, von dito [Beschey]. [Le pendant du precedent, une prairie avec du du [sic] betail päturant, par le meme [Beschey].] I Pendant zu Nr. 362 Maße: 1 Schuh breit, 10 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (27 fl für die Nrn. 362 und 363)
1769/00/00 MUAN 0182 Beschey I Deux Paysages, avec de tres belles figures, d'apres la maniere de Brüghel. Peints sur cuivre mar-
1778/09/28 FRAN 0514 Beschey \ Die vier Jahrszeiten in Landschaften vorgestellt, von Beschey, der Sommer. [Les quatre saisons
286
GEMÄLDE
representees dans des paysages, l'ete par Beschey.] I Maße: 2 Schuh 7 Zoll breit, 1 Schuh 7 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (100 fl für die Nrn. 514-517) Käufer: ν Franckenstein 1778/09/28 FRAN 0515 Beschey I Der Winter, von dito [Beschey], nemliches Maaß. [L'hiver, par le meme [Beschey], meme hauteur & meme largeur.] I Maße: 2 Schuh 7 Zoll breit, 1 Schuh 7 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (100 fl für die Nm. 514-517) Käufer: ν Franckenstein 1778/09/28 FRAN 0516 Beschey I Der Frühling, von dito [Beschey], nemliches Maaß. [Le printems, par le meme [Beschey], meme hauteur & meme largeur.] I Maße: 2 Schuh 7 Zoll breit, 1 Schuh 7 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (100 fl für die Nrn. 514-517) Käufer: ν Franckenstein 1778/09/28 FRAN 0517 Beschey \ Der Herbst, von dito [Beschey], nemliches Maaß. [L'automne, par le meme [Beschey], meme hauteur & meme largeur.] I Maße: 2 Schuh 7 Zoll breit, 1 Schuh 7 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (100 fl für die Nrn. 514-517) Käufer: ν Franckenstein 1778/09/28 FRAN 0659 Beschey I Eine waldigte Landschaft mit vielen Figuren, von Beschey, nemliches Maaß. [Un paysage couvert de bois avec beaucoup de figures, par Beschey, meme hauteur & meme largeur.] I Pendant zu Nr. 660 Maße: 1 Schuh 2 Zoll breit, 10 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (33 fl für die Nm. 659 und 660) Käufer: le Boux 1778/09/28 FRAN 0660 Beschey I Der Compagnon, das nemliche vorstellend [eine waldigte Landschaft mit vielen Figuren], von dito [Beschey]. [Le pendant du precedent, meme objet [un paysage], par le meme maitre [Beschey].] I Pendant zu Nr. 659 Maße: 1 Schuh 2 Zoll breit, 11 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (33 fl für die Nrn. 659 und 660) Käufer: le Boux 1779/09/27 FRNGL 0119 Beschey I Salvator Mundi, sehr angenehm und geistreich abgebildet. [Le Christ, piece excellente.] I Pendant zu Nr. 120 Maße: 7 Zoll hoch, 6 Zoll breit Transakt.: Verkauft (14.30 fl für die Nrn. 119 und 120) Käufer: Lindenlau 1779/09/27 FRNGL 0120 Beschey I Zum Gegenbild die Mutter Gottes, eben so schön und geistreich, von nemlich. Meister [Beschey] und Maas. [Le pendant du precedant, la S. Vierge, meme force, par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 119 Maße: 1 Zoll hoch, 6 Zoll breit Transakt.: Verkauft (14.30 fl für die Nrn. 119 und 120) Käufer: Lindenlau 1779/09/27 FRNGL 0145 Beschey I Der heilige Apostel Petrus, geistreich und fleißig ausgeführt. [S. Pierre, piece superieurement executee.] I Pendant zu Nr. 146 Maße: 7 Zoll hoch, 6 Zoll breit Transakt.: Verkauft (5 fl für die Nrn. 145 und 146) Käufer: Kaufman Maintz
piece], I Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh breit Transakt.: Verkauft (15 fl) Käufer: Wild von Nürnberg 1779/09/27 FRNGL 0341 Beshey I Der Apostel Jacobus, sehr gut und fleißig ausgeführt. [L'apötre S. Jacques, piece tres bein peinte.] I Pendant zu Nr. 342 Maße: 7 Zoll hoch, 6 Zoll breit Transakt.: Verkauft (5.30 fl für die Nm. 341 und 342) Käufer: Kaufman Maintz 1779/09/27 FRNGL 0342 Beshey I Bartholomäus zum Gegenbild, von nemlichem Meister [Beshey] und Maas. [Le pendant du precedant, S. Barthelemy, par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 341 Maße: 1 Zoll hoch, 6 Zoll breit Transakt.: Verkauft (5.30 fl für die Nm. 341 und 342) Käufer: Kaufman Maintz 1779/09/27 FRNGL 0397 Beschey I Der Apostel Matthäus, fleißig ausgearbeitet. [Matthieu l'apötre, piece tres bien peinte.] I Pendant zu Nr. 398 Maße: 7 Zoll hoch, 6 Zoll breit Transakt.: Verkauft (9 fl für die Nm. 397 und 398) Käufer: Kaufman Maintz 1779/09/27 FRNGL 0398 Beschey I Judas Tadäus zum Compagnon, von nemlichem Meister [Beschey] und Maas. [Le pendant du precedant, Judas Thadee, par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 397 Maße: 7 Zoll hoch, 6 Zoll breit Transakt.: Verkauft (9 fl für die Nm. 397 und 398) Käufer: Kaufman Maintz 1779/09/27 FRNGL 0420 Beschey I Die keusche Susanna mit den beyden Aeltesten, fein und fleißig ausgearbeitet. [Susanne avec les deux vieillards, piece tres bein peinte.] I Maße: 1 Schuh 1 Vi Zoll hoch, 10 Zoll breit Transakt.: Verkauft (13.45 fl) Käufer: Mergenbaum Zigelgaß 1779/09/27 FRNGL 0522 Beschey I Eine heilige Familie, schön und fleißig ausgeführt. [La sainte famille, piece tres bien peinte.] I Maße: 1 Schuh 1 Vi Zoll hoch, 10 Zoll breit Transakt.: Verkauft (18.45 fl) Käufer: Mergenbaum Zigelgaß 1779/09/27 FRNGL 0579 Beschey I Der Apostel Jacobus, minor, sehr fein und fleißig ausgeführt. [S. Jacques le Mineur, apötre, tres bonne piece.] I Pendant zu Nr. 580 Maße: 7 Zoll hoch, 6 Zoll breit Transakt.: Verkauft (6 fl für die Nm. 579 und 580) Käufer: Kaufman Maintz 1779/09/27 FRNGL 0580 Beschey \ Der Compagnon, der Apostel Jacobus, major, eben so schön, von nemlichem Meister [Beschey] und Maas. [Le pendant du precedant, S. Jacques le Majeur, apötre, meme beaute, par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 579 Maße: 7 Zoll hoch, 6 Zoll breit Transakt.: Verkauft (6 fl für die Nm. 579 und 580) Käufer: Kaufman Maintz 1779/09/27 FRNGL 0707 Beschey I Der Apostel Matthias, fein und fleißig ausgearbeitet. [S. Matthieu l'apötre, tres belle piece.] I Pendant zu Nr. 708 Maße: 7 Zoll hoch, 6 Zoll breit Transakt.: Verkauft (6 fl für die Nm. 707 und 708) Käufer: Dr Siegler
1779/09/27 FRNGL 0146 Beschey I Zum Compagnon, der Apostel Andreas, eben so schön, von nemlichem Meister [Beschey] und Maas. [Le pendant du precedant, S. Andre, meme beaute, par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 145 Maße: 7 Zoll hoch, 6 Zoll breit Transakt.: Verkauft (5 fl für die Nrn. 145 und 146) Käufer: Kaufman Maintz
1779/09/27 FRNGL 0708 Beschey I Simon zum Compagnon, von nemlichem Meister [Beschey] und Maas. [Le pendant du precedant, S. Simon, par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 707 Maße: 7 Zoll hoch, 6 Zoll breit Transakt.: Verkauft (6 fl für die Nm. 707 und 708) Käufer: Dr Siegler
1779/09/27 FRNGL 0224 Beschey I Der Apostel Paulus, sehr schön und fleißig ausgearbeitet. [S. Paul, piece superieurement bien peinte.] I Pendant zu Nr. 225 Maße: 7 Zoll hoch, 6 Zoll breit Transakt.: Verkauft (8.30 fl für die Nrn. 224 und 225) Käufer: Mund
1781/05/07 FRHUS 0016 bild mit der Weltkugel in der Schuh hoch und 10 Zoll breit Verkauft (5.24 fl für die Nm.
1779/09/27 FRNGL 0225 Beschey I Philippus, als Compagnon zu obigem, von nemlichem Meister [Beschey] und Maas. [Le pendant du precedant, S. Philippe, par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 224, "Der Apostel Paulus" Maße: 1 Zoll hoch, 6 Zoll breit Transakt.: Verkauft (8.30 fl für die Nm. 224 und 225) Käufer: Mund
1781/05/07 FRHUS 0017 Beschey \ Das Gegenbild zu obigem, eine schmerzhafte Mutter Gottes, von nehml. Meister [Beschey] und Maas. I Pendant zu Nr. 16 Maße: 1 Schuh hoch und 10 Zoll breit Verkäufer: Jacob Bemus Transakt.: Verkauft (5.24 fl für die Nm. 16 und 17) Käufer: Dr Siegler
1779/09/27 FRNGL 0288 Beschay I Die Verspottung Christi, sehr fleißig und meisterhaft ausgeführt. [Le Christ insulte, tres belle
1781/05/07 FRHUS 0059 Beschey \ Eine Holl. Magistrats Person, sehr fleissig gemahlt von Beschey. I Maße: 9 Zoll hoch und 8
Beschey \ Ein anmuthiges ChristusHand. I Pendant zu Nr. 17 Maße: 1 Verkäufer: Jacob Bemus Transakt.: 16 und 17) Käufer: Dr Siegler
GEMÄLDE
287
Zoll breit Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (3.2 fl) Käufer: Ehrman 1781/05/07 FRHUS 0119 Beschey I Susanna im Baad, sehr fleissig gemahlt von Beschey. I Pendant zu Nr. 120 Maße: 4 Schuh 2 Zoll hoch und 3 Schuh 5 Zoll breit Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (6.36 fl für die Nrn. 119 und 120) Käufer: Jgf Bernus 1781/05/07 FRHUS 0120 Beschey I Compagnon, die Historie der Batseba, von nehm. Meister [Beschey] und Maas. I Pendant zu Nr. 119 Maße: 4 Schuh 2 Zoll hoch und 3 Schuh 5 Zoll breit Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (6.36 fl für die Nrn. 119 und 120) Käufer: Jgf Bernus 1781/05/07 FRHUS 0262 Beschey \ Ein sehr fleissig Portrait in alter Tracht, im Geschmack des Holbein von Beschey. I Maße: 9 Zoll hoch und 7 Zoll breit Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (3.30 fl) Käufer: Jgf Bernus 1782/03/18 HBTEX 0324 Beschey] Zwey ländliche Gegenden, in welchen sich Bauern mit Kegeln und Bogenschiessen belustigen; im Gusto von Tenier, auf Holz. I Diese Nr.: Eine ländliche Gegend, in welcher sich Bauern mit Kegeln und Bogenschiessen belustigen Mat.: auf Holz Maße: Höhe 11 Zoll 3 Linien, Breite 16 Zoll 6 Linien Anm.: Die Lose 324 und 325 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0325 Beschey I Zwey ländliche Gegenden, in welchen sich Bauern mit Kegeln und Bogenschiessen belustigen; im Gusto von Tenier, auf Holz. I Diese Nr.: Eine ländliche Gegend, in welcher sich Bauern mit Kegeln und Bogenschiessen belustigen Mat.: auf Holz Maße: Höhe 11 Zoll 3 Linien, Breite 16 Zoll 6 Linien Anm.: Die Lose 324 und 325 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/09/30 FRAN 0319 Beschay I Zwo freundliche kleine Landschaften mit artigen Figuren, von Beschay in Breughells Manier verfertigt. [Deux jolis petits paysages avec des belles figures, par Beschay, dans le gout de Breughell.] I Diese Nr.: Eine freundliche kleine Landschaft mit artigen Figuren Maße: 6 Zoll hoch, 6 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 319 und 320 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (5 fl für die Nrn. 319 und 320) Käufer: Breyttingk 1782/09/30 FRAN 0320 Beschay I Zwo freundliche kleine Landschaften mit artigen Figuren, von Beschay in Breughells Manier verfertigt. [Deux jolis petits paysages avec des belles figures, par Beschay, dans le gout de Breughell.] I Diese Nr.: Eine freundliche kleine Landschaft mit artigen Figuren Maße: 6 Zoll hoch, 6 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 319 und 320 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (5 fl für die Nm. 319 und 320) Käufer: Breyttingk 1782/09/30 FRAN 0336 Beschay I Eine kleine Landschaft. [Un petit paysage, par Beschay.] I Maße: 5 Zoll hoch, 6 Vi Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Unbekannt (1.30 fl) 1784/08/02 FRNGL 0097 Beschay I Eine heilige Familie in ovalen Format. I Format: oval Maße: 5 Zoll breit, 4 Zoll hoch Verkäufer: C Transakt.: Verkauft (6 fl) Käufer: von Dessau 1784/08/02 FRNGL 0494 Beschayl Susanna mit denen beyden Aeltesten fleisig ausgearbeitet. I Maße: 10 Zoll breit, 13 % Zoll hoch Transakt.: Verkauft (11.30 fl) Käufer: von Dessau Gegenw. Standort: Dessau, Deutschland. Anhaltische Gemäldegalerie. (630) als Jacob Beschey 1784/08/02 FRNGL 0544 Beschay I Zwey kleine Landschaften mit vielen Figuren, von Beschay im Breughelischen Geschmack. I Diese Nr.: Eine kleine Landschaft mit vielen Figuren Maße: 1 Zoll breit, 5 Vi Zoll hoch Anm.: Die Lose 544 und 545 wurden zusammen katalogisiert. Transakt. : Verkauft (4.15 fl für die Nrn. 544 und 545) Käufer: Leonhard! 288
GEMÄLDE
1784/08/02 FRNGL 0545 Beschay I Zwey kleine Landschaften mit vielen Figuren, von Beschay im Breughelischen Geschmack. I Diese Nr.: Eine kleine Landschaft mit vielen Figuren Maße: 7 Zoll breit, 5 Vi Zoll hoch Anm.: Die Lose 544 und 545 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (4.15 fl für die Nrn. 544 und 545) Käufer: Leonhardi 1785/05/17 MZAN 0051 Beschey I Zwey allegorische Stücke, welche die vier Jahreszeiten vorstellen von Beschey. [Deux pieces allegoriques, qui representent les quatre saisons.] I Diese Nr.: Ein allegorisches Stück, welches zwei der vier Jahreszeiten vorstellt Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 1 Schuh 5 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 51 und 52 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Unverkauft 1785/05/17 MZAN 0052 Beschey I Zwey allegorische Stücke, welche die vier Jahreszeiten vorstellen von Beschey. [Deux pieces allegoriques, qui representent les quatre saisons.] I Diese Nr.: Ein allegorisches Stück, welches zwei der vier Jahreszeiten vorstellt Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 1 Schuh 5 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 51 und 52 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Unverkauft 1785/05/17 MZAN 0053 Beschey I Zwey ovidische Fabelstücke von eben dem Meister [Beschey], [Deux pieces, dont le sujet est pris des Metamorphoses d'Ovide par le meme [Beschey].] I Diese Nr.: Ein ovidisches Fabelstück Maße: 1 Schuh 7 Zoll hoch, 1 Schuh 3 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 53 und 54 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (33 fl für die Nrn. 53 und 54) Käufer: Hofrath ν Leykam 1785/05/17 MZAN 0054 Beschey I Zwey ovidische Fabelstücke von eben dem Meister [Beschey]. [Deux pieces, dont le sujet est pris des Metamorphoses d'Ovide par le meme [Beschey].] I Diese Nr.: Ein ovidisches Fabelstück Maße: 1 Schuh 7 Zoll hoch, 1 Schuh 3 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 53 und 54 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (33 fl für die Nrn. 53 und 54) Käufer: Hofrath ν Leykam 1785/05/17 MZAN 0088 Beschey \ Die Mutter Gottes mit dem Jesukind und einige Heilige von Beschey. [La S. Vierge avec l'enfant Jesus & quelques saints.] I Maße: 1 Schuh 4 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 1 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (42 fl) Käufer: Tit Dom Scholaster Graf von der Leyen 1785/05/17 MZAN 0119 Beschey I Die Mutter Gottes mit dem Jesukind und einige Heilige von Beschey. [La S. Vierge avec l'enfant Jesus & quelques saints.] I Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch, 1 Schuh 4 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (62.30 fl) Käufer: Tit Com ä Leyen 1785/05/17 MZAN 0130 Beschey I Die Sündflut von Beschey. [Le deluge.] I Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch, 2 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (147 fl) Käufer: Leüzgen 1785/05/17 MZAN 0201 Beschey I Der babylonische Thurm von Beschey. [La tour de Babel.] I Maße: 1 Schuh 5 Zoll hoch, 1 Schuh 10 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (118 fl) Käufer: Rath Zumbach 1785/05/17 MZAN 0236 Beschey \ Die Himmelfahrt Mariä von Beschey. [L'assomption de la S. Vierge.] I Maße: 2 Schuh 5 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 7 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (100 fl) Käufer: Rath Zumbach 1785/05/17 MZAN 0305 Beschey I Die sieben Werke der Barmherzigkeit von Beschey. [Les oeuvres de la charite.] I Maße: 1 Schuh 8 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 2 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (115 fl) Käufer: Rmus D Cantor L Β äl Hoheneck 1785/05/17 MZAN 0643 Beschey I Eine Landschaft mit der H. Familie von Beschey. [La S. famille representee dans un paysage.] I
Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch, 2 Schuh 6 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (92.30 fl) Käufer: Becker Glöckner 1785/05/17 MZAN 0762 Beschey I Abraham der den kleinen Isaac liebkoset von Beschey auf Kupfer. [Abraham caressant le petit Isaac.] I Mat.: auf Kupfer Maße: 1 Schuh hoch, 10 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (15.30 fl) Käufer: Geh Rath ν Heüser 1785/05/17 MZAN 0810 Beschey \ Zwey Landschaften, wovon eine den Winter, die andre den Sommer vorstellt von Beschey. [Deux paysages, dont Tun represente l'hiver, l'autre l'ete.] I Diese Nr.: Eine Landschaft, die den Winter vorstellt Maße: 9 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 1 Zoll breit Anm.: Die Lose 810 und 811 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (45.30 fl für die Nm. 810, 811, 990 und 991) Käufer: Rmus D Cantor L Β äl Hoheneck 1785/05/17 MZAN 0811 Beschey \ Zwey Landschaften, wovon eine den Winter, die andre den Sommer vorstellt von Beschey. [Deux paysages, dont Tun represente l'hiver, l'autre l'ete.] I Diese Nr.: Eine Landschaft, die den Sommer vorstellt Maße: 9 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 1 Zoll breit Anm.: Die Lose 810 und 811 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (45.30 fl für die Nrn. 810, 811, 990 und 991) Käufer: Rmus D Cantor L Β äl Hoheneck 1785/05/17 MZAN 0812 Beschey I Die Söhne Jacobs, welche ihrem Vater den blutigen Rock ihres Bruders Joseph zeigen von eben demselben [Beschey]. [Les fils de Jacob montrans ä leur pere la robe ensanglantee de Joseph par le meme [Beschey].] I Pendant zu Nr. 813 Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 10 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (44.30 fl für die Nrn. 812 und 813) Käufer: Strecker 1785/05/17 MZAN 0813 Beschey I Das Gegenbild, Abraham mit seinem Sohne Isaac auf dem Berge Morea vom nämlichen Meister [Beschey], von nämlicher Höhe und Breite. [Le pendant, Abraham avec son fils Isaac sur le mont Moree par le meme [Beschey], meme hauteur & meme largeur.] I Pendant zu Nr. 812 Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 10 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (44.30 fl für die Nrn. 812 und 813) Käufer: Strecker 1785/05/17 MZAN 0990 Beschey I Ein Paar Landschaften, wovon eine den Herbst, die andre den Frühling vorstellt von Beschey. [Deux paysages, dont Tun represente l'automne, et l'autre le printemps.] I Diese Nr.: Eine Landschaft den Herbst vorstellend Maße: 10 Zoll hoch, 1 Schuh Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 990 und 991 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (45.30 fl für die Nrn. 810, 811, 990 und 991) Käufer: Rmus D Cantor L Β äl Hoheneck 1785/05/17 MZAN 0991 Beschey I Ein Paar Landschaften, wovon eine den Herbst, die andre den Frühling vorstellt von Beschey. [Deux paysages, dont l'un represente l'automne, et l'autre le printemps.] I Diese Nr.: Eine Landschaft den Herbst vorstellend Maße: 10 Zoll hoch, 1 Schuh Vi Zoll breit Anm..· Die Lose 990 und 991 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (45.30 fl für die Nm. 810, 811, 990 und 991) Käufer: Rmus D Cantor L Β äl Hoheneck 1785/05/17 MZAN 1042 Beschey I Ein Mädchen und eine Mannsperson in polnischer Kleidung von Beschey. [Une fille & un homme en habit polonois.] I Diese Nr.: Ein Mädchen in polnischer Kleidung Maße: 9 Zoll hoch, 7 Zoll breit Anm.: Die Lose 1042 und 1043 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (12.30 fl für die Nm. 1042 und 1043) Käufer: Becker Glöckner 1785/05/17 MZAN 1043 Beschey I Ein Mädchen und eine Mannsperson in polnischer Kleidung von Beschey. [Une fille & un homme en habit polonois.] I Diese Nr.: Eine Mannsperson in polnischer Kleidung Maße: 9 Zoll hoch, 7 Zoll breit Anm.: Die Lose
1042 und 1043 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (12.30 fl für die Nrn. 1042 und 1043) Käufer: Becker Glöckner 1785/05/17 MZAN 1044 Beschey] Ein Mann in einer Perrucke, wovon das Gegenbild ein Mädchen mit einem Hut vorstellt, von eben demselben [Beschey] und von nämlicher Höhe und Breite. [Un homme perruque & une fille en ayant un chapeau rond sur la tete, par le meme [Beschey] & de la meme hauteur & largeur.] I Diese Nr.: Ein Mann in einer Perrucke; Pendant zu Nr. 1045 Maße: 9 Zoll hoch, 7 Zoll breit Anm.: Die Lose 1044 und 1045 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (9.30 fl für die Nm. 1044 und 1045) Käufer: Strecker 1785/05/17 MZAN 1045 Beschey \ Ein Mann in einer Perrucke, wovon das Gegenbild ein Mädchen mit einem Hut vorstellt, von eben demselben [Beschey] und von nämlicher Höhe und Breite. [Un homme perruque & une fille en ayant un chapeau rond sur la tete, par le meme [Beschey] & de la meme hauteur & largeur.] I Diese Nr.: Ein Mädchen mit einem Hut; Pendant zu Nr. 1044 Maße: 9 Zoll hoch, 7 Zoll breit Anm.: Die Lose 1044 und 1045 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (9.30 fl für die Nm. 1044 und 1045) Käufer: Strecker 1785/05/17 MZAN 1046 Beschey \ Ein Mädchen mit einem Fächer vom nämlichen Meister [Beschey] und von nämlicher Höhe und Breite. [Une fille ayant un eventail dans la main par le meme [Beschey], meme hauteur & meme largeur.] I Maße: 9 Zoll hoch, 7 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (7 fl) Käufer: Schwanck 1785/05/17 MZAN 1088 Beschey \ Ein alter Mann der mit der Brille auf der Nase eine Feder schneidet von Beschey. [Un vieillard ayant des lunettes sur le nez & taillant une plume.] I Maße: 10 Vi Zoll hoch, 8 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (20 fl) Käufer: Winterstein 1785/05/17 MZAN 1089 Beschey I Ein Philosophenkopf von eben demselben [Beschey], [La tete d'un philosophe par le meme [Beschey].] I Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 9 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (11.30 fl) Käufer: Neüss 1785/05/17 MZAN 1125 Beschey I Ein Crucifix von Beschey. [Un Crucifix.] I Maße: 2 Schuh 8 Zoll hoch, 1 Schuh 10 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (20.30 fl) Käufer: Hofr Reüter Senr 1786/10/18 HB TEX 0123 Von Beschey, wie Rubens I Zwey Historien aus dem neuen Testament; fleißig und schön gemahlt. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine Historie aus dem neuen Testament Mat.: auf Holz Maße: Hoch 19 Zoll, breit 15 Zoll Anm.: Die Lose 123 und 124 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/10/18 HB TEX 0124 Von Beschey, wie Rubens I Zwey Historien aus dem neuen Testament; fleißig und schön gemahlt. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine Historie aus dem neuen Testament Mat.: auf Holz Maße: Hoch 19 Zoll, breit 15 Zoll Anm.: Die Lose 123 und 124 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1787/00/00 HB AN 0282 Beschey I Der Betlehemitische Kindermord, von einer großen Menge Figuren. Im Hintergrunde stürzen sich verschiedene Weiber mit ihren Kindern von der Höhe eines Gebäudes herab. Ueberaus fleissig gemahlt. A.K. [Auf Kupfer] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 11 Vi Zoll, breit 17 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (260 M) Käufer: Fesser 1787/10/06 HBTEX 0122 Beschehey I Nessus und Dejanire, von Beschehey, mit dito [vergoldeten] Rahm. I Transakt.: Unbekannt 1788/10/01 FRAN 0049 Balthasar Beschey I Zwey betende Einsiedler in ihren Cellen. I Maße: 8 Zoll hoch, 7 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (6 fl) Käufer: Spitalmeister GEMÄLDE
289
1788/10/01 FRAN 0094 Baltasar Bescheyl Ein unvergleichlich kleines allegorisches Gemälde von großer Composition, und ausnehmend ausgeführt von Baltasar Beschey. I Maße: 8 Vi Zoll hoch, 10 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (26 fl) Käufer: Spitalmeister 1788/10/01 FRAN 0153 Beschey I Die heilige Familie, von Beschey sehr schön und fleißig. I Maße: 13 Vi Zoll hoch, 10 Zoll breit Transakt.: Verkauft (12.15 fl) Käufer: Trautman 1789/04/16 HBTEX 0104 Bechey I Nessus und Dejanina [sie] in einer bergigten Gegend; von plaisanten Colorit und sanfter Mahlerey, auf Leinew. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 14 Zoll, breit 10 Zoll Transakt.: Verkauft (3.10 M) Käufer: Engel 1789/06/06 HBPAK 0003 Bechey I Maria mit dem Christkinde und Joseph, umgeben von Elisabeth, Johannes, ec. In einer Landschaft; sehr schön und mit vielem Fleiß gemahlt, auf Leinew. ohne R[ahm]. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll, breit 28 Zoll Transakt.: Verkauft (11M) Käufer: Ruprecht 1789/06/12 HBTEX 0122 Bechey \ Die heilige Familie in einer Landschaft. Sehr fleißig gemahlt, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 35 Zoll, breit 28 Zoll Transakt.: Verkauft (2.8 M) Käufer: Bertheau 1789/08/18 HB GOV 0019 Bescheyl Zwey holländische Dorf= Gegenden mit Land=Leuten, im Geschmack wie David Tenier. I Diese Nr.: Eine holländische Dorf=Gegend mit Land=Leuten Maße: Hoch 16 Zoll, breit 25 Zoll Anm.: Die Lose 19 und 20 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1789/08/18 HB GOV 0020 Beschey I Zwey holländische Dorf= Gegenden mit Land=Leuten, im Geschmack wie David Tenier. I Diese Nr.: Eine holländische Dorf=Gegend mit Land=Leuten Maße: Hoch 16 Zoll, breit 25 Zoll Anm.: Die Lose 19 und 20 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1790/04/13 HBLIE 0085 Beschey I Bachus wird von Bachanten geführt, mit mehreren Nebenfiguren, in einer plaisanten Gegend; mit vielem Fleiß ausgeführt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Vi Zoll, breit 29 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (1.4 M) Käufer: Eckhardt 1790/08/25 FRAN 0054 Beschai I Der Apostel Petrus. I Maße: hoch 8 Zoll, breit 6 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (1 fl) Käufer: Kaller 1791/09/26 FRAN 0238 Beschey I Zwey kleine fleißige Landschaften. I Diese Nr.: Eine kleine fleißige Landschaft Maße: 6 Zoll hoch, 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 238 und 239 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0239 Bescheyl Zwey kleine fleißige Landschaften. I Diese Nr.: Eine kleine fleißige Landschaft Maße: 6 Zoll hoch, 6 Zoll breit Anm..· Die Lose 238 und 239 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0253 Pechey I Wie die keusche Susanna von den beyden Alten im Bade überrascht wird, von Pechey. I Maße: 2 Schuh hoch, 1 Schuh 8 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0131 Beschey I Christus spricht mit Nicodemus bei Nacht. Sie sitzen an einem Tische worauf ein Buch liegt. Bey Licht vorgestellt. Halbe Figur. Ausführlich gemalt von Beschey. I Maße: Hoch 11 Zoll, breit 14 Zoll Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 FGAN [B]0108 Bachai I Zwey Kopfstücke, Weib und Mann, auf Holz gemalt. I Mat.: auf Holz Maße: 8 Zoll hoch, 6 Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt (12 fl) 1794/09/00 LGAN 0025 Beschey I Zwei herrlich stafirte Landschaften von Beschey, auf Kupfer, in modern verguldten Rahmen. I 290
GEMÄLDE
Mat.: auf Kupfer Maße: breit 1 Schuh 3 Zoll, hoch 1 Schuh Verkäufer: [Friedrich Karl Ludwig, Freiherr von Moser] Transakt.: Unbekannt (300 rh fl Schätzung) 1796/00/00 BSAN 0024 Balthazar Beschey l Une fuite en Egypte. La Vierge est assise ä l'ombre d'un bosquet, tient l'enfant Jesus qui se penche, pour prendre une guirlande que lui apporte le petit Saint Jean. Joseph appuye sur un roc, tient un livre ouvert, et regarde un Ange qui fait paitre l'ane. Des petits Anges tressent des couronnes, apportent des corbeilles de fleurs, et volent en tenant des bouquets; Tun d'eux est monte sur l'agneau de St. Jean. Un lointain d'arbres, et des montagnes. Les figures sont de la plus belle carnation. Surtout la tete de la Vierge et celle de St. Joseph sont d'un fini precieux. II regne une grande fraicheur dans les details. Sur le tableau est ecrit: B. Beschey. I Mat.: auf Holz Maße: Haut de 1 pied 7 pouces; large de 2 pieds 1 pouce Inschr.: B. Beschey (bezeichnet) Verkäufer: Merian l'aine Transakt.: Unbekannt (150) 1796/00/00 HLAN [0026] Beschey I Zwey herrlich staffirte Landschaften v. Beschey. 1 Sch. 1 Sch. 3 Z. auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Sch. 1 Sch. 3 Z. Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: [Friedrich Karl Lang] Transakt.: Unbekannt (222.5 Rt; 400 fl Schätzung) 1796/02/17 HBPAK 0040 Bescheyl ImThaleeineranmuthigen Gegend sitzen bey einer steinernen Gallerie, auf welcher eine hellrothe Decke hängt, zwey Frauenzimmer, wovon die Eine singt und die Andere auf der Zither spielt, indem zwey junge Mannspersonen unbemerkt zu ihnen kommen. Oben auf einer grossen Erdanhöhe, sieht man Waldungen und einige Figuren. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 31 Vi Zoll, Breite 24 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (167 M) Käufer: Koch 1796/02/17 HBPAK 0241 Beschey I Die Himmelfahrt Maria, reich an Figuren. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 16 Zoll, Breite 12 Zoll Transakt.: Unbekannt (70 M) 1797/02/27 HBPAK 0016 Boscheyl Der König David aufm Bette liegend, worauf Krone, Zepter und Schwerdt, welches er seinem Sohne übergiebt. Sehr schön gemahlt. Auf Holz, im goldnen Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0075 Beschei I Eine Landschaft, zur rechten eine egiptische Piramide, darneben ein Schloß, im Vordergrunde Maria mit dem vor ihr in einem Tuche schlafenden Christkinde, neben denen Joseph auf einem Esel; ganz meisterhaft ausgeführt. Auf Leinw., goldene Rahm. I Mat. : auf Leinwand Maße: hoch 19 Zoll, breit 25 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 LZRCH 0093 Beschey I L'apotheose de la vierge, composition de 40 figures d'une touche, legere, et extremement precieuse. I Mat.: auf Holz Maße: h. 17.1. 14. pouces Verkäufer: J F Rauch Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0496 Balthasar Beschey I Die Taufe Christi, von Balthasar Beschey. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 5 Zoll breit 1 Schuh 1 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0683 Balthasar Bescheyl Eine Weibsperson mit einer Hand und eine Mannsperson mit einem Barte und einer Mütze, von Balthasar Beschey. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine Weibsperson mit einer Hand Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 683 und 684 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0684 Balthasar Bescheyl Eine Weibsperson mit einer Hand und eine Mannsperson mit einem Barte und einer Mütze, von Balthasar Beschey. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine Mannsperson mit einem Barte und einer Mütze Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 683 und 684 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1799/12/04 HBPAK 0040 Baschey I An einem grünen Berge sitzt ein Mädchen mit einer alten Wahrsagerin. Schön gemahlt. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 13 Zoll Transakt. : Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0063 v. Boschee I Zwey Stücke mit Landhäusern Auf dem Einen befinden sich Kohlwurzeln ec. Auf dem Andern ein Haase und Grünigkeiten; vor dem Hause amüsiren sich die Herrschaften mit Musik. Auf Holz. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Ein Stück mit Landhäusern Mat. : auf Holz Maße: Hoch 21 Zoll, breit 24 Zoll Anm.: Die Lose 63 und 64 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0064 v. Boschee I Zwey Stücke mit Landhäusern Auf dem Einen befinden sich Kohl wurzeln ec. Auf dem Andern ein Haase und Grünigkeiten; vor dem Hause amüsiren sich die Herrschaften mit Musik. Auf Holz. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Ein Stück mit Landhäusern Mat.: auf Holz Maße: Hoch 21 Zoll, breit 24 Zoll Anm.: Die Lose 63 und 64 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN1 0013 Beskaire (ein Zögling Rubens.) I zwei prächtige Stück, das Eine stellt die keusche Susana vor, wie sie halb Nackend von zwei Alten überfallen wird: das Andere, die Toillette der Venus; Zeichnungen und Colorit sind von aller Schönheit. I Diese Nr.: Die keusche Susana, wie sie halb Nackend von zwei Alten überfallen wird Mat.: auf Kupfer Maße: 14 Zoll hoch, 20 Zoll breit Anm.: Die Lose 13 und 14 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN1 0014 Beskaire (ein Zögling Rubens.) I zwei prächtige Stück, das Eine stellt die keusche Susana vor, wie sie halb Nackend von zwei Alten überfallen wird: das Andere, die Toillette der Venus; Zeichnungen und Colorit sind von aller Schönheit. I Diese Nr.: Die Toillette der Venus Mat.: auf Kupfer Maße: 14 Zoll hoch, 20 Zoll breit Anm.: Die Lose 13 und 14 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Beschey, Balthasar (Kopie von) 1764/05/17 BOAN 0072 Peschay; Van Dyck I Un Tableau de deux pieds deux pouces de largeur & d'un pied dix pouces de hauteur, representant la Vierge avec des Anges, peint par Peschay dans le gout de van Dyck. [Ein stück Vorstellend die Muttergottes mit Vielen Engelen, gemahlt nach van Dyck Von Beschay.] I Kopie von B. Beschey nach Anth. van Dyck Maße: 2 pieds 2 pouces de largeur & 1 pied 10 pouces de hauteur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (37 Rt) Käufer: Beckerin 1764/05/18 BOAN 0073 Peschay; Van Baien I Un dito [Tableau] d'un pied dix pouces de largeur & d'un pied cinq pouces de hauteur, peint par Peschay dans le gout de van Baien. [Ein stück Vorstellend die muttergottes Vielen Engelen nach van Baalen durch Beschay.] I Kopie von B. Beschey nach H. Baien (I) Maße: 1 pied 10 pouces de largeur & 1 pied 5 pouces de hauteur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (96 Rt) Käufer: Beckering 1781/05/07 FRHUS 0206 Beschey; Holbein I Das Bildnis Heinrich des Achten Königs von England, von Beschey nach Holbein. I Kopie von B. Beschey nach H. Holbein (II) Maße: 10 Zoll hoch und 9 Zoll breit Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (4 fl) Käufer: Jgf Bernus 1785/05/17 MZAN 0935 Beschey; Rubens I Die Hirten welche das Jesukind anbeten, und die H. drey Könige welche ihm Weihrauch opfern, beide Stücke von Beschey nach Rubens. [L'adoration des pasteurs, & les trois Rois presentens de l'encens par Beschey d'apres Rubens.] I Diese Nr.: Die Hirten welche das Jesukind anbeten; Kopie von B. Beschey nach Rubens Maße: 1 Schuh 10 Zoll hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Anm.: Die Lose 935 und 936 wurden zu-
sammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (36.30 fl für die Nrn. 935 und 936) Käufer: Hofr ν Leykam 1785/05/17 MZAN 0936 Beschey; Rubens I Die Hirten welche das Jesukind anbeten, und die H. drey Könige welche ihm Weihrauch opfern, beide Stücke von Beschey nach Rubens. [L'adoration des pasteurs, & les trois Rois presentens de l'encens par Beschey d'apres Rubens.] I Diese Nr.: Die H. drey Könige welche dem Jesukind Weihrauch opfern; Kopie von B. Beschey nach Rubens Maße: 1 Schuh 10 Zoll hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Anm.: Die Lose 935 und 936 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (36.30 fl für die Nrn. 935 und 936) Käufer: Hofr ν Leykam 1788/10/01 FRAN 0029 Β. Beschey; Rubens I Die Bekehrung Pauli, von B. Beschey nach Rubens, 17 Zoll hoch, 25 Zoll breit, auf Kupfer. Dieses Gemälde, ohnerachtet es eine Copie ist, hat sehr viele Verdienste. I Kopie von B. Beschey nach Rubens Mat.: auf Kupfer Maße: 17 Zoll hoch, 25 Zoll breit Transakt.: Verkauft (24 fl) Käufer: Brönner 1791/09/26 FRAN 0293 Beschey; van Dyck I Die Weiber, Joseph von Arimadia und ein Capuciner, salben der todten Leichnam Christi, ein fleißiges Bild von Beschey nach van Dyck. I Kopie von B. Beschey nach Anth. van Dyck Maße: 24 Zoll hoch, 16 Zoll breit Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 HB AN 0125 Beschey; nach A. v. Dyck I Die römische Liebe. Mit Himmelsfreude im Auge blickt sie zum Himmel auf und trägt ihre schönen, durch Beschey vielleicht verschönerten, Lieblinge an ihrem mütterlichen Busen und Halse. I Kopie von B. Beschey nach Anth. van Dyck Maße: Höhe 18 Zoll, Breite 15 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt
Beschey, Balthasar (geändert von Brueghel, J. (I)) 1799/00/00 LZRCH 0046 Jean Breughel, dit, de Velour; Beschey I Dans un joli paysage, on remarque la vierge qui tient l'enfant Jesus sur ses genoux; sur la gauche est Joseph, qui fixe la mere et le fils, au quel 3 anges presentent du haut des nues, la croix meurtriere; ce tab. fait une tres belle production. I Mat.: auf Holz Maße: h. 13.1. 10. pouces Anm.: Im Exemplar AAP wurde der Name "Jean Breughel, dit, de Velour" handschriftlich durchgestrichen und in "Beschey" korrigiert. Verkäufer: J F Rauch Transakt.: Unbekannt
Beschey, Balthasar (Kopie nach) 1790/01/07 MUAN 0795 Nach Bescai I Eine Landschaft, und ein Seestück, auf Kupfer, in geschnittenen und vergoldeten Ramen. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 9 Zoll, Breite 1 Schuh Anm.: Die Lose 795 und 796 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0796 Nach Bescail Eine Landschaft, und ein Seestück, auf Kupfer, in geschnittenen und vergoldeten Ramen. I Diese Nr.: Ein Seestück Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 9 Zoll, Breite 1 Schuh Anm.: Die Lose 795 und 796 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0797 Nach Bescai I Zwo Landschaften, auf Kupfer, in geschnittenen und vergoldeten Ramen. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 9 Zoll, Breite 1 Schuh Anm.: Die Lose 797 und 798 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0798 Nach Bescai I Zwo Landschaften, auf Kupfer, in geschnittenen und vergoldeten Ramen. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 9 Zoll, Breite 1 Schuh Anm.: Die Lose 797 und 798 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
291
1790/01/07 MUAN 0799 Nach Bescai I Zwo Landschaften mit Thieren und Figuren, auf Holz, in geschnittenen und vergoldeten Ramen. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Thieren und Figuren Mat.: auf Holz Maße: Höhe 9 Zoll, Breite 1 Schuh Anm.: Die Lose 799 und 800 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0800 Nach Bescai I Zwo Landschaften mit Thieren und Figuren, auf Holz, in geschnittenen und vergoldeten Ramen. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Thieren und Figuren Mat.: auf Holz Maße: Höhe 9 Zoll, Breite 1 Schuh Anm.: Die Lose 799 und 800 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
Beschey, Balthasar (Stil) 1799/12/04 HBPAK 0004 Von dem englischen Bodscheye I Eine Dorfgegend, wo sich Bauern und Bäurinnen mit Musik und tanzen belustigen. Sehr schön gemahlt, ganz in des Tenniers Manier. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll, breit 36 Zoll Anm.: Die Lose 4 und 5 wurden zusammen katalogisiert. Der Katalog ordnet diesem Eintrag zwar zwei Losnummern zu, doch verzeichnet er wahrscheinlich nur ein Gemälde. Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0005 Von dem englischen Bodscheye I Eine Dorfgegend, wo sich Bauern und Bäurinnen mit Musik und tanzen belustigen. Sehr schön gemahlt, ganz in des Tenniers Manier. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll, breit 36 Zoll Anm.: Die Lose 4 und 5 wurden zusammen katalogisiert. Der Katalog ordnet diesem Eintrag zwar zwei Losnummern zu, doch verzeichnet er wahrscheinlich nur ein Gemälde. Transakt.: Unbekannt
Beschey, Jacob Andries 1768/07/00 MUAN 0037 Beschey (Jacobus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0038 Beschey (Jacobus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0120 Beschey (Jacobus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0397 Beschey (Jacobus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0398 Beschey (Jacobus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0432 Beschey (Jacobus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 292
GEMÄLDE
1768/07/00 MUAN 0433 Beschey (Jacobus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1787/00/00 HB AN 0680 Jacobus Beschey I Ein alter Mann mit gelben Turban und kleinem weißem Barte, in gelbligten rauhen Rokke, sitzt auf einer Anhöhe neben einem Gebäude, und hält zwischen seinen Knieen einen kleinen Knaben, der einen Apfel in der Hand hat. Im Hintergrunde eine angenehme Landschaft. Besonders schön und angenehm wegen seines reizenden Colorits und besondern Fleißes. A.H. [Auf Holz] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Vi Zoll, breit 9 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (60 M) Käufer: Fesser 1790/04/13 HBLIE 0072 Beschey, so schön wie J. van Huysum I Verschiedene nach der Natur gemahlte Blumen stehen in Caravine auf Tische, wobey noch einige Trauben und Gartenfrüchte liegen; plaisant und schön gemahlt. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Verschiedene nach der Natur gemahlte Blumen stehen in Caravine auf Tische, wobey noch einige Trauben und Gartenfrüchte liegen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Vi Zoll, breit 18 Zoll Anm.: Die Lose 72 und 73 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (12.12 Μ für die Nrn. 72 und 73) Käufer: Boemer 1790/04/13 HBLIE 0073 Beschey, so schön wie J. van Huysum I Verschiedene nach der Natur gemahlte Blumen stehen in Caravine auf Tische, wobey noch einige Trauben und Gartenfrüchte liegen; plaisant und schön gemahlt. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Verschiedene nach der Natur gemahlte Blumen stehen in Caravine auf Tische, wobey noch einige Trauben und Gartenfrüchte liegen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Vi Zoll, breit 18 Zoll Anm.: Die Lose 72 und 73 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (12.12 Μ für die Nrn. 72 und 73) Käufer: Boemer
Beuckelaer, Joachim 1776/00/00 WZTRU 0126 Joachim Buecklaer I Ein Stück, 2 Schuhe, 3 Zoll hoch, 4 Schuhe, 6 Zoll breit v. Joachim Buecklaer, stellet vor einen Tisch mit verschiedenem Kuchengeschirr, in Vorgrunde siehet man einen Deller auf einen über den Tisch geworfenen Serviet stehen, worauf ein großer entzwey geschnittener Hecht. Es ist hierinn zu bewundern die schöne Obtik, die wahre Colorit die der Natur gemäs, die wohl überlegte Ordnung, der schöne Schatten und Licht, welches auf Kupfer, Zinn, Silber, Glas, Blech und Eisernen Geschirr observiret, und mit gröster Expression vorgestellet; es ist unbeschreiblich, was hierinn in allen Theilen für eine Natur herrschet. I Maße: 2 Schuhe 3 Zoll hoch, 4 Schuhe 6 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (40 fl Schätzung) 1781/00/00 WZAN 0126 Joachim Buecklaer I Ein Stück 2 Schuhe, 3 Zoll hoch, 6 Schuhe, 6 Zoll breit von Joachim Buecklaer, stellet einen Tisch mit verschiedenem Kuchengeschirr vor, in Vorgrunde sieht man einen Teller auf einem über den Tisch geworfenen Serviet stehen, worauf ein großer entzwey geschnittener Hecht ist. Es ist hierinn zu bewundem die schöne Optik, die wahre und der Natur gemäse Kolorit, die wohl überlegte Ordnung, der schöne Schatten und Licht, welches auf Kupfer, Zinn, Silber, Glas, Blech und eisernem Geschirre observiret, und mit größter Expression vorgestellet wird; es ist unbeschreiblich, was für eine Natur hier in allen Theilen herrschet. I Maße: 2 Schuhe 3 Zoll hoch, 6 Schuhe 6 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Beuterlin [Nicht identifiziert] (Kopie nach) 1788/09/01 KOAN 0241 Beuterlin I 2 beißende Hahnen, nach Beuterlin. [2 p[ieces). des Coques se mortants, selon Beuterlin.] I Diese Nr.: Ein beissender Hahn Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Fuß 11 Zoll, Breite 2 Fuß 4 Zoll Anm.: Die Lose 241 und 242 wur-
den zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0242 Beuterlin I 2 beißende Hahnen, nach Beuterlin. [2 p[i£ces], des Coques se mortants, selon Beuterlin.] I Diese Nr.: Ein beissender Hahn Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Fuß 11 Zoll, Breite 2 Fuß 4 Zoll Anm.: Die Lose 241 und 242 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt
Beutler, Clemens 1790/01/07 MUAN 1214 Clement Beutler I Ein großes Thierstück, mit einem Thanhirschen, Haasen, und Federwildprett, auf Leinwand, in einer geschnittenen und vergoldeten Ram. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 4 Schuh, Breite 5 Schuh 4 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
1764/03/12 FRKAL 0007 Van Beyer I Un tres-beau tableau representant toutes sortes de poisons etendus sur une table, le tout si admirablement represent6 qu'il egale la nature. I Maße: hauteur 42 pouces, largeur 52 pouces Transakt.: Verkauft (30 fl) Käufer: Kaller 1774/03/28 HBBMN 0060 van Beyern I Ein ungemein natürliches Fisch=Stück mit Neben=Sachen, im verguldeten Rahm. I Maße: Höhe 3 Fuß 6 Vi Zoll, Breite 2 Fuß 8 Zoll Transakt.: Unbekannt 1775/02/25 HBBMN 0002 van Beyern I Ein dito [Still=Leben] Stück mit Fischen, als Kabeljau, ein eingekerbeter Lachs, ungemein natürlich gemahlt. I Transakt.: Unbekannt 1775/05/08 HBPLK 0156 A. Beyer I Eine Holländerinn, so Fische verkauft, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 12 Zoll, Breite 16 Zoll Transakt.: Unbekannt 1775/10/07 HBBMN Transakt.: Unbekannt
0021
van Beyern I Ein Vieh=Stück. I
Beuts [Nicht identifiziert]
1776/06/21 HB NEU 0065 Beyer I Ein Fisch=Stück, fleißig und lebhaft gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 6 Zoll, Breite 10 Zoll Transakt.: Unbekannt
1799/12/04 HBPAK 0121 Beuts I Eine Landschaft, wo auf der Landstrasse viele Bagage=Wagen, Reuter zu Pferde ec. sich befinden. Kräftig gemahlt. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Mat.: auf Leinwand Transakt. : Unbekannt
1776/07/19 HBBMN 0049 van Beyern I Ein schönes und natürliches Fisch=Stück. I Maße: Höhe 2 Fuß 6 Vi Zoll, Breite 2 Fuß 11 Zoll Transakt.: Verkauft (5 M) Käufer: Lilie
Bevilacqua 1768/07/00 MUAN 0923 Berelaqua I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0323 Bevilacqua I Le Portrait d'un homme inconnu, jusqu'aux genoux. Peint sur toile marque du No. 923. I Mat.: auf Leinwand Maße: 3. p. 3 Vi p. de haut sur 2. p. 6. p. de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt
Beyer 1742/08/01 BOAN 0256 Beyer I Ein Stuck die Heyl. drey Könige praesentirend, eine Exquise von Beyer. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt
Beyerd [Nicht identifiziert] 1778/09/28 FRAN 0320 Beyerd I Ein Holländisches Bauernstück. [Une piece röpresentante des paysans Hollandois.] I Maße: 1 Schuh 8 Zoll breit, 1 Schuh 4 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (10 fl) Käufer: ν Frankenstein
Beyeren, Abraham Hendricksz. van 1742/08/01 BOAN 0550 Beyeren I Ein Früchten Stuck. Orig. von Beyeren. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1749/07/31 HBRAD 0051 A. v. Beyern I See=Fische. I Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (15.4) 1759/00/00 LZEBT 0157 van Beyer I Ein Stück mit See Fischen auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 4 Schuh 4 Zoll, Breite 3 Schuh 5 Vi Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (150 Th Schätzung) 1763/01/17 UNAN [A]0016 Adr. v. Beyern I Representation de differens Poissons, p. Adr. v. Beyern, sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hauteur 2 pieds 10 pouces, Largeur 3 pieds 7 pouces Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt
1777/02/21 HBHRN 0049 v. Beyern i Hangende Trauben und Früchte. I Maße: Höhe 2 Fuß 2 Zoll, Breite 1 Fuß 8 Zoll Transakt.: Unbekannt 1777/04/11 Unbekannt
HB NEU
0076
Bejer\ Ein Fischstück. I Transakt.:
1778/05/30 HBKOS 0142 A. Beyer I Zwey Quodlibet, von A. Beyer, auf Holz. [Diese Gemähide sind alle mittlere Grösse, können also an alle Plätze gebraucht werden - dieweilen keine Theilen= Stück, dabey befindlich] I Diese Nr.: Ein Quodlibet Mat.: auf Holz Anm.: Die Lose 142 und 143 wurden zusammen katalogisiert. Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 150 und beziehen sich auf die Nm. 1 bis 150. Verkäufer: Dr Friederici Transakt.: Verkauft (1.4 Μ für die Nrn. 142 und 143) Käufer: Bertheau 1778/05/30 HBKOS 0143 A. Beyer I Zwey Quodlibet, von A. Beyer, auf Holz. [Diese Gemähide sind alle mittlere Grösse, können also an alle Plätze gebraucht werden - dieweilen keine Theilen= Stück, dabey befindlich] I Diese Nr.: Ein Quodlibet Mat.: auf Holz Anm.: Die Lose 142 und 143 wurden zusammen katalogisiert. Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 150 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 150. Verkäufer: Dr Friederici Transakt.: Verkauft (1.4 Μ für die Nm. 142 und 143) Käufer: Bertheau 1778/07/11 HBTEX 0034 van Beyern I Ein extra=schönes und natürliches Fruchtstück, mit einem Hummer. I Transakt.: Unbekannt 1778/07/11 HBTEX 0043 van Beyern I Ein großes Still=Leben mit Früchten; item Fische und Gemüse. I Transakt.: Unbekannt 1778/10/23 HBKOS 0025 A. Beyer I Zwey lebhafte Fisch=Stükke, auf Holz. I Diese Nr.: Ein lebhaftes Fisch=Stück Mat.: auf Holz Maße: hoch 17 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 25 und 26 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/10/23 HBKOS 0026 A. Beyer I Zwey lebhafte Fisch=Stükke, auf Holz. I Diese Nr.: Ein lebhaftes Fisch=Stück Mat.: auf Holz Maße: hoch 17 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 25 und 26 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1782/08/21 HBKOS 0039 Beyer I Ein Stilleben, mit verschiedenen Eßwaren, und silbernen Geräthschaften, nach der Natur gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 26 Zoll 5 Linien, breit 36 Zoll Verkäufer: Moddermann Transakt.: Verkauft (6 M) Käufer: Timm GEMÄLDE
293
1786/04/21 HBTEX 0107 von Beyern I Ein ungemein natürliches Fischstück, mit der Gegend von Schevelingen. I Transakt.: Unbekannt 1786/05/12 HBTEX 0008 Beyer I Zwey Stillleben, nach der Natur gemahlt, mit verschiedenen Garten=Früchten, Victualien und Geschirren, auf Leinewand. I Diese Nr.: Ein Stillleben, nach der Natur gemahlt, mit verschiedenen Garten=Früchten, Victualien und Geschirren; Nr. 7 von Kalf Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 26 Zoll, breit 32 Zoll Anm.: Die Lose 7 und 8 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (20 Μ für die Nm. 7 und 8) Käufer: Hofr Ehrenreich 1789/04/16 HBTEX 0082 van Bayren I Verschiedene Fische liegen auf einem Tische, auf Leinew. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 9 Vi Zoll, breit 12 Zoll Transakt.: Verkauft (6 Sch) Käufer: Petti 1790/04/13 HBLIE 0171 A. Bayer I Ein Stillleben mit Geschirre und Eßwaren. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 18 Zoll, breit 24 Zoll Transakt.: Verkauft (1.8 M) Käufer: Ego [und] Ε 1792/04/19 HBBMN 0030 A. Beyer I Ein Stilleben mit Eswaaren und einigen Gartenfrüchten, welche auf einem halb überdeckten Tische befindlich, von A. Beyer. Auf L. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 35 Zoll, breit 46 Zoll Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 HB AN 0142 A. von Beyeren I Ein Stilleben. Auf dem Küchentische liegen neben einem Kohlkopf und einem Armkorbe Fische auf einem Stutzfasse. I Maße: Höhe 11 Zoll, Breite 14 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1794/02/21 HBHEG 0087 A. Beyer I Auf überdeckten Tischen befinden sich Poeale, Flaschen=Krüge, Gläser, Schinken, Heering, Zwiebeln, (Zitronen und weiß Brod. Alles sehr natürlich gemahlt. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 53 Zoll, breit 43 Zoll Transakt.: Unbekannt 1795/11/17 HBPAK 0052 Beyern I Zwey Stücke mit Fische; als Hechte, Brasen und Karpen. Schw. Rahm mit gold. Leisten. I Diese Nr.: Ein Stück mit Fische; als Hechte, Brasen und Karpen Mat.: auf Holz Maße: Hoch 30 Zoll, breit 38 Zoll Anm.: Die Lose 52 und 53 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1795/11/17 HBPAK 0053 Beyern I Zwey Stücke mit Fische; als Hechte, Brasen und Karpen. Schw. Rahm mit gold. Leisten. I Diese Nr.: Ein Stück mit Fische; als Hechte, Brasen und Karpen Mat.: auf Holz Maße: Hoch 30 Zoll, breit 38 Zoll Anm.: Die Lose 52 und 53 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0051 Beyern I Ein Küchenstück mit Kabliau, Lachse, Schellfische, Stöhre und Hummers. Auf Leinwand, ohne Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 48 Zoll, breit 62 Zoll Transakt.: Unbekannt
Bibiena 1794/09/10 HBGOV [A]0041 Bibiena I Vier römische Prospecte; von Bibiena. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein römischer Prospect Mat.: auf Holz Maße: Hoch 2 V* Zoll, breit 1 % Zoll Anm.: Die Lose [A]41 bis [A]44 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV [A]0042 Bibiena I Vier römische Prospecte; von Bibiena. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein römischer Prospect Mat.: auf Holz Maße: Hoch 2 Ά Zoll, breit 1 % Zoll Anm.: Die Lose [A]41 bis [A]44 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV [A]0043 Bibiena I Vier römische Prospec te; von Bibiena. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein römischer Prospect Mat.: auf Holz Maße: Hoch 2 14 Zoll, breit 1 % Zoll Anm.: Die Lose [A]41 bis [A]44 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV [A]0044 Bibiena I Vier römische Prospec te; von Bibiena. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein römischer Prospect Mat.: auf Holz Maße: Hoch 2 V* Zoll, breit 1 % Zoll Anm.: Die Lose [A]41 bis [A]44 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/02/17 HBPAK 0218 Bibiena I Unter einem perspectivischen Colonaden=Gebäude von Bogen=Gängen werden Reisende von Räubern angefallen. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 15 Vi Zoll, Breite 20 Zoll Transakt.: Verkauft (31 M) Käufer: Τ 1796/12/07 HBPAK 0136 Bibiani I Ein Perspectivisches Colonaden=Gebäude. I Transakt.: Unbekannt 1797/08/10 MM AN 0010 Bibiens I Zwei Architecteur Stücke von Bibiens mit vergoldeten Rahmen, auf Tuch. I Diese Nr.: Ein Architekteur Stück Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 10 und 11 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (10 fl für die Nrn. 10 und 11, Schätzung) 1797/08/10 MM AN 0011 Bibiens I Zwei Architecteur Stücke von Bibiens mit vergoldeten Rahmen, auf Tuch. I Diese Nr.: Ein Architekteur Stück Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 10 und 11 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (10 fl für die Nm. 10 und 11, Schätzung) 1799/10/18 LZAN 0054 Bibiani I Ein Architectur mit Figuren; hoch 34 Zoll, breit 45 Zoll. Auf Leinwand, mit Leisten umgeben. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 34 Zoll, breit 45 Zoll Verkäufer: Rauch Transakt.: Verkauft (3 Th) Käufer: Schwarz
Bibiena (und Miel) Beyeren, Abraham Hendricksz. van (Geschmack von) 1742/08/01 BOAN 0329 Van Beveren I Zwey Früchten Stuck. Original von dem Meister von van Beveren. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0255 Van Bevern I Des Fruits. Couple, par le Maitre de Van Bevern. I Maße: Haut 1. pied 2. pou., larges 1. pied 6. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt
1796/02/17 HBPAK 0003 Bibiena; J. Miel I Ruinen von Ehrenpforten und Tempel=Gebäuden mit Wasserfallen. Diese Alterthümer werden von Verschiedenen, welche theils unter, theils auf den Ruinen befindlich sind, besehen. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 31 Zoll, Breite 41 Zoll Transakt.: Verkauft (161 M) Käufer: Koch
Bibiena (und Romanelli, Giov.Fr.) Biazzetta, Franz Cosmo [Nicht identifiziert] 1784/08/02 FRNGL 0141 Franz Cosmo Biazzetta I Ein alter Mann, welcher einen Knaben lesen lernt, von Franz Cosmo Biazzetta, 1610 verfertigt. I Maße: 13 Zoll breit, 16 Zoll hoch Inschr.: 1610 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: C Transakt.: Verkauft (4.40 fl) Käufer: Bäumer 294
GEMÄLDE
1799/10/17 LZAN 0041 Bibian; Romanelli I Ahasveros und Esther: Komposition von sechs Figuren; die Architektur von Bibian ist sehr wohl angeordnet, und beide Meister scheinen sich in diesem Stücke auszeichnen zu wollen; hoch 24 Z. br. 18. Z, Auf Leinwand, in einem vergoldeten Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 24 Z. br. 18. Z, Verkäufer: Rauch Transakt.: Verkauft (9.2 Th) Käufer: Bottger
Bibiena (und Trevisani, Fr.) 1796/02/17 HBPAK 0067 Bibienna; Trevisani I Unter und bey verfallenen Architectur=Gebäuden, in römischen Land= und Wasser=Gegenden, befinden sich Bacchanten, welche zusammen musiciren, sich baden u. s. w. Auf Leinwand. I Mat. : auf Leinwand Maße: Höhe 24 Zoll, Breite 27 Zoll Transakt.: Verkauft (126 M) Käufer: Chevremont 1798/06/04 HBPAK 0381 Bibiena; die Figuren von Trevisani I Zwey italiänische Gegenden mit alten Ruinen und Architektur. Im Vordergrunde ein Gewässer mit badenden Nymphen, tanzend und spielend vorgestellt. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine italiänische Gegend mit alten Ruinen und Architektur Mat.: auf Holz Maße: Hoch 20 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 381 und 382 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0382 Bibiena; die Figuren von Trevisani I Zwey italiänische Gegenden mit alten Ruinen und Architektur. Im Vordergrunde ein Gewässer mit badenden Nymphen, tanzend und spielend vorgestellt. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine italiänische Gegend mit alten Ruinen und Architektur Mat.: auf Holz Maße: Hoch 20 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 381 und 382 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Bibiena, F. 1788/01/15 LZRST 3908 F. Bibiena I Ein grosses schön ausgeführtes Architectur Stück, mit Figuren, von F. Bibiena, in schw. Rahm mit verg. Leiste. I Maße: 54 Zoll hoch, 76 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (9.12 Th) Käufer: C R 1788/01/15 LZRST 3909 F. Bibiena I Ein andres [Architectur Stück] eben so schön von F. Bibiena, von gleichem Maasse, gleichem [schw.] Rahme [mit verg. Leiste]. I Maße: 54 Zoll hoch, 76 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (9.4 Th) Käufer: C R
Biboge [Nicht identifiziert] 1705/06/25 HNAN 0019 Biboge I Ein trefflich Stück von dem Engelländer Biboge verfertiget / da das Leinen einem Dannen Brete / und das Portrait einem veritablen Kupffer gleichet. I Mat.: Leinwand auf Holz Verkäufer: Anthon Lucio Transakt.: Unbekannt
Bicy [Nicht identifiziert] 1765/03/27 FRKAL 0015 Bicy I Un lievre & des oiseaux morts. I Maße: hauteur 21 pouces, largeur 29 pouces Transakt.: Verkauft (20.30 fl für die Nrn. 15 und 16) Käufer: Hoch 1765/03/27 FRKAL 0016 Bicy I Une autre pour servir de pareil au precedent avec de la volaille morte. I Maße: hauteur 21 pouces, largeur 29 pouces Transakt.: Verkauft (20.30 fl für die Nrn. 15 und 16) Käufer: Hoch
Bideri [Nicht identifiziert] 1788/04/07 FRFAY O l l i Bideri I Zwey Italiänische Landschaften mit Ruinen, von Bideri. Auf Tuch, und auf Holz gezogen. I Diese Nr.: Eine Italiänische Landschaft mit Ruinen Mat.: Leinwand auf Holz Maße: 10 Vi Z. hoch, und 13 Vi Z. breit Anm.: Die Lose 111 und 112 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (13 fl für die Nrn. 111 und 112) Käufer: Levi ν M[annheim] 1788/04/07 FRFAY 0112 Bideri I Zwey Italiänische Landschaften mit Ruinen, von Bideri. Auf Tuch, und auf Holz gezogen. I Diese Nr.: Eine Italiänische Landschaft mit Ruinen Mat.: Leinwand auf Holz Maße: 10 Vi Z. hoch, und 13 Vi Z. breit Anm.: Die Lose 111
und 112 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (13 fl für die Nrn. 111 und 112) Käufer: Levi ν M[annheim]
Bie, Cornells de 1750/00/00 KOAN 0220 Corneille de Pie I Deux perspectives, sur bois. I Diese Nr.: Une Perspective Mat.: auf Holz Maße: Largeur 1 Pies 8 Vi Pouces, Haut 1 Pies 3 14 Pouces Anm.: Die Lose 220 und 221 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollem Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0221 Corneille de Pie I Deux perspectives, sur bois. I Diese Nr.: Une Perspective Mat.: auf Holz Maße: Largeur 1 Pies 8 Vi Pouces, Haut 1 Pies 3 Ά Pouces Anm.: Die Lose 220 und 221 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollem Transakt.: Unbekannt
Bielers [Nicht identifiziert] 1792/02/01 LZRST 4832 Bielers I 2 Stk. Eine alte Frau in einem Buche lesend, und ein alter Mann mit der Pfeiffe, auf Leinwand, von Bielers gemahlt. I Mat.: auf Leinwand Maße: 21 Zoll hoch, 16 Zoll breit Transakt.: Verkauft oder Unverkauft (8 Gr) Käufer: R[ost] 1793/01/15 LZRST 7012 Bielers I 2 Stück, eine alte Frau im Buche lesend und ein alter Mann mit der Pfeife, auf Leinw. von Bielers gemahlt. I Mat.: auf Leinwand Maße: 21 Zoll hoch, 16 Zoll breit Verkäufer: Pg Transakt.: Verkauft oder Unverkauft (13 Gr) Käufer: Pg
Bijlert, Jan Hermansz. van 1764/00/00 BLAN 0606 Peylart I 1. schäfer Stück auf Leinwand gemahld. I Mat.: auf Leinwand Maße: 3 Fuß 9 Zoll hoch, 4 Fuß 10 Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (360 Rt Schätzung) 1766/07/28 KOSTE [A]0007 Büart \ Ein Conversations-Stuck mit Spanier am Tisch sitzende von Bilart. I Transakt.: Unbekannt (25 Rt) 1784/08/02 FRNGL 0048 Byler I Eine Gesellschaft, welche sich bey Bretzel und Wein vergnüget, besonders angenehm und meisterhaft von Byler verfertiget. I Maße: 44 Zoll breit, 34 Zoll hoch Verkäufer: Α Transakt.: Verkauft (7.30 fl) Käufer: Ν
Biltius 1750/00/00 KOAN 0194 Biltius I Deux pieces, representant des perdrix tuees, sur toile. I Diese Nr.: Une piece, representant des perdrix tuees Mat.: auf Leinwand Maße: Largeur 1 Pies 1 Vi Pouces, Haut 1 Pies 5 Pouces Anm.: Die Lose 194 und 195 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollem Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0195 Biltius I Deux pieces, representant des perdrix tuees, sur toile. I Diese Nr.: Une piece, representant des perdrix tuees Mat.: auf Leinwand Maße: Largeur 1 Pies 1 Vi Pouces, Haut 1 Pies 5 Pouces Anm. : Die Lose 194 und 195 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollem Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0196 Biltius I Deux autres pieces avec des pigeons plumes, par le meme [Biltius], I Diese Nr.: Une piece avec des pigeons plumes Maße: Largeur 1 Pi6s 1 % Pouces, Haut 1 Pies 4 Pouces Anm.: Die Lose 196 und 197 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollem Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
295
1750/00/00 KOAN 0197 Biltius I Deux autres pieces avec des pigeons plumes, par le meme [Biltius]. I Diese Nr.: Une piece avec des pigeons plumes Maße: Largeur 1 Pies 1 % Pouces, Haut 1 Pies 4 Pouces Anm.: Die Lose 196 und 197 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1764/05/14 BOAN 0305 Bilzius I Deux Tableaux representants des Oiseaux morts en grandeur naturelle, d'un pied onze pouces de hauteur, d'un pied cinq pouces de largeur, peints par Bilzius. [Zwey stück mit todten Vögel in Lebensgröße Von Biltzius.] I Diese Nr.: Un Tableau representant des Oiseaux morts Maße: 1 pied 11 pouces de hauteur, 1 pied 5 pouces de largeur Anm.: Die Lose 305 und 306 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (6 Rt für die Nrn. 305 und 306) Käufer: Ν Nelles von Aachen 1764/05/14 BOAN 0306 Bilzius I Deux Tableaux representants des Oiseaux morts en grandeur naturelle, d'un pied onze pouces de hauteur, d'un pied cinq pouces de largeur, peints par Bilzius. [Zwey stück mit todten Vögel in Lebensgröße Von Biltzius.] I Diese Nr.: Un Tableau representant des Oiseaux morts Maße: 1 pied 11 pouces de hauteur, 1 pied 5 pouces de largeur Anm.: Die Lose 305 und 306 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (6 Rt für die Nrn. 305 und 306) Käufer: Ν Nelles von Aachen 1764/05/14 BOAN 0307 Bilzius I Deux Tableaux de meme Espece [representant des Oiseaux morts], d'un pied dix pouces de hauteur, d'un pied cinq pouces de largeur, peints par Bilzius. [Zwey stück mit todten Vögelen in Lebensgröße von Biltzius.] I Diese Nr.: Un Tableau representant des Oiseaux morts Maße: 1 pied 10 pouces de hauteur, 1 pied 5 pouces de largeur Anm.: Die Lose 307 und 308 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (5.50 Rt für die Nrn. 307 und 308) Käufer: Baruch Simon 1764/05/14 BOAN 0308 Bilzius I Deux Tableaux de meme Espece [representant des Oiseaux morts], d'un pied dix pouces de hauteur, d'un pied cinq pouces de largeur, peints par Bilzius. [Zwey stück mit todten Vögelen in Lebensgröße von Biltzius.] I Diese Nr.: Un Tableau reprisentant des Oiseaux morts Maße: 1 pied 10 pouces de hauteur, 1 pied 5 pouces de largeur Anm.: Die Lose 307 und 308 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (5.50 Rt für die Nm. 307 und 308) Käufer: Baruch Simon 1764/05/14 BOAN 0320 Bilzius I Deux Tableaux reprisentants des oiseaux morts de deux pieds trois pouces de hauteur, d'un pied huit pouces de largeur, peints par Bilzius. [Zwey stück mit todten Vögelen in Lebensgröße von Biltzius.] I Diese Nr.: Un Tableau representant des oiseaux morts Maße: 2 pieds 3 pouces de hauteur, 1 pied 8 pouces de largeur Anm.: Die Lose 320 und 321 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (17 Rt für die Nrn. 320 und 321) Käufer: Doussetti 1764/05/14 BOAN 0321 Bilzius I Deux Tableaux representants des oiseaux morts de deux pieds trois pouces de hauteur, d'un pied huit pouces de largeur, peints par Bilzius. [Zwey stück mit todten Vögelen in Lebensgröße von Biltzius.] I Diese Nr.: Un Tableau representant des oiseaux morts Maße: 2 pieds 3 pouces de hauteur, 1 pied 8 pouces de largeur Anm.: Die Lose 320 und 321 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (17 Rt für die Nm. 320 und 321) Käufer: Doussetti 1764/05/28 BOAN 0280 Bilzius I Deux Tableaux d'un pied dix pouces de hauteur, d'un pied trois pouces de largeur, representants de la Volatile, peints par Bilzius. [Zwey stück geflügel Von Pilzius.] I Diese Nr.: Un Tableau representant de la Volaille Maße: 1 pied 10 pouces de hauteur, 1 pied 3 pouces de largeur Anm.: Die Lose 280 und 281 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kurfürst 296
GEMÄLDE
Clemens August Transakt.: Verkauft (6 Rt für die Nrn. 280 und 281) Käufer: Zisler 1764/05/28 BOAN 0281 Bilzius I Deux Tableaux d'un pied dix pouces de hauteur, d'un pied trois pouces de largeur, representants de la Volaille, peints par Bilzius. [Zwey stück geflügel Von Pilzius.] I Diese Nr.: Un Tableau reprfisentant de la Volaille Maße: 1 pied 10 pouces de hauteur, 1 pied 3 pouces de largeur Anm.: Die Lose 280 und 281 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (6 Rt für die Nrn. 280 und 281) Käufer: Zisler 1765/00/00 FRRAU 0013 Bilzius I Ein Rebhuhn und noch drey andere todte Vögel natürlicher Grösse zusammen gebunden, und an einem Nagel hangend. Bilzius hat die Natur wohl nachzuahmen gewußt, und man kan ihm die Ehre lassen, daß er die Subjecta in Colorit hat wohl auseinander zu treiben wissen. Wann er nur für das Graue, sich eine andere Grund=Farbe erwählet hätte. Ohne die verguldete Rahme auf Leinw. gemahlt. Une perdrix & trois autres oiseaux tues d'une grandeur naturelle lies ensemble & pendans ä un clou. Bilzius a trfes-bien sü imiter la nature, & il faut lui laisser l'honneur d'avoir bien sü pousser le coloris de chaque sujet. S'il avoit seulement choisi une autre couleur pour le fond, qu'une couleur grise. Sans la bordure doree peint sur de la toile. I Annotat.: 2 Stück (AAP) Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 2 Schuh 4 Zoll, breit 1 Schuh 8 Zoll Transakt.: Unbekannt 1766/07/28 KOSTE 0014 Bilcius I Ein groß Stück mit Vögels= Körbger [sie] von Bilcius. I Transakt.: Unbekannt (4 Rt) 1766/07/28 KOSTE 0015 Bilcius I Ein groß stück von selbigem Meister [Bilcius] mit Flinten. I Transakt.: Unbekannt (4 Rt) 1766/07/28 KOSTE 0163 Bilcius I Ein grosses mit Flinten von Bilcius. I Transakt.: Unbekannt (4 Rt) 1778/09/28 FRAN 0533 Pilcius I Ein junger Haase mit etlichen todten Vögeln. [Un levreau avec quelques oiseaux tues.] I Pendant zu Nr. 534 Maße: 1 Vi Schuh breit, 1 Schuh 10 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (15 fl für die Nrn. 533 und 534) Käufer: Canonicus Burger 1778/09/28 FRAN 0534 Pilcius I Der Compagnon, von dito [Pilcius], nemliches Maaß. [Le pendant du pr6cedent, par le meme maitre [Philcius], meme hauteur & meme largeur.] I Pendant zu Nr. 533, "Ein junger Haase mit etlichen todten Vögeln" Maße: 1 Vi Schuh breit, 1 Schuh 10 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (15 fl für die Nrn. 533 und 534) Käufer: Canonicus Burger 1781/05/07 FRHUS 0009 Bilsinus I Ein todter hängender Haas und Vögel fleissig ausgearbeitet von Bilsinus. I Maße: 3 Schuh hoch und 2 Schuh 6 Zoll breit Anm.: Dieses Los wurde zusammen mit der Nr. 8 (J.M. Roos) verkauft. Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (1.14 fl für die Nrn. 8 und 9) Käufer: Heuser 1784/08/02 FRNGL 0077 Bilcius I Eine todte Schnepfe und Rebhuhn nebst andern Vögeln, von Bilcius nach der Natur gemahlt. I Diese Nr.: Eine todte Schnepfe Maße: 17 Zoll breit, 20 Zoll hoch Anm.: Die Lose 77 und 78 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: C Transakt.: Verkauft (2.12 fl für die Nrn. 77 und 78) Käufer: Berger 1784/08/02 FRNGL 0078 Bilcius I Eine todte Schnepfe und Rebhuhn nebst andern Vögeln, von Bilcius nach der Natur gemahlt. I Diese Nr.: Ein Rebhuhn nebst andern Vögeln Maße: 17 Zoll breit, 20 Zoll hoch Anm.: Die Lose 77 und 78 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: C Transakt.: Verkauft (2.12 fl für die Nrn. 77 und 78) Käufer: Berger 1784/08/02 FRNGL 0427 Bilcius I Ein hängend todter junger Hase mit artigen Beywesen. I Maße: 17 Zoll breit, 20 Zoll hoch Verkäufer: C Transakt.: Verkauft (2.45 fl) Käufer: Bäumer
1785/05/17 MZAN 0761 Bilcius I Ein todtes Kaninchen und ein Karpfenkopf von Bilcius. [Un lapin tue & la tete tranchee d'une carpe.] I Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 1 Schuh 1 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (2 fl) Käufer: Neüs 1790/01/07 MUAN 1012 Biltius I Zwey Federwildprettstücke, auf Leinwat, in geschnittenen und metallisirten Ramen. I Diese Nr.: Ein Federwildprettstück Aiaf..· auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 10 Zoll, Breite 1 Schuh 7 Zoll Anm.: Die Lose 1012 und 1013 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
Biltius (Kopie nach) 1792/08/20 KOAN 0282 Bilcius \ Ein still liegendes Leben in Vögel nach Bilcius. I Maße: 2 Schuh 2 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 7 Vi Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt
Biltius, Cornells 1786/05/02 NGAN 0318 C. Bilcius I Ein hängender Haas. I Maße: 3 Schuh 1 Zoll hoch, 2 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (3.25 fl) Käufer: R Grüner
1790/01/07 MUAN 1013 Biltius I Zwey Federwildprettstücke, auf Leinwat, in geschnittenen und metallisirten Ramen. I Diese Nr.: Ein Federwildprettstück Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 10 Zoll, Breite 1 Schuh 7 Zoll Anm.: Die Lose 1012 und 1013 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
1786/05/02 NGAN 0324 C. Bilcius I Zwey Vögelstücke. I Diese Nr.: Ein Vögelstück Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch, 1 Schuh 5 Zoll breit Anm.: Die Lose 324 und 325 wurden zusammen katalogisiert. Dieses Los wurde zusammen mit der Nr. 323 (Alex. Adriaenssen) verkauft. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (4.8 fl für die Nrn. 323-325) Käufer: Resid Grüner
1792/08/20 KOAN 0012 Bilcius I Ein Todten Kopf mit einem Licht und Mahler=Instrumenten auf Tuch von Bilcius. I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Schuh 10 Zoll hoch, 2 Schuh 2 Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt
1786/05/02 NGAN 0325 C. Bilcius I Zwey Vögelstücke. I Diese Nr.: Ein Vögelstück Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch, 1 Schuh 5 Zoll breit Anm.: Die Lose 324 und 325 wurden zusammen katalogisiert. Dieses Los wurde zusammen mit der Nr. 323 (Alex. Adriaenssen) verkauft. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (4.8 fl für die Nrn. 323-325) Käufer: Resid Grüner
1792/08/20 KOAN 0051 Filcius \ Ein schön Häßchen mit Vögel, Flint und Pulver=Hom auf Tuch von Filcius. I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch, 2 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0203 Bilcius I Zwey Stück, ein still liegendes Leben in wilden Vögel vorstellende auf Tuch von Bilcius. I Diese Nr.: Ein still liegendes Leben in wilden Vögel vorstellend; Pendant zu Nr. 204 Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Schuh Vi Zoll hoch, 1 Schuh 7 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 203 und 204 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0204 Bilcius I Zwey Stück, ein still liegendes Leben in wilden Vögel vorstellende auf Tuch von Bilcius. I Diese Nr.: Ein still liegendes Leben in wilden Vögel vorstellend; Pendant zu Nr. 203 Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Schuh V2 Zoll hoch, 1 Schuh 7 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 203 und 204 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0241 Bilcius I Zwey afrikanische Vögel auf Tuch von Bilcius. I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Schuh 3 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 9 Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt
1786/05/02 NGAN 0457 C. Bilcius I Ein Quodlibet. I Maße: 1 Schuh 10 Zoll hoch, 1 Schuh 9 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (32 Kr) Käufer: Schuckert 1792/08/20 KOAN 0250 Cornelius Bilcius I Ein Feldhühner= Stück von Cornelius Bilcius. I Maße: 2 Schuh 8 Zoll hoch, 2 Schuh 3 Vi Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt
Biltius, Jacobus 1776/00/00 WZTRU 0217 Johann Franciscus Biezius I Ein Stück 1 Schuhe, 3 Zoll hoch, 10 Zoll breit, stellet vor eine auf weissen Grund hangende Feldhuhn von Johann Franciscus Biezius, worinnen vortreflich die Natur imitiret. I Pendant zu Nr. 218 Maße: 1 Schuhe 3 Zoll hoch, 10 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (4 fl Schätzung) 1776/00/00 WZTRU 0218 Johann Franciscus Biezius I Compagnion zu Nro. 217 worauf eine Amschel und ein Grammtsvogel todter abgemalet an einem Stricke hangen, von nämlichen Gusto und Meister [Johann Franciscus Biezius] verfertiget. I Pendant zu Nr. 217 Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (4 fl Schätzung)
1792/08/20 KOAN 0242 Bilcius I Ein Schnepp auf Tuch außerordentlich gemahlt von Bilcius. I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Schuh 8 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 4 Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt
1781/00/00 WZAN 0217 Johann Franz Biezius I Ein Stück 1 Schuhe, 3 Zoll hoch, 10 Zoll breit, stellet eine auf weissen Grunde hangende Feldhenne vor, worinn von Johann Franz Biezius die Natur vortrefflich imitiret wurde. I Pendant zu Nr. 218 Maße: 1 Schuhe 3 Zoll hoch, 10 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
1792/08/20 KOAN 0243 Bilcius I Eine Wachtel in einem Korb ganz lebhaft gemahlt mit zwey Wachtel=Pfeiffen von Bilcius. I Maße: 2 Schuh 8 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 4 Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt
1781/00/00 WZAN 0218 Johann Franz Biezius I Der Kompagnon zu Nro 217, worauf eine todte Amsel und ein Krammetsvogel an einem Stricke hangen, ist von nämlichen Gusto und Meister [Johann Franz Biezius] verfertiget. I Pendant zu Nr. 217 Transakt.: Unbekannt
1792/08/20 KOAN 0244 Bilcius I Ein todtes Leben in zwey Tauben auf einem Bild von Bilcius. I Maße: 2 Schuh 8 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 4 Vi Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt
Binck, Jacob
1792/08/20 KOAN 0272 Bilcius I Ein Trappganss mit einem Feldhuhn von Bilcius. I Maße: 2 Schuh 11 Zoll hoch, 2 Schuh 5 Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt
1799/00/00 WZAN 0141 Jacob Binck I Ein Weibsköpfchen mit einem Kröße und goldreicher Kleidung, von Jacob Binck. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh Vi Zoll breit 8 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1792/10/12 KOAN 0148 Bilzius I Zwei Flügel Wildprett von Bilzius. I Verkäufer: Moureaux Transakt.: Unbekannt
1799/00/00 WZAN AO 136 Jacob Binck I Ein Kopf mit einem weissen Barte und Kröße, von Jacob Binck. Auf Leinwand. I Mat.: GEMÄLDE
297
auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 11 Zoll breit 1 Schuh 7 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Binck, P.L. [Nicht identifiziert] 1778/07/21 HBHTZ 0070 P.L. Binck I Eine Corps de Gardes, sehr lebhaft vorgestellet, auf Holz, von P.L. Bink, 1667. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 19 Zoll, breit 23 Zoll Inschr.: 1667 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt (9 M) 1790/05/20 HBSCN 0246 P. Binck. fee. 1667. I In einer holländischen Wachtstube wird Karten gespielet und dabey getrunken, wozu ein vor der Thür zu Pferde haltender Trompeter blaset. Eine besondere Beleuchtung, durch das einfallende Licht umgiebet die Gesellschaft auf das lebhafteste; Meisterhaft und schön gemahlt. Auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 15 Vi Zoll, breit 20 % Zoll Inschr.: P. Binck. fee. 1667 (signiert und datiert) Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (9 M) Käufer: Büsch
Binkel [Nicht identifiziert]
1763/11/09 FRJUN 0156 J.P. Pisset I Un semblable representant un homme qui vend de l'eau de vie avec une vieille femme pas moindre & de la meme grandeur. I Maße: hauteur 14 pouces, largeur 11 pouces Transakt.: Verkauft (19.15 fl für die Nrn. 155 und 156) Käufer: Mevius
Bissoni, Giovanni Battista (Giambattista) 1763/01/17 HNAN [A]0098 Giov. Bissoni I Une tete de Mort, sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 9 pouces, Largeur 7 Vi pouces Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt
Blaauw 1790/08/25 FRAN 0228 Blaaw I Zwey Seestück. I Diese Nr.: Eine Seestück Maße: hoch 22 Zoll, breit 26 Zoll Anm.: Die Lose 228 und 229 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (5 fl für die Nrn. 228 und 229) Käufer: Kaller
1794/00/00 FGAN [B]0229 Bmkel I Ein kleiner Weiberkopf, mit einem runden Bande, auf Holz gemalt. I Mat.: auf Holz Maße: 3 Vi Zoll hoch, 2 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt (1 fl)
1790/08/25 FRAN 0229 Blaaw I Zwey Seestück. I Diese Nr.: Eine Seestück Maße: hoch 22 Zoll, breit 26 Zoll Anm.: Die Lose 228 und 229 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (5 fl für die Nrn. 228 und 229) Käufer: Kaller
Binoit, Peter
Blättner, Samuel
1775/04/12 HBNEU 0029 P. Binoir I Ein Still=Leben mit hangenden Früchten, auf Holz. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt
1791/07/29 HBBMN 0017 Sam. Blaetner, aus Altenburg I Die freyen Künste, mit außerordentlichem Fleiß gemahlt; auf Leinen. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 35 Zoll, breit 30 Zoll Transakt.: Unbekannt (1.8 M)
Bircke [Nicht identifiziert] 1790/08/25 FRAN 0051 Bircke I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: hoch 7 Vi Zoll, breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 51 und 52 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (3 fl für die Nrn. 51 und 52) Käufer: Kaller 1790/08/25 FRAN 0052 Bircke I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: hoch 7 Vi Zoll, breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 51 und 52 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (3 fl für die Nrn. 51 und 52) Käufer: Kaller
Biset, Charles Emmanuel 1742/08/01 BOAN 0346 Pizet I Zwey kleine Bawren Stuck. Original von Pizet. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt
Biset, Jean Andreas 1781/02/17 FRAN 0037 J. Biset I Eine schlafende Venus von J. Biset. I Maße: 11 Zoll breit, 9 Zoll hoch Transakt.: Unbekannt (8 fl) 1784/08/02 FRNGL 0084 Bisset I Eine schlafende Venus. I Maße: 9 Vi Zoll breit, 8 Zoll hoch Verkäufer: Β Transakt.: Verkauft (1.30 fl) Käufer: Berger
Bisset, J.B. [Nicht identifiziert] 1763/11/09 FRJUN 0155 J.P. Pisset I Un medecin avec 1'urinal dans la main, derriere & ä cote de lui une vieille & une jeune femme tres bien acheve. I Maße: hauteur 14 pouces, largeur 11 pouces Transakt.: Verkauft (19.15 fl für die Nrn. 155 und 156) Käufer: Mevius 298
GEMÄLDE
Blamberg [Nicht identifiziert] 1789/00/00 MMAN 0355 Blamberg I Cupido auf eine Satyr, auf Kupfer. [Un Cupidon sur un Satyr, sur cuivre.] I Mat.: auf Kupfer Maße: 1 Fuß 3 Zoll hoch, 1 Fuß breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (30 Kr)
Blanchard,Jacques 1743/00/00 BWGRA 0008 Jaques Blanchard I Wie Vulcanus die Waffen vor dem AEneas in Gegenwart der Venus schmiedet, ein Stück mit grossem Verstände gemahlet von Jaques Blanchard. I Maße: hoch 6 Fuß, breit 4 Fuß 10 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/02/17 HBPAK 0009 Blanchard I Unter einer sammtnen Gardine sitzt Maria, das Kind Jesu mit innigstem Vergnügen in ihren Armen haltend. Auf Leinwand. Halbe Figuren, kleine Lebensgrösse. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 42 V* Zoll, Breite 32 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (50 M) Käufer: Packi
Blanckerhoff, Jan Theunisz. 1782/09/30 FRAN 0261 Blankhoef genannt Jean Maat I Eine stille Seegegend, mit einem Orloogschiff und einer holländischen Stadt in der Feme, nach der Natur verfertigt von Blankhoef, genannt Jean Maat. [Une vüe maritime en calme, avec un vaisseau de guerre Hollandois & une ville Hollandoise dans le lointain, peinte d'apres nature, par Blankhoef, dit Jean Maat.] I Maße: 1 Schuh 4 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 1 Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (48.30 fl) Käufer: Grahe
Bleker, Dirck 1750/06/15 HBRAD 0003 D. Blecker I D. Β lecker, eine Landschaft von besonderer Natur. I Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 HBMFD 0012 d. Blecker. 16691 Diana auf der Jacht. Sie ist vorgestellt den Leib beynah en Profiel, und der Kopf % von vorne zu sehen, mit der rechten Hand fasst sie ein Jachthom, in der Stellung, als wollte sie drauf blasen; und in der linken hält sie einen kleinen Spiess, welcher auf ihr Knie gestützt ist. Sie sizt bey einem hohen Felsen. Ihre einzige Kleidung ist ein weisses Gewand und eine Hirschhaut. Rechts sieht man in eine gebürgigte Landschaft. Die ganze Figur ist von richtiger Zeichnung und von meisterhaften Contour, und mit verständigen Pinsel ausgeführt. I Mat.: auf Holz Maße: 2 Fuss 1 Vi Zoll hoch, 1 Fuss 8 Vi Zoll breit Inschr.: 1669 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Pierre Laporterie Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0098 D. Blecker I Ein junges Mädchen im Bade. Halbe Figur, schön gemahlt von D. Blecker. I Pendant zu Nr. 99 von Georg Norwic Maße: Hoch 11 Zoll, breit 9 Zoll Transakt.: Unbekannt
Inschr.: Blieck, Anno 1654 (signiert und datiert) Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0133 de Blick I Das Innere einer Kirche, mit verschiedenen Figuren. Auf Holz, goldenen Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 21 Zoll, breit 18 Zoll Transakt.: Unbekannt
Block 1782/02/18 RGBZN 0028 Transakt.: Unbekannt (11 fl)
Block I Ein unbekanntes Portrait. I
1782/02/18 RGBZN 0065 akt.: Unbekannt (1.31 fl)
Block I Ein gutes Portrait. I Trans-
1784/08/02 FRNGL 0725 Plock I Eines vornehmen Mannes Bildniß. I Maße: 24 Zoll breit, 29 Vi Zoll hoch Transakt.: Verkauft (1 fl) Käufer: Reinhard
Block, Benjamin von
Blendinger, Georg
1782/02/18 RGBZN 0017 Benj. Block I Das Portrait des vormaligen Kaiserl. Höchstansehnlichen Herrn Principal Commissarii und Bischofs von Eichstätt. I Transakt.: Unbekannt (6 fl)
1782/02/18 RGBZN 0026 Blendinger I Rudera, ein Stück von Blendinger. I Transakt.: Unbekannt (7 fl)
Block, Daniel
Bleydorn, J.G. [Nicht identifiziert]
1800/11/12 HBPAK 0090 gur. I Transakt.: Unbekannt
1784/05/11 HBKOS 0034 J.G. Bleydorn I Ein Mahler= und Bildhauer=Zimmer, in welchem gearbeitet wird, von J. G. Bleydorn, auf Holz. I Diese Nr.: Ein Mahler=Zimmer, in welchem gearbeitet wird Mat.: auf Holz Maße: hoch 9 Zoll 6 1., breit 13 Zoll 3 1. Anm.: Die Lose 34 und 35 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (3 M) 1784/05/11 HBKOS 0035 J.G. Bleydorn I Ein Mahler= und Bildhauer=Zimmer, in welchem gearbeitet wird, von J. G. Bleydorn, auf Holz. I Diese Nr.: Ein Bildhauer=Zimmer, in welchem gearbeitet wird Mat.: auf Holz Maße: hoch 9 Zoll 61., breit 13 Zoll 3 1. Anm.: Die Lose 34 und 35 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (3 M) 1798/08/10 HBPAK 0074 J.G. Bleydorn I Zwey plaisante Landschaften. Die eine mit einer Windmühle und wandernden Bauern, die andere eine Bleiche vorstellend. Gut und kräftig gemahlt. Auf Holz, im schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Eine plaisante Landschaft mit einer Windmühle und wandernden Bauern Mat.: auf Holz Maße: Hoch 6 Vi Zoll, breit 9 Zoll Anm.: Die Lose 74 und 75 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/08/10 HBPAK 0075 J.G. Bleydorn I Zwey plaisante Landschaften. Die eine mit einer Windmühle und wandernden Bauern, die andere eine Bleiche vorstellend. Gut und kräftig gemahlt. Auf Holz, im schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Eine plaisante Landschaft, eine Bleiche vorstellend Mat.: auf Holz Maße: Hoch 6 Vi Zoll, breit 9 Zoll Anm.: Die Lose 74 und 75 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Blieck, Daniel de 1797/04/20 HBPAK 0254 Marquirt: Blieck, Anno 16541 Das Inwendige einer Kirche mit vielen Figuren. Vielleicht giebt es wenige Stücke, die mit solchem Fleiß und Kenntniß in der Architektur ausgearbeitet sind. Im Hintergrunde sieht man das Altarblatt, auf welchem der grosse Christoph vorgestellt ist. Der obige unbekannte Künstler verdient das größte Lob, und die Gerechtigkeit, in die Reihe der ersten Perspektivmahler gesetzt zu werden. Auf Holz, mit goldn. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 22 Zoll, breit 20 Zoll
D. Block I Ein Stück mit einer Fi-
Blocklandt, Anthonie van Montfoort 1670/04/21 WNHTG 0078 Blockland I Elia Profeta, che risuscita un figliol morto. I Maße: Alto tre, e mezzo, largo 3. Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0245 Ant. de Montfort, genannt Blockland I Christus wird im Grabe von zween Engeln aufgerichtet. Noch andere beschäfftigen sich hinten am Grabe mit einer Fackel. Auf Holz. [Deux anges soulevent notre Seigneur dans le tombeau. D'autres sur le derriere du tombeau appretent un flambeau. Sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß hoch, 1 Fuß 3 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt
Bloem, Matheus 1764/00/00 BLAN 0221 M: Blom I 1. Toder Schwan, und eine Trappe. I Maße: 5 Fuß 6 Zoll hoch, 4 Fuß 4 Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (400 Rt Schätzung) Gegenw. Standort: Sankt-Peterburg, Rossiya. Ermitazh. (N 1108) 1798/08/10 HBPAK 0016 J. M. Bloom I Zwey Stücke mit todtem Federvieh. Auf dem einen, auf einen Tisch liegt ein Hahn und Tauben. Zur Linken eine Katze, welche auf den Raub bedacht ist. Das andere, ein hängender Fasan, auf einem Tische liegen Tauben. Gut gemahlt. Auf Leinwand, im schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein Stück mit todtem Federvieh. Auf einen Tisch liegt ein Hahn und Tauben. Zur Linken eine Katze, welche auf den Raub bedacht ist Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 32 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 16 und 17 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/08/10 HBPAK 0017 J. M. Bloom I Zwey Stücke mit todtem Federvieh. Auf dem einen, auf einen Tisch liegt ein Hahn und Tauben. Zur Linken eine Katze, welche auf den Raub bedacht ist. Das andere, ein hängender Fasan, auf einem Tische liegen Tauben. Gut gemahlt. Auf Leinwand, im schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein Stück mit todtem Federvieh. Ein hängender Fasan, auf einem Tische liegen Tauben Mat.: auf Leinwand Maße: GEMÄLDE
299
Hoch 32 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 16 und 17 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Bloemaert, Abraham 1716/00/00 FRHDR 0102 Blomard I Von Blomard Mutter Gottes und das Kind Jesus. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (75) 1742/08/01 BOAN 0485 Abraham Blumard I Ein grosses Stuck, worauff Christus mit denen Jüngeren zu Tisch sitzet. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0300 Abraham Blumard I J. Christ ä Table avec les disciples, par Abraham Blumard. [Een Avondmaal door Α. Bloemaart.] I Maße: Haut 4. pieds 10. pou., large 6. pieds 2. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt (31) 1743/00/00 BWGRA 0009 Abrah. Bloemaart I Eine Venus im Bade, so sich die Nägel am Fusse abschneidet, w o ein nebenstehender Cupido zusiehet, von Abrah. Bloemaart sehr schöen gemahlet. I Maße: hoch 5 Fuß 8 Zoll, breit 4 Fuß 1 Zoll Transakt.: Unbekannt
schöne Natur gewehlet hat, noch weniger sie durch die Kunst zu verschönern gesuchet hat. Der hintere Grund stellet ein Feld vor wo geemdtet wird; die Haltung im Colorit ist lebhaft und besonders mit vieler Fertigkeit gemahlt. [Text hier gekürzt]. I Mat.: auf Leinwand Maße: 5 Fuß 8 Zoll hoch und 6 Fuß 9 Zoll breit Verkäufer: Johann Georg Eimbke Transakt.: Verkauft (105 Rt) Käufer: Hofk Trieblr Gegenw. Standort: Montreal, Canada. Museum of Fine Arts. (1971.26) 1764/05/21 BOAN 0048 Abraham Bloemart I Un Tableau d'un pied dix pouces de hauteur, d'un pied six pouces de largeur, representant la tete d'un Vieillard en sa grandeur naturelle peinte par Abraham Bloemart. [Ein stück Vorstellend einen alten Kopf in Lebensgröße Von Abraham Bloemart.] I Maße: 1 pied 10 pouces de hauteur, 1 pied 6 pouces de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (41.30 Rt) Käufer: Frantzen 1764/11/26 LZBER 0016 Blömant I Die Flucht Christi von Βlömant. I Transakt.: Unbekannt 1766/07/28 KOSTE 0054 Blomart I Eine Frau mit Katzen auf holz von Blomart. I Mat.: auf Holz Transakt.: Verkauft (3 Rt)
1743/00/00 BWGRA 0010 Abraham Bloemaart I Ein Portrait von Abraham Bloemaart. I Maße: hoch 1 Fuß 10 Zoll, breit 1 Fuß 7 Zoll Transakt.: Unbekannt
1766/07/28 KOSTE 0143 Abraham Blomart I Ein Stuck auf Leinwandt stellt vor ein altes Weib von Abraham Blomart. I Mat.: auf Leinwand Transakt.: Unbekannt (3.30 Rt)
1749/07/31 HBRAD 0091 Blomart I Zwey Historien=Stücke. i Diese Nr.: Ein Historien=Stück Anm.: Die Lose 91 und 92 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (5.8 für die Nrn. 91 und 92)
1771/05/06 FRAN 0022 Bloemart I Die Verkündigung Christi denen Hirten durch einen Engel, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 19 Zoll, breit 14 Zoll Verkäufer: Johann Friederich Armand von Uffenbach Transakt.: Verkauft (4.8 fl) Käufer: [unleserlich]
1749/07/31 HBRAD 0092 Blomart I Zwey Historien=Stücke. I Diese Nr.: Ein Historien=Stück Anm.: Die Lose 91 und 92 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (5.8 für die Nrn. 91 und 92)
1773/12/18 HBBOY 0067 Abr. Blomardt [Mannskopf]. I Transakt.: Unbekannt
1763/11/09 FRJUN 0018 Bloemaart I Un excellent Tableau representant l'Ange qui annonce aux Bergers la naissance de Jesus, rempli de figures & le tout admirablement peint, dans son meilleur tems. I Maße: hauteur 21 Vi pouces, largeur 15 Vi pouces Transakt.: Verkauft (18.35 fl) Käufer: Dick 1764/00/00 BLAN 0346 A. Blomart I Tobias mit den Engel, beydes landschaften und figuren. I Diese Nr.: Tobias mit den Engeln, landschaft und figuren Maße: 4 Fuß 4 Vi Zoll hoch, 3 Fuß 5 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 346 und 347 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (800 Rt für die Nrn. 346 und 347, Schätzung) Gegenw. Standort: Sankt-Peterburg, Rossiya. Ermitazh. (N 3545) 1764/00/00 BLAN 0347 A. Blomart I Tobias mit den Engel, beydes landschaften und figuren. I Diese Nr.: Tobias mit den Engeln, landschaft und figuren Maße: 4 Fuß 4 Vi Zoll hoch, 3 Fuß 5 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 346 und 347 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (800 Rt für die Nrn. 346 und 347, Schätzung) Gegenw. Standort: Sankt-Peterburg, Rossiya. Ermitazh. (N 9911) (?) 1764/00/00 BLAN 0381 Blomart I Die Nacht vorstellend. I Maße: 5 Fuß 3 Vi Zoll hoch, 4 Fuß 2 Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (500 Rt Schätzung) 1764/03/12 FRKAL 0008 A. Bloemaart I L'Ange qui annonce aux Bergers la naissance de Jesus, rempli de figures, peint dans son meilleur tems. I Maße: hauteur 24 pouces, largeur 16 pouces Transakt.: Verkauft (27 fl) Käufer: Kaller 1764/05/18 BLAN 0017 Abraham Bloemaart I Die Mittagsstunden. Ganze Figuren Lebensgröße auf Leinwand gemahlt; 5. Fuß 8. Zoll hoch und 6. Fuß 9. Zoll breit. Einige Bauren die Mittagsstunde halten auf dem Felde; ein Bauermädgen die sich ausdehnet, in dessen Gesichte die Müdigkeit sehr gut ausgedruckt ist. Vorne an lieget ein Bauer der schläft, der vom Rücken anzusehen und sehr natürlich und frey gezeichnet ist; nur ist es Schade, daß der Meister nicht die 300
GEMÄLDE
1774/08/13 HBBMN 0031 grau. I Transakt.: Unbekannt
A. Blomaert
I Ein alter dito I Eine Scizze, grau in
1774/08/13 HBBMN 0072 A. Blomaert I Ein allegorisches Stück, die Zeit, der Fleiß, und die Faulheit. I Transakt.: Unbekannt 1774/10/05 HBNEU 0112 Transakt.: Unbekannt
Abr. Blomard I Ein Evangeliste. I
1775/04/12 HBNEU 0008 A. Bloemaert I Johannes prediget in der Wüsten; in der Entfernung siehet man die taufe Christi, meisterhaft gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt 1775/09/09 HBBMN 0019 Abraham Bloemaert I Die Predigung Johannis des Täufers in der Wüsten, ein extra rares und wunderschönes Bild, heiter, und dabey glühend von Colorit, reich von Ordonnanz und Figuren, angefüllet mit vortrefflich behandelten Bäumen, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 4 F, Breit 5 F 8 Ζ Transakt.: Verkauft (30.4 M) Käufer: Oom [?] 1775/09/09 HBBMN 0036 Bloemaert I Die goldene Zeit, reich von Figuren, auf Kupfer gemahlt. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 1 F 6 Z, Breit 2 F 3 Ζ Transakt.: Verkauft (26 M) Käufer: Kohlm[es] 1776/00/00 WZTRU 0228 Abraham Bloemaert I Ein Stück 1 Schuhe, 11 Zoll hoch, 1 Schuhe, 5 Zoll breit von Abraham Bloemaert, stellet vor die heilige Magdalena, welche mit der einen Hand ein Crucifix mit der andern Hand aber eine Alabasterbüchse haltet: die Art der Malerey ist zwar sehr antique, allein aber sehr wohlausgeführet. I Pendant zu Nr. 229 Maße: 1 Schuhe 11 Zoll hoch, 1 Schuhe 5 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (3 fl Schätzung) 1776/00/00 WZTRU 0229 Abraham Bloemaert I Compagnion zu Nro. 228 stellet vor den heiligen Hieronymus , von gleichem Gusto des obigen Meisters [Abraham Bloemaert] verfertiget. I Pendant zu Nr. 228 Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (3 fl Schätzung) 1776/04/15 HBBMN 0150 Abrah. Blomard I Ein grosses Stück, mit ein Fahrzeug, beladen mit Vieh und Bauren. I Maße: Höhe 4 Fuß 9 Zoll, Breite 6 Fuß 2 Zoll Transakt.: Unbekannt
1777/02/21 HBHRN 0015 Abrah. Blomard I Eine alte Frau, so bey einen Krück gehet, ungemein natürlich. I Maße: Höhe 2 Fuß 4 Vi Zoll, Breite 1 Fuß 11 Zoll Transakt.: Unbekannt 1777/02/21 HBHRN 0067 Abr. Blomard I Die Geburt Christi. I Maße: Höhe 3 Fuß 8 Zoll, Breite 3 Fuß 2 Zoll Transakt.: Unbekannt 1777/03/03 AU AN 0035 Blumart I Eine Auferweckung Lazari. I Maße: Höhe 2 Sch., Breite 3 Sch. 5 Vi Zoll Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt 1777/05/26 FRAN 0021 Bloemart I 2 St. In Tannenholz gemahlt, mit Kupferstich, v. Bloemart & Ostade. I Diese Nr.: 1 St. In Tannenholz gemahlt, mit Kupferstich; Nr. 22 von Ostade Anm.: Die Lose 21 und 22 wurden zusammen katalogisiert. Es ist unklar, ob sich der Titel des Loses auf zwei Gemälde und einen Kupferstich oder ein Gemälde und einen Kupferstich bezieht. Wir vermuten Letzteres, aber es bleibt dennoch unklar, welchem Künstler das Gemälde zuzuweisen ist. Verkäufer: Finsterwalder Transakt.: Verkauft (1.36 fl) Käufer: Mevius 1778/05/21 HBKOS 0002 Blomard I Orcheus [siel, unter der Belustigung der Thiere. I Transakt.: Unbekannt 1778/05/23 HBKOS 0032 Bloemaert I Paris mit den Aepfel, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 23 Zoll, Breite 17 Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/05/23 HBKOS 0038 Bloemart I Ein Hieronimus, kleine Lebengrösse, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 19 Vi Zoll, Breite 15 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/09/28 FRAN 0031 Abraham Bloemaat I Die Flucht nach Aegypten. [La fuite en Egypte par Abraham Bloemat.] I Maße: 3 Schuh 10 Zoll breit, 2 Schuh 11 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (40.30 fl) Käufer: Jos Brentano 1778/09/28 FRAN 0174 Abr. Bloemaert I Ein Crucifix mit der heil. Maria und dem heil. Johannes. [Un Crucifix avec la S. Vierge & S. Jean.] I Maße: 2 Schuh 3 Zoll breit, 3 Schuh hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (5.30 fl) Käufer: Morgenstern 1778/09/28 FRAN 0607 Abraham Bloemart I Zwey mit einander scherzende junge Leute. [Deux jeunes gens badinant ensemble.] I Maße: 1 Schuh 9 Zoll breit, 2 Schuh 4 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (41 fl) Käufer: Dr Hartzberg 1778/09/28 FRAN 0608 Α. Bloemart I Eine Schäferinn. [Une bergere.] I Maße: 2 Schuh breit, 2 Schuh 8 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (4 fl) Käufer: Schweitzer [...?] 1778/10/30 HBKOS 0121 A. Bloemarh I Der Apostel St. P. Ein meisterhaftes Gemähide, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 37 Vi Zoll, breit 30 Zoll Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0066 A. Bloemaert I Eine Hirtinn, die auf einem grauen Pferde sitzt, vor welchem ein bepackter Schimmel geht, spricht mit einem Hirten, der zur Linken einige Ochsen durchs Wasser treibt. Der Zug geht zur Rechten an einem moosichten Felsen mit altem Gemäuer vorbey, und ein Hirte reitet auf einem bepackten Esel voran. [Une bergere, montee sur un cheval gris, devant lequel marche un cheval blanc charge, s'entretient avec un berger, qui est ä gauche & qui fait passer la riviere ä ses boeufs. La troupe passe devant un rocher tapisse de mousse & couvert de vieilles masures; un berger marche ä la tete, monte sur un äne charge.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 8 Zoll hoch, 2 Fuß 1 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0334 Bloemaert I Das Bildniß eines alten Mannes. [Portrait d'un vieillard.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 4 Zoll hoch, 1 Fuß breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt
1779/00/00 HB AN 0335 Bloemaert I Das Bildniß einer alten Frau. Beide [Nr. 334 und 335] auf Holz. [Portrait d'une vieille. Tous deux peints sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 4 Zoll hoch, 1 Fuß breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/09/27 FRNGL 0042 Abraham Bloemarth I Das kananäische Weib, wie es zu Christo komt, mit vielen schönen wohlcroupirten Figuren. [La femme Cananeenne venante ä Jesus-Christ, avec beaueoup de belles figures tres bien groupees.] I Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Transakt.: Verkauft (11.15 fl) Käufer: Hüsgen 1779/09/27 FRNGL 0293 Abraham Bloemaert I Adam und Eva im Paradies, fleißig und schön ausgeführt. [Adam & Eve au Paradis, tres belle piece], I Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 10 Zoll breit Transakt.: Verkauft (20.59 fl) Käufer: Hüsgen 1779/09/27 FRNGL 0842 Abraham Bloemaert I Eine unvergleichlich geistreich, meisterhaft und fleißig ausgeführte Geburt Christi. [La naissance de Jesus-Christ, piece excellente.] I Maße: 2 Schuh 5 Vi Zoll hoch, 3 Schuh 5 Zoll breit Transakt.: Verkauft (80 fl) Käufer: Dehnhardt 1781/00/00 WZAN 0228 Abraham Bloemaert I Ein Stück 1 Schuhe, 11 Zoll hoch, 1 Schuhe, 5 Zoll breit von Abraham Bloemaert, stellet die heil. Magdalena vor, welche mit der einen Hand ein Krucifix, mit der andern aber eine Alabasterbüchse haltet: die Art der Malerey ist zwar sehr antik, aber sehr wohl ausgeführet. I Pendant zu Nr. 229 Maße: 1 Schuhe 11 Zoll hoch, 1 Schuhe 5 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0229 Abraham Bloemaert I Der Kompagnon zu Nro 228 stellet den heil. Hieronymus vor, und ist von gleichem Gusto des obigen Meisters [Abraham Bloemaert] verfertiget. I Pendant zu Nr. 228 Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0222 Abraham Bloemaert I Ein Mädchen, das nach Noten singet, und ein Knabe, der auf der Flöte bläset. An beyden ist Natur und denkendes Gefühl aufs lebhafteste abgebildet; Collorit und Klarheit in den Farben, wie auch ein leichter und freyer Pinsel an denselben, veredeln diese Stücke im ganzen, auf Holz. I Diese Nr.: Ein Mädchen, das nach Noten singet Mat.: auf Holz Maße: Höhe 26 Zoll 6 Linien, Breite 20 Zoll 3 Linien Anm.: Die Lose 222 und 223 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0223 Abraham Bloemaert I Ein Mädchen, das nach Noten singet, und ein Knabe, der auf der Flöte bläset. An beyden ist Natur und denkendes Gefühl aufs lebhafteste abgebildet; Collorit und Klarheit in den Farben, wie auch ein leichter und freyer Pinsel an denselben, veredeln diese Stücke im ganzen, auf Holz. I Diese Nr.: Ein Knabe, der auf der Flöte bläset Mat.: auf Holz Maße: Höhe 26 Zoll 6 Linien, Breite 20 Zoll 3 Linien Anm.: Die Lose 222 und 223 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1784/08/02 FRNGL 0174 Abraham Blcemaert I Die Antrometa am Felsen geschlossen. I Maße: 7 % Zoll breit, 10 Zoll hoch Verkäufer: Β Transakt.: Verkauft (2.32 fl) Käufer: Collomb 1784/08/02 FRNGL 0570 Abraham Bloemart I Die Geburt Christi, von reicher Composition und meisterhafter Ausführung. I Maße: 25 Zoll breit, 33 Vi Zoll hoch Transakt.: Verkauft (36 fl) Käufer: Knapper 1785/03/14 DRHLM 3583 A. Bloemaert I Sr. Paul en couleur, par Α. Bloemaert. I Anm.: Es ist unsicher, ob es sich um ein Gemälde oder um eine Zeichnung handelt. Verkäufer: Christian Gotthold Crußius Transakt.: Unbekannt (0.9 Rt) 1785/04/22 HBTEX 0082 Abraham Blomart I Die Predigt Johannes in der Wüsten, mit vielen Zuhörern. Von großer Composition und Force. Auf Leinewand. Goldner Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 52 Zoll, breit 76 Zoll Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
301
1785/05/17 MZAN 0727 Bloemaert I Zwey biblische Historiestücke von Bloemaert. [Deux pieces, dont le sujet est pris de la bible.] I Diese Nr.: Ein biblisches Historiestück Maße: 4 Schuh 7 Zoll hoch, 6 Schuh 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 727 und 728 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (10.30 fl für die Nrn. 727 und 728) Käufer: Strecker 1785/05/17 MZAN 0728 Bloemaert I Zwey biblische Historiestücke von Bloemaert. [Deux pieces, dont le sujet est pris de la bible.] I Diese Nr.: Ein biblisches Historiestück Maße: 4 Schuh 7 Zoll hoch, 6 Schuh 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 727 und 728 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (10.30 fl für die Nrn. 727 und 728) Käufer: Strecker 1786/10/18 HBTEX 0043 A. Bloemart \ Die den Hirten geschehene Verkündigung - und die Taufe Christi von Johanne im Jordan. Beyde mit Geist vorgestellet und vortreflich gemahlt auf Kupfer. I Diese Nr.: Die den Hirten geschehene Verkündigung Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 17 Zoll 9 Linien, breit 13 Zoll 3 Linien Anm.: Die Lose 43 und 44 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/10/18 HBTEX 0044 A. Bloemart I Die den Hirten geschehene Verkündigung - und die Taufe Christi von Johanne im Jordan. Beyde mit Geist vorgestellet und vortreflich gemahlt auf Kupfer. I Diese Nr.: Die Taufe Christi von Johanne im Jordan Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 17 Zoll 9 Linien, breit 13 Zoll 3 Linien Anm.: Die Lose 43 und 44 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/10/18 HBTEX 0231 A. Bloemard I Eine Dorf=Gegend; im Vorgrunde zwey große Stämme von Bäumen, welche eine Oeffnung vorbilden, mit perspectivischer ländlichen Entfernung: Zur Rechten lieget ein schlafender Hirte mit seiner Frauen; lebhaft gemahlt auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 14 Zoll, breit 20 Zoll Transakt.: Unbekannt 1787/00/00 HB AN 0183 Abr. Blomaert I Ein junges lachendes Mädchen, nur mit einem dünnen weißen Gewände umworfen, und mit einem Strohhuthe auf dem Kopf; vor ihr steht ein bärgtiger Alter, der sie umfasset und carreßirt. Dieses Bild ist besonders schön wegen des zwischen den beyden Figuren einfallenden Lichts, welches eine vortreffliche Wirkung verursacht. Von einer sanften und angenehmen Mahlerey, so daß man es nicht von diesem Meister halten sollte. A.H. [Auf Holz] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 32 Zoll, breit 25 Zoll Transakt.: Verkauft (69 M) Käufer: Cober 1787/00/00 HB AN 0255 A. Bloemaert I Maria sitzt im Vordergrunde, und zeigt einigen Hirten den neugebohrnen Heiland. Hinten befindet sich Joseph. A.K. [Auf Kupfer] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 13 Zoll, breit 10 Zoll Transakt.: Verkauft (26.8 M) Käufer: Cober 1787/10/06 HBTEX 0039 Blomardt I Zwey fleißige Landschaften. I Diese Nr.: Eine fleißige Landschaft Anm.: Die Lose 39 und 40 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1787/10/06 HBTEX 0040 Blomardt I Zwey fleißige Landschaften. I Diese Nr.: Eine fleißige Landschaft Anm.: Die Lose 39 und 40 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1787/10/06 HBTEX 0154 A. Blomard I Ein Fischer, so einen Fisch in der Hand hält. I Transakt.: Unbekannt 1788/04/08 FRFAY 0133 A. Bloemaert I Eine alte Frau mit zusammengefallenen Händen, von A. Bloemaert. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: 10 'Λ Z. hoch, und 7 Vi Z. breit Transakt.: Verkauft (3 fl) Käufer: Mevius 1789/04/16 HBTEX 0050 Abraham Bloemart I In einer Landgegend schläft ein Hirte mit seinem Weibe in guter Ruhe unter einigen Bäumen; lebhaft vorgestellt auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 14 Zoll, breit 12 Zoll Transakt.: Verkauft (1.10 M) Käufer: Ego 302
GEMÄLDE
1789/04/16 HBTEX 0088 A. Bloemart I Die Verehrung des Christkindes von denen Hirten, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 26 Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Verkauft (4.02 M) Käufer: Sieberg 1789/08/18 HBGOV 0114 A. Bloemaert I Ein sitzender Hirthe spricht mit seiner getreuen Hirthinn, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 12 Zoll Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0092 Abr. Bloemart I Johann der Täufer, auf Leinwat, in einer geschnittenen und vergoldeten Ram. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 6 Zoll, Breite 1 Schuh 10 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0275 Abr. Bloemart I Eine Maria mit dem Kinde im Arm, auf Leinwat. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 4 Schuh 2 Zoll, Breite 3 Schuh 3 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/02/04 HBDKR 0013 A. Blaemcert I Zwey Land= und Wassergegenden mit Dörfern, wo Landleute fischen und andere Arbeiten verrichten; sehr lebhaft nach der Natur gemahlt, auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Land= und Wassergegend mit Dörfern, wo Landleute fischen und andere Arbeiten verrichten Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 36 Zoll, breit 51 Zoll Anm.: Die Lose 13 und 14 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (9.4 Μ für die Nrn. 13 und 14) Käufer: Ego 1790/02/04 HBDKR 0014 A. Blcemcert I Zwey Land= und Wassergegenden mit Dörfern, wo Landleute fischen und andere Arbeiten verrichten; sehr lebhaft nach der Natur gemahlt, auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Land= und Wassergegend mit Dörfern, wo Landleute fischen und andere Arbeiten verrichten Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 36 Zoll, breit 51 Zoll Anm.: Die Lose 13 und 14 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (9.4 Μ für die Nm. 13 und 14) Käufer: Ego 1790/04/13 HBLIE 0064 A. Bloemart I Eine Dorfgegend mit Hirten, Rinder und Schafe. In der Entfernung siehet man den verlohnten Sohn die Schweine hüten. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 18 Zoll, breit 28 Zoll Transakt.: Verkauft (9 Sch) Käufer: Ego 1790/05/20 HBSCN 0208 Abraham Bloemart I Gebürgigte Land= und Wassergegenden mit Schlösser und Dörfer, im Vordergrunde viele Figuren, welche sich mit Fischangeln und andern Dingen beschäftigen; alles ist von einem schönen Sonnenlicht beleuchtet, ganz besonders reitzend und angenehm gemahlt. Vom benannten grossen Künstler besten Zeit, auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine gebürgigte Land= und Wassergegend mit Schlösser und Dörfer Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 47 Zoll Anm.: Die Lose 208 und 209 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (14 Μ für die Nrn. 208 und 209) Käufer: Fesser 1790/05/20 HBSCN 0209 Abraham Bloemart I Gebürgigte Land= und Wassergegenden mit Schlösser und Dörfer, im Vordergrunde viele Figuren, welche sich mit Fischangeln und andern Dingen beschäftigen; alles ist von einem schönen Sonnenlicht beleuchtet, ganz besonders reitzend und angenehm gemahlt. Vom benannten grossen Künstler besten Zeit, auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine gebürgigte Land= und Wassergegend mit Schlösser und Dörfer Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 47 Zoll Anm.: Die Lose 208 und 209 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (14 Μ für die Nrn. 208 und 209) Käufer: Fesser 1790/08/13 HBBMN 0039 Bloemart I Christus am Oelberge; hinten die schlafenden Jünger ec. besonders fleißig gemahlt. Auf Holz S.R.G.L. [Schwarzen Rahm, goldne Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 14 Zoll, breit 10 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (1.8 M) 1790/08/25 FRAN 0508 Bloemart I Eine Landschaft mit Pferden und schlafenden Figuren. I Maße: hoch 12 Zoll, breit 15 Zoll
Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (5 fl) Käufer: Lindlau
1796/12/07 HBPAK 0166 Transakt.: Unbekannt
1791/01/05 HBBMN 0276 A. Bloemart I Der Evangelist Matthäus mit dem Engel, besonders schön gemahlt, von A. Bloemart. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Vi Zoll, breit 11 Zoll Transakt.: Verkauft (14 M) Käufer: Ego
1797/04/25 HBPAK 0052 Blomeart I Eine Mutter hält ihren Säugling auf ihrem Schooß, welcher einen Apfel in seinen Händchen hat. Die mütterliche Liebe, und die Freude des Kindes sind wunderbar ausgedrückt. Auf Leinwand, schwarzen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 29 V2 Zoll, breit 24 Zoll Transakt.: Unbekannt
1791/07/29 HBBMN 0012 A. Blomert I Eine Landschaft, da unter einem Baum, im Dorfe ein Hirte mit seiner Frau lieget; auf Holz. 1 Mat.: auf Holz Maße: Hoch 20 Zoll, breit 19 Zoll Transakt.: Unbekannt (2 M) 1791/09/21 FRAN 0100 Bloemaert I Eine reiche und wohl verfertigte Vereinbarung von vier bis sechs und dreißig Figuren, welche Glorien vorstellen, so die Jungfrau umringen, die das Kind auf ihrem Schoose hält, welchem eine Königinn Huldigung leistet, unten zur Linken sind schöne reiche Säulen, man siehet Engel, welche auf verschiedenen Instrumenten spielen; dieses Stück ist sehr durchscheinend, die Farben sind wohl gemischt und es ist sehr ausdrücklich. I Transakt.: Verkauft (117 fl) Käufer: Hindt 1791/09/21 FRAN 0131 Abraham Bloemaert I Eine sterbende Heilige, so zwo Frauen bey sich hat, die ihr Hülfe leisten; dieses kleine Gemälde ist gestochen worden. I Transakt.: Verkauft (5.15 fl) Käufer: Levy 1791/09/26 FRAN 0130 Abrah. Blömart I Ein sitzendes Bauemweib mit gefaltenen Händen, ungemein gut ausgeführt von Abrah. Blömart 1627. I Maße: 9 Zoll breit, 12 Zoll hoch Inschr.: 1627 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1792/04/19 HBBMN 0041 Abr. Bloemart I Die Geschichte der Diana mit Catista [sie], plaisant gemahlt, von Abr. Bloemart. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 % Zoll, breit 13 Zoll Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0127 Abraham Blummard I Ein kniender, mit ausgestreckten Händen bethender Elisäus auf Baneel von Abraham Blummard. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Schuh 4 Vi Zoll hoch, 11 Vz Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0215 Blömart I Die Verkündigung der Geburt Christi den Hirten mit einer Glorie von Engeln umgeben, von Blömart. I Maße: 2 Schuh 3 Zoll hoch, 1 Schuh 10 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 FGAN [B]0137 Abraham Blömart I Christus, wie er die Kranken besucht, auf Holz gemalt. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Schuh 5 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 1 Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt 1795/03/12 HBSDT 0223 Alb. Blcemart I Christus beym Brunnen. I Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "Alb. Blcemart", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0072 Abr. Blömart I Die Anbetung der Hirten. Schön ordinieret, und dreist im italiänischen Geschmack gemahlt; wie Bassano. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Zoll, breit 36 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0079 Blomardt I Die Geburt Christi, mit vielen Figuren. Auf Holz. Schwarzer Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 10 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0072 Abraham Blomeart I Die Geburt Christi, wie die Hirten das Christkind anbeten; in der Luft ein Chor jubilirender Engel. Eins von seinen schönsten Gemählden. I Maße: Hoch 18 Vi Zoll, breit 12 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0163 Transakt.: Unbekannt
A. Blomert I Cains Bruder=Mord. I
A. Blomert I Ein alegorisches Stück. I
1797/04/25 HBPAK 0217 Blomeart I Eine Landschaft, mit dem heiligen Hieronimus. Meisterhaft gemahlt. Auf Holz, schwarzen Rahm, goldene Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 8 Zoll, breit 6 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/09/13 FRAN 0044 Abraham Bloemaert I Die Ueppigkeiten vor der Sündfluth. I Maße: 10 Zoll hoch, 1 Schuh 2 Zoll breit Transakt.: Unbekannt (2 [?] fl) 1799/00/00 LZAN 0047 Abraham Blömart I Deux Pendants; plusieurs figures d'hommes et femmes rassemblees et mises en action, en clair-obscur. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hauteur 19 pouces, largeur 18 pouces Transakt.: Unbekannt (20 Louis Schätzung) 1799/00/00 WZAN 0009 Abraham Bloemaert I Eine Bauernhütte, einige Figuren und Viehe, von Abraham Bloemaert. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 4 Zoll breit 1 Schuh Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0508 A. Blömart I Die Andromede. von A. Blömart. oval. I Format: oval Transakt.: Unbekannt
Bloemaert, Abraham (Geschmack von) 1776/04/15 HBBMN 0084 Blomardt I Ein Hirten=Stück, in einer Landschaft, im Gusto von Blomardt. I Maße: Höhe 3 Fuß 5 Zoll, Breite 4 Fuß 7 Zoll Transakt.: Verkauft (9 M) Käufer: Leck
Bloemaert, Abraham (Kopie nach) 1743/00/00 BWGRA 0206 Abrah. Bloemaart I Die heilige Familie, nach Abrah. Bloemaart. I Maße: hoch 1 Fuß 4 Zoll, breit 1 Fuß 9 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1772/09/15 BNSCT 0044 Bloemart I Sechs Portraits: so viel Aposteln vorstellend, nach Blcemart, 8 Zoll hoch, 6 Zoll breit, auf Holz. I Diese Nr.: Ein Apostel Mat.: auf Holz Maße: 8 Zoll hoch, 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 44 bis 49 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (1 fl) 1772/09/15 BNSCT 0045 Bloemart I Sechs Portraits: so viel Aposteln vorstellend, nach Blcemart, 8 Zoll hoch, 6 Zoll breit, auf Holz. I Diese Nr.: Ein Apostel Mat.: auf Holz Maße: 8 Zoll hoch, 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 44 bis 49 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (1 fl) 1772/09/15 BNSCT 0046 Biosmart I Sechs Portraits: so viel Aposteln vorstellend, nach Blcemart, 8 Zoll hoch, 6 Zoll breit, auf Holz. I Diese Nr.: Ein Apostel Mat.: auf Holz Maße: 8 Zoll hoch, 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 44 bis 49 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (1 fl) 1772/09/15 BNSCT 0047 Bloemart I Sechs Portraits: so viel Aposteln vorstellend, nach Blcemart, 8 Zoll hoch, 6 Zoll breit, auf Holz. I Diese Nr.: Ein Apostel Mat.: auf Holz Maße: 8 Zoll hoch, 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 44 bis 49 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (1 fl) 1772/09/15 BNSCT 0048 Bloemart I Sechs Portraits: so viel Aposteln vorstellend, nach Blcemart, 8 Zoll hoch, 6 Zoll breit, auf Holz. I Diese Nr.: Ein Apostel Mat.: auf Holz Maße: 8 Zoll hoch, 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 44 bis 49 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (1 fl) GEMÄLDE
303
1772/09/15 BNSCT 0049 Bloemart I Sechs Portraits: so viel Aposteln vorstellend, nach Bloemart, 8 Zoll hoch, 6 Zoll breit, auf Holz. I Diese Nr.: Ein Apostel Mat.: auf Holz Maße: 8 Zoll hoch, 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 44 bis 49 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (1 fl)
peinte, avec des fleurs & des fruits.] I Maße: 1 Schuh 2 Vi Zoll hoch, 11 Zoll breit Transakt.: Verkauft (3 fl) Käufer: Kaufman Maintz
1776/07/19 HBBMN 0085 Blomardt I Eine biblische Geschichte, nach Blomardt. I Maße: Höhe 2 Fuß 4 Zoll, Breite 1 Fuß 9 Zoll Transakt.: Verkauft (4.6 M) Käufer: Köster
1787/10/06 HBTEX 0031 H. Blomard I Ein alter Mann mit seiner Frau. I Diese Nr.: Ein alter Mann Anm.: Dieses Los trägt im Katalog irrtümlicherweise die Nr. 21. Die Lose 31 und 32 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1788/09/01 KOAN 0192 Blömart I Die Geburt Christi, nach Blömart. [1 p[iece], la Nativite de Jesus Christ, selon Bloemart.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 3 Fuß 1 Zoll, Breite 2 Fuß 5 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1790/05/20 HBSCN 0244 Nach Bloemart I Dorfgegend mit Hirten und Vieh. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 18 Zoll, breit 27 Vi Zoll Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (1.4 M) Käufer: Soltau 1792/08/20 KOAN 0319 Blumard I Ein Mutter Gottes mit gefallenen Händen in oval nach Blumard. I Format: oval Maße: 1 Schuh 7 Zoll hoch, 1 Schuh 3 Vi Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt
Bloemaert, Abraham (Manier) 1790/04/13 HBLIE 0239 Wie Bloemart I Die Verkündigung Christi durch den Engel, bei die Hirten. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 14 Zoll, breit 18 Zoll Transakt.: Verkauft (4 Sch) Käufer: Schilack
Bloemaert, Hendrick
1787/10/06 HBTEX 0032 H. Blomard I Ein alter Mann mit seiner Frau. I Diese Nr.: Seine Frau Anm.: Die Lose 31 und 32 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1793/09/18 HBSCN 0083 H. Blomert I Im Thal von Felsen und Klippen ein Trift Ochsen, mit dem Treiber, im Hintergrund noch eine gebürgigte Landschaft, das einfallend Licht verherlicht dies schöne Bild. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 18 Zoll, breit 10 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1793/09/18 HBSCN 0084 H. Blomert I Sowohl auf den Hügel zur Linken, als auch im Thal mit Bäume umgeben, weiden Ziegen ohne Hirten, in der Mitte ein Fluß, vorauf ein Kahn gefahren wird, den etliche am Ufer stehende Personen erwarten, zur Rechten eine Stadt, hinter Wiese ragen Gebürge hervor. Im sanften Tohn gemahlt. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Vi Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Unbekannt
Bioemen
1791/01/05 HBBMN 0292 A. Bloemart I Die Geschichte der Diana und der Callista. Wie A. Bloemart. Auf Leinwand gemahlt. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 1014 Zoll, breit 16 14 Zoll Transakt.: Verkauft (0.10 M) Käufer: Ego
1763/11/09 FRJUN 0017 van Bioemmen I Une tres bonne piece representant un cabaret de pai'sans dans un pai'sage orne de plusieurs figures, chevaux & un chariot de foin. I Maße: hauteur 18 pouces, largeur 22 Vi pouces Transakt.: Verkauft (18 fl) Käufer: Kaller
Bloemaert, Abraham (Schule)
1764/03/12 FRKAL 0009 Van Bioemen I Un agreable pai'sage ome de figures & de chevaux aupres d'un cabaret de pai'sans tres bien peint. I Maße: hauteur 19 pouces, largeur 24 pouces Transakt.: Verkauft (25.30 fl) Käufer: Schütz
1769/03/30 HBTOU 0041 Blömart I Andromeda & Leda aus der Blomartischen Schule. [Die Mehresten in fein verguldte Rahmen, und die übrigen in schwarz gebeizten mit goldenen Staber.] I Diese Nr.: Andromeda Maße: Höhe 1 Fuß 8 Zoll, Breite 1 Fuß 2 Zoll Anm.: Die Lose 41 und 42 wurden zusammen katalogisiert. Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 51 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 51. Transakt.: Verkauft (7.12 Μ für die Nrn. 41 und 42) Käufer: Lilie Sen 1769/03/30 HBTOU 0042 Blömart I Andromeda & Leda aus der Blomartischen Schule. [Die Mehresten in fein verguldte Rahmen, und die übrigen in schwarz gebeizten mit goldenen Staber.] I Diese Nr.: Leda Maße: Höhe 1 Fuß 8 Zoll, Breite 1 Fuß 2 Zoll Anm.: Die Lose 41 und 42 wurden zusammen katalogisiert. Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 51 und beziehen sich auf die Nm. 1 bis 51. Transakt.: Verkauft (7.12 Μ für die Nrn. 41 und 42) Käufer: Lilie Sen 1775/09/09 HBBMN 0049 Bloemaert I Zwey Stücke, ein alter Manns= und ein alter Frauens=Kopf, auf Leinewand, aus Bloemaerts Schule. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 1 F 2 Z, Breit 10 Ζ Transakt.: Verkauft (9 Μ für jedes Gemälde) Käufer: Pauli 1779/09/27 FRNGL 0413 Abraham Bloemart I Die Geburt Christi, aus der Schul von Abraham Bloemart. [La naissance de Jesus-Christ, de l'ecole d'Abraham Bloemart.] I Maße: 2 Schuh 2 Vi Zoll hoch, 2 Schuh breit Transakt.: Verkauft (3.12 fl) Käufer: Mevius
1764/03/12 FRKAL 0153 Bioemen I Un cheval par Bioemen. I Anm.: Dieses Los wurde zusammen mit der Nr. 152 (Bemmel) verkauft. Transakt.: Verkauft (2.8 fl für die Nrn. 152 und 153) Käufer: R Ehrenreich 1764/05/14 BOAN 0330 Blomen I Un Tableau de trois pieds trois pouces de largeur, deux pieds neuf pouces de hauteur, representant le retour de la Chasse avec Chevaux & chiens enrichi de figures, peint par Bioemen. [Ein stück Vorstellend eine ruckkunft Von der jagd mit vielen figuren, pferd und hunden, Von van Blomen.] I Maße: 3 pieds 3 pouces de largeur, 2 pieds 9 pouces de hauteur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (30 Rt) Käufer: Doussetti 1765/00/00 FRRAU 0006 Blomen I Vorstellend eine Zurückkunft von der Jagd, auf Leinwand gemahlt. Dieses Stück hat viele Caracter vom Tennier, und der Meister hat bey den vielen Figuren der Pferdten und Wildpret ausnehmend Fleiß bezeiget. Die Gegend ist sehr plaisant, die Colorit machet es lieblich, und in der Haltung ist es wohl ausgeführet, überhaupt ist in diesem Stück viel gutes und schönes. In einer vergoldeten Rahmen. Representant un retour de chasse peint sur de la toile. Ce tableau a beaucoup de traits de Tennier & le Maitre a mis une peine incro'iable ä tant de figures de cheveaux & de venaison. La contree est plaisante, le Coloris le rend agreable & l'ordonnance en est bien faite. En un mot il y a bien du beau & du bon dans cette piece. Dans une bordure doree. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 2 Schuh 9 Zoll, breit 3 Schuh 3 Zoll Transakt.: Unbekannt
Bloemaert, Cornells (II) 1779/09/27 FRNGL 0479 Cornelius Bloemaert I Ein fleißiges Stückgen mit Blumen und Früchten. [Une petite piece trfes bien 304
GEMÄLDE
1768/08/16 KOAN 0052[b] van Blumen I Zwey Landschaften eine von Salvator Rosa, und die andere von van Blumen. I Diese Nr.: Eine Landschaft; Nr. 52[a] von S. Rosa Maße: Höhe 9 Zoll,
Breite 1 Fuß 3 Zoll Verkäufer: Freyherr von Kaas Transakt.: Unbekannt 1770/10/29 FRAN 0112 Bioemen I Ein Bauemstück. I Maße: Hoch 17 Zoll. Breit 12 Zoll. Transakt.: Unbekannt 1776/06/21 HBNEU 0110 v. Blomen I Zwey plaisante Schaaf= Stücke, vortreflich gemahlt, auf dito [Holz]. I Diese Nr.: Ein plaisantes Schaaf=Stück Mat.: auf Holz Maße: Höhe 8 Z, Breite 11 Ζ Anm.: Die Lose 110 und 111 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1776/06/21 HBNEU O l l i v. Blomen I Zwey plaisante Schaaf= Stücke, vortreflich gemahlt, auf dito [Holz], I Diese Nr.: Ein plaisantes Schaaf=Stück Mat.: auf Holz Maße: Höhe 8 Z, Breite 11 Ζ Anm.: Die Lose 110 und 111 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0167 van Bloom I Eine Landgegend, in welcher ein Mädchen Rinder und Schafe weidet, lebhaft gemahlt, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 20 Zoll 8 Linien, Breite 30 Zoll 9 Linien Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0203 van Bloom I Zwey CampagnenStück, so schön wie van der Meulen, auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Campagnen-Stück Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 11 Zoll 3 Linien, Breite 9 Zoll 1 Linien Anm.: Die Lose 203 und 204 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0204 van Bloom I Zwey CampagnenStück, so schön wie van der Meulen, auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Campagnen-Stück Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 11 Zoll 3 Linien, Breite 9 Zoll 1 Linien Anm.: Die Lose 203 und 204 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1785/05/17 MZAN 1047 van Bioemen I Zwey Landschaften mit Hünden von van Bioemen. [Deux paysages avec des chiens.] I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Hünden Maße: 5 Vi Zoll hoch, 4 Zoll breit Anm.: Die Lose 1047 und 1048 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (8.30 fl für die Nrn. 1047 und 1048) Käufer: Winterstein 1785/05/17 MZAN 1048 van Bioemen I Zwey Landschaften mit Hünden von van Bioemen. [Deux paysages avec des chiens.] I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Hünden Maße: 5 Vi Zoll hoch, 4 Zoll breit Anm.: Die Lose 1047 und 1048 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (8.30 fl für die Nrn. 1047 und 1048) Käufer: Winterstein 1785/05/17 MZAN 1126 van Bioemen I Ein Wirthshaus mit Reisenden. [Des voyageurs dans un cabaret, & Un paysage avec des voyageurs.] I Pendant zu Nr. 1127 Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 9 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Unverkauft 1785/05/17 MZAN 1127 van Bioemen I Das Gegenbild, eine Landschaft mit Reisenden, beide Stücke von van Bioemen. [Des voyageurs dans un cabaret, & Un paysage avec des voyageurs.] I Pendant zu Nr. 1126 Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 9 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Unverkauft 1786/11/11 HBRMS 0043 van der Blohm I Zwey Pferdestücke mit verschiedenen großen Figuren, meisterhaft vorgestellet. I Diese Nr.: Ein Pferdestück mit verschiedenen großen Figuren Maße: Höhe 18 Zoll, Breite 24 Zoll Anm.: Die Lose 43 und 44 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/11/11 HBRMS 0044 van der Blohm I Zwey Pferdestücke mit verschiedenen großen Figuren, meisterhaft vorgestellet. I Diese Nr.: Ein Pferdestück mit verschiedenen großen Figuren Maße: Höhe 18 Zoll, Breite 24 Zoll Anm.: Die Lose 43 und 44 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1788/10/01 FRAN 0148 van Bioemen I Zwey Pferdstücke mit Figuren, sehr gut croupirt von van Bioemen. I Maße: 17 Vi Zoll hoch, 21 Zoll breit Transakt.: Verkauft (12 fl) Käufer: Schneidewind 1792/08/20 KOAN 0227 van Blumen I Zwey kleine Pferdestükkelcher auf Tuch von van Blumen. I Diese Nr.: Ein kleines Pferdestückeichen auf Tuch Mat.: auf Leinwand Maße: 5 Vi Zoll hoch, 7 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 227 und 228 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0228 van Blumen I Zwey kleine Pferdestükkelcher auf Tuch von van Blumen. I Diese Nr.: Ein kleines Pferdestückelchen auf Tuch Mat.: auf Leinwand Maße: 5 Vi Zoll hoch, 7 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 227 und 228 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1796/00/00 HLAN [0072] van Blemen I Gruppe von Pferden. 11 Z. 14 Z. auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: 11 Z. 14 Z. Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: [Friedrich Karl Lang] Transakt.: Unbekannt (30.12 Rt; 55 fl Schätzung) 1797/04/25 HBPAK 0049 Van Blomme I Eine Aussicht vor einem Stadtthore, wo eine Gesellschaft reisender Comödianten ihr Theater etwas erhöhet aufgeschlagen haben, und eben anzukündigen scheinen, was sie spielen werden. Viele Zuschauer beyderley Geschlechts, und aller Stände, in Lebensgrösse; im Vordergrunde ein Trompeter, nach dessen Musick ein Bär tanzt; noch verschiedene andere Gruppen. Ganz meisterhaft gemahlt. Auf Leinwand, schwarzen Rahm, goldene Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 21 Vi Zoll, breit 30 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK O l l i van Blomme I Eine Landschaft, im Vordergrunde, der Heyland sitzend, Jünglinge unterrichtend, hinter ihm noch zwey Personen, alle in Lebensgrösse. Auf Leinwand, schwarzen Rahm, goldene Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 27 Vi Zoll, breit 37 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0124 Van Blomme I Zwey Landschaften, die erste zur rechten ein Cavalerist, neben den ein Pauker abgestiegen ist, um sich von einer nebenstehenden Frau etwas zu trinken zapfen zu lassen, im Vordergrunde drey angebundene Pferde, noch viele andere Figuren; auf der andern verschiedene Reuter nebst andern Figuren, sehr gut gemahlt. Auf Leinw., schwarzen Rahm, goldene Leisten. I Diese Nr.: Eine Landschaft, zur rechten ein Cavalerist, neben den ein Pauker abgestiegen ist, um sich von einer nebenstehenden Frau etwas zu trinken zapfen zu lassen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 20 Vi Zoll, breit 17 Zoll Anm.: Die Lose 124 und 125 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0125 Van Blomme I Zwey Landschaften, die erste zur rechten ein Cavalerist, neben den ein Pauker abgestiegen ist, um sich von einer nebenstehenden Frau etwas zu trinken zapfen zu lassen, im Vordergrunde drey angebundene Pferde, noch viele andere Figuren; auf der andern verschiedene Reuter nebst andern Figuren, sehr gut gemahlt. Auf Leinw., schwarzen Rahm, goldene Leisten. I Diese Nr.: Eine Landschaft, verschiedene Reuter nebst andern Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 20 Vi Zoll, breit 17 Zoll Anm.: Die Lose 124 und 125 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 LZRCH 0051 Van Bioemen I Un tableau de differentes figures. I Mat.: auf Leinwand Verkäufer: J F Rauch Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0104 von Blohm I Eine Landschaft, wo Herrschaften auf Pferden von der Jagd vor einem Wirthshause ruhen. Ganz kräftig gemahlt. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 31 Zoll, breit 49 Zoll Transakt.: Unbekannt 1800/07/09 HBPAK 0022 Van Bioomen I A Γ entree d'une Village, sur une grande route un marechal ferre un beau Cheval blanc, GEMÄLDE
305
pres de la est une Dame et plusieurs Voyageurs. Ce Tableaux est transparent. Sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: 23 pouces de hauteur. Sur 29 pouces de largeur Transakt.: Unbekannt
Bioemen (oder Blom) 1782/07/00 FRAN 0068 Bloem I Eine sehr schöne, felsigte, mit Wasserfall und einer wohlgewählten Staffage versehenen Landschaft. I Maße: 1 Schuh 6 Zoll hoch, 1 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] fl)
Bioemen (oder Lauterer) 1772/00/00 BSFRE 0089 Lauterer; ou Van Bioemen I Sur ce petit Tableau, il y a une Vache rouge, avec quelques Moutons & Chevres, gardes par une Femme, qui allaite un Enfant: dans un joly Payssage. Cette Piece imite fort le Pinceau de Berghem. Cadre noir avec Lit. d'ores. I Mat.: auf Holz Maße: haut 10 Vi largue [sie] 13 14 pouces Transakt.: Unbekannt
Bioemen (Kopie nach) 1797/08/10 MMAN 0203 Van Bioomen I Diese 2. Stücke stellen Pferde und Figuren vor. Auf dem einen siehet man diese Gegenstände in einer Grotte, auf dem anderen in einer Landschaft, nach Van Bioomen auf Holz. I Diese Nr.: Ein Stück Pferde und Figuren in einer Grotte vorstellend Mat.: auf Holz Anm.: Die Lose 203 und 204 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (22 fl für die Nrn. 203 und 204, Schäftung) 1797/08/10 MMAN 0204 Van Bioomen I Diese 2. Stücke stellen Pferde und Figuren vor. Auf dem einen siehet man diese Gegenstände in einer Grotte, auf dem anderen in einer Landschaft, nach Van Bioomen auf Holz. I Diese Nr.: Ein Stück Pferde und Figuren in einer Landschaft vorstellend Mat.: auf Holz Anm.: Die Lose 203 und 204 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (22 fl für die Nrn. 203 und 204, Schäftung)
Kupfer] g.R. [in goldenem Rahm] I Diese Nr.: In einer angenehmen Landschaft befindet sich im Vordergründe eine Bande Bettler Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 8 Vi Zoll, breit 11 Vi Zoll Anm.: Die Lose 498 und 499 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (12.8 Μ für die Nrn. 498 und 499) Käufer: Tietjen 1787/00/00 HB AN 0499 J. van Blohm, genannt Horizont I In einer angenehmen Landschaft befindet sich im Vordergrunde eine Bande Bettler, davon einer von dem auf einem weißen Pferd sitzenden Reisenden einen Almosen bekommt, während dessen ein anderer dem Reisenden den hinten auf seinem Pferde sich befindenden rothen Mantel raubt. Zwey Frauenzimmer, als Nonnen gekleidet, unterreden sich mit Bauern, welche verschiedenes Federvieh in ihren Körben haben, das sie zu verkaufen scheinnen. In der Ferne etliche Reisende zu Pferde und zu Fuß. Beyde Bilder von edler Composition, richtiger Zeichnung der Figuren, von angenehmem Colorit und von schöner ausführlicher und meisterhafter Mahlerey. A.K. [Auf Kupfer] g.R. [in goldenem Rahm] I Diese Nr.: Zwey Frauenzimmer, als Nonnen gekleidet, unterreden sich mit Bauern Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 8 Vi Zoll, breit 11 Vi Zoll Anm.: Die Lose 498 und 499 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (12.8 Μ für die Nrn. 498 und 499) Käufer: Tietjen 1790/02/04 HBDKR 0066 Jann van Blohm I Eine Jagd=Gesellschaft, welche sich samt ihren Pferden und Hunden neben einem Herrnhause in einem Garten=Prospect befindet, sehr schön gemahlt, auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 28 Zoll, breit 34 Zoll Transakt.: Verkauft (6.14 M) Käufer: Ego 1791/09/26 FRAN 0282 J. van Bioomen I Zwey überaus fleißige Pferdestück. I Diese Nr.: Ein überaus fleißiges Pferdestück Maße: 23 Zoll breit, 20 Zoll hoch Anm.: Die Lose 282 und 283 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0283 J. van Bioomen I Zwey überaus fleißige Pferdestück. I Diese Nr.: Ein überaus fleißiges Pferdestück Maße: 23 Zoll breit, 20 Zoll hoch Anm.: Die Lose 282 und 283 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt
Bioemen, Norbert van Bioemen, Jan Frans van (Orizzonte) 1747/04/06 HB AN 0041 Horizont aus Rom I Eine kleine Landschaft von Horizont aus Rom. I Maße: 9 Zoll Breite und 11 Zoll Höhe Verkäufer: Brockes Transakt.: Unbekannt (2.1) 1768/07/00 MUAN 0360 Bioemen (Julius Franc.) van I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0361 Bioemen (Julius Franc.) van I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1787/00/00 HB AN 0498 J. van Blohm, genannt Horizont I In einer angenehmen Landschaft befindet sich im Vordergrunde eine Bande Bettler, davon einer von dem auf einem weißen Pferd sitzenden Reisenden einen Almosen bekommt, während dessen ein anderer dem Reisenden den hinten auf seinem Pferde sich befindenden rothen Mantel raubt. Zwey Frauenzimmer, als Nonnen gekleidet, unterreden sich mit Bauern, welche verschiedenes Federvieh in ihren Körben haben, das sie zu verkaufen scheinnen. In der Ferne etliche Reisende zu Pferde und zu Fuß. Beyde Bilder von edler Composition, richtiger Zeichnung der Figuren, von angenehmem Colorit und von schöner ausführlicher und meisterhafter Mahlerey. A.K. [Auf 306
GEMÄLDE
1783/06/19 HBRMS 0003 N. v. Bloom I Landschaften mit zechenden Bauren. L[einwand]. s.R. [schwarze Rahmen] I Diese Nr.: Eine Landschaft mit zechenden Bauren Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 4 Zoll hoch, 2 Fuß 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 3 und 4 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1783/06/19 HBRMS 0004 N. v. Bloom I Landschaften mit zechenden Bauren. L[einwand]. s.R. [schwarze Rahmen] I Diese Nr.: Eine Landschaft mit zechenden Bauren Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 4 Zoll hoch, 2 Fuß 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 3 und 4 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1787/04/19 HBTEX 0053 N. van Bloom I Zwo Stücke mit lustige und zechende Bauren. I Diese Nr.: Ein Stück mit lustige und zechende Bauren Anm.: Dieses Los trägt im Katalog irrtümlicherweise die Nr. 55. Die Lose 53 und 54 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (20 Μ für die Nm. 53 und 54) Käufer: Böhmer 1787/04/19 HBTEX 0054 N. van Bloom I Zwo Stücke mit lustige und zechende Bauren. I Diese Nr.: Ein Stück mit lustige und zechende Bauren Anm.: Die Lose 53 und 54 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (20 Μ für die Nrn. 53 und 54) Käufer: Böhmer
Bioemen, Pieter van (Stendardo) 1723/00/00 PRAN [A]0013 Standar oder Blumen I Ein Vieh= Stück / vom Standar / oder Blumen / Compagnion von No [A]20. I
Pendant zu Nr. [A]20 Maße: Höhe 2 Schuh 5 Zoll, Breite 3 Schuh 4 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN [AJ0020 Standar oder Blumen I Die Area Noe / vom Standar / oder Blumen. I Pendant zu Nr. [A] 13 Maße: Höhe 2 Schuh 5 Zoll, Breite 3 Schuh 4 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1750/06/15 HBRAD 0096 Pieter van Bloom I Pieter van Bloom, zwey sehr ausführliche Stücke mit vielen Pferden und Figuren. I Diese Nr.: Ein sehr ausführliches Stück mit vielen Pferden und Figuren Anm.: Die Lose 96 und 97 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1750/06/15 HBRAD 0097 Pieter van Bloom I Pieter van Bloom, zwey sehr ausführliche Stücke mit vielen Pferden und Figuren. I Diese Nr.: Ein sehr ausführliches Stück mit vielen Pferden und Figuren Anm.: Die Lose 96 und 97 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1764/08/25 FRAN 0340 ν. Bioemen autrement dit Standart I Deux chevaux par v. Blcemen autrement dit Standart. I Diese Nr.: Un cheval Maße: haut 1 pied 2 Vi pouces sur 1 pied 4 Vi pouces de large Anm.: Die Lose 340 und 341 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1764/08/25 FRAN 0341 v. Blcemen autrement dit Standart I Deux chevaux par ν. Bioemen autrement dit Standart. I Diese Nr.: Un cheval Maße: haut 1 pied 2 Vi pouces sur 1 pied 4 Vi pouces de large Anm.: Die Lose 340 und 341 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0125 Pierre van Bioemen I Deux pieces d'animaux. Peints sur toile marquees des Ν os 360 et 361. I Diese Nr.: Un piece d'animaux Mat.: auf Leinwand Maße: 1. p. 3. p. de haut sur 1. p. 9. p. de large Anm.: Die Lose 125 und 126 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0126 Pierre van Bioemen I Deux pieces d'animaux. Peints sur toile marquees des Ν os 360 et 361. I Diese Nr.: Un piece d'animaux Mat.: auf Leinwand Maße: 1. p. 3. p. de haut sur 1. p. 9. p. de largeAnm.: Die Lose 125 und 126 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1775/09/09 HBBMN 0032 Pieter von Bioemen I Ein rares und schönes Bild mit vielen Figuren und Vieh, ungemein wohl gemahlt, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 1 F 6 Z, Breit 1 F 10 Ζ Transakt.: Verkauft (38.8 M) Käufer: Lilie 1776/11/09 HBKOS 0059 Piter von Bloom I Zwo schöne Landschaften mit Vieh, auf Leinwand gemahlt, mit dito [schwarzen] Rahmen und verguldeten Leisten. I Diese Nr.: Eine schöne Landschaft mit Vieh Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 59 und 60 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (40.8 Μ für die Nrn. 59 und 60) Käufer: Kost[er] [und] Ehren[reich] 1776/11/09 HBKOS 0060 Piter von Bloom I Zwo schöne Landschaften mit Vieh, auf Leinwand gemahlt, mit dito [schwarzen] Rähmen und verguldeten Leisten. I Diese Nr.: Eine schöne Landschaft mit Vieh Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 59 und 60 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (40.8 Μ für die Nrn. 59 und 60) Käufer: Kost[er] [und] Ehren[reich] 1776/11/09 HBKOS 0092 Pieter van Bloom I Zween Campements mit Soldaten und Pferden, von des Meisters besten Zeit, auf Leinwand, mit schwarzen Rähmen und Leisten. I Diese Nr.: Ein Compement mit Soldaten und Pferden Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 5 Zoll, Breite 1 Fuß 8 Zoll Anm.: Die Lose 92 und 93 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (142 Μ für die Nrn. 92 und 93) Käufer: Dr Hassberg 1776/11/09 HBKOS 0093 Pieter van Bloom I Zween Campements mit Soldaten und Pferden, von des Meisters besten Zeit, auf
Leinwand, mit schwarzen Rähmen und Leisten. I Diese Nr.: Ein Compement mit Soldaten und Pferden Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 5 Zoll, Breite 1 Fuß 8 Zoll Anm.: Die Lose 92 und 93 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (142 Μ für die Nrn. 92 und 93) Käufer: Dr Hassberg 1777/05/26 FRAN 0626 P.V. Blemen I 2 Schöne Vieh=Stück, mit Figuren vom P.V. Blemen. I Verkäufer: Finsterwalder Transakt.: Verkauft oder Unverkauft (43.30 fl) Käufer: Finsterwald 1778/09/28 FRAN 0257 Peter van Bioomen I Ein Viehstück. [Une piece representante du betail.] I Pendant zu Nr. 258 Maße: 2 Schuh breit, 1 Schuh 7 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (30 fl für die Nm. 257 und 258) Käufer: Hüsgen 1778/09/28 FRAN 0258 Peter van Bioomen I Der Compagnon, von dito [Peter van Bioomen]. [Le pendant du precedent, par le meme Maitre [Pierre van Bioomen].] I Pendant zu Nr. 257, "Ein Viehstück" Maße: 2 Schuh breit, 1 Schuh 7 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (30 fl für die Nrn. 257 und 258) Käufer: Hüsgen 1778/09/28 FRAN 0634 Peter van Bioomen I Eine Landschaft mit Figuren, von Peter van Bioomen, nemliches Maaß. [Un paysage avec des figures, par Pierre van Bioomen, meme hauteur & meme largeur.] I Maße: 2 Schuh 11 Zoll breit, 2 Schuh 2 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (10 fl) Käufer: Otto [..·?] 1779/00/00 HB AN 0276 P. v. Bioemen I Vier Reiter halten an einer Schenke; der Wirth schneidet ihnen ein Frühstück von Brod; sie trinken einander aus dem Kruge zu. Einige Packpferde kommen von einer feisichten Anhöhe über eine Brücke, zu dem zur Linken vorbeyfließenden Wasser, worin ein Soldat sein Pferd tränkt und eine Frau Wasser schöpfen will. [Quatre cavaliers font halte dans un cabaret. L'höte leur prepare un dejeüne [sie] de pain. Iis boivent ä la sante Tun de l'autre. Quelques chevaux de charge descendent d'une hauteur garnie de rochers & passent pardessus un pont. Ce pont traverse une riviere qui coule ä gauche & dans laquelle un soldat abreuve son cheval; une femme vient y puiser de l'eau.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 5 Zoll hoch, 2 Fuß 11 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/09/27 FRNGL 0204 Peter van Bioomen I Ein reichcroupirtes [sie] und wohlausgeführtes Vieh= und Pferdstück, von der besten Zeit des Peter van Bioomen. [Une belle piece representante du betail & des chevaux, grouppe nombreuse, par Pierre von Bioomen, du tems de sa force.] I Pendant zu Nr. 205 Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch, 2 Schuh 3 Zoll breit Transakt.: Verkauft (67 fl für die Nrn. 204 und 205) Käufer: Synd Hofmann 1779/09/27 FRNGL 0205 Peter van Bioomen I Das Gegenbild hierzu, eine dergleichen Vorstellung, eben so schön, von neml. Meister [Peter van Bioomen] und Maas. [Le pendant du precedant, meme objet [betail & chevaux], meme beaute, par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 204 Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch, 2 Schuh 3 Zoll breit Transakt.: Verkauft (67 fl für die Nrn. 204 und 205) Käufer: Synd Hofmann 1779/09/27 FRNGL 0358 Peter von Bioomen I Ein Vieh= und Pferdstück. [Une piece represantant du betail & des chevaux.] I Pendant zu Nr. 359 Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 1 Schuh 9 Zoll breit Transakt.: Verkauft (7.15 fl für die Nrn. 358 und 359) Käufer: Kaufman Maintz 1779/09/27 FRNGL 0359 Peter von Bioomen I Der Compagnon zu lezterm, von nemlicher Vorstellung, Meister [Peter von Bioomen] und Maas. [Le pendant du precedant, meme objet [une piece representante du betail & des chevaux], par les memes maitres.] I Pendant zu Nr. 358, "Ein Vieh= und Pferdstück" Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 1 Schuh 9 Zoll breit Transakt.: Verkauft (7.15 fl für die Nm. 358 und 359) Käufer: Kaufman Maintz GEMÄLDE
307
1779/09/27 FRNGL 0803 Peter von Bioomen I Das Gegenbild zu obigem, ein Viehstück, von Peter von Bioomen, nemliche Höhe und Breite. [Le pendant du precedent, meme objet [betail], par Pierre von Bioomen.] I Pendant zu Nr. 802 von N.P. Berchem Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 1 Schuh 5 Zoll breit Transakt.: Verkauft (20.30 fl für die Nrn. 802 und 803) Käufer: Mentzinger 1783/06/19 HBRMS 0058 P. v. Bloom I Schöne Viehstücke mit Rindern und Schaafen. L[einwand]. s.R. [schwarze Rahmen] I Diese Nr.: Ein schönes Viehstück mit Rindern und Schaafen Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 1 Zoll hoch, 1 Fuß 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 58 und 59 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1783/06/19 HBRMS 0059 P. v. Bloom I Schöne Viehstücke mit Rindern und Schaafen. Lfeinwand]. s.R. [schwarze Rahmen] I Diese Nr.: Ein schönes Viehstück mit Rindern und Schaafen Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 1 Zoll hoch, 1 Fuß 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 58 und 59 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1784/08/02 FRNGL 0049 Peter van Bioomen I Zwey wohlausgeführte meisterhafte Pferde=Stücke. I Diese Nr.: Ein wohlausgeführtes meisterhaftes Pferde=Stück Maße: 13 Zoll breit, 15 Zoll hoch Anm.: Die Lose 49 und 50 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: C Transakt.: Verkauft (5 fl für die Nrn. 49 und 50) Käufer: Bäumer 1784/08/02 FRNGL 0050 Peter van Bioomen I Zwey wohlausgeführte meisterhafte Pferde=Stücke. I Diese Nr.: Ein wohlausgeführtes meisterhaftes Pferde=Stück Maße: 13 Zoll breit, 15 Zoll hoch Anm.: Die Lose 49 und 50 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: C Transakt.: Verkauft (5 fl für die Nrn. 49 und 50) Käufer: Bäumer 1784/08/02 FRNGL 0337 Peter van Bioomen I Zwey meisterhafte Pferdstücke. I Diese Nr.: Ein meisterhaftes Pferdstück Maße: 23 Zoll breit, 18 Zoll hoch Anm.: Die Lose 337 und 338 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Β Transakt.: Verkauft (13 fl für die Nrn. 337 und 338) Käufer: Mövius 1784/08/02 FRNGL 0338 Peter van Bioomen I Zwey meisterhafte Pferdstücke. I Diese Nr.: Ein meisterhaftes Pferdstück Maße: 23 Zoll breit, 18 Zoll hoch Anm. : Die Lose 337 und 338 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Β Transakt.: Verkauft (13 fl für die Nrn. 337 und 338) Käufer: Mövius 1784/08/02 FRNGL 0439 Peter van Bioomen I Zwey antique Ruinen mit fürtreflich meisterhaftem Vieh. I Diese Nr.: Eine antique Ruine mit fürtreflich meisterhaftem Vieh Maße: 30 Zoll breit, 44 Zoll hoch Anm.: Die Lose 439 und 440 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (12.30 fl für die Nrn. 439 und 440) Käufer: von Schmidt 1784/08/02 FRNGL 0440 Peter van Bioomen I Zwey antique Ruinen mit fürtreflich meisterhaftem Vieh. I Diese Nr.: Eine antique Ruine mit fürtreflich meisterhaftem Vieh Maße: 30 Zoll breit, 44 Zoll hoch Anm.: Die Lose 439 und 440 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (12.30 fl für die Nrn. 439 und 440) Käufer: von Schmidt 1784/08/02 FRNGL 0715 Peter van Bioomen I Eine bergigte Landschaft, mit meisterhaft ausgeführtem Vieh. I Maße: 19 Zoll breit, 23 Zoll hoch Transakt.: Verkauft (2 fl) Käufer: Reinhard 1785/04/22 HBTEX 0058 Pieter van Blohm I Eine Bataille. Der Compagnon ein Campement. Kräftig auf Leinewand gemahlt. Goldne Rahmen. I Diese Nr.: Eine Bataille; Pendant zu Nr. 59 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 17 Vi Zoll, breit 23 Zoll Anm.: Die Lose 58 und 59 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1785/04/22 HBTEX 0059 Pieter van Blohm I Eine Bataille. Der Compagnon ein Campement. Kräftig auf Leinewand gemahlt. Goldne Rahmen. I Diese Nr.: Ein Campement; Pendant zu Nr. 58 308
GEMÄLDE
Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 17 Vi Zoll, breit 23 Zoll Anm.: Die Lose 58 und 59 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1785/05/17 MZAN 0346 Peter van Bioomen i Zwey Landschaften mit Vieh. [Deux paysages avec du betail.] I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Vieh Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 1 Schuh 5 Zoll breit Anm.: Die Lose 346 und 347 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (16.30 fl für die Nm. 346 und 347) Käufer: Schneider Mahler 1785/05/17 MZAN 0347 Peter van Bioomen I Zwey Landschaften mit Vieh. [Deux paysages avec du betail.] I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Vieh Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 1 Schuh 5 Zoll breit Anm.: Die Lose 346 und 347 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt. : Verkauft (16.30 fl für die Nrn. 346 und 347) Käufer: Schneider Mahler 1785/05/17 MZAN 0485 Peter van Bioemen I Zwey Pferdstükke von Peter van Bioemen. [Des chevaux.] I Diese Nr.: Ein Pferdstück Maße: 6 Vi Zoll hoch, 7 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 485 und 486 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (4 fl für die Nm. 485 und 486) Käufer: Michel Hähnlein 1785/05/17 MZAN 0486 Peter van Bioemen I Zwey Pferdstükke von Peter van Bioemen. [Des chevaux.] I Diese Nr.: Ein Pferdstück Maße: 6 Vi Zoll hoch, 7 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 485 und 486 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (4 fl für die Nrn. 485 und 486) Käufer: Michel Hähnlein 1785/05/17 MZAN 0890 Peter van Bioemen I Ein Paar Landschaften mit Vieh von Peter van Bioemen. [Deux paysages avec du betail.] I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Vieh Maße: 1 Schuh 7 Zoll hoch, 1 Schuh 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 890 und 891 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (65 fl für die Nm. 890 und 891) Käufer: Zitz 1785/05/17 MZAN 0891 Peter van Bioemen I Ein Paar Landschaften mit Vieh von Peter van Bioemen. [Deux paysages avec du betail.] I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Vieh Maße: 1 Schuh 7 Zoll hoch, 1 Schuh 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 890 und 891 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (65 fl für die Nrn. 890 und 891) Käufer: Zitz 1785/05/17 MZAN 0894 Peter van Bioemen I Zwey Stücke welche Marketendereyen vorstellen von Peter van Bioemen. [Deux pieces qui representent des vivandiers.] I Diese Nr.: Ein Stück welches Marketendereyen vorstellt Maße: 2 Schuh 1 Zoll hoch, 2 Schuh 7 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 894 und 895 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (38.30 fl für die Nm. 894 und 895) Käufer: Strecker 1785/05/17 MZAN 0895 Peter van Bioemen I Zwey Stücke welche Marketendereyen vorstellen von Peter van Bioemen. [Deux pieces qui representent des vivandiers.] I Diese Nr.: Ein Stück welches Marketendereyen vorstellt Maße: 2 Schuh 1 Zoll hoch, 2 Schuh 7 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 894 und 895 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (38.30 fl für die Nrn. 894 und 895) Käufer: Strecker 1785/05/17 MZAN 0896 Peter van Bioemen I Ein Paar Landschaften mit Reisenden von eben dem Meister [Peter van Bioemen] und von nämlicher Höhe und Breite. [Deux paysages avec des voyageurs, par le meme maitre [Pierre van Bioemen] & de la meme hauteur & largeur.] I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Reisenden Maße: 2 Schuh 1 Zoll hoch, 2 Schuh 7 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 896 und 897 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (34.30 fl für die Nrn. 896 und 897) Käufer: Hofr ν Leykam 1785/05/17 MZAN 0897 Peter van Bioemen I Ein Paar Landschaften mit Reisenden von eben dem Meister [Peter van Bioemen]
und von nämlicher Höhe und Breite. [Deux paysages avec des voyageurs, par le meme maitre [Pierre van Bioemen] & de la meme hauteur & largeur.] I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Reisenden Maße: 2 Schuh 1 Zoll hoch, 2 Schuh 7 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 896 und 897 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (34.30 fl für die Nrn. 896 und 897) Käufer: Hofr ν Leykam 1785/05/17 MZAN 0910 Peter van Bioemen I Ein Paar Vieh= und Pferdstücke von Peter van Bioemen. [Du betail & des chevaux.] I Diese Nr.: Ein Vieh= und Pferdstück Maße: 6 Vi Zoll hoch, 9 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 910 und 911 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (14.30 fl für die Nrn. 910 und 911) Käufer: Weingärtner 1785/05/17 MZAN 0911 Peter van Bioemen I Ein Paar Vieh= und Pferdstücke von Peter van Bioemen. [Du betail & des chevaux.] I Diese Nr.: Ein Vieh= und Pferdstück Maße: 6 Vi Zoll hoch, 9 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 910 und 911 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (14.30 fl für die Nrn. 910 und 911) Käufer: Weingärtner 1785/05/17 MZAN 0962 Peter van Bioemen I Ein Pferdstall, wovon das Gegenbild eine Schmiede vorstellt, wo Pferde beschlagen werden von Peter van Bioemen. [Une ecurie, & une forge ou l'on serre des chevaux.] I Diese Nr.: Ein Pferdstall; Pendant zu Nr. 963 Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 962 und 963 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (30.30 fl für die Nrn. 962 und 963) Käufer: Hofr Heimes 1785/05/17 MZAN 0963 Peter van Bioemen I Ein Pferdstall, wovon das Gegenbild eine Schmiede vorstellt, wo Pferde beschlagen werden von Peter van Bioemen. [Une ecurie, & une forge ou l'on serre des chevaux.] I Diese Nr.: Eine Schmiede, wo Pferde beschlagen werden; Pendant zu Nr. 962 Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 962 und 963 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (30.30 fl für die Nrn. 962 und 963) Käufer: Hofr Heimes 1786/10/18 HBTEX 0155 P. van Bloom I Eine Ochsen=Hetze mit vielen Hunden und einigen zu Pferde, welche mit Spießen und Schwerdtem ihn zu erlegen suchen. Sehr frey und meisterhaft gemahlt auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 35 Zoll 6 Linien, breit 50 Zoll Transakt.: Unbekannt 1786/11/11 HBRMS 0089 Standart v. der Blohm I Zwey Stück mit lustige und tanzende Hirten, plaisant gemahlt, goldener Rahm. I Diese Nr.: Ein Stück mit lustige und tanzende Hirten Anm.: Die Lose 89 und 90 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/11/11 HBRMS 0090 Standart v. der Blohm I Zwey Stück mit lustige und tanzende Hirten, plaisant gemahlt, goldener Rahm. I Diese Nr.: Ein Stück mit lustige und tanzende Hirten Anm.: Die Lose 89 und 90 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1787/00/00 HB AN 0011 Piter van Blohm, genannt Standardo I Vor einem alten Landhause sitzt ein betrunkener eingeschlafener Bauer auf einem Stuhl; ein Mann und eine Frau kommen von hinten, und suchen ihn zu ermuntern. Ein anderer Betrunkener, der vor ihm auf einem umgekehrten Gefäß sitzet, will ihm noch ein Glas Branntewein überreichen. Zur Seite und in der Ferne eine Menge Figuren. Eine dergleichen Vorstellung. Im Hintergründe sitzen mehrere beym Tische, so sich mit Zechen belustigen. In der Feme wird man eines Kirchdorfs gewahr. Sehr keck und meisterhaft gemahlt. Auf Leinew. s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Diese Nr.: Vor einem alten Landhause sitzt ein betrunkener eingeschlafener Bauer auf einem Stuhl Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 32 Zoll, breit 40 Zoll Anm.: Die Lose 11 und 12 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (61 Μ für die Nm. 11 und 12) Käufer: Friedrich
1787/00/00 HB AN 0012 Piter van Blohm, genannt Standardo I Vor einem alten Landhause sitzt ein betrunkener eingeschlafener Bauer auf einem Stuhl; ein Mann und eine Frau kommen von hinten, und suchen ihn zu ermuntern. Ein anderer Betrunkener, der vor ihm auf einem umgekehrten Gefäß sitzet, will ihm noch ein Glas Branntewein überreichen. Zur Seite und in der Feme eine Menge Figuren. Eine dergleichen Vorstellung. Im Hintergrunde sitzen mehrere beym Tische, so sich mit Zechen belustigen. In der Feme wird man eines Kirchdorfs gewahr. Sehr keck und meisterhaft gemahlt. Auf Leinew. s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Diese Nr.: Im Hintergrunde sitzen mehrere beym Tische, so sich mit Zechen belustigen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 32 Zoll, breit 40 Zoll Anm.: Die Lose 11 und 12 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (61 Μ für die Nm. 11 und 12) Käufer: Friedrich 1787/00/00 HB AN 0037 Peter van Blohm, genannt Standardo I Eine Gesellschaft von Herren und Damen hält Mittagsmahl im Grünen. Zwey Herren halten zu Pferde, mit ihren Hüthen in den Händen, und scheinen die Gesundheit der Gesellschaft zu trinken. Zur linken im Vordergrunde befinden sich zwey gesattelte Pferde. Hinter diesen ein Knecht, der noch zu essen und zu trinken aufträgt. Zur rechten im Vordergrunde sieht man eine Bettlerbande. Im Hintergrunde wird Kegeln gespielt, Sehr frey gemahlt. Auf Leinew. g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 26 Zoll, breit 30 Zoll Transakt.: Verkauft (28.4 M) Käufer: Ekhard 1787/00/00 HB AN 0048 Piter van Blohm, genannt Standardo. 1702 I Ein Lager, wo die Pferde alle hinter den Gezelten angebunden sind. Einige Soldaten unterreden sich, auf der Erde sitzend. Im Hintergrunde mehrere Gezelte. Eine Vorstellung von gleicher Art. Zur linken sitzt eine Frau auf der Erde neben verschiedenem Geschirre ec. In der Entfernung sieht man mehrere Gezelte, Pferde und Figuren. Besonders frey und kräftig gemahlt, und von einer richtigen Zeichnung. Auf Leinew. s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Diese Nr.: Ein Lager, wo die Pferde alle hinter den Gezelten angebunden sind Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 17 Zoll, breit 20 Zoll Inschr.: 1702 (datiert?) Anm.: Die Lose 48 und 49 wurden zusammen katalogisiert. Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Verkauft (104 Μ für die Nm. 48 und 49) Käufer: Fesser 1787/00/00 HB AN 0049 Piter van Blohm, genannt Standardo. 1702 I Ein Lager, wo die Pferde alle hinter den Gezelten angebunden sind. Einige Soldaten unterreden sich, auf der Erde sitzend. Im Hintergründe mehrere Gezelte. Eine Vorstellung von gleicher Art. Zur linken sitzt eine Frau auf der Erde neben verschiedenem Geschirre ec. In der Entfernung sieht man mehrere Gezelte, Pferde und Figuren. Besonders frey und kräftig gemahlt, und von einer richtigen Zeichnung. Auf Leinew. s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Diese Nr.: Zur linken sitzt eine Frau auf der Erde neben verschiedenem Geschirre ec. Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 17 Zoll, breit 20 Zoll Inschr.: 1702 (datiert?) Anm.: Die Lose 48 und 49 wurden zusammen katalogisiert. Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Verkauft (104 Μ für die Nm. 48 und 49) Käufer: Fesser 1787/00/00 HB AN 0433 Pit. van Blohm, gen. Standardo I Ein Abendstück. Eine Hirtinn sitzt auf einem Pferde. Hinter ihr der Hirte, welcher die Heerde durch ein Wasser treibet. Auf einem Berge befinden sich verschiedene Wohnungen und Figuren, so durch den aufgehenden Mond besonders beleuchtet werden. Sehr natürlich gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 17 Zoll, breit 17 Zoll Transakt.: Verkauft (4.4 M) Käufer: Sigberg 1787/00/00 HB AN 0562 P. v. Blohm, gen. Standardo I Ein Herr reitet im Vordergrunde; zu seiner rechten gehet ein anderer zu Fuß. Im Hintergrunde ein Springbrunnen. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 9 Vi Zoll, breit 7 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (4 M) Käufer: Tietjen GEMÄLDE
309
1788/06/12
HBRMS
0083
P. v. Bloom
I Zwey Landschaften mit
Holzungen, worin Colonaden, Mauern und Häuser, von Rindern, Schaafen und bepackten Pferden mit ihren Hirten und Treibern belebt. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Holzungen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 58 Zoll, breit 40 Vi Zoll Anm.: Die Lose 83 und 84 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1788/06/12 HBRMS 0084 P. v. Bloom I Zwey Landschaften mit Holzungen, worin Colonaden, Mauern und Häuser, von Rindern, Schaafen und bepackten Pferden mit ihren Hirten und Treibern belebt. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Holzungen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 58 Zoll, breit 40 Vi Zoll Anm.: Die Lose 83 und 84 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1788/10/01 FRAN 0008 P. van Bioomen I Zwey Landschaften mit Figuren, Kühen und Schaafen. I Maße: 12 V2 Zoll hoch, 18 Zoll breit Transakt.: Verkauft (32.15 fl) Käufer: Spitalmeister 1788/10/01 FRAN 0083 P. van Blommen I Eine kleine Landschaft mit Figuren und Pferden, meisterhaft gemalt von P. van Blommen. I Maße: 16 Zoll hoch, 20 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (9.15 fl) Käufer: von Schmid 1789/00/00 MM AN 0118 Peter van Bioemen I Zwei Pastoralstücke, auf Leinw. [Deux pieces pastorales, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 9 Zoll hoch, 11 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (8 fl) 1789/00/00 MM AN 0203 Peter van Bioemen I Ein Halt von Cavallerie, auf Leinw. [Une halte Cavalerie, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 4 Zoll hoch, 2 Fuß 10 Zoll breit Anm.: Dieses Los trägt in der deutschen Fassung des Katalogs irrtümlich die Nr. 103. Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (44 fl)
Maulthier hineingeführet wird; lebhaft gemahlt, von Piter van Ploom. Auf Leinew. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 10 Zoll, breit 26 Zoll Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0150 Standart, oder van Blomen I Ein Viehmarkt mit vielen Figuren, von Standart, oder van Blomen. I Maße: 3 Schuh 1 Zoll hoch, 4 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0008 Pieter van Blohm I Zwey Campagnenstücke mit vielen Pferden und Figuren vor Zelte. Keck gemahlt von Pieter van Blohm. I Diese Nr.: Ein Campagnenstück mit vielen Pferden und Figuren vor Zelte Maße: Hoch 19 Zoll, breit 23 Zoll Anm.: Die Lose 8 und 9 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0009 Pieter van Blohm I Zwey Campagnenstücke mit vielen Pferden und Figuren vor Zelte. Keck gemahlt von Pieter van Blohm. I Diese Nr.: Ein Campagnenstück mit vielen Pferden und Figuren vor Zelte Maße: Hoch 19 Zoll, breit 23 Zoll Anm.: Die Lose 8 und 9 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0014 P. v. Blohm I Eine Reitbahn, mit vielen Pferden. Im Hintergrunde eine schöne Landschaft, von P. v. Blohm. I Maße: Hoch 22 Zoll, breit 25 Zoll Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0184 P. van Bloom I Römische Gegenden, mit dergleichen Vorstellungen; vortreflich gemahlt. Auf Leinw., von P. van Bloom. I Diese Nr.: Eine römische Gegend Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 15 Zoll 4 Lin., breit 17 Zoll 6 Lin. Anm.: Die Lose 184 und 185 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1789/00/00 MMAN 0233 Peter van Bioemen I Zwei Landschaften, auf Leinw. [Deux paysages, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 1 Zoll hoch, 1 Fuß 11 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (100 fl)
1793/06/07 HBBMN 0185 P. van Bloom I Römische Gegenden, mit dergleichen Vorstellungen; vortreflich gemahlt. Auf Leinw., von P. van Bloom. I Diese Nr.: Eine römische Gegend Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 15 Zoll 4 Lin., breit 17 Zoll 6 Lin. Anm.: Die Lose 184 und 185 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1789/04/16 HBTEX 0008 P. v. Ploom I In einer Landgegend sitzet ein Hirtenmädchen auf dem Esel, und reichet ein Stückgen Brod ihrem Hunde, der vor ihr in die Höhe springt; neben bey ist ein Ochs und 2 Schaafe; stark gemahlt, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 16 Vi Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Verkauft (1.08 M) Käufer: Ego
1794/00/00 HB AN 0035 Pet. van Bloem I Im Thorwege werden die Pferde vor einem Frachtwagen gefüttert, denen sich ein Esel nähert. Daneben steht ein Frauenzimmer mit zweyen Kindern; weiter zurück halten zwey Reuter. Im Vorgrunde liegt der Pferdeknecht neben seinem grauen Hofhunde. I Maße: Höhe 25 Zoll, Breite 30 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt
1789/06/12 HBTEX 0208 Peter van Blohm I Zwey stark gemahlte Bataillen. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine stark gemahlte Bataille Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Vi Zoll, breit 15 Zoll Anm.: Die Lose 208 und 209 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1794/00/00 HB AN 0079 Pet. van Bloem I Vor einem Wirthshause warten einige Reitknechte mit einem schönen braunen Pferde, einem Weissen und einem Apfelschimmel auf ihre von der Jagd zurückkehrende Herren; weiter hin halten noch andere. I Maße: Höhe 25 Vi Zoll, Breite 31 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt
1789/06/12 HBTEX 0209 Peter van Blohm I Zwey stark gemahlte Bataillen. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine stark gemahlte Bataille Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Vi Zoll, breit 15 Zoll Anm.: Die Lose 208 und 209 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1790/02/04 HBDKR 0042 P.V. Ploom I In einer arcadischen Gegend siehet man verschiedene theils zu Pferd theils zu Fuß, um einen Brunnen, welche trinken; in der Entfernung zur Linken auf dem Wasser befinden sich verschiedene Fahrzeuge, welche abgehen und ankommen; eine besonders angenehme Gegend, welche lebhaft vorgestellet, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 24 Zoll, breit 34 Zoll Transakt.: Verkauft (17 M) Käufer: Schmidt 1791/10/21 HBRMS 1 0061 Peter van Blohm I Landleute beyderley Geschlechts und Kinder sitzen vor einem Landhause und scheinen Streit mit einem Herrn zu haben, der vor ihnen steht und den Degen zieht. Hinten ein Kirchdorf, sehr dreist gemahlt; auf Leinew. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 29 Zoll, breit 35 Zoll Transakt.: Verkauft (11.8 M) Käufer: Sch[oen] 1792/04/19 HBBMN 0065 Piter van Ploom I Rinder und Schaafe stehen vor einem Bauerhause, wo ein bepacktes Reitpferd und 310
GEMÄLDE
1794/00/00 HB AN 0122 P. van Bloem I Zwey Feldlagerstücke. Vor einem Zelte im Lager zechen, auf dem Ersten, Reuter, die ihre Pferde bey sich haben, zusammen. Auf dem Andern begleitet ein Hund mit seinem Geheul den, vor einem Zelte, blasenden Trompeter, um den Offiziere, die von einem Krüppel angebettelt werden, und Reuter versammelt sind. I Diese Nr.: Ein Feldlagerstück. Vor einem Zelte im Lager zechen, auf diesem, Reuter, die ihre Pferde bey sich haben, zusammen Maße: Höhe 15 Zoll, Breite 17 Zoll Anm.: Die Lose 122 und 123 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 HB AN 0123 P. van Bloem I Zwey Feldlagerstücke. Vor einem Zelte im Lager zechen, auf dem Ersten, Reuter, die ihre Pferde bey sich haben, zusammen. Auf dem Andern begleitet ein Hund mit seinem Geheul den, vor einem Zelte, blasenden Trompeter, um den Offiziere, die von einem Krüppel angebettelt werden, und Reuter versammelt sind. I Diese Nr.: Ein Feldlagerstück. Auf diesem begleitet ein Hund mit seinem Geheul den, vor einem Zelte, blasenden Trompeter, um den Offiziere, die von einem Krüppel an-
gebettelt werden, und Reuter versammelt sind Maße: Höhe 15 Zoll, Breite 17 Zoll Anm.: Die Lose 122 und 123 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1794/02/21 HBHEG 0033 Pieterus van Bimmen I Eine Hirten= Caravane in römischer Gegend. Menschen, Thiere und Land sind auf das lebhafteste gemahlt. Man kann sehr wohl sehen, daß dieser Künstler sich nach der römischen Schule gebildet hat. Er wurde zu Antwerpen gebohren, und starb 1746 zu Amsterdam. ! Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 13 Vi Zoll, breit 15 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0281 P.vanPloom I Zwey Campagnenstücke, von guter Ordonance, welche mit freyem Pinsel gemahlt. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Campagnenstück Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 19 Zoll 3 Lin., breit 33 Zoll 1 Lin. Anm.: Die Lose 281 und 282 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0282 P. van Ploom I Zwey Campagnenstücke, von guter Ordonance, welche mit freyem Pinsel gemahlt. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Campagnenstück Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 19 Zoll 3 Lin., breit 33 Zoll 1 Lin. Anm.: Die Lose 281 und 282 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/12/08 HBPAK 0005 Peter v. Blohm I Zwey Marktplätze, wo vor einem Wirthshause Leute von ihren Pferden absteigen; der andere eine Schmiede, wo Pferde beschlagen werden. Auf Leinwand, im goldenen Rahm. I Diese Nr.: Ein Marktplatz, wo vor einem Wirthshause Leute von ihren Pferden absteigen Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 28 Zoll, Breite 37 Zoll Anm.: Die Lose 5 und 6 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/12/08 HBPAK 0006 Peter v. Blohm I Zwey Marktplätze, wo vor einem Wirthshause Leute von ihren Pferden absteigen; der andere eine Schmiede, wo Pferde beschlagen werden. Auf Leinwand, im goldenen Rahm. I Diese Nr.: Ein Marktplatz, eine Schmiede, wo Pferde beschlagen werden Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 28 Zoll, Breite 37 Zoll Anm.: Die Lose 5 und 6 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0016 Peter von Blohm I Zwey Städte mit perspectivischen Gebäuden und Gartenprospecten, auch mit vielen Figuren und Pferden. Ganz im Geschmack Wowermanns. Auf Leinwand, schwarzer Rahm. I Diese Nr.: Eine Stadt mit perspectivischen Gebäuden und Gartenprospecten, auch mit vielen Figuren und Pferden Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 32 Zoll, breit 42 Zoll Anm.: Die Lose 16 und 17 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0017 Peter von Blohm I Zwey Städte mit perspectivischen Gebäuden und Gartenprospecten, auch mit vielen Figuren und Pferden. Ganz im Geschmack Wowermanns. Auf Leinwand, schwarzer Rahm. I Diese Nr.: Eine Stadt mit perspectivischen Gebäuden und Gartenprospecten, auch mit vielen Figuren und Pferden Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 32 Zoll, breit 42 Zoll Anm.: Die Lose 16 und 17 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/08/10 HBPAK 0031 P. von Blohm I Zwey Stücke mit Figuren und Pferden. Kräftig und gut gemahlt. Auf Holz, im schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein Stück mit Figuren und Pferden Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Zoll, breit 12 Zoll Anm.: Die Lose 31 und 32 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/08/10 HBPAK 0032 P. von Blohm I Zwey Stücke mit Figuren und Pferden. Kräftig und gut gemahlt. Auf Holz, im schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein Stück mit Figuren und Pferden Mal.: auf Holz Maße: Hoch 9 Zoll, breit 12 Zoll Anm.: Die Lose 31 und 32 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1798/11/14 HBPAK 0090 Peter von Blohm I Zwey Stücke mit perspectivischen Gebäuden und Garten=Prospecten, mit vielen Figuren und Pferden. Ganz im Geschmack des Wowermanns. Auf Leinwand, im schw. Rahm. I Diese Nr.: Ein Stück mit perspectivischen Gebäuden und Garten=Prospecten, mit vielen Figuren und Pferden Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 32 Zoll, breit 42 Zoll Anm.: Die Lose 90 und 91 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/11/14 HBPAK 0091 Peter von Blohm I Zwey Stücke mit perspectivischen Gebäuden und Garten=Prospecten, mit vielen Figuren und Pferden. Ganz im Geschmack des Wowermanns. Auf Leinwand, im schw. Rahm. I Diese Nr.: Ein Stück mit perspectivischen Gebäuden und Garten=Prospecten, mit vielen Figuren und Pferden Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 32 Zoll, breit 42 Zoll Anm.: Die Lose 90 und 91 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/11/14 HBPAK 0182 Peter v. Blohm I Zwey Marktplätze. Im Vordergrunde des Einen: Ein Cavallerist zu Pferde, nebst einem Hunde, welchen ein baarfuß gehender Armer anbettelt. Im Hintergrunde eine Schmiede, und vor selbiger wird ein Pferd beschlagen. Im Vordergrunde des Andern: Cavalleristen, welche ihren Pferden Brod zu fressen geben. Im Hintergrunde ein Hirte mit stehenden und liegenden Kühen. Auf Leinwand, in 2 goldnen Rähmen. I Diese Nr.: Ein Marktplatz. Im Vordergrund: Ein Cavallerist zu Pferde, nebst einem Hunde, welchen ein baarfuß gehender Armer anbettelt. Im Hintergrunde eine Schmiede, und vor selbiger wird ein Pferd beschlagen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 32 Zoll, breit 41 Vi Zoll Anm.: Die Lose 182 und 183 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/11/14 HBPAK 0183 Peter v. Blohm I Zwey Marktplätze. Im Vordergrunde des Einen: Ein Cavallerist zu Pferde, nebst einem Hunde, welchen ein baarfuß gehender Armer anbettelt. Im Hintergrunde eine Schmiede, und vor selbiger wird ein Pferd beschlagen. Im Vordergrunde des Andern: Cavalleristen, welche ihren Pferden Brod zu fressen geben. Im Hintergrunde ein Hirte mit stehenden und liegenden Kühen. Auf Leinwand, in 2 goldnen Rähmen. I Diese Nr.: Ein Marktplatz. Im Vordergrund: Cavalleristen, welche ihren Pferden Brod zu fressen geben. Im Hintergrunde ein Hirte mit stehenden und liegenden Kühen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 32 Zoll, breit 41 Vi Zoll Anm.: Die Lose 182 und 183 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 LZAN 0039[a] Pierre van Bioomen I Trois Tableaux dont les deux pendans sont differens animaux, vaches, chevaux, etc. les fonds en paysage agreste et rembruni; hauteur 15 pouc. larg. 23. Bois. La piece du milieu represente des chameaux, mulets et chevaux charges en caravanne, avec leurs conducteurs Arabes dans leur costume: le tout d'une touche vigoureuse et savante: haut. 22 pouc. larg. 21. Bois. Prix des trois Tableaux. 30. I Diese Nr.: Trois Tableaux dont les deux pendans sont differens animaux, vaches, chevaux Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 15 pouces, largeur 23 pouces Transakt.: Unbekannt (30 Louis für die Nm. 39[a] und 39[b], Schätzung) 1799/00/00 LZAN 0039[b] Pierre van Bioomen I Trois Tableaux dont les deux pendans sont differens animaux, vaches, chevaux, etc. les fonds en paysage agreste et rembruni; hauteur 15 pouc. larg. 23. Bois. La piece du milieu represente des chameaux, mulets et chevaux charges en caravanne, avec leurs conducteurs Arabes dans leur costume: le tout d'une touche vigoureuse et savante: haut. 22 pouc. larg. 21. Bois. Prix des trois Tableaux. 30. I Diese Nr.: La piece du milieu represente des chameaux, mulets et chevaux charges en caravanne, avec leurs conducteurs Arabes dans leur costume Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 22 pouces, largeur 21 pouces Transakt.: Unbekannt (30 Louis für die Nrn. 39[a] und 39[b], Schätzung) 1799/00/00 WZAN A0179 Peter van Bioemen, genannt Stendardo I Zwey Bataille=Stücke, von Peter van Bioemen, genannt GEMÄLDE
311
Stendardo. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Bataille=Stück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 5 Zoll breit 3 Schuh 1 Zoll Anm.: Die Lose A179 und A180 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0180 Peter van Bioemen, genannt Stendardo I Zwey Bataille=Stücke, von Peter van Bioemen, genannt Stendardo. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Bataille=Stück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 5 Zoll breit 3 Schuh 1 Zoll Anm.: Die Lose A179 und A180 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/08/09 HBPAK 0148 P. von Blohm I Zwey Stücke mit Figuren und Pferden. Kräftig und gut gemahlt. Auf Holz, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein Stück mit Figuren und Pferden Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Zoll, breit 12 Zoll Anm.: Die Lose 148 und 149 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/08/09 HBPAK 0149 P. von Blohm I Zwey Stücke mit Figuren und Pferden. Kräftig und gut gemahlt. Auf Holz, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein Stück mit Figuren und Pferden Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Zoll, breit 12 Zoll Anm.: Die Lose 148 und 149 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/10/18 LZAN 0079 Peter van Blomen I Ein Viehstück, wo man 11 Figuren zählt; im Hintergrund sind Bäume und Architecturstücke; hoch 15 Zoll, breit 22 Zoll. Leinwand, in einem vergoldeten Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 15 Zoll, breit 22 Zoll Verkäufer: Rauch Transakt.: Verkauft (7 Th) Käufer: Hendel 1799/12/04 HBPAK 0089 Der alte Blohm I Ein großes Bauerhaus, vor welchem sich Bauern und Bäuerinnen mit Tanzen und Musik belustigen. Auf Leinwand. Goldner Rahm I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 34 Zoll, breit 43 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0128 Peter von Blom I Eine Landschaft mit Pferden und Figuren. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 20 Zoll, breit 27 Zoll Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0076 P. v. Blohm I Zwey Gebäudenperspektive mit Figuren und Pferden. So gut wie Wouvermans. Auf Leinwand, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Eine Gebäudenperspektive mit Figuren und Pferden Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 27 Zoll, breit 41 Zoll Anm.: Die Lose 76 und 77 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0077 P. v. Blohm I Zwey Gebäudenperspektive mit Figuren und Pferden. So gut wie Wouvermans. Auf Leinwand, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Eine Gebäudenperspektive mit Figuren und Pferden Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 27 Zoll, breit 41 Zoll Anm.: Die Lose 76 und 77 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Blom (Kopie von) 1740/00/00 AUAN 0011 Blum; Wabermann I 1. Niederländisch Stücklein /1. Marquetenter / copirt von Blum / nach Wabermann. I Kopie von Blom nach Wouwerman Maße: 1. Schuh 11. Zoll hoch / 2. Schuh breit Transakt.: Unbekannt (12 fl) 1781/05/07 FRHUS 0130 van der Blom; Bassano I Die vier Jahrszeiten von van der Blom nach Bassano. I Diese Nr.: Eine der vier Jahrszeiten; Kopie von Blom nach Bassano Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch und 2 Schuh 7 Zoll breit Anm..· Die Lose 130 bis 133 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (50 fl für die Nrn. 130-133) Käufer: Heusser 1781/05/07 FRHUS 0131 van der Blom; Bassano I Die vier Jahrszeiten von van der Blom nach Bassano. I Diese Nr.: Eine der vier Jahrszeiten; Kopie von Blom nach Bassano Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch und 2 Schuh 7 Zoll breit Anm.: Die Lose 130 bis 133 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (50 fl für die Nrn. 130-133) Käufer: Heusser in
GEMÄLDE
1781/05/07 FRHUS 0132 van der Blom; Bassano I Die vier Jahrszeiten von van der Blom nach Bassano. I Diese Nr.: Eine der vier Jahrszeiten; Kopie von Blom nach Bassano Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch und 2 Schuh 7 Zoll breit Anm.: Die Lose 130 bis 133 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (50 fl für die Nrn. 130-133) Käufer: Heusser 1781/05/07 FRHUS 0133 van der Blom; Bassano I Die vier Jahrszeiten von van der Blom nach Bassano. I Diese Nr.: Eine der vier Jahrszeiten; Kopie von Blom nach Bassano Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch und 2 Schuh 7 Zoll breit Anm.: Die Lose 130 bis 133 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (50 fl für die Nm. 130-133) Käufer: Heusser
Blom (oder Bioemen) 1782/07/00 FRAN 0068 Bloem I Eine sehr schöne, felsigte, mit Wasserfall und einer wohlgewählten Staffage versehenen Landschaft. I Maße: 1 Schuh 6 Zoll hoch, 1 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] fl)
Blom, C.V. [Nicht identifiziert] 1780/00/00 AUAN 0020 C. v. Blom I Zwey Pferd und Viehstücke. I Diese Nr.: Ein Pferd und Viehstück Anm.: Die Lose 20 und 21 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1780/00/00 AUAN 0021 C. v. Blom I Zwey Pferd und Viehstücke. I Diese Nr.: Ein Pferd und Viehstück Anm.: Die Lose 20 und 21 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Blom, Delt V . [Nicht identifiziert] (Manier) 1799/12/04 HBPAK 0083 In der Manier von Delt v. Blom I Eine bergigte Landschaft mit Figuren und Vieh. Gut gemahlt. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 49 Zoll Transakt.: Unbekannt
Blom, Jan 1788/10/01 FRAN 0014 J. Blom I Eine unvergleichliche Landschaft mit Figuren von großem Umfang. I Maße: 21 Zoll hoch, 31 Zoll breit Transakt.: Verkauft (15.30 fl) Käufer: Spitalmeister
Blome, A . [Nicht identifiziert] 1779/00/00 HB AN 0246 A. Blome I Ein Ruß schlängelt sich mitten durch eine gebirgichte Landschaft, wo am Ufer zur Rechten eine Stadt am Berge liegt. Auf einem mit Bäumen bekleideten Hügel weiden einige Ziegen. Auf Holz. [Une riviere traverse en serpentant une contree montagneuse; sur la rive est une ville au haut d'une montagne. Quelques ch6vres paissent sur une hauteur revetue d'arbres. Sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 4 Zoll hoch, 1 Fuß 9 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt
Bloot, Pieter de 1779/09/27 FRNGL 0863 Peter de Bloet I Ein klein angenehm niederländisches Bauernstückgen, im Geschmack von Ostade. [Une piece tres jolie representante des paysans Flamands, dans le gout d'Ostade.] I Pendant zu Nr. 864 Maße: 4 Vi Zoll hoch, 6 Zoll breit Transakt.: Verkauft (16 fl für die Nm. 863 und 864) Käufer: Stöber 1779/09/27 FRNGL 0864 Peter de Bloet I Das Gegenbild zu obigem, eben ein so schönes Bauernstückgen, von neml. Meist. [Peter de Bloet] u. Maas. [Le pendant du precedant, meme objet [paysans], meme beaute, par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 863 Ma-
ße: 4 Vi Zoll hoch, 6 Zoll breit Transakt.: Verkauft (16 Π für die Nrn. 863 und 864) Käufer: Stöber 1781/09/10 BNAN 0123 D. de Β loot I Bey einem Faße, worauf, neben einem Topf mit Feuer, Toback und Pfeiffen, eine Bierkrucke stehet, sitzen drey junge Bauern, so singen und rauchen; zur Linken stehet ein Bejahrter mit kurzen Wams und bis zu den Schuhen reichenden Hosen, neben einem Backofen, woran eine Schnur Zwiebeln und Schalen hängen; verschiedene Geschirre, Kessel und Töpfe siehet man mit vielen Spielkarten auf dem Boden zerstreuet; in der Manier von A. Brauer, von D. de Bloot. g.R. [im verguldeten Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: 14 Zoll hoch, 20 Zoll breit Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "D. de Bloot", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt 1788/10/01 FRAN 0038 de Bloot I Eine Landschaft mit Figuren, in der Manier von P. Wauwermann, in dem Vordergrund siehet man Soldaten in der Karte spielen. I Maße: 16 Zoll hoch, 14 Zoll breit Transakt.: Verkauft (19.15 fl) Käufer: Hoynk 1797/04/20 HBPAK 0186 De Bloot I Zwey Pendante: Felsen= Bogen und Figuren. Geistreich gezeichnet. Auf Holz. I Diese Nr.: Felsen=Bogen und Figuren; Pendant zu Nr. 187 Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Zoll, breit 11 Zoll Anm.: Die Lose 186 und 187 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0187 De Bloot I Zwey Pendante: Felsen= Bogen und Figuren. Geistreich gezeichnet. Auf Holz. I Diese Nr.: Felsen=Bogen und Figuren; Pendant zu Nr. 186 Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Zoll, breit 11 Zoll Anm.: Die Lose 186 und 187 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/08/09 HBPAK 0011 P. de Bloot I Eine Landschaft, im Vordergrunde befinden sich vier Figuren, im Hintergrunde werden die Pferde von dem Wagen losgespannt, nebst einige Figuren zu Fuß und zu Pferde; auf der andern Seite siehet man eine Kirche, wo die Leute dem Anschein nach, eingehen. Auf Holz, goldn. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 25 Zoll, breit 35 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0238 de Blod I Eine Landschaft. Auf der Landstraße befindet sich ein Bauer mit seinem Karren und Pferde, nebst andern Figuren. Kräftig und gut gemahlt. Auf Holz. Goldner Rahm I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 Zoll, breit 6 Zoll Transakt.: Unbekannt 1800/00/00+ LZRST [0008] Van Blot I Ein Lagerstück mit einem Marquetenderzelte, Wagen, Reutern, und vielen Figuren. I Mat.: auf Holz Maße: 45 Zoll breit 30 Vi Zoll hoch Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Rost Transakt.: Unbekannt
Bock 1794/09/10 HBGOV 0080 v. Pock I Wie Christus im Tempel lehrt unter den Schriftgelehrten; wo ihn seine Mutter findet. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 41 Zoll, breit 33 Zoll Transakt.: Unbekannt
Bockhoudt [Nicht identifiziert] 1790/04/13 HBLIE 0258 Bockhoudt I Ein halb geschlachtetes Kalb, und hängendes Federvieh, nach der Natur gemahlt. Auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 32 Zoll, breit 26 Zoll Transakt.: Verkauft (11 Sch) Käufer: Schreiber
Bockhout [Nicht identifiziert] 1786/10/18 HBTEX 0220 Bockhout I Extra fleißig und schön gemahltes Feder=Vieh, theils hangend, als auch auf einem Tische liegend, von welchem die Hälfte mit einer grünen sammitnen Decke
behangen. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 22 Zoll, breit 18 Zoll Transakt.: Unbekannt
Bockler, Daniel [Nicht identifiziert] 1781/07/18 FRAN 0064 Daniel Bockler I Ein schönes Früchten= und Speiß=Stück mit einem Eichhörngen. I Maße: 3 Schuh 2 Zoll hoch, 4 Schuh 8 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Bocksberger 1790/01/07 MUAN 0052 Bocksberger I König Saul mit seinem Waffenträger, aufLeinwat. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 10 Zoll, Breite 2 Schuh 6 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
Boeckhorst, Johann 1716/00/00 FRHDR 0100 Langejan I Von Langejan die Mutter Gottes und das Kind Jesus. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (75) 1716/00/00 FRHDR 0101 Langejan I Von dito [Langejan] Christus gebunden. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (45) 1716/00/00 FRHDR 0107 Langejan I Von Langejan St.Sebastian und ein Engel. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (150) 1742/08/01 BOAN 0003[a] Langejan I S. Joannis Köpft mit einem schwartzen Rahm. Original von Langejan. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0112 Langejan I Ein S. Petri Kopff. Original von Langejan. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0103 Langejan I La tete de St. Pierre, par Langejan. I Maße: Haut 1. p. 8. pouc. large 1. pied 5. pouc. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0324 Langejan I Une Tete de St. Jean, par Langejan. I Maße: Haut 1. pied 6. pouc. large 1. pied 8. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRRAU 0096 Aus Rubens Schule von langen Jean I Der Apostel St. Paulus, in der Hand ein Schwerdt, brav gezeichnet und gemahlt. L'Apötre St. Paul tenant un glaive d'une main, bien dessine & bien peint. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 2 Schuh 3 Zoll, breit 1 Schuh 3 Zoll Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRRAU 0097 Aus Rubens Schule von langen Jean I Der Apostel St. Petrus mit beyden Händen ein Buch haltend, und darinn lesend. Von gleicher Qualität. L'Apötre St. Pierre lisant dans un livre, qu'il tient des deux mains. Peint de la meme qualite. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 2 Schuh 3 Zoll, breit 1 Schuh 3 Zoll Transakt.: Unbekannt 1766/07/28 KOSTE 0001 der sogenannte Lange Jean I Ein groß Stück auf Leinwand, eine Familie, worauf drey Figuren und zwey Kinder mit Schaaf und einem Hund, Lebensgröße, dem Ansehen nach vom sogenannten Langen Jean. I Mat.: auf Leinwand Trans akt.: Unverkauft (45 Rt) 1785/05/17 MZAN 0490 Langjan I Ein Mannsportrait von Langjan. [Le portrait d'un homme.] I Maße: 3 Schuh 2 Zoll hoch, 2 Schuh 1 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (11.30 fl) Käufer: Geh R ν Heüser 1789/00/00 MMAN 0204 Johann van Bockhorst I Die Geburt Christi, auf Holz. [La nativite de Iesus Christ, sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 3 Fuß 7 Zoll hoch, 2 Fuß 6 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
313
1793/00/00 NGWID 0191 Lang lean I Die Kreuzigung Christi mit den beeden Schachern, nebst noch einigen Figuren, von Lang lean. I Maße: 2 Schuh 3 Zoll hoch, 1 Schuh 7 Vi Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
Boegel, H.C. [Nicht identifiziert] 1776/00/00 WZTRU 0003 HCBOEGELI Ein Architekturstück von 6 Schuhe, 6 Zoll hoch, 7 Schuhe, 4 Zoll breit, bezeichnet HCBOEGEL FECIT ano MDCLXII. Ein Stück, dessen Stärke und hierinn wohl observirte Optik, besser dann Heinrich Steenovyk und Peter Neefs ist. Es stellet das innwendige Perspectiv vor eine Antiquekirche, allwo der Augpunkt von Mitten genommen worden. Dieses Werk ist von unbeschreiblicher Natur, und man kann nichts verständigers in dieser Art von Malerey sehen, sowohl im einfallenden Lichte und Schatten, als Schmelz der Coloriten; beynebst sind mehr dann 35 wohlgezeichnete Figuren in bester Wendung hierinn mit guten Verstände angebracht, und alles auf das fleißigste ausgeführet. I Maße: 6 Schuhe 6 Zoll hoch, 7 Schuhe 4 Zoll breit Inschr.: HCBOEGEL FECIT ano MDCLXII (bezeichnet und datiert) Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (800 fl Schätzung) 1781/00/00 WZAN 0003 HCBOEGEL I Ein Architekturstück von 6 Schuhen und 6 Zollen hoch, 7 Schuhe, 4 Zoll breit, bezeichnet HCBOEGEL FECIT an ° MDCLXII. Ein Stück, dessen Stärke und wohl observirte Optik besser, dann Heinrichs Steenovyks und Peter Neefs ist. Es stellet das inwendige Perspectiv einer antiquen Kirche vor, wo der Augpunkt von der Mitte ist genommen worden. Dieses Werk ist von unbeschreiblicher Natur, und man kann nichts verständigers in dieser Art von Malerey sehen, sowohl im einfallenden Lichte und Schatten, als Schmelz der Coloriten; beynebst sind mehr, dann 35 wohlgezeichnete Figuren in bester Wendung hierinn mit gutem Verstände angebracht, und alles auf das fleißigste ausgeführet. I Maße: 6 Schuhe 6 Zoll hoch, 7 Schuhe 4 Zoll breit Inschr.: HCBOEGEL FECIT an° MDCLXII (bezeichnet und datiert) Transakt.: Unbekannt
Böhm, Johann George (I) 1800/01/00 LZAN [AJ0007 Joh. Ge. Boehm I Des Künstlers eigenes wohlgetroffenes Bildniss. Lebensgross, mit den Händen; in der Rechten hält er eine Schreibfeder. Brav gemalt. Auf Holz. Ohne Rahmen. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 2 Fuß 6 Zoll, Breite 2 Fuß Verkäufer: A F Oeser Transakt.: Unbekannt
Böhm, Johann George (II) 1783/08/01 LZRST 0029 Böhm I Eine meisterhafte Landschaft von Böhm im Geschmack von Salv. Rosa und im heroischen Styl, die ganze Gegend mit Bergen Steinklippen und Bäumen, im Mittelgrunde zwey Arcadische Figuren 1 Elle 4 Zoll hoch 1 Elle 11 Zoll breit in verg. Rahm. I Maße: 1 Elle 4 Zoll hoch, 1 Elle 11 Zoll breit Transakt.: Verkauft (4 Th) Käufer: Zaar
Boel, Peeter 1723/00/00 PRAN [B]0003 der alte Poul I Früchten=Korb / vom alten Poul. I Maße: Höhe 3 Schuh 6 Vi Zoll, Breite 4 Schuh 5 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN [B]0051 Pouhl I Zwey Haaßenstück mit Vögeln / vom Pouhl. I Diese Nr.: Ein Haaßenstück mit Vögeln Maße: Höhe 1 Vi Schuh 5 Zoll, Breite 1 Vi Schuh 3 Vi Zoll Anm.: Die Lose [B]51 und [B]52 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN [B]0052 Pouhl I Zwey Haaßenstück mit Vögeln / vom Pouhl. I Diese Nr.: Ein Haaßenstück mit Vögeln Maße: Höhe 1 Vi Schuh 5 Zoll, Breite 1 Vi Schuh 3 Vi Zoll Anm. : Die Lose 314
GEMÄLDE
[B]51 und [B]52 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN 0018 Pul I Ein Haaß und Rebhünlein / vom Pul. I Pendant zu Nr. 19 Maße: Höhe 2 Schuh 4 Vi Zoll, Breite 3 Schuh 2 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN 0019 Pul I Ein Compagnion darzu. I Pendant zu Nr. 18, "ein Haaß und Rebhünlein" Maße: Höhe 2 Schuh 4 Vi Zoll, Breite 3 Schuh 2 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN 0048 Pul I Fruchtstücklein vom Pul / in Metalliner Rahm. I Maße: Höhe 5 Vi Schuh 3 Zoll, Breite 8 Vi Schuh Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1764/06/06 BOAN 0603 Pierre Bohl I Deux Tableaux de dix pouces de largeur, huit pouc de hauteur, representant l'un un marche ä Poissons, Γ autre une course de traineau, peints par Pierre Bohl. [Zwey stück Vorstellend Eins Einen fisch-Marck und andertes Eine schlittenfahrt aufm Eiß, gemahlt Von Peteren Pohl.] I Maße: 10 pouces de largeur, 8 pouc de hauteur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (68.30 Rt) Käufer: Hof C Rath Broggia pprio noie 1765/00/00 FRRAU 0047 Peter Bohl I Vorstellend einen Fischmark, wo man hinten einen kleinen Prospect von dem Meer hat, nebst einem abgedeckten Schiff. Alles, was zu einem geschickten Mahler gehört, ist hier in der schönsten Harmonie zusammen gebracht; Peter Bohl meritirt in einem Cabinet einen vorzüglichen Platz. Ohne die Rahme auf Tuch gemahlt und auf Holz gezogen. Representant un marche ä poisson, oü il y a la mer par derriere dans un petit eloignement & un vaisseau decouvert. Tout ce qui fait voir un habile maitre, est concentre dans ce tableau avec un harmonie incomparable; Pierre Bohl merite une place distinguee dans un cabinet. Sans la bordure peint sur de la toile & cole sur du bois. I Mat.: Leinwand auf Holz Maße: Hoch 8 Zoll, breit 10 Zoll Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRRAU 0058 Peter Bohl I Eine Schlittenfahrt vorstellend. Die Composition in dieser Landschafft ist ohne Tadel, und machet dem Meister Ehre, und die Zeichnung ist recht brav und fleißig. Auf Tuch gemahlt und auf Holtz aufgezogen. Representant un divertissement de traineaux. La Composition de ce pa'isage est sans defaut & fait honneur au Maitre & le dessein est vigoureux & fait avec beaucoup d'assiduite. Peint sur de la toile & cole sur du bois. I Mat.: Leinwand auf Holz Maße: Hoch 8 Zoll, breit 10 Zoll Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0625 Boule I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0031 Pierre Boule I Une piece de cuisine en volailles de basse cour avec une tete de cochon & un lievre pendu par la patte. Peint sur toile, marque du No. 625. I Mat.: auf Leinwand Maße: 2. p. 11. p. de haut sur 4. p. 1. p. de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1778/09/28 FRAN 0687 Peter Boel I Ein sehr schönes Früchtenstück mit einem brennenden Licht, silbernen Geschirren und einem Rebhuhn, von Peter Boel, 2 Sch. 1 Vi Z. breit, 1 Sch. 8 Z. hoch NB. Compagnon zu No. 236. [Une tres belle piece representante des fruits avec une chandelle allumee, des vases d'argent & une perdrix, par Pierre Boel, haut, d'un pied 8 pouces sur 2 pieds & demi de large. NB. le pendant de Nro. 236.] I Pendant zu Nr. 236 von J.P. Gillemans Maße: 2 Schuh 1 Vi Zoll breit, 1 Schuh 8 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (23 fl) Käufer: Schütz 1788/04/07 FRFAY 0021 P. Boel I Der Kopf eines Geisbocks, von P. Boel. Auf Tuch. I Mat.: auf Leinwand Maße: 9 Vi Z. hoch,
und 7. Ζ. breit Transakt.: Verkauft (30 Kr) Käufer: Levi ν M a n nheim] 1799/00/00 WZAN 0310 Peter Poel I Ein Früchtenstück, worauf Papageyen, ein Seekrebs, Austem, ein ganzer Rehebock, auf einem Tische liegend, nebst einem hangenden Pfauen, von Peter Poel. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 4 Schuh 1 Zoll breit 6 Schuh 4 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Boel, Peeter (oder Cuyck, F.) 1774/03/28 HBBMN 0056 Boel; Cuyck I Eine Köchinn mit vielerley Gemüse und andern Neben=Sachen, im schwarzen Rahm und goldenen Leisten, von Boel oder Cuyck. I Maße: Höhe 3 Fuß 7 Zoll, Breite 4 Fuß 7 Zoll Transakt.: Unbekannt
Boels, Frans 1799/00/00 WZAN 0063 Franz van der Boit oder Boets I Eine Landschaft mit einem Wartthurme, in der Ferne Wasser und Schiffe, von Franz van der Boit oder Boets. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 8 Zoll breit 1 Schuh 3 Vi Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Bogaert 1790/07/28 ZHWDR 0032 Bogaart I [Ohne Titel] \ Annotat.: Recht angesetzt. (LAVATER) Transakt.: Unbekannt
Bogaert, Hendrick Hendricksz. 1782/03/18 HBTEX 0503 H. Bogert I Ein hübsches Mädgen, spielet mit einem Papagoy. Zu dessen Compagnon ein Mann, welcher sich über einem Feuertopf wärmet. Beyde stehen in einer Niesche mit halb umgeschlagener Gardine, extra fleißig und plaisant gemahlt; im Gusto von Mieris, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 12 Zoll 6 Linien, Breite 6 Zoll Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0504 H. Bogert I Knaben liebkosen mit einander wegen eines Vogels, welcher im Bauer aufgehangen. Der Compagnon hat eine dazu passende Belustigung von Knaben, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 12 Zoll 6 Linien, Breite 16 Zoll 6 Linien Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt
Diese Nr.: Zwey nackende Frauenzimmer die den Priap anflehen; Pendant zu Nr. 35 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 14 Zoll, breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 34 und 35 wurden zusammen katalogisiert. Transakt. : Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0035 L. Boilly I Das eine stellt zwey nakkende Frauenzimmer vor, die den Priap anflehen; das Gegenstück eine Dame, die auf der Zitter einem vor sich sitzenden jungen Manne auf dem Ciavier accompagnirt. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine Dame, die auf der Zitter einem vor sich sitzenden jungen Manne auf dem Ciavier accompagnirt; Pendant zu Nr. 34 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 14 Zoll, breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 34 und 35 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0112 Boilly I Zwey Damen am Fenster; die eine zeigt der andern die Uhr, um ihr anzudeuten, daß sie nicht länger verweilen könnte. Sehr schön gemahlt. Auf Holz. Goldn. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Zoll, breit 10 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0198 Boilly \ Zwey dito [Guaches?]; das eine, eine Dame vor ihrer Toilette mit ihren Kammerjungfern; das andere, zwey Damens vor einer Statüe. Zwey vortrefliche Bilder. I Diese Nr.: Eine Dame vor ihrer Toilette mit ihren Kammerjungfern Mat.: Gouache [?] Anm.: Die Lose 198 und 199 wurden zusammen katalogisiert. Es ist unsicher, worauf sich das "dito" im Titel bezieht. Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0199 Boilly I Zwey dito [Guaches?]; das eine, eine Dame vor ihrer Toilette mit ihren Kammeijungfern; das andere, zwey Damens vor einer Statüe. Zwey vortrefliche Bilder. I Diese Nr.: Zwey Damens vor einter Statüe Mat.: Gouache [?] Anm.: Die Lose 198 und 199 wurden zusammen katalogisiert. Es ist unsicher, worauf sich das "dito" im Titel bezieht. Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0296 L. Boilly I Ein Frauenzimmer akkompagnirt auf der Zitter einen auf dem Ciavier spielenden jungen Mann. Sehr schön. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 14 Zoll, breit 10 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0307 Boilly I Eine Jagdparthie mit Pferden, Hunden ec. Aufs angenehmste ausgeführt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 Vi Zoll, breit 9 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0069 Boilly I Ein Liebhaber überrascht seine Geliebte in einem Zimmer, sie eilt bey seinem Anblicke davon. Auf Leinwand, goldn. Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 19 Zoll, breit 16 Zoll Transakt.: Unbekannt
Bohl, van [Nicht identifiziert] (Kopie von)
Boiney [Nicht identifiziert]
1799/10/10 HBPAK 0084 Van Bohl; nach le Due \ Die wiedergefundene Tochter. Ausnehmend schön und meisterhaft gemahlt. Auf Leinwand, schw. und goldn. Rahm. I Kopie von Bohl nach Johan le Ducq Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 20 Vi Zoll, breit 23 Zoll Transakt.: Unbekannt
1765/00/00 FRNGL 0121 Unbekannt (6 fl Schätzung)
Boilly, Louis Leopold 1796/02/17 HBPAK 0119 Boilly \ Aus einem hohlen Baume langt eine in weissen Atlas gekleidete junge Schöne Vögel aus einem Neste, wo die Alte davon geflogen, und dicht dabey auf einem Aste sitzt und zürnt. Ein bologneser Hund sitzt vor ihr auf einem steinernen Tische, worüber Rosen wachsen. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 16 % Zoll, Breite 13 % Zoll Transakt.: Verkauft (100 M) Käufer: Liborius 1796/11/02 HBPAK 0034 L. Boilly I Das eine stellt zwey nakkende Frauenzimmer vor, die den Priap anflehen; das Gegenstück eine Dame, die auf der Zitter einem vor sich sitzenden jungen Manne auf dem Clavier accompagnirt. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I
Boiney I 2 Frucht Stücke. I Transakt.:
Bois, le [Nicht identifiziert] 1794/09/09 HBPAK 0147 le Bois I Ein vortreflicher dunkler Wald dessen Ende man nicht absehen kann; zween reisenden Persohnen wandern durch denselben. Ein vortrefliches Stück. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 28 Zoll, breit 22 Zoll Transakt.: Unbekannt
Boit, Charles 1769/03/30 HBTOU 0023 Mr. Boit I Das Portrait des berühmten Grafen von Königs=Mark, nach dem Leben durch Mr. Boit gemahlen auf Kupfer. [Die Mehresten in fein verguldte Rahmen, und die übrigen in schwarz gebeizten mit goldenen Staber.] I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 7 Vi Zoll, Breite 8 Vi Zoll Anm.: Die Angaben in ekkigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 51 und bezieGEMÄLDE
315
hen sich auf die Nrn. 1 bis 51. Transakt.: Verkauft (20 M) Käufer: Hofrath
1765/03/27 FRKAL 0019 Boll I Un excellent portrait d'homme. I Maße: hauteur 40 pouces, largeur 34 pouces Transakt.: Unbekannt
Boizot, Antoine
1769/03/30 HBTOU 0036 Ferd. Boll I Manoa und sein Weib, wie ihnen der Engel des Herrn erscheinet, durch Ferd. Boll auf Holz gemahlen. [Die Mehresten in fein verguldte Rahmen, und die übrigen in schwarz gebeizten mit goldenen Staber.] I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Fuß 4 Zoll, Breite 1 Fuß 1 Zoll Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 51 und beziehen sich auf die Nm. 1 bis 51. Transakt. : Verkauft (12.4 M) Käufer: Duve
1784/05/11 HBKOS 0006 Boizot I Bain et Diane, par Boizot, ein sehr plaisantes Gemähide und lebhafter Vorstellung, auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 41 Zoll 61., breit 66 Zoll 61. Transakt.: Verkauft 1790/02/04 HBDKR 0006 Boizot I Diana sitzet in einer felsigten Anhöhe in herrschender Vergnügung mitten unter ihren Gespielinnen, welche theils um sie herum liegen theils stehen, wovon einige beschäftiget von der Jagd kommen, das Wild, welches sie erleget vorzuzeigen, indem zwey von denselben ihr Trauben und Pfirsige, welche in einem Korb liegen vorhalten, wonach sie langet. Die ganze Harmonie in dieser Vorstellung ist nur dahin gerichtet die Schönheit, diese Geschichte mit dem ländlichen Reitz verbunden, auf das Vollkommenste vorzustellen, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 42 Zoll, breit 69 Zoll Transakt.: Verkauft (50 M) Käufer: Dittmer
Bol, Ferdinand 1744/05/20 FRAN 0154 Ferd. Boll I 1 Schöner alter Manns Kopff. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 6 Zoll, Breite 2 Schuh 4 Zoll Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1749/07/31 HB RAD 0017 F. Boll I Abraham und Melchisedeck. I Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (5) 1750/10/15 HB AN 0008 Boll (Johann) I Ein Manns=Portrait. I Maße: 3 Fuß 5 Ά Zoll hoch, 2 Fuß 10 3/4 Zoll breit Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "Johann Boll", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt 1759/00/00 LZEBT 0203 Boll I Ein Manns-Portrait auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 3 Zoll, Breite 2 Schuh 8 Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (60 Th Schätzung) 1763/01/19 FRJUN 0080 F. Bol I Un petite tete de vieille femme peint en maitre. I Maße: hauteur 11 pouces, large 9 pouces Transakt.: Unbekannt (13 V* fl) 1764/00/00 BLAN 0609 Ferd. Boll I Stellet eine an Ihren putz Tisch sitzende Frau vor. I Maße: 2 Fuß 10 Zoll hoch, 2 Fuß 4 Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (200 Rt Schätzung) 1764/03/12 FRKAL 0010 Ferdinand Boll I Un exellent portrait d'homme parfaitement peint. I Maße: hauteur 39 pouces, largeur 65 pouces Transakt.: Verkauft (26 fl) Käufer: Göring 1764/05/18 BLAN 0011 Ferdinand Bol I Elias, wie ihm der Engel in der Wüsten erscheinet. Halbe Figuren, Lebensgröße, auf Leinewand gemahlt, 3 Fuß 6 Zoll hoch, und 4 Fuß 7 Zoll breit. Dieses Bild ist ziemlich gut gezeichnet, vorzüglich ist die Haltung im Colorit angenehm und schön. Der Affect in dem Kopf des Eliä ist sehr natürlich und meisterlich ausgedruckt, wie er von sanften Schlaf erweckt wird, und den Engel vor sich siehet, der Ihn mit einem angenehmen heitern Angesichte anredet. In dem ganzen Bilde herrschet eine angenehme Stille, die das Auge eines Kenners reitzen muß. [Text hier gekürzt]. I Mat.: auf Leinwand Maße: 3 Fuß 6 Zoll hoch, und 4 Fuß 7 Zoll breit Anm.: Dieses Los wurde zusammen mit der Nr. 10 (Rembrandt) verkauft. Verkäufer: Johann Georg Eimbke Transakt.: Verkauft (350 Rt für die Nrn. 10 und 11) Käufer: Ephraim 1765/03/27 FRKAL 0018 Ferdinand Boll I Un beau tableau historique. I Maße: hauteur 40 pouces, largeur 34 pouces Transakt.: Verkauft (7 fl) Käufer: Hoch 316
GEMÄLDE
1770/10/29 FRAN 0004 F. Boll I Ein Frauen Portrait. I Maße: h. 19. Zoll. b. 15. Zoll. Transakt.: Unbekannt 1770/10/29 FRAN 0005 F. Boll I Ein alter Philosoph. I Maße: h. 46. Zoll. b. 38. Zoll. Transakt.: Unbekannt 1774/08/13 HBBMN akt.: Unbekannt
0142
Fr. Bol I Ein Frauenzimmer. I Trans-
1776/07/19 HBBMN 0084 Ferdinand Boll I Ein Soldat im Harnisch, extra schön. I Maße: Höhe 1 Fuß 6 Zoll, Breite 1 Fuß 4 Zoll Transakt.: Verkauft (13.12 M) Käufer: David 1777/02/21 HBHRN 0011 Ferdinand Boll I Ein Kopf, oder brustbild, mit einem Pelzmantel. I Maße: Höhe 2 Fuß 3 Zoll, Breite 1 Fuß 8 Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/08/29 HBTEX 0023 Bool I Ein allegorisches Stück, die Elora [sie], Ceres und Genien vorstellend. I Maße: Höhe 2 Fuß, Breite 1 Fuß 6 Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/09/28 FRAN 0077 Ferdinand Bol I Ein Mannsportrait mit braunen Haaren und schwarzer Kleidung. [Un portrait d'homme avec des cheveux bruns, habille en noir par Ferdinand Bol.] I Maße: 2 Schuh 3 Zoll breit, 3 Schuh 1 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (13 fl) Käufer: Gogel 1778/09/28 FRAN 0283 Ferdinand Bol I Eine Frauensperson, welche auf der Laute spielet. [Une femme qui touche du luth.] I Maße: 1 Schuh breit, 1 Schuh 2 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (55.30 fl) Käufer: Abe Bava 1778/09/28 FRAN 0605 Ferdinand Boll I Ein Weibskopf. [Une tete de femme.] I Maße: 15 Zoll breit, 1 Vi Schuh hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (9 fl) Käufer: Dr Hartzberg 1779/00/00 HB AN 0029 Ferd. Bol I Ein Frauenzimmerkopf in niederländischer Tracht. [Tete de femme ajustee ä la Hollandoise.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 10 Zoll hoch, 1 Fuß 7 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/09/27 FRNGL 0179 Ferd. Bol I Eines alten Mannes Bildniß, meisterhaft u. kräftig. [Le portrait d'un vieillard, piece excellente.] I Pendant zu Nr. 180 Maße: 2 Schuh 1 Zoll hoch, 1 Schuh 7 Zoll breit Transakt.: Verkauft (7.15 fl für die Nm. 179 und 180) Käufer: Adaria Wien 1779/09/27 FRNGL 0180 Ferd. Bol I Zum Gegenbild ein dergleichen alter Mann, von nemlichem Meister [Ferd. Bol] und Maas. [Le pendant du precedant, meme objet [portrait d'un vieillard], par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 179 Maße: 2 Schuh 1 Zoll hoch, 1 Schuh 7 Zoll breit Transakt.: Verkauft (7.15 fl für die Nrn. 179 und 180) Käufer: Adaria Wien 1779/09/27 FRNGL 0343 Ferdinand Bol I Eine alte Frau, welche durch die Brille in einem Buch lieset, sehr meisterhaft. [Une vieille femme portante des lunettes & lisante dans un livre, chef d'oeuvre.] I Maße: 2 Schuh 7 Zoll hoch, 1 Schuh 10 Zoll breit Transakt.: Verkauft (1.40 fl) Käufer: Dr Ehrman 1779/09/27 FRNGL 0464 Ferdinand Bol I Ein alter Mannskopf. [La tete d'un vieillard.] I Pendant zu Nr. 465 Maße: 1 Schuh 4 Zoll
hoch, 1 Schuh 1 Zoll breit Transakt.: Verkauft (3.30 fl für die Nrn. 464 und 465) Käufer: Rath Ehrenreich 1779/09/27 FRNGL 0465 Ferdinand Bol I Einer jungen Frauen Bildniß zum Compagnon, von nemlichem Meister [Ferdinand Bol] und Maas. [Le pendant du precedant, la tete d'une jeune femme, par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 464 Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 1 Zoll breit Transakt.: Verkauft (3.30 fl für die Nrn. 464 und 465) Käufer: Rath Ehrenreich 1781/05/07 FRHUS 0091 Ferdinand Bol I Das Bildniss des Jan De Wit, von Ferdinands Bol, bekanntem schönen Pinsel. I Maße: 8 Zoll hoch und 8 Zoll breit Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (10 fl) Käufer: Ettling 1783/06/19 HBRMS 0096 Ferdinandus Boll I Ein mit einer Mütze bedeckter bärtiger Manneskopf, um dessen Hals eine goldene Kette hängt. L[einwand]. g.R. [verguldeter Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß hoch, 1 Fuß 8 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1785/05/17 MZAN 0582 Ferdinand Bol I Isaac der seinen Sohn Jacob segnet von Ferdinand Bol. [Isaac donnant la Benediction ä son fils Jacob.] I Maße: 3 Schuh 6 Zoll hoch, 4 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Unverkauft Gegenw. Standort: Aschaffenburg, Deutschland. Bayerische Staatsgemäldesammlungen. (6339) als Joachim Sandrart (I) 1787/00/00 HB AN 0364 Ferd. Bol I Das Bildniß eines Mannes von mittein Jahren, mit einer schwarzen mit Gold gestickten Mütze, in einem dunkelen Kleide, und mit einer goldenen Kette über der Brust. So schön wie Rembrandt. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Zoll, breit 16 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (10 M) Käufer: Tietjen 1787/00/00 HB AN 0483 Ferdin. Boll I Das Brustbild eines Türken mit einem weißen Turban, woran sich vorne unter andern Zierathen einer halber Mond befindet, in einem gestickten dunkelen Kleide. Brustbild. Besonders schön und kräftig gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] s.R. [in schwarzem Rahm] R. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll, breit 18 Zoll Transakt.: Verkauft (9.4 M) Käufer: Mathees 1787/00/00 HB AN 0550 Ferd. Boll I Das Brustbild eines jungen Mannes mit schwarzem Huthe und dunkler Kleidung. A.H. [Auf Holz] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 23 Zoll, breit 20 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (4.4 M) Käufer: Tietjen 1788/04/07 FRFAY 0012 F. Bol I Rembrands Frau im Profil von J. Livens, und ein alter Mannskopf mit einer Pelzmütze, von F. Bol. Beyde auf Holz. I Diese Nr.: Ein alter Mannskopf mit einer Pelzmütze Mat.: auf Holz Maße: 8 % Z. hoch, und 7 V* Z. breit Anm.: Die Lose 11 und 12 wurden zusammen katalogisiert. Dieses Los wurde zusammen mit der Nr. 11 (J. Lievens (I)) verkauft. Transakt.: Verkauft (2 fl für die Nm. 11 und 12) Käufer: Levi ν Man[n]he[im] 1789/00/00 MMAN 0129 Ferdinand Bol I Büste eines Alten, aufLeinw. [Le Büste d'un ancien, surtoile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß hoch, 9 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (5 fl) 1789/00/00 MMAN 0265 Ferd. Bol I Ein Kopf mit einem Turban, auf Leinw. [Une tete avec un turban, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 8 Zoll hoch, 2 Fuß 1 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (3 fl) 1789/00/00 MMAN 0304 Ferdinand Bol I Eine halbe Figur eines schreibenden Mannes, auf Leinw. [Une de mie figure, d'un homme qui ecrit, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 5 Zoll hoch, 2 Fuß breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt 1789/04/16 HBTEX 0114 Ferd. Boll I Einwendige Zimmer, wo man die heilige Familie im Vordergrunde sieht, eines bey Nacht vorgestellt, mit sehr vielen Nebensachen; von schöner Haltung und
Licht und Schatten, auf Η. I Diese Nr.: Einwendiges Zimmer, wo man die heilige Familie im Vordergrunde sieht, eines bey Nacht vorgestellt Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Zoll, breit 18 Vi Zoll Anm.: Die Lose 114 und 115 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (14 Μ für die Nrn. 114 und 115) Käufer: Saphier 1789/04/16 HBTEX 0115 Ferd. Boll I Einwendige Zimmer, wo man die heilige Familie im Vordergründe sieht, eines bey Nacht vorgestellt, mit sehr vielen Nebensachen; von schöner Haltung und Licht und Schatten, auf Η. I Diese Nr.: Einwendiges Zimmer, wo man die heilige Familie im Vordergrunde sieht Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Zoll, breit 18 Vi Zoll Anm.: Die Lose 114 und 115 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (14 Μ für die Nrn. 114 und 115) Käufer: Saphier 1791/01/05 HBBMN 0258 Ferdinand Boll I Eine biblische Historie aus dem alten Testament, sehr schön gemahlt, von Ferdinand Boll. Auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 32 Zoll, breit 44 Zoll Transakt.: Verkauft (0.12 M) Käufer: Ego 1791/09/26 FRAN 0029 Ferdinand Boll I Ein alter Philosoph mit der Sanduhr. I Maße: 2 Sch. 10 Zoll hoch, 2 Sch. 5 Zoll breit Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1792/04/19 HBBMN 0054 F. Boll I In einer angenehmen morgenländischen Gegend sitzt Rebecka neben Isaac; etwas entfernter steht Elieser und spricht mit ihnen, vor welchem ein bepacktes Maulthier liegt. Dieses schöne Gemähide ist sehr natürlich vorgestellet und vortreflich gemahlt, von F. Boll. Auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 31 Vi Zoll, breit 42 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0047 F. Boll I Das Bildniß eines Kriegers, mit Pelzmütze und Brustharnisch, beynahe en Profil, von F. Boll. I Maße: Hoch 25 Zoll, breit 22 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 LZRCH 0070 Mre. De Ferd. Bol. I Une tete de vieillard, d'un beau pinceau. I Mat.: auf Leinwand Maße: h. 26.1. 22. pouces Verkäufer: J F Rauch Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0028 Ferdinand Bol I Ein Frauenkopf mit Händen und einem Kröße, von Ferdinand Bol. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 2 Schuh 2 Zoll breit 3 Schuh 10 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 BLBOE 0052 F. Bol I Eine Matrone liest in einem Buche. Vor ihr ein Tisch, auf welchen [sie] ein Cruzifix, Bücher, ein Globus und ein Todtenkopf befindlich sind. Zur Seiten steht ein Spinnrocken. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 BLBOE 0053 F. Bol I Ein Brustbild mit einem Turban. Skizze. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN2 0007 Boll (Ferdinand) I Zwey Halbfiguren. Die Eine stellet vor, einen Kavalier mit einem violet Mantel und einer rothen Mütze auf dem Haupt. Die Andere eine Holländerin mit einem blauen Korset, und in Haaren frisirt. Kunstliebhaber werden finden, daß diese beyde Stück mit denen Rambrande schönen Arbeiten können verglichen werden. I Diese Nr.: Eine Halbfigur, einen Kavalier mit einem violet Mantel und einer rothen Mütze auf dem Haupt vorstellend Maße: 11 Zoll hoch, 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 7 und 8 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN2 0008 Boll (Ferdinand) I Zwey Halbfiguren. Die Eine stellet vor, einen Kavalier mit einem violet Mantel und einer rothen Mütze auf dem Haupt. Die Andere eine Holländerin mit einem blauen Korset, und in Haaren frisirt. Kunstliebhaber werden finden, daß diese beyde Stück mit denen Rambrande schönen Arbeiten können verglichen werden. I Diese Nr.: Eine Halbfigur, eine Holländerin mit einem blauen Korset, und in den Haaren frisirt vorstellend Maße: 11 Zoll hoch, 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 7 und 8 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/00/00+ LZRST [0009] Ferd. Bol I Eine rauchende sitzende Bäuerin und ein junger Bauer mit der Flasche. I Mat.: auf Holz GEMÄLDE
317
Maße: 14 Zoll breit 16 Zoll hoch Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Rost Transakt.: Unbekannt
Bol, Ferdinand (Kopie nach) 1775/05/08 HBPLK 0154 Ferd. Boll I Ein Mädchen mit einer Birne in der Hand, auf Leinewand, nach Ferd. Boll. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 19 Zoll 9 Linie, Breite 16 Zoll 10 Linie Transakt.: Unbekannt
Bol, Ferdinand (Manier) 1779/09/27 FRNGL 0725 Ferdinand Bol \ Ein Türkenkopf, in der Manier von Ferdinand Bol. [Une tete de Türe, dans le gout de Ferdinand Bol.] I Maße: 9 Vi Zoll hoch, 8 Zoll breit Transakt.: Verkauft (1.30 fl für die Nrn. 725 und 726) Käufer: Zerbes 1779/09/27 FRNGL 0726 Ferdinand Bol I Ein dergleichen Persianischer Kopf, von nemlichem Meister [in der Manier von Ferdinand Bol] und Größe. [La tete d'un Persan, par le meme maitre.] I Maße: 9 Vi Zoll hoch, 8 Zoll breit Transakt.: Verkauft (1.30 fl für die Nrn. 725 und 726) Käufer: Zerbes
Bol, Hans 1750/00/00 KOAN 0049 l'ancien Hans Bol I Un süperbe paisage, sur bois, de l'ancien Hans Bol; piece, NB. laquelle par son antiquite, & par la rarete des ouvrages du maitre, qui n'est pas inferieur ä Breugel, est inestimable. I Mat.: auf Holz Maße: Largeur 11 Vi Pouces, Haut 1 Pies 3 V* Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1764/05/25 BOAN 0473 Hans Boll I Douze Pieces representantes les douze mois de l'an enrichis de figures, qui representent l'Histoire de l'Evangile, peintes par Hans Boll ä tempera. [Zwölf stück Vorstellend die zwölf monathen im jähr a tempera, ornirt mit figurlem Von Evangelischer Historie Von Hans Boll.] I Mat.: Tempera Maße: 7 pouces de largeur, 5 pouces de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (70 Rt) Käufer: Excellence frh von Gymnich 1767/00/00 KOAN 0099 Hans Boll I Eine vortrefliche und fleißige Landschaft auf Holtz von dem uralten Hans Boll. NB. ein Stück wegen beydes des Alterthums so wohl, als Seltenheit des Meisters hochzuschätzen, und dem Breugel nicht ungleich. I Mat.: auf Holz Maße: Breite 2 Fuß, Höhe 1 Fuß 7 Ά Zoll Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt 1776/07/19 HBBMN 0003 H. Boll I Ein Mann und eine Frau, halbe Figuren, so schön wie Koning. I Diese Nr.: Ein Mann Maße: Höhe 1 Fuß 1 Zoll, Breite 11 Zoll Anm.: Die Lose 3 und 4 wurden zusammen katalogisiert. Der Künstler ist vermutlich Ferdinand Bol und nicht Hans Bol. Transakt.: Verkauft (28 Μ für die Nrn. 3 und 4) Käufer: Lilie 1776/07/19 HBBMN 0004 H. Boll I Ein Mann und eine Frau, halbe Figuren, so schön wie Koning. I Diese Nr.: Eine Frau Maße: Höhe 1 Fuß 1 Zoll, Breite 11 Zoll Anm.: Die Lose 3 und 4 wurden zusammen katalogisiert. Der Künstler ist vermutlich Ferdinand Bol und nicht Hans Bol. Transakt.: Verkauft (28 Μ für die Nrn. 3 und 4) Käufer: Lilie 1779/09/27 FRNGL 0827 Hans Bol I Eine mit Gebürgen und Felsen sehr fleißig ausgearbeitete Landschaft. [Un paysage couvert de montagnes & de rochers, tres belle piece.] I Maße: 1 Schuh 5 Zoll hoch, 2 Schuh 4 Zoll breit Transakt.: Verkauft (41 fl) Käufer: Mentzinger 1787/00/00 HB AN 0490 Hanns Boll I Das Portrait eines Frauenzimmers in schwarzer Kleidung und weißer Kappe. A.H. [Auf 318
GEMÄLDE
Holz] s.R. [in schwarzem Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 12 Zoll Anm.: Der Künstler ist vermutlich Ferdinand Bol und nicht Hans Bol. Transakt.: Verkauft (5.4 M) Käufer: Tietjen 1794/00/00 FGAN [B]0043 Jan Bol I Zwey Felsenstücke nebst einer Aussicht. Eine Mühle, und der Winter, auf Holz gemalt. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Schuh 2 Zoll hoch, 1 Schuh 7 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt
Bol, Hans (Kopie nach) 1796/10/17 HBPAK 0188 Nach Η Boll I Ein Kopf; sehr gut gemahlt. Auf Leinwand. Schwarzer Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 23 Zoll, breit 19 Zoll Anm.: Der Künstler ist vermutlich Ferdinand Bol und nicht Hans Bol. Transakt.: Unbekannt
Bollandt, Heinrich 1784/08/02 FRNGL 0575 Heinrich Bolland I Die Auferwekkung Lazari, mit ausnehmenden Fleiß und Stärke ausgeführt von Heinrich Bolland 1636. verfertigt. I Maße: 26 Zoll breit, 16 Zoll hoch Inschr.: 1636 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Verkauft (15.30 fl) Käufer: Pr von Dessau Gegenw. Standort: Dessau, Deutschland. Anhaltische Gemäldegalerie. (622) 1791/09/26 FRAN 0095 Heinrich Boland I Der Zinsgroschen, ein fleißiges geistreiches Bild so Heinrich Boland im Geschmack des Rubens verfertiget hat. I Maße: 13 breit 9 Zoll hoch Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt
Bollandt, Heinrich (Manier; Kopie von) 1784/09/27 FRAN 0117 Henrich Bolland: Rubens I Der Zinßgroschen, ein vortrefflich und sehr fleißiges Bild, in der Manier von Henrich Bolland, nach Rubens. [Une piece representante l'histoire tiree de la bible touchant le tribut, superieurement bien peinte dans le gout de Henri Bollard d'aprfes Rubens.] I Kopie in der Manier von H. Bollandt nach Rubens Maße: 9 Zoll hoch, 1 Schuh 1 Zoll breit Verkäufer: Freyherr von Berberich Transakt.: Verkauft (30 fl) Käufer: Müller
Bollongier, Hans 1763/01/17 HNAN [A]0027 Jan Ballangier I Menage d'un Paysan Hollandois, par Jan Ballangier 1620, sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 11 pouces, Largeur 1 pied 2 pouces Inschr.: 1620 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt. : Unbekannt 1763/01/17 HNAN [A]0110 J. Ballangier I Chambre d'un Paysan Hollandois, sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hauteur 1 pied 5 pouces, Largeur 1 pied 10 pouces Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt 1788/01/31 LZRST [0011] Boulanger I Feuersbrunst von Boulanger auf Holz. I Mat.: auf Holz Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Transakt.: Unbekannt
Bonhagen [Nicht identifiziert] 1723/00/00 PRAN [C]0019 Bonhagen I Compagnion vom Bonhagen. I Pendant zu Nr. [C]18, "Blumen=Stücklein" von Veerendael Maße: Höhe 2 Schuh 2 Zoll, Breite 1 Vi Schuh 3 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt
Bonne [Nicht identifiziert] 1790/05/20 HBSCN 0163 Bonne I Ein Mädchen sitzt am Tisch und schreibt Noten bey Licht. Halbe Figur. Auf H[olz], S.R.G.L. [Schwarzen Rahm, goldne Leisten] I Mat. : auf Holz Maße: Hoch 11 Zoll, breit 10 Zoll Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Trans akt.: Verkauft (2 M) Käufer: Ranzow 1792/07/28 HBSCN 0108 Bonne I Ein Mädchen sitzt am Tisch und schreibt Noten bey Licht. Halbe Figur. Auf H[olz]. S.R.G.L. [Schwarzen Rahm Goldne Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Zoll, breit 10 Zoll Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt
Bonnefoy 1799/12/04 HBPAK 0048 Bonnefoy I Ein Ovidisches Stück. Ganz kräftig und brav gemahlt. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 27 Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Unbekannt
Bonzi, Pietro Paolo (Gobbo dei Carracci) 1788/09/01 KOAN 0002 Gobbo Carazzi I 6 Figuren in Lebensgröße. [Une piece avec 6 personnes en grandeur d ' h o m m e . ] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 3 Fuß 10 Zoll, Breite 3 Fuß 10 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt
1789/04/16 HBTEX 0035 Bontje I Ein holländischer Muschelverkäufer sitzet auf seiner Karre und schreiet mit vollem Halse, solche bekannt zu machen; lebhaft vorgestellet auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 11 Zoll, breit 9 Zoll Transakt.: Verkauft (4 M) Käufer: Bostelmann 1789/06/12 HBTEX 0173 D. Boone, fee. I Bauren amüsiren sich mit Trinken. Halbe Figuren. Besonders fleißig gemahlt. I Diese Nr.: Bauren amüsiren sich mit Trinken Maße: Hoch 10 Zoll, breit 7 Vi Zoll Inschr.: D. Boone fee. (signiert) Anm.: Die Lose 173 und 174 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (1.8 Μ für die Nrn. 173 und 174) Käufer: Ego 1789/06/12 HBTEX 0174 D. Boone, fee. I Bauren amüsiren sich mit Trinken. Halbe Figuren. Besonders fleißig gemahlt. I Diese Nr.: Bauren amüsiren sich mit Trinken Maße: Hoch 10 Zoll, breit 7 V2 Zoll Inschr.: D. Boone fee. (signiert) Anm.: Die Lose 173 und 174 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (1.8 Μ für die Nrn. 173 und 174) Käufer: Ego 1797/06/13 HBPAK 0053 Botje I Ein Bauer und Bäuerinn fahren in einer Karre durch eine Landgegend. Etwas entfernter gehet verschiedenes Hornvieh. Sehr plaisant gemahlt. Auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 23 Zoll, breit 32 Zoll Transakt.: Unbekannt
Boonen, Arnold Boon, J. [Nicht identifiziert] 1796/09/08 HBPAK 0152 Marq. J. Boon. 17261 Ein schönes See=Stück; grau in grau gemahlt, wie mit der Feder gezeichnet. Von außerordentlichem Fleiße. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 20 Zoll, breit 21 Zoll Inschr.: J. Boon 1726 (bezeichnet und datiert) Transakt.: Unbekannt
Boone, Daniel 1747/04/06 HB AN 0017 Boontjes I Boontjes Portrait von ihm selbst. I Maße: 2 Fuß 2 Zoll Breite und 2 Fuß 3 Zoll Höhe Verkäufer: Brockes Transakt.: Unbekannt (12) 1759/00/00 LZEBT 0062 Bontje I Ein Doctor Medicino auf Holtz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 10 Vi Zoll, Breite 1 Schuh 1 Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (20 Th Schätzung) 1765/03/27 FRKAL 0020 Boon I Une jolie piece representant un vaisseau a bord, delicatement peint. I Maße: hauteur 19 pouces, largeur 27 pouces Transakt.: Verkauft (8 fl) Käufer: Lampert 1782/03/18 HBTEX 0250 B. Boone I Ein Mann, welcher sich am Essen verbrannt, und eine Frau, die eine Tobacks=Pfeife am Lichte ansteckt, wie Brauer, auf Holz. I Diese Nr.: Ein Mann, welcher sich am Essen verbrannt Mat.: auf Holz Maße: Höhe 5 Zoll 3 Linien, Breite 4 Zoll 8 Linien Anm.: Die Lose 250 und 251 wurden zusammen katalogisiert. Der N a m e des Künstlers ist angegeben als "B. Boone", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0251 B. Boone I Ein Mann, welcher sich am Essen verbrannt, und eine Frau, die eine Tobacks=Pfeife am Lichte ansteckt, wie Brauer, auf Holz. I Diese Nr.: Eine Frau, die eine Tobacks=Pfeife am Lichte ansteckt Mat.: auf Holz Maße: Höhe 5 Zoll 3 Linien, Breite 4 Zoll 8 Linien Anm.: Die Lose 250 und 251 wurden zusammen katalogisiert. Der N a m e des Künstlers ist angegeben als "B. Boone", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1787/04/03 HBHEG 0115 Bontge I Ein Muschelnverkäufer, von Bontge, auf Holz. I Mat.: auf Holz Transakt.: Verkauft (1.12 M) Käufer: Hofr Ehrenreich
1749/07/31 HBRAD 0056 A. Boon I Ein Philosoph. I Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (12.8) 1764/05/18 BLAN 0027 Amoldus Boonen I Die bußfertige Maria Magdalena. Gantze Figur, auf Leinewand gemahlt, 2 Fuß hoch und 1 Fuß 4 Zoll breit. Es ist ein Nachtstück. Die Magdalena sitzet neben einem Tische, worauf eine brennende Lampe stehet. Der Effekt des Lichtes ist sehr gut und natürlich ausgedruckt. Indessen hat Boonen es noch lange so weit nicht gebracht Nachtstücken so schön vorzustellen als Gerard Dou, Hondhorst, und sein Lehrmeister Schalken; denn diese Meister haben Nachtstücke verfertiget, die bewunderswürdig schön sind, worinn ihnen bis hieher niemand zuvorgekommen ist. [Text hier gekürzt] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß hoch und 1 Fuß 4 Zoll breit Verkäufer: Johann Georg Eimbke Transakt.: Verkauft (1.12 Rt) Käufer: Engel 1790/05/20 HBSCN 0131 A. Boon I Ein alter Geldwechsler sitzt an einem mit vielen Büchern ec. belegten Tisch und ließt einen Brief; seine ihn zur Rechten sitzende Frau wiegt einige Geldstücke. Halbe Figuren. Auf L[einwand]. G.R. [Goldnen Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 15 Zoll, breit 13 Zoll Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (13 M) Käufer: Ranzow
Bootem, C. [Nicht identifiziert] 1790/02/04 HBDKR 0041 C. Bootem 1690 I Eine sehr lebhafte Land= und Wassergegend, mit einigen Gebürgen, worauf Schlösser und Städte zusehen. Im Vorgrunde ist ein Monument zur Rechten, einige Reisende befinden sich theils gehend theils ausruhend an dem Ufer; besonders schön wie Rembrandt gemahlt, wovon er ein Discipul gewesen, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 26 Zoll, breit 34 Zoll Inschr.: 1690 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Verkauft (13.8 M) Käufer: Ego
Boots, Jan 1798/06/04 HBPAK 0229 Boots I Eine Landschaft. Gut gemahlt. Auf Holz, goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Zoll, breit 15 Zoll Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
319
Boques [Nicht identifiziert] 1796/11/02 HBPAK 0103 Boques I Ein Wasser=Prospect mit sehr hohen Klippen. Man sieht viele badende Personen. Und im Vordergrunde befinden sich viele Zuschauer und weidendes Vieh. Ganz im Claud, le Lorrainschen Geschmack. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 20 Zoll Transakt.: Unbekannt
Borbaum [Nicht identifiziert] 1716/00/00 FRHDR 0109 Borbaum I Von Borbaum die Strassen zu Amsterdam / 4 . stuck. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (180)
Borch, Gerard ter (II) 1763/01/19 FRJUN 0114 G. Terburg I Cinq Portraits en petit sur un tableau tre [sic] bien touche. I Maße: hauteur 17 Vi pouces, large 14 Vi pouces Transakt.: Unbekannt (11 fl) 1764/00/00 BLAN 0434 Terburg I 1 Cabinet stück, stellend einen in voller rüstung bis zu den Knien gekleydeter officier vor. I Maße: 1 Fuß 3 Vi Zoll hoch, 1 Fuß Vi Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (300 Rt Schätzung) Gegenw. Standort: SanktPeterburg, Rossiya. Ermitazh. (N 1845) 1764/03/12 FRKAL O l l i G. Terburg I Un excellent Tableau representant un corps de garde avec des Officiers jouant au trictrac, tableau de cinq figures & parfaitement peint. I Maße: hauteur 17 Vi pouces, largeur 15 Vi pouces Transakt.: Unbekannt 1764/05/25 BOAN 0237 Derburg I Deux Portraits en Oval de trois pouces de hauteur, deux pouces & demi de largeur, peints par Derburg. [Zwey portraitger oval ins kleine Von Derburg.] I Diese Nr.: Un Portrait Format: oval Maße: 3 pouces de hauteur, 2 pouces et demi de largeur Anm.: Die Lose 237 und 238 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (11 Rt für die Nrn. 237 und 238) Käufer: Broggia 1764/05/25 BOAN 0238 Derburg I Deux Portraits en Oval de trois pouces de hauteur, deux pouces & demi de largeur, peints par Derburg. [Zwey portraitger oval ins kleine Von Derburg.] I Diese Nr.: Un Portrait Format: oval Maße: 3 pouces de hauteur, 2 pouces et demi de largeur Anm.: Die Lose 237 und 238 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (11 Rt für die Nrn. 237 und 238) Käufer: Broggia 1765/03/27 FRKAL 0162 Terburg I Un Corps de Garde avec plusieurs figures tres-bien peint. I Maße: hauteur 51 pouces, largeur 52 pouces Transakt.: Unbekannt 1772/00/00 BSFRE 0160 Therbourgh (Gerard) I Represente une Dame assise, habillee, d'une Robe verte de Satin, ä Bordüre noire, ayant une espece de Mantille blanche, garnie de Dentelles larges ä double rang, par dessus les epaules, eile boit avec un verre de vin rouge la Sante d'un Cavalier, qui est debout devant eile & qui paroit luy dire des Galanteries. Celui-cy a un habit noir, un Baudrier brode Culottes. & Bas olives, le Chappeau rabatu, & un Rabat blanc, tenant une Baguette en Main ; sur le devant du Tableau est une Table, couverte d'un tapis verd, sur la quelle se trouve une Cruche de fayance blanche, gamie d'Argent, un Plat, avec un Citron decoupe, une orange & un Couteau ; au fond du Tableau, est un Lit, & une Chaise rouge. Cette piece peut aller de pair [sic], avec les meilleurs Tableaux de ce celebre Artiste. Cadre sculpte & d'ore. I Mat.: auf Holz Maße: haut 20 Vi large 15 pouces Transakt.: Unbekannt 1778/08/29 HBTEX 0094 Terburg I Ein Holländisches Mädgen, welches nähet, plaisant gemahlt auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 9 Zoll, Breite 7 Zoll Transakt.: Unbekannt 320
GEMÄLDE
1785/05/17 MZAN 0339 Terburg I Ein Frauenzimmer das an einem Tische sitzt und den Saft aus einer Citrone drückt, neben ihm ein Mann mit einer Laute von Terburg. [Une femme qui assisse ä une table exprime le sue d'un citron & un homme tenant un Luth ä cöte d'elle.] I Maße: 1 Schuh 2 Zoll hoch, 1 Schuh breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (58 fl) Käufer: Becker Glöckner 1785/05/17 MZAN 1041 Terburg I Ein Gesellschaftsstück von Terburg. [Une conversation.] I Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 1 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (31.30 fl) Käufer: ν Loquowitz 1785/10/17 LZRST 0089 Terburg I Ein meisterhaft ausgeführtes Gesellschaftsstück, scheint nach der Kenner Meynung von Terburg zu seyn. Zwey niederländische Damen, welche Picquet an einem Tische spielen, hinterm Tische ein Cavalier, der der Dame zeigt, wie sie spielen soll, in hölz. Rahm. I Maße: 15 Zoll hoch, 11 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (3.11 Th) Käufer: Caj 1787/03/01 HBLOT 0092 Terburg I Ein Kerl, welcher ein Frauenzimmer caressirt. I Transakt.: Unbekannt (4.8 M) 1788/04/07 FRFAY 0055 Terburg I Eine lächlende Männliche Figur mit einer Tabackspfeife und einem Weinrömer, von Terburg. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: 8 14 Z. hoch, und 6 Ά Ζ. breit Transakt.: Verkauft (11 fl) Käufer: Levi ν M[annheim] 1789/00/00 MMAN 0160 Gerhard Terburg I Ein Conversations· Stück, auf Leinwand. [Une conversation, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 4 Zoll hoch, 2 Fuß breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt 1791/10/21 HBRMS1 0040 G. Terburg I Das Innere eines Landhauses, im Vordergrunde sitzt die Hausmutter bey der Wiege und nähet, hinten ist die Magd beym Feuerheerd beschäftigt. Besonders schön und fleißig gemahlt; auf Leinew. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Zoll, breit 18 Zoll Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0405 G. Terburg I Wie ein Doctor bey einer kranken Frau seinen Besuch abstattet, und über den Lauf der Krankheit sich mit ihr zu unterhalten sucht, nebst noch zwey wohlangebrachten Dienstbothen, von G. Terburg. 1740. I Maße: 1 Schuh 10 Zoll hoch, 2 Schuh 2 Zoll breit Inschr.: 1740 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0079 G. Terburg I Eine sitzende Holländerin, hält eine Zeitung in der rechten Hand. Figur bis ans Knie. Ausfuhrlich und schön gemahlt von G. Terburg. I Maße: Hoch 11 Zoll, breit 9 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1795/03/12 HBSDT 0175 Tyburg I Ein Tobacks=Raucher. I Maße: Hoch 9 Zoll, breit 7 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0010 Terburg I Zwey Stücke mit allegorischen Figuren. I Diese Nr.: Ein Stück mit allegorischen Figuren Anm.: Die Lose 10 und 11 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0011 Terburg I Zwey Stücke mit allegorischen Figuren. I Diese Nr.: Ein Stück mit allegorischen Figuren Anm.: Die Lose 10 und 11 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0013 Transakt.: Unbekannt
Terburg I Eine Fischverkäuferin. I
1796/12/07 HBPAK 0076 Transakt.: Unbekannt
Terburg I Ein Stück mit Figuren. I
1796/12/07 HBPAK 0231 Terburg i Eine Bäuerin bringt einer Dame Federvieh zum Verkauf. I Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 LZAN 0106 Terburg I Un Tableau dans le genre de la Bambochade. Groupe d'hommes et femmes egayes par le vin. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 19 pouces, largeur 16 pouces Transakt.: Unbekannt (8 Louis Schätzung)
1799/00/00 LZRCH 0034 Gerard Therburg I Deux pendants portaits [sic] preseutant [sic] un ministre Protestant et sa femme, traite avec precision, rien est, qui approche plus de la nature, que ces deux figures. I Mat.: auf Holz Maße: h. 12.1. 9. pouces Verkäufer: J F Rauch Transakt.: Unbekannt
1764/08/25 FRAN 0160 van der Borcht I Deux vieillards Tun avec un livre et l'autre avec un verre. I Diese Nr.: Un vieillard avec un verre Maße: haut 2 pouces sur 7 pouces de large Anm.: Die Lose 159 und 160 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt
1799/00/00 WZAN 0679 Gerard Terburg I Zwey Gesellschaftsstückchen, von Gerard Terburg. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Gesellschaftsstückchen Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh breit 9 Zoll Anm.: Die Lose 679 und 680 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1782/09/30 FRAN O l l i van der Borcht I Eines alten Mannes Bildnis. [Le portrait d'un Viellard, par van der Borcht.] I Pendant zu Nr. 112 Maße: 6 Vi Zoll hoch, 5 Vi Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (6 fl für die Nrn. 111 und 112) Käufer: Müller
1799/00/00 WZAN 0680 Gerard Terburg I Zwey Gesellschaftsstückchen, von Gerard Terburg. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Gesellschaftsstückchen Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh breit 9 Zoll Anm.: Die Lose 679 und 680 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1782/09/30 FRAN 0112 van der Borcht I Zum Gegenbildchen hierzu, ein dergleichen alter bärtiger Mann, von nehmlichem Meister [van der Borcht] und Maas. [Le pendant du precedant, un Viellard barbu, par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 111 Maße: 6 Vi Zoll hoch, 5 Vi Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (6 fl für die Nrn. 111 und 112) Käufer: Müller
1799/10/18 LZAN 0102 Terburgh I Eine Conversation. I Verkäufer: Rauch Transakt.: Verkauft (20 Th) Käufer: Geist 1799/12/23 WNAN 0083 Terbourg I Un petit Portrait. I Trans akt.: Verkauft (50) Käufer: moi 1800/00/00 BLBOE 0022 Terburg I Eine Dame liest einen Brief, den ein Bothe gebracht, der auf Antwort wartet. Er steht an einem Tisch, der mit einem Teppich bedeckt ist. I Mat.: auf Leinwand Transakt.: Unbekannt 1800/00/00+ LZRST [0099] Gerh. Terburg I Ein Kavalier und eine Dame beym Frühstück. I Mat.: auf Leinwand Maße: 21 Zoll hoch 18 Zoll breit Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Rost Transakt.: Unbekannt
Borch, Gerard ter (II) (Kopie nach) 1784/08/01 LZRST 0155 Terburg I Ein sehr fleissig ausgeführtes Gesellschaftsstück nach Terburg, meisterhaft copirt, auf Holz gemahlt, 11 Vi Z. br. 15 Z. hoch, in Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: 11 Vi Zoll breit, 15 Zoll hoch Transakt.: Verkauft (1.20 Th) Käufer: C 1797/08/10 MMAN 0202 Terburg I Ein Knab, seinen Hund die Flöhe suchend. Nach Terburg, auf Holz. I Mat.: auf Holz Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (20 fl Schätzung)
1791/09/26 FRAN 0090 van der Borcht I Zwey sehr fleißig ausgeführte Köpfe. I Diese Nr.: Ein sehr fleißig ausgeführter Kopf Maße: 1 Zoll hoch, 6 Zoll breit Anm. : Die Lose 90 und 91 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0091 van der Borcht I Zwey sehr fleißig ausgeführte Köpfe. I Diese Nr.: Ein sehr fleißig ausgeführter Kopf Maße: 7 Zoll hoch, 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 90 und 91 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0115 van der Borcht I Ein alter Kirchenlehrer, der beim Schein eines Lichts ein Buch schreibt, würkend und fleißig ausgeführt von van der Borcht. I Maße: 6 Zoll breit, 7 Zoll hoch Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HB GOV 0097 Van der Borch I Christus am Creuze, um welchem ein Cranz von Blumen, sehr schön gemahlt. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 22 Zoll, breit 18 Zoll Transakt.: Unbekannt
Borcht, van der (oder Borght, Jan) 1779/09/27 FRNGL 1028 van der Borgt I Ein klein fleißig ausgearbeitetes Blumenstückgen. [Une belle piece representante des fleurs.] I Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 9 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (2.6 fl) Käufer: Nothnagel
Borchens [Nicht identifiziert] 1799/12/04 HBPAK 0132 Borchens I Zwey Landschaften mit Figuren. Auf Holz. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Zoll, breit 23 Zoll Anm.: Die Lose 132 und 133 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0133 Borchens I Zwey Landschaften mit Figuren. Auf Holz. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Zoll, breit 23 Zoll Anm.: Die Lose 132 und 133 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Borcht, Pierre van der (II) 1784/09/27 FRAN 0047 P.ν. Borcht I Eine Landschaft mit Ruinen, von P.v. Borcht 1628 verfertigt. [Un pay sage avec des ruines, par P. ν. Borcht de l'annee 1628.] I Maße: 2 Schuh 1 Zoll hoch, 3 Schuh 8 Zoll breit Inschr.: 1628 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Freyherr von Berberich Transakt.: Verkauft (7 fl) Käufer: Ihr durchl[aucht] Prinzess ν Dessau Gegenw. Standort: Dessau, Deutschland. Anhaltische Gemäldegalerie. (450)
Bordone, Paris Borcht, van der 1744/05/20 FRAN 0064 v.d. Borcht I 1 Stück Andromeda v.d. Borcht. I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 7 Zoll, Breite 6 Zoll Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1764/08/25 FRAN 0159 van der Borcht] avec un livre et l'autre avec un verre. I Diese un livre Maße: haut 2 pouces sur 7 pouces de 159 und 160 wurden zusammen katalogisiert. Haeckel Transakt.: Unbekannt
Deux vieillards l'un Nr.: Un vieillard avec large Anm.: Die Lose Verkäufer: Baron de
1787/00/00 HB AN 0184 Paris Bordon I Ein Mann von mittlem Jahren, in einem grünen Gewände, umfasset ein wohlgekleidetes Mädchen, welches in ihrer linken ein Gebinde von Blumen hält. In der Ferne wird man eine Landschaft gewahr. Sehr ausführlich gemahlt. A.H. [Auf Holz] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 32 Zoll, breit 25 Zoll Transakt.: Verkauft (30.4 M) Käufer: Mathees 1799/12/23 WNAN 0013 Paris Bourdon I Un Ecce Homo, par Paris Bourdon sur Toile. I Mat.: auf Leinwand Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
321
Bordone, Paris (oder Bourdon)
Borris [Nicht identifiziert]
1742/08/01 BOAN 0226 Bordon I Ein Ovidisches Stuck, die schlaffende Venus mit einem Kindlein prasentirend. Original von Bordon. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt
1778/03/28 HBSCM 0094 Transakt.: Unbekannt
1742/08/30 BOAN 0129 Bourdon I Venus dormant, avec un enfant, par Bourdon. I Maße: Haut 11. pou. large 1. p. 2. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt
Borsch [Nicht identifiziert]
Borris I Ein aufsehender Kopf. I
Borg, der [Nicht identifiziert]
1788/09/01 KOAN 0417 Borsch I Einzug von einem Türk, [l'entree d'un Turk.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 3 Fuß 3 Zoll, Breite 4 Fuß 4 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt
1770/10/29 FRAN 0218 der Borg I Eine Landschaft von der Borg. I Maße: Hoch 21 Zoll. Breit 24 Zoll. Transakt.: Unbekannt
Borssom, Anthonie van
Borgh, F. van der [Nicht identifiziert] 1794/09/10 HBGOV 0062 F. van der Borgh I Blumen=Kränze mit symbolischen Vorstellungen. Ganz vortreflich gemahlt. I Diese Nr.: Ein Blumen=Kranz mit symbolischen Vorstellungen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 72 Zoll, breit 55 V4 Zoll Anm.: Die Lose 62 und 63 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV 0063 F. van der Borgh I Blumen=Kränze mit symbolischen Vorstellungen. Ganz vortreflich gemahlt. I Diese Nr.: Ein Blumen=Kranz mit symbolischen Vorstellungen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 72 Zoll, breit 55 V2 Zoll Anm.: Die Lose 62 und 63 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Borght, Jan van der (oder Borcht) 1779/09/27 FRNGL 1028 van der Borgt I Ein klein fleißig ausgearbeitetes Blumenstiickgen. [Une belle piece representante des fleurs.] I Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 9 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (2.6 fl) Käufer: Nothnagel
Borgianni, Orazio 1789/00/00 MMAN 0223 Horatio Borgiani I Christus im Grab, auf Holz. [Iesus au tombeau, sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 3 Fuß 1 Zoll hoch, 3 Fuß 6 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (55 fl)
Boris [Nicht identifiziert] 1776/06/21 HB NEU 0017 Boris 17541 Ein alter Hist. Manns= Kopf, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 F 1 Z, Breite 11 Ζ Inschr.: 1754 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Verkauft (2 M) Käufer: W S[enior] 1776/06/21 HBNEU 0042 Boris I Ein Kopf mit einer Calotte und Kragen, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 8 Z, Breite 6 Ζ Transakt.: Unbekannt
Borman, Johannes 1793/09/18 HBSCN 0039 Bormann I Vor einer Gardiene stehet ein steinerner Tisch, welcher mit einer blauen Gold befransete Dekke belegt ist, auf diesem steht ein Gefäß mit mancherley sehr natürlichen Früchten, die ebenfalls zerstreut auf dem Tische umher liegen, besonders fleißig gemahlt. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 34 Zoll, breit 28 Zoll Transakt.: Unbekannt
Borresio [Nicht identifiziert] (Kopie nach) 1800/11/12 HBPAK 0076 Borresio I Zwey spielende Kinder, nach Borresio. I Transakt.: Unbekannt 322
GEMÄLDE
1797/04/25 HBPAK 0044 Van Borsum I Eine Garten=Aussicht, um den Garten ist ein Graben, im Vordergrunde einige Enten; und hinten im Garten sieht man eine Dame. Auf Holz, schwarzen Rahm, goldene Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 13 Zoll, breit 12 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0019 A. Borssom I Eine horizontalische Landschaft, worin auf dem Vordergrunde zur Linken ein Dorf, wo vorne ein Hirte sich an ein altes Mauerwerk lehnet, und sich mit einem Mädchen unterredet; zur Rechten weiden Ochsen und Kühe. Ganz gut und brav gemahlt. Auf Leinwand, schwarzer Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 31 Zoll, breit 46 Zoll Transakt.: Unbekannt
Bos, Caspar van den 1772/09/15 BNSCT 0014 C. van den Bos I 2 Compagnons grau in grau, eine stille und stürmende See mit Schiffen, von C. van den Bos, 10 Zoll hoch, 1 F. 2 Zoll breit, schwarzen Rahm. I Diese Nr.: Eine stille See mit Schiffen; Pendant zu Nr. 15 Maße: 10 Zoll hoch, 1 Fuß 2 Zoll breit Anm.: Die Lose 14 und 15 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (2.1 fl) 1772/09/15 BNSCT 0015 C. van den Bos I 2 Compagnons grau in grau, eine stille und stürmende See mit Schiffen, von C. van den Bos, 10 Zoll hoch, 1 F. 2 Zoll breit, schwarzen Rahm. I Diese Nr.: Eine stürmende See mit Schiffen; Pendant zu Nr. 14 Maße: 10 Zoll hoch, 1 Fuß 2 Zoll breit Anm.: Die Lose 14 und 15 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (2.1 fl)
Bos, M. von [Nicht identifiziert] 1791/05/28 HBSDT 0053 M. von Bos. Fee. 16601 Zwey kämpfende Hähne mit mehreren Federvieh umgeben, im Geschmack von Hondekutter, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 45 Zoll, breit 70 Zoll Inschr.: M. von Bos. Fee. 1660 (signiert und datiert) Transakt.: Unbekannt
Bos, Pieter van den 1785/05/17 MZAN 0535 Bos I Ein Tisch auf welchem Früchten, Austern und Trinkgeschirre stehen. [Une table sur la quelle on voit des fruits, des huitres & des vases ä boire.] I Pendant zu Nr. 536 Maße: 3 Schuh hoch, 4 Schuh breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (40 fl für die Nrn. 535 und 536) Käufer: D L Β ä Harff 1785/05/17 MZAN 0536 Bos I Das Gegenbild, ein Tisch, worauf Früchten, ein Schinken, ein Seekrebs und Trinkgeschirre ec. stehen, beide Stücke von Bos. [Le pendant, une table sur la quelle on voit des fruits, un jambon, un homard & des vases ä boire &c.] I Pendant zu Nr. 535 Maße: 3 Schuh hoch, 4 Schuh breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (40 fl für die Nrn. 535 und 536) Käufer: D L Β ä Harff
Bosch (Bossche) (und Snyders, F.) 1799/12/04 HBPAK 0049 Snyders; van den Bosch I Zwey Stükke. Das Eine mit einem Garten=Hause; vor demselben liegen Garten=Gewächse, als: Kohl, Zwiebeln ec. Ein Mädchen bey demselben, um solche zu verkaufen. Ein Knabe unterhält sich mit ihr in Unterredung. Das Andere ein Landhaus. Vor demselben ein Jäger mit seinem Wilde; eine Dame handelt mit dem Jäger um das Federvieh. Gut gemahlt. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Ein Stück mit einem Garten=Hause Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 31 Zoll, breit 37 Zoll Anm.: Die Lose 49 und 50 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0050 Snyders; van den Bosch I Zwey Stükke. Das Eine mit einem Garten=Hause; vor demselben liegen Garten=Gewächse, als: Kohl, Zwiebeln ec. Ein Mädchen bey demselben, um solche zu verkaufen. Ein Knabe unterhält sich mit ihr in Unterredung. Das Andere ein Landhaus. Vor demselben ein Jäger mit seinem Wilde; eine Dame handelt mit dem Jäger um das Federvieh. Gut gemahlt. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Ein Landhaus Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 31 Zoll, breit 37 Zoll Anm.: Die Lose 49 und 50 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1791/09/26 FRAN 0087 Herrn. Boos I Zwey Stücke, die Hagar in der Wüste und die Anbetung der Hirten. I Diese Nr.: Die Anbetung der Hirten Maße: 5 Sch. 4 Zoll hoch, 4 Sch. 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 86 und 87 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt
Bosschaert 1742/08/01 BOAN 0042 Boschard I Ein Blumen Stuck. Original von Boschard. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0407 Boschart I Zwey schön-Original Blumen Stuck vom Boschart. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0483 Boschard I Ein grosses Blumen Stuck mit einer Figur. Orig. von Boschard. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0521 Boschard I Vier grosse Blumen-Stuck. Original von Boschard. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0279 Boschart I Des Fleurs, par Boschart. I Maße: Haut 1. pied 9. pouces. large 1. pied 5. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt
Bosch, Jacob van den 1763/01/19 FRJUN 0089 Jasques van den Bosch I Un excellent tableau avec des fruits, peches, citrons, Raisins &c. naturellement peint & aussi bon que s'il etoit de Heem. I Maße: hauteur 45 pouces, large 33 pouces Transakt.: Unbekannt (73 V* fl)
Bosje [Nicht identifiziert] 1800/11/12 HBPAK 0301 Bosje I Zwey Stücke mit spielenden Kindern. I Transakt.: Unbekannt
1742/08/30 BOAN 0298 Boschard I Des Fleurs avec une Figure, par Boschard. I Maße: Haut 3. pieds 6. pou., large 4. pieds 3. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0309 Boschart I Des Fleurs, par Boschart, deux couples. I Maße: Haut 5. pieds 2. pouces, large 3. pieds 8. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1763/01/19 FRJUN 0145 Boschart I Une piece de fleurs. I Maße: hauteur 28 pouces, large 23 pouces Transakt.: Unbekannt (3 fl) 1765/03/27 FRKAL 0023 Boschaart I Deux beaux tableaux avec des fleurs tres bien peint. I Maße: hauteur 36 pouces, largeur 28 pouces Transakt.: Unbekannt
Bosnians, Andre 1774/08/13 HBBMN 0009 lena. I Transakt.: Unbekannt
Lose 86 und 87 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt
A. Bosmann I Eine büßende Magda-
Boss, Hermann 1782/09/30 FRAN 0204 Hermann Boos I Zwo Vorstellungen aus der heiligen Schrift, die eine die Hagar in der Wüste, und die andre die Geburt unsers Heilandes vorstellend. [Deux representations tirees de l'Ecriture Sainte, l'une Hagar dans le desert, & l'autre, la naissance du Sauveur, par Herman Boas.] I Diese Nr.: Eine Vorstellung aus der heiligen Schrift, die Hagar in der Wüste vorstellend Maße: 4 Schuh 6 Zoll hoch, 5 Schuh 4 Zoll breit Anm.: Die Lose 204 und 205 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (6.15 fl für die Nm. 204 und 205) Käufer: Müller 1782/09/30 FRAN 0205 Hermann Boos I Zwo Vorstellungen aus der heiligen Schrift, die eine die Hagar in der Wüste, und die andre die Geburt unsers Heilandes vorstellend. [Deux representations tirees de l'Ecriture Sainte, l'une Hagar dans le desert, & l'autre, la naissance du Sauveur, par Herman Boas.] I Diese Nr.: Eine Vorstellung aus der heiligen Schrift, die Geburt unsers Heilands vorstellend Maße: 4 Schuh 6 Zoll hoch, 5 Schuh 4 Zoll breit Anm.: Die Lose 204 und 205 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (6.15 fl für die Nrn. 204 und 205) Käufer: Müller 1791/09/26 FRAN 0086 Herrn. Boos I Zwey Stücke, die Hagar in der Wüste und die Anbetung der Hirten. I Diese Nr.: Die Hagar in der Wüste Maße: 5 Sch. 4 Zoll hoch, 4 Sch. 6 Zoll breit Anm. : Die
1770/10/29 FRAN 0043 Bossart I Zwey Blumenstücke. I Maße: Hoch 48 Zoll. Breit 34 Zoll. Transakt.: Unbekannt 1775/02/25 HBBMN Transakt.: Unbekannt
0085
Boschard I Ein Blumen=Stück. I
1778/09/28 FRAN 0157 Bossehaert I Ein schönes Stück mit Frauenspersonen, Kindern und Blumen. [Une belle piece representante des femmes, des enfans & des fleurs.] I Pendant zu Nr. 158 Maße: 3 Schuh breit, 2 Schuh 4 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (68 fl für die Nrn. 157 und 158) Käufer: Morgenstern 1778/09/28 FRAN 0158 Bossehaert I Der Compagnon mit den nemlichen Vorstellungen [Frauenspersonen, Kindern und Blumen], von dito [Bossehaert], [Le pendant du precedent representant les meines objets [des femmes, des enfans & des fleurs], par le meme [Bossehaert].] I Pendant zu Nr. 157 Maße: 3 Schuh breit, 2 Schuh 4 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (68 fl für die Nrn. 157 und 158) Käufer: Morgenstern 1785/12/21 HB KOS 0060 Boschard I Zwey Blumen=Stücke, in verguldeten Rahmens. I Diese Nr.: Ein Blumen=Stück Anm.: Die Lose 60 und 61 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1785/12/21 HB KOS 0061 Boschard I Zwey Blumen=Stücke, in verguldeten Rahmens. I Diese Nr.: Ein Blumen=Stück Anm.: Die Lose 60 und 61 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/04/21 HBTEX 0106 Boschard I Ein schönes Blumen= Stück. I Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
323
1787/04/03 HBHEG 0010 Boschart I Eine Vase mit Blumen, von Boschart, auf ditto [Leinewand]. I Mat.: auf Leinwand Transakt.: Verkauft (8 Sch) Käufer: Henning [und] Ehrenreich 1788/08/21 HBRMS 0039 Boschard I Gefäße mit Blumen beziert und behangen, sehr frey und meisterhaft gemahlt, auf L[einwand], schw. R[ahm]. I Diese Nr.: Ein Gefäß mit Blumen beziert und behangen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll, breit 28 Zoll Anm.: Die Lose 39 und 40 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (2 Μ für die Nrn. 39 und 40) Käufer: Seegel 1788/08/21 HBRMS 0040 Boschard I Gefäße mit Blumen beziert und behangen, sehr frey und meisterhaft gemahlt, auf Leinwand]. schw. R[ahm]. I Diese Nr.: Ein Gefäß mit Blumen beziert und behangen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll, breit 28 Zoll Anm.: Die Lose 39 und 40 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (2 Μ für die Nrn. 39 und 40) Käufer: Seegel 1790/01/07 MUAN 0200 Boschart I Zwey Blumenstücke, auf Kupfer, in geschnittenen und metallisirten Ramen. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 1 Schuh 1 Zoll, Breite 11 Zoll Anm.: Die Lose 200 und 201 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0201 Boschart I Zwey Blumenstücke, auf Kupfer, in geschnittenen und metallisirten Ramen. I Diese Nr.: Ein Β lumenstück Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 1 Schuh 1 Zoll, Breite 11 Zoll Anm.: Die Lose 200 und 201 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/02/04 HBDKR 0110 Bosckart I Ein vortrefliches Blumenstück, welches sehr stark und lebhaft gemahlt, auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 22 Zoll, breit 17 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (2.6 M) Käufer: Flügge 1790/08/25 FRAN 0031 Boschard I Zwey Blumenstück. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Maße: hoch 36 Zoll, breit 41 Zoll Anm.: Die Lose 31 und 32 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (7.15 fl für die Nrn. 31 und 32) Käufer: Erlinger 1790/08/25 FRAN 0032 Boschard I Zwey Blumenstück. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Maße: hoch 36 Zoll, breit 41 Zoll Anm.: Die Lose 31 und 32 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (7.15 fl für die Nm. 31 und 32) Käufer: Erlinger 1790/08/25 FRAN 0236 Boschard I Ein Blumenstück. I Maße: hoch 45 Zoll, breit 40 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (2.15 fl) Käufer: Kaller 1790/08/25 FRAN 0237 Boschard I Ein Blumenstück. I Maße: hoch 48 Zoll, breit 40 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (2 fl) Käufer: Kaller 1790/08/25 FRAN 0377 Boschard I Ein Blumenstück. I Maße: hoch 43 Zoll, breit 39 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (5 fl) Käufer: Kaller 1791/01/05 HBBMN 0285 Bochard I Zwey sehr natürlich gemahlte Blumen=Stücke; von Bochard. Auf Leinew. gemahlt. I Diese Nr.: Ein sehr natürlich gemahltes Blumen=Stück Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 16 Vi Zoll, breit 12 Vi Zoll Anm.: Die Lose 285 und 286 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft ( I M für die Nrn. 285 und 286) Käufer: Ego ä 8[...?] 1791/01/05 HBBMN 0286 Bochard I Zwey sehr natürlich gemahlte Blumen=Stücke; von Bochard. Auf Leinew. gemahlt. I Diese Nr.: Ein sehr natürlich gemahltes Blumen=Stück Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 16 Vi Zoll, breit 12 V* Zoll Anm.: Die Lose 285 und 286 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft ( I M für die Nm. 285 und 286) Käufer: Ego ä 8[...?] 1791/07/29 HBBMN 0141 Boschard I Verschiedene Bluman [sie] in einer Vase, auf dem Tische stehend; auf Holz. I Mat.: auf 324
GEMÄLDE
Holz Maße: Hoch 28 Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Verkauft (2 M) Käufer: Matfeld 1793/09/18 HBSCN 0160 Brochardt I Zwey fleißige Blumenstücke. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll, breit 20 Zoll Transakt.: Unbekannt 1795/11/14 HBPAK 0002 Bossehart I Ein Ecce Homo. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 1 Fuß 11 Zoll, breit 1 Fuß 7 Zoll Transakt.: Unbekannt
Bosschaert (Kopie nach) 1742/08/01 BOAN 0536 Boschard I Ein Blumen Stuck in einem Pott, nach Boschard. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0395 Boschart I Bouquet de fleurs, d'apres Boschart. I Maße: Haut 2. p. 3. pouces, large 1. p. 8. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt
Bosschaert (Manier) 1775/10/07 HBBMN 0018 Bossart I Zwey Stücke mit todtes Feder=Vieh und Früchten, in der Manier von Bossart. I Diese Nr.: Ein Stück mit todtes Feder=Vieh und Früchten Anm.: Die Lose 18 und 19 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1775/10/07 HBBMN 0019 Bossart I Zwey Stücke mit todtes Feder=Vieh und Früchten, in der Manier von Bossart. I Diese Nr.: Ein Stück mit todtes Feder=Vieh und Früchten Anm.: Die Lose 18 und 19 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Bosschaert (Schule) 1742/08/01 BOAN 0548 Boschart I Ein gross Blumen Stuck aus der Schuhle von Boschart. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt
Bosschaert, Johannes 1799/00/00 WZAN A0092 Johann Zosschaert I Zwey Blumenstücke, von Johann Zosschaert. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 10 Zoll breit 2 Schuh 3 Zoll Anm.: Die Lose A92 und A93 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0093 Johann Zosschaert I Zwey Blumenstücke, von Johann Zosschaert. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 10 Zoll breit 2 Schuh 3 Zoll Anm.: Die Lose A92 und A93 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Bossche, Balthasar van den 1777/04/11 HBNEU 0038 Bosche I Zwey Stücke, die Mahler= und Bildhauerkunst vorstellend. I Diese Nr.: Ein Stück, die Mahlerkunst vorstellend Anm.: Die Lose 38 und 39 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1777/04/11 HBNEU 0039 Bosche I Zwey Stücke, die Mahler= und Bildhauerkunst vorstellend. I Diese Nr.: Ein Stück, die Bildhauerkunst vorstellend Anm.: Die Lose 38 und 39 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1783/06/19 HBRMS 0001 W. Bossche I Angenehme Vorstellungen von Maler= und Bildhauer=Academien, reich an Figuren. Leinwand]. g.R. [verguldete Rahmen] I Diese Nr.: Eine angenehme Vorstellung einer Maler=Academie Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 2 Zoll hoch, 2 Fuß 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 1 und 2 wurden zusammen katalogisiert. Der Name des Künstlers ist angegeben als
"W. Bossche", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt 1783/06/19 HBRMS 0002 W. Bossche I Angenehme Vorstellungen von Maler= und Bildhauer=Academien, reich an Figuren. L[einwand]. g.R. [verguldete Rahmen] I Diese Nr.: Eine angenehme Vorstellung einer Bildhauer=Academie Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 2 Zoll hoch, 2 Fuß 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 1 und 2 wurden zusammen katalogisiert. Der Name des Künstlers ist angegeben als "W. Bossche", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt 1785/04/22 HBTEX 0134 A.v. Bossche I Bildhauer= und Mahler=Academie, mit sehr schönen Figuren. Auf Leinewand. Goldne Rahmen. I Diese Nr.: Bildhauer=Academie, mit sehr schönen Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 27 Zoll, breit 35 Zoll Anm.: Die Lose 134 und 135 wurden zusammen katalogisiert. Der Name des Künstlers ist angegeben als "A.v. Bossche", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt 1785/04/22 HBTEX 0135 A.v. Bossche I Bildhauer= und Mahler=Academie, mit sehr schönen Figuren. Auf Leinewand. Goldne Rahmen. I Diese Nr.: Mahler=Academie, mit sehr schönen Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 27 Zoll, breit 35 Zoll Anm.: Die Lose 134 und 135 wurden zusammen katalogisiert. Der Name des Künstlers ist angegeben als "A.v. Bossche", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt 1785/05/17 MZAN 0638 Balthasar van Bosch I Die Werkstätte eines Mahlers der ein Frauenzimmerportrait mahlt, und die Werkstätte eines Bildhauers, der an einer Bildsäule arbeitet von Balthasar van Bosch. [L'attelier d'un peintre occupee ä faire le portrait d'une Dame, le pendant represente l'attelier d'un sculpteur occupe ä faire une Statue.] I Diese Nr.: Die Werkstätte eines Mahlers der ein Frauenzimmerportrait mahlt; Pendant zu Nr. 639 Maße: 1 Schuh 11 Zoll hoch, 1 Schuh 6 Zoll breit Anm..· Die Lose 638 und 639 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Unverkauft 1785/05/17 MZAN 0639 Balthasar van Bosch I Die Werkstätte eines Mahlers der ein Frauenzimmerportrait mahlt, und die Werkstätte eines Bildhauers, der an einer Bildsäule arbeitet von Balthasar van Bosch. [L'attelier d'un peintre occupee ä faire le portrait d'une Dame, le pendant reprisente l'attelier d'un sculpteur occupe ä faire une Statue.] I Diese Nr.: Die Werkstätte eines Bildhauers, der an einer Bildsäule arbeitet; Pendant zu Nr. 638 Maße: 1 Schuh 11 Zoll hoch, 1 Schuh 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 638 und 639 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Unverkauft 1787/00/00 HB AN 0256 A. v. Bossche I Ein kleiner Knabe trinkt aus einer umflochtenen Italienischen Weinbouteille; hinter ihm stehen in einem Korbe verschiedene Früchte. Im Hintergrunde sieht man durch eine Oeffnung in eine Landschaft. Ein Mädchen lieset mit einer vergnügten Miene in einem Buche, welches sie mit beyden Händen hält. Neben ihm befinden sich einige Früchte und andere Nebensachen. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Diese Nr.: Ein kleiner Knabe trinkt aus einer umflochtenen Italienischen Weinbouteille Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 16 Zoll, breit 12 Zoll Anm.: Die Lose 256 und 257 wurden zusammen katalogisiert. Der Name des Künstlers ist angegeben als "A. v. Bossche", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Verkauft (18 Μ für die Nrn. 256 und 257) Käufer: Sigberg 1787/00/00 HB AN 0257 A. v. Bossche I Ein kleiner Knabe trinkt aus einer umflochtenen Italienischen Weinbouteille; hinter ihm stehen in einem Korbe verschiedene Früchte. Im Hintergrunde sieht man durch eine Oeffnung in eine Landschaft. Ein Mädchen lieset mit einer vergnügten Miene in einem Buche, welches sie mit beyden Händen hält. Neben ihm befinden sich einige Früchte und andere Nebensachen. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem
Rahm] I Diese Nr.: Ein Mädchen lieset mit einer vergnügten Miene in einem Buche Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 16 Zoll, breit 12 Zoll Anm.: Die Lose 256 und 257 wurden zusammen katalogisiert. Der Name des Künstlers ist angegeben als "A. v. Bossche", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Verkauft (18 Μ für die Nrn. 256 und 257) Käufer: Sigberg 1798/06/04 HBPAK 0208 Von den Bosch I Zwey Stücke mit Figuren. Stark und brav gemahlt. Auf Holz, goldner Rahm. I Diese Nr.: Ein Stück mit Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 13 Zoll Anm.: Die Lose 208 und 209 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0209 Von den Bosch I Zwey Stücke mit Figuren. Stark und brav gemahlt. Auf Holz, goldner Rahm. I Diese Nr.: Ein Stück mit Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 13 Zoll Anm.: Die Lose 208 und 209 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0016 Van den Bosch I Ein inwendiges Bauern=Haus, wo sie beym Essen beten. Ganz natürlich vorgestellt. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 17 Zoll, breit 15 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0066 van der Bosch I Ein Stück mit Figuren, wo die Königin die Perle im Giftbecher wirft. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 25 Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0236 v. den Bosch I Ein alter Wanderer ruhet von seiner Reise an einem Postamente; neben ihn sein abgesattelter Esel, und eine Frau und ein Knabe, welche ihn aus dem Schlafe wecken. Kräftig und gut gemahlt. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 14 Zoll, breit 11 Zoll Transakt.: Unbekannt
Bosse, Abraham 1790/01/07 MUAN 0129 Bosse Abrah. I Bethsabe und David, auf Leinwat. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 4 Zoll, Breite 1 Schuh 11 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
Bossi, Antonio Giuseppe (und Grooth, J.N.) 1776/00/00 WZTRU 0183 Anton Bossy; Johann Nikolaus Grooth I Ein Stück 5 Schuhe, 10 Zoll hoch, von Anton Bossy, und Johann Nikolaus Grooth verfertiget, stellet vor den am Kreuze sterbenden Heiland, worinnen letzterer Meister einen weinenden Engel mit einem in der Hand haltenden Zettel verfertiget hat: in diesem Stücke ist sowohl die correcte Zeichnung, Colorit der Carnation, als auch Uebereinstimmung im Schatten und Licht auf das treflichste observiret worden. I Maße: 5 Schuhe 10 Zoll hoch Anm.: Der Eintrag enthält keine Angaben zur Breite des Bildes. Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (50 fl Schätzung) 1781/00/00 WZAN 0183 Anton Bossy; Johann Nikolaus Grooth I Ein Stück 5 Schuhe, 10 Zoll hoch, welches von Anton Bossy und Johann Nikolaus Grooth verfertiget ist, stellet den am Kreuze sterbenden Heiland vor, worinnen letzterer Meister einen weinenden Engel mit einem in der Hand haltenden Zettel verfertiget hat: in diesem Stücke ist sowohl die korrekte Zeichnung, die Kolorit der Karnation, als auch die Uebereinstimmung im Schatten und Licht auf das trefflichste observiret worden. I Maße: 5 Schuhe 10 Zoll hoch Anm.: Der Eintrag enthält keine Angaben zur Breite des Bildes. Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
325
Both, Andries Dirksz. 1743/00/00 BWGRA 0037 Andreas Both I Ein Kloster, woselbst einigen Bettlern etwas ausgetheilet wird, von Andreas Both. I Maße: hoch 1 Fuß 2 Zoll, breit 1 Fuß 6 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1759/00/00 LZEBT 0172 Andreas Both I Ein Stück worauf ein Soldaten March auf Holtz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 5 Schuh 5 Zoll, Breite 3 Schuh 3 Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (300 Th Schätzung) 1763/00/00 BLAN 0026 Andreas Both I Christi Geisselung. Ganze Figuren, auf Holz gemahlt, 1 Fuß 11 Zoll hoch, und 1 Fuß 7 Zoll breit. Der Effect vom Licht und Schatten ist in diesem Gemählde bewundernswürdig schön. Es ist übrigens fast ganz in dem Geschmacke des Elsheimer und Bramer gemahlet. Die Composition ist sehr hübsch; besonders sind die Affecten mit vieler Wahrheit ausgedruckt. Die Zeichnung ist auch gut. Das Hauptlicht fällt auf die Figur des Heilandes, und verlieret sich nach und nach in der allerschönsten Verbindung mit dem Ganzen des Bildes. Das Colorit ist kräftig und mit meisterlichem Pinsel ausgeführet. Kurz, dieses Gemählde ist ein würdiges Cabinetstück. [Text hier gekürzt] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 11 Zoll hoch, und 1 Fuß 7 Zoll breit Verkäufer: Johann Gottlieb Stein Transakt.: Unbekannt 1764/03/12 FRKAL 0012 Andre Both I Un süperbe Tableau representant un grand nombre de Soldats ä pied & ä cheval continuant leur marche, grande ordonance vigoureusement & parfaitement peint. I Maße: hauteur 39 pouces, largeur 65 pouces Transakt.: Unbekannt 1765/03/27 FRKAL 0021 A. Both I Le siege d'une ville avec un grand nombre de figures parfaitement peint. I Maße: hauteur 17 pouces, largeur 30 pouces Transakt.: Verkauft (27.15 fl) Käufer: Schlundt 1778/09/28 FRAN 0648 Andreas Both I Ein Bauernstück. [Une piece representante des paysans.] I Maße: 11 Zoll breit, 14 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (36 fl) Käufer: Hüsgen 1787/00/00 HB AN 0663 Andreas Both I In einer Landschaft befinden sich im Vordergrunde bey einem kleinen mit Bäumen bewachsenen Berge verschiedene Figuren, die sich an ein Feuer wärmen, von welchem das Gemähide ein besonderes Licht empfängt. Bey Licht vorgestellt. Sehr schön gemahlt. A.H. [Auf Holz] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 '/2 Zoll, breit 12 '/2 Zoll Transakt.: Verkauft (55 [?] M) Käufer: Fesser 1792/10/12 KOAN 0141 Andreas Booth I Eine Landschaft von Andreas Booth. I Verkäufer: Moureaux Transakt.: Unbekannt 1793/09/18 HBSCN 0045 A. Bot I In einer bergigten Landschaft weiden Schaafe, ein auf der Landstraße vorüber reitender Reisender scheinet den Hirten ein Labsal zu reichen. Mit vieler Wärme und Heiß gemahlt. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 21 Zoll, breit 18 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/02/17 HBPAK 0148 Andreas Both I In einem Landhause um eine Tonne sitzen Bauren und Bäurinnen, welche zum Theil rauchen. Im Hintergrunde zur Linken steht ein Mädgen beym Camin. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 11 Vi Zoll, Breite 14 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (100 M) Käufer: L 1799/00/00 LZRCH 0041 Andre Both I Un interieur d'un maison flamande repres. 4 figures occupees ä netoyer un corps des vermines, dont il paroit souffrir. C'est un sujet risible, rendu avec autant de verite, que la touche en est fine et precieuse. I Mat.: auf Holz Maße: h. 16.1. 12. pouces Verkäufer: J F Rauch Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0164 Andreas Both I Eine Landschaft, von Andreas Both. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 8 Zoll breit 1 Schuh 2 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 326
GEMÄLDE
1800/07/09 HBPAK 0072 Andre Boths I Scene de paysans ä table pres d'une maison; une femme en jupon rouge s'avance vers Eux, une Cruche ä la main. Le Lointain presente en perspective un village. Ce Tableau est d'une belle Couleur. Sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: 12 pouces de hauteur. Sur 21 pouces de largeur Transakt.: Unbekannt
Both, Andries Dirksz. (und Both, J.) 1787/00/00 HB AN 0612 Johann Both; Die Figuren von Andreas Both I Dieses vortreffliche und schätzbare Gemähide stellet eine angenehme waldigte Landschaft vor bey Sonnen Untergang, wo man die warme Abendluft und Dämmerung zu sehen glaubt, welche die hinter Dunst und Nebel versteckte Sonne noch übrig läßt. Zur linken ein dicker Wald. Zur rechten ein kleiner Bach. In der duftenden Ferne wird man viele Berge, Thäler, Wälder und Dörfer gewahr, welche sich in einer vortrefflich angebrachten Luftperspectiv verlieren. Die schöne Staffirung des Andrea Both stellet vor, wie sich verschiedene vom Holzhauen und von der Tages=Hitze ermüdete Arbeiter im kühlen Schatten ausruhen. Ein Jäger mit seinen erlangten Wild, und seine Hunde zur Seite, sitzt zur linken im Vordergrunde auf der Erde. Vom Hintergrunde kommen einige Reisende hervor. Dieses Gemähide ist von einer ausnehmenden Schönheit. Der Abend ist unvergleichlich ausgedrückt. In dem ganzen Bilde herrscht eine angenehme Dämmerung und vergnügte Stille. Die Haltung von Licht und Schatten ist reizend. Es ist mit unter die besten zu zählen, die man von diesem Meister sehen kann. Der Baumschlag ist besonders mit einem wahren, warmen und anmuthigem Colorit, und einem feinen und freyen Pinsel ausgeführt. Die Figuren sind alle von richtiger und schöner Zeichnung, und von einer besondern Uebereinstimmung mit der Landschaft. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 48 Zoll, breit 61 Zoll Transakt.: Verkauft (190 M) Käufer: Ekhard 1787/00/00 HB AN 0627 Jann Both; Die Figuren von Andreas Both I Eine angenehme Landschaft, wo zur rechten Berge und ein kleiner Wasserfall. Zur linken eine reizende Aussicht von einer bergigten und waldigten Gegend, welche vom Untergang der Sonne auf das schönste beleuchtet wird; nebelichte Berge schließen die Ferne. Zur linken eine Landschaft, bey einer mit Bäumen bewachsenen Anhöhe vorbey; auf derselben befinden sich viele Figuren zu Pferde und zu Fuß, und auf Maulthieren. In diesem schönen Gemähide herrscht eine vortreffliche Haltung von Licht und Schatten, und eine angenehme Dämmerung, welches, wie auch das warme Colorit der untergehenden Sonne, einen süssen Anblick verschafft. Die Figuren sind von richtiger Zeichnung und edeler Wählung. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 34 Vi Zoll, breit 41 Zoll Transakt.: Verkauft (55 M) Käufer: Fesser 1796/02/17 HBPAK 0117 Jean Both; Andre Both I Zwischen Palästen, in einer der edelsten gebirgigten Landgegend, wird eine grosse Trift von Schaafen und Ziegen nebst einem Rinde, den schlangenförmigen Weg vom Berge herunter getrieben, vom tanzt ein auf der Flöte blasender Hirt vorauf. Zur Rechten trinkt einiges Rindvieh aus einem kleinen Wasser; und in der Entfernung wird man einen reitenden und einen gehenden Landmann gewahr, welche zwey bepackte Maulthiere vor sich auf gehen haben. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 14 Vi Zoll, Breite 18 % Zoll Transakt.: Verkauft (209 M) Käufer: Kreuter 1799/00/00 LZ AN 0053 Jean Both; et Andre Both, Freres I Deux Pendants. Diff6rens troupeaux de vaches et chevres auxquels d'agreables paysages servent de fonds; d'une touche brillante et d'un precieux fini. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 11 pouces, largeur 13 pouces Transakt.: Unbekannt (20 Louis Schätzung)
Both, Andries Dirksz. (und Boudewyns) 1800/00/00 FRAN1 0015 Boudewyns; And. Both I Zwei schöne Stück, italienische Gebäude vorstellend, mit unzähligen Figuren von And. Both staffirt. I Diese Nr.: Ein schönes Stück, italienische Gebäude vorstellend, mit unzähligen Figuren Mat.: auf Holz Maße: 11 Zoll hoch, 15 Zoll breit Anm.: Die Lose 15 und 16 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN1 0016 Boudewyns; And. Both I Zwei schöne Stück, italienische Gebäude vorstellend, mit unzähligen Figuren von And. Both staffirt. I Diese Nr.: Ein schönes Stück, italienische Gebäude vorstellend, mit unzähligen Figuren Mat.: auf Holz Maße: 11 Zoll hoch, 15 Zoll breit Anm.; Die Lose 15 und 16 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN1 0017 Boudewyns; And. Both I Eine prächtige Landschaft mit unzähligen Figuren, Pferde und Maulthiere staffirt von And. Both. Im ersten Plan ist ein Halt zur Rajerbaitz, im zweiten siehet man einen Fluß, auf welchem ein Schiff u. mehrere Barken sind. I Mat.: auf Kupfer Maße: 7 Zoll hoch, 9 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Both, Andries Dirksz. (Kopie nach) 1785/03/14 DRHLM 3465 Andre Both I Un jeun Villageois, d'apres Andre Both. I Anm.: Es ist unsicher, ob es sich um ein Gemälde oder um eine Zeichnung handelt. Verkäufer: Christian Gotthold Crußius Transakt.: Unbekannt (0.1 Rt) 1792/08/20 KOAN 0044 Andreas Bott I Zwey Bauren Nachtstück auf Baneel eins nach Adrian Brauer das andere nach Andreas Bott. I Diese Nr.: Ein Bauren Nachtstück; Nr. 43 Kopie nach Adrian Brauer Mat.: auf Holz Maße: 1 Schuh 6 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 1 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 43 und 4 4 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt
Both, Jan 1740/00/00 AUAN 0075 Both I 1. Niederländische Landschafft vom Both. I Maße: 3. Schuh hoch / 4. Schuh breit Transakt.: Unbekannt (50 fl) 1750/04/00 HB AN 0052 Bott I Eine grosse Landschaft mit Vielte und Figuren, von Bott. I Transakt.: Unbekannt 1759/00/00 LZEBT 0014 Joh. Both I Ein Vieh Stückgen auf Holtz. I Mat.: auf Holz Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (60 Th für die Nrn. 14 und 15, Schätzung) 1759/00/00 LZEBT 0015 Joh. Both I Ein dergleichen [Vieh Stückgen] auf Holtz. I Mat.: auf Holz Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (60 Th für die Nrn. 14 und 15, Schätzung) 1759/00/00 LZEBT 0017 Joh. Both I Eine Landschaft auf Holtz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 5 Schuh 5 Zoll, Breite 3 Schuh 3 Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (300 Th Schätzung) 1763/00/00 BLAN 0027 Johann Both I Eine Landschaft. Auf Holz gemahlt, 1 Fuß 4 Zoll hoch, und 1 Fuß 2 Zoll breit. Dieser geschickte Landschafter hat verschiedene Schönheiten in diesem Gemähide ausgedruckt. Das Colorit ist warm und angenehm. Die Staffirung ist ein Bauer, der ein Maulthier führet; und im Vordergrunde ist ein kleines Wasser, das durch einige Steine rauschend fällt. [Text hier gekürzt] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 4 Zoll hoch, und 1 Fuß 2 Zoll breit Verkäufer: Johann Gottlieb Stein Transakt.: Unbekannt 1764/00/00 BLAN 0657 Bott I 1. schöne Capital landschaft. I Maße: 2 Fuß 1 Vi Zoll hoch, 1 Fuß 9 Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (400 Rt Schätzung) Gegenw. Standort: Sankt-Peterburg, Rossiya. Ermitazh. (N 652) (?)
1764/03/12 FRKAL 0011 Jean Both I Un tres beau paisage ome de plusieurs figures & Animaux tres-bien peint. I Maße: hauteur 39 pouces, largeur 65 pouces Transakt.: Unbekannt 1764/06/06 BOAN 0629 Jean Both I Un Tableau d'un pied six pouces de largeur, d'un pied trois pouces de hauteur, representant un Pai'sage avec des ruines peintes par Jean Both. [Ein stück Vorstellend Eine Landschaft mit zerfallenen gebäuden, gemahlt Von Johan Both.] I Maße: 1 pied 6 pouces de largeur, 1 pied 3 pouces de hauteur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (24 Rt) Käufer: Hof C Rath Broggia 1764/08/25 FRAN 0290 Jan Bott I Un paisage. I Maße: haut 1 pied 5 pouces sur 1 pied 11 pouces de large Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1764/08/25 FRAN 0366 lean Bott I Des pa'fsans. I Maße: haut 1 pied 3 pouces sur 1 pied 8 pouces de large Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRRAU 0085 Jean Both I Eine Landschaft, wie man solche in des Meisters besten Gusto nur sehen kan, seine schmeltzende Colorit ergötzet das Aug, und der Niedergang der Sonne ist wohl ausgeführt; von Stavage hat es wenig, was aber da ist, das hat er wohl angebracht. Auf Tuch gemahlt. Un pai'sage du meilleur goüt, qu'on puisse voir de ce Maitre, son coloris coulant fait plaisir ä l'oeil, & le coucher du soleil est bien acheve; il n'a pas beaucoup d'etalage; mais ce qu'il en a, est bien aplique. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 1 Schuh 2 Zoll, breit 1 Schuh 7 Zoll Transakt.: Unbekannt 1765/03/27 FRKAL 0022 J. Both I Un joli petit paisage avec quelques animaux bien acheve. I Maße: hauteur 6 pouces, largeur 7 pouces Transakt.: Verkauft (4.30 fl) Käufer: Kaller 1766/07/28 KOSTE [A]0001 Joan Both I Zwey kleine Landschaften dunckel gemacht von Joan Both. I Diese Nr.: Eine kleine Landschaft Anm.: Die Lose [A] 1 und [A]2 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (16.3 Rt für die Nrn. [A]l und [A]2) Käufer: Schmitz 1766/07/28 KOSTE [AJ0002 Joan Both I Zwey kleine Landschaften dunckel gemacht von Joan Both. I Diese Nr.: Eine kleine Landschaft Anm.: Die Lose [A]l und [A]2 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (16.3 Rt für die Nrn. [A]l und [A]2) Käufer: Schmitz 1768/08/16 KOAN 0047 Jan Bott I Eine Landschaft von Jan Bott. I Maße: Höhe 1 Fuß 8 Zoll, Breite 2 Fuß 5 Zoll Verkäufer: Freyherr von Kaas Transakt.: Unbekannt 1776/00/00 WZTRU 0242 Johann Booth I Ein Stück 1 Schuhe, 6 Vi Zoll hoch, 2 Schuhe, 8 Zoll breit, von Johann Booth, stellet vor eine felsigte Landschaft, wovon einem Berge ein Wasserabfall mit vielen wohlausgeführten Figuren sich Zeigen, eine gute Verständniß von Schatten und Licht, eine schöne Manier im Baumschlage, eine glühende und angenehme Colorit machen dieses Stücke sonderbar reizend. I Pendant zu Nr. 243 von S. Rosa Maße: 1 Schuhe 6 Vi Zoll hoch, 2 Schuhe 8 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (16 fl Schätzung) 1776/04/15 HBBMN 0001 Bott I Zwo extra schöne Landschaften mit Figuren, Pferde und Vieh, das erste von Bott, das andere von Verschürig. I Diese Nr.: Eine extra schöne Landschaft mit Figuren, Pferde und Vieh Maße: Höhe 2 Fuß, Breite 1 Fuß 9 Zoll Anm.: Die Lose 1 und 2 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (128 M) Käufer: Berckm 1776/06/28 HBBMN 0062 J. Both I Eine Arcadische Landschaft, eine Abend=Röthe vorstellend, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 7 Vi Zoll, Breite 2 Fuß 1 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0088 J. Both I Auf einem Wege, neben einem leimichten, mit Gesträuch bewachsenen Berge, ziehen zween GEMÄLDE
327
Reisende mit ihrem Maulthiere. In der bergichten Feme bekränzen etliche Bäume das Ufer eines stillen Wassers. Auf Holz. [Sur un chemin ä cöte d'une montagne argilleuse & couverte d'arbustes, on voit passer deux voyageurs avec leurs mulets. Quelques arbres entourent une eau tranquille dans un lointain montueux. Sur bois.] I Mat.: auf Holz Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0101 J. Both I Durch hohle Felsenwege ziehen Reisende mit ihren Maulthieren von der Linken bey einem Hölzchen vorbey, über einen Bach zur Rechten, nach der gebirgichten Ferne. [Des voyageurs, venant de la gauche, avancent ä droite avec leurs mulets sur des chemins pratiques dans des rochers caverneux, cötoyent un petit bois & passent un ruisseau ä droite pour arriver ä un lointain montagneux.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 4 Zoll hoch, 2 Fuß 11 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0102 J. Both I Von einer steilen und feisichten Anhöhe, die mit schlanken Bäumen bewachsen ist, kommen drey Reisende mit zwey bepackten Pferden herab. Unten zur Linken an dem jenseitigen Ufer eines spiegelhellen Wassers wollen etliche beladene Maulthiere den Durst löschen, um den durch Berge sich schlangelnden Weg weiter zu verfolgen. [Trois voyageurs descendent d'une hauteur escarpee, couverte de roches & d'arbrisseaux, & conduisent deux chevaux charges. Plus bas, vers la gauche de la rive opposee, quelques mulets veulent etancher leur soif dans le courant d'une eau claire, pour continuer leur chemin entre des rochers.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 4 Zoll hoch, 2 Fuß 11 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0281 J. Both I In einer gebirgichten Gegend zieht ein Reisender an einem Felsen durchs Thal mit seinem Maulthiere. Vor ihm sieht man einen Reiter auf dem Wege. Einige schlanke Bäume nebst lockerm Gesträuche machen den Vorgrund aus. [Paysage montagneux. Un voyageur avec son mulet traverse un vallon le long d'un rocher. Devant lui on voit un cavalier sur le chemin. Quelques arbres & des broussailles 6parses forment le premier plan.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 2 Zoll hoch, 3 Fuß 1 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0294 J. Both I Aus Felsenwegen im waldichten Gebirge, worin Ruinen von Raubschlössern stehen, ziehen einige Reisende zum Vorgrunde. Zur Linken windet sich in die dämmernde Ferne ein Fluß, an dessen Ufern sich durchs Gehölze einige Dörfer zeigen. [Sur le devant quelques voyageurs sortent par des chemins pratiques dans des rochers & des montagnes revetues de bois, & couvertes des vestiges de quelques chateaux de brigands. A gauche, serpente une riviere dans le lointain vaporeux. Sur ses bords on remarque entre les bois quelques villages.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 3 Fuß 3 Zoll hoch, 3 Fuß 6 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/09/27 FRNGL 0336 Both I Ein Niederländisches Winter= Stück mit schönen Bauemfiguren, welche sich mit Schweinschlachten beschäftigen. [Une piece Flamande representante la saison d'hyver avec de belles figures de paysans, qui s'occupent ä tuer des cochons], I Maße: 10 Zoll hoch, 1 Schuh 1 Zoll breit Transakt.: Verkauft (5.45 fl) Käufer: Stoeber Wien 1781/00/00 WZAN 0242 Johann Booth I Ein Stück 1 Schuhe, 6 Vi Zoll hoch, 2 Schuhe, 8 Zoll breit, von Johann Booth, stellet eine felsigte Landschaft vor, wo sich von einem Berge ein Wasserabfall mit vielen wohl ausgeführten Figuren zeiget. Eine gute Verständniß von Schatten und Licht, eine schöne Manier im Baumschlage, eine glühende und angenehme Kolorit machen dieses Stücke sonderbar reizend. I Pendant zu Nr. 243 von S. Rosa Maße: 1 Schuhe 6 Vi Zoll hoch, 2 Schuhe 8 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/09/10 BNAN 0131 /. Boot I Am schilfreichen Ufer eines Teiches, der mit schwer belaubten Eichen umgeben, stehet mit hohen Federn geschmückt, im weiten weißen Gewände, Pharaos Tochter, in schlanker edler Gestalt; ihre gelbliche Schleppe wird von ei328
GEMÄLDE
nem Neger getragen; und ein Egypter, in Orientalischer Kleidung, hält ihr den Schirm; zur linken Seite sitzt eine vom Gefolge, mit zugewandtem Rücken; zur Rechten am Teiche zween andere auf den Knien, wovon die vordere im rothen Kleide, neben der im violetten, den kleinen Moses aus dem Korbe gehoben; entfernter beim Dickigt ein Wagen mit zwey Pferden; die Landschaft von I. Boot, die Figuren wie von Rembrand. g.L. [im schwarzen Rahm mit verguldeten Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: 21 Zoll hoch, 36 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1785/03/14 DRHLM 3464 Jean Both I Tres beau Paysage de Jean Both. I Anm.: Es ist unsicher, ob es sich um ein Gemälde oder um eine Zeichnung handelt. Verkäufer: Christian Gotthold Crußius Transakt.: Unbekannt (0.3 Rt) 1787/04/03 HBHEG O l l i J. Both I Eine warme gebürgigte Landschaft. I Transakt.: Verkauft (2.14 M) Käufer: Hofr Ehrenreich 1787/10/06 HBTEX 0020 Bott I Eine Flandrische Gegend, von Bott, mit vergoldeten Rahm. I Transakt.: Unbekannt 1787/10/06 HBTEX 0033 M. Bout I Zwey Niederländische Land= und Wasser=Prospecte, mit vielen Figuren. I Diese Nr.: Ein Niederländischer Land= und Wasser=Prospect Anm.: Die Lose 33 und 34 wurden zusammen katalogisiert. Der Name des Künstlers ist angegeben als "M. Bout", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt 1787/10/06 HBTEX 0034 M. Bout I Zwey Niederländische Land= und Wasser=Prospecte, mit vielen Figuren. I Diese Nr.: Ein Niederländischer Land= und Wasser=Prospect Anm.: Die Lose 33 und 34 wurden zusammen katalogisiert. Der Name des Künstlers ist angegeben als "M. Bout", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt 1788/01/31 LZRST [0005] Both I 1. Detto [Landschaft] in die Höhe mit einem Falconier von Both, auf Tuch. I Mat.: auf Leinwand Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummem hinzugefügt. Transakt.: Unbekannt 1788/10/01 FRAN 0031 Johann Both I Eine bergichte Landschaft von groser Composition, warm und von guter Würkung. I Maße: 15 Zoll hoch, 22 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (15.30 fl) Käufer: Brönner 1790/01/07 MUAN 0357 Both Joh. I Eine Landschaft mit Figuren, auf Leinwat. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 5 Zoll, Breite 1 Schuh 8 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1791/09/21 FRAN 0077 Both I Eine prächtige bergigte Landschaft, wo man vorne bey einem Morast einen Schäfer mit einem Schaafsfell bedeckt sieht, weiter ist ein Mann zu Pferde und eine Frau an seiner Seite im Wasser, eine Kuh und Schaafe; dieses angenehme Stück verdient die Aufmerksamkeit der Kenner. I Transakt.: Verkauft (162 fl) Käufer: De Neufville 1792/07/05 LBKIP 0117 Joh. Both I Eine Landschaft mit Figuren von Joh. Both. I Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 HBMFD 0066 Both I Gebürge mit vieler Waldung, durchfliessenden Gewässer und einige Rudera von alten Schlössern &c. Jäger zu Pferde und zu Fuss mit ihren Hunden, auf den Landstrassen. I Pendant zu Nr. 67 Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuss 6 Zoll hoch, 2 Fuss 11 Zoll breit Verkäufer: Pierre Laporterie Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 HBMFD 0067 Both I Das Gegenstück von gleicher Vorstellung. Diese beyden Bilder sind ausnehmend frey behandelt. Von schöner und frischer Färbung und Meisterhaft ausgeführt. I Pendant zu Nr. 66 Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuss 6 Zoll hoch, 2 Fuss 11 Zoll breit Verkäufer: Pierre Laporterie Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 HB AN 0044 Joh. Both I In einer bergigten, warmkolorirten Landschaft stürzt ein Giessbach, in mehreren Wasserfäl-
len, über Felsen; ein Steg, auf dem ein Wanderer mit seinem Hunde geht, führt jenseits. I Maße: Höhe 15 Zoll, Breite 17 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt
1799/08/09 HBPAK 0086 J. Bott I Eine Landschaft mit Figuren. Kräftig und gut gemahlt. Auf Leinw., schw. Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 60 Zoll, breit 54 Zoll Transakt.: Unbekannt
1795/11/14 HBPAK 0058 J. Boht I Ein Marien=Bild. Stark und kräftig gemahlt; und wegen seines Alterthums und Seltenheit vorzüglich schätzbar. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 1 Fuß, breit 9 % Zoll Transakt.: Unbekannt
1799/08/09 HBPAK 0128 J. Bott I Eine Landschaft, wo ein Hirte mit einem Bauernmädchen Ochsen, Pferde und Schaafe nach der Weide treiben. Auf Holz, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 17 Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Unbekannt
1795/11/17 HBPAK 0011 Both I Eine bergigte Landschaft; in deren Mittelgründe=ein ein auf einem Esel reitender Bauer=Knabe und zwey an einem Hügel liegende Bettler ansichtig wird. Schw. Rahm mit gold. Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 35 Zoll, breit 31 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/00/00 Β SAN 0015 Jean Both, D'Italie I Pay sage Italien, du plus beau fini. Sur le devant, des arbres, un voyageur assis, une femme sur un mulet, et un paysan ä pied, qui viennent d'un chateau gothique. Sur le derriere, une portion de lac; un rivage irregulier oü l'on voit une Chapelle. Dans le fond, des montagnes. Beau couchant, malgri quelques nuages. C'est une piece capitale. I Mat.: auf Leinwand Maße: Haut de 3 pieds; large de 3 pieds 7 pouces Verkäufer: Merian l'aine Transakt.: Unbekannt (125) 1796/08/00 HBPAK 0002 Jan Both I Eine Gegend in Rom, auf dem Campo Vaccino, worauf der Triumphbogen des Titus und das Amphitheater des Vespasianus zu sehen ist. Im Vordergrunde viele Personen bey einer schenke. Ein unvergleichliches Gemähide, welches eines der edelsten von diesem großen Meister ist. Auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 29 Zoll, Breite 36 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/08/00 HBPAK 0068 Jan Both I In einer bergigten, mit Ruinen angefüllten Gegend, ziehen im Vordergrunde ein Hirt und Hirtin mit ihrer Heerde, von einigen Stieren und Schaafen, durch ein kleines Wasser. Ein kostbares Gemähide. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 45 Zoll, Breite 39 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0055 Johann Both I Eine bergigte Landschaft, wo sich zwey Berge beynahe zusammen schliessen, so daß sie ein angenehmes Perspective ausmachen, in deren Mitte ein Wasserfall: zur Linken am Berge verschiedene Figuren. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 46 Zoll, breit 38 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0227 J. Boht I Eine bergigte Gegend mit einem Wasserfall, vermuthlich, nach der Natur, eine Gegend vom Rhein. Auf Holz, mit goldnen Rahm. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0228 Both I Eine bergigte Landschaft, oben auf dem Berge ein Haus, neben dem einige Ruinen, unten am Fusse des Berges ein Schäfer mit seiner Heerde. Auf Holz, gold. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 11 Vi Zoll, breit 8 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/12/08 HBPAK 0159 Von dem italiänischen Both I Eine Landschaft; im Hintergrunde ein hoher Berg, an dem Berge ein Kirchdorf mit einem verfallenen Schloß; im Vordergrunde siehet man viele Reisende; zur Linken an einem kleinen Bache tränken Bauern ihr Vieh. Auf Holz, im goldnen Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 21 Zoll, Breite 27 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/11/14 HBPAK 0156 Von dem italiänischen Both I Eine vortrefliche Landschaft. Im Hintergründe ein hoher Berg, und an dem Berge ein Kirchdorf mit einem verfallenen Schlosse. Im reichen goldnen Rahm. I Maße: Hoch 29 Zoll, breit 36 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/12/10 WNAN 0020 Both I Eine Landschaft auf Holz von Both, vorzüglich gutes Stück. I Mat.: auf Holz Verkäufer: Prof Adam Transakt.: Unbekannt
1799/08/09 HBPAK 0129 J. Bott I Eine Landschaft, wo Hirten eine Heerde Schaafe nach einem Walde treiben. Ganz auf das natürlichste vorgestellt und gemahlt. Auf Leinwand, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 24 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/10/18 LZAN 0069 Komposition von Both I Im innem einer Stube, sitzen 4 Flamänder in einer artigen Beschäftigung. Sehr keck und fett gemahlt; hoch 14 Zoll, br. 11 Zoll. Auf Holz, in einem neuen reich verzierten Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 14 Zoll, br. 11 Zoll Verkäufer: Rauch Transakt.: Verkauft (12 Th) Käufer: Schwarz 1799/12/23 WNAN akt.: Unbekannt
0050
Boot d'Italie I Un payssage. I Trans-
1800/00/00 FRAN1 0018 Both I Eine Bauerngesellschaft mit vielen Kindern; im zweiten Plan sind Gebäude. I Mat.: auf Holz Maße: 9 Zoll hoch, 12 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1800/07/09 HBPAK 0011 Both I Paysage sur la liziere [sie] d'une foret, avec du Betail. Ce tableau est peint d'une maniere large et hardie. Sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: 14 pouces de hauteur. Sur 18 pouces de largeur Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0025 J. Both I In einer bergigten Landschaft weiden Hirten ihre Schaafe am Berge, andere treiben ihre Heerde am Fusse desselben. Auf Holz, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 33 Zoll, breit 26 Zoll Transakt.: Unbekannt
Both, Jan (und Both, Α.) 1787/00/00 HB AN 0612 Johann Both; Die Figuren von Andreas Both I Dieses vortreffliche und schätzbare Gemähide stellet eine angenehme waldigte Landschaft vor bey Sonnen Untergang, wo man die warme Abendluft und Dämmerung zu sehen glaubt, welche die hinter Dunst und Nebel versteckte Sonne noch übrig läßt. Zur linken ein dicker Wald. Zur rechten ein kleiner Bach. In der duftenden Ferne wird man viele Berge, Thäler, Wälder und Dörfer gewahr, welche sich in einer vortrefflich angebrachten Luftperspectiv verlieren. Die schöne Staffirung des Andrea Both stellet vor, wie sich verschiedene vom Holzhauen und von der Tages=Hitze ermüdete Arbeiter im kühlen Schatten ausruhen. Ein Jäger mit seinen erlangten Wild, und seine Hunde zur Seite, sitzt zur linken im Vordergrunde auf der Erde. Vom Hintergrunde kommen einige Reisende hervor. Dieses Gemähide ist von einer ausnehmenden Schönheit. Der Abend ist unvergleichlich ausgedrückt. In dem ganzen Bilde herrscht eine angenehme Dämmerung und vergnügte Stille. Die Haltung von Licht und Schatten ist reizend. Es ist mit unter die besten zu zählen, die man von diesem Meister sehen kann. Der Baumschlag ist besonders mit einem wahren, warmen und anmuthigem Colorit, und einem feinen und freyen Pinsel ausgeführt. Die Figuren sind alle von richtiger und schöner Zeichnung, und von einer besondern Uebereinstimmung mit der Landschaft. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 48 Zoll, breit 61 Zoll Transakt.: Verkauft (190 M) Käufer: Ekhard 1787/00/00 HB AN 0627 Jann Both; Die Figuren von Andreas Both I Eine angenehme Landschaft, wo zur rechten Berge und ein kleiner Wasserfall. Zur linken eine reizende Aussicht von einer berGEMÄLDE
329
gigten und waldigten Gegend, welche vom Untergang der Sonne auf das schönste beleuchtet wird; nebelichte Berge schließen die Ferne. Zur linken eine Landschaft, bey einer mit Bäumen bewachsenen Anhöhe vorbey; auf derselben befinden sich viele Figuren zu Pferde und zu Fuß, und auf Maulthieren. In diesem schönen Gemähide herrscht eine vortreffliche Haltung von Licht und Schatten, und eine angenehme Dämmerung, welches, wie auch das warme Colorit der untergehenden Sonne, einen süssen Anblick verschafft. Die Figuren sind von richtiger Zeichnung und edeler Wählung. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 34 Vi Zoll, breit 41 Zoll Transakt. : Verkauft (55 M) Käufer: Fesser 1796/02/17 HBPAK 0117 Jean Both; Andre Both I Zwischen Palästen, in einer der edelsten gebirgigten Landgegend, wird eine grosse Trift von Schaafen und Ziegen nebst einem Rinde, den schlangenförmigen Weg vom Berge herunter getrieben, vorn tanzt ein auf der Flöte blasender Hirt vorauf. Zur Rechten trinkt einiges Rindvieh aus einem kleinen Wasser; und in der Entfernung wird man einen reitenden und einen gehenden Landmann gewahr, welche zwey bepackte Maulthiere vor sich auf gehen haben. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 14 Vi Zoll, Breite 18 % Zoll Transakt.: Verkauft (209 M) Käufer: Kreuter 1799/00/00 LZAN 0053 Jean Both; et Andre Both, Freres I Deux Pendants. Differens troupeaux de vaches et chevres auxquels d'agreables paysages servent de fonds; d'une touche brillante et d'un precieux fini. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 11 pouces, largeur 13 pouces Transakt.: Unbekannt (20 Louis Schätzung)
Both, Jan (und Hackaert, J.) 1779/09/27 FRNGL 0124 Hackaert; Both I Eine sehr gute Landschaft vom holländ. Hackaert, worinnen die Figuren und Vieh von Both staffirt sind. [Un tres beau paysage par Hackaert le Hollandais, les figures & le betail par Both.] I Maße: 2 Schuh 7 Zoll hoch, 1 Schuh 6 Zoll breit Transakt.: Verkauft (16.30 fl) Käufer: Denhard Post
ken sind Ruinen, der Grund bietet Gebirge dar; diese Landschaft ist mit vielem Ausdrucke und Wahrheit gemalt. I Transakt.: Verkauft (5 fl) 1792/07/05 LBKIP 0096 Bott I Spielende Bauern in der Manier von Bott. I Transakt.: Unbekannt
Botten [Nicht identifiziert] 1752/05/08 LZAN 0212 Botten I Maria Magdalena mit einem Todten=Kopfe, von Botten, im Holl. Rahmen. I Maße: 2 Ellen hoch, 1 Vi Elle breit Transakt.: Verkauft (15 Gr) Käufer: Loon
Bottschild, Samuel 1752/05/08 LZAN 0061 Bodtschild I Die schlafende Venus von Bodtschild, 2 Ά Elle hoch 3 Ellen breit im vergoldeten Rahmen. I Maße: 2 lA Elle hoch, 3 Ellen breit Transakt.: Verkauft (5.16 Th) Käufer: Haussender [?] 1783/08/01 LZRST 0066 Bothschildts I Eine weibliche Halbfigur, Lebensgrösse, welche dem bey sich habenden Amor seinen Pfeil schleift, von Bothschildts, sehr gut erhalten, 1 Elle 15 Zoll hoch und 1 Elle 10 Zoll breit, ohne Rahm. I Pendant zu Nr. 67 Maße: 1 Elle 15 Zoll hoch, 1 Elle 10 Zoll breit Transakt.: Verkauft (8 Gr) Käufer: Buchs 1783/08/01 LZRST 0067 Bothschildts I Eine andere weibliche Figur, ganz das Gegenbild von voriger, von eben diesen Meister [Bothschildts], in ihrer rechten Hand hält sie eine Handtrommel, und ihr Kopf ist mit Lorbeer geziert, sie hat gleiches Maass, beide Figuren sind halb bekleidet. I Pendant zu Nr. 66 Maße: 1 Elle 15 Zoll hoch, 1 Elle 10 Zoll breit Transakt.: Verkauft (4 Gr) Käufer: Buchs 1785/03/14 DRHLM 3664 Bottschild I Eine Vorstellung des Aeneas und Anchises, auf Leinwand mit Oelfarben gemahlt von Bottschild, in schwarzgoldnen Rahm, eine Esquisse. I Mat.: Öl auf Leinwand Anm.: Es ist unsicher, ob es sich um ein Gemälde oder um eine Zeichnung handelt. Verkäufer: Christian Gotthold Crußius Transakt. : Unbekannt (0.3 Rt)
Both, Jan (und Wouwerman) 1796/12/07 HBPAK 0037 Jan Both; Wouwermann I Staffage Wouwermann, eine vorzüglich schöne Landschaft. I Transakt.: Unbekannt
Both, Jan (Kopie nach)
Boucher, Francois 1781/00/00 WRAN 0184 Bouche I Venus donnant une couronne de fleurs ä l'Amour. Esquisse peinte sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: haut 15 pouces 2 lignes, large 12 pouces Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt
1800/07/09 HBPAK 0028 D'apres Both I L'Interieur d'une füret, un grand arbre sur le devant, le soleil eclaire un chemin au bord du quel plusieurs personnes assises. Des Trouppeaux dans le lointain. Ce tableau est harmonieux. I Maße: 22 pouces de hauteur. Sur 17 pouces de largeur Transakt.: Unbekannt
1781/00/00 WRAN 0186 Bouche I La toilette de Venus, l'Amour devant eile tenant un ruban bleu, au bout deux Colombes sont attachees. Esquisse peinte sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: haut 15 pouces, large 12 pouces Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt
1800/07/09 HBPAK 0031 D 'apres Both, i Italie I Marine; sur le devant des fabriques ruinees, au pied des quelles des matelots jouent aux cartes; sur une grande houte est un paysan a Cheval, le ton de ce Tableau rend la Chaleur des Soleils couchant d'Italie. I Maße: 23 pouces de hauteur. Sur 19 pouces de largeur Transakt.: Unbekannt
1781/00/00 WRAN 0187 Bouche I Angelique & son Amant, devant eux deux Brebis & un Bouc, l'homme ecrivant, sur un le pied d'un arbre Angelique. Esquisse peinte sur toile, meme grandeur. I Mat.: auf Leinwand Maße: haut 15 pouces, large 12 pouces. Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt
1800/11/12 HBPAK 0468 Bott I Zwey Landschaften mit Figuren. nach Bott. I Transakt.: Unbekannt
1781/00/00 WRAN 0188 Bouche I Le trait dangereux. Venus tenant de la main droite une fleche, & de la gauche un carquois rempli de fleches, l'Amour appuye contre sa mere, la prie instament les mains jointes de lui rendre ces armes. Esquisse peinte sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: haut 14 pouces, large 11 pouces 8 lignes Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt
Both, Jan (Manier) 1772/09/15 BNSCT 0102 Boht I Ein Baurenstück in der Manier von Boht, 11 z. h. 9 z. br. auf Holz, schw. R[ahm]. I Mat.: auf Holz Maße: 11 Zoll hoch, 9 Zoll breit Transakt.: Unbekannt (4 fl) 1791/09/21 FRAN 0136 Nach Booths Art I Eine Landschaft von Italien, wo vorne eine Flucht nach Egypten ist, zur Rechten und Lin330
GEMÄLDE
1781/00/00 WRAN 0197 Bouche I Un Enfant jouant du haubois [sie], plusieurs livres et instrumens de Musique se voyent devant lui. Esquisse sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: haut 24 pouces large 26 pouces Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt
1784/05/11 HBKOS 0009 Baucher I Tete de Femrae, par Baucher, en profil, voller Geist und mit freyem Pinsel gemahlt, auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 18 Zoll 6 1., breit 14 Zoll 3 1. Transakt.: Unbekannt 1784/08/02 FRNGL 0614 Franz Boucher I Zwey Masqueradenstücke v. Franz Boucher. I Maße: 13 Zoll breit, 17 Zoll hoch Transakt.: Verkauft (6.15 fl) Käufer: Berger 1788/06/12 HBRMS 0069 Boucher I Zwey Garten=Prospecte. Auf den einem, der mit einer Fontaine geziert ist, schleicht ein Schäfer gebückt herbey, um einige scherzende Schäferinnen zu belauschen; auf dem andern übergiebt eine Mutter ihr Kind einer Amme auf dem Lande vor einer Ländlichen Wohnung, und der Vater zahlt dem Manne Geld dafür. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Garten=Prospect. Auf dem einem, der mit einer Fontaine geziert ist, schleicht ein Schäfer gebückt herbey, um einige scherzende Schäferinnen zu belauschen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 22 Zoll, breit 26 Zoll Anm.: Die Lose 69 und 70 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1788/06/12 HBRMS 0070 Boucher I Zwey Garten=Prospecte. Auf den einem, der mit einer Fontaine geziert ist, schleicht ein Schäfer gebückt herbey, um einige scherzende Schäferinnen zu belauschen; auf dem andern übergiebt eine Mutter ihr Kind einer Amme auf dem Lande vor einer Ländlichen Wohnung, und der Vater zahlt dem Manne Geld dafür. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Garten=Prospect. Auf dem andern übergiebt eine Mutter ihr Kind einer Amme auf dem Lande vor einer Ländlichen Wohnung, und der Vater zahlt dem Manne Geld dafür Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 22 Zoll, breit 26 Zoll Anm.: Die Lose 69 und 70 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1789/04/16 HBTEX 0009 Boucher I Bachus, Venus und Amor, belustigen sich mit Weintraubenessen, in einer angenehmen bergigten Gegend; lebhaft von diesem großen Künstler gemahlt, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 16 Zoll, breit 12 Zoll Transakt.: Verkauft (1.08 M) Käufer: Ego 1789/06/06 HBPAK 0021 Boucher I Eine dichtende Schöne schreibet in ihr Buch, sehr plaisant gemahlt, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 9 Zoll, breit 7 Zoll Transakt.: Verkauft (6.12 M) Käufer: Schmeichel 1790/02/04 HBDKR 0009 Boucher I Eine im Profil abgebildete Schöne mit einen Schleier über dem Kopfe, welcher unter dem Kinn zusammen gebunden ist. Der Künstler ahmte besonders die lebhafte Natur vorzustellen, nach, welche ihn beliebt gemacht. Auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 V* Zoll, breit 14 Ά Zoll Transakt.: Verkauft (4 M) Käufer: Ego 1793/09/18 HBSCN 0069 Boucher. 1722 I Zwölf nackte tanzende Kinder, in abwechselnder Stellung, lassen sich von noch zwey dergleichen zum Tanz aufspielen in einen dunklen Hayn, über ihnen hänget ein Kranz von rothe Beeren, welcher mit Seilen an zwey von einander stehende Bäume befestiget ist. In richtiger Zeichnung und colorit. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 18 Zoll, breit 24 Zoll Inschr.: 1722 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 FGAN [B]0226 Bouche I Die Mutter mit drey Kindern, auf Holz gemalt. I Mat.: auf Holz Maße: 6 Zoll hoch, 7 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt (5.30 fl) 1795/11/17 HBPAK 0058 Bouchi I Zwey Landschaften, mit spielende Kinder. Schw. Rahm mit gold. Leisten. I Diese Nr.: Eine Landschaft, mit spielende Kinder Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 22 Zoll Anm.: Die Lose 58 und 59 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1795/11/17 HBPAK 0059 Bouchi I Zwey Landschaften, mit spielende Kinder. Schw. Rahm mit gold. Leisten. I Diese Nr.: Eine Landschaft, mit spielende Kinder Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch
18 Zoll, breit 22 Zoll Anm.: Die Lose 58 und 59 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/00/00 BSAN 0053 Frangois Boucher I L'amour et Psyche. Celle-ci, un poignard d'une main, une lampe de l'autre, est ä genoux devant le lit oü repose l'Amour, dans un sommeil tres gracieux. L'expression du visage de Psyche rend vivement la passion qui l'anime; et son buste decouvert est d'une carnation fraiche et delicate. F. Boucher 1714. I Mat.: auf Leinwand Maße: Haut de 1 pied 6 pouces; large de 2 pieds. Inschr.: F. Boucher 1714 (bezeichnet und datiert) Verkäufer: Merian l'aine Transakt.: Unbekannt (4) 1797/02/27 HBPAK 0079 Bochee I Eine Ovidische Geschichte, mit vielen Figuren. Gut gemahlt. Auf Leinwand, im goldnen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 28 Zoll, breit 34 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0266 F. Boucher I Eine schlafende Venus von Liebesgöttern umgeben. Das Gegenstück stellt ein Frauenzimmer, auf der Flöte spielend, vor, wozu Liebesgötter tanzen. Boucher hat durch seine Vollkommenheit in Vorstellungen dieser Art, den Beynamen eines Mahlers der Wollust und der Grazien, mit Recht erhalten, wovon obige Stücke zeugen; denn die Zeichnung ist darin mit der Zusammensetzung aufs richtigste und angenehmste beobachtet, und mit einem reizenden Colorit verbunden. Oval. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine schlafende Venus von Liebesgöttern; Pendant zu Nr. 267 Mat.: auf Leinwand Format: oval Maße: Hoch 22 Zoll, breit 26 Zoll Anm.: Die Lose 266 und 267 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0267 F. Boucher I Eine schlafende Venus von Liebesgöttern umgeben. Das Gegenstück stellt ein Frauenzimmer, auf der Flöte spielend, vor, wozu Liebesgötter tanzen. Boucher hat durch seine Vollkommenheit in Vorstellungen dieser Art, den Beynamen eines Mahlers der Wollust und der Grazien, mit Recht erhalten, wovon obige Stücke zeugen; denn die Zeichnung ist darin mit der Zusammensetzung aufs richtigste und angenehmste beobachtet, und mit einem reizenden Colorit verbunden. Oval. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Das Gegenstück stellt ein Frauenzimmer, auf der Flöte spielend, vor, wozu Liebesgötter tanzen; Pendant zu Nr. 266 Mat.: auf Leinwand Format: oval Maße: Hoch 22 Zoll, breit 26 Zoll Anm.: Die Lose 266 und 267 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 LZAN 0081 Le Boucher I Un Tableau. Mercure ä demi couche enseignant la Geographie ä l'Amour appuye sur ses genoux. Tableau ingenieux et piquant, d'un dessein correct et d'un brillant coloris. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hauteur 17 pouces, largeur 24 pouces Transakt.: Unbekannt (18 Louis Schätzung) 1800/00/00 FRAN1 0019 Bouche I Zwei Verliebte I Mat.: auf Leinwand Maße: 18 Zoll hoch, 22 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1800/00/00+ LZRST [0010] Frangois Boucher I Ariadne in den Armen des Bacchus. I Mat.: auf Leinwand Maße: 31 Zoll breit 23 Zoll hoch Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Rost Transakt.: Unbekannt
Boucher, Fran(ois (und Crepin, L.P.) 1798/06/04 HBPAK 0317 Crepin: die Figuren von Boucher I Ein sehr schätzbares Stück. Von hohen Felsen stürzen Wasserfalle herab, und am Fusse derselben befinden sich Personen. In diesem Stücke ist der meisterhafteste Ausdruck. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 20 Zoll, breit 25 Zoll Transakt.: Unbekannt
Boucher, Francois (oder Coypel, Ant.) 1781/00/00 WRAN 0198 Bouche; A. Coypel I Diane et Endimion, ä droite se voit la Lüne sur un nuage, ses deux mains allongeGEMÄLDE
331
es sous la tete d'Endimion dormant, sur les genoux d'un Vieillard qui est le Symbole du tems. Belle esquisse bien terminee, peint sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: haut 11 pouces 3 lignes, large 8 pouces 10 lignes Anm.: Der Name des Künstlers "A. Coypel" wurde wahrscheinlich bei den Losen 198 bis 200 weggelassen und im Exemplar RKDH handschriftlich ergänzt. Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0199 Bouche; A. Coypel I Les Nymphes de Psyche volent les fleches & les carquois de Cupidon endormi. I Pendant zu Nr. 200 Mat.: auf Leinwand Maße: 24 pouces de haut, sur 30 pouces de large Anm.: Der Name des Künstlers "A. Coypel" wurde wahrscheinlich bei den Losen 198 bis 200 weggelassen und im Exemplar RKDH handschriftlich ergänzt. Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0200 Bouche; A. Coypel \ Pendant du precedent, oü se voit Venus ä sa toilette, faite par les trois Graces & servie par une quantite de Cupidons. Ce Tableau & le precedent sont peints sur toile. I Pendant zu Nr. 199 Mat.: auf Leinwand Maße: 24 pouces de haut, sur 30 pouces de large Anm..: Der Name des Künstlers "A. Coypel" wurde wahrscheinlich bei den Losen 198 bis 200 weggelassen und im Exemplar RKDH handschriftlich ergänzt. Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt
Boucher, Frangois (Geschmack von) 1774/08/13 HBBMN 0112 Boucher I Spielende Kinder, in dem Gusto von Boucher. I Transakt.: Unbekannt
Boucher, Fran£ois (Kopie nach) 1775/00/00 BLAN 0011 Boucher I Eine Landschaft in gld. Rahm nach Boucher. I Verkäufer: George Friedrich Schmidt Transakt.: Unbekannt 1775/05/08 HBPLK 0022 N.W.; Boucher I Zwo plaisante Landschaften mit Schäfer=Historien, meisterhaft gemahlt, auf Holz, nach Boucher, von N.W. I Diese Nr.: Eine plaisante Landschaft mit Schäfer=Historien; Kopie von Monogrammist N.W. nach Boucher Mat.: auf Holz Maße: Höhe 19 Zoll 4 Linie, Breite 14 Zoll 9 Linie Anm.: Die Lose 22 und 23 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] Μ für die Nrn. 22 und 23) 1775/05/08 HBPLK 0023 N.W.; Boucher I Zwo plaisante Landschaften mit Schäfer=Historien, meisterhaft gemahlt, auf Holz, nach Boucher, von N.W. I Diese Nr.: Eine plaisante Landschaft mit Schäfer=Historien; Kopie von Monogrammist N.W. nach Boucher Mat.: auf Holz Maße: Höhe 19 Zoll 4 Linie, Breite 14 Zoll 9 Linie Anm.: Die Lose 22 und 23 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] Μ für die Nm. 22 und 23) 1776/12/21 HBBMN 0047 Boucher I Zwey französische Schäferstücke, nach Boucher. I Diese Nr.: Ein französisches Schäferstück Maße: Hoch 1 Fuß 1 Zoll, breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 47 und 48 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (20 Sch) Käufer: Hagel 1776/12/21 HBBMN 0048 Boucher I Zwey französische Schäferstücke, nach Boucher. I Diese Nr.: Ein französisches Schäferstück Maße: Hoch 1 Fuß 1 Zoll, breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 47 und 48 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (20 Sch) Käufer: Hagel 1776/12/21 HBBMN 0051 Boucher I Eine Dame, so sich im Spiegel betrachtet, nach Boucher. I Maße: Hoch 1 Fuß, breit 10 Zoll Transakt.: Verkauft (5 Sch) Käufer: Hagel 1781/00/00 WRAN 0185 Briagard; Bouche I Une Baigneuse. Esquisse terminee ceintree du haut, peint sur toile d'apres Bouche par Briagard. I Kopie von Briagard nach Boucher Mat.: auf Lein332
GEMÄLDE
wand Maße: haut 15 pouces, large 12 pouces Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0189 Bouche I Deux Paysages, sur Tun ä droite un jeune Homme assis, jouant de la Clarinette, devant lui une Femme appuyee sur son genou de la main gauche, & de la droite re^oit une corbeille de fleurs d'un autre jeune Homme qui se voit sur la gauche, sur l'autre une jeune Femme resoit une poire d'un jeune Homme assis ä son cötfi, ä gauche se voit un panier remplis de fruits &c. Tableaux peints sur toile d'apres Bouche. I Diese Nr.: Un Paysage Mat.: auf Leinwand Maße: haut 15 pouces 4 lignes, large 18 pouces 4 lignes chaque Anm.: Die Lose 189 und 190 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0190 Bouche I Deux Paysages, sur l'un ä droite un jeune Homme assis, jouant de la Clarinette, devant lui une Femme appuyee sur son genou de la main gauche, & de la droite reijoit une corbeille de fleurs d'un autre jeune Homme qui se voit sur la gauche, sur l'autre une jeune Femme resoit une poire d'un jeune Homme assis ä son cöte, ä gauche se voit un panier remplis de fruits &c. Tableaux peints sur toile d'apres Bouche. I Diese Nr.: Un Paysage Mat.: auf Leinwand Maße: haut 15 pouces 4 lignes, large 18 pouces 4 lignes chaque Anm.: Die Lose 189 und 190 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0191 Bouchel Une Venus et une L&la d'aprfes Bouche. Tableaux peints sur toile. I Diese Nr.: Venus Mat.: auf Leinwand Maße: 24 pouces de haut, sur 26 de large Anm.: Die Lose 191 und 192 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0192 Bouche I Une Venus et une Leda d'apres Bouche. Tableaux peints sur toile. I Diese Nr.: L6da Mat.: auf Leinwand Maße: 24 pouces de haut, sur 26 de large Anm. : Die Lose 191 und 192 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0193 Bouche I Un Cupidon en Γ air, tenant d'une main une fleche, & de l'autre un flambeau, au dessus de lui se voit deux Colombes. Tableau peint sur toile, d'apres Bouche. I Pendant zu Nr. 194 Mat.: auf Leinwand Maße: haut 17 pouces, large 14 pouces Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0194 Bouche I L'Amour aiguisant ces fleches pendant du precedent & meme grandeur, [d'aprfes Bouche] I Pendant zu Nr. 193 Mat.: auf Leinwand Maße: haut 17 pouces, large 14 pouces Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0195 Bouche I Venus sur les eaux. Tableau peint sur toile, d'apres Bouche. I Mat.: auf Leinwand Maße: haut 19 pouces 4 lignes, large 23 pouces 6 lignes Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0196 Bouche I Alliance de Bacchus & de l'Amour, d'apres Bouche, meme grandeur. I Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0063 Finsterwald; Bouche I Die vier Jahreszeiten, mit sehr anmuthigen Kindern in Wolken vorgestellt, reitzend kolorirt nach Bouche von Finsterwald. I Diese Nr.: Eine der vier Jahreszeiten, mit sehr anmuthigen Kindern in Wolken vorgestellt; Kopie von Finsterwald nach Boucher Maße: 1 Sch. hoch, 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 63 bis 66 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0064 Finsterwald; Bouche I Die vier Jahreszeiten, mit sehr anmuthigen Kindern in Wolken vorgestellt, reitzend kolorirt nach Bouche von Finsterwald. I Diese Nr.: Eine der vier Jahreszeiten, mit sehr anmuthigen Kindern in Wolken vorgestellt; Kopie von Finsterwald nach Boucher Maße: 1 Sch. hoch, 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 63 bis 66 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt
1791/09/26 FRAN 0065 Finsterwald; Bouche I Die vier Jahreszeiten, mit sehr anmuthigen Kindern in Wolken vorgestellt, reitzend kolorirt nach Bouch6 von Finsterwald. I Diese Nr.: Eine der vier Jahreszeiten, mit sehr anmuthigen Kindern in Wolken vorgestellt; Kopie von Finsterwald nach Boucher Maße: 1 Sch. hoch, 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 63 bis 66 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0066 Finsterwald; Bouche I Die vier Jahreszeiten, mit sehr anmuthigen Kindern in Wolken vorgestellt, reitzend kolorirt nach Bouche von Finsterwald. I Diese Nr.: Eine der vier Jahreszeiten, mit sehr anmuthigen Kindern in Wolken vorgestellt; Kopie von Finsterwald nach Boucher Maße: 1 Sch. hoch, 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 63 bis 66 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1793/01/15 LZRST 7077 Gottlob; Boucher I Bacchus und Ariadne in einer Landschaft, ein historisches Bild, nach Boucher, 32 Zoll breit, 28 Zoll hoch, nicht völlig ausgeführt. [Folgende Gemählde sind von der Hand des ohnlängst verstorbenen geschickten Malers Gottlob zu Leipzig. Sie sind grösstemtheils noch nicht völlig beendigt, und einige davon blos angelegt.] I Kopie von Ernst Gottlob nach Boucher Maße: 32 Zoll breit, 28 Zoll hoch Anm.: Die Angaben in eckigen Klammem im Bildtitel erscheinen über der Nr. 7074 und beziehen sich auf die Nrn. 7074 bis 7099. Transakt.: Verkauft (13 Gr) Käufer: Schwarz
Boucher, Francois (Manier) 1790/02/04 HBDKR O l l i Wie Boucher I Spielende Kinder im Gewölke, Grau in Grau gemahlt, auf Holz. I Diese Nr.: Spielende Kinder im Gewölke Mat.: auf Holz Maße: Hoch 17 Vi Zoll, breit 15 Zoll Anm.: Die Lose 111 und 112 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (5 Μ für die Nrn. 111 und 112) Käufer: Westphalen 1790/02/04 HBDKR 0112 Wie Boucher I Spielende Kinder im Gewölke, Grau in Grau gemahlt, auf Holz. I Diese Nr.: Spielende Kinder im Gewölke Mat.: auf Holz Maße: Hoch 17 Vi Zoll, breit 15 Zoll Anm.: Die Lose 111 und 112 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (5 Μ für die Nrn. 111 und 112) Käufer: Westphalen 1798/11/14 HBPAK 0130 In Bouche's Manier I Zwey Darstellungen aus dem Ovid; mit Figuren in Lebensgrösse. Treflich geordnet und schön gemahlt. Auf Leinw., im goldn. Rahm. I Diese Nr.: Eine Darstellung aus dem Ovid Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 46 Zoll, breit 56 Zoll Anm.: Die Lose 130 und 131 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/11/14 HBPAK 0131 In Bouche's Manier I Zwey Darstellungen aus dem Ovid; mit Figuren in Lebensgrösse. Treflich geordnet und schön gemahlt. Auf Leinw., im goldn. Rahm. I Diese Nr.: Eine Darstellung aus dem Ovid Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 46 Zoll, breit 56 Zoll Anm.: Die Lose 130 und 131 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Boudewyns, Adriaen Frans 1767/00/00 KOAN 0078 Rodewin ! Eine Landschaft auf Leinewand und kleinen Figuren durch Rodewin. I Mat.: auf Leinwand Maße: Breite 2 Fuß 1 % Zoll, Höhe 1 Fuß 9 Vi Zoll Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt 1767/00/00 KOAN 0112 Budouwin I Ein See=Haaven von Budouwin. I Maße: Breite 1 Fuß 10 Vi Zoll, Höhe 1 Fuß 5 % Zoll Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt 1772/00/00 BSFRE 0008 Boudewins I Deux jolys petits Payssages. Cadres noirs avec des Liteaux dores. I Diese Nr.: Un joly petit Payssage Mat.: auf Kupfer Maße: haut de 5, & large de 6 % pouces
Anm.: Die Lose 8 und 9 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1772/00/00 BSFRE 0009 Boudewins I Deux jolys petits Payssages. Cadres noirs avec des Liteaux dores. I Diese Nr.: Un joly petit Payssage Mat.: auf Kupfer Maße: haut de 5, & large de 6 % pouces Anm.: Die Lose 8 und 9 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1776/00/00 WZTRU 0128 Heinrich Boudewyns I Compagnion zu Nro. 127 von Heinrich Boudewyns, eine eben dergleichen holländische Gegend vorstellend, worinn alles mit wohlausgeführten Figuren belebet, und ein wohlüberlegeter Schatten und Licht hierinn observiret. I Pendant zu Nr. 127 von Jan Bunnik Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "Heinrich Boudewyns", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (22 fl Schätzung) 1778/05/23 HBKOS 0069 Bodewin I Eine sehr fleißige Landschaft, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 9 Vi Zoll, Breite 12 Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/05/30 HBKOS 0015 Bodevin I Zwey extra fleißig gemalte Arcadische Landschaften, auf Holz. [Diese Gemähide sind alle mittlere Grösse, können also an alle Plätze gebraucht werden - dieweilen keine Theilen=Stück, dabey befindlich] I Diese Nr.: Eine extra fleißig gemalte Arcadische Landschaft Mat.: auf Holz Anm.: Die Lose 15 und 16 wurden zusammen katalogisiert. Die Angaben in ekkigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 150 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 150. Verkäufer: Dr Friederici Transakt.: Verkauft (28.4 Μ für die Nm. 15 und 16) Käufer: Eckhardt 1778/05/30 HBKOS 0016 Bodevin I Zwey extra fleißig gemalte Arcadische Landschaften, auf Holz. [Diese Gemähide sind alle mittlere Grösse, können also an alle Plätze gebraucht werden - dieweilen keine Theilen=Stück, dabey befindlich] I Diese Nr.: Eine extra fleißig gemalte Arcadische Landschaft Mat.: auf Holz Anm.: Die Lose 15 und 16 wurden zusammen katalogisiert. Die Angaben in ekkigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 150 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 150. Verkäufer: Dr Friederici Transakt.: Verkauft (28.4 Μ für die Nrn. 15 und 16) Käufer: Eckhardt 1778/05/30 HBKOS 0130 Bodewin I Zwey extra fleißig gemalte Torf=Gegenden, von Bodewin, auf Holz. [Diese Gemähide sind alle mittlere Grösse, können also an alle Plätze gebraucht werden - dieweilen keine Theilen=Stück, dabey befindlich] I Diese Nr.: Eine extra fleißig gemalte Torf=Gegend Mat.: auf Holz Anm.: Die Lose 130 und 131 wurden zusammen katalogisiert. Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 150 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 150. Verkäufer: Dr Friederici Transakt.: Verkauft (13 Μ für die Nrn. 130 und 131) Käufer: Loffhagen 1778/05/30 HBKOS 0131 Bodewin I Zwey extra fleißig gemalte Torf=Gegenden, von Bodewin, auf Holz. [Diese Gemähide sind alle mittlere Grösse, können also an alle Plätze gebraucht werden - dieweilen keine Theilen=Stück, dabey befindlich] I Diese Nr.: Eine extra fleißig gemalte Torf=Gegend Mat.: auf Holz Anm.: Die Lose 130 und 131 wurden zusammen katalogisiert. Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 150 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 150. Verkäufer: Dr Friederici Transakt.: Verkauft (13 Μ für die Nrn. 130 und 131) Käufer: Loffhagen 1778/09/28 FRAN 0370 Bautewins I Eine Landschaft mit einem Jahrmarkt. [Un paysage representant une foire de village.] I Maße: 1 Schuh breit, 10 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (27.30 fl) Käufer: Jos Brentano 1779/09/27 FRNGL 0021 Baudewin I Eine wohlausgeführte Landschaft von Baudewin, mit schönem Vieh und Figuren. [Un paysage tres bien travaille par Baudewin, ome de beau betail & de belies figures.] I Pendant zu Nr. 22 Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 2 Schuh breit Transakt.: Verkauft (13 fl für die Nrn. 21 und 22) Käufer: Hüsgen GEMÄLDE
333
1779/09/27 FRNGL 0022 Baudewin I Das Gegenbild zu obigem, von nemlicher Vorstellung [eine wohlausgeführte Landschaft], Meister [Baudewin] und Maas. [Le pendant du precedant, meme objet [un paysage], par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 21 Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 2 Schuh breit Transakt.: Verkauft (13 fl für die Nm. 21 und 22) Käufer: Hüsgen 1779/09/27 FRNGL 0190 Baudewin I Eine sehr fleißig ausgeführte Landschaft, von Baudewin, mit vielen schönen Figuren. [Un paysage fini avec bien de l'exactitude avec beaucoup de belles figures.] I Maße: 1 Schuh 7 Zoll hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Transakt.: Verkauft (11 fl) Käufer: Adaria Wien 1781/00/00 WZAN 0128 Heinrich Boudewyns I Kompagnon zu Nro 127, von Heinrich Boudewyns, stellet eine eben dergleichen holländische Gegend vor, worinn alles mit wohl ausgeführten Figuren belebet, und ein beßtens überlegeter Schatten und Licht beobachtet ist. I Pendant zu Nr. 127 von Jan Bunnik Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "Heinrich Boudewyns", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt 1782/02/18 RGBZN 0043 Transakt.: Unbekannt (10 fl)
Boudewyns I Zwey Landschaften. I
1790/08/25 FRAN 0198 Bodewein I Zwey Landschaften mit vielen Figuren. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit vielen Figuren Maße: hoch 13 Zoll, breit 16 Zoll Anm.: Die Lose 198 und 199 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (5 fl für die Nrn. 198 und 199) Käufer: Kaller 1790/08/25 FRAN 0199 Bodewein I Zwey Landschaften mit vielen Figuren. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit vielen Figuren Maße: hoch 13 Zoll, breit 16 Zoll Anm.: Die Lose 198 und 199 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (5 fl für die Nm. 198 und 199) Käufer: Kaller 1797/04/20 HBPAK 0220 B. v. Bodewein I Eine Landschaft mit Figuren. Auf Holz, mit schwarzen Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 6 Zoll, breit 7 Zoll Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "B. v. Bodewein", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0198 Boudevins I Eine bergigte Landschaft, durch den Thal schlängelt sich ein Fluß, auf den Gebirgen verschiedene Schlösser, nebst vielen Figuren. Auf Holz, schwarzen Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 11 Zoll, breit 14 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0006 Anton Franz Boudewyns I Zwey Landschaften von Anton Franz Boudewyns. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Holz Maße: hoch 10 Zoll breit 1 Schuh 2 Zoll Anm.: Die Lose 6 und 7 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0007 Anton Franz Boudewyns I Zwey Landschaften von Anton Franz Boudewyns. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Holz Maße: hoch 10 Zoll, breit 1 Schuh 2 Zoll Anm.: Die Lose 6 und 7 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0332 Anton Franz Boudewyns I Ein Wald, von Anton Franz Boudewyns. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 10 Zoll breit 3 Schuh 1 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 BLBOE 0050 Boudewyns I Eine Landschaft. Mehrere Kähne mit lustigen Leuten fahren auf dem Wasser hin und her. Auf beiden Ufern sind Wirthshäuser. Im Hintergrunde der Prospekt eines Dorfs. I Mat.: auf Leinwand Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0197 Bodewein I Zwey Stücke; Landschaften mit Figuren. I Diese Nr.: Ein Stück; Landschaft mit Figuren Anm.: Die Lose 197 und 198 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 334
GEMÄLDE
1800/11/12 HBPAK 0198 Bodewein I Zwey Stücke; Landschaften mit Figuren. I Diese Nr.: Ein Stück; Landschaft mit Figuren Anm.: Die Lose 197 und 198 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Boudewyns, Adriaen Frans (und Both, Α.) 1800/00/00 FRAN1 0015 Boudewyns: And. Both I Zwei schöne Stück, italienische Gebäude vorstellend, mit unzähligen Figuren von And. Both staffirt. I Diese Nr.: Ein schönes Stück, italienische Gebäude vorstellend, mit unzähligen Figuren Mat.: auf Holz Maße: 11 Zoll hoch, 15 Zoll breit Anm.: Die Lose 15 und 16 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN1 0016 Boudewyns; And. Both I Zwei schöne Stück, italienische Gebäude vorstellend, mit unzähligen Figuren von And. Both staffirt. I Diese Nr.: Ein schönes Stück, italienische Gebäude vorstellend, mit unzähligen Figuren Mat.: auf Holz Maße: 11 Zoll hoch, 15 Zoll breit Anm.: Die Lose 15 und 16 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN1 0017 Boudewyns; And. Both I Eine prächtige Landschaft mit unzähligen Figuren, Pferde und Maulthiere staffirt von And. Both. Im ersten Plan ist ein Halt zur Rajerbaitz, im zweiten siehet man einen Fluß, auf welchem ein Schiff u. mehrere Barken sind. I Mat.: auf Kupfer Maße: 7 Zoll hoch, 9 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Boudewyns, Adriaen Frans (und Bout, P.) 1750/00/00 KOAN 0053 Bout; Boudwins I Un paisage tres enjoui, & bien conserve, avec quantite de figures par de Bout, & Boudwins. I Maße: Largeur 1 Pies 6 Vi Pouces, Haut 1 Pies 4 % Pouce Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1750/04/00 HB AN 0021 Bout; Baudeweins I Zwey extra ausführliche Landschaften mit vielen Figuren, von Bout und Baudeweins. I Diese Nr.: Eine extra ausführliche Landschaft mit vielen Figuren Anm.: Die Lose 21 und 22 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1750/04/00 HB AN 0022 Bout; Baudeweins I Zwey extra ausführliche Landschaften mit vielen Figuren, von Bout und Baudeweins. I Diese Nr.: Eine extra ausführliche Landschaft mit vielen Figuren Anm.: Die Lose 21 und 22 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1764/05/28 BOAN 0337 Boud; Boudovinx I Deux Pa'isages enrichis de figures & betail peints par Boud, les Pai'sages peints par Boudouvinx. [Zwey Landschaften mit Vielen figurlein und Viehe Vom Boudt die Landschaft Vom Boudovinx.] I Diese Nr.: Un Paisage enrichi de figures & betail Maße: 2 pieds de largeur, 1 pied 8 pouces de hauteur Anm.: Die Lose 337 und 338 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (134 Rt für die Nrn. 337 und 338) Käufer: Broggia proprio nomine 1764/05/28 BOAN 0338 Boud; Boudovinx I Deux Pai'sages enrichis de figures & betail peints par Boud, les Pa'isages peints par Boudouvinx. [Zwey Landschaften mit Vielen figurlein und Viehe Vom Boudt die Landschaft Vom Boudovinx.] I Diese Nr.: Un Paisage enrichi de figures & betail Maße: 2 pieds de largeur, 1 pied 8 pouces de hauteur Anm.: Die Lose 337 und 338 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (134 Rt für die Nrn. 337 und 338) Käufer: Broggia proprio nomine 1764/06/15 BOAN 0689 Boutt; Bouduins I Deux petits Tableaux de dix pouces & demi de largeur, huit pouces de hauteur, representants des Paisages avec des figures & du Betail, dont les figu-
res sont peintes par Boutt, & les paisages par Bouduins. [Zwey stücklein Vorstellend Landschaften mit figurlein und Viehe, gemahlt die figuren Von Baut, und die Landschaften Von Bouduins.] I Maße: 10 pouces & demi de largeur, 8 pouces de hauteur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (20.10 Rt) Käufer: Hof C Rath Broggia 1765/00/00 FRRAU 0025 Boutt; Bouduins I Der angenehme Penzel des Bouduins in den Landschaften, welcher ohnehin seine Meriten hat, wird um so viel herrlicher, wann solcher durch Boutt staffiret worden, wie hierinnen zu sehen, und beyde verbinden sich gut mit einander. Ohne Rahme gemessen, auf Holtz gemahlt. Le pingeau agreable de Bouduin pour ce qui regarde les paisages, qui a sans cela ses merite, devient encor plus charmant, quand il est orne de celui de Boutt, comme on le voit ici, & ces deux s'accordent parfaitement bien. Sans la bordure, peint sur du bois. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Zoll, breit 10 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRRAU 0026 Boutt; Bouduins I Eine dergleichen schöne Landschaft von beyden Meistern verfertiget. Un semblable pa'isage, tres-beau, & fait par ces deux Maitres. I Maße: Hoch 8 Zoll, breit 10 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRRAU 0083 Boutt; Boudouin I Boutt und Boudouin. Eine Landschaft, welche Boudouin verfertiget, die Stavage durch Boutt gemahlet ist. Dieses vortrefliche Meister=Stück von einer Landschaft können Liebhaber nicht genug betrachten, alles was das Aug darauf entdecket, gereichet zum Vergnügen. Der Fleiß in der zahlreichen Stavage ist nicht genug zu loben, und die Ordination ist unverbesserlich. Was das Wasser anlangt, so ist solches Breglisch, und accordirt sich sehr wohl. C'est un pa'isage que Boudouin a peint & l'etalage par Boutt. Les Amateurs ne sauvoient se rassasier en regardant ce pa'isage, tout ce que l'oeuil y decouvre lui fait plaisir. On ne sauroit assez louer la diligence dans le nombre de l'etalage & l'ordonnance ne sauroit etre mieux. L'eau est dans le goüt de Bregel & s'accorde tres-bien. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 1 Schuh 9 Zoll, breit 2 Schuh Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRRAU 0084 Boutt; Boudouin I Auch eine Landschaft, so angenehm und fleißig, wie jetzt beschriebene. C'est est aussi un pa'isage, fait avec autant d'attention & aussi agreable, que celui qu'on vient de depeindre. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 1 Schuh 9 Zoll, breit 2 Schuh Transakt.: Unbekannt 1767/00/00 KOAN 0114 Peter Bouth; Budouwin I Zwey angenehme fleissig ausgeführte Landschaften auf Holtz von Peter Bouth, und Budouwin. I Mat.: auf Holz Maße: Breite 1 Fuß 10 VA Zoll, Höhe 1 Fuß 6 % Zoll Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0320 Bout; Boudewins I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0321 Boul; Boudewins I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0348 Boul; Boudewins I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0349 Boul; Boudewins I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
1768/07/00 MUAN 0434 Boul; Boudewins I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0864 Boul; Boudewins I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0865 Boul; Boudewins I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1004 Boul; Boudewins I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0123 Bout; Boudewyns I Deux Paysages avec figures. Peints sur cuivre marques des N o s 348. & 349. ! Diese Nr.: Un Pay sage avec figures Mat.: auf Kupfer Maße: 6 Vi. pouces de haut sur 8. pouces de large Anm.: Die Lose 123 und 124 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0124 Bout; Boudewyns I Deux Paysages avec figures. Peints sur cuivre marques des Ν os 348. & 349. I Diese Nr.: Un Pay sage avec figures Mat.: auf Kupfer Maße: 6 Vi. pouces de haut sur 8. pouces de large Anm.: Die Lose 123 und 124 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francis Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0189 Bout; Boudewyns I Deux Paysages avec nombre de figures. Peints sur cuivre, marques des N o s 320. & 321. I Diese Nr.: Un Paysage avec nombre de figures Mat.: auf Kupfer Maße: 8. pouces de haut sur 11. pouces de large Anm.: Die Lose 189 und 190 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0190 Bout; Boudewyns I Deux Paysages avec nombre de figures. Peints sur cuivre, marques des N o s 320. & 321. I Diese Nr.: Un Paysage avec nombre de figures Mat.: auf Kupfer Maße: 8. pouces de haut sur 11. pouces de large Anm.: Die Lose 189 und 190 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1776/11/09 HB KOS 0034 Baudt; Baudeweins I Ein schöner Land=Prospect, reich an Figuren, auf Leinwand, mit dito [schwarzen] Rahm und verguldete Leisten. I Pendant zu Nr. 79 Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß, Breite 1 Fuß 5 Zoll Transakt.: Verkauft (30 Μ für die Nrn. 34 und 79) Käufer: Köster [und] Ehr[enreich] 1776/11/09 HB KOS 0064 Baudt; Bandeweins I Zwo Landschaften mit vielen Figuren, besonders fleißig gemahlt auf Holz, mit dito [schwarzen] Rähmen und verguldeten Leisten, von Baudt und Bandeweins [sic]. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit vielen Figuren Mat.: auf Holz Maße: Höhe 10 Vi Zoll, Breite 1 Fuß 2 Zoll Anm.: Die Lose 64 und 65 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (25.8 Μ für die Nm. 64 und 65) Käufer: Köst[er] [und] Ehrenreich 1776/11/09 HBKOS 0065 Baudt; Bandeweins I Zwo Landschaften mit vielen Figuren, besonders fleißig gemahlt auf Holz, mit dito [schwarzen] Rähmen und verguldeten Leisten, von Baudt und Bandeweins [sic]. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit vielen Figuren Mat.: auf Holz Maße: Höhe 10 Vi Zoll, Breite 1 Fuß 2 Zoll Anm.: Die Lose 64 und 65 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: VerGEMÄLDE
335
kauft (25.8 Μ für die Nrn. 64 und 65) Käufer: Köst[er] [und] Ehrenreich 1776/11/09 HBKOS 0079 Baudt; Baudeweins I Ein schöner Land=Prospect, zu Nr. 34 gehörig, auf Leinwand, mit dito [schwarzen] Rahm und verguldeten Leisten. I Pendant zu Nr. 34 Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß, Breite 1 Fuß 5 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (30 Μ für die Nrn. 34 und 79) Käufer: Köster [und] Ehr[enreich] 1779/09/27 FRNGL 0093 Baudewin; Baut I Von Baudewin eine fleißig ausgeführte Landschaft, worinnen die Figuren und Vieh von Baut, reich und schön staffirt. [Un tres beau paysage par Baudewin, les figures & le betail par Baut, piece excellente.] I Pendant zu Nr. 94 Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Transakt.: Verkauft (25 fl für die Nrn. 93 und 94) Käufer: Abel von Hamburg 1779/09/27 FRNGL 0094 Baudewin; Baut I Das Gegenbild darzu, eine dergleichen Landschaft mit Figuren und Vieh, von beiden Meistern [Baudewin und Baut] und Maas. [Le pendant du precedant, meme objet [paysage], par les memes maitres.] I Pendant zu Nr. 93 Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Transakt.: Verkauft (25 fl für die Nrn. 93 und 94) Käufer: Abel von Hamburg 1783/06/19 HBRMS 0105 Baut; Baudewins I Plaisante Land= und Wasser=Gegenden, mit schifreiche Flüßen, Städten und viele Figuren. H[olz], g.R. [verguldete Rahmen] I Diese Nr.: Eine plaisante Lamd= und Wasser=Gegend Mat.: auf Holz Maße: 11 Zoll hoch, 13 Zoll breit Anm.: Die Lose 105 und 106 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1783/06/19 HBRMS 0106 Baut; Baudewins I Plaisante Land= und Wasser=Gegenden, mit schifreiche Flüßen, Städten und viele Figuren. H[olz]. g.R. [verguldete Rahmen] I Diese Nr.: Eine plaisante Lamd= und Wasser=Gegend Mat.: auf Holz Maße: 11 Zoll hoch, 13 Zoll breit Anm.: Die Lose 105 und 106 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1784/08/02 FRNGL 0289 Baudewin; Bauth I Zwey warm ausgeführte Landschaften mit Vieh, von Baudewin und Bauth. I Diese Nr.: Eine warm ausgeführte Landschaft mit Vieh Maße: 22 Zoll breit, 16 Zoll hoch Anm.: Die Lose 289 und 290 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: D Transakt.: Verkauft (8 fl für die Nm. 289 und 290) Käufer: Rath Ehrenreich
1787/00/00 HB AN 0677 Peter Bout; Anton Franz Boudewyns I Eine waldigte Land= und Wassergegend mit verschiedenen bäuerlichen Wohnungen, Hirten und Vieh. Sehr plaisant gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 11 Zoll, breit 14 Zoll Transakt.: Verkauft (6.4 M) Käufer: Texier 1790/05/20 HBSCN 0191 Boutt; Boudewien I Land= und Wasser=Gegenden mit Schiffen, und eine Menge Pferde und Figuren. Mit sehr vielen Heiß ausgeführt. Auf Holz, G.R. [Goldnen Rahm] I Diese Nr.: Eine Land= und Wasser=Gegend mit Schiffen, und eine Menge Pferde und Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Zoll, breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 191 und 192 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (12 Μ für die Nrn. 191 und 192) Käufer: Richardi 1790/05/20 HBSCN 0192 Boutt; Boudewien I Land= und Wasser=Gegenden mit Schiffen, und eine Menge Pferde und Figuren. Mit sehr vielen Reiß ausgeführt. Auf Holz, G.R. [Goldnen Rahm] I Diese Nr.: Eine Land= und Wasser=Gegend mit Schiffen, und eine Menge Pferde und Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Zoll, breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 191 und 192 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (12 Μ für die Nrn. 191 und 192) Käufer: Richardi 1790/08/13 HBBMN 0071 Boutt; Boudwien I Eine beschattete Land= und Wassergegend; mit verschiedenen Reisenden, theils zu Pferde und theils zu Fuß, welche sich auf der Landstraße befinden. In der gebürgigten Entfernung siehet man einige Schlösser und Landhäuser; sehr fleißig und schön gemahlt. Auf Holz, in fein vergoldeten Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Zoll, breit 14 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (3.8 M) Käufer: Ego 1791/10/21 HBRMS2 0014 Bout; Bodewyns I In einer waldigten Landschaft befinden sich im Vordergrunde Reisende, die sich mit Hirten unterreden, welche ihr Vieh übern Vordergrund treiben. Von brillanten collorirter und freyer Bearbeitung. Auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 25 Zoll, breit 37 Zoll Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 HB AN 0146 Bout; Boudewyns I An einem Schlosshofe vorbey wird auf der Landstrasse Vieh getrieben; am Thorwege spricht ein Reuter mit einigen Personen; über Feld kommt ein Frachtwagen von der fernen Stadt. I Maße: Höhe 7 Zoll, Breite 9 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt
1784/08/02 FRNGL 0290 Baudewin; Bauth I Zwey warm ausgeführte Landschaften mit Vieh, von Baudewin und Bauth. I Diese Nr.: Eine warm ausgeführte Landschaft mit Vieh Maße: 22 Zoll breit, 16 Zoll hoch Anm.: Die Lose 289 und 290 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: D Transakt.: Verkauft (8 fl für die Nrn. 289 und 290) Käufer: Rath Ehrenreich
1794/09/10 HBGOV 0041 Boudt; Baudevin I Hirten mit Tristen von Rinder und Schaafe, in bergigter Land=Gegend. I Diese Nr.: Hirten mit Tristen von Rinder und Schaafe, in bergigter Gegend Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 12 Zoll, breit 24 Zoll Anm.: Die Lose 41 und 42 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1785/12/03 HBBMN 0025 Baud; Baudewins I Zwey kleine Landschaften mit vielen Figuren, von Baud und Baudewins, in schwarze Rahmen. I Diese Nr.: Eine kleine Landschaft mit vielen Figuren Anm.: Die Lose 25 und 26 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1794/09/10 HBGOV 0042 Boudt; Baudevin I Hirten mit Tristen von Rinder und Schaafe, in bergigter Land=Gegend. I Diese Nr.: Hirten mit Tristen von Rinder und Schaafe, in bergigter Gegend Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 12 Zoll, breit 24 Zoll Anm.: Die Lose 41 und 42 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1785/12/03 HBBMN 0026 Baud; Baudewins I Zwey kleine Landschaften mit vielen Figuren, von Baud und Baudewins, in schwarze Rahmen. I Diese Nr.: Eine kleine Landschaft mit vielen Figuren Anm.: Die Lose 25 und 26 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1785/12/21 HBKOS 0009 Baud; Baudewins I Zwo Landschaften mit vielen kleintn [sie] Figuren, in verguldete Rahmen. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit vielen kleintn Figuren Anm.: Die Lose 9 und 10 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1785/12/21 HBKOS 0010 Baud; Baudewins I Zwo Landschaften mit vielen kleintn [sie] Figuren, in verguldete Rahmen. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit vielen kleintn Figuren Anm.: Die Lose 9 und 10 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 336
GEMÄLDE
1794/09/10 HBGOV 0132 Boudt; Bodewin I Holzungen in gebürgigten Gegenden, mit Reisenden zu Pferde und zu Fuße. I Diese Nr.: Eine Hölzung in gebürgigter Gegend Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 Zoll, breit 7 Vi Zoll Anm.: Die Lose 132 und 133 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV 0133 Boudt; Bodewin I Holzungen in gebürgigten Gegenden, mit Reisenden zu Pferde und zu Fuße. I Diese Nr.: Eine Hölzung in gebürgigter Gegend Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 Zoll, breit 7 Vi Zoll Anm.: Die Lose 132 und 133 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1795/11/17 HBPAK 0039 Baut; Baudewein I Zwey Landschaften mit Figuren. Gold. Rahm. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figu-
ren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Zoll, breit 13 Zoll Anm.: Die Lose 39 und 40 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1795/11/17 HBPAK 0040 Baut; Baudewein I Zwey Landschaften mit Figuren. Gold. Rahm. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Zoll, breit 13 Zoll Anm.: Die Lose 39 und 40 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1795/11/17 HBPAK 0041 Baut; Baudewein I Zwey Landschaften mit Figuren. Gold. Rahm. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 15 Zoll Anm.: Die Lose 41 und 42 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1795/11/17 HBPAK 0042 Baut; Baudewein I Zwey Landschaften mit Figuren. Gold. Rahm. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 15 Zoll Anm.: Die Lose 41 und 42 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/02/17 HBPAK 0143 Baut; Baudoin I Eine beschattete römische Land= und Wasser=Gegend mit vielen Gebäuden und Figuren nebst Maulthieren. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 14 14 Zoll, Breite 19 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (80 M) Käufer: W 1796/10/17 HBPAK 0051 Bauth; Boldewin I Zwey Landschaften mit einer Dorfgegend, nebst Figuren, Vieh und Wagen. Auf Holz. Schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit einer Dorfgegend, nebst Figuren, Vieh und Wagen Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 15 Zoll Anm.: Die Lose 51 und 52 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0052 Bauth; Boldewin I Zwey Landschaften mit einer Dorfgegend, nebst Figuren, Vieh und Wagen. Auf Holz. Schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit einer Dorfgegend, nebst Figuren, Vieh und Wagen Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 15 Zoll Anm.: Die Lose 51 und 52 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0197 Booth; Boodewein I Eine Land= und Wassergegend. Auf Leinwand. Schw. Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 16 Zoll, breit 20 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0082 Baut; Baudewein I Zwey Landschaften mit Figuren. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren Anm.: Die Lose 82 und 83 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0083 Baut; Baudewein I Zwey Landschaften mit Figuren. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren Anm.: Die Lose 82 und 83 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0084 Both; Baudevin I Ein italienischer Prospect, welcher einen Markt vorstellt; sehr reich an Figuren, vortreflichen Gebäuden, und guter Architectur. Im ganzen ein sehr unterhaltendes und mit vielem Fleiß ausgearbeitetes Bild. Auf Leinwand, mit vergoldeten Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 15 Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/12/08 HBPAK 0095 Bod; Bodewein I Eine Landschaft mit Figuren. Auf Holz, im schwazen [sie] Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 5 Vi Zoll, Breite 7 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/12/08 HBPAK 0140 Both; Bodewin I Eine schöne plaisante Landschaft, mit einer Wassergegend. Im Vordergründe ein Reuter zu Pferde. Auf Leinwand, im schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 16 Zoll, Breite 19 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/12/08 HBPAK 0160 Both; Baudewin I Eine Landschaft, wo in der Ferne eine Vestung mit alte Rudera; im Vordergrunde führet ein auf seiner Flöte spielender Hirte eine ganze Heerde Schaafe; mit vielen andern Figuren. Auf Leinwand, im goldnen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 16 Zoll, Breite 19 Zoll Transakt.: Unbekannt
1798/06/04 HBPAK 0150 Both; Baudewin I Eine Landschaft, wo in der Ferne eine Vestung mit alte Rudera. Im Vordergründe führet ein auf seiner Flöte spielender Hirte eine ganze Heerde Schaafe. Mit vielen andern Figuren. Auf Leinwand, goldner Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 16 Zoll, breit 19 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 LZAN 0062 Bout; Baudevin I Deux Pendans. Paysages d'une touche vraie et spirituelle avec figures. I Maße: Hauteur 15 pouces, largeur 21 pouces Transakt.: Unbekannt (20 Louis Schätzung) 1799/00/00 LZRCH 0048 Both; Baudewins I Un pay sage et figures. I Mat.: auf Leinwand Maße: h. 13 Vi 1. 20 Vi. pouces Verkäufer: J F Rauch Transakt.: Unbekannt 1799/08/09 HBPAK 0110 Both; Boselwein I Zwey Land= und Wassergegenden mit Figuren. Auf Holz, schw. Rahm. I Diese Nr.: Eine Land= und Wassergegend mit Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Zoll, breit 16 Zoll Anm.: Die Lose 110 und 111 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/08/09 HBPAK O l l i Both; Boselwein I Zwey Land= und Wassergegenden mit Figuren. Auf Holz, schw. Rahm. I Diese Nr.: Eine Land= und Wassergegend mit Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Zoll, breit 16 Zoll Anm.: Die Lose 110 und 111 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0161 Boot; Boodewins I Zwey Landschaften mit Figuren und Vieh, von Boot & Boodewins. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren und Vieh Anm.: Die Lose 161 und 162 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0162 Boot; Boodewins I Zwey Landschaften mit Figuren und Vieh, von Boot & Boodewins. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren und Vieh Anm.: Die Lose 161 und 162 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Boudewyns, Adriaen Frans (und Michau) 1742/08/01 BOAN 0179 Bodifee; Mischo I Eine Landschafft mit einigen Figuren. Original von Bodifee und Mischo. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0243 Bodifee; Mischovv I Zwey Landschafften beyde Originalien von Bodifee und Mischovv. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0468 Mischo; Bodifee I Zwey Stuck, eines die Bombardirung von Brüssel, und das andere die Verbrennung Trojae praesentirend, beyde Originalien von Mischo und Bodifee. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0222 Bodisee; Mischou I Un Paisage avec figures, par Bodisee & Mischou. I Maße: Haut 9 Vi pouces, large un pied Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0237 Bodisee; Mischou I Deux Pai'sages, par Bodisee, & Mischou. Couple. I Maße: Haut 1. pied, large 1. pied 3. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0294 Mischou; Bodisee I Le Bombardement de Bruxelles ; l'Incendie de Tro'ie Par Mischou & Bodisee. Couple. I Maße: Haut 2. pies, larges 3. pieds 2. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt
Boudewyns, Adriaen Frans (und Monogrammist P.) 1779/00/00 HB AN 0204 P.; Baudewyn I Eine steinerne Brücke führt über einen Fluß zu einigen von hohen Bäumen beschatteten artigen Gebäuden. Ein Hirte treibt seine Schafe über die Brücke in die reizende Gegend, die in der Ferne sich mit blauen Gebirgen endiget. Auf dem Flusse segeln einige kleine Fahrzeuge. [Un pont de pierres conduit par-dessus une riviere ä quelques fabriques elegantes, omGEMÄLDE
337
bragees par des arbres. Un berger mene ses moutons par-dessus le pont ä une contree agreable, qui se perd au loin dans l'azur des montagnes. Sur la riviere des barques ä voiles deployees.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 9 Zoll hoch, 1 Fuß breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0205 P.; Baudewyn I Ueber zween Absätze unter einer steinernen Brücke fällt der kleine Fluß zum Vorgrunde. Reisende ziehen über die Brücke, hinter welcher ein Meyerhof liegt. Weiter erhebt sich ein angenehmes Dorf, und allmählich verliert sich das Thal im fernen Gebirge. [Sur le devant du tableau une petite riviere tombe en cascade sous un pont de pierre, par-dessus deux degrds. Des voyageurs passent sur le pont, derriere lequel est une metairie. Plus loin s'eleve un village agreable, & la vallee se perd insensiblement dans des montagnes eloignees.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 9 Zoll hoch, 1 Fuß breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt
Boudewyns, Adriaen Frans (und Schoevaerdts, M.) 1742/08/01 BOAN 0227 Scovart; Bodifee I Zwey Stuck mit perspectiven Landschafften und vielen Figuren. Originalien von Scovart und Bodifee. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0245 Schovart; Bodifee I Z w e y Landschafften. Original von Schovart und Bodifee. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0248 Scovart; Bodifee I Z w e y Landschafften mit vielen Figuren Orig. von Scovart und Bodifee. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0319 Bodifee; Scovart I Noch eine Landschafft. Orig. von Bodifee und Scovart. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0239 Schovart; Bodisee I Deux Pafsages, par Schovart & Bodisee. Couple. I Maße: Haut 9. pou. large 1. pied 1. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0242 Schovart; Bodisee I Deux Paisages avec figures, par Schovart & Bodisee. Couple. I Maße: Haut 9. pouc. large 1. pied Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0253 Schovart; Bodisee I Autre Pay sage par Schovart & Bodisee. I Maße: Haut 11. pou., large 1. pie. 3. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0347 Schovart; Bodisee I Deux Perspectives avec Figures, par Schovart & Bodisee. Couple. I Maße: Haut 11. pou., large 1. pie 3. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1788/10/01 FRAN 0072 Baudewyns; Schovaert I Eine Landschaft mit Figuren, von Baudewyns & Schovaert. I Maße: 9 Zoll hoch, 12 Zoll breit Transakt.: Verkauft (6.30 fl) Käufer: Schneidewind 1788/10/01 FRAN 0119 Baudewyns; Schoevaerts I Eine Landschaft, in deren Vordergrund sich ein Schäfer mit seiner Heerde befindet, von Baudewyns, die Figuren sind von Schoevaerts. I Maße: 25 Vi Zoll hoch, 35 Zoll breit Transakt.: Verkauft (15 fl) Käufer: Heussel
Boudewyns, Adriaen Frans (und Vermeer, J.) 1782/09/30 FRAN 0052 van der Meer; Baudewins I Zwei sehr schöne Landschaften mit vortrefflich ausgeführten Figuren und Vieh, von van der Meer und Baudewins. [Deux tres beaux paysages avec des figures & du betail, superieurement bien peintes par van der Mees & Baudewins.] I Diese Nr.: Eine sehr schöne Landschaft mit vortrefflich ausgeführten Figuren und Vieh Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 1 lh Zoll breit Anm.: Die Lose 52 und 53 wurden 338
GEMÄLDE
zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (38 fl für die Nm. 52 und 53) Käufer: Küstner 1782/09/30 FRAN 0053 van der Meer; Baudewins I Zwei sehr schöne Landschaften mit vortrefflich ausgeführten Figuren und Vieh, von van der Meer und Baudewins. [Deux tres beaux paysages avec des figures & du betail, superieurement bien peintes par van der Mees & Baudewins.] I Diese Nr.: Eine sehr schöne Landschaft mit vortrefflich ausgeführten Figuren und Vieh Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 1 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 52 und 53 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (38 fl für die Nm. 52 und 53) Käufer: Küstner
Boudewyns, Adriaen Frans (Geschmack von) 1765/00/00 FRRAU 0075 Bouduins I Eine Landschaft in dem Gusto von Bouduins. C'est un pa'isage dans le gout de Bouduin. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Zoll, breit 10 Zoll Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRRAU 0076 Bouduins I Eine dergleichen [Landschaft] von diesem Meister [in dem Gusto von Bouduins]. Encore un semblable [pai'sage] du meme Maitre [un inconnu]. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Zoll, breit 10 Zoll Transakt.: Unbekannt 1784/09/27 FRAN 0013 Baudewins I Zwey bäumigte Landschaften im Geschmack von Baudewins. [Deux paysages couverts d'arbres dans le gout de Baudewins.] I Maße: 1 Schuh 7 Zoll hoch, 1 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Freyherr von Berberich Transakt.: Verkauft (3.45 fl) Käufer: Morgenstern
Boullongne 1742/08/01 BOAN 0265 Monsieur de Bologne I Ein Ovidisches Stuck mit der Sonnen. Original von Monsieur de Bologne. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0873 Boulogne I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0874 Boulogne I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0100 Boulogne I Deux belles Battailles. Marques des N o s 873. & 874. I Diese Nr.: Un belle Battaille Maße: 1. p. 5. p. de haut sur 2. p. 14. p. de haut Anm.: Die Lose 100 und 101 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0101 Boulogne I Deux belles Battailles. Marques des N° s 873. & 874. I Diese Nr.: Un belle Battaille Maße: 1. p. 5. p. de haut sur 2. p. 14. p. de haut Anm.: Die Lose 100 und 101 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francis Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1790/08/25 FRAN 0353 Boulogne I Zwey Bataillen. I Diese Nr.: Eine Bataille Maße: hoch 19 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 353 und 354 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Unbekannt 1790/08/25 FRAN 0354 Boulogne I Zwey Bataillen. I Diese Nr.: Eine Bataille Maße: hoch 19 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 353 und 354 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Unbekannt 1796/02/17 HBPAK 0014 Boulogne I Wie Christus Lazarus aus dem Grabe erweckt, wodurch die Umstehenden in grosse Verwunde-
rang gesetzt werden. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 34 Vi Zoll, Breite 49 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (161 M) Käufer: W 1796/02/17 HBPAK 0098 Boulogne I In einem Landhause, nahe bey der offenen Thüre, in welcher eine alte Frau am Spinn=Rocken sitzt, spielt ein Officier Karten mit einer Dame, die von einem andern dazu kommenden Officier complimentirt wird. Zur linken Seite des spielenden Officiers steht ein Herr, welcher auf der Guitarre spielt, und zur Rechten ein kleiner Junge. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 19 Zoll, Breite 24 Zoll Transakt.: Verkauft (181 M) Käufer: Τ
Boullongne (Kopie nach) 1800/06/03 BLAN 0028 Wolter; nach Boulogne I Die Geburt der Venus, dito [in Oel auf Leinwand]. I Kopie von Herrn. Wolters nach Boullongne Mat.: Öl auf Leinwand Maße: Höhe 27 Zoll, Breite 32 Zoll Transakt.: Verkauft (4 Rt) Käufer: Lesser
Boullongne, Bon 1796/02/17 HBPAK 0057 Bon Boulogne I In einer ländlichen Gegend sitzt Bacchus und Ariadne auf einer Terrasse unter Bäumen, welche mit Weinranken durchgeflochten sind. Neben ihnen steht eine Faun=Statur. Ein Satyr reicht der Ariadne Weintrauben. Zur Linken scherzt ein Genius mit zwey Tigern, und hinter einer Erdenhöhe stehen zwey Nymphen. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 20 Vi Zoll, Breite 26 Zoll Transakt.: Verkauft (130 M) Käufer: Eckhardt 1798/06/04 HBPAK 0394 B. Boulogne I Spielende Kinder. Sehr fein und fleißig gemahlt, und von schönem Colorit und Zeichnung. Auf Leinwand. \Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 15 Zoll, breit 12 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 LZRCH 0092 Bon Boulogne I Jesus allant ä Emaus, represante dans un joli paysage. I Mat.: auf Leinwand Maße: h. 11. 1. 15. pouces Verkäufer: J F Rauch Transakt.: Unbekannt
Bouman, Johan 1778/09/28 FRAN 0314 Boumann I Ein Körbchen mit Baumfrüchten. [Une petite corbeille remplie de fruits.] I Pendant zu Nr. 315 Maße: 1 Schuh 8 Zoll breit, 1 Schuh 7 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (14 fl für die Nm. 314 und 315) Käufer: Dr Hartzberg 1778/09/28 FRAN 0315 Boumann I Der Compagnon, von dito [Boumann]. [Le pendant du precedent.] I Pendant zu Nr. 314, "Ein Körchen mit Baumfrüchten" Maße: 1 Schuh 8 Zoll breit, 1 Schuh 7 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (14 fl für die Nrn. 314 und 315) Käufer: Dr Hartzberg 1785/04/22 HBTEX 0013 Boumann I Em hangender Blumen= Veston. Kräftig gemahlt auf Leinewand. Schwarzer Rahm und goldne Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Zoll, breit 27 Zoll Transakt.: Unbekannt 1785/04/22 HBTEX 0051 Boumann I Zwey hängende Blumen= Vestons. Sehr kräftig gemahlt. Auf Kupfer. Schwarze Rahmen und goldne Leisten. I Diese Nr.: Ein hängender Blumen=Veston Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 7 Zoll, breit 9 Zoll Anm.: Die Lose 51 und 52 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1785/04/22 HBTEX 0052 Boumann I Zwey hängende Blumen= Vestons. Sehr kräftig gemahlt. Auf Kupfer. Schwarze Rahmen und goldne Leisten. I Diese Nr.: Ein hängender Blumen=Veston Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 7 Zoll, breit 9 Zoll Anm.: Die Lose 51 und 52 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Bouniere [Nicht identifiziert] 1796/02/17 HBPAK 0103 Bouniere I Halb überschattet unter hohen Bäumen, liegt eine entblösste schlafende Nymphe, auf einem weissen und gelben Gewände. Amor und ein Faun sehen sie entzückt an. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 15 Zoll, Breite 16 Zoll Transakt.: Verkauft (112 M) Käufer: Butefirt [?]
Bourdon, Sebastien 1725/01/24 BOAN [0004] Bourdon I Mater dolorosa mit dem Heil. Leichnam Christi von Bourdon. I Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Joseph Clemens Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0234 Bourdon I Eine Ovidische Historie. Original vom Bourdon. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0543 Bourdon I Zwey grosse Landschafften. Original von Bourdon. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0590 Bourdon I Ein Historie Stuck. Orig. von Bourdon. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0236 Bourdon I Une fable d'Ovide, par Bourdon. I Maße: Haut un pied 6. pou. large 1. pied 1. pouce Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0311 Bourdon I Deux Paisages, par Bourdon. hauts 3. pieds, larges 3. pieds. Couple. I Maße: Hauts 3. pieds, larges 3. pieds Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0318 Bourdon I Histoire, par Bourdon. I Maße: Haut 3. pieds 1. pou. large 4. pieds 3. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0187 Bourdon (Sebastian) I [Ohne Titel] Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0263 Bourdon (Sebastian) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0052 Bastien Bourdon I Un tableau qui represente les Anges qui annoncent aux pasteurs la naissance du fils de Dieu. Peint de forme ronde sur l'etain. I Mat.: auf Blech Format: rund Maße: 6 Vi pouces de haut sur 6 Vi pouces de large Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0186 Sebastien Bourdon I Les anges annoncent aux pasteurs la naissance de Jesus Christ. Peint sur bois, marque du No. 187. \Mat.: auf Holz Maße: 1. p. 3 'λ. p. de haut sur 1. p. 8 Vi. p. de large Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0183 Bourdon I Une Ste. Familie, ä droite se voit Ste. Elizabeth ä genoux, les bras en croix sur son sein, devant eile St. Jean Baptiste, & Jesus, se disputant une Colombe, Marie les regarde, tenant de ses deux mains son voile eleve, ä gauche St. Zacharie & St. Joseph, Tun appuie sur son äne & l'autre sur son baton, plus loin en haut, la Ville de Nazareth & son Lac. Tableau ovale, precieux, d'une belle composition, & d'un beau coloris, peint sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: haut 19 pouces 3 lignes, large 20 pouces 3 lignes Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1789/00/00 MMAN 0156 Sebastian Bourdon I Eine historische Vorstellung, auf Leinw. [Une representation historique, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 3 Fuß 6 Zoll hoch, 5 Fuß breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (22 fl) GEMÄLDE
339
1790/01/07 MUAN 0110 Bourdon Sebast. I Ein Hirtenstück, auf Leinwat, in einer geschnittenen, u. metallisirten Ram. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 9 Zoll, Breite 1 Schuh 6 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0395 Bourdon Sebast. I Eine Seelandschaft, auf Leinwat, in einer geschnittenen und vergoldeten Ram. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 8 Zoll, Breite 3 Schuh Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1791/09/21 FRAN 0006 Bourdon I Eine heilige Familie, wo zur Linken die Jungfrau mit ihrem Kinde im Schooße ist, zur Rechten der heil. Joseph, so sich mit einem Engel unterredet, zu Maria Füßen ist der heil. Johannes, so sich auf seinen Hammel lehnt, der Grund endiget sich mit einer Landschaft; es ist von einer überaus schönen Vermischung und einer angenehmen Zusammensetzung. I Transakt.: Verkauft (35 fl) Käufer: Lorrion 1791/09/21 FRAN 0133 Sebastien Bourdon I Eine Landschaft von runder Forme, mit Bäumen, so einen Wasserfall vorstellen, Schlössern und Vieh gezieret, im Grunde sind verschiedene Personen. I Format: rund Transakt.: Verkauft (18 fl) Käufer: R Scheibler 1795/12/02 HBPAK 0001 De Bourdon I 1 Stfuck] Caravanne. I Maße: 3 p. haut 4 large Transakt.: Unbekannt 1796/00/00 BS AN 0004 Sebastien Bourdon I Le Martyre de Saint Sebastien. La tete du Saint a une expression celeste de douceur, d'esperance et de resignation; sa main droite est repliee sur la tete, comme pour l'affermir; sa gauche est separee par une branche seche, du tronc de l'arbre auquel il est attache. Une fleche a dejä perce son flanc. Son corps, de la plus belle carnation, est nud jusqu'ä la ceinture; une draperie couvre le reste. I Mat.: auf Leinwand Maße: Haut de 3 pieds 6 pouces; large de 2 pieds 5 pouces Verkäufer: Merian l'aine Transakt.: Unbekannt (100) 1796/02/17 HBPAK 0029 Bourdon I Unter den Ruinen eines alten Gebäudes sitzen, stehen und liegen eine Menge Arme, welche sich auf mancherley Art beschäftigen; einige kochen, andere unterreden sich, noch andere spielen Karten, wobey zwey uneinig geworden, daher sie sich mit Fäusten schlagen u.s.w. Zur Rechten bey der Öfnung der Höhle weidet einiges Hornvieh, und oben von einem Felsen sieht eine alte Frau nach den armen Leuten herunter. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 17 Vi Zoll, Breite 21 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (74 M) Käufer: Τ 1796/02/17 HBPAK 0048 Bourdon I Eine römische Landschaft. Im Vordergrunde, bey einem Monumente, sitzt Joseph und Maria mit dem Christ=K[i]nde, welche von Engeln bed[i]ent werden, die Flucht nach Egypten vorstellend. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 19 % Zoll, Breite 23 % Zoll Transakt.: Verkauft (88 M) Käufer: Eckhardt 1796/02/17 HBPAK 0051 Bourdon \ Im Vordergrunde am Ufer eines Flusses stehen einige von ihren Pferden abgestiegene Officiere, welche zwey neben ihnen liegende todte Körper plündern lassen. Über dem Wasser auf einer langen steinernen Brücke, ist ein heftiges Gefechte von Cavallerie und Infanterie. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 18 Vi Zoll, Breite 31 Zoll Transakt.: Verkauft (61 M) Käufer: W 1796/02/17 HBPAK 0079 Bourdon I Eine römische gebirgigte Land= und Wasser=Gegend mit Schlössern und Gehölze. Im Vordergrunde zur Linken sitzen und stehen einige Personen bey einem Monumente, und am jenseitigen Ufer in der Entfernung gehen Mehrere. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 13 % Zoll, Breite 16 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (65 M) Käufer: Wailer 1796/02/17 HBPAK 0167 Bourdon I Eine gebirgigte italienische Gegend mit verschiedenen steinernen Gebäuden, welche theils zerfallen. In der Mitte fliesst ein Wasser hindurch, worüber eine steinerne Brücke mit zwey Bogen=Öffnungen. Am Ufer zur Rechten wird gefischt. Auf Kupfer. Runden Formats. I Mat.: auf Kupfer For340
GEMÄLDE
mat: rund Maße: Höhe 8 Vi Zoll, Breite 8 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (61 M) Käufer: W 1797/04/25 HBPAK 0025 Bourdon I Eine Ovidische Geschichte. Auf Leinwand, goldenen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Format: oval Maße: hoch 34 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/12/08 HBPAK 0156 Bourdon I Eine Landschaft mit Rudera. Im mittlem Grunde zur Linken, wo Bauern sich mit Tanzen belustigen. Im Vordergrunde einem Brunnen, wo Wasser geschöpft wird. Licht und Klarheit sehr brav gemahlt. Auf Holz, im goldnen Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 10 Zoll, Breite 14 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0149 Bourdon I Eine Landschaft mit Rudera. Im mittlem Grunde, zur Linken, wo Bauern sich mit Tanzen belustigen. Im Vordergrunde einem Brunnen, wo Wasser geschöpft wird. Licht und Klarheit sehr brav gemahlt. Auf Holz, goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 14 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0277 Bourdon I Die Heyrath der heiligen Catharine. Von der schönsten Zusammensetzung, Zeichnung und Colorit. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 6 Vi Zoll, breit 7 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/10/17 LZAN 0025 Bourdon I Ein Manns-Portrait bis an die Brust, mit einem weissen Halskragen; hoch 26 Zoll, breit 21 Zoll. Auf Leinwand, mit weissen Leisten umgeben. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 26 Zoll, breit 21 Zoll Verkäufer: Rauch Transakt.: Verkauft (5.18 Th) Käufer: Pfarr 1800/00/00 FRAN2 0107 Bourdon (Sebastian) I Ein Zahnarzt hebt einem Bauer einen Zahn aus, weiter zurück eine Frau nebst einem Kinde sitzen bey einem Tisch. I Mat.: auf Holz Maße: 5 Zoll hoch, 7 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN2 0144 Bourdon (Sebastian) I Christus am Oelberge. Ein in den Wolken schwebender Engel präsentirt ihm den Kelch und das Kreuz, im Hintergrunde sind die schlafenden Jünger. Diess Stück ist leicht und fleissig gemahlt, und zwar in der beliebtesten Manier dieses Meisters. I Mat.: auf Leinwand Maße: 23 Zoll hoch, 19 Zoll breit Transakt. : Unbekannt 1800/00/00+ LZRST [0011 ] Bourdon I Das Innere eines Gebäudes, wo Bauern bey Tische, einer trunken, führt eine Bäuerin tanzend bey der Hand. I Mat.: auf Holz Maße: 19 Zoll hoch 16 Zoll breit Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Rost Transakt.: Unbekannt 1800/07/09 HBPAK 0074 Bourdon I Interieur: Scene de paysans dont la plus part assis ä une Table, Tun deux qui paeoit [sie] yvre conduit par la main une femme en dansant. Un chien le precede. L'effet en est agreable. Sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: 19 pouces de hauteur. Sur 16 pouces de largeur Transakt.: Unbekannt 1800/07/09 HBPAK 0075 Bourdon I Au bas d'un Edifice un marche aux herbes. Une vendeuse de fruits est assise sur une brouette. Une femme compte des oeufs. Plusieurs figures sont dans le fond. Ce Tableau presente la belle couleur de l'ecole flamande. Sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: 21 pouces de hauteur. Sur 15 pouces de largeur Transakt.: Unbekannt
Bourdon, Sebastien (oder Bordone) 1742/08/01 BOAN 0226 Bordon I Ein Ovidisches Stuck, die schlaffende Venus mit einem Kindlein praesentirend. Original von Bordon. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0129 Bourdon I Venus dormant, avec un enfant, par Bourdon. I Maße: Haut 11. pou. large 1. p. 2. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt
Bourdon, Sebastien (Kopie nach) 1797/08/10 MMAN 0175 Bourdon I Vier Copien in der Form von Dessusporten, wovon 2 nach Poussin, und 2 nach Bourdon, Stellen aus der Η. Schrift vorstellend, auf Tuch mit Rahmen. I Diese Nr.: Eine Copie in der Form einer Dessusporte, Stelle aus der H. Schrift vorstellend Mat.: auf Leinwand Format: Dessusporten Anm.: Die Lose 173 bis 176 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Verkauft (40.10 fl für die Nrn. 173-176) 1797/08/10 MMAN 0176 Bourdon I Vier Copien in der Form von Dessusporten, wovon 2 nach Poussin, und 2 nach Bourdon, Stellen aus der H. Schrift vorstellend, auf Tuch mit Rahmen. I Diese Nr.: Eine Copie in der Form einer Dessusporte, Stelle aus der H. Schrift vorstellend Mat.: auf Leinwand Format: Dessusporten Anm.: Die Lose 173 bis 176 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Verkauft (40.10 fl für die Nrn. 173-176)
Bourny, Heinrich Adam Elias 1789/06/12 HBTEX 0006 H.A.E. Borney. 1762 I Die Geschichte Salomonis, als sein erstes Urtheil und die Opferung mit den Kebsweibern vor dem Götzenpriester. Plaisant gemahlt, auf Holz. I Diese Nr.: Die Geschichte Salomonis, als sein erstes Urtheil Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 14 Zoll lnschr.: 1762 (datiert?) Anm.: Die Lose 6 und 7 wurden zusammen katalogisiert. Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Verkauft (7.4 Μ für die Nrn. 6 und 7) Käufer: Ego 1789/06/12 HBTEX 0007 H.A.E. Bomey. 17621 Die Geschichte Salomonis, als sein erstes Urtheil und die Opferung mit den Kebsweibern vor dem Götzenpriester. Plaisant gemahlt, auf Holz. I Diese Nr.: Die Opferung mit den Kebsweibern vor dem Götzenpriester Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 14 Zoll lnschr.: 1762 (datiert?) Anm.: Die Lose 6 und 7 wurden zusammen katalogisiert. Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Verkauft (7.4 Μ für die Nrn. 6 und 7) Käufer: Ego
Bout, Peeter 1723/00/00 PRAN [A]0129 Bauth I Seestücklein / vom Bauth. I Maße: Höhe 1 Schuh, Breite 1 Schuh 5 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1740/00/00 AUAN 0009 Baut I 2. Niederländische Landschäfftlein / von Baut. I Maße: 1. Schuh 4. Zoll hoch / 1 . Schuh 8. Zoll breit Transakt.: Unbekannt (60 fl) 1740/00/00 AUAN 0078 Bautt I 2. Landschafften vom Bautt. I Maße: 1. Schuh / 9. Zoll hoch / 2. Schuh breit Transakt.: Unbekannt (200 fl) 1742/08/01 BOAN 0156 Bauth \ Zwey Stuck, wovon eines einen Fisch-Marckt, und das anderes eine Schlitten-Fahrt exhibiret. Original vom Bauth. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0475 Bauth I Eine Landschafft. Original vom Bauth. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0117 Bauth I Un marche ä poissons, & une course de traineaux, couple, par Bauth. I Maße: Haut 7. pouc. large 9. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0297 Bauth \ Un Paysage, par Bauth. I Maße: Haut 1. pied 4. pouces, large 1. pied 8. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0054 Pierre Bout I Deux beaux paisages, bien travailles, sur bois, par le meme Pierre Bout. I Diese Nr.: Un beau paisage Mat.: auf Holz Maße: Largeur 1 Pies 7 Vi Pouces, Haut 1 Pies 1 14 Pouces Anm.: Die Lose 54 und 55 wurden zusammen ka-
talogisiert. Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0055 Pierre Bout I Deux beaux paisages, bien travailles, sur bois, par le meme Pierre Bout. I Diese Nr.: Un beau paisage Mat.: auf Holz Maße: Largeur 1 Pies 7 Vt Pouces, Haut 1 Pies 1 Vi Pouces Anm.: Die Lose 54 und 55 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0104 Pierre Bout I Un clair de lune, avec plusieurs Figures, sur bois, Γ une des plus belles pieces dans ce genre. I Mat.: auf Holz Maße: Largeur 1 Pies 2 Pouces, Haut 1 Pies 4 Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1767/00/00 KOAN 0067 Peter Bouth I Zwey Landschaften von Peter Bouth. I Maße: Breite 2 Fuß 2 % Zoll, Höhe 1 Fuß 8 Zoll Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt 1767/00/00 KOAN 0077 Peter Bouth I Ein auf Holtz gemahlter Mondschein von Peter Bouth. I Mat.: auf Holz Maße: Breite 1 Fuß 10 Vi Zoll, Höhe 2 Fuß % Zoll Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0067 Bout I Un Port de mer, ou se trouvent nombre de personnes assemblees sur le rivage. Peint sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: 1. p. 2 Vi. p. de haut sur 1. pied 11. pouces de large Verkäufer: Fran5ois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0230 P. Baut I Eine Landgegend mit verschiedenen reysenden, meisterhaft gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 21 Zoll 6 Linien, Breite 26 Zoll 9 Linien Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0356 Baut oder Bout I Eine Landschaft, auf Holz, in einer ungefaßten Ram. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 2 Zoll, Breite 1 Schuh 5 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1251 Baut oder Bout I Zwey asiatische Karavanstücke, auf Leinwat. I Diese Nr.: Ein asiatisches Karavanstück Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 3 Schuh 5 Zoll, Breite 2 Schuh 9 Zoll Anm.: Die Lose 1251 und 1252 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1252 Baut oder Bout I Zwey asiatische Karavanstücke, auf Leinwat. I Diese Nr.: Ein asiatisches Karavanstück Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 3 Schuh 5 Zoll, Breite 2 Schuh 9 Zoll Anm.: Die Lose 1251 und 1252 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1791/05/28 HBSDT 0002 A.F. Boudt I Ländliche Gegenden mit durchfließenden Gewässer ec. Beyde mit eine menge Figuren, als Herrschaften die von der Jagd kommen und wandernde Bauren. Zwey ganz vortrefliche Gemähide, auf Holz. I Diese Nr.: Eine ländliche Gegend mit durchfliessenden Gewässer; Nr. 3 von Bredael Mat.: auf Holz Maße: Hoch 14 ιΛ Zoll, breit 18 Vi Zoll Anm.: Die Lose 2 und 3 wurden zusammen katalogisiert. Der Name des Künstlers ist angegeben als "A.F. Boudt", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt 1793/09/18 HBSCN 0040 P. Bout I Am Gestade der See liegen angekommene Fahrzeuge und Fischerböte; gleich am Ufer werden Fische verkauft; noch siehet man am Strande einen welcher Fisch aufträgt, einen andern der vorüber reitet; in einen niedlichen Ton, grau in grau gemahlt. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 20 Zoll, breit 27 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/08/10 MMAN 0232 Pierre Bout I Zwei Landschaften mit vielen Figuren, auf Tuch. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit vielen Figuren Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 232 und 233 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (50 fl für die Nm. 232 und 233, Schätzung) GEMÄLDE
341
1797/08/10 MMAN 0233 Pierre Bout I Zwei Landschaften mit vielen Figuren, auf Tuch. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit vielen Figuren Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 232 und 233 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (50 fl für die Nrn. 232 und 233, Schätzung) 1799/12/23 WNAN akt.: Unbekannt
0055
Bout I Un Retour de la peche. I Trans-
Bout, Peeter (und Arthois) 1788/10/01 FRAN 0047 Jacob von Arthois; Baut I Eine Landschaft sehr natürlich, von Jacob von Arthois, 9 Vi Zoll hoch, 12 Zoll breit, die Figuren sind von Baut. I Maße: 9 Vi Zoll hoch, 12 Zoll breit Transakt.: Verkauft (7 fl) Käufer: von Schmid 1788/10/01 FRAN 0065 Jacob van Arthois; Baut' Eine ganz unvergleichliche Landschaft, von Jacob van Arthois, die Figuren von Baut. Man kann keine schönere natürliche Vorstellung sehen, als auf diesem Stück. I Maße: 21 Zoll hoch, 27 Zoll breit Transakt.: Verkauft (31.15 fl) Käufer: Hoynk 1788/10/01 FRAN 0101 Arthois; Bauth I Eine waldigte Landschaft, von Arthois, mit Figuren von Bauth. I Maße: 19 Zoll hoch, 25 Zoll breit Transakt.: Verkauft (18.15 fl) Käufer: Huth modo Hüsgen 1794/09/09 HBPAK 0076 Bout; Artois I In einem dicken Gehölze werden Reisende von Räuber überfallen und geplündert. In der Entfernung noch mehrere Personen, mit vielen Fleiß entworfen. Auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Zoll, breit 27 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/09/13 FRAN 0021 Jacob van Artois; staffirt ν. Bauth I Eine angenehme Landschaft. I Maße: 1 Schuh 2 Zoll hoch 1 Schuh 7 Zoll breit Transakt.: Unbekannt (41 [?] fl) 1800/00/00+ LZRST [0001] Jacob van Artois; P. Bout I Eine Landschaft, zur Rechten auf einer Anhöhe ein Birkengehölz, zur Linken ein alter Stamm und schlanke Bäume mit grossen Blättermassen; ein grasreicher Vordergrund mit grossen Pflanzen, in der blauen Ferne Gebirge. Die Figuren sind von P. Bout. I Mat.: auf Leinwand Maße: 30 Vi Zoll breit 24 Zoll hoch Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Rost Transakt.: Unbekannt
Bout, Peeter (und Boudewyns) 1750/00/00 KOAN 0053 Bout; Boudwins I Un paisage tres enjoue, & bien conserve, avec quantite de figures par de Bout, & Boudwins. I Maße: Largeur 1 Pies 6 Vi Pouces, Haut 1 Pies 4 % Pouce Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollem Transakt.: Unbekannt 1750/04/00 HB AN 0021 Bout; Baudeweins I Zwey extra ausführliche Landschaften mit vielen Figuren, von Bout und Baudeweins. I Diese Nr.: Eine extra ausführliche Landschaft mit vielen Figuren Anm.: Die Lose 21 und 22 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1750/04/00 HB AN 0022 Bout; Baudeweins I Zwey extra ausführliche Landschaften mit vielen Figuren, von Bout und Baudeweins. I Diese Nr.: Eine extra ausführliche Landschaft mit vielen Figuren Anm.: Die Lose 21 und 22 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1764/05/28 BOAN 0337 Boud; Boudovinx I Deux Pai'sages enrichis de figures & betail peints par Boud, les Pai'sages peints par Boudouvinx. [Zwey Landschaften mit Vielen figurlein und Viehe Vom Boudt die Landschaft Vom Boudovinx.] I Diese Nr.: Un Paisage enrichi de figures & betail Maße: 2 pieds de largeur, 1 pied 8 pouces de hauteur Anm.: Die Lose 337 und 338 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Ver342
GEMÄLDE
kauft (134 Rt für die Nrn. 337 und 338) Käufer: Broggia proprio nomine 1764/05/28 BOAN 0338 Boud; Boudovinx I Deux Pai'sages enrichis de figures & betail peints par Boud, les Pai'sages peints par Boudouvinx. [Zwey Landschaften mit Vielen figurlein und Viehe Vom Boudt die Landschaft Vom Boudovinx.] I Diese Nr.: Un Paisage enrichi de figures & betail Maße: 2 pieds de largeur, 1 pied 8 pouces de hauteur Anm.: Die Lose 337 und 338 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (134 Rt für die Nrn. 337 und 338) Käufer: Broggia proprio nomine 1764/06/15 BOAN 0689 Boutt; Bouduins I Deux petits Tableaux de dix pouces & demi de largeur, huit pouces de hauteur, representants des Paisages avec des figures & du Betail, dont les figures sont peintes par Boutt, & les paisages par Bouduins. [Zwey stücklein Vorstellend Landschaften mit figurlein und Viehe, gemahlt die figuren Von Baut, und die Landschaften Von Bouduins.] I Maße: 10 pouces & demi de largeur, 8 pouces de hauteur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (20.10 Rt) Käufer: Hof C Rath Broggia 1765/00/00 FRRAU 0025 Boutt; Bouduins I Der angenehme Penzel des Bouduins in den Landschaften, welcher ohnehin seine Meriten hat, wird um so viel herrlicher, wann solcher durch Boutt staffiret worden, wie hierinnen zu sehen, und beyde verbinden sich gut mit einander. Ohne Rahme gemessen, auf Holtz gemahlt. Le pin$eau agreable de Bouduin pour ce qui regarde les pai'sages, qui a sans cela ses merite, devient encor plus charmant, quand il est ome de celui de Boutt, comme on le voit ici, & ces deux s'accordent parfaitement bien. Sans la bordure, peint sur du bois. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Zoll, breit 10 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRRAU 0026 Boutt; Bouduins I Eine dergleichen schöne Landschaft von beyden Meistern verfertiget. Un semblable paisage, tres-beau, & fait par ces deux Maitres. I Maße: Hoch 8 Zoll, breit 10 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRRAU 0083 Boutt; Boudouin I Boutt und Boudouin. Eine Landschaft, welche Boudouin verfertiget, die Stavage durch Boutt gemahlet ist. Dieses vortrefliche Meister=Stück von einer Landschaft können Liebhaber nicht genug betrachten, alles was das Aug darauf entdecket, gereichet zum Vergnügen. Der Fleiß in der zahlreichen Stavage ist nicht genug zu loben, und die Ordination ist unverbesserlich. Was das Wasser anlangt, so ist solches Breglisch, und accordirt sich sehr wohl. C'est un paisage que Boudouin a peint & l'etalage par Boutt. Les Amateurs ne sauvoient se rassasier en regardant ce paisage, tout ce que l'oeuil y decouvre lui fait plaisir. On ne sauroit assez louer la diligence dans le nombre de l'etalage & l'ordonnance ne sauroit etre mieux. L'eau est dans le goüt de Bregel & s'accorde tres-bien. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 1 Schuh 9 Zoll, breit 2 Schuh Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRRAU 0084 Boutt; Boudouin I Auch eine Landschaft, so angenehm und fleißig, wie jetzt beschriebene. C'est est aussi un paisage, fait avec autant d'attention & aussi agreable, que celui qu'on vient de depeindre. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 1 Schuh 9 Zoll, breit 2 Schuh Transakt.: Unbekannt 1767/00/00 KOAN 0114 Peter Bouth; Budouwin I Zwey angenehme fleissig ausgeführte Landschaften auf Holtz von Peter Bouth, und Budouwin. I Mat.: auf Holz Maße: Breite 1 Fuß 10 % Zoll, Höhe 1 Fuß 6 % Zoll Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0320 Boul; Boudewins I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
1768/07/00 MUAN 0321 Boul; Boudewins I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0348 Boul; Boudewins I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0349 Boul; Boudewins I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0434 Boul; Boudewins I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0864 Boul; Boudewins I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0865 Boul; Boudewins I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1004 Boul; Boudewins I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0123 Bout; Boudewyns I Deux Paysages avec figures. Peints sur cuivre marques des N o s 348. & 349. I Diese Nr.: Un Paysage avec figures Mat.: auf Kupfer Maße: 6 Vi. pouces de haut sur 8. pouces de large Anm.: Die Lose 123 und 124 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0124 Bout; Boudewyns I Deux Paysages avec figures. Peints sur cuivre marques des N o s 348. & 349. I Diese Nr.: Un Paysage avec figures Mat.: auf Kupfer Maße: 6 Vi. pouces de haut sur 8. pouces de large Anm.: Die Lose 123 und 124 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francis Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0189 Bout; Boudewyns I Deux Paysages avec nombre de figures. Peints sur cuivre, marques des Ν os 320. & 321. I Diese Nr.: Un Paysage avec nombre de figures Mat.: auf Kupfer Maße: 8. pouces de haut sur 11. pouces de large Anm.: Die Lose 189 und 190 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0190 Bout; Boudewyns I Deux Paysages avec nombre de figures. Peints sur cuivre, marques des Ν os 320. & 321. I Diese Nr.: Un Paysage avec nombre de figures Mat.: auf Kupfer Maße: 8. pouces de haut sur 11. pouces de large Anm.: Die Lose 189 und 190 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francis Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1776/11/09 HBKOS 0034 Baudt; Baudeweins I Ein schöner Land=Prospect, reich an Figuren, auf Leinwand, mit dito [schwarzen] Rahm und verguldete Leisten. I Pendant zu Nr. 79 Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß, Breite 1 Fuß 5 Zoll Transakt.: Ver-
kauft (30 Μ für die Nrn. 34 und 79) Käufer: Köster [und] Ehr[enreich] 1776/11/09 HBKOS 0064 Baudt; Bandeweins I Zwo Landschaften mit vielen Figuren, besonders fleißig gemahlt auf Holz, mit dito [schwarzen] Rähmen und verguldeten Leisten, von Baudt und Bandeweins [sic]. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit vielen Figuren Mat.: auf Holz Maße: Höhe 10 Vi Zoll, Breite 1 Fuß 2 Zoll Anm.: Die Lose 64 und 65 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (25.8 Μ für die Nrn. 64 und 65) Käufer: Köst[er] [und] Ehrenreich 1776/11/09 HBKOS 0065 Baudt; Bandeweins I Zwo Landschaften mit vielen Figuren, besonders fleißig gemahlt auf Holz, mit dito [schwarzen] Rähmen und verguldeten Leisten, von Baudt und Bandeweins [sic]. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit vielen Figuren Mat.: auf Holz Maße: Höhe 10 Vi Zoll, Breite 1 Fuß 2 Zoll Anm.: Die Lose 64 und 65 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (25.8 Μ für die Nrn. 64 und 65) Käufer: Köst[er] [und] Ehrenreich 1776/11/09 HBKOS 0079 Baudt; Baudeweins I Ein schöner Land=Prospect, zu Nr. 34 gehörig, auf Leinwand, mit dito [schwarzen] Rahm und verguldeten Leisten. I Pendant zu Nr. 34 Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß, Breite 1 Fuß 5 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (30 Μ für die Nrn. 34 und 79) Käufer: Köster [und] Ehr[enreich] 1779/09/27 FRNGL 0093 Baudewin; Baut I Von Baudewin eine fleißig ausgeführte Landschaft, worinnen die Figuren und Vieh von Baut, reich und schön staffirt. [Un tres beau paysage par Baudewin, les figures & le betail par Baut, piece excellente.] I Pendant zu Nr. 94 Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Transakt.: Verkauft (25 fl für die Nm. 93 und 94) Käufer: Abel von Hamburg 1779/09/27 FRNGL 0094 Baudewin; Baut I Das Gegenbild darzu, eine dergleichen Landschaft mit Figuren und Vieh, von beiden Meistern [Baudewin und Baut] und Maas. [Le pendant du precedant, meme objet [paysage], par les memes maitres.] I Pendant zu Nr. 93 Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Transakt.: Verkauft (25 fl für die Nrn. 93 und 94) Käufer: Abel von Hamburg 1783/06/19 HBRMS 0105 Baut; Baudewins I Plaisante Land= und Wasser=Gegenden, mit schifreiche Flüßen, Städten und viele Figuren. H[olz], g.R. [verguldete Rahmen] I Diese Nr.: Eine plaisante Lamd= und Wasser=Gegend Mat.: auf Holz Maße: 11 Zoll hoch, 13 Zoll breit Anm.: Die Lose 105 und 106 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1783/06/19 HBRMS 0106 Baut; Baudewins I Plaisante Land= und Wasser=Gegenden, mit schifreiche Flüßen, Städten und viele Figuren. H[olz]. g.R. [verguldete Rahmen] I Diese Nr.: Eine plaisante Lamd= und Wasser=Gegend Mat.: auf Holz Maße: 11 Zoll hoch, 13 Zoll breit Anm.: Die Lose 105 und 106 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1784/08/02 FRNGL 0289 Baudewin; Bauth I Zwey warm ausgeführte Landschaften mit Vieh, von Baudewin und Bauth. I Diese Nr.: Eine warm ausgeführte Landschaft mit Vieh Maße: 22 Zoll breit, 16 Zoll hoch Anm.: Die Lose 289 und 290 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: D Transakt.: Verkauft (8 fl für die Nrn. 289 und 290) Käufer: Rath Ehrenreich 1784/08/02 FRNGL 0290 Baudewin; Bauth I Zwey warm ausgeführte Landschaften mit Vieh, von Baudewin und Bauth. I Diese Nr.: Eine warm ausgeführte Landschaft mit Vieh Maße: 22 Zoll breit, 16 Zoll hoch Anm.: Die Lose 289 und 290 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: D Transakt.: Verkauft (8 fl für die Nrn. 289 und 290) Käufer: Rath Ehrenreich 1785/12/03 HBBMN 0025 Baud; Baudewins I Zwey kleine Landschaften mit vielen Figuren, von Baud und Baudewins, in schwarze Rahmen. I Diese Nr.: Eine kleine Landschaft mit vielen FiGEMÄLDE
343
guren Anm.: Die Lose 25 und 26 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1785/12/03 HBBMN 0026 Baud; Baudewins I Zwey kleine Landschaften mit vielen Figuren, von Baud und Baudewins, in schwarze Rahmen. I Diese Nr.: Eine kleine Landschaft mit vielen Figuren Anm.: Die Lose 25 und 26 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1785/12/21 HBKOS 0009 Baud; Baudewins I Zwo Landschaften mit vielen kleintn [sie] Figuren, in verguldete Rahmen. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit vielen kleintn Figuren Anm.: Die Lose 9 und 10 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1785/12/21 HBKOS 0010 Baud; Baudewins I Zwo Landschaften mit vielen kleintn [sie] Figuren, in verguldete Rahmen. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit vielen kleintn Figuren Anm.: Die Lose 9 und 10 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1787/00/00 HB AN 0677 Peter Bout; Anton Franz Boudewyns I Eine waldigte Land= und Wassergegend mit verschiedenen bäuerlichen Wohnungen, Hirten und Vieh. Sehr plaisant gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 11 Zoll, breit 14 Zoll Transakt.: Verkauft (6.4 M) Käufer: Texier 1790/05/20 HBSCN 0191 Boutt; Boudewien I Land= und Wasser=Gegenden mit Schiffen, und eine Menge Pferde und Figuren. Mit sehr vielen Fleiß ausgeführt. Auf Holz, G.R. [Goldnen Rahm] I Diese Nr.: Eine Land= und Wasser=Gegend mit Schiffen, und eine Menge Pferde und Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Zoll, breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 191 und 192 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (12 Μ für die Nrn. 191 und 192) Käufer: Richardi 1790/05/20 HBSCN 0192 Boutt; Boudewien I Land= und Wasser=Gegenden mit Schiffen, und eine Menge Pferde und Figuren. Mit sehr vielen Fleiß ausgeführt. Auf Holz, G.R. [Goldnen Rahm] I Diese Nr.: Eine Land= und Wasser=Gegend mit Schiffen, und eine Menge Pferde und Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Zoll, breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 191 und 192 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (12 Μ für die Nm. 191 und 192) Käufer: Richardi 1790/08/13 HBBMN 0071 Boutt; Boudwien I Eine beschattete Land= und Wassergegend; mit verschiedenen Reisenden, theils zu Pferde und theils zu Fuß, welche sich auf der Landstraße befinden. In der gebürgigten Entfernung siehet man einige Schlösser und Landhäuser; sehr fleißig und schön gemahlt. Auf Holz, in fein vergoldeten Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Zoll, breit 14 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (3.8 M) Käufer: Ego 1791/10/21 HBRMS2 0014 Bout; Bodewyns I In einer waldigten Landschaft befinden sich im Vordergrunde Reisende, die sich mit Hirten unterreden, welche ihr Vieh übern Vordergrund treiben. Von brillanten collorirter und freyer Bearbeitung. Auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 25 Zoll, breit 37 Zoll Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 HB AN 0146 Bout; Boudewyns I An einem Schlosshofe vorbey wird auf der Landstrasse Vieh getrieben; am Thorwege spricht ein Reuter mit einigen Personen; über Feld kommt ein Frachtwagen von der fernen Stadt. I Maße: Höhe 7 Zoll, Breite 9 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV 0041 Boudt; Baudevin I Hirten mit Tristen von Rinder und Schaafe, in bergigter Land=Gegend. I Diese Nr.: Hirten mit Tristen von Rinder und Schaafe, in bergigter Gegend Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 12 Zoll, breit 24 Zoll Anm.: Die Lose 41 und 42 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV 0042 Boudt; Baudevin I Hirten mit Tristen von Rinder und Schaafe, in bergigter Land=Gegend. I Diese Nr.: Hirten mit Tristen von Rinder und Schaafe, in bergigter Gegend 344
GEMÄLDE
Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 12 Zoll, breit 24 Zoll Anm.: Die Lose 41 und 42 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV 0132 Boudt; Bodewin I Holzungen in gebürgigten Gegenden, mit Reisenden zu Pferde und zu Fuße. I Diese Nr.: Eine Hölzung in gebürgigter Gegend Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 Zoll, breit 7 Vi Zoll Anm.: Die Lose 132 und 133 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV 0133 Boudt; Bodewin I Holzungen in gebürgigten Gegenden, mit Reisenden zu Pferde und zu Fuße. I Diese Nr.: Eine Hölzung in gebürgigter Gegend Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 Zoll, breit 7 Vz Zoll Anm.: Die Lose 132 und 133 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1795/11/17 HBPAK 0039 Baut; Baudewein I Zwey Landschaften mit Figuren. Gold. Rahm. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Zoll, breit 13 Zoll Anm.: Die Lose 39 und 40 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1795/11/17 HBPAK 0040 Baut; Baudewein I Zwey Landschaften mit Figuren. Gold. Rahm. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Zoll, breit 13 Zoll Anm.: Die Lose 39 und 40 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1795/11/17 HBPAK 0041 Baut; Baudewein I Zwey Landschaften mit Figuren. Gold. Rahm. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 15 Zoll Anm.: Die Lose 41 und 42 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1795/11/17 HBPAK 0042 Baut; Baudewein I Zwey Landschaften mit Figuren. Gold. Rahm. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 15 Zoll Anm.: Die Lose 41 und 42 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/02/17 HBPAK 0143 Baut; Baudoin I Eine beschattete römische Land= und Wasser=Gegend mit vielen Gebäuden und Figuren nebst Maulthieren. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 14 V* Zoll, Breite 19 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (80 M) Käufer: W 1796/10/17 HBPAK 0051 Bauth; Boldewin \ Zwey Landschaften mit einer Dorfgegend, nebst Figuren, Vieh und Wagen. Auf Holz. Schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr. : Eine Landschaft mit einer Dorfgegend, nebst Figuren, Vieh und Wagen Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 15 Zoll Anm.: Die Lose 51 und 52 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0052 Bauth; Boldewin I Zwey Landschaften mit einer Dorfgegend, nebst Figuren, Vieh und Wagen. Auf Holz. Schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit einer Dorfgegend, nebst Figuren, Vieh und Wagen Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 15 Zoll Anm.: Die Lose 51 und 52 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0197 Booth; Boodewein I Eine Land= und Wassergegend. Auf Leinwand. Schw. Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 16 Zoll, breit 20 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0082 Baut; Baudewein I Zwey Landschaften mit Figuren. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren Anm.: Die Lose 82 und 83 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0083 Baut; Baudewein I Zwey Landschaften mit Figuren. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren Anm.: Die Lose 82 und 83 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0084 Both; Baudevin I Ein italienischer Prospect, welcher einen Markt vorstellt; sehr reich an Figuren, vortreflichen Gebäuden, und guter Architectur. Im ganzen ein sehr unterhaltendes und mit vielem Fleiß ausgearbeitetes Bild. Auf Leinwand, mit vergoldeten Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 15 Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Unbekannt
1797/12/08 HBPAK 0095 Bod; Bodewein I Eine Landschaft mit Figuren. Auf Holz, im schwazen [sie] Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 5 Vi Zoll, Breite 7 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/12/08 HBPAK 0140 Both; Bodewin I Eine schöne plaisante Landschaft, mit einer Wassergegend. Im Vordergrunde ein Reuter zu Pferde. Auf Leinwand, im schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 16 Zoll, Breite 19 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/12/08 HBPAK 0160 Both; Baudewin I Eine Landschaft, wo in der Ferne eine Vestung mit alte Rudera; im Vordergrunde führet ein auf seiner Flöte spielender Hirte eine ganze Heerde Schaafe; mit vielen andern Figuren. Auf Leinwand, im goldnen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 16 Zoll, Breite 19 Zoll Transakt. : Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0150 Both; Baudewin I Eine Landschaft, wo in der Ferne eine Vestung mit alte Rudera. Im Vordergrunde führet ein auf seiner Flöte spielender Hirte eine ganze Heerde Schaafe. Mit vielen andern Figuren. Auf Leinwand, goldner Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 16 Zoll, breit 19 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 LZAN 0062 Bout; Baudevin I Deux Pendans. Paysages d'une touche vraie et spirituelle avec figures. I Maße: Hauteur 15 pouces, largeur 21 pouces Transakt.: Unbekannt (20 Louis Schätzung) 1799/00/00 LZRCH 0048 Both; Baudewins I Un pay sage et figures. I Mat.: auf Leinwand Maße: h. 13 Vi 1. 20 Vi. pouces Verkäufer: J F Rauch Transakt.: Unbekannt 1799/08/09 HBPAK 0110 Both; Boselwein I Zwey Land= und Wassergegenden mit Figuren. Auf Holz, schw. Rahm. I Diese Nr.: Eine Land= und Wassergegend mit Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Zoll, breit 16 Zoll Anm.: Die Lose 110 und 111 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/08/09 HBPAK 0111 Both; Boselwein I Zwey Land= und Wassergegenden mit Figuren. Auf Holz, schw. Rahm. I Diese Nr.: Eine Land= und Wassergegend mit Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Zoll, breit 16 Zoll Anm.: Die Lose 110 und 111 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0161 Boot; Boodewins I Zwey Landschaften mit Figuren und Vieh, von Boot & Boodewins. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren und Vieh Anm.: Die Lose 161 und 162 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0162 Boot; Boodewins I Zwey Landschaften mit Figuren und Vieh, von Boot & Boodewins. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren und Vieh Anm.: Die Lose 161 und 162 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Bout, Peeter (und Heil, Daniel van) 1788/10/01 FRAN 0124 van Heil; Baut I Eine Landschaft von van Heil, die Staffage von Baut. I Maße: 22 Zoll hoch, 31 Zoll breit Transakt.: Verkauft (9 fl) Käufer: Heussel
Bouttats, Johann Baptiste 1723/00/00 PRAN 0039 Pouttats I Ein Vogel=Stuck / vom Pouttats in Metalliner Rahm. Compagnion von No. 79. I Pendant zu Nr. 79 von Anonym Maße: Höhe 4 Vi Schuh 3 Zoll, Breite 6 Schuh Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt. : Unbekannt 1723/00/00 PRAN 0052 Porottats I Ein Vieh=Stücklein / vom Porottats, in Metalliner Rahm. I Maße: Höhe 5 Schuh 2 Zoll, Breite 7 Schuh 5 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN 0053 Porottats I Ein Geflügel=Stücklein / von eben diesem [Porottats]. I Maße: Höhe 6 Vi Schuh, Breite 4 Vi Schuh 7 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1779/09/27 FRNGL 0150 Bouffats I Ein nach der Natur meisterhaft abgebildeter todter Fasan mit mehrern kleinen Vögeln. [Un faisan tue peint au naturel avec plusieurs petits oiseaux.] I Pendant zu Nr. 151 Maße: 2 Schuh 3 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 9 Zoll breit Transakt.: Verkauft (88 fl für die Nrn. 150 und 151) Käufer: Bäumer 1779/09/27 FRNGL 0151 Bouffats I Der Compagnon hierzu, eine Mandel=Rrähe, nebst andern todten Vögeln, von nemlichem Meister [Bouffats] und Gröse. [Le pendant du precedant, une Corneille emmantelee, avec d'autres oiseaux tues, par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 150 Maße: 2 Schuh 3 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 9 Zoll breit Transakt.: Verkauft (88 fl für die Nrn. 150 und 151) Käufer: Bäumer
Bouzonnet-Stella, Claudine 1796/02/17 HBPAK 0046 Claude Stella I Unter hohen Bäumen, bey einer Grabstätte, sitzt Maria mit dem Christ=Kinde aufm Schoss; vor ihr steht Johannes mit dem Lamm und neben ihr Joseph, der sich auf einen Stein gelehnt. In der Entfernung steht eine Pyramide zwischen alten Gebäuden. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 30 Zoll, Breite 23 Zoll Transakt.: Verkauft (61.8 M) Käufer: Bemasconi
Boy, Gottfried 1782/09/30 FRAN 0080 Godefroy Boy I Ein Kniestück, das Bildnis des Herrn von Uchlen, mit verschiedenen Künstlern vorstellend, von Godefroy Boy fleisig und schön verfertigt. [Le portrait de Mr. d'Uchlen avec plusieurs artistes par Godefroi Boy, piece trfes bien peinte.] I Maße: 2 Schuh 3 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 11 Vi Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (10.15 fl) Käufer: Mergenbaum
Boyer, Michel 1781/00/00 WRAN 0051 Boyer I Un Hiver peint sur toile, oü se voit une Chaumiere & plusieurs Personnages qui s'amusent ä patiner sur la glace. I Mat.: auf Leinwand Maße: haut 12 pouces, large 15 pouces 4 lignes Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt
Bozatti, Bartholomäus [Nicht identifiziert] Bout, Peeter (und Michau) 1742/08/01 BOAN 0517 Boud; Mischow I Eine Fewrs-Brunst, von Boud und Mischow. Original. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0307 Boud; Mischou I Un incendie, par Boud & Mischou. I Maße: Haut 1. pied 10. pouces ; large 2. pieds 1. pouce Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt
1776/00/00 WZTRU 0273 Bartholomäus Bozatti I Ein Stück 10 Zoll hoch, 8 Zoll breit von Bartholomäus Bozatti, stellet vor ein Ecce Homo Kopf in welchem ein geistreicher Ausdruck und wohl verstandene Colorit observiret ist. I Maße: 10 Zoll hoch, 8 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (4 fl Schätzung) 1781/00/00 WZAN 0273 Bartholomäus Bozatti I Ein Stück 10 Zoll hoch, 8 Zoll breit von Bartholomäus Bozatti, stellet einen Ecce GEMÄLDE
345
Homo Kopf vor, an welchem ein geistreicher Ausdruck und eine gut verstandene Kolorit beobachtet wird. I Maße: 10 Zoll hoch, 8 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Brakenburg, Richard 1742/08/01 BOAN 0115 Brackenberg I Ein klein Familie Stucklein. Original von Brackenberg. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0104 Blackenberg I Un tableau de famille, par Blackenberg. I Maße: Haut 1. p. 8. pouc. large 1. p. 5. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1744/05/20 FRAN 0221 Brackenbourg I 2 Schöne Baurenstükke. I Diese Nr.: 1 Schönes Baurenstück Mat.: auf Holz Maße: Höhe 11 Zoll, Breite 14 Zoll Anm.: Die Lose 221 und 222 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1744/05/20 FRAN 0222 Brackenbourg I 2 Schöne Baurenstükke. I Diese Nr.: 1 Schönes Baurenstück Mat.: auf Holz Maße: Höhe 11 Zoll, Breite 14 Zoll Anm.: Die Lose 221 und 222 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0143 Brakenburg I Une Conversation, d'une belle ordonnance, & d'une belle expression, sur toile, du beaux tems de Brakenburg. I Pendant zu Nr. 144 Mat.: auf Leinwand Maße: Largeur 9 % Pouces, Haut 1 Pies Vi Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0144 Brakenburg I Son Pendant, d'une force egale, par le meme [Brakenburg]. I Pendant zu Nr. 143, "Une Conversation" Maße: Largeur 9 % Pouces, Haut 1 Pies Vi Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1763/11/09 FRJUN 0023 Brakenburg I Une jolie piece de Cabinet, representant Samson & Delila avec d'autres figures delicatement peint. I Maße: hauteur 12 Vi pouces, largeur 10 pouces Transakt.: Verkauft (7 fl) Käufer: Kaller 1764/03/12 FRKAL 0013 R. Brakenburg I Delila fait couper les cheveux ä Samson delicatement peint. I Maße: hauteur 9 pouces, largeur 12 pouces Transakt.: Verkauft (8.45 fl) Käufer: Schütz 1764/06/06 BOAN 0628 Brackenburgh I Un Tableau d'un pied dix pouces de hauteur, d'un pied huit pouces de largeur representant les noces de Cana en Gallilee, peint par Brackenburgh en goüt de Myris. [Ein stück Vorstellend die hochzeit zu Cana und gallilea gemahlt Von Brackenburgh in die manier Von Myris.] I Maße: 1 pied 10 pouces de hauteur, 1 pied 8 pouces de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (50 Rt) Käufer: Hof C Rath Broggia 1765/00/00 FRRAU 0157 Brackenburg I Die Hochzeit zu Cana in Galiläa in dem Gusto von Myris. Auf Tuch gemahlt. Les nöces de Canaan en Galilee dans le goüt de Myris. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 1 Schuh 10 Zoll, breit 1 Schuh 8 Zoll Transakt.: Unbekannt 1765/03/27 FRKAL 0025 Brakenburg I Un tableau historique enrichi de figures & tres-bien acheve. I Maße: hauteur 20 pouces, largeur 25 pouces Transakt.: Verkauft (12 fl) Käufer: Lampert 1767/00/00 KOAN 0064 Drackenburgs I Ein ConversationsStuck auf Leinewand von Drackenburgs. I Pendant zu Nr. 64a Mat.: auf Leinwand Maße: Breite 1 Fuß 8 Vi Zoll, Höhe 1 Fuß 11 % Zoll Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt 1767/00/00 KOAN 0064a Drackenburgs I Der Compagnon von dito [Drackenburgs]. I Pendant zu Nr. 64, "Ein Conversations-Stuck" Mat.: auf Leinwand Maße: Breite 1 Fuß 8 Vi Zoll, Höhe 1 Fuß 11 % Zoll Anm.: Im Katalog tragen zwei Lose die Nummer 64. Diesem Los wurde deshalb zur Unterscheidung die Nummer 64a gegeben. Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt 346
GEMÄLDE
1768/07/00 MUAN 0341 Brackenburg (Regnerus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0342 Brackenburg (Regnerus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0149 Brackembourg I Deux assemblees de Paysans dans leurs maisons. Peintes sur bois, marquees des N o s 341. & 342. I Diese Nr.: Un assemble de Paysans dans leur maison Mat.: auf Holz Maße: 9. pouces de haut sur 1. pied de large Anm.: Die Lose 149 und 150 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0150 Brackembourg I Deux assemblees de Paysans dans leurs maisons. Peintes sur bois, marquees des N o s 341. & 342. I Diese Nr.: Un assemble de Paysans dans leur maison Mat.: auf Holz Maße: 9. pouces de haut sur 1. pied de large Anm.: Die Lose 149 und 150 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1773/12/18 HBBOY 0102 Braakenburg I Zwo Bauem=Stücke, als: ein Zahnarzt, und eine Soldaten=Schlägerey. Eins von Braakenburg, und das andere von Molinaar. I Diese Nr.: Ein Zahnarzt Anm.: Die Lose 102 und 103 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1775/05/08 HBPLK 0067 R. Brackenburgh I Ein Paar Verliebte in einem Zimmer mit vielem Beywesen, aufs lebhafteste vorgestellt, und meisterhaft gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 16 Zoll 3 Linie, Breite 13 Zoll 2 Linie Transakt.: Unbekannt 1776/06/28 HBBMN 0059 Brackenburg I Ein verliebter Holländer, so extra schön gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Fuß 4 Vi Zoll, Breite 1 Fuß 1 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/05/16 HBBMN 0089 Brakenburg I Ein schönes Conversations=Stück, reich an Figuren. I Transakt.: Unbekannt 1778/05/23 HB KOS 0001 R. Brackenburg I Ein holländisches Bördel voller Figuren, fleißig und plaisant gemalet, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 23 Vi Zoll, Breite 28 Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/09/28 FRAN 0592 Brackenburg I Die Aussicht eines Venetianischen Marktplatzes, mit vielen Figuren. [La vue d'un marche ä Venise, avec beaucoup de figures.] I Maße: 2 Schuh 1 Zoll breit, 1 Schuh 10 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (65 fl) Käufer: Hüsgen 1779/00/00 HB AN 0197 R. Brackenburg \ Eine grosse Gesellschaft lustiger Niederländer mit ihren Kindern sind in einer Schenke um eine Eule her, die auf einer Stange sitzt. Ein Mann, der mit seiner Frau auf einem Fasse sitzt, reichet der Eule ein Stück Fleisch auf dem Messer. Ein anderer schneidet ihr Grimassen zu. Hinten am Kamine unterhält ein Musikant die Gesellschaft mit seiner Geige. [Une grande compagnie de Flamands joyeux avec leurs enfants se divertit dans un cabaret, autour d'un hibou place sur une perche. Un homme assis avec sa femme sur un tonneau, lui presente un morceau de viande sur la pointe de son couteau. Un autre lui fait la grimace. Sur le fond un musicien egaye la compagnie avec son violon, aupres de la cheminee.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 5 Zoll hoch, 3 Fuß 2 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0198 R. Brackenburg I Ein Mann als Harlekin gekleidet, der einen Trichter auf dem Kopfe hat, scherzt am Kamine mit einer Frau, die mit einem zugebundenen Topfe den Zuhörern eine lächerliche Musik macht. Eine große Gesellschaft lustiger Leute sitzt um den gedeckten Tisch, über welchen die Wirthinn sich
herüber lehnet, und einer vornan [sie] sitzenden Frau Wein einschenkt, während daß sich ihr neben ihr sitzender Liebhaber einige Freyheiten erlaubt. Im Hintergründe bläst ein Pfeifer aus allen Kräften den Dudelsack. [Un homme en habit d'arlequin & un entonnoir sur la tete, cajole pres de la cheminee une femme, qui fait une musique risible avec un pot couvert. Une grande compagnie de gens gais est assise autour d'une table couverte, par-dessus laquelle l'hötesse s'incline pour verser du vin ä une femme assise sur le devant, pendant que son amant assis ä cöte d'elle se permet quelques libertes. Sur le fond un musicien joue de la cornemuse de toutes ses forces.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 5 Zoll hoch, 3 Fuß 2 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/09/27 FRNGL 0253 Bracklinburg I Die Reue Judä, wie derselbe denen Hohenpriestern die 30 Silberlinge wieder zurück wirft, mit sehr vielen Ausdrücken fleißig ausgeführt. [Le repentir de Judas, qui rend les 30 pieces d'argent aux pontifes, piece superieurement bien exprimee.] I Maße: 1 Schuh 2 Zoll hoch, 1 Schuh 10 Zoll breit Transakt.: Verkauft (18.30 fl) Käufer: Balkel Wien 1779/09/27 FRNGL 0706 Brackenburg I Ein Venetianischer Marktplaz mit vielen Figuren. [La grande place ä Venise, avec beaucoup de figures.] I Maße: 1 Schuh 10 Zoll hoch, 2 Schuh 1 Zoll breit Transakt.: Verkauft (25 fl) Käufer: Hüsgen 1783/06/19 HBRMS 0113 R. Brackenburgh I Vor einem Bauerhause zeiget ein Mann einen Raritätskasten, welcher viele alte und junge Leute herbey locket. H[olz], g.R. [verguldete Rahmen] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 1 Zoll hoch, 1 Fuß 4 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1784/08/02 FRNGL 0577 Brakenburg I Eine Niederländische Baurenstube, mit vielen schön ausgeführten und wohl croupirten Bauemfiguren, in Ostadens Geschmack, von Brakenburg meisterhaft verfertigt. I Maße: 21 Zoll breit, 18 Zoll hoch Transakt.: Verkauft (25.15 fl) Käufer: Bäumer 1785/04/22 HBTEX 0097 Brakenburg I Ein Bauernhaus mit etlichen Bauern. Auf Leinewand. Schwarzer Rahm und goldne Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 20 Vi Zoll, breit 17 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1785/05/17 MZAN 0161 Brackenburg I Eine Wöchnerinn von Brackenburg. [Une femme en couche.] I Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 11 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (71.30 fl) Käufer: ν Lokowitz
1789/04/16 HBTEX 0074 Brakenburg I Ein Kerl läßt verschiedenen Personen in einem Guckkasten sehn; auf Leinew. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 17 Zoll, breit 16 Zoll Transakt.: Verkauft (4.04 M) Käufer: Sieberg 1789/06/12 HBTEX 0276 R. Brakenburg, f . 16751 Lustige, zechende und musicirende Bauern und Bäurinnen; eine große Composition. Vortreflich gemahlt. Auf Holz. Schwarzer Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Vi Zoll, breit 17 Zoll Inschr.: R. Brakenburg, f. 1675 (signiert und datiert) Transakt.: Verkauft (11.4 M) Käufer: Ego 1789/08/18 HBGOV 0057 Brackenburg I Zwey scherzhafte Bauren=Gesellschafts=Stücke, sehr lebhaft und schön gemahlt, w. c. auf Holz. I Diese Nr.: Ein scherzhaftes Bauren=Gesellschafts=Stück Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 % Zoll, breit 7 Zoll Anm.: Die Lose 57 und 58 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1789/08/18 HBGOV 0058 Brackenburg I Zwey scherzhafte Bauren=Gesellschafts=Stücke, sehr lebhaft und schön gemahlt, w. c. auf Holz. I Diese Nr.: Ein scherzhaftes Bauren=Gesellschafts=Stück Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 % Zoll, breit 7 Zoll Anm.: Die Lose 57 und 58 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1790/09/10 HBBMN 0032 Brakenburg I In der Thüre eines Landwirths=Hauses stehet die Frau mit dem Kinde aufm Arm, und spricht mit einem, der auf der Bänke vors Haus sitzet. Etwas entfernter spielen Kinder mit einem Hunde. Im Vordergrunde Hüner. Ein sehr schönes und meisterhaftes Gemähide. Auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 20 % Zoll, breit 17 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (3.12 M) Käufer: Ego 1791/05/28 HBSDT 0028 R. Brakenburg, 1675.I Landleute beyderley Geschlechts, amusiren sich mit zechen, tanzen, singen und spielen. Eine Composition von 20 Figuren die Haltung, und die Austheilung von Licht und Schatten in diesem vortreflichen Bilde, ist unvergleichlich angebracht, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 14 Zoll, breit 18 Zoll Inschr.: 1675 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt 1791/09/21 FRAN 0031 Brakemburg I Das Innwendige eines Flamändischen Bier=Hauses, eine Vereinigung von achtzehn Figuren, wo man zur Linken die Frau sieht, so sich mit ihrem Mann streitet, welchem sie die Faust weiset, zur Rechten sind andere Personen beym Trinken, und scheinen sie zu vexiren und auszulachen, es ist mit vielen andern Zusätzen so sich darauf beziehen, gezieret und von einem sehr lustigen Zusammenhange. I Pendant zu Nr. 32 Transakt.: Verkauft (26.30 fl) Käufer: Lorrion
1785/05/17 MZAN 0872 Brackenburg I Zwey Gesellschaftsstücke von Brackenburg. [Deux pieces de conversation.] I Diese Nr.: Ein Gesellschaftsstück Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 1 Schuh 5 Zoll breit Anm.: Die Lose 872 und 873 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (16 fl für die Nrn. 872 und 873) Käufer: Winterstein
1791/09/21 FRAN 0032 Brakemburg I Der Compagnon von eben demselben [Brakemburg]. Dieses ist nicht weniger angenehm, als das vorige, und von einem lustigen und spaßhaften Zusammenhange. I Pendant zu Nr. 31 Transakt.: Verkauft (49 fl) Käufer: Lorrion
1785/05/17 MZAN 0873 Brackenburg I Zwey Gesellschaftsstücke von Brackenburg. [Deux pieces de conversation.] I Diese Nr.: Ein Gesellschaftsstück Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 1 Schuh 5 Zoll breit Anm.: Die Lose 872 und 873 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (16 fl für die Nrn. 872 und 873) Käufer: Winterstein
1791/10/21 HBRMS 1 0054 R. Brackenburg. 1692. I Ein Kerl spielt auf der Leyer und läßt seinen Hund vor einem Bauerhause tanzen, Bauer und Bäurinn mit ihren Kindern sehen zu, sehr schön gemahlt; auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Zoll, breit 8 Vi Zoll Inschr.: 1692 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt
1786/05/02 NGAN 0018 Brakenburg \ Zwey Conversations Stüke. I Diese Nr.: Ein Conversations Stük Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 7 Zoll breit Anm.: Die Lose 18 und 19 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (70.1 fl für die Nrn. 18 und 19) Käufer: Wild
1792/04/19 HBBMN 0046 R. Brackenburg I Die Verstoßung Hagar mit Ismael, ganz besonders schön gemahlt, von R. Brackenburg. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 47 Zoll, breit 35 Zoll Transakt.: Unbekannt
1786/05/02 NGAN 0019 Brakenburg I Zwey Conversations Stüke. I Diese Nr.: Ein Conversations Stük Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 7 Zoll breit Anm.: Die Lose 18 und 19 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (70.1 fl für die Nrn. 18 und 19) Käufer: Wild
1794/00/00 HB AN 0148 Brackenburg I Zwey Gesellschaftsstücke. Bauern und Bäurinnen unterhalten sich in ihrem ländlichen Kreise. I Diese Nr.: Ein Gesellschaftsstück. Bauern und Bäurinnen unterhalten sich in ihrem ländlichen Kreise Maße: Höhe 7 Zoll, Breite 7 Vi Zoll Anm.: Die Lose 148 und 149 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
347
1794/00/00 HB AN 0149 Brackenburg I Zwey Gesellschaftsstücke. Bauern und Bäurinnen unterhalten sich in ihrem ländlichen Kreise. I Diese Nr.: Ein Gesellschaftsstück. Bauern und Bäurinnen unterhalten sich in ihrem ländlichen Kreise Maße: Höhe 7 Zoll, Breite 7 Vi Zoll Anm.: Die Lose 148 und 149 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1795/03/12 HBSDT 0022 Brakenburg I Bauern=Gesellschaften; im Geschmack Ostadens. Auf Holz, im schwarzen Rahm. I Diese Nr.: Eine Bauern=Gesellschaft Mat.: auf Holz Maße: Hoch 14 Zoll, breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 22 und 23 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1795/03/12 HBSDT 0023 Brakenburg I Bauern=Gesellschaften; im Geschmack Ostadens. Auf Holz, im schwarzen Rahm. I Diese Nr.: Eine Bauern=Gesellschaft Mat.: auf Holz Maße: Hoch 14 Zoll, breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 22 und 23 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0094 Brakenburg I Die Beschneidung des Christkindes. Auf Holz, goldenen Rahm. I Mat. : auf Holz Maße: hoch 14 Zoll, breit 10 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1800/00/00+ LZRST [0012] Brackenburg I Eine Mädchenschule, mit vielen Figuren. I Mat.: auf Leinwand Maße: 26 Zoll breit 20 Zoll hoch Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Rost Transakt.: Unbekannt
Brakenburg, Richard (Manier) 1778/09/28 FRAN 0282 Brackenburg I Christus in dem Hause der Maria Magdalena und Martha, in der Manier von Brackenburg. [Jesus-Christ dans la maison de Marie Madeleine & de Marthe, dans le gout de Brackenburg.] I Maße: 1 Schuh 7 Zoll breit, 1 Schuh 2 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (12 fl) Käufer: Fräulein ν Mühl
Brakintz [Nicht identifiziert] 1766/07/28 KOSTE 0034 Brakintz I Ein klein Crucifix auf leinwand mit Maria Joan. Magdal. von Brakintz. I Mat.: auf Leinwand Transakt.: Verkauft (15 Rt) Käufer: R
Bramer, Leonard 1742/08/01 BOAN 0110 Bramer I Die Abnehmung Christi vom Creutz. Original von Bramer. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0133 Bramer I Ein Enthauptungs Stuck auff Kupffer. Original von Bramer. I Mat.: auf Kupfer Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0436 Bramer I Ein Stuck vom Bramer. Original. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0037 Bramer I Descente de Croix, par Bramer. [Een afneming van het kruys door Bramer.] I Maße: Haut 3. p. 4. pou. large 2. p. 8. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt (60) 1742/08/30 BOAN 0043 Bramer I La Decollation de S. Jean, avec plusieurs figures, sur cuivre, par Bramer. I Mat.: auf Kupfer Maße: Haut 1. p. 4. pou. large un p. 10. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0179 Bramer I Un Tableau, par Bramer. I Maße: Haut 4. pies large 3. pies Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 348
GEMÄLDE
1744/05/20 FRAN 0131 L. Bramer I 1 sehr schön Stück Christus unter den Lehrern. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh Vi Zoll, Breite 11 Zoll Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1744/05/20 FRAN 0159 L. Bramer I 1 Schön Stück Petrus aus dem Gefängnuss gehend. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 1 V2 Zoll, Breite 9 Zoll Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1759/00/00 LZEBT 0156 Bramer I Ein Bachanale auf Holtz. I Mat.: auf Holz Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (50 Th Schätzung) 1763/01/19 FRJUN 0035 Bramer I L'Histoire de Pirame & de Thisbe, dans une espece de grote. Ce tableau est aussi bien peint & ordonne, que s'il etoit de Rembrand. I Maße: hauteur 13 pouces, large 17 pouces Transakt.: Unbekannt (46 Ά fl) 1763/11/09 FRJUN 0024 Bramer I Le Sermon de St. Jean rempli de figures. I Maße: hauteur 6 Vi pouces, largeur 9 pouces Transakt.: Verkauft (15.15 fl für die Nrn. 24 und 25) Käufer: Schorer 1763/11/09 FRJUN 0025 Bramer I Un Semblable representant le passage de la mer rouge de meme grandeur. I Maße: hauteur 6 Vi pouces, largeur 9 pouces Transakt.: Verkauft (15.15 fl für die Nrn. 24 und 25) Käufer: Schorer 1764/03/12 FRKAL 0014 Bramer I Un Bachanal de plusieurs figures tres bien peint. I Maße: hauteur 11 Vi pouces, largeur 16 pouces Transakt.: Verkauft (15.40 fl) Käufer: Göring 1764/03/12 FRKAL 0154 Bramer I Une homme avec un flambeau par Bramer. I Anm.: Dieses Los wurde zusammen mit der Nr. 155 (P. Brinckmann) verkauft. Transakt.: Verkauft (1.20 fl für die Nrn. 154 und 155) Käufer: R Ehrenreich 1764/05/21 BOAN 0046 Bramer I Un Tableau de deux pieds de largeur, d'un pied six pouces de hauteur, representant une Sainte Martyre, peinte par Bramer. [Ein stück Vorstellend Eine heilige Martyrin gemahlt Von Bramer.] I Maße: 2 pieds de largeur, 1 pied 6 pouces de hauteur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (30 Rt) Käufer: Cammer-Praesident frhr ν Belderbusch 1764/05/21 BOAN 0047 Bramer I Un Tableau de deux pieds de largeur, d'un pied six pouces de hauteur, representant un Sacrifice Payen, peint par Bramer. [Ein stück Vorstellend ein heidnisches Sacrificium gemahlt Von Bramer.] I Maße: 2 pieds de largeur, 1 pied 6 pouces de hauteur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (41 Rt) Käufer: Beckering 1764/05/22 BOAN 0088 Bramer I Un Tableau d'un pied dix pouces de largeur, d'un pied trois pouces de hauteur, representant deux corps morts deplores par un Rois, peint par Bramer. [Ein stück Vorstellend zwey todten so Von einem König beweint werden, ist etwas beschädiget, Von Bramer.] I Maße: 1 pied 10 pouces de largeur, 1 pied 3 pouces de hauteur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (17 Rt) Käufer: Neveu 1765/03/27 FRKAL 0026 Bramer I Une Adoration des Rois avec plusieurs figures, bien touche. I Maße: hauteur 19 Vi pouces, largeur 15 pouces Transakt.: Verkauft (8 fl) Käufer: Kaller 1768/07/00 MUAN 0782 Bramer (Leonhardus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1776/00/00 WZTRU 0313 Leonhardus Bramer I Ein Stück 6 Zoll hoch, 9 Zoll breit von Leonhardus Bramer, stellet vor eine Nacht, wo der heil. Joseph Mariam (welcher auf einem Esel sitzet) mit der Laterne leuchtet. I Maße: 6 Zoll hoch, 9 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (4 fl Schätzung) 1776/04/15 HBBMN 0009 Leonh. Bramer I Die Beschneidung, oder die Vorbereitung dazu, ein wahres Stück. I Maße: Höhe 1 Fuß
8 Zoll, Breite 2 Fuß 2 Zoll Transakt.: Verkauft (64.8 M) Käufer: Dr Hassperg 1776/04/15 HBBMN 0067 Leonh. Braamer \ Eine biblische Geschichte, das schönste Gemähide, so von diesem Meister bekannt. I Maße: Höhe 2 Fuß 9 Zoll, Breite 3 Fuß 8 Zoll Transakt.: Verkauft (50 M) Käufer: Lilie Sen 1776/07/19 HBBMN 0019 Leonh. Brauner I Eine Landschaft mit der Findung Mosis, besonders schön. I Maße: Höhe 1 Fuß 4 Zoll, Breite 1 Fuß 11 Zoll Transakt.: Verkauft (8 M) Käufer: Lilie 1777/02/21 HBHRN 0047 Leonh. Braamer I Ein Portrait mit Hände. I Maße: Höhe 3 Fuß 3 Zoll, Breite 2 Fuß 5 Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/07/21 HBHTZ 0032 L. Bramer I Christus lässet die Kindlein zu sich kommen, auf dito [Holz]. I Mat.: auf Holz Maße: 20 Zoll hoch, 28 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1778/07/21 HBHTZ 0053 L. Bramer I Salomons Opferung, und Josephs Erzehlung in dem Gefangniß, auf Holz, meisterhaft gemahlt von L. Bramer. I Diese Nr.: Salomons Opferung Mat.: auf Holz Maße: hoch 11 Zoll, breit 15 Zoll Anm.: Die Lose 53 und 54 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (12 M) 1778/07/21 HBHTZ 0054 L. Bramer I Salomons Opferung, und Josephs Erzehlung in dem Gefangniß, auf Holz, meisterhaft gemahlt von L. Bramer. I Diese Nr.: Josephs Erzehlung in dem Gefangniß Mat.: auf Holz Maße: hoch 11 Zoll, breit 15 Zoll Anm.: Die Lose 53 und 54 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (12 M) 1779/09/27 FRNGL 0414 Leonhard Ρramer I Die drey Weisen aus Morgenlande, wie selbige dem Kind JEsu die Verehrung bringen. [Les trois Rois portants les presents ä l'enfant Jesus.] I Maße: 1 Schuh 6 Zoll hoch, 1 Schuh 1 Zoll breit Transakt.: Verkauft (6 fl) Käufer: Rath Ehrenreich 1779/09/27 FRNGL 0959 Leonhard Bramer I Der Trojanische Brand. [La ville de Troye en flammes.] I Maße: 9 Zoll hoch, 1 Schuh breit Transakt.: Verkauft (34 fl) Käufer: Dehnhardt 1781/00/00 WZAN 0313 Leonard Bramer I Ein Stück 6 Zoll hoch, 9 Zoll breit von Leonard Bramer, stellet eine Nacht vor, wo der heil. Maria, welche auf einem Esel sitzet, von dem heil. Joseph geleuchtet wird. I Maße: 6 Zoll hoch, 9 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/09/10 BNAN 0153 Leonh. Bramer I Auf der in des Tempels Vorhofe herunter führenden runden Stuffe, liegt, neben den ihr leitenden tief gebückten Soldaten, im glänzenden Harnisch, die Ehebrecherinn in weißlichter Kleidung, auf den Knien; und vor ihr, im hellrothen Kleide, mit blauem Gewand umgeben, der Heiland, mit gesenktem Haupte und nach ihr hingestrecktem Arm; ein Schriftgelehrter im weiten umgürteten Kleide und Turban hinter der Verbrecherinn: neben ihn andere; um sie eine große Anzahl Juden und Kriegsleute; auf den erhöheteren Theil des Tempels entfernt sich von dem, neben einer mit reichem Geschirre besetzten Tafel, stehenden goldenen Throne, der Hohepriester, unter einem von vier Knaben getragenen Baldachin; andere in Priesterkleidung stehen neben dem Tische; stark, geistreich und natürlich, von Leonh. Bramer. g.L. [im schwarzen Rahm mit verguldeten Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: 34 Zoll hoch, 28 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0086 L. Bramer I Ein vortrefliches Gemählde, die Verehrung Christi vorstellend, so schön wie Rembrand, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 23 Zoll 9 Linien, Breite 36 Zoll 2 Linien Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0187 L. Bramer I Der Triumpf Davids mit Goliaths Haupt, vortreflich gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 23 Zoll, Breite 37 Zoll 2 Linien Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt
1782/09/30 FRAN 0217 Leonhardt Braamer I Pyramus und Thisbe, wie beide am Brunnen todt gefunden werden. [Pyrame & Thisbe, trouves morts pres du puits, par Leonard Braamer.] I Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (30.15 fl) Käufer: Grahe 1785/05/17 MZAN 0665 Bramer I Die Himmelfahrt Christi von Bramer. [L'ascension de Jesus Christ.] I Maße: 1 Schuh 6 ιΛ Zoll hoch, 1 Schuh 2 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (14 fl) Käufer: Schwanck 1788/10/01 FRAN 0085 Bramer I Eine Mahlerey grau in grau, von Bramer, in der Manier von Rembrant seinem Meister. I Maße: 7 Zoll hoch, 8 Zoll breit Transakt.: Verkauft (8.15 fl) Käufer: von Schmid 1790/08/25 FRAN 0053 Pramer I Eine Landschaft mit ovidischen Historien Piramus und Tisbe. i Maße: hoch 8 Zoll, breit 10 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (1 fl) Käufer: Kaller 1790/09/10 HBBMN 0041 L. Bramer I Die Auferweckung Lazarus, mit vielen umstehenden Figuren; vortreflich gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Vi Zoll, breit 16 Zoll Transakt.: Verkauft (2.6 M) Käufer: Commiss Kesten 1791/09/21 FRAN 0126 Leonard Braamer I Ein kleines Gemälde auf Kupfer gemalt, so eine Anbetung der Könige vorstellt, eine Vereinbarung von zehn Figuren, so eine schöne Wirkung macht. I Mat.: auf Kupfer Transakt.: Verkauft (25.15 fl) Käufer: Hindt 1793/00/00 NGWID 0144 Bramer I Die Beschneidung Christi, von Bramer. I Maße: 2 Schuh 6 Zoll hoch, 1 Schuh 10 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1796/00/00 BSAN 0025 Leonard Bramer I Les Israelites ramassent la manne dans le desert. Sur le devant, des fetnmes, des hommes, des enfans diversement grouppes pres d'une tente, recueillent ou portent la manne dans des vases, des sacs et des corbeilles. Une de ces femmes debout, est surtout bien dessinee et drappee. Dans un plan plus recule, Moi'se paröit sur un rocher, avec Aaron et quelques Levites. Dans le fond, une partie du camp. Paysage des deserts d'Arabie. I Mat.: auf Holz Maße: Haut de 1 pied 7 pouces; large de 2 pieds Verkäufer: Merian l'aine Transakt.: Unbekannt (60) 1796/09/08 HBPAK 0138 Leonhard Bramer I Zwey biblische Historien aus dem alten Testament, von Esther und Mardochai. Oval. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine biblische Historie, von Esther und Mardochai Mat.: auf Holz Format: oval Maße: Hoch 13 Zoll, breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 138 und 139 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0139 Leonhard Bramer I Zwey biblische Historien aus dem alten Testament, von Esther und Mardochai. Oval. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine biblische Historie, von Esther und Mardochai Mat.: auf Holz Format: oval Maße: Hoch 13 Zoll, breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 138 und 139 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/09/13 FRAN 0003 Leonhard Bramer I Der ungläubige Thomas und Loth mit seinen Töchtern. I Diese Nr.: Der ungläubige Thomas Maße: 3 Schuh 9 Zoll hoch 5 Vi Schuh breit Anm.: Die Lose 3 und 4 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (58 fl für die Nrn. 3 und 4) 1797/09/13 FRAN 0004 Leonhard Bramer I Der ungläubige Thomas und Loth mit seinen Töchtern. I Diese Nr.: Loth mit seinen Töchtern Maße: 3 Schuh 9 Zoll hoch 5 '/z Schuh breit Anm..· Die Lose 3 und 4 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (58 fl für die Nrn. 3 und 4) 1800/00/00 BLBOE 0054 Bramer I Ein historisches Stück. I Mat.: auf Leinwand Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
349
1800/00/00 FRAN1 0020 Bramer (Leonh.) I Die Anbettung der Weißen. I Mat.: auf Holz Maße: 10 Zoll hoch, 12 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN2 0013 Bramer (Leonh.) I Ein Inneres von einem Pallast. Im ersten Plan siehet man einen Sultan mit seiner Favorite an der Tafel, welcher einen knieenden Sklaven zu bedrohen scheint. Mehrere im Hintergrund vertheilte Figuren, erheben dieses schöne Stück. I Mat.: auf Leinwand Maße: 21 Zoll hoch, 26 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Bramer, Leonard (Kopie nach) 1742/08/01 BOAN 0593 Bramer I Die Auffopfferung im Tempel, nach Bramer. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0320 Bramer I Offrande au Temple, d' apres Bramer. I Maße: Haut 1. pied 9. pouces, large 1. pied 6. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt
Bramer, Leonard (Manier) 1743/00/00 BWGRA 0062 Leonard Bramer I Wie der verlohrne Sohn von seinem Vater bey seiner Zurückkunft embrassiret wird, in die Manier von Leonard Bramer. I Maße: hoch 11 Zoll, breit 1 Fuß 2 Zoll Transakt.: Unbekannt
Brand (Brandt) 1765/03/27 FRKAL 0027 Brand I Deux tres-beaux & agreable pai'sage avec des figures parfaitement peint. I Maße: hauteur 22 pouces, largeur 30 pouces Transakt.: Verkauft (53.30 fl) Käufer: Brönner 1765/03/27 FRKAL 0028 Brand I Deux semblables du meme maitre [Brand], Tun peint dans le gout de Jean Both & l'autre dans celui de Huismann pas moins bien acheve. I Maße: hauteur 23 pouces, largeur 30 pouces Transakt.: Verkauft (49 fl) Käufer: Hoch 1771/05/06 FRAN 0026 Brand I Zwey Landschaften auf Tuch. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 16 Zoll, breit 20 Zoll Anm.: Die Lose 26 und 27 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friederich Armand von Uffenbach Transakt.: Verkauft (9.30 fl für die Nrn. 26 und 27) Käufer: Haupt Jäger 1771/05/06 FRAN 0027 Brand I Zwey Landschaften auf Tuch. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 16 Zoll, breit 20 Zoll Anm.: Die Lose 26 und 27 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friederich Armand von Uffenbach Transakt.: Verkauft (9.30 fl für die Nrn. 26 und 27) Käufer: Haupt Jäger 1775/09/09 HBBMN 0027 Brand, der Sohn I Zwo schöne Landschaften mit Figuren, glühend, keck, und dabey angenehm behandelt, auf Leinewand, in modernen vergoldeten schönen Rahmen, von Brand, dem Sohn. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 1 F l W Z, Breit 1 F 7 Vi Ζ Transakt.: Verkauft (31 Μ für jedes Gemälde) Käufer: Lilie 1777/02/21 HBHRN 0031 der Prager Brandt I Eine gebährende Frau mit Neben=Figuren, ein Nacht=Stück, vom Prager Brandt. I Maße: Höhe 2 Fuß 11 Zoll, Breite 4 Fuß 6 Zoll Transakt.: Unbekannt 1781/07/18 FRAN 0115 Brand I Eine Landschaft. I Pendant zu Nr. 116 Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 2 Schuh 4 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/07/18 FRAN 0116 Brand I dito [Ein Blumen=Stück] Compagn. I Pendant zu Nr. 115 Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 2 Schuh 4 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1784/09/27 FRAN 0058 Brandt I Zwey schöne Landschaften von Brandt. [Deux beaux paysages, par Brandt.] I Maße: 1 Schuh 9 350
GEMÄLDE
Zoll hoch, 2 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Freyherr von Berberich Transakt.: Verkauft (19 fl) Käufer: Kaller 1785/05/17 MZAN 0231 Brand I Ein paar Landschaften von Brand. [Deux paysages.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch, 2 Schuh 5 Vi Zoll breit Anm. : Die Lose 231 und 232 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (105 fl für die Nrn. 231 und 232) Käufer: Tischbein 1785/05/17 MZAN 0232 Brand I Ein paar Landschaften von Brand. [Deux paysages.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch, 2 Schuh 5 Vi Zoll breit Anm..· Die Lose 231 und 232 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (105 fl für die Nrn. 231 und 232) Käufer: Tischbein 1785/05/17 MZAN 0391 Brand I Ein Paar Landschaften von Brand. [Deux paysages.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 1 Schuh 11 Zoll hoch, 1 Schuh 7 Zoll breit Anm.: Die Lose 391 und 392 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (7.30 fl für die Nrn. 391 und 392) Käufer: Schneider Mahler 1785/05/17 MZAN 0392 Brand I Ein Paar Landschaften von Brand. [Deux paysages.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 1 Schuh 11 Zoll hoch, 1 Schuh 7 Zoll breit Anm.: Die Lose 391 und 392 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (7.30 fl für die Nrn. 391 und 392) Käufer: Schneider Mahler 1785/05/17 MZAN 0393 Brand I Noch zwey [Landschaften] von dem nämlichen Meister [Brand]. [Deux autres [paysages] par le meme [Brand].] I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 1 Schuh 4 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 10 Zoll breit Anm. : Die Lose 393 und 394 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (42.30 fl für die Nm. 393 und 394) Käufer: Hofr Handel 1785/05/17 MZAN 0394 Brand I Noch zwey [Landschaften] von dem nämlichen Meister [Brand]. [Deux autres [paysages] par le meme [Brand].] I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 1 Schuh 4 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 10 Zoll breit Anm. : Die Lose 393 und 394 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (42.30 fl für die Nrn. 393 und 394) Käufer: Hofr Handel 1785/05/17 MZAN 0540 Brand I Zwey Landschaften mit Vieh von Brand. [Deux paysages avec du betail.] I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Vieh Maße: 1 Schuh 11 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 6 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 540 und 541 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (50 fl für die Nrn. 540 und 541) Käufer: Schwanck 1785/05/17 MZAN 0541 Brand I Zwey Landschaften mit Vieh von Brand. [Deux paysages avec du betail.] I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Vieh Maße: 1 Schuh 11 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 6 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 540 und 541 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (50 fl für die Nrn. 540 und 541) Käufer: Schwanck 1785/05/17 MZAN 0869 Brand I Ein Paar Seestücke von Brand. [Des vües de mer.] I Diese Nr.: Ein Seestück Maße: 1 Schuh Vi Zoll hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Anm.: Die Lose 869 und 870 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (18 fl für die Nrn. 869 und 870) Käufer: Schwanck 1785/05/17 MZAN 0870 Brand I Ein Paar Seestücke von Brand. [Des vües de mer.] I Diese Nr.: Ein Seestück Maße: 1 Schuh Vi Zoll hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Anm.: Die Lose 869 und 870 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (18 fl für die Nrn. 869 und 870) Käufer: Schwanck 1785/05/17 MZAN 0960 Brand I Ein Paar Landschaften von Brand. [Deux paysages.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 1 Schuh 3 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 960 und 961 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (30 fl für die Nrn. 960 und 961) Käufer: Schwanck
1785/05/17 MZAN 0961 Brand I Ein Paar Landschaften von Brand. [Deux paysages.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 1 Schuh 3 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 960 und 961 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (30 fl für die Nrn. 960 und 961) Käufer: Schwanck
1790/08/25 FRAN 0076 Brand I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: hoch 24 Zoll, breit 32 Zoll Anm.: Die Lose 76 und 77 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (15 fl für die Nrn. 76 und 77) Käufer: Erlinger
1785/05/17 MZAN 1059 Brand I Ein Paar detto [Landschaften] vom jungen Brand. [Deux autres [paysages].] I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 6 Zoll hoch, 9 Zoll breit Anm.: Die Lose 1059 und 1060 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (14 fl für die Nrn. 1059 und 1060) Käufer: Schwanck
1790/08/25 FRAN 0077 Brand I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: hoch 24 Zoll, breit 32 Zoll Anm.: Die Lose 76 und 77 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (15 fl für die Nrn. 76 und 77) Käufer: Erlinger
1785/05/17 MZAN 1060 der junge Brand I Ein Paar detto [Landschaften] vom jungen Brand. [Deux autres [paysages].] I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 6 Zoll hoch, 9 Zoll breit Anm.: Die Lose 1059 und 1060 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (14 fl für die Nrn. 1059 und 1060) Käufer: Schwanck 1785/05/17 MZAN 1079 Brand I Ein Mutter Gotteskopf von Brand auf Kupfer. [La tete de la S. Vierge.] I Mat.: auf Kupfer Maße: 1 Schuh 3 Vi Zoll hoch, 1 Schuh breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (19.30 fl) Käufer: Lauterer
1791/01/10 HNAN 0024 Brand I Ein weiblich Portrait und das Portrait des Mahler Brand beyde v. ihm selbst gemacht. Rhm.: ohne. Leist.: - . I Diese Nr.: Ein weiblich Portrait Maße: Höhe 1 F. 11 Zoll, Brte. 1 F. 7 ZI. Anm.: Die Lose 24 und 25 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Meier Transakt.: Unbekannt 1791/01/10 HNAN 0025 Brand I Ein weiblich Portrait und das Portrait des Mahler Brand beyde v. ihm selbst gemacht. Rhm.: ohne. Leist.: - . I Diese Nr.: Das Portrait des Mahler Brand Maße: Höhe 1 F. 11 Zoll, Brte. 1 F. 7 ZI. Anm.: Die Lose 24 und 25 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Meier Transakt.: Unbekannt
1785/09/22 MZAN 0524 Brand I 2. Landschaften von Brand. I Diese Nr.: 1. Landschaft von Brand Anm.: Die Lose 524 und 525 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (2 fl für die Nrn. 524 und 525) Käufer: Can ν Lammerz
1792/08/20 KOAN 0019 Brandt I Zwey kleine Landschäftcher auf Tuch gemahlt von Brandt. I Diese Nr.: Ein kleines Landschäftchen Mat.: auf Leinwand Maße: 9 Vi Zoll hoch, 1 Schuh Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 19 und 20 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt
1785/09/22 MZAN 0525 Brand I 2. Landschaften von Brand. I Diese Nr.: 1. Landschaft von Brand Anm.: Dieses Los trägt im Katalog irrtümlicherweise die Nr. 1725. Die Lose 524 und 525 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (2 fl für die Nrn. 524 und 525) Käufer: Can ν Lammerz
1792/08/20 KOAN 0020 Brandt I Zwey kleine Landschäftcher auf Tuch gemahlt von Brandt. I Diese Nr.: Ein kleines Landschäftchen Mat.: auf Leinwand Maße: 9 Vi Zoll hoch, 1 Schuh Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 19 und 20 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt
1785/09/22 MZAN 0526 Brand I 2. Detto [Landschaften von Brand], I Diese Nr.: 1. Landschaft von Brand Anm.: Die Lose 526 und 527 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (3.16 fl für die Nrn. 526 und 527) Käufer: Can ν Lamerz
1792/08/20 KOAN 0056 Brandt \ Zwey Landschaften, wovon eine, eine Waßer=Gegend mit einem Schif, und Land mit einer Stadt, Bauren, Karrig und schönen Bäumen: Die andere einen Kavallerie=Zug aus dem Schloß vorstellet, staffirt von Brandt. I Diese Nr.: Eine Landschaft, eine Waßer=Gegend mit einem Schif,und Land mit einer Stadt, Bauren, Karrig, und schönen Bäumen vorstellet Maße: 2 Schuh 4 Vi Zoll hoch, 3 Schuh 1 Zoll breit Anm.: Die Lose 56 und 57 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt
1785/09/22 MZAN 0527 B r a n d I 2. Detto [Landschaften von Brand]. I Diese Nr.: 1. Landschaft von Brand Anm.: Die Lose 526 und 527 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (3.16 fl für die Nrn. 526 und 527) Käufer: Can ν Lamerz
1788/01/31 LZRST [0021] der junge Brand I 2 Landsch. vom jungen Brand, flüchtig aber gustos, Tuch. I Mat.: auf Leinwand Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Transakt.: Unbekannt
1792/08/20 KOAN 0057 Brandt I Zwey Landschaften, wovon eine, eine Waßer=Gegend mit einem Schif, und Land mit einer Stadt, Bauren, Karrig und schönen Bäumen: Die andere einen Kavallerie=Zug aus dem Schloß vorstellet, staffirt von Brandt. I Diese Nr.: Eine Landschaft, einen Kavallerie=Zug aus dem Schloß vorstellet Maße: 2 Schuh 4 Vi Zoll hoch, 3 Schuh 1 Zoll breit Anm.: Die Lose 56 und 57 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt
1788/09/01 KOAN 0031 Brandt I Pferde und Cameelen. [1 p[iece]. avec des chevaux & des chamaux, de Brant.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß, Breite 1 Fuß 4 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt
1793/00/00 NGWID 0045 Brandt der junge 1 Eine angenehme Landschaft mit Eremitagen, und Eremiten, vom jungen Brandt Schüler von seinem Vater. I Maße: 3 Schuh 6 Zoll hoch, 4 Schuh 9 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
1788/12/13 HB TEX 0151 Brandt zu Wien I Der heilige Sebastian, mit zwey Neben=Figuren. Ein Nachtstück, bey brennender Kerze vorgestellt. I Transakt.: Verkauft (2 M) Käufer: Lillie
1793/00/00 NGWID 0105 der junge Brand I Eine bergigte Landschaft, auf dessen hohen Felsen, eine schöne Burg sehr gut angebracht, vom jungen Brand. I Pendant zu Nr. 106 Maße: 1 Schuh 10 Zoll hoch, 2 Schuh 7 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
1787/03/01 HBLOT 0019 Brandt I Eine waldigte Landschaft, bey Sonnen=Untergang, mit Figuren. I Transakt.: Unbekannt ( I M )
1789/04/16 HB TEX 0121 Brandt I Eine Land- und Wassergegend, bey Sonnen Untergang mit Jäger, auf Leinew. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 10 Vi Zoll, breit 14 Zoll Transakt.: Verkauft (2.10 M) Käufer: Engel 1790/01/07 MUAN 1628 Brand I Ein Petruskopf, auf Leinwat, in einer metallisirten Ram. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 5 Zoll, Breite 1 Schuh 10 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
1793/00/00 NGWID 0106 der junge Brand I Ein Gegenstück von nemlichen Inhalt, Meister [vom jungen Brand] und Maaß. I Pendant zu Nr. 105 Maße: 1 Schuh 10 Zoll hoch, 2 Schuh 7 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0270 der junge Brandt I Eine Landschaft mit einigen Figuren, und schiffbaren Wasser, von jungen Brandt. I GEMÄLDE
351
Pendant zu Nr. 271 Maße: 9 Zoll hoch, 9 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0271 der junge Brandt i Zum Compagnon, eine in nemlicher Manier gemahlte Landschaft von obigem Meister [vom jungen Brandt] und Maaß. I Pendant zu Nr. 270 Maße: 9 Zoll hoch, 9 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00
NGWID
0325
derjunte
Brand I Ein Steinbruch mit
einigen Figuren und Vieh, vom jungen Brand. I Pendant zu Nr. 326 Maße: 2 Schuh 2 Zoll hoch, 3 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
Land=Gegend mit Staffage, eine der vier Tages=Zeiten vorstellend Anm.: Die Lose [A]54 bis [A]57 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV [A]0057 Der Wiener Brand I Vier kleinere dito [Land=Gegenden mit Staffage]. Die vier Tages=Zeiten vorstellend. Von Demselben [Wiener Brand]. I Diese Nr.: Eine kleinere Land=Gegend mit Staffage, eine der vier Tages=Zeiten vorstellend Anm.: Die Lose [A]54 bis [A]57 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1793/00/00 NGWID 0326 der junge Brand I Zum Gegenstück, ein desgleichen Inhalts und Manier, von obigem Meister [vom jungen Brand] und Maaß. I Pendant zu Nr. 325 Maße: 2 Schuh 2 Zoll hoch, 3 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
1794/09/10 HBGOV [A]0058 Der Wiener Brand I Vier noch kleinere dito [Land=Gegenden mit Staffage]. Von Demselben [Wiener Brand], I Diese Nr.: Eine noch kleinere Land=Gegend mit Staffage Anm.: Die Lose [A]58 bis [A]61 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1793/00/00 NGWID 0431 der junge Brand I Eine ausnehmend warme und fleißig ausgeführte bergigte Landschaft mit einigen Figuren, Vieh und Wasser, vom jungen Brand. I Pendant zu Nr. 432 Maße: 2 Schuh 4 Zoll hoch, 3 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
1794/09/10 HBGOV [A]0059 Der Wiener Brand I Vier noch kleinere dito [Land=Gegenden mit Staffage]. Von Demselben [Wiener Brand]. I Diese Nr.: Eine noch kleinere Land=Gegend mit Staffage Anm.: Die Lose [A]58 bis [A]61 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1793/00/00 NGWID 0432 der Junge Brand I Zum Gegenstück, eine nicht minder schöne Landschaft, mit sehr schönem Baumschlag staffiert, vom nemlichen Meister [vom jungen Brand] und Maaß. I Pendant zu Nr. 431 Maße: 2 Schuh 4 Zoll hoch, 3 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
1794/09/10 HBGOV [A]0060 Der Wiener Brand I Vier noch kleinere dito [Land=Gegenden mit Staffage]. Von Demselben [Wiener Brand], I Diese Nr.: Eine noch kleinere Land=Gegend mit Staffage Anm.: Die Lose [A]58 bis [A]61 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1794/09/10 HBGOV [A]0050 Der Wiener Brand I Vier kleine Land=Gegenden mit Staffage. Vom Wiener Brand. Quer Ovalen Formats. I Diese Nr.: Eine kleine Land=Gegend mit Staffage Format: queroval Maße: Hoch 1 14 Zoll, breit 2 Zoll Anm.: Die Lose [A]50 bis [A]53 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1794/09/10 HBGOV [A]0061 Der Wiener Brand I Vier noch kleinere dito [Land=Gegenden mit Staffage]. Von Demselben [Wiener Brand]. I Diese Nr.: Eine noch kleinere Land=Gegend mit Staffage Anm.: Die Lose [A]58 bis [A]61 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1794/09/10 HBGOV [A]0051 Der Wiener Brand I Vier kleine Land=Gegenden mit Staffage. Vom Wiener Brand. Quer Ovalen Formats. I Diese Nr.: Eine kleine Land=Gegend mit Staffage Format: queroval Maße: Hoch 1 14 Zoll, breit 2 Zoll Anm.: Die Lose [A]50 bis [A]53 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV [A]0052 Der Wiener Brand \ Vier kleine Land=Gegenden mit Staffage. Vom Wiener Brand. Quer Ovalen Formats. I Diese Nr.: Eine kleine Land=Gegend mit Staffage Format: queroval Maße: Hoch 1 Vt Zoll, breit 2 Zoll Anm.: Die Lose [A]50 bis [A]53 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV [A]0053 Der Wiener Brand I Vier kleine Land=Gegenden mit Staffage. Vom Wiener Brand. Quer Ovalen Formats. I Diese Nr.: Eine kleine Land=Gegend mit Staffage Format: queroval Maße: Hoch 1 14 Zoll, breit 2 Zoll Anm.: Die Lose [A]50 bis [A]53 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV [A]0054 Der Wiener Brand I Vier kleinere dito [Land=Gegenden mit Staffage]. Die vier Tages=Zeiten vorstellend. Von Demselben [Wiener Brand], I Diese Nr.: Eine kleinere Land=Gegend mit Staffage, eine der vier Tages=Zeiten vorstellend Anm.: Die Lose [A]54 bis [A]57 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV [A]0055 Der Wiener Brand I Vier kleinere dito [Land=Gegenden mit Staffage], Die vier Tages=Zeiten vorstellend. Von Demselben [Wiener Brand], I Diese Nr.: Eine kleinere Land=Gegend mit Staffage, eine der vier Tages=Zeiten vorstellend Anm.: Die Lose [A]54 bis [A]57 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV [A]0056 Der Wiener Brand I Vier kleinere dito [Land=Gegenden mit Staffage]. Die vier Tages=Zeiten vorstellend. Von Demselben [Wiener Brand]. I Diese Nr.: Eine kleinere 352
GEMÄLDE
1794/09/10 HBGOV [A]0062 Der Wiener Brand I Acht dito [Land=Gegenden mit Staffage] ganz kleine. Von Demselben [Wiener Brand]. I Diese Nr.: Eine ganz kleine Land=Gegend mit Staffage Anm.: Die Lose [A]62 bis [A]69 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV [A]0063 Der Wiener Brand I Acht dito [Land=Gegenden mit Staffage] ganz kleine. Von Demselben [Wiener Brand]. I Diese Nr.: Eine ganz kleine Land=Gegend mit Staffage Anm.: Die Lose [A]62 bis [A]69 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV [A]0064 Der Wiener Brand I Acht dito [Land=Gegenden mit Staffage] ganz kleine. Von Demselben [Wiener Brand], I Diese Nr.: Eine ganz kleine Land=Gegend mit Staffage Anm.: Die Lose [A]62 bis [A]69 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV [A]0065 Der Wiener Brand I Acht dito [Land=Gegenden mit Staffage] ganz kleine. Von Demselben [Wiener Brand]. I Diese Nr.: Eine ganz kleine Land=Gegend mit Staffage Anm.: Die Lose [A]62 bis [A]69 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV [A]0066 Der Wiener Brand I Acht dito [Land=Gegenden mit Staffage] ganz kleine. Von Demselben [Wiener Brand], I Diese Nr.: Eine ganz kleine Land=Gegend mit Staffage Anm.: Die Lose [A]62 bis [A]69 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV [A]0067 Der Wiener Brand I Acht dito [Land=Gegenden mit Staffage] ganz kleine. Von Demselben [Wiener Brand]. I Diese Nr.: Eine ganz kleine Land=Gegend mit Staffage Anm.: Die Lose [A]62 bis [A]69 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV [A]0068 Der Wiener Brand I Acht dito [Land=Gegenden mit Staffage] ganz kleine. Von Demselben [Wiener Brand]. I Diese Nr.: Eine ganz kleine Land=Gegend mit Staffage
Anm.: Die Lose [A]62 bis [A]69 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV [AJ0069 Der Wiener Brand I Acht dito [Land=Gegenden mit Staffage] ganz kleine. Von Demselben [Wiener Brand]. I Diese Nr.: Eine ganz kleine Land=Gegend mit Staffage Anm.: Die Lose [A]62 bis [A]69 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/08/00 HBPAK 0030 Brandt, von Frankfurt I Zwey Judenschulen. Große Compositionen, und durch halbe Figuren vorgestellt. Nachtstücke. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine Judenschule Mat.: auf Holz Maße: Höhe 17 Vi Zoll, Breite 22 Vi Zoll Anm.: Die Lose 30 und 31 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/08/00 HBPAK 0031 Brandt, von Frankfurt I Zwey Judenschulen. Große Compositionen, und durch halbe Figuren vorgestellt. Nachtstücke. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine Judenschule Mat.: auf Holz Maße: Höhe 17 Vi Zoll, Breite 22 Vi Zoll Anm.: Die Lose 30 und 31 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0127 Brandt I Zwey waldigte Landschaften, mit Figuren. Ganz in der Manier von Ruysdaal. Auf Holz. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine waldigte Landschaft, mit Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 4 Vi Zoll, breit 7 Zoll Anm.: Die Lose 127 und 128 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0128 Brandt I Zwey waldigte Landschaften, mit Figuren. Ganz in der Manier von Ruysdaal. Auf Holz. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine waldigte Landschaft, mit Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 4 Vi Zoll, breit 7 Zoll Anm.: Die Lose 127 und 128 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/05/14 KOAN 0037 Brandt I Une begasse. I Mat.: auf Leinwand Maße: Η. 1 pied 2 p. L. 11 pouc. Verkäufer: de Bors d'Overen Transakt.: Unbekannt 1798/05/14 KOAN 0041 Brandt I Trois petits paysages, par Brandt, sur ferblanc. I Mat.: auf Weißblech Maße: H. 4 Vi pouc. L. 5 Vi pouc. Verkäufer: de Bors d'Overen Transakt.: Unbekannt 1798/12/10 WNAN 0010 Brand I Zwey klein skizzirte Landschaften. I Mat.: auf Holz Verkäufer: Prof Adam Transakt.: Unbekannt
Brand (Brandt) (und Hamilton) 1786/11/11 HBRMS 0073 Hamilton; Brandt \ Eine wilde Schweinsjagd in einer Landschaft, ganz herrlich gemahlt; die Figuren, als: eine große wilde Sau, die drey Hunde verfolgen, sind von Hamilton, und die Landschaft von Brandt. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 21 Zoll, Breite 24 Zoll Transakt.: Unbekannt
Brand (Brandt) (und Swebach, J.F J.) 1796/11/02 HBPAK 0114 Brandt; Sweback I Eine Landschaft, wo im Horizont beladene Fracht=Wagen. Im Vordergrunde befinden sich einige Reuter und einige Fußgänger. Ganz in dem Ruysdaalschen Geschmack. Auf Holz. Goldn. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Vi Zoll, breit 19 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt
Brand (Brandt) (Kopie nach) 1764/08/25 FRAN 0046 Brand I Le Portrait du Comte de Cobentzl d'apres Brand. I Maße: haut 1 pied 5 pouces sur 1 pied de large Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt
Brand, Christian Hilfgott 1776/00/00 WZTRU 0234 Christianus Hülfgott Brand I Ein Stück 1 Schuhe, 3 Zoll hoch, 1 Schuhe, 5 Zoll breit von Christianus Hülfgott Brand, stellet vor einen Niedergang der Sonne in einer an-
genehmen Landschaft, woselbst ein und andere Figuren mit gutem Verstände und Harmonie zu ersehen. I Pendant zu Nr. 235 von Chr. Dietrich Maße: 1 Schuhe 3 Zoll hoch, 1 Schuhe 5 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (12 fl Schätzung) 1779/09/27 FRNGL 0524 der alte Brandt I Ein Mondschein, meisterhaft ausgearbeitet, vom alten Brandt. [Un clair de lune, chef d'oeuvre, par le vieux Brandt.] I Pendant zu Nr. 525 Maße: 1 Schuh hoch, 1 Schuh 5 Zoll breit Transakt.: Verkauft (25 fl für die Nrn. 524 und 525) Käufer: Brentano Sandgaß 1779/09/27 FRNGL 0525 der alte Brandt I Das Gegenbild zu obigem, eine felsigte Landschaft mit schönem Licht und Schatten, von nemlichem Meister [vom alten Brandt] und Maas. [Le pendant du precedent, un paysage couvert de rochers, le clair obscur tres bien observe, par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 524 Maße: 1 Schuh hoch, 1 Schuh 5 Zoll breit Transakt.: Verkauft (25 fl für die Nm. 524 und 525) Käufer: Brentano Sandgaß 1779/09/27 FRNGL 0542 der alte Brandt I Eine baumigte Landschaft in die Höhe gemalt, vom alten Brandt. [Un paysage couvert d'arbres, par le vieux Brandt.] I Pendant zu Nr. 543 Maße: 8 Zoll hoch, 6 Zoll breit Transakt.: Verkauft (25.30 fl für die Nrn. 542 und 543) Käufer: Ettling 1779/09/27 FRNGL 0543 der alte Brandt I Eine dergleichen schöne baumigte Landschaft zum Compagnon von nemlichem Meister [vom alten Brandt] und Maas. [Le pendant du precedant, meme objet [un paysage couvert d'arbres], par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 542 Maße: 8 Zoll hoch, 6 Zoll breit Transakt.: Verkauft (25.30 fl für die Nm. 542 und 543) Käufer: Ettling 1781/00/00 WZAN 0234 Christian Hülfgott Brand I Ein Stück 3 Schuhe, 3 Zoll hoch, 1 Schuhe, 5 Zoll breit von Christian Hülfgott Brand, stellet den Niedergang der Sonne in einer angenehmen Landschaft vor, wo ein und andere mit gutem Verstände und Harmonie verfertige Figuren zu sehen vorkommen. I Pendant zu Nr. 235 von Chr. Dietrich Maße: 3 Schuhe 3 Zoll hoch, 1 Schuhe 5 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1782/02/18 RGBZN 0023 der alte Brand I Zwey Landschaften, vom alten Brand. I Transakt.: Unbekannt (14 fl) 1786/11/11 HBRMS 0048 C.N. Brand I Zwey ungemein herrliche Landschaften, mit Ruinen, Wasserfälle und schönen Figuren, mit großen Verstand meisterhaft ausgeführt, und Capitalstücke. I Diese Nr.: Eine ungemein herrliche Landschaft, mit Ruinen, Wasserfälle und schönen Figuren Maße: Höhe 27 Zoll, Breite 24 Zoll Anm.: Die Lose 48 und 49 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/11/11 HBRMS 0049 C.N. Brand I Zwey ungemein herrliche Landschaften, mit Ruinen, Wasserfälle und schönen Figuren, mit großen Verstand meisterhaft ausgeführt, und Capitalstücke. I Diese Nr.: Eine ungemein herrliche Landschaft, mit Ruinen, Wasserfälle und schönen Figuren Maße: Höhe 27 Zoll, Breite 24 Zoll Anm.: Die Lose 48 und 49 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1788/04/07 FRFAY 0028 der alte Brand I Zwey Landschaften von angenehmer Färbung und fleißiger Ausführung, vom alten Brand. Auf Tuch. I Diese Nr.: Eine Landschaft von angenehmer Färbung und fleißiger Ausführung Mat.: auf Leinwand Maße: 10 % Zoll hoch, und 14 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 28 und 29 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (13 fl für die Nm. 28 und 29) Käufer: Levi ν M[annheim] 1788/04/07 FRFAY 0029 der alte Brand I Zwey Landschaften von angenehmer Färbung und fleißiger Ausführung, vom alten Brand. Auf Tuch. I Diese Nr.: Eine Landschaft von angenehmer Färbung und fleißiger Ausführung Mat.: auf Leinwand Maße: 10 % Zoll hoch, und 14 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 28 und 29 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (13 fl für die Nm. 28 und 29) Käufer: Levi ν M[annheim] GEMÄLDE
353
1789/00/00 MM AN 0172 C.H. Brand der ältere I Eine Landschaft, auf Leinw. 1 Fuß 8 Zoll hoch und 2 Fuß 1 Zoll breit, vom C.H. Brand dem altern. [Un paysage, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 8 Zoll hoch, 2 Fuß 1 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (11 fl) 1789/00/00 MM AN 0185 C.H. Brand der ältere I Der Kuss Judä, auf Holz, 2 Fuß hoch und 2 Fuß 7 Zoll breit, vom C.H. Brand dem ältern. [Le Baiser de Juda, sur bois.] I Mat. : auf Holz Maße: 2 Fuß hoch, 2 Fuß 7 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (50 fl) 1789/00/00 MMAN 0227 C.H. Brand der ältere I Zwei Landschaften, auf Leinw. jede 2 Fuß 3 Zoll hoch und 1 Fuß 6 Zoll breit, vom C.H. Brand dem ältern. [Deux paysages, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 3 Zoll hoch, 1 Fuß 6 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (25 fl) 1789/00/00 MMAN 0301 C.H. Brand der ältere I Eine Landschaft, auf Leinwand, 1 Fuß 6 Zoll hoch und 2 Fuß breit, vom C.H. Brand dem ältern. [Un paysage, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 6 Zoll hoch, 2 Fuß breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (50 fl) 1789/00/00 MMAN 0356 C.H. Brand der ältere I Ein Landschäftchen, auf Leinw., 1 Fuß 4 Zoll hoch und 1 Fuß 2 Zoll breit, vom C.H. Brand dem ältern. [Un petit paysage, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 4 Zoll hoch, 1 Fuß 2 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt 1790/10/18 LZRST 1869 Brandt der ältere I Eine schöne Landschaft, von Brandt dem ältem, ein Fluss an einem bewachsenen Felsen hin, im Vordergrunde einige Marktschiffe nebst vielen Figuren. 24 Zoll hoch, 28 Zoll breit, in schwarzem Rahm mit vergold. Leiste. I Maße: 24 Zoll hoch, 32 Zoll breit Transakt.: Unbekannt (9 Rt) 1790/10/18 LZRST 1870 Brandt der ältere I Eine andere schöne Landschaft von eben diesem Meister [Brandt dem ältern], mit eben diesen Gegenständen [ein Fluss an einem bewachsenen Felsen], nur anders behandelt, hat einige unbedeutende Risse, von gleichem Maas und [schwarzem] Rahm [mit vergoldet. Leiste]. I Maße: 24 Zoll hoch, 32 Zoll breit Transakt.: Unbekannt (7.12 Rt) 1791/09/26 FRAN 0196 der alte Brand I Zwey fleißige Landschaften vom alten Brand. I Diese Nr.: Eine fleißige Landschaft Maße: 11 Zoll breit, 10 Zoll hoch Anm.: Die Lose 196 und 197 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0197 der alte Brand I Zwey fleißige Landschaften vom alten Brand. I Diese Nr.: Eine fleißige Landschaft Maße: 11 Zoll breit, 10 Zoll hoch Anm.: Die Lose 196 und 197 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0022 der alte Brandt I Eine auf Marmor gemahlte reizende Landschaft, von alten Brandt, ein Schüler des Agricola. I Pendant zu Nr. 23 Mat.: auf Marmor Maße: 2 Schuh hoch, 1 Schuh 8 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0023 der alte Brandt I Zum Gegenstück eine nicht minder schön staffierte Landschaft von obigem Meister [alten Brandt] und Maaß. I Pendant zu Nr. 22 Maße: 2 Schuh hoch, 1 Schuh 8 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt. : Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0046 der alte Brandt I Eine mit angenehmer Wärme und guten Staffage vereinbarte Landschaft vom alten Brandt. I Pendant zu Nr. 47 Maße: 3 Schuh 6 Zoll hoch, 5 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0047 Brandt der Ältere I Zum Gegenstück eine nicht minder schöne Landschaft von nemlicher Hand [vom alten Brandt] und Maaß. I Pendant zu Nr. 46 Maße: 3 Schuh 6 Zoll hoch, 5 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 354
GEMÄLDE
1793/00/00 NGWID 0089 der alte Brand I Eine schöne Landschaft mit Vieh staffiert vom alten Brand. I Pendant zu Nr. 90 von Anonym Maße: 2 Schuh hoch, 2 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0290 der alte Brand I Eine angenehme Landschaft, mit einigen Figuren, und fließendem Wasser, vom alten Brand. I Pendant zu Nr. 291 Maße: 2 Schuh 9 Zoll hoch, 3 Schuh 5 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0291 der alte Brand I Zum Gegenstück, eine nicht minder schöne Landschaft, mit sehr guten Baumschlag staffiert, vom nemlichen Meister [vom alten Brandt] und Maaß. I Pendant zu Nr. 290 Maße: 2 Schuh 9 Zoll hoch, 3 Schuh 5 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 FGAN [B]0189 Christian Brand I Zwo Landschaften mit einer Windmühle, stafiert mit vielen Figuren, gemalt auf Tuch. I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 1 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt (88 fl) 1794/01/20 LZRST 5867 der alte Brandt I 2 Stk. schöne Landschaften, vom alten Brandt, die eine ein Dorf, die andere eine felsigte Gegend, beyde mit ländlichen Figuren, 19 Zoll breit, 16 Zoll hoch, auf Holz, in schwarzem Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: 19 Zoll breit, 16 Zoll hoch Transakt.: Verkauft oder Unverkauft (14 Gr) Käufer: R[ost] 1799/00/00 WZAN 0019 Christian Hülfgott Brandl Zwey Landschaften, von Christian Hülfgott Brand. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 5 Zoll breit 1 Schuh 7 Zoll Anm.: Die Lose 19 und 20 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0020 Christian Hülfgott Brandl Zwey Landschaften, von Christian Hülfgott Brand. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 5 Zoll breit 1 Schuh 7 Zoll Anm.: Die Lose 19 und 20 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Brand, Christian Hilfgott (und Hamilton) 1779/09/27 FRNGL 0222 Hamilton; der alte Brandl Eine. waldigte Landschaft, worinnen eine sehr natürlich und fleißig ausgearbeitetes wildes Schwein in vollem Lauf abgebildet, von Hamilton, und die Landschaft vom alten Brand. [Un paysage couvert de montagnes, avec un sanglier courant, peint au natural par Hamilton, le paysage par le vieux Brand.] I Pendant zu Nr. 223 Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch, 2 Schuh 1 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (61 fl für die Nrn. 222 und 223) Käufer: Hüsgen 1779/09/27 FRNGL 0223 Hamilton; der alte Brandl Das Gegenbild hierzu, ein majestätischer Löwe in Ruinen von alten Gebäuden, von beiden Meistern [Hamilton und vom alten Brand] und Maas. [Le pendant du precedent, un Lion fier entre des ruines, par les deux maitres.] I Pendant zu Nr. 222 Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch, 2 Schuh 1 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (61 fl für die Nrn. 222 und 223) Käufer: Hüsgen 1784/08/02 FRNGL 0066 Hamilton; der alte Brandl Ein junger nach dem Leben fürtreflicher abgebildeter Löwe, von Hamilton, und die Landschaft darhinter vom alten Brand. I Maße: 17 Zoll breit, 13 Zoll hoch Verkäufer: D Transakt.: Verkauft (25 fl) Käufer: von Dessau
Brand, Christian Hilfgott (und Hamilton, P.F.) 1799/00/00 WZAN A0134 Christian Brand; Ferdinand Hamilton I Ein Garten mit zween Hunden, von welchen einer auf einem blauen sammetenen Küssen liegt. Der Garten von Christian Brand, und die Hunde von Ferdinand Hamilton. Auf Leinwand. I Mat.: auf
Leinwand Maße: hoch 3 Schuh Vi Zoll breit 3 Schuh 11 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Luft ist sehr mit Wolken überzogen, und der auf der See sich verbreitende Nebel ist hier wohl imitiret. I Pendant zu Nr. 272a Maße: 1 Schuhe 3 Zoll hoch, 1 Schuhe 7 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Brand, Johann Christian
1781/00/00 WZAN 0272a Johann Christian Brand I Der Kompagnon zu Nro 272 ist eine eben dergleichen vorgestellte und mit nämlichen Geschmack des Meisters [Johann Cristian Brand] verfertigete Gegend. I Pendant zu Nr. 272 Anm.: Im Katalog tragen zwei Lose die Nummer 272. Diesem Los wurde deshalb zur Unterscheidung die Nummer 272a gegeben. Transakt.: Unbekannt
1776/00/00 WZTRU 0261 Johann Christian Brand I Ein Stück 1 Schuhe, 3 Zoll hoch, 1 Schuhe, 6 Zoll breit von Johann Christian Brand, stellet vor eine sehr heitere und angenehme Landschaft, worinn ein Fluß zwischen Waldungen hervorströmet; im Vorgrund aber ersiehet man ein Schiff, worin verschiedene Figuren in bestem Geschmack verfertiget. Uberhaupt herrschet hierin eine freye und ungezwungene Nachahmung der Natur. I Pendant zu Nr. 262 Maße: 1 Schuhe 3 Zoll hoch, 1 Schuhe 6 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (6 fl Schätzung) 1776/00/00 WZTRU 0262 Johann Christian Brand I Compagnion zu Nro. 261 von gleicher Güte und Stärke des obigen Meisters [Johann Christian Brand]. I Pendant zu Nr. 261 Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (6 fl Schätzung) 1776/00/00 WZTRU 0272 Johann Christian Brand I Ein Stück 1 Schuhe, 3 Zoll hoch, 1 Schnhe, 7 Zoll breit von Johann Christian Brand, stellet vor eine felsigte Seegegend, wo ein Schiff mit einigen Figuren gegen dem Lande scheinet zuzulaufen, woselbsten auf solchen im Vorgrunde ein und andere wohlausgeführte stehende Figuren zu ersehen sind: die Luft ist sehr mit Wolken überzogen der auf die See hin sich verbreitende Nebel ist wohl hierinn imitiret. I Pendant zu Nr. 272a Maße: 1 Schuhe 3 Zoll hoch, 1 Schuhe 7 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (10 fl Schätzung) 1776/00/00 WZTRU 0272a Johann Christian Brand I Compagnion zu Nro. 272 eine eben dergleichen vorstellende Gegend mit nämlichen Gusto des Meisters [Johann Cristian Brand] verfertiget. I Pendant zu Nr. 272 Anm.: Im Katalog tragen zwei Lose die Nummer 272. Diesem Los wurde deshalb zur Unterscheidung die Nummer 272a gegeben. Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (10 fl Schätzung) 1776/00/00 WZTRU 0274 Johann Christian Brand I Ein Stück 1 Schuhe, 5 Zoll hoch, 1 Schuhe, 2 Zoll breit von Johann Christian Brand, stellet vor eine an einem Flusse im Busche liegende Rudera, wobey ein und andere Figuren im Grunde mit guter Practic zu ersehen. I Pendant zu Nr. 275 Maße: 1 Schuhe 5 Zoll hoch, 1 Schuhe 2 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (6 fl Schätzung) 1776/00/00 WZTRU 0275 Johann Christian Brandl Compagnion zu Nro. 274 von nämlichem Gusto und Stärke des obigen Meisters [Johann Christian Brand]. I Pendant zu Nr. 274 Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (6 fl Schätzung) 1781/00/00 WZAN 0261 Johann Christian Brand I Ein Stück 1 Schuhe, 3 Zoll hoch, 1 Schuhe, 10 Zoll breit, von Johann Christian Brand, stellet eine sehr heitere und angenehme Landschaft vor, wo ein Fluß zwischen Waldungen hervorströmet; im Vorgrunde aber sieht man ein Schiff, worinn verschiedene in beßtem Geschmack verfertigte Figuren sind. Ueberhaupt herrschet hierinn eine freye und ungezwungene Nachahmung der Natur. I Pendant zu Nr. 262 Maße: 1 Schuhe 3 Zoll hoch, 1 Schuhe 10 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0262 Johann Christian Brand I Kompagnon zu Nro 261 ist von gleicher Güte und Stärke des obigen Meisters [Johann Christian Brand], I Pendant zu Nr. 261 Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0272 Johann Christian Brand I Ein Stück 1 Schuhe, 3 Zoll hoch, 1 Schnhe [sie], 7 Zoll breit, von Johann Christian Brand, stellet eine felsigte Seegegend vor, wo ein Schiff mit einigen Figuren gegen dem Lande zuzulaufen scheint; im Vorgrunde ist ein und andere wohl ausgeführte Figur [sie] stehend zu sehen: die
1781/00/00 WZAN 0274 Johann Christian Brand I Ein Stück 1 Schuhe, 5 Zoll hoch, 1 Schuhe, 2 Zoll breit, von Johann Christian Brand, stellet eine an einem Fluße im Busche liegende Rudera vor, wobey im Grunde ein und andere Figuren mit guter Praktik zu ersehen sind. I Pendant zu Nr. 275 Maße: 1 Schuhe 5 Zoll hoch, 1 Schuhe 2 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0275 Johann Christian Brand I Kompagnon zu Nro 274 ist vom nämlichen Gusto und Stärke des obigen Meisters [Johann Christian Brand]. I Pendant zu Nr. 274 Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 FGAN [B]0047 Joh. Christ. Brand I Zwo Landschaften, mit Vieh stafiert, auf Tuch gemalt. I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Schuh 2 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 6 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt (33 fl)
Brand, Johann Christian (und Querfurt, A.) 1786/11/11 HBRMS 0017 J.C. Brand; Querfurt I Zwey sehr angenehme Landschaften mit herrlichen Baumschlägen, reich von Figuren, die von Querfurt staffirt sind, ein paar Capitalstücke und meisterhaft behandelt. I Diese Nr.: Eine sehr angenehme Landschaft mit herrlichen Baumschlägen, reich von Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 22 Zoll, Breite 27 Zoll Anm.: Die Lose 17 und 18 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/11/11 HBRMS 0018 /. C. Brand: Querfurt I Zwey sehr angenehme Landschaften mit herrlichen Baumschlägen, reich von Figuren, die von Querfurt staffirt sind, ein paar Capitalstücke und meisterhaft behandelt. I Diese Nr.: Eine sehr angenehme Landschaft mit herrlichen Baumschlägen, reich von Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 22 Zoll, Breite 27 Zoll Anm.: Die Lose 17 und 18 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Brandenberg, Johannes 1776/00/00 WZTRU 0333 Johannes Brandenberg I Ein Stück 10 Zoll hoch, 5 Vi Zoll breit von Johannes Brandenberg, stellet einige Personen (welche miteinander unter einem Thore zu sprechen vorgestellet sind) vor, worinn ein schön einfallendes Licht und gute Zeichnung observiret ist. I Maße: 10 Zoll hoch, 5 Vi Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (8 fl Schätzung) 1781/00/00 WZAN 0333 Johann Brandenberg I Ein Stück 10 Zoll hoch, 5 V4 Zoll breit, von Johann Brandenberg, zeiget einige unter einem Thore mit einander sprechende Personen. Hierinn ist ein schön einfallendes Licht und gute Zeichnung angebracht. I Maße: 10 Zoll hoch, 5 Vi Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Brandes 1799/01/07 WW AN 0073 Brandes I Die Bathseba im Bade. I Verkäufer: Frandorff Transakt.: Unbekannt
Brandi, Domenico (Micco) 1786/05/02 NGAN 0415 Domenico Brandi I Ein Hund und zwey Kazen. Rund. I Format: rund Maße: im Durchschnitt 2 Schuh GEMÄLDE
355
6 Zoll Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (3.18 fl) Käufer: ν Pez
Brandl, Giacinto 1768/08/16 KOAN 0071 Hyacintho Brande I Creutzigung Christi von Hyacintho Brande. I Maße: Höhe 1 Fuß 10 Zoll, Breite 2 Fuß 5 Zoll Verkäufer: Freyherr von Kaas Transakt.: Unbekannt 1787/01/15 LZRST 0035 Hyacinth Brandy I Die Marter des heiligen Bartholomaeus, ein schönes Bild mit 3 Halbfiguren, sehr gut conservirt von Hyacinth Brandy. 4 Fuss 6 Zoll h. und 3 Fuss 6 Z. br. in schmalen goldenen Rahm. I Maße: 4 Fuß 6 Zoll hoch, 3 Fuß 6 Zoll breit Verkäufer: Richter Transakt.: Unbekannt
Brandl, Lazaro [Nicht identifiziert] 1768/08/16 KOAN 0075 Lazaro Brandi I Petrus Dalcantra der H. v. Lazaro Brandi. I Maße: Höhe 2 Fuß, Breite 2 Fuß 6 Zoll Verkäufer: Freyherr von Kaas Transakt.: Unbekannt
Brandl, Maximilian Ignaz 1742/08/01 BOAN 0474 der Junge Brandet I Vorstellung einer Gallerie. Original vom Jungen Brandel. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0296 Brandel le jeune I Une Gallerie, par Brandel le jeune. I Maße: Haut 1. pied 9. pou., large 2. pieds 5. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0041 Brandl le Fils I Vue de l'Adige, beau Paysage, oü se voit ä droite une Chaumiere entouree de grands arbres, plusieurs figures, entre autre un Homme qui ramene de l'abreuvoir un Cheval seile, le milieu est rempli de Betail, qui est dans l'eau, le fond de la gauche est termine par la vue d'un Chateau. [Ces deux Tableaux sont graves, & dedie ä S.E. Mgr. le Comte Grand Chambellan de Pologne, par F. Dequevawiller. Iis sont d'un lointain le mieux minage, peint sur bois.] I Pendant zu Nr. 42 Mat.: auf Holz Maße: 11 pouces de haut, sur 16 pouces de large Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 42 und beziehen sich auf die Nrn. 41 und 42. Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0042 Brandl le Fils I Vue de Landeck, beau Paysage, pendant du precedent, oü se voit ä droite des Rochers en perspective, dans le bas contre le milieu, une Femme & un chien passant l'eau, au milieu un Homme ä cheval un fouet ä la main, faisant boire du betail, dans la Riviere, dans le fond la vue du Chateau, la gauche est terminee par des gros arbres, entre est un homme ä cheval qui mene une Charette attelee de deux chevaux, deux Femmes sont ä cöte, une assise & l'autre de bout un paniers ä son bras. Ces deux Tableaux sont graves, & dedie ä S.E. Mgr. le Comte Grand Chambellan de Pologne, par F. Dequevawiller. lis sont d'un lointain le mieux menage, peint sur bois. I Pendant zu Nr. 41 Mat.: auf Holz Maße: 11 pouces de haut, sur 16 pouces de large Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt
Brandl, Petr 1723/00/00 PRAN [A]0095 Brandl I Venus / vom Brandl. Compagnion No [A] 103. I Pendant zu Nr. [A]103 von M. Gundelach Maße: Höhe 1 Schuh 1 Vi Zoll, Breite 1 Vi Schuh Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN 0076 Brandel I Zwey Kindlein mit Früchten / vom Brandel / im Metall=Rahme. I Diese Nr.: Ein Kindlein mit Früchten Maße: Höhe 3 Vi Schuh 1 Zoll, Breite 4 Vi Schuh 4 Zoll Anm.: Die Lose 76 und 77 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 356
GEMÄLDE
1723/00/00 PRAN 0077 Brandel I Zwey Kindlein mit Früchten / vom Brandel / im Metall=Rahme. I Diese Nr.: Ein Kindlein mit Früchten Maße: Höhe 3 Vi Schuh 1 Zoll, Breite 4 Vi Schuh 4 Zoll Anm.: Die Lose 76 und 77 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1744/05/20 FRAN 0112 Brandel I 2 Landschäfftgen. I Diese Nr.: 1 Landschäfftgen Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh, Breite 1 Schuh 8 Zoll Anm.: Die Lose 112 und 113 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1744/05/20 FRAN 0113 Brandel! 2 Landschäfftgen. I Diese Nr.: 1 Landschäfftgen Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh, Breite 1 Schuh 8 Zoll Anm.: Die Lose 112 und 113 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1772/00/00 BSFRE 0010 Brandel (Pierre) I La Tete d'un vieillard ä Barbe, vigoureusement peint. Cadre d'ore. I Mat.: auf Leinwand Maße: haut de 16 Vx sur 12 !4 de large Transakt.: Unbekannt 1778/09/28 FRAN 0298 Brandell I Ein Kopf mit langem Bart. [Une tete avec une longue barbe.] I Maße: 1 Vi Schuh breit, 1 Schuh 10 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (14 fl) Käufer: Nothnagel 1778/09/28 FRAN 0479 Brandell I Ein Portrait des Admirals Ruyters. [Le Portrait de Γ Amirai Ruyters.] I Maße: 1 Schuh 10 Zoll breit, 2 Schuh 3 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (16 fl) Käufer: Dr Hartzberg 1787/00/00 HB AN 0278 Piter Brandel I Der Holländische Admiral Ruyter, bewaffnet, mit kriegerischem Gesicht. Halbe Figur. Von sehr schöner Zeichnung, freyen und meisterhaften Mahlerey, und starkem grünlichen Colorit. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 27 Vi Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Verkauft (21 M) Käufer: Fesser 1790/01/07 MUAN 0558 Prandel I Ein alter Kopf, auf Leinwat. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 9 Zoll, Breite 1 Schuh 5 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1791/05/30 FRAN 0154 Brandel I Zwey Viehstück mit Geißen und Schaafen in Lebensgröße sehr natürlich und lebhaft vorgestellt. I Diese Nr.: Ein Viehstück mit Geissen und Schaafen in Lebensgrösse Maße: 4 Schuh 2 Zoll hoch und 5 Schuh 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 154 und 155 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Bansa Transakt.: Verkauft (20 für die Nrn. 154 und 155) 1791/05/30 FRAN 0155 Brandel I Zwey Viehstück mit Geißen und Schaafen in Lebensgröße sehr natürlich und lebhaft vorgestellt. I Diese Nr.: Ein Viehstück mit Geissen und Schaafen in Lebensgrösse Maße: 4 Schuh 2 Zoll hoch und 5 Schuh 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 154 und 155 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Bansa Transakt.: Verkauft (20 für die Nrn. 154 und 155) 1791/09/26 FRAN 0161 Brandel I Ein alter bärtiger Philosoph. I Maße: 24 Zoll hoch, 18 Zoll breit Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0257 Brandel I Ein alter keckgemahlter Kopf von Brandel. I Maße: 2 Schuh 8 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 2 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HB GOV [A]0030 Brandel I Die vier Theile der Welt; in allegorischen Figuren vorgestellet. Von Brandel. Ovalen Formats. Auf Holz. I Diese Nr.: Einer der vier Theile der Welt Mat.: auf Holz Format: oval Maße: Hoch 2 % Zoll, breit 2 Ά Zoll Anm.: Die Lose [A]30 bis [A]33 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HB GOV [A]0031 Brandel I Die vier Theile der Welt; in allegorischen Figuren vorgestellet. Von Brandel. Ovalen Formats. Auf Holz. I Diese Nr.: Einer der vier Theile der Welt Mat.: auf Holz Format: oval Maße: Hoch 2 % Zoll, breit 2 VA Zoll Anm.:
Die Lose [A]30 bis [A]33 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV [A]0032 Brandel I Die vier Theile der Welt; in allegorischen Figuren vorgestellet. Von Brandel. Ovalen Formats. Auf Holz. I Diese Nr.: Einer der vier Theile der Welt Mat.: auf Holz Format: oval Maße: Hoch 2 % Zoll, breit 2 VA Zoll Anm.: Die Lose [A]30 bis [A]33 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV [A]0033 Brandel I Die vier Theile der Welt; in allegorischen Figuren vorgestellet. Von Brandel. Ovalen Formats. Auf Holz. I Diese Nr.: Einer der vier Theile der Welt Mat.: auf Holz Format: oval Maße: Hoch 2 % Zoll, breit 2 VA Zoll Anm.: Die Lose [A]30 bis [A]33 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV 0078 Brandel I Die Verhöhnung [sie] Christi, wie er die Dornen=Krone auf hat und an der Säule gebunden ist. Ein sehr starkes Gemähide. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 45 Zoll, breit 34 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0100 Peter Brandel I Ein Apostelkopf mit einem Barte, sehr keck, von Peter Brandel. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 6 Zoll breit 1 Schuh 2 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0548 Peter Brandel I Vier Köpfe mit Barten, sehr keck gemahlt, von Peter Brandel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Kopf mit Bart Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 7 Zoll breit 1 Schuh 4 Zoll Anm.: Die Lose 548 bis 551 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0549 Peter Brandel I Vier Köpfe mit Barten, sehr keck gemahlt, von Peter Brandel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Kopf mit Bart Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 7 Zoll breit 1 Schuh 4 Zoll Anm.: Die Lose 548 bis 551 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0550 Peter Brandel I Vier Köpfe mit Bärten, sehr keck gemahlt, von Peter Brandel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Kopf mit Bart Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 7 Zoll breit 1 Schuh 4 Zoll Anm.: Die Lose 548 bis 551 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0551 Peter Brandel I Vier Köpfe mit Barten, sehr keck gemahlt, von Peter Brandel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Kopf mit Bart Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 7 Zoll breit 1 Schuh 4 Zoll Anm.: Die Lose 548 bis 551 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0066 Petrus Brandel I Zwey Apostelköpfe, von Petrus Brandel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Apostelkopf Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 6 Zoll breit 2 Schuh Anm. : Die Lose A66 und A67 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0067 Petrus Brandel I Zwey Apostelköpfe, von Petrus Brandel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Apostelkopf Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 6 Zoll breit 2 Schuh Anm.: Die Lose A66 und A67 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1800/01/00 LZAN [A]0008 Pet. Brandel I Ein guter Porträtmaler, welcher zu Anfang dieses Jahrh. (grösstentheils in Wien) lebte; es ist sein eigenes Bildniss, mit vieler Kraft gemalt, in Lebensgrösse; derselbe hat das Gesicht nach der rechten Seite gewendet; mit einem scharfen Blicke scheint er seiner Arbeiten zu beurtheilen, indem er zugleich aus der in der linken Hand haltenden Dose Tobak nimmt. Eine rothe Mütze und gelber Schlafrock sind seine Bekleidung. I Maße: Höhe 3 Fuß 3 Zoll, Breite 2 Fuß 7 Zoll Verkäufer: A F Oeser Transakt.: Unbekannt
Brandmüller, Gregor 1798/12/10 WNAN 0034 Brandmüller I Die Entführung der Europa, und Jupiters goldener Regen bey Danäe, zwey meisterhafte Skizzen. I Mat.: auf Leinwand Verkäufer: Prof Adam Transakt.: Unbekannt
Brandon, Jean Henri 1776/00/00 WZTRU 0198 Johann Heinrich Brandon\ Ein Stück 1 Schuhe, 2 Zoll hoch, 10 Zoll breit von Johann Heinrich Brandon, stellet vor einen alten singenden Mann, welcher auf einer Violine spielet, wo ihm auf der Achsel eine Nachteule sitzet, ein anderer alter Mann hat ein Nottenbuch vorsieh [sie] liegen, singet, und giebt den Dackt hiebey: dieses Stücke ist sehr fleißig und wohlausgeführet. I Maße: 1 Schuhe 2 Zoll hoch, 10 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (6 fl Schätzung) 1781/00/00 WZAN 0198 Johann Heinrich Brandon I Ein Stück 1 Schuhe, 2 Zoll hoch, 10 Zoll breit von Johann Heinrich Brandon, stellet einen alten singenden Mann vor, welcher auf einer Violine spielet, wo ihm auf der Achsel eine Nachteule sitzet; ein anderer alter Mann hat ein Notenbuch vor sich liegen, singet und giebt den Takt hiebey: dieses Stück ist sehr fleißig und gut ausgeführt. I Maße: 1 Schuhe 2 Zoll hoch, 10 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Brandt, Mile. [Nicht identifiziert] 1800/06/03 BLAN 0001 Mile Brandt I Zwey Bildnisse geistlicher Herrn, in Oel auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Bildnis eines geistlichen Herrn Mat.: Öl auf Leinwand Maße: Höhe 16 Zoll, Breite 13 Zoll Anm.: Die Lose 1 und 2 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (6 Gr) Käufer: Eckert 1800/06/03 BLAN 0002 Μlie Brandt \ Zwey Bildnisse geistlicher Herrn, in Oel auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Bildnis eines geistlichen Herrn Mat.: Öl auf Leinwand Maße: Höhe 16 Zoll, Breite 13 Zoll Anm.: Die Lose 1 und 2 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (12 Gr) Käufer: Geh Rath Moelter
Brandy, Sebastian [Nicht identifiziert] 1776/00/00 WZTRU 0376 Sebastian Brandy I Ein Stück 1 Schuhe, 3 Zoll hoch, 9 Zoll breit von Sebastian Brandy, stellet vor eine Landschaft von kräftig und warmer Manier. I Maße: 1 Schuhe 3 Zoll hoch, 9 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (2 fl Schätzung) 1781/00/00 WZAN 0376 Sebastian Brandy I Ein Stück 1 Schuhe, 3 Zoll hoch, 9 Zoll breit von Sebastian Brandy, giebt eine Landschaft von kräftiger und warmer Manier zu erkennen. I Maße: 1 Schuhe 3 Zoll hoch, 9 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Brasch, J.C. [Nicht identifiziert] 1790/08/13 HBBMN 0087 J.C. Brasch I Land= und Wassergegenden, mit vielen Figuren: die eine bey Sommer, und die andere bey Winter=Zeit vorgestellt. Auf Leinw. in schwarz gebeitzten Rahm mit vergoldeten Leisten. I Diese Nr.: Eine Land= und Wassergegend, mit vielen Figuren: bey Sommer=Zeit Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 30 Zoll, breit 44 Zoll Anm.: Die Lose 87 und 88 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (2 Μ für die Nrn. 87 und 88) Käufer: Ego 1790/08/13 HBBMN 0088 J. C. Brasch I Land= und Wassergegenden, mit vielen Figuren: die eine bey Sommer, und die andere bey Winter=Zeit vorgestellt. Auf Leinw. in schwarz gebeitzten Rahm mit vergoldeten Leisten. I Diese Nr.: Eine Land= und Wassergegend, mit vielen Figuren: bey Winter=Zeit Mat.: auf Leinwand GEMÄLDE
357
Maße: Hoch 30 Zoll, breit 44 Zoll Anm.: Die Lose 87 und 88 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (2 Μ für die Nrn. 87 und 88) Käufer: Ego
Brassauw, Melchior 1781/00/00 WRAN 0043 Brassaw I Une Femme nue, un genou sur une chaise, appuiee des deux mains sur le dos de ladite chaise, sous laquel'elle est un Singe, derriere eile un Peintre qui travaille sur un chevalet & sur le dos de la chaise de l'Artiste un homme est appuie & qui semble admirer cette nudite. Ce beau tableau est peint sur bois, par Brassaw. I Annotat.: Cabinet (RKDH) Mat.: auf Holz Maße: 9 pouces 8 lignes de haut, sur 7 pouces de large Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt
derungsvoll da steht, welches Frauenzimmer ihn stets mit einem schielenden Blick beobachtet, deren ganze Gruppe von einer dritten lauschenden Figur durch die Thür des Zimmers angenehm unterhalten wird, sowohl die Eintheilung als die Drapperie der Figuren und übrigen Beywesen ist durchgehende mit ungemeinem Fleiß kräftig ausgeführt, von jungen Braun. I Maße: 2 Schuh 3 Zoll hoch, 2 Schuh breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 BLBOE 0136 Braun I Cimeon wird im Gefängniß von seiner Tochter gesäugt; im Hintergrunde beobachten zwei Kriegsknechte diese Scene durch ein Gitter. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt
Braun, Augustin
1794/09/09 HBPAK 0059 Brassieu I Im Innern eines Zimmers befinden sich viele Personen beyderley Geschlechts, zur Linken eine Gesellschaft Musikanten. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 21 Zoll, breit 27 Zoll Transakt.: Unbekannt
1768/08/16 KOAN 0099 Augustin Bruun I Christus am Creutz, Maria, Johannes und Magdalena auf Kupfer von Augustin Bruun. I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 1 Fuß, Breite 9 Zoll Verkäufer: Freyherr von Kaas Transakt.: Unbekannt
Brauer, Caspar [Nicht identifiziert]
1791/07/29 HBBMN 0015 A. Braun I Die Findung Moses, mit vielem Heiß gemahlt; auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 32 Zoll, breit 42 Zoll Transakt.: Unbekannt (1.4 M)
1742/08/01 BOAN 0244 Caspar Brauer I Zvvey Bavvren Stuck. Beyde Originalien von Caspar Brauer. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0238 Caspar Brauer I Des Paisans, par Caspar Brauer, Couple. I Maße: Haut 10. pou. large 8. pou. Verkäufer: lean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt
1792/08/20 KOAN 0271 Augustin Braun I Ein drey Königen Stuck mit den schönsten Coloritten reich gemahlt auf Baneel von Augustin Braun so gut, als von ihm selbst. I Mat.: auf Holz Maße: 2 Schuh 5 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 3 Zoll breit Anm.: Die Angabe "so gut, als von ihm selbst" ist handschriftlich im Exemplar KH durchgestrichen. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt
Brauer, M. [Nicht identifiziert]
Brauns [Nicht identifiziert]
1800/11/12 HBPAK 0592 ren. I Transakt.: Unbekannt
Braun
1763/01/17 HNAN [A]0072 Brauns I Deux Pieces de Volaille, sur bois. I Diese Nr.: Piece de Vollailles Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 9 pouces, Largeur 1 pieds 1 pouces Anm.: Die Lose [A]72 und [A]73 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt
1793/00/00 NGWID 0053 der alte Braun I Ein sehr natürlicher alter Mannskopf mit einem Stoppelbart, ganz im Geschmack des Denners, vom alten Braun. I Pendant zu Nr. 54 Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 1 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
1763/01/17 HNAN [A]0073 Brauns I Deux Pieces de Volaille, sur bois. I Diese Nr.: Piece de Vollailles Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 9 pouces, Largeur 1 pied 1 pouce Anm.: Die Lose [A]72 und [A]73 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt
1793/00/00
NGWID
0054
M. Brauer I Zwey Stücke mit Figu-
der alte Braun
I Z u m G e g e n b i l d , ein
nicht minder treflicher alter Frauenkopf mit einer Taffetkappe, beyde Stücke sind mit unbeschreiblicher Mühe ausgeführt, von obigem Meister [vom alten Braun] und Maaß. I Pendant zu Nr. 53 Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 1 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00
NGWID
0057
der junge
Braun
I Ein sehr e m p f e h -
lendes Cabinetstück, wie eine junge Dame in ihrem Schlafgemach von ihren Kammerzofen, die im Begrif stehen sie zu entkleiden, umgeben ist, und dem vor ihr stehenden künftigen Gemahl schamhaft anblickt, vom jungen Braun. I Maße: 2 Schuh 4 Zoll hoch, 2 Schuh 2 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0058 der junge Braun I Noch ein Zweytes, wie ein Spanischer Ritter bey einem jungen Frauenzimmer um Spitzen handelt, wo im Hintergrund noch ein ältlicher Mann, der sich am Camin erwärmt, sehr gut angebracht ist, vom jungen Braun. I Maße: 2 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 2 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0410 Braun I Zum Gegenstück, ein altspanischer Ritter, der im Begriff steht, sein Schwerdt zu ziehen, von Braun. I Pendant zu Nr. 409 von W. Mieris Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 1 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0516 der junge Braun I Wie ein spanischer Edelmann, vor einem scheinbar schlafenden Frauenzimmer bewun358
GEMÄLDE
Braustein [Nicht identifiziert] 1799/00/00 WZAN A0082 Braustein I Zwey Landschaften, eine den Winter vorstellend, von Braustein. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Zoll breit 1 Schuh 1 Zoll Anm.: Die Lose A82 und A83 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0083 Braustein I Zwey Landschaften, eine den Winter vorstellend, von Braustein. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft, den Winter vorstellend Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Zoll breit 1 Schuh 1 Zoll Anm.: Die Lose A82 und A83 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Bray 1797/04/25 HBPAK 0022 De Bray I Eine biblische Geschichte, vorstellend das Innere eines königlichen Pallastes, wo ein jüdischer Monarch auf seinem Thron sitzt, und einen Jüngling, der vor ihm eine Harfe haltend, kniet, mit einem Spiesse zu durchbohren drohet, für den aber ein junges Frauenzimmer kläglich zu bitten scheint. Die Leidenschaften des Zorn, der Furcht, und des Mitleides sind meisterhaft ausgedrückt. Auf Holz, goldene Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 24 Zoll, breit 31 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt
1797/04/25 HBPAK 0137 de Brag! Ein heidnischer Priester steht bey einer Art von Altar, vor ihm eine Frauensperson auf die Knien, die ihm ihren kleinen Sohn vorstellt, auf dem er seine Hand legt; nebst noch mehreren Figuren, alle in Lebensgrösse. Auf Holz, schwarzen Rahm, goldene Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 24 Vi Zoll, breit 18 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt
Bray (oder Bry) 1798/06/04 HBPAK 0197 Van de Bry\ Ein hoher Berg mit Mauerwerk, wo am Fuße desselben ein Fluß, worüber eine Brücke führt, und auf welchem ein Fahrzeug mit Herrschaften übergesetzt wird. Schön gemahlt. Auf Holz, goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 21 Zoll, breit 29 Zoll Transakt.: Unbekannt
Bray, Dirck de 1787/04/03 HBHEG 0074 Theodor de Brag I Judith mit dem Haupte Holofernes, vortreflich gemahlt, von Theodor de Brag, auf Holz. I Mat.: auf Holz Transakt.: Verkauft (3.8 M) Käufer: Bertheau 1791/07/29 HBBMN 0004 T. de Bray I Die Geschichte der Caliste; auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 37 Vi Zoll, breit 49 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt (6.4 M) 1792/04/19 HBBMN 0066 Theodor de Bray I Im Gezelte des enthaupteten Holofemis steht Judith mit den Kopf in der Hand, und will solchen in den Sack stecken, welchen die Magd, so zur Erde sich bückt, offen hält; ganz excellent, von Theodor de Bray. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Zoll, breit 11 Zoll Transakt.: Unbekannt
Bray, Jacob de 1776/00/00 WZTRU 0423 Jakobus von Bray I Ein Stück 1 Schuhe, 4 Zoll hoch, 1 Schuhe, Vi Zoll breit von Jakobus von Bray, stellet vor einen Weibskopf in beßten Jahren, worinn die Colorit sehr wohl verstanden, und gut gemalet ist. I Pendant zu Nr. 424 von Anonym Maße: 1 Schuhe 4 Zoll hoch, 1 Schuhe Vi Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (5 fl Schätzung) 1781/00/00 WZAN 0423 Jakob von Bray I Ein Stück 1 Schuhe, 4 Zoll hoch, 1 Schuhe, Vi Zoll breit, vom Jakob von Bray, stellet einen Weibskopf in beßten Jahren vor, worinn die Kolorit sehr wohl verstanden, und gut gemalet ist. I Pendant zu Nr. 424 von Anonym Maße: 1 Schuhe 4 Zoll hoch, 1 Schuhe Vi Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Breckel [Nicht identifiziert] 1791/07/29 HBBMN 0061 Breckel I Ein Fischmarkt mit vielen Figuren, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Zoll, breit 17 Zoll Transakt.: Unbekannt (1.2 M)
Bredael 1716/00/00 FRHDR 0185 Breta Von Breta einige Rudera mit Vieh. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (75) 1742/08/01 BOAN 0315 Breidel I Zvvey Stuck mit Battallien. Original von Breidel. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1744/05/20 FRAN 0041 Breidel I 1 Landschafft. I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 5 Zoll, Breite 8 Zoll Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0058 Breidel I Deux paisages, avec des figures fort ingenieuses. I Diese Nr.: Un paisage Maße: Largeur 1 Pies 2 Pouces, Haut 11 Pouces Anm.: Die Lose 58 und 59 wurden zusam-
men katalogisiert. Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0059 Breidel I Deux paisages, avec des figures fort ingenieuses. I Diese Nr.: Un paisage Maße: Largeur 1 Pies 2 Pouces, Haut 11 Pouces Anm.: Die Lose 58 und 59 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1763/11/09 FRJUN 0028 Bredaal I Une Boutique de chirugien dans la quelle il y a un pa'isan sur une chaise ä qui on panse le pied; Dans le fond de la boutique on en voit un qui arrache des dents & beaucoup d'omemens, tres bien peint. I Maße: hauteur 19 pouces, largeur 24 pouces Transakt.: Verkauft (45 fl für die Nm. 28 und 29) Käufer: Winterstein 1763/11/09 FRJUN 0029 Bredaal I Un Pareil de meme maitre representant un alchimiste dans son laboratoire orne de plusieurs figures & accompagnemens pas moindre que le precedent & de la meme grandeur. I Maße: hauteur 19 pouces, largeur 24 pouces Transakt.: Verkauft (45 fl für die Nm. 28 und 29) Käufer: Winterstein 1763/11/09 FRJUN 0030 Bredaa I Un exellent pai'sage orne de plusieurs figures bien peint dans le goüt de Breugel. I Maße: hauteur 10 Vi pouces, largeur 13 Vi pouces Transakt.: Verkauft (32 fl) Käufer: Geyß 1765/00/00 FRNGL 0033 bekannt (18 fl Schätzung)
Prettal I 2 Bataillen. I Transakt.: Un-
1765/03/27 FRKAL 0031 Breitet I Deux Batailles enrichies de figures & bien peintes. I Maße: hauteur 21 pouces, largeur 24 pouces Transakt.: Verkauft (15.30 fl) Käufer: Hoch 1774/10/05 HBNEU 0067 Breidel I Zwey ungemein fleißige Landschaften, eine lustige, und eine kriegerische Vorstellung. I Diese Nr.: Eine ungemein fleißige Landschaft, eine lustige Vorstellung Anm.: Die Lose 67 und 68 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1774/10/05 HBNEU 0068 Breidel I Zwey ungemein fleißige Landschaften, eine lustige, und eine kriegerische Vorstellung. I Diese Nr.: Ein ungemein fleißige Landschaft, eine kriegerische Vorstellung Anm.: Die Lose 67 und 68 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1777/05/26 FRAN 0450 Breittel I 2 Schöne Batallien. I Verkäufer: Finsterwalder Transakt.: Verkauft (33.15 fl) Käufer: Zimmer 1778/09/28 FRAN 0392 Breydael I Eine Bataille, von Bredael, nemliches Maaß. [Une bataille, par Breydael, meme hauteur & meme largeur.] I Pendant zu Nr. 393 Maße: 9 Zoll breit, 8 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (8 fl für die Nrn. 392 und 393) Käufer: Prß von Dessau 1778/09/28 FRAN 0393 Breydael I Der Compagnon, von dito [Bredael], nemliches Maaß. [Le pendant du precedent, par le meme [Breydael], meme hauteur & meme largeur.] I Pendant zu Nr. 392, "Eine Bataille" Maße: 9 Zoll breit, 8 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (8 fl für die Nrn. 392 und 393) Käufer: Prß von Dessau 1779/09/27 FRNGL 0029 Breydell I Eine angenehme Gegend worinnen Markt gehalten wird, mit vielen kleinen schönen Figuren. [Une foire de Campagne, figuration tres riante, ornee de betail & de figures.] I Pendant zu Nr. 30 Maße: 8 Vi Zoll hoch, 10 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (22.30 fl für die Nm. 29 und 30) Käufer: Rath Ehrenreich 1779/09/27 FRNGL 0030 Breydell I Der Compagnon zu obigem, eine dergleichen Vorstellung [eine angenehme Gegend worinnen Markt gehalten wird] von nemlichem Meister [Breydell] und Größe. [Le pendant du precedent, meme objet [une foire de Campagne], par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 29 Maße: 8 Vi Zoll hoch, GEMÄLDE
359
10 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (22.30 fl für die Nm. 29 und 30) Käufer: Rath Ehrenreich 1779/09/27 FRNGL 0040 Breydel I Eine kleine fleißig ausgearbeitete Bataille. [Un petit tableau tres bien executi representant une bataille.] I Pendant zu Nr. 41 Maße: 8 Vi Zoll hoch, 11 Zoll breit Transakt.: Verkauft (22 fl für die Nrn. 40 und 41) Käufer: Rath Eichhorn 1779/09/27 FRNGL 0041 Breydel I Das Gegenbild zu obigem, eben so schön ausgeführt, von nemlichem Meister [Breydel] und Maas. [Le pendant du precedant, de la meme perfection, par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 40 Maße: 8 Vi Zoll hoch, 11 Zoll breit Transakt.: Verkauft (22 fl für die Nrn. 40 und 41) Käufer: Rath Eichhorn 1779/09/27 FRNGL 0781 Breydell I Bauern, wie sich selbige dem Kriegsvolk wiedersetzen, in vielen schönen wohlausgearbeiteten Figuren vorgestellt. [Des paysans qui s'opposent ä des soldats, beaucoup de figures trfes bein representees.] I Pendant zu Nr. 782 Maße: 1 Schuh 2 Zoll hoch, 1 Schuh 8 Zoll breit Transakt.: Verkauft (33.45 fl für die Nrn. 781 und 782) Käufer: Bager 1779/09/27 FRNGL 0782 Breydell I Kriegsvolk, wie selbiges ein Dorf plündert und in Brand stecket, zum Compagnon, eben so schön und reich ausgeführt, von neml. Meister [Breydell] und Maas. [Des soldats qui pillent un village & y mettent le feu, pendant du precedant, meme beaute, par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 781 Maße: 1 Schuh 2 Zoll hoch, 1 Schuh 8 Zoll breit Transakt.: Verkauft (33.45 fl für die Nrn. 781 und 782) Käufer: Bager 1781/09/10 BNAN 0103 Breydel I Ein Gefecht von Reutern und Türken; der schwarze Pulverdampf verdunkelt die Ferne zur Linken, hebt aber dadurch die dafür scharmutzirende so viel besser heraus. [Beyde von Breydel.] I Pendant zu Nr. 104 Mat.: auf Holz Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 104 und beziehen sich auf die Nrn. 103 und 104. Transakt.: Unbekannt 1781/09/10 BNAN 0104 Breydel I Das Nebenbild zeiget zur Rechten eine dunkele Anhöhe, wodurch die schönen Blicke auf denen sich dafür herumtummelnden eine frapante Wirkung thun. Beyde von Breydel. g.R. [im verguldeten Rahm] I Pendant zu Nr. 103 Mat.: auf Holz Maße: 17 Zoll hoch, 23 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0039 Bredael I Eine Sommer= und Winter=Landgegend, sehr schön gemahlt, auf Holz. I Diese Nr.: Eine Sommer=Landgegend Mat.: auf Holz Maße: Höhe 12 Zoll, Breite 15 Zoll Anm.: Die Lose 39 und 40 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0040 Bredael I Eine Sommer= und Winter=Landgegend, sehr schön gemahlt, auf Holz. I Diese Nr.: Eine Winter=Landgegend Mat.: auf Holz Maße: Höhe 12 Zoll, Breite 15 Zoll Anm.: Die Lose 39 und 40 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0044 Breidel I Vier extra schöne Landgegenden, die vier Tagszeiten vorstellend, oval, auf Kupfer. I Diese Nr.: Eine extra schöne Landgegend, eine der vier Tagszeiten vorstellend Mat.: auf Kupfer Format: oval Maße: Höhe 6 Zoll, Breite 7 Zoll 8 Linien Anm.: Die Lose 44 bis 47 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0045 Breidel I Vier extra schöne Landgegenden, die vier Tagszeiten vorstellend, oval, auf Kupfer. I Diese Nr.: Eine extra schöne Landgegend, eine der vier Tagszeiten vorstellend Mat.: auf Kupfer Format: oval Maße: Höhe 6 Zoll, Breite 7 Zoll 8 Linien Anm.: Die Lose 44 bis 47 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0046 Breidel I Vier extra schöne Landgegenden, die vier Tagszeiten vorstellend, oval, auf Kupfer. I Diese 360
GEMÄLDE
Nr.: Eine extra schöne Landgegend, eine der vier Tagszeiten vorstellend Mat.: auf Kupfer Format: oval Maße: Höhe 6 Zoll, Breite 7 Zoll 8 Linien Anm.: Die Lose 44 bis 47 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0047 Breidel I Vier extra schöne Landgegenden, die vier Tagszeiten vorstellend, oval, auf Kupfer. I Diese Nr.: Eine extra schöne Landgegend, eine der vier Tagszeiten vorstellend Mat. : auf Kupfer Format: oval Maße: Höhe 6 Zoll, Breite 7 Zoll 8 Linien Anm.: Die Lose 44 bis 47 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/09/30 FRAN 0325 Bredael I Zwo Gegenden, bei zwo an den Ufern eines Strohms gelegenen Städten, mit vielen kleinen Figuren. [Deux vües de deux villes situees aux rivages d'un fleuve, avec nombre de petites figures, par Bredael.] I Diese Nr.: Eine Gegend, bei einer an den Ufern eines Strohms gelegenen Stadt, mit vielen kleinen Figuren Maße: 5 Vi Zoll hoch, 7 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 325 und 326 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (25 fl für die Nrn. 325 und 326) Käufer: Quaita 1782/09/30 FRAN 0326 Bredael I Zwo Gegenden, bei zwo an den Ufern eines Strohms gelegenen Städten, mit vielen kleinen Figuren. [Deux vües de deux villes situies aux rivages d'un fleuve, avec nombre de petites figures, par Bredael.] I Diese Nr.: Eine Gegend, bei einer an den Ufern eines Strohms gelegenen Stadt, mit vielen kleinen Figuren Maße: 5 Vi Zoll hoch, 7 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 325 und 326 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (25 fl für die Nrn. 325 und 326) Käufer: Quaita 1782/09/30 FRAN 0338 Breydell I Zwo angenehme niederländische Landschaften mit schönen Entfernungen, Schufen und vielen wohl ausgearbeiteten kleinen Figuren. [Deux beaux paysages Flamands avec des beaux lointains, des bateaux & nombre de jolies petites figures, par Breydell.] I Diese Nr.: Eine angenehme niederländische Landschaft mit schönen Entfernungen, Schufen und vielen wohl ausgearbeiteten kleinen Figuren Maße: 8 Vi Zoll hoch, 10 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 338 und 339 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (27 fl für die Nrn. 338 und 339) Käufer: Kaller 1782/09/30 FRAN 0339 Breydell I Zwo angenehme niederländische Landschaften mit schönen Entfernungen, Schufen und vielen wohl ausgearbeiteten kleinen Figuren. [Deux beaux paysages Flamands avec des beaux lointains, des bateaux & nombre de jolies petites figures, par Breydell.] I Diese Nr.: Eine angenehme niederländische Landschaft mit schönen Entfernungen, Schufen und vielen wohl ausgearbeiteten kleinen Figuren Maße: 8 Vi Zoll hoch, 10 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 338 und 339 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (27 fl für die Nm. 338 und 339) Käufer: Kaller 1784/09/27 FRAN 0089 Breydell I Zwey sehr gute Bataillen= Stücke von Breydell. [Deux trös bonnes pieces representantes des batailles.] I Maße: 1 Schuh hoch, 1 Schuh 5 Zoll breit Verkäufer: Freyherr von Berberich Transakt.: Verkauft (16.30 fl) Käufer: Stöber 1784/09/27 FRAN 0123 Breydäll I Zwey fleißig ausgeführte Bataillen von Breydäll. [Deux belles pieces representantes des batailles, par Breydäll.] I Maße: 1 Schuh hoch, 1 Schuh 2 Zoll breit Verkäufer: Freyherr von Berberich Transakt.: Verkauft (13.30 fl) Käufer: Stoeber 1784/09/27 FRAN 0140 Bredael I Ein schönes Viehstück von Bredael. [Une belle piece representante du betail.] I Maße: 2 Schuh 7 Zoll hoch, 3 Schuh 9 Zoll breit Verkäufer: Freyherr von Berberich Transakt.: Verkauft (5 fl) Käufer: Kessel 1785/05/17 MZAN 0167 Bredael I Ein Feldlager und ein Bagagewägenzug von Bredael. [Un camp dont le pendant repr6sente un
train de chariots de Bagage.] I Diese Nr.: Ein Feldlager; Pendant zu Nr. 168 Maße: 1 Schuh hoch, 1 Schuh 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 167 und 168 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (47 fl für die Nrn. 167 und 168) Käufer: Ettling 1785/05/17 MZAN 0168 Bredael I Ein Feldlager und ein Bagagewägenzug von Bredael. [Un camp dont le pendant represente un train de chariots de Bagage.] I Diese Nr.: Ein Bagagewägenzug; Pendant zu Nr. 167 Maße: 1 Schuh hoch, 1 Schuh 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 167 und 168 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (47 fl für die Nrn. 167 und 168) Käufer: Ettling 1785/05/17 MZAN 0234 Bredael I Eine Landschaft von Bredael in Breughels Manier auf Kupfer. [Un paysage par Bredael dans le gout de Breughel.] I Mat.: auf Kupfer Maße: 6 Vi Zoll hoch, 9 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (21.30 fl) Käufer: Dechant Pestel 1785/05/17 MZAN 0311 Bredael I Ein Paar Landschaften auf Kupfer von Bredael. [Deux paysages.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Kupfer Maße: 8 Vi Zoll hoch, 11 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 311 und 312 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (40 fl für die Nrn. 311 und 312) Käufer: Geh R ν Koch 1785/05/17 MZAN 0312 Bredael I Ein Paar Landschaften auf Kupfer von Bredael. [Deux paysages.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Kupfer Maße: 8 Vi Zoll hoch, 11 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 311 und 312 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (40 fl für die Nm. 311 und 312) Käufer: Geh R ν Koch 1785/05/17 MZAN 0487 Bredael I Ein Bataillestück von Bredael. [Une bataille .] I Maße: 6 Zoll hoch, 8 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (12.30 fl) Käufer: Dechant Pestel 1785/05/17 MZAN 0654 Bredael I Eine Landschaft von Bredael. [Un paysage.] I Maße: 8 Vi Zoll hoch, 11 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt. : Verkauft (18 fl) Käufer: Leützgen 1785/05/17 MZAN 0655 Bredael I Eine Landschaft auf Kupfer von eben demselben [Bredael], [Un autre [paysage] sur cuivre par le meme [Bredael].] I Mat.: auf Kupfer Maße: 11 Zoll hoch, 1 Schuh 2 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (9.30 fl) Käufer: Zitz 1785/05/17 MZAN 0656 Bredael I Eine detto [Landschaft] von dem nämlichen Meister [Bredael], [Un paysage par le meme [Bredael].] I Maße: 9 Zoll hoch, 11 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (1.30 fl) Käufer: Leützgen 1785/05/17 MZAN 0657 Bredael I Noch eine [Landschaft] auf Kupfer von eben demselben [Bredael], [Un autre [paysage] sur cuivre par le meme [Bredael].] I Mat.: auf Kupfer Maße: 5 Zoll hoch, 7 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (8 fl) Käufer: Schwanck 1785/05/17 MZAN 0663 Breydel I Zwey Seehäfen von Breydel auf Kupfer. [Deux ports de mer.] I Diese Nr.: Ein Seehafen Mat.: auf Kupfer Maße: 11 Zoll hoch, 1 Schuh 2 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 663 und 664 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (9 fl für die Nm. 663 und 664) Käufer: Melber 1785/05/17 MZAN 0664 Breydel I Zwey Seehäfen von Breydel auf Kupfer. [Deux ports de mer.] I Diese Nr.: Ein Seehafen Mat.: auf Kupfer Maße: 11 Zoll hoch, 1 Schuh 2 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 663 und 664 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (9 fl für die Nm. 663 und 664) Käufer: Melber 1785/05/17 MZAN 0808 Bredael I Noch ein Paar [Landschaften] von Bredael auf Kupfer. [Deux paysages.] I Diese Nr.: Eine
Landschaft Mat.: auf Kupfer Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 1 Schuh 4 Vi Zoll breit Anm. : Die Lose 808 und 809 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (21.30 fl für die Nrn. 808 und 809) Käufer: Tit Hofmarschall Frh ν Franckenstein 1785/05/17 MZAN 0809 Bredael I Noch ein Paar [Landschaften] von Bredael auf Kupfer. [Deux paysages.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Kupfer Maße: 1 Schuh 1 Zollhoch, 1 Schuh 4 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 808 und 809 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (21.30 fl für die Nm. 808 und 809) Käufer: Tit Hofmarschall Frh ν Franckenstein 1785/05/17 MZAN 0832 Bredael I Die Ruckkehr von der Jagd von Bredael. [Le retour de la chasse.] I Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 7 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (10 fl) Käufer: Rmus D Custos L Β ä Zobel 1785/05/17 MZAN 0844 Breidel I Eine Landschaft von Breidel. [Un paysage.] I Maße: 1 Schuh 7 Zoll hoch, 2 Schuh 1 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (56.30 fl) Käufer: Winterstein 1785/05/17 MZAN 0923 Braedael I Die Ruckkehr von der Jagd von Braedael. [Le retour de la chasse.] I Maße: 10 Zoll hoch, 1 Schuh 2 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (7.30 fl) Käufer: Hofr ν Leykam 1785/12/21 HBKOS 0037 Breydel I Zwo Landschaften, als Winter und Sommer, in verguldeten Rähmen. I Diese Nr.: Eine Landschaft, als Winter Anm.: Die Lose 37 und 38 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1785/12/21 HBKOS 0038 Breydel I Zwo Landschaften, als Winter und Sommer, in verguldeten Rähmen. I Diese Nr.: Eine Landschaft, als Sommer Anm.: Die Lose 37 und 38 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/04/21 HBTEX 0033 Breidell I Vier kleine Landschaften mit Figuren. I Diese Nr.: Eine kleine Landschaft mit Figuren Anm.: Die Lose 33 bis 36 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/04/21 HBTEX 0034 Breidell I Vier kleine Landschaften mit Figuren. I Diese Nr.: Eine kleine Landschaft mit Figuren Anm.: Die Lose 33 bis 36 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/04/21 HBTEX 0035 Breidell I Vier kleine Landschaften mit Figuren. I Diese Nr.: Eine kleine Landschaft mit Figuren Anm.: Die Lose 33 bis 36 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/04/21 HBTEX 0036 Breidell I Vier kleine Landschaften mit Figuren. I Diese Nr.: Eine kleine Landschaft mit Figuren Anm.: Die Lose 33 bis 36 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/11/11 HBRMS 0096 Breidel I Ein kleines Stück mit vielen kleinen Figuren, einen Bauren=Tanz vorstellend, auf Holz. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt 1787/10/06 HBTEX 0091 Breydel I Zwey See=Haven mit Schiffen und unzähligen Figuren, besonders ausführlich gemahlt. I Diese Nr.: Ein See=Haven mit Schiffen und unzähligen Figuren Anm.: Die Lose 91 und 92 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1787/10/06 HBTEX 0092 Breydel I Zwey See=Haven mit Schiffen und unzähligen Figuren, besonders ausführlich gemahlt. I Diese Nr.: Ein See=Haven mit Schiffen und unzähligen Figuren Anm.: Die Lose 91 und 92 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0604 Bredal I 2 Batallien, von Bredal. [2 Batailles de Bretal.] I Diese Nr.: Eine Batallie Mat.: auf Holz Maße: Höhe 8 Zoll, Breite 10 Zoll Anm.: Die Lose 604 und 605 wurden GEMÄLDE
361
zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0605 Bredal I 2 Batallien, von Bredal. [2 Batailles de Bretal.] I Diese Nr.: Eine Batallie Mat.: auf Holz Maße: Höhe 8 Zoll, Breite 10 Zoll Anm.: Die Lose 604 und 605 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0622 Bredal I Batallien, von Bredal. [1 p[iece]. de Bataille, de Bretal.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 6 Zoll, Breite 7 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1790/04/13 HBLIE 0033 Bredal I Eine sombere Land= und Wassergegend mit verschiedenen Landleuten, nebst einigen Reisenden zu Pferd und zu Fuß; sehr frei und schön gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Zoll, breit 14 % Zoll Transakt.: Verkauft (8.4 M) Käufer: Ego [und] Η 1790/05/20 HBSCN 0197 Β redaal I Seehaven mit Schiffen und einer unzähligen Menge Figuren. Sehr meisterhaft gemahlt. Auf L[einwand]. G.R. [Goldnen Rahm] I Diese Nr.: Ein Seehaven mit Schiffen und einer unzähligen Menge Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 17 Zoll, breit 12 Vi Zoll Anm.: Die Lose 197 und 198 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (16.8 Μ für die Nrn. 197 und 198) Käufer: Richardi 1790/05/20 HBSCN 0198 Bredaal I Seehaven mit Schiffen und einer unzähligen Menge Figuren. Sehr meisterhaft gemahlt. Auf Lfeinwand]. G.R. [Goldnen Rahm] I Diese Nr.: Ein Seehaven mit Schiffen und einer unzähligen Menge Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 17 Zoll, breit 12 Vi Zoll Anm.: Die Lose 197 und 198 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (16.8 Μ für die Nrn. 197 und 198) Käufer: Richardi 1790/07/28 ZHWDR 0006 Bredaeil [Ohne Titel] \ Annotat.: Von dem Werthe der zwey van Bredael kann ich nicht urtheilen. (LAVATER) Transakt.: Unbekannt 1790/08/25 FRAN 0043 Breydel I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: hoch 6 Vi Zoll, breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 43 und 44 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (2.15 fl für die Nrn. 43 und 44) Käufer: Müntzrath Dietz 1790/08/25 FRAN 0044 Breydel I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: hoch 6 Vi Zoll, breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 43 und 44 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (2.15 fl für die Nrn. 43 und 44) Käufer: Müntzrath Dietz 1790/08/25 FRAN 0130 Brüytel I Zwey Landschaften mit Vieh und Figuren. 1 Diese Nr. : Eine Landschaft mit Vieh und Figuren Maße: hoch 11 Zoll, breit 17 Zoll Anm.: Die Lose 130 und 131 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (5 fl für die Nrn. 130 und 131) Käufer: Diehl 1790/08/25 FRAN 0131 Brüytel I Zwey Landschaften mit Vieh und Figuren. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Vieh und Figuren Maße: hoch 11 Zoll, breit 17 Zoll Anm.: Die Lose 130 und 131 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (5 fl für die Nrn. 130 und 131) Käufer: Diehl 1790/08/25 FRAN 0383 Breydel I Zwey frölich masquirte Gesellschaften welche tanzen und trinken. I Diese Nr.: Eine frölich masquirte Gesellschaft welche tanzt und trinkt Maße: hoch 8 Zoll, breit 7 Zoll Anm.: Die Lose 383 und 384 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (10.15 fl für die Nrn. 383 und 384) Käufer: Trautman 1790/08/25 FRAN 0384 Breydel I Zwey frölich masquirte Gesellschaften welche tanzen und trinken. I Diese Nr.: Eine frölich masquirte Gesellschaft welche tanzt und trinkt Maße: hoch 8 Zoll, breit 362
GEMÄLDE
7 Zoll Anm.: Die Lose 383 und 384 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (10.15 fl für die Nm. 383 und 384) Käufer: Trautman 1790/08/25 FRAN 0499 Bredal I Zwey Landschaften mit vielen Figuren. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit vielen Figuren Maße: hoch 28 Zoll, breit 34 Zoll Anm.: Die Lose 499 und 500 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (8 fl für die Nrn. 499 und 500) Käufer: Kaller 1790/08/25 FRAN 0500 Bredal I Zwey Landschaften mit vielen Figuren. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit vielen Figuren Maße: hoch 28 Zoll, breit 34 Zoll Anm.: Die Lose 499 und 500 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (8 fl für die Nrn. 499 und 500) Käufer: Kaller 1791/05/28 HBSDT 0003 Breydel I Ländliche Gegenden mit durchfließenden Gewässer ec. Beyde mit eine menge Figuren, als Herrschaften die von der Jagd kommen und wandernde Bauren. Zwey ganz vortrefliche Gemähide, auf Holz. I Diese Nr.: Eine ländliche Gegend mit durchfliessenden Gewässer; Nr. 2 von P. Bout Mat.: auf Holz Maße: Hoch 14 Vi Zoll, breit 18 Vi Zoll Anm.: Die Lose 2 und 3 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1791/05/28 HBSDT 0026 Breydel I Vier.Land= und Wassergegenden mit Schiffen und eine menge Staffage, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 9 Zoll, breit 12 Zoll Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 HB AN 0037 Bredael I Auf dem Einen wird in einer waldigten Landschaft eine Hochjagd gehalten. Ein Hirsch und eine Hirschkuh werden von mehreren verfolgt und von zweyen, im Vorgrunde stehenden Schützen erlegt. Auf dem Zweyten wird in einem, von Bergen eingeschlossenen Thale ein grosser Keuler erlegt. I Diese Nr.: Auf diesem wird in einer waldigten Landschaft eine Hochjagd gehalten. Ein Hirsch und eine Hirschkuh werden von mehreren verfolgt und von zweyen, im Vorgrunde stehenden Schützen erlegt Maße: Höhe 22 Vi Zoll, Breite 37 Zoll Anm.: Die Lose 37 und 38 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 HB AN 0038 Bredael I Auf dem Einen wird in einer waldigten Landschaft eine Hochjagd gehalten. Ein Hirsch und eine Hirschkuh werden von mehreren verfolgt und von zweyen, im Vorgrunde stehenden Schützen erlegt. Auf dem Zweyten wird in einem, von Bergen eingeschlossenen Thale ein grosser Keuler erlegt. I Diese Nr.: Auf diesem wird in einem, von Bergen eingeschlossenen Thale ein grosser Keuler erlegt Maße: Höhe 22 Vi Zoll, Breite 37 Zoll Anm.: Die Lose 37 und 38 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1794/02/21 HB HEG 0110 Bredael I In einer gebürgigten Land= und Wasser=Gegend; befinden sich viele Reisende zu Wagen und zu Fuße. Auf dem mitten hindurch gehenden Landwege des Dorfes vor einem Wirthshause, sitzet eine Bauerin die Aepfel verkauft. Sehr fleißig und lebhaft gemahlt. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 6 14 Zoll, breit 9 % Zoll Transakt.: Unbekannt 1794/09/06 HBBMN 0140 Bredal I Zwey plaisant gemahlte Landschaften. I Diese Nr.: Eine plaisant gemahlte Landschaft Anm.: Die Lose 140 und 141 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/06 HBBMN 0141 Bredal I Zwey plaisant gemahlte Landschaften. I Diese Nr.: Eine plaisant gemahlte Landschaft Anm.: Die Lose 140 und 141 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/06 HBBMN 0142 Bredal I Zwey desgleichen [plaisant gemahlte Landschaften], von Demselben [Bredal]. I Diese Nr.: Eine plaisant gemahlte Landschaft Anm.: Die Lose 142 und 143 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1794/09/06 HBBMN 0143 Bredal I Zwey desgleichen [plaisant gemahlte Landschaften], von Demselben [Bredal]. I Diese Nr.: Eine plaisant gemahlte Landschaft Anm.: Die Lose 142 und 143 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1799/00/00 LZAN 0138 Breydel I 2 Paysages, dans le gout de Wauvermans, ornes de plusieurs Cavaliers. I Maße: Hauteur 26 pouces, largeur 18 pouces environ Transakt.: Unbekannt (18 Louis Schätzung)
1794/09/09 HBPAK 0164 Bredael I Zwey fleißig gemahlte Seehafen, mit einer Menge Figuren. I Diese Nr.: Ein fleißig gemahlter Seehafen, mit einer Menge Figuren Anm.: Die Lose 164 und 165 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1799/12/04 HBPAK 0024 Bredahl I Eine Landschaft, wo im Vordergrunde Schäfer und Schäferinnen sitzen, und sich mit Musik belustigen. Neben ihnen ihre Heerde liegend und stehend. Ganz kräftig und brav gemahlt. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 42 Zoll, breit 50 Zoll Transakt.: Unbekannt
1794/09/09 HBPAK 0165 Bredael I Zwey fleißig gemahlte Seehafen, mit einer Menge Figuren. I Diese Nr.: Ein fleißig gemahlter Seehafen, mit einer Menge Figuren Anm.: Die Lose 164 und 165 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/02/17 HBPAK 0125 Breydel I Kayserliche und Ottomanen liefern zu Pferde eine hitzige Schlacht. Der Compagnon stellt ein gleiches Gefechte vor. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 11 Zoll, Breite 16 Zoll Transakt.: Verkauft (242 M) Käufer: Τ 1796/02/17 HBPAK 0153 Breda in Berghems Manier I Im Vordergrunde einer Weide steht eine Hirtin, welche spinnt. Ein anderes Mädgen melkt eine Kuh, und nicht weit davon liegen Schaafe, wie auch eine Kuh. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 9 Zoll, Breite 12 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (70 M) Käufer: Τ 1796/09/08 HBPAK 0179 Bredal I Eine Landschaft mit vielen Figuren und Bauren=Hütten. Zur Linken ein Deich, worauf Endten schwimmen. Zur Rechten ein Brunnen. Verschiedenes Vieh treibt aus dem Dorfe. I Maße: Hoch 12 Zoll, breit 17 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/02/27 HBPAK 0033 Bredahl I Zwey hitzige Bataillen. Ganz in der Hachtenburgischen Manier, kräftig und gut gemahlt. Auf Leinwand. Im goldn. Rahm. I Diese Nr.: Eine hitzige Bataille Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 20 Zoll, breit 25 Zoll Anm.: Die Lose 33 und 34 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/02/27 HBPAK 0034 Bredahl I Zwey hitzige Bataillen. Ganz in der Hachtenburgischen Manier, kräftig und gut gemahlt. Auf Leinwand. Im goldn. Rahm. I Diese Nr.: Eine hitzige Bataille Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 20 Zoll, breit 25 Zoll Anm.: Die Lose 33 und 34 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0022 Breydel I Eine Landschaft mit Vieh, welche die Erndtegeschäffte und die damit verknüpften ländlichen Lustbarkeiten darstellt. Ein Gemähide, reich an Figuren, und mit vielem Fleiß ausgearbeitet. Auf Leinwand, mit schwarzen Rahm und vergoldeten Stäben. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 14 Zoll, breit 19 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/08/10 MMAN 0312 Breidel I Eine Landschaft mit Figuren von Breidel. auf Tuch. I Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (8 fl Schätzung) 1798/01/19 HBPAK 0096 Bredan I Eine Schlacht, von Bredan. In einem blauen Tone. Gut gemahlt. 8 Zoll hoch, 10 Zoll breit. Goldn. Rahm. I Maße: 8 Zoll hoch, 10 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1798/08/10 HBPAK 0039 Bredel I Ein Flecken mit einer Kirche und Gebäuden, nebst einem Marktplatz mit vielen Figuren, und eine Kutsche mit zwey Pferden, nebst mehrern Ochsen und Pferden. Gut gemahlt. Auf Holz, im schw. Rahm mit goldnen Leisten. Gehört zu Nr. 94. I Pendant zu Nr. 94 Mat.: auf Holz Maße: Hoch 24 Zoll, breit 28 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/08/10 HBPAK 0094 Bredel I Ein Flecken mit einer Kirche und Gebäuden ec. Gut gemahlt. Auf Leinwand, im hölzernen Rahm mit goldnen Leisten. Gehört zu No. 39. I Pendant zu Nr. 39 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll, breit 28 Zoll Transakt.: Unbekannt
Bredael (Kopie nach) 1788/09/01 KOAN 0521 Bretal I 2 Baurenstuck, nach Bretal. [2 p[ieces], Villageoises, selon Bretal.] I Diese Nr.: Ein Baurenstuck Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 11 Zoll, Breite 1 Fuß 11 Zoll Anm.: Die Lose 521 und 522 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0522 Bretal I 2 Baurenstuck, nach Bretal. [2 pfieces]. Villageoises, selon Bretal.] I Diese Nr.: Ein Baurenstuck Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 11 Zoll, Breite 1 Fuß 11 Zoll Anm.: Die Lose 521 und 522 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt
Bredael (Manier) 1778/09/28 FRAN 0310 Bredael I Eine sehr fleißig ausgearbeitete Türkische Bataille, in der Manier von Bredael, mit Rubens bezeichnet. [Une bataille de Turcs, ouvrage trfes exactement fini, dans le gout de Bredael, marquee Rubens.] I Pendant zu Nr. 311 Maße: 1 Schuh 4 Zoll breit, 13 Zoll hoch Inschr.: Rubens (bezeichnet) Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (100 fl für die Nrn. 310 und 311) Käufer: Becker bey Nothnagel 1778/09/28 FRAN 0311 Bredael I Der Compagnon, auch eine Türkische Bataille, vom nemlichen Meister [Manier von Bredael]. [Le pendant du precedent, meme objet [une bataille de Turcs], par le meme maitre [dans le gout de Bredael].] I Pendant zu Nr. 310 Maße: 1 Schuh 4 Zoll breit, 13 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (100 fl für die Nm. 310 und 311) Käufer: Becker bey Nothnagel 1778/09/28 FRAN 0412 Bredael I Eine Landschaft, in der Manier von Bredael. [Un paysage dans le gout de Bredael.] I Maße: 7 Zoll breit, 5 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (5 fl) Käufer: Sarrasin 1784/08/02 FRNGL 0348 Breydel I Zwey Soldatenstücke, in der Manier von Breydel. I Diese Nr.: Ein Soldatenstück Maße: 15 Zoll breit, 9 Zoll hoch Anm.: Die Lose 348 und 349 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Α Transakt.: Verkauft (3.15 fl für die Nm. 348 und 349) Käufer: Berger 1784/08/02 FRNGL 0349 Breydel I Zwey Soldatenstücke, in der Manier von Breydel. I Diese Nr.: Ein Soldatenstück Maße: 15 Zoll breit, 9 Zoll hoch Anm.: Die Lose 348 und 349 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Α Transakt.: Verkauft (3.15 fl für die Nrn. 348 und 349) Käufer: Berger 1785/05/17 MZAN 0907 Bredael I Ein Paar Landschaften in Bredaeis Manier auf Kupfer. [Deux paysages dans le gout de Bredael.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Kupfer Maße: 6 Vi Zoll hoch, 8 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 907 und 908 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (4 fl für die Nm. 907 und 908) Käufer: Schwanck 1785/05/17 MZAN 0908 Bredael I Ein Paar Landschaften in Bredaeis Manier auf Kupfer. [Deux paysages dans le gout de Bredael.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Kupfer Maße: 6 Vi Zoll hoch, 8 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 907 und 908 wurden zusammen GEMÄLDE
363
katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (4 fl für die Nrn. 907 und 908) Käufer: Schwanck
Bredael, Jan Frans van 1742/08/01 BOAN 0185 Frantz Breidel I Zwey Battaille Stuck. Originalien vom Frantz Breidel. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt
Bredael, Alexander van 1776/00/00 WZTRU 0144 Alexander Bredael I Ein Stück 7 Vi Zoll hoch, 9 Zoll breit von Alexander Bredael, vorstellend eine Winterlandschaft, worinn eine Schlittenfahrt auf dem Eys gehalten wird, dieses Stücke ist mit sehr vielen wohl ausgeführten Figuren belebet, und diese Art von Malerey ist vorzüglich und gut ausgeführet. I Pendant zu Nr. 145 Maße: 7 Vi Zoll hoch, 9 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (8 fl Schätzung)
1742/08/01 BOAN 0216 Frans Breidel I Zwey kleine PassionsStücker. Original von Frans Breidel. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt
1776/00/00 WZTRU 0145 Alexander Bredael I Commpagnion [sie] zu Nro. 144 von gleicher Stärke und Gusto des obigen Meisters [Alexander Bredael], eben dergleichen Winterstück vorstellend. I Pendant zu Nr. 144 Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (8 fl Schätzung)
1742/08/30 BOAN 0343 Franfois Breudel I Deux Morceaux de la Passion, par Francois Breudel. Couple. I Maße: Haut 9. pouces, larges 6. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt
1778/10/23 HBKOS 0014 A. v. Bredael I Zwey extra schöne Land=Stücke, von A. v. Bredael, auf dito [Leinwand], Das eine stellet die Korn=Erndte vor, und das andere wie die Schaafe geschoren werden, mit vielen lustigen Landleuten. I Diese Nr.: Die Korn= Erndte Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 29 Zoll, breit 36 Zoll Anm.: Die Lose 14 und 15 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/10/23 HBKOS 0015 A. v. Bredael I Zwey extra schöne Land=Stücke, von A. v. Bredael, auf dito [Leinwand]. Das eine stellet die Korn=Erndte vor, und das andere wie die Schaafe geschoren werden, mit vielen lustigen Landleuten. I Diese Nr.: Wie die Schaafe geschoren werden, mit vielen lustigen Landleuten Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 29 Zoll, breit 36 Zoll Anm.: Die Lose 14 und 15 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0144 Alexander Bredael I Ein Stück 7 Vi Zoll hoch, 9 Zoll breit, von Alexander Bredael, stellet eine Winterlandschaft vor, worinn eine Schlittenfahrt auf dem Eise gehalten wird; dieses Stück ist mit sehr vielen wohl ausgeführten Figuren belebet, und diese Art von Malerey ist vorzüglich und gut ausgeführet. I Pendant zu Nr. 145 Maße: 1 Vi Zoll hoch, 9 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0145 Alexander Bredael I Der Kompagnon zu Nro 144. von gleicher Stärke und Gusto des obigen Meisters [Alexander Bredael], stellet ein eben dergleiches Winterstück vor. I Pendant zu Nr. 144 Transakt.: Unbekannt 1793/00/00
HBMFD
0064
Alexander
von Bredaael.
16491 Das
Innere eines grossen Landhauses. Im Vordergründe auf der Diehle sitzt ein junges Mädchen und milcht eine Kuh die von einem alten Bauren gehalten wird. Zur Linken steht die Bäurin beym Zuchbrunnen. Ein Knabe bringt auf einem Schubkarren Kohl &c. herbey. An der Krippe stehen Pferde: gegenüber Kühe. Mit noch vielen andern Sachen. Hinten sieht man durch die geöfnete Thür ins ferne Dorf. I Pendant zu Nr. 65 Mat.: auf Leinwand Maße: 3 Fuss 8 Zoll hoch, 4 Fuss 7 Zoll breit Inschr.: 1649 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Pierre Laporterie Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 HBMFD 0065 Alexander von Bredaael 16491 Das Gegenstück. Vor einer Scheune sitzt ein Hirtenjunge zwischen seinen Schaafen, hält mit beyden Händen eine Flöte, und sieht mit vergnügter Miene nach der Hirtin um, die neben einer Kuh stehet, wo noch mehreres Vieh lieget. Hinten wird Korn vom fernen Felde hergefahren und in die Scheune gebracht. Beyde Bilder sind frey gemalt und mit einem markichten Pinsel ausgeführt. Ersteres ganz im Geschmack des Cornelius Saghtleven, und Letzteres hat vieles von dem Geiste des alten D. Tenniers. I Pendant zu Nr. 64 Mat.: auf Leinwand Maße: 3 Fuss 8 Zoll hoch, 4 Fuss 7 Zoll breit Inschr.: 1649 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Pierre Laporterie Transakt.: Unbekannt 364
GEMÄLDE
1742/08/30 BOAN 0224 Frantz Breidel I Deux Batailles, par Frantz Breidel. I Maße: Haut 6 Vi pouces. large 9. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt
1799/00/00 WZAN 0262 Johann Franz van Bredael oder Bredal I Zwey Jahrmärkte, von Johann Franz van Bredael oder Bredal. Auf Kupfer. I Diese Nr.: Ein Jahrmarkt Mat.: auf Kupfer Maße: hoch 8 Zoll breit 1 Schuh Anm.: Die Lose 262 und 263 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0263 Johann Franz van Bredael oder Bredal I Zwey Jahrmärkte, von Johann Franz van Bredael oder Bredal. Auf Kupfer. I Diese Nr.: Ein Jahrmarkt Mat.: auf Kupfer Maße: hoch 8 Zoll breit 1 Schuh Anm.: Die Lose 262 und 263 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Bredael, Jan Frans van (und Francken oder Vrancx) 1790/01/07 MUAN 2137 Franc. Bredael; der Niederländer Frank; der Niederländer Frank I Die vier Jahrszeiten, mit Göttern und Faunen, auf Holz. Die Landschaft ist vom Franc. Bredael, und die Figuren sind vom Niederländer Frank gemalt. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 11 Zoll, Breite 3 Schuh 1 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
Bredael, Jan Peter van 1789/00/00 MMAN 0384 Joh. Peter van Bredal I Zwei Stücke eine Bauemkirchweihe und einen Marktschreier vorstellend, auf Leinw. [Deux morceaux, une fete de paysans et un Operateur sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 10 Zoll hoch, 2 Fuß 5 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (88 fl) 1798/06/04 HBPAK 0022 Von Breda I Ein Stilleben; ein Tisch worauf ein Globus, ein Todtenkopf, Bücher, Instrumente ec. Ganz gut ordinirt und brav gemahlt. Auf Leinwand, schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 46 Zoll, breit 64 Zoll Transakt.: Unbekannt
Bredael, Peeter van 1750/00/00 KOAN 0210 Pierre Bredael I Une Cumpagne [sie], sur toile, dans le gout de Wauwermann, fort jolie. I Mat.: auf Leinwand Maße: Largeur 1 Pi6s 6 Pouces, Haut 1 Pies 3 Vt Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1767/00/00 KOAN 0066 Peter Bredahl I Zwey Stück auf Leinewand in dem Wouvermannischen Gusto von Peter Bredahl. I Mat.: auf Leinwand Maße: Breite 2 Fuß 4 V* Zoll, Höhe 2 Fuß 1 Vt Zoll Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt 1773/12/18 HBBOY 0034 Piter Bredaal I Zwo schöne Landschaften, reich von Figuren. I Diese Nr.: Eine schöne Landschaft, reich von Figuren Anm.: Die Lose 34 und 35 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1773/12/18 HBBOY 0035 Piter Bredaal I Z w o schöne Landschaften, reich von Figuren. I Diese Nr.: Eine schöne Landschaft, reich von Figuren Anm.: Die Lose 34 und 35 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1776/00/00 WZTRU 0177 Petrus von Bredael I Ein Stück 1 Schuhe hoch, 1 Schuhe 6 Zoll breit von Petrus von Bredael, stellet vor eine angenehme Landschaft mit alten Gebäuden, worinn sich flammländische Edelleute mit Tanzen belustigen, dieses Stücke ist von einer angenehmen Composition, überaus guten Colorit, und beßter Verständniß ausgeführet. I Pendant zu Nr. 178 Maße: 1 Schuhe hoch, 1 Schuhe 6 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (18 fl Schätzung) 1776/00/00 WZTRU 0178 Petrus von Bredael I Compagnion zu Nro. 177 von gleichem Gusto des obigen Meisters [Petrus von Bredael]. I Pendant zu Nr. 177 Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (18 fl Schätzung)
auf Leinwand Maße: Hoch 9 Vi Zoll, breit 12 Zoll Anm.: Die Lose 41 und 4 2 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1785/04/22 HBTEX 0042 Peter Bredel I Zwey Land= und Wasserprospecte, mit Gebäuden und sehr schönen Figuren. Auf Leinewand. Schwarzer R a h m und goldne Leisten. I Diese Nr.: Ein Land= und Wasserprospect, mit Gebäuden und sehr schönen Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 9 Vi Zoll, breit 12 Zoll Anm.: Die Lose 41 und 4 2 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1785/04/22 HBTEX 0138 Peter Bredel I Zwey sehr schöne Land= und Wasserprospecte, mit vielen kleinen Figuren zu Pferde und zu Fuß. Auf Holz. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Ein sehr schönes Land= und Wasserprospect, mit vielen kleinen Figuren zu Pferde und zu Fuss Mat.: auf Holz Maße: Hoch 6 lA Zoll, breit 9 Zoll Anm.: Die Lose 138 und 139 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1781/00/00 WZAN 0177 Peter von Bredael I Ein Stück 1 Schuhe hoch, 1 Schuhe 6 Zoll breit von Peter von Bredael, stellet eine angenehme Landschaft mit alten Gebäuden vor, worinn sich flammländische Edelleute mit Tanzen belustigen; dieses Stück ist angenehm zusammengesetzet, überaus gut kolorirt, und mit beßter Verständniß ausgeführet. I Pendant zu Nr. 178 Maße: 1 Schuhe hoch, 1 Schuhe 6 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
1785/04/22 HBTEX 0139 Peter Bredel I Zwey sehr schöne Land= und Wasserprospecte, mit vielen kleinen Figuren zu Pferde und zu Fuß. Auf Holz. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Ein sehr schönes Land= und Wasserprospect, mit vielen kleinen Figuren zu Pferde und zu Fuss Mat.: auf Holz Maße: Hoch 6 Ά Zoll, breit 9 Zoll Anm.: Die Lose 138 und 139 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1781/00/00 WZAN 0178 Peter von Bredael I Kompagnon zu Nro 177 ist von gleichem Gusto des obigen Meisters [Peter von Bredael], I Pendant zu Nr. 177 Transakt.: Unbekannt
1786/10/18 HBTEX 0055 P.Bredael I Zwey vortrefliche See= Häfen, mit sehr vielen Figuren und Schiffen, die ankommen und abgehen. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Ein vortreflicher See=Hafen, mit sehr vielen Figuren und Schiffen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll 6 Linien, breit 34 Zoll 9 Linien Anm.: Die Lose 55 und 56 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1784/08/13 HBDEN 0012 P.Bredael I Zwey Brabandische Stadt=Land= und Wassergegenden, theils mit Processionen und Kirmissen. Auf einem jeden mehr denn 100 Figuren. Von P. Bredael lebhaft vorgestellt, auf Leinwand. [NB. Alle Gemähide bis No. 33 haben keine Rahmen.] I Diese Nr.: Eine Brabandische Stadt=Land= und Wassergegend, theils mit Processionen und Kirmissen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll. Breit 25 Zoll. Anm.: Die Lose 12 und 13 wurden zusammen katalogisiert. Die Angaben in eckigen K l a m m e m im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 33 und beziehen sich auf die N m . 1 bis 33. Verkäufer: Pasche [oder] Flügge Transakt.: Verkauft (6 M) Käufer: Β 1784/08/13 HBDEN 0013 P.Bredael I Zwey Brabandische Stadt=Land= und Wassergegenden, theils mit Processionen und Kirmissen. Auf einem jeden mehr denn 100 Figuren. Von P. Bredael lebhaft vorgestellt, auf Leinwand. [NB. Alle Gemähide bis No. 33 haben keine Rahmen.] I Diese Nr.: Eine Brabandische Stadt=Land= und Wassergegend, theils mit Processionen und Kirmissen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll. Breit 25 Zoll. Anm.: Die Lose 12 und 13 wurden zusammen katalogisiert. Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 33 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 33. Verkäufer: Pasche [oder] Flügge Transakt.: Verkauft (6 M) Käufer: Β 1785/04/22 HBTEX 0026 Peter Bredel I Ein Seehaven, wo Güter geladen werden. Der Compagnon eine waldigte Landschaft. Auf Leinewand. Schwarzer Rahm. I Diese Nr.: Ein Seehaven, w o Güter geladen werden; Pendant zu Nr. 27 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 12 Zoll, breit 17 Zoll Anm.: Die Lose 26 und 27 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1785/04/22 HBTEX 0027 Peter Bredel I Ein Seehaven, w o Güter geladen werden. Der Compagnon eine waldigte Landschaft. Auf Leinewand. Schwarzer Rahm. I Diese Nr.: Eine waldigte Landschaft; Pendant zu Nr. 26 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 12 Zoll, breit 17 Zoll Anm.: Die Lose 26 und 27 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1785/04/22 HBTEX 0041 Peter Bredel I Zwey Land= und Wasserprospecte, mit Gebäuden und sehr schönen Figuren. Auf Leinewand. Schwarzer Rahm und goldne Leisten. I Diese Nr.: Ein Land= und Wasserprospect, mit Gebäuden und sehr schönen Figuren Mat.:
1786/10/18 HBTEX 0056 P. Bredael I Zwey vortrefliche See= Häfen, mit sehr vielen Figuren und Schiffen, die ankommen und abgehen. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Ein vortreflicher See=Hafen, mit sehr vielen Figuren und Schiffen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll 6 Linien, breit 34 Zoll 9 Linien Anm.: Die Lose 55 und 56 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1787/00/00 HB AN 0538 P. Breydel I Ein Seehaven mit Gebäuden und alten Thürmen, wobey Schiffe vor Anker liegen. Im Vordergrunde Arbeiter, welche Güter auf Maulthiere laden; und viele andere Figuren. Sehr schön und meisterhaft gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 25 Zoll, breit 31 Zoll Transakt.: Verkauft (3 M) Käufer: Berth[eau] 1788/08/21 HBRMS 0001 Peter Breedaal I Die Aussicht eines Italienischen Markt=Platzes; besonders reich an Figuren und Vieh. Sehr fleißig gemahlen auf Leinewand schwarzen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 30 Zoll, breit 35 Zoll Transakt.: Verkauft (12.8 M) Käufer: Meyer 1790/01/07 MUAN 0021 Bredael, Peter, von I Ein Bauernstück mit einer Landschaft, auf Leinwat, in vergoldter Ram. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 10 Zoll, Breite 2 Schuh 8 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0097 P. van Breda I Ein Opfer=Fest. Ein Priester stehet in einem von vier Säulen erbauten Tempel, und opfert, da indessen einige mit Blumen bekränzte Weiber in einem Kreise nach einer Tambourine vor denselben tanzen. I Maße: Hoch 53 Zoll, breit 58 Zoll Transakt.: Unbekannt 1800/00/00+ LZRST [0013] Peter van Bredael I Ein Viehmarkt in einer heroischen Landschaft, reiche Zusammensetzung mit einer unendlichen Menge von Gegenständen. I Mat.: auf Leinwand Maße: 36 Zoll breit 26 Zoll hoch Anm.: D a die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Rost Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
365
Bredah, Mart. [Nicht identifiziert] 1799/12/04 HBPAK 0086 Mart. Bredah I Zwey Land= und Dorfgegenden mit Figuren und Vieh. Auf Holz. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine Land= und Dorfgegend mit Figuren und Vieh Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Vi Zoll, breit 15 Zoll Anm.: Die Lose 86 und 87 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0087 Mart. Bredah I Zwey Land= und Dorfgegenden mit Figuren und Vieh. Auf Holz. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine Land= und Dorfgegend mit Figuren und Vieh Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Vi Zoll, breit 15 Zoll Anm.: Die Lose 86 und 87 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Bree 1799/12/04 HBPAK 0098 van de Free I Ein inwendiges Bauemhaus, worin eine Frau ihr Kind auf dem Schöße stillet; die Mutter neben ihr, bey der Wiege, vor einem Camin sitzend, um Essen zuzubereiten. Im Hintergrunde der Mann, als Küper, mit Arbeit beschäftigt. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Vi Zoll, breit 6 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt
Bree, Mathieu Ignace van 1798/06/04 HBPAK 0174 Von de Bree I Eine schlafende Venus, die von ihrem Geliebten in der linken Hand mit Blumen auf ihrem Busen zu erwachen hoffet. Auf das herrlichste gemahlt. Auf Holz, goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Unbekannt
Breenbergh, Bartholomeus 1750/00/00 KOAN 0021 Bartholome Breemberg I Une Piece du nouveau Testament, oü la Femme adultere est menee devant le Sauveur du monde; belle disposition, beau dessein, belle distribution dans les caracteres, sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: Largeur 3 Pies 11 Pouces, Haut 2 Pies 11 Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1763/01/19 FRJUN 0091 B. Breenberg I Un admirable petit paisage sur cuivre orne de quelques figures tres bien acheve. I Mat.: auf Kupfer Maße: hauteur 6 pouces, large 7 Vi pouces Transakt.: Unbekannt (24 Vi fl) 1763/11/09 FRJUN 0031 B. Breenberg I Un tres beau & agreable pa'isage orne de quelques figures, parfaitement acheve. I Maße: hauteur 6 pouces, largeur 7 Vi pouces Transakt.: Verkauft (31.15 fl) Käufer: Kaller 1763/11/09 FRJUN 0032 B. Breenberg I Un agreable paisage orne de figures aussi bien peint. I Maße: hauteur 12 Vi pouces, largeur 16 Vi pouces Transakt.: Verkauft (12 fl für die Nrn. 32 und 33) Käufer: Kamerrath Boltz 1763/11/09 FRJUN 0033 B. Breenberg I Un Pareil pas moindre & de meme grandeur. I Maße: hauteur 12 Vi pouces, largeur 16 Vi pouces Transakt.: Verkauft (12 fl für die Nrn. 32 und 33) Käufer: Kamerrath Boltz 1764/03/12 FRKAL 0018 B. Breenberg i Un tres agreable petit pa'isage orne de quelques figures parfaitement acheve. I Maße: hauteur 6 Vi pouces, largeur 8 pouces Transakt.: Verkauft (12 fl) Käufer: Kaller 1764/06/07 BOAN 0635 Barthelemi Breemberg lUn Tableau d'un pied trois pouces de hauteur d'un pied de largeur, representant la Rebecq au puit une cruche ä la main, peint par Barthelemi Breemberg. [Ein stück Vorstellend die Rebeccam mit Krug am brunnen, gemahlt Von Bartholomeo Bremberg.] I Maße: 1 pied 3 pouces de 366
GEMÄLDE
hauteur 1 pied de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (64 Rt) Käufer: Broggia 1765/00/00 FRRAU 0144 Barthol. Breemberg I Wie Rebecca am Brunnen Wasser holt; Dieses Bild ist eines mit der schönsten im Cabinet, glühend im Colorit, gut gezeichnet, und von angenehmer Ordination. Representant Rebecca puisant de l'eau ä la Fontaine. C'est un des plus beaux tableaux de ce cabinet, le coloris est enflamme, il est bien dessine & l'ordonnance agreable. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 1 Schuh 4 Zoll, breit 1 Schuh 1 Zoll Transakt.: Unbekannt 1767/00/00 KOAN 0036 Bremberck I Ein Historien=stuck aus dem Evangelio auf Holtz vom Bremberck. I Mat.: auf Holz Maße: Breite 5 Fuß !4 Zoll, Höhe 3 Fuß 10 Vi Zoll Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt 1769/03/30 HBTOU 0012 Bartolome Bremberg I Eine Landschaft von Bartolome Bremberg auf Holz gemahlt. [Die Mehresten in fein verguldte Rahmen, und die übrigen in schwarz gebeizten mit goldenen Staber.] I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Fuß 3 Zoll, Breite 1 Fuß 7 Zoll Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 51 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 51. Transakt.: Verkauft (30.12 M) Käufer: Hofrath 1776/00/00 WZTRU 0059 Barholomäus Breenberg I Ein Stück 1 Schuhe, 10 Zoll hoch, 2 Schuhe, 2 Zoll breit von Barholomäus [sie] Breenberg, vorstellend eine Landschaft, welche von guter Verständniß und angenehmer Colorit mit einem Antiquengebäu zu ersehen. Dieses angenehme Stück ist treflich unnachahmlich exprimiret. I Maße: 1 Schuhe 10 Zoll hoch, 2 Schuhe 2 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (15 fl Schätzung) 1776/07/19 HBBMN 0020 Bremberg I Eine dito Landschaft, mit einen Brunnen. I Maße: Höhe 1 Fuß 4 Vi Zoll, Breite 1 Fuß 9 Zoll Transakt.: Verkauft (12.8 M) Käufer: Lilie 1778/07/11 HBTEX 0069 Bartholomceus Bremberg I Eine schöne Landschaft mit Ruderibus und viele kleine Figuren. I Transakt.: Unbekannt 1778/09/28 FRAN 0356 Bartholom. Breemberg I Eine Landschaft, alte Rudera vorstellend. [Un paysage representant des debris.] I Pendant zu Nr. 357 Maße: 8 Zoll breit, 6 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (58 fl für die Nrn. 356 und 357) Käufer: Ettling 1778/09/28 FRAN 0357 Bartholom. Breemberg I Der Compagnon, eine Landschaft mit der nemlichen Vorstellung, von dito [Bartholom. Breemberg]. [Le pendant du precedent, un paysage representant le meme objet [paysage representant des debris], par le meme maitre [Barthelemy Breemberg].] I Pendant zu Nr. 356 Maße: 8 Zoll breit, 6 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (58 fl für die Nrn. 356 und 357) Käufer: Ettling 1779/00/00 HB AN 0120 Barthol. Breenberg I In einer bergichten Gegend binden einige Nymphen unweit eines Gemäuers zur Rechten einem Satyr die Hände, der sich mit seinen Bocksfüßen wehrt. Auf Holz. [Dans un paysage montagneux on voit des Nymphes pres de quelques vieilles masures ä droite lier les mains ä un Satyre, qui se defend avec ses pieds de bouc. Sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 2 Fuß hoch, 3 Fuß 1 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0047 Breemberg. (Bartolome) I Paysage, oü se voit ä gauche des Ruines, sur le devant un peu sur la droite deux Hommes luttant ensemble, Tableau peint sur cuivre. I Mat.: auf Kupfer Maße: haut 5 pouces sur 6 de large Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0048 Breemberg. (Bartolome) I Le marche aux poisson, oü se voit une quantite innombrable de Monde habilles ä la Venitienne, sur la gauche se voit une grande Ville, & sur la droite au milieu un Pont de pierre sous lequel passe une quantite de
Gondoles. Tableau peint sur cuivre: il porte 18 pouces 3 lignes de haut, sur 24 pouces de large. On lit en bas B. 1655. I Mat.: auf Kupfer Maße: 18 pouces 3 lignes de haut, sur 24 pouces de large Inschr.: B. 1655 (bezeichnet und datiert) Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0059 Bartholomäus Breenberg I Ein Stück 1 Schuhe, 10 Zoll hoch, 2 Schuhe, 2 Zoll breit von Bartholomäus Breenberg, eine Landschaft vorstellend, welche von guter Verständniß und angenehmer Kolorit mit einem Antiken Gebäude zu sehen ist. Dieses angenehme Stück ist trefflich unnachahmlich exprimiret. I Maße: 1 Schuhe 10 Zoll hoch, 2 Schuhe 2 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1782/09/30 FRAN 0031 Bartholomaus Breemberg I Eine fein und fleisig ausgeführte Landschaft mit Ruinen und Vieh. [Un tres beau paysage avec des debris & du betail, par Barthelemy Breemberg.] I Pendant zu Nr. 32 von C. Poelenburgh Maße: 1 Schuh 5 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (110.15 fl für die Nrn. 31 und 32) Käufer: Kaller 1782/09/30 FRAN 0139 Bartholomaeus Breemberg I Die Geburt des Erlösers, fein und fleisig wie Emaille ausgearbeitet von Bartholomaeus Breemberg. [La naissance du Sauveur, piece soigneusement travaillee en gout d'email, par Barthelemy Breemberg.] I Maße: 10 Zoll hoch, 8 Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (70.15 fl) Käufer: Hüsgen 1783/06/19 HBRMS 0097 B. Bremberg I Im einen reich gezierten Vorplatze will ein geharnischter Mann eine kniende Frauensperson erstechen, eine andere stoßet ihn aber zurück. H[olz]. g.R. [verguldeter Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 11 Zoll hoch, 1 Fuß 5 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1785/05/17 MZAN 0075 Bartholomaus Breemberg I Christus der mit der Dornenkron gekrönet wird von Bartholomaeus Breemberg. [Jesus Christ couronne d'epines.] I Maße: 2 Schuh 1 Zoll hoch, 1 Schuh 8 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (156 fl) Käufer: Tischbein 1785/05/17 MZAN 0196 Breemberg I Ein paar Landschaften mit Kirchen von Breemberg. [Deux eglises representees dans 2 paysages.] I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Kirchen Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 196 und 197 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (94 fl für die Nrn. 196 und 197) Käufer: Ettling 1785/05/17 MZAN 0197 Breemberg I Ein paar Landschaften mit Kirchen von Breemberg. [Deux eglises representees dans 2 paysages.] I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Kirchen Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 196 und 197 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (94 fl für die Nrn. 196 und 197) Käufer: Ettling 1785/05/17 MZAN 0199 Breemberg I Eine Landschaft mit einem Felsen, worinn eine Höhle ist von Breemberg. [Une caveme dans un rocher.] I Maße: 8 Vi Zoll hoch, 1 Schuh breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (132.30 fl) Käufer: Tischbein 1785/05/17 MZAN 0238 Breemberg I Diane an einer Grotte schlafend von Breemberg. [Diane en sommeil aupres d'une grotte.] I Maße: 1 Schuh 11 Zoll hoch, 2 Schuh 4 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (25 fl) Käufer: Hofr ν Leykam
1787/00/00 HB AN 0122 Bartholomen Brenberg I Die verfallenen Rudera eines alten Gebäudes, welches mit vielen Moos und Kräutern bewachsen ist. Im Vordergrunde ein kleines Wasser, bey welchem sich viele Stauden befinden. Zur rechten des Gemähides sitzt eine Nymphe auf einer Anhöhe, ein junger Mann siehet sich verwundernd vor ihr. In der nebelichten Ferne wird man eine angenehme Aussicht gewahr. A.H. [Auf Holz] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 14 Vi Zoll, breit 12 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (70 M) Käufer: Fesser 1787/00/00 HB AN 0625 Bartholomen Brenberg I Die Kreuzigung Christi. Verschiedene Hencker bevestigen das Kreuz. Im Vordergrunde einige Hauptleute, hinter welchen man viele zu Pferde siehet. Zur rechten drey Krieger, die um das Kleid des Heilandes würfeln. Hinter diesen im Hintergrunde die betrübte Familie. Eine dunkele dunstige Luft veredelt diese Trauerscene. Von reizender Schönheit. Die Composition ist reich und voll Geist, die Zeichnung richtig, die Mahlerey meisterhaft; aber vorzüglich ist die angenehme Austheilung des Lichs [sie] und Schattens zu bewundern. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 45 Vi Zoll, breit 39 Zoll Transakt.: Verkauft (31 M) Käufer: Ekhard 1787/04/19 HBTEX 0011 Bartholomaeus Bremberg I Diogenes sucht Menschen mit der Lanterne, ein ausnehmend Gemähide. I Transakt.: Verkauft (90 M) Käufer: Eck 1789/00/00 MM AN 0208 Barth. Breenberg I Eine Landschaft mit Ruinen, auf Leinw. [Un paysage avec une ruine, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 11 Zoll hoch, 2 Fuß 5 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt 1790/08/25 FRAN 0249 Breuberg I Eine Landschaft. I Maße: hoch 7 Zoll, breit 8 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (1 fl) Käufer: Kaller 1793/00/00 HBMFD 0080 B. Brenberg I Christus am Kreutz. Hinten zieht der Zug die Anhöhe hinunter nach der im Thale liegenden Stadt Jerusalem. Die dunkle Luft macht mit dem Hauptsujet den vortreflichsten Contrast. Besonders keck und meisterhaft gemalt. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuss 4 Zoll hoch, 1 Fuss breit Verkäufer: Pierre Laporterie Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 HB AN 0020 Barth. Breenberg I In einer anmuthigen Landschaft ruht die ermüdete, ganz entkleidete, Göttin der Jagd, neben den Ruinen eines Schlosses, in tiefem Schlummer, mit zweyen ihrer Nymphen. Sie bieten dem lusttrunkenen Auge des, sie und sich überraschenden, Jünglings Reize dar, die frey willig nur die überwundene Schaam, sich mit lässigem Sträuben wehrend, dem Blicke der Liebe allein vergönnt. Köcher, Pfeile, Bogen, Hom und Jagdspiess liegen, neben den reichen Kleidern, um sie her. I Maße: Höhe 35 Zoll, Breite 44 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1796/02/17 HBPAK 0030 Barth. Bremberg I In einer anmuthigen Gegend vor einem zerfallenen Schlosse wird Hornvieh getrieben. Zur Linken über ein kleines Wasser, geht ein Steg, worauf ein Reuter und ein Fussgänger befindlich. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 16 3/4 Zoll, Breite 22 V* Zoll Transakt.: Verkauft (26 M) Käufer: Τ
1785/05/17 MZAN 0299 Breemberg I Ein alter Philosoph von Breemberg. [Un Vieux philosophe.] I Maße: 1 Schuh 5 Zoll hoch, 1 Schuh 2 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (60 fl) Käufer: Rev Rmus de Fechenbach [und] Hofrath Mulzer
1796/02/17 HBPAK 0049 Bartholome I In einer gebirgigten Landgegend, unter einer Felsen=Höhle, tanzen und scherzen verschiedene Faunen; um sie und bey ihnen liegen und stehen Ziegenböcke. Etwas entfernter stürzt ein Wasserfall zwischen Felsen hinab. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 19 Zoll, Breite 26 Zoll Transakt.: Verkauft (60 M) Käufer: Τ
1786/10/18 HBTEX 0011 B. Bremberg I Einige römische Gegenden, mit Ruinen, nebst verschiedenen Reisenden und einem Hirten mit Schafen, fleißig gemahlt auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Zoll 6 Linien, breit 14 Zoll 9 Linien Transakt.: Unbekannt
1796/02/17 HBPAK 0101 Bartholome I Vor einem alten italiänischen Schlosse treibt ein Hirte Rinder und Ziegen. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 12 % Zoll, Breite 25 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (60 M) Käufer: Τ GEMÄLDE
367
1796/02/17 HBPAK 0166 Barth. Bremberg I In einer römischen Landgegend bey einem Gemäuer sitzt Joseph mit dem Christ=Kinde aufm Schoosse; zwey Engel beten das Kind an. Zur Linken kniet Maria bey einem Flusse, woneben der Esel steht. Auf Holz. Runden Formats. I Mat.: auf Holz Format: rund Maße: Höhe 10 Vi Zoll, Breite 10 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (91.8 M) Käufer: Τ 1798/05/14 KOAN 0009 Bremberg I Les 7 merveilles du monde par Bremberg, en 7 petits tableaux sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 1 pieds; Largeur 1 pieds 4 Vi pouces Verkäufer: de Bors d'Overen Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 LZAN 0072 Bartholome Braemberg I Un Tableau. La separation de Jacob et de Laban, et de leurs troupeaux; d'un precieux fini. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 12 pouces, largeur 15 pouces Transakt.: Unbekannt (12 Louis Schätzung) 1799/00/00 LZAN 0116 D. F. Braemberg I Un Paysage en camayeux avec figures, representant sur une elevation les restes d'une ancienne architecture gothique tombant en ruines, dont les souterrains servent de retraite ä des Hermites. II regne dans ce paysage une harmonie de couleur tres-brillante et une intelligence de perspective du plus grand effet. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 18 pouces, largeur 23 pouces Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "D. F. Braemberg", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt (25 Louis Schätzung) 1799/00/00 LZRCH 0039 Bartholome Bremberg lUn paysage avec architecture et ruines, orne de baigneuses et autres figures, qui semblent s'entretenir, ce tab. est d'une brillante couleur, et d'une belle conservation. I Mat.: auf Leinwand Maße: h. 13.1. 19. pouces Verkäufer: J F Rauch Transakt.: Unbekannt 1799/10/18 LZAN 0071 Bartholome Breemberg I Bey den Ruinen eines zerfallenen Theaters, siehet man eine Heerde Ziegen, der Hirt sitzt im schattigten Vordergrund; hoch 4 Vi Zoll, breit 5 Vi Zoll. Auf Kupfer, in einem reichen Rahm. I Mat.: auf Kupfer Maße: hoch 4 Vi Zoll, breit 5 Vi Zoll Verkäufer: Rauch Transakt.: Verkauft (5 Th) Käufer: Schwarz
ren hin und her und landen. Im Mittelpunkt ein Felsen, an dessen Fuß ein Fort, und auf dem Gipfel die Rudera einer alten Burg sichtbar sind. In den Hintergründen wechseln Städte und Gebirge ab. Die Figuren von Rembrand. I Transakt.: Unbekannt
Breenbergh, Bartholomeus (und Wouwerman) 1800/00/00 BLBOE 0026 Breenberg; Wouvermann I Eine zum Theil zerfallene Burg an den Ufern der See. Mehrere Schiffe laufen in den Hafen. Am Ufer ist man mit Aus= und Einladen beschäftigt. Die Stafage ist von Ph. Wouvermann. I Transakt.: Unbekannt
Breenbergh, Bartholomeus (Manier) 1782/07/00 FRAN 0126 Bartholom. Bremberg I Eine sehr fleißig ausgearbeitete Höhle, worinn ein weisser Bock und liegendes Schaaf angebracht sind, nebst einer angenehmen Feme, in der Manier des Bartholom. Bremberg I Maße: 5 Zoll hoch, 5 Zoll breit Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt (2.26 fl) 1795/03/12 HBSDT 0219 In der Manier von Bremberg I Christus am Kreutze, mit Neben=Figuren. I Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0035 In der Manier von Bremberg I Wie Joseph seinen Brüdern Getraide verkauft. Reich von Figuren; und kräftig gemahlt. I Maße: Hoch 36 Zoll, breit 57 Zoll Transakt.: Unbekannt
Breidel, Cristophel [Nicht identifiziert] 1742/08/01 BOAN 0332 Cristophel Breidel I Eine Frey-Parthey die Bawren plünderend. Orig. von Christophel Breidel. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0337 Cristoph. Breidel I Zwey Battaillien von Cristoph. Breidel. Original. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt
1799/12/04 HBPAK 0010 Bremberg I Der Bethlehemitische Kindermord, mit vielen Figuren. Auf das schönste und prächtigste gemahlt. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 40 Zoll, breit 52 Zoll Transakt.: Unbekannt
1742/08/30 BOAN 0259 Christophle Breidel I Deux batailles. Couple, par Christophle Breidel. I Maße: Haut 1. pied 3. pou., large 1. pied 9 Vi. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt
1799/12/04 HBPAK 0059 Bremberg I Ein Ovidisches Stück. Eine Venus liegt an einem Berge, und wird von Cupido mit einem Pfeile geschossen. Gut gemahlt. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Zoll, breit 13 Zoll Transakt.: Unbekannt
1742/08/30 BOAN 0361 Christophe Breidel I Une Compagnie Franche pillant un village, par Christophe Breidel. Couple. I Maße: Haut 9 Vi. pou., large 1. p. 2. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt
1800/00/00 FRAN2 0014 Breemberg (Barth.) I Eine Landschaft mit Ruinen. Im vordem Plan sind Schäfer, welche sich unterhalten mit dem, daß sie einiges Vieh auf verschiedene Plätze tanzen machen. Der kecke Pinsel erhebet die schöne Arbeit dieses Stücks. I Mat.: auf Holz Maße: 15 Zoll hoch, 24 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1800/00/00+ LZRST [0014] Barth. Breemberg I Eine Landschaft mit Ruinen; bey einem heissen Sommerabende schlafen Jagdnymphen bey einer Fontaine und werden von einem jungen Jäger belauscht. I Mat.: auf Holz Maße: 21 Zoll breit 16 Zoll hoch Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Rost Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0590 M. Bremberg I Christus am Creutze. I Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "M. Bremberg", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt
Breenbergh, Bartholomeus (und Rembrandt) 1800/00/00 BLBOE 0025 Breenberg; Rembrand I Im Vordergrunde bemerkt man auf beiden Seiten Ruinen. Mehrere Schiffe fah368
GEMÄLDE
Brekelencam, Quiringh Gerritsz. van 1763/11/09 FRJUN 0038 Q. van Brecklenkam I Un tres beau morceau representant un homme assis qui ecaille des poissons, ä cote de lui un garcon & une fille qui tiennent un petit poisson le tout naturellement peint. I Maße: hauteur 14 Vi pouces, largeur 19 pouces Transakt.: Verkauft (141 fl) Käufer: Rath Ehrenreich Gegenw. Standort: Karlsruhe, Deutschland. Staatliche Kunsthalle. (256) 1764/05/21 BOAN 0051 Breckelenkam I Un Tableau de deux pieds de hauteur, d'un pied huit pouces de largeur, representant un Boeuf tue & suspendü, peint par Breckelenkam. [Ein stück Vorstellend Einen geschlachtet= und aufgehenckten ochßen Von Breckelenkamp.] I Maße: 2 pieds de hauteur, 1 pied 8 pouces de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (33 Rt) Käufer: Gilles 1764/05/25 BOAN 0272 Breckelenkamp I Deux Tableaux de deux pieds cinq pouces de largeur, d'un pied dix pouces de hauteur representants Tun un jambon, & divers autres mets gras, l'autre des mets maigres, peints par Breckelenkamp. [Zwey stück Vorstellend allerley speisen, eins Einen schuncken und dergleichen, und andertes fastenspeiß, Von Breckelenkamp.] I Diese Nr.: Un jambon, & divers
autres mets gras Maße: 2 pieds 5 pouces de largeur, 1 pied 10 polices de hauteur Anm.: Die Lose 272 und 273 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (32 Rt für die Nm. 272 und 273) Käufer: jud Baruch 1764/05/25 BOAN 0273 Breckelenkamp I Deux Tableaux de deux pieds cinq pouces de largeur, d'un pied dix pouces de hauteur representants Tun un jambon, & divers autres mets gras, l'autre des mets maigres, peints par Breckelenkamp. [Zwey stück Vorstellend allerley speisen, eins Einen schuncken und dergleichen, und andertes fastenspeiß, Von Breckelenkamp.] I Diese Nr.: Des mets maigres Maße: 2 pieds 5 pouces de largeur, 1 pied 10 pouces de hauteur Anm.: Die Lose 272 und 273 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (32 Rt für die Nm. 272 und 273) Käufer: jud Baruch 1764/08/25 FRAN 0344 Quirin van Brecklinkam I Deux vieillards et vielles. I Diese Nr.: Un vieillard et une vielle Maße: haut 1 pied 9 pouces sur 1 pied 6 pouces de large Anm.: Die Lose 344 und 345 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1764/08/25 FRAN 0345 Quirin van Brecklinkam I Deux vieillards et vielles. I Diese Nr.: Un vieillard et une vielle Maße: haut 1 pied 9 pouces sur 1 pied 6 pouces de large Anm.: Die Lose 344 und 345 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRRAU 0139 Breckenkamp I Eine Schüssel stehet auf dem Tisch, worinnen ein angeschnittener Schincken lieget, darneben stehet ein Teller mit einem Glaß Wein, und ein abgeschnittenes Stück Schincken, eine angeschnittene Citrone lieget dabey, ein Messer, noch ein Glaß Wein, Brodt, ein Teller mit Servelat Würst und ein Senff=Kängen gamiren das Stück ungemein. Es ist zum Appetit gemahlt. C'est un plat sur une table dans le quel il y a un jambon entame, ä cote une assiete avec un verre de vin & une tranche de jambon avec un citron entame ä cote, un couteau, encore un verre de vin, du pain, un assiete avec du cervelat & un moutardier ornent admirablement bien cette piece. Tout est peint ä prendre. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 1 Schuh 10 Zoll, breit 2 Schuh 5 Zoll Transakt.: Unbekannt 1770/10/29 FRAN 0072 Brecklenlamp I Ein ConversationStück. I Maße: Hoch 24 Zoll. Breit 29 Zoll. Transakt.: Unbekannt 1770/10/29 FRAN 0109 Brecklencamp I Ein Weibgen das sich kämmt. I Maße: Hoch 19 Zoll. Breit 16 Zoll. Transakt.: Unbekannt 1772/00/00 BSFRE 0013 Breckelnkamp (Quirin) I Un vieux Capucin, ou Hermite ä tete chauve, vu ä my-corps, assis sous un Arbre, lisant dans un Livre, ä travers des Lunettes. Cadre sculpte & d'ore. I Mat.: auf Holz Maße: haut 10. large 7 % pouces Transakt.: Unbekannt 1776/04/15 HBBMN 0105 Bröcklincamp I Eine Bauern=Lustbarkeit, wo gezecht und getanzt wird. I Maße: Höhe 1 Fuß 4 Vi Zoll, Breite 1 Fuß 8 Zoll Transakt.: Unverkauft 1776/04/15 HBBMN 0137 Bröcklencamp I Eine Bauren=Gesellschaft, so sich divertiren beym Schmause. I Maße: Höhe 1 Fuß 3 Vi Zoll, Breite 1 Fuß 1 Zoll Transakt.: Verkauft (12.4 M) Käufer: Lilie Sen 1776/11/09 HBKOS 0007 Bröckincamp I Ein alter Mann so vor einem dreyfüßigen Stuhl sitzet, worauf ein Heering, Brod und Zwiebeln, wovor er andächtig betet, auf Holz, mit schwarzen Rahm und verguldete Leisten, von Bröckincamp, ein Discipel von Gerh. Dau. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Fuß 7 Zoll, Breite 1 Fuß 2 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt (110.8 M) 1778/05/23 HBKOS 0009 Breklingkamp I Ein schlafendes Bauernmädgen, und ein Bauemjunge, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 14 Vi Zoll, Breite 11 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt
1778/05/30 HBKOS 0122 Brecklingkamp I Zwey lustige Bauern=Stücke, von M. Molinär und Brecklingkamp, auf Holz. [Diese Gemähide sind alle mittlere Grösse, können also an alle Plätze gebraucht werden - dieweilen keine Theilen=Stück, dabey befindlich] I Diese Nr.: Ein lustiges Bauem=Stück; Nr. 121 von J.M. Molenaer Mat.: auf Holz Anm.: Die Lose 121 und 122 wurden zusammen katalogisiert. Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 150 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 150. Dieses Los wurde zusammen mit der Nr. 121 (J.M. Molenaer) verkauft. Verkäufer: Dr Friederici Transakt.: Verkauft (6.8 Μ für die Nrn. 121 und 122) Käufer: Ehrenreich 1778/09/28 FRAN 0560 Quirin van Braeklinkam I Ein Holländisches Bauernstück, eine Wirthinn mit einem Reisenden. [Des paysans Hollandois, une hotesse & des voyageurs.] I Pendant zu Nr. 561 Maße: 1 Vi Schuh breit, 1 Schuh 8 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (125 fl für die Nrn. 560 und 561) Käufer: Mevius modo Schütz 1778/09/28 FRAN 0561 Quirin van Braeklinkam I Der Compagnon, nemliches Maaß. [Le pendant du precedent, meme hauteur & meme largeur.] I Pendant zu Nr. 560, "Ein Holländisches Bauernstück, eine Wirthin mit einem Reisenden" Maße: 1 Vi Schuh breit, 1 Schuh 8 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (125 fl für die Nrn. 560 und 561) Käufer: Mevius modo Schütz 1779/00/00 HB AN 0305 Brekelenkamp I Ein Marktschreyer in spanischer Tracht, der im Begriffe ist, einem Menschen, der mit ängstlicher Mine vor ihm steht, den Zahn auszureißen. Zween seiner Gehülfen stehen hinter ihm an einem Tische, worauf zwey Todtenköpfe, Flaschen und Büchsen befindlich sind. Hinter diesen sieht man noch einige Zuschauer in ängstlicher Erwartung. Auf Holz. [Un charlatan, en habit espagnol, est sur le point d'arracher une dent ä un homme qui est devant lui d'un air de detresse. Deux de ses compagnons sont derriere lui ä une table, sur laquelle on voit deux tetes de mort, des bouteilles & des pots. Quelques spectateurs sont dans l'attente. Sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 2 Fuß 3 Zoll hoch, 3 Fuß 7 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0247 Brecklingkamp I Ein alter reicher Musicus, welcher Geld wieget, um ihn her ist eine Niesche mit halb umgeschlagenem Vorhang. Musicalische Instrumente, ein abgetheilter Geldbeutel, Chatoull=Binde und ein Buch liegen und stehen zerstreut aufm Tisch, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 19 Zoll 3 Linien, Breite 15 Zoll 9 Linien Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/09/30 FRAN 0349 Braklinkamm I Eine studierende junge Mannsperson, in ihrer Hauskleidung an einem Tische sitzend, schön und natürlich ausgearbeitet von Braklinkamm. [Un jeune homme en neglige, assis ä une table pour etudier, tres belle piece, par Braklinkam.] Maße: 1 Schuh 6 Zoll hoch, 1 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (50.45 fl) Käufer: Grahe 1785/05/17 MZAN 0022 Quirin van Braecklinkam I Ein Eremit mit einem Crucifix von Quirin van Braecklinkam. [Un hermite tenant un Crucifix.] I Pendant zu Nr. 23 Maße: 1 Schuh 5 Zoll hoch, 1 Schuh 1 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (36 fl für die Nrn. 22 und 23) Käufer: Vergolder Schwanck 1785/05/17 MZAN 0023 Quirin van Braecklinkam I Das Gegenbild, zwey Eremiten, der eine mit einem Todtenkopfe, der andere in einem Buche lesend vom nämlichen Meister [Quirin van Breacklinkam] und von eben der Höhe und Breite. [Le pendant, deux hermites, Tun tenant une tete de mort, & l'autre lisant dans un Livre par le meme [Quirin van Breaklinkam], meme hauteur & meme largeur.] I Pendant zu Nr. 22 Maße: 1 Schuh 5 Zoll hoch, 1 Schuh 1 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (36 fl für die Nrn. 22 und 23) Käufer: Vergolder Schwanck GEMÄLDE
369
1785/05/17 MZAN 0050 Braeklinkam I Ein Fischmarkt von Braeklinkam. [Un marche aux poissons.] I Maße: 1 Schuh 6 V4 Zoll hoch, 1 Schuh 2 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (64 fl) Käufer: ν Lockowitz 1785/05/17 MZAN 0330 Braecklinkam I Ein betender Einsiedler von Braecklinkam. [Un hermite en prieres.] I Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 2 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (16 fl) Käufer: Hofr ν Leykam 1785/05/17 MZAN 0331 Braecklinkam I Die nämliche Vorstellung [ein betender Einsiedler] von eben dem Meister [Braecklinkam]. [Le meme sujet [un hermite en prieres] par le meme [Braecklinkam].] I Maße: 2 Schuh 3 Zoll hoch, 1 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (34 fl) Käufer: Weingärtner 1785/05/17 MZAN 0413 Braecklinkam I Eine Frau die an einem Tische sitzt und Brod schneidet von Braecklinkam. NB. ist das Gegenbild von Nro. 695. [Une femme assise ä une table converte & tranchante du pain.] I Pendant zu Nr. 695 Maße: 9 Vi Zoll hoch, 10 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (30 fl für die Nrn. 413 und 695) Käufer: Hofr ν Leykam 1785/05/17 MZAN 0483 Braecklinkam I Eine Küche mit einem Mädchen das Rüben schabt von Braecklinkam in Gerard Douw Manier. [Une cuisine dans la quelle une fille ratisse des carottes par Braecklinkam dans le gout de Gerard Douw.] I Maße: 1 Schuh 10 Zoll hoch, 1 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (22.30 fl) Käufer: Dom vic Pingel 1785/05/17 MZAN 0695 Braecklinkam I Ein alter Mann, der an einem Tische sitzt und einen Häring zerschneidet von Braecklinkam, 9 Z. hoch, 10 Z. breit. NB ist das Gegenbild zu Nro. 413. [Un vieillard assis ä une table & tranchant un hareng. NB. C'est le pendant de Nro. 413.] I Pendant zu Nr. 413 Maße: 9 Zoll hoch, 10 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (30 fl für die Nrn. 413 und 695) Käufer: Hofr ν Leykam 1786/05/12 HBTEX 0055 Brecklinkamp I Zwey zechende Bauern mit ihrem Weibe, welche ein Glaß Bier hält, alle um einen Tische sitzend, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 6 Zoll, breit 7 Zoll Transakt.: Verkauft (1 M) Käufer: Schön 1787/00/00 HB AN 0061 Q. Brekelenkamp I Eine vor ihrem Bette sitzende, in einem großen Buche lesende Frau, die das Licht von einer ihr zur Seite brennenden Lampe und Caminfeuer empfängt. Auf Holz, s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 14 Vi Zoll, breit 11 Zoll Transakt.: Verkauft (10.12 M) Käufer: Fesser 1787/00/00 HB AN 0150 Q. Brekelenkamp I Eine Dorfschaft, wo ein Marktschreyer unter einem aufgeschlagenen Zelt auf seinem Theater Zettel auswirft, so viele von der um ihm versammelten Menge Bauern und Kinder aufsuchen. A.H. [Auf Holz] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Zoll, breit 9 Zoll Transakt.: Verkauft (6.8 M) Käufer: Hagen 1787/04/03 HBHEG 0082 Brecklingkamp I Eine ländliche Bauren=Gesellschaft, welche essen und trinken, auf Holz. I Mat.: auf Holz Transakt.: Verkauft (1.8 M) Käufer: Hofr Ehrenreich 1787/10/06 HBTEX 0076 Bröcklinkamp I Ein Philosoph in einem Zimmer, mit Nebensachen, als Bücher u.s.f. mit großem Fleiß ausgeführt, so schön, wie H. Dou. I Transakt.: Unbekannt 1789/08/18 HBGOV 0099 Brecklincamp I Ein Bauren=Gelach, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 17 Zoll, breit 14 Zoll Anm.: Dieses Los trägt im Katalog irrtümlicherweise die Nr. 90. Transakt.: Unbekannt 1790/02/04 HBDKR 0079 Brecklingkamp I Zwey Stücke. Ein Bauer hält einen Hering in der rechten und in der linken seinen Stock, die Frau aber mit beyden Händen eine hölzerne Bierkanne, so schön wie Ostade gemahlt, auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: 370
GEMÄLDE
Hoch 10 Zoll, breit 7 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (3.2 M) Käufer: Oetsmann 1790/08/25 FRAN 0010 Brecklenkamp I Zwey Stück, das eine eine Köchin mit verschiedenen Speisen und Geschirr, das andere ein vergnügter Bauer an der Tafel sitzend neben seiner Frau mit einem Glas Bier in der Hand. I Diese Nr.: Eine Köchin mit verschiedenen Speisen und Geschirr Maße: hoch 16 Zoll, breit 12 Zoll Anm.: Die Lose 10 und 11 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (8.15 fl für die Nrn. 10 und 11) Käufer: Trautman 1790/08/25 FRAN 0011 Brecklenkamp I Zwey Stück, das eine eine Köchin mit verschiedenen Speisen und Geschirr, das andere ein vergnügter Bauer an der Tafel sitzend neben seiner Frau mit einem Glas Bier in der Hand. I Diese Nr.: Ein vergnügter Bauer an der Tafel sitzend neben seiner Frau mit einem Glas Bier in der Hand Maße: hoch 16 Zoll, breit 12 Zoll Anm.: Die Lose 10 und 11 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (8.15 fl für die Nrn. 10 und 11) Käufer: Trautman 1790/08/25 FRAN 0028 Brecklenkamp I Ein Doctor mit einem Uringlas in der Hand. I Maße: hoch 13 Zoll, breit 11 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (3.30 fl) Käufer: Graf Bianc[?] 1790/09/10 HBBMN 0030 Brecklinkamp I Ein alter vergnügter Bauer sieht aus einer Lücke, indem er einen Bier=Krug im Arm hält und sein Pfeifgen raucht, zu dessen Comp, ein sitzender Bauer, welcher die linke Hand an einem aufm Tische stehenden Krug hält, und in der rechten ein Glas Bier. Auf Leinw. I Diese Nr. : Ein alter vergnügter Bauer sieht aus einer Lücke, indem er einen Bier=Krug im Arm hält und sein Pfeifgen raucht; Pendant zu Nr. 31 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 14 Zoll, breit 12 Zoll Anm.: Die Lose 30 und 31 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (4 Μ für die Nrn. 30 und 31) Käufer: Oetsmann 1790/09/10 HBBMN 0031 Brecklinkamp I Ein alter vergnügter Bauer sieht aus einer Lücke, indem er einen Bier=Krug im Arm hält und sein Pfeifgen raucht, zu dessen Comp, ein sitzender Bauer, welcher die linke Hand an einem aufm Tische stehenden Krug hält, und in der rechten ein Glas Bier. Auf Leinw. I Diese Nr.: Ein sitzender Bauer, welcher die linke Hand an einem aufm Tische stehenden Krug hält, und in der rechten ein Glas Bier; Pendant zu Nr. 30 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 14 Zoll, breit 12 Zoll Anm.: Die Lose 30 und 31 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (4 Μ für die Nrn. 30 und 31) Käufer: Oetsmann 1791/05/28 HBSDT 0040 Brocklingkamp I Ein alter Docter [sie] besieht ein Glas Urin. Vor ihm steht ein Mopser, Bücher liegen über ein ander, und noch andre Sachen. Hinten die Aussicht einer Landschaft. Mit ausnehmenden Fleiß gemahlt, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 29 Zoll, breit 25 Zoll Transakt.: Unbekannt 1793/09/18 HBSCN 0007 Brecklenkamp I Zwey Personen ländliche Figuren spielen Karten, ein Zechender sitzt neben ihnen, einer steht hinterm Stuhl das Spiel zu beobachten. Vorzüglich schön gemahlt. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 17 Zoll, breit 15 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1793/09/18 HBSCN 0057 Breklenkamp I Tief im Nachdenken, im braunen Rock und Pelzmütze, sitzt ein alter Mann auf dem Stuhl mit der Pfeiffe in der Hand. Zum bewundern meisterhaft gemahlt. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Zoll, breit 7 Zoll Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 HB AN 0153 Brecklinkam I Ein Mann mit rother Mütze und im Hausrock schmaucht, vor einem Kamine sitzend, seine Pfeife. I Maße: Höhe 14 Zoll, Breite 12 Zoll Verkäufer: Leonelli Transakt.: Unbekannt 1795/11/14 HBPAK 0040 Breeklinkamp I Ein alter Geitziger hält seinen angefüllten Geldbeutel in den Händen; seine Freude dar-
über ist sehr gut ausgedrückt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 % Zoll, breit 7 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0046 Brecklincamp I Das Innere einer Küche, wo eine Wäscherin am Waschfaß beschäftiget ist, und ein alter bärtiger Greis ihr die Cour macht; nebst vielen andern Gegenständen. Ein vortrefliches Bild. Auf Holz, goldenen Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 19 Zoll, breit 15 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0209 Brecklinkamp I Eine Küche, worinnen zwey Frauenzimmer sich befinden, mit verschiedenen Gartengewächsen. Auf Holz, schwarzen Rahm, goldene Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 12 Zoll, breit 13 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0243 Brecklincamp I Das inwendige einer Küche, wo eine Wäscherin am Waschfaß beschäftigt ist, und ein alter bärtiger Greis ihr die Cour macht; nebst vielen andern Gegenständen. Ein vortrefliches Bild. Auf Holz, goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 19 Zoll, breit 15 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/08/09 HBPAK 0014 Breckelenkamp I Eine Stube, worin ein alter Mann auf einen Stuhl sitzt, welcher in der einen Hand eine Kanne mit Bier, und in der andern ein Glas hält; neben selbigen stehet verschiedenes Hausgeräthe. Auf Holz, goldn. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 12 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0077 Bröckelkamp I Eine alte Frau stehet bey einer Zucke oder Brunnen, woraus sie Wasser schöpfet; neben ihr stehen und liegen Schaafe. Sehr gut gemahlt. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Zoll, breit 10 Zoll Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN2 0125 Breckelnkampf \ Eine schwangere Frau steht im Vorhofe bey einem Röhrbrunnen. Dies Bild hat viel Aehnlichkeit mit der Natur. I Mat.: auf Holz Maße: 18 Zoll hoch, 13 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Brenet, Nicolas Guy 1796/02/17 HBPAK 0054 Brenet. 17811 Eine in gelben Atlas gekleidete Dame steht vor einem mit blauem Zeuge überdeckten Tische, auf welchem musikalische Instrumente, Notenbücher und eine Vase mit Rosen, wovon sie eine abzupflücken beginnt. In einem Zimmer vorgestellt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 27 Zoll, Breite 19 Zoll Inschr.: 1781 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Verkauft (36 M) Käufer: Janssen 1796/02/17 HBPAK 0192 Brenet 17751 Ein junges Frauenzimmer, welche eine Taube liebkoset. Zum Compagnon ein Jüngling mit Blumen=Kranz. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 9 % Zoll, Breite 13 Vi Zoll Inschr.: 1775 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Verkauft (102 M) Käufer: W
Brennel, C.V. [Nicht identifiziert] 1784/09/27 FRAN 0074 C. v. Brennel I Zwey meisterhaft gemahlte Landschaften von C.v. Brennel. [Deux paysages superieurement bien peints par C. v. Brennel.] I Maße: 3 Schuh 2 Zoll hoch, 3 Schuh 11 Zoll breit Verkäufer: Freyherr von Berberich Transakt.: Verkauft (4 fl) Käufer: Heiser
Breschiau [Nicht identifiziert] 1750/00/00 KOAN 0149 Breschiau I Une piece, avec des Paisans, bien ordonnee, sur toile, par Breschiau, egal ä Teniers. I Mat.: auf Leinwand Maße: Largeur 1 Pies 10 Pouces, Haut 1 Pies 3 Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt
Bretschneider
Brendel (Brentel)
1706/03/02 DRAN 0037 Bretschneider I Die Stadt Dreßden in perspectivischen Grunde / von Bretschneider auff Holtz. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt
1763/11/09 FRJUN 0039 Brendel I Une tres agreable piece representant une conversation rijouissante de plusieurs figures aupres de quelques Edifices ruines. I Maße: hauteur 26 pouces, largeur 32 pouces Transakt.: Verkauft (34 fl für die Nrn. 39 und 40) Käufer: Kamerrath von Boltz
1793/00/00 NGWID 0126 Bredtschneider I Eine Zeichnungs Academie, worin junge Leute sich der Uebung der Kunst befleißigen, von Bredtschneider. I Pendant zu Nr. 127 Maße: 4 Schuh 3 Zoll hoch, 3 Schuh 11 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
1763/11/09 FRJUN 0040 Brendel I Un Semblable [une tres agreable piece representant une conversation rejouissante de plusieurs figures aupres de quelques Edifices ruines] pas moindre & de meme grandeur. I Maße: hauteur 26 pouces, largeur 32 pouces Transakt.: Verkauft (34 fl für die Nrn. 39 und 40) Käufer: Kamerrath von Boltz 1763/11/09 FRJUN 0041 Brendel I Un autre representant une danse auprfes de quelques ruines d'anciens edifices avec beaucoup de figures parfaitement peint. I Maße: hauteur 23 pouces, largeur 27 Vi pouces Transakt.: Verkauft (23.15 fl) Käufer: Kamerrath Boltz 1764/08/25 FRAN 0035 Brendel I La Resurrection de Lazare en mignature. I Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1786/05/02 NGAN 0548 Brendel I Bildniß einer Frauens=Person. I Maße: 2 Schuh 8 Zoll hoch, 2 Schuh 1 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Unverkauft (1.30 fl Schätzung)
1793/00/00 NGWID 0127 Bredtschneider I Zum Gegenstück eine Bildhauer Academie, mit dem nemlichen Fleiß treflich ausgearbeitet von obigem Meister [Bredtschneider] und Maaß. I Pendant zu Nr. 126 Maße: 4 Schuh 3 Zoll hoch, 3 Schuh 11 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
Bretschneider, Johann Michael 1723/00/00 PRAN [B]0020 Brettschneider I Die vier Elementen / vom Brettschneider. Comp. Ν. [B]17. I Pendant zu Nr. [B] 17 von J. Kessel (I) Maße: Höhe 1 Vi Schuh 1 Vi Zoll, Breite 2 Schuh 3 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt
Breun, Rudolph [Nicht identifiziert] 1744/05/20 FRAN 0004 Rudolph Breun I Contrefait von Rudolph Breun. I Mat.: auf Kupfer Format: rund Verkäufer: von Ucheln Transakt. : Unbekannt
Brendel, Johann Andreas (Le Muet) Breuningk, J. 1784/08/02 FRNGL 0649 der stumme Brendell I Ein Bildniß des Königs Adolphs in Schweden, vom stummen Brendell. I Maße: 11 Zoll breit, 14 Zoll hoch Transakt.: Verkauft (20 Kr) Käufer: Berger
1793/04/06 HBSCN 0008 J. Brüning I Sehr fleißig gemahlte Früchte im Korbe, dergleichen nebenher auf einem steinern Tische liegend. I Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
371
Breydel, C.H. [Nicht identifiziert] 1763/01/17 ΗΝAN [A]0119 C.H. Breydel I Une Piece de fruits, sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 10 Vi pouces, Largeur 11 pouces Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt
Breydel, Karel 1785/05/17 MZAN 0340 Carl Breydel I Zwey Seehäfen von Carl Breydel. [Deux ports de mer.] I Diese Nr.: Ein Seehafen Maße: 10 Zoll hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Anm.: Die Lose 340 und 341 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (18.30 fl für die Nrn. 340 und 341) Käufer: Strecker 1785/05/17 MZAN 0341 Carl Breydel I Zwey Seehäfen von Carl Breydel. [Deux ports de mer.] I Diese Nr.: Ein Seehafen Maße: 10 Zoll hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Anm.: Die Lose 340 und 341 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (18.30 fl für die Nrn. 340 und 341) Käufer: Strecker 1785/05/17 MZAN 0945 Carl Breydel I Zwey Bataillestücke von Carl Breydel. [Deux batailles.] I Diese Nr.: Ein Bataillestück Maße: 1 Schuh 5 Zoll hoch, 2 Schuh 1 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 945 und 946 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (46.30 fl für die Nrn. 945 und 946) Käufer: Hofr Heimes 1785/05/17 MZAN 0946 Carl Breydel I Zwey Bataillestücke von Carl Breydel. [Deux batailles.] I Diese Nr.: Ein Bataillestück Maße: 1 Schuh 5 Zoll hoch, 2 Schuh 1 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 945 und 946 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (46.30 fl für die Nrn. 945 und 946) Käufer: Hofr Heimes 1788/04/08 FRFAY 0155 C. Breidel I Zwey kleine Bataillenstücke, von C. Breidel. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein kleines Bataillenstück Mat.: auf Holz Maße: 5 Vi Z. hoch, und 7 Vi Z. breit Anm.: Die Lose 155 und 156 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (9 fl für die Nrn. 155 und 156) Käufer: Levi ν Μ 1788/04/08 FRFAY 0156 C. Breidel I Zwey kleine Bataillenstücke, von C. Breidel. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein kleines Bataillenstück Mat.: auf Holz Maße: 5 Vi Z. hoch, und 7 Vi Z. breit Anm.: Die Lose 155 und 156 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (9 fl für die Nrn. 155 und 156) Käufer: Levi ν M[annheim] 1794/00/00 FGAN [B]0063 C. Breidol I Eine Landschaft, mit der Aussicht eines Klosters, und eine laufende Uhr, auf Kupfer gemalt. I Mat.: auf Kupfer Maße: 9 % Zoll hoch, 1 Schuh 2 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt (33 fl) 1794/00/00 HB AN 0067 Cheval. C. Breydel I Zwey hitzige Gefechte, zwischen Franken und Ottomanen. Das Eine fällt auf einer hüglichten Ebene, vor einem Warthethurm, vor; das Andere in einer gebirgigten Gegend neben den Trümmern eines griechischen Grabmaals. I Diese Nr.: Ein hitziges Gefecht, zwischen Franken und Ottomanen. Dieses fällt auf einer hüglichten Ebene, vor einem Warthethurn, vor Maße: Höhe 12 Zoll, Breite 14 Zoll Anm.: Die Lose 67 und 68 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 HB AN 0068 Cheval. C. Breydel I Zwey hitzige Gefechte, zwischen Franken und Ottomanen. Das Eine fällt auf einer hüglichten Ebene, vor einem Warthethurm, vor; das Andere in einer gebirgigten Gegend neben den Trümmern eines griechischen Grabmaals. I Diese Nr.: Ein hitziges Gefecht, zwischen Franken und Ottomanen. Dieses [fällt] in einer gebirgigten Gegend neben den Trümmern eines griechischen Grabmaals [vor] Maße: Höhe 12 Zoll, Breite 14 Zoll Anm.: Die Lose 67 und 68 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 372
GEMÄLDE
1797/04/20 HBPAK 0150 Chevalier Breidel I Eine Schlacht. Ein vollkommnes Gemähide. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 9 Zoll, breit 13 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 LZAN 0098 Charles Breydel I Deux Pendans. Chocs de cavalerie d'une touche savante et pleine de chaleur. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hauteur 12 pouces, largeur 15 pouces Transakt.: Unbekannt (12 Louis Schätzung) 1799/00/00 LZAN 0099 Charles Breydel I Deux Pendans. Chocs de cavalerie oü rfegne la meme chaleur de composition que dans les precedens avec plus de rapport ä la miniature. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 6 pouces, largeur 6 pouces Transakt.: Unbekannt (10 Louis Schätzung) 1799/00/00 LZRCH 0057 Chevalier Breydel I Deux sujets de batailles, d'un effet tres brillant. I Mat.: auf Leinwand Maße: h. 11 1. 13. pouces Verkäufer: J F Rauch Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN2 0121 Breydael (Chevalier) I Zwey Schlachtstücke, Capital von diesem Meister. Auf dem ersten sieht man, wie Bauern von Soldaten sehr übel behandelt werden. Auf dem zweyten aber, wie jene in Uebermacht auf diese herfallen. Die gewöhnliche Manier dieses Mahlers ist bekannt genug, um hier nichts mehr zum Vortheile dieses Bildes sagen zu dürfen. I Diese Nr.: Ein Schlachtstück, worauf Bauern von Soldaten sehr übel behandelt werden Mat.: auf Holz Maße: 18 Vi Zoll hoch, 24 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 121 und 122 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN2 0122 Breydael (Chevalier)! Zwey Schlachtstücke, Capital von diesem Meister. Auf dem ersten sieht man, wie Bauern von Soldaten sehr übel behandelt werden. Auf dem zweyten aber, wie jene in Uebermacht auf diese herfallen. Die gewöhnliche Manier dieses Mahlers ist bekannt genug, um hier nichts mehr zum Vortheile dieses Bildes sagen zu dürfen. I Diese Nr.: Ein Schlachtenstück, worauf jene [Bauern] in Uebermacht auf diese [Soldaten] herfallen Mat.: auf Holz Maße: 18 Vi Zoll hoch, 24 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 121 und 122 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Briagard [Nicht identifiziert] (Kopie von) 1781/00/00 WRAN 0185 Briagard: Bouche I Une Baigneuse. Esquisse terminee ceintree du haut, peint sur toile d'apres Bouche par Briagard. I Kopie von Briagard nach Boucher Mat.: auf Leinwand Maße: haut 15 pouces, large 12 pouces Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt
Bridt, Bernaert de 1775/02/25 HBBMN 0048 B. de Bridt I Zwey Stück, als eine Gärtner=Familie mit allerley Gemüse, der Compagnon eine Jäger= Gesellschaft mit todtes Wild. I Diese Nr.: Ein Stück, als eine Gärtner=Familie mit allerley Gemüse; Pendant zu Nr. 49 Anm.: Die Lose 48 und 49 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1775/02/25 HBBMN 0049 B. de Bridt I Zwey Stück, als eine Gärtner=Familie mit allerley Gemüse, der Compagnon eine Jäger= Gesellschaft mit todtes Wild. I Diese Nr.: Ein Stück, als eine Jäger= Gesellschaft mit todtes Wild; Pendant zu Nr. 48 Anm.: Die Lose 48 und 49 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1793/01/15 LZRST 7053 R. de Brid I Ein todter Haase und verschiedenes wildes Geflügel, von einem Jagdhunde bewacht, in einer Landschaft, meisterhaft von R. de Brid, auf Leinwand gemahlt, etwas brüchigt, 13 Zoll breit, 11 Zoll hoch, ohne Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: 13 Zoll breit, 11 Zoll hoch Transakt.: Verkauft (19 Gr) Käufer: Geiser 1797/06/13 HBPAK 0144 B. de Bridt I Zwey sehr lebhaft gemahlte Jagdstücke, mit vielen Geräthschaften und Hunden, nebst
verschiedenen todten Federvieh und Haasen. Auf Holz. Zwey schöne Gemähide. I Diese Nr.: Ein sehr lebhaft gemahltes Jagdstück Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 % Zoll, breit 17 % Zoll Anm.: Die Lose 144 und 145 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/06/13 HBPAK 0145 B. de Bridt I Zwey sehr lebhaft gemahlte Jagdstücke, mit vielen Geräthschaften und Hunden, nebst verschiedenen todten Federvieh und Haasen. Auf Holz. Zwey schöne Gemähide. I Diese Nr.: Ein sehr lebhaft gemahltes Jagdstück Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 % Zoll, breit 17 % Zoll Anm.: Die Lose 144 und 145 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Briefe, C. [Nicht identifiziert]
breit Anm.: Die Lose 85a und 85b wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (7.13 Th für die Nrn. 85a und 85b) Käufer: Loon 1752/05/08 LZAN 0085b Paul Brühlen i Zwey Landschaften von Paul Brühlen jedes 1 Vi Elle breit % Elle hoch, im vergoldeten Rahmen. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 1 Vi Elle hoch, % Elle breit Anm.: Die Lose 85a und 85b wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (7.13 Th für die Nrn. 85a und 85b) Käufer: Loon 1752/05/08 LZAN 0126a Paul Brühlen I Zwey Landschaften von Paul Brühlen, % Elle hoch 1 Vs Elle breit, im vergoldeten Rahmen. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: % Elle hoch, 1 Vs Elle breit Anm.: Die Lose 126a und 126b wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (3 Th für die Nrn. 126a und 126b)
1786/04/21 HBTEX 0105 C. Briefe fecit. 16601 Das Portrait eines vornehmen Herrn, als Astronomus vorgestellt, ganze Figuren, halbe Größe. I Inschr.: C. Briefe fecit. 1660 (signiert und datiert) Transakt.: Unbekannt
1752/05/08 LZAN 0126b Paul Brühlen I Zwey Landschaften von Paul Brühlen, % Elle hoch 1 Ά Elle breit, im vergoldeten Rahmen. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: % Elle hoch, 1 Vs Elle breit Anm..· Die Lose 126a und 126b wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (3 Th für die Nm. 126a und 126b)
Briesse, de [Nicht identifiziert]
1752/05/08 LZAN 0162a Paul Brühlen I Zwey Landschaften von Paul Brühlen auf Holtz gemahlt, im vergoldeten Rahmen. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Holz Maße: Vi Elle hoch, % Elle breit Anm.: Die Lose 162a und 162b wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (6 Th für die Nrn. 162a und 162b) Käufer: Hennewardt
1787/03/01 HBLOT 0061 de Briesse I Ein perspektivisches Gebäude, von verschiedenen Logengängen und etlichen Figuren. I Transakt.: Unbekannt (1.8 M)
Brigel, Paul [Nicht identifiziert] 1777/03/03 AUAN 0037 Paul Brigel I Ein die Geschichte Kaiser Rudolphi Imo. I Maße: Höhe 1 Sch. 7 Zoll, Breite 2 Sch. 5 Zoll Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt
Bril, Mathys (der Jüngere) 1796/09/08 HBPAK 0115 Matthias Brill I Eine bergigte Landschaft, mit einem Bergwerk und vielen Wasser=Maschienen. Sehr reich an Figuren. I Maße: Hoch 31 Zoll, breit 41 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/10/17 LZAN 0010 Mathias Brill I Eine Landschaft; im Vordergrunde bemerkt man eine Hirschjagd; im Hintergrunde sind einige Häuser; hoch 30 Zoll, breit 42 Zoll. Auf Holz; in einem vergoldeten Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 30 Zoll, breit 42 Zoll Verkäufer: Rauch Transakt.: Verkauft (1.4 Th) Käufer: Hendel
Bril, Paul 1742/08/01 BOAN 0219 Paul. Briell I Eine Seefahrt. Original von Paul. Briell. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0480 Breill I Eine Landschafft. Orig. von Breill. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0233 Paul Briell I Une piece de mer, par Paul Briell. I Maße: Haut 6. pouces, large 10. pouc. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0388 Breill \ Un Paisage, par Breill. I Maße: Haut 1. pied 10. pou. large 2. pied 9. pouc. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0001 Paul Bril I Un tres beau Paisage, avec figures, en hommes & en animaux, sur bois, bien conserve, Tun des chefs d'oeuvre de Paul Bril. I Mat.: auf Holz Maße: Largeur 3 Pies 11 Pouces, Haut 2 Pies 10 Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollem Transakt.: Unbekannt 1752/05/08 LZAN 0085a Paul Brühten I Zwey Landschaften von Paul Brühlen jedes 1 Vi Elle breit % Elle hoch, im vergoldeten Rahmen. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 1 Vi Elle hoch, % Elle
1752/05/08 LZAN 0162b Paul Brühlen I Zwey Landschaften von Paul Brühlen auf Holtz gemahlt, im vergoldeten Rahmen. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Holz Maße: Vi Elle hoch, % Elle breit Anm.: Die Lose 162a und 162b wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (6 Th für die Nrn. 162a und 162b) Käufer: Hennewardt 1759/00/00 LZEBT 0195 Paul Brill I Eine Landschaft auf Holtz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 2 Schuh 6 Zoll, Breite 1 Schuh 10 Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (60 Th Schätzung) 1763/01/17 HNAN 0035 P. Brill I Construction de la Tour de Babel, par P. Brill, sur bois. Excellent Tableau. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 2 pieds 7 pouces, Largeur 3 pieds 5 pouces Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt 1763/01/19 FRJUN 0063 Paul Bril I Un tres beau & agreable paisage orne de plusieurs figures en attitude diferente parfaitement peint sur cuivre. I Mat.: auf Kupfer Maße: hauteur 14 pouces, large 21 pouces Transakt.: Unbekannt (47 % fl) 1764/05/14 BOAN 0304 Paul Bril \ Un Pai'sage avec figures de sept pieds trois pouces de largeur, quatre pieds six pouces de hauteur, peint par Paul Bril. [Eine große Landschaft mit figuren Von Paul [Brill].] I Maße: 1 pieds 3 pouces de largeur, 4 pieds 6 pouces de hauteur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (18 Rt) Käufer: Doussetti 1767/00/00 KOAN 0003 Paulus Prill I Eine Landschaft mit Figuren und Thieren auf Holtz, von Paulus Prill. I Mat.: auf Holz Maße: Breite 4 Fuß 4 Vi Zoll, Höhe 4 Fuß 1 Zoll Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0288 Brill (Paulus) I [Ohne Titel] \Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0362 Brill (Paulus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
373
1769/00/00 MUAN 0090 Paul Brill I Un Paysage qui represente les principaux faits de l'evangile, comme Jesus Christ delivre les possedes, & commande aux diables de se refugier dans un troupeau de cochons. Peint sur bois marque du No. 362. I Mat.: auf Holz Maße: 1. p. 1. p. de haut sur 1. p. 5 Vi. p. de large Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0095 Paul Brill I Un Paysage dans lequel on voit deux hermites qui voyagent ensemble. Peint sur cuivre marque du No. 288. I Mat.: auf Kupfer Maße: 5 %. pouces de haut sur 7 Vi. pouces de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1770/10/29 FRAN 0121 Brill I Die Historie vom Hauptmann zu Capernaum. I Maße: Hoch 42 Zoll. Breit 66 Zoll. Transakt.: Unbekannt 1771/05/06 FRAN 0063 Paul Brill I Eine Landschaft mit Felsen und Wasserfall, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 29 Zoll, breit 48 Zoll Verkäufer: Johann Friederich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt 1771/05/06 FRAN 0131 Paul Brill I Eine runde meisterhaft gemahlte Landschaft auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Format: rund Maße: 10 Zoll im Durchschnitt Verkäufer: Johann Friederich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt 1773/12/18 HBBOY 0105 Paul Bril I Zwo kleine Landschaften. I Diese Nr.: Eine kleine Landschaft Anm.: Die Lose 105 und 106 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1773/12/18 HBBOY 0106 Paul Bril I Zwo kleine Landschaften. I Diese Nr.: Eine kleine Landschaft Anm.: Die Lose 105 und 106 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1775/04/12 HB NEU 0027 Paul Bril I Magdalena in einer Arcadischen Landschaft, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Transakt. : Unbekannt 1775/05/15 FRAN 0031 Paul Brill I Eine Landschaft mit Felsen und Wasserfall, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 29 Zoll, breit 48 Zoll Verkäufer: Johann Friedrich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt 1775/05/15 FRAN 0085 Paul Brill I Eine runde meisterhaft gemahlte Landschaft auf Kupfer, von Paul Brill, 10 Zoll im Durchschnitt. I Mat.: auf Kupfer Format: rund Maße: 10 Zoll im Durchschnitt Verkäufer: Johann Friedrich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt 1776/00/00 WZTRU 0201 Paulus Brill I Ein Stück 7 Zoll hoch, 10 Zoll breit von Paulus Brill, stellet vor eine bergigte und mit vielen Landschaften sich zeigende Gegend, welche an der See lieget, und mit vielen wohlausgerüsteten Schiffen versehen ist, wobey sich auch sehr viele auf das beßte ausgeführte Figuren befinden; alles ist zum erstaunen gut ausgeführet. I Maße: 1 Zoll hoch, 10 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (20 fl Schätzung) 1776/00/00 WZTRU 0394 Paul Bruel I Ein Stück 6 Vi Zoll hoch, 4 Vi Zoll breit von Paul Bruel, stellet vor einen an der Krücken gehenden Bauern, sammt seiner Frau und Kindern: Dieses Stücke ist sehr gut verstanden, und zeiget eine Verständniß und imitirung der Natur. I Maße: 6 Vi Zoll hoch, 4 Vi Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (3 fl Schätzung) 1776/07/19 HBBMN 0010 P. Bril I Eine dito [kleine ausführliche Landschaft], auf Kupfer, wo die heilige Familie vorgestellet ist. I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 6 Vi Zoll, Breite 9 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (4.4 M) Käufer: Lilie 1776/07/19 HBBMN 0097 Paul Bril I Zwo dito [fleißige] Landschaften. I Diese Nr.: Eine fleißige Landschaft Maße: Höhe 10 Zoll, Breite 1 Fuß 3 Zoll Anm.: Die Lose 97 und 98 wurden zusammen 374
GEMÄLDE
katalogisiert. Transakt.: Verkauft (12 Μ für die Nm. 97 und 98) Käufer: Ohman 1776/07/19 HBBMN 0098 Paul Bril I Zwo dito [fleißige] Landschaften. I Diese Nr.: Eine fleißige Landschaft Maße: Höhe 10 Zoll, Breite 1 Fuß 3 Zoll Anm.: Die Lose 97 und 98 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (12 Μ für die Nrn. 97 und 98) Käufer: Ohman 1776/11/09 HBKOS 0123 Paul Brill I Eine Landschaft mit der Geschichte, wie Christus einen Blinden heilet, auf Holz, im schwarzen Rahm mit verguldete Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Fuß 11 Zoll, Breite 2 Fuß 6 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (1.2 M) Käufer: Lüss 1777/03/03 AU AN 0038 Brihl I Ein die drey Marien beym Grab. I Maße: Höhe 1 Sch. 10 Zoll, Breite 2 Sch. 7 Zoll Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt 1778/05/21 HBKOS 0043 Transakt.: Unbekannt
Paul Brill I Eine kleine Landschaft. I
1778/09/28 FRAN 0019 Paul Briel I Eine schöne Landschaft mit vielen Figuren von Paul Briel. [Un beau paysage avec beaucoup de figures par Paul Briel.] I Maße: 3 Schuh 5 Zoll hoch, 5 Schuh breit Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (18 fl) Käufer: Przß ν Dessau 1778/10/30 HBKOS 0018 P. Brill I Eine Brabandsche Land= und Wasser=Gegend, worinnen einige Schlösser und Dörffer, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 22 Zoll, breit 31 Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/10/30 HBKOS 0188 P. Brill I Die Erbauung eines Tempels, vermuthlich des Salomons vorstellend. I Maße: hoch 54 Zoll, breit 54 Zoll Transakt.: Unbekannt 1779/03/05 HBRMS akt.: Unbekannt
0182
Paul Brill I Eine Landschaft. I Trans-
1781/00/00 WZ AN 0201 Paul Brill I Ein Stück 7 Zoll hoch, 10 Zoll breit vom Paul Brill, stellet eine bergigte und mit vielen wohl ausgerüsteten Schiffen versehen ist, wobey sich auch sehr viele auf das beßte ausgeführte Figuren sich befinden; alles ist zum Erstaunen gut angebracht. I Maße: 1 Zoll hoch, 10 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0394 Paul Bruel I Ein Stück 6 Vi Zoll hoch, 4 Vi Zoll breit von Paul Bruel, stellet einen an der Krücken gehenden Bauern vor, sammt seiner Frau und Kindern. Dieses Stücke ist sehr gut verstanden, und zeiget eine Verständniß und Nachahmung der Natur. I Maße: 6 Vi Zoll hoch, 4 Vi Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0152 Paul Bril I Eine bergigte Land= und Wassergegend, worauf die Historie Bileams abgebildet, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 45 Zoll, Breite 64 Zoll Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1784/08/02 FRNGL 0199 Paul Briel I Eine schön und fleißig ausgearbeitete Landschaft von Paul Briel. I Maße: 12 Zoll breit, 9 Vi Zoll hoch Verkäufer: C Transakt.: Verkauft (7.15 fl) Käufer: Bäumer 1784/08/02 FRNGL 0229 Paul Brühe I Eine im Frühjahr sich belustigende Gesellschaft. I Maße: 24 Zoll breit, 14 Zoll hoch Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "Paul Brühe", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Verkäufer: A Transakt.: Verkauft (14 fl) Käufer: von Schmidt 1784/08/02 FRNGL 0469 Paul Briel I Eine wohl ausgeführte Landschaft. I Maße: 9 Vi Zoll breit, 7 Zoll hoch Transakt.: Verkauft (4 fl) Käufer: Kissner 1785/05/17 MZAN 0662 Paul Brill I Eine Landschaft von Paul Brill. [Un paysage.] I Maße: 8 Zoll hoch, 10 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (6 fl) Käufer: Zitz
1785/05/17 MZAN 1030 Paul Brill I Susana und die zwey Alte von Paul Brill auf Kupfer. [Suzanne & les deux vieillards.] I Mat.: auf Kupfer Maße: 6 Zoll hoch, 8 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (5.30 fl) Käufer: Schaal Vergolder 1785/10/17 LZRST 0019 Paul Brill I Eine Landschaft, welche nach der Kenner Ausspruch von Paul Brill zu seyn scheint, rechts ein grosser Fluss, der sich bis in die Ferne verbreitet, links ein grosser Platz, das Ufer des Flusses, worauf verschiedene Figuren, am Ufer sind eine Menge Kähne, welche voll geladen werden, im Mittelgrunde viele Bäume, im Hintergrunde ein Dorf und Berge. 11 Zoll hoch, 10 Zoll breit, in guten vergoldeten Rahm. I Pendant zu Nr. 20 Maße: 11 Zoll hoch, 10 Zoll breit Transakt.: Verkauft (2.13 Th) Käufer: Streit 1785/10/17 LZRST 0020 Paul Brill I Eine Landschaft, in eben der Manier, scheint von eben dem Meister [Paul Brill] zu seyn, rechts im Vordergrunde ein grosser Platz mit Bäumen besetzt, worauf viele Figuren befindlich, links ein Fluss, auf welchen verschiedene Kähne mit Masten fahren, und im Mittelgrunde ein Stück Land, worauf einige Häuser und Bäume, in der Entfernung Bäume, Wasser und Häuser. Das Gegenbild zu vorigen [Nr. 19]. von gleicher Grösse. I Pendant zu Nr. 19 Maße: 11 Zoll hoch, 10 Zoll breit Transakt.: Verkauft (2.11 Th) Käufer: Caj 1785/10/17 LZRST 0021 Paul Brill I 2 andere Landschaften, in eben der Manier, scheinen ebenfalls von diesem Meister [Paul Brill] zu seyn, zwey Winterstücke, in der einen Landschaft rechts Anhöhen, hinter welchen ein Dorf hervorgeht, auf dem Wege gehende und fahrende Bauern, links Wasser, auf welchem Bauern Schlittschuhe laufen, in der Ferne Windmühlen und beschneite Berge, in der zweyten ist die Gegend eines Dorfes auf der linken Seite mit Bäumen besetzt, rechts ist Wasser, in der Ferne einige Häuser, Gebüsche und beschneite Berge, beyde in vergoldete Rähme. I Maße: 11 Vi Zoll hoch, 15 Zoll breit Transakt.: Verkauft (3.6 Th) Käufer: Caj 1785/12/03 HBBMN 0046 Paul Brill I Schweizerische Gebürge, mit Pferde und Figuren. I Transakt.: Unbekannt 1786/11/11 HBRMS 0035 P. Brill \ Eine Land= und Wasser= Gegend: die erste hat im Vorgrunde einige Figuren, die an einem Hügel liegen, zur Linken ein Kasteel, oder alte Warte, zur Rechten ein hoher Berg, wo einige Figuren ausruhen; die andere ein Haven, wo Schiffe geankert, im Vorgrunde ein Nachen mit verschiedenen Leuten, die Güter ausladen, fleißig und schön gemahlt. I Diese Nr.: Die erste hat im Vorgrunde einige Figuren, die an einem Hügel liegen, zur Linken ein Kasteel, oder alte Warte, zur Rechten ein hoher Berg, wo einige Figuren ausruhen Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 15 Zoll, Breite 20 Zoll Anm.: Die Lose 35 und 36 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/11/11 HBRMS 0036 P. Bril I Eine Land= und Wasser= Gegend: die erste hat im Vorgrunde einige Figuren, die an einem Hügel liegen, zur Linken ein Kasteel, oder alte Warte, zur Rechten ein hoher Berg, wo einige Figuren ausruhen; die andere ein Haven, wo Schiffe geankert, im Vorgrunde ein Nachen mit verschiedenen Leuten, die Güter ausladen, fleißig und schön gemahlt. I Diese Nr.: Ein Haven, wo Schiffe geankert, im Vorgrunde ein Nachen mit verschiedenen Leuten, die Güter ausladen Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 15 Zoll, Breite 20 Zoll Anm.: Die Lose 35 und 36 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1787/00/00 HB AN 0024 Paul Brill I In einer waldigten und bergigten Landschaft stürzt im Vordergrunde Saul von seinem Pferde. Ein Krieger suchet ihn aufzurichten. Im Mittelgrunde zur Linken befindet sich das ganze Heer. Auf Leinew. g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 43 Zoll, breit 67 Zoll Transakt.: Verkauft (25 M) Käufer: Lelly
1787/10/06 HBTEX 0048 Paul Brill I Eine Landschaft mit vielen Figuren, auf Kupfer gemahlt. I Mat.: auf Kupfer Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0069 Paul Bril I 1 Landschaft. [1 p[iece]. de paysage.] I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 9 Zoll, Breite 1 Fuß 2 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1789/00/00 MM AN 0023 Paul Brill I Ein Landschäftchen, auf Kupfer. [Un petit paysage, sur cuivre.] I Mat.: auf Kupfer Maße: 6 Zoll hoch, 7 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (1 fl) 1789/00/00 MMAN 0028 Paul Brill I Ein Landschäftchen, auf Kupfer. [Un petit paysage, sur cuivre.] I Mat.: auf Kupfer Maße: 6 Zoll hoch, 7 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (1 fl) 1789/00/00 MMAN 0046 Paul Brill I Vier Landschaften, auf Leinw. [Quatres paysages, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 10 Zoll hoch, 4 Fuß 1 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (50 fl) 1789/00/00 MMAN 0103 Paul Brill I Die Sündfluth, auf Kupfer. [Le deluge, sur cuivre.] I Mat.: auf Kupfer Maße: 1 Fuß hoch, 1 Fuß 3 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (44 fl) 1789/00/00 MMAN 0311 Paul Brill I Ein Landschäftchen, auf Kupfer. [Un petit paysage, sur cuivre.] I Mat.: auf Kupfer Maße: 1 Fuß 6 Zoll hoch, 2 Fuß breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (15 fl) 1790/01/07 MUAN 0020 Brill Paul I Eine Seelandschaft, auf Holz, in einer vergoldeten Ram. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 2 Schuh, Breite 3 Schuh 9 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1444 Brill Paul I Ein Seesturm, rund, auf Holz, in einer metallisirten Ram. I Mat.: auf Holz Format: rund Maße: Höhe 6 Zoll, Breite 6 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1445 Brill Paul I Eine runde Landschaft, auf Holz, in einer metallisirten Ram. I Mat.: auf Holz Format: rund Maße: Höhe 8 Zoll, Breite 8 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1450 Brill Paul I Ein Tag= und ein Nachtstück, oval, auf Holz, in geschnittenen, und metallisirten Ramen. I Diese Nr.: Ein Tagstück Mat.: auf Holz Format: oval Maße: Höhe 8 Zoll, Breite 7 Zoll Anm.: Die Lose 1450 und 1451 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1451 Brill Paul I Ein Tag= und ein Nachtstück, oval, auf Holz, in geschnittenen, und metallisirten Ramen. I Diese Nr.: Ein Nachtstück Mat.: auf Holz Format: oval Maße: Höhe 8 Zoll, Breite 7 Zoll Anm.: Die Lose 1450 und 1451 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1453 Brill Paul I Eine kleine bergigte Landschaft mit kleinen Figuren, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 8 Zoll, Breite 1 Schuh Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1791/09/21 FRAN 0014 Paul Brill I Eine kleine Landschaft, wo vornen verschiedene Personen sind, weiter ein Fluß mit Schiffen gezieret und in weiter abgelegenen Plätzen wird man alte Schlösser gewahr; dies kleine Gemälde, so sehr fein, ist von der besten Zeit des Meisters. I Transakt.: Verkauft (11.15 fl) Käufer: G Η R Scheibler 1791/09/21 FRAN 0112 Paul Brill I Ein Dorf in Holland, so einen Winter vorstellet, die Spitzen der Bäume sind mit Schnee bedeckt, in der Mitte ist ein Kanal, aufweichem viele Bauern mit GEMÄLDE
375
Schlittschuhen gehen; das Ganze macht eine sehr natürliche Wirkung. I Transakt.: Verkauft (10 fl) Käufer: Levy 1791/09/21 FRAN 0149 Paul Brill I Eine Landschaft, wo vome eine alte Steinbrücke, eine Art von Schloß, und weiter eine Aussicht von einem Fluß und andere dazu gehörige Sachen sind. I Transakt.: Verkauft (5 fl) Käufer: Schmidt 1791/09/26 FRAN 0049 Paul Bril I Zwey Landschaften mit Gebürgen, Gewäfsser] und angenehmen Fernen, von Paul Bril's Meisterhand. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Gebürgen, Gewässer und angenehmen Fernen Maße: 14 Zoll breit 10 Zoll hoch Anm.: Die Lose 49 und 50 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0050 Paul Bril I Zwey Landschaften mit Gebürgen, Gewä[sser] und angenehmen Fernen, von Paul Bril's Meisterhand. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Gebürgen, Gewässer und angenehmen Femen Maße: 14 Zoll breit 10 Zoll hoch Anm.: Die Lose 49 und 50 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0275 Paul Brill I Ein Landschäftchen mit einem Schloss, schönen Bäumen, und angenehmer Gegend auf Kupfer von Paul Brill. I Mat.: auf Kupfer Maße: 11 Zoll hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0503 Bril I Eine angenehme Landschaft mit einigen Figuren, und fließendem Wasser, von Bril. I Pendant zu Nr. 504 Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 2 Schuh 1 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0504 Bril I Zum Gegenstück, ein mit vielen Schatten umgebener großer Bauemhof, nebst einer Brücke über einen kleinen Fluß und schön staffierten Hornvieh, von nemlichem Meister [Bril] und Maaß. I Pendant zu Nr. 503 Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 2 Schuh 1 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0117 Paul Brill I Eine Gegend der Alepen. Im Vordergrunde Figuren. Meisterhaft gemahlt von Paul Brill. I Maße: Hoch 5 Vi Fuß, breit 7 % Fuß Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 FGAN 0060 Paul Brül I Eine Landschaft mit Ruinen, stafiert mit vielen Figuren, auf Kupfer gemalt. I Mat.: auf Kupfer Maße: 8 Zoll hoch, 9 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt (11 fl) 1794/02/21 HBHEG 0129 Paul Brill I Die Taufe Christi, von Johannes im Jordan. In der Entfernung siehet man eine Stadt und Schloß und zu beyden Seiten gebürgigte Hölzung. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 5 Vi Zoll, breit 7 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/06/13 HBPAK 0224 Paul Brill I Unter einer Bergeshöle, welche mit Bäumen, Kräutern und Gras bewachsen, sind unterschiedene Männer, Weiber und Kinder, die sich auf mancherley Art beschäftigen. Ein sehr schönes Gemähide. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 19 % Zoll, breit 28 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/12/08 HBPAK 0009 Paul Brill I Zwey bergigte Landgegenden mit reisenden Figuren zu Pferde und zu Fuß. Ganz gut gemahlt. Auf Holz, im schw. Rahm. I Diese Nr.: Eine bergigte Landgegend mit reisenden Figuren zu Pferde und zu Fuß Mat.: auf Holz Maße: Höhe 20 Zoll, Breite 32 Zoll Anm.: Die Lose 9 und 10 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/12/08 HBPAK 0010 Paul Brill I Zwey bergigte Landgegenden mit reisenden Figuren zu Pferde und zu Fuß. Ganz gut gemahlt. Auf Holz, im schw. Rahm. I Diese Nr.: Eine bergigte Landgegend mit reisenden Figuren zu Pferde und zu Fuß Mat.: auf Holz Maße: Höhe 20 Zoll, Breite 32 Zoll Anm.: Die Lose 9 und 10 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/05/14 KOAN 0024 Briel I Deux paysages avec figures par Briel, sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 1 pied 6 pouces; Largeur 2 pieds Verkäufer: de Bors d'Overen Transakt.: Unbekannt 376
GEMÄLDE
1798/06/04 HBPAK 0122 Paul Bril I Zwey bergigte Landschaften, auf das kräftigste gemahlt. Auf Holz, goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine bergigte Landschaft Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 22 Zoll Anm.: Die Lose 122 und 123 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0123 Paul Bril I Zwey bergigte Landschaften, auf das kräftigste gemahlt. Auf Holz, goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine bergigte Landschaft Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 22 Zoll Anm.: Die Lose 122 und 123 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 LZAN 0044 Paul Brill I Un Paysage d'une touche franche dont les sites et les lointains sont trfes-bien rendus. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hauteur 18 pouces, largeur 28 pouces Transakt.: Unbekannt (20 Louis Schätzung) 1799/00/00 WZAN A0173 Paul Brill I Zwey Landschäftchen mit biblischen Geschichten, von Paul Brill. Auf Kupfer. I Diese Nr.: Ein Landschäftchen Mat.: auf Kupfer Maße: hoch 5 Vi Zoll breit 7 Zoll Anm.: Die Lose A173 und A174 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0174 Paul Brill I Zwey Landschäftchen mit biblischen Geschichten, von Paul Brill. Auf Kupfer. I Diese Nr.: Ein Landschäftchen Mat.: auf Kupfer Maße: hoch 5 Vi Zoll breit 7 Zoll Anm.: Die Lose A173 und A174 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/08/09 HBPAK 0061 Paul Bril I Zwey bergigte Landschaften, worauf ruhende und reisende Figuren. Kräftig gemahlt. Auf Leinwand, schwarzer Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Eine bergigte Landschaft, worauf ruhende und reisende Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 19 Zoll, breit 25 Zoll Anm.: Die Lose 61 und 62 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/08/09 HBPAK 0062 Paul Bril I Zwey bergigte Landschaften, worauf ruhende und reisende Figuren. Kräftig gemahlt. Auf Leinwand, schwarzer Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Eine bergigte Landschaft, worauf ruhende und reisende Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 19 Zoll, breit 25 Zoll Anm.: Die Lose 61 und 62 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0198 P. Briel I Eine bergigte Landschaft, wo im Mittelgmnde Schäffer ihre Schaafe hüten. Im Vordergrunde reisende Figuren. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 37 Zoll, breit 30 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/12/23 Unbekannt
WNAN
0059
Paul Β rile I Un payssage. I Transakt.:
1800/00/00+ LZRST [0016] Paul Brill I Vier sehr fleissig ausgeführte Landschaften mit schönen Bäumen, Gebäuden und Figuren, ganz rund. I Mat.: auf Kupfer Format: rund Maße: 12 Zoll im Durchschnitt Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Rost Transakt.: Unbekannt 1800/07/09 HBPAK 0053 Paul Brill I Vue maritime tres etendue, avec quantite de Batimens. Sur le devant des rochers eleves et domines par des Chateaux. Au premier plan deux Chariots descendant de la montagne. Prfes delä deux Capucins. Sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: 18 pouces de hauteur. Sur 25 pouces de largeur Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0027 Paul Brill I In einer felsigten Berglandschaft mit vielem Wasser, sieht man auf Brücken und Wegen viele Reisende. Auf Holz, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 32 Zoll, breit 45 Zoll Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0040 P. Brill I Eine Winterlandschaft mit einer Schlittenfahrt. Auf Holz, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 Zoll, breit 9 Zoll Transakt.: Unbekannt
1800/11/12 HBPAK 0382 Transakt.: Unbekannt
P. Brill I Eine bergigte Landschaft. I
und die Figuren von Josephin. I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 17 V2 Zoll, Breite 13 Zoll Transakt.: Verkauft (201 M) Käufer: Τ
Bril, Paul (und Brueghel, J. (I))
Bril, Paul (und Momper, J. (II))
1776/04/15 HBBMN 0114 Paul Bril; Brägel I Eine Landschaft mit einer Eremitage, von Paul Bril, die Figuren von Brögel. I Maße: Höhe 1 Fuß 8 Zoll, Breite 2 Fuß 7 Zoll Transakt.: Unverkauft
1796/09/08 HBPAK 0093 Momper; Brill I Eine Landschaft mit einem Berg=Schloß am Ufer des Meeres, mit wandernden Pilgrimmen, wovon einer vor einer Capelle mit einem Rosenkranz in der Hand kniet. I Maße: Hoch 16 Zoll, breit 28 Zoll Transakt.: Unbekannt
1778/07/21 HBHTZ 0073 Paul Brill; Breugel I Eine bergigte Land Gegend, auf Holz, von Paul Brill, die Figuren von Breugel, sehr schön gemahlt. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 20 Zoll, breit 29 Zoll Transakt.: Unbekannt (18 M) 1779/00/00 HB AN 0329 Bril; die Staffirung von Breughel I Ein Fluß schlängelt sich zwischen hohen Gebirgen in die blaue Ferne. Reisende ziehen auf dem Wege zur Rechten näher. Auf Holz. [Une riviere s'etend en serpentant entre de hautes montagnes jusqu'au lointain azure. Des voyageurs avancent de la droite. Sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 7 Zoll hoch, 2 Fuß 8 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0330 Bril; die Staffirung von Breughel I Auf steilen Felsen steigt ein Schloß empor, neben welchem der Weg in tiefe Klippen fortgeht, worauf einige Reisende mit ihren bepackten Maulthieren ziehen. Der hinunter schleichende Fluß bewässert die sich in die Ferne erstreckenden Gebirge. Auf Holz. [Sur des rochers escarpes s'eleve un chateau, ä cöte duquel le chemin s'etend le long de profonds precipices: des voyageurs y passent avec leurs mulets chargös. Une riviere qui coule avec lenteur baigne le pied des montagnes qui s'6tendent au loin.]. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 7 Zoll hoch, 2 Fuß 8 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt
Bril, Paul (und Carracci) 1787/10/06 HBTEX 0023 Paul Brill; Carasch I Eine Römische Gegend, von Paul Brill, mit Figuren, von Carasch, mit dito [vergoldeten] Rahm. I Transakt.: Unbekannt 1791/10/21 HBRMS2 0017 Paul Brill; Caracci I Eine gebürgigte Gegend mit Wasserfällen, Waldungen, Gebäuden ec. im Vordergrunde einige Figuren und Thiere. Ein seltenes und schönes Gemählde. Auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 44 Zoll, breit 74 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 LZRCH 0052 Paul Brill; Carache I Un paysage figures et fabriques, tableau trfes capital de ces deux artistes. I Mat.: auf Leinwand Maße: h. 29.1.45. pouces Verkäufer: J F Rauch Transakt.: Unbekannt
Bril, Paul (und Cesari, G.) 1796/02/17 HBPAK 0050 P. Bull; Josephim I Eine waldigte Gegend. Zur Rechten ist ein Bassin, in welchen das Wasser aus einer Felsen=Höhle hinab fällt; um dasselbe stehen und sitzen v[i]ele Nymphen, in deren Mitte befindet sich Diana, welche den Akteon in einen Hirsch verwandelt, der am gegenseitigen Ufer liegt. Verschiedene Jagende, wie auch Hirsche und Hunde sieht man hin und wieder. Auf Leinwand. Die Landschaft von P. Bull, und die Figuren von Josephim. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 20 Vi Zoll, Breite 27 Vi Zoll Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "P. Bull", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Verkauft (76 M) Käufer: Packi 1796/02/17 HBPAK 0075 Paul Brill; Josephin I Im Vordergrunde einer gebirgigten Gegend, bey Felsen=Klippen und Wasserfall, betet der heilige Hieronymus kniend als Mönch gekleidet, indem der Strahl aus den Wolken auf ihn herab fällt. Zur Linken zwischen Felsen unter einem Baume, sitzt ein anderer Mönch, welcher in einem Buche liest. Auf Kupfer. Die Landschaft von Paul Brill,
Bril, Paul (und Teniers) 1765/00/00 FRRAU 0022 Paul Brill; Tennier I Die Colorit des Meisters Landschaften sind bekannt, daß sie viel ins Grüne fallen; diese Manier stehet seinem Pinzel wohl an, und verbindet sich gut mit einander. Tennier hat die Estavage gemacht und wohl plaisirt; man wird von Paul Brill wenig fleißigere Landschaften finden, als gegenwärtige ist. On fait, que le coloris des pai'sages de ce maitre tombe beaucoup dans le verd; Mais cette faijon de peindre convient bien ä son pinfeau & s'accordent bien ensemble. Tennier en a fait l'etalage & l'a bien place; On trouvera peu de pai'sages de Paul Brille qui soient faits avec plus d'attention, que celui-ci. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 2 Schuh 3 Zoll, breit 3 Schuh 7 Zoll Transakt.: Unbekannt
Bril, Paul (Kopie nach) 1788/09/01 KOAN 0602 Paul Bryl I 2 Bauren, nach Paul Bryl. [2 p[ieces], Villageoises, selon Paul de Bryl.] I Diese Nr.: Ein Baur Mat.: auf Holz Maße: Höhe 8 Zoll, Breite 10 Zoll Anm.: Die Lose 602 und 603 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0603 Paul Bryl I 2 Bauren, nach Paul Bryl. [2 p[ieces]. Villageoises, selon Paul de Bryl.] I Diese Nr.: Ein Baur Mat.: auf Holz Maße: Höhe 8 Zoll, Breite 10 Zoll Anm.: Die Lose 602 und 603 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt
Bril, Paul (Manier) 1778/09/28 FRAN 0065 Paul Briel I Eine Landschaft mit einem Dorf, welches im Brand steht, in der Manier von Paul Briel. [Un paysage avec un village embrase dans le gout de Paul Briel.] I Pendant zu Nr. 66 Maße: 4 Schuh 1 Zoll breit, 2 Schuh 3 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (12 fl für die Nrn. 65 und 66) Käufer: Prß ν Dessau 1778/09/28 FRAN 0066 Paul Briel I Der Compagnon zu obigem, eine Landschaft vom nemlichen Meister [Manier von Paul Briel]. [Le pendant du precedent, un paysage par le meme Maitre [Paul Briel].] I Pendant zu Nr. 65 Maße: 4 Schuh 1 Zoll breit, 2 Schuh 3 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (12 fl für die Nrn. 65 und 66) Käufer: Prß ν Dessau
Brinckmann, Philipp Hieronymus 1759/00/00 LZEBT 0131 Brinckmann I Eine Landschaft auf Holtz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 8 Zoll, Breite 6 Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (80 Th für die Nrn. 131 und 132, Schätzung) 1759/00/00 LZEBT 0132 Brinckmann I Eine dergleichen [Landschaft] auf Holtz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 8 Zoll, Breite 6 Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (80 Th für die Nrn. 131 und 132, Schätzung) GEMÄLDE
377
1763/11/09 FRJUN 0042 Brinckmann I Une nape d'eau dans un pai'sage montagneux orne de quelques figures. I Maße: hauteur 29 pouces, largeur 24 pouces Transakt.: Verkauft (3.20 fl) Käufer: Hoch 1764/03/12 FRKAL 0021 Brinckmann I Un tres beau petit pai'sage ome de quelques figures parfaitement peint. I Maße: hauteur 6 pouces, largeur 8 pouces Transakt.: Verkauft (22.30 fl für die Nrn. 21 und 22) Käufer: Schlundt 1764/03/12 FRKAL 0022 Brinckmann I Un semblable [un tres beau petit pai'sage orne de quelques figures] pas moindre & de meme grandeur. I Maße: hauteur 6 pouces, largeur 8 pouces Transakt.: Verkauft (22.30 fl für die Nrn. 21 und 22) Käufer: Schlundt 1764/03/12 FRKAL 0155 Brinckmann i Une petite tete de vieillard par Brinckmann. I Anm.: Dieses Los wurde zusammen mit der Nr. 154 (Bramer) verkauft. Transakt.: Verkauft (1.20 fl für die Nrn. 154 und 155) Käufer: R Ehrenreich 1764/08/25 FRAN 0161 Brinckmann I 2 paisages. I Diese Nr.: 1 paisage Maße: haut 9 pouces sur 11 pouces de large Anm.: Die Lose 161 und 162 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1764/08/25 FRAN 0162 Brinckmann I 2 paisages. I Diese Nr.: 1 paisage Maße: haut 9 pouces sur 11 pouces de large Anm.: Die Lose 161 und 162 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1764/08/25 FRAN 0444 Brinckmann I 2 paisages par Trautmann et Brinckmann. I Diese Nr.: 1 paisage; Nr. 443 von J.G. Trautmann Maße: haut 7 Vi pouces sur 5 Vi pouces de large Anm.: Die Lose 443 und 444 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1772/00/00 BSFRE 0016 Brinckmann (Philippe Jerome) I Deux Payssages sauvages, avec des Arbres d'un grand finy. Cadres sculptes & d'ores. I Diese Nr.: Un Payssage sauvage, avec des Arbres Mat.: auf Holz Maße: haut de 8, & large de 11 pouces Anm.: Die Lose 16 und 17 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1772/00/00 BSFRE 0017 Brinckmann (Philippe Jerome) I Deux Payssages sauvages, avec des Arbres d'un grand finy. Cadres sculptes & d'ores. I Diese Nr.: Un Payssage sauvage, avec des Arbres Mat.: auf Holz Maße: haut de 8, & large de 11 pouces Anm.: Die Lose 16 und 17 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1772/00/00 BSFRE 0018 Brinckmann (Philippe Jerome) I Deux Payssages, l'un represente un orage de nuit, avec eclairs & l'autre un ouragan d'hyver. Cadres sculptes & d'ores. I Diese Nr.: Un Payssage, un orage de nuit Mat.: auf Leinwand Maße: haut de 11 14 & large de 14 pouces Anm.: Die Lose 18 und 19 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1772/00/00 BSFRE 0019 Brinckmann (Philippe Jerome) I Deux Payssages, l'un represente un orage de nuit, avec eclairs & l'autre un ouragan d'hyver. Cadres sculptes & d'ores. I Diese Nr.: Un Payssage, un ouragan d'hyver Mat.: auf Leinwand Maße: haut de 11 14 & large de 14 pouces Anm.: Die Lose 18 und 19 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/05/23 HB KOS 0023 Brinckmann I Zwey plaisante Landschaftgens, sehr fleißig gemahlet, auf Kupfer. I Diese Nr.: Ein plaisantes Landschaftgens Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 6 Zoll, Breite 8 Zoll Anm.: Die Lose 23 und 24 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/05/23 HBKOS 0024 Brinckmann I Zwey plaisante Landschaftgens, sehr fleißig gemahlet, auf Kupfer. I Diese Nr.: Ein plaisantes Landschaftgens Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 6 Zoll, Breite 8 Zoll Anm.: Die Lose 23 und 24 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 378
GEMÄLDE
1779/09/27 FRNGL 0896 Brinckmann I Ein Winterstück, von Brinckmann, meisterhaft gemalt. [Une piece representante la saison d'hyver, superieurement bien peinte.] I Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 1 Schuh 6 Zoll breit Transakt.: Verkauft (2.45 fl) Käufer: Becker Maler 1785/05/17 MZAN 0037 Brinkmann I Ein Paar Landschaften von Brinkmann. [Deux paysages.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 1 Schuh 10 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 37 und 38 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (93 fl für die Nrn. 37 und 38) Käufer: Tischbein 1785/05/17 MZAN 0038 Brinkmann I Ein Paar Landschaften von Brinkmann. [Deux paysages.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 1 Schuh 10 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 37 und 38 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (93 fl für die Nm. 37 und 38) Käufer: Tischbein 1785/05/17 MZAN 0764 Brinkmann I Ein Paar Landschaften von Brinkmann. [Deux paysages.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 6 Zoll hoch, 8 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 764 und 765 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (12.30 fl für die Nrn. 764 und 765) Käufer: Hofkammerrath Goerz 1785/05/17 MZAN 0765 Brinkmann I Ein Paar Landschaften von Brinkmann. [Deux paysages.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 6 Zoll hoch, 8 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 764 und 765 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (12.30 fl für die Nrn. 764 und 765) Käufer: Hofkammerrath Goerz 1785/05/17 MZAN 1037 Brinckmann I Ein Paar Landschaften von Brinckmann auf Kupfer. [Deux paysages.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Kupfer Maße: 4 Vi Zoll hoch, 6 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 1037 und 1038 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (12.30 fl für die Nrn. 1037 und 1038) Käufer: Weingärtner 1785/05/17 MZAN 1038 Brinckmann I Ein Paar Landschaften von Brinckmann auf Kupfer. [Deux paysages.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Kupfer Maße: 4 Vi Zoll hoch, 6 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 1037 und 1038 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (12.30 fl für die Nrn. 1037 und 1038) Käufer: Weingärtner 1786/05/02 NGAN 0165 Brinkmann I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 9 Zoll breit Anm.: Die Lose 165 und 166 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (20.3 fl für die Nrn. 165 und 166) Käufer: Wild 1786/05/02 NGAN 0166 Brinkmann I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 9 Zoll breit Anm.: Die Lose 165 und 166 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (20.3 fl für die Nrn. 165 und 166) Käufer: Wild 1788/01/31 LZRST [0004] Brinckmann I 2. Landschaften von Brinckmann, Leinw. I Mat.: auf Leinwand Anw..· Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Transakt.: Unbekannt 1788/01/31 LZRST [0022] Brinckm. I 1 schweizerische Winterlandschaft v. Brinckm. Tuch. I Mat.: auf Leinwand Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Transakt.: Unbekannt 1789/00/00 MMAN 0036 Brinckmann I Der barmherzige Samaritan, eine Skizze auf Holz. [Le charitable Samarirain [sie], Esquisse, sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 8 Zoll hoch, 6 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (30 Kr) 1789/00/00 MMAN 0075 Brinckmann I Ein Landschäftchen, auf Holz. [Un petit paysage, sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 6 Zoll
hoch, 8 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (15 fl)
sammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt
1789/00/00 MM AN 0077 Brinckmann I Das Opfer Isaacs, eine Skizze, auf Holz. [Le sacrifice d'Isaac, Esquisse, sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 8 Zoll hoch, 6 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (30 Kr)
1794/00/00 FGAN [B]0158 Bringmann I Zwo Landschaften, ovidisches Stück. Auf Holz gemalt. I Mat.: auf Holz Maße: 7 Vi Zoll hoch, 10 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt
1789/00/00 MM AN 0102 Brinckmann I Eine Landschaft, auf Leinw. [Un paysage, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 4 Zoll hoch, 1 Fuß 2 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt
1794/00/00 FGAN [B]0162 Bringmann I Eine Landschaft, stafiert mit der Diana, mit vielem Gewilde und Figuren, auf Holz gemalt. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Schuh 5 Zoll hoch, 2 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt
1789/00/00 MMAN 0125 Brinckmann I Eine Landschaft, auf Holz. [Un paysage, sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 6 Zoll hoch, 8 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (15 fl)
1794/00/00 FGAN [B]0163 Bringmann I Eine Landschaft, die Diana auf der Jagd, auf Holz gemalt. I Mat.: auf Holz Maße: 9 Vi Zoll hoch, 10 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt
1789/00/00 MMAN 0171 Brinckmann I Eine Landschaft, auf Leinw. [Un paysage, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 6 Zoll hoch, 2 Fuß breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt 1789/00/00 MMAN 0271 Brinckmann I Eine Landschaft, auf Leinw. [Un paysage, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 3 Zoll hoch, 1 Fuß 9 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (22 fl)
1799/00/00 LZAN 0019 Breenckman I Deux Pendans. Paysages ornes de figures et fabriques, d'une touche suave et brillante et d'un precieux fini. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 9 pouces, largeur 12 pouces Transakt.: Unbekannt (35 Louis Schätzung) 1799/00/00 LZAN 0117 Braenckman I Petit paysage, avec un chasseur. I Maße: Hauteur 10 pouces, largeur 8 pouces Transakt.: Unbekannt (10 Louis Schätzung)
1790/07/28 ZHWDR 0043 Brinckmann I [Ohne Titel] I Annotat. : Brinckmann fallt - So heißt es in der Handschrift! [als Anmerkung unten auf der Seite] (LAVATER) Transakt.: Unbekannt
Brinckmann, Philipp Hieronymus (und Hirt, F.W.)
1790/08/25 FRAN 0092 Brinckmann I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: hoch 10 Zoll, breit 13 Zoll Anm.: Die Lose 92 und 93 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (2.45 fl für die Nrn. 92 und 93) Käufer: Müntzrath Dietz
1772/00/00 BSFRE 0020 Brinckmann (Philippe Jerome); Hirt I Deux Payssages, ornes de figures & betail par Hirt. Les Tableaux de ce maitre, sont en s'y grande Reputation, qu'il seroit inutile de les proner. Cadres unys d'ores. I Diese Nr.: Un Payssage, ome de figures & betail Mat.: auf Leinwand Maße: haut de 9 Vi & large de 12 % pouces Anm.: Die Lose 20 und 21 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1790/08/25 FRAN 0093 Brinckmann I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: hoch 10 Zoll, breit 13 Zoll Anm.: Die Lose 92 und 93 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (2.45 fl für die Nrn. 92 und 93) Käufer: Müntzrath Dietz 1790/08/25 FRAN 0216 Brinckmann I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: hoch 14 Zoll, breit 11 Zoll Anm.: Die Lose 216 und 217 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (16.30 fl für die Nrn. 216 und 217) Käufer: Erlinger 1790/08/25 FRAN 0217 Brinckmann I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: hoch 14 Zoll, breit 11 Zoll Anm.: Die Lose 216 und 217 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (16.30 fl für die Nrn. 216 und 217) Käufer: Erlinger 1790/08/25 FRAN 0451 Brinckmann I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: hoch 9 Vi Zoll, breit 11 Vi Zoll Anm.: Die Lose 451 und 452 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (2 fl für die Nrn. 451 und 452) Käufer: Kaller 1790/08/25 FRAN 0452 Brinckmann I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: hoch 9 Vi Zoll, breit 11 Vi Zoll Anm.: Die Lose 451 und 452 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (2 fl für die Nrn. 451 und 452) Käufer: Kaller 1791/09/26 FRAN 0395 Brinckmann I Zwey fleißige reitzende Landschaften. I Diese Nr.: Eine fleißige reitzende Landschaft Maße: 14 Zoll breit, 10 Zoll hoch Anm.: Die Lose 395 und 396 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0396 Brinckmann I Zwey fleißige reitzende Landschaften. I Diese Nr.: Eine fleißige reitzende Landschaft Maße: 14 Zoll breit, 10 Zoll hoch Anm.: Die Lose 395 und 396 wurden zu-
1772/00/00 BSFRE 0021 Brinckmann (Philippe Jerome); Hirt I Deux Payssages, ornes de figures & betail par Hirt. Les Tableaux de ce maitre, sont en s'y grande Reputation, qu'il seroit inutile de les proner. Cadres unys d'ores. I Diese Nr.: Un Payssage, orne de figures & betail Mat.: auf Leinwand Maße: haut de 9 Vi & large de 12 % pouces Anm.: Die Lose 20 und 21 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Brinckmann, Philipp Hieronymus (Manier) 1798/12/10 WNAN 0001 Brinkmann I Zwey kleine Landschaften in der Manier Brinkmanns, auf Holz gemahlt. I Mat.: auf Holz Verkäufer: Prof Adam Transakt.: Unbekannt
Brio, R. [Nicht identifiziert] 1779/09/27 FRNGL 0615 R. Brio I Eine fürtreflich fleißige niederländische Bauernmahlzeit, schön in Licht und Schatten gewählt, und ausgeführt von R. Brio. [Un repas de paysans Flamands, tres belle piece, le clair obscur superieurement bien exprime.] I Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch, 2 Schuh 2 Zoll breit Transakt.: Verkauft (52 fl) Käufer: Denhardt
Brisel, C. [Nicht identifiziert] 1781/00/00 WRAN 0052 Brisel (C.) I Deux Paysages, oü se voit la chasse au Cerf. On lit sur la gauche d'en bas C. B. Tableau peint sur toile. I Diese Nr.: Un Paysage Mat.: auf Leinwand Maße: 10 pouces 6 lignes, sur 8 pouces de large Inschr.: C. B. (bezeichnet) Anm.: Die Lose 52 und 53 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0053 Brisel (C.) I Deux Paysages, oü se voit la chasse au Cerf. On lit sur la gauche d'en bas C. B. Tableau GEMÄLDE
379
peint sur toile. I Diese Nr.: Un Paysage Mat.: auf Leinwand Maße: 10 pouces 6 lignes, sur 8 pouces de large Inschr.: C. B. (bezeichnet) Anm.: Die Lose 52 und 53 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt
Britt, de [Nicht identifiziert] 1778/05/16 HBBMN 0057 de Britt I Zwey extra rare Jagdstükke, mit todtem Federvieh und einem Haasen. I Diese Nr.: Ein extra rares Jagdstück, mit todtem Federvieh und einem Haasen Anm.: Die Lose 57 und 58 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/05/16 HBBMN 0058 de Britt I Zwey extra rare Jagdstükke, mit todtem Federvieh und einem Haasen. I Diese Nr.: Ein extra rares Jagdstück, mit todtem Federvieh und einem Haasen Anm.: Die Lose 57 und 58 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Broeck, Elias van den 1716/00/00 FRHDR 0029 Broecken I Von Broecken ein Blumenglas. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (60) 1744/05/20 FRAN 0143 El. vander Brock I 1 Schön Blumen Stück. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 5 Zoll, Breite 2 Schuh Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0171 Elie van den Broeck I Item, une piece ä Fleurs, sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: Largeur 1 Pies 5 lA Pouces, Haut 1 Pies 1 % Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1763/01/19 FRJUN 0081 E. van den Brnek I Une piece capitale representant un pot avec plusieurs fleurs & Insectes tentrement touch6e. I Maße: hauteur 24 pouces, large 20 pouces Transakt.: Unbekannt (45 V* fl für die Nrn. 81 und 82) 1763/01/19 FRJUN 0082 E. van den Broek I Une semblable [une piece capitale representant un pot avec plusieurs fleurs & Insectes] pas moins achevee & de la meme grandeur. I Maße: hauteur 24 pouces, large 20 pouces Transakt.: Unbekannt (45 Vt fl für die Nm. 81 und 82) 1767/00/00 KOAN 0113[b] Elias von den Broeck I Zwey Blumen=Stück auf Leinwand eines von David de Heem, und das änderte von Elias von den Broeck. I Diese Nr.: Ein Blumen=Stück; Nr. 113 [a] von David Heem Mat.: auf Leinwand Maße: Breite 1 Fuß 11 14 Zoll, Höhe 2 Fuß 2 Vi Zoll Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0113 Broeck (Elias van dem) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0026 Elias van der Broeck I Un tableau en fleurs. Peint sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: 2. p. 1. p. de haut sur 1. p. 9. p. de large Verkäufer: Francis Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1775/09/09 HBBMN 0016 Elias v.d. Broek I Zwey extra schöne Blumen=Stücke, auf Leinewand, in modernen vergoldeten Rahmen. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 1 F 11 Z, Breit 1 F 8 Ζ Transakt.: Verkauft (11.8 Μ für jedes Gemälde) Käufer: Hasbferg] 1785/12/03 HBBMN 0013 Esais von den Brock I Ein Blumen= Stück, von Esais von den Brock, im schwarzen Rahm. I Transakt.: Unbekannt 1787/00/00 HB AN 0110 Elias van der Brocks I In einem Topfe, welcher auf einem steinernen Tische steht, befinden sich unterschiedene sehr schöne Blumen, Rosen, Tulpen, Lilien, ec. Auf einem stei380
GEMÄLDE
nernen Tische stehen in einem Glase viele Blumen, wo vom einige Rosen und eine Mohnblume den schönsten Effect verursachen. Beyde Bilder sind sehr reich an Insecten vielerley Art. Sehr natürlich und schön gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Diese Nr.: In einem Topfe, welcher auf einen steinernen Tische steht, befinden sich unterschiedene sehr schöne Blumen, Rosen, Tulpen, Lilien Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 26 Vi Zoll, breit 21 Vi Zoll Anm.: Die Lose 110 und 111 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (12.8 Μ für die Nrn. 110 und 111) Käufer: Tietgen 1787/00/00 HB AN O l l i Elias van der Brocks I In einem Topfe, welcher auf einem steinernen Tische steht, befinden sich unterschiedene sehr schöne Blumen, Rosen, Tulpen, Lilien, ec. Auf einem steinernen Tische stehen in einem Glase viele Blumen, wo vorn einige Rosen und eine Mohnblume den schönsten Effect verursachen. Beyde Bilder sind sehr reich an Insecten vielerley Art. Sehr natürlich und schön gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Diese Nr.: Auf einen steinernen Tische stehen in einem Glase viele Blumen, wo vorn einige Rosen und eine Mohnblume den schönsten Effect verursachen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 26 Vi Zoll, breit 21 Vi Zoll Anm.: Die Lose 110 und 111 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (12.8 Μ für die Nrn. 110 und 111) Käufer: Tietgen 1790/08/13 HBBMN 0063 El. v.d. Broeks I Rosen, Tulpen, Mohnblumen, Hiazinten ec., in einem Glase a u f m Tische stehend, der Natur auf das getreuste nachgeahmt. Auf H[olz], G.R. [Goldnen Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 17 Zoll, breit 13 Zoll Transakt.: Verkauft (10 Sch) 1793/00/00 HBMFD 0020 Elias van den Brock I Eine Vase voller Blumen, mit einigen Insecten, macht zusammen eine glückliche Uebereinstimmung. Die Blumen sind reich und leicht untermischt von ihren Blättern, worin man eine richtige Anatomie bemerkt. Das Durchsichtige und das Lebhafte ist an allem auf das natürlichste und bewundernswürdigste ausgedruckt. I Mat.: auf Holz Maße: 2 Fuss 11 Zoll hoch, 2 Fuss 5 Zoll breit Verkäufer: Pierre Laporterie Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0142 Elias v. d. Broeck I Bluhmen in einem Topfe. Sehr natürlich von Elias v. d. Broeck. I Maße: Hoch 22 Zoll, breit 19 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0062 Elias van den Brock I Zwey sehr fleißig gemahlte Blumenstücke, größtentheils Feld=Blumen. Mit einer fertigen Leichtigkeit nach der Natur gemahlt. I Diese Nr.: Ein sehr fleißig gemahltes Blumenstück, größtentheils Feld=Blumen Maße: Hoch 26 Zoll, breit 22 Zoll Anm.: Die Lose 62 und 63 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0063 Elias van den Brock I Zwey sehr fleißig gemahlte Blumenstücke, größtentheils Feld=Blumen. Mit einer fertigen Leichtigkeit nach der Natur gemahlt. I Diese Nr.: Ein sehr fleißig gemahltes Blumenstück, größtentheils Feld=Blumen Maße: Hoch 26 Zoll, breit 22 Zoll Anm.: Die Lose 62 und 63 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0182 Elias v. d. Broocks I Zwey Blumenstücke, in Gläser aufm Tisch stehend. Auf Holz. Schw. Rahm. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 13 Zoll Anm.: Die Lose 182 und 183 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0183 Elias v. d. Broocks I Zwey Blumenstücke, in Gläser aufm Tisch stehend. Auf Holz. Schw. Rahm. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 13 Zoll Anm.: Die Lose 182 und 183 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0187 Elias v. d. Broocks I Eine Schüssel auf einem Tische mit Früchten und Blumen. Auf Leinwand. Schw.
Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 20 Zoll, breit 26 Zoll Transakt.: Unbekannt
Maße: 1 Schuh hoch, 9 Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt
1796/10/17 HBPAK 0207 Elias v. d. Brocks I Ein Blumenstück. Auf Leinwand. Schw. Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 20 Zoll, breit 16 Zoll Transakt.: Unbekannt
Broers, Jasper
1796/10/17 HBPAK 0308 E. von der Broeck I Ein Blumenstück. I Maße: Hoch 24 Zoll, breit 17 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/12/08 HBPAK 0135 Elias v. d. Bröks I Ein Tisch, worauf ein Glas mit Blumen. Ganz natürlich und gut gemahlt. Auf Leinwand, im schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 24 Zoll, Breite 19 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0226 E.v.d. Brocks I Zwey Blumenstücke. Gut gemahlt. Auf Holz, goldner Rahm. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Mat.: auf Holz Maße: Hoch 22 Zoll, breit 17 Zoll Anm.: Die Lose 226 und 227 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0227 E.v.d. Brocks I Zwey Blumenstücke. Gut gemahlt. Auf Holz, goldner Rahm. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Mat.: auf Holz Maße: Hoch 22 Zoll, breit 17 Zoll Anm.: Die Lose 226 und 227 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/08/10 HBPAK 0057 E.v.d. Brooks I Ein Blumenstück. Auf einem Tische eine Vase mit Blumen, Tulpen ec. Gut gemahlt. Auf Leinwand, im schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll, breit 19 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/08/10 HBPAK 0084 Elias von der Brooks I Zwey Blumenstücke. Sehr gut gemahlt. Auf Leinwand, im schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 15 Zoll Anm.: Die Lose 84 und 85 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/08/10 HBPAK 0085 Elias von der Brooks I Zwey Blumenstücke. Sehr gut gemahlt. Auf Leinwand, im schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 15 Zoll Anm.: Die Lose 84 und 85 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0012 Elias v. d. Brock I Zwey Blumenstükke. Gläser mit verschiedenen Blumen stehen auf einen Tisch. Auf Kupfer, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein Blumenstück. Gläser mit verschiedenen Blumen stehen auf einen Tisch Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 15 Zoll, breit 11 Zoll Anm.: Die Lose 12 und 13 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0013 Elias v. d. Brock I Zwey Blumenstükke. Gläser mit verschiedenen Blumen stehen auf einen Tisch. Auf Kupfer, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein Blumenstück. Gläser mit verschiedenen Blumen stehen auf einen Tisch Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 15 Zoll, breit 11 Zoll Anm.: Die Lose 12 und 13 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0706 Transakt.: Unbekannt
1750/00/00 KOAN 0056 Broers I Deux Ports de mer, avec de belles figures. I Diese Nr.: Un Port de mer, avec de belles figures Maße: Largeur 1 Pies 4 Vi Pouces, Haut 1 Pies 1 Vi Pouce Anm.: Die Lose 56 und 57 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0057 Broers I Deux Ports de mer, avec de belles figures. I Diese Nr.: Un Port de mer, avec de belles figures Maße: Largeur 1 Pies 4 Vi Pouces, Haut 1 Pies 1 Vi Pouce Anm.: Die Lose 56 und 57 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0087 Broers I Deux batailles, belle ordonnance, & coulenment exprimees, le plus bei ouvrage de Broers. I Diese Nr.: Une bataille Maße: Largeur 1 Pies 8 Vi Pouces, Haut 1 Pies 2 Pouces Anm.: Die Lose 60 und 61 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0088 Broers I Deux batailles, belle ordonnance, & coulenment exprimees, le plus bei ouvrage de Broers. I Diese Nr.: Une bataille Maße: Largeur 1 Pies 8 Vi Pouces, Haut 1 Pies 2 Pouces Anm. : Die Lose 60 und 61 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1767/00/00 KOAN 0095 Broers I Zwey fleissig gemahlte mit vielen Figuren treflich ordinirte Land Bataillen, die schönste Arbeit von Broers. I Maße: Breite 2 Fuß 5 VA Zoll, Höhe 2 Fuß % Zoll Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0049 Broersi I Vues Maritimes, oü sc voit une quantite de Monde tant Hommes que Femmes habilles ä la Turque, sur la droite de Tun, & sur la gauche de l'autre sont des grands Rochers. Tableau peint sur toile. I Diese Nr.: Vue Maritime Mat.: auf Leinwand Maße: 12 pouces de hauteur, sur 14 de largeur Anm.: Die Lose 49 und 50 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0050 Broersi I Vues Maritimes, oü se voit une quantite de Monde tant Hommes que Femmes habilles ä la Turque, sur la droite de Tun, & sur la gauche de l'autre sont des grands Rochers. Tableau peint sur toile. I Diese Nr.: Vue Maritime Mat.: auf Leinwand Maße: 12 pouces de hauteur, sur 14 de largeur Anm.: Die Lose 49 und 50 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt
Broger [Nicht identifiziert]
Brocks I Zwey Blumenstücke. I
Broeck, W. [Nicht identifiziert] 1775/05/08 HBPLK 0048 W. Broeck I Eine vortreffliche Arcadische Landschaft mit 3 Nymphen, welche einen Korb aufmachen, aus welchem ein junger Knabe herauskommt, von der besten Zeit des [W. Broeck], I Maße: Höhe 18 Zoll 3 Linie, Breite 24 Zoll 10 Linie Transakt.: Unbekannt (70 M)
Broeg, F. van den [Nicht identifiziert] 1792/08/20 KOAN 0305 F. van den Broeg I Ein Tafel=Stückelchen mit Citronen von F. van den Broeg auf Holz. I Mat.: auf Holz
1796/10/17 HBPAK 0192 Broger I Eine Landschaft, wo auf der Landstraße ein Karren mit Reisenden. Im Vordergrunde einige Figuren. Auf Kupfer. Schw. Rahm. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 8 Zoll, breit 10 Zoll Transakt.: Unbekannt
Broichetiers [Nicht identifiziert] 1764/06/06 BOAN 0490 Broichetiers I Une Pie9e representante sept Portraits de la famille des Princes de Nassau en figures entieres peints en miniature par Broichetiers. [Ein stück Vorstellend sieben Contrefait in gantzen figuren Von fürstlich Nassauischer famille, gemahlt in miniatur von Broichetiers.] I Maße: 1 pied 6 pouces de hauteur, 1 pied 2 pouces de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (18 Rt) Käufer: Hof Cammerrath Broggia GEMÄLDE
381
Brolo, I. [Nicht identifiziert]
Brosch (oder Prasch)
1793/00/00 NGWID 0466 /. Brolo I Ein entkleidetes Frauenzimmer, der zur Seite eine alte Kupplerin sitzt; die ganze Gruppe ist mit ungemein schönem Colorit bearbeitet, von I. Brolo. I Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 2 Schuh 1 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
1759/00/00 LZEBT 0088 Brasch I Ein Stück mit Feder Wilpret [sie] einem Hirsch und Hunde auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 1 Schuh, Breite 9 Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (60 Th für die Nrn. 88 und 89, Schätzung)
Bronadir, Adrian [Nicht identifiziert] 1799/12/04 HBPAK 0174 Adrian Bronadir I Ein Bauer sitzet in einem Zimmer auf einer halbabgeschnittenen Tonne, und raucht mit vergnügter Miene Toback. Zur Rechten, am Camine, stehen andere Bauern, und wärmen sich. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Zoll, breit 9 Zoll Transakt.: Unbekannt
Bronchorst, Jan Gerritsz. van 1785/05/17 MZAN 0726 Bronkhorst I Ein poetisches Stück von Bronkhorst. [Un tableau, dont le sujet est poetique.] I Maße: 10 Schuh 6 Zoll hoch, 7 Schuh 8 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (6 fl)
Bronckhorst, Pieter Anthonisz. van 1781/09/10 BNAN 0041 Pitr. Bronckhorst I Mit ausgestreckten Armen entfliehet, zum höheren dunkelen Firmament zur Linken, die schöne Andromede, denen ihr umgebenden noch auf den Wolken ruhenden Gespielinnen; ein weiter brauner mit Sternen bedeckter Mantel, scheidet sie noch von den als Dunst entweichenden Pegasus; aus den obern Gegenden zur Rechten, streuen die mit dem jungen Morgen herabsteigende Amonretten [sie] Blumen auf die Unterwelt; und eine Gruppe von Flußgöttem, scheinet hier am Gestade des Meeres, beym untergehenden Monde zu erwachen; von Pitr. Bronckhorst. Von guter Stellung und Colorit, auf Tuch. g.R. [im vergüteten Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: 62 Zoll hoch, 50 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1791/05/30 FRAN 0050 Peter van Bronckhorst I Das Inwendige eines jüdischen Tempels wo Christus die Käufer und Verkäufer austreibet. I Maße: 2 Schuh 4 Zoll hoch und 1 Schuh 8 Zoll breit Verkäufer: Bansa Transakt.: Verkauft (4.15) Käufer: Lindlau
Bronzino, Agnolo 1764/06/06 BOAN 0608 Brunsino de Florence I Un Tableau d'un pied sept pouces de hauteur, d'un pied trois pouces de largeur, representant une tete en grandeur naturelle, peint par Brunsino de Florence. [Ein stück Vorstellend Einen Kopf in Lebensgröße gemahlt Von Brunsino aus florentz.] I Maße: 1 pied 7 pouces de hauteur, 1 pied 3 pouces de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (36 Rt) Käufer: Hof C Rath Kugelgen nahmens Frantzen
1759/00/00 LZEBT 0089 Brasch I Ein dergleichen [Stück mit Feder Wilpret [sie] einem Hirsch und Hunde] auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 1 Schuh, Breite 9 Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (60 Th für die Nrn. 88 und 89, Schätzung) 1764/03/12 FRKAL 0015 Brasch I Une jolie pi£ce representant quelques chiens pres d'un Gibier mort dans un beau pai'sage, tres delicatement peint. I Maße: hauteur 9 pouces, largeur 12 pouces Trans akt.: Verkauft (24 fl für die Nrn. 15 und 16) Käufer: Etling 1764/03/12 FRKAL 0016 Brasch I Un semblable [une jolie ρίέce representant quelques chiens pres d'un Gibier mort dans un beau pai'sage] de la meme grandeur & pas moindre que le precedent. I Maße: hauteur 9 pouces, largeur 12 pouces Transakt.: Verkauft (24 fl für die Nrn. 15 und 16) Käufer: Etling 1764/08/25 FRAN 0380 Prasch I 2 pieces representant des chevaux. I Diese Nr.: 1 piece representant des chevaux Maße: haut 10 pouces sur 1 pied 1 Vi pouces de large Anm.: Die Lose 380 und 381 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1764/08/25 FRAN 0381 Prasch I 2 pieces representant des chevaux. I Diese Nr.: 1 piece representant des chevaux Maße: haut 10 pouces sur 1 pied 1 Vi pouces de large Anm.: Die Lose 380 und 381 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRNGL 0071 Prasch I 2 Viehstücke. I Transakt.: Unbekannt (10 fl Schätzung) 1777/04/11 HB NEU 0033 Brasch I Zwey Jagdstücke. I Diese Nr.: Ein Jagdstück Anm.: Die Lose 33 und 34 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1777/04/11 HB NEU 0034 Brasch I Zwey Jagdstücke. I Diese Nr.: Ein Jagdstück Anm.: Die Lose 33 und 34 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1779/09/27 FRNGL 0003 Prasch I Eine Räuberbande, wie selbige eine zu Pferd reisende Gesellschaft überfällt, fleißig und schön ausgearbeitet von Prasch. [Une bände de voleurs attaquants une compagnie de voyageurs ä cheval, piece travaillee avec beaueoup d'exactitude.] I Pendant zu Nr. 4 Maße: 8 Vi Zoll hoch, 11 Zoll breit Transakt.: Verkauft (6.40 fl für die Nrn. 3 und 4) Käufer: Lindenlau 1779/09/27 FRNGL 0004 Prasch I Das Gegenbild zu obigem, von nemlichen Meister [Prasch] und Maas. [Le pendant du ρτέοέdent, par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 3 Maße: 8 Vi Zoll hoch, 11 Zoll breit Transakt.: Verkauft (6.40 fl für die Nrn. 3 und 4) Käufer: Lindenlau 1782/02/18 RGBZN 0010 Brasch I Eine sitzende Jägerin vom Brasch, sehr fleißig gearbeitet. I Transakt.: Unbekannt (3.1 fl)
1789/00/00 MMAN 0065 Angelo Bronzino I Ein Hieronymus, auf Holz. [St Jerosme, sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 2 Fuß 5 Zoll hoch, 1 Fuß 10 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (22 fl)
1782/08/21 HBKOS 0067 Brasch I Zwey Jagdstücke von Brasch, auf Holz. I Diese Nr.: Ein Jagdstück Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll 6 Linien, breit 12 Zoll 3 Linien Anm.: Die Lose 67 und 68 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Moddermann Transakt.: Verkauft (3.4 Μ für die Nrn. 67 und 68) Käufer: Meyerhof
1789/00/00 MMAN 0338 Angelo Bronzino Vechhio I Eine Mater Dei, oval auf Zinn. [La Mere de Dieu, oval sur etaim [sic].] I Mat.: auf Zinn Format: oval Maße: 1 Fuß 2 Zoll hoch, 11 Zoll breit [1 pied 2 pouces de haut, 10 pouces de large] Anm.: Die Dimensionen unterscheiden sich in der deutschen und französischen Fassung des Katalogs. Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt
1782/08/21 HBKOS 0068 Brasch I Zwey Jagdstücke von Brasch, auf Holz. I Diese Nr.: Ein Jagdstück Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll 6 Linien, breit 12 Zoll 3 Linien Anm.: Die Lose 67 und 68 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Moddermann Transakt.: Verkauft (3.4 Μ für die Nrn. 67 und 68) Käufer: Meyerhof
382
GEMÄLDE
1783/08/01 LZRST 0086 Brasoh I 2 Jagdstücke, mit Hühnern, Haasen, Füchsen, Jäger und Jägerin, von Brasoh gemahlt, 14 Vi Zoll hoch, 10 Vi Z. breit ohne Rahm. I Maße: 14 Vi Zoll hoch, 10 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (2.16 Th) Käufer: Korn 1784/08/01 LZRST 0149 Brasch I Zwey Iagdstücke, mit Hühnern, Haasen und Hunden, läger und Iägerinnen, fleissig von Brasch gemahlt, 10 Vi Z. br. 15 Z. hoch, ohne Rahm. I Maße: 10 Vi Zoll breit, 15 Zoll hoch Transakt.: Verkauft (1.14 Th) Käufer: ST 1784/08/02 FRNGL 0565 Prasch I Zwey Jagdstücke von Prasch. I Maße: 11 Vi Zoll breit, 9 Zoll hoch Transakt.: Verkauft (1.30 fl) Käufer: Hacker [?] 1785/05/17 MZAN 1101 Brasch I Ein Jäger mit seiner Flinte und einer Schnepfe in der Hand, und ein Mädchen das mit ihm scherzt von Brasch. [Un chasseur ayant son fusil & une beccasse ä la main, & une fille badinante avec lui.] I Pendant zu Nr. 1102 Maße: 9 Vi Zoll hoch, 7 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (9 fl für die Nm. 1101 und 1102) Käufer: Schwanck 1785/05/17 MZAN 1102 Brasch I Das Gegenbild, ein Jäger der ein Glas Wein trinkt, von eben demselben [Brasch] und von eben der Höhe und Breite. [Le pendant, un chasseur vuidant un verre de vin par le meme [Brasch], meme hauteur & largeur.] I Pendant zu Nr. 1101 Maße: 9 Vi Zoll hoch, 7 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (9 fl für die Nm. 1101 und 1102) Käufer: Schwanck 1785/05/17 MZAN 1103 Brasch I Ein Jäger mit seiner Flinte, ein Jagdhund und todtes Geflügel. Das Gegenbild, ein Jäger der seine Flinte ladet, ein Jagdhund und ein todter Haas, beide Stücke vom vorhergehenden Meister [Brasch]. [Un chasseur ayant un fusil, un chien de chasse & une chevrette tuee.] I Diese Nr.: Ein Jäger mit seiner Hinte, ein Jagdhund und todtes Geflügel; Pendant zu Nr. 1104 Maße: 11 Zoll hoch, 8 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 1103 und 1104 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (14.30 fl für die Nrn. 1103 und 1104) Käufer: Forstrath Keck 1785/05/17 MZAN 1104 Brasch I Ein Jäger mit seiner Flinte, ein Jagdhund und todtes Geflügel. Das Gegenbild, ein Jäger der seine Flinte ladet, ein Jagdhund und ein todter Haas, beide Stücke vom vorhergehenden Meister [Brasch]. [Le pendant, un chasseur chargeant son fusil, un chien de chasse & un lievre tue, les deux pieces par le meme [Brasch].] I Diese Nr.: Ein Jäger der seine Flinte ladet, ein Jagdhund und ein todter Haas; Pendant zu Nr. 1103 Maße: 11 Zoll hoch, 8 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 1103 und 1104 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (14.30 fl für die Nrn. 1103 und 1104) Käufer: Forstrath Keck 1785/05/17 MZAN 1115 Brasch I Ein Jäger der mit einem Mädchen scherzt, Jagdhünde, eine Reh und todtes Geflügel. [Un chasseur badinant avec une fille, des chiens de chasse, une chevrette & de la volaille tuee.] I Pendant zu Nr. 1116 Maße: 3 Schuh 6 Zoll hoch, 4 Schuh 4 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Unverkauft 1785/05/17 MZAN 1116 Brasch I Das Gegenbild, ein Jäger mit seinem Hunde, ein todtes Schwein und todtes Geflügel, beide Stücke von Brasch. [Le pendant, un chasseur, son chien, un sanglier & de la volaille tuee.] I Pendant zu Nr. 1115 Maße: 3 Schuh 6 Zoll hoch, 4 Schuh 4 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Unverkauft 1785/12/21 HBKOS 0023 Brasch I Eine Landschaft mit lebendigen Hirschen, im schwarzen Rahm. I Transakt.: Unbekannt
1786/10/18 HBTEX 0061 Brasch I Zwey Hirsch= und Reh= Jagden mit vielen Hunden, in einer Hölzung mit Wasser, von der besten Zeit benannten Künstlers. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Eine Hirsch= und Rehjagd mit vielen Hunden, in einer Hölzung mit Wasser Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 13 Zoll 3 Linien, breit 17 Zoll Anm.: Die Lose 61 und 62 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/10/18 HBTEX 0062 Brasch I Zwey Hirsch= und Reh= Jagden mit vielen Hunden, in einer Hölzung mit Wasser, von der besten Zeit benannten Künstlers. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Eine Hirsch= und Rehjagd mit vielen Hunden, in einer Hölzung mit Wasser Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 13 Zoll 3 Linien, breit 17 Zoll Anm.: Die Lose 61 und 62 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/10/18 HBTEX 0070 Broschen I Eine wilde Schweins= und zu dessen Compagnon eine Hirsch=Jagd, vortreflich gemahlt. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Eine wilde Schweins=Jagd; Pendant zu Nr. 71 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 13 Zoll 3 Linien, breit 17 Zoll Anm.: Die Lose 70 und 71 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/10/18 HBTEX 0071 Broschen I Eine wilde Schweins= und zu dessen Compagnon eine Hirsch=Jagd, vortreflich gemahlt. Auf l^einewand. I Diese Nr.: Eine Hirsch=Jagd; Pendant zu Nr. 70 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 13 Zoll 3 Linien, breit 17 Zoll Anm.: Die Lose 70 und 71 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1787/10/06 HBTEX 0044 Brasch I Zwey Landschaften mit Hirschen, extra fleißig gemahlt. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Hirschen Anm.: Die Lose 44 und 45 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1787/10/06 HBTEX 0045 Brasch I Zwey Landschaften mit Hirschen, extra fleißig gemahlt. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Hirschen Anm.: Die Lose 44 und 45 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1787/10/06 HBTEX 0046 Brasch I Zwey dito [Landschaften], mit Hunden und Hirschen. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Hunden und Hirschen Anm.: Die Lose 46 und 47 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1787/10/06 HBTEX 0047 Brasch I Zwey dito [Landschaften], mit Hunden und Hirschen, t Diese Nr.: Eine Landschaft mit Hunden und Hirschen Anm.: Die Lose 46 und 47 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1787/10/06 HBTEX 0086 Brasch I Geschossenes Wild, so von Hunden bewacht wird, in der besten Zeit gemahlt. I Diese Nr.: Geschossenes Wild, so von Hunden bewacht wird Anm.: Die Lose 86 und 87 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1787/10/06 HBTEX 0087 Brasch I Geschossenes Wild, so von Hunden bewacht wird, in der besten Zeit gemahlt. I Diese Nr.: Geschossenes Wild, so von Hunden bewacht wird Anm.: Die Lose 86 und 87 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1787/10/06 HBTEX 0112 Bratsch I Zwey fleißige Landschaften mit Hirschen und Rehen. I Diese Nr.: Eine fleißige Landschaft mit Hirschen und Rehen Anm.: Die Lose 112 und 113 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1787/10/06 HBTEX 0113 Bratsch I Zwey fleißige Landschaften mit Hirschen und Rehen. I Diese Nr.: Eine fleißige Landschaft mit Hirschen und Rehen Anm.: Die Lose 112 und 113 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1790/04/13 HBLIE 0066 Brasch pinxit I Zwey Eremitagen, worinnen sich Mönche befinden, welchen Geschenke von Früchten und Wild gebracht wird; ganz besonders fleißig und schön gemahlt. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Eine Eremitage, worinnen sich Mönche befinden, welchen Geschenke von Früchten und Wild gebracht wird GEMÄLDE
383
Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 16 Vi Zoll, breit 20 Zoll Inschr.: Brasch pinxit (signiert) Anm.: Die Lose 66 und 67 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (16 Μ für die Nrn. 66 und 67)
zu Boden gerissen; Pendant zu Nr. 128 Maße: 10 Zoll hoch und 1 Schuh breit Anm.: Die Lose 127 und 128 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Bansa Transakt.: Verkauft (10 für die Nrn. 127 und 128)
1790/04/13 HBLIE 0067 Brasch pinxit I Zwey Eremitagen, worinnen sich Mönche befinden, welchen Geschenke von Früchten und Wild gebracht wird; ganz besonders fleißig und schön gemahlt. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Eine Eremitage, worinnen sich Mönche befinden, welchen Geschenke von Früchten und Wild gebracht wird Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 16 Vi Zoll, breit 20 Zoll Inschr.: Brasch pinxit (signiert) Anm.: Die Lose 66 und 67 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (16 Μ für die Nrn. 66 und 67)
1791/05/30 FRAN 0128 Prasch I Ein Hirsch von etlichen Hunden angefallen, wird davon zu Boden gerissen, mit vielem Ausdruck fleißig gemalt, von Prasch. Das Gegenbild ein wilder Eber wie er von einigen Hunden angefallen wird, vom nemlichen Meister. I Diese Nr.: Ein wilder Eber wie er von einigen Hunden angefallen wird; Pendant zu Nr. 127 Maße: 10 Zoll hoch und 1 Schuh breit Anm.: Die Lose 127 und 128 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Bansa Transakt.: Verkauft (10 für die Nrn. 127 und 128)
1790/08/25 FRAN 0061 Prasch I Zwey Landschaften mit Geflügel, Wildprett und Hund, staffirt von Prasch. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Geflügel, Wildprett und Hund Maße: hoch 13 Zoll, breit 16 Zoll Anm.: Die Lose 61 und 62 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (2 fl für die Nrn. 61 und 62) Käufer: Bender 1790/08/25 FRAN 0062 Prasch I Zwey Landschaften mit Geflügel, Wildprett und Hund, staffirt von Prasch. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Geflügel, Wildprett und Hund Maße: hoch 13 Zoll, breit 16 Zoll Anm. : Die Lose 61 und 62 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (2 fl für die Nrn. 61 und 62) Käufer: Bender 1790/08/25 FRAN 0094 Prasch I Zwey Landschaften mit todtem Wild. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit todtem Wild Maße: hoch 9 Zoll, breit 12 Zoll Anm.: Die Lose 94 und 95 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (3 fl für die Nm. 94 und 95) Käufer: Kaller 1790/08/25 FRAN 0095 Prasch I Zwey Landschaften mit todtem Wild. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit todtem Wild Maße: hoch 9 Zoll, breit 12 Zoll Anm.: Die Lose 94 und 95 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (3 fl für die Nrn. 94 und 95) Käufer: Kaller 1790/08/25 FRAN 0147 Prasch I Zwey Landschaften mit Herrn und Damens die auf die Jagd gehen. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Herrn und Damens die auf die Jagd gehen Maße: hoch 26 Zoll, breit 30 Zoll Anm.: Die Lose 147 und 148 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (20.30 fl für die Nrn. 147 und 148) Käufer: Schneidewind 1790/08/25 FRAN 0148 Prasch I Zwey Landschaften mit Herrn und Damens die auf die Jagd gehen. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Herrn und Damens die auf die Jagd gehen Maße: hoch 26 Zoll, breit 30 Zoll Anm.: Die Lose 147 und 148 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (20.30 fl für die Nrn. 147 und 148) Käufer: Schneidewind 1790/09/10 HBBMN 0028 Brasch I Gebürgigte Land=Gegenden mit Staffage; Sommer und Winter vorstellend. Auf Leinw. I Diese Nr.: Eine geürgigte Land=Gegend mit Staffage; Sommer vorstellend Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 9 % Zoll, breit 14 V* Zoll Anm.: Die Lose 28 und 29 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (6 Μ für die Nrn. 28 und 29) Käufer: Kesten 1790/09/10 HBBMN 0029 Brasch I Gebürgigte Land=Gegenden mit Staffage; Sommer und Winter vorstellend. Auf Leinw. I Diese Nr.: Eine geürgigte Land=Gegend mit Staffage; Winter vorstellend Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 9 % Zoll, breit 1414 Zoll Anm.: Die Lose 28 und 29 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (6 Μ für die Nm. 28 und 29) Käufer: Kesten 1791/05/30 FRAN 0127 Prasch I Ein Hirsch von etlichen Hunden angefallen, wird davon zu Boden gerissen, mit vielem Ausdruck fleißig gemalt, von Prasch. Das Gegenbild ein wilder Eber wie er von einigen Hunden angefallen wird, vom nemlichen Meister. I Diese Nr.: Ein Hirsch von etlichen Hunden angefallen, wird davon 384
GEMÄLDE
1791/07/29 HBBMN 0028 Brasch I Ein Kaninchen; auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Zoll, breit 9 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt (15 Sch) 1793/00/00 NGWID 0258 Prasch I Ein unter einem Baume ruhender Jäger, zu dessen Füssen verschiedenes todtes Wildbret liegt, von Prasch. I Pendant zu Nr. 259 Maße: 3 Schuh hoch, 2 Schuh 4 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0259 Prasch I Zum Gegenstück, wie ein Jäger unter einem Baum von seinen Hunden umgeben da steht, und das zu seinen Füssen todte Wildbret, mit Aufmerksamkeit betrachtet, von obigem Meister [Prasch] und Maaß. I Pendant zu Nr. 258 Maße: 3 Schuh hoch, 2 Schuh 4 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1795/11/17 HBPAK 0009 Brasch I Zwey Landschaften mit Hirschen und Rehen. Sehr gut gemahlt. Schw. Rahm mit goldnen. Leisten. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Hirschen und Rehen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 22 Zoll Anm.: Die Lose 9 und 10 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1795/11/17 HBPAK 0010 Brasch I Zwey Landschaften mit Hirschen und Rehen. Sehr gut gemahlt. Schw. Rahm mit goldnen. Leisten. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Hirschen und Rehen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 22 Zoll Anm.: Die Lose 9 und 10 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1795/11/17 HBPAK 0013 Brasch I Zwey Landschaften, in denen Hirsche und wilde Schweine gejagt werden. Schw. Rahm mit gold. Leisten. I Diese Nr.: Eine Landschaft, in der Hirsche und wilde Schweine gejagt werden Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 22 Zoll Anm.: Die Lose 13 und 14 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1795/11/17 HBPAK 0014 Brasch I Zwey Landschaften, in denen Hirsche und wilde Schweine gejagt werden. Schw. Rahm mit gold. Leisten. I Diese Nr.: Eine Landschaft, in der Hirsche und wilde Schweine gejagt werden Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 22 Zoll Anm.: Die Lose 13 und 14 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0186 Brasch I Ein Wald mit Hirschen und Rehen. Ein gutes Gemähide. Auf Holz. Schwarzer Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 17 Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/06/13 HBPAK 0065 Brasch I Zwey ländliche Bergeshölungen mit Wasserfall, wie auch einige Figuren. Plaisant gemahlt. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Eine ländliche Bergeshöhlung mit Wasserfall, wie auch einige Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 11 Vi Zoll, breit 16 Zoll Anm.: Die Lose 65 und 66 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/06/13 HBPAK 0066 Brasch I Zwey ländliche Bergeshölungen mit Wasserfall, wie auch einige Figuren. Plaisant gemahlt. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Eine ländliche Bergeshöhlung mit Wasserfall, wie auch einige Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 11 V* Zoll, breit 16 Zoll Anm.: Die Lose 65 und 66 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Brosch (Kopie nach; oder Prasch, Kopie nach)
1784/08/02 FRNGL 0311 Wensel Ignatius Prasch I Zwey besonders fleisig nach der Natur ausgearbeitete Jagdstücke. I Diese Nr.: Ein besonders fleisig nach der Natur ausgearbeitetes Jagdstück Maße: 12 Vi Zoll breit, 10 Zoll hoch Anm.: Die Lose 311 und 312 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: D Transakt.: Verkauft (15 fl für die Nrn. 311 und 312) Käufer: Kiehbecher
1784/09/27 FRAN 0258 Spengler; Brasch I Zwey Jagdstück nach Brasch auf Glas gemahlt von Spengler. [Deux pieces representantes des chasses, peintes en verre d'apres Brasch, par Spengler.] I Kopie von Spengler nach Prasch oder Brosch Mat.: auf Glas Maße: 10 Vi Zoll hoch, 8 Zoll breit Verkäufer: Freyherr von Berberich Transakt.: Verkauft (2.45 fl) Käufer: Jhs[?] Morche
1784/08/02 FRNGL 0312 Wensel Ignatius Prasch I Zwey besonders fleisig nach der Natur ausgearbeitete Jagdstücke. I Diese Nr.: Ein besonders fleisig nach der Natur ausgearbeitetes Jagdstück Maße: 12 Vi Zoll breit, 10 Zoll hoch Anm.: Die Lose 311 und 312 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: D Transakt.: Verkauft (15 fl für die Nrn. 311 und 312) Käufer: Kiehbecher
Brosch (Manier; oder Prasch, Manier)
1786/05/02 NGAN 0290 W.I. Brasch I Zwey Pferde. I Diese Nr.: Ein Pferd Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Anm.: Die Lose 290 und 291 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (17 fl für die Nrn. 290 und 291) Käufer: Kleinknecht
1800/11/12 HBPAK 0580 Transakt.: Unbekannt
Ν. Braasah I Zwey Stücke mit Wild. I
1790/05/20 HBSCN 0206 Wie Brasch I Eine waldigte Landschaft mit Jägern ec. Schön und natürlich gemahlt. Auf L[einwand]. ohne Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 34 Vi Zoll, breit 44 Zoll Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (14 M) Käufer: Eckhardt
Brosch, Wenzel Ignaz 1772/00/00 BSFRE 0011 Brasch (Wenceslas Ignace) I Deux Pieces, sujets de Chasse, l'une represente un Cerf, & l'autre une Biche forcee par les Chiens, d'un grand finy. Cadres unys d'ores. I Diese Nr.: Une Piece, sujet de Chasse, un Cerf Mat.: auf Leinwand Maße: haut de 11 % & large de 15 V2 pouces Anm.: Die Lose 11 und 12 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1772/00/00 BSFRE 0012 Brasch (Wenceslas Ignace) I Deux Pieces, sujets de Chasse, l'une represente un Cerf, & l'autre une Biche forcee par les Chiens, d'un grand finy. Cadres unys d'or£s. I Diese Nr.: Une Piece, sujet de Chasse, une Biche forcee par les Chiens Mat.: auf Leinwand Maße: haut de 11 % & large de 15 Vi pouces Anm.: Die Lose 11 und 12 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1777/02/21 HBHRN 0079 Will. Brasch I Eine extra fleißige Bataille. I Maße: Höhe 2 Fuß 3 Zoll, Breite 2 Fuß 10 Zoll Transakt.: Unbekannt 1779/09/27 FRNGL 0866 J. W. Brasch I Eine kleine angenehme Landschaft mit Vieh. [Un joli paysage avec du betail.] I Pendant zu Nr. 867 Maße: 5 Vi Zoll hoch, 7 Zoll breit Transakt.: Verkauft (4.20 fl für die Nrn. 866 und 867) Käufer: Colomb 1779/09/27 FRNGL 0867 J. W. Brasch I Der Compagnon zu lezterm, eine dergleichen schöne Landschaft mit Vieh, von neml Meist. [J.W. Brasch] u. Maas. [Le pendant du precedant, meme objet [paysage], meme beaute, par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 866 Maße: 5 Vi Zoll hoch, 7 Zoll breit Transakt.: Verkauft (4.20 fl für die Nrn. 866 und 867) Käufer: Colomb 1784/08/02 FRNGL 0004 Wenzel Ignatius Brasch I Ein todter Fuchs, bey welchem ein Jagdhund befindlich. I Pendant zu Nr. 5 Maße: 12 Zoll breit, 9 Zoll hoch Verkäufer: Α Transakt.: Verkauft (1 fl für die Nrn. 4 und 5) Käufer: Berger 1784/08/02 FRNGL 0005 Wenzel Ignatius Brasch I Das Gegenbild hierzu, zwey Jagdhunde bey einem todten Haasen vorstellend, vom nehmlichen Meister [Wenzel Ignatius Brasch] und Grösse. I Pendant zu Nr. 4 Maße: 12 Zoll breit, 9 Zoll hoch Verkäufer: A Transakt.: Verkauft (1 fl für die Nrn. 4 und 5) Käufer: Berger
1786/05/02 NGAN 0291 W.I. Brasch \ Zwey Pferde. I Diese Nr.: Ein Pferd Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Anm.: Die Lose 290 und 291 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (17 fl für die Nrn. 290 und 291) Käufer: Kleinknecht 1791/10/21 HBRMS1 0070 W. Brasch I Eine Ruhe auf der Jagd. Im Vordergründe sitzt ein Hund und bewacht ein erlegtes wildes Schwein, fleißig gemahlt; auf Holz. Gehört zu No. 86. I Pendant zu Nr. 86 Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Vi Zoll, breit 11 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1791/10/21 HBRMS1 0086 W. Brasch I Das Gegenstück zu No. 70. Eine dergleichen Vorstellung [eine Ruhe auf der Jagd] von selbiger Größe. I Pendant zu Nr. 70 Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Vi Zoll, breit 11 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1792/09/07 HBBMN 0166 W. Brasch I Husaren mit ihren Pferden vor Gezelte. Sehr fleißig gemahlt, von W. Brasch. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Husaren mit ihren Pferden vor Gezelte Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 166 und 167 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (1.8 M) Käufer: Eckh 1792/09/07 HBBMN 0167 W. Brasch I Husaren mit ihren Pferden vor Gezelte. Sehr fleißig gemahlt, von W. Brasch. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Husaren mit ihren Pferden vor Gezelte Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 166 und 167 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (1.8 M) Käufer: Eckh 1792/09/28 HBBMN 0032 W. J. Brasch I Zwey Jagdstücke; sehr fleißig gemahlt, von W. J. Brasch. Auf L[einwand]. I Diese Nr.: Ein Jagdstück Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 10 Zoll, breit 14 Zoll Anm.: Die Lose 32 und 33 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1792/09/28 HBBMN 0033 W. J. Brasch \ Zwey Jagdstücke; sehr fleißig gemahlt, von W. J. Brasch. Auf L[einwand]. I Diese Nr.: Ein Jagdstück Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 10 Zoll, breit 14 Zoll Anm.: Die Lose 32 und 33 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1792/09/28 HBBMN 0034 W. J. Brasch I Zwey Campagnenstücke, mit Verwundeten und Sterbenden; sehr schön gemahlt von dito [W. J. Brasch]. Auf L[einwand]. I Diese Nr.: Ein Campagnenstück, mit Verwundeten und Sterbenden Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Ve Zoll, breit 14 Zoll Anm.: Die Lose 34 und 35 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1792/09/28 HBBMN 0035 W. J. Brasch I Zwey Campagnenstücke, mit Verwundeten und Sterbenden; sehr schön gemahlt von dito [W. J. Brasch]. Auf Lfeinwand], I Diese Nr.: Ein Campagnenstück, mit Verwundeten und Sterbenden Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Ve Zoll, breit 14 Zoll Anm.: Die Lose 34 und 35 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
385
1793/06/07 HBBMN 0140 W. Brasch I Zwey Campagnenstükke. Fleißig gemahlt. I Diese Nr.: Ein Campagnenstück Maße: Hoch 10 Zoll, breit 13 Vi Zoll Anm.: Die Lose 140 und 141 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Nr.: Eine Landschaft, wo ein Hirsch von Hunden verfolget wird Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 17 Zoll, Breite 24 Zoll Anm.: Die Lose 72 und 73 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1793/06/07 HBBMN 0141 W. Brasch I Zwey Campagnenstükke. Fleißig gemahlt. I Diese Nr.: Ein Campagnenstück Maße: Hoch 10 Zoll, breit 13 Vi Zoll Anm.: Die Lose 140 und 141 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1800/08/20 HBPAK 0032 Wilh. Brache I Zwey Landschaften, wo in der einen ein wüthender grauer Ochse von Hunden verfolgt, und auf der andern ein brauner wilder Stier von ihnen angefallen wird. Brav gemahlt. Auf Leinwand, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Eine Landschaft, wo in der einen ein wüthender grauer Ochse von Hunden verfolgt wird Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 25 Zoll, breit 33 Zoll Anm. : Die Lose 32 und 33 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1796/09/08 HBPAK 0022 Wilh. Brasch I Tyger, die einen Hirsch angefallen haben. Fleißig gemahlt. I Diese Nr.: Tyger, die einen Hirsch angefallen haben Maße: Hoch 12 Zoll, breit 17 Zoll Anm.: Die Lose 22 und 23 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0023 Wilh. Brasch I Tyger, die einen Hirsch angefallen haben. Fleißig gemahlt. I Diese Nr.: Tyger, die einen Hirsch angefallen haben Maße: Hoch 12 Zoll, breit 17 Zoll Anm.: Die Lose 22 und 23 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/12/08 HBPAK 0064 W. Braasch I Zwey Stücke; das eine, wo die Hunde einen Hirsch anfallen; das andere, wo ein Wolf sich einen Haasen zur Beute verschaft. Auf Leinwand, im goldnen Rahm. I Diese Nr.: Ein Stück, wo die Hunde einen Hirsch anfallen Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 13 Zoll, Breite 18 Zoll Anm.: Die Lose 64 und 65 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/12/08 HBPAK 0065 W. Braasch I Zwey Stücke; das eine, wo die Hunde einen Hirsch anfallen; das andere, wo ein Wolf sich einen Haasen zur Beute verschaft. Auf Leinwand, im goldnen Rahm. I Diese Nr.: Ein Stück, wo ein Wolf sich einen Haasen zur Beute verschaft Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 13 Zoll, Breite 18 Zoll Anm.: Die Lose 64 und 65 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/12/08 HBPAK 0070 W. Braasche I Zwey Stücke; das eine, wo Jäger ihr Wild niedergeleget und sich an einem Baume ausruhen; das andere, wo ein Jäger sein Wild niedergeleget und mit einer Frauensperson redet, welche Schampions im Korbe trägt. Gut gemahlt und ordinirt. Auf Leinwand, im schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein Stück, wo Jäger ihr Wild niedergeleget und sich an einem Baume ausruhen Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 34 Zoll, Breite 29 Zoll Anm.: Die Lose 70 und 71 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/12/08 HBPAK 0071 W. Braasche I Zwey Stücke; das eine, wo Jäger ihr Wild niedergeleget und sich an einem Baume ausruhen; das andere, wo ein Jäger sein Wild niedergeleget und mit einer Frauensperson redet, welche Schampions im Korbe trägt. Gut gemahlt und ordinirt. Auf Leinwand, im schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein Stück, wo ein Jäger sein Wild niedergeleget und mit einer Frauensperson redet Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 34 Zoll, Breite 29 Zoll Anm.: Die Lose 70 und 71 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/12/08 HBPAK 0072 W. Braasche I Zwey Landschaften; die eine, wo ein Hund und ein Wildschwein sich einander dem Untergang drohen; die andere, wo ein Hirsch von Hunden verfolget wird. Ganz auf das schönste, wie von diesem Künstler bekannt, gemahlt. Auf Leinwand, im schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Eine Landschaft, wo ein Hund und ein Wildschwein sich einander dem Untergang drohen Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 17 Zoll, Breite 24 Zoll Anm.: Die Lose 72 und 73 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/12/08 HBPAK 0073 W. Braasche I Zwey Landschaften; die eine, wo ein Hund und ein Wildschwein sich einander dem Untergang drohen; die andere, wo ein Hirsch von Hunden verfolget wird. Ganz auf das schönste, wie von diesem Künstler bekannt, gemahlt. Auf Leinwand, im schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Diese 386
GEMÄLDE
1800/08/20 HBPAK 0033 Wilh. Brache I Zwey Landschaften, wo in der einen ein wüthender grauer Ochse von Hunden verfolgt, und auf der andern ein brauner wilder Stier von ihnen angefallen wird. Brav gemahlt. Auf Leinwand, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Eine Landschaft, wo ein brauner wilder Stier von Hunden angefallen wird Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 25 Zoll, breit 33 Zoll Anm.: Die Lose 32 und 33 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Brotus, J. [Nicht identifiziert] 1779/09/27 FRNGL 0619 J. Brotus I Eine fürtreflich meisterhaft ausgeführte Bataille. [Une bataille, chef d'oeuvre.] I Pendant zu Nr. 620 Maße: 1 Schuh 7 Zoll hoch, 10 Zoll breit Transakt.: Verkauft (48 fl für die Nrn. 619 und 620) Käufer: Becker Maler 1779/09/27 FRNGL 0620 J. Brotus I Das Gegenbild zu obigem, eine Plünderung der Equipage vorstellend, von neml. Meister [J. Brotus] und Maas. [Le pendant du precedant, l'equipage pille, par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 619 Maße: 1 Schuh 7 Zoll hoch, 10 Zoll breit Transakt.: Verkauft (48 fl für die Nrn. 619 und 620) Käufer: Becker Maler
Brouere, L.T. [Nicht identifiziert] 1782/09/30 FRAN 0265 LT. Brouere I Ein allegorisches Stück, grau in grau gemahlt, von L.T. Brouere 1743 verfertigt. [Une piece allegorique, en camayeux, par L. T. Brouere, en 1743.] I Maße: 3 Schuh 6 Zoll hoch, 5 Schuh 6 Zoll breit Inschr.: 1743 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (20 fl) Käufer: Wild
Broupper, Nikolaus [Nicht identifiziert] 1776/00/00 WZTRU 0427 Nikolaus Broupper I Ein Stück 1 Schuhe, 6 Zoll hoch, 1 Schuhe, 2 Zoll breit von Nikolaus Broupper, stellet vor einen alten Mannskopf mit einem weisen Barte sehr gut gemalet. I Pendant zu Nr. 428 Maße: 1 Schuhe 6 Zoll hoch, 1 Schuhe 2 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (5 fl Schätzung) 1776/00/00 WZTRU 0428 Nikolaus Broupper I Compagnion zu Nro. 427 einen alten Weibskopf mit einer Beizhauben vorstellend, ist sehr schön und recht meisterlich angebracht. I Pendant zu Nr. 427 Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (5 fl Schätzung) 1781/00/00 WZAN 0427 Nikolaus Broupper I Ein Stück 1 Schuhe, 6 Zoll hoch, 1 Schuhe, 1 Zoll breit, von Nikolaus Broupper, stellet einen alten sehr gut gemalten Mannskopf mit einem weisen Barte vor. I Pendant zu Nr. 428 Maße: 1 Schuhe 6 Zoll hoch, 1 Schuhe 1 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0428 Nikolaus Broupper I Der Kompagnon zu Nro 427, welcher einen alten Weibskopf mit einer Beizhaube vorstellet, ist sehr schön und recht meisterlich angebracht. I Pendant zu Nr. 427 Transakt.: Unbekannt
Brouwer, Adriaen 1716/00/00 FRHDR 0077 Ρrauer I Von Prauer 4. Cabinets stuck von unterschiedener Grosse. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (32) 1723/00/00 PRAN [B]0053 Β rower I Ein Holländischer Barbierer / vorn Brower. I Maße: Höhe 1 Schuh 3 Vi Zoll, Breite 1 Schuh 3 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN [C]0013 Brower I Holländischer Bauer / vom Brower. I Maße: Höhe Vi Schuh 1 Zoll, Breite 5 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0159 Brauer ] Ein Bavvren Stuck. Original vom Brauer. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0212 Brauer I Ein Bawren Stuck, Original vom Brauer. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0220 Brauer I Des Buveurs & un Violon, de l'ecole de Brauer. I Maße: Haut 9. pouces, large 1. pied Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0231 Brauer I Des Pa'isans, par Brauer. I Maße: Haut 1. pied 1. pou. large 1. pied Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0334 Brauer I Des Pa'isans, par Brauer. I Maße: Haut 1. pie, large 10. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1744/05/20 FRAN 0022 Prouwer I 1 Bauren=Stück. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 1 Zoll, Breite 11 Zoll Verkäufer: von Ucheln Transakt. : Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0155 Brouwer I Une piece, avec toutes sortes de Legumes, ci vue d'oeil par Brouwer. I Maße: Largeur 2 Pies 5 Pouces, Haut 1 Pies 7 14 Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1759/00/00 LZEBT 0064 Adr. Brauer I Ein paar Bauer die Toback rauchen auf Holtz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 7 V* Zoll, Breite 8 V* Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (30 Th für die Nrn. 64 und 65, Schätzung) 1759/00/00 LZEBT 0065 Adr. Brauer I Ein paar dergleichen [Bauer die Toback rauchen] auf Holtz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 7 Vt Zoll, Breite 8 Vi Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (30 Th für die Nrn. 64 und 65, Schätzung) 1763/11/09 FRJUN 0026 Brauer I Trais pa'isans joyeux parfaitement peint dans son meilleur tems. I Maße: hauteur 8 pouces, largeur 6 Vi pouces Transakt.: Verkauft (37 fl) Käufer: Rath Ehrenreich 1763/11/09 FRJUN 0027 Brauer I L'Interieur d'une chambre dans la quelle deux pa'isans en quereile, aussi bien peint que le precedent. I Maße: hauteur 12 Vi pouces, largeur 17 Vi pouces Transakt.: Verkauft (66 fl) Käufer: Rath Ehrenreich 1764/00/00 BLAN 0454 Brauer I 2. Cabinet Stücken, bauem die Toback rauchend vorstellend. I Diese Nr.: Bauern die Toback rauchend Maße: 1 Fuß Vi Zoll hoch, 1 Fuß 1 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 454 und 455 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (250 Rt für die Nm. 454 und 455, Schätzung) Gegenw. Standort: Sankt-Peterburg, Rossiya. Ermitazh. (N 667) (?) 1764/00/00 BLAN 0455 Brauer I 2. Cabinet Stücken, bauern die Toback rauchend vorstellend. I Diese Nr.: Bauem die Toback rauchend Maße: 1 Fuß Vi Zoll hoch, 1 Fuß 1 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 454 und 455 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (250 Rt für die Nm. 454 und 455, Schätzung)
1764/03/12 FRKAL 0017 Brauer I Un pai'san assis fumant sa pipe. I Maße: hauteur 9 pouces, largeur 7 pouces Transakt.: Verkauft (7.30 fl) Käufer: Weisenbach 1764/05/18 BLAN 0009 Adrian Brauwer I Drey sitzende singende Bauern, der vierte stehet und spielet auf dem Dudelsack. Ganze Figuren auf Holz gemahlt, 9 Zoll hoch, und 1 Fuß 1 Zoll breit. Dieses Bild ist gut conservirt; und sehr in einander geschmolzen gemahlt, so, daß die Haltung in diesem Bilde sehr schön ausgedruckt ist. [Text hier gekürzt]. I Mat.: auf Holz Maße: 9 Zoll hoch, und 1 Fuß 1 Zoll breit Verkäufer: Johann Georg Eimbke Transakt.: Verkauft (12 Rt) Käufer: Ghk Schönemark 1764/08/25 FRAN 0442 Adrien Brauer I Un pai'san. I Maße: haut 11 pouces sur 1 pied 1 Vi pouces de large Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1764/08/25 FRAN 0493 Brauer I Des mendiants. I Maße: haut 9 pouces sur 1 pied 1 pouce de large Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1765/03/27 FRKAL 0029 Brauer I Un excellent tableau representant trois pa'isans ä fumer & aboire aupres d'un barril, peint dans son meilleur tems. I Maße: hauteur 14 pouces, largeur 13 pouces Transakt.: Verkauft (20 fl) Käufer: Kaller 1765/03/27 FRKAL 0030 Brauer I Un joli piece avec des choses inanimees. I Maße: hauteur 30 pouces, largeur 26 pouces Transakt.: Verkauft (7 fl) Käufer: Schlundt 1768/07/00 MUAN 0204 Brouwer (Adrianus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0230 Brouwer (Adrianus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigemng besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0231 Brouwer (Adrianus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0338 Brouwer (Adrianus) I [Ohne Titel] Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0356 Brouwer (Adrianus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0364 Brouwer (Adrianus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0374 Brouwer (Adrianus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0407 Brouwer (Adrianus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigemng besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog GEMÄLDE
387
wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
Zoll breit, 14 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (36 fl) Käufer: Schweitzer [...?]
1768/07/00 MUAN 0449 Brouwer (Adrianus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
1779/00/00 HB AN 0081 Adrian Brouwer I Ein Bauer liebkoset sein Weib, die zur Rechten an einem Tische sitzt, auf dem ein Krug und eine Semmel auf einem weißen Tuche befindlich sind. Die Frau hält ein Glas Wein in der Hand. Auf Holz. [Un paysan carresse sa femme, qui est assise ä droite ä une table, couverte d'une nappe blanche, sur laquelle se trouve une cruche & un pain. La femme tient un verre de vin. Sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 8 Zoll hoch, 7 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt
1769/00/00 MUAN 0168 Brouwer I Trois paysans fumant du tabac. Peint sur bois, marque du No. 356. I Mat.: auf Holz Maße: 9 Vi. pouces de haut sur 7 V*. pouces de large Verkäufer: Franjois Ignace de Dufresne Transakt. : Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0169 Brouwer I Quatre paysans assis dans une taverne qui chantent, un autre paysan est appui'e contre la muraille, & un enfant assis sur une chaise percee. Peint sur bois, marque du No. 338. I Mat.: auf Holz Maße: 9 Vi. pouces de haut sur 7 Vi. pouces de large Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0193 Brouwer I Une Compagnie de paysans, qui boivent, on en voit entre autre un, qui leve une cruche pour boire. Peinte sur cuivre, marquee du No. 449. I Mat.: auf Kupfer Maße: 1. pied de haut sur 1. p. 6. p. de large Verkäufer: Franfois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0208 Brouwer I Un morceau qui represente quatre paysans qui chantent & un apu'ie contre le mur, & un enfant sur sa chaise percee. Peint sur bois marque du No. 364. I Mat.: auf Holz Maße: 9. pouces de haut sur 7 Vi. pouces de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1775/09/09 HBBMN 0035 Adr. Brouwer I Ein Bauern=Gelach, allwo es ziemlich frey zugeht, heiter und lebhaft gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Z, Breit 1 F Transakt.: Verkauft (21.8 M) Käufer: Pauli 1776/00/00 WZTRU 0046 Adrian Brouwer I Ein Stück , 10 Zoll hoch, 12 Zoll breit von Adrian Brouwer ein Bauern-Conversationsstück, allwo ein alter nicht wohl mehr sehender Bauer, welcher mit seiner in beßten Jahren zu seyn scheinenden Frau auf einen Tisch mit Karten spielet, und sich ganz erzürnend zeiget; ein anderes paar Eheleute sehen mit Vergnügen diesem Spiele zu. In diesem Stücke herrschet überhaupt eine Verständniß der Colorit, Zeichnung und Harmonie, welche die Kenner von diesem Meister bewundert haben. I Pendant zu Nr. 47 Maße: 10 Zoll hoch, 12 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (20 fl Schätzung) 1776/00/00 WZTRU 0047 Adrian Brouwer I Compagnion zu Nro. 46 stellet vor eine Bauernfrau, so mit ihrer Nachbarinn Chokolate trinket; der gute Mann stehet hinter dem Tische und richtet denselben zu, noch einer sitzet gleich dabey, und ziehet die Bäuerinn lächelnd an. Dieses Stück ist von gleicher Stärke, und sehr glühend gemalet. I Pendant zu Nr. 46 Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (20 fl Schätzung) 1778/07/21 HBHTZ 0022 A. Brauer I Eine Dame so nach Figuren von Gips zeichnet, vor ihrem Tische sitzend, mit vielem Beywesen, auf Holz, zu dessen Compagnon, ein Chirurgus so einem das Bein verbindet, schön gemahlt, mit vielem Affect, auf Holz, ersteres von G. Metzu, und das andere von A. Brauer. I Diese Nr.: Ein Chirurgus so einem das Bein verbindet; Pendant zu Nr. 21 von Metsu Mat.: auf Holz Maße: 18 Zoll hoch, 12 Zoll breit Anm.: Die Lose 21 und 22 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1779/09/27 FRNGL 0055 Adrian Brouwer I Ein Niederländischer Bauer, mit einem Trinkgeschirr in der Hand. [Un pai'san Flamand tenant un vase ä boire dans la main.] I Pendant zu Nr. 56 Maße: 5 % Zoll hoch, 6 Zoll breit Transakt.: Verkauft (7.30 fl für die Nrn. 55 und 56) Käufer: Rath Eichhorn 1779/09/27 FRNGL 0056 Adrian Brouwer I Das Gegenbild zu obigem, eine dergleichen Vorstellung [ein Niederländischer Bauer, mit einem Trinkgeschirr], von nemlichem Meister [Adrian Brouwer] und Maas. [Le pendant du precedent, meme objet [un pai'san Flamand tenant un vase ä boire dans la main], par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 55 Maße: 5 % Zoll hoch, 6 Zoll breit Transakt.: Verkauft (7.30 fl für die Nrn. 55 und 56) Käufer: Rath Eichhorn 1779/09/27 FRNGL 0551 Ad. Brouwer I Eine holländische Bauemküche, mit Küchengeräthschaften. [La cuisine d'un paysan Hollandois avec differentes pieces d'une batterie de cuisine.] I Maße: 7 Zoll hoch, 10 Zoll breit Transakt.: Verkauft (18.15 fl) Käufer: Hüsgen modo Burger 1779/09/27 FRNGL 0666 Adrian Brouwer I Eine trinkende Bauerngesellschaft mit vielem schönen Beywesen, meisterhaft, fein und fleißig ausgeführt. [Des paysans qui boivent, avec de tres beaux objets accessoires, piece sup6rieurement executee.] I Maße: 1 Schuh 2 % Zoll hoch, 1 Schuh 6 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (141 fl) Käufer: Hüsgen 1779/09/27 FRNGL 0937 Adrian Brouwer I Ein Niederländischer Zahnarzt, welcher einem Bauern einen Zahn ausbricht, mit verschiedenen dabey stehenden Bauernfiguren, ein Stück von einer herrlichen Composition, in Licht und Schatten schön ausgeführt. [Un Dentiste Flamand, qui arrache une dent ä un paysan assistens, tres belle piece, clair-obscur superieurement bien observe.] I Maße: 10 Zoll hoch, 1 Schuh Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (110 fl) Käufer: Hüsgen 1781/00/00 WZAN 0046 Adrian Brouwer I Ein Stück, 10 Zoll hoch, 12 Zoll breit von Adrian Brouwer, bestehend in einer Bauernkonversation, allwo ein alter nicht mehr wohl sehender Bauer, welcher mit seiner in beßten Jahren zu seyn scheinenden Frau auf einem Tische mit Karten spielet, und sich ganz zornig zeiget; ein anderes Paar Eheleute sehen mit Vergnügen diesem Spiele zu. In diesem Stücke herrschet überhaupt ein Verständniß der Kolorit, Zeichnung und Harmonie, welche die Kenner an diesem Meister bewundert haben. I Pendant zu Nr. 47 Maße: 10 Zoll hoch, 12 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0047 Adrian Brouwer I Kompagnon zu Nro 46 stellet eine Bauernfrau vor, so mit ihrer Nachbarinn Chokolate trinket; der gute Mann steht hinter dem Tische, und richtet denselben zu: noch einer sitzet gleich dabey, und sieht die Bäurinn lächelnd an. Dieses Stück ist von gleicher Stärke, und sehr glühend gemalet. I Pendant zu Nr. 46 Transakt.: Unbekannt
1778/09/28 FRAN 0438 Adrian Bromer I Ein Bauernstück. [Une piece representante des paysans.] I Maße: 1 Schuh breit, 10 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (15 fl) Käufer: Dr Hartzberg
1781/02/17 FRAN 0061 Adrian Brouwer I Ein Schuhmacher in seiner Werkstatt. I Pendant zu Nr. 62 Maße: 1 Schuh 5 Zoll breit, 1 Schuh 8 Zoll hoch Transakt.: Unbekannt (52.15 fl für die Nm. 61 und 62)
1778/09/28 FRAN 0649 Adrian Brouwer I Eine Tabak rauchende Bauemgesellschaft. [Des paysans fumants du tabac.] I Maße: 11
1781/02/17 FRAN 0062 Adrian Brouwer I Zum Gegenbild eine alte Frau, welche sich mit Spinnen beschäftiget, von nemlicher Hand
388
GEMÄLDE
und Größe. I Pendant zu Nr. 61 Maße: 1 Schuh 5 Zoll breit, 1 Schuh 8 Zoll hoch Transakt.: Unbekannt (52.15 fl für die Nrn. 61 und 62)
sich stehen hat. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll 8 Linien, breit 8 Zoll 6 Linien Transakt.: Unbekannt
1781/03/26 BLHRG 2382 Adrian Brauer I Une fille assise avec son Chien. I Transakt.: Unbekannt
1786/10/18 HBTEX 0081 Brauer I Einige sitzende und stehende Bauren, welche Toback rauchen und miteinander discutiren, vor dem Camin=Feuer; zu deren Compagnon musicirende Land=Leute; beyde mit Affect und freyem Pinsel gemahlt. Auf Kupfer. I Diese Nr.: Musicirende Land=Leute; Pendant zu Nr. 80 von Teniers Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 13 Zoll 3 Linien, breit 9 Zoll 10 Linien Anm.: Die Lose 80 und 81 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1781/03/26 BLHRG 2383 Adrian Brauer I Une dito [une fille], avec un petit garcon, ayant un Chat sur ses genoux, ä quil [sie] il offre un morceau de Pain. I Transakt.: Unbekannt 1781/05/07 FRHUS 0334 Brauer I Zwey Stück, ein alter Bauer mit einem Bierkrug und ein dergleichen altes Weib, meisterhaft gemahlt von Brauer. I Diese Nr.: Ein Stück, ein alter Bauer mit einem Bierkrug Maße: 1 Schuh hoch und 9 Zoll breit Anm.: Die Lose 334 und 335 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Jacob Bemus Transakt.: Verkauft (15 fl für die Nrn. 334 und 335) Käufer: Behr 1781/05/07 FRHUS 0335 Brauer I Zwey Stück, ein alter Bauer mit einem Bierkrug und ein dergleichen altes Weib, meisterhaft gemahlt von Brauer. I Diese Nr.: Ein Stück, ein altes Weib Maße: 1 Schuh hoch und 9 Zoll breit Anm.: Die Lose 334 und 335 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Jacob Bemus Transakt.: Verkauft (15 fl für die Nrn. 334 und 335) Käufer: Behr 1782/05/29 FRFAY 0017 Brauer I Zwey Baurenstuck, das eine von Brauer, der Compagnon von Schweyer. I Diese Nr.: Ein Baurenstuck; Pendant zu Nr. 18 von J.P. Schweyer Maße: 14 Zoll hoch, 12 Zoll breit Anm.: Die Lose 17 und 18 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Thorhorst Transakt.: Unbekannt (8.15 fl für die Nrn. 17 und 18) 1782/09/30 FRAN 0122 Adrian Brouwer I Ein holländischer Matrose mit einem Bierkrug, meisterhaft verfertigt von Adrian Brouwer. [Un matelot Hollandois avec une cruche ä bierre, tres belle piece par Adrien Brouwer.] I Maße: 1 Schuh 2 Zoll hoch, 1 Schuh breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (15 fl) Käufer: Hüsgen 1782/09/30 FRAN 0133 Adrian Brouwer I Ein Bauernweib, wie selbiges an der Spindel zu spinnen beschäftigt ist, nach der Natur verfertigt von Adrian Brouwer. [Une paysanne filante avec un fuseau d'aprfes nature par Adrien Brouwer.] I Maße: 1 Schuh 2 Zoll hoch, und 11 Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (30.30 fl) Käufer: Dr Siegler 1783/06/19 HBRMS 0152 A. Brauer I Drey musicirende Bauren, nebenbey liegen Instrumente. H[olz], g.R. [verguldeter Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: 8 Zoll hoch, 8 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1785/05/17 MZAN 0419 Brouwer I Ein schlafender Bauer von Brouwer. [Un paysan en sommeil.] I Maße: 6 Vi Zoll hoch, 5 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (5 fl) Käufer: Zitz 1785/05/17 MZAN 1077 Brouwer I Ein Bauer mit einer Stange auf der Achsel auf Kupfer von Brouwer. [Un paysan portant une perche sur l'epaule.] I Mat.: auf Kupfer Maße: 5 Vi Zoll hoch, 4 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (5 fl) Käufer: Zitz 1786/05/02 NGAN 0043 Adrian Brauer I Zwey Köpfe eines alten Mannes, und Weibes. I Diese Nr.: Der Kopf eines alten Mannes Maße: 1 Schuh 7 Zoll hoch, 1 Schuh 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 43 und 44 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (50.15 fl für die Nrn. 43 und 44) Käufer: Ego 1786/05/02 NGAN 0044 Adrian Brauer I Zwey Köpfe eines alten Mannes, und Weibes. I Diese Nr.: Der Kopf eines alten Weibes Maße: 1 Schuh 7 Zoll hoch, 1 Schuh 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 43 und 44 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (50.15 fl für die Nrn. 43 und 44) Käufer: Ego 1786/10/18 HBTEX 0067 A: Brauer I Ein reicher Bauer mit einem Jungen, welcher sich mit einen Geld=Sack, den er in dem Arm hält, belustiget, nebst einem Koffer voll Geldes, den er offen vor
1787/00/00 HB AN 0317 Adrianus Brouwer I Zwey Bauern sitzen an einer Tonne, und spielen Karten. Ein Alter steht daneben, und raucht Toback. Im Hintergrunde noch ein Bauer. Dieses Gemählde ist von einem warmen und natürlichen Colorit, richtiger Zeichnung, und von plaisanter und ausführlicher Mahlery. A.H. [Auf Holz] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 14 % Zoll, breit 15 Zoll Transakt.: Verkauft (29.8 M) Käufer: Bertheau 1787/00/00 HB AN 0590 Adrian Brouwer 1 Ein alter singender Bauer sitzt auf einem Stuhl, und spielt die Violine. Halbe Figur. Von richtiger Zeichnung und schöner Mahlerey. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 7 Zoll, breit 6 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (7 M) Käufer: Fesser 1788/04/08 FRFAY 0147 A. Brauer I Ein sehr gut gemaltes Stilleben, von A. Brauer. Auf Tuch. I Mat.: auf Leinwand Maße: 23 Z. hoch, und 19 Z. breit Transakt.: Verkauft (3 fl) Käufer: Hirth 1790/01/07 MUAN 0257 Brouwer Hadr. I Ein lustiger Tabackschmaucher, auf Holz, mit einem Glase, in einer schwarzgepeizten Ram mit vergoldeten Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 10 Zoll, Breite 10 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/04/13 HBLIE 0084 Adrian Brouwer I Mit seinem Weibe zur Seite, sitzt ein alter Bauer in nachdenkender Stellung vorm Camien; ganze Figuren mit vielen Nebenwerken. Ein sehr schönes Gemählde auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Vi Zoll, breit 11 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (4.8 M) Käufer: Boemer 1790/08/25 FRAN 0280 Brouwer I Zwey Bauernstück. I Diese Nr.: Ein Bauernstück Maße: hoch 16 Zoll, breit 9 Vi Zoll Anm.: Die Lose 280 und 281 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (7.15 fl für die Nrn. 280 und 281) Käufer: Erlinger 1790/08/25 FRAN 0281 Brouwer I Zwey Bauernstück. I Diese Nr.: Ein Bauemstück Maße: hoch 16 Zoll, breit 9 Vi Zoll Anm.: Die Lose 280 und 281 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (7.15 fl für die Nm. 280 und 281) Käufer: Erlinger 1792/04/19 HBBMN 0121 Λ. Brouwer I Bauren amusiren sich auf verschiedene Weise, halbe Figuren; sehr schön gemahlt, von A. Brouwer. Auf Holz. I Diese Nr.: Bauren amusiren sich auf verschiedene Weise Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 Zoll, breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 121 und 122 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1792/04/19 HBBMN 0122 A. Brouwer I Bauren amusiren sich auf verschiedene Weise, halbe Figuren; sehr schön gemahlt, von A. Brouwer. Auf Holz. I Diese Nr.: Bauren amusiren sich auf verschiedene Weise Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 Zoll, breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 121 und 122 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1792/04/19 HBBMN 0129 A. Brouwer I Zwey holländische Baurenstücke, auf dem einen prügeln sie sich ec. sehr schön, von A. Brouwer. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 Zoll, breit 10 Zoll Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
389
1792/08/20 KOAN 0317 Adrian Brauer I Ein Kopf in viereckigem Format auf Holz von Adrian Brauer. I Mat.: auf Holz Format: quadratisch Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt
1798/05/14 KOAN 0038 Brauwer I Une Compagnie de paysans. I Mat.: auf Holz Maße: Η. 11 pouc. L. 10 pouc. Verkäufer: de Bors d'Overen Transakt.: Unbekannt
1793/00/00 NGWID 0112 Brauer I Ein niederländischer Bauer mit einem Bierkrug, von Brauer. I Pendant zu Nr. 113 Maße: 10 Zoll hoch, 6 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
1798/06/04 HBPAK 0178 Adrian Brauer I Em inwendiges Bauemhaus, wo sich Bauern bey Frauenzimmern amusiren und zechen. Auf Holz, goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 20 Zoll, breit 28 Zoll Transakt.: Unbekannt
1793/00/00 NGWID 0113 Brauer I Zum Compagnon, ein Bauer welcher einen Bierkrug und Trinkgeschirr in Händen hält, von obigem Meister [Brauer] und Maaß. I Pendant zu Nr. 112 Maße: 10 Zoll hoch, 6 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0132 Brauer I Ein Bauemjunge, welcher einen Bierkrug in der Hand hält, von Brauer. I Maße: 9 Zoll hoch, 8 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0296 Brauer I Der inwendige Theil einer holländischen Bauernstube, in welcher ein alter Bauer mit einer Bäuerin caressiert, welche von einer dritten im Hintergrund wohl angebrachten Figur eifrig belauscht werden, von Brauer. I Maße: 2 Schuh 3 Zoll hoch, 2 Schuh breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/09/18 HBSCN 0027 Adrian Brouwer I In einer armseligen Landstube sitzt ein alter Bauer auf einem schlechten Stuhl, einer Tonne dienet ihm zum Tisch, er zündet eine Pfeiffe Toback an. So ordinair auch der Gegenstand, so auffallend schön ist dieses Bild. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 9 Zoll Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV [A]0049 A. Brauer I Ein lachender Bauer. Sehr fleißig und kräftig gemahlt; von A. Brauer. Ovalen Formats. I Format: oval Maße: Hoch 2 Vi Zoll, breit 2 Zoll Transakt.: Unbekannt 1795/11/14 HBPAK 0081 Braur I Musicirende Bauern; sehr fleißig und schön gemahlt. Auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 10 Zoll, breit 7 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1795/11/14 HBPAK 0082 Braur I Zwey Verliebte; mit vielen Ausdruck, und schön gemahlt. Auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 10 Zoll, breit 7 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/02/27 HBPAK 0095 A. Brauer I Ein Bauernstück, wo sie am Tische sehr vergnügt sitzen, und sich mit Musick ec. unterhalten. Sehr gut gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 15 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0035 A. Brauver I Eine Gruppe Flamänder, welche sich mit Musik unterhalten. Eine dem Künstler eigene Manier, so wohl im Ausdruck der komischen Figuren, als in Absicht des Colorits. Ein sehr unterhaltendes Gemähide. Auf Holz, mit schwarzen Rahm und vergoldeten Stäben. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 18 Zoll, breit 13 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0189 Brouwer I Das Inwendige eines Hauses mit Figuren und andern Nebensachen. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Zoll, breit 17 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0177 C. Brouwer I Das Innere eines Bauemhauses, im Vordergrunde sind vier Personen, der eine hält ein Glas Bier in die Höhe, die Frau scheint einen Schlag von dem hinter ihr stehenden Bauer bekommen zu haben, weil sie ihren Kopf hält, ein anderer Bauer raucht, nebst noch mehreren Figuren. Auf Holz, goldenen Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 12 Zoll, breit 17 Vi Zoll Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "C. Brouwer", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0256 Brauwes I Ein Bauer der Taback raucht. Auf Holz, goldenen Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 8 Vi Zoll, breit 7 Zoll Transakt.: Unbekannt 390
GEMÄLDE
1798/06/04 HBPAK 0271 A. Brouwer I Ein Alter hat ein Glas und einen Krug in der Hand, und zwey Kinder wollen ihm solche entreissen, worüber er lächelt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 Vi Zoll, breit 5 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0041 Adrian Brouwer I Zwey holländer= Bauern=Stückchen, von Adrian Brouwer. Rund auf Holz. I Diese Nr.: Ein holländer=Bauern=Stückchen Mat.: auf Holz Format: rund Maße: hoch 8 Zoll breit 1 Schuh Anm.: Die Lose 41 und 42 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0042 Adrian Brouwer I Zwey holländen= Bauern=Stückchen, von Adrian Brouwer. Rund auf Holz. I Diese Nr.: Ein holländer=Bauern=Stückchen Mat.: auf Holz Format: rund Maße: hoch 8 Zoll breit 1 Schuh Anm.: Die Lose 41 und 42 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0297 Adrian Brouwer I Zwey Holländer^ Bauern=Stücke, von Adrian Brouwer. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Holländer=Bauern=Stück Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 4 Zoll breit 1 Schuh 8 Zoll Anm.: Die Lose 297 und 298 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0298 Adrian Brouwer I Zwey Holländer Bauern=Stücke, von Adrian Brouwer. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Holländer=Bauem=Stück Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 4 Zoll breit 1 Schuh 8 Zoll Anm.: Die Lose 297 und 298 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0316 Adrian Brouwer I Zwey Holländer Bauern=Stücke, von Adrian Brouwer. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Holländer=Bauern=Stück Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 7 Zoll breit 2 Schuh 2 Zoll Anm.: Die Lose 316 und 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0317 Adrian Brouwer I Zwey Holländer Bauern=Stücke, von Adrian Brouwer. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Holländer=Bauern=Stück Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 7 Zoll breit 2 Schuh 2 Zoll Anm.: Die Lose 316 und 317 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0387 Adrian Brouwer I Ein Holländer Bauem=Stück, von Adrian Brouwer. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 4 Zoll breit 1 Schuh 6 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0711 Adrian Brouwer I Ein Stück, worauf zwey Bauern mit Tobakspfeifen sind, von Adrian Brouwer. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 11 Schuh 1 Zoll breit 7 Schuh 11 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/08/09 HBPAK 0051 Brouwer I Ein alter Mann in einer Nische, welcher einen Krug in der Hand hält. Schön gemahlt. Auf Holz, goldn. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Zoll, breit 7 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0023 Adrian Brauwer I Ein inwendiges Bauern=Haus, wo Bauern Karten spielen. Auf Holz. Goldn. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 15 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0151 Brauwer I In einer Höhle sitzet ein alter Philosoph vor einem aufgeschlagenen Buche sehr andächtig.
Auf Holz. Goldner Rahm. \Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Zoll, breit 13 Zoll Transakt.: Unbekannt
sammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt
1800/00/00 FRAN1 0021 Brouver I Ein Bauer u. eine Bäuerin. Mat.: auf Holz Maße: 6 Zoll hoch, 7 Vi Zoll breit Transakt.: Unbekannt
1782/03/18 HBTEX 0078 Im Gusto von Brauer I Die fünf Sinnen, in gesellschaftlichen Landleuten lebhaft vorgestellet, auf Holz. I Diese Nr.: Einer der fünf Sinne Mat.: auf Holz Maße: Höhe 7 Zoll 6 Linien, Breite 9 Zoll 6 Linien Anm.: Die Lose 77 bis 81 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt
1800/00/00 FRAN1 0022 Brouver I Ein Bauer stopft seine Pfeife. I Mat.: Leinwand auf Holz Maße: 6 Vi Zoll hoch, 8 Vi Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN1 0023 Brouver I Ein inneres holl. Bauernhaus, im ersten Plan liebkoset ein Bauer eine Bäuerin, welche einen großen Topf auf der Erde haltet; im zweiten stehen zwei Bauern am Kamin. I Mat.: auf Holz Maße: 18 Zoll hoch, 23 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN2 0114 Brauer (Adrian) I Das Innere eines chymischen Laboratoriums mit drey Figuren. Dies Bild ist in einem lieblichen Ton schön gemahlt. I Mat.: auf Holz Maße: 11 Zoll hoch, 13 Vi Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1800/00/00+ LZRST [0017] Adrian Brouwer I Eine Bauernlustbarkeit in einem Dorfe, mit sehr vielen Figuren. I Mat.: auf Holz Maße: 33 Zoll breit 24 Zoll hoch Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Rost Transakt.: Unbekannt 1800/07/09 HBPAK 0056 Brauer I Paysans jouant aux boules dans une Cour de Cabaret. Plusieurs dans le fond fument et boivent. Sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: 14 pouces de hauteur. Sur 12 pouces de largeur Transakt.: Unbekannt 1800/07/09 HBPAK 0081 Brauer I Trois paysans allumant leurs pipes. Deux autres dans le fond. Un tonneau sur le devant, aupres d'Eux un brasier sur la table. Sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: 16 pouces de hauteur. 13 pouces de largeur Transakt.: Unbekannt
Brouwer, Adriaen (oder Craesbeeck) 1772/00/00 BSFRE 0022 Brouwer (Adrien); ou Craesbeck I Ce Tableau represente le dedans d'une Maison rustique, ou un gros Savetier est assis ä cote d'une Femme, qui luy verse du Brandewin ; au fond de l'appartement on voit plusieurs Payssans, qui se chauffent. L'on observe partout une touche s^avante & legere. Cadre noir, avec Liteaux d'ores. I Mat.: auf Holz Maße: haut de 14 % & large de 19 pouces Transakt.: Unbekannt 1772/00/00 BSFRE 0023 Brouwer (Adrien); ou Craesbeck I Dans ce petit Tableau, il y a deux Payssans ä my corps, qui se rejouissent ä boire & ä fumer. Cadre sculpte & d'ore. I Mat. : auf Holz Maße: haut de 4 Vi & large de 3 Vi pouces Transakt.: Unbekannt
Brouwer, Adriaen (Geschmack von) 1781/05/07 FRHUS 0021 Brauer I Ein holländischer Bauer, mit einer Tabakspfeiffe im Gusto von Brauer. I Pendant zu Nr. 22 Maße: 1 Schuh 2 Zoll hoch und 1 Schuh breit Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (3.4 fl für die Nm. 21 und 22) Käufer: Fa Bemus 1781/05/07 FRHUS 0022 Brauer I Das Gegenbild zu obigem, ein ditto [holländischer Bauer] mit einem Bierkrug, von nehml. Hand [im Gusto von Brauer] und Maas. I Pendant zu Nr. 21 Maße: 1 Schuh 2 Zoll hoch und 1 Schuh breit Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (3.4 fl für die Nm. 21 und 22) Käufer: Fa Bernus 1782/03/18 HBTEX 0077 Im Gusto von Brauer I Die fünf Sinnen, in gesellschaftlichen Landleuten lebhaft vorgestellet, auf Holz. I Diese Nr.: Einer der fünf Sinne Mat.: auf Holz Maße: Höhe 7 Zoll 6 Linien, Breite 9 Zoll 6 Linien Anm.: Die Lose 77 bis 81 wurden zu-
1782/03/18 HBTEX 0079 Im Gusto von Brauer I Die fünf Sinnen, in gesellschaftlichen Landleuten lebhaft vorgestellet, auf Holz. I Diese Nr.: Einer der fünf Sinne Mat.: auf Holz Maße: Höhe 7 Zoll 6 Linien, Breite 9 Zoll 6 Linien Anm.: Die Lose 77 bis 81 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0080 Im Gusto von Brauer I Die fünf Sinnen, in gesellschaftlichen Landleuten lebhaft vorgestellet, auf Holz. I Diese Nr.: Einer der fünf Sinne Mat.: auf Holz Maße: Höhe 7 Zoll 6 Linien, Breite 9 Zoll 6 Linien Anm.: Die Lose 77 bis 81 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0081 Im Gusto von Brauer I Die fünf Sinnen, in gesellschaftlichen Landleuten lebhaft vorgestellet, auf Holz. I Diese Nr.: Einer der fünf Sinne Mat.: auf Holz Maße: Höhe 7 Zoll 6 Linien, Breite 9 Zoll 6 Linien Anm.: Die Lose 77 bis 81 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt
Brouwer, Adriaen (Kopie nach) 1742/08/01 BOAN 0532 Brauer I Ein Bawren Stuck, nach Brauer. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1764/03/12 FRKAL [A]0034 Brauer I Zwey Bauren nach Brauer I Transakt.: Verkauft (3.4 fl) Käufer: Schlundt 1788/09/01 KOAN 0442 Brauer I Portrait, nach Brauer, [un portrait, selon Brauer.] I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 7 Zoll, Breite 6 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0069a Chr. Guil. Em. Dietrich; nach Adrien Brower I Un paysan qui bäille en ouvrant largement la bouche, en veste grise et en bonnet rouge. Demi-figure. Peint sur bois. I Kopie von Chr. Dietrich nach Adr. Brouwer; Pendant zu Nr. 70b Mat.: auf Holz Maße: haut de 5 Vi pouces, large de 4 Vi pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0070b Chr. Guil. Ern. Dietrich; nach Adrien Brower I Pendant. Un Paysan ivre, en veste rouge, et en chapeau rond et brun, tenant sa main devant la bouche ouverte. Demi-figure. Peint sur bois, de la meme grandeur, que le precedent. I Kopie von Chr. Dietrich nach Adr. Brouwer; Pendant zu Nr. 69a Mat.: auf Holz Maße: haut de 5 Vi pouces, large de 4 Vi pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0071 Chr. Guil. Ern. Dietrich; nach Adrien Brower I Un paysan tenant sous le bras un enfant, decouvert par derriere, occupe ä le nettoyer. Derriere lui on remarque une vieille la bouche ouverte, tenant une quenouille. Devant eux on voit sur une table une couche aupres d'un pot. Dans le fond on apper^oit sur une corniche quelques meubles de menage. Demi figures jusqu'aux genoux. Piece d'un beau fini. Peinte sur bois. I Kopie von Chr. Dietrich nach Adr. Brouwer Mat.: auf Holz Maße: haut de 8 Ά pouces, large de 6 pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0189 Brauer I Ein lustiger Trinker, nach Brauer. I Maße: 12 Zoll hoch, 10 Zoll breit Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
391
1791/09/26 FRAN 0368 Brauer I Ein rauchender und ein trinkender Bauer, nach Brauer. I Diese Nr.: Ein rauchender Bauer Maße: 12 Zoll hoch, 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 368 und 369 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0369 Brauer I Ein rauchender und ein trinkender Bauer, nach Brauer. I Diese Nr.: Ein trinkender Bauer Maße: 12 Zoll hoch, 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 368 und 369 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0043 Adrian Brauer I Zwey Bauren Nachtstück auf Baneel eins nach Adrian Brauer das andere nach Andreas Bott. I Diese Nr.: Ein Bauren Nachtstück; Nr. 44 Kopie nach Andreas Bott Mat.: auf Holz Maße: 1 Schuh 6 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 1 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 43 und 44 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0188 Adrian Brauer I Ein Baur umarmet seine Frau, und gießt derselben Wein ins Glaß, auf Holz nach Adrian Brauer. I Mat.: auf Holz Maße: 9 Zoll hoch, 6 Vi Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1794/09/09 HBPAK 0152 Nach Adrian Brauer I Zwey Bauren= Stücke, auf das eine wird lustig gezecht, auf das andere läuset die Frau ihrem Manne, und ein anderer Landmann steht in der Kruke. I Diese Nr.: Ein Bauren=Stück. Es wird lustig gezecht Maße: Hoch 17 Zoll, breit 13 Zoll Anm.: Die Lose 152 und 153 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/09 HBPAK 0153 Nach Adrian Brauer I Zwey Bauren= Stücke, auf das eine wird lustig gezecht, auf das andere läuset die Frau ihrem Manne, und ein anderer Landmann steht in der Kruke. I Diese Nr.: Ein Bauren=Stück. Die Frau läuset ihre Manne, und ein anderer Landmann steht in der Kruke Maße: Hoch 17 Zoll, breit 13 Zoll Anm.: Die Lose 152 und 153 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0392 Adrian Brouwer I Zwey Holländer Bauem=Stückchen, nach Adrian Brouwer. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Holländer Bauern=Stückchen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh breit 10 Zoll Anm.: Die Lose A392 und A393 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0393 Adrian Brouwer I Zwey Holländer Bauern=Stückchen, nach Adrian Brouwer. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Holländer Bauern=Stückchen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh breit 10 Zoll Anm.: Die Lose A392 und A393 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Brouwer, Adriaen (Manier) 1784/05/11 HBKOS 0120 Brauer I Zechende Bauern, lebhaft gemahlt auf Holz, in der Brauerschen Manier. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 18 Zoll, breit 22 Zoll Transakt.: Unbekannt (6.4 M) 1784/08/02 FRNGL 0151 Brauer I Ein Niederländisches Bauernstück, im Brauers Manier. I Maße: 10 Vi Zoll breit, 14 Zoll hoch Verkäufer: Α Transakt.: Verkauft (24 Kr) Käufer: Nothnagel 1785/05/17 MZAN 0420 Brouver I Ein Bauer an einem gedeckten Tische mit dem Kruge in der Hand sitzend, [beide Stücke in Brouvers Manier.] [Un paysan assis ä une table converte ayant une cruche dans la main. ] [les deux pieces dans le gout de Brouwer.] I Pendant zu Nr. 421 Maße: 6 Zoll hoch, 6 Zoll breit Anm.: Die ersten Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 421 und beziehen sich auf die Nrn. 420 und 421. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (5 fl für die Nrn. 420 und 421) Käufer: Schwanck 392
GEMÄLDE
1785/05/17 MZAN 0421 Brouver I Das Gegenbild, ein Bauer der an einem Tische sitzt und Schinken ißt, beide Stücke in Brouvers Manier. [Le pendant, un paysan assis ä une table mangeant du jambon, les deux pieces dans le gout de Brouwer.] I Pendant zu Nr. 420 Maße: 6 Zoll hoch, 6 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (5 fl für die Nrn. 420 und 421) Käufer: Schwanck 1785/05/17 MZAN 0422 Brouver I Eine Gesellschaft von Tabackrauchenden Bauern in eben der [Brouvers] Manier. [Un compagnie des paysans fumans du tabac dans le meme gout [Brouwer].] I Maße: 11 Zoll hoch, 9 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (5.30 fl) Käufer: Geh R ν Heüser 1785/05/17 MZAN 0496 Brouwer I Bauern die mit Karten spielen in Brouwers Manier. [Des paysans jouans au cartes dans le gout de Brouwer.] I Maße: 1 Schuh 2 Zoll hoch, 11 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (13.30 fl) Käufer: Zitz 1785/05/17 MZAN 0850 Brouwer I Das Gegenbild, ein Dorfwundarzt, der einem Bauer die Wunde verbindet in Brouwers Manier, von eben der Höhe und Breite. [Le pendant, un Chirurgien de village pansant la playe d'un paysan dans le gout de Brouwer, meme hauteur & meme largeur.] I Pendant zu Nr. 849 von J. Steen Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 9 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (30 fl für die Nm. 849 und 850) Käufer: Schwanck
Brouwer, Adriaen (Schule) 1742/08/01 BOAN 0167 Brauer I Zwey Stuck. Einen Bacchi Bruderen, und einen Bavvren Violinisten praesentirend, von der Schuhle von Brauer. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1779/09/27 FRNGL 0010 Adrian Brouwer I Eine Niederländische Bauernküche mit verschiedenen natürlich abgebildeten Küchengeräthschaften und einer Figur aus der Schul, von Adrian Brouwer. [Une cuisine d'un pai'san Flamand avec diff6rentes pieces d'une batterie de cuisine peints au naturel, ornee d'une figure, de l'Ecole Adrian Brouwer.] I Maße: 10 Zoll hoch, 1 Schuh 2 Zoll breit Transakt.: Verkauft (6 fl) Käufer: Hüsgen
Brouwer, J. (1648) 1750/00/00 KOAN 0202 J. Brouver I Une piece, sur bois, avec des poissons, tres naturel, sur laquelle on lit J. Brouver. I Maße: Largeur 2 Pies 3 Pouces, Haut 1 Ρίέβ 7 % Pouces Inschr.: J. Brouver (signiert) Anm.: Dieses Los trägt im Katalog irrtümlicherweise die Nr. 212. Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt
Brown 1796/12/07 HBPAK 0132 Brown I Zwey alte bärtige Köpfe. I Diese Nr.: Ein alter bärtiger Kopf Anm.: Die Lose 132 und 133 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0133 Brown I Zwey alte bärtige Köpfe. I Diese Nr.: Ein alter bärtiger Kopf Anm.: Die Lose 132 und 133 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Bru, de [Nicht identifiziert] 1790/07/28 ZHWDR 0016 de Bru I [Ohne Titel] I Annotat.: Ein prächtiges Stück! (LAVATER) Transakt.: Unbekannt
Bruandet, Lazare 1796/02/17 HBPAK 0159 L. Bruaudet I In einer angenehmen Gegend befinden sich auf der Landstrasse, welche zwischen Kornfelder bey einem Dorfe vorbey geht, verschiedene Wagen wie auch Fussgänger und Reiter. Auf Leinwand I Mat.: auf Leinwand Maße:
Höhe 9 % Zoll, Breite 11 Zoll Transah.: Verkauft (10 M) Käufer: Juffin 1796/02/17 HBPAK 0173 Bruandet I Eine Land= und Dorf=Gegend. Im Vordergrunde auf der Heerstrasse, welche durch einen niedern Wasser gehet, reitet ein Officier. Zur Linken gehen zwey Landleute und zur Rechten sitzt Einer. In der Entfernung representiren sich verschiedene Dörfer. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 9 Vi Zoll, Breite 11 'Λ Zoll Transakt.: Verkauft (17.8 M) Käufer: Η Goverts 1798/06/04 HBPAK 0328 Bruandet I Ein Wald mit Personen. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Unbekannt
Brüe, Carlo del [Nicht identifiziert] 1787/00/00 HB AN 0732 Carlo del Brüe I Maria sitzt im Vordergrunde, und hält das Christkindlein auf ihrem Schooß. Im Hintergrunde befinden sich etliche Engel. A.H. [Auf Holz] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 13 Zoll Transakt.: Verkauft (3.12 M) Käufer: Tietjen
Bruegel, Pieter (der Ältere) 1723/00/00 PRAN [A]0025 der alte Breugel I Ein Landschafft / vom alten Breugel. I Maße: Höhe 1 Vi Schuh 3 Vi Zoll, Breite 3 Vi Schuh 2 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt
1800/00/00 FRAN2 0136 Bruandet I Das Aeußere einer ländlichen Wohnung. Man bemerkt vorne einen Hirten und Schaafe bey verschiedenen Nebenwerken. Dieß Stück ist eines der schönsten, so dieser Künstler bis jetzt verfertigt hat. I Mat.: auf Holz Maße: 8 Vi Zoll hoch, 10 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
1723/00/00 PRAN [B]0035 der alte Breugel I Christus treibet Teüffel auß / vom alten Breugel. I Maße: Höhe 1 Schuh 3 Vi Zoll, Breite 1 Vi Schuh 2 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt
1800/07/09 HBPAK 0048 Bruhandet I Forets bordees de grandes routes, auprfes des quelles sont des arbres Touffus. L'un et l'autre sont ornes de figures piquantes et bien grouppees. Sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: 14 pouces de hauteur. Sur 16 pouces de largeur Transakt.: Unbekannt
1750/00/00 KOAN 0113 le Vieux Breugel I Un pillage, plein de Figures, bien expromees, sur bois, par le Vieux Breugel, surnomme le Paisur. I Mat.: auf Holz Maße: Largeur 2 Pies 7 Pouces, Haut 2 Pies 2 Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt
Bruandet, Lazare (und Michel, G.)
1759/00/00 LZEBT 0010 Bauer Breugel I Ein Bauren Stück auf Holtz. I Mat.: auf Holz Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (25 Th Schätzung)
1796/02/17 HBPAK 0124 G. Michel; Bruaudet I Eine plaisante Land= und Wasser=Gegend. Zur Linken von einem steilen Wege, beym Kornfelde fährt ein bedeckter Wagen mit zwey Pferden; auf einem derselben sitzt der Fuhrmann, womit er stürzt. Vorauf laufen zwey erschrockene Landleute. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 13 14 Zoll, Breite 16 V* Zoll Transakt.: Verkauft (50 M) Käufer: Τ 1796/02/17 HBPAK 0183 Bruaudet; Michel I Eine Landschaft mit Hölzung und Figuren. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 13 Vi Zoll, Breite 15 Zoll Transakt.: Verkauft (40.8 M) Käufer: Τ
Bruandet, Lazare (und Swebach, J.F.J.) 1796/00/00 BSAN 0062 Swebach Des Fontaines; Le Pay sage, par Bruandet I Le Manege de Versailles. Tableau du plus grand detail. Beaucoup de vie et de mouvement, dans les nombreuses figures d'hommes et d'animaux, dont il est plein. Des hommes et des femmes, dans tous les costumes. Des chevaux dans toutes les attitudes, montes, menes par la bride oü ä la main, atteles ä des carosses &c. Sur le devant, un cheval en repos, un autre qu'on exerce au feu, en tirant contre lui un coup de pistolet, et un troisifeme qui rue, sont frappans et bien finis. Le paysage est agreable et diversifie. Le massif d'arbres qui est sur le devant est tres bien feuille. En general, les grouppes sont pleins d'action; et la nature est rendue, dans une foule de scfenes variees, avec autant de v£rit£ que de grace. I Mat.: auf Leinwand Maße: Haut de 3 pieds; large de 4 pieds 6 pouces Verkäufer: Merian l'aine Transakt.: Unbekannt (35) 1800/07/09 HBPAK 0067 Bruhandet; Sueback I Les bords d'un Etang dans un Jardin. De grands arbres dominent a l'entour. Sur le devant sont des Cavaliers et une Dame. Les figures finement touchees sont de Sueback desfontaines. Sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: 13 pouces de hauteur. Sur 10 pouces de largeur Transakt.: Unbekannt
Bruckner 1775/02/13 FRAN 0096 Bruckner I Ein Waldteufel mit einem Trauben in den Klauen. I Maße: Höhe 9 % Zoll. Breite 10 % Zoll Verkäufer: von der Lahr Transakt.: Unbekannt
1767/00/00 KOAN 0084 Breugel der alte I Ein Bauren Kirmes in einer Landschaft, auf Holtz voll von Figuren von Breugel dem alten. I Mat.: auf Holz Maße: Breite 2 Fuß Vi Zoll, Höhe 1 Fuß 7 % Zoll Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt 1773/12/18 HBBOY 0022 der alte Brägel I Ein Schlachtfeld, wo die Todt[e]n ausgezogen werden. Vom alten Brögel. I Transakt.: Unbekannt 1773/12/18 HBBOY 0084 der alte Brögell I Ein Winter=Stück mit vielen Figuren. Vom alten Brögell. I Transakt.: Unbekannt 1774/10/05 HBNEU 0037 der alte Brögel I Ein Turnir=Spiel, auf Kupfer gemahlt, von dem alten Brögel. I Mat.: auf Kupfer Transakt.: Unbekannt 1775/04/12 HBNEU 0004 der Bauern Breugel I Eine Bauern= Hochzeit, wo im Vorgrunde einige Bauern tanzen, aufs fleißigste gemahlt, und mit vielem Affect, auf Holz, von dem Bauern Breugel. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt 1775/04/12 HBNEU 0024 der Bauern Breugel I Ein inwendiges Bauern=Haus, fleißig gemahlt, auf Holz, von dem Bauern Breugel. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt 1775/05/08 HBPLK 0019 Bauern [Breugel] I Tanzende Bauern, auf Holz, von dem Bauern [Breugel]. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 12 Zoll 2 Linie, Breite 17 Zoll 1 Linie Anm.: Dieses Los wurde zusammen mit der Nr. 20 (C. Willaerts) verkauft. Transakt.: Unbekannt (8 [?] Μ für die Nrn. 19 und 20) 1776/04/15 HBBMN 0095 der alte Brögel I Eine Landschaft mit einer Bauren=Kirmes, sehr fleißig gemahlt, vom alten Brögel. I Maße: Höhe 1 Fuß 1 Vi Zoll, Breite 1 Fuß 9 Vi Zoll Transakt.: Unverkauft 1776/04/15 HBBMN 0166 Pet. Brögel, der Alte I Zwölf Monate, ungemein fleißig ausgeführt, von Pet. Brögel, den Alten. I Diese Nr.: Ein Monat Maße: Höhe 5 Vi Zoll, Breite 5 Vi Zoll Anm.: Die Lose 166 bis 177 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (32.8 Μ für die Nrn. 166-177) Käufer: Auct Köst[er] 1776/04/15 HBBMN 0167 Pet. Brögel, der Alte I Zwölf Monate, ungemein fleißig ausgeführt, von Pet. Brögel, den Alten. I GEMÄLDE
393
Diese Nr.: Ein Monat Maße: Höhe 5 Vi Zoll, Breite 5 Vi Zoll Anm.: Die Lose 166 bis 177 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (32.8 Μ für die Nrn. 166-177) Käufer: Auct Köst[er] 1776/04/15 HBBMN 0168 Pet. Brägel, der Al fei Zwölf Monate, ungemein fleißig ausgeführt, von Pet. Brögel, den Alten. I Diese Nr.: Ein Monat Maße: Höhe 5 Vi Zoll, Breite 5 Vi Zoll Anm.: Die Lose 166 bis 177 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (32.8 Μ für die Nm. 166-177) Käufer: Auct Köst[er] 1776/04/15 HBBMN 0169 Pet. Brögel, der Alte I Zwölf Monate, ungemein fleißig ausgeführt, von Pet. Brögel, den Alten. I Diese Nr.: Ein Monat Maße: Höhe 5 Vi Zoll, Breite 5 Vi Zoll Anm.: Die Lose 166 bis 177 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (32.8 Μ für die Nrn. 166-177) Käufer: Auct Köst[er] 1776/04/15 HBBMN 0170 Pet. Brögel, der Alte I Zwölf Monate, ungemein fleißig ausgeführt, von Pet. Brögel, den Alten. I Diese Nr.: Ein Monat Maße: Höhe 5 Vi Zoll, Breite 5 Vi Zoll Anm.: Die Lose 166 bis 177 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (32.8 Μ für die Nrn. 166-177) Käufer: Auct Köst[er] 1776/04/15 HBBMN 0171 Pet. Brögel, der Alte I Zwölf Monate, ungemein fleißig ausgeführt, von Pet. Brögel, den Alten. I Diese Nr.: Ein Monat Maße: Höhe 5 V2 Zoll, Breite 5 Vi Zoll Anm.: Die Lose 166 bis 177 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (32.8 Μ für die Nrn. 166-177) Käufer: Auct Köst[er] 1776/04/15 HBBMN 0172 Pet. Brögel, der Alte I Zwölf Monate, ungemein fleißig ausgeführt, von Pet. Brögel, den Alten. I Diese Nr.: Ein Monat Maße: Höhe 5 Vi Zoll, Breite 5 Vi Zoll Anm.: Die Lose 166 bis 177 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (32.8 Μ für die Nrn. 166-177) Käufer: Auct Köst[er] 1776/04/15 HBBMN 0173 Pet. Brögel, der Alte I Zwölf Monate, ungemein fleißig ausgeführt, von Pet. Brögel, den Alten. I Diese Nr.: Ein Monat Maße: Höhe 5 Vi Zoll, Breite 5 Vi Zoll Anm.: Die Lose 166 bis 177 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (32.8 Μ für die Nrn. 166-177) Käufer: Auct Köst[er] 1776/04/15 HBBMN 0174 Pet. Brögel, der Alte I Zwölf Monate, ungemein fleißig ausgeführt, von Pet. Brögel, den Alten. I Diese Nr.: Ein Monat Maße: Höhe 5 Vi Zoll, Breite 5 Vi Zoll Anm.: Die Lose 166 bis 177 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (32.8 Μ für die Nrn. 166-177) Käufer: Auct Köst[er] 1776/04/15 HBBMN 0175 Pet. Brögel, der Alte I Zwölf Monate, ungemein fleißig ausgeführt, von Pet. Brögel, den Alten. I Diese Nr.: Ein Monat Maße: Höhe 5 Vi Zoll, Breite 5 Vi Zoll Anm.: Die Lose 166 bis 177 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (32.8 Μ für die Nrn. 166-177) Käufer: Auct Köst[er] 1776/04/15 HBBMN 0176 Pet. Brögel, der Alte I Zwölf Monate, ungemein fleißig ausgeführt, von Pet. Brögel, den Alten. I Diese Nr.: Ein Monat Maße: Höhe 5 Vi Zoll, Breite 5 Vi Zoll Anm.: Die Lose 166 bis 177 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (32.8 Μ für die Nrn. 166-177) Käufer: Auct Köst[er] 1776/04/15 HBBMN 0177 Pet. Brögel, der Alte I Zwölf Monate, ungemein fleißig ausgeführt, von Pet. Brögel, den Alten. I Diese Nr.: Ein Monat Maße: Höhe 5 Vi Zoll, Breite 5 Vi Zoll Anm.: Die Lose 166 bis 177 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (32.8 Μ für die Nrn. 166-177) Käufer: Auct Köst[er] 1777/05/26 FRAN 0109 Bauren Brögel I Ehrent: v. Bauren Brögel. I Verkäufer: Finsterwalder Transakt.: Verkauft (6.20 fl) Käufer: Rath Eichhorn 1778/05/16 HBBMN 0081 der alte Brögel I Ein Blumen=Stück, vom alten Brögel. I Transakt.: Unbekannt 1778/05/23 HBKOS 0057 der alte Breugel I Eine extra fleißige Landschaft mit lustigen Bauern, auf H.folz] von der besten Zeit des alten [Breugel]. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 11 Vi Zoll, Breite 17 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt (30 M) 394
GEMÄLDE
1778/10/30 HBKOS 0007 der alte Breugel I Ein Mannskopf und eine alte Frau, lebhaft und mit großem Affect gemahlt, auf Holz, von dem alten Breugel. I Diese Nr.: Ein Mannskopf Mat.: auf Holz Maße: hoch 8 Zoll, breit 5 Vi Zoll Anm.: Die Lose 7 und 8 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/10/30 HBKOS 0008 der alte Breugel I Ein Mannskopf und eine alte Frau, lebhaft und mit großem Affect gemahlt, auf Holz, von dem alten Breugel. I Diese Nr.: Eine alte Frau Mat.: auf Holz Maße: hoch 8 Zoll, breit 5 Vi Zoll Anm. : Die Lose 7 und 8 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1779/09/27 FRNGL 0502 Bauern Breughell I Eine Landschaft, worinnen Strassenräuber einen Reisewagen angreifen, vom Bauern Breughell. [Un paysage representant des voleurs de grand chemin qui attaquent un coche, par Breughell le paysan.] I Pendant zu Nr. 503 Maße: 2 Schuh 3 Zoll hoch, 3 Schuh 8 Zoll breit Transakt.: Verkauft (9.30 fl für die Nrn. 502 und 503) Käufer: Rath Ehrenreich 1779/09/27 FRNGL 0503 Bauern Breughell I Das Gegenbild zu obigem, einen Marktplatz vorstellend, von nemlicher Hand [vom Bauern Breughell] und Größe. [Le pendant du precedant, un marche, par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 502 Maße: 2 Schuh 3 Zoll hoch, 3 Schuh 8 Zoll breit Transakt.: Verkauft (9.30 fl für die Nrn. 502 und 503) Käufer: Rath Ehrenreich 1779/09/27 FRNGL 0669 der Bauern Breughell I Eine Winterlandschaft mit vielen Figuren, vom Bauern Breughell. [Un paysage avec beaueoup de figures, saison d'hiver, par Breughell dit le paysan.] I Maße: 1 Schuh Vi Zoll hoch, 1 Schuh 8 Zoll breit Transakt.: Verkauft (11.30 fl) Käufer: Hüsgen 1782/03/18 HBTEX 0200 Bauern Breugel I Zwey Dorfgegenden mit Landleuten, fleißig gemahlt, auf Holz. I Diese Nr.: Eine Dorfgegend mit Landleuten, fleißig gemahlt, auf Holz Mat.: auf Holz Maße: Höhe 14 Zoll 6 Linien, Breite 17 Zoll 3 Linien Anm.: Die Lose 200 und 201 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0201 Bauern Breugel I Zwey Dorfgegenden mit Landleuten, fleißig gemahlt, auf Holz. I Diese Nr.: Eine Dorfgegend mit Landleuten, fleißig gemahlt, auf Holz Mat.: auf Holz Maße: Höhe 14 Zoll 6 Linien, Breite 17 Zoll 3 Linien Anm.: Die Lose 200 und 201 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0229 Vom alten Breugel I In einer Küche beschäftigen sich Frauenspersonen mit Zubereitung verschiedener Eßwaaren; zur Linken in der Entfernung ist die Historie von Christus, mit denen beyden Jüngem zu Emaus am Tische sitzend vorgestellt, lebhaft gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 21 Zoll 6 Linien, Breite 29 Zoll 6 Linien Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/07/00 FRAN 0065 Bauern Breughel I Zwey runde in viereckigten Rahmen eingefaßte Gesellschaftsstücke vom Bauern Breughel. I Diese Nr.: Ein Gesellschaftsstück Format: rund Maße: 8 Zoll hoch, 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 65 und 66 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] fl für die Nrn. 65 und 66) 1782/07/00 FRAN 0066 Bauern Breughel I Zwey runde in viereckigten Rahmen eingefaßte Gesellschaftsstücke vom Bauern Breughel. I Diese Nr.: Ein Gesellschaftsstück Format: rund Maße: 8 Zoll hoch, 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 65 und 66 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] fl für die Nrn. 65 und 66) 1784/05/11 HBKOS 0058 B. Breugel I Eine historische Landschaft, von B. Breugel, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 7 Zoll 6 1., breit 10 Zoll 6 1. Transakt.: Verkauft (2 M) Käufer: Feindt 1784/08/02 FRNGL 0194 Bauern Breughel I Eine Winter Landschaft vom Bauern Breughel. I Maße: 27 Vi Zoll breit, 17 Zoll hoch
Verkäufer: Β Transakt.: Verkauft (4 fl) Käufer: Pr von Dessau Gegeriw. Standort: Dessau, Deutschland. Anhaltische Gemäldegalerie. (381) als Art des Jan Brueghel
Figuren Mat.: auf Holz Anm.: Die Lose 5 und 6 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (6.4 Μ für die Nrn. 5 und 6) Käufer: von Axen
1785/05/17 MZAN 0368 Bauer=Breughel I Ein Hinkender der von einem Blinden geführet wird, vom sogenannten Bauer=Breughel. [Un boiteux conduit par un aveugle par Breughel le paysan.] I Maße: 9 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 1 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (4.30 fl) Käufer: Zitz
1787/04/03 HBHEG 0026 der alte Breugel I Ein Bauren=Gelag, vom alten Breugel, auf Holz. I Mat.: auf Holz Transakt.: Verkauft (1 Sch) Käufer: Ort
1785/05/17 MZAN 0493 Bauerbreughel I Ein Bauemkirchweihfest vom sogenannten Bauerbreughel. [Une fete de village.] I Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 2 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (25.30 fl) Käufer: Strecker 1785/05/17 MZAN 0572 Bauerbreughel I Die Kreuzschleifung Christi vom sogenannten Bauerbreughel. [Jesus Christ trainant la Croix.] I Maße: 2 Schuh 8 Zoll hoch, 4 Schuh breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (13.50 fl) Käufer: Geistl R Hodedorff [?] 1785/05/17 MZAN 0802 Bauerbreughel I Eine niederländische Pfingstfestfeyer vom Bauerbreughel. [La fete de la pentecöte celebree ä la maniere flamande.] I Maße: 1 Schuh 7 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 5 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (50 fl) Käufer: Strecker 1786/10/18 HBTEX 0106 Bauern Breugel I Holländische Land=Gegenden mit Reisenden zu Pferde und zu Fuß, wie auch einige Land=Leute. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Holländische Land= Gegend mit Reisenden zu Pferde und zu Fuß, wie auch einige Land=Leute Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Zoll 3 Linien, breit 10 Zoll 7 Linien Anm.: Die Lose 106 und 107 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/10/18 HBTEX 0107 Bauern Breugel I Holländische Land=Gegenden mit Reisenden zu Pferde und zu Fuß, wie auch einige Land=Leute. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Holländische Land= Gegend mit Reisenden zu Pferde und zu Fuß, wie auch einige Land=Leute Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Zoll 3 Linien, breit 10 Zoll 7 Linien Anm..· Die Lose 106 und 107 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/10/18 HBTEX 0182 Bauern Breugel I Eine Holländische Kirmis mit Männer, Frauen und Kinder, welche Zechen und tanzen, naiv vorgestellet. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll 6 Linien, breit 14 Zoll 3 Linien Transakt.: Unbekannt 1787/00/00 HB AN 0091 Vom alten Brägel I Ein Gefecht zwischen geharrnischten Cavalleristen. Bey Winterzeit. In der F e m e wird man eine Stadt gewahr. Ueberaus fleißig gemahlt. Auf Kupfer, s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 5 Zoll, breit 7 % Zoll Transakt.: Verkauft (7 M) Käufer: Bertheau 1787/00/00 HB AN 0395 Vom Bauren Brägel I Eine zahlreiche Gesellschaft an einem mit Essen und Trinken besetzten Tische. Im Hintergrunde mehrere Personen. A.H. [Auf Holz] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Zoll, breit 16 Zoll Transakt.: Verkauft (11.12 M) Käufer: Mathees 1787/04/03 HBHEG 0005 der alte Breugel I Zwey bergigte Gegenden mit Flüssen und Holzungen, und vielen darauf befindlichen Figuren, von dem alten Breugel, auf Holz. I Diese Nr.: Eine bergigte Gegend mit Flüssen und Holzungen, und vielen darauf befindlichen Figuren Mat.: auf Holz Anm.: Die Lose 5 und 6 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (6.4 Μ für die Nrn. 5 und 6) Käufer: von Axen 1787/04/03 HBHEG 0006 der alte Breugel I Zwey bergigte Gegenden mit Flüssen und Holzungen, und vielen darauf befindlichen Figuren, von dem alten Breugel, auf Holz. I Diese Nr.: Eine bergigte Gegend mit Flüssen und Holzungen, und vielen darauf befindlichen
1788/09/01 KOAN 0006 alter Breugel I Johann in der Wüste predigt, von alten Breugel. [1 p[iece]. St. Jean prechant aut [sic] desert du vieux Breugel.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Fuß 4 Zoll, Breite 3 Fuß 2 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1789/00/00 MMAN 0287 Peter Bruegel dem ältem I Ein Landschäftchen, auf Holz. [Un petit paysage, sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 11 Zoll hoch, 1 Fuß 3 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (1 fl) 1790/01/07 MUAN 0381 Breugel Peter Sen. I Z w o Landschaften mit Figuren, und Thieren, auf Holz, in geschnittenen und metallisirten Ramen. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren, und Thieren Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 6 Zoll, Breite 2 Schuh 3 Zoll Anm.: Die Lose 381 und 382 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0382 Breugel Peter Sen. I Zwo Landschaften mit Figuren, und Thieren, auf Holz, in geschnittenen und metallisirten Ramen. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren, und Thieren Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 6 Zoll, Breite 2 Schuh 3 Zoll Anm.: Die Lose 381 und 382 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/02/04 HBDKR 0085 Vom alten Breugel I Die bekannte Geschichte des verlorenen Sohns, wie er lustig lebt, und auch in seinem Elende lebet, sehr fein gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Zoll, breit 22 Zoll Transakt.: Verkauft (1 M ) Käufer: Ego 1790/04/13 HBLIE 0138 Von dem alten Breugel I Wie der verlohme Sohn schwelget; sehr lebhaft vorgestellet, und schön gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 14 Vi Zoll, breit 22 Zoll Transakt.: Verkauft (1.8 M) Käufer: Bostelmann 1790/08/25 FRAN 0196 Bauern Breugel I Ein Advocat bey dem die Bauern klagen und Geschenke bringen, von Bauern Breugel. I Maße: hoch 31 Zoll, breit 51 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (5 fl) Käufer: Kaller 1791/01/05 HBBMN 0297 der alte Broegel I Eine historische Landschaft mit Waldung Vieh und Figuren; sehr schön gemahlt vom alten Broegel. Auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 41 Zoll, breit 53 Zoll Transakt.: Verkauft (2 M) Käufer: Ulrich 1791 /05/30 FRAN 0100 Bauren Broegel I Ein blinder Leyermann, so von einem Hunde geleitet wird, nebst vielen Figuren. I Maße: 1 Schuh 6 Zoll hoch und 2 Schuh 2 Zoll breit Verkäufer: Bansa Transakt.: Verkauft (13) Käufer: M r Kämpf 1791/07/29 HBBMN 0130 Von dem alten Breugel I Ein alter Landmann hält eine Ente in den Armen, zu dessen Compagnon eine Frau welche Garn haspelt, sehr lebhaft nach der Natur gemahlt; auf dito [Holz], I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 14 Vi Zoll, breit 11 lÄ Zoll Transakt.: Verkauft (2.8 M) Käufer: Ε 1791/09/26 FRAN 0125 Bauern Breugel Sen. I Ein Pferdemarkt nach altem Schrot und Korn, von Bauern Breugel Sen. I Maße: 3 Sch. 3 Zoll breit, 18 Zoll hoch Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0141 Bauern Broeugel I Der Bethlehemische Kindermord in Vorstellung eines holländischen Dorfs im Winter, mit Action ausgeführt vom Bauern Broeugel. I Maße: 30 Zoll hoch, 44 Zoll breit Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
395
1791/09/26 FRAN 0209 Bauern Broeugel I Eine fleißig und wohlausgeführte Dorfkirchweyh, vom Bauern Broeugel. I Maße: 10 Zoll hoch, 10 Zoll breit Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1793/09/18
HBSCN
0018
Bauren-Breugel
I Die fünf Sinne im
rundem Format; jede 6 Vi Zoll im Durchschnitt, mit vieler Laune vorgestellet. I Mat.: auf Holz Format: rund Maße: Hoch 19 Vi Zoll, breit 20 Zoll Transakt.: Unbekannt 1794/09/09 HBPAK 0046 Bauren Breugel I Ein lustiger Fastnachtschmaus, mit unannehmlichen Vorfällen untermischt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 32 Zoll, breit 44 Zoll Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HB GOV [A]0039 der alte Breugel I Eine alte Frau mit übergehangenen Schleier hält ein Gläsgen rothen Wein mit beyden Händen. Vom alten Breugel. Sehr fleißig gemahlt. Ovalen Formats. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Format: oval Maße: Hoch 6 Vi Zoll, breit 5 Zoll Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV 0075 Vom alten Breugel I Durch ein Holzung gehet die Landstraße, auf welcher sich Reisende zu Wagen und zu Fuß befinden; zur Linken sitzet eine Bauer=Frau und verkauft Garten=Früchte. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 55 Zoll Transakt.: Unbekannt
1800/00/00 FRAN2 0112 Breughel (genannt der Alte) I Zwey Landschaften, wovon eine die Plünderung eines Dorfes, die andere ein Scharmüzel vorstellt. Diese Stücke sind mit lebhaften Farben recht brav gemahlt. I Diese Nr.: Eine Landschaft, die Plünderung eines Dorfes vorstellend Mat.: auf Kupfer Maße: 15 Zoll hoch, 23 Zoll breit Anm.: Die Lose 112 und 113 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN2 0113 Breughel (genannt der Alte) I Zwey Landschaften, wovon eine die Plünderung eines Dorfes, die andere ein Scharmüzel vorstellt. Diese Stücke sind mit lebhaften Farben recht brav gemahlt. I Diese Nr.: Eine Landschaft, ein Scharmüzel vorstellend Mat.: auf Kupfer Maße: 15 Zoll hoch, 23 Zoll breit Anm.: Die Lose 112 und 113 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Brueghel 1777/05/26 FRAN 0141 Mandus Brögel I Bauren=Kirch= Weyh. I Verkäufer: Finsterwalder Transakt.: Verkauft (12.30 fl) Käufer: Morgenstern
Brueghel, Abraham (Ryngraaf)
1797/06/13 HBPAK 0057 Bauren Brögel I Eine gebürgigte Land= und Wassergegend, mit Städten und Schlösser. In der Entfernung ist die Geschichte der Abigael vorgestellet. Ein schön Gemählde. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Zoll, breit 24 Zoll Transakt.: Unbekannt
1768/07/00 MUAN 0961 Breughel (Abraham) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
1798/08/10 HBPAK 0008 Von dem alten Brögel I Ein Dorfflekken. Eine Kirchmeß vorstellend. Auf einem grossen Marktplatz, wo aus allen Gegenden Herrschaften und Bauern angekommen, wo Eß= und andere Waaren verkauft werden, und wo sie sich mit Tanzen belustigen. Auf das kräftigste gemahlt. Auf Holz, im schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 21 Zoll, breit 27 Zoll Transakt.: Unbekannt
1768/07/00 MUAN 0962 Breughel (Abraham) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
1799/00/00 LZRCH 0059 Breughel, le vieux I Une assemblee de paysans, on y distingue 18 figures d'un beau caractere; ce tableau est d'une belle conservation. I Mat.: auf Holz Maße: h. 16.1. 22. pouces Verkäufer: J F Rauch Transakt.: Unbekannt 1799/08/09 HBPAK 0039 Von den [sie] alten Breughel] Eine Hexenmeisterkunst, wobey man zwey Damen siehet, welche sich auskleiden, um die Kunst zu lernen, daneben stehet eine Tafel, worauf die dazu brauchenden Geräthe liegen, auf der Seite, wo ein Licht brennt, siehet man den Teufel binden, und sonst verschiedene Kunststücke. Auf Holz, goldn. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 22 Zoll, breit 28 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0080 Der alte Brögel I Eine Land= und Dorfgegend mit vielen Figuren, die sich mit Tanzen belustigen. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 25 Zoll, breit 30 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0115 Der alte Brögel I Zwey Winters Landschaften mit vielen Figuren, die sich aufm Eise belustigen. Auf Holz. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine Winter=Landschaft mit vielen Figuren, die sich aufm Eise belustigen Mat.: auf Holz Maße: Hoch 21 Zoll, breit 28 Zoll Anm.: Die Lose 115 und 116 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0116 Der alte Brögel I Zwey Winter= Landschaften mit vielen Figuren, die sich aufm Eise belustigen. Auf Holz. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine Winter=Landschaft mit vielen Figuren, die sich aufm Eise belustigen Mat.: auf Holz Maße: Hoch 21 Zoll, breit 28 Zoll Anm.: Die Lose 115 und 116 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/12/23 WNAN 0061 Transakt.: Unbekannt 396
GEMÄLDE
Breugel le vieux I Trois payssages. I
1769/00/00 MUAN 0049 Abraham Breüghel I Deux tableaux en fruits. Peints sur toile marques des N o s 961 & 962. I Diese Nr.: Un tableau en fruits Mat.: auf Leinwand Maße: 2. p. 3. p. de haut sur 3. pieds de large Anm.: Die Lose 49 und 50 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0050 Abraham Breüghel I Deux tableaux en fruits. Peints sur toile marquis des N o s 961 & 962. I Diese Nr.: Un tableau en fruits Mat.: auf Leinwand Maße: 2. p. 3. p. de haut sur 3. pieds de large Anm.: Die Lose 49 und 50 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francis Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1790/08/25 FRAN 0290 Abraham von Brughel I Ein kleines Früchtenstück. I Maße: hoch 23 Zoll, breit 18 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (2 fl) Käufer: Kaller 1797/04/20 HBPAK 0010 Abraham Breugel I Die Flucht nach Egypten; Joseph, mit Maria und dem Kinde Jesu, auf dem Esel sitzend. Die Landschaft ist mit einer Guirlande, von drey kostbaren Blumen=Bouqets umgeben. Ganz Natur, mit vielem Fleiß ausgearbeitet. Auf Holz, mit vergoldeten Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 23 Zoll, breit 14 Zoll Transakt.: Unbekannt
Brueghel, Abraham (Ryngraaf) (und Thulden) 1776/00/00 WZTRU 0101 Abraham Brüghel; Theodor van Dulden I Ein Stück zu Nro. 77, 3 Schuhe hoch, 2 Schuhe, 1 Zoll breit, von Abraham Brüghel verfertiget, worauf sich ein Kranz mit Blummen und Früchten befindet, welches alles treflich nach der Natur ausgedrucket, in der Mitte des Umhangs der Früchten und Blumen hat Theodor von Dülden eine Königinn mit einem Lorberzweige hierinn verfertiget, welches mit des Briighels Manier eine gute Verständniß hat, worinnen die Colorit sehr warm und angenehm ge-
halten ist. I Pendant zu Nr. 77 von D. Seghers Maße: 3 Schuhe hoch, 2 Schuhe 1 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (30 fl Schätzung) 1781/00/00 WZAN 0101 Abraham Brüghel; Theodor van Dulden I Ein Stück zu Nro 77, 3 Schuhe hoch, 2 Schuhe, 1 Zoll breit ist von Abraham Brüghel verfertiget. Hierauf befindet sich ein Kranz mit Blummen und Früchten, welches alles treflich nach der Natur ausgedrucket ist; in der Mitte des Umhangs der Früchte und Blumen hat Theodor von Dülden eine Königinn mit einem Lorberzweige verfertiget, welches mit des Brüghels Manier eine gute Verständniß hat, worinn die Kolorit sehr warm und angenehm gehalten ist. I Pendant zu Nr. 77 von D. Seghers Maße: 3 Schuhe hoch, 2 Schuhe 1 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Brueghel, Jan (der Ältere) 1670/04/21 WNHTG 0073 Lavecio Breugel I Un dissegno sopra un legno con sette figure. I Maße: Alto un palmo, largo uno e mezzo Anm.: Es ist nicht sicher, ob es sich um ein Gemälde oder eine Zeichnung handelt. Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt 1670/04/21 WNHTG 0074 Lavecio Breugel I Due Historie in rotondo. I Format: rund Maße: Larghe undici dita Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt 1670/04/21 WNHTG 0075 Lavecio Breugel I Due altre simili [Historie in rotondo]. I Format: rund Maße: Larghe undici dita Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt 1670/04/21 WNHTG 0076 Lavecio Breugel I Un ballo di nove persone. I Maße: Alto un palmo, due dita, largo uno, e otto Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt 1670/04/21 WNHTG 0077 Lavecio Breugel I Due Matti, uno cova l'ova, e l'altro Ii maturisce. I Maße: Alto un palmo, e mezzo, largo due Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt 1670/04/21 WNHTG 0103 Breugel I Due Matti sotto una scuffia del Breugel. I Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt 1670/04/21 WNHTG 0149 Breughel I Due piccioli pezzi del Breughel. I Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt 1716/00/00 FRHDR 0002 Pregel I Von Pregel ein dito [Winterstuk], I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (90) 1716/00/00 FRHDR 0074 Pregel I Von Pregel 4. ouale Cabinets stuck. I Format: oval Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (108)
1723/00/00 PRAN [A]0056 Breugel I Blumen=Krug / vom Breugel. Compagnion No [A]66 I Pendant zu Nr. [A]66 Maße: Höhe 2 Schuh 5 Zoll, Breite 1 Vi Schuh 3 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN [A]0066 Breugel I Blumen=Krug / vom Breugel. Compagnion No [A]56. I Pendant zu Nr. [A]56 Maße: Höhe 2 Schuh 5 Zoll, Breite 1 Vi Schuh 3 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN [A]0072 Breugel I Landschafft / vom Breugel. I Pendant zu Nr. [A]73 von Jos. Lesquier Maße: Höhe 1 Vi Schuh 2 Zoll, Breite 2 Schuh 2 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN [A]0114 Breugel I Blumen=Stuck / vom Breugel. I Pendant zu Nr. [A]l 16 Maße: Höhe 3 Schuh 3 Zoll, Breite 2 Schuh 3 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN [A]0116 Breugel I Blumen=Krug / vom Breugel. Compagnion / No [A] 114.1 Pendant zu Nr. [A] 114 Maße:
Höhe 3 Schuh 3 Zoll, Breite 2 Schuh 3 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN [B]0004 Breugel I Landschafft / vom Breugel. Compag. No [B]37. I Pendant zu Nr. [B]37 von J. Momper (II) Maße: Höhe 1 Schuh 5 Zoll, Breite 2 Schuh 2 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN [B]0008 Breugel 1 Landschafft / vom Breugel. Compagnion No [B]33. I Pendant zu Nr. [B]33 von Jos. Lesquier Maße: Höhe 1 Schuh 2 Vi Zoll, Breite 1 Vi Schuh 5 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN [B]0038 Breugel I Blumenstuck / vom Breugel. I Maße: Höhe 2 Vi Schuh 5 Zoll, Breite 2 Schuh 1 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN 0017 Breugel I Flucht in Egypten / vom Breügel / in vergulter Rahm. I Maße: Höhe 1 Schuh 4 Zoll, Breite 2 Schuh Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN 0133 Breugel I Das Paradyß vom Breugel / in weisser Rahm. I Maße: Höhe 1 Vi Schuh 3 Vi Zoll, Breite 2 Vi Schuh 2 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN 0134 Breugel I Ein anders Paradeyß / vom Breugel / in Metalliner Rahm. I Maße: Höhe 1 Vi Schuh 3 Vi Zoll, Breite 2 Vi Schuh 2 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN 0135 Breugel I Die Erden vom Breugel / in Metalliner Rahm. I Maße: Höhe 1 Vi Schuh 3 Vi Zoll, Breite 2 Vi Schuh 2 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1725/01/24 BOAN [0009] Breugel de Velleurs I Unterschiedliche Cabinets stuck von Breugel de Velleurs. Van der Mer. Peter Castiels. Choward Hulsman und anderen mehr Original und Copeyen nach denen ersten Meisteren. I Diese Nr.: Ein Cabinets stuck von Breugel de Velleurs Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Joseph Clemens Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0103 Brugel de Velour I Zwey Landschafften. Original vom Brugel de Velour. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0247 der Junge Broegel I Eine Landschafft mit einer ovidischen Historie. Original vom Jungen Broegel. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0029 Brugel de velours I Un Paisage de Brugel de velours. [Een Landschap door den Fluweelen Breugel.] I Maße: Haut 6. p. 6. pou. & demi, large 9. pou. [h. 1 v. 6 d., br. 9 d.] Anm.: Die Dimensionen, die bei Hoet angegeben sind, unterscheiden sich von denen des Katalogs. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt (118) 1742/08/30 BOAN 0030 Brugel de velours I Un Päisage avec Figures, par le meme [Brugel de velours]. [Een Landschap door denzelve [Fluweelen Breugel].] I Maße: Haut 10. pou. large un p. & un pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt (165) 1742/08/30 BOAN 0241 Bruegel le jeune I Fable d'Ovide, avec Paisage, par Bruegel le jeune. I Maße: Haut 10. pou. large 1. pied 2. pouc. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0052 Johann Breugel I Eine Landschaft von Johann Breugel, seiner ersten Manier. I Maße: hoch 1 Fuß 5 Zoll, breit 1 Fuß 11 Zoll Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0060 Johann Breugel I Eine Landschaft von Johann Breugel, ersten Manier. I Maße: hoch 2 Fuß 2 Zoll, breit 1 Fuß 8 Zoll Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
397
1744/05/20 FRAN 0216 Breugel I 1 Extra feiner See=Haaven. I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 6 Zoll, Breite 7 Zoll Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0045 Breugel de Velours I Une fete de Paisans, dans un Paisage, avec figures, sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: Largeur 1 Pies 4 Pouces, Haut 10 % Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0046 Breugel de Velours I Une foret, bien conserve, & d'un grand gout, sur bois, par le meme [Breugel de Velours]. I Pendant zu Nr. 47 Mat.: auf Holz Maße: Largeur 1 Pies 7 V2 Pouces, Haut 1 Pies V3 Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0047 Breugel de Velours I Son Pendant, avec plusieurs figures, du meme [Breugel de Velours]. I Pendant zu Nr. 46, "Une foret" Mat.: auf Holz Maße: Largeur 1 Pies 7 V4 Pouces, Haut 1 Pies Vi Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0048 Breugel de Velours I S. Martin, dans une plaine, avec plusieurs figures, bien execute, en rond, par le meme [Breugel de Velours]. I Format: rund Maße: Largeur 1 Pies, Haut 1 Pies Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0089 Breugel de Velours I Une foret avec de belles figures, sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: Largeur 3 Pies 1 Vi Pouces, Haut 2 Pies 4 Vi Pouce Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0090 Breugel de Velours I Un Paisage, travaille avec beaucoup de soin, avec de tres belles figures, sur cuivre, par le meme [Breugel de Velours]. I Mat.: auf Kupfer Maße: Largeur 1 Pies 2 Pouces, Haut 9 V2 Pouce Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0109 Breugel de Velours I Une piece ä Fleurs, sur bois, egallement bien conservee, & des plus belles de Breugel de Velours. I Mat.: auf Holz Maße: Largeur 1 Pies 8 Pouces, Haut 2 Pies 3 V3 Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1750/04/00 HB AN 0001 Brägel I Zwey extra rare Landschaften auf Kupfer in vergüldeten Rahmen, von Brägel. I Diese Nr.: Eine extra rare Landschaft Mat.: auf Kupfer Anm.: Die Lose 1 und 2 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1750/04/00 HB AN 0002 Brügel I Zwey extra rare Landschaften auf Kupfer in vergüldeten Rahmen, von Brügel. I Diese Nr.: Eine extra rare Landschaft Mat.: auf Kupfer Anm.; Die Lose 1 und 2 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1750/04/00 HB AN 0014 Brügel I Eine kleine und sehr ausführliche Landschaft, von Brügel. I Transakt.: Unbekannt 1752/00/00 NGWOL 0005 Joh. Brägel I Vier runde Landschaften. Quattro paesi tondi. I Diese Nr.: Eine runde Landschaft Format: rund Anm.: Die Lose 5 bis 8 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (80 Th für die Nrn. 5-8) 1752/00/00 NGWOL 0006 Joh. Brägel I Vier runde Landschaften. Quattro paesi tondi. I Diese Nr.: Eine runde Landschaft Format: rund Anm.: Die Lose 5 bis 8 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (80 Th für die Nm. 5-8) 1752/00/00 NGWOL 0007 Joh. Brägel I Vier runde Landschaften. Quattro paesi tondi. I Diese Nr.: Eine runde Landschaft Format: rund Anm.: Die Lose 5 bis 8 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (80 Th für die Nrn. 5-8) 1752/00/00 NGWOL 0008 Joh. Brägel I Vier runde Landschaften. Quattro paesi tondi. I Diese Nr.: Eine runde Landschaft Format: rund Anm.: Die Lose 5 bis 8 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (80 Th für die Nrn. 5-8) 398
GEMÄLDE
1752/05/08 LZAN 0114 Bregeln I Eine Landschaft, wie die Engel die Marie und Christkind speisen, von Bregeln gemahlt, 1 % Elle hoch 1 Vs Elle breit, im vergoldeten Rahmen. I Maße: 1 % Elle hoch, 1 >/s Elle breit Transakt.: Verkauft (15.12 Th) Käufer: Henewardt 1759/00/00 LZEBT 0135 Jane Breugel I Eine Landschaft auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 2 Schuh 4 Zoll, Breite 1 Schuh 9 Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (400 Th Schätzung) 1763/00/00 BLAN 0013 Johann Breugel I Eine Landschaft. Auf Holz gemahlt, 2 Fuß hoch, und 1 Fuß 3 Zoll breit. Diese Landschaft stellt sich in einer sehr weiten Aussicht dar. In der Mitte stehet man ein Schloß; und auf dem Vordergrunde sind verschiedene Stauden, Kräuter und Blumen angebracht. Breugel hat dieses Stück noch in seinen ersten Jahren verfertiget, wovon mich das viele und überflüßige Blaue im Colorite, welches sich gar zu stark hervor thut, überzeuget hat. Er hatte sich damahls hauptsächlich auf Blumen und Kräutermahlen gelegt; und war folglich in den Vorstellungen anderer Gegenstände noch nicht geübt. [Text hier gekürzt]. I Mat.: auf Holz Maße: 2 Fuß hoch, und 1 Fuß 3 Zoll breit Verkäufer: Johann Gottlieb Stein Transakt.: Unbekannt 1763/00/00 BLAN 0014 Johann Breugel I Ein Landschaft mit Figuren. Auf Holz gemahlt, 1 Fuß 3 Zoll hoch, und 1 Fuß 10 Zoll breit. Als Breugel dieses schöne Cabinetstück verfertiget hat, muß er in dem Zeitpuncte gelebet haben, in welchem seine Kunstfertigkeiten den Grad von Vollkommenheit erreichet hatten, den sie erreichen sollten: Denn hierinn finden sich alle die großen Vorzüge der Geschicklichkeit, die man diesem Meister insgemein in seiner Kunst beyleget. Die Vorstellung von diesem Gemähide ist eine Landschaft, mit einer kleine Anhöhe, worauf ein Gericht zu sehen ist, und von welcher ein, mit dreyen Pferden bespannter und verdeckter Wagen fähret. Ein Frauenzimmer ist im Begrif auszusteigen. In dem einem Winkel des Bildes sitzen neben einem kleinen Bache zwo andere Frauenzimmer, die sich mit einem stehenden Bauer, der eine Hacke auf der Schulter hat, in einer Unterredung einlassen. Auf der Anhöhe hat der Meister noch die ganze Fläche derselben ausgedruckt: Und von weiten siehet man zween andere Wagen kommen, die von der Sonne, die durch trübe Wolken scheinet, beleuchtet werden. Alles dieses macht einen bewundernswürdigen schönen Effect. Die Haltung ist in diesem Gemähide mit vielem Fleiße und großer Kunst beobachtet, wie man denn überhaubt ganz aufrichtig und von der Wahrheit der Sache selbst überzeugt, gestehen muß, daß dieses Stück würdig genug ist, das schönste und beste Cabinet zu zieren. [Text hier gekürzt] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 3 Zoll hoch, und 1 Fuß 10 Zoll breit Verkäufer: Johann Gottlieb Stein Transakt.: Unbekannt 1763/01/17 HNAN 0022 Jan Breugel I La Deesse Pomone, ä la quelle des Genies & des Satyres apportent des Fleurs & des Fruits, dans un Paysage des plus beaux, & des plus finis sur lequel sont representee quantite de fleurs & de fruits, avec un travail etonnant; par Jan Breugel, sur toile. I Pendant zu Nr. 23 Mat.: auf Leinwand Maße: Hauteur 2 pieds, Largeur 3 pieds 3 pouces Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt 1763/01/17 HNAN 0023 Jan Breugel I L'accompagnant Vulcain dans sa forge, qui travaille aux Armes d'Enee ä la Priere de Venus; par le meme. I Pendant zu Nr. 22 Mat.: auf Leinwand Maße: Hauteur 2 pieds, Largeur 3 pieds 3 pouces Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt 1763/01/19 FRJUN 0055 J. Breugel I Un tres beau & agreables paisage ome de figures, & d'une maison pres d'une riviere delicatement peint. I Maße: hauteur 8 pouces, large 12 pouces Transakt.: Unbekannt (34 fl) 1763/11/09 FRJUN 0034 I. Breugel I La vue d'une riviere avec des vaisseaux pres d'un village, orne de plusieurs figures, tres bien
peint. I Maße: hauteur 11 Vi pouces, largeur 15 Vi pouces Transakt.: Verkauft (24.30 fl) Käufer: Jacob Andrae 1763/11/09 FRJUN 0035 I. Breugel I Un port de Mer d'ltalie rempli de figures & delicatement peint. I Maße: hauteur 8 pouces, largeur 10 pouces Transakt.: Verkauft (15.45 fl) Käufer: Rath Ehrenreich
1765/03/27 FRKAL 0033 Breugel I Un hiver avec des figures sur la glace. I Maße: hauteur 5 Vi pouces, largeur 7 Vi pouces Transakt.: Verkauft (6 fl) Käufer: Ihro durchl 1765/03/27 FRKAL 0034 Breugel I Deux jolis tableaux avec des fleurs tres-bien peints. I Maße: hauteur 31 pouces, largeur 26 pouces Transakt.: Verkauft (8 fl) Käufer: Kaller
1763/11/09 FRJUN 0036 /. Breugel I La vue d'une riviere avec des bateaux rempli de figures. I Maße: hauteur 10 pouces, largeur 12 Ά pouces Transakt.: Verkauft (16.45 fl) Käufer: von der Lahr
1766/07/28 KOSTE [A]0026 Breugel I Ein Schetz auf Holtz vorstellend, eine Landschaft von Breugel. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt (6 Rt)
1764/00/00 BLAN 0023 van Brauel defolour I 2 außerlesene Cabinet stücke, auf Kupfer gemahlt. I Diese Nr.: Ein außerlesenes Cabinet stück Mat.: auf Kupfer Maße: 11 Zoll hoch, 1 Fuß 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 23 und 24 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (800 Rt für die Nrn. 23 und 24, Schätzung) Gegenw. Standort: Sankt-Peterburg, Rossiya. Ermitazh. (N 429)
1767/00/00 KOAN 0006 Breugel I Eine Waldung auf Holtz von Breugel. I Pendant zu Nr. 6a Mat.: auf Holz Maße: Breite 2 Fuß 3 Zoll, Höhe 1 Fuß 7 Zoll Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt
1764/00/00 BLAN 0024 van Brouel de folour I 2 außerlesene Cabinet stücke, auf Kupfer gemahlt. I Diese Nr.: Ein außerlesenes Cabinet stück Mat.: auf Kupfer Maße: 11 Zoll hoch, 1 Fuß 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 23 und 24 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (800 Rt für die Nm. 23 und 24, Schätzung) Gegenw. Standort: Sankt-Peterburg, Rossiya. Ermitazh. (N 3090) 1764/05/18 BOAN 0612 Fluen Prögel I Un Paisage avec des mines enrichies de figures, d'un pied trois pouces de largeur, d'onze pouc. de hauteur, representant la fuite en Egypte, peinte par Fluen Prögel. [Ein Landschaft mit zerfallenen gebäwen omirt mit figuren, Vorstellend die Muttergottes mit dem h. Joseph in Ägypten, an Einem Eck etwas beschädiget, gemahlt Von Fluenprögel.] I Maße: 1 pied 3 pouces de largeur, 11 pouc. de hauteur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (47 Rt) Käufer: Neveu 1764/05/25 BOAN 0247 Broghie de Fleur I Un Vase de Fleurs, peintes par Broghle de Fleur. [Ein stück Vorstellend Eine vase mit blumen Von Broghle de fleur.] I Maße: 1 pied 5 pouces de hauteur, 1 pied 4 pouces de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (14.30 Rt) Käufer: Broggia proprio nomine 1764/06/07 BOAN 0637 Brägel de Velour I Un Tableau de deux pieds six pouces de hauteur, d'un pied onze pouces de largeur, representant une Guirlande avec des insectes, peint par Brügel de Velour. [Ein stück Vorstellend Einen blumen Krantz mit Vielen insecten gemahlt Von Brugel de velour.] I Maße: 2 pieds 6 pouces de hauteur, 1 pied 11 pouces de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (120 Rt) Käufer: Hof C Rath Broggia 1764/08/25 FRAN 0180 Breughel I Des figures. I Maße: haut 9 pouces sur 7 pouces de large Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1764/08/25 FRAN 0373 Breughel I Les noces des paisans. I Maße: haut 1 pied 2 Vi pouces sur 1 pied 6 pouces de large Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRRAU 0160 Blumen Breugel I Ein Blumen= Krantz mit Insecten, in der Mitten an einer viereckigten Tafel JEsus, Maria und Joseph. Die edle Manier dieses Andenckens=würdigen Meisters ist Liebhabern der Kunst sattsam bekannt. Une couronne de fleurs avec des insectes, au milieu ä une table quarree Jesus, Marie & Joseph. La noble maniere de peindre de ce peintre digne de memoire est suffisamment connue aux Amateurs. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 2 Schuh 6 Zoll, breit 1 Schuh 10 Zoll Transakt.: Unbekannt 1765/03/27 FRKAL 0032 Breugel I Un petit paisage avec des figures. I Maße: hauteur 5 pouces, largeur 8 pouces Transakt.: Verkauft (11 fl) Käufer: Ihro durchl
1767/00/00 KOAN 0006a Breugel I Compagnon mit schiffen und vielen Figuren von dito [Breugel]. I Pendant zu Nr. 6 Mat.: auf Holz Maße: Breite 2 Fuß 3 Zoll, Höhe 1 Fuß 7 Zoll Anm.: Im Katalog tragen zwei Lose die Nummer 6. Diesem Los wurde deshalb zur Unterscheidung die Nummer 6a gegeben. Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt 1767/00/00 KOAN 0043 Breugel I Eine Waldung mit schönen Figuren auf Holtz von Breugel. I Mat.: auf Holz Maße: Breite 3 Fuß 10 Zoll, Höhe 3 Fuß Vi Zoll Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt 1767/00/00 KOAN 0096 Breugel I S. Martinus in einer Landschaft mit vielen Figuren auf Holtz rund von Proportion, fleissig und kostbar von Breugel. I Mat.: auf Holz Format: rund Maße: Breite 1 Fuß 10 Zoll, Höhe 1 Fuß 10 Zoll Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt 1767/00/00 KOAN 0101 Breugel I Eine sehr fleissig ausgeführte Landschaft auf Kupfer mit vielen ausbündig schönen Figuren von Breugel. I Mat.: auf Kupfer Maße: Breite 1 Fuß 11 Zoll, Höhe 1 Fuß 6 Vi Zoll Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0085 Breughel (Johannes) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0193 Breughel (Johannes) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0226 Breughel (Johannes) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0243 Breughel (Johannes) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0244 Breughel (Johannes) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0395 Breughel (Johannes) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog GEMÄLDE
399
wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0396 Breughel (Johannes) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0414 Breughel (Johannes) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0417 Breughel (Johannes) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0423 Breughel (Johannes) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0879 Breughel (Johannes) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1161 Breughel (Johannes) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0062 Breüghel I Un Paysage ou sont representee, Corah, Dathan, & Abiram, qui sont tous engloutis avec les leurs, ainsi que les 250. Israelites, qui vouloient offrir un sacrifice de feu ä Dieu, sont tous consumes par ce meme feu. Peint sur cuivre. I Mat.: auf Kupfer Maße: 9 Vi. pouces de haut sur 1. p. Vi. p. de large Verkäufer: Francis Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0063 Breüghel I Un Paysage avec de tres belles forets, il y a aussi deux Villes ainsi que plusieurs personnages. Peint sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: 1. p. 7 Vi. de haut sur 2. p. 6. p. de large Verkäufer: Francis Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0119 Breugel I Deux Pay sages avec nombre de figures, & une tres belle vüe. Peints sur bois marques des Ν os 395. & 396. I Diese Nr.: Un Paysage avec nombre de figures, & une tres belle vüe Mat.: auf Holz Maße: 1. p. 6. p. de haut sur 2. p. 3. p. de large Anm.: Die Lose 119 und 120 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0120 Breügel I Deux Paysages avec nombre de figures, & une tres belle vüe. Peints sur bois marques des Ν os 395. & 396. I Diese Nr.: Un Paysage avec nombre de figures, & une tres belle vüe Mat.: auf Holz Maße: 1. p. 6. p. de haut sur 2. p. 3. p. de large Anm.: Die Lose 119 und 120 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/03/30 HBTOU 0009 F. Breugel I Eine Landschaft von F. Breugel, wie Christus die Blinden sehend macht, ausführlich gemahlt auf Holz. [Die Mehresten in fein verguldte Rahmen, und die übrigen in schwarz gebeizten mit goldenen Staber.] I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 8 Zoll, Breite 1 Fuß Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 51 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 51. Transakt.: Verkauft (75 M) Käufer: Winckelm[ann] 400
GEMÄLDE
1772/00/00 BSFRE 0014 Breughel (Jean) sumomme de Vlour I Deux Payssages, avec beaucoup de figures, representants les quatre saisons, partages sur ces deux petits Tableaux, tres termines. Cadres [sic] d'ores, ä la grecque. I Diese Nr.: Un Payssage, avec beaucoup de figures, representant deux saisons Mat.: auf Kupfer Maße: haut 6 Vi large de 5 pouces Anm.: Die Lose 14 und 15 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1772/00/00 BSFRE 0015 Breughel (Jean) surnomme de Vlour I Deux Payssages, avec beaucoup de figures, representants les quatre saisons, partages sur ces deux petits Tableaux, trfes termines. Cadres [sic] d'ords, ä la grecque. I Diese Nr.: Un Payssage, avec beaucoup de figures, representant deux saisons Mat.: auf Kupfer Maße: haut 6 Vi large de 5 pouces Anm.: Die Lose 14 und 15 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1775/02/13 FRAN 0084 J. Breugel I Eine Landschaft von J. Breugel. I Maße: Höhe 11 % Zoll. Breite 9 % Zoll Verkäufer: von der Lahr Transakt.: Unbekannt 1775/04/12 HBNEU 0014 Breugel! Ein Jahrmarkt mit lustigen Bauern. I Transakt.: Unbekannt 1775/04/12 HBNEU 0028 S. Breugel I Eine Winterlandschaft, auf Holz. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt 1775/04/12 HBNEU 0032 F. Breugel I Die taufe Philippi, auf Holz. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt 1775/05/08 HBPLK 0015 Breugel I Ein Garten=Prospect und eine Winter=Landschaft, beyde auf Kupfer. I Diese Nr.: Ein Garten= Prospect Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 7 Zoll 3 Linie, Breite 9 Zoll 7 Linie Anm.: Die Lose 15 und 16 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (8 Μ für die Nrn. 15 und 16) 1775/05/08 HBPLK 0016 Breugel I Ein Garten=Prospect und eine Winter=Landschaft, beyde auf Kupfer. I Diese Nr.: Eine Winter=Landschaft Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 7 Zoll 3 Linie, Breite 9 Zoll 7 Linie Anm.: Die Lose 15 und 16 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (8 Μ für die Nrn. 15 und 16) 1775/05/08 OGAN 0262 Brügel I Ein Stück auf Holz gemalt, der Brabantische Jahrmarkt. [La foire de Brabant. Peinture sur bois de la main de Brugel.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Schuh 7 % Zoll hoch, und 2 Schuh 6 Vi Zoll breit Verkäufer: Marggräfinn Augusta Sibylla von Baaden=Baaden Transakt.: Unbekannt (44 [?]) 1776/04/15 HBBMN 0027 Brägel I Ein Land= und Wasser= Prospect, ungemein ausführlich gemahlt. I Maße: Höhe 8 Vi Zoll, Breite 11 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (13.4 M) Käufer: Leck 1776/07/19 HBBMN 0006 Brägel de Vel I Eine kleine Landschaft, extra ausführlich, auf Kupfer gemahlt. I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 4 Vi Zoll, Breite 5 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (6.12 M) Käufer: David 1776/07/19 HBBMN 0009 Brägel I Eine kleine ausführliche Landschaft, auf Kupfer, ungemein rar. I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 5 Zoll, Breite 6 % Zoll Transakt.: Verkauft (4 M) Käufer: Diederich 1776/07/19 HBBMN 0086 Brägel I Eine schöne Landschaft, wo Christus mit die Jünger nach Emaus wandert, auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 7 Vi Zoll, Breite 12 Zoll Transakt.: Verkauft (9 M) Käufer: Lilie 1776/11/09 HBKOS 0023 J. Brägel I Zwo kleine Landschaften, auf Kupfer, mit grossen Fleiß gemahlt, in schwarzen Rähmen mit verguldeten Leisten. I Diese Nr.: Eine kleine Landschaft Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 6 Zoll, Breite 8 Vi Zoll Anm.: Die Lose 23 und 24 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (21.14 Μ für die Nrn. 23 und 24) Käufer: Lilie S 1776/11/09 HBKOS 0024 J. Brägel I Zwo kleine Landschaften, auf Kupfer, mit grossen Fleiß gemahlt, in schwarzen Rähmen mit verguldeten Leisten. I Diese Nr.: Eine kleine Landschaft Mat.: auf
Kupfer Maße: Höhe 6 Zoll, Breite 8 Vi Zoll Anm.: Die Lose 23 und 24 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (21.14 Μ für die Nrn. 23 und 24) Käufer: Lilie S
le combat de la mort contre les hommes.] I Maße: 1 Vi Schuh breit, 1 Schuh hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (91.30 fl) Käufer: Abe Bava
1777/05/26 FRAN 0186 Brägel I Bauren=Stück. I Verkäufer: Finsterwalder Transakt.: Verkauft (15.15 fl) Käufer: Zimmer
1778/09/28 FRAN 0753 Breughell I Eine sehr schöne Landschaft. [Un trfes beau paysage.] I Maße: 1 Vi Zoll breit, 6 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (22 fl) Käufer: Nothnagel
1777/05/26 FRAN 0618 Brägel I Bauren=Stück von Brägel. I Verkäufer: Finsterwalder Transakt.: Verkauft (6 fl) Käufer: Rath Eichhorn 1778/05/16 HBBMN 0015 Breugel I Ein ländliches Fest. [Diese Stücke sind alle gut gefaßt, theils schwarze Rahmen mit goldenen Leisten, theils goldene Rahmen; auch ist die Höhe und Breite ohne Rähmen gemessen.] I Maße: 17 Zoll hoch, 23 Zoll breit Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 24 und beziehen sich wahrscheinlich auf die Nrn. 1 bis 24. Transakt.: Unbekannt 1778/05/21 HBKOS 0005 Brägel I Vier Landschaften mit Figuren, die vier Jahrzeiten vorstellend. I Diese Nr.: Eine der vier Jahreszeiten Anm.: Die Lose 5 bis 8 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/05/21 HBKOS 0006 Brägel I Vier Landschaften mit Figuren, die vier Jahrzeiten vorstellend. I Diese Nr.: Eine der vier Jahreszeiten Anm.: Die Lose 5 bis 8 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/05/21 HBKOS 0007 Brägel I Vier Landschaften mit Figuren, die vier Jahrzeiten vorstellend. I Diese Nr.: Eine der vier Jahreszeiten Anm.: Die Lose 5 bis 8 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/05/21 HBKOS 0008 Brägel I Vier Landschaften mit Figuren, die vier Jahrzeiten vorstellend. I Diese Nr.: Eine der vier Jahreszeiten Anm.: Die Lose 5 bis 8 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/07/11 HBTEX 0086 Brägel I Ein Blumenstück von Brägel, ungemein fleißig. I Transakt.: Unbekannt 1778/07/21 HBHTZ 0041 Breugel I Eine Winter=Landschaft, wo sich viele mit Schlittschuhlaufen belustigen, von Breugel, fleißig gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: 11 Zoll hoch, 16 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1778/07/21 HBHTZ 0060 Breugel I Eine Holländische Winter= Gegend, so sich viele auf dem Eiß mit Schlittschuhlaufen belustigen, extra fleissig gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 24 Zoll, breit 33 Zoll Transakt.: Unbekannt (30 M) 1778/08/29 HBTEX 0076 Breugell de Velours I Eine extra fleißige Landschaft von Breugell de Velours, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 5 Zoll, Breite 6 Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/09/28 FRAN 0622 Breughell I Ein Caroussel mit vielen Figuren. [Un caroussel avec beaucoup de figures.] I Maße: 2 Schuh 8 Zoll breit, 1 Schuh 11 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (131 fl) Käufer: ν Frankenstein 1778/09/28 FRAN 0686 Samuel Breughel I Eine ausnehmend schöne Landschaft mit vielen Figuren. [Un paysage superieurement bien peint avec beaucoup de figures.] I Maße: 1 Schuh 7 Zoll breit, 1 Vi Schuh hoch Anm. : Der Name der Künstlers ist angegeben als "Samuel Breughel", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (250 fl) Käufer: Jos Brentano 1778/09/28 FRAN 0697 Breughell I Eine schöne Landschaft mit einer Windmühle. [Un beau paysage avec un moulin ä vent.] I Maße: 1 Schuh 8 Zoll breit, 1 Schuh 2 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (78 fl) Käufer: Schweitzer [.··?] 1778/09/28 FRAN 0701 Sam. Breughell I Ein vortrefliches Stück, der Todtenkampf gegen die Menschen. [Une excellente piece,
1778/10/23 HBKOS 0003 Breugel I Eine Winter=Gegend, allwo sich viele auf dem Eise belustigen, auf dito [Leinwand]. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 29 Zoll, breit 36 Zoll Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0064 Joh. Breughel I Ein Bauemgelag. Im Vorgrunde tanzen Etliche unter grünen Bäumen. Das Dorf erstreckt sich in die Ferne, und Berge beschließen die Aussicht. Auf Holz. [Une guinguette de paysans. Sur le devant quelques uns dansent sous des arbres. Le village s'etend dans le lointain & des montagnes terminent la vue. Sur bois] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 8 Zoll hoch, 1 Fuß 8 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1780/00/00 AUAN 0004 Breughels I Ein extra rare Landschaft von Breughels auf Holz gemahlet, mit einer Rahm von Ebenholz. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt 1780/08/21 DAAN 0019 Sammet-Breughel I Eine herrliche Landschaft vom Sammet=Breughel, H[olz], I Mat.: auf Holz Maße: 2 Schuh 3 Zoll breit, 1 Schuh 6 Vi Zoll hoch Verkäufer: [Friedrich Karl Ludwig, Freiherr von Moser] Transakt.: Unbekannt 1780/08/21 DAAN 0081 Breughel I Eine herrliche Landschaft und Berg=Gegend, von Breughel, Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: 10 Vi Zoll breit, 9 Zoll hoch Verkäufer: [Friedrich Karl Ludwig, Freiherr von Moser] Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0044 Breughels De Velour I Un paysage, oü se voit trois chevaux attelles ä une voiture remplis de Monde, plusieurs personnages ä pied sur la gauche, en bas deux femmes assise, & un homme devant elles debout, tenant une espece de pique de la main droite; au milieu sur le lointain la vue de plusieurs Chateaux & Villages. Ce Tableau est peint sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: haut 14 pouces 6 lignes, large 21 pouces 3 lignes Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/03/26 BLHRG 2369 Breghel de Velour I Un Paisage des Laboureurs. I Transakt.: Unbekannt 1781/07/14 FRAN 0013 Sammt=Breughel I Eine herrliche Landschaft. I Mat.: auf Holz Maße: 2 Schuh 3 Zoll breit, 1 Schuh 6 Vi Zoll hoch Verkäufer: Moser Transakt.: Unbekannt (50 fl) 1781/07/14 FRAN 0053 Sammt=Breughel I Eine herrliche Landschaft und Berg=Gegend. I Mat.: auf Kupfer Maße: 10 Vi Zoll breit, 9 Zoll hoch Verkäufer: Moser Transakt.: Unbekannt (46 fl) 1781/07/18 FRAN 0001 Brugell I Eine Wildniß, die Historie von Jason vorstellend, vom besten Brugell. I Maße: 1 Schuh 10 Zoll hoch, 2 Schuh 5 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/09/10 BNAN 0075 Ian Breugel I Der Babylonische Thurmbau mit vielen Schmelz= und Schmiedehütten zur Rechten des Vorgrundes; zur Linken, innerhalb eines eingeschlossenen Hofes, Steinmetzen und andere Arbeiter; hiernächst für einer Corinthischen Arcade; an welcher ein rother Vorhang, der König auf seinem Stuhl; neben ihm die Großen; die blaue Ferne zeiget eine See. Das ganze Gemähide wimmelt von Thieren, Menschen und Fuhrwerken; mit ausnehmender Sorgfallt leicht und geistreich behandelt, von Ian Breugel, auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: 13 Zoll hoch, 17 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0048 F. Breugel I Wie das Gewitter in einem Tempel gezündet, ganz vortreflich vorgestellet, besonders das Feuer, welches einen natürlichen Effect macht, auf Holz. I Mat.: auf GEMÄLDE
401
Holz Maße: Höhe 14 Zoll, Breite 20 Zoll Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt
ben, von Brögel, auf Kupfer, im schwarzen Rahm. I Mat.: auf Kupfer Transakt.: Unbekannt
1782/03/18 HBTEX 0322 Breugel I Eine Landgegend mit einem Hirten, der von einem Wolf erwürget wird, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 8 Zoll, Breite 11 Zoll Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt
1786/04/21 HBTEX 0048 Brögel I Eine Winter=Landschaft mit Figuren. I Transakt.: Unbekannt
1782/07/00 FRAN 0026 Sammet Breughel I Ein auf Kupfer fleißig gemaltes Landschäftchen, wobey Vogelfänger zur Staffage angebracht sind. I Mat.: auf Kupfer Maße: 5 Zoll hoch, 8 Zoll breit Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] fl) 1782/09/30 FRAN 0314 Sammt Breughell I Eine angenehme und fleisig ausgearbeitete Landschaft, mit schönen Bäumen und herrlich grouppirten Waagen, Pferden und Figuren vom Sammt Breughell. [Un paysage riant & tres bien peint avec de beaux arbres & d'excellents grouppes en chariots, chevaux & figures, par Sammt Breughell.] I Maße: 10 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 3 Vi Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (56.45 fl) Käufer: Hüsgen 1783/06/19 HBRMS 0165 J. Breughel I Ein Jahrmarkt in einem holländischen Dorfe, zahlreich an lustigen und beschäftigten Leuten. Land= und Wasser=Gegend; im Vordergrunde ein Wirthshaus, am Ufer Fahrzeuge mit Menschen; im Hintergrunde ein Kirch=Dorf. H[olz]. g.R. [verguldete Rahmen] I Diese Nr.: Ein Jahrmarkt in einem holländischen Dorfe, zahlreich an lustigen und beschäftigten Leuten Mat.: auf Holz Maße: 7 Zoll hoch, 15 Zoll breit Anm.: Die Lose 165 und 166 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1783/06/19 HBRMS 0166 J. Breughel I Ein Jahrmarkt in einem holländischen Dorfe, zahlreich an lustigen und beschäftigten Leuten. Land= und Wasser=Gegend; im Vordergrunde ein Wirthshaus, am Ufer Fahrzeuge mit Menschen; im Hintergrunde ein Kirch=Dorf. H[olz], g.R. [verguldete Rahmen] I Diese Nr.: Land= und Wasser= Gegend; im Vordergrunde ein Wirthshaus, am Ufer Fahrzeuge mit Menschen; im Hintergründe ein Kirch=Dorf Mat.: auf Holz Maße: 7 Zoll hoch, 15 Zoll breit Anm.: Die Lose 165 und 166 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1785/05/17 MZAN 0184 Breughel I Eine Landschaft mit Reisenden von Breughel. [Un paysage avec des voyageurs.] I Maße: 1 Schuh 6 Zoll hoch, 2 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (116 fl) Käufer: Strecker 1785/05/17 MZAN 0293 Breughel I Ein Blumenkrug von Breughel. [Un pot ä fleurs.] I Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 10 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (56 fl) Käufer: Melber 1785/05/17 MZAN 0440 Breughel I Christus wie er auf denen Wogen Petrus, der untergehen will, entgegengeht von Breughel. [Jesus Christ marchant sur les vogues vers S. Pierre, qui va etre submerge.] I Maße: 6 Zoll hoch, 8 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (10.30 fl) Käufer: Clausius 1785/05/17 MZAN 0466 Breughel I Die nämliche Vorstellung [ein Blumenstück] von Breughel. [Meme objet [des fleurs].] I Maße: 9 Vi Zoll hoch, 7 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (20.30 fl) Käufer: Strecker 1785/05/17 MZAN 0501 Breughel de Velour I Eine Landschaft von Breughel. [Un paysage.] I Maße: 5 Zoll hoch, 4 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (23.30 fl) Käufer: Strecker 1785/05/17 MZAN 1007 Breughel I Ein Blumenstück von Breughel. [Des fleurs.] I Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 11 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (10 fl) Käufer: Strekker 1785/12/03 HBBMN 0010 Brägel I Eine schöne Landschaft, wo die heilige Familie vorgestellet ist, mit einem Blumenkranz umge402
GEMÄLDE
1786/10/18 HBTEX 0092 Breugel I Die vier Jahrs=Zeiten, als Holländische Land= und Wasser=Gegenden vorstellend. Auf Kupfer. I Diese Nr.: Eine der vier Jahrs=Zeiten Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 12 Zoll, breit 16 Zoll 6 Linien Anm.: Die Lose 92 bis 95 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/10/18 HBTEX 0093 Breugel I Die vier Jahrs=Zeiten, als Holländische Land= und Wasser=Gegenden vorstellend. Auf Kupfer. I Diese Nr.: Eine der vier Jahrs=Zeiten Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 12 Zoll, breit 16 Zoll 6 Linien Anm.: Die Lose 92 bis 95 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/10/18 HBTEX 0094 Breugel I Die vier Jahrs=Zeiten, als Holländische Land= und Wasser=Gegenden vorstellend. Auf Kupfer. I Diese Nr.: Eine der vier Jahrs=Zeiten Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 12 Zoll, breit 16 Zoll 6 Linien Anm.: Die Lose 92 bis 95 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/10/18 HBTEX 0095 Breugel I Die vier Jahrs=Zeiten, als Holländische Land= und Wasser=Gegenden vorstellend. Auf Kupfer. I Diese Nr.: Eine der vier Jahrs=Zeiten Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 12 Zoll, breit 16 Zoll 6 Linien Anm.: Die Lose 92 bis 95 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/10/18 HBTEX 0101 Breugel I Eine Holzung mit bergigter Entfernung, durch welche ein schiffreicher Fluß bey einer Stadt vorbeyfliesset, auf Kupfer; und zu dessen Compagnon eine Holländische niedere Land=Gegend, zur Linken eine Wind=Mühle, und auf der Landstraße Reisende zu Pferde und zu Fuß, nebst einen Postwagen mit Passagiers. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine Holländische niedere Land=Gegend, zur Linken eine Wind=Mühle, und auf der Landstrasse Reisende zu Pferde und zu Fuß, nebst einen Postwagen mit Passagiers; Pendant zu Nr. 100 von Alex. Keirincx Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 Zoll 3 Linien, breit 9 Zoll 9 Linien Anm.: Die Lose 100 und 101 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/10/18 HBTEX 0104 Joh. Breugel I Holzungen mit biblischen Geschichten aus dem neuen Testament. Auf Kupfer. I Diese Nr.: Eine Hölzung mit biblischer Geschichte aus dem neuen Testament Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 7 Zoll, breit 9 Zoll 6 Linien Anm.: Die Lose 104 und 105 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/10/18 HBTEX 0105 Joh. Breugel I Holzungen mit biblischen Geschichten aus dem neuen Testament. Auf Kupfer. I Diese Nr.: Eine Hölzung mit biblischer Geschichte aus dem neuen Testament Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 7 Zoll, breit 9 Zoll 6 Linien Anm.: Die Lose 104 und 105 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/10/18 HBTEX 0189 Breugel I Eine waldigte Gegend mit Gebürgen und Wasser; auf der Landstrasse befinden sich viele Reisende, theils zu Pferde, als auch in einer Land=Kutsche und zu Fuß, lebhaft gemahlt auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Zoll 6 Linien, breit 21 Zoll 6 Linien Transakt.: Unbekannt 1786/10/18 HBTEX 0329 Breugel I Eine Kirmesse. I Pendant zu Nr. 330 Transakt.: Unbekannt 1786/10/18 HBTEX 0330 Breugel I Ein Pendant. I Pendant zu Nr. 329, "Eine Kirmesse" Transakt.: Unbekannt 1787/00/00 HB AN 0021 Brögel I Alte Bogengänge. Links wird man die auf einem Teppich sitzende Venus im Vordergrunde gewahr, mit dem Cupido zur Seite. Sie redet mit dem Vulcan, hinter welchem man die arbeitenden Cyclopen gewahr wird. In der Ferne siehet man nochmals die Venus, wie sie mit mehreren Gehülfen einem Französis. Helden Waffen anlegt. Hinten den feuerspeyenden Berg Aetna. Im Hintergrunde und Vordergrunde eine Menge Waf-
fen. Alles aufs schönste gemahlt und ausgeführt. Auf Holz, s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 20 Zoll, breit 36 Zoll Transakt.: Verkauft (38.8 M) Käufer: Schoen [mit] L 1787/00/00 HB AN 0147 Brägel I Angenehmes abwechselndes Land und Wasser. Zur linken erheben sich am Ufer sehr hohe Bäume, bey welchen sich Fischer befinden. Im Vordergrunde auf dem Wasser siehet man Schiffe. In der Ferne wird man bey einem Kirchdorfe verschiedene Wagen, Pferde und Figuren gewahr. Sehr ausführlich gemahlt. A.K. [Auf Kupfer] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 9 Vi Zoll, breit 11 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (36 M) Käufer: Segberg 1787/00/00 HB AN 0287 Jann Brägel, gen. van Vlour I Eine Landschaft, zur rechten ein Berg, über welchen eine Landstraße gehet, auf welcher ein Bauerwagen und eine Karre im Vordergrunde fahrt, vor welchen sich zwey Reisende zu Pferde befinden. Im Vordergrunde sitzen und stehen verschiedene Bauern. Im Hintergrunde wird man auf einem Berge einen Hirten mit seinem Vieh gewahr; hinterwärts mehrere Wagen, Pferde, Vieh und Figuren. Zur rechten in der Ferne eine Menge Städte, Flecken und Dörfer. Ein schönes Gemähide. Die Lage und Wählung der Gegend ist selten, die Haltung schön, die Figuren sind gut gezeichnet, und alles ist auf das fleißigste ausgeführt. A.K. [Auf Kupfer] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 10 Vi Zoll, breit 16 Zoll Transakt.: Verkauft (126 M) Käufer: Schoen 1787/00/00 HB AN 0445 Johann Brägel I Eine angenehme waldigte Landschaft. Zur linken ein Wald, an dessen Fuße ein kleiner Fluß. Zur rechten im Vordergrunde auf der Landstraße treibt ein Hirt und Hirtinn ihre Heerde durch ein Wasser nach dem Walde zu; weiter zurück gehen noch verschiedene Maulthiertreiber mit ihren bepackten Maulthieren. Die Haltung ist schön und angenehm, das Colorit reizend, die Figuren von richtiger Zeichnung und von besonderer Ausführung. A.K. [Auf Kupfer] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 13 Zoll, breit 18 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (23 M) Käufer: Tietjen 1787/00/00 HB AN 0678 Johann Brägel I Ein Kirchdorf. Im Vordergrunde eine Landstraße, die sich im Hintergrunde zwischen verschiedenen Häusern verlieret; auf derselben befinden sich eine Menge Reisende zu Wagen, zu Pferde und zu Fuß, und Bauern mit ihrem Vieh. Zur rechten neben der Kirche eine Weide mit Vieh, über welche sich ein Fußweg schlängelt, worauf unterschiedene Bauern gehen. Eine angenehme Aussicht schließt die Ferne. Eine Land= und Wassergegend bey Winter Zeit. Aus der sich zur linken befindenden Stadt kommen sehr viele Figuren zu Wagen, zu Pferde und zu Fuß, welche sich alle nach der Landstraße verfügen. Auf einer Anhöhe steht ein Jäger mit seinen ζweyen Hunden. Auf dem gefrornen Wasser amüsiren sich viele mit Winterlustbarkeiten. Beyde Gemähide sind besonders reizend, die Haltung ist schön und angenehm, und die Figuren sind alle gut gezeichnet, und auf das fleißigste ausgemahlt. A.H. [Auf Holz] g.R. [in goldenem Rahm] I Diese Nr.: Ein Kirchdorf Mat.: auf Holz Maße: Hoch 6 Vi Zoll, breit 8 Vi Zoll Anm.: Die Lose 678 und 679 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (32 Μ für die Nrn. 678 und 679) Käufer: Sigberg 1787/00/00 HB AN 0679 Johann Brägel I Ein Kirchdorf. Im Vordergrunde eine Landstraße, die sich im Hintergrunde zwischen verschiedenen Häusern verlieret; auf derselben befinden sich eine Menge Reisende zu Wagen, zu Pferde und zu Fuß, und Bauern mit ihrem Vieh. Zur rechten neben der Kirche eine Weide mit Vieh, über welche sich ein Fußweg schlängelt, worauf unterschiedene Bauern gehen. Eine angenehme Aussicht schließt die Ferne. Eine Land= und Wassergegend bey Winter Zeit. Aus der sich zur linken befindenden Stadt kommen sehr viele Figuren zu Wagen, zu Pferde und zu Fuß, welche sich alle nach der Landstraße verfügen. Auf einer Anhöhe steht ein Jäger mit seinen zweyen Hunden. Auf dem gefromen Wasser amüsiren sich viele mit Winterlustbarkeiten. Beyde
Gemähide sind besonders reizend, die Haltung ist schön und angenehm, und die Figuren sind alle gut gezeichnet, und auf das fleißigste ausgemahlt. A.H. [Auf Holz] g.R. [in goldenem Rahm] I Diese Nr.: Eine Land= und Wassergegend bey Winter Zeit Mat.: auf Holz Maße: Hoch 6 Vi Zoll, breit 8 Vi Zoll Anm.: Die Lose 678 und 679 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (32 Μ für die Nrn. 678 und 679) Käufer: Sigberg 1787/00/00 HB AN 0748 Johann Brägel I Paris Urtheil. Zur linken bey einem dicken Walde. Im Hintergrunde eine angenehme Landschaft. Wie das wilde Schwein, um der Attalante den Kopf zu überliefern, erlegt wird. In einer angenehmen waldigten Landschaft. Beyde auf das schönste und allerfleißigste gemahlt. A.K. [Auf Kupfer] I Diese Nr.: Paris Urtheil Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 2 Zoll, breit 3 Zoll Anm.: Die Lose 748 und 749 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (6.8 Μ für die Nm. 748 und 749) Käufer: Tietjen 1787/00/00 HB AN 0749 Johann Brägel I Paris Urtheil. Zur linken bey einem dicken Walde. Im Hintergrunde eine angenehme Landschaft. Wie das wilde Schwein, um der Attalante den Kopf zu überliefern, erlegt wird. In einer angenehmen waldigten Landschaft. Beyde auf das schönste und allerfleißigste gemahlt. A.K. [Auf Kupfer] I Diese Nr.: Wie das wilde Schwein, um der Attalante den Kopf zu überliefern, erlegt wird Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 2 Zoll, breit 3 Zoll Anm.: Die Lose 748 und 749 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (6.8 Μ für die Nm. 748 und 749) Käufer: Tietjen 1787/00/00 HB AN 0750 Johann Brägel I Die Rache der Latona, in einer reizenden Land= und Wassergegend. Andromeda befindet sich zur linken, an einem Felsen geschlossen; zur rechten wird man den Perseus gewahr. In der Feme eine Stadt. Beyde auf das fleißigste und schönste gemahlt. A.K. [Auf Kupfer] I Diese Nr.: Die Rache der Latona, in einer reizenden Land= und Wassergegend Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 2 Zoll, breit 2 % Zoll Anm.: Die Lose 750 und 751 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (6.8 Μ für die Nm. 750 und 751) Käufer: Tietjen 1787/00/00 HB AN 0751 Johann Brägel I Die Rache der Latona, in einer reizenden Land= und Wassergegend. Andromeda befindet sich zur linken, an einem Felsen geschlossen; zur rechten wird man den Perseus gewahr. In der Ferne eine Stadt. Beyde auf das fleißigste und schönste gemahlt. A.K. [Auf Kupfer] I Diese Nr.: Andromeda befindet sich zur linken, an einem Felsen geschlossen, zur rechten wird man den Perseus gewahr Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 2 Zoll, breit 2 % Zoll Anm.: Die Lose 750 und 751 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (6.8 Μ für die Nm. 750 und 751) Käufer: Tietjen 1787/10/06 HBTEX 0006 Brägel I Eine große Landschaft mit Figuren, ungemein ausführlich gemahlt, von Brögel im vergoldeten Rahm. I Transakt.: Unbekannt 1787/10/06 HBTEX 0088 Brögel I Zwey Holländische Land= und Wasser=Prospecte, sehr reich an schönen Figuren, in vergoldeten Rahmen. I Diese Nr.: Ein Holländischer Land= und Wasser=Prospect Anm.: Die Lose 88 und 89 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1787/10/06 HBTEX 0089 Brögel I Zwey Holländische Land= und Wasser=Prospecte, sehr reich an schönen Figuren, in vergoldeten Rähmen. I Diese Nr.: Ein Holländischer Land= und Wasser=Prospect Anm.: Die Lose 88 und 89 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0065 Brögel I Eine Landschaft mit Figuren. [1 p[iece]. de paysage ä figure.] I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Fuß 4 Zoll, Breite 1 Fuß 8 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
403
1788/09/01 KOAN 0081 Breugel I Eine Landschaft. [1 p[iece], un petit pay sage.] I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 4 Zoll, Breite 8 Vi Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0272 Breugel I Blumenstuck. [1 p[iece]. de fleures.] I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Fuß 9 Zoll, Breite 1 Fuß 6 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0281 Breugel I 2 Seestuck. [2 p[ieces], de Vierge mer.] I Diese Nr.: Ein Seestuck Mat.: auf Holz Maße: Höhe 4 Zoll, Breite 8 Zoll Anm.: Die Lose 281 und 282 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0282 Breugel I 2 Seestuck. [2 p[ieces]. de Vierge mer.] I Diese Nr.: Ein Seestuck Mat.: auf Holz Maße: Höhe 4 Zoll, Breite 8 Zoll Anm.: Die Lose 281 und 282 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/12/13 HBTEX 0173 Broegel I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 173 und 174 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (3.10 Μ für die Nrn. 173 und 174) Käufer: Ehr[enreich] 1788/12/13 HBTEX 0174 Broegel I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 173 und 174 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (3.10 Μ für die Nrn. 173 und 174) Käufer: Ehr[enreich] 1789/00/00 MMAN 0057 Johann Brueghel I Ein Landschäftchen mit Figuren, auf Kupfer. [Un petit paysage avec figure, sur cuivre.] I Mat.: auf Kupfer Maße: 9 Zoll hoch, 10 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt 1789/00/00 MMAN 0205 Johann Brueghel I Der unschuldige Kindermord, auf Holz. [Le massacre des St. Innocens, surbois [sic].] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 8 Zoll hoch, 2 Fuß 10 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (33 fl) 1789/00/00 MMAN 0332 Joh. Brueghel I Zwei Landschäftchen, auf Kupfer. [Deux paysages, sur cuivre.] I Mat.: auf Kupfer Maße: 4 Zoll hoch, 5 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (15 fl) 1789/00/00 MMAN 0354 Johann Brueghel I Eine Landschaft mit Vieh und Figuren, auf Holz. [Un paysage avec figures et animaux, sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 4 Zoll hoch, 2 Fuß 2 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt 1789/04/16 HBTEX 0030 Breugel I Zwey gebürgigte Landgegenden mit vielen Figuren; fleißig und schön gemahlt auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 7 Zoll Transakt.: Verkauft (4 M) Käufer: Ego 1789/04/16 HBTEX 0045 I. Breugel I Eine holländische Wintergegend, in welcher sich verschiedene auf dem Eise belustigen; fleißig gemahlt auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 6 Vi Zoll, breit 9 % Zoll Transakt.: Verkauft (1.06 M) Käufer: Ego 1789/04/16 HBTEX 0090 Breugel I In einer ländl. Gegend befinden sich Reisende vor Wirthshäuser, zu Wagen, zu Pferde und zu Fuß; plaisant und fleißig gemahlt auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Zoll, breit 14 Zoll Transakt.: Verkauft (4 M) Käufer: Eckhardt 1789/08/00 HNAN 0010 Breughel I Der Brand von Troja a. K. [auf Kupfer] ein fürtreflich Stück. gg.R. [glanzgolden Rahm] I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 7 Vi Zoll, Breite 9 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1789/08/00 HNAN 0039 Breughel I Zwei Landschaften a. K. [auf Kupfer] Schw.R.m.g.L. [Schwarze Rahmen mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 6 Vi Zoll, Breite 9 Zoll Transakt.: Unbekannt 1789/08/18 HB GOV 0009 Breughel I In einer Dorf=Gegend wird Kirmyß gehalten von etliche hundert Land=Leute, auf Holz. I 404
GEMÄLDE
Mat.: auf Holz Maße: Hoch 28 Zoll, breit 84 Zoll Transakt.: Unbekannt 1789/08/18 HBGOV 0080 Breughel I Zwey holländische Stadt= und Land=Gegenden, im Dorfe wird Kirmeß gehalten; fleißig gemahlt, auf Kupfer. I Diese Nr.: Eine holländische Stadt= und Land= Gegend Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 8 % Zoll, breit 13 Vt Zoll Anm.: Die Lose 80 und 81 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1789/08/18 HBGOV 0081 Breughel I Zwey holländische Stadt= und Land=Gegenden, im Dorfe wird Kirmeß gehalten; fleißig gemahlt, auf Kupfer. I Diese Nr.: Eine holländische Stadt= und Land= Gegend Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 8 % Zoll, breit 13 V* Zoll Anm.: Die Lose 80 und 81 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0195 Breugel Joh. I Eine niederländische Landschaft, auf Holz, in einer geschnittenen und vergoldeten Ram. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh, Breite 1 Schuh 4 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0208 Breugel Joh. I Ein großes niederländisches Marktstück, auf Holz, in einer geschnittenen und vergoldeten Ram. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 10 Zoll, Breite 2 Schuh 4 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0209 Breugel Joh. I Ein niederländisches Marktstück, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 11 Zoll, Breite 2 Schuh 4 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0211 Breugel Joh. I Ein niederländisches Winterstück, auf Holz, in einer geschnittenen und vergoldeten Ram. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 1 Zoll, Breite 1 Schuh 8 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0235 Breugel Joh. I Ein niederländisches Marktstück, auf Kupfer, in einer geschnittenen und vergoldeten Ram. I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 8 Zoll, Breite 10 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0237 Breugel Joh. I Zwo Landschaften mit Figuren, auf Holz, in geschnittenen und vergoldeten Ramen. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren Mat.: auf Holz Maße: Höhe 6 Zoll, Breite 1 Schuh 2 Zoll Anm.: Die Lose 237 und 238 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0238 Breugel Joh. I Zwo Landschaften mit Figuren, auf Holz, in geschnittenen und vergoldeten Ramen. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren Mat.: auf Holz Maße: Höhe 6 Zoll, Breite 1 Schuh 2 Zoll Anm.: Die Lose 237 und 238 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1452 Breugel Joh. I Eine Seelandschaft, auf Kupfer, in einer eben dergleichen [geschnittenen und metallisirten] Ram. I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 4 Zoll, Breite 10 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1562 Breugel Joh. I Eine Landschaft mit Figuren, und Pferden, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 7 Zoll, Breite 11 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/04/13 HBLIE 0024 Broegel I In einer Gegend siehet man bey Winterzeiten geharnischte Reuter, die sich mit einander herumfechten, in der Ferne wird man eine Stadt gewahr, sehr fleißig gemahlt. Auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 5 Zoll, breit 7 % Zoll Transakt.: Verkauft (3.4 M) Käufer: Schön 1790/08/13 HBBMN 0058 Breughel I Eine sehr fleißige waldigte Landschaft, im Vordergrunde ruhet Maria und Joseph auf der Flucht nach Egypten. Auf Kupfer, S.R.G.L. [Schwarzen Rahm,
goldne Leisten] I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 13 Zoll, breit 17 Zoll Transakt.: Verkauft (6 M) Käufer: Sieberg 1790/08/25 FRAN 0030 Breugel I Eine Landschaft mit vielen Figuren. I Maße: hoch 10 Zoll, breit 12 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (5.15 fl) Käufer: Müntzrath Dietz 1790/08/25 FRAN 0143 Breugel I Zwey Landschaften, von Momber & Breugel. I Diese Nr.: Eine Landschaft; Nr. 142 von J. Momper (II) Maße: hoch 4 Vi Zoll, breit 7 Zoll Anm.: Die Lose 142 und 143 wurden zusammen katalogisiert. Dieses Los wurde zusammen mit der Nr. 142 (J. Momper (II)) verkauft. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (3.45 fl für die Nrn. 142 und 143) Käufer: Leicht Ritter 1790/08/25 FRAN 0434 Jan Breugel I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: hoch 4 Vi Zoll, breit 6 Zoll Anm.: Die Lose 434 und 435 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (5.15 fl für die Nrn. 434 und 435) Käufer: Hüsgen 1790/08/25 FRAN 0435 Jan Breugel I Zwey Landschaften. Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: hoch 4 Vi Zoll, breit 6 Zoll Anm.: Die Lose 434 und 435 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (5.15 fl für die Nrn. 434 und 435) Käufer: Hüsgen 1791/05/28 HBSDT 0062 Sammit Breughel I Alle Arten Blumen in einem Glase mit Insecten, sehr schön gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 25 Zoll, breit 16 Zoll Transakt.: Unbekannt 1791/09/21 FRAN 0021 Breugel dit de Velour I Ein Dorf in Flandern, wo vomen ein Canal mit Schiffen und Matrosen bedeckt ist, zur Rechten ist eine hölzerne Brücke, wo ein Postwagen herüber fährt. Auf der andern Seite sind verschiedene Fässer zum Einschiffen fertig, weiter zur Rechten ist ein Kornmarkt mit einer großen Menge Bauern von beiderlei Geschlecht, zur Linken sind Häuser, der Boden endiget sich mit Dörfern zur Aussicht; das Ganze ist sehr angenehm, und es scheint, daß es auf der Stelle gemacht worden; die Liebhaber kennen den Verdienst der Werke dieses Meisters und dieses ist ohne Widerspruch eines der schönsten. I Transakt.: Verkauft (88 fl) Käufer: De Neufville 1791/09/21 FRAN 0132 Breugel dit de Velour I Eine Landschaft, vome mit vielen Bäumen gezieret und ein Jäger mit seinem Hunde, in den Entfernungen zur Rechten und Linken sind Dörfer; Aussicht von Holland. I Transakt.: Verkauft (4 fl) Käufer: Scheibler 1791/09/26 FRAN 0092 Joh. Breugel I Ein fleißiges Blumenstück. I Maße: 25 Zoll hoch, 19 Zoll breit Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0271 Broeugel I Eine kleine nette Winterlandschaft. I Maße: 6 Zoll breit, 5 Zoll hoch Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt
1792/08/20 KOAN 0168 Jan Breughell I Ein Bauren=Dorf mit vielerley Viehe, Karrigen, und Figuren, hat zum Compagnon Jacob und Esau nebst vielem Hornviehe, Schaafen, und Figuren von Jan Breughell. I Diese Nr.: Jacob und Esau nebst vielem Hornviehe, Schaafen, und Figuren; Pendant zu Nr. 167 Maße: 1 Schuh 3 Vi Zoll hoch, 2 Schuh breit Anm.: Die Lose 167 und 168 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0304 Breughell I Ein Blumen=Stückelchen auf Holz von Breughell. I Mat.: auf Holz Maße: 9 Vi Zoll hoch, 7 Vi Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/09/28 HBBMN 0055 Breugel I Eine Stadt in Brand, von Breugel. Auf Hz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Vi Zoll, breit 14 Zoll Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 HBMFD 0008 Johann Breughel, (van Vlour) I Dieses schöne Gemälde stellet den Brand von Gomorra vor, welcher sich zur Rechten anfängt und sich in zwey Abtheilungen darstellet, wovon der höchste Brand von den Feuer des Himmels unterhalten wird. Ganz im Hintergrunde befinden sich auf einem Wege eine Menge Volks auf der Flucht. Grosse Felsen zur Linken, bey welchen man eine Anhöhe mit einer kleinen Stadt sieht. Auf einem Gewässer Barken mit Menschen angefüllt. Unten im Gemälde sieht man Loth auf der Flucht mit seinen Töchtern von Engeln gefolgt. Die Figuren sind so schön gezeichnet und mit solcher Delicatesse ausgeführt, dass der Meister sich als Landschafter fast selbst übertroffen hat. Der Ton und die Harmonie des Stücks ist unvergleichlich. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuss 9 Vi Zoll hoch, 2 Fuss 3 Vi Zoll breit Verkäufer: Pierre Laporterie Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0031 Sammt=Breughel I In einem weißen Topfe stehen eine Menge Blumen aller Art. Unten aufn Tisch Kirschen ec. Fleißig und schön gemahlt von Sammt=Breughel. I Maße: Hoch 26 Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0149 Breughel I Eine große Aussicht übers Land. Im Vordergrunde, auf der Landstraße, Reisende und Bauren. Sehr fleißig. I Maße: Hoch 16 Zoll, breit 29 Zoll Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0216 Breugel I Tanzende Bauern und Bäuerinnen im Grase, wozu die No. 221 gehörig. Auf Holz, von Breugel. I Diese Nr.: Tanzende Bauern und Bäuerinnen im Grase; Pendant zu Nr. 221 Mat.: auf Holz Maße: Hoch 3 Zoll 6 Lin., breit 5 Zoll Anm.: Die Lose 216 bis 218 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0217 Breugel I Tanzende Bauern und Bäuerinnen im Grase, wozu die No. 221 gehörig. Auf Holz, von Breugel. I Diese Nr.: Tanzende Bauern und Bäuerinnen im Grase; Pendant zu Nr. 221 Mat.: auf Holz Maße: Hoch 3 Zoll 6 Lin., breit 5 Zoll Anm.: Die Lose 216 bis 218 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1792/04/19 HBBMN 0076 Johannes Breugel I Bey Winter=Zeiten vor einer holländischen Stadtgegend belustigen sich viele mit Schrittschuhlaufen und Schlittenfahren; sehr fleißig gemahlt von Johannes Breugel. Auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 4 Ά Zoll, breit 5 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt
1793/06/07 HBBMN 0218 Breugel I Tanzende Bauern und Bäuerinnen im Grase, wozu die No. 221 gehörig. Auf Holz, von Breugel. I Diese Nr.: Tanzende Bauern und Bäuerinnen im Grase; Pendant zu Nr. 221 Mat.: auf Holz Maße: Hoch 3 Zoll 6 Lin., breit 5 Zoll Anm.: Die Lose 216 bis 218 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1792/08/20 KOAN 0132 Sammt Breugheel I Der Winter mit Bauren=Häuser, Kirchen, und Figuren sehr schön vorgestellt von Sammt Breughel. I Maße: 1 Schuh 2 Zoll hoch, 1 Schuh 10 Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt
1793/06/07 HBBMN 0221 Breugel I Tanzende Landleute zu No. 216=18. Auf dito [Holz], von dito [Breugel]. I Pendant zu den Nm. 216 bis 218 Mat.: auf Holz Maße: Hoch 3 Zoll 6 Lin., breit 5 Zoll Transakt.: Unbekannt
1792/08/20 KOAN 0167 Jan Breughell I Ein Bauren=Dorf mit vielerley Viehe, Karrigen, und Figuren, hat zum Compagnon Jacob und Esau nebst vielem Hornviehe, Schaafen, und Figuren von Jan Breughell. I Diese Nr.: Ein Bauren=Dorf mit vielerley Viehe, Karrigen und Figuren; Pendant zu Nr. 168 Maße: 1 Schuh 3 Vi Zoll hoch, 2 Schuh breit Anm.: Die Lose 167 und 168 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt
1793/09/18 HBSCN 0060 Sammet Breugel I In einer Landschaft auf einer kleinen Anhöhe steht eine Windmühle, auf der Treppe wird Korn getragen, daß der Müller in Empfang nimmt, unten ein ledig bespannter Kam, auf einen andern wird Mehl geladen, wo das Pferd von einer Frau gefüttert wird, aus einen mit Reisenden besetzter Wagen, der mit drey Pferden bespannet ist, reicht eine Dame den nebenher lauffenden Bettelknaben Almosen, am Schlag des Wagens GEMÄLDE
405
reitet ein Herr mit seinen Bedienten, seitwärts kömmt eine lasttragende Frau herzu, weiter zurück noch eine Windmühle, ganz in der Entfernung eine Stadt. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 7 V* Zoll, breit 9 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1793/09/18 HBSCN 0061 Sammet Breugel I Durch ein Dorf fährt auf der Landstrasse ein Fuhrwerk mit Schimmel bespannet, im Vordergrund eine Frau, welche ein Kind auf dem Arm, das andre an der Hand führet, ein Landmann folgt den Weg der Kutsche nach, ein sein Pferd am Zügel führender Herr ist in Begleitung einer masquirten Dame, zur Seiten ein abgestigener [sie] Reuter der sein Wasser abschlägt, vor dem Eckhause des Dorfs wird ein Pferd beschlagen, zerstreut umher verschiedene Fußgänger, der hintergrund endiget sich mit Gebüsche und Alleen. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 10 Zoll, breit 13 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1793/09/18 HBSCN 0062 Sammet Breugel I Auf ein mitten durchs Dorf fliessendes Wasser befinden sich Fahrzeuge, wovon eines durch die Zugbrücke paßiret, zur Linken verschiedene Personen die vom Hunde angebellet werden, nebenher werden Pferde vor einer Landchaise gefüttert seitwärts sind Häuser, Scheuren und andere Gebäude vor welchen Schweine laufen, man sieht noch mehre Personen zu Pferde und zu Fuß, im Hintergrund ein Wald und Windmühle. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 7 Zoll, breit 10 Zoll Transakt.: Unbekannt 1793/09/18 HBSCN 0063 Sammet Breugel I In einem Dorf zur Linken ein Kelter wo Weintrauben getreten werden, vor denselben liegt Wein in Fässer, der von einem Herrn untersucht wird, zwey bespannte Wagen halten nebenher, seitwärts treiben die Hirten ihr Vieh vorbey, in ein der Häuser steht eine Person in der Hausthüre, noch zwey zur Seiten, weiter zurück zwey Reuter, am Ende Gebürge. Das Gegenbild eine Landstrasse mit Bäume besetzt, an beiden Seiten fließt Wassee vorbey, zur Linken eine Wiese mit Vieh, zur Rechten ein gethürmtes Schloß. Man kann von diesen fünf Stücken [Nr. 60-64] nicht genug den feinen Pinsel des Künstlers bewundern. I Diese Nr.: In einem Dorf zur Linken ein Kelter wo Weintrauben getreten werden, vor denselben liegt Wein in Fässer, der von einem Herrn untersucht wird; Pendant zu Nr. 64 Mat.: auf Kupfer Format: oval Maße: Hoch 3 Zoll, breit 4 Zoll Anm.: Die Lose 63 und 64 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1793/09/18 HBSCN 0064 Sammet Breugel I In einem Dorf zur Linken ein Kelter wo Weintrauben getreten werden, vor denselben liegt Wein in Fässer, der von einem Herrn untersucht wird, zwey bespannte Wagen halten nebenher, seitwärts treiben die Hirten ihr Vieh vorbey, in ein der Häuser steht eine Person in der Hausthüre, noch zwey zur Seiten, weiter zurück zwey Reuter, am Ende Gebürge. Das Gegenbild eine Landstrasse mit Bäume besetzt, an beiden Seiten fließt Wassee vorbey, zur Linken eine Wiese mit Vieh, zur Rechten ein gethürmtes Schloß. Man kann von diesen fünf Stücken [Nr. 60-64] nicht genug den feinen Pinsel des Künstlers bewundem. I Diese Nr.: Eine Landstrasse mit Bäume besetzt, an beiden Seiten fließt Wassee vorbey, zur Linken eine Wiese mit Vieh, zur Rechten ein gethürmtes Schloß; Pendant zu Nr. 63 Mat.: auf Kupfer Format: oval Maße: Hoch 3 Zoll, breit 4 Zoll Anm.: Die Lose 63 und 64 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1793/09/18 HBSCN 0097 Sammet Breugel I Reisende Personen zu Pferde und zu Fuß, treffen auf der Landstraße eine Bettel=Familie an, welche aus einem blinden Mann, seine Frau die ein Kind wiegt, und ein im Hemde stehendes, an Feuer sich wärmendes Mädchen bestehet, der eine Herr ist abgestiegen und spricht mit den Blinden, der sein Hut um Almosen zu fordern, hinhält. Diese schöne Landschaft, allwo zur Rechten ein dunkler Hayn, zur Linken im Thal Dorfschaften im hellen Lichte erscheinen, macht ein auffallendes Ansehen. [Ohne Rahmen.] I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 16 Vi Zoll, breit 24 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 FGAN [B]0044 Joh. Breugel I Ein Bataillestück, auf Holz gemalt. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Schuh 2 Vi Zoll hoch, 1 406
GEMÄLDE
Schuh 5 Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 FGAN [B]0201 Johann Breugel I Eine Landschaft mit der heiligen Familie, auf Kupfer gemalt. I Mat.: auf Kupfer Maße: 10 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 FGAN [B]0221 Jan Breugel I Eine Winter=Landschaft nebst einem Vogelfange, mit vielen Figuren, gemalt auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 1 Schuh 9 Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt (55 fl) 1794/01/20 LZRST 5864 Brughel I Die Flucht nach Egypten, mit Bluhmen eingefasst, ein vortrefliches meisterh. Bild, von Brughel, auf Holz; die Bluhmen sind der Hauptgegenstand des Bildes, 18 Zoll breit, 24 Zoll hoch, in vergold. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: 18 Zoll breit, 24 Zoll hoch Transakt.: Verkauft oder Unverkauft (12 Gr) Käufer: R[ost] 1794/09/00 LGAN 0019 Johann Breughel I Ein schönes Dorf von Johann Breughel, auf Kupfer, in einer verguldten antiken Rahme. I Mat.: auf Kupfer Maße: breit 1 Schuh 8 Vi Zoll, hoch 1 Schuh 2 Vi Zoll Verkäufer: [Friedrich Karl Ludwig, Freiherr von Moser] Transakt.: Unbekannt (150 rh fl Schätzung) 1794/09/00 LGAN 0047 Sammet-Breughel I Ein Dorf mit Canälen, vom Sammet=Breughel, auf Kupfer, in schwarz gebeizter Rahme. I Mat.: auf Kupfer Maße: breit 10 Vi Zoll, hoch 7 Zoll Verkäufer: [Friedrich Karl Ludwig, Freiherr von Moser] Transakt.: Unbekannt (50 rh fl Schätzung) 1794/09/00 LGAN 0060 Breughel I Eine reich stafirte Landschaft mit Waldung von Breughel, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: breit 2 Schuh 4 Zoll, hoch 1 Schuh 9 Zoll Verkäufer: [Friedrich Karl Ludwig, Freiherr von Moser] Transakt.: Unbekannt (100 rh fl Schätzung) 1794/09/09 HBPAK 0044 Breugel I Jagdpartie und andere sich im Walde aufhaltende Personen, seitwärts ein Dorf, alles mit vieler Delicatesse entworfen. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 24 Zoll, breit 32 Zoll Transakt.: Unbekannt 1794/09/09 HBPAK 0113 Sammit Breugel I Eine ganz vortrefliche äußerst gemahlte Landschaft mit Figuren und andere kleine Gegenstände. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 5 Zoll, breit 8 Zoll Transakt.: Unbekannt 1794/09/09 HBPAK 0168 Sammit Breughel I Eine sehr fleißig gemahlte Landschaft, mit vielen Figuren, Pferde und Wagen ausstaffirt. I Transakt.: Unbekannt 1795/03/12 HBSDT 0020 Breugel I Eine bergigte Gegend. Auf Holz, im schwarzen Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Vi Zoll, breit 12 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1795/03/12 HBSDT 0096 Breughel I Beyde: Linker Hand Passagen zu einem Dorfe welche mit vielen Figuren, Wagen und Horn= Vieh versehen, und vortreflich gruppirt sind. Rechter Hand Flüße, wovon der eine mit Schiffen angefüllt ist. I Diese Nr.: Linker Hand Passagen zu einem Dorfe welche mit vielen Figuren, Wagen und Hom=Vieh versehen, und vortreflich gruppirt sind. Rechter Hand Fluße, der mit Schiffen angefüllt ist Maße: Hoch 17 Zoll, breit 21 Zoll Anm.: Die Lose 96 und 97 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1795/03/12 HBSDT 0097 Breughel I Beyde: Linker Hand Passagen zu einem Dorfe welche mit vielen Figuren, Wagen und Horn= Vieh versehen, und vortreflich gruppirt sind. Rechter Hand Flüße, wovon der eine mit Schiffen angefüllt ist. I Diese Nr.: Linker Hand Passagen zu einem Dorfe welche mit vielen Figuren, Wagen und Horn=Vieh versehen, und vortreflich gruppirt sind. Rechter Hand ein Fluß Maße: Hoch 17 Zoll, breit 21 Zoll Anm.: Die Lose 96 und 97 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1795/03/12 HBSDT 0116 Johann Breughel I Der Brand von Gomorra, mit sehr vielen Figuren; welche sehr brav gezeichnet, und mit großer Delicatesse ausgeführt sind. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 21 Vi Zoll, breit 27 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/00/00 HLAN [0020] Joh. Breughel I Ein Dorf von Joh. Breughel 1 Sch. 2 Vi Ζ. 1 Sch. 8 Vi Z. auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: 1 Sch. 2 Vi Ζ. 1 Sch. 8 Vi Z. Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: [Friedrich Karl Lang] Transakt.: Unbekannt (83.7 Rt; 150 fl Schätzung) 1796/00/00 HLAN [0079] Breughel I Eine Waldgegend. 13. 18. auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: 13. 18. Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: [Friedrich Karl Lang] Transakt.: Unbekannt (30.12 Rt; 55 fl Schätzung) 1796/02/17 HBPAK 0031 Breughels van Velours I Zwey Stillleben. Auf einem Tische stehen Körbe mit Blumen und Früchten angefüllt, wovon einige zerstreut herum liegen. Auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 7 Zoll, Breite 9 14 Zoll Transakt.: Verkauft (49 M) Käufer: Η Goverts 1796/10/17 HBPAK 0269 Joh. Broegel I Zwey plaisant gemahlte bergigte Holzungen, mit biblischen Geschichten. Auf Kupf. I Diese Nr.: Eine plaisant gemahlte bergigte Hölzung, mit biblischer Geschichte Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 10 Zoll 6 Lin., breit 14 Zoll 6 Lin. Anm.: Die Lose 269 und 270 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0270 Joh. Broegel I Zwey plaisant gemahlte bergigte Holzungen, mit biblischen Geschichten. Auf Kupf. I Diese Nr.: Eine plaisant gemahlte bergigte Hölzung, mit biblischer Geschichte Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 10 Zoll 6 Lin., breit 14 Zoll 6 Lin. Anm.: Die Lose 269 und 270 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0168 Breugel I Zwo Landschaften; die eine, ein Flecken, wo Markt gehalten wird; die andere, eine Dorfgegend; voll von Figuren. Sehr gut gemahlt. Auf Kupfer. Schwarzer Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Eine Landschaft; ein Flekken, wo Markt gehalten wird Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 9 Zoll, breit 13 Ά Zoll Anm.: Die Lose 168 und 169 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0169 Breugel I Zwo Landschaften; die eine, ein Flecken, wo Markt gehalten wird; die andere, eine Dorfgegend; voll von Figuren. Sehr gut gemahlt. Auf Kupfer. Schwarzer Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Eine Landschaft; eine Dorfgegend Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 9 Zoll, breit 13 Vi Zoll Anm.: Die Lose 168 und 169 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0091 N. Breughel I Eine Dorflandschaft mit Vieh und Figuren. I Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "N. Breughel", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0099 Broegel I Eine Dorflandschaft in vollem Brande. I Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0106 Broegel I In einer ländlichen Gegend, Figuren die sich unterhalten. I Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0137 Broegel I Zwey Stücke, das erste, Eine Wintergegend, wo viele Figuren sich mit Schlittschuhlaufen belustigen, das andere eine ländliche Gegend mit Hirten und Vieh. I Diese Nr.: Eine Wintergegend, wo viele Figuren sich mit Schlittschuhlaufen belustigen Anm.: Die Lose 137 und 138 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0138 Broegel I Zwey Stücke, das erste, Eine Wintergegend, wo viele Figuren sich mit Schlittschuhlaufen belustigen, das andere eine ländliche Gegend mit Hirten und Vieh. I
Diese Nr.: Eine ländliche Gegend mit Hirten und Vieh Anm.: Die Lose 137 und 138 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0226 Broegel I Zwey Landschaften mit Figuren. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren Anm.: Die Lose 226 und 227 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0227 Broegel I Zwey Landschaften mit Figuren. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren Anm.: Die Lose 226 und 227 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/02/27 HBPAK 0010 Brägel I Ein Winterstück, Betlehem vorstellend, wo Kayser Augustus die erste Schätzung einnehmen lassen. Zur Linken, im Vordergrunde, wo in einem Hause die Schätzung eingenommen wird; zur Rechten, im Vordergrunde, kommt Maria, auf einem Esel reitend, mit Joseph an. Im Hintergrunde sind viele Reisende, welche mit Abladen beschäftigt sind, und kommen noch viele Reisende in der Ferne an. Dieses Bild ist sehr schätzbar wegen seiner Composition, Ordinirung und Conservirung. Eins der schönsten Stücke von diesem Künstler. Auf Leinwand, im goldnen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 51 Zoll, breit 72 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/02/27 HBPAK 0030 Brägel I Ein Italienischer Marktplatz, worauf viele Läden, in welchen Waaren ec. verkauft werden; nebst vielen Figuren. Sehr schön gemahlt. Auf Holz. Im goldn. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 17 Zoll, breit 24 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0085 Breugel I Eine überaus angenehme ländliche Gegend am Wasser; ein flamändisches Festin enthaltend. Ein sowohl in Absicht der Figuren, als der Naturgegenstände sehr unterhaltendes Stück. Auf Holz, mit vergoldeten Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0221 Brögeln I Zwey Landschaften mit Figuren. Auf Kupfer, mit schwarzen Rahm. Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 7 Zoll, breit 10 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0222 Brögeln I Zwey Landschaften mit Figuren. Auf Kupfer, mit schwarzen Rahm. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 7 Zoll, breit 10 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0223 Brögeln I Eine Landschaft mit Figuren. Auf Kupfer, mit schwarzen Rahm. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 7 Zoll, breit 10 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0034 Breugel I Eine Aussicht einer Stadt, wo Jahrmarkt ist, es sind auf diesem Bilde über 300 Figuren theils in Lebensgröße und theils im kleinen; das ganze aber sehr angenehm gruppirt und sehr lebhaft vorgestellt. Auf Holz, goldenen Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 21 Vi Zoll, breit 29 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0095 Breugel I Eine Landschaft, mit vielen Menschen beyderley Geschlechts; einigen Wagens, Pferde und Karren, auch in der Entfernung eine Heerde Schafe. Auf Holz, goldenen Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 10 Zoll, breit 12 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/06/13 HBPAK 0141 Broegel I Eine holländische Dorfgegend, bey Winterzeit vorgestellt, wo alles mit Schnee überdeckt ist. In der Mitte sind auf dem gefrornen Fluß sehr viele, welche sich mit Schlittenfahren und Schrittschuhlaufen belustigen. Besonders fleißig und schön gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 23 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/09/13 FRAN 0039 Sammet Breughel I Eine reich staffirte Landschaft. I Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch 1 Schuh 10 Vi Zoll breit Transakt.: Unbekannt (20 Vi fl) 1797/12/08 HBPAK 0048 Brägel I Eine Bauern=Hochzeit mit vielen Figuren. Auf Holz, im schw. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 10 Zoll, Breite 13 Zoll Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
407
1797/12/08 HBPAK 0146 Breugel I Eine Landschaft, worin der Engel die Hagar tröstet. Auf Holz, im schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 9 Zoll, Breite 8 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/05/14 KOAN 0058 Breugel I Un bocal avec des fleurs. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hauteur 1 pied; Largeur 8 pouces Verkäufer: de Bors d'Overen Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0070 Brägel I Eine bergigte Landschaft mit Figuren, eine Räuberbande vorstellend. Auf das feinste und zärtlichste gemahlt. Auf Kupfer, goldner Rahm. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 7 Vi Zoll, breit 10 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0188 Brägel, senior I Ein Winterstück mit vielen Figuren, wo in einem Dorfe ein Markt, wo Fleisch und Gemüse verkauft wird; im Vordergründe viel Lahme und Krüppel. Auf Holz, goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 32 Zoll, breit 46 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0215 Brägel I Ein Bauer der ein Bauermädgen caressiert. Gut und brav gemahlt. Auf Holz, goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 14 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/08/10 HBPAK 0058 ßrögei I Ein Kirchdorf, im Winter vorgestellt, mit Figuren. Auf Holz, im schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt 1798/11/14 HBPAK 0008 Brägel I Ein Kirchdorf vorstellend, wo ein Jahrmarkt gehalten wird. Mit vielen Figuren. Auf das kräftigste gemahlt. Auf Holz, im schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 23 Zoll, breit 36 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 LZAN 0054 Bruguel, Jean dit de Velours I Un Tableau. Guirlande de fleurs en tout genre, entourant un medaillon en camayeux gris qui reprisente une statue Pagode. Ce tableau reunit au brillant du coloris, verite, fraicheur et delicatesse. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 27 pouces, largeur 20 pouces Transakt.: Unbekannt (16 Louis Schätzung) 1799/00/00 LZRCH 0045 Jean Breughel, dit, De Velourl On joli pay sage d'un site tres etendu, dont le milieu et occupe par un grande chemin, couvert de chariots et figures de voyageurs et passagers; touchees avec beaucoup d'esprit. I Mat.: auf Holz Maße: h. 8. 1. 10 pouces Verkäufer: J F Rauch Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 LZRCH 0064 Breughel I Un tab. representant un vase avec des fleurs. I Mat.: auf Kupfer Maße: h. 10.1. 7. pouces Verkäufer: J F Rauch Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0275 Johann Breughel, genannt Sammet Breughel I Eine Landschaft, worauf ein Scharmützel ist, von Johann Breughel, genannt Sammet Breughel. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh breit 1 Schuh 3 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0411 Johann Breughell, genannt BlumenBreughel I Ein Blumenkranz, mit der h. Familie. Die Blumen von Johann Breughell, genannt Blumen-Breughel. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 1 Zoll breit 1 Schuh 7 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0280 Johann, genannt Blumen-Breughel I Ein Blumenstückchen, in der Mitte ein Todtenkopf, von Johann, genannt Blumen-Breughel. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh breit 10 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/08/09 HBPAK 0033 Von denfruweelen Breughel I Zwey bergigte Landschaften mit Figuren. Auf Holz, goldn. Rahm. I Diese Nr.: Eine bergigte Landschaft mit Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 15 Zoll Anm.: Die Lose 33 und 34 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 408
GEMÄLDE
1799/08/09 HBPAK 0034 Von denfruweelen Breughel I Zwey bergigte Landschaften mit Figuren. Auf Holz, goldn. Rahm. I Diese Nr.: Eine bergigte Landschaft mit Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 15 Zoll Anm.: Die Lose 33 und 34 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/08/09 HBPAK 0048 Breughel I Zwey bergigte Landschaften mit vielen Figuren. Wenn man die von der Seite ansiehet, so stellet es ein Manns= und Frauenskopf vor. Sehr schön und sonderbar gemahlt. Auf Leinwand, goldn. Rahm. I Diese Nr.: Eine bergigte Landschaft mit vielen Figuren. Wenn man die von der Seite ansiehet, so stellet es ein Mannskopf vor Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 22 Zoll, breit 28 Zoll Anm.: Die Lose 48 und 49 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/08/09 HBPAK 0049 Breughel I Zwey bergigte Landschaften mit vielen Figuren. Wenn man die von der Seite ansiehet, so stellet es ein Manns= und Frauenskopf vor. Sehr schön und sonderbar gemahlt. Auf Leinwand, goldn. Rahm. I Diese Nr.: Eine bergigte Landschaft mit vielen Figuren. Wenn man die von der Seite ansiehet, so stellet es ein Frauenskopf vor Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 22 Zoll, breit 28 Zoll Anm.: Die Lose 48 und 49 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0027 Brägel I Eine Bauern=Kirchmeße mit vielen Figuren, welche sich mit tanzen und Musik belustigen. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 17 Zoll, breit 24 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0065 Brägel I Ein Land= und Wasserprospekt mit vielen Lustschiffen und Figuren. Kräftig gemahlt. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Zoll, breit 13 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0092 Brägel I Ein Blumenstück. Ein steinerner Topf, worin verschiedene Blumen. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 22 Zoll, breit 18 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0172 Brägel I Ein Winterstück mit vielen Figuren, die Verehrung Christi von den Weisen aus Morgenland vorstellend. Gut ordinirt und gemahlt. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 22 Zoll, breit 25 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0190 Brägel I Eine bergigte Landschaft. Im Vordergrunde vor dem Berge reisende Figuren. Kräftig und brav gemahlt. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 29 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0234 Brägel I Zwey Dorf= und Landgegenden. Auf der Einen im Mittelgrunde eine Windmühle, nach welcher, über der Landstraße, Getraide gefahren wird. Die Andere ein Kirchdorf, wo von dem Hirten das Vieh ausgetrieben wird. Gut und kräftig gemahlt. Auf Holz. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine Dorf= und Landgegend. Auf der Einen im Mittelgrunde eine Windmühle, nach welcher, über der Landstraße, Getreide gefahren wird Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 Vi Zoll, breit 6 Vi Zoll Anm.: Die Lose 234 und 235 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0235 Brägel I Zwey Dorf= und Landgegenden. Auf der Einen im Mittelgrunde eine Windmühle, nach welcher, über der Landstraße, Getreide gefahren wird. Die Andere ein Kirchdorf, wo von dem Hirten das Vieh ausgetrieben wird. Gut und kräftig gemahlt. Auf Holz. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine Dorf= und Landgegend. Die Andere ein Kirchdorf, wo von dem Hirten das Vieh ausgetrieben wird Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 Vi Zoll, breit 6 Vi Zoll Anm.: Die Lose 234 und 235 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/12/23 WNAN 0060 Breugel de Veloure I Trois petites payssages. I Transakt.: Unbekannt
1799/12/23 WNAN 0071 Briügel de Velours I Un Concert d'Oiseaux. I Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 BLBOE 0057 J. Breugel I Eine Landschaft. Im Vorgrunde links ein Haus mit einem Laden, vor welchem ein Karren steht; ein Mann ist beschäftigt, das zerbrochene Rad wieder aufzurichten. Marktleute gehen hin und her. Im zweiten und dritten Plan eine Mühle. Im Hintergrunde der Prospekt einer großen Stadt. I Mat.: auf Kupfer Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN1 0024 Brueghel I Eine perspektivische Ansicht vom Lauf eines Flusses, welcher sich durch einen waldigen Thal schlänglet [sie]; Im ersten Plan sind zwei hohe Felsen, mit Gebäude; zwei Flotze mit mehreren Figuren laufen zwischen den Felsen durch; am Ufer sind zwei Reuter. I Mat.: auf Holz Maße: 13 Vi Zoll hoch, 17 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN1 0025 Brueghel I Zwei holl. Landschaften, auf der eine sieht man das Schloß von Teniers; beide sind schöne u. fleißig gearbeitete Stück. I Diese Nr.: Eine holl. Landschaft, worauf man sieht das Schloß von Teniers Mat.: auf Kupfer Maße: 9 Vi Zoll hoch, 12 Zoll breit Anm.: Die Lose 25 und 26 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN1 0026 Brueghel I Zwei holl. Landschaften, auf der eine sieht man das Schloß von Teniers; beide sind schöne u. fleißig gearbeitete Stück. I Diese Nr.: Eine holl. Landschaft Mat.: auf Kupfer Maße: 9 Vi Zoll hoch, 12 Zoll breit Anm.: Die Lose 25 und 26 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN1 0027 Brueghel I Eine Landschaft mit Wagen, Pferde u. vielen Figuren staffir[t]. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN1 0028 Brueghel I Zwei kleine sehr artige Landschaften. I Diese Nr.: Eine kleine sehr artige Landschaft Mat.: auf Holz Anm.: Die Lose 28 und 29 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN1 0029 Brueghel I Zwei kleine sehr artige Landschaften. I Diese Nr.: Eine kleine sehr artige Landschaft Mat.: auf Holz Anm.: Die Lose 28 und 29 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN2 0108 Breughel (Summe t) I Zwey Landschaften mit Figuren. Auf dem einen bemerkt man eine Windmühle, auf dem andern eine Heerde Vieh. Beyde sind mit besonderm Kunstfleiß ausgeführt. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren und einer Windmühle Mat.: auf Kupfer Maße: 6 Zoll hoch, 7 Zoll breit Anm.: Die Lose 108 und 109 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN2 0109 Breughel (Sammet) I Zwey Landschaften mit Figuren. Auf dem einen bemerkt man eine Windmühle, auf dem andern eine Heerde Vieh. Beyde sind mit besonderm Kunstfleiß ausgeführt. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren und einer Heerde Vieh Mat.: auf Kupfer Maße: 6 Zoll hoch, 7 Zoll breit Anm.: Die Lose 108 und 109 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/00/00+ LZRST [0015] Johan. Breughel de Velours I Eine Dorfkirmes mit unendlich vielen Figuren. I Mat.: auf Holz Maße: 29 Zoll breit 24 Zoll hoch Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Rost Transakt.: Unbekannt 1800/07/09 HBPAK 0069 Breughel I Deux processions, l'une de femmes et l'autres d'hommes, conduites vers l'eglise dans la Campagne par 2 Epoux qui vont etre unis. Sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: 15 pouces de hauteur. Sur 21 pouces de largeur Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK akt. : Unbekannt
0257
Brägel I Zwey Landschaften. I Trans-
1800/11/12 HBPAK 0563 Transakt.: Unbekannt
Breugel I Zwey Landschaften. I
Brueghel, Jan (der Ältere) (und Baien, Η. (I)) 1744/05/20 FRAN 0225 Van Baalem; Breugel I 2 Sehr feine und wohlgemachte Stück eines von Van Baalem & Breugel, das andere von Elsheimer. I Diese Nr.: 1 Sehr fein und wohlgemachtes Stück; Nr. 226 von A. Elsheimer Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 5 Zoll, Breite 8 Zoll Anm.: Die Lose 225 und 226 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1759/00/00 LZEBT 0112 Breugel; van Baalen I Eine Landschaft von Breugel und van Baalen auf Holtz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 2 Schuh 4 Zoll, Breite 2 Schuh 6 Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (200 Th Schätzung) 1763/01/19 FRJUN 0038 Van Baien; Breugel I La vierge avec l'Enfant Jesus bordee d'une Guirlande, tres jolie piece, bien rangee & le tout parfaitement acheve. I Maße: hauteur 24 pouces, large 18 pouces Transakt.: Unbekannt (50 Vi fl) 1764/00/00 BLAN 0628 van Baelen; Brougel de felour I 1. sehr Capitales Gallerie gemählde stellet in natürlicher große, Venus und Cupido vor, in der ferne siehet man man den Vulcanus der waffen schmidet, die Früchte und bluhmen sind von Brougel de felour gemahlt. I Maße: 6 Fuß 3 Zoll hoch, 4 Fuß 8 Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (900 Rt Schätzung) Gegenw. Standort: Sankt-Peterburg, Rossiya. Ermitazh. (N 3256) als Hendrik van Baien 1768/07/00 MUAN 0051 Breughel; van Balem I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0052 Breughel; van Balem I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0053 Breughel; van Balem I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0054 Breughel; van Balem I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0890 Breughel; van Balem I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0056 Breüghel; Van Baalen I Les Bains de Diane, avec le curieux Acteon dans un paysage. Peint sur cuivre. I Mat.: auf Kupfer Maße: 4. pouces de haut sur 7. pouces de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1778/09/28 FRAN 0245 van Baalen; Breughel I Ein sehr fleißig gemaltes Marienbild in einem schönen Blumenkranz, von van Baalen und Breughel. [Une S. Vierge tres bien peinte dans une belle couronne de fleurs, par van Baalen & Breughel.] I Maße: 1 Schuh 7 Zoll breit, 2 Schuh 1 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (60.30 fl) Käufer: Jos Brentano GEMÄLDE
409
1778/09/28 FRAN 0652 van Baalen; Breughell I Der Compagnon, ein Venusbad, von van Baalen, die Figuren und die Landschaft von Breughell. [Le pendant du precedent, un bain de Venus, les figures par van Baalen & le paysage par Breughell.] I Pendant zu Nr. 651 von Chr. Schütz (I) und G.M. Kraus Maße: 1 Schuh 4 Zoll breit, 10 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (70.30 fl) Käufer: Nothnagel 1778/10/30 HB KOS 0041 Breugel; Baalen I Venus und Diana in einem Gehölze, plaisant und fleißig gemahlt, auf Holz, von Breugel und Baalen. I Mai.: auf Holz Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0045 Van Buten: Breughels de Velour I Alliance de Bacchus & de Γ Amour. Bacchus est au milieu assis sur une tonne, le bras gauche eleve tenant un ver ä la main, comme pour marquer son triomphe, autour de lui plusieurs Personnages, comme Bacchantes portant des paniers de raisins, ä droite Venus assise & l'Amour ä ses pieds, lui tendant une main. Ce Tableau est peint sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: 14 pouces & 4 lignes, de large Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/07/18 FRAN 0055 Baalen; Brugell I Ein Marien=Bild im Blumenkranz auf Holz, von Baalen Brugell. I 'Mat.: auf Holz Maße: 2 Schuh hoch, 1 Schuh 6 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1782/01/28 LZAN 4151 Heinrich von Baalens; Joh. Breugel I 4 Stück Landschaften, die 4 Elemente vorstellend. Sehr schön, schwarz und goldner Rahm, 1 Elle 7 Vi Zoll breit, 20 Zoll hoch, auf Holz. Die Figuren sind von Heinrich von Baalens, die Landschaft und das übrige von Joh. Breugel. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Elle 7 Vi Zoll breit, 20 Zoll hoch Verkäufer: Caroli Ferdinandi Hommelii Transakt.: Unbekannt 1784/08/02 FRNGL 0613 van Baalen; Breughell I Verschiedene Frauens=Personen, welche sich an einer Fontaine in einem Garten mit Baaden beschäftigen, von van Baalen & Breughell. I Maße: 23 Vi Zoll breit, 18 Zoll hoch Transakt.: Verkauft (27.15 fl) Käufer: Bäumer 1785/05/17 MZAN 0781 Breughel; van Baien I Ein Blumenkranz, in dessen Mitte die Mutter Gottes mit dem Jesukind und der H. Joseph vorgestellet sind, auf Kupfer von Breughel, die Figuren von van Baien. [La S. Vierge avec l'enfant Jesus & S. Joseph representee au milieu d'une couronne de fleurs, les figures par van Baien, les fleurs par Breughel de velour.] I Pendant zu Nr. 782 Mat.: auf Kupfer Maße: 5 Vi Zoll hoch, 4 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (16 fl für die Nrn. 781 und 782) Käufer: Hofr ν Leykam 1785/05/17 MZAN 0782 Breughel; van Baien I Das Gegenbild, ein Früchtenkranz, in dessen Mitte Christus, wie er Magdalenen erscheint, vorgestellet ist, von eben denen beiden Meistern [Breughel und van Baien] auf Kupfer, und von eben der Höhe und Breite. [Le pendant, Jesus Christ apparoissant ä Madelaine represente au milieu d'une couronne de fruits par les memes Maitres [van Baien & Breughel de velour] sur cuivre, mSme hauteur & largeur. I Pendant zu Nr. 781 Mat.: auf Kupfer Maße: 5 Vi Zoll hoch, 4 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (16 fl für die Nrn. 781 und 782) Käufer: Hofr ν Leykam 1785/05/17 MZAN 0798 Breughel; van Baien I Christus wie er Magdalenen als Gärtner erscheint, die Landschaft von Breughel, die Figuren von van Baien. [Jesus Christ en jardiner apparoissant ä Madelaine, le paysage par Breughel de velour, les figures par van Baien.] I Maße: 1 Schuh 8 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 5 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (26 fl) Käufer: Strecker 1786/10/18 HBTEX 0303 von Baalen; Breugel I Die heilige Familie, in einer Landschaft, von von Baalen ot [sie] Breugel. I Transakt.: Unbekannt 1788/06/12 HBRMS 0040 von Baalen; und Breugel I In einer angenehmen ländlichen Hölzung sitzen im Vorgrunde Bacchus, Ceres und Venus mit Amor zur Linken, der dem Bacchus ein Trinkge410
GEMÄLDE
fäß mit rothem Wein gereicht zu haben scheint. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 25 Zoll, breit 20 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1791/05/28 HBSDT 0121 Breughel; Henricus van Baalen I Dieses unschätzbare und gewiß eines der vorzüglichsten und fleißigsten Stücken dieses grossen Meisters, stellet einen dicken Wald vor; in der Mitte eine Oeffnung und zur Linken eine Aussicht über einer bergigten Gegend, welche von einen Fluß getheilt wird, an dessen Ufer man eine Menge Städte und Dorfe gewahr wird. - Im Vordergrunde ein kleines Gewässer. Dies Stück wird noch sehr verädelt durch die von H. van Baalen darin gemachte Staffage. Die Geschichte, wie die Latona dem Jupiter um Rache gegen die Bauren anflehet, der sie in Frösche verwandelt. In allen 15 Figuren mit Nebensachen. Kunst und Fleiß wetteifern gleichsam in diesem Stücke um die Wette. - Gemahlt auf Holz. In einen aparten Kasten. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Zoll, breit 23 % Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/09/13 FRAN 0018 Baalen; Breughel I Eine büssende Magdalena. I Maße: 8 Zoll hoch 10 Zoll breit Transakt.: Unbekannt (15 Vi fl) 1798/12/10 WNAN [0070] Van Baien; Breughls I Das erste stellt Diana vor, die nach geendigter Jagd ausruhet, neben und hinter ihr sind drey ihrer Gespielinnen, die theils ihre Jagdgeräthschaften, theils verschiedene erlegte Thiere tragen. Zwey Genien weiblichen Geschlechts, biethen der Göttinn aller Gattung Früchte dar - und im Hintergrunde sieht man noch einige ruhende und sich besprechende weibliche Figuren. Alles dieses ist in einer überaus angenehmen Landschaft vorgestellet. Die Figuren sind von Van Baien mit einer bewunderungswürdigen Wahrheit und Delicatesse gemahlt - und das vorkommende Gewilde nebst den Vögeln und Früchten sind auf eine täuschende, ausserordentlich geistreiche und delicate Art behandelt. - Die Landschaft ist von Breughls, und in seiner besten Manier gemahlt, besonders schön sind in solcher die in dem Vorgrunde befindlichen Details von Gewächsen und Kräutern, die mit einer ausnehmenden Sorgfalt ausgeführet sind - die Zeichnung ist, ungeachtet man den niederländischen Geschmack daran nicht verkennet, edel und richtig, und die Färbung hat jenen freudigen Ton, der dieser Schule besonders eigen ist. I Anm.: Da dieses Los in diesem Katalog nicht numeriert ist, wurde die Nummer hinzugefügt. Verkäufer: Prof Adam Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0311 Paalen; Breughel I Fünf Stücke, das Paradies vorstellend. Die Figuren sind von Paalen, die Landschaft von Breughel. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Stück, das Paradies vorstellend Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 8 Zoll breit 2 Schuh 11 Zoll Anm.: Die Lose 311 bis 315 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0312 Paalen; Breughel I Fünf Stücke, das Paradies vorstellend. Die Figuren sind von Paalen, die Landschaft von Breughel. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Stück, das Paradies vorstellend Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 8 Zoll breit 2 Schuh 11 Zoll Anm.: Die Lose 311 bis 315 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0313 Paalen; Breughel I Fünf Stücke, das Paradies vorstellend. Die Figuren sind von Paalen, die Landschaft von Breughel. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Stück, das Paradies vorstellend Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 8 Zoll breit 2 Schuh 11 Zoll Anm.: Die Lose 311 bis 315 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0314 Paalen; Breughel I Fünf Stücke, das Paradies vorstellend. Die Figuren sind von Paalen, die Landschaft von Breughel. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Stück, das Paradies vorstellend Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 8 Zoll breit 2 Schuh 11 Zoll Anm.: Die Lose 311 bis 315 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0315 Paalen; Breughel I Fünf Stücke, das Paradies vorstellend. Die Figuren sind von Paalen, die Landschaft
von Breughel. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Stück, das Paradies vorstellend Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 8 Zoll breit 2 Schuh 11 Zoll Anm.: Die Lose 311 bis 315 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Brueghel, Jan (der Ältere) (und Bassen) 1763/01/17 HNAN 0010 van Bassen; Breuget I Vue Interieure & belle Perspective d'une Eglise Catolique avec nombre de figures 1625. L'architecture de van Bassen & les Figures de Breugel, sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 2 pieds 10 pouces, Largeur 4 pieds 2 pouces Inschr.: 1625 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt
Brueghel, Jan (der Ältere) (und Bril, P.) 1776/04/15 HBBMN 0114 Paul Bril; Brägel I Eine Landschaft mit einer Eremitage, von Paul Bril, die Figuren von Brögel. I Maße: Höhe 1 Fuß 8 Zoll, Breite 2 Fuß 7 Zoll Transakt.: Unverkauft 1778/07/21 HBHTZ 0073 Paul Brill; Breugel I Eine bergigte Land Gegend, auf Holz, von Paul Brill, die Figuren von Breugel, sehr schön gemahlt. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 20 Zoll, breit 29 Zoll Transakt.: Unbekannt (18 M) 1779/00/00 HB AN 0329 Bril; die Stajfirung von Breughel I Ein Fluß schlängelt sich zwischen hohen Gebirgen in die blaue Ferne. Reisende ziehen auf dem Wege zur Rechten näher. Auf Holz. [Une riviere s'etend en serpentant entre de hautes montagnes jusqu'au lointain azure. Des voyageurs avancent de la droite. Sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 7 Zoll hoch, 2 Fuß 8 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0330 Bril; die Stajfirung von Breughel I Auf steilen Felsen steigt ein Schloß empor, neben welchem der Weg in tiefe Klippen fortgeht, worauf einige Reisende mit ihren bepackten Maulthieren ziehen. Der hinunter schleichende Fluß bewässert die sich in die Ferne erstreckenden Gebirge. Auf Holz. [Sur des rochers escarpes s'eleve un chateau, ä cöte duquel le chemin s'etend le long de profonds precipices: des voyageurs y passent avec leurs mulets charges. Une riviere qui coule avec lenteur baigne le pied des montagnes qui s'etendent au loin.]. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 7 Zoll hoch, 2 Fuß 8 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt
Brueghel, Jan (der Ältere) (und Dyck, Anth. van) 1768/07/00 MUAN 0153 Dyck (Ant. van); Breughel I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
Brueghel, Jan (der Ältere) (und Francken oder Vrancx) 1723/00/00 PRAN 0132 Breugel; Franck I Die vier Elemmenten / vom Breugel und Franck in Metallinen Rahmen. I Maße: Höhe 1 Vi Schuh 3 Vi Zoll, Breite 2 Vi Schuh 2 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0528 Breughel; Franck I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0027 Breüghel; Franck I Une couronne de fleurs dans laquelle sont distribues ä propos les cinq Misteres de la Naissance & de la Vie de nötre Seigneur Jesus Christ. Aux quatre
coins sont les quatre Evangelistes, entoures de fleurs. Peint sur bois, marque du No. 528. I Mat.: auf Holz Maße: 3. p. 8. p. de haut sur 2. p. 9. p. de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0043 Breüghel; Franck I Une Couronne de fleurs, dans le milieu est la Vierge avec l'Enfant Jesus. Peints sur bois marquee du No. 153. I Mat.: auf Holz Maße: 2. p. 10. p. de haut sur 2. p. 2. p. de large Verkäufer: Franjois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1799/10/18 LZAN 0073 Frank; Breughel I Maria stehet bey dem Kind Jesu; in einem Medaillon; hoch 25 Zoll, br. 22 Zoll. Auf Holz, in einem grauen Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 25 Zoll, br. 22 Zoll Verkäufer: Rauch Transakt.: Verkauft (3 Th) Käufer: Schwarz
Brueghel, Jan (der Ältere) (und Kessel, Ferd.) 1789/00/00 MMAN 0207 Johann Brueghell; Ferdinand van Kessel I Vulcanus und Venus vorstellend die Armatur von Frankreich auf Holz. [Vulcain et Venus representants Γ armature de la France, sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 10 Zoll hoch, 2 Fuß 11 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (33 fl)
Brueghel, Jan (der Ältere) (und Momper, J. (II)) 1723/00/00 PRAN 0101 Mompart; Breugel I 2. Landschafften vom Mompart / und Breugel / in Metall. Rahmen. I Diese Nr.: Eine Landschafft Maße: Höhe 3 Vi Schuh 3 Zoll, Breite 5 Schuh 4 Zoll Anm.: Die Lose 101 und 102 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN 0102 Mompart; Breugel I 2. Landschafften vom Mompart / und Breugel / in Metall. Rahmen. I Diese Nr.: Eine Landschafft Maße: Höhe 3 Vi Schuh 3 Zoll, Breite 5 Schuh 4 Zoll Anm.: Die Lose 101 und 102 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1763/01/19 FRJUN 0119 Momper; Breugel I Un tres beau pa'isage montagneux orne de plusieurs figures tres bien acheve. I Maße: hauteur 30 pouces, large 37 pouces Transakt.: Unbekannt (22 fl) 1778/05/16 HBBMN 0036 Momper; Brögel I Eine Landschaft, von Momper, mit Figuren, von Brögel. I Transakt.: Unbekannt 1778/05/23 HBKOS 0037 Mompert; Breugel I Eine meisterhafte Landschaft, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 18 Vi Zoll, Breite 27 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/09/28 FRAN 0531 Mompert; Breughell I Vorstellung, wie Johannes der Täufer in der Wüste predigt. [S. Jean Baptiste prechant dans le desert.] I Maße: 3 Schuh 2 Zoll breit, 1 Schuh 7 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (49.30 fl) Käufer: Hüsgen 1778/09/28 FRAN 0621 Mompert; Breughell I Ein sehr schöner Babylonischer Thurm, von Mompert und Breughell. [Une tres belle piece representante la tour de Babel.] I Maße: 2 Schuh 5 Zoll breit, 1 Schuh 8 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (130 fl) Käufer: Goentgen 1778/10/30 HBKOS 0079 Mompert; Breugel I Eine extra schöne arcadische Landschaft, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 16 Zoll, breit 27 Zoll Transakt.: Unbekannt 1779/09/27 FRNGL 0851 Mompert; Breughell I Der Babylonische Thurm=Bau, sehr fleißig und mühsam ausgeführt, mit vielen Figuren von Mompert und Breughell. [La tour de Babel, tres belle piece, avec beaucoup de figures.] I Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 1 Schuh 6 Zoll breit Transakt.: Verkauft (40 fl) Käufer: Stöber 1782/03/18 HBTEX 0233 Mompert; Breugel I Eine ländliche Gegend bey Mondenlicht. Zur rechten brennen einige Landhäuser, GEMÄLDE
411
aus welchen Effecten getragen werden, lebhaft vorgestellet, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 21 Zoll 6 Linien, Breite 27 Zoll 6 Linien Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/07/00 FRAN 0166 Mompert; Breughel I Eine schöne wohlausgeführte Landschaft, welche mit fleißig gemalten Figuren ausgeziert ist, von Mompert und Breughel. I Pendant zu Nr. 167 von Chr. Schütz (I) Maße: 1 Schuh hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt (19.15 fl für die Nrn. 166 und 167) 1784/08/02 FRNGL 0159 Momperte; Breugel I Eine keckgemahlte Landschaft von Momperte und Breugel. I Maße: 21 Vi Zoll breit, 18 Zoll hoch Verkäufer: C Transakt.: Verkauft (2.2 fl) Käufer: Bäumer 1785/05/17 MZAN 0129 Momper; Breughel I Eine Landschaft von Momper, die Figuren von Breughel. [Un pay sage par Momper, les figures par Breughel de Velour.] I Maße: 1 Schuh 7 Zoll hoch, 2 Schuh 8 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (19 fl) Käufer: Hofrat ν Leykam 1786/10/18 HBTEX 0320 Mompert; Breugel \ Eine Landschaft, von Mompert et Breugel. I Transakt.: Unbekannt 1788/10/01 FRAN 0024 Momper; Sammel Breughel I Eine Landschaft mit Figuren und Pferden, von Momper und Sammel Breughel. I Maße: 14 Zoll hoch, 18 Zoll breit Transakt.: Verkauft (5.15 fl) Käufer: von Schmid 1788/10/01 FRAN 0123 Momper; Breugel I Eine bergichte Landschaft von Momper, die Figuren sind von Breugel. I Maße: 21 Zoll hoch, 31 Zoll breit Transakt.: Verkauft (9 fl) Käufer: Heussel 1788/10/01 FRAN 0128 Momper; Sammet Breugel I Eine bergichte Landschaft von Momper, in dem Vordergrund ist eine Schlacht, von Sammet Breugel gemalt. I Maße: 15 Zoll hoch, 24 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (7 fl) Käufer: Heussel 1789/00/00 MMAN 0268 Monpre; Brueghel I Eine Landschaft den Diogenes im Fass vorstellend, auf Leinw. 2 Fuß 2 Zoll hoch und 3 Fuß 1 Zoll breit, vom Monpre und Brueghel. [Un paysage avec Diogene dans un tonneau, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 2 Zoll hoch, 3 Fuß 1 Zoll breit Anm.: Dieses Los trägt in der französischen Fassung des Katalogs irrtümlich die Nr. 267. Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (11 fl) 1790/02/04 HBDKR 0036 Mompert; Breugel I Eine gebürgigte Gegend, welche sich durch ein in der Mitte hindurch schlängelndes Wasser theilet; zu beiden Seiten siehet man auf den steilen Felsen Schlösser, welche meistens mit Bäumen umgeben, im Vorgrunde gehet über dem Fluß eine hohe Brücke, welche zugleich mit zur Landstraße dienet; worauf verschiedene Reisende theils zu Pferde theils zu Fuß sich befinden, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 36 Zoll, breit 44 Zoll Transakt.: Verkauft (10.8 M) Käufer: Dittmer 1791/09/21 FRAN 0005 Momper; Breugel I Eine Landschaft, wo zur Rechten und zur Linken Felsen sind, worüber eine wankende Brücke geht, wovon die Mitte ein Fluß ist, welcher einen Wasserfall vorstellt, der Anblick bietet eine bergigte Gegend und ein Schloß in dicken Gebüschen dar. I Transakt.: Verkauft (12 fl) Käufer: Levy 1793/00/00 NGWID 0179 Montpert; Breigel I Eine Landschaft mit einigen Figuren, von Montpert und Breigel. I Pendant zu Nr. 180 Maße: 2 Schuh hoch, 2 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0180 Montpert; Breigel \ Zum Gegenstück, wie Reisende unter dickbelaubten Bäumen ausruhen, von nemlicher Hand [Montpert und Breigel] und Maaß. I Pendant zu Nr. 179 Maße: 2 Schuh hoch, 2 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 412
GEMÄLDE
1796/00/00 HLAN [0084] Breughel; Momper I 2 Landschaften. 5. 8. auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: 5. 8. Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: [Friedrich Karl Lang] Transakt.: Unbekannt (12.5 Rt; 22 fl Schätzung) 1800/00/00+ LZRST [0070] Jodoc. Momper; Breughel I Einsicht in ein Dorf mit vielen Figuren und Vieh. Die Staffage ist von Breughel. I Mat.: auf Holz Maße: 27 Zoll breit 18 Zoll hoch Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Rost Transakt.: Unbekannt
Brueghel, Jan (der Ältere) (und Neeffs, P. (I)) 1764/05/18 BLAN 0012 Peter Neeffs; Breugel I Das Innere einer schönen Gothischen Kirche mit kleinen Figuren von Breugel gemahlt. In diesen beyden Gemählden hat Peter Neeffs alle Schönheiten ausgedruckt, welche die Kunst in dieser Art von Vorstellungen darzeigen kann. Das Nachtstück insbesondere ist bewunderswürdig schön, diese beyden Stücke hat Neeffs Ao. 1666. verfertiget. [Text hier gekürzt]. I Pendant zu Nr. 13 von P. Neeffs (I) Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 4 Zoll hoch, und 2 Fuß 1 Zoll breit Inschr.: Ao. 1666 (datiert?) Anm.: Die Lose 12 und 13 wurden zusammen katalogisiert. Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Johann Georg Eimbke Transakt.: Verkauft (300 Rt für die Nm. 12 und 13) Käufer: Ghk Eichel
Brueghel, Jan (der Ältere) (und Pepyn, M.) 1789/00/00 MMAN 0059 Johann Brueghel; Pepyn I Eine Landschaft, mit Figuren, auf Holz, 2 Fuß 1 Zoll hoch und 3 Fuß 8 Zoll breit, vom Johann Brueghel, die Figuren sind von Pepyn. [Un paysage avec figures, sur bois, de 2 p. 1 pouce de haut, sur 3 pieds 8 pouces de large, par Jean Brueghel, les figures, par Pepyn.] I Mat.: auf Holz Maße: 2 Fuß 1 Zoll hoch, 3 Fuß 8 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (33 fl)
Brueghel, Jan (der Ältere) (und Rottenhammer, Η. (I)) 1744/05/20 FRAN 0163 Rottenhammer; Breugel I 1 Extra schön Stück der Evangelist Johannes. I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 1 Schuh 1 Vi Zoll, Breite 10 Zoll Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1778/07/21 HBHTZ 0087 Breugel; Rothenhammerl Die Missende Magdalena, in einer angenehmen Landschaft, schön gemahlt, die Landschaft von Breugel, die Figuren von Rothenhammer, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 40 Zoll, breit 68 Zoll Transakt.: Verkauft (10.8 M) Käufer: Köster 1779/09/27 FRNGL 0416 Rottenhammer; Breughell I Die Mutter Gottes mit dem Jesukindlein, über derselben zwey fliegende Engel, in einer sehr schönen blumigten Landschaft, die Figuren von Rottenhammer, und die Landschaft von Breughell. [La S. Vierge avec l'enfant Jesus, au dessus d'elle deux anges dans les airs, tres belle perspective, les figures par Rottenhammer, le paysage par Breughell.] I Maße: 1 Schuh 7 Zoll hoch, 2 Schuh breit Transakt.: Verkauft (40 fl) Käufer: Gogel 1781/09/10 BNAN 0128 Rottenhamer; I. Breugel I Unter dem Baum des Lebens, auf welchem verschiedene Papagoyen und andere Vögel sitzen, empfängt Eva aus dem Munde der Schlange den Apfel; einem andern hat sie an dem neben ihr sitzenden, sie um die Hälfte umfassenden Adam gereicht; vor ihr ruhen einige Böcke und ein Schafhund; zur Seite ein größerer; weiter nach hinten ein Pferd, Cammeel, Stier und schwimmendes Geflügel, nebst einigen andern, theils stehenden, theils liegenden; das hoch aufsteigende Gehölze wird durch ein Wasser durchströhmet; Figuren und Thiere von Rottenhamer, in seiner besten, fleißigeren und lebhafteren Färbung; die
Landschaft von I. Breugel. g.R. [im verguldeten Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: 15 Zoll hoch, 11 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1783/06/19 HBRMS 0179 Breughel; Rothenhammerl In der Mitte unter hohen Bäumen sitzen Bachus Venus und Ceres an einer mit Früchten besetzten Tafel; rechter Seite wird Vieh geweidet, zur Linken am Berge fließt Wasser; im Hintergrunde Gebürge mit Schlösser. K[upfer]. g.R. [verguldeter Rahm] I Mat.: auf Kupfer Maße: 1 Fuß 10 Zoll hoch, 2 Fuß 10 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1784/09/27 FRAN 0068 Rothenhammer; Breughels I Ein Stück mit sehr schönen und fleißig ausgearbeiteten Kindern von Rothenhammer die Landschaft von Breughels. [Une piece representante des enfans tres bien peints par Rothenhammer, le paysage par Breughels.] I Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 11 Zoll breit Verkäufer: Freyherr von Berberich Transakt.: Verkauft (42 fl) Käufer: Kaller 1790/08/25 FRAN 0324 J. Rottenhammer; van Brughell Eine nackende Venus, von J. Rottenhammer, in einer Landschaft, von van Brughel. I Maße: hoch 5 Vi Zoll, breit 7 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (5.30 fl) Käufer: Kaller 1794/00/00 HB AN 0041 I. Breughel; I. Rottenhammer i Die in einer lieblichen Landschaft, aus dem Bade steigende Diana und ihre Nymphen werden von Aktäon überfallen. In der Bestürzung geben die treflich gruppirten Halbgöttinnen bloss, was sie so sorgfaltig zu verbergen suchen, und der arme Jüngling fühlt, im Anschauen versunken, nicht den Fluch der strengen Göttin der seinem Haupte sich zeiget. I Maße: Höhe 17 Vi Zoll, Breite 25 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1796/02/17 HBPAK 0083 Rothenhammer; Breughels I Im Vordergrunde einer Holzung unterredet sich Endymion mit Diana und einer ihrer Gespielinnen, indem Amor den Endymion, welcher im Begriff ist wegzugehen, beym Kleide fasst und zurückhalten will. Zur Linken sind noch zwey Genien. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 14 Zoll, Breite 19 Zoll Transakt.: Verkauft (110 M) Käufer: Kreuter 1796/02/17 HBPAK 0206 Rothenhammer; Breughel I Die heilige Familie auf der Flucht nach Egypten, mit Engeln umgeben, im Vordergrunde einer Landschaft, bey grossen Bäumen, vorgestellt. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 38 Zoll, Breite 30 Zoll Transakt.: Verkauft (81 M) Käufer: Packi 1798/06/04 HBPAK 0100 Brägel; Rothenhamer I Brägel, die Landschaft und Figuren von Rothenhammer. Eine Landschaft mit Figuren, ein Bachusfest vorstellend. Ganz gut gemahlt. Auf Holz, schwarzer Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 33 Zoll, breit 42 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0361 Breughel; Rotenhammer I Eine sehr fleißige Landschaft vom ersten Meister, worin man nackende Kinder tanzend vom letzten Künstler vorgestellt bemerkt. Ein sehr seltenes und kostbares Gemähide. Auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 12 Zoll, breit 15 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0497 Johann Rottenhamer; Johann Breughel I Ein mythologisches Stück. Mehrere Weibspersonen machen Musik; einige Satyren oder Faunen hören zu, und in der Ferne ist eine Landschaft. Die Figuren sind von Johann Rottenhammer, und die Landschaft von Johann Breughel. Auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: hoch 1 Schuh 2 Zoll breit 1 Schuh 6 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Brueghel, Jan (der Ältere) (und Rubens) 1778/09/28 FRAN 0154 P.P. Rubens; Breughell I Christus als Gärtner, die Figuren von P.P. Rubens, die Landschaft und Gartenfrüchten von Breughell. [Jesus-Christ en Jardinier, les figures par P.P. Rubens, le paysage & les herbes potageres par Breughell.] I Maße: 3 Schuh 4 Zoll breit, 2 Schuh hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (183 fl) Käufer: Weitsch
1796/02/17 HBPAK 0086 Vom ältern Breugels; Rubens I Eine Dorfgegend. Im Vordergründe in der Mitte, schlagen sich verschiedene Bauern blutige Köpfe. Im Hintergrunde stehen viele Landhäuser, welche das Dorf formiren. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 16 Zoll, Breite 24 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (171 M) Käufer: Τ
Brueghel, Jan (der Ältere) (und Savery, R.) 1779/09/27 FRNGL 0053 Roland Savery; Breuggell I Von Roland Savery, eine schöne baumigte Landschaft, worinnen fleißig ausgeführte Figuren, von Breuggell staffirt. [Un tres beau paysage couvert d'arbres par Roland Savery, les figures soigneusement executees par Breughell.] I Maße: 1 % Zoll hoch, 10 Zoll breit Transakt.: Verkauft (16 fl) Käufer: Rath Ehrenreich
Brueghel, Jan (der Ältere) (und Schut, C. (I)) 1789/00/00 MMAN 0133 Cornel Schut; Johann Brueghell Die Mutter Gottes mit dem Jesu Kind auf dem Schooße, in Lebensgröse mit Engeln und Blumenkränzen umgeben, auf Leinw. 5 Fuß hoch und 6 Fuß 3 Zoll breit, vom Cornel Schut, die Blumen sind vom Johann Brueghel. [La Mere de Dieu avec l'Enfant Iesus sur les genoux, detail d'hommes, couronnee par des Anges, sur toile, de 5 pieds de haut, sur 6 pieds 3 p. de large, par Cornell Schut; les fleurs, par Jean Brueghel.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 5 Fuß hoch, 6 Fuß 3 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (100 fl)
Brueghel, Jan (der Ältere) (und Snayers, P.) 1768/07/00 MUAN 0280 Breughel; Snayers I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
Brueghel, Jan (der Ältere) (und Snyders, F.) 1769/00/00 MUAN 0204 Breüghel; Sneyders I Une flotte espagnole, qui fait une descente dans la province de Seelande. Peinte sur bois marquee du No. 280. I Mat.: auf Holz Maße: 1. p. 9 Vi. p. de haut sur 2. p. 8. p. de large Verkäufer: Francis Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt
Brueghel, Jan (der Ältere) (und Teniers) 1799/10/18 LZAN 0100 Teniers; Breughel 1 Ein ländliches Fest. I Verkäufer: Rauch Transakt.: Verkauft (12 Th) Käufer: Schwarz
Brueghel, Jan (der Ältere) (und Uden, Lucas) 1778/09/28 FRAN 0590 Lucas van Uden; Breugell I Eine Hirschjagd, die Landschaft von Lucas van Uden und die figuren und Thiere von Breugell. [Une chasse au cerf, le paysage par Lucas van Uden, les figures & les animaux par Breugell.] I Pendant zu Nr. 591 von Lucas Uden Maße: 2 Schuh 6 Zoll breit, 1 Schuh 9 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (82 fl für die Nrn. 590 und 591) Käufer: Rath Ehrenreich modo Prß ν Dessau
Brueghel, Jan (der Ältere) (und Velde, Ε. (I)) 1785/05/17 MZAN 0109 Breughel; Esaias van der Velde I Noch eine solche Landschaft von Breughel, die Figuren von Esaias van der Velde. [Un paysage pareil par Breughel de velour, les figures par Isai'e van der Velde.] I Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch, 2 Schuh 8 GEMÄLDE
413
Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (150 fl) Käufer: Melber
Brueghel, Jan (der Ältere) (und Vinckeboons, D.) 1778/08/29 HBTEX 0081 Finckenboom; Breugel I Ein vortreffliches Gehölze, in welchem Johannes bey vielen Zuhörern prediget, extra fleißig gemahlt, auf Holz, von Finckenboom und Breugel. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 11 Zoll, Breite 1 Fuß 5 Zoll Transakt.: Unbekannt 1784/09/27 FRAN 0060 Finckeboom; Breugheell Eine sehr warm und fleißig ausgearbeitete Landschaft mit vielen Bäumen von Finckeboom, und mit vortreflichen Figuren von Breugheel. [Un tres beau pay sage avec quantite d'arbres par Finckelboom, garnie de figures excellentes par Breughel.] I Maße: 1 Schuh 7 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 11 Zoll breit Verkäufer: Freyherr von Berberich Transakt.: Verkauft (27.15 fl) Käufer: Kessel
Brueghel, Jan (der Ältere) (und Wyck, Kopie nach) 1788/09/01 KOAN 0292 Breugel; Van Wyck I Ein Mutter Gottes mit dem Kindchen, Blumen und Früchten umrungen, nach Breugel und van Wyck. [une Ste. Vierge avec l'enfant Jesus environne de fleures & de fruits, selon Breugel & de v. Wyck.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 4 Fuß 3 Zoll, Breite 5 Fuß Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt
Brueghel, Jan (der Ältere) (Kopie von) 1791/01/10 HNAN 0013 Brogel; Penier I Landschaft v. Brogel nach Penier. Rhm.: Swzr. Leist.: - . I Kopie von J. Brueghel (I) nach Penier Maße: Höhe 1 F. 4 Zoll, Brte. 1 F. 11 ZI. Verkäufer: Meier Transakt.: Unbekannt 1791/01/10 HNAN 0014 Brogel; Penier I Dito [Landschaft] von Brägel nach Penier. Rhm.: Swzr. Leist.: Gig. I Kopie von J. Brueghel (I) nach Penier Maße: Höhe 1 F. 4 Zoll, Brte. 1 F. 11 ZI. Verkäufer: Meier Transakt.: Unbekannt
Brueghel, Jan (der Ältere) (oder Savery, R.) 1786/10/18 HBTEX 0004 F. Breughel; oder Rul. Savery besten Zeit I Eine Hölzung mit gebürgigter Gegend, vortreflich gemahlt und collorirt. Im Vorgrunde zur Linken werden ein paar Landleute gemißhandelt; zur Rechten reitet ein Herr im vollen Gallopp davon. Auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 8 Zoll 10 Linien, breit 11 Zoll 9 Linien Transakt.: Unbekannt
Brueghel, Jan (der Ältere) (geändert in Beschey, B.) 1799/00/00 LZRCH 0046 Jean Breughel, dit, de Velour; Beschey I Dans un joli paysage, on remarque la vierge qui tient l'enfant Jesus sur ses genoux; sur la gauche est Joseph, qui fixe la mere et le fils, au quel 3 anges presentent du haut des nues, la croix meurtriere; ce tab. fait une tres belle production. I Mat.: auf Holz Maße: h. 13.1. 10. pouces Anm.: Im Exemplar AAP wurde der Name "Jean Breughel, dit, de Velour" handschriftlich durchgestrichen und in "Beschey" korrigiert. Verkäufer: J F Rauch Transakt.: Unbekannt
1792/10/12 KOAN 0135 Breughel I Eine Winterlandschaft, im Geschmacke des Breughel, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Fuss 6 Zoll - breit 2 Fuss 1 Zoll Verkäufer: Moureaux Transakt.: Unbekannt
Brueghel, Jan (der Ältere) (Imitation nach) 1778/10/30 HB KOS 0056 Breugel I Eine Bauren=Kirmes, auf Holz. Eine Imitation nach Breugel. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 10 Zoll, breit 15 Zoll Transakt.: Unbekannt
Brueghel, Jan (der Ältere) (Kopie nach) 1723/00/00 PRAN [A]0016 Breugel I Die 4. Elementen / nach Breugel. I Maße: Höhe 1 Vi Schuh 1 Vi Zoll, Breite 2 Vi Schuh 1 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN [A]0017 Breugel I Die vier Elementen / nach Breugel. I Maße: Höhe 1 Vi Schuh 1 Vi Zoll, Breite 2 Vi Schuh 1 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN [A]0043 Breugel I Die Erden / nach Breugel. I Maße: Höhe 1 Vi Schuh 1 Vi Zoll, Breite 2 Vi Schuh 1 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1764/03/12 FRKAL [A]0032 Breugel I Zwey Landschafften nach Breugel. I Transakt.: Verkauft (3.36 fl) Käufer: Mevius 1788/09/01 KOAN 0219 Breugel I 2 Bauren Kirmes, nach Breugel. [2 p[ieces], des dedicaces villageoises, selon Breugel.] I Diese Nr.: Ein Bauren Kirmes Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Fuß 1 Zoll, Breite 2 Fuß 8 Zoll Anm.: Die Lose 219 und 220 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0220 Breugel I 2 Bauren Kirmes, nach Breugel. [2 p[ieces]. des dedicaces villageoises, selon Breugel.] I Diese Nr.: Ein Bauren Kirmes Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Fuß 1 Zoll, Breite 2 Fuß 8 Zoll Anm.: Die Lose 219 und 220 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0372 Brägel I H. Johann in der Wüste predigt, nach Brägel. [St Jean qui preche dans le desert, par Brcegel.] I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 9 Zoll, Breite 1 Fuß 8 Zoll Anm.: Dieses Los trägt im gedruckten französischen Katalog irrtümlich die Nr. 272. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0576 Breugel I Landschaft mit Figuren, nach Breugel. [un paysage avec des figures, selon Breugel.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 11 Zoll, Breite 2 Fuß 6 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0627 Breugel I Landschaft, nach Breugel. [un paysages, sei. Breugel.] I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 7, Breite 9 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0630 Breugel I Landschaft, nach Breugel. [un paysage, sei. Breugel.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 7 Zoll, Breite 9 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt
Brueghel, Jan (der Ältere) (Geschmack von)
1788/09/01 KOAN 0640 Breugel I 2 Landschaften, nach Breugel. [deux paysages, de Breugel.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 5 Zoll, Breite 7 Zoll Anm.: Die Lose 640 und 641 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt
1784/09/27 FRAN 0040 Breughels I Eine Landschaft mit vielen schönen Bäumen, im Geschmack von Breughels. [Un paysage garni d'un grand nombre de beaux arbres dans le gout de Breughals.] I Maße: 12 Zoll hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Verkäufer: Freyherr von Berberich Transakt.: Verkauft (16 fl) Käufer: Stoeber
1788/09/01 KOAN 0641 Breugel I 2 Landschaften, nach Breugel. [deux paysages, de Breugel.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 5 Zoll, Breite 7 Zoll Anm.: Die Lose 640 und 641 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt
414
GEMÄLDE
1788/09/01 KOAN 0775 Broegel I Landschaft mit Figuren, nach Broegel. [un paysage avec des figures selon Broegel.] I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Fuß 2 Zoll, Breite 1 Fuß 9 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0401 Broeugel I Eine Winterlandschaft nach Broeugel. I Maße: 27 Zoll breit, 23 Zoll hoch Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0121 Brengheel I Eine Landschaft mit grossen Bäumen, worin Familia sacra auf Holz nach Brengheel von Geldorff. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Schuh 7 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 4 Vi Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt
Brueghel, Jan (der Ältere) (Manier) 1768/08/16 KOAN 0054 Breugel I Ein Stuck auf Holtz den Brand Sodoma so gut als Breugel. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 9 Zoll, Breite 1 Fuß 1 Zoll Verkäufer: Freyherr von Kaas Transakt.: Unbekannt 1772/09/15 BNSCT 0080 Breughel I Eine schöne Landschaft, in der Manier von Breughel, auf Kupfer, 8 Vi Z. h. 1 Fuß breit, schw. Rahm. I Mat.: auf Kupfer Maße: 8 Vi Zoll hoch, 1 Fuß breit Transakt.: Unbekannt (4.5 fl) 1776/11/09 HBKOS 0035 Brogel I Eine Landschaft, auf Kupfer gemahlt, mit dito [schwarzen] Rahm und verguldeten Leisten, nach Brogels Manier. I Pendant zu Nr. 80 Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 10 Zoll, Breite 1 Fuß 3 Zoll Transakt.: Verkauft (27 Μ für die N m . 35 und 80) Käufer: Auct Köster 1776/11/09 HBKOS 0080 Brägel I Eine schöne Landschaft, zu Nr. 35 gehörig, auf Kupfer, mit dito [schwarzen] Rahm und verguldeten Leisten, nach Brägels Manier. I Pendant zu Nr. 35 Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 10 Zoll, Breite 1 Fuß 2 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (27 Μ für die Nrn. 35 und 80) Käufer: Auct Köster 1776/11/09 HBKOS 0118 Brägel I Ein Porcelain=Geschirr mit ein Bouquet Blumen, fleißig gemahlt auf Leinwand, im schwarzen Rahm mit verguldete Leisten, in der Art des Brögel. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Fuß 6 Zoll, Breite 1 Fuß 10 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (2 M) Käufer: Lillie 1778/09/28 FRAN 0364 Breughell I Eine kleine Landschaft mit vielen Figuren, in der Manier von Breughell. [Un petit paysage avec beaucoup de figures, dans le gout de Breughell.] I Pendant zu Nr. 365 Maße: 13 Zoll breit, 10 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (25 fl für die Nrn. 364 und 365) Käufer: Schrintz 1778/09/28 FRAN 0365 Breughell I Der Compagnon, von dito [Manier von Breughell]. [Le pendant du precedent, par le m e m e [dans le gout de Breughell].] I Pendant zu Nr. 364, "Eine kleine Landschaft mit vielen Figuren" Maße: 13 Zoll breit, 10 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt. : Verkauft (25 fl für die Nrn. 364 und 365) Käufer: Schrintz 1779/09/27 FRNGL 1016 Sammt Breughell I Der Zug einer Bauernhochzeit mit vielen Pferden, Wagen und Figuren, sehr schön ausgeführt in der Manier von Sammt Breughell. [La marche d ' u n e nöce de paysans avec beaucoup de chevaux, chariots & figures, tres bein peinte dans le gout de Breughell surnomme de velours.] I Maße: 1 Vi Schuh hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Transakt.: Verkauft (124 fl) Käufer: Hüsgen 1781/09/10 BNAN 0027 I. Breugel I Eine Zurückkünft aus Egypten; auf Kupfer, in der Manier von I. Breugel. g.L. [im schwarzen Rahm mit verguldeten Leisten] I Mat.: auf Kupfer Maße: 4 Zoll hoch, 6 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1782/07/00 FRAN 0091 Breughel I Die zwölf Monate, in Breughels Manier. I Diese Nr.: Ein Monat Anm.: Die Lose 91 bis
102 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] fl für die Nrn. 91-102) 1782/07/00 FRAN 0092 Breughel I Die zwölf Monate, in Breughels Manier. I Diese Nr.: Ein Monat Anm.: Die Lose 91 bis 102 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] fl für die Nrn. 91-102) 1782/07/00 FRAN 0093 Breughel I Die zwölf Monate, in Breughels Manier. I Diese Nr.: Ein Monat Anm.: Die Lose 91 bis 102 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] fl für die N m . 91-102) 1782/07/00 FRAN 0094 Breughel I Die zwölf Monate, in Breughels Manier. I Diese Nr.: Ein Monat Anm.: Die Lose 91 bis 102 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] fl für die Nrn. 91-102) 1782/07/00 FRAN 0095 Breughel I Die zwölf Monate, in Breughels Manier. I Diese Nr.: Ein Monat Anm.: Die Lose 91 bis 102 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] fl für die N m . 91-102) 1782/07/00 FRAN 0096 Breughel I Die zwölf Monate, in Breughels Manier. I Diese Nr.: Ein Monat Anm.: Die Lose 91 bis 102 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] fl für die N m . 91-102) 1782/07/00 FRAN 0097 Breughel I Die zwölf Monate, in Breughels Manier. I Diese Nr.: Ein Monat Anm.: Die Lose 91 bis 102 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] fl für die N m . 91-102) 1782/07/00 FRAN 0098 Breughel I Die zwölf Monate, in Breughels Manier. I Diese Nr.: Ein Monat Anm.: Die Lose 91 bis 102 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] fl für die N m . 91-102) 1782/07/00 FRAN 0099 Breughel I Die zwölf Monate, in Breughels Manier. I Diese Nr.: Ein Monat Anm.: Die Lose 91 bis 102 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] fl für die N m . 91-102) 1782/07/00 FRAN 0100 Breughel I Die zwölf Monate, in Breughels Manier. I Diese Nr.: Ein Monat Anm.: Die Lose 91 bis 102 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] fl für die N m . 91-102) 1782/07/00 FRAN 0101 Breughel I Die zwölf Monate, in Breughels Manier. I Diese Nr.: Ein Monat Anm.: Die Lose 91 bis 102 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] fl für die N m . 91-102) 1782/07/00 FRAN 0102 Breughel I Die zwölf Monate, in Breughels Manier. I Diese Nr.: Ein Monat Anm.: Die Lose 91 bis 102 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] fl für die N m . 91-102) 1784/08/02 FRNGL 0408 Samuel Breughel I Eine angenehm gewählte Landschaft mit vielen Figuren und Schiffen, in der Manier Samuel Breughel. I Maße: 15 Zoll breit, 11 Zoll hoch Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "Samuel Breughel", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Verkäufer: C Transakt.: Verkauft (4.45 fl) Käufer: Bäumer 1786/10/18 HBTEX 0323 Breugel I Anthonius Versuchung, nach der Art von Breugel. I Transakt.: Unbekannt 1789/08/18 HBGOV 0062 Wie Breughel I St. Gerome sitzet in einer Eremitage mit Genien, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 V* Zoll, breit 10 % Zoll Transakt.: Unbekannt 1791/09/21 FRAN 0144 Nach der Art von Breugel I Eine Landschaft mit Bäumen und einigen Figuren geziert. I Transakt.: Verkauft (2.15 fl) Käufer: Barensfeld GEMÄLDE
415
1792/07/05 LBKIP 0103 Breugel I Eine Landschaft in der Manier von Breugel. I Transakt.: Unbekannt 1798/12/10 WNAN 0009 Breughel I Zwey kleine niederländische Landschaften in der Manier Breughels. I Verkäufer: Prof Adam Transakt.: Unbekannt 1798/12/10 WNAN 0036 Breughel I Die Weisen aus Morgenland, die dem Kinde Jesu Geschenke bringen, in der Manier Breughels, mit sonderbarer Wahrheit gemahlt; ein merkwürdiges Stück. I Verkäufer: Prof Adam Transakt.: Unbekannt
Brueghel, Jan (der Ältere) (Manier; und Michau, Manier) 1788/10/01 FRAN 0102 Breugel; Michau I Eine Landschaft mit vielen Figuren, in der Manier von Breugel und Michau. I Maße: 17 Vi Zoll hoch, 26 Zoll breit Transakt.: Verkauft (7 fl) Käufer: Heussel
Brueghel, Jan (der Ältere) (Schule) 1670/04/21 WNHTG 0134 Breugel I Un Ritratto d'un Huomo, e d'una Donna venuti fuori dalla Scuola del Breugel. I Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0186 Brügel I Eine kleine Landschafft von der Schuhle von Brügel. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1767/00/00 KOAN 0072 Breugel I Eine Landschaft auf Holtz mit kleinen Figuren von Scholar von Breugel. I Maße: Breite 2 Fuß 3 Zoll, Höhe 1 Fuß 11 Zoll Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt
Brueghel, Paul [Nicht identifiziert] 1763/01/17 HNAN 0027 Paul Breugel I Loth dans une Grotte avec ses Filles & l'Embrasement de Sodome &c. dans l'Eloignement; par Paul Breugel, sur cuivre. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hauteur 7 pouces, Largeur 11 pouces Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt
Brueghel, Pieter 1750/00/00 KOAN 0166 Pierre Breugel I Des Festons & des Guirlandes, avec une Perspective, le tout tres naturel & bien distribue, sur toile, le plus beau travail dans ce genre de Pierre Breugel. I Mat.: auf Leinwand Maße: Largeur 3 Pies 11 Pouces, Haut 3 Pies 1 V* Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1750/06/15 HB RAD 0001 Pieter Brügel I Pieter Brügel, die verkehrte Welt, ein rares und mit besondern Fleiß verfertigtes Stück. I Transakt.: Unbekannt 1763/01/17 HNAN [AJ0018 P. Breugel I L'Empire de Pluton, sur Cuivre. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hauteur 11 pouces, Largeur 1 pied 3 pouces Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt
1764/03/12 FRKAL 0020 Pierre Pietersz Breughel I Des pa'isans, dansant dans un agreable pai'sage. I Maße: hauteur 11 Vi pouces, largeur 16 pouces Transakt.: Verkauft (7.30 fl) Käufer: Kaller 1769/00/00 MUAN 0330 Breüghel (Pierre) I Un Pay sage dans lequel on voit comme le sanglier est attaque. Peint sur toile, marque du No. 85. I Mat.: auf Leinwand Maße: 3. p. 2. p. de haut sur 4. p. 2. p. de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1776/00/00 WZTRU 0092 Peter Brügel f Ein Stück, 1 Schuhe, 10 Zoll breit, von Peter Brügel, stellet vor, wie die spannische niederländische Kriegsknechten ein und andere Uebelthäter zum Tod zu führen begriffen sind, ein und andere Weiber bitten um Gnade, aber vergebens; in diesem Stücke nimmt man wahr den noch Antiquengeschmack des Meisters, und den selbiger Zeit wohlanständigen Chatacter [sie], eine kräftige Colorit, eine Zeichnung nach den Antiquen, eine Landschaft von kurzem Gegenstande geben diesem Stücke einen Rang unter den flammländischen Meistern. I Maße: 10 Schuhe hoch, 10 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (200 fl Schätzung) 1779/09/27 FRNGL 0447 Peter Breughel I Eine Winterlandschaft mit vielen Figuren. [Un paysage en tems d'hyver avec beaucoup de figures.] I Maße: 1 Schuh 2 Zoll hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Transakt.: Verkauft (7 fl) Käufer: Rath Ehrenreich 1781/00/00 WZAN 0092 Peter Prügel I Ein Stück 1 Schuhe, 10 Zoll breit, von Peter Prügel, stellet vor, wie die spanische niederländische Kriegsknechte ein und andere Uebelthäter zum Tod zu führen begriffen sind: ein und andere Weiber bitten um Gnade, aber vergebens; in diesem Stücke nimmt man noch den Antiquen Geschmack des Meisters, und den selbiger Zeit wohl anständigen Karakter wahr. Eine kräftige Kolorit, eine Zeichnung nach den Antiquen, eine Landschaft von kurzem Gegenstande geben diesem Stücke einen Rang unter den flammändischen Meistern. I Maße: 10 Schuhe hoch, 10 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/07/18 FRAN 0023 Peter Brugell I Ein sehr schön gemaltes Brustbild in Spanischer Tracht auf Holz. I Pendant zu Nr. 24 Mat.: auf Holz Maße: 2 Schuh 2 Zoll hoch, 1 Schuh 7 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/07/18 FRAN 0024 Peter Brugell I dito [Ein sehr schön gemaltes Brustbild in Spanischer Tracht] Compagn. von dito [Peter Brugell]. I Pendant zu Nr. 23 Mat.: auf Holz Maße: 2 Schuh 2 Zoll hoch, 1 Schuh 7 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/07/18 FRAN 0048 Peter Brugell I Eine 50jährige Hochzeit von Peter Brugell. I Maße: 2 Schuh 4 Zoll hoch, 3 Schuh 2 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/07/18 FRAN 0066 Peter Brugell I Ein Spanisch gekleidetes Manns=Brustbild, auf Holz. I Pendant zu Nr. 67 Mat.: auf Holz Maße: 2 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 9 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/07/18 FRAN 0067 Peter Brugell I dito [Ein Spanisch gekleidetes Manns=Brustbild] Compagn. I Pendant zu Nr. 66 Mat.: auf Holz Maße: 2 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 9 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
1763/01/17 HNAN 0065 Peter Breugel I Noce de Paysans par Peter Breugel, sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 1 pied 4 pouces, Largeur 2 pieds Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt
1781/09/10 BNAN 0026 Peter Breughel I Auf dem aus dem Dickigt führenden Wege ein Postwagen mit Reisenden, nebst anderen Wanderern; fernerhin treibt der Hirte seine Schafe zum Dorfe; auf dem Vordergrund zur Linken ein Bauerhaus im Schatten der sich verbreitenden Eiche. I Mat. : auf Holz Maße: 7 Zoll hoch, 11 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
1764/03/12 FRKAL 0019 Pierre Breugel I La vue d'une riviere avec des bateaux pres d'un village, ome de plusieurs figures & bien peint. I Maße: hauteur 12 pouces, largeur 16 pouces Transakt.: Verkauft (21.30 fl) Käufer: Kaller
1782/09/30 FRAN 0328 Peter van Breughell I Ein Eremit vor seiner Zelle an einem Grab mit Todten umgeben, in einer angenehmen Landschaft. [Un Ermite devant sa cellule pres d'un tombeau entoure de morts, dans un beau paysage, par Pierre van Breughell.] I
416
GEMÄLDE
Maße: 5 Zoll hoch, 6 Vi Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (18 fl) Käufer: Trautman 1786/05/02 NGAN 0020 Peter Breughel I Zwey Holländische Jahrmärkte, auf Kupfer gemalt. I Diese Nr.: Ein Holländischer Jahrmarkt Mat.: auf Kupfer Maße: 1 Schuh 7 Zoll hoch, 2 Schuh 5 Zoll breit Anm.: Die Lose 20 und 21 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (273 fl für die Nrn. 20 und 21) Käufer: Kastner im Deutschen Haus 1786/05/02 NGAN 0021 Peter Breughel I Zwey Holländische Jahrmärkte, auf Kupfer gemalt. I Diese Nr.: Ein Holländischer Jahrmarkt Mat.: auf Kupfer Maße: 1 Schuh 7 Zoll hoch, 2 Schuh 5 Zoll breit Anm.: Die Lose 20 und 21 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (273 fl für die Nrn. 20 und 21) Käufer: Kastner im Deutschen Haus 1786/05/02 NGAN 0199 Breughel I Ein Ballonspiel zwischen einer Allee; auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: 6 Zoll hoch, 8 Zoll breit Anm.: Im Index des Katalogs erscheint der Künstlername als "Pet. Breughel". Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (6 fl) Käufer: Pfann 1786/05/02 NGAN 0295 Breughel I Schnapphanen lauern in einem Hinterhalt auf einen Reißenden. I Maße: 1 Schuh hoch, 1 Schuh 8 Zoll breit Anm.: Im Index des Katalogs erscheint der Künstlername als "Pet. Breughel". Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (13.3 fl) Käufer: ν Holzschuher 1787/04/19 HBTEX 0064 Peter Brägel I Eine Bauren=Schule, wo der Meister seine Schüler züchtiget. I Transakt.: Verkauft (64 M) Käufer: Texier 1791/10/21 HBRMS2 0004 P. Breughel I Dieses vortrefliche und seiner Größe wegen unschätzbare Gemähide, stellet eine Gegend mit abwechselnden Land und Wasser vor; mit eine Menge Wälder, und an den Ufern Städte und sehr viele andere Gebäude. Auf der Landstraße sieht man Reisende und Hirten, welche hinter ihr Vieh hertreiben. Alles mit den unnachahmlichen Fleiß, wie man es von diesen großen Künstler gewohnt ist, ausgeführt. Auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 48 Zoll, breit 74 Zoll Transakt.: Unbekannt 1794/02/21 HB HEG 0022 Petrus Breugel I In einem Dorfe vor einem Landhause, sitzen an einem großen gedeckten Tische ein Brautpaar, mit vielen Hochzeits=Gästen; mehrere Landleute belustigen sich hin und wieder, indem Kirchweihen gefeyret werden. Die vielen Tanzenden machen die Feyer besonders lebhaft. Ausnehmend fleißig gemahlt. Breugel wurde im 15ten Seculo nahe bey Breda gebohren in einem Dorf das seinem Namen führt, er lernte bey Pet. Kock. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Zoll, breit 15 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1794/09/00 LGAN 0029 Peter Breughel I Zwei ovale Landschaften, mit Wald und Figuren, von Peter Breughel, auf Kupfer, in verguldten Rahmen. I Mat.: auf Kupfer Format: oval Maße: breit 1 Schuh 2 Zoll, hoch 10 Vi Zoll Verkäufer: [Friedrich Karl Ludwig, Freiherr von Moser] Transakt.: Unbekannt (120 rh fl Schätzung) 1796/00/00 HLAN [0030] Peter Breughel I Zwei Ovale Landschaften. 10 Vi Ζ. 1 Sch. 2 Z. auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Format: oval Maße: 10 Vi Ζ. 1 Sch. 2 Z. Anm. : Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: [Friedrich Karl Lang] Transakt.: Unbekannt (66.16 Rt; 300 fl Schätzung) 1796/00/00 HLAN [0095] Peter Breughel I Blumenstük 21. 16. auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: 21. 16. Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: [Friedrich Karl Lang] Transakt.: Unbekannt (47.18 Rt; 88 fl Schätzung)
1797/09/13 FRAN 0059 Peter Breughel I Eine sehr schöne mit einem Reuterzug staffirte Landschaft. I Maße: 1 Schuh 7 Zoll hoch 2 Schuh 3 Zoll breit Transakt.: Unbekannt (42 fl) 1797/12/08 HBPAK 0055 P. Broegel I Eine Landschaft mit vielen Figuren und Vieh. Auf Pergament, im goldnen Rahm mit Glas. I Mat.: auf Pergament Maße: Höhe 8 Zoll, Breite 18 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/08/09 HBPAK 0040 P. Breughel I Ein grosses Bauern Jahrmarkt, woselbst man verschiedene grosse und kleine Figuren sieht. Auf Holz, goldn. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 47 Zoll, breit 67 Zoll Transakt.: Unbekannt
Brueghel, Pieter (der Jüngere) 1744/05/20 FRAN 0193 Η. Breugel I 1 Extra feines Stück der Brand von Troja. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 9 Zoll, Breite 2 Schuh 9 Zoll Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1763/11/09 FRJUN 0037 Breugel Lenfer I Une piece remplie de figures de fortilege bien peint. I Maße: hauteur 8 pouces, largeur 10 pouces Transakt.: Verkauft (26.15 fl) Käufer: Hoch 1766/07/28 KOSTE 0043 Höller Breugel I Einen Bauren=tanz auf holz von Höller Breugel. I Mat.: auf Holz Transakt. : Verkauft (8.30 Rt) Käufer: Schmitz [?] 1776/00/00 WZTRU 0125 Höllenbrugel I Ein Stück, 8 Zoll hoch, 9 Vi Zoll breit von Höllenbrugel genannt, stellet vor den Brand von Sodoma, woselbst Loth mit seinen 2 Töchtern im Vorgrunde hierauf zu ersehen, die hierinn imitirte Nacht, der Mond, die Wirkung des Feuers, die in halben Schatten zu erkennende Abtheilung geben diesem Stücke einen besondem Werth in diesem Fache der Malerey, welche nur diesem Meister eigen war. I Maße: 8 Zoll hoch, 9 Vi Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (60 fl Schätzung) 1776/04/15 HBBMN 0019 Höllen Brägel I Eine ausnehmende und ungemeine fleißige Landschaft, den Brand von Sodom vorstellend, der Auszug von Loth mit seine Töchter wird mit Engel begleitet; die Figuren sind extra schön, von dem sogenannten Höllen Brägel. I Maße: Höhe 1 Fuß 9 Vi Zoll, Breite 2 Fuß 3 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (173 M) Käufer: Petersen 1777/05/26 FRAN 0467 Höllen Brägel i Antonius Einsiedler. I Verkäufer: Finsterwalder Transakt.: Verkauft (11.45 fl) Käufer: Rath Eichhorn 1781/00/00 WZAN 0125 Höllenbrugel I Ein Stück, 8 Zoll hoch, 9 u. einen halben Zoll breit, von Höllenbrugel genannt, stellet den Brand von Sodoma vor, wo Loth und seine 2 Töchter im Vorgrande zu sehen sind; die hierinn imitirte Nacht, der Mond, die Wirkung des Feuers, die in halben Schatten zu erkennende Abtheilung geben diesem Stücke einen besondem Werth in diesem Fache der Malerey, welche nur diesem Meister eigen war. ] Maße: 8 Zoll hoch, 9 Vi Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/05/07 FRHUS 0406 Höllenbrögel I Die sogenannte Walpertsnacht, mit vielen wunderlich und lächerlichen Hexenvorstellungen und Actionen, vom Höllenbrögel. I Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch und 2 Schuh 4 Zoll breit Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (40.45 fl) Käufer: Burger 1782/03/18 HBTEX 0329 Höllen Breugel! Troja im Brande, mit unendlich vielen Figuren. Eines der exellentesten Gemähide im Ganzen, und eine der vollkommensten Vorstellung und Ausführung, sowol der vielen Menschen, die bis auf Punkten=Größe scheinen, als auch der Gebäude und des Feuers wegen: kurz, was von Nr. 244 gesagt worden, wird bey diesem billig wiederholt, auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 11 Zoll 6 Linien, Breite 18 Zoll Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
417
1782/09/30 FRAN 0180 Höllen Breughell I Eine satyrische Allegorie auf die Zeiten vor der Reformation, mit vielen wohlausgearbeiteten sich selbst erklärenden Figuren, vom Höllen Breughell. [Une allegorie satyrique sur les tems avant la reformation avec beaucoup de figures bien rendues, qui s'expliquent d'elles memes, par Hoellen Breughell.] I Maße: 1 Schuh 6 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 2 Vi Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (75 fl) Käufer: Hüsgen 1788/10/01 FRAN 0077 Hollen Breugel I Der betrogene Blinde in einer Landschaft, von Hollen Breugel. I Maße: 7 Vi Zoll hoch, 10 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (5.30 fl) Käufer: von Schmid 1790/01/07 MUAN 0239 Breugel Peter Jun., genannt Höllen= Breugel I Die Fahrt der Hoffart zur Hölle, ein poetisches Stück, auf Kupfer, in einer geschnittenen und vergoldeten Ram. I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 8 Zoll, Breite 4 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 2158 Breugel Peter Jun., genannt Höllen= Breugel I Ein Bataillenstück, auf Holz, in einer eben dergleichen [geschnittenen und vergoldten] Ram. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 7 Zoll, Breite 9 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/04/13 HBLIE 0049 Vom sogenannten Höllen Broegel 1 Der Auszug Loths mit seiner Familie aus Sodom und Gomorra, welche in vollen Flammen stehen, deren Beleuchtung einen großen Effect macht; stark und schön gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Zoll, breit 12 Zoll Transakt.: Verkauft (1.2 M) Käufer: Ego [und] S 1792/08/20 KOAN 0015 Höllenbrenghell I Zwey bergige und buschige Landschaften mit Schaafen und Hirten auf Baneel von Höllenbrenghel. I Diese Nr.: Eine bergige und buschige Landschaft mit Schaafen und Hirten Mat.: auf Holz Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 2 Schuh 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 15 und 16 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0016 Höllenbrenghell I Zwey bergige und buschige Landschaften mit Schaafen und Hirten auf Baneel von Höllenbrenghel. I Diese Nr.: Eine bergige und buschige Landschaft mit Schaafen und Hirten Mat.: auf Holz Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 2 Schuh 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 15 und 16 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0034 Höllenbrenghell I Ein Bauren=Dorf und Hütten, allwo sich die Bauren mit trinken und tanzen belüstigen auf Baneel von Höllen brenghell. I Mat.: auf Holz Maße: 2 Schuh 3 Zoll hoch, 3 Schuh 6 Vi Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1793/09/18 HBSCN 0076 Vom Höllen Brägel I Vor einen verfallenen Zauberschloß in einer Erhöhung sitzen zwey Personen Herr und Dame zu Tische, auf der Tafel kriechen Kröten und Ungeziefer, verschiedene Geister warten bey Tische auf, und präsentiren den Gästen unglaubliche Dinge, gegen über auf einem Berge stehen Gebäude und Kirchen in vollen Flammen, etwas niedriger siehet man den heiligen Antonius vor einem Crucifix andächtig beten, ganz im Vordergrunde erscheinen im Triumphwagen und Schlitten, Larven und monstreuse Figuren, in lächerliche und scheußliche Gestalten, auch davon ist die Luft und wo man nur hinblickt allenthalben angefüllet, der Hintergrund präsentiret eine Stadt, allwo von allen den Geschmeiß nichts zu sehen ist. Diese contrastische Mahlerey ist ausserordentlich fleißig und sehr auffallend. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 22 Vi Zoll, breit 32 Zoll Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 FGAN [B]0022 Höllen Brengel I Ein Felsonstück [sie] mit Räubergesindel, auf Tuch gemalt. I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Schuh 2 Zoll hoch, 1 Schuh 7 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt (22 fl) 1794/02/21 HBHEG 0030 Breugel, Petrus Sohn I Bey Nachtzeiten siehet man hinter eine hohe steinerne Brücke eine große Feuers418
GEMÄLDE
brunst; eine danebenstehende Mühle, scheint ebenfalls in Brand zugerathen; einige Kähne mit Menschen eilen herbey zu löschen. Der Anblick ist fürchterlich, aber benannter Künstler zeigte seine force dadurch. Er wurde zu Breda Ao. 1583 gebohren. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Vi Zoll, breit 13 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/11/14 HBPAK 0044 Höllenbrögel I Der Brand Trojä, mit vielen Figuren. Auf das schönste gemahlt. Auf Kupfer, im schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Mat. : auf Kupfer Maße: Hoch 11 Zoll, breit 19 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 LZAN 0107 Bruguel d'Enfer I Deux Pendans en esquisses; Tun represente le passage de Jourdain: l'autre, le Rocher desalterant. Une foule de figures en action et pleines d'expression rend ces deux petits tableaux tres-interessans. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hauteur 10 pouces, largeur 14 pouces Transakt.: Unbekannt (8 Louis Schätzung) 1799/10/17 LZAN 0009 Hoellen Breughel I Die Zerstörung von Troyes; hoch 9 Zoll, breit 11 Zoll. Auf Holz; in einem vergoldeten Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 9 Zoll, breit 11 Zoll Verkäufer: Rauch Transakt.: Verkauft (0.16 Th) Käufer: Hendel 1799/12/04 HBPAK 0127 Höllenbrögel I Den Thurm zu Babylon vorstellend. Gut und brav gemahlt. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 20 Zoll, breit 27 Zoll Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 BLBOE 0056 P. Breugel d.j. I Eine lustige Bauerngesellschaft und Schlägerei vor einem Wirthshause. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt
Brueghel, Pieter (der Jüngere) (und Baien, Η. (I) und Francken oder Vrancx) 1785/05/17 MZAN 0506 van Baien; Franck; Höllenbreughel I Christus wie er die Altväter erlöset, zum Theil von van Baien, zum Theil von Franck und zum Theil vom sogenannten Höllenbreughel. [Jesus Christ delivrant les patriarches.] I Maße: 8 Vi Zoll hoch, 11 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Unverkauft Gegenw. Standort: Aschaffenburg, Deutschland. Bayerische Staatsgemäldesammlungen. (6408) (?) als Kopie nach J. Brueghel (I) und Rottenhammer
Brueghel, Pieter (der Jüngere) (und Rottenhammer, Η . (I)) 1778/08/29 HBTEX 0099 Rothenhammer; P. Breugel I Die Flucht nach Egypten, in einer angenehmen Landschaft; die Figuren von Rothenhammer und die Landschaften von P. Breugel, auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 6 Vi Zoll, Breite 9 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1782/09/30 FRAN 0287 Rottenhammer; Peter van Breughell I Maria mit dem Kind Jesu, mit verschiedenen Engeln in einer blumenreichen Landschaft, von Rottenhammer, die Figuren, die Landschaft und Blumen von Peter van Breughell. [La Ste. Vierge avec l'enfant Jesus avec plusieurs anges dans un paysage emaille de fleurs, par Rottenhammer, les figures, le paysage & les fleurs par Pierre van Breughell.] I Maße: 1 Schuh 7 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 1 Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (40.30 fl) Käufer: Fellner
Brueghel, Pieter (der Jüngere) (Geschmack von) 1780/10/02 FRSTK 0005 Höllen Breüghell I Eine Niederländische Bauem=Kermiss mit vielen schön gezeichnet, und croupirten Figuren im Geschmack des Höllen Breüghell. I Maße: 1 Schuh 7 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 1 Zoll breit Transakt.: Unbekannt (11.1/2 fl)
Brueghel, Pieter (der Jüngere) (Manier) 1785/05/17 MZAN 0484 Höllenbreughel I Die Hölle in des sogenannten Höllenbreugheis Manier auf Kupfern. [L'enfer dans le gout de Breughel.] I Mat.: auf Kupfer Maße: 7 Vi Zoll hoch, 10 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (12.30 fl) Käufer: Geh R ν Heuser
Brüncker [Nicht identifiziert]
Rosen und andern Blumen auf einem Tische Maße: Hoch 19 Zoll, breit 16 Zoll Anm.: Die Lose 41 und 42 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0042 Brüning I Zwey Vasen mit Rosen und andern Blumen auf einem Tische. I Diese Nr.: Eine Vase mit Rosen und andern Blumen auf einem Tische Maße: Hoch 19 Zoll, breit 16 Zoll Anm.: Die Lose 41 und 42 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1742/08/01 BOAN 0294 Brüncker I Zvvölff kleine Stücke. Originalien von Brüncker. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt
Brüggen, Jan van der
1742/08/30 BOAN 0074 Brunker I Des Fleurs par Brunker. I Maße: Haut 5. p. large 3. p. 8. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt
1742/08/30 BOAN 0102 Brüggen I Des vaisseaux en mer, couple par Brüggen. I Maße: Haut 2. p. 6 Vi pouc. large 4. p. 6 p. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt
1742/08/30 BOAN 0353 Brüncker I Douze petits tableaux, par Brüncker. I Maße: Hauts 6. pou., larges 4. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt
Brüning 1789/06/12 HBTEX 0239 Brüning I Eine Dame bey ihrem Coffee-Tisch. Der Pendent eine dergleichen Vorstellung. Sehr plaisant und natürlich gemahlt. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Eine Dame bey ihrem Coffee-Tisch; Pendant zu Nr. 240 Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 239 und 240 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1789/06/12 HBTEX 0240 Brüning I Eine Dame bey ihrem Coffee-Tisch. Der Pendent eine dergleichen Vorstellung. Sehr plaisant und natürlich gemahlt. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Eine Dame bey ihrem Coffee-Tisch; Pendant zu Nr. 239 Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 239 und 240 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1795/03/12 HBSDT 0005 Brüning I Ein alter Geck, welcher mit einem jungen Mädchen tändelt. Auf Leinwand, im schw. Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 32 Zoll, breit 28 Zoll Transakt.: Unbekannt
Brüning, B. 1777/04/11 HBNEU akt.: Unbekannt
Brusaferro, Girolamo 1779/00/00 HB AN 0193 Brusaferro I Danae liegt im süßen Schlafe, unter einem rothen Vorhange, auf einer grünen Decke; den rechten Arm über dem Kopfe. Zu ihren Füßen steht der Adler Jupiters, und an ihrer rechten Seite die Alte, welche den Goldregen in einer Schale auffängt. Liebesgötter flattern vor dem kommenden Gotte her. [Danae, couchee sur un drap vert, sous un rideau rouge, est ensevelie dans un doux sommeil & a le bras droit par dessus sa tete. A ses pieds l'aigle de Jupiter, & ä sa droite la vieille, qui resoit la pluie d'or dans une coupe. Des Amours volent devant le Dieu qui arrive.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 10 Zoll hoch, 1 Fuß 6 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0289 Brusaferro I Venus sitzt auf einem Stuhle auf rothem Gewände. Eine vor ihr knieende Nymphe reicht ihr ein Gefäss. Zween Liebesgötter ziehen zur Rechten den Vorhang auf. [Venus est assise sur une chaise, couverte d'une draperie rouge. Une nymphe ä genoux devant eile lui presente un vase. Α droite deux Amours tirent le rideau.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 10 Zoll hoch, 2 Fuß 4 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt
Brusasorci 0005
Brüning I Ein Fruchtstück. I Trans-
1786/11/11 HBRMS 0110 Brüning I Ein großes Blumen=Stück mit sehr vielen Blumen. I Transakt.: Unbekannt 1787/04/19 HBTEX 0083 Brüning I Ein Blumen=Stück. I Transakt.: Verkauft (6 M) Käufer: Eck 1790/05/20 HBSCN 0222 Brüning I In einer Nische siehet man die Vorstellung einer gebürgigten Landgegend, rings umher ist ein Gebinde von verschiedenen Blumen; alles ist sehr schön nach der Natur. Auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 54 Zoll, breit 45 Zoll Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (12 Sch) Käufer: Ego 1790/05/20 HBSCN 0245 Brüning I Ein Stilleben mit Früchten, welche auf einem Tische liegen. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 13 Zoll, breit 21 Zoll Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (10 Sch) Käufer: Ego 1790/08/13 HBBMN 0099 Brüning I Verschiedene Gartenfrüchte liegen auf einem Tisch; sehr stark gemahlt. Auf Leinwand, in schwarzen Rahm goldnen Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 16 Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Verkauft (1 M) Käufer: Packischefsky 1796/09/08 HBPAK 0041 Brüning I Zwey Vasen mit Rosen und andern Blumen auf einem Tische. I Diese Nr.: Eine Vase mit
1742/08/01 BOAN 0066 Brusa Sordi I Ein grosses Stuck, die Blinde von Venetien praesentirend. Original von Brusa Sordi. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0180 Brusa Sordi I Ein Stuck, vvorauff der Heyl. Franciscus den Ablass Portiunculae empfanget auf Marmor gemahlet. Original von Brusa Sordi. I Mat.: auf Marmor Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0017 Brusa, Sordi I L'Aveuglement des Venitiens, par Brusa, Sordi. I Maße: haut 3. p. large 7. p. 7. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0044 Brusa Sordi I S. Francois recevant l'Indulgence de la Portioncule, sur Marbre ; par Brusa Sordi (piece qui ne seroit pas defavouee par Raphael Urbino). I Mat.: auf Marmor Maße: Haut 1. p. 4. pou. & demi, large 11. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt
Bruyn, Nicolaes de (Kopie nach) 1792/08/20 KOAN 0002 Nicolaus de Brin I Ecce Homo mit vielem zusammen geloffenen Volk auf Tuch nach Nicolaus de Brin. I Mat. : auf Leinwand Maße: 3 Schuh 9 Zoll hoch, 2 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
419
Bry (oder Bray) 1798/06/04 HBPAK 0197 Van de Bry I Ein hoher Berg mit Mauerwerk, wo am Fuße desselben ein Fluß, worüber eine Brücke führt, und auf welchem ein Fahrzeug mit Herrschaften übergesetzt wird. Schön gemahlt. Auf Holz, goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 21 Zoll, breit 29 Zoll Transakt.: Unbekannt
Bryer, Cornells de 1782/07/00 FRAN 0064 C.D. Bryer I Ein sehr fleißig ausgeführtes Früchtenstückchen, wobey ein Römerglas angebracht ist, von C.D. Bryer 1655. I Maße: 9 Zoll hoch, 10 Zoll breit Inschr.: 1655 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] fl) 1794/09/09 HBPAK 0049 C. de Dryer I Ein fleißig gemahltes Fruchtstück. Auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 23 Zoll, breit 30 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/02/27 HBPAK 0044 C. de Briers I Zwey italienische Fruchtstücke. Auf dem einen liegen auf einem Tische Trauben, Kirschen ec. nebst Federvieh. Auf dem andern liegen auf einem Tische Trauben, Feigen, Castanien ec. Ganz kräftig gemahlt. Auf Leinwand. Im goldn. Rahm. I Diese Nr.: Ein italienisches Fruchtstück. Auf einem Tische Trauben, Kirschen ec. nebst Federvieh Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 14 Zoll, breit 18 Zoll Anm.: Die Lose 44 und 45 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/02/27 HBPAK 0045 C. de Briers I Zwey italienische Fruchtstücke. Auf dem einen liegen auf einem Tische Trauben, Kirschen ec. nebst Federvieh. Auf dem andern liegen auf einem Tische Trauben, Feigen, Castanien ec. Ganz kräftig gemahlt. Auf Leinwand. Im goldn. Rahm. I Diese Nr.: Ein italienisches Fruchtstück. Auf einem Tische liegen Trauben, Feigen, Castianien ec. Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 14 Zoll, breit 18 Zoll Anm.: Die Lose 44 und 45 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
lich Schade, daß das Colorit ein wenig kalt ist; indem es zu stark in das Aschfarbige fällt. Jedoch sind viele andere Schönheiten der Kunst in diesem Stücke angebracht, die es einer Achtung würdig machen. Der Geschmack des Palamedes; der Fleiß eines Mieres und Gerard Dovs, denen Buck in diesem Gemähide sorgfältig gefolget ist; und seine Nachahmung in der Zeichnungsart des Gerard Teerbourgs, tragen sehr viel zur Verschönerung dieses Bildes bey. [Text hier gekürzt] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 3 Zoll hoch, und 2 Fuß 10 Zoll breit Verkäufer: Johann Gottlieb Stein Transakt.: Unbekannt
Budi [Nicht identifiziert] 1793/00/00 NGWID 0361 Budi I Ein schwarz und braunes Pferd ohne Rahmen, von Budi. I Pendant zu Nr. 362 Maße: 11 Zoll hoch, 1 Schuh breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0362 Budi I Zum Gegenstück, ein graues und braunes Pferd, vom nemlichen Meister [Budi] und Maaß. I Pendant zu Nr. 361 Maße: 11 Zoll hoch, 1 Schuh breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
Bürchs [Nicht identifiziert] 1794/00/00 FGAN [B]0020 Bürchs I Eine Landschaft mit Schaafen stafiert, auf Tuch gemalt. I Mat.: auf Leinwand Maße: 10 Zoll hoch, 1 Schuh breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt (33 fl)
Bueren (Büren) 1784/08/02 FRNGL 0068 van Büren I Eine Landschaft wo verschiedene Weibspersonen sich am Wasser mit Waschen beschäftigen. I Maße: 30 Zoll breit, 22 Zoll hoch Verkäufer: C Transakt.: Verkauft (2 fl) Käufer: Bäumer
Bugner [Nicht identifiziert] Buchten [Nicht identifiziert] 1752/05/08 LZ AN 0074a Buchten I Zwey Bataillen von Buchten, jedes 1 lA Elle hoch 1 ιλ Elle breit, im Holl. Rahmen. I Diese Nr.: Eine Bataille Maße: 1 V* Elle hoch, 1 Vi Elle breit Anm.: Die Lose 74a und 74b wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (3.16 Th für die Nm. 74a und 74b) Käufer: Faber 1752/05/08 LZAN 0074b Buchten I Zwey Bataillen von Buchten, jedes 1 V* Elle hoch 1 Vi Elle breit, im Holl. Rahmen. I Diese Nr.: Eine Bataille Maße: 1 lA Elle hoch, 1 V2 Elle breit Anm.: Die Lose 74a und 74b wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (3.16 Th für die Nrn. 74a und 74b) Käufer: Faber
Buck, J. 1763/00/00 BLAN 0047 J. U. Buck I Ein Officier, der sich in einem Bauerhause einquartieret hat. Ganze Figuren, auf Leinewand gemahlt, 2 Fuß 3 Zoll hoch, und 2 Fuß 10 Zoll breit. Die Vorstellung ist eigentlich das Innere eines Bauerhauses, in welchem ein Officier sitzt und eine Pfeife Taback rauchet. Neben ihm stehet ein hübsches Frauenzimmer, vielleicht seine gefällige Wirthinn, die ihre Hand, ohnzweifel bedeutungsvoll, auf seine Schulter leget, für welche Galanterie er ihr auch einen freudlichen und verliebten Blick macht. Um ihn herum sind einige Waffen; und an der einen Seite der Stube liegen zween ermüdete Kriegesknechte, die sehr sanft zu schlafen scheinen. Alle diese mannigfaltige Gegenstände, wozu noch ein Windhund kommt, den man ebenfalls ganz deutlich auf diesem Gemählde sehen kann, sind in einer angenehmen Haltung mit großen Heiße ausgemahlt. Die Zeichnung sowol der Hauptfiguren, als auch aller übrigen erzählten Nebensachen ist sehr schön; und es ist war420
GEMÄLDE
1786/10/18 HBTEX 0014 Bugner so schön als Wateau I Tanzende Kinder im Grünen; lebhaft gemahlt auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 5 Zoll 9 Linien, breit 6 Zoll 7 Linien Transakt.: Unbekannt
Buken, Jan van 1777/05/26 FRAN 0448 Shan von Buken I Schönes Bauren= Stück, vom Shan von Buken discipel von Tiniers. I Verkäufer: Finsterwalder Transakt.: Verkauft (36.15 fl) Käufer: Mevius 1790/01/07 MUAN 0770 Bücken van I Ein Federwildprettstück, nebst einem Haasen, auf Leinwat, in einer geschnittenen und vergoldeten Ram. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 10 Zoll, Breite 1 Schuh 3 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
Bulland [Nicht identifiziert] 1785/05/17 MZAN 1081 Bulland I Ein Mann mit einem Trinkglase in der Hand von Bulland. [Un homme ayant un verre ä boire ä la main.] I Pendant zu Nr. 1082 Maße: 8 Zoll hoch, 7 V2 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (12 fl für die Nm. 1081 und 1082) Käufer: Rmus D Custos L Β ä Zobel 1785/05/17 MZAN 1082 Bulland I Das Gegenbild, ein Mädchen mit einem Musikbuch in der Hand, und eine Mannsperson mit einer Zitter von eben demselben [Bulland] und von nämlicher Höhe und Breite. [Le pendant, une fille ayant un papier de musique ä la main, & un jeune homme tenant une guitarre, par le meme [Bul-
land], meme hauteur & largeur.] I Pendant zu Nr. 1081 Maße: 8 Zoll hoch, 7 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (12 fl für die Nrn. 1081 und 1082) Käufer: Rmus D Custos L Β ä Zobel
Bunnik, Jan van 1776/00/00 WZTRU 0127 Johann Bunnick I Ein Stück, 1 Schuhe, 5 Zoll breit von Johann Bunnick stellet vor eine Winterlandschaft in einer holländischen Gegend mit sehr fleißigen Figuren staffirt. Eine glänzende Colorit, ein in der Ferne sich verbreitender Tuft [sie], geben diesem Stücke den behörten Ausdruck. I Pendant zu Nr. 128 von Boudewyns Maße: 1 Schuhe hoch, 5 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (22 fl Schätzung) 1781/00/00 WZAN 0127 Johann Bunnick I Ein Stück, 1 Schuhe, 5 Zoll breit von Johann Bunnick, stellet vor eine Winterlandschaft in einer holländischen Gegend mit sehr fleißigen Figuren staffln vor. Eine glänzende Kolorit, ein in der Ferne sich verbreitender Duft, geben diesem Stücke den gehörigen Ausdruck. I Pendant zu Nr. 128 von Boudewyns Maße: 1 Schuhe hoch, 5 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1788/06/12 HBRMS 0095 J. Bunninck I Zwey schöne Landschaften mit Stoffage, stark gemalt. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine schöne Landschaft mit Stoffage Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 22 Zoll, breit 26 Zoll Anm.: Die Lose 95 und 96 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1788/06/12 HBRMS 0096 J. Bunninck I Zwey schöne Landschaften mit Stoffage, stark gemalt. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine schöne Landschaft mit Stoffage Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 22 Zoll, breit 26 Zoll Anm.: Die Lose 95 und 96 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Büppel [Nicht identifiziert] (Kopie nach) 1800/11/12 HBPAK 0451 pel. I Transakt.: Unbekannt
Büppel I Zwey Seestücke, nach Büp-
Burg(Burgh) 1742/08/01 BOAN 0259 der Burg der Vatter \ Ein Stuck mit einer Uhr. Original von der Burg dem Vatter. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0391 Van der Burg I Noch eine Landschafft von Van der Burg. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0459 van der Burg I Eine kleine Landschafft. Orig. von van der Burg. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt
1742/08/30 BOAN 0313 Van der burg I Un päisage, par Van der burg. I Maße: Haut 2. pieds 3. pou. large 2. pieds 8. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0365 Van der Burg I Un Paisage, par Van der Burg. I Maße: Haut 2. p. 5. pou., large 3. pies Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1763/01/19 FRJUN O l l i Van der Burg I Une tres belle piece en camayeux representant la Justice avec la prudence, parfaitement peinte. I Maße: hauteur 44 pouces, large 69 pouces Transakt.: Unbekannt (30 fl) 1771/05/06 FRAN 0138 van der Burg I Ein klein Stück, darauf St. Hieronymus in einer Höhle, auf Tuch. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 10 Zoll, breit 8 Zoll Verkäufer: Johann Friederich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt 1775/05/15 FRAN 0091 van der Burg I Ein klein Stück, darauf St. Hieronymus in einer Höhle, auf Tuch. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 10 Zoll, breit 8 Zoll Verkäufer: Johann Friedrich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt
Burg, Adriaan van der 1750/00/00 KOAN 0076 Burg de Dortdrecht I Une tres belle piece, representant une Dame, dans sa chambre ä coucher, ä qui Cupido fait un bandage au pie, Par Burg de Dortdrecht, Eleve de van der Werffs. I Maße: Largeur 2 Pies, Haut 1 Pies 6 Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1767/00/00 KOAN 0051 Burg von Dordrecht I Ein Stuck auf Holtz, worauf ein Frauenzimmer, welchem Cupido den Fuß verbindet, von Burg von Dordrecht. I Maße: Breite 2 Fuß 10 % Zoll, Höhe 2 Fuß 4 Vi Zoll Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt
Burg, Adriaan van der (und Siberechts, J. und Huysmans, C.) 1786/05/02 NGAN 0181 Siebrecht; Heusmann; van der Burg I Ein Kriegs Armaturen Stück von 3 Mahlern auf Holz, von Siebrecht, Heusmann und van der Burg. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Schuh 10 Zoll hoch, 2 Schuh 8 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (14.1 fl) Käufer: Wild 1793/00/00 NGWID 0030 Siebrecht; Huyssmann; van der Borgt I Ein Waffenstück, von Siebrecht, Huyssmann, und van der Borgt, diese drey Mahler scheinen sich vereinigt zu haben, etwas vollständiges zu liefern, indem sowohl die Figuren, als Waffen und übrigen Gruppirungen sehr gut dargestellt sind. I Maße: 2 Schuh 8 Zoll hoch, 3 Schuh 4 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
1742/08/01 BOAN 0544 Van der Burg I Eine kleine Landschafft. Origin, von van der Burg. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt
Burger, J.
1742/08/01 BOAN 0545 der alte von der Bourg I Noch eine Landschafft mit Figuren. Orig. vom alten von der Bourg. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt
1791/07/29 HBBMN 0099 J. Burger I Eine türkische Vestung, vor welche sich Reisende zu Pferde, und zu Fuß befinden, auf Lein. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 28 Zoll, breit 36 Zoll Transakt.: Unbekannt (1.8 M)
1742/08/30 BOAN 0143 Van der Burg le pere I Une Orloge peinte par Van der Burg le pere. I Maße: Haut 2. pies large 1. pie 3. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0292 Van der Burg I Un Paysage par Van der Burg. I Maße: Haut 9. pou., large 1. pied Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0312 Vanderburg le vieux I Autres pai'sages avec figures, par Vanderburg le vieux. Couple. I Maße: Haut 2. pieds 9. pouces, large 3 Vi pieds Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt
Burgkmair, Hans (der Ältere) 1723/00/00 PRAN [A]0011 Purchmejer I Ein Contrafait / vom Purchmejer. I Pendant zu Nr. [A]12 von Flinck Maße: Höhe 2 Schuh 3 Zoll, Breite 1 Vi Schuh 3 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1777/03/03 AU AN 0004 Burgmair I Ein Christus am Oelberg, de anno 1505. I Maße: Höhe 5 Sch. 9 Vi Zoll, Breite 3 Sch. 8 Zoll Inschr.: anno 1505 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde GEMÄLDE
421
datiert ist. Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt Gegenw. Standort: Hamburg, Deutschland. Kunsthalle. (394) 1790/01/07 MUAN 0726 Burgmayr Joh. I Maria mit dem Jesuskinde, auf der Schoose, auf Holz, mit der Jahrzahl 1509. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 4 Zoll, Breite 11 Zoll Inschr.: 1509 (datiert) Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1200 Burgmayr Joh. I Die Kreuzigung Christi, auf Holz, in einer schwarzgepeizten Ram mit vergoldeten Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 4 Schuh 3 Zoll, Breite 2 Schuh 9 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1335 Burgmayr Joh. I Das Opfer der drey Weisen aus Morgenland, auf Holz, in einer geschnittenen und metallisirten Ram. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 3 Schuh 6 Zoll, Breite 2 Schuh 6 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0475 Hans Burgmayr I Christus am Kreuze, unten Maria, Johannes und Magdalena, von Hans Burgmayr. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 2 Schuh 3 Zoll breit 1 Schuh 9 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Busch 1765/03/27 FRKAL 0024 Van den Busch I Un beau tableau avec des fruits & assortments bien acheve. I Maße: hauteur 38 pouces, largeur 30 pouces Transakt.: Verkauft (15 fl)
Busch, Ludwig Wilhelm 1763/01/17 HNAN [AJ0031 Busch\ St. Jean dans 1'Isle de Pathmos, par Busch, sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 6 pouces, Largeur 4 Vi pouces Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt 1763/01/17 HNAN [A]0053 Busch I Une Adoration des Bergers, par Busch, sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 6 pouces, Largeur 8 Vi pouces Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt 1763/01/17 HNAN [A]0054 Busch I Une Annonciation, par le meme [Busch] sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 6 pouces, Largeur 8 Vi pouces Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt 1763/01/17 HNAN [A]0055 Busch I Une Fuite en Egypte, du meme [Busch] sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 6 pouces, Largeur 8 Vi pouces Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt 1763/01/17 HNAN [A]0056 Busch I Nötre Seigneur avec ses Disciples, allant ä Emaus par le meme [Busch] sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 6 pouces, Largeur 8 Vi pouces Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt 1763/01/17 HNAN [A]0061 Busch I Les Fian^ailles de Jesus Christ, & de St. Catharine, par Busch, sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 1 pied 11 pouces, Largeur 1 pied 2 Vi pouces Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt 1763/01/17 HNAN [A]0062 Busch I Entretien de Jesus Christ avec Marie & Marthe, sur toile, du meme [Busch]. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hauteur 2 pieds 3 pouces, Largeur 2 pieds 11 pouces Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt 1763/01/17 HNAN 0057 Busch I La sepulture de J. Christ, par Busch, sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 1 pied 10 Vi pouces, Largeur 2 pieds 2 pouces Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt 422
GEMÄLDE
1774/10/05 HBNEU 0092 Lud. W. Busch I Zwo philosophische Köpfe. I Diese Nr.: Ein philosophisher Kopf Anm.: Die Lose 92 und 93 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1774/10/05 HBNEU 0093 Lud. W. Busch I Zwo philosophische Köpfe. I Diese Nr.: Ein philosophisher Kopf Anm.: Die Lose 92 und 93 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1775/02/25 HBBMN 0079 Busch I Zwey philosophische Köpfe. I Diese Nr.: Ein philosophischer Kopf Anm.: Die Lose 79 und 80 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1775/02/25 HBBMN 0080 Busch I Zwey philosophische Köpfe. I Diese Nr.: Ein philosophischer Kopf Anm.: Die Lose 79 und 80 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1775/04/20 HNAN 0345 Busch I Zwey Köpfe von Busch. I Diese Nr.: Ein Kopf von Busch Anm.: Die Lose 345 und 346 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Avgvsti Rvdolphi Iesaiae Bvenemanni Transakt.: Unbekannt 1775/04/20 HNAN 0346 Busch I Zwey Köpfe von Busch. I Diese Nr.: Ein Kopf von Busch Anm.: Die Lose 345 und 346 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Avgvsti Rvdolphi Iesaiae Bvenemanni Transakt.: Unbekannt 1776/11/09 HBKOS 0009 Ludwig Willhetm Busch] Zv/ey Köpfe, eine alte Frau und ein alter Mann, im Gusto von Rembrandt, auf Holz, im schwarzen Rahm mit verguldete Leisten. I Diese Nr.: Ein Kopf einer alten Frau Mat.: auf Holz Maße: Höhe 11 Zoll, Breite 9 Vi Zoll Anm.: Die Lose 9 und 10 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (24 Μ für die Nm. 9 und 10) Käufer: Lillie Sen 1776/11/09 HBKOS 0010 Ludwig Willhelm Busch I Zwey Köpfe, eine alte Frau und ein alter Mann, im Gusto von Rembrandt, auf Holz, im schwarzen Rahm mit verguldete Leisten. I Diese Nr.: Ein Kopf eines alten Mannes Mat.: auf Holz Maße: Höhe 11 Zoll, Breite 9 Vi Zoll Anm.: Die Lose 9 und 10 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (24 Μ für die Nrn. 9 und 10) Käufer: Lillie Sen 1776/12/21 HBBMN 0061 Busch I Eine Dame in einer Niesche, die das Ciavier spielt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 Vi Zoll, breit 6 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (14.12 M) Käufer: Rohlfs 1777/02/21 HBHRN 0007 Lud. Wilh. Busch I Zwo halbe Figuren, eine alte Frau und ein junger Kerl. I Diese Nr.: Eine halbe Figur, eine alte Frau Maße: Höhe 11 Zoll, Breite 9 Vi Zoll Anm.: Die Lose 7 und 8 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1777/02/21 HBHRN 0008 Lud. Wilh. Busch I Zwo halbe Figuren, eine alte Frau und ein junger Kerl. I Diese Nr.: Eine halbe Figur, ein junger Kerl Maße: Höhe 11 Zoll, Breite 9 Vi Zoll Anm.: Die Lose 7 und 8 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/05/23 HBKOS 0013 Busch I St. Hieronimus voller Affect, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 33 Vi Zoll, Breite 26 Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/07/11 HBTEX 0024 Busch I Ein kleiner Mannskopf, in dem Gusto von Rembrand. I Transakt.: Unbekannt 1778/07/21 HBHTZ 0083 Busch I Ein Officirs=Kopf. I Maße: hoch 5 Zoll, breit 4 Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/08/29 HBTEX 0060 Busch zu Salzdahl I Ein auf der Laute spielender Musicus, in einer Niesche, von Busch zu Salzdahl, ein vorzügliches Stück. I Maße: Höhe 8 Zoll, Breite 6 Zoll Transakt. : Unbekannt (15 Μ [?]) 1781/09/10 BNAN 0043 L. W. Busch I Büste eines Alten, mit großem Bart und Calotte, von vorne. [Beyde von L.W. Busch.] I Mat.: auf Holz Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 44 und beziehen sich auf die Nrn. 43 und 44. Transakt.: Unbekannt
1781/09/10 BNAN 0044 L.W. Busch I Büste eines unbärtigen Türcken. Beyde von L.W. Busch. I Mat.: auf Holz Maße: 9 Zoll hoch, 8 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1784/05/11 HBKOS 0091 Busch I Ein sehr lebhafter Junge, nach der Natur, von Busch, gemahlt auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 18 Zoll, breit 14 Zoll Transakt.: Unbekannt (20 Sch) 1785/04/22 HBTEX 0010 W.L. Busch I Eine auf dem Clav l er spielende Dame. Auf Holz. Schwarzer Rahm und goldne Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 Zoll, breit 6 Zoll Transakt.: Unbekannt 1785/12/21 HBKOS 0100 Busch I Ein alter bärthigter Manns= Kopf, im schwarzen Rahm. I Transakt.: Unbekannt 1786/05/12 HBTEX 0041 mit dem Lichte der Katze eine gen hat, plaissant gemahlt, auf 11 Zoll, breit 8 Zoll Transakt.:
Busch I Ein junges Mädgen, zeiget Maus, welche sie in der Falle gefanHolz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch Verkauft (1.4 M) Käufer: Schoen
1786/10/18 HBTEX 0076 Busch I Eine reiche Frau, die Gold= Stücke aus einem Sacke auf der Goldwage wiegt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 6 Zoll 6 Linien, breit 4 Zoll 9 Linien Transakt.: Unbekannt 1786/11/11 HBRMS 0120 W.L. Busch I Zwey Manns=Köpfe, dessen einer mit einem Turban. I Diese Nr.: Ein Manns=Kopf Anm.: Die Lose 120 und 121 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/11/11 HBRMS 0121 W.L. Busch I Zwey Manns=Köpfe, dessen einer mit einem Turban. I Diese Nr.: Ein Manns=Kopf Anm.: Die Lose 120 und 121 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/11/11 HBRMS 0122 L. W. Busch I Zwey dergleichen [Manns=] Köpfe. I Diese Nr.: Ein Manns=Kopf Anm.: Die Lose 122 und 123 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/11/11 HBRMS 0123 L.W. Busch I Zwey dergleichen [Manns=] Köpfe. I Diese Nr.: Ein Manns=Kopf Anm.: Die Lose 122 und 123 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1787/00/00 HB AN 0310 Ludewig Wilhelm Busch I Ein alter Mann mit langem greisen Bart und Haaren sitzt, mit einem ehrwürdigen Gesicht, in einen rauhen Pelz gehüllt. So schön gemahlt, wie Gerhard Dow. Brustbild. A.H. [Auf Holz] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Pendant zu Nr. 337 Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 % Zoll, breit 8 Zoll Transakt.: Verkauft (4 M) Käufer: Bertheau 1787/00/00 HB AN 0337 L. W. Busch I Das Brustbild eines alten Mannes in bloßem Kopfe und kurzem Barte, in braunem Kleide. Sehr schön gemahlt. A.H. [Auf Holz] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] Ist der Pendant zu No. 310. I Pendant zu Nr. 310 Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 % Zoll, breit 8 Zoll Transakt.: Verkauft (4 M) Käufer: Bertheau 1787/10/06 HBTEX 0127 W. Busch I Das Brustbild eines Türken, von W. Busch, im vergoldeten Rahm. I Transakt.: Unbekannt 1789/03/05 SCAN [0005] Hofmahler Busch zu Salzdahlen \ 12 Stuck en minuature [sie], Apostel und Fürstl. Personen aus dem Hause Braunschweig vorstellend, vom Hofmahler Busch zu Salzdahlen. I Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: loan Arnold Ballenstadii Transakt.: Unbekannt
Zoll Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (18.4 M) Käufer: Ρ ν Hessenstein 1790/08/13 HBBMN 0040 M.L. Busch, so schön wie Gerh. Dow I St. Hieronymus betet mit gefaltenen Händen über einen Todtenkopf, halbe Figur. Sehr angenehm und mit ausnehmendnen Fleis gemahlt. Auf Holz G.R. [Goldnen Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Vi Zoll, breit 8 Zoll Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "M.L. Busch", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einem Fehler. Transakt.: Verkauft (1.10 M) Käufer: Eckhardt 1792/07/28 HBSCN 0121 Busch I Die heilige Familie, auf der Flucht nach Egypten, in einer gebüschichten Landstraße mit vielen Fleiße vorgestellet. Auf H[olz]. G.R. [Goldnen Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 8 Zoll Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0127 Busch I Ein bärtiger Mannskopf mit vielen Fleiß und Wärme entworfen. Auf H[olz]. S.R.G.L. [Schwarzen Rahm Goldne Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 7 Vi Zoll Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0129 Busch I Des berühmten Mahlers Gerhoux Portrait, historisch und angenehm vorgestellet. Auf Holz. S.R.G.L. [Schwarzen Rahm Goldne Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 Zoll, breit 6 Zoll Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 HBMFD O l l i Busch von Salzthalen I Die sich erstechende Lucretia. Halbe Figur. I Pendant zu Nr. 112 Mat.: auf Holz Maße: 8 Zoll hoch, 6 Zoll breit Verkäufer: Pierre Laporterie Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 HBMFD 0112 Busch von Salzthalen I Das Gegenstück. Ein junges Mädchen hält in ihrer rechten Hand eine Nelke. Hinten eine Nische. Besonders delicat behandelt. I Pendant zu Nr. 111 Mat.: auf Holz Maße: 8 Zoll hoch, 6 Zoll breit Verkäufer: Pierre Laporterie Transakt.: Unbekannt 1793/09/18 HBSCN 0151 L. Busch I Ein Philosoph, der Federn schneidet. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Vi Zoll, breit 7 Zoll Transakt.: Unbekannt 1795/03/12 HBSDT 0008 Busch I Der Kopf eines Knaben. Auf Holz, im schwarzen Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 8 Zoll Transakt.: Unbekannt 1795/11/17 HBPAK 0066 Von Busch I Eine Frau, die in der Hand Geld zählet. Schw. Rahm mit gold. Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 14 Zoll, breit 12 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/08/00 HBPAK 0109 Salzdaler Busch I Ein alter Mannskopf mit einer Pelzmütze. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 15 Zoll, Breite 12 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0147 Busche I Eine schlafende Venus mit dem Amor. I Maße: Hoch 26 Zoll, breit 31 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0015 L. Busch I Zwey Köpfe, Frau und Mann. I Diese Nr.: Ein Kopf einer Frau Anm.: Die Lose 15 und 16 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0016 L. Busch I Zwey Köpfe, Frau und Mann. I Diese Nr.: Ein Kopf eines Mannes Anm.: Die Lose 15 und 16 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1789/06/12 HBTEX 0222 W.L. Busch I Ein Persianer. Halbe Figur. Sehr schön gemahlt. Auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 15 Zoll, breit 18 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt
1796/12/07 HBPAK 0113 S. Busch I Zwey alte Köpfe. I Diese Nr.: Ein alter Kopf Anm.: Die Lose 113 und 114 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1790/05/20 HBSCN 0152 W.L. Busch I Ein alter Mann in Morgenländischer Kleidung, mit vielen Fleiß gemahlt. Auf H[olz]. G.R. [Goldnen Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 7 Vi
1796/12/07 HBPAK 0114 S. Busch I Zwey alte Köpfe. I Diese Nr.: Ein alter Kopf Anm.: Die Lose 113 und 114 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
423
1796/12/07 HBPAK 0128 S. Busch I Zwey Apostel=Köpfe. I Diese Nr.: Ein Apostel=Kopf Anm.: Die Lose 128 und 129 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0129 5. Busch I Zwey Apostel=Köpfe. I Diese Nr.: Ein Apostel=Kopf Anm.: Die Lose 128 und 129 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 Unbekannt
HBPAK
0131
1798/08/10 HBPAK 0078 Busch I Zwey Köpfe. Stark und gut gemahlt. Im goldnen Rahm. I Diese Nr.: Ein Kopf Maße: Hoch 5 Zoll, breit 4 Zoll Anm.: Die Lose 77 und 78 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0184 Busch I Zwey alte Köpfe. Auf Holz, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein alter Kopf Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Zoll, breit 7 Zoll Anm.: Die Lose 184 und 185 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0185 Busch I Zwey alte Köpfe. Auf Holz, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein alter Kopf Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Zoll, breit 7 Zoll Anm.: Die Lose 184 und 185 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0186 Busch I Zwey alte Köpfe. Auf Holz, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein alter Kopf Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Zoll, breit 7 Zoll Anm.: Die Lose 186 und 187 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0187 Busch I Zwey alte Köpfe. Auf Holz, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein alter Kopf Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Zoll, breit 7 Zoll Anm.: Die Lose 186 und 187 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Busch, Ludwig Wilhelm (Kopie von) 1793/06/07 HBBMN 0105 W. L. Busch; Rembrandt I Das Brustbild eines Mannes, in morgenländischen Costüme. Nach Rembrandt, fleißig gemahlt, von W. L. Busch. I Kopie von L.W. Busch nach Rembrandt Maße: Hoch 7 Vi Zoll, breit 6 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/00/00 HLAN [0119] Busch in Braunschweig; Hondhorst I Ein Knabe mit der Flöte. 16. 13. nach Hondhorst, von Busch in Braunschweig auf Leinvv. I Kopie von L.W. Busch nach G. Honthorst Mat.: auf Leinwand Maße: 16. 13. Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: [Friedrich Karl Lang] Transakt.: Unbekannt (18.8 Rt; 33 fl Schätzung)
Busch, M. [Nicht identifiziert] 1790/02/04 HBDKR 0059 M. Busch I Zwey Land= und Wassergegenden mit vielen Figuren, auf Holz. I Diese Nr.: Eine Land= und Wassergegend mit vielen Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 V* Zoll, breit 7 Zoll Anm.: Die Lose 59 und 60 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (3.4 Μ für die Nrn. 59 und 60) Käufer: Engel 1790/02/04 HBDKR 0060 M. Busch I Zwey Land= und Wassergegenden mit vielen Figuren, auf Holz. I Diese Nr.: Eine Land= und Wassergegend mit vielen Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Ά Zoll, breit 7 Zoll Anm.: Die Lose 59 und 60 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (3.4 Μ für die Nrn. 59 und 60) Käufer: Engel GEMÄLDE
1800/11/12 HBPAK 0671 N. Busch I Zwey Köpfe, nach N. Busch. I Transakt.: Unbekannt
Busch, R. von [Nicht identifiziert] (Manier)
S. Busch I Ein alter Kopf. I Transakt.:
1798/08/10 HBPAK 0077 Busch I Zwey Köpfe. Stark und gut gemahlt. Im goldnen Rahm. I Diese Nr.: Ein Kopf Maße: Hoch 5 Zoll, breit 4 Zoll Anm.: Die Lose 77 und 78 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
424
Busch, N. [Nicht identifiziert] (Kopie nach)
1787/04/03 HB HEG 0065 R. von Busch I Ein Kopf mit langem Barte und einen Turban, wie Titians Portrait vorstellend, wie R. von Busch, auf Leinewand. I Transakt.: Verkauft (2.2 M) Käufer: Hofr Ehrenreich
Buschian [Nicht identifiziert] 1767/00/00 KOAN 0069 Buschian I Ein Bauren=stuck auf Leinewand von Buschian so gut als Teniers. I Mat.: auf Leinwand Maße: Breite 2 Fuß 7 % Zoll, Höhe 2 Fuß Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt
Butler 1793/00/00 HBMFD 0018 Van Butler. 16551 Ganze Figuren in der Grösse von 10 ä 11 Zoll. Das Innere einer ländlichen Küche. Zur rechten sitzt eine Frau im Stuhl vor'm Feuerheerd und backt Kuchen. Der Feuerheerd ist mitten aufm Gemälde, und zur linken ein Knabe der sich wärmt; er sitzt auf einem Stuhle und man sieht nur wenig von sein [sie] Gesichte; hinter ihm ein erwachsenes Mädchen. Mit einer Menge Küchengeräthschaf [sie] und sonstigen Nebensachen. I Pendant zu Nr. 19 Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuss 7 Vi Zoll hoch, 2 Fuss Vi Zoll breit Inschr.: 1655 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Pierre Laporterie Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 HBMFD 0019 Van Butler. 1655 I Das Gegenstück. Das Innere eines Bauerhauses, wo zur rechten der Hintergrund mit verschiedenen Hausgerathe angefüllt ist. Durch eine geöfnete Thür sieht man eine alte Frau vorm Feuerheerd. Das Hauptlicht fallt durch ein grosses Fenster von der linken Seite her. Im Vordergründe sitzt ein bärtiger Alter im Lehnstuhle und preparirt Fische. Neben ihn auf der Erde eine Schüssel mit Fische &c. Die Werke dieses Meisters sind ausserordentlich rar; man schickt selten was von ihm ausm Lande, so sehr schätzt man sie. Er hat sich nach Mieris und Gerhard Douw gebildet, und seine Gemälde mit ungewöhnlicher Uebereinstimmung und äusserst lebhaften Fleis ausgeführt. Richtig gezeichnet und von natürlichen Ausdrücken. I Pendant zu Nr. 18 Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuss 7 Vi Zoll hoch, 2 Fuss Vi Zoll breit Inschr.: 1655 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Pierre Laporterie Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0057 Von Buttler I Das Innere von zwey Bauernhäusem; das eine, wo eine Frau Kuchen backt; und das andere, ein alter Mann, der Fische reinigt; nebst verschiedenen andern Figuren. Zwey sehr schöne und schätzbare Gemähide. Auf Holz. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Das Innere von einem Bauernhaus wo eine Frau Kuchen backt Mat.: auf Holz Maße: Hoch 19 Zoll, breit 24 Zoll Anm.: Die Lose 57 und 58 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0058 Von Buttler I Das Innere von zwey Bauernhäusern; das eine, wo eine Frau Kuchen backt; und das andere, ein alter Mann, der Fische reinigt; nebst verschiedenen andern Figuren. Zwey sehr schöne und schätzbare Gemähide. Auf Holz. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Das Innere von einem Bauernhaus; ein alter Mann, der Fische reinigt Mat.: auf Holz Maße: Hoch 19 Zoll, breit 24 Zoll Anm.: Die Lose 57 und 58 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Buttner, Jurriaan 1750/06/15 HB RAD 0011 J. Büttner I J. Büttner, zwey angenehme und lustige Baurengesellschaften. I Diese Nr.: Eine angenehme und lustige Baurengesellschaft Anm,: Die Lose 11 und 12 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1750/06/15 HB RAD 0012 J. Büttner I J. Büttner, zwey angenehme und lustige Baurengesellschaften. I Diese Nr.: Eine angenehme und lustige Baurengesellschaft Anm.: Die Lose 11 und 12 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/02/17 HBPAK 0065 J. Büttner I Auf der Diehle eines Landhauses sitzen um eine Tanne einige junge Bauren, wovon zwey musiciren. Durch die halb offene Thüre, wo man nach dem Dorfe hinaus sieht, guckt ein Bauer herein, und durch ein kleines Wandfenster sieht ihnen eine alte Frau zu. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 24 Zoll, Breite 50 Zoll Transakt.: Verkauft (121 M) Käufer: Τ
Butzi, Sebastian [Nicht identifiziert] 1768/08/16 KOAN 0079 Sebastian Butzi I Ein Schetz Venus & Adonis auf Holtz von Sebastian Butzi. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 9 Zoll, Breite 1 Fuß 2 Zoll Verkäufer: Freyherr von Kaas Transakt.: Unbekannt
Buys, Jacobus 1799/00/00 WZAN AO 124 Jacob Buys I Zwey Gesellschaftsstücke, von Jacob Buys. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Gesellschaftsstück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 8 Zoll breit 1 Schuh 2 Zoll Anm.: Die Lose A124 und A125 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0125 Jacob Buys I Zwey Gesellschaftsstücke, von Jacob Buys. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Gesellschaftsstück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 8 Zoll breit 1 Schuh 2 Zoll Anm.: Die Lose A124 und A125 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Buytewech, Willem Pietersz. 1799/00/00 WZAN 0718 Willhelm Buytenweg I Drey Holländer Bauernstückchen, von Willhelm Buytenweg. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Holländer Bauemstückchen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 8 Zoll breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 718 bis 720 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0719 Willhelm Buytenweg I Drey Holländer Bauernstückchen, von Willhelm Buytenweg. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Holländer Bauemstückchen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 8 Zoll breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 718 bis 720 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0720 Willhelm Buytenweg I Drey Holländer Bauernstückchen, von Willhelm Buytenweg. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Holländer Bauernstückchen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 8 Zoll breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 718 bis 720 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Höhe 2 Vi Schuh 2 Zoll, Breite 3 Schuh 4 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN [A]0089 Pys I Ein Haaß / vom Pys. I Pendant zu Nr. [A]87 von Hamilton Maße: Höhe 3 Schuh 2 Vi Zoll, Breite 2 Schuh 5 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN [A]0090 Pys I Flora / vom Pys. I Maße: Höhe 2 Schuh, Breite 2 Schuh 5 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN [A]0091 Pyss I Ceres / vom Pyss. I Maße: Höhe 2 Schuh, Breite 2 Schuh 5 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN [A]0101 Pyss I Engel Gabriel / vom Pyss. Compag. No [A] 108. I Pendant zu Nr. [A]109 von Pasquale Rossi Maße: Höhe 1 Vi Schuh, Breite 1 Schuh 2 Vi Zoll Anm.: Im Katalog ist irrtümlich die Nr. [A] 108 als Pendant angegeben. Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN [A]0108 Pyss I Companion vom Pyss. I Pendant zu Nr. [A]107, "Ein Blumen Stuck" von R. Savery Maße: Höhe 1 Schuh, Breite Vi Schuh 1 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN [AJ0121 Pyss I Blumenstuck / vom Pyss. Compagnion No [A]128. I Pendant zu Nr. [A]128 Maße: Höhe 1 Vi Schuh 3 Vi Zoll, Breite 1 Schuh 4 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt Gegenw. Standort: Praha, Ceskä Republika. Närodni Galeri. (DO 4834) 1723/00/00 PRAN [A]0128 Pyss I Blumen=Stück / vom Pyss. Pendant zu Nr. [A]121 Maße: Höhe 1 Vi Schuh 3 Vi Zoll, Breite 1 Schuh 4 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt Gegenw. Standort: Praha, Ceskä Republika. Närodni Galeri. (DO 4835) 1723/00/00 PRAN [BJ0049 Pyß I S[t]einhüner / vom Pyß. I Maße: Höhe 2 Schuh 1 Zoll, Breite 1 Vi Schuh 2 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN 0061 Pyss I Venus, und AEneas/ vom Pyss. I Maße: Höhe 5 Schuh 3 Zoll, Breite 6 Schuh 2 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN 0066 Pyss I Ein Historye / vom Pyss. I Pendant zu Nr. 67 Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN 0067 Pyss I Ein Compagnion / von eben diesem Meister [Pyss], I Pendant zu Nr. 66 Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN 0068 Pyss I Ein Kopff Oval / vom Pyss. I Format: oval Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN 0069 Pyss I Drey Oval=Stück Historyen / vom Pyss. I Format: oval Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt Gegenw. Standort: Nürnberg, Deutschland. Germanisches Nationalmuseum, Leihgabe der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, hier das Bild Die Probe der Vestalin Tuscia (452) (erstes "Oval=Stück"), die beiden anderen Bilder heute in Praha, Ceskä Republika. Närodni Galeri, hier die Gemälde Die Vestalin Claudia Quinta (O-l 1977) und Penelope mit ihren Freiern (O-l 1978)
Bys, Johann Rudolf 1723/00/00 PRAN [A]0029 Pyss I Christus predigt im Schiff / vom Pyss. Compagnion von No. [A]31. I Pendant zu Nr. [A]31 von D. Vinckeboons Maße: Höhe 2 Vi Schuh 2 Vi Zoll, Breite 4 Vi Schuh Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN [A]0042 Pyss I Blumen=Crantz / vom Pyss, Compagnion No [A]45. I Pendant zu Nr. [A]45 von Panner Maße:
1723/00/00 PRAN 0124 Pyss I Zwey Blumen=Stück / vom Pyss / in vergulten Rahmen. I Maße: Höhe 1 Schuh, Breite 1 Schuh 4 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN 0142 Pyss I Ein Blumen=Stuck / vom Pyss, in weisser Rahm. I Pendant zu Nr. 143 von J.A. Angermayer Maße: Höhe 1 Vi Schuh 2 Zoll, Breite 1 Schuh 1 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
425
1776/00/00 WZTRU 0395 Rudolph Byess I Ein Stück 8 Zoll hoch, 1 Schuhe breit, von Rudolph Byess, stellet vor verschiedene Stellungen von Schwanen auf einem grauen Grund gemalet. I Maße: 8 Zoll hoch, 1 Schuhe breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (2 fl Schätzung) 1776/00/00 WZTRU 0401 Rudolph Byess I Ein Stück 6 Zoll hoch, 4 Zoll breit von Rudolph Byess, stellet vor einen fliegenden Cupido, so den Bogen in der Hand und den Pfeil abzudrucken vorgestellet ist. I Maße: 6 Zoll hoch, 4 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (2 fl Schätzung) 1781/00/00 WZAN 0395 Rudolph Byess I Ein Stück 8 Zoll hoch, 1 Schuhe breit, von Rudolph Byess, enthält verschiedene auf einem grauen Grunde gemalte Stellungen von Schwanen. I Maße: 8 Zoll hoch, 1 Schuhe breit Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0401 Rudolph Byess I Ein Stück 6 Zoll hoch, 4 Zoll breit von Rudolph Byess, stellet einen fliegenden Kupido vor, welcher mit dem Bogen in der Hand den Pfeil abdrucket. I Maße: 6 Zoll hoch, 4 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0159 Rodolphus Bys I Der h. Joseph mit dem Kinde, von Rodolphus Bys. Auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: hoch 1 Schuh 11 Zoll breit 1 Schuh 7 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Bys, Johann Rudolf (und Hoet, G. (I)) 1723/00/00 PRAN 0004 van de Hoet; Pyss I Eine Jagd Dianae van de Hoet und Pyss, in vergulter Rahm. I Maße: Höhe 4 Schuh 1 x h Zoll, Breite 1 Schuh 6 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt
Cabel, Adrian van der 1742/08/01 BOAN 0157 Cabel I Zwey schöne Seefahrten auf Kupffer gemahlt von Cabel. I Mat.: auf Kupfer Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0253 der Cabel I Eine Seefahrt. Orig. von der Cabel. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0140 Van der Cabel I Des Vaisseaux en mer, par Van der Cabel. I Maße: Haut 9. pou. large un pie. 1 Vi pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt
sammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (25 fl für die Nrn. 858 und 859) Käufer: Forstrath Keck 1785/05/17 MZAN 0859 van der Kabel I Ein Gartenprospect und ein Seehafen von van der Kabel. [La vüe d'un jardin & un port de mer.] I Diese Nr.: Ein Seehafen Maße: 2 Schuh 3 Zoll hoch, 3 Schuh 2 Zoll breit Anm.: Die Lose 858 und 859 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (25 fl für die Nrn. 858 und 859) Käufer: Forstrath Keck 1785/05/17 MZAN 0860 van der Kabel I Ein Paar Landschaften mit Vieh von eben demselben [van der Kabel], und von eben der Höhe und Breite. [Deux paysages avec du betail par le meme [van der Kübel] & de la meme hauteur & largeur.] I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Vieh Maße: 2 Schuh 3 Zoll hoch, 3 Schuh 2 Zoll breit Anm.: Die Lose 860 und 861 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (26.30 fl für die Nm. 860 und 861) Käufer: Strecker 1785/05/17 MZAN 0861 van der Kabel I Ein Paar Landschaften mit Vieh von eben demselben [van der Kabel], und von eben der Höhe und Breite. [Deux paysages avec du betail par le meme [van der Kübel] & de la meme hauteur & largeur.] I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Vieh Maße: 2 Schuh 3 Zoll hoch, 3 Schuh 2 Zoll breit Anm.: Die Lose 860 und 861 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (26.30 fl für die Nrn. 860 und 861) Käufer: Strecker 1788/10/01 FRAN 0100 van der Cabel I Zwey Landschaften mit Figuren, Fabriquen von van der Cabel. I Maße: 14 Vi Zoll hoch, 20 Zoll breit Transakt.: Verkauft (9 fl) Käufer: Bäumer 1793/09/18 HBSCN 0106 v. d. Cabel I Ein morgenländischer Seehafen. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 22 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0190 Adrian van der Kabel I Ein angenehmes stilles Wasser. Vor einem zerfallenen Gebäude liegen einige kleine Fahrzeuge, wobey sich viele Menschen mit aus und einladen beschäftigen. Der Compagnon: Eine stürmisch=brausende See, wo an einem Felsen ein Schiff scheitert, und das Volk sich an den Felsen zu retten sucht. Verständig und keck gemahlt. I Diese Nr.: Ein angenehmes stilles Wasser; Pendant zu Nr. 191 Maße: Hoch 20 Zoll, breit 26 Zoll Anm.: Die Lose 190 und 191 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1776/07/19 HBBMN 0027 van der Kaabel I Zwo italiänische Land= und Wasser=Prospecte. I Diese Nr.: Ein italiänischer Land= und Wasser=Prospect Maße: Höhe 11 Vi Zoll, Breite 1 Fuß 5 Vi Zoll Anm.: Die Lose 27 und 28 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (22 Μ für die Nrn. 27 und 28) Käufer: Berenberg
1796/09/08 HBPAK 0191 Adrian van der Kabel I Ein angenehmes stilles Wasser. Vor einem zerfallenen Gebäude liegen einige kleine Fahrzeuge, wobey sich viele Menschen mit aus und einladen beschäftigen. Der Compagnon: Eine stürmisch=brausende See, wo an einem Felsen ein Schiff scheitert, und das Volk sich an den Felsen zu retten sucht. Verständig und keck gemahlt. I Diese Nr.: Eine stürmisch=brausende See; Pendant zu Nr. 190 Maße: Hoch 20 Zoll, breit 26 Zoll Anm.: Die Lose 190 und 191 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1776/07/19 HBBMN 0028 van der Kaabel I Zwo italiänische Land= und Wasser=Prospecte. I Diese Nr.: Ein italiänischer Land= und Wasser=Prospect Maße: Höhe 11 Vi Zoll, Breite 1 Fuß 5 Vi Zoll Anm.: Die Lose 27 und 28 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (22 Μ für die Nrn. 27 und 28) Käufer: Berenberg
1797/12/08 HBPAK 0120 Adrian van der Kabel I Vor einem Wirthshause spricht ein Bettler einen Reitenden um ein Allmosen an. Im Geschmack von Wouvermann. Auf Holz, im schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 16 Zoll, Breite 12 Zoll Transakt.: Unbekannt
1779/00/00 HB AN 0006 Van der Kabel I Ein Seestück. Wolken und Dünste, hinter welchen die Sonne versteckt ist, scheinen den nahen Sturm zu verkündigen. [Marine. Des nuages & des vapeurs qui cachent le soleil, semblent annoncer une tempete prochaine.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 8 Zoll hoch, 2 Fuß 5 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt
1798/06/04 HBPAK 0154 Adrian van der Kabel I Vor einem Wirthshause spricht ein Bettler einen Reitenden um ein Allmosen an. Im Geschmack von Wouvermann. Auf Holz, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Zoll, breit 12 Zoll Transakt.: Unbekannt
1774/11/03 HBNEU 0001 Van der Gabel I Ein See=Haven auf Holz gemahlt. I Mat.: auf Holz Verkäufer: Ritter Transakt.: Verkauft (6 M) Käufer: Lilye Sen
1785/05/17 MZAN 0858 van der Kabel I Ein Gartenprospect und ein Seehafen von van der Kabel. [La vüe d'un jardin & un port de mer.] I Diese Nr.: Ein Gartenprospect Maße: 2 Schuh 3 Zoll hoch, 3 Schuh 2 Zoll breit Anm.: Die Lose 858 und 859 wurden zu426
GEMÄLDE
1799/00/00 LZAN O l l i Van der Kabel I Une Marine. Vaisseaux dans le calme avec figures; d'une touche sombre et fortement ombree mais d'un grand effet. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hauteur 14 pouces, largeur 23 pouces Transakt.: Unbekannt (10 Louis Schätzung)
1800/00/00+ LZRST [0045] Adrian van der Kabel I Ein Seestück, reiche Zusammensetzung von Schiffen, Barken, Architectur, Figuren von allen Nationen, Pferden, Kaufmannsgütern etc. I Pendant zu Nr. [46] Mat.: auf Leinwand Maße: 57 Zoll breit 33 Zoll hoch Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Rost Transakt.: Unbekannt
sitzt im Schoosse seiner Mutter, Joseph steht rechts im Hintergruude [sie], so wie Elisabeth in demselben links steht; dies Bild, in Guerchino's Manier, ist meisterhaft gemahlt; hoch 28 Zoll, breis [sie] 32 Zoll. Auf Leinwand; in einem grauen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 28 Zoll, breit 32 Zoll Verkäufer: Rauch Transakt.: Verkauft (10.12 Th) Käufer: Schwarz
1800/00/00+ LZRST [0046] Adrian van der Kabel I Ein Seestück, eine ähnliche Zusammensetzung. Gegenstück [zu Nr. 45]. I Pendant zu Nr. [45] Mat.: auf Leinwand Maße: 57 Zoll breit 33 Zoll hoch Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Rost Transakt.: Unbekannt
Cagnacci, Guido (Manier) 1794/09/10 HB GOV 0025 Guido Gagriacho I Die büßende Magdalena sitzet in einer Eremitage. Wie Guido gemahlt. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 38 Zoll, breit 31 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt
Cabel, Adrian van der (Schule)
Cagnolino [Nicht identifiziert]
1742/08/01 BOAN 0392 der Cabel I Noch zwey Holländische Landschafften von der Schuhle von der Cabel. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0366 Dercabel I Deux Pai'sages, de l'Ecole de Dercabel. Couple. I Maße: Haut 1. p. 9. pou., large 2. p. 10. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt
Caffi, Margherita 1768/07/00 MUAN 0959 Caffa I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0960 Caffa I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0047 Caffa I Deux tableaux en fleurs. Peints sur toile marques des n o s 959 & 960. I Diese Nr.: Un tableau en fleurs Mat.: auf Leinwand Maße: 2. p. 10 p. de haut sur 3. p. 11. de large Anm.: Die Lose 47 und 48 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0048 Caffa I Deux tableaux en fleurs. Peints sur toile marques des n o s 959 & 960. I Diese Nr.: Un tableau en fleurs Mat.: auf Leinwand Maße: 2. p. 10 p. de haut sur 3. p. 11. de large Anm.: Die Lose 47 und 48 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1777/03/03 AU AN 0012 Caffie Cremona I Vier große Blumenstücke. I Maße: Höhe 3 Sch. 8 Zoll, Breite 5 Sch. Vi Zoll Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt
Cagnacci, Guido 1774/08/13 HBBMN 0061 Guido Cangiasi I Ein Cupido, Lebensgröße, ein Kniestück. I Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1558 Cagnacci Quido, genannt Canlassi I Cacilia, auf Leinwat. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 6 Zoll, Breite 1 Schuh 2 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0086 Guido Conlassi I Eine Weibsperson, die Wasser aus einem grünen Kruge schüttet, von Guido Conlassi. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 1 Zoll breit 1 Schuh 7 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/10/17 LZAN 0024 Guido Cagnacci I Eine Komposition von vier Figuren, vorstellend, die heilige Familie. Das Kind Jesus
1777/03/03 AU AN 0020 Cagnolino I Zwey Stücke Märkte vorstellend. I Maße: Höhe 1 Sch., Breite 1 Sch. 4 Zoll Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt
Cairo, Francesco del 1799/00/00 WZAN 0626 Franz Cairo I Ein Mannskopf mit einem Barte, und eine Frau mit einer Mütze. Der Mannskopf von Franz de Veve, die Frau von Franz Cairo. Auf Holz. I Diese Nr.: Frau mit einer Mütze Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 7 Zoll breit 1 Schuh 1 Zoll Anm.: Die Lose 625 und 626 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Calau, Benjamin 1787/00/00 HB AN 0586 B. Calau I Das Brustbild eines mit Weinlaub bekränzten Faunen, über dessen Brust und rechten Schulter ein Fell hängt. Ein junges bekränztes Mädchen, mit Weintrauben in den Händen. Auf Gyps gemahlt. Mit Wachsfarben gemahlt. S.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Diese Nr.: Das Brustbild eines mit Weinlaub bekränzten Faunen Mat.: Wachsfarben auf Gips Maße: Hoch 5 % Zoll, breit 5 Zoll Anm.: Die Lose 586 und 587 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (6 Μ für die Nm. 586 und 587) Käufer: Fesser 1787/00/00 HB AN 0587 B. Calau I Das Brustbild eines mit Weinlaub bekränzten Faunen, über dessen Brust und rechten Schulter ein Fell hängt. Ein junges bekränztes Mädchen, mit Weintrauben in den Händen. Auf Gyps gemahlt. Mit Wachsfarben gemahlt. S.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Diese Nr.: Ein junges bekränztes Mädchen, mit Weintrauben in den Händen Mat.: Wachsfarben auf Gips Maße: Hoch 5 % Zoll, breit 5 Zoll Anm.: Die Lose 586 und 587 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (6 Μ für die Nm. 586 und 587) Käufer: Fesser
Calcar, Jan Stephan von 1778/09/28 FRAN 0151 Jean van Calicar I Ein Ecce=Homo in einem Früchtenkranz. [Un Ecce-Homo dans une couronne de fruits par Jean van Calicar.] I Maße: 3 Schuh 8 Zoll breit, 4 Schuh hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (12 fl) Käufer: Scheintz
Caldon, John [Nicht identifiziert] 1781/05/07 FRHUS 0030 John Caldon I Ein keck und meisterhaft ausgeführter Apostelkopf. I Maße: 2 Schuh 1 Zoll hoch und 2 Schuh 11 Zoll breit Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (2.10 fl) Käufer: Heusser GEMÄLDE
427
Calecken [Nicht identifiziert] 1716/00/00 FRHDR 0118 Calecken I Von Calecken Silber und Gold geschirr. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (30)
Caliari, Carlo (Carlotto Veronese) (Kopie von) 1752/00/00 NGWOL 0004 Paulo Veronesi; dessen Sohn I Die Hochzeit zu Cana, eine Copie von Paulo Veronesi, so dessen Sohn copirt. Le nozze celebrate in Cana, copia di Paolo Veronese, fatta dal di lui figlio. I Kopie von C. Caliari nach Veronese Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (240 Th)
Call [Nicht identifiziert] 1742/08/01 BOAN 0136 Call I Ein Feldhuhn mit einigen Tauben. Original von Call. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN O l l i Call I Une perdrix & un pigeon, par Call. I Maße: Haut 1. p. 10. pouc. large 1. p. 6. pouc. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt
Callot, Jacques 1690/10/30 WFAN 0229 Calot I Ein Büßer von Calot. I Verkäufer: Herzog Friedrich von Holstein-Norburg Transakt.: Verkauft (12 Gr) Käufer: Luttich 1778/05/23 HBKOS 0077 Calott I Eine Carnevals Lustbarkeit, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 12 3/2 Zoll, Breite 15 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1790/04/13 HBLIE 0208 Jac. Callot I Zwey Ziegeuner=Vorstelllungen, mit sehr vielen Figuren. I Diese Nr.: Eine Ziegeuner= Vorstellung mit sehr vielen Figuren Maße: Hoch 21 Zoll, breit 32 Zoll Anm.: Die Lose 208 und 209 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (8 Μ für die Nm. 208 und 209) Käufer: Confr R Grill 1790/04/13 HBLIE 0209 Jac. Callot I Zwey Ziegeuner=Vorstelllungen, mit sehr vielen Figuren. I Diese Nr.: Eine Ziegeuner= Vorstellung mit sehr vielen Figuren Maße: Hoch 21 Zoll, breit 32 Zoll Anm.: Die Lose 208 und 209 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (8 Μ für die Nrn. 208 und 209) Käufer: Confr R Grill 1793/00/00 NGWID 0135 Calot I Eine Spielergesellschaft schön gruppiert von Calot. I Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 1 Schuh 7 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1794/09/00 LG AN 0033 Callot I Ein Bettler von Callot, auf Leinwand, in einer verguldten Rahme. I Mat.: auf Leinwand Maße: breit 11 Zoll, hoch 1 Schuh 3 Zoll Verkäufer: [Friedrich Karl Ludwig, Freiherr von Moser] Transakt.: Unbekannt (40 rh fl Schätzung) 1795/11/14 HBPAK 0017 Callot I Zwey Bettler Familien. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Bettler Familie Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 9 Zoll, breit 7 Zoll Anm.: Die Lose 17 und 18 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1795/11/14 HBPAK 0018 Callot I Zwey Bettler Familien. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Bettler Familie Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 9 Zoll, breit 7 Zoll Anm.: Die Lose 17 und 18 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/00/00 HLAN [0034] Callot I Ein Bettler. 1 Sch. 3 Ζ. 11 Z. auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Sch. 3 Ζ. 11 Z. Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: [Friedrich Karl Lang] Transakt.: Unbekannt (27.18 Rt; 50 fl Schätzung) 1798/01/19 HBPAK 0060 Callot I Zwey vortrefliche Gemähide; mit einem markigen Pinsel gemahlt, und einer reichen Phantasie ent428
GEMÄLDE
worfen. Es sind Räuberscenen. Auf dem ersten sitzen die Räuber unter freyem Himmel und spielen Karten, indeß die Weiber eine Mahlzeit bereiten; auf dem zweyten haben sie eine Art von Gezelt aufgeschlagen, und entkleiden sich. Gleicher Grösse. 2 Fuß hoch, 3 Fuß breit. Goldn. Rahm. I Diese Nr.: Eine Räuberscene Maße: 2 Fuß hoch, 3 Fuß breit Anm.: Die Lose 60 und 61 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/01/19 HBPAK 0061 Callot I Zwey vortrefliche Gemähide; mit einem markigen Pinsel gemahlt, und einer reichen Phantasie entworfen. Es sind Räuberscenen. Auf dem ersten sitzen die Räuber unter freyem Himmel und spielen Karten, indeß die Weiber eine Mahlzeit bereiten; auf dem zweyten haben sie eine Art von Gezelt aufgeschlagen, und entkleiden sich. Gleicher Grösse. 2 Fuß hoch, 3 Fuß breit. Goldn. Rahm. I Diese Nr.: Eine Räuberscene Maße: 2 Fuß hoch, 3 Fuß breit Anm.: Die Lose 60 und 61 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Callot, Jacques (Kopie nach) 1785/10/17 LZRST 0107 Callot I 2 St. Bettlerfiguren, nach Callot, von eben dieser Hand [ungenannte Meisterinn], ohne Rahm. I Maße: 17 Zoll hoch, 13 Zoll breit Transakt.: Verkauft (14 Gr) Käufer: Buch 1785/10/17 LZRST 0108 Callot I 2 St. Bettlerfiguren, nach eben diesem Meister [Callot] von eben dieser Hand [ungenannte Meisterinn] verfertigt. Ein alter Mann mit dem Huthe in der Hand und eine Frau mit zwey Kindern, ohne Rahm. I Maße: 16 Zoll hoch, 13 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1503 Nach Callot I Eine Zigeuner=Karavane, auf Leinwat, in einer geschnittenen und metallisirten Ram. Der Compagnon davon kömmt unten sub Nro. 1515. vor. I Pendant zu Nr. 1515 Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 7 Zoll, Breite 2 Schuh 11 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1515 Nach Callot I Eine Zigeunergesellschaft in einem Walde, auf Leinwat, in einer geschnittenen und metallisirten Ram. Der Compagnon davon ist schon oben sub. Nro. 1503. vorgekommen. I Pendant zu Nr. 1503 Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 7 Zoll, Breite 2 Schuh 11 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
Callot, Jacques (Manier) 1796/10/17 HBPAK 0098 In der Manier von Caloo I Ein kleiner italienischer Prospect. Auf Holz. Schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 4 Zoll, breit 7 Zoll Transakt.: Unbekannt
Calvaert, Denys (Dionisio Fiammingo) 1791/09/26 FRAN 0473 Calvard I Venus in der Mitte vieler ihrer Nymphen die sie bedienen und sich lustig unter sich machen, perspektivisch siehet man zu beiden Seiten ein Gastmahl und Liebesentflammung angebracht, ein reich ordinirtes Bild mit schönen Figuren von Calvard. I Maße: 22 Zoll breit, 17 Zoll hoch Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0011 In der Manier von Colvart I David mit dem Kopfe Goliaths. I Maße: Hoch 39 Zoll, breit 33 Zoll Transakt. : Unbekannt
Calza, Antonio 1777/03/03 AUAN 0062 Calzi I Zwey Batallienstücke. I Maße: Höhe 1 Sch., Breite 1 Sch. 7 Vi Zoll Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt
1785/05/17 MZAN 0573 Anton Calza I Zwey Bataillestücke von Anton Calza. [Deux batailles.] I Diese Nr.: Ein Bataillestück Maße: 2 Schuh 5 Zoll hoch, 3 Schuh 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 573 und 574 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (30 fl für die Nrn. 573 und 574) Käufer: Baumann 1785/05/17 MZAN 0574 Anton Calza I Zwey Bataillestücke von Anton Calza. [Deux batailles.] I Diese Nr.: Ein Bataillestück Maße: 2 Schuh 5 Zoll hoch, 3 Schuh 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 573 und 574 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (30 fl für die Nrn. 573 und 574) Käufer: Baumann 1799/00/00 WZAN 0608 Anton Calza I Eine bergige Landschaft, von Anton Calza. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 4 Schuh 2 Zoll breit 6 Schuh 10 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Camassei 1770/10/29 FRAN 0012 Camesei I Die drey Waysen aus Morgenland, wie sie vor dem Thron des Königs Herodes erschienen. I Maße: h. 66. Zoll. b. 48. Zoll. Transakt.: Unbekannt
bien peint. I Maße: hauteur 25 pouces, largeur 33 pouces Transakt.: Unbekannt 1776/04/15 HBBMN 0132 Camphuise I Eine Landschaft mit Vieh, in dem Gusto von Adrian von der Velden. I Maße: Höhe 1 Fuß, Breite 1 Fuß 2 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (8 M) Käufer: Leck 1776/11/09 HBKOS 0008 Camphüsen I Eine Landschaft mit Hilten und Vieh, in dem Gusto von Berghem, auf Leinwand, im schwarzen Rahm mit verguldete Leisten. I Mat.: auf Leinwand Transakt.: Verkauft (38 M) Käufer: Lüss 1792/04/19 HBBMN 0094 Camphuysen I Eine Landschaft mit vielen Bergen ec. und sehr schönen Figuren, fleißig gemahlt, von Camphuysen. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 25 Zoll, breit 33 Zoll Transakt.: Unbekannt 1793/09/18 HBSCN 0042 Kamphuys I Zwey Kühe stehen und drey Schaafe liegen auf einer Weide, die Hirtin stehet unter einem Baum dameben mit ihrer Spindel, vor ihr ein schlafender Hund, in der Entfernung geht ein Bauer seines Weges nach dem Kirchdorff zu. Dieses Bild ist so schön, wie ein Berghem. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 26 Zoll, breit 30 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0108 Kamphuyse I Eine Landschaft mit verschiedenen Kühen und Schaafen in Lebensgröße. Auf Leinw. schwarzen Rahm, goldene Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 30 Vi Zoll, breit 39 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt
Cambiaso, Luca 1776/00/00 WZTRU 0041 Lucas Cambiasii I Ein Stück, die Kreuzigung Christi, 1 Schuhe, 11 Zoll hoch, 6 Schuhe, 5 Zoll breit, worauf bey 80 ganze Figuren sich befinden, welche in beßter Stellung und Laage, und einer frischen Colorit gewäs Tintoretts Schule ausgedruckt sind: es ist von einem der beßten Discipel des Jakob Tintoretto, Lucas Cambiasii genannt. I Maße: 1 Schuhe 11 Zoll hoch, 6 Schuhe 5 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (40 fl Schätzung) 1781/00/00 WZAN 0041 Lukas Cambiasii I Ein Stück 1 Schuhe, 11 Zoll hoch, 6 Schuhe, 5 Zoll breit, die Kreuzigung Christi vorstellend, worauf bey 80 ganze Figuren sich befinden, welche in beßter Stellung und Lage, und einer frischen Kolorite, Tintoretts Schule gemäß, ausgedruckt sind: es ist von einem der beßten Schüler des Jakobs Tintoretto, Lukas Cambiasii genannt. I Maße: 1 Schuhe 11 Zoll hoch, 6 Schuhe 5 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1799/12/23 WNAN 0046 Cambioso I Une Venus avec l'amour parCambioso. I Transakt.: Unbekannt
Campagnola
Camphuysen, Dirck Raphaelsz. 1791/10/21 HBRMS1 0030 T. Camphceüzen I Aussicht bey Rom, mit vielen verfallnen Gebäuden und Figuren ec. Dieses Gemählde ist so schön und fleißig, wie Breughel; auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 4 Vi Zoll, breit 7 Zoll Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0092 Theodor Kamphuyzen I Der Herr mit seinen Dienern auf der Jagd reitend, von vielen Hunden, und andern Beywesen umgeben, von Theodor Kamphuyzen. I Maße: 2 Schuh 2 Zoll hoch, 2 Schuh 9 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
Camphuysen, Govert Dircksz. 1786/10/18 HBTEX 0059 G. D. Camphuysen I Ein Binnehuys, worinnen ein alter Mann sitzet, welcher verschiedene Fische vor sich liegen hat, nebst vielen häuslichen und Küchen=Geräthschaften, welche um ihn her stehen und liegen; wie Ostade. Gemahlt auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 24 Zoll 6 Linien, breit 31 Zoll Transakt.: Unbekannt
1798/01/19 HBPAK 0085 Compagnola I Die Versuchung des heiligen Antonius. Er bedekt sich die Augen mit dem Mantel, um die nakten Mädchens nicht zu sehn, welche ihn umringen. 1 Fuß 9 Zoll hoch, 1 Fuß breit. Goldner Rahm. I Maße: 1 Fuß 9 Zoll hoch, 1 Fuß breit Transakt.: Unbekannt
1797/06/13 HBPAK 0078 G.D. Camphuysen I Ein alter Fischer ziehet seine Stiefeln auf, indem er in seiner Hütte sitzet, wo sehr viele Fische theils auf der Erde und theils in Baijen befindlich, wie auch andere Geräthschaften mehr. Alles ist mit vieler Natur, vorgestellt, und sehr meisterhaft gemahlt. Auf Holz I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 2 % [?] Zoll, breit 29 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt
Camphuysen
Camphuysen, J.
1759/00/00 LZEBT 0188 Cambhuysen I Eine Landschaft auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 8 Zoll, Breite 2 Schuh 3 Vi Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (50 Th Schätzung) 1763/11/09 FRJUN 0102 Kamphuisen I Un Prince d'Orange ä cheval dans un tres beau pai'sage accompagne de deux chiens parfaitement peint. I Maße: hauteur 27 pouces, largeur 21 Vi pouces Transakt.: Verkauft (37.30 fl) Käufer: Dick 1765/03/27 FRKAL 0097 Kamphuysen I Des gens ä cheval & ä pied dans un agreable pai'sage accompagnes de quelques chiens tres-
1772/09/15 BNSCT 0022 J. Kamphuys I Eine Ochsen=Trift auf einer Landschaft, sehr wohl von J. Kamphuys, 3 Fuß hoch, 3 Fuß 10 Zoll breit, schw. R[ahm], I Maße: 3 Fuß hoch, 3 Fuß 10 Zoll breit Transakt.: Unbekannt (10.14 fl)
Campidoglio Rosa [Nicht identifiziert] (oder Pace, Mich.) 1779/00/00 HB AN 0301 Rosa di Campidoli I Ein Wasserfall kömmt über viele Absätze durch eine feisichte Gegend zum Vorgrunde. Aus finstern Gewitterwolken schießen Blitze herab. Drey GEMÄLDE
429
Personen suchen Schutz unter etlichen Bäumen. [Sur le devant on voit un torrent se precipiter sur plusieurs degres dans une contree couverte de rochers. Des eclairs partent du fond de quelques nuages obscurs. Trais personnes cherchent un asyle sous des arbres.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 3 Fuß 1 Zoll hoch, 3 Fuß 6 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1785/04/22 HBTEX 0077 Campidoglio Rosa I Ein Frucht= und Blumenstück. Im Vordergrunde steht eine große Schüssel mit Früchten, wovon ein Affe einen Apfel raubt. Mit großer Force gemahlt auf Leinewand. Schwarzer Rahm und goldene Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 46 Zoll, breit 41 Zoll Transakt.: Unbekannt 1790/05/20 HBSCN 0041 Campidogl. Roosa I Trauben, Melonen, ec. auf einem Tische, zur Linken sieht man die bekränzte Büste des Bachus. Sehr natürlich und stark gemahlt. Auf L[einwand]. S.R.G.L. [Schwarzen Rahm, goldne Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 39 Zoll, breit 50 Zoll Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (12 M) Käufer: Fesser 1791/10/21 HBRMS1 0068 Campidoglio Roosa I Alle möglichen Arten Früchte liegen im Vordergrunde einer Landschaft. Alles der Natur auf das getreueste nachgeahmt, und auf das dreisteste und meisterhafteste gemahlt; auf L. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 61 Zoll, breit 77 Zoll Transakt.: Unbekannt 1792/04/19 HBBMN 0142 Camp. Roosa I Trauben und andere Früchte liegen auf einem Tische; besonders schön gemahlt, von Camp. Roosa. Auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 25 Zoll, breit 28 Zoll Transakt.: Unbekannt
Camus, P.N. [Nicht identifiziert] 1796/02/17 HBPAK 0147 P.N. Camus. 17791 Eine gebirgigte Land= und Wassergegend. Im Vordergrunde zur Rechten, bey einem Brunnen, steht ein alter Mann und ein Frauenzimmer, nebst einem Pferde, welches aus einem Korbe frisst. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 9 % Zoll, Breite 12 Zoll Inschr.: 1779 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Verkauft (74 M) Käufer: Veiller
Canaletto (Giovanni Antonio Canal) 1768/07/00 MUAN 1053 Cavale (Antonius) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1054 Cavale (Antonius) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1055 Cavale (Antonius) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1056 Cavale (Antonius) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1057 Cavale (Antonius) I [Ohne Titel] Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 430
GEMÄLDE
1768/07/00 MUAN 1058 Cavale (Antonius) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1059 Cavale (Antonius) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1060 Cavale (Antonius) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1061 Cavale (Antonius) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1062 Cavale (Antonius) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1063 Cavale (Antonius) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1064 Cavale (Antonius) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1118 Cavale (Antonius) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0343 Canale (Antoine) I Douze perspectives des plus fameuses places, eglises & palais de Venise. Peintes sur toile, marquees des Nos. 1053. jusqu'au No. 1064. I Diese Nr.: Une perspective Mat.: auf Leinwand Maße: 1. p. 7. p. de haut sur 2. p. 3. p. de large Anm.: Die Lose 343 bis 354 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0344 Canale (Antoine) I Douze perspectives des plus fameuses places, eglises & palais de Venise. Peintes sur toile, marquees des Nos. 1053. jusqu'au No. 1064. I Diese Nr.: Une perspective Mat.: auf Leinwand Maße: 1. p. 7. p. de haut sur 2. p. 3. p. de large Anm.: Die Lose 343 bis 354 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0345 Canale (Antoine) I Douze perspectives des plus fameuses places, eglises & palais de Venise. Peintes sur toile, marquees des Nos. 1053. jusqu'au No. 1064. I Diese Nr.: Une perspective Mat.: auf Leinwand Maße: 1. p. 7. p. de haut sur 2. p. 3. p. de large Anm.: Die Lose 343 bis 354 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0346 Canale (Antoine) I Douze perspectives des plus fameuses places, eglises & palais de Venise. Peintes sur toile, marquees des Nos. 1053. jusqu'au No. 1064. I Diese Nr.: Une perspective Mat.: auf Leinwand Maße: 1. p. 7. p. de haut sur 2. p. 3.
p. de large Anm.: Die Lose 343 bis 354 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0347 Canale (Antoine) I Douze perspectives des plus fameuses places, eglises & palais de Venise. Peintes sur toile, marquees des Nos. 1053. jusqu'au No. 1064. I Diese Nr.: Une perspective Mat.: auf Leinwand Maße: 1. p. 7. p. de haut sur 2. p. 3. p. de large Anm.: Die Lose 343 bis 354 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0348 Canale (Antoine) I Douze perspectives des plus fameuses places, eglises & palais de Venise. Peintes sur toile, marquees des Nos. 1053. jusqu'au No. 1064. I Diese Nr.: Une perspective Mat.: auf Leinwand Maße: 1. p. 7. p. de haut sur 2. p. 3. p. de large Anm.: Die Lose 343 bis 354 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0349 Canale (Antoine) I Douze perspectives des plus fameuses places, eglises & palais de Venise. Peintes sur toile, marquees des Nos. 1053. jusqu'au No. 1064. I Diese Nr.: Une perspective Mat.: auf Leinwand Maße: 1. p. 7. p. de haut sur 2. p. 3. p. de large Anm.: Die Lose 343 bis 354 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0350 Canale (Antoine) I Douze perspectives des plus fameuses places, eglises & palais de Venise. Peintes sur toile, marquees des Nos. 1053. jusqu'au No. 1064. I Diese Nr.: Une perspective Mat.: auf Leinwand Maße: 1. p. 7. p. de haut sur 2. p. 3. p. de large Anm.: Die Lose 343 bis 354 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0351 Canale (Antoine) \ Douze perspectives des plus fameuses places, eglises & palais de Venise. Peintes sur toile, marquees des Nos. 1053. jusqu'au No. 1064. I Diese Nr.: Une perspective Mat.: auf Leinwand Maße: 1. p. 7. p. de haut sur 2. p. 3. p. de large Anm.: Die Lose 343 bis 354 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0352 Canale (Antoine) I Douze perspectives des plus fameuses places, eglises & palais de Venise. Peintes sur toile, marquees des Nos. 1053. jusqu'au No. 1064. I Diese Nr.: Une perspective Mat.: auf Leinwand Maße: 1. p. 7. p. de haut sur 2. p. 3. p. de large Anm.: Die Lose 343 bis 354 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francis Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0353 Canale (Antoine) I Douze perspectives des plus fameuses places, eglises & palais de Venise. Peintes sur toile, marquees des Nos. 1053. jusqu'au No. 1064. I Diese Nr.: Une perspective Mat.: auf Leinwand Maße: 1. p. 7. p. de haut sur 2. p. 3. p. de large Anm.: Die Lose 343 bis 354 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0354 Canale (Antoine) I Douze perspectives des plus fameuses places, eglises & palais de Venise. Peintes sur toile, marquees des Nos. 1053. jusqu'au No. 1064. I Diese Nr.: Une perspective Mat.: auf Leinwand Maße: 1. p. 7. p. de haut sur 2. p. 3. p. de large Anm.: Die Lose 343 bis 354 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0355 Canale (Antoine) I Perspective de la Place, & de l'eglise de St. Marie, de la rotonde, de Rome. Peinte sur toile, marquee du No. 1118. I Mat.: auf Leinwand Maße: 2. p. 3. p. de haut sur 3. pieds de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1773/12/18 HBBOY 0083 Canaletto I Die Sünderin vor Christo im Tempel. I Transakt.: Unbekannt 1775/05/08 HBPLK 0081 Canaletti I Zwey Venetianische Prospecte, auf Leinewand. I Diese Nr.: Ein Venetianisches Prospect Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 14 Zoll 8 Linie, Breite 21 Zoll 1 Linie Anm.: Die Lose 81 und 82 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1775/05/08 HBPLK 0082 Canaletti I Zwey Venetianische Prospecte, auf Leinewand. I Diese Nr.: Ein Venetianisches Prospect Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 14 Zoll 8 Linie, Breite 21 Zoll 1 Linie Anm.: Die Lose 81 und 82 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1776/06/21 HBNEU 0001 Canaletti i Ein venetianisches Perspectiv=Stück, aufLeinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 F 4 Z, Breite 1 F 8 Ζ Transakt.: Verkauft (7.8 M) Käufer: Suther 1776/11/09 HB KOS 0002 Canaletto I Eine inwendige Kirche mit schön gezeichneten Figuren, so vor einem Altar ihre Andacht halten, im schwarzen Rahm mit verguldete Leisten, auf Leinwand gemahlt. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 4 Fuß 2 Zoll, Breite 3 Fuß 7 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (39 M) Käufer: Hofr Ehrenreich 1777/02/26 HB KOS 0054 Canalleto I Ein paar Italienische Prospecte. I Diese Nr.: Ein Italienischer Prospect Maße: Höhe 2 Fuß 3 Zoll, Breite 4 Fuß 9 Zoll Anm.: Die Lose 54 und 55 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1777/02/26 HBKOS 0055 Canalleto I Ein paar Italienische Prospecte. I Diese Nr.: Ein Italienischer Prospect Maße: Höhe 2 Fuß 3 Zoll, Breite 4 Fuß 9 Zoll Anm.: Die Lose 54 und 55 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1777/04/11 Unbekannt
HBNEU
0018
Canaletto I Ein Prospect. I Transakt.:
1778/05/21 HBKOS 0032 Canaletto I Ein Theil des Prospects von Neapolis, mit dem Berge Vesuvius. I Transakt.: Unbekannt 1779/09/27 FRNGL 0600 Canaletta I Ein italiänischer Prospect, meisterhaft gemalt. [Vue d'une contree en Italie, chef d'oeuvre.] I Maße: 1 Schuh 2 Zoll hoch, 1 Schuh 5 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (10 fl) Käufer: Schütz 1781/02/17 FRAN 0009 Canaletta I Ein kleiner sehr angenehmer italienischer Prospect von Canaletta. I Pendant zu Nr. 10 Maße: 9 Vi Zoll breit, 7 Zoll hoch Transakt.: Unbekannt (7.36 fl für die Nrn. 9 und 10) 1781/02/17 FRAN 0010 Canaletta I Das Gegenbildgen hierzu eben so schön von nemlichen Meister [Canaletta] und Maas. I Pendant zu Nr. 9, "Ein kleiner sehr angenehmer italienischer Prospect" Maße: 9 Vi Zoll breit, 7 Zoll hoch Transakt.: Unbekannt (7.36 fl für die Nm. 9 und 10) 1783/08/01 LZRST 0019 Canaletto I Eine Perspective von Canaletto im Niederländischen Geschmack des Peter Neefs gemahlt; sie stellt das Innre einer Kirche vor, ein unter einer Kuppel hängender mit Lichtern besetzter Kronleuchter, erleuchtet die Mitte, auf dem Vordergrunde geht ein Herr, welcher sich mit einer Pappier Laterne leuchten lässt, nahe dabey geht ein Bedienter mit einer Blendlaterne, das Bild ist wohlerhalten, der Rahm verg. aber schadhaft. I Maße: 1 Elle 7 Vi Zoll hoch, 1 Elle 18 Zoll breit Transakt.: Verkauft (5 Th) Käufer: Zaar 1784/05/11 HBKOS 0018 Canaletti I Stadt und Canal=Prospecten, perspectivischer Vorstellung, stark gemahlt und mit lebhaftem Sonnenlicht als auch einfallenden Schatten, gemahlt von Canaletti, auf Leinw. I Diese Nr.: Stadt= und Canal=Prospect Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 30 Zoll 4 1., breit 46 Zoll 2 1. Anm.: Die Lose 18 und 19 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (29 M) Käufer: Berthfeau] 1784/05/11 HBKOS 0019 Canaletti I Stadt und Canal=Prospecten, perspectivischer Vorstellung, stark gemahlt und mit lebhaftem Sonnenlicht als auch einfallenden Schatten, gemahlt von Canaletti, auf Leinw. I Diese Nr.: Ein Stadt und Canal=Prospect Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 30 Zoll 4 1., breit 46 Zoll 2 1. Anm.: Die Lose 18 und 19 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (29 M) Käufer: Berth[eau] GEMÄLDE
431
1784/08/02 FRNGL 0079 Canaletta I Zwey Italiänische Ruinen, meisterhaft von Canaletta verfertigt. I Maße: 20 Vi Zoll breit, 13 Zoll hoch Verkäufer: D Transakt.: Verkauft (3.12 fl) Käufer: Nothnagel 1784/09/27 FRAN 0006 Cannaleta I Zwey Venetianische Veduten von Cannaleta, sehr Meisterhaft und fleißig ausgeführt. [Deux Vetutes [sic] Venitiennes par Cannaleta peinte avec la derniere exactitude.] I Maße: 2 Schuh 2 Zoll hoch, 3 Schuh 1 Zoll breit Verkäufer: Freyherr von Berberich Transakt.: Verkauft (41 fl) Käufer: Wüst 1784/09/27 FRAN 0050 Canaletta I Zwey vortreflich und meisterhaft ausgeführte Prospecte, den St. Marcus-Platz vorstellend von Canaletta. [Deux vues, chef d'oeuvre representans la place de S.Marc.] I Maße: 2 Schuh 3 Zoll hoch, 3 Schuh breit Verkäufer: Freyherr von Berberich Transakt.: Verkauft (90.45 fl) Käufer: Fay ρ fr ν Berberich 1784/09/27 FRAN 0052 Canaletta I Zwey Prospecten von Venedig von der bekannten Meisterhand des Canaletta. [Deux vues de Venise par la main du fameux Maitre Canaletta.] I Maße: 2 Schuh 3 Zoll hoch, 3 Schuh breit Verkäufer: Freyherr von Berberich Transakt.: Verkauft (73.30 fl) Käufer: Wüst 1785/04/22 HBTEX 0043 Canaletta I Zwey Prospecte von Venedig, davon der eine den Marcusplatz vorstellt, mit Schiffen und Figuren. Auf Leinewand. Goldne Rahmen. I Diese Nr.: Ein Prospect von Venedig, den Marcusplatz vorstellend, mit Schiffen und Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 23 Vi Zoll, breit 33 Vi Zoll Anm.: Die Lose 43 und 44 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1785/04/22 HBTEX 0044 Canaletta I Zwey Prospecte von Venedig, davon der eine den Marcusplatz vorstellt, mit Schiffen und Figuren. Auf Leinewand. Goldne Rahmen. I Diese Nr.: Ein Prospect von Venedig Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 23 Vi Zoll, breit 33 Vi Zoll Anm.: Die Lose 43 und 44 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1785/05/17 MZAN 0822 Canaletta I Der Prospect von Neapel und der Prospect von London von Canaletta. [La vüe de Naples, dont le pendant est la vüe de Londres.] I Diese Nr.: Der Prospect von Neapel; Pendant zu Nr. 823 Maße: 1 Schuh 2 Zoll hoch, 1 Schuh 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 822 und 823 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (11 fl für die Nm. 822 und 823) Käufer: Zitz 1785/05/17 MZAN 0823 Canaletta I Der Prospect von Neapel und der Prospect von London von Canaletta. [La vüe de Naples, dont le pendant est la vüe de Londres.] I Diese Nr.: Der Prospect von London; Pendant zu Nr. 822 Maße: 1 Schuh 2 Zoll hoch, 1 Schuh 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 822 und 823 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (11 fl für die Nrn. 822 und 823) Käufer: Zitz 1785/05/17 MZAN 0954 Canale I Vier Prospecte von Venedig von Canale. [4 vües de Venise.] I Diese Nr.: Ein Prospect von Venedig Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 2 Schuh 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 954 bis 957 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (57 fl für die Nrn. 954-957) Käufer: Strecker 1785/05/17 MZAN 0955 Canale I Vier Prospecte von Venedig von Canale. [4 vües de Venise.] I Diese Nr.: Ein Prospect von Venedig Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 2 Schuh 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 954 bis 957 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (57 fl für die Nrn. 954-957) Käufer: Strecker 1785/05/17 MZAN 0956 Canale I Vier Prospecte von Venedig von Canale. [4 vües de Venise.] I Diese Nr.: Ein Prospect von Venedig Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 2 Schuh 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 954 bis 957 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf 432
GEMÄLDE
von Elz Transakt.: Verkauft (57 fl für die Nrn. 954-957) Käufer: Strecker 1785/05/17 MZAN 0957 Canale I Vier Prospecte von Venedig von Canale. [4 vües de Venise.] I Diese Nr.: Ein Prospect von Venedig Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 2 Schuh 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 954 bis 957 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (57 fl für die Nrn. 954-957) Käufer: Strecker 1785/05/17 MZAN 1108 Canaletta I Ein Prospect von einem öffentlichen Platze zu Venedig von Canaletta. [La vüe d'une place publique de Venise.] I Maße: 1 Schuh 1 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 2 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (20.30 fl) Käufer: Strecker 1785/05/17 MZAN 1109 Canaletta I Der Prospect der Markus= Kirche zu Venedig von eben demselben [Canaletta], [La vüe de l'eglise de S. Marc de Venise, par le meme [Canaletta].] I Maße: 1 Schuh Vi Zoll hoch, 1 Schuh 8 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (10 fl) Käufer: Becker Glöckner 1786/10/18 HBTEX 0227 Von dem alten Canaletti I Zwey perspectivische Garten=Prospecte, mit Colonaden=Gebäude und Fontainen, stark gemahlt auf Leinewand. I Diese Nr.: Ein perspectivisches Garten=Prospect Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll, breit 34 Zoll Anm.: Die Lose 227 und 228 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/10/18 HBTEX 0228 Von dem alten Canaletti I Zwey perspectivische Garten=Prospecte, mit Colonaden=Gebäude und Fontainen, stark gemahlt auf Leinewand. I Diese Nr.: Ein perspectivisches Garten=Prospect Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll, breit 34 Zoll Anm.: Die Lose 227 und 228 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/11/11 HBRMS 0103 von Canalette I Ein Venetianischer Prospect mit durchfließende Canäle, sehr fleißig gemahlt, goldner Rahm. I Transakt.: Unbekannt 1789/00/00 MMAN 0290 der alte Canaletti I Zwei Venetianische Prospekten, auf Leinw. 11 Zoll hoch und 1 Fuß 6 Zoll breit, vom alten Canaletti. [Deux vües [sie] des environs de venise, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 11 Zoll hoch, 1 Fuß 6 Zoll breit [10 pouces de haut, 1 pied 6 pouces de large] Anm.: Die Dimensionen unterscheiden sich in der deutschen und französischen Fassung des Katalogs. Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (200 fl) 1789/00/00 MMAN 0307 Canaletti der ältere I Zwei Seehäfen mit vielen Figuren, auf Leinw. 1 Fuß hoch und 1 Fuß 6 Zoll breit, vom Canaletti dem ältern. [Deux ports de Mer avec figures, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß hoch, 1 Fuß 6 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (100 fl) 1790/08/16 KAAN 0074 Canaletti I Eine Prospect von Canaletti. I Maße: 1 Fuß 11 Zoll hoch, 2 Fuß 2 Zoll breit Verkäufer: Johann Heinrich Tischbein Transakt.: Unbekannt 1791/05/28 HBSDT 0048 A. Canale I Venetianische Prospecte. Auf dem einen sieht man im Hintergrunde ein Canal mit Schiffen: beyde mit einer Menge Figuren. Zwey sehr schöne Gemähide welche mit sehr vielen Fleiß ausgeführt sind, auf Leinewand. I Diese Nr.: Ein venezianisches Prospect Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 15 Zoll, breit 23 Zoll Anm.: Die Lose 48 und 49 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1791/05/28 HBSDT 0049 A. Canale I Venetianische Prospecte. Auf dem einen sieht man im Hintergrunde ein Canal mit Schiffen: beyde mit einer Menge Figuren. Zwey sehr schöne Gemähide welche mit sehr vielen Fleiß ausgeführt sind, auf Leinewand. I Diese Nr.: Ein venezianisches Prospect Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 15 Zoll, breit 23 Zoll Anm.: Die Lose 48 und 49 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1791/05/30 FRAN 0126 Canaletta der ältere I Ein prächtiger sehr hoher Saal, in den Ecken mit grotirten Nischen und vielen Zierathen, deren Reitz durch Wasserwerke und ein schönes Perspectiv in den Garten vermehret wird. Mit einer großen Wirkung gemalt, von Canaletta dem ältern in Venedig. I Maße: 2 Schuh 3 Zoll hoch und 1 Schuh 10 Zoll breit Verkäufer: Bansa Transakt.: Verkauft (3) 1791/09/21 FRAN 0142 Canalleti I Eine Aussicht von Venedig, wo vorne ein Canal mit Gondolen und Schiffen gezieret ist, weiter ist die Aussicht eines Pallastes, der Vordertheil zeiget viele Personen. I Transakt.: Verkauft (5 fl) Käufer: Kissner 1791/09/26 FRAN 0059 Canaletti I Zwey meisterhafte venerianische Prospecten. I Diese Nr.: Ein meisterhafter venetianischer Prospect Maße: 1 Sch. 3 Zoll hoch, 2 Sch. breit Anm.: Die Lose 59 und 60 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0060 Canaletti I Zwey meisterhafte venetianische Prospecten. I Diese Nr.: Ein meisterhafter venetianischer Prospect Maße: 1 Sch. 3 Zoll hoch, 2 Sch. breit Anm.: Die Lose 59 und 60 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0244 Canaletta I Zwey meisterhafte venetianische Prospekten. I Diese Nr.: Ein meisterhafter venetianischer Prospekt Maße: 14 Zoll hoch, 20 Zoll breit Anm.: Die Lose 244 und 245 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0245 Canaletta I Zwey meisterhafte venetianische Prospekten. I Diese Nr.: Ein meisterhafter venetianischer Prospekt Maße: 14 Zoll hoch, 20 Zoll breit Anm.: Die Lose 244 und 245 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/10/21 HBRMS1 0059 A. Canale I Venetianische Prospecte: das eine der Marcus=Plaz, das andre ein Kanal=Prospect, beyde mit einer Menge Figuren. Von den besten Stücken dieses Meisters; auf Leinew. I Diese Nr.: Ein Venetianisches Prospect: der Marcus=Plaz Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 14 Zoll, breit 19 Zoll Anm.: Die Lose 59 und 60 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1791/10/21 HBRMS1 0060 A. Canale I Venetianische Prospecte: das eine der Marcus=Plaz, das andre ein Kanal=Prospect, beyde mit einer Menge Figuren. Von den besten Stücken dieses Meisters; auf Leinew. I Diese Nr.: Ein Venetianisches Prospect: ein Kanal=Prospect Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 14 Zoll, breit 19 Zoll Anm.: Die Lose 59 und 60 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 HBMFD 0016 Canale I Profil der Stadt Neapel. Im Vordergrunde sieht man einen Theil des Havens, und eine Menge Barken aller Art. Eine Kirche von reicher und glänzender Architectur sieht man zur Rechten: sie ist ganz getreu nach der Natur. Jedes Haus ist bis zum erkennen abgebildet. I Pendant zu Nr. 17 Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuss 6 Vi Zoll hoch, 2 Fuss 1 Zoll breit Verkäufer: Pierre Laporterie Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 HBMFD 0017 Canale I Das Gegenstück. Eine andre Aussicht der Stadt Neapel sehr übereinstimmend mit der Vorigen, mit der einzigen Veränderung, dass man in der Ferne den Berg Vesuv sieht. Diese Bilder sind mit so vieler Bestimmung und Geduld gemalt, dass auch jeder Contour durch den Glase noch sauber scheint. Der Pinsel dieses Meisters ist leicht, bestimmt, ausdrucksvoll und sehr gefällig. Bilder des Canale von dieser Ausführung sind schon bey seinen Lebzeiten sehr geschätzt und in Neapel theuer bezahlt. I Pendant zu Nr. 16 Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuss 6 Vi Zoll hoch, 2 Fuss 1 Zoll breit Verkäufer: Pierre Laporterie Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 HB AN 0012 Canaletti I Die Ansicht eines Theils der Stadt Venedig. Ueber dem Canale reggio zeigt sich, am Ausfluss
des Canale della giudecca, das Zollhaus und die Chiesa della salute mit ihrem Kloster. Diesseits des Wassers sieht man im Vorgrunde einen Theil der Kunstakademie mit der Vorsetzen und der Anfuhr hinter dem Quarantainhause. In diesem Vorgrunde beschäftigen sich viele auf mancherley Weise; unter ihnen zeichnet Canaletti an das steinerne Geländer der Anfuhr gelehnt. Auf dem äusserst klaren Wasser des Kanals schweben Gondeln und andere Fahrzeuge, sich in der stillen und silberhellen Fläche spiegelnd. I Maße: Höhe 22 Zoll, Breite 30 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1795/11/17 HBPAK 0030 Canna Letta I Vier italienische Markt=Plätze mit Figuren und perspectivischen Gebäuden. Schw. Rahm mit goldnen. Leisten. I Diese Nr.: Ein italienischer Markt= Platz mit Figuren und perspectivischen Gebäuden Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll, breit 32 Zoll Anm.: Die Lose 30 bis 33 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1795/11/17 HBPAK 0031 Canna Letta I Vier italienische Markt=Plätze mit Figuren und perspectivischen Gebäuden. Schw. Rahm mit goldnen. Leisten. I Diese Nr.: Ein italienischer Markt= Platz mit Figuren und perspectivischen Gebäuden Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll, breit 32 Zoll Anm.: Die Lose 30 bis 33 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1795/11/17 HBPAK 0032 Canna Letta I Vier italienische Markt=Plätze mit Figuren und perspectivischen Gebäuden. Schw. Rahm mit goldnen. Leisten. I Diese Nr.: Ein italienischer Markt= Platz mit Figuren und perspectivischen Gebäuden Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll, breit 32 Zoll Anm.: Die Lose 30 bis 33 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1795/11/17 HBPAK 0033 Canna Letta I Vier italienische Markt=Plätze mit Figuren und perspectivischen Gebäuden. Schw. Rahm mit goldnen. Leisten. I Diese Nr.: Ein italienischer Markt= Platz mit Figuren und perspectivischen Gebäuden Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll, breit 32 Zoll Anm.: Die Lose 30 bis 33 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0038 Canaletto I Zwey sehr schöne Ansichten des Marcus=Platzes in Venedig. I Diese Nr.: Eine sehr schöne Ansicht des Marcus=Platzes in Venedig Anm.: Die Lose 38 und 39 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0039 Canaletto I Zwey sehr schöne Ansichten des Marcus=Platzes in Venedig. I Diese Nr.: Eine sehr schöne Ansicht des Marcus=Platzes in Venedig Anm.: Die Lose 38 und 39 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0241 dig. I Transakt.: Unbekannt
Canoletto I Eine Gegend von Vene-
1797/04/20 HBPAK 0050 Cunale I Eine venetianische Gegend, welche einen Pallast mit Säulen vorstellt, mit vielen Figuren im Vordergrunde, die sich mit Mancherley beschäfftigen. Eine ganz vortrefliche Architectur, so gut, als sie nur immer Caneolecto gemahlt hat. Auf Leinwand, mit schwarzen Rahm und vergoldeten Stäben. I Pendant zu Nr. 51 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Zoll, breit 30 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0051 Cunale I Das Gegenstück, von eben Demselben. Welches ebenfalls einen venetianischen Pallast vorstellt, mit vielen Figuren im venetianischen Kostüm. Man sieht im Vorgrunde eine Gondel, die eine Herrschaft erwartet, welche sich bereits in der Annäherung befindet. Alles mit dem größten Fleiß und der besten Harmonie verfertiget. Ebenfalls auf Leinwand, mit schwarzen Rahm und vergoldeten Stäben. I Pendant zu Nr. 50 Mat.: auf Leinwand Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0120 Canaletti I Prospect von Venedig; vorstellend die Marcus Kirche und andere Häuser. Im Vordergrunde der große Canal, verschiedene Fahrzeuge und Gondeln, Dieses treffende Gemähide ist ein Meisterstück dieses Künstlers. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 25 Zoll, breit 33 Zoll Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
433
1797/06/13 HBPAK 0046 Vom alten Canaletti I Der Prospect mit der Petri=Kirche von Rom. Zum Compagnon Ruinen eines alten Gebäudes, in römischen Gegenden vorgestellet. Zwey vortrefliche Gemähide. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Der Prospect mit der Petri= Kirche von Rom; Pendant zu Nr. 47 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 30 Zoll, breit 42 Zoll Anm.: Die Lose 46 und 47 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/06/13 HBPAK 0047 Vom alten Canaletti I Der Prospect mit der Petri=Kirche von Rom. Zum Compagnon Ruinen eines alten Gebäudes, in römischen Gegenden vorgestellet. Zwey vortrefliche Gemähide. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Ruinen eines alten Gebäudes, in römischen Gegenden vorgestellet; Pendant zu Nr. 46 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 30 Zoll, breit 42 Zoll Anm.: Die Lose 46 und 47 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/08/10 MMAN 0350 Canaletto I Zwei Aussichten auf Venedig, die eine auf den großen Canal gerichtet, die andere auf den St. Marcusplaz. von Canaletto, auf Tuch. I Diese Nr.: Eine Aussicht auf Venedig, die eine auf den großen Canal gerichtet Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 350 und 351 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (160 fl für die Nrn. 350 und 351, Schätzung) 1797/08/10 MMAN 0351 Canaletto I Zwei Aussichten auf Venedig, die eine auf den großen Canal gerichtet, die andere auf den St. Marcusplaz. von Canaletto, auf Tuch. I Diese Nr.: Eine Aussicht auf Venedig, die andere auf den St. Marcusplaz Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 350 und 351 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (160 fl für die Nrn. 350 und 351, Schätzung) 1797/12/08 HBPAK 0098 Canoletto I Zwey italiänische Marktplätze, mit Rudera und Figuren. Auf das schönste vorgestellt. Auf Leinwand, im schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein italiänischer Marktplatz, mit Rudera und Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 16 Zoll, Breite 22 Zoll Anm.: Die Lose 98 und 99 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/12/08 HBPAK 0099 Canoletto I Zwey italiänische Marktplätze, mit Rudera und Figuren. Auf das schönste vorgestellt. Auf Leinwand, im schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein italiänischer Marktplatz, mit Rudera und Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 16 Zoll, Breite 22 Zoll Anm.: Die Lose 98 und 99 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/11/14 HBPAK 0178 Canoletto I Zwey italiänische Marktplätze, worauf ganz natürliche Rudera zu sehen. Viele Personen besehen selbige in der Nähe und in der Ferne. Auf das schönste vorgestellt. Auf Leinwand, in 2 schw. Rähmen mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein italiänischer Marktplatz, worauf ganz natürliche Rudera zu sehen. Viele Personen besehen selbige in der Nähe und in der Ferne Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll, breit 31 Zoll Anm.: Die Lose 178 und 179 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/11/14 HBPAK 0179 Canoletto I Zwey italiänische Marktplätze, worauf ganz natürliche Rudera zu sehen. Viele Personen besehen selbige in der Nähe und in der Ferne. Auf das schönste vorgestellt. Auf Leinwand, in 2 schw. Rähmen mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein italiänischer Marktplatz, worauf ganz natürliche Rudera zu sehen. Viele Personen besehen selbige in der Nähe und in der Ferne Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll, breit 31 Zoll Anm.: Die Lose 178 und 179 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/12/23 WNAN akt.: Unbekannt
0034
CANALETTI I Deux Vues. I Trans-
1800/11/12 HBPAK 0044 N. Canette I Ein italiänischer Seeprospekt. I Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "N. Canette", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt 434
GEMÄLDE
Canaletto (Giovanni Antonio Canal) (Geschmack von) 1778/04/11 HBBMN 0037 Canaletto I Sechs Stück Venetianische Prospecte, in dem Gusto von Canaletto. I Diese Nr.: Ein Venetianisches Prospect Anm.: Die Lose 37 bis 42 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (5.2 M) Käufer: Hasp[erg] 1778/04/11 HBBMN 0038 Canaletto I Sechs Stück Venetianische Prospecte, in dem Gusto von Canaletto. I Diese Nr.: Ein Venetianisches Prospect Anm.: Die Lose 37 bis 42 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (5.2 M) Käufer: Hasp[erg] 1778/04/11 HBBMN 0039 Canaletto I Sechs Stück Venetianische Prospecte, in dem Gusto von Canaletto. I Diese Nr.: Ein Venetianisches Prospect Anm.: Die Lose 37 bis 42 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (5.2 M) Käufer: Hasp[erg] 1778/04/11 HBBMN 0040 Canaletto I Sechs Stück Venetianische Prospecte, in dem Gusto von Canaletto. I Diese Nr.: Ein Venetianisches Prospect Anm.: Die Lose 37 bis 42 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (5.2 M) Käufer: Hasp[erg] 1778/04/11 HBBMN 0041 Canaletto I Sechs Stück Venetianische Prospecte, in dem Gusto von Canaletto. I Diese Nr.: Ein Venetianisches Prospect Anm.: Die Lose 37 bis 42 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (5.2 M) Käufer: Hasp[erg] 1778/04/11 HBBMN 0042 Canaletto I Sechs Stück Venetianische Prospecte, in dem Gusto von Canaletto. I Diese Nr.: Ein Venetianisches Prospect Anm.: Die Lose 37 bis 42 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (5.2 M) Käufer: Hasp[erg] 1778/07/11 HBTEX 0001 Canaletto I Zwey Venetianische Land= und Wasser=Prospecte, in dem Gusto von Canaletto. I Diese Nr.: Ein Venetianisches Land= und Wasser=Prospect Anm.: Die Lose 1 und 2 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/07/11 HBTEX 0002 Canaletto I Zwey Venetianische Land= und Wasser=Prospecte, in dem Gusto von Canaletto. I Diese Nr.: Ein Venetianisches Land= und Wasser=Prospect Anm.: Die Lose 1 und 2 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Canaletto (Giovanni Antonio Canal) (Kopie nach) 1784/09/27 FRAN 0237 Spengler; Canaletto I Der MarcusPlatz von Venedig nach Canaletta auf Glas von Spengler gemahlt. [La place de S. Marc ä Venise peinte en verre d'apres Canaletta par Spengler.] I Kopie von Spengler nach Canaletto Mat.: auf Glas Maße: 1 Schuh 1 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 1 Vi Zoll breit Verkäufer: Freyherr von Berberich Transakt.: Verkauft (4.45 fl) Käufer: Adrian ν Offenbach
Canaletto (Giovanni Antonio Canal) (Manier) 1799/12/04 HBPAK 0046 In der Manier von Canolette I Ein Markt=Platz mit einer italienischen Kirche und Gebäuden, Figuren und Vieh. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Zoll, breit 31 Zoll Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0070 In Canaletti 's Manier I Zwey Stücke: Les Tuilleries und Les Invalides. Auf Holz, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein Stück: Les Tuilleries Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Zoll, breit 18 Zoll Anm.: Die Lose 70 und 71 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0071 In Canaletti's Manier I Zwey Stücke: Les Tuilleries und Les Invalides. Auf Holz, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein Stück: Les Invalides Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Zoll, breit 18 Zoll Anm.: Die Lose 70 und 71 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Candel [Nicht identifiziert] 1797/04/25 HBPAK 0086 Candel I Ein Frauenzimmer, hinter ihr steht ein junger Bauer. Auf Holz, goldene Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 12 Vi Zoll, breit 9 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt
Cantarini, Simone (Simone da Pesaro) 1774/03/28 HBBMN 0006 Cantarini I Eine heilige Familie, ungemein ausführlich und kräftig gemahlt, im verguldeten Rahm. I Maße: Höhe 1 Fuß 10 Zoll, Breite 2 Fuß 4 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1775/09/09
HBBMN
0067
d'Apessara,
Schüler
des
Corregio
1 Eine heilige Familie, gänzlich in des Corregios Art, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 2 F 9 Z, Breit 2 F 3 Ζ Transakt.: Verkauft (11M) Käufer: Lilie Sr 1790/01/07 MUAN 0049 Cantarini Sim. da Besaro I Die Flucht nach Egypten, und die Rückkehre, auf Leinwat. I Diese Nr.: Die Flucht nach Egypten Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 1 Zoll, Breite 2 Schuh 6 Zoll Anm.: Die Lose 49 und 50 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0050 Cantarini Sim. da Besaro I Die Flucht nach Egypten, und die Rückkehre, auf Leinwat. I Diese Nr.: Die Rückkehre aus Egypten Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 1 Zoll, Breite 2 Schuh 6 Zoll Anm.: Die Lose 49 und 50 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0167 Cantarini Sim. da Besaro I Die Geburt Maria, auf Leinw. in einer geschnittenen u. metallisirten Ram. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 9 Zoll, Breite 1 Schuh 4 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0196 Cantarini Sim. da Besaro I Maria mit dem schlafenden Kinde auf der Schoose, und Joseph, auf Leinwat, in einer geschnittenen und vergoldeten Ram. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 2 Zoll, Breite 1 Schuh 5 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1549 Cantarini Sim. da Besaro I Die Geburt Christi, auf Holz, in einer schwarzen Ram mit vergoldeten Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 2 Schuh 8 Zoll, Breite 1 Schuh 8 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 FGAN 0011 Simon da Pesaro Querino I Zwo Sybillen. Eine schreibt, die andre liest. Die Figuren sind in Lebensgröße auf Tuch gemalt. I Mat. : auf Leinwand Maße: 4 Schuh 2 Zoll hoch, 2 Schuh 11 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt (44 fl) 1796/02/17 HBPAK 0242 Pezaraze I Maria mit dem Christ= Kinde. Auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 7 Zoll, Breite 5 Zoll Transakt.: Unbekannt (110 M)
Canton
1782/09/30 FRAN 0384 Canton I Zwei angenehme kleine Landschaften, von Canton, mit vielen Figuren. [Deux petits paysages riants, par Canton, avec nombre de figures.] I Diese Nr.: Eine angenehme kleine Landschaft mit vielen Figuren Maße: 4 Vi Zoll hoch, 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 383 und 384 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (8.15 fl für die Nm. 383 und 384) Käufer: Fehlner 1784/08/02 FRNGL 0475 Canton I Zwey meisterhafte Landschaften mit Jagd=Figuren. I Diese Nr.: Eine meisterhafte Landschaft mit Jagd=Figuren Maße: 14 Vi Zoll breit, 10 Zoll hoch Anm.: Die Lose 475 und 476 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (5.15 fl für die Nm. 475 und 476) Käufer: Knapper 1784/08/02 FRNGL 0476 Canton I Zwey meisterhafte Landschaften mit Jagd=Figuren. I Diese Nr.: Eine meisterhafte Landschaft mit Jagd=Figuren Maße: 14 Vi Zoll breit, 10 Zoll hoch Anm.: Die Lose 475 und 476 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (5.15 fl für die Nrn. 475 und 476) Käufer: Knapper
Canton, Franz Thomas 1776/00/00 WZTRU 0206 Franciscus Thomas Cantone I Ein Stück 1 Schuhe, 8 Zoll hoch, 1 Schuhe, 3 Zoll breit von Franciscus Thomas Cantone, stellet vor ein altes Gebäu, welches in Schatten und Licht sehr wohl verstanden. I Maße: 1 Schuhe 8 Zoll hoch, 1 Schuhe 3 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (4 fl Schätzung) 1781/00/00 WZAN 0206 Franz Thomas Cantone I Ein Stück 1 Schuhe, 8 Zoll hoch, 1 Schuhe, 3 Zoll breit von Franz Thomas Cantone, stellet ein altes Gebäude vor, welches im Schatten und Licht sehr wohl verstanden ist. I Maße: 1 Schuhe 8 Zoll hoch, 1 Schuhe 3 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0577 Franz Cantone I Zwey Landschaften mit vielen Bäumen, von Franz Cantone. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit vielen Bäumen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 7 Zoll breit 1 Schuh 1 Zoll Anm.: Die Lose 577 und 578 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0578 Franz Cantone I Zwey Landschaften mit vielen Bäumen, von Franz Cantone. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit vielen Bäumen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 7 Zoll breit 1 Schuh 1 Zoll Anm.: Die Lose 577 und 578 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0443 Franz Cantone I Zwey Landschaften, von Franz Cantone. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh breit 1 Schuh 5 Zoll Anm.: Die Lose A443 und A444 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0444 Franz Cantone I Zwey Landschaften, von Franz Cantone. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh breit 1 Schuh 5 Zoll Anm.: Die Lose A443 und A444 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1777/05/26 FRAN 0184 Canton I Landschaft. I Anm.: Dieses Los wurde zusammen mit der Nr. 605 (J. Momper (II)) verkauft. Verkäufer: Finsterwalder Transakt.: Verkauft (11.4 fl für die Nrn. 184 und 605) Käufer: Colomb
1799/00/00 WZAN A0496 Franz Cantone I Eine Landschaft, von Franz Cantone. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 9 Zoll breit 2 Schuh Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1782/09/30 FRAN 0383 Canton I Zwei angenehme kleine Landschaften, von Canton, mit vielen Figuren. [Deux petits paysages riants, par Canton, avec nombre de figures.] I Diese Nr.: Eine angenehme kleine Landschaft mit vielen Figuren Maße: 4 Vi Zoll hoch, 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 383 und 384 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (8.15 fl für die Nrn. 383 und 384) Käufer: Fehlner
Canton, Johann Gabriel 1778/09/28 FRAN 0372 der junge Canton I Eine Landschaft mit Figuren, vom jungen Canton. [Un paysage avec des figures, par Canton, le jeune.] I Pendant zu Nr. 373 Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (12 fl für die Nrn. 372 und 373) Käufer: Freulein ν Mühl GEMÄLDE
435
1778/09/28 FRAN 0373 der junge Canton I Der Compagnon, ebenfalls eine Landschaft mit Figuren, von dito [vom jungen Canton]. [Le pendant du precedent, meme objet [un pay sage avec des figures], par le meme [Canton, le jeune].] I Pendant zu Nr. 372 Maße: 10 Zoll breit, 9 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (12 fl für die Nrn. 372 und 373) Käufer: Freulein ν Mühl 1782/07/00 FRAN 0062 Johann Gabriel Cantone I Zwo sehr fleißig gearbeitete Feldschlachten. I Diese Nr.: Eine sehr fleißig gearbeitete Feldschlacht Maße: 8 Zoll hoch, 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 62 und 63 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt (4.26 fl für die Nrn. 62 und 63) 1782/07/00 FRAN 0063 Johann Gabriel Cantone I Zwo sehr fleißig gearbeitete Feldschlachten. I Diese Nr.: Eine sehr fleißig gearbeitete Feldschlacht Maße: 8 Zoll hoch, 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 62 und 63 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt (4.26 fl für die Nrn. 62 und 63)
1799/00/00 WZAN A0070 Johann Gabriel Cantone I Zwey Soldatenstückchen mit Pferden; auf einem ein Trompeter, der blaset, von Johann Gabriel Cantone. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Soldatenstückchen mit Pferden Mat.: auf Holz Maße: hoch 9 Zoll breit 6 Vi Zoll Anm.: Die Lose A70 und A71 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0071 Johann Gabriel Cantone I Zwey Soldatenstückchen mit Pferden; auf einem ein Trompeter, der blaset, von Johann Gabriel Cantone. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Soldatenstückchen mit Pferden und einem Trompeter, der blaset Mat.: auf Holz Maße: hoch 9 Zoll breit 6 Vi Zoll Anm.: Die Lose A70 und A71 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0284 Joh. Gabriel Cantone I Zwey Pferde, mit etwas Landschaft, von Joh. Gabriel Cantone. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Pferd, mit etwas Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 8 Zoll breit 2 Schuh Anm.: Die Lose A284 und A285 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1787/04/19 HBTEX 0008 Capelle I Zwo Holländische Wasser= Prospecte, mit vielen Schiffen und Figuren. I Diese Nr.: Ein Holländischer Wasser=Prospect, mit vielen Schiffen und Figuren Anm.: Die Lose 8 und 9 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (82.8 Μ für die Nrn. 8 und 9) Käufer: Mathes 1787/04/19 HBTEX 0009 Capelle I Zwo Holländische Wasser= Prospecte, mit vielen Schiffen und Figuren. I Diese Nr.: Ein Holländischer Wasser=Prospect, mit vielen Schiffen und Figuren Anm.: Die Lose 8 und 9 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (82.8 Μ für die Nrn. 8 und 9) Käufer: Mathes 1789/00/00 MMAN 0093 Capilh I Ein Seestück auf Kupfer. [Un paysage maritime, sur cuivre.] I Mat.: auf Kupfer Maße: 1 Fuß 1 Zoll hoch, 1 Fuß 6 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (1.30 fl) 1790/05/20 HBSCN 0039 J.v.d. Cappelle I Prospect von Sparrendam mit sehr vielen Schiffen, Fahrzeugen und Figuren. Ganz vortreflich gemahlt. Auf L[einwand]. S.R.G.L. [Schwarzen Rahm, goldne Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 28 Zoll, breit 42 Zoll Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (30.4 M) Käufer: Bostelmann 1790/08/13 HBBMN 0026 Jann v. d. Capelle I Aussicht einer holländischen See mit großen und kleinen Schiffen, Fischerboten ec. besonders schön, und die Natur auf das getreuste nachgeahmt. Auf H[olz]. S.R.G.L. [Schwarzen Rahm, goldne Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 21 Vi Zoll, breit 35 Zoll Transakt.: Verkauft (4 M) Käufer: Eckhardt 1791/05/28 HBSDT 0074 J. v. d. Cappelle I Ein holländisches Gewässer mit grossen und kleinen Schiffen. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 14 Zoll, breit 16 Zoll Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0028 J. v. d. Capelle I Prospect von Sparrendam mit sehr vielen Schiffen, Fahrzeugen und Figuren. Ganz vortreflich gemahlt. Auf L[einwand]. S.R.G.L. [Schwarzen Rahm Goldne Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 28 Zoll, breit 42 Zoll Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt
Capurro, Francesco
1799/00/00 WZAN A0285 Joh. Gabriel Cantone I Zwey Pferde, mit etwas Landschaft, von Joh. Gabriel Cantone. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Pferd, mit etwas Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 8 Zoll breit 2 Schuh Anm.: Die Lose A284 und A285 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1799/00/00 WZAN A0263 Franz Capuro I Ecce Homo, von Franz Capuro. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 11 Zoll breit 2 Schuh 5 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Cappelle, Jan van de
1794/09/09 HBPAK 0107 Caraff I Zwey Landschaften mit Figuren, in der Manier wie Tenniers. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Zoll, breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 107 und 108 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1764/05/22 BOAN 0105 Jean de Capile I Une Marine de trois pieds dix pouces de largeur, deux pieds huit pouces de hauteur, peinte par Jean de Capile. [Ein stück Vorstellend Eine Marine Von Johan de Capile gemahlt.] I Maße: 3 pieds 10 pouces de largeur, 2 pieds 8 pouces de hauteur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (23 Rt) Käufer: Zisler 1776/04/15 HBBMN 0100 Jean v. Cappel I Eine stillstehende See, mit Schiffe und vielen Figuren. I Maße: Höhe 1 Fuß 8 Zoll, Breite 2 Fuß 4 Zoll Transakt.: Unverkauft 1781/09/10 BNAN 0051 v. d. Capelle I Von den mit einigen Pfählen versehenen kleinen Theil des Strandes, an welchem ein paar Kähne mit flatternden Segeln liegen, siehet man etwas entfernter, auf der ruhigen See, ein kleineres Schiff auf das im Mittelgrunde zur Linken sich zeigende Dorf zu segeln; hier liegen und fahren verschiedene kleinere, und in der hellen Ferne noch einige Kriegsschiffe. Eine angenehme Zusammensetzung von v. d. Capelle. I Mat.: auf Holz Maße: 35 Zoll hoch, 47 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 436
GEMÄLDE
Caraff [Nicht identifiziert]
1794/09/09 HBPAK 0108 Carajfl Zwey Landschaften mit Figuren, in der Manier wie Tenniers. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Zoll, breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 107 und 108 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Caravaggio, Michelangelo Merisi da 1670/04/21 WNHTG 0128 Michel'Angelo da Caravaggio I Un Villano di Michel'Angelo da Caravaggio. I Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt 1750/04/00 HB AN 0003 M. Angelo da Carrawaggio I St. Hieronymus von besonderer Kraft von M. Angelo da Carrawaggio. I Transakt.: Unbekannt
1768/07/00 MUAN 0032 Caravaggio (Michael Angelus da) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0362 Caravaggio (Michel Ange de) I Jesus Christ se trouve au temple, parmi les grands pretres, & les sijavans, toutes les figures de grandeur naturelle. Peint sur toile, marque du No. 32. I Mat.: auf Leinwand Maße: 4. p. 11. p. de haut sur 6. p. 8. p. de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1770/10/29 FRAN 0019 Carrauagio I Ein schlaffender Cupido. I Maße: Hoch 46 Zoll. Breit 56 Zoll. Transakt.: Unbekannt 1777/03/03 AU AN 0017 Caravaggio I Zwey alte Köpfe. I Maße: Höhe 1 Sch. 8 Vi Zoll, Breite 1 Sch. 6 Zoll Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt 1782/09/30 FRAN 0458 Carravaggio I Der schlafende Amor von Caravaggio. [L'Amour dormant, par Carravaggio.] I Maße: 2 Schuh 11 Zoll hoch, 4 Schuh 1 Zoll breit Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (10.30 fl) Käufer: Grahe 1786/05/02 NGAN 0133 Mich. Ang. da Caravagio I Vögel und Fisch=Stuke. I Diese Nr.: Ein Vögel und Fisch=Stuk Maße: 3 Schuh 4 Zoll hoch, 2 Schuh 5 Zoll breit Anm.: Die Lose 133 und 134 wurden zusammen katalogisiert. Im Eintrag sind die Maße mit "3 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 5 Zoll breit" angegeben. Dieser Fehler wird in den Errata berichtigt, die am Ende des Katalogs abgedruckt sind. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (40.24 fl für die Nm. 133 und 134) Käufer: Ego 1786/05/02 NGAN 0134 Mich. Ang. da Caravagio I Vögel und Fisch=Stuke. I Diese Nr.: Ein Vögel und Fisch=Stuk Maße: 3 Schuh 4 Zoll hoch, 2 Schuh 5 Zoll breit Anm.: Die Lose 133 und 134 wurden zusammen katalogisiert. Im Eintrag sind die Maße mit "3 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 5 Zoll breit" angegeben. Dieser Fehler wird in den Errata berichtigt, die am Ende des Katalogs abgedruckt sind. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (40.24 fl für die Nrn. 133 und 134) Käufer: Ego 1786/05/02 NGAN 0351 Mich. Ang. da Caravagio I Eine Lucretia. I Maße: 3 Schuh 9 Zoll hoch, 2 Schuh 10 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (5 fl) Käufer: Professor Hofmann 1786/05/02 NGAN 0418 Merigi I Semetee wie sie auf ihr Begehren vom Jupiter in seiner Majestät besucht wird. I Maße: 2 Schuh 9 Zoll hoch, 3 Schuh 9 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (2.1 fl) Käufer: ν Pez 1787/00/00 HB AN 0276 Michael Angelo Amerigi dit le Caravach I Christus, mit einem schmerzvollen Gesicht, ist ganz entkräftet unter der Last des Kreuzes auf eine Anhöhe niedergesunken. Ein Kriegsknecht, mit einer Keule in der Hand, sucht das Kreuz wieder aufzurichten, welches durch verschiedene andere nachgeschoben wird. Im Vordergrunde befindet sich die heilige Veronica, die den in Händen habenden Schweißtuch ansieht. Im Hintergrunde wird man den ferneren Zug gewahr, welcher nach dem Berge Golgatha geht. Die Zeichnung in diesem schönen Gemähide ist richtig und edel, die Composition schön und wohl gewählt, das Colorit sanft und angenehm. A.H. [Auf Holz] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 28 Zoll, breit 22 Zoll Transakt.: Verkauft (80 M) Käufer: Fesser 1790/01/07 MUAN 0039 Carravaggio I Zween Narren, ein Trauriger, und ein Lachender, auf Leinwat. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 3 Zoll, Breite 2 Schuh 10 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0076 Mich. Angelo Merici da Carravagio I Ein alter Portraitkopf, auf Leinwat. I Mat.: auf Leinwand Maße:
Höhe 2 Schuh 1 Zoll, Breite 1 Schuh 8 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0425 Mich. Angelo Merici da Carravagio I Ein bethender Apostel, auf Holz, in einer geschnittenen und vergoldeten Ram. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 2 Schuh, Breite 1 Schuh 8 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/07/28 ZHWDR 0071 Carravaggio I [Ohne Titel] I Annotat.: Aber ja kein Pope, des Preises werth. (LAVATER) Transakt.: Unbekannt 1790/08/25 FRAN 0326 Michel Angelo di Caravaggio I Die betende Magdalena. I Maße: hoch 48 Zoll, breit 39 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0110 Michael Angelo Carravaggio I Christus lehret die Pharisäer, hat zum Gegenbild: Ein Schulmeister lehret die Kinder, beyde mit vieler Stärke zum sprechen gemahlt von Michael Angelo Carravaggio. I Diese Nr.: Christus lehret die Pharisäer; Pendant zu Nr. 111 Maße: 3 Schuh 4 Zoll hoch, 4 Schuh 2 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 110 und 111 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN O l l i Michael Angelo Carravaggio I Christus lehret die Pharisäer, hat zum Gegenbild: Ein Schulmeister lehret die Kinder, beyde mit vieler Stärke zum sprechen gemahlt von Michael Angelo Carravaggio. I Diese Nr.: Ein Schulmeister lehret die Kinder; Pendant zu Nr. 110 Maße: 3 Schuh 4 Zoll hoch, 4 Schuh 2 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 110 und 111 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0135 Michael Ange de Carravage I Ein rundes Gemähide; ein halber Manns=Körper, welcher im Schreiben begriffen ist. Der Kopf ist stark und lebhaft gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Format: rund Maße: Hoch 17 Zoll, breit 17 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/12/10 WNAN 0037 Carravaggio I Eine Maria Magdalena, von Carravaggio; ein vortreffliches Bild. I Verkäufer: Prof Adam Transakt. : Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0198 Michael Angelo Merigi genannt Carravagio I Eine alte Frau, welche ein Buch in der hand hat, von Michael Angelo Merigi genannt Carravagio. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 2 Schuh breit 1 Schuh 8 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0448 Michael Angelo Merigi genannt Carravagio I Laokoon mit seinen zween Söhnen, wie sie von der Schlange todt gebissen werden, von Michael Angelo Merigi genannt Carravagio. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 5 Schuh 6 Zoll breit 5 Schuh 3 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt Gegenw. Standort: Würzburg, Deutschland. Martin von Wagner Museum. (F446) als Italienisch, 17. Jahrhundert
Caravaggio, Michelangelo Merisi da (Kopie nach) 1743/00/00 BWGRA 0011 Michelangelo Caravaggio I Die Maria mit dem Kindlein JEsu und Joseph nebst 2 Engeln nach Michelangelo Caravaggio. I Maße: hoch 6 Fuß, breit 4 Fuß 3 Zoll Transakt.: Unbekannt
Cardisco, Marco (Marco Calabrese) 1785/05/17 MZAN 0504 Marcus Cardisco I Ein Christuskopf mit der Dornenkrone von Marcus Cardisco. [Une tete de Jesus Christ portant la couronne d'epines.] I Maße: 9 Zoll hoch, 7 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (12 fl) Käufer: Rmus D Decanus L Β ä Fechenbach GEMÄLDE
437
Careel, Johann 1786/05/02 NGAN 0367 Karell I Zwey Blumenstücke. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Maße: 11 Vi Zoll hoch, 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 367 und 368 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (6 fl für die Nrn. 367 und 368) Käufer: Pedro [?] 1786/05/02 NGAN 0368 Karell I Zwey Blumenstücke. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Maße: 11 Vi Zoll hoch, 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 367 und 368 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (6 fl für die Nrn. 367 und 368) Käufer: Pedro [?] 1786/05/02 NGAN 0369 Karell I Item [Zwey Blumenstücke]. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Maße: 11 Vi Zoll hoch, 8 Zoll breit Anm. : Die Lose 369 und 370 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (6.36 fl für die Nrn. 369380) Käufer: ν Holzschuher auf den Rosten [?] 1786/05/02 NGAN 0370 Karell I Item [Zwey Blumenstücke]. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Maße: 11 Vi Zoll hoch, 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 369 und 370 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (6.36 fl für die Nm. 369380) Käufer: ν Holzschuher auf den Rosten [?] 1786/05/02 NGAN 0371 Karell I Item [Zwey Blumenstücke]. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Maße: 11 Vi Zoll hoch, 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 371 und 372 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (6.36 fl für die Nrn. 369380) Käufer: ν Holzschuher auf den Rosten [?] 1786/05/02 NGAN 0372 Karell I Item [Zwey Blumenstücke]. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Maße: 11 Vi Zoll hoch, 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 371 und 372 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (6.36 fl für die Nrn. 369380) Käufer: ν Holzschuher auf den Rosten [?] 1786/05/02 NGAN 0373 Karell I Item [Zwey Blumenstücke]. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Maße: 11 Vi Zoll hoch, 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 373 und 374 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (6.36 fl für die Nrn. 369380) Käufer: ν Holzschuher auf den Rosten [?] 1786/05/02 NGAN 0374 Karell I Item [Zwey Blumenstücke]. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Maße: 11 Vi Zoll hoch, 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 373 und 374 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (6.36 fl für die Nrn. 369380) Käufer: ν Holzschuher auf den Rosten [?] 1786/05/02 NGAN 0375 Karell I Item [Zwey Blumenstücke]. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Maße: 11 Vi Zoll hoch, 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 375 und 376 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (6.36 fl für die Nm. 369380) Käufer: ν Holzschuher auf den Rosten [?] 1786/05/02 NGAN 0376 Karell I Item [Zwey Blumenstücke]. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Maße: 11 Vi Zoll hoch, 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 375 und 376 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (6.36 fl für die Nm. 369380) Käufer: ν Holzschuher auf den Rosten [?] 1786/05/02 NGAN 0377 Karell I Item [Zwey Blumenstücke]. I Diese Nr.: Ein Β lumenstück Anm.: Die Lose 377 und 378 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (6.36 fl für die Nm. 369-380) Käufer: ν Holzschuher auf den Rosten [?]
1786/05/02 NGAN 0379 Karell I Item [Zwey Blumenstücke]. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Maße: 11 Vi Zoll hoch, 9 Zoll breit Anm.: Die Lose 379 und 380 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (6.36 fl für die Nrn. 369380) Käufer: ν Holzschuher auf den Rosten [?] 1786/05/02 NGAN 0380 Karell I Item [Zwey Blumenstücke]. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Maße: 11 Vi Zoll hoch, 9 Zoll breit Anm.: Die Lose 379 und 380 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (6.36 fl für die Nrn. 369380) Käufer: ν Holzschuher auf den Rosten [?] 1789/08/18 HBGOV 0027 Karel I Zwey extra fleißige nach der Natur immitirte Blumen=Bouquets in Caravin, auf Leinw. I Diese Nr.: Ein extra fleißiges nach der Natur immitirtes Blumen=Bouquet Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 12 % Zoll, breit 9 % Zoll Anm.: Die Lose 27 und 28 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1789/08/18 HBGOV 0028 Karel I Zwey extra fleißige nach der Natur immitirte Blumen=Bouquets in Caravin, auf Leinw. I Diese Nr.: Ein extra fleißiges nach der Natur immitirtes Blumen=Bouquet Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 12 V* Zoll, breit 9 % Zoll Anm.: Die Lose 27 und 28 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0241 Karel I Ein Blumenstück, von Karel. I Pendant zu Nr. 242 Maße: 1 Schuh 5 Zoll hoch, 1 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0242 Karel I Zum Gegenstück ein nicht minder schönes Blumenstück, von obigem Meister [Karel] und Maaß. I Pendant zu Nr. 241 Maße: 1 Schuh 5 Zoll hoch, 1 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0289 Karel I Sechs kleine verschiedene Blumenstücke von Karel. I Maße: 5 Vi Zoll hoch, 4 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0348 Karel I Ein Blumenstück, nebst einigen Früchten, von Karel. I Maße: 1 Schuh 6 Zoll hoch, 1 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0359 Karel I Ein Blumenstück von Karel. I Pendant zu Nr. 360 Maße: 1 Schuh 2 Zoll hoch, 10 Vi Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0360 Karel I Zum Gegenstück ein dergleichen Blumenstück, vom nemlichen Meister [Karel] und Maaß. I Pendant zu Nr. 359 Maße: 1 Schuh 2 Zoll hoch, 10 Vi Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0495 Karell I Ein Blumenstück von Karell. I Maße: 1 Schuh 6 Zoll hoch, 1 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0675 Karell I Zwey Blumenstücke, bezeichnet Karell. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 2 Zoll breit 1 Schuh Inschr.: Karell (bezeichnet) Anm.: Die Lose 675 und 676 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0676 Karell I Zwey Blumenstücke, bezeichnet Karell. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 2 Zoll breit 1 Schuh Inschr.: Karell (bezeichnet) Anm.: Die Lose 675 und 676 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Caresia [Nicht identifiziert] 1786/05/02 NGAN 0378 Karell I Item [Zwey Blumenstücke]. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Anm.: Die Lose 377 und 378 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (6.36 fl für die Nrn. 369-380) Käufer: ν Holzschuher auf den Rosten [?] 438
GEMÄLDE
1799/12/04 HBPAK 0088 Caresia I Christus, Maria und Johannes. Ganz kräftig und auf das schönste gemahlt. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 37 Zoll, breit 25 Zoll Transakt.: Unbekannt
Caresme, Jacques Philippe 1796/02/17 HBPAK 0182 PI. Caresme I Auf der Diehle eines Landhauses sitzt ein alter Mann beym Tische, und gegen ihm über sitzt eine j u n g e Frau, welche ihr Kind säuget. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 9 Vi Zoll, Breite 11 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (38 M) Käufer: Τ
Carlevariis, Luca 1794/02/21 HB HEG 0114 Lucas Carlevarys I Vor einer Holländischen Stadt und entferntem Dorfe, fährt am Ufer des Canals, eine Scheut mit Herren und einer Dame, welches durch einem Pferde gezogen wird, vorbey. Sehr klar und stark bearbeitet. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 !4 Zoll, breit 14 % Zoll Transakt.: Unbekannt
Carlier, Jean Guillaume 1788/09/01 KOAN 0235 Carlier I Die Eitelkeit, [la vanite.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Fuß 7 Zoll, Breite 3 Fuß 10 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt
Carlone 1777/03/03 AUAN 0014 Carlone I Ein St. Johann Baptist. I Maße: Höhe 3 Sch. 4 Zoll, Breite 2 Sch. 6 Zoll Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt
Carnats [Nicht identifiziert] 1787/01/15 LZRST 0043 Carnats I Ein schönes Gemälde von Carnats, auf einem mit einem Tuch behangenen Tische befinden sich 2 Globi, verschiedene Attributen und Pretiosen grosser Herren, als Krone, Ordens &c. mit einem aufgeschlagnen Buch Het Bleygh van de Sterke Stadt Ostende. 3 Fuss 10 Vi Zoll hoch, 3 Fuss 6 Zoll br. in vergoldeten Rahm. I Pendant zu Nr. 44 Maße: 3 Fuß 10 Vi Zoll hoch, 3 Fuß 6 Zoll breit Verkäufer: Richter Transakt.: Unbekannt 1787/01/15 LZRST 0044 Carnats I Das Gegenbild zu vorigen von eben dem Meister [Carnats], auf einem mit Tuch behangenen Tische befindet sich ein Globus, Bluhmen, Pretiosen und ein aufgeschlagenes Buch, Beschrivinge of Out Batavia, von gleichem Maass und Rahm. I Pendant zu Nr. 43 Maße: 3 Fuß 10 Vi Zoll hoch, 3 Fuß 6 Zoll breit Verkäufer: Richter Transakt.: Unbekannt
Caro, Baidassare de 1778/08/29 HBTEX 0029 del Caro I Ein Stillleben mit Flügelwerk, wornach ein Englischer Hund schnappet, besonders ausführlich. I Maße: Höhe 1 Fuß 7 Zoll, Breite 1 Fuß 10 Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/10/23 HBKOS 0004 del Caro I Ein sehr lebhaftes Blumen= und Früchten=Stück von del Caro, auf dito [Leinwand], I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 35 Zoll, breit 47 Zoll Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0115 del Caro I Zwey Frucht=Stücke, nach dem Leben gemahlt, auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Frucht=Stück Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 15 Zoll 6 Linien, Breite 17 Zoll 3 Linien Anm.: Die Lose 115 und 116 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0116 del Caro I Zwey Frucht=Stücke, nach dem Leben gemahlt, auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Frucht=Stück Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 15 Zoll 6 Linien, Breite 17 Zoll 3 Linien Anm.: Die Lose 115 und 116 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt
1782/03/18 HBTEX 0153 del Caro I Ein vortrefliches S t i l l l e ben, mit Früchten, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 28 Zoll, Breite 4 0 Zoll Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1787/00/00 HB AN 0527 Balthasar di Caro I Verschiedene Hüner, ein Caninchen und eine Schildkröte bey einer steinernen Vase, welche mit Blumen behangen ist. Im Hintergrunde ein angenehmer Garten=Prospect. Besonder frey und natürlich gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 41 Zoll, breit 32 Zoll Transakt.: Verkauft (5 M) Käufer: Bertheau 1787/04/03 HBHEG 0063 del Cavo I Ein Garten=Prospect, im Vorgrunde eine Vase mit Blumen, auf der Erde vor derselben verschiedene Garten=Früchte, frey und natürlich gemahlt, von del Cavo, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Anm.: Der N a m e des Künstlers ist angegeben als "del Cavo", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Verkauft (7.6 M) Käufer: Bertheau
Carolino 1777/03/03 AUAN 0059 Carolino I Eine Madonna. I Maße: Höhe 1 Sch. 5 Zoll, Breite 1 Sch. 1 Zoll Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt
Carpioni, Giulio (I) 1764/00/00 BLAN 0048 Carpioni I 1. ausmendes schönes Stück, die sündfluth vorstellend, mit sehr vielen Figuren. I Maße: 3 Fuß 4 Zoll hoch, 4 Fuß 5 Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (2000 Rt Schätzung) 1779/00/00 HB AN 0176 Carpioni I Ein Faun, mit dem Rücken an das Postement einer Statüe gelehnt, bläst auf der Schallmey, die eine vor ihm sitzende Bacchantinn mit der Handpauke begleitet, drey horchenden Zuhörern seine Lieder vor. Im Vorgrunde schläft eine trunkene Bacchantinn; etwas hinter ihr ruhet ein Knabe, mit dem Kopfe an einen umgestürzten Krug gelehnt. Im Hintergrunde vergnügt sich noch eine Bacchantinn mit zwey Kindern auf Instrumenten. [Un Faune, le dos appuye contre le piedestal d ' u n e Statue, j o u e un air sur son chalumeau ä trois personnes qui l'ecoutent. Une Bacchante l'accompagne du tympanon. Sur le devant une autre Bacchante yvre & endormie; plus loin derriere eile repose un jeune gar90η, la tete appuyee contre une cruche renversee. Sur le fond une Bacchante & deux enfans s'amusent ä jouer des instrumens.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 6 Zoll hoch, 2 Fuß 5 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0177 Carpioni I Eine Gesellschaft Bacchanten, die an dem Fußgestelle der Statüe einer Bacchantinn sitzen, sind im Begriffe, auf das Wohl des von der Rechten auf seinem Esel kommenden Silens, der trunken ist, und von zwo Personen gehalten wird, zu trinken. Ein Knabe führt den Esel, vor dem zwey Kinder mit Musik voranziehen. [Une assemblee de Bacchantes, assises devant le piedestal de la Statue d ' u n e Bacchante, se dispose ä boire ä la sante de Silence, qui arrive du cöte droit, monte sur son äne. II est yvre & soutenu par deux personnes.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 6 Zoll hoch, 2 Fuß 5 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1491 Carpioni Jul. I Diana im Bade mit Nymphen, auf Leinwat, in einer geschnittenen und metallisirten Ram. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 11 Zoll, Breite 2 Schuh 11 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1795/11/14 HBPAK 0026 Carpione I Christus am Creutz, M a ria Magdalena umfaßet dasselbe; zur rechten kniet Johannes mit dem Lamme, und der Fahne, mit der Bittschrift: Ecce Agnns [sie] GEMÄLDE
439
Dei. Ein schönes Colorit, zeichnet dieses Gemähide besonders aus. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 4 Fuß 4 Zoll, breit 3 Fuß 6 Zoll Transakt.: Unbekannt 1795/11/14 HBPAK 0034 Carpione I Ein geistliches Stück. Der König David spielt auf der Harfe; in Wolken sitzt das Kind Jesu, welches mit Engeln umgeben. Von schönen Colorit und vielen Ausdruck. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 4 Fuß 4 Zoll, breit 3 Fuß 6 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/01/19 HBPAK [A]0003 Julio Carpioni I Ein Plafond, von Julio Carpioni. Eine schöne Gruppe leichtschwebender Genien, die sich mit Blumenkränzen umwinden. Die Zeichnung ist geistvoll, und das Fleisch sehr schön. I Maße: 8 Fuß 1 Zoll lang, 4 Fuß 11 Zoll hoch Transakt.: Unbekannt 1800/01/00 LZAN [AJ0009 Carpioni I Alpheus und Arethusa, eine Skizze. Diana mit ihrem blauen Gewand bis unter die Brust bekleidet, sitzt auf einer Wolke und schützt die Nymphe vor ihrem Verfolger, dem sie mit einer zurückweisenden edlen Geberde eine Wolke zuschickt. Arethusa ist hinter der Göttin verborgen, der Gott der Liebe schwebt über dem getäuschten Flussgott, eine Flamme lodert in seiner Rechten. I Maße: Höhe 1 Fuß 10 Zoll, Breite 1 Fuß 4 Zoll Verkäufer: A F Oeser Transakt.: Unbekannt 1800/01/00 LZAN [A]0010 Carpioni I Von Ebendemselben [Carpioni]. Drei sitzende leicht bekleidete junge Bachantinnen und ein junger Faun, sind, wohl gruppirt, der Hauptgegenstand in diesem Gemälde. Im Mittelgrund zur Rechten liegt bey einem grossen Gefässe ein schlafender Faun, altes Gemäuer füllt den Hintergrund. Die edle Einfalt der Stellungen und des ungekünstelten Ausdrucks dieses Meisters, findet man sehr vorzüglich in diesem kleinen reizenden Bilde. I Maße: Höhe 1 Fuß 3 Zoll, Breite 1 Fuß 8 Zoll Verkäufer: A F Oeser Transakt.: Unbekannt
Carpioni, Giulio (I) (Kopie nach) 1800/01/00 LZAN 0029 A.F. Oeser; Carpioni I Alpheus und Arethusa, nach Carpioni. Das Original steht unter den Gemälden fremder Künstler angezeigt. Dieses Gemälde ist korrekter und fleissiger ausgeführt, als das Original. I Kopie von A.F. Oeser nach G. Carpioni (I) Maße: Höhe 1 Fuß 9 Zoll, Breite 1 Fuß 6 Zoll Verkäufer: A F Oeser Transakt.: Unbekannt
Carracci 1742/08/01 BOAN 0048 Caratsch I Ein grosses Stuck den Samson und Dalilam praesentirend Originalien vom Caratsch. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1747/04/06 HB AN 0024 Carraccio I Ein Polyphemus von Carraccio. I Maße: 2 Fuß Vi Zoll Breite und 1 Fuß 9 Zoll Höhe Verkäufer: Brockes Transakt.: Unbekannt (8.8) 1759/00/00 LZEBT 0117 Caraz I Cupido auf dem Delphin in der See stehend auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 10 Zoll, Breite 3 Schuh 6 Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (100 Th Schätzung)
1768/07/00 MUAN 0023 Caraccio I [Ohne Titel] \Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0162 Caraccio I [Ohne Titel] lAnm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0906 Caraccio I [Ohne Titel] \Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0922 Caraccio I [Ohne Titel] \Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1112 Caraccio I [Ohne Titel] \Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1158 Caraccio I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0357 Carracci I Une piece d'academie, qui represente un homme nud & assis. Peint sur toile, marquee du No. 23. I Mat.: auf Leinwand Maße: 3. pieds de haut sur 2. p. 3 Vi. p. de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0358 Carracci I La Magdeleine penitente. Peinte sur toile, & marquee du No. 922. I Mat.: auf Leinwand Maße: 3. pieds de haut sur 2. pieds de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0359 Carracci I Un ecce homo. Peint sur toile, marque du No. 1112. I Mat.: auf Leinwand Maße: 3. p. 5. p. de haut sur 2. p. 11. p. de haut [sie] Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0360 Carracci I Jesus Christ couronne d'epines, en buste. Peint sur toile, marque du No. 1158. I Mat.: auf Leinwand Maße: 1. p. 8. p. de haut sur 1. p. 2. p. de large Verkäufer: Franfois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0361 Carracci I La sainte famille de Jesus Christ. Peinte sur toile, marquee du No. 162. I Mat.: auf Leinwand Maße: 2. p. 2. p. de haut sur 1. p. 9. p. de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1774/08/13 HBBMN Transakt.: Unbekannt
0160
Corrazzi I Johannes in der Wüsten. I
1763/11/09 FRJUN 0043 Carrage I Le Bust d'un Apötre peint en Maitre. I Maße: hauteur 29 pouces, largeur 22 Vi pouces Transakt.: Verkauft (6.32 fl für die Nrn. 43 und 44) Käufer: Winterstein
1777/03/03 AUAN 0086 Caraccio I Ein St. Theresia. I Maße: Höhe 1 Sch. Vi Zoll, Breite 6 Vi Zoll Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt
1763/11/09 FRJUN 0044 Carrage I Un Pareil [Le Bust d'un Apötre] pas moindre & de meme grandeur. I Maße: hauteur 29 pouces, largeur 22 Vi pouces Transakt.: Verkauft (6.32 fl für die Nrn. 43 und 44) Käufer: Winterstein
1777/05/26 FRAN 0581 Caragio I Stillet. I Verkäufer: Finsterwalder Transakt.: Verkauft (2.20 fl) Käufer: Morgenstern
1764/00/00 BLAN 0527 Carach I Stellet die Comödie vor. Maße: 3 Fuß 4 Zoll hoch, 2 Fuß 8 Vi Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (140 Rt Schätzung) 440
GEMÄLDE
1778/05/23 HBKOS 0074 Carache I Eine Leda, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 10 Zoll, Breite 14 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/10/30 HBKOS 0031 Caragge I Zwey Philosophen=Köpfe im Profil; meisterhaft gemahlt, auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Philo-
sophen=Kopf im Profil Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 21 Zoll, breit 20 Zoll Anm.: Die Lose 31 und 32 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/10/30 HBKOS 0032 Caragge I Zwey Philosophen=Köpfe im Profil; meisterhaft gemahlt, auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Philosophen=Kopf im Profil Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 21 Zoll, breit 20 Zoll Anm.: Die Lose 31 und 32 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/10/30 HBKOS 0176 Caragge I Die Grablegung Christi, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 48 Zoll, breit 35 Zoll Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0093 Caraccio I Venus und Adonis. [1 p[iece]. venus & adonis.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 3 Fuß 7 Zoll, Breite 5 Fuß 7 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1791/07/29 HBBMN 0144 Caraccio I Amor halb liegend unter beschattenden Bäumen, auf dito [Leinen]. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 19 Vi Zoll, breit 25 Zoll Transakt.: Verkauft (12 Sch) Käufer: Springh [?] 1799/10/18 LZAN 0094 Caracci I Christi Taufung am Jordan; eine schöne Komposition von 19 Figuren, der Grund offerirt eine Landschaft. Diess Bild ist durch das nach demselben gestochenen Kupfer bekannt; hoch 32 Zoll, breit 40 Zoll. Auf Leinwand, in einem vergoldeten Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 32 Zoll, breit 40 Zoll Verkäufer: Rauch Transakt.: Verkauft (24.12 Th) Käufer: Hendel 1799/12/23 WNAN 0019 Carrache I Deux tableaux ovales, representant des Bachanales de Carrache sur Toile. I Mat. : auf Leinwand Format: oval Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN1 0030 Carrache I Eine heil. Familie natürlicher Größe: Maria haltet das Kind auf dem Schooß, ein Engel bettet dasselbe an. Ein Stuck von aller Schönheit und geschmolzenem Pinsel, auch bestens conservirt. 31 Z. h., 28 Z. b. T. [i.e. Leinwand] Signirt Carratius MDXCIII. I Mat.: auf Leinwand Maße: 31 Zoll hoch, 28 Zoll breit Inschr.: Carratius MDXCIII (signiert und datiert) Transakt.: Unbekannt
Carracci (und Bril, P.) 1787/10/06 HBTEX 0023 Paul Brill; Carasch I Eine Römische Gegend, von Paul Brill, mit Figuren, von Carasch, mit dito [vergoldeten] Rahm. I Transakt.: Unbekannt 1791/10/21 HBRMS2 0017 Paul Brill; Caracci I Eine gebürgigte Gegend mit Wasserfällen, Waldungen, Gebäuden ec. im Vordergrunde einige Figuren und Thiere. Ein seltenes und schönes Gemählde. Auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 44 Zoll, breit 74 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 LZRCH 0052 Paul Brill; Carache I Un pay sage figures et fabriques, tableau tres capital de ces deux artistes. I Mat.: auf Leinwand Maße: h. 29.1. 45. pouces Verkäufer: J F Rauch Transakt.: Unbekannt
Carracci (Geschmack von) 1740/00/00 AUAN 0037 Charatio I 1. Stuck Adam und Eva / Gusto vom Charatio. I Maße: 1. Schuh / 9. Zoll hoch / 2. Schuh / 2. Zoll breit Transakt.: Unbekannt (50 fl) 1792/02/01 LZRST 4865 Carrache I Der Kopf eines Heiligen, welcher ein Crucifix anbetet, im Geschmack von Carrache, 23 Zoll hoch, 16 Zoll breit, auf Leinwand, beschädigt. I Mat.: auf Leinwand Maße: 23 Zoll hoch, 16 Zoll breit Transakt.: Verkauft oder Unverkauft (4 Gr) Käufer: R[ost]
1793/01/15 LZRST 7034 Carrache I Der Kopf eines Heiligen, der ein Cruzifix anbetet, im Geschmack von Carrache, 23 Zoll hoch, 16 Zoll breit, auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: 23 Zoll hoch, 16 Zoll breit Transakt.: Verkauft (11 Gr) Käufer: f
Carracci (Kopie nach) 1743/00/00 BWGRA 0012 Caracche I Ein kniender und betender Hieronymus, nach Caracche. I Maße: hoch 2 Fuß 4 Zoll, breit 1 Fuß 11 Zoll Transakt.: Unbekannt 1773/12/18 HBBOY 0073 Carasch I Eine Galathea. Nach Carasch. I Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0546 Caracci I Hercules, nach Caracci. [un Hercule, selon Caracci.] I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Fuß 6 Zoll, Breite 1 Fuß 11 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0005 Carass I Eine nacke Fraue Person einen Dorn aus dem Fuß nehmend nach Carass. I Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh Vi Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1795/03/12 HBSDT 0190 Nach Caracci I Die Pest in Eypten [sic]. I Transakt.: Unbekannt
Carracci (Manier) 1787/00/00 HB AN 0418 Wie Caraccio I Der Evangelist Marcus, mit aufgehobenen Händen und gen Himmel sehend, sitzt auf der Erde, neben ihm ein großes Buch, und hinter ihm steht der Löwe. Im Hintergründe eine Landschaft. Besonders schön und ausführlich gemahlt, und von vortrefflichem Ausdruck und angenehmen Colorit. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 11 Zoll, breit 14 Zoll Transakt.: Verkauft (9 M) Käufer: Hagel
Carracci (Schule) 1752/05/08 LZAN 0059 Carache I Eine liegende Venus aus Carache Schule 2 Vi Elle hoch 4 Vi Elle breit, ohne Rahmen. I Maße: 2 Vi Elle hoch, 4 Vi Elle breit Transakt.: Verkauft (4 Th) Käufer: Ludwigs [?] 1778/09/28 FRAN 0058 Caraccio I Der Prophet Arnos, aus der Schule von Caraccio. [Le prophete Arnos de l'ecole de Caraccio.] I Maße: 1 Schuh 9 Zoll breit, 2 Schuh 8 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (12.30 fl) Käufer: Pirien 1781/05/07 FRHUS 0153 Caracci I Venus und Cupido aus der Caraccischen Schule. I Maße: 3 Schuh 6 Zoll hoch und 3 Schuh breit Verkäufer: Jacob Bemus Transakt.: Verkauft (43 Kr) Käufer: Heusser 1785/05/17 MZAN 0086 Carraccio I Diane und Endymion aus Carraccio Schule. [Diane & Endymion de l'ecole de Carraccio.] I Maße: 2 Schuh 11 Zoll hoch, 3 Schuh breit Anm.: Dieses Los wurde zusammen mit der Nr. 87 (L. Giordano) verkauft. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (91 fl für die Nrn. 86 und 87) Käufer: Geistliche Rath Rolandi 1787/04/19 HBTEX 0106 Carasch I Ein historisches Stück, schön gezeichnet, aus der Schule von Carasch. I Transakt.: Verkauft (3 M) Käufer: Lilli 1790/01/07 MUAN 1497 Aus der Schule der Caraccio I Cäcilia in einem Blumenkranz, auf Leinwat. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 3 Schuh 4 Zoll, Breite 2 Schuh 6 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1796/02/17 HBPAK 0104 Aus der Schule von Carraccio I Wie Perseus die am Felsen angeschlossene Andromeda von dem UngeGEMÄLDE
441
heuer befreyt. Am gegenseitigen Ufer steht ein König und eine Königinn, wie auch Andere, welche in Schrecken gerathen. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 12 % Zoll, Breite 19 V* Zoll Transakt.: Verkauft (30 M) Käufer: Packischefsky 1796/02/17 HBPAK 0106 Aus der Schule von Carraccio I Wie Marie auf Wolken gen Himmel gebracht wird. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 25 Zoll, Breite 17 % Zoll Transakt.: Verkauft (60 M) Käufer: Packi [für] C
Carracci, A.
Maße: 2 Schuh 2 Zoll hoch, 1 Schuh 8 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (13 fl) Käufer: Becker Glöckner 1790/01/07 MUAN 1440 Caraccio August I Familia Christi, auf Leinwat, in einer eben derlei [geschnittenen und vergoldeten] Ram. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 4 Schuh 1 Zoll, Breite 3 Schuh 2 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0108 Augustin Carrache I Der barmherzige Samariter, von noch drey andern Personen begleitet. Von natürlicher Größe. Kräftig und gut gemahlt. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 52 Zoll, breit 70 Zoll Transakt.: Unbekannt
1764/00/00 BLAN 0080 A. Carass. I 2 Biblische historien. I Diese Nr.: Eine Biblische historie Maße: 1 Fuß 8 Zoll hoch, 2 Fuß 1 Zoll breit Anm.: Die Lose 80 und 82 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (2000 Rt für die Nrn. 80 und 82, Schätzung)
1798/01/19 HBPAK 0025 Augustin Carracci I St. Sebastian. Der Heilige ist eben im Verscheiden, und hängt der Kopf über die Schulter herab. Kniestück in Lebensgrösse. Schade, daß in diesem vortreflichen Gemähide, wie gewöhnlich in den Gemählden des Carraccis, die Schatten ein wenig zu schwarz geworden sind. I Maße: 3 Fuß hoch, 2 Fuß 3 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
1764/00/00 BLAN 0082 A. Carass. I 2 Biblische historien. I Diese Nr.: Eine Biblische historie Maße: 1 Fuß 8 Zoll hoch, 2 Fuß 1 Zoll breit Anm.: Die Lose 80 und 82 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (2000 Rt für die Nrn. 80 und 82, Schätzung)
1799/00/00 WZAN 0318 August in Caraccio I Christus im Oehlberge mit einem Engel, von Augustin Caraccio. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 8 Zoll breit 1 Schuh 3 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1775/09/09 HBBMN 0018 A. Carrache I Eine extra rare Guache, oder mit W a s s e r f a r b e n gemahlte Exquisse, vorstellend St. Bruno, der Allmosen austheilet, reich von wohlgezeichneten Figuren. Dieses Stück ist bekannt durch das von Annibal Carrache in Kupfer geätzte Blatt; auf Leinewand, mit Glas über, und ist verwahret in einem dazu gemachten netten Kästchen. I Mat.: Gouache auf Leinwand Maße: Hoch 1 F 10 Z, Breit 2 F 5 Ζ Transakt.: Verkauft (51.8 M) Käufer: Hasberg 1779/00/00 HB AN 0340 A. Caracci I Magdalena sitzt vor einer Höhle, und zeigt mit der linken Hand auf das zu ihrer Rechten liegende Buch. Auf Holz. [La Madelaine assise devant une caveme, montre de la main gauche un livre qui est ä sa droite. Sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß hoch, 10 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1794/09/10
HBGOV
0034
A. Caraccio
1796/09/08 HBPAK 0127 A. Carracce I Ein Petrus=Kopf, mit gefaltenen Händen. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 20 Zoll, breit 16 Zoll Transakt.: Unbekannt
Carracci, A. (Kopie nach) 1776/07/19 HBBMN 0119 Lahn Sen.; A. Carasch I Ein Stück mit Lebensgrosse Figuren, der Triumph von Galate, nach A. Carasch durch Lahn Sen. I Kopie von Joachim Luhn nach A. Carracci Maße: Höhe 6 Fuß 10 Zoll, Breite 8 Fuß 4 Zoll Transakt.: Verkauft (23.4 M)
Carracci, Agostino 1777/03/03 AU AN 0034 Agost. Caracci I Ein Vigilanze vorstellend. I Maße: Höhe 3 Sch. 4 Zoll, Breite 2 Sch. 7 Zoll Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0082 Aug. Caraccio I Eine Frau zählet einem hinter dem Tische sitzenden Bauer das Geld in die Hand für den Wein, der vor ihm auf dem Tische steht. [Une femme compte de l'argent ä un paysan assis derriere la table pour le vin qui est devant lui.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 8 Vi Zoll hoch, 6 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1785/05/17 MZAN 1130 Augustin Caraccio I Der H. Franziskus Seraphikus von Augustin Caraccio. [S. Francois Seraphique.] I GEMÄLDE
Carracci, Agostino (Schule) 1789/00/00 MMAN 0123 Augostino Carracci I Ein Satyr, so eine Nymphe peitschet, auf Leinw. 4 Fuß hoch und 3 Fuß 3 Zoll breit, aus der Schul des Augostino Carracci. [Un Satyr qui fouete une Nimphe, sur toile, de 4 pieds de haut, sur 3 p. 3 po. de large, de l'Ecole d'Augustin Carrani [sic].] I Mat.: auf Leinwand Maße: 4 Fuß hoch, 3 Fuß 3 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt
I W i e der Engel des
Herrn Christus am Oelberg den Glaubens=Kelch darreicht. Meisterhaft gemahlt. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 27 Vi Zoll, breit 21 Ά Zoll Transakt.: Unbekannt
442
1800/01/00 LZAN [A]0011 Aug. Carracie I In einer Grotte, in welcher ein Wasserfall ist, ruhen einige Nymphen der Diana, ihr Jagdgeräthe und ihre Hunde sind ihnen zur Seite. I Maße: Höhe 1 Fuß 4 Zoll, Breite 1 Fuß 11 Zoll Verkäufer: A F Oeser Transakt.: Unbekannt
Carracci, Annibale 1670/04/21 WNHTG 0136 Annibale Carrats I Nostra Signora di Annibale Carrats. I Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt 1750/10/15 HB AN 0011 Carracio (Hannibal) I Zwey ovale auf Instrumenten spielende Figuren. I Format: oval Maße: 1 Fuß 8 Zoll hoch, 2 Fuß Vi Zoll breit Transakt.: Unbekannt (45) 1750/10/15 HB AN 0012 Carracio (Hannibal) I Maria mit dem Kinde und Joseph. I Maße: 1 Fuß 2 Zoll hoch, 1 Fuß 8 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1752/05/08 LZAN 0047 Hannibal Carache I Ein alter Philosophus von Hannibal Carache gemahlt. I Maße: 1 V* Elle hoch, 1 Vi Elle breit Transakt.: Verkauft (1 Th) Käufer: Fleischer [?] 1759/00/00 LZEBT 0073 Annibal Caraz I Der Herr Christus von Pilato dem Volcke vorgestelt auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 4 Schuh 7 Zoll, Breite 5 Schuh 2 Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (400 Th Schätzung) 1763/01/17 HNAN 0077 Hannibal Carache I St. Francois avec l'apparition d'un Ange. I Maße: Hauteur 6 pieds 8 pouces, Largeur 4 pieds Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt 1769/03/30 HBTOU 0006 Anibal Carragge I Ein todter Christus auf einen Grabstein liegend vor einer Felsen Höhle, wobey 2 Engel über dessen Haupt, welche weinen, auf Leinwand. [Die Mehresten in fein verguldte Rahmen, und die übrigen in schwarz gebeizten mit goldenen Staber.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 14 Zoll, Breite 2 Fuß 4 Zoll Anm.: Die Angaben in eckigen Klam-
mern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 51 und beziehen sich auf die Nm. 1 bis 51. Transakt.: Verkauft (18.4 M) Käufer: Duve 1770/10/29 FRAN 0007 Η. Carrats I Die Verspottung Christi. I Maße: h. 48. Zoll. b. 36. Zoll. Transakt.: Unbekannt 1777/05/26 FRAN 0218 Haunibal Caragio I Brustbild von Haunibal Caragio. I Verkäufer: Finsterwalder Transakt.: Verkauft (2.40 fl) Käufer: Rath Eichhorn 1777/05/26 FRAN 0455 Hani Caragio I Schöner Johannes, Brustbild von Hani Caragio. I Verkäufer: Finsterwalder Transakt.: Verkauft (48 fl) Käufer: Mevius 1778/09/28 FRAN 0126 Hanibal Carraccii I Ein Portrait des Hanibal Carraccii mit dunkeln Haaren und Bart, von ihm selbst. [Portrait d'Anibal Carache, barbe & cheveux de couleur foncee, par lui meme.] I Maße: 1 Schuh 2 Zoll breit, 1 Vi Schuh hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (8 fl) Käufer: Przß ν Dessau 1781/00/00 WRAN 0032 Carrache Annibal Bolog. I Sanson en grandeur naturelle, tenant un Lion par les deux mächoires, & terrasse sous lui. Tableau peint sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: 50 pouces de haut, sur 43 de large Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0033 Carrache Annibal Bolog. I Daniel en grandeur naturelle, dans la fosse aux Lions, un genou en terre, & les deux mains jointes, regarde en haut; devant lui un Lion couche, on remarque dans ce Tableau, ainsi que dans Ie precedent, la correction du dessein & la beaute des contours, qui font avec justice admirer ce grand maltre: ce beau Tableau peint sur toile porte 48 pouces de haut, sur 36 pouces de large. I Mat.: auf Leinwand Maße: 48 pouces de haut, sur 36 pouces de large Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0034 Carrache Annibal Bolog. I Une Sainte Familie, oü se voit Ste. Claire ä genoux devant la Vierge qui tient l'Enfant Jesus sur ses genoux. Tableau d'une belle composition, & d'un beau coloris. I Maße: 11 pouces 3 lignes de haut, sur 5 pouces 6 lignes de large Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/02/17 FRAN 0033 Hannibal Carrache I Das Bildnis des berühmten Hannibal Carrache, von ihm selbsten sehr meisterhaft gemahlt. I Pendant zu Nr. 34 von H.P. Voskuyl Maße: 1 Schuh 1 Vi Zoll breit, 1 Schuh 6 Zoll hoch Transakt.: Unbekannt (65 fl für die Nm. 33 und 34) 1782/05/29 FRFAY 0035 Hannibal Carauio I Ein Desparto. I Maße: 30 Zoll hoch, 24 Zoll breit Verkäufer: Kaspar Thorhorst Transakt.: Unbekannt (44 fl) 1782/07/00 FRAN 0142 Hannibal Carraggio I Eine nackende weibliche Figur, neben welcher ein schöner auf dem linken Knie ruhender Cupido, zur rechten Hand aber eine Mannsperson, ihr den Schuh ausziehend vorgestellt ist. I Maße: 3 Schuh 4 Zoll hoch, 2 Schuh 10 Zoll breit Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt (2.8 fl) 1787/00/00 HB AN 0100 Hannibal Carraccio I Wie St. Roch den Armen Geld austheilet. In einem prächtigen Gebäude steht St. Roch auf einer Erhöhung, und wirft mit einem freundlichen Gesicht einigen armen Männern, Weibern und Kindern Geld zu. Zur Rechten kömmt jemand mit einem Kranken auf einer Karre, welcher seinen Rosenkranz hält, und mit jammernden Gesicht über sich gegen den St. Roch blickt. Eine Frau mit ihrem Kinde auf den Armen kömmt daneben die Steige herunter. Im Vordergrunde sitzt eine andere Frau auf der Erde, die ihr bekommenes Geld mit fröhlicher Miene nachzählt. Ein alter Mann sitzt neben einem fröhlichen Jüngling mit seinen beyden Söhnen, davon einer eine Frucht ißt, der andere aber seinem Vater ein bekommenes Stück Geld zeigt. Noch mehrere Arme und Kranke kommen hinzu zu den offenen Thüren
herein, wovon einige ihre Kinder auf den Schultern tragen. Dieses ist ein vortreffliches und seltenes Gemähide. Die Mahlerey ist leicht und markigt, und die Zeichnung sehr richtig. Es ist ä la Gouache gemahlt. Auf Leinew. g.R. [in goldenem Rahm] und mit einem dicken Spiegelglase I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll, breit 31 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (450 M) Käufer: Schoen 1787/01/15 LZRST 0011 An. Carrache I Hercules den Centaurus tödtend, ein vortreflich grosses meisterhaftes Bild, von An. Carrache. 27 Z. hoch, 31 Zoll br. in schwarz gebeizten Rahmen, gut erhalten. I Maße: 27 Zoll hoch, 31 Zoll breit Verkäufer: Richter Transakt.: Unbekannt 1788/06/12 HBRMS 0026 H. Carraccio I Ein Fest von Bacchanten und Nymphen: von großer Bearbeitung, Anordnung und Vertheilung des Lichts und Schattens. Auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 15 Zoll, breit 19 Zoll Transakt.: Unbekannt 1788/10/01 FRAN 0161 Hanibal Caracci I Desperato, mit ausserordentlich vielem Ausdruck, meisterhaft verfertigt von Hanibal Caracci. I Maße: 24 Vi Zoll hoch, 18 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (8 fl) Käufer: Trautman 1790/01/07 MUAN 0426 Caraccio Hannib. I Mater dolorosa, auf Holz, in einer geschnittenen und vergoldeten Ram. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 2 Schuh 1 Zoll, Breite 1 Schuh 6 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1203 Caraccio Hannib. I Maria mit dem Jesukinde, auf Leinwat, in einer geschnittenen und vergoldeten Ram. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 3 Schuh 6 Zoll, Breite 2 Schuh 8 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1791/09/21 FRAN 0059 Hannibal Carache I Eine Zimmermannswerkstätte, wo zur Rechten die Jungfrau sitzt mit dem Kinde auf dem Schooße, vor ihr stehet Joseph, so ein Bret hobelt, hinten sind Engel und andere Gegenstände, so sich dazu schicken. I Transakt.: Verkauft (89 fl) Käufer: Breiting 1793/00/00 HBMFD 0014 Nanibal Carache I Christi Geburt. Hirten beten das Kindlein an im Stall. Das Hauptsüjet ist unter einem alten verfallnen Gebäude, wo man noch die Fragmente alter Bildhauer-Arbeit, und Ueberbleibsel von Architectur sieht. Zur Linken wird das Kindlein angebetet und verehret, von Maria, Joseph, verschiedne Engel, und eine Menge Hirten. Welche Gruppe ein lebhaftes Licht von oben erhält. Ueber diesen Gegenstand sieht man eine Glorie von kleinen Cherubinen. Die schöne Beleuchtuug [sie] würkt über den ganzen Gemälde. Zur Rechten sieht man durch eine Oefnung aufs Feld die Verkündigung der Hirten. Dieses Gemälde von besondrer Erfindung und Stärke der Ausführung wird dadurch noch seltner, dass sich an der Architectur eine Art von Wappen befindet, wo anstatt einer Inschrift, man den Nahmen Hanibal Carache auf zwey Linien, und auf der dritten 1601. und auf der vierten ein S und endlich ein V mit ein Ρ eingeschlossen, welches auf eine päpstliche Regierung deuten kann, sub Paulo V. &c. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuss 6 Zoll hoch, 1 Fuss 11 Vi Zoll breit Inschr.: Hanibal Carache 1601 SVP (signiert und datiert) Verkäufer: Pierre Laporterie Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 FGAN 0048 Anibal Coraci I Ein Pauluskopf, auf Tuch gemalt. I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Schuh 3 Zoll hoch, 1 Schuh 10 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt (6 fl) 1796/08/00 HBPAK 0006 H. Carraccio I Maria mit dem Kinde und Johannes. Halbe Figuren; vortreflich gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 14 Zoll, Breite 11 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0118 Annibal Caraccio I Die Kreutzigung Christi, mit den beyden Schächern. I Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0134 Annibal Caraccio I Die Flucht Josephs und der Maria. I Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
443
1798/01/19 HBPAK 0002 Annibal Carracci I Hero und Leander. Ein vortrefliches Gemähide. Eine Gruppe Nymphen trägt den todten Leander durch die dunkel stürmenden Wogen, Hymen löscht seine Fackel weinend in den Wellen, und in der Ferne stürzt sich Hero von dem felsigten Ufer herab. Die dunkeln Wolken werden durch einen Blitz zerrissen, welcher über die Landschaft das Licht verbreitet. Das Ganze ist so kühn entworfen als stark ausgeführt, und vortreflich erhalten. Ein Querstück. I Maße: 3 Fuß 5 Zoll hoch, 4 Fuß 9 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Carracci, Francesco 1786/05/02 NGAN 0204 Francesco Caracci I Ein nakender Knabe läßt ein Bologneser Hündchen aufwarten. I Maße: 2 Schuh 2 Zoll hoch, 2 Schuh 7 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (13 fl) Käufer: Ego
Carracci, Ludovico
1798/06/04 HBPAK 0320 Hanibal Carache I Der todte Christus, von mehrern Figuren umgeben. Dieses Meisters Werke bedürfen auch keines Lobes. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 25 Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Unbekannt
1764/00/00 BLAN 0414 Lud: Caratti I Die heilige Familie vorstellend. I Maße: 1 Fuß 2 Zoll hoch, 10 Vi Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (110 Rt Schätzung) Gegenw. Standort: Moskva, Rossiya. Musei imeni Pushkina. (N 188)
1799/00/00 LZAN 0143 Annibal Carrache I Dedale et Icare; tableau un veu [sic] en dommage. I Transakt.: Unbekannt (8 Louis Schätzung)
1787/00/00 HB AN 0253 Ludovicus Carraccio I Der Leichnam Christi, von zweyen Engeln gehalten, davon einer eine Fackel trägt. Maria knieet zu den Füßen Christi mit offenen Armen und mit einem überaus traurigen Gesichte. Diese traurige Scene ist unter einer Hole vorgestellt, durch deren Ausgang man den Berg Golgatha mit den sich noch darauf befindenden Kreutzen gewahr wird. Die Composition ist voll Geist, das Colorit schön und kräftig, und die Stellungen reizend und natürlich. A.K. [Auf Kupfer] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 11 Vi Zoll, breit 15 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (30 M) Käufer: Schoen
1799/00/00 WZAN A0264 Hannibal Caraccio I Die Steinigung Stephani, von Hannibal Caraccio. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 5 Zoll breit 3 Schuh 3 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN2 0150 Carraccio (Annibal) I Die Flucht nach Egypten. Vorne sitzt die Maria, das Kind Jesu auf den Knien haltend, welches zwey Engel betrachten; links ist Joseph und füttert den Esel. Ueber der Jungfrau sind zwey Engel, die Palmzweige abbrechen; der Grund präsentirt eine perspektivische Aussicht. I Mat.: auf Leinwand Maße: 21 Zoll hoch, 24 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1800/00/00+ LZRST [0019] Annib. Carrache I Ein schöner Christuskopf im Profil. I Mat.: auf Leinwand Maße: 16 Zoll breit 21 Zoll hoch Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Rost Transakt.: Unbekannt
Carracci, Annibale (Kopie nach) 1784/08/02 FRNGL 0393 Harnwal Carazzi I Cephales und Aurora mit dem Tistonus, nach Harnwal Carazzi. I Maße: 14 Zoll breit, 10 % Zoll hoch Verkäufer: Α Transakt.: Verkauft (2.30 fl) Käufer: Nothnagel
1787/01/15 LZRST 0007 Ludwig Carrache I Christus und die Samariterinn am Brunnen, von Ludwig Carrache auf Holz gezogen, 20 Zoll hoch und 16 Zoll br. in grossen schwarzgebeizten Rahm, ist etwas weniges beschädigt und braun geworden. I Mat.: auf Holz Maße: 20 Zoll hoch, 16 Zoll breit Verkäufer: Richter Transakt.: Unbekannt 1788/01/15 LZRST 3971 Ludwig Carrache I Christus und die Samariterinn am Brunnen, von Ludwig Carrache, auf Holz gezogen, 20 Z. hoch, 16 Z. breit, in grossen schwarz gebeizten Rahm, ist etwas weniges beschädigt und braun geworden. I Mat.: auf Holz Maße: 20 Zoll hoch, 16 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (1 Th) Käufer: D Κ 1789/00/00 MMAN 0187 Lodovico Carracci I Ein heil. Dominicus, auf Leinw. [St. Dominique, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 5 Zoll hoch, 1 Fuß breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (400 fl)
1787/01/15 LZRST 0029 Ann. Carrache I Maria und der todte Christus beym Grabe, nach Ann. Carrache, auf Leinewand, 3 Fuss 3 Z. 4 Fuss 3 Z. br. etwas brüchicht. I Mat.: auf Leinwand Maße: 3 Fuß 3 Zoll hoch, 4 Fuß 3 Zoll breit Verkäufer: Richter Transakt.: Unbekannt
1789/00/00 MMAN 0371 Lodovico Carracci I Die Grablegung Christi, auf Leinwand. [Iesus au tombeau, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 7 Zoll hoch, 1 Fuß 7 Zoll breit [1 pied 7 pouces de haut, 1 pied 3 pouces de large] Anm.: Die Dimensionen unterscheiden sich in der deutschen und französischen Fassung des Katalogs. Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt
1788/01/15 LZRST 3980 Ann. Carrache 1 Maria und der todte Christus beym Grabe, nach Ann. Carrache auf Leinwand, 3 Fuss, 3 Z. hoch, 4 Fuss, 3 Z. breit, etwas brüchigt. I Mat.: auf Leinwand Maße: 3 Fuß 3 Zoll hoch, 4 Fuß 3 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (3 Gr) Käufer: Benz
Carracci, Ludovico (Geschmack von)
1797/08/10 MMAN 0196 Hannibal Carrache I Der Heil: Johannes der Täufer. Nach Hannibal Carrache. auf Tuch. I Mat.: auf Leinwand Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (5 fl Schätzung)
1778/05/16 HBBMN 0063 Ludw. Carasch I In einer Landschaft wird die Venus vorgestellet, wie Cupido ihr die Füße verbindet, schön gezeichnet in dem Gusto von Ludw. Carasch. I Transakt.: Unbekannt
Carree, Abraham
1792/08/20 KOAN 0108 Hannibal Caratz I Eine Frau mit einem Kind auf Tuch von einem Schüler des Hannibal Caratz. I Mat.: auf Leinwand Maße: 4 Schuh hoch, 1 Schuh 10 Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt
1782/09/30 FRAN 0321 Abraham Carre I St. Hieronymus in der Höhle bei einer Lampe. [St. J£röme dans le caveau aupres d'une lampe, par Abraham Carre.] I Maße: 6 Zoll hoch, 4 Vi Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (6.30 fl) Käufer: Prinz ν D[essau] Gegenw. Standort: Dessau, Deutschland. Anhaltische Gemäldegalerie. (142) als F. Carree
1795/03/12 HBSDT 0156 Aus der Schule des Annibal Carache I Christus mit den Jüngern zu Emaus; vortreflich angeordnet und brav gezeichnet. Auf Leinwand, im schwarzen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 46 Zoll, breit 60 Zoll Transakt.: Unbekannt
1797/04/20 HBPAK 0068 A. Carre I Die drey Weisen aus dem Morgenlande; nebst den Stern, wobey Gruppen von Kindern und Alten. Auf Holz, mit schwarzen Rahm und vergoldeten Stäben. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Zoll, breit 6 Zoll Transakt.: Unbekannt
Carracci, Annibale (Schule)
444
GEMÄLDE
Carree, Franciscus 1766/07/28 KOSTE 0044 F. Carre I Ein klein conversations= stück auf holz. I Mat.: auf Holz Transakt.: Verkauft (6 Rt) Käufer: Schmitz 1776/00/00 WZTRU 0223 Franz Carree I Ein Stück 6 Zoll hoch, 7 Zoll breit von Franz Carree, vorstellend eine Nachtlandschaft, wo der Mond seine Wirkung des Lichts halb in den Wolken verborgener, auf die Gegenstände aber ganz schwach zu erkennen giebt: im Vorgrunde erstehet man einige Figuren bey einem Kohlfeuer, und alles ist aufs beßte verstanden. I Pendant zu Nr. 224 Maße: 6 Zoll hoch, 7 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (6 fl Schätzung) 1776/00/00 WZTRU 0224 Franz Carree I Compagnion zu Nro. 223 ein gleiches Nachtstück, wo die Sonne noch etwas Wirkung ihres Lichtes auf die Gefielder machet, ist von nämlicher Stärke des Meisters [Franz Carree]. I Pendant zu Nr. 223 Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (6 fl Schätzung) 1781/00/00 WZAN 0223 Franz Carree I Ein Stück, 6 Zoll hoch, 7 Zoll breit von Franz Carree, besieht in einer Nachtlandschaft, wo der Mond seine Wirkung des Lichtes halb in den Wolken verborgen haltet, und halb auf die Gegenstände, aber ganz schwach fallen läßt. Im Vorgrunde sieht man einige Figuren bey einem Kohlfeuer, und alles ist aufs beßte verstanden. I Pendant zu Nr. 224 Maße: 6 Zoll hoch, 7 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0224 Franz Carree I Kompagnon zu Nro 223 ein gleiches Nachtstück, wo die Sonne noch etwas Wirkung ihres Lichtes auf die Gefilde machet, ist von nämlicher Stärke des Meisters [Franz Carree], I Pendant zu Nr. 223 Transakt.: Unbekannt 1784/08/02 FRNGL 0460 F. Caree I Zwey schön und glüend ausgeführte Bauernstücke, von F. Caree 1657 verfertigt. I Maße: 12 Zoll breit, 14 Zoll hoch Inschr.: 1657 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Verkauft (33.15 fl) Käufer: von Dessau Gegenw. Standort: Dessau, Deutschland. Anhaltische Gemäldegalerie. (279)
Carree, Hendrik 1790/08/13 HBBMN 0018 H. Carre, Ao. 1758 d. 2. Jul. I Fridrich II. Rex Bor. in seinen jungen Jahren. Auf H[olz]. G.R. [Goldnen Rahm] I Mat.: auf Holz Format: rund Maße: 4 Zoll im Durchmesser Inschr.: H. Carre, Ao. 1758 d. 2. Jul. (bezeichnet und datiert) Transakt.: Verkauft (2.4 M) Käufer: Meyerhoff
Carree, Hendrik (I) 1744/05/20 FRAN 0024 Hen. Caree I 1 Landschafft. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 6 Zoll, Breite 1 Schuh 9 Zoll Verkäufer: von Ucheln Transakt. : Unbekannt 1781/09/10 BNAN 0025 H. Cam I Ein Engel senket sich aus der Glorie vieler anderer zu den anbetenden Hirten herunter; eine Ochse wird flüchtig, Heerden ruhen in der dunkelen Landschaft. Beyde von lebhafter reiner Färbung; von H. Carre, auf Tuch, 1718. g.L. [im schwarzem Rahm mit verguldeten Leisten]. I Mat.: auf Leinwand Maße: 28 Zoll hoch, 24 Zoll breit Inschr.: 1718 (datiert?) Anm.: Die Angaben im Bildtitel beziehen sich auf die Nm. 24 und 25. Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt 1796/00/00 HLAN [0054] H. Carre I Nächtliche Scene, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: 8 Z. 6 Ζ Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: [Friedrich Karl Lang] Transakt.: Unbekannt (27.18 Rt; 50 fl Schätzung) 1799/00/00 LZAN 0131 Henri Carre I Deux Pendans. Des moutons couches pres de leurs bergeries; d'une verite frappante en
precieux fini. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 5 pouces, largeur 7 pouces Transakt.: Unbekannt (6 Louis Schätzung)
Carree, Michiel 1749/07/31 HBRAD 0040 M. Caree I Zwey Vieh=Stücke. I Diese Nr.: Ein Vieh=Stück Anm.: Die Lose 40 und 41 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (14 für die Nrn. 40 und 41) 1749/07/31 HBRAD 0041 M. Caree I Zwey Vieh=Stücke. I Diese Nr.: Ein Vieh=Stück Anm.: Die Lose 40 und 41 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (14 für die Nrn. 40 und 41) 1750/04/00 HB AN 0019 M. Carre I Zwey sehr schöne Landschaften mit Viehe, von M. Carre. I Diese Nr.: Eine sehr schöne Landschaft mit Viehe Anm.: Die Lose 19 und 20 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1750/04/00 HB AN 0020 M. Carre I Zwey sehr schöne Landschaften mit Viehe, von M. Carre. I Diese Nr.: Eine sehr schöne Landschaft mit Viehe Anm.: Die Lose 19 und 20 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1759/00/00 LZEBT 0032 Carre I Eine Landschaft mit Vieh auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 3 Schuh 7 Zoll, Breite 2 Schuh 10 Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (250 Th für die Nrn. 32 und 33, Schätzung) 1759/00/00 LZEBT 0033 Carre I Eine dergleichen [Landschaft mit Vieh] auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 3 Schuh 7 Zoll, Breite 2 Schuh 10 Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (250 Th für die Nm. 32 und 33, Schätzung) 1763/11/09 FRJUN 0045 M. Carre I Un tres beau Päisage dans le quel le Berger defend les brebis contre le loup, parfaitement peint. I Maße: hauteur 24 Vi pouces, largeur 32 pouces Transakt.: Verkauft (19.15 fl) Käufer: Dick 1764/03/12 FRKAL 0025 Carre I Un beau pai'sage, ού Γ on voit une bergere tenant un Agneau dans les bras, pres d'elle quelques moutons, Boucs vaches marchant dans l'eau pour boire tres bien peint. I Maße: hauteur 37 pouces, largeur 44 pouces Transakt.: Unbekannt 1764/03/12 FRKAL 0026 Carre I Un pareil representant sur le devant un berger qui se repose, & plusieurs animaux pas moins bien peint que le precedent & de la meme grandeur. I Maße: hauteur 37 pouces, largeur 44 pouces Transakt.: Unbekannt 1765/03/27 FRKAL 0035 Carre I Un süperbe pai'sage orne des bestiaux tres-bien peint & dans son meilleur tems. I Maße: hauteur 16 Vi pouces, largeur 20 Vi pouces Transakt. : Verkauft (11 fl) Käufer: Kaller 1765/03/27 FRKAL 0036 Carre I Deux paisages avec des animaux bien peints. I Maße: hauteur 18 pouces, largeur 20 pouces Transakt.: Verkauft (15.15 fl) Käufer: Hoch 1766/07/28 KOSTE [A]0018 Mr. Carre I Ein stück auf leinwand, worauf Viehe mit einer Frauen so einen Korb traget von Mr. Carre. I Mat.: auf Leinwand Transakt.: Unbekannt (15 Rt) 1774/10/05 HBNEU 0083 Michel Carre I Zwo Landschaften, mit Vieh. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 83 und 84 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1774/10/05 HBNEU 0084 Michel Carre I Zwo Landschaften, mit Vieh. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 83 und 84 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1775/00/00 BLAN 0046 Carre I Zwey Viehstücke in golden Rahm. I Verkäufer: George Friedrich Schmidt Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
445
1775/05/08 HBPLK 0027 Μ. Carre I Zwo Arcadische Landschaften mit Rinder und Schaafe, auf Leinewand, besonders lebhaft gemahlt. I Diese Nr.: Eine Arcadische Landschaft mit Rinder und Schaafe Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 13 Zoll 11 Linie, Breite 17 Zoll 6 Linie Anm.: Die Lose 27 und 28 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] Μ für die Nrn. 27 und 28) 1775/05/08 HBPLK 0028 M. Carre I Zwo Arcadische Landschaften mit Rinder und Schaafe, auf Leinewand, besonders lebhaft gemahlt. I Diese Nr.: Eine Arcadische Landschaft mit Rinder und Schaafe Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 13 Zoll 11 Linie, Breite 17 Zoll 6 Linie Anm.: Die Lose 27 und 28 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] Μ für die Nrn. 27 und 28) 1775/10/07 HBBMN akt.: Unbekannt
0004
M. Caree I Ein Vieh=Stück. I Trans-
1776/04/15 HBBMN 0161 Michael Carre I Eine Landschaft. I Maße: Höhe 8 Zoll, Breite 10 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (8 M) Käufer: Köst[er] 1776/06/21 HBNEU 0037 M. Carrie I Zwey Schafe in einer plaisanten Landschaft, auf dito [Leinw.]. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 F, Breite 1 F 4 Ζ Transakt.: Unbekannt 1776/06/28 HBBMN 0002 M. Carrie I Zwo Arcadische Landschaften mit Rinder und Schaafe, ausführlich gemahlt, auf Leinewand. I Diese Nr.: Eine Arcadische Landschaft mit Rinder und Schaafe, ausführlich gemahlt Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 9 Zoll, Breite 2 Fuß 1 Vi Zoll Anm.: Die Lose 2 und 3 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Carre, auf Leinwand. [Diese Gemähide sind alle mittlere Grösse, können also an alle Plätze gebraucht werden - dieweilen keine Theilen=Stück, dabey befindlich] I Diese Nr.: Ein Hirtenstück mit Rinder und Schaafe Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 25 und 26 wurden zusammen katalogisiert. Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 150 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 150. Verkäufer: Dr Friederici Transakt.: Verkauft (35 Μ für die Nrn. 25 und 26) Käufer: Loffhagen 1778/07/11 HBTEX 0062 Mich. Carre I Zwey rare Landschaften mit Vieh. I Diese Nr.: Eine rare Landschaft mit Vieh Anm.: Die Lose 62 und 63 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/07/11 HBTEX 0063 Mich. Carre I Zwey rare Landschaften mit Vieh. I Diese Nr.: Eine rare Landschaft mit Vieh Anm.: Die Lose 62 und 63 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/07/11 HBTEX 0072 Mich. Carre I Eine Landschaft mit Vieh. I Transakt.: Unbekannt 1778/08/29 HBTEX 0010 Carre I Zwo Landschaften mit Figuren und Vieh, sehr fleißig gemahlt, von Carre, so gut wie Berghem. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren und Vieh Maße: Höhe 1 Fuß 11 Zoll, Breite 2 Fuß 6 Zoll Anm.: Die Lose 10 und 11 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (10-18 Μ Schätzung) 1778/08/29 HBTEX 0011 Carre I Zwo Landschaften mit Figuren und Vieh, sehr fleißig gemahlt, von Carre, so gut wie Berghem. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren und Vieh Maße: Höhe 1 Fuß 11 Zoll, Breite 2 Fuß 6 Zoll Anm.: Die Lose 10 und 11 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (10-18 Μ Schätzung)
1776/06/28 HBBMN 0003 M. Carrie I Zwo Arcadische Landschaften mit Rinder und Schaafe, ausführlich gemahlt, auf Leinewand. I Diese Nr.: Eine Arcadische Landschaft mit Rinder und Schaafe, ausführlich gemahlt Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 9 Zoll, Breite 2 Fuß 1 Vi Zoll Anm.: Die Lose 2 und 3 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1778/08/29 HBTEX 0016 Carre I Zwey Landschaften von der ersten und feinsten Mahlerey. I Diese Nr.: Eine Landschaft von der ersten und feinsten Mahlerey Maße: Höhe 1 Fuß 9 Zoll, Breite 2 Fuß Anm.: Die Lose 16 und 17 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1776/06/28 HBBMN 0014 M. Carree I Eine Arcadische Landschaft mit Hirten, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Fuß 2 Vi Zoll, Breite 2 Fuß 8 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt
1778/08/29 HBTEX 0017 Carre I Zwey Landschaften von der ersten und feinsten Mahlerey. I Diese Nr.: Eine Landschaft von der ersten und feinsten Mahlerey Maße: Höhe 1 Fuß 9 Zoll, Breite 2 Fuß Anm.: Die Lose 16 und 17 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1776/12/21 HBBMN 0059 M. Carre I Zwey Arkadische Landschaften mit Rinder und Schafen, auf Leinewand. I Diese Nr.: Eine Arkadische Landschaft mit Rinder und Schafen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 1 Fuß 2 Zoll, breit 1 Fuß 5 Vi Zoll Anm.: Die Lose 59 und 60 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (15.12 M) Käufer: Ehrenreich 1776/12/21 HBBMN 0060 M. Carre I Zwey Arkadische Landschaften mit Rinder und Schafen, auf Leinewand. I Diese Nr.: Eine Arkadische Landschaft mit Rinder und Schafen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 1 Fuß 2 Zoll, breit 1 Fuß 5 Vi Zoll Anm.: Die Lose 59 und 60 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (15.12 M) Käufer: Ehrenreich 1777/04/11 Unbekannt
HBNEU
0077
Carree I Ein Viehstück. I Transakt.:
1778/05/30 HBKOS 0025 M. Carre I Zwey Hirtenstücke mit Rinder und Schaafe, plaisante Gegenden, von der besten Zeit des M. Carre, auf Leinwand. [Diese Gemähide sind alle mittlere Grösse, können also an alle Plätze gebraucht werden - dieweilen keine Theilen=Stück, dabey befindlich] I Diese Nr.: Ein Hirtenstück mit Rinder und Schaafe Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 25 und 26 wurden zusammen katalogisiert. Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 150 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 150. Verkäufer: Dr Friederici Transakt.: Verkauft (35 Μ für die Nrn. 25 und 26) Käufer: Loffhagen 1778/05/30 HBKOS 0026 M. Carre I Zwey Hirtenstücke mit Rinder und Schaafe, plaisante Gegenden, von der besten Zeit des M. 446
GEMÄLDE
1778/10/23 HBKOS 0016 M. Carre I Ein Hirten=Stück, plaisant gemahlt, auf dito [Leinwand]. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 31 Zoll, breit 27 Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/10/23 HBKOS 0040 Michel Carree I Zwey arcadische Landschaften, mit Hirten, Rindern und Schaafen, meisterhaft gemahlt, von Michel Carree, auf dito [Leinwand]. I Diese Nr.: Eine arcadische Landschaft, mit Hirten, Rindern und Schaafen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 24 Zoll, breit 30 Zoll Anm.: Die Lose 40 und 41 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/10/23 HBKOS 0041 Michel Carree I Zwey arcadische Landschaften, mit Hirten, Rindern und Schaafen, meisterhaft gemahlt, von Michel Carree, auf dito [Leinwand]. I Diese Nr.: Eine arcadische Landschaft, mit Hirten, Rindern und Schaafen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 24 Zoll, breit 30 Zoll Anm.: Die Lose 40 und 41 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/10/30 HBKOS 0073 M. Carre I Eine Landschaft mit einem Bock und Schaaf, extra schön gemahlt, auf Holz, von M. Carre seiner besten Zeit. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 8 Vi Zoll, breit 11 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1779/09/27 FRNGL 0701 Carre I Der heilige Hyronimus, ein schönes Nachtstück. [S. Jerome, une nuit, belle piece.] I Maße: 6 Zoll hoch, 4 Zoll breit Transakt.: Verkauft (2 fl) Käufer: Mevius 1781/09/10 BNAN 0064 M. Caar I Eine Hirtin lehnet sich auf einen Stein unter einer Eiche; vor ihr einige Schafe; von M. Caar.
g.R. [im verguldeten Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: 7 Zoll hoch, 7 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1782/07/00 FRAN 0090 Carre I Ein Hieronymus, mit einem Buch auf dem Schoos, bey Nacht. I Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 1 Schuh 1 Zoll breit Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] fl) 1782/08/21 HBKOS 0055 M. Caree I Zwey Arcadische Landgegenden mit Hirten, Rinder und Schaafen, auf L. von großer Ordonence und fleißig gemahlt auf Leinw. von M. Caree. I Diese Nr.: Eine Arcadische Landgegend mit Hirten, Rinder und Schaafen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 28 Zoll 6 Linien, breit 32 Zoll 9 Linien Anm.: Die Lose 55 und 56 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Moddermann Transakt.: Verkauft (15 Μ für die Nrn. 55 und 56) Käufer: Ehrenreich 1782/08/21 HBKOS 0056 M. Caree I Zwey Arcadische Landgegenden mit Hirten, Rinder und Schaafen, auf L. von großer Ordonence und fleißig gemahlt auf Leinw. von M. Caree. I Diese Nr.: Eine Arcadische Landgegend mit Hirten, Rinder und Schaafen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 28 Zoll 6 Linien, breit 32 Zoll 9 Linien Anm.: Die Lose 55 und 56 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Moddermann Transakt.: Verkauft (15 Μ für die Nrn. 55 und 56) Käufer: Ehrenreich 1782/08/21 HBKOS 0057 M. Caree I Zwey dergleichen Stücke [Arcadische Landgegenden mit Hirten, Rinder und Schaafen], allwo auf dem einen ein Ochs wild geworden , auf Leinwand, von M. Caree, gleicher Größe. I Diese Nr.: Eine Arcadische Landgegend mit Hirten, Rinder und Schaafen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 28 Zoll 6 Linien, breit 32 Zoll 9 Linien Anm.: Die Lose 57 und 58 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Moddermann Transakt.: Verkauft (16 Μ für die Nrn. 57 und 58) Käufer: Ehrenreich 1782/08/21 HBKOS 0058 M. Caree I Zwey dergleichen Stücke [Arcadische Landgegenden mit Hirten, Rinder und Schaafen], allwo auf dem einen ein Ochs wild geworden , auf Leinwand, von M. Caree, gleicher Größe. I Diese Nr.: Eine Arcadische Landgegend mit Hirten, Rinder und Schaafen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 28 Zoll 6 Linien, breit 32 Zoll 9 Linien Anm.: Die Lose 57 und 58 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Moddermann Transakt.: Verkauft (16 Μ für die Nrn. 57 und 58) Käufer: Ehrenreich 1782/09/30 FRAN 0162 Michael Carre I Ein schön ausgeführtes Viehstück. [Une tres belle piece representante du betail, par Michel Carre.] I Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 1 Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (19.30 fl) Käufer: Grahe 1784/08/02 FRNGL 0501 IM. Carrie I Eine meisterhafte Landschaft mit sehr fleißig ausgeführten Vieh. I Maße: 18 Zoll breit, 14 Vi Zoll hoch Transakt.: Verkauft (4 fl) Käufer: Reinhardt 1785/05/17 MZAN 0186 Michael Carre I Ein paar Landschaften mit Vieh von Michael Carre. [Deux paysages avec du betail.] I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Vieh Maße: 1 Schuh 5 Zoll hoch, 1 Schuh 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 186 und 187 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (51 fl für die Nm. 186 und 187) Käufer: Geh Rath ν Heüser 1785/05/17 MZAN 0187 Michael Carrel Ein paar Landschaften mit Vieh von Michael Carre. [Deux paysages avec du betail.] I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Vieh Maße: 1 Schuh 5 Zoll hoch, 1 Schuh 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 186 und 187 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (51 fl für die Nrn. 186 und 187) Käufer: Geh Rath ν Heüser 1785/12/03 HBBMN 0050 Michael Carre I Zwey Stück Landschaften mit Vieh und Figuren. I Diese Nr.: Ein Stück Landschaften mit Vieh und Figuren Anm.: Die Lose 50 und 51 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1785/12/03 HBBMN 0051 Michael Carre I Zwey Stück Landschaften mit Vieh und Figuren. I Diese Nr.: Ein Stück Landschaften mit Vieh und Figuren Anm.: Die Lose 50 und 51 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1787/00/00 HB AN 0599 M. Carre I Zwey Stück mit Ziegen, welche sich auf den mit Kräutern bewachsenem Vordergrunde befinden. Im Hintergrunde waldigte Landschaften. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Diese Nr.: Ein Stück mit Ziegen, welche sich auf den mit Kräutern bewachsenem Vordergrunde befinden. Im Hintergrunde eine waldigte Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 7 Ά Zoll, breit 6 V* Zoll Anm.: Die Lose 599 und 600 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (5 Μ für die Nrn. 599 und 600) Käufer: Hagel 1787/00/00 HB AN 0600 M. Carre I Zwey Stück mit Ziegen, welche sich auf den mit Kräutern bewachsenem Vordergrunde befinden. Im Hintergrunde waldigte Landschaften. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Diese Nr.: Ein Stück mit Ziegen, welche sich auf den mit Kräutern bewachsenem Vordergrunde befinden. Im Hintergrunde eine waldigte Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 7 14 Zoll, breit 6 Vi Zoll Anm.: Die Lose 599 und 600 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (5 Μ für die Nm. 599 und 600) Käufer: Hagel 1787/00/00 HB AN 0692 Michael Carre I Etliche Stiere und Schaafe weiden neben einer bemooßten Anhöhe und etlichen Bäumen im Vordergrunde bey Sonnen=Untergang. Verschiedene Stiere und Schaafe gehen im Vordergründe durch ein Wasser, angenehme bedünstete Berge schließen die Aussicht. Meisterhaft und plaisant gemahlt. A.H. [Auf Holz] g.R. [in goldenem Rahm] I Diese Nr.: Etliche Stiere und Schaafe weiden neben einer bemooßten Anhöhe Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Zoll, breit 13 Zoll Anm.: Die Lose 692 und 693 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (20 Μ für die Nrn. 692 und 693) Käufer: Berth[eau] 1787/00/00 HB AN 0693 Michael Carre I Etliche Stiere und Schaafe weiden neben einer bemooßten Anhöhe und etlichen Bäumen im Vordergrunde bey Sonnen=Untergang. Verschiedene Stiere und Schaafe gehen im Vordergrunde durch ein Wasser, angenehme bedünstete Berge schließen die Aussicht. Meisterhaft und plaisant gemahlt. A.H. [Auf Holz] g.R. [in goldenem Rahm] I Diese Nr.: Verschiedene Stiere und Schaafe gehen im Vordergrunde durch ein Wasser Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Zoll, breit 13 Zoll Anm.: Die Lose 692 und 693 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (20 Μ für die Nrn. 692 und 693) Käufer: Berth[eau] 1788/06/12 HBRMS 0002 Mich. Carre I Zwey gebürgichte italienische Landschaften mit Hirten, Rindern und Schaafen. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Eine gebürgichte italienische Landschaft Mai..· auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll, breit 28 Zoll Anm.: Die Lose 2 und 3 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1788/06/12 HBRMS 0003 Mich. Carre I Zwey gebürgichte italienische Landschaften mit Hirten, Rindern und Schaafen. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Eine gebürgichte italienische Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll, breit 28 Zoll Anm.: Die Lose 2 und 3 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1790/04/13 HBLIE 0102 Mich. Carree I Hirten treiben ihre Herde, durch Gebürge im Vordergrunde, bey Untergang der Sonnen; wie Berghem. Auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 29 Zoll, breit 16 Zoll Transakt.: Verkauft (6.8 M) Käufer: Eckhardt 1790/04/13 HBLIE 0115 M. Carree I Hirten mit Schaafen und Ziegen ec. Auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 10 Zoll, breit 13 Zoll Transakt.: Verkauft (13 Sch) 1790/08/25 FRAN 0104 Carre I Zwey Landschaften mit Vieh und Figuren. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Vieh und Figuren Maße: hoch 17 Zoll, breit 20 Zoll Anm.: Die Lose 104 und 105 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (3 fl für die Nrn. 104 und 105) Käufer: Kaller GEMÄLDE
447
1790/08/25 FRAN 0105 Carre I Zwey Landschaften mit Vieh und Figuren. I Diese Nr. : Eine Landschaft mit Vieh und Figuren Maße: hoch 17 Zoll, breit 20 Zoll Anm.: Die Lose 104 und 105 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (3 fl für die Nrn. 104 und 105) Käufer: Kaller 1790/08/25 FRAN 0285 Michel de Carri I Zwey Landschaften mit Vieh und Figuren. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Vieh und Figuren Maße: hoch 16 Zoll, breit 19 Zoll Anm.: Die Lose 285 und 286 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (10 fl für die Nrn. 285 und 286) Käufer: Kaller 1790/08/25 FRAN 0286 Michel de Carre I Zwey Landschaften mit Vieh und Figuren. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Vieh und Figuren Maße: hoch 16 Zoll, breit 19 Zoll Anm.: Die Lose 285 und 286 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (10 fl für die Nrn. 285 und 286) Käufer: Kaller 1790/08/25 FRAN 0402 Carre I Eine italiänische Landschaft mit Vieh und Figuren. I Maße: hoch 26 Zoll, breit 31 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (6.15 fl) Käufer: Hüsgen 1791/01/15 LZRST 2872 M. Carre I Eine Landschaft mit einem ländlichen Feste, und schön gemahlten Kühen, Ochsen und Ziegen, die Hirtin hält einen Kranz in die Höhe, vor ihr drey nackende Kinder, einer mit einem Tamburin, einer mit der Pfeiffe, und einer spielt mit einer Ziege. In der Ferne hauen einige Bauern Getreyde, von M. Carre auf Leinwand, 29 Zoll breit, 22 Zoll hoch, in schwarzem Rahm mit goldener Leiste. I Mat.: auf Leinwand Maße: 29 Zoll breit, 22 Zoll hoch Anm.: Die Abürzung St. z. steht als Überschrift über der Losnummer und verweist wahrscheinlich auf den Einlieferer. Verkäufer: St ζ Transakt.: Unbekannt (2.1 Th) 1792/07/05 LBKIP 0098 Transakt.: Unbekannt
Carre I Ein Viehstück von Carre. I
1793/06/07 HBBMN 0182 Carre I Einige Rinder und Schaafe mit Hirten und Hirtinnen, in einer bergigten Landgegend mit fließenden Wasser, von der besten Zeit. Auf Leinw., von Carre. I Diese Nr.: Einige Rinder und Schaafe mit Hirten und Hirtinnen, in einer bergigten Landgegend mit fließenden Wasser Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 13 Zoll 6 Lin., breit 18 Zoll Anm.: Die Lose 182 und 183 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0183 Carre I Einige Rinder und Schaafe mit Hirten und Hirtinnen, in einer bergigten Landgegend mit fließenden Wasser, von der besten Zeit. Auf Leinw., von Carre. I Diese Nr.: Einige Rinder und Schaafe mit Hirten und Hirtinnen, in einer bergigten Landgegend mit fließenden Wasser Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 13 Zoll 6 Lin., breit 18 Zoll Anm.: Die Lose 182 und 183 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/09 HBPAK 0064 I. M. Came I Die Verkündigung der Hirten auf dem Felde. Auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 22 Zoll, breit 20 Zoll Transakt.: Unbekannt
1796/12/07 HBPAK 0103 M. Caree I Zwey Landschaften mit Vieh und Figuren. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Vieh und Figuren Anm.: Die Lose 102 und 103 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0217 M. Care I Eine Landschaft mit Architektur und Figuren. I Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0148 Michael Carre I Eine Flucht von Widdern in einer Landschaft; von diesem Meister aufs vollkommenste gemahlt. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 16 Zoll, breit 19 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/08/10 HBPAK 0054 M. Carre I Eine Landschaft mit Ochsen, Schaafen, Ziegen ec. Gut gemahlt. Auf Leinwand, im schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 22 Zoll, breit 26 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/08/10 HBPAK 0087 M. Caree I Zwey Stücke mit Ochsen und Schaafen. Sehr gut gemahlt. Auf Leinwand, im schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein Stück mit Ochsen und Schaafen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 12 Zoll, breit 8 Zoll Anm.: Die Lose 87 und 88 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/08/10 HBPAK 0088 M. Caree I Zwey Stücke mit Ochsen und Schaafen. Sehr gut gemahlt. Auf Leinwand, im schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein Stück mit Ochsen und Schaafen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 12 Zoll, breit 8 Zoll Anm.: Die Lose 87 und 88 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/11/14 HBPAK 0037 M. Care I Eine waldigte Landgegend; wo ein Hirte auf einem Maulthiere sitzet und die Flöte spielt, zur Linken die Schäferin mit einem Schaafe, welches sie unterm Arm hält, und treibet ihr Vieh aus dem Walde nach der Landstrasse. Gut gemahlt. Auf Leinwand, im schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 20 Zoll, breit 26 Zoll Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0018 Corree I Ein Stück mit Federvieh, und einen spanischen Hund. I Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0445 M. Caree I Zwey Stücke mit Hirten und Schaafen. I Transakt.: Unbekannt
Carree, Michiel (Kopie nach) 1775/11/18 HBBMN 0029 Carre I Eine Landschaft mit Vieh, nach Carre. I Transakt.: Unbekannt
Carree, Michiel (Manier) 1776/04/15 HBBMN 0010 Carre I Eine Landschaft mit Vieh, in der Manier von Carre. I Pendant zu Nr. 25 von Anonym Maße: Höhe 1 Fuß 7 Zoll, Breite 1 Fuß 2 Zoll Transakt.: Verkauft (2.12 M) Käufer: Leck
1796/10/17 HBPAK 0060 M. Carre I Ein Stier mit Schaafe. Sehr gut und fleißig gemahlt. Auf Holz. Schwarzer Rahm mit goldnen Leisten. I Pendant zu Nr. 76 Mat.: auf Holz Maße: Hoch 14 Zoll, breit 12 Zoll Transakt.: Unbekannt
1784/09/27 FRAN 0035 Cam I Zwey kleine Viehstücke von einem Französischen Meister, in der Manier von Carrä. [Deux petites pieces representantes du betail, par un Maitre Francois, dans le goüt de Carre.] I Maße: 7 Zoll hoch, 9 Zoll breit Verkäufer: Freyherr von Berberich Transakt.: Verkauft (5.45 fl) Käufer: Berger
1796/10/17 HBPAK 0076 Von M. Carre I Ein Stück mit alten Gebäuden, im Vordergrunde einige Schaafe; gehört zu No. 60. Sehr gut gemahlt. Auf Holz. Schwarzer Rahm mit goldnen Leisten. I Pendant zu Nr. 60 Mat.: auf Holz Maße: Hoch 14 Zoll, breit 12 Zoll Transakt.: Unbekannt
Carriera, Rosalba
1796/12/07 HBPAK 0102 M. Caree I Zwey Landschaften mit Vieh und Figuren. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Vieh und Figuren Anm.: Die Lose 102 und 103 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 448
GEMÄLDE
1764/05/14 BOAN 0128 Rosalba Carera I Les quatres Saisons ä demi figures de grandeur naturelle de deux pieds de hauteur, d'un pied cinq pouces de largeur, peintes par Rosalba Carera. [Die Vier jahrs Zeiten halbe figuren Von Rosalba Carera.] I Diese Nr.: Une des quatre Saisons Maße: 2 pieds de hauteur, d'un pied 5 pouces de largeur Anm.: Die Lose 128 bis 131 wurden zusammen katalogisiert.
Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (252 Rt für die Nrn. 128-131) Käufer: Neveu 1764/05/14 BOAN 0129 Rosalba Carera I Les quatres Saisons ä demi figures de grandeur naturelle de deux pieds de hauteur, d'un pied cinq pouces de largeur, peintes par Rosalba Carera. [Die Vier jahrs Zeiten halbe figuren Von Rosalba Carera.] I Diese Nr.: Une des quatre Saisons Maße: 2 pieds de hauteur, d'un pied 5 pouces de largeur Anm.: Die Lose 128 bis 131 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (252 Rt für die Nrn. 128-131) Käufer: Neveu 1764/05/14 BOAN 0130 Rosalba Carera I Les quatres Saisons ä demi figures de grandeur naturelle de deux pieds de hauteur, d'un pied cinq pouces de largeur, peintes par Rosalba Carera. [Die Vier jahrs Zeiten halbe figuren Von Rosalba Carera.] I Diese Nr.: Une des quatre Saisons Maße: 2 pieds de hauteur, d'un pied 5 pouces de largeur Anm.: Die Lose 128 bis 131 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (252 Rt für die Nm. 128-131) Käufer: Neveu 1764/05/14 BOAN 0131 Rosalba Carera I Les quatres Saisons ä demi figures de grandeur naturelle de deux pieds de hauteur, d'un pied cinq pouces de largeur, peintes par Rosalba Carera. [Die Vier jahrs Zeiten halbe figuren Von Rosalba Carera.] I Diese Nr.: Une des quatre Saisons Maße: 2 pieds de hauteur, d'un pied 5 pouces de largeur Anm.: Die Lose 128 bis 131 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (252 Rt für die Nm. 128-131) Käufer: Neveu 1764/05/21 BOAN 0515 Rosalba Carara I Deux Pieces representantes des Filles avec des chapeaux de paille peintes en miniature par Rosalba Carara. [Zwey stück Vorstellend mägdlein mit strohhuth gemahlt in miniatur Von Rosalba Carera.] I Maße: 4 pouces de hauteur & 3 pouces de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (12 Rt) Käufer: Neveu 1764/05/21 BOAN 0516 Rosalba Carera I Une Piece representante une Fille avec des fleurs peintes en miniature par Rosalba Carera. [Ein stück Vorstellend ein mägdlein mit blumen gemahlt in miniatur Von Rosalba Carera.] I Maße: 3 pouces de hauteur & 3 pouces de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (8.10 Rt) Käufer: Neveu 1764/05/21 BOAN 0517 Rosalba Carera I Deux Pieces representantes deux Portraits peints en miniature par Rosalba Carara. [Zwey stück Vorstellend portrait gemahlt in miniatur Von Rosalba Carera.] I Maße: 3 pouces de hauteur, 2 pouces de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (14 Rt) Käufer: Neveu 1764/05/21 BOAN 0518 Rasalba Carera I Deux Pieces reprisentantes l'une un Oiseau noir, l'autre un Hibou, peints par Rasalba Carera en miniature. [Zwey stück Vorstellend eins ein portrait mit Einem schwartzen Vogel, und andertes mit Einer Eulen Von Rosalba Carera gemahlt.] I Maße: 3 pouces de hauteur & 2 pouces de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (14.20 Rt) Käufer: Neveu 1774/08/13 HBBMN Transakt.: Unbekannt
0154
Rosalba I Ein schlafendes Kind. I
1784/08/02 FRNGL 0038 Mad. Rosalba I Das Bildniß des Landschaften=Mahlers Agricola, von Mad. Rosalba, fleißig ausgearbeitet. I Maße: 11 Vi Zoll breit, 16 Zoll hoch Verkäufer: Α Transakt.: Verkauft (30 Kr) Käufer: von Schmidt
Carteaux, Jean-Baptiste Frangois 1800/06/03 BLAN 0003 Cartau I Friedrich Wilhelm II König von Preußen zu Pferde über Naturgröße, in Oel auf Leinwand, ist nicht fertig. I Mat.: Öl auf Leinwand Maße: Höhe 156 Zoll, Breite 108 Zoll Transakt.: Zurückgezogen
Casanova, Francesco Giuseppe 1781/00/00 WRAN 0201 Casanova I Paysage, oü se voit un Homme, un baton ä la main, & une besace sur le dos, qui mene devant lui un Cheval & un troupeau de Moutons, allant de la droite du Tableau sur la gauche, ä son cöte son Chien, & plus loin un Rocher qui remplit toute la gauche. Peint sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: haut 6 pouces 6 lignes Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0202 Casanova I Idem [Paysage], oü se voit ä droite un Horame ä cheval, tenant un autre tout seile ä l'abreuvoir, ä gauche un Homme & une Femme assis, & derriere eux un Chien, au fond de la droite est un grand Rocher. Tableau peint sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: haut 6 pouces 2 lignes, large 5 pouces Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0203 Casanova I Idem [Paysage], oü se voit une quantite de grands Rochers, ä droite un Homme ä cheval mene plusieurs autres Chevaux charges, au milieu un Chien qui passe l'eau, ä gauche un Homme ä cheval qui mene aussi un charge, parlant ä une Femme qui a un panier ä son bras gauche, & une verge ä sa main droite, trois Moutons & une Chevre autour d'elle, en haut de la gauche, sur un Rocher une Femme assise & un Homme appuye sur le derriere du Boeuf, qui est ä cöte d'eux, ainsi qu'une Chevre & un Mouton. [Tableaux capitaux & d'un beau coloris, peints sur toile.] I Pendant zu Nr. 204 Mat.: auf Leinwand Maße: 28 pouces de haut, sur 43 pouces de largeur Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter Nr. 204 und beziehen sich auf die Nrn. 203 und 204. Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0204 Casanova I Idem [Paysage], pendant, au milieu une Femme assise derriere trois Moutons, & devant eile une Chfevre regardant deux Hommes, in ä Cheval, avec qui eile semble avoir une conversation, l'autre arrange la seile du sien, la gauche est terminee par deux arbres. Tableaux capitaux et d'un beau coloris, peints sur toile. I Pendant zu Nr. 203 Mat.: auf Leinwand Maße: 28 pouces de haut, sur 43 pouces de largeur Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0295 Casanova I Une Femme la baguette ä la main, & une besace derriere le dos, menant une Vache & son Veau, & trois gros Moutons, allant contre la gauche. Tableau peint sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: haut 4 pouces 10 lignes, large 6 pouces 7 lignes Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1791/09/21 FRAN 0105 Casanova I Ein Stück, so eine Schlacht vorstellet, wo vornen Reiter sind, die sich auf den Säbel schlagen, der Grund bietet einen zahlreichen Haufen Truppen dar, so eine Schlacht liefern, zur Rechten ist eine Stadt; es ist ungezwungen und mit Hitze gemalt. I Pendant zu Nr. 106 Transakt.: Verkauft (60 fl) Käufer: Trautman 1791/09/21 FRAN 0106 Casanova I Der Compagnon. Ein gleiches Bataillestück und ist ebenfalls mit vielem Fleiß und Hitze gemalt. I Pendant zu Nr. 105 Transakt.: Verkauft (35.15 fl) Käufer: Wüste 1791/09/21 FRAN 0127 Casanova I Eine kleine Landschaft, wo zur Linken ein junger Schäfer auf einem Baumstock sitzet und vor him sind verschiedene Thiere; das Ganze ist mit vielem Verstände und mit vieler Stärke ausgeführt. I Transakt.: Verkauft (41.15 fl) Käufer: Trautmann 1793/00/00 NGWID 0060 Cassa nova I Eine angenehme Abenddämmerung einer sanften Landschaft von Cassa nova. I Pendant zu Nr. 61 Maße: 2 Schuh 8 Zoll hoch, 3 Schuh 5 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0061 Cassa nova I Zum Gegenstück eine reisende Caravane, welche von einem nahen Gewitter gehemmt GEMÄLDE
449
wird, ihre Reise fortzusetzen, vom nemlichen Meister [Cassa nova] und Maaß. I Pendant zu Nr. 60 Maße: 2 Schuh 8 Zoll hoch, 3 Schuh 5 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1798/01/19 HBPAK [A]0001 Casanova I Eine Jagd, von Casanova; ein grosses vortrefliches Gemähide. Ein Hirsch wird von Jägern zu Pferde und einer Menge Hunde verfolgt. Die Landschaft ist vorzüglich schön, gut gehalten, und der Himmel zeigt einen heitern Abend. I Pendant zu Nr. [A]2 Maße: 4 Fuß 10 Zoll hoch, 7 Fuß 4 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
zeigte sich ein welscher Hahn in Lebensgröße, eine Gans ein Haasenkühlein, ein Hahn und alles in beßter Wendung, beynebst zeiget sich ein umgeworfener Korb; und diese Art von Malerey, machet eine vortrefliche Wirkung, und und drücker die Natur auf das verständigste aus, und die hiebey so leichte Pinsel, und das wohl verstandene Licht und Schatten setzen dieses Stücke in einen wohlverdienten Ruhm der Malerey. I Pendant zu Nr. 91 Maße: 3 Schuhe 10 Zoll hoch, 5 Schuhe 3 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (50 fl Schätzung)
1798/01/19 HBPAK [A]0002 Casanova I Ein Pendant zu dem vorigen [Al], von demselben Meister [Casanova]. Die Jagd verfolgt einen wüthenden Eber. Die Landschaft ist eben so schön, und in demselben Ton gemahlt. Gleicher Grösse. I Pendant zu Nr. [A]l Maße: 4 Fuß 10 Zoll hoch, 7 Fuß 4 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
1776/00/00 WZTRU 0091 Johann Augustin Cassani, genannt der Abbt I Compagnion zu Nro. 90 von gleicher Stärke und Gusto des nämlichen Meisters verfertiget [Johann Augustin Cassani]. I Pendant zu Nr. 90 Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (50 fl Schätzung)
1799/00/00 LZRCH 0081 Cazanova I Un bataille, oü l'on remarque une choc terrible sur le devant; plus loin ä gauche, une masse d'arbre, ä la droite on decouvre au lointain, une marche d'armee; ce tableau est d'un ton tres lumineux par l'effet du soleil et d'un beau ciel. I Mat.: auf Leinwand Maße: h. 40.1. 50. pouces Verkäufer: J F Rauch Transakt.: Unbekannt
1781/00/00 WZAN 0090 Johann Augustin Cassani, der Abbt genannt I Ein Oekonomiestück 3 Schuhe, 10 Zoll hoch, 5 Schuhe, 3 Zoll breit von Johann Augustin Cassani, der Abbt genannt: hierauf zeigt sich ein welscher Hahn in natürlicher Größe, eine Gans, ein Kanninchen, ein anderer Hahn und alles in beßter Wendung, beynebst zeigt sich ein umgeworfener Korb; und diese Art von Malerey machet eine vortrefliche Wirkung, und drucket die Natur auf das verständigste aus, und der hiebey so leichte Pinsel, auch das wohl verstandene Licht sammt dem Schatten setzen dieses Stück in einen wohlverdienten Ruhm der Malerey. I Pendant zu Nr. 91 Maße: 3 Schuhe 10 Zoll hoch, 5 Schuhe 3 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
1799/00/00 LZRCH 0082 Cazanova I Un sujet de camp. I Mat.: auf Leinwand Maße: h. 20.1. 15. pouces Verkäufer: J F Rauch Transakt.: Unbekannt
Casanova, Giovanni Battista 1793/00/00 HBMFD 0023 Casanova von Dresden. [Fußnote: Jetziger Directeur des Maler-Academie zu Dresden] I Ganze Figuren halbnatürliche Grösse. Venus hält den Adonis zurück, der bereit ist auf die Jacht zu gehen; er führt einen Hund und zwey Pfeile mit sich. Neben der Göttin befindet sich Cupydo, der an einem doppelten Faden zwey Tauben hält, die auf dem Stamme eines grossen Baumes sitzen. Dieses Gemälde ist durchgängig gut gezeichnet und ausgeführt, von einem ausserordentlich frischen Colorite, und besonders gefallig. Die Gemälde des Casanova sind sehr theuer [Fußnote: Der Besitzer hat dieses Gemälde vom Maler selbst, in Dresden gekauft, und obgleich er sein Freund war - mit einer ansehnlichen Summa bezahlt.] und höchst selten, weil er so wenig malt. Er ist der beste Schüler des großen Mengs. Casanova hat sich von jeher sehr beflissen, dieses Künstlers Colorit nachzuahmen. I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuss 10 Zoll hoch, 3 Fuss 4 Zoll breit Verkäufer: Pierre Laporterie Transakt.: Unbekannt
1781/00/00 WZAN 0091 Johann Augustin Cassani, der Abbt genannt I Kompagnon zu Nro 90, von gleicher Stärke und Gusto des nämlichen Meisters [Johann Augustin Cassani, der Abbt genannt] verfertiget. I Pendant zu Nr. 90 Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0376 Joh. Augustin Cassani I Ein welsches Huhn nebst mehrerem Federviehe, von Joh. Augustin Cassani. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh 10 Zoll breit 2 Schuh 6 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0377 Joh. August. Cassani I Zwey Kaninchen nebst Federviehe, von Joh. August. Cassani. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh 1 Zoll breit 2 Schuh 6 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Cassana, Niccolo Casio [Nicht identifiziert] 1766/07/28 KOSTE 0162 Casio I Zwey alte grosse Landschaften auf Leinentuch von Casio. I Mat.: auf Leinwand Transakt.: Unbekannt (6 Rt)
Cassana 1774/10/05 HB NEU 0059 Caffano I Zwo Landschaften, mit wilden und zahmen Thieren. I Diese Nr.: Eine Landschaft, mit wilden und zahmen Thieren Anm.: Die Lose 59 und 60 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1774/10/05 HBNEU 0060 Caffano I Zwo Landschaften, mit wilden und zahmen Thieren. I Diese Nr.: Eine Landschaft, mit wilden und zahmen Thieren Anm.: Die Lose 59 und 60 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Cassana, Giovanni Agostino (Abate Cassana) 1776/00/00 WZTRU 0090 Johann Augustin Cassani, genannt der Abbt I Ein Oeconomiestück, 3 Schuhe, 10 Zoll hoch, 5 Schuhe, 3 Zoll breit von Johann Augustin Cassani, genannt der Abbt, hierauf 450
GEMÄLDE
1764/00/00 BLAN 0002 N. Cassano I 1. Wunderns schönes Bachanal, gantze figuren auf leinwand gemahlt. I Mat.: auf Leinwand Maße: 3 Fuß 9 Zoll hoch, 4 Fuß 8 Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (1200 Rt Schätzung) Gegenw. Standort: Sankt-Peterburg, Rossiya. Ermitazh. (N 1585) als Niccolo Cassano 1764/00/00 BLAN 0154 N. Cassano I 1. sehr angenehmes und schönes Bachenall auf leinewand gemahlt. I Mat.: auf Leinwand Maße: 4 Fuß 9 Zoll hoch, 3 Fuß 6 Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (1500 Rt Schätzung) Gegenw. Standort: Sankt-Peterburg, Rossiya. Ermitazh. (N 7635) (?) 1768/07/00 MUAN 0558 Cassana (Nicolaus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0363 Cassani (Nicolas dit) I Le dieu Pan rencontre Venus, & lui decouvre son amour. Peint sur toile, marque du No.558. I Mat.: auf Leinwand Maße: 4. p. 10. p. de haut sur 4. pieds de large Verkäufer: Francis Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt
Casteels 1765/03/27 FRKAL 0037 Castel I Une Bataille enrichie de figures parfaitement peint & la vivacite dans Taction des figures bien exprimee. I Maße: hauteur 35 pouces, largeur 50 pouces Transakt.: Verkauft (30 fl) Käufer: Kaller 1768/07/00 MUAN 0172 Castels I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0173 Castels I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0525 Castels I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0526 Castels I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0533 Castels I [Ohne Titel] \Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0534 Castels I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0535 Castels I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0536 Castels I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0537 Castels I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0538 Castels I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0539 Castels I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0540 Castels I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künst-
lernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0206 Castels I Deux ports de mer, avec plusieurs morceaux d'architecture, & nombre de personnes qui sont sur le rivage. Peints sur cuivre, marques des N o s 172. & 173. I Diese Nr.: Un port de mer, avec plusieurs morceaux d'architecture, & nombre de personnes qui sont sur le rivage Mat.: auf Kupfer Maße: 7 Ά pouces de haut sur 11. pouces de large Anm.: Die Lose 206 und 207 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0207 Castels I Deux ports de mer, avec plusieurs morceaux d'architecture, & nombre de personnes qui sont sur le rivage. Peints sur cuivre, marques des N o s 172. & 173. I Diese Nr.: Un port de mer, avec plusieurs morceaux d'architecture, & nombre de personnes qui sont sur le rivage Mat.: auf Kupfer Maße: 7 Vi. pouces de haut sur 11. pouces de large Anm.: Die Lose 206 und 207 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1771/05/06 FRAN 0160 Castels I Zwey grosse Stück, die Belagerung und der Entsatz von Mastrich mit vielen Figuren, auf Tuch. I Diese Nr.: Ein grosses Stück, die Belagerung von Mastrich mit vielen Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 62 Zoll, breit 91 Zoll Anm.: Die Lose 160 und 161 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friederich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt 1771/05/06 FRAN 0161 Castels I Zwey grosse Stück, die Belagerung und der Entsatz von Mastrich mit vielen Figuren, auf Tuch. I Diese Nr.: Ein grosses Stück, der Entsatz von Mastrich mit vielen Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 62 Zoll, breit 91 Zoll Anm.: Die Lose 160 und 161 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friederich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt 1775/05/15 FRAN 0112 Castels I Zwey große Stück, die Belagerung und der Entsatz von Mastricht mit vielen Figuren, auf Tuch. I Diese Nr.: Ein großes Stück, die Belagerung von Mastricht Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 62 Zoll, breit 91 Zoll Anm.: Die Lose 112 und 113 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt 1775/05/15 FRAN 0113 Castels I Zwey große Stück, die Belagerung und der Entsatz von Mastricht mit vielen Figuren, auf Tuch. I Diese Nr.: Ein großes Stück, der Entsatz von Mastricht Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 62 Zoll, breit 91 Zoll Anm.: Die Lose 112 und 113 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt 1779/09/27 FRNGL 1021 Casteels I Zwey Prospecten von Seestädten mit unzählbaren schönen kleinen Figuren. [Deux vues de villes maritimes avec nombre de belles petites figures.] I Diese Nr.: Ein Prospect von einer Seestadt mit unzählbaren schönen kleinen Figuren Maße: 11 Zoll hoch, 1 Schuh 2 Zoll breit Anm.: Die Lose 1021 und 1022 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (9 fl für die Nrn. 1021 und 1022) Käufer: Hüsgen 1779/09/27 FRNGL 1022 Casteels I Zwey Prospecten von Seestädten mit unzählbaren schönen kleinen Figuren. [Deux vues de villes maritimes avec nombre de belies petites figures.] I Diese Nr.: Ein Prospect von einer Seestadt mit unzählbaren schönen kleinen Figuren Maße: 11 Zoll hoch, 1 Schuh 2 Zoll breit Anm.: Die Lose 1021 und 1022 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (9 fl für die Nrn. 1021 und 1022) Käufer: Hüsgen 1791/09/26 FRAN 0601 Castels I Ein reich ordinirtes Vögel= Concert. I Maße: 18 Zoll breit, 15 Zoll hoch Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0112 der alte Castell I Ein Kavallerie Bataillien mit vielem Fleiß ausgearbeitet, auf Holz vom alten Castell. I GEMÄLDE
451
Mat.: auf Holz Maße: 2 Schuh 2 Vi Zoll hoch, 3 Schuh 3 Vi Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt
Casteels, Pieter 1725/01/24 BOAN [0011] Peter Castiels I Unterschiedliche Cabinets stuck von Breugel de Velleurs. Van der Mer. Peter Castiels. Choward Hulsman und anderen mehr Original und Copeyen nach denen ersten Meistern. I Diese Nr.: Ein Cabinets stuck von Peter Castiels Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Joseph Clemens Transakt.: Unbekannt 1759/00/00 LZEBT 0152 Peter Casteels I Eine Landschaft mit einer Gegend an der See auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 5 Zoll, Breite 1 Schuh Vi Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (60 Th für die Nrn. 152 und 153, Schätzung) 1759/00/00 LZEBT 0153 Peter Casteels I Eine dergleichen [Landschaft mit einer Gegend an der See] auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 5 Zoll, Breite 1 Schuh Vi Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (60 Th für die Nrn. 152 und 153, Schätzung)
Die Lose 138 und 139 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/07/00 FRAN 0073 Casteels I Zwey Blumenstücke von Casteels. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Maße: 2 Schuh 11 Zoll hoch, 2 Schuh 4 Zoll breit Anm.: Die Lose 73 und 74 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] fl für die Nm. 73 und 74) 1782/07/00 FRAN 0074 Casteels I Zwey Blumenstücke von Casteels. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Maße: 2 Schuh 11 Zoll hoch, 2 Schuh 4 Zoll breit Anm.: Die Lose 73 und 74 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] fl für die Nm. 73 und 74) 1785/05/17 MZAN 0830 Casteels I Ein Paar Blumenstücke von Casteels. [Des fleurs.] I Diese Nr.: Ein Blumenstück Maße: 1 Schuh 11 Zoll hoch, 1 Schuh 9 Zoll breit Anm.: Die Lose 830 und 831 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (11.30 fl für die Nm. 830 und 831) Käufer: Kanzellist Lehr
Casteels, Pieter (III)
1785/05/17 MZAN 0831 Casteels I Ein Paar Blumenstücke von Casteels. [Des fleurs.] I Diese Nr.: Ein Blumenstück Maße: 1 Schuh 11 Zoll hoch, 1 Schuh 9 Zoll breit Anm.: Die Lose 830 und 831 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (11.30 fl für die Nm. 830 und 831) Käufer: Kanzellist Lehr
1778/09/28 FRAN 0052 Peter Casteels I Ein Blumenstück von Peter Casteels. [Une piece representante des fleurs par Pierre Casteels.] I Pendant zu Nr. 53 Maße: 2 Schuh 3 Zoll breit, 2 Schuh 9 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt. : Verkauft (18.30 fl für die Nm. 52 und 53) Käufer: Schrintz
1790/01/07 MUAN 0022 Castels Peter I Zwey Blumenstücke, auf Leinwat, in vergoldeten Ramen. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 10 Zoll, Breite 2 Schuh 3 Zoll Anm.: Die Lose 22 und 23 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
1778/09/28 FRAN 0053 Peter Casteels I Ein dito [Blumenstück] als Compagnon vom nemlichen Meister [Peter Casteels]. [Une pareille [des fleurs] faisante le pendant de la precedente par le meme Maitre [Pierre Casteels].] I Pendant zu Nr. 52 Maße: 2 Schuh 3 Zoll breit, 2 Schuh 9 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (18.30 fl für die Nm. 52 und 53) Käufer: Schrintz
1790/01/07 MUAN 0023 Castels Peter I Zwey Blumenstücke, auf Leinwat, in vergoldeten Ramen. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 10 Zoll, Breite 2 Schuh 3 Zoll Anm.: Die Lose 22 und 23 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
1781/05/07 FRHUS 0163 Castell I Eine Landschaft mit einer grossen Menge allerley Vögel, oder Vorstellung der bekannten Fabel, wie die Vögel nach den Noten singen von Castell. I Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch und 1 Schuh 9 Zoll breit Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (3.20 fl) Käufer: Ehrman 1781/05/07 FRHUS 0338 P. Casteels I Zwey Blumenstück, natürlich und fleissig ausgeführt von P. Casteels. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Maße: 2 Schuh 2 Zoll hoch und 2 Schuh 4 Zoll breit Anm.: Die Lose 338 und 339 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (6.28 fl für die Nm. 338 und 339) Käufer: F Bemus 1781/05/07 FRHUS 0339 P. Casteels I Zwey Blumenstück, natürlich und fleissig ausgeführt von P. Casteels. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Maße: 2 Schuh 2 Zoll hoch und 2 Schuh 4 Zoll breit Anm.: Die Lose 338 und 339 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Jacob Bemus Transakt.: Verkauft (6.28 fl für die Nm. 338 und 339) Käufer: F Bemus 1782/03/18 HBTEX 0138 P. Casteel I Zwey stark und nach dem Leben gemahlte Blumenstücke, auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein starkes und nach dem Leben gemahltes Blumenstück Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 53 Zoll 4 Linien, Breite 41 Zoll 6 Linien Anm.: Die Lose 138 und 139 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0139 P. Casteel I Zwey stark und nach dem Leben gemahlte Blumenstücke, auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein starkes und nach dem Leben gemahltes Blumenstück Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 53 Zoll 4 Linien, Breite 41 Zoll 6 Linien Anm.: 452
GEMÄLDE
1792/09/28 HBBMN 0105 P. Castails I Zwey Blumenstücke, von P. Castails. Auf L[einwand]. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 36 Zoll, breit 38 Zoll Anm.: Die Lose 105 und 106 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1792/09/28 HBBMN 0106 P. Castails I Zwey Blumenstücke, von P. Castails. Auf L[einwand]. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 36 Zoll, breit 38 Zoll Anm.: Die Lose 105 und 106 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Castell, V.G. [Nicht identifiziert] 1781/05/07 FRHUS 0301 V.G. Castell I Zwey angenehme sehr fleisige Landschaften mit schönem Vieh. I Diese Nr.: Eine angenehme sehr fleisige Landschaft mit schönem Vieh Maße: 7 Zoll hoch und 1 Schuh breit Anm.: Die Lose 301 und 302 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Jacob Bemus Transakt.: Verkauft (5.20 fl für die Nm. 301 und 302) Käufer: F Bemus 1781/05/07 FRHUS 0302 V.G. Castell I Zwey angenehme sehr fleisige Landschaften mit schönem Vieh. I Diese Nr.: Eine angenehme sehr fleisige Landschaft mit schönem Vieh Maße: 7 Zoll hoch und 1 Schuh breit Anm.: Die Lose 301 und 302 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Jacob Bemus Transakt.: Verkauft (5.20 fl für die Nm. 301 und 302) Käufer: F Bemus
Castellano, Tommaso 1800/00/00 BLBOE 0015 Castelano I Ein Blumenstück. I Mat.: auf Leinwand Transakt.: Unbekannt
Castelli (Castello) 1723/00/00 PRAN [A]0075 Castelli I Seefahrt / vom Castelli. Compagnion No [A]80. I Pendant zu Nr. [A]80 Maße: Höhe 1 Schuh, Breite 1 Schuh 3 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN [A]0080 Castelli I Seestücklein vom Castelli. I Pendant zu Nr. [A]75 Maße: Höhe 1 Schuh, Breite 1 Schuh 3 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN [A]0120 Castelli I Seestücklein / vom Castelli. Compagnion No [A]127. I Pendant zu Nr. [A]127 Maße: Höhe Vi Schuh 5 Vi Zoll, Breite 1 Schuh 5 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN [A]0127 Castelli I Ein Seestücklein / vom Castelli. I Pendant zu Nr. [A]120 Maße: Höhe Vi Schuh 5 Vi Zoll, Breite 1 Schuh 5 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0718 Castelli I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0042 Castelli I Un tableau en fleurs qui forme deux couronnes entrelassees. Peint sur toile marque du No. 718. I Mat.: auf Leinwand Maße: p. 2 Vi. p. de haut sur 3. p. 4. p. de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0020 Castelli I Eine feisichte Gegend. Im Vorgrunde rieselt ein kleiner Bach durch Felsenstücke, neben einigen Landleuten, die sich unterreden. Ein Hirte besieht das vom Felsen stürzende Wasser. [Un paysage coupe de rochers. Sur le devant du tableau on voit un petit ruisseau qui coule par dessus des roches, & quelques villageois qui conversent ensemble. Un berger contemple l'eau qui se precipite d'un rocher.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 7 Zoll hoch, 2 Fuß 1 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0021 Castelli I Ein Gebirge mit einem gothischen Schlosse. Zur Rechten etliche Reisende. Im Vorgrunde etliche Fischer, an dem von der Linken herfließenden Wasser beschäfftigt. [Une montagne avec un chateau gothique. Du cöte droit quelques voyageurs. Sur le devant des pecheurs travaillent dans l'eau, qui coulent du cote gauche.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 7 Zoll hoch, 2 Fuß 1 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt
Castello, Valerio 1790/08/25 FRAN 0327 Valerio Castelli I Zwey arkadische Landschaften. I Diese Nr.: Eine arkadische Landschaft Maße: hoch 15 Zoll, breit 18 Zoll Anm.: Die Lose 327 und 328 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Unbekannt 1790/08/25 FRAN 0328 Valerio Castelli! Zwey arkadische Landschaften. I Diese Nr.: Eine arkadische Landschaft Maße: hoch 15 Zoll, breit 18 Zoll Anm.: Die Lose 327 und 328 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Unbekannt 1796/00/00 BS AN 0007 Valerio Castelli I L' enfant Jesus dormant. II est couche presque nud sur un lit couvert d'une draperie blanche. Saint Jean lui prend la main, comme pour la baiser. Le sourire de l'innocence, l'abandon du sommeil, la beaute des formes, le naturel de la carnation caractirisent la figure du Christ. L'expression celeste d'une amitie tendre et respectueuse anime le visage de St. Jean, dont on ne voit que la tete, le bras, et une partie du buste. I
Mat.: auf Leinwand Maße: Haut de 2 pieds 4 pouces; large de 2 pieds 9 pouces Verkäufer: Merian l'aine Transakt.: Unbekannt (30) 1799/00/00 LZRCH 0012 Valerio. Castelly I Une Magdalaine repentante comp, de 4 figures d'un beau ton de couleur. I Mat.: auf Leinwand Maße: h. 48.1. 36 pouces Verkäufer: J F Rauch Transakt.: Unbekannt
Castiglione, Giovanni Benedetto (II Grechetto) 1742/08/01 BOAN 0487 Castilliori I Ein paar Italiänische Früchten Stuck. Orig. von Castilliori. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0301 Castigliori I Des Fruits par Castigliori. [Een Fruytstuk door Castiglioni.] I Maße: Haut 1. pied 4. pou., large 1. pied 10. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt (40) 1750/10/15 HB AN 0016 Castiglione (Ben.) I Die Erscheinung denen Hirten. I Maße: 1 Fuß 6 Zoll hoch, 1 Fuß 3 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0013 Castiglione (Balthasar) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0428 Castiglione (Balthasar) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0364 Castiglione (Balthasar) I Abraham suivant I'ordre qu'il a re^u de Dieu, va avec les siens dans le pays de Canaan. Peint sur toile, marque du No. 13. I Mat.: auf Leinwand Maße: 3. p. 3. p. de haut sur 4. p. 6. p. de large Verkäufer: Franfois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1773/12/18 HBBOY 0062 Castilione I Ein Stück mit Hirten und Vieh. I Transakt.: Unbekannt 1776/00/00 WZTRU 0103 Johann Benedictus Castiglione I Ein Stück 2 Schuhe hoch, 1 Schuhe, 8 Zoll breit von Johann Benedictus Castiglione, stellet vor einen in Kuras auf einem weisen Pferde sitzenden Reuter, woselbsten verschiedene Trouppen in gleicher Tracht ihm folgen, im Vorgrunde zeiget sich ein bewaffneter Soldat zu Fuß, in dieser Gattung der Kunst bewundert man die vollkommene Erkänntniß des Schatten und Lichts, die Herzhaftigkeit seines Auftrages der Colorit, und die Kraft seiner Zusammsetzung [sie], welche sich verbreitet, und mann bemerket hierinn den Geschmack der römischen Schule. I Maße: 2 Schuhe hoch, 1 Schuhe 8 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (40 fl Schätzung) 1776/04/15 HBBMN 0011 Bendetto Castiglione I Zwo Caravanen, reich von Figuren und vieles Vieh. I Diese Nr.: Eine Caravane, reich von Figuren und vieles Vieh Maße: Höhe 2 Fuß 2 Zoll, Breite 2 Fuß 8 Vi Zoll Anm.: Die Lose 11 und 12 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (8 M) Käufer: L[illy] S 1776/04/15 HBBMN 0012 Bendetto Castiglione I Zwo Caravanen, reich von Figuren und vieles Vieh. I Diese Nr.: Eine Caravane, reich von Figuren und vieles Vieh Maße: Höhe 2 Fuß 2 Zoll, Breite 2 Fuß 8 Vi Zoll Anm.: Die Lose 11 und 12 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (8 M) Käufer: L[illy] S 1776/06/21 HBNEU 0019 B. Castiglione I Ein vortreflich Federvieh=Stück, auf dito [Leinw.]. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 3 F 6 Z, Breite 4 F 5 Ζ Transakt.: Unbekannt 1777/02/21 HBHRN 0059 Castiglione I Zwey schöne Blumenstücke. I Diese Nr.: Ein schönes Blumenstück Maße: Höhe 2 Fuß 9 GEMÄLDE
453
Vi Zoll, Breite 3 Fuß 3 Zoll Anm.: Die Lose 59 und 60 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1777/02/21 HBHRN 0060 Castiglione I Zwey schöne Blumenstücke. I Diese Nr.: Ein schönes Blumenstück Maße: Höhe 2 Fuß 9 Vi Zoll, Breite 3 Fuß 3 Zoll Anm.: Die Lose 59 und 60 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/05/23
HBKOS
0048
B. Castiglione
I Ein Italienisches
Mädgen, mit sehr starken Pinsel gemalet, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 36 Vi Zoll, Breite 29 Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/05/23 HBKOS 0065 B. Castiglione I Ein Stilleben mit Haasen und Rephüner, von großer Force und Fleiß, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 25 Zoll, Breite 33 Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/05/23 HBKOS 0067 Castiglione I Eine Carravane, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 13 Zoll, Breite 18 Zoll Transakt.: Unbekannt (30 M) 1778/08/29 HB TEX 0075 Castillione I Liegende Schaafe. I Maße: Höhe 9 Zoll, Breite 11 Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/09/28 FRAN 0449 Β. Castilliogne I Eine Landschaft mit Ziegen und Schaafen. [Un paysage avec des Chevres & des brebis.] I Maße: 14 Zoll breit, 12 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (24.15 fl) Käufer: Hoym 1778/10/30 HBKOS 0161 B. Castiglione I Zwey Philosophen= Köpfe über Lebens=Grösse, meisterhaft gemahlt, auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Philosophen=Kopf über Lebens=Grösse Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 36 Zoll, breit 28 Zoll Anm.: Die Lose 161 und 162 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/10/30 HBKOS 0162 B. Castiglione I Zwey Philosophen= Köpfe über Lebens=Grösse, meisterhaft gemahlt, auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Philosophen=Kopf über Lebens=Grösse Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 36 Zoll, breit 28 Zoll Anm.: Die Lose 161 und 162 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0103 Johann Benedikt Castiglione I Ein Stück 2 Schuhe hoch, 1 Schuhe, 8 Zoll breit von Johann Benedikt Castiglione, stellet einen in Küraß auf einem weisen Pferde sitzenden Reuter vor, woselbst verschiedene Truppen in gleicher Tracht ihm folgen; im Vorgrunde zeigt sich ein bewaffneter Soldat zu Fuß; in dieser Gattung der Kunst bewundert man die vollkommene Erkänntniß des Schatten und Lichtes, die Herzhaftigkeit seiseines [sie] Auftrages der Kolorit, und die Kraft seiner Zusammensetzung, welche sich verbreitet, und mann bemerket hierinn den Geschmack der römischen Schule. I Maße: 2 Schuhe hoch, 1 Schuhe 8 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/03/26 BLHRG 2370 Bendes Castiglione I Un petit amour forgeant de Flisches [sic], I Transakt.: Unbekannt (27 [?]) 1783/06/19 HBRMS 0143 Castiglione I Schöne italienische Land= und Wasser=Gegenden. Hirten und Vieh fliehen bey einem starken Gewitter. Seegelnde Fahrzeuge auf einem ruhigen Fluße. L[einwand]. g.R. [verguldete Rahmen] I Diese Nr.: Eine schöne italienische Land= und Wasser=Gegend. Hirten und Vieh fliehen bey einem starken Gewitter Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 4 Zoll hoch, 2 Fuß 4 Zoll breit Anm.: Die Lose 143 und 144 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1783/06/19 HBRMS 0144 Castiglione I Schöne italienische Land= und Wasser=Gegenden. Hirten und Vieh fliehen bey einem starken Gewitter. Seegelnde Fahrzeuge auf einem ruhigen Fluße. L[einwand], g.R. [verguldete Rahmen] I Diese Nr.: Eine schöne italienische Land= und Wasser=Gegend. Seegelnde Fahrzeuge auf einem ruhigen Flusse Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 4 Zoll hoch, 2 Fuß 4 Zoll breit Anm.: Die Lose 143 und 144 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 454
GEMÄLDE
1784/09/27 FRAN 0103 Castiglione I Die Geburt Christi, von Castiglione vortrefflich gemahlt. [La naissance de Jesus-Christ, piece superieurement bien peinte.] I Maße: 1 Schuh 5 Zoll hoch, 1 Schuh 7 Zoll breit Verkäufer: Freyherr von Berberich Transakt.: Verkauft (22.45 fl) Käufer: Stöber 1787/04/03 HBHEG 0118 Benedetto Castiglione I Democrit und Heraclit, von Benedetto Castiglione, mit großem Affect gemahlt. I Diese Nr.: Democrit Anm.: Die Lose 118 und 119 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (2.4 Μ für die Nrn. 118 und 119) Käufer: Hofr Ehrenreich 1787/04/03 HBHEG 0119 Benedetto Castiglione I Democrit und Heraclit, von Benedetto Castiglione, mit großem Affect gemahlt. I Diese Nr.: Democrit Anm.: Die Lose 118 und 119 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (2.4 Μ für die Nrn. 118 und 119) Käufer: Hofr Ehrenreich 1788/06/12 HBRMS A0038 Castiglione I Ein lachender Bauer= Junge hält ein Vogelnest mit zwey Jungen in dem linken Arm. Auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 8 % Zoll, breit 7 Zoll Transakt.: Unbekannt 1789/00/00 MM AN 0297 Benedetto Castiglioni I Verschiedenes Viehe, auf Leinw. [Differens betail, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 5 Zoll hoch, 2 Fuß 6 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (5 fl) 1789/04/16 HBTEX 0004 Castiglione I Eine gebürgigte italiänische Landgegend, mit einigen Reisenden, bey beladenen Maulthieren; stark gemahlt auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Zoll, breit 17 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (1.10 M) Käufer: Averdick 1790/01/07 MUAN 0106 Castiliogne Benedeto I Ein Kameelthier, auf Leinwat. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 9 Zoll, Breite 2 Schuh 3 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1243 Castiliogne Benedeto I Ein Bataillenstück, auf Leinwat. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 7 Zoll, Breite 4 Schuh 7 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1244 Castiliogne Benedeto I Ein Bataillenstück, auf Leinwat. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 7 Zoll, Breite 4 Schuh 7 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/04/13 HBLIE 0257 B. Castiglione I Verschiedene Gartenfrüchte und Federwild liegen auf einem Tische, sehr stark gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 18 Zoll, breit 30 Zoll Transakt.: Verkauft (2 M) Käufer: Steemann 1790/08/25 FRAN 0345 Castellione di Benedetto I Ein Stück mit Geflügel und andern Thieren. I Maße: hoch 13 Zoll, breit 21 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (2 fl) Käufer: Kaller 1791/05/28 HBSDT 0081 B. Castiglione I Eine Menge Garten= Früchte ec. Ein Knabe sitzt zur Linken und ißt eine Melone. Sehr natürlich gemahlt, auf Leinewand. Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 46 Zoll, breit 56 Zoll Transakt.: Unbekannt 1791/07/29 HBBMN 0010 Bar Castiligione I Eine Caravanne von besondem Schatten und Licht; auf Leinen. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 38 Vi Zoll, breit 52 Zoll Transakt.: Unbekannt (2 M) 1792/08/20 KOAN 0233 Cassilione Benedetti I Zwey große Viehe Stück, Ochs, Schafen und Geisten vorstellend mit Figuren. I Diese Nr.: Ein große Viehe Stück, Ochs, Schafen und Geisten vorstellend mit Figuren Maße: 4 Schuh 3 Zoll hoch, 5 Schuh 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 233 und 234 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0234 Cassilione Benedetti I Zwey große Viehe Stück, Ochs, Schafen und Geisten vorstellend mit Figuren. I
Diese Nr.: Ein große Viehe Stück, Ochs, Schafen und Geisten vorstellend mit Figuren Maße: 4 Schuh 3 Zoll hoch, 5 Schuh 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 233 und 234 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt
hoch, 30 Z. breit, auf dito [Leinwand]. I Diese Nr.: Eine bergigte Landschaft, mit Rindern und Schaafen Mat.: auf Leinwand Maße: 30 Zoll hoch, 30 Zoll breit Anm.: Die Lose 45 und 46 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (6 M) Käufer: Bertheau
1792/09/28 HBBMN 0059 Castiglione I Eine Hölzung mit Hirten und Hornvieh, von Castiglione. Auf L[einwand], I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 15 Vi Zoll, breit 22 Zoll Transakt.: Unbekannt
1778/07/21 HBHTZ 0046 Castiglione I Zwey bergigte Landschaften, mit Rindern und Schaafen, so schön wie Castiglione, 30 Z. hoch, 30 Z. breit, auf dito [Leinwand]. I Diese Nr.: Eine bergigte Landschaft, mit Rindern und Schaafen Mat.: auf Leinwand Maße: 30 Zoll hoch, 30 Zoll breit Anm.: Die Lose 45 und 46 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (6 M) Käufer: Bertheau
1793/00/00 NGWID 0349 Castiglione I Die Geburt Christi mit vielen Figuren, von Castiglione. I Pendant zu Nr. 350 Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch, 1 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0350 Castiglione I Zum Gegenstück, die drey Weisen aus Morgenland, wie selbige dem Kind Jesu die Verehrung bringen, von obigem Meister [Castiglione] und Maaß. I Pendant zu Nr. 349 Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch, 1 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1796/08/00 HBPAK 0063 Benedetto Castiglione I Ein Frauenzimmer; historisch vorgestellt. Halbe Figur mit beyden Händen. Besonders stark und meisterhaft gemahlt. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 27 Zoll, Breite 22 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0171 Castiglione I Zwey schöne bergigte Landschaften, mit Schäfern und ihren Heerden, in Lebensgrösse. Auf Kupfer, goldenen Rahm. I Diese Nr.: Eine schöne bergigte Landschaft Mat.: auf Kupfer Maße: hoch 17 Zoll, breit 14 Vi Zoll Anm.: Die Lose 171 und 172 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0172 Castiglione I Zwey schöne bergigte Landschaften, mit Schäfern und ihren Heerden, in Lebensgröße. Auf Kupfer, goldenen Rahm. I Diese Nr.: Eine schöne bergigte Landschaft Mat.: auf Kupfer Maße: hoch 17 Zoll, breit 14 Vi Zoll Anm.: Die Lose 171 und 172 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Castiglione, Giovanni Benedetto (II Grechetto) (Geschmack von) 1775/04/12 HB NEU 0021 B. Castiglione I Eine Caravane in einer Arcadischen Landschaft, auf Leinewand, in dem Gusto von B. Castiglione. I Mat.: auf Leinwand Transakt.: Unbekannt
Castiglione, Giovanni Benedetto (II Grechetto) (Kopie nach) 1793/06/07 HBBMN 0230 Loenberg; Castiglione I Zwey Köpfe, Imitationes, nach Castiglione. Auf dito [Holz], von Loenberg. I Diese Nr.: Ein Kopf; Kopie von L. Lönberg nach G.B. Castiglione Mat.: auf Holz Anm.: Die Lose 230 und 231 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0231 Loenberg; Castiglione I Zwey Köpfe, Imitationes, nach Castiglione. Auf dito [Holz], von Loenberg. I Diese Nr.: Ein Kopf; Kopie von L. Lönberg nach G.B. Castiglione Mat.: auf Holz Anm.: Die Lose 230 und 231 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0029 Castiglione I Eine Landschaft mit Figuren. nach Castiglione. I Transakt.: Unbekannt
Castiglione, Giovanni Benedetto (II Grechetto) (Manier) 1778/07/21 HBHTZ 0045 Castiglione I Zwey bergigte Landschaften, mit Rindern und Schaafen, so schön wie Castiglione, 30 Z.
1779/09/27 FRNGL 0345 Castiglione I Ein Stück mit Geisen und Schaafen, in der Manier von Castiglione. [Une piece representante des chevres & des brebis, dans le gout de Castiglione]. I Pendant zu Nr. 346 Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 1 Schuh 5 Zoll breit Transakt.: Verkauft (50 Kr für die Nrn. 345 und 346) Käufer: Mergenbaum 1779/09/27 FRNGL 0346 Castiglione I Das Gegenbild hierzu, ein dergleichen Viehstück, von nemlicher Hand [Manier von Castiglione] und Gröse. [Le pendant du precedant, meme objet [chevres & brebis], representant du betail, par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 345 Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 1 Schuh 5 Zoll breit Transakt.: Verkauft (50 Kr für die Nrn. 345 und 346) Käufer: Mergenbaum
Castro, Pedro de 1799/00/00 WZAN A0094 Peter de Castro I Ein Zeichnungsstück mit Zeichnungen, von Peter de Castro. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh breit 2 Schuh 6 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Catel, Pieter 1781/09/10 BNAN 0151 P. Cattel I Innerhalb eines Gewölbebogens ein Mädchen, so Heeringe, Brodt ec. verkaufet. I Pendant zu Nr. 152 Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt 1781/09/10 BNAN 0152 P. Cattel I Das Nebenbild, ein Mann, so aus einem offenen Gewölbe Schullen verkauft; von P. Cattel. g.L. [im schwarzen Rahm mit verguldeten Leisten] I Pendant zu Nr. 151 Mat.: auf Holz Maße: 11 Zoll hoch, 9 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Caulitz, Peter 1764/03/12 FRKAL 0027 Caulitz I Un Renard mort attache par une patte ä un arbre & une arquebuse ä cote, bien peint. I Maße: hauteur 41 pouces, largeur 31 Vi pouces Transakt.: Verkauft (3.42 fl) Käufer: Gayss 1788/04/08 FRFAY 0236 BP. Caaliz I Eine gute Landschaft, von Β. P. Caaliz. Auf Tuch. I Mat.: auf Leinwand Maße: 25 Vi Z. hoch und 33 Vi Z. breit Transakt.: Verkauft (3 fl) Käufer: Levi ν M[annheim]
Cave, Peter le 1743/00/00 BWGRA 0154 le Cave I Ein Schäfer so auf der Flöte spielet und zwo Nymphen tanzen von le Cave. I Pendant zu Nr. 155 Maße: hoch 1 Fuß 6 Zoll, breit 1 Fuß 3 Zoll Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0155 le Cave I Die drey Gratien vom vorigen maitre [le Cave], ein Compagnon zu dem vorigen. I Pendant zu Nr. 154 Maße: hoch 1 Fuß 6 Zoll, breit 1 Fuß 3 Zoll Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
455
Cavedone, Giacomo
Centzen [Nicht identifiziert]
1777/03/03 AUAN 0095 Cavedone I Zwey Landschaften. I Maße: Höhe 10 Zoll, Breite 1 Sch. 2 Vi Zoll Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt
1752/05/08 LZAN 0132 Centzen I Antromida von Centzen im Holl. Rahmen. I Maße: % Elle hoch, Vi Elle breit Transakt.: Verkauft (2.8 Th) Käufer: Ceich [?]
1796/02/17 HBPAK 0179 Cavedone, Schüler des Caraccio I Eine heilige Familie in Wolken sitzend. Auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 11 Vi Zoll, Breite 10 Zoll Transakt.: Verkauft (127 M) Käufer: Packi
Cerezo, Mateo (der Jüngere)
Cazes, Pierre Jacques 1796/02/17 HBPAK 0088 Pet. Jac. Cazes I Amor scherzt mit Venus, welche den Deckel eines bey ihr stehenden Rauchfasses abgenommen. Der Compagnon stellt Diana vor, welche von einigen Nymphen bewundert wird. Auf Kupfer. Ovalen Formats. I Mat.: auf Kupfer Format: oval Maße: Höhe 18 % Zoll, Breite 15 % Zoll Transakt.: Verkauft (188 M) Käufer: Kreuter
Celesti, Andrea 1759/00/00 LZEBT 0005 Canal (Celesty) I Die Verkündigung Mariae auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 4 Zoll, Breite 2 Schuh 3 Vi Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (200 Th Schätzung) 1790/01/07 MUAN 0963 Celesti I Ein Stück mit zwo Figuren, und einem Adler, auf Leinwat. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 3 Schuh 4 Zoll, Breite 5 Schuh 3 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1209 Celesti I Ein Portraitkopf, auf Leinwat, in einer geschnittenen und metallisirten Ram. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 6 Zoll, Breite 1 Schuh 1 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1668 Celesti I Eine griechische Geschichte, auf Leinwat, in einer metallisirten Ram. Der Compagnon dazu kömmt unten sub Nro. 2131. vor. I Pendant zu Nr. 2131 Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 4 Schuh 6 Zoll, Breite 6 Schuh 7 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 2131 Celesti I Eine griechische Geschichte, auf Leinwat, in einer metallisirten Ram. Das Gegenstück davon ist vome sub Nro. 1668 vorgekommen. I Pendant zu Nr. 1668 Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 4 Schuh 6 Zoll, Breite 6 Schuh 7 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
Celestini 1750/00/00 KOAN 0070 Celestini I L'Amour Romain, figure par une Femme & trois enfants, sur toile, grand gout, belle expression. I Mat.: auf Leinwand Maße: Largeur 3 Pies 9 Vi Pouces, Haut 3 Pies 2 Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1767/00/00 KOAN 0029 Ccelestini I Die Römische Liebe durch eine Frauens=Person, und drey Kinder auf Leinewand von Coelestini. I Mat.: auf Leinwand Maße: Breite 4 Fuß 8 !4 Zoll, Höhe 4 Fuß Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt
Cenone, Gio. del [Nicht identifiziert] 1670/04/21 WNHTG 0046 Gio. del Cenone I II Giudicio estremo assai curioso, con infinite figure, alto palmi 5. e un dito, largo 4. e diti cinque, e schizzo. I Maße: Alto palmi 5, e un dito, largo 4. e diti cinque Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt 456
GEMÄLDE
1791/09/21 FRAN 0055 Mathieu Sereso I Eine Academische Figur, so einen heil. Johannes stehend in der Wüste vorstellet, ein Gemälde nach Rubens Art gemalt, es wird sehr hoch geachtet, und die Farben sind wohl gemischt, es ist auch von Spanien mitgebracht, wo die Werke diese Meisters sehr rar sind, und man findet sie blos in des Königs Gallerien. I Transakt.: Verkauft (100 fl) Käufer: ν Döring
Cerquozzi, Michelangelo (Michelangelo delle Battaglie) 1768/07/00 MUAN 0278 Cerquozzi (Michael Angelus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0110 Michel Ange de la Bataille I Une danse de paysans, avec nombre de personnages. Peinte sur toile, marquee du No. 278. I Mat.: auf Leinwand Maße: 1. p. 6 Vi. p. de haut sur 2. p. 1. p. de large Verkäufer: Francis Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0287 Mich. Angelo de la Battaglia I Joseph und Maria mit dem Kinde erhalten Schafe, Lämmer und Milch von den Hirten zum Geschenke. An einer Thüre stehen Ochsen und Esel. [St. Joseph & Sainte Marie avec l'enfant Jesus re^oivent des moutons, des agneaux & du lait en prösens par les bergers. Des boeufs & des änes sont ä une porte.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 1 Zoll hoch, 2 Fuß 8 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0331 M. Angelo della Battaglia I Ein Bauer tanzt, mit der Flasche in der Hand, nach der Musik des gegen über stehenden Sackpfeifers, neben welchem ein Soldat sitzt, vor einem hinter ihm stehenden Hause. Sein Karren, mit Ochsen bespannt, hält etwas weiter zurück. [Un paysan, tenant une bouteille ä la main danse au son d'une cornemuse dont joue un musicien ambulant, ä cöte duquel est assis un soldat devant une maison. Sa charette attelee de boeufs est arretee plus loin.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 7 Zoll hoch, 2 Fuß breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1787/00/00 HB AN 0087 Michael Angelo de la Batalje I Eine Landwirtschaft. Ein Herr sitzt auf einem braunen Pferde, und zeigt in die Landschaft hin, wartend auf einem andern, welcher im Begriff ist, neben ihm auf einen Schimmel zu steigen, der von einem Bauern gehalten wird. Im Hintergrunde zur rechten nahe an dem Wirthshause steht ein Pferd, welches gefuttert wird, ein daneben stehender Bauer schneidet ihm Brod vor; ihm zur Seite sitzt ein anderer mit abgenommenem Huthe, und trinkt aus einer Kanne, hinter welchem noch ein dritter mit gefaltenen Armen steht. Im Vordergrunde liegt ein alter Sattel. Zur linken befindet sich ein aufgemauerter Brunnen mit Brettern zugedeckt, bey welchem ein umgeworfener Eimer liegt. Im Hintergrunde fährt ein bepackter Rüstwagen auf der bey einem Bauerhause vorbey gehenden Landstraße. Dieses ist ein herrliches Gemähide, welches jeder Kenner und Liebhaber bewundern wird, und es für eine seltene Nachahmung der Natur und ein Meisterstück der Kunst haltem muß, ohne die Reinheit und schönen Conditionirung zu gedenken. Auf Holz, g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 28 Zoll, breit 38 Zoll Transakt.: Verkauft (450 M) Käufer: Schoen
1788/10/01 FRAN 0122 Michel ange de Bataille I Eine Landschaft von auffallender Würkung, in dem Vordergrund siehet man einige Figuren und Thiere durch ein Wasser gehen. I Maße: 18 V2 Zoll hoch, 30 Zoll breit Transakt.: Verkauft (9.15 fl) Käufer: Lindlau 1790/08/25 FRAN 0358 Michel Angelode la Bataille I Zwey spielende Gesellschaften. I Diese Nr.: Eine spielende Gesellschaft Maße: hoch 12 Zoll, breit 9 Zoll Anm.: Die Lose 358 und 359 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (10 fl für die Nrn. 358 und 359) Käufer: Kaller 1790/08/25 FRAN 0359 Michel Angelo de la Bataille I Zwey spielende Gesellschaften. I Diese Nr.: Eine spielende Gesellschaft Maße: hoch 12 Zoll, breit 9 Zoll Anm.: Die Lose 358 und 359 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (10 fl für die Nrn. 358 und 359) Käufer: Kaller 1794/00/00 HB AN 0124 Mich. Ang. Cerquozzi, genannt Delle Battaglie I An der Hausthür sitzt eine freundliche Bäurin mit ihrem Säugling an der Brust und ein erwachsener Bursche, der seinem Hündlein Künste beybringt; ein anderes Frauenzimmer wäscht Leinewand. Neben dem Hause graset ein Pferd. Dieses Bild zeichnet sich vorzüglich durch eine kühne und treffliche Beleuchtung und durch die zarte und lebendige Karnation der Figuren aus. I Maße: Höhe 13 Vi Zoll, Breite 15 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1796/00/00 BSAN 0017 Michelange des Batailles I Paysage, battu par la tempete. Des arbres courbes par les vents. Des voyageurs egares; Tun ä cheval, l'autre est descendu et se met avec son cheval, ä l'abri d'un rocher; un troisieme s'enfuit avec effroi. Des bords gonfles par l'orage. Beaucoup d'expression et de naturel, pour rendre le tumulte des 61emens, et la crainte inquiete des hommes. I Mat.: auf Leinwand Maße: Haut de 1 pied 7 pouces; large de 1 pied 4 pouces Verkäufer: Merian l'aine Transakt.: Unbekannt (20) 1796/02/17 HBPAK 0248 Michael Angelo de la Bataille I Zechende Landleute sitzen um einen Camin auf der Land=Diehle. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 15 Vi Zoll, Breite 12 Zoll Transakt.: Unbekannt (41 M) 1800/00/00 BLBOE 0003 Michael Angelo Cerquozzi I Eine große Bataille, aus der römischen Geschichte. I Mat.: auf Leinwand Transakt.: Unbekannt
Cerquozzi, Michelangelo (Michelangelo delle Battaglie) (Kopie nach) 1785/12/21 HBKOS 0072 Michael Angelo della Battalje I Ein Rencontre, im schwarzen Rahm, nach Michael Angelo della Battalje. I Transakt.: Unbekannt
Cerquozzi, Michelangelo (Michelangelo delle Battaglie) (zugeschrieben) 1799/00/00 LZRCH 0088 Attribute ά Michel Ange des Batailles I Un Escarmouche de cavallerie, faite dans une tres belle maniere. I Mat.: auf Leinwand Maße: h. 19.1. 26. pouces Verkäufer: J F Rauch Transakt.: Unbekannt
Ceruti, Fabio 1759/00/00 LZEBT 0102 Zerudi I Eine Landschaft auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 7 Zoll, Breite 1 Schuh 4 Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (60 Th für die Nrn. 102 und 103, Schätzung) 1759/00/00 LZEBT 0103 Zerudi I Eine dergleichen [Landschaft] auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 7
Zoll, Breite 1 Schuh 4 Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (60 Th für die Nrn. 102 und 103, Schätzung) 1764/03/12 FRKAL 0141 Zerudi I Un tres agreable pa'isage avec des figures trfes bien peint. I Maße: hauteur 16 pouces, largeur 19 pouces Transakt.: Verkauft (29.15 fl für die Nrn. 141 und 142) Käufer: Etling 1764/03/12 FRKAL 0142 Zerudi I Un semblable pas moindre que le pricedent [Un trfes agreable pa'isage avec des figures] & de la meme grandeur. I Maße: hauteur 16 pouces, largeur 19 pouces Transakt.: Verkauft (29.15 fl für die Nrn. 141 und 142) Käufer: Etling
Cesare da Sesto 1785/05/17 MZAN 0862 Cesar da Sesto I Die Mutter Gottes mit dem Jesukinde, der kleine Johannes und zwey Kinder von Cesar da Sesto. [La S. Vierge avec l'enfant Jesus, le petit S. Jean & deux enfans.] I Maße: 2 Schuh 9 Zoll hoch, 2 Schuh 2 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (15.30 fl) Käufer: Hofr ν Leykam
Cesari, Giuseppe (Cavalier d'Arpino) 1670/04/21 WNHTG 0042 Cavalier Gioseppino I II Rapimento di Elena, con 50. persone. I Maße: Alto pal. due, e tre dita, largo uno, e mezzo Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0014 L'Harpmo I Ein Bachi-Tantz. Original von l'Harpino. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0011 l'Harpino I Une Bacchanale par l'Harpino. I Maße: haut 5. p. 8. pou. large 7. p. 8. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1768/08/16 KOAN 0098 Chev. Darpin I GOtt Vatter von Chev. Darpin. I Maße: Höhe 9 Zoll, Breite 1 Fuß 3 Zoll Verkäufer: Freyherr von Kaas Transakt.: Unbekannt 1787/00/00 HB AN 0665 Josephus Cesari, genannt Josepin I Wie der Engel St. Michael den bösen Geist aus den Himmel in den Abgrund wirft. Sehr schön gemahlt, und von richtiger Zeichnung. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 12 Zoll Transakt.: Verkauft (6.8 M) Käufer: Tietjen 1789/00/00 MMAN 0340 Giuseppe Cesari Arpino I Eine Frau, oval auf Leinw. [Une femme, oval, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Format: oval Maße: 1 Fuß 3 Zoll hoch, 1 Fuß 2 Zoll breit [1 pied 3 pouces de haut, 2 pieds de large] Anm.: In der Taxierungsliste von 1787 ist als Material "auf Holz" angegeben. Die Dimensionen unterscheiden sich in der deutschen und französischen Fassung des Katalogs. Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (1 fl) 1793/00/00 NGWID 0219 Giuseppino I Das Urtheil des Paris, nebst noch einigen Figuren, von Giuseppino. I Maße: 1 Schuh 10 Zoll hoch, 2 Schuh 5 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
Cesari, Giuseppe (Cavalier d'Arpino) (und Bril, P.) 1796/02/17 HBPAK 0050 P. Bull; Josephim I Eine waldigte Gegend. Zur Rechten ist ein Bassin, in welchen das Wasser aus einer Felsen=Höhle hinab fällt; um dasselbe stehen und sitzen v[i]ele Nymphen, in deren Mitte befindet sich Diana, welche den Akteon in einen Hirsch verwandelt, der am gegenseitigen Ufer liegt. Verschiedene Jagende, wie auch Hirsche und Hunde sieht man hin und wieder. Auf Leinwand. Die Landschaft von P. Bull, und die Figuren von Josephim. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 20 Vi Zoll, Breite 27 V2 Zoll Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "P. GEMÄLDE
457
Bull", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Verkauft (76 M) Käufer: Packi 1796/02/17 HBPAK 0075 Paul Brill; Josephin I Im Vordergrunde einer gebirgigten Gegend, bey Felsen=Klippen und Wasserfall, betet der heilige Hieronymus kniend als Mönch gekleidet, indem der Strahl aus den Wolken auf ihn herab fällt. Zur Linken zwischen Felsen unter einem Baume, sitzt ein anderer Mönch, welcher in einem Buche liest. Auf Kupfer. Die Landschaft von Paul Brill, und die Figuren von Josephin. I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 17 Vi Zoll, Breite 13 Zoll Transakt.: Verkauft (201 M) Käufer: Τ
Cesi, Bartolomeo 1759/00/00 LZEBT 0130 Bart. Cesio I Der Herr Christus, denen Heiligen frauen erscheinend auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 8 Vi Zoll, Breite 11 Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (60 Th Schätzung)
Chaise, Charles-Edouard 1800/07/09 HBPAK 0084 Chaise I L'amour apportant un Collier ä une jeune femme. Sur ardoise. I Maße: 8 pouces de hauteur. Sur 11 pouces de largeur Transakt.: Unbekannt
Chalon, Louis 1743/00/00 BWGRA 0149 Chalon I Zwey plaisante Landschaften von Chalon. I Diese Nr.: Eine plaisante Landschaft Maße: hoch 11 Zoll, breit 8 Vi Zoll Anm.: Die Lose 149 und 150 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0150 Chalon I Zwey plaisante Landschaften von Chalon. I Diese Nr.: Eine plaisante Landschaft Maße: hoch 11 Zoll, breit 8 Vi Zoll Anm.: Die Lose 149 und 150 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1772/00/00 BSFRE 0025 Chalons (Louis) ] Deux Payssages, Tun representant le Bord d'une Rivierre, ou il y a plusieurs Barques, avec beaucoup de Monde ; Γ autre un hyver, ou grand nombre de Personnes se divertissent sur la Glace soit en allant en traineaux, ou glissant en Patins. Ces deux Pieces sont fort amüsantes. Cadres noirs, avec Liteaux dores. I Diese Nr.: Un Payssage, le Bord d'une Rivierre, ou il y a plusieurs Barques, avec beaucoup de Monde Mat.: auf Leinwand Maße: haut de 18 & large de 21 pouces Anm.: Die Lose 25 und 26 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1772/00/00 BSFRE 0026 Chalons (Louis) I Deux Payssages, Tun representant le Bord d'une Rivierre, ou il y a plusieurs Barques, avec beaucoup de Monde ; Γ autre un hyver, ou grand nombre de Personnes se divertissent sur la Glace soit en allant en traineaux, ou glissant en Patins. Ces deux Pieces sont fort amüsantes. Cadres noirs, avec Liteaux dores. I Diese Nr.: Un Payssage, un hyver, ou grand nombre de Personnes se divertissent sur la Glace soit en allant en traineaux, ou glissant en Patins Mat.: auf Leinwand Maße: haut de 18 & large de 21 pouces Anm.: Die Lose 25 und 26 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1775/05/08 HBPLK 0078 L. Chalon I Zwo Landschaften, beyde mit Wasserfällen, meisterhaft gemahlt, auf Leinewand. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Wasserfall Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 18 Zoll 5 Linie, Breite 15 Zoll 7 Linie Anm.: Die Lose 78 und 79 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1775/05/08 HBPLK 0079 L. Chalon I Zwo Landschaften, beyde mit Wasserfällen, meisterhaft gemahlt, auf Leinewand. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Wasserfall Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 18 Zoll 5 Linie, Breite 15 Zoll 7 Linie Anm.: Die Lose 78 und 79 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 458
GEMÄLDE
1775/11/18 HBBMN 0087 L. Chalon I Zwey schöne plaisante Landschaften. I Diese Nr.: Eine schöne plaisante Landschaft Anm.: Die Lose 87 und 88 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1775/11/18 HBBMN 0088 L. Chalon I Zwey schöne plaisante Landschaften. I Diese Nr.: Eine schöne plaisante Landschaft Anm.: Die Lose 87 und 88 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1785/05/17 MZAN 0327 Chalons I Zwey Stücke, welche Gestade vorstellen, wo man Schiffe ausladet und belastet von Chalons. [Deux tableaux representans des bords de riviere, ou l'on est occupe ä charger & decharger des vaisseaux.] I Diese Nr.: Ein Stück, welches ein Gestade vorstellt, wo man Schiffe ausladet und belastet Maße: 10 Zoll hoch, 1 Schuh 1 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 327 und 328 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (22 fl für die Nrn. 327 und 328) Käufer: Rmus D Custos L Β ä Zobel 1785/05/17 MZAN 0328 Chalons I Zwey Stücke, welche Gestade vorstellen, wo man Schiffe ausladet und belastet von Chalons. [Deux tableaux representans des bords de riviere, ou l'on est occupe ä charger & decharger des vaisseaux.] I Diese Nr.: Ein Stück, welches ein Gestade vorstellt, wo man Schiffe ausladet und belastet Maße: 10 Zoll hoch, 1 Schuh 1 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 327 und 328 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (22 fl für die Nm. 327 und 328) Käufer: Rmus D Custos L Β ä Zobel 1790/08/25 FRAN 0351 Chalon I Eine Sommer= und eine Winterlandschaft. I Diese Nr. : Eine Sommerlandschaft Maße: hoch 26 Zoll, breit 32 Zoll Anm.: Die Lose 351 und 352 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (30.30 fl für die Nm. 351 und 352) Käufer: Lieut Brönner 1790/08/25 FRAN 0352 Chalon I Eine Sommer= und eine Winterlandschaft. I Diese Nr.: Eine Winterlandschaft Maße: hoch 26 Zoll, breit 32 Zoll Anm.: Die Lose 351 und 352 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (30.30 fl für die Nrn. 351 und 352) Käufer: Lieut Brönner
Chalon, Louis (Manier) 1785/05/17 MZAN 0780 Chalon I Eine Landschaft in Chalons Manier. [Un paysage dans le gout de Chalon.] I Maße: 11 Zoll hoch, 6 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (7 fl) Käufer: Zitz
Champaigne, Philippe de 1785/05/17 MZAN 0146 Philipp de Champagne I Ein poetisches Stück von Philipp de Champagne. [Une piece poetique.] I Maße: 4 Schuh 8 Zoll hoch, 6 Schuh breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Unverkauft 1787/00/00 HB AN 0662 Philip de Champagne I Das Portrait des berühmten Ministers Theodor de Baise, mit kleinem Zwickelbart, großem Huth und schwarzer Kleidung. Brustbild. Von vortrefflicher Zeichnung, angenehmem Colorit und meisterhafter Mahlerey. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll, breit 16 Zoll Transakt.: Verkauft (18.4 M) Käufer: Tietjen
Champaigne, Philippe de (Kopie nach) 1800/06/03 BLAN 0017 Kretschmer; nach Champagne I Ein Madonnen-Kopf, in Oel auf Leinwand in Holzrahm. I Kopie von J.C.H. Kretschmar nach P. Champaigne Mat.: Öl auf Leinwand Maße: Höhe 25 Zoll, Breite 19 Zoll Transakt.: Verkauft (5.8 Rt) Käufer: Lieut Werder
Chapron, Nicolas 1789/00/00 MM AN 0031 Nikolas Carapron I Ein Bacchanal, auf Tuch. [Une Orgie, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 10 Zoll hoch, 1 Fuß 6 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (30 Kr) 1796/02/17 HBPAK 0087 Chaperon I In einer gebirgigten Gegend sieht man die Vorstellung, wie dem Bacchus ein Bock geopfert werden soll. Im Vordergründe zur Rechten steht ein Monument von Stein, worauf eine dergleichen Abbildung en bas relief eingehauen. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 13 % Zoll, Breite 23 % Zoll Transakt.: Verkauft (83 M) Käufer: Τ 1796/02/17 HBPAK 0174 Chaperon I Venus nebst Tritonen und Genien im Triumph auf dem Meere. Auf Holz. Runden Formats. I Mat.: auf Holz Format: rund Maße: Höhe 11 Ά Zoll, Breite 11 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (25 M) Käufer: Packi 1800/07/09 HBPAK 0006 Chaperon I Bacchus, une lance a la main, sur le devant une femme assise ä sa Droite tenant un Enfant, derriere, un faune buvant dans un Vase, plus loin une jeune femme dansant et jouant du tambourin, plusieurs autres figures accessoires, qui prenent part ä la Scene. Ce tableau savament compose est sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: De 40 pouces de hauteur. Sur 53 pouces de largeur Transakt.: Unbekannt
Chardin, Jean Baptiste Simeon 1789/00/00 MMAN 0257 Chartin I Ein Kaninchen und Feldhuhn, auf Leinw. [Un chien canard et une perdrix, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 5 Zoll hoch, 2 Fuß 5 Zoll breit Anm.: In der Taxierungsliste von 1789 ist das Gemälde dem "alten Houdekooter" zugeschrieben. Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt
Charpentier 1796/12/07 HBPAK 0012 Charpentier I Ein Mädchen mit einem Knaben, die Weintrauben pflücken. I Transakt.: Unbekannt
Chavaner [Nicht identifiziert] 1796/02/17 HBPAK 0191 Chavaner I Eine felsigte römische Landgegend. Zur Rechten im Vordergrunde ist eine Wasser=Mühle. Am Ufer reitet ein Falkanir. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 25 Vi Zoll, Breite 20 % Zoll Transakt.: Verkauft (40 M) Käufer: Janssen
Cheverie [Nicht identifiziert] 1788/01/15 LZRST 3935 Cheverie I 2 St. Maskeraden, von Cheverie, gut ausgeführt, 14 Zoll hoch, 16 Zoll breit, in vergold. Rahm. I Maße: 14 Zoll hoch, 16 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (6 Th) Käufer: C R
Cignani, Carlo 1742/08/01 BOAN 0585 Carolo Signani I Eine Mater Dei und Simeon im Tempel. Orig. vom Carolo Signani. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0082 Carolo Signano I Une fable d'Ovide par Carolo Signano. I Maße: Haut 3. p. 8. pou. large 3. p. 1. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0191 Charles Signani I La Presentation de la Sainte Vierge au Temple, par Charles Signani. I Maße: Haut 3. pies, large 3. pies 6. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt
1750/10/15 HB AN 0017 Cignano (Carl) I Maria mit dem Kinde und Joseph. I Maße: 4 Fuß 9 Vi Zoll hoch, 3 Fuß 9 % Zoll breit Transakt.: Unbekannt (105) 1750/10/15 HB AN 0018 Cignano (Carl) I Die Charite. I Maße: 1 Fuß 1 Zoll hoch, 1 Fuß 3 Zoll breit Transakt.: Unbekannt (36) 1777/05/26 FRAN 0560 Cignani I Kind von Cignani aus Bossonien. I Verkäufer: Finsterwalder Transakt.: Verkauft (3 fl) Käufer: Hofrath Gerken 1779/00/00 HB AN 0151 Carlo Cignani I Eine sitzende Mutter hat ein Kind an ihrer rechten Brust; eins ruhet in ihrem linken Arme, ein drittes liegt eingewickelt und schlafend in der Wiege. Sie hebt ein weißes Gewand auf, womit das letztere zugedeckt ist. [Une mere assise tient un enfant ä la mamelle droite, un second repose sur son bras gauche, & un troisieme en maillot dort dans un berceau. Elle decouvre un drap blanc dont ce dernier est couvert.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß hoch, 1 Fuß 3 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1787/00/00 HB AN 0169 C. Cygniany I Eine Frau sitzt im Vordergrunde auf der Erde, in ein purpurnes Gewand gehüllt, und sieht weinend mit einer besonders trauriger Miene auf den vor ihr auf der Erde liegenden sterbenden nackten Knaben herab, welcher in ihrem rechten Arm ruhet. Hinter der Frau liegt ein anderer Knabe über ihren Schooß, welcher seine weinende Augen mit den Händen reibet. Im Hintergrunde wird man einer dunklen Luft gewahr, welche diese Trauer=Scene sehr veredelt. Die Zeichnung ist durchgängig richtig. Die Haltung von dem angenehmen Colorit ziehet das Auge des Kenners an sich. Ueberhaupt ist dieses Cabinetstück für wahre Kenner ein kostbares Gemähide. [G.F. fast Lebensgr.] A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 41 Zoll, breit 30 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (250 M) Käufer: Fesser 1787/00/00 HB AN 0332 Carl Cygniani I Die Faulheit. Im Hintergrunde eine Landschaft. Halbe Figur. A.K. [Auf Kupfer] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 8 Ά Zoll, breit 7 % Zoll Transakt.: Verkauft (12.4 M) Käufer: Tietjen 1793/00/00 HBMFD 0015 Carlo Cigmani f Taufe Christi. Der Hintergrund stellet eine Landschaft vor; vorne eine Erhöhung mit einigen Bäumen, wo der Jordan vorbei fliesst. Der Erlöser steht in den Fluss, mit Kreutzweis über der Brust gelegten Armen, ganz en face St. Jean, schüttet mit der hohlen Hand ihm das Wasser übern Kopf. Der heilige Geist, in der Gestalt einer Taube, kömmt von oben herunter, und dessen Klarheit beleuchtet die ganze Gruppe. Jenseits des Flusses zur Linken sieht man 5 ä 6 kleine Figuren die sich baden. Dieses Gemälde ist ganz im Geschmack des Carache, und mit viel Studium gearbeitet. Das sanfte des Pinsels, der treffende Ausdruck des Lichts, die Wahrheit des Colorits, die bestimmte Ausführung, und eine ungewöhnliche Uebereinstimmung, verbreitet auf diesem Gemälde einen bezaubernden Reitz. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuss 1 Zoll hoch, 8 Vi Zoll breit Verkäufer: Pierre Laporterie Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV 0060 Carlo Cignari I Auf einem sammtnen Polster sitzt ein nackend Kind, welches nach der Uhr hin zeigt. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 27 Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Unbekannt
Cignani, Carlo (und Nuzzi, M.) 1791/09/21 FRAN 0063 Carlo Cigniani; Die Blumen von Mario Nazzi I In der Mitte unter einer Felsenkluft ist eine busfertige Magdalena mit Blumen umgeben; dieses Gemälde verdienet viele Achtung und macht eine schöne Wirkung. I Transakt.: Verkauft (33 fl) Käufer: Emerich GEMÄLDE
459
Cignani, Carlo (Kopie nach)
Claes, Isaac [Nicht identifiziert]
1788/09/01 KOAN 0176 Carlo Cignane I Bachanalia Fest, nach Carlo Cignane. [1 p[iece]. de Baccanale, de Satyren selon Carlo Cignane.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 6 Zoll, Breite 2 Fuß Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt
1799/00/00 WZAN 0438 Isaac Claes I Der vom Tode erstandene Christus, mit vielen Engeln, den Himmel vorstellend, von Isaac Claes. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 4 Zoll breit 1 Schuh Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1800/06/03 BLAN 0004 Strantz; nach Cignani I Der keusche Joseph mit Potifars Weib, in Oel auf Leinwand. I Kopie von Stranz (Strantz) nach C. Cignani Mat.: Öl auf Leinwand Maße: Höhe 24 Zoll, Breite 25 Zoll Transakt.: Verkauft (3 Rt) Käufer: Lieut ν Werder 1800/06/03 BLAN 0008 L. Hoppe; nach Cignani I Amor und Psyche, in Oel auf Leinwand, mit schwarzen Rahm und vergoldetem Leistchen. I Kopie von L. Hoppe nach C. Cignani Mat.: Öl auf Leinwand Maße: Höhe 25 Zoll, Breite 18 Zoll Transakt.: Verkauft (4.16 Rt) Käufer: Lesser 1800/06/03 BLAN 0010 Kuhbeil; nach Cignani I Kinder beklagen den Tod einer Taube, in Oel auf Leinwand, in schwarzen Rahm mit vergoldetem Leistchen. I Kopie von C.L. Kuhbeil nach C. Cignani Mat.: Öl auf Leinwand Maße: Höhe 25 Zoll, Breite 30 Zoll Transakt.: Verkauft (5.8 Rt) Käufer: Lieut ν Werder
Cignaroli 1763/00/00 BLAN 0009 M. Zigmarolli I Circe. Halbe Figur, Lebensgröße, auf Leinewand gemahlt, 2 Fuß 6 Zoll hoch, und 2 Fuß breit. Sie legt die rechte Hand auf ein Buch, das nur halb aufgeschlagen ist, und in der linken hält sie den Zauberstab. Die Austeilung des Lichts und Schattens ist voll Kunst angebracht, das Colorit frey und die Zeichnung in dem Geschmacke des Coreggio, nach dessen Gemählden, besonders nach denen die in Parma in einer Kirche sich befinden, Zigmarolli einige Jahre gearbeitet hat. Dieses Stück ist das erste, welches nach Deutschland gekommen ist und wodurch er bekannt worden. Der Graf Accoromboni ließ es verfertigen, brachte es nach Dreßden und zeigete es Ihro Majestät. Hernach bekam es der Herr von Heinecke. Remy beschreibt es in seinen Catalogus. [Text hier gekürzt] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 6 Zoll hoch, 2 Fuß breit Verkäufer: Johann Gottlieb Stein Transakt.: Unbekannt 1789/00/00 MMAN 0286 Zingarolo I Mater modestissima, auf Leinw. [Une tres modeste, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 7 Zoll hoch, 1 Fuß 2 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (22 fl)
Cigoli (Ludovico Cardi) 1742/08/01 BOAN 0034 Cigalla I Noch zwey Lebens-grosse Ovidische Stuck, beyde Originalien von Cigalla. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0015 Cigala I Deux fables d' Ovide, par Cigala. I Maße: haut 6. p. 8. pou. large 5. p. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1799/12/23 WNAN 0012 Cigoli I Une Madelaine agonisante par Cigoli sur Toile. I Mat.: auf Leinwand Transakt.: Unbekannt
Circignani, Antonio (II Pomarancio) 1764/05/21 BOAN 0028 Ant. Pommeranci I Un tableau de cinq pieds six pouces de hauteur & sept pied de largeur, representant Jesus Christ allant ä Emaus avec quelques uns de ses Disciples en figures de grandeur naturelle, peint par Ant. Pommeranci. [Ein stück Vorstellend Christum mit einigen jüngeren zu Emaus in gantzen figuren Lebensgröße Von Anton Pomeranci.] I Maße: 5 pieds 6 pouces de hauteur & 7 pied de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (63.40 Rt) Käufer: Herstatt Gegenw. Standort: K0benhavn, Danmark. Statens Museum for Kunst. (1181?) 460
GEMÄLDE
Claesz., Pieter 1750/06/15 HBRAD 0015 Pieter Classen I Pieter Classen, ein extra natürliches Still=Leben. I Transakt.: Unbekannt 1775/11/18 HBBMN 0073 Piter Classen I Ein dito [schön und natürliches Still=Leben]. I Transakt.: Unbekannt 1776/11/09 HBKOS 0120 Pieter Ciaassen I Ein Still=Leben mit Silber= und Glas=Geschirr und eine ausgeschnittene Citrone, auf Holz, im schwarzen Rahm mit verguldete Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 2 Fuß 6 Zoll, Breite 1 Fuß 10 Zoll Transakt.: Verkauft (8.4 M) Käufer: Kost[er] [und] Ehrenr[eich] 1777/02/21 HBHRN 0098 Pit. Ciaassen I Ein schönes S t i l l l e ben. I Maße: Höhe 2 Fuß 9 Zoll, Breite 2 Fuß 4 Zoll Transakt.: Unbekannt 1788/08/21 HBRMS 0094 Pieter Classen I Ein Stillleben mit einem Römer Wein u.s.w. Auf Leinewand, schwarzen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 25 Zoll, breit 18 Zoll Transakt.: Verkauft ( I M ) Käufer: Westphalen 1794/00/00 HB AN 0106 Pet. Klaase, so gut wie de Heem \ Ein Stillleben. Auf einem Tische sieht man einen Teller mit Pastete, Messer, Krug und Gläser. I Maße: Höhe 17 Zoll, Breite 24 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0064 J. P. Claess, 16481 Ein schönes und meisterhaft gemahltes Stilleben. Auf einem mit einen Teppich belegten Tische stehet ein Römer mit Wein, daneben liegen einige Weintrauben und Kastanien; vorne liegt eine durchschnittene und halb abgeschahlte Citrone bey einem Teller. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 28 Zoll, breit 22 Zoll Inschr.: 1648 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0107 P. Classen I Ein Stilleben, worauf ein Tisch mit einem Römer voll Wein, nebst Weintrauben und andern Früchten mehr. Auf Holz. Schwarzer Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 8 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0061 Pieter Ciaass I Ein gedeckter Tisch, mit Pokalen und Speisen. Fisch, Obst, Brod, Citronen, welsche Nüsse, u.s.w. sind bewundernswürdig=täuschend nach der Natur getroffen, und das Ganze ein sehr unterhaltendes Bild. Auf Leinwand, mit vergoldeten Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 30 Zoll, breit 25 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0211 P. Classen I Eine inwendige Nische mit einen Römer mit Wein und einen silbernen Teller mit Brodt, nebst Pfirschen. Auf Holz, mit schwarzen Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 26 Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Unbekannt
Classen, P. [Nicht identifiziert] 1796/12/07 HBPAK 0237 P. Classen I Zwey Landschaften mit Figuren. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren Anm.: Die Lose 237 und 238 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0238 P. Classen I Zwey Landschaften mit Figuren. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren Anm.: Die Lose 237 und 238 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Claude Lorrain (Claude Gellee) 1670/04/21 WNHTG 0098 Claudio di Lorena I Un Paese di Claudio di Lorena. I Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0494 Clode Loraine I Eine Landschafft, von Clode Loraine Orig. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0594 Cloth, de Loraine I Eine Landschafft auf Kupffer. Origin, von Cloth, de Loraine. I Mat.: auf Kupfer Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0193 Claude de Lorraine I Un Pay sage sur cuivre, par Claude de Lorraine. I Mat.: auf Kupfer Maße: Haut 1. pie 1. pouce, large 1. pie 5. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0282 Claude de Lorraine I Deux pay sages, par Claude de Lorraine. Couple. I Maße: Haut 1. pied 8, pouces. larges 2. pies 3. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0390 Claude de Lorraine I Un pa'isage, par Claude de Lorraine. I Maße: Haut 1. pied 3. pou. large 1. pied 8. pouc. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0098 Claude Lorraine I Eine Landschaft von Claude Lorraine. I Maße: hoch 1 Fuß 5 Zoll, breit 2 Fuß Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0043 Claude Gielis de Loraine I Le soleil couchanz [sie], belle piece, sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: Largeur 2 Pies 1 Vi Pouces, Haut 17 Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1750/10/15 HB AN 0067 Lorrain (Claude) I Eine Landschafft mit Figuren, ein Nachtstück. I Maße: 1 Fuß 11 Vi Zoll hoch, 1 Fuß, 7 Zoll breit Transakt.: Unbekannt (12) 1764/08/25 FRAN 0481 Claude le Lorrain I Un dito [pa'isage]. I Maße: haut 1 pied 2 Vi pouces sur 1 pied 6 pouces de large Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1764/08/25 FRAN 0505 Claude le Lorrain I Un pa'isage. I Maße: haut 2 pieds 11 pouces sur 1 pied 8 pouces de large Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0084 Gelee (Claudius Lorraine) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0095 Gelee (Claudius Lorraine) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0096 Gelee (Claudius Lorraine) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0275 Gelee (Claudius Lorraine) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0889 Gelee (Claudius Lorraine) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
1769/00/00 MUAN 0057 Claude Lorrain I Un port de Mer, qui represente le Soleil levant. Peint sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: 1. p. 11. p. de haut sur 2. p. 3. p. de large Verkäufer: Fran5ois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1778/05/16 HBBMN 0061 Claude Lorin \ Eine vorzüglich schöne Landschaft. I Transakt.: Unbekannt 1778/08/29 HB TEX 0001 Claude Lourin \ Eine Landschaft. Maße: Höhe 1 Fuß 8 Zoll, Breite 2 Fuß 6 Zoll Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0157 Claude Lorrain I Zur Linken vor einem Gebäude unter hohen Bäumen läßt die Tochter Pharaos, von ihren Gespielinnen begleitet, den jungen Moses aus dem Kästchen nehmen. Zur Rechten führt eine Brücke zu den Ziegelbrennereyen der Israeliten. Gegen über liegt an hohen Ufern des Nils eine Stadt, die sich bis in die blaue Ferne erstreckt. [La fille de Pharaon, placee ä gauche & entouree de ses compagnes, fait tirer le jeune Moi'se de la corbeille. La scene qui est devant un edifice sous des arbres eleves, offre vers la droite un pont, qui mene aux fours ä brique des Israelites. Vis-ä-vis est situe sur les rives du Nil une ville qui s'etend jusqu'au lointain azure.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 3 Fuß 5 Zoll hoch, 4 Fuß 10 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0158 Claude Lorrain I An einem Brunnen, der unter grünen Bäumen am Fuße eines Berges liegt, hilft Jakob der Rahel ihre Schafe tränken, indem er die neidischen Hirten mit ihren Schafen entfernet. Auf dem Berge erblickt man etwas von einer Stadt, und durch fruchtbare Felder sieht man zur Linken ins ferne Gebirge. [Jacob aide Rachel ä abreuver son troupeau ä une fontaine construite au pied d'une montagne. II ecarte les bergers envieux & leurs brebis. Sur la montagne, on appergoit une ville, & la vue s'etend ä gauche sur des champs fertiles, jusqu'ä des montagnes, eloignees.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 3 Fuß 5 Zoll hoch, 4 Fuß 10 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0247 Claude Lorrain I Ein Seesturm, wo Schiffe an einem Felsen, der zur Rechten sich erhebt, und mit Gesträuch bewachsen ist, scheitern. Auf Holz. [Une tempete oü des vaisseaux echouent contre un rocher, qui s'eleve de la droite & qui est couvert de broussailles. Sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 9 Zoll hoch, 2 Fuß 4 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0254 Claude Lorrain I Eine Menge Menschen ziehen über eine Brücke zu einem antiken Tempel. Im Vorgrunde fällt ein kleiner Bach über einen Absatz, an dessen linken Ufer schattichte Bäume stehen. Auf dem Rücken der fernen Berge stehen einige Schlösser in Wäldern. [Une foule de personnes, traversant un pont, se rendent ä un temple antique. Sur le devant une petite cascade formee par un ruisseau, dont la rive gauche est ombragee d'arbres touffus. Sur la pente des montagnes lointaines sont quelques chateaux entoures de bois.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 3 Zoll hoch, 2 Fuß breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0205 Claude Gelee, dit le Lorrain I Une Marine, oü se voit sur la droite plusieurs Vaisseaux, sur le milieu dans le fond une Ville, sur le devant un Fort, & un autre Fort termine la gauche, plusieurs Personnages s'amusent ä la peche. Tout le monde sait qu'on appelle ce maitre, le Pere de la lumiere, il le prouve bien dans ce Tableau qui est d'une chaleur, d'une perspective, d'un transparent, & d'un lointain le mieux menage, enfin c'est un des plus beaux du maitre. II est peint sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: 16 pouces 6 lignes de haut, sur 27 pouces 6 lignes de large Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0206 Claude Gelee, dit le Lorrain I Ruine d'un Port de la Grece, oü se voit sur la droite une quantite de colonnes, devant plusieurs Turcs; dans le fond, le reste du Fort, sur la gauche une Piramide, ä cöte un Vaisseau en rade &c. Tableau peint sur GEMÄLDE
461
bois. I Mat. : auf Holz Maße: haut 20 pouces 6 lignes, large 24 pouces Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0068 Glaude Lorraine I Eine Landschaft. [1 p[iece]. de paysage.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 1 Zoll, Breite 9 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0405 Lorrain Claud. I Eine Landschaft mit der Geschichte von der Wanderung des Tobias, auf Holz, in einer geschnittenen und vergoldeten Ram. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 7 Zoll, Breite 2 Schuh 2 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1791/09/21 FRAN 0078 Claude Lorrain I Eine Landschaft, wo zur Linken die Ruinen eines alten Schloßes sind, unten und vorne zu sind drey Figuren, und zur Rechten die Aussicht eines Flusses, so mit Schiffen gezieret ist; dieses Gemälde, so von der seltensten Classe, verdienet die Aufmerksamkeit der Liebhaber. I Transakt.: Verkauft (70.15 fl) Käufer: Trautmann 1793/00/00 NGWID 0116 Claudius Gelee I Eine felsigte Landschaft, mit einer sehr angenehmen Aussicht, von Claudius Gelee. I Maße: 2 Schuh 3 Zoll hoch, 3 Schuh 4 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0137 Glot la Raing, oder Claudius Gelee I Drey badende Mädchen, welche im Begriff sind, dem Wasser zu entsteigen, alles dieses in einer angenehmen Landschaft, sehr gut ausgeführt von Glot la Raing, oder Claudius Gelee. I Maße: 2 Schuh 9 Zoll hoch, 2 Schuh 4 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0223 Claudius Gelle I Eine sehr angenehme Landschaft, nebst einer Brücke über einen Fluß nebst einigen badenden Figuren staffirt, von Claudius Gelle. I Pendant zu Nr. 224 Maße: 2 Schuh 8 Zoll hoch, 3 Schuh 8 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0224 Claudius Gelle I Zum Gegenstück, ein herannahendes Gewitter ohnweit einer naheliegenden Stadt, mit eben dem Fleiß sehr gut ausgeführt, vom nemlichen Meister [Claudius Gelle] und Maaß. I Pendant zu Nr. 223 Maße: 2 Schuh 8 Zoll hoch, 3 Schuh 8 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 HB AN 0015 Claude Gelee, genannt Lorrain I Eine bergigte Landschaft wird von einem Flusse, in welchem Giessbäche herabstürzen, durchschnitten; über den einen Arm desselben führt im Vorgrunde eine kleine Brücke, auf welcher Vieh, die sich ins Gebürge verlierende Landstrasse, entlang getrieben wird. Linker Hand der Brücke, ganz im Vordergrunde, steht eine trefliche Gruppe von Bäumen, unter denen sich auf einem Baumstamme zwey Bauren, neben einem stehenden Frauenzimmer, gesetzt haben. Im Mittelgrunde erhebt sich, dichte am Wasser, eine Rotunde, über die ferne Berge emporsteigend, sich in warmer, durch Sonnenlicht blendender Luft, verlieren. I Maße: Höhe 31 Zoll, Breite 42 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 HB AN 0089 Claude Lorrain I In einer lieblichen Landschaft bringen einige griechische, mit Rosen umkränzte Mädchen, in Gesellschaft einer Priesterin des Gottes, dem Apollo ihr Opfer. I Maße: Höhe 19 Vi Zoll, Breite 27 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1794/09/09 HBPAK 0137 C. Lorrain I Eine vortrefliche waldigte Gegend, Jacob erscheinet mit sein Gefolge und Camelen wie auch eine Heerde Schafe bey dem Brunnen, wo Rebecca die ihrigen tränken will, alle beschäftigen sich den Stein abzuwälzen. Vorzüglich schön gemahlt. Auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 48 Zoll, breit 56 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/00/00 BSAN 0014 Claude Gelee, dit le Lorrain I Paysage du plus beau fini. Une riviere passe sous un pont de pierre, et se perd dans un lointain varie d'habitations, de collines et de montagnes. 462
GEMÄLDE
Pres du pont sont des lavandieres. Sur le devant, au bord de l'eau, sont neuf figures: une femme assise au pied d'un roc; un berger jouant de la cornemuse; un grouppe de deux femmes qui dansent avec un homme; un autre de trois personnes assises; et enfin une femme seule. Les jeux de l'ombre et de la lumiere, le feuille des arbres et la beaute des eaux sont dignes de Claude Lorrain. C'est un morceau tres precieux. I Mat.: auf Leinwand Maße: Haut de 1 pied 10 pouces; large de 2 pied 3 pouces Verkäufer: Merian l'aine Transakt.: Unbekannt (125) 1796/02/17 HBPAK 0002 Claude Lorrain I Eine italienische Gegend mit Colonaden=Gebäuden. In der Mitte, im Vordergrunde, sitzt einer, der zeichnet; neben und hinter demselben, über einem kleinen Flusse, sind verschiedene Heerden von Schaafen, Rindern und Ziegen, nebst ihren Hirten. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 26 Zoll, Breite 43 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (180 M) Käufer: Τ 1796/11/02 HBPAK 0023 Claude le Lorrain I Eine bergigte mit Wald bewachsene Landschaft, wo in der Mitte derselben ein Fluss fließt, über dem eine Brücke, worüber Hirten ihr Vieh nach dem Wald treiben; im Vordergrunde unter hohen Eichen, befinden sich einige Landleute so sich mit einander unterhalten. Dieses Bild ist in Ansehung der Composition, Lichts und Schattens, nebst Colorits, eines der besten Gemähide dieses Meisters. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 30 Zoll, breit 45 Zoll Transakt. : Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0242 Claude le Lorain I Eine gebirgigte und waldigte Landschaft, zur rechten sieht man das Ende einer Colonade, welche sich mit einem Tempel endigt, vor demselben ein Junge, mehr am Fuße des Berges und am Ufer des Flußes ein Schäfer, und Schäferin, deren Schaafe herum weiden; zur linken ein hoher starker Baum, in der Entfernung ein Dorf: Nebst noch verschiedenen andern Gegenständen. Meisterhaft und sehr angenehm gemahlt. Auf Leinw., goldenen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 27 Vi Zoll, breit 34 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/10/17 LZAN 0049 Claude le Lorain I Eine Landschaft an der See, beym Untergange der Sonne; zur Linken sieht man ein altes Schloss, vor demselben sind verschiedene Figuren, vome in der Mitte stehen dreye, welche mit einander sprechen, hinter und neben ihnen ziehen Fischer ihre geworfenen Netze; mitten auf dem zweyten Plane sind mehrere Schaluppen und Fischerböte, rechts die offene See; im Grunde bemerkt man eine Erdspitze, darauf eine Veste. Dieses Bild, obgleich von den ersten Jahren dieses Meisters, ist mit viel Stärke gemahlt; hoch 30 Z. br. 46 Z. Auf Leinwand; in einem reich vergoldeten Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 30 Z. br. 46 Z. Verkäufer: Rauch Transakt.: Verkauft (39 Th) Käufer: Blümner 1800/00/00 FRAN2 0039 Lorrain (Claud.) I Ein asiatischer Seehaffen bey Sonnenaufgang Im vorderen Plan sind einige Ueberbleibsel von architektischen Denkmähler, linker Seite ist eine Befestigung, welche die Einfahrt in den Hafen anzeuget; mehrere Schiffe siehet man auf der Küste liegen nebst vielen Figuren. Dieses Stück ist vor allem Heiß und Schönheit von gedachtem Künstler seinem berühmte Pinsel. I Mat.: auf Leinwand Maße: 24 Zoll hoch, 29 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN2 0040 Lorrain (Claud.) I Ditto [Claud. Lorrain]. Eine schöne Marine bey Sonnenuntergang. Im vordem Plan sind mehrere Personen mit Ausladung eines Schiffes beschäftiget. In der Mitte des Stücks liegt ein Kriegsschiff. Der Hintergrund bietet die Aussicht auf das offene Meer dar, auf welchem mehrere Schiffe und Barken eine schöne Vorstellung machen. I Mat.: auf Leinwand Maße: 34 Zoll hoch, 44 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN2 0087 Claude Gelee (genannt Lorain) I Ein Seestück. Man sieht vome auf dem ersten Plan verschiedene stehende Figuren, andere scheinen mit Abladung der Waaren beschäftigt; links steht eine dreymastige Fregatte, rechts ein Fischerboot; die
hierin herrschende Harmonie, und die gegen den Horizont sich zu erheben scheinende Duft, empfehlen jedem Kenner die Vollkommenheit dieses Bildes. I Mat. : auf Leinwand Maße: 15 Zoll hoch, 41 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1800/07/09 HBPAK 0001 Claude Lorrain I Ce tableau tres capital represente une Vue de Tivoli, par un soleil couchant lumineux. Un Troupeau et des Bergers traversent un Ruisseau dont l'Eau transparente reflechit de grandes masses d'arbres. La fraicheur qui regne dans ce beau paysage, parfaitement conserve le rend digne de l'attention des amateurs. Sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: 42 pouces de hambourg en hauteur, 55 en largeur Transakt.: Unbekannt
Claude Lorrain (Claude Gellee) (und Courtois, J.) 1798/06/04 HBPAK 0290 Claude Gelee, genannt le Lorrain; Die Figuren von Jac. Courtois, genannt Bourguignon I Zwey sehr kostbare Landschaften, von der besten Art obiger grossen Künstler. Die eine stellt Felsen vor, auf welchen ein Schloß sich befindet. Am Fusse derselben, ruht sich eine von der Jagd gekommene Gesellschaft aus, und im Vordergrunde sind mehrere Jäger mit Pferden, Hunden ec. Das Gegenstück zeigt einen hohen Berg mit einem Wasserfall, und vorne Reisende auf Maulthieren, und verschiedene andere Figuren, die diesen vortreflichen Stücken (deren Haltung, Baumschlag und Effect der Luft aufs vollkommenste ist), den größten Werth geben, der sie zur Aufnahme in die ersten Sammlungen berechtigt. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine sehr kostbare Landschaft stellt Felsen vor, auf welchen ein Schloß sich befindet; Pendant zu Nr. 291 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 25 Zoll Anm.: Die Lose 290 und 291 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0291 Claude Gelee, genannt le Lorrain; Die Figuren von Jac. Courtois, genannt Bourguignon I Zwey sehr kostbare Landschaften, von der besten Art obiger grossen Künstler. Die eine stellt Felsen vor, auf welchen ein Schloß sich befindet. Am Fusse derselben, ruht sich eine von der Jagd gekommene Gesellschaft aus, und im Vordergrunde sind mehrere Jäger mit Pferden, Hunden ec. Das Gegenstück zeigt einen hohen Berg mit einem Wasserfall, und vorne Reisende auf Maulthieren, und verschiedene andere Figuren, die diesen vortreflichen Stücken (deren Haltung, Baumschlag und Effect der Luft aufs vollkommenste ist), den größten Werth geben, der sie zur Aufnahme in die ersten Sammlungen berechtigt. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine sehr kostbare Landschaft zeigt einen hohen Berg mit einem Wasserfall; Pendant zu Nr. 290 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 25 Zoll Anm.: Die Lose 290 und 291 wurden zusammen katalogisiert. Transakt. : Unbekannt
Claude Lorrain (Claude Gellee) (und Lauri, F.) 1799/00/00 WZAN 0005 Claudius Gelee genannt Claude Lorrain; Philipp Lauri I Johannes der Täufer, predigend in der Wüste; die Landschaft ist von Claudius Gelee genannt Claude Lorrain, und die Figuren von Philipp Lauri. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 7 Zoll, breit 3 Schuh 4 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Claude Lorrain (Claude Gellee) (Kopie nach) 1792/08/20 KOAN 0072 Claude Loreen I Eine Landschaft, worauf der Schäfers=Jung den Schaafen auf der Feldflauten pfleift [sie], und ein schönes Mädchen auf einem Esel reitet, nach Claude Loreen, so gut, als von ihm selbst. I Maße: 1 Schuh 6 ¥2 Zoll hoch, 10 '/2 Zoll breit Anm.: Im Exemplar KH wurde der Name handschriftlich "nach Claude Loreen" in "von Claude Loreen" korrigiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN2 0015 Courtois; Claude Lorrain I Eine schöne Copie nach Clande [sie] Lorrain. Eine Landschaft mit Vieh vorstellend. I Kopie von J. Courtois nach Claude Lorrain Mat.: auf Leinwand Maße: 25 Zoll hoch, 38 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Claude Lorrain (Claude Gellee) (Manier) 1782/09/30 FRAN 0494 Claude Lorrain I Eine Abendlandschaft in der Manier von Claude Lorrain. [Un paysage en tems de soiree, dans la manifere de Claude Lorrain.] I Maße: 11 Zoll hoch, 1 Schuh 1 Vi Zoll breit Anm.: Dieses Los wurde zusammen mit den Nm. 495 bis 501 (J. Tintoretto) verkauft. Verkäufer: Heinrich Dominicus von Heyden Transakt.: Verkauft (150 fl für die Nm. 494-501) Käufer: Grahe
Claude Lorrain (Claude Gellee) (Schule) 1742/08/01 BOAN 0433 Claud de Loraine I Zwey schöne Landschafften von der Schuhle vom Claud de Loraine. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt
Claude Lorrain (Claude Gellee) (zugeschrieben) 1799/00/00 LZRCH 0096 Attribue ä Claude Le Lorrain I Un beau paysage avec figures: des eaux et une masse d'arbres; l'effet de ce tableau, fait remarquer la vapeur des eaux. I Mat.: auf Leinwand Verkäufer: J F Rauch Transakt.: Unbekannt
Clerck, Hendrik de 1799/00/00 WZAN 0339 Heinrich de Klerck I Ein Faun. Grau in Grau. Von Heinrich de Klerck. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 3 V2 Zoll breit 11 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Cleve, Cornells van (oder Cleve, Joos van) 1670/04/21 WNHTG 0070 Sötte Cleeff] Nostra Signora con il Bambino Giesü. I Maße: Alto p. 2, e 8. dita, largo due Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt 1670/04/21 WNHTG 0071 Sötte Cleeff \ Nostra Signora circondata da molti Angeli. I Maße: Alto 1. e 8, largo 1. e 3. Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt 1670/04/21 WNHTG 0072 Sötte Cleeff \ Un Ballo di 20. e piü figure. I Maße: Alto tre palmi, e dieci dita, largo cinque palmi, e mezzo Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt
Cleve, Joos van (oder Cleve, Corn, van) Claude Lorrain (Claude Gellee) (Geschmack von) 1797/08/10 MM AN 0020 Claude I Eine d[itt]o Landschaft im Geschmak von Claude mit Viehe und Figuren, die Aussicht auf einen Fluß. auf Tuch. I Mat.: auf Leinwand Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (11 fl Schätzung)
1670/04/21 WNHTG 0070 Sötte Cleeff I Nostra Signora con il Bambino Giesü. I Maße: Alto p. 2, e 8. dita, largo due Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt 1670/04/21 WNHTG 0071 Sötte Cleeff \ Nostra Signora circondata da molti Angeli. I Maße: Alto 1. e 8, largo 1. e 3. Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
463
1670/04/21 WNHTG 0072 Sotte Cleeff \ Un Ballo di 20. e piü figure. I Maße: Alto tre palmi, e dieci dita, largo cinque palmi, e mezzo Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt
Clouton [Nicht identißziert] 1784/08/02 FRNGL 0646 Clouton I Zwey meisterhafte Prospecte von Clouton, Schüler des berühmten Vemets. I Maße: 14 Vi Zoll breit, 12 Zoll hoch Transakt.: Verkauft (4.15 fl) Käufer: Nothnagel
Clovio, Giorgio Giulio (Julije Klovic) 1764/06/13 BOAN 0441 Don Julio Clovio I Un Benitier d' argent, garni de huit petites & une grande peinture de Don Julio Clovio. [Ein wey-Keßel, worin Verschiedenes gemähl ad acht kleine und Ein großes gemähl Von Don Julio Clovio die gemähl seynd taxirt, das silber und übriges nicht geschätzt worden.] I Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (67 Rt) Käufer: jud Bingen
Cock, Hieronymus 1794/00/00 HB AN 0085 Cocks I Am Ufer des Tyberstroms steht im Vorgrunde ein Brunnen, an dem Weinreben hinauf ranken und sich oben zur Krone weben; dann erhebt sich ein Berg und in tiefer Ferne schimmert, im warmen Sonnenglanze, ein hohes Gebürge. I Maße: Höhe 29 Zoll, Breite 25 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0084 H. Cock. 16051 Eine Landschaft mit einer Brücke, worüber ein Hirte Vieh treibt; vor der Brücke ruhen sich zwey Pilger aus. I Maße: Hoch 30 Zoll, breit 38 Zoll Inschr.: 1605 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt
Cock, Jan de (Wellens) 1778/09/28 FRAN 0734 Jancok I Ein Ecce=Homo. [Un EcceHomo.] I Pendant zu Nr. 739 von F.C. Janneck Maße: 11 Zoll breit, 13 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (14 fl) Käufer: Mertens
1796/11/02 HBPAK 0054 Nicolaus Viviani I Zwey Perspectiven, wo die See von weitem gesehen wird, mit Ruinen und vielen Figuren. Ganz ausserordentlich schön von Licht und Schatten. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine Perspective, wo die See von weitem gesehen wird, mit Ruinen und vielen Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 31 Zoll, breit 43 Zoll Anm.: Die Lose 53 und 54 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0068 Nicolaus Viviani I Zwey Perspectiven, wo die See von weitem gesehen wird, mit Ruinen und vielen Figuren. Ganz ausserordentlich schön von Licht und Schatten. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine Perspective, wo die See von weitem gesehen wird, mit Ruinen und vielen Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 31 Zoll, breit 43 Zoll Anm.: Die Lose 68 und 69 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0069 Nicolaus Viviani ί Zwey Perspectiven, wo die See von weitem gesehen wird, mit Ruinen und vielen Figuren. Ganz ausserordentlich schön von Licht und Schatten. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine Perspective, wo die See von weitem gesehen wird, mit Ruinen und vielen Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 31 Zoll, breit 43 Zoll Anm.: Die Lose 68 und 69 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0100 Nicolaus Viviani I Eine große Colonade mit Ruinen. Man sieht durch die Bogen Gebürge und Wasser, worauf Fahrzeuge. Im Vordergrunde Springbrunnen, mit vielen Personen. Auf das kräftigste gemahlt. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 20 Zoll, breit 26 Zoll Transakt. : Unbekannt
Coeck, Jan [Nicht identifiziert] 1787/00/00 HB AN 0569 Jann Coeck I Ein singender Bauer sitzt im Vordergrunde auf einem Stuhl; neben ihm eine Trinkkanne. Wie Tenniers. A.H. [Auf Holz] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Vi Zoll, breit 5 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (7 M) Käufer: Ekhard 1789/04/16 HBTEX 0102 Jan Coock I Eine bergigte holländische Landschaft mit Bauren; in Tenniers Manier auf Holz gemahlt. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Zoll, breit 22 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (3 M) Käufer: Eckhardt
Coelemanns [Nicht identifiziert] Coders 1794/00/00 HB AN 0138 Coders in der Manier von Mieris I Das Innere eines Kaffeeladens. Durch eine Fensteröfnung sieht man die Ladenjungfer einer alten Frau, die Geld aus der Tasche sucht, gebrannten Kaffee verkaufen. I Maße: Höhe 12 Zoll, Breite II Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt
Cocq [Nicht identifiziert] 1723/00/00 PRAN [A]0130 Cocq I Apelles und Alexander / vom Cocq. I Maße: Höhe 1 Schuh 3 Zoll, Breite 1 Schuh Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt
1790/10/18 LZRST 1867 Coelemanns I Herodias, welche den Nagel in die Zunge des Hauptes Iohannis sticht, Halbfigur, ein meisterhaftes Bild von Coelemanns, 33 Zoll hoch, 28 Zoll breit, in schw. Rahm mit gold. Leiste. I Maße: 33 Zoll hoch, 28 Zoll breit Transakt.: Unbekannt (5 Rt) 1792/02/01 LZRST 4804 Coelemanns I Herodias sticht mit einer Nadel in die Zunge des Hauptes Iohannes, Halbfigur. Ein meisterhaftes Bild von Coelemanns, 23 Zoll hoch, 28 Zoll breit, in schwarzem Rahm mit gold. Leiste. I Maße: 33 Zoll hoch, 28 Zoll breit Transakt.: Verkauft oder Unverkauft (4 Th) Käufer: R[ost]
Coesermans, Johannes Codazzi, Niccolö Viviani 1796/11/02 HBPAK 0053 Nicolaus Viviani I Zwey Perspectiven, wo die See von weitem gesehen wird, mit Ruinen und vielen Figuren. Ganz ausserordentlich schön von Licht und Schatten. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine Perspective, wo die See von weitem gesehen wird, mit Ruinen und vielen Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 31 Zoll, breit 43 Zoll Anm.: Die Lose 53 und 54 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 464
GEMÄLDE
1771/05/06 FRAN 0084 Joh. Cosermans I Ein Kirchenstück, auf Tuch. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 16 Zoll, breit 13 Zoll Verkäufer: Johann Friederich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt 1775/05/15 FRAN 0049 Joh. Cosermans I Ein Kirchenstück, auf Tuch. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 16 Zoll, breit 13 Zoll Verkäufer: Johann Friedrich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt
1782/09/30 FRAN 0355 Johann Coessermanns I Ein ganz heller, auf das reinlichste ausgearbeiteter innwendiger Kirchenprospekt. [La vüe interieure d'une Eglise, bien rendue, par Jean Coessermanns.] I Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 1 Schuh Vi Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (40.30 fl) Käufer: Prinz ν D[essau] Gegenw. Standort: Dessau, Deutschland. Anhaltische Gemäldegalerie. (581)
Coffre, Benoit 1775/02/25 HBBMN 0022 Coffer I Ein Bauer mit ein Mädchen, so tanzen. I Transakt.: Unbekannt 1775/02/25 HBBMN 0024 tin. I Transakt.: Unbekannt
Coffer I Ein Stück aus Blau Schat-
1778/05/16 HBBMN 0098 Koffer I Ein allegorisches Stück, vom Denischen Hause. I Transakt.: Unbekannt 1783/06/19 HBRMS 0027 B. Coffre I Trinkende, rauchende und musicirende Bauren. Ljeinwand]. s.R. [schwarze Rahmen] I Diese Nr.: Trinkende, rauchende und musicirende Bauren Mat.: auf Leinwand Maße: 13 Zoll hoch, 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 27 und 28 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1783/06/19 HBRMS 0028 B. Coffre I Trinkende, rauchende und musicirende Bauren. L[einwand], s.R. [schwarze Rahmen] I Diese Nr.: Trinkende, rauchende und musicirende Bauren Mat.: auf Leinwand Maße: 13 Zoll hoch, 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 27 und 28 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1787/00/00 HB AN 0510 Benedictas Coiffre I Die Verleugnung Petri. Eine Menge Kriegsknechte und andere Personen wärmen sich bey einem auf der Erde angemachten Feuer, worunter man zur rechten den Petrus gewahr wird, neben ihm die Magd. Sehr schön ä la prima gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 9 Zoll, breit 12 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (4.8 M) Käufer: Schachmann [?] 1787/00/00 HB AN 0740 Benedictus Coiffre I Einige Bauern belustigen sich vor einem Hause mit Zechen und Tobackrauchen. Im Hintergrunde ein Wald. Verschiedene musicirende Bauern in einer waldigten Landschaft. Beyde ä la prima auf das hurtigste und schönste gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] I Diese Nr.: Einige Bauern belustigen sich vor einem Hause mit Zechen und Tobackrauchen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 13 Zoll, breit 9 % Zoll Anm.: Die Lose 740 und 741 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (6 Μ für die Nrn. 740 und 741) Käufer: Tietjen 1787/00/00 HB AN 0741 Benedictus Coiffre I Einige Bauern belustigen sich vor einem Hause mit Zechen und Tobackrauchen. Im Hintergrunde ein Wald. Verschiedene musicirende Bauern in einer waldigten Landschaft. Beyde ä la prima auf das hurtigste und schönste gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] I Diese Nr.: Verschiedene musicirende Bauern in einer waldigten Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 13 Zoll, breit 9 % Zoll Anm.: Die Lose 740 und 741 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (6 Μ für die Nm. 740 und 741) Käufer: Tietjen 1788/06/12 HBRMS A0011 Le Coffre I Zwey stark gemalte Holzungen, mit lustigen und tanzenden Bauern. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Eine stark gemalte Hölzung, mit lustigen und tanzenden Bauern Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 13 Zoll, breit 10 % Zoll Anm.: Die Lose Al 1 und A12 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1788/06/12 HBRMS A0012 Le Coffre I Zwey stark gemalte Holzungen, mit lustigen und tanzenden Bauern. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Eine stark gemalte Hölzung, mit lustigen und tanzenden Bauern Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 13 Zoll, breit 10 % Zoll Anm.: Die Lose Al 1 und A12 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1793/00/00 HBMFD 0007 Coffre ί Figuren in natürlicher Lebensgrösse bis ans Knie. Die ganze Composition besteht aus 13 Personen beyderley Geschlechts, in morgenländischer Kleidung, ihre Beschäftigung ist die Musik. In der Mitte des Gemäldes sitzt eine junge Frau, welche singt und aufm Spinet schlägt. Zur Rechten der Hausvater in einer leichten aufmerksamen Stellung. Drey hübsche junge Mädchen sitzen zur Linken auf der Erde. Diese 5 Figuren machen den sehr gut gruppirten und stark beleuchteten Vordergrund aus. Ein junger Flötenspieler sitzt ein wenig zurück hinter den Alten; die übrigen Figuren, welche den Hintergrund ausmachen, sind alle im zweyten Lichte gestellt. Der Pinsel dieses Meisters ist stark, markicht, glänzend und voller Feuer, und gewiss so kühn wie jemals einer seyn kann. In einer gewissen Entfernung scheinen die Figuren zu leben. Dieses ist fast das einzige Galleriestück, welches von Coffre; ausser diejenigen in dem königlichen Pallais zu Copenhagen bekannt ist. I Mat.: auf Leinwand Maße: 3 Fuss 11 Zoll hoch, 6 Fuss 6 Zoll Verkäufer: Pierre Laporterie Transakt.: Unbekannt
Coignet, Gillis (I) 1789/00/00 MMAN 0225 Coignet I Ein groses Stück, wo Christus die Kleine zu sich berufet, mit Figuren in Lebensgröse, auf Leinwand. [Une grande piece, oü Iesus appelle ä lui une fille, taille d'homme, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 5 Fuß hoch, 7 Fuß 6 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (5 fl)
Colibert, Nicolas 1796/02/17 HBPAK 0150 Collibert I Eine anmuthige Gegend. Im Vordergrunde steht ein Hirtenjunge, der sich an einen Felsen lehnt, und neben ihm sitzt ein kleines Mädgen, die ihn liebkost; vor denselben liegen zwey Schaafe und ein drittes graset. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 7 % Zoll, Breite 10 V* Zoll Transakt.: Verkauft (41 M) Käufer: Kreuter [und] Τ
Colin (Collin) 1749/07/31 HB RAD 0086 Colin I Eine dito [Landschaft], I Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (1.12)
Colin, Petrus Gerardus Philippus 1799/00/00 LZRCH 0069 P.G.P. Collin I L'entree d'un bourg hollandais, traverse par un canal, qui offre une süperbe perspective, il est orne de differens groupes de figures, dont un est place, devant une maison oü Ton donne ä boire; ce tableau, d'un vrai merite, est l'ouvrage d'un artiste moderne,tres soigne, et fidel en son genre. I Mat.: auf Holz Maße: h. 18 Vi. 1. 24. pouces Verkäufer: J F Rauch Transakt.: Unbekannt
Colle, Raffaello dal 1790/08/25 FRAN 0004 Raphael del Callo I Eine heilige Familie. I Maße: hoch 51 Zoll, breit 41 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (9 fl) Käufer: Schneidewind
Collyn, Robert [Nicht identifiziert] 1784/08/02 FRNGL 0380 Robert Collyn I Zwey Stücke das eine der Apostel Mathäus als Zöllner in seiner Zollstube, und das andere wie derselbe Christum dem Herrn als Apostel nachfolget, vorstellend. I Diese Nr.: Der Apostel Mathäus als Zöllner in seiner Zollstube Maße: 16 Zoll breit, 12 Zoll hoch Anm.: Die Lose 380 und 381 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Α Transakt.: Verkauft (6.30 fl für die Nrn. 380 und 381) Käufer: von Dessau GEMÄLDE
465
1784/08/02 FRNGL 0381 Robert Collyn \ Zwey Stücke das eine der Apostel Mathäus als Zöllner in seiner Zollstube, und das andere wie derselbe Christum dem Herrn als Apostel nachfolget, vorstellend. I Diese Nr.: Wie der Apostel Mathäus Christum dem Herrn als Apostel nachfolget Maße: 16 Zoll breit, 12 Zoll hoch Anm.: Die Lose 380 und 381 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: A Transakt.: Verkauft (6.30 fl für die Nrn. 380 und 381) Käufer: von Dessau
Colombo, Giovanni Battista Innocenzo 1771/05/06 FRAN 0143 Colombo I Ein Stück von einem Plavong, auf dito [Tuch]. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 23 Zoll, breit 27 Zoll Verkäufer: Johann Friederich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt 1775/05/15 FRAN 0096 Colomba I Ein Stück von einem Plavong, auf dito [Tuch]. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 13 Zoll, breit 27 Zoll Verkäufer: Johann Friedrich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt 1778/09/28 FRAN 0060 Collomba I Die Marter des heil. Sebastian!. [Le martyre de S. Sebastien par Collomba.] I Maße: 2 Schuh 4 Zoll breit, 3 Schuh 1 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (4 fl) Käufer: ν Franckenstein 1778/09/28 FRAN 0863 Collomba I Eine Fama, mit der Posaune, von Collomba, in gross Oval. [La renommee tenante la trompette, par Colomba, en grand Oval.] I Pendant zu Nr. 864 Format: oval Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (10 fl für die Nrn. 863 und 864) Käufer: Canonicus Burger 1778/09/28 FRAN 0864 Collomba I Der Compagnon, von dito [Collomba], [Le pendant du precedent, par le meme [Colomba].] I Pendant zu Nr. 863, "Eine Fama, mit der Posaune" Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (10 fl für die Nm. 863 und 864) Käufer: Canonicus Burger 1779/09/27 FRNGL 0284 Columba I Eine fleißig und meisterhaft ausgeführte baumigte Landschaft mit schönen Figuren. [Un tres beau paysage couvert d'arbres avec de belles figures]. I Pendant zu Nr. 285 Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh breit Transakt.: Verkauft (16 fl für die Nrn. 284 und 285) Käufer: Cotrel von Hanau 1779/09/27 FRNGL 0285 Columba I Der Compagnon hierzu, eine dergleichen Landschaft mit Figuren, von neml. Meister [Columba] und Maas. [Le pendant du precedant, meme objet avec des figures, par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 284 Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh breit Transakt.: Verkauft (16 fl für die Nrn. 284 und 285) Käufer: Cotrel von Hanau 1789/04/16 HBTEX 0064 Joh. Babt. Collomba:, 17551 In einer angenehmen waldigten Gegend siehet man im Vordergrunde Luna und Endimion, von Genien umgeben; auf das Geistreichste vorgestellt, auf Leinew. I Maße: Hoch 34 Zoll, breit 44 Zoll Inschr.: 1755 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Verkauft (6 M) Käufer: Eckhardt 1791/09/26 FRAN 0301 Colamba I Ein sitzendes Bauemweib, die mit freudiger Miene ihren Säugling in der Wiege zeigt, natürlich vorgestellt von Colamba. I Maße: 24 Zoll hoch, 19 Zoll breit Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt
Colonia, Adam 1749/07/31 HBRAD 0022 Caloni I Zwey Vieh=Stücke. I Diese Nr.: Ein Vieh=Stück Anm.: Die Lose 22 und 23 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (10.12 für die Nrn. 22 und 23) 1749/07/31 HBRAD 0023 Caloni I Zwey Vieh=Stücke. I Diese Nr.: Ein Vieh=Stück Anm.: Die Lose 22 und 23 wurden zusammen 466
GEMÄLDE
katalogisiert. Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (10.12 für die Nrn. 22 und 23)
Colyer, Edwaert 1765/03/27 FRKAL 0039 Coljer \ Un beau tableau representant une vanite avec plusieurs choses inanimees tres-bien execute. I Maße: hauteur 37 pouces, largeur 30 pouces Transakt.: Verkauft (15.15 fl) Käufer: Lampert 1765/03/27 FRKAL 0040 Coljer I Un autre piece sur planche imitee avec des Livres & Lettres imitees. I Maße: hauteur 27 pouces, largeur 21 pouces Transakt.: Verkauft (3 fl) Käufer: Kaller
Compe, Jan ten 1763/00/00 BLAN 0052 Johann Ten Compe I Zween Prospecte von der Stadt Amsterdam. Auf Leinewand gemahlt, 1 Fuß 7 Zoll hoch, und 1 Fuß 10 Zoll breit. In diesen beyden Stücken herscht viel Wahrheit, Kunst und Fleiß, ohne daß sie ins Harte fallen. Das Colorit ist in der schönsten Haltung. Die Werke des Ten Compe verdienen sogleich nach des Johann van der Heyden und Gerhard Berkheiden ihren Arbeiten, den Rang: Denn ich habe in Holland von dem ersteren, Gemähide von großer Schönheit gesehen. Der Herr Leander de Neuffville hat eins seiner schönsten Stücke, worinn Dieterich die Figuren, einem Liebhaber zu Gefallen, der ehedem Besitzer von diesem Gemähide gewesen ist, verfertiget hat, wodurch dieses Bild einen großen Werth bekommt. Remy beschreibt dieses Gemähide; und N. du Four hat es in Paris in Kupfer gestochen. Die ersten Abdrücke sind mit dem Wapen des Herrn von Heinecken; und die übrigen mit dem Rahmen des Herrn Johann Ernst Gotzkowsky gezeichnet. [Text hier gekürzt] I Diese Nr.: Ein Prospecte von der Stadt Amsterdam Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 7 Zoll hoch, und 1 Fuß 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 52 und 53 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Gottlieb Stein Transakt.: Unbekannt 1763/00/00 BLAN 0053 Johann Ten Compe I Zween Prospecte von der Stadt Amsterdam. Auf Leinewand gemahlt, 1 Fuß 7 Zoll hoch, und 1 Fuß 10 Zoll breit. In diesen beyden Stücken herscht viel Wahrheit, Kunst und Fleiß, ohne daß sie ins Harte fallen. Das Colorit ist in der schönsten Haltung. Die Werke des Ten Compe verdienen sogleich nach des Johann van der Heyden und Gerhard Berkheiden ihren Arbeiten, den Rang: Denn ich habe in Holland von dem ersteren, Gemähide von großer Schönheit gesehen. Der Herr Leander de Neuffville hat eins seiner schönsten Stücke, worinn Dieterich die Figuren, einem Liebhaber zu Gefallen, der ehedem Besitzer von diesem Gemähide gewesen ist, verfertiget hat, wodurch dieses Bild einen großen Werth bekommt. Remy beschreibt dieses Gemähide; und N. du Four hat es in Paris in Kupfer gestochen. Die ersten Abdrücke sind mit dem Wapen des Herrn von Heinecken; und die übrigen mit dem Rahmen des Herrn Johann Ernst Gotzkowsky gezeichnet. [Text hier gekürzt] I Diese Nr.: Ein Prospecte von der Stadt Amsterdam Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 7 Zoll hoch, und 1 Fuß 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 52 und 53 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Gottlieb Stein Transakt.: Unbekannt 1790/04/13 HBLIE 0121 ten Compee I Ueber Land sieht man im Prospect eine Stadt, und im Horizonte eine besonders angenehme Gegend von abwechselndes Land und Wasser; mit vielem Fleiß gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 14 Zoll, breit 18 Zoll Transakt.: Verkauft (3 M) 1797/04/25 HBPAK 0186 Tencompe I Eine schöne Landschaft mit einigen Figuren; in der Entfernung eine Stadt. Auf schwarzen Rahm, goldene Leisten. I Maße: hoch 9 Vi Zoll, breit 12 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0187 Tencompen I Zwey sehr schöne holländische Land= und Wasser=Prospecten, mit vielen Figuren Fein gemahlt. Auf Leinw., goldenen Rahm. I Diese Nr.: Ein sehr schöner
holländische Land= und Wasser=Prospect Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 16 Zoll, breit 21 Zoll Anm.: Die Lose 187 und 188 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0188 Tencompen I Zwey sehr schöne holländische Land= und Wasser=Prospecten, mit vielen Figuren Fein gemahlt. Auf Leinw., goldenen Rahm. I Diese Nr.: Ein sehr schöner holländische Land= und Wasser=Prospect Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 16 Zoll, breit 21 Zoll Anm.: Die Lose 187 und 188 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Conca, Sebastiano 1750/00/00 KOAN 0022 Sebastien Conca I Une Figure de la Ste. Vierge avec l'Enfant Jesus, beau colons, agrement du pinceau, & beaute du dessein, sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: Largeur 2 Pies 9 Pouces, Haut 3 Pies 2 Vi Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1768/08/16 KOAN 0042 Sebastian Conca I H. Lucia von Sebastian Conca. I Maße: Höhe 2 Fuß 4 Zoll, Breite 1 Fuß 9 Zoll Verkäufer: Freyherr von Kaas Transakt.: Unbekannt 1777/03/03 AU AN 0022 Seb. Conca I Zwey Stücke römische Historien. I Maße: Höhe 3 Sch. 3 Zoll, Breite 4 Sch. 6 Zoll Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt 1777/03/03 AUAN 0078 Seb. Conca I Zwey Ecce Homo und Mater dolorosa. I Maße: Höhe 2 Sch. 5 Vi Zoll, Breite 2 Sch. Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt 1777/03/03 AUAN 0079 Seb. Conca I Zwey Madonna und St. Joseph. I Maße: Höhe 2 Sch. 5 Vi Zoll, Breite 2 Sch. Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0078 Conca I Die Geburt Christi. [1 pfiece], la nativite de Jesu Christ.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Fuß, Breite 1 Fuß 6 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0514 Cancha Sebast. I Jupiter und Cupido, auf Leinwat. I Diese Nr.: Jupiter Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 2 Zoll, Breite 1 Schuh 8 Zoll Anm.: Die Lose 514 und 515 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0515 Cancha Sebast. I Jupiter und Cupido, auf Leinwat. I Diese Nr.: Cupido Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 2 Zoll, Breite 1 Schuh 8 Zoll Anm.: Die Lose 514 und 515 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0516 Cancha Sebast. I Johannes der Täufer, auf Leinwat. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 2 Zoll, Breite 1 Schuh 8 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0279 Sebast. Conca I Zwey allegorische Stücke, in religiöser Rücksicht; von der richtigen Zeichnung und lieblichsten Colorit. Wie schätzbar und selten ächte Originale von obigem Meister sind, ist bekannt. Diese beyden Stücke sind von Conca, und Kenner werden darüber urtheilen. Auf Kupfer. I Diese Nr.: Ein allegorisches Stück, in religiöser Rücksicht Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 14 Zoll, breit 10 Vi Zoll Anm.: Die Lose 279 und 280 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0280 Sebast. Conca I Zwey allegorische Stücke, in religiöser Rücksicht; von der richtigen Zeichnung und lieblichsten Colorit. Wie schätzbar und selten ächte Originale von obigem Meister sind, ist bekannt. Diese beyden Stücke sind von Conca, und Kenner werden darüber urtheilen. Auf Kupfer. I Diese Nr.: Ein allegorisches Stück, in religiöser Rücksicht Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 14 Zoll, breit 10 Vi Zoll Anm.: Die Lose 279 und 280 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Conca, Sebastiano (Kopie nach) 1788/09/01 KOAN 0425 Conca I H. Margaretha mit einem Engel, nach Conca. [Ste Margeritte avec des anges, selon Concha.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 7 Zoll, Breite 2 Fuß Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt
Coniers [Nicht identifiziert] (geändert in Cossiers, J.) 1765/00/00 FRRAU 0023 Coniers; Cocciers I Einen schlafenden Kopf von einem jungen Menschen vorstellend, ist wohl gezeichnet, in einer starken Colorit und einem rothen Gewand. Ohne Rahme auf Holz. Repräsentant une tete de jeune homme dormant, eile est tres-bien dessinee, d'un haut colons & d'une etofe rouge. Sans la bord. sur du b. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 1 Schuh 3 Zoll, breit 1 Schuh 1 Zoll Anm.: Im Exemplar AAP wurde der Name "Coniers" handschriftlich durchgestrichen und in "Cocciers" korrigiert. Transakt.: Unbekannt
Coninck, David de 1764/00/00 BLAN 0573 D: v: Köninck I 2. unvergleichliche alte Köpfe. I Diese Nr.: Ein alter Kopf Maße: 1 Fuß 9 Vi Zoll hoch, 1 Fuß 3 Vi Zoll breit Anm. : Die Lose 573 und 574 wurden zusammen katalogisiert. Der Künstler ist vermutlich Salomon oder Philips de Köninck und nicht David de Coninck. Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (150 Rt für die Nrn. 573 und 574, Schätzung) Gegenw. Standort: Sankt-Peterburg, Rossiya. Ermitazh. (N 721) als S. Köninck 1764/00/00 BLAN 0574 D: v: Köninck I 2. unvergleichliche alte Köpfe. I Diese Nr.: Ein alter Kopf Maße: 1 Fuß 9 lA Zoll hoch, 1 Fuß 3 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 573 und 574 wurden zusammen katalogisiert. Der Künstler ist vermutlich Salomon oder Philips de Köninck und nicht David de Coninck. Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (150 Rt für die Nrn. 573 und 574, Schätzung) 1768/08/16 KOAN 0091 David König I Zwey Geflügel=Stück von David König. I Maße: Höhe 1 Fuß, Breite 8 Zoll Verkäufer: Freyherr von Kaas Transakt.: Unbekannt 1776/00/00 WZTRU 0011 David Koning I Ein Stück, 2 Schuhe, 2 Zoll hoch, 2 Schuhe, 7 Zoll breit von David Koning, stellet vor eine Schöpf Henne nebst einem Haasenkühlein sammt einer hierländischen Huhn in einer wohlanständigen Landschaft, worinn sowohl die Colorit als Practik sehr wohl verstanden, und diese Art von Mahlerey des Meisters, ist vielen anderen in diesem Fache vorzuziehen. I Maße: 2 Schuhe, 2 Zoll hoch, 2 Schuhe 7 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (60 fl Schätzung) 1776/00/00 WZTRU 0070 David Koning I Ein Stück 3 Schuhe, 8 Zoll hoch, 2 Schuhe, 4 Zoll breit von David Koning, stellet vor einem in einer wohlausgeführten Landschaft stehenden Hahnen, welcher treflich exprimiret, ein herzhafter Pinsel, teuschende Einbildungskraft, eine kräftige und leichte Manier werden Kännern und Liebhabern alle Satisfaction in diesem Stücke zu erkennen geben, die Landschaft hierin ist in dem Gusto von Peter Paul Rubens verfertiget. I Maße: 3 Schuhe 8 Zoll hoch, 2 Schuhe 4 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (80 fl Schätzung) 1781/00/00 WZAN 0011 David Koning I Ein Stück, 2 Schuhe, 2 Zoll hoch, 2 Schuhe, 7 Zoll breit von David Koning, stellet vor eine Schopfhenne nebst einem Kaninnchen und einem hieländischen Huhn in einer wohlanständigen Landschaft, worinn sowohl die Kolorit, als Praktik sehr wohl verstanden ist; diese Art von Mahlerey des Meisters ist vielen andern in diesem Fache vorzuziehen. I Maße: 2 Schuhe, 2 Zoll hoch, 2 Schuhe 7 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0070 David Koning I Ein Stück 3 Schuhe, 8 Zoll hoch, 2 Schuhe, 4 Zoll breit von David Koning, stellet einen in einer wohl ausgeführten Landschaft stehenden Hahnen vor, welcher GEMÄLDE
467
trefflich exprimirt ist; ein herzhafter Pinsel, täuschende Einbildungskraft, eine kräftige und leichte Manier werden Kennern und Liebhabern alles Genügen in diesem Stücke zu erkennen geben, die Landschaft hierinn ist in dem Gusto von Peter Paul Rubens verfertiget. I Maße: 3 Schuhe 8 Zoll hoch, 2 Schuhe 4 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1789/00/00 MMAN 0001 David de Koning I Zwei Stücke mit Früchten und Federviehe, auf Leinwand. [Deux pieces en fruits et volailles, sur toile.] I Diese Nr.: Ein Stück mit Früchten und Federvieh Mat.: auf Leinwand Maße: 4 Fuß 4 Zoll hoch, 5 Fuß 11 Zoll breit [4 pieds 4 pouces de haut, 5 pieds 4 pouces de large] Anm.: Die Lose 1 und 2 wurden zusammen katalogisiert. Die Dimensionen unterscheiden sich in der deutschen und französischen Fassung des Katalogs. Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (150 fl für die Nrn. 1 und 2) 1789/00/00 MMAN 0002 David de Koning I Zwei Stücke mit Früchten und Federviehe, auf Leinwand. [Deux pieces en fruits et volailles, sur toile.] I Diese Nr.: Ein Stück mit Früchten und Federvieh Mat.: auf Leinwand Maße: 4 Fuß 4 Zoll hoch, 5 Fuß 11 Zoll breit [4 pieds 4 pouces de haut, 5 pieds 4 pouces de large] Anm.: Die Lose 1 und 2 wurden zusammen katalogisiert. Die Dimensionen unterscheiden sich in der deutschen und französischen Fassung des Katalogs. Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (150 fl für die Nrn. 1 und 2) 1789/00/00 MMAN 0195 David de Koning I Em Landschäftchen, auf Holz. [Un petit paysage, sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 6 Zoll hoch, 11 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (24 Kr) 1799/00/00 WZAN 0045 David de Koning I Zwey Federvieh= Stücke, von David de Koning. Auf Leinwand. ! Diese Nr.: Ein Federvieh=Stück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 8 Zoll breit 2 Schuh 1 Zoll Anm.: Die Lose 45 und 46 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0046 David de Koning I Zwey Federvieh= Stücke, von David de Koning. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Federvieh=Stück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 8 Zoll breit 2 Schuh 1 Zoll Anm.: Die Lose 45 und 46 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0181 David de Koning I Zwey Federviehe= Stücke, von David de Koning. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Federviehe=Stück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 9 Zoll breit 3 Schuh 2 Zoll Anm.: Die Lose 181 und 182 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0182 David de Koning I Zwey Federviehe= Stücke, von David de Koning. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Federviehe=Stück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 9 Zoll breit 3 Schuh 2 Zoll Anm.: Die Lose 181 und 182 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1774/03/28 HBBMN 0050 Conixloo I Eine kleine Landschaft auf Kupfer, in der Brögelschen Manier, schwarz, mit verguldet=ledernen Rahm. I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 8 Zoll, Breite 1 Fuß Transakt.: Unbekannt 1782/09/30 FRAN 0131 Koninksloo I Eine Flußgegend, mit wohl angebrachten Felsen. [Vüe d'une fleuve avec des rochers bien ordonnes, par Koninksloo.] I Maße: 1 Schuh 6 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 10 Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (30.30 fl) Käufer: Hüsgen
Conselits [Nicht identifiziert] (Manier) 1799/12/04 HBPAK 0018 In Conselits Manier I Eine Land= und Wasser=Gegend. Im Hintergrunde das Schäflingsche Ufer vorstellend. im Vordergründe eine Prozession, wo viele Herrschaften mit Kutschen fahren, und viele andere zu Fuße gehen. Gut gemahlt. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 27 Zoll, breit 49 Zoll Transakt.: Unbekannt
Conson [Nicht identifiziert] 1790/01/07 MUAN 0246 Conson I Zwey Stücke mit kleinen Ruinen von Gebäuden, auf Holz, in schwarzgepeizten Ramen mit vergoldeten Leisten. I Diese Nr.: Ein Stück mit kleinen Ruinen von Gebäuden Mat.: auf Holz Maße: Höhe 4 Zoll, Breite 6 Zoll Anm.: Die Lose 246 und 247 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0247 Conson I Zwey Stücke mit kleinen Ruinen von Gebäuden, auf Holz, in schwarzgepeizten Ramen mit vergoldeten Leisten. I Diese Nr.: Ein Stück mit kleinen Ruinen von Gebäuden Mat.: auf Holz Maße: Höhe 4 Zoll, Breite 6 Zoll Anm.: Die Lose 246 und 247 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
Contong [Nicht identifiziert] 1777/05/26 FRAN 0470 Contong I 2 Früchten=Stück v. Contong. I Diese Nr.: 1 Früchten=Stück Anm.: Die Lose 470 und 471 wurden zusammen katalogisiert. Dieses Los wurde zusammen mit der Nr. 465 (Anton Mirou) verkauft. Verkäufer: Finsterwalder Transakt.: Verkauft (4.40 fl für die Nrn. 465,470 und 471) Käufer: Cotrel 1777/05/26 FRAN 0471 Contong I 2 Früchten=Stück v. Contong. I Diese Nr.: 1 Früchten=Stück Anm.: Die Lose 470 und 471 wurden zusammen katalogisiert. Dieses Los wurde zusammen mit der Nr. 465 (Anton Mirou) verkauft. Verkäufer: Finsterwalder Transakt.: Verkauft (4.40 fl für die Nrn. 465, 470 und 471) Käufer: Cotrel
Cooghen, Leendert van der 1799/00/00 WZAN 0294 David de Koning I Ein Hahn, ein Kaninchen, ein Hund und Musik, von David de Koning. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 3 Zoll breit [??] Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1750/10/15 HB AN 0028 Konixloo (Hans) I Ein Götter=Banquet. I Maße: 3 Fuß 7 Zoll hoch, 7 Fuß 3 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
1776/00/00 WZTRU 0108 Leonhardus von der Roogen I Ein Stück 1 Schuhe, 10 Zoll hoch, 1 Schuhe, 8 Zoll breit von Leonhardus von der Roogen, stellet vor 4 in einem alten Gebäude sich befindende Bauern, worinn ein extra ordinaire Gedank von Stellungen exprimiret, die Colorit ist hierinn meisterlich, das einfallende Licht von sehr schöner Wirkung, und giebt ganz wahrscheinlich zu erkennen seines Lehrmeisters Jakob Jordaens Manier, wessen er mit Cornelius Bega gar wohl zu vereinigen wußte. I Maße: 1 Schuhe 10 Zoll hoch, 1 Schuhe 8 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (24 fl Schätzung)
1763/11/09 FRJUN 0105 Koningsloo I Quatre voleurs ä pied qui attaquent deux voyageurs ä cheval dans une foret tres bien peint. I Maße: hauteur 17 Vi pouces, largeur 26 pouces Transakt.: Verkauft (22.15 fl) Käufer: Geyß
1781/00/00 WZAN 0108 Leonardus von der Roogen I Ein Stück 1 Schuhe, 10 Zoll hoch, 1 Schuhe, 8 Zoll breit von Leonardus von der Roogen, stellet 4 in einem alten Gebäude sich befindende Bauern vor, worinn ein ausserordentlichen Gedanke von Stellungen
Coninxloo, Gillis van
468
GEMÄLDE
exprimiret ist; die Kolorit ist hierinn meisterlich, das einfallende Licht von sehr schöner Wirkung, und giebt ganz wahrscheinlich seines Lehrmeisters Jakob Jordaens Manier, welche er mit Kornelius Bega gar wohl zu vereinigen wußte, zu erkennen. I Maße: 1 Schuhe 10 Zoll hoch, 1 Schuhe 8 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Cook, J. 1783/08/01 LZRST 0077 I. Cook I Ein Seestück, von I. Cook, im Mittelgrunde zwo Fregatten, in der Entfernung Schiffe, am Horizont die aufgehende Sonne, 17 Zoll hoch, 22 Zoll br. ohne Rahm. I Pendant zu Nr. 78 Maße: 17 Zoll hoch, 22 Zoll breit Verkäufer: W Transakt.: Verkauft (1.20 Th) Käufer: Korn 1783/08/01 LZRST 0078 I. Cook I Ein anderes Seestück, von eben diesem Meister [I. Cook], ein Sturm mit Ungewitter, einige Schiffe in Gefahr, und ein Schiffbruch, das Gegenbild zu vorigen [Nr. 77], von gleichem Maasse, ohne Rahm. I Pendant zu Nr. 77 Maße: 17 Zoll hoch, 22 Zoll breit Verkäufer: W Transakt.: Verkauft (2.14 Th) Käufer: Kom
Coosemans, Alexander 1774/08/13 HBBMN Transakt.: Unbekannt
0029
Cosemann I Ein Fruchtstück. I
1781/05/07 FRHUS 0326 Alexander Coosermann I Ein sehr natürlich und mit vielem Fleiß ausgefühtes [sie] Früchtenstück, mit einem grossen Krebs. I Maße: 2 Schuh hoch und 2 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Jacob Bemus Transakt.: Verkauft (30 fl) Käufer: Manger 1799/00/00
WZAN
0587
Adam
Goosemans
I Vier Früchtestük-
ke, von Adam Goosemans. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Früchtestück Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 2 Zoll breit 1 Schuh 7 Zoll Anm.: Die Lose 587 bis 590 wurden zusammen katalogisiert. Der Name des Künstlers ist angegeben als "Adam Goosemans", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0588 Adam Goosemans I Vier Früchtestükke, von Adam Goosemans. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Friichtestück Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 2 Zoll breit 1 Schuh 7 Zoll Anm.: Die Lose 587 bis 590 wurden zusammen katalogisiert. Der Name des Künstlers ist angegeben als "Adam Goosemans", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0589 Adam Goosemans I Vier Früchtestükke, von Adam Goosemans. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Früchtestück Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 2 Zoll breit 1 Schuh 7 Zoll Anm.: Die Lose 587 bis 590 wurden zusammen katalogisiert. Der Name des Künstlers ist angegeben als "Adam Goosemans", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0590 Adam Goosemans I Vier Früchtestükke, von Adam Goosemans. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Früchtestück Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 2 Zoll breit 1 Schuh 7 Zoll Anm.: Die Lose 587 bis 590 wurden zusammen katalogisiert. Der Name des Künstlers ist angegeben als "Adam Goosemans", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1782/09/30 FRAN 0092 Consalvo I Das Bildnis einer spanischen Prinzeß. [Le portrait d'une Princesse Espagnole par Consalvo.] I Maße: 4 Vi Zoll hoch, 3 Vi Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (7 fl) Käufer: Prinz ν D[essau] 1788/10/01 FRAN 0074 Gonsales I Ein Mann auf der Cither spielend. I Maße: 12 Zoll hoch, 9 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (11 fl) Käufer: Heussel 1790/08/25 FRAN 0140 Gonzallo I Die drey Grazien. I Maße: hoch 17 Zoll, breit 14 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (14 fl) Käufer: Erlinger 1793/00/00 NGWID 0424 Georg de Quoqes I Eine spanische musikalische Conversation, von sechs Figuren, nebst einigen Beywesen, von Georg de Quoqes. I Maße: 1 Schuh 11 Zoll hoch, 2 Schuh 4 Zoll breit Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "Georg de Quoqes", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 LZAN 0115 Gonsal Cock, eleve de Vandyck I Un Tableau. Le portrait d'une femme en ancien costume Hollandois; d'un bon ton de couleur. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hauteur 27 pouces, largeur 19 pouces Transakt.: Unbekannt (12 Louis Schätzung) 1800/01/00 LZAN [A]0086 Gonzalo Coques I 13 kleine Gemälde. Unter einem Glas, und Rahmen, theils in Miniatur, theils in Oel, von verschiedenen, vortreflichen Künstlern, z.B. in Oel von Gonzalo Coques, der der kleine Titian genannt wurde, in Miniatur von Meitens, Klingstädt und alten Menges u.s.w. I Diese Nr.: Eine kleine Gemälde Mat.: Öl Anm.: Die Lose [A]86 bis [A]98 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: A F Oeser Transakt.: Unbekannt
Cordua 1723/00/00 PRAN [B]0029 Corda I Ein Contrefait / vom Corda. I Maße: Höhe 1 Vi Schuh 5 Zoll, Breite 2 Vi Schuh 4 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN 0043 Corda I Ein Kopff vom Corda oval / in vergulter Rahm. I Format: oval Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN 0085 Corda I Ein Compagnion darzu [ein Contrafait=Oval], vom Corda. I Pendant zu Nr. 84, Kopie nach Kupezky Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN 0094 Corda I Ein Kopff Oval / vom Corda / in Metalliner Rahm. I Format: oval Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt
Corellje, H. [Nicht identißziert] 1798/08/10 HBPAK 0040 H. Corellje I Eine bergigte Landschaft. Ein Reuter zu Pferde, welcher sich mit einem Landmädgen auf dem Wege unterredet. Kräftig und gut gemahlt. Auf Leinwand, im schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Zoll, breit 23 Zoll Transakt.: Unbekannt
Corneille 1800/00/00 FRAN1 0031 Corneille I Jupiter entführt den Ganymede. I Mat.: auf Leinwand Maße: 15 Zoll hoch, 10 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Coques, Gonzales
Corneille, Michel
1769/00/00 MUAN 0407 Gonzales I Un Crucifix aux pieds duquel est la Magdelaine ä genoux. Peint sur toile, marque du No. 132. I Mat.: auf Leinwand Maße: 3. p. 3. p. de haut sur 2. p. 4. p. de large Verkäufer: Francis Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt
1796/02/17 HBPAK 0069 Michel Corneille I In einer gebirgigten Landgegend, am Oelberge, sitzt im Vordergrunde zur Rechten, Christus, vor welchem drey Engel kniend beten. In der Höhe in Wolken schwebt eine Glorie von Engeln, die ein Korb mit vielen FrüchGEMÄLDE
469
ten tragen. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 29 Zoll, Breite 19 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (110 M) Käufer: Eckhardt
1764/08/25 FRAN 0155 Corneil. de Harlem I Mars et Venus nuds. I Maße: haut 1 pied 10 pouces sur 2 pieds 2 Vi pouces de large Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt
1796/02/17 HBPAK 0105 Michel Corneille I Die Geburth Christi unter einem zerfallenen römischen Gebäude vorgestellt, wo die Weisen aus dem Morgenlande dem Kinde Geschenke bringen. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 19 Vi Zoll, Breite 16 Zoll Transakt.: Verkauft (86 M) Käufer: Ε
1764/08/25 FRAN 0334 Cornel, de Harlem I Des nudites. I Maße: haut 2 pieds 2 pouces sur 3 pied [?] large Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt
1796/02/17 HBPAK 0213 Michel Corneille I Die Entführung der Europe. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 13 V2 Zoll, Breite 17 Zoll Transakt.: Verkauft (61 M) Käufer: Packi
Cornelisz. van Haarlem, Cornells
1764/08/25 FRAN 0377 Cornel, de Harlem I Une femme en bain. I Maße: haut 1 pied 6 pouces sur 1 pied 2 Vi pouces de large Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0170 Harlem (Cornelius van) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
1723/00/00 PRAN [A]0137 Harleem I Ceres / Bachus / und Venus / vom Harleem. I Maße: Höhe 5 Schuh 3 Vi Zoll, Breite 6 Schuh 2 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt Gegenw. Standort: Dresden, Deutschland. Gemäldegalerie. (851)
1769/00/00 MUAN 0420 Harlem (Corneil van) I Un homme tenant un verre en main, demie figure. Peint sur bois, marque du No. 170.1 Mat.: auf Holz Maße: 1. p. 10 Vi. p. de haut sur 1. p. 4 Vi. p. de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt
1742/08/01 BOAN 0209 Cornelio d'Harlem I Ein Stuck, so die Zusammenkunfft deren Götter repraesentiret. Original vom Cornelio d'Harlem. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt
1770/10/29 FRAN 0011 C. von Harlem I Venus & Cupido. I Maße: h. 55. Zoll. b. 43. Zoll. Transakt.: Unbekannt
1742/08/01 BOAN 0350 Cornelius von Harlem I Vulcanus und Darius. Orig. von Cornelius von Harlem. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0410 Cornel, von Harlem I Ein Stuck, worauff die Götter zu Tische sitzen. Original von Cornel, von Harlem. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0425 Cornelius von Hartem I Eine GötterMahlzeit. Original von Cornelius von Harlem. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0168 Corneille von Hartem I Les Dieux ä table, par. Corneille von Hartem. I Maße: Haut 4. pies, large 6. pies 3. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0177 Comeile de Harlem I Un Festin des Dieux par Corneile de Harlem. [Een Goode Maaltyd door C. van Haarlem.] I Maße: Haut 3. pies 9. pouces. large 4. pies 10. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt (55) 1742/08/30 BOAN 0268 Corneille von Harlem I Vulcain & Darius, par Corneille von Harlem. I Maße: Haut 2. pieds 7. pou., large 2. pieds 6. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1744/05/20 FRAN 0140 Corn.v. Haarlem I 1 Schöner Bacchus Kopff. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 2 Schuh, Breite 1 Schuh 7 Zoll Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1744/05/20 FRAN 0178 Corn, de Haerlem I 1 Stück das Leben vor der Sündfluth. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 4 Zoll, Breite 2 Schuh 2 Zoll Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1759/00/00 LZEBT 0082 Corn, von Harlem I Ein Mans Kopf auf Holtz. I Mat.: auf Holz Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (30 Th für die Nm. 82 und 83, Schätzung) 1759/00/00 LZEBT 0083 Com von Harlem I Ein Frauenkopf auf Holtz. I Mat.: auf Holz Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (30 Th für die Nrn. 82 und 83, Schätzung) 1763/01/19 FRJUN 0050 C. de Harlem I Pallas Venus & Junon, ce tableau est extremement bien travaille & comparable ä ceux des meilleurs maitres d'Italie. I Maße: hauteur 34 pouces, large 31 pouces Transakt.: Unbekannt (50 fl) 1764/08/25 FRAN 0136 Cornel, de Harlem I Des nudites. I Maße: haut 12 Vi pouces sur 1 pied 6 pouces de large Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 470
GEMÄLDE
1771/05/06 FRAN 0046 Harlem I Eine Eva, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 14 Zoll, breit 10 Zoll Verkäufer: Johann Friederich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt 1775/05/15 FRAN 0014 Harlem I Die Cleopatra, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 14 Zoll, breit 10 Zoll Verkäufer: Johann Friedrich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt 1776/04/15 HBBMN 0149 Corn. v. Haarlem I Ein Fresser, auf Kupfer gemahlt. I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 8 Zoll, Breite 6 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (4.4 M) Käufer: Pauly 1778/07/21 HBHTZ 0050 Cornelius von Harlem I Die Liebe vorstellend, sehr schön gemahlt auf Holz von Cornelius von Harlem. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 21 Zoll, breit 16 Zoll Transakt.: Unbekannt (10 M) 1779/00/00 HB AN 0072 Cornelius van Harlem I Eine grosse Versammlung heidnischer Gottheiten, die um eine lange bedeckte Tafel herum sitzen, und sich beym frohen Gastmahle unterhalten. Auf Holz. [Une assemblee de Divinites pai'ennes, assises autour d'une longue table couverte de mets, & s'entretenant dans un festin joyeux. Sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 3 Fuß 4 Zoll hoch, 3 Fuß 11 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1781/05/07 FRHUS 0356 Cornelius von Harlem I Drey schlaffende nackende Weibger, die von zwey Satyrn belauscht werden, überaus reizend vorgestellt und angenehm colorirt, von Cornelius von Harlem, A. 1625 verfertigt. I Maße: 1 Schuh hoch und 1 Schuh 5 Zoll breit Inschr.: 1625 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (50 fl) Käufer: Dr Siegler 1781/09/10 BNAN 0049 Cornelis von Haerlem I Mit zurückgewandtem Gesicht, schnitzet Medore, der zu seiner Seite sitzenden Angelica Namen, im hinter ihnen stehenden Baum; beyde sitzen nackend an einem beschatteten Wasserfall. Ein wohl conservirtes Gemähide von Cornelis von Haerlem, auf Tuch. I Mat.: auf Leinwand Maße: 10 Zoll hoch, 14 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1782/09/30 FRAN 0077 Cornelius Harlem I Ein Musikus mit verschiedenen Sängern umgeben. [Un Musicien entoure de plusieurs chanteurs, par Corneille Harlem.] I Maße: 2 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 9 Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (44 fl) Käufer: Will 1789/00/00 MM AN 0335 Cornel Cornelissen I Der Drach in Böotien mit einer fliehenden Nymphe, oval auf Kupfer. [Le Dragon de Boetie, avec une Nimphe qui fuit, oval, sur cuivre.] I Mat.: auf Kupfer Format: oval Maße: 2 Vi Zoll hoch, 3 Zoll breit [3 pouces Vi
de haut, 3 pouces de large] Anm.: Es ist unklar, ob es sich um das in der Taxierungsliste von 1787 beschriebene Gemälde Nr. 335 "Eine weibliche figur mit einem apfel" handelt. Die Dimensionen unterscheiden sich in der deutschen und französischen Fassung des Katalogs. Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt 1790/04/13 HBLIE 0242 Cornel. Harlem I Adam und Eva sitzen unter dem verbotenen Baum, indem seine Frau ihm den Apfel gegeben; sehr ausnehmend fleißig gemahlt. Auf Η. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 20 Zoll, breit 17 Zoll Transakt.: Verkauft (1 M) Käufer: Ego Gegenw. Standort: Quimper, France. Musee des Beaux Arts. (408) (?) 1790/09/10 HBBMN 0092 Cornel. Haerlem I Adam und Eva sitzen unter dem verbotenen Baum; sehr fleißig gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 20 Zoll, breit 17 Zoll Transakt.: Verkauft (3 M) Käufer: Bargmann 1793/06/07 HBBMN 0101 Cornelius von Harlem I Diana im rothen Gewände, hält mit der linken Hand einen Jagdhund. Halbe Figur, ein kleines schönes Gemähide von Cornelius von Harlem 1597. Oval. I Format: oval Maße: Hoch 8 Zoll, breit 6 Vi Zoll lnschr.: 1597 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt Gegenw. Standort: Kiel, Deutschland. Kunsthalle. (CAU 53) 1797/04/20 HBPAK 0003 Cornelius von Harlem I Christus in seiner Kindheit, mit Johannes dem Täufer, und vier jungen Knaben. Ein sehr fleißiges Bild. Auf Holz, mit vergoldeten Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Zoll, breit 17 Zoll Transakt.: Unbekannt
Cornelisz. van Haarlem, Cornells (und Savery, R.) 1743/00/00 BWGRA 0016 Roland Saveri; Cornelius van Harlem I Adam und Eva in Paradiese, ein unvergleichliches Stück. Die Landschaft und Thiere sind gemahlet von Roland Saveri, und Adam und Eva von Cornelius van Harlem. I Maße: hoch 2 Fuß 2 Zoll, breit 4 Fuß 3 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt
Cornelisz. van Haarlem, Cornells (Kopie nach) 1759/00/00 LZEBT 0197 C. v. Harlem I Ein Bachanale auf Holtz nach C. v. Harlem. I Mat.: auf Holz Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (80 Th Schätzung)
Cornelisz. van Haarlem, Cornells (Manier)
1763/01/17 HNAN 0008 Antoine Lieri de Correge lUnCupidon dormant par Antoine Lieri de Correge, sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hauteur 3 pieds 3 pouces, Largeur 4 pieds 1 pouce Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt 1764/00/00 BLAN [1003] Corregio I Danae mit 2. Cupidos, ein vordrefliches und rahres gemälde. I Anm.: Da dieses Los in diesem Katalog nicht numeriert ist, wurde die Nummer hinzugefügt. Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (2500 Rt Schätzung) 1764/00/00 BLAN 0001 A: di Coreggio I Die Stärke und die Vorsicht, 2 gantze Figuren auf Holtz gemahlet in einem acht eck. I Format: achteckig Maße: 3 Fuß 11 Zoll hoch, 3 Fuß 11 Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (2500 Rt Schätzung) Gegenw. Standort: Sankt-Peterburg, Rossiya. Ermitazh. (1505) als Correggio Umkreis 1764/03/12 FRKAL 0029 Corregio I La Sainte Vierge avec l'Enfant Jesus parfaitement peint. I Maße: hauteur 10 pouces, largeur 8 pouces Transakt.: Verkauft (16.30 fl) Käufer: Scherrer 1765/00/00 FRNGL 0032 Coregio I Die Findung Mosis. I Transakt.: Unbekannt (20 fl Schätzung) 1768/07/00 MUAN 0016 Corregio (Anton. Allegri da) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1778/09/28 FRAN 0207 Corregio I Eine mit sehr rührendem Ausdruck gemalte Magdalena mit halbentblößter Brust. [Madelaine, le sein ä demi nud, peinte avec beaucoup d'energie.] I Maße: 1 Schuh 7 Zoll breit, 2 Schuh hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (65 fl) Käufer: Gogel 1779/00/00 HB AN 0187 Correggio I Maria, von Engeln und Seraphinen umgeben, fährt gen Himmel. Der heilige Geist wirft seine Stralen auf sie herab. Auf Lapis Lazuli gemalt. [L'assomption. Marie est entouree d'Anges & de Seraphins. Le Saint Esprit jette ses rayons sur eile. Peint sur du lapis lazuli.] I Mat.: auf Lapislazuli Maße: 10 Vi Zoll hoch, 6 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/09/27 FRNGL 0339 Carraggio I Ein todter Christus mit Engeln umgeben, eine Scizze, grau in grau gemalt. [Le corps mort de Jesus-Christ, entoure d'anges, une esquisse, en camayeu.] I Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh breit Transakt.: Verkauft (2.32 fl) Käufer: Rath Ehrenreich
1779/09/27 FRNGL 0547 Cornelius Harlem I Adam und Eva, in der Manier von Cornelius Harlem. [Adam & Eve, dans le gout de Cornelius Harlem.] I Maße: 1 Schuh hoch, 8 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (6.15 fl) Käufer: Mund
1781/05/07 FRHUS 0243 Corregio I Andromeda auf einem Florentinischen Stein mit vielem Fleiß gemahlt, bey welchem Kunst und Natur in eine schöne Harmonie gebracht sind. I Maße: 9 Zoll hoch und 7 Zoll breit Verkäufer: Jacob Bemus Transakt. : Verkauft (11.30 fl) Käufer: Bemus
1779/09/27 FRNGL 0960 Cornelius Harlem I Adam und Eva, in der Manier von Cornelius Harlem. [Adam & Eve, dans le gout de Corn. Harlem.] I Maße: 1 Schuh 9 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 2 Zoll breit Transakt.: Verkauft (5 fl) Käufer: Mund
1784/08/02 FRNGL 0245 Correggio I St. Antonius von Correggio. I Maße: 27 Zoll breit, 23 Vi Zoll hoch Verkäufer: Β Transakt.: Verkauft (10 fl) Käufer: Mövius
Correggio (Antonio Allegri)
1788/10/01 FRAN 0146 Antonius Corregio I St. Antonius, ein Buch und ein Creutz in beyden Händen habend, geistreich und mit vielem Ausdruck. I Maße: 33 Vi Zoll hoch, 27 Zoll breit Transakt.: Verkauft (5 fl) Käufer: Trautman
1670/04/21 WNHTG 0014 Antonio Coreggio I Una Testa di Christo di tutta statura. I Maße: Alto un palmo, e dieci diti, largo uno, e sei diti Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0237 Correggio I Ein Englischer Gruss. Von Correggio. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1759/00/00 LZEBT 0120 Ant. da Carrigio I Andrometa an einem fellsen auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 3 Schuh 6 Zoll, Breite 4 Schuh 10 Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (500 Th Schätzung)
1791/09/21 FRAN 0107 Le Correge I Ein Mannskopf mit seinem Bart; er ist mit vielem Nachdruck und Feuer gemalt. I Transakt.: Verkauft (40 fl) Käufer: Scheibler 1793/00/00 HBMFD 0026 Corregio I Der Heyland ist vorgestellt in den besten Jugendjahren, auf seiner linken Schulter ein grosses Kreutz [Fußnote: An dem Kreutze findet sich das Monagramat. des Meisters ein Α.] tragend, nebst einer langen Lanze wo oben am Heft ein Schwam sticht. In der rechten herabhängenden Hand hält er einen Korb mit Passions-Instrument. Er nimmt seinen Weg mit GEMÄLDE
471
leichten Schritten, von der linken zur rechten Seite des Gemäldes. Sein Körper ist beynah en profil und der Kopf % von vorne zu sehn; im langen purpurnen Rocke, mit bräunlichen Mantel. Um dem Haupte des Heylands eine Klarheit. Der Hintergrund macht eine ganz leichte Landschaft; der Horizont ist sehr tief und bestehet aus einer sehr kleinen Ferne. Die ganze Figur ist von grossen Stile. Man sieht die Bewegung des Fortschreitens. Der Kopf ist voller Leben, und glücklich erhoben durch das treffende Colorit der schönsten Natur. Man sieht mit Bewunderung, wie der Meister die Farben bearbeitet hat. I Mat.: auf Kupfer Maße: 11 Vi Zoll hoch, 8 Vi Zoll breit Verkäufer: Pierre Laporterie Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV 0010 Corregio I Johannes sitzet mit einigen seiner Anhänger unter einem Baum in der Wüste, und deutet auf Christus, welcher etwas entfernter hinzu kommt. Ein vortreflich Gemählde. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 37 Zoll, breit 35 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV 0032 Corregio I Die Findung Moses; und wie Moses Wasser aus den Felsen schlägt in der Wüsten. Beyde in morgenländischen Vorstellungen von Land= und Wasser=Gegenden. Ganz exellente Ausführungen von diesem gmßen [sie] Meister. I Diese Nr.: Die Findung Moses Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Vi Zoll, breit 25 Vi Zoll Anm.: Die Lose 32 und 33 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV 0033 Corregio I Die Findung Moses; und wie Moses Wasser aus den Felsen schlägt in der Wüsten. Beyde in morgenländischen Vorstellungen von Land= und Wasser=Gegenden. Ganz exellente Ausführungen von diesem gmßen [sie] Meister. I Diese Nr.: Wie Moses Wasser aus den Felsen schlägt in der Wüsten Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Vi Zoll, breit 25 Vi Zoll Anm.: Die Lose 32 und 33 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV 0036 Corregio I Auf der Flucht nach Egypten, bey Abendzeit, reicht Joseph und Maria dem Kinde Jesu etwas zu Essen. Sehr fleißig und schön gemahlt. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 22 Vi Zoll, breit 16 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/01/19 HBPAK 0012 Antonio Allegri I Ein Engel mit einem betenden Kinde. Ein mit kühnem Pinsel hingeworfnes, edles Ideal. Der Engel hält daß, mit kindlicher Inbrunst und einem reitzenden Ausdruck des Vertrauens, betende Kind, mit der linken Hand zwischen seinen Knien; blikt es mit ruhiger Theilnahme an, und zeigt mit der rechten gen Himmel, wo ihm ein Lichtglanz entgegen schimmert. Dies Gemähide gehört zu den edelsten Idealen der Kunst, und gerne übersieht man's, daß der linke Arm des Engels oben ein wenig zu sehr verkürzt ist, und die Farben nicht genug in einander getrieben sind. Es ist 2 Fuß 11 Zoll hoch, 2 Fuß 3 Zoll breit. Goldn. Rahm. I Maße: 2 Fuß 11 Zoll hoch, 2 Fuß 3 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0010 Antonius Allegri genannt Corregio I Christus im Oelberge mit einem Engel, von Antonius Allegri genannt Corregio. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 2 Zoll breit 10 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/08/09 HBPAK 0117 Coresio I Eine perspectivische Landschaft. Unter einen Baum sitzet eine betende Heilige als Hirtin, und hütet die Schaafe. Auf Leinwand, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 42 Zoll, breit 36 Zoll Transakt.: Unbekannt
1800/00/00 FRAN2 0104 Corregio I Maria hält das Kind Jesu auf dem Arm; die Stärke des Kolorits, und der mit Grazie und Geist vermengte Ausdruck in den Gesichtszügen, empfehlen dieses Stück jedem Kenner. I Mat.: auf Kupfer Maße: 21 Zoll hoch, 17 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0038 H. Correggio I Zwey Köpfe alter Männer mit Bärten. Kräftig gemahlt. Auf Leinw., schw. Rahm. I Diese Nr.: Kopf eines alten Mannes mit Bart Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 17 Zoll, breit 14 Zoll Anm.: Die Lose 38 und 39 wurden zusammen katalogisiert. Der Name des Künstlers ist angegeben als "H. Correggio", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0039 H. Correggio I Zwey Köpfe alter Männer mit Bärten. Kräftig gemahlt. Auf Leinw., schw. Rahm. I Diese Nr.: Kopf eines alten Mannes mit Bart Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 17 Zoll, breit 14 Zoll Anm.: Die Lose 38 und 39 wurden zusammen katalogisiert. Der Name des Künstlers ist angegeben als "H. Correggio", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0104 Correggio I Die Madonna, der heil. Hieronymus und die Magdalena, jedes in einer Landschaft dargestellt. Auf Leinwand, goldn. Rahm. I Diese Nr.: Die Madonna in einer Landschaft dargestellt Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Zoll, breit 18 Zoll Anm.: Die Lose 104 bis 106 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0105 Correggio I Die Madonna, der heil. Hieronymus und die Magdalena, jedes in einer Landschaft dargestellt. Auf Leinwand, goldn. Rahm. I Diese Nr.: Der heilige Hieronymus in einer Landschaft dargestellt Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Zoll, breit 18 Zoll Anm.: Die Lose 104 bis 106 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0106 Correggio I Die Madonna, der heil. Hieronymus und die Magdalena, jedes in einer Landschaft dargestellt. Auf Leinwand, goldn. Rahm. I Diese Nr.: Die Magdalena in einer Landschaft dargestellt Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Zoll, breit 18 Zoll Anm.: Die Lose 104 bis 106 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Correggio (Antonio Allegri) (Geschmack von) 1778/09/28 FRAN 0429 Correggio I Der heil. Johannes in der Wüste, im Geschmack von Correggio. [S. Jean dans le desert, dans le gout de Correge.] I Maße: 14 Zoll breit, 11 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (15.30 fl) Käufer: Weitsch
Correggio (Antonio Allegri) (Kopie nach) 1742/08/01 BOAN 0250 Corregio I Eine Mater Dei. Nach Corregio. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0597 Corregio I Eine Mater Dei mit dem Kindlein und Joanne nach Corregio. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0348 Correggio I Une Mere de Dieu, d'aprfes Correggio. I Maße: Haut 1. pied 7. pou., large 1. pied 3. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt
1799/10/10 HBPAK 0007 Correggio I Der Kopf einer Heiligen. Sehr schön gemahlt. Auf Leinwand, goldn. Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 25 Zoll, breit 18 Zoll Transakt.: Unbekannt
1742/08/30 BOAN 0398 Correggio I La Ste. Vierge avec l'Enfant Jesus & S. Jean, d'apres Correggio. I Maße: Haut 1. p. 9. pouc. large 1. pied 4. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt
1799/10/10 HBPAK 0026 Correggio I Der Sohn des Tobias mit dem Engel. Meisterhaft gemahlt. Auf Kupfer, braunen und goldnen Rahm. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 15 Zoll, breit 17 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt
1752/05/08 LZAN 0060 Correggio I Eine liegende Venus, die Vanitset vorstellend, eine Copie nach Correggio, 2 Ellen hoch 3 Vi Elle breit im Holl. Rahmen. I Maße: 2 Ellen hoch, 3 14 Elle breit Transakt.: Verkauft (3.12 Th) Käufer: Freund [?]
472
GEMÄLDE
1764/00/00 BLAN 0633 Pologne; Cor regio I 1. Extra schöne Copie nach dem Corregio verfertiget. I Kopie von Pologne nach Correggio Maße: 4 Fuß 5 Zoll hoch, 3 Fuß 4 Vi Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (800 Rt Schätzung) 1768/08/16 KOAN 0080 Corregio I Liegende Magdalena Schetz nach Corregio. I Verkäufer: Freyherr von Kaas Transakt.: Unbekannt 1786/05/02 NGAN 0643 Correggio I Eine büssende Magdalena; nach Correggio. I Maße: 1 Schuh Vi Zoll hoch, 1 Schuh 3 Vi Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (2.3 fl) Käufer: Hacker 1789/00/00 MM AN 0184 Corregio I Sposalitiae Catharinae, auf Holz, 1 Fuß hoch und 10 Zoll breit, nach Corregio. [Les noces de St. Catherine, sur bois, de 1 pied de haut, sur 10 po. de large, däprüs Corregio.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß hoch, 10 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (1.30 fl) 1790/01/07 MUAN 1329 Nach Corregio I Maria mit dem Jesuskinde, oval, auf Leinwat. I Mat.: auf Leinwand Format: oval Maße: Höhe 2 Schuh, Breite 1 Schuh 6 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0156 Korregio I Ein klein liegende Magdalena mit einem Buch in der Hand nach Korregio. I Maße: 7 Vi Zoll hoch, 11 Vi Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1797/08/10 MM AN 0186 Correge I Eine H. Familie: der H. Johannes, ein Märtyrer und einige Engel, welche des Marter Testament halten. Scheint eine Copie nach Correge zu seyn. auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Trans akt.: Unbekannt (20 fl Schätzung) 1797/08/10 MMAN 0212 Correge I Die H. Magdalena auf der Erde liegend und in einem Buch lesend. Nach Correge, auf Tuch. I Mat.: auf Leinwand Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (10 fl Schätzung) 1799/10/18 LZAN 0089 Nach der Zeichnung von Corregio ! Silene von denen Bachanten gebunden, eine bekannte Komposition von fünf Figuren, sehr angenehm gemahlt; hoch 54 Zoll, breit 4 0 Zoll. Auf Leinwand, mit Leisten umgeben. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 54 Zoll, breit 40 Zoll Verkäufer: Rauch Transakt.: Verkauft (7 Th) Käufer: Schwarze 1800/00/00 BLBOE 0146 Schiffner; Coregio I Eine liegende Magdalene liest in einem Buche; nach Coregio. I Kopie von G. Schiffner nach Correggio Transakt.: Unbekannt 1800/01/00 LZAN 0028 A.F. Oeser; Corregio I Joseph mit dem Kinde, nach Corregio. Ein schönes, kräftig gehaltenes Gemälde, und fleissig ausgeführt. I Kopie von A.F. Oeser nach Correggio Maße: Höhe 2 Fuß 5 Zoll, Breite 2 Fuß Verkäufer: A F Oeser Transakt.: Unbekannt
Correggio (Antonio Allegri) (Manier) 1792/09/07 HBBMN 0162 Correggio I Maria mit dem Kinde und Joseph. Ein schönes Gemähide, in der Manier von Correggio. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Transakt.: Verkauft (5 M) Käufer: Eckh 1796/09/08 HBPAK 0131 Corregio I Cupido in einer Muschel auf dem Wasser stehend, hält in der rechten Hand einen Pfeil, und in der linken den Bogen. So schön wie Corregio. I Maße: Hoch 48 Zoll, breit 32 Zoll Transakt.: Unbekannt
Cossiau (Schwester Von) [Nicht identifiziert] (und Cossiau) 1765/03/27 FRKAL 0041 Cossiau; Sa Soeur I Un pai'sage avec des fruits & figures oü les figures sont peintes par sa Soeur. I Maße: hauteur 39 pouces, largeur 32 pouces Transakt.: Verkauft (5 fl) Käufer: Hoch
Cossiau, Jan Joost van 1716/00/00 FRHDR 0065 Cosio I Von Cosio 2. dito [Landschafften]. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (30) 1764/08/25 FRAN 0191 Cossiau I Une Vierge. I Maße: haut 1 pied 9 pouces sur 1 pied 5 pouces de large Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1765/03/27 FRKAL 0042 Cossiau I Lucrece s'enfon5ant le poignard dans le sein. I Maße: hauteur 26 pouces, largeur 26 pouces Transakt.: Verkauft (2 fl) Käufer: Kaller 1768/07/00 MUAN 0551 Cossiau I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0552 Cossiau I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0366 Cossiau I Deux Paysages entremeles de differentes figures. Peints sur toile, marques des Nos. 551 & 552. I Diese Nr.: Un Pay sage entremeles de differentes figures Mat.: auf Leinwand Maße: 2. p. 1 Vi. p. de haut sur 1. p. 7. p. de large Anm.: Die Lose 366 und 367 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0367 Cossiau I Deux Paysages entremeles de differentes figures. Peints sur toile, marques des Nos. 551 & 552. I Diese Nr.: Un Paysage entremeles de differentes figures Mat.: auf Leinwand Maße: 2. p. 1 Vi. p. de haut sur 1. p. 7. p. de large Anm.: Die Lose 366 und 367 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1777/05/26 FRAN 0030 Cossian I Landschaft mit Ruinen und Wasserfall, in die Manier von Elzheimer von Cossian I Verkäufer: Finsterwalder Transakt.: Verkauft (6.20 fl) Käufer: Mevius 1778/09/28 FRAN 0049 Cossian I Eine schöne bergigte Landschaft von Cossian. [Un beau paysage parseme de montagnes par Cossian.] I Maße: 4 Schuh 3 Zoll breit, 3 Schuh 1 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (26 fl) Käufer: Rath Ehrenreich 1779/09/27 FRNGL 0157 Cossiaux I Eine felsigte Landschaft mit Wasserfällen, schönen Figuren und Vieh staffirt. [Un paysage couvert de montagnes avec des cataractes, orne de belles figures & de betail.] I Pendant zu Nr. 158 Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 2 Schuh 10 Zoll breit Transakt.: Verkauft (16 fl für die Nrn. 157 und 158) Käufer: Mund Maler
Correggio (Antonio Allegri) (Schule)
1779/09/27 FRNGL 0158 Cossiaux I Der Compagnon zu obigem, eben so meisterhaft, von nemlicher Hand [Cossiaux] und Maas. [Le pendant du precedant, m e m e force, par le m e m e maitre.] I Pendant zu Nr. 157, "Eine felsigte Landschaft mit Wasserfällen" Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 2 Schuh 10 Zoll breit Transakt.: Verkauft (16 fl für die Nrn. 157 und 158) Käufer: Mund Maler
1742/08/01 BOAN 0155 Corregio I Ein Stuck, drey nackende Weibs-Bilder praesentirend, von der Schule von Corregio. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt
1779/09/27 FRNGL 0236 Cossiaux I Eine kräftig und meisterhaft ausgeführte Landschaft mit Ovidischen Vorstellungen. [Un paysage superieurement bien peint representant des objets tires des meGEMÄLDE
473
tamorphoses d'Ovide.] I Pendant zu Nr. 237 Maße: 1 Schuh 6 % Zoll hoch, 2 Schuh % Zoll breit Transakt.: Verkauft (12.45 fl für die Nrn. 236 und 237) Käufer: Hofnas Manheim 1779/09/27 FRNGL 0237 Cossiaux I Der Compagnon hierzu, eine dergleichen Vorstellung [eine kräftige und meisterhaft ausgeführte Landschaft mit Ovidischen Vorstellungen], von neml. Meister [Cossiaux] und Maas. [Le pendant du precedent, meme objet [un pay sage superieurement bien peint representant des objets tire des metamorphoses d'Ovide], par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 236 Maße: 1 Schuh 6 % Zoll hoch, 2 Schuh % Zoll breit Transakt.: Verkauft (12.45 fl für die Nrn. 236 und 237) Käufer: Hofnas Manheim 1779/09/27 FRNGL 0514 Cossiaux I Eine meisterhafte bergigte Landschaft. [Un tres beau paysage couvert de montagnes.] I Pendant zu Nr. 515 Maße: 1 Schuh 9 V* Zoll hoch, 2 Schuh 2 Zoll breit Transakt.: Verkauft (30 fl für die Nrn. 514 und 515) Käufer: Burger 1779/09/27 FRNGL 0515 Cossiaux I Der Compagnon zu obigem, eine dergleichen schöne Landschaft, von nemlichem Meister [Cossiaux] und Maas. [Le pendant du precedant, meme objet [un tres beau paysage couvert de montagnes], meme beaute, par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 514 Maße: 1 Schuh 9 V* Zoll hoch, 2 Schuh 2 Zoll breit Transakt.: Verkauft (30 fl für die Nrn. 514 und 515) Käufer: Burger 1779/09/27 FRNGL 0947 Cossiaux I Eine schöne bergigt und waldigte Landschaft. [Un beau paysage couvert de montagnes & de bois.] I Maße: 3 Schuh 1 Zoll hoch, 4 Schuh 3 Zoll breit Transakt.: Verkauft (31 fl) Käufer: Mund 1781/02/17 FRAN 0041 Cossiaux I Eine sehr meisterhafte Landschaft, mit Figuren und Vieh von Cossiaux. I Maße: 1 Schuh 6 Zoll breit, 9 Vi Zoll hoch Transakt.: Unbekannt (4.24 fl) 1782/09/30 FRAN 0381 Cossiana I Eine meisterhafte Landschaft, die Gegend eines Waldes vorstellend. [Un paysage representant une foret, chef d'oeuvre, par Cossiana.] I Maße: 1 Schuh 6 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 2 Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (27 fl) Käufer: Grahe 1789/00/00 MM AN 0263 Coscian I Eine Landschaft mit Ruinen, auf Leinw. [Un paysage avec ruine.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 4 Zoll hoch, 1 Fuß 8 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0265 Cosiau I Zwey Landschaften, die eine von Cosiau, die andere von Wilh. Bemmel. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft von Cosiau Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 5 Zoll breit 1 Schuh 9 Zoll Anm.: Die Lose A265 und A266 wurden zusammen katalogisiert. Dieses Los wurde zusammen mit der Nr. A266 (W. Bemmel) verkauft. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Cossiau, Jan Joost van (und Cossiau (Schwester von)) 1765/03/27 FRKAL 0041 Cossiau; Sa Soeur I Un pai'sage avec des fruits & figures oü les figures sont peintes par sa Soeur. I Maße: hauteur 39 pouces, largeur 32 pouces Transakt.: Verkauft (5 fl) Käufer: Hoch
Cossiers, Jan 1764/05/28 BOAN 0342 Cocciers I La Tete d'unjeune Homme peinte par Cocciers. [Ein jünglings Kopf Von Cocciers.] I Maße: 1 pied 6 pouces de hauteur, 1 pied 3 pouces de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (2.40 Rt) Käufer: Broggia 1788/09/01 KOAN 0112 Cossiers I Schäfer und Schäferin mit Schafen. [1 p[iece]. d'un Berger & Bergere avec des moutons.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 6 Fuß 5 Zoll, Breite 7 Fuß 8 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 474
GEMÄLDE
1791/09/21 FRAN 0060 Coetsiers I Eine heil. Familie aus fünf Figuren bestehend; dieses Gemälde ist nach des Van Dyks Art gemalt, sehr fein und die Farben wohl gemischt. I Transakt.: Verkauft (17.15 fl) Käufer: Levy
Cossiers, Jan (geändert von Corners) 1765/00/00 FRRAU 0023 Coniers; Cocciers I Einen schlafenden Kopf von einem jungen Menschen vorstellend, ist wohl gezeichnet, in einer starken Colorit und einem rothen Gewand. Ohne Rahme auf Holz. Representant une tete de jeune homme dormant, eile est tres-bien dessinee, d'un haut colons & d'une etofe rouge. Sans la bord. sur du b. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 1 Schuh 3 Zoll, breit 1 Schuh 1 Zoll Anm.: Im Exemplar AAP wurde der Name "Coniers" handschriftlich durchgestrichen und in "Cocciers" korrigiert. Transakt.: Unbekannt
Costa, Angelo-Maria 1798/01/19 HBPAK 0092 Costa de Milano I Zwey römische Ruinen, nach der Natur gezeichnet, und vortreflich gemahlt. Gleicher Grösse. 1 Fuß 9 Zoll hoch, 1 Fuß 6 Zoll breit. Goldn. Rahm. I Diese Nr.: Eine römische Ruine Maße: 1 Fuß 9 Zoll hoch, 1 Fuß 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 92 und 93 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/01/19 HBPAK 0093 Costa de Milano I Zwey römische Ruinen, nach der Natur gezeichnet, und vortreflich gemahlt. Gleicher Grösse. 1 Fuß 9 Zoll hoch, 1 Fuß 6 Zoll breit. Goldn. Rahm. I Diese Nr.: Eine römische Ruine Maße: 1 Fuß 9 Zoll hoch, 1 Fuß 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 92 und 93 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Coster, Willem Jansz. 1747/04/06 HB AN 0079 Cosier aus Bremen I Ein Tabacksraucher von Cöster aus Bremen. I Maße: 2 Fuß 5 Zoll Breite und 2 Fuß 9 Zoll Höhe Verkäufer: Brockes Transakt.: Unbekannt (4.2)
Cosway, Richard 1789/04/16 HBTEX 0110 Cosway I Liebe und Unschuld, durch Kinder vorgestellt; halbe Figuren, von schönen und angenehmen Colorit und fleißiger Mahlerey, auf Holz. I Diese Nr.: Liebe, durch Kinder vorgestellt; halbe Figur, von schönen und angenehmen Colorit und fleißiger Mahlerey Mat.: auf Holz Maße: Hoch 5 Zoll, breit 4 Zoll Anm.: Die Lose 110 und 111 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (6 Μ für die Nm. 110 und 111) Käufer: Muhl 1789/04/16 HBTEX O l l i Cosway I Liebe und Unschuld, durch Kinder vorgestellt; halbe Figuren, von schönen und angenehmen Colorit und fleißiger Mahlerey, auf Holz. I Diese Nr.: Unschuld, durch Kinder vorgestellt; halbe Figur, von schönen und angenehmen Colorit und fleißiger Mahlerey Mat.: auf Holz Maße: Hoch 5 Zoll, breit 4 Zoll Anm.: Die Lose 110 und 111 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (6 Μ für die Nrn. 110 und 111) Käufer: Muhl
Courripi [Nicht identifiziert] 1799/00/00 WZAN 0479 Courripi I Die Familie Christi, bezeichnet Courripi. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 11 Zoll breit 1 Schuh 5 Zoll Inschr.: Courripi (bezeichnet) Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Courtin, Jacques Francois 1764/00/00 BLAN 0044 Cortoing I 1. Pries ten η der Venus auf Leinwand gemahlt. I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 11 Zoll hoch, 2 Fuß 4 Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (500 Rt Schätzung) Gegenw. Standort: Sankt-Peterburg, Rossiya. Ermitazh. (N 1212) als Jean Raoux 1796/00/00 BSAN 0073 Jean Courtin I Une Esquisse non finie. Dans une foret, un berger poursuit une bergere. D ' u n cöte, une fontaine oü des femmes viennent puiser de l'eau; de l'autre, un autel au bord du ruisseau qui vient de la fontaine, oü des bergeres apportent des guirlandes. Au coin, un pasteur j o u e de la flute, en gardant son troupeau. Costume Grec. I Mat.: auf Holz Maße: Haut de 1 pied 5 pouces; large de 1 pied 10 pouces Anm.: Der N a m e des Künstlers ist angegeben als "Jean Courtin", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Verkäufer: Merian l'aine Transakt.: Unbekannt (4)
Courtois, Jacques (II Borgognone) 1742/08/30 BOAN 0181 Bourguignon I Deux Batailles, par Bourguignon. I Maße: Hauts 1. pie 3. pouces, larges 2. pies 8. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1750/10/15 HB AN 0009 Brodignano I Zwey Bataillen, oval. I Diese Nr.: Eine Bataille Format: oval Maße: 1 Fuß 6 Vi Zoll hoch, 1 Fuß 11 Zoll breit Anm.: Die Lose 9 und 10 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (30 für die Nrn. 9 und 10) 1750/10/15 HB AN 0010 Brodignano I Zwey Bataillen, oval. I Diese Nr.: Eine Bataille Format: oval Maße: 1 Fuß 6 Vi Zoll hoch, 1 Fuß 11 Zoll breit Anm..· Die Lose 9 und 10 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (30 für die Nrn. 9 und 10) 1759/00/00 LZEBT 0060 Bourgognon I Eine Bataille auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 6 Schuh 2 Zoll, Breite 4 Schuh Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (500 Th Schätzung) 1763/11/09 FRJUN 0021 Bourgognon I Une Bataille vigoureusement peint. I Maße: hauteur 17 pouces, largeur 25 Vi pouces Transakt.: Verkauft (21.15 fl für die Nrn. 21 und 22) Käufer: Hoch 1763/11/09 FRJUN 0022 Bourgognon I Une semblable [Bataille] pas moindre & de m e m e grandeur. I Maße: hauteur 17 pouces, largeur 25 Vi pouces Transakt.: Verkauft (21.15 fl für die Nrn. 21 und 22) Käufer: Hoch 1764/00/00 BLAN 0198 Bourgignon I 1. Scharmützel vorstellend, Extra schön auf Holtz gemahlt. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 8 Zoll hoch, 2 Fuß 8 Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (500 Rt Schätzung) 1764/00/00 BLAN 0586 Bourgignon I 1. feine verfertigte Bataille. I Maße: 1 Fuß 2 Vi Zoll hoch, 1 Fuß 9 Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (100 Rt Schätzung) 1764/00/00 BLAN 0701 Bourgignon \ 1. Bataille. I Maße: 2 Fuß 1 Vi Zoll hoch, 3 Fuß breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (200 Rt Schätzung) 1764/05/16 BOAN 0011 Bourguignon I Deux Tableaux de deux pieds un pouce de longueur & d ' u n pied un pouce de hauteur, representants une Bataille & Campement, peints par Bourguinon. [Zwey stück Vorstellend Bataillen und Campements gemahlt von Bourgignon.] I Diese Nr.: Une Bataille & Campement Maße: 2 pieds 1 pouce de longueur & 1 pied 1 pouce de hauteur Anm.: Die Lose 11 und 12 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (32 Rt für die Nrn. 11 und 12) Käufer: jud Baruch 1764/05/16 BOAN 0012 Bourguignon I Deux Tableaux de deux pieds un pouce de longueur & d ' u n pied un pouce de hauteur, repre-
sentants une Bataille & Campement, peints par Bourguinon. [Zwey stück Vorstellend Bataillen und Campements gemahlt von Bourgignon.] I Diese Nr.: Une Bataille & Campement Maße: 2 pieds 1 pouce de longueur & 1 pied 1 pouce de hauteur Anm.: Die Lose 11 und 12 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (32 Rt für die Nrn. 11 und 12) Käufer: jud Baruch 1764/06/06 BOAN 0607 Bourguignon I Deux Pieces de Bataille de deux pieds neuf pouces de hauteur, trois pieds quatre pouces de largeur, peintes par Bourguignon. [Zwey stück Vorstellend bataillen, gemahlt Von Bourgignon.] I Maße: 2 pieds 9 pouces de hauteur, 3 pieds 4 pouces de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (75 Rt) Käufer: Hof C Rath Broggia 1764/08/25 FRAN 0421 Bourgignon I 2 Batailles. I Diese Nr.: 1 Bataille Maße: haut 1 pied 3 pouces sur 1 pied 7 pouces de large Anm.: Die Lose 421 und 422 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1764/08/25 FRAN 0422 Bourgignon I 2 Batailles. I Diese Nr.: 1 Bataille Maße: haut 1 pied 3 pouces sur 1 pied 7 pouces de large Anm.: Die Lose 421 und 422 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRRAU 0060 Bourguignon I Vorstellend eine Schlacht. Man solte glauben, Bourguignon hätte dieses Bild in währender Action gemahlt; denn natürlicher ist wol durch den Pinzel nichts auszudrucken, als der Affect in den agierenden Kriegern und Pferdten; Die Colorit ist warm und glühend, die Zeichnung ist sehr gut, in der Haltung so viel Fleiß, als Geschicklichkeit, überhaupt alles so ordinirt, dass man den Meister einen der vollkommensten Bataillen=Mahler nennen kan. Auf Tuch gemahlt. Representant Bataille. On diroit que Bourguignon a fait cette piece pendant Taction; Car il n'est pas possible de rien exprimer plus naturellement avec le pingeau, que la passion qui est exprimee dans les actions des gueriers & des chevaux. Le Coloris est chaud & enflamme, le dessein est parfait & il y a dans l'ordonnance autant d'art, que de soin. En general tout est si bien arrange, qu'on le peut appeller un parfait Maitre en fait de batailles. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 2 Schuh 9 Zoll, breit 3 Schuh 5 Zoll Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRRAU 0061 Bourguignon I Präsentiret auch ein Treffen, und ist dieses Bild so herrlich ausgeführt, daß es zu obigem den Compagnon abgeben kan; Dann bey dem ersten ist die Action gegen Tag und bey diesem gegen die Nacht gemahlt. Von derselbigen Höhe und Breite auf Tuch gemahlt. Representant encor une bataille, & cette piece est si bien travaillee; qu'elle peut etre le compagnon de l'autre; car dans l'autre Taction se passe le matin & dans celle-ci le soir. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 2 Schuh 9 Zoll, breit 3 Schuh 5 Zoll Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0088 Bourguignon (Petr. Courtois) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0089 Bourguignon (Petr. Courtois)\ [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0315 Bourguignon (Petr. Courtois) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0316 Bourguignon (Petr. Courtois) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger GEMÄLDE
475
Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0481 Bourguignon (Petr. Courtois)\ [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0482 Bourguignon (Petr. Courtois) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0550 Bourguignon (Petr. Courtois) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0728 Bourguignon (Petr. Courtois) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0729 Bourguignon (Petr. Courtois) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/08/16 KOAN 0019 Bourdignon I Eine Landschaft der Mondschein von Bourdignon mit Rahmen. I Maße: Höhe 3 Fuß 10 Zoll, Breite 2 Fuß 10 Zoll Verkäufer: Freyherr von Kaas Transakt.: Unbekannt 1768/08/16 KOAN 0026[b] Bourgignon I Zwey Stück Stell von Sosuve, daß andere Bekehrung Saulus von Bourgignon mit braunen Rahmen. I Diese Nr.: Bekehrung Saulus; Nr. 26[a] von Sosuve Maße: Höhe 1 Fuß 5 Zoll, Breite 1 Fuß 3 Zoll Verkäufer: Freyherr von Kaas Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0324 Bourguignon (Pierre Courtois) I Deux Batailles. Peintes sur toile marquees des Nos. 315. & 316. I Diese Nr.: Une Bataille Mat.: auf Leinwand Maße: 1. p. 3 p. de haut sur 2. pieds de large Anm.: Die Lose 324 und 325 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0325 Bourguignon (Pierre Courtois) I Deux Batailles. Peintes sur toile marquees des Nos. 315. & 316. I Diese Nr.: Une Bataille Mat.: auf Leinwand Maße: 1. p. 3 p. de haut sur 2. pieds de large Anm.: Die Lose 324 und 325 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt. : Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0326 Bourguignon (Pierre Courtois) I Deux Battailles. Peintes sur toile, marquees des Nos. 481. & 482. [ Diese Nr.: Une Battaille Mat.: auf Leinwand Maße: 4. pieds de haut sur 6. pieds de large Anm.: Die Lose 326 und 327 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francis Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0327 Bourguignon (Pierre Courtois) I Deux Battailles. Peintes sur toile, marquees des Nos. 481. & 482. I Diese Nr.: Une Battaille Mat.: auf Leinwand Maße: 4. pieds de haut sur 6. pieds de large Anm.: Die Lose 326 und 327 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0328 Bourguignon (Pierre Courtois) I Une Battaille. [Peintes sur toile marquees des Nos. 728. & 729.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2. p. 3. p. de haut sur 2. p. 11. p. de large 476
GEMÄLDE
Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 329 und beziehen sich auf die Nrn. 328 und 329. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0329 Bourguignon (Pierre Courtois) I Comme les paysans sont contraints de se rendre prisonniers ä un parti de troupes legeres. Peintes sur toile marquees des Nos. 728 & 729. I Mat.: auf Leinwand Maße: 2. p. 3. p. de haut sur 2. p. 11. p. de large Anm.: Die Angaben zum Material im Bildtitel beziehen sich auf die Nrn. 328 und 329. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1770/10/29 FRAN 0161 Burgignon I Zwey Bataille. I Maße: Hoch 30 Zoll. Breit 60 Zoll. Transakt.: Unbekannt 1771/05/06 FRAN 0112 Bourgignon I Zwey schöne und sehr meisterhaft auf Tuch gemahlte Bataillen. I Diese Nr.: Eine schöne und sehr meisterhaft auf Tuch gemahlte Bataille Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 27 Zoll, breit 32 Zoll Anm.: Die Lose 112 und 113 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friederich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt 1771/05/06 FRAN 0113 Bourgignon I Zwey schöne und sehr meisterhaft auf Tuch gemahlte Bataillen. I Diese Nr.: Eine schöne und sehr meisterhaft auf Tuch gemahlte Bataille Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 27 Zoll, breit 32 Zoll Anm.: Die Lose 112 und 113 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friederich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt 1775/05/15 FRAN 0074 Bourgignon I Zwey schöne und sehr meisterhaft auf Tuch gemahlte Bataillen. I Diese Nr.: Eine schöne und sehr meisterhaft auf Tuch gemahlte Bataille Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 27 Zoll, breit 32 Zoll Anm.: Die Lose 74 und 75 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt 1775/05/15 FRAN 0075 Bourgignon I Zwey schöne und sehr meisterhaft auf Tuch gemahlte Bataillen. I Diese Nr.: Eine schöne und sehr meisterhaft auf Tuch gemahlte Bataille Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 27 Zoll, breit 32 Zoll Anm.: Die Lose 74 und 75 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt 1776/00/00 WZTRU 0020 Jakob Courtois genannt Bourgoignon I Ein Stück von 1 Schuhe, 11 Zoll hoch, 2 Schuhe, 5 Zoll breit von Jakob Courtois genannt Bourgoignon, eine von Cavallerie sich zeigende Bataille. Man findet in diesem Werke einen erhabenen Verstand, eine erstaunliche Lebhaftigkeit, die Composition hierinn gleichet nichts gemeines, ist voll der Stärke und Herzhaftigkeit; eine frische und glänzende Colorite unterstützet sie, und überhaupt herrschet das hierinn, was vorzüglich in dieser Art Malerey ihm vielen Ruhm zuwegen brachte. I Maße: 1 Schuhe 11 Zoll hoch, 2 Schuhe 5 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (150 fl Schätzung) 1777/05/26 FRAN 0555 Burchiliung I 2 Batallien. I Verkäufer: Finsterwalder Transakt.: Verkauft (4.16 fl) Käufer: Zimmer 1777/05/26 FRAN 0636 Burgliung I 2 Batallien v. Burgliung. I Verkäufer: Finsterwalder Transakt.: Verkauft (7.4 fl) Käufer: Hüsgen 1778/03/28 HBSCM 0011 Burginion I Zween Bataillen von Cavallerie. I Diese Nr.: Eine Bataille von Cavallerie Anm.: Die Lose 11 und 12 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/03/28 HBSCM 0012 Burginion I Zween Bataillen von Cavallerie. I Diese Nr.: Eine Bataille von Cavallerie Anm.: Die Lose 11 und 12 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/05/21 HBKOS 0045 Burginion I Eine Seite von einer Cavallerie=Bataille. I Transakt.: Unbekannt 1779/09/27 FRNGL 0458 Bourgignon I Eine meisterhafte Bataille. [Une bataille superieurement bien peinte.] I Pendant zu Nr.
459 Maße: 1 Schuh 5 Zoll hoch, 2 Schuh breit Transakt.: Verkauft (10 fl für die Nrn. 458 und 459) Käufer: Rath Eichhorn 1779/09/27 FRNGL 0459 Bourgignon \ Der Compagnon zu obigem, von nemlichem Meister [Bourgignon] und Maas. [Le pendant du precedant, par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 458, "Eine meisterhafte Bataille" Maße: 1 Schuh 5 Zoll hoch, 2 Schuh breit Transakt.: Verkauft (10 fl für die Nrn. 458 und 459) Käufer: Rath Eichhorn 1781/00/00 WRAN 0240 Jacques Courtois, dit le Bourgignon I Deux Batailles, une par Philippe le Napolitain, & l'autre par Jacques Courtois, dit le Bourgignon, faisant pendant ensemble, lignes de large. I Diese Nr.: Une Bataille; Pendant zu Nr. 239 von Filippo Napoletano Maße: 6 pouces 7 lignes de haut, sur 8 pouces 5 lignes de large Anm.: Die Lose 239 und 240 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0020 Jakob Courtois genannt Bourgoignon 1 Ein Stück von 1 Schuhe, 11 Zoll hoch, 2 Schuhe, 5 Zoll breit von Jakob Courtois genannt Bourgoignon, eine Bataille unter der Kavallerie vorstellend. Man findet in diesem Werke einen erhabenen Verstand, eine erstaunliche Lebhaftigkeit, die Komposition hat hierinn nichts gemeines, sie ist voll der Stärke und Herzhaftigkeit; eine frische und glänzende Kolorite unterstützet sie, und überhaupt herrschet hierinn das, was vorzüglich in dieser Art Malerey ihm vielen Ruhm zuwegebrachte. I Maße: 1 Schuhe 11 Zoll hoch, 2 Schuhe 5 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1782/09/30 FRAN 0046 Bourgignon I Verschiedene ganze und angeschnittene Citronen, Brod, und ein grosses Römerglas mit Wein, fleißig nach dem Leben abgebildet von Bourgignon. [Plusieurs citrons tant en entier que coupes, du pain, un grand verre rempli de vin, tres bien imite d'aprfes nature, par Bourguignon.] I Maße: 2 Schuh hoch, 1 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (4.30 fl) Käufer: Prinz von D[essau] 1782/09/30 FRAN 0194 Bourgignon I Zwei meisterhafte Reutergefechte. [Deux combats entre des cavaliers, chefs d'oeuvre, par Bourguignon.] I Diese Nr.: Ein meisterhaftes Reutergefecht Maße: 1 Schuh 10 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 194 und 195 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (32 fl für die Nrn. 194 und 195) Käufer: Mevius 1782/09/30 FRAN 0195 Bourgignon I Zwei meisterhafte Reutergefechte. [Deux combats entre des cavaliers, chefs d'oeuvre, par Bourguignon.] I Diese Nr.: Ein meisterhaftes Reutergefecht Maße: 1 Schuh 10 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 194 und 195 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (32 fl für die Nm. 194 und 195) Käufer: Mevius 1783/06/19 HBRMS 0032 Bourguignon I Ein Scharmützel; im Vordergrunde wird ein Reuter erstochen, zur Linken liegen verschiedene todte Pferde. L[einwand]. g.R. [verguldeter Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 5 Zoll hoch, 1 Fuß 10 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1784/09/27 FRAN 0093 Bourguignon I Zwey kleine meisterhafte Bataillen von Bourguignon. [Deux petites pieces representantes des batailles, chefs d'oeuvre par Bourguignon.] I Maße: 6 Zoll hoch, 8 Zoll breit Verkäufer: Freyherr von Berberich Transakt.: Verkauft (22.45 fl) Käufer: Stoeber 1785/05/17 MZAN 0002 Bourguignon I Zwey Bataillenstücke von Bourguignon. [Deux batailles.] I Diese Nr.: Ein Bataillenstück Maße: 3 Schuh hoch, 4 Schuh 9 Zoll breit Anm.: Die Lose 2 und 3 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Unverkauft Gegenw. Standort: Aschaffenburg, Deutschland. Bayerische Staatsgemäldesammlungen. (6582) als Nachfolger von J. Courtois
1785/05/17 MZAN 0003 Bourguignon I Zwey Bataillenstücke von Bourguignon. [Deux batailles.] I Diese Nr.: Ein Bataillenstück Maße: 3 Schuh hoch, 4 Schuh 9 Zoll breit Anm.: Die Lose 2 und 3 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Unverkauft Gegenw. Standort: Aschaffenburg, Deutschland. Bayerische Staatsgemäldesammlungen. (6555) als Nachfolger von J. Courtois 1785/05/17 MZAN 0403 Bourguignon I Noch Zwey dergleichen [Bataille=] Stücke von Bourguignon. [Deux batailles.] I Diese Nr.: Ein Bataillestück Maße: 10 Zoll hoch, 1 Schuh 2 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 403 und 404 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (5 fl für die Nrn. 403 und 404) Käufer: Schwanck 1785/05/17 MZAN 0404 Bourguignon I Noch Zwey dergleichen [Bataille=] Stücke von Bourguignon. [Deux batailles.] I Diese Nr.: Ein Bataillestück Maße: 10 Zoll hoch, 1 Schuh 2 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 403 und 404 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (5 fl für die Nrn. 403 und 404) Käufer: Schwanck 1786/11/11 HBRMS 0065 Bourgignon I Zwey vortrefliche Battaillien, sehr kräftig und meisterhaft ausgedruckt. I Diese Nr.: Eine vortrefliche Battaillie Maße: Höhe 15 Zoll, Breite 20 Zoll Anm.: Die Lose 65 und 66 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/11/11 HBRMS 0066 Bourgignon I Zwey vortrefliche Battaillien, sehr kräftig und meisterhaft ausgedruckt. I Diese Nr.: Eine vortrefliche Battaillie Maße: Höhe 15 Zoll, Breite 20 Zoll Anm.: Die Lose 65 und 66 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1787/00/00 HB AN 0197 Jac. Courtois, gen. Bourgignion I Zwey Bataillen zwischen Christen und Türken. In den Vordergründen attaquiren sich verschiedene Cavalleristen. Diese beyden Bilder sind von schauderndem Anblick, und mit einem besondern hurtigen und kräftigen Pinsel gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Diese Nr.: Eine Bataille zwischen Christen und Türken Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 14 Vi Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 197 und 198 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (132.8 Μ für die Nrn. 197 und 198) Käufer: Fesser 1787/00/00 HB AN 0198 Jac. Courtois, gen. Bourgignion I Zwey Bataillen zwischen Christen und Türken. In den Vordergründen attaquiren sich verschiedene Cavalleristen. Diese beyden Bilder sind von schauderndem Anblick, und mit einem besondern hurtigen und kräftigen Pinsel gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Diese Nr.: Eine Bataille zwischen Christen und Türken Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 14 Vi Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 197 und 198 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (132.8 Μ für die Nrn. 197 und 198) Käufer: Fesser 1788/04/07 FRFAY 0050 Bourguignon I Zwey Bataillenstücke, richtig gezeichnet und markigt gemalt, von Bourguignon. Auf Tuch. I Diese Nr.: Ein Bataillenstück, richtig gezeichnet und markigt gemalt Mat.: auf Leinwand Maße: 14 Z. hoch, und 22 Z. breit Anm.: Die Lose 50 und 51 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (7 fl für die Nrn. 50 und 51) Käufer: Hirth 1788/04/07 FRFAY 0051 Bourguignon I Zwey Bataillenstücke, richtig gezeichnet und markigt gemalt, von Bourguignon. Auf Tuch. I Diese Nr.: Ein Bataillenstück, richtig gezeichnet und markigt gemalt Mat.: auf Leinwand Maße: 14 Z. hoch, und 22 Z. breit Anm.: Die Lose 50 und 51 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (7 fl für die Nrn. 50 und 51) Käufer: Hirth 1788/06/12 HBRMS 0023 Bourgignon I Zwey Schlachten zwischen Türken und Christen: in dem bekannten Feuer dieses großen Künstlers, und mit dem freyesten Pinsel gemalt. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Ein Schlacht zwischen Türken und Christen Mat.: auf GEMÄLDE
477
Leinwand Maße: Hoch 28 Zoll, breit 39 Vi Zoll Anm.: Die Lose 23 und 24 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1788/06/12 HBRMS 0024 Bourgignon I Zwey Schlachten zwischen Türken und Christen: in dem bekannten Feuer dieses großen Künstlers, und mit dem freyesten Pinsel gemalt. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Ein Schlacht zwischen Türken und Christen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 28 Zoll, breit 39 ¥2 Zoll Anm.: Die Lose 23 und 24 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0034 Bourgignon I Eine Batallie. [1 pfiece]. d'une Bataille.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 2 Zoll, Breite 1 Fuß 6 Zoll Anm.: Dieses Los trägt im Katalog irrtümlicherweise die Nr. 31. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0042 Bourgignon I 2 Batallien. [2 p[ieces], de Batailles.] I Diese Nr.: Eine Bataillie Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 8 Zoll, Breite 1 Fuß 2 Zoll Anm.: Die Lose 42 und 43 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0043 Bourgignon I 2 Batallien. [2 p[ieces], de Batailles.] I Diese Nr.: Eine Bataillie Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 8 Zoll, Breite 1 Fuß 2 Zoll Anm.: Die Lose 4 2 und 43 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0817 Bourgignon I 2 Batallien. [2 p[ieces]. de Batailles.] I Diese Nr.: Eine Batallie Maße: Höhe 1 Fuß 6 Zoll, Breite 2 Fuß Anm.: Die Lose 817 und 818 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0818 Bourgignon I 2 Batallien. [2 p[ieces], de Batailles.] I Diese Nr.: Eine Batallie Maße: Höhe 1 Fuß 6 Zoll, Breite 2 Fuß Anm.: Die Lose 817 und 818 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1789/00/00 MMAN 0234 Jacques Bourguignon I Zwei Bataillenstücke, auf Leinw. [Deux batailles, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 11 Zoll hoch, 2 Fuß 10 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (400 fl) 1790/01/07 MUAN 0318 Bourguignon I Em Bataillestück, auf Leinwat. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 6 Zoll, Breite 4 Schuh Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0393 Bourguignon I Eine niederländische Landschaft mit kleinen Figuren, auf Holz, in einer geschnittenen und vergoldeten Ram. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 4 Zoll, Breite 2 Schuh Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0403 Bourguignon I Ein Lagerstück, auf Leinwat, in einer vergoldeten Ram. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh, Breite 1 Schuh 4 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0521 Bourguignon I Zwey Scharmüzelstükke, auf Leinw. I Diese Nr.: Ein Scharmüzelstück Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 6 Zoll, Breite 2 Schuh 4 Zoll Anm.: Die Lose 521 und 522 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0522 Bourguignon I Zwey Scharmüzelstükke, auf Leinw. I Diese Nr.: Ein Scharmüzelstück Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 6 Zoll, Breite 2 Schuh 4 Zoll Anm.: Die Lose 521 und 522 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1646 Bourguignon I Zwey Bataillenstücke, auf Leinwat, in metallisirten Ramen. I Diese Nr.: Ein Bataillenstück Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 4 Schuh 4 Zoll, Breite 5 Schuh 8 Zoll Anm.: Die Lose 1646 und 1647 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 478
GEMÄLDE
1790/01/07 MUAN 1647 Bourguignon I Zwey Bataillenstücke, auf Leinwat, in metallisirten Ramen. I Diese Nr.: Ein Bataillenstück Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 4 Schuh 4 Zoll, Breite 5 Schuh 8 Zoll Anm.: Die Lose 1646 und 1647 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 2154 Bourguignon I Ein Bataillenstück, auf Leinwat. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 8 Zoll, Breite 2 Schuh 3 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/08/25 FRAN 0271 Bourgignon I Zwey Campagnestück. I Diese Nr.: Ein Campagnestück Maße: hoch 30 Zoll, breit 59 Zoll Anm.: Die Lose 271 und 272 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Unbekannt (5.45 fl für die Nrn. 271 und 272) 1790/08/25 FRAN 0272 Bourgignon I Zwey Campagnestück. I Diese Nr.: Ein Campagnestück Maße: hoch 30 Zoll, breit 59 Zoll Anm.: Die Lose 271 und 272 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Unbekannt (5.45 fl für die Nrn. 271 und 272) 1791/05/28 HBSDT 0125 Jacob Courtois Brgn: I Cavalleristen attaquiren sich im Vordergrunde auf einer Anhöhe. Hinten wird man ein hitziges Gefechte gewahr. Besonders stark, und mit meisterhaften Pinsel gemahlt, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 28 Zoll, breit 38 Zoll Transakt.: Unbekannt 1791/05/30 FRAN 0166 Bourguignon I Eine schöne Bataille von Bourguignon. I Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch und 1 Schuh 9 Zoll breit Verkäufer: Bansa Transakt.: Verkauft (3) Käufer: Lindlau 1791/09/21 FRAN 0040 Bourguignon I Verschiedene Angriffe von Reuterey auf verschiedenen Abrissen, in der Entfernung siehet man eine Festung; dieses Gemähide ist von einem schönen Zusammenhange und sehr lebhaft gemahlt. I Transakt.: Verkauft (35 fl) Käufer: ν Schmidt 1792/08/20 KOAN 0225 Burgion I Zwey Batallien von Kavallerie in rundem Format von Burgion. I Diese Nr.: Ein Batallie von Kavallerie in rundem Format Format: rund Maße: 10 Zoll hoch, 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 225 und 226 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0226 Burgion I Zwey Batallien von Kavallerie in rundem Format von Burgion. I Diese Nr.: Ein Batallie von Kavallerie in rundem Format Format: rund Maße: 10 Zoll hoch, 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 225 und 226 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/09/28 HBBMN 0019 Burgignon I Zwey morgenländische Seeprospecte; sehr stark und meisterhaft gemahlt, von Burgignon. Auf L[einwand], I Diese Nr.: Ein morgenländischer Seeprospect Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 15 % Zoll, breit 22 14 Zoll Anm.: Die Lose 19 und 20 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1792/09/28 HBBMN 0020 Burgignon I Zwey morgenländische Seeprospecte; sehr stark und meisterhaft gemahlt, von Burgignon. Auf L[einwand]. I Diese Nr.: Ein morgenländischer Seeprospect Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 15 % Zoll, breit 22 % Zoll Anm.: Die Lose 19 und 20 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1792/10/12 KOAN 0010 Bourgignon I Eine Soldatentrup an einem Wirthshaus, von Bourgignon, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 4 Fuss 3 Zoll - breit 4 Fuss 6 Zoll Verkäufer: Moureaux Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0024 Bourguignion I Eine mit vielem Feuer und Geist kräftig ausgeführte Bataille, mit unzähliger Menge von Figuren, von Bourguignion. I Pendant zu Nr. 25 Maße: 2 Schuh 11 Zoll hoch, 4 Schuh 11 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
1793/00/00 NGWID 0025 Bourguignion I Der Compagnon zu obigem, mit eben der Mühe ausgearbeitet, vom nemlichen Meister [Bourguignion] und Maaß. I Pendant zu Nr. 24 Maße: 2 Schuh 11 Zoll hoch, 4 Schuh 11 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0226 Bourguignon I Eine sehr gute Bataille, mit sehr vielen Figuren, von Bourguignon. I Pendant zu Nr. 227 Maße: 2 Schuh 11 Zoll hoch, 4 Schuh breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0227 Bourguignon I Zum Compagnon, eine in nemlicher Manier, und eben so fleißig ausgearbeitete Bataille, von obigem Meister [Bourguignon] und Maaß. I Pendant zu Nr. 226 Maße: 2 Schuh 11 Zoll hoch, 4 Schuh breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 HB AN 0119 Courtois genannt Bourguignon I Ein Reutergefecht. Auf einen, im Vorgrunde an der Erde, wehrlos liegenden Verwundeten schiesst ein Reuter sein Pistol ab, dem mit blutigen Degen ein feindlicher Reuter nachsprengt; mehrere verfolgen einander. I Maße: Höhe 13 Zoll, Breite 19 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1796/02/17 HBPAK 0135 Bergigneau I Eine schattige Landschaft mit Gehölz und Figuren. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 16 Zoll, Breite 19 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (92 M) Käufer: Ρ 1797/09/13 FRAN 0014 Jacob Courtois, genannt Bourguignon I Zwey fürtrefliche Bataillen=Stücke. I Diese Nr.: Ein fürtrefliches Bataillen=Stück Maße: 1 Vi Schuh hoch, 2 Schuh 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 14 und 15 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (101 fl für die Nrn. 14 und 15) 1797/09/13 FRAN 0015 Jacob Courtois, genannt Bourguignon I Zwey fürtrefliche Bataillen=Stücke. I Diese Nr.: Ein fürtrefliches Bataillen=Stück Maße: 1 Vi Schuh hoch 2 Schuh 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 14 und 15 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (101 fl für die Nrn. 14 und 15) 1798/01/19 HBPAK 0043 Burgignon I Fünf grosse Gemähide von vielem Werth, a) Die Belagerung von Wien durch die Türken, und die Entsetzung durch J. Sobieski. Im Hintergrunde Wien mit dem Lauf der Donau, die Türken nehmen die Flucht, ob sie sich noch gleich im Vordergrunde wüthend vertheidigen. Die Figuren sind im Vordergrunde 3 bis 4 Zoll hoch, und die Menge erstaunlich. Das Ganze gehört zu den besten Schlachten Burgignons. b.c.d.e) Sind vier Portraits in Lebensgrösse. Sobieski, Eugen und andre Personen die in diesem Kriege berühmt wurden, vorstellend. Die Köpfe sind nach der Natur gemahlt, voll Leben und vortreflichen Ausdruks. Von gleicher Grösse. I Diese Nr.: Die Belagerung von Wien durch die Türken und die Entsetzung durch J. Sobieski Maße: 3 Fuß 5 Zoll hoch, 3 Fuß 9 Zoll breit Anm.: Die Lose 43 bis 47 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/01/19 HBPAK 0044 Burgignon I Fünf grosse Gemähide von vielem Werth, a) Die Belagerung von Wien durch die Türken, und die Entsetzung durch J. Sobieski. Im Hintergrunde Wien mit dem Lauf der Donau, die Türken nehmen die Flucht, ob sie sich noch gleich im Vordergrunde wüthend vertheidigen. Die Figuren sind im Vordergrunde 3 bis 4 Zoll hoch, und die Menge erstaunlich. Das Ganze gehört zu den besten Schlachten Burgignons. b.c.d.e) Sind vier Portraits in Lebensgrösse. Sobieski, Eugen und andre Personen die in diesem Kriege berühmt wurden, vorstellend. Die Köpfe sind nach der Natur gemahlt, voll Leben und vortreflichen Ausdruks. Von gleicher Grösse. I Diese Nr.: Sobieski Maße: 3 Fuß 9 Zoll hoch, 4 Fuß 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 43 bis 47 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/01/19 HBPAK 0045 Burgignon I Fünf grosse Gemähide von vielem Werth, a) Die Belagerung von Wien durch die Türken, und die Entsetzung durch J. Sobieski. Im Hintergrunde Wien mit
dem Lauf der Donau, die Türken nehmen die Flucht, ob sie sich noch gleich im Vordergrunde wüthend vertheidigen. Die Figuren sind im Vordergrunde 3 bis 4 Zoll hoch, und die Menge erstaunlich. Das Ganze gehört zu den besten Schlachten Burgignons. b.c.d.e) Sind vier Portraits in Lebensgrösse. Sobieski, Eugen und andre Personen die in diesem Kriege berühmt wurden, vorstellend. Die Köpfe sind nach der Natur gemahlt, voll Leben und vortreflichen Ausdruks. Von gleicher Grösse. I Diese Nr.: Eugen Maße: 3 Fuß 9 Zoll hoch, 4 Fuß 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 43 bis 47 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/01/19 HBPAK 0046 Burgignon I Fünf grosse Gemähide von vielem Werth, a) Die Belagerung von Wien durch die Türken, und die Entsetzung durch J. Sobieski. Im Hintergrunde Wien mit dem Lauf der Donau, die Türken nehmen die Flucht, ob sie sich noch gleich im Vordergrunde wüthend vertheidigen. Die Figuren sind im Vordergrunde 3 bis 4 Zoll hoch, und die Menge erstaunlich. Das Ganze gehört zu den besten Schlachten Burgignons. b.c.d.e) Sind vier Portraits in Lebensgrösse. Sobieski, Eugen und andre Personen die in diesem Kriege berühmt wurden, vorstellend. Die Köpfe sind nach der Natur gemahlt, voll Leben und vortreflichen Ausdruks. Von gleicher Grösse. I Diese Nr.: Ein Portrait in Lebensgrösse Maße: 3 Fuß 9 Zoll hoch, 4 Fuß 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 43 bis 47 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/01/19 HBPAK 0047 Burgignon I Fünf grosse Gemähide von vielem Werth, a) Die Belagerung von Wien durch die Türken, und die Entsetzung durch J. Sobieski. Im Hintergrunde Wien mit dem Lauf der Donau, die Türken nehmen die Flucht, ob sie sich noch gleich im Vordergrunde wüthend vertheidigen. Die Figuren sind im Vordergrunde 3 bis 4 Zoll hoch, und die Menge erstaunlich. Das Ganze gehört zu den besten Schlachten Burgignons. b.c.d.e) Sind vier Portraits in Lebensgrösse. Sobieski, Eugen und andre Personen die in diesem Kriege berühmt wurden, vorstellend. Die Köpfe sind nach der Natur gemahlt, voll Leben und vortreflichen Ausdruks. Von gleicher Grösse. I Diese Nr.: Ein Portrait in Lebensgrösse Maße: 3 Fuß 9 Zoll hoch, 4 Fuß 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 43 bis 47 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/01/19 HBPAK 0079 Burgignon I Zwey Schlachten, voll Feuer und kriegerischer Grausamkeit. Die Figuren fallen im Hintergrunde sehr klein, und doch sind sie mühsam ausgezeichnet. Gleicher Grösse. 9 Zoll hoch, 1 Fuß breit. Goldn. Rahm. I Diese Nr.: Eine Schlacht Maße: 9 Zoll hoch, 1 Fuß breit Anm.: Die Lose 79 und 80 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/01/19 HBPAK 0080 Burgignon I Zwey Schlachten, voll Feuer und kriegerischer Grausamkeit. Die Figuren fallen im Hintergrunde sehr klein, und doch sind sie mühsam ausgezeichnet. Gleicher Grösse. 9 Zoll hoch, 1 Fuß breit. Goldn. Rahm. I Diese Nr.: Eine Schlacht Maße: 9 Zoll hoch, 1 Fuß breit Anm.: Die Lose 79 und 80 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 LZRCH 0080 Courtois I Un paysage, sur lerdevant [sic] une riviere, au bord de la quelle sont quelques figures. I Mat.: auf Holz Maße: h. 6.1. 9. pouces Verkäufer: J F Rauch Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0067 Jacob Courtois genannt Bourguignon I Zwey Bataille=Stücke, von Jacob Courtois genannt Bourguignon. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Bataille=Stück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh 3 Zoll breit 4 Schuh 6 Zoll Anm.: Die Lose 67 und 68 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0068 Jacob Courtois genannt Bourguignon I Zwey Bataille=Stücke, von Jacob Courtois genannt Bourguignon. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Bataille=Stück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh 3 Zoll breit 4 Schuh 6 Zoll Anm.: Die Lose 67 und 68 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
479
1799/10/17 LZAN 0027 Bourguignon I Ein Schlachtstück; vorne ist ein Reuter, welcher samt seinem Pferde zu Boden stürzt. Die Schlacht geht vor zur Rechten; links bemerkt man eine perspektivische Aussicht; h. 23 Zoll, breit 37 Zoll. Auf Leinwand, in einem reich vergoldeten Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: h. 23 Zoll, breit 37 Zoll Verkäufer: Rauch Transakt.: Verkauft (21.4 Th) Käufer: Seger 1800/07/09 HBPAK 0005 Bourgnignon I 2 Batailles, chocs de Cavaleries d'une composition extremement animee. Le feu, la fumee, l'ardeur des Combattans, et des chevaux rend au naturel les images de la Guerre, et font envisager ces 2 Tableaux comme des chefs d'Oeuvre. Sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: 40 pouces de hauteur. Sur 54 pouces de largeur Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0102 Transakt.: Unbekannt
Borgenjong I Ein hitziges Gefecht. I
Courtois, Jacques (II Borgognone) (und Claude Lorrain) 1798/06/04 HBPAK 0290 Claude Gelee, genannt le Lorrain; Die Figuren von Jac. Courtois, genannt Bourguignon I Zwey sehr kostbare Landschaften, von der besten Art obiger grossen Künstler. Die eine stellt Felsen vor, auf welchen ein Schloß sich befindet. Am Fusse derselben, ruht sich eine von der Jagd gekommene Gesellschaft aus, und im Vordergrunde sind mehrere Jäger mit Pferden, Hunden ec. Das Gegenstück zeigt einen hohen Berg mit einem Wasserfall, und vorne Reisende auf Maulthieren, und verschiedene andere Figuren, die diesen vortreflichen Stücken (deren Haltung, Baumschlag und Effect der Luft aufs vollkommenste ist), den größten Werth geben, der sie zur Aufnahme in die ersten Sammlungen berechtigt. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine sehr kostbare Landschaft stellt Felsen vor, auf welchen ein Schloß sich befindet; Pendant zu Nr. 291 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 25 Zoll Anm.: Die Lose 290 und 291 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0291 Claude Gelee, genannt le Lorrain: Die Figuren von Jac. Courtois, genannt Bourguignon I Zwey sehr kostbare Landschaften, von der besten Art obiger grossen Künstler. Die eine stellt Felsen vor, auf welchen ein Schloß sich befindet. Am Fusse derselben, ruht sich eine von der Jagd gekommene Gesellschaft aus, und im Vordergrunde sind mehrere Jäger mit Pferden, Hunden ec. Das Gegenstück zeigt einen hohen Berg mit einem Wasserfall, und vorne Reisende auf Maulthieren, und verschiedene andere Figuren, die diesen vortreflichen Stücken (deren Haltung, Baumschlag und Effect der Luft aufs vollkommenste ist), den größten Werth geben, der sie zur Aufnahme in die ersten Sammlungen berechtigt. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine sehr kostbare Landschaft zeigt einen hohen Berg mit einem Wasserfall; Pendant zu Nr. 290 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 25 Zoll Anm.: Die Lose 290 und 291 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Courtois, Jacques (II Borgognone) (Kopie von) 1800/00/00 FRAN2 0015 Courtois; Clande Lorrain I Eine schöne Copie nach Clande [sie] Lorrain. Eine Landschaft mit Vieh vorstellend. I Kopie von J. Courtois nach Claude Lorrain Mat.: auf Leinwand Maße: 25 Zoll hoch, 38 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
1765/00/00 FRRAU 0123 Nach Bourguignon I Ein Lager vorstellend. Es sind beyde Stücke brav gemahlt. Ce tableau represente un camp. Ces deux pieces sont tres-bien peintes. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 1 Schuh 1 Zoll, breit 2 Schuh 1 Zoll Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0628 Bourgignon I 2 Batallien, nach Bourgignon. [2 p[ieces]. de Bataille, selon Bourgignon.] I Diese Nr.: Eine Batallie Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 5 Zoll, Breite 8 Zoll Anm.: Die Lose 628 und 629 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0629 Bourgignon I 2 Batallien, nach Bourgignon. [2 p[ieces]. de Bataille, selon Bourgignon.] I Diese Nr.: Eine Batallie Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 5 Zoll, Breite 8 Zoll Anm.: Die Lose 628 und 629 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt
Courtois, Jacques (II Borgognone) (Manier) 1742/08/01 BOAN 0440 Borgingnon I Zwey kleine Battaillen so gut als vom Borgingnon. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1768/08/16 KOAN 0027 Bourgignone I Eine Bataille auf Leinewand so gut als Bourgignone. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 3 Fuß 3 Zoll, Breite 4 Fuß 5 Zoll Verkäufer: Freyherr von Kaas Transakt.: Unbekannt 1785/05/17 MZAN 0575 Bourguignon I Noch Zwey Bataillestücke in Bourguignons Manier. [Deux autres [batailles] dans le gout de Bourguignon.] I Diese Nr.: Ein Bataillestück Maße: 2 Schuh 3 Zoll hoch, 3 Schuh 7 Zoll breit Anm.: Die Lose 575 und 576 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (12 fl für die Nrn. 575 und 576) Käufer: Winterstein 1785/05/17 MZAN 0576 Bourguignon I Noch Zwey Bataillestücke in Bourguignons Manier. [Deux autres [batailles] dans le gout de Bourguignon.] I Diese Nr.: Ein Bataillestück Maße: 2 Schuh 3 Zoll hoch, 3 Schuh 7 Zoll breit Anm.: Die Lose 575 und 576 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (12 fl für die Nrn. 575 und 576) Käufer: Winterstein
Courtz [Nicht identifiziert] 1781/00/00 WRAN 0054 Courtz I Une Femme assise, entre ses jambes un Enfant, un Homme ä cheval semble faire conversation avec eile, entre cette Femme & le Cavalier on voit deux Moutons, un debout & l'autre couche belant. Tableau peint sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: haut 12 pouces, large 15 pouces Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt
Cousin, Jean (II) 1800/00/00 FRAN2 0120 Cousin (Johann) I Das jüngste Gericht. Zusammensetzung von 80 Figuren in einem schönen Kolorit. Diess Stück, äußerst rar, hat überdieß den Vorzug einer sehr schönen Produktion. I Mat.: auf Kupfer Maße: 15 Zoll hoch, 19 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Coussin, I. [Nicht identifiziert]
Courtois, Jacques (II Borgognone) (Kopie nach)
1763/11/09 FRJUN 0048 I. Coussin I Une tres belle piece de fleurs parfaitement & naturellement peint. I Maße: hauteur 26 pouces, largeur 18 pouces Transakt.: Verkauft (16.30 fl) Käufer: Dick
1765/00/00 FRRAU 0122 Nach Bourguignon I Vorstellend eine Bataille. Auf Tuch gemahlt. Repräsentant une bataille. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 1 Schuh 1 Zoll, breit 2 Schuh 1 Zoll Transakt.: Unbekannt
1764/03/12 FRKAL 0028 Coussin I Une belle piece representant un vase avec des fleurs naturellement peint. I Maße: hauteur 28 pouces, largeur 19 Vi pouces Transakt.: Verkauft (18.45 fl) Käufer: Gayss
480
GEMÄLDE
Couwenberch 1716/00/00 FRHDR 0135 Kauenburg I Von Kauenburg ein Bootsknecht mit einem Romer Wein. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (15) 1716/00/00 FRHDR 0148 Kauenburg I Von Kauenburg Phoebus. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (45) 1716/00/00 FRHDR 0149 Kauenburg I Von dito [Kauenburg] eine schlaffende Nimpfe. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (15) 1716/00/00 FRHDR 0150 Kauenburg I Von dito [Kauenburg] eine Diana. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (60) 1716/00/00 FRHDR 0151 Kauenburg I Von dito [Kauenburg] ein Jagd stuck. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (15) 1766/07/28 KOSTE 0153 Kavenberg I Ein Venus-Stuck von Kavenberg. I Transakt.: Verkauft (5 Rt) 1788/09/01 KOAN 0502 Kauenberg I 2 Köpfe, von Kauenberg, [deux tetes, de Kaunenberg [sic].] I Diese Nr.: Ein Kopf Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 10 Zoll, Breite 1 Fuß 6 Zoll Anm.: Die Lose 502 und 503 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0503 Kauenberg I 2 Köpfe, von Kauenberg, [deux tetes, de Kaunenberg [sic].] I Diese Nr.: Ein Kopf Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 10 Zoll, Breite 1 Fuß 6 Zoll Anm.: Die Lose 502 und 503 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt
Coxie, Jan 1788/10/01 FRAN 0121 J. de Coxis I Eine sehr schöne Landschaft mit Figuren, sehr gut componirt von J. de Coxis. I Maße: 20 Zoll hoch, 30 Zoll breit Transakt.: Verkauft (8.45 fl) Käufer: Brönner
Coxie, Michiel (I) 1788/09/01 KOAN 0386 Michel Coxcis I Elias mit einer Frau und Kind. [Elias avec une femme & un enfant.] I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Fuß 5 Zoll, Breite 3 Fuß 5 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt
Coxie, Michiel (I) (oder Floris, F. (I)) 1778/10/30 HB KOS 0087 der niederländische Raphael I Eine betende Maria mit Joseph, schön gemahlt, auf Holz, von dem Niederländischen Raphael. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 6 Zoll, breit 5 Zoll Transakt.: Unbekannt
Coypel 1768/07/00 MUAN 0442 Coypel I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0443 Coypel I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 HBMFD 0122 Coypel I Galathe auf dem Meere, mit einer Menge Tritonen und Najaden umgeben. Im Hintergründe der
Polyphem. I Mat.: auf Kupfer Maße: 1 Fuss 6 Zoll hoch, 2 Fuss breit Verkäufer: Pierre Laporterie Transakt.: Unbekannt 1796/02/17 HBPAK 0066 Coypel I In einer Landgegend, im Vordergrunde zur Rechten, steht Adam und neben demselben liegt Eva auf den Knien; über ihnen schwebt Gott der Vater im heiligen Glänze auf vielen Seraphim. Vor Adam und Eva, welche sich vor dem Angesichte des Herrn schämen, liegt die Schlange und hinter ihnen steht der verbotene Baum. Auf Leinwand. Dies Gemähide geht in Kupfer heraus. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 24 Vi Zoll, Breite 19 Zoll Transakt.: Verkauft (275 M) Käufer: Kreuter 1796/02/17 HBPAK 0177[a] Coypel I Zwey ovidische Stücke. Das Eine, Amor auf einem Satyr reitend, und das Andere, wie ein Satyr die schlafende Venus aufdeckt, vorstellend. Auf Holz. Quer ovalen Formats. I Diese Nr.: Ein ovidisches Stück. Amor auf einen Satyr reitend; Nr. 177[b] von Fr. Le Moyne Mat.: auf Holz Format: oval Maße: Höhe 9 Vi Zoll, Breite 10 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (125 Μ für die Nrn. 177[a] und 177[b]) Käufer: Packi
Coypel (Kopie nach) 1747/04/06 HB AN 0056 Coypel I Eine Europa nach Coypel. ί Maße: 3 Fuß 2 Zoll Breite und 2 Fuß 3 Zoll Höhe Verkäufer: Brockes Transakt.: Unbekannt (7.10) 1786/05/02 NGAN 0307 Coypel I Cupido, nach Coypel. I Maße: 3 Schuh 8 Zoll hoch, 3 Schuh breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (30 Kr) Käufer: Professor Hofmann
Coypel, Antoine 1769/00/00 MUAN 0131 Antoine Coypel I Un tableau qui represente Psiche qui fait connoitre ä Cupidon son mari (encore inconnu) ses trop vifs desirs, & l'amour qu'elle a pour lui. Le Compagnon represente encore Psiche, & comme Cupidon courre pour l'empecher de se laisser aller au someil. Peints surtoile marques des N o s 442. & 443. I Diese Nr.: Un tableau qui represente Psiche qui fait connitre ä Cupidon son mari; Pendant zu Nr. 132 Mat.: auf Leinwand Maße: 1. p. 2. p. de haut sur 1. p. 5. p. de large Anm.: Die Lose 131 und 132 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0132 Antoine Coypel I Un tableau qui represente Psiche qui fait connoitre ä Cupidon son mari (encore inconnu) ses trop vifs desirs, & l'amour qu'elle a pour lui. Le Compagnon represente encore Psiche, & comme Cupidon courre pour l'empecher de se laisser aller au someil. Peints sur toile marques des N o s 442. & 443. I Diese Nr.: Psiche, & comme Cupidon courre pour l'empecher de se laisser aller au someil; Pendant zu Nr. 131 Mat.: auf Leinwand Maße: 1. p. 2. p. de haut sur 1. p. 5. p. de large Anm.: Die Lose 131 und 132 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: F r a n c i s Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1787/00/00 HB AN 0001 Antonius Coypel I Wie die Krone der Adriadne in Sterne verwandelt wird. Bachus zeigt mit seiner Rechten der auf einer Anhöhe neben ihm sitzenden Adriadne die Sternen=Krone. Hinter ihr Nymphen. Im Vordergründe verschiedene Satyren, Bachanten und Amors. Wie die Venus dem Ulysses den von Vulcan verfertigten Schild überreicht. Venus kommt zur linken des Ulysses in den Wolken herab, und zeigt ihm den von Amors getragenen Schild, worunter sich die zwey Tauben befinden. Diese beyden Bilder sind mit einem besonders freyen Pinsel gemahlt, und wegen ihrer Zeichnung und wannen Colorits sehr schätzbar. Auf Leinewand in goldenen Rahmen. I Diese Nr.: Wie die Krone der Adriadne in Sterne verwandelt wird Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 50 Zoll, breit 69 Zoll Anm.: Die Lose 1 und 2 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (68 Μ für die Nrn. 1 und 2) Käufer: Fesser GEMÄLDE
481
1787/00/00 HB AN 0002 Antonius Coypel I Wie die Krone der Adriadne in Sterne verwandelt wird. Bachus zeigt mit seiner Rechten der auf einer Anhöhe neben ihm sitzenden Adriadne die Sternen=Krone. Hinter ihr Nymphen. Im Vordergrunde verschiedene Satyren, Bachanten und Amors. Wie die Venus dem Ulysses den von Vulcan verfertigten Schild überreicht. Venus kommt zur linken des Ulysses in den Wolken herab, und zeigt ihm den von Amors getragenen Schild, worunter sich die zwey Tauben befinden. Diese beyden Bilder sind mit einem besonders freyen Pinsel gemahlt, und wegen ihrer Zeichnung und warmen Colorits sehr schätzbar. Auf Leinewand in goldenen Rahmen. I Diese Nr.: Wie die Venus dem Ulysses den von Vulkan verfertigten Schild überreicht Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 50 Zoll, breit 69 Zoll Anm.: Die Lose 1 und 2 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (68 Μ für die Nrn. 1 und 2) Käufer: Fesser 1789/04/16 HB TEX 0106 A. Coypel I Wie Hercules dem Admetes die Alceste wieder darstellt; von richtiger Zeichnung und freyer Mahlerey, auf Leinew. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 34 Zoll, breit 28 Zoll Transakt.: Verkauft (14.08 M) Käufer: Engel 1791/05/28 HBSDT 0055 A. Coypel I Triumpf des Bachus, mit eine menge Figuren. Eine andre Ovidische Historie zum Gegenstück: beyde von grosser Composition, und sehr leicht gemahlt, auf Kupfer. I Diese Nr.: Triumpf des Bachus, mit eine menge Figuren; Pendant zu Nr. 56 Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 18 Zoll, breit 23 Zoll Anm.: Die Lose 55 und 56 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1791/05/28 HBSDT 0056 A. Coypel I Triumpf des Bachus, mit eine menge Figuren. Eine andre Ovidische Historie zum Gegenstück: beyde von grosser Composition, und sehr leicht gemahlt, auf Kupfer. I Diese Nr.: Eine Ovidische Historie; Pendant zu Nr. 55 Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 18 Zoll, breit 23 Zoll Anm.: Die Lose 55 und 56 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/01/00 LZAN [A]0013 Ant. Coypel I Athalia, wie sie bei Darstellung des jungen Königs Joas beim jüdischen Volke Aufruhr zu erregen sucht, Zorn blitzt aus ihren Augen, und verbissene Verzweiflung schwebt auf ihren Lippen. Brustbild. Lebensgross. I Maße: Höhe 2 Fuß 2 Zoll, Breite 1 Fuß 8 Zoll Verkäufer: A F Oeser Transakt.: Unbekannt
Coypel, Antoine (oder Boucher) 1781/00/00 WRAN 0198 Bouche; A. Coypel I Diane et Endimion, ä droite se voit la Lüne sur un nuage, ses deux mains allongees sous la tete d'Endimion dormant, sur les genoux d'un Vieillard qui est le Symbole du tems. Belle esquisse bien terminee, peint sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: haut 11 pouces 3 lignes, large 8 pouces 10 lignes Anm.: Der Name des Künstlers "A. Coypel" wurde wahrscheinlich bei den Losen 198 bis 200 weggelassen und im Exemplar RKDH handschriftlich ergänzt. Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781 /00/00 WRAN 0199 Bouche; A. Coypel I Les Nymphes de Psyche volent les fleches & les carquois de Cupidon endormi. I Pendant zu Nr. 200 Mat.: auf Leinwand Maße: 24 pouces de haut, sur 30 pouces de large Anm.: Der Name des Künstlers "A. Coypel" wurde wahrscheinlich bei den Losen 198 bis 200 weggelassen und im Exemplar RKDH handschriftlich ergänzt. Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt. : Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0200 Bouche; A. Coypel I Pendant du precedent, oü se voit Venus ä sa toilette, faite par les trois Graces & servie par une quantite de Cupidons. Ce Tableau & le precedent sont peints sur toile. I Pendant zu Nr. 199 Mat.: auf Leinwand Maße: 24 pouces de haut, sur 30 pouces de large Anm.: Der Name des Künstlers "A. Coypel" wurde wahrscheinlich bei den Losen 198 bis 200 weggelassen und im Exemplar RKDH handschriftlich ergänzt. Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 482
GEMÄLDE
Crabeth, Franz [Nicht identifiziert] 1799/00/00 WZAN 0424 Franz Crabeth I Die Geißlung Christi, von Franz Crabeth. Auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: hoch 10 Zoll breit 8 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Craen, Adriaen 1787/00/00 HB AN 0539 A. Kraar. 1643 I Ein Tisch mit unterschiedlichen Sachen, als: goldene und silberne Geschirre, Gläser, Früchte, Brod u.s.w. Sehr natürlich gemahlt. A.H. [Auf Holz] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 21 Zoll, breit 28 Zoll Inschr.: 1643 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Verkauft (12.4 M) Käufer: Berth[eau]
Craen, Cornelius [Nicht identifiziert] 1787/00/00 HB AN 0609 Cornelius Craen. Wie David de Heem I Auf einem mit einer grauen Decke belegten Tische befinden sich unterschiedliche Eßwaaren, als: ein großer Hummer, Weintrauben, mit den sich noch davon befindenden Blättern, Zitronen; daneben stehen Gläser. Ueberaus natürlich und schön gemahlt. A.H. [Auf Holz] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 19 Zoll, breit 24 Zoll Transakt.: Verkauft (19.12 M) Käufer: Friedrich
Craer, A. [Nicht identifiziert] 1789/06/12 HBTEX 0272 Λ. Craer I Zwey Kühe und einige Schaafe mit ihren Hirten in einer ländlichen Gegend. Sehr schön gemahlt. Auf Holz. Schwarzer Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 17 Zoll, breit 22 Zoll Transakt.: Verkauft (12.4 M) Käufer: Eckh[ardt]
Craesbeeck, Joos van 1785/05/17 MZAN 0367 Craesbecke I Zwey Bauern, der eine mit einem Gerüchte, der andere mit einem Löffel in der Hand von Craesbecke. [Deux paysans, Tun apportant un mets, l'autre ayant une cuilliere ä la main.] I Maße: 8 Vi Zoll hoch, 7 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (6 fl) Käufer: Schwanck 1785/05/17 MZAN 0414 Craesbecke I Eine Frau die auf ihrem Schoose ein Kind hat, mit dem an ander Kind spielt von Craesbecke. [Une femme ayant sur le sein un enfant, avec lequel un autre enfant joue.] I Maße: 7 Vi Zoll hoch, 6 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (9 fl) Käufer: Weingärtner 1792/02/01 LZRST 4837 Craesbeck I Das Brustbild eines lachenden Mannes mit einer goldenen Kette um den Hals, ein gutes Bild von Craesbeck, auf Holz gemahlt, 27 Zoll hoch, 21 Zoll breit, in schwarzem Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: 27 Zoll hoch, 21 Zoll breit Transakt.: Verkauft oder Unverkauft (21 Gr) Käufer: R[ost] 1792/08/20 KOAN 0175 Grassbeck I Ein lachender Kopf mit den natürlichsten Zügen von Grassbeck. I Maße: 8 Zoll hoch, 7 Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0205 Grassbeck I Ein Bauren=Gesellschaft, die sich mit Taback rauchen und trinken ergötzen, auf Holz von Grassbeck. I Mat.: auf Holz Maße: 9 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 3 Vi Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0316 Grassbeck I Ein Kopf in rundem Format auf Holz von Grassbeck. I Mat.: auf Holz Format: rund Maße: 4 Zoll hoch, 4 Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1793/01/15 LZRST 7019 Craespeck I Brustbild eines lachenden Mannes mit einer goldenen Kette um den Hals, ein schönes Bild von Craespeck auf Holz gemahlt, 27 Zoll hoch, 21 Zoll breit, in schw.
Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: 27 Zoll hoch, 21 Zoll breit Verkäufer: Pg Transakt.: Verkauft (4.12 Th) Käufer: Ε 1794/00/00 FGAN 0062 Craesbek I Ein Gemäld mit zween Köpfen, der eine hält in der Hand einen Topf, der andere einen Löffel, auf Holz gemalt. I Mat.: auf Holz Maße: 8 Vi Zoll hoch, 7 Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt (6fl) 1799/00/00 WZAN 0740 Joseph van Craesbecke I Eine Mannsperson mit einem Löffel und Scherben, und eine andere mit einem Kruge, von Joseph van Craesbecke. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine Mannsperson mit einem Löffel und Scherben Mat.: auf Holz Maße: hoch 8 Zoll breit 6 Zoll Anm.: Die Lose 740 und 741 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0741 Joseph van Craesbecke I Eine Mannsperson mit einem Löffel und Scherben, und eine andere mit einem Kruge, von Joseph van Craesbecke. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine Mannsperson mit einem Kruge Mat.: auf Holz Maße: hoch 8 Zoll breit 6 Zoll Anm.: Die Lose 740 und 741 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0014 Joseph van Craesbeke I Zwey Holländer Gesellschafts=Stücke, von Joseph van Craesbeke. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Holländer Gesellschafts=Stück Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 7 Zoll breit 1 Schuh 1 Vi Zoll Anm.: Die Lose A14 und Al 5 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0015 Joseph van Craesbeke I Zwey Holländer Gesellschafts=Stücke, von Joseph van Craesbeke. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Holländer Gesellschafts=Stück Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 7 Zoll breit 1 Schuh 1 Vi Zoll Anm.: Die Lose A14 und A15 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Craesbeeck, Joos van (oder Brouwer, Adr.) 1772/00/00 BSFRE 0022 Brouwer (Adrien); ou Craesbeck 1 Ce Tableau represente le dedans d'une Maison rustique, ou un gros Savetier est assis ä cote d'une Femme, qui luy verse du Brandewin ; au fond de l'appartement on voit plusieurs Payssans, qui se chauffent. L'on observe partout une touche sgavante & legere. Cadre noir, avec Liteaux d'ores. I Mat.: auf Holz Maße: haut de 14 % & large de 19 pouces Transakt.: Unbekannt 1772/00/00 BSFRE 0023 Brouwer (Adrien): ou Craesbeck I Dans ce petit Tableau, il y a deux Payssans ä my corps, qui se rejouissent ä boire & ä fumer. Cadre sculpte & d'ore. I Mat.: auf Holz Maße: haut de 4 Vi & large de 3 Vi pouces Transakt.: Unbekannt
Craesbeeck, Joos van (Geschmack von) 1797/08/10 MMAN 0049 Creasbeck I Ein Mann und eine Frau an einem Tisch sizend, in Craesbecks Geschmack, mit vergoldeten Rahmen, auf Holz. I Mat.: auf Holz Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (16 fl Schätzung)
Cramer, Lucas [Nicht identifiziert] 1799/00/00 WZAN A0427 Lucas Cramer I Zwey Gesellschaftsstückchen, von Lucas Cramer. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Gesellschaftsstückchen Mat.: auf Holz Maße: hoch 7 Schuh breit 5 Zoll Anm.: Die Lose A427 und A428 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0428 Lucas Cramer \ Zwey Gesellschaftsstückchen, von Lucas Cramer. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Gesellschaftsstückchen Mat.: auf Holz Maße: hoch 7 Schuh breit 5 Zoll
Anm.: Die Lose A427 und A428 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Cranach, Lucas (der Ältere) 1670/04/21 WNHTG 0079 Luca Cranach I Nostra Signora con il Bambino Giesü in grembo, figure piccole. I Maße: Alto due palmi, e tre dita, largo uno, e mezzo Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt 1670/04/21 WNHTG 0104 Cranachi I Una Lucretia Romana del Cranachi. I Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt 1705/06/25 HNAN 0017 Lucas Kranack I Dr. Martin Lutheri Portrait sehr sauber gemacht mit Lucas Kranack seinem Zeichen 1526. in einem von Eplern=Holtz verfertigen Rahmen. I Inschr.: 1526 (datiert) Verkäufer: Anthon Lucio Transakt.: Unbekannt 1705/06/25 HNAN 0018 Lucas Kranack I Jetztgemeldten Dr. Lutheri Ehefrau / von selbigem Meister [Lucas Kranack] gemacht / und in solchen [von Eplem=Holtz verfertigten] Rahmen. I Verkäufer: Anthon Lucio Transakt.: Unbekannt 1714/05/07 LZAN 0019 L. Kranach I Ein alter Mann auf Holtz von L. Kranach in schwartzen Rehmen. I Mat.: auf Holz Verkäufer: Christian Wolff Transakt.: Unbekannt 1714/05/07 LZAN 0094 Luc. Kranachen I D. M. Lutheri Bildniss auf Holtz von Luc. Kranachen, in schwartzen Rehmen. I Mat.: auf Holz Verkäufer: Christian Wolff Transakt.: Unbekannt 1714/05/07 LZAN 0105 L. Kranachen I Ein grosser Riß auf Pappier, das Heil. Abendmahl, nach dem Wittenberg. Altarstück vorstellend, von L. Kranachen. I Mat.: auf Papier Verkäufer: Christian Wolff Transakt.: Unbekannt 1716/00/00 FRHDR 0114 Lucas Granach I Von Lucas Granach eine Lucretia. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (150) 1723/00/00 PRAN [D]0001 Lucas Kranach ! Stuck auff Holtz / ein Römische Geschieht la Bocca di verita genannt / vom Lucas Kranach / in einer Französischen unvergulten Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 2 Vi Schuh 3 Vi Zoll, Breite 3 Vi Schuh 4 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1723/00/00 PRAN 0029 Lucas Kranach I Jesus und Maria auff Holtz / vom Lucas Kranach / in weisser Rahm. I Pendant zu Nr. 30 Mat.: auf Holz Maße: Höhe 2 Vi Schuh 4 Zoll, Breite 2 Schuh Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt Gegenw. Standort: Dresden, Deutschland. Gemäldegalerie. (1907) 1723/00/00 PRAN 0030 Lucas Kranach I Ein Compagnion darzu. I Pendant zu Nr. 29, "Jesus und Maria" Maße: Höhe 2 Vi Schuh 5 Zoll, Breite 2 Schuh Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1744/05/20 FRAN 0129 L. Cranach I 1 Stück Adam und Eva. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 2 Schuh 4 Zoll, Breite 1 Schuh 8 Zoll Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0116 Luc Kranach I L'Enfant prodigue sur bois, bien conserve, des beaux jours de Luc Kranach. I Mat.: auf Holz Maße: Largeur 2 Pies 10 Pouces, Haut 1 Pies 2 'h Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1750/10/15 HB AN 0029 Kranach (Lucas) I Portrait Caroli Vti. I Maße: 1 Fuß 8 Zoll hoch, 1 Fuß 3 Vi Zoll breit Transakt. : Unbekannt 1752/05/08 LZAN 0079 Lucas Kranachen I Die Ehebrecherin wie sie von den Juden vor Christum geführet wird, von Lucas Kranachen 1 Vi Elle hoch % Ellen breit, auf Holtz gemahlt, im vergoldeten Rahmen. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Vi Elle hoch, % Ellen breit Transakt.: Verkauft (2.16 Th) Käufer: Schröter GEMÄLDE
483
1759/00/00 LZEBT 0160 Kranach I Das Portrait des Leipziger Bürgermeisters Lutters auf Holtz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 2 Schuh 10 Zoll, Breite 3 Schuh 5 Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (100 Th Schätzung) 1763/01/17 HNAN 0064 Lucas Cranach I Piece Morale, representant la Volupte, l'orgueil & l'avarice, qui tachent de Seduire un jeune homme, mais qu'un spectre fait souvenir de sa Mortalite, par Lucas Cranach, sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 1 pied, Largeur 1 pied 6 pouces Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt 1763/11/09 FRJUN 0049 L. Cranach I Maria avec Γ Enfant bien peint. I Maße: hauteur 12 pouces, largeur 9 pouces Transakt.: Verkauft (10.15 fl) Käufer: Pf Bechthold 1764/03/12 FRKAL 0156 Lucas Cranach ! Judith qui empörte la tete d'Holofernes par Lucas Cranach. I Transakt.: Unbekannt (1.4 fl) 1764/08/25 FRAN 0349 Lucas Cranach I Un vieux tableau representant des filles nues. I Maße: haut 1 pied 11 pouces sur 1 pied 3 Vi pouces de large Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRRAU 0116 Lucas Cranach I Vorstellend eine Jungfer in gantzer Figur, in der Hand ein blau Porcelain=Gefaß haltend, hinten ist eine Landschaft mit Thieren reich estafiert, und alles nach des Meisters bekannten Manier verfertiget. Representant la figure entiere d'une fille, qui tient dans sa main un vase de porcelaine bleue, il y a derriere eile un pa'isage avec des animaux richement faςοηηέ & le tout acheve de la maniere de ce maitre, qui est si connue. Peint sur du bois. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 1 Schuh 8 Zoll, breit 1 Schuh Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1183 Kranach (Lucas Müller) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/03/30 HBTOU 0049 L. Cranach I Der fromme Churfürst Friederich und seine Gemahlin, von L. Cranach auf Holz. [Die Mehresten in fein verguldte Rahmen, und die übrigen in schwarz gebeizten mit goldenen Staber.] I Diese Nr.: Der fromme Churfürst Friederich Mat.: auf Holz Maße: Höhe 8 Zoll, Breite 6 Zoll Anm.: Die Lose 49 und 50 wurden zusammen katalogisiert. Die Angaben in ekkigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 51 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 51. Transakt.: Verkauft (16.4 Μ für die Nrn. 49 und 50) Käufer: Duve 1769/03/30 HBTOU 0050 L. Cranach I Der fromme Churfürst Friederich und seine Gemahlin, von L. Cranach auf Holz. [Die Mehresten in fein verguldte Rahmen, und die übrigen in schwarz gebeizten mit goldenen Staber.] I Diese Nr.: Die Gemahlin des Churfürsten Friederich Mat.: auf Holz Maße: Höhe 8 Zoll, Breite 6 Zoll Anm.: Die Lose 49 und 50 wurden zusammen katalogisiert. Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 51 und beziehen sich auf die Nm. 1 bis 51. Transakt.: Verkauft (16.4 Μ für die Nrn. 49 und 50) Käufer: Duve 1771/05/06 FRAN 0011 L. Cranach I Ein Stück mit zwey Figuren auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 20 Zoll, breit 15 Zoll Verkäufer: Johann Friederich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt (0.24 fl) 1771/05/06 FRAN 0040 L. Cranach I Ein Kniestück, einen Mann und ein Weibsbild vorstellend, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 20 Zoll, breit 15 Zoll Verkäufer: Johann Friederich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt 1771/05/06 FRAN 0108 L. Cranach I Ein Portrait des Churfürst und Herzogen zu Sachsen Johannis I. auf Holz. I Mat.: auf Holz Ma484
GEMÄLDE
ße: hoch 11 Zoll, breit 9 Zoll Verkäufer: Johann Friederich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt 1771/05/06 FRAN 0117 L. Cranach I Ein altes Portrait, auf dito [Holz], I Mat.: auf Holz Maße: hoch 19 Zoll, breit 15 Zoll Verkäufer: Johann Friederich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt 1772/00/00 BSFRE 0027 Cranach (Luc.) I Le Büste d'un Chevalier de la Toisson d'or, avec une Barette sur la Tete, & habille de Satin noir d'un grand finy, & bien conserve. Cadre noir ä l'antique. I Mat.: auf Holz Maße: haut de 15 & large de 10 pouces Transakt.: Unbekannt 1775/04/12 HB NEU 0005 L. Cranach I D. Martin Luther und Johannes Calvinus, nach dem Leben, auf Holz. I Diese Nr.: D. Martin Luther Mat.: auf Holz Anm.: Die Lose 5 und 6 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1775/04/12 HBNEU 0006 L. Cranach I D. Martin Luther und Johannes Calvinus, nach dem Leben, auf Holz. I Diese Nr.: Johannes Calvinus Mat.: auf Holz Anm.: Die Lose 5 und 6 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1775/04/12 HBNEU 0039 L. Cranach I Ein alter Verliebter, auf Holz. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt 1775/05/08 OGAN 0261 Lucas Cranach I Ein Stück auf Holz gemacht, die Melancholie vorstellend, ein Original von Lucas Cranach. [La melancolie, original de Luc Cranach, peint sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 3 Schuh 5 Zoll hoch, und 2 Schuh 2 Vi Zoll breit Verkäufer: Marggräfinn Augusta Sibylla von Baaden=Baaden Transakt.: Unbekannt (22 [?]) 1775/05/15 FRAN 0008 L. Cranach I Ein Kniestück, einen Mann und ein Weibsbild vorstellend, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 20 Zoll, breit 15 Zoll Verkäufer: Johann Friedrich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt 1775/05/15 FRAN 0072 L. Cranach I Ein Portrait des Churfürst und Herzogen zu Sachsen Johannis I. auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 11 Zoll, breit 9 Zoll Verkäufer: Johann Friedrich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt 1776/06/21 HBNEU 0007 L. Cranach I Eine Vanitee-Hist. vorgestellt, mit einen alten und jungen Mädchen, lebhaft gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 2 F 8 Z, Breite 2 F 2 Ζ Transakt.: Unbekannt 1776/06/28 HBBMN 0022 L. Cranach I Vater und Mutter von D. Luther, so 1530 und 31 gestorben, fleißig gemahlt, auf Holz. I Diese Nr.: Vater von D. Luther Mat.: auf Holz Maße: Höhe 8 Vi Zoll, Breite 6 Zoll Anm.: Die Lose 22 und 23 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1776/06/28 HBBMN 0023 L. Cranach I Vater und Mutter von D. Luther, so 1530 und 31 gestorben, fleißig gemahlt, auf Holz. I Diese Nr.: Mutter von D. Luther Mat.: auf Holz Maße: Höhe 8 Vi Zoll, Breite 6 Zoll Anm.: Die Lose 22 und 23 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1776/06/28 HBBMN 0024 L. Cranach I D. Luther und seine Frau, von nämlicher Güte gemahlt. I Diese Nr.: D. Luther Maße: Höhe 8 V2 Zoll, Breite 6 Zoll Anm.: Die Lose 24 und 25 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1776/06/28 HBBMN 0025 L. Cranach I D. Luther und seine Frau, von nämlicher Güte gemahlt. I Diese Nr.: Die Frau von D. Luther Maße: Höhe 8 Vi Zoll, Breite 6 Zoll Anm.: Die Lose 24 und 25 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1776/11/09 HB KOS 0109 Lucas Cranach I Zwo Portraits, als Friedrich der III. Churfürst zu Sachsen, und seine Gemahlinn, auf Holz, in schwarzen Rähmen. I Diese Nr.: Ein Portrait, als Friedrich der III. Churfürst zu Sachsen Mat.: auf Holz Maße: Höhe 9 Zoll, Breite 7 Zoll Anm.: Die Lose 109 und 110 wurden zusammen kata-
logisiert. Transakt.: Verkauft (4.4 Μ für die Nm. 109 und 110) Käufer: Eckhardt 1776/11/09 HBKOS 0110 Lucas Cranach I Zwo Portraits, als Friedrich der III. Churfürst zu Sachsen, und seine Gemahlinn, auf Holz, in schwarzen Rahmen. I Diese Nr.: Ein Portrait, als die Gemahlinn Friedrich des III. Churfürst zu Sachsen Mat.: auf Holz Maße: Höhe 9 Zoll, Breite 7 Zoll Anm.: Die Lose 109 und 110 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (4.4 Μ für die Nrn. 109 und 110) Käufer: Eckhardt 1777/03/03 AUAN 0054 Lucas Cranach I Ein Portrait Caroli V. auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Sch. 10 Vi Zoll, Breite 1 Sch. 8 Zoll Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt 1777/04/11 HB NEU 0053 mer. I Transakt. : Unbekannt
Lucas Kranach I Ein Frauenzim-
1778/10/30 HBKOS 0015 L. Cranach I Ein Damens=Portrait mit der Neben=Schrift: S.F.Z.A.G.B.G.S. aetatis 38. Anno 1562. von L. Cranach, auf Holz. Vermuthlich die Gemahlin des vorigen Churfürsten. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 21 Zoll, breit 17 Zoll Inschr.: S.F.Z.A.G.B.G.S. aetatis 38. Anno 1562 (Inschrift und datiert) Transakt.: Unbekannt (30 M) 1778/10/30 HBKOS 0181 Luc. Cranach I Dr. Martin Luther, 1483 gebohren, und gestorben 1546. von Luc. Cranach, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 16 Zoll, breit 12 Zoll Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0336 Lucas Cranach I Adam umfasset die Eva unter dem verbotenen Baume. Auf Holz. [Adam embrasse Eve sous l'arbre defendu. Sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 11 Vi Zoll hoch, 8 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt
1777/05/26 FRAN 0297 Lucas Granach I Kopf. I Verkäufer: Finsterwalder Transakt.: Verkauft (3 fl) Käufer: Zimmer
1779/03/05 HBRMS 0101 ther. I Transakt.: Unbekannt
1777/05/26 FRAN 0444 Lucas Granach I 2 [St.] D. M. Luther, und seine Gemahlin Catharina, von Born. Nach den Leben, von Lucas Granach gemahlt. I Verkäufer: Finsterwalder Transakt.: Verkauft (22 fl) Käufer: Zimmer
1779/09/27 FRNGL 1046 Lucas Cranach I Ein fleißig und sehr mühsam ausgeführtes Stück mit nackenden Manns= und Weibspersonen, aus der Fabel des Ovidii. [Une tres belle piece representante des personnes nues des deux sexes, objet tire des metamorphoses d'Ovide.] I Maße: 1 Schuh 7 Zoll hoch, 1 Schuh 3 Zoll breit Transakt.: Verkauft (7 fl) Käufer: Kaufmann
1778/03/28 HBSCM 0050 Lucas Kranach I Maria mit dem Christ=Kinde, ein rares Original von Lucas Kranach, 1529. gemahlet. I Inschr.: 1529 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt 1778/07/21 HBHTZ 0003 L. Cranach I Churfürst Friedrich und dessen Gemahlin, Zirkel rund, auf Kupfer, extra fleißig gemahlt, mit zwey Händen, im Durchschnitt 6 Zoll. I Diese Nr.: Churfürst Friedrich Mat.: auf Kupfer Format: rund Maße: 6 Zoll im Durchmesser Anm.: Die Lose 3 und 4 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/07/21 HBHTZ 0004 L. Cranach I Churfürst Friedrich und dessen Gemahlin, Zirkel rund, auf Kupfer, extra fleißig gemahlt, mit zwey Händen, im Durchschnitt 6 Zoll. I Diese Nr.: Die Gemahlin des Churfürsten Friedrich Mat.: auf Kupfer Format: rund Maße: 6 Zoll im Durchmesser Anm.: Die Lose 3 und 4 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/09/28 FRAN 0122 Lucas Cranach I Ein junges Frauen= Portrait mit blauem Hut und goldener Halskette. [Portrait d'une jeune femme avec un chapeau bleu & un chaine d'or au col par Luc Cranach.] I Maße: 1 Schuh 2 Zoll breit, 1 Vi Schuh hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (5 fl) Käufer: Resid Müller 1778/09/28 FRAN 0745 Lucas Cranach I Ein Knabenköpfchen. [Une tete d'un petit garijon.] I Maße: 7 Zoll breit, 6 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (15.30 fl) Käufer: Prß ν Dessau 1778/10/30 HBKOS 0001 L. Cranach I Adam und Eva, in klein Lebensgrösse abgebildet und in zwey Tableau getheilet, extra schön gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 30 Zoll, breit 26 Zoll Transakt.: Unbekannt (60 M) 1778/10/30 HBKOS 0002 L. Cranach I Friedrich der Fromme, Churfürst von Sachsen, nach dem Leben, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 20 Zoll, breit 16 Zoll Transakt.: Unbekannt (60 M) 1778/10/30 HBKOS 0005 Cranach I Lucretia, sehr selten gekleidet und angenehm gemahlt, auf Holz, von Cranach seiner besten Zeit. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 28 Zoll, breit 19 Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/10/30 HBKOS 0014 L. Cranach 1523 I Der Churfürst von Sachsen, sehr schön nach dem Leben gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 21 Zoll, breit 17 Zoll Inschr.: 1523 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt (60 M)
1780/00/00 AUAN akt.: Unbekannt
0012
Lucas Cranach I Doctor Martin Lu-
Lucas Kranach I Ein Portrait. I Trans-
1781/05/07 FRHUS 0076 Lucas Cranach I Eine vornehme Dame, in sehr altfränckischer Tracht von Lucas Cranach. I Maße: 1 Schuh 5 Zoll hoch und 1 Schuh 2 Zoll breit Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (1.20 fl) Käufer: Heusser 1781/09/10 BNAN 0032 L Cranach I Ein nackende Diana ruhet neben einer Quelle auf frischem Grase; in der Entfernung ein Bergschloß. I Mat.: auf Holz Maße: 6 Zoll hoch, 9 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/09/10 BNAN 0063 L. Cranach I Eine nackte Lucretia bis zu der Hälfte der Schenkel; ein dünner Flor bedeckt Haar und Stirne; ein anderer schmälerer fällt über dem hinter dem Kopf gehaltenen linken Arm von der Schulter bis zu den Lenden herab, und windet sich wieder über den rechten, worin sie den Dolch hält, hinauf; eine doppelte goldene Kette zieret den Hals; von L. Cranach, angenehm, gelinde, frisch und glänzend gemahlet. I Mat.: auf Holz Maße: 30 Zoll hoch, 23 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1782/02/18 RGBZN 0003 Luc. Cranach I Der heil. Hieronymus mit einem Buch, und neben sich den Todtenkopf, Luc. Cranach, auf Holz gemahlen. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt (7 fl) 1782/09/30 FRAN 0030 Lucas Cranach I Ritter St. Georg mit dem Drachen. [St George avec le Dragon, par Luc Cranach.] I Maße: 7 Zoll hoch, 3 Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (2 fl) Käufer: R Ehrenreich 1784/05/11 HBKOS 0080 L. Cranach I Zwey Verliebte, von L. Cranach. I Maße: hoch 8 Zoll, breit 7 Zoll Transakt.: Verkauft (9 Sch) Käufer: Eckhardt 1784/08/01 LZRST 0160 Lucas Cranach I Zwey fleissig ausgeführte Gemähide auf Holz von Lucas Cranach, Adam und Eva, 5 Vi Z. br. 18 Z. hoch, in vergoldeten Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: 5 Vi Zoll breit, 18 Zoll hoch Verkäufer: N ° 2 Transakt.: Verkauft (1.15 Th) Käufer: ST 1785/05/17 MZAN 0773 Lucas van Cranach I Die 4 Evangelisten von Lucas van Cranach. [Les 4 Evangelistes.] I Diese Nr.: Einer der 4 Evangelisten Maße: 2 Schuh 6 Zoll hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Anm.: Die Lose 773 bis 776 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (11 fl für die Nrn. 773776) Käufer: Schwanck GEMÄLDE
485
1785/05/17 MZAN 0774 Lucas van Cranach I Die 4 Evangelisten von Lucas van Cranach. [Les 4 Evangelistes.] I Diese Nr.: Einer der 4 Evangelisten Maße: 2 Schuh 6 Zoll hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Anm.: Die Lose 773 bis 776 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (11 fl für die Nrn. 773776) Käufer: Schwanck 1785/05/17 MZAN 0775 Lucas van Cranach I Die 4 Evangelisten von Lucas van Cranach. [Les 4 Evangelistes.] I Diese Nr.: Einer der 4 Evangelisten Maße: 2 Schuh 6 Zoll hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Anm.: Die Lose 773 bis 776 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (11 fl für die Nrn. 773776) Käufer: Schwanck
1787/01/15 LZRST 0026 Lucas Kranach I Friedrich, Churfürst der 3te von Sachsen, von Lucas Kranach auf Holz gemalt, in vergoldeten Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: 11 Zoll hoch, 9 Zoll breit Verkäufer: Richter Transakt.: Unbekannt 1787/01/15 LZRST 0047 Lucas Cranach I 2 Portraits, scheinen von Lucas Cranach zu seyn: das Portrait des D. Christopherus Seling und seiner Frau, auf Holz gemalt, etwas beschädigt, 1 Elle 7 Zoll hoch, 1 Elle br. ohne Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Elle 7 Zoll hoch, 1 Elle breit Verkäufer: Richter Transakt.: Unbekannt 1787/01/15 LZRST 0048 Lucas Cranach I Das Portrait von Melanchton, scheint von Lucas Cranach zu seyn, noch nicht beendigt, 18 Zoll hoch, 13 Zoll br. in vergoldeten Rahm. I Maße: 18 Zoll hoch, 13 Zoll breit Verkäufer: Richter Transakt.: Unbekannt
1785/05/17 MZAN 0776 Lucas van Cranach I Die 4 Evangelisten von Lucas van Cranach. [Les 4 Evangelistes.] I Diese Nr.: Einer der 4 Evangelisten Maße: 2 Schuh 6 Zoll hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Anm.: Die Lose 773 bis 776 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (11 fl für die Nm. 773776) Käufer: Schwanck
1787/01/15 LZRST 0049 Lucas Cranach I Das Portr. einer Frau mit vielem Schmuck bekleidet, von Lucas Cranach, 17 Vi Zoll hoch, 12 Z. br. gold. Rahm. I Maße: 17 Vi Zoll hoch, 12 Zoll breit Verkäufer: Richter Transakt.: Unbekannt
1785/05/17 MZAN 0944 Lucas van Cranach I Die Mutter Gottes mit dem Leichname Christi von Lucas van Cranach. [La S. Vierge tenante le corps mort de Jesus Christ.] I Maße: 1 Schuh 8 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 5 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (5 fl) Käufer: Schwanck
1788/01/15 LZRST 3903 Lucas Cranach I Christus unter den Kindern und Weibern, (Lasset die Kinder zu mir kommen ec.) ein vortrefliches Bild von Lucas Cranach, hat einige Risse und ist an der Ecke etwas weniges beschädiget, sonst ist das Bild wohl erhalten, 51 Zoll breit, 30 Zoll hoch, in schw. Rahm mit gold. Leiste. I Maße: 51 Zoll breit, 30 Zoll hoch Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (10.13 Th) Käufer: Caj
1785/10/17 LZRST 0066 Lucas Cranach I 2 Portraits, halbe Figuren, welche nach der Kenner Meinung von Lucas Cranach zu seyn scheinen. Das Portrait des D. Luthers etwas bejahrt, und von seiner Frau Käthe, beyde haben Gebetbücher in Händen, über jedem oben sind allemal zwey Wappen, in schw. Rahm. 31 Zoll hoch, 18 Zoll breit, hin und wieder sind sie etwas weniges beschädigt. I Maße: 31 Zoll hoch, 18 Zoll breit Transakt.: Verkauft oder Unverkauft (18 Gr) Käufer: Rost 1786/05/02 NGAN 0057 Cranach I Loth und seine Töchter, auf Holz, von Cranach. I Mat.: auf Holz Maße: 10 Vi Zoll hoch, 11 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (15 fl) Käufer: Wild 1786/05/02 NGAN 0096 L. Cranach I Catharina von Boren D. Luthers Ehefrau, auf Holz in der Rundung. I Mat.: auf Holz Format: rund Maße: im Durchschnitt 4 Zoll Anm.: Im Eintrag ist der Künstlername als "Kronach" angegeben. Dieser Fehler wird in den Errata berichtigt, die am Ende des Katalogs abgedruckt sind. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (3.6 fl) Käufer: Kleinknecht 1786/05/02 NGAN 0263 Cranach I Eine Wallfahrt; auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Schuh 7 Zoll hoch, 1 Schuh 10 Vi Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (25.1 fl) Käufer: Ego 1786/05/02 NGAN 0267 Cranach I Das Portrait Prinz Friederichs eines Sohns Herzogs Georg von Sachsen, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: 2 Schuh 1 Vi Zoll hoch, 1 Schuh breit Anm.: Im Eintrag ist der Künstlername als "Cronach" angegeben. Dieser Fehler wird in den Errata berichtigt, die am Ende des Katalogs abgedruckt sind. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (2.18 fl) Käufer: Wild 1786/05/02 NGAN 0294 Cranach I Das Bildniß Dr. Martin Luthers. I Maße: 2 Schuh 7 Zoll hoch, 2 Schuh breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (60 fl) Käufer: Wild 1787/00/00 HB AN 0330 Lucas Kranach I Ein Manns=Portrait mit kleinem Bart, schwarzer Kleidung und Huthe. Brustbild auf einem grünen Grunde. Ueberaus fleißig gemahlt. A.H. [Auf Holz] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Zoll, breit 6 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (5 M) Käufer: Tietjen 1787/00/00 HB AN 0568 Lucas Cranach I Ein Mann von mittlen Jahren mit bloßem Kopfe und kleinen Bart, in schwarzer Kleidung. Sehr natürlich und ausführlich gemahlt. A.H. [Auf Holz] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Zoll, breit 5 % Zoll Transakt.: Verkauft (1.12 M) Käufer: Weher [?] 486
GEMÄLDE
1788/01/15 LZRST 3977 Lucas Cranach I Friedrich III. Churfürst von Sachsen, von Lucas Cranach auf Holz gemahlt, in vergold. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: 11 Zoll hoch, 9 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (1.8 Th) Käufer: Parthey 1788/10/01 FRAN 0145 Lucas Cranach I Christus am Creutz mit Johannes und Maria. I Maße: 13 Vi Zoll hoch, 9 % Zoll breit Transakt.: Verkauft (6.15 fl) Käufer: Schalck 1789/00/00 MM AN 0288 Lucas Kranach der ältere I Ein verliebter Alter, auf Holz, 1 Fuß 4 Zoll hoch und 11 Zoll breit, vom Lucas Kranach dem ältern. [Un veil [sic] amoureux, sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 4 Zoll hoch, 11 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (30 Kr) 1789/00/00 MM AN 0378 Lucas Cranach I Eine Türkenbüste mit Knaben, eine Skizze, auf Leinw. [Le buste d'un Türe avec des enfans, Esquise, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 7 Zoll hoch, 2 Fuß 10 Zoll breit [2 pieds 7 pouces de haut, 1 pied de large] Anm.: Die Dimensionen unterscheiden sich in der deutschen und französischen Fassung des Katalogs. Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (33 fl) 1789/01/19 LZRST 3959[b] L. Cranach I 2 St. Ein Ecce homo, nach L. Cranach. in schw. R. mit goldn. Leiste. 9 Z. h. 6 Vi Zoll br. und Christina Pfalzgräfin bey Rhein, von L. Cranach. 1505. in schw. R[ahm]. I Diese Nr.: Christina Pfalzgräfin bey Rhein; Nr. 3959[a] Kopie nach L. Cranach (I) Maße: 6 Vi Zoll breit, 8 Zoll hoch Inschr.: 1505 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Pf Transakt.: Verkauft (9 Gr für die Nrn. 3959[a] und 3959[b]) Käufer: Wald 1789/01/19 LZRST 3961 L. Cranach I Christus läßt die Kindlein zu sich kommen, ein meisterh. Original von L. Cranach auf Holz gem. hat einige kl. unbedeut. Risse an der Ecke sonst ist es wohl erhalten. 51 Zoll br. 30 Z. h. in schw. R[ahm]. mit goldner Leiste. I Mat.: auf Holz Maße: 51 Zoll breit, 30 Zoll hoch Verkäufer: Ε Transakt.: Verkauft (5 Th) Käufer: Caj 1789/06/06 HBPAK 0016 Lucas Cranach I Doctor Luther und Melanchton, fleißig gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Zoll, breit 6 Zoll Transakt.: Verkauft (6 M) Käufer: Schmeichl 1789/08/18 HBGOV 0036 Lucas Cranach I Ein Frauens=Portrait, fleißig gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Zoll, breit 10 Zoll Transakt.: Unbekannt
1790/01/07 MUAN 0079 Cranach Luc. I Ein altes Weib am Rocken, auf Holz, in einer metallisirten Ram. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 1 Zoll, Breite 9 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
1793/00/00 NGWID 0193 Lucas Cranach I Ein emblematisches Stück mit vielen Figuren, und sonstigen Beywesen, von Lucas Cranach. I Maße: 3 Schuh 1 Zoll hoch, 4 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
1790/01/07 MUAN 0433 Cranach Luc. I Herodias mit dem Haupte Johannis, auf Holz, in einer geschnittenen und vergoldeten Ram. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 2 Schuh 1 Zoll, Breite 1 Schuh 9 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
1793/00/00 NGWID 0194 Lucas Cranach I Ein kleiner sächsischer Prinz im Brustbilde von obigem Meister [Lucas Cranach]. I Maße: 1 Schuh 5 Zoll hoch, 1 Schuh 2 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
1790/02/04 HBDKR 0080 Lucas Cranach I Dr. Martin Luthers Bildniß, von den besten Stücken dieser Art, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 19 Vi Zoll, breit 14 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (1.12 M) Käufer: Eckhardt
1793/00/00 NGWID 0196 Lucas Cranach I Piramus und Thisbe, von Lucas Cranach. I Maße: 2 Schuh 3 Zoll hoch, 1 Schuh 6 Vi Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
1790/08/25 FRAN 0171 Lucas Cranach I Ein Hieronimus mit vielem Beiwerk. I Maße: hoch 43 Zoll, breit 34 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Unbekannt (11.45 fl) 1791/01/05 HBBMN 0287 L. Cranach I Ein alter Verliebter mit einem jungen Frauenzimmer, welche in seiner anhabenden Geldbörse langet. Sehr fleißig gemahlt, von L. Cranach. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Zoll, breit 9 Zoll Anm.: Dieses Los wurde zusammen mit der Nr. 288 (H. Leichner) verkauft. Transakt.: Verkauft (2.4 Μ für die Nrn. 287 und 288) Käufer: Ego ä 1 [...?] 2[...?] 1791/05/15 LZHCT 0063 Lucas Cranach I Portrait de Γ artiste peint par lui meme. II est vu la tete decouverte, avec une longue barbe grise et une fraise blanche autour du cou. Büste de grandeur naturelle, peint sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: haut de 22 % pouces, large de 17 pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0064 Lucas Cranach I Büste de Martin Luther de grandeur naturelle, en habit noir et en collet rouge. C'est un des plus beaux portraits de Luther, oü sa physionomie exprime tresnaturellement son caractere. Peint sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: haut de 22 % pouces, large de 17 pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/10/21 HBRMS1 0033 Lucas Cranach I Ein alter verliebter Jude umfaßt ein junges Mädchen, die ihn aber unterdessen in den Geldsack greift; das Gegenstück, einem jungen Frauenzimmer in Ritters Kleidung mit'n Schwerd an der Seite, wird von einer alten Kuplerin Geld gebracht. Halbe Figuren. Diese beyden Bilder sind mit unglaublichen Fleiß ausgeführt, und von den schönsten Stücken dieses Meisters; auf Holz. I Diese Nr.: Ein alter verliebter Jude umfaßt ein junges Mädchen, die ihn aber unterdessen in den Geldsack greift; Pendant zu Nr. 34 Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Vi Zoll, breit 11 Vi Zoll Anm.: Die Lose 33 und 34 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1791/10/21 HBRMS1 0034 Lucas Cranach I Ein alter verliebter Jude umfaßt ein junges Mädchen, die ihn aber unterdessen in den Geldsack greift; das Gegenstück, einem jungen Frauenzimmer in Ritters Kleidung mit'n Schwerd an der Seite, wird von einer alten Kuplerin Geld gebracht. Halbe Figuren. Diese beyden Bilder sind mit unglaublichen Fleiß ausgeführt, und von den schönsten Stücken dieses Meisters; auf Holz. I Diese Nr.: Einem jungen Frauenzimmer in Ritters Kleidung mit'n Schwerd an der Seite, wird von einer alten Kuplerin Geld gebracht; Pendant zu Nr. 33 Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Vi Zoll, breit 11 Vi Zoll Anm.: Die Lose 33 und 34 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1793/00/00 NGWID 0216 Lucas Cranach I Der heilige Hieronymus, nebst noch verschiedenen Beywesen, sehr gut und kräftig dargestellt, von Lucas Cranach. I Maße: 2 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 10 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0471 Lucas Kranach I Doctor Martin Luther im halben Brustbilde, von Lucas Kranach. I Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 1 Schuh breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0026 Luc. Cranach I Das Bildniß eines alten Churfürsten, mit beyden Händen. Fleißig gemahlt von Luc. Cranach. I Maße: Hoch 21 Zoll, breit 15 Zoll Transakt.: Unbekannt 1793/09/18 HBSCN 0146 L. Cranach. 15301 Doctor Lutter und seine Frau. I Diese Nr.: Doctor Lutter Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Zoll, breit 11 Vi Zoll Inschr.: 1530 (datiert?) Anm.: Die Lose 146 und 147 wurden zusammen katalogisiert. Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt 1793/09/18 HBSCN 0147 L. Cranach. 15301 Doctor Lutter und seine Frau. I Diese Nr.: Seine Frau Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Zoll, breit 11 Vi Zoll Inschr.: 1530 (datiert?) Anm.: Die Lose 146 und 147 wurden zusammen katalogisiert. Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 FGAN [A]0003 Lucas Kranach I Zwo alte gottische Geschichten, auf Holz gemalt. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Schuh hoch, 11 Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt (2 fl) 1794/00/00 FGAN [A]0012 Lucas Kranach I Die Maria umarmt Christum, und küßt ihn das Letztemal, auf Holz gemalt. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch, 1 Schuh 5 Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt (11 fl) 1794/00/00 FGAN [B]0194 Lucas Kranach I Ein Portrait eines Mathematikers, mit dem Zirkel in der Hand, auf Holz gemalt. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Schuh 1 Vi Zoll hoch, 11 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt (22 fl) 1794/09/00 LGAN 0031 Lucas Cranach I Johannes der Täufer, in der Wüste, mit vielen Figuren, von Lucas Cranach, auf Holz, in einer verguldten Rahme. I Mat.: auf Holz Maße: breit 1 Schuh 1 Vi Zoll, hoch 1 Schuh 6 Zoll Verkäufer: [Friedrich Karl Ludwig, Freiherr von Moser] Transakt.: Unbekannt (50 rh fl Schätzung) 1794/09/09 HBPAK 0133 L. Cranach I Christus am Kreuz, zur Seiten Maria und Joseph, der Rückzug des Volks und Kriegesknechte geht über eine Brücke, welche zur Stadt Jerusalem führet, mit vielen Fleiß und Ausdruck gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 34 Zoll, breit 27 Zoll Transakt.: Unbekannt
1793/00/00 NGWID 0138 Lucas Cranach I Ein sehr fleißig ausgearbeitetes Ecce Homo Bild, von Lucas Cranach. I Maße: 3 Schuh hoch, 2 Schuh 1 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
1794/09/10 HBGOV 0091 Lucas Cranach I Der Heyland der Welt. So schön gemahlt, als ein Stück von diesen Künstler bekannt. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 29 Zoll, breit 20 Zoll Transakt.: Unbekannt
1793/00/00 NGWID 0181 Lucas Cranach I Der Probst von Besler, welcher den Beschluß der Aebte zu Nürnberg machte, von Lucas Cranach. I Maße: 2 Schuh 5 Zoll hoch, 2 Schuh 5 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
1795/03/12 HBSDT 0039 Lucas Cranach I Ein alter Verliebter, dem von seinem Mädchen die Börse leichter gemacht wird. Auf Leinwand, im goldenen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 34 Zoll, breit 37 Zoll Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
487
1795/11/14 HBPAK 0016 Lucas Cranach, Ao. 1542 I Ein Miniatur=Gemählde, ein Feldprediger welcher ein Buch in der Hand mit diesen Worten: Beati posidentes, und der Unterschrift: Sous cet habit un lceur volage, d'un vrai Tartuffe est le partage; mit ungemein vielen Fleiß gemahlt, und wegen seiner Seltenheit für den Sammler sehr schätzbar. Auf Pergament. I Mat.: auf Pergament Maße: Hoch 7 Vi Zoll, breit 5 Vi Zoll Inschr.: Ao. 1542 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt. : Unbekannt 1795/11/14 HBPAK 0022 Lucas Cranach I Ein stehend Kind mit einem Creutz, welches die Finger in die Höhe hält, vor ihm kniet eins und betet. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 1 Fuß Vi Zoll, breit 8 % Zoll Transakt.: Unbekannt 1795/11/14 HBPAK 0031 Lucas Cranach, Ao. 15061 Der Herr Christus mit der Dornen=Krone, in der rechten Hand hält er die Ruthe, mit der linken greift er nach der Wunde in der Seite. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 1 Fuß 10 Zoll, breit 1 Fuß 2 Vi Zoll Inschr.: Ao. 1506 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt 1795/11/14 HBPAK 0032 Lucas Cranach I Die Tochter Herodias, mit dem Haupt Johannis des Täufers in einer Schüßel, im Prospekt wird er enthauptet; ein schönes altes Gemähide. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 1 Fuß 9 Vi Zoll, breit 1 Fuß 2 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1795/11/14 HBPAK 0033 Lucas Cranach. Anno 15061 Der Herr Christus mit der Dornen=Krone, die Hände über einander geschlagen, in welche er die Geißeln hält. Vor ihm stehet eine Heilige. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 2 Fuß Vi Zoll, breit 1 Fuß 2 Vi Zoll Inschr.: Anno 1506 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt 1795/11/14 HBPAK 0041 Lucas Cranach. Anno 1535 I Charitas hat ein kleines Kind an der Brust; eines stehet hinter ihr, und umfaßt sie mit beyden Händen; neben ihr knieet eins, welches sie mit der rechten Hand umfasst; eins stehet mit einem Krug und einem Wikkel=Kind neben ihr. Mit sehr vielem Fleiß gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 1 Fuß 10 Zoll, breit 1 Fuß 3 Zoll Inschr.: Anno 1535 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt 1795/11/14 HBPAK 0044 Lucas Cranach. Anno 1542 I Puer Jesus. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 V* Zoll, breit 6 Zoll Inschr.: Anno 1542 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt 1795/11/14 HBPAK 0067 Lucas Cranach I Venus hält den Cupido bey der Hand, in welcher er den Bogen hat. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 1 Fuß 3 Zoll, breit 11 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1795/11/14 HBPAK 0105 Lucas Cranach I Die Geschichte eines hängenden Heiligen. Im Hintergrunde bekämpft er einen ungeheuren Drachen, und befreiet eine schöne Heilige von diesem Schäusal. Im Vordergrunde weiht er sich dem Martertode, den er von scheußlichen Henkern gequält, überliefert wird. Es ist ein trefliches Bild, mit vielem Fleiß, sonderlich die Figuren im Vordergrunde, ausgeführt. Auf Holz. Schw. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 35 Zoll, breit 30 Zoll Transakt.: Unbekannt 1795/11/17 HBPAK 0055 Kranach I Ein Römischer Kayser, oval; sehr gut gemahlt. Gold. Rahm. I Format: oval Maße: Hoch 30 Zoll, breit 30 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/00/00 HLAN [0032] Luc. Cronach I Johannes der Täufer. 1 Sch. 6 Ζ. 1 Sch. 1 Vi Z. auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Sch. 6 Ζ. 1 Sch. 1 Vi Z. Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: [Friedrich Karl Lang] Transakt.: Unbekannt (83.7 Rt; 150 fl Schätzung) 1796/08/01 NGFRZ 0018 Lucas Cranach I Die Liebe, mit vielen Kindern umgeben, von Lucas Cranach. [Gemälde in Oel in schö488
GEMÄLDE
nen Rahmen. (N.B. Die Größe ist ohne das Rahm gemessen.)] I Mat.: Öl Maße: Höhe 2 Schuh, Breite 1 Schuh 5 Zoll. [Rheinisch Maaß] Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen über der Nr. 1 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 25. Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0181 Lucas Kranach \ Hinricus der Achte. Auf Holz. Schwarzer Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 25 Zoll, breit 22 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0232 Lucas Cranach I Einige lustige Mädgens spielen mit einem alten Verliebten, welcher an einem Tische sitzet, auf welchen Goldstücke liegen, wovon die eine verschiedene wegnimmt, indem ihm eine andere rückwerts die Augen zuhält; fleissig gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 25 Zoll 2 Lin., breit 50 Zoll 11 Lin. Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0318 Cranach I Diogenes in Mönchshabit, und zwey Eremiten. I Diese Nr.: Diogenes in Mönchshabit Maße: Hoch 5 Zoll, breit 3 Vi Zoll Anm.: Die Lose 318 und 319 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0319 Cranach I Diogenes in Mönchshabit, und zwey Eremiten. I Diese Nr.: Zwey Eremiten Maße: Hoch 5 Zoll, breit 3 Vi Zoll Anm.: Die Lose 318 und 319 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0157 L Cranach I Zwey historische Stükke des Tobias. Zwey ausserordentlich schöne Bilder von diesem alten Meister. Auf Holz. Schwarzer Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein historisches Stück des Tobias Mat.: auf Holz Maße: Hoch 33 Zoll, breit 43 Zoll Anm.: Die Lose 157 und 158 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0158 L. Cranach I Zwey historische Stükke des Tobias. Zwey ausserordentlich schöne Bilder von diesem alten Meister. Auf Holz. Schwarzer Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein historisches Stück des Tobias Mat.: auf Holz Maße: Hoch 33 Zoll, breit 43 Zoll Anm.: Die Lose 157 und 158 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK O l l i Lucas Cranach I Ein lustiger trinkender Bauer. I Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0122 Lucas Kranach I Eine alte Sybille sitzend und lesend. I Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0126 ther. I Transakt.: Unbekannt
Lucas Kranach I Doctor Martin Lu-
1796/12/07 HBPAK 0187 ben. I Transakt.: Unbekannt
L. Kranach I J. H. Hus nach dem Le-
1797/02/27 HBPAK 0101 Lucas Cranach I Der Churfürst und die Churfürstin von Sachsen. Beyde von den besten Stücken dieses Meisters. Auf Holz, im schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Der Churfürst von Sachsen Mat.: auf Holz Maße: Hoch 21 Zoll, breit 17 Zoll Anm.: Die Lose 101 und 102 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/02/27 HBPAK 0102 Lucas Cranach I Der Churfürst und die Churfürstin von Sachsen. Beyde von den besten Stücken dieses Meisters. Auf Holz, im schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Die Churfürstin von Sachsen Mat.: auf Holz Maße: Hoch 21 Zoll, breit 17 Zoll Anm.: Die Lose 101 und 102 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0101 Lucas Kranach I Eine Magdalena, welche ihre Andacht vor einem Crucifix verrichtet. Mit vielem Ausdruck gemahlt. Auf Holz, mit schwarz=gebeitzten Rahm und vergoldeten Stäben. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 14 Zoll, breit 7 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0103 Lucas Kranach I Petrus, wie er auf dem Söller liegt, und ihm die Erscheinung vorkommt. Sehr wohl erhalten, und gut conditionirt. Auf Holz, mit schwarzen Rahm und
vergoldeten Stäben. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 14 Zoll, breit 9 Y.2 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0119 Lucas Kranach I Das Portrait von Philip Melanchthon. Auf Holz, schwarzer Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt 1798/08/10 HBPAK 0064 Lucas Cranach I Vier Gelehrte. 1. Dr. Luther. 2. Philip Melanchton. 3. Erasmus. 4. Calvinus. Auf Holz, im schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Dr. Luther Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Zoll, breit 6 Zoll Anm.: Die Lose 64 bis 67 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/08/10 HBPAK 0065 Lucas Cranach I Vier Gelehrte. 1. Dr. Luther. 2. Philip Melanchton. 3. Erasmus. 4. Calvinus. Auf Holz, im schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Philip Melanchton Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Zoll, breit 6 Zoll Anm.: Die Lose 64 bis 67 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/08/10 HBPAK 0066 Lucas Cranach I Vier Gelehrte. 1. Dr. Luther. 2. Philip Melanchton. 3. Erasmus. 4. Calvinus. Auf Holz, im schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Erasmus Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Zoll, breit 6 Zoll Anm.: Die Lose 64 bis 67 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/08/10 HBPAK 0067 Lucas Cranach I Vier Gelehrte. 1. Dr. Luther. 2. Philip Melanchton. 3. Erasmus. 4. Calvinus. Auf Holz, im schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Calvinus Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Zoll, breit 6 Zoll Anm.: Die Lose 64 bis 67 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0076 Lucas Müller genannt Sunders I Ein Mann und ein Weib mit Händen, von Lucas Müller genannt Sunders, nach seiner Vaterstadt Cranach. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Mann mit Händen Mat.: auf Holz Maße: hoch 2 Schuh 3 Zoll breit 1 Schuh 10 Zoll Anm.: Die Lose 76 und 77 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0077 Lucas Müller genannt Sunders I Ein Mann und ein Weib mit Händen, von Lucas Müller genannt Sunders, nach seiner Vaterstadt Cranach. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Weib mit Händen Mat.: auf Holz Maße: hoch 2 Schuh 3 Zoll breit 1 Schuh 10 Zoll Anm.: Die Lose 76 und 77 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0080 Lucas Müller genannt Cranach I Ein Mann im Pelze mit einem Rosenkranze in den Händen, von Lucas Müller genannt Cranach. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 10 Zoll breit 1 Schuh 5 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0246 Lucas Müller genannt Cranach] Die Grablegung Christi, von Lucas Müller genannt Cranach. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1799/00/00 WZAN A0279 Lucas Müller, genannt Cranach der Alte I Die Erweckung Lazari, von Lucas Müller, genannt Cranach dem Alten. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 8 Zoll breit 1 Schuh 3 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0378 Lucas Müller genannt Cranach I Ein Manns=Porträt mit einer Hand, Pelz und Kröße, von Lucas Müller genannt Cranach. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 8 Zoll breit 2 Schuh 2 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/08/09 HBPAK 0063 Lucas Kranach I Lucretia vorstellend, welche bereit ist, sich den Dolch in die Brust zu stechen, und ein flohrnes durchsichtiges Gewand um hat, und eine rauhe Pelz= Mantel über den Schultern hängend, mit goldnen Ketten=Perln und sonstigen Schmuck umgeben. Außerordentlich nach der Natur auf das schönste gemahlt. Auf Holz, schwarzer Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 30 Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/10/17 LZAN 0004 Lukas Cranach I Eine Madonna, das Kind Jesu an das Gesicht haltend; hoch 16 Zoll, breit 13 Zoll. Ehedem auf Holz gemalt, nun aber auf Leinwand gezogen; vergoldeter Rahm. I Mat.: von Holz auf Leinwand übertragen Maße: hoch 16 Zoll, breit 13 Zoll Verkäufer: Rauch Transakt.: Verkauft (5 Th) Käufer: Geist 1800/00/00 BLBOE 0123 L. Cranach I Die Tochter des Herodes trägt das Haupt Johannis in einer Schüssel. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0297 Lucas Kranach I Dr. Luthers Frauen Bildniß. I Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0352 L. Cranach I Zwey Stücke; Dr. Martin Luther und seine Frau. I Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0600 L. Kranach I Maria mit dem Christkinde aufm Schooß. I Transakt.: Unbekannt
Cranach, Lucas (der Ältere) (Geschmack von) 1771/05/06 FRAN 0159a L. Cranach I Eine heilige Familie, auf Kupfer gemahlt, in gousto von L. Cranach. I Mat.: auf Kupfer Maße: hoch 10 Zoll, breit 8 Zoll Anm.: Im Katalog tragen zwei Lose die Nummer 159. Diesem Los wurde deshalb zur Unterscheidung die Nummer 159a gegeben. Verkäufer: Johann Friederich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt 1775/05/15 FRAN O l l i L Cranach I Eine heilige Familie, auf Kupfer gemahlt, in gousto von L. Cranach. I Mat.: auf Kupfer Maße: hoch 10 Zoll, breit 8 Zoll Verkäufer: Johann Friedrich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt
1799/00/00 WZAN 0357 Lucas Müller genannt Cranach I Ein Kopf, bezeichnet Sixtus Oelhasen 1503. Von Lucas Müller genannt Cranach. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 5 Zoll breit 2 Schuh Inschr.: Sixtus Oelhasen 1503 (bezeichnet und datiert) Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1743/00/00 BWGRA 0124 Kranach I Doct. Mart. Luther nach Kranach. I Maße: hoch 1 Fuß 4 Zoll, breit 10 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt
1799/00/00 WZAN 0733 Lucas Müller, genannt Cranach I Zwey Mannsköpfe mit Händen, von Lucas Müller, genannt Cranach. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Mannskopf mit Händen Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 5 Zoll breit 1 Schuh 3 Zoll Anm.: Die Lose 733 und 734 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1772/09/15 BNSCT 0040 Luc Cranach I Portraits: Johann Huß, Mart. Luther, Johann Calvini und Philip Melanchthon, nach Luc Cranach, 1 Fuß 5 Zoll hoch, 1 Fuß 2 Z. breit, in schw. Rahmen. I Diese Nr.: Johann Huß Maße: 1 Fuß 5 Zoll hoch, 1 Fuß 2 Zoll breit Anm.: Die Lose 40 bis 43 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (2.3 fl)
1799/00/00 WZAN 0734 Lucas Müller, genannt Cranach I Zwey Mannsköpfe mit Händen, von Lucas Müller, genannt Cranach. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Mannskopf mit Händen Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 5 Zoll breit 1 Schuh 3 Zoll Anm.: Die Lose 733 und 734 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1772/09/15 BNSCT 0041 Luc Cranach I Portraits: Johann Huß, Mart. Luther, Johann Calvini und Philip Melanchthon, nach Luc Cranach, 1 Fuß 5 Zoll hoch, 1 Fuß 2 Z. breit, in schw. Rahmen. I Diese Nr.: Mart. Luther Maße: 1 Fuß 5 Zoll hoch, 1 Fuß 2 Zoll breit Anm.: Die Lose 40 bis 43 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (2.3 fl)
Cranach, Lucas (der Ältere) (Kopie nach)
GEMÄLDE
489
1772/09/15 BNSCT 0042 Luc Cranach I Portraits: Johann Huß, Mart. Luther, Johann Calvini und Philip Melanchthon, nach Luc Cranach, 1 Fuß 5 Zoll hoch, 1 Fuß 2 Ζ. breit, in schw. Rahmen. I Diese Nr.: Johann Calvini Maße: 1 Fuß 5 Zoll hoch, 1 Fuß 2 Zoll breit Anm.: Die Lose 40 bis 43 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (2.3 fl) 1772/09/15 BNSCT 0043 Luc Cranach I Portraits: Johann Huß, Mart. Luther, Johann Calvini und Philip Melanchthon, nach Luc Cranach, 1 Fuß 5 Zoll hoch, 1 Fuß 2 Z. breit, in schw. Rahmen. I Diese Nr.: Philip Melanchthon Maße: 1 Fuß 5 Zoll hoch, 1 Fuß 2 Zoll breit Anm.: Die Lose 40 bis 43 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (2.3 fl) 1789/01/19 LZRST 3959[a] L Cranach I 2 St. Ein Ecce homo, nach L. Cranach. in schw. R. mit goldn. Leiste. 9 Z. h. 6 Vi Zoll br. und Christina Pfalzgräfin bey Rhein, von L. Cranach. 1505. in schw. R[ahm]. I Diese Nr.: Ein Ecce homo; Nr. 3959[b] von L. Cranach (I) Maße: 9 Zoll hoch, 6 Vi Zoll breit Verkäufer: Pf Transakt.: Verkauft (9 Gr für die Nrn. 3959[a] und 3959[b]) Käufer: Wald 1789/03/05 SCAN [0003] Lukas Cranach I Luthers Bildniß nach dem Original des Lukas Cranach in der Salzdahlischen Gallerte, in Oelfarbe. I Mat.: Öl Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: loan Arnold Ballenstadii Transakt.: Unbekannt 1794/02/21 HBHEG 0170 Kranach I Doctor Luther mit seiner Frau, nach dem Original, von Kranach zu Wittenberg. I Diese Nr.: Doctor Luther Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 8 Zoll, breit 16 Zoll Anm.: Die Lose 170 und 171 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/02/21 HBHEG 0171 Kranach I Doctor Luther mit seiner Frau, nach dem Original, von Kranach zu Wittenberg. I Diese Nr.: Seine Frau Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 8 Zoll, breit 16 Zoll Anm.: Die Lose 170 und 171 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0189 Nach Kranach I Dr. Luthers Portrait. Auf Holz. Schwarzer Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Zoll, breit 9 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/08/10 MMAN 0185 Cranach I Die H. Jungfrau mit dem Kind Jesus und dem H. Johannes, nach Cranach, auf Holz. I Mat.: auf Holz Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (15 fl Schätzung) 1800/08/20 HBPAK 0124 Nach L. Cranach I Zwey Portraits. D. M. Luther, und Phil. Melanchton. Auf Leinwand, goldner Rahm. I Diese Nr.: Ein Portrait. D. M. Luther Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll, breit 15 Zoll Anm.: Die Lose 124 und 125 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0125 Nach L. Cranach I Zwey Portraits. D. M. Luther, und Phil. Melanchton. Auf Leinwand, goldner Rahm. I Diese Nr.: Ein Portrait. Melanchton Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll, breit 15 Zoll Anm.: Die Lose 124 und 125 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 20 Zoll, breit 16 Zoll Transakt.: Unbekannt
Cranach, Lucas (der Ältere) (Manier) 1785/10/17 LZRST 0067 Lucas Cranach I 2 Portraits, von eben dem Meister [Lucas Cranach] in eben der Manier, etwas kleiner, ebenfalls D. Luther und seine Frau vorstellend, unten mit Schrift. 18 Z. h. 13 Z. br. etwas beschädigt, in schwarzen Rahm mit goldener Leiste. I Maße: 18 Zoll hoch, 13 Zoll breit Transakt.: Verkauft oder Unverkauft (1.8 Th) Käufer: Rost 1787/01/15 LZRST 0050 Lucas Cranach I Das Portrait eines grossen Herrn, in Lucas Cranachs Manier, etwas beschädigt, 9 Zoll hoch, 7 Zoll br. ohne Rahm. I Maße: 9 Zoll hoch, 7 Zoll breit Verkäufer: Richter Transakt.: Unbekannt 1792/02/01 LZRST 4834 Cranach I 4 Gemähide von einem alten guten Meister, in Cranachs Manier, auf Holz gemahlt, vermuthlich Altarbilder. Zwey enthalten heilige Familien, das dritte die Ausgiessung des heil. Geistes, das vierte eine Himmelfahrt Christi, letzteres ist aber etwas beschädigt, 49 Zoll hoch, 21 Zoll breit in schwarzen Rahmen. I Mat.: auf Holz Maße: 49 Zoll hoch, 21 Zoll breit Transakt.: Verkauft (17 Gr) Käufer: dd 1794/09/06 HBBMN 0099 Wie Lucas Cranach I Ein großes biblisches Stück. I Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0211 In Kranachscher Manier I Dr. Luthers Ehefrau. Auf Kupfer. Schw. Rahm. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 8 Zoll, breit 5 Zoll Transakt.: Unbekannt
Cranach, Lucas (der Ältere) (Schule) 1786/05/02 NGAN 0244 Cranach I Dr. Martin Luther, und Catharina von Boren. Beyde auf Holz. Aus der Cranachischen Schule. I Diese Nr.: Dr. Martin Luther Mat.: auf Holz Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 244 und 245 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (18.24 fl für die Nrn. 244 und 245) Käufer: Kleinknecht 1786/05/02 NGAN 0245 Cranach I Dr. Martin Luther, und Catharina von Boren. Beyde auf Holz. Aus der Cranachischen Schule. I Diese Nr.: Catharina von Boren Mat.: auf Holz Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 244 und 245 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (18.24 fl für die Nrn. 244 und 245) Käufer: Kleinknecht
Cranach, Lucas (der Ältere) (Stil) 1788/01/15 LZRST 3947 L. Cranach I Venus, Cupido und Mercurius, im Styl des L. Cranach, auf Kupfer, 9 Vi Z. hoch, 7 Vi Z. breit, in schw. Rahm. I Mat.: auf Kupfer Maße: 9 Vi Zoll hoch, 7 Vi Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (2 Th) Käufer: CR
Cranach, Lucas (der Ältere) (zugeschrieben)
1800/08/20 HBPAK 0126 Nach Cranach I Zwey Portraits von katholischen Geistlichen. Auf Leinwand, goldner Rahm. I Diese Nr.: Ein Portrait eines katholischen Geistlichen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll, breit 15 Zoll Anm.: Die Lose 126 und 127 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1779/04/12 GAAN 0006 Lukas Cranach der Aeltere I Churfürst Ernst von Sachsen ein antikes rar Stück, vermutlich von Lukas Cranach dem Aeltem. I Maße: 19 Vi Zoll hoch und 15 Zoll breit Verkäufer: Schöber Transakt.: Unbekannt
1800/08/20 HBPAK 0127 Nach Cranach I Zwey Portraits von katholischen Geistlichen. Auf Leinwand, goldner Rahm. I Diese Nr.: Ein Portrait eines katholischen Geistlichen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll, breit 15 Zoll Anm.: Die Lose 126 und 127 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1792/02/01 LZRST 4808 Lucas Cranach I Ein altes Originalgemählde, vermuthlich von Lucas Cranach, auf Holz. Der Ritter George tödtet den Lindwurm, fleissig ausgeführt, 17 Zoll hoch, 11 Zoll breit, in schwarzem Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: 17 Zoll hoch, 11 Zoll breit Verkäufer: WL Transakt.: Verkauft (1 Th) Käufer: Ζ
1800/08/20 HBPAK 0144 Nach Cranach I Ein Mannsportrait mit einem weissen Barte. Auf Holz, schwarzer Rahm mit goldnen
1793/01/15 LZRST 7008 Lucas Cranach I Der Ritter St. Georg tödtet den Lindwurm, ein Originalgemählde, vermuthlich von Lucas
490
GEMÄLDE
Cranach fleissig ausgeführt, auf Holz, 17 Zoll hoch, 11 Zoll breit, in schw. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: 17 Zoll hoch, 11 Zoll breit Transakt.: Verkauft oder Unverkauft (4.16 Th) Käufer: R[ost]
Crayer, Gaspar de 1742/08/30 BOAN 0142 Creyer I Les 3. Roys, par Creyer. I Maße: Haut 2. p. 1. pou. large 1. p. 7. pou. Verkäufer Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1763/11/09 FRJUN 0050 Crayer1 Une petite Tete de vieillard vigoureusement peint. I Maße: hauteur 5 Vi pouces, largeur 4 pouces Transakt.: Verkauft (2.4 fl) Käufer: von Lauterbach 1764/00/00 BLAN 0625 Crayer I 1. sehr schönes und mit einer guten und kräftigen Colorit versehenes gemählde, stellet Pan und Prinx [sie] in natürlicher große vor. I Maße: 5 Fuß 7 Zoll hoch, 5 Fuß 8 Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (2000 Rt Schätzung) Gegenw. Standort: Erevan, Armenia. National Gallery of Art, als Gaspar de Crayer 1778/05/16 HBBMN 0025 Caspar de Creyer I Zwey Brustbilder mit Händen, als Christus, so den Segen giebt, und die betende Maria, schön exprimirt und gezeichnet von Caspar de Creyer. I Diese Nr.: Ein Brustbild mit Händen, als Christus, so den Segen giebt Anm.: Die Lose 25 und 26 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/05/16 HBBMN 0026 Caspar de Creyer I Zwey Brustbilder mit Händen, als Christus, so den Segen giebt, und die betende Maria, schön exprimirt und gezeichnet von Caspar de Creyer. I Diese Nr.: Ein Brustbild mit Händen, die betende Maria Anm.: Die Lose 25 und 26 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
une tete de mort, par Caspar de Crayer.] I Maße: 2 Schuh 3 Zoll hoch, 1 Schuh 10 Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (41.15 fl) Käufer: Deinet 1782/09/30 FRAN 0307 Caspar de Crayer I Ein mit vielem Geist meisterhaft ausgeführter Apostelkopf. [Une tete d'Apötre superieurement bien exprime par Caspar de Crayer.] I Maße: 2 Schuh hoch, 1 Schuh 6 Vi Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (10.45 fl) Käufer: Dr Siegler 1785/05/17 MZAN 0994 de Crajer I Die Mutter Gottes mit dem Jesukind und die H. Catharina von de Crajer. [La S. Vierge avec Γ enfant Jesus & S. Catherine.] I Maße: 1 Schuh 4 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (32.30 fl) Käufer: Dechant Pestel 1787/00/00 HB AN 0141 Caspar de Crayer I Eine schwarz gekleidete junge Frau mit weißer Kappe und Kragen, in den Händen hält sie die Handschuh. Halbe Figur. Besonders richtig gezeichnet, und von schönem und klaren Colorit, auch von einer überaus kecken Mahlerey. Auf Leinew. s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 35 Zoll, breit 27 Zoll Transakt.: Verkauft (21 M) Käufer: Fesser 1787/00/00 HB AN 0347 Caspar de Crayer I Das Bildmß eines Holländischen Admirals in bloßem Haupte, mit beyden Händen; in schwarzer Kleidung. Ueberaus schön und kräftig gemahlt, und von natürlichem Colorit und richtiger Zeichnung. Wie Adam van Dyck. [Ganze Figur Lebensgröße.] A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 81 Zoll, breit 33 Zoll Transakt.: Verkauft (30 M) Käufer: Lilly
1778/09/28 FRAN 0113 Krayer I Ein Mannskopf mit einem Kragen. [Une tete d'homme avec un collet.] I Maße: 1 Schuh 2 Zoll breit, 1 Vi Schuh hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (30 fl) Käufer: Weitsch
1787/00/00 HB AN 0660 Caspar de Crayer I Das Bildniß eines Mannes von mittlen Jahren, in bloßen Haaren und mit kleinem Zwickelbart, in schwarzer Kleidung und Kragen. Sehr schön gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll, breit 16 Zoll Transakt.: Verkauft (8 M) Käufer: Berth[eau]
1779/09/27 FRNGL 0405 Caspar de Crayer I Ein schönes niederländisches Mannsbildniß. [Un tres beau portrait d'un Flamand.] I Pendant zu Nr. 406 Maße: 1 Schuh 1 Vi Zoll hoch, 11 % Zoll breit Transakt.: Verkauft (8.15 fl für die Nrn. 405 und 406) Käufer: Rath Ehrenreich
1791/09/21 FRAN 0076 Crayer I Ein Werk von neun Figuren, so den Heller des Cesars vorstellet, die Köpfe sind von einem schönen Charakter; der Grund stellet eine Baukunst vor; das Ganze macht eine reiche und schöne Vorstellung. I Transakt.: Verkauft (33 fl) Käufer: Levy
1779/09/27 FRNGL 0406 Caspar de Crayer I Ein dergleichen Portrait zum Gegenbild, von nemlichem Meister [Casparde Crayer] und Maas. [Le pendant du precedant, meme objet [portrait d'un Flamand], par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 405 Maße: 1 Schuh 1 Vi Zoll hoch, 11 % Zoll breit Transakt.: Verkauft (8.15 fl für die Nrn. 405 und 406) Käufer: Rath Ehrenreich
1791/09/26 FRAN 0098 Caspar de Creyer I Ein ausdrucksvoller alter Mannskopf, von der Meisterhand des Caspar de Creyer. I Maße: 18 Zoll hoch, 24 Zoll breit Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt
1779/09/27 FRNGL 0770 Caspar de Crayer I Ein alter Apostelkopf, sehr meisterhaft. [Une vieille tete d'apötre, chef d'oeuvre.] I Maße: 2 Schuh hoch, 1 Schuh 7 Zoll breit Transakt.: Verkauft (12 fl) Käufer: Hüsgen 1779/09/27 FRNGL 0903 Caspar de Crayer I Ein sehr gutes Mannsbildniss mit einem Knebelbart. [Un tres beau portrait d'homme avec une moustache.] I Maße: 1 Schuh 2 Zoll hoch, 10 Zoll breit Transakt.: Verkauft (15 fl) Käufer: Kaufmann
1794/09/00 LG AN 0032 Caspar de Crayer I Christus und die Pharisär mit dem Zins=Groschen, von Caspar de Crayer, Rubens Gehülfen, auf Kupfer, in einer reich verguldten Rahme. I Mat.: auf Kupfer Maße: breit 1 Schuh 2 Vi Zoll, hoch 10 Vi Zoll Verkäufer: [Friedrich Karl Ludwig, Freiherr von Moser] Transakt.: Unbekannt (300 rh fl Schätzung)
1782/09/30 FRAN 0129 Caspar de Crayer I Ein niederländischer Bauemwirth, welcher seinen Dorfgästen die Rechnung vorzeigt. [Un cabaretier villageois Flamand faisant l'ecot aux paysans par Caspard de Crayer.] I Maße: 2 Schuh 7 Zoll hoch, 3 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (23 fl) Käufer: Grahe
1796/00/00 BS AN 0026 Gaspard De Crayer I Magdelaine penitente, fondant en larmes dans la sainte Baume. Elle s'incline, ä mains jointes, contre une croix de bois; ses longs cheveux couvrent ses epaules et sa gorge. Dans la tete qui n'est vue qu'en profil, on est moins frappe de la beaute des traits, que de l'expression d'une ame tendre qui tourne vers les choses celestes, la vivacite des affections qu'elle prodigua trop longtems aux objets terrestres. La figure est drappee avec art, et les clair-obscurs, tres bien entendus. I Mat.: auf Leinwand Maße: Haut de 2 pieds 9 pouces; large de 3 pieds 8 pouces Verkäufer: Merian l'aine Transakt.: Unbekannt (30)
1782/09/30 FRAN 0179 Caspar de Crayer I Ein Philosoph, welcher nachdenkend an einem Tische sitzt und neben sich verschiedene Schriften und einen Todenkopf liegen hat. [Un Philosophe en meditation assis ä une table, ayant ä cöte de lui plusieurs ecrits &
1796/00/00 HLAN [0033] Caspar de Crayer I Der Zinnsgroschen, 10 Vi Ζ. 1 Sch. 2 Vi Z. auf Kupfer, v. Caspar de Crayer, Rubens Gehülfen. I Mat.: auf Kupfer Maße: 10 Vi Ζ. 1 Sch. 2 Vi Z. Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben GEMÄLDE
491
wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: [Friedrich Karl Lang] Transakt.: Unbekannt (277.18 Rt; 500 fl Schätzung) 1796/12/07 HBPAK 0003 Casp de Crayer I Ein Portrait mit Händen. I Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 BLBOE 0066 C.d. Cray er I Christus lehrt im zwölften Jahre im Tempel. Die Schriftgelehrten sind voller Erwartung. Maria und Joseph staunen über diese Begebenheit. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0056 C. d. Creyer I Ein Mannsportrait mit Zwickelbart und blossen Haaren. Kräftig gemahlt. Auf Leinwand, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Zoll, breit 18 Zoll Transakt.: Unbekannt
Crayer, Gaspar de (und Rubens) 1800/00/00 FRAN2 0016 Crayer; Rubens i Venus und Adonich, in Halbfiguren, von so schöner Zusammensetzung, als geschickter Zeichnung; man darf glauben, daß dieses Stück von Rubens Pinsel ist, wenigstens ist nicht zu zweifeln, daß Er an demselben geholfen hat, dann allenthalben bemerkt man seine Manieren. I Mat.: auf Leinwand Maße: 44 Zoll hoch, 35 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Crayer, Gaspar de (und Snyders, F.) 1764/05/24 BOAN 0204 Jaspar de Crayer; Schneyers I Un Tableau de huit pieds neuf pouces de largeur, cinq pieds neuf pouces de hauteur, representant deux Figures & diverses Venaisons, les Figures sont peintes par Jaspar de Crayer, & la Venaison par Schneyers. [Ein großes stück mit zwey figuren und Verschiedenes wildprett in Lebensgröße die figuren Von Gaspar de Crayer und die thier Von Snyers gemahlt.] I Maße: 8 pieds 9 pouces de largeur, 5 pieds 9 pouces de hauteur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (130 Rt) Käufer: Broggia 1765/00/00 FRRAU 0015 Crayer; Schneyers I Dieses stellet ein Stück von einem Hof vor, an der Mauer sitzet eine Frau, welche ein Kind neben sich stehend, und auf dem Schooß ein Körbgen mit Brod und Trauben, oben drüber ein Messer liegend hat. In der rechten Hand hat sie einen Bissen Brodt, welchen sie auf den neben ihr auf einem Piedestal stehenden Pfauen darreichet. Neben diesem noch eine Pfau=Henne sitzet. Hinter den Piedestal stehet ein Reiger, ein Wind=Hund passet auf, dem Pfauen den Bissen Brodt wegzuschnappen. Auf einem schregliegenden Stück Holz sitzet ein Fassen, und ein paar Gänß=Köpfe sehen aus dem Stall. Vor der Frau stehet ein Korb mit jungen Hahnen, auf demselben sitzet ein paar sich schnäbelende [sie] Tauben; eine andere Taube sitzet dabey, in die Höhe sehend nach ihrem fliegend körnenden Tauber; und zwey Hähne haben einen Kampf. Die Gedancken und Ausführung von Schneyer sind angenehm, das Rangement ist gut. Die Crayerische Figuren würden dem Stück mehr Schönheit einräumen, wann sie, um der Hände willen, nicht den Platz innen hätten. Sonsten sind die Figuren in Colorit gut gemahlt. Ohne die güldene Rahme auf Leinwand gemahlt. Ce tableau represente la partie d'une cours, une femme est assise ä la muraille, qui a un enfant debout ä cote d'elle & sur ses genoux un panier plein de pain & de raisins fins & un couteau dessus. Elle tient dans la main droite un petit morceau de pain, qu'elle veut donner ä un pan, qui est perche ä cöte d'elle sur un Piedestal. A cöte de celui-ci encor une femelle de pan. II y ä derriere le Piedestal un heron & un levrier qui guette le petit morceau de pain, pour le prendre devant le pan. II y a sur un bois couche de travers un faissan & deux tetes d'o'ie qui sortent de leur ecurie. Devant la femme est une corbeille de poulets & au dessus de cette corbeille deux pigeons qui jouent du bee; II y a tout auprfes une femelle de pigeon, qui regarde en haut, apräs son male, qui vole ä eile, & deux coqs qui se battent ensemble. Les Idies & l'ordonnance de Schneyer sont agreables & l'arrangement trfes-bon. Les Figures de Crayer donner492
GEMÄLDE
oient plus d'ornement ä cette piece, si elles n'occupoient pas la place ä cause des mains. Les Figures sont d'ailleurs pour ce qui regarde le Coloris tres-bien peintes. Sans la bordure doree peint sur de la toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 5 Schuh 9 Zoll, breit 8 Schuh 9 Zoll Transakt.: Unbekannt
Crayer, Gaspar de (Geschmack von) 1750/00/00 KOAN 0039 Caspar de Krayer I Un Ecce Homo, tres bien touche dans le gout de Caspar de Krayer. I Maße: Largeur 1 Pies 6 Vi Pouces, Haut 2 Pies Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt
Crayer, Gaspar de (Kopie nach) 1750/00/00 KOAN 0242 Gaspard de Kraier I Un Ecce Homo, beau, copie avec soin sur Gaspard de Kraier I Maße: Largeur 2 Pies 2 Pouces, Haut 3 Pies 4 Vi Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollem Transakt.: Unbekannt
Cree 1799/12/04 HBPAK 0076 v. Cree I Ein Schmidt vor seiner Esse hält das Kind der Mutter zu. Gut und schön gemahlt. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 13 Zoll Transakt.: Unbekannt
Crepin, Louis Philippe 1800/07/09 HBPAK 0049 Crepin I Les bords d'une foret auprfes d'un Lac. Sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: 9 pouces de hauteur. 11 pouces de largeur Transakt.: Unbekannt 1800/07/09 HBPAK 0073 de rochers et de Chutte d'Eau des Soldats. Sur toile. I Mat.: hauteur. 26 pouces de largeur
Crepin I 2 Paysages avec beaueoup on y remarque aussi des pecheurs et auf Leinwand Maße: 20 pouces de Transakt.: Unbekannt
Crepin, Louis Philippe (und Boucher) 1798/06/04 HBPAK 0317 Crepin; die Figuren von Boucher I Ein sehr schätzbares Stück. Von hohen Felsen stürzen Wasserfälle herab, und am Fusse derselben befinden sich Personen. In diesem Stücke ist der meisterhafteste Ausdruck. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 20 Zoll, breit 25 Zoll Transakt.: Unbekannt
Crespi, Giuseppe Maria (Lo Spagnuolo) 1764/05/25 BOAN 0255 Joseppi Crespi I Un Paisanne en figure entiere, d'un pied trois pouces de hauteur, dix pouces de largeur, peinte par Joseppi Crespi. [Ein Baurin in gantzer figur von Joseppi Crespi.] I Maße: 1 pied 3 pouces de hauteur, 10 pouces de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (21.10 Rt) Käufer: Neveu 1777/03/03 AUAN 0028 Crespi Bolog. I Ein mit zwey Köpfe auf Schiferstein. I Mat.: auf Schiefer Maße: Höhe 1 Sch., Breite 9 Zoll Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0142 Crespi, genannt Spagnuolo I Ein Bischof, welcher den vor ihm knieenden heiligen Ludwig einweihet. Dahinter spricht dessen Fahnenträger mit einem Kirchendiener. Maria mit dem Christkinde in den Wolken, neben der zween Heilige stehen, schickt einen Engel herab. [Un eveque, qui sacre S. Louis ä genoux devant lui. Derriere le roi on voit son ecuyer s'entretenir avec un desservant de l'eglise. Marie dans les nuages avec l'enfant Jesus, accompagnee de deux Saints, leur envoie un ange.] I Mat.: auf
Leinwand Maße: 2 Fuß 3 Zoll hoch, 1 Fuß 8 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0362 Crespi Jos. I Ein niederländisches Stück, aufLeinwat. Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 4 Zoll, Breite 1 Schuh Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0367 Crespi Jos. I Ein niederländisches Stück, auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 10 Zoll, Breite 1 Schuh Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1792/10/12 KOAN 0008 Jos. Marie Crespi I Ein schönes Marienbild, von Jos. Marie Crespi, auf Leinwand I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Fuss Anm.: Diese Seite des Katalogs ist unvollständig; ein Teil der Maßangaben ist verlorengegangen. Verkäufer: Moureaux Transakt.: Unbekannt 1796/02/17 HBPAK 0222 Maria Crespi I Im Innern eines Land=Hauses, bewacht ein Frauenzimmer einen schlafenden Bauern; mit vielem Beywesen. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 14 Zoll, Breite 12 Zoll Transakt.: Verkauft (42 M) Käufer: Τ 1799/00/00 LZRCH 0006 Joseph Marie Crespi I Le sujet de la decollation de S. Jean Baptiste. Compos, de 5 figures de grandeur naturelles. C'est une production du meilleur temps de l'artiste, digne d'entrer dans le plus beau cabinet; tant pour Γ execution, que pour la conservation. I Mat.: auf Leinwand Maße: h. 72.1. 48. pouces Verkäufer: J F Rauch Transakt.: Unbekannt
Creus, J. [Nicht identifiziert] 1778/10/30 HBKOS 0129 J. Creus I Das Haupt Christi in seinen Kinder=Jahren, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 7 Ά Zoll, breit 6 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt
Cristophe [Nicht identifiziert] 1781/00/00 WRAN 0055 Cristophe I Suzanne & les deux Vieillards, Tableau peint sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: haut 25 pouces, large 21 pouces 10 lignes Verkäufer: Comte Vincent Potokki Transakt.: Unbekannt
Crivelli, Angelo Maria (Crivellone) 1764/08/25 FRAN 0336 Griveli I Des oiseaux. I Diese Nr.: Des oiseaux Maße: haut 1 pied 6 pouces sur 2 pieds Vi pouce de large Anm.: Die Lose 336 und 337 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1764/08/25 FRAN 0337 Griveli I Des oiseaux. I Diese Nr.: Des oiseaux Maße: haut 1 pied 6 pouces sur 2 pieds Vi pouce de large Anm.: Die Lose 336 und 337 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1772/00/00 BSFRE 0028 Crivelly (Angelus Maria) I Deux Pieces de Volaille, sur Tun des Canards dans l'Eau, & sur l'autre un Coq avec des Poules. Cadres unys d'ores. I Diese Nr.: Une Piece de Volaille, des Canards dans l'Eau Mat.: auf Leinwand Maße: haut de 18 & large de 21 pouces Anm.: Die Lose 28 und 29 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1772/00/00 BSFRE 0029 Crivelly (Angelus Maria) I Deux Pieces de Volaille, sur Tun des Canards dans l'Eau, & sur l'autre un Coq avec des Poules. Cadres unys d'ores. I Diese Nr.: Une Piece de Volaille, un Coq avec des Poules Mat.: auf Leinwand Maße: haut de 18 & large de 21 pouces Anm.: Die Lose 28 und 29 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/10/18 LZAN 0085 Maria Angelo Grivelli I Ein Architectur-Stück. Es präsentirt das Gewölb eines Pallastes, unter welchem
ein Brunnen, um den mehrere Figuren wohl angebracht sind; über dieselbe hinweg sieht man eine weite Entfernung, welche vermittelst der Anordnung und Beleuchtung sehr täuschend ist; hoch 30 Zoll, breit 24 Zoll. Auf Leinwand, in einem verziert und vergoldeten Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 30 Zoll, breit 24 Zoll Verkäufer: Rauch Transakt.: Verkauft (30 Th) Käufer: Geist
Croicar, S. [Nicht identifiziert] 1778/04/11 HBBMN 0014 S. Croicar I Maria und das Christkindlein, mit Engeln umgeben, so sein Kreuz tragen. I Transakt.: Unbekannt
Croock, van [Nicht identifiziert] 1798/11/14 HBPAK 0133 Van Croock I Ein Seestück, ganz in Vernets Manier. In der Nähe eines Hafens, mit einem Leuchtthurm, kämpft ein Schiff gegen die Wuth eines gewitterschwangem Orkans. Schiffbrüchige werden auf einen Felsen im Vordergrunde von Andern gerettet. Auf Leinwand, im golden Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 35 Zoll, breit 44 Zoll Transakt.: Unbekannt
Croocks [Nicht identifiziert] 1796/11/02 HBPAK 0115 Croocks I Zwey Landschaften, die Eine bergigt und waldigt, die andere mit einem Felsen= und Wasser=Prospect, nebst Figuren. Sehr gut gemahlt. Auf Leinwand. Gold. Rahm. I Diese Nr.: Eine Landschaft, bergigt und waldigt Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 20 Zoll, breit 15 Zoll Anm.: Die Lose 115 und 116 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0116 Croocks I Zwey Landschaften, die Eine bergigt und waldigt, die andere mit einem Felsen= und Wasser=Prospect, nebst Figuren. Sehr gut gemahlt. Auf Leinwand. Gold. Rahm. I Diese Nr.: Eine Landschaft, mit einem Felsen= und Wasser=Prospect, nebst Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 20 Zoll, breit 15 Zoll Anm.: Die Lose 115 und 116 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0118 Croocks I Zwey Landschaften; die erste eine bergigte Gegend mit einem Wasserfall. Im Vordergrunde viele Figuren; die zweyte ein Land= und Wasser=Prospect. Im Vordergrunde ziehen Fischer ihre Fahrzeuge am Lande. Zwey äußerst schöne Gemähide. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine Landschaft; eine bergigte Gegend mit einem Wasserfall Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 10 Zoll, breit 13 Vi Zoll Anm.: Die Lose 118 und 119 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0119 Croocks I Zwey Landschaften; die erste eine bergigte Gegend mit einem Wasserfall. Im Vordergrunde viele Figuren; die zweyte ein Land= und Wasser= Prospect. Im Vordergrunde ziehen Fischer ihre Fahrzeuge am Lande. Zwey äußerst schöne Gemähide. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine Landschaft; ein Land= und Wasser=Prospect. Im Vordergründe ziehen Fischer ihre Fahrzeuge am Lande Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 10 Zoll, breit 13 Vi Zoll Anm.: Die Lose 118 und 119 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0131 Croocks I Ein Seestrand. Auf der rechten Seite ein zur Vestung gehöriger Thurm. Im Vordergrunde, am Strande, befinden sich viele Figuren. Ein sehr schönes Bild. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Zoll, breit 12 Zoll Transakt.: Unbekannt
Crooers [Nicht identifiziert] 1790/01/07 MUAN 1267 Crooers I Zwey Bataillenstücke, auf Leinwat, in schwarzen Ramen mit vergoldeten Leisten. I Diese Nr.: Ein Bataillenstück Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 4 Zoll, GEMÄLDE
493
Breite 1 Schuh 8 Zoll Anm.: Die Lose 1267 und 1268 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1268 Crooers I Zwey Bataillenstücke, auf Leinwat, in schwarzen Ramen mit vergoldeten Leisten. I Diese Nr.: Ein Bataillenstück Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 4 Zoll, Breite 1 Schuh 8 Zoll Anm.: Die Lose 1267 und 1268 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
Croonenbergh, Isaack 1793/06/07 HBBMN 0045 J. Croonenbergh I Hirten mit ihren Vieh, ziehen durch ein kleines Gewässer, welches zwischen Berge im Thale hinfließt. Im Geschmack des Berghms [sie], von J. Croonenbergh 1672. I Maße: Hoch 25 Zoll, breit 36 Zoll Inschr.: 1672 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt
Croos 1776/04/15 HBBMN 0089 Croos I Ein extra schöner See= Sturm. I Maße: Höhe 2 Fuß 1 Zoll, Breite 2 Fuß 8 Zoll Transakt.: Verkauft (12.4 M) Käufer: Leck 1776/07/19 HBBMN 0024 Croos I Ein kleiner See=Sturm. I Maße: Höhe 6 Vi Zoll, Breite 1 Fuß 10 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (3.12 M) Käufer: Meberg
Croos, F. [Nicht identifiziert] 1782/03/18 HBTEX 0214 F. Croos I Eine vortrefliche See=Bataille, in welcher die Wahrheit bey allen Bewegungen der Action aufs vollkommenste abgebildet, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 38 Zoll 6 Linien, Breite 45 Zoll 6 Linien Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0215 F. Croos I Zwey See=Häfen mit vielen Schiffen und voller Arbeitenden, die Güter von und zu Schiffe bringen, von gleicher force, auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein See=Hafen Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 39 Zoll, Breite 46 Zoll Anm.: Die Lose 215 und 216 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0216 F. Croos I Zwey See=Häfen mit vielen Schiffen und voller Arbeitenden, die Güter von und zu Schiffe bringen, von gleicher force, auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein S e e h a fen Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 39 Zoll, Breite 46 Zoll Anm.: Die Lose 215 und 216 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt
Croos, Henning [Nicht identifiziert] 1800/00/00+ LZRST [0021] Henning Croos I Eine Landschaft mit lockern Bäumen, in der Ferne eine Dorfkirche. I Mat.: auf Leinwand Maße: 28 Zoll breit 21 Zoll hoch Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummem hinzugefügt. Verkäufer: Rost Transakt.: Unbekannt
Croos, J.
1793/06/07 HBBMN 0134 Cross I Eine stürmende See mit Schiffen ec. von Cross. I Maße: Hoch 8 Vi Zoll, breit 10 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt
1776/04/15 HBBMN 0017 Jean Croos I Ein Winter=Stück, mit vielen Figuren. I Maße: Höhe 1 Fuß 4 Vi Zoll, Breite 1 Fuß 10 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (10.4 M) Käufer: Pauli
1793/09/18 HBSCN 0114 Croos I Eine Landschaft, allwo sich eine Frau unterm Baum ausruhet. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 10 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt (2.2 Μ für die Nm. 114 und 115)
1790/08/13 HBBMN 0096 J. Croos I Die Geschichte der Hexe von Endor, mit vielen ihrer Begleiterinnen, in einer Berges=Höle vorgestellet, ein zur linken Seite durch die Hölzung der Gebürge herabfallendes Licht, verschaffet eine sonderbare Beleuchtung; vortreflich gemahlt. Auf Holz, in fein vergold. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Verkauft (8.4 M) Käufer: Bertheau
1795/03/12 HBSDT 0028 Croos I Seestücke. Auf Holz, mit schwarzen Rahm. I Diese Nr.: Ein Seestück Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 14 Zoll Anm.: Die Lose 28 und 29 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1795/03/12 HBSDT 0029 Croos I Seestücke. Auf Holz, mit schwarzen Rahm. I Diese Nr.: Ein Seestück Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 14 Zoll Anm.: Die Lose 28 und 29 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1795/03/12 HBSDT 0045 Croos I Ein Dorf, durch dessen Mitte ein Fluß geht, worüber eine Brücke ist. Auf Holz, im schwarzen Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 24 Zoll, breit 31 Zoll Transakt.: Unbekannt
Croos, Anthony Jansz. van der 1781/09/10 BNAN 0056 A. v. Croos I Längst einem Fluß, auf dem sich in ihrem Nachen Fischer beschäftigen, ziehet sich ein dichtes Gehölze zur Feme; vorne blickt aus demselben eine schlechte Bauem=Wohnung, und fernerhin ein Kirchthurm hervor. I Mat.: auf Holz Maße: 11 Zoll hoch, 14 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1791/09/21 FRAN 0118 A. van Croos I Eine Landschaft von der Aussicht von Holland, wo vornen ein Jäger ist, der Vögel schießt, hinter ihm stehet ein Mann, auf weitern Abrissen zur Linken, sind Bäume und Häuser, die Rechte stellet einen Sumpf vor, und hinten sind Wiesen und ein Dorf. I Transakt.: Verkauft (7 fl) Käufer: [unleserlich] 494
GEMÄLDE
1800/00/00+ LZRST [0020] Johan van Croos I Ein grosses gothisches Gebäude am Wasser, von Bäumen umgeben, mit Figuren, davon ein Mann nach Enten schiesst. I Mat.: auf Holz Maße: 30 Zoll breit 24 Zoll hoch Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Rost Transakt.: Unbekannt
Croos, Pieter van der 1790/02/04 HBDKR 0027 P. Croos I In einer stürmenden See; scheitern Schiffe vor steilen Felsen. Diese Vorstellung ist besonders rührend ausgedrückt, indem die Wuth der Wellen den Untergang der Schiffe, welche sie zu verschlingen beginnen drohet, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 21 Zoll, breit 26 Zoll Transakt.: Verkauft (8.2 M) Käufer: Ego 1794/02/21 HB HEG 0051 P. Croon I Zwey stürmische See= Prospecte mit Schiffen, wovon einige dem Untergange nahe sind. Die schaudervolle Schönheit ist an beiden vortreflich ausgeführt. I Diese Nr.: Ein stürmischer See=Prospect mit Schiffen, wovon einige dem Untergange nahe sind Mat.: auf Holz Maße: Hoch 20 Vi Zoll, breit 33 Zoll Anm.: Die Lose 51 und 52 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/02/21 HBHEG 0052 P. Croon I Zwey stürmische See= Prospecte mit Schiffen, wovon einige dem Untergange nahe sind. Die schaudervolle Schönheit ist an beiden vortreflich ausgeführt. I
Diese Nr.: Ein stürmischer See=Prospect mit Schiffen, wovon einige dem Untergange nahe sind Mat.: auf Holz Maße: Hoch 20 Vi Zoll, breit 33 Zoll Anm.: Die Lose 51 und 52 wurden zusammen katalogisiert. Transakt. : Unbekannt
Cross, D. [Nicht identifiziert] 1790/02/04 HBDKR 0115 D. Cross I Ein See=Prospect mit großen und kleinen Schiffen, in der Entfernung siehet man eine feste Stadt, besonders schön gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 26 Zoll, breit 36 Zoll Transakt.: Verkauft (7.12 M) Käufer: Ego
Crosse [Nicht identifiziert] 1787/10/06 HB TEX 0016 Crosse I Eine Landschaft mit Pann und Sirings, ausführlich gemahlt, von Crosse, mit dito [vergoldeten] Rahm. I Transakt.: Unbekannt
Cuiso [Nicht identifiziert] 1796/02/17 HBPAK 0236 Cuiso I Auf einer ländlichen Anhöhe, im Vordergrunde des Gemähides, liegt ein Baueijunge, welcher mit verschiedenen Hunden umgeben ist. Neben demselben steht ein röthliches Pferd, welches stallet. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 13 Zoll, Breite 10 Zoll Transakt.: Verkauft (357 M) Käufer: Τ
Cuiso, Albert [Nicht identifiziert] 1789/00/00 MMAN 0219 Albert Cuiso I Ein Bauer und seine Frau, eine Skizze auf Holz. [Un paysan et sa femme, Esquise, sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 8 Zoll hoch, 11 Zoll breit [8 pouces de haut, 10 pouces de large] Anm.: Dieses Los trägt in der deutschen Fassung des Katalogs irrtümlich die Nr. 119. Die Dimensionen unterscheiden sich in der deutschen und französischen Fassung des Katalogs. Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (3 fl)
Curradi, Francesco 1765/03/27 FRKAL 0043 Curradi I Une Academie. I Maße: hauteur 26 pouces, largeur 26 pouces Transakt.: Verkauft (4 fl) Käufer: Hoch
Cuyck, Frans van 1799/00/00 WZAN A0406 Franz Cuyk I Zwey Seefische=Stükke; in der Ferne die See, von Franz Cuyk. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Seefische=Stück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 4 Schuh 3 Zoll breit 5 Schuh 9 Zoll Anm.: Die Lose A406 und A407 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0407 Franz Cuyk I Zwey Seefische=Stükke; in der Feme die See, von Franz Cuyk. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Seefische=Stück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 4 Schuh 3 Zoll breit 5 Schuh 9 Zoll Anm.: Die Lose A406 und A407 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Cuyck, Frans van (oder Boel, P.) 1774/03/28 HBBMN 0056 Boel; Cuyck I Eine Köchinn mit vielerley Gemüse und andern Neben=Sachen, im schwarzen Rahm und goldenen Leisten, von Boel oder Cuyck. I Maße: Höhe 3 Fuß 7 Zoll, Breite 4 Fuß 7 Zoll Transakt.: Unbekannt
Cuylenborch 1774/03/28 HBBMN 0075 Cuylenbach I Ein Corps de Guarde, ungemein angeordnet und schön gemahlt, im schwarzen Rahm mit verguldeten Leisten. I Maße: Höhe 2 Fuß Vi Zoll, Breite 2 Fuß 5 Zoll Transakt.: Unbekannt
Cuylenborch, Abraham van 1750/00/00 KOAN 0017 Ceulenburg I Diane, dans les bains, en bon etat, sur bois, Tun des chefs d'oeuvre de Ceulenburg. I Mat.: auf Holz Maße: Largeur 2 Pies 5 Pouces, Haut 1 Pies 8 Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1763/11/09 FRJUN 0046 Ceulenburg I Un petit pa'isage avec des ruines. I Maße: hauteur 8 pouces, largeur 10 pouces Transakt.: Verkauft (2 fl) Käufer: Kaller 1764/03/12 FRKAL 0161 Ceulenburg I Un semblable [un petit pa'isage] par Ceulenburg. I Anm.: Dieses Los wurde zusammen mit der Nr. 160 (C.J. Vemet) verkauft. Transakt.: Verkauft (1.40 fl für die Nrn. 160 und 161) Käufer: Kaller 1765/03/27 FRKAL 0038 Ceulenburg I Un tableau historique. I Maße: hauteur 33 pouces, largeur 46 pouces Transakt.: Verkauft (10 fl für die Nrn. 38 und 215) Käufer: Kaller 1775/05/08 HBPLK 0030 Α. V. Cuylenborch I Rudera, in welchen die Historie mit der Diana und Actäon auf das angenehmste gemahlt, auf Holz. I Diese Nr.: Rudera, in welcher die Historie mit der Diana und Actäon auf das angenehmste gemahlt Mat.: auf Holz Maße: Höhe 13 Zoll 2 Linie, Breite 15 Zoll 6 Linie Anm.: Die Lose 30 und 31 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] Μ für die Nrn. 30 und 31) 1775/05/08 HBPLK 0031 A.V. Cuylenborch I Rudera, in welchen die Historie mit der Diana und Actäon auf das angenehmste gemahlt, auf Holz. I Diese Nr.: Rudera, in welcher die Historie mit der Diana und Actäon auf das angenehmste gemahlt Mat.: auf Holz Maße: Höhe 13 Zoll 2 Linie, Breite 15 Zoll 6 Linie Anm.: Die Lose 30 und 31 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] Μ für die Nrn. 30 und 31) 1775/05/08 HBPLK 0043 A.v. Cuylenborch I Zwo plaisante Landschaften, in welchen die Historie von der Diana und Actäon mit ihren Nymphen im Bade, auf Holz. I Diese Nr.: Eine plaisante Landschaft, in welcher die Historie von der Diana und Actäon mit ihren Nymphen im Bade Mat.: auf Holz Maße: Höhe 11 Zoll 4 Linie, Breite 14 Zoll 8 Linie Anm.: Die Lose 43 und 44 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (66 Μ für die Nm. 43 und 44) 1775/05/08 HBPLK 0044 A.v. Cuylenborch I Zwo plaisante Landschaften, in welchen die Historie von der Diana und Actäon mit ihren Nymphen im Bade, auf Holz. I Diese Nr.: Eine plaisante Landschaft, in welcher die Historie von der Diana und Actäon mit ihren Nymphen im Bade Mat.: auf Holz Maße: Höhe 11 Zoll 4 Linie, Breite 14 Zoll 8 Linie Anm.: Die Lose 43 und 44 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (66 Μ für die Nrn. 43 und 44) 1775/05/08 HBPLK 0070 A.v. Ceuylenborch I Eine Arcadische Landschaft, worinnen Bacchus, Venus und Ceres unter einer Gardine zu Tische sitzen, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 12 Zoll 8 Linie, Breite 17 Zoll 1 Linie Transakt.: Unbekannt 1775/05/08 HBPLK 0072 A.v. Ceuylenborgh I Eine Arcadische Landschaft mit der Diana und ihren Nymphen, so schlafen, welche ihre Wind=Hunde bewachen, auf Holz, von der besten Zeit des A.v. Ceuylenborgh. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 12 Zoll 7 Linie, Breite 16 Zoll 2 Linie Transakt.: Unbekannt 1778/10/23 HBKOS 0027 Ceulenburg I Eine plaisante Land= und Wasser=Gegend, zur linken auf der Berges Anhöhe ein zerstörGEMÄLDE
495
ter Tempel, im Vorgrunde befindet sich Diana mit ihren Nymphen, wovon einige baden, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 21 Zoll, breit 31 Zoll Transakt.: Unbekannt
schichte der Diana mit Calista Mat.: auf Holz Maße: Hoch 25 Zoll 10 Lin., breit 35 Zoll 11 Lin. Anm.: Die Lose 235 und 236 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1779/00/00 HB AN 0313 Kailenburgh I Ein Reiter verweilt unter dem Gemäuer eines alten Gewölbes bey verschiedenen zur Rechten auf einer Erhöhung stehenden Statuen. Auf Holz. [Un cavalier s'arrete ä droite sous la muraille d'une voüte antique, aupres de plusieurs statues placees sur une eminence. Sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 6 Zoll hoch, 1 Fuß 2 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt
1797/04/20 HBPAK 0056 Cuylenburg I Eine Landschaft mit Grotten, Grabmählem und Urnen, wo besonders das Grabmahl im Vordergrunde mit vielem Fleiß ausgearbeitet ist. Auf der Seite siehet man Hirten mit einigem Vieh. Alles sehr wohl gezeichnet, und in der besten Harmonie zusammengefaßt. Auf Leinwand, mit schwarzen Rahm und vergoldeten Stäben. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll, breit 35 Zoll Transakt.: Unbekannt
1779/03/05 HBRMS 0002 Ceulenburg I Zwey Stücke mit Ruderibus, in einer Landschaft mit Nymphen oder Nuditäten, ungemein ausführlich gemahlt. I Diese Nr.: Ein Stück mit Ruderibus, in einer Landschaft mit Nymphen oder Nuditäten, ungemein ausführlich gemahlt Anm.: Die Lose 2 und 3 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1797/06/13 HBPAK 0157 Ceulenburg I Diana in Unterredung mit einiger ihrer Gespielinnen sitzen in gebirgigter Hölzung bey Monumenten, nebst einem durchschlängelnden Wasser, worinnen viele Nimphen sich baden. Sehr angenehm und schön gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 24 Zoll, breit 35 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt
1779/03/05 HBRMS 0003 Ceulenburg I Zwey Stücke mit Ruderibus, in einer Landschaft mit Nymphen oder Nuditäten, ungemein ausführlich gemahlt. I Diese Nr.: Ein Stück mit Ruderibus, in einer Landschaft mit Nymphen oder Nuditäten, ungemein ausführlich gemahlt Anm.: Die Lose 2 und 3 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1797/06/13 HBPAK 0178 Keulenborg 16401 Die schlafende Diana wird von einem Satyr belauscht. Vor ihr stehet Amor. Zur Linken beim Bade noch unterschiedene Satyren und Nimphen. Alles ist unter Bergeshölungen vorgestellet, wodurch man Landgegenden gewahr wird. Ein sehr schönes und besonders fleißig ausgeführtes Gemähide. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 17 Zoll, breit 23 Zoll Inschr.: 1640 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt
1782/03/18 HBTEX 0320 Ceuylenborch I Eine in einer Bergeshöhle liegend schlafende Nymphe, die von einem Satyr belauschet wird, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 11 Zoll, Breite 14 Zoll 6 Linien Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt
Cuylenborch, Abraham van (Kopie nach)
1782/09/30 FRAN 0387 Keulenburg I Das Innwendige eines alten romanischen Gewölbes mit einer antiken Statue, Figuren und Vieh. [L'interieur d'une voute antique Romaine, avec une statue antique, des figures & du betail, par Keulenburg.] I Pendant zu Nr. 388 von G.H. Hergenröder Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 11 Vi Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (34.30 fl für die Nrn. 387 und 388) Käufer: Müller
1790/05/20 HBSCN 0113 Nach Couylenburg I Die Susanna mit den beyden Alten, und die Bathseba mit ihre Aufwärterin im Bade. Auf P. S.R.G.L. [Schwarzen Rahm, goldne Leisten] I Diese Nr.: Die Susanna mit den beyden ALten Mat.: auf P. Maße: Hoch 14 Zoll, breit 12 Zoll Anm.: Die Lose 113 und 114 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (24.4 Μ für die Nrn. 113 und 114) Käufer: Schöen
1785/12/21 HBKOS 0096 Ceulenburg I Eine Landschaft mit Rudera, Hirten und Vieh, im goldenen Rahm. I Transakt.: Unbekannt
1790/05/20 HBSCN 0114 Nach Couylenburg I Die Susanna mit den beyden Alten, und die Bathseba mit ihre Aufwärterin im Bade. Auf P. S.R.G.L. [Schwarzen Rahm, goldne Leisten] I Diese Nr.: Die Bathseba mit ihre Aufwärterin im Bade Mat.: auf P. Maße: Hoch 14 Zoll, breit 12 Zoll Anm.: Die Lose 113 und 114 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (24.4 Μ für die Nrn. 113 und 114) Käufer: Schöen
1790/08/25 FRAN 0107 Keulenburg I Eine Landschaft mit Figuren. I Maße: hoch 8 Zoll, breit 10 Vi Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (2.45 fl) Käufer: Müntzrath Dietz 1791/07/29 HBBMN 0142 Keuyleuburg I Die Verwunderung der Diana, über Calista, welche von einigen ihrer Nimphen gehalten, lieget; auf Leinen. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 20 Zoll, breit 29 Zoll Transakt.: Verkauft (14 Sch) Käufer: Rost [?] 1791/09/26 FRAN 0459 Kylenburg I Das Innwendige zweyer Felsenhöhlen, mit grosen Statuen im Vorgrund geziert, fleißig und schön ausgeführt die eine von Kylenburg die andere von Hergenröther. I Diese Nr.: Das Innwendige einer Felsenhöhle, mit grosen Statuen im Vordergrunde Maße: 12 Zoll breit, 15 Zoll hoch Anm.: Die Lose 459 und 460 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1792/04/19 HBBMN 0153 Keylenburg I Badende Nymphen unter einer Höhle; sehr fleißig gemahlt. I Maße: Hoch 22 Zoll, breit 29 Zoll Transakt.: Unbekannt
1792/07/28 HBSCN 0074 Nach Couylenburg I Die Susanna mit den beyden Alten, und die Bathseba mit ihre Aufwärterin im Bade. Auf P[apier]. S.R.G.L. [Schwarzen Rahm Goldne Leisten] I Diese Nr.: Die Susanna mit den beyden Alten Mat.: auf Papier Maße: Hoch 14 Zoll, breit 12 Zoll Anm.: Die Lose 74 und 75 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0075 Nach Couylenburg I Die Susanna mit den beyden Alten, und die Bathseba mit ihre Aufwärterin im Bade. Auf P[apier]. S.R.G.L. [Schwarzen Rahm Goldne Leisten] I Diese Nr.: Die Bathseba mit ihre Aufwärterin in Bade Mat.: auf Papier Maße: Hoch 14 Zoll, breit 12 Zoll Anm.: Die Lose 74 und 75 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt
1796/10/17 HBPAK 0235 Ceuylenburg I Die Geschichte der Diana mit Acteon und Calista in Spelunken, oder perspectivischen gebürgigten Gegenden mit Wasser. Auf Holz. I Diese Nr.: Die Geschichte der Diana mit Acteon Mat.: auf Holz Maße: Hoch 25 Zoll 10 Lin., breit 35 Zoll 11 Lin. Anm.: Die Lose 235 und 236 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1797/06/13 HBPAK 0207 Nach Keulenburg I Diana im Bade, nebst einigen Nimphen, unter Felsenhölungen. Zur Linken Rudera und Monumente mit Inschriften. Dieses Gemähide ist so schön, als von Keulenburg selbst. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Vi Zoll, breit 18 Zoll Transakt.: Unbekannt
1796/10/17 HBPAK 0236 Ceuylenburg I Die Geschichte der Diana mit Acteon und Calista in Spelunken, oder perspectivischen gebürgigten Gegenden mit Wasser. Auf Holz. I Diese Nr.: Die Ge-
1799/08/09 HBPAK 0123 Nach Keilenburg I Zwey Stücke mit alte Rudera und Figuren. Auf Leinwand, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein Stück mit alte Rudera und Figuren Mat.:
496
GEMÄLDE
auf Leinwand Maße: Hoch 28 Zoll, breit 35 Zoll Anm.: Die Lose 123 und 124 wurden zusammen katalogisiert. Transakt. : Unbekannt
1775/04/12 HB NEU 0068 Cuyp I Ein alter Gelehrter mit zwey Händen. I Transakt.: Unbekannt
1799/08/09 HBPAK 0124 Nach Keilenburg I Zwey Stücke mit alte Rudera und Figuren. Auf Leinwand, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein Stück mit alte Rudera und Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 28 Zoll, breit 35 Zoll Anm.: Die Lose 123 und 124 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1776/07/19 HBBMN 0078 Coyp I Eine Amazonen=Bataille. I Maße: Höhe 2 Fuß 4 Zoll, Breite 3 Fuß 1 Zoll Transakt.: Verkauft (2.12 M) Käufer: Lillie
Cuylenburg, Cornells van 1790/04/13 HB LIE 0068 C. Keuylenborg I In einer Berges Hole, welche mit Säulen und Rudera gezieret, befindet sich Diana mit ihren Gespielinnen; zur Linken ist ein stilles Wasser, worinnen sich einige Nymphen baden. Die gebürgigte Entfernung machet einen reizenden Anblick. Dieses Gemähide ist so schön wie Cornelius Poelenburg gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 30 Vi Zoll, breit 25 Zoll Anm.: Der Künstler ist vermutlich Abraham van Cuylenborch und nicht Cornells van Cuylenburg. Transakt.: Verkauft (15 M) Käufer: Boemer
Cuyp, Aelbert 1750/00/00 KOAN 0028 Albert Kuip \ S. Pierre, delivre de la prison par un Ange, d'une tres ingenieuse disposition, clair-obscur. I Maße: Largeur 1 Pies 10 Vi Pouces, Haut 2 Pies 2 Vi Pouc Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollem Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0123 Albert Kuip I Les Anges annoncant aux Pasteurs la naisance du Christ, avec un Grand gout de lumiers & d'ombres. I Pendant zu Nr. 124 Maße: Largeur 3 Pies 4 Pouces, Haut 2 Pies 6 Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollem Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0124 Albert Kuip I Son Pendant, representant la circoncision, tout aussi bon, par le meme [Albert Kuip]. I Pendant zu Nr. 123 Maße: Largeur 3 Pies 4 Pouces, Haut 2 Pies 6 Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollem Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0125 Albert Kuip I Des vivandiers, piece peinte avec legerete & bien dessinee, par le meme [Albert Kuip]. I Maße: Largeur 3 Pies 2 Pouces, Haut 2 Pies 2 Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollem Transakt.: Unbekannt 1763/11/09 FRJUN 0051 A. Cuyp I Un süperbe Tableau representant trois Enfans habilles en Bergers pres d'un agneau dans un tres beau pai'sage, naturellement peint, dans son meilleur tems. I Maße: hauteur 47 pouces, largeur 47 pouces Transakt.: Verkauft (26 fl) Käufer: Kaller Gegenw. Standort: Innsbruck, Oesterreich. Ferdinandeum. (634) 1764/03/12 FRKAL 0030 A. Cuyp I Trois Enfans pres d'un Agneau represente dans un agreable pai'sage, ce tableau est tres bien peint & du meilleur tems de ce Maitre. I Maße: hauteur 51 pouces, largeur 51 pouces Transakt.: Verkauft (37 fl) Käufer: Β ν Beroldingen Gegenw. Standort: Innsbruck, Oesterreich. Ferdinandeum. (634) 1765/03/27 FRKAL 0199 Kuip I Un vieillard ecrivant par Kuip. I Transakt.: Unbekannt 1767/00/00 KOAN 0025 Alderknip I Petrus im Kercker auf Holtz von Alderknip. I Maße: Breite 2 Fuß 5 Vi Zoll, Höhe 2 Fuß 10 Zoll Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt 1767/00/00 KOAN 0057 Aldert Knip I Die beschneidung Christi auf Holtz von Aldert Knip. I Mat.: auf Holz Maße: Breite 3 Fuß 11 Vi Zoll, Höhe 3 Fuß Vi Zoll Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt 1770/10/29 FRAN 0028 Cuip I Eine Landschaft. I Maße: Hoch 24 Zoll. Breit 34 Zoll. Transakt.: Unbekannt
1778/05/23 HBKOS 0036 Cuyp I Das Portrait des berühmten Olden Bameveld, nach dem Leben gemalet, so schön wie Rembrandt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 32 Zoll, Breite 24 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt (50 M) 1779/00/00 HB AN 0001 A. Kuyp I Drey Kühe, von der Sonne beleuchtet, liegen im Grase, und wiederkäuen ihr Mittagsfutter. Zur Rechten gießt die Hirtinn die Milch der hinter ihr noch stehenden erst gemolknen Kuh in einige Gefässe. Ein Hund wird von einem darnebensitzenden Knaben zurückgehalten. Ueber eine Anhöhe kommen zur Rechten noch einige Hirten näher, und in der Feme des Gemäldes sieht man die Stadt Utrecht. [Trois vaches, eclairees par le soleil, sont couchees sur l'herbe, & ruminent leur nourriture. Sur la droite on voit une jeune paysanne verser dans des vaisseaux le lait qu'elle vient de traire d'une vache placee derriere eile. Un jeune gar90η assis ä ses cötes, retient un chien. Α droite au haut d'un cöteau s'avancent quelques patres. Dans le lointain on voit la ville d'Utrecht.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 5 Fuß 8 Zoll hoch, 7 Fuß 2 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt Gegenw. Standort: London, England, UK. National Gallery. (961) 1779/00/00 HB AN 0185 A. Kuyp I In einer Gegend an der See liegen zur Linken zween kleine Berge, zwischen denen ein Kirchthurm hervorragt. Etliche Bauern halten auf einem ausgefahrnen Wege, und weiter hin verweilt eine große Menge bey einem Wagen. In der Feme liegen etliche Schiffe vor Anker. Auf Holz. [Dans un paysage pres de la mer, l'on voit ä gauche deux collines, entre lesquelles s'eleve la tour d'une eglise. Quelques [Paysans sont arretes pres d'un chemin fraye; plus loin une multitude de gens entoure une voiture. Dans le lointain quelques vaisseaux ä l'ancre. Sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 1 Zoll hoch, 1 Fuß 6 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/09/27 FRNGL 0064 Kuyp I Das inwendige einer Niederländischen Bauemschenke, worinnen sich die Bauren mit trinken und spielen belustigen, meisterhaft mit schönem Beywesen ausgeführt. [L'interieur d'un cabaret de Village Flamand, representant des paysans qui boivent & jouent, piece superieurement travaillee & ornee de beaux accessoires.] I Pendant zu Nr. 65 Maße: 2 Schuh 1 Zoll hoch, 2 Schuh 11 Zoll breit Transakt.: Verkauft (15.45 fl für die Nm. 64 und 65) Käufer: Kaller 1779/09/27 FRNGL 0065 Kuyp I Das Gegenbild hierzu, eine Bauemschule mit Kindern beiderlei Geschlechts, gar schön und ländlich vorgestellt, von nemlichem Meister [Kuyp] und Maas. [Le pendant du precedant, representant une ecole d'enfans paysans des deux sexes, tres bien travaille dans le gout rustique, par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 64 Maße: 2 Schuh 1 Zoll hoch, 2 Schuh 11 Zoll breit Transakt.: Verkauft (15.45 fl für die Nm. 64 und 65) Käufer: Kaller 1779/09/27 FRNGL 0129 Kuypp I Ein holländischer Bauer mit einem Rumpeltopf, neben demselben Kinder welche ihm zuhören. [Un paysan Hollandois avec un toupie, entoure d'enfans.] I Maße: 8 Zoll hoch, 6 Zoll breit Transakt.: Verkauft (4.4 fl für die Nm. 129 und 130) Käufer: Rath Eichhorn 1779/09/27 FRNGL 0130 Kuypp I Ein dergleichen holländischer Bauer mit einem Bierglas, von neml. Meister [Kuypp] und Maas. [Un paysan Hollandois avec un verre ä bierre, par le meme maitre.] I Maße: 8 Zoll hoch, 6 Zoll breit Transakt.: Verkauft (4.4 fl für die Nrn. 129 und 130) Käufer: Rath Eichhorn 1782/03/18 HBTEX 0231 V. Cuip I Zwey vortrefliche See=Prospecten mit Bergvestungen und vielen Schiffen, fleißig gemahlt, auf Holz. I Diese Nr.: Ein vortreflicher See=Prospect Mat.: auf Holz GEMÄLDE
497
Maße: Höhe 28 Zoll, Breite 37 Zoll Anm.: Die Lose 231 und 232 wurden zusammen katalogisiert. Der Name des Künstlers ist angegeben als "V. Cuip", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einem Fehler. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0232 V. Cuip I Zwey vortrefliche See=Prospecten mit Bergvestungen und vielen Schiffen, fleißig gemahlt, auf Holz. I Diese Nr.: Ein vortreflicher See=Prospect Mat.: auf Holz Maße: Höhe 28 Zoll, Breite 37 Zoll Anm..· Die Lose 231 und 232 wurden zusammen katalogisiert. Der Name des Künstlers ist angegeben als "V. Cuip", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einem Fehler. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1785/05/17 MZAN 0649 Kuyp I Die Geburt Christi von Kuyp. [La naissance de Jesus Christ.] I Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 2 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (8 fl) Käufer: Winterstein 1787/00/00 HB AN 0700 A. Kuyp I Eine gelbe Kuh auf einer Weide; hinter ihr verschiedenes Gebüsche und Bäume, hinten eine angenehme Aussicht, alles von der Sonne auf das stärkste beleuchtet. Dieses kleine Gemähide kann an Schönheit der Zeichnung, Mahlerey und Colorit, und wegen der angenehmen Haltung von Schatten und Licht, und der darinn herrschenden reizenden Dämmerung dem schönsten Potter zur Seite gestellt werden. A.L. [Auf Leinewand] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 8 V* Zoll, breit 5 V* Zoll Transakt.: Verkauft (50 M) Käufer: Fesser 1787/04/19 HBTEX 0017 Keup I Die Geschichte von Simson und Delila. I Transakt.: Verkauft (13.8 M) Käufer: Lilli 1788/09/01 KOAN 0814 Cuyp I Anbetung der Hirten. [Γ adoration des Bergers.] I Maße: Höhe 2 Fuß 9 Zoll, Breite 2 Fuß 3 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/10/01 FRAN 0093 Albert Cuyp I Ein Stück mit Jagdhunden. I Maße: 12 Zoll hoch, 14 Zoll breit Transakt.: Verkauft (3 fl) Käufer: von Schmid 1789/00/00 MMAN 0247 Albert Kuyp I Ein Bataillenstück, auf Kupfer. [Une bataille, sur cuivre.] I Mat.: auf Kupfer Maße: 1 Fuß 5 Zoll hoch, 1 Fuß 11 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt 1789/08/18 HBGOV 0100 Cuyp I Zwey sandigte Land=Gegenden mit Staffage, w. c. wie gezeichnend gemahlt, auf Holz. I Diese Nr.: Eine sandigte Land=Gegend mit Staffage Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Zoll, breit 14 Zoll Anm.: Die Lose 100 und 101 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1789/08/18 HBGOV 0101 Cuyp I Zwey sandigte Land=Gegenden mit Staffage, w. c. wie gezeichnend gemahlt, auf Holz. I Diese Nr.: Eine sandigte Land=Gegend mit Staffage Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Zoll, breit 14 Zoll Anm.: Die Lose 100 und 101 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1790/05/20 HBSCN 0238 A. Ceuyp I Eine waldigte Landschaft mit Vieh und Figuren. Sehr schön gemahlt, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Zoll, breit 27 Zoll Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (4.12 M) Käufer: Richardi 1790/08/25 FRAN 0438 Kuyp I Zwey Stück, auf dem einen ein Bauemwirthshaus, auf dem andern eine Bauernschul. I Diese Nr.: Ein Stück, auf dem ein Bauemwirthshaus Maße: hoch 30 Zoll, breit 39 Zoll Anm.: Die Lose 438 und 439 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (14.15 fl für die Nrn. 438 und 439) Käufer: Martens 1790/08/25 FRAN 0439 Kuyp I Zwey Stück, auf dem einen ein Bauemwirthshaus, auf dem andern eine Bauernschul. I Diese Nr.: Ein Stück, auf dem eine Bauernschul Maße: hoch 30 Zoll, breit 39 Zoll Anm.: Die Lose 438 und 439 wurden zusammen katalogisiert. 498
GEMÄLDE
Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (14.15 fl für die Nrn. 438 und 439) Käufer: Martens 1791/09/21 FRAN 0072 Aalbert Kuyp I Vome sind Kühe, Schaafe, Ziegen und andere Thiere, zur Linken ist ein Bauemhauß, so übem Haufen fällt, und zur Rechten vome bey einer offenen Landschaft ist ein Schäfer, welcher schläft; das Ganze macht eine fürtrefliche Wirkung. I Transakt.: Verkauft (251 fl) Käufer: J Η R [?] Brentano 1791/09/21 FRAN 0089 Aalbert Kuyp I Ein holländischer Meyerhof, vomen sieht man eine Frau, welche beschäftiget ist, Kühe zu melken, zur Linken eine Entfernung von Wiesen mit kleinen Dörfern gezieret, nebst vielem Vieh; es macht im Ganzen eine angenehme und sehr natürliche Wirkung. I Transakt.: Verkauft (148 fl) Käufer: De Neufville 1793/06/07 HBBMN 0210 Cuyp I Eine holländische Dorf=Land und Wasser=[Ge]gend. Auf Holz, von Cuyp. I Diese Nr.: Eine holländische Dorf=[Ge]gend Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 14 Zoll Anm.: Die Lose 210 und 211 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0211 Cuyp I Eine holländische Dorf=Land und Wasser=[Ge]gend. Auf Holz, von Cuyp. I Diese Nr.: Eine holländische Land= und Wasser=[Ge]gend Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 14 Zoll Anm.: Die Lose 210 und 211 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1793/09/18 HBSCN 0050 Cuyp I Die Verkündigung der Hirten auf dem Felde durch den Engel; ganze Heerden Schaafe und Hornvieh mit etlichen Hirten befinden sich auf einer kleinen Anhöhe, die übrigen Wächter vor einer Feldhütte am Fuße dessen; das Schrecken auf allen Gesichtern, die Ehrfurcht und das Anstaunen ist höchst zu bewundern, Menschen und Vieh blicken gen Himmel, und der dreiste Pinsel dieses Mahlers hat die Vorstellung unverbesserlich gemacht. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 34 Zoll, breit 41 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 HB AN 0011 A. Kuyp I In einer hüglichten Landschaft weiden Hirt und Hirtin ihr Vieh. Links erhebt sich, ganz im Vorgrunde, ein hoher mit Bäumen bewachsener Felsen, und rechts die Ruinen eines Schlosses. Zwischen finsteren, gewitterschwarzen Wolken giesst die Sonne ihre erwärmende Stralen herunter. I Maße: Höhe 20 Zoll, Breite 26 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 HB AN 0072 A. Kuyp I Hirten treiben ihre Heerde über einen Hügel hin; andere treiben ihre Ziegen und die muthwilligen Lämmer und Böcke am Fusse desselben weg. Im Vorgrunde steht ein vom Wintergrün umschlungener Baum. I Maße: Höhe 30 Vi Zoll, Breite 28 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0184 Kuip I Eine eben so schöne Landschaft, wie vorhergehende, mit vielen Hügeln. Auf einem derselben, in der Mitte, stehet ein Falkonier, mit einem Falken auf der linken Hand, und in der rechten hat er einen gebeitzten Reiger bey den Beinen. Rechts knieet ein Mönch vor einem Crucifix auf einem Hügel, neben welchen ein Landweg zwischen den beyden Hügeln geht, worauf ein Reisender reitet, der seinen Huth vor dem Crucifix abnimmt. Unten, im Vordergrunde, ist ein Zaun von Stroh. Warm und meisterhaft gemahlt. I Maße: Hoch 27 Zoll, breit 36 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0011 Albert Cuyp I Eine Landschaft, wo sich ein Hirte an einem Baum lehnet, auf einer Schalmey bläset und seine Heerde weidet. Sehr warmes Colorit, und ganz in dem Geschmack des Berghems. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 20 Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0019 Albert Cuyp I Eine bergigte Landschaft, wo eine Kuhmagd melkt, neben ihr ein Knecht und noch andere Personen, die das Vieh hüten. Dieses Bild hat eine ausserordentlich schöne Beleuchtung und Colorit. Auf Holz. Goldner
Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 26 Zoll, breit 33 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0184 Albert Cuyps I Eine Landschaft, wo Männer zu Pferde auf die Jagd gehen. Dieses Gemähide ist von frischer Farbe, und einer angenehmen Composition. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll, breit 18 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0274 A. Kuyp I Zwey Viehstücke. So schön wie von Berghem gemahlt. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Viehstück Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 11 Vi Zoll, breit 15 Vi Zoll Anm.: Die Lose 274 und 275 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0275 A. Kuyp I Zwey Viehstücke. So schön wie von Berghem gemahlt. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Viehstück Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 11 Vi Zoll, breit 15 Vi Zoll Anm.: Die Lose 274 und 275 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 LZAN 0124 Albert Khipp I Deux pendans. Paysages avec figures et animaux; une vache qu'une femme trait sur le päturage; d'autres qui paissent avec des chevres: le tout d'un bon dessein et d'un bon ton de couleur. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hauteur 16 pouces, largeur 22 pouces Transakt.: Unbekannt (14 Louis Schätzung) 1799/10/18 LZAN 0078 Alb. Kuyp I Ein Schlachtstück, worinn viel Charakter, und ein vortreffliches Kolorit herrscht; hoch 28 Zoll, breit 36 Zoll. Auf Leinwand, in einem grauen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 28 Zoll, breit 36 Zoll Verkäufer: Rauch Transakt.: Verkauft (15 Th) Käufer: Straube 1799/12/04 HBPAK 0021 Alb. Kuip I Eine bergigte Land= und Wasser=Gegend. Im Vordergrunde zwey Reisende mit Pferden. Kräftig und gut gemahlt. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 17 Zoll, breit 22 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0137 Albert Kayp I Ein Land= und Wasser=Prospect. Im Vordergrunde Hornvieh, welches trinkt und sich ausruhet. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 18 Zoll, breit 22 Zoll Transakt.: Unbekannt
andern eine Ente. Vier Figuren Männer und Weiber sitzen nahe bey ihm und butzen Fische. Auf dem zweyten Plan siehet man ein kleinen Marktflecken, nächst welchem mehrere Manner ihr Vieh in ein Schiff führen, das Ganze ist mit mehreren Schifftn [sie] begränzet, welche sich anschicken bey einem heitem Himmel unter Segel zu gehen. Dieses Gemälde kann für eines der Ersten Stücke gedachten Künstlers betrachtet werden. I Mat.: auf Holz Maße: 24 Zoll hoch, 34 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Cuyp, Aelbert (und Wils, Jan) 1791/09/21 FRAN 0041 Diese Landschaft ist von Wils; Die Figuren von Aalbert Kuyp I Wir können versichern, daß dieses Gemählde eines der schönsten Dinge ist, welche man sehen kann, es stellet eine bergigte Landschaft vor, wo zur Linken Bäume sind, wovon der Hintertheil, so von einem schönen Sonnen=Untergang beleuchtet wird, eine der größesten und wahresten Wirkungen darbietet, weiter gegen die Mitte ist ein krummer Weg, wo ein Mann auf Spanische Art gekleidet auf einem Spanischen weisen Pferde vorbey reitet, hinter ihm sind Reisende zu Fuß, etwas herunter sind Jagdknechte, welche Hunde bey einem Riemen halten, in mehr entfernten Abrissen auf eben dem grosen Wege ist eine Frau zu Pferde, die Mitte zeiget eine offene Landschaft, so mit Wasser und Gebirgen durchschnitten ist, zur Rechten sind Mühlen und ein Mann, so einen Esel über eine wankende Brücke leitet, der ganze Grund ist mit Hügeln gezieret und alles sehr wohl eingetheilt, der Himmel ist hell, rein und leicht gefärbt, die Bäume scheinen in Bewegung zu seyn und macht eine betrügerische Wirkung. I Transakt.: Verkauft (295 fl) Käufer: Levy
Cuyp, Aelbert (Kopie nach) 1800/11/12 HBPAK 0073 Kaip I Eine geistliche Historie, nach Kaip. I Transakt.: Unbekannt
Cuyp, Aelbert (Manier)
1799/12/04 HBPAK 0169 Albert Kayp I Eine Landschaft, eine Kornerndte vorstellend. Im Vordergrunde ruhen sich die Leute aus. Im Hintergrunde sind sie mit der Arbeit beschäftiget. Ganz gut und brav gemahlt. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Zoll, breit 12 Zoll Transakt.: Unbekannt
1797/12/08 HBPAK 0035 In der Manier von Keyp I Eine bergigte Land= und Wassergegend; im Vordergrunde Wandernde mit Maulthieren. Auf Holz, im schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 26 Zoll, Breite 36 Zoll Transakt.: Unbekannt
1800/00/00 FRAN1 0059 Kuyp I Eine holl. Landschaft. Im ersten Plan sind drei Kühe; im zweiten ist ein Fluß und eine Ruine, ein ebenfalls schönes Stück. I Mat.: auf Holz Maße: 9 Zoll hoch, 12 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Cuyp, Baerend [Nicht identifiziert]
1800/00/00 FRAN1 0060 Kuyp I zwei schöne Landschaften. Diese Nr.: Eine schöne Landschaft Mat.: auf Kupfer Maße: 7 Zoll hoch, 8 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 60 und 61 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN1 0061 Kuyp I zwei schöne Landschaften. I Diese Nr.: Eine schöne Landschaft Mat.: auf Kupfer Maße: 7 Zoll hoch, 8 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 60 und 61 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN2 0036 Kuyp (Albert.) I Ein Inneres von einem Gefängniß, in welchem man siehet wie ein Engel den heil. Petrus befreyet, das Stück ist von schöner Farbenwechselung und ganz in Rembrand's Manier, weshalb daßelbe einen vorzüglichen Platz in einer Gallerie behaupten kann. I Maße: 35 Zoll hoch, 26 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN2 0037 Kuyp (Albert.) I Eine holländ. Kanal, linker Seite des Stücks, im ersten Plan siehet man an dem Ufer einen Jäger stehen, roth gekleidet, in einer Hand haltet er die Flinte, in der
1790/08/25 FRAN 0007 Baerend Cuip I Das erste Opfer von Noa wie er aus der Arch kommt. I Maße: hoch 44 Zoll, breit 72 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (10 fl) Käufer: Schneidewind
Cuyp, Benjamin Gerritsz. 1799/08/09 HBPAK 0002 Belgemin Kuyp I Eine Landschaft vorstellend, allwo die Engeln die Geburth Christi verkündigen, welches die Hirten mit Verwunderung anhören. Ausnehmend schön gemahlt. Auf Leinwand, goldner Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 43 Zoll, breit 55 Zoll Transakt.: Unbekannt
Cuyp, Gerrit Gerritsz. 1789/04/16 HB TEX 0109 Gerdt Cuyp I Anacreon unterrichtet den Cupido; sehr merklich gemahlt auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 17 Vi Zoll, breit 14 Zoll Transakt.: Verkauft (4 M) Käufer: Eckhardt GEMÄLDE
499
Cuyp, S. [Nicht identifiziert]
Dacovert [Nicht identifiziert]
1800/00/00+ LZRST [0047] S. Kuyp I Ein holländischer Prospekt mit einer Windmühle, am Wasser. I Mat. : auf Holz Maße: 19 Zoll breit 17 Zoll hoch Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Rost Transakt.: Unbekannt j)***
1740/00/00 AUAN 0088 Dacovert I 1. Stuck vom Dacovert von 2. Personen. I Maße: 4. Schuh / 1 . Zoll hoch / 3. Schuh / 3. Zoll breit Transakt.: Unbekannt (200 fl)
1789/06/12 HBTEX 0030 D*** I Diogenes mit der Leuchte, Menschen zu suchen, ohnerachtet Große und Kinder um denselben stehen. Auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 32 Zoll, breit 52 Zoll Transakt.: Verkauft (10.12 M) Käufer: Bertheau 1796/10/17 HBPAK 0267 £>*** I Zwey historische Vorstellungen, von guter Ordonance, Collorit. Licht und Schatten. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine historische Vorstellung Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 38 Zoll 10 Lin., breit 33 Zoll 9 Lin. Anm.: Die Lose 267 und 268 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0268 £>*** I Zwey historische Vorstellungen, von guter Ordonance, Collorit. Licht und Schatten. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine historische Vorstellung Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 38 Zoll 10 Lin., breit 33 Zoll 9 Lin. Anm.: Die Lose 267 und 268 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
D***, B. 1789/06/12 HBTEX 0041 B.D*** I Ein sehr fleißig gemahlter Mannskopf, meist im Profil. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 14 Zoll Transakt.: Verkauft (28 M) Käufer: Cober 1790/02/04 HBDKR 0037 B.D*** I Zwey Stücke, mit verschiedenen Blumen, welche in Vasen auf Tischen stehen, sehr fleißig nach der Natur gemahlt, auf Leinw. I Diese Nr.: Ein Stück, mit verschiedenen Blumen, welche in Vasen auf Tischen stehen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 14 Zoll, breit 11 Zoll Anm.: Die Lose 37 und 38 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (3.2 Μ für die Nrn. 37 und 38) Käufer: Ego
Dahl, Michael (I) 1775/09/09 HBBMN 0007 M. Dahl ä London I Ein extra schönes Portrait des Herzogs von Marlborough, Kniestück mit 2 Händen, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 3 F 11 Z, Breit 3 F 2 Ζ Transakt.: Verkauft (13 M) Käufer: Dr Hasberg
Dahlsteen, Augustin 1796/10/17 HBPAK 0092 Dahlsten I Zwey alte Köpfe. Auf Holz. Schwarzer Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein alter Kopf Mat.: auf Holz Maße: Hoch 4 Zoll, breit 2 Zoll Anm.: Die Lose 92 und 93 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0093 Dahlsten I Zwey alte Köpfe. Auf Holz. Schwarzer Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr. : Ein alter Kopf Mat.: auf Holz Maße: Hoch 4 Zoll, breit 2 Zoll Anm.: Die Lose 92 und 93 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0176 Dahlstein I Eine Landschaft mit ovidischen Figuren. I Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0215 Dahlstein I Ein Kopf mit einer sammtnen Mütze. I Transakt.: Unbekannt 1799/08/09 HBPAK 0141 Mann und eine alte Frau. Auf Portrait, ein alter Mann Mat.: Zoll Anm.: Die Lose 141 und Transakt.: Unbekannt
Dahlsteen I Zwey Portraits, ein alter Holz, goldn. Rahm. I Diese Nr.: Ein auf Holz Maße: Hoch 8 Zoll, breit 6 142 wurden zusammen katalogisiert.
1799/08/09 HBPAK 0142 Dahlsteen I Zwey Portraits, ein alter Mann und eine alte Frau. Auf Holz, goldn. Rahm. I Diese Nr.: Ein Portrait, eine alte Frau Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Zoll, breit 6 Zoll Anm.: Die Lose 141 und 142 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1790/02/04 HBDKR 0038 B.D*** I Zwey Stücke, mit verschiedenen Blumen, welche in Vasen auf Tischen stehen, sehr fleißig nach der Natur gemahlt, auf Leinw. I Diese Nr.: Ein Stück, mit verschiedenen Blumen, welche in Vasen auf Tischen stehen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 14 Zoll, breit 11 Zoll Anm.: Die Lose 37 und 38 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (3.2 Μ für die Nrn. 37 und 38) Käufer: Ego
1788/04/08 FRFAY 0134 J. Dak I Eine Bauersfrau, die ihrem Manne das Haar säubert, von J. Dak. Auf Blech. I Mat.: auf Blech Maße: 4 % Z. hoch, und 4 Z. breit Transakt.: Verkauft (1 fl) Käufer: Levi ν M[annheim]
D***, J. van
Dalen, Francois van
1789/08/18 HBGOV 0011 J. van D*** I Ein Stillleben mit Fische allerley Arten, nach dem Leben gemahlt, auf Leinew. I Maße: Hoch 24 Zoll, breit 40 Zoll Transakt.: Unbekannt
D***, J.D. 1792/04/19 HBBMN 0042 J.D.D*** I Ein Stillleben mit Garten=Früchte und Geschirre, welche auf einem überdeckten Tische befindlich, von J.D.D***. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Stillleben Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Zoll, breit 16 Zoll Anm.: Die Lose 42 und 43 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1792/04/19 HBBMN 0043 J.D.D*** I Ein Stillleben mit Garten=Früchte und Geschirre, welche auf einem überdeckten Tische befindlich, von J.D.D***. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Stillleben Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Zoll, breit 16 Zoll Anm.: Die Lose 42 und 43 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 500
GEMÄLDE
Dak, J. [Nicht identifiziert]
1781/05/07 FRHUS 0266 F. V. Dale I Zwey Studierstuben, in welchen allerley Bücher, Noten und Manuscripte auf den Tischen liegen, fleissig und natürlich ausgeführt von F.V. Dale. I Diese Nr.: Eine Studierstube, in welcher allerley Bücher, Noten und Manuscripte auf den Tischen liegen Maße: 1 Schuh 2 Zoll hoch und 11 Zoll breit Anm.: Die Lose 266 und 267 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Jacob Bemus Transakt.: Verkauft (5.30 fl für die Nrn. 266 und 267) Käufer: Ehrman 1781/05/07 FRHUS 0267 F. V. Dale I Zwey Studierstuben, in welchen allerley Bücher, Noten und Manuscripte auf den Tischen liegen, fleissig und natürlich ausgeführt von F.V. Dale. I Diese Nr.: Eine Studierstube, in welcher allerley Bücher, Noten und Manuscripte auf den Tischen liegen Maße: 1 Schuh 2 Zoll hoch und 11 Zoll breit Anm.: Die Lose 266 und 267 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (5.30 fl für die Nrn. 266 und 267) Käufer: Ehrman
Dalens, Dirck 1763/11/09 FRJUN 0052 D. Daalens I Un beau Tableau representant une belle femme dans une niche ayant ä la main des raisins & un verre tres bien peint. I Maße: hauteur 19 pouces, largeur 15 Vi pouces Transakt.: Verkauft (14 fl für die Nrn. 52 und 53) Käufer: Kaller 1763/11/09 FRJUN 0053 D. Daalens I Un pareil au pricedent representant une Flora, pas moindre & de la meme grandeur. I Maße: hauteur 19 pouces, largeur 15 Vi pouces Transakt.: Verkauft (14 fl für die Nrn. 52 und 53) Käufer: Kaller 1764/03/12 FRKAL 0182 Dalens I Deux jolies pieces representant de belles femmes avec beaucoup d'ornement par Dalens. I Transakt.: Verkauft (10 fl) Käufer: Kaller 1765/03/27 FRKAL 0044 Dalens I Deux tableaux representant deux jolies femmes dans une niche avec assortment. I Maße: hauteur 19 pouces, largeur 15 Vi pouces Transakt.: Unbekannt 1776/07/19 HBBMN 0047 Dirck Daalens I Zwo unvergleichliche Landschaften, mit Figuren. I Diese Nr.: Eine unvergleichliche Landschaft, mit Figuren Maße: Höhe 2 Fuß 4 Vi Zoll, Breite 2 Fuß 8 Zoll Anm.: Die Lose 47 und 48 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (16 Μ für die Nm. 47 und 48) Käufer: Lilie 1776/07/19 HBBMN 0048 Dirck Daalens I Zwo unvergleichliche Landschaften, mit Figuren. I Diese Nr.: Eine unvergleichliche Landschaft, mit Figuren Maße: Höhe 2 Fuß 4 Vi Zoll, Breite 2 Fuß 8 Zoll Anm.: Die Lose 47 und 48 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (16 Μ für die Nrn. 47 und 48) Käufer: Lilie 1776/07/19 HBBMN 0110 Dirk Daalens I Eine waldigte Landschaft, mit Satyren und Bachantinen, rar gemahlt. I Maße: Höhe 3 Fuß 4 Zoll, Breite 4 Fuß 2 Zoll Transakt.: Verkauft (15 M) Käufer: Lilie 1778/05/16 HBBMN 0016 Dahlens I Zwey Landschaften. [Diese Stücke sind alle gut gefaßt, theils schwarze Rahmen mit goldenen Leisten, theils goldene Rähmen; auch ist die Höhe und Breite ohne Rähmen gemessen.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 14 Zoll hoch, 12 Zoll breit Anm.: Die Lose 16 und 17 wurden zusammen katalogisiert. Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 24 und beziehen sich wahrscheinlich auf die Nrn. 1 bis 24. Transakt.: Unbekannt 1778/05/16 HBBMN 0017 Dahlens I Zwey Landschaften. [Diese Stücke sind alle gut gefaßt, theils schwarze Rähmen mit goldenen Leisten, theils goldene Rähmen; auch ist die Höhe und Breite ohne Rähmen gemessen.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 14 Zoll hoch, 12 Zoll breit Anm.: Die Lose 16 und 17 wurden zusammen katalogisiert. Die Angaben in eckigen Klammem im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 24 und beziehen sich wahrscheinlich auf die Nrn. 1 bis 24. Transakt.: Unbekannt 1778/05/16 HBBMN Transakt.: Unbekannt
0073
Dirck Dalens I Eine Landschaft. I
1782/03/18 HBTEX 0248 D. Dalens I Zwey Land= und Wassergegenden, meisterhaft gemahlt, auf Holz. I Diese Nr.: Eine Land= und Wassergegend Mat.: auf Holz Maße: Höhe 6 Zoll 9 Linien, Breite 8 Zoll 2 Linien Anm.: Die Lose 248 und 249 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0249 D. Dalens I Zwey Land= und Wassergegenden, meisterhaft gemahlt, auf Holz. I Diese Nr.: Eine Land= und Wassergegend Mat.: auf Holz Maße: Höhe 6 Zoll 9 Linien, Breite 8 Zoll 2 Linien Anm.: Die Lose 248 und 249 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0252 D. Dalens I Zwey Holzungen, auf dem einen siehet man in der Entfernung Wasser vor einer Stadt, Hir-
ten weiden Schafe, und im Vorgrunde reitet ein Herr, der einen Läufer vor sich her hat, auf Holz. I Diese Nr.: Eine Hölzung, auf dem einen siehet man in der Entfernung Wasser vor einer Stadt, Hirten weiden Schafe, und im Vorgrunde reitet ein Herr, der einen Läufer vor sich her hat Mat.: auf Holz Maße: Höhe 8 Zoll 2 Linien, Breite 6 Zoll 6 Linien Anm.: Die Lose 252 und 253 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0253 D. Dalens I Zwey Holzungen, auf dem einen siehet man in der Entfernung Wasser vor einer Stadt, Hirten weiden Schafe, und im Vorgrunde reitet ein Herr, der einen Läufer vor sich her hat, auf Holz. I Diese Nr.: Eine Hölzung Mat.: auf Holz Maße: Höhe 8 Zoll 2 Linien, Breite 6 Zoll 6 Linien Anm.: Die Lose 252 und 253 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1783/06/19 HBRMS 0033 Dirck Dalens I Lebhafte, bergigte Land= und Wasser=Gegenden mit Ziegen und Schaafe. L[einwand]. s.R. [schwarze Rahmen] I Diese Nr.: Eine lebhafte, bergigte Land= und Wasser=Gegend mit Ziegen und Schaafe Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 4 Zoll hoch, 1 Fuß 2 Zoll breit Anm.: Die Lose 33 und 34 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1783/06/19 HBRMS 0034 Dirck Dalens I Lebhafte, bergigte Land= und Wasser=Gegenden mit Ziegen und Schaafe. L[einwand], s.R. [schwarze Rahmen] I Diese Nr.: Eine lebhafte, bergigte Land= und Wasser=Gegend mit Ziegen und Schaafe Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 4 Zoll hoch, 1 Fuß 2 Zoll breit Anm.: Die Lose 33 und 34 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1785/12/21 HBKOS 0024 Dirck Daalens I Eine Landschaft mit einer Korn=Erndte, im verguldeten Rahm. I Transakt.: Unbekannt 1785/12/21 HBKOS 0053 van Daalen I Eine waldigte Landschaft mit Figuren, im schwarzen Rahm. I Transakt.: Unbekannt 1786/10/18 HBTEX 0034 D. Dalens I Die Geschichte des verlomen Sohns, in einer Landgegend vorgestellet, wie lustig er lebet, und wie sie ihn davonjagen. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 26 Zoll, breit 46 Zoll 6 Linien Transakt.: Unbekannt 1787/00/00 HB AN 0286 Dierck Dalens I Auf einem Sandhügel, über welchem eine Landstraße auf ein Bauerhaus zu geht, zeigt sich zur linken der Eingang eines Waldes, auf welchen durch ein kleines Wasser eine Jagdgesellschaft mit ihren Hunden zureitet. Zur rechten befindet sich eine Wanderinn neben ihrer niedergelegten Bürde mit ihren Kindern, wovon sie einem die Brust giebt. Im Hintergrunde wird man noch verschiedene Figuren gewahr. Angenehm und frey gemahlt. A.H. [Auf Holz] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Vi Zoll, breit 16 Zoll Transakt.: Verkauft (25.4 M) Käufer: Bertheau 1792/07/05 LBKIP 0092 Daalens I Zwo Landschaften von Daalens. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 92 und 93 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1792/07/05 LBKIP 0093 Daalens I Zwo Landschaften von Daalens. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 92 und 93 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0413 Theodor Dalens I Zwey Landschaften mit Ruinen und Viehe, von Theodor Dalens. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Ruinen und Viehe Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh 3 Zoll breit 2 Schuh 5 Zoll Anm.: Die Lose A413 und A414 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0414 Theodor Dalens I Zwey Landschaften mit Ruinen und Viehe, von Theodor Dalens. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Ruinen und Viehe Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh 3 Zoll breit 2 Schuh 5 Zoll Anm.: Die Lose A413 und A414 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
501
Dalens, Dirck (und Teniers) 1776/07/19 HBBMN 0072 D. Daalens; D. Tenirs I Eine dito [ausnehmend schöne und fleißige] Landschaft, von D. Daalens, mit Figuren von D. Tenirs. I Maße: Höhe 2 Fuß 9 Zoll, Breite 3 Fuß 10 Zoll Transakt.: Verkauft (12 M) Käufer: Lilie
Dalens, Dirck (und Vliet) 1792/10/12 KOAN 0017 van Vliet; van Dehlen I Die See in Ruhe, von van Vliet und van Dehlen, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Fuss 3 Zoll - breit 2 Fuss 7 Zoll Verkäufer: Moureaux Transakt.: Unbekannt
Dalens, Dirck (I) 1776/06/21 HB NEU 0004 D. Dalens. 1635 I Eine plaisante Landschaft, worinnen ein Hirt mit einen Reflex=Licht beleuchtet, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 7 Z, Breite 1 F Inschr.: 1635 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt 1784/08/02 FRNGL 0173 D. Dalens I Eine heilige Familie, fleißig und warm in einer angenehmen Landschaft, von D. Dalens 1666 verfertigt. I Maße: 14 Vi Zoll breit, 11 Vi Zoll hoch Inschr.: 1666 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: F Transakt.: Verkauft (2.16 fl) Käufer: W[üst]
Dallinger 1785/05/17 MZAN 0194 Dallinger i Ein paar Landschaften von Dallinger. [Deux paysages.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 2 Schuh 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 194 und 195 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (36 fl für die Nm. 194 und 195) Käufer: Zitz 1785/05/17 MZAN 0195 Dallinger I Ein paar Landschaften von Dallinger. [Deux paysages.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 2 Schuh 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 194 und 195 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (36 fl für die Nrn. 194 und 195) Käufer: Zitz 1785/05/17 MZAN 0385 Dallinger I Zwey Landschaften, welche den Winter vorstellen von Dallinger. [Deux paysages representans l'hiver.] I Diese Nr.: Eine Landschaft, welche den Winter vorstellt Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 3 Schuh 5 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 385 und 386 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (61 fl für die Nrn. 385 und 386) Käufer: Germann 1785/05/17 MZAN 0386 Dallinger I Zwey Landschaften, welche den Winter vorstellen von Dallinger. [Deux paysages representans l'hiver.] I Diese Nr.: Eine Landschaft, welche den Winter vorstellt Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 3 Schuh 5 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 385 und 386 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (61 fl für die Nm. 385 und 386) Käufer: Germann 1785/05/17 MZAN 0387 Dallinger I Vier Landschaften, welche die 4 Elemente vorstellen vom vorhergehenden Meister [Dallinger]. [Les 4 elemens representes dans 4 paysages par le meme [Dallinger].] I Diese Nr.: Eine Landschaft, welche eines der 4 Elemente vorstellt Maße: 1 Schuh 2 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 7 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 387 bis 390 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (42.30 fl für die Nrn. 387390) Käufer: Rmus D Cantor L Β äl Hoheneck 1785/05/17 MZAN 0388 Dallinger I Vier Landschaften, welche die 4 Elemente vorstellen vom vorhergehenden Meister [Dallinger]. [Les 4 elemens representes dans 4 paysages par le meme [Dallinger].] I Diese Nr.: Eine Landschaft, welche eines der 4 Elemente 502
GEMÄLDE
vorstellt Maße: 1 Schuh 2 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 7 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 387 bis 390 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (42.30 fl für die Nrn. 387390) Käufer: Rmus D Cantor L Β äl Hoheneck 1785/05/17 MZAN 0389 Dallinger I Vier Landschaften, welche die 4 Elemente vorstellen vom vorhergehenden Meister [Dallinger]. [Les 4 elemens representes dans 4 paysages par le meme [Dallinger].] I Diese Nr.: Eine Landschaft, welche eines der 4 Elemente vorstellt Maße: 1 Schuh 2 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 7 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 387 bis 390 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (42.30 fl für die Nrn. 387390) Käufer: Rmus D Cantor L Β äl Hoheneck 1785/05/17 MZAN 0390 Dallinger I Vier Landschaften, welche die 4 Elemente vorstellen vom vorhergehenden Meister [Dallinger]. [Les 4 elemens representes dans 4 paysages par le meme [Dallinger].] I Diese Nr.: Eine Landschaft, welche eines der 4 Elemente vorstellt Maße: 1 Schuh 2 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 7 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 387 bis 390 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (42.30 fl für die Nrn. 387390) Käufer: Rmus D Cantor L Β al Hoheneck
Dam, F. [Nicht identifiziert] 1791/07/29 HBBMN 0072 F. Dam I Eine Landschaft mit Figuren; auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 20 Vi Zoll, breit 26 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt (2 M)
Dam, S.E. [Nicht identifiziert] 1791/07/29 HBBMN 0105 S. e. Dam I Ein See Prospect; auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Vi Zoll, breit 17 Zoll Transakt.: Unbekannt (1.3 M)
Damery 1768/07/00 MUAN 0169 Damerii I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0368 Damery I Une allegorie sur le manage d'une Princesse de France, avec differens personnages rassembles. Peinte sur toile, marquee du No. 169. I Mat.: auf Leinwand Maße: 5. p. 4. p. de haut sur 7. p. 1 Vi. p. de large Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt
Damian 1742/08/01 BOAN 0554 der Bruder Damian I Eine Abnehmung vom Creutz. Original vom Bruder Damian. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0554 Damian I Eine Mutter Gottes mit dem Kindchen, [la mere Dieu & l'enfant Jesus.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 9 Zoll, Breite 1 Fuß 5 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0598 Damian I Damian mit 3 Köpf, [trois tetes, de Damian.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 6 Zoll, Breite 8 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt
Damini 1777/03/03 AUAN 0024 Damini I Zwey Isaak und Jakob. I Maße: Höhe 1 Sch. 9 Zoll, Breite 1 Sch. 4 Vi Zoll Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt
1777/03/03 AUAN 0025 Damini I Zwey Stücke Kinder in Oval. I Format: oval Maße: Höhe 1 Sch. 1 Zoll, Breite 1 Sch. 4 Vi Zoll Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt
Damins [Nicht identifiziert] 1781/07/18 FRAN 0087 Damins I Ein Engel, so Maria den Gruß bringt. I Pendant zu Nr. 88 Maße: 1 Schuh 11 Zoll hoch, 1 Schuh 5 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/07/18 FRAN 0088 Damins I dito Comp. Maria. I Pendant zu Nr. 87 Maße: 1 Schuh 11 Zoll hoch, 1 Schuh 5 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Danckerts, Hendrick 1800/00/00 FRAN1 0032 Dankerts (Heinr.) I Ein Mondschein: Alle Kunst und Schönheit findet man in diesem prächtigen Stuck vereint. Im ersten Plan seeglet [sie] eine Barke mit drei Figuren längst dem Ufer. Im zweiten sind zwei andere Barken ebenfalls unter Seegel. Linker Seite des Stücks ist eine Windmühle; in Entfernung liegen zwei Dörfer, über dem einen ziehen schwere Wetterwolken auf welche den vollen Mond, der seinen Schein auf die sich zu bewegen scheinende kleine Wellen des Wassers wirft, zu umgeben drohen. 29 Vi Z. h„ 24 Z. b. H[olz]. Signirt mit verzogenen H.SD. 1645 I Mat.: auf Holz Maße: 29 Vi Zoll hoch, 24 Zoll breit Inschr.: H.SD. 1645 (signiert und datiert) Transakt.: Unbekannt
Danloux, Henri-Pierre 1796/02/17 HBPAK 0019 Danlou I In einem Zimmer nahe am Bette sitzt ein nachdenkendes junges Frauenzimmer und näht. I Maße: Höhe 16 % Zoll, Breite 13 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (23 M) Käufer: Τ
Dantibelf?] [Nicht identifiziert] 1723/00/00 PRAN [C]0008 Dantibel[?71 Contrafait / vom Dantibel[?]. I Maße: Höhe 7 Zoll, Breite 5 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt
Darbes, Joseph Friedrich August 1791/05/28 HBSDT 0135 Darbes I Catharina der II. Brustbild. Sehr schön gemahlt, auf Leinewand. Dito Rahm [wo oben eine Trophee der Gelehrsamkeit angebracht ist]. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 30 Zoll, breit 23 Zoll Transakt.: Unbekannt
Daun, N.G. [Nicht identifiziert] 1796/12/07 HBPAK 0090 N. G. Daun I Die bekannte Blumenbegiesserin. I Transakt.: Unbekannt
David, Johann Marcus 1790/02/04 HBDKR 0011 David I Seine Königl. Hoheit der Kronprinz von Dännemark, und zu dessen Compagnon die Kronprinzeßin; sehr fleißig gemahlt, ovalen Formats, auf Leinwand. I Diese Nr.: Seine Königl. Hoheit der Kronprinz von Dänemark; Pendant zu Nr. 12 Mat.: auf Leinwand Format: oval Maße: Hoch 30 Zoll, breit 23 Zoll Anm.: Die Lose 11 und 12 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (61 Μ für die Nrn. 11 und 12) Käufer: Schmidt 1790/02/04 HBDKR 0012 David I Seine Königl. Hoheit der Kronprinz von Dännemark, und zu dessen Compagnon die Kronprinzeßin; sehr fleißig gemahlt, ovalen Formats, auf Leinwand. I Diese Nr.: Die Kronprinzessin; Pendant zu Nr. 11 Mat.: auf Leinwand Format: oval Maße: Hoch 30 Zoll, breit 23 Zoll Anm.: Die Lose 11 und 12 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (61 Μ für die Nm. 11 und 12) Käufer: Schmidt 1790/02/04 HBDKR 0015 David I Ihro Majestät, der hochselige König von Preussen, Friedrich der II. hält den Huth in der Hand, kleine Lebensgröße, auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 39 Zoll, breit 30 Zoll Transakt.: Verkauft (7 M) Käufer: Benjaminn 1790/02/04 HBDKR 0020 David I Die Vorstellung des Cato wie er sich entleibt, auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 27 Zoll, breit 23 Zoll Transakt.: Verkauft (2.2 M) Käufer: Bong 1790/02/04 HBDKR 0024 David I Das Bildmß der Madame Brandes, auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 30 Zoll, breit 22 Zoll Transakt.: Verkauft (6.8 M) Käufer: Rust 1790/02/04 HBDKR 0026 David I Magdalena hält ihre Hände über die Brust, und siehet mit andächtigen Blick in die Höhe; ovalen Formats, auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 25 Vi Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Verkauft (1.5 M) Käufer: Westphalen 1790/02/04 HBDKR 0030 David I Die Gegend vom Grasbrock an der Elbe, mit dem Prospect der Stadt Hamburg, auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 15 Zoll, breit 23 Zoll Transakt.: Verkauft (3 M) Käufer: Friederich 1790/02/04 HBDKR 0032 David I Eine Land= und Wassergegend; im Vorgrunde befindet sich ein kleines Fahrzeug, worinnen Leute Angeln, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 15 Zoll, breit 19 Ά Zoll Transakt.: Verkauft (1.12 M) Käufer: Ego 1790/02/04 HBDKR 0040 David I Ein Frauenskopf, im Gusto von Rembrandt, auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 19 Vi Zoll, breit 16 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (2.2 M) Käufer: Schmidt
Davison [Nicht identifiziert] Dassonville, Jacques 1779/09/27 FRNGL 0834 Dassonville I Eine Bauerngesellschaft in einem Wirthshause. [Des paysans assembles dans un cabaret.] I Pendant zu Nr. 835 Maße: 1 Schuh 7 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 2 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (6.30 fl für die Nm. 834 und 835) Käufer: Dr Ehrmann 1779/09/27 FRNGL 0835 Dassonville I Der Compagnon, eine Bauernfamilie mit Weibern und Kindern, von nemlichem Meister [Dassonville] und Maas. [Le pendant du precedant, une famille de paysans avec des femmes & des enfans, par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 834 Maße: 1 Schuh 7 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 2 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (6.30 fl für die Nrn. 834 und 835) Käufer: Dr Ehrmann
1792/02/01 LZRST 4889 Davison I Ein schönes Bluhmenstück, von Davison, auf Leinwand, 36 Zoll hoch, 30 Zoll breit, hat einen kleinen Riss. I Mat.: auf Leinwand Maße: 36 Zoll hoch, 30 Zoll breit Transakt.: Verkauft (1 Th) Käufer: G S
Decker 1778/03/28 HBSCM 0028 Decker I Zween Campements. I Diese Nr.: Ein Campement Anm.: Die Lose 28 und 29 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/03/28 HBSCM 0029 Decker I Zween Campements. I Diese Nr.: Ein Campement Anm.: Die Lose 28 und 29 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
503
1778/05/21 HB KOS 0057 Transakt.: Unbekannt
Deeker I Reuter vor ein Gezelt. I
1784/05/11 HB KOS 0065 Decker I Eine Winterlandschaft mit vielen Figuren, von Decker. a[uf], L[einewand]. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 33 Zoll, breit 38 Zoll Transakt.: Verkauft (12 Sch) Käufer: Adler 1787/04/03 HB HEG 0072 Decker I Eine lebhafte Bataille, von Decker, auf Holz. I Mat.: auf Holz Transakt.: Verkauft (2.2 M) Käufer: Bertheau 1790/02/04 HBDKR 0097 Decker I Ein sehr lebhaftes Reuter= Gefechte, mit feinem Pinsel gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 18 Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Verkauft (1.10 M) Käufer: Schmidt 1790/04/13 HBLIE 0255 Dekker I Eine plaisante Landschaft. Auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 22 Zoll, breit 29 Zoll Transakt.: Verkauft (10 Sch) 1793/09/18 HBSCN 0049 Dekker I Bergigte Landschaft mit vielen Gebüschen und zerstreuten Wohnungen, der Hirte mit zwey Kühen und einem Schaaf spricht mit einem Landmann, welcher hintern Zaun steht, in der Entfernung will einer zu Pferde über eine Brücke reiten, wo ihm eine Bettelfrau begegnet. Warm und mit vielen Fleiß gemahlt. [Ohne Rahmen.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 30 Zoll, breit 27 Zoll Transakt.: Unbekannt 1794/02/21 HB HEG 0061 Decker I Zwey Holzungen mit Jagd= Gesellschaften. I Diese Nr.: Eine Holzung mit Jagd=Gesellschaft Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 22 Vi Zoll, breit 28 Vi Zoll Anm.: Die Lose 61 und 62 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/02/21 HBHEG 0062 Decker I Zwey Holzungen mit Jagd= Gesellschaften. I Diese Nr.: Eine Hölzung mit Jagd=Gesellschaft Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 22 Vi Zoll, breit 28 Vi Zoll Anm.: Die Lose 61 und 62 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1795/11/17 HBPAK 0038 Decker I Ein Rancontre, wo sie sich auf der Landstraße attakiren. Schw. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 36 Zoll, breit 44 Zoll Transakt.: Unbekannt 1795/11/17 HBPAK 0043 Decker I Zwey Battallien. I Diese Nr.: Eine Battallie Mat.: auf Holz Maße: Hoch 20 Zoll, breit 29 Zoll Anm.: Die Lose 43 und 44 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1795/11/17 HBPAK 0044 Decker I Zwey Battallien. I Diese Nr.: Eine Battallie Mat.: auf Holz Maße: Hoch 20 Zoll, breit 29 Zoll Anm.: Die Lose 43 und 44 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Decker (Kopie nach) 1800/11/12 HBPAK 0366 Decker I Zwey Stücke mit Figuren und Pferden, nach Decker. I Transakt.: Unbekannt
Decker, Cornells Gerritsz. 1789/00/00 MM AN 0281 Carl Decker I Eine Landschaft, auf Leinw. [Un pay sage, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 4 Zoll hoch, 2 Fuß 11 Zoll breit Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "Carl Decker", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (44 fl) 1799/10/18 LZAN 0088 Decker I Eine Landschaft mit Figuren, rechts im Vordergrunde liegt ein umgehauener Baum, dann ein stehender; weiter zurück, über einen kleinen See hinweg, bemerkt man eine kleine Heerde Schaafe am Eingang des Waldes. Vorne zur Linken sind schöne Fabriken, eine männliche Figur, die am Bache Wasser schöpfte geht hinein; oben auf der Brücke, steht ein beladener Esel. In der Mitte des Bildes ist eine perspektivische Aussicht, über welche sich eine schöne wolkichte Luft erhebt. Es ist sehr harmonisch und mit einem fertigen Pinsel gemahlt; hoch 28 Zoll, breit 35 Zoll. Auf Leinwand in einem neuvergoldeten Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 28 Zoll, breit 35 Zoll Verkäufer: Rauch Transakt.: Verkauft (50 Th) Käufer: Seger 1800/00/00 FRAN2 0019 Dekker (Jac. de) I Ein holländ. Kanal. Im vordem Grund siehet man altes Mauerwerk mit Bäume, zwey Fischerbarken zieren den ersten Plan. Ein fleißig ausgearbeitetes Stück. I Mat.: auf Holz Maße: 13 Zoll hoch, 18 Zoll breit Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "Jac. de Dekker", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN2 0099 Decker I Eine Landschaft nach der Natur. Am Bord eines Canals sieht man ein Bauerhaus, vor welchem zwey Schiffer halten und ihren Nachen ausladen; im Hintergründe sind Bäume. Mit einem kecken Pinsel fett und durchsichtig gemahlt. I Mat.: auf Holz Maße: 16 Zoll hoch, 14 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1800/00/00+ LZRST [0022] Decker I Eine alte Hütte am Wasser, nebst Figuren. I Mat.: auf Holz Maße: 21 Zoll breit 18 Zoll hoch Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Rost Transakt.: Unbekannt 1800/00/00+ LZRST [0023] Decker I Zwey Landschaften mit alten Hütten am Wasser. I Mat.: auf Holz Maße: 11 Vi Zoll breit 9 Zoll hoch Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Rost Transakt.: Unbekannt
1800/11/12 HBPAK 0212 Decker I Ein Bombardement vor einer Stadt. I Transakt.: Unbekannt
Decker, Frans
1800/11/12 HBPAK 0330 Transakt.: Unbekannt
Decker I Zwey Batallienstücke. I
1800/11/12 HBPAK 0514 Transakt.: Unbekannt
Decker I Zwey Batallienstücke. I
1800/11/12 HBPAK 0642 Transakt.: Unbekannt
Decker I Zwey historische Stücke. I
1782/03/18 HBTEX 0049 F. Decker I Die Verehrung Christi von den Hirten, wohl ordonnirt, sehr schön beleuchtet und mit Affect gebildet, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 39 Zoll 7 Linien, Breite 28 Zoll Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt
1800/11/12 HBPAK 0707 Transakt.: Unbekannt
Decker I Vier Batallienstücke. I
Decker, G. [Nicht identifiziert]
1800/11/12 HBPAK 0734 Decker I Zwey dito [Stücke] mit Figuren und Pferden. I Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0797 Transakt.: Unbekannt 504
GEMÄLDE
Decker I Zwey Winterstücke. I
1785/05/17 MZAN 0479 G. Decker I Ein arbeitender Leinenweber bezeichnet G. Decker. [Un tisserand travaillant, la piece est marquee G. Decker.] I Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 1 Schuh 2 Zoll breit Inschr.: G. Decker (bezeichnet) Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (12.30 fl) Käufer: ν Loquowitz
Decker, Georg [Nicht identifiziert] 1775/02/25 HBBMN 0030 Georg Decker I Zwo Bataillen. I Diese Nr.: Eine Bataille Anm.: Die Lose 30 und 31 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1775/02/25 HBBMN 0031 Georg Decker I Zwo Bataillen. I Diese Nr.: Eine Bataille Anm.: Die Lose 30 und 31 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1777/02/21 HBHRN 0056 Georg Decker I Eine Bataille. I Maße: Höhe 2 Fuß 3 Zoll, Breite 3 Fuß 1 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/07/11 HBTEX 0065 Georg Decker I Zwey Bataillen. I Diese Nr.: Eine Bataille Anm.: Die Lose 65 und 66 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/07/11 HBTEX 0066 Georg Decker I Zwey Bataillen. I Diese Nr.: Eine Bataille Anm.: Die Lose 65 und 66 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/07/11 HBTEX 0071 Transakt.: Unbekannt
Georg Decker I Eine Bataille. I
Decker, Paul (II) 1786/05/02 NGAN 0006 Decker! Batseba, ein Kmestück. I Maße: 2 Schuh 9 Zoll hoch, 2 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (20 fl für die Nrn. 6 und 7) Käufer: Res Grüner 1786/05/02 NGAN 0007 Decker I Susanna mit den beyden Aeltesten. I Maße: 2 Schuh 9 Zoll hoch, 2 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (20 fl für die Nrn. 6 und 7) Käufer: Res Grüner 1786/05/02 NGAN 0073 Decker I Judith mit des Holofernis Haupt. I Maße: 4 Schuh 5 Zoll hoch, 3 Schuh 9 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (6.30 fl für die Nrn. 73 und 74) Käufer: Res Grüner 1786/05/02 NGAN 0074 Decker I Jael und Barak. I Maße: 4 Schuh 5 Zoll hoch, 3 Schuh 9 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (6.30 fl für die Nm. 73 und 74) Käufer: Res Grüner 1786/05/02 NGAN 0108 Decker I Jupiter und Juno. Argus, den der Merkur eingeschläfert. I Diese Nr.: Jupiter und Juno Maße: 3 Schuh 7 Zoll hoch, 2 Schuh 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 108 und 109 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Trans akt.: Verkauft (11.30 fl für die Nrn. 108 und 109) Käufer: Cons ν Pez
gisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (32.15 fl für die Nrn. 154a, 154b, 155 und 156) Käufer: Möglich 1786/05/02 NGAN 0156 Decker I Vier Philosophen. I Diese Nr.: Ein Philosoph Maße: 2 Schuh 2 Zoll hoch, 1 Schuh 5 Zoll breit Anm.: Die Lose 154a, 154b, 155 und 156 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (32.15 fl für die Nm. 154a, 154b, 155 und 156) Käufer: Möglich 1786/05/02 NGAN 0334 Decker I Maria Magdalena; und Petrus. I Diese Nr.: Maria Magdalena Maße: 2 Schuh 2 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 6 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 334 und 335 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (7 fl für die Nm. 334 und 335) Käufer: S Panzer 1786/05/02 NGAN 0335 Decker I Maria Magdalena; und Petrus. I Diese Nr.: Petrus Maße: 2 Schuh 2 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 6 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 334 und 335 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (7 fl für die Nm. 334 und 335) Käufer: S Panzer 1786/05/02 NGAN 0346 Decker I Die vier Jahreszeiten. I Diese Nr.: Eine der vier Jahreszeiten Maße: 2 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 7 Zoll breit Anm.: Die Lose 346 bis 349 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (6.1 fl für die Nm. 346-349) Käufer: Lochner 1786/05/02 NGAN 0347 Decker I Die vier Jahreszeiten. I Diese Nr.: Eine der vier Jahreszeiten Maße: 2 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 7 Zoll breit Anm.: Die Lose 346 bis 349 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (6.1 fl für die Nm. 346-349) Käufer: Lochner 1786/05/02 NGAN 0348 Decker I Die vier Jahreszeiten. I Diese Nr.: Eine der vier Jahreszeiten Maße: 2 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 7 Zoll breit Anm.: Die Lose 346 bis 349 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (6.1 fl für die Nm. 346-349) Käufer: Lochner 1786/05/02 NGAN 0349 Decker I Die vier Jahreszeiten. I Diese Nr.: Eine der vier Jahreszeiten Maße: 2 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 7 Zoll breit Anm.: Die Lose 346 bis 349 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (6.1 fl für die Nm. 346-349) Käufer: Lochner 1786/05/02 NGAN 0360 Decker I Der heilige Johannes. I Maße: 2 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 7 Zoll breit Anm.: Dieses Los wurde zusammen mit der Nr. 364 (Anonym) verkauft. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (40.1 fl für die Nm. 360-364) Käufer: Möglich
1786/05/02 NGAN 0109 Decker I Jupiter und Juno. Argus, den der Merkur eingeschläfert. I Diese Nr.: Argus, den der Merkur eingeschläfert Maße: 3 Schuh 7 Zoll hoch, 2 Schuh 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 108 und 109 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (11.30 fl für die Nrn. 108 und 109) Käufer: Cons ν Pez
1786/05/02 NGAN 0361 Decker I Der heilige Hieronymus. I Maße: 2 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 7 Zoll breit Anm.: Dieses Los wurde zusammen mit der Nr. 364 (Anonym) verkauft. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (40.1 fl für die Nm. 360-364) Käufer: Möglich
1786/05/02 NGAN 0154a Decker I Vier Philosophen. I Diese Nr.: Ein Philosoph Maße: 2 Schuh 2 Zoll hoch, 1 Schuh 5 Zoll breit Anm.: Die Lose 154a, 154b, 155 und 156 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (32.15 fl für die Nm. 154a, 154b, 155 und 156) Käufer: Möglich
1786/05/02 NGAN 0362 Decker I Cimon und Pero. I Maße: 2 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 7 Zoll breit Anm.: Dieses Los wurde zusammen mit der Nr. 364 (Anonym) verkauft. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (40.1 fl für die Nm. 360-364) Käufer: Möglich
1786/05/02 NGAN 0154b Decker I Vier Philosophen. I Diese Nr.: Ein Philosoph Maße: 2 Schuh 2 Zoll hoch, 1 Schuh 5 Zoll breit Anm.: Die Lose 154a, 154b, 155 und 156 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (32.15 fl für die Nrn. 154a, 154b, 155 und 156) Käufer: Möglich
1786/05/02 NGAN 0363 Decker I Loth mit seinen zwey Töchtern. I Maße: 2 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 7 Zoll breit Anm.: Dieses Los wurde zusammen mit der Nr. 364 (Anonym) verkauft. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (40.1 fl für die Nm. 360-364) Käufer: Möglich
1786/05/02 NGAN 0155 Decker I Vier Philosophen. I Diese Nr.: Ein Philosoph Maße: 2 Schuh 2 Zoll hoch, 1 Schuh 5 Zoll breit Anm.: Die Lose 154a, 154b, 155 und 156 wurden zusammen katalo-
1786/05/02 NGAN 0411 Decker I Portrait, des Mahlers Peter Decker. I Maße: 2 Schuh 11 Zoll hoch, 2 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (12.1 fl) Käufer: Möglich GEMÄLDE
505
1786/05/02 NGAN 0414 Decker I Ein Portrait eines Frauenzimmers. I Maße: 2 Schuh 9 Zoll hoch, 2 Schuh 1 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (48 Kr) Käufer: ν Pez
Defrance, Leonard 1800/00/00 FRAN2 0018 Defrance I Ein Meisterstück von diesem Künstler, welcher in derselben Zeit Vorsteher der Mahler=Akademie zu Lüttich gewesen ist. Das Stück stellet einen großen Platz vor, auf welchem Klöster und Kirchen sind, im ersten Plan siehet man mehrere Nonnen, Mönche, welche nach dem Gesetze Josephs II. bey Aufhebung der Klöster aus ihrem geistlichen Stande, zu dem weltlichen verwandelt werden, den Nonnen werden Hauben von Putzmacherinnen gebracht, Kapuziner werden die Bärt abgeschoren, Karthäuser werden Perücken probiret, einige Militaire suchen die Nonnen zu trösten. Ganz vorne am Stück rechter Seite, liegt die abgebrochene Säule. Im mitten Stück steht Joseph der Große auf einem Postament in römischer Tracht mit der Lorbeerkrone, an demselben sind mehrere seiner unvergleichlichen Verordnungen angeheftet, welche von dem Volk gelesen worden. Das Stück ist vom Kupferstück bekannt, und theils wegen Schönheit des Pinsels, als Gruppierung und der Merkwürdigkeit von der Geschichte, schätzbar. I Mat.: auf Leinwand Maße: 24 Zoll hoch, 34 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1800/07/09 HBPAK 0062 France de Liege I L'Inteneur d'une forge. Un ouvrier sur une Chaise est endormi pres de son Enclume. Sa femme lui passe un Chalumeau de paille sous le ne. Les accessoires de cette scene sont peints facilement et d'une bonne Couleur. Sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: 12 pouces de hauteur. 15 pouces de largeur Transakt.: Unbekannt
Degener 1774/10/05 HBNEU 0041 Degner I Zwey Stücke, mit Vögeln. I Diese Nr.: Ein Stück, mit Vögeln Anm.: Die Lose 41 und 42 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1774/10/05 HBNEU 0042 Degner I Zwey Stücke, mit Vögeln. I Diese Nr.: Ein Stück, mit Vögeln Anm.: Die Lose 41 und 42 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Degler 1768/07/00 MUAN 1190 Degler I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1191 Degler I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1192 Degler I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1193 Degler I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0369 Degler I Les quatre. Evangelistes, demies figures. Peints sur toile, marques des Nos. 1190. jusqu'au No. 1193. I Diese Nr.: Un Evangeliste, demi figure Mat.: auf Leinwand 506
GEMÄLDE
Maße: 2. p. 9. p. de haut sur 2. p. 1. p. de large Anm.: Die Lose 369 bis 372 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Frangois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0370 Degler I Les quatre. Evangelistes, demies figures. Peints sur toile, marquis des Nos. 1190. jusqu'au No. 1193. I Diese Nr.: Un Evangeliste, demi figure Mat.: auf Leinwand Maße: 2. p. 9. p. de haut sur 2. p. 1. p. de large Anm.: Die Lose 369 bis 372 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francis Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0371 Degler I Les quatre. Evangelistes, demies figures. Peints sur toile, marques des Nos. 1190. jusqu'au No. 1193. I Diese Nr.: Un Evangeliste, demi figure Mat.: auf Leinwand Maße: 2. p. 9. p. de haut sur 2. p. 1. p. de large Anm.: Die Lose 369 bis 372 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0372 Degler I Les quatre. Evangelistes, demies figures. Peints sur toile, marques des Nos. 1190. jusqu'au No. 1193. I Diese Nr.: Un Evangeliste, demi figure Mat.: auf Leinwand Maße: 2. p. 9. p. de haut sur 2. p. 1. p. de large Anm.: Die Lose 369 bis 372 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francis Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt
Dehaer, Peter [Nicht identifiziert] 1784/08/02 FRNGL 0699 Peter Dehcer I Ein Räuberstück von schöner Composition und guter Ausführung. I Maße: 11 Vi Zoll breit, 14 Zoll hoch Transakt.: Verkauft (9.30 fl) Käufer: Reinhard
Delen, Dirck van 1763/11/09 FRJUN 0054 van Deelen I Notre Seigneur guerissant les Malades, Tableau d'un grand nombre de figures parfaitement peint. I Maße: hauteur 28 pouces, largeur 36 pouces Transakt.: Verkauft (91.15 fl) Käufer: Saarbrücken 1764/00/00 BLAN 0211 D: v: Dalen I Daß innere von einer großen Kirche, mit vielen Figuren, Extra schön auf Holtz gemahlen. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 2 Zoll hoch, 1 Fuß 7 Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (230 Rt Schätzung) Gegenw. Standort: Sankt-Peterburg, Rossiya. Ermitazh. (N 1895) als Hendrick van Steenwyck (II) 1772/00/00 BSFRE 0030 Daelen (Theodor van) I L'Inteneur d'une Eglise, avec plusieurs figures. Cadre noir. I Mat.: auf Holz Maße: haut de 10 large de 13 pouces Transakt.: Unbekannt 1778/05/23 HBKOS 0055 v. Deelen I Zwei kleine Kirchen, auf Holz. I Diese Nr.: Eine kleine Kirche Mat.: auf Holz Maße: Höhe 8 Vi Zoll, Breite 5 Vi Zoll Anm.: Die Lose 55 und 56 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/05/23 HBKOS 0056 v. Deelen I Zwei kleine Kirchen, auf Holz. I Diese Nr.: Eine kleine Kirche Mat.: auf Holz Maße: Höhe 8 Vi Zoll, Breite 5 Vi Zoll Anm.: Die Lose 55 und 56 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0312 van Deelen I Zwey perspectivische Kirchen=Stücke, plaisant mit Sonnenschein beleuchtet, auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein perspectivisches Kirchen=Stück, plaisant mit Sonnenschein beleuchtet Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 12 Zoll 9 Linien, Breite 14 Zoll 9 Linien Anm.: Die Lose 312 und 313 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0313 van Deelen I Zwey perspectivische Kirchen=Stücke, plaisant mit Sonnenschein beleuchtet, auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein perspectivisches Kirchen=Stück, plaisant mit Sonnenschein beleuchtet Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 12 Zoll 9 Linien, Breite 14 Zoll 9 Linien Anm.: Die Lose 312 und 313 wurden
zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0331 J. v. Deelen I Zwey schöne Kirchen= Stücke, mit vielen Figuren, plaisant gemahlt, auf Leinw. I Diese Nr.: Ein schönes Kirchen=Stück, mit vielen Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 15 Zoll, Breite 13 Zoll Anm.: Die Lose 331 und 332 wurden zusammen katalogisiert. Der Name des Künstlers ist angegeben als "J. v. Deelen", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0332 J. v. Deelen I Zwey schöne Kirchen= Stücke, mit vielen Figuren, plaisant gemahlt, auf Leinw. I Diese Nr.: Ein schönes Kirchen=Stück, mit vielen Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 15 Zoll, Breite 13 Zoll Anm.: Die Lose 331 und 332 wurden zusammen katalogisiert. Der Name des Künstlers ist angegeben als "J. v. Deelen", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1790/02/04 HBDKR 0122 J.v. Deelen I Eine perspectivische Kirche, mit einigen Figuren, sehr fleißig gemahlt, und besonders regelmäßig gezeichnet, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 20 Zoll, breit 17 Zoll Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "J.v. Deelen", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Verkauft (8 M) Käufer: Schmidt 1793/09/18 HBSCN 0059 van Delem I Der Heiland sitzt mit der Maria im perspektivischen Tempel am Tische welche ein Buch vor sich liegen hat, wird aber von der Martha abgerussen [sie], die er Verweise zu geben scheinet, zwischen zweyen Eingängen ist ein Gemählde mit der Erscheinung der Hirten am Ende des langen Sahls zu sehen. Ein sehr kostbares Stück. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 10 Vi Zoll, breit 13 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1794/02/21 HBHEG 0028 Theodor van Deelen I Eine Niederländische Kirche welche meist weiß gegipst; die Bögen und Creutzgänge ruhen auf Säulen, woran sehr schöne Epidemien hängen. Die Kanzel, Orgel=Holz und Stühle sind von gelbbräunlicher Farbe, wie auch einige Theile der Decke von Gothischen Tafelwerk. Das Chor ist durch gewundene messingene Stangen und Holzwerk, ganz zierlich separirt. Die Sonne welche recht mitten durch die Fenster ihre Strahlen wirft, machet einen herrlichen Effect. Verschiedene Herren und Damen wie auch Kinder, gehen in derselben auf und ab, und Arme bekommen Allmosen von ihnen. Dieses schöne Gemähide ist von vortreflichen und richtigen Perspectiv und edler Zeichnung. Van Deelen war ein Discipel von F. Hals, er wurde zu Heusden Ao. 1619 gebohren. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 20 Zoll, breit 24 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/06/13 HBPAK 0002 J. van Deelen I Eine brabandische Kirche mit verschiedenen Figuren. Sehr stärkt gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Zoll, breit 9 Zoll Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "J. van Deelen", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt
Delen, Dirck van (und Vrancx) 1788/06/12 HBRMS 0032 Von Deelen; S. Franck I Die perspectivischen Gebäude von von Deelen, die Figuren von S. Franck. Der König David mit seinem Hofe umgeben, sitzt auf dem Thron in einem von Säulen getragenen offenen Saal, und empfängt die Geschenke der vor ihm knienden Abigail mit ihrem Gefolge. Der Prospect des etwas entfernten Schlosses und Gartens, verbunden mit der prachtvollen Anordnung des Ganzen, macht einen herrlichen Effect, so wie überhaupt dieß Stück an Colorit, Composition, Licht und Schatten wenige seines Gleichen haben wird. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 42 Zoll, breit 66 Zoll Transakt.: Unbekannt (150 Μ Schätzung)
1793/00/00 HBMFD 0057 Dirck von Deelen: Sebastian Franck I Die Figuren: Wie Christus im Tempel lehret, von Sebastian Franck. Jede Beschreibung von diesem kostbaren Gemälde wird unvollkommen seyn! Die innere Majestät lässt sich nur empfinden. - Kein Neeffs hat - und zwar nur im kleinen - einen solchen Tempel jemals hervorgebracht, in Rücksicht der Bauart, Wahl des Standtpunckts, Beleuchtung und Haltung. Franck scheint auch nur für diesem Bilde die Figuren gedacht und ausgeführt zu haben. Die Handlung geht im Vordergrunde vor. Die Composition der sämmtlichen Figuren macht eine der schönsten Gruppen die man sehen kann. Die Zeichnung richtig und die Färbung glänzend und schön. Man weis nicht, welches Vortrefliche man zuerst bey diesem Gemälde anschauen will; und doch hat das Auge die erwünschteste Ruhe. Die Figuren sind in der Grösse von 8 Zoll. I Mat.: auf Holz Maße: 3 Fuss 4 Zoll hoch, 4 Fuss 7 Zoll breit Verkäufer: Pierre Laporterie Transakt.: Unbekannt
Delen, Dirck van (und Wouwerman, Ph.) 1793/00/00 HBMFD 0061 Dirck von Deelen; Philip Wouwermann I Die Figuren von Philip Wouwermann. Aussicht in Venedig bey Nacht. Zur Rechten ein grosses Gebäude, welches sanft durch den im Hintergrunde aufgehenden Mond beleuchtet wird. Viele Personen beyderley Geschlechts befinden sich unter der Halle des Gebäudes. Ein Herr in schwartz sammetnen Mantel und Ordensband führt seine Dame zu der geöfneten Kutsche; zwey Knaben mit Fakkeln gehen voran. Ein Bedienter führt ein Pferd vor. Die Beleuchtung der Fackeln, mit den blassen Schein des Mondes, macht den vortreflichsten Contrast. Es scheint als wenn sich beyde Künstler auf eine eigentliche Art vereinigt haben, um eine solche seltne Vorstellung von Beleuchtung hervor zu bringen. Die Figuren sind in der Grösse von 6 Zoll. I Mat.: auf Holz Maße: 3 Fuss hoch, 3 Fuss 9 Zoll breit Verkäufer: Pierre Laporterie Transakt.: Unbekannt
Delen, Dirck van (Manier) 1772/09/15 BNSCT 0077 Dierich van Deelen I Perspectivische Vorstellung einer Kirche, sehr wohl in der Manier von Dierich van Deelen, auf Holz, 1 F. 5 Z. hoch. 1 F. 10 Z. br. schw. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 5 Zoll hoch, 1 Fuß 10 Zoll breit Transakt.: Unbekannt (4 Vi fl)
Delerive, Nicolas Louis Albert 1796/00/00 BSAN 0065 N. Delerive I Combat de cavalerie. Des hommes et des chevaux morts et mourans. Beaucoup de mouvement. Des soldats ä pied, foncent sur un gros de cavalerie en desordre. Sur le devant, un grouppe de cavaliers qui font le coup de pistolet, dont les chevaux sont au naturel. Dans l'eloignement l'escarmouche se continue, jusqu'au pied d'un vieux chateau. Sur le tableau, est peint: N. Delerive, 1795. I Pendant zu Nr. 66 Mat.: auf Holz Maße: Haut de 1 pied 8 pouces; large de 2 pieds 4 pouces Inschr.: N. Delerive, 1795 (bezeichnet und datiert) Verkäufer: Merian l'aine Transakt.: Unbekannt (12) 1796/00/00 BSAN 0066 N. Delerive I Attaque de deux coches, par des Houssards. Les Dragons qui escortent les coches, les defendent. Un voyageur assis sur le siege, leve son sabre. Trois femmes temoignent leur frayeur. Le cocher du premier equipage prend la fuite, avec les demonstrations de la plus grande epouvante. Ce tableau fait pendant au precedent. II est ecrit dessus: Delerive. I Pendant zu Nr. 65 Mat.: auf Holz Maße: Haut de 1 pied 7 pouces; large de 2 pieds 4 pouces Inschr.: Delerive (bezeichnet) Verkäufer: Merian l'aine Transakt.: Unbekannt (12) GEMÄLDE
507
Delff, Cornells Jacobsz.
Delmont, Deodat
1781/09/10 BNAN 0008 K. Delfl Weiber in einer Kellerküche, so Flachs hecheln; zur Rechten steigt einer die Treppe herunter; von K. Delf. 1650. I Mat.: auf Holz Maße: 15 Zoll hoch, 21 Zoll breit Inschr.: 1650 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt
1799/00/00 WZAN 0529 Deodatus Delmont I Die büßende Magdalena, von Deodatus Delmont. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 5 Schuh 1 Zoll breit 4 Schuh 2 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1786/05/12 HBTEX 0036 Delfft I Zwey Stillleben, mit Früchten, Confect, nebst Hummer und Schüsseln, worauf solche liegen, auf Holz. I Diese Nr.: Ein Stillleben, mit Früchten, Confect, nebst Hummer und Schüsseln, worauf solche liegen Mat.: auf Holz Maße: Hoch 6 Zoll, breit 9 Zoll Anm.: Die Lose 36 und 37 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (2.4 Μ für die Nrn. 36 und 37) Käufer: Schön
Demeerten[?] [Nicht identifiziert]
1786/05/12 HBTEX 0037 Delfft I Zwey Stillleben, mit Früchten, Confect, nebst Hummer und Schüsseln, worauf solche liegen, auf Holz. I Diese Nr.: Ein Stillleben, mit Früchten, Confect, nebst Hummer und Schüsseln, worauf solche liegen Mat.: auf Holz Maße: Hoch 6 Zoll, breit 9 Zoll Anm.: Die Lose 36 und 37 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (2.4 Μ für die Nrn. 36 und 37) Käufer: Schön 1787/00/00 HB AN 0579 K. Delf. 1650. Im Geschmack des Jann Steens I Im Innern eines Bauemhauses sitzen verschiedene Weiber an einem Tische, und reinigen und wiegen Flachs. Zur rechten geht ein Bauer, mit einer Kanne in der Hand, nach der Thüre, wo eine alte Frau im Begriff ist, hereinzutreten. Mit vielen Nebensachen. Sehr schön und natürlich gemahlt; so schön wie Jann Steen. A.H. [Auf Holz] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Vi Zoll, breit 22 Vi Zoll Inschr.: 1650 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Verkauft (40.8 M) Käufer: Schoen [mit] L 1789/04/16 HBTEX 0026 van Delfft I Eine Vanitait vorstellend, vortreflich gemahlt auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 17 Zoll, breit 22 Zoll Transakt.: Verkauft (2 M) Käufer: Engel
Delff, Jacob Willemsz. (I) 1764/05/18 BLAN 0020 Jakob Delff \ Isaacs Seegen über Jacob. Gantze Figuren, auf Leinewand gemahlt, halb Lebensgröße, 3 Fuß 5 Zoll hoch und 4 Fuß 5 Zoll breit. Die Haltung ist so ziemlich in diesem Bilde; übrigens ist es eine gesuchte und gezwungene Art zu mahlen. Die Gemüthsbewegungen in den Gesichtern sind gut ausgedruckt. [Text hier gekürzt]. I Mat.: auf Leinwand Maße: 3 Fuß 5 Zoll hoch und 4 Fuß 5 Zoll breit Verkäufer: Johann Georg Eimbke Transakt.: Verkauft (7 Rt) Käufer: Hofk Schönemark
1752/05/08 LZAN 0176a Demeerten[?] I Zwey See=Stücken von Demeerten[?], im Holl. Rahmen. I Diese Nr.: Ein See=Stück Maße: 2 Ellen hoch, 3 Ellen breit Anm.: Die Lose 176a und 176b wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (3.8 Th für die Nrn. 176a und 176b) Käufer: Wagner [?] 1752/05/08 LZAN 0176b Demeerten[?] I Zwey See=Stücken von Demeerten[?], im Holl. Rahmen. I Diese Nr.: Ein See=Stück Maße: 2 Ellen hoch, 3 Ellen breit Anm.: Die Lose 176a und 176b wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (3.8 Th für die Nrn. 176a und 176b) Käufer: Wagner [?]
Denef [Nicht identifiziert] 1797/08/10 MM AN 0230 Denef I Zwei Tafelstücke, auf Tuch. I Diese Nr.: Ein Tafelstück Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 230 und 231 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (56 fl für die Nm. 230 und 231, Schätzung) 1797/08/10 MM AN 0231 Denef I Zwei Tafelstücke, auf Tuch. I Diese Nr.: Ein Tafelstück Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 230 und 231 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (56 fl für die Nrn. 230 und 231, Schätzung)
Denner 1743/00/00 BWGRA 0205 Denner Junior I Ein Stück mit einer Rosen und einem Meerschweine von Denner Junior in seinem lOten Jahre gemahlt. I Maße: hoch 11 Zoll, breit 1 Fuß 2 Zoll Transakt.: Unbekannt 1787/00/00 HB AN 0594 Vom jungen Denner I Das Bildniß einer alten Frau in purpurner Kleidung und Mütze. Sehr ausführlich gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 7 Zoll, breit 5 3 /4 Zoll Transakt.: Verkauft (3.12 M) Käufer: Ekhard [mit] L[?]
Denner, Balthasar Delff, Jann [Nicht identifiziert] 1787/00/00 HB AN 0436 Jann Delff \ Auf einem Tische befinden sich Eßwaaren und unterschiedliche andere Früchte, Geschirre, u.s.w. alles von besonderer Natur und edelen Wählung. A.H. [Auf Holz] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Vi Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Verkauft (15.4 M) Käufer: Bertheau 1787/00/00 HB AN 0496 Jann Delff I An einem Tische steht ein junger Mensch, der sich mit verschiedenen darauf befindlichen Sachen beschäfftigt. Besonders natürlich gemahlt. A.K. [Auf Kupfer] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 7 % Zoll, breit 11 % Zoll Transakt.: Verkauft (3.4 M) Käufer: Bertheau
1743/00/00 BWGRA 0099 Balthasar Denner I Der heilige Hieronymus von Balthasar Denner sehr delicat und fein mit grossem Fleisse gemahlet. I Maße: hoch 1 Fuß 6 Zoll, breit 1 Fuß 3 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0100 Denner I Ein Knabe der einen Römer mit Wein anstehet, welcher in sein Gesichte reflectiret von Denner sehr gut gemacht. I Maße: hoch 1 Fuß 11 Zoll, breit 1 Fuß 7 Zoll Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0101 Denner I Ein Frauens=Kopf von Denner, ungemein ausgeführet, und von seiner besten Manier. I Maße: hoch 1 Fuß 6 Zoll, breit 1 Fuß 3 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt
Deiker [Nicht identifiziert]
1743/00/00 BWGRA 0102 Denner I Ein alter Manns=Kopf auch von Denner. I Pendant zu Nr. 103 Maße: hoch 2 Fuß 7 Vi Zoll, breit 2 Fuß 2 Zoll Transakt.: Unbekannt
1765/03/27 FRKAL 0045 Deiker I Le Portrait d'un vieillard, peint dans le gout de Rembrand. I Maße: hauteur 24 pouces, largeur 19 pouces Transakt.: Verkauft (3 fl) Käufer: Hoch
1743/00/00 BWGRA 0103 Denner I Der Compagnon zum vorigen, ein Frauens=Kopf vom vorigen maitre sehr curieux gemahlet, indem die Farben alle mit Hecken an einander geleget und nicht ver-
508
GEMÄLDE
trieben sind, und dabey doch einen guten effect thun. I Pendant zu Nr. 102 Maße: hoch 1 Fuß 6 Zoll, breit 1 Fuß 3 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt
1743/00/00 BWGRA 0122 Denner I Ein Frauens=Kopf en profil. I Maße: hoch 6 Zoll, breit 5 Zoll Transakt.: Unbekannt
1743/00/00 BWGRA 0104 Denner I Ein Manns=Kopf mit einer rauchen Mütze von Denner. I Maße: hoch 2 Fuß 1 Zoll, breit 1 Fuß 6 Zoll Transakt.: Unbekannt
1743/00/00 BWGRA 0123 Denner I Ein Frauenzimmer den Herbst vorstellend, hoch 2 Fuß 7 Vi Zoll, breit 2 Fuß 2 Zoll, gleichfals alle 3 von Denner. I Maße: hoch 2 Fuß 7 Vi Zoll, breit 2 Fuß 2 Zoll Transakt.: Unbekannt
1743/00/00 BWGRA 0105 Denner I Ein alter Manns=Kopf mit einem greisen Bart, vom vorigen maitre [Denner]. I Maße: hoch 1 Fuß 2 Vi Zoll, breit 1 Fuß Transakt.: Unbekannt
1747/04/06 HB AN 0025 Denner I Ein alter Manns=Kopf mit vollen Farben gemahlt. I Maße: 2 Fuß 4 Zoll Breite und 2 Fuß 10 Zoll Höhe Verkäufer: Brockes Transakt.: Unbekannt (53)
1743/00/00 BWGRA 0106 Denner I Zwey alte Frauens=Köpfe auch vom vorigen Künstler [Denner]. I Diese Nr.: Ein alter Frauens= Kopf Maße: hoch 1 Fuß 2 Vi Zoll, breit 1 Fuß Anm.: Die Lose 106 und 107 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1747/04/06 HB AN 0062 Denner I Ein Blumen=Stücke von Denner. I Maße: 1 Fuß 3 Zoll Breite und 1 Fuß 7 Zoll Höhe Verkäufer: Brockes Transakt.: Unbekannt (24)
1743/00/00 BWGRA 0107 Denner I Zwey alte Frauens=Köpfe auch vom vorigen Künstler [Denner]. I Diese Nr.: Ein alter Frauens= Kopf Maße: hoch 1 Fuß 2 Vi Zoll, breit 1 Fuß Anm.: Die Lose 106 und 107 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0108 Balthasar Denner I Ein Glas mit Sect, daneben weis Brot auf welches die reflexion von Wein fällt, sehr natürlich gemahlt von Balthasar Denner. I Pendant zu Nr. 109 Maße: hoch 10 Vi Zoll, breit 9 Zoll Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0109 Denner I Der Compagnon ein Wein=Glas mit rothem Wein nebst gebratenen Castanien, auch von Denner. I Pendant zu Nr. 108 Maße: hoch 10 Vi Zoll, breit 9 Zoll Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0110 Denner I Ein Frucht=Stück, worauf Trauben, von Denner. I Maße: hoch 1 Fuß, breit 9 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0111 Denner I Ein Stück mit Pfirschen von Denner. I Maße: hoch 1 Fuß, breit 9 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0112 Denner I Einer Dame Portrait gleichfals von Denner. I Maße: hoch 1 Fuß 6 Vi Zoll, breit 1 Fuß 3 Zoll Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0113 Denner I Portrait einer Dame von Denner. I Maße: hoch 1 Fuß 7 Zoll, breit 1 Fuß 4 Zoll Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0114 Denner I Eine Flora von Denner. I Maße: hoch 1 Fuß 8 Zoll, breit 1 Fuß 5 Zoll Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0115 Denner I Eine schlafende Venus gleichfals von Denner. I Maße: hoch 1 Fuß, breit 1 Fuß 3 Zoll Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0116 Denner I Denners eigen Portrait, von ihm selber gemahlet. I Maße: hoch 2 Fuß 7 Vi Zoll, breit 2 Fuß 2 Zoll Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0117 Denner I Seiner Frauen Portrait von Denner. I Maße: hoch 2 Fuß 7 Vi Zoll, breit 2 Fuß 2 Zoll Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0118 Denner I Sein Vater, gleichfals vom vorigen maitre [Denner], I Maße: hoch 2 Fuß 7 Vi Zoll, breit 2 Fuß 2 Zoll Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0119 Denner I Sein Sohn mit einem Lichte in der Hand, von Denner. I Maße: hoch 2 Fuß 7 Vi Zoll, breit 2 Fuß 2 Zoll Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0120 Denner I Seine älteste Tochter, von Denner. I Maße: hoch 2 Fuß 7 Vi Zoll, breit 2 Fuß 2 Zoll Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0121 Denner I Seine [Denners] jüngste Tochter. I Maße: hoch 1 Fuß 5 Vi Zoll, breit 1 Fuß 2 Zoll Transakt.: Unbekannt
1749/07/31 HBRAD 0001 B. Denner I Eine andächtige Frauens=Person. I Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (60) 1749/07/31 HBRAD 0031 Denner I Ein wohlausgeführtes Portrait. I Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (10) 1749/07/31 HBRAD 0032 Denner I Eine Coffee=Schenkerinn. I Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (20) 1749/07/31 HBRAD 0033 Denner I Todtes Feder=Vieh. I Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (11) 1749/07/31 HBRAD 0034 Denner I Stillliegende Sachen. I Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (11) 1749/07/31 HBRAD 0059 Denner I Ein alter Manns= u. Frauens=Kopf. I Diese Nr.: Ein alter Manns=Kopf Anm.: Die Lose 59 und 60 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (60 für die Nrn. 59 und 60) 1749/07/31 HBRAD 0060 Denner I Ein alter Manns= u. Frauens=Kopf. I Diese Nr.: Ein alter Frauens=Kopf Anm.: Die Lose 59 und 60 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (60 für die Nrn. 59 und 60) 1749/07/31 HBRAD 0066 Denner I Ein alter Manns= u. Frauens=Kopf. I Diese Nr.: Ein alter Manns=Kopf Anm.: Die Lose 66 und 67 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (34 für die Nm. 66 und 67) 1749/07/31 HBRAD 0067 Denner I Ein alter Manns= u. Frauens=Kopf. I Diese Nr.: Ein alter Frauens=Kopf Anm.: Die Lose 66 und 67 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (34 für die Nrn. 66 und 67) 1749/07/31 HBRAD 0068 Denner I Ein Portrait einer Dame. I Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (4) 1749/07/31 HBRAD 0069 Denner I Ein junger Knabe. I Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (20) 1749/07/31 HBRAD 0074 Denner I Ein kleiner Knabe. I Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (7) 1749/07/31 HBRAD 0075 Denner I Ein alter Mann und I Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (8.8) 1749/07/31 HBRAD 0076 Denner I Ein junges Mädgen. I Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (8) 1749/07/31 HBRAD 0080 Denner I Ein Knabe mit einem Apfel. I Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (15.8) 1749/07/31 HBRAD 0081 Denner I Ein lesendes Mädgen. I Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (23.4) 1749/07/31 HBRAD 0082 von Denner I Ein Knabe mit einem Glase. I Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (13.8) 1749/07/31 HBRAD 0089 Denner I Ein junger Kopf. I Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (22) 1749/07/31 HBRAD 0115 Denner I Ein Portrait eines bekannten großen Hrn. I Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (20) GEMÄLDE
509
1750/04/00 HB AN 0015 Balth. Denner I Ein Portrait von einer Dame, von Balth. Denner. I Transakt.: Unbekannt 1764/00/00 BLAN 0122 B. Denner I 1. alter Mann mit einen Toden Kopf, halbe Figur, Extra schön auf leinwand gemahlt. I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 9 Zoll hoch, 2 Fuß 1 Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (1000 Rt Schätzung) Gegenw. Standort: Sankt-Peterburg, Rossiya. Ermitazh. (1324) 1764/05/18 BLAN 0040 Balthasar Denner I Drey Mannsportraits ins Kleine nach dem Leben. Auf Leinewand gemahlt. [Text hier gekürzt]. I Diese Nr.: Ein Mannsportrait ins Kleine nach dem Leben Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 2 Zoll hoch und 1 Fuß breit Anm. : Die Lose 40 bis 42 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Georg Eimbke Transakt.: Verkauft (7.12 Rt für die Nrn. 4042) Käufer: Wilman 1764/05/18 BLAN 0041 Balthasar Denner I Drey Mannsportraits ins Kleine nach dem Leben. Auf Leinewand gemahlt. [Text hier gekürzt]. I Diese Nr.: Ein Mannsportrait ins Kleine nach dem Leben Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 2 Zoll hoch und 1 Fuß breit Anm.: Die Lose 40 bis 42 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Georg Eimbke Transakt.: Verkauft (7.12 Rt für die Nrn. 4042) Käufer: Wilman 1764/05/18 BLAN 0042 Balthasar Denner I Drey Mannsportraits ins Kleine nach dem Leben. Auf Leinewand gemahlt. [Text hier gekürzt]. I Diese Nr.: Ein Mannsportrait ins Kleine nach dem Leben Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 2 Zoll hoch und 1 Fuß breit Anm.: Die Lose 40 bis 42 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Georg Eimbke Transakt.: Verkauft (7.12 Rt für die Nrn. 4042) Käufer: Wilman 1764/05/24 BOAN 0207 Denner I Deux Portraits l'un d'un Vieillard, l'autre d'une vieille ä demi figure de grandeur naturelle de deux pieds deux pouces de hauteur d'un pied huit pouces de largeur, peints dans le premier gout de Denner. [Zwey portrait Von alten man und fraw, halber figur in Lebensgröße in die erste manier Von Denner.] I Diese Nr.: Portrait d'un Vieillard Maße: 2 pieds 2 pouces de hauteur 1 pied 8 pouces de largeur Anm.: Die Lose 207 und 208 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (70 Rt für die Nm. 207 und 208) Käufer: Spenner [für] a Auarius 1764/05/24 BOAN 0208 Denner I Deux Portraits l'un d'un Vieillard, l'autre d'une vieille ä demi figure de grandeur naturelle de deux pieds deux pouces de hauteur d'un pied huit pouces de largeur, peints dans le premier gout de Denner. [Zwey portrait Von alten man und fraw, halber figur in Lebensgröße in die erste manier Von Denner.] I Diese Nr.: Portrait d'une vieille Maße: 2 pieds 2 pouces de hauteur 1 pied 8 pouces de largeur Anm.: Die Lose 207 und 208 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (70 Rt für die Nrn. 207 und 208) Käufer: Spenner [für] a Auarius 1764/06/07 BOAN 0638 Denner d'Hambourg I Un Tableau d'un pied sept pouces de hauteur, d'un pied trois pouces de largeur, representant une Vieille en Pelisse, peint par Denner d'Hambourg. [Ein stück Vorstellend Einen Kopf Von Einer alten frawen in Lebensgröße mit Kleidung Von peltz, gemahlt Von Denner in Hamburg.] I Maße: 1 pied 7 pouces de hauteur, 1 pied 3 pouces de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (95 Rt) Käufer: Broggia 1764/06/07 BOAN 0639 Denner I Un Tableau d'un pied sept pouces de hauteur, d'un pied trois pouces de largeur, representant la tete d'une jeune Dame avec un bouquet, peinte en grandeur naturelle par Denner. [Ein stück Vorstellend Einen Kopf Von einer jungen Dame in Lebensgröße mit blumenstrauß aufm Kopf, gemahlt Von Denner.] I Maße: 1 pied 7 pouces de hauteur, 1 pied 3 pouces de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (50.10 Rt) Käufer: Broggia 510
GEMÄLDE
1765/00/00 FRRAU 0099 Denner v. Hamburg I Ein Portrait eines Raths=Herrn von Hamburg in seiner Amts=Kleidung mit einer Hand; Alles, was ich von diesem Portrait sagen kan, so hat Denner hier seinen Fleiß und Kunst fast zu reden gebracht. Auf Tuch gemahlt. C'est le Portrait d'un Senateur de Hambourg en habit de ceremonie avec une main; Tout ce que je puis dire de ce Portrait, c'est que Denner a presque porte sa diligence & son art ä parier. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 2 Schuh 10 Zoll, breit 2 Schuh 3 Zoll Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRRAU 0114 Denner von Hamburg I Ein alter Frauen=Kopf in einem Mordere-Gewand mit Katzen Peltzen aufgeschlagen. An diesem alten Kopf muß der Meister viel Plaisir zu mahlen gefunden haben, weilen er ihn verschiedene mahlen repetirt. Was man Natur, Fleiß und Feinheit vom Pinzel nennen kan, findet sich nebst einem schönen Colorit in diesem Bild. Auf Tuch gemahlt. Une tete de vieille femme en habit mordere, qui est borde de pelisse. II faut que le Maitre a'ie pris beaucoup de plaisir ä peindre cette vieille tete, ä cause qu'il Γa peint ä differentes reprises. Tout ce qu'on peu nommer nature, attention & finesse de l'art, tout se trouve dans ce tableau avec un beau coloris. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 1 Schuh 7 Zoll, breit 1 Schuh 3 Zoll Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRRAU 0124 Denner von Hamburg I Einen alten Greiß vorstellend, in des Denners ersten Gusto, wie er angefangen hat fein zu mahlen. Representant un vieillard, dans le premier goüt de Denner, lors qu'il a commence ä bien peindre. I Mat.: auf Blei Maße: Hoch 2 Schuh 2 Zoll, breit 1 Schuh 8 Zoll Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRRAU 0125 Denner von Hamburg I Eine alte Frau gleicher Arbeit. C'est est une vieille femme de meme travail. I Mat.: auf Blei Maße: Hoch 2 Schuh 2 Zoll, breit 1 Schuh 8 Zoll Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRRAU 0126 Denner von Hamburg I Eine junge Dame mit einem Bouquet in den Haaren; Dieses Bild ist so reitzend, als es von Fleisch und Colorit fein gemahlt und gut gezeichnet ist. Auf Tuch gemahlt. C'est une jeune Dame qui a un bouquet sur la tete; Ce portrait est aussi ravissant, qu'il est parfaitement peint de chair & de coloris & tres-bien dessine. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 1 Schuh 7 Zoll, breit 1 Schuh 3 Zoll Transakt.: Unbekannt 1769/03/30 HBTOU 0032 Baltas. Denner I Ein alter Weiber Kopf von Baltas. Denner, wohl conserviret und Meisterhaft gemahlen auf Leinwand. [Die Mehresten in fein verguldte Rahmen, und die übrigen in schwarz gebeizten mit goldenen Staber.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 8 Zoll, Breite 1 Fuß 3 Zoll Anm.: Die Angaben in eckigen Klammem im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 51 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 51. Transakt.: Verkauft (40.4 M) Käufer: Hofrath 1774/03/28 HBBMN 0031 Denner I Das Portrait von Denner, seiner Frauen, und Sohn, im verguldeten Rahmen, von Ihm selbst mit ungemeinem Fleiß gemahlt. I Diese Nr.: Das Portrait von Denner Maße: Höhe 1 Fuß 10 Zoll, Breite 1 Fuß 4 Vi Zoll Anm.: Die Lose 31 bis 33 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1774/03/28 HBBMN 0032 Denner I Das Portrait von Denner, seiner Frauen, und Sohn, im verguldeten Rahmen, von Ihm selbst mit ungemeinem Fleiß gemahlt. I Diese Nr.: Das Portrait von Denners Frauen Maße: Höhe 1 Fuß 10 Zoll, Breite 1 Fuß 4 Vi Zoll Anm.: Die Lose 31 bis 33 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1774/03/28 HBBMN 0033 Denner I Das Portrait von Denner, seiner Frauen, und Sohn, im verguldeten Rahmen, von Ihm selbst mit ungemeinem Fleiß gemahlt. I Diese Nr.: Das Portrait des Sohnes Maße: Höhe 1 Fuß 6 Zoll, Breite 1 Fuß 3 Zoll Anm.: Die Lose 31 bis 33 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1774/08/13 HBBMN 0038 ner. I Transakt.: Unbekannt
Denner I Das Portrait von M. Den-
org Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (113 fl für die Nrn. 102 und 103) Käufer: Hüsgen
1774/08/13 HBBMN Transakt.: Unbekannt
Denner I Ein angefangenes Portrait. I
1778/09/28 FRAN 0116 Denner I Eine ausnehmend fleißig und schön gemalte alte Frau mit braunem Schleyer, von dem berühmten Denner. [Une vieille femme avec un voile brun, superieurement finie par le celebre Denner.] I Maße: 1 Schuh 2 Zoll breit, 1 V2 Schuh hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (110 fl) Käufer: Jos Brentano
0060
1775/10/07 HBBMN 0002 Β. Denner I Ein alter Frauens= Kopf. I Transakt.: Unbekannt 1775/10/07 HBBMN 0003 kes. I Transakt.: Unbekannt
Β. Denner I Das Portrait von Broc-
1776/06/21 HB NEU 0030 Β. Denner I Zwey Dames=Köpfe in Profiel, auf Leinw. I Diese Nr.: Ein Dames=Kopf in Profiel Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 F 3 Z, Breite 1 F Anm.: Die Lose 30 und 31 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1776/06/21 HBNEU 0031 B. Denner I Zwey Dames=Köpfe in Profiel, auf Leinw. I Diese Nr.: Ein Dames=Kopf in Profiel Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 F 3 Z, Breite 1 F Anm.: Die Lose 30 und 31 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1777/04/11 HBNEU 0001 Denner I Zwey Portraits, ein alter Mann und Frau. I Diese Nr.: Ein Portrait eines alten Mannes Anm.: Die Lose 1 und 2 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1777/04/11 HBNEU 0002 Denner I Zwey Portraits, ein alter Mann und Frau. I Diese Nr.: Ein Portrait einer alten Frau Anm.: Die Lose 1 und 2 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/05/16 HBBMN 0021 Denner I Ein alter schöner Kopf. [Diese Stücke sind alle gut gefaßt, theils schwarze Rähmen mit goldenen Leisten, theils goldene Rähmen; auch ist die Höhe und Breite ohne Rähmen gemessen.] I Maße: 18 Zoll hoch, 15 Zoll breit Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 24 und beziehen sich wahrscheinlich auf die Nrn. 1 bis 24. Transakt.: Unbekannt 1778/05/21 HBKOS 0013 Denner I Ein Stück mit einem Glase mit Blumen. I Transakt.: Unbekannt 1778/05/21 HBKOS 0034 rait. I Transakt.: Unbekannt
Denner I Ein Frauenzimmer=Port-
1778/05/23 HBKOS 0068 B. Denner I Ein Pilosoph [sie] so durch die Hand guckt, eine Esquice, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 21 Zoll, Breite 15 Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/08/29 HBTEX 0035 Denner I Blumen in einem Glase. I Maße: Höhe 1 Fuß, Breite 10 Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/08/29 HBTEX 0048 Denner I Zwey ausführlich jugendliche Köpfe. I Diese Nr.: Ein ausführlich jugendlicher Kopf Maße: Höhe 1 Fuß 3 Zoll, Breite 1 Fuß Anm.: Die Lose 48 und 49 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/08/29 HBTEX 0049 Denner I Zwey ausführlich jugendliche Köpfe. I Diese Nr.: Ein ausführlich jugendlicher Kopf Maße: Höhe 1 Fuß 3 Zoll, Breite 1 Fuß Anm.: Die Lose 48 und 49 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/08/29 HBTEX 0087 Balth. Denner I Ein junger Manns= Kopf, sehr fleißig nach dem Leben gemahlt, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 10 Zoll, Breite 1 Fuß 5 Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/09/28 FRAN 0102 Denner I Ein unvergleichlich gemalter alter Mannskopf mit weissem Bart, von dem berühmten Denner. [Une tete de Vieillard avec une barbe blanche peinte avec une exactitude superieure par le celebre Denner.] I Maße: 1 Schuh 2 Zoll breit, 1 Vi Schuh hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (113 fl für die Nrn. 102 und 103) Käufer: Hüsgen 1778/09/28 FRAN 0103 Denner I Ein dergleichen sehr guter Mannskopf mit weissem Bart, von dito [Denner], [Une tete de Vieillard pareille tres belle avec une barbe blanche, par le meme [Denner].] I Maße: 1 Schuh 2 Zoll breit, 1 Vi Schuh hoch Verkäufer: Ge-
1778/09/28 FRAN 0545 Denner I Ein unvergleichlich fleißig und besonders schön gemalter alter Mannskopf mit einem Stoppelbart, von dem berühmten Denner. [Une tete de vieillard superieurement peinte par le celebre Denner.] I Pendant zu Nr. 546 Maße: 1 Schuh 2 Zoll breit, 1 Vi Schuh hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (717 fl für die Nrn. 545 und 546) Käufer: Prß ν Dessau 1778/09/28 FRAN 0546 Denner I Der Compagnon hierzu, ein alter Weibskopf, eben so schön, von dito [Denner], nemliches Maaß. [Le pendant du precedent, une tete de vieille femme, d'une beaute egale, par le meme maitre [Denner], meme hauteur & meme largeur.] I Pendant zu Nr. 545 Maße: 1 Schuh 2 Zoll breit, 1 Vi Schuh hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (717 fl für die Nrn. 545 und 546) Käufer: Prß ν Dessau 1778/09/28 FRAN 0611 Denner I Das Portrait des berühmten Denner, von ihm selbst, sehr schön mit einem Strohhut. [Le portrait du celebre Denner, tres bien peint, ayant un chapeau de paille sur la tete, par lui-meme. ] I Maße: 1 Vi Schuh breit, 1 Schuh 10 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (17 fl) Käufer: Cotrel 1778/10/30 HBKOS 0011 Denner I Ein Nordischer Bauer mit einem Hut auf dem Kopf und in der rechten Hand einen Stock haltend, nach dem Leben gemahlt, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 35 Zoll, breit 27 Zoll Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0189 B. Denner I Ein männliches Portrait im blauen Unterkleide und sammetnen Mantel, der über die vorgekehrte rechte Schulter herabfallt. Auf Kupfer. [Une colline sablonneuse, couverte de saules desseches, ä cöte d'un chemin fraye; sur le fond quelques maisons.] I Mat.: auf Kupfer Maße: 7 Vi Zoll hoch, 5 Vi Zoll breit Anm.: Dieses Los ist in der französischen Fassung des Katalogs nicht verzeichnet. Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0279 B. Denner \ Das Bildniß Carpsers. [Portrait de Carpser.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 8 Zoll hoch, 1 Fuß 4 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0280 B. Denner I Van der Schmissens Bildniß. [Portrait de Van der Smissen.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 8 Zoll hoch, 1 Fuß 4 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/03/05 HBRMS 0102 Denner I Ein kleiner Knabe, so eine Auster in der Hand hält. I Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0164 B. Denner I Der verstorbene König von Schweden, als Herzog von Holstein, vortreflich gemahlt, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 72 Zoll 6 Linien, Breite 55 Zoll 4 Linien Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0224 B. Denner I Ein alter Mann mit dem Huth aufm Kopf, und in der rechten hand den Stock haltend, seine aufmerksame Miene verräth das Auge eines Liebhabers, ohne an den Fleiß des Mahlers zu gedenken, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 33 Zoll 3 Linien, Breite 25 Zoll 9 Linien Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0275 B. Denner I Dessen Portrait, von ihm selbst gemahlt. Der freye Pinsel, das lebhafte Colorit, und die grosse Aehnlichkeit machen dieses Bild schätzbar, auf Leinwand. I Mat.: GEMÄLDE
511
auf Leinwand Maße: Höhe 31 Zoll 3 Linien, Breite 27 Zoll 3 Linien Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0276 B. Denner I Mademoiselle Denner Portrait, als ein historischer Kopf vorgestellet, vortreflich gemahlt, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 16 Zoll 6 Linien, Breite 13 Zoll 6 Linien Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0326 B. Denner I Ein historischer alter Manns= und Frauens=Kopf, Natur und Kunst streiten gleichsam um die Wette darinn, und verdienen billig unter die edelsten Stücke von diesem berühmten Manne gezehlt zu werden, auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein historischer alter Manns=Kopf Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 18 Zoll, Breite 14 Zoll Anm.: Die Lose 326 und 327 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0327 B. Denner I Ein historischer alter Manns= und Frauens=Kopf, Natur und Kunst streiten gleichsam um die Wette darinn, und verdienen billig unter die edelsten Stücke von diesem berühmten Manne gezehlt zu werden, auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein historischer alter Frauens=Kopf Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 18 Zoll, Breite 14 Zoll Anm.: Die Lose 326 und 327 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/09/30 FRAN 0284 Balthasar Denner I Das Bildnis der Tochter des berühmten Künstlers Balthasar Denner, von Ihm selbst mit unglaublichem Fleiß als eine büsende Maria Magdalena vorgestellt. [Le portrait de la fille du celebre artiste Balthasar Denner, superieurement peint par lui-meme & representee en Madeleine penitente.] I Maße: 1 Schuh 8 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (425 fl) Käufer: Kaller 1783/06/19 HBRMS 0098 Denner I Dessen eigenes Bildniß, mit einer blauen Mütze im violetten Schlafrock. L[einwand], g.R. [vergüteter Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 8 Zoll hoch, 1 Fuß 4 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1784/05/11 HBKOS 0042 B. Denner I Carpsers Portrait in seinen jüngem Jahren, von B. Denner gemahlt, auf Lein. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 24 Zoll 1 1., breit 18 Zoll 2 1. Transakt.: Verkauft (6 M) Käufer: Ε 1785/04/22 HBTEX 0007 Balthasar Denner I Ein schöner Frauenkopf in schwarzer Kleidung. Auf Leinewand. Im goldnen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 19 Zoll, breit 16 Zoll Transakt.: Unbekannt 1785/04/22 HBTEX 0030 Balthasar Denner I Ein vortreflicher alter Mannskopf, mit greisen Haaren und Bart. Auf Leinewand. Schwarzer Rahm und goldne Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 20 Zoll, breit 16 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1785/04/22 HBTEX 0033 Balthasar Denner I Zwey historische alte Mann= und Frauen=Köpfe. Natur, Kunst und Fleiß sind in diesen Bildern unbeschreiblich, und sie können für die besten Stücke dieses Meisters gehalten werden. Auf Leinewand. Schwarzer Rahm und goldne Leisten. I Diese Nr.: Ein historischer alter Manns=Kopf Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 14 Zoll Anm.: Die Lose 33 und 34 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1785/04/22 HBTEX 0034 Balthasar Denner I Zwey historische alte Mann= und Frauen=Köpfe. Natur, Kunst und Fleiß sind in diesen Bildern unbeschreiblich, und sie können für die besten Stücke dieses Meisters gehalten werden. Auf Leinewand. Schwarzer Rahm und goldne Leisten. I Diese Nr.: Ein historischer alter Frauen=Kopf Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 14 Zoll Anm.: Die Lose 33 und 34 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 512
GEMÄLDE
1785/04/22 HBTEX 0127 Balthasar Denner I Der verstorbene König von Schweden, als Herzog von Holstein. Auf Leinewand. Goldner Rahm. I Mat. : auf Leinwand Maße: Hoch 64 Zoll, breit 55 Zoll Transakt.: Unbekannt 1785/04/22 HBTEX 0137 Balthasar Denner I Ein kleiner Knabenkopf mit einer Pelzmütze. Hinter Glas. Schwarzer Rahm und goldne Leisten. I Maße: Hoch 21 Zoll, breit 16 Zoll Transakt.: Unbekannt 1785/05/17 MZAN 0131 Denner I Ein alter Mannskopf von Denner. [Tete d'un vieillard.] I Maße: 2 Schuh 5 Zoll hoch, 2 Schuh breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (89 fl) Käufer: Tischbein 1787/00/00 HB AN 0022 Balthasar Denner I Ein Greis von noch lebhafter Gesichtsfarbe wendet sein graues mit einer sammtnen rauhen Mütze besetztes Haupt über die Schulter, und scheint den Mund sprechend zu öffnen; sein silbergrauer Bart zeiget sein Alter. Ein alter Frauenskopf von gleicher Art mit einer kleinen weißen Nachthaube und weißen Tuch um den Hals, von besonders freundlichem Ansehen. Kunst, Fleiß und Natur scheinen in diesen beyden Bildern um die Wette zu eifern, und sie sind für wahre Meisterstükke der Natur zu halten. Auf Leinwand, s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Diese Nr.: Ein Greis von noch lebhafter Gesichtsfarbe wendet sein graues mit einer sammtnen rauhen Mütze besetztes Haupt über die Schulter Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 19 Zoll, breit 14 Zoll Anm.: Die Lose 22 und 23 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (90.8 M) Käufer: Bertheau 1787/00/00 HB AN 0023 Balthasar Denner I Ein Greis von noch lebhafter Gesichtsfarbe wendet sein graues mit einer sammtnen rauhen Mütze besetztes Haupt über die Schulter, und scheint den Mund sprechend zu öffnen; sein silbergrauer Bart zeiget sein Alter. Ein alter Frauenskopf von gleicher Art mit einer kleinen weißen Nachthaube und weißen Tuch um den Hals, von besonders freundlichem Ansehen. Kunst, Fleiß und Natur scheinen in diesen beyden Bildern um die Wette zu eifern, und sie sind für wahre Meisterstükke der Natur zu halten. Auf Leinwand, s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Diese Nr.: Ein alter Frauenskopf von gleicher Art mit einer kleinen weissen Nachthaube und weissen Tuch um den Hals Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 19 Zoll, breit 14 Zoll Anm.: Die Lose 22 und 23 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (90.8 M) Käufer: Bertheau 1787/00/00 HB AN 0081 Balthasar Denner I Dieses Künstlers eigenes Portrait, mit aller Vivacite, ä la prima gemahlt. Sein Haupt etwas gegen die rechte Schulter gewandt, in einem rothen sammtnen Kleide. Brustbild. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Vi Zoll, breit 14 Zoll Transakt.: Verkauft (40 M) Käufer: Fesser 1787/00/00 HB AN 0090 Balthasar Denner I Das historische Bildniß eines jungen freundlichen Mädchens mit einem Strohhuthe, welcher mit einem rothen Bande umwunden ist, in einem purpurnen Kleid und ein graues seidenes Tuch um den Hals. Sehr delicat und schön gemahlt, und von warmen Colorit. s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Maße: Hoch 18 Zoll, breit 13 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (36 M) Käufer: Fesser 1787/00/00 HB AN 0114 Balth. Denner I Ein junges Mädchen mit zur Seite gewandtem Haupte und einer rothen sammtnen mit Rauhwerk gefutterten Mütze, in einem blau sammtnen Rock gekleidet. Sehr sanft gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 17 Zoll, breit 13 Zoll Transakt.: Verkauft (40 M) Käufer: Bertheau 1787/00/00 HB AN 0159 Balthasar Denner I Ein ehrwürdiger Alter mit wenig greisen Haaren und kleinem Barte, in einen dunkelgrünen Rocke. Ein freundliches altes Mütterchen mit einer weißen Kappe, roth gekleidet, und einen frauen Schleyer über dem Haupte. Diese beyden Bilder sind selten in ihrer Art, weil sie von Denner ä
la prima gemahlt, und doch in der Ferne den nämlichen Effect thun, als wären sie auf das fleißigste ausgeführt. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Diese Nr.: Ein ehrwürdiger Alter mit wenigen greisen Haaren und kleinem Barte, in einen dunkelgrünen Rocke Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 14 Zoll Anm.: Die Lose 159 und 160 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (49 Μ für die Nrn. 159 und 160) Käufer: Bertheau 1787/00/00 HB AN 0160 Balthasar Denner I Ein ehrwürdiger Alter mit wenig greisen Haaren und kleinem Barte, in einen dunkelgrünen Rocke. Ein freundliches altes Mütterchen mit einer weißen Kappe, roth gekleidet, und einen frauen Schleyer über dem Haupte. Diese beyden Bilder sind selten in ihrer Art, weil sie von Denner ä la prima gemahlt, und doch in der Ferne den nämlichen Effect thun, als wären sie auf das fleißigste ausgeführt. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Diese Nr.: Ein freundliches altes Mütterchen mit einer weißen Kappe, roth gekleidet, und einen grauen Schleyer über dem Haupte Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 14 Zoll Anm.: Die Lose 159 und 160 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (49 Μ für die Nrn. 159 und 160) Käufer: Bertheau 1787/00/00 HB AN 0211 Vom alten Denner I Die büßende Maria Magdalena, mit gen Himmel gewandten Augen, in einem blauen Gewände, hält einen Todtenkopf an ihrer Brust. Ueberaus fleißig gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 27 Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Verkauft (36 M) Käufer: Fesser 1787/00/00 HB AN 0232 Balthasar Denner I In einem Blumenglase befinden sich Rosen, Tulpen, Hyacinthen, ec. Auf dem Tische liegen verschiedene Früchte, als Weintrauben, Kirschen und Erdbeeren. Besonders schön und natürlich gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 23 Zoll Transakt.: Verkauft (14.4 M) Käufer: Tietjen 1787/00/00 HB AN 0260 Balth. Denner I Ein alter Mann mit langem Bart und etwas aufgehobenem Gesicht, in einem grauen Kleide. Ein dergleichen alter Mann mit greisen Bart und Haaren, in einem blauen sammtnen Pelzrock. Beyde Brustbilder, und ä la prima gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Diese Nr.: Ein alter Mann mit langem Bart und etwas aufgehobenem Gesicht Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Vi Zoll, breit 14 Zoll Anm.: Die Lose 260 und 261 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (38 Μ für die Nrn. 260 und 261) Käufer: Bertheau 1787/00/00 HB AN 0261 Balth. Denner I Ein alter Mann mit langem Bart und etwas aufgehobenem Gesicht, in einem grauen Kleide. Ein dergleichen alter Mann mit greisen Bart und Haaren, in einem blauen sammtnen Pelzrock. Beyde Brustbilder, und ä la prima gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Diese Nr.: Ein dergleichen alter Mann mit greisen Bart und Haaren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Vi Zoll, breit 14 Zoll Anm.: Die Lose 260 und 261 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (38 Μ für die Nm. 260 und 261) Käufer: Bertheau 1787/00/00 HB AN 0270 Balth. Denner I Eine alte runzelichte Frau von noch wackerem Ansehen, in einem gelben Gewände. Ein alter Mann mit rauher Mütze und grauer Kleidung. Beyde ä la prima gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Diese Nr.: Eine alte runzelichte Frau von noch wackerem Ansehen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Vi Zoll, breit 14 Zoll Anm.: Die Lose 270 und 271 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (60 Μ für die Nrn. 270 und 271) Käufer: Fesser 1787/00/00 HB AN 0271 Balth. Denner I Eine alte runzelichte Frau von noch wackerem Ansehen, in einem gelben Gewände. Ein alter Mann mit rauher Mütze und grauer Kleidung. Beyde ä la prima gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Diese Nr.: Ein alter Mann mit rauher Mütze und grauer Kleidung Mat.:
auf Leinwand Maße: Hoch 18 Vi Zoll, breit 14 Zoll Anm.: Die Lose 270 und 271 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (60 Μ für die Nrn. 270 und 271) Käufer: Fesser 1787/00/00 HB AN 0293 Balth. Denner I Das Brustbild eins alten Mannes mit langem Bart und einer purpurnen Mütze, in grauer Kleidung. Ein Mannskopf mit kurzem Bart und einer blauen sammtnen Mütze, in einem grauen Rocke. Beyde ä la prima gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Diese Nr.: Das Brustbild eins alten Mannes mit langem Bart und einer purpurnen Mütze Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 14 Zoll Anm.: Die Lose 293 und 294 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (49 Μ für die Nrn. 293 und 294) Käufer: Bertheau 1787/00/00 HB AN 0294 Balth. Denner I Das Brustbild eins alten Mannes mit langem Bart und einer purpurnen Mütze, in grauer Kleidung. Ein Mannskopf mit kurzem Bart und einer blauen sammtnen Mütze, in einem grauen Rocke. Beyde ä la prima gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Diese Nr.: Ein Mannskopf mit kurzem Bart und einer blauen sammtnen Mütze Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 14 Zoll Anm.: Die Lose 293 und 294 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (49 Μ für die Nrn. 293 und 294) Käufer: Bertheau 1787/00/00 HB AN 0361 Balth. Denner I Das Bildniß einer jungen Frauensperson, in bloßen Haaren und blauem Kleide. Sehr schön gemahlt. Brustbild. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 14 Zoll, breit 11 Zoll Transakt.: Verkauft (10.6 M) Käufer: Bertheau 1787/00/00 HB AN 0369 Balth. Denner] Das Brustbild eines jungen freundlichen Mädchens in bloßen Haaren mit einem hell purpurnen Kleide und einem gelblichten Schleyer. Auf das schönste und fleißigste gemahlt, und von einem sehr angenehmen Colorit. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Vi Zoll, breit 14 Zoll Transakt.: Verkauft (18 M) Käufer: Graf Laner [?] 1787/00/00 HB AN 0374 Balth. Denner I Das Bildniß einer Dame in bloßen Haaren mit einem schwarzen Schleyer. Sehr schön und delicat gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] s.R. [in schwarzem Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 15 lA Zoll, breit 11 % Zoll Transakt.: Verkauft (4.12 M) Käufer: Tietjen 1787/00/00 HB AN 0427 Balth. Denner I Auf dem Tische stehet eine Weinflasche, ein angefülltes Glas, einige gebratene Castanien, eine halbe Zitrone und einige Austern. Besonders schön und mit vielem Fleiß gemahlt, und von einer besonderen Nachahmung der Natur. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 11 Vi Zoll, breit 15 Zoll Transakt.: Verkauft (9 M) Käufer: Tietjen 1787/00/00 HB AN 0432 Balth. Denner I Das Bildniß des Sohnes dieses berühmten Meisters in seiner zarten Jugend gemahlt, mit einer rauhen Mütze und Kleide. Besonders schön und fleißig ausgeführt. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 17 Zoll, breit 14 Zoll Transakt.: Verkauft (30 M) Käufer: Schoen 1787/00/00 HB AN 0489 Balth. Denner I Dieses berühmten Mahlers Tochter in bloßen Haaren und gelbem Kleide. Sehr sanft und angenehm gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 16 Vi Zoll, breit 11 % Zoll Transakt.: Verkauft (3.4 M) Käufer: Texier [mit] L 1787/00/00 HB AN 0502 Balth. Denner I Das Brustbild eines alten Mannes mit grauem Haar und Bart, in einem blauen Rocke, von würdigem Ansehen. Besonders sanft und fleißig gemahlt. A.H. [Auf Holz] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Vi Zoll, breit 7 Zoll Transakt.: Verkauft (6.4 M) Käufer: Bertheau GEMÄLDE
513
1787/00/00 HB AN 0517 Balthasar Denner I Das Brustbild eines alten Mannes in bloßem Kopfe, kurzen weißen Barte und wenig grauen Haar, in einem gräulichen Rock, a la prima von diesem berühmten Meister gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat. : auf Leinwand Maße: Hoch 14 !4 Zoll, breit 16 Zoll Transakt.: Verkauft (16.4 M) Käufer: Tietjen 1787/00/00 HB AN 0666 Balth. Denner I Ein historischer alter Mannskopf in bloßen wenigen grauen Haaren und Bart. In grauem Rocke ä la prima sehr natürlich gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 19 Zoll, breit 14 Zoll Transakt.: Verkauft (19.5 M) Käufer: Berth[eau] 1787/03/01 HBLOT 0067 Balthasar Denner I Ein Tisch mit verschiedenen Früchten und Insekten, besonders schön und natürlich gemahlt von Balthasar Denner. I Transakt.: Unbekannt (1.4 M) 1787/04/03 HB HEG 0120 Balth. Denner I Die zwey Demoiselles Denner, von ihren Vater, den berühmten Balth. Denner, gemahlt, auf Kupfer. I Diese Nr.: Demoiselle Denner Mat.: auf Kupfer Anm.: Die Lose 120 und 121 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (27 Μ für die Nm. 120 und 121) Käufer: Bertheau 1787/04/03 HBHEG 0121 Balth. Denner I Die zwey Demoiselles Denner, von ihren Vater, den berühmten Balth. Denner, gemahlt, auf Kupfer. I Diese Nr.: Demoiselle Denner Mat.: auf Kupfer Anm. : Die Lose 120 und 121 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (27 Μ für die Nrn. 120 und 121) Käufer: Bertheau 1788/06/12 HBRMS A0013 B. Denner I Ein geistreicher alter Mannskopf, welchen Denner bey vielen Gelegenheiten zum Nachmalen sich bedienet. Auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 16 Vi Zoll, breit 14 Zoll Transakt.: Unbekannt 1789/04/16 HB TEX 0003 B. Denner I Zwey alte Mannsköpfe, von starken Colorit, affect und fleißiger Bearbeitung, auf Leinew. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 11 14 Zoll, breit 9 V* Zoll Transakt.: Verkauft (4 M) Käufer: Ego 1790/01/07 MUAN 0497 Denner I Ein niederländisches Stück, auf Holz, in einer geschnittenen und vergoldeten Ram. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh, Breite 10 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/02/04 HBDKR 0039 Denner I Ein Dames Portrait, auf Leinw. Hoch 17 Zoll, Breit 14 Zoll. Ohne Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 17 Zoll, breit 14 Zoll Transakt.: Verkauft (4 Sch) Käufer: Eckhardt 1790/02/04 HBDKR 0142 B. Denner I Zwey mit Blumen angefüllte Caravins stehen auf Tische, ganz vortreflich nach der Natur gemahlt, auf Leinw. I Diese Nr.: Ein mit Blumen angefüllter Caravin Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 14 Zoll, breit 10 Vi Zoll Anm.: Die Lose 142 und 143 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (3 Μ für die Nrn. 142 und 143) Käufer: Ego 1790/02/04 HBDKR 0143 B. Denner I Zwey mit Blumen angefüllte Caravins stehen auf Tische, ganz vortreflich nach der Natur gemahlt, auf Leinw. I Diese Nr.: Ein mit Blumen angefüllter Caravin Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 14 Zoll, breit 10 Vi Zoll Anm.: Die Lose 142 und 143 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (3 Μ für die Nrn. 142 und 143) Käufer: Ego 1790/04/13 HBLIE 0228 B. Denner I Die Tante des berühmten benannten Künstlers, ganz vortreflich nach dem Leben gemahlt, in dieser große wohl das einzigste das Er gemahlt. Auf Holz, in einem Schiebekasten von Mahagonieholz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 Zoll, breit 5 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (10 M) Käufer: Ego [und] F 1790/05/20 HBSCN 0164 Balth. Denner I Die Bildnisse zweyer Hamburger Senatoren im Ornat. Brustbilder. Ganz vortreflich und sanft gemahlt. Auf H[olz], G.R. [Goldnen Rahm] I Diese Nr.: Das Bildnis eines Hamburger Senators im Ornat Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 Vi Zoll, breit 5 Vi Zoll Anm.: Die Lose 164 und 165 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh 514
GEMÄLDE
Transakt.: Verkauft (24.8 Μ für die Nrn. 164 und 165) Käufer: Stoker 1790/05/20 HBSCN 0165 Balth. Denner I Die Bildnisse zweyer Hamburger Senatoren im Ornat. Brustbilder. Ganz vortreflich und sanft gemahlt. Auf H[olz]. G.R. [Goldnen Rahm] I Diese Nr.: Das Bildnis eines Hamburger Senators im Ornat Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 Vi Zoll, breit 5 Vi Zoll Anm.: Die Lose 164 und 165 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (24.8 Μ für die Nrn. 164 und 165) Käufer: Stoker 1790/08/13 HBBMN 0062 B. Denner I Das Bildnis der Mademoiselle Denner, in bloßen Haaren mit einigen Blumen auf dem Kopfe, besonders schön und mit ausnehmenden Fleiß gemahlt. Auf L[einwand]. G.R. [Goldnen Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 17 Zoll, breit 14 Zoll Transakt.: Verkauft (8 Sch) Käufer: Bertheau 1791/05/28 HBSDT 0065 Balthasar Denner I Das Brustbild der Mademoiselle Denner. In bloßen Haaren und rothsammtner Kleidung. Von sanften Colorit und ganz vortreflichen und ausführlichen Mahlerey, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Zoll, breit 17 Zoll Transakt.: Unbekannt 1791/05/28 HBSDT 0072 Balthas. Denner I Die Tante des berühmten Denners, mit kleiner Haube und weissen Flortuch; besonders schön und fleißig gemahlt, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 23 Zoll, breit 19 Zoll Transakt.: Unbekannt 1791/05/30 FRAN 0182 Denner I Zwey Apostels Köpfe sehr wohl und fleißig ausgeführt. I Diese Nr.: Ein Apostels Kopf Maße: 1 Schuh 7 Zoll hoch und 1 Schuh 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 182 und 183 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Bansa Transakt.: Verkauft (65 für die Nrn. 182 und 183) Käufer: Barensfeld 1791/05/30 FRAN 0183 Denner I Zwey Apostels Köpfe sehr wohl und fleißig ausgeführt. I Diese Nr.: Ein Apostels Kopf Maße: 1 Schuh 7 Zoll hoch und 1 Schuh 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 182 und 183 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Bansa Transakt.: Verkauft (65 für die Nrn. 182 und 183) Käufer: Barensfeld 1791/10/21 HBRMS1 0021 Balth. Denner, 1734.1 Das Bildnis eines Mannes in schwarzsammtner Kleidung. Brustbild. Ganz vortreflich und ausführlich gemahlt, wie man es von diesem Meister gewohnt ist; auf Leinew. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 23 Zoll, breit 19 Zoll Inschr.: 1734 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt 1792/04/19 HBBMN 0061 B. Denner I Das Bildniss einer jungen Dame; fleissig und schön gemahlt, von B. Denner. Auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 19 Zoll, breit 15 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1792/04/19 HBBMN 0148 Balthasar Denner I Ein historischer alter Mannskopf mit kleinen Bart, und nach sehr lebhaften Ansehn; ganz vortreflich gemahlt schmelzend und fleißig gemahlt. I Maße: Hoch 19 Zoll, breit 15 Zoll Transakt.: Unbekannt 1792/07/05 LBKIP 0017 Denner I Ein Portrait, einen Musikus vorstellend von Denner. I Transakt.: Unbekannt 1792/09/28 HBBMN 0018 B. Denner I Ein Kinderkopf. I Maße: Hoch 13 Zoll, breit 11 Zoll Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 HBMFD 0049 Bathasar Denner von Hamburg I Halbe Figur in halbnatürlicher Grösse. Ein junger Knabe [Fußnote: Sohn des Mahlers.] von ungefähr 8 bis 10 Jahren, in Lillafarbner Weste, grünen Mütze und kurzes Haar, im Begrif eine Auster zu verschlucken, die er in der rechten Hand hält; man sieht ihn dreyviertheile von vorne, und in einer sehr muntern Stellung. Jeder Kenner wird die sanfte und ausführliche Mannier des Denners kennen, und diese hat er auf eine glückliche Art vereinigt an dem Bilde seines Sohnes angebracht. I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuss 1 Zoll hoch, II Vi Zoll breit Verkäufer: Pierre Laporterie Transakt.: Unbekannt
1793/00/00 NGWID 0055 Denner I Ein Manns=Portrait von mittlerem Alter von Denner. I Maße: 1 Schuh 10 Zoll hoch, 1 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0059 Denners I Ein junges Mädchen die Tochter des Mahler Denners, von ihm selbst gemahlt. I Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0145 der alte Denner I Eine kleine Holländische Bauern=Zusammenkunft, vom alten Denner. I Pendant zu Nr. 146 Maße: 1 Schuh hoch, 11 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0146 der alte Denner I Zum Gegenstück, wie zwey Bauern im Gespräch sich unterhalten, von obigem Meister [vom alten Denner] und Maaß. I Pendant zu Nr. 145 Maße: 1 Schuh hoch, 11 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0132 B. Denner I Das Bildniss der Mademoiselle Denner. Brustbild. Von den großen Künstler B. Denner in seiner bekannten delicaten Manier gemalt. Lebensgröße. I Maße: Hoch 15 Zoll, breit 12 Zoll Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0197 B. Denner I Eine junge andächtige Frauensperson, soll die Tochter des berühmten Denners vorstellen; fleißig gemahlt, auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 14 Zoll 3 Lin., breit 12 Zoll Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0198 B. Denner I Ein greiser Manns=Kopf mit Halsbinde, und umgeschlagenen Sammtnen Gewände; meisterhaft, und mit freyem Pinsel nach dem Leben gemahlt, von B. Denner. I Maße: Hoch 24 Zoll, breit 19 Zoll 3 Lin. Transakt.: Unbekannt 1794/09/06 HBBMN 0039 Denner I Ein Stilleben, Apricosen und Nüsse in einer Schüssel. I Transakt.: Unbekannt 1794/09/06 HBBMN 0159 Denner I Ein freundlicher Knaben= Kopf, mit einer Pelz=Mütze. I Transakt.: Unbekannt 1795/03/12 HBSDT 0137 B. Denner I Das Bildniß einer bejahrten Frau. Auf Leinwand, im goldenen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 23 Zoll, breit 18 Zoll Transakt.: Unbekannt 1795/03/12 HBSDT 0142 B. Denner I Das Bildniß eines jungen Frauenzimmers; sehr lebhaft dargestellt. Auf Leinwand, im schwarzen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Zoll, breit 17 Zoll Transakt.: Unbekannt 1795/03/12 HBSDT 0198 v. Denner I Ein dito [Stück mit Früchten]; sehr natürlich vorgestellt. I Transakt.: Unbekannt 1795/03/12 HBSDT 0201 v. Denner I Ein Stillleben, mit Früchten ec.; schön gemahlt. I Transakt.: Unbekannt 1796/08/00 HBPAK 0013 Bathasar Denner Ao. 17361 Ein alter Manns= und ein alter Frauens Kopf. Die Natur mit einen unaussprechlichen Fleiß auf das getreueste nachgeahmt; von denen besten Stücken dieses Meisters. Auf Leinwand. In Nußbäumenen Schränken. I Diese Nr.: Ein alter Manns=Kopf Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 18 Vi Zoll, Breite 14 Vi Zoll Inschr.: Ao. 1736 (datiert?) Anm.: Die Lose 13 und 14 wurden zusammen katalogisiert. Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt 1796/08/00 HBPAK 0014 Bathasar Denner Ao. 17361 Ein alter Manns= und ein alter Frauens Kopf. Die Natur mit einen unaussprechlichen Fleiß auf das getreueste nachgeahmt; von denen besten Stücken dieses Meisters. Auf Leinwand. In Nußbäumenen Schränken. I Diese Nr.: Ein alter Frauens Kopf Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 18 Vi Zoll, Breite 14 Vi Zoll Inschr.: Ao. 1736 (datiert?) Anm.: Die Lose 13 und 14 wurden zusammen katalogisiert. Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt 1796/08/00 HBPAK 0064 B. Denner I Verschiedene Blumen in einem Glase auf einem halbüberdecktem Tisch. Sehr schön gemahlt.
Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 27 Zoll, Breite 22 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/08/00 HBPAK 0072 B. Denner I Das Portrait des berühmten Mahlers Balthasar Denner, und dasjenige seiner Frauen zum Compagnon. Besonders schön gemahlt. Auf Leinwand. I Diese Nr. : Das Portrait des berühmten Mahlers Balthasar Denner; Pendant zu Nr. 73 Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 19 Vi Zoll, Breite 15 Zoll Anm.: Die Lose 72 und 73 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/08/00 HBPAK 0073 B. Denner I Das Portrait des berühmten Mahlers Balthasar Denner, und dasjenige seiner Frauen zum Compagnon. Besonders schön gemahlt. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Das Portrait seiner [Balthasar Denner] Frauen; Pendant zu Nr. 72 Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 19 Vi Zoll, Breite 15 Zoll Anm.: Die Lose 72 und 73 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0085 B. Denner I Denners Portrait und dessen Tochter. I Diese Nr.: Denners Portrait Maße: Hoch 21 Zoll, breit 16 Zoll Anm.: Die Lose 85 und 86 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0086 B. Denner I Denners Portrait und dessen Tochter. I Diese Nr.: Denners Tochter Maße: Hoch 21 Zoll, breit 16 Zoll Anm.: Die Lose 85 und 86 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0092 B. Denner I Ein Manns=Portrait mit einer Hand in einem braunen mit Gold gestickten Kleide. I Maße: Hoch 30 Zoll, breit 26 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0174 B. Denner I Denners Tochter im Brustbild. Fleißig gemahlt. I Maße: Hoch 25 Zoll, breit 20 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0151 Denner I Eine alte Frau, nach dem Leben gemahlt. I Maße: Hoch 17 Zoll, breit 14 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/06/13 HBPAK 0137 Balthasar Denner I Ein sehr freundlicher alter Mann mit blossem Haar. Zum Compagnon eine alte Frau. Beyde sind mit vieler Lebhaftigkeit vorgestellt, und besonders stark und meisterhaft gemahlt. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Ein sehr freundlicher alter Mann mit blossem Haar; Pendant zu Nr. 138 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 22 Zoll, breit 18 Zoll Anm.: Die Lose 137 und 138 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/06/13 HBPAK 0138 Balthasar Denner I Ein sehr freundlicher alter Mann mit blossem Haar. Zum Compagnon eine alte Frau. Beyde sind mit vieler Lebhaftigkeit vorgestellt, und besonders stark und meisterhaft gemahlt. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Eine alte Frau; Pendant zu Nr. 137 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 22 Zoll, breit 18 Zoll Anm.: Die Lose 137 und 138 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/12/08 HBPAK 0136 Balth. Denner I Ein Manns=Portrait. Eines seiner besten Stücke. Auf Leinwand, im goldnen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 19 Zoll, Breite 17 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/12/08 HBPAK 0137 Balth. Denner I Ein alter Mann mit einem Bart. Ganz kräftig, und von Beleuchtung ausnehmend schön bearbeitet. Auf Leinwand, im goldnen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 26 Zoll, Breite 21 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/01/19 HBPAK 0221 Denner I Desselben Tochter. 1 Fuß 5 Zoll hoch, 1 Fuß 2 Zoll breit. Auf Leinw., schw. Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 5 Zoll hoch, 1 Fuß 2 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0403 Denner I Ein alter Frauenkopf. Sehr schön und fleißig gemahlt. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 17 Zoll, breit 14 Zoll Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
515
1798/08/10 HBPAK 0018 Balth. Denner I Zwey Blumenstücke. Auf einem Tische stehet ein Glas mit Blumen, als Rosen, Tulpen, auf dem Tische liegen Früchte, als Erdbeeren, Kirschen ec. Das andere, auf einem Tische stehet ein Glas mit Blumen, als Rosen, Tulpen, Auriculn ec.; auf dem Tische liegen Zwetschen, Pfirschen und Trauben. Ganz auf das natürlichste gemahlt. Im goldnen Rahm. I Diese Nr.: Ein Blumenstück. Auf einem Tische stehet ein Glas mit Blumen, als Rosen, Tulpen, auf dem Tische liegen Früchte, als Erdbeeren, Kirschen ec. Maße: Hoch 32 Zoll, breit 26 Zoll Anm.: Die Lose 18 und 19 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/08/10 HBPAK 0019 Balth. Denner I Zwey Blumenstücke. Auf einem Tische stehet ein Glas mit Blumen, als Rosen, Tulpen, auf dem Tische liegen Früchte, als Erdbeeren, Kirschen ec. Das andere, auf einem Tische stehet ein Glas mit Blumen, als Rosen, Tulpen, Auriculn ec.; auf dem Tische liegen Zwetschen, Pfirschen und Trauben. Ganz auf das natürlichste gemahlt. Im goldnen Rahm. I Diese Nr.: Ein Blumenstück. Auf einem Tische stehet ein Glas mit Blumen, als Rosen, Tulpen, Auriculn ec.; auf dem Tische liegen Zwetschen, Pfirschen und Trauben Maße: Hoch 32 Zoll, breit 26 Zoll Anm.: Die Lose 18 und 19 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/08/10 HBPAK 0024 Balthasar Denner I Zwey Fruchtstükke. Auf steinernen Tischen liegen Pflaumen, Pfirschen, Trauben, Wallnüsse und Melonen. Ganz auf das natürlichste vorgestellt und auf das schönste gemahlt. Auf Leinwand, im schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein Frachtstück. Auf steinernen Tischen liegen Pflaumen, Pfirschen, Trauben, Wallnüsse und Melonen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 26 Zoll, breit 32 Zoll Anm.: Die Lose 24 und 25 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/08/10 HBPAK 0025 Balthasar Denner I Zwey Fruchtstükke. Auf steinernen Tischen liegen Pflaumen, Pfirschen, Trauben, Wallnüsse und Melonen. Ganz auf das natürlichste vorgestellt und auf das schönste gemahlt. Auf Leinwand, im schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein Fruchtstück. Auf steinernen Tischen liegen Pflaumen, Pfirschen, Trauben, Wallnüsse und Melonen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 26 Zoll, breit 32 Zoll Anm.: Die Lose 24 und 25 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/08/10 HBPAK 0228 Denner I Ein Manns=Portrait, mit goldgarnirter Kleidung und Bänder. Auf Leinwand, im goldnen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 31 Zoll, breit 25 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/08/10 HBPAK 0244 Balthasar Denner I Drey Portraits; zwey Herren= und ein Damens=Portrait. I Diese Nr.: Ein Herren= Portrait Maße: Hoch 54 Zoll, breit 42 Zoll Anm.: Die Lose 244 bis 246 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/08/10 HBPAK 0245 Balthasar Denner I Drey Portraits; zwey Herren= und ein Damens=Portrait. I Diese Nr.: Ein Herren= Portrait Maße: Hoch 54 Zoll, breit 42 Zoll Anm.: Die Lose 244 bis 246 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/08/10
HBPAK
0246
Balthasar
Denner
I D r e y Portraits;
zwey Herren= und ein Damens=Portrait. I Diese Nr.: Ein Damens= Portrait Maße: Hoch 54 Zoll, breit 42 Zoll Anm.: Die Lose 244 bis 246 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 BLBOE 0128 Denner I Ein bejahrter Mann, mit einer Mütze auf dem Kopfe. I Mat.: auf Leinwand Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN2 0020 Denner I Ein Kopf von einem Philosophen mit einer violet Mütze in einem braunlichen Rock. Der Ausdruck der Gesichtszügen dieses Mannes ist so meisterhaft, daß man kein Stück von dieses geschickten Künstlers unvergleichlichen Pin516
GEMÄLDE
sel stärkerer finden wird. I Mat.: auf Leinwand Maße: 19 Zoll hoch, 14 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Denner, Balthasar (Kopie nach) 1765/00/00 FRRAU 0004 Nach Denner v. Hamb. I Zwey Stück, vorstellend einen alten Frauen=Kopf mit einer Peltz=Mütze, und einen Mans=Kopf mit eben solcher Mütze. Ohne Rahme. Representant deux pieces, une tete de vieille femme avec un bonnet de pelice & un habit bleu garnit de fourure, la seconde une tete d'homme. Sans Bordüre. I Maße: Hoch 1 Schuh 4 Zoll, breit 1 Schuh 1 Zoll Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0064 Denner I Ein alter Mannskopf nach Denner. Brustbild Lebensgröse. I Maße: Hoch 23 Zoll, breit 19 Zoll Transakt.: Unbekannt 1794/09/06 HBBMN 0107 Denner I Ein Frauenzimmer=Portrait; nach Denner. I Transakt.: Unbekannt 1794/09/06 HBBMN 0113 Denner I Ein Knaben=Kopf; nach Denner. I Transakt.: Unbekannt 1794/09/06 HBBMN 0120 Denner I Ein Frauenzimmer=Kopf, nach Denner. I Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0324 Nach Denner I Ein nackender Knabe, der auf einem Polster liegt. I Maße: Hoch 17 Zoll, breit 22 Zoll Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0319 ner. I Transakt.: Unbekannt
Denner I Zwey alte Köpfe, nach Den-
1800/11/12 HBPAK 0337 Transakt.: Unbekannt
Denner I Zwey Köpfe, nach Denner. I
Denner, Balthasar (Manier) 1775/10/07 HBBMN 0012 Denner I Ein alter Manns=Kopf, in der Manier von Denner. I Transakt.: Unbekannt 1782/09/30 FRAN 0407 Denner I Zwei dito [Mannsköpfe], wovon einer in der Dennerischen, und der andre in der Rembrandtischen Manier verfertigt ist, von nehmlicher Höhe und Breite als obige. [Deux pareilles [tetes d'homme], Γune dans le gout de Denner, l'autre dans la maniere de Rembrandt.] I Diese Nr.: Ein Mannskopf in der Dennerischen Manier Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Anm.: Die Lose 407 und 408 wurden zusammen katalogisiert. Dieses Los wurde zusammen mit der Nr. 408 (in der Manier von Rembrandt) verkauft. Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (11 fl für die Nrn. 407 und 408) Käufer: Müller 1785/10/17 LZRST 0106 Denner I Zwey alte Köpfe, von eben dieser Hand [ungenannte Meisterinn], in der Manier von Denner. Ein alter Weiberkopf, mit einem Stück Butterbrodt in der Hand, und ein alter Bauer im Calender lesend, 23 ¥2 Zoll h. 18 Z. br. ohne Rahm. I Maße: 23 Vi Zoll hoch, 18 Zoll breit Transakt.: Verkauft (5.6 Th) Käufer: Caj 1794/09/06 HBBMN 0066 So schön wie B. Denner I Ein alter Manns=Kopf mit langem Bart und kahler Scheitel, und im Pelz= Rock. Original. I Transakt.: Unbekannt 1795/11/17 HBPAK 0072 In Denners Manier I Zwey auf einem Tische stehende Blumen. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine auf einem Tische stehende Blume Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 22 Zoll, breit 18 Zoll Anm.: Die Lose 72 und 73 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1795/11/17 HBPAK 0073 In Denners Manier I Zwey auf einem Tische stehende Blumen. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine auf einem Tische stehende Blume Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 22 Zoll, breit 18 Zoll Anm.: Die Lose 72 und 73 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Denner, David [Nicht identifiziert] 1793/00/00 NGWID 0437 David Denner I Eine überaus schöne ländliche Gegend mit einer Bauernhütte und einigen Figuren, von David Denner. I Pendant zu Nr. 438 Maße: 1 Schuh 2 Zoll hoch, 1 Schuh 7 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0438 David Denner I Zum Gegenstück, eine im nemlichen Geschmack wohl ausgeführte Landschaft, mit vielen Beywesen, vom nemlichen Meister [David Denner] und Maaß. I Pendant zu Nr. 437 Maße: 1 Schuh 2 Zoll hoch, 1 Schuh 7 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
nehm und meisterhaft gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 13 Zoll, breit 10 Zoll Transakt.: Verkauft (1.8 M) Käufer: Texier [mit] L 1787/03/01 HB LOT 0007 Besheyes I Eine schöne Aktrise Brustbild. I Transakt.: Unbekannt (26 Sch) 1787/10/06 HBTEX 0116 Deshayes I Der Kopf eines Französischen Mädchens. I Transakt.: Unbekannt 1790/02/04 HBDKR 0004 Besheyer I Sujet Galant; sehr kräftigt, frey und so schön wie Boucher gemahlt, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Transakt.: Verkauft (18 M) Käufer: Ego
Denys, Frans Desiderio 1793/09/18 HBSCN 0162 Frans Deny I Ein alter bärtiger Kopf. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 14 Zoll, breit 10 Zoll Transakt.: Unbekannt
Denys, Gre. [Nicht identifiziert] 1796/00/00 BSAN 0036 Gre. Denys I Escarmouche de cavalerie. Sur le devant, un cavalier tire de fort pres un coup de pistolet, sur son ennemi dont le visage annonce tout ä la fois la terreur et la douleur; leurs chevaux sont pleins de vie. Sur le devant, un cheval tue est tres naturel. I Mat.: auf Holz Maße: Haut de 1 pied; large de 1 pieds 8 pouces Verkäufer: Merian l'aine Transakt.: Unbekannt (10)
Derichs, Sophonias de 1777/03/03 AU AN 0105 Sopho. Derichs I Zwey Köpfe Frau und Mann. I Maße: 1 Vi Zoll hoch, 1 V* Zoll breit Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt 1777/03/03 AUAN 0107 Sopho. Derichs I Ein Samson. I Maße: 2 Vt Zoll hoch, 3 Zoll breit Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt
Descamps, Jean Baptiste 1783/06/19 HBRMS 0068 Descamps I Zwey en basrelief gemalte Stücke mit spielenden Kindern. L[einwand]. grau in grau, g.R. [verguldete Rahmen] I Diese Nr.: Ein en basrelief gemaltes Stück mit spielenden Kindern Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 3 Zoll hoch, 1 Fuß 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 68 und 69 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1783/06/19 HBRMS 0069 Descamps I Zwey en basrelief gemalte Stücke mit spielenden Kindern. L[einwand]. grau in grau, g.R. [verguldete Rahmen] I Diese Nr.: Ein en basrelief gemaltes Stück mit spielenden Kindern Mat. : auf Leinwand Maße: 2 Fuß 3 Zoll hoch, 1 Fuß 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 68 und 69 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1783/06/19 HBRMS 0091 Descamps I Drey französische Bauer=Mädgen, stehen um einen Tisch, und lassen sich von einem daran sitzenden jungen Menschen im Kartenspiel unterrichten; unter dem Tische steht eine Mausefalle. H[olz]. g.R. [verguldeter Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 2 Zoll hoch, 11 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
1792/10/12 KOAN 0006 Chev. Desiderio I Die Einnahme von Troja, von Chev. Desiderio, ganz im hohen Styl, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 4 Fuss 1 Zoll - breit 6 Fuss 3 Zoll Anm.: Der Künstler ist vermutlich Francis de Nome oder Didier Barra. Verkäufer: Moureaux Transakt.: Unbekannt
Desmarais, Jean-Baptiste Frederic 1790/08/16 KAAN 0091 Desmarais I Ein Portrait, der Rath Reifenstein in Rom. I Maße: 2 Fuß 3 Zoll hoch, 1 Fuß 10 Zoll breit Verkäufer: Johann Heinrich Tischbein Transakt.: Unbekannt 1790/08/16 KAAN 0093 Desmarais I Ein Portrait, der Mahler Desmarais, von ihm selbst. I Maße: 2 Fuß 9 Zoll hoch, 2 Fuß 1 Zoll breit Verkäufer: Johann Heinrich Tischbein Transakt.: Unbekannt
Desportes, Alexandre Fran?ois 1800/00/00 FRANl 0033 Desportes (Alex. Franz.) I zwei Stück mit Obst u. todter Natur. Auf dem einen sind Pfirsching; von allmöglichster Kunst und Schönheit, im zweiten Plan liegen Feldhüner, wo der Natur im höchsten Grad nahe gekommen ist. Das andere Stück hat ein Körbchen mit Pflaumen, auf welchen der vollkommenste Reif liegt, zwei Schnepfen vervollkommen dieses schöne Stück. 12 Z. h, 14 Z. b. L[einwand]. Signirt Desportes 1716. I Diese Nr.: Ein Stück mit Obst u. todter Natur Mat.: auf Leinwand Maße: 12 Zoll hoch, 14 Zoll breit Inschr.: Desportes 1716 (signiert und datiert) Anm.: Die Lose 33 und 34 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRANl 0034 Desportes (Alex. Franz.) I Zwei Stück mit Obst u. todter Natur. Auf dem einen sind Pfirsching; von allmöglichster Kunst und Schönheit, im zweiten Plan liegen Feldhüner, wo der Natur im höchsten Grad nahe gekommen ist. Das andere Stück hat ein Körbchen mit Pflaumen, auf welchen der vollkommenste Reif liegt, zwei Schnepfen vervollkommen dieses schöne Stück. 12 Z. h, 14 Z. b. L[einewand], Signirt Desportes 1716. I Diese Nr.: Ein Stück mit Obst u. todter Natur Mat.: auf Leinwand Maße: 12 Zoll hoch, 14 Zoll breit Inschr.: Desportes 1716 (signiert und datiert) Anm.: Die Lose 33 und 34 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Deurwerders
Deshays, Jean-Baptiste-Henri
1790/01/07 MUAN 0458 Deuvverders I Ein Blumenstück, auf Leinwat. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 3 Schuh, Breite 1 Schuh 2 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
1784/05/11 HBKOS 0004 Berhayes I Sujet galant, par Berhayes eleve par Boucher, sehr stark gemahlt, und könnte vor Boucher selbst paßiren, auf Leinw. I Mat. : auf Leinwand Maße: hoch 32 Zoll 3 1., breit 26 Zoll 9 1. Transakt.: Unbekannt
Deusz [Nicht identifiziert]
1787/00/00 HB AN 0509 Besheyes I Ein junges Mädchen in bloßen Haaren, und mit einem rothen Pelzrocke. Brustbild. Sehr ange-
1716/00/00 FRHDR 0098 Deusz \ Von Deusz die reine Seele nach den Himmel bracht. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (150) GEMÄLDE
517
Diaar, J.G. [Nicht identifiziert] 1778/08/29 HBTEX 0046 J. G. Diaar I Die Geschichte des Orphei, wie er die Thiere bewegt, mühsam ausgeführt von J.G. Diaar 1641. I Maße: Höhe 1 Fuß, Breite 1 Fuß 4 Zoll Inschr.: 1641 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt
1764/00/00 BLAN 0236 Dipenbeck I Stellet vor die liebe, die das laster bewältiget. I Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (400 Rt Schätzung) Gegenw. Standort: Sankt-Peterburg, Rossiya. Ermitazh. (439 oder 3627) als H. von Baien (I) oder J. Droochsloot 1764/03/12 FRKAL 0031 A. Diepenbeck I Un Christ couronne d'Epines entre Pilate & un Soldat, Tableau d'une grande expression & bien execute. I Maße: hauteur 44 Vi pouces, largeur 40 pouces Transakt.: Verkauft (47.45 fl) Käufer: Göring
Diamantini, Giuseppe 1778/04/11 HBBMN 0006 Diamantino I Die Mahlerey, Poesie und Musik vorstellend, halbe Figuren, in Lebensgröße. I Transakt.: Unbekannt
Diartini [Nicht identifiziert] 1790/04/13 HBLIE 0057 Diartini fecit 16251 Eines Gelehrten Portrait in schwarzer Kunst ist auf einem Holzgrund wie aufgeklebt gemahlt, auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 32 Zoll, breit 26 Zoll Inschr.: Diartini fecit 1625 (signiert und datiert) Transakt.: Verkauft (1.3 M)
Diclaert, C.V. [Nicht identifiziert] 1775/05/08 HBPLK 0064 C.v. Diclaert I Zwey Still=Leben mit Blumen und Früchten, auf Holz. I Diese Nr.: Ein Still=Leben mit Blumen und Früchten Mat.: auf Holz Maße: Höhe 17 Zoll 2 Linie, Breite 14 Zoll 7 Linie Anm.: Die Lose 64 und 65 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1775/05/08 HBPLK 0065 C.v. Diclaert I Zwey Still=Leben mit Blumen und Früchten, auf Holz. I Diese Nr.: Ein Still=Leben mit Blumen und Früchten Mat.: auf Holz Maße: Höhe 17 Zoll 2 Linie, Breite 14 Zoll 7 Linie Anm.: Die Lose 64 und 65 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Dicos, Gerhard von [Nicht identifiziert] 1716/00/00 FRHDR 0216 Gerhard von Dicos I Gerhard von Dicos 3 nackende Kinder/ 2 stucke. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (15)
Die, van [Nicht identifiziert] 1763/01/19 FRJUN 0090 Van Die I Un beau tableau representant toutes sortes de poissons parfaitement execute. I Maße: hauteur 28 pouces, large 35 pouces Transakt.: Unbekannt (13 fl)
Diep, van [Nicht identifiziert] 1790/01/07 MUAN 1306 Diep van I Jupiter und Leda, auf Leinwat, in einer schwarzen Ram mit vergoldeten Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 7 Zoll, Breite 10 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
Diepenbeeck, Abraham Jansz. van 1750/00/00 KOAN 0119 Abraham Diepenbeck I Une piece, representant une Paisanne, avec un garcon & des fruits, sur bois par Abraham Diepenbeck. I Mat.: auf Holz Maße: Largeur 2 Pies 2 % Pouces, Haut 2 Pies 9 Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1750/04/00 HB AN 0044 Abraham Diepenbeck I Die Königin aus Arabien, wie sie die Geschencke an Salomon bringet, von Abraham Diepenbeck. I Transakt.: Unbekannt 518
GEMÄLDE
1764/05/18 BOAN 0035 Abraham Diepenbeck I Deux Pieces sur pierre de touche d'un pied de hauteur & dix pouces de largeur, l'une represente Jesus Christ au Calvaire avec l'Ange, l'autre Jesus Christ avec St. Pierre le penitent, peintes par Abraham Diepenbeck. [Zwey stück Vorstellend eins Christum am öhlberg mit dem Engel, und das andere Christum mit weinendem Petro auf einem Probierstein Von Abraham Diepenpeck gemahlt.] I Diese Nr.: Jesus Christ au Calvaire avec l'Ange Mat.: auf Stein Maße: 1 pied de hauteur & 10 pouces de largeur Anm.: Die Lose 35 und 36 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (45 Rt für die Nm. 35 und 36) Käufer: Neveu Gegenw. Standort: Paris, France. Musee du Louvre. (931) als Murillo 1764/05/18 BOAN 0036 Abraham Diepenbeck I Deux Pieces sur pierre de touche d'un pied de hauteur & dix pouces de largeur, l'une represente Jesus Christ au Calvaire avec l'Ange, l'autre Jesus Christ avec St. Pierre le penitent, peintes par Abraham Diepenbeck. [Zwey stück Vorstellend eins Christum am öhlberg mit dem Engel, und das andere Christum mit weinendem Petro auf einem Probierstein Von Abraham Diepenpeck gemahlt.] I Diese Nr.: Jesus Christ avec St. Pierre le penitent Mat.: auf Stein Maße: 1 pied de hauteur & 10 pouces de largeur Anm.: Die Lose 35 und 36 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (45 Rt für die Nrn. 35 und 36) Käufer: Neveu Gegenw. Standort: Paris, France. Musee du Louvre. (932) als Murillo 1769/03/30 HBTOU 0024 Dibenbeck I Die Liebe von Dibenbeck, auf Leinwand gemahlen. [Die Mehresten in fein verguldte Rahmen, und die übrigen in schwarz gebeizten mit goldenen Staber.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 4 Fuß 7 Zoll, Breite 3 Fuß 10 Zoll Anm.: Die Angaben in eckigen Klammem im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 51 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 51. Transakt.: Verkauft Käufer: Hofrath 1770/10/29 FRAN 0054 Diepenbeck I Die vier Evangelisten 4. Stück. I Maße: Hoch 36 Zoll. Breit 28 Zoll. Transakt.: Unbekannt 1774/08/13 HBBMN 0153 nes. I Transakt.: Unbekannt
Diepenbeck I Ein schlafender Johan-
1775/10/07 HBBMN 0001 A. Dipenbeck I Eine Mutter mit ihrem Kinde, wie sie dasselbe die Milch aus ihrer Brust im Munde sprützet, ein schönes Stück. I Transakt.: Unbekannt 1776/06/21 HBNEU 0074 Diebenbeck I Die Verehrung Christi, auf dito [Holz], I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 2 F 6 Z, Breite 3 F 8 Ζ Transakt.: Unbekannt 1777/04/11 HBNEU 0052 Dieppenbeck I Simeon im Tempel, auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Transakt.: Unbekannt 1777/05/26 FRAN 0536 Diebenböck I Bauren=Stück von Diebenböck. I Verkäufer: Finsterwalder Transakt.: Verkauft (7.30 fl) Käufer: Rath Eichhorn 1778/05/23 HBKOS 0012 Diepenbeck I Ein büßende Magdalena. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 31 Vi Zoll, Breite 24 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/05/23 HBKOS 0039 Diepenbeck I Die Geißelung Christi, sehr schön gemalet, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 20 Vi Zoll, Breite 16 Zoll Transakt.: Unbekannt (20 M)
1778/08/29 HBTEX 0095 Abr. Diebenbeck I Christi Himmelfahrt, meisterhaft gemahlt auf Leinewand. I Maße: Höhe 1 Fuß 4 Zoll, Breite 1 Fuß 1 Zoll Transakt.: Unbekannt
Hand auf das ihrige leget, mit freyem Pinsel gemahlt, wie P.P. Rubens, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 38 Zoll, breit 27 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (3 M) Käufer: Ego
1778/09/28 FRAN 0523 Diepenbeck I Eine Frau, so ihr Kind mit Milch bespritzet, von Diepenbeck, so schön wie P.P. Rubens. [Une femme faisant rejaillir du lait sur son enfant, par Diepenbeck, de la meme beaute que les ouvrages de P. P. Rubens.] I Maße: 1 Schuh 8 Zoll breit, 2 Schuh 2 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (54 fl) Käufer: Hüsgen
1790/04/13 HBLIE 0146 Diebenbeck I Maria hält das Christkindlein an sich, welches sanft an ihrer Brust eingeschlafen; sehr frey gemahlt. Auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 30 Zoll, breit 24 Zoll Transakt.: Verkauft (7 Sch) Käufer: Fick
1782/03/18 HBTEX 0186 Diepenbeck I Die Erhöhung der Schlange in der Wüsten, extra schön gemahlt, wie Rubens, auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 38 Zoll 6 Linien, Breite 58 Zoll 6 Linien Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1783/06/19 HBRMS 0227 Abr. Diepenbeck I Die Geburt Christi mit großen Figuren. L[einwand], s.R. [schwarzer Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: 5 Fuß 8 Zoll hoch, 5 Fuß 10 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1785/05/17 MZAN 0926 Dieppenbeck I Die Reinigung Maria von Dieppenbeck auf Kupfer. [La purification de la S. Vierge.] I Mat.: auf Kupfer Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 1 Schuh 7 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (13.30 fl) Käufer: Zitz 1785/05/17 MZAN 0927 Dieppenbeck I Das letzte Abendmal von eben demselben [Dieppenbeck]. [L'institution de la S. Cene par le meme [Dieppenbeck].] I Maße: 1 Schuh 8 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 1 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (10 fl) Käufer: Schwanck 1785/05/17 MZAN 1131 Dieppenbeck I Die Kreuzigung Christi auf Kupfer von Dieppenbeck. [Jesus Christ mis ä la croix.] I Mat. : auf Kupfer Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch, 1 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (20.30 fl) Käufer: Peter Pfannenkuch 1786/10/18 HBTEX 0049 Dibenbeck I Die Creuzschleifung Christi, lebhaft und fleißig gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Zoll, breit 11 Zoll 9 Linien Transakt.: Unbekannt 1787/00/00 HB AN 0177 Abraham Dieppenbeck I Neptunus auf dem Meere, mit der Gabel in der Hand, woran zwey Fische hängen, auf seinem güldenen Wagen stehend, mit vier muthigen Seepferden bespannt, so von Kindern geführt werden, umgeben mit einer Menge Tritonen und Nereiden. Ihm nach folgt die Venus, auf einem Dolphin sitzend, und einem zahlreichen Gefolge von See=Nymphen. Besonders schön und frey gemahlt, und von einer richtigen Zeichnung, wie Rubens. A.K. [Auf Kupfer] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 20 V2 Zoll, breit 27 Zoll Transakt.: Verkauft (55 M) Käufer: Fesser 1787/10/06 HBTEX 0022 Ab. Diepenbeck I Apollo mit die Musen auf dem Pamaß, ein capitales Stück, von Ab. Diepenbeck, im vergoldeten Rahm. I Transakt.: Unbekannt 1788/04/08 FRFAY 0176 Diepenbeck I Das Bildniß einer vornehmen Dame als Diana, vorgebildt von Diepenbeck. Auf Tuch. I Mat.: auf Leinwand Maße: 22 V2 Z. hoch, und 18 Vi Z. breit Transakt.: Verkauft (5.15 fl) Käufer: Levi ν M[annheim] 1789/04/16 HBTEX 0020 Abr. Diöbenbeck I Die Creutzschleufung [sie] Christi nach dem Berge Golgatha, mit vielen Figuren; vortrefflich gemahlt auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 23 Vi Zoll, breit 19 Zoll Transakt.: Verkauft (9 M) Käufer: Flügge 1789/06/12 HBTEX 0029 Dieppenbeck I Die Verehrung Christi. Von großer Ordonence, mit vielen Figuren, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 32 Zoll, breit 46 Zoll Transakt.: Verkauft (10.4 M) Käufer: Krüger 1790/02/04 HBDKR 0069 Diebenbeck I Maria hält mit innigstem Vergnügen das Christkindlein, welches vor ihr steht und seine
1790/05/20 HBSCN 0232 A. Dieppenbceck I Maria hält mit innigstem Vergnügen das Christkindlein, welches vor ihr steht und seine Hand auf die ihrige legt. Mit freyen Pinsel gemahlt, wie Rubens, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 38 Zoll, breit 27 Vi Zoll Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (4 M) Käufer: Richardi 1790/08/25 FRAN 0371 Diepenbeck I Die Göttin Diana mit einigen Windhunden die einen Hirsch verfolgen. I Maße: hoch 36 Zoll, breit 51 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (15 fl) Käufer: Kaller 1791/07/29 HBBMN 0041 Diepenbeck I Die Geisselung des Heilandes; auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Vi Zoll, breit 11 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt (7 Sch) 1791/07/29 HBBMN O l l i Diepenbeck I Eine heilige Familie; auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 27 Zoll, breit 22 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt (12 Sch) 1791/10/21 HBRMS2 0016 Abraham Dieppenbaeck\ Oer Vainassus. Im Vordergrunde sitzen und stehen durcheinander die Musen, welche zum Theil musiciren, hinten sitzt die Pallas, in der Entfernung eine angenehme Aussicht. Ganze Figuren. Von schöner und richtiger Zeichnung, brillanten colloriter und delicater Mahlerey. Auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 49 Zoll, breit 79 Zoll Transakt.: Unbekannt 1792/09/07 HBBMN 0161 A. Dieppenbaeck I Wie Isaac seinem Sohne Jacob segnet. Ein meisterhaftes Gemähide, von A. Dieppenbaeck. Auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Transakt.: Verkauft (11.12 M) Käufer: Eckhardt 1792/09/28 HBBMN 0012 Dieppenbeck I Die Creutzschleifung Christi, von Dieppenbeck. Auf L[einwand]. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 30 Zoll, breit 22 % Zoll Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 HBMFD 0035 Diepenbeck I Eine heilige Familie von sehr schönen Stiel. Maria sitzt beynah von vorne zu sehen, und hält das auf ihrem Schosse ruhende Christkind an der Brust; Sie unterredet sich mit Elisabeth. Johannes befindet sich vor seiner Mutter zur Rechten des Gemäldes, und scheinet die Füsse des Heylandes küssen zu wollen, neben ihm ein Lamm. Links wird man den Joseph hinter einer Säule gewahr, an welcher eine Gardine herunter hängt. Im Hintergrunde eine Landschaft. Die Carnation in diesem Gemälde ist schön; die Tinten sind gefällig und helle; die Contoure sind delicat und meisterhaft. I Mat.: auf Kupfer Maße: 1 Fuss 2 Zoll hoch, 10 Zoll breit Verkäufer: Pierre Laporterie Transakt.: Unbekannt 1796/02/17 HBPAK 0024 Diepenbeck I Die Verehrung Christi von den heiligen drey Königen, die ihm ihre Geschenke darbringen. Auf Kupfer, (Compagnon zu No. 20). I Pendant zu Nr. 20, Schule des Reni Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 11 Ά Zoll, Breite 15 Zoll Transakt.: Verkauft (160 Μ für die Nm. 20 und 24) Käufer: Packi 1796/02/17 HBPAK 0078 Abr. Diepenbeck I Maria hält das Kind Jesu sanft, stehend auf ihrem Schoosse; zwey Engel halten eine grüne Gardine, mit goldenen Franzen besetzt, über ihnen. Auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 18 % Zoll, Breite 13 % Zoll Transakt.: Verkauft (70 M) Käufer: Eckhardt 1796/11/02 HBPAK 0031 Diepenbeck I Maria trägt das Christkind auf ihrem rechten Arm, an derselben ein Engel auf der Zitter, und zur Linken ein Engel auf der Violine spielend. Dieses Bild kann an Schönheit und Ausdruck, Rubens oder van Dyke an die Seite geGEMÄLDE
519
stellt werden. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 48 Zoll, breit 40 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0094 A. Diepenbeck I Die Auferstehung Christi. Ganz im Rubenschen Geschmack. Auf Leinw. Goldn. Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 15 Zoll, breit 13 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/00/00
WZAN
A0043
Abraham
van Dieppenbeck
I Die
Abnehmung vom Kreuze, Maria und der todte Christus, halb auf ihrem Schooße und auf der Erde liegend, nebst einigen Engeln und einer Mannsperson, welche auf einer Leiter steht, von Abraham van Dieppenbeck. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 4 Zoll breit 1 Schuh 7 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/10/17 LZAN 0017 Dieppenbek I Ein Fragment von einem grossen Bild, worauf zwey Figuren, sehr meisterhaft gemahlt; hoch 16 Zoll, breit 23 Zoll. Vergoldeter Rahm. I Maße: hoch 16 Zoll, breit 23 Zoll Verkäufer: Rauch Transakt.: Verkauft (4.16 Th) Käufer: Geist 1800/11/12 HBPAK 0619 N. Diepenbeck I Zwey Stücke. Christi Kreuztragen, und Magdalena. I Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "N. Diepenbeck", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt
Diepenbeeck, Abraham Jansz. van (und Son, J.F.) 1796/10/17 HBPAK 0166 Jan von Sonn; Dietenbeck I Einen Blumenkranz um einer Nische mit Blumen und Früchten, worinnen Maria, Christus und Johannes; von Dietenbeck sehr gut gemahlt. Auf Leinw. Schw. Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 72 Zoll, breit 58 Zoll Transakt.: Unbekannt
Diepenbeeck, Abraham Jansz. van (Kopie von) 1785/05/17 MZAN 0619 Dieppenbeck; Rubens I Das letzte Gericht von Dieppenbeck nach Rubens. [Le jugement universel par Dieppenbeck d'apres Rubens.] I Kopie von A.J. Diepenbeeck nach Rubens Maße: 3 Schuh 4 Zoll hoch, [?] Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (48.30 fl) Käufer: Leüzgen 1785/05/17 MZAN 0793 Dieppenbeck; Rubens I Magdalena die dem Heiland die Füsse wascht von Dieppenbeck nach Rubens. [Madelaine lavante les pieds de Jesus Christ par Dieppenbeck d'apres Rubens.] I Kopie von A.J. Diepenbeeck nach Rubens Maße: 1 Schuh 10 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 7 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (20.30 fl) Käufer: Strecker
Diepenbeeck, Abraham Jansz. van (Geschmack von) 1791/09/26 FRAN 0365 Diepenbeck I Lustige Bacchantinnen und spielende Kinder, im Geschmack von Diepenbeck. I Maße: 32 Zoll breit, 26 Zoll hoch Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt
Diepenbeeck, Abraham Jansz. van (Kopie nach) 1800/11/12 HBPAK 0033 Dipenbeck I Die Verspottung Christi, nach Dipenbeck. I Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0229 Piepenbeck I Zwey Stücke; Christus und Maria, nach Piepenbeck. I Diese Nr.: Ein Stück; Christus Anm.: Die Lose 229 und 230 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0230 Piepenbeck I Zwey Stücke; Christus und Maria, nach Piepenbeck. I Diese Nr.: Ein Stück; Maria Anm.: Die Lose 229 und 230 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 520
GEMÄLDE
Diepenbeeck, Abraham Jansz. van (Manier) 1796/10/17 HBPAK 0075 In der Manier von Dietenbeck I Die heilige Familie, Christus aufm Schooß Mariä, und Joseph und Johannes. Auf Holz. Schwarzer Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 14 Zoll Transakt.: Unbekannt
Diepenbeeck, Abraham Jansz. van (Schule) 1779/05/08 HBHRN 0043 Diepenbeck I Eine Kreuzigung Christi mit den beyden Schachern, gelb in gelb gemahlt; ist eine Scitze aus der Diepenbeckischen Schule. I Transakt.: Unbekannt
Diepraem, Abraham 1782/09/30 FRAN 0311 Dieprams I Das Innwendige einer Bauemschenke, worin ein Bauerntambour die trinkenden Gäste mit seiner Trommel belustigt, von Dieprams, Schüler des Adrian Brouwers, 1677 verfertigt. [L'interieur d'un cabaret villageois, un tambour paysan amüsant les buveurs en battant la caisse, par Dieprams, ecolier d'Adrien Brouwer, peint en 1677.] I Maße: 1 Schuh 6 Zoll hoch, I Schuh 10 Zoll breit Inschr.: 1677 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (20 fl) Käufer: Küstner 1784/08/02 FRNGL 0379 Duprams I Eine Bauren=Schencke mit vielen Niederländischen Bauren, wie sich selbige erlustigen, von Duprams, Schüler von Teniers. I Maße: 22 Zoll breit, 18 Zoll hoch Verkäufer: Β Transakt.: Verkauft (6 fl) Käufer: von Schmidt 1794/00/00 HB AN 0140 Du Pram I Ein alter am Knie verwundeter Bauer legt sich selbst Pflaster auf seine Wunde. I Maße: Höhe II Zoll, Breite 9 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 HB AN 0154 A. du Pram I Ein Wundarzt verbindet, in seiner Wohnung, einen am Halse Verwundeten; ein anderer streicht Pflaster, über einem Kohlenfasse. I Maße: Höhe 10 Vi Zoll, Breite 8 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt
Diest, Willem van 1790/01/07 MUAN 0365 Diest W. van I Ein Seestück, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 8 Zoll, Breite 1 Schuh 2 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
Dietrich, Christian Wilhelm Ernst 1743/00/00 BWGRA 0063 Dietrich I Ein betender Hieronymus von Dietrich. I Pendant zu Nr. 64, Kopie nach B. Strozzi Maße: hoch 5 Fuß 7 Zoll, breit 4 Fuß 2 Zoll Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0084 Dietrich I Eine Gesellschaft in Masquen-Habit von Dietrich in den Gout von Wateau gemahlet. I Maße: hoch 2 Fuß 6 Zoll, breit 2 Fuß 6 Zoll Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0085 Dietrich I Wie Cupido eine Gesellschaft en masque zu zween Verliebten hinführet, von vorigen maitre [Dietrich], I Maße: hoch 2 Fuß 6 Zoll, breit 2 Fuß 6 Zoll Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0086 Dietrich I Ein Vieh=Stück vom vorigen maitre [Dietrich], in die Manier des Rosa de Tivoli. I Pendant zu Nr. 87 Maße: hoch 2 Fuß 7 Zoll, breit 3 Fuß 6 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0087 Dietrich I Der Compagnon zum vorigen, auch von Dietrich und von gleicher Manier [des Rosa de Tivoli], I Pendant zu Nr. 86, "Ein Vieh=Stück" Maße: hoch 2 Fuß 7 Zoll, breit 3 Fuß 6 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0094 Dietrich I Der sterbende Hieronymus, wie er die Communion empfängt, gemahlt von Dietrich, ein
Stück mit vielen Figuren. I Maße: hoch 2 Fuß, breit 1 Fuß 6 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0160 Dietrich I Eine Landschaft den Morgen vorstellend von Dietrich. I Maße: hoch 8 Zoll, breit 11 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0161 Dietrich I Wie Loth mit den Seinigen aus Sodom gehet von voriger Hand [Dietrich]. I Pendant zu Nr. 162, Schule des C. Poelenburgh Maße: hoch 8 Vi Zoll, breit 11 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0163 Dietrich I Ein Scharmützel von Reutern von Dietrich. I Pendant zu Nr. 164 Maße: hoch 1 Fuß, breit 1 Fuß 2 Zoll Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0164 Dietrich I Der Compagnon, vom vorigen maitre [Dietrich]. I Pendant zu Nr. 163, "Ein Scharmützel" Maße: hoch 1 Fuß, breit 1 Fuß 2 Zoll Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0165 Dietrich I Zwey Vieh=Stück in die Manier des Rose Tivoli, gemahlt von Dietrich. I Diese Nr.: Ein Vieh=Stück Maße: hoch 1 Fuß 7 Zoll, breit 1 Fuß 2 Vi Zoll Anm.: Die Lose 165 und 166 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0166 Dietrich I Zwey Vieh=Stück in die Manier des Rose Tivoli, gemahlt von Dietrich. I Diese Nr.: Ein Vieh=Stück Maße: hoch 1 Fuß 7 Zoll, breit 1 Fuß 2 Vi Zoll Anm.: Die Lose 165 und 166 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0167 Dietrich I Ein Manns Kopf, auch von Dietrich. I Maße: hoch 1 Fuß 2 Zoll, breit 11 Zoll Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0168 Dietrich I Eine Landschaft vom vorigen maitre [Dietrich]. I Maße: hoch 1 Fuß 1 Vi Zoll, breit 1 Fuß Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0193 Dietrich I Ein Frauenzimmer in masquen-Habit von Dietrich. Compagnon zum vorigen. I Pendant zu Nr. 192 von Richard Maße: hoch 1 Fuß 10 Zoll, breit 1 Fuß 6 Zoll Transakt.: Unbekannt 1749/07/31 HBRAD 0071 Dieterichs I Kräuter und Insecten. I Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (8.12) 1750/00/00 KOAN 0181 Dietrich I Une tete, dans le gout de Rembrand, sur bois, l'une des meilleures pieces de Dietrich. I Mat.: auf Holz Maße: Largeur 9 % Pouces, Haut 11 Vi Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1750/06/15 HBRAD 0090 Diedrichs I Diedrichs, zwey plaisante Landschaften. I Diese Nr.: Eine plaisante Landschaft Anm.: Die Lose 90 und 91 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1750/06/15 HBRAD 0091 Diedrichs I Diedrichs, zwey plaisante Landschaften. I Diese Nr.: Eine plaisante Landschaft Anm.: Die Lose 90 und 91 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1759/00/00 LZEBT 0002 Dietrich I Der Herr Christus in seinem 12ten Jahr im Tempel lehrend [Beyde auf Holtz], I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 11 Vi Zoll, Breite 1 Schuh 6 Zoll Anm.: In Nr. 3 wird das Material für die Nrn. 2 und 3 angegeben. Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (300 Th für die Nrn. 2 und 3, Schätzung) 1759/00/00 LZEBT 0003 Dietrich I Die Auferweckung Lazari auf Holtz Beyde auf Holtz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 11 Vi Zoll, Breite 1 Schuh 6 Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (300 Th für die Nrn. 2 und 3, Schätzung) 1759/00/00 LZEBT 0011 Dietrich I Eine Landschaft auf Holtz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 7 Zoll, Breite 1 Schuh Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (60 Th Schätzung)
1759/00/00 LZEBT 0211 Dietrich I Die Vorstellung des H. Christi der [sie] volcke [?] auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 3 Schuh 1 Zoll, Breite 4 Schuh 5 Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (500 Th für die Nrn. 211 und 212, Schätzung) 1759/00/00 LZEBT 0212 Dietrich I Die Abnehmung des H. Christi vom Creutz auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 3 Schuh 1 Zoll, Breite 4 Schuh 5 Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (500 Th für die Nm. 211 und 212, Schätzung) 1763/00/00 BLAN 0065 Christian Willhelm Emst Dieterich 1 Ein Hirtenstück. Auf Leinewand gemahlt, 2 Fuß hoch, und 2 Fuß 6 Zoll breit. Der schmeichelnde Pinsel des Dieterichs, in dessen jedem Zuge eine Meisterhand steckt, ist freylich nur allein fähig uns immer neue Schönheiten in seiner Kunst vorzustellen. Mit welcher lieblichen Anmuth und stolzen siegenden Reitze hat er abermahls dieses Stück gezieret! Der erste Blick davon gewähret schon ein süßes Vergnügen; wie stark, wie rührend und entzückend muß es aber dann seyn, wenn man mit Ueberlegung die meisterlichen Ausschmückungen desselben betrachtet. Die Berge und überhaupt die ganze Gegend sind mit bewundernswürdiger Volkommenheit, sehr natürlich und schön vorgestellet. Man entdecket einen Weg, in welchen eine Hirtinn ihre Heerde treibet; eine kleine Fläche auf welcher einige junge reitzende Schäferinnen, um welche einige Schafe liegen, ruhen, wovon die eine tanzet; und endlich einen auf der Erde sitzenden Hirten, der auf die Flöte spielet. Die Haltung, das Colorit und die Zeichnung, in welcher etwas vom Geschmack des Gerard de Laireße herrscht, sind unvergleichlich schön. Wolte man diesem Stücke einen allgemeinen gegründeten Beyfall streitig machen; so könnte man vielleicht die Stellung der einen Schäferinn, die über ihre Achsel wegsiehet, ein wenig zu frey, aber keinesweges unnatürlich nennen, wie sich gleichwol einige auszudrucken, erdreistet haben. Man darf nur wenige Einsicht in der Zeichnung, die nach dem Leben geschieht, haben, und die natürliche Beschaffenheiten, Gewohnheiten, Verhältnisse und Sitten der Menschen kennen, oder kurz zu sagen, man darf sie nur so nehmen wie sie sind, um von dem Irrthume, daß die Stellung dieser Schäferinn unnatürlich sey, abzustehen. Sind nicht die Wendungen eines jungen Mädchens, das ohne Einpressungen, ohne verhüllten Kleidern, ohne Zwang, frey und munter lebt, gar sehr von der Wendungen der eingekerkerten und vermummten Frauenzimmer verschieden? Jene geschehen nach den Empfindungen des Herzens, diese nach denen strengen Gesetzen der Mode. Was Wunder, wenn die ersteren daher auch viel freyer als die letzteren sind. Und wird nun Dieterichs Figur unnatürlich seyn, da sie eine Schäferinn vorstellet, die zu keiner gezwungenen Stellung erzogen wird? Raphael und Parmeggiannino haben auch oft dergleichen freye Stellungen in ihren Gemählden angebracht, wie man in ihren schönen Kupferstichen deutlich sehen kann. Es bleibt also ohnstreitig gewiß, daß Dieterich hier keine unnatürliche, sondern nur eine etwas zu freye Figur gezeichnet habe. Die übrigen Volkommenheiten aber, womit dieses Bild den Beyfall der Kenner nach sich zieht, verdunkeln völlig diesem kleinen Fehler. Der Effect der untergehende Sonne, den man am Horizonte erblicket, giebt dem ganzen Stükke einen ausnehmende Glanz. [Text hier gekürzt] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß hoch, und 2 Fuß 6 Zoll breit Verkäufer: Johann Gottlieb Stein Transakt.: Unbekannt 1763/01/17 HNAN [A]0067 Dietrichs I Deux Portrait d'un Vieillard, & d'une Vieille Femme, sur bois, par Dietrichs. I Diese Nr.: Un Portrait d'un Vieillard Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 1 pied 2 pouces, Largeur 11 pouces Anm.: Die Lose [A]67 und [A]68 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt 1763/01/17 HNAN [A]0068 Dietrichs I Deux Portrait d'un Vieillard, & d'une Vieille Femme, sur bois, par Dietrichs. I Diese Nr.: Un Portrait d'une Vieille Femme Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 1 pied 2 pouces, Largeur 11 pouces Anm.: Die Lose [A]67 und [A]68 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
521
1764/00/00 BLAN 0164 Diedrich I 1. in geschmack des Philip Wouwermanns verfertigtes Cabinet Stück. I Maße: 1 Fuß 8 Vi Zoll hoch, 2 Fuß V* Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (150 Rt Schätzung) Gegenw. Standort: Sankt-Peterburg, Rossiya. Ermitazh. (N 2603) 1764/00/00 BLAN 0450 Diederich I 2. Extra feine gemahlte kleine landschaften. I Diese Nr.: Eine feine gemahlte kleine landschaft Maße: 10 Zoll hoch, 1 Fuß Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 450 und 451 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (200 Rt für die Nrn. 450 und 451, Schätzung) Gegenw. Standort: Sankt-Peterburg, Rossiya. Ermitazh. (N 1337) (?) 1764/00/00 BLAN 0451 Diederich I 2. Extra feine gemahlte kleine landschaften. I Diese Nr.: Eine feine gemahlte kleine landschaft Maße: 10 Zoll hoch, 1 Fuß Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 450 und 451 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (200 Rt für die Nrn. 450 und 451, Schätzung) Gegenw. Standort: Sankt-Peterburg, Rossiya. Ermitazh. (N 1800) (?) 1764/03/12 FRKAL 0032 Ditrichs \ Un foudroyement sur un chariot de foin avec des Chevaux dans un pai'sage, bien & vigoureusement peint. I Maße: hauteur 12 V* pouces, largeur 20 pouces Transakt.: Unbekannt (24 fl) 1764/05/18 BLAN 0048 Christian Wilhelm Ernst Dieterich 1 Die Anbetung der Hirten. Gantze Figuren, auf Leinewand gemahlt, 2 Fuß 4 Zoll hoch und 1 Fuß 8 Zoll breit. Dieses Gemähide ist eine Copie von einem der allerschönsten und berühmtesten Bilder, die bekannt sind. Das Original=Gemählde befindet sich in der Königlichen Bilder=Gallerie in Dreßden; und einer der allerberühmtesten Kupferstecher unserer Zeiten, Surugue {Regueil D Estampes d'äpres les plus celebres Tableaux de la Gallerie Rojale de Dresde, Tom. II. No. I. gr. Folio, ä Dresde 1757) in Paris, hat es in Kupfer gestochen. Es ist selbiges ehedem die Zierde der Gallerie der D'Este in Modena gewesen. Dieterich hat dieses Bild auch für Ihro Majestät den König von Preußen in der Größe des Originals auf Leinewand copirt, doch hat er sich dadurch nicht viel Ehre verdient. Man kann ihn deshalb damit entschuldigen, daß er seine Copie verfertigen müssen, ohne das Original beständig vor Augen haben zu können. Diese kleine Kopie ist um ein vieles besser und schöner. I Pendant zu Nr. 49 Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 4 Zoll hoch und 1 Fuß 8 Zoll breit Verkäufer: Johann Georg Eimbke Transakt.: Verkauft (232 Rt für die Nrn. 48 und 49) Käufer: Ghk Eichel 1764/05/18 BLAN 0049 Christian Wilhelm Ernst Dieterich I Die Beschenckung der heiligen drey Könige. Gantze Figuren, auf Leinewand gemahlt, 2 Fuß 4 Zoll hoch und 1 Fuß 8 Zoll breit. Dieses Bild ist eine schöne Composition, von seiner selbst eigenen Erfindung, das er zum Compagnon des vorigen Gemähides verfertiget hat. Er hat es Anno 1756. gemahlt. Die Haltung in Licht und Schatten ist sehr schön; und das ganze Gemähide in dem Geschmack des Ekhout ganz vollkommen gemahlt, wie denn Dieterich in seinen Nachahmungen besonders glücklich ist. I Pendant zu Nr. 48 Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 4 Zoll hoch und 1 Fuß 8 Zoll breit Inschr.: Anno 1756 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Johann Georg Eimbke Transakt.: Verkauft (232 Rt für die Nrn. 48 und 49) Käufer: Ghk Eichel 1764/05/18 BLAN 0050 Christian Wilhelm Ernst Dieterich I Eine Landschafft. Auf Leinewand gemahlt, 1 Fuß 4 Zoll hoch und 1 Fuß 9 Zoll breit. Die Landschafft stellet einen Sandhügel vor, worüber ein Gewitter aufsteiget, welches sehr schön und natürlich ausgedrückt ist. Der Effect ist besonders schön in diesem Bilde, und die Mahlerey in dem Geschmacke des Wouwermann. I Pendant zu Nr. 51 Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 4 Zoll hoch, und 1 Fuß 9 Zoll breit Verkäufer: Johann Georg Eimbke Transakt.: Verkauft (85 Rt für die Nrn. 50 und 51) Käufer: Cesar 522
GEMÄLDE
1764/05/18 BLAN 0051 Christian Wilhelm Emst Dieterich I Dieses Bild ist der Compagnon zu dem vorigen, und stellet eine bergichte Gegend, durch die ein Ruß rinnt, mit der untergehenden Sonne vor. Alles das ist sehr schön vorgestellet, die Haltung vortreflich, und die Mahlerey in dem Geschmacke des Ewerdingen. I Pendant zu Nr. 50 Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 4 Zoll hoch, und 1 Fuß 9 Zoll breit Verkäufer: Johann Georg Eimbke Transakt.: Verkauft (85 Rt für die Nrn. 50 und 51) Käufer: Cesar 1764/05/18 BLAN 0052 Christian Wilhelm Ernst Dieterich I Eine Landschafft mit Vieh und Figuren. Auf Leinewand gemahlt, 2 Fuß 7 Zoll hoch und 3 Fuß 3 Zoll breit. Bey der Betrachtung eines Gemähides ist etwas, das vorangehen muß. Und dieses ist, wie iemand sagt, die Belustigung der Augen, die in den ersten Reitzungen besteht. Dieses findet man in diesen beiden Gemählden in der grasten Vollkommenheit. Die Rudera eines alten auf einem Berge gelegenen Schlosses sind sehr schön, und durch die Kunst natürlich vorgestellet. Auf dem Vordergründe sind Figuren und Vieh; alles in dem Geschmack des Poulemburg gemahlt. Die Figuren sind schön gezeichnet, und das Colorit angenehm. Dieterich hat dieses Bild Anno 1754. gemahlt. I Pendant zu Nr. 53 Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 7 Zoll hoch und 3 Fuß 3 Zoll breit Inschr.: Anno 1754 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Johann Georg Eimbke Transakt.: Verkauft (480 Rt für die Nrn. 52 und 53) Käufer: Wilman 1764/05/18 BLAN 0053 Christian Wilhelm Ernst Dieterich 1 Eine Landschafft mit Vieh und Figuren. Auf Leinewand gemahlt, 2 Fuß 7 Zoll hoch und 3 Fuß 3 Zoll breit. Wiewohl dieses Bild, welches der Compagnon zu dem vorigen ist zu derselben Zeit gemahlt ist, so entdeckt man doch darin viele Schönheiten mehr, als in ienem. Die Vorstellung ist eine bergichte Gegend. Auf den Anhöhen sind einige Rudera, welche besonders schön gemahlt sind. Die Haltung im Colorit ist bewundernswürdig. Die Figuren sind mit einem großen und besondern Fleiße gezeichnet und ausgemahlt. Das stehende nackende Frauenzimmer im Rücken anzusehen, und der kleine vor ihr stehende Knabe, übertreffen alles, was Mieris, Poulenburg, und van der Werff Schönes in der Art gemahlt haben. Dieses Gemähide ist für den Kenner unschätzbar, indem der zärtliche van der Werff, dessen Arbeiten mit Golde aufgewogen werden, so daß sie nur allein die Cabinette der Großen der Welt zieren, niemahls etwas schöners in der Art und mit der Vollkommenheit verfertiget hat. [Text hier gekürzt], I Pendant zu Nr. 52 Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 7 Zoll hoch und 3 Fuß 3 Zoll breit Verkäufer: Johann Georg Eimbke Transakt.: Verkauft (480 Rt für die Nm. 52 und 53) Käufer: Wilman 1767/00/00 KOAN 0108 Dietrich I Ein Kopf im Rembrantischen Gusto auf Holtz, eines der besten von Dietrich. I Mat.: auf Holz Maße: Breite 1 Fuß 5 % Zoll, Höhe 1 Fuß 8 Zoll Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt 1774/10/05 HB NEU 0062 Diedrichs I Zwey alte Köpfe. I Diese Nr.: Ein alter Kopf Anm.: Die Lose 62 und 63 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1774/10/05 HBNEU 0063 Diedrichs I Zwey alte Köpfe. I Diese Nr.: Ein alter Kopf Anm.: Die Lose 62 und 63 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1775/00/00 BLAN 0014 Dietrich I 2 alte Köpfe dito [in gld. Rahm]. I Verkäufer: George Friedrich Schmidt Transakt.: Unbekannt 1775/00/00 BLAN 0015 Dietrich I 2 dito [alte Köpfe] dito [in gld. Rahm], I Verkäufer: George Friedrich Schmidt Transakt.: Unbekannt 1775/00/00 BLAN 0016 Dietrich I Eine Landschaft in schwarzen Rahm. I Verkäufer: George Friedrich Schmidt Transakt.: Unbekannt
1775/00/00 BLAN 0017 Dietrich I Ein Viehstück in schwarz. Rahm. I Verkäufer: George Friedrich Schmidt Transakt.: Unbekannt
1777/04/11 HBNEU 0074 Dieterichs I Bachus mit Satyren und Kinder. I Transakt.: Unbekannt
1775/00/00 BLAN 0018 Dietrich I Zwey Köpfe dito [in schwarz. Rahm]. I Verkäufer: George Friedrich Schmidt Transakt.: Unbekannt
1777/05/26 FRAN 0158 Dietrich I Bataille. I Verkäufer: Finsterwalder Transakt.: Verkauft (2.40 fl) Käufer: Zimmer
1775/00/00 BLAN 0044 Dietrich I Zwey Landschaften mit Vieh in schwarzen Rahm. I Verkäufer: George Friedrich Schmidt Transakt.: Unbekannt 1775/00/00 BLAN 0049 Dietrich I Die Verkündigung der Geburt Christi an die Hirten, und die Geburt Christi, in golden Rahm. I Verkäufer: George Friedrich Schmidt Transakt. : Unbekannt 1775/10/07 HBBMN 0005 Diderichs I Zwey Vieh=Stücke. I Diese Nr.: Ein Vieh=Stück Anm.: Die Lose 5 und 6 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1775/10/07 HBBMN 0006 Diderichs I Zwey Vieh=Stücke. I Diese Nr.: Ein Vieh=Stück Anm.: Die Lose 5 und 6 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1775/11/18 HBBMN 0078 Diedrichs I Zwey schöne plaisante Landschaften. I Diese Nr.: Eine schöne plaisante Landschaft Anm.: Die Lose 78 und 79 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1775/11/18 HBBMN 0079 Diedrichs I Zwey schöne plaisante Landschaften. I Diese Nr.: Eine schöne plaisante Landschaft Anm.: Die Lose 78 und 79 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1776/00/00 WZTRU 0235 Christianus Dietrich I Compagnion zu Nro. 234 von Christianus Dietrich, stellet vor eine Landschaft mit einem alten Gebäude sammt einer am Berge sitzenden Hirtenfrau, welche vieles Viehe um sich herum weiden hat: dieses Stücke ist von artiger Practic und Colorit des Meisters verfertiget. I Pendant zu Nr. 234 von Chr. Brand Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (4 fl Schätzung) 1776/00/00 WZTRU 0363 Christianus Dietrich I Ein Stück 6 Zoll hoch, 5 Zoll breit von Christianus Dietrich, stellet vor eine in einer Bauernstube versammelte Gesellschaft, wo das Mittagmahl gehalten wird, die Frau haltet das Kind an der Brust, der Mann theilet unter die übrige Kinder Brod aus, und man siehet verschiedenes Geschirr hie und da stehen: Dieses Stück ist von sonderbarem Gusto, angenehmer Colorit, wohlausgeführtem Schatten und Licht, und mit fleißiger Ausarbeitung verfertiget. I Pendant zu Nr. 364 Maße: 6 Zoll hoch, 5 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (4 fl Schätzung) 1776/00/00 WZTRU 0364 Christianus Dietrich l Compagnion zu Nro. 363. Stellet ein eben dergleiches Bauernstück vor, von nämlicher Güte und Stärke des Meisters [Christianus Dietrich], I Pendant zu Nr. 363 Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (4 fl Schätzung) 1777/02/26 HBKOS 0040 Diedrichs I Zwey sehr fleißige Landschaften. I Diese Nr.: Eine sehr fleißige Landschft Maße: Höhe 1 Fuß 1 Vi Zoll, Breite 1 Fuß 4 Zoll Anm.: Die Lose 40 und 41 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1777/02/26 HBKOS 0041 Diedrichs I Zwey sehr fleißige Landschaften. I Diese Nr.: Eine sehr fleißige Landschft Maße: Höhe 1 Fuß 1 Vi Zoll, Breite 1 Fuß 4 Zoll Anm.: Die Lose 40 und 41 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1777/04/11 HBNEU 0022 Dieterichs I Zwey angenehme Prospecte. I Diese Nr.: Ein angenehmer Prospect Anm.: Die Lose 22 und 23 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1777/04/11 HBNEU 0023 Dieterichs I Zwey angenehme Prospecte. I Diese Nr.: Ein angenehmer Prospect Anm.: Die Lose 22 und 23 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1778/05/16 HBBMN 0032 Diedrichs I Zwey alte philosophische Köpfe, in dem Gusto von Rembrand. I Diese Nr.: Ein alter philosophischer Kopf Anm.: Die Lose 32 und 33 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/05/16 HBBMN 0033 Diedrichs I Zwey alte philosophische Köpfe, in dem Gusto von Rembrand. I Diese Nr.: Ein alter philosophischer Kopf Anm.: Die Lose 32 und 33 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/05/30 HBKOS 0004 Diethrichs I Zwey Hirthen=Stücke, mit Rinder und Schaafe, von Diethrichs, auf Leinwand. [Diese Gemählde sind alle mittlere Grösse, können also an alle Plätze gebraucht werden - dieweilen keine Theilen=Stück, dabey befindlich] I Diese Nr.: Ein Hirthen=Stück, mit Rinder und Schaafe Annotat.: brauner [?] Hirsch (KH) Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 4 und 5 wurden zusammen katalogisiert. Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 150 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 150. Verkäufer: Dr Friederici Transakt.: Verkauft (10.8 Μ für die Nm. 4 und 5) Käufer: Eckhardt 1778/05/30 HBKOS 0005 Diethrichs I Zwey Hirthen=Stücke, mit Rinder und Schaafe, von Diethrichs, auf Leinwand. [Diese Gemählde sind alle mittlere Grösse, können also an alle Plätze gebraucht werden - dieweilen keine Theilen=Stück, dabey befindlich] I Diese Nr.: Ein Hirthen=Stück, mit Rinder und Schaafe Annotat.: brauner [?] Hirsch (KH) Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 4 und 5 wurden zusammen katalogisiert. Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 150 und beziehen sich auf die Nm. 1 bis 150. Verkäufer: Dr Friederici Transakt.: Verkauft (10.8 Μ für die Nm. 4 und 5) Käufer: Eckhardt 1778/05/30 HBKOS 0007 Diethrichs I Zwey Hirten Stücke, plaisant gemalt auf Leinwand. [Diese Gemähide sind alle mittlere Grösse, können also an alle Plätze gebraucht werden - dieweilen keine Theilen=Stück, dabey befindlich] I Diese Nr.: Ein Hirten Stück Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 7 und 8 wurden zusammen katalogisiert. Die Angaben in eckigen Klammem im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 150 und beziehen sich auf die Nm. 1 bis 150. Verkäufer: Dr Friederici Transakt.: Verkauft (10.4 Μ für die Nm. 7 und 8) Käufer: Verscheau 1778/05/30 HBKOS 0008 Diethrichs I Zwey Hirten Stücke, plaisant gemalt auf Leinwand. [Diese Gemähide sind alle mittlere Grösse, können also an alle Plätze gebraucht werden - dieweilen keine Theilen=Stück, dabey befindlich] I Diese Nr.: Ein Hirten Stück Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 7 und 8 wurden zusammen katalogisiert. Die Angaben in eckigen Klammem im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 150 und beziehen sich auf die Nm. 1 bis 150. Verkäufer: Dr Friederici Transakt.: Verkauft (10.4 Μ für die Nm. 7 und 8) Käufer: Verscheau 1778/05/30 HBKOS 0010 Dieterichs I Zwey Hirtenstücke, auf Leinwand. [Diese Gemähide sind alle mittlere Grösse, können also an alle Plätze gebraucht werden - dieweilen keine Theilen=Stück, dabey befindlich] I Diese Nr.: Ein Hirtenstück Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 10 und 11 wurden zusammen katalogisiert. Die Angaben in eckigen Klammem im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 150 und beziehen sich auf die Nm. 1 bis 150. Verkäufer: Dr Friederici Transakt.: Verkauft (10.10 Μ für die Nm. 10 und 11) Käufer: Verscheau 1778/05/30 HBKOS 0011 Dieterichs I Zwey Hirtenstücke, auf Leinwand. [Diese Gemähide sind alle mittlere Grösse, können also an alle Plätze gebraucht werden - dieweilen keine Theilen=Stück, dabey befindlich] I Diese Nr.: Ein Hirtenstück Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 10 und 11 wurden zusammen katalogisiert. Die AnGEMÄLDE
523
gaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 150 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 150. Verkäufer: Dr Friederici Transakt.: Verkauft (10.10 Μ für die Nrn. lOund 11) Käufer: Verscheau 1778/05/30 HBKOS 0081 Dieterichs I Ein Gehölze mit Jagdgesellschaft. [Diese Gemähide sind alle mittlere Grösse, können also an alle Plätze gebraucht werden - dieweilen keine Theilen=Stück, dabey befindlich] I Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 150 und beziehen sich auf die Nm. 1 bis 150. Verkäufer: DrFriederici Transakt.: Verkauft (5.2 M) Käufer: Köster 1778/07/11 HBTEX 0056 Diedrichs I Zwey felsigte Landschaften mit Wasserfalle. I Diese Nr.: Eine felsigte Landschaft mit Wasserfälle Anm.: Die Lose 56 und 57 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/07/11 HBTEX 0057 Diedrichs I Zwey felsigte Landschaften mit Wasserfälle. I Diese Nr.: Eine felsigte Landschaft mit Wasserfälle Anm.: Die Lose 56 und 57 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/07/11 HBTEX 0080 Diedrichs I Ein Frauenzimmer mit einen Huth, eine Esquisse. I Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0070 Dietrich I Durch bemooste feisichte Lücken stürzen Wasserfälle über doppelte Absätze herunter, und verlieren sich auf der andern Seite in dicken Gesträuchen. Durch die Lücken wird man einige Gebäude eben gewahr. In der Mitte rauschet noch ein Wasserfall zwischen bewachsenen Felsen herunter. Hohes Felsengebirge schliesst die Aussicht. [Des torrens se precipitent par les interstices des rochers revetus de mousse, & par dessus les doubles degres des cascades, puis vont se perdre de l'autre cöte dans l'epaisseur d'un taillis. A travers les perces on apercjoit quelques fabriques. Dans le milieu est encore une cascade entre des rochers couverts d'arbustes. Des montagnes coupes de rochers ferment le paysage.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 10 Zoll hoch, 2 Fuß 7 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0071 Dietrich I Von einer feisichten, mit Gesträuch bewachsenen Anhöhe, auf deren Gipfel altes Gemäuer um einen auf Säulen ruhenden Tempel steht, stürzt schäumend der Wasserfall in doppelten Absätzen zum Vorgrunde her. Zur Rechten verliert die bergichte Ferne sich in der dunstigen Luft. [Sur le devant un torrent se precipite d'une hauteur couverte de rochers & d'arbres; au sommet de cette hauteur on voit de vieilles masures autour d'un temple appuy6 sur des colomnes. A droite le lointain montagneux se perd dans Γ atmosphere chargee de vapeurs.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 10 Zoll hoch, 2 Fuß 7 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0103 Dieterich I Ein verliebtes Paar hat sich von der Maskerade weggeschlichen, um beym Mondscheine einen einsamen Platz zu suchen, den eine steinerne Gruppe, die auf einem Geländer hinter ihnen steht, veredelt. Amor hält schalkhaft eine Fakkel in der Rechten, und zeigt über dem Geländer zwoen lachenden Damen, nebst ihren hinter ihnen stehenden erfreuten Liebhabern die Entdeckung. Fette Kräuter winden sich an beiden Seiten des Vorgrundes in die Höhe. [Un couple d'amans s'est eclipse d'un bal masque pour chercher au clair de la lune un endroit solitaire, ennobli par un groupe de pierre, plac£ sur une balustrade derriere eux. L'Amout [sie] tient d'un air malin un flambeau dans sa main droite, & montre derriere la balustrade sa decouverte ä deux dames qui rient, & ä leurs amans ravis qui sont derriere elles. Sur les deux cötes du devant s'elevent des plantes fertiles.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 8 Zoll hoch, 2 Fuß 1 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0130 Dieterich, 1757 \ Ein vom steilen Gebirge zur Rechten abgerissener Felsenklumpen, mit Moos und Fichten bewachsen, ragt aus dem ruhigen Wasser hervor, hinter welchem 524
GEMÄLDE
aus einem finstem Fichtenhaine der leimichte Steinweg, worauf Reisende ziehen, sich zum grasreichen Vorgrunde herwindet. Das ferne Gebirge verliert sich in warmer Morgenduft. [Une röche detachee d'une montagne escarpee, couverte de mousse & de pins, s'eleve ä droite du fond d'une eau tranquille. Derriere cette eau paroit sur le devant revetu de gazon une Chaussee argileuse, qui traverse un bois de pins tr£s obscur. Les montagnes eloignees se perdent dans les vapeurs du matin.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 10 Zoll hoch, 1 Fuß 6 Zoll breit Inschr.: 1757 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0131 Dieterich, 17571 Zwo Hütten im Geschmack des Everdingen stehen auf einer feisichten Anhöhe zur Linken, zwischen deren Klippen fette Gesträuche Nahrung finden. Am Fuße des Felsen sind zur Rechten einige Schiffer im Kahne beschäfftiget. Blaue Gebirge verlieren sich in der sanft gewölkten Ferne. [Deux baraques, dans le goüt d'Everdingen, sur une hauteur couvert de rochers, entre lesquels croissent des herbes fertiles. Au pied du rocher sont quelques pecheurs dans un bateau. Des montagnes d'azur se perdent dans les nuages legers du lointain.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 10 Zoll hoch, 1 Fuß 6 Zoll breit Inschr.: 1757 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0208 Dieterich I An überschütteten und verwachsenen Ruinen ruhet eine Hirtinn mit ihrer Heerde im Sonnenscheine. Im dämmernden Morgenglanze verliert sich die Gegend. [Une bergere se repose au soleil avec son troupeau auprfes de quelques ruines comblees & couvertes d'arbustes. Le paysage se perd dans le crepuscule du matin.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 3 Fuß 10 Zoll hoch, 5 Fuß 1 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0209 Dieterich I Zween Hirten und ein Weib, welche mit ihrem Kinde auf einem Schimmel sitzt, ziehen mit ihrer Heerde durch einen seichten Fluß, einen hohen Felsen vorüber, zu ihrer Wohnung, die im fernen Gebirge hinter Ruinen liegt. Die Scene ist am kühlen Abende. [Deux bergers avec leur troupeau & une femme montee avec son enfant sur un cheval, traversent une riviere ä bas fond & cotoyent un haut rocher, pour arriver ä leur maison situee derriere des ruines dans le lointain montagneux. L'heure du jour est la fratcheur du soir.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 3 Fuß 10 Zoll hoch, 5 Fuß 1 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0284 Dieterich I Aus dem ruhig vorbeyfließenden Wasser, an dem im Vorgrunde einige Fischer ausruhen, erhebt sich ein mit Gesträuchen, schlanken Bäumen und Moos bewachsener Felsen in reizender Abwechselung. Das feisichte Ufer zur Rechten verliert sich in dunstreicher Ferne. [Un rocher agreablement varie d'arbres, de broussailles & de mousse, s'eleve du sein d'une eau courante, au bord de laquelle reposent sur le devant quelques pecheurs. Le rivage garni de rochers se perd ä droite dans un lointain vaporeux.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 11 Zoll hoch, 2 Fuß 3 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0285 Dieterich I An dem mit Quadersteinen gepflasterten Ufer eines Hafens steht eine Statüe auf einem hohen Fußgestelle, unter einigen schlanken dünnbelaubten Bäumen. Schiffer sind mit den ausgeladenen Waaren beschäfftiget. Weiter hin erhebt sich an dem hinterliegenden Gebirge eine Stadt, an deren Ende ein Leuchtthurm steht. [La jett6e d'un port, faite de pierres de taille, oü l'on voit une statue sur un grand piedestal, sous des arbres eleves & garnis d'un feuillage leger. Des mariniers sont occupes ä debarquer des marchandises. Plus loin s'etend au pied d'une montagne situee derriere le port une ville, au bout de laquelle est un fanal.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 11 Zoll hoch, 2 Fuß 3 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/09/27 FRNGL 0213 C.W.E. Dietricij I Die Mutter Gottes mit dem Jesukindlein, und dem kleinen Johannes, in italiänischem
Geschmack. [La S. Vierge avec l'enfant Jesus & le petit S. Jean, dans le gout Italien.] I Maße: 1 Schuh 6 Zoll hoch, 1 Schuh 6 Zoll breit Transakt.: Verkauft (10.30 fl) Käufer: Kaufman Maintz 1779/09/27 FRNGL 0545 Dieterich I Ein sehr meisterhaft und keck gemalter Mannskopf. [Une tete d'homme superieurement bien peinte.] I Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh breit Transakt.: Verkauft (8 fl) Käufer: Becker Maler 1779/09/27 FRNGL 0563 Dietricij I Die Austreibung der Käufer und Verkäufer aus dem Tempel. [Les acheteurs et les vendeurs chasses hors du temple.] I Maße: 7 Zoll hoch, 9 Zoll breit Transakt.: Verkauft (27.15 fl) Käufer: Synd Hofmann 1779/09/27 FRNGL 0633 Dietricij I Ein jüdischer Rabbine in seiner Schulkleidung, so schön wie Rembrandt. [Un Rabbin en habit de synagogue, dans la force de Rembrandt.] I Pendant zu Nr. 634 Maße: 6 Vi Zoll hoch, 4 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (19 fl für die Nrn. 633 und 634) Käufer: Becker Maler 1779/09/27 FRNGL 0634 Dietricij I Ein türkischer Gelehrter zum Gegenbild, eben so meisterhaft, von nemlichem Meister [Dietricij] und Maas. [Le pendant du precedant, un Savant Türe, meme beaute, par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 633 Maße: 6 Vi Zoll hoch, 4 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (19 fl für die Nrn. 633 und 634) Käufer: Becker Maler 1779/09/27 FRNGL 0648 Dietrich I Eine sächsische alte Frau mit einer Pelzmütze. [Une vieille femme Saxonne couverte d'un bonnet fourre.] I Maße: 9 Zoll hoch, 7 Zoll breit Transakt.: Verkauft (2.40 fl) Käufer: Becker Maler 1779/09/27 FRNGL 0796 C.W.E. Dietricij I Der Patriarche Abraham, wie er seinen Sohn Isaac opfern will, ein herrlich und geistreiches Gemälde, von C.W.E. Dietricij, 1731. in Italien verfertigt. [Le Patriarche Abraham sur le point de sacrifier son fils Isaac, piece excellente, par C. W. E. Dietricij, peinte 1731. en Italie.] I Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Inschr.: 1731 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Verkauft (151.45 fl) Käufer: Schütz 1779/09/27 FRNGL 0910 Dietrici I Ein in einem angenehmen Gusto meisterhaft gemaltes Bauernstück. [Une tres jolie piece representante des paysans.] I Maße: 1 Schuh 2 Zoll hoch, 11 Zoll breit Transakt.: Verkauft (67.30 fl) Käufer: Sind Hofmann 1780/10/02 FRSTK 0022 Dietriy I Der Compagnon hierzu ein alter Türcke in seinem Ornat von Dietriy, von nehmlichen Maas. I Pendant zu Nr. 21 von Rembrandt Maße: 1 Schuh 2 Vi Zoll hoch, 11 Zoll breit Transakt.: Unbekannt (35.1/4 fl für die Nrn. 21 und 22) 1780/10/02 FRSTK 0031 Dietericy I Eine kleine aber fürtrefflich meisterhafft und schön gemahlde Landschafft. I Pendant zu Nr. 32 von J.F.A. Thiele Maße: 6 Vi Zoll hoch, 8 Vi Zoll breit Transakt.: Unbekannt (72.1/4 fl für die Nm. 31 und 32) 1781/00/00 WZAN 0235 Christian Dietrich I Der Kompagnon zu Nro 234 von Christian Dietrich, stellet eine Landschaft mit einem alten Gebäude sammt einer am Berge sitzenden Hirtenfrau vor, welche vieles Viehe um sich hemm weiden hat: dieses Stücke ist von artiger Praktik und Kolorit. I Pendant zu Nr. 234 von Chr. Brand Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0363 Christian Dietrich I Ein Stück 6 Zoll hoch, 5 Zoll breit von Christian Dietrich, stellet eine in einer Bauernstube versammelte Gesellschaft vor, wo das Mittagmahl gehalten wird; die Frau haltet das Kind an die Brust, der Mann theilet unter die übrigen Kinder Brod aus, und man sieht hie und da verschiedenes Geschirr stehen. Dieses Stück ist von sonderbarem Geschmack, angenehmer Farbe, wohl ausgeführtem Schatten und Licht, und ist mit fleißiger Ausarbeitung verfertiget. I Pendant zu Nr. 364 Maße: 6 Zoll hoch, 5 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0364 Christian Dietrich I Kompagnon zu Nro 363 stellet ein eben dergleiches Bauernstück vor, und ist von
nämlicher Güte und Stärke des Meisters [Christian Dietrich]. I Pendant zu Nr. 363 Transakt.: Unbekannt 1781/03/26 BLHRG 2378 Guilh. Diedrich I Un petit Paisage, compose d'Animaux & de figures. I Transakt.: Unbekannt 1781/03/26 BLHRG 2379 Guilh. Diedrich I Un dito [petit Paisage, compose d'Animaux & de figures] surbois. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt 1781/03/26 BLHRG akt.: Unbekannt
2384
Dietrich I Le Redempteur. I Trans-
1781/03/26 BLHRG 2386 Dietrich I Un Paisage d'Italie, representant la Cascade de Tibuli. I Transakt.: Unbekannt (45) 1782/03/18 HBTEX 0001 Dieterich I Eine Land= und Wassergegend mit Reisenden zu Pferde und zu Fuß, die ankommen und abgehen: zu dessen Compagnon eine Winter=Belustigung auf dem Eise, zur Linken stehet eine Windmühle, und in der Entfernung zeiget sich eine Stadt, beyde stark gemahlt, von des Mahlers erster Zeit, auf Holz. I Diese Nr.: Eine Land= und Wassergegend mit Reisenden zu Pferde und zu Fuss, die ankommen und abgehen; Pendant zu Nr. 2 Mat.: auf Holz Maße: Höhe 7 Zoll 6 Linien, Breite 9 Zoll 8 Linien Anm.: Die Lose 1 und 2 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0002 Dieterich I Eine Land= und Wassergegend mit Reisenden zu Pferde und zu Fuß, die ankommen und abgehen: zu dessen Compagnon eine Winter=Belustigung auf dem Eise, zur Linken stehet eine Windmühle, und in der Entfernung zeiget sich eine Stadt, beyde stark gemahlt, von des Mahlers erster Zeit, auf Holz. I Diese Nr.: Eine Winter=Belustigung auf dem Eise, zur Linken stehet eine Windmühle, und in der Entfernung zeiget sich eine Stadt; Pendant zu Nr. 1 Mat.: auf Holz Maße: Höhe 7 Zoll 6 Linien, Breite 9 Zoll 8 Linien Anm.: Die Lose 1 und 2 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0023 Dieterichs I Eremiten in Berges= Höhlen, welche mit grosser Andacht beten, extra schön gemahlt, auf Holz. I Diese Nr.: Eremiten in Berges=Höhlen, welche mit grosser Andacht beten Mat.: auf Holz Maße: Höhe 16 Zoll 6 Linien, Breite 12 Zoll 3 Linien Anm.: Die Lose 23 und 24 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0024 Dieterichs I Eremiten in Berges= Höhlen, welche mit grosser Andacht beten, extra schön gemahlt, auf Holz. I Diese Nr.: Eremiten in Berges=Höhlen, welche mit grosser Andacht beten Mat.: auf Holz Maße: Höhe 16 Zoll 6 Linien, Breite 12 Zoll 3 Linien Anm.: Die Lose 23 und 24 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0043 Dieterich I Lucretia unter einem Baldachin liegend, und schon entleibet, bey Nachtzeit, schön gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 20 Zoll, Breite 16 Zoll Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0069 Dieterich I Sechs Landschaften, meisterhaft gemahlt, auf Holz. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Holz Maße: Höhe 7 Zoll 1 Linie, Breite 10 Zoll 9 Linien Anm.: Die Lose 69 bis 74 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0070 Dieterich I Sechs Landschaften, meisterhaft gemahlt, auf Holz. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Holz Maße: Höhe 7 Zoll 1 Linie, Breite 10 Zoll 9 Linien Anm.: Die Lose 69 bis 74 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0071 Dieterich I Sechs Landschaften, meisterhaft gemahlt, auf Holz. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Holz Maße: Höhe 7 Zoll 1 Linie, Breite 10 Zoll 9 Linien Anm.: Die GEMÄLDE
525
Lose 69 bis 74 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0072 Dieterich I Sechs Landschaften, meisterhaft gemahlt, auf Holz. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Holz Maße: Höhe 7 Zoll 1 Linie, Breite 10 Zoll 9 Linien Anm.: Die Lose 69 bis 74 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0073 Dieterich I Sechs Landschaften, meisterhaft gemahlt, auf Holz. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Holz Maße: Höhe 7 Zoll 1 Linie, Breite 10 Zoll 9 Linien Anm. : Die Lose 69 bis 74 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0074 Dieterich I Sechs Landschaften, meisterhaft gemahlt, auf Holz. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Holz Maße: Höhe 7 Zoll 1 Linie, Breite 10 Zoll 9 Linien Anm.: Die Lose 69 bis 74 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0095 Dieterich I Ein Mann und eine Frau, im Gusto, von Rembrand, vortreflich gemahlt, auf Holz. I Diese Nr.: Ein Mann Mat.: auf Holz Maße: Höhe 13 Zoll 9 Linien, Breite 10 Zoll 6 Linien Anm.: Die Lose 95 und 95a wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0095a Dieterich I Ein Mann und eine Frau, im Gusto, von Rembrand, vortreflich gemahlt, auf Holz. I Diese Nr. : Ein Frau Mat.: auf Holz Maße: Höhe 13 Zoll 9 Linien, Breite 10 Zoll 6 Linien Anm.: Im Katalog tragen zwei Lose die Nummer 95. Diesem Los wurde deshalb zur Unterscheidung die Nummer 95a gegeben. Die Lose 95 und 95a wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0101 Dieterich I Eine Landschaft mit Ruinen und verschiedenen reisenden, brav gemahlt, auf Holz. I Pendant zu Nr. 352 von Monogrammist D. Mat.: auf Holz Maße: Höhe 9 Zoll 10 Linien, Breite 7 Zoll 6 Linien Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0166 Dieterich I Eine plaisante Land= und Wassergegend, mit vergnügten Gesellschaften, in der Entfernung sind Schäfer im Gebürge, frey und meisterhaft gemahlt, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 19 Zoll 3 Linien, Breite 25 Zoll 9 Linien Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0360 Dieterich I Ein persiani scher Kopf, die Hand an die Brust haltend, mit freyem Pinsel gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 12 Zoll, Breite 9 Zoll Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/09/30 FRAN 0128 Dietrich I Eine meisterhafte Landschaft mit vortrefflichen Figuren und Pferden in Wauermanns Manier von Dietrich. [Une trfes beau paysage avec d'excellentes figures & des chevaux, dans le gout de Wauermann, par Dietrich.] I Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 7 Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (130.15 fl) Käufer: Kaller 1782/09/30 FRAN 0206 Dietricyl Lazarus im Schoos Abrahams, und der reiche Mann in der Quaal, besonders meisterhaft und schön ausgedrückt von Dietricy. [Lazare dans le sein d'Abram, & l'homme riche dans les tourments, chef d'oeuvre par Dietricy.] I Pendant zu Nr. 207 Maße: 2 Schuh Vi Zoll hoch, 1 Schuh 8 Vi Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (420 fl für die Nrn. 206 und 207) Käufer: ν Schmit 1782/09/30 FRAN 0207 Dietricyl Zum Gegenbild hierzu, das Gleichnis aus dem neuen Testament, wie ein Blinder dem andern den Weg zeigen will, und beide in die Grube fallen, von gleicher herrlicher Ausführung, nemlichem Meister [Dietricy] und Maas. [Le pendant du precedant, la parabole du Nouveau Testament, l'aveugle voulant montrer le chemin ä l'autre, & tous les deux tombant dans la 526
GEMÄLDE
fosse, meme beaute, par le meme maitre [Dietricy].] I Pendant zu Nr. 206 Maße: 2 Schuh Vi Zoll hoch, 1 Schuh 8 Vi Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (420 fl für die Nm. 206 und 207) Käufer: ν Schmit 1782/09/30 FRAN 0377 Dietricy I Eine angenehme Gegend mit einer Brücke über einen kleinen Fluß ohnweit Rom, nach der Natur abgebildet und mit wohlgewählten Figuren und Vieh auf das schönste staffirt, von Dietricy 1743 in Rom verfertigt. [Une belle contree avec un pont sur une petite riviere, situee pres de Rome, peinte d'apres nature, avec des figures bien choisies & du betail, par Dietricy, peinte ä Rome en 1743.] I Pendant zu Nr. 378 von Chr. Schütz (I) Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch, 2 Schuh 3 Vi Zoll breit Inschr.: 1743 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (350 fl für die Nrn. 377 und 378) Käufer: Hoynck 1782/09/30 FRAN 0382 Dietricy I Ein Küchenstück, wie eine Köchin mit einem Wildpretshändler um todtes Wild und Vögel handelt, vorstellend, so schön und fein ausgearbeitet, wie Mieris. [Une piece de cuisine, une cuisiniere avec un vendeur de gibier, marchandante pour du gibier tue & des oiseaux, de meme beaute, que le pinceau de Mieris, par Dietricy.] I Maße: 1 Schuh 6 Zoll hoch, 1 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (120.15 fl) Käufer: Kaller 1783/06/19 HBRMS 0021 Dieterich I Die Auferweckung Lazari. H[olz], s.R. [schwarzer Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 11 Zoll hoch, 1 Fuß 4 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1783/06/19 HBRMS 0065 Dieterich I Zwo lustige Gesellschaften von Bauren in dem Geschmack von Ostade. H[olz]. g.R. [verguldete Rahmen] I Diese Nr.: Eine lustige Gesellschaft von Bauren Mat.: auf Holz Maße: 11 Zoll hoch, 9 Zoll breit Anm.: Die Lose 65 und 66 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1783/06/19 HBRMS 0066 Dieterich I Zwo lustige Gesellschaften von Bauren in dem Geschmack von Ostade. H[olz]. g.R. [verguldete Rahmen] I Diese Nr.: Eine lustige Gesellschaft von Bauren Mat.: auf Holz Maße: 11 Zoll hoch, 9 Zoll breit Anm.: Die Lose 65 und 66 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1783/08/01 LZRST 0035a C. W. E. Dietricy I Ein Stieglitz an einem Baum auf einem Zweige sitzend, unten her sein Nest mit 4 Eyern, auf den Blättern und dem Vordergrunde, Schnecken, Raupen, Käfer, Johanniswürmer etc. von C. W. E. Dietricy gemahlt, 22 Zoll hoch und 16 Vi Zoll breit ohne Rahm. I Maße: 22 Zoll hoch, 16 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (1.12 Th) Käufer: W 1784/08/02 FRNGL 0531 W.E. Dieterici I Das Bildniß Paul Rembrandts mit dessen Frau. I Maße: 9 Zoll breit, 12 Zoll hoch Transakt.: Verkauft (13 fl) Käufer: von Dessau 1784/08/13 HBDEN 0001 Dieterici I Zwey ländliche Belustigungen von Herren und Damen, von Dieterici, auf Leinwand. [NB. Alle Gemähide bis No. 33 haben keine Rahmen.] I Diese Nr.: Eine ländliche Belustigung von Henen und Damen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 48 Zoll. Breit 62 Zoll. Anm.: Die Lose 1 und 2 wurden zusammen katalogisiert. Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 33 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 33. Verkäufer: Pasche [oder] Flügge Transakt.: Verkauft (20 [?] M) Käufer: Ehr[enreich] 1784/08/13 HBDEN 0002 Dieterici I Zwey ländliche Belustigungen von Herren und Damen, von Dieterici, auf Leinwand. [NB. Alle Gemähide bis No. 33 haben keine Rahmen.] I Diese Nr.: Eine ländliche Belustigung von Herren und Damen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 48 Zoll. Breit 62 Zoll. Anm.: Die Lose 1 und 2 wurden zusammen katalogisiert. Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 33 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 33. Verkäufer: Pasche [oder] Flügge Transakt.: Verkauft (20 [?] M) Käufer: Ehr[enreich]
1784/08/13 HBDEN 0020 Dietericj I Ein musicirender Bauer lehrt seiner Schönen auf der Pfeife spielen, die Alte öffnet die Thüre, sie zu belauschen. Sehr fleissig und plaisant gemahlt, mit Beywesen, wie Tenier, von Dietericj, auf Leinwand. [NB. Alle Gemähide bis No. 33 haben keine Rahmen.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 14 Zoll. Breit 12 Zoll. Anm.: Die Angaben in eckigen Klammem im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 33 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 33. Verkäufer: Pasche [oder] Flügge Transakt.: Verkauft (42 Sch) Käufer: Β
schenket Jenever in eine Kumpe, meisterschaft gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 8 Zoll Transakt.: Verkauft (4.4 M) Käufer: Schön
1784/08/13 HBDEN 0029 Dietericj I Zwey Land= und Wassergegenden, mit Rudera und bergigter Entfernung. Von Dietericj erster Zeit, auf Holz. [NB. Alle Gemähide bis No. 33 haben keine Rahmen.] I Diese Nr.: Eine Land= und Wassergegend, mit Rudera und bergigter Entfernung Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Zoll. Breit 10 Zoll. Anm.: Die Lose 29 und 30 wurden zusammen katalogisiert. Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 33 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 33. Verkäufer: Pasche [oder] Flügge Transakt.: Verkauft (6 M) Käufer: Β
1786/10/18 HBTEX 0016 Dieterichs I Zwey perspectivische Land= und Wasser=Prospecten. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein perspectivischer Land= und Wasser=Prospect Mat.: auf Holz Maße: Hoch 5 Zoll 6 Linien, breit 7 Zoll 3 Linien Anm.: Die Lose 15 und 16 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1784/08/13 HBDEN 0030 Dietericj I Zwey Land= und Wassergegenden, mit Rudera und bergigter Entfernung. Von Dietericj erster Zeit, auf Holz. [NB. Alle Gemähide bis No. 33 haben keine Rahmen.] I Diese Nr.: Eine Land= und Wassergegend, mit Rudera und bergigter Entfernung Mat. : auf Holz Maße: Hoch 8 Zoll. Breit 10 Zoll. Anm.: Die Lose 29 und 30 wurden zusammen katalogisiert. Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 33 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 33. Verkäufer: Pasche [oder] Flügge Transakt.: Verkauft (6 M) Käufer: Β
1787/00/00 HB AN 0130 Christian Wilhelm Ernst Diderch I Eine Morgenländische Landschaft. Zur Linken erhebet sich ein hoher Berg, auf welchem verschiedene kleine Bäume stehen. Am Fuße desselben fließt bey kleinem niederm Gebüsche ein klares Wasser. Einige Bäume, Berge und Thäler schließen den Hintergrund. Zur Linken an einer Anhöhe sitzt eine Frau, die sich mit einer Mannsperson unterredet. Zur Rechten wird man mehrere wandernde und sich ausruhende Bauern gewahr. Sehr warm und schön gemahlt. A.H. [Auf Holz] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 19 Vi Zoll, breit 15 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (41 M) Käufer: Ekhard
1785/04/22 HBTEX 0028 Diederich I Ein inwendiges Baurenhaus mit zechenden Bauren, kräftig auf Leinewand gemahlt, in goldnem Rahmen. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 14 Vi Zoll, breit 11 Zoll Transakt.: Unbekannt 1785/04/22 HBTEX 0143 Diederichs I Zwey Stücke mit Bauern; auf dem einen ein Guckkasten mit vielen Zuschauern; das andere ein Nachtstück, woselbst Kinder mit einem Eichhorn spielen. Auf Holz. Schwarzer Rahm und goldne Leisten I Diese Nr.: Ein Stück mit Bauern; auf dem einen ein Guckkasten mit vielen Zuschauem Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Zoll, breit 12 Zoll Anm.: Die Lose 143 und 144 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1785/04/22 HBTEX 0144 Diederichs I Zwey Stücke mit Bauern; auf dem einen ein Guckkasten mit vielen Zuschauem; das andere ein Nachtstück, woselbst Kinder mit einem Eichhorn spielen. Auf Holz. Schwarzer Rahm und goldne Leisten I Diese Nr.: Ein Stück mit Bauern; ein Nachtstück, woselbst Kinder mit einem Eichhorn spielen Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Zoll, breit 12 Zoll Anm.: Die Lose 143 und 144 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1785/05/17 MZAN 0871 Dietrich ! Eine Landschaft von Dietrich. [Un paysage.] I Maße: 1 Schuh 4 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 10 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (15.30 fl) Käufer: Zitz 1785/05/17 MZAN 1021 Dieterich I Die büsende Magdalena von Dieterich. [Madelaine penitente.] I Maße: 11 Vi Zoll hoch, 9 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (5 fl) Käufer: Schwanck 1786/04/21 HBTEX 0006 Dieterichs I Zwey kleine See=Prospecte. I Diese Nr.: Ein kleiner See=Prospect Anm.: Die Lose 6 und 7 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (4 Μ für die Nrn. 6 und 7) 1786/04/21 HBTEX 0007 Dieterichs I Zwey kleine See=Prospecte. I Diese Nr.: Ein kleiner See=Prospect Anm.: Die Lose 6 und 7 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (4 Μ für die Nrn. 6 und 7) 1786/05/12 HBTEX 0022 Dieterici I Ein lustiger trinckender Bauerjnnge [sie], hinter welchen annoch einer stehet und lachet,
1786/10/18 HBTEX 0015 Dieterichs I Zwey perspectivische Land= und Wasser=Prospecten. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein perspectivischer Land= und Wasser=Prospect Mat.: auf Holz Maße: Hoch 5 Zoll 6 Linien, breit 7 Zoll 3 Linien Anm.: Die Lose 15 und 16 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1786/10/18 HBTEX 0119 Dieterichs I Flora mit Blumen, im Garten vor einem Fenster sitzend, plaisant gemahlt. Auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 17 Zoll, breit 13 Zoll 6 Linien Transakt.: Unbekannt
1787/00/00 HB AN 0240 C. W. E. Diederich I Das Brustbild einer alten runzelichten Frau, über sich sehend, mehr profil, in einem gelben Gewände. Besonders schön und natürlich gemahlt, und von richtigem Licht und Schatten. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 15 Zoll, breit 13 Zoll Transakt.: Verkauft (4.8 M) Käufer: Texier [mit] L 1787/00/00 HB AN 0262 C. W. E. Diderich I Ein Entwurf. Verschiedene Grabmäler unter einer Hole, wo auf Befehl und in Gegenwart eines Heiligen verschiedene todte Leichname beerdigt werden. Dieses alles empfängt sein Licht von der Fackel, so einer von den Arbeitern auf den Schultern trägt. Sehr schön und correct gemahlt, und von einem warmen Colorit. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 12 Zoll, breit 16 Zoll Transakt.: Verkauft (11M) Käufer: Bertheau 1787/00/00 HB AN 0324 C.W.E. Diederich I Esquiseses. In einer angenehmen Gegend befindet sich im Vordergrunde die Historie der Cananiterinn beym Brunnen. In der Feme mehrere kleine Figuren. In einer dergleichen Landschaft im Vordergrunde die Flucht nach Egypten. Beyde Gemähide sind von edler Wahl, angenehmen Colorit und schönem freyen Pinsel. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Diese Nr.: In einer angenehmen Gegend befindet sich im Vordergrunde die Historie der Cananiterinn beym Brunnen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 11 Zoll, breit 15 Vi Zoll Anm.: Die Lose 324 und 325 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (12.8 Μ für die Nrn. 324 und 325) Käufer: Tietjen 1787/00/00 HB AN 0325 C.W.E. Diederich I Esquiseses. In einer angenehmen Gegend befindet sich im Vordergrunde die Historie der Cananiterinn beym Brunnen. In der Feme mehrere kleine Figuren. In einer dergleichen Landschaft im Vordergrunde die Flucht nach Egypten. Beyde Gemähide sind von edler Wahl, angenehmen Colorit und schönem freyen Pinsel. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Diese Nr.: In einer dergleichen Landschaft im Vordergrunde die Flucht nach Egypten Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 11 Zoll, breit 15 Vi Zoll Anm.: Dieses Los trägt im Katalog irrtümlicherweise die Nr. 225. Die Lose 324 und 325 wurden zusamGEMÄLDE
527
men katalogisiert. Transakt.: Verkauft (12.8 Μ für die Nrn. 324 und 325) Käufer: Tietjen 1787/00/00 HB AN 0631 Christian Wilh. Ernst Dieterich I Ein Seehaven, wo verschiedene Leute neben einer Tonne sitzen, und rauchen und trinken. Zu ihrer Linken im Vordergrunde befindet sich eine prächtig gekleidete Mohrinn, welche einen angeschlossenen Affen zu ihren Füßen hat, der mit Karten, Pfeiffen, ec. spielet. Hinter dieser Gruppe kömmt ein Knecht mit einem beladenen Kameel. Im Hintergrunde verschiedene Arbeiter. In der Ferne mehrere Güter, aus Schiffen geladen. Zur rechten im Vordergrunde sitzt auf einigen Packen eine Bettlerinn mit ihrem Kinde. Dieses alles ist von der in der Ferne im Nebel roth untergehenden Sonne auf das vortrefflichste beleuchtet. Die Composition ist edel, die Zeichnung richtig, das Colorit warm, und die Mahlerey meisterhaft. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Zoll, breit 34 Zoll Transakt.: Verkauft (200 M) Käufer: Schoen 1787/03/01 HBLOT 0001 Christian Wilhelm Emst Diederichs I Die Darstellung Christi im Tempel, mit überaus vielen Nebenfiguren und Priestern, zur Comp, die Genesung des Jairi Tochter, mit vielen umstehenden Figuren und Nebenwerken. Beyde auf das schönste und fleißigste gemahlt, in schönen goldenen Rahmen. I Diese Nr.: Die Darstellung Christi im Tempel; Pendant zu Nr. 2 Anm.: Die Lose 1 und 2 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (22 M) 1787/03/01 HBLOT 0002 Christian Wilhelm Ernst Diederichs I Die Darstellung Christi im Tempel, mit überaus vielen Nebenfiguren und Priestern, zur Comp, die Genesung des Jairi Tochter, mit vielen umstehenden Figuren und Nebenwerken. Beyde auf das schönste und fleißigste gemahlt, in schönen goldenen Rahmen. I Diese Nr.: Die Genesung des Jairi Tochter; Pendant zu Nr. 1 Anm.: Die Lose 1 und 2 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (22 M) 1787/04/19 HBTEX O l l i Chr. Wilh. ErnstDiderichs I Die Darstellung Christi, und die Genesung der Jairy Tochter, beyde überaus reich an Figuren und auf das schönste und fleißigste gemahlt. I Diese Nr.: Die Darstellung Christi Anm.: Die Lose 111 und 112 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (62 Μ für die Nm. 111 und 112) Käufer: Eck[hardt] 1787/04/19 HBTEX 0112 Chr. Wilh. Ernst Diderichs I Die Darstellung Christi, und die Genesung der Jairy Tochter, beyde überaus reich an Figuren und auf das schönste und fleißigste gemahlt. I Diese Nr. . Die Genesung der Jairy Tochter Anm. . Die Lose 111 und 112 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (62 Μ für die Nrn. 111 und 112) Käufer: Eck[hardt] 1787/10/06 HBTEX 0130 C.W.E. Diederichs I Zwey Dorfgegenden, wo sich Bauren belustigen, ausführlich gemahlt. I Diese Nr.: Eine Dorfgegend, wo sich Bauren belustigen Anm.: Die Lose 130 und 131 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1787/10/06 HBTEX 0131 C.W.E. Diederichs I Zwey Dorfgegenden, wo sich Bauren belustigen, ausführlich gemahlt. I Diese Nr.: Eine Dorfgegend, wo sich Bauren belustigen Anm.: Die Lose 130 und 131 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1788/06/12 HBRMS 0039 Diedrichs I Eine Landschaft mit Wasser und hohen Gebürgen, worauf Schlösser: im Vorgrunde geht ein Reisender durch das Thor, welches durch eine Mauer mit einem runden Thor gebrochen ist. Die Morgenröthe und einiges Gehölze thun auf des Kenners Auge eine seltene Würkung, und die Stärke des Pinsels, womit dieß Stück gemalt ist, macht es zu einem Meisterwerke. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 21 Zoll, breit 27 Zoll Transakt.: Unbekannt 1788/06/12 HBRMS 0050 Diederich I Eine alte Frau, welche Fische vor sich liegen hat, ruht auf der Wanne, worin solche gewesen, mit dem linken Arme. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 % Zoll, breit 8 Zoll Transakt.: Unbekannt 528
GEMÄLDE
1788/06/12 HBRMS 0056 Diederichs I Eine sächsische Schäfererin und Ein junger Schäfer. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine sächsische Schäfererin Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 8 Zoll Anm.: Die Lose 56 und 57 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1788/06/12 HBRMS 0057 Diederichs I Eine sächsische Schäfererin und Ein junger Schäfer. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein junger Schäfer Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 8 Zoll Anm.: Die Lose 56 und 57 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1788/06/12 HBRMS 0107 Diederich I Zwey außerordentlich schöne Köpfe eines Mannes und einer Frau nach dem Leben. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein außerordentlich schöner Kopf eines Mannes Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Vi Zoll, breit 8 % Zoll Anm.: Die Lose 107 und 108 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1788/06/12 HBRMS 0108 Diederich I Zwey außerordentlich schöne Köpfe eines Mannes und einer Frau nach dem Leben. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein außerordentlich schöner Kopf einer Frau Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Vi Zoll, breit 8 % Zoll Anm.: Die Lose 107 und 108 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1788/06/12 HBRMS 0109 Diederich I Zwey Landschaften, auf der einen Ziegen, auf der andern Schaafe, vortreflich gemalt. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine Landschaft, auf der einen Ziegen Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 8 Zoll Anm.: Die Lose 109 und 110 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1788/06/12 HBRMS 0110 Diederich I Zwey Landschaften, auf der einen Ziegen, auf der andern Schaafe, vortreflich gemalt. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine Landschaft, auf der andern Schaafe Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 8 Zoll Anm.: Die Lose 109 und 110 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1788/06/12 HBRMS 0126 Diederich I Zwey schöne Landschaften mit Wasserfälle; verschiedenen Reisenden und Landleuten auf den Landstraßen. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine schöne Landschaft mit Wasserfall; verschiedenen Reisenden und Landleuten auf den Landstraßen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 8 Vi Zoll, breit 12 V2 Zoll Anm.: Die Lose 126 und 127 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1788/06/12 HBRMS 0127 Diederich I Zwey schöne Landschaften mit Wasserfalle; verschiedenen Reisenden und Landleuten auf den Landstraßen. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine schöne Landschaft mit Wasserfall; verschiedenen Reisenden und Landleuten auf den Landstraßen Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 8 Vi Zoll, breit 12 Vi Zoll Anm.: Die Lose 126 und 127 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1788/06/12 HBRMS A0004 Dieterich I Eine sächsische Schöne, plaisant nach der Natur gemalt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Zoll, breit 9 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1788/08/21 HBRMS 0051 C.W.E. Diedrich I Land= und Wasser=Gegenden mit Schiffen, Vieh und Figuren, sehr meisterhaft gemahlt. Auf Ixinewand, schwarzen Rahm. I Diese Nr.: Eine Land= und Wasser=Gegend mit Schiffen, Vieh und Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 10 Zoll, breit 13 Vi Zoll Anm.: Die Lose 51 bis 54 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (6 Μ für die Nrn. 51-54) Käufer: Bostelmann 1788/08/21 HBRMS 0052 C.W.E. Diedrich I Land= und Wasser=Gegenden mit Schiffen, Vieh und Figuren, sehr meisterhaft gemahlt. Auf Leinewand, schwarzen Rahm. I Diese Nr.: Eine Land= und Wasser=Gegend mit Schiffen, Vieh und Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 10 Zoll, breit 13 Vi Zoll Anm.: Die Lose 51 bis 54 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (6 Μ für die Nrn. 51-54) Käufer: Bostelmann
1788/08/21 HBRMS 0053 C.W.E. Diedrich I Land= und Wasser=Gegenden mit Schiffen, Vieh und Figuren, sehr meisterhaft gemahlt. Auf Leinewand, schwarzen Rahm. I Diese Nr.: Eine Land= und Wasser=Gegend mit Schiffen, Vieh und Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 10 Zoll, breit 13 Vi Zoll Anm.: Die Lose 51 bis 54 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (6 Μ für die Nm. 51-54) Käufer: Bostelmann 1788/08/21 HBRMS 0054 C.W.E. Diedrich I Land= und Wasser=Gegenden mit Schiffen, Vieh und Figuren, sehr meisterhaft gemahlt. Auf Leinewand, schwarzen Rahm. I Diese Nr.: Eine Land= und Wasser=Gegend mit Schiffen, Vieh und Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 10 Zoll, breit 13 Vi Zoll Anm.: Die Lose 51 bis 54 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (6 Μ für die Nrn. 51-54) Käufer: Bostelmann 1788/09/01 KOAN 0264 Dieterichs I 3 Landschaften. [3 paysages.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 11 Zoll, Breite 1 Fuß 4 Zoll Anm.: Die Lose 264 bis 266 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0265 Dieterichs I 3 Landschaften. [3 paysages.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 11 Zoll, Breite 1 Fuß 4 Zoll Anm.: Die Lose 264 bis 266 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0266 Dieterichs I 3 Landschaften. [3 paysages.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 11 Zoll, Breite 1 Fuß 4 Zoll Anm.: Die Lose 264 bis 266 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1789/04/16 HBTEX 0099 Ch. W. Ernst Diedrichs I Die Darstellung Christi im Tempel, halbe Figuren; mit vielem Fleiß auf Holz gemahlt. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 Zoll, breit 5 Zoll Anm.: Dieses Los wurde zusammen mit den Nrn. 100 und 101 (J.J. Tischbein) verkauft. Transakt.: Verkauft (10.08 Μ für die Nrn. 99-101) Käufer: Eckhardt 1789/06/12 HBTEX 0014 Dieterich I Loth mit seinen Töchtern. Fleißig gemahlt, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 11 Zoll, breit 15 Zoll Transakt.: Verkauft (2.2 M) Käufer: Lofhagen 1789/06/12 HBTEX 0044 Dieterichs I Ein Ecce Homo, kleine Lebensgröße. Vortreflich und schön gemahlt, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 45 Zoll, breit 33 Zoll Transakt.: Verkauft (6.8 M) Käufer: Eckhardt 1789/08/18 HB GOV 0079 Diterichs erster Zeit I Ein See=Hafen mit Schiffe, stark gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Zoll, breit 14 Zoll Transakt.: Unbekannt
1790/04/13 HBLIE 0226 Dieterici I Ein historischer Manns= Kopf, wie Rembrandt. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 14 Vi Zoll, breit 12 V* Zoll Transakt.: Verkauft (3 M) 1790/05/20 HBSCN 0009 Dieterici I Venus und Diana lassen sich durch ihre Nymphen schmücken; Amor macht Seifenblasen; hinten badende Nymphen. Mit vielen Fleiß gemahlt. Auf Holz, S.R.G.L. [Schwarzen Rahm, goldne Leisten] I Pendant zu Nr. 28 Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Vi Zoll, breit 14 Zoll Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (24 Μ für die Nrn. 9 und 28) Käufer: Ranzow 1790/05/20 HBSCN 0028 Dieterici I Die Entführung der Europa. Sehr schön gemahlt. Auf H[olz]. S.R.G.L. [Schwarzen Rahm, goldne Leisten] Gehört zu No. 9. I Pendant zu Nr. 9 Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Vi Zoll, breit 14 Zoll Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (24 Μ für die Nrn. 9 und 28) Käufer: Ranzow 1790/08/13 HBBMN 0079 Diterici I Ein Frauens=Kopf, von besondere Aufmerksamkeit vorgestellet, und mit einem Schleyer über den Kopf, welcher auf die Brust herabfällt, umhüllet. Eine vortrefliche Bearbeitung zeiget die Größe des benannten Künstlers. Auf Holz, in schwarz Ebenhölzernen Rahm mit vergoldeten Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 22 Zoll, breit 17 Zoll Transakt.: Verkauft (15 M) Käufer: Ego 1790/08/25 FRAN 0036 Diedrich I Eine Ovidische Historie. I Maße: hoch 8 Zoll, breit 11 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (1.30 fl) Käufer: Kaller 1790/08/25 FRAN 0087 Dietrich I Zwey Stück mit Figuren. I Diese Nr.: Ein Stück mit Figuren Maße: hoch 11 Zoll, breit 12 Zoll Anm.: Die Lose 87 und 88 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (22.15 fl für die Nrn. 87 und 88) Käufer: Trautman 1790/08/25 FRAN 0088 Dietrich I Zwey Stück mit Figuren. I Diese Nr.: Ein Stück mit Figuren Maße: hoch 11 Zoll, breit 12 Zoll Anm.: Die Lose 87 und 88 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (22.15 fl für die Nrn. 87 und 88) Käufer: Trautman 1790/08/25 FRAN 0293 C.W.E. Dietrich I Die Opferung Isaacs. I Maße: hoch 22 Zoll, breit 18 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (12 fl) Käufer: Erlinger 1790/08/25 FRAN 0305 C.M.E. Dietrich I Eine kleine Landschaft. I Maße: hoch 15 Zoll, breit 12 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (4 fl) Käufer: Kaller 1790/08/25 FRAN 0308 C.W.E. Dietrich I Christus wird mit Dornen gekrönt. I Maße: hoch 15 Zoll, breit 12 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (15.15 fl) Käufer: Erlinger
1790/01/07 MUAN 0388 Dietericy Christ. I Zwo niederländische Landschaften, auf Holz, in geschnittenen und vergoldeten Ramen. I Diese Nr.: Eine niederländische Landschaft Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 3 Zoll, Breite 1 Schuh Anm.: Die Lose 388 und 389 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
1790/08/25 FRAN 0314 C.W.E. Dietrich I Die Geburt Christi nebst Verkündigung der Hirten. I Diese Nr.: Die Geburt Christi Maße: hoch 20 Zoll, breit 14 Zoll Anm.: Die Lose 314 und 315 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (36 fl für die Nm. 314 und 315) Käufer: Erlinger
1790/01/07 MUAN 0389 Dietericy Christ. I Zwo niederländische Landschaften, auf Holz, in geschnittenen und vergoldeten Ramen. I Diese Nr.: Eine niederländische Landschaft Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 3 Zoll, Breite 1 Schuh Anm.: Die Lose 388 und 389 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
1790/08/25 FRAN 0315 C. W.E. Dietrich I Die Geburt Christi nebst Verkündigung der Hirten. I Diese Nr.: Die Verkündigung der Hirten Maße: hoch 20 Zoll, breit 14 Zoll Anm.: Die Lose 314 und 315 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (36 fl für die Nrn. 314 und 315) Käufer: Erlinger
1790/02/04 HBDKR 0065 Dieterici I Eine plaisante gebürgigte Landgegend, auf der Landstrasse, welche um den Berg gehet; mit verschiedenen Reisenden, theils zu Fuß als auch in einer Kutsche. Zur Linken liegt ein Dorf, ganz besonders fleißig und lebhaft gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 Zoll, breit 8 % Zoll Transakt.: Verkauft (1.10 M) Käufer: Ego
1790/09/10 HBBMN 0081 Dieterici I Eine sehr angenehme gebürgigte Landgegend, auf der Landstraße, die um einen Berg gehet, sind verschiedene Reisende zu Wagen und zu Fuß. Zur Linken liegt ein Dorf, besonders schön gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 Zoll, breit 8 % Zoll Transakt.: Verkauft (2 M) Käufer: Ego GEMÄLDE
529
1791/05/15 LZHCT 0001a Chretien Guillaume Ernest Dietrich dit Dietricy I Buste d'un vieillard habille dans le gout oriental en manteau brun velu et en veste rouge. La tete est couverte d'un haut bonnet velu attache avec une bande blanche. Peint sur bois dans le goüt de Benedetto Castiglione. I Pendant zu Nr. 2b Mat.: auf Holz Maße: haut de 16 [A pouces, large de 12 pouces Verkäufer: Chrit Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0002b Chretien Guillaume Ernest Dietrich dit Dietricy I Pendant. Autre buste de vieillard en habit semblable, en bonnet brun avec une bande verdätre. De la meme grandeur que η. la. I Pendant zu Nr. la Mat.: auf Holz Maße: haut de 16 ιΛ pouces, large de 12 pouces Verkäufer: Chret Guill Emest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0003a Chretien Guillaume Emest Dietrich dit Dietricy I Buste d'un vieillard, habille ä l'orientale en manteau velu, tenant un baton ä la main. Peint sur bois. I Pendant zu Nr. 4b Mat.: auf Holz Maße: haut de 14 pouces, large de 10 Vi pouces Verkäufer: Chret Guill Emest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0004b Chretien Guillaume Emest Dietrich dit Dietricy I Pendant. Autre buste de vieillard, habille dans le meme goüt, portant un grand bandeau blanc, ome sur le devant d'une inscription Orientale. De la meme grandeur que η. 3a. I Pendant zu Nr. 3a Mat.: auf Holz Maße: haut de 14 pouces, large de 10 ¥2 pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0005 Chretien Guillaume Emest Dietrich dit Dietricy I Buste d'un vieillard, vetu dans le goüt oriental, ä grande barbe blanche, en habit noir, la tete couverte d'un bonnet noir. Peint sur bois...Ces cinq bustes [Nr. la-5] sont peints dans la meilleure maniere de Dietricy. I Mat.: auf Holz Maße: haut de 14 pouces, large de 10 Vi pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0006a Chretien Guillaume Emest Dietrich dit Dietricy I L'Ete sous la figure d'une jeune fille, tenant une gerbe sous le bras gauche, et une faucille de la main droite. Demi-figure. Peinte sur bois en grisaille, d'une belle execution. I Pendant zu Nr. 7b Mat.: auf Holz Maße: haut de 9 % pouces, large de 8 pouces Anm.: Dieses Los trägt im Katalog irrtümlicherweise die Nr. 4a. Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0007b Chretien Guillaume Emest Dietrich dit Dietricy I Pendant. L'Automne represente sous la figure d'une jeune fille, portant un chapeau de paille, et tenant au bras gauche une corbeille remplie des fruits. Demi-figure, peinte sur bois en grisaille avec la meme exicution. De la meme grandeur que η. 6a. I Pendant zu Nr. 6a Mat.: auf Holz Maße: haut de 9 % pouces, large de 8 pouces Anm.: Dieses Los trägt im Katalog irrtümlicherweise die Nr. 4a. Verkäufer: Chr£t Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0008 Chretien Guillaume Emest Dietrich dit Dietricy I Buste d'un vieillard venerable vetu dans le goüt oriental, ä barbe blanche, en habit brun fonce, avec la tete couverte d'une petite calotte noire. Piece süperbe, peinte dans le goüt de Rembrandt, avec autant de feu que de delicatesse. I Maße: haut de 32 pouces, large de 26 pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0009 Chretien Guillaume Emest Dietrich dit Dietricy I Abraham sur le point de sacrifier son fils, represente devant son pere avec la päleur de la mort et ä genoux sur un autel de pierres brutes. Sur le visage du vieillard on voit l'expression de la douleur la plus profonde et de la confiance la plus ferme en Dieu. Dans sa main droite il tient le couteau, tandis que son bras, deja etendu pour frapper la victime, est retenu par un ange qui descend 530
GEMÄLDE
derriere lui dans un nuage, et qui lui montre le belier destine pour le sacrifice. Les lointains offrent un paysage montagneux. Piece d'une belle ordonance et pleine d'expression, peinte sur une lame de cuivre. I Mat.: auf Kupfer Maße: haut de 18 % pouces, large de 16 % pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0010 Chretien Guillaume Emest Dietrich dit Dietricy I Jesus ä l'äge de douze ans enseignant dans le temple de Jerusalem. On le voit debout au milieu des scribes et des pretres, assis autour de lui et remplis d'admiration et de surprise. Sur le devant on voit un vieux pretre, qui tient une banderole developpee, que Jesus semble indiquer. Figures jusqu' aux genoux. Peint sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: haut de 9 pouces, large de 13 pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0011 Chretien Guillaume Emest Dietrich dit Dietricy I La Samaritaine. Une cruche ä la main, eile est devant Jesus avec l'expression du respect et de l'attention. Jesus est assis au bord de la fontaine, dont on voit sortir les eaux d'un reservoir de pierre entoure d'arbustes el£gamment gΓouppέs. Le lointain offre les disciples de Jesus revenant de la ville, dont on voit la perspective sur le demier plan. Piece de cabinet d'une execution spirituelle er d'un coloris admirable, peinte sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: haut de 11 % pouces, large de 15 % pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0012a Chretien Guillaume Emest Dietrich dit Dietricy I L'enfant prodigue ä genoux sur le seuil de la porte devant son pere, qui se panche [sic] vers lui plein de tendresse et de compassion, et qui le presse en presence de plusieurs temoins entre ses bras patemels. Derriere le pere on voit accourir la mere pleine de joie, les mains levees. Quelques serviteurs et une servante qui regarde par une fenetre, expriment tous l'interet, qu'ils prennent ä cette sc£ne touchante. Au loin on voit un paysage montagneux richement ome d'arbres. Piece d'un beau fini, d'un coloris admirable, et d'une expression pleinte de verit6, peinte sur bois. I Pendant zu Nr. 13b Mat.: auf Holz Maße: haut de 15 Vi pouces, large de 12 pouces Verkäufer: Chret Guill Emest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0013b Chretien Guillaume Ernest Dietrich dit Dietricy I Pendant. La brebis retrouvee. Dans un paysage agreable, eclaire par les rayons du soleil couchant, on voit sur le devant un pasteur, qui porte sur ses epaules sa brebis egar6e et retrouvee, allant rejoindre ses compagnons assis ä terre. Piece precieuse egalement pleine d'expression et de verite. Sur bois. De la meme grandeur que η. 12a. I Pendant zu Nr. 12a Mat.: auf Holz Maße: haut de 15 Vi pouces, large de 12 pouces Verkäufer: Chret Guill Emest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0014 Chretien Guillaume Emest Dietrich dit Dietricy I Susanne nue au bain, dans lequel on descend par un escalier de pierre. L'un des deux vieillards cherche ä lui arracher la drapperie blanche, dont eile veut se couvrir. Avec l'expression de la plus grande inquietude sur son beau visage, eile appelle du secours. Derriere eux on voit l'autre vieillard descendre l'escalier, se tenant ä la rampe. Ce grouppe expressif est place dans un beau paysage ä l'ombre de quelques grands arbres. Cet excellent morceau, peint sur bois, est un des chef-d'oeuvres de Dietrich. I Mat.: auf Holz Maße: haut de 27 pouces, large de 32 pouces Verkäufer: Chret Guill Emest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0015 Chretien Guillaume Emest Dietrich dit Dietricy I Un porte-balle devant un cabaret de village hollandois, oü l'höte regarde par la porte, dont la partie superieure est ouverte. Devant la maison on voit une femme, tenant un petit garfon par la main et paroissant s'entretenir avec le mercier. Un autre petit gargon s'amuse avec un cerceau. Α droite on voit un gros paysan habille de rouge, fumant sa pipe, assis ä cöt6 d'un tonneau. Piece excellente, d'un beau fini et comparable ä tout ce que les maitres hollandois ont
fait de mieux dans ce genre. Sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: haut de 19 % pouces, large de 16 pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0016a Chretien Guillaume Ernest Dietrich dit Dietricy I Büste d'une vieille femme, en coiffe blanche, habillee d'une pelisse de velours rouge, sous laquelle eile porte un habit de satin jaune. [Ces quatre bustes peints dans le goüt de Rembrandt, sont d'un tres-beau fini, joint ä une execution tres-spirituelle. Les deux premiers sont peints sur des planches de cuivre, et les deux derniers sur du velin.] I Pendant zu Nr. 17b Mat.: auf Kupfer Maße: haut de 3 V* pouces, large de 2 Vi pouces Anm.: Die Angaben in ekkigen Klammem im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 19b und beziehen sich auf die Nrn. 16a bis 19b. Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0017b Chretien Guillaume Ernest Dietrich dit Dietricy I Pendant. Büste d'un vieillard ä barbe longue, en bonnet noir et en habit noir, portant sur la poitrine un hausse-col garni d'or. [Ces quatre bustes peints dans le goüt de Rembrandt, sont d'un tresbeau fini, joint ä une execution tres-spirituelle. Les deux premiers sont peints sur des planches de cuivre, et les deux demiers sur du velin.] I Pendant zu Nr. 16a Mat.: auf Kupfer Maße: haut de 3 V* pouces, large de 2 Vi pouces Anm.: Die ersten Angaben in eckigen Klammem im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 19b und beziehen sich auf die Nrn. 16a bis 19b. Verkäufer: Chret Guill Emest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0018a Chretien Guillaume Ernest Dietrich dit Dietricy I Büste d'un guerrier portant moustache, la tete couverte d'un chapeau rond, en cheveux noirs, en habit brun et en veste rougeatre, avec un hausse-col de fer sur la poitrine. [Ces quatre bustes peints dans le goüt de Rembrandt, sont d'un tres-beau fini, joint ä une execution tres-spirituelle. Les deux premiers sont peints sur des planches de cuivre, et les deux demiers sur du velin.] I Pendant zu nr. 19b Mat.: auf Pergament Maße: haut de 3 Vi pouces, large de 2 Vi pouces Anm.: Die ersten Angaben in eckigen Klammem im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 19b und beziehen sich auf die Nm. 16a bis 19b. Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0019b Chretien Guillaume Ernest Dietrich dit Dietricy I Pendant. Büste d'une jeune fille en chapeau rouge, ome de plumes blanches, habillee de verd. Ces quatre bustes, peints dans le goüt de Rembrandt, sont d'un tres-beau fini, joint ä une execution tres-spirituelle. Les deux premiers sont peints sur des planches de cuivre, et les deux derniers sur du velin. I Pendant zu Nr. 18a Mat.: auf Pergament Maße: haut de 3 !4 pouces, large de 2 Vi pouces Anm.: Die Angaben im Bildtitel beziehen sich auf die Nm. 16a bis 19b. Verkäufer: Chret Guill Emest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0020 Chretien Guillaume Ernest Dietrich dit Dietricy I La Resurrection du Lazare. Jesus, la main levee, est debout sur une haute magonnerie du tombeau, duquel on voit le Lazare se lever les bras etendus. A droite on remarque sur le devant la pierre sepulcrale, ä cöte de laquelle on voit les soeurs de Lazare ä genoux avec l'expression de la joie et de l'etonnement. Α cöte de Jesus on voit sur la haute magonnerie un grouppe de spectateurs, dont les airs de tete expriment les differens sentiments, soit d'admiration et de joie, soit d'envie et de haine. Tableau du plus grand merite, tant pour le coloris, que pour l'ordonnance et les jours et les ombres. I Maße: haut de 17 V* pouces, large de 13 pouces Verkäufer: Chret Guill Emest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0021 Chretien Guillaume Ernest Dietrich dit Dietricy I Jesus porte au sepulcre. Le corps de Jesus Christ est soutenu par trois hommes, ä cöte desquels on voit la mere eploree dans Γ attitude de la plus profonde douleur. Parmi les personnes qui l'accompagnent se distinguent Nicodeme et Joseph d'Arimathie. L'un vieillard venerable avec le caractere d'une tristesse reflechie,
mais profonde, l'autre le corps incline et paroissant donner les ordres necessaires pour la sepulture. Ά gauche on voit Marie Salome qui pleure, assise ä terre aupres des linceuls, entouree de quelques personnes qui la consolent. A travers l'ouverture du rocher on voit approcher quelques autres figures, et en meme terns on voit de loin les tenebres ceder aux demiers rayons du soleil couchant. Piece precieuse, dans laquelle se trouvent reunis les beautes d'un dessein noble, d'un coloris brillant et harmonieux, et d'une ordonnance savante. C'est enfin un des meilleurs ouvrages de ce maitre. Sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: haut de 17 VA pouces, large de 13 pouces Verkäufer: Chret Guill Emest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0022a Chretien Guillaume Ernest Dietrich dit Dietricy I La decollation de St. Jean. Dans un cachot souterrein on voit sur un manteau bleu etendu ä terre l'homme de Dieu ä genoux presque nud, la päleur de la mort sur le visage et sur le corps, les mains jointes et la tete un peu inclinee. Sa physionomie porte l'expression de l'innocence souffrante et de la grandeur tranquille; il est pret ä recevoir le coup mortel de la main du bourreau, qui paroit derriere lui le glaive leve, pour lui trancher la tete. Α droite on appergoit une vieille, tenant un plat, dans l'impatience de l'attente. A guache se tient debout un jeune homme drappe de verd, avec un air noble, et dont le visage päle exprime Γ inquietude et la compassion. II tient un flambeau, dont la lumiere sert ä eclairer cette scene d'horreur. Sur le devant on voit assis un guerrier dans son armure. Sur le demier plan paroissent ä Γ entree de la porte quelques figures d'hommes, dont les airs de tete expriment la compassion. Ce süperbe tableau peint sur toile se distingue par la beaute du clair-obscur et par l'expression des caracteres. I Pendant zu Nr. 23b Mat.: auf Leinwand Maße: haut de 17 pouces, large de 22 14 pouces Verkäufer: Chret Guill Emest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0023b Chretien Guillaume Ernest Dietrich dit Dietricy I Pendant. St. Paul et Silas dans la prison. Sur la droite se presente le geolier entrant dans le cachot souterrein par la porte ouverte par le tremblement de terre, sur le point de se percer d'un poignard. Derriere lui est un homme qui tient un flambeau. St. Paul s'avance vers lui d'un air de gravite. Derriere celui-ci on voit Silas ä terre, les pieds dans les entraves et les mains levees. Sur le devant on remarque plusieurs autres prisonniers dans l'attitude de la priere. Au fond du cachot on voit une fenetre, de laquelle on voit regarder un homme qui se tient au treillis de fer et qui semble s'etre guinde lä de 1'autre cöte de la muraille par un monument de curiosite. Piece d'expression, peinte sur toile, de la meme grandeur, que η. 22a. I Pendant zu Nr. 22a Mat.: auf Leinwand Maße: haut de 17 pouces, large de 22 V* pouces Verkäufer: Chret Guill Emest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0024a Chretien Guillaume Ernest Dietrich dit Dietricy I Les Bergers autour de la creche de Bethlehem. Devant l'enfant Jesus, couche dans une creche on voit dans l'attitude de l'adoration un grouppe de bergers et de bergeres, auxquels la mere montre d'un air joyeux le nouveau ne, qui reflechit une douce lumiere sur les objets d'alentour. Α cöte se presente Joseph transporte de joie et d'admiration. L'un des pasteurs porte une lanteme, dont la lueur repand une foible lumiere sur les objets places sur le devant du tableau. Ce morceau brille singulierement par l'harmonie du clairobscur, par le charme du coloris et par l'intelligence de l'execution. Sur bois. I Pendant zu Nr. 25b Mat.: auf Holz Maße: haut de 17 pouces, large de 22 pouces Verkäufer: Chret Guill Emest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0025b Chretien Guillaume Ernest Dietrich dit Dietricy I Pendant. L'annonciation de la naissance de Jesus Christ aux bergers. Sur le devant ä droite on voit un ange ome de tous les charmes d'une jeunesse etemelle et d'une innocence celeste, et environne de la splendeur eblouissante du ciel ouvert. Devant lui on remarque quelques bergers effrayes, les uns etendus ä terre, les autres couvrant, ou detournant les yeux eblouis de la clarte qui environne GEMÄLDE
531
le messager celeste. On voit pareillement les brebis effrayees courir en desordre 1'une contre l'autre. A quelque distance on remarque une figure de femme couchee ä terre ä cote d'une vache. Le paysage, qui s'offre dans le fond, est couvert des tenebres de la nuit. Cette piece superieurement bien coloriee est d'une harmonie inimitable digne des plus grands maitres dans ce genre. De la meme grandeur que n. 24a. I Pendant zu Nr. 24a Mat.: auf Holz Maße: haut de 17 pouces, large de 22 pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0026 Chretien Guillaume Ernest Dietrich dit Dietricy I La fuite nocturne de la sainte famille en Egypte. Α cöte de rochers escarpes ornes d'arbustes, on voit sur le devant Marie assise sur l'äne, tenant l'enfant endormi sous une draperie bleue, qui lui descend de 1'epaule. Avec l'expression de l'innocence virginale eile regarde Fange, qui vole ä son cöte un flambeau ä la main, dont la lumiere eclaire le sentier nocturne. Joseph, qui marche devant, regarde l'ange, qui semble lui indiquer le chemin. Dans cette piece süperbe Dietrich semble s'etre surpasse lui meme. A une expression interessante se trouve reuni un coloris brillant et harmonieux, des lumieres sagement distribuees, une ordonnance excellente, et une execution spirituelle, beautes, dont la description ne peut donner qu'une foible idee. Peint sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: haut de 17 14 pouces, large de 13 Vi pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0027a Chretien Guillaume Ernest Dietrich dit Dietricy I St. Pierre guerissant les malades par son ombre. L'apötre est represente, son manteau deploye et leve en haut. A ses pieds et couche ä terre est un jeune homme malade, dont le pere ä genoux implore le secours du thaumaturge. Parmi les divers grouppes d'hommes, que Ton voit assembles devant St. Pierre, et qui expriment les differens sentiments, soit d'admiration et de gratitude, soit de haine et d'envie, se distingue un homme perclus des mains et des pieds, qui s'approche de l'apötre. Vers le fond on voit avancer encore plusieurs figures. Ce beau tableau se distingue par l'originalite de l'invention et de l'execution, et en meme tems par la sagesse de l'ordonnance et par la verite de l'expression. Avant lui ce sujet n'avoit jamais ete traite par aucun artiste. Peint sur bois. I Pendant zu Nr. 28b Mat.: auf Holz Maße: haut de 12 pouces, large de 16 Vi pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0028b Chretien Guillaume Ernest Dietrich dit Dietricy I Pendant. St. Philippe pret ä baptiser l'eunuque de la reine de Candace. Celui-ci est vu sur le devant, presque nud, les reins couverts d'une legere drapperie blanche et le corps incline, debout dans une eau qui coule au pied d'un rocher. Sur la rive se presentent trois personnes de sa suite, dont une porte un parasol leve, une autre tient les habits somptueux et le turban de son maitre. Non loin de ce grouppe on remarque un char attele, entoure de plusieurs figures. Le tout est distribue dans un paysage riant, dont le fond offre l'aspect de hautes montagnes. Piece d'un coloris brillant, extremement bien ordonnee, de la meme grandeur que Ν. 27a. I Pendant zu Nr. 27a Maße: haut de 12 pouces, large de 16 Vi pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0029 Chretien Guillaume Ernest Dietrich dit Dietricy I Narcisse reposant ä terre sur la rive d'une eau limpide, les yeux fixes sur le reflet de sa propre figure. Α sa droite est une drapperie rouge, aupres de laquelle est assis son chien. Du meme cöte, un peu plus reculi, se presentent deux nymphes nues, assises aupres d'une ume sur une petite bute de terre, couverte d'une drapperie bleue. Derriere elles on voit un rocher escarpe. Sur le second plan s'offre une pierre elevee, sur laquelle on remarque en haut-relief une figure debout. Le fond offre un beau paysage orne d'un bois, d'oü l'on voit sortir un satyre. Piece d'un dessin noble, d'un coloris admirable, peinte dans le goüt du Poussin sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: haut de 33 pouces, large de 37 Vi pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 532
GEMÄLDE
1791/05/15 LZHCT 0030 Chretien Guillaume Emest Dietrich dit Dietricy I Jesus ä l'äge de douze ans au temple de Jerusalem. Sur un siege eleve, auquel conduisent de larges degres de pierre, on voit assis le divin adolescent dans l'attitude de l'instruction, la main levee vers le ciel, entoure de pretres et de docteurs de la loi representee ä son cöte, ou places sur les degres dans diverses attitudes expressives. Sur les degres les plus hauts avancent respectueusement vers lui Marie et Joseph. Derriere lui se montrent encore plusieurs figures, sur lesquelles descend un rideau. Peint sur toile en grisaille avec beaucoup d'esprit et de hardiesse. I Mat.: auf Leinwand Maße: haut de 28 Vi pouces, large de 18 V* pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0031 Chretien Guillaume Emest Dietrich dit Dietricy I Le repos en Egypte. La sainte famille reposant sous un arbre, duquel Joseph plie une branche, ayant l'äne ä cöte de lui; sur la droite quelques morceaux de bois allumes ä terre eclairent cette scene nocturne. Peint sur bois, tableau presque fini et ceintre en haut. I Mat.: auf Holz Format: halboval Maße: haut de 12 Vi pouces, large de 9 lA pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0032 Chretien Guillaume Emest Dietrich dit Dietricy I Le Denier de Cesar. J6sus dans le portique du temple de Jerusalem, entoure des scribes et des pharisiens, dont l'un lui präsente le denier du tribut avec l'expression de l'astuce et de l'hypocrisie. Le fond offre l'aspect des colonnades majestueuses du temple. Cet excellent morceau joint au merite d'une expression naturelle celle d'une composition savante. Peint sur le champ, ou alla prima sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: haut de 35 Vi pouces, large de 28 Vi pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0033 Chretien Guillaume Emest Dietrich dit Dietricy 17301 Decouverte de la grossesse de Callisto. Diane en robe flottante, donne d'un air imperieux des ordres ä ses Nymphes, dont quelques-unes sont debout dans l'eau et d'autres assises au bord. La deesse dirige la main droite sur Callisto, assise sur une pierre, et depouillee de son vetement par deux nymphes. Le tout est dispose dans une grotte de rochers entouree d'eau, et garnie d'arbustes. Cette piece a ete peinte par notre artiste en 1730 alla prima sous les yeux d'Auguste II. Roi de Pologne. Sur toile. I Maße: haut de 22 Vi pouces, large de 30 Vi pouces Inschr.: 1730 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0034a Chretien Guillaume Emest Dietrich dit Dietricy I Paysage montagneux, richement orne d'arbustes. Le devant offre de grands troncs d'arbres sur de hauts rochers, aut [sie] pied desquels on remarque quelques hommes, qui montrent le chemin ä un voyageur. I Pendant zu Nr. 35b Mat.: auf Holz Maße: haut de 17 Vi pouces, large de 14 pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0035b Chretien Guillaume Emest Dietrich dit Dietricy I Pendant. Paysage orne de hautes montagnes, au pied desquelles on voit sur la rive d'une eau limpide, entouree d'un agreable bocage, quelques guerriers, les uns debout, les autres assis. Ces deux paysages sont peints sur bois dans le goüt de Salvador Rosa, mais d'une execution plus finie, de la meme grandeur, que Ν. 34. I Pendant zu Nr. 34a Mat.: auf Holz Maße: haut de 17 Vi pouces, large de 14 pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0036a Chretien Guillaume Emest Dietrich dit Dietricy I Grande cascade, qui se preeipite d'une haute montagne. Sur le devant un hermite couche ä terre, duquel s'approche un autre. Α cöte l'on voit une croix attachee ä un vieux tronc. Peint sur bois. I Pendant zu Nr. 37b Mat.: auf Holz Maße: haut de 13 Vi pouces, large de 17 pouces Verkäufer: Chr£t Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt
1791/05/15 LZHCT 0037b Chretien Guillaume Ernest Dietrich dit Dietricy I Pendant. Contree couverte de rochers. Le devant offre un hermite ä genoux et les mains levees au pied d'un crucifix. Derriere lui on voit quelques vieux troncs d'arbres avec quelques branches peu garnies de feuilles. Sur le dernier plan s'elfevent des hauts rochers richement ornes d'arbustes, au travers desquels on voit un ciel serein. Ces deux paysages sont peints avec beaucoup de force et avec un beau fini sur bois. De la meme grandeur, que N. 36a. I Pendant zu Nr. 36a Mat.: auf Holz Maße: haut de 13 Vi pouces, large de 17 pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0038 Chretien Guillaume Ernest Dietrich dit Dietricy I Paysage romain οπιέ de gros et de menu betail, aupres duquel on voit un berger et une bergere ä cöte de la Statue d'Antinoüs, placee sur un piedestal. Α peu de distance de lä repose une vache rousse. Le demier plan offre les ruines d'un vieux chateau, entoure de hautes montagnes. Paysage süperbe dans la meilleure maniere de Dietrich. Sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: haut de 21 pouces, large de 25 V* pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0039 Chretien Guillaume Ernest Dietrich dit Dietricy I Paysage riant, oü l'on voit au bord d'une eau tranquille quelques rochers et collines richement ornes de sapins et d'autres arbres; sur cette hauteur est pratique un sentier, oü l'on voit quelques voyageurs. Piece d'un beau fini, d'un colons brillant et d'un dessin spirituel, peinte sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: haut de 12 pouces, large de 15 % pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0040a Chretien Guillaume Ernest Dietrich dit Dietricy I Le matin. Dans un paysage escarpe et eclaire foiblement des premiers rayons du soleil on voit entre deux rochers richement omes d'arbustes une cascade. Un pont de bois, sur lequel un homme conduit un äne, communique d'une röche ä l'autre. Excellent Paysage peint dans un tems oü Dietrich etoit encore dans toute sa force, et dans le goüt d'Elzheimer. Sur bois. I Pendant zu Nr. 41b Mat.: auf Holz Maße: haut de 7 % pouces, large de 10 pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0041b Chretien Guillaume Ernest Dietrich dit Dietricy I Pendant. Le Soir. Paysage montagneux orne de beaux arbres. Sur le devant on voit voyageur suivant un chemin, le long duquel il y a quelques tilleuls. Dans le lointain on remarque sur une colline une vieille tour ruinie. Le tout est eclaire des rayons brillants du soleil couchant. De la meme grandeur, que le precedent [Nr. 40a]. I Pendant zu Nr. 40a Mat.: auf Holz Maße: haut de 7 % pouces, large de 10 pouces Verkäufer: Chret Guill Emest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0042 Chretien Guillaume Ernest Dietrich dit Dietricy I Vue d'une petite ville de Hollande au bord d'une riviere, sur laquelle voguent quelques navires ä pleines voiles. Sur le devant se presente un coche, entoure de plusieurs personnes, et cotoye par un homme ä cheval. Peint sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: haut de 7 V* pouces, large de 14 pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0043 Chretien Guillaume Ernest Dietrich dit Dietricy I Paysage, oü l'on voit sur le second plan un grand rocher pele. Sur le devant est un berger avec quelques vaches et ä cöte une femme monte sur un äne parlant ä une servante qui l'accompagne. A quelque distance on remarque un homme conduisant un äne charg£, et plus loin un paysan labourant la terre. Cette belle piece est peinte d'une maniere si imposante dans le goüt de Berghem, qu'un grand connoisseur disoit en la contemplant: "Berghem semble l'avoir peint et s'etre surpasse lui-meme." Sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: haut de 10 Vi pouces, large de 14 pouces Verkäufer: Chrtt Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt
1791/05/15 LZHCT 0044a Chretien Guillaume Ernest Dietrich dit Dietricy I Beau paysage representant le penchant d'une colline revetue de quelques sapins elegamment grouppes. Sur le devant on remarque un quartier de rocher, aupres duquel se voit la cascade d'un ruisseau, que l'on passe par un petit pont de bois. A droite on remarque une femme portant sur son dos une hotte chargee. Peint sur bois. I Pendant zu Nr. 45b Mat.: auf Holz Maße: haut de 10 lA pouces, large de 9 Vt pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0045b Chretien Guillaume Ernest Dietrich dit Dietricy I Pendant. L'antre d'un rocher ä demi-eclaire, et surmonte de pins et de broussailles. Du fond de cet antre coule un ruisseau sur un lit pierreux traverse par un pont rustique oü l'on voit un paysan avec un chien. Peint sur bois de la meme grandeur que Ν. 44a. Ces deux paysages sont d'un beau fini, et d'un coloris tres-brillant. I Pendant zu Nr. 44a Mat.: auf Holz Maße: haut de 10 Ά pouces, large de 9 V* pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0046a Chretien Guillaume Emest Dietrich dit Dietricy I Ruines antique dans un paysage d'une vaste etendue. Dans le fond du milieu se presente un grand portail d'ordre Dorique, devant lequel on voit les ruines d'un tombeau antique, sur lequel on remarque un hautrelief representant Cleopatre mourante. A cöte de ce tombeau est le torse antique d'un homme, aupres duquel quelques gens sont occupe ä fouiller la terre, pour trouver des antiques. Peint sur toile. I Pendant zu Nr. 47b Mat.: auf Leinwand Maße: haut de 18 pouces, large de 25 pouces Verkäufer: Chrit Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0047b Chretien Guillaume Ernest Dietrich dit Dietricy I Pendant. Beau Paysage romain orne de hauts arbres, derriere lesquels se presente une petite ville. Sur le devant on voit deux bergers occupes ä rassembler leurs bestiaux. Plus loin on voit une femme voyageant sur un äne, et ä cöte d'elle un homme qui arrache une grosse branche d'un arbre. De la meme grandeur, que Ν. 46a. Ces deux paysages sont peints ä l'huile dans la maniere ä gouache de Marco Ricci jusqu'ä faire illusion. On peut les considerer comme des temoignages remarquables de la facilite, avec laquelle Dietrich savoit imiter la maniere des autres maitres. I Pendant zu Nr. 46a Mat.: auf Leinwand Maße: haut de 18 pouces, large de 25 pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0048 Chretien Guillaume Ernest Dietrich dit Dietricy I Paysage d'hyver orne de beaucoup de figures, qui vont en traineau et en patins sur une riviere prise par la glace. A droite on voit sur le devant une baraque; une paysanne regarde par la porte et un paysan est devant avec un traineau charge de bois, aupres duquel se trouve une femme avec deux enfans et un chien. Sur le dernier plan on voit un coche, qui passe devant une maison. Piece d'un beau fini dans le goüt hollandois, peinte sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: haut de 15 pouces, large de 17 Vi pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0049 Chretien Guillaume Ernest Dietrich dit Dietricy I Paysage orne d'une riviere traversee par un haut pont de bois, sur lequel on voit des paysans menant des brouettes chargees. Sur le devant il y a plusieurs chevaux dans la riviere; sur le bord il se pr6sente un paysan ä cheval, qui dirige la main vers un autre. Plus loin on remarque une femme qui porte un enfant sur le dos. Peint dans la meilleure maniere de Wouwermann sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: haut de 17 Vi pouces, large de 24 pouces Verkäufer: Chret Guill Emest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0050a Chretien Guillaume Ernest Dietrich dit Dietricy I Paysage oü l'on voit un vieux moulin entoure de beau arbres, et situe au bord d'un ruisseau que l'on passe sur un petit pont rustique. Peint sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: haut de 9 pouces, GEMÄLDE
533
large de 12 Vi pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0051b Chretien Guillaume Ernest Dietrich dit Dietricy I Paysage oü l'on voit un quelques cabanes au bord d'une riviere, dans laquelle sont disperses plusieurs quartiers de rochers. Sur le devant on voit travailler quelques pecheurs aupres d'un bateau. De la meme grandeur, que le precedent. Ces deux beaux paysages sont peints dans le premier terns de Dietrich et dans le gout de Waterloo. I Mat.: auf Holz Maße: haut de 9 pouces, large de 12 'Λ pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0052a Chretien Guillaume Ernest Dietrich dit Dietricy I Betes ä cornes et ä laine au päturage. On voit un berger sonnant du comet, ayant aupres de lui une femme qui repose ä terre avec son enfant. Dans le lointain on remarque de hautes ruines entourees d'un boccage. Peint sur bois. I Pendant zu Nr. 53b Mat.: auf Holz Maße: haut de 19 pouces, large de 14 % pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0053b Chretien Guillaume Ernest Dietrich dit Dietricy I Pendant. Betes ä cornes et ä laine au päturage aupres d'un antre voute, qui traverse le devant du tableau et qui est revetu de broussailles. Un peu plus loin on appercoit une femme avec un enfant, lequel etend les bras vers un berger. De la meme grandeur que le precedent. Ces deux pieces sont peints sur bois avec beaucoup d'esprit et d'un coloris brillant. I Pendant zu Nr. 52a Mat.: auf Holz Maße: haut de 19 pouces, large de 14 % pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/07/29 HBBMN 0075 Diederichs I Zwey Landschaften mit Vieh; auf Holz. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Vieh Annotat.: fehlt eine Landsch. (KH) Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Zoll, breit 16 Zoll Anm.: Die Lose 75 und 76 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1791/07/29 HBBMN 0076 Diederichs I Zwey Landschaften mit Vieh; auf Holz. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Vieh Annotat.: fehlt eine Landsch. (KH) Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Zoll, breit 16 Zoll Anm.: Die Lose 75 und 76 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0128 Diederici I Ein Wald mit Satyren und Nymphen belebt, von Diederici Meisterhand. I Maße: 7 Zoll breit, 5 Zoll hoch Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0469 Dietricy I Die Anbetung der Hirten, ein reich ordinirtes Bild mit vielem Ausdruck gemalt und bezeichnet Dietricy 1770. I Maße: 39 Zoll hoch, 28 Zoll breit Inschr.: Dietricy 1770 (bezeichnet und datiert) Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1792/07/05 LBKIP 0018 Diederich I Zwey kleine Winterstücke von Diederich. I Diese Nr.: Ein kleines Winterstück Anm.: Die Lose 18 und 19 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1792/07/05 LBKIP 0019 Diederich I Zwey kleine Winterstücke von Diederich. I Diese Nr.: Ein kleines Winterstück Anm.: Die Lose 18 und 19 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1792/07/05 LBKIP 0085 Diederichs I Ein alter Mann mit einer Brille auf der Nase, sehr andächtig in einem Buche lesend, sehr vortreflich und mit vielen Fleiss gemahlt. I Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0007 Dieterici I Venus und Diana lassen sich durch ihre Nymphen schmücken; Amor macht Seifenblasen; hinten badende Nymphen. Mit vielem Fleiß gemahlt. Auf Holz, S.R.G.L. [Schwarzen Rahm Goldne Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Vi Zoll, breit 14 Zoll Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1792/09/28 HBBMN 0086 Dieterici I Ein junger historischer Mannskopf, ä la Rembrandt, von Dieterici. Auf Hz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Zoll, breit 6 Zoll Transakt.: Unbekannt 534
GEMÄLDE
1793/00/00 HBMFD 0036 Dietrich I Landschaft mit Ruinen zur linken, zur rechten zwey Bäume. Im Vordergründe eine Kuh % von vorne zu sehen, mit einer Kloke am Halse, ein wenig mehr nach vorne vier ruhende Schaafe. I Pendant zu Nr. 37 Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuss 3 Vi Zoll hoch, 11 % Zoll breit Verkäufer: Pierre Laporterie Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 HBMFD 0037 Dietrich I Das Gegenstück eine dergleichen Vorstellung. Rechts gleichfals Ruinen mit alten Bildhauerarbeiten. Eine Kuh stellt sich hier ganz von der Seite dar, im Vordergrunde eine andre liegende; nebenbey noch zwey Schaafe, wovon eins schläft. Diese beyden Gemälde sind warm und von markichten Pinsel; richtig und schön gezeichnet. I Pendant zu Nr. 36 Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuss 3 Vi Zoll hoch, 11 % Zoll breit Verkäufer: Pierre Laporterie Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0100 Dietrich I Eine sächsische Gegend mit Gebürge ec. von Dietrichs ersten Zeit. I Maße: Hoch 9 Zoll, breit 12 Zoll Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0190 Dieterichs I Eine vergnügte Conversations=Gesellschaft, in angenehmer Landgegend; sehr schön gemahlt. Auf Holz, von Dieterichs. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 14 Zoll 3 Lin., breit 17 Zoll 9 Lin. Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0226 Dieterichs I Zwey Landgegenden. Im Vordergrunde auf dem einen ein Schimmel und Schaaf, auf dem andern Rinder und Schaaf, meisterhaft gemahlt. Auf Holz, von Dieterichs. I Diese Nr.: Eine Landgegend. Im Vordergrunde auf dem einen ein Schimmel und Schaaf Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 Zoll 3 Lin., breit 9 Zoll 6 Lin. Anm.: Die Lose 226 und 227 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0227 Dieterichs I Zwey Landgegenden. Im Vordergrunde auf dem einen ein Schimmel und Schaaf, auf dem andern Rinder und Schaaf, meisterhaft gemahlt. Auf Holz, von Dieterichs. 1 Diese Nr.: Eine Landgegend. Im Vordergrunde Rinder und Schaaf Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 Zoll 3 Lin., breit 9 Zoll 6 Lin. Anm.: Die Lose 226 und 227 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 FGAN [B]0089 E.W.E. Dietrich I Zwey Konversationsstücke, mit Soldaten. Ein Tambour ruht an der Trommel, auf Kupfer gemalt. I Mat.: auf Kupfer Maße: 7 Vi Zoll hoch, 9 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt (44 fl) 1794/01/20 LZRST 5856 C.W.E. Dietrich I Eine Nymphe aus dem Bade, der ein Liebesgott die Füsse abtrocknet, nebst einem jungen Satyr; ein lascives Stück; fleissig auf Holz gemahlt, von ebendemselben [C.W.E. Dietrich], 12 Vi Zoll hoch, 9 Vi Zoll breit, in schwarzem Rahm, i Mat.: auf Holz Maße: 12 Vi Zoll hoch, 9 Vi Zoll breit Verkäufer: WR Transakt.: Verkauft (16 Gr) Käufer: WL 1794/02/21 HBHEG 0007 C. W. Ernst Dieterich I In der Mitte auf einer kleinen erdnen Fläche, sitzen zwey junge Schäferinnen, welche miteinander Unterredung halten; neben Dieselben liegen Schaafe und am Fuße des Berges treiben zwey Hirtinnen ihre Heerde vor sich her. Zur Linken vergnügen sich einige Andere mit Tanzen, wozu ein Schäfer auf der Flöte spielt, und eine Schäferinn mit einer Tambour demselben accompagnirt. Die steile Berges Höhe ist bis in die Ebene mit Gesträuche bewachsen, und das fette Graß mit Klee angefüllet, scheint den Ueberfluß des Landlebens zu verherrlichen. Der Untergang der Sonne des Horizontes, welcher mit warmer Luft und einem stolzem Gewölke pranget, verschaffet eine gleich schöne Beleuchtung auf diese zufriedene Land=Gesellschaft. Der schmeichelhafte Pinsel des Dieterichs verschönerte gleichsam die Natur mit seinem angenehmen Laubgrün an dem Gehölze, so wie das Fleisch der jugendlichen Landschönen, welche mit unschuldsvollen wenigen Gewänder ihre Zierde bereichern. Er verfertigte dieses ganz schöne Gemähide Ao. 1761. I Mat.: auf Leinwand Maße:
Hoch 24 Zoll, breit 30 Zoll Inschr.: Ao. 1761 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt 1794/09/09 HBPAK 0188 Dieterici I Zwey schön gemahlte Köpfe. I Diese Nr.: Ein schön gemahlter Kopf Anm.: Die Lose 188 und 189 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/09 HBPAK 0189 Dieterici I Zwey schön gemahlte Köpfe. I Diese Nr.: Ein schön gemahlter Kopf Anm.; Die Lose 188 und 189 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1795/03/12 HBSDT 0009 Dietrici] In einer Schmiede, vor dem Ofen, ein Arbeiter, welcher durch den Contrast des dabey im Schatten stehenden Knaben, welcher den Blasebalg tritt, eine sehr gute Wirkung verursacht. Auf Holz; im schwarzen Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Vi Zoll, breit 9 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1795/03/12 HBSDT 0024 Dietrici I Ein Mann mit einem Guckkasten, um dem viele Figuren stehen; und eine Gesellschaft am Tische mit einem Eichhörnchen beschäftigt. Auf Holz, im schwarzen Rahm. I Diese Nr.: Ein Mann mit einem Guckkasten, um dem viele Figuren stehen Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 12 Zoll Anm.: Die Lose 24 und 25 wurden zusammen katalogisiert. Trans akt.: Unbekannt 1795/03/12 HBSDT 0025 Dietrici I Ein Mann mit einem Guckkasten, um dem viele Figuren stehen; und eine Gesellschaft am Tische mit einem Eichhörnchen beschäftigt. Auf Holz, im schwarzen Rahm. I Diese Nr.: Eine Gesellschaft am Tische mit einem Eichhörnchen beschäftigt Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 12 Zoll Anm.: Die Lose 24 und 25 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1795/03/12 HBSDT 0098 Dietrici, in der Manier Thielens I Landschaften mit großen Felsen=Massen, an deren Füßen Städte aufs angenehmste neben hindurchschlängelnde Flüße angebracht sind; brav und kühn gemahlt. Auf Holz, im schw. Rahm. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 13 Zoll Anm.: Die Lose 98 und 99 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1795/03/12 HBSDT 0099 Dietrici, in der Manier Thielens I Landschaften mit großen Felsen=Massen, an deren Füßen Städte aufs angenehmste neben hindurchschlängelnde Flüße angebracht sind; brav und kühn gemahlt. Auf Holz, im schw. Rahm. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 13 Zoll Anm.: Die Lose 98 und 99 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1795/03/12 HBSDT 0153 Ditrici I Ein Hirte; im Geschmacke Berghems komponirt. Auf Holz, im schwarzen Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Zoll, breit 9 Zoll Transakt.: Unbekannt 1795/11/14 HBPAK 0038 C.W.E. Dietrich I Ein Nacht=Stück. Eine alte Frau hält ein Licht in der Hand; die andere hält sie davor. Ein Knabe kömmt, und will sein Licht anbrennen. Die Beleuchtung ist sehr schön und überaus fleißig gemahlt. Auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 9 Zoll, breit 8 Zoll Transakt.: Unbekannt 1795/11/14 HBPAK 0059 C. W. E. Dietrich I Ein alter Manns= Kopf. Sehr lebhaft gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 1 Fuß 1 Zoll, breit 9 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1795/11/14 HBPAK 0060 C. W. E. Dietrich I Ein alter Manns= Kopf. Sehr frey gearbeitet. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 11 Zoll, breit 10 Zoll Transakt.: Unbekannt 1795/11/14 HBPAK 0068 C. W. E. Dietrich I Eine Bettel=Frau, welche ein Munstrum auf dem Rücken hat. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 4 Vi Zoll, breit 4 Zoll Transakt.: Unbekannt 1795/11/14 HBPAK 0069 C. W. E. Dietrich I Ein Bettelmann mit einem Jungen. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 4 Vi Zoll, breit 4 Zoll Transakt.: Unbekannt
1795/11/14 HBPAK 0074 C. W. E. Dietrich I Eine Landschaft. Sehr fleißig und lebhaft gemahlt, wie die bekannten Arbeiten dieses Meisters. Auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 8 Zoll, breit 11 Zoll Transakt.: Unbekannt 1795/11/14 HBPAK 0085 C. W. E. Dietrich I Ein Türkischer Kopf. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 4 Vi Zoll, breit 4 Zoll Transakt.: Unbekannt 1795/11/14 HBPAK 0126 Diedrichs I Ein geharnischter Tambour, in seiner Corps du Garde, sitzet beym Tische und rauchet sein Pfeifgen; in der rechten Hand hält er ein Glas Bier, zur linken liegt seine Trommel. Auf Holz. Schwarz. Rahm. \Mat.: auf Holz Maße: Hoch 20 Zoll, breit 16 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/02/17 HBPAK O l l i Dietericyl Aus einem dichten Gehölze geht eine steinerne Brücke zu einem runden Thurm. Auf der Brücke reitet Einer aufm Esel, woneben ein Anderer geht. Unten im Vordergrunde zur Rechten weidet ein Hirt seine Ziegen. Alles ist mit einem warmen Sonnenlicht, welches durch die Wolken dringt, beleuchtet. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 12 Zoll, Breite 15 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (305 M) Käufer: Τ 1796/08/00 HBPAK 0074 Chr. Wilh. Ernst Dietrich I Zwey chirurgische Operationen, im Innern eines Zimmers vorgestellt; mit vielen Nebenwerken. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine chirurgische Operation Mat.: auf Holz Maße: Höhe 16 Zoll, Breite 12 Vi Zoll Anm.: Die Lose 74 und 75 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/08/00 HBPAK 0075 Chr. Wilh. Ernst Dietrich I Zwey chirurgische Operationen, im Innern eines Zimmers vorgestellt; mit vielen Nebenwerken. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine chirurgische Operation Mat.: auf Holz Maße: Höhe 16 Zoll, Breite 12 Vi Zoll Anm.: Die Lose 74 und 75 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0241 Dieterici I Ein sehr lebhaftes Hirtenstück; welches wohl componirt und schön gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll 9 Lin., breit 8 Zoll 7 Lin. Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0109 Dieterich I Zwey Land= und Wasser=Prospecte: das Eine der Sonnen Aufgang. Im Hintergründe sieht man Berge und eine Stadt; zwischen der Stadt und den Bergen, im Vordergrunde, Schiffe im vollen seegein, und noch viele andere Personen, welche fischen und Schiffe am Lande ziehn. Das Andere ein Nachtstück mit dem vollen Monde. Auf dem Wasser große und kleine Schiffe; am Ufer Personen, welche fischen. Ganz in der Vernetschen Manier. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Ein Land= und Wasser=Prospect: der Sonnen Aufgang Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 10 Zoll, breit 13 Vi Zoll Anm.: Die Lose 109 und 110 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0110 Dieterich I Zwey Land= und Wasser=Prospecte: das Eine der Sonnen Aufgang. Im Hintergrunde sieht man Berge und eine Stadt; zwischen der Stadt und den Bergen, im Vordergrunde, Schiffe im vollen seegein, und noch viele andere Personen, welche fischen und Schiffe am Lande ziehn. Das Andere ein Nachtstück mit dem vollen Monde. Auf dem Wasser große und kleine Schiffe; am Ufer Personen, welche fischen. Ganz in der Vernetschen Manier. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Ein Land= und Wasser=Prospect: ein Nachtstück mit dem vollen Monde Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 10 Zoll, breit 13 Vi Zoll Anm.: Die Lose 109 und 110 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0125 Dieterich I Zwey Landschaften; die Eine mit einigen Häusern; die Andere mit einem Kirchdorfe, nebst vielen Figuren. Zwey sehr schöne Bilder. Auf Holz. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit einigen Häusern Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 13 Vi Zoll Anm. : Die Lose 125 und 126 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
535
1796/11/02 HBPAK 0126 Dieterich i Zwey Landschaften; die Eine mit einigen Häusern; die Andere mit einem Kirchdorfe, nebst vielen Figuren. Zwey sehr schöne Bilder. Auf Holz. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit einem Kirchdorfe, nebst vielen Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 13 Vi Zoll Anm.: Die Lose 125 und 126 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0178 Dietrich I Ein sehr schönes Mädgen sitzt an einem Tische vor einen Garten, faßt sich mit der rechten Hand an ihrem Schmuck. Ein sehr gutes Bild. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Zoll, breit 9 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0044 Diederichs I Zwey waldigte Landschaften. I Diese Nr.: Eine waldigte Landschaft Anm.: Die Lose 44 und 45 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0045 Diederichs I Zwey waldigte Landschaften. I Diese Nr.: Eine waldigte Landschaft Anm.: Die Lose 44 und 45 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0125 Diederichs I Ein Seehafen mit einem Castell und vielen Figuren. I Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0127 Diederichs I Eine Landschaft mit Hirten und Vieh. I Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0015 Dieterich I Eine Schmiede; wo der Schmid ein Pferd beschlägt, und der Knabe, der das Pferd hält, mit dem Hunde spielt. Mit mehrern Figuren ausstaffirt. Eins der fleißigsten Bilder von diesem Künstler. Auf Holz, mit vergoldeten Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 14 Zoll, breit 11 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0025 Christian Wilhelm Emst Dietrich I Der heilige Bernardus in einer Eremitage, von einer Lampe beleuchtet, vor einem Buche sitzend. Ganz in der diesem Künstler eigenen Manier mit vielem Fleiß ausgearbeitet. Auf Holz, mit schwarzen Rahm und vergoldeten Stäben. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Zoll, breit 9 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0033 C. W. E. Dietrich I Zwey mit großem Fleiß ausgeführte Landschaften, von einer schiffreichen Gegend, mit vielen kleinen Figuren ausstaffirt. Auf Holz, mit schwarzen Rahm und vergoldeten Stäben. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Zoll, breit 10 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0034 C. W. E. Dietrich I Zwey Dito [mit großem Fleiß ausgeführte Landschaften]. Eins den Sommer vorstellend. Das Gegenstück den Winter. Auch mit vielem Fleiß verfertiget. Ebenfalls auf Holz, mit schwarzen Rahm und vergoldeten Stäben. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Zoll, breit 20 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0040 C. IV. E. Dietrich I Der Kopf eines Holländers, in der Tracht aus dem vorigen Jahrhundert. Mit einem ausserordentlichen Fleiß, und ganz in der Manier des Rembrandt ausgearbeitet. Auf Holz, mit vergoldeten Rahm. I Pendant zu Nr. 41 Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Zoll, breit 10 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0041 C. W. E. Dietrich I Das Gegenstück, welches einen jüdischen Rabbinen vorstellt. Ebenfalls mit großem Fleiß und starkem Colorit verfertiget. Auf Holz, mit vergoldeten Rahm. I Pendant zu Nr. 40 Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0065 Dietrich I Ein altes Mütterchen; mit vielem Ausdruck. Mit dem besten Fleiß, vortreflich angeordneten Licht und Schatten, so ganz in Rembrands Geschmack ausgefertiget. Auf Holz, mit schwarzen Rahm und vergoldeten Stäben. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Zoll, breit 7 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0078 C. W. E. Dieterich I Zwey sehr schöne Landschaften, mit Pferden, Ochsen und Schaafen; nebst eini536
GEMÄLDE
gen Hirten, die ihr Vieh auf der Weide bewachen. Mit vielem Fleiß und sehr warmen Colorit gemahlt, und sehr gut conservirt. Auf Leinwand, mit schwarzen Rahm und vergoldeten Stäben. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 11 Zoll, breit 14 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0099 Dietrich I Eine sehr angenehme Landschaft, mit Leuten, die theils mit der Angel, theils mit Netzen fischen. Auf Holz, mit schwarzen Rahm und vergoldeten Stäben. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 6 Vi Zoll, breit 9 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0104 Dieterich I Zwey sehr angenehme und fleißige Landschaften; sehr warm gemahlt und ausgeführt. Auf Holz, mit vergoldeten Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 6 Vi Zoll, breit 8 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0105 Dieterich I Zwey Landschaften mit Felsen; in einer ganz besondern Manier, grau in grau, gemahlt. Auf Holz, mit schwarz=gebeitzten Rahm und vergoldeten Stäben. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 7 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0131 C. Dieterich, nach der Manier von Vateau I Zwey Pendante; das Innere ζweyer Häuser. In dem Einen ein Mann, welcher Bauern Raritäten zeigt. In dem Andern Kinder, welche bey Licht mit einem Eichhörnchen spielen. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Das Innere eines Hauses; Pendant zu Nr. 132 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 22 Zoll Anm.: Die Lose 131 und 132 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0132 C. Dieterich, nach der Manier von Vateau I Zwey Pendante; das Innere zweyer Häuser. In dem Einen ein Mann, welcher Bauern Raritäten zeigt. In dem Andern Kinder, welche bey Licht mit einem Eichhörnchen spielen. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Das Innere eines Hauses; Pendant zu Nr. 131 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 22 Zoll Anm.: Die Lose 131 und 132 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0137 C. Dieterich I Ein Manns=Portrait; nach der Manier von Rembrand. Von sehr frischer Farbe. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Zoll, breit 9 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0149 C. Dieterich I Eine gebirgigte Landschaft und Ansicht der See; ein Schiff, ein Fahrzeug, ein Fischer und andere Figuren. Von frischer Farbe und herrlicher Composition. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0155 C. Dieterich I Zwey Pendante; der eine stellt einen Mann, und der andere ein Frauenzimmer vor. Von sehr frischer Farbe. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Mann; Pendant zu Nr. 156 Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Zoll, breit lOZolMnm..· Die Lose 155 und 156 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0156 C. Dieterich I Zwey Pendante; der eine stellt einen Mann, und der andere ein Frauenzimmer vor. Von sehr frischer Farbe. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Frauenzimmer; Pendant zu Nr. 155 Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Zoll, breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 155 und 156 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0161 C. Dieterich I Ein sehr artiges Winterstück; nach der Wahrheit gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 6 Zoll, breit 8 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0163 C. Dieterich I Ein Astrolog, in seinem Laboratorio sitzend. Mit sehr frischen Farben, und fein gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Vi Zoll, breit 8 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0166 C. Dieterich, nach der Maniers de Rosa von Tivoli I Zwey Landschaften, im Vordergründe Widder, Kühe und Figuren; in der Feme Felsen, alte Ruinen, Cascaden ec. Stark und frisch gemahlt. Diese beyden Stücke machen sowohl ihm, als dem Mahler, den er nachgeahmt hat, Ehre. Auf Leinwand. I Diese
Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 13 Vi Zoll, breit 21 Zoll Anm.: Die Lose 166 und 167 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0167 C. Dieterich, nach der Maniers de Rosa von Tivoli I Zwey Landschaften, im Vordergrunde Widder, Kühe und Figuren; in der Feme Felsen, alte Ruinen, Cascaden ec. Stark und frisch gemahlt. Diese beyden Stücke machen sowohl ihm, als dem Mahler, den er nachgeahmt hat, Ehre. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 13 Vi Zoll, breit 21 Zoll Anm.: Die Lose 166 und 167 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0172 Dieterich I Zwey Pendante: Ruinen, Statüen, Tempel, Figuren und Monumente. Alles wohl componirt; und von sehr frischer Farbe. Auf Holz. I Diese Nr.: Ruinen, Statüen, Tempel, Figuren und Monumente; Pendant zu Nr. 173 Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Zoll, breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 172 und 173 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0173 Dieterich I Zwey Pendante: Ruinen, Statüen, Tempel, Figuren und Monumente. Alles wohl componirt; und von sehr frischer Farbe. Auf Holz. I Diese Nr.: Ruinen, Statüen, Tempel, Figuren und Monumente; Pendant zu Nr. 172 Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Zoll, breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 172 und 173 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0213 Diedrichs I Die Verkündigung der Hirten auf dem Felde. Auf Holz, mit schwarzen Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 24 Zoll, breit 29 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0259 Dietrici I Dieser grosse Künstler hat hier zween schöne bergigte Gegenden Sachsens vorgestellt. In der einen sieht man eine wilde Entenjagd, und in der andern weidende Schaafe ec. Diese Stücke sind von der herrlichsten Haltung und sehr angenehmen Kolorit. Sie verdienen einen Platz in den ersten Sammlungen. Auf Holz, mit goldn. Rahm. I Diese Nr.: Eine schöne bergigte Gegend Sachsens vorstellend; eine wilde Entenjagd Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Zoll, breit 20 Zoll Anm.: Die Lose 259 und 260 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0260 Dietrici I Dieser grosse Künstler hat hier zween schöne bergigte Gegenden Sachsens vorgestellt. In der einen sieht man eine wilde Entenjagd, und in der andern weidende Schaafe ec. Diese Stücke sind von der herrlichsten Haltung und sehr angenehmen Kolorit. Sie verdienen einen Platz in den ersten Sammlungen. Auf Holz, mit goldn. Rahm. I Diese Nr.: Eine schöne bergigte Gegend Sachsens vorstellend; weidende Schaafe Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Zoll, breit 20 Zoll Anm.: Die Lose 259 und 260 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/06/13 HBPAK 0075 Dieterichs erster Zeit I Eine junge Dame, als Schäferinn vorgestellt. Lebhaft gemahlt. Auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 13 Zoll, breit 10 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/06/13 HBPAK 0129 Diterich I Christus am Kreuz mit Engeln umgeben. Hinter dem Kreuze stehen Maria und Johannes. Im Hintergründe siehet man die Stadt Jerusalem. Alles ist mit großem Fleiß gemahlt und von vortreflichem Colorit. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Zoll, breit 7 % Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/06/13 HBPAK 0183 Dieterich I Eine feisichte Gegend mit Wasserfall; sehr schön gemahlt, wie Everdingen. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 6 3/s Zoll, breit 5 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/06/13 HBPAK 0216 Diterich I Ein andächtiger Mönch lieset in einem Buche, welches er mit beyden Händen hält und auf seinen Knien liegen hat. So schön wie Gerhard Dow. Auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 15 Vi Zoll, breit 12 % Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/12/08 HBPAK 0103 Diederichs I Zwey bergigte Land= und Wassergegenden, mit Schiffen und Figuren. Sehr gut gemahlt.
Auf Holz, im schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Eine bergigte Land= und Wassergegend, mit Schiffen und Figuren Mat.: auf Holz Maße: Höhe 9 Zoll, Breite 12 Zoll Anm.: Die Lose 103 und 104 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/12/08 HBPAK 0104 Diederichs I Zwey bergigte Land= und Wassergegenden, mit Schiffen und Figuren. Sehr gut gemahlt. Auf Holz, im schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Eine bergigte Land= und Wassergegend, mit Schiffen und Figuren Mat.: auf Holz Maße: Höhe 9 Zoll, Breite 12 Zoll Anm.: Die Lose 103 und 104 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/01/19 HBPAK 0028 Diedrich I Zwey Mädchens, von denen das eine mit ein Paar Tauben, das andere mit einen Papagoy spielt. Bruststücke, voll schönem Ausdrucks; aus der besten Zeit dieses berühmten Meisters. 1 Fuß 2 Zoll hoch, 1 Fuß breit. Auf Holz gemahlt, goldn. Rahm. I Diese Nr.: Ein Mädchen, das mit ein Paar Tauben spielt Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 2 Zoll hoch, 1 Fuß breit Anm.: Die Lose 28 und 29 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/01/19 HBPAK 0029 Diedrich I Zwey Mädchens, von denen das eine mit ein Paar Tauben, das andere mit einen Papagoy spielt. Bruststücke, voll schönem Ausdrucks; aus der besten Zeit dieses berühmten Meisters. 1 Fuß 2 Zoll hoch, 1 Fuß breit. Auf Holz gemahlt, goldn. Rahm. I Diese Nr.: Ein Mädchen, das mit einen Papagoy spielt Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 2 Zoll hoch, 1 Fuß breit Anm.: Die Lose 28 und 29 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0071 Diederichs I Zwey Land= und Wassergegenden mit vielen kleinen Figuren. Ganz in der Manier von Grefje. Auf Holz, goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine Land= und Wasergegend mit vielen kleinen Figuren Mal.: auf Holz Maße: Hoch 5 Vi Zoll, breit 7 Vi Zoll Anm.: Die Lose 71 und 72 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0072 Diederichs I Zwey Land= und Wassergegenden mit vielen kleinen Figuren. Ganz in der Manier von Grefje. Auf Holz, goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine Land= und Wasergegend mit vielen kleinen Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 5 Vi Zoll, breit 7 Vi Zoll Anm.: Die Lose 71 und 72 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0230 C. Dieterich, nach der Manier von Vateau I Zwey Pendante, das Innere zweyer Häuser. In dem Einen ein Mann, welcher Bauern Raritäten zeigt. In dem Andern Kinder, welche bey Licht mit einem Eichhörnchen spielen. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Das Innere eines Hauses. Ein Mann, welcher Bauern Raritäten zeigt; Pendant zu Nr. 231 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 22 Zoll Anm.: Die Lose 230 und 231 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0231 C. Dieterich, nach der Manier von Vateau I Zwey Pendante, das Innere zweyer Häuser. In dem Einen ein Mann, welcher Bauern Raritäten zeigt. In dem Andern Kinder, welche bey Licht mit einem Eichhörnchen spielen. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Das Innere eines Hauses. Kinder, welche bey Licht mit einem Eichhörnchen spielen; Pendant zu Nr. 230 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 22 Zoll Anm.: Die Lose 230 und 231 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0299 Dietrici I Zwey Land= und Wasserprosepete. Auf dem Einen ist der Sonnenaufgang vorgestellt. Im Hintergrunde sieht man Berge und eine Stadt; zwischen der Stadt und den Bergen, im Vordergrunde, Schiffe in vollem segeln, und viele Personen, welche fischen und und Schiffe ans Land ziehen. Das Andere stellt ein Nachtstück mit dem vollen Monde vor. Auf dem Wasser befinden sich grosse und kleine Schiffe, und am Ufer Personen, welche fischen. So schön wie Vernet. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Land= und Wasserprospect worauf der Sonnenaufgang vorgestellt ist Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 10 Zoll, breit GEMÄLDE
537
13 Vi Zoll Anm.: Die Lose 299 und 300 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 19 Zoll, breit 26 Zoll Transakt.: Unbekannt
1798/06/04 HBPAK 0300 Dietrici I Zwey Land= und Wasserprosepete. Auf dem Einen ist der Sonnenaufgang vorgestellt. Im Hintergrunde sieht man Berge und eine Stadt; zwischen der Stadt und den Bergen, im Vordergrunde, Schiffe in vollem segeln, und viele Personen, welche fischen und und Schiffe ans Land ziehen. Das Andere stellt ein Nachtstück mit dem vollen Monde vor. Auf dem Wasser befinden sich grosse und kleine Schiffe, und am Ufer Personen, welche fischen. So schön wie Vernet. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Land= und Wasserprospect, ein Nachtstück mit dem vollen Monde Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 10 Zoll, breit 13 Vi Zoll Anm.: Die Lose 299 und 300 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1799/10/10 HBPAK 0088 Dietrich I Ein alter Frauenskopf. Auf Holz, schw. und goldn. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Zoll, breit 7 Zoll Transakt.: Unbekannt
1798/06/04 HBPAK 0365 Dietrici I Zwey sehr schöne Landschaften, Gegenden in Sachsen vorstellend. Aeusserst schön in jeder Hinsicht. Auf Holz. I Diese Nr.: Eien sehr schöne Landschaft, Gegend in Sachsen vorstellend Mat.: auf Holz Maße: Hoch 19 Zoll, breit 24 Zoll Anm.: Die Lose 365 und 366 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0366 Dietrici I Zwey sehr schöne Landschaften, Gegenden in SAchsen vorstellend. Aeusserst schön in jeder Hinsicht. Auf Holz. I Diese Nr.: Eien sehr schöne Landschaft, Gegend in Sachsen vorstellend Mat.: auf Holz Maße: Hoch 19 Zoll, breit 24 Zoll Anm.: Die Lose 365 und 366 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/11/14 HBPAK 0001 Diederici I Eine Landschaft mit lebensgrossen Figuren. Eine Dame, die an einer Anhöhe sitzet, und Blumen in ihrer Schürze hält. Ein Schäfer, welcher vor ihr auf den Knien seine Hochachtung bezeiget. Neben derselben noch mehrere Damen und ein Schäfer und spielende Kinder. Auf Leinwand, im schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 27 Zoll, breit 34 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/11/14 HBPAK 0059 Diederici I Ein Berg, Land= und Wasser=Prospect; im Vordergrunde mit Figuren. Ganz auf das kräftigste gemahlt. Auf Kupfer, im schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 14 Zoll, breit 22 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/11/14 HBPAK 0086 Diederichs I Eine bergigte Landschaft mit einem Wasserfalle, unten am Berge weidet der Schäfer seine Schaafe. Auf das kräftigste gemahlt. Auf Holz, im schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 LZAN 0055 Dietrich I Deux Paysages; dans l'un, on voit tout l'effet d'un orage, la foudre tombant sur un chateau eleve; l'autre presente un pont sur un torrent: tous deux d'une composition ingenieuse et d'une touche aussi belle que vigoureuse. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 20 pouces, largeur 24 pouces Transakt.: Unbekannt (25 Louis Schätzung) 1799/00/00 LZAN 0056 Dietrich I L'embrasement de Sodome, la fuite de la famille de Loth sous la conduite de l'Ange: tableau du plus grand effet et d'un precieux fini. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 11 pouces, largeur 14 pouces Transakt.: Unbekannt (16 Louis Schätzung) 1799/10/10 HBPAK 0009 Dietrich I Eine kleine Landschaft mit Schiffen. Gut gemahlt. Auf Holz, goldn. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 5 Vi Zoll, breit 8 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/10/10 HBPAK 0033 Dietrich I Eine kleine Landschaft. Gut gemahlt. Auf Holz, schw. und goldn. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 Vi Zoll, breit 10 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/10/10 HBPAK 0082 Dietrich I Der Ratzenfänger. Ausnehmend schön gemahlt. Auf Leinwand, schw. und goldn. Rahm. I 538
GEMÄLDE
1799/10/10 HBPAK 0089 Dietrich I Eine kleine Landschaft. Angenehm gemahlt. Auf Holz, schw. und goldn. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 Zoll, breit 12 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/10/10 HBPAK 0096 Dietrich I Zwey sehr schöne Landschaften. Auf Leinwand, mit hölzernen Leisten umgeben. I Diese Nr.: Eine sehr schöne Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 20 Zoll, breit 32 Zoll Anm.: Die Lose 96 und 97 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/10/10 HBPAK 0097 Dietrich I Zwey sehr schöne Landschaften. Auf Leinwand, mit hölzernen Leisten umgeben. I Diese Nr.: Eine sehr schöne Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 20 Zoll, breit 32 Zoll Anm.: Die Lose 96 und 97 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/10/10 HBPAK 0098 Dietrich I Zwey Landschaften mit Figuren. Auf Holz, ohne Rahm. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Zoll, breit 11 Vi Zoll Anm.: Die Lose 98 und 99 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/10/10 HBPAK 0099 Dietrich I Zwey Landschaften mit Figuren. Auf Holz, ohne Rahm. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Zoll, breit 11 Vi Zoll Anm.: Die Lose 98 und 99 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/12/23 WNAN 0068 Dietrich I Une Figure vetue a la turque, dans la maniere de Rembrand par Dietrich. I Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 BLBOE 0137 Dietrich d.j. I Ein Eremit betet mit Innbrunst. Zum Gegenstück eine klagende Magdalene. I Diese Nr.: Ein Eremit betet mit Innbrunst; Pendant zu Nr. 138 Mat.: auf Holz Anm.: Die Lose 137 und 138 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 BLBOE 0138 Dietrich d.j. I Ein Eremit betet mit Innbrunst. Zum Gegenstück eine klagende Magdalene. I Diese Nr.: Eine klagende Magdalene; Pendant zu Nr. 137 Mat.: auf Holz Anm.: Die Lose 137 und 138 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/00/00+ LZRST [0024] C.W.E. Dietrich I Zwey Landschaften mit betenden Eremiten im Geschmack von Salv. Rosa. I Mat.: auf Holz Maße: 10 Zoll breit 13 Vi Zoll hoch Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Rost Transakt.: Unbekannt 1800/01/00 LZAN [A]0016 Dietrich I Der Frühling unter dem Bilde eines jungen leicht bekleideten Mädchens, dessen braune Lokken zum Theil ein Strohhut bedekt [sie], an ihrem linken Arm hängt ein Korb mit Blumen, sie ist beschäftigt gebundene Blumen in einen Kranz zu formen. Halbe Figur. I Pendant zu Nr. [A]17 Maße: Höhe 2 Fuß 9 Zoll, Breite 2 Fuß 5 Zoll Verkäufer: A F Oeser Transakt.: Unbekannt 1800/01/00 LZAN [A]0017 Dietrich I Der Compagnon [zu Nr. A16]. Von gleicher Grösse, halbe Figur. Der Herbst, unter dem nemlichen Bilde, das schöne Gesicht zieren schwarze Haare, die von der Stirn hängend hinten zusammen gebunden sind, ein weisses und blaues Gewand bedeckt die Schultern und Hüften. Verschiedene Früchte des Herbstes liegen vor ihr auf einem Tisch, mit der Linken hält sie eine Melone, und in der rechten offnen Hand liegt eine blaue Traube. Von des Meisters ersten Manier, sehr lebhaft colorirt und klar gemalt. I Pendant zu Nr. [A]16 Maße: Höhe 2 Fuß 9 Zoll, Breite 2 Fuß 5 Zoll Verkäufer: A F Oeser Transakt.: Unbekannt
1800/01/00 LZAN [A]0018 Dietrich I Von Ebendemselben [Dietrich]. Loth mit seinen Töchtern, eine Skizze. Eine Tochter sitzt dem Vater zur Seite und reicht ihm eine volle Schaale: die zweite steht hinter Beiden, den Krug haltend, aus welchem sie der Schwester den Wein in die Schaale gegossen. Ein sehr geistreicher Entwurf. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Fuß 9 Zoll, Breite 1 Fuß 2 Zoll Verkäufer: A F Oeser Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0193 Dietrich I Eine Land= und Dorfgegend. Auf Holz, goldn. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Vi Zoll, breit 11 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0194 Dietrich I Eine Landschaft, in deren Vordergrunde über einen Fluß eine Brücke führet, mit Figuren. Auf Holz, goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Zoll, breit 11 Zoll Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0692 N. Dieterichs I Zwey dito [Landschaften]. I Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "N. Dieterichs", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt
Dietrich, Christian Wilhelm Ernst (und Vollerdt, J.C.) 1788/06/12 HBRMS 0027 Diedrichs; Vollars I Zwey Landschaften, die erste einen Einsiedler in einem Buche lesend; die andere die Geschichte der Hagar mit Ismael vorstellend; beyde von großer Stärke. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Eine Landschaft, einen Einsiedler in einem Buch lesend vorstellend Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 58 Zoll, breit 46 Zoll Anm.: Die Lose 27 und 28 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1788/06/12 HBRMS 0028 Diedrichs; Vollars I Zwey Landschaften, die erste einen Einsiedler in einem Buche lesend; die andere die Geschichte der Hagar mit Ismael vorstellend; beyde von großer Stärke. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Eine Landschaft, die Geschichte der Hagar mit Ismael vorstellend Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 58 Zoll, breit 46 Zoll Anm.: Die Lose 27 und 28 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Dietrich, Christian Wilhelm Ernst (Kopie von) 1791/05/15 LZHCT 0068 Chr. Guil. Ern. Dietrich; nach Gerard Dow I Vieille paysanne hollandoise proprement habillee, ä une fenetre tenant un hareng, qu'elle vient de tirer d'un baril place sur la fenetre. Hors de la fenetre on voit suspendues diverses herbes potageres et racines; ä cöte de l'embrasure de la fenetre on voit pendre la balance et un petit panier rempli d'oeufs; en haut pend un jambon et un botte de tetes de pavöt. Au fond on apper9oit deux filles occupees du menage. Cette excellente copie est d'un extreme fini et imite parfaitement la delicatesse de l'original. Elle est d'autant plus precieuse, qu'il est certain, que l'original n'existe plus. Peinte sur bois. I Kopie von Chr. Dietrich nach Dou Mat.: auf Holz Maße: haut de 20 pouces, large de 16 pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0069a Chr. Guil. Ern. Dietrich; nach Adrien Brower I Un paysan qui bäille en ouvrant largement la bouche, en veste grise et en bonnet rouge. Demi-figure. Peint sur bois. I Kopie von Chr. Dietrich nach Adr. Brouwer; Pendant zu Nr. 70b Mat.: auf Holz Maße: haut de 5 Vi pouces, large de 4 Vi pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0070b Chr. Guil. Ern. Dietrich; nach Adrien Brower I Pendant. Un Paysan ivre, en veste rouge, et en chapeau rond et brun, tenant sa main devant la bouche ouverte. Demi-figure. Peint sur bois, de la meme grandeur, que le precedent. I Kopie von Chr. Dietrich nach Adr. Brouwer; Pendant zu Nr. 69a Mat.: auf Holz Maße: haut de 5 Vi pouces, large de 4 Vi pouces Verkäufer: Chret Guill Emest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt
1791/05/15 LZHCT 0071 Chr. Guil. Ern. Dietrich; nach Adrien Brower I Un paysan tenant sous le bras un enfant, decouvert par derriere, occupe ä le nettoyer. Derriere lui on remarque une vieille la bouche ouverte, tenant une quenouille. Devant eux on voit sur une table une couche aupres d'un pot. Dans le fond on appergoit sur une corniche quelques meubles de menage. Demi figures jusqu'aux genoux. Piece d'un beau fini. Peinte sur bois. I Kopie von Chr. Dietrich nach Adr. Brouwer Mat.: auf Holz Maße: haut de 8 !4 pouces, large de 6 pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1794/01/20 LZRST 5855 C.W.E. Dietrich; Ph. Wouwermann I Eine Jagdpartie, wo ein Herr und eine Dame auf die Jagd reiten, fleissig gemahlt, nach Ph. Wouwermann, von C.W.E. Dietrich, von seiner erstem Arbeit, 15 Zoll br. 10 Vi Zoll hoch, auf Holz, in vergold. Rahm. I Kopie von Chr. Dietrich nach Ph. Wouwerman Mat.: auf Holz Maße: 15 Zoll breit, 10 Vi Zoll hoch Transakt.: Verkauft (9 Gr) Käufer: D 1795/11/14 HBPAK 0005 Dietrich; nach Rubens I Loth mit seinen zwey Töchtern. Loth sitzet und hat eine auf dem Schoos, in der Hand einen Becher; die zweite Tochter stehet vor ihm. Im Prospect ist die Stadt Sodom und die Salzsäule in Brand. Auf Leinwand. I Kopie von Chr. Dietrich nach Rubens Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 1 Fuß 3 Vi Zoll, breit 1 Fuß Transakt.: Unbekannt 1795/11/14 HBPAK 0014 Dietrich; nach Rubens I Die Plage Hiobs, welcher auf Stroh sitzet, die höllischen Furien plagen ihm, sein Weib stehet dabey und verspottet ihm. Auf Holz. I Kopie von Chr. Dietrich nach Rubens Mat.: auf Holz Maße: Hoch 1 Fuß 6 Zoll, breit 1 Fuß 2 Zoll Transakt.: Unbekannt 1800/07/09 HBPAK 0020 Dietricy; Rembrandt van Ryn I Imitation d'une descente de Croix tres celebre de Rembrandt van Ryn, et dont l'estampe est fort recherchee. La couleur et l'effet de ce Tableau sont admirables, les Draperies magnifiques et l'energie de l'execution donne la plus grande saillie aux Objets. Cette pretieuse composition sur Bois est haute de 22 pouces, sur 19 pouces de largeur. I Kopie von Chr. Dietrich nach Rembrandt Mat.: auf Holz Maße: 22 pouces de hauteur. Sur 19 pouces de largeur Transakt.: Unbekannt
Dietrich, Christian Wilhelm Ernst (oder Dietrich, Chr., Schule) 1797/04/20 HBPAK 0142 Dieterich, oder aus seiner Schule I Zwey Landschaften, mit Felsen, Brücken, Wasser, Berge und Figuren. Alles von einer sehr frischen Farbe. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft, mit Felsen, Brücken, Wasser, Berge und Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Zoll, breit 25 Zoll Anm.: Die Lose 142 und 143 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0143 Dieterich, oder aus seiner Schule I Zwey Landschaften, mit Felsen, Brücken, Wasser, Berge und Figuren. Alles von einer sehr frischen Farbe. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft, mit Felsen, Brücken, Wasser, Berge und Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Zoll, breit 25 Zoll Anm.: Die Lose 142 und 143 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Dietrich, Christian Wilhelm Ernst (Kopie nach) 1777/05/26 FRAN 0033 Klengel; Dietrich I 2 Landschaften nach Dietrich von Klengel in Dresden. I Diese Nr.: 1 Landschaft; Kopie von Johann Klengel nach Chr. Dietrich Anm.: Die Lose 33 und 34 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Finsterwalder Transakt.: Verkauft (27 fl für die Nrn. 33 und 34) Käufer: Mevius 1777/05/26 FRAN 0034 Klengel; Dietrich I 2 Landschaften nach Dietrich von Klengel in Dresden. I Diese Nr.: 1 Landschaft; GEMÄLDE
539
Kopie von Johann Klengel nach Chr. Dietrich Anm.: Die Lose 33 und 34 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Finsterwalder Transakt.: Verkauft (27 fl für die Nm. 33 und 34) Käufer: Mevius
1800/11/12 HBPAK 0119 Diederici I Zwey Landschaften, nach Diederici. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 118 und 119 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1782/01/28 LZAN 4158 Helmsdorf; Dietrich I Zwey Landschaften von Helmsdorf nach Dietrich, 15 Zoll breit, eine halbe Elle hoch. Den Winter und die untergehende Sonne vorstellend, auf Leinwand. Schwarz und goldner Rahm. I Kopie von Helmsdorff nach Chr. Dietrich Mat.: auf Leinwand Maße: 15 Zoll breit, 1 halbe Elle hoch Verkäufer: Caroli Ferdinandi Hommelii Transakt.: Unbekannt
1800/11/12 HBPAK 0627 Diederici I Diogenes mit der Laterne, nach Diederici. I Transakt.: Unbekannt
1782/01/28 LZAN 4182 Dietrich I Zwey biblische Stücken nach Dietrich, 10 Zoll breit 7 Vi Zoll hoch. I Maße: 10 Zoll breit, 7 Vi Zoll hoch Verkäufer: Caroli Ferdinandi Hommelii Transakt.: Unbekannt
Dietrich, Christian Wilhelm Ernst (Manier) 1778/07/21 HBHTZ 0015 Dieterichs I Zwey Meisterhafte Land= und Wassergegenden, so schön wie Dieterichs, auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Meisterhafte Land= und Wassergegend Mat.: auf Leinwand Maße: 12 Zoll hoch, 17 Zoll breit Anm.: Die Lose 15 und 16 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1782/01/28 LZAN 4188 Dietrich I Musiciens ambulans auf Holz, nach Dietrich, 12 Vi Zoll hoch, 1014 Zoll breit mit Laubwerke verzierten Rahmen. I Mat.: auf Holz Maße: 12 Vi Zoll hoch, 10 Vi Zoll breit Verkäufer: Caroli Ferdinandi Hommelii Transakt.: Unbekannt
1778/07/21 HBHTZ 0016 Dieterichs I Zwey Meisterhafte Land= und Wassergegenden, so schön wie Dieterichs, auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Meisterhafte Land= und Wassergegend Mat.: auf Leinwand Maße: 12 Zoll hoch, 17 Zoll breit Anm.: Die Lose 15 und 16 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1793/00/00 NGWID 0529 Dietrich I Eine fein und fleißig ausgeführte Landschaft, mit einigen Figuren und fliessenden Wasser, ohnfern eines Rittersitzes, von sehr schöner Haltung, und mit treflichem Baumschlag staffiert, nach Dietrich. I Pendant zu Nr. 530 Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
1789/06/12 HBTEX 0200 Die Manier von Dietrichs I Bergigte Landschaften mit Vieh und Figuren. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Eine bergigte Landschaft mit Vieh und Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 15 Zoll, breit 24 Zoll Anm.: Die Lose 200 und 201 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft Käufer: Sieberg
1793/00/00 NGWID 0530 Dietrich I Zum Gegenstück, eine romantische Gegend, mit einigen Figuren und fließenden Wasser, nebst grasenden Ziegen, alles dieses ist mit ungemeiner Kunst angenehm unterhalten, von nemlichem Meister [nach Dietrich] und Maaß. I Pendant zu Nr. 529 Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/01/15 LZRST 7085 Gottlob; Dietrich I Eine Landschaft mit einem alten Thurme am Wasser, nach Dietrich, 29 Zoll breit, 21 Zoll hoch, auf Leinwand blos angelegt. [Folgende gemählde sind von der Hand des ohnlängst verstorbenen geschickten Malers Gottlob zu Leipzig. Sie sind grösstentheils noch nicht völlig beendigt, und einige davon blos angelegt.] I Kopie von Emst Gottlob nach Chr. Dietrich Mat.: auf Leinwand Maße: 29 Zoll breit, 21 Zoll hoch Anm.: Die Angaben in eckigen Klammem im Bildtitel erscheinen über der Nr. 7074 und beziehen sich auf die Nm. 7074 bis 7099. Transakt.: Verkauft (2 Gr) Käufer: Schwarz 1795/11/17 HBPAK 0061 Nach Diederichs I Zwey Stücke mit Bauren, die Essen und Trinken. Schw. Rahm mit gold. Leisten. I Diese Nr.: Ein Stück mit Bauren, die Essen und Trinken Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Zoll, breit 9 Zoll Anm.: Die Lose 61 und 62 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1795/11/17 HBPAK 0062 Nach Diederichs I Zwey Stücke mit Bauren, die Essen und Trinken. Schw. Rahm mit gold. Leisten. I Diese Nr.: Ein Stück mit Bauren, die Essen und Trinken Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Zoll, breit 9 Zoll Anm.: Die Lose 61 und 62 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0015 Nach Diederichs I Der bekannte Ratzenfänger. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 5 Zoll, breit 4 Zoll Transakt.: Unbekannt
1789/06/12 HBTEX 0201 Die Manier von Dietrichs I Bergigte Landschaften mit Vieh und Figuren. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Eine bergigte Landschaft mit Vieh und Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 15 Zoll, breit 24 Zoll Anm.: Die Lose 200 und 201 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft Käufer: Sieberg 1790/02/04 HBDKR 0092 In der Mannier von Dieterich I Zwey Stücke mit Ziegen und Schaafen, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 10 Vi Zoll, breit 13 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (3.12 M) Käufer: Eckhardt 1795/03/12 HBSDT 0139 In Dietricis Manier I Landschaften, mit schifbaren Gewässern. Auf Leinwand, im schwarzen Rahm. I Diese Nr.: Eine Landschaft, mit schifbaren Gewässern Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 12 Zoll, breit 13 Zoll Anm.: Die Lose 139 und 140 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1795/03/12 HBSDT 0140 In Dietricis Manier I Landschaften, mit schifbaren Gewässern. Auf Leinwand, im schwarzen Rahm. I Diese Nr.: Eine Landschaft, mit schifbaren Gewässern Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 12 Zoll, breit 13 Zoll Anm.: Die Lose 139 und 140 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/12/08 HBPAK 0131 In der Manier von Diedrichs I Eine Rheingegend mit einem Wasserfall, wo am Fusse desselben ein Hirte seine Schaafe führet. Auf Holz, im schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 16 Zoll, Breite 21 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0155 Inder Manier von Diedrichs I Eine Rheingegend mit einem Wasserfall, wo am Fusse desselben ein Hirte seine Schaafe führet. Auf Holz, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Unbekannt
1799/08/09 HBPAK 0125 Nach Diederichs I Ein Manns=Portrait im Pelz, hält in der linken Hand ein offenes Buch. Auf Leinwand, schw. Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 29 Zoll, breit 25 Zoll Transakt.: Unbekannt
1798/08/10 HBPAK 0124 In der Manier von Dieterichs I Eine Landschaft, wo in der Mitte eine Brücke über Wasser gehet, und Hirten ihr Vieh hüten. Auf Leinwand, im schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Zoll, breit 27 Zoll Transakt.: Unbekannt
1800/11/12 HBPAK 0118 Diederici I Zwey Landschaften, nach Diederici. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 118 und 119 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1798/11/14 HBPAK 0017 Diederici I Ein Brustbild im Harnisch gekleidet, die rechte Hand auf der Brust liegend, und eine rothe Mütze auf dem Kopfe habend. Ganz wie Diederici. Auf Leinwand, im
540
GEMÄLDE
goldnen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 31 Zoll, breit 26 Zoll Transakt.: Unbekannt
Dietrich.] I Maße: 10 Vi Zoll hoch, 7 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (2 fl) Käufer: Pfeiffer
1798/11/14 HBPAK 0040 In der Manier von Diederichs I Zwey Stücke mit Hirten und Vieh. Auf das schönste gemahlt, ganz so, als wenn es von diesem Meister selbst wäre. Auf Leinwand, im goldnen Rahm. I Diese Nr.: Ein Stück mit Hirten und Vieh Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 16 Zoll, breit 20 Zoll Anm.: Die Lose 40 und 41 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1779/09/27 FRNGL 0982 der alte Dieterich I Ein schön kleines niederländisches Landschäftgen, vom alten Dieterich. [Un beau paysage Flamand, par le vieux Dietrich.] I Pendant zu Nr. 983 Maße: 3 Vi Zoll hoch, 4 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (3.28 fl für die Nrn. 982 und 983) Käufer: Hüsgen
1798/11/14 HBPAK 0041 In der Manier von Diederichs I Zwey Stücke mit Hirten und Vieh. Auf das schönste gemahlt, ganz so, als wenn es von diesem Meister selbst wäre. Auf Leinwand, im goldnen Rahm. I Diese Nr.: Ein Stück mit Hirten und Vieh Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 16 Zoll, breit 20 Zoll Anm.: Die Lose 40 und 41 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Dietrich, Christian Wilhelm Ernst (Schule) 1776/06/28 HBBMN 0028 v. Dietrichs I Zwo plaisante Landschaften, auf Holz, aus der Schule v. Dietrichs. I Diese Nr.: Eine plaisante Landschaft Mat.: auf Holz Maße: Höhe 9 Zoll, Breite 1 Fuß Anm.: Die Lose 28 und 29 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1776/06/28 HBBMN 0029 v. Dietrichs I Zwo plaisante Landschaften, auf Holz, aus der Schule v. Dietrichs. I Diese Nr.: Eine plaisante Landschaft Mat.: auf Holz Maße: Höhe 9 Zoll, Breite 1 Fuß Anm.: Die Lose 28 und 29 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1779/09/27 FRNGL 0362 Dieterich I Eine schöne Landschaft mit Felsen und Wasserfällen, aus der Schule von Dieterich. [Un beau paysage avec des rochers, & des cataractes, de l'ecole de Dieterich.] I Pendant zu Nr. 363 Maße: 10 Zoll hoch, 8 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (5.30 fl für die Nrn. 362 und 363) Käufer: Rath Ehrenreich modo Gerken 1779/09/27 FRNGL 0363 Dieterich I Der Compagnon hierzu, von nemlichem Meister [aus der Schule von Dieterich] und Gröse. [Le pendant du precedant, par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 362, "Eine schöne Landschaft mit Felsen und Wasserfällen" Maße: 10 Zoll hoch, 8 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (5.30 fl für die Nrn. 362 und 363) Käufer: Rath Ehrenreich modo Gerken 1793/00/00 NGWID 0130 Didrichs I Eine felsigte Landschaft mit einigen Figuren, aus Didrichs Schule. I Pendant zu Nr. 131 Maße: 10 Zoll hoch, 1 Schuh breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0131 Didrichs I Zum Gegenstück eine Landschaft mit einem Bauernhause und guter Baum=Staffage, von nemlicher Hand [aus Didrichs Schule] und Maaß. I Pendant zu Nr. 130 Maße: 10 Zoll hoch, 1 Schuh breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0442 Dietrich I Ein schön beleuchtetes Nachtstück, wie ein Faun eine Nymphe belauscht, aus Dietrichs Schule, ohne Rahmen. I Pendant zu Nr. 443 Maße: 2 Schuh 1 Zoll hoch, 2 Schuh 7 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0443 Dietrich I Zum Gegenstück wie eine Nymphe im Begriff ist, einen schlafenden Amor zu erstechen, von obigem Meister [aus Dietrichs Schule] und Maaß. I Pendant zu Nr. 442 Maße: 2 Schuh 1 Zoll hoch, 2 Schuh 7 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
Dietrich, Johann Georg 1779/09/27 FRNGL 0662 der alte Dieterich l Ein Frauenzimmer welches mit einem Pologneser=Hündgen scherzet, vom alten Dieterich. [Une Dame qui badine avec une ipagneule, par le vieux
1779/09/27 FRNGL 0983 der alte Dieterich I Das Gegenbild zu obigem, eine eben so meisterhafte Landschaft, von neml. Hand [vom alten Dieterich] und Größe. [Le pendant du precedant, m^me objet [un paysage], par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 982 Maße: 3 Vi Zoll hoch, 4 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (3.28 fl für die Nrn. 982 und 983) Käufer: Hüsgen 1779/09/27 FRNGL 0996 der alte Dietrich I Zwey Landschäftgen vom alten Dietrich. [Deux paysages, par le vieux Dietrich.] I Diese Nr.: Ein Landschäftgen Maße: 3 Vi Zoll hoch, 4 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 996 und 997 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (1.24 fl für die Nrn. 996 und 997) Käufer: Mergenbaum 1779/09/27 FRNGL 0997 der alte Dietrich I Zwey Landschäftgen vom alten Dietrich. [Deux paysages, par le vieux Dietrich.] I Diese Nr.: Ein Landschäftgen Maße: 3 Vi Zoll hoch, 4 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 996 und 997 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (1.24 fl für die Nm. 996 und 997) Käufer: Mergenbaum 1783/08/01 LZRST 0081 Dietrichs Vater I Ein heiliger Hieronymus, in seiner Höhle betend, von Dietrichs Vater, fleissig ausgeführt und wohl erhalten auf Holz gemahlt. 14 Z. hoch 10 Vi Z. br. in hölz. Rahm. I Pendant zu Nr. 82 Mat.: auf Holz Maße: 14 Zoll hoch, 10 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (3.1 Th) Käufer: Buchs 1783/08/01 LZRST 0082 Dietrichs Vater I Ein betender Einsiedler in seiner Höhle, auf Holz gemahlt, von eben dem Meister [Dietrichs Vater], das Gegenbild von vorigen [Nr. 81], von gleichem Maasse und gleichem [hölz] Rahm. I Pendant zu Nr. 81 Mat.: auf Holz Maße: 14 Zoll hoch, 10 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (3 Th) Käufer: Buchs 1784/08/13 HBDEN 0028 der alte Dieterichs I Einige Bauern in und vor ihrem Hause sitzend, nebst einer Bäuerin und Kinde im Vorgrunde zur Linken; ein Quacksalber preiset seine Waare denselben an. Von dem alten Dieterichs, auf Leinwand. [NB. Alle Gemählde bis No. 33 haben keine Rahmen.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 19 Zoll. Breit 15 Vi Zoll. Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 33 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 33. Verkäufer: Pasche [oder] Flügge Transakt.: Verkauft (40 Sch) Käufer: Β 1787/01/15 LZRST 0016 Dietrich der Vater I Eine Flucht nach Aegypten, ein grosses schönes fleissiges Gemälde von Dietrich dem Vater, 35 Zoll hoch, 37 Zoll breit, ohne Rahm, wohl erhalten. I Pendant zu Nr. 17 Maße: 35 Zoll hoch, 37 Zoll breit Verkäufer: Richter Transakt.: Unbekannt 1787/01/15 LZRST 0017 Dietrich der Vater I Eine Ruhe in Aegypten, das Gegenbild zu vorigem, eben so schön von eben demselben Meister [Dietrich dem Vater], von gleichem Maasse ohne Rahm. I Pendant zu Nr. 16 Maße: 35 Zoll hoch, 37 Zoll breit Verkäufer: Richter Transakt.: Unbekannt 1787/04/03 HBHEG 0048 der alte Diterichs I Ein türkischer Manns=Kopf, vom alten Diterichs, auf ditto [Holz], I Mat.: auf Holz Transakt.: Verkauft (12 Sch) Käufer: Hofr Ehrenreich 1788/01/15 LZRST 3983 Dietrich der Vater I Eine Flucht nach Egypten, ein grosses schönes fleissiges Gemähide, von Dietrich dem Vater, 35 Z. hoch, 37 Z. breit, ohne Rahm, wohlerhalten. I Pendant zu Nr. 3984 Maße: 35 Zoll hoch, 37 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (3 Th) Käufer: Ernst GEMÄLDE
541
1788/01/15 LZRST 3984 Dietrich der Vater I Eine Ruhe in Egypten, das Gegenbild zu vorigem eben so schön, von eben demselben Meister [Dietrich dem Vater], englichem Maasse, ohne Rahm. I Pendant zu Nr. 3983 Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (4.2 Th) Käufer: Ernst 1790/08/25 FRAN 0318 der alte Dietrich I Eine Magd mit einem Licht in der Hand, vom alten Dietrich. I Maße: hoch 9 Zoll, breit 7 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (6 fl) Käufer: Trautman 1790/10/18 LZRST 1888 Dietrich der Vater I Das Brustbild eines alten Mannes im Pelze mit der orientalischen Mütze von Dietrich dem Vater kräftig und meisterhaft skizzirt. 16 Zoll hoch, 12 Zoll breit, auf Holz gemahlt, ohne Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: 16 Zoll hoch, 12 Zoll breit Transakt.: Unbekannt (2 Rt) 1790/10/18 LZRST 1889 Dietrich der Vater I Das Brustbild eines Mannes im Mantel, mit dem Barte und der Pelzmütze, vom nehmlichen Meister [Dietrich dem Vater], eben so schön, von gleichem Maase. I Mat.: auf Holz Maße: 16 Zoll hoch, 12 Zoll breit Transakt.: Unbekannt (2 Rt) 1793/00/00 NGWID 0422 der alte Dietrich I Ein Nachtstück, auf welchem ein junges Mädchen, ein brennendes Licht in eine Laterne stellt, und von einer im Hintergrunde stehenden Mannsperson unbemerkt belauscht wird, vom alten Dietrich. I Pendant zu Nr. 423 Maße: 2 Schuh 2 Zoll hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0423 der alte Dietrich I Zum Gegenstück, ein auf einem Stuhle schlafendes Mädchen, so von einem alten Mann, welcher ein Licht hinter der Hand hält, aufmerksam betrachtet wird, vom obigen Meister [vom alten Dietrich] und Maaß. I Pendant zu Nr. 422 Maße: 2 Schuh 2 Zoll hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1795/11/14 HBPAK 0072 Vom alten Dietrich I Ein Bauem= Stück. Ein Vater sitzt mit seinen drey Söhnen und raucht Toback. Die Gesichtsfarbe des einen zeigt, daß er solchen nicht vertragen kann. Mit vielen Ausdruck und kraftvoll gemahlt. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 3 Fuß 4 Zoll, breit 3 Fuß 9 Zoll Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN2 0123 Dietrich (Vater) I Jesus in Mitte der Gelehrten. Geistreiche Zusammensetzung von 25 Figuren. Es ist eine von seinen schönsten Produktionen. I Mat.: auf Leinwand Maße: 20 Zoll hoch, 17 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Dietzsch 1752/00/00 NGWOL 0021 Dietsch I Zwey Dietschische Blumenstücke in vergoldten Geschirren. Due Pezzi di fiori in vasi indorati. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Anm.: Die Lose 21 und 22 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (60 Th für die Nrn. 21 und 22) 1752/00/00 NGWOL 0022 Dietsch I Zwey Dietschische Blumenstücke in vergoldten Geschirren. Due Pezzi di fiori in vasi indorati. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Anm.: Die Lose 21 und 22 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (60 Th für die Nrn. 21 und 22)
siert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (6 Th für die Nrn. 69 und 70) 1752/00/00 NGWOL 0101 Dietsch I Zwey Dietschische Landschaften. Due Paesettini del Dietsch. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 101 und 102 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (5 Th für die Nm. 101 und 102) 1752/00/00 NGWOL 0102 Dietsch I Zwey Dietschische Landschaften. Due Paesettini del Dietsch. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 101 und 102 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (5 Th für die Nrn. 101 und 102) 1752/00/00 NGWOL 0105 Dietsch I Zwey Dietschische Blumenstücke. Due Pezzi di fiori della S. Dietsch. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Anm.: Die Lose 105 und 106 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (5 Th für die Nrn. 105 und 106) 1752/00/00 NGWOL 0106 Dietsch I Zwey Dietschische Blumenstücke. Due Pezzi di fiori della S. Dietsch. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Anm.: Die Lose 105 und 106 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (5 Th für die Nrn. 105 und 106) 1752/00/00 NGWOL 0107 Dietsch I Zwey Dietschische Landschaften. Due Paesaggi del Dietsch. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 107 und 108 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (5 Th für die Nrn. 107 und 108) 1752/00/00 NGWOL 0108 Dietsch I Zwey Dietschische Landschaften. Due Paesaggi del Dietsch. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 107 und 108 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (5 Th für die Nrn. 107 und 108) 1752/00/00 NGWOL 0109 Dietsch I Zwey Dietschische Vogelstücke. Due Pezzi d'Augelli della Dietsch. I Diese Nr.: Ein Vogelstück Anm.: Die Lose 109 und 110 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (4 Th für die Nrn. 109 und 110) 1752/00/00 NGWOL 0110 Dietsch I Zwey Dietschische Vogelstücke. Due Pezzi d'Augelli della Dietsch. I Diese Nr.: Ein Vogelstück Anm.: Die Lose 109 und 110 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (4 Th für die Nrn. 109 und 110) 1752/00/00 NGWOL O l l i Dietsch I Zwo Dietschische Landschaften. Due Paesi del Dietsch. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 111 und 112 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (5 Th für die Nrn. 111 und 112) 1752/00/00 NGWOL 0112 Dietsch I Zwo Dietschische Landschaften. Due Paesi del Dietsch. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 111 und 112 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (5 Th für die Nm. 111 und 112) 1752/00/00 NGWOL 0116 Dietsch I Eine ganz kleine Landschaft. Vn Paesettino. I Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (ITh)
1752/00/00 NGWOL 0069 Dietsch I Zwey kleine Landschaften von Dietsch. Due paesettini dal Dietsch. I Diese Nr.: Eine kleine Landschaft Anm.: Die Lose 69 und 70 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (6 Th für die Nrn. 69 und 70)
1752/00/00 NGWOL 0117 Dietsch I Zwo Landschaften, von Dietsch auf Kupfer. Due Paesi del Dietsch in Rame. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Kupfer Anm.: Die Lose 117 und 118 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (4 Th für die Nrn. 117 und 118)
1752/00/00 NGWOL 0070 Dietsch I Zwey kleine Landschaften von Dietsch. Due paesettini dal Dietsch. I Diese Nr.: Eine kleine Landschaft Anm.: Die Lose 69 und 70 wurden zusammen katalogi-
1752/00/00 NGWOL 0118 Dietsch I Zwo Landschaften, von Dietsch auf Kupfer. Due Paesi del Dietsch in Rame. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Kupfer Anm.: Die Lose 117 und 118 wur-
542
GEMÄLDE
den zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (4 Th für die Nrn. 117 und 118) 1765/00/00 FRNGL 0055 Dietsch I 2 ditto [Pferdstücke]. I Transakt.: Unbekannt (12 fl Schätzung)
del Poth. I Diese Nr.: Eine grössere Landschaft; Kopie von Dietzsch nach Poth Anm.: Die Lose 95 und 96 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (6 Th für die Nm. 95 und 96)
1765/00/00 FRNGL 0056 Dietsch I 2 ditto [Pferdstücke]. I Transakt.: Unbekannt (12 fl Schätzung)
Dietzsch (Fräulein)
1793/00/00 NGWID 0314 Dietz I Eine ovale Landschaft mit einigen Figuren, von Dietz. I Pendant zu Nr. 315 Format: oval Maße: 6 Zoll hoch, 7 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0315 Dietz I Zum Gegenstück, eine felsigte Landschaft mit einem Wasserfall, von obigem Meister [Dietz] und Maaß. I Pendant zu Nr. 314 Format: oval Maße: 6 Zoll hoch, 7 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1796/08/01 NGFRZ 0004 Dietsch I 2 holländischen Bauemstücke, von Dietsch. [Gemälde in Oel in schönen Rahmen. (N.B. Die Größe ist ohne das Rahm gemessen.)] I Mat.: Öl Maße: Höhe 8 Zoll, Breite 6 V* Zoll. [Rheinisch Maaß] Anm.: Die Angaben in ekkigen Klammem im Bildtitel erscheinen über der Nr. 1 und beziehen sich auf die Nm. 1 bis 25. Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0104 Dietsch I Vier kleine Landschaften mit Figuren; ganz fleißig und schön gemahlt. Auf Kupfer, goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine kleine Lndschaft mit Figuren Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 6 Vi Zoll, breit 8 Zoll Anm.: Die Lose 104 und 107 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0105 Dietsch I Vier kleine Landschaften mit Figuren; ganz fleißig und schön gemahlt. Auf Kupfer, goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine kleine Lndschaft mit Figuren Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 6 Vi Zoll, breit 8 Zoll Anm.: Die Lose 104 und 107 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0106 Dietsch I Vier kleine Landschaften mit Figuren; ganz fleißig und schön gemahlt. Auf Kupfer, goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine kleine Lndschaft mit Figuren Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 6 Vi Zoll, breit 8 Zoll Anm.: Die Lose 104 und 107 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0107 Dietsch I Vier kleine Landschaften mit Figuren; ganz fleißig und schön gemahlt. Auf Kupfer, goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine kleine Lndschaft mit Figuren Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 6 Vi Zoll, breit 8 Zoll Anm.: Die Lose 104 und 107 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0131 Dietsch I Zwey kleine Landschaften. Auf Holz, goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine kleine Landschaft Mat.: auf Holz Maße: Hoch 4 Zoll, breit 5 Vi Zoll Anm.: Die Lose 131 und 132 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0132 Dietsch I Zwey kleine Landschaften. Auf Holz, goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine kleine Landschaft Mat.: auf Holz Maße: Hoch 4 Zoll, breit 5 Vi Zoll Anm.: Die Lose 131 und 132 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0222 ten. I Transakt.: Unbekannt
Dietz I Vier Stück kleine Landschaf-
1800/11/12 HBPAK 0409 ten. I Transakt.: Unbekannt
N. Dietz I Zwey Stücke; Landschaf-
Dietzsch (Kopie von) 1752/00/00 NGWOL 0095 Dietsch; Poth I Zwo grössere Landschaften, von Dietsch nach Poth. Due piü grandi del Dietsch ä guisa del Poth. I Diese Nr.: Eine grössere Landschaft; Kopie von Dietzsch nach Poth Anm.: Die Lose 95 und 96 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (6 Th für die Nm. 95 und 96) 1752/00/00 NGWOL 0096 Dietsch; Poth I Zwo grössere Landschaften, von Dietsch nach Poth. Due piü grandi del Dietsch ä guisa
1752/00/00 NGWOL 0019 Jgfr. Dietschin I Eine Nelke und ein Veilstraus. Vn garofano ed un mazzo di Viole. I Diese Nr.: Eine Nelke Anm.: Die Lose 19 und 20 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (8 Th für die Nm. 19 und 20) 1752/00/00 NGWOL 0020 Jgfr. Dietschin I Eine Nelke und ein Veilstraus. Vn garofano ed un mazzo di Viole. I Diese Nr.: Ein Veilstraus Anm.: Die Lose 19 und 20 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (8 Th für die Nm. 19 und 20) 1752/00/00 NGWOL 0052 Jgfr. Dietschin I Zwei kleine Blumenstücke von der Jgrf. Dietschin. Due pezzetti di fiori della S. Dietsch. I Diese Nr.: Ein kleines Blumenstück Anm.: Die Lose 52 und 53 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (12 Th für die Nm. 52 und 53) 1752/00/00 NGWOL 0053 Jgfr. Dietschin I Zwei kleine Blumenstücke von der Jgrf. Dietschin. Due pezzetti di fiori della S. Dietsch. I Diese Nr.: Ein kleines Blumenstück Anm.: Die Lose 52 und 53 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (12 Th für die Nm. 52 und 53) 1752/00/00 NGWOL 0085 Jungfer Dietschin I Zwey Vogel= Stücke. Due pezze d'augelli. I Diese Nr.: Ein Vogel=Stück Anm.: Die Lose 85 und 86 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (4 Th für die Nm. 85 und 86) 1752/00/00 NGWOL 0086 Jungfer Dietschin I Zwey Vogel= Stücke. Due pezze d'augelli. I Diese Nr.: Ein Vogel=Stück Anm.: Die Lose 85 und 86 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (4 Th für die Nm. 85 und 86) 1752/00/00 NGWOL 0097 Jungfer Dietschin I Zwey Blumenstücke. Due Pezzi di fiori. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Anm.: Die Lose 97 und 98 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (4 Th für die Nm. 97 und 98) 1752/00/00 NGWOL 0098 Jungfer Dietschin I Zwey Blumenstücke. Due Pezzi di fiori. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Anm.: Die Lose 97 und 98 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (4 Th für die Nm. 97 und 98) 1752/00/00 NGWOL 0099 Jungfer Dietschin I Zwey dergleichen [Blumenstücke] etwas schönere. Due simili [Pezzi di fiori] piu belli. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Anm.: Die Lose 99 und 100 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (5 Th für die Nm. 99 und 100) 1752/00/00 NGWOL 0100 Jungfer Dietschin I Zwey dergleichen [Blumenstücke] etwas schönere. Due simili [Pezzi di fiori] piu belli. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Anm.: Die Lose 99 und 100 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (5 Th für die Nm. 99 und 100) 1764/03/12 FRKAL [A]0067 Frau Dierschin in Nürnberg I Zwey Stück mit Blumen. [Diese sämtliche Stücke sind auf weis Pergament von der Frau Dierschin in Nürnberg gemahlt und alle unter Glaß gelegt.] I Mat.: auf Pergament Anm.: Die Angaben in eckigen Klammem im Bildtitel erscheinen neben den Nm. [A]67 bis [A]80 und beziehen sich auf die Nm. [A]67 bis [A]80. Transakt.: Unbekannt (12.45 fl für die Nm. [A]67-[A]69) 1764/03/12 FRKAL [A]0068 Frau Dierschin in Nürnberg I Zwey detto [Stück] mit detto [Blumen]. [Diese sämtliche Stücke sind auf weis Pergament von der Frau Dierschin in Nürnberg geGEMÄLDE
543
mahlt und alle unter Glaß gelegt.] I Mat.: auf Pergament Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen neben den Nrn. [A]67 bis [A]80 und beziehen sich auf die Nrn. [A]67 bis [A]80. Transakt.: Unbekannt (12.45 fl für die Nm. [A]67-[A]69)
ben in eckigen Klammem im Bildtitel erscheinen neben den Nm. [A]67 bis [A]80 und beziehen sich auf die Nm. [A]67 bis [A]80. Transakt.: Verkauft (2.4 fl für die Nm. [A]77 und [A]78) Käufer: Bender
1764/03/12 FRKAL [A]0069 Frau Dierschin in Nürnberg I Zwey detto [Stück] mit detto [Blumen]. [Diese sämtliche Stücke sind auf weis Pergament von der Frau Dierschin in Nürnberg gemahlt und alle unter Glaß gelegt.] I Mat.: auf Pergament Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen neben den Nrn. [A]67 bis [A]80 und beziehen sich auf die Nm. [A]67 bis [A]80. Transakt.: Unbekannt (12.45 fl für die Nrn. [A]67-[A]69)
1764/03/12 FRKAL [A]0078 Frau Dierschin in Nürnberg I Ein detto [Stück] mit detto [Vögel]. [Diese sämtliche Stücke sind auf weis Pergament von der Frau Dierschin in Nürnberg gemahlt und alle unter Glaß gelegt.] I Mat.: auf Pergament Anm.: Die Angaben in eckigen Klammem im Bildtitel erscheinen neben den Nm. [A]67 bis [A]80 und beziehen sich auf die Nm. [A]67 bis [A]80. Transakt.: Verkauft (2.4 fl für die Nm. [A]77 und [A]78) Käufer: Bender
1764/03/12 FRKAL [A]0070 Frau Dierschin in Nürnberg I Zwey detto [Stück] mit Landschaften. [Diese sämtliche Stücke sind auf weis Pergament von der Frau Dierschin in Nürnberg gemahlt und alle unter Glaß gelegt.] I Mat.: auf Pergament Anm.: Die Angaben in eckigen Klammem im Bildtitel erscheinen neben den Nrn. [A]67 bis [A]80 und beziehen sich auf die Nrn. [A]67 bis [A]80. Transakt.: Unbekannt (4.38 fl)
1764/03/12 FRKAL [A]0079 Frau Dierschin in Nürnberg I Fünf Stück mit Insecten. [Diese sämtliche Stücke sind auf weis Pergament von der Frau Dierschin in Nürnberg gemahlt und alle unter Glaß gelegt.] I Mat.: auf Pergament Anm.: Die Angaben in eckigen Klammem im Bildtitel erscheinen neben den Nm. [A]67 bis [A]80 und beziehen sich auf die Nm. [A]67 bis [A]80. Transakt.: Verkauft (3.12 fl für die Nm. [A]79 und [A]80) Käufer: Bender
1764/03/12 FRKAL [A]0071 Frau Dierschin in Nürnberg I Zwey detto [Stück] mit detto [Landschaften]. [Diese sämtliche Stücke sind auf weis Pergament von der Frau Dierschin in Nürnberg gemahlt und alle unter Glaß gelegt.] I Mat.: auf Pergament Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen neben den Nrn. [A]67 bis [A]80 und beziehen sich auf die Nrn. [A]67 bis [A]80. Transakt.: Verkauft (7.30 fl) Käufer: Etling
1764/03/12 FRKAL [A]0080 Frau Dierschin in Nürnberg I Zwey Stück mit Blumen. [Diese sämtliche Stücke sind auf weis Pergament von der Frau Dierschin in Nürnberg gemahlt und alle unter Glaß gelegt.] I Mat.: auf Pergament Anm.: Die Angaben in eckigen Klammem im Bildtitel erscheinen neben den Nm. [A]67 bis [A]80 und beziehen sich auf die Nm. [A]67 bis [A]80. Transakt.: Verkauft (3.12 fl für die Nm. [A]79 und [A]80) Käufer: Bender
1764/03/12 FRKAL [A]0072 Frau Dierschin in Nürnberg I Zwey detto [Stück] mit Vögel. [Diese sämtliche Stücke sind auf weis Pergament von der Frau Dierschin in Nürnberg gemahlt und alle unter Glaß gelegt.] I Mat.: auf Pergament Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen neben den Nrn. [A]67 bis [A]80 und beziehen sich auf die Nrn. [A]67 bis [A]80. Transakt.: Verkauft (5.12 fl) Käufer: Etling
1776/07/19 HBBMN 0029 Mad. Titchen I Eine kleine Landschaft bey Mondschein, mit brennend Feuer. I Maße: Höhe 6 Vi Zoll, Breite 10 Zoll Transakt.: Verkauft (1 M) Käufer: Grätz
1764/03/12 FRKAL [A]0073 Frau Dierschin in Nürnberg I Zwey detto [Stück] mit detto [Vögel]. [Diese sämtliche Stücke sind auf weis Pergament von der Frau Dierschin in Nürnberg gemahlt und alle unter Glaß gelegt.] I Mat.: auf Pergament Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen neben den Nrn. [A]67 bis [A]80 und beziehen sich auf die Nm. [A]67 bis [A]80. Transakt.: Unbekannt (5.32 fl für die Nm. [A]73-[A]76) 1764/03/12 FRKAL [A]0074 Frau Dierschin in Nürnberg I Zwey detto [Stück] mit detto [Vögel]. [Diese sämtliche Stücke sind auf weis Pergament von der Frau Dierschin in Nürnberg gemahlt und alle unter Glaß gelegt.] I Mat.: auf Pergament Anm.: Die Angaben in eckigen Klammem im Bildtitel erscheinen neben den Nm. [A]67 bis [A]80 und beziehen sich auf die Nm. [A]67 bis [A]80. Transakt.: Unbekannt (5.32 fl für die Nm. [A]73-[A]76) 1764/03/12 FRKAL [A]0075 Frau Dierschin in Nürnberg I Zwey detto [Stück] mit detto [Vögel], [Diese sämtliche Stücke sind auf weis Pergament von der Frau Dierschin in Nürnberg gemahlt und alle unter Glaß gelegt.] I Mat.: auf Pergament Anm.: Die Angaben in eckigen Klammem im Bildtitel erscheinen neben den Nm. [A]67 bis [A]80 und beziehen sich auf die Nm. [A]67 bis [A]80. Transakt.: Unbekannt (5.32 fl für die Nm. [A]73-[A]76) 1764/03/12 FRKAL [A]0076 Frau Dierschin in Nürnberg I Zwey detto [Stück] mit detto [Vögel]. [Diese sämtliche Stücke sind auf weis Pergament von der Frau Dierschin in Nürnberg gemahlt und alle unter Glaß gelegt.] I Mat.: auf Pergament Anm.: Die Angaben in eckigen Klammem im Bildtitel erscheinen neben den Nm. [A]67 bis [A]80 und beziehen sich auf die Nm. [A]67 bis [A]80. Transakt.: Unbekannt (5.32 fl für die Nm. [A]73-[A]76) 1764/03/12 FRKAL [A]0077 Frau Dierschin in Nürnberg I Zwey detto [Stück] mit detto [Vögel], [Diese sämtliche Stücke sind auf weis Pergament von der Frau Dierschin in Nürnberg gemahlt und alle unter Glaß gelegt.] I Mat.: auf Pergament Anm.: Die Anga544
GEMÄLDE
1776/11/09 HBKOS 0021 Mademois. Titchen I Zwo Landschaften, auf Pergament, mit Glas davor, mit dito [schwarzen] Rähmen. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Pergament Anm.: Die Lose 21 und 22 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (10 Μ für die Nm. 21 und 22) 1776/11/09 HBKOS 0022 Mademois. Titchen I Zwo Landschaften, auf Pergament, mit Glas davor, mit dito [schwarzen] Rähmen. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Pergament Anm.: Die Lose 21 und 22 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (10 Μ für die Nm. 21 und 22) 1776/11/09 HBKOS 0045 Mademoiselle Titchen I Zwey Stücke mit Früchten und Insecten, auf Pergament, mit Glas davor, mit dito [schwarzen] Rähmen. I Diese Nr.: Ein Stück mit Früchten und Insecten Mat.: auf Pergament Maße: Höhe 11 Vi Zoll, Breite 9 Zoll Anm.: Die Lose 45 und 46 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (9 Μ für die Nm. 45 und 46) Käufer: Lillie 1776/11/09 HBKOS 0046 Mademoiselle Titchen I Zwey Stücke mit Früchten und Insecten, auf Pergament, mit Glas davor, mit dito [schwarzen] Rähmen. I Diese Nr.: Ein Stück mit Früchten und Insecten Mat.: auf Pergament Maße: Höhe 11 Vi Zoll, Breite 9 Zoll Anm.: Die Lose 45 und 46 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (9 Μ für die Nm. 45 und 46) Käufer: Lillie 1780/00/00 AUAN 0035 Dütschin I Zwey Stück mit Vögel. I Diese Nr.: Ein Stück mit Vögel Anm.: Die Lose 35 und 36 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1780/00/00 AUAN 0036 Dütschin I Zwey Stück mit Vögel. I Diese Nr.: Ein Stück mit Vögel Anm.: Die Lose 35 und 36 wurden zusammen katalogisiert. Tremsakt.: Unbekannt 1784/08/02 FRNGL 0014 die Jungfer Dietschin I Eine blühende Distelblume mit verschiedenen Insecten, nach der Natur abgebildet von der Jungfer Dietschin. I Pendant zu Nr. 15 Maße: 10 Zoll breit, 12 Zoll hoch Verkäufer: Α Transakt.: Verkauft (3.4 fl für die Nm. 14 und 15) Käufer: Hoink 1784/08/02 FRNGL 0015 die Jungfer Dietschin I Das Gegenbild hierzu, ein dergleichen Gewächs [eine blühende Distelblume]
nebst einem Cicoryen=Saamenkopf mit Insecten, ebenfalls nach der Natur schön ausgeführt von nemlicher Hand [Jungfer Dietschin] und Maas. I Pendant zu Nr. 14 Maße: 10 Zoll breit, 12 Zoll hoch Verkäufer: Α Transakt.: Verkauft (3.4 fl für die Nrn. 14 und 15) Käufer: Hoink 1784/08/02 FRNGL 0032 die Jungfer Dietschin I Ein nach der Natur gemahlter Eisvogel und eine Rose mit Insecten, von der Jungfer Dietschin. I Diese Nr.: Ein nach der Natur gemahlter Eisvogel Maße: 8 Zoll breit, 11 Zoll hoch Anm.: Die Lose 32 und 33 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Α Transakt.: Verkauft (50 Kr für die Nrn. 32 und 33) Käufer: Kiehbecher 1784/08/02 FRNGL 0033 die Jungfer Dietschin I Ein nach der Natur gemahlter Eisvogel und eine Rose mit Insecten, von der Jungfer Dietschin. I Diese Nr.: Eine Rose mit Insecten Maße: 8 Zoll breit, 11 Zoll hoch Anm.: Die Lose 32 und 33 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Α Transakt.: Verkauft (50 Kr für die Nrn. 32 und 33) Käufer: Kiehbecher 1784/08/02 FRNGL 0043 Mad. Dietsch I Drey fleißige Landschäftgens unter Glas, von Mad. Dietsch. I Diese Nr.: Ein fleißiges Landschäftgen Maße: 1 Vi Zoll breit, 5 Vi Zoll hoch Anm.: Die Lose 43 bis 45 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Α Transakt.: Verkauft (2.8 fl für die Nrn. 43-45) Käufer: Kiehbecher [?] 1784/08/02 FRNGL 0044 Mad. Dietsch I Drey fleißige Landschäftgens unter Glas, von Mad. Dietsch. I Diese Nr.: Ein fleißiges Landschäftgen Maße: 7 Vi Zoll breit, 5 Vi Zoll hoch Anm.: Die Lose 43 bis 45 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Α Transakt.: Verkauft (2.8 fl für die Nrn. 43-45) Käufer: Kiehbecher [?] 1784/08/02 FRNGL 0045 Mad. Dietsch I Drey fleißige Landschäftgens unter Glas, von Mad. Dietsch. I Diese Nr.: Ein fleißiges Landschäftgen Maße: 1 Vi Zoll breit, 5 Vi Zoll hoch Anm.: Die Lose 43 bis 45 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Α Transakt.: Verkauft (2.8 fl für die Nrn. 43-45) Käufer: Kiehbecher [?] 1784/08/02 FRNGL 0098 die Junfer Dietschin I Zwey Blumenbouquetes unter Glas, von der Junfer [sie] Dietschin. I Diese Nr.: Ein Blumenbouquet Maße: 7 V* Zoll breit, 10 14 Zoll hoch Anm.: Die Lose 98 und 99 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Β Transakt.: Verkauft (3.12 fl) Käufer: Kiehbecher 1784/08/02 FRNGL 0099 die Junfer Dietschin I Zwey Blumenbouquetes unter Glas, von der Junfer [sie] Dietschin. I Diese Nr.: Ein Blumenbouquet Maße: 7 lA Zoll breit, 10 V* Zoll hoch Anm.: Die Lose 98 und 99 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Β Transakt.: Verkauft (3.12 fl) Käufer: Kiehbecher 1791/05/30 FRAN 0069 Mile. Dietsch I Zwey Muscheln und Schneckenstücke in Wasserfarbe gemalt. I Maße: 1 Schuh hoch und 8 Zoll breit Verkäufer: Bansa Transakt.: Verkauft (1.14 für die Nrn. 69 und 70) Käufer: Staud 1791/05/30 FRAN 0070 Mile. Dietsch I Zwey Muscheln und Schneckenstücke in Wasserfarbe gemalt. I Maße: 1 Schuh hoch und 8 Zoll breit Verkäufer: Bansa Transakt.: Verkauft (1.14 für die Nrn. 69 und 70) Käufer: Staud
Dietzsch, Johann Christoph 1794/00/00 FGAN [B]0199 Johann Christian Dietschl Zwey Blumenstücke jedes im Glas, auf Papendeckel gemalt. I Mat.: auf Pappe Maße: 1 Schuh Vi Zoll hoch, 1 Schuh 5 Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt (44 fl) 1799/00/00 WZAN 0702 Joh. Christoph Dietsch I Zwey Landschaften. Die eine von Cornelius Poelemburg. Auf Holz. Die andere von Joh. Christoph Dietsch. Auf Kupfer. I Diese Nr.: Eine Landschaft; Nr. 701 von C. Poelenburgh Mat.: auf Kupfer Maße: hoch 10 Zoll breit 1 Schuh 3 Zoll Anm.: Die Lose 701 und 702 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Dillemanns, Georg [Nicht identifiziert] 1776/00/00 WZTRU 0328 Georg Dillemanns I Ein Stück 7 Vi Zoll hoch, 8 Vi Zoll breit von Georg Dillemanns, vorstellend eine Landschaft mit alten Gebäuden, und v[i]elen kleinen Figuren, welche dieses Stücke um so annehmlicher machen. I Pendant zu Nr. 329 Maße: 7 Vi Zoll hoch, 8 Vi Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (8 fl Schätzung) 1776/00/00 WZTRU 0329 Georg Dillemanns I Compagnion zu Nro. 328 von nämlichen Gusto des Meisters [Georg Dillemans]. I Pendant zu Nr. 328 Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (8 fl Schätzung) 1781/00/00 WZAN 0328 Georg Dillemanns I Ein Stück 7 Vi Zoll hoch, 8 Vi Zoll breit von Georg Dillemanns, stellet eine Landschaft mit alten Gebäuden, und vielen kleinen Figuren vor, welche dieses Stück um so annehmlicher machen. I Pendant zu Nr. 329 Maße: 7 Vi Zoll hoch, 8 Vi Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0329 Georg Dillemanns I Kompagnon zu Nro 328 von nämlichen Gusto des Meisters [Georg Dillemans]. I Pendant zu Nr. 328 Transakt.: Unbekannt
Dillent [Nicht identifiziert] 1716/00/00 FRHDR 0211 Dillent I Von Dillent Kaszen und Fische. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (15)
Dimantiny, Johannes [Nicht identifiziert] 1782/09/30 FRAN 0003 Johannes Dimantiny I Ein erwachsener Jüngling, welcher auf der Laute spielt. [Un adolescent pinjant le luth, par Jean Dimantini.] I Maße: 2 Schuh 7 Zoll hoch, 2 Schuh 1 Zoll breit Anm..· Dieses Los wurde zusammen mit der Nr. 4 (Pietro della Vecchia) verkauft. Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (13 fl für die Nrn. 3 und 4) Käufer: Will
Dittmers 1790/05/20 HBSCN 0250 Dittmer I Mit einer sanftmüthigen Miene ist der berühmte Prediger Ahrens abgebildet. Auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Zoll, breit 18 Zoll Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (1.8 M) Käufer: Ego
Dittmers, W.M. 1789/04/16 HBTEX 0034 Dittmers I Ein Stilleben mit Geschirren, allwo besonders schöne Haselnüsse und einige Gartenfrüchte; nach der Natur gemahlt auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 26 Zoll, breit 29 Zoll Transakt.: Verkauft (3.80 M)
Dobson, William 1765/03/27 FRKAL 0046 Dobson I Un beau tableau representant Jael ayant un clou dans la mein delicatement peint. I Maße: hauteur 20 pouces, largeur 16 pouces Transakt.: Verkauft (18.30 fl) Käufer: Stöckl 1784/08/02 FRNGL 0521 Dopsoon I Eine junge Frauenperson mit einem Hamer in der Hand, die Jael vorstellend, besonders fein fleisig und geistreich ausgeführt von Dopsoon. I Maße: 15 Zoll breit, 17 Vi Zoll hoch Transakt.: Verkauft (23 fl) Käufer: Bäumer
Does 1764/05/18 BOAN 0064 Van der Does I Un Paisage avec des Brebis d'un pied onze pouces de hauteur & d'un pied sept pouces de GEMÄLDE
545
longueur, peint par van der Does. [Ein stück Vorstellend eine Landschaft mit schaaf Von van der Does.] I Maße: 1 pied 11 pouces de hauteur & 1 pied 7 pouces de longueur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (9.10 Rt) Käufer: Beckering 1764/05/23 BOAN 0120 Van der Does I Un Tableau de quatre pieds deux pouces de hauteur, quatre pieds de largeur, representant un Belier & des Chardons, peint par van der Does. [Ein stück Vorstellend Einen großen widder bock mit schönen distelen, gemahlt von van der Does.] I Maße: 4 pieds 2 pouces de hauteur, 4 pieds de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (36 Rt) Käufer: Geh Rath Haes 1768/08/16 KOAN 0048 Vander Does I Eine Landschaft die Nacht vorstellend von Vander Does mit einem Hirt und Schaaf in Rahmen. I Maße: Höhe 1 Fuß 4 Zoll, Breite 1 Fuß 9 Zoll Verkäufer: Freyherr von Kaas Transakt.: Unbekannt 1778/09/28 FRAN 0643 van der Does I Ein sehr schönes Viehstück. [Une tres belle piece representante du betail.] I Pendant zu Nr. 644 Maße: 1 Schuh 5 Zoll breit, 1 Schuh hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (40.30 fl für die Nrn. 643 und 644) Käufer: Prß ν Dessau 1778/09/28
FRAN
0644
van der Does I Der C o m p a g n o n , das
nemliche vorstellend [ein Viehstück], von dito [van der Does], nemliches Maaß. [Le pendant du precedent, meme objet [piece representante du betail], par le meme [Van der Does], meme hauteur & meme largeur.] I Pendant zu Nr. 643 Maße: 1 Schuh 5 Zoll breit, 1 Schuh hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (40.30 fl für die Nrn. 643 und 644) Käufer: Prß ν Dessau 1778/10/30 HBKOS 0042 van der Dois I Eine Landschaft. Im Vorgrunde ein schlafender Schäfer und ein säugendes Lamm, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 9 Vi Zoll, breit 12 Zoll Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0277 Van der Does I Ein Hirtenmädchen ruhet mit ihrer Heerde in einer bergichten Gegend, wo am nahen Felsen, unter einigen Bäumen, eine Hütte steht, vor der ein Bauer mit seinem Weibe spricht, und einiges Vieh befindlich ist. [Une jeune bergere se repose avec son troupeau dans une contree montagneuse. Un paysan parle ä sa femme devant une chaumiere situee sous des arbres pres d'un rocher, & entouree de betail.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 7 Zoll hoch, 2 Fuß 1 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0278 Van der Does I Eine Kuh steht an dem Sturze einer Weide, vor welchem eine Hirtinn bey etlichen Schafen sitzt. Zur Linken treibt ein Schäfer seine Heerde näher. [Une vache pres du tronc d'un saule, devant lequel est assise une bergere avec quelques moutons. A gauche un berger s'approche avec son troupeau.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 7 Zoll hoch, 2 Fuß 1 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1782/08/21 HBKOS 0011 von der Dois I Eine ländliche Gegend, mit stillen Wasser, durch welches ein Mädchen an das Ufer steiget, ihr Essel folgt nach, nebst dem Hund. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Zoll 3 Linien, breit 13 Zoll 6 Linien Verkäufer: Moddermann Transakt.: Verkauft (17 M) Käufer: Keetsch 1783/06/19 HBRMS 0043 v. d. Does I Eine Landschaft mit Schaafen und Ziegen, zur Rechten ein antiquer Brunnen, aus dessen laufendem Wasser ein Hund seinen Durst stillet. L[einwand]. g.R. [verguldeter Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 4 Zoll hoch, 1 Fuß 7 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1784/08/02 FRNGL 0253 van der Does I Ein schönes nach der Natur besonders fleisig ausgeführtes Blumenstück. I Maße: 11 Zoll breit, 15 Zoll hoch Verkäufer: D Transakt.: Verkauft (7 fl) Käufer: Reinhardt 1788/06/12 HBRMS 0122 Van der Dois I Eine schöne Landschaft, worin Hornvieh und Schaafe in einem kleinen See treiben; in 546
GEMÄLDE
der Entfernung mehrere Schaafe und Hirten, auch alte Bergschlösser. Sehr schön und fleißig gemahlt. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 15 Zoll, breit 18 Zoll Transakt.: Unbekannt 1788/10/01 FRAN 0073 van der Does I Eine Landschaft auf welcher ein Schäfer mit Schaafen. I Maße: 11 Vi Zoll hoch, 13 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (9 fl) Käufer: Heussel 1788/12/13 HBTEX 0166 van der Dois I Ein Viehstück. I Transakt.: Verkauft (1.8 M) Käufer: Ehrfenreich] 1790/05/20 HBSCN 0188 van der Dous I Hirten mit ihren Heerden in einem mit Wasser durchflossenen Thale, bey Sonnenuntergang. Ein Gemähide wie Berghem. Auf Holz. S.R.G.L. [Schwarze Rahm, goldne Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 14 Vi Zoll, breit 20 Zoll Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (6 M) Käufer: Stöker 1791/09/21 FRAN 0001 Van der Does I Eine Landschaft, welche den Untergang der Sonne vorstellet, wo vorwärts eine Schäferinn mit Hämmeln und Ziegen umringt ist, und neben ihr eine Kuh; der Hintertheil zur Rechten ist mit einer alten Baukunst gezieret, die linke Seite endiget sich mit einer entfernten Gegend mit Figuren und Vieh gezieret; dieses kleine Gemälde ist von einer sehr angenehmen Verfaßung, und man kann es wie eines der besten Stücke des Meisters ansehen. I Transakt.: Verkauft (151 fl) Käufer: Emerich 1791/09/21 FRAN 0033 Van der Does I Eine Landschaft, so den Aufgang der Sonne vorstellt, wo vornen zur Rechten Kühe, Pferde, Schaafe und Ziegen sind, zur Linken unten an einem Felsen ein Schäfer und eine Schäferin, und zu ihren Füßen ein Hund, hinten auf dem Gipfel einer Menge Felsen sieht man einen Mann und ein Frauenzimmer, welche Vieh weiden, zur Rechten in der Entfernung gehen Gebirge hinaus; das Helle und das Dunkele, so sehr reitzend sind, machen dieses Gemälde zu eines der angenehmsten. I Pendant zu Nr. 34 Transakt.: Verkauft (99.15 fl) Käufer: Wüste 1791/09/21 FRAN 0034 Van der Does I Der Compagnon von eben demselben [Van der Does], Der Untergang der Sonne, wo vorne Pferde, Kühe und Ziegen sind, welche der Schäfer zu Pferde in den Stall führet, welchen man von vome siehet und welcher scheint in den Felsen eingegraben zu seyn, die linke Seite endiget sich mit einer bergigten Entfernung; dieses Gemälde ist gleichfalls sehr angenehm und macht eine reizende Wirkung. I Pendant zu Nr. 33 Transakt.: Verkauft (100 fl) Käufer: Wüste 1791/09/21 FRAN 0036 Van der Does I Eine prächtige bergigte Landschaft, wo vorne ein Schäfer unten an einem Felsen sitzt, hinter ihm ist sein Hund, ein wenig mehr gegen die Mitte ist ein Maulesel mit seinem Sattel und zwey Körben, in welchem zwey kleine Kälber sind, beladen, der vordere Theil ist mit Schafen gezieret, zur Rechten sind Felsen und zur Linken eine bergigte Oefnung, der ganze Zusammenhang ist sehr angenehm in allen seinen Theilen. I Transakt.: Verkauft (140.30 fl) Käufer: Kissner 1791/09/21 FRAN 0111 Van der Does I Eine bergigte Landschaft, auf den Seiten mit Felsen gezieret, vorne sind Schaafe und Schäfer, die Mitte stellet die Aussicht eines Gebirges vor; dieses kleine Stück ist sehr fein. I Transakt.: Verkauft (18.15 fl) Käufer: Wüste 1797/04/20 HBPAK 0252 Van der Does I Ein kleines Schaafstück in sehr dunklem Kolorit. Es ist von einfacher angenehmer Zusammensetzung und richtiger Zeichnung. Dieses Meisters Werke sind sehr gesucht. Auf Holz, mit goldn. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 5 Zoll, breit 8 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0097 v. d. Does I Eine bergigte Landschaft, mit einer Schäferin, und einer Heerde Schafe und Ziegen; in der Entfernung sieht man eine Caravanne ziehn. Auf Leinw. goldenen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 20 Zoll, breit 22 Zoll Transakt.: Unbekannt
1797/04/25 HBPAK 0232 v. d. Does I Eine Landschaft, zur rechten ein Monument, im Vordergrunde zwey Schafe und eine Ziege. Auf Holz, goldene Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 9 Vi Zoll, breit 8 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0124 Van der Duus I Eine Landschaft mit einer Dorf=Gegend. Im Vordergrunde ein Hirt, der Schaafe weidet. Neben ihm ein Mädgen, die dem Wanderer einen Weg zeiget. Auf das schönste und prächtigste gemahlt. Auf Leinwand, schwarzer Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 34 Zoll, breit 42 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/08/09 HBPAK 0050 van den Doos I Eine Landschaft, worin verschiedene Figuren und einiges Vieh. Auf Holz, goldn. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Zoll, breit 15 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0019 Van der Doos I Zwey Landschaften mit Rudera, wo Schäfer ihre Heerden weiden. Ganz kräftig und gut gemahlt. Auf Holz. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Rudera, wo Schäfer ihre Heerden weiden Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Zoll, breit 19 Zoll Anm.: Die Lose 19 und 20 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0020 Van der Doos I Zwey Landschaften mit Rudera, wo Schäfer ihre Heerden weiden. Ganz kräftig und gut gemahlt. Auf Holz. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Rudera, wo Schäfer ihre Heerden weiden Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Zoll, breit 19 Zoll Anm.: Die Lose 19 und 20 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0107 v. d. Doos I Eine Landschaft mit Figuren. I Transakt.: Unbekannt
Does (und Hackaert, J.) 1793/09/18 HBSCN 0038 Hakkart: v. d. Does I Vor einem ländlichen Lusthause, eigentlich der Eingang zum Garten werden herrschaftliche Personen von Kloster=Geistlichen empfangen, im Vordergrund steht ein großer Baum, an dessen Fuß eine Ziege Disteln frißt, hinter ihr steht ein Schaf, nebenher verschiedenes Federvieh. Die Landschaft ist von Hakkert, die Figuren sind von v. d. Does staffiret. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 42 Zoll, breit 30 Zoll Transakt.: Unbekannt
Does, Jacob van der (der Ältere) 1743/00/00 BWGRA 0093 Jacob van der Doos I Ein Vieh= Stück von Jacob van der Doos. I Maße: hoch 1 Fuß 9 Zoll, breit 1 Fuß 4 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0097 Does (Jacobus van der) I [Ohne Titel] I Anm. : Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1776/00/00 WZTRU 0026 Jokab von Does I Ein Stück von 1 Schuhe, 7 Zoll hoch, 1 Schuhe, 9 Zoll breit, verfertigt von Jokab von Does: die Landschaft stellet vor einen angenehmen Abend, man nimmt hierinn wahr des Bamboccio Manier, ein Hirt sitzend hütet bey einer Rudera, allwo ein Brüllochs sammt vieles Viehe um denselben herumweidet. Es ist unbeschreiblich, wie angenehm in halben Schatten dieses Viehe sammt Hirten gehalten ist: die zwar in Aschengrau fallende Colorite ist unerwartet mit den angenehmsten Localfarben vereinigt, von Fleis und Ausdruck wird dem Kenner genugsam des Meisters Hand bekannt sein, welche man hierinn versichert. I Maße: 1 Schuhe 7 Zoll hoch, 1 Schuhe 9 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (200 fl Schätzung) 1781/00/00 WZAN 0026 Jakob von Does I Ein Stück 1 Schuhe 7 Zoll hoch, 1 Schuhe, 9 Zoll breit, verfertigt von Jakob von Does
zeiget eine Landschaft von einen angenehmen Abend; man nimmt hierinn wahr die Manier des Bamboccio Manier: ein Hirt hütet sitzend bey einer Rudera, wo ein Brüllochs sammt vielem Viehe um denselben herumweidet. Es ist unbeschreiblich, wie angenehm in halben Schatten dieses Vieh sammt Hirten gehalten ist: die Aschengrau fallende Kolorite ist unerwartet und mit den angenehmsten Lokalfarben vereinigt, von Fleiße und Ausdrucke wird dem Kenner genugsam des Meisters Hand bekannt seyn, welche man hierinn versichert. I Maße: 1 Schuhe 7 Zoll hoch, 1 Schuhe 9 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1787/00/00 HB AN 0674 Jacob van der Does I In einer waldigten Land= und Wassergegend befindet sich im Vordergrunde eine an einer Anhöhe sitzende schlafende Nymphe, welche von einem hinten herkommenden Pater belauscht wird. A.H. [Auf Holz] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 Zoll, breit 9 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (8.12 M) Käufer: Mathees 1794/00/00 HB AN 0030 J. van de Does I Vor den Ruinen eines Schlosses weidet Vieh. Die liegenden Schaafe, der stehende Ochse und der Hund ganz im Vorgrunde sind meisterhaft gezeichnet und natürlich dargestellt. I Maße: Höhe 48 Zoll, Breite 38 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0369 J.v.d. Does I Schaafe liegend vorgestellt. Sehr frey und leicht bearbeitet. I Maße: Hoch 7 Zoll, breit 10 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0058 Jacob van der Does I Zwey Landschaften, von Jacob van der Does. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 1 Zoll breit 1 Schuh 3 Zoll Anm.: Die Lose 58 und 59 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0059 Jacob van der Does I Zwey Landschaften, von Jacob van der Does. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 1 Zoll breit 1 Schuh 3 Zoll Anm.: Die Lose 58 und 59 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0378 Jacob van der Does I Zwey Landschaften, von Jacob van der Does. Auf Kupfer. Sehr schön. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Kupfer Maße: hoch 1 Schuh 3 Zoll breit 1 Schuh 5 Zoll Anm.: Die Lose 378 und 379 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0379 Jacob van der Does I Zwey Landschaften, von Jacob van der Does. Auf Kupfer. Sehr schön. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Kupfer Maße: hoch 1 Schuh 3 Zoll breit 1 Schuh 5 Zoll Anm.: Die Lose 378 und 379 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0709 Jacob van der Does I Zwey Landschaften, von Jacob van der Does. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 3 Zoll breit 1 Schuh 7 Zoll Anm.: Die Lose 709 und 710 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0710 Jacob van der Does I Zwey Landschaften, von Jacob van der Does. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 3 Zoll breit 1 Schuh 7 Zoll Anm.: Die Lose 709 und 710 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Does, Simon van der 1763/01/17 HNAN [A]0020 Simon van der Does I Bataille sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 2 pieds lA pouces, Largeur 2 pieds 10 pouces Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt 1793/09/18 HBSCN 0065 S. v. d. Does I Schafe und eine Kuhe in einer gebürgigten Landschaft, der Hirte bringt noch ein Lamm GEMÄLDE
547
herdey [sic], zu der Hirtin füssen liegt der Hund, neben ihr steht ein Knabe welcher sich auf ein Lamm lehnet. Ganz vortreflich gemahlet. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 % Zoll, breit 12 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0431 Simon van der Does I Fünf Landschaften, von Simon van der Does. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 3 Zoll breit 1 Schuh 2 Zoll Anm.: Die Lose A431 bis A435 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0432 Simon van der Does I Fünf Landschaften, von Simon van der Does. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 3 Zoll breit 1 Schuh 2 Zoll Anm.: Die Lose A431 bis A435 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0433 Simon van der Does I Fünf Landschaften, von Simon van der Does. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 3 Zoll breit 1 Schuh 2 Zoll Anm.: Die Lose A431 bis A435 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0434 Simon van der Does I Fünf Landschaften, von Simon van der Does. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 3 Zoll breit 1 Schuh 2 Zoll Anm.: Die Lose A431 bis A435 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0435 Simon van der Does I Fünf Landschaften, von Simon van der Does. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 3 Zoll breit 1 Schuh 2 Zoll Anm.: Die Lose A431 bis A435 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1800/07/09 HBPAK 0059 Simon Vander-doos I Marche d'animaux dans une riviere. Sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: 9 pouces de hauteur. 14 pouces de largeur Transakt.: Unbekannt
Dohmsen [Nicht identifiziert] 1793/00/00 NGWID 0123 Dohmsen I Ein Wuchrer nebst einigen Figuren, welcher mit Kostbarkeiten und übrigen Beywesen schön ausgeziert, von Dohmsen. I Pendant zu Nr. 124 Maße: 2 Schuh 7 Zoll hoch, 3 Schuh 1 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0124 Dohmsen I Zum Gegenstück, wie der Tod einen Geizigen übereilt, der von seinen Schätzen umgeben ist, von obigem Meister [Dohmsen] und Maaß. I Pendant zu Nr. 123 Maße: 2 Schuh 7 Zoll hoch, 3 Schuh 1 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
Dois, A.V. [Nicht identifiziert] 1793/00/00 NGWID 0400 A. v. Dois I Wie Jupiter in Gestalt eines Frauenzimmers zu einer Göttin kommt, um sie in dieser Verkleidung zu täuschen, ist meisterhaft und mit kräftigen Colorit dargestellt von A. v. Dois. I Maße: 1 Schuh 11 Zoll hoch, 1 Schuh 8 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
Dolci, Carlo 1750/00/00 KOAN 0020 Carlo Dolce I Jesus Christ, portant la croix, beau, & delicat. I Maße: Largeur 1 Pies 3 Vi Pouces, Haut 1 Pies 6 Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollem Transakt.: Unbekannt 1778/09/28 FRAN 0175 Carl Lodolci I Ein Ecce=Homo. [Un Ecce-Homo.] I Maße: 1 Schuh 10 Zoll breit, 2 Schuh 8 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (15.30 fl) Käufer: Hüsgen 548
GEMÄLDE
1779/00/00 HB AN 0149 Carlo Dolci I Venus sitzt vor einem steinernen Monumente auf einem gelben Gewände, und verlangt von dem vor ihr stehenden Amor, der mit der Linken sich die Augen reibt, daß er ihr die Rechte statt der Abbitte reichen soll. Zur Rechten schnäbeln sich zwo Tauben. Auf Holz. [Venus est assise devant un monument de pierre, sur une draperie jaune. Elle semble dire ä l'Amour qui est devant eile & qui se frotte les yeux de la main gauche, de lui donner sa main droite, au lieu de lui demander pardon. A gauche on voit des tourterelles se becqueter. Sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 6 Zoll hoch, 1 Fuß 2 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/09/27 FRNGL 0926 Carlo Dolcy I Das Bildniß eines schönen griechischen Frauenzimmers, ganz besonders, fein und gristreich [sie] ausgearbeitet von Carlo Dolcy. [Le portrait d'une belle Dame Grecque, piece superieurement bien peinte.] I Maße: 1 Vi Schuh hoch, 1 Schuh 3 % Zoll breit Transakt.: Verkauft (300 fl) Käufer: Nothnagel modo Sind Hofman 1781/03/26 BLHRG 2367 Carlo dolci I Une Vierge en oval, sur cuivre, par Carlo dolci bien conservee. I Mat.: auf Kupfer Format: oval Transakt.: Unbekannt (122) 1785/05/17 MZAN 0097 Carl Lodolci I Ein Mutter Gottesbild von Carl Lodolci auf Kupfer. [La S. Vierge.] I Mat.: auf Kupfer Maße: 2 Schuh hoch, 1 Schuh 7 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (56 fl) Käufer: Hofrath ν Leykam 1787/00/00 HB AN 0143 Carlo Dolci I Ein junges freundliches Mädchen, deren linker Arm, mit welcher Hand sie einen Palmenzweig hält, auf einem Postamente ruht. Mit der rechten hält sie ein kleines Buch, worinn sie mit einer aufmerksamen Miene lieset. Sehr angenehm und fließend gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 32 Zoll, breit 27 Zoll Transakt.: Verkauft (27 M) Käufer: Fesser 1787/00/00 HB AN 0164 Carlo Dolci I Maria, roth gekleidet, mit einem blauen Gewände und gelben Schleyer über dem Haupte, lieset andächtig in einem Buche, so sie mit beyden Händen hält; in ihren Armen hat sie das Kindlein, welches vergnügt mit einem Vogel spielt. Besonders angenehm und schön gemahlt. A.K. [Auf Kupfer] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 12 Zoll, breit 10 Zoll Transakt.: Verkauft (75 M) Käufer: Fesser 1789/08/00 HNAN 0161 Carlin Dolci I Eine Madonna, ein fürtreflich Original oval a. K. [auf Kupfer] in einer Schacht. I Mat.: auf Kupfer Format: oval Maße: Höhe 11 Zoll, Breite 6 Zoll Transakt.: Unbekannt 1789/08/18 HBGOV 0034 Carlo Doled I Christus mit der Dornenkrone, von großen Affect, auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 10 Zoll, breit 7 Zoll Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0002 Dolce Carlo I Eine das Jesuskind säugende Maria mit Engeln, in einer geschnittenen und vergoldeten Ram mit einem Glase. I Maße: Höhe 1 Schuh 2 Zoll, Breite 1 Schuh Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0099 Dolce Carlo I Die Unschuld in der Gestalt eines jungen Frauenzimmers mit einer weissen Taube, auf Leinwat, in einer geschnittenen und vergoldeten Ram. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 2 Zoll, Breite 1 Schuh 7 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV [A]0026 C. Dolci I Eine betende Magdalena; von Carlo Dolci. Auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 3 V* Zoll, breit 2 V* Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/02/17 HBPAK 0058 Carlo Dulci I Christus mit der Dornen=Krone und dem rothen Mantel, welcher über die Schultern herunter hängt, so, dass die Brust entblösst ist. Auf Holz. Brustbild. I
Mat.: auf Holz Maße: Höhe 27 Zoll, Breite 21 Zoll Transakt.: Verkauft (271 M) Käufer: Τ 1796/11/02 HBPAK 0073 Carl Dolci I Christus am Oelberge, wie er von dem Engel gestärkt wird. Ein schönes und seltenes Bild. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 20 Zoll, breit 15 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0246 C. Dolei I Eine betende Magdalena, die Andacht dieser Person ist unaussprechlich ausgedrückt. Die Draperie ist Meisterhaft. Auf Leinw. goldenen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Format: oval Maße: hoch 22 Zoll, breit 18 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/10/10 HBPAK 0013 Carlo Dolce I Eine Mutter Gottes mit dem Kindlein Jesu. Sehr schön gemahlt. Auf Marmor, goldn. Rahm. I Mat.: auf Marmor Maße: Hoch 9 Vi Zoll, breit 7 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN1 0035 Dolce (Carl.) I Ein Bruststück Christi mit entblöstem Oberleib u. der dornen Krön; dieses Stück ist von einer sehr fleißigen Manier und glänzendem Colorit gearbeitet. I Mat.: auf Kupfer Maße: 8 Vi Zoll hoch, 10 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Dolci, Carlo (Kopie nach) 1778/09/28 FRAN 0100 Lippold; Carl Lodolcy I Ein Ecce=Homo von obigem Meister [Lippold], nach Carl Lodolcy. [Un EcceHomo d'aprfes Charles Lodolcy par le meme Maitre [Lippold].] I Kopie von Fr. Lippold nach C. Dolci Maße: 1 Schuh 3 Zoll breit, 1 Schuh 8 Zoll hoch Anm.: Dieses Los wurde zusammen mit der Nr. 101 (Fr. Lippold) verkauft. Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (18 fl für die Nrn. 100 und 101) Käufer: Schrintz 1793/06/07 HBBMN 0104 Carlo Dolce I Die büßende Maria Magdalena mit Creutzweis über der Brust gelegten Händen. Halbe Figur, nach Carlo Dolce. I Maße: Hoch 9 Zoll, breit 7 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0184 Nach Carl Dolzi I Eine betende Maria. Auf Leinwand. Schwarzer Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 20 Zoll, breit 16 Zoll Transakt.: Unbekannt
Dolci, Carlo (Schule) 1742/08/01 BOAN 0189 Carolo Dulci I Eine Mater Dei auf Kupffer gemahlet, von der Schuhle von Carolo Dulci. I Mat.: auf Kupfer Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt
Domann, Paulo [Nicht identifiziert] 1788/06/12 HBRMS 0099 Paulo Domann I Zwey gebürgichte Landschaften mit Wasser: in der einen ein Wasserfall zwischen steilen Felsen, die durch eine Brücke verbunden sind. Landleute, Hirten mit Rindern und Schaafen, Fuhrleute und Arbeiter, die sich mit Ein= und Ausladen aus den Schiffen beschäfftigen, beleben. Diese Stücke sind mit großer Freyheit gemalt. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine gebürgichte Landschaft mit Wasser: in der einen ein Wasserfall zwischen steilen Felsen, die durch eine Brücke verbunden sind. Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 27 Zoll, breit 36 Zoll Anm.: Die Lose 99 und 100 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1788/06/12 HBRMS 0100 Paulo Domann \ Zwey gebürgichte Landschaften mit Wasser: in der einen ein Wasserfall zwischen steilen Felsen, die durch eine Brücke verbunden sind. Landleute, Hirten mit Rindern und Schaafen, Fuhrleute und Arbeiter, die sich mit Ein= und Ausladen aus den Schiffen beschäfftigen, beleben. Diese Stücke sind mit großer Freyheit gemalt. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine gebürgichte Landschaft mit Wasser Mat.: auf Leinwand Maße:
Hoch 27 Zoll, breit 36 Zoll Anm.: Die Lose 99 und 100 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Dombrechts [Nicht identifiziert] 1742/08/01 BOAN 0079 Dombrechts I Ein Mariae Magdalenas Nacht-Stuck auff Kupfferen Plathen gemahlt. Original von Dombrechts. I Mat.: auf Kupfer Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt
Domenichino, Constantin [Nicht identifiziert] 1779/00/00 HB AN 0133 Constantin Dominichino I Eine Geschichte aus der Legende. Ein Bischof, vor dem Altare stehend, spricht über ein junges Kind, welches von einer Königinn dargebracht wird, den Segen aus. Verschiedene umherstehende Personen betrachten diese Handlung mit andächtiger Aufmerksamkeit. [Histoire tiree de la legende. Un 6veque ä l'autel donne la benediction ä un jeune enfant, qui lui est presente par une reine. Plusieurs personnes assistent ä cette ceremonie avec une devotion attentive.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 6 Zoll hoch, 1 Fuß 10 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt
Domenichino (Domenico Zampieri) 1710/05/21 HB AN 0018 Dominicien I Ein rares dito [Italiänisches Stück], worauf der König David auf seiner Harpfe andächtig spielet / verfertiget von Dominicien. I Transakt.: Unbekannt 1750/10/15 HB AN 0020 Dominichino I Einige Figuren. I Maße: 1 Fuß 8 Zoll hoch, 2 Fuß 6 % Zoll breit Transakt.: Unbekannt (20) 1752/05/08 LZAN 0100 Domenico Zampieri I Die G r a b l e gung Christi von Domenico Zampieri, 2 Ellen breit, 1 lA Ellen hoch im vergoldeten Rahmen. I Maße: 2 Ellen hoch, 1 V* Elle breit Transakt.: Verkauft (7.16 Th) Käufer: Janssen 1763/11/09 FRJUN 0055 Dominiquin I Une sainte familie tres bien acheve. I Maße: hauteur 20 pouces, largeur 23 pouces Transakt.: Verkauft (17.45 fl) Käufer: Döbele 1764/00/00 BLAN 0418 Dominicken I 1. sehr schönes stück, stellend Agar u. Ismael vor. I Maße: 1 Fuß 11 Zoll hoch, 2 Fuß 2 Vi Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (600 Rt Schätzung) 1768/07/00 MUAN 0924 Dominichino (Dominicus Zampiri) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1777/03/03 AUAN 0023 Domenichini I Ein Adam und Eva. I Maße: Höhe 4 Sch. 4 Zoll, Breite 3 Sch. 3 Zoll Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt 1778/04/11 HBBMN 0008 Dominichino I Der Feldmarschall von Schulenburg, ein Kniestück=Portrait, in Lebensgröße. I Transakt.: Verkauft (30.4 M) Käufer: Ehr[enreich] 1778/09/28 FRAN 0624 Dominichino I Die Ausgiessung des heil. Geistes über die Apostel, ein sehr schönes Stafeleygemälde. [La descente du S. Esprit sur les apötres, trfes belle piece de cabinet.] I Maße: 2 Schuh 5 Zoll breit, 2 Schuh hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (88 fl) Käufer: Schütz 1779/09/27 FRNGL 0101 Domenechino I Die Göttin Diana im Brustbild. [Diane en buste.] I Maße: 1 Schuh 1 Vi Zoll hoch, 11 Zoll breit Transakt.: Verkauft (8.15 fl) Käufer: Rath Eichhorn 1787/00/00 HB AN 0258 Dominiquino I Die heilige Cecilia, mit gen Himmel gewandtem Haupte und kreuzweis über die Brust gelegten Händen, weiß gekleidet, und mit einem blauen Gewände, in GEMÄLDE
549
den Wolken schwebend. Halbe Figur. In diesem kleinen Gemähide ist überaus viel edles, sowol in der Zeichnung und Mahlerey, als auch im Ausdruck. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 8 Vi Zoll, breit 7 Zoll Transakt.: Verkauft (20 M) Käufer: Fesser
lisch schön gezeichnet und vortreflich ausgeführt. In dem Ton der Farben liegt so viel Harmonie und Wärme, wie Genie in der Empfindung. Sie sind von gleicher Grösse. I Diese Nr.: Tobias, der den Fisch fängt Maße: 4 Fuß 8 Zoll hoch, 3 Fuß 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 5 bis 8 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1787/00/00 HB AN 0277 Le Dominiquin I Juno mit aufgehabenem Gesichte, in einem prächtigen Kleide, schüttet ein Gefäß voller Goldmünzen aus. Hinter ihr wird man die zwey Pfauen gewahr. Halbe Figur. Von richtiger Zeichnung und schöner Uebereinstimmung der Farben. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 28 Zoll, breit 20 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (18 M) Käufer: Tietjen
1798/01/19 HBPAK 0009 D. del Sarti, genannt Dominichino I Eine allegorische Figur, die Astronomie vorstellend. Eine weibliche, in sehr edlem Styl gezeichnete Gestalt, richtet ihr Auge mit einem erhabenen Ausdruck voll Würde gen Himmel. Die Hände ruhen auf einem Globus. Die Ausführung ist so meisterhaft wie die Empfindungen. I Maße: 4 Fuß 7 Zoll hoch, 3 Fuß 7 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
1790/01/07 MUAN 0005 Dominichino I Die Lucretia auf Leinwat in einer geschnittenen und vergoldeten Ram. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 6 Zoll, Breite 2 Schuh Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
1798/11/14 HBPAK 0149 D. del Sarti, genannt Dominichino I Eine allegorische Figur, die Astronomie vorstellend. Eine weibliche, in sehr edlem Styl gezeichnete Gestalt richtet ihre Augen mit erhabenen Ausdruck und voll Würde zum Himmel. Die Hände ruhen auf einem Globo, und die Ausführung ist so meisterhaft, wie die Empfindungen. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 59 Zoll, breit 47 Zoll Transakt.: Unbekannt
1798/01/19 HBPAK 0005 Dominico del Sarti, genannt Dominichino I Vier historische Gemähide: a) Die Taufe Christi. Eine Gruppe von drey Personen, Johannes, Christus und ein Engel, b) Abraham, der die drey Engeln bewirthet. c) Der Königische [sie], welcher Christus bittet seinen Sohn gesund zu machen, d) Tobias, der den Fisch fängt; vor ihn steht ein Engel. Vier Gemähide, die die Bewunderung jedes Kenners verdienen. Die idealisch schön gruppirten Figuren, sind etwa 1 Fuß hoch. Die Landschaften sind gleichfals idealisch schön gezeichnet und vortreflich ausgeführt. In dem Ton der Farben liegt so viel Harmonie und Wärme, wie Genie in der Empfindung. Sie sind von gleicher Grösse. I Diese Nr.: Die Taufe Christi Maße: 4 Fuß 8 Zoll hoch, 3 Fuß 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 5 bis 8 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/01/19 HBPAK 0006 Dominico del Sarti, genannt Dominichino I Vier historische Gemähide: a) Die Taufe Christi. Eine Gruppe von drey Personen, Johannes, Christus und ein Engel, b) Abraham, der die drey Engeln bewirthet. c) Der Königische [sie], welcher Christus bittet seinen Sohn gesund zu machen, d) Tobias, der den Fisch fängt; vor ihn steht ein Engel. Vier Gemähide, die die Bewunderung jedes Kenners verdienen. Die idealisch schön gruppirten Figuren, sind etwa 1 Fuß hoch. Die Landschaften sind gleichfals idealisch schön gezeichnet und vortreflich ausgeführt. In dem Ton der Farben liegt so viel Harmonie und Wärme, wie Genie in der Empfindung. Sie sind von gleicher Grösse. I Diese Nr.: Abraham, der die drey Engeln bewirthet Maße: 4 Fuß 8 Zoll hoch, 3 Fuß 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 5 bis 8 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/01/19 HBPAK 0007 Dominico del Sarti, genannt Dominichino I Vier historische Gemähide: a) Die Taufe Christi. Eine Gruppe von drey Personen, Johannes, Christus und ein Engel, b) Abraham, der die drey Engeln bewirthet. c) Der Königische [sie], welcher Christus bittet seinen Sohn gesund zu machen, d) Tobias, der den Fisch fängt; vor ihn steht ein Engel. Vier Gemähide, die die Bewunderung jedes Kenners verdienen. Die idealisch schön gruppirten Figuren, sind etwa 1 Fuß hoch. Die Landschaften sind gleichfals idealisch schön gezeichnet und vortreflich ausgeführt. In dem Ton der Farben liegt so viel Harmonie und Wärme, wie Genie in der Empfindung. Sie sind von gleicher Grösse. I Diese Nr.: Der Königische, welcher Christus bittet seinen Sohn gesund zu machen Maße: 4 Fuß 8 Zoll hoch, 3 Fuß 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 5 bis 8 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/01/19 HBPAK 0008 Dominico del Sarti, genannt Dominichino I Vier historische Gemähide: a) Die Taufe Christi. Eine Gruppe von drey Personen, Johannes, Christus und ein Engel, b) Abraham, der die drey Engeln bewirthet. c) Der Königische [sie], welcher Christus bittet seinen Sohn gesund zu machen, d) Tobias, der den Fisch fängt; vor ihn steht ein Engel. Vier Gemähide, die die Bewunderung jedes Kenners verdienen. Die idealisch schön gruppirten Figuren, sind etwa 1 Fuß hoch. Die Landschaften sind gleichfals idea550
GEMÄLDE
1799/00/00 LZRCH 0004 Le Dominicain I La continance de Scipion, belle et riche composition de 16 fig. de forme ovale, d'un beau ton de couleur. I Mat.: auf Holz Format: oval Maße: h. 43.1. 55. pouces Verkäufer: J F Rauch Transakt.: Unbekannt 1799/12/23 WNAN 0015 Dominiquire I Un enfant sur Toile par dominiquire. I Mat.: auf Leinwand Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 BLBOE 0011 Domenichino, oder Zampieri I Ein Greis mit beiden Händen auf einen Stab gestützt. Mit vieler Wahrheit dargestellt. I Mat.: auf Leinwand Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN2 0084 Dominichino I Drey Engel halten in ihren Händen verschiedene musikalische Instrumente. Das Bild ist in einem schönen gelblichten Ton gemahlt, die Zeichnung und das Colorit, so wie der Ausdruck, wird allgemein bewundert. I Mat.: auf Leinwand Maße: 27 Zoll hoch, 37 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0172 Transakt.: Unbekannt
D. Zampieri I Ein Christus=Kopf.
Domenichino (Domenico Zampieri) (Geschmack von) 1773/12/18 HBBOY 0057 Dominikino I Die sterbende Dido, in dem Gusto von Dominikino. I Transakt.: Unbekannt
Domenichino (Domenico Zampieri) (Kopie nach) 1797/08/10 MM AN 0184 Dominicain I Die H. Cecilie nach Dominicain, auf Tuch. I Mat.: auf Leinwand Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (11 fl Schätzung)
Donck, C. [Nicht identifiziert] 1788/06/12 HBRMS 0022 C. Donck I Ein Marktplatz, auf welchem grüne Gartengewächse und abgepflücktes Federvieh verkauft wird: überaus fleißig und nach der Natur. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 21 % Zoll, breit 28 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt
Donck, G. 1788/04/08 FRFAY 0171 G. Donck I Ein niederländischer Bauer und Bäuerin, welche Gemüs verkaufen, nebst vortreflich gemalten Beywesen, von G. Donck. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: 21 Z. hoch, und 24 Z. breit Transakt.: Verkauft (45 fl) Käufer: Levi ν M[annheim]
Donducci, Giovanni Andrea (Mastelletta) 1770/10/29 FRAN 0221 Mastaletta I Pigmaleon vor seiner Statua. I Maße: Hoch 26 Zoll. Breit 19 Zoll. Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0002 Johann Andreas Donducci I Eine Frau mit einem Kinde, zwey Mannspersonen, von welchen eine nakkend ist, und die andere Suppe isset, von Johann Andreas Donducci. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 8 Zoll breit 2 Schuh 2 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Donker, Jan 1763/11/09 FRJUN 0056 I. Doncker I Un tres joli enfant assis sur un coussin devant un pot ä fleurs naturellement peint. I Maße: hauteur 33 pouces, largeur 23 Vi pouces Transakt.: Verkauft (10.30 fl) Käufer: von der Lahr
1794/02/21 HBHEG 0002 Ludewig Dorigny I Laurentius lieget voller Glaubens=Hoffnung auf dem mit vielem Feuer unterlegtem Roste, und stehet seine Marter standhaft aus. Sein Anblick ist dabey sehr rührend, - und seine Beförderer zum Tode ohne Gefühl, wie alle übrige Zuschauer; worunter zwar einige mit großer Bewunderung zusehen. Die ganze Composition ist von großem Affekt, herrlicher Beleuchtung, und mit sehr freyen Pinselszügen (welche diesem Künstler eigen waren) gemahlt. Er wurde zu Paris, Anno 1654, gebohren; bildete sich in Rom, und ganz Italien war sein Wohn= Platz, wo er die Größe seiner Kunst hinterließ. Anno 1706 gieng [sie] er nach Paris, kehrte aber nehmliches Jahr nach Neapel zurück, und besuchte den großen Solimene, der ihn freundschaftlich aufnahm, und in Ansehung seiner richtigen Zeichnung, schönen Collorit, und besondern Auswahl in der Verkürtzung seiner Figuren, hochschätzte. Er starb Anno 1742 zu Verona. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 36 Zoll, breit 39 Zoll Transakt.: Unbekannt
Dorn Donneel, H.E. [Nicht identifiziert] 1763/01/17 HNAN 0062 H.E. Donneel I Le grand embrasement de la Ville de Londres, par Η. Ε. Donneel, sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 1 pied 7 pouces, Largeur 2 pieds 3 pouces Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt
Doomer, Lambert 1763/11/09 FRJUN 0057 Doomer I Un Depart de cavallier sortant d'un cabaret de pa'fsans, ä qui un pauvre vieillard demande la charite dans un beau pai'sage, bien peint. I Maße: hauteur 15 Vi pouces, largeur 23 Vi pouces Transakt.: Verkauft (10 fl) Käufer: Geyß 1797/06/13 HBPAK 0215 M. Domer I In einer Holzung gehet mitten hindurch eine Brücke, die von einem Felsen zu der Landstraße führt, worüber Hornvieh getrieben wird. Unter derselben wird man einen Wasserfall gewahr. Sehr angenehm und schön gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Vi Zoll, breit 14 V* Zoll Transakt.: Unbekannt
Doornik, Jan van 1786/10/18 HBTEX 0234 Domick I Eine Holzung an einem vorbeyfließenden Wasser, auf welchem ein Kahn befindlich. I Maße: Hoch 13 Zoll, breit 17 Zoll Transakt.: Unbekannt
Dorigny, Louis 1763/00/00 BLAN 0066 Ludewig Dorigny I Die Marter des heiligen Lorenzius. Ganze Figuren, auf Leinewand gemahlt, 3 Fuß hoch, und 3 Fuß 3 Zoll breit. Der Anblick dieses Gemähides ist sehr rührend. Das angenehme klare und helle Colorit, würde schon an sich selbst dem Seher Vergnügen verschaffen, wenn er auch nicht mehrere Vorwürfe zu demselben fände. Allein sollte er nicht durch die verschiedenen Leidenschaften, welche Dorigny in den vielen Gesichtern ausnehmend schön auszudrücken gewußt hat; sollte er nicht durch die freye und reiche Composition; durch die meisterliche Ausführung der Zeichnung; durch die schöne übereinstimmige Haltung, die in diesem vortreflichen Gemähide herrschen, in freudiger Bewunderung gesetzet werden können? Wie viel Genie, wie viel Kunst und lebhafte Einbildungskraft müssen verreint zusammen seyn, wenn ein Mahler dergleichen Vorstellungen schön ausarbeiten will! Dorigny, einer der besten Meister in der französischen Schule, hat sich durch dieses Gemähide in dieser großen Vollkommenheit gezeiget: Und wer wird nun daran zweifeln, daß es würdig sey die schönste Gallerie zu zieren? [Text hier gekürzt] I Mat.: auf Leinwand Maße: 3 Fuß hoch, 3 Fuß 3 Zoll breit Verkäufer: Johann Gottlieb Stein Transakt.: Unbekannt
1794/09/00 LGAN 0018 Dorn I Der Pendant dazu, ein alter Mannskopf, von Dorn in Würzburg, eben so breit und hoch, beide zusammen. I Pendant zu Nr. 17 von Chr. Seybold Maße: breit 1 Schuh 1 Zoll, hoch 1 Schuh 3 Vi Zoll Anm.: Dieses Los wurde zusammen mit der Nr. 17 (Chr. Seybold) verkauft. Verkäufer: [Friedrich Karl Ludwig, Freiherr von Moser] Transakt.: Unbekannt (500 rh fl für die Nrn. 17 und 18, Schätzung) 1796/00/00 HLAN [0019] Dom I Der Pendant von gleicher Gröse, ein alter Mannskopf. I Pendant zu Nr. [18] von Chr. Seybold Maße: 1 Sch. 3 Vi Ζ. 1 Sch. 1 Z. Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: [Friedrich Karl Lang] Transakt.: Unbekannt (277.18 Rt; 500 fl für die Nrn. [18] und [19], Schätzung)
Dorn, Joseph 1793/00/00 NGWID 0498 loseph Dorn I Ein Fischhändler, so verschiedene Arten von Fischen in einem vor sich habenden Zuber unter einem Bogen=Fenster aus einander gelegt, nebst noch einem wohl angebrachten Bas relief, von loseph Dorn. I Pendant zu Nr. 499 Maße: 1 Schuh 2 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 1 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0499 loseph Dorn I Zum Gegenstück, wie eine Zuckerbeckerin aus einem vor ihr liegenden aufgeschlagenen Buche zu einem frischen Backwerk nachdenkend sich Raths erholt, und die gefundenen Zuthaten im Begriff ist, abzuwägen, mit vielen Beywesen, und sehr schönen Bas relief, treflich ausgeführt, von nemlichem Meister [loseph Dorn] und Maaß. I Pendant zu Nr. 498 Maße: 1 Schuh 2 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 1 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
Dorner, Johann Jakob (I) 1789/00/00 MMAN 0243 Jacob Dorner I Zwei Stücke spielende und raufende Bauemknaben und Mädchen vorstellend, auf Holz. [Deux morceaux de petits et petites paysannes jouants et fumant, sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 2 Fuß 1 Zoll hoch, 1 Fuß 7 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0336 Domer Jac. I Ein Konversationsstück, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 2 Schuh, Breite 1 Schuh 7 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
Dort, Adam van [Nicht identifiziert] 1750/00/00 KOAN 0078 Adam van Dort! L'amour, figure par une Femme, entouree de plusieurs Enfants, sur bois, bien conserve, & bien peint. I Mat.: auf Holz Maße: Largeur 2 Pies 7 Pouces, Haut GEMÄLDE
551
3 Pies 6 Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt
Dosl, G.V. [Nicht identifiziert] 1790/01/07 MUAN 0777 Dosl G. V. I Ein niederländisches Nachtstück, auf Holz, in einer geschnittenen, und vergoldeten Ram. I Pendant zu Nr. 778 Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 7 Zoll, Breite 1 Schuh 3 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0778 Dosl G. V. I Das Gegenstück zu dem vorigen Gemälde, auf Holz, in einer geschnittenen, und vergoldeten Ram. I Pendant zu Nr. 777 Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 7 Zoll, Breite 1 Schuh 3 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
Dotz [Nicht identifiziert] 1788/09/01 KOAN 0824 Dotz I Laban, von Dotz. [un envoye de Laban, de Dolz [sic].] I Maße: Höhe 1 Fuß 9 Zoll, Breite 2 Fuß 9 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt
Dou, Gerard 1742/08/01 BOAN 0106 Gerard Daw I Ein Stuck mit einem Todten-Kopff. Original vom Gerard Daw. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0169 Gerard Daw I Ein Stuck ein Fravvenzimmer mit einem Hund prassentirend von Gerard D a w . I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0036 Gerard Daw I Une TSte de Mort par Gerard D a w . [Een Doodshoofd door Gerard Douw.] I Maße: Haut 1. p. 6. pou. large 1. p. 2. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt (80) 1742/08/30 BOAN 0335 Gerard Daw I Une Femme avec un Chien, par Gerard Daw. I Maße: Haut 9. pouces, large 8. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1759/00/00 LZEBT 0034 Gerh. Dauw I Ein altes Manns Portrait auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh, Breite 2 Schuh 7 Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (100 Th Schätzung) 1763/01/17 HNAN 0021 G. Douw I Un Eremite en Priere par G. Douw, sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hauteur 1 pied 6 pouces, Largeur 1 pied 4 pouces Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt 1763/01/19 FRJUN 0009 Gerard Dou I Un tres beau morceau de cabinet representant une fille dans une niche tenant un faisan dans la main & plusieurs autres omemens, peint avec beaueoup d'art & de delicatesse. I Maße: hauteur 15 % pouces, large 12 % pouces Transakt.: Unbekannt (34 % fl) 1763/01/19 FRJUN 0010 Gerard Dou I Une vanite par le meme [Gerard Dou]. I Maße: hauteur 10 Vi pouces, large 13 pouces Transakt.: Unbekannt (16 Vi fl) 1763/11/09 FRJUN 0058 G. Dou I Un Hermite en oraison devant un crucifix dans un pai'sage trfes bien peint. I Maße: hauteur 11 pouces, largeur 13 pouces Transakt.: Verkauft (20.45 fl) Käufer: Dick
goureusement peint. I Maße: hauteur 31 pouces, largeur 24 pouces Transakt.: Verkauft (16.15 fl) Käufer: ν Beroldingen 1764/05/14 BOAN 0602 Gerard Douw I Un Tableau d'onze pouces de hauteur, neuf pouces de largeur, repr6sentant un Philosophe taillant sa plume avec des lunettes, peint par Gerard Douw. [Ein stück Vorstellend einen Philosophum mit brill auf der nasen und die feder schneidend, in etwas beschädiget gemahlt Von gerarden Douw.] I Maße: 11 pouces de hauteur, 9 pouces de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (151 Rt) Käufer: jud Baruch 1764/05/18 BLAN 0014 Gerard Dov I Zwey sitzende Frauenzimmer, ein alter Mann und ein Kind. Ganze Figuren, fast Lebensgröße, auf Leinewand gemahlt, 4 Fuß 8 Zoll hoch, 5 Fuß 10 Zoll breit. Es ist mehr wegen der seltsamen als wegen der Schönheit, daß dieses Bild zu bewundern ist; denn Gerard Dov. wie allen Kennern bekannt ist, hat fast niemahls keine andere Gemähide verfertiget als ganz kleine Cabinet=Stücke. Aus der Ursache ist dieses Bild etwas besonders. In dem Kopf des Kindes das die eine Frau vor sich hat, und in des alten Mannes Kopf kann man des Meisters seine Art zu mahlen nicht verkennen, er gefallt aber doch allezeit mehr in seinen kleinen Stücken. [Text hier gekürzt]. I Mat.: auf Leinwand Maße: 4 Fuß 8 Zoll hoch, und 5 Fuß 10 Zoll breit Verkäufer: Johann Georg Eimbke Transakt.: Verkauft (51 Rt) Käufer: Engel 1764/06/15 BOAN 0669 Gerard Douw I Un Tableau de deux pieds deux pouces de hauteur, d'un pied neuf pouces de largeur, reprisentant un jeune Homme Türe ä demi figure de grandeur naturelle, peint par Gerard Douw. [Ein stuck Vorstellend Einen türckischen jüngling halbe figur in Lebensgröße gemahlt Von Gerard Douw.] I Maße: 2 pieds 2 pouces de hauteur, 1 pied 9 pouces de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (65.40 Rt) Käufer: Hof C Rath Broggia 1764/08/25 FRAN 0269 Girard Dou I Une vielle avec une coupe. I Maße: haut 6 Vi pouces sur 5 pouces de large Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1764/08/25 FRAN 0283 Girard Dou I Des verres & des cruches. I Diese Nr.: Des verres & des cruches Maße: haut 1 pied 1 pouce sur 10 pouces de large Anm.: Die Lose 283 und 284 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1764/08/25 FRAN 0284 Girard Dou I Des verres & des cruches. I Diese Nr.: Des verres & des cruches Maße: haut 1 pied 1 pouce sur 10 pouces de large Anm.: Die Lose 283 und 284 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRRAU 0118 Douw\ Ein Philosoph sitzet an einem Tisch, und schneidet eine Feder, vor ihm lieget ein Buch in folio. Das Bild ist sehr fleißig und in dem besten Gusto nach Gerhard Douw gemahlt. C'est encore un Philosophe assis ä table & taillant une plume, il a devant lui un livre en folio. Ce tableau est fait avec beaueoup d'attention dans le meilleur goüt & peint par Gerhard Douw. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Zoll, breit 9 Zoll Anm.: Im Exemplar AAP wurde der Name "Douwen" handschriftlich in "Douw" korrigiert. Transakt.: Unbekannt 1765/03/27 FRKAL 0047 G. Dou I Un Philosophe avec beaueoup d'assortiment. I Maße: hauteur 11 pouces, largeur 14 pouces Transakt.: Verkauft (14 fl) Käufer: Varrentrapp
1764/03/12 FRKAL 0033 G. Dou I Un Hermite en oraison devant un crucifix represente dans un pai'sage bien peint. I Maße: hauteur 12 pouces, largeur 14 pouces Transakt.: Verkauft (25.30 fl) Käufer: ν Weisenbach
1768/07/00 MUAN 0357 Douw (Gerhardus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
1764/03/12 FRKAL 0034 G. Dou I Un beau Portrait de Vieillard avec une longue barbe grise, apui'ant les mains sur un baton, vi-
1769/00/00 MUAN 0164 Gerard Douw I Un vieillard fumant du tabac, & tenant en main une cruche pour boire, demie figure. I
552
GEMÄLDE
Mat.: auf Holz Maße: 11 Vi. pouces de haut sur 8 Vi. pouces de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/03/30 HBTOU 0034 Gerhard Dou I Ein extra schöner Kopf von Gerhard Dou auf Holz. [Die Mehresten in fein verguldte Rahmen, und die übrigen in schwarz gebeizten mit goldenen Staber.] I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 7 Zoll, Breite 5 Zoll Anm.: Die Angaben in eckigen Klammem im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 51 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 51. Transakt.: Verkauft (31 M) Käufer: D r G r u n d t 1770/10/29 FRAN 0219 Gerard Dou I Eine Kuchenbäckerin. I Maße: Hoch 14 Zoll. Breit 11 Zoll. Transakt.: Unbekannt 1772/00/00 BSFRE 0031 Douvv (Gerard) I Le Portrait d'une Grosse rejouie, vue ä my corps, presque de face, vetüe en jeaune, avec une Drapperie noire fourree ; c'est un des plus excellents, & des mieux termines morceaux de ce maitre. II sort du fameux Cabinet de Monsieur van Heemskerck ä la Haye & peut servir de pendant au No. 67. Cadre noir de Bois d'Ebene, orne de Sculptures d'orees. I Pendant zu Nr. 67 von H. Holbein (II) Mat.: auf Holz Maße: haut de 6 large de 5 pouces Transakt.: Unbekannt 1776/04/15 HBBMN 0026 G. Dou I Ein alter Mann, so in ein Buch lieset, ungemein natürlich und fleißig ausgeführt. I Maße: Höhe 1 Fuß 1 Zoll, Breite 11 Zoll Transakt.: Verkauft (30.8 M) Käufer: D Hasp [erg] 1776/11/09 HBKOS 0044 Gerhard Dou I Eine alte Frau, gleichfalls bey Licht, so ein Spindel mit Garn abwindet, vortreflich auf Holz gemahlt, mit dito [schwarzen] Rahm und verguldeten Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 11 Zoll, Breite 8 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (39 M) Käufer: Lt Lüss 1777/05/26 FRAN 0617 Gerhardt Daid I Nacht=Stück, eine alte Frau. I Anm.: Das Exemplar SBF enthält im Künstlerindex den handschriftlichen Hinweis: "villeicht Douw". Verkäufer: Finsterwalder Transakt.: Verkauft (40.45 fl) Käufer: Mevius 1778/05/30 HBKOS O l l i G. Dou I Ein nach dem Leben gemalter Todtenkopf, extra fleißig, von G. Dou, auf Holz. [Diese Gemählde sind alle mittlere Grösse, können also an alle Plätze gebraucht werden - die weilen keine Theilen=Stück, dabey befindlich] I Mat.: auf Holz Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 150 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 150. Verkäufer: Dr Friederici Transakt.: Verkauft (8 Μ [?]) Käufer: Ehrenreich 1778/09/28 FRAN 0308 Gerhard Douw I Ein alter Mann mit schwarzsammetem Pelzrock, [un vieillard en pelisse couverte de velours noir.] I Maße: 7 Zoll breit, 8 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (41 fl) Käufer: Fuchs Schnurgaß ν Amsterdam 1778/09/28 FRAN 0493 Gerhard Douw I Der Compagnon, eine alte Frau, in einem Buche lesend. [Le pendant du precedent, une vieille femme lisante dans un livre.] I Pendant zu Nr. 492 von Jus. Juncker Maße: 9 Zoll breit, 12 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (77 fl für die Nrn. 492 und 493) Käufer: Abe Bava
Schuh breit, 1 Schuh 2 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (53 fl für die Nrn. 557 und 558) Käufer: Dr Hartzberg 1778/09/28 FRAN 0650 Gerh. Douw I Eine Frau mit stillliegenden Küchensachen. [Une femme avec des objets de cuisine couches sur une table.] I Maße: 11 Zoll breit, 14 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (150 fl) Käufer: Jos Brentano 1778/09/28 FRAN 0727 Gerhard Douw I Eine Spitzenklöpplerinn, ausnehmend schön. [Une faiseuse de dentelles, superieurement bien peinte.] I Maße: 11 Zoll breit, 15 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (117 fl) Käufer: Schütz 1778/10/30 HBKOS 0030 G. Dou I Ein bey Nachzeit sich entkleidendes Frauenzimmer mit ihrer Aufwärterinn, so vor dem Bette stehen. Das Licht, so vor ihnen aufm Tisch stehet, machet eine ganz natürliche Beleuchtung. Zur linken siehet der Mahler zu, als wenn er alle Aufmerksamkeit darauf gerichtet hätte, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 15 Zoll, breit 17 Zoll Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0348 Gerhard Douwl Ein alter Mannskopf. [Tete de vieillard.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 7 Zoll hoch, 5 Vi Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/09/27 FRNGL 0340 Gerhard Douw I Ein sehr schön und fleißig ausgearbeitetes Nachtstück. [Une nuit, piece excellente]. I Maße: 10 Vi Zoll hoch, 8 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (70 fl) Käufer: Mentzinger 1779/09/27 FRNGL 0482 Gerhard Douw I Ein andächtiger Eremit. [Un hermite en prieres.] I Maße: 11 Zoll hoch, 8 Zoll breit Transakt.: Verkauft (16.30 fl) Käufer: Hüsgen 1781/00/00 WRAN 0065 Gerard Dau I Un Satyre portant une brassee de joncs. Peint sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: haut 10 pouces 6 lignes, large 9 pouces Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0066 Gerard Dau I Une Femme qui lave du linge dans un cuvier, la main appuiee dessus, ä cöte du cuvier sur le meme banc se voit 3 fruits & un couteau. Tableau peint sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: haut 10 pouces & demi, sur 9 pouces 6 lignes de large Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0067 Gerard Dau 1 Un Viellard ä tete chauve, cheveux & barbe blanche, vue presque en face, regarde sur la droite, assis sous un arbre, tenant un livre in 4to ouvert sur ses genoux des deux mains, on lit sur les tranches du dit livre: Girard Dau. Peint sur bois: haut 9 pouces 5 lignes, large 7 pouces 2 lignes. Ce Tableau a ete grave par Η. Van Meurs. I Mat.: auf Holz Maße: haut 9 pouces 5 lignes, large 7 pouces 2 lignes Inschr.: Girard Dau (bezeichnet) Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/05/07 FRHUS 0042 Gerh. Dauw I Ein Tisch mit Büchem und Musikalien sehr natürlich und delicat gemahlt von Gerh. Dauw. I Maße: 1 Schuh 2 Zoll hoch und 1 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (6 fl) Käufer: Hüsgen
1778/09/28 FRAN 0557 Gerhard Douw I Ein alter Mann, der in einem Buche ließt. [Un Vieillard lisant dans un livre.] I Maße: 1 Schuh breit, 1 Schuh 2 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (53 fl für die Nm. 557 und 558) Käufer: Dr Hartzberg
1781/09/10 BNAN 0158 G. Dou I Durch die bekannte gewölbte Oefnung, schauet zwischen den zurückgezogenen grünen Vorhängen G. Douw heraus; die Rechte ruhet vorwärts auf dem unterem Gemäuer; in der Linken Palette und Pinsel; er in einer Art zugeschlagenen Schlafrockes; auf dem Kopf ein rundes violettes Barret, mit einem Zug von Edelgesteinen; hinter ihm auf einer mit grünem Teppich behangenen Tafel eine Weltkugel; daneben die Staffeley; vorne ist an dem unteren Gemäuer ein Zettel, worauf G. Dou. Leide 1652. aetatis 1639. sehr fleißig und der Natur gemäß. g.R. [im verguldeten Rahm] I Mat. : auf Holz Maße: 9 Zoll hoch, 7 Zoll breit Inschr.: G. Dou. Leide 1652. aetatis 1639. (signiert und datiert) Transakt.: Unbekannt
1778/09/28 FRAN 0558 Gerhard Douw I Ein alter Mann mit einem Mantel, von dito [Gerhard Douw], nemliches Maaß. [Un vieillard couvert d'un manteau, par le meme [Gerard Douw].] I Maße: 1
1783/06/19 HBRMS 0085 Gerhardt Dow I Aus einer mit Epheu bewachsenen Niche guckt eine alte Frau, die mit beyden Händen einen steinern Krug hält, vorne an der Niche ist ein Basrelief, seitwerts
1778/09/28 FRAN 0544 Gerhard Douw I Ein sehr schön gemalter alter Weibskopf. [Une tete de vieille femme tres bien peinte.] I Maße: 1 Schuh 2 Zoll breit, 1 Vi Schuh hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (70 fl) Käufer: Dr Hartzberg
GEMÄLDE
553
ein Topf mit Blumen, oben Sperlingsnester in Töpfe, durch die Niche sieht man ein Gebäude mit Colonade. H[olz]. g.R. [verguldeter Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: 9 Zoll hoch, 12 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1783/06/19 HBRMS 0095 G. Dow I Ein vortreflicher Mannskopf mit einer Mütze, im Rembrantischen Geschmack. L[einwand]. g.R. [verguldeter Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß hoch, 1 Fuß 8 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1783/06/19 HBRMS 0155 G. Douwl Eine mit dem Hut bedeckte Mannsperson in schwarzer Kleidung hält seinen Tuch in der rechten Hand. H[olz]. g.R. [verguldeter Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: 8 Zoll hoch, 6 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
und vortreflich gemaltes Bild von G. Douw. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: 19 Zoll hoch und 14 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (23.30 fl) Käufer: Levi ν M[annheim] 1788/06/12 HBRMS 0025 G. Douwl Eine mit vielen Geschirren und Küchengeräthschaften angefüllte Küche, worin eine junge Köchin an der Pumpe, um sich die Hände zu waschen, stehet, die schalkhaft umsieht, als wenn sie jemand kommen hörte: mit dem größten Fleiße gemalt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 22 Zoll, breit 17 % Zoll Transakt.: Unbekannt 1789/00/00 MM AN 0255 Gevard Dov I Eine Vanitas, auf Holz. [Une vanite, sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 8 Zoll hoch, 1 Fuß 3 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt
1785/05/17 MZAN 0016 Gerard Douw I Ein junger Mannskopf von Gerard Douw. [Portrait d'un jeune homme.] I Maße: 1 Schuh 2 Vi Zoll hoch, 11 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (200 fl) Käufer: Tischbein
1790/02/04 HBDKR 0061 G. Douw I Ein lachendes Mädgen, hält ein Stück Lachs mit beyden Händen, um ihr herum ist eine Nische mit Gardine, extra fleißig gemahlt auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Zoll, breit 6 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (5.6 M)
1785/05/17 MZAN 0502 Gerard Douw I Ein Mädchen mit einem Korb voll Obst von Gerard Douw. [Une fille tenant une corbeille pleine de fruits.] I Maße: 5 Zoll hoch, 4 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (40 fl) Käufer: Hofr ν Leykam
1790/05/20 HBSCN 0129 G. Dow I Ein alter Mann in den Armen eines jungen Mädchens am Tisch sitzend, nebenher befinden sich eine Menge Sachen, als: Bücher, Globus, musicalische Instrumente, Gläser, Geschirre, Todtenkopf, und ein verlöschendes Licht, als das Zeichen der Vergänglichkeit. Halbe Figuren, ganz vortreflich und mit ausnehmenden Fleiß ausgeführt. Auf Holz S.R.G.L. [Schwarzen Rahm, goldne Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 13 Zoll Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (21.8 M) Käufer: Stöker
1787/00/00 HB AN 0057 Gerhardt Dow I Ein Greis, mit der Brille auf der Nase, lieset mit andächtiger Miene in einem Buche. Seine niedergeschlagene Augen und sein halbgeöffneter Mund zeigen seine wahre Andacht, und die runzelichten Hände sein Alter. Vor ihm steht ein Tisch. Im Hintergrunde wird man noch mehrere Nebenwerke gewahr, welches alles auf das fleißigste ausgeführt, und auf das allernatürlichste gemahlt und gezeichnet ist. Auf Holz, g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Zoll, breit 10 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (200 M) Käufer: Fesser 1787/00/00 HB AN 0076 Gerhard Dow I Ein freundliches altes Mütterchen, mit einer schwarzen Kappe mit Gold gestickt, schwarz gekleidet, und mit einer goldenen Kette um den Hals. Das Alter ist in diesem Bilde besonders schön und natürlich ausgedrückt. Auf Holz, g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 19 Zoll, breit 14 Zoll Transakt.: Verkauft (120.8 M) Käufer: Tietjen 1787/00/00 HB AN 0119 Gerhard Dow I Em alter Mann mit langem Barte lieset in einem Buche, welches er mit seiner linken Hand hält; in seiner rechten hält er eine Feder. Besonders schön und fleißig gemahlt. A.H. [Auf Holz] g.R. [in goldenem Rahm] Zum Compagnon des vorigen. I Pendant zu Nr. 118 von J.H. Roos Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Zoll, breit 9 % Zoll Transakt.: Verkauft (25 M) Käufer: Fesser 1787/00/00 HB AN 0368 Gerhard Dow I Aus einer steinernen Niche sieht ein junges lachendes Mädchen hervor, und hält eine brennende Lampe, welche diesem kleinen besonders ausgeführten Gemähide ein sehr schönes Licht und Schatten verursacht. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 9 Zoll, breit 6 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (15.8 M) Käufer: Fesser 1787/00/00 HB AN 0724 Gerh. Dow I Ein alter Mann mit grauen Haaren und kleinem Zwickelbart, mit einer bunten Mütze und dergleichen Kleide; hält in seiner Linken einen Befehlshaberstab. Halbe Figur. Besonders schön und fleißig gemahlt. A.H. [Auf Holz] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 V* Zoll, breit 10 Zoll Transakt.: Verkauft (30.4 M) Käufer: Tietjen 1788/04/08 FRFAY 0132 G. Douw I Ein Mädchen und ein Knabe, so sich an einem Fenster mit einem Vogelkäfig beschäftigen, ein vortreflich ausgeführtes Stück von G. Douw. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: 10 Vi Z. hoch, und 8 Z. breit Transakt.: Verkauft (36.30 fl) Käufer: Levi ν M[annheim] 1788/04/08 FRFAY 0202 G. Douw\ Ein Wundarzt, der einer alten Frau am Kopfe eine Wunde zu sondiren scheint. Ein sehr delicat 554
GEMÄLDE
1790/09/10 HBBMN 0001 G. Daw I Vor einem Tische sitzet ein Philosoph und lieset in einem Buche, welches er mit beyden Händen hält. Zur Linken stehen zwey Globi; sehr fleißig gemahlt, und besonders schön beleuchtet. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 25 Zoll, breit 18 Zoll Transakt.: Verkauft (6 M) Käufer: Ego 1791/05/28 HBSDT 0128 G. Dow I Ein alter Mann mit einer weissen Mütze und einen mit Rauchwerk gefütterten Mantel. Dieser Kopf ist in einer dreisten Manier mit Oelfarben auf Papier entworfen. Nachher aber auf Leinewand gezogen. I Mat.: Öl auf Papier auf Leinwand Maße: Hoch 20 Zoll, breit 15 Ά Zoll Transakt.: Unbekannt 1791/05/30 FRAN 0101 Gerh. Dauw I Ein junges Weibchen, welche in einer Laterne ein Licht anzünden will. I Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch und 11 Zoll breit Verkäufer: Bansa Transakt.: Verkauft (1.30) Käufer: Streng 1791/09/26 FRAN 0433 G. Dou I Der meditirende Astronom, ein überaus fleißiges Nachtstück mit vielem Beywesen, bezeichnet G. Dou. I Maße: 10 Zoll breit, 12 Zoll hoch Inschr.: G. Dou (bezeichnet) Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0213 Transakt.: Unbekannt
G. Dau I Ein schlafendes Mädchen. I
1797/02/27 HBPAK 0025 Gerhard Dow\ Ein inwendiges Zimmer, wo der Mahler vor seiner Stafelei, worauf ein Gemähide stehet, sitzet, und eine Pfeife Toback rauchet. Zur Rechten ein Tisch mit einer Blumen=Decke, worauf ein Globus, ein Gliedermann, eine Baßgeige ec. befindlich. Ganz natürlich vorgestellet. Auf Holz. Im goldn. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 14 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0242 Gerard Douw I Ein Frauenzimmer in altbrabantscher Tracht, ist in ihrem Zimmer mit Verfertigung von Spitzen beschäftigt. Im Hintergrunde des Zimmers hängt eine Landschaft, auf der man auch die kleinsten Gegenstände deutlich angezeigt findet. Die diesem grossen Künstler ganz eigne Ausarbeitung und Feinheit des Pinsels, ist in diesem herrlichen Bilde nicht verkennbar, und man kann nicht davon gehen ohne sich überzeugt zu haben, daß obiger Künstler einzig in seiner Art gewesen sey. Dieß herrliche Gemähide hat ohne seinem andern Werthe auch noch den
grossen Vorzug, daß es in dem allerbesten Zustande ist. Auf Holz, mit goldn. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Vi Zoll, breit 13 V2 Zoll Transakt.: Unbekannt
mit Urin. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Zoll, breit 9 Zoll Transakt.: Unbekannt
1800/00/00 BLBOE 0023 G. Douw I Ein Mädchen und ein Knabe sehen zum Fenster hinaus, der Vater steht hinter ihnen, und raucht sein Pfeifchen. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt
Dou, Gerard (Kopie nach)
1800/00/00 FRAN1 0036 Douw I Eine Flamändische Köchin, in ihrer Küche beschäftiget, um sie herum liegen grüne Waare, an der Wand henkt ein fleißig gearbeitetes Huhn. I Mat.: auf Holz Maße: 14 Zoll hoch, 10 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN2 0021 Dow (Gerhard)! Ein Inneres von einem Hollzimmer. Im vordem Grunde nahe an einem Fenster rupft ein junges Mädchen eine Ente; welcher von einem Mann ein Glas Wein angeboten wird. In diesem Stück herrschet viel Natur, und ein schönes Kolorit. I Mat.: auf Holz Maße: 26 Zoll hoch, 21 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Dou, Gerard (und Douven, Bart.) 1750/00/00 KOAN 0132 Gerard Dou; Le Jeune Douven I Une piece admirable, representant une vielle femme, vendant toutes sortes de fruits, de l'Invention de Gerard Dou, & finie par le Jeune Douven. I Maße: Largeur 1 Pies 2 Vi Pouces, Haut 11 Vi Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1767/00/00 KOAN 0109 Gerhard Don; der junge Douven\ Ein unvergleichliches Stuck vorstellend ein, allerley Garten=Früchte verkauffendes altes Weib, eine Invention von Gerhard Don, ausgeführet vom jungen Douven. I Maße: Breite 1 Fuß 9 V* Zoll, Höhe 1 Fuß 6 Zoll Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt
Dou, Gerard (und Rembrandt) 1765/00/00 FRRAU 0147 Rembrandt; Gerhard Douw I Vorstellend das Portrait eines Orientalischen Printzens. Den Kopf hat Gerh. Douw, und das übrige der Rembrandt gemahlet; An diesem Bild haben beyde Verehrungs=würdige Meister ohntrüglich ihre gröste Force angewandt; Jeder hat sich beeifert, dieses Bild in der höchsten Vollkommenheit darzustellen. Es ist ihnen auch gerathen, zur Bewunderung des Kenners. Representant le portrait d'un Prince d'orient. Gerhard Douw en a peint la tete & Rembrandt le reste. Ces deux venerables maitres ont tous deux emploi'es leur plus grands talens ä ce tableau. Chacun s'est eforce de representer ce portrait dans sa plus grande perfection. Et chaque connoisseur avouera avec etonnement, qu'ils ont parfaitement bien reussi. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 2 Schuh 4 Zoll, breit 1 Schuh 9 Zoll Transakt.: Unbekannt
Dou, Gerard (oder Dou, Manier) 1763/11/09 FRJUN 0059 G. Dou, ou dans son manier I Une fille dans une niche nettoyant un chaudron de cuivre delicatement peint. I Maße: hauteur 12 pouces, largeur 9 pouces Transakt.: Verkauft (17.15 fl) Käufer: Geyß
Dou, Gerard (Geschmack von) 1784/09/27 FRAN 0077 Gerhard Douw I Ein junges Frauenzimmer in einem Pelz und Stauchen, im Geschmack von Gerhard Douw. [Une jeune Dame en pelisse avec un manchon, dans le goüt de Gerard Dow.] I Maße: 1 Schuh 2 Zoll hoch, 11 Zoll breit Verkäufer: Freyherr von Berberich Transakt.: Verkauft (5 fl) Käufer: Kessel 1786/10/18 HB TEX 0184 Im gusto von Dou I Ein Medicus sitzet in seiner Studier=Stube im Lehn=Sessel, und besiehet ein Glas
1743/00/00 BWGRA 0075 Gerhard Douw I Ein alter Eremit, welcher in einen Buche lieset, nach Gerhard Douw. I Maße: hoch 1 Fuß 3 Zoll, breit 1 Fuß Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1752/05/08 LZAN 0117 Gerhard Dau I Ein Holl. Stück, einen Mann und Frau vorstellend, nach Gerhard Dau, 1 % Elle hoch 1 Elle breit, im Holl. Rahmen. I Maße: 1 V* Elle hoch, 1 Elle breit Transakt.: Verkauft (3 Th) Käufer: Wohlrabe 1775/05/08 HBPLK 0146 G. Dou I Eine Frau, welche spinnet, und ein Mädchen mit einem Papagey, nach G. Dou. I Diese Nr.: Eine Frau, welche spinnet Maße: Höhe 11 Zoll 5 Linie, Breite 9 Zoll 3 Linie Anm.: Die Lose 146 und 147 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1775/05/08 HBPLK 0147 G. Dou I Eine Frau, welche spinnet, und ein Mädchen mit einem Papagey, nach G. Dou. I Diese Nr.: Ein Mädchen mit einem Papagey Maße: Höhe 11 Zoll 5 Linie, Breite 9 Zoll 3 Linie Anm.: Die Lose 146 und 147 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1776/04/15 HBBMN 0031 Gerhard Dau I St. Hieronymus, nach Gerhard Dau. I Maße: Höhe 2 Fuß 2 Zoll, Breite 1 Fuß 8 Zoll Transakt.: Verkauft (6.4) Käufer: [unleserlich] 1778/07/21 HBHTZ 0010 Dou I Eine alte Frau, so sich über der Feuerkieke wärmet, nach Dou, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: 12 Zoll hoch, 9 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1787/01/15 LZRST 0024 G. Dow I Ein Kopf einer alten Frau mit einer Brille, von einem guten Meister, nach G. Dow, 24 Zoll hoch, 17 Z. br. in schw. Rahm. I Maße: 24 Zoll hoch, 17 Zoll breit Verkäufer: Richter Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0459 Gerard Douw I 2 Kuchenstuck, nach Gerard Douw. [2 p[ieces]. de Cuisines, selon Gerhard Douw.] I Diese Nr.: Ein Kuchenstuck Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 4 Zoll, Breite 1 Fuß 2 Zoll Anm.: Die Lose 459 und 460 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0460 Gerard Douw I 2 Kuchenstuck, nach Gerard Douw. [2 p[ieces], de Cuisines, selon Gerhard Douw.] I Diese Nr.: Ein Kuchenstuck Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 4 Zoll, Breite 1 Fuß 2 Zoll Anm.: Die Lose 459 und 460 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1791/05/15 LZHCT 0068 Chr. Guil. Em. Dietrich; nach Gerard Dow I Vieille paysanne hollandoise proprement habillee, ä une fenetre tenant un hareng, qu'elle vient de tirer d'un baril place sur la fenetre. Hors de la fenetre on voit suspendues diverses herbes potageres et racines; ä cöte de l'embrasure de la fenetre on voit pendre la balance et un petit panier rempli d'oeufs; en haut pend un jambon et un botte de tetes de pavöt. Au fond on appenjoit deux filles occupees du menage. Cette excellente copie est d'un extreme fini et imite parfaitement la delicatesse de Γ original. Elle est d'autant plus precieuse, qu'il est certain, que l'original n'existe plus. Peinte sur bois. I Kopie von Chr. Dietrich nach Dou Mat.: auf Holz Maße: haut de 20 pouces, large de 16 pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1791/10/21 HBRMS1 0014 D. G. Waerdigh; nach G. Douw I G. Douw sitzt am Fenster, im bräunlichen Rock und sammtner Mütze, hält Palette und Pinsel in der Hand, hinten steht ein Gemähide, und aufm Tische Globus und Bücher, vome in der Nische des Fensters befindet sich ein Gefäß mit Hiacinten und eine Wasser=BouteilIe; das Gegenstück, eine alte Frau mit kleinem Strohhute steht hinter eiGEMÄLDE
555
ner Nische und wickelt Zwirn von der Winde, vor ihr ein Topf mit Nelken und ein klein Trinkgefäß, hinten befinden sich verschiedene Nebenwerke. Besonders schön gemahlt, und auf das fleißigste ausgeführt, wie G. Douw; auf Holz. I Diese Nr.: G. Douw sitzt am Fenster, im bräunlichen Rock und sammtner Mütze, hält Palette und Pinsel in der Hand, Kopie von D.G. Waerdigh nach Dou; Pendant zu Nr. 15 Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Vi Zoll, breit 9 Zoll Anm.: Die Lose 14 und 15 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1791/10/21 HBRMS1 0015 D. G. Waerdigh; nach G. Douw I G. Douw sitzt am Fenster, im bräunlichen Rock und sammtner Mütze, hält Palette und Pinsel in der Hand, hinten steht ein Gemähide, und aufm Tische Globus und Bücher, vorne in der Nische des Fensters befindet sich ein Gefäß mit Hiacinten und eine Wasser=Bouteille; das Gegenstück, eine alte Frau mit kleinem Strohhute steht hinter einer Nische und wickelt Zwirn von der Winde, vor ihr ein Topf mit Nelken und ein klein Trinkgefäß, hinten befinden sich verschiedene Nebenwerke. Besonders schön gemahlt, und auf das fleißigste ausgeführt, wie G. Douw; auf Holz. I Diese Nr.: Eine alte Frau mit kleinem Strohhute steht hinter einer Nische und wickelt Zwim von der Winde, Kopie von D.G. Waerdigh nach Dou; Pendant zu Nr. 14 Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 »/• Zoll, breit 9 Zoll Anm.: Die Lose 14 und 15 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0090 Gerard Au I Zwey Stück, wovon eins ein lesende Frau, das andere ein Feder schneidender Mann vorstellet, auf Baneel zum Leben abgebildet nach Rembrand und Gerard Au. I Diese Nr.: Ein Stück, ein Feder schneidender Mann vorstellet; Nr. 89 Kopie nach Rembrandt Mat.: auf Holz Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 11 Zoll breit Anm.: Die Lose 89 und 90 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0186 Gerhard Au I Ein Feder schneidender Mann mit einem Brill auf der Nasen nach Gerhard Au. I Maße: 10 Vi Zoll hoch, 9 Vi Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0200 Gerhard Au I Ein Gemüß=Krämerin empfangt von einer Bauren Frau das Geld vor die gekaufte Waar, das Gemüß ist so wohl ganz der Natur ähnlich, als die Personen zum Leben und Sprechen abgebildet auf Holz nach Gerhard Au. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Schuh hoch, 1 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/09/28 HBBMN 0081 G. Daw I Ein Mädgen hält eine Mausfalle, worüber sich ein Knabe vergnüget, nach G. Daw. Auf Hz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Vi Zoll, breit 10 !4 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/08/00 HBPAK 0067 Rob. Griffier; Gerh. Douw I Ein Eremit in einer Höhle mit vielen Nebenwerken vorgestellt. Halbe Figur. Ausnehmend fleißig gemahlt. Auf Holz. Nach Gerh. Douw. I Kopie von R. Griffier nach Dou Mat.: auf Holz Maße: Höhe 17 Zoll, Breite 15 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0111 Nach Gerard Douw I Ein Kind in einer Nische mit seiner Puppe spielend. So schön als von ihm selbst. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 8 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0011 De Vlieger; nach Gerhard Douw I Ein alter Heiliger sitzt vor seiner Höhle an einem Tische, in einem Buche lesend. Auf Holz, schwarzer Rahm mit goldnen Leisten. I Kopie von S. Vlieger nach Dou Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt
1782/07/00 FRAN 0035 Douw I Ein Arzt, ein Uringlas in der Hand haltend, wobey eine Frau und ein gewirkter Teppich angebracht sind, in der Manier von Douw. I Pendant zu Nr. 36 Maße: 1 Schuh 11 Zoll hoch, 1 Schuh 7 Zoll breit Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt (4 fl für die Nrn. 35 und 36) 1782/07/00 FRAN 0036 Douw I Das Gegenbild, ein Mann der mit der einen Hand ein Buch hält, eine Sackuhr vor sich hat und mit einer Frau spricht, wobey ein Kind in ein Fläschchen bläßt, vom nemlichen Meister [Manier von Douw] und Maaß. I Pendant zu Nr. 35 Maße: 1 Schuh 11 Zoll hoch, 1 Schuh 7 Zoll breit Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt (4 fl für die Nrn. 35 und 36) 1784/05/11 HBKOS 0059 G. Dow\ Ein hübsches Gärtnermädchen will eine Nelke pflücken, plaisant gemahlt, in der Manier von G. Dow. a[uf], H[olz], I Mat.: auf Holz Maße: hoch 13 Zoll, breit 11 Zoll Transakt.: Verkauft (2.3 M) Käufer: Ε 1791/09/26 FRAN 0278 G. Daw I Ein sitzender Philosoph liest beym Schein eines Lichts im Buch, ungemein würkend und so fleißig ausgeführt wie G. Daw. I Maße: 12 Zoll hoch, 8 Zoll breit Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0443 G. Dou I Das Bildniß eines Amsterdamer Rathsherrn und seiner Frau, mit großem Fleiß so schön gemalt als G. Dou. I Diese Nr.: Das Bildniß eines Amsterdamer Rathsherm Maße: 6 Zoll breit, 8 Zoll hoch Anm.: Die Lose 443 und 444 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0444 G. Dou I Das Bildniß eines Amsterdamer Rathsherrn und seiner Frau, mit großem Fleiß so schön gemalt als G. Dou. I Diese Nr.: Das Bildniß seiner Frau Maße: 6 Zoll breit, 8 Zoll hoch Anm.: Die Lose 443 und 444 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0196 G. Douw I Ein Philosoph, welcher schreibt, in seiner Eremitage; so fleißig wie G. Douw gemahlt. Auf Holz, Unbekannt. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Zoll, breit 9 Zoll 6 Lin. Transakt.: Unbekannt
Doubels [Nicht identifiziert] 1764/03/12 FRKAL 0035 Doubels I Un Portrait d'homme. I Maße: hauteur 31 Vi pouces, largeur 25 pouces Transakt.: Verkauft (15.15 fl für die Nrn. 35 und 36) Käufer: ν Beroldingen 1764/03/12 FRKAL 0036 Doubels I Un autre [Portrait] de femme, de la meme grandeur. I Maße: hauteur 31 Vi pouces, largeur 25 pouces Transakt.: Verkauft (15.15 fl für die Nrn. 35 und 36) Käufer: ν Beroldingen
Doudijns (Doedyns), Willem 1764/00/00 BLAN 0351 Dowdins I Die Keusche Susanna, gantze Figur auf Leinwand gemah. I Mat.: auf Leinwand Maße: 5 Fuß 7 Zoll hoch, 7 Fuß 10 Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (400 Rt Schätzung)
Douet 1742/08/01. BOAN 0005 Douet I Zwey Brabandische Bawren. Original, von Douet. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt
1800/11/12 HBPAK 0381 G. Dow\ Ein Stück mit dito [Figuren], nach G. Dow. I Transakt.: Unbekannt
1742/08/30 BOAN 0322 Douvet I Deux paisans Braban^ns, par Douvet. I Maße: Haut 9. pouces, large 1. p'ied Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt
Dou, Gerard (Manier)
Douet, Johann [Nicht identifiziert]
1774/10/05 HBNEU 0108 G. Dou I Ein Philosoph bey Licht, in der Manir von G. Dou. I Transakt.: Unbekannt
1788/09/01 KOAN 0052 Johann Douet I Simeon im Tempel. [1 p[iece]. Simeon au Temple.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2
556
GEMÄLDE
Fuß 2 Zoll, Breite 2 Fuß 8 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt
Douffet, Gerard 1776/00/00 WZTRU 0426 Gerhardus Duffeit \ Compagnion zu Nro. 425 stellet vor einen Knabenkopf von Gerhardus Duffeit, welcher sehr gut gemalet. I Pendant zu Nr. 425 von Matthys Bergh Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (5 fl Schätzung) 1781/00/00 WZAN 0426 Gerhard Duffeit I Kompagnon zu Nro 425 stellet einen Knabenkopf vor, welcher von Gerhard Duffeit sehr gut gemalet ist. I Pendant zu Nr. 425 von Mattys Bergh Transakt.: Unbekannt 1794/02/21 HBHEG 0144 Duffait I Ein Morgenländer, halbe Figur. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 11 Zoll, breit 9 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt
Dousset [Nicht identifiziert] 1788/09/01 KOAN 0022 Dousset I Ein Spanier, Baur und Baurenmädchen. [une tete L p. un paysan d'espagne & 6 filles de paysans.] I Diese Nr.: Ein Spanier Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 9 Zoll, Breite 1 Fuß 5 Zoll Anm.: Die Lose 22 und 23 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0023 Dousset I Ein Spanier, Baur und Baurenmädchen. [une tete L p. un paysan d'espagne & 6 filles de paysans.] I Diese Nr.: Baur und Baurenmädchen Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 9 Zoll, Breite 1 Fuß 5 Zoll Anm.: Die Lose 22 und 23 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt
Douven 1759/00/00 LZEBT 0186 Douvens I Ein Manns Portrait auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 1 Zoll, Breite 2 Schuh 7 Vi Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (60 Th für die Nrn. 186 und 187, Schätzung) 1759/00/00 LZEBT 0187 Douvens I Ein Frauen Portrait auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 1 Zoll, Breite 2 Schuh 7 Vi Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (60 Th für die Nrn. 186 und 187, Schätzung) 1768/07/00 MUAN 0326 Douven I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0327 Douven I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1771/05/06 FRAN 0041 Douven I Eine liegende Venus, auf Tuch. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 9 Zoll, breit 11 Zoll Verkäufer: Johann Friederich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt 1775/05/15 FRAN 0009 Douven I Eine liegende Venus, auf Tuch. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 9 Zoll, breit 11 Zoll Verkäufer: Johann Friedrich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt 1779/09/27 FRNGL 0378 van Douven I Der Frühling, in einem schönen jungen Frauenzimmer mit entblößter Schulter und Blumen in den Händen, fein und fleißig ausgearbeitet. [Le printems, piece
allegorique representee dans une belle & jeune Dame, qui a les epaules decouvertes & tient des fleurs dans les mains, tres bien peinte par van Douven.] I Pendant zu Nr. 379 Maße: 1 Schuh 7 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Transakt.: Verkauft (33 fl für die Nrn. 378 und 379) Käufer: Honet 1779/09/27 FRNGL 0379 van Douven I Das Gegenbild hierzu, ein dergleichen junges Frauenzimmer mit einem Pocal in der Hand, den Herbst vorstellend, eben so schön, von nemlichem Meister [van Douven] und Maas. [Le pendant du precedant, une jeune Dame tenante une coupe dans la main, symbole de l'automne, meme beaute, par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 378 Maße: 1 Schuh 7 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Transakt.: Verkauft (33 fl für die Nrn. 378 und 379) Käufer: Honet 1782/09/30 FRAN 0040 van Douwen I Angelica und Medoro fleisig und fein ausgearbeitet. [Angelique & Medore, piece tres exactement finie, par van Douwen.] I Maße: 8 Vi Zoll hoch, 6 Vi Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (12 fl) Käufer: ν Schmit 1785/05/17 MZAN 0784 Douwen I Die Mutter Gottes mit dem Jesukind und der kleine Johannes von Douwen auf Kupfer. [La S. Vierge avec l'enfant Jesus & le petit S. Jean.] I Mat.: auf Kupfer Maße: 8 Vi Zoll hoch, 7 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (8.30 fl) Käufer: Geh R ν Heüser 1788/09/01 KOAN 0029 Douven I Ein Portrait. [1 p[iece], d'un portrait.] I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 2 Fuß, Breite 1 Fuß 6 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0805 Dowen I Mater Dolorosa. [Mater dolorose.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 3 Zoll, Breite 1 Fuß Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 2142 Douwen, van I Zween Viehmärkte, auf Leinwat. I Diese Nr.: Ein Viehmarkt Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 2 Zoll, Breite 1 Schuh 7 Zoll Anm.: Die Lose 2142 und 2143 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 2143 Douwen, van I Zween Viehmärkte, auf Leinwat. I Diese Nr.: Ein Viehmarkt Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 2 Zoll, Breite 1 Schuh 7 Zoll Anm.: Die Lose 2142 und 2143 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0458 van Douven I Eine wohllüstige liegende Venus. I Maße: 18 Zoll breit, 6 Zoll hoch Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 HBMFD 0113 von Douven I Die reuige Maria Magdalena kniet vor einer Anhöhe, worauf ein Todtenkopf &c. sich befindet. I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuss 7 Zoll hoch, 1 Fuss 3 Zoll breit Verkäufer: Pierre Laporterie Transakt.: Unbekannt 1798/05/14 KOAN 0052 Doowen I Une buste. I Maße: Hauteur 2 pieds 8 pouces; Largeur 2 pieds 3 pouces Verkäufer: de Bors d'Overen Transakt.: Unbekannt
Douven (Kopie von) 1764/05/22 BOAN 0087 Douwen; Van Dijck I La Vierge douloureuse d'un pied huit pouces de largeur, d'un pied deux pouces de hauteur, peinte par Douwen. [Ein Vesper-Bild mit Engelen im Licht und Schatten gemahlt Von Douven nach van Dyck.] I Kopie von Douven nach Anth. van Dyck Maße: 1 pied 8 pouces de largeur, 1 pied 2 pouces de hauteur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (17 Rt) Käufer: Bell 1765/00/00 FRRAU 0169 Douven: Nach Myris I Ein Herr und eine Dame an einem Tisch sitzend und Juwelen besehen. Es ist dieses Bild nach dem besten Gusto des Meisters verfertiget, und hat viele Kennzeichen eines Originals. Repräsentant un Seigneur & une GEMÄLDE
557
Dame assis & regardans des bijoux. Ce tableau est fait dans le meilleur goüt du maitre & resemble beaucoup ä Γ original. I Kopie von Douven nach Mieris Mat.: auf Holz Maße: Hoch 1 Schuh 6 Zoll, breit 1 Schuh 3 Zoll Transakt.: Unbekannt
Douven, Bartholomeus 1759/00/00 LZEBT 0136 Frantz Bartet Duven I Eine bey einem Tische sitzende und bey Lichte schlafende Frauens Person auf Holtz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 7 Zoll, Breite 7 Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (60 Th für die Nrn. 136 und 137, Schätzung) 1759/00/00 LZEBT 0137 Frantz Bartet Duven I Ein an einem Tische worauf Naderey [?] liegt und ein Hund befindlich. Sitzender Frauens Person auf Holtz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 7 Zoll, Breite 9 Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (60 Th für die Nrn. 136 und 137, Schätzung) 1792/08/20 KOAN 0148 Bartholomaus Douven I Zwey Brustbilder, eines Bartholomaus Douven Kabinetsmahleren von Kurkölln: das andere Herrn Demaree vorstellend, beyde Stücke von beyden Meisteren selbst gemahlt. I Diese Nr.: Bartholomasus Douven Kabinetsmahleren von Kurkölln vorstellend; Nr. 149 von G. Marees Maße: 2 Schuh 10 Zoll hoch, 2 Schuh 3 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 148 und 149 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt
Douven, Bartholomeus (und Dou) 1750/00/00 KOAN 0132 Gerard Dou; Le Jeune Douven I Une piece admirable, representant une vielle femme, vendant toutes sortes de fruits, de l'Invention de Gerard Dou, & finie par le Jeune Douven. I Maße: Largeur 1 Pies 2 Vi Pouces, Haut 11 Vi Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1767/00/00 KOAN 0109 Gerhard Don; der junge Douven I Ein unvergleichliches Stuck vorstellend ein, allerley Garten=Früchte verkauffendes altes Weib, eine Invention von Gerhard Don, ausgeführet vom jungen Douven. I Maße: Breite 1 Fuß 9 !4 Zoll, Höhe 1 Fuß 6 Zoll Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt
Douven, Bartholomeus (und Poelenburgh, C.) 1750/00/00 KOAN 0015 Corneille Poelenburg; le jeune Douven I Deux Paisages bien dessines, plusieurs Bergeres se baignant, du meme [Corneille Poelenburg], & NB. tres bien retouches par le jeune Douven. I Diese Nr.: Une Paisage bien dessine, plusieurs Bergeres se baignant Maße: Largeur 9 Vi Pouces, Haut 8 Pouces Anm.: Die Lose 15 und 16 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt
Stücke ist treflich gut gemalet, und mit sonderbarem Fleise ausgeführet. I Pendant zu Nr. 408 Maße: 5 Zoll hoch, 3 Vi Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (5 fl Schätzung) 1776/00/00 WZTRU 0408 Johannes Franciscus Douven I Compagnion zu Nro. 407 von obigen Meister [Johannes Franciscus Douven] und nämlicher Stärke einen Mannskopf. I Pendant zu Nr. 407 Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (5 fl Schätzung) 1781/00/00 WZAN 0407 Johann Franz Douven I Ein Stück 5 Zoll hoch, 3 Vi Zoll breit, vom Johann Franz Douven, stellet vor eine französische Prinzessin in antiker Tracht vor. Dieses Stück ist treflich gut gemalet, und mit sonderbarem Fleiße ausgeführet. I Pendant zu Nr. 408 Maße: 5 Zoll hoch, 3 Vi Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0408 Johann Franz Douven I Kompagnon zu Nro 407 zeiget vom obigen Meister [Johann Franz Douven] und nämlicher Stärke einen Mannskopf dar. I Pendant zu Nr. 407 Transakt.: Unbekannt 1789/08/18 HB GOV 0026 J. van Douven I St. Magdalena, in einer Eremitage sitzend; so schön als van der Werff gemahlt, w. c. auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 15 Zoll, breit 12 Zoll Transakt.: Unbekannt
Douw, Simon Johannes van 1788/09/01 KOAN 0051 S.V. Douw I 1 Viehmark, von S.V. Douw. [1 p[iece]. un marche de betails du Sr. Douw.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 3 Fuß 5 Zoll, Breite 5 Fuß 6 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1792/10/12 KOAN 0031 S. Douw\ Ein Gefecht zwischen türkischen und andern Reuter, von S. Douw. auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Fuss 10 Zoll - breit 4 Fuss 2 Zoll Verkäufer: Moureaux Transakt.: Unbekannt 1793/09/18 HBSCN 0016 Douwe I Vor einer ländlichen Schmiede wird ein gesatteltes Pferd beschlagen; das Gegenstück Jäger vor einer Dorfschenke, die sich zu trinken geben lassen, um ihnen Jagdhunde. I Diese Nr.: Vor einer ländlichen Schmiede wird ein gesatteltes Pferd beschlagen; Pendant zu Nr. 17 Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Vi Zoll, breit 18 Zoll Anm.: Die Lose 16 und 17 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1793/09/18 HBSCN 0017 Douwe I Vor einer ländlichen Schmiede wird ein gesatteltes Pferd beschlagen; das Gegenstück Jäger vor einer Dorfschenke, die sich zu trinken geben lassen, um ihnen Jagdhunde. I Diese Nr.: Jäger vor einer Dorfschenke, die sich zu trinken geben lassen, um ihnen Jagdhunde; Pendant zu Nr. 16 Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Vi Zoll, breit 18 Zoll Anm.: Die Lose 16 und 17 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1750/00/00 KOAN 0016 Corneille Poelenburg; le jeune Douven I Deux Paisages bien dessines, plusieurs Bergeres se baignant, du meme [Corneille Poelenburg], & NB. tres bien retouches par le jeune Douven. I Diese Nr.: Une Paisage bien dessine, plusieurs Bergeres se baignant Maße: Largeur 9 Vi Pouces, Haut 8 Pouces Anm.: Die Lose 15 und 16 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt
Doy [Nicht identifiziert]
Douven, Jan Frans
Drentwett, Abraham
1768/08/16 KOAN 0086 alter Douven I Ein Portrait eines Teutschmeisters von alten Douven. I Maße: Höhe 1 Fuß 3 Zoll, Breite 1 Fuß Verkäufer: Freyherr von Kaas Transakt.: Unbekannt 1776/00/00 WZTRU 0407 Johannes Francicus Douven I Ein Stück 5 Zoll hoch, 3 Vi Zoll breit von Johannes Francicus Douven, stellet vor eine französische Prinzessin in Antiquertracht: Dieses 558
GEMÄLDE
1763/01/17 HNAN [A]0041 Doy I Un Eremite en devotion, par Doy 1511, sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 2 pieds, Largeur 3 pieds Inschr.: 1511 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt
1790/01/07 MUAN 1547 Drentwet Abrah. I Zwo Landschaften mit Thieren; eine auf Holz, die andere auf Kupfer, in schwarzen Ramen mit vergoldeten Leisten. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Thieren Mat.: auf Holz Maße: Höhe 5 Zoll, Breite 8 Zoll Anm.: Die Lose 1547 und 1548 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
1790/01/07 MUAN 1548 Drentvvet Abrah. I Zwo Landschaften mit Thieren; eine auf Holz, die andere auf Kupfer, in schwarzen Ramen mit vergoldeten Leisten. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Thieren Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 5 Zoll, Breite 8 Zoll Anm.: Die Lose 1547 und 1548 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
Drever, Adrian van 1799/00/00 WZAN 0252 Adrian van Drever I Ein Winterlandschäftchen mit vielen Figürchen, von welchen einige Schlittschuhe laufen, andere Schlitten fahren, von Adrian van Drever. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 7 Zoll breit 8 Vi Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0581 Adrian von Drever I Ein Mondschein= und ein Schneestück, von Adrian von Drever. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Mondscheinstück Mat.: auf Holz Maße: hoch 11 Zoll breit 1 Schuh 1 Zoll Anm.: Die Lose 581 und 582 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0582 Adrian von Drever I Ein Mondschein= und ein Schneestück, von Adrian von Drever. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Schneestück Mat.: auf Holz Maße: hoch 11 Zoll breit 1 Schuh 1 Zoll Anm.: Die Lose 581 und 582 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Dreyghe [Nicht identifiziert] (Geschmack von) 1782/05/29 FRFAY 0087 Dreyghe I Eine Landschaft in Geschmack, von Dreyghe. I Maße: 17 Zoll hoch, 20 Zoll breit Verkäufer: Kaspar Thorhorst Transakt.: Unbekannt (6 fl)
Drielenburch, Willem van 1759/00/00 LZEBT 0196 Trielenburg I Eine Landschaft auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 1 Zoll, Breite 2 Schuh 6 Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (60 Th Schätzung) 1793/09/18 HBSCN 0009 Drillenburg I In einer bergigten Landschaft wo ein Bach vorbey fließt, siehet man bey Anbruch des Tages= und Morgenröthe, Jäger mit Hunden, die einen Bauern befragen, der ihnen den Weg zeiget, mehrere Figuren zeigen sich auf einer Anhöhe. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Vi Zoll, breit 13 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt
Drölling, Martin 1796/02/17 HBPAK 0133 Droling I Eine Dame bey der Toilette sitzend, erhält einen Brief, worüber sie sehr erschrocken zu seyn scheint. Hinter ihr steht ein Kammermädgen. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 19 Vi Zoll, Breite 15 % Zoll Transakt.: Verkauft (34 M) Käufer: Bertheau 1796/11/02 HBPAK 0113 Drolling I Vor einem Gebäude ist die Rückkehr der Tugend vorgestellt. Ein sehr rührendes und schönes Gemähide. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Zoll, breit 7 Zoll Transakt.: Unbekannt
Droochsloot, Joost Cornelisz.
18 Vi pouces, largeur 23 Vi pouces Transakt.: Verkauft (39.30 fl) Käufer: Geyß 1765/03/27 FRKAL 0048 Droogschloot I La vue d'un village le long d'une riviere avec un grand nombre de figures se divertissant au jeu d'oie. I Maße: hauteur 18 pouces, largeur 24 pouces Transakt.: Verkauft (17 fl) Käufer: Dr Basquay 1770/10/29 FRAN 0151 Drogschlot I Zwey Landschaften mit Figuren von Drogschlot. I Maße: Hoch 13 Zoll. Breit 17 Zoll. Transakt.: Unbekannt 1778/09/28 FRAN 0029 Droogschloden I Eine Holländische Seegegend von Droogschloden. [Une marine Hollandoise par Droogschloden.] I Maße: 3 Schuh 9 Zoll breit, 2 Schuh 3 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (30 fl) Käufer: ν Franckenstein 1778/09/28 FRAN 0498 Droogslooden I Eine Bauernmahlzeit. [Un repas de paysans.] I Maße: 2 Schuh 9 Zoll breit, 2 Schuh hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (17.30 fl) Käufer: Prß ν Dessau 1779/09/27 FRNGL 0014 Droogslooten I Eine Bauern Kirmes mit vielen vielen Figuren und schönem Beywesen. [Une foire de village avec beaucoup de figures & de beaux objets accessoires.] I Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 1 Schuh 8 Zoll breit Transakt.: Verkauft (15 fl) Käufer: Hofr Gerken 1781/09/10 BNAN 0121 Kroogsloot I Viele, so sich auf dem Eise mit Schrittschue laufen, und andere, so sich am Ufer zur Rechten, bey den näheren Häusern, unter den entlaubten Bäumen, mit Wandeln vergnügen. I Mat.: auf Holz Maße: 11 Zoll hoch, 17 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1782/07/00 FRAN 0050 Droogsloden I Ein sehr schönes perspectivisches Niederländisches Dorf mit sehr vielen angebrachten Figuren. I Maße: 1 Schuh 7 Zoll hoch, 2 Schuh breit Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt (10.15 fl) 1782/07/00 FRAN 0121 Droogsloden I Ein Weibchen, so vor einem Hause veschiedenes Küchengeschirr reibt, ovalen Formats. I Format: oval Maße: 10 Zoll hoch, 12 Zoll breit Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt (7 fl) 1785/05/17 MZAN 0635 Droogsloot I Zwey Stücke welche zusammen die Werke der Barmherzigkeit vorstellen von Droogsloot. [Deux pieces qui representent les oeuvres de la charite.] I Diese Nr.: Eines von zwey Stücken welche zusammen die Werke der Barmherzigkeit vorstellen Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 2 Schuh breit Anm.: Die Lose 635 und 636 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (17 fl für die Nrn. 635 und 636) Käufer: Geh R ν Heüser 1785/05/17 MZAN 0636 Droogsloot I Zwey Stücke welche zusammen die Werke der Barmherzigkeit vorstellen von Droogsloot. [Deux pieces qui representent les oeuvres de la charite.] I Diese Nr.: Eines von zwey Stücken welche zusammen die Werke der Barmherzigkeit vorstellen Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 2 Schuh breit Anm.: Die Lose 635 und 636 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (17 fl für die Nrn. 635 und 636) Käufer: Geh R ν Heüser
1763/01/17 HNAN [A]0003 Droogslot I Une Kermesse Hollondoise, par Droogslot, sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 1 pied 10 pouces, Largeur 2 pieds 5 pouces Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt
1785/05/17 MZAN 0637 Droogsloot I Ein Dorfjahrmarkt Jahrmarkt von eben demselben [Droogsloot], [Une foire de village par le meme [Droogsloot].] I Maße: 1 Schuh 8 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (23 fl) Käufer: Zitz
1763/11/09 FRJUN 0060 Droogschloot I Une tres bonne piece representant un vieux chateau dans un pai'sage, entoure d'un grand nombre de pauvres ä qui l'on donne des aumones. I Maße: hauteur
1788/09/01 KOAN 0125 van Droogslooß I Bettler. [1 p[iece]. des mendians.] I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Fuß 6 Zoll, Breite 2 Fuß Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
559
1788/09/01 KOAN 0834 Droogsloot I Landschaft mit Figuren, [un paysage avec des figures.] I Maße: Höhe 2 Fuß, Breite 3 Fuß Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1789/00/00 MMAN 0040 J. C. Drooch Sloot I Ein Pferdestückchen, auf Holz. [Chevaux, sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 10 Zoll hoch, 1 Fuß 3 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (2.20 fl) 1789/00/00 MMAN 0104 J.C. Drooch=Sloot I Ein Bauernkrieg, auf Holz. [Une dispute de paysans, sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 2 Zoll hoch, 1 Fuß 7 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (2.24 fl) 1791/09/26 FRAN 0188 Drogslot I Ein Theil der äussern Stadt Amsterdam im Winter, mit schönen Figuren belebt von Drogslot. I Maße: 42 Zoll breit, 30 Zoll hoch Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1792/10/12 KOAN 0027 Droogsloot I Ein Baurendorf, mit vielen Figuren, von Droogsloot, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 2 Fuss - breit 2 Fuss 6 Zoll Verkäufer: Moureaux Transakt.: Unbekannt 1792/10/12 KOAN 0130 Droogsloot I Ein holländisches Bauerndorf, in Perspectiv mit einer Menge Figuren staffirt, sehr lebhaft und natürlich gemalt: von Droogsloot, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 2 Fuis [sie] 10 Zoll - breit 3 Fuss 8 Zoll Verkäufer: Moureaux Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0198 Trochschloten I Ein sogenanntes holländisches Fischerstechen, nebst einer sehr angenehmen Landschaft, mit einer Menge von wohl gruppirenden Figuren, von Trochschloten. I Maße: 2 Schuh 4 Zoll hoch, 2 Schuh 11 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0202 Drogschlot I Ein Bauerhaus, wo vor demselben Bauern sich mit einer über der Thüre liegenden Frau unterreden; neben denselben stehet ein Mädchen mit einer Milchtracht. Ganz in der Manier von de Winter. Auf Holz, goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 22 Zoll, breit 26 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0242 Drooch Sloot I Die Geschichte, wie der Engel des Herrn den ersten der Blinden und Lahmen oder Kranken, der in den Teich steigt, die Heilung verheißt. Dieses so rar als schöne Gemähide verdient die Achtung jedes Kenners. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 30 Vi Zoll, breit 41 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0054 Droogsloot I Zwey Holländer Dorfslustbarkeiten, von Droogsloot. Auf Holz. Sehr schön. I Diese Nr.: Eine Holländer Dorfslustbarkeit Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 4 Zoll breit 2 Schuh 1 Vi Zoll Anm.: Die Lose 54 und 55 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0055 Droogsloot I Zwey Holländer Dorfslustbarkeiten, von Droogsloot. Auf Holz. Sehr schön. I Diese Nr.: Eine Holländer Dorfslustbarkeit Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 4 Zoll breit 2 Schuh 1 Vi Zoll Anm.: Die Lose 54 und 55 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/08/09 HBPAK 0013 Droogsloot I Eine perspectivische Landschaft, welche ein Bauern Jahrmarkt vorstellt, allwo man verschiedene Leute sieht, welche sich mit Tanzen, Fechten und Trinken belustigen. Ein sehr elegantes Gemähide. Auf Holz, goldn. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 31 Zoll, breit 45 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/08/09 HBPAK 0044 Droogsloet I Zwey schöne Land= und Wassergegenden mit Figuren. Auf Holz, goldn. Rahm. I Diese Nr.: Eine schöne Land= und Wassergegend mit Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 18 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 44 und 45 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 560
GEMÄLDE
1799/08/09 HBPAK 0045 Droogsloet I Zwey schöne Land= und Wassergegenden mit Figuren. Auf Holz, goldn. Rahm. I Diese Nr.: Eine schöne Land= und Wassergegend mit Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 18 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 44 und 45 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/08/09 HBPAK 0046 Droogsloet I Eine Landschaft, wo man im Vordergrunde einen Wagen siehet, welcher von vier Räubern zu Pferde angehalten wird. Auf Holz, goldn. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 24 Zoll, breit 35 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0011 Drogschlod I Eine Landschaft, ein Kirchdorf vorstellend, wo im Vordergrunde Bauern beym Tische sitzen, und sich mit spielen und singen unterhalten. Zur Rechten eine Kirchmeße mit vielen Figuren. In der Manier wie Tennier. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 41 Zoll, breit 60 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0162 Droogschlot I Ein Stück mit vielen Figuren, die Genesung der Lahmen und Krüppel vorstellend. Auf das schönste ordinirt und kräftig gemahlt. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 31 Zoll, breit 46 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0188 Drogschlot I Eine Land= und Dorf= Gegend. Im Mittelgrunde sitzen Bauern und Bäurinnen vor einem Hause, welche sich sättigen. Zur Rechten, im Vordergrunde, vor einem Hause stehen Bauern, welche eine Unterredung unter sich halten. Ganz in der Manier von Tennier. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 20 Zoll, breit 29 Zoll Transakt.: Unbekannt
Dubbels, Hendrik Jacobsz. 1782/03/18 HBTEX 0240 Dubbels I Ein See=Prospect mit vielen Orlog- und andern kleinen Schiffen, beym Aufgang der Sonne, welche einen herrlichen Effect machet, sehr schön und gut gemahlt, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 22 Zoll 1 Linie, Breite 27 Zoll 6 Linien Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 FGAN [BJ0107 Dübels I Eine Landschafts=Aussicht am Rhein, stafiert mit vielen Figuren, auf Tuch gemalt. I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 2 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt (20 fl) 1797/04/20 HBPAK 0147 Doubbels, nach der Manier von W. van de Velde I Eine See=Gegend; verschiedene Schiffe und kleine Fahrzeuge. Von schönem Prospect, und herrlicher Composition, welches eine treffliche Wirkung macht. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 14 Zoll, breit 17 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0067 Dubbels I Eingang eines Seehavens, mit verschiedenen Schiffen; ganz außerordentlich gemahlt. Auf Leinwand, schwarzen Rahm, goldene Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 25 Vi Zoll, breit 25 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0085 Dubbels I Ein Winterstück, mit einigen Figuren. Auf Holz, goldenen Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 10 Vi Zoll, breit 13 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0106 Dubbels I Ein Seestück, mit verschiedenen Schiffen, und andern Figuren. Auf Leinw. schwarzen Rahm, goldene Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 25 Zoll, breit 32 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/12/08 HBPAK 0090 Von Dobbels I Ein Seestück mit Schiffen, wovon einige scheitern. Auf Leinwand, im schw. Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 38 Zoll, Breite 76 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0321 Dubbels I Ein Seestück mit Schiffen. Von herrlicher Wirkung. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 19 Vi Zoll, breit 13 Zoll Transakt.: Unbekannt
1798/06/04 HBPAK 0344 Dubbels I Eine stürmische See mit Schiffen. In diesem Stücke zeigt sich die viele Kenntniß des Meisters. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Zoll, breit 26 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/11/14 HBPAK 0030 Dubbels I Eine stille See mit vielen Schiffen, wo die Sonne aufgehet. Auf das schönste gemahlt, so gut wie von von der Neer. Auf Leinwand, im schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 22 Zoll, breit 29 Zoll Transakt.: Unbekannt
Dubois 1775/00/00 BLAN 0094 Dubois I Eine Landschaft auf Holz. I Mat.: auf Holz Verkäufer: George Friedrich Schmidt Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN1 0037 Dubois I Ein Frauenkopf in Betrachtung. I Mat.: auf Leinwand Maße: 17 Zoll hoch, 13 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN1 0038 Dubois I Ein Bruststück von einem sitzenden Mädchen. I Mat.: auf Leinwand Maße: 17 Zoll hoch, 14 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN2 0022 Dubois I Ein Bruststück von einem sitzenden Mädchen. I Mat.: auf Leinwand Maße: 17 Zoll hoch, 14 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
1784/08/13 HBDEN A0008[H] Dubuason I 2 St ditto [gemählde von Dubuason], I Diese Nr.: Ein Gemählde Anm.: Dieses Los wurde handschriftlich dem Exemplar KH ohne Angabe eines Titels hinzugefügt. Die Lose A7[H] und A8[H] wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Pasche [oder] Flügge Transakt.: Unbekannt 1784/08/13 HBDEN A0009[H] Dubuason I 2 St ditto [gemählde von Dubuason]. I Diese Nr.: Ein Gemählde Anm.: Dieses Los wurde handschriftlich dem Exemplar KH ohne Angabe eines Titels hinzugefügt. Die Lose A9[H] und A10[H] wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Pasche [oder] Flügge Transakt.: Unbekannt 1784/08/13 HBDEN A0010[H] Dubuason I 2 St ditto [gemählde von Dubuason]. I Diese Nr.: Ein Gemählde Anm.: Dieses Los wurde handschriftlich dem Exemplar KH ohne Angabe eines Titels hinzugefügt. Die Lose A9[H] und A10[H] wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Pasche [oder] Flügge Transakt.: Unbekannt 1784/08/13 HBDEN A0011[H] Dubuason I 1 St ditto [gemählde von Dubuason]. I Anm.: Dieses Los wurde handschriftlich dem Exemplar KH ohne Angabe eines Titels hinzugefügt. Verkäufer: Pasche [oder] Flügge Transakt.: Unbekannt 1795/11/14 HBPAK 0008 Du Buisson I Ein schön lebhaft gemahlt ital. Blumenstück. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 2 Fuß 7 Zoll, breit 2 Fuß 1 Zoll Transakt.: Unbekannt
Duchatel, Francois Dubois, Charles 1742/08/01 BOAN 0317 Du Boys de Valencienne I Zvvey Landschafften. Orig. von du Boys de Valencienne. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0357 Dubois de Valenciennes I Deux Paisages, par Dubois de Valenciennes. I Maße: Haut 1. p. 7. pou., larges 1. p. 11. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt
Dubuisson
1793/00/00 NGWID 0236 Du Castell I Eine mit vielem Feuer und Geist wohl ausgeführte Bataille, mit einer Menge von Figuren, von Du Castell. I Maße: 3 Schuh 1 Zoll hoch, 4 Schuh 2 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
Ducq, Johan le 1742/08/01 BOAN 0254 Duck I Ein Stuck einen Land-Carthenmacher praesentirend. Original von Duck. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt
1775/00/00 BLAN 0036 Dubuisson I Ein Blumenstück ohne Rahm. I Verkäufer: George Friedrich Schmidt Transakt.: Unbekannt
1749/07/31 HBRAD 0061 Ledük I Ein Soldat. I Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (121)
1784/08/13 HBDEN A0003[H] Dubuason I 2 St gemählde von Dubuason. I Diese Nr.: Ein Gemählde Anm.: Dieses Los wurde handschriftlich dem Exemplar KH ohne Angabe eines Titels hinzugefügt. Die Lose A3[H] und A4[H] wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Pasche [oder] Flügge Transakt.: Unbekannt
1750/00/00 KOAN 0161 Le Due I Une piece, avec quelques Espagnols, bien conservee, sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: Largeur 1 Pies 6 Pouces, Haut 1 Pies 1 Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt
1784/08/13 HBDEN A0004[H] Dubuason I 2 St gemählde von Dubuason. I Diese Nr.: Ein Gemählde Anm.: Dieses Los wurde handschriftlich dem Exemplar KH ohne Angabe eines Titels hinzugefügt. Die Lose A3[H] und A4[H] wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Pasche [oder] Flügge Transakt.: Unbekannt 1784/08/13 HBDEN A0005[H] Dubuason I 2 St ditto [gemählde von Dubuason], I Diese Nr.: Ein Gemählde Anm.: Dieses Los wurde handschriftlich dem Exemplar KH ohne Angabe eines Titels hinzugefügt. Die Lose A5[H] und A6[H] wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Pasche [oder] Flügge Transakt.: Unbekannt 1784/08/13 HBDEN A0006[H] Dubuason I 2 St ditto [gemählde von Dubuason]. I Diese Nr.: Ein Gemählde Anm.: Dieses Los wurde handschriftlich dem Exemplar KH ohne Angabe eines Titels hinzugefügt. Die Lose A5[H] und A6[H] wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Pasche [oder] Flügge Transakt.: Unbekannt 1784/08/13 HBDEN A0007[H] Dubuason ! 2 St ditto [gemählde von Dubuason], I Diese Nr.: Ein Gemählde Anm.: Dieses Los wurde handschriftlich dem Exemplar KH ohne Angabe eines Titels hinzugefügt. Die Lose A7[H] und A8[H] wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Pasche [oder] Flügge Transakt.: Unbekannt
1750/00/00 KOAN 0244 Le Due I Une piece sur bois, representant quelques Espangols partagant [sic] Leur pillage, tres bei ouvrage du Le Due. I Mat.: auf Holz Maße: Largeur 1 Pies 8 Pouces, Haut 1 Pies 1 Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1763/01/19 FRJUN 0016 Le Due I Un excellent Tableau representant une vieille devineresse ou Egptienne [sic], dans une Compagnie d'hommes & de femmes dans une belle chambre avec beaucoup d'ornemens delicatement & gracieusement peint il peut etre considere comme un des meilleurs morceau de ce maitre, comme il Test effectivement. I Maße: hauteur 20 pouces, large 30 Vi pouces Transakt.: Unbekannt (250 fl) 1763/11/09 FRJUN 0061 Le Due I Laban prenant conge de Jacob & de ses femmes, rempli de figures & tres bien peint. I Maße: hauteur 31 pouces, largeur 26 Υϊ pouces Transakt.: Verkauft (35.30 fl) Käufer: Winterstein 1763/11/09 FRJUN 0062 Le Due I Un Monsieur & une Dame dans l'interieur d'une chambre avec ornement aussi bien acheve. I Maße: hauteur 18 Vi pouces, largeur 13 pouces Transakt.: Verkauft (22.30 fl) Käufer: Staedel GEMÄLDE
561
1765/03/27 FRKAL 0049 Le Due I Un Corps de Garde avec plusieurs figures tres-bien acheve. I Maße: hauteur 17 pouces, largeur 27 pouces Transakt.: Verkauft (15.15 fl) Käufer: Lampert 1765/03/27 FRKAL 0050 Le Due I Un Officier ä qui le valet met les ipirons, execute en maitre. I Maße: hauteur 16 pouces, largeur 13 pouces Transakt.: Verkauft (10.15 fl) Käufer: Lampert 1766/07/28 KOSTE 0030 Le Due I Ein Pferdgen auf holz von le Due. I Mat.: auf Holz Transakt.: Verkauft (4 Rt) Käufer: Esch [?] 1770/10/29 FRAN 0016 le Duck I Der noch unbekehrte Augustinus & Moneca. I Maße: Hoch 24 Zoll. Breit 20 Zoll. Transakt.: Unbekannt 1774/03/28 HBBMN 0043 le Due I Ein inwendiger W e i n k e l ler, wo man probiret, im goldenen Rahm. I Maße: Höhe 1 Fuß 2 Vi Zoll, Breite 10 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt (40 M) 1776/04/15 HBBMN 0133 le Due I Ein Corps de Garde. I Maße: Höhe 1 Fuß 4 Vi Zoll, Breite 1 Fuß 2 Vi Zoll Transakt.: Unverkauft 1778/07/21 HBHTZ 0063 le Due I Ein Conversations Stück, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 19 Zoll, breit 23 Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/08/29 HBTEX 0098 Lesdue I Eine Corps de Garde, extra schön gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Fuß 4 Zoll, Breite 1 Fuß 7 Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/09/28 FRAN 0503 Le Due I Ein Soldat in spanischer Tracht bey einer alten Damel. [Un soldat en habillement Espagnol avec une vieille Dame.] I Maße: 1 Schuh 7 Zoll breit, 2 Schuh hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (50 fl) Käufer: Dr Hartzberg 1778/10/30 HBKOS 0103 le Due I Ein Herr in alter teutscher Tracht, auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: hoch 9 Zoll, breit 6 Zoll Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0083 Le Dueq I Alte de Procession dans l'interieur d'un Cabaret. Süperbe Tableau d'une riche composition & d'un colons agröable: il est capital & singuliferement precieux. Peint sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: 34 pouces de haut, sur 43 pouces de large Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0084 Le Dueq I Attelier du Sculpteur, oü se voit au milieu un jeune Homme assis, tenant un portrait de la main gauche, la droite pendante, sur une longue Table sont des livres in 12, un chandelier, une pipe, plusieurs vases &C. Peint sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: haut 18 pouces, large 23 pouces Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/09/10 BNAN 0156 le Due I Neben einem schlechten Tische, sitzt im gelben Coller, mit zugewandtem Rücken, ein Officier, der seinen violetten mit grün gefutterten Mantel und Degen auf dem ihn zur Seite stehenden Tabouret hingeworfen; zur Linken stehet auf einem dreibeinigten Stuhl eine Kanne; und zur Rechten macht ein anderer sein Wasser. Das Gemähide ist von le Due, hat aber gelitten. g.L. [im schwarzen Rahm mit verguldeten Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: 12 Zoll hoch, 16 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0314 Le Due I Eine im Garten musicirende Gesellschaft, sehr schön gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 18 Zoll 9 Linien, Breite 26 Zoll 6 Linien Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/08/21 HBKOS 0016 de Due I Ein wohl ordinirtes Conversations=Stück; einige Herren und Damen sitzen um einen Tisch und spielen Karten, wobey ein Herr und Dame stehet und zusieht: zur linken Hand liegt ein Jagdhund, von der besten Zeit de Due. so schön als Terburg. auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll 7 Linien, breit 30 Zoll 6 Linien Verkäufer: Moddermann Transakt.: Verkauft (139.4 M) Käufer: Keetsch 562
GEMÄLDE
1784/05/11 HBKOS 0056 Le Due I Eine vergnügte Conversations=Geschichte, von Le Due. auf L[einewand]. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 18 Zoll, breit 24 Zoll 61. Transakt.: Verkauft (1.10 M) Käufer: Hahn 1787/00/00 HB AN 0404 Le Doue I Zwey Spanier, welche Karten gespielt haben. Der eine ist aufgestanden, und beschäfftigt sich im Hintergrunde. Im Vordergrunde steht auf einem Stuhle eine Kanne. Sehr fleißig gemahlt. A.H. [Auf Holz] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Zoll, breit 18 Zoll Transakt.: Verkauft (8.4 M) Käufer: Bertheau 1787/00/00 HB AN 0488 Le Doue I Ein Corps de Garde, wo zur linken bey verschiedenen Waffen zwey Soldaten sitzen, die auf einer Trommel Karten spielen. Im Vordergrunde ein Spanischer Officier. Hinten Gewehre und andere dergleichen Sachen. Von edler Composition, schöner natürlicher und ausführlicher Mahlerey. A.H. [Auf Holz] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll, breit 14 % Zoll Transakt.: Verkauft (8.8 M) Käufer: Cober 1787/00/00 HB AN 0635 Le Douck I Eine Frau von mittlem Jahren, in einem gelben Rock und Pelz gekleidet, und mit einer schwarzen Kappe, sitzt bey einem Tisch, welcher mit einer gestickten Dekke belegt ist, mit gefaltenen Händen, und scheint vor einem herantretenden Spanier zu erschrecken, welcher mit einer barbarischen Miene rückwärts sieht. Dieses Gemähide ist von solcher edlen Zeichnung, natürlichem Colorit, vortrefflichen Ausdruck und ausführlichen Mahlerey, daß es den schönsten Konings kann zur Seite gestellt werden. A.H. [Auf Holz] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 22 Vi Zoll, breit 18 Zoll Transakt.: Verkauft (20 M) Käufer: Fesser 1787/03/01 HBLOT 0025 le Doue I Ein Conversationsstück von vielen Figuren in spanischer Kleidung. I Transakt.: Unbekannt (3 M) 1787/04/19 HBTEX 0031 le Due I Eine Holländische W i r t schaft mit verliebte Vorstellungen, extra rar. I Transakt.: Verkauft (92 M) Käufer: Eck 1790/02/04 HBDKR 0135 Le Due I Ein scherzhaftes Paar sitzen auf einem Ruhebette, auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 6 Zoll, breit 4 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (1 M) 1790/04/13 HBLIE 0133 C. le Due I Verschiedene Herren und Damen sitzen und stehen um einer gedeckten Tafel, wo der eine Herr zu viel in sein Weinglas gesehen haben muß, dieweil er es herauslaufen läßt, indem er taumeint auf seinen Stuhl sitzet; besonders schön gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 17 V* Zoll, breit 21 % Zoll Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "C. le Due", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Verkauft (7.10 M) Käufer: Boemer 1790/05/20 HBSCN 0019 le Doue I Ein auf Ordre seines schreibenden Officiers wartender Trompeter, in spanischer Kleidung. Besonders schön gemahlt auf L[einwand]. S.R.G.L. [Schwarzen Rahm, goldne Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 23 Vi Zoll, breit 19 Zoll Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (23 M) Käufer: Ethatsrath Rigardi 1791/05/28 HBSDT 0130 Le Doue I Herr und Dame in spanischer Kleidung. In Landschaften vorgestellt, auf Holz. I Diese Nr.: Herr in spanischer Kleidung Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Vi Zoll, breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 130 und 131 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1791/05/28 HBSDT 0131 Le Doue I Herr und Dame in spanischer Kleidung. In Landschaften vorgestellt, auf Holz. I Diese Nr.: Dame in spanischer Kleidung Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Vi Zoll, breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 130 und 131 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1791/09/21 FRAN 0026 Ledue I Dieses Gemälde stellet das Innere eines Spanischen Wachthauses vor, wo man zur Rechten einen Mann und eine Frau siehet, welche Karten spielen auf einer Trom-
mel, ein dritter hält einen Spiegel über die Karten des Spielers, hinter welchem er stehet, zur Linken sind zween Männer und eine Frau beym Trinken, unten ist ein Soldat, welcher eine Pfeiffe rauchet, am Ende sieht man ein Zelt. I Transakt.: Verkauft (22 fl) Käufer: Levy 1792/04/19 HBBMN 0068 Le Düc I Eine musicalische und eine scherzhafte Gesellschaft, beyde vor Tische sitzend, von Le Düc. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine musicalische Gesellschaft Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Vi Zoll, breit 7 V* Zoll Anm.: Die Lose 68 und 69 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1792/04/19 HBBMN 0069 Le Düc I Eine musicalische und eine scherzhafte Gesellschaft, beyde vor Tische sitzend, von Le Düc. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine scherzhafte Gesellschaft Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Vi Zoll, breit 7 V* Zoll Anm.: Die Lose 68 und 69 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0214 Le Dück I Die Frau präsentirt dem Mann die Tabacks=Pfeif kniend, auf Baneel von le Dück. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch, 1 Schuh 3 Vi Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0406 le Due I Eine Gesellschaft spanischer Edelleute, welche sich in Brettspielen unterhalten, von le Due. I Maße: 2 Schuh 1 Zoll hoch, 2 Schuh 8 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0480 le Due I Ein Conversations=Stück spanischer Edelleute, so sich mit Brettspielen in Gesellschaft einer jungen Dame angenehm unterhalten, mit markichten Colorit dargestellt, von le Due. I Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 1 Schuh 5 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 HB AN 0056 J. le Due I Die Wirthin einer Dorfschenke schäkert mit einem Kriegsmann, der mit phlegmatischem Wohlbehagen ihre Liebkosungen erwiedert. I Maße: Höhe 15 Zoll, Breite 12 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1794/09/06 HBBMN 0007 le Dug I Ein schönes Conversations= Stück I Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0139 Le Due I Eine Wachtstube mit verschiedenen Soldaten, in Lebengrösse, vor einem Camin sich wärmend. Ein sehr schönes Gemähide. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Format: oval Maße: Hoch 16 Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0146 Le Due I Eine Gesellschaft von sechs Personen, am Tische Karten spielend; Figuren in Lebensgrösse, Spanische Kleidung. Ein sehr gutes Bild. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 25 Zoll, breit 32 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0245 Le Due I Ein Spanier mit einem großen Federbusch, der die Zitter spielt. Sehr gut gemahlt. Auf Leinw., goldenen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 25 Vi Zoll, breit 20 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/05/14 KOAN 0015 Leduck I Le portrait de Gustaphe Adolphe ä cheval, par Leduck, sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 1 pied 11 pouces; Largeur 1 pied 5 pouces Verkäufer: de Bors d'Overen Transakt.: Unbekannt 1798/08/10 HBPAK 0004 Le Due I Ein Garten=Prospect. Vor einem Gartenhause sitzen Damen und Herren. Eine Dame hat einen Zettel in der Hand, liest den neben ihr sitzenden Herrn solchen vor, welcher mit Aufmerksamkeit zu höret. Zur Linken stehet noch ein Herr und eine Dame. Zur Rechten ein Herr und eine Dame welche sich umarmen. Ganz vortreflich und geschmackvoll gemahlt. Auf Leinwand, im schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 27 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/08/10 HBPAK 0130 le Due I Ein inwendiges Zimmer mit einer musikalischen Gesellschaft. Auf das schönste gemahlt und or-
dinirt. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 19 Zoll, breit 26 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/08/09 HBPAK 0053 Le Duk I Ein Mann, welcher neben einer Pumpe sitzet und arbeitet. Auf Holz, goldn. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Vi Zoll, breit 7 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/08/09 HBPAK 0057 Le Duck I Zwey inwendige Corps de Garden mit spanischen Kriegern. Das Eine, wo einem Offizier ein Brief oder Ordre gebracht wird; das Andere, wo welche bey Tische sitzen, zechen, und mit Mädchens caressiren. Auf Leinwand, schwarzer Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein inwendiges Corps de Garden mit spanischen Kriegern. Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 57 und 58 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/08/09 HBPAK 0058 Le Duck I Zwey inwendige Corps de Garden mit spanischen Kriegern. Das Eine, wo einem Offizier ein Brief oder Ordre gebracht wird; das Andere, wo welche bey Tische sitzen, zechen, und mit Mädchens caressiren. Auf Leinwand, schwarzer Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein inwendiges Corps de Garden mit spanischen Kriegern. Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Zoll, breit 27 Zoll Anm.: Die Lose 57 und 58 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/10/10 HBPAK 0020 Le Due I Ein Conversationsstück. Auf Holz, goldn. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 17 Zoll, breit 23 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/10/17 LZAN 0033 Leduc I Eine Versammlung von Räubern, scheinen bey Theilung der Beute uneinig geworden zu seyn, und fangen an sich zu schlagen; mit Klarheit vorgestellt; hoch 17 Zoll, breit 25 Zoll. Auf Holz; mit einem vergoldeten Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 17 Zoll, breit 25 Zoll Verkäufer: Rauch Transakt.: Verkauft (25.8 Th) Käufer: Straube 1799/12/04 HBPAK 0033 Carl le Due I Eine Dame, welche aus dem Garten mit einem Korbe mit Blumen nach ihrem Landhause gehet. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 14 Zoll, breit 11 Zoll Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "Carl le Due", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt 1799/12/04 HBPAK 0173 le Duck I Ein inwendiger Saal. Eine Dame sitzet bey einem Tische, und spielet auf der Zitter. Zur Rechten stehet ein Stuhl, an dem eine Baßgeige lehnet. Gut gemahlt. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 17 Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 BLBOE 0077 Le Due I Zwei Ritter sind im traulichen Gespräch begriffen. Der eine hält eine Tobackspfeife, der andere einen Krug in den Händen. Auf dem Tische sieht man Karten, Pfeife, Toback, und einen gefüllten Pokal. Im Hintergrunde eine beschäftigte Figur. I Transakt.: Unbekannt 1800/00/00+ LZRST [0025] Le Ducq I Eine Gerichtsstube, der Richter in schwarzer Kleidung sitzt am Arbeitstische, vor ihm steht der Gerichtsfrohn, hinter ihm ein Mann im rothen Mantel, im Hintergründe ein sitzender Alter im Mantel, an der Thür steht ein junger Bauer Wache. I Mat.: auf Holz Maße: 27 Zoll breit 31 Zoll hoch Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Rost Transakt.: Unbekannt 1800/00/00+ LZRST [0026] Le Ducq I Ein niederländisches Frühstück, mit Herren und Damen, welche musiziren. I Mat.: auf Holz Maße: 20 Zoll breit 16 Zoll hoch Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Rost Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
563
Ducq, Johan le (Kopie nach) 1799/10/10 HBPAK 0084 Van Bohl; nach le Due I Die wiedergefundene Tochter. Ausnehmend schön und meisterhaft gemahlt. Auf Leinwand, schw. und goldn. Rahm. I Kopie von Bohl nach Johan le Ducq Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 20 Vi Zoll, breit 23 Zoll Transakt.: Unbekannt
Ducq, Johan le (Manier) 1790/08/13 HBBMN 0108 Wie le Douc I Zechende und lustige Spaniern, im Innern eines Hauses. Auf H[olz]. G.R. [Goldnen Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Verkauft (3 M) Käufer: Ego
Ducree, Friedrich Wilhelm 1781/05/07 FRHUS 0351 Ducree I Zwey wohl ordinirte Markstück. I Diese Nr.: Ein wohl ordinirtes Markstück Maße: 7 Zoll hoch und 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 351 und 352 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (5 fl für die Nm. 351 und 352) Käufer: Collomb 1781/05/07 FRHUS 0352 Ducree I Zwey wohl ordinirte Markstück. I Diese Nr.: Ein wohl ordinirtes Markstück Maße: 7 Zoll hoch und 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 351 und 352 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (5 fl für die Nm. 351 und 352) Käufer: Collomb 1791/09/26 FRAN 0017 Ducree I Ein Reutergefecht, lebhaft ausgedruckt und in Action gesetzt von Ducree. I Pendant zu Nr. 18 Maße: 1 Sch. 8 Zoll hoch, 2 Sch. 3 Zoll breit Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0018 Ducree I Das Gegenstück zu obigem, ein Markedenterszelt wo einige Husaren schmausen, von nemlichen Meister [Ducree] und Maas. I Pendant zu Nr. 17 Maße: 1 Sch. 8 Zoll hoch, 2 Sch. 3 Zoll breit Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0334 Ducree I Ein Äff als Mahler, und ein Äff als Bildhauer. I Diese Nr.: Ein Äff als Mahler Maße: 7 Zoll hoch, 5 Zoll breit Anm. : Die Lose 334 und 335 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0335 Ducree I Ein Äff als Mahler, und ein Äff als Bildhauer. I Diese Nr.: Ein Äff als Bildhauer Maße: 7 Zoll hoch, 5 Zoll breit Anm.: Die Lose 334 und 335 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt
Dudtde, J. [Nicht identifiziert] 1781/05/07 FRHUS 0070 J. Dudtde I Die Sammlung des Manna in der Wüsten, mit vielen schönen Figuren, sehr gut in Licht und Schatten gehalten von J. Dudtde. I Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch und 2 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (50.15 fl) Käufer: Burger 1781/05/07 FRHUS 0308 J. Dudtde I Christus speist 5000 Mann in der Wüsten, reich componirt fleissig und meisterhaft in Licht und Schatten gehalten, so schön wie de Wett bezeichnet J. Dudtde. I Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch und 2 Schuh 4 Zoll breit Inschr.: J. Dudtde (bezeichnet) Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (71.17 fl) Käufer: Burger
Mercurius, und zur Seiten ein Wasser=Gott. I Maße: hoch 19 Zoll, breit 14 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (11 fl) Käufer: Erlinger
Düelen, W.V. [Nicht identifiziert] 1786/10/18 HBTEX 0194 W. v. Düelen I Eine Berges=Höhle, in welcher einige Menschen theils zu Pferde, als auch zu Fuß befindlich, nebst einem Hirten mit Schafen; auch fliesset ein Bach durch die gebirgigte Gegend. Auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 11 Zoll 6 Linien, breit 14 Zoll 6 Linien Transakt.: Unbekannt
Dürer, Albrecht 1670/04/21 WNHTG 0061 Alberto Durer I Le tre Marie visitanti il Sepolcro di Christo, figure piccole. I Maße: Alto palmi tre, e undid dita, largo due palmi, e quattro dita Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt 1670/04/21 WNHTG 0062 Alberto Durer I Un Ritratto d'una Donna con color d'aequa, d'inferior statura. I Maße: Alto palmi due, largo uno, e mezzo Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt Gegenw. Standort: Frankfurt, Deutschland. Städelsches Institut. (937) 1670/04/21 WNHTG 0063 Alberto Durer I Un altro simile [Un Ritratto d'una Donna con color d'aequa, d'inferior statura]. I Maße: Alto palmi due, largo uno, e mezzo Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt Gegenw. Standort: Berlin, Deutschland. Gemäldegalerie. (77.1) 1670/04/21 WNHTG 0132 Alberto Dürer I Un Ritratto d'Alberto Dürer. I Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt 1690/10/30 WFAN 0045 Dürer I Adam. I Verkäufer: Herzog Friedrich von Holstein-Norburg Transakt.: Verkauft (23 Rt für die Nrn. 45 und 46) Käufer: Prtz A W 1690/10/30 WFAN 0046 Durer I Eva von Dürer. I Verkäufer: Herzog Friedrich von Holstein-Norburg Transakt.: Verkauft (23 Rt für die Nrn. 45 und 46) Käufer: Prtz A W 1714/05/07 LZAN 0106 Albrecht Düren I Ein klein Marien= Bildgen von Albrecht Düren. I Verkäufer: Christian Wolff Transakt.: Unbekannt 1716/00/00 FRHDR 0186 Aldrecht Durer I Von Aldrecht Dürer der grosse Christophel. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (15) 1750/10/15 HB AN 0021 Dürer (Albrecht) I Der unterm Schlaffen Unkraut zwischen den Weitzen säende Feind. I Maße: 2 Fuß 5 Vi Zoll hoch, 3 Fuß 4 Zoll breit Transakt.: Unbekannt (1.10) 1750/10/15 HB AN 0022 Dürer (Albrecht) I Die Mutter GOttes. I Maße: 2 Fuß hoch, 1 Fuß 10 Vi Zoll breit Transakt.: Unbekannt (2) 1750/10/15 HB AN 0064 Durer (Albrecht) i Maria mit dem Kinde und Joseph im Stall auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: 7 Vi Zoll hoch, 5 Vi Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1752/00/00 NGWOL 0046 Albr. Dürrer I Ein Hieronymus am Tische sitzend, mit einem Löwen und Hund. Vn Girolamo assiso alia tavola con un lione e cane. I Verkäufer: Neubauer Transakt. : Unbekannt (8 Th)
Düburg [Nicht identifiziert]
1752/05/08 LZAN 0143 Albrecht Dürer I Die Printze von Oranien zu Pferde von Albrecht Dürer auf Holtz gemahlt, V2 Elle hoch % Elle breit, im Holl. Rahmen. I Mat.: auf Holz Maße: Vi Elle hoch, % Elle breit Transakt.: Verkauft (2.13 Th) Käufer: Loon
1790/08/25 FRAN 0120 Düburg I Venus und Cupido auf Wolken, vor ihnen sizt ein Jüngling auf einem Erdenschutt, hinter ihm
1752/05/08 LZAN 0228 Albrecht Dürer I Iudith mit Holofernis Haupte auf Holz gemahlt von Albrecht Dürer im Holl. Rahmen. I
564
GEMÄLDE
Mat.: auf Holz Maße: Vi Elle hoch, 1 Elle breit Transakt.: Verkauft (4.3 Th) Käufer: Loon 1759/00/00 LZEBT 0151 Albr. Durer I Ein Stück in Form eines Altargens von 3 Blatt worauf der Meister das Ewige Leben vorstellen wollen, auf Holtz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 6 Schuh 5 Zoll, Breite 3 Schuh 1 Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (1000 Th Schätzung) 1763/01/17 HNAN 0029 Albrecht Durer I L'Adoration des Mages, par Albrecht Dürer, sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 2 pieds 5 pouces, Largeur 2 pieds Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt 1763/01/19 FRJUN 0051 A. Durer I Une Adoration des Rois, trfes bien achevöe. I Maße: hauteur 35 pouces, large 29 pouces Transakt.: Unbekannt (25 Vi fl)
1778/05/30 HBKOS 0002 A. Durer I Maria mit dem Christ Kindlein, von A. Dürer, auf Holz. [Diese Gemähide sind alle mittlere Grösse, können also an alle Plätze gebraucht werden - dieweilen keine Theilen=Stück, dabey befindlich] I Mat.: auf Holz Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 150 und beziehen sich auf die Nm. 1 bis 150. Verkäufer: Dr Friederici Transakt.: Verkauft (6 M) Käufer: Mrne Le Dr F 1778/05/30 HBKOS 0138 A. Durer I Maria mit dem Christkindlein, von A. Durer, auf Holz. [Diese Gemähide sind alle mittlere Grösse, können also an alle Plätze gebraucht werden - dieweilen keine Theilen=Stück, dabey befindlich] I Mat.: auf Holz Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 150 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 150. Verkäufer: Dr Friederici Transakt.: Verkauft (1.8 M) Käufer: Ehrenreich
1763/11/09 FRJUN 0063 A. Duurer I Le portrait de ce grand maitre par lui merae parfaitement peint. I Maße: hauteur 6 pouces, largeur 5 pouces Transakt.: Verkauft (5.30 fl) Käufer: Geyß
1778/09/28 FRAN 0156 Albert Dürer I Eine heilige Rosamunde mit dem Giftbecher. [S. Rosemonde avec la coupe empoisonnee.] I Maße: 2 Schuh 4 Zoll breit, 3 Schuh hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (19.30 fl) Käufer: Prß ν Dessau
1764/05/25 BOAN 0253 Albrecht Durer I La Tete d'un Ecce Homo peinte par Albrecht Durer. [Ein Ecce Homo Kopf Von Albrecht Durer.] I Maße: 1 pied 3 pouces de hauteur, 11 pouces de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (30.10 Rt) Käufer: Spenner [für] a Auarius
1778/09/28 FRAN 0163 Albert Dürer I Ein Muttergottesbild mit dem Jesukind und zween Engeln. [Une S. Vierge avec l'enfant Jesus & deux anges.] I Maße: 2 Schuh 4 Zoll breit, 3 Schuh hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (50.30 fl) Käufer: Gogel
1765/00/00 FRRAU 0165 A. Dürrer I Das schmertzhafte Haupt unsers Erlösers. Le chef douloureux de notre Redempteur. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 1 Schuh 4 Zoll, breit 1 Schuh Transakt.: Unbekannt
1778/09/28 FRAN 0348 Albert Dürer I Eine Kreutzigung Christi mit vielen Figuren. [Jesus-Christ mis ä la croix, avec beaueoup de figures.] I Maße: 1 Schuh 1 Zoll breit, 18 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (9 fl) Käufer: Fräulain ν Mühl (N Mülhen)
1766/07/28 KOSTE 0037 Albert Durer I Ein antique Crucifix= stuck von Albert Durer. I Transakt.: Verkauft (27.2 Rt) Käufer: Schmitz 1768/07/00 MUAN 0142 Durer (Albertus) I [Ohne Titel] Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/08/16 KOAN 0104 Albrecht Durer I Ein Crucifix mit vieles Beywerck von Albrecht Durer. I Maße: Höhe 1 Fuß 2 Zoll, Breite 10 Zoll Verkäufer: Freyherr von Kaas Transakt.: Unbekannt 1775/05/08 OGAN 0253 Albrecht Dürer I Ein kostbares auf Holz gemahltes Mutter=Gottes=Bild, das JEsus=Kindlein auf dem Arm haltend, hoch 1 Schuh 10 Zoll, breit 1 Schuh 5 Vi Zoll, wohl conservirt; ist ein wahres Original von Albrecht Dürer, auch dessen Namen samt der Jahrzahl 1523 darauf gezeichnet. [Une peinture ρτέcieuse, la Ste. Vierge tenant l'enfant Jesus sur ses bras. Haute de 1 ρίέ 10 pouces, large de 1 pie 5 V* pouces, trfes-bien conservee. C'est une peinture originale d'Albert Durer, dont le nom est marque avec l'annee 1523.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Schuh 10 Zoll hoch, und 1 Schuh 5 V* Zoll breit Inschr.: 1523 (datiert) Verkäufer: Marggräfinn Augusta Sibylla von Baaden=Baaden Transakt.: Unbekannt (550 [?]) 1776/00/00 WZTRU 0113 Alb recht Dürer I Ein Stück, 1 Schuhe, 2 Zoll hoch, 8 Zoll breit von Albrecht Dürer, stellet vor die Mutter Gottes mit dem Kind Jesu, welches dieselbe an der Brust säuget, die Mutter sowohl als das Kind sind mit möglichstem Reiß in einer wohlverstandenen gewöhnlichen Landschaft verfertiget, und ist eines seiner wohlausgefürtesten [sie] Stücke. I Maße: 1 Schuhe 2 Zoll hoch, 8 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (8 fl Schätzung) 1777/03/03 AUAN 0087 Albrecht Dürer I Ein Christus am Oelberg. I Maße: Höhe 1 Sch. 8 Zoll, Breite 1 Sch. 1 Vi Zoll Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt 1777/04/11 HBNEU 0090 de. I Transakt.: Unbekannt
A. Dürer I Maria mit dem Christkin-
1778/09/28 FRAN 0396 Albert Dürer I Ein kleiner sehr schön gemalter Mannskopf. [Une petite tete d'homme tres bien peinte.] I Maße: 5 Zoll breit, 6 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (10.30 fl) Käufer: Jos Brentano 1778/10/30 HBKOS 0010 A. Dürer I Maria mit dem Christkindlein, ganz besonders schön gemahlt und colorirt, auf Holz, von A. Dürer seiner besten Zeit, und vollkommen gut conserviret, hoch 31 Vi Zoll, breit 22 Zoll. Oben ist dieses Gemälde etwas rund fornirt und vermuthlich zu einem Altar=Stück bestimmt gewesen. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 31 Vi Zoll, breit 22 Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/10/30 HBKOS 0175 A. Dürer I Ein Philosoph, so andächtig lieset; auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 30 Zoll, breit 39 Zoll Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0123 Alb. Dürer I Das Haupt Christi mit einer aufgehobenen Hand. [La tete du Christ avec une main levee.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 8 Zoll hoch, 1 Fuß 3 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0124 Alb. Dürer I Maria mit gefalteten Händen. Beide [Nr. 123 und 124] auf Holz. [Marie, les mains jointes. Tous deux peints sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 8 Zoll hoch, 1 Fuß 3 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0282 Albr. Dürer I Die Anbetung der drey Weisen aus Morgenlande, die dem Heilande Geschenke bringen. [L'adoration des Mages, qui apportent des presens ä l'enfant Jesus.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 2 Zoll hoch, 1 Fuß 7 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/09/27 FRNGL 0019 Albert Dürer I St. Hyronimus, in einem nach dem alten Costume abgebildeten Zimmer an einem Tische sitzend, mit schönem wohl ausgeführtem Beywesen. [S. Jeröme assis ä une table dans un chambre representee ä l'antique ornee de tres beaux accesoires.] I Maße: 4 Schuh 5 Zoll hoch, 1 Schuh Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (34 fl) Käufer: Mentzinger 1779/09/27 FRNGL 1089 Albert Dürer I Ein dergleichen kleineres, von oben halbrundes Hausaltar, mit zwey Flügeln, worauf von aussen ein todter Leichnam mit verschiedenen lateinischen InGEMÄLDE
565
scriptionen, sehr gut gemalt, auf der innern Seite derer Thüren ein Bischof, welcher über eine für demselben auf den Knien liegenden zahlreichen Familie beyderley Geschlechts die Benediction ertheilet, auf dem Mittelblatt ist gleichfalls eine mit unvergleichlichem Fleiße sehr rührende Kreutzigung Christi, mit vielen geistreich ausgeführten Figuren, fürtreflich abgebildet von Albert Dürer, 3 Schuh 11 Zoll Hoch, und bey offenen Flügeln, 5 S. 9 Z. breit I Maße: 3 Schuh 11 Zoll hoch, 5 Schuh 9 Zoll breit Transakt.: Verkauft (40 fl) Käufer: Bager Gegenw. Standort: Frankfurt, Deutschland. Städelsches Institut. (715) als Meister von Frankfurt 1781/00/00 WZAN 0113 Albrecht Dürer I Ein Stück, 1 Schuhe, 2 Zoll hoch, 8 Zoll breit von Albrecht Dürer, stellet die Mutter Gottes mit dem Kinde Jesu vor, welches dieselbe an der Brust säuget; die Mutter sowohl als das Kind sind mit möglichstem Fleiße in einer wohl verstandenen gewöhnlichen Landschaft verfertiget, und dieses ist eines seiner wohl ausgefürtesten Stücke. I Maße: 1 Schuhe 2 Zoll hoch, 8 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/07/18 FRAN 0061 Albrecht Durer I Die Geburt Christi, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: 2 Schuh 2 Zoll hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0137 A. Dürer I Ein als ein St. Hyeronimus abgebildet meditirender Cardinal, aus dem offenen Fenster zur Linken zeiget sich eine extra fleißig gemahlte bergigte Landgegend, durch welche ein Fluß strömet, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 40 Zoll 3 Linien, Breite 33 Zoll 6 Linien Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0202 A. Dürer I Ein St. Hieronymus in seiner Zelle, fleißig gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 22 Zoll 6 Linien, Breite 17 Zoll 3 Linien Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/05/29 FRFAY 0099 Albert Durer I Zwey geistliche Stuck, Christus am Oelberg und die Gefangennehmung. I Diese Nr.: Ein geistliches Stuck, Christus am Oelberg Maße: 25 Zoll hoch, 18 Zoll breit Anm.: Die Lose 99 und 100 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Thorhorst Transakt.: Unbekannt (20 fl für die Nrn. 99 und 100) 1782/05/29 FRFAY 0100 Albert Durer I Zwey geistliche Stuck, Christus am Oelberg und die Gefangennehmung. I Diese Nr.: Ein geistliches Stuck, die Gefangennehmung Maße: 25 Zoll hoch, 18 Zoll breit Anm.: Die Lose 99 und 100 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Thorhorst Transakt.: Unbekannt (20 fl für die Nrn. 99 und 100) 1782/09/30 FRAN 0350 Albert Dürer I Eine Mutter Gottes mit dem Kind Jesu, von Albert Dürer 1503 geistreich und schön verfertigt. [La sainte Vierge avec l'enfant Jesus, par Albert Duerer, en 1503, tres belle piece.] I Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 2 Vi Zoll breit Inschr.: 1503 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (20.15 fl) Käufer: Wild 1785/05/17 MZAN 0688 Albert van Dürer I Die H. drey Könige die dem Jesukinde Weihrauch opfern von Albert van Dürer. [Le trois Roi presentans de l'encens ä l'enfant Jesus.] I Maße: 1 Schuh 10 Zoll hoch, 1 Schuh 5 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (8.30 fl) Käufer: Schwanck 1786/05/02 NGAN 0040 Dürer I Ein Ecce Homo, eine ganze Figur, unter einem gothischen Bogen. Auf dem Fußgestell stehet Albrecht Durers Zeichen mit der Jahrzahl 1509. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: 3 Schuh 8 Zoll hoch, 1 Schuh 10 Zoll breit Inschr.: 1509 (datiert) Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (22 fl) Käufer: Möglich 1786/05/02 NGAN 0071 Durer I Ein an Haupt, Leib, Arm und Schenkeln geharnischter Reuter auf einem galoppirenden Pferd. Er führt ein gezogenes Schwerd und Pistolen in Hulstern. Grau in Grau gemahlt, und an verschiedenen Orten mit Gold aufgehöht, auf Papier 566
GEMÄLDE
und dieses wieder auf Holz aufgeklebt. I Mat.: Papier auf Holz Maße: 9 Vi Zoll hoch, 7 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Unverkauft (5 fl Schätzung) 1786/05/02 NGAN 0277 Dürer I Ein Ecce Homo, mit des Meisters Zeichen, und Jahrzahl 1519; auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 11 Zoll breit Inschr.: 1519 (datiert) Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (57.16 fl) Käufer: Wild 1787/00/00 HB AN 0375 Albertus Dürer I Im Vordergrunde sitzt ein alter Lautenspieler, neben ihm eine alte verhüllte Frau, so die Violine spielt. Ein alter auf der Erde sitzender Bauer läßt sich an der an seinem Kopfe befindlichen Wunde von einem Chirurgus schneiden. Ganze Figuren, in steinernen Nichen vorgestellt. Sehr schön gemahlt, und besonders ist der Fleiß in diesen Bildern zu bewundern. A.H. [Auf Holz] s.R. [in schwarzem Rahm] I Diese Nr.: Im Vordergrunde sitzt ein alter Lautenspieler, neben ihm eine alte verhüllte Frau, so die Violine spielt Mat.: auf Holz Maße: Hoch 5 Vi Zoll, breit 4 Zoll Anm.: Die Lose 375 und 376 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (18.8 M) Käufer: Tietjen 1787/00/00 HB AN 0376 Albertus Dürer I Im Vordergrunde sitzt ein alter Lautenspieler, neben ihm eine alte verhüllte Frau, so die Violine spielt. Ein alter auf der Erde sitzender Bauer läßt sich an der an seinem Kopfe befindlichen Wunde von einem Chirurgus schneiden. Ganze Figuren, in steinernen Nichen vorgestellt. Sehr schön gemahlt, und besonders ist der Fleiß in diesen Bildern zu bewundern. A.H. [Auf Holz] s.R. [in schwarzem Rahm] I Diese Nr.: Ein alter auf der Erde sitzender Bauer läßt sich an der an seinem Kopfe befindlichen Wunde von einem Chirurgus schneiden Mat.: auf Holz Maße: Hoch 5 Vi Zoll, breit 4 Zoll Anm.: Die Lose 375 und 376 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (18.8 M) Käufer: Tietjen 1787/00/00 HB AN 0396 A. Dürer I Christus mit einer Dornenkrone und in einem purpurrothen Gewände, mit niedergewandtem Haupte. Brustbild. Mit vielem Ausdruck, und von sehr fleißiger Mahlerey. A.H. [Auf Holz] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Vi Zoll, breit 10 % Zoll Anm.: Dieses Los trägt im Katalog irrtümlicherweise die Nr. 386. Transakt.: Verkauft (4.12 M) Käufer: Grunwald 1787/03/01 HBLOT 0081 Alb. Düren I Ein Christus=Kopf, von besonderem Ausdrucke. I Transakt.: Unbekannt (1 M) 1788/06/12 HBRMS 0151 Albrecht Durer. 1524 I Maria, in prachtvoller Kleidung, das Kindlein vor ihr liegend und mit Andacht anschauend. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 2 Fuß 8 Zoll, breit 2 Fuß Inschr.: 1524 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0018 Albert Düren I Eine Mutter Gottes mit dem Kindchen und Joseph. [1 p[iece]. l'enfant Jesus & Joseph.] I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 2 Fuß 1 Zoll, Breite 1 Fuß 7 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0157 Albert Dürer \ H. Hieronymus. [1 p[iece], St. Jerome.] I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 2 Fuß 6 Zoll, Breite 1 Fuß 8 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1789/00/00 MM AN 0107 Albrecht Dürer I Vier nackende Weiber, auf Holz. [Quatre femes [sic] nues, sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 7 Zoll hoch, 6 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (30 fl) 1789/06/12 HBTEX 0009 Albrecht Durer. 15171 Maria mit dem Christkinde. Geistreich vorgestellet und schön gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Vi Zoll, breit 6 % Zoll Inschr.: 1517 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Verkauft (3.10 M) Käufer: Matthes 1789/08/18 HBGOV 0059 Albert Dürer I Eine vortreflich schön gemahlte Madonna, w. c. auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 9 Vi Zoll, breit 7 Zoll Transakt.: Unbekannt
1790/01/07 MUAN 0427 Dürer Albr. I Ecce Homo, auf Holz, in einer geschnittenen und vergoldeten Ram. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 2 Schuh 1 Zoll, Breite 1 Schuh 6 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0431 Dürer Albr. I Ein Apostel, auf Holz, in einer geschnittenen und metallisirten Ram. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 2 Schuh 1 Zoll, Breite 1 Schuh 9 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0671 Dürer Albr. I Ein Christuskopf, auf Leinwat. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 3 Zoll, Breite 1 Schuh Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1332 Dürer Albr. I Ein geharnischter Ritter mit dem Streithammer, in einer Landschaft mit einem Bergschloße, auf Holz, in einer schwarzen Ram mit vergoldeten Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 2 Schuh, Breite 1 Schuh 8 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 2144 Dürer Albr. I Die Kreuzigung Christi, auf Holz, in einer geschnittenen, und vergoldeten Ram. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 7 Zoll, Breite 6 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/02/04 HBDKR 0123 A. Durer I Das Bildniß der Jungfrau Maria, besonders lebhaft und schön gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 21 Zoll, breit 18 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (3.2 M) Käufer: Friedrich 1790/04/13 HBLIE 0229 Albr. Durer I Der bethende Petrus, sehr fleißig gemahlt. Auf Holz, in einem dergleichen [Schiebe-]Kasten [von Mahagonieholz]. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 6 Zoll, breit 7 Zoll Transakt.: Verkauft (3 M) Käufer: Ego 1790/08/25 FRAN 0014 Albert Dürer I Ein heiliger Hieronymus an einer Tafel sitzend und schreibend. I Maße: hoch 15 Zoll, breit 11 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (6 fl) Käufer: Kaller 1792/04/19 HBBMN 0067 Albertus Durerus I Die Ruhe der Heiligen Familie, auf dem Wege nach Egypten; besonders fleißig gemahlt, von Albertus Durerus. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Zoll, breit 23 Zoll Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0140 Albrecht Düren I Christophel traget das Jesu Kindlein durchs Meer, zwey Städte am Meer, viele Figuren, Fische und Schiffen auf Holz von Albrecht Dürer. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Schuh 6 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0151 Albrecht Düren I Zwey Stück, das eine die Geburt Christi mit Engelen, Ochs, Esel und Hirten, das andere die Hh. drey Königen opferen dem Jesu Kindlein, vorstellend, von Albrecht Düren auf Holz. I Diese Nr.: Ein Stück, die Geburt Christi mit Engelen, Ochs, Esel und Hirten, vorstellend Mat.: auf Holz Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch, 1 Schuh 2 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 151 und 152 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0152 Albrecht Düren I Zwey Stück, das eine die Geburt Christi mit Engelen, Ochs, Esel und Hirten, das andere die Hh. drey Königen opferen dem Jesu Kindlein, vorstellend, von Albrecht Düren auf Holz. I Diese Nr.: Ein Stück, die Hl. drey Königen opferen dem Jesu Kindlein, vorstellend Mat.: auf Holz Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch, 1 Schuh 2 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 151 und 152 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 HBMFD 0076 Alb Durer I Der heilige Eustachius kniet vor den Hirsch, welcher das Kreutz Christi aufn Kopf hat. Neben ihn steht sein weisses Pferd. Im Vordergrunde sehr viele Jachthunde &c. Hinten Gebürge mit alten Schlössern. Dieses Stück ist von A. D. selbst in Kupfer heraus. Ein sehr schönes und seltnes Ge-
mälde. I Mat.: auf Leinwand Maße: 3 Fuss 1 Zoll hoch, 2 Fuss 3 Zoll breit Verkäufer: Pierre Laporterie Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0015 Albrecht Durrer I Eine Madonna mit dem Jesukindlein, im halben Brustbilde, von Albrecht Durrer. I Maße: 2 Schuh hoch, 1 Schuh 10 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0249 Albrecht Durrer I Ein lustiger Bauer, nebst seinem Weibe, welche nach einer Bockspfeife tanzen, von Albrecht Dürrer. I Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1794/02/21 HBHEG 0008 A. Durerus I Ein sehr nachdenkender Philosoph, stützet die eine Hand unterm Kopf und mit der andern zeiget er auf einem Hirnschädel von Knochen; vor ihm aufm Tische lieget ein offengeschlagenes Buch, und neben bey stehet ein Leuchter. Nach den Insignien, welche zur Rechten hinter ihm stehen, stellet er ein Bischof vor; zur Linken an der Wand hänget eine goldene Taschen=Uhr. Dieses alte Gemähide welches im 15ten Seculo verfertiget, ist sehr wohl conservirt. Durerus wurde Ao. 1470 zu Nürnberg gebohren, und starb allda Ao. 1528. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 21 Ά Zoll, breit 27 Zoll Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV 0087 Alb. Durer I Die Könige aus Morgenland bringen dem Kinde Jesu Geschenke, welches die Mutter Maria auf dem Schooß hält. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 32 Zoll, breit 31 Zoll Transakt.: Unbekannt 1795/11/14 HBPAK 0048 Albrecht Dürer I Ein Christus=Kopf. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 >/« Zoll, breit 7 % Zoll Transakt.: Unbekannt 1795/11/14 HBPAK 0066 Albrecht Dürer I Der Heiland macht den Blinden sehend; hinter und neben ihm stehen seine Jünger. Der viele Ausdruck und das schöne Colorit, so wie der Fleiß, mit welchem alles gearbeitet ist, machen dieses Gemähide jeden Verehrer der Kunst vorzüglich schätzbar. Auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 1 Fuß 2 Zoll, breit 11 Zoll Transakt.: Unbekannt 1795/11/14 HBPAK 0083 Albrecht Dürer I Die Hochzeit zu Canaan. An einem Tisch sitzen Braut und Bräutigam, vor demselben der Heiland, daneben die Wasser=Krüge; sehr reich an Figuren, und wegen der fleißigen Arbeit und Lebhaftigkeit der Farben, so wie seines Alterthums sehr schätzbar. Auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 1 Fuß 3 Zoll, breit 1 Fuß 8 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0185 Albrecht Dürer I Maria in einer Landschaft sitzend, Christus aufm Schooss habend, welcher eine Taube in der Hand hält; sehr fleißig gemahlt. Auf Holz. Schwarzer Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 17 Zoll, breit 12 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0225 Albrecht Dürer I Eine biblische Historie. Auf Holz gemahlt. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 26 Zoll, breit 20 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0258 Alb. Dürer I Maria mit dem Christ= Kinde; vortreflich gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 18 Zoll 10 Lin., breit 10 Zoll 3 Lin. Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0095 Albrecht Dürer I Eine betende Magdalena. Sehr gut gemahlt. Auf Kupfer. Goldner Rahm. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 9 Zoll, breit 6 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/02/27 HBPAK 0068 A. Dürer I Eine schöne betende Magdalena, welche das Buch an einem Todtenkopf gelehnet, andächtig die Hände gefaltet, und ihre Augen nach dem Creutze, welches vor ihr hänget, wendet. Ganz vortreflich gemahlt. Auf Holz, im goldnen Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 21 Zoll, breit 26 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0207 Albert Dür I Das Innere eines Tempels, im Vordergrunde, die Beschneidung Christi, alle anwesende Personen in Lebensgröße, sehr schön gemahlt. Auf Holz, schwarzen GEMÄLDE
567
Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 17 Zoll, breit 9 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/12/08 HBPAK 0115 Alb. Durer I Ein alter Mann, der die Vergänglichkeit des Lebens vorstellt, mit einem vor sich auf dem Tische liegenden Todtenkopfe. Auf Holz, im schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 22 Zoll, Breite 29 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0379 A. Dürer I Die Mutter Gottes mit dem Christkinde. Sehr schön von Ausdruck, und ohnerachtet des Alters, gut conservirt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Zoll, breit 6 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0099 Albert Dürer I Christus mit drey Jüngern im Oehlberge, von Albert Dürer. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh Vi Zoll breit 6 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0115 Albert Dürer I Die heiligen drey Könige in der Krippe, von Albert Dürer. Auf Holz. Sehr schön. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 3 Schuh 1 Zoll breit 3 Schuh 8 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0001 Albert Dürer 1 Die Mutter Gottes mit dem Kinde, außen herum verschiedene Kräuter und Blumen, nebst zwey Landschaften, von Albert Dürer. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 3 Schuh 1 Zoll breit 2 Schuh 7 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0330 Albert Dürer I Albert Dürers Bildnis, von ihm selbst. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 2 Schuh breit 1 Schuh 7 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN1 0039 Dürer (Albrecht) I Ein im Baad sitzende am obern Leib ganz entblößte schöne Frau; die rechte Hand haltet sie auf dem Tisch u. hat eine Nelke; eine Schüssel mit Obst steht auf dem Tisch, nach welcher ein schöner Knabe greift; im zweiten Plan hat eine ländliche Frau mit heiterer Miene ein saugendes Kind an der Brust. In Entfernung haltet eine Magd eine gelbe Kanne am Brunnen in den Armen. Der Hintergrund ist mit schönen Holzarbeiten geendiget, vor dem Ganzen ist eine prächtige Drapperie von glänzendem Colorit, mit Blumensträuße geziert. I Mat.: auf Holz Maße: 36 Zoll hoch, 28 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN2 0023 Dürer (Albrecht) I Ein Hauptstückt von diesem Künstler, eines Raphaels würdig. Es stellet ein Inneres von einem Tempel zu Jerusalem vor, der für die heil. Familie geweihet ist. In desselben Mitte siehet man Maria mit dem Jesukind, welchem ein Weintraube gereicht wird; siebenzehn Figuren in verschiedene Plane sind so gut angebracht, daß an diesem Stück nichts zu wünschen übriget, welches nebst diesem durch die Schönheit des Kolorits und beste Erhaltung erhoben wird. I Mat.: auf Holz Maße: 33 Zoll hoch, 25 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN2 0152 Dürer (Albert) I Eine heil. Familie, Maria hält das Kind Jesu auf dem Tische. Joseph steht hinter ihr. Dies Bild ist preciös gemahlt und gut gehalten. I Mat.: auf Holz Maße: 17 Zoll hoch, 13 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Dürer, Albrecht (und Rubens) 1744/05/20 FRAN 0201 Rubens; Durer I 1 Alte Extra schöne Landschafft = Rubens & Durer. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 2 Schuh, Breite 2 Schuh 7 Zoll Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt
Dürer, Albrecht (oder Dürer, Schule) 1779/04/12 GAAN 0024 A. Dürer oder einem seiner Schüler I Die sich erstechende Lukretia von A. Dürer oder einem seiner Schüler. I Maße: 17 Zoll hoch und 11 Vi Zoll breit Verkäufer: Schöber Transakt.: Unbekannt 568
GEMÄLDE
Dürer, Albrecht (Geschmack von) 1784/08/02 FRNGL 0356 Albert Dürer I Zwey Engel das Schweisstuch Christi haltend, von einem alten guten Meister im Geschmack von Albert Dürer. I Maße: 6 % Zoll breit, 5 Zoll hoch Verkäufer: Β Transakt.: Verkauft (1 fl) Käufer: von Dessau 1784/09/27 FRAN 0020 Albrecht Dürer I Zwey Paßions=Stükke, ganz im Geschmack des Albrecht Dürers. [Deux pieces representantes la passion tout ä fait dans le goüt d'Albert Dürer.] I Maße: 1 Schuh 6 Zoll hoch, 1 Schuh breit Verkäufer: Freyherr von Berberich Transakt.: Verkauft (28.15 fl) Käufer: Müller 1786/04/21 HBTEX 0004 Albrecht Dürer I St. Hieronymus mit dem Creuze Christi und einem Todtenkopf, in einer felsigten Landschaft, im gusto von Albrecht Dürer. I Transakt.: Unbekannt 1793/01/15 LZRST 7029 Dürer I Der Kopf eines alten Mannes, in Dürers Geschmack auf Holz gemahlt, 6 Zoll breit, 8 Zoll hoch, in schwarzem Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: 6 Zoll breit, 8 Zoll hoch Transakt.: Verkauft oder Unverkauft (8 Gr) Käufer: R[ost]
Dürer, Albrecht (Kopie nach) 1768/05/02 KOAN 0032 Albr. Dürer] Eine kleine Grablegung Christi, auf Holz gemahlt; nach Albr. Dürer. I Mat.: auf Holz Verkäufer: Joannes Petrus Süssmilch Transakt.: Unbekannt 1781/05/07 FRHUS 0416 Albrecht Dürer I Adam und Eva im Paradies, fleissig gemahlt nach dem bekannten Kupferstich des Albrecht Dürer. I Maße: 1 Schuh hoch und 9 Zoll breit Verkäufer: Beiruts Transakt.: Verkauft (3.50 fl) Käufer: Heusser 1781/09/10 BNAN 0109 Albrecht Dürer I Adam und Eva im Paradiese; nach Albrecht Dürer, auf Kupfer, von lieblicher Carnation, und ungemein fleißig ausgeführet. g.L. [im schwarzen Rahm mit verguldeten Leisten] I Mat.: auf Kupfer Maße: 10 Zoll hoch, 8 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1786/05/02 NGAN 0049 Albrecht Dürrer I Albrecht Dürrers Bildniß, auf Holz. Zur Rechten ist sein Zeichen mit der Jahrszahl 1500. zur Linken steht, Albertus Durerus Noricus ipsum me propriis sic effingebam coloribus, aetatis anno XXVIII. Es ist eine zu Zeiten Dürers gemachte schoene Copey nach dem Portrait auf dem hiesigen Rathhauß. Nach Dürer. I Mat.: auf Holz Maße: 2 Schuh 3 Zoll hoch, 1 Schuh 7 Zoll breit Inschr.: 1500 Albertus Durerus Noricus ipsum me propriis sie effingebam coloribus, aetatis anno XXVIII. (datiert und Inschrift) Verkäufer: von Hagen Transakt.: Unverkauft (100 fl Schätzung) 1789/08/18 HBGOV 0021 Nach Albrecht Dürer I Maria mit dem Christkinde, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 22 % Zoll, breit 17 % Zoll Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1664 Nach Albr. Dürer I Ein Portrait in uralter Kleidung, auf Holz, in einer metallisirten Ram. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 4 Schuh 4 Zoll, Breite 2 Schuh 1 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0113 F. S. Η.; A. Durer I Maria hält den Leichnam Christi auf ihrem Schooß. Sehr fein mit dem Grabstichel in einem silbernen Platte gestochen. Nach A. Durer von F. S. Η. I Kopie von Monogrammist F.S.H. nach Dürer Maße: Hoch 8 Zoll, breit 6 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1793/09/18 HBSCN 0152 nach A. Durer I Christus Kopf, mit Beyschrift. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Vi Zoll, breit 9 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/08/10 MMAN 0205 Albert D"urer I Ein Portrait, nach Albert Dürer auf Holz. I Mat.: auf Holz Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Verkauft (11 fl) 1800/11/12 HBPAK 0569 A. Dürre I Zwey Figuren; die Hoffnung und Gerechtigkeit, nach A. Dürre. I Transakt.: Unbekannt
Dürer, Albrecht (Manier) 1775/05/08 OGAN 0258 Albrecht Dürer I Ein Gemälde, St. Hieronymus in der Einöde, auf ein Crucifix sehend, mit vielen Thieren umgeben, auf Albrecht Dürers Art, auf Holz gemalt. [Une peinture sur bois, Albert Durer. Elle represente St. Jerome au desert, fixant ses yeux sur un crucifix & entoure de beaucoup d'animaux.] I Mat.: auf Holz Maße: 2 Schuh 9 Zoll hoch, und 1 Schuh 10 Vi Zoll breit Verkäufer: Marggräfinn Augusta Sibylla von Baaden=Baaden Transakt.: Unbekannt (50 [?]) 1778/09/28 FRAN 0309 Alb. Dürer I Ein Muttergottesbild mit dem Jesuskind, in der Manier von Alb. Dürer. [Une S. Vierge avec l'enfant Jesus, dans le gout d'Alb. Dürer.] I Maße: 1 Schuh 4 Zoll breit, 1 Schuh 9 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (5 fl) Käufer: Prinß ν Dessau 1791/09/26 FRAN 0642 Albrecht Dürer I Zwey Portraits von mittlerm Alter, so schön wie Albrecht Dürers geschmolzener Pinsel. I Diese Nr.: Ein Portrait von mittlerm Alter Maße: 13 Zoll hoch, 11 Zoll breit Anm.: Die Lose 642 und 643 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt
Dürer.] I Mat.: auf Kupfer Maße: 1 Fuß 3 Zoll hoch, 1 Fuß breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (15 fl) 1794/09/00 LGAN 0022 Albrecht Dürer I Eine äusserst fleißige und reiche Anbetung der Weisen, aus Albrecht Dürers Schule, auf Kupfer, in einer antiken verguldten Rahme. I Mat.: auf Kupfer Maße: breit 1 Schuh 3 Zoll, hoch 1 Schuh Verkäufer: [Friedrich Karl Ludwig, Freiherr von Moser] Transakt.: Unbekannt (100 rh fl Schätzung) 1796/00/00 HLAN [0023] Dürer I Eine reiche Anbetung der Weisen, aus Dürers Schule. 1 Sch. 1 Sch. 3 Z. auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: 1 Sch. 1 Sch. 3 Z. Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: [Friedrich Karl Lang] Transakt.: Unbekannt (55.13 Rt; 100 fl Schätzung) 1798/12/10 WNAN 0033 Dürer I Ein auf einen Todtenkopf deutender alter Philosoph, aus Dürers Schule, von einem unbekannten alten Meister. I Verkäufer: Prof Adam Transakt.: Unbekannt
Dürer, Albrecht (Stil)
1791/09/26 FRAN 0643 Albrecht Dürer I Zwey Portraits von mittlerm Alter, so schön wie Albrecht Dürers geschmolzener Pinsel. I Diese Nr.: Ein Portrait von mittlerm Alter Maße: 13 Zoll hoch, 11 Zoll breit Anm.: Die Lose 642 und 643 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt
1792/02/01 LZRST 4850 Dürer I Der Kopf eines alten Mannes, in Dürers Styl, auf Holz gemahlt, 6 Zoll breit, 8 Zoll hoch, in schwarzem Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: 8 Zoll hoch, 6 Zoll breit Transakt.: Verkauft oder Unverkauft (4 Gr) Käufer: R[ost]
1795/03/12 HBSDT 0216 be. I Transakt.: Unbekannt
Düringer, Daniel
Wie Alb. Durer I Die römische Lie-
1798/12/10 WNAN 0015 Albert Dürer I Eine Vorstellung Maria mit dem Kind, in der Manier Albert Dürers sehr fleissig auf Holz gemahlt, von einem alten deutschen Meister. I Mat.: auf Holz Verkäufer: Prof Adam Transakt.: Unbekannt
1794/00/00 FGAN 0025 Düringer I Eine Landschaft mit Wascherinnen, und ein spielendes Kind mit einem Hunde, auf Tuch gemalt. I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 12 Schuh 4 Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt (9 fl)
Dürer, Albrecht (Schule) Dürr, Georg 1742/08/01 BOAN 0193 Albrecht Düren I Ein kleines Kind mit einem Todten-Kopff von der Schuhle von Albrecht Düren. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0225 Albrecht Düren I Un enfant & une tete de mort, de l'ecole d'Albrecht Düren. I Maße: Haut un pied, un pouce, large dix pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1776/00/00 WZTRU 0442 Allbrecht Dürer I Zwey Köpfe aus der Schule von Allbrecht Dürer. I Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (2 fl Schätzung) 1776/00/00 WZTRU 0443 Allbrecht Dürer I Zwey eben dergleiche Köpfe von nämlicher Schule [Allbrecht Dürer]. I Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (2 fl Schätzung) 1776/00/00 WZTRU 0444 Allbrecht Dürer I Zwey Weibsköpfe von obiger Schule [Allbrecht Dürer] I Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (2 fl Schätzung) 1781/00/00 WZAN 0442 Albrecht Dürer I Zwey Köpfe aus der Schule von Albrecht Dürer. I Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0443 Albrecht Dürer I Zwey eben dergleichen Köpfe von nämlicher Schule [Albrecht Dürer]. I Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0444 Albrecht Dürer I Zwey Weibsköpfe von obiger Schule [Albrecht Dürer] I Transakt.: Unbekannt 1789/00/00 MM AN 0216 Albrecht Dürer I Adam und Eva im Paradeis, auf Kupfer, 1 Fuß 3 Zoll hoch und 1 Fuß breit, aus der Schul des Albrecht Dürer. [Adam et Eve dans le Paradis, sur cuivre, de 1 pied 3 po. de haut, sur 1 p. de large, de lecole [sie] d'Albrecht
1795/11/14 HBPAK 0001 Dürr I Ein Frucht=Stück. Eine Porcellaine Schüßel mit Weintrauben und Apricosen, eine Apfelsina und Kirschen. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 1 Fuß 2 Vi Zoll, breit 1 Fuß 6 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt
Dufresnoy, Charles Alphonse 1791/09/21 FRAN 0044 Alphonse Dufresnoy I Ein reicher Zusammenhang von 30 Figuren, so Moses vorstellt, da er an den Felsen schlug, vorne sind verschiedene Personen, so Wasser aus dem Felsen trinken, hinten ist eine Landschaft, die Abbildung ist nach le Poussin, es ist mit einer großen Ausdrücklichkeit gemalt, die Farben sind geschickt vermischt und es ist ein Meisterstück. I Transakt.: Verkauft (23 fl) Käufer: Hindt
Dughet, Gaspard (Gaspard Poussin) 1743/00/00 BWGRA 0039 Gaspar Poussin I Eine Landschaft von Gaspar Poussin. I Pendant zu Nr. 40 von A. Everdingen Maße: hoch 2 Fuß 6 Zoll, breit 2 Fuß 1 Zoll Transakt.: Unbekannt 1750/10/15 HB AN 0040 Pousin (Casp.) I Eine Landschafft. I Maße: 2 Fuß 9 Vi Zoll hoch, 3 Fuß 6 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1764/05/16 BOAN 0219 Caspar Pussing I Un Pa'isage peint par Caspar Pussing. [Ein Landschaft Von Caspar Pussing.] I Maße: 3 pieds 7 pouces de largeur, 2 pieds 3 pouces de hauteur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (45 Rt) Käufer: Neveu GEMÄLDE
569
1768/07/00 MUAN 0083 Poussin (Casparus Doughet) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0175 Poussin (Casparus Doughet) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
1768/08/16 KOAN 0097 Caspar Poussino I Zwey Römische Prospecten von Caspar Poussino. I Maße: Höhe 1 Fuß, Breite 1 Fuß 6 Zoll Verkäufer: Freyherr von Kaas Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0104 Caspart Poussin I Deux paysages Tun represente la fuite en Egypte, Γ autre une Compagnie de trois personnes. Marques des N o s 843. & 844. I Diese Nr.: La fuite en Egypte Maße: 2. pieds de haut sur 2. p. 6. p. de large Anm.: Die Lose 104 und 105 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: F r a n c i s Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt
1768/07/00 MUAN 0176 Poussin (Casparus Doughet) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
1769/00/00 MUAN 0105 Caspart Poussin I Deux paysages l'un represente la fuite en Egypte, l'autre une Compagnie de trois personnes. Marques des N o s 843. & 844. I Diese Nr.: Une Compagnie de trois personnes Maße: 2. pieds de haut sur 2. p. 6. p. de large Anm.: Die Lose 104 und 105 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: F r a n c i s Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt
1768/07/00 MUAN 0177 Poussin (Casparus Doughet) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
1769/00/00 MUAN 0482 Poussin (Gaspart Doughet dit le) I Un Paysage dans lequel on voit une tres belle architecture. Peint sur toile, marque du No. 83. I Mat.: auf Leinwand Maße: 3. p. 2. p. de haut sur 4. p. 1. p. de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt
1768/07/00 MUAN 0178 Poussin (Casparus Doughet) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
1769/00/00 MUAN 0483 Poussin (Gaspart Doughet dit le) I Deux Paysages. Peints sur toile, marques des Nos. 175. & 176. I Diese Nr.: Un Paysage Mat.: auf Leinwand Maße: 1. p. 10. p. de haut sur 2. p. 6 Vi. p. de large Anm.: Die Lose 483 und 484 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt
1768/07/00 MUAN 0487 Poussin (Casparus Doughet) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0488 Poussin (Casparus Doughet) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0810 Poussin (Casparus Doughet) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus ein e m Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0811 Poussin (Casparus Doughet) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus ein e m Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0812 Poussin (Casparus Doughet) \ [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus ein e m Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0843 Poussin (Casparus Doughet) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0844 Poussin (Casparus Doughet) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/08/16 KOAN 0072 Caspar Poussino I Eine Landschaft von Caspar Poussino mit Figuren. I Maße: Höhe 2 Fuß, Breite 2 Fuß 6 Zoll Verkäufer: Freyherr von Kaas Transakt.: Unbekannt 570
GEMÄLDE
1769/00/00 MUAN 0484 Poussin (Gaspart Doughet dit le) I Deux Paysages. Peints sur toile, marques des Nos. 175. & 176. I Diese Nr.: Un Paysage Mat.: auf Leinwand Maße: 1. p. 10. p. de haut sur 2. p. 6 Vi. p. de large Anm.: Die Lose 483 und 484 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0485 Poussin (Gaspart Doughet dit le) I Deux Paysages. Peints sur toile, marques des Nos. 177. & 178. I Diese Nr.: Un Paysage Mat.: auf Leinwand Maße: 1. p. 5. p. de haut sur 2. pieds de large Anm.: Die Lose 485 und 486 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0486 Poussin (Gaspart Doughet dit le) I Deux Paysages. Peints sur toile, marques des Nos. 177. & 178. I Diese Nr.: Un Paysage Mat.: auf Leinwand Maße: 1. p. 5. p. de haut sur 2. pieds de large Anm.: Die Lose 485 und 486 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: F r a n c i s Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0487 Poussin (Gaspart Doughet dit le) I Deux Paysages avec des tres belles vües. Peints sur toile, marques des Nos. 487. & 488. I Diese Nr.: Un Paysage avec des tres belles vües Mat.: auf Leinwand Maße: 2. p. 3. p. de haut sur 2. p. 10 l A de large Anm.: Die Lose 487 und 488 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0488 Poussin (Gaspart Doughet dit le) I Deux Paysages avec des tres belles vües. Peints sur toile, marques des Nos. 487. & 488. I Diese Nr.: Un Paysage avec des tres belles vües Mat.: auf Leinwand Maße: 2. p. 3. p. de haut sur 2. p. 10 Ά de large Anm.: Die Lose 487 und 488 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0489 Poussin (Gaspart Doughet dit le) I Deux Paysages dans lesquels on voit plusieurs personnes qui ceüillent le fruits de dessus les arbres, & d'autres occupies ä le ramasser & ä le transporter. Peints sur toile, marques des Nos. 810. & 811. I Diese Nr.: Un Paysage dans lesquels on voit plusieurs personnes qui ceüillent le fruits de dessus les arbres Mat.: auf Leinwand Maße: 2. p. 10. p. de haut sur 3. p. 9. de large Anm.: Die Lose 489 und 490
wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0490 Poussin (Gaspart Doughet dit le) I Deux Paysages dans lesquels on voit plusieurs personnes qui ceüillent le fruits de dessus les arbres, & d'autres occupees ä le ramasser & ä le transporter. Peints sur toile, marques des Nos. 810. & 811. I Diese Nr.: Un Pay sage dans lesquels on voit plusieurs personnes qui ceüillent le fruits de dessus les arbres Mat.: auf Leinwand Maße: 2. p. 10. p. de haut sur 3. p. 9. de large Anm.: Die Lose 489 und 490 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0491 Poussin (Gaspart Doughet dit fej I Un Paysage avec differentes figures. Peint sur toile, marque du No. 812. I Mat. : auf Leinwand Maße: 2. p. 6 Vi. p. de haut sur 3. p. 7 Vi. de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1788/06/12 HBRMS 0010 C. Poußin I Italienische Gegenden mit Landleuten im Vorgrunde, in der Entfernung mit Städten und Schlössern, Wasser und Gebürgen: mit freyem Pinsel gemalt. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Eine Italienische Gegend Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 14 Vi Zoll, breit 14 Vi Zoll Anm.: Die Lose 10 und 11 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1788/06/12 HBRMS 0011 C. Poußin I Italienische Gegenden mit Landleuten im Vorgrunde, in der Entfernung mit Städten und Schlössern, Wasser und Gebürgen: mit freyem Pinsel gemalt. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Eine Italienische Gegend Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 14 Vi Zoll, breit 14 Vi Zoll Anm.: Die Lose 10 und 11 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1788/10/01 FRAN 0059 Caspar Poussin I Eine Landschaft, vorstellend die Würkung eines Gewitters mit Figuren. I Format: rund Maße: 9 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (7 fl) Käufer: von Schmid 1789/00/00 MMAN 0135 Caspar Poussin I Eine Landschaft, auf Leinw. [Un paysage, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 5 Zoll hoch, 2 Fuß breit [1 pied 5 pouces de haut, 2 pieds 2 pouces de large] Anm.: Die Dimensionen unterscheiden sich in der deutschen und französischen Fassung des Katalogs. Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (15 fl) 1790/02/04 HBDKR 0074 Caspar Dughet I Eine gebürgigte Landschaft bey Sonnen Untergang, mit Gebäuden und Staffage, sehr stärkt gemahlt, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 15 Zoll, breit 22 Zoll Transakt.: Verkauft (1 M) 1790/08/13 HBBMN 0037 Caspar Dugh. Poussin I Gegenden mit vieler Waldung und durchfliessenden Gewässer, reich an Staffage. Sehr kräftig gemahlt. Auf L[einwand]. G.R. [Goldnen Rahm] I Diese Nr.: Eine Gegend mit vieler Waldung und durchfliessenden Gewässer, reich an Staffage Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 11 Zoll, breit 13 Zoll Anm.: Die Lose 37 und 38 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (8 Μ für die Nm. 37 und 38) Käufer: Eckhardt 1790/08/13 HBBMN 0038 Caspar Dugh. Poussin I Gegenden mit vieler Waldung und durchfliessenden Gewässer, reich an Staffage. Sehr kräftig gemahlt. Auf Lfeinwand], G.R. [Goldnen Rahm] I Diese Nr.: Eine Gegend mit vieler Waldung und durchfliessenden Gewässer, reich an Staffage Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 11 Zoll, breit 13 Zoll Anm.: Die Lose 37 und 38 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (8 Μ für die Nm. 37 und 38) Käufer: Eckhardt 1794/00/00 FGAN [B]0055 Caspar Pousin I Zwo Landschaften, stafiert mit vielen Figuren und Vieh, auf Tuch gemalt. I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Schuh 10 Zoll hoch, 2 Schuh 5 Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt 1796/00/00 BSAN 0012 Gaspard Dughet, dit Poussin I Un Paysage, apres le coucher du soleil, ome de beaux arbres. Un berger et
une femme assis au bord d'un ruisseau, attendent une autre femme qui sort de derriere des arbres. Un troupeau de moutons va rentrer dans une ferme. Dans le fond, un village ä clocher, et des montagnes. I Mat.: auf Leinwand Maße: Haut de 2 pieds 1 pouce; large de 2 pieds 7 pouces Verkäufer: Merian l'aine Transakt.: Unbekannt (35) 1796/00/00 BSAN 0013 Gaspard Dughet, dit Poussin I Un Paysage de nuit. La lune eclaircit le feuille des arbres, et blanchit les nuages. On distingue ä un certain eloignement, un chateau fort avec ses tours et ses murs garnis de creneaux. Sur le devant, une eau assez large. Trois hommes vetus en longues robes ä la Grecque, s'approchent d'un bateau qui arrive au bord. Sur ce bateau, sont deux hommes qui le conduisent, et une femme assise qui leur parle, ä mains jointes. Le Paysage est du plus grand effet, par la teinte tranquille et melancolique, que la nuit repand sur la nature. I Mat.: auf Leinwand Maße: Haut de 1 pied 9 pouces; large de 2 pieds 3 pouces Verkäufer: Merian l'aine Transakt.: Unbekannt (15) 1796/02/17 HBPAK 0184 Caspar Duchet I Eine römische Schloss=Gegend mit Wasser=Fall und Figuren. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 11 Vi Zoll, Breite 15 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (42 M) Käufer: Τ 1797/04/20 HBPAK 0121 Gasper Poussin I Eine Landschaft. Im Vordergrunde ist eine Frau, welche zu einem sitzenden Manne spricht. Diese Composition ist nach der Manier von Claude Lorraine. Das Colorit und das Ganze bringt eine bewundernswürdige Wirkung hervor. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 26 Zoll, breit 32 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0263 C. Poussin I Eine vortrefliche Landschaft, mit Wald und Häusern im Hintergrunde. Vorne befinden sich Personen, Pferde ec. Dieß Stück ist von sehr schönem Effect. Auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 22 Zoll, breit 21 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 LZAN 0014 Gaspard Dughet, sur nomme le Guaspre, oü le Poussin I Un Paysage d'une touche moelleuse et soignee, de la plus grande beaute. I Maße: Hauteur 24 pouces, largeur 30 pouces Transakt.: Unbekannt (25 Louis Schätzung) 1799/00/00 LZRCH 0077 Gaspar Poussin I Deux paysages, petits tableaux, fort jolis. I Mat.: auf Leinwand Maße: h. 5.1. 9. pouces Verkäufer: J F Rauch Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0029 Caspar Dughet genannt Poussin I Zwey Landschaften, von Caspar Dughet genannt Poussin. Auf Leinw. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 4 Zoll breit 1 Schuh 2 Zoll Anm.: Die Lose 29 und 30 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0030 Caspar Dughet genannt Poussin I Zwey Landschaften, von Caspar Dughet genannt Poussin. Auf Leinw. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 4 Zoll breit 1 Schuh 2 Zoll Anm.: Die Lose 29 und 30 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0347 Caspar Dughet genannt Poussing I Zwey bergige Landschaften, von Caspar Dughet genannt Poussing. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine bergige Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 3 Zoll breit 2 Schuh 8 Zoll Anm.: Die Lose 347 und 348 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0348 Caspar Dughet genannt Poussing I Zwey bergige Landschaften, von Caspar Dughet genannt Poussing. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine bergige Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 3 Zoll breit 2 Schuh 8 Zoll Anm.: Die Lose 347 und 348 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
571
1799/00/00 WZAN 0544 Caspar Dughet genannt Poussin I Zwey Landschaften, von Caspar Dughet genannt Poussin. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 4 Zoll breit 3 Schuh 3 Zoll Anm.: Die Lose 544 und 545 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0545 Caspar Dughet genannt Poussin I Zwey Landschaften, von Caspar Dughet genannt Poussin. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 4 Zoll breit 3 Schuh 3 Zoll Anm.: Die Lose 544 und 545 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0239 Caspar Dughet genannt Poussing I Zwey Landschaften, von Caspar Dughet genannt Poussing. Auf Leinwand. Sehr schön. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh 1 zoll breit 4 Schuh 6 Zoll Anm.: Die Lose A239 und A240 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0240 Caspar Dughet genannt Poussing I Zwey Landschaften, von Caspar Dughet genannt Poussing. Auf Leinwand. Sehr schön. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh 1 zoll breit 4 Schuh 6 Zoll Anm.: Die Lose A239 und A240 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Dughet, Gaspard (Gaspard Poussin) (Geschmack von) 1792/02/01 LZRST 4868 C. Poussin I Eine Landschaft mit einer Felsenhöhle. Ein gutes Bild im Geschmack von C. Poussin, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: 14 Vi Zoll hoch, 19 Zoll breit Transakt.: Verkauft oder Unverkauft (14 Gr) Käufer: R[ost] 1793/01/15 LZRST 7035 C. Poussin I Eine Landschaft mit einer Felsenhöhle, im Geschmack von C. Poussin, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: 14 Vi Zoll hoch, 19 Zoll breit Transakt.: Verkauft oder Unverkauft (8 Gr) Käufer: R[ost]
Dughet, Gaspard (Gaspard Poussin) (Manier) 1779/09/27 FRNGL 1009 Caspar Poussin I Eine kleine Landschaft, in der Manier von Caspar Poussin. [Un paysage dans le gout de Gaspar Poussin.] I Maße: 1 Schuh hoch, 14 Zoll breit Transakt.: Verkauft (2 fl) Käufer: Hofrath ν Heyden 1787/00/00 HB AN 0440 Wie Caspar Dughet I In einem Walde liegt Hagar an einem Baume, welcher durch einen Engel den Ort der Quelle gezeigt wird, um ihren in der Feme liegenden Sohne vom Tode zu erretten. Sehr richtig gezeichnet und brav gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] s.R. [in schwarzem Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 19 Zoll, breit 15 Zoll Transakt.: Verkauft (6 M) Käufer: Fesser [?] 1789/01/19 LZRST 3938 G. Poussin I 2 schöne Landschaften, in G. Poussins Manier, von einem guten unbekannten Meister auf Kupfer gemalt in schw. Rahm mit gold. Leiste. I Mat.: auf Kupfer Maße: 18 Zoll breit, 13 Vi Zoll hoch Verkäufer: Pf Transakt.: Verkauft (3.20 Th) Käufer: Strahl
Dujardin, Karel 1750/00/00 KOAN 0103 Charles du Jardin I Un Pai'sage avec 3. Figures, & un Cheval, tres ingenieux, sur toile ä vue de pais. I Mat.: auf Leinwand Maße: Largeur 1 Pies 2 Pouces, Haut 1 Pies 5 Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0134 Charles du Jardin I Des Italiens jouant, piece de 5. Figures, & de quelques animaux, du Grand gout, 572
GEMÄLDE
& d'un Bon pinceau, sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: Largeur 1 Pies 5 Pouces, Haut 1 Pies 1 Vi Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1767/00/00 KOAN 0073 Carl du Jardin I Eine Landschaft mit drey Figuren und einem Pferd von Carl du Jardin. I Maße: Breite 1 Fuß 9 Vi Zoll, Höhe 2 Fuß Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0426 Jardin (Carolus du) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1775/02/25 HBBMN 0091 Carl du Jardin I Ein kleines Stück mit Figuren und Ruderibus. I Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0004 Carl du Jardin I Ein paar reisende Personen, die ein bepacktes Maulthier mit sich führen, sind im Begriffe, durch einen Fluß zu waden. Im Schatten einiger hohen Stämme weidet ein Büffel. In einer von der Sonne erhellten Kapelle sitzt ein Götze, und in der Entfernung ziehen noch einige Reisende vorüber. [Deux voyageurs, qui menent un mulet charge, sont sur le point de passer une riviere ä pied. Un bufle pait ä l'ombre de quelques arbres eleves. Dans une chapelle eclairee par le soleil est accroupie une pagode. Le lointain offre encore quelques voyageurs.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 8 Zoll hoch, 2 Fuß 3 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0040 Carl du Jardin I Eine bergichte Gegend. Im Vorgrunde treiben Hirten ihre kleine Heerde durch einen seichten Fluss. In der Ferne wird ein ungeheurer Felsen von der Sonne an einem warmen Sommerabend beleuchtet. Auf Holz. [Un paysage montagneux. Sur le premier plan on voit des bergers qui sont passer une riviere basse ä leur petit troupeau. Dans le lointain le soleil eclaire un rocher enorme pendant une soiree d'ete. Sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 10 Vi Zoll hoch, 1 Fuß 2 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1782/09/30 FRAN 0050 Carl du Jardin I Narcissus am Brunnen, schön und fleisig ausgearbeitet von Carl du Jardin. [Narcisse ä la fontaine, tres belle piece, par Charles Du Jardin.] I Maße: 1 Vi Zoll hoch, 6 Vi Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (18 fl) Käufer: Mevius 1786/10/18 HBTEX 0135 C. du Schardin I Zwey vortreflich gemahlte ländliche Vorstellungen. Vor einem Bauernhause wird eines Herrn Pferd zu trinken gegeben, vor welchem er stehet und zusiehet. Zu dessen Compagnon eine bergigte sandigte Gegend; im Vorgrunde eine stehende roth=braune Kuh und zwey liegende Schaafe; in etwas entfernter Gegend zur Rechten treibet ein Hirte aus einem Gehöfte Pferde auf die Weyde. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine vortreflich gemahlte ländliche Vorstellung. Vor einem Bauernhause wird eines Herrn Pferd zu trinken gegeben, vor welchem er stehet und zusiehet; Pendant zu Nr. 136 Mat.: auf Holz Maße: Hoch 14 Zoll, breit 15 Zoll 9 Linien Anm.: Die Lose 135 und 136 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/10/18 HBTEX 0136 C. du Schardin I Zwey vortreflich gemahlte ländliche Vorstellungen. Vor einem Bauernhause wird eines Herrn Pferd zu trinken gegeben, vor welchem er stehet und zusiehet. Zu dessen Compagnon eine bergigte sandigte Gegend; im Vorgrunde eine stehende roth=braune Kuh und zwey liegende Schaafe; in etwas entfernter Gegend zur Rechten treibet ein Hirte aus einem Gehöfte Pferde auf die Weyde. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine bergigte sandigte Gegend: im Vorgrunde eine stehende roth=braune Kuh und zwey liegende Schaafe; Pendant zu Nr. 135 Mat.: auf Holz Maße: Hoch 14 Zoll, breit 15 Zoll 9 Linien Anm.: Die Lose 135 und 136 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1788/10/01 FRAN 0163 Carl du Jardin I Ein Viehstück mit einem Ochsen, Schaaf und zwey Figuren. I Maße: 15 Zoll hoch, 18 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (34.15 fl) Käufer: Schneidewind 1790/01/07 MUAN 0294 Jardin Carl du I Zwey niederländische Hirtenstücke mit Figuren, einem gepackten weißen Maulthier, und andern Thieren, auf Leinwat. I Diese Nr.: Ein niederländisches Hirtenstück mit Figuren, einem gepackten weißen Maulthier, und andern Thieren Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 8 Zoll, Breite 3 Schuh 2 Zoll Anm.: Die Lose 294 und 295 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0295 Jardin Carl du I Zwey niederländische Hirtenstücke mit Figuren, einem gepackten weißen Maulthier, und andern Thieren, auf Leinwat. I Diese Nr.: Ein niederländisches Hirtenstück mit Figuren, einem gepackten weißen Maulthier, und andern Thieren Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 8 Zoll, Breite 3 Schuh 2 Zoll Anm.: Die Lose 294 und 295 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/04/13 HBLIE 0136 Carl du Jardyn I Zwey plaisante Land= und Wassergegenden, mit gebürgigter Holzung und Staffage; ganz vortreflich gemahlt. Auf Leinw. I Diese Nr.: Eine plaisante Land= und Wassergegend, mit gebürgigter Hölzung und Staffage Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 12 Zoll, breit 11 Zoll Anm.: Die Lose 136 und 137 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (1.14 Μ für die Nrn. 136 und 137) Käufer: Ego 1790/04/13 HBLIE 0137 Carl du Jardyn I Zwey plaisante Land= und Wassergegenden, mit gebürgigter Hölzung und Staffage; ganz vortreflich gemahlt. Auf Leinw. I Diese Nr.: Eine plaisante Land= und Wassergegend, mit gebürgigter Hölzung und Staffage Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 12 Zoll, breit 11 Zoll Anm.: Die Lose 136 und 137 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (1.14 Μ für die Nrn. 136 und 137) Käufer: Ego 1791/09/21 FRAN 0090 Charles Dujardm I Eine bergigte Landschaft, wo man zur Rechten unten an einem Hügel einen Bauern und eine Bäuerinn sieht, so beschäftiget sind, Ziegen zu melken, zur Linken ist ein großer Haufen Kühe, und in der Entfernung ist eine Menge kleines Vieh. I Transakt.: Verkauft (71 fl) Käufer: Levy 1794/00/00 HB AN 0009 Carl du Jardin I Im Vorgrunde einer warmkolorirten Landschaft treibt ein junges Bauermädchen ihre kleine Heerde zusammen, neben ihr reitet ein Mann auf einem Esel, sein nakter Rücken ist von vorzüglich schöner Karnation. Auf einem sich im Mittelgrunde erhebenden Felsen ragen die Ruinen einer Warthe hervor. I Maße: Höhe 19 Vi Zoll, Breite 24 Vi Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 HB AN 0057 Carl du Jardin I In einer hüglichten Landschaft hütet ein Hirt seine Heerde. Vorzüglich zart ist, in diesem fleissig gemahlten Blatt, der Hirt ausgeführet. I Maße: Höhe 14 Zoll, Breite 18 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 HB AN 0108 C. du Jardin I An einem klaren Wasser, im Vorgrunde unter einer alten Eiche sitzend, badet ein Jüngling seine Füsse. Hinter der Eiche liegt eine friedliche Hütte. I Maße: Höhe 18 Zoll, Breite 15 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 LZAN 0004 Karle Du Jardin I Un Tableau representant une place publique en Italie oü un empirique en costume analogue ä l'art qu'il professe, avec tous ses attribute et accessoires, debite du haut de son treteau, force charlatanneries et remedes pretendus ä une foule de badauds en tout genre attires par ce spectacle. Ce tableau reunit verite dans tous les details, expression et varieti piquante dans les attitudes; le tout d'un excellent ton de couleur et du meilleur tems de ce peintre. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hauteur 21 pouces, largeur 26 pouces Transakt.: Unbekannt (35 Louis Schätzung)
1799/00/00 LZRCH 0053 Karel Du Jardin I Un paysage, on y voit des ruines des figures et animaux; ce tableau d'un effet piquant, est d'un couleur suave, et d'un pinceau tres fondu. I Mat.: auf Holz Maße: h. 9.1. 12. pouces Verkäufer: J F Rauch Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0164 Carl du Jardin genannt Bocksbart I Zwey Viehestückchen, von Carl du Jardin genannt Bocksbart. Auf Kupfer. I Diese Nr.: Ein Viehestückchen Mat.: auf Kupfer Maße: hoch 5 Zoll breit 6 Vi Zoll Anm.: Die Lose 164 und 165 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0165 Carl du Jardin genannt Bocksbart I Zwey Viehestückchen, von Carl du Jardin genannt Bocksbart. Auf Kupfer. I Diese Nr.: Ein Viehestückchen Mat.: auf Kupfer Maße: hoch 5 Zoll breit 6 Vi Zoll Anm.: Die Lose 164 und 165 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/10/18 LZAN 0098 Dujardin I Ein Viehstück. I Verkäufer: Rauch Transakt.: Verkauft (36 Th) Käufer: Schwarze 1800/00/00 BLBOE 0032 du Jardin I Eine stehende Kuh, hinter welcher zwei Esel liegen und einer steht. Im Hintergrunde ein Bauernhaus und eine Bäuerin, die etwas auf dem Kopfe trägt. Im Vordergrunde ein bellender Hund. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt
Dujardin, Karel (Manier) 1796/12/07 HBPAK 0062 Wie du Jardin I Eine Rudera mit Figuren. I Transakt.: Unbekannt
Dukre [Nicht identifiziert] 1782/07/00 FRAN 0018 Dukre I Zwey Bauemstücke von Dukre. I Diese Nr.: Ein Bauernstück Maße: 9 Zoll hoch, 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 18 und 19 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] fl für die Nrn. 18 und 19) 1782/07/00 FRAN 0019 Dukre I Zwey Bauernstücke von Dukre. I Diese Nr.: Ein Bauernstück Maße: 9 Zoll hoch, 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 18 und 19 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] fl für die Nrn. 18 und 19)
Dullaert, Heyman 1763/00/00 BLAN 0044 Heymann Dullaert I Eine geistliche Vorstellung. Ganze Figuren, auf Holz gemahlt, 1 Fuß 7 Zoll hoch, und 2 Fuß breit. Die Hauptfigur ist die Maria mit dem Kinde Jesus. Hinterwärts siehet man den Joseph an einem Stücke Holz zimmern. Dieses ist eins der ersten Stücke, welche dieser Meister verfertiget hat: Denn man entdecket darinn, daß er noch sein Muster in der Nachahmung gesucht habe; und daß seine Fertigkeit noch keine lange Uebung kenne. Es ist jemand so unverschämt gewesen, auf diesem Gemähide den Nahmen des Rembrandt zu setzen; allein der Unterschied ist so merklich, daß man ihn mit halben Augen gewahr werden kann. [Text hier gekürzt] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 7 Zoll hoch, und 2 Fuß breit Verkäufer: Johann Gottlieb Stein Transakt.: Unbekannt
Dumont, Jacques (Le Romain) 1796/02/17 HBPAK 0230 J. Dumont 17291 Die vier Jahrs=Zeiten, durch halbgekleidete Nymphen vorgestellt. Knie=Stücke lebensgrosse Figuren. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 53 Zoll, Breite 38 Zoll Inschr.: 1729 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Verkauft (156 M) Käufer: Friederich GEMÄLDE
573
1796/11/02 HBPAK 0003 Du Mont le Romain, Cassanova's Lehrer I Eine Historie aus Ovid, vorstellend den König Lyrius, indem er den jungen Triptolomeus ermorden will, wird aber von der Göttin Ceres abgehalten, und in einem Löwen verwandelt. Sowohl die Zeichnung als das Colorit, Licht und Schatten dieses Gemähldes, ist aufs vortreflichste angebracht. Auf Leinwand. Goldner Rahm. I Mai.: auf Leinwand Maße: Hoch 22 Zoll, breit 30 Zoll Transakt.: Unbekannt
Dunouy, Alexandre Hyacinthe 1798/06/04 HBPAK 0273 Dunony I Eine Landschaft mit Berg und Thal. Von sehr angenehmen Colorit und herrlicher Haltung. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 10 Zoll, breit 16 Zoll Transakt.: Unbekannt
Dunster, W. de [Nicht identifiziert] 1776/04/15 HBBMN 0107 W. de Dunster, 1634 I Ein Prinz, so Kronen und Scepter verachtet, ein schönes Gemälde. I Maße: Höhe 1 Fuß 9 Zoll, Breite 1 Fuß 4 Vi Zoll Inschr.: 1634 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unverkauft
Du Pan [Nicht identifiziert] 1800/07/09 HBPAK 0076 Du Pan I Un chateau au pied du quel est un Chemin avec 2 Cavaliers. Dans le lointain un camp. Sur bois. I Maße: 15 pouces de hauteur. Sur 17 pouces de largeur Transakt.: Unbekannt
Duplessis, C. Michel H. 1796/02/17 HBPAK 0077 M.H. Duplessis I Nahe an einer steinernen Brücke, unter welcher ein Wasserfall, steht eine Frau, die mit einem im Grase sitzenden Hirten spricht; neben ihnen steht eine Kuh und zwey Schaafe; weiter hin stehen und sitzen einige Leute, und auf der Brücke befinden sich noch Zwey. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 14 Zoll, Breite 18 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (101 M) Käufer: Janssen 1796/02/17 HBPAK 0181 Hamon Duplessis. 17911 Ein Campagnen Stück. Zur Linken auf einer Anhöhe ist ein Marquetenter= Zelt, hinter welchem ein Bagage=Wagen hervorragt. Zur Rechten reitet ein Officier auf einem Schimmel und hinter demselben steht ein anderes Pferd, wovon der Reiter abgestiegen. Auf Holz. I Mat. : auf Holz Maße: Höhe 8 Vi Zoll, Breite 11 Vi Zoll Inschr.: 1791 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Verkauft (32 M) Käufer: Packi 1796/11/02 HBPAK 0132 Duplessis I Zwey Landschaften; auf dem Einen, wo vor einer Schmiede ein Pferd beschlagen wird; auf dem Andern steht jemand vor einem Wirthshause, und füttert sein Pferd. Ganz im Wouvermannschen Geschmack. Auf Holz. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine Landschaft; wo vor einer Schmiede ein Pferd beschlagen wird Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 Zoll, breit 9 Zoll Anm.: Die Lose 132 und 133 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0133 Duplessis I Zwey Landschaften; auf dem Einen, wo vor einer Schmiede ein Pferd beschlagen wird; auf dem Andern steht jemand vor einem Wirthshause, und füttert sein Pferd. Ganz im Wouvermannschen Geschmack. Auf Holz. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine Landschaft; jemand steht vor einem Wirthshause, und füttert sein Pferd Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 Zoll, breit 9 Zoll Anm.: Die Lose 132 und 133 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 574
GEMÄLDE
1800/07/09 HBPAK 0085 Duplessis I Repos de Cavalerie. Sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: 8 pouces de hauteur. Sur 11 pouces de largeur Transakt.: Unbekannt
Dupont 1796/02/17 HBPAK 0199 Dupont I Eine waldigte Land= und Wasser=Gegend. In der Mitte über dem Fluss ist eine steinerne Brücke, welche nach einem zerfallenen Gebäude führt. Vorne am Ufer wird gefischt. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 9 Zoll, Breite 12 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (101.8 M) Käufer: Τ
Dupont (und Thibault, J.T.) 1796/02/17 HBPAK 0141 Dupont; Thieback I Eine römische Land= und Wasser=Gegend mit Staffage. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 11 Vi Zoll, Breite 14 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (40 M) Käufer: Kreuter
Dupont (Pointie) (und Schoevaerdts, M.) 1788/10/01 FRAN 0071 Dupont; Schovaert I Eine waldigte Landschaft mit Figuren, besonders fleißig ausgemalt von Dupont & Schovaert. I Maße: 9 Zoll hoch, 12 Zoll breit Transakt.: Verkauft (11 fl) Käufer: Schneidewind
Dupuis, Pierre 1775/04/12 HBNEU 0037 Dupui I Ein Still=Leben mit Früchten und Federwild, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Transakt.: Unbekannt
Dusart, Cornells 1744/05/20 FRAN 0137 J. Dussart I 2 Schöne Bauern Stück. I Diese Nr.: 1 Schönes Bauern Stück Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 3 Zoll, Breite 1 Schuh Anm.: Die Lose 137 und 138 wurden zusammen katalogisiert. Der Name des Künstlers ist angegeben als "J. Dussart", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1744/05/20 FRAN 0138 J. Dussart I 2 Schöne Bauern Stück. I Diese Nr.: 1 Schönes Bauern Stück Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 3 Zoll, Breite 1 Schuh Anm.: Die Lose 137 und 138 wurden zusammen katalogisiert. Der Name des Künstlers ist angegeben als "J. Dussart", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1763/00/00 BLAN 0051 Cornelius Düsart I Eine Bauern=Gesellschaft. Auf Holz gemahlt, 1 Fuß 2 Zoll hoch, und 1 Fuß 7 Zoll breit. Die verschiedenen Beschäftigungen dieser Bauern und ihr heiteres Vergnügen, das sie dabey empfinden, sind in diesem Stücke sehr schön ausgedrückt. Colorit und Haltung verdienen auch Beyfall. Düsarts fließender und fleißiger Pinsel hat zuweilen Gemähide hervorgebracht, die so schön sind, als hätte sie ein Ostade verfertiget. Und da dieses Mannes Werke, wie bekannt ist, so rar sind, daß die Liebhaber derselben sie nicht allein mit entsetzlich großen Summen bezahlen müssen, wenn ihnen einmahl eins davon vorkommt; sondern man auch selten, wollte man gleich keinen Preis achten, von ihm ein Gemähide bekommen kann. [Text hier gekürzt] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 2 Zoll hoch, und 1 Fuß 7 Zoll breit Verkäufer: Johann Gottlieb Stein Transakt.: Unbekannt 1763/11/09 FRJUN 0064 Dussard I Un homme qui fume du tabac. I Maße: hauteur 7 Vi pouces, largeur 6 Vi pouces Transakt.: Verkauft (3.45 fl) Käufer: Staedel
1770/10/29 FRAN 0154 Dussart I Ein Bauer mit einem Römer Wein in der Hand. I Maße: Hoch 7 Zoll. Breit 6 Zoll. Transakt.: Unbekannt 1776/06/28 HBBMN 0049 C. Dussert I Ein Laborante, lebhaft gemahlt, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 2 Zoll, Breite 1 Fuß Transakt.: Unbekannt 1778/09/28 FRAN 0439 Corn. Dussaert I Ein dergleichen [Bauernstück]. [Une pareille [une piece representante des paysans].] I Maße: 14 Zoll breit, 10 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (34 fl) Käufer: Weitsch 1778/09/28 FRAN 0595 Cornelius Dussart I Ein Wundarzt, der einer Frau den Wurm nimmt. [Un Chirurgien ötant le vers ä une femme.] I Maße: 1 Schuh 9 Zoll breit, 1 Schuh 7 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (51 fl) Käufer: Gogel 1779/09/27 FRNGL 0630 Cornel. Düsaert I Ein niederländischer Bauer, welcher Brandtwein feil trägt, mit seiner Frau. [Un paysan flamand, qui vend de l'eau de vie, avec sa femme.] I Maße: 9 Zoll hoch, 6 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (8 fl) Käufer: Hüsgen modo Burger
1796/02/17 HBPAK 0198 Duval I Eine Landschaft mit Wasserfall und Gehölze wie auch Staffirung. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 7 VA Zoll, Breite 9 Zoll Transakt.: Verkauft (36.8 M) Käufer: Τ 1800/07/09 HBPAK 0029 Du val I Pay sage representant 1' entree d'un bois avec une percee qui laisse entrevoir une horizon ä perte de vue: sur le devant une femme au pied d'un arbre avec un Enfant et un chien. Le premier plan est enrichi de plantes et de vegetaux. 25 p. de haut. Sur 20 p. larg. Le pendant du meme maitre et de meme mesure. I Maße: 25 pouces de hauteur. Sur 20 pouces de largeur Transakt.: Unbekannt
Duynen, Gerardt van 1794/09/09 HBPAK 0041 G. v. Deynum I Ein sehr fleißig gemahltes Stilleben mit Früchte und vielen Nebensachen. Auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 25 Zoll, breit 32 Zoll Transakt.: Unbekannt
Duys
1784/08/02 FRNGL 0717 Cornelius Düsart I Zwey lustige Niederländische Bauren=Figuren in einer angenehmen Landschaft, im Tenierischen Geschmack. I Maße: 6 Vi Zoll breit, 9 Zoll hoch Transakt.: Verkauft (5 fl) Käufer: Reinhard
1744/05/20 FRAN 0080 ν. Duys I 1 Hund. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 7 Zoll, Breite 8 Zoll Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt
1789/06/06 HBPAK 0014 C. Düssart I Eine Baurenconversation, vortreflich gemahlt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Vi Zoll, breit 7 Zoll Transakt.: Verkauft (7 M) Käufer: Schmeichel
Duyster, Willem Cornelisz.
1794/00/00 HB AN 0046 Cornel, du Sart I Eine kleine Baurenfamilie verzehrt ihr ländliches Mahl in einer friedlichen Hütte, die von dem durch ein kleines Fenster einfallenden Licht schön erleuchtet wird. I Maße: Höhe 13 Vi Zoll, Breite 11 Vi Zoll Verkäufer: Leonelli Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0153 Corneille Duseert I Zwey alte Köpfe; der eine, ein alter bärtiger Mann; und das andere, eine alte Frau. Sie sind auf einmal mit starken Farben aufgetragen; zwey ausserordentlich schöne Bilder. Auf Leinwand. Schwarzer Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein alter Kopf; ein alter bärtiger Mann Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 25 Vi Zoll, breit 20 Zoll Anm.: Die Lose 153 und 154 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0154 Corneille Duseert I Zwey alte Köpfe; der eine, ein alter bärtiger Mann; und das andere, eine alte Frau. Sie sind auf einmal mit starken Farben aufgetragen; zwey ausserordentlich schöne Bilder. Auf Leinwand. Schwarzer Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein alter Kopf; eine alte Frau Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 25 Vi Zoll, breit 20 Zoll Anm.: Die Lose 153 und 154 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 BLBOE 0078 C. Dussard I Zwei Wanderer sitzen vor einem Hause und unterreden sich. Zu ihren Füßen liegen ihre Reisebündel und ein wachsamer Hund. I Mat.: auf Leinwand Transakt.: Unbekannt
1800/00/00 BLBOE 0079 Dyster I Eine Rauferei aus den Ritterzeiten. Mehrere Personen sind im Handgemenge, in einer Scheune, begriffen. Eine Menge Sachen liegen umher. Vielleicht ist es eine Probe zur theatralischen Vorstellung. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt
Duyts, Jan de 1794/09/09 HBPAK 0005 /. de Duyts I Die Mutter Gottes mit dem Kinde, und Neben=Figuren, in einer Landschaft. Auf Leinewand, ohne Rahm. I Mat. : auf Leinwand Maße: Hoch 48 Zoll, breit 69 Zoll Transakt.: Unbekannt
Dyck, Abraham van 1785/05/17 MZAN 0543 Dyk van Alkemar! Ein alter Philosoph von Dyk van Alkemar. [Un vieux philosophe.] I Maße: 2 Schuh 9 Zoll hoch, 3 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (6 fl) Käufer: Geh R ν Heuser 1785/05/17 MZAN 0571 Dyck van Alkemar I Der H. Petrus von Dyck van Alkemar. [Une tete de S. Pierre.] I Maße: 2 Schuh 8 Zoll hoch, 2 Schuh 1 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (17 fl) Käufer: Vic Lustberger
Dyck, Anthonie van Dusart, Cornells (Kopie nach) 1775/05/08 HBPLK 0150 Dussart I Ein Brillen=Händler, nach Dussart. I Maße: Höhe 11 Zoll 10 Linie, Breite 9 Zoll 2 Linie Transakt.: Unbekannt
Duval 1796/02/17 HBPAK 0152 Duval I Zwey gebirgigte Land= und Wasser=Gegenden mit Hirten, Rindern, Schaafen und Ziegen. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 10 Zoll, Breite 12 % Zoll Transakt.: Verkauft (25 M) Käufer: Koch
1670/04/21 WNHTG 0057 Antonio van Dych I II Ritratto di Carlo Primo Re d'Inghilterra colla Regina sua Consorte di tutta statura sino a' ginocchi. I Maße: Alto pal. 4 diti due, largo sei Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt Gegenw. Standort: Kromeriz, Ceska republika. Arcibiskupsky zamek. 1670/04/21 WNHTG 0058 Antonio van Dych I II Ritratto del Regnante Re d'Inghilterra, con un cane. I Maße: Alto tre palmi, e otto dita, largo palmi tre Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt 1716/00/00 FRHDR [A]0015 Deick I Von Deick Contrefait selbst. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (225) GEMÄLDE
575
1716/00/00 FRHDR [A]0016 Deick I Von Deick 4 Konige aus Engelland. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (4700) 1716/00/00 FRHDR [AJ0032 Deick I Von Deick ein dito [manns köpf]. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (225) 1716/00/00 FRHDR [A]0061 Deick I Von Deick ein Pourtrait. Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (30) 1716/00/00 FRHDR 0004 Deick I Von Deick ein dito [Winterstuk] auf den Eysz schleiffendes Stuk. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (60) 1716/00/00 FRHDR 0103 Deick I Von Deick ein Mutter Gottes Bild. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (30)
1742/08/30 BOAN 0150 Van Deick I Une decolation, par Van Deick. I Maße: Haut 1. pie 1. pouce, large 10. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0154 Van Deick I Portrait d'un Amirai, par Van Deick. I Maße: Haut 3. pies 9. pouces, large 2. pies 10. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0183 Van Deick I Portrait d'un Espagnol avec un chien, par Van Deick. I Maße: Haut 3. pies 5. pouces. large 2. pi6s 7. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt
1716/00/00 FRHDR 0171 Deick I Von Deick die Schlacht Senaiherib [sic]. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (175)
1743/00/00 BWGRA 0041 Chev. Anton van Dyk I Ein unvergleichlicher Kopf sehr natürlich und hardi gemahlet von Chev. Anton van Dyk. I Maße: hoch 1 Fuß 10 Zoll, breit 1 Fuß 8 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt
1723/00/00 PRAN [A]0015 Van Dyck I Ein Contrefait / vom Van Dyck. I Maße: Höhe 2 Vi Schuh 4 Zoll, Breite 2 Schuh 2 Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt
1743/00/00 BWGRA 0042 Chev. Anton van Dyk I Noch ein Manns=Kopf vom vorigen maltre [Chev. Anton van Dyck]. I Maße: hoch 1 Fuß 2 Zoll, breit 1 Fuß 8 Zoll Transakt.: Unbekannt
1723/00/00 PRAN [A]0038 Van Dick I Ein Contrafait / von Van Dick. I Maße: Höhe 2 Schuh 5 Zoll, Breite 1 Vi Schuh 3 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt
1743/00/00 BWGRA 0183 Dyk I Ein kleiner Kopf von Dyk. I Pendant zu Nr. 184 von C. Poelenburgh Maße: hoch 4 Zoll, breit 3 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt
1723/00/00 PRAN [A]0048 Van Dyck l Zwey Contrefaits / vom Van Dyck. I Diese Nr.: Ein Contrefait Maße: Höhe 2 Schuh 5 Zoll, Breite 1 Vi Schuh 3 Vi Zoll Anm.: Die Lose [A]48 und [A]49 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt
1749/07/31 HB RAD 0019 A. v. Dyk I Die Enthauptung eines Heiligen. I Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (7 [?])
1723/00/00 PRAN [A]0049 Van Dyck \ Zwey Contrefaits / vom Van Dyck. I Diese Nr.: Ein Contrefait Maße: Höhe 2 Schuh 5 Zoll, Breite 1 Vi Schuh 3 Vi Zoll Anm.: Die Lose [A]48 und [A]49 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0016 van Deick I Ein S. Joannis Kopff Original vom van Deick. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0130 van Deick I Zwey Stuck, vvorauff zwey kleine Kinder Köpftger. Ein Original von van Deick. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0174[b] van Deick I Z w e y Portrait. Eines von der Schuhle von Titian, und das anderes vom van Deick. I Diese Nr.: Ein Portrait; Nr. 174[a] Schule des Tiziano Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0203 van Deick I Ein Grisaille Stuck. Original von van Deick. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0283 Dack I Eine Enthauptung. Eine Exquise von Dack. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0316 van Deick I Zwey kleine Stuck Orig. von van Deick. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0508 Van Deick I Noch ein schöner Manns Kopff, von selbigem [van Dyck]. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0094 Van Deick I Tete de S. Jean Baptiste, par van Deick. I Maße: Haut 1. p. 5. pou. large 1. p. 2. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0107 Van Deick I S. Sebastien, par Van Deick. I Maße: Haut 1. pie, 4. pou. large 1. pied Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0141 Van Deick I Un Geographe, par Van Deick. I Maße: Haut 1. pie, large 1. p. 3. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0148 Van Deick I Une tete de Vieillard & celle d'un enfant, par Van Deick. I Maße: Haut 10. pouces, large 8. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 576
GEMÄLDE
1749/07/31 HB RAD 0083 A. v. Dyk I Ein Heiliger. I Verkäufer: Denner Transakt. : Unbekannt (4.4) 1750/00/00 KOAN 0175 Antoine van Dyck lUn Portrait d'homme, sur bois, belle touche d'Antoine van Dyck. I Mat.: auf Holz Maße: Largeur 1 Pies 4 Pouces, Haut 1 Pies 6 Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollem Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0176 Antoine van Dyck I Autre piece, du meme gout, bien conservee, sur bois, par le meme [Antoine van Dyck]. I Mat.: auf Holz Maße: Largeur 1 Pies 7 Pouces, Haut 1 Pies 10 Vi Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollem Transakt.: Unbekannt 1750/04/00 HB AN 0004 Anth. van Dyck I Die Taufe Christi durch Johannem, in der frühen Zeit von Anth. van Dyck. I Transakt.: Unbekannt 1750/04/00 HB AN 0038 A. v. Dyck I Ein Portrait von einem Knaben, von A. v. Dyck. I Transakt.: Unbekannt 1750/04/00 HB AN 0048 van Dyck I Ein Stück mit zwey Kindern aus der Schule, von van Dyck. I Transakt.: Unbekannt 1750/04/00 HB AN 0082 Antonii van Dyck I Portrait eines Knabens, von Antonii van Dyck. I Transakt.: Unbekannt 1750/10/15 HB AN 0019 Dyck (Anth. van) I Ein Knaben=Kopf, ein Escquise. I Maße: 1 Fuß 5 Vi Zoll hoch, 1 Fuß 2 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1752/05/08 LZAN 0149 Anton de Dück I Eines grossen Herren Portrait mit Cürass von Anton de Dück gemahlt, im Holl. Rahmen. I Maße: 1 V* Elle hoch, 1 Vs Elle breit Transakt.: Verkauft (12 Th) Käufer: a ν b [?] 1759/00/00 LZEBT 0128 Anton van Dyck I Die Liebe unter dem Bilde einer Frauens Persohn mit 3 Kindern vorgestellt auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 4 Schuh 2 Vi Zoll, Breite 5 Schuh 5 Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (1000 Th Schätzung) 1763/00/00 BLAN 0019 Anton van Dyk I Zwey Bildnisse. Halbe Figuren, Lebensgröße, auf Leinewand gemahlt, 3 Fuß 5 Zoll hoch, und 2 Fuß 9 Zoll breit. Das erste ist eine artige hübsche Frau in schwarzer Kleidung, mit einem weissen krausen Kragen um den Hals. Die rechte Hand läßt sie seitwärts fallen und faßt damit nach ihrem Kleide. Die linke hält sie vor sich. Lauter Leben und Natur! Van Dyk stellt hier das Natürliche einer stillen sittsamen Schöne,
mit schmeichelnden Pinsel vor. Wie reitzend steht sie da! Das Colorit ist angenehm; und Wahrheit und Lebhaftigkeit sind in dieser vortreflichen Vorstellung, ungemein rührend ausgedruckt. Das andere Bildniß ist ein Mann in seinen besten Jahren, der eben so schön und kunstvoll wie die Frau vorgestellet ist. Er ist schwarz gekleidet und hat auch einen weissen Kragen um den Hals. Die rechte Hand hält er auf den Rücken und mit der linken faßt er seinen Mantel. Die Stellungen dieser beyden Personen sind überhaupt ohne allen Zwang, frey und schön gezeichnet; aber noch schöner gemahlet. Wer einen guten und feinen Geschmack hat, dem werden diese Stücke angenehme Gegenstände der Betrachtung und Bewunderung seyn; da sie eine Zierde der allerbesten Galerien sind. [Text hier gekürzt] I Diese Nr.: Ein Bildniß von einer Frau in schwartzer Kleidung mit einen weissen Kragen um den Hals Mat.: auf Leinwand Maße: 3 Fuß 5 Zoll hoch, und 2 Fuß 9 Zoll breit Anm.: Die Lose 19 und 20 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Gottlieb Stein Transakt.: Unbekannt 1763/00/00 BLAN 0020 Anton van Dyk I Zwey Bildnisse. Halbe Figuren, Lebensgröße, auf Leinewand gemahlt, 3 Fuß 5 Zoll hoch, und 2 Fuß 9 Zoll breit. Das erste ist eine artige hübsche Frau in schwarzer Kleidung, mit einem weissen krausen Kragen um den Hals. Die rechte Hand läßt sie seitwärts fallen und faßt damit nach ihrem Kleide. Die linke hält sie vor sich. Lauter Leben und Natur! Van Dyk stellt hier das Natürliche einer stillen sittsamen Schöne, mit schmeichelnden Pinsel vor. Wie reitzend steht sie da! Das Colorit ist angenehm; und Wahrheit und Lebhaftigkeit sind in dieser vortreflichen Vorstellung, ungemein rührend ausgedruckt. Das andere Bildniß ist ein Mann in seinen besten Jahren, der eben so schön und kunstvoll wie die Frau vorgestellet ist. Er ist schwarz gekleidet und hat auch einen weissen Kragen um den Hals. Die rechte Hand hält er auf den Rücken und mit der linken faßt er seinen Mantel. Die Stellungen dieser beyden Personen sind überhaupt ohne allen Zwang, frey und schön gezeichnet; aber noch schöner gemahlet. Wer einen guten und feinen Geschmack hat, dem werden diese Stücke angenehme Gegenstände der Betrachtung und Bewunderung seyn; da sie eine Zierde der allerbesten Galerien sind. [Text hier gekürzt] I Diese Nr.: Ein Bildniß von einem Mann in schwarz gekleidet und hat auch einen weissen Kragen um dem Hals Mat.: auf Leinwand Maße: 3 Fuß 5 Zoll hoch, und 2 Fuß 9 Zoll breit Anm..· Die Lose 19 und 20 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Gottlieb Stein Transakt.: Unbekannt 1763/01/19 FRJUN 0002 Antoine van Dyk I Un excellent tableau representant un homme assis dans un appartement & jouant du clavessin sa femme ä cote de lui, menanr [sic] un enfant. Ce tableau admirablement peint est d'une grande beaute. I Maße: hauteur 12 Vi pouces, large 16 pouces Transakt.: Unbekannt (140 V* fl) 1763/01/19 FRJUN 0003 Antoine van Dyck I Une parreille süperbe pifece representant la sainte Vierge tenant l'Enfant Jesus sur ses genoux d'un coloris fondu & vigoureux. I Maße: hauteur 14 pouces, large 12 pouces Transakt.: Unbekannt (60 fl) 1763/01/19 FRJUN 0147 Van Dyk I Une Tfete de Vieillard peinte avec hardiesse. I Maße: hauteur 18 Vi pouces, large 16 pouces Transakt.: Unbekannt (12 fl) 1764/00/00 BLAN 0124 A. van Dyck I Salvator Mundi, halbe figur auf leinwand gemahlt Extra schön. I Mat.: auf Leinwand Maße: 4 Fuß 5 Zoll hoch, 3 Fuß 8 Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (1500 Rt Schätzung) 1764/00/00 BLAN 0131 A: v: Dyk I Jupiter und Antiopa gantze figur auf leinwand gemah. I Mat.: auf Leinwand Maße: 4 Fuß 2 Zoll hoch, 5 Fuß 8 Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (1500 Rt Schätzung) 1764/00/00 BLAN 0432 van Dyck I 1. sehr schöner Kopf. I Maße: 2 Fuß 1 hoch, 1 Fuß 7 Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (250 Rt Schätzung) Gegenw. Standort: Sankt-Peterburg, Rossiya. Ermitazh. (N 553)
1764/00/00 BLAN 0483 van Dyck I 2. Portraits in Knie stücken, daß eine Carl den lten daß ander aber maria von Bourbon seiner gemahlin vorstellend. I Diese Nr.: Ein Portrait, Carl der lte Maße: 4 Fuß 6 Zoll hoch, 3 Fuß 5 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 483 und 484 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (1000 Rt für die Nrn. 483 und 484, Schätzung) 1764/00/00 BLAN 0484 van Dyck I 2. Portraits in Knie stücken, daß eine Carl den lten daß ander aber maria von Bourbon seiner gemahlin vorstellend. I Diese Nr.: Ein Portrait, maria von Bourbon Maße: 4 Fuß 6 Zoll hoch, 3 Fuß 5 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 483 und 484 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (1000 Rt für die Nm. 483 und 484, Schätzung) 1764/06/06 BOAN 0604 Antoine van Dyck I Deux Tableaux d'un pied onze pouc. de largeur, deux pieds trois pouces de hauteur, dont Tun representante un Portrait d'une Femme en habit noir & collet blanc, 1'autre un Homme en meme habillement ä demi figure de grandeur naturelle, peints par Antoine van Dyck. [Zwey stück Vorstellend eins ein frawen portrait in schwartzer Kleidung mit weißen Kragen, dan andertes Ein mans portrait mit selbiger Kleydung halbe figur in Lebensgröße, gemahlt Von Anton van Dyck.] I Maße: 1 pied 11 pouc. de largeur, 2 pieds 3 pouces de hauteur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (151 Rt) Käufer: Hof C Rath Broggia 1764/06/06 BOAN 0606 Am. v. Dyck I Un Tableau de quatre pieds trois pouces de haut, trois pieds trois pouc. de larg. representant un Portrait d'un Admiral Hollandois, ä demi figure de grand, naturelle peint par Ant. ν. Dyck. [Portrait Eines holländischen Schifadmirals, Ein Kniestück in Lebensgröße, gemahlt Von Anton van Dyck, so in etwa beschädiget.] I Maße: 4 pieds 3 pouces de haut. 3 pieds 3 pouc. de larg. Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (61 Rt) Käufer: Hof C Rath Broggia 1764/06/06 BOAN 0615 Van Dyck I Un Tableau de quatre pieds onze pouces de hauteur, trois pieds onze pouces de largeur, representant le Portrait de la Reine de France Marie de Medicis, ä demi figure de grandeur naturelle, peint par van Dyck. [Ein portrait der Königin in franckreich Maria de Medicis ein Kniestück in Lebensgröße gemahlt Von van Dyck.] I Maße: 4 pieds 11 pouces de hauteur, 3 pieds 11 pouces de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (30.10 Rt) Käufer: Broggia 1764/06/07 BOAN 0633 Antoine van Dyck I Deux Portraits d'un Homme & d'une Femme ä demi figure de deux pieds deux pouces de hauteur, d'un pied neuf pouces de largeur, peint par Antoine van Dyck. [Zwey stück Vorstellend portraiten man und fraw, brust-stücker, gemahlt Von Anton van Dyck.] I Maße: 2 pieds 2 pouces de hauteur, 1 pied 9 pouces de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (110 Rt) Käufer: Hof C Rath Broggia 1764/06/07 BOAN 0647 Van Dyck I Un Tableau de deux pieds deux pouces de hauteur, d'un pied huit pouces de largeur, representant St. Ignafe en buste de grandeur naturelle peint par van Dyck. [Ein portrait des heiligen Ignatus Lojola, Bruststück in Lebensgröße, gemahlt Von van Dyck.] I Maße: 2 pieds 2 pouces de hauteur, 1 pied 8 pouces de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (10 Rt) Käufer: Broggia 1764/06/13 BOAN 0664 Antoine van Dyck I Un tableau d'un pied dix pouces de hauteur, d'un pied huit pouces de largeur, representant l'enfant Jesus dans sa gloire, le Globe de la terre en main, peint par Antoine van Dyck. [Ein stück Vorstellend das Kindlein Jesus, in der glorie die weldkugel haltend gemahlt Von Anton van Dyck.] I Maße: 1 pied 10 pouces de hauteur, 1 pied 8 pouces de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (30 Rt) Käufer: Schild GEMÄLDE
577
1764/06/15 BOAN 0679 Antoine van Dyck I Deux Tableaux de deux pieds deux pouces de hauteur, d'un pied huit pouces de largeur, representant l'un le Portrait d'un Homme, l'autre celui d'une Femme, en buste de grandeur naturelle, peints par Antoine van Dyck. [Zwey stück Vorstellend ein portrait eines manns und einer frawenpersohn, Bruststück in Lebensgröße, gemahlt Von Anton van Dyck.] I Maße: 2 pieds 2 pouces de hauteur, 1 pied 8 pouces de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (100 Rt) Käufer: Hof C Rath Broggia 1764/08/25 FRAN 0138 Van Dyck I Les Portraits d'une Femme. I Diese Nr.: Portrait d'une Femme Maße: haut 1 pied 10 Vi pouces sur 1 pied 5 pouces de large Anm.: Die Lose 138 und 139 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1764/08/25 FRAN 0139 Van Dyck \ Les Portraits d'une Femme. I Diese Nr.: Portrait d'une Femme Maße: haut 1 pied 10 Vi pouces sur 1 pied 5 pouces de large Anm. : Die Lose 138 und 139 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1764/08/25 FRAN 0244 van Dyck I Portrait d'une femme. I Maße: haut 2 pieds 10 pouces sur 2 pieds de large Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1764/08/25 FRAN 0347 van Dyck I Le portrait d'une jeune fille. I Maße: haut 9 pouces sur 7 pouces de large Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1764/08/25 FRAN 0351 Van Dyck I Un portrait. I Maße: haut 2 pieds 3 pouces sur 1 pied 8 Vi pouces de large Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1764/08/25 FRAN 0423 van Dyck I Un Ecce homo touche tres vigoureusement et en maitre. I Maße: haut 1 pied 9 Vi pouces sur 1 pied 3 pouces de large Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRRAU 0011 A. van Dyk I Einen Holländischen Admiral vorstellend. Das Ernsthaffte hat Van Dyk in diesem Bild besonders hervorgebracht, da er aber das gantze Bild im Colorit sehr sombre gehalten, so thut die rothe Binde, welche der Admiral um den Leib träget, und mit Franzen garnirt ist, dem Auge sehr wohl. Die rechte Hand hat er in die Seite gestellt, und mit dem lincken Arm lieget er auf einem Buch, in der Hand einen Circkel haltend; gantz hinten hinaus ist eine Flotte von Schiffen zu sehen. Das gantze Bild ist sehr vest gezeichnet, und er hat sonsten das schmeichlende [sie] seines Penseis hier unvergleichlich verbergen können. Nur ist zu beklagen, daß die Lasur starck daran verwaschen ist. Ohne die verguldete Rahme auf Leinw. gemahlt. Ce tableau represente un Admiral Hollandois. Van Dik a particulierement bien exprime le serieux en cette piece. Mais comme il a fait le colons tres-sombre, l'echarpe rouge que l'Amiral a autour de son corps, qui est gamie de frange, fait plaisir ä l'oeil. II y a la main droite au cote & le bras gauche est apu'ie sur un livre tenant un compas ä la main. On voit bien dans l'61oignement une flotte. Toute la piece est bien dessinee & il a tres-bien sü cacher la flatterte de son pingeau. II est aureste ä plaindre, que le vernis en est un peu gate. Sans la bordure doree & peint sur de la toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 4 Schuh 4 Zoll, breit 3 Schuh 4 Zoll Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRRAU 0088 Anton van Dyk I Ein Portrait eines Mannes, so gut gezeichnet, und eine unvergleichliche Haltung von Licht und Schatten. C'est le portrait d'un homme, qui est bien dessine avec une parfaite ordonnance pour ce qui regarde l'ombre & le jour. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 2 Schuh 3 Zoll, breit 1 Schuh 9 Zoll Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRRAU 0089 Ant. van Dyk I Ein Frauens=Portrait, feurig von Colorit und recht gut gemahlt. C'est est le portrait d'une femme, le colons est tout enflame & tres-bien peint. I Mat.: auf Holz 578
GEMÄLDE
Maße: Hoch 2 Schuh 3 Zoll, breit 1 Schuh 9 Zoll Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRRAU 0090 Ant. van Dyk I Ein Manns=Portrait mit einem etwas erschrockenem Gesicht, aber mit Wahrheit der Natur brav gemahlt und gut gezeichnet. C'est le portrait d'un homme avec un visage un peu craintif, mais resemblant la nature vigoureusement peint & bien dessine. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 2 Schuh 3 Zoll, breit 1 Schuh 9 Zoll Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRRAU 0091 Ant. van Dyk I Ein Frauens=Portrait, gut gezeichnet, und voller Schönheit und Kunst. Die Höhe und Breite ist wie das obige. C'est le portrait d'une femme, qui est bien dessine plein d'art & de beaute. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 2 Schuh 3 Zoll, breit 1 Schuh 9 Zoll Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRRAU 0092 Ant. van Dyk I Ein Manns=Portrait mit einer Hand, eben so vest gezeichnet, als gut gemahlt. C'est encore le portrait d'un homme avec une main, qui est aussi vigoureusement dessine & peint. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 2 Schuh 3 Zoll, breit 1 Schuh 9 Zoll Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRRAU 0093 Ant. van Dyk I Ein Frauens=Portrait mit einer Hand; das Portrait ist so fleißig gemahlt, als brav gezeichnet; was aber die Hand anlangt, lasse ich Kennern zu beurtheilen. Encore un portrait de femme avec une main; ce portrait est tres-bien peint & dessine; Mais pour ce qui regarde la main, j'en laisse le jugement aux connoisseurs. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 2 Schuh 3 Zoll, breit 1 Schuh 9 Zoll Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRRAU 0206 Ant. van Dyck I Vorstellend das Portrait des heiligen Ignatius. Representant le portrait de St. Ignace. Peint sur du bois. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 2 Schuh 2 Zoll, breit 1 Schuh 10 Zoll Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRRAU 0249 Ant. van Dyck I Das Portrait der französischen Königin Mariae de Medicis, ein Knie=Stück; was man nur von des Meisters glücklichem Pinzel zu erwarten hat, ist hier in der grösten Vollkommenheit zu finden. Auf Tuch gemahlt. C'est le portrait de Marie de Medicis Reine de france un Buste; On y trouve dans la plus grande perfection, tout ce qu'on peut attendre de l'heureux pin^eau de ce maitre. Peint sur de la toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 4 Schuh 11 Zoll, breit 3 Schuh 11 Zoll Transakt.: Unbekannt 1765/03/27 FRKAL 0051 Antoine van Dyck I Un Christ ou Crucifix, & au bas les S[ain]tes femmes & S. Jean, aupres des soldats qui jettent le sort pour les habits. I Maße: hauteur 14 pouces, largeur 20 pouces Transakt.: Verkauft (15 fl) Käufer: Kaller 1765/03/27 FRKAL 0052 Antoine van Dyck I Une tete de jeune Garijon tres-bien touche. I Maße: hauteur 12 pouces, largeur 11 pouces Transakt.: Verkauft (3 fl) Käufer: Kaller 1766/07/28 KOSTE [A]0028[H] Van deick I Dito [Portrait] von Van deick. I Anm.: Dieses Los wurde handschriftlich dem Exemplar U B K I hinzugefügt. Transakt.: Unbekannt (12 Rt) 1766/07/28 KOSTE 0002 Anton van Dyck I Ein Stück auf Holz, die Beschneidung Christi zwy [sie] Schuhe hoch, Schetz von Anton van Dyck. I Mat.: auf Holz Maße: 2 Schuhe hoch Transakt.: Unbekannt (35 Rt) 1768/07/00 MUAN 0008 Dyck (Anton van) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0009 Dyck (Anton van) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
1768/07/00 MUAN 0024 Dyck (Anton van) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0025 Dyck (Anton van) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0055 Dyck (Anton van) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0056 Dyck (Anton van) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0115 Dyck (Anton van) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0117 Dyck (Anton van) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0127 Dyck (Anton van) I [Ohne Titel] Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0132 Dyck (Anton van) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0240 Dyck (Anton van) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0241 Dyck (Anton van) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0453 Dyck (Anton van) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0520 Dyck (Anton van) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0775 Dyck (Anton van) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog
wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0802 Dyck (Anton van) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0871 Dyck (Anton van) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0872 Dyck (Anton van) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0908 Dyck (Anton van) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0909 Dyck (Anton van) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1164 Dyck (Anton van) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1165 Dyck (Anton van) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1166 Dyck (Anton van) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1167 Dyck (Anton van) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1168 Dyck (Anton van) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1169 Dyck (Anton van) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1170 Dyck (Anton van) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
579
1769/00/00 MUAN 0373 Dyck (Antoine van) I Le Portrait de Philipe le Roy, sieur de Ravels, vrai connoisseur, & amateur des sciences, & des beaux-arts, dans les Pays-bas, peint jusqu'au genoux, de grandeur naturelle. [Peints sur toile, marques des Nos. 8. & 9.]. I Pendant zu Lot Nr. 374 Mat.: auf Leinwand Maße: 3. p. 9. p. de haut sur 3. p. 3. p. de large Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 374 und beziehen sich auf die Nrn. 373 und 374. Verkäufer: Franfois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0374 Dyck (Antoine van) I Son pendant est le Portrait de sa femme de meme position [jusqu'au genoux]. Peints sur toile, marques des Nos. 8. & 9. I Pendant zu Lot Nr. 373 Mat.: auf Leinwand Maße: 3. p. 9. p. de haut sur 3. p. 3. p. de large Anm.: Die Angaben zum Material im Bildtitel beziehen sich auf die Nrn. 373 und 374. Verkäufer: Franjois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0375 Dyck (Antoine van) I La sainte Vierge qui donne le sein ä l'enfant Jesus & St. Joseph qui est aupres. Peint sur bois, marquee du No. 117.1 Mat.: auf Holz Maße: 2. pieds de haut sur 1. p. 6. p. de large Verkäufer: Franfois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0376 Dyck (Antoine van) I Jesus Christ est eleve en croix. Peint sur toile, marque du No. 115. I Mat.: auf Leinwand Maße: 1. p. 8 Vi. p. de haut sur 1. p. 2 Vi. p. de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0377 Dyck (Antoine van) I Le Portrait de Justus Lipsius, demie figure. Peinte sur bois, marque du No. 127. I Mat.: auf Holz Maße: 2. p. 1. p. de haut sur 1. p. 8 Vi. p. de large Verkäufer: Fran5ois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0378 Dyck (Antoine van) I Saint Martin avec toute sa suite. II est represente ä cheval, & distribuant les pieces de son manteau ä tous les pauvres qui se trouvent pres de lui. Derriere le saint, on voit le peintre Rubens ä cheval, qui lui sert de compagnon. Peint sur toile, marque du No. 151. I Mat.: auf Leinwand Maße: 7. p. 11. p. de haut sur 6. pieds de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0379 Dyck (Antoine van) I Une femme. Peinte sur sur toile jusqu'aux genoux, marquee du No.520. I Mat.: auf Leinwand Maße: 5 Vi. p. de haut sur 1. p. 3 Vi. p. de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0380 Dyck (Antoine van) I Le Portrait du peintre van Dyck en Büste. Peint sur toile, marque du No. 775. I Mat.: auf Leinwand Maße: 2. p. 2 p. de haut sur 1. p. 8. p. de large Verkäufer: Francis Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/03/30 HBTOU 0001 V. Dyk I Ein Familien Stück, worauf 8 Personen befindl. von dem berühmten v. Dyck auf Holz gemahlt. [Die Mehresten in fein verguldte Rahmen, und die übrigen in schwarz gebeizten mit goldenen Staber.] I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 4 Fuß 8 Zoll, Breite 5 Fuß 4 Zoll Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 51 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 51. Transakt.: Unbekannt 1770/10/29 FRAN 0033 Dyk I Die Geißlung Christi. I Maße: Hoch 38 Zoll. Breit 32 Zoll. Transakt.: Unbekannt 1770/10/29 FRAN 0138 Dyk I Die Herodias mit dem Haupt Johannis. I Maße: Hoch 11 Zoll. Breit 6 Zoll. Transakt.: Unbekannt 1771/05/06 FRAN 0007 van Dyck I Ein Portrait eines Manns in spanischer Tracht auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 18 Zoll, breit 14 Zoll Verkäufer: Johann Friederich Armand von Uffenbach Transakt.: Verkauft (12 fl) Käufer: Dr Franck 1771/05/06 FRAN 0105 van Dyck I Ein Christusbild mit dem Creutz, auf dito [Holz]. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 14 Zoll, breit 11 Zoll Verkäufer: Johann Friederich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt 580
GEMÄLDE
1771/05/06 FRAN 0110 van Dyck I Eine Conversation, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 12 Zoll, breit 20 Zoll Verkäufer: Johann Friederich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt 1773/12/18 HBBOY 0063 Transakt.: Unbekannt
Ant. van Dyck I Ein Mannskopf. I
1774/08/13 HBBMN 0010 A. van Dyck I Christus am Kreuz, todt, eine sehr schöne Scizze. I Transakt.: Unbekannt 1775/04/20 HNAN 0294 Ant. van Deyk I Ein Kopfstück von Ant. van Deyk. I Verkäufer: Avgvsti Rvdolphi Iesaiae Bvenemanni Transakt.: Unbekannt 1775/05/15 FRAN 0001 van Dyck I Ein Portrait eines Mannes in spanischer Tracht auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 18 Zoll, breit 14 Zoll Verkäufer: Johann Friedrich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt 1775/05/15 FRAN 0070 van Dyck I Ein Christusbild mit dem Creutz, auf dito [Holz], I Mat.: auf Holz Maße: hoch 14 Zoll, breit 11 Zoll Verkäufer: Johann Friedrich Armand von Uffenbach Transakt.: Unbekannt 1776/00/00 WZTRU 0027 Anton von Dyck I Ein Kopf von 2 Schuhe, 2 Zoll hoch, 1 Schuhe, 11 Zoll breit von Anton von Dyck. Dieser Kopf ist so reizend und natürlich, daß das Aug eines Kenners kann betrogen werden, und man bemerket hierinn den Geist, Colorite, und den beßten Discipel des Peter Paul Rubens. I Maße: 2 Schuhe 2 Zoll hoch, 1 Schuhe 11 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (250 fl Schätzung) 1776/06/21 HBNEU 0101 v. Dyck I Eine St. Magdalena, voller Andacht und Geist, auf Leinw. I Pendant zu Nr. 102 von H. Meijer (I) Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 4 F 7 Z, Breite 3 F 8 Ζ Transakt.: Unbekannt 1777/05/26 FRAN 0454 Antoni v. Deick I Todter Christus mit mehreren Figuren von Antoni v. Deick. I Verkäufer: Finsterwalder Transakt.: Verkauft (11.15 fl) Käufer: Cotrel 1777/05/26 FRAN 0458 Antoni v. Deick I Brustbild v. Antoni v. Deick. I Verkäufer: Finsterwalder Transakt.: Verkauft (1.20 fl) Käufer: Hofrath Gerken 1778/03/28 HBSCM 0040 Anthony van Dyck I Der Marterer= Tod des heil. Laurentii, wie er an der Röste gezogen und von einem Engel gestärket wird; herrlich gezeichnet und geschildert. I Transakt.: Unbekannt 1778/05/16 HBBMN 0055 Ant. v. Dyck I Ein Manns=Portrait, Brustbild. I Transakt.: Unbekannt 1778/05/23 HBKOS 0071 v. Dyck I Eine Maria mit dem Kindlein, eine Esquice, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 48 Zoll, Breite 42 Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/05/23 HBKOS 0082 V. Dyk I Eine heilige Familie mit vielen Engeln im Vorgrunde und in den Wolken, sehr schön gemalt, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 21 Zoll, Breite 26 Zoll Transakt.: Unbekannt (50 M) 1778/08/29 HBTEX 0028 van Dyck I Eine allegorische Ausführung, bestehend in eine Gruppe von vier Figuren, nebst umstehende. I Maße: Höhe 1 Fuß 8 Zoll, Breite 1 Fuß 3 Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/08/29 HBTEX 0056 Anton van Dyck I Das Portrait eines Prinzen von Oranien, von Anton van Dyck, mit Nachdruck. I Maße: Höhe 2 Fuß, Breite 1 Fuß 8 Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/08/29 HBTEX 0066 van Dyck I Eine Esquisse von van Dyck. Dieses Stück ist merkwürdig, weil das Bild, so darnach gemahlet, vom Lord Bullingbrock für 24000 Rthlr. erhandelt worden, aber auf der See verunglückt ist. Das nach diesem Stück in England gestochne Kupfer bezeuget mit mehrem die wahre Geschichte. I Maße: Höhe 1 Fuß 1 Zoll, Breite 1 Fuß 5 Zoll Transakt.: Unbekannt
1778/08/29 HBTEX 0091 von Dyk I Zwey Kinder, so mit Trauben spielen, meisterhaft gemahlt, auf Leinewand, so schön wie von Dyk. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Fuß 2 Zoll, Breite 1 Fuß 9 Zoll Transakt.: Unbekannt
1778/09/28 FRAN 0617 Anton van Dyck I Ein vortrefliches Mannsportrait. [Un tres beau portrait d'homme.] I Maße: 1 Schuh 8 Zoll breit, 2 Schuh 2 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (40 fl) Käufer: Dr Hertzberg
1778/08/29 HBTEX 0093 van Dyck I Carl Stuardt, eine Esquice. I Maße: Höhe 1 Fuß 8 Zoll, Breite 1 Fuß 3 Zoll Transakt.: Unbekannt
1778/09/28 FRAN 0664 Ant. van Dyck I Ein vortrefliches Vesperbild. [Une excellente piece, la S. Vierge tenante le corps de Jesus-Christ detache de la croix.] I Maße: 2 Schuh 9 Vi Zoll breit, 2 Schuh hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (100.30 fl) Käufer: Hoym modo Dr Hartzen
1778/09/28 FRAN 0080 Ant. van Dyck I Ein junger Mann mit schwarzen Haaren. [Un jeune homme avec des cheveux noirs par Ant. van Dyck.] I Maße: 1 Schuh 11 Zoll breit, 2 Schuh 7 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (43 fl) Käufer: Weitsch 1778/09/28 FRAN 0081 Anton van Dyck I Ein wunderschönes Frauen=Portrait in alter Tracht. [Un portrait de femme superieurement beau en habillement ä l'ancienne par Antoine van Dyck.] I Maße: 2 Schuh breit, 2 Schuh 7 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (116 fl) Käufer: Gogel 1778/09/28 FRAN 0127 A. van Dyck I Ein schöner Mannskopf mit schwarzen Haaren und weissem Kragen. [Une belle tete d'homme avec des cheveux noirs & un collet blanc, par A. van Dyck.] I Maße: 1 Schuh 2 Zoll breit, 1 Vi Schuh hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (9.30 fl) Käufer: Sind Hoffmann 1778/09/28 FRAN 0144 Ant. van Dyck I Ein alter Kopf mit schwarzen Haaren. [Une vieille tete avec des cheveux noirs par Ant. van Dyck.] I Maße: 1 Schuh 7 Zoll breit, 2 Schuh 1 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (75.30 fl) Käufer: Weitsch 1778/09/28 FRAN 0145 van Dyck I Eine junge Frau mit schwarzem Schleyer. [Une jeune femme avec un voile noir.] I Maße: 1 Schuh 10 Zoll breit, 2 Schuh 3 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (22.30 fl) Käufer: Nothnagel 1778/09/28 FRAN 0172 Anton van Dyck I Ein mit grossem Gefühl gemaltes Crucifix. [Un crucifix plein d'expression.] I Maße: 1 Schuh 11 Zoll breit, 2 Schuh 9 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (67 fl) Käufer: Canonicus Burger 1778/09/28 FRAN 0209 Anton van Dyck I Ein ungemein schöner Mannskopf mit einem weissen Kragen. [Une trfes belle tete d'homme avec un collet blanc par Antoine van Dyck.] I Pendant zu Nr. 210 Maße: 1 Vi Schuh breit, 2 Schuh hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (151 fl für die Nrn. 209 und 210) Käufer: Sind Hoffmann 1778/09/28 FRAN 0210 Anton van Dyck I Ein Weibskopf, als Compagnon, mit weissem Kragen, von dito [Anton van Dyck]. [Une tete de femme, pendant du precedent, avec un collet blanc, par le meme [Antoine van Dyck].] I Pendant zu Nr. 209 Maße: 1 Vi Schuh breit, 2 Schuh hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (151 fl für die Nrn. 209 und 210) Käufer: Sind Hoffmann 1778/09/28 FRAN 0261 Ant. van Dyck I Ein unvergleichlich schön gemaltes Crucifix. [Un Crucifix sup&ieurement bien peint.] I Maße: 1 Schuh 9 Zoll breit, 3 Schuh hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (103.30 fl) Käufer: Weitsch 1778/09/28 FRAN 0568 van Dyck I Die Mutter Gottes mit einem Jesukind, eines der schönsten Stafeleygemälde. [Une S. Vierge avec Γ enfant Jesus, un des plus beaux tableaux de cabinet.] I Maße: 1 Schuh breit, 1 Schuh 4 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (93 fl) Käufer: Wenner Buchhändl 1778/09/28 FRAN 0613 Ant. van Dyck I Ein Jungfrauenbildniß in schwarzer Tracht. [Le portrait d'une Demoiselle en habillement noir.] I Maße: 1 Vi Schuh breit, 1 Schuh 10 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (86 fl) Käufer: Schütz
1778/10/30 HB KOS 0016 van Dyk I St. Stephanus, wie er mit einem Pfeil durchschossen, mit großem Affect gemahlt, auf Leinwand. Esquice von van Dyk, in Tintorets Manier. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 18 Zoll, breit 13 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0138 Van Dyck, im Geschmack von Tintoret I Das Portrait einer Mannsperson im Profil, mit einem schwarzen Mantel. Auf Holz. [Portrait d'un homme en profil, ajuste d'un manteau noir. Sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 4 Zoll hoch, 1 Fuß breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/09/27 FRNGL 0448 Antonio van Dyk I Ein mit grosem Ausdruck und meisterhaft ausgeführtes Ecce=Homo. [Un Ecce-Homo, piece superieurement bien peinte.] I Maße: 1 Schuh 8 Vt Zoll hoch, 1 Schuh 8 % Zoll breit Transakt.: Verkauft (55.15 fl) Käufer: Hüsgen 1779/09/27 FRNGL 0687 Antonio von Dyk I Ein fürtreflich lebhaft geistreich ausgeführtes Bildniß eines Jünglings, mit einer sehr natürlichen schönen Hand. [Le portrait d'un jeune homme, superieurement bien peint, surtout la main.] I Maße: 2 Schuh 2 Ά Zoll hoch, 1 Schuh 7 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (172 fl) Käufer: Schütz 1779/09/27 FRNGL 1063 Antonio von Dyk I Ein sehr schönes Mutter Gottesbild mit dem Jesukindlein, angenehm und meisterhaft. [La S. Vierge avec l'enfant Jesus, piece superieurement bien peinte.] I Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh breit Transakt.: Verkauft (102 fl) Käufer: Hüsgen 1781/00/00 WRAN 0131 Van Dick (Α.) I Deux enfans de P.P. Rubens, celui qui se voit ä droite accouple deux Chiens levriers, un Singe derriere lui le tire par la manche de son juste-au corps, l'autre sur la gauche appuie contre une Fontaine, ä ses pieds un fusil, au milieu entre les deux un Cheval blanc seile, en haut sur un gros arbre un Aigle perche & ä droite un Peroquet. Süperbe esquise bien terminee & precieuse, peint sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: haut 18 pouces, large 27 pouces Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0132 Van Dick (Α.) I Une esquise, oü se voit le Pape assis sur un Tröne ä trois marches, sur la seconde est la Couronne du Pontif, plusieurs autres Personnages, entr'autre un ä genoux qui refoit une clef de sa Saintete. Grisaille peint sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: haut 5 pouces 3 lignes, large 8 pouces 4 lignes Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0027 Anton von Dyck I Ein Kopf 2 Schuhe, 2 Zoll hoch, 1 Schuhe, 11 Zoll breit von Anton von Dyck ist so reizend und natürlich, daß das Auge eines Kenners kann betrogen werden, und man bemerket hierinn den Geist, die Kolorite, und den beßten Schüler des Peter Paul Rubens. I Maße: 2 Schuhe 2 Zoll hoch, 1 Schuhe 11 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/05/07 FRHUS 0235 Ant. van Dyck I Zwey unvergleichlich schöne Portraite in spanischer Tracht, Lebensgrös von Ant. van Dyck. I Diese Nr.: Ein unvergleichlich schönes Portrait in spanischer Tracht Maße: 6 Schuh 5 Zoll hoch und 3 Schuh 11 Zoll breit Anm.: Die Lose 235 und 236 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (1 fl für die Nrn. 235 und 236) Käufer: Ehrman 1781/05/07 FRHUS 0236 Ant. van Dyck I Zwey unvergleichlich schöne Portraite in spanischer Tracht, Lebensgrös von Ant. van GEMÄLDE
581
Dyck. I Diese Nr.: Ein unvergleichlich schönes Portrait in spanischer Tracht Maße: 6 Schuh 5 Zoll hoch und 3 Schuh 11 Zoll breit Anm.: Die Lose 235 und 236 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (1 fl für die Nrn. 235 und 236) Käufer: Ehrman 1781/05/07 FRHUS 0282 Ant. van Dyck I Christus am Creuz, mit vielem Geist und Natur vorgestellt von Ant. van Dyck. I Maße: 5 Schuh 1 Zoll hoch und 3 Schuh 7 Zoll breit Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (10 fl) Käufer: Kaller 1781/05/07 FRHUS 0347 Anton van Dyck I Der H. Franciscus ein wunder schönes meisterhaftes Bild, mit einer ganz besonderen Würkung in Licht und Schatten gehalten. I Maße: 3 Schuh hoch und 2 Schuh 5 Zoll breit Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (100 fl) Käufer: Halm 1781/07/14 FRAN 0113[H] van Dijck I St. Franciscus ein schönes Brustbild von van Dijck. I Anm.: Dieses Los wurde handschriftlich dem Exemplar SBF hinzugefügt. Verkäufer: Moser Transakt.: Unbekannt (87 fl) 1781/09/10 BNAN 0099 A. v. Dyk I Carl I. und seine Gemahlinn zu Pferde; neben ihnen ein Wasserträger; eine Sybille verkündiget ihm aus einem offengeschlagenen Buche sein Schicksal; zwey andere Frauen stehen hinter ihr; Rosen liegen auf dem Vorgrunde; und eine Glorie von Engeln tragen Cronen, Scepter und Palmen her. Etwas ausgebessert von A. v. Dyk. I Mat.: auf Holz Maße: 22 Zoll hoch, 17 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/09/10 BNAN 0101 van Dyck I Das Bildniß eines Mannes im schwarzen geblümten Kleide, und herumgeschlagenen Mantel, kleinem Kragen, Zwickbart und kurzen Haaren, die Rechtehand auf der Brust, in der Linken die Handschuh. I Pendant zu Nr. 102 Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt 1781/09/10 BNAN 0102 van Dyck I Das Gegenbild stellet ein Frauenzimmer von mittleren Jahren vor, im schwarzen mit goldenen Ketten zugehakten Kleide, einem herunterliegenden Kragen und aufsteiften Ermein von Spitzen; ihre über einander geschlagene Hände sind mit goldenen Ketten und Ringen gezieret; von so schöner und frischer Färbung, wie je Portraits von van Dyck gemahlet sind. I Pendant zu Nr. 101 Mat.: auf Holz Maße: 31 Zoll hoch, 21 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1782/07/00 FRAN 0129 V.Dyk I Ein todter Christus mit der Maria, dem Johannes und zwo Figuren, sehr fleissig und schön gemalt von V. Dyk. I Maße: 1 Schuh 10 Zoll hoch, 1 Schuh 10 Zoll breit Verkäufer: Joh Christian Kißner Transakt.: Unbekannt (6 fl) 1782/09/30 FRAN 0232 Anton van Dyk I Ein unvergleichliches gutes Bildnis von einer etwas bejahrten Frau, von der Meisterhand des Anton van Dyk. [Un portrait excellent d'une femme avancee en äge, par la main de maitre d'Antoine van Dick.] I Maße: 2 Schuh 5 Zoll hoch, 1 Schuh 10 Vi Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (65 fl) Käufer: Grahe
Dyk. [S. Pierre delivre par un ange.] I Maße: 4 Schuh 4 Zoll hoch, 5 Schuh 2 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (40 fl) Käufer: Winterstein 1786/05/02 NGAN 0160 van Dyck I Ein jugendliches Bildnis Kniestück. I Maße: 3 Schuh 11 Zoll hoch, 3 Schuh 1 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft? (200 fl Schätzung) Käufer: Verel 1786/05/02 NGAN 0250 Ant.v. Dyck I Das Portrait eines Antwerpen. I Maße: 8 Vi Zoll hoch, 7 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (36.59 fl) Käufer: Möglich 1786/10/18 HBTEX 0302 Anthoni van Dyck I Magdalena Bussfertigkeit. I Anm.: Dieses Los trägt im Katalog irrtümlicherweise die Nr. 323. Transakt.: Unbekannt 1787/00/00 HB AN 0658 Antonio van Dyck I Das historische Bildniß eines Mannes in bloßem gegen die linke Schulter gewandten Haupte, in einem gelbligten Kleide, über welches ein schwarzer Mantel geworfen, welchen er mit seiner linken Hand zusammen hält. Die Stellung ist edel, und das Colorit lebhaft, wahr und Künstlich. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 24 Zoll, breit 16 Zoll Transakt.: Verkauft (14 M) Käufer: Tietjen 1787/04/03 HBHEG 0060 V. Dyk I Ein Frauens=Portrait mit gezierter altdeutschen Tracht, soll von v. Dyk gemahlt sein, auf ditto [Leinewand]. I Mat.: auf Leinwand Transakt.: Verkauft (1.2 M) Käufer: Bertheau 1787/04/03 HBHEG 0109 A. van Dyk I Ein Damens=Portrait, von A. von Dyk, auf Holz. I Mat.: auf Holz Transakt.: Verkauft (7 M) Käufer: Bertheau 1787/04/03 HBHEG 0113 Ant. van Dyks I Ant. van Dyks Portrait, von ihm selbst gemahlt. I Transakt.: Verkauft (14.4 M) Käufer: Bertheau 1787/04/19 HBTEX 0108 A. v. Dyck I Ein Portrait, schön gemahlt. I Transakt.: Verkauft (4.12 M) Käufer: Böhmer 1787/10/06 HBTEX 0077 Ant. von Dyck I Ein Holländischer Admiral, Kniestück mit Hände, vortreflich gezeichnet. I Transakt.: Unbekannt 1788/06/12 HBRMS A0043 Ant. van Dyk I Benannten Künstlers Portrait, als Ritter: von ihm selbst gemalt; welches in Kupfer gestochen worden von L. Vostermann, und auf Verlangen dazu gegeben werden kann. Auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 25 Zoll, breit 22 Zoll Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0086 van Dyck I H. Muttergottes Kindchen und Elisabeth. [1 p[iece]. un St. Vierge & l'enfant, & Elisabeth.] I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 3 Fuß, Breite 2 Fuß 6 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt
1783/06/19 HBRMS 0125 A. v. Dyck I Die Abnehmung Christi vom Kreutze, grau in grau gemalt. L[einwand]. g.R. [verguldeter Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 2 Zoll hoch, 1 Fuß 7 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
1788/10/01 FRAN 0001 Anton van Dyck I Die Aufrichtung des Creutzes Christi, eine Skizze von dem kühnen Pinsel des Anton van Dyck. I Maße: 25 Zoll hoch, 21 Zoll breit Transakt.: Verkauft (9.15 fl) Käufer: Boy
1785/05/17 MZAN 0017 Anton van Dyck I Ein Kopf von einem gepanzerten Manne der seine Tabackspfeiffe anzündet von Anton van Dyck. [Tete d'un homme en cuirasse, qui allume sa pipe.] I Maße: 2 Schuh hoch, 1 Schuh 7 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (140 fl) Käufer: Melber
1788/10/01 FRAN 0092 A. van Dyck I Die Enthauptung der heil. Barbara, eine Scizze von A. van Dyck. I Maße: 12 Zoll hoch, 14 '/2 Zoll breit Transakt. : Verkauft (5 fl) Käufer: von Schmid
1785/05/17 MZAN 0020 Anton van Dyck I Eines jungen Edelmannes Portrait von Anton van Dyck. [Portrait d'un jeune gentilhomme.] I Maße: 2 Schuh 2 Zoll hoch, 1 Schuh 8 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (78 fl) Käufer: Deitzinger 1785/05/17 MZAN 0147 Anton van Dyk I Der H. Petrus der von einem Engel aus dem Gefängnisse befreyet wird von Anton van 582
GEMÄLDE
1789/00/00 MMAN 0080 Anton van Dyck I Ein Crucifix in Lebensgröse, auf Leinw. [Un crucifix, grandeur d'homme, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 8 Fuß 9 Zoll hoch, 4 Fuß 5 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (150 fl) 1789/00/00 MMAN 0108 Anton van Dyck I Das Portrait eines Jünglings, auf Holz. [Le portrait d'un jeune homme, sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 11 Zoll hoch, 10 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (11 fl)
1789/00/00 MMAN O l l i A. van DyckI Eine schlafende weibliche Unschuld, auf Holz. [Une femme innocente en dormie, sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 8 Zoll hoch, 10 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (1 fl) 1789/00/00 MMAN 0258 Anton van Dyck I Ein weises Pferd, auf Leinw. [Un cheval blanc, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 10 Zoll hoch, 2 Fuß 5 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt 1789/00/00 MMAN 0272 Anton van Dyck I Die Charitas in grau gemalt, auf Holz. [La charite peinte en gris, sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 6 Zoll hoch, 1 Fuß 1 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (33 fl) 1789/00/00 MMAN 0316 Anton van Dyck I Ein Crucifix, auf Leinw. [Un crucifix, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 4 Fuß 7 Zoll hoch, 3 Fuß 6 Zoll breit [4 pieds 7 pouces de haut, 4 pieds 6 pouces de large] Anm.: Die Dimensionen unterscheiden sich in der deutschen und französischen Fassung des Katalogs. Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (50 fl) 1789/08/00 HNAN 0001 v. Dyck I Ein Manns- und ein FrauensPortrait a.L. [auf Leinen] Schw.R.m.g.L. [Schwarze Rahmen mit goldenen Leisten] I Diese Nr.: Ein Manns-Portrait Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 36 Zoll, Breite 29 Zoll Anm.: Die Lose 1 und 2 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1789/08/00 HNAN 0002 v. Dyck I Ein Manns- und ein FrauensPortrait a.L. [auf Leinen] Schw.R.m.g.L. [Schwarze Rahmen mit goldenen Leisten] I Diese Nr.: Ein Frauens-Portrait Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 36 Zoll, Breite 29 Zoll Anm.: Die Lose 1 und 2 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0028 Dyck Ant. van I Ein Portrait eines Malermeisters in einer Kleidung nach alten Kostüm, auf Leinwat, in einer geschnittenen und vergoldeten Ram. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 9 Zoll, Breite 2 Schuh 2 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0423 Dyck Ant. van I Ecce Homo, auf Leinwat, in einer geschnittenen und vergoldeten Ram. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 6 Zoll, Breite 1 Schuh 10 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0980 Dyck Ant. van I Laurentius, auf Leinwat. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 4 Schuh, Breite 3 Schuh 4 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1367 Dyck Ant. van I Christus am Kreuz, auf Leinwat, in einer geschnittenen und vergoldeten Ram. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 4 Schuh 5 Zoll, Breite 2 Schuh 6 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1416 Dyck Ant. van I Ein alter Baumeister mit dem Zirkel in der Hand, mit der Aufschrift: Aetatis suae 55. ao 1649, auf Leinwat, in einer dergleichen [geschnittenen und vergoldten] Ram. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 2 Schuh 6 Zoll, Breite 2 Schuh 3 Zoll Inschr.: Aetatis suae 55. ao 1649 (Inschrift und datiert) Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1436 Dyck Ant. van I Die Kreuzigung Christi, auf Leinwat, in einer eben dergl. [geschnittenen und metallisirten] Ram. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 6 Zoll, Breite 1 Schuh 2 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 2140 Dyck Ant. van I Centaurus entführt eine Nymphe, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 3 Zoll, Breite 1 Schuh 7 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/04/13 HBLIE 0025 Ant. v. Dyk I Die Geschichte Loths mit seinen Töchtern. Grau in grau, von großer Force, Licht und Schatten, ein Esquice, welche mit besonders freyen und starken Pin-
selszügen verfertiget. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 20 Zoll, breit 26 Zoll Transakt.: Verkauft (3.9 M) Käufer: Dellewy 1790/08/25 FRAN 0110 Antoni van Dyck I Eine heilige Geschichte aus der Legende. I Maße: hoch 54 Zoll, breit 40 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (30.15 fl) Käufer: Trautman 1790/08/25 FRAN 0153 Antoni van Dyk I Christus am Creutz. I Maße: hoch 60 Zoll, breit 42 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (9 fl) Käufer: Schneidewind 1791/05/28 HBSDT 0119 Anthon van Dyck I Das Bildnis eines Mannes. In Hämisch, worauf sein lockichtes Haar herunter wallet. Der emsthafte Blick, das lebhafte und doch dabey natürliche Colorit, ohne die vortrefliche und meisterhafte Mahlerey zu gedenken, macht den Kennern dieses Stück sehr schätzbar. Brustbild, in völliger Lebensgrösse, auf Leinewand. In einen dergleichen [mit vielen Zierrathen geschnittenen vergoldeten] Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 15 % Zoll, breit 13 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1791/05/28 HBSDT 0123 Anthon van Dyck I Christus am Kreutze hängend. Der Ausdruck des Sterbens ist in dem Kopfe besonders schön ausgedrückt, und ist überhaupt vortreflich gemahlt, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 29 Zoll, breit 19 Zoll Transakt.: Unbekannt 1791/09/21 FRAN 0003 Van Dyck I Ein Gemälde, das die Herabnehmung Christi vom Kreuze vorstellet; es sind neun Figuren darauf, welche ein sehr prächtiges Ansehen machen, und die Farben sind überaus schön vermischt; dieses Gemälde verdient das schönste Cabinet zu zieren. I Transakt.: Verkauft (60 fl) Käufer: Emerich 1791/09/21 FRAN 0029 Van Dyck I Ein Gang=Gemälde, so Abraham vorstellt, welcher Gott dankt, daß er Isaac, welchen er in seinen Armen hält, gerettet hat, sie sind beyde neben einen Holzhaufen auf den Knien; die eigentliche Vorstellung dieses schönen Stükkes, hat ein gebietherisches und sinnreiches Ansehen und bestätiget den großen Ruhm dieses Künstlers, dessen Werke sehr rar sind, und sehr hoch geschätzet werden; es ist auch von Spanien gebracht, wo die Gemälde dieses Meisters mit Recht in der größten Verehrung gehalten werden. I Transakt.: Verkauft (167 fl) Käufer: ν Döring 1791/09/21 FRAN 0073 Van Dyck I Ein heil. Carolus in tiefer Andacht vor einem Crucifix, einen Todtenkopf auf seinem Tisch, nebst einem Dintenfaß und seine Hand auf ein Buch gestütz; jedermann kennet die Seltenheit der Werke dieses Meisters, wovon dieses ohne Widersprach ein Original ist. I Pendant zu Nr. 74 Transakt.: Verkauft (60 fl) Käufer: Hindt 1791/09/21 FRAN 0074 Van Dyck I Der Compagnon von eben demselben [Van Dyck], Dieses stellet eine busfertige Magdalena vor, die einen Tisch, Bücher und ein Crucifix vor sich hat, und die Hand auf einen Todtenkopf gelehnt. I Pendant zu Nr. 73 Transakt.: Verkauft (24.15) Käufer: Nellessen 1792/08/20 KOAN 0010 Van Dyk I Ein Crucifix mit einer Mutter Gottes auf Tuch von van Dyk. I Mat.: auf Leinwand Maße: 3 Schuh 8 Zoll hoch, 2 Schuh 8 Vi Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0011 Van Dyk I Ein Brustbild von van Dyk. I Maße: 2 Schuh hoch, 1 Schuh 8 Zoll breit Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/10/12 KOAN 0145 van Dyk I Eine Sacra Familia. I Verkäufer: Moureaux Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0037 van Dyk I Eine Madonna, welche das Jesukindlein auf ihrem Schooße sitzen hat, von van Dyk. I Maße: 2 Schuh 9 Zoll hoch, 2 Schuh 4 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0234 van Dyck I Ein alter ehrwürdiger Mannskopf, von van Dyck. I Pendant zu Nr. 235 von Mansinger MaGEMÄLDE
583
ße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 1 Schuh 1 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0252 van Dyck I Die Grablegung Christi, von van Dyck. I Maße: 3 Schuh 2 Zoll hoch, 2 Schuh 7 Vi Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0310 van Dyck I Die Beschneidung Christi, mit sehr vielen Figuren, von van Dyck. I Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch, 3 Schuh breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0129 A. v. Dyck I Die Kreutzigung Christi mit vielen untenstehenden Figuren. Der Entwurf zu einem großen Gemähide von A. v. Dyck. I Maße: Hoch 36 Zoll, breit 25 Zoll Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 HB AN 0054 A. von Dyck I Die Kreuzerhöhung Christi. Eine vorzüglich schön komponirte Darstellung. I Maße: Höhe 20 Zoll, Breite 16 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 HB AN 0059 A. van Dyck I Der heil. Martin zu Pferde zerschneidet, mit dem Schwerdte, seinen Mantel um ihn mit den Armen zu theilen. Eine trefliche Komposition. I Maße: Höhe 24 Zoll, Breite 21 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 HB AN 0061 A.v. Dyck I Der König David mit seiner Harfe, in heiliger Ergiessung seiner Gefühle vor dem, den er unnachgesungen sang. I Maße: Höhe 31 Zoll, Breite 24 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV [A]0036 A.v. Dyck I A.v. Dycks Bildniß; von ihm selbst gemahlt. Ovalen Formats. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Format: oval Maße: Hoch 6 Vi Zoll, breit 5 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV 0081 Ant. van Dyck I Ein Herr und eine Dame mit Hände, in alter Brabandischer Tracht: Beyde nach dem Leben gemahlt, wie lebend anzusehen. I Diese Nr.: Ein Herr mit Hände, in alter Brabandischer Tracht Mat.: auf Holz Maße: Hoch 54 Zoll, breit 43 Zoll Anm.: Die Lose 81 und 82 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV 0082 Ant. van Dyck I Ein Herr und eine Dame mit Hände, in alter Brabandischer Tracht: Beyde nach dem Leben gemahlt, wie lebend anzusehen. I Diese Nr.: Eine Dame mit Hände, in alter Brabandischer Tracht Mat.: auf Holz Maße: Hoch 54 Zoll, breit 43 Zoll Anm.: Die Lose 81 und 82 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/10 HBGOV 0085 A. van Dyk I Eine sitzende Dame mit zwey Hände, in alt Deutscher Tracht, mit goldener Kette umgürtet. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 41 Zoll, breit 31 Zoll Transakt.: Unbekannt 1795/11/14 HBPAK 0042 Van Dyck I Ein oval Manns=Portrait; vortreflich gemahlt, und für den Kenner sehr schätzbar. Auf Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Format: oval Maße: Hoch 3 Zoll, breit 2 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1795/11/14 HBPAK 0063 Van Dyk I Ein Manns=Köpfgen. Sehr fleißig gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Zoll, breit 6 lA Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/00/00 BSAN 0028 Antoine Van Dyk I Portrait d'homme, en demi buste. On voit une partie de sa main qui tient ses cheveux. Cette tete, d'une grande expression , et d'un beau fini, offre des traits egalement gracieux et bien prononces. I Mat.: auf Leinwand Maße: Haut de 1 pied; large de 11 pouces. Verkäufer: Merian l'aine Transakt.: Unbekannt (12) 1796/00/00 HLAN [0085] van Dyk I Eine nakende sizende Weibsperson, 34. 25. vortrefliches Colorit auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: 34. 25. Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummem hinzugefügt. Verkäufer: [Friedrich Karl Lang] Transakt.: Unbekannt (222.5 Rt; 400 fl Schätzung) 584
GEMÄLDE
1796/11/02 HBPAK 0091 Van Dyke I Sein eigenes Brustbild. Ganz ausnehmend schön gemahlt. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 19 Zoll, breit 14 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0138 Van Dyke I Der Abschied des unglücklichen Stuarts von seinem Sohne. Ein vortrefliches Stück. Auf Kupfer. Goldner Rahm. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 9 Zoll, breit 7 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0117 Anton von Deyck I Ein junger Spanier mit einer Ordenskette. I Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0224 A. von Deyk I Zwey mit Blumen bekränzte Knaben. I Transakt.: Unbekannt 1797/02/27 HBPAK 0001 Anton van Dyck I Eine Landschaft, wo zur Rechten ein hoher Felsen, woran eine, in alter Niederländischer Kleidung, stehende Mannsperson mit vergnüglicher Betrachtung ein Kind beobachtet, welches einer sitzenden Dame Blumen bringt. Dem Vermuthen nach, ein Familienstück. Ganz kräftig und gut gemahlt. Auf Leinwand, im goldnen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 60 Zoll, breit 76 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/02/27 HBPAK 0013 Van Dyck I Ein Portrait, halbe Fignr [sie], im Harnisch. Kräftig und gut gemahlt. Auf Holz, im goldnen Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 21 Zoll, breit 16 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/02/27 HBPAK 0084 Van Dyck I Ein kleiner Knabe auf einem sammtnen Küssen sitzend, mit einer Feder am Kopfe; neben ihn, auf der Erde, liegen vielerley Früchte. Kräftig gemahlt. Auf Leinwand, im goldnen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 31 Zoll, breit 25 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0030 van Dyk I Christus am Oelberge; wie er in seinem größten Leiden vor einem Engel mit der einen Hand gehalten, und mit der andern ihm den Kelch darreicht. Der Schmerz, der in dem Christus=Gesichte ausgedruckt ist, ist nicht zu beschreiben; so wie auch die Verwunderung, die der Engel von sich blicken läßt, über die Erscheinung einer Gruppe von Engeln in der Luft, welche ein Kreuz tragen. Wie richtig die Zeichnung ist, wird jeder Kenner von selbst erachten, wenn er den Namen dieses Künstlers nennen hört, zumal da man ganz von der Originalität versichert seyn kann. Auf Holz, in schwarzen Rahm mit vergoldeten Stäben. I Pendant zu Nr. 31 Mat.: auf Holz Maße: Hoch 20 Zoll, breit 13 Zoll Transakt. : Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0031 van Dyk I Das Gegenstück, von Demselben. Christus am Kreuz erblassend. Eine Gruppe von Engeln, die ihn umschweben, und sein herabfliessend Blut mit Begierde auffassen. Unten am Kreuz die Magdalena, welche, vom Schmerz erschüttert, das Kreuz umfaßt. Maria, die Mutter Gottes, welche ausgeweint zu haben scheint, sieht mit Wehmuth an das Kreuz hinauf; so wie auch der Jünger Johannes, welcher voll Vertrauen seine Hand empor hält. Ebenfalls ein Gemähide, das man, in Betracht der vortreflichen Zeichnung und Harmonie, ganz ohne Fehler nennen kann. Auf Holz, mit schwarzen Rahm und vergoldeten Stäben. I Pendant zu Nr. 30 Mat.: auf Holz Maße: Hoch 20 Zoll, breit 30 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0144 A. van Dyck I Ein Portrait mit halben Körper; von einer sehr großen Wirkung. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 14 Zoll, breit 10 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0247 A. van Dyk I Das Portrait eines Herrn, mit einer goldenen Kette um den Hals. Sehr gut gemahlt. Auf Leinw. goldenen Rahm. I Mat. : auf Leinwand Maße: hoch 22 Vi Zoll, breit 18 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0159 Ant. van Dyck I Ein großes Stück, die Liebe vorstellend. Venus sitzt und hält ein kleines Kind aufm Schoose; vor derselben stehet ein Kind vor der Wiege und spielt mit demselben. Hinter der Venus zwey kleine Genies, die sich liebkosen. Ganz auf das schönste gemahlt. Auf Leinwand, goldner Rahm. I
Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 61 Zoll, breit 54 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0195 Van Dyck I Die Mutter Maria mit dem Christkinde auf dem Schooße. Gut gemahlt. Auf Leinwand, goldner Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 37 Zoll, breit 30 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0081 Anton van Dyk I Isabella Eugenia, eine spanische Infantinn und Tochter Alberts Erzherzogs von Burgund, als Nonne, von Anton van Dyk. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 6 Zoll breit 1 Schuh 2 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0183 Anton van Dyck I Die büssende Magdalena, von Anton van Dyck. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 2 Schuh 2 Zoll breit 1 Schuh 8 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0334 Anton van Dyk I Zwey Köpfe mit schwarzen Mützen und Kleidungen, von Anton van Dyk. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Kopf mit schwarzer Mütze und Kleidung Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh breit 1 Schuh 8 Vi Zoll Anm.: Die Lose 334 und 335 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0335 Anton van Dyk I Zwey Köpfe mit schwarzen Mützen und Kleidungen, von Anton van Dyk. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Kopf mit schwarzer Mütze und Kleidung Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh breit 1 Schuh 8 Vi Zoll Anm: Dieses Los trägt irrtümlicherweise die Nr. 336. Die Lose 334 und 335 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0336 Anton van Dyk I Ein Mannskopf mit einem weissen Kragen, von Anton van Dyk. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 9 Zoll breit 1 Schuh 5 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/10/10 HBPAK 0014 Van Dyck I Der Kopf der heiligen Magdalena. Auf Holz, goldn. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Vi Zoll, breit 9 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/10/18 LZAN 0074 Anton Vandyk ! Das Portrait eines Niederländischen Ratsherrn, sehr geistreich gemahlt; hoch 17 Zoll, breit 13 Zoll. Oval, auf Karton in einem vergoldeten Rahm. I Mat.: auf Karton Format: oval Maße: hoch 17 Zoll, breit 13 Zoll Verkäufer: Rauch Transakt.: Verkauft (8.16 Th) Käufer: Geist 1799/12/04 HBPAK 0241 van Deyck I Christus am Kreuze. Im Hintergrunde die Stadt Jerusalem. Kräftig und gut gemahlt. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 28 Zoll, breit 16 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/12/23 WNAN 0048 Antoin Vandyk I Le Crist [sic] lie au Pilori, par Antoin Vandyk sur Toile. I Mat.: auf Leinwand Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 BLBOE 0045 v. Dyck I Christus am Kreuze; Maria, Magdalene, Elisabeth, Johannes und der Kriegsknecht mit dem Speere, befinden sich am Fuße des Kreuzes. I Mat.: auf Leinwand Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 BLBOE 0046 v. Dyck I Das Portrait eines Amsterdammer Bürgermeisters. I Mat.: auf Leinwand Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN2 0024 Dyk (van) I Ein Kopfstück von einem Mann, schwarz gekleidet mit weißem Kragen; seine Gesichtszüge und Ausdruck scheinen die Natur selbsten zu seyn. I Mat.: auf Holz Maße: 20 Zoll hoch, 25 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1800/01/00 LZAN [A]0019 Ant. v. Dyck I Alusius, wie derselbe von Scipio seine Verlobte zurück erhält. Scipio sitzt zu Linken auf einem Throne, den ein Vornehmer des Reichs und einige Krieger umgeben. Alusius mit seiner Braut knien mit dankbarer Geberde vor
dem grossmüthigen Helden. Eine Dienerin aus der Braut ihrem Gefolge trägt die Schleppe ihres sammtnen Oberkleides. Ein weisses prächtig geschmücktes Ross, mit dem Kopf und der Brust nur sichtbar, steht zur rechten Seite. Auf dem Fussboden zur Linken ist ein Sclave beschäftigt, die Geschenke des Scipio aufzustellen. Eine stille Grösse herrscht in dem Ganzen. "Dieser schöne Anstand, den so viele Andere "in der Behandlung dieser Geschichte verfehlt "haben, macht dieses Stück doppelt schätzbar," sagte Oeser. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Fuß 10 Zoll, Breite 2 Fuß 7 Zoll Verkäufer: A F Oeser Transakt.: Unbekannt 1800/07/09 HBPAK 0002 Van-Dick I St. Martin ä cheval faisant l'aumone ä un mendiant. Ce tableau d'une Couleur brillante, paroit etre la premiere pensee de celui qui existe ä Paris dans le museum national. Sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: 16 pouces de hauteur. Sur 14 pouces de largeur Transakt.: Unbekannt
Dyck, Anthonie van (und Brueghel, J. (I)) 1768/07/00 MUAN 0153 Dyck (Ant. van): Breughel I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
Dyck, Anthonie van (und Rubens) 1742/08/30 BOAN 0165 Rubens; Van Deick I Les 12. Apötres, l'Ascension du Seigneur, Couple. Par Rubens & par Van Deick. I Maße: Haut [?] pies 5. pouces, larges 2. pies 7. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt
Dyck, Anthonie van (und Rubens und Jordaens, J. (I)) 1781/00/00 WRAN 0098 Rubens. (P. P.): Van Dick; Jordans I Une Contemplation, oü Ton voit le Corps de J. C. couche de la droite contre la gauche, ä ses pieds une Femme assise, la tete appuyee sur sa main droite, une seconde Femme tient les doigts de J. C. ä sa tete une troisieme Femme semble ecarter ses cheveux & regarder les blessures que la couronne d'epines lui a faite, trois autres Femmes sont en haut du Tableau, deux les mains jointes, la troisieme levant les yeux au Ciel, ä droite un jeune Homme de bout, le menton appuye sur la main, ä gauche Joseph Darimathee; Ton voit sur toutes ces Figures les marques de douleurs trfes bien exprimees, trois de ces Figures sont de Van Dick, & une de Jordans. Ce magnifique Tableau dont tous les Personnages sont en grandeur naturelle, et du meilleur tems du maitre. I Maße: haut 74 pouces 6 lignes, large 74 pouces 6 lignes Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt
Dyck, Anthonie van (und Seghers, G.) 1800/01/00 LZAN [A]0020 Ant. v. Dyck; Gerh. Seghers I Von Ebendemselben [Ant. v. Dyck], Eine Glorie der Mutter Gottes: Ein Bildniss der Maria mit dem Kinde, heben zwölf unbekleidete Engel in Kindergestalt zu einer Glorie, welche aus mehrern Engeln und Wolken bestehet, empor. Acht Engel in Jünglingsgestalt knien zu beiden Seiten im Vorgrunde, und verehren mit aufgehobenem Gesicht und Händen dieses Bild; ein erhabener Ausdruck ist in ihren Blicken, die Gewänder, so dieselben umgeben, sind vortreflich entworfen. Das Bildniss der Maria mit dem Kinde ist wahrscheinlich von Gerh. Seghers; in diesem Gemälde sieht man, sowohl in den Umrissen, als Colorit, den Schüler von Rubens. I Maße: Höhe 3 Fuß 1 Zoll, Breite 2 Fuß Verkäufer: A F Oeser Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
585
Dyck, Anthonie van (oder Rubens) 1670/04/21 WNHTG 0093 Rubens; Dych I Un Ritratto d'un Huomo di tutta statura, del Rubens, ö del Dych. I Verkäufer: Franz von Imstenraedt Transakt.: Unbekannt
Dyck, Anthonie van (oder Velazquez, D. und Weenix) 1791/09/21 FRAN 0010 Weninks; Die Figur von Van Dyck; Velasques I Ein Gang=Gemälde von einer sehr reichen Verfertigung; in der Mitte ist ein Tisch, auf welchem ein Korb mit Wein=Trauben steht, weiter eine Schüssel mit einem Seekrebs und andere Sachen, z. C. ein Rebhuhn, eine Melone, zur Linken in den Händen eines Kochs, von Velasques gemalt, ist ein todter Hirsch, zur linken ein wildes Schwein an einem Hacken gehängt, zu Ende ist ein Fenster und andere Baukunst, alle Umstände davon sind mit sehr lebhaften Farben gemalt und man kann mit Rechte sagen, daß es eines der schönsten Gemälde dieser Art ist; dieses sowohl als verschiedene andere, so wir anzeigen werden, sind durch einen Bothschafter von Spanien gebracht. I Transakt.: Verkauft (460 fl) Käufer: Hindt
Dyck, Anthonie van (Geschmack von) 1775/02/25 HBBMN 0098 v. Dyck I Ein Kopf, in dem Gusto von v. Dyck. I Transakt.: Unbekannt 1775/02/25 HBBMN 0099 v. Dyck I Ein dito Kopf [in dem Gusto von v. Dyck]. I Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0402 Im Gusto von Dyck I Die Domenkrönung und Verspottung Christi, extra fleißig in Mignatur und lavirter Kunst, auf Pergament. I Diese Nr.: Die Verspottung Christi; Nr. 401 Geschmack von Rubens Mat.: auf Pergament Maße: Höhe 7 Zoll 9 Linien, Breite 6 Zoll Anm.: Die Lose 401 und 402 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/09/30 FRAN 0406 van Dyk I Zwei Mannsköpfe, einer in Rembrandts, und der andre in van Dyks Geschmack. [Deux tetes d'homme l'une dans le gout de Rembrandt, l'autre dans la maniere de van Dyk.] I Diese Nr.: Ein Mannskopf in van Dyks Geschmack Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Anm.: Die Lose 405 und 406 wurden zusammen katalogisiert. Dieses Los wurde zusammen mit der Nr. 405 (im Geschmack von Rembrandt) verkauft. Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (15.30 fl für die Nrn. 405 und 406) Käufer: Nothnagel 1787/00/00 HB AN 0392 Im Gusto von van Dyck I Maria sitzt, und hält das Christkindlein auf ihrem Schooß, welches mit ihrem Schleyer spielt. Im Hintergrunde eine Landschaft. Sehr schön gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 9 Vi Zoll, breit 7 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (4 M) Käufer: Tietjen
Dyck, Anthonie van (Kopie nach) 1716/00/00 FRHDR 0229 von Deick I Nach von Deick ein stuck mit drey Kinder. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (8) 1723/00/00 PRAN [B]0026 Antoni Van Dyck I Ein Kopff / nach Antoni Van Dyck. I Maße: Höhe 2 Vi Schuh 5 Vi Zoll, Breite 2 Schuh 2 Vi Zoll Verkäufer: Graff von Werschowitz Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0160 von Deick I Zwey gute Stuck nach von Deick. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0190 van Deick i Ein Stuck, worauff Ludovicus auff einem Pferd reithet. Nach van Deick. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 586
GEMÄLDE
1742/08/01 BOAN 0196 von Deick I Ein Stuck, worauff Diana, und Endimion nach von Deick. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0261 van Deick I Noch ein Portrait eines Frawenzimmers, nach van Deick. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0404 von Deick I Diana und Endimion, nach van Deick. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0449 von Deick I Ein Portrait des Königs in Hispanien, nach von Deick. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0473 van Deick I Ein Portrait eines Spaniers mit einem Hund, nach van Deick. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0478 Von Deick I Das Portrait von Carl Stuart Königs in Engelland, nach von Deick. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0484 Van Deick I Mater Dei mit dem Kindlein, nach van Deick. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0498 Van Deick I Ein Petrus, nach van Deick. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0507 Van Deick I Ein Magdalena; Kopff, nach van Deick. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0570 Von Deick I Ein Ecce Homo, nach von Deick. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0574 Von Deick I Ein Stuck mit der schmertzhaffter Mutter, nach von Deick. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0299 Van Deick I La Sainte Vierge & son Fils d'apres Van Deick. I Maße: Haut 2. pieds 9. pou., large 2. pieds Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0340 Van Deick I Portrait d'un Vieux Paisan, d'apres Van Deick. I Maße: Haut 2. pies 3. pouces, large 2. pies Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0346 Van Deick I Bain de Diane, d'aprfes Van Deick. I Maße: Haut 7. pou., large 10. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0386 Van Deick I Portrait de Charles Stuart, Roy d'Angleterre, d'apres Van Deick. I Maße: Hauts 3. pieds 9. pouces, larges 2. pieds 4. pouc. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1750/04/00 HB AN 0018 A. van Dyck I Die Liebe mit Kindern vorstellend, nach A. van Dyck, schön gemahlt. I Transakt.: Unbekannt 1763/11/09 FRJUN 0065 Apres van Dyk I Une piece capitale representant un Christ mort sur les genoux de Marie entoure d'anges parfaitement peint. I Maße: hauteur 43 Vi pouces, largeur 64 pouces Transakt.: Verkauft (6.15 fl) Käufer: Dick 1764/05/17 BOAN 0072 Peschay; Van Dyck I Un Tableau de deux pieds deux pouces de largeur & d'un pied dix pouces de hauteur, representant la Vierge avec des Anges, peint par Peschay dans le gout de van Dyck. [Ein stück Vorstellend die Muttergottes mit Vielen Engelen, gemahlt nach van Dyck Von Beschay.] I Kopie von B. Beschey nach Anth. van Dyck Maße: 2 pieds 2 pouces de largeur & 1 pied 10 pouces de hauteur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (37 Rt) Käufer: Beckerin 1764/05/22 BOAN 0087 Douwen; Van Dijck I La Vierge douloureuse d'un pied huit pouces de largeur, d'un pied deux pouces de hauteur, peinte par Douwen. [Ein Vesper-Bild mit Engelen im Licht und Schatten gemahlt Von Douven nach van Dyck.] I Kopie von
Douven nach Anth. van Dyck Maße: 1 pied 8 pouces de largeur, 1 pied 2 pouces de hauteur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (17 Rt) Käufer: Bell 1766/07/28 KOSTE 0164 Antonio Dyck I Ein klein Stücklein auf Leinen=Tuch auf Holtz gepabt, vorstellend die keusche Susanna Schetz, nach von Antonio Dyck. I Mat.: Leinwand auf Holz Transakt.: Verkauft (2 Rt) Käufer: Schmitz 1774/08/13 HBBMN 0052 van Dyck I Christus und Johannes, nach van Dyck. I Transakt.: Unbekannt 1774/08/13 HBBMN 0114 van Dyck I Die heilige Familie, nach van Dyck. I Transakt.: Unbekannt 1775/00/00 BLAN 0064 Van Dyck I Ein dito [Kopf] dito [ohne Rahm] nach van Dyck. I Verkäufer: George Friedrich Schmidt Transakt.: Unbekannt 1775/00/00 BLAN 0089 Van Dyck I Maria mit dem Kinde Jesu, ohne Rahm nach van Dyck. I Verkäufer: George Friedrich Schmidt Transakt.: Unbekannt 1776/06/21 HBNEU 0084 v. Dyck I Die Flucht nach Egypten, auf dito [Leinwand], nach v. Dyck. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 5 F 6 Z, Breite 7 F 7 Ζ Transakt.: Unbekannt 1777/03/03 AU AN 0113 Vandigg I Ein Portrait nach Vandigg. I Maße: % Zoll hoch, Vi Zoll breit Verkäufer: Bassi Transakt.: Unbekannt 1778/04/11 HBBMN 0068 Ant. van Dyck I Die Kreuztragung Christi, nach Ant. van Dyck. I Transakt.: Verkauft (3 M) Käufer: L[illy] S 1779/05/08 HBHRN 0018 van Dyck I Christus am Kreuze, mit Neben=Figuren; nach van Dyck. I Transakt.: Unbekannt 1779/05/08 HBHRN 0027 van Dyck I Maria mit dem Christ= Kindlein und einem Engel; nach van Dyck. I Transakt.: Unbekannt 1780/08/21 DAAN 0058 Kehrer; von Dyck I Ein Manns=Gesicht, eine sehr gute Copie nach von Dyck, von Kehrer. I Kopie von K.C. Kehrer nach Anth. van Dyck Maße: 1 Schuh 5 Vi Zoll breit, 1 Schuh 9 Zoll hoch Verkäufer: [Friedrich Karl Ludwig, Freiherr von Moser] Transakt.: Unbekannt 1781/07/14 FRAN 0065 Kehrer; van Dyck I Ein Manns=Gesicht, eine sehr gute Copie nach van Dyck, von Kehrer. I Kopie von K.C. Kehrer nach Anth. van Dyck Maße: 1 Schuh 5 Vi Zoll breit, 1 Schuh 9 Zoll hoch Verkäufer: Moser Transakt.: Unbekannt (4 fl) 1782/03/18 HB TEX 0122 Nach van Dyck I Ein Portrait, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 24 Zoll 6 Linien, Breite 18 Zoll 9 Linien Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0135 Nach van Dyk I Christus am Creuz, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 50 Zoll 3 Linien, Breite 34 Zoll 6 Linien Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt
30 Vi Zoll Anm.: Die Lose 94 und 95 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1785/04/22 HBTEX 0095 Rund; nach van Dyck I Die Kreuzigung und die Grablegung Christi; vortreflich gemahlt, wie auch schön gezeichnet auf Leinewand. Schwarzer Rahm und goldne Leisten. I Diese Nr.: Die Grablegung Christi; Kopie von H.H. Rundt nach Anth. van Dyck Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 40 Zoll, breit 30 Vi Zoll Anm.: Die Lose 94 und 95 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1785/05/17 MZAN 0644 van Dyk I Dalila die Samson die Haare abschneidet nach van Dyk. [Dahle coupant les cheveux ä Samson d'apres van Dick.] I Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 2 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (17.30 fl) Käufer: Leützgen 1786/05/02 NGAN 0122 van Dyk I Vier Köpfe nach van Dyk. I Diese Nr.: Ein Kopf Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 1 Schuh 5 Zoll breit Anm.: Die Lose 122 bis 125 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (17 fl für die Nrn. 122125) Käufer: ν Cimarolo 1786/05/02 NGAN 0123 van Dyk I Vier Köpfe nach van Dyk. Diese Nr.: Ein Kopf Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 1 Schuh 5 Zoll breit Anm.: Die Lose 122 bis 125 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (17 fl für die Nrn. 122125) Käufer: ν Cimarolo 1786/05/02 NGAN 0124 van Dyk I Vier Köpfe nach van Dyk. I Diese Nr.: Ein Kopf Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 1 Schuh 5 Zoll breit Anm.: Die Lose 122 bis 125 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (17 fl für die Nm. 122125) Käufer: ν Cimarolo 1786/05/02 NGAN 0125 van Dyk I Vier Köpfe nach van Dyk. I Diese Nr.: Ein Kopf Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 1 Schuh 5 Zoll breit Anm.: Die Lose 122 bis 125 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (17 fl für die Nrn. 122125) Käufer: ν Cimarolo 1787/00/00 HB AN 0406 Nach van Dyck I Maria sitzt mit offenen Armen und gen Himmel gewandtem Haupt, und hält auf ihrem Schooß den Leichnam Christi, mit einigen Engeln umgeben. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 14 Vi Zoll, breit 14 % Zoll Transakt.: Verkauft (3 M) Käufer: Bertheau 1787/01/15 LZRST 0019 Klein; van Dyck I Eine Verspottung Christi, nach van Dyck von Klein. 27 Zoll hoch, 21 Z. br. in schwarzen Rahm gold. Leiste. I Kopie von Klein nach Anth. van Dyck Maße: 27 Zoll hoch, 21 Zoll breit Verkäufer: Richter Transakt.: Unbekannt 1787/04/19 HBTEX 0097 A. v. Dyck \ Zwo Stücke mit tanzende Kinder, nach A.v. Dyck. I Diese Nr.: Ein Stück mit tanzende Kinder Anm.: Die Lose 97 und 98 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (20 Μ für die Nrn. 97 und 98) Käufer: Batheau
1782/09/30 FRAN 0147 van Dyk I Der trunkene Silen mit Bachanten umgeben, nach van Dyk. [Un Silene yvre entoure de Bacchants, d'apres van Dyk.] I Maße: 2 Schuh 10 Zoll hoch, 3 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (15.30 fl) Käufer: Müller
1787/04/19 HBTEX 0098 A. v. Dyck I Zwo Stücke mit tanzende Kinder, nach A.v. Dyck. I Diese Nr.: Ein Stück mit tanzende Kinder Anm.: Die Lose 97 und 98 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (20 Μ für die Nrn. 97 und 98) Käufer: Batheau
1784/08/02 FRNGL 0549 van Dyk I Eines jungen Mannes Bildniß, nach van Dyk. I Maße: 10 Zoll breit, 12 Vi Zoll hoch Transakt.: Verkauft (1.30 fl) Käufer: Leonhardi
1788/08/21 HBRMS 0006 Nach van Dyck I Christus und Johannes sich liebkosend. Auf Leinew. goldner Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 32 Zoll, breit 27 Zoll Transakt.: Verkauft (4 M) Käufer: Siemsen
1785/04/22 HBTEX 0094 Rund; nach van Dyck I Die Kreuzigung und die Grablegung Christi; vortreflich gemahlt, wie auch schön gezeichnet auf Leinewand. Schwarzer Rahm und goldne Leisten. I Diese Nr.: Die Kreuzigung Christi; Kopie von H.H. Rundt nach Anth. van Dyck Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 40 Zoll, breit
1788/09/01 KOAN 0301 von Deick I Christus im Grab, nach von Deick. [Jesus Christ au sepulcre, selon v. Dyck.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 3 Fuß 5 Zoll, Breite 5 Fuß 6 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
587
1788/09/01 KOAN 0305 v. Dyck I Löwenjagd, nach v. Dyck, [une chasse aux lions, selon de Dyck.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 4 Fuß 7 Zoll, Breite 6 Fuß 1 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0335 von Dyck I Crucifixbild, nach von Dyck, [un Crucifix, selon de Dyck.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 5 Fuß 10 Zoll, Breite 4 Fuß 2 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0469 van Dyck I Susanna im Baad, nach van Dyck. [Susanne au bain, selon van Dyck.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 6 Zoll, Breite 2 Fuß Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1788/09/01 KOAN 0483 Von Dyck I Ein Vesperbild nach von Dyck, [un Crucifix, s[elon]. de Dyck.] I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 3 Fuß 1 Zoll, Breite 2 Fuß 3 Zoll Verkäufer: Johann Anton Farina Transakt.: Unbekannt 1789/06/06 HBPAK 0002 Nach Anth. v. Dyck I Die Dornenkrönung Christi, mit sehr vielen umstehenden Figuren, auf Leinew. ohne R[ahm]. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 27 Zoll, breit 20 Zoll Transakt.: Verkauft (2 M) Käufer: Ruprecht 1790/02/04 HBDKR 0029 Nach v. Dyck I Eines Gelehrten Bildniß, mit kleinem Umschlag und schwarzer Kleidung, auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 26 Zoll, breit 20 Zoll Transakt.: Verkauft (1.10 M) Käufer: Schmidt 1790/05/20 HBSCN 0075 Nach Anthon van Dyck I Die Bildnisse von Peter Paul Rubens und Anthon van Dyck. Brustbilder. Auf Lfeinwand], S.R.G.L. [Schwarzen Rahm, goldne Leisten] I Diese Nr.: Das Bildnis von Anthon van Dyck; Nr. 74 Kopie nach Rubens Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 17 Zoll, breit 13 Zoll Anm.: Die Lose 74 und 75 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Verkauft (10.8 Μ für die Nrn. 74 und 75) Käufer: Eckhardt 1791/01/10 HNAN 0050 Vandick I Ein Portrait nach Vandick kl. Oval. Rhm: Swzr. Leist.: gl. I Format: oval Verkäufer: Meier Transakt.: Unbekannt 1791/05/31 FRAN 0215 Ant. van Dyk I Eine Abnehmung Christi vom Creutz, der Heiland in den Armen Maria und von Engeln umgeben, nach Ant. van Dyk. I Maße: 4 Schuh 4 Zoll hoch und 6 Schuh breit Verkäufer: Bansa Transakt.: Verkauft (3) Käufer: Chamot 1791/07/29 HBBMN [A]0013 van Dyck I Das Begräbniß Christi; nach van Dyck. I Transakt.: Unbekannt (2 Sch) 1791/09/26 FRAN 0281 van Dyck I Die Verspottung und Krönung Christi, von einer Meisterhand nach van Dyck. I Maße: 25 Zoll hoch, 19 Zoll breit Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0293 Beschey; van Dyck I Die Weiber, Joseph von Arimadia und ein Capuciner, salben der todten Leichnam Christi, ein fleißiges Bild von Beschey nach van Dyck. I Kopie von B. Beschey nach Anth. van Dyck Maße: 24 Zoll hoch, 16 Zoll breit Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1792/04/19
HBBMN
0073
R.; v. Dyck I D i e G r a b l e g u n g Christi;
stark gemahlt, von R. nach v. Dyck. Auf Leinw. I Kopie von Monogrammist R. nach Anth. van Dyck Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 23 Zoll, breit 17 Zoll Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0053 Nach v. Dyck I Die Bildnisse von Peter Paul Rubens und Anthon van Dyck. Brustbilder. Auf L[einwand]. S.R.G.L. [Schwarzen Rahm Goldne Leisten] I Diese Nr.: Das Bildnis von Anthon van Dyck; Nr. 52 Kopie nach Rubens Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 17 Zoll, breit 13 Zoll Anm.: Die Lose 52 und 53 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 588
GEMÄLDE
1794/00/00 HB AN 0125 Beschey; nach A. v. Dyck I Die römische Liebe. Mit Himmelsfreude im Auge blickt sie zum Himmel auf und trägt ihre schönen, durch Beschey vielleicht verschönerten, Lieblinge an ihrem mütterlichen Busen und Halse. I Kopie von B. Beschey nach Anth. van Dyck Maße: Höhe 18 Zoll, Breite 15 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1794/09/09 HBPAK 0035 Nach v. Dyck I Das Bild Christi, zum Compagnon die Mutter Gottes. Auf Holz. I Diese Nr.: Das Bild Christi; Pendant zu Nr. 36 Mat.: auf Holz Maße: Hoch 27 Zoll, breit 21 Zoll Anm.: Die Lose 35 und 36 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/09 HBPAK 0036 Nach v. Dyck I Das Bild Christi, zum Compagnon die Mutter Gottes. Auf Holz. I Diese Nr.: Die Mutter Gottes; Pendant zu Nr. 35 Mat.: auf Holz Maße: Hoch 27 Zoll, breit 21 Zoll Anm.: Die Lose 35 und 36 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1794/09/09 HBPAK 0092 Nach v. Dyck I Die Auferweckung Lazari, mit vielen Ausdruck. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 16 Zoll, breit 12 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/00/00 HLAN [0118] [a] van Dyk I Zvvey Bildnisse, nach van Dyk und Rembrandt. 20. 16. auf Leinw. unter Fugers Anleitung verf. I Diese Nr.: Ein Bildnis; Nr. [118][b] Kopie nach Rembrandt Mat.: auf Leinwand Maße: 20. 16. Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: [Friedrich Karl Lang] Transakt.: Unbekannt (18.8 Rt; 33 fl für die Nrn. [118][a] und [118][b], Schätzung) 1796/10/17 HBPAK 0169 Nach von Deyck I Christus vom Creutze genommen, im Schoosse der Maria liegend, und von zwey Engeln bewundert wird. Ganz vortreflich gemahlt. Auf Holz. Schwarzer Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 30 Zoll, breit 42 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0148 Aus der Rubenschen Schule, nach van Dyke I Die Kreutztragung Christi, mit sehr vielen Figuren in Lebensgrösse. Auf Holz. Goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 18 Zoll, breit 24 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/06/13 HBPAK 0090 Nach van Dyck I Der betrunkene Sylen wird von Bachanten getragen. Auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 15 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/08/10 MM AN 0180 Van Dick I Ein d[itt]o [Manns Portrait] nach Van Dick, auf Tuch. I Mat.: auf Leinwand Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (8 fl Schätzung) 1797/08/10 MM AN 0198 Van Dick I Eine H. Familie. Gute Copie nach van Dick, auf Tuch. I Mat.: auf Leinwand Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (22 fl Schätzung) 1797/08/10 MMAN 0208 Van Dick I Ein Manns Portrait nach Van Dick auf Tuch. I Mat.: auf Leinwand Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (6 fl Schätzung) 1798/08/10 HBPAK 0218 Nach von Deyck I Christus mit Maria und Johannes. Auf Leinwand, im schwarzen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 32 Zoll, breit 28 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/11/14 HBPAK 0110 Nach von Dyck I Christus am Kreutz. Auf Leinwand, im schw. Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 38 Zoll, breit 28 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/08/09 HBPAK 0090 Nach v. Dick \ Eine Schäferin mit einen [sie] Blumenkranz um Kopfe. Kräftig und gut gemahlt. Auf Holz, schw. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 30 Zoll, breit 24 Zoll Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0189 von Deycks \ Christus am Creutze. nach van Deycks. I Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0236 von Deyck I Zwey Stücke; die Jünger zu Emaus, und die Abnehmung Christi vom Creutze. nach von Deyck. I Transakt.: Unbekannt
1800/11/12 HBPAK 0464 van Deyck I Zwey Figuren in Lebensgröße. nach van Deyck. I Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0501 van Deyck I Zwey Portraits; Mann und Frau, nach van Deyck. I Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0586 van Dyck I Zwey Stücke mit Figuren, nach van Dyck. I Transakt.: Unbekannt
1796/12/07 HBPAK 0001 Wie van Deyck I Christus auf dem Schoos der Maria sitzend, und Johannes neben ihr stehend. I Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0002 Wie van Deyck I Maria, das Christkind an der Brust haltend. I Transakt.: Unbekannt
Dyck, Anthonie van (Schule) Dyck, Anthonie van (Manier) 1774/11/03 HBNEU 0005 van Dyck I Das Portrait eines Englischen Prinzen, in ovaler Form, auf Holz, so schön wie von van Dyck. \ Mat.: auf Holz Format: oval Verkäufer: Ritter Transakt.: Verkauft (1.8 M) Käufer: Lilye S 1775/02/25 HBBMN 0078 van Dyck I Ein Stück in alter Brabandischer Kleidung vorgestellte Staats=Personen, so sich durch Ziegeuner Glück sagen lassen, wie van Dyck. I Transakt.: Unbekannt 1776/06/21 HBNEU 0056 Van Dyck I Ein Port., lebhaft gemalt, auf Kupfer, so schön wie Van Dyck. I Mat. : auf Kupfer Maße: Höhe 9 Z, Breite 6 Ζ Transakt.: Unbekannt 1778/09/28 FRAN 0661 van Dyck I Ein Vesperbild, in der Manier von van Dyck. [La S. Vierge tenante le corps de Jesus-Christ detache de la croix, dans le gout de van Dyck.] I Maße: 1 Schuh 5 Ά Zoll breit, 1 Schuh 10 Vi Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (14.30 fl) Käufer: Viarig Solph (N Solf) 1781/09/10 BNAN 0144 van Dyk I Bildnis eines Mannes in ganzer Länge, herunterhängendem Kragen, schwarzem Kleide mit aufgeschnittenen Ermein, und abgestützten Haaren, in der Rechten den Huth, neben einer Tafel zur Linken, [in van Dyks Manier gearbeitet] I Pendant zu Nr. 145 Mat.: auf Holz Maße: 15 Zoll hoch, 12 Zoll breit Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 145 und beziehen sich auf die Nrn. 144 und 145. Transakt.: Unbekannt 1781/09/10 BNAN 0145 van Dyk I Auf dem Gegenbilde, ein Frauenzimmer im schwarzen Kleide, aufgesteiften Spitzenermeln, breitem rundstehendem Kragen, und goldenen Knöpfen, im gewürkten Corset, neben einer Tafel zur Rechten; in van Dyks Manier gearbeitet, aber etwas verwaschen. I Pendant zu Nr. 144 Mat.: auf Holz Maße: 15 Zoll hoch, 12 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1784/08/02 FRNGL 0037 van Dyk \ Eines jungen Mannes Bildniß, vollkommen in van Dyks Manier meisterhaft verfertigt. I Maße: 14 Zoll breit, 16 Zoll hoch Verkäufer: D Transakt.: Verkauft (40 Kr) Käufer: Berger 1786/04/21 HBTEX 0095 Λ.ν. Dyck I Ein Manns=Portrait, Kniestück, Lebens=Größe, mit beyden Händen, in schwarzer Kleidung, so schön, wie A.v. Dyck. I Transakt.: Unbekannt 1786/10/18 HBTEX 0305 Dyck I Christus am Creuze, in der Manier von Dyck. I Transakt.: Unbekannt 1787/01/15 LZRST 0013 In Vandycks Manier I Ein todter Christus im Schoosse der Maria, in Vandycks Manier auf Leinewand gemalt, etwas ausgebessert. 17 Zoll hoch, 14 Z. br. schw. Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: 17 Zoll hoch, 14 Zoll breit Verkäufer: Richter Transakt.: Unbekannt 1792/07/28 HBSCN 0126 Inder Manier von van Dyk I Eine geschmückte Dame, in altdeutscher Tracht. K[upfer], G.R. [Goldnen Rahm] I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 9 Zoll, breit 7 Zoll Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0077 In der Manier von Deieck I Christus liegend, ein Tisch hinter ihm, wo zwey brennende Lichter auf stehen, und zwey bey ihm. Ein sehr altes brav gemahltes Stück. I Maße: Hoch 14 Zoll, breit 19 Zoll Transakt.: Unbekannt
1742/08/01 BOAN 0007 von Deick I Ein klein Stuck die Abnehmung Christi vom Creutz reprcesentirend. Original von der Schuhle von Deick. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0008[a] von Deick I Eine Ovidische Historie ins graw gemahlt. Original von der Schuhle von Deick. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0125 van Deick I Ein klein Sebastiani Stuck von der Schuhle von van Deick. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0199 van Deick I Ein Portrait eines altfränckischen Bawren aus der Schuhle vom van Deick. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0221 Van Deick I Ein Stuck das Dianae Baadt prsesentirend von der Schuhle vom Van Deick. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0280 van Deick I Ein Kinds-Kopff mit einem alten Kopff, von der Schuhle von van Deick. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0301 van Deick I Ein Portrait eines See-Admirals. Von einem Discipul von van Deick. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0312 van Deick I Ein Portrait der Betsabe®, von einem Scholar von van Deick. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0348 van Deick I Ein klein Ovidisches Stuck. Ein Exquise von einem Discipul von van Deick. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0555 Van Deick I Eine kleine Exquise aus der Schuhle von van Deick. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/01 BOAN 0584 Van Deick I Ein Stuck eines Priesters aus der Societät Jesu. Orig. von einem Discipul von van Deick. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0019 Van Deick I Une fontaine avec des bergers & bergeres, de l'ecolle de Van Deick. I Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0251 Van Deick I Bethsabee, par un disciple de Van Deick. I Maße: Haut 2. pieds 3. pou., large 1. pie 9. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0317 Van Deick I Portrait d' un Jesuite, par un Ecolier de Van Deick. I Maße: Haut 1. pied 7. pouces, large 1. pied 2. pouces Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1764/00/00 BLAN 0552 in der Schule van Dyk I 1. artiges in der Schule van Dyk verfertigtes Stück stellet die Maria mit dem Kind Jesu vor. I Maße: 2 Fuß 6 Vi Zoll hoch, 1 Fuß 11 Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (300 Rt Schätzung) 1776/07/19 HBBMN 0081 van Dyck I Eine Maria und eine Magdalena, aus der Schule von van Dyck, ungemein rar. I Diese Nr.: Eine Maria Maße: Höhe 1 Fuß 6 Zoll, Breite 1 Fuß 3 Zoll Anm.: Die Lose 81 und 82 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (5.12 Μ für die Nrn. 81 und 82) Käufer: Tischbein 1776/07/19 HBBMN 0082 van Dyck I Eine Maria und eine Magdalena, aus der Schule von van Dyck, ungemein rar. I Diese GEMÄLDE
589
Nr.: Eine Magdalena Maße: Höhe 1 Fuß 6 Zoll, Breite 1 Fuß 3 Zoll Anm.: Die Lose 81 und 82 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (5.12 Μ für die Nrn. 81 und 82) Käufer: Tischbein
verguldeten Leisten] I Mat.: auf Kupfer Maße: 9 Zoll hoch, 7 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
1777/02/21 HBHRN 0037 v. Dyck I Eine Maria mit das Christ= Kindlein, ungemein aus der Schule von v. Dyck. I Maße: Höhe 3 Fuß 4 Vi Zoll, Breite 2 Fuß 10 Zoll Transakt.: Unbekannt
Dyck, Jan van
1777/02/21 HBHRN 0068 van Dyck I Christus mit der Dornen= Krone, aus der Schule von van Dyck. I Maße: Höhe 4 Fuß, Breite 2 Fuß 3 Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/07/21 HBHTZ 0079 van Dyk I Ein Portrait auf Kupfer, aus der Schule von van Dyk. I Mat.: auf Kupfer Maße: hoch 10 Zoll, breit 8 Zoll Transakt.: Unbekannt (3 M) 1778/09/28 FRAN 0054 Anton van Dyck I Ein sehr schönes Ecce=Homo=Bild, aus der Schule von Anton van Dyck. [Un tres bei Ecce-Homo de l'ecole d'Antoine van Dyck.] I Maße: 3 Schuh breit, 3 Schuh 8 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (15.30 fl) Käufer: Schrintz 1778/09/28 FRAN 0120 van Dyck I Ein schöner Mannskopf mit grossem blaulichtem Kragen, aus der Schule vom van Dyck. [Une belle tete d'homme avec un grand collet bleuatre, de l'ecole de Van Dyck.] I Maße: 1 Schuh 2 Zoll breit, 1 Vi Schuh hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (45 fl) Käufer: Morgenstern Mahler
1778/08/29 HBTEX 0065 J.v. Daeik I Ein Pohlnischer Magnat in sehr reicher Kleidung; man findet den Namen J.v. Daeik darauf, sonst würde man ihn mit Recht für einen Rembrand halten. I Maße: Höhe 2 Fuß 6 Zoll, Breite 2 Fuß 1 Zoll Anm.: Der Künstler ist vermutlich Abraham van Dyck. Transakt.: Unbekannt
Dyk, Philip van 1765/03/27 FRKAL 0053 Philipp van Dyck I Un beau tableau representant la paix dans la figure d'une jolie femme ä genoux devant Mars, priant de mettre l'epee dans son fourreau. I Maße: hauteur 30 pouces, largeur 28 pouces Transakt.: Verkauft (10 fl) Käufer: Kaller 1768/07/00 MUAN 0122 Dyck (Philippus van) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
1779/09/27 FRNGL 1041 van Dyk I Eine Creutzigung Christi, schön und fleißig ausgeführt mit vielen Figuren, aus der Schule von van Dyk. [Jesus-Christ mis ä la croix, tres belle piece avec beaucoup de figures, de l'ecole de van Dyck.] I Maße: 1 Schuh 8 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 2 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (44 fl) Käufer: Hüsgen
1768/07/00 MUAN 0740 Dyck (Philippus van) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt
1781/05/07 FRHUS 0268 Ant. van Dyck I Ein Frauenzimmerportrait in Lebensgrös und prächtigem Anzug, meisterhaft und schön ausgeführt aus der Schule des Ant. van Dyck. I Maße: 6 Schuh 5 Zoll hoch und 3 Schuh 11 Zoll breit Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (1.2 fl) Käufer: Ehrman
1769/00/00 MUAN 0381 Dyck (Philipe van) I La femme du dit peintre assise proche d'une table. Peinte sur toile, marquee du No. 122. \Mat.: auf Leinwand Maße: 1. p. 6 Vi. p. de haut sur 1. p. 3 Vi. p. de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt
1787/00/00 HB AN 0452 Aus der Schule von van Dyck I Maria sitzt in einem blauen Gewände, mit gen Himmel gewandtem Haupte, weinend den Leichnam Christi auf ihrem Schooß haltend, zu dessen Füßen sich zwey leidtragende Engel befinden; hinten das Kreuz, über welches verschiedene kleine Engel schweben. Von richtiger und edler Zeichnung, und von vortrefflicher Mahlerey und Colorit. So schön, als von van Dyck. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 25 Zoll, breit 36 Zoll Transakt.: Verkauft (21.8 M) Käufer: Fesser [?]
1787/00/00 HB AN 0193 P. van Dyck I Ein Holländer steht mit einer erhabenen Miene und Stellung, seinen Huth in der rechten Hand haltend, und die andere in seine Seite gesetzt, an einem Tische, worauf sich Feder, Dinte und ein Brief befindet. Dessen Frau mit einer weißen Kappe und schwarz gekleidet stehet neben einem Tische, worauf ein Buch liegt. Diese beyden Bilder sind so wohl gemahlt, so schön gezeichnet, und so richtig von Licht und Schatten, als wären sie von Anton van Dyck. A.H. [Auf Holz] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Diese Nr.: Ein Holländer steht mit einer erhabenen Miene und Stellung Mat.: auf Holz Maße: Hoch 17 Vi Zoll, breit 13 Vi Zoll Anm.: Die Lose 193 und 194 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (42 Μ für die Nrn. 193 und 194) Käufer: Tietjen
1791/09/26 FRAN 0117 van Dyck I Ein überaus fleißiger Kopf mit einem weisen Kragen, aus der Schule des van Dyck. I Maße: 19 Zoll breit, 20 Zoll hoch Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0507 van Dyk I Ein Weibskopf mit einem Kröße, aus der Schule des van Dyks. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 5 Zoll breit 1 Schuh 3 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Dyck, Anthonie van (Schule; und Rubens, Schule) 1742/08/01 BOAN 0374 Rubens; von Deick I Die zwölff Apostolen mit der Himmelfahrt Christi, gross, und gemahlet von zweyen Discipulen von Rubens und von Deick. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt
1787/00/00 HB AN 0194 P. van Dyck I Ein Holländer steht mit einer erhabenen Miene und Stellung, seinen Huth in der rechten Hand haltend, und die andere in seine Seite gesetzt, an einem Tische, worauf sich Feder, Dinte und ein Brief befindet. Dessen Frau mit einer weißen Kappe und schwarz gekleidet stehet neben einem Tische, worauf ein Buch liegt. Diese beyden Bilder sind so wohl gemahlt, so schön gezeichnet, und so richtig von Licht und Schatten, als wären sie von Anton van Dyck. A.H. [Auf Holz] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Diese Nr.: Dessen Frau mit einer weissen Kappe und schwarz gekleidet stehet neben einem Tische Mat.: auf Holz Maße: Hoch 17 Vi Zoll, breit 13 Vi Zoll Anm.: Die Lose 193 und 194 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (42 Μ für die Nrn. 193 und 194) Käufer: Tietjen
Dyck, Anthonie van (zugeschrieben) 1781/09/10 BNAN 0140 van Dyck I Die Verspottung Christi. Ein Gemähide voll Ausdruck, auf Kupfer, vermuthlich von van Dyck. Es ist dasselbe, so er radiert. g.L. [im schwarzen Rahm mit 590
GEMÄLDE
1788/04/07 FRFAY 0013 Phi. van Dick I Ein besonders fleißig gemahltes Portrait eines jungen Menschen, von Phl. van Dick. Auf Tuch. I Mat.: auf Leinwand Maße: 17 Vi Z. hoch, und 12 Vi Z. breit Transakt.: Verkauft (36 Kr) Käufer: Barensfeld
1788/04/07 FRFAY 0037 Philip van Dyck I Ein vortreflich und delicat gemaltes Bildniß des Prinzen Heinrich Wilhelm von Oranien, von der geschickten Hand des Philip van Dyck. Auf Tuch. I Mat.: auf Leinwand Maße: 33 % Z. hoch, und 26 % Z. breit Transakt.: Verkauft (5.30 fl) Käufer: Boy 1788/04/08 FRFAY 0200 Phil, van Dyck I Ein schönes Bildniß eines Geistlichen von Phil, van Dyck. Auf Tuch. I Mat.: auf Leinwand Maße: 18 Zoll hoch und 15 Zoll breit Transakt.: Verkauft (11.30 fl) Käufer: Levi ν M[annheim] 1790/08/25 FRAN 0442 P. van Dyk I Der Friede in Gestalt eines Frauenzimmers, bittet Mars das Schwerdt einzustecken. I Maße: hoch 30 Zoll, breit 31 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (4.15 fl) Käufer: Mansinger von Regenspurg
Dyk, Philip van (und Gool, Jan) 1772/00/00 BSFRE 0042 Gool (Jean van); Philippe van Dyck I Une Piece de Betail, ou il y a des Vaches, Chevres & Moutons, avec quelques figures peintes, par Philippe van Dyck, c'est un Tableau des plus agreables & mieux termines, qui a ete dans le celebre Cabinet du feu Comte de Wassenaar. Bordüre sculptee & d'oree. I Mat.: auf Holz Maße: haut de 14 Vi & large de 20 V* pouces Transakt.: Unbekannt
E.** 1791/07/29 HBBMN [AJ0011 Ε.** I Die Himmelfahrt Christi, auf Holz. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt
Eberlein, Christian Nikolaus 1780/10/02 FRSTK 0007 Eberlein I Eines Mannes Bildniß, mit einem kurtzen Bart, und auf dem Kopf mit einer Pohlnischen Mütze. I Pendant zu Nr. 8 Maße: 8 Zoll hoch, 7 Zoll breit Transakt.: Unbekannt (1.4 fl für die Nm. 7 und 8) 1780/10/02
FRSTK
0008
Eberlein
I Z u m C o m p a g n o n ein der-
gleichen alter Kopf von nehmlicher Hand und Maas. I Pendant zu Nr. 7 Maße: 8 Zoll hoch, 7 Zoll breit Transakt.: Unbekannt (1.4 fl für die Nrn. 7 und 8) 1780/10/02 FRSTK 0013 E i e r t e n I Ein alter Mann mit einem grauen Barte, welcher sich auf einen Stock stützet, fleissig und schön ausgearbeitet von Eberlein. I Pendant zu Nr. 14 Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 10 Vi Zoll breit Transakt.: Unbekannt (7.1/4 fl für die Nrn. 13 und 14) 1780/10/02 FRSTK 0014 Eberlein I Das Gegenbild hierzn [sie], ein dergleichen alter Mann, mit einem Tabacks=Pfeifgen und einer Bier=Kanne, vom nehmlichen Meister und Maas. I Pendant zu Nr. 13 Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 10 Vi Zoll breit Transakt.: Unbekannt (7.1/4 fl für die Nrn. 13 und 14) 1792/07/28 HBSCN 0136 Eberlein I Cephalus und Procris, mit einem meisterhaften Pinsel entworfen. Auf Lfeinwand], G.R. [Goldnen Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 17 Vi Zoll, breit 25 Zoll Verkäufer: Dominicus Gottfried Waerdigh Transakt.: Unbekannt
Echard, Charles 1781/00/00 WRAN 0056 Echard \ Marine oü se voient plusieurs Bateaux rempli de Monde, sur le milieu de la gauche une grande Eglise, un bout d'avenue d'Arbres termine la gauche, sous laqu'elle on lit Ε. Tableau peint sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: haut 18 pouces 7 lignes, sur 24 pouces 4 lignes de large Inschr.: E. (bezeichnet) Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0057 Echard I Idem [Marine], ä droite on voit un Village avec un Moulin ä vent, contre le milieu une Chaloupe ä la voile, sur la gauche une Maison, par une fenetre un Homme regarde deux autres Hommes qui passent sur le Pont, & un troisieme, qui entre dans la cour; la gauche est terminee par deux arbres touffus, sous lesquels se voit une arcade; plusieurs personnes s'amusent ä parier, ä fumer, & ä pecher. Tableau peint sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: haut 15 pouces 6 lignes, large 13 pouces 6 lignes Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0058 Echard i Paysage, oü se voit ä droite un grand arbre, en bas contre le milieu un Chien, un Homme couche, & une Femme assise devidant du fil, devant eile un pot, & trois Vaches couchees, sur la gauche un Cheval blanc avec une seile, plus loin un Homme ä cheval & un autre ä pied un baton sur son epaule, plus bas on lit Ε. Tableau peint sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: haut 18 pouces 6 lignes, large 22 pouces 4 lignes Inschr.: E. (bezeichnet) Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0059 Echard I Marine, oü se voit ä droite deux Chaloupes ä la voile, plus bas un Bateau, contre le milieu [sic] un Village oü est un Clocher & un Moulin ä vent, au milieu une grande Maison au pieds du mur deux petits Bateaux oü sont des Pecheurs, ä gauche un Pont d'oü une Femme regarde en bas, on lit plus bas Ε. Tableau peint sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: haut 18 pouces 6 lignes, large 25 pouces Inschr.: E. (bezeichnet) Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0060 Echard I Marine, oü se voit les refles d'un vieu Fort, plus bas deux Bateaux, dans Tun trois Hommes, & dans l'autre deux, plus loin sur la gauche trois Chaloupes ä la voile, & un Bateau pres du Fort, on lit au bas sur le mur du Rempart E. Tableau peint sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: haut 12 pouces 5 lignes, sur 19 pouces 11 lignes de largeur Inschr.: E. (bezeichnet) Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1791/09/21 FRAN 0030 Eehard, Maler der Königl. Französ. Akademie I Vorne siehet man auf diesem Gemälde einen Canal und Bauern, welche ein Schif überfahren, auf der andern Seite sind Häußer, von der Sonne beleuchtet, zur Rechten ist eine Oefnung von Wasser, auf welchem eine wankende Brücke ist, so sich bey einem Haufen Bäumen endiget, der Himmel ist sehr leicht gefärbt, und macht eine sehr angenehme Wirkung. I Transakt.: Verkauft (126 fl) Käufer: Joseph Η R [?] Brentano
Eckhard, I.E. [Nicht identifiziert] 1794/01/20 LZRST 5858 I.E. Eckhard I Eine Landschaft, blos angelegt, mit Figuren, I.E. Eckhard pinx. auf Holz, 12 Zoll br. 13 Zoll hoch, in schw. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: 12 Zoll breit, 13 Zoll hoch Inschr.: I.E. Eckhard pinx. (signiert) Transakt.: Verkauft (1 Th) Käufer: D
Eberlein, Christian Nikolaus (Kopie von) Eckhardt, Georg Ludwig 1796/00/00 HLAN [0117] Eberlein I Kupezkis Bildnis. 24. 18. auf Leinvv. Copie von Eberlein. I Mat.: auf Leinwand Maße: 24. 18. Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: [Friedrich Karl Lang] Transakt.: Unbekannt (18.8 Rt; 33 fl Schätzung)
1794/02/21 HBHEG 0107 Louis Eckhardt I Ein Niederländischer Land= und Wasser=Prospect, mit Schiffen. Plaisant und schön gemahlt. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 13 Zoll, breit 17 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
591
1797/06/13 HBPAK 0103 Eckhard I Zwey sehr angenehme Land= und Wassergegenden, mit Staffage. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine sehr angenehme Land= und Wassergegend, mit Staffage Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Zoll, breit 23 % Zoll Anm.: Die Lose 103 und 104 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1775/09/09 HBBMN 0002 G. von Eckhoudt I Wie Jupiter die Europa entführet, extra rar gemahlt, mit großer Force und Kraft, so schön wie Rembrandt, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 3 F 2 Z, Breit 4 F 3 Ζ Transakt.: Verkauft (200.4 M) Käufer: Oom [?]
1797/06/13 HBPAK 0104 Eckhard I Zwey sehr angenehme Land= und Wassergegenden, mit Staffage. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine sehr angenehme Land= und Wassergegend, mit Staffage Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Zoll, breit 23 % Zoll Anm.: Die Lose 103 und 104 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1776/00/00 WZTRU 0037 Gerbrand von Eckhout I Ein Stück von 2 Schuhe, 6 Zoll hoch, 2 Schuhe, 3 Zoll breit von Gerbrand von Eckhout, stellet vor eine mit einer Brille auf der Nase in einem Buche bethende Frau. In diesem Stücke siehet man mit Erstaunen, wie mit wenigen Strichen dieser große Meister so viel Natur zu erkennen gegeben: ein starker Auftrag, ein wohlangebrachter Schatten, ein gehacktes Licht verherrlichen hierinn den Ruhm des Meisters, und die genaue Leidenschaft, der gute Geschmack der Costume geben den großen Lehrmeister Rembrandt ganz distinct zu erkennen. I Maße: 2 Schuhe 6 Zoll hoch, 2 Schuhe 3 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (200 fl Schätzung)
Eckhardt, Georg Ludwig (Kopie nach) 1792/02/01 LZRST 4842 Eckhard I Das Brustbild eines Kriegers, mit dem Knebelbart. Copie nach Eckhard, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: 12 Zoll hoch, 10 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft oder Unverkauft (4 Gr) Käufer: R[ost] 1793/01/15 LZRST 7027 Eckhard I Brustbild eines Kriegers mit dem Knebelbart, Copie nach Eckhard, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: 13 Zoll hoch, 10 Vi Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Eeckhout, Anthonie van den 1791/07/29 HBBMN 0006 Anth. Eckhout I Ein Conversations Stück; auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 14 Zoll, breit 17 Zoll Transakt.: Unbekannt ( I M )
Eeckhout, Gerbrand van den 1750/00/00 KOAN 0080 Gerbrand van den Eeckhaut I Une piece, representant un vieillard, dormant dans un fauteuil, sur bois, par Gerbrand van den Eeckhaut, qui egale Rembrand. I Mat.: auf Holz Maße: Largeur 1 Pies 7 Pouces, Haut 3 Pies Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollem Transakt.: Unbekannt 1763/11/09 FRJUN 0066 Eckhout I Un excellent tableau representant le Roi David qui decouvre Saül dans la Caverne, peint en perfection. I Maße: hauteur 13 Vi pouces, largeur 16 Vi pouces Transakt.: Verkauft (50 fl) Käufer: Hoch 1764/00/00 BLAN 0457 v. d'Eckhout I Maria die dem Kind Jesu die brüst gibt. I Maße: 1 Fuß 5 Zoll hoch, 1 Fuß 3 Vi Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (300 Rt Schätzung) Gegenw. Standort: Sankt-Peterburg, Rossiya. Ermitazh. (N 2075) 1764/00/00 BLAN 0579 v: d'Eckhout I Stellet den Tobiam vor, wie er seiner frau den Verweiß gibt. I Maße: 2 Fuß 2 Zoll hoch, 1 Fuß 8 Vi Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (300 Rt Schätzung) 1764/05/22 BOAN 0068 Eckhoelt I Un Tableau de quatre pieds six pouces de hauteur & trois pieds six pouces de largeur, representant un grand Pretre & des Scribes, peint par Eckhoelt. [Ein stück Vorstellend Einen hohen priester und schriftgelehrten, so sehr beschädiget, Von van Eckhodt.] I Maße: 4 pieds 6 pouces de hauteur & 3 pieds 6 pouces de largeur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (13.20 Rt) Käufer: Zisler 1764/11/26 LZBER 0021 Transakt.: Unbekannt
Enhout I Mardochai von Enhout. I
1767/00/00 KOAN 0049 van den Beckhaut I Ein Stuck auf Holtz, auf welchem ein alter Mann von van den Beckhaut. I Mat.: auf Holz Maße: Breite 3 Fuß 3 Zoll, Höhe 4 Fuß Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt 1775/05/08 HBPLK 0039 G. van Eckhoudt I Die Bathseba im Bade, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 13 Zoll 2 Linie, Breite 14 Zoll 5 Linie Transakt.: Unbekannt ([unleserlich] M) 592
GEMÄLDE
1776/00/00 WZTRU 0255 Gerbrand von der Eckhout I Ein Stück 1 Schuhe, 5 Zoll hoch, 1 Schuhe, 2 Zoll breit von Gerbrand von der Eckhout, stellet vor ein Bauernhaus, wo an der Thür ein berauschter Bauer einen Krug in der Hand haltend neben einem Bauernmägdlein heraus schauet, hiebey stehet ein Bauer mit einer Leyer, beynebens ein Jung und ein Mägdgen: dieses Stücke ist nach des Kenners genugsam bekannten Manier eines seiner beßten Zeiten verfertiget. I Maße: 2 Schuhe 5 Zoll hoch, 1 Schuhe 2 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (8 fl Schätzung) 1776/00/00 WZTRU 0314 Gerbrand von der Ekhout I Ein Stück 7 Zoll hoch, 5 Zoll breit von Gerbrand von der Ekhout, stellet vor Antonius den Eremiten in Versuchung: dieses Stücke ist mit guter Practique und wohl verstandenen einfallenden Licht unter die beßte Art der Mahlerey zu setzen. I Maße: 7 Zoll hoch, 5 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (6 fl Schätzung) 1776/04/15 HBBMN 0101 Gerbrand van Eckhaud I Die Diana mit Endimeon und Nebenfiguren, ein ungemein rares Stück. I Maße: Höhe 2 Fuß 2 Zoll, Breite 1 Fuß 10 Vi Zoll Transakt.: Unverkauft 1778/07/21 HBHTZ 0076 Eckhoudt I Die Römische Liebe, so schön als Rembrandt, von Eckhoudt, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 9 Zoll, breit 11 Zoll Transakt.: Unbekannt (9 M) 1778/10/30 HBKOS 0077 Eckhoudt I Ein Philosoph, der im Schreiben beschäftigt, mit vielen Büchern aufm Tische, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 12 Zoll, breit 17 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1779/09/27 FRNGL 0598 Eckhout I Eines Türken Bildniß, von Eckhout, meisterhaft ausgearbeitet. [Le portrait d'un Türe, trfes bien peint.] I Maße: 2 Schuh hoch, 1 Schuh 3 Zoll breit Transakt.: Verkauft (9 fl) Käufer: Baron von Braweck 1781/00/00 WZAN 0037 Gerbrand von Eckhout I Ein Stück von 2 Schuhen, 6 Zoll hoch, 2 Schuhe 3 Zoll breit von Gerbrand von Eckhout, stellet eine mit einer Brille auf der Nase in einem Buche bethende Frau vor. In diesem Stücke sieht man mit Erstaunen, wie mit wenigen Strichen dieser große Meister so viel Natur zu erkennen gegeben: ein starker Auftrag, ein wohl angebrachter Schatten, ein gebacktes Licht verherrlichen hierinn den Ruhm des Meisters, und die genaue Leidenschaft, der gute Geschmack der Kostüme geben den großen Lehrmeister Rembrand ganz deutlich zu erkennen. I Maße: 2 Schuhe 6 Zoll hoch, 2 Schuhe 3 Zoll breit Transakt. : Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0255 Gerbrand von der Eckhout I Ein Stück, 1 Schuhe, 5 Zoll hoch, 1 Schuhe, 2 Zoll breit von Gerbrand von der Eckhout, stellet ein Bauernhaus vor, wo an der Thüre ein berauschter Bauer einen Krug in der Hand haltend neben einem Bauermädchen heraus schauet; hiebey stehet ein Bauer mit einer Leyer, nebst einem Jungen, und einem Mädchen: dieses Stück ist nach des Kenners genugsam bekannten Manier eines seiner beßten Zei-
ten. I Maße: 2 Schuhe 5 Zoll hoch, 1 Schuhe 2 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0314 Gerbrand von der Ekhout I Ein Stück 7 Zoll hoch, 5 Zoll breit vom Gerbrand von der Ekhout, zeiget den Eremiten Antonium in Versuchung: dieses Stück ist wegen guter Praktik und wohl verstandenem einfallendem Licht unter die beßte Art der Mahlerey zu setzen. I Maße: 1 Zoll hoch, 5 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1784/05/11 HBKOS 0119 G. van Eckhoudt I Die Kinder Israel in der Wüsten, mit Moses und Aaron, von großem Affect gemahlt, wie auch von vortreflicher Ordonnanz, fleißig gemahlt auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 34 Zoll, breit 55 Zoll Transakt.: Verkauft (31 M) Käufer: Ε 1785/05/17 MZAN 0237 van Eckhout I Christus wie er bey entstandnem Gewitter von seinen Jüngern aus dem Schlafe geweckt wird von van Eckhout. [Jesus Christ eveille par ses disciples dans l'orage.] I Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch, 2 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (21 fl) Käufer: Rmus D Custos L Β ä Zobel 1785/05/17 MZAN 0332 van Eckhout I Christus lehrend im Tempel von van Eckhout. [Jesus Christ enseignant au temple.] I Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 2 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (25 fl) Käufer: Rmus D Cantor L Β äl Hoheneck 1785/05/17 MZAN 0545 van Eckhout I Ein Philosophenkopf von van Eckhout. [Une tete de philosophe.] I Maße: 2 Schuh 3 Zoll hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (20 fl) Käufer: Hofr ν Leykam 1785/05/17 MZAN 0690 Eckhout I Ein ovidisches Fabelstück von Eckhout. [Un tableau dont le sujet est pris des metamorphoses d'Ovide.] I Maße: 1 Schuh 2 Vi Zoll hoch, 11 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (7 fl) Käufer: Clausius 1787/00/00 HB AN 0039 Gerbrand van den Eckhondt I Hagar führt mit thränenden Augen ihren sich schreckhaft umsehenden Sohne zu ihrer Rechten. Unter ihren linken Arme trägt sie eine kleine Bürde. In der Ferne sieht man eine Landschaft. Dieses Gemählde ist sowohl in der Zeichnung, Mahlerey, als Colorit und Ausdrücke, aufs schönste bearbeitet. [Halbe Figuren, Lebensgrösse] Auf Leinewand, g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 48 Zoll, breit 39 Zoll Transakt.: Verkauft (40.8 M) Käufer: Fesser 1787/00/00 HB AN 0144 Gerbrand van den Eckhoudt I Maria Magdalena in der Höhle, roth bekleidet, und mit einem purpurnen Schleyer über dem Haupte. Sie faltet ihre beyden Hände über einen Todtenkopf, und wendet ihre thränenden Augen auf ein vor ihr offen stehendes Buch. Sehr frey gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 32 Zoll, breit 27 Zoll Transakt.: Verkauft (10 M) Käufer: Packy 1787/00/00 HB AN 0239 Gerbr. van den Eckhout I Ein geharrnischter Krieger in einem rothen Gewände raucht eine Pfeiffe Toback, so er in seiner linken Hand hält. Sehr kräftig und frey gemahlt, und von besonders auffallendem Lichte. Halbe Figur. A.H. [Auf Holz] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Zoll, breit 10 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (27 M) Käufer: Fesser 1787/00/00 HB AN 0245 Gerbr. v. d. Eckhout I Der todte heilige Sebastian, bey den aufgehabenen Händen an einen Baum gebunden; über sein hervorragendes Knie ist ein blaues und rothes Gewand geworfen. Zu seinen Füßen liegen Waffen. Im Hintergrunde verschiedene bewaffnete Krieger. Besonders hurtig gemahlt und von richtiger Zeichnung. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 12 % Zoll Transakt.: Verkauft (7.4 M) Käufer: Tietjen
1787/10/06 HBTEX 0114 Gerb. v. Eckhaud I Zwey historische Vorstellungen, eines vom Samariter, vortreflich gezeichnet und gemahlt, von Gerb. v. Eckhaud; der Compognion [sie] von Aug. Querfurt. I Diese Nr.: Eine historische Vorstellung; Pendant zu Nr. 115 von A. Querfurt Anm.: Die Lose 114 und 115 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1788/04/07 FRFAY 0079 Eckhout I Ein kleines Portrait eines Orientalischen Priesters, von Eckhout. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: 9 Zoll hoch, und 6 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (20 Kr) Käufer: Barensfelde 1788/06/12 HBRMS A0028 G. v. Eckhoudt I Die Geschichte des Juda und Thamar; und Loth mit seinen Töchtern, zum Comp, wie Rembrand gemalt. Auf Holz. I Diese Nr.: Die Geschichte des Juda und Thamar; Pendant zu Nr. A29 Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Vi Zoll, breit 16 lA Zoll Anm.: Die Lose A28 und A29 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1788/06/12 HBRMS A0029 G. v. Eckhoudt I Die Geschichte des Juda und Thamar; und Loth mit seinen Töchtern, zum Comp, wie Rembrand gemalt. Auf Holz. I Diese Nr.: Loth mit seinen Töchtern; Pendant zu Nr. A28 Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Vi Zoll, breit 16 Ά Zoll Anm.: Die Lose A28 und A29 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1788/10/01 FRAN 0089 Eckhout I Christus im Oelgarten da ihm der Engel erscheinet, von van den Eckhout, 18 Zoll hoch, 14 Zoll breit. Dieses Gemälde ist so schön, als von Rembrant, welchem es auch viele zuschreiben. I Maße: 18 Zoll hoch, 14 Zoll breit Transakt.: Verkauft (9 fl) Käufer: von Schmid 1789/04/16 HBTEX 0042 Gerbrand v. Eckhaudt I Die Geschichte Lots, so schön wie Rembrand, auf Leinewand. I Maße: Hoch 22 Zoll, breit 16 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (3.08 M) Käufer: Bostelmann 1790/04/13 HBLIE 0039 Gerb, van Eckhoudt I Wie die Samariterinn Christus zu trinken giebt, wobey die Achtsamkeit von beyden auf das edelste beobachtet ist; die schöne Sonnen=Beleuchtung herrscht in der ganzen Composition vortreflich, und ist in allen geistreich vorgestellet und schön gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 24 Zoll, breit 36 Zoll Transakt.: Verkauft (6.2 M) Käufer: Bertheau 1790/09/10 HBBMN 0060 Gerbrand v. Eckhoudt I Wie Abraham mit Isaac zum opfern geht, ganz besonders fleißig und sehr schön gemahlt. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 37 Zoll, breit 29 Zoll Transakt.: Verkauft (5 M) Käufer: Ego 1790/09/10 HBBMN 0113 G. v. d. Eckhout I Die angeschlossene Andromeda wird durch den Perseus vom Meerwunder befreiet; sehr schön gemahlt. Auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 30 Zoll, breit 21 Zoll Transakt.: Verkauft (2.4 M) Käufer: Bargmann 1792/09/28 HBBMN 0060 G. v. Eckhaudt I Eine priesterliche Trauung, von G. v. Eckhaudt. Auf H[olz]. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Zoll, breit 10 % Zoll Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 FGAN [B]0197 Gerhard Ekhaut I Ein Weibskopf mit einem weißen Kragen, auf Holz gemalt. I Mat.: auf Holz Maße: 6 Zoll hoch, 4 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt (8 fl) 1794/00/00 HB AN 0157 Gebrand van den Ekhout I Unter einer dichten Eiche ruht ein frischer Bauernknabe. Der süsse Schlaf ist über sein ganzes Gesicht, sonderlich auf seinen Lippen, ausgegossen. I Maße: Höhe 12 Vi Zoll, Breite 11 Vi Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1794/02/21 HB HEG 0142 den Eckhout I Eine Mutter mit ihren Sohn. In der Feme eine Stadt. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 17 Zoll, breit 15 Zoll Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
593
1795/11/14 HBPAK 0020 G. Eckhaudt I Mit sehr aufmerksamer Miene, wiegt ein Philosoph der in seiner Eremitage sitzt die Welt und Himmelskugel. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 13 Zoll, breit 11 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/08/00 HBPAK 0043 Gerbrand van den Eckhout I Ein alter Mann, welcher singet, wozu ein kleiner Knabe die Flöte blaset. Im Innern eines Zimmers mit vielen Nebenwerken vorgestellt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 10 Zoll, Breite 13 Vs Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/08/00 HBPAK 0091 Gerbrand van den Eckhout I Eine Frau, mit ihrem Knaben zur Seite, reinigt ihr kleines Hündchen. Mit vielen Nebenwerken im Innern eines Zimmers. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 16 Vi Zoll, Breite 12 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/10/17 HBPAK 0299 Gerbr. van Eckhaudt I Simeon mit dem Christ=Kinde. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 17 Zoll 6 Lin., breit 31 Zoll 10 Lin. Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0156 Gerbrand von den Eckhut I Ein Nachdenkender, der sich auf der rechten Hand ruhet. I Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0159 Gerbrand von den Eckhut I Ein weisbärtiger alter Kopf mit Händen. I Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0167 Gerbrand von den Eckhut I Ein bärtiger Kopf. I Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0174 G. v. d. Eckhut I Ein weisbärtiger Kopf mit einer sammtnen Mütze. I Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0196 G. v. d. Eckhut I Venus und Cupido in einer Landschaft. I Transakt.: Unbekannt 1797/04/25 HBPAK 0033 Eckhoudt I Eine biblische Geschichte, vorstellend wie die drey Engel von Abraham sind bewirthet worden, hauptsächlich aber hier andeutend wie der eine Engel Abraham verspricht, daß seine Frau Sara noch einen Sohn haben sollte, man sieht sie hinter der Thüre lächelnd stehen; alle Figuren in Lebensgröße, und aufs Meisterhafteste vorgestellt, und ausgedrückt. Auf Leinw. goldenen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 24 Vi Zoll, breit 29 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt Gegenw. Standort: Sankt-Peterburg, Rossiya. Ermitazh. (8523) (?) 1797/04/25 HBPAK 0063 Eckhoudt I Eine Landschaft, wo eine Frau mit ihrem Kinde im Schooß auf der Erde sizt, ein alter Greis neben ihr. Sehr gut gemahlt. Auf Holz, schwarzen Rahm, goldene Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 25 Vi Zoll, breit 20 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/12/08 HBPAK 0031 Eckhaut I Ein inwendiges Zimmer mit einer Frau, welche ein Kind aufm Schoosse hält. Auf Leinwand, im schw. Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 16 Zoll, Breite 13 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/12/08 HBPAK 0050 Eckhaut I Ein alter Mannskopf. Sehr gut gemahlt. Auf Holz, im schw. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 7 Vi Zoll, Breite 6 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/11/14 HBPAK 0174 Eckhaut I Das Inwendige eines Zimmers: Eine Frau sitzt und hält ein Kind aufm Schoosse an der Brust. Auf Leinwand, im schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 26 Zoll, breit 24 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 LZAN 0037 van den Eckhout Guerbrant I Eleve de Rembrant. Un Tableau. Joseph et Marie fuyants en Egypte: piquant par l'ordonnance et les accessoires superieurement rendus. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 18 pouces, largeur 16 pouces Transakt.: Unbekannt (20 Louis Schätzung) 1799/00/00 WZAN 0188 Gerbrand van den Ekhout I David mit dem Haupte Goliaths, wie Abner denselben vor Saul führet. Von Gerbrand van den Ekhout. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 6 Zoll breit 1 Schuh 10 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 594
GEMÄLDE
1800/00/00 FRANl 0040 Eckhout (van) I Die Abnehmung vom Kreuz. Mehrere Figuren sind beschäftigt Christus herunter zu nehmen, ein Richter steht vor demselben, eine auf der Erde sitzende Frau u. zwei männliche Figuren sind Zuschauer. In Entfernung ist ein Gebäude. I Mat.: auf Holz Maße: 19 Vi Zoll hoch, 16 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0096 G. Eckhout I Ein lachender Bauer mit einem Glase Wein in der Hand. Auf Leinw., goldn. Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 16 Zoll, breit 12 Zoll Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0773 Gerbr. Eckhaudt I Zwölf Stücke; Skizzen mit Figuren. I Transakt.: Unbekannt
Eeckhout, Gerbrand van den (und Isaacsz., Isaac) 1796/08/00 HBPAK 0004 J. Jsackss invent; Gerbrand van den Eckhout pinxit I Ein Priester, von verschiednen Personen umgeben, scheint, an einigen vor ihm stehenden Kriegern, Brodt auszutheilen. Mit vielen Nebensachen. Ganze Figuren. Ein kostbares Gemähide. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 38 Zoll, Breite 42 Zoll Inschr.: Gerbrand van den Eckhout pinxit J. Jsackss invent, (signiert) Transakt.: Unbekannt
Eeckhout, Gerbrand van den (und Saftleven, H.) 1764/05/18 BLAN 0029 Gerbrant van den Eekhout; Hermann Sachtleven I Christi Berg=Predigt. Auf Holtz gemahlt, 1 Fuß 12 Zoll hoch und 1 Fuß 7 Zoll breit. Die Vorstellung ist sehr zahlreich von Figuren, die ungemein schön ausgeführt sind; besonders ist die Haltung in diesem Bilde schön und ganz meisterhaft. Der Hintergrund ist eine Landschafft von Hermann Sachtleven gemahlt, welche sich mit denen Figuren ausnehmend gut verbindet, und sehr angenehm und Verblasen gemahlt ist. Die Gemähide von Eekhout werden von Kennern und Liebhabern sehr hoch geschätzt, und können einem ieden Cabinette viel Zierde geben. Dieses Stück ist vorzüglich schön und kostbar, weil die Figuren so ausnehmend klein sind, und dieser Meister sonst nicht viele von der Art verfertiget hat. [Text hier gekürzt], I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 12 Zoll hoch, und 1 Fuß 7 Zoll breit Verkäufer: Johann Georg Eimbke Transakt.: Verkauft (93 Rt) Käufer: Ghk Eichel
Eeckhout, Gerbrand van den (Geschmack von) 1787/00/00 HB AN 0531 Im Gusto von Eckhoudt I Die Historie vom Zinsegroschen. Sehr brav gemahlt. Halbe Figuren. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 27 Zoll, breit 32 Zoll Transakt.: Verkauft (10 M) Käufer: Fesser
Eeckhout, Gerbrand van den (Manier) 1774/11/03 HBNEU 0028 Eckhoudt I Die Ausstoßung der Hagar aus dem Hause Abrahams, kräftig gemahlt wie von Eckhoudt. I Verkäufer: Ritter Transakt.: Verkauft (18.4 M) Käufer: Linau 1789/08/18 HB GOV 0076 Wie G. van Eckhaud I Ein Conversations=Stück, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 Vi Zoll, breit 10 % Zoll Transakt.: Unbekannt 1795/03/12 HBSDT 0070 Wie Eckhout I Ein Hirtenknabe, der seinen Schaafen auf der Schalmey was vorbläset. Auf Holz, im goldnen Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Zoll, breit 14 Zoll Transakt.: Unbekannt
Eertvelt, Andries van
zog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (36 fl für die Nrn. 228 und 229, Schätzung)
1786/05/02 NGAN 0486 Andreas van Artveit I Ein Seesturm. I Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch, 2 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (1.31 fl) Käufer: ν Führer 1794/02/21 HB HEG 0044 Andreas van Ardveit I In einem fürchterlichen Seesturm verunglücken zwey Schiffe, deren Spitzen am Fuße der steilen Felsen, worauf ein Casteel ist, nur noch etwas hervorragen. Drey andere Schiffe leiden ebenfalls Gefahr. Kräftig und stark gemahlt. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 27 Zoll, breit 36 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0681 Andreas van Artveit I Zwey Seestükke, von Andreas van Artveit. Auf Kupfer. I Diese Nr.: Ein Seestück Mat.: auf Kupfer Maße: hoch 10 Zoll breit 1 Schuh 7 Zoll Anm.: Die Lose 681 und 682 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0682 Andreas van Artveit I Zwey Seestükke, von Andreas van Artveit. Auf Kupfer. I Diese Nr.: Ein Seestück Mat.: auf Kupfer Maße: hoch 10 Zoll breit 1 Schuh 7 Zoll Anm.: Die Lose 681 und 682 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Eger, Georg Adam 1765/00/00
FRNGL
0099
Eger\
2
Jagdstücke,
i
Transakt.: Un-
bekannt (6 fl Schätzung) 1785/05/17 MZAN 0595 /Eger I Zwey Hirschköpfe bezeichnet AEger. [Deux tetes tranchees de cerfs marquees AEger.] I Diese Nr.: Ein Hirschkopf Maße: 3 Schuh 7 Zoll hoch, 3 Schuh 3 Zoll breit Inschr.: JEger (bezeichnet) Anm.: Die Lose 595 und 596 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (13.30 fl für die Nrn. 595 und 596) Käufer: Forstrath Keck 1785/05/17 MZAN 0596 JEger I Zwey Hirschköpfe bezeichnet AEger. [Deux tetes tranchees de cerfs marquees AEger.] I Diese Nr.: Ein Hirschkopf Maße: 3 Schuh 7 Zoll hoch, 3 Schuh 3 Zoll breit Inschr.: JEger (bezeichnet) Anm.: Die Lose 595 und 596 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (13.30 fl für die Nrn. 595 und 596) Käufer: Forstrath Keck
Ehlers, Martin [Nicht identifiziert] 1794/09/09 HBPAK 0058 Martin Ehlers I Ein sehr schönes Stilleben, mit Austern, Früchte u. a. m. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 27 Zoll, breit 20 Zoll Transakt.: Unbekannt
Ehrenberg, Wilhelm van 1740/00/00 AU AN 0003 Ehrenberger I 2. Romanische Gebäu vom Ehrenberger. I Maße: 3 Vi. Schuh hoch / 4. Schuh 9. Zoll breit Transakt.: Unbekannt (300 fl) 1740/00/00 AUAN 0008 Ehrenberger I 1. Romanisch Gebäu vom Ehrenberger. I Maße: 4. Schuh hoch / 5. Schuh / 7. Zoll breit Transakt.: Unbekannt (200 fl) 1797/08/10 MMAN 0228 Elenberg I Zwei Gegenstück, Architectur vorstellend, auf Tuch. I Diese Nr.: Ein Gegenstück, Architectur vorstellend; Pendant zu Nr. 229 Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 228 und 229 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (36 fl für die Nrn. 228 und 229, Schätzung) 1797/08/10 MMAN 0229 Elenberg I Zwei Gegenstück, Architectur vorstellend, auf Tuch. I Diese Nr.: Ein Gegenstück, Architectur vorstellend; Pendant zu Nr. 228 Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 228 und 229 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Her-
1797/08/10 MMAN 0240 Ehrenberg I Zwei Gegenstücke. Architectur mit vielen Figuren, auf Tuch. I Diese Nr.: Ein Gegenstück. Architectur mit vielen Figuren; Pendant zu Nr. 241 Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 240 und 241 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (40 fl für die Nrn. 240 und 241, Schätzung) 1797/08/10 MMAN 0241 Ehrenberg I Zwei Gegenstücke. Architectur mit vielen Figuren, auf Tuch. I Diese Nr.: Ein Gegenstück. Architectur mit vielen Figuren; Pendant zu Nr. 240 Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 240 und 241 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (40 fl für die Nrn. 240 und 241, Schätzung) 1797/08/10 MMAN 0303 Ehrenberg I Gegenstücke. Grabmäler vorstellend von Ehrenberg, auf Tuch. I Diese Nr.: Ein Gegenstück. Grabmäler vorstellend; Pendant zu Nr. 304 Anm.: Die Lose 303 und 304 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (16 fl für die Nrn. 303 und 304, Schätzung) 1797/08/10 MMAN 0304 Ehrenberg I Gegenstücke. Grabmäler vorstellend von Ehrenberg, auf Tuch. I Diese Nr.: Ein Gegenstück. Grabmäler vorstellend; Pendant zu Nr. 303 Anm.: Die Lose 303 und 304 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (16 fl für die Nrn. 303 und 304, Schätzung)
Ehrenfried [Nicht identifiziert] 1796/10/17 HBPAK 0320 Ehrenfried! Maria und Elisabeth. 1 Maße: Hoch 7 Zoll, breit 6 Zoll Transakt.: Unbekannt
Ehrenstrahl, David Klöcker 1747/04/06 HB AN 0071 Klöcker von Ehrenstral I Ein Portrait von Klöcker von Ehrenstral klein Oval. I Format: oval Verkäufer: Brockes Transakt.: Unbekannt (2.8) 1775/09/09 HBBMN 0055 Ehrenstrahl I Ein Bibliothek=Stückchen, vorstellend in Lebens=Größe, den Bauer, der bey der Taufe König Carls XII. als Repräsentant des Bauern=Standes Gevatter stand, auf Leinewand, in einem sauber vergoldeten Rahmen. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 1 F 4 Z, Breit 1 F Transakt.: Verkauft (6 [?]) Käufer: Lilie 1778/03/28 HBSCM 0061 Klöcker Ehrenstral I Ein kleiner Knabe. I Transakt.: Unbekannt 1784/05/11 HB KOS 0122 G. Ludw. von Ehrenstrahl I Zwei Bataillen mit König Carl dem XII. von G. Ludw. von Ehrenstrahl, auf Leinewand. I Diese Nr.: Eine Bataille mit König Carl dem XII. Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 14 Zoll, breit 18 Zoll Anm.: Die Lose 122 und 123 wurden zusammen katalogisiert. Der Name des Künstlers ist angegeben als "G. Ludw. von Ehrenstrahl", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt. : Verkauft (3 M) Käufer: Β 1784/05/11 HBKOS 0123 G. Ludw. von Ehrenstrahl I Zwei Bataillen mit König Carl dem XII. von G. Ludw. von Ehrenstrahl, auf Leinewand. I Diese Nr.: Eine Bataille mit König Carl dem XII. Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 14 Zoll, breit 18 Zoll Anm.: Die Lose 122 und 123 wurden zusammen katalogisiert. Der Name des Künstlers ist angegeben als "G. Ludw. von Ehrenstrahl", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Verkauft (3 M) Käufer: Β 1785/12/03 HBBMN 0063 CI. Ehrenstraal I Die Königinn Christina in Schweden. I Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
595
1790/08/13 HBBMN 0009 David Klöeker I Das Bildnis eines Fürsten, im Harnisch; von starken Coulleurite. Auf L[einwand]. G.R. [Goldnen Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 33 Zoll, breit 27 Zoll Transakt.: Verkauft (1.8 M) Käufer: Eckhardt
Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein Fruchtstück mit Trauben, Melonen, Pfirschen, Blumen ec. Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 29 Zoll, breit 38 Zoll Anm.: Die Lose 119 und 120 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1796/10/17 HBPAK 0162 Baron K. Erenstral I König Carl der 1 lte. Wahres Original von diesem Meister. Schwarzer Rahm. I Maße: Hoch 46 Vi Zoll, breit 40 Zoll Transakt.: Unbekannt
1799/08/09 HBPAK 0120 Eichler I Zwey Fruchtstücke mit Trauben, Melonen, Pfirschen, Blumen ec. Auf Leinwand, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Ein Fruchtstück mit Trauben, Melonen, Pfirschen, Blumen ec. Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 29 Zoll, breit 38 Zoll Anm.: Die Lose 119 und 120 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1796/12/07 HBPAK 0162 K. Ehrenstrahl I Ein junger Kopf in Ritter=Costüm. I Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK akt. : Unbekannt
0610
Ehrenstrahl I Carolus XII. I Trans-
Ehrenstrahl, David Klöeker (Kopie nach) 1800/11/12 HBPAK 0048 Ehrenstrahl I Carlotus, ein Portrait, nach Ehrenstrahl. I Diese Nr.: Carlotus Anm.: Die Lose 48 und 49 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0049 Ehrenstrahl I Carlotus, ein Portrait, nach Ehrenstrahl. I Diese Nr.: Ein Portrait Anm.: Die Lose 48 und 49 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Ehrler, J.P. [Nicht identifiziert] 1794/00/00 FGAN [A]0008 J.P. Ehrler I Zwey Stücke, die Geburt Christi und die Flucht in Egypten, auf Holz gemalt. I Mat.: auf Holz Maße: 10 Vi Zoll hoch, 8 Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt (22 fl)
Eichhorn, Franz Joseph 1764/08/25 FRAN 0112 Eichhorn I Une femme en habit espagnol avec un oiseau et un gargon jouant de la flute. I Diese Nr.: Une femme en habit espagnol avec un oiseau Maße: haut 8 pouces sur 6 pouces de large Anm.: Die Lose 112 und 113 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1764/08/25 FRAN 0113 Eichhorn I Une femme en habit espagnol avec un oiseau et un garfon jouant de la flute. I Diese Nr.: Un gargon jouant de la flute Maße: haut 8 pouces sur 6 pouces de large Anm.: Die Lose 112 und 113 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1764/08/25 FRAN 0216 Eichhorn I Une Vierge. I Maße: haut 1 pied 3 pouces sur 1 pied 1 Vi pouces de large Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt
Eichler, Johann Conrad 1743/00/00 BWGRA 0185 Eichler I Ein Frucht=Stück von Eichler. I Pendant zu Nr. 186 von A.F. Harms Maße: hoch 2 Fuß 6 Zoll, breit 3 Fuß Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0200 Eichler I Ein Blumen= und Frucht= Stück von Eichler. I Diese Nr.: Ein Blumen=Stück Maße: hoch 9 Zoll, breit 11 Vi Zoll Anm.: Die Lose 200 und 201 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0201 Eichler I Ein Blumen= und Frucht= Stück von Eichler. I Diese Nr.: Ein Frucht=Stück Maße: hoch 9 Zoll, breit 11 Vi Zoll Anm.: Die Lose 200 und 201 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1789/08/00 HNAN 0080 Eichler I Ein Fruchtstück. Schw.R.m.g.L. [Schwarzer Rahm mit goldenen Leisten] I Maße: Höhe 39 Zoll, Breite 53 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/08/09 HBPAK 0119 Eichler I Zwey Fruchtstücke mit Trauben, Melonen, Pfirschen, Blumen ec. Auf Leinwand, schw. 596
GEMÄLDE
Eik, J. [Nicht identifiziert] 1781/00/00 WRAN 0062 Eik (J.) I Conversation Espagnole, tous personnages dans le genre de Vatteau. Beaux Tableaux peints sur bois: ils portent 14 pouces 6 lignes de haut, sur 16 pouces de large, faisant pendant. I Pendant zu Nr. 63 Mat.: auf Holz Maße: 14 pouces 6 lignes de haut, sur 16 pouces de large Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WRAN 0063 Eik (J.) I Conversation Espagnole, tous personnages dans le genre de Vatteau. Beaux Tableaux peints sur bois: ils portent 14 pouces 6 lignes de haut, sur 16 pouces de large, faisant pendant. I Pendant zu Nr. 62 Mat.: auf Holz Maße: 14 pouces 6 lignes de haut, sur 16 pouces de large Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt
Eill (Eyll) [Nicht identifiziert] 1742/08/01 BOAN 0229 von Eill \ Noch zwey Landschafften. Originalien vom von Eill. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0132 Van Eyll I Deux Pai'sages, par Van Eyll. I Maße: Haut 1. pie, 5. pou. large 2. p. 3. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt
Eimmart, Georg Christoph (I) 1799/00/00 WZAN 0583 Georg Christoph Eimart IVierKüchen= und Früchtestücke, von Georg Christoph Eimart. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Küchen= und Früchtenstück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 8 Zoll breit 1 Schuh 9 Zoll Anm.: Die Lose 583 bis 586 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0584 Georg Christoph Eimart I Vier Küchen= und Früchtestücke, von Georg Christoph Eimart. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Küchen= und Früchtenstück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 8 Zoll breit 1 Schuh 9 Zoll Anm.: Die Lose 583 bis 586 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0585 Georg Christoph Eimart I Vier Küchen= und Früchtestücke, von Georg Christoph Eimart. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Küchen= und Früchtenstück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 8 Zoll breit 1 Schuh 9 Zoll Anm.: Die Lose 583 bis 586 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0586 Georg Christoph Eimart I Vier Küchen= und Früchtestücke, von Georg Christoph Eimart. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Küchen= und Früchtenstück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 8 Zoll breit 1 Schuh 9 Zoll Anm.: Die Lose 583 bis 586 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0090 Georg Christoph Eimart I Zwey Stücke, worauf Federwildprett, Früchte und Blumen, von Georg Christoph Eimart. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Stück, worauf Fe-
derwildprett, Früchte und Blumen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 6 Zoll breit 2 Schuh Anm.: Die Lose A90 und A91 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0091 Georg Christoph Eimart I Zwey Stücke, worauf Federwildprett, Früchte und Blumen, von Georg Christoph Eimart. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Stück, worauf Federwildprett, Früchte und Blumen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 6 Zoll breit 2 Schuh Anm.: Die Lose A90 und A91 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Eimmart, Maria Clara 1799/00/00 WZAN 0206 Maria Clara Eimart I Zwey Blumenstücke, von Maria Clara Eimart. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 4 Zoll breit 1 Schuh Anm.: Die Lose 206 und 207 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0207 Maria Clara Eimart I Zwey Blumenstücke, von Maria Clara Eimart. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Blumenstück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 4 Zoll breit 1 Schuh Anm.: Die Lose 206 und 207 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0504 Maria Clara Eimart I Drey Blumenstückchen, von Maria Clara Eimart. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Blumenstückchen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 8 Zoll breit 11 Zoll Anm.: Die Lose 504 bis 506 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0505 Maria Clara Eimart I Drey Blumenstückchen, von Maria Clara Eimart. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Blumenstückchen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 8 Zoll breit 11 Zoll Anm.: Die Lose 504 bis 506 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0506 Maria Clara Eimart I Drey Blumenstückchen, von Maria Clara Eimart. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Blumenstückchen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 8 Zoll breit 11 Zoll Anm.: Die Lose 504 bis 506 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Eisele [Nicht identifiziert] 1790/01/07 MUAN 0900 Eisele I Der Erzengel Michael, auf Kupfer, de Anno 1691. I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 4 Zoll, Breite 3 Zoll Inschr.: Anno 1691 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt
Eisen, Francois 1791/09/26 FRAN 0229 F. Eisen I Ein holländischer Doktor und ein dergleichen Bauer, fleißig gemahlt von F. Eisen. I Diese Nr.: Ein holländischer Doktor Maße: 7 Zoll hoch, 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 229 und 230 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 1791/09/26 FRAN 0230 F. Eisen I Ein holländischer Doktor und ein dergleichen Bauer, fleißig gemahlt von F. Eisen. I Diese Nr.: Ein holländischer Bauer Maße: 1 Zoll hoch, 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 229 und 230 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt
Eisenmann, Georg 1752/00/00 NGWOL 0038 Eisenmann I Ein Winter und Nachtstück. Due pezzi rappresentanti l'invemo e la notte. I Diese Nr.: Ein Winterstück Anm.: Die Lose 38 und 39 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (8 Th für die Nrn. 38 und 39) 1752/00/00 NGWOL 0039 Eisenmann I Ein Winter und Nachtstück. Due pezzi rappresentanti l'inverno e la notte. I Diese Nr.: Ein Nachtstück Anm.: Die Lose 38 und 39 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (8 Th für die Nm. 38 und 39) 1752/00/00 NGWOL 0042 Eisenmann I Zwey kleine Landschäftlein. Due paesettini. I Diese Nr.: Ein kleines Landschäftlein Anm.: Die Lose 42 und 43 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (2.16 Th für die Nrn. 42 und 43) 1752/00/00 NGWOL 0043 Eisenmann I Zwey kleine Landschäftlein. Due paesettini. I Diese Nr.: Ein kleines Landschäftlein Anm.: Die Lose 42 und 43 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (2.16 Th für die Nrn. 42 und 43) 1752/00/00 NGWOL 0054 Eisenmann I Zwo Landschaften. Due paesaggi. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 54 und 55 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (10 Th für die Nrn. 54 und 55) 1752/00/00 NGWOL 0055 Eisenmann I Zwo Landschaften. Due paesaggi. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 54 und 55 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (10 Th für die Nrn. 54 und 55) 1752/00/00 NGWOL 0058 Eisenmann I Eine Landschaft mit einem Regen. Vn paesaggio con pioggia. I Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (3 Th) 1752/00/00 NGWOL 0059 Eisenmann I Eine kleine Landschaft von Eisenmann. Vn altro [paesaggio] piü piccolo del medes. [Eisenmann] I Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (1.8 Th) 1752/00/00 NGWOL 0061 Eisenmann I Eine Landschaft. Vn paesaggio. I Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (3 Th) 1752/00/00 NGWOL 0066 Eisenmann I Eine kleines Viehstück, von Eisenmann auf Rosische Art. Vn pezzetto d'armenti dall' Eisenmann a guisa del Rosa. I Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (4 Th) 1752/00/00 NGWOL 0083 Eisenmann I Zwo Landschaften. Due Paesaggi. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 83 und 84 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (4 Th für die Nrn. 83 und 84) 1752/00/00 NGWOL 0084 Eisenmann I Zwo Landschaften. Due Paesaggi. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 83 und 84 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (4 Th für die Nrn. 83 und 84) 1752/00/00 NGWOL 0087 Eisenmann I Zwo grössere und zwo kleinere Landschaften. Due paesaggi piü grandi e due piü piccoli. I Diese Nr.: Eine grössere Landschaft Anm.: Die Lose 87 bis 90 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (6 Th für die Nrn. 87-90) 1752/00/00 NGWOL 0088 Eisenmann I Zwo grössere und zwo kleinere Landschaften. Due paesaggi piü grandi e due piü piccoli. I Diese Nr.: Eine grössere Landschaft Anm.: Die Lose 87 bis 90 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (6 Th für die Nrn. 87-90) 1752/00/00 NGWOL 0089 Eisenmann I Zwo grössere und zwo kleinere Landschaften. Due paesaggi piü grandi e due piü piccoli. I GEMÄLDE
597
Diese Nr.: Eine kleinere Landschaft Anm.: Die Lose 87 bis 90 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (6 Th für die Nm. 87-90) 1752/00/00 NGWOL 0090 Eisenmann I Zwo grössere und zwo kleinere Landschaften. Due paesaggi piü grandi e due piü piccoli. I Diese Nr.: Eine kleinere Landschaft Anm.: Die Lose 87 bis 90 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (6 Th für die Nrn. 87-90)
1752/00/00 NGWOL 0211 Eisenmann I Sechs Landschaften. Sei simili [Paesaggi]. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 211 bis 216 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (4 Th für die Nm. 211-216) 1752/00/00 NGWOL 0212 Eisenmann I Sechs Landschaften. Sei simili [Paesaggi], I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 211 bis 216 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (4 Th für die Nm. 211-216)
1752/00/00 NGWOL 0093 Eisenmann I Zwo kleine Landschaften. Due paesettini. I Diese Nr.: Eine kleine Landschaft Anm.: Die Lose 93 und 94 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (1.8 Th für die Nm. 93 und 94)
1752/00/00 NGWOL 0213 Eisenmann I Sechs Landschaften. Sei simili [Paesaggi]. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 211 bis 216 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (4 Th für die Nm. 211-216)
1752/00/00 NGWOL 0094 Eisenmann I Zwo kleine Landschaften. Due paesettini. I Diese Nr.: Eine kleine Landschaft Anm.: Die Lose 93 und 94 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (1.8 Th für die Nm. 93 und 94)
1752/00/00 NGWOL 0214 Eisenmann I Sechs Landschaften. Sei simili [Paesaggi]. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 211 bis 216 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (4 Th für die Nm. 211-216)
1752/00/00 NGWOL 0119 Eisenmann I Eine kleinere Landschaft. Vn simile [Paese] piu piccolo. I Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (2 Th)
1752/00/00 NGWOL 0215 Eisenmann I Sechs Landschaften. Sei simili [Paesaggi]. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 211 bis 216 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (4 Th für die Nm. 211-216)
1752/00/00 NGWOL 0175 Eisenmann I Zwo überhöhete Landschafften. Due Paesaggi sopralzati. I Diese Nr.: Eine überhöhete Landschafft Anm.: Die Lose 175 und 176 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (6 Th für die Nm. 175 und 176) 1752/00/00 NGWOL 0176 Eisenmann I Zwo überhöhete Landschafften. Due Paesaggi sopralzati. I Diese Nr.: Eine überhöhete Landschafft Anm.: Die Lose 175 und 176 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (6 Th für die Nm. 175 und 176) 1752/00/00 NGWOL 0190 Eisenmann I Zwo Landschaften. Due Paesi. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 190 und 191 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (6 Th für die Nm. 190 und 191) 1752/00/00 NGWOL 0191 Eisenmann I Zwo Landschaften. Due Paesi. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 190 und 191 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (6 Th für die Nm. 190 und 191) 1752/00/00 NGWOL 0196 Eisenmann I Zwey kleine Bataillen. Due piccole Battaglie. I Diese Nr.: Eine kleine Bataille Anm.: Die Lose 196 und 197 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (4 Th für die Nm. 196 und 197) 1752/00/00 NGWOL 0197 Eisenmann I Zwey kleine Bataillen. Due piccole Battaglie. I Diese Nr.: Eine kleine Bataille Anm.: Die Lose 196 und 197 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (4 Th für die Nm. 196 und 197) 1752/00/00 NGWOL 0198 Eisenmann I Vier kleine Landschaften. Quattro Paesettini. I Diese Nr.: Eine kleine Landschaft Anm.: Die Lose 198 bis 201 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (6 Th für die Nm. 198-201) 1752/00/00 NGWOL 0199 Eisenmann I Vier kleine Landschaften. Quattro Paesettini. I Diese Nr.: Eine kleine Landschaft Anm.: Die Lose 198 bis 201 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (6 Th für die Nm. 198-201) 1752/00/00 NGWOL 0200 Eisenmann I Vier kleine Landschaften. Quattro Paesettini. I Diese Nr.: Eine kleine Landschaft Anm.: Die Lose 198 bis 201 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (6 Th für die Nm. 198-201) 1752/00/00 NGWOL 0201 Eisenmann I Vier kleine Landschaften. Quattro Paesettini. I Diese Nr.: Eine kleine Landschaft Anm.: Die Lose 198 bis 201 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (6 Th für die Nm. 198-201) 598
GEMÄLDE
1752/00/00 NGWOL 0216 Eisenmann \ Sechs Landschaften. Sei simili [Paesaggi], I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 211 bis 216 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (4 Th für die Nm. 211-216) 1779/09/27 FRNGL 0048 Eissemann I Eine felsigte Landschaft. [Un paysage couvert de rochers.] I Maße: 1 Schuh 5 Zoll hoch, 2 Schuh breit Transakt.: Verkauft (5 fl) Käufer: Hofr Gercken 1779/09/27 FRNGL 0487 Eiszemann I Eine bergigte Landschaft mit einem Wasserfall, kräftig und wohl ausgearbeitet. [Un paysage couvert de montagnes, avec un cataracte, tres belle piece.] I Pendant zu Nr. 488 Maße: 2 Schuh 5 Zoll hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Transakt.: Verkauft (6.15 fl für die Nm. 487 und 488) Käufer: Cotrell 1779/09/27 FRNGL 0488 Eiszemann I Der Compagnon zu obigem, eine dergleichen felsigte Landschaft, von nemlichem Meister [Eiszemann] und Maas. [Le pendant du precedant, meme objet [un paysage couvert de montagnes], par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 487 Maße: 2 Schuh 5 Zoll hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Transakt.: Verkauft (6.15 fl für die Nm. 487 und 488) Käufer: Cotrell 1779/09/27 FRNGL 0657 Eisemann I Alte Ruinen in einer flachen Landschaft. [Des ruines dans une plaine.] I Maße: 2 Schuh 6 Zoll hoch, 3 Schuh breit Transakt.: Verkauft (40 Kr) Käufer: Dr Ehrmann 1790/01/07 MUAN 0873 Eisenmann I Zwo bergigte kleine Landschaften, auf Leinwat, in schwarzgepeizten Ramen. I Diese Nr.: Eine bergigte kleine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 4 Zoll, Breite 5 Zoll Anm.: Die Lose 873 und 874 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0874 Eisenmann I Zwo bergigte kleine Landschaften, auf Leinwat, in schwarzgepeizten Ramen. I Diese Nr.: Eine bergigte kleine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 4 Zoll, Breite 5 Zoll Anm.: Die Lose 873 und 874 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1793/06/07 HBBMN 0103 Eisemann I Landschaft mit Gebürge und Staffage. Fleißig gemahlt von Eisemann. I Maße: Hoch 7 V2 Zoll, breit 9 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/00/00 HLAN [0108] Eisemann I Zwey Landschaften. 7. 10. auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: 1. 10. Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: [Friedrich Karl Lang] Transakt.: Unbekannt (6.3 Rt; 11 fl Schätzung)
1796/08/01 NGFRZ 0007 Eisenmann I Zwei Landschaften von Eisenmann. [Gemälde in Oel in schönen Rahmen. (N.B. Die Größe ist ohne das Rahm gemessen.)] I Mat.: Öl Maße: Breite 9 Vi Zoll, Höhe 7 Vi Zoll. [Rheinisch Maaß] Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen über der Nr. 1 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 25. Transakt.: Unbekannt 1796/08/01 NGFRZ 0015 Eisenmann I 2 detti [Landschaften], das Laufer= und das Frauenthor von Eisenmann. [Gemälde in Oel in schönen Rahmen. (N.B. Die Größe ist ohne das Rahm gemessen.)] I Mat.: Öl Maße: Breite 9 Zoll, Höhe 7 Zoll. [Rheinisch Maaß] Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen über der Nr. 1 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 25. Transakt.: Unbekannt
Eismann 1768/07/00 MUAN 0182 Eismann I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0675 Eismann I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0676 Eismann I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0723 Eismann I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0724 Eismann I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1783/08/01 LZRST 0079 Eismann I Ein Bataillen Stück, meisterhaft von Eismann skizzirt. 14 Zoll hoch, 21 Zoll breit, ohne Rahm. I Pendant zu Nr. 80 Maße: 14 Zoll hoch, 21 Zoll breit Transakt.: Verkauft (1.20 Th) Käufer: Korn 1783/08/01 LZRST 0080 Eismann I Ein anderes Bataillen Stück, von eben diesem Meister [Eismann], das Gegenbild zu vorigen, von gleichem Maasse ohne Rahm. I Pendant zu Nr. 79 Maße: 14 Zoll hoch, 21 Zoll breit Transakt.: Verkauft (2.9 Th) Käufer: Korn 1786/05/02 NGAN 0152 Eismann I Sechs kleine Vogelstück. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (1.36 fl) Käufer: ν Führer 1786/05/02 NGAN 0205 Eismann I Vier kleine Vögelstücke. I Maße: 3 Zoll hoch, 2 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (1.18 fl) Käufer: Glaser 1786/05/02 NGAN 0212 Eisman I Landschäftlein. I Maße: 7 Zoll hoch, 11 Zoll breit Anm.: Für dieses Los erscheint der Bildtitel nur in den Errata, die am Ende des Katalogs abgedruckt sind. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (5.32 fl für die Nrn. 212215) Käufer: ν Pez 1786/05/02 NGAN 0213 Eisman I Landschäftlein. I Maße: 7 Zoll hoch, 11 Zoll breit Anm.: Für dieses Los erscheint der Bildtitel nur in den Errata, die am Ende des Katalogs abgedruckt sind. Ver-
käufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (5.32 fl für die Nrn. 212215) Käufer: ν Pez 1786/05/02 NGAN 0214 Eisman I Landschäftlein. I Maße: 1 Zoll hoch, 11 Zoll breit Anm.: Für dieses Los erscheint der Bildtitel nur in den Errata, die am Ende des Katalogs abgedruckt sind. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (5.32 fl für die Nm. 212215) Käufer: ν Pez 1786/05/02 NGAN 0215 Eisman I Landschäftlein. I Maße: 7 Zoll hoch, 11 Zoll breit Anm.: Für dieses Los erscheint der Bildtitel nur in den Errata, die am Ende des Katalogs abgedruckt sind. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (5.32 fl für die Nrn. 212215) Käufer: ν Pez 1786/05/02 NGAN 0222 Eismann I Zwey Speluncken von Eismann. I Diese Nr.: Eine Speluncke Maße: 1 Zoll hoch, 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 222 und 223 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (2.36 fl für die Nrn. 222 und 223) Käufer: ν Holzschuher 1786/05/02 NGAN 0223 Eismann I Zwey Speluncken von Eismann. I Diese Nr.: Eine Speluncke Maße: 7 Zoll hoch, 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 222 und 223 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (2.36 fl für die Nrn. 222 und 223) Käufer: ν Holzschuher 1786/05/02 NGAN 0273 Eismann I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 5 Vi Zoll hoch, 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 273 und 274 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (1.15 fl für die Nrn. 273 und 274) Käufer: ν Pez 1786/05/02 NGAN 0274 Eismann I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 5 Vi Zoll hoch, 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 273 und 274 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (1.15 fl für die Nrn. 273 und 274) Käufer: ν Pez 1786/05/02 NGAN 0404 Eismann I Landschaften. I Diese Nr.: Landschaft Maße: 1 Schuh 3 Vi Zoll hoch, 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 404 und 405 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (3.12 fl für die Nrn. 404 und 405) Käufer: ν Holzschuher 1786/05/02 NGAN 0405 Eismann I Landschaften. I Diese Nr.: Landschaft Maße: 1 Schuh 3 Vi Zoll hoch, 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 404 und 405 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (3.12 fl für die Nrn. 404 und 405) Käufer: ν Holzschuher 1786/05/02 NGAN 0406 Eismann I Landschaften. I Diese Nr.: Landschaft Maße: 1 Schuh Vi Zoll hoch, 1 Schuh 5 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 406 und 407 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (3.18 fl für die Nrn. 406 und 407) Käufer: ν Holzschuher 1786/05/02 NGAN 0407 Eismann I Landschaften. I Diese Nr.: Landschaft Maße: 1 Schuh Vi Zoll hoch, 1 Schuh 5 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 406 und 407 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (3.18 fl für die Nrn. 406 und 407) Käufer: ν Holzschuher 1786/05/02 NGAN 0408 Eismann ! Landschaften. I Diese Nr.: Landschaft Maße: 1 Schuh Vi Zoll hoch, 1 Schuh 5 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 408 und 409 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (3.36 fl für die Nm. 408 und 409) Käufer: ν Holzschuher 1786/05/02 NGAN 0409 Eismann I Landschaften. I Diese Nr.: Landschaft Maße: 1 Schuh Vi Zoll hoch, 1 Schuh 5 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 408 und 409 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (3.36 fl für die Nrn. 408 und 409) Käufer: ν Holzschuher GEMÄLDE
599
1786/05/02 NGAN 0646 Eismann I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 7 Zoll hoch, 9 ιΛ Zoll breit Anm.: Die Lose 646 und 647 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (24 Kr für die Nm. 646 und 647) Käufer: Hofrath Schüz 1786/05/02 NGAN 0647 Eismann I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 7 Zoll hoch, 9 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 646 und 647 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (24 Kr für die Nm. 646 und 647) Käufer: Hofrath Schüz 1786/05/02 NGAN 0648 Eismann I Item [Zwey Landschaften], I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 7 Zoll hoch, 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 648 und 649 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (21 Kr für die Nrn. 648 und 649) Käufer: Krüger [?] 1786/05/02 NGAN 0649 Eismann I Item [Zwey Landschaften], I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 7 Zoll hoch, 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 648 und 649 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (21 Kr für die Nrn. 648 und 649) Käufer: Krüger [?] 1786/05/02 NGAN 0650 Eismann I Item [Zwey Landschaften]. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 7 Zoll hoch, 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 650 und 651 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (22 Kr für die Nm. 650 und 651) Käufer: Hofrath Schüz
3 Zoll Anm.: Die Lose A290 und A291 wurden zusammen katalogisiert. Dieses Los wurde zusammen mit der Nr. A291 (Anonym) verkauft. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0334 Johann Anton Eismann I Sechs Landschaften, von Johann Anton Eismann. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mal.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 1 Zoll breit 1 Schuh 6 Zoll Anm.: Die Lose A334 bis A339 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0335 Johann Anton Eismann I Sechs Landschaften, von Johann Anton Eismann. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 1 Zoll breit 1 Schuh 6 Zoll Anm.: Die Lose A334 bis A339 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0336 Johann Anton Eismann I Sechs Landschaften, von Johann Anton Eismann. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 1 Zoll breit 1 Schuh 6 Zoll Anm.: Die Lose A334 bis A339 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0337 Johann Anton Eismann I Sechs Landschaften, von Johann Anton Eismann. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 1 Zoll breit 1 Schuh 6 Zoll Anm.: Die Lose A334 bis A339 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1786/05/02 NGAN 0651 Eismann I Item [Zwey Landschaften], I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 7 Zoll hoch, 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 650 und 651 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (22 Kr für die Nm. 650 und 651) Käufer: Hofrath Schüz
1799/00/00 WZAN A0338 Johann Anton Eismann I Sechs Landschaften, von Johann Anton Eismann. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 1 Zoll breit 1 Schuh 6 Zoll Anm.: Die Lose A334 bis A339 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1786/05/02 NGAN 0652 Eismann I Item [Zwey Landschaften], I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 7 Zoll hoch, 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 652 und 653 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (24 Kr für die Nm. 652 und 653) Käufer: Hofrath Schüz
1799/00/00 WZAN A0339 Johann Anton Eismann I Sechs Landschaften, von Johann Anton Eismann. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 1 Zoll breit 1 Schuh 6 Zoll Anm.: Die Lose A334 bis A339 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1786/05/02 NGAN 0653 Eismann I Item [Zwey Landschaften]. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 1 Zoll hoch, 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 652 und 653 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (24 Kr für die Nm. 652 und 653) Käufer: Hofrath Schüz 1786/05/02 NGAN 0679 Eismann I Zwey Fruchtstücke. I Diese Nr.: Ein Fruchtstück Maße: 2 Zoll hoch, 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 679 und 680 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (14 Kr für die Nm. 679 und 680) Käufer: Wild 1786/05/02 NGAN 0680 Eismann I Zwey Fruchtstücke. I Diese Nr.: Ein Fruchtstück Maße: 2 Zoll hoch, 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 679 und 680 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (14 Kr für die Nm. 679 und 680) Käufer: Wild
Eismann, Johann Anton 1784/08/01 LZRST 0144 Eusemann I Ein Bataillenstück meisterhaft von Eusemann entworfen, 21 Z. br. 14. Z. hoch, ohne Rahm. I Pendant zu Nr. 145 Maße: 21 Zoll breit, 14 Zoll hoch Transakt.: Verkauft (2.2 Th) Käufer: ST 1784/08/01 LZRST 0145 Eusemann I Ein anderes Bataillenstück von eben diesem Meister [Eusemann], das Gegenbild von vorigen [Nr. 144], von gleichem Maasse. I Pendant zu Nr. 144 Maße: 21 Zoll breit, 14 Zoll hoch Transakt.: Verkauft (2.3 Th) Käufer: ST 1799/00/00 WZAN A0290 Anton Eismann I Zwey Landschaften, die eine von Anton Eismann, die andere von einem unbekannten Meister. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft von Anton Eismann Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 9 Zoll breit 5 Schuh 600
GEMÄLDE
1799/00/00 WZAN A0418 Joh. Anton Eismann I Vier Landschäftchen, von Joh. Anton Eismann. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Landschäftchen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh breit 10 Zoll Anm.: Die Lose A418 bis A421 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0419 Joh. Anton Eismann I Vier Landschäftchen, von Joh. Anton Eismann. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Landschäftchen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh breit 10 Zoll Anm.: Die Lose A418 bis A421 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0420 Joh. Anton Eismann I Vier Landschäftchen, von Joh. Anton Eismann. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Landschäftchen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh breit 10 Zoll Anm.: Die Lose A418 bis A421 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0421 Joh. Anton Eismann I Vier Landschäftchen, von Joh. Anton Eismann. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Landschäftchen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh breit 10 Zoll Anm.: Die Lose A418 bis A421 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Ekels, Jan (der Ältere) 1790/08/25 FRAN 0080 Eckels I Das Gesicht von der Leidner Pfort in Amsterdam. I Maße: hoch 13 Zoll, breit 18 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (3.30 fl) Käufer: Diehl
Elkan, David [Nicht identifiziert] 1793/00/00 NGWID 0540 David Elkan I Ein sehr viel bedeutender alter Mannskopf im halben Brustbilde, von David Elkan. I Maße: 2 Schuh 1 Zoll hoch, 1 Schuh 10 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
Elliger, Ottmar (der Ältere) 1764/08/25 FRAN 0299 Ellger \ Des Pappillons et autres insectes. I Maße: haut 11 pouces sur 1 pied Vi pouce de large Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1776/04/15 HBBMN 0016 Ottomar Elliger I Ein ungemein fleißiges Stück, mit Früchte und Insecten. I Maße: Höhe 1 Fuß 11 Zoll, Breite 1 Fuß 4 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (14.8 M) Käufer: Bresler 1776/06/28 HBBMN 0007 Ottomar Elliger I Ein extra fleißiges Still=Leben mit Früchten, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Fuß 10 Zoll, Breite 1 Fuß Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1776/06/28 HBBMN 0065 O. Elliger I Ein extra fleißiges Früchten=Stück, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Fuß 8 Zoll, Breite 1 Fuß 2 Zoll Transakt.: Unbekannt 1777/02/26 HBKOS 0042 Ottomar. Elliger I Ein großes, sehr schönes und seltenes Fruchtstück. I Maße: Höhe 4 Fuß 5 Zoll, Breite 3 Fuß 10 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/03/28 HBSCM 0088 Ottomar Elliger I Ein Todtenkopf, wodurch eine Schlange kriecht. I Transakt.: Unbekannt 1778/05/21 HBKOS 0024 Otto Mar. Elliger I Zwey botanische Stücke mit Insecten. I Diese Nr.: Ein botanisches Stück mit Insecten Anm.: Die Lose 24 und 25 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/05/21 HBKOS 0025 Otto Mar. Elliger I Zwey botanische Stücke mit Insecten. I Diese Nr.: Ein botanisches Stück mit Insecten Anm.: Die Lose 24 und 25 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/09/28 FRAN 0384 Ottmar Ellingen I Ein Blumenstück. [Une piece representante des fleurs.] I Maße: 7 Zoll breit, 9 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (8 fl) Käufer: Prß ν Dessau Gegenw. Standort: Dessau, Deutschland. Anhaltische Gemäldegalerie. (334)(?) 1784/05/11 HBKOS 0013 Otto Marelliger I Ein Gebinde von Blumen und Früchten, nach der Jahrszeit, und jede Frucht nach der Natur, auf das lebhafeteste [sie] und fleißigste gemahlt, und ist wohl das einzgste in seiner Art und Schönheit, des Otto Marelliger, auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 48 Zoll 9 1., breit 42 Zoll 3 1. Transakt.: Verkauft (43.8 M) Käufer: Ε 1785/04/22 HBTEX 0104 Ottomar Elliger I Ein Blumen=Topf auf einem marmornen Tische, mit sehr schönen Insecten. Auf Leinewand. Schwarzer Rahm und goldene Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 20 Zoll, breit 14 Zoll Transakt.: Unbekannt 1785/07/07 HBBMN 0504 Ottmar Eiliger I Das Portrait von Ottmar Elliger, mit Insecten, von ihm selbst gemahlt. Ein Kniestück. I Verkäufer: Anthon Tischbein Transakt.: Unbekannt 1786/10/18 HBTEX 0077 Ottomar Elliger I Eine Dame, welche Blumen und Früchte hält zu ihrem Vergnügen. Auf Blech, ovalen Formats. I Mat.: auf Blech Format: oval Maße: Hoch 7 Zoll 9 Linien, breit 6 Zoll 9 Linien Transakt.: Unbekannt 1787/00/00 HB AN 0127 Ottmar Elliger. 1664 I In einer sehr angenehmen Landschaft stehen auf dem grasigten Vordergründe einige hohe Bäume, vor welchen sich die Diana mit ihren Bogen in der Hand und Köcher befindet; neben ihr die Venus in einem weißen Gewände, welche die Diana liebreich umfaßt. Sehr sanft und überaus fleißig gemahlt. A.H. [Auf Holz] s.R. [in schwarzem Rahm] I
Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Zoll, breit 8 Vi Zoll Inschr.: 1664 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Verkauft (16 M) Käufer: Fesser 1787/00/00 HB AN 0336 Ottmar Elliger I Auf einem weißen marmornen Tische liegen zwey Rosen mit ihren Blättern, nebst vielen Insecten. Von besonderer Natur und Fleiß. A.H. [Auf Holz] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Ά Zoll, breit 8 Zoll Transakt.: Verkauft (11.4 [?] M) Käufer: Cober 1787/00/00 HB AN 0628 Ottmar Elliger I Am Fuß eines Berges liegen verschiedene Früchte, als: Weintrauben, Aepfel, Pfirschen, ec. Im Hintergrunde eine Landschaft. Sehr natürlich gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 40 Zoll, breit 33 Zoll Transakt.: Verkauft (8.4 M) Käufer: Berth[eau] 1787/01/15 LZRST 0040 Ottomak. Elliger I Ein meisterhaftes Fruchtstück mit Weintrauben, einem Hummer, Citronen und verschiedene Trinkgeschirre, von Ottomak. Elliger 1671. 3 Fuss 5 Zoll hoch, 2 Fuss 9 Z. br. in schmalen gold. Rahm. I Maße: 3 Fuß 5 Zoll, 2 Fuß 9 Zoll Inschr.: 1671 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Richter Transakt.: Unbekannt 1787/01/15 LZRST 0041 Ottomak. Eiliger I Ein anderes fürtrefliches Fruchtstück, von eben diesem Meister [Ottomak. Elliger], mit Weintrauben, Pfirschen und Pflaumen, 1675. 3 Fuss 8 Zoll hoch, 2 F. 10 Z. br in schmalen gold. Rahm. I Pendant zu Nr. 42 Maße: 3 Fuß 5 Zoll, 2 Fuß 9 Zoll Inschr.: 1675 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Richter Transakt.: Unbekannt 1787/01/15 LZRST 0042 Ottomak. Elliger I Ein Bluhmenstück, das Gegenbild zu vorigen [Nr. 41], von eben diesem Meister [Ottomak. Elliger], von gleichem Maass und Rahm. I Pendant zu Nr. 41 Maße: 3 Fuß 5 Zoll, 2 Fuß 9 Zoll Verkäufer: Richter Transakt.: Unbekannt 1788/12/13 HBTEX 0147 Ottmar Ellinger I Früchte und Trauben, nach der Natur gemahlt. I Transakt.: Verkauft (2 M) Käufer: Albrecht 1790/08/13 HBBMN 0095 Ottomar Elliger I Gartenfrüchte, als ein Gebinde anzusehen, mit verschiedenen Schmetterlingen. Extra fleißig nach der natur gemahlt. Auf Holz, in schwarzen Rahm mit fein vergoldeten Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 22 Vi Zoll, breit 17 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (2 M) Käufer: Ego 1790/08/25 FRAN 0055 Ellger I Ein Blumenstück. I Maße: hoch 20 Zoll, breit 13 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (3 fl) Käufer: Kaller 1793/06/07 HBBMN 0189 Otto Mar. Elliger I Ein Gebinde von Früchten, Blumen und Insecten; ganz vortreflich nach der Natur, und auf das fleißigste gemahlt. Auf Holz, von Otto Mar. Eiliger, 1766. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 26 Zoll 9 Lin., breit 19 Zoll 3 Lin. Inschr.: 1766 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt 1796/08/00 HBPAK 0045 Ottomar Elliger I Gebinde von Früchten. Sehr natürlich gemahlt. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Gebinde von Früchten Mat.: auf Holz Maße: Höhe 18 Vi Zoll, Breite 14 Vi Zoll Anm.: Die Lose 45 und 46 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/08/00 HBPAK 0046 Ottomar Elliger I Gebinde von Früchten. Sehr natürlich gemahlt. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Gebinde von Früchten Mat.: auf Holz Maße: Höhe 18 Vi Zoll, Breite 14 Vi Zoll Anm.: Die Lose 45 und 46 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0132 Ottorar Elliger I Feigen und Kirschen auf einem Tische. I Maße: Hoch 11 Zoll, breit 8 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
601
1797/04/20 HBPAK 0248 Ottomar Ellinger I Ein Bouquet von Rosen und Vergißmeinnicht, um welchen drey Schmetterlinge flattern. Maykäfer sitzen auf den grünen Blättern, deren einige durchfressen sind. Dieß alles ist so natürlich vorgestellt, daß man es im Leben glaubt. Kein van Huysum kann schöner vorgezeigt werden. Auf Holz, mit goldn. Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Zoll, breit 6 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/06/13 HBPAK 0170 Ottmar Eiliger f . 16671 In einem Caravin, der auf einem marmornen Tische steht, sind die schönsten Blumen als ein Bouquet eingesteckt, reizend anzusehen; dessen Fleiß der fast unnachahmenden Natur auf das edelste gleicht. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 21 Vi Zoll, breit 14 % Zoll Inschr.: Ottmar Elliger f. 1667 (datiert) Transakt.: Unbekannt 1797/06/13 HBPAK 0229 Ottmar Elliger I An einem Gebinde, welches über einen marmornen Tisch angebracht, hängen Pfirschen, Apricosen und Trauben, woran Schmetterlinge, Käfer und Fliegen sich vergnügen. Auf dem Tische liegen Erdbeeren, Kirschen, und eine Muscateller=Traube. Alles getreu der Natur auf das fleissigste nachgeahmt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 23 Ά Zoll, breit 16 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/08/09 HBPAK 0069 Otto Ellinger I Zwey Fruchtstücke, w o auf einem Tische Trauben, Pfirschen und Pflaumen, welche mit Insecten umgeben sind. Auf Holz, schwarzer Rahm. I Diese Nr.: Ein Fruchtstück, wo auf einem Tische Trauben, Pfirschen und Pflaumen, welche mit Insecten umgeben sind Mat.: auf Holz Maße: Hoch 24 Zoll, breit 18 Zoll Anm.: Die Lose 69 und 70 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/08/09 HBPAK 0070 Otto Ellinger I Zwey Fruchtstücke, wo auf einem Tische Trauben, Pfirschen und Pflaumen, welche mit Insecten umgeben sind. Auf Holz, schwarzer Rahm. I Diese Nr.: Ein Fruchtstück, wo auf einem Tische Trauben, Pfirschen und Pflaumen, welche mit Insecten umgeben sind Mat.: auf Holz Maße: Hoch 24 Zoll, breit 18 Zoll Anm.: Die Lose 69 und 70 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0017 Otto Ellinger I Zwey Still=Leben mit Pfirschen, Trauben und Kirschen. Sehr natürlich dargestellt. Auf Holz, schw. Rahm. I Diese Nr.: Ein Still=Leben mit Pfirschen, Trauben und Kirschen Mat.: auf Holz Maße: Hoch 24 Zoll, breit 18 Zoll Anm.: Die Lose 17 und 18 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0018 Otto Ellinger I Zwey Still=Leben mit Pfirschen, Trauben und Kirschen. Sehr natürlich dargestellt. Auf Holz, schw. Rahm. I Diese Nr.: Ein Still=Leben mit Pfirschen, Trauben und Kirschen Mat.: auf Holz Maße: Hoch 24 Zoll, breit 18 Zoll Anm.: Die Lose 17 und 18 wurden zusammen katalogisiert. Trans akt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0211 Otto Ellinger I Ein Fruchtstück, Trauben und Pfirschen. Auf Holz, schwarzer Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 20 Zoll, breit 18 Zoll Transakt.: Unbekannt 1800/11/12 HBPAK 0585 Transakt.: Unbekannt
Otto Ellinger I Drey Fruchtstücke. I
Elliger, Ottmar (der Jüngere) 1763/00/00 BLAN 0058 Otmar Elliger I Zweyer Frauenzimmer Bildnisse. Auf Holz gemahlt, 2 Fuß hoch, und 10 Zoll breit, halbe Figuren. Die eine von diesen Schönen hält ein nackendes Kind und einen Papagey, der in einem Vogelbauer verwahret ist; und vor der andern, die auch ein Kind hat, stehen Früchte und eine Pastete. Beyde Gemähide sind frey und angenehm colorirt, und ohnfehlbar Entwürfe, die der Meister hernach in Lebensgröße nach der Natur gemahlet hat. Sein feuriger Geist entdeckt sich auch in diesen kleinen Stücken hell und deutlich. [Text hier gekürzt] I Diese Nr.: Eine Frau602
GEMÄLDE
en Bildnisse mit ein Kind und Papagey Mat.: auf Holz Maße: 2 Fuß hoch, und 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 58 und 59 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Gottlieb Stein Transakt.: Unbekannt 1763/00/00 BLAN 0059 Otmar Elliger I Zweyer Frauenzimmer Bildnisse. Auf Holz gemahlt, 2 Fuß hoch, und 10 Zoll breit, halbe Figuren. Die eine von diesen Schönen hält ein nackendes Kind und einen Papagey, der in einem Vogelbauer verwahret ist; und vor der andern, die auch ein Kind hat, stehen Früchte und eine Pastete. Beyde Gemähide sind frey und angenehm colorirt, und ohnfehlbar Entwürfe, die der Meister hernach in Lebensgröße nach der Natur gemahlet hat. Sein feuriger Geist entdeckt sich auch in diesen kleinen Stücken hell und deutlich. [Text hier gekürzt] I Diese Nr.: Eine Frauen Bildnisse mit ein Kind und Früchte und eine Pastete Mat.: auf Holz Maße: 2 Fuß hoch, und 10 Zoll breit Anm.: Die Lose 58 und 59 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Gottlieb Stein Transakt.: Unbekannt 1763/01/19 FRJUN 0109 Elleger! Un tableau Historique, orae de plusieurs figures. I Maße: hauteur 33 pouces, large 27 pouces Transakt.: Unbekannt (12 fl) 1763/11/09 FRJUN 0068 Elleger I Une tres jolie piece representant une Demoiselle derriere une table avec beaucoup d'accompagnement. I Maße: hauteur 12 Vi pouces, largeur 10 Vi pouces Transakt. : Verkauft (34 für die Nrn. 68 und 69) Käufer: Jacob Andres 1763/11/09 FRJUN 0069 Elleger I Une semblable belle femme pres d'une table, des huitres & beaucoup d'assortment parfaitement peint & de la mSme grandeur. I Maße: hauteur 12 Vi pouces, largeur 10 Vi pouces Transakt.: Verkauft (34 für die Nrn. 68 und 69) Käufer: Jacob Andre« 1764/03/12 FRKAL 0037 Elleger I Une tres jolie piece representant une femme derriere une Table avec beaucoup d'assortiment parfaitement peint. I Maße: hauteur 13 Vi pouces, largeur 11 Vi pouces Transakt.: Verkauft (19 fl für die Nm. 37 und 38) Käufer: Kaller 1764/03/12 FRKAL 0038 Elleger I Une semblable pas moindre que la precedente [une tres jolie piece representant une femme derriere une Table avec beaucoup d'assortiment] de la meme grandeur. I Maße: hauteur 13 Vi pouces, largeur 11 Vi pouces Transakt.: Verkauft (19 fl für die Nrn. 37 und 38) Käufer: Kaller 1764/05/18 BLAN 0038 Otmar Elliger I Das Gastmahl des Marcus Antonius und der Cleopatra. Gantze Figuren, auf Leinewand gemahlt, 1 Fuß 9 Zoll hoch, und 2 Fuß 2 Zoll breit. In diesen beiden Bildern findet man viel Genie, und eine sehr zahlreiche Composition. Beider Hintergründe stellen eine schöne und prächtige Architectur vor. Die Vorstellungen sind lebhaft, und die Affecte gut ausgedruckt. Ueberhaupt sind beide in dem Geschmack des Lairesse gemahlt, aber nicht völlig so gut gezeichnet. [Text hier gekürzt]. I Pendant zu Nr. 39 Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 9 Zoll hoch, und 2 Fuß 2 Zoll breit Verkäufer: Johann Georg Eimbke Transakt.: Verkauft (142 Rt für die Nrn. 38 und 39) Käufer: F Gegenw. Standort: Hamburg, Deutschland. Kunsthalle. (360) 1764/05/18 BLAN 0039 Otmar Elliger I Der Tod der Königin Semiramis. Gantze Figuren, auf Leinewand gemahlt. Das ist der Compagnon zum vorigen. In diesen beiden Bildem findet man viel Genie, und eine sehr zahlreiche Composition. Beider Hintergründe stellen eine schöne und prächtige Architectur vor. Die Vorstellungen sind lebhaft, und die Affecte gut ausgedruckt. Ueberhaupt sind beide in dem Geschmack des Lairesse gemahlt, aber nicht völlig so gut gezeichnet. [Text hier gekürzt]. I Pendant zu Nr. 38 Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 9 Zoll hoch, und 2 Fuß 2 Zoll breit Verkäufer: Johann Georg Eimbke Transakt.: Verkauft (142 Rt für die Nrn. 38 und 39) Käufer: F Gegenw. Standort: Hamburg, Deutschland. Kunsthalle. (359)
1764/06/15 BOAN 0677 Ο. Elliger I Deux tableaux de deux pieds quatre pouces de largeur, d'un pied onze pouces de hauteur, representants Tun Cleopatre avallant des perles, l'autre Cleopatre morte, & Marc Antoine, les deux d'une riche composition, peints par O. Elliger. [Zwey stück Vorstellend eins Cleopatram, welche die perlen Verschluckt, und andertes die todte Cleopatram mit dem Marco Antonio, beyde sehr reich Von Von Composition und gemahlt Von O. Elliger.] I Maße: 2 pieds 4 pouces de largeur, 1 pied 11 pouces de hauteur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (50 Rt) Käufer: Hof C Rath Broggia 1765/00/00 FRRAU 0062 O. Elliger I Vorstellend das herrliche Gastmahl der Cleopatra. In diesem Bild hat Elliger nichts vergessen, was zur Pompe und Pracht beytragen kann; die Colorit macht den grösten Kenner denckend, alles ist wie im Feuer geschmoltzen, und die Architectur und Omement sind so schön in der Haltung, daß Kenner und Liebhaber in vollkommeneren Grad von Elliger wenig Bilder, wie dieses, finden werden. Ohne die Rahme auf Tuch gemahlt. Representant le grand festin de Cleopatre; Ellinger n'a den oublie dans ce tableau de ce qui peut contribuer ä la pompe & ä Γ opulence; Le Coloris surprend tous les connoisseurs, & tout y est comme fondant en feu; l'architecture & les ornemens sont parfaits dans l'ordonnance. Desorte que les Amateurs & les connoisseurs trouveront peu de tableaux d'Ellinger, qui soient si parfaits, que celui-ci. Sans la bordure peint sur de la toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 1 Schuh 11 Zoll, breit 2 Schuh 4 Zoll Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRRAU 0063 O. Elliger I Vorstellend den Todt der Cleopatra. So groß in dem einen Stück die Hoheit und Pracht exprimiret, so starck ist in diesem Stück der Todt, und die Betrübnüß ausgedruckt; ja in der Figur des Marcus Antonius thut sich der Schrekken mit der Wehmuth besonders verbinden. Representant la mort de Cleopatre. Autant que la grandeur & la magnificence sont exprimees dans l'autre, aussi fortement la mort & la tristesse sont exprimees dans celui-ci; On voit meme que dans la figure de Marcus Antonius la frai'eur [sic] & la douleur sont parfaitement combinees en semble. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 1 Schuh 11 Zoll, breit 2 Schuh 4 Zoll Transakt.: Unbekannt 1765/03/27 FRKAL 0054 Elliger I Deux jolis tableaux hi s toriques bien peints. I Maße: hauteur 22 pouces, largeur 18 pouces Transakt.: Verkauft (18 fl) Käufer: Hoch 1765/03/27 FRKAL 0055 Elliger I Une jolie femme dans une niche avec assortment bien peint. I Maße: hauteur 14 pouces, largeur 11 pouces Transakt.: Verkauft (12 fl) Käufer: Ihro durchl 1776/11/09 HBKOS 0051 Ottmar Ellinger I Zwey Stücke mit Frauenzimmern, so sich zieren, daneben ein junger Knabe, mit vielen andern Nebensachen, auf Holz gemahlt, mit schwarzen Rahmen und verguldeten Leisten. I Diese Nr.: Ein Stück mit Frauenzimmern, so sich zieren Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Fuß 2 Zoll, Breite 1 Fuß Anm.: Die Lose 51 und 52 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (22 Μ für die Nrn. 51 und 52) Käufer: Siers 1776/11/09 HBKOS 0052 Ottmar Ellinger I Zwey Stücke mit Frauenzimmern, so sich zieren, daneben ein junger Knabe, mit vielen andern Nebensachen, auf Holz gemahlt, mit schwarzen Rahmen und verguldeten Leisten. I Diese Nr.: Ein Stück mit Frauenzimmern, so sich zieren Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Fuß 2 Zoll, Breite 1 Fuß Anm.: Die Lose 51 und 52 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (22 Μ für die Nrn. 51 und 52) Käufer: Siers 1778/09/28 FRAN 0525 Otmar Elliger I Ein vortrefliches Stück aus der Griechischen Geschichte. [Une piece excellente dont le sujet est pris de l'histoire Grecque.] I Pendant zu Nr. 526 Maße: 2 Schuh 3 Zoll breit, 1 Schuh 10 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (352 fl für die Nrn. 525 und 526) Käufer: Hüsgen
1778/09/28 FRAN 0526 Otmar Elliger I Der Compagnon, von dito [Otmar Elliger], nemliches Maaß. [Le pendant du precedent, meme hauteur & meme largeur.] I Pendant zu Nr. 525, "Ein vortrefliches Stück aus der Griechischen Geschichte" Maße: 2 Schuh 3 Zoll breit, 1 Schuh 10 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (352 fl für die Nm. 525 und 526) Käufer: Hüsgen 1784/05/11 HBKOS 0015 Ellinger I Diana mit zwey Hunden zur Jagd gehend, hinter derselben siehet man ein anmuthiges Gehölze, fleißig und plaisant gemahlt, auf Leinw. von Ellinger. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 28 Zoll 6 1., breit [?] Zoll 21. Transakt.: Verkauft (13.15 M) Käufer: Mohn 1785/05/17 MZAN 0333 Ottomar Elger I Ein Herr in orientalischer Kleidung, der sein Pferd führet. Das Gegenbild, ein Mohr der sein Pferd führet, beide Stücke von Ottomar Elger. [Un seigneur en habillement oriental menant son cheval, le pendant represente un negre menant son cheval.] I Diese Nr.: Ein Herr in orientalischer Kleidung, der sein Pferd führet; Pendant zu Nr. 334 Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 1 Schuh 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 333 und 334 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (10.30 fl für die Nm. 333 und 334) Käufer: Hofrath Mulzer 1785/05/17 MZAN 0334 Ottomar Elger I Ein Herr in orientalischer Kleidung, der sein Pferd führet. Das Gegenbild, ein Mohr der sein Pferd führet, beide Stücke von Ottomar Elger. [Un seigneur en habillement oriental menant son cheval, le pendant represente un negre menant son cheval.] I Diese Nr.: Ein Mohr der sein Pferd führet; Pendant zu Nr. 333 Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 1 Schuh 3 Zoll breit Anm.: Die Lose 333 und 334 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (10.30 fl für die Nrn. 333 und 334) Käufer: Hofrath Mulzer 1788/10/01 FRAN 0056 Otto Elliger I Der Tod der Lucretia, umgeben von ihren Verwandten, von Otto Eiliger, dieses Stück ist sehr fein und wohl colorirt. I Maße: 12 Zoll hoch, 15 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft oder Unverkauft (30 fl) Käufer: Huth 1789/08/18 HB GOV 0117 Elliger, besten Zeit I Zwey ovidische Vorstellungen, wie Jupiter. I Diese Nr.: Eine ovidische Vorstellung, wie Jupiter Anm.: Die Lose 117 und 118 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1789/08/18 HBGOV 0118 Elliger, besten Zeit I Zwey ovidische Vorstellungen, wie Jupiter. I Diese Nr.: Eine ovidische Vorstellung, wie Jupiter Anm.: Die Lose 117 und 118 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1790/02/04 HBDKR 0098 Ottomar Eiliger I Christus und Johannes sich einander liebkosend, so schön wie van Dyck, lebensgroße Figuren, auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 49 Zoll, breit 37 Zoll Transakt.: Verkauft (3.8 M) Käufer: Eckhardt 1790/08/13 HBBMN 0060 Otto mar Elliger I Cleopatra, wie sie sich durch den Gift der Otter tödtet. Auf H[olz]. S.R.G.L. [Schwarzen Rahm, goldne Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 17 Zoll, breit 30 Zoll Transakt.: Verkauft (2 M) Käufer: Bertheau 1790/08/25 FRAN 0389 Elecher I Zwey ovidische Historien. I Diese Nr.: Eine ovidische Historie Maße: hoch 29 Zoll, breit 34 Zoll Anm.: Die Lose 389 und 390 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (12 fl für die Nrn. 389 und 390) Käufer: Kaller 1790/08/25 FRAN 0390 Elecher I Zwey ovidische Historien. I Diese Nr.: Eine ovidische Historie Maße: hoch 29 Zoll, breit 34 Zoll Anm.: Die Lose 389 und 390 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (12 fl für die Nm. 389 und 390) Käufer: Kaller 1790/08/25 FRAN 0443 Elecher I Zwey Frauenzimmer, die eine den Frühling, die andere den Herbst vorstellend. I Diese Nr.: GEMÄLDE
603
Ein Frauenzimmer, den Frühling vorstellend Maße: hoch 19 Zoll, breit 16 Zoll Anm.: Die Lose 443 und 444 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (5 fl für die Nrn. 443 und 444) Käufer: Kaller 1790/08/25 FRAN 0444 Elecher I Zwey Frauenzimmer, die eine den Frühling, die andere den Herbst vorstellend. I Diese Nr.: Ein Frauenzimmer, den Herbst vorstellend Maße: hoch 19 Zoll, breit 16 Zoll Anm.: Die Lose 443 und 444 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (5 fl für die Nrn. 443 und 444) Käufer: Kaller 1791/07/29 HBBMN 0008 Eiliger I Bachus scherzet mit einer Nymphe; auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 22 Vi Zoll, breit 15 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt (19 M) 1791/10/21 HBRMS1 0017 Elliger I Eine Dame spielt auf der Guitarre, ihr Mädchen singt dazu; das Gegenstück, ein Frauenzimmer gießt Wein ein, neben ihr Cupido. Beyde mit vielem Nebenwerk; auf Leinew. I Diese Nr.: Eine Dame spielt auf der Guitarre, ihr Mädchen singt dazu; Pendant zu Nr. 18 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 12 Zoll, breit 9 Zoll Anm.: Die Lose 17 und 18 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1791/10/21 HBRMS1 0018 Elliger I Eine Dame spielt auf der Guitarre, ihr Mädchen singt dazu; das Gegenstück, ein Frauenzimmer gießt Wein ein, neben ihr Cupido. Beyde mit vielem Nebenwerk; auf Leinew. I Diese Nr.: Ein Frauenzimer giesst Wein ein, neben ihr Cupido; Pendant zu Nr. 17 Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 12 Zoll, breit 9 Zoll Anm.: Die Lose 17 und 18 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1792/10/12 KOAN 0022 Otto Elliger I Eine Allegorie auf Kunst und Fleiss, von Otto Elliger, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Fuss - breit 2 Fuss 6 Zoll Verkäufer: Moureaux Transakt.: Unbekannt 1796/08/00 HBPAK 0021 Ottomar Elliger I Zwey Allegorien; das eine, wie die Mahlerey belohnet wird. Beyde von gewählter Composition, und auf das leichteste und schönste gemahlt. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Allegorie, wie die Mahlerey belohnet wird Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 28 Zoll, Breite 24 Zoll Anm.: Die Lose 21 und 22 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1797/06/13 HBPAK 0158 O. Ellinger I Musicirende und scherzende Damen=Gesellschaften. Hinter dieselben Collonaden, über welche Gardinen herunter hängen, nebst andern Verzierungen mit Blumen und Früchten, welche gallerieartige Nischen präsentiren. Sehr stark gemahlt und von besonders lebhaftem Colorit. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine musicirende und scherzende Damen=Gesellschaft Mat.: auf Holz Maße: Hoch 19 Zoll, breit 16 Vi Zoll Anm.: Die Lose 158 und 159 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/06/13 HBPAK 0159 O. Ellinger I Musicirende und scherzende Damen=Gesellschaften. Hinter dieselben Collonaden, über welche Gardinen herunter hängen, nebst andern Verzierungen mit Blumen und Früchten, welche gallerieartige Nischen präsentiren. Sehr stark gemahlt und von besonders lebhaftem Colorit. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine musicirende und scherzende Damen=Gesellschaft Mat.: auf Holz Maße: Hoch 19 Zoll, breit 16 V* Zoll Anm.: Die Lose 158 und 159 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Elsevier 1782/09/30 FRAN 0086 Elsevier I Wie wilde Enten gefangen werden, in einer angenehmen Wassergegend. [La chasse aux Canards sauvages dans une belle contree aquatique par Elsevier.] I Maße: 2 Schuh 2 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 10 Vi Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (31 fl) Käufer: Prinz ν D[essau] Gegenw. Standort: Dessau, Deutschland. Anhaltische Gemäldegalerie. (190) als L.A. Elsevier
Elsevier, Aernout 1799/00/00 WZAN 0486 Arnold Elzevir I Vier Landschaften, von Arnold Elzevir. Auf Pappendeckel. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Pappe Maße: hoch 7 Zoll breit 9 Zoll Anm.: Die Lose 486 bis 489 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0487 Arnold Elzevir I Vier Landschaften, von Arnold Elzevir. Auf Pappendeckel. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Pappe Maße: hoch 7 Zoll breit 9 Zoll Anm.: Die Lose 486 bis 489 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1796/08/00 HBPAK 0022 Ottomar Elliger I Zwey Allegorien; das eine, wie die Mahlerey belohnet wird. Beyde von gewählter Composition, und auf das leichteste und schönste gemahlt. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Allegorie Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 28 Zoll, Breite 24 Zoll Anm.: Die Lose 21 und 22 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1799/00/00 WZAN 0488 Arnold Elzevir I Vier Landschaften, von Arnold Elzevir. Auf Pappendeckel. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Pappe Maße: hoch 7 Zoll breit 9 Zoll Anm.: Die Lose 486 bis 489 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1796/09/08 HBPAK 0026 Ottomar Elger I Ein junger Hercules, der einen Drachen erlegt hat. Neben ihm Cupido in einer Landschaft. I Maße: Hoch 17 Zoll, breit 13 Zoll Transakt.: Unbekannt
1799/00/00 WZAN 0489 Arnold Elzevir I Vier Landschaften, von Arnold Elzevir. Auf Pappendeckel. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Pappe Maße: hoch 7 Zoll breit 9 Zoll Anm.: Die Lose 486 bis 489 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1796/11/02 HBPAK 0175 Otto Marellinger I Zwey Damens; die eine sitzt beym Tisch mit einem Fische in der Hand; die andere mit einem Becher in der Hand. So schön wie Mieris. Auf Holz. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine Dame sitzt beym Tisch mit einem Fische in der Hand Mat.: auf Holz Maße: Hoch 14 Zoll, breit 11 Zoll Anm.: Die Lose 175 und 176 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/11/02 HBPAK 0176 Otto Marellinger I Zwey Damens; die eine sitzt beym Tisch mit einem Fische in der Hand; die andere mit einem Becher in der Hand. So schön wie Mieris. Auf Holz. Goldner Rahm. I Diese Nr.: Eine Damee mit einem Becher in der Hand Mat.: auf Holz Maße: Hoch 14 Zoll, breit 11 Zoll Anm.: Die Lose 175 und 176 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0079 Transakt.: Unbekannt 604
GEMÄLDE
Otto Ellinger I Adam und Eva. I
Elsheimer, Adam 1716/00/00 FRHDR 0041 Elszheim I Von Elszheim Turcken zu Pherd. I Verkäufer: van Merian Transakt.: Unbekannt (45) 1740/00/00 AUAN 0046 Elzheimer I 1. Stuck vom Elzheimer, die Auferweckung Lazari / auf Holtz. I Mat.: auf Holz Maße: 2. Schuh / 2. Zoll hoch / 1. Sch. 10. Zoll breit Transakt.: Unbekannt (200 fl) 1742/08/01 BOAN 0232[d] Elzhemmer I Die Flucht nach /Egypten. Original vom Elzhemmer. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1743/00/00 BWGRA 0034 Adam Elsheimer I Eine sehr schöne Landschaft von Adam Elsheimer sehr fein und nett gemahlet, und
von seiner allerbesten Manier. I Maße: hoch 1 Fuß 3 Zoll, breit 1 Fuß 9 Zoll Transakt.: Unbekannt 1744/05/20 FRAN 0036 Elsheimer I 1 Klein Landschäfftgen. I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 5 Vi Zoll, Breite 5 Zoll Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1744/05/20 FRAN 0081 Elsheimer I 1 Landschafft Hagar. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 10 Zoll, Breite 1 Schuh 1 Zoll Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1744/05/20 FRAN 0082 Elsheimer I 1 dito [Landschafft) dito [Elsheimer]. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 8 Zoll, Breite 12 Zoll Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1744/05/20 FRAN 0099 Elsheimerl 1 Landschäfftgen. \Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 5 Vi Zoll, Breite 5 Vi Zoll Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1744/05/20 FRAN 0189 Α. Elsheimer I 1 Extra schön Stück die Geburth Christi. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 3 Vi Zoll, Breite 1 Schuh 1 Vi Zoll Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1744/05/20 FRAN 0192 Elsheimer I 1 Extra schönes Stück die Flucht Christi. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 7 Vi Zoll, Breite 2 Schuh 3 Zoll Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1744/05/20 FRAN 0226 Elsheimer I 2 Sehr feine und wohlgemachte Stück eines von Van Baalem & Breugel, das andere von Elsheimer. I Diese Nr.: 1 Sehr fein und wohlgemachtes Stück; Nr. 225 von Van Baalem und Breugel Mat.: auf Holz Maße: Höhe 5 Zoll, Breite 8 Zoll Anm.: Die Lose 225 und 226 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt 1750/00/00 KOAN 0102 Adam Elzhaimer I Un paisage bien conserve, representant le Sacrifice d'Abraham, sur cuivre. I Mat.: auf Kupfer Maße: Largeur 8 Vi Pouces, Haut 11 Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt 1763/01/17 HNAN [A]0029 Elsheimer I La Delivrance de St. Pierre Esquisse d'Elsheimer, sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: Hauteur 9 pouces, Largeur 1 pied Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt 1763/11/09 FRJUN 0067 A. Elshaimer I Jupiter transforme en pluie d'or pres de Diane. I Maße: hauteur 7 Vi pouces, largeur 9 Vi pouces Transakt.: Verkauft (3.20 fl) Käufer: Dick 1764/00/00 BLAN 0063 Elsheimer I 1. sehr schone landschaft auf Holtz gemahlt, die gemählde von diesem Meister sind sehr rahr und wenig zu haben. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 1 Zoll hoch, 1 Fuß 6 Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (350 Rt Schätzung) Gegenw. Standort: Sankt-Peterburg, Rossiya. Ermitazh. (N 690) als Schule von Elsheimer 1764/06/15 BOAN 0688 Adam Eltzheimer I Un Paisage d'un pied cinq pouces de largeur, d'un pied deux pouces de hauteur, representant Jacob Luttant avec l'Ange, peint par Adam Eltzheimer. [Ein stück Vorstellend den ringenden Engel mit dem Jacob in einer schonen Landschaft Von Adam Eltzheimer.] I Maße: 1 pied 5 pouces de largeur, 1 pied 2 pouces de hauteur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (32 Rt) Käufer: Hof C Rath Broggia 1764/08/25 FRAN 0297 Elzheimer I St Philippe avec le Camerier Maure. I Maße: haut 9 pouces sur 1 pied de large Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt 1765/00/00 FRRAU 0162 A. Eltzheimer I Eine Landschafft, darinnen vorgestellet, wie Jacob mit dem Engel ringet. Von der ersten Manier des Meisters. Un paisage oü Jacob est represente lutant avec l'Ange, de la premifere fafon de ce maitre. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 1 Schuh 3 Zoll, breit 1 Schuh 7 Zoll Transakt.: Unbekannt 1767/00/00 KOAN 0092 Adam Eltzheimer I Eine wohl conditionirte Landschaft auf Kupfer mit der Biblischen Historie des Abra-
hams, wie er seinen Sohn zum Opfer führet, von Adam Eltzheimer. I Mat.: auf Kupfer Maße: Breite 1 Fuß 3 V* Zoll, Höhe 1 Fuß 6 Zoll Verkäufer: Antonii, Graf von Hohenzölleren Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0139 Elsheimer (Adam) I [Ohne Titel] Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0180 Elsheimer (Adam) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0223 Elsheimer (Adam) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0266 Elsheimer (Adam) I [Ohne Titel] Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0293 Elsheimer (Adam) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0365 Elsheimer (Adam) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0054 Elsheimer I Un Pay sage dans lequel est represente Tobie avec un Ange. Peint sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: 4 Vi. pouces de haut sur 6 pouces de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0064 Elsheimer I Hagar renvoyee avec son fils Ismael, ä qui l'ange envoye de Dieu montre une source d'eau, dans un paysage. Peint sur bois. I Mat.: auf Holz Maße: 8. pouces de haut sur 10 %. pouces de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0094 Elsheimer I Un Paysage avec six figures, parmi les quelles celle qui est sur le devant est nud, couchee sur un lit & endormie. Peint sur cuivre marque du No. 223. I Mat.: auf Kupfer Maße: 5 Vi. pouces de haut sur 7 %. pouces de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0096 Elsheimer I Apollon avec Daphne dans un paysage. Peint sur cuivre marque du No. 293. I Mat.: auf Kupfer Maße: 10. pouces de haut sur 1. pied de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1774/08/13 HBBMN Transakt.: Unbekannt
0152
Elzheimer I Die Geißelung Christi. I
1776/00/00 WZTRU 0056 Adam Elzheimer I Ein Historienstück, 1 Schuhe, 6 Zoll hoch, 1 Schuhe, 1 Zoll breit von Adam Elzheimer, man gewähret hierinn seines Lehrmeisters Philipp Uffenbachs Manier, stellet vor den im Gefängniß gesessenen heiligen Petrus, welchen ein Engel bey der Hand aus einer mit einem Lichte beleuchten Gefängniß in die Freyheit bringet, woselbst die Wächter schlafend liegen. Man erblicket in der ferne bey schwachem Lichte verschiedene Figuren in Beschäftigung, es ist eines der Historie und Nachtcolorit wohlanständiges Stücke, und ist so im Stande, als wenn solches annerst durch des Meisters Hand verfertiget worden wäre. I GEMÄLDE
605
Maße: 1 Schuhe 6 Zoll hoch, 1 Schuhe 1 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (60 fl Schätzung) 1776/00/00 WZTRU 0133 Adam Elsheimer I Ein Stück, 1 Schuhe, 6 Zoll hoch, 1 Schuhe, 11 Zoll breit von Adam Elsheimer, vorstellend ein Nachtstück, wo der volle Mond aufgehet, im Vorgrunde erstehet man ein altes Gebäu, da Maria mit dem Kind Jesu sammt Joseph hiebey zu ersehen, die Wirkung des Mondeslichtes beleuchtet an verschiedene Gegenständen mit gutem Verstände die hierauf sich befindenden Figuren ganz treflich. I Maße: 1 Schuhe 6 Zoll hoch, 1 Schuhe 11 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (12 fl Schätzung) 1776/04/15 HBBMN 0006 Adam Eltzheymer I St. Laurentius, wie er entkleidet wird, um gemartert zu werden, ein capitales Gemählde, gehet in Kupfer aus, von Adam Eltzheymer, auf Kupfer gemahlt. I Mat.: auf Kupfer Maße: Höhe 11 Zoll, Breite 8 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (205 M) Käufer: Schwalbe 1778/09/28 FRAN 0253 Adam Elsheimer I Abrahams Knecht mit seinen Kameelen und der Rebecca am Brunnen, in einer sehr schön ausgearbeiteten Landschaft. [Le valet d'Abraham avec ses chameaux & Rebecca pres du puits dans un paysage tres bien peint.] I Maße: 2 Schuh breit, 1 Schuh 8 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (97 fl) Käufer: Nothnagel 1778/09/28 FRAN 0291 Adam Elsheimer I Eine ausnehmend schöne Christnacht. [Vigile de Noel, piece excellente.] I Maße: 1 Schuh breit, 1 Schuh 2 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (165.30 fl) Käufer: Abe Biva 1778/09/28 FRAN 0301 Α. Elsheimer I Eine vortrefliche waldigte Landschaft von A. Elsheimer. [un tres beau paysage couvert de bois.] I Maße: 2 Schuh breit, 15 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (67 fl) Käufer: Tischbein 1778/09/28 FRAN 0539 Adam Elsheimer I Eine sehr schöne Landschaft mit einer Heerde Vieh. [Un tres beau paysage avec un troupeau de betail.] I Maße: 2 Schuh breit, 1 Vi Schuh hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (137 fl) Käufer: Hüsgen 1779/00/00 HB AN O l l i Adam Elzheimer I Der reisende Tobias schreitet vor seinem Führer her über Steine, die aus einem Bache hervorragen. Den Fisch hält er unterm Arme. Im Hintergrunde eine Landschaft. Auf Kupfer. [Tobie voyageur, marchant devant son guide, enjambe par-dessus des pierres qui s'elevent du fond d'un ruisseau. II tient le poisson sous son bras. Le lointain offre un paysage. Sur cuivre.] I Mat.: auf Kupfer Maße: 5 Zoll hoch, 8 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0183 Adam Elzheimer I Dem heiligen Lorenz wird von einem Knechte der Gürtel abgelöset. Hinter ihm steht ein Priester, der ihm zumuthet, den Herkules anzubeten. Ein Engel bringt einen Oelzweig, und zeigt mit der Hand auf die ihn erwartende Wohnung des Friedens. Hinten brennt das Feuer unter dem Roste. Knechte bringen Kohlen und schüren sie auf. Auf Kupfer. [Un bourreau depouille S. Laurent de sa ceinture. Derriere lui est un pretre pai'en, qui le presse d'adorer Hercule. Un ange lui apporte une branche d'olivier & lui montre le sejour de la paix qui l'attend. Dans le fond un gril, sous lequel il y a un brasier. Des valets apportent du charbon & attisent le feu. Sur cuivre.] I Mat.: auf Kupfer Maße: 1 Fuß hoch, 9 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0200 Adam Elsheimer I Zur Linken schlängelt sich der Weg durch fette Bäume, über abgebrochene Felsen zu den Ruinen eines Schlosses. Zur Linken treibt der Hirte eine Ziege an dem Flusse, der über viele Absätze vom Felsen herunterstürzt, wo jenseits bergichte Anhöhen mit Schlössern und Bäumen die Aussicht hemmen. [Un chemin passe ä gauche entre des arbres vigoureux, au milieu de plusieurs quartiers de rochers & conduit aux mines d'un chateau. Un berger mene une chevre vers une riviere, qui se precipite du rocher de degres en degres. De l'autre cöte des colli606
GEMÄLDE
nes & des montagnes avec des chateaux & des arbres bouchent la vue.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 7 Zoll hoch, 2 Fuß 6 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0201 Adam Elsheimer I Ein Fluß rieselt über sein steinernes absätziges Bette zum Vorgrunde. Zur Linken decken eine Parthie Bäume die abwechselnde Ferne. Zur Rechten die Ruinen eines Tempels am Berge. Beide Stücke [Nr. 200 und 201] auf Holz gemalt. [Une riviere coule sur le devant du tableau par-dessus un lit de pierres & forme des chütes d'eau. A gauche des bouquets d'arbres couvrent un lointain varie. A droite les ruines d'un temple au pied d'une montagne. Tous deux peints sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 7 Zoll hoch, 2 Fuß 6 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/09/27 FRNGL 0613 Adam Elsheimer I Der Trojanische Brand, besonders fein und fleißig ausgearbeitet. [La ville de Troye en flammes, piece excellente.] I Pendant zu Nr. 614 Maße: 8 Vi Zoll hoch, 1 Schuh Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (27.30 fl für die Nrn. 613 und 614) Käufer: Dehnhardt 1779/09/27 FRNGL 0614 Adam Elsheimer I Das Gegenbild zu obigem, Nicodemus bey Christo, ein Nachtstück, eben so schön, von nemlichem Meister [Adam Elsheimer] und Maas. [Le pendant du precedant, Nicodeme avec Jesus-Christ, une nuit, meme beaute, par le meme maitre.] I Pendant zu Nr. 613 Maße: 8 Ά Zoll hoch, 1 Schuh Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (27.30 fl für die Nrn. 613 und 614) Käufer: Dehnhardt 1779/09/27 FRNGL 1048 Adam Elsheimer I Eine sehr fleißig ausgeführte Landschaft, mit biblischen Figuren. [Un tres beau paysage avec des figures, objet tire de l'ecriture sainte.] I Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch, 2 Schuh breit Transakt.: Verkauft (71 fl) Käufer: Hüsgen 1780/08/21 DAAN 0067 Esheimer I Eine Wald=Gegend, von Esheimer, K[upfer], I Mat.: auf Kupfer Maße: 1 Schuh 2 Vi Zoll breit, 10 Zoll hoch Verkäufer: [Friedrich Karl Ludwig, Freiherr von Moser] Transakt.: Unbekannt 1780/08/21 DAAN 0088 Elsheimer I Ein Wald von Elsheimer, Kupfer. I Mat.: auf Kupfer Maße: 6 Zoll breit, 5 Zoll hoch Verkäufer: [Friedrich Karl Ludwig, Freiherr von Moser] Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0056 Adam Elzheimer I Ein Historienstück, 1 Schuhe, 6 Zoll hoch, 1 Schuhe, 1 Zoll breit von Adam Elzheimer; man gewährt hierinn seines Lehrmeisters Philipp Uffenbachs Manier. Es stellet den im Gefängniß gesessenen heil. Petrus vor, welchen ein Engel bey der Hand aus einem mit einem Lichte beleuchten Gefangniße in Freyheit bringet, wo die Wächter im tiefen Schlafe liegen. Man erblicket in der Ferne bey schwachem Lichte verschiedene Figuren in Beschäftigung, es ist eines der Historie und Nachtkolorit wohlanständiges Stück, und ist so im Stande, als wenn es erst durch des Meisters Hand verfertiget worden. I Maße: 1 Schuhe 6 Zoll hoch, 1 Schuhe 1 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0133 Adam Elsheimer I Ein Stück 1 Schuhe, 6 Zoll hoch, 1 Schuhe, 11 Zoll breit von Adam Elsheimer, stellet ein Nachtstück vor, wo der volle Mond aufgehet; im Vorgrunde ersieht man ein altes Gebäude, wo Maria mit dem Kinde Jesu, und Joseph zu sehen sind. Die Wirkung des Mondeslichtes beleuchtet an verschiedenen Gegenständen mit gutem Verstände die hierauf sich befindende Figuren ganz treflich. I Maße: 1 Schuhe 6 Zoll hoch, 1 Schuhe 11 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1781/02/17 FRAN 0024 Adam Elsheimer I Die Flucht in Aegypten von Adam Elsheimer. I Maße: 10 Zoll breit, 7 Vi Zoll hoch Transakt.: Unbekannt (3 fl) 1781/02/17 FRAN 0044 Adam Elsheimer I Die Geschichte derer Baals=Pfaffen, wie der Prophet Daniel, dem König deren Betrug entdecket = fürtreflich ausgeführt von Adam Elsheimer. I Maße: 1
Schuh 11 Zoll breit, 1 Schuh 5 Zoll hoch Transakt.: Unbekannt (22.30 fl) 1781/05/07 FRHUS 0212 Adam Elsheimer! Eine Landschaft meistens Wildniss und stilles Gewässer in welcher die bußfertige Magdalena bethend kniet, sehr fein und reizend ausgeführt von dem berühmten Adam Elsheimer. I Maße: 5 Zoll hoch und 8 Zoll breit Verkäufer: Jacob Bernus Transakt.: Verkauft (56 fl) Käufer: Hüsgen 1781/07/14 FRAN 0045 Elsheimer I Eine Wald=Gegend. Mat.: auf Kupfer Maße: 1 Schuh 2 Vi Zoll breit, 10 Zoll hoch Verkäufer: Moser Transakt.: Unbekannt (40 fl) 1781/07/14 FRAN 0046 Elsheimerl Eine dito [Wald=Gegend, von Elsheimer]. I Mat.: auf Kupfer Maße: 6 Zoll breit, 5 Zoll hoch Verkäufer: Moser Transakt.: Unbekannt (25.30 fl) 1782/09/30 FRAN 0351 Adam Elsheimer I Eine mit grossem Fleiß und Kunst nach der Natur verfertigte baumigte Landschaft mit schönen Figuren. [Un paysage parseme d'arbres, tres joliment peint d'apres nature, avec de belles figures, par Adam Elsheimer.] I Maße: 1 Schuh 6 Vi Zoll hoch, 2 Schuh breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (99.45 fl) Käufer: Kaller 1782/09/30 FRAN 0389 Adam Elsheimer I Eine ungemein schön ausgeführte Landschaft, worin Diana mit ihren Nymphen nach Hirschen jagt. [Un paysage superieurement bien peint, dans lequel Diane avec ses Nymphes chasse le Cerf, par Adam Elsheimer.] I Maße: 10 Zoll hoch, 8 Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (100 fl) Käufer: Mergenbaum 1783/06/19 HBRMS 0088 Adam Eitzheimer I Eine Dorf=Gegend beym Untergange der Sonne, mit vorgestellter Geschichte, wie der Engel den Tobias begleitet. H[olz]. s.R. [schwarzer Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: 9 Zoll hoch, 12 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1784/09/27 FRAN 0084 Adam Elsheimer I Die Gefangennehmung Christi, ein schätzbares und vortrefliches Bild, von der bekannten Meisterhand des Adam Elsheimers. [La capture de JesusChrist, tres belle & excellente piece, par le fameux Maitre Adam Elsheimer.] I Maße: 1 Schuh hoch, 1 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Freyherr von Berberich Transakt.: Verkauft (56.15 fl) Käufer: Wüst 1785/05/17 MZAN 0082 Adam Elsheimer I Ein ovidisches Fabelstück von Adam Elsheimer. [Une piece, dont le sujet est pris des Metamorphoses d'Ovide.] I Maße: 1 Schuh 10 Zoll hoch, 2 Schuh 2 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (72 fl) Käufer: Geheimer Rath ν Heüser 1785/05/17 MZAN 0181 Elsheimer I Der Marterertod des H. Andreas von Elsheimer. [Le martyre de S. Andre.] I Maße: 1 Schuh 2 Zoll hoch, 1 Schuh 9 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (105 fl) Käufer: Melber Gegenw. Standort: Aschaffenburg, Deutschland. Bayerische Staatsgemäldesammlungen. (6534) (?) als niederländische Kopie nach G. Reni 1785/05/17 MZAN 0359 Elsheimer I Eine Landschaft von Elsheimer. [Un autre [paysage].] I Maße: 1 Schuh hoch, 1 Schuh 4 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (49 fl) Käufer: Zitz 1785/05/17 MZAN 0552 Elsheimer I Der H. Franziskus Seraphicus von Elsheimer. [S. Francois Seraphique.] I Maße: 8 Vi Zoll hoch, 6 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (4.30 fl) Käufer: Zitz 1785/05/17 MZAN 0692 Elsheimer I Die H. Theresia vor einem Crucifix betend von Elsheimer auf Stein. [S. Therese en prieres devant un Crucifix.] I Mat.: auf Stein Maße: 1 Schuh 3 Vi Zoll hoch, 1 Schuh 1 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (16 fl) Käufer: Winterstein 1785/05/17 MZAN 0708 Elsheimer I Der H. Franziskus vor einem Crucifix betend von Elsheimer auf Kupfer. [S. Francois Sera-
phique en prieres devant un Crucifix.] I Mat.: auf Kupfer Maße: 6 Zoll hoch, 5 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (10 fl) Käufer: Becker Glöckner 1785/05/17 MZAN 1091 Elsheimer I Ein studierendes Frauenzimmer von Elsheimer. [Une femme etudiante.] I Maße: 1 Schuh hoch, 10 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (4.30 fl) Käufer: Winterstein 1786/10/18 HBTEX 0072 A. Elsheimer I Zwey Eremiten in angenehmen Land=Gegenden, in aparter Manier gemahlt. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Eremit in angenehmer Land=Gegend Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll 3 Linien, breit 13 Zoll 3 Linien Anm.: Die Lose 72 und 73 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/10/18 HBTEX 0073 A. Elsheimer I Zwey Eremiten in angenehmen Land=Gegenden, in aparter Manier gemahlt. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein Eremit in angenehmer Land=Gegend Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Zoll 3 Linien, breit 13 Zoll 3 Linien Anm.: Die Lose 72 und 73 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1786/11/11 HBRMS 0080 A. Eltzheymer I Wie die Ceres den Steiles zu einem Eydex verwandelt, umgeben mit mehrern Figuren und Vieh, bey Nacht bey brennendem Lichte vorgestellt, grau in grau, sehr vortreflich gemahlt, auf Kupfer; oval, aber durch die goldne Einfassung in einen viereckigen Rahm gesetzt. I Mat.: auf Kupfer Format: oval Transakt.: Unbekannt 1787/00/00 HB AN 0225 Ad. Eltzheimer! Im Mittelpunkt einer waldigten Landschaft befinden sich bey einigen Häusern Hirten und Vieh. Im Vordergrunde geht Christus mit den beyden Jüngern von Emaus. In der Ferne wird man mehrere Hirten und Vieh gewahr. Sehr fleißig gemahlt. A.H. [Auf Holz] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Zoll, breit 12 Zoll Transakt.: Verkauft (40 M) Käufer: Fesser 1787/00/00 HB AN 0283 Adam Eltzheymer I Dieses vortreffliche Gemähide stellet die Auferweckung Lazari vor. Lazarus steigt aus einem steinernen Grabe hervor. Ein junger Mensch löset ihm die gebundenen Arme, einige andere reichen ihm voller Verwunderung hülfreich die Hände. Ein Alter setzt erstaunungsvoll die Brille auf die Nase, um diese Scene genauer zu betrachten. Vor dem Grabe steht Christus mit aufgehobener Hand, in einer majestätischen Stellung, voller Reiz, und wird von den vielen um ihn versammelten Zuschauern verehret. Im Hintergründe wird man noch zwey andere herzueilende gewahr. Die Composition ist reizend, die Zeichnung schön und edel, die Wahrheit in den Gesichtern vortrefflich ausgedrückt, die Haltung und Austheilung des Lichts und Schattens überaus richtig, und das Colorit meisterhaft, so daß dieses Cabinetstück ein wahrhafter Schatz für Kenner ist. A.K. [Auf Kupfer] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 11 Vi Zoll, breit 16 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (165 M) Käufer: Schoen 1788/06/12 HBRMS 0120 A. Elsheimer I Eine Frau mit einem Kinde auf dem Arme hält ein Gefäß dem Mädchen hin, welche etwas aus dem Hängelkorb hinein legen will. Treflich beleuchtet und sehr schön gemalt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 4 Vi Zoll, breit 6 Zoll Transakt.: Unbekannt 1789/08/18 HBGOV 0116 Elsheimer I In einer Italienischen Landgegend siehet man in der Entfernung einen Tempel, Stadt und Pyramyde, vor welchen ein Fluß vorbey fließet, der im Vordergrunde einen doppelten Wasserfall machet. Es scheinet alles auf das fleißigste nach der Natur abgebildet zu seyn des bekannten Künstlers, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 8 Vi Zoll, breit 14 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0358 Elzheimer I Drey Seestücke, auf Holz, in schwarzgepeizten Ramen mit vergoldeten Leisten. I Diese Nr.: Ein Seestück Mat.: auf Holz Maße: Höhe 8 Zoll, Breite 10 Zoll Anm.: Die Lose 358 bis 360 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
607
1790/01/07 MUAN 0359 Elzheimer I Drey Seestücke, auf Holz, in schwarzgepeizten Ramen mit vergoldeten Leisten. I Diese Nr.: Ein Seestück Mat.: auf Holz Maße: Höhe 8 Zoll, Breite 10 Zoll Anm.: Die Lose 358 bis 360 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0360 Elzheimer I Drey Seestücke, auf Holz, in schwarzgepeizten Ramen mit vergoldeten Leisten. I Diese Nr.: Ein Seestück Mat.: auf Holz Maße: Höhe 8 Zoll, Breite 10 Zoll Anm.: Die Lose 358 bis 360 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/08/25 FRAN 0212 Elzheimer I Die Flucht nach Egypten. I Maße: hoch 7 Zoll, breit 9 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (2 fl) Käufer: Kaller 1791/09/21 FRAN 0057 Adam Elsheimer I Ein Gegenstand der Heiligkeit, wo man Joseph sieht, der den Sattel seines Esels bereitet, und zwey Engel, so ihm kund thun, daß er nach Egypten gehen soll, zur Rechten ist die Jungfrau sitzend und hält das Kind Jesus in ihren Armen, Engel auf den Knien bieten ihr Blumen dar; dieses Gemälde, so auf Schieferstein gemalt, ist von einem feinen und lieblichen Pinsel. I Mat.: auf Schiefer Transakt.: Verkauft (25 fl) Käufer: Neufville 1797/04/20 HBPAK 0005 Adam Elzhaimer I Christus am Oelberge, mit drey schlafenden Jüngern. Ein Engel erscheint vom Himmel, mit einem Kelch in der Hand, um den kämpfenden Christus zu stärken. Im Hintergrunde siehet man Judas kommen, mit einer bewaffneten Schaar, versehen mit Fackeln und Lampen. Ein sehr fleißiges Bild. Auf Kupfer, mit vergoldeten Rahm. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 9 Zoll, breit 11 Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/12/23 WNAN 0066 Eishemmer I Deux Tableaux precieux. I Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 BLBOE 0112 Elschaimer I Christus betet am Oehlberge. Ein Engel reicht ihm den Kelch. Auf der einen Seite die schlafenden Jünger, auf der andern die Schaarwache. I Mat.: auf Kupfer Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN2 0118 Elsheimer (Adam) I Eine Landschaft mit Figuren. Vorwärts links sind zwey nackende Figuren und verschiedene Stücke Vieh; im zweyten Plan in der Mitte eine Heerde Kühe; rechts ein Teich; der Hintergrund bietet die Aussicht in eine Ferne dar. Dieses Bild ist für das Zeitalter mit vieler Harmonie ausgeführt. I Mat.: auf Holz Maße: 18 Zoll hoch, 23 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0026 Adam Elzheimer I Christus im Grabe: zwey Engel sehen mit anbetender Bewunderung ihn in der Gruft liegen. Aufs schönste gemahlt. Auf Kupfer, goldn. Rahm. I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 13 Zoll, breit 18 Zoll Transakt.: Unbekannt
Elsheimer, Adam (und Keirincx, Alex.) 1785/05/17 MZAN 0191 Kierings; Elsheimer I Die Flucht in Aegypten, die Landschaft von Kierings, die Figuren von Elsheimer. [La fuite en Egypte, le paysage par Kierings, les figures par Elsheimer.] I Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 2 Schuh 1 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (140 fl) Käufer: Melber Oegenw. Standort: Aschaffenburg, Deutschland. Bayerische Staatsgemäldesammlungen. (6304) als Alex. Keirincx.
Elsheimer, Adam (Geschmack von) 1791/09/26 FRAN 0129 Adam Elsheimer I Eine angenehme Landschaft, in deren Vordergrund ein sehr groser Baum sich besonders ausnimmt, überaus fleißig behandelt im Geschmack Adam Elsheimers. I Maße: 6 Zoll breit, 5 Zoll hoch Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt 608
GEMÄLDE
Elsheimer, Adam (Kopie nach) 1743/00/00 BWGRA 0182 Adam Elsheimer I Eine Maria Magdalena, ein Nacht=Stück, nach Adam Elsheimer. I Maße: hoch 6 Vi Zoll, breit 4 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt
Elsheimer, Adam (Manier) 1772/09/15 BNSCT 0082 Elsheimer I Eine detto [Landschaft] in der Manier von Elsheimer, auf Holz, 1 F. h. 1 F. 5 Z. br. schw. R[ahm], I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß hoch, 1 Fuß 5 Zoll breit Transakt.: Unbekannt (4.5 fl) 1774/10/05 HBNEU 0073 Eltzheimer I Eine Landschaft, mit der Flucht nach Egypten, in der Manier von Eltzheimer. I Transakt.: Unbekannt 1781/09/10 BNAN 0110 Λ. Elzheimer I Eine Anbetung der Hirten; über ihnen eine Glorie von Engeln; warm und fleißig in A. Elzheimers Manier ausgeführet. g.L. [im schwarzen Rahm mit verguldeten Leisten] I Mat.: auf Holz Maße: 11 Zoll hoch, 10 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Elsheimer, Adam (Schule) 1764/05/29 BOAN 0361 Eltzheimers I Un Tableau representant le Christ & des Scribes de trois pieds six pouces de largeur, deux pieds dix pouces de hauteur, de l'Ecöle d'Eltzheimers. [Ein stück Vorstellend Christum mit Einigen schriftgelehrten aus der schul des Ellzheimers.] I Maße: 3 pieds 6 pouces de largeur, 2 pieds 10 pouces de hauteur Verkäufer: Kurfürst Clemens August Transakt.: Verkauft (13.10 Rt) Käufer: von Beckers
Elsheimer, Adam (zugeschrieben) 1788/04/07 FRFAY 0110 Λ. Elzheimer I Badende und nackende weibliche Figuren an der Seeküste, angeblich von A. Elzheimer. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: 16 Z. hoch, und 12 Z. breit Transakt.: Verkauft (12 fl) Käufer: Levi ν M[annheim]
Engebrechtsz., Cornelis 1799/00/00 WZAN A0349 Cornelius Engelbrecht I Ein Beinhaus, unten verschiedene todte menschliche Körper, von Cornelius Engelbrecht. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 1 Schuh 1 Vi Zoll breit 10 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Engelhart, Sebastian 1768/07/00 MUAN 0137 Engelhard I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0138 Engelhard I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 0159 Engelhard] [OhneTitel] \Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0185 Engelhart I Jesus Christ elev6 en croix sur la montagne calvaire, entre deux larrons. Peint sur toile, marque du No. 159. I Mat.: auf Leinwand Maße: l . p . 11 Vi. p. de haut sur 1.
p. 5. p. de large Verkäufer: Franijois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0253 Engelhardt I Ein Mathematiker, auf Leinwat, in einer schwarzgepeizten Ram mit vergoldeten Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 8 Zoll, Breite 6 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 0254 Engelhardt I Ein Brustbild mit einer Tobackpfeife, auf Leinwat, in einer schwarzgepeizten Ram mit vergoldeten Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 8 Zoll, Breite 6 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1378 Engelhardt I Zween Apostel, auf Leinwat, in vergoldeten Ramen. I Diese Nr.: Ein Apostel Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 9 Zoll, Breite 7 Zoll Anm.: Die Lose 1378 und 1379 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1379 Engelhardt I Zween Apostel, auf Leinwat, in vergoldeten Ramen. I Diese Nr.: Ein Apostel Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 9 Zoll, Breite 7 Zoll Anm.: Die Lose 1378 und 1379 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1790/01/07 MUAN 1412 Engelhardt I Ein halbnacktes Kind, auf Leinwat, in einer derlei [geschnittenen und vergoldeten] Ram. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh 6 Zoll, Breite 1 Schuh 1 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1797/08/10 MM AN 0331 Sebast. Engelhard I Gegenstücke, auf dem ersten ein Cruzifix, auf dem zweiten der Leichnam unseres Herrn Jesu Christi von Sebast. Engelhard, auf Tuch. I Diese Nr.: Ein Gegenstück, auf dem ersten ein Cruzifix; Pendant zu Nr. 332 Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 331 und 332 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (30 fl für die Nm. 331 und 332, Schätzung) 1797/08/10 MMAN 0332 Sebast. Engelhard I Gegenstücke, auf dem ersten ein Cruzifix, auf dem zweiten der Leichnam unseres Herrn Jesu Christi von Sebast. Engelhard, auf Tuch. I Diese Nr.: Ein Gegenstück, auf dem zweiten der Leichnam unseres Herrn Jesu Christi; Pendant zu Nr. 331 Mat.: auf Leinwand Anm.: Die Lose 331 und 332 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (30 fl für die Nrn. 331 und 332, Schätzung)
Engels, Gabriel 1750/04/00 HB AN 0076 Gabriel Engels I Ein Perspectivisch Stück von Gabriel Engels. I Transakt.: Unbekannt 1773/12/18 HBBOY 0031 Gabriel Engels I Ein perspectivischer Tempel. I Transakt.: Unbekannt 1775/11/18 HBBMN 0006 Gabriel Engels I Ein schöner perspectivischer Palais. I Transakt.: Unbekannt 1776/06/28 HBBMN 0010 G. Engel I Eine perspectivische Kirche mit vielen Figuren, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Fuß 8 Zoll, Breite 1 Fuß 1 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1776/12/21 HBBMN 0057 Gabriel Engels I Eine inwendige Kirche von vortreflicher Architectur und Perspectiv, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 1 Fuß 11 Zoll, breit 2 Fuß 7 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (38.4 M) Käufer: Ehrenreich 1776/12/21 HBBMN 0072 Gabriel Engels I Ein Italiänisches perspectivisches Prospect mit vielen Figuren, von der besten Zeit des Gabriel Engels, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 3 Fuß 9 Zoll, breit 4 Fuß 2 Zoll Transakt.: Verkauft (26 M) Käufer: Bostelm[ann] [für] R
1777/02/21 HBHRN 0063 Gabr. Engels I Ein ungemein ausführliches Perspectiv. I Maße: Höhe 2 Fuß 7 Vi Zoll, Breite 4 Fuß 2 Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/05/21 HBKOS 0003 Gabriel Engels I Eine perspectivische Kirche. I Transakt.: Unbekannt 1778/07/21 HBHTZ 0037 G. Engels I Zwey Perspectivische Kirchen, ovalen Formats, auf Holz. I Diese Nr.: Eine Perspectivische Kirche Mat.: auf Holz Format: oval Anm.: Die Lose 37 und 38 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/07/21 HBHTZ 0038 G. Engels I Zwey Perspectivische Kirchen, ovalen Formats, auf Holz. I Diese Nr.: Eine Perspectivische Kirche Mat.: auf Holz Format: oval Anm.: Die Lose 37 und 38 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1778/10/23 HBKOS 0018 Gab. Engels I Ein vortreflicher Prospect von Colonaden, so perspectivisch vorgestellet, auf dito [Leinwand]. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 30 Zoll, breit 47 Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/10/23 HBKOS 0020 G. Engels I Ein perspectivischer Prospect, von G. Engels, auf dito [Leinwand]. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 26 Zoll, breit 37 Zoll Transakt.: Unbekannt 1782/09/30 FRAN 0118 Gabriel Engel I Ein fleisig ausgearbeitetes Architekturstück von Gabriel Engel aus Hamburg. [Une tres belle piece d'Architecture, par Gabriel Engel de Hambourg.] I Maße: 1 Schuh 10 Zoll hoch, 2 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (13.15 fl) Käufer: Kaller 1785/12/03 HBBMN 0062 Gabr. Engels I Wie Christus im Tempel lehrt. I Transakt.: Unbekannt 1787/04/19 HB TEX 0006 Gabriel Engels I Ein inwendiger perspectivischer Palais mit Figuren. I Transakt.: Verkauft (8.4 M) Käufer: Eck 1788/08/21 HBRMS 0104 G. Engels I Das Bildniß eines Predigers. Auf Leinewand, schwarzen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 17 Zoll, breit 12 Zoll Transakt.: Unbekannt 1789/06/12 HBTEX 0057 G. Engels I Zwey perspectivische Gartenprospecte, mit Herren und Dames in denselben. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Ein perspectivisches Gartenprospect, mit Herren und Dames in demselben Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 28 Zoll, breit 41 Zoll Anm.: Die Lose 57 und 58 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (3.4 Μ für die Nm. 57 und 58) Käufer: Freundt 1789/06/12 HBTEX 0058 G. Engels I Zwey perspectivische Gartenprospecte, mit Herren und Dames in denselben. Auf Leinewand. I Diese Nr.: Ein perspectivisches Gartenprospect, mit Herren und Dames in demselben Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 28 Zoll, breit 41 Zoll Anm.: Die Lose 57 und 58 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (3.4 Μ für die Nrn. 57 und 58) Käufer: Freundt 1790/04/13 HBLIE 0069 Gabr. Engels I Zwey perspectivische Garten=Prospecte; das eine ist wie ein Zimmer vorgestellt, wo man durch die Thür eine Fontaine siehet. Sie sind beyde von regelmäßiger Zeichnung, starken Colorit und sehr fleißiger Ausarbeitung. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein perspectivischer Garten=Prospect Mat.: auf Holz Maße: Hoch 23 Zoll, breit 41 Zoll Anm.: Die Lose 69 und 70 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (12 M) Käufer: Eckhardt [mit] S 1790/04/13 HBLIE 0070 Gabr. Engels I Zwey perspectivische Garten=Prospecte; das eine ist wie ein Zimmer vorgestellt, wo man durch die Thür eine Fontaine siehet. Sie sind beyde von regelmäßiger Zeichnung, starken Colorit und sehr fleißiger Ausarbeitung. Auf Holz. I Diese Nr.: Ein perspectivischer Garten=Prospect Mat.: auf Holz Maße: Hoch 23 Zoll, breit 41 Zoll Anm.: Die Lose 69 und 70 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (6 M) GEMÄLDE
609
1790/04/13 HBLIE 0134 Gabriel Engels I Ein Schloß und Herrschaftlicher Garten=Prospect, perspectivisch vorgestellet. Auf L. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 26 Zoll, breit 32 Zoll Transakt.: Verkauft (12 Sch) Käufer: Ego 1790/08/13 HBBMN 0035 Gabr. Engels I Unter einem Gebäude von vielen Bogengängen wird man Hercules & Omphale mit Neben=Figuren gewahr. Auf Lfeinwand]. dito R[ahm]. [Schwarzen Rahm, goldne Leisten] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 27 Zoll, breit 36 Zoll Transakt.: Verkauft (2 M) Käufer: Eckhardt 1792/07/05 LBKIP 0076 Engels I Das Prospect einer inwendigen Kirche, ein sehr vortrefliches Bild. I Transakt.: Unbekannt 1795/03/12 HBSDT 0074 Gabriel Engels I Das Inwendige eines Tempels. Auf Leinwand, im schwarzen Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 37 Zoll, breit 56 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/12/07 HBPAK 0151 Gabriel Engels I Ein alter weisbärtiger Kopf. I Transakt.: Unbekannt 1797/06/13 HBPAK 0034 Gabriel Engels I Eine perspectivische Kirche; von sehr schöner Beleuchtung. Auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 25 Zoll, breit 33 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0080 Gabriel Engel I Ein perspectivisches Gebäude. Von Beleuchtung und Fleiß ausnehmend schön. Eines der schönsten von dem Meister bekannt. Auf Leinw. schw. Rahm mit gold. Leist. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 66 Zoll, breit 92 Zoll Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0020 Gabriel Engels I Zwey perspektivische Vorstellungen, in denen man unter schlanken, wohlerleuchteten Bogengängen mehrere Figuren sieht. Täuschend gemahlt. Auf Leinwand, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Eine perspektivische Vorstellung, in der man unter schlanken, wohlerleuchteten Bogengängen mehrere Figuren sieht Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Zoll, breit 25 Zoll Anm.: Die Lose 20 und 21 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0021 Gabriel Engels I Zwey perspektivische Vorstellungen, in denen man unter schlanken, wohlerleuchteten Bogengängen mehrere Figuren sieht. Täuschend gemahlt. Auf Leinwand, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Eine perspektivische Vorstellung, in der man unter schlanken, wohlerleuchteten Bogengängen mehrere Figuren sieht Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Zoll, breit 25 Zoll Anm.: Die Lose 20 und 21 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0100 G. Engels I Die Perspektive eines Gebäudes; schön ordinirt und treflich erleuchtet. Auf Leinwand, schw. Rahm mit goldnen Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 34 Zoll, breit 42 Zoll Transakt.: Unbekannt 1800/11/12
HBPAK
0608
Gabriel
Engels
I Ein perspectivisches
Gebäude mit Figuren. I Transakt.: Unbekannt
Engels, Gabriel (Kopie nach) 1747/04/06 HB AN 0068 Engels I Ein perspectivisch Stücke nach Engels. I Maße: 4 Fuß 4 Zoll Breite und 5 Fuß 5 Zoll Höhe Verkäufer: Brockes Transakt.: Unbekannt (3.4)
Enzinger, Anton 1793/00/00 NGWID 0379 Enzinger I Eine wilde Schweinshatz, von Enzinger. I Pendant zu Nr. 380 Maße: 1 Schuh 6 Zoll hoch, 1 Schuh 10 Vi Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0380 Enzinger I Zum Gegenstück, eine dergleichen Schweinshatz mit einem Raubbären, von vorhergehendem Meister [Enzinger] und Maaß. I Pendant zu Nr. 379 Maße: 1 Schuh 6 Zoll hoch, 1 Schuh 10 Vi Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 610
GEMÄLDE
Ep.*** 1797/06/13 HBPAK 0056 Ep. I Liegende und stehende Genien spielen mit Ziegen im Grünen. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 24 Zoll, breit 30 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/06/13 HBPAK 0084 Ep.*** I Zwey ländliche Hirtenstükke. Auf Holz. Queeroval=Format. I Diese Nr.: Ein ländliches Hirtenstück Mat.: auf Holz Format: queroval Maße: Hoch 17 Zoll, breit 22 Zoll Anm.: Die Lose 84 und 85 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/06/13 HBPAK 0085 Ep.*** I Zwey ländliche Hirtenstükke. Auf Holz. Queeroval=Format. I Diese Nr.: Ein ländliches Hirtenstück Mat.: auf Holz Format: queroval Maße: Hoch 17 Zoll, breit 22 Zoll Anm.: Die Lose 84 und 85 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Eques de Ruska [Nicht identifiziert] 1788/01/15 LZRST 3925 Eques de Ruska I 2 Stück schön skitzirte Köpfe, ein alter Mannskopf und ein Frauenzimmer, von Eques de Ruska 1737. 21 Zoll hoch, 17 Zoll breit, in schw. gebeizt. Rahmen mit verg. Leisten. I Maße: 21 Zoll hoch, 17 Zoll breit Inschr.: 1737 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (3.18 Th) Käufer: C R
Erasmus, Desiderius 1785/05/17 MZAN 0124 Erasmus von Rotterdam I Ein Christus= und ein Marienkopf von Erasmus von Rotterdam. [Une tete de Jesus Christ, le pendant une tete de la S. Vierge.] I Diese Nr.: Ein Christuskopf; Pendant zu Nr. 125 Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 11 Zoll breit Anm.: Die Lose 124 und 125 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (36 fl für die Nrn. 124 und 125) Käufer: Schwanck Vergolder 1785/05/17 MZAN 0125 Erasmus von Rotterdam I Ein Christus= und ein Marienkopf von Erasmus von Rotterdam. [Une tete de Jesus Christ, le pendant une tete de la S. Vierge.] I Diese Nr.: Ein Marienkopf; Pendant zu Nr. 124 Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 11 Zoll breit Anm.: Die Lose 124 und 125 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (36 fl für die Nm. 124 und 125) Käufer: Schwanck Vergolder 1785/05/17 MZAN 0500 Erasmus von Rotterdam I Christus der von Pilatus denen Juden vorgestellet wird von Erasmus von Rotterdam. [Jesus Christ presente aux juifs par Pilate.] I Maße: 1 Schuh Vi Zoll hoch, 9 Vi Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (17.30 fl) Käufer: Schwanck 1794/00/00 FGAN [A]0004 Erasmus Rotterdam I Zwey Stücke, Christus und Maria, beyde Köpfe in Lebensgröße, auf Holz gemalt. I Mat.: auf Holz Maße: 1 Schuh 3 Zoll hoch, 11 Zoll breit Verkäufer: Graf Heinrich von Kageneck Transakt.: Unbekannt (88 fl)
Erasmus, Georg Christoph 1799/00/00 WZAN A0331 G. C. Erasmus I Das Urtheil Salomons, von G. C. Erasmus. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 1 Zoll breit 4 Schuh Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Ergo, Engelbert 1786/04/21 HB TEX 0108 Engelbert Eago I Eine waldigte Landschaft bey Mondschein, mit Vieh und Figuren. I Transakt.: Unbekannt
Eries, C. de [Nicht identifiziert] 1776/12/21 HBBMN 0032 C. de Eries I Eine meisterhafte Landschaft, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 1 Fuß 10 Zoll, breit 2 Fuß 3 Zoll Transakt.: Verkauft (6 M) Käufer: Lt Lüss
Ermels, Johann Franciscus 1752/00/00 NGWOL 0032 Ermels I Eine Spelunca und Gascade, beide von Ermels. Vna Spelonea [sic] e Cascäta d'aequa ambedue del Ermels. I Diese Nr.: Eine Spelunca Anm.: Die Lose 32 und 33 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (20 Th für die Nrn. 32 und 33)
Leinwand Maße: 1 Fuß 1 Zoll hoch, 1 Fuß 4 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0232 J.F. Ermels I Abgebrochene Felsen, mit grünenden Bäumen bekleidet, erheben sich zur Rechten. Weiter hin bespühlt der Fluß, über den eine steinerne Brücke geht, die Mauer eines verfallenen Schlosses im waldichten Gebirge. [Des rochers detaches, revetus d'arbres verts s'elevent ä droite. Plus loin la riviere, traversee par un pont de pierre, baigne la muraille d'un chateau ruine, sur des montagnes couvertes de bois.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 1 Zoll hoch, 1 Fuß 4 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt
1752/00/00 NGWOL 0057 Ermels I Ein Prospect durch einen Wald. Prospettiva d'un bosco. I Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (3 Th)
1781/00/00 WZAN 0086 Johann Franz Ermels I Em Stück 1 Schuhe, 10 Zoll hoch, 1 Schuhe, 7 Zoll breit von Johann Franz Ermels, eine felsigte Gegend vorstellend, welche mit starkem Buschwerke bewachsen ist: der Hirt treibt durch einen Hohlweg welcher sehr steinigt, wo ein Schlaglicht von den Sonnenstralen eine angenehme Wirkung auf den Felsen verursachet, und man erkennet in diesem Stücke jene Manier und Art, welche er nach Artoas studirte, und seine Figuren sind in so wohl ausgewählten Stellungen sehr korrekt gut angebracht. I Pendant zu Nr. 87 Maße: 1 Schuhe 10 Zoll hoch, 1 Schuhe 7 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
1772/00/00 BSFRE 0032 Ermels (Jean Francois) I Un Payssage avec quelques Chevres. Cadre uny d'orfi. I Mat.: auf Leinwand Maße: haut de 17 & large de 25 pouces Transakt.: Unbekannt
1781/00/00 WZAN 0087 Johann Franz Ermels I Kompagnon zu Nro 86, von nämlicher Güte und Stärke des obigen Meisters [Johann Franz Ermels]. I Pendant zu Nr. 86 Transakt.: Unbekannt
1772/00/00 BSFRE 0033 Ermels (Jean Francois) I Ce sont des Souterreins de Rochers perces, avec quelques figures ; Cette Piece fait Pendant au No. 104. Pareil cadre [Cadre uny d'ore]. I Pendant zu Nr. 104 von J.Z. Kneller Mat.: auf Holz Maße: haut de 4 & large de 6 Vi pouces Anm.: In einer Errata-Liste auf Seite 63 des Katalogs wurde die im Bildtitel angegebene Losnummer des Pendants korrigiert. Es handelt sich um Nr. 104, nicht um Nr. 103. Transakt.: Unbekannt
1782/05/29 FRFAY 0039 Ermels I Eine Landschaft. I Maße: 17 Zoll hoch, 23 Zoll breit Verkäufer: Kaspar Thorhorst Transakt.: Unbekannt (16 fl)
1752/00/00 NGWOL 0033 Ermels I Eine Spelunca und Gascade, beide von Ermels. Vna Spelonea [sic] e Cascäta d'aequa ambedue del Ermels. I Diese Nr.: Eine Gascade Anm.: Die Lose 32 und 33 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (20 Th für die Nm. 32 und 33)
1776/00/00 WZTRU 0086 Johann Franciscus Ermels I Ein Stück, 1 Schuhe, 10 Zoll hoch, 1 Schuhe, 7 Zoll breit von Johann Franciscus Ermels eine felsigte Gegend vorstellend, welche mit starkem Buschwerke bewachsen, der Hirt treibet durch einen Hohlweg welcher sehr steinigt, allwo ein Schlaglicht von der Sonnenstrahlen eine angenehme Wirkung auf den Felsen verursachet, und man erkennet in diesem Stücke jene Manier und Art, welche er nach Artoas studirte, und seine Figuren so in wohl ausgewählten Stellungen, sind sehr correct und wohl angebracht. I Pendant zu Nr. 87 Maße: 1 Schuhe 10 Zoll hoch, 1 Schuhe 7 Zoll breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (35 fl Schätzung) 1776/00/00 WZTRU 0087 Johann Franciscus Ermels I Compagnion zu Nro. 86 von nämlicher Güte und Stärke des obigen Meisters [Johann Franciscus Ermels]. I Pendant zu Nr. 86 Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (35 fl Schätzung) 1778/09/28 FRAN 0061 Ermels I Eine schöne Landschaft mit Vieh. [Un beau paysage avec du betail par Ermels.] I Pendant zu Nr. 62 Maße: 3 Schuh breit, 2 Schuh 3 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (7 fl für die Nm. 61 und 62) Käufer: Resident Müller 1778/09/28 FRAN 0062 Ermels I Der Compagnon, eine Landschaft mit Gebirgen und Vieh, von dito [Ermels], [Le pendant du precedent representant un paysage avec des montagnes & du betail, par le meme [Ermels].] I Pendant zu Nr. 61 Maße: 3 Schuh breit, 2 Schuh 3 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (7 fl für die Nrn. 61 und 62) Käufer: Resident Müller 1779/00/00 HB AN 0231 J.F. Ermels I An einem bemoosten Felsen, hinter welchem ein Wald anfängt, ruhen zween Wanderer, an einem sich schlängelnden Wege. Noch zween andere kommen aus dem fernen Gehölze. [Deux voyageurs se reposent contre un rocher couvert de mousse, derriere lequel s'eleve une foret, pres d'un chemin sinueux. Deux autres viennent d'un bois eloigne.] I Mat.: auf
1784/09/27 FRAN 0022 Ermels I Eine Landschaft von Ermels. [Un paysage.] I Maße: 10 Zoll hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Verkäufer: Freyherr von Berberich Transakt.: Verkauft (12.45 fl) Käufer: Hüsgen 1786/05/02 NGAN 0029 Ermel I Zwo Landschaften von Ermel. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 3 Schuh 8 Zoll hoch, 2 Schuh 9 Zoll breit Anm.: Die Lose 29 und 30 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (10.46 fl für die Nrn. 29 und 30) Käufer: Möglich 1786/05/02 NGAN 0030 Ermel I Zwo Landschaften von Ermel. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 3 Schuh 8 Zoll hoch, 2 Schuh 9 Zoll breit Anm.: Die Lose 29 und 30 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (10.46 fl für die Nm. 29 und 30) Käufer: Möglich 1786/05/02 NGAN 0082 Ermel I Eine Landschaft. I Maße: 6 Zoll hoch, 9 Vi Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (1.30 fl) Käufer: Pfann 1786/05/02 NGAN 0218 Ermel I Eine Landschaft von Ermel. I Maße: 7 Zoll hoch, 9 Vi Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (1.2 fl) Käufer: ν Scheurl 1786/05/02 NGAN 0300 Ermel I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 2 Schuh 8 Zoll hoch, 3 Schuh 7 Zoll breit Anm.: Die Lose 300 und 301 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (18.30 fl für die Nrn. 300 und 301) Käufer: Frauenholz 1786/05/02 NGAN 0301 Ermel I Zwey Landschaften. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 2 Schuh 8 Zoll hoch, 3 Schuh 7 Zoll breit Anm.: Die Lose 300 und 301 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (18.30 fl für die Nrn. 300 und 301) Käufer: Frauenholz 1790/04/13 HBLIE 0197 J. Ermels I Zwey sehr plaisante Land= und Wassergegenden mit Figuren. Auf Leinw. I Diese Nr.: Eine sehr plaisante Land= und Wassergegend mit Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 16 Zoll, breit 19 Zoll Anm.: Die Lose 197 und 198 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (1 Μ für die Nrn. 197 und 198) Käufer: Siegberg GEMÄLDE
611
1790/04/13 HBLIE 0198 J. Ermels I Zwey sehr plaisante Land= und Wassergegenden mit Figuren. Auf Leinw. I Diese Nr.: Eine sehr plaisante Land= und Wassergegend mit Figuren Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 16 Zoll, breit 19 Zoll Anm.: Die Lose 197 und 198 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (1 Μ für die Nm. 197 und 198) Käufer: Siegberg 1798/12/10 WNAN 0012 Ermels I Zwey Landschaften auf Holz, Rudern vorstellend. I Mat.: auf Holz Verkäufer: Prof Adam Transakt.: Unbekannt 1798/12/10 WNAN 0021 Ermels I Vorstellung alter Ruinen, von Ermels auf Holz gemahlt. I Mat.: auf Holz Verkäufer: Prof Adam Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0430 Johann Franz Ermels I Zwey Landschaften, von Johann Franz Ermels und von Johann Murrer staffirt. Auf Leinwand. Sehr Schön. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft, von Johann Franz Ermels staffirt Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh 3 Zoll breit 4 Schuh 4 Zoll Anm.: Die Lose 430 und 431 wurden zusammen katalogisiert. Dieses Los wurde zusammen mit der Nr. 431 (Joh. Murrer) verkauft. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0449 Joh. Franz Ermels I Vier Landschaften, von Joh. Franz Ermels. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh breit 2 Schuh 8 Zoll Anm.: Die Lose 449 bis 452 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0450 Joh. Franz Ermels I Vier Landschaften, von Joh. Franz Ermels. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh breit 2 Schuh 8 Zoll Anm.: Die Lose 449 bis 452 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0451 Joh. Franz Ermels I Vier Landschaften, von Joh. Franz Ermels. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh breit 2 Schuh 8 Zoll Anm.: Die Lose 449 bis 452 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0452 Joh. Franz Ermels I Vier Landschaften, von Joh. Franz Ermels. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh breit 2 Schuh 8 Zoll Anm.: Die Lose 449 bis 452 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0189 Johann Franz Ermels I Zwey Landschaften mit römischen Ruinen, von Johann Franz Ermels. Sehr schön. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit römischen Ruinen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 8 Zoll breit 4 Schuh 4 Zoll Anm.: Die Lose A189 und A190 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0190 Johann Franz Ermels I Zwey Landschaften mit römischen Ruinen, von Johann Franz Ermels. Sehr schön. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit römischen Ruinen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh 8 Zoll breit 4 Schuh 4 Zoll Anm.: Die Lose Al 89 und A190 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
deH'Ermels figurate da G. Bemmel. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 171 und 172 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (6 Th für die Nrn. 171 und 172) 1752/00/00 NGWOL 0173 Ermels; G. Bemmel I Zwo dergleichen Landsch[a]ften. Due simili [Paesi]. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 173 und 174 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (3 Th für die Nrn. 173 und 174) 1752/00/00 NGWOL 0174 Ermels; G. Bemmel I Zwo dergleichen Landsch[a]ften. Due simili [Paesi]. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 173 und 174 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (3 Th für die Nrn. 173 und 174)
Ermels, Johann Franciscus (und Murrer, Joh.) 1799/00/00 WZAN 0350 Johann Franz Ermels; Johann Murrer I Eine Landschaft, worauf nackend badende Mädchen von Faunen belauscht werden, von Johann Franz Ermels. Die Figürchen sind von Johann Murrer. Auf Leinwand. Sehr schön. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 11 Zoll breit 2 Schuh 9 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0306 Johann Franz Ermels; Johann Murrer I Zwey Stücke mit römischen Ruinen, von Johann Franz Ermels, und von Johann Murrer staffirt. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Stück mit römischen Ruinen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh 6 Zoll breit 4 Schuh 11 Zoll Anm.: Die Lose A306 und A307 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN A0307 Johann Franz Ermels; Johann Murrer I Zwey Stücke mit römischen Ruinen, von Johann Franz Ermels, und von Johann Murrer staffirt. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Stück mit römischen Ruinen Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh 6 Zoll breit 4 Schuh 11 Zoll Anm.: Die Lose A306 und A307 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1800/01/00 LZAN [A]0042 Murer: Ermels I Diogenes schöpft in Gegenwart einiger andern Philosophen mit der holen Hand Wasser aus der Quelle. Ruinen von einem hohen Säulengebäude stehen zur Rechten, Bäume und Gebirge sind im Mittel- und Hintergrund. Die Landschaft ist von Ermels. I Maße: Höhe 17 Zoll, Breite 15 Zoll Verkäufer: A F Oeser Transakt.: Unbekannt
Ermels, Johann Franciscus (und Roos) 1793/00/00 NGWID 0100 Ermels; Roos I Eine bergigte Landschaft von Ermels; so von Roos mit Vieh und übrigen Beywesen staffiert ist. I Maße: 3 Schuh 6 Zoll hoch, 5 Schuh breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0170 Ermels; Roos I Eine schöne Landschaft von Ermels, die darauf befindliche Staffage von Roos. I Maße: 2 Schuh hoch, 2 Schuh 11 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
Ermels, Johann Franciscus (und Bemmel, Georg) 1752/00/00 NGWOL 0171 Ermels; G. Bommel I Ein paar Landschaften, von Ermels, von G. Bommel staffirt. Vna coppia di Paesi dell'Ermels figurate da G. Bemmel. I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 171 und 172 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (6 Th für die Nrn. 171 und 172) 1752/00/00 NGWOL 0172 Ermels; G. Bommel I Ein paar Landschaften, von Ermels, von G. Bommel staffirt. Vna coppia di Paesi 612
GEMÄLDE
Ermels, Johann Franciscus (und Roos, J.H.) 1778/09/28 FRAN 0234 Ermels; H. Roos I Eine ungemein schöne Landschaft mit Vieh, erstere von Ermels, das Vieh von H. Roos. [Un tres beau paysage avec du betail, le paysage par Ermels, le betail, par Η. Roos.] I Pendant zu Nr. 235 Maße: 2 Schuh 3 Zoll breit, 1 Schuh 9 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (233.30 fl für die Nrn. 234 und 235) Käufer: Synd Hoffmann
1778/09/28 FRAN 0235 Ermels; Η. Roos I Ein Compagnon zu obigem, von dito [Ermels und H. Roos], [Le pendant du precedent, par le meme [Ermels et H. Roos].] I Pendant zu Nr. 234, "Eine ungemein schöne Landschaft mit Vieh" Maße: 2 Schuh 2 Zoll breit, 1 Schuh 9 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (233.30 fl für die Nm. 234 und 235) Käufer: Synd Hoffmann 1779/09/27 FRNGL 0581 Ermels; Henr. Roos I Eine sehr meisterhafte Landschaft, von Ermels, von Henr. Roos staffirt. [Un trfes beau paysage, par Ermels, les figures par Henr. Roos.] I Pendant zu Nr. 582 Maße: 2 Schuh 2 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 11 Zoll breit Transakt.: Verkauft (13.45 fl für die Nrn. 581 und 582) Käufer: Becker Maler 1779/09/27 FRNGL 0582 Ermels; Henr. Roos I Das Gegenbild zu obigem, eben so schön, von beyden Meistern [Ermels und Henr. Roos] und Maas. [Le pendant du precedant, meme beaute, par les memes maitres.] I Pendant zu Nr. 581, "Eine sehr meisterhafte Landschaft" Maße: 2 Schuh 2 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 11 Zoll breit Transakt.: Verkauft (13.45 fl für die Nrn. 581 und 582) Käufer: Becker Maler 1781/02/17 FRAN 0038 Ermels; Heinrich Roos I Eine warm und reitzend ausgeführte Landschaft, von Ermels, die Figuren und Vieh von Heinrich Roos. I Pendant zu Nr. 39 Maße: 2 Schuh breit, 1 Schuh 6 Zoll hoch Transakt.: Unbekannt (60.30 fl für die Nrn. 38 und 39) 1781/02/17 FRAN 0039 Ermels; Heinrich Roos I Das Gegenbild hierzu, eine dergleichen [warm und reitzend ausgefürte] Landschaft mit Vieh von beyden Meistern [Ermels und Heinrich Roos], nemlichen Maas. I Pendant zu Nr. 38 Maße: 2 Schuh breit, 1 Schuh 6 Zoll hoch Transakt.: Unbekannt (60.30 fl für die Nrn. 38 und 39) 1797/09/13 FRAN 0006 Johann Franz Ermels; staffirt Heinrich Roos I Zwey Gebürg=Landschaften. I Diese Nr.: Eine Gebürg=Landschaft Maße: 3 Schuh 9 Zoll hoch 5 Schuh breit Anm.: Die Lose 6 und 7 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (114 fl für die Nrn. 6 und 7) 1797/09/13 FRAN 0007 Johann Franz Ermels; staffirt Heinrich Roos I Zwey Gebürg=Landschaften. I Diese Nr.: Eine Gebürg=Landschaft Maße: 3 Schuh 9 Zoll hoch 5 Schuh breit Anm.: Die Lose 6 und 7 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt (114 fl für die Nrn. 6 und 7)
Ermels, Johann Franciscus (Kopie nach) 1752/00/00 NGWOL 0103 Ermels I Zwey dergl. kleine [Landschaften] nach Ermels. Due piccoli simili [Paesettini] a guisa dell' Ermels. I Diese Nr.: Eine kleine Landschaft Anm..· Die Lose 103 und 104 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (4 Th für die Nrn. 103 und 104) 1752/00/00 NGWOL 0104 Ermels I Zwey dergl. kleine [Landschaften] nach Ermels. Due piccoli simili [Paesettini] a guisa dell' Ermels. I Diese Nr.: Eine kleine Landschaft Anm.: Die Lose 103 und 104 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Neubauer Transakt.: Unbekannt (4 Th für die Nm. 103 und 104)
Ernst, Karl Mathias 1787/00/00 HB AN 0146 Ernest I In einer Höhle wird der Ceres ein Opfer gehalten; einige Priesterinnen werfen Korn in das auf dem Altar brennende Feuer. Hinter dem Altar befinden sich noch mehrere Figuren; andere bringen Korn, ec. Im Vordergrunde sind noch verschiedene Sachen, als Früchte, Gefäße, Körbe, u. s. w. nebst einem kleinen Knaben. In der Ferne siehet man mehrere sich beym Korn beschäfftigende Personen. Sehr fleißig gemahlt. A.H. [Auf
Holz] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 % Zoll, breit 8 Zoll Transakt.: Verkauft (13.12 M) Käufer: Bertheau
Es, Jacob Fopsen van 1759/00/00 LZEBT 0056 J. van Es I Ein Stück mit See=Fischen. auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 3 Schuh 3 Zoll, Breite 3 Schuh Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (100 Th Schätzung) 1763/11/09 FRJUN 0070 Jaques van Es I Une Piece Capitale representant toutes sortes de poissons, naturellement & parfaitement peint. I Maße: hauteur 33 Vi pouces, largeur 84 pouces Transakt.: Verkauft (30.15 fl) Käufer: Broenner 1774/03/28 HBBMN 0037 van Es I Ein rares und mit großem Fleiß ausgeführtes Blumen=Stück, im verguldeten Rahm. I Maße: Höhe 1 Fuß 11 Zoll, Breite 1 Fuß 5 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/09/28 FRAN 0572 van Es I Ein sehr schönes Früchtenstück. [Une tres belle piece representante des fruits.] I Maße: 1 Schuh 4 Zoll breit, 1 Schuh 4 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (22 fl) Käufer: Baeumer 1779/09/27 FRNGL 0001 Jacob van Es I Eine Köchin mit welcher eine Mannsperson scherzet, mit wohlgroupirten und sehr natürlich ausgearbeiteten Eßwaaren umgeben. [Une cuisiniere et un homme qui badine avec eile, les figures sont entourees de vivres peints au naturel & bien grouppes.] I Maße: 2 Schuh 5 Zoll hoch, 3 Schuh 2 Zoll breit Transakt.: Verkauft (6.24 fl) Käufer: Kaufman Hatmaier [?] zu Maintz 1779/09/27 FRNGL 0485 Jacob von Es I Ein braun in braun, schön und meisterhaft gemaltes Marienbild, mit einem sehr natürlich ausgearbeiteten Blumen= und Früchtenkranz umgeben. [Une S. Vierge superieurement bien peinte en camayeu, entouree d'une couronne de fleurs & de fruits rendus au naturel.] I Maße: 2 Schuh hoch, 1 Schuh 7 Zoll breit Transakt.: Verkauft (30 fl) Käufer: Stöber Wien 1782/09/30 FRAN 0098 Jacob van Es I Ein grosser englischer Käß, Brod, Fisch= und andere Eßwaaren, nebst einem Krug und hohen Glas, nach der Natur gemahlt von Jacob van Es. [Un grand fromage d'Angleterre, du pain, du poisson, & autres vivres, avec une cruche & un verre haut, peint d'apres nature, par Jacques van Es.] I Maße: 1 Schuh 6 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 7 Vi Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (12.45 fl) Käufer: Hoink 1782/09/30 FRAN 0140 Jacob van Es I Stilliegende Speisen, Citronen, Brod und ein Glas rother Wein. [Des vivres, des citrons, du pain & un verre de vin rouge, par Jacques van Es.] I Maße: 1 Schuh Vi Zoll hoch, 1 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Johann Noe Gogel Transakt.: Verkauft (11.30 fl) Käufer: Müller 1789/04/16 HBTEX 0069 Jacob van Es, fee. I Auf einem Tische steht ein Teller mit Butter, und einen Heering ec. die Natur auf das getreuste nachgeahmt auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 21 Zoll, breit 27 Zoll Transakt.: Verkauft (2 M) Käufer: Eckhardt 1790/01/07 MUAN 0100 Ess I Ein Früchtenstück mit einem Krepse, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Schuh 8 Zoll, Breite 2 Schuh 5 Zoll Verkäufer: Freyherr von Obermaier Transakt.: Unbekannt 1792/04/19 HBBMN 0134 J. v. Es I Zwey Heeringe auf einem Teller, Brodt, Käse, Butter, Geschirre ec. auf einem Tische, ganz natürlich und schön gemahlt, von J. v. Es. Auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 26 Zoll, breit 42 Zoll Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0197 Jaques von Ess I Auf einem mit einem Tuch halb bedeckten marmornen Tisch, stehet ein Glas mit vielen herrlich gemahlten Blumen. Leicht und sanft gemahlt, und schön colorirt. I Maße: Hoch 17 Zoll, breit 13 Zoll Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
613
1799/00/00 WZ AN A0095 Jacob van Es I Zwey Früchtenstükke; auf einem Austern, auf dem andern ein Häring auf einem Teller. Von Jacob van Es. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Früchtenstück mit Austern Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh Vi Zoll breit 1 Schuh 6 Zoll Anm.: Die Lose A95 und A96 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1799/00/00 WZAN 0290 Johann Esperling I Der büßende Petrus, von Johann Esperling. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 3 Vi Zoll breit 2 Vi Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1799/00/00 WZAN A0096 Jacob van Es I Zwey Früchtenstükke; auf einem Austern, auf dem andern ein Häring auf einem Teller. Von Jacob van Es. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Früchtenstück mit einem Häring auf einem Teller Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 2 Schuh Vi Zoll breit 1 Schuh 6 Zoll Anm.: Die Lose A95 und A96 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1772/00/00 BSFRE 0040 Esperlin (Joseph) le Fils I Le Portrait de l'Admiral Moncton de Pied en Cap, devant sa tente. Cadre blanc. I Mat.: auf Leinwand Maße: haut de 17 Vi lsrge [sie] de 13 Vi pouces Transakt.: Unbekannt
Esedins, I.C. [Nicht identifiziert] 1764/08/25 FRAN 0451 I. C. Esedins I Un paisage. I Maße: haut 1 pied 6 pouces sur 1 pied 9 pouces de large Verkäufer: Baron de Haeckel Transakt.: Unbekannt
Esperlin, Joseph (II) [Nicht identifiziert]
Esselens, Jacob 1797/04/25 HBPAK 0099 Esselens I Ein Land und Wasser Prospect, am Ufer stehen einige Wagen, welche mit Fischen beladen werden; auch noch verschiedene andere Gegenstände, sehr fleißig gemahlt. Auf Holz, goldenen Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 11 Vi Zoll, breit 14 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt
Essen, Cornells van Esperlin, Joseph 1765/03/27 FRKAL 0056 Van Essen I Deux agreable pai'sages. I Maße: hauteur 9 Vi pouces, largeur 12 pouces Transakt.: Verkauft (8.30 fl) Käufer: Dr Basquay
1772/00/00 BSFRE 0034 Esperlin (Joseph) I La Resurrection du fils de la Veuve de Nain, avec beaucoup de figures, tres bien dessines & executes en 1756. Ce Tableau fait Pendant au No. 182. Cadre sculpte & d'ore. I Pendant zu Nr. 182 von Jan. Zick Mat.: auf Leinwand Maße: haut de 17 Vi & large de 13 Vi pouces Inschr.: 1756 (datiert?) Anm.: In einer Errata-Liste auf Seite 63 des Katalogs wurde die im Bildtitel angegebene Losnummer des Pendants korrigiert. Es handelt sich um Nr. 182, nicht um Nr. 181. Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt
1780/10/02 FRSTK 0011 C.V. Essen I Ein schön und besonders Meisterhaftes Pferdtstück von C.V. Essen. I Pendant zu Nr. 12 Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 6 Zoll breit Transakt.: Unbekannt (11.1/4 fl für die Nrn. 11 und 12)
1772/00/00 BSFRE 0035 Esperlin (Joseph) I Une Nativite de Notre Seigneur Jesus, avec l'Adoration des Bergers, les reflets de la Lumierre font un bei Effect dans ce Tableau, son Pendant represente l'Adoration des Mages. Ce sont des meilleurs morceaux de ce maitre ; peints en 1757. Cadres sculptes & d'ores. I Diese Nr.: Une Nativite de Nötre Seigneur Jesus, avec l'Adoration des Bergers; Pendant zu Nr. 36 Mat.: auf Leinwand Maße: haut de 22 & large de 15 % pouces Inschr.: 1757 (datiert?) Anm.: Die Lose 35 und 36 wurden zusammen katalogisiert. Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt
1793/09/18 HBSCN 0015 C. v. Essen I Bey einem Pferde:Jahrmarkt stehet im Vordergrund die Dorfschenke, Zelte und Boutiquen; man siehet Reuter, gesattelte und lose Pferde; in der Entfernung verschiedene Personen, davon einige im Handel begriffen sind. Sehr schön. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Zoll, breit 19 Zoll Transakt.: Unbekannt
1772/00/00 BSFRE 0036 Esperlin (Joseph) I Une Nativite de Nötre Seigneur Jesus, avec l'Adoration des Bergers, les reflets de la Lumierre font un bei Effect dans ce Tableau, son Pendant represente l'Adoration des Mages. Ce sont des meilleurs morceaux de ce maitre ; peints en 1757. Cadres sculptes & d'ores. I Diese Nr.: L'Adoration des Mages; Pendant zu Nr. 35 Mat.: auf Leinwand Maße: haut de 22 & large de 15 % pouces Inschr.: 1757 (datiert?) Anm..· Die Lose 35 und 36 wurden zusammen katalogisiert. Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt 1772/00/00 BSFRE 0037 Esperlin (Joseph) I Une Fuite en Egypte, joly Tableau, bien colorie. Cadre uny d'ore. I Mat.: auf Leinwand Maße: haut de 15 Vi & large de 14 Vi pouces Transakt.: Unbekannt 1772/00/00 BSFRE 0038 Esperlin (Joseph) I Le Portrait de Charles Eugene Due regnant de Würtemberg represente ä my corps. Cadre uny d'ore. I Mat.: auf Leinwand Maße: haut de 7 Vi & large de 6 pouces Transakt.: Unbekannt 1772/00/00 BSFRE 0039 Esperlin (Joseph) I Ce Tableau represente Moyse, defendant les sept filles de Jethro, (qui abreuvent leurs moutons, aupres d'un vieux Puit) de l'Insolence des Bergers peint en 1767. C'est une Sus de Porte. Bordüre sculptee & d'oree. I Mat.: auf Leinwand Format: Supraporte Maße: haut de 21 large de 45 pouces Inschr.: 1767 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt 614
GEMÄLDE
1780/10/02 FRSTK 0012 C. V. Essen I Der Compagnon zu obigen ein dergleichen gutes Pferdstück von nehmlichen Meister und Maas. I Pendant zu Nr. 11 Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 6 Zoll breit Transakt.: Unbekannt (11.1/4 fl für die Nrn. 11 und 12)
Euler 1744/05/20 FRAN 0106 Euler I 1 Alte Landschafft. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 11 Zoll, Breite 1 Schuh 3 Zoll Verkäufer: von Ucheln Transakt.: Unbekannt
Eustach, I.H. [Nicht identifiziert] 1784/08/02 FRNGL 0210 I.H. Eustach I Eine Bildhauer= und Mahlerwerkstädte mit schönen Beywesen, von I.H. Eustach verfertiget. I Diese Nr.: Eine Bildhauerwerkstädte mit schönen Beywesen Maße: 16 Zoll breit, 12 Zoll hoch Anm.: Die Lose 210 und 211 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Β Transakt.: Verkauft (2.30 fl für die Nrn. 210 und 211) Käufer: Bäumer 1784/08/02 FRNGL 0211 LH. Eustach \ Eine Bildhauer= und Mahlerwerkstädte mit schönen Beywesen, von I.H. Eustach verfertiget. I Diese Nr.: Eine Mahlerwerkstädte mit schönen Beywesen Maße: 16 Zoll breit, 12 Zoll hoch Anm.: Die Lose 210 und 211 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Β Transakt.: Verkauft (2.30 fl für die Nrn. 210 und 211) Käufer: Bäumer
Everdingen, Allart van 1743/00/00 BWGRA 0040 Aldert van Everdingen I Eine Mühle von Aldert van Everdingen, der Compagnon zum vorigen. I Pendant
zu Nr. 39 von Dughet Maße: hoch 2 Fuß 6 Zoll, breit 2 Fuß 1 Zoll Transakt.: Unbekannt 1750/04/00 HB AN 0083 Everdingen I Eine schöne Landschaft, von Everdingen. I Transakt.: Unbekannt 1763/11/09 FRJUN 0071 Everdingen I Une mer orageuse avec des vaisseaux tres bien peint. I Maße: hauteur 10 Vi pouces, largeur 13 pouces Transakt.: Verkauft (6.30 fl) Käufer: Pf Bechthold 1764/00/00 BLAN 0581 Everdingen I 1. mit großer Kunst verfertigter See=Hafen. I Maße: 2 Fuß hoch, 2 Fuß 6 Zoll breit Verkäufer: Gotzkowski Transakt.: Unbekannt (200 Rt Schätzung) Gegenw. Standort: Sankt-Peterburg, Rossiya. Ermitazh. (N 1027) 1764/03/12 FRKAL 0039 Everdingen I Une mer orageuse avec des vaisseaux tres bien peint. I Maße: hauteur 24 pouces, largeur 36 pouces Transakt.: Verkauft (12 fl) Käufer: Β ν Beroldingen 1766/07/28 KOSTE 0017 Everdingen I Ein Landschaft auf holz von Everdingen. ! Mat. : auf Holz Transakt.: Verkauft (12 Rt) Käufer: Schmitz 1768/08/16 KOAN 0029 Everdingen I Eine dito [Landschaft] von Everdingen. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Fuß 7 Zoll, Breite 2 Fuß 2 Zoll Verkäufer: Freyherr von Kaas Transakt.: Unbekannt 1774/03/28 HBBMN 0052 Everdingen I Eine Tyrolische Landschaft mit Felsen und Cascaden, unvergleichlich gemahlt, im schwarzen Rahm und goldenen Leisten. I Maße: Höhe 3 Fuß 9 Vi Zoll, Breite 4 Fuß 9 Zoll Transakt.: Unbekannt 1774/03/28 HBBMN 0053 Everdingen I Eine kleinere schöne Landschaft, im schwarzen Rahm und goldenen Leisten. I Maße: Höhe 1 Fuß 6 Vi Zoll, Breite 1 Fuß 11 Zoll Transakt.: Unbekannt 1774/10/05 HBNEU 0002 Everdingen I Eine Landschaft mit einem Wasserfall. I Transakt.: Unbekannt 1776/00/00 WZTRU 0185 Albert von Everdingen I Ein Stück 3 Schuhe, 10 Zoll hoch, 5 Schuhe breit, von Albert von Everdingen, stellet vor eine an die See liegende Stadt, wo viele Schiffe vor Anker liegen, im Vorgrunde zeiget sich vieles mit Pack beladenes Rindviehe, wobey sich viele Figuren in ausländischen Trachten wohl vorgestellter befinden. I Maße: 3 Schuhe 10 Zoll hoch, 5 Schuhe breit Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (6 fl Schätzung) 1776/07/19 HBBMN 0042 Everdingen I Eine sehr schöne Landschaft, mit einem Wasserfall. I Maße: Höhe 1 Fuß 10 Zoll, Breite 1 Fuß 11 Zoll Transakt.: Verkauft (9.12 M) Käufer: Tischb[ein] 1777/02/21 HBHRN 0074 Everdingen I Eine extra schöne und natürliche Landschaft. I Maße: Höhe 8 Vi Zoll, Breite 10 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/05/23 HB KOS 0049 A. Everding I Eine Landschaft mit einer Wassermühle, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 42 Zoll, Breite 39 Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/05/30 HB KOS 0134 Everdingen I Zwey Landschaften. [Diese Gemähide sind alle mittlere Grösse, können also an alle Plätze gebraucht werden - dieweilen keine Theilen=Stück, dabey befindlich] I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 134 und 135 wurden zusammen katalogisiert. Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 150 und beziehen sich auf die Nm. 1 bis 150. Verkäufer: DrFriederici Transakt.: Verkauft (3 Μ für die Nrn. 134 und 135) Käufer: Bertheau 1778/05/30 HB KOS 0135 Everdingen I Zwey Landschaften. [Diese Gemähide sind alle mittlere Grösse, können also an alle Plätze gebraucht werden - dieweilen keine Theilen=Stück, dabey befindlich] I Diese Nr.: Eine Landschaft Anm.: Die Lose 134 und 135 wurden zusammen katalogisiert. Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen unter der Nr. 150 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 150. Verkäufer: Dr Friederici Transakt.: Verkauft (3 Μ für die Nrn. 134 und 135) Käufer: Bertheau
1778/09/28 FRAN 0242 Everdingen I Eine Landschaft. [Un paysage par Everdingen.] I Maße: 1 Schuh 8 Zoll breit, 1 Schuh 2 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (7 fl) Käufer: Prß ν Dessau 1778/09/28 FRAN 0339 Albert van Ewerdingen I Eine felsigte Landschaft mit Wasser. [Un paysage couvert de rochers & de bords de riviere.] I Maße: 14 Zoll breit, 10 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (50.30 fl) Käufer: ν Frankenstein 1778/09/28 FRAN 0704 Albert van Everdingen I Der Jonas mit dem Wallfisch. [Jonas avec la baieine.] I Maße: 15 Zoll breit, 11 Zoll hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (20 fl) Käufer: Jos Brentano 1779/00/00 HB AN 0038 Everdingen I Ein Landschaftsstück. In einer bergichten Gegend erhebt sich auf Felsen ein alter Thurm, neben welchem durch ein verfallenes Portal einige Reisende wandern. Auf Holz. [Paysage. Dans une contree montagneuse s'eleve sur des rochers une vieille tour, ä cöte de laquelle des voyageurs passent par un portail ruine. Sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 8 Vi Zoll hoch, 11 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0154 Everdingen I Gewitterwolken verfinstern die feisichten Berge, die zu beiden Seiten ein stilles Wasser einschließen. Einige nordische Hütten stehen auf den mit Fichten bewachsenen Felsen. [D'epais nuages obscurcissent des montagnes escarpees, qui enferment des deux cötes une eau tranquille. Quelques baraques de Norvege sont situees sur des rochers, couverts de pins.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß hoch, 2 Fuß 6 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0155 Everdingen I Zur Rechten erheben sich steile Felsen, auf deren Gipfel einige Häuser stehen, und eine Heerde Schafe weidet. Am Fuße des Felsen rieselt der Bach von einer kleinen Mühle zum Vorgrunde. Drey Reiter kommen von der Linken auf einem Wege, der einen Fichtenhain vorbey führet. Gebirge schließen die Aussicht. [A droite s'elevent des rochers escarpes sur le sommet desquels on apergoit quelques maisons & on voit paitre un troupeau de moutons. Sur le devant, au pied du rocher, coule un ruisseau qui vient d'un petit moulin. Trois cavaliers arrivent de la gauche sur un chemin qui mene le long d'un bois de pins. De hautes montagnes bouchent le paysage.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß hoch, 2 Fuß 6 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0175 Everdingen I Ein Wasserfall stürzt bey einer kleinen zurückstehenden Mühle auf seinem Felsenbette herab. Hinter der Mühle läuft ein Weg von grünen Bäumen beschattet hinaus, über welchem die an nahen Feldern liegende Dorfkirche herüberragt. Die entfernten Berge thürmen sich bis in die Wolken. [Un torrent se precipite sur un lit de rochers, pres d'un petit moulin. Derriere ce moulin passe un chemin ombrage d'arbres garnis d'un vert feuillage. Par-dessus le chemin s'eleve l'eglise du village, situee pres des champs. Les montagnes du lointain se perdent dans les nues.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 3 Fuß 7 Zoll hoch, 3 Fuß 2 Vi Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0233 Everdingen I Ein Wasserfall stürzt von einem ungeheuern Felsengebirge, das mit Fichten bedeckt ist, herab. Im Vorgrunde stehen einige Hütten. [Un torrent se precipite du haut d'un enorme rocher, couvert de pins. Sur le devant quelques cabanes.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 4 Zoll hoch, 3 Fuß 1 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0312 Everdingen I Zur Linken rollet ein Bach vom fernen Gebirge über sein steinichtes Bette. Ein Sonnenstral erwärmt das feisichte mit fettem Gesträuche bekleidete Ufer, und eine Hütte mit Bäumen umgeben steht im Vorgrunde. [A gauche un ruisseau, descendant d'une montagne eloignee, coule sur son lit pierreux. Un echappe de lumiere eclaire le rivage garni de rochers & de broussailles. Sur le devant une cabane entouree d'arbres.] I Mat.: GEMÄLDE
615
auf Leinwand Maße: 1 Fuß 7 Zoll hoch, 1 Fuß 11 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt
Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Fuss 9 Zoll - breit 5 Fuss 8 Zoll Verkäufer: Moureaux Transakt.: Unbekannt
1779/09/27 FRNGL 0807 Aldert van Everdingen I Eine fürtreflich ausgearbeitete felsigte Landschaft. [Un excellent paysage couvert de rochers.] I Maße: 1 Schuh 7 Zoll hoch, 2 Schuh 1 Zoll breit Transakt.: Verkauft (153 fl) Käufer: Mevius modo Ettling
1793/00/00 NGWID 0492 Everdingen I Eine mit vielem Fleiß ausgeführte angenehme Landschaft, mit vielen Figuren, nebst Gebäuden, schöner Entfernung und ruhendem Vieh, von Everdingen. I Pendant zu Nr. 493 Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
1781/00/00 WRAN 0061 Everdingen I Entree d'un Pare, ού se voit sur le devant un peu ä gauche un Homme, & derriere lui deux Figures presque imperceptibles, meme ligne sur la droite un petit Chien ä longues oreilles, & au milieu dans le lointain un homme sur un cheval blanc. Ce süperbe Tableau qui fait l'admiration des Coinnoisseurs, est peint sur toile. I Mat.: auf Leinwand Maße: 24 pouces de haut, sur 20 pouces 6 lignes de large Verkäufer: Comte Vincent Potocki Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0185 Albert von Everdingen I Ein Stück 3 Schuhe, 10 Zoll hoch, 5 Schuhe breit, von Albert von Everdingen, stellet eine an der See liegende Stadt vor, wo viele Schiffe vor Anker liegen; im Vorgrunde zeiget sich vieles mit Pack beladenes Rindviehe, wobey sich viele in ausländischen Trachten wohl vorgestellte Figuren befinden. I Maße: 3 Schuhe 10 Zoll hoch, 5 Schuhe breit Transakt.: Unbekannt 1783/06/19 HBRMS 0076 Everdingen I Eine bergigte Landschaft mit Gehölz und Wasserfällen, im Vordergrunde weidende Schaafe. L[einwand], g.R. [verguldeter Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: 2 Fuß 7 Zoll hoch, 3 Fuß 4 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 1784/08/02 FRNGL 0256 N. Everdingen I Eine Landschaft mit Vieh, N. Everdingen bezeichnet. I Maße: 25 Zoll breit, 20 Zoll hoch Inschr.: N. Everdingen (bezeichnet) Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "N. Everdingen", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Verkäufer: Β Transakt.: Verkauft (3.45 fl) Käufer: Leonhard! 1785/04/22 HBTEX 0036 Everdingen I Ein Wasserfall stürzt sich von vielen Klippen und Felsen herunter, an welchen Gänse klättern. Hoch in der Feme wird man Wald und alte Baurenhäuser gewahr, welche mit Hirten und Vieh umgeben sind. Dieses Stück ist schön und mit vieler Wahrheit gemahlt. Auf Leinewand. Schwarzer Rahm und goldne Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 21 Zoll, breit 15 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1785/05/17 MZAN 0107 Aldert van Everdingen I Eine Landschaft von Aldert van Everdingen. [Un paysage.] I Maße: 1 Schuh 10 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (13 fl) Käufer: Tit D Com ä Leyen 1786/11/11 HBRMS O l l i w Ewerrdin \ Eine kleine Landschaft mit einem Wasserfall und Figuren. I Anm.: Der Name des Kunstlers ist angegeben als "w Ewerrdin", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt.: Unbekannt 1790/08/13 HBBMN 0073 E. Everdingen I Zwischen zwey steile Felsengebürge siehet man ein Wasserfall, worüber ein Steg, darauf ein Reisender gehet; in der Entfernung wird man auf Felsen noch einige Schlösser und tannen Bäume gewahr. Die ganze Gegend ist mit einem Sonnenlichte beleuchtet, und sehr schön nach der Natur gemahlt. Auf Leinwand, in schwarz gebeitzten Rahm mit vergoldeten Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 17 Zoll, breit 15 Vi Zoll Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "E. Everdingen", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einem Fehler. Transakt.: Verkauft (3 M) Käufer: Schmidt 1791/10/21 HBRMS 1 0089 Albert von Everdingen I Eine Alpengegend mit vielen großen Felsen, Bergen, Bäumen und Wasserfällen, Vieh und Figuren. Ein vortrefliches und ausgeführtes Gemählde; auf Leinew. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 44 Zoll, breit 60 Zoll Transakt.: Unbekannt 1792/10/12 KOAN 0005 A. van Everdingen I Eine grosse, schön staffirte Landschaft von A. van Everdingen. Auf Leinwand. I 616
GEMÄLDE
1793/00/00 NGWID 0493 Everdingen I Zum Gegenstück, eine eben so angenehme Landschaft, mit einigen Figuren, und grasendem Hornvieh, nebst felsigten Wasserfall, von nemlichem Meister [Everdingen] und Maaß. I Pendant zu Nr. 492 Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch, 1 Schuh 4 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1795/11/14 HBPAK 0095 Everding I Eine bergigte Landschaft, worin ein Wasserfall; im Vorgrunde ein architecturischer Brunnen, wobey ein Schäfer seine Heerde weidet. Auf Leinwand. Schwarz. Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 16 Zoll, breit 20 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/08/10 MMAN 0336 Alb. van Everdingen I Ein Seestück, von Alb. van Everdingen, auf Tuch. I Mat.: auf Leinwand Verkäufer: Herzog Carl von Zweibrücken Transakt.: Unbekannt (18 fl Schätzung) 1800/00/00 BLBOE 0080 Everdingen I Ein Fort. Unten Felsenklippen u. Strudel. I Mat.: auf Holz Transakt.: Unbekannt 1800/00/00+ LZRST [0027] Aldert van Everdingen I Eine heitere felsige Landschaft mit einem Wasserfalle u. Figuren. I Mat.: auf Holz Maße: 12 Vi Zoll breit 16 Zoll hoch Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Rost Transakt.: Unbekannt 1800/00/00+ LZRST [0028] Aid. van Everdingen I Eine rauhe norwegische Landschaft mit einem Wasserfalle und Figuren. I Mat.: auf Leinwand Maße: 29 Zoll breit 32 Zoll hoch Anm.: Da die Lose in diesem Katalog nicht numeriert sind, haben wir die Nummern hinzugefügt. Verkäufer: Rost Transakt.: Unbekannt 1800/08/20 HBPAK 0050 Aid. von Everdingen I Im wüthenden Orkane scheitert an einer hohen Klippe zur Rechten ein Schiff mit aufgespannten Segeln, die in die Masten gekletterte und im Wasser treibende Mannschaft scheint ohne Rettung verlohren zu seyn. Kräftig und wahr gemahlt. Auf Leinwand, schw. Rahm. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 40 Zoll, breit 56 Zoll Transakt.: Unbekannt
Everdingen, Allart van (und Wouwerman) 1750/04/00 HB AN 0037 Everdingen; Wauwermann I Eine schöne Landschaft mit einer Jagd, wo der Hirsch durchs Wasser setzet, von Everdingen, die Figuren von Wauwermann. I Transakt.: Unbekannt
Everdingen, Allart van (und Wouwerman, Ph.) 1750/00/00 KOAN 0051 Everdingen; Philippe Wouwermann I Un Bois, bien invente, sur toile partie, par Everdingen, & partie par Philippe Wouwermann. I Mat.: auf Leinwand Maße: Largeur 2 Pies 7 Vi Pouces, Haut 2 Pies 3 Pouces Verkäufer: Comte Ferdinand de Hohenzollern Transakt.: Unbekannt
Everdingen, Allart van (Manier) 1790/02/04 HBDKR 0130 So schön wie Everdingen I Eine gebürgigte Holzung, mit einem Wasserfall, welcher sich in einem Fluß ergiest, der mitten hindurch strömet, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 Vi Zoll, breit 6 Zoll Transakt.: Verkauft (12 Sch) Käufer: Ego
Eyck, Hubert van 1799/10/18 LZAN 0091 Hubert van Eyk I Der englische Grass: Maria sitzt vor einem Tisch auf welchem ein offenes Buch liegt: über ihr ist der heil. Geist; vor ihr steht der Engel mit einem Zepter in der Hand. Diess Bild ist sehr gut konservirt; hoch 18 Zoll, breit 13 Zoll. Auf Holz; in einem reich verzierten Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 18 Zoll, breit 13 Zoll Verkäufer: Rauch Transakt.: Verkauft (8.12 Th) Käufer: Hendel
Eyck, Jan van 1750/10/15 HB AN 0023 Eick (Joh. von) I Das Portrait einer Herzogin von Braband, sehr alt. I Maße: 2 Fuß 5 Vi Zoll hoch, 3 Fuß 4 Zoll breit Transakt.: Unbekannt (21.8) 1752/05/08 LZAN 0170 Jan van Eycken I Die Maria mit der heil. Barbara und Catharina auf Holtz gemahlt, im Holl. Rahmen, von Jan van Eycken. I Maße: 2 Ellen hoch, 1 Vi Elle breit Transakt.: Unbekannt (17.2 Th) 1776/06/28 HBBMN 0006 J. van Eyck I Ein Ecce-Homo, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 1 Fuß 9 Zoll, Breite 1 Fuß 3 Vi Zoll Transakt. : Unbekannt 1778/10/30 HBKOS 0059 J. Eyk I Das Portrait von D. Martin Luther, auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: hoch 9 Zoll, breit 7 Zoll Transakt.: Unbekannt 1778/10/30 HBKOS 0076 J. van Eyck I Maria mit dem Christkindlein, fleißig gemahlt auf Goldgrund, von J. van Eyck, auf Holz, oben faconnirt. I Mat.: Goldgrund auf Holz Maße: hoch 9 Zoll, breit 7 Zoll Transakt.: Unbekannt (9 M) 1779/00/00 HB AN 0238 Johann van Eyk I Das Portrait eines jungen Prinzen. Auf Holz. [Portrait d'un jeune prince. Sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 1 Zoll hoch, 10 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1785/05/17 MZAN 0432 van der Eyck I Ein Mädchen mit einem Papaquay auf der Hand, und ein Jung mit einer Schale voll Futter von van der Eyck. [Une fille ayant un perroquet sur la main, & un gar^on tenant une coupe pleine de mangeaille.] I Maße: 1 Schuh I Vi Zoll hoch, 10 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (21 fl) Käufer: Becker Glöckner 1792/07/05 LBKIP 0066 J. v. Eyck I Ein geharnischter Soldat mit einem Römer mit Wein in der Hand, ein sehr schönes Gemählde. I Transakt.: Unbekannt 1792/09/28 HBBMN 0071 J. v. Eyck I Ein verliebter Alter, mit einem jungen Mädchen, welche er ein Geldstück anbiethet; vortreflich gemahlt, von J. v. Eyck. Auf Hz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch II Zoll, breit 9 Zoll Transakt.: Unbekannt 1797/06/13 HBPAK 0182 Jean van Ick I Das Bildniß der Demoiselle Schurmann, wie sie im Buche lieset. Ganz excellent und ausnehmend fleißig gemahlt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 7 % Zoll, breit 5 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 LZRCH 0043 Jean Van Eick \ La presentation au temple, composition de 9 figures dans le goüt antique; ce tableau d'une grande finesse, et d'un effet trfes piquant, est aussi de la meilleure conservation. I Mat.: auf Holz Maße: h. 12.1. 18. pouces Verkäufer: J F Rauch Transakt.: Unbekannt
1778/03/28 HBSCM 0076 Eykens I Bachanten in der Gegend eines Garten, von Eykens, so schön wie Laresse. I Transakt.: Unbekannt 1787/00/00 HB AN 0066 C Eyckens I Waldung mit lustigen Hirten. Mitten auf dem Gemähide im Vordergrunde tanzt eine Hirtinn mit einer Hand=Paucke, andere sitzen im Vordergrunde, umgeben mit Früchten und Geschirr. Noch andere befinden sich im Hintergrunde bey einem Grabmaal. Im Hintergrunde eine angenehme waldigte Landschaft. Ganz im Geschmack des Caspar Düghets gemahlt. Auf L[einewand]. g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 17 Zoll, breit 22 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (10.8 M) Käufer: Matthes 1796/09/08 HBPAK 0029 Eykens I Zwey fleißige Landschaften im Heroischen Styl, mit Staffirungen aus der Mythologie. I Diese Nr.: Eine fleißige Landschaft im Heroischen Styl Maße: Hoch 29 Zoll, breit 35 Zoll Anm.: Die Lose 29 und 30 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0030 Eykens I Zwey fleißige Landschaften im Heroischen Styl, mit Staffirungen aus der Mythologie. I Diese Nr.: Eine fleißige Landschaft im Heroischen Styl Maße: Hoch 29 Zoll, breit 35 Zoll Anm.: Die Lose 29 und 30 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0031 Eykens I Zwey Landschaften, wie vorhergehende [im Heroischen Styl, mit Staffirungen aus der Mythologie]. I Diese Nr.: Eine Landschaft im Heroischen Styl Maße: Hoch 29 Zoll, breit 35 Zoll Anm.: Die Lose 31 und 32 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0032 Eykens I Zwey Landschaften, wie vorhergehende [im Heroischen Styl, mit Staffirungen aus der Mythologie]. I Diese Nr.: Eine Landschaft im Heroischen Styl Maße: Hoch 29 Zoll, breit 35 Zoll Anm. : Die Lose 31 und 32 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0033 Eykens I Zwey noch schönere dito [Landschaften im Heroischen Styl, mit Staffirungen aus der Mythologie]; reich staffirt. I Diese Nr.: Eine Landschaft im Heroischen Styl Maße: Hoch 29 Zoll, breit 35 Zoll Anm.: Die Lose 33 und 34 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0034 Eykens I Zwey noch schönere dito [Landschaften im Heroischen Styl, mit Staffirungen aus der Mythologie]; reich staffirt. I Diese Nr.: Eine Landschaft im Heroischen Styl Maße: Hoch 29 Zoll, breit 35 Zoll Anm.: Die Lose 33 und 34 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1796/09/08 HBPAK 0186 Marq. C. Eyckens I In einer angenehmen Landschaft belustigen sich die Nymphen mit Tanzen; eine von ihnen spielet die Tambourine; einige sind gelagert, und sehen zu; einige brechen im Gebüsche Zweige ab; und andere belauschen dieselben. Fleißig und ausführlich gemahlt. I Maße: Hoch 17 Zoll, breit 22 Zoll Inschr.: C. Eyckens (signiert) Transakt.: Unbekannt
Eyck, Kasper van 1742/08/01 BOAN 0246 Eck I Zwey Seefahrten mit vielen Figuren. Orig. von Eck. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0240 Von Eck I Des Vaisseaux en mer, avec figures, par Von Eck. Couple. I Maße: Haut 10. pou. large 9. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt
Eyck, Jan Carel van
1765/03/27 FRKAL 0057 C. van Eyk I Deux beaux tableaux representant deux combats sur mer. I Maße: hauteur 23 pouces, largeur 34 pouces Transakt.: Verkauft (37 fl) Käufer: Diesl
1776/06/28 HBBMN 0016 J. v. Eyckens I Eine plaisante Landschaft mit der Diana, welche sich zum Baden auskleidet, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Fuß 2 Zoll, Breite 1 Fuß Transakt.: Unbekannt
1792/08/20 KOAN 0163 Eick I Zwey Seestück, das eine ein Seeschiffahrt mit vielen Seeschiffen, das andere auch viele Seeschiffen und ein Seebrand vorstellend, auf Baneel von Eick 1640. I Diese Nr.: Ein Seestück, das eine ein Seeschiffahrt mit vielen Seeschiffen GEMÄLDE
617
vorstellend Mat.: auf Holz Maße: 1 Schuh 6 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 2 Vi Zoll breit Inschr.: 1640 (datiert?) Anm.: Die Lose 163 und 164 wurden zusammen katalogisiert. Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1792/08/20 KOAN 0164 Eick I Zwey Seestück, das eine ein Seeschiffahrt mit vielen Seeschiffen, das andere auch viele Seeschiffen und ein Seebrand vorstellend, auf Baneel von Eick 1640. I Diese Nr.: Ein Seestück, auch viele Seeschiffen und ein Seebrand vorstellend Mat.: auf Holz Maße: 1 Schuh 6 Vi Zoll hoch, 2 Schuh 2 Vi Zoll breit Inschr.: 1640 (datiert?) Anm.: Die Lose 163 und 164 wurden zusammen katalogisiert. Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Kaspar Philipp Kox Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0339 Casper Eyck I Ein morgenländischer Markt, mit einigen Figuren, von Casper Eyck. I Pendant zu Nr. 340 Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0340 Casper Eyck I Ein Gegenstück, in nemlicher Manier, und von gleichem Inhalt, von nemlichem Meister [Casper Eyck] und Maaß. I Pendant zu Nr. 339 Maße: 1 Schuh 8 Zoll hoch, 1 Schuh 11 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt
Eycken, Carel [Nicht identifiziert] 1799/00/00 WZAN 0593 Carl von Eychn I Zwey Gesellschaftsstücke mit Kindern, von Carl von Eychn. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Gesellschaftstück mit Kindern Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 1 Zoll breit 1 Schuh 6 Zoll Anm.: Die Lose 593 und 594 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0594 Carl von Eychn I Zwey Gesellschaftsstücke mit Kindern, von Carl von Eychn. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Gesellschaftstück mit Kindern Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 1 Zoll breit 1 Schuh 6 Zoll Anm.: Die Lose 593 und 594 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0599 Carl von Eychn I Vier Gesellschaftsstücke, von Carl von Eychn. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Gesellschaftsstück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 2 Zoll breit 1 Schuh 6 Zoll Anm.: Die Lose 599 bis 602 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Charles Eichen.] I Pendant zu Nr. 511 Maße: 1 Vi Zoll hoch, 10 Zoll breit Transakt.: Verkauft (13 fl für die Nrn. 510 und 511) Käufer: Becker Maler 1779/09/27 FRNGL 0511 Schinnagel; Carl Eichen I Der Compagnon zu obigem, ebenfalls eine dergleichen Landschaft [mit Ruinen], von beyden Meist. [Schinnagel und Carl Eichen] und Maas. [Le pendant du precedant, meme objet [un tres beau pay sage avec des ruines], par les deux memes maitres.] I Pendant zu Nr. 510 Maße: 7 Vi Zoll hoch, 10 Zoll breit Transakt.: Verkauft (13 fl für die Nrn. 510 und 511) Käufer: Becker Maler
Eyse [Nicht identifiziert] 1791/01/10 HNAN 0022 Eyse I Ein Quodlibet v. Eyse. Rhm.: Swzr. Leist.: gl. I Maße: Höhe 4 F., Brte. 3 F. 5 ZI. Verkäufer: Meier Transakt.: Unbekannt
1791/07/29 HBBMN 0128 E.F*** I Ein sitzender Gelehrter schreibt in sein Buch, welches er auf dem Tische vor sich liegen hat; auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 10 Vi Zoll, breit 8 Zoll Transakt.: Verkauft (1.8 M) Käufer: Ε
F***, J. 1784/08/13 HBDEN 0096 J.F*** I Ein Stilleben mit Federwild und Früchten. Besonders stark gemahlt auf Holz von J.F***. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 19 Zoll. Breit 30 Zoll. Verkäufer: Pasche [oder] Flügge Transakt.: Verkauft (1 M) Käufer: Ε
F***, J. von 1796/10/17 HBPAK 0272 J. von F***, 1742 I Ein allegorisches Conversations=Stück von grosser Composition, welches ganz excellent gemahlt. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 26 Zoll 6 Lin., breit 32 Zoll 1 Lin. Inschr.: 1742 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt
F***, S.
1799/00/00 WZAN 0600 Carl von Eychn I Vier Gesellschaftsstücke, von Carl von Eychn. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Gesellschaftsstück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 2 Zoll breit 1 Schuh 6 Zoll Anm.: Die Lose 599 bis 602 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1789/04/16 HBTEX 0036 S.F***. I Ein Mohrenjunge hält ein vortrefliches weißes Pferd mit Tigerflecken, an den Zaum; nach der Natur gemahlt auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 18 Zoll, breit 24 Zoll Transakt.: Verkauft (1 M) Käufer: Schröder
1799/00/00 WZAN 0601 Carl von Eychn I Vier Gesellschaftsstücke, von Carl von Eychn. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Gesellschaftsstück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 2 Zoll breit 1 Schuh 6 Zoll Anm.: Die Lose 599 bis 602 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Faber, Jean
1799/00/00 WZAN 0602 Carl von Eychn I Vier Gesellschaftsstücke, von Carl von Eychn. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Gesellschaftsstück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 2 Zoll breit 1 Schuh 6 Zoll Anm.: Die Lose 599 bis 602 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
Eycken, Carel [Nicht identifiziert] (und Schinnagl, M.J.) 1779/09/27 FRNGL 0510 Schinnagel; Carl Eichen] Eine ileißig und angenehm ausgeführte Landschaft mit Ruinen, von Schinnagel, mit schönen Figuren von Carl Eichen staffirt. [Un tres beau paysage avec des ruines, par Schinnagel, les figures bien peintes par 618
GEMÄLDE
1750/06/15 HBRAD 0026 J. v. de Faber I J. v. de Faber, zwey sehr artige Landschaften. I Diese Nr.: Eine sehr artige Landschaft Anm.: Die Lose 26 und 27 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1750/06/15 HBRAD 0027 J. v. de Faber I J. v. de Faber, zwey sehr artige Landschaften. I Diese Nr.: Eine sehr artige Landschaft Anm.: Die Lose 26 und 27 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Fabienius, B. [Nicht identifiziert] 1781/05/07 FRHUS 0250 B. Fabienius I Ein geistreich meisterhaftes Mannsportrait, mit einem Huth, bezeichnet B. Fabienius 1650. I Maße: 2 Schuh 4 Zoll hoch und 2 Schuh 8 Zoll breit Inschr.: B. Fabienius 1650 (bezeichnet und datiert) Verkäufer: Jacob Bemus Transakt.: Verkauft (5.44 fl) Käufer: Heusser
Fabricius, J.C.
Faistenberger (Manier)
1788/06/12 HBRMS 0163 J. C. Fabricius. 16851 In andächtiger Stellung siehet ein alter Greis ein junges Mädchen Unterricht im Lesen geben, von ein sitzendes Frauenzimmer. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Zoll, breit 10 Zoll Inschr.: 1685 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Transakt.: Unbekannt
1798/12/10 WNAN 0059 Faistenberg I Zwei Landschaften in Faistenbergs Manier. I Verkäufer: Prof Adam Transakt.: Unbekannt
Fabritius, Barent 1781/05/07 FRHUS 0201 Fabricius I Das Bildniß eines Quakkers meisterhaft A. 1650 gemahlt von Fabricius. I Maße: 2 Schuh 6 Zoll hoch und 2 Schuh breit Inschr.: A. 1650 (datiert?) Anm.: Es ist unsicher, ob das Gemälde datiert ist. Verkäufer: Jacob Bemus Transakt.: Verkauft (30 fl) Käufer: Heusser Gegenw. Standort: Frankfurt, Deutschland. Städelsches Institut. (736) als Selbstportrait 1785/05/17 MZAN 0583 Bernard Fabritius I Die Geburt Christi bezeichnet Bernard Fabritius 1670. [L'adoration des pasteurs marquee Bernard Fabritius 1670.] I Maße: 3 Schuh 6 Zoll hoch, 4 Schuh 3 Zoll breit Inschr.: Bernard Fabritius 1670 (bezeichnet und datiert) Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (9 fl) Käufer: Dechant Pestel
Fabritius, Chilian 1785/05/17 MZAN 0591 Kilian Fabritius I Zwey Landschaften von Kilian Fabritius. [Deux paysages.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 2 Schuh 5 Zoll hoch, 3 Schuh 1 Zoll breit Anm.: Die Lose 591 und 592 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (41 fl für die Nm. 591 und 592) Käufer: Ohans noe Hofr Handel 1785/05/17 MZAN 0592 Kilian Fabritius I Zwey Landschaften von Kilian Fabritius. [Deux paysages.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 2 Schuh 5 Zoll hoch, 3 Schuh 1 Zoll breit Anm..· Die Lose 591 und 592 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (41 fl für die Nrn. 591 und 592) Käufer: Ohans noe Hofr Handel
Faistenberger, Anton 1799/00/00 WZAN 0645 Anton Feistenberger I Eine Landschaft mit Ruinen, von Anton Feistenberger. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 3 Schuh 2 Zoll breit 4 Schuh 5 Zoll Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1800/01/00 LZAN [A]0021 Ant. Faistenberger I Eine gute Landschaft, kräftig und meisterhaft gemalt. Grosse Felsenmassen ragen zur Linken empor, ein kleines Gewässer drängt hindurch, bei welchem sich eine männliche Figur entkleidet, einige Bäume und abgebrochene Stämme sind im Vorgrunde, flache Gebirge decken den Horizont. I Maße: Höhe 1 Fuß 4 Zoll, Breite 1 Fuß 8 Zoll Verkäufer: A F Oeser Transakt.: Unbekannt
Faistenberger, Joseph 1789/00/00 MMAN 0068 Joseph Feistenberger I Eine Landschaft mit Figuren, auf Leinw. re[Un paysage avec figure, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 3 Fuß 3 Zoll hoch, 4 Fuß 6 Zoll breit [3 pieds 9 pouces de haut, 4 pieds 6 pouces de large] Anm.: Die Dimensionen unterscheiden sich in der deutschen und französischen Fassung des Katalogs. Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt (55 fl) 1789/00/00 MMAN 0224 Joseph Feistenberger I Eine Landschaft, auf Leinw. [Un paysage, sur toile.] I Mat.: auf Leinwand Maße: 3 Fuß 4 Zoll hoch, 3 Fuß 2 Zoll breit Verkäufer: F von Castell Transakt.: Unbekannt
Falbe, Joachim Martin 1775/00/00 BLAN 0009 Falbe I Das Portrait des Minister von Saldern in gold. Rahm. I Verkäufer: George Friedrich Schmidt Transakt.: Unbekannt
Falbe, Joachim Martin (Kopie nach) Faistenberger 1776/06/21 HB NEU 0044 Fastenberg I Der Einzug des Carnevals zu Venedig, so schön wie Tintoret, auf dito [Leinw.]. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 3 F 1 Z, Breite 6 F 8 Ζ Transakt.: Verkauft (30 M) Käufer: W Sen[ior] 1784/08/02 FRNGL 0244 Feistenberger I Eine meisterhafte Landschaft im Poussins Geschmack. I Maße: 13 Zoll breit, 9 Zoll hoch Verkäufer: D Transakt.: Verkauft (11.30 fl) Käufer: Reinhardt
1775/00/00 BLAN 0034 Falbe I David Splittgerber ohne Rahm nach Falbe. I Verkäufer: George Friedrich Schmidt Transakt.: Unbekannt
Falch, Johann 1759/00/00 LZEBT 0093 Falch I Ein distel und Insecten Stück auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh Vi Zoll, Breite 1 Schuh 5 Vi Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (100 Th für die Nrn. 93 und 94, Schätzung)
1786/05/02 NGAN 0005a Faistenberger I Zwey Frucht=Stükke. I Diese Nr.: Ein Frucht=Stück Maße: 1 Schuh 2 Zoll hoch, 1 Schuh 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 5a und 5b wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (14 fl für die Nrn. 5a und 5b) Käufer: Res Grüner
1759/00/00 LZEBT 0094 Falch I Ein dergleichen [distel und Insecten Stück] auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 1 Schuh Vi Zoll, Breite 1 Schuh 5 Vi Zoll Verkäufer: Böttcher Transakt.: Unbekannt (100 Th für die Nrn. 93 und 94, Schätzung)
1786/05/02 NGAN 0005b Faistenberger I Zwey Frucht=Stükke. I Diese Nr.: Ein Frucht=Stück Maße: 1 Schuh 2 Zoll hoch, 1 Schuh 6 Zoll breit Anm.: Die Lose 5a und 5b wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (14 fl für die Nrn. 5a und 5b) Käufer: Res Grüner
1799/00/00 WZAN 0699 Johann Falch I Zwey Distel= und Insectenstücke, von Johann Falch. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Dis t e l und Insectenstück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 7 Zoll breit 1 Schuh 3 Zoll Anm.: Die Lose 699 und 700 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt
1788/01/15 LZRST 3955 Feistenberger 1 2 gute Landschaften, in Oel, auf Holz gemahlt, von Feistenberger, 17 Z. hoch, 21 Z. breit, in schwarz gebeitzten Rahm, mit verg. Leiste. I Mat.: Öl auf Holz Maße: 17 Zoll hoch, 21 Zoll breit Verkäufer: von Hagen Transakt.: Verkauft (6.1 Th) Käufer: C R
1799/00/00 WZAN 0700 Johann Falch I Zwey Distel= und Insectenstücke, von Johann Falch. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Dis t e l und Insectenstück Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh 7 Zoll breit 1 Schuh 3 Zoll Anm.: Die Lose 699 und 700 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt GEMÄLDE
619
Falens, Carel van 1784/08/02 FRNGL 0568 P. Valens I Ein wohlausgeführtes Pferdstück. I Maße: 12 Zoll breit, 9 Zoll hoch Anm.: Der Name des Künstlers ist angegeben als "P. Valens", hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Fehler. Transakt. : Verkauft (1.15 fl) Käufer: Nothnagel 1798/06/04 HBPAK 0314 Von Falens I Der flandersche Frachtwagen, vor welchem Pferde und Ochsen gespannt sind. Dieses Stück gehet in Kupfer heraus und ist sehr schätzbar. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 15 Zoll, breit 19 Zoll Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0323 Van Falens I Ein Viehstück. Von sehr gutem Effekt, richtiger Zeichnung und starkem Colorite. Auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 12 Zoll, breit 15 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0276 Carl von Falens I Zwey Landschaften, worauf reitende Frauenzimmer und Herren sind, von Carl von Falens. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft, worauf reitende Frauenzimmer und Herren sind Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh breit 1 Schuh 4 Zoll Anm.: Die Lose 276 und 277 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1799/00/00 WZAN 0277 Carl von Falens I Zwey Landschaften, worauf reitende Frauenzimmer und Herren sind, von Carl von Falens. Auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Landschaft, worauf reitende Frauenzimmer und Herren sind Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 1 Schuh breit 1 Schuh 4 Zoll Anm.: Die Lose 276 und 277 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Hartmann Transakt.: Unbekannt 1800/00/00 FRAN2 0025 Falens (van) I Eine schöne Landschaft, die Abreise zur Jagd, von reicher Zusammensetzung und schöner Färbung, man könnte dasselbe dem Peter Wouwermanns zueignen. I Maße: 15 Zoll hoch, 22 Zoll breit Transakt.: Unbekannt
Falens, Carel van (Schule) 1779/09/27 FRNGL 0016 Vaalens I Ein Pferdtstück aus der Schule von Vaalens. [Une piece representante des chevaux, de l'ecole de Vaalens.] I Maße: 1 Schuh 10 Zoll hoch, 2 Schuh 3 Zoll breit Transakt.: Verkauft (2 fl) Käufer: Hüsgen
Fani, A. [Nicht identifiziert] (und Momper, J. (II)) 1796/02/17 HBPAK 0211 Jodocus Momper; A. Fani I Eine Landgegend, wo in der Mitte ein Schloss, welches zu drey Seiten mit Wasser umgeben. Vorne auf der Heerstrasse ist die Begebenheit: wie Sauli sich kniend vor Christi bekehrt. Auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: Höhe 24 Zoll, Breite 35 Zoll Transakt.: Verkauft (80 M) Käufer: Packi
Farelli, Giacomo 1742/08/01 BOAN 0010 Cavallieri Farelli I Ein Stuck. Die Pyramis und Tispe Original von Cavallieri Farelli. I Verkäufer: von Gise Transakt.: Unbekannt 1742/08/30 BOAN 0077 Chevalier Forelli I Pirrha & Tisbe, par le Chevalier Forelli. I Maße: Haut 3. p. 2. pou. large 4. p. 10. pou. Verkäufer: Jean Henri de Gise Transakt.: Unbekannt 1768/07/00 MUAN 1084 Farelli (Jacobus) I [Ohne Titel] I Anm.: Der Katalog dieser Versteigerung besteht nur aus einem Index von Künstlernamen und Losnummern; ein vollständiger Katalog wurde 1769 publiziert. Verkäufer: Franciscus Ignatius von Dufresne Transakt.: Unbekannt 1769/00/00 MUAN 0382 Farelli (Jacques) I La sainte vierge, avec l'enfant Jesus. Peinte sur toile, marquee du No. 1084. I Mat.: 620
GEMÄLDE
auf Leinwand Maße: 3. p. 3. p. de haut sur 2. p. 11. p. de large Verkäufer: Francois Ignace de Dufresne Transakt.: Unbekannt
Fargue 1763/00/00 BLAN 0054 Fargues I Zween Prospecte: Eine von Delft, und die andere vom Haag. Auf Holz gemahlt, 1 Fuß 9 Zoll hoch, und 2 Fuß 2 Zoll breit. In dem Prospect von einer Gegend in der Stadt Delft, hat Fargues eine Kirche gesetzt. Das andere Stück stellt die Scheewelingsche Brücke im Haag vor. Dieser neue Meister, der ohnzweifel gar nicht bekannt seyn muß, weil noch niemand von ihm Anzeige gethan hat, befleißiget sich in dem Geschmacke des van der Heyden zu mahlen. Man findet in seinen Gemählden schon viel gutes; ob sie gleich freylich mit den Arbeiten seines Musters, des van der Heyden, in keine Vergleichung gesetzet werden können. [Text hier gekürzt] I Diese Nr.: Ein Prospecte von die Stadt Delft Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 9 Zoll hoch, und 2 Fuß 2 Zoll breit Anm.: Die Lose 54 und 55 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Gottlieb Stein Transakt.: Unbekannt 1763/00/00 BLAN 0055 Fargues I Zween Prospecte: Eine von Delft, und die andere vom Haag. Auf Holz gemahlt, 1 Fuß 9 Zoll hoch, und 2 Fuß 2 Zoll breit. In dem Prospect von einer Gegend in der Stadt Delft, hat Fargues eine Kirche gesetzt. Das andere Stück stellt die Scheewelingsche Brücke im Haag vor. Dieser neue Meister, der ohnzweifel gar nicht bekannt seyn muß, weil noch niemand von ihm Anzeige gethan hat, befleißiget sich in dem Geschmacke des van der Heyden zu mahlen. Man findet in seinen Gemählden schon viel gutes; ob sie gleich freylich mit den Arbeiten seines Musters, des van der Heyden, in keine Vergleichung gesetzet werden können. [Text hier gekürzt] I Diese Nr.: Ein Prospecte von die Stadt Den Haag Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß 9 Zoll hoch, und 2 Fuß 2 Zoll breit Anm..· Die Lose 54 und 55 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Johann Gottlieb Stein Transakt.: Unbekannt 1778/07/21 HBHTZ 0057 La Farcke I Eine Caffee= und eine Bier=Stube, lebhaft gemahlt, auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Caffee=Stube Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 22 Zoll, breit 19 Zoll Anm.: Die Lose 57 und 58 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (5 M) Käufer: Köster 1778/07/21 HBHTZ 0058 La Farcke I Eine Caffee= und eine Bier=Stube, lebhaft gemahlt, auf Leinwand. I Diese Nr.: Eine Bier= Stube Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 22 Zoll, breit 19 Zoll Anm.: Die Lose 57 und 58 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (5 M) Käufer: Köster 1779/09/27 FRNGL 0255 La Foorge I Die Gegend eines Niederländischen Dorfs, in Geschmack des David Tenniers. [Vue d'un village Flamand, dans le goüt de David Tenniers.] I Maße: 9 Zoll hoch, 1 Schuh 1 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (3.15 fl) Käufer: Kaller 1797/04/25 HBPAK 0225 La Farque I Ein sehr schön gewählter Prospect von Amsterdam; zur rechten eine Reihe der prächtigsten Häuser, vor denen ein Rundtheil Bäume, durch Pfosten geziert; im Vordergrunde, dicht an die Vorsetzen ein schöner großer Baum, dann folgt zur linken der breite spiegelartige Canal, welcher alle Gegenstände gleichsam doppelt zeigt; in der Mitte des Canals eine kleine büschigte Insel, noch weiter links eine Reihe der geschmackvollsten Gebäude; endlich wird die Aussicht durch die so schönen Häusern und Thürmen begränzt, nebst einigen Personen, welche spazieren gehen. Sehr meisterhaft und sauber gemahlt. Auf Leinwand, schwarzen Rahm, goldene Leisten. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 15 Vi Zoll, breit 20 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt
Fargue, Jacob Elias la 1775/09/09 HBBMN 0065 Joh. Elias la Fargue I Ein inwendiger Prospect im Haag, auf des Prinzen Moritz Pallast, wenn man
von Vyver=Berg kommt; man siehet den Prinzen Statthalter mit dessen Gemahlinn in einer Carosse, Dieses schöne Bild ist extra natürlich auf Holz gemahlet. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 1 F 10 Z, Breit 2 F 6 Ζ Transakt.: Verkauft (15 M) Käufer: Pauli 1796/08/01 NGFRZ 0002 Jac. de la Foorge I Eine detto [schöne Landschaft] von Jac. de la Foorge auf Holz. [Gemälde in Oel in schönen Rahmen. (N.B. Die Größe ist ohne das Rahm gemessen.)] I Mat.: Öl auf Holz Maße: Breite 13 Zoll, Höhe 9 Zoll. [Rheinisch Maaß] Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern im Bildtitel erscheinen über der Nr. 1 und beziehen sich auf die Nrn. 1 bis 25. Transakt.: Unbekannt
Fassauer, Johann Adam 1783/08/01 LZRST 0097 Fassauern I 2 Stück Hühner und Hähne von Fassauern, gut nach der Natur ausgeführt und auf Holz gemahlt, ohne Rahmen. I Mat.: auf Holz Maße: 8 Zoll hoch, 9 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (17 Gr) Käufer: Korn 1783/08/01 LZRST 0098 Fassauern I 2 andere Stück Hühner und Hähne, von eben diesem Meister [Fassauern], ohne Rahm v. gleich. Maasse. I Maße: 8 Zoll hoch, 9 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (20 Gr) Käufer: Korn
Fargue, Paulus Constantijn la
1783/08/01 LZRST 0099 Fassauern I 2 andere Stück von nehmlichen Meister [Fassauern], mit Hühnem und Hähnen, von gleichem Maasse, ohne Rahm. I Maße: 8 Zoll hoch, 9 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (20 Gr) Käufer: Korn
1775/09/09 HBBMN 0066 P.C. la Fargue I Eine schöne warme Landschaft unweit Wassenaer, in Holland, mit Figuren und Vieh staffiret, auf Leinewand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 1 F 10 Vi Z, Breit 2 F 6 Ζ Transakt.: Verkauft (40 M) Käufer: [unleserlich]
1783/08/01 LZRST 0100 Fassauern I 2 andere Stück, von eben diesem Meister [Fassauern], mit Hühnern und Hähnen, von gleichen Maasse, ohne Rahm. I Maße: 8 Zoll hoch, 9 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (22 Gr) Käufer: Korn
Farinati, Paolo 1763/01/17 HNAN 0045 Paolo Farinato I L'inceste de Loth avec ses Filles par Paolo Farinato, sur pierre noire bien polie. I Pendant zu Nr. 46 Mat.: auf Stein Maße: Hauteur 1 pied 6 pouces, Largeur 1 pied 2 Vi pouces Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt 1763/01/17 HNAN 0046 Paolo Farinato I L'accompagnant le Christ sortant du Purgatoire par le meme [Paolo Farinato]. I Pendant zu Nr. 45 Mat.: auf Stein Maße: Hauteur 1 pied 6 pouces, Largeur 1 pied 2 Vi pouces Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt 1763/01/17 HNAN 0047 Paolo Farinato I Le Christ Guerissant des Estropies par Paolo Farinato, sur une pareille pierre. I Pendant zu Nr. 48 Mat.: auf Stein Maße: Hauteur 1 pied 9 pouces, Largeur 1 pied 4 pouces Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt 1763/01/17 HNAN 0048 Paolo Farinato I L'accompagnant la Flagellation de Iesus Christ par le meme [Paolo Farinato]. I Pendant zu Nr. 47 Mat.: auf Stein Maße: Hauteur 1 pied 9 pouces, Largeur 1 pied 4 pouces Verkäufer: le Grand Drossart de Reden Transakt.: Unbekannt 1772/00/00 BSFRE 0041 Farinotto (Paolo) I Le Massacre des Innocens, de Grandeur naturelle, dont le principal Grouppe est une Mere desolee, qui veut preserver son Enfant des mains des Bourreaux. Son Action est caracteristique, & des plus touchantes. Cadre noir avec Liteaux d'ores. I Mat.: auf Leinwand Maße: haut de 55 large de 66 pouces Transakt.: Unbekannt
Farino [Nicht identifiziert] 1790/08/25 FRAN 0362 Farino I Eine Seeschlacht und ein Seesturm. I Diese Nr.: Eine Seeschlacht Maße: hoch 10 Zoll, breit 15 Zoll Anm.: Die Lose 362 und 363 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (5.30 fl für die Nrn. 362 und 363) Käufer: Jacobi [...?] 1790/08/25 FRAN 0363 Farino I Eine Seeschlacht und ein Seesturm. I Diese Nr.: Ein Seesturm Maße: hoch 10 Zoll, breit 15 Zoll Anm.: Die Lose 362 und 363 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (5.30 fl für die Nrn. 362 und 363) Käufer: Jacobi [...?]
1784/08/01 LZRST 0156 Fassauer I 2 fleissige Hühnerstücke von Fassauer auf Holz gemahlt, 9 Vi Z. br. 8 Z. hoch, ohne Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: 9 Vi Zoll breit, 8 Zoll hoch Transakt.: Verkauft (1 Th) Käufer: ST 1784/08/01 LZRST 0157 Fassauer i 2 andere Hühnerstücke von eben diesen Meister [Fassauer] auf Holz, vom gleichen Maasse. I Mat.: auf Holz Maße: 9 Vi Zoll breit, 8 Zoll hoch Transakt.: Verkauft (12 Gr) Käufer: Menge 1784/08/01 LZRST 0158 Fassauer I Noch 2 andere Hühnerstücke von eben diesen Meister [Fassauer] auf Holz. I Mat.: auf Holz Maße: 9 Zoll breit, 8 Zoll hoch Transakt.: Verkauft (6 Gr) Käufer: dd 1784/08/01 LZRST 0159 Fassauer I Noch 2 andere Hühnerstücke von eben diesen Meister [Fassauer] auf Holz, von gleichen Maasse. I Mat.: auf Holz Maße: 9 Zoll breit, 8 Zoll hoch Transakt.: Verkauft (16 Gr) Käufer: Menge 1789/01/19 LZRST 3948 Fassauer I Archimedes von Fassauer auf Holz gemalt, in schw. R[ahm]. mit goldner Leiste. I Mat.: auf Holz Maße: 10 Zoll breit, 12 Zoll hoch Verkäufer: Pf Transakt.: Verkauft (10 Gr) Käufer: Eschenbach 1789/01/19 LZRST 3949 Fassauer I 2 Hühnerstücke von Fassauer auf Holz, in schw. R[ahm]. mit goldner Leiste. I Mat.: auf Holz Maße: 10 Vi Zoll breit, 11 Zoll hoch Verkäufer: Pf Transakt.: Verkauft (21 Gr) Käufer: Weis 1789/01/19 LZRST 3950 Fassauer I 2 Entenstücke, von ebendems. [Fassauer] auf Holz gemalt, in schw. R[ahm]. mit goldn. Leiste. I Mat.: auf Holz Maße: 7 Vi Zoll hoch, 10 Zoll breit Verkäufer: Pf Transakt.: Verkauft (12 Gr) Käufer: Weis 1789/01/19 LZRST 3951 Fassauer I 2 Hühnerstücke, von ebendemselben [Fassauer]. 8 Z. br. 7 Z. h. in schw. R[ahm]. mit goldner Leiste. I Mat.: auf Holz Maße: 8 Zoll breit, 7 Zoll hoch Verkäufer: Pf Transakt.: Verkauft (11 Gr) Käufer: Fran 1789/01/19 LZRST 3952 Fassauer I 2 Hühnerstücke, von ebendems. [Fassauer] ohne Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: 11 Zoll breit, 8 Zoll hoch Verkäufer: Pf Transakt.: Verkauft (1.11 Th) Käufer: D Κ 1789/01/19 LZRST 3953 Fassauer I 2 Bettlerstücke, von ebendems. [Fassauer] ohne Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: 11 Zoll breit, 8 Zoll hoch Verkäufer: Pf Transakt.: Verkauft (21 Gr) Käufer: Caj 1789/01/19 LZRST 3954 Fassauer I 2 Hühnerstücke, von Fasanen und Enten, von ebendems. [Fassauer]. 7 Vi Z. br. 6 Z. h. ohne Rahm. I Mat. : auf Holz Maße: 1 Vi Zoll breit, 6 Zoll hoch Verkäufer: Pf Transakt.: Verkauft (11 Gr) Käufer: Fran GEMÄLDE
621
1789/01/19 LZRST 3955 Fassauer I 2 St. Die Versuchung des heil. Antonius v. ebendems. [Fassauer] 5 Vi Z. br. 6 Z. h ohne Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: 5 Vi Zoll breit, 6 Zoll hoch Verkäufer: Pf Transakt.: Verkauft (22 Gr) Käufer: Caj
1791/09/26 FRAN 0432 Chevallier Fassin I Ein meisterhaftes vortrefliches Viehstück, so schön als Berghem. I Maße: 18 Zoll hoch, 14 Zoll breit Verkäufer: Johann Friedrich Müller Transakt.: Unbekannt
1789/01/19 LZRST 3956 Fassauer I 2 kleine Hühnerstücke. 4 Vi Z. br. 4 Z. h. von ebendems. [Fassauer] ohne Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: 4 Vi Zoll breit, 4 Zoll hoch Verkäufer: Pf Transakt.: Verkauft (12 Gr) Käufer: Fran
1794/00/00 HB AN 0024 Cheval. Fassin I Eine in der Abendsonne glühende gebirgigte Landschaft, in deren Vorgrunde, neben einem über Klippen rauschenden Bache, Vieh graset und Hirt und Hirtin ruhen. Weiter aufwärts wird eine andere Heerde getränkt. I Maße: Höhe 35 Zoll, Breite 44 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt
1789/01/19 LZRST 3957 Fassauer I 2 noch kleinere Hühnerstücke. 3 Vi Zoll breit und eben so h. ohne R[ahm]. von ebendems. [Fassauer]. I Mat.: auf Holz Maße: 3 Vi Zoll breit, 4 Zoll hoch Verkäufer: Pf Transakt.: Verkauft (12 Gr) Käufer: D Κ 1789/01/19 LZRST 3958 Fassauer I 4 versch. Hühnerstücke, von ebendemselb. [Fassauer] ohne R[ahm]. I Mat.: auf Holz Maße: 4 Zoll hoch, 5 Zoll breit Verkäufer: Pf Transakt.: Verkauft (19 Gr) Käufer: Wald
Fassin, Nicolas Henri Joseph (Chevalier de) 1787/00/00 HB AN 0182 Chevalier Fassin I Zur linken befinden sich bey einigen hohen Bergen etliche Bäume neben einem grünen Hügel, auf welchem zwey Schaafe gehen. Im Vordergrunde sitzt eine Hirtinn auf einem alten umgehauenen Baum mit bloßen Kopf in einem rothen bäuerischen Rocke, und nähet an einem weißen Tuch; neben ihr befindet sich auf der Erde ein kleiner Korb. Zu ihren Füßen liegt eine bunte Kuh, und genießt die milde Wärme der untergehenden Sonne. Zur Seite befindet sich eine kleine weiße Ziege; weiter hin bey drey ruhenden Schaafen steht eine glebrothe [sie] Kuh und eine graue daneben, über welche der Hirte sich in einer ermüdeten Stellung zum Schlafen gelegt; neben demselben, mehr vorwärts, befinden sich noch zwey Schaafe und ein schwarzer Ziegenbock auf einer mit Heidekraut bewachsenen Anhöhe. Im Hintergrunde, am Ufer eines klar fließenden Wassers, sieht man noch drey Stiere und etliche Schaafe. In der Ferne im Nebel der untergehenden Sonne wird man viele Wälder, Flecken und Dörfer gewahr. Natur und Kunst sind in diesem Bilde aufs harmonischste angebracht. Dieses vortrefliche Gemähide verdient, daß man es mit den schönsten, Berghem, vergleiche. A.H. [Auf Holz] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 25 Zoll, breit 30 Zoll Transakt.: Verkauft (200 M) Käufer: Schoen 1787/00/00 HB AN 0299 Chevalier Fassin. Im Geschmack des Paul Potter I Auf einer Weide steht im Vordergrunde ein weißgepfleckter Ochse neben einem kleinen Esel, worauf der schlummernde Hirte sein Haupt gelegt. Hinten siehet man eine Kuh auf dem Grase liegen. Im Vordergrunde befinden sich zwey Ziegen. Im Hintergrunde gehen zwey Schaafe nach einem Wasser, welches in der Ferne hinfließt, wo Gewitterluft aufsteiget. Dieses Gemähide ist von einer ausnehmenden Schönheit. Die gedrückte und dunstige Gewitterluft ist unvergleichlich dargestellt. In dem ganzen Bilde herrscht eine stille und angenehme Dämmerung. Das Colorit ist warm, und mit Fleiß und Kunst ausgemahlt. A.H. [Auf Holz] g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 V* Zoll, breit 16 '/2 Zoll Transakt.: Verkauft (116 M) Käufer: Fesser 1788/10/01 FRAN 0016 Chevalier Fassin I Eine Landschaft, warm gemalt mit Figuren und Vieh in der Manier von Berghem. I Maße: 17 Vi Zoll hoch, 13 Vi Zoll breit Transakt.: Verkauft (10 fl) Käufer: Müller 1791/09/21 FRAN 0017 Chevalier Fassin I Eine Gegend von der Schweitz, wo vornen Hämmel und eine Kuhe sind, zur Rechten sieht man auf einem grünen Wasen einen Schäfer, so auf der Erde liegt und eine Schäferin stehend, zur Linken auf entferntem Plätzen sind Heerden; dieses Gemälde ist in seiner Verfassung sehr angenehm, und macht eine schöne Wirkung; die Werke dieses Meisters werden sehr hoch geachtet. I Transakt.: Verkauft (71.15 fl) Käufer: Levy 622
GEMÄLDE
1794/00/00 HB AN 0081 Cheval. Fassin I Ein an seinen Esel sich lehnender Hirt bespricht sich mit einem sitzenden Mädchen, im Vorgrunde einer schön erleuchteten Landschaft. Rechts beginnt, an Abhang des Berges, ein Kühlung verheissender Wald; Links sieht man die Ruinen einer Rotunde, hinter welcher ein ferner Berg, in warmem Duft, zurückweicht. I Maße: Höhe 37 Zoll, Breite 48 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 HB AN 0151 Cheval. Fassin I Vor einer Hole tränken zwey Reuter ihre Pferde, ein Braunes und einen Schimmel, aus dem Brunnen im Vorgrunde. Die sinkende Sonne verbreitet ein mildes Licht über die umnebelte Ferne. I Maße: Höhe 14 Vi Zoll, Breite 18 Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt
Feene [Nicht identifiziert] 1784/08/02 FRNGL 0156 Feene I Ein Küchenstück mit Käs, Häringe, und Brod, von Feene, nach der Natur verfertigt. I Maße: 28 Zoll breit, 29 Zoll hoch Verkäufer: Α Transakt.: Verkauft (11.15 fl) Käufer: Nothnagel
Fegy [Nicht identifiziert] 1765/03/27 FRKAL 0060 Fegy I Un tableau pistorique [sie] vigoureusement peint. I Maße: hauteur 19 pouces, largeur 26 pouces Transakt.: Verkauft (3 fl) Käufer: Hoch
Feld, C. [Nicht identifiziert] 1776/12/21 HBBMN 0020 C. Feld I Zwey plaisante Land= und Wasser=Prospecte, auf Holz. I Diese Nr.: Ein plaisantes Land= und Wasser=Prospect Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Zoll, breit 1 Fuß Anm.: Die Lose 20 und 21 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (2.9 M) Käufer: Hauschild 1776/12/21 HBBMN 0021 C. Feld I Zwey plaisante Land= und Wasser=Prospecte, auf Holz. I Diese Nr.: Ein plaisantes Land= und Wasser=Prospect Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Zoll, breit 1 Fuß Anm.: Die Lose 20 und 21 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (2.9 M) Käufer: Hauschild 1776/12/21 HBBMN 0037 C. Feld I Zwey Arkadische Landschaften, mit Hirten, Rinder und Schaafe, auf Holz, fleißig gemahlt. I Diese Nr.: Eine Arkadische Landschaft, mit Hirten, Rinder und Schaafe Mat.: auf Holz Maße: Hoch 6 Zoll, breit 8 Zoll Anm.: Die Lose 37 und 38 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (2.8 M) Käufer: Berenberg 1776/12/21 HBBMN 0038 C. Feld I Zwey Arkadische Landschaften, mit Hirten, Rinder und Schaafe, auf Holz, fleißig gemahlt. I Diese Nr.: Eine Arkadische Landschaft, mit Hirten, Rinder und Schaafe Mat.: auf Holz Maße: Hoch 6 Zoll, breit 8 Zoll Anm.: Die Lose 37 und 38 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (2.8 M) Käufer: Berenberg 1778/10/30 HBKOS 0154 C. Feld I Ein Garten Prospect, auf Pappe gemahlt von C. Feld. I Mat.: auf Pappe Maße: hoch 8 Vi Zoll, breit 11 Zoll Transakt.: Unbekannt
1792/09/28 HBBMN 0038 C. Feld I Zwey Land= und Wassergegenden, von C. Feld. Auf Pappe. I Diese Nr.: Eine Land= und Wassergegend Mat.: auf Pappe Maße: Hoch 9 Zoll, breit 12 Zoll Anm.: Die Lose 38 und 39 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1792/09/28 HBBMN 0039 C. Feld I Zwey Land= und Wassergegenden, von C. Feld. Auf Pappe. I Diese Nr.: Eine Land= und Wassergegend Mat.: auf Pappe Maße: Hoch 9 Zoll, breit 12 Zoll Anm.: Die Lose 38 und 39 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1792/09/28 HBBMN 0040 C. Feld I Eine dito [Land= und Wassergegend], von dito [C. Feld], Auf Hz. I Mat.: auf Holz Maße: Hoch 9 Zoll, breit 12 Zoll Transakt.: Unbekannt
Fennagel [Nicht identifiziert]
ihm wenig gleich thun, keiner aber ihm leicht übertreffen konnte; es sind ungefehr 100 wohlausgeführte Figuren in bester Stellung hierauf zu ersehen. I Pendant zu Nr. 53a Maße: 2 Schuhe 2 Zoll hoch, 2 Schuhe 8 Zoll breit Anm.: Im Katalog tragen zwei Los die Nummer 53. Diesem Los wurde deshalb zur Unterscheidung die Nummer 53a gegeben. Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (25 fl Schätzung) 1776/00/00 WZTRU 0053a Franciscus Ferg I Compagnion zu Nro. 53, stellet vor ein Winterstück, worauf ein Faßnachtsfest gehalten wird, wobey ein Markschreier vieles Volk um sich stehen hat, beynebst sind viele Figuren in Spanisch Niederländischer Tracht zu ersehen, und läßt dem obigen Stücke nicht das mindeste in der Ausarbeitung nach. I Pendant zu Nr. 53 Anm.: Im Katalog tragen zwei Lose die Nummer 53. Diesem Los wurde deshalb zur Unterscheidung die Nummer 53a gegeben. Verkäufer: Johann Peter Mohr Transakt.: Unbekannt (25 fl Schätzung)
1794/09/10 HBGOV 0159 Fennagel I St. Marcus=Platz von Venedig. Eine seltene Bearbeitung. I Mat.: auf Pergament Maße: Hoch 5 Vi Zoll, breit 7 Vi Zoll Transakt.: Unbekannt
1778/08/29 HBTEX 0067 Verg I Zwey fleißig gemahlte Landschaften. I Diese Nr.: Eine fleißig gemahlte Landschaft Maße: Höhe 10 Zoll, Breite 1 Fuß 3 Zoll Anm.: Die Lose 67 und 68 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
Ferden, H. von
1778/08/29 HBTEX 0068 Verg I Zwey fleißig gemahlte Landschaften. I Diese Nr.: Eine fleißig gemahlte Landschaft Maße: Höhe 10 Zoll, Breite 1 Fuß 3 Zoll Anm.: Die Lose 67 und 68 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1772/09/15 BNSCT 0119 H. von Ferden I Die Königin Cleopatra, welche sich ankleidet mit verschiedenen Personen, von H. von Ferden, 5 f. 3 z. h. 6 f. 2 z. br. schw. Rahm. I Pendant zu Nr. 120 Maße: 5 Fuß 3 Zoll hoch, 6 Fuß 2 Zoll breit Transakt.: Unbekannt (3.34 fl) 1772/09/15 BNSCT 0120 H. von Ferden I Die Lucretia, wie sie wegen der von Sexto Tarquinio ihr zugefügten Schmach in Gegenwart ihrer Anverwandten sich selbst erstochen. Compagnon des vorigen, von selbigem Maitre [H. von Ferden], auch gleicher Höhe und Breite, schw. Rahm. I Pendant zu Nr. 119 Maße: 5 Fuß 3 Zoll hoch, 6 Fuß 2 Zoll breit Transakt.: Unbekannt (2.33 fl)
Feret, Jean Baptiste 1784/05/11 HBKOS 0010 Ferret I St. Genevive, par Ferret, von grosser Force, wie P. Veronese, auf Leinw. I Mat.: auf Leinwand Maße: hoch 43 Zoll 6 1., breit 33 Zoll 6 1. Transakt.: Verkauft 1787/03/01 HBLOT 0010 Babtist Jerett I Die heilige Jenevieve, sitzet in einer angenehmen waldigten Landschaft und lieset, umgeben mit vielen Schafen, sehr schön gemahlet, von Babtist Jerett, in goldenem Rahm. I Transakt.: Unbekannt (3.4 M) 1790/02/04 HBDKR 0010 Ferret I Ste. Jenevieve sitzet unter hohen Bäumen auf einer Terrasse, worauf sie ihrem Arm stützet, und in einem Buche lieset, hinter derselben wird man in der Entfernung gebürgigte Gegenden mit Schlösser gewahr, zur rechten weiden ihre Schaafe, und vorne befindet sich ihr getreuer Hund. In diesem Gemähide herrscht eine angenehme Stille, die den Anblick verschönert; und alles ist auf das freieste und schönste gemahlt, auf Leinwand. I Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 43 Zoll, breit 34 Zoll Transakt.: Verkauft (20.8 M) Käufer: Ego
Ferg, Franz de Paula 1743/00/00 BWGRA 0151 Ferg I Eine Landschaft von Ferg. I Maße: hoch 1 Fuß 1 Vi Zoll, breit 1 Fuß Transakt.: Unbekannt 1749/07/31 HB RAD 0004 Ferg I Eine dito [Landschaft mit Pferden]. I Verkäufer: Denner Transakt.: Unbekannt (81) 1776/00/00 WZTRU 0053 Franciscus Ferg I Ein Stück 2 Schuhe, 2 Zoll hoch, 2 Schuhe, 8 Zoll breit, stellet eine in Flandern liegende Gegend vor, worinn sich nebst Nobles viele andere Personen belustigen und beschäftigen. Dieses von Franciscus Ferg verfertigte Stück ist mit solcher Zierlichkeit und von so guter Erfindung, daß es
1778/09/28 FRAN 0532 Franz de Paula Feerg I Der Zug einer Bauernhochzeit mit vielen Figuren in einer schönen Landschaft. [Le train de nöces de paysans avec beaucoup de figures dans un paysage riant.] I Maße: 1 Schuh 11 Zoll breit, 1 Vi Schuh hoch Verkäufer: Georg Wilhelm Bögner Transakt.: Verkauft (149.30 fl) Käufer: Wenner Buchhändler 1779/00/00 HB AN 0077 Ferg I Ein Bauer auf einem Schimmel, neben dem ein bepacktes Maulthier steht, spricht mit einem Reisenden, neben welchem zur Linken des Gemäldes sein Weib sitzt, und auf der andern Seite seine junge Tochter steht. Weiter zurück fängt ein Bauer das aus einem zierlichen Springbrunnen rinnende Wasser in einen Krug auf, um dem auf einem bepackten Esel sitzende Weibe zu trinken zu geben. Von der Linken erstreckt sich das Gebüsch zur bergichten Ferne, worauf man einige Ruinen erblickt. Auf Holz. [Un paysan monte sur un cheval blanc, ä cöte duquel est un mulet charge, parle ä un voyageur dont la femme est assise sur la gauche du tableau, & dont la fille est debout de l'autre cote. Plus loin un paysan remplit sa cruche de l'eau qui coule d'une fontaine de forme elegante, pour donner ä boire ä une femme montee sur un äne charge. Sur la gauche il y a un taillis d'arbres, qui se perd dans un lointain coupe par des montagnes, sur lesquelles on apperfoit quelques ruines. Sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß hoch, 9 Zoll breit Anm.: Dieses Los trägt im gedruckten französischen Katalog irrtümlich die Nr. 31. Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0078 Ferg I Ein Bauer führt seinen bepackten Esel zum ausgewölbten Brunnen, neben welchem ein steinernes Monument steht. Hinter dem Gemäuer erhebt sich ein Garten, und zur Linken kömmt ein Reisender auf einem falben Pferde, nebst seinem Weibe auf einem Maulthiere. Ein zu Fusse gehendes Weib und zween Männer zeigen auf einen Knaben, der auf einem Hunde zu reiten versucht. Auf Holz. [Un paysan mene son äne charge ä une fontaine construite en voüte, ä cöte de laquelle est un monument de pierre. Derriere la muraille s'eleve un jardin, & ä gauche s'acheminent un voyageur sur un cheval alezan & sa femme sur un mulet. Une femme ä pied & deux hommes montrent un enfant, qui cherche ä monter sur un chien. Sur bois.] I Mat.: auf Holz Maße: 1 Fuß hoch, 9 Zoll breit Anm.: Dieses Los trägt im gedruckten französischen Katalog irrtümlich die Nr. 32. Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0128 F. Ferg I An einem alten runden Thurme hat ein Marktschreyer unter einem Baume sein Theater aufGEMÄLDE
623
geschlagen, vor dem eine große Menge Zuschauer stehen. Weiter hinaus sind unzähliche mit Jahrmarktssachen beschäfftiget. Einige alte Gebäude, hinter denen das Gebirge emporsteigt, schließen die Aussicht. [Un charlatan vient d'ouvrir son theatre sous un arbre, pres d'une vieille tour ronde. Une quantite de spectateurs est devant ce theatre. Plus loin une multitude de personnes s'occupent ä la foire du village. Quelques vieux bätimens, derriere lesquels s'eleve une montagne, ferment la vue.] I Mat.: auf Kupfer Maße: 1 Fuß 2 Zoll hoch, 1 Fuß 6 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt
1782/01/28 LZAN 4155 Ferg I Zwey Landschaften von Ferg auf Holz. 8 Zoll breit, 11 Zoll hoch. Schwarz und goldner Rahm. I Mat.: auf Holz Maße: 8 Zoll breit, 11 Zoll hoch Verkäufer: Caroli Ferdinandi Hommelii Transakt.: Unbekannt
1779/00/00 HB AN 0129 F. Ferg I Eine Bauemgesellschaft belustiget sich zur Linken mit Tanzen vor einem zerfallenen Thurme, an dessen Mauer einige Bäume heranwachsen. Zur Rechten ziehen eine Menge Leute auf eine mit Bäumen eingeschlossene Wiese. Noch weiter zur Rechten erheben sich die Ruinen einer Stadt auf einem Berge, und das blaue Gebirge verliert sich im Horizonte. Beide Stücke [Nr. 128 und 129] auf Kupfer. [Sur la gauche une assemblee de paysans s'amuse ä danser sous une tour ruinee; le long de ses murs s'elevent quelques arbres. A droite une quantite de monde se rend ä une prairie entouree d'arbres. Plus loin du meme cöte s'elevent les vestiges d'une ville sur une montagne. L'azur des montagnes se perd dans l'horizon. Tous deux peints sur cuivre.] I Mat.: auf Kupfer Maße: 1 Fuß 2 Zoll hoch, 1 Fuß 6 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt
1783/06/19 HBRMS 0151 Ferg I Landschaften mit alten Denkmälern und Hirten. K[upfer]. g.R. [verguldete Rahmen] I Diese Nr.: Eine Landschaft mit alten Denkmälern und Hirten Mat.: auf Kupfer Maße: 7 Zoll hoch, 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 150 und 151 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1779/00/00 HB AN 0217 F. Ferg I Elieser, da er die Rebekka beym Brunnen findet, bindet ihr die Spangen um den Arm. Neben ihm steht einer seiner Gefährten, der die übrigen Geschenke in einem Korbe unter dem Arme hält. Hinter ihnen sind seine bepackten Kameele mit den Treibern. Im Mittelgrunde sieht man Ruinen einer alten Stadt. [Elieser ayant trouve Rebecca ä la fontaine lui attache les bracelets au bras. Α cöte de lui un de ses compagnons tient les autres presens dans une corbeille sous son bras. Derriere lui sont ses chameaux & les chameliers. Sur le plan du milieu les ruines d'une ville.] I Mat.: auf Kupfer Maße: 1 Fuß 7 Vi Zoll hoch, 2 Fuß 2 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0218 F. Ferg I Joseph, um die Hüften mit einem weißen Gewände bekleidet, wird von seinen Brüdern an die Ismaeliten verkauft. Hinter ihnen sind bepackte Kameele; etwas weiter hin sieht man noch eine Menge durch das ferne Gebirge herkommen. Beide Stücke [Nr. 217 und 218] auf Kupfer. [Joseph, habille de blanc, est vendu par ses freres aux Ismaelites. Derriere eux sont des chameaux charges; plus loin on en voit avancer plusieurs autres de la montagne eloignee. Tous deux peints sur cuivre.] I Mat.: auf Kupfer Maße: 1 Fuß 7 Vi Zoll hoch, 2 Fuß 2 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1779/00/00 HB AN 0315 F. Ferg I Im Vorgrunde, wo eine Pyramide steht, trägt ein Steg einige Reisende über einen Wasserfall, dessen felsichtes Ufer von den Sonnenstralen erleuchtet wird. Weiter hinten erhebt sich ein Schloß über die Bäume des nähern Thaies, und ein ungeheurer steiler Felsen, und niedrige ferne Gebirge schließen den Horizont. [Le devant du tableau orne d'une pyramide offre un pont rustique, qui conduit des voyageurs par-dessus une chüte d'eau, dont les bords couvert de rochers sont eclaires des rayons du soleil. Plus loin derriere s'eleve un chateau par-dessus les arbres du vallon & un enorme rocher escarpe. Des montagnes lointaines ferment l'horizon.]. I Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 2 Zoll hoch, 1 Fuß 5 Zoll breit Verkäufer: Schwalbe Transakt.: Unbekannt 1781/00/00 WZAN 0053 Franciscus Ferg I Ein Stück 2 Schuhe, 2 Zoll hoch, 2 Schuhe, 8 Zoll breit, stellet eine in Flandern gelegene Gegend vor, worinn sich nebst Noblesse viele andere Personen belustigen und beschäftigen. Dieses von Franciscus Ferg verfertigte Stück ist von solcher Zierlichkeit und so guter Erfindung, daß es ihm wenige gleich thun, keines aber ihm leicht übertreffen könnte; es sind ungefehr 100 wohl ausgeführte Figuren in beßter Stellung hierauf zu ersehen. I Pendant zu Nr. 53a von Anonym Maße: 2 Schuhe 2 Zoll hoch, 2 Schuhe 8 Zoll breit Transakt.: Unbekannt 624
GEMÄLDE
1783/06/19 HBRMS 0150 Ferg I Landschaften mit alten Denkmälern und Hirten. K[upfer], g.R. [verguldete Rahmen] I Diese Nr.: Eine Landschaft mit alten Denkmälern und Hirten Mat.: auf Kupfer Maße: 7 Zoll hoch, 8 Zoll breit Anm.: Die Lose 150 und 151 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt
1783/06/19 HBRMS 0156 Ferg I Landschaften mit Wasser und Ruinen, vorne baden sich Nimphen. K[upfer]. g.R. [verguldete Rahmen] I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Wasser und Ruinen, vorne baden sich Nimphen Mat.: auf Kupfer Maße: 11 Zoll hoch, 14 Zoll breit Anm.: Die Lose 156 und 157 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1783/06/19 HBRMS 0157 Ferg I Landschaften mit Wasser und Ruinen, vorne baden sich Nimphen. K[upfer], g.R. [verguldete Rahmen] I Diese Nr.: Eine Landschaft mit Wasser und Ruinen, vome baden sich Nimphen Mat.: auf Kupfer Maße: 11 Zoll hoch, 14 Zoll breit Anm.: Die Lose 156 und 157 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1785/05/17 MZAN 0014 Franciscus Ferg I Zwey Jahrmärkte von Franciscus Ferg, auf Kupfer. [Deux foires.] I Diese Nr.: Ein Jahrmarkt Mat.: auf Kupfer Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 2 Schuh 7 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 14 und 15 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (123 fl für die Nm. 14 und 15) Käufer: Rmus D äl Hoheneck Cantor 1785/05/17 MZAN 0015 Franciscus Ferg I Zwey Jahrmärkte von Franciscus Ferg, auf Kupfer. [Deux foires.] I Diese Nr.: Ein Jahrmarkt Mat.: auf Kupfer Maße: 1 Schuh 9 Zoll hoch, 2 Schuh 7 Vz Zoll breit Anm.: Die Lose 14 und 15 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (123 fl für die Nrn. 14 und 15) Käufer: Rmus D äl Hoheneck Cantor 1785/05/17 MZAN 0874 Ferg I Ein Paar Landschaften von Ferg. [Deux paysages.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 10 Zoll hoch, 1 Schuh 2 Vi Zoll breit Anm.: Die Lose 874 und 875 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (40 fl für die Nm. 874 und 875) Käufer: Zitz 1785/05/17 MZAN 0875 Ferg I Ein Paar Landschaften von Ferg. [Deux paysages.] I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: 10 Zoll hoch, 1 Schuh 2 Vi Zoll breit Anm. : Die Lose 874 und 875 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (40 fl für die Nrn. 874 und 875) Käufer: Zitz 1785/05/17 MZAN 1085 Ferg I Eine Landschaft von Ferg auf Kupfer. [Un pay sage.] I Mat.: auf Kupfer Maße: 1 Schuh 1 Zoll hoch, 1 Schuh 3 Zoll breit Verkäufer: Graf von Elz Transakt.: Verkauft (34 fl) Käufer: Winterstein 1787/00/00 HB AN 0075 Franciscus Ferg I Susanna sitzt blau gekleidet vor einem Baldachin, und hält einen weißen Tuch an ihrer Brust. Die beyden Alten kommen von hinten, und unterreden sich mit ihr. Im Hintergrunde wird man einen angenehmen Garten=Prospect gewahr, mit einem prächtigen Gebäude. Von einer angenehmen Mahlerey und Colorit, auch richtiger Zeichnung. Auf Kupfer, g.R. [in goldenem Rahm] I Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 7 Vi Zoll, breit 5 Vi Zoll Transakt.: Verkauft (70 M) Käufer: Ekhard 1787/00/00 HB AN 0123 Franciscus Ferg I Bey einem mit Moos bewachsenen verfallenen alten Monument, hinter welchem sich einige gekappte Bäume befinden, sitzen verschiedene mit ein-
ander sich unterredende Personen. In dem mit vielen Kräutern bewachsenem Vordergrunde befinden sich einige auf alten verfallenen Trümmern sitzende und stehende Soldaten, auf Römische Art gekleidet. Neben einigen Trümmern und Bäumen ein Paar sich unterredende Geliebte auf einem grünen Hügel. Im Vordergrunde bey einigen bemooßten Steinen und Ruinen sitzt ein Mann und Weib, womit sich ein vor ihnen stehender Soldate unterredet. Diese beyden Bilder sind auf das angenehmste und schönste gemahlt. A.K. [Auf Kupfer] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Diese Nr.: Bey einem mit Moos bewachsenen verfallenen alten Monument, hinter welchem sich einige gekappte Bäume befinden, sitzen verschiedene mit einander sich unterredende Personen Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 11 Zoll, breit 9 Zoll Anm.: Die Lose 123 und 124 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (312 Μ für die Nrn. 123 und 124) Käufer: Ekhard 1787/00/00 HB AN 0124 Franciscus Ferg I Bey einem mit Moos bewachsenen verfallenen alten Monument, hinter welchem sich einige gekappte Bäume befinden, sitzen verschiedene mit einander sich unterredende Personen. In dem mit vielen Kräutern bewachsenem Vordergrunde befinden sich einige auf alten verfallenen Trümmern sitzende und stehende Soldaten, auf Römische Art gekleidet. Neben einigen Trümmern und Bäumen ein Paar sich unterredende Geliebte auf einem grünen Hügel. Im Vordergrunde bey einigen bemooßten Steinen und Ruinen sitzt ein Mann und Weib, womit sich ein vor ihnen stehender Soldate unterredet. Diese beyden Bilder sind auf das angenehmste und schönste gemahlt. A.K. [Auf Kupfer] s.R.g.L. [in schwarzem Rahm mit goldenen Leisten] I Diese Nr.: Neben einigen Trümmern und Bäumen sitzen ein Paar sich unterredende Geliebte auf einem grünen Hügel Mat.: auf Kupfer Maße: Hoch 11 Zoll, breit 9 Zoll Anm.: Die Lose 123 und 124 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (312 Μ für die Nrn. 123 und 124) Käufer: Ekhard 1790/08/25 FRAN 0267 Furg I Zwey Landschaften in Gusto von Roos. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: hoch 42 Zoll, breit 32 Zoll Anm.: Die Lose 267 und 268 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (5 fl für die Nrn. 267 und 268) Käufer: Bender 1790/08/25 FRAN 0268 Furg I Zwey Landschaften in Gusto von Roos. I Diese Nr.: Eine Landschaft Maße: hoch 42 Zoll, breit 32 Zoll Anm.: Die Lose 267 und 268 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (5 fl für die Nm. 267 und 268) Käufer: Bender 1790/08/25 FRAN 0432 P. Ferg I Zwey Landschaften mit vielen Figuren und Vieh. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit vielen Figuren und Vieh Maße: hoch 11 Zoll, breit 16 Zoll Anm.: Die Lose 432 und 433 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (7.15 fl für die Nrn. 432 und 433) Käufer: Müntzrath Dietz 1790/08/25 FRAN 0433 P. Ferg I Zwey Landschaften mit vielen Figuren und Vieh. I Diese Nr.: Eine Landschaft mit vielen Figuren und Vieh Maße: hoch 11 Zoll, breit 16 Zoll Anm.: Die Lose 432 und 433 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (7.15 fl für die Nrn. 432 und 433) Käufer: Müntzrath Dietz 1791/05/15 LZHCT 0067 Frangois de Paula Ferg I Le portrait de cet artiste peint par lui merae, portant grande penruque, un habit pälejaune avec un rabat violet. Büste peint sur du velin. Haut de 3 Vi pouces, large de 2 Vi. C'est d'aprfes cette peinture qu'est grave le portrait de Ferg, place ä la tete du cinquieme tome de la nouvelle Bibliotheque allemande des beaux arts. I Maße: haut de 3 Vi pouces, large de 2 Vi pouces Verkäufer: Chret Guill Ernest Dietrich, dit Dietricy Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0094 Ferg I Ein Seestück mit einigen Schiffen und Figuren, von Ferg. I Pendant zu Nr. 95 Maße: 1 Schuh
3 Zoll hoch, 1 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0095 Ferg I Zum Gegenstück ein alter Wachtthurm, nebst angrenzender See, mit verschiedenen Schiffen, vom nemlichen Meister [Ferg] und Maaß. I Pendant zu Nr. 94 Maße: I Schuh 3 Zoll hoch, 1 Schuh 6 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0155 Ferg I Eine Landschaft mit einer Menge von Figuren, allwo Jahrmarkt gehalten wird, nebst angrenzenden Seehafen, in welchen die Schiffe einlaufen von Ferg. I Pendant zu Nr. 156 Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 8 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1793/00/00 NGWID 0156 Ferg I Zum Gegenstück eine sehr angenehme wasserreiche Gegend einer Landschaft, von obigem Meister [Ferg] und Maaß. I Pendant zu Nr. 155 Maße: 1 Schuh 4 Zoll hoch, 1 Schuh 8 Zoll breit Verkäufer: Wild Transakt.: Unbekannt 1794/00/00 HB AN 0129 Fr. de Paula Ferg I Ueber einem wilden Waldstrom verbindet ein Steg die zwey Felsenufer mit einander; rechts erblickt man eine Pyramide und links erhebt sich eine treflich erleuchtete und mit dem schönen Ganzen in lieblicher Harmonie stehende kahle Felswand. Gewiss ist dieses Bild eins der besten von diesem Künstler. I Maße: Höhe 13 Zoll, Breite 16 Vi Zoll Verkäufer: Leoneiii Transakt.: Unbekannt 1795/03/12 HBSDT 0026 Ferg I Eine Heerstraße, woselbst neben Brunnen und Monumenten viele Leute zu Pferde und zu Fuße sind. Auf Holz, im schwarzen Rahm. I Diese Nr.: Eine Heerstraße, woselbst neben Brunnen und Monumenten viele Leute zu Pferde und zu Fuße sind Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Zoll, breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 26 und 27 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1795/03/12 HBSDT 0027 Ferg I Eine Heerstraße, woselbst neben Brunnen und Monumenten viele Leute zu Pferde und zu Fuße sind. Auf Holz, im schwarzen Rahm. I Diese Nr.: Eine Heerstraße, woselbst neben Brunnen und Monumenten viele Leute zu Pferde und zu Fuße sind Mat.: auf Holz Maße: Hoch 13 Zoll, breit 10 Zoll Anm.: Die Lose 26 und 27 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0238 Paul Ferg I Zwey sehr fleißige Landschaften, so schön wie Moucheron gemahlt, mit Figuren und Vieh, die Berghem Ehre machen würden. Auf Holz, mit goldn. Rahm. I Diese Nr.: Eine sehr fleißige Landschaft Mat.: auf Holz Maße: Hoch II Vi Zoll, breit 14 Zoll Anm.: Die Lose 238 und 239 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1797/04/20 HBPAK 0239 Paul Ferg I Zwey sehr fleißige Landschaften, so schön wie Moucheron gemahlt, mit Figuren und Vieh, die Berghem Ehre machen würden. Auf Holz, mit goldn. Rahm. I Diese Nr.: Eine sehr fleißige Landschaft Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Vi Zoll, breit 14 Zoll Anm.: Die Lose 238 und 239 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/01/19 HBPAK 0094 Franz Fere I Bauernbelustigungen. Viele und gut gezeichnete Figuren auf schönen Landschaften. Gleicher Grösse. 10 Zoll hoch, 1 Fuß breit. Goldn. Rahm. I Diese Nr.: Eine Bauernbelustigung Maße: 10 Zoll hoch, 1 Fuß breit Anm.: Die Lose 94 und 95 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/01/19 HBPAK 0095 Franz Fere I Bauernbelustigungen. Viele und gut gezeichnete Figuren auf schönen Landschaften. Gleicher Grösse. 10 Zoll hoch, 1 Fuß breit. Goldn. Rahm. I Diese Nr.: Eine Bauernbelustigung Maße: 10 Zoll hoch, 1 Fuß breit Anm.: Die Lose 94 und 95 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0373 P. Ferg I Diese zwey vortreflichen Landschaften mit Vieh, verdienen eine Aufnahme in die ersten CaGEMÄLDE
625
binette. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine vortrefliche Landschaft mit Vieh Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Vi Zoll, breit 14 Vi Zoll Anm.: Die Lose 373 und 374 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/06/04 HBPAK 0374 P. Ferg I Diese zwey vortreflichen Landschaften mit Vieh, verdienen eine Aufnahme in die ersten Cabinette. Auf Holz. I Diese Nr.: Eine vortrefliche Landschaft mit Vieh Mat.: auf Holz Maße: Hoch 11 Vi Zoll, breit 14 Vi Zoll Anm.: Die Lose 373 und 374 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/08/10 HBPAK 0013 Ferg I Zwey Landgegenden mit Rudera. An der Rudera sitzen zwey Figuren, welche sich mit einander unterreden. Am Fusse noch mehrere Figuren. Das andere: an der Rudera sitzen ebenfalls zwey Figuren, welche sich mit einander zu unterreden scheinen. Am Fusse noch mehrere Figuren. Ganz gut gemahlt. Auf Holz, im schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Eine Landgegend mit Rudera. An der Rudera sitzen zwey Figuren, welche sich mit einander unterreden. Am Fusse noch mehrere Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Zoll, breit 9 Zoll Anm.: Die Lose 13 und 14 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1798/08/10 HBPAK 0014 Ferg I Zwey Landgegenden mit Rudera. An der Rudera sitzen zwey Figuren, welche sich mit einander unterreden. Am Fusse noch mehrere Figuren. Das andere: an der Rudera sitzen ebenfalls zwey Figuren, welche sich mit einander zu unterreden scheinen. Am Fusse noch mehrere Figuren. Ganz gut gemahlt. Auf Holz, im schwarzen Rahm mit goldnen Leisten. I Diese Nr.: Eine Landgegend mit Rudera. An der Rudera sitzen ebenfalls zwey Figuren, welche sich mit einander zu unterreden scheinen. Am Fusse noch mehrere Figuren Mat.: auf Holz Maße: Hoch 12 Zoll, breit 9 Zoll Anm.: Die Lose 13 und 14 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1799/12/23 WNAN 0064 Transakt.: Unbekannt
Fergue I Trois petits payssages. I
Ferg, Franz de Paula (und Thiele, A.) 1783/06/19 HBRMS 0126 Thiele: Ferg I Holzung auf Gebirge, unten ein Schloß, wobei Reisende und eine Heerde Schaafe auf der Landstraße angeberacht sind. Eine Winter=Gegend; auf dem Wasser laufen Leute Schrittschuhe, und auf dem Lande fallen andere Holz. L[einwand]. g.R. [verguldete Rahmen]. I Diese Nr.: Holzungen auf Gebirge, unten ein Schloss, wobey Reisende und eine Heerde Schaafe auf der Landstrasse sind Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 2 Zoll hoch, 11 Zoll breit Anm.: Die Lose 126 und 127 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1783/06/19 HBRMS 0127 Thiele: Ferg \ Holzung auf Gebirge, unten ein Schloß, wobei Reisende und eine Heerde Schaafe auf der Landstraße angeberacht sind. Eine Winter=Gegend; auf dem Wasser laufen Leute Schrittschuhe, und auf dem Lande fallen andere Holz. L[einwand]. g.R. [verguldete Rahmen]. I Diese Nr.: Eine Winder= Gegend; auf dem Wasser laufen Leute Schrittschuhe, und auf dem Lande fällen andere Holz Mat.: auf Leinwand Maße: 1 Fuß 2 Zoll hoch, 11 Zoll breit Anm.: Die Lose 126 und 127 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Unbekannt 1783/08/01 LZRST 0009 Alex. Thielen: Franz Ferg I Eine volkreiche Dorfansicht, in der Mitte eine grosse Bauerhütte mit Bäumen, in einiger Entfernung eine Kirche, Häuser und eine entfernte bergichte Aussicht, im Vordergrunde belustigen sich Bauern und Bäuerinnen und Hirten treiben ihr Vieh vorüber, von Alex. Thielen und von Franz Ferg meisterhaft stafirt, 16 Vi Zoll hock 23 Zoll breit in schw. gebeitz. Rahm mit verg. Leiste. I Pendant zu Nr. 10 Maße: 16 Vi Zoll hoch, 23 Zoll breit Verkäufer: W Transakt.: Verkauft (3 Th) Käufer: Buchs 626
GEMÄLDE
1783/08/01 LZRST 0010 Alex. Thielen; Franz Ferg I Eine andere volkreiche Dorfansicht, rechter Hand der Weg durch ein Dorf, tiefer im Vordergrunde, ein grosses Wirthshauss mit Bäumen, vor welchem Bauern und Bäuerinnen spielen und sich belustigen, von Alex. Thielen und von Franz Ferg stafirt, sie ist das Gegenbild von voriger [Nr. 9], hat gleiche Grösse und gleichen [schw. gebeitz.] Rahm [mit verg. Leiste] I Pendant zu Nr. 9 Maße: 16 Vi Zoll hoch, 23 Zoll breit Verkäufer: W Transakt.: Verkauft (3 Th) Käufer: Buchs 1790/08/25 FRAN 0284 Α. Thiele; P. Ferg I Ein Seehaven, von A. Thiele und P. Ferg. I Maße: hoch 12 Zoll, breit 18 Zoll Verkäufer: Kaller [und] Michael Transakt.: Verkauft (10 fl) Käufer: Kaller 1800/01/00 LZAN [A]0069 Alex. Thiele; Ferg I Von Ebendemselben [Alex. Thiele]. Eine schöne Landschaft mit vielem Gebüsche, die Figuren von Ferg. Ein Reisender auf einem Schimmel (einwärts gekehrt) spricht mit einem ihm zur Rechten stehenden Manne und Knaben. Auf beiden Seiten in der Entfernung hören einige ihrem Gespräche zu. Reiter und Pferd ist vortreflich gemalt. Auf Holz. I Pendant zu Nr. [A]70 Mat.: auf Holz Maße: Höhe 5 Zoll, Breite 7 Vi Zoll Verkäufer: A F Oeser Transakt.: Unbekannt 1800/01/00 LZAN [A]0070 Alex. Thiele; Ferg I Gleicher Grösse [wie Nr. A69]. Der Compagn. Aehnliche Gegenstände mit einer ähnlichen Staffage, von Ferg. Auf Holz. I Pendant zu Nr. [A]69 Mat.: auf Holz Maße: Höhe 5 Zoll, Breite 7 Vi Zoll Verkäufer: A F Oeser Transakt.: Unbekannt
Ferg, Franz de Paula (Geschmack von) 1782/03/18 HBTEX 0337 Im Gusto von Ferg I Zwey Kirmiß= Stücke, mit vielen lustigen Landleuten und Kindern, plaisant gemahlt, auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Kirmiß=Stück, mit vielen lustigen Landleuten und Kindern Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 6 Zoll 9 Linien, Breite 9 Zoll 6 Linien Anm.: Die Lose 337 und 338 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt 1782/03/18 HBTEX 0338 Im Gusto von Ferg I Zwey Kirmiß= Stücke, mit vielen lustigen Landleuten und Kindern, plaisant gemahlt, auf Leinwand. I Diese Nr.: Ein Kirmiß=Stück, mit vielen lustigen Landleuten und Kindern Mat.: auf Leinwand Maße: Höhe 6 Zoll 9 Linien, Breite 9 Zoll 6 Linien Anm.: Die Lose 337 und 338 wurden zusammen katalogisiert. Verkäufer: Joachim Hinrich Thielcke Transakt.: Unbekannt
Ferg, Franz de Paula (Kopie nach) 1786/11/11 HBRMS 0075[b] Ferg I Sechs Stück beschädigte alte italiänische Blumen=Stücke, und 4 Stück auf Blech gemahlte beschädigte Conversationes, nach Ferg, ohne Rahme. I Diese Nr.: 4 Stück auf Blech gemahlte beschädigte Conversationes; Nr. 75[a] von Anonym Mat.: auf Blech Transakt.: Unbekannt 1787/00/00 HB AN 0521 Nach F. Ferg I Bey verschiedenen alten Ruinen hat ein Marktschreyer seine Bude aufgeschlagen, um welche viele Bauern versammlet sind. Im Vordergrunde andere Bauern, worunter sich zwey mit vieler Wuth schlagen wollen. Neben altem Gemäuer tanzen viele Bauern und Bäuerinnen nach der Musik. Im Hintergrunde eine angenehme Aussicht, über aus reich an Figuren. Sehr plaisant und mit vielem Fleiß gemahlt. A.L. [Auf Leinewand] g.R. [in goldenem Rahm] I Diese Nr.: Bey verschiedenen alten Ruinen hat ein Marktschreyer seine Bude aufgeschlagen, um welche viele Bauern versammlet sind Mat.: auf Leinwand Maße: Hoch 10 Zoll, breit 11 % Zoll Anm.: Die Lose 521 und 522 wurden zusammen katalogisiert. Transakt.: Verkauft (20 Μ für die Nrn. 521 und 522) Käufer: Fesser 1787/00/00 HB AN 0522 Nach F. Ferg I Bey verschiedenen alten Ruinen hat ein Marktschreyer seine Bude aufgeschlagen, um
welche viele Bauern versammlet sind. Im Vordergrunde andere Bauern, worunter sich zwey mit vieler



![Das Recht des Papiermacherhandwerkes im deutschsprachigen Raum in der Zeit von 1400 bis 1800: Unter besonderer Berücksichtigung der Organisation der Papiermacher [1 ed.]
9783428470631, 9783428070633](https://dokumen.pub/img/200x200/das-recht-des-papiermacherhandwerkes-im-deutschsprachigen-raum-in-der-zeit-von-1400-bis-1800-unter-besonderer-bercksichtigung-der-organisation-der-papiermacher-1nbsped-9783428470631-9783428070633.jpg)
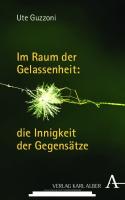
![Das Individuum im transkulturellen Raum: Identitätsentwürfe in der deutschsprachigen Literatur Böhmens und Mährens 1918-1938 [1. Aufl.]
9783839427484](https://dokumen.pub/img/200x200/das-individuum-im-transkulturellen-raum-identittsentwrfe-in-der-deutschsprachigen-literatur-bhmens-und-mhrens-1918-1938-1-aufl-9783839427484.jpg)

![Finanz, Industrie und Währung in Italien und im deutschsprachigen Raum [1 ed.]
9783428468300, 9783428068302](https://dokumen.pub/img/200x200/finanz-industrie-und-whrung-in-italien-und-im-deutschsprachigen-raum-1nbsped-9783428468300-9783428068302.jpg)

