Verbraucherpolitik in der Marktwirtschaft: Konzeptionen und internationale Erfahrungen [1 ed.] 9783428490523, 9783428090525
Die Verbraucherpolitik ist spätestens seit den 70er Jahren als eigenständiger Teilbereich der Wirtschaftspolitik in entw
144 27 44MB
German Pages 485 Year 1997
Polecaj historie
Citation preview
VERÖFFENTLICHUNGEN DES FORSCHUNGSINSTITUTS FÜR WIRTSCHAFTSPOLITIK AN DER UNIVERSITÄT MAINZ
Herausgegeben von HARTWIG BARTLING WALTER HAMM
WERNER ZOHLNHÖFER HELMUT DIEDERICH
Schriftleiter PETER VEST
BAND
55
Das Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik an der Universität Mainz hat ein doppeltes Ziel: Es möchte die Grundlagen der Ordnung der Wirtschaft - Geld, Eigentum und Wettbewerb - untersuchen und hofft, Verbesserungen der geltenden Ordnung vorschlagen zu können. Daneben will das Institut von dem gewonnenen Standpunkt aus zu aktuellen Spezialfragen der Wirtschaftspolitik Stellung nehmen. Es dient weder Interessenten noch Interessentenorganisationen. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeit des Instituts einem breiteren Kreis zugänglich zu machen, ist der Sinn dieser Schriftenreihe.
Verbraucherpolitik in der Marktwirtschaft Konzeptionen und internationale Erfahrungen
Von Dr. Stefan Mitropoulos
DUNCKER & HUMBLOT / BERLIN
CIP-Titelaufnahme der Deutschen Bibliothek
Mitropoulos, Stefan:
Verbraucherpolitik in der Marktwirtschaft : Konzeptionen und internationale Erfahrungen I von Stefan Mitropoulos. - Berlin : Duncker und Humblot, 1997 (Veröffentlichungen des Forschungsinstituts für Wirtschaftspolitik an der Universität Mainz ; Bd. 55) Zug!.: Mainz, Univ., Diss., 1996 ISBN 3-428-09052-7
Alle Rechte vorbehalten Cl 1997 Duncker & Humblot GmbH, Berlin Satz: FfW Mainz Druck: Berliner Buchdruckerei Union GmbH, Berlin Printed in Germany ISSN 05~2-1497 ISBN 3-428-09052-7
e
Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier entsprechend ISO 9706
Vorwort
Die vorliegende Arbeit entstand auf der Grundlage eines Gutachtens, das im Auftrag des Bundesministeriums ftlr Wirtschaft am Forschungsinstitut ftlr Wirtschaftspolitik an der Universität Mainz e. V. erstellt wurde. Die Ausarbeitung dieser Studie zur Dissertation wurde durch ein großzügiges Stipendium der FAZIT-Stiftung, Fankfurt, ermöglicht, woftlr ich mich an dieser Stelle herzlich bedanke. Die Untersuchung wurde im August 1996 vom Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der Johannes GutenbergUniversität als Dissertation angenommen. Zum Gelingen dieser Arbeit haben Personen innerhalb und außerhalb des Instituts beigetragen. Mein Dank gilt meinem Doktorvater, Herrn Univ.-Prof. Dr. Hartwig Bartling, rur die gute Betreuung, ftlr wertvolle Diskussionen und Hinweise. Dies gilt in gleicher Weise ftlr Herrn Univ.-Prof. Dr. Werner Zohlnhöfer, der freundlicherweise das Zweitgutachten übernahm. An seinem Lehrstuhl konnte die Dissertation in angenehmer Atmosphäre abgeschlossen werden. Auch die Geschäftsfllhrung des Instituts hat die Arbeit vielseitig unterstützt. Weiterhin bin ich ehemaligen Kollegen und wissenschaftlichen Hilfskräften ftlr eine freundschaftliche Zusammenarbeit verbunden. Besondere Erwähnung verdient Herr Markus Köbel, dessen kurzes, aber engagiertes Gastspiel am FtW dazu beigetragen hat, daß das Gutachten pünktlich seinen Auftraggeber erreichen konnte. Mein Dank gilt auch den Damen des Sekretariats: Frau Edith Beyer, vor allem aber Frau Renate Simon ftlr ihre hohe Einsatzbereitschaft bei den umfangreichen Schreibarbeiten. Abschließen möchte ich diese Aufzählung mit Frau Margitta Hetzius, deren Beitrag zu einem guten Arbeitsklima im Institut ich nicht vergessen werde. Außerhalb des Forschungsinstituts danke ich meinen Eltern ftlr ihre vielseitige Unterstützung und schließlich Frau Katrin Westphal - ohne die die letzten zwei Jahre der Anfertigung dieser Arbeit nur halb so schön gewesen wären. Rüsselsheim, im Oktober 1996
Stefan Mitropoulos
Inbaltsverzeichnis Übersichtsverzeicbnis ................................................. ...... ... ... XV Abbildungsverzeicbnis ........................................................... XVI AbkOrzungsverzeicbnis ......................... ................ ... ........ ... XVIII A. Einleitung ............................................................................ . B. Verbraucberpolitiscbe Konzeptionen ................................ 4 1. Zum Begriff der wirtschaftspolitischen Konzeption ........ 4 2. Gliederungskriterien fUr eine Klassifizierung der ver-
braucherpolitischen Konzeptionen................................... 10
3. Darstellung der in der Wissenschaft entwickelten ver-
braucherpolitischen Konzeptionen ................................... 18 3.1 Wettbewerbspolitik als einzige Verbraucher-
politik ...................................................................... 18
3.2 Verbraucherpolitik als Ergänzung der Wettbe-
werbspolitik ............................................................. 23 3.2.1 Liberales Wettbewerbs- und Infonnations-
modell ........................................................... 23
3.2.2 Programmatische Verbraucherpolitik
(Scherhom) und das Gegenmachtmodell..... 29
3.2.3 Verbraucherpolitik auf verhaltenswissen-
schaftlicher Grundlage (Kroeber-Riel u.a.) .. 40
3.3 Interventionsstarke Konzeptionen ........................... 52 3.3.1 Partizipatorisch-emanzipatorischer An-
satz (Biervert u. a.) ....................................... 52
3.3.2 Verbraucherschutzkonzeption bei Simitis .... 63 3.3.3 Kommunikationsansatz von Czerwonka
u.a................................................................. 65
3.3.4 Ökologisch orientierte Ansätze und Ver-
braucherpolitik im öffentlichen Bereich....... 68
VIII
Inhaltsverzeichnis
3.4 Interventionsskeptische Konzeptionen........... .................. 72 3.4.1 Konzeption der Wettbewerbs- und Konsumfreiheit (Mähling) .................................. 72 3.4.2 Ökonomische Analyse des Rechts der Chicago School (Posner u. a.) ...................... 81 4. Zusammenfassende Würdigung der verbraucherpolitischen Konzeptionen....................................................... 92 C. Internationale Praxis der Verbraucherpolitik ...............
99
1. Einleitende Bemerkungen ................ .............................
99
1.1 Allgemeine Vorgehensweise ................................
99
1.2 Auswahl der untersuchten Länder und internationalen Organisationen........................................ 101 1.3 Informationsquellen und ihre Bewertung ............. 105 2. Verbraucherpolitische Praxis in Großbritannien ........... 107 2.1 Institutionelle Ausgestaltung der britischen Verbraucherpolitik ...................................................... 107 2.1.1 Verbraucherpolitische Verantwortlichkeiten auf ministerieller Ebene .................. 107 2.1.2 Office of Fair Trading ............................... 108 2.1.3 Trading Standards Departments ................ 113 2.1.4 Nationaler Verbraucherrat und Consumers in Europe Group ........................................ 114 2.1.5 Vertretung der Verbraucherinteressen in den verstaatlichten und den privatisierten Industrien ................................................... 118 2.1.6 Lokale Beratungsstellen ............................ 124 2.1.7 Consumer Policy Committee der British Standards Institution .................................. 128 2.1.8 Private britische Verbraucherverbände ..... 129
InhaltSllerzeichnis
IX
2.2 Allgemeine Charakterisierung der britischen
Verbraucherpolitik ................................................ 132
2.3 Einordnung der britischen Verbraucherpolitik
in die wirtschaftspolitische Gesamtkonzeption .... 139
3. Verbraucherpolitische Praxis in den Niederlanden ....... 144 3.1 Institutionelle Ausgestaltung der niederländi-
schen Verbraucherpolitik ...................................... 144
3.1.1 Verbraucherpolitische Verantwortlich-
keiten in der Regierung ............................. 144
3.1.2 Sozial-Ökonomischer Rat... ....................... 146 3.1.3 Private Verbraucherverbände .................... 150 3.1.4 Weitere verbraucherpolitisch relevante
Institutionen ............................................... 155
3.2 Allgemeine Charakterisierung der niederländi-
schenVerbraucherpolitik....................................... 160
3.3 Einordnung der niederländischen Verbraucher-
politik in die wirtschaftspolitische Gesamtkonzeption .................................................................. 166
4. Verbraucherpolitische Praxis in Schweden ................... 170 4.1 Vorbemerkungen .................................................. 170 4.2 Institutionelle Ausgestaltung der schwedischen
Verbraucherpolitik ................................................ 171
4.2.1 Die Rolle der Regierung in der Verbrau-
cherpolitik und Besonderheiten in der schwedischen Gesetzgebung ..................... 171
4.2.2 Die nationale Verbraucherschutzbehörde
und der Verbraucherombudsmann ............ 174
4.2.3 Zentrale Beschwerdestelle ......................... 184 4.2.4 Marktgericht .............................................. 186 4.2.5 Verbraucherpolitische Aktivitäten auf
lokaler Ebene ............................................. 189
X
Inhaltsverzeichnis
4.2.6 Aktuelle Bestrebungen zum Aufbau einer unabhängigen Verbraucherbewegung ....... 192 4.3 Allgemeine Charakterisierung der schwedischen Verbraucherpolitik ................................................ 195 4.4 Einordnung der schwedischen Verbraucherpolitik in die wirtschaftspolitische Gesamtkonzeption .... 198 5. Verbraucherpolitische Praxis in Frankreich .................. 205 5.1 Institutionelle Ausgestaltung der französischen Verbraucherpolitik ................................................ 205 5.1.1 Verbraucherpolitische Verantwortlichkeiten auf Regierungsebene ........................... 205 5.1.2 Institut National de la Consommation ....... 209 5.1.3 Verbraucherpolitisch relevante Beratungsgremien der französischen Regierung ....... 213 5.1.4 Die privaten Verbraucherorganisationen in Frankreich ............................................. 215 5.1.5 Verbrauchervertretung auf regionaler und lokaler Ebene ............................................. 222 5.2 Allgemeine Charakterisierung der französischen Verbraucherpolitik ................................................ 224 5.3 Einordnung der französischen Verbraucherpolitik in die wirtschaftspolitische Gesamtkonzeption .... 229 6. Verbraucherpolitische Praxis in den Vereinigten Staaten ........................................................................... 233 6.1 Institutionelle Ausgestaltung der US-amerikanischen Verbraucherpolitik ...................................... 233 6.1.1 Verbraucherpolitische Aktivitäten der Bundesregierung.... .................. .................. 233 6.1.2 Unabhängige Regulierungskommissionen 236 6.1.3 Verbraucherschutzbehörden auf einzelstaatlicher, regionaler und lokaler Ebene.. 247
Inhaltsverzeichnis
XI
6.1.4 Private Verbraucherverbände von nationaler Bedeutung.. ....................................... 251 6.1.5 Die "Consumerism"-Bewegung und ihre Organisationen .......................................... 265 6.1.6 Selbstregulierung der Wirtschaft............... 260 6.2 Allgemeine Charakterisierung der US-amerikanischen Verbraucherpolitik ................................... 263 6.3 Einordnung der US-amerikanischen Verbraucherpolitik in die wirtschaftspolitische Gesamtkonzeption ............................................................ 268 7. Verbraucherpolitische Aktivitäten internationaler Organisationen .............................................................. 272 7.1 Vereinte Nationen ................................................. 272 7.2 OECD ................................................................... 276 7.3 Die Verbraucherpolitik der europäischen Union .. 279 7.3.1 Vorbemerkungen ....................................... 279 7.3.2 Institutionelle Ausgestaltung der EU-Verbraucherpolitik .......................................... 280 7.3.3 Allgemeine Charakterisierung der Verbraucherpolitik der Europäischen Union ... 288 8. Vergleichende Betrachtung der internationalen verbraucherpolitischen Praxis ............ .................. ........ ...... 296 8.1 Einleitende Bemerkungen..................................... 296 8.2 Institutionelle Ausgestaltung der Verbraucherpolitik.................................................................... 297 8.2.1 Verbraucherpolitik auf Regierungsebene und nationale Verbraucherschutzbehörden 297 8.2.2 Beratungsgremien der Regierung .............. 299 8.2.3 Private Verbraucherverbände .................... 301 8.2.4 Lokale Verbraucherberatungsstellen ......... 305
XII
Inhaltsverzeichnis
8.2.5 Struktur der organisierten Verbraucherinteressen ............. ................ ...... ........... ........ 307 8.3 Neuere Entwicklungen in der Verbraucherpolitik ausgewählter Länder............................................. 3 11 8.3.1 Verbraucherpolitische Konzeption und wirtschaftspolitische Gesamtkonzeption ... 311 8.3.2 Staatliche Ausgaben rur Verbraucherpolitik ........................................................ 313 8.3.3 Selbstregulierung der Wirtschaft ............... 315 8.3.4 Kennzeichen einer Tendenz zu stärker marktwirtschaftlicher Orientierung ........... 317
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer
Ansätze .............................................................................. 332 1. Vorbemerkungen ........................................................... 332 2. Informationsökonomik .................................................. 324 2.1 Grundlagen der Informationsökonomik ............... 324 2.1.1 Einordnung des Ansatzes .......................... 324 2.1.2 Das Gut Information und seine besonderen Eigenschaften ...................................... 326 2.1.3 Informationsökonomische Güterklassifikation ......................................................... 331 2.2 Probleme asymmetrischer Informationsverteilung 334 2.2.1 Adverse Selektion und Moral Hazard ....... 334 2.2.2 Marktliehe Lösungsmöglichkeiten: Screening und Signaling ............................ 337 2.2.3 Verbraucherpolitische Maßnahmen .......... 341 2.3 Kritische Beurteilung der Informationsökonomik aus verbraucherpolitischer Sicht ........................... 343 3. Neue Institutionenökonomik ......................................... 348
Inhaltsverzeichnis
XIII
3.1 Grundlagen der Neuen Institutionenökonomik .... 348 3.2 Transaktionskostenansatz ..................................... 353 3.3 Property Rights- Theorie ....................................... 356 3.4 Principal-Agent-Ansatz und ökonomische Vertragstheorie ........................................................... 360 3.5 Kritische Beurteilung der Neuen Institutionenökonomik aus verbraucherpolitischer Sicht.. ........ 364 4. Evolutionsökonomik ..................................................... 367 4.1 Einordnung des Ansatzes ...................................... 367 4.2 Gegenüberstellung von Informations- und Evolutionsökonomik ...................................................... 370 4.3 Evolutionsökonomische Beiträge zur Verbraucherpolitik ............................................................. 373 4.4 Kritische Beurteilung der Evolutionsökonomik aus verbraucherpolitischer Sicht ........................... 377 5. Politisch-ökonomische Ansätze .................................... 380 5.1 Einordnung der politisch-ökonomischen Ansätze 380 5.2 Vorgehensweise zur Ableitung eines politischökonomischen Modells der Verbraucherpolitik ... 385 5.3 Komponenten des politisch-ökonomischen Modells ................................................................. 390 5.3.1 Demokratie ................................................ 390 5.3.2 Interessenvertretung .................................. 395 5.3.3 Bürokratie .................................................. 400 5.3.4 Wissenschaft .............................................. 404 5.3.5 Politisch-ökonomisches Umfeld ................ 405 5.4 Zusammenschau der Komponenten ...................... 409
XIV
Inhaltsverzeichnis
E. Fazit
413
1. Vorbemerkungen ........................................................... 413
2. Ergebnisse grundsätzlicher Art ..................................... 413 2.1 Einordnung in die Gesamtkonzeption. ................. 413
2.2 Situationsanalyse und verbraucherpolitische Ziele 415 2.3 Beurteilungskriterien ft1r verbraucherpolitische Methoden .............. ....... ........................... .............. 418 2.4 Verbraucherpolitik im weiteren und im engeren Sinne ..................................................................... 420
2.5 Träger der Verbraucherpolitik.............................. 423
3. Spezielle Ergebnisse ..................................................... 425 Literaturverzeichnis ............ ........ ...................................... ..... 431 Anhang .................................................................................... 455
Obersichtsverzeichnis Übersicht 1:
Wichtige verbraucherpolitische Ereignisse in Großbritannien ......... ............... ............... ......... 142
Übersicht 2:
Wichtige verbraucherpolitische Ereignisse in den Niederlanden ............................................ 169
Übersicht 3:
Wichtige verbraucherpolitische Ereignisse in Schweden .................................................. ...... 200
Übersicht 4:
Wichtige verbraucherpolitische Ereignisse in Frankreich......................... .............................. 231
Übersicht 5:
Wichtige verbraucherpolitische Ereignisse in den USA .......................................................... 271
Übersicht 6:
Wichtige verbraucherpolitische Ereignisse in der Europäischen Union.................................. 294
Übersicht 7:
Die Testorganisationen in den untersuchten Ländern ........................................................... 303
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1:
Gliederungskriterien rur eine KlassifIzierung verbraucherpolitischer Konzeptionen und Merkmale einer Konzeption ...........................
11
Abbildung 2:
Übersicht der in der Studie behandelten verbraucherpolitischen Konzeptionen und Ansätze 17
Abbildung 3:
Zielsystem der Verbraucherpolitik..................
33
Abbildung 4:
Einschränkungen der Konsumfreiheit bei Scherhorn ........................................................
39
Abbildung 5:
Schema der Verbraucherpolitik bei KroeberRiel..................................................................
47
Abbildung 6:
Zielsystem der Konzeption von Mähling........
76
Abbildung 7:
Spektrum verbraucherpolitischer Konzeptionen 94
Abbildung 8:
Die wichtigsten verbraucherpolitischen Institutionen in Großbritannien.............................. 13 7
Abbildung 9:
Die wichtigsten verbraucherpolitischen Institutionen in den Niederlanden.......................... 163
Abbildung 10: Das schwedische Verbraucherschutzamt und seine Vorgängerorganisationen ................ 175 Abbildung 11: Die wichtigsten verbraucherpolitischen Institutionen in Schweden ...................................... 196 Abbildung 12: Die wichtigsten verbraucherpolitischen Institutionen in Frankreich ..................................... 226 Abbildung 13: Die wichtigsten verbraucherpolitischen Institutionen in den USA ........................................ 266 Abbildung 14: Die wichtigsten verbraucherpolitischen Institutionen in der Europäischen Union ............... 287 Abbildung 15: Informationsökonomisches Dreieck nach Weiber/Adler................................................... 334
Abbildungsverzeichnis
XVII
Abbildung 16: Mögliche Lösungen bei adverser Selektion durch asymmetrische Information .................. 339 Abbildung 17: Interaktionsstrukturen der Regulierung bei Schubert .......................................................... 412
2 Mitropoulos
Abkürzungsverzeichnis
Zeitschriften FAZ
-
GRUR Int. -
Frankfurter Allgemeine Zeitung Gewerblicher Rechtschutz und Wettbewerb, Internationaler Teil
JCP
-
Journal of Consumer Policy
WiSt
-
Wirtschaftswissenschaftliches Studium
WISU
-
Das Wirtschaftsstudium
ZfV
-
Zeitschrift ftlr Verbraucherpolitik
ZgS
-
Zeitschrift rur die gesamte Staatswissenschaft
ZWS
-
Zeitschrift rur Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Abkürzungen britischer Institutionen BSI
-
British Standards Institution
CAB
-
Citizens' Advice Bureaux
CAC
-
Consumer Advice Centres
CECG
-
Consumers in the European Community Group
CEG
-
Consumers in Europe Group
DTI
-
Department of Trade and Industry
LACOTS
-
Local Authorities Coordinating Body on Trading Standards
NACAB
-
National Association of Citizens Advice Bureaux
NCC
-
National Consumer Council
NFCG
-
National Federation of Consumer Groups
NICC
-
National Industry Consumer Council
OFFER
-
Office of Electricity Regulations
OFGAS
-
Office of Gas Supply
OFT
-
Office of Fair Trading
OFTEL
-
Office of Telecommunications
OFWAT
-
Office of Water Supply
AbkiJrzungsverzeichnis
XIX
Abkürzungen niederländischer Institutionen AKB
-
Alternatieve Konsumenten Bond
CCA
-
Commissie vor Consumentenaangelegenheden Consumenten Commissie voor Europa
CCE CDA
-
Christen Democratisch Appel
COMAC
-
Coördinatiepunt Massamediale Consumentenvoorlichting
D'66
-
Democraten '66 Interministerieller Ausschuß ft1r Verbraucherangelegenheiten
ICC NIBUD
-
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
PrdA
-
Partij van de Arbeid
SCV
Stichting Consument en Veiligheit
SER
Sociaal-Economische Raad
SGC
Stichting Geschillencommissies vor Consumentenzaken
STISAM
Stichting Samenswerking
SVWO
Stichting Vergelijkend Warenonderzoek
SWOKA
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Konsumentenaangelegenheden
VVD
-
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Abkürzungen schwedischer Institutionen ARN
-
Allmänna Reklamationsnämnden (Zentrale Beschwerdestelle)
HFI
-
Hemmens Forskningsinstitut (Institut ft1r Haushaltsforschung)
KF
-
Kooperativa Förbundet (Genossenschaftsverband)
KI
-
Konsumentinstitutet (Institut rur Verbraucherinformation)
KO KOV 2"
Konsumentombudsmannen -
Konsumentverket (Verbraucherschutzamt)
xx
Abkürzungsverzeichnis
KR
Konsumenträdet (Rat rur Verbraucherforschung und -infonnation)
LO
-
Landsorganisationen (Schwedischer Gewerkschaftsdachverband)
NO
-
Näringsfrihetombudsmannen (Wettbewerbsombudsmann)
SOU
Statens offentliga utredningar (Öffentliche Untersuchungen des Staates)
SPK
Statens Pris- och Kartellnämd (Staatliches Preisund Kartellamt)
TCO
-
Tjänstemännens Centralorganisation (Zentralgewerkschaft der Angestellten)
VON
-
Varudeklarationsnämnden (Institut ft1r infonnative Warenkennzeichnung)
Abkürzungen französischer Institutionen CCA
Chambre de Consommation d'Alsace
COC
-
Comites Oepartementaux de la Consommation
CLIP
-
Centres Locaux d'Infonnation sur les Prix
CNC
Conseil National de la Consommation
CRC
-
Centre Regional de la Consommation
CSC
-
Commission de la Securite des Consommateurs
CTRC
-
Centre Technique Regional de la Consommation
OGCCRF -
Oirection Generale de la Concurrence, de la Consommation et de la Repression des Fraudes
FNCC
Federation Nationale des Cooperatives de Consommation
-
INC
Institut National de la Consommation
OR.GE.CO -
Organisation Generale des Consommateurs
UFC
-
Union Federale des Consommateurs
UNAF
-
Union Nationale des Associations Familiales
AbkiJrzungsverzelchnis
XXI
Abkürzungen amerikaniseher Institutionen ACCI
-
American Council of Consumer Interests
BBB
-
Better Business Bureau
CAC
-
Consumer Affairs Council
CAP
Consumer Action Panel
CBBB
-
Council of Better Business Bureaus
CFA
-
Consumer Federation of America
CPSC
Consumer Product Safety Commission
CU
Consumers Union
FDA
-
Food and Drug Administration
FTC
-
Federal Trade Commission
LARB
-
Local Advertising Review Board
NACAA
-
National Association ofConsumer Agency Administrators
NAD
-
National Advertising Division
NARB
-
National Advertising Review Board
NCL
-
National Consumers League
PIRG
-
Public Interest Research Group
USOCA
-
United States Office of Consumer Affairs
Internationale Institutionen: ANEC
-
Association de la Normalisation Europeenne pour les Consommateurs
BEUC
-
Bureau Europeen des Unions de Consommateurs
CCC
-
Conseil Consultatif des Consommateurs (Consumers Consultive Council)
COFACE -
Comite des Organisations Familiales aupre des Communautes Europeenes
EFTA
-
Europäische Freihandelszone
EG
-
Europäische Gemeinschaft
ETUC
-
European Trade Unions Council
Ablcürzungsverzeichnis
XXII
EU Europäische Union Eurocoop - European Federation of Consumer Cooperatives IOCU - International Organization of Consumers Unions OECD - Organisation for Economic Co-Operation and Development Secretariat Coordination pour la Normalisation SECO UNO - United Nations Organisation Währungszeichen
US-Dollar britisches Pfund - European Currency Unit französische Francs - niederländische Gulden - schwedische Kronen
$
-
f.
-
ECU FF NLG SKr
Sonstige Abkürzungen
Aufl. Bd. Diss. Hrsg. Jg. Mio. N.F. Nr. o. J. Univ.
- Auflage - Band - Dissertation - Herausgeber - Jahrgang - Millionen - Neue Folge - Nummer - ohne Jahr - Universität
A. Einleitung Ihre Glanzzeit hat die Verbraucherpolitik in den 70er Jahren erlebt, in denen sie sich zu einem eigenständigen Teilbereich der Wirtschaftspolitik entwickelt hat. Nachdem in den Industrieländern damals das Interesse an Problemen der Verbraucher in den Vordergrund getreten ist, sind staatliche Institutionen und RegierungssteIlen eingerichtet worden, um sich mit Verbraucherpolitik und Verbraucherschutz zu beschäftigen, und auch privaten Verbraucherverbänden ist es - teilweise erst durch starke staatliche UnterstUtzung - gelungen, sich als Interessenvertretung der Konsumenten zu etablieren. Zugleich hat sich auch die Wissenschaft und zwar insbesondere die wirtschaftswissenschaftlichen Disziplinen und die Rechtswissenschaft - dem Erkenntnisobjekt Verbraucherpolitik zugewandt. Vor allem sind bis Anfang der 80er Jahre eine Reihe zum Teil kontroverser Konzeptionen zur Rolle des Verbrauchers und zur Notwendigkeit verbraucherpolitischen Handelns entstanden. In der Folgezeit ist es dann um dieses Politikfeld etwas ruhiger geworden. Die Zahl der einschlägigen Veröffentlichungen hat abgenommen, und es sind inhaltlich kaum völlig neue Gesichtspunkte entdeckt worden. Mehrere Gründe lassen den Zeitpunkt ft1r eine Bestandsaufnahme sowohl der theoretischen als auch der praktischen Verbraucherpolitik als geeignet erscheinen. Gerade weil die wissenschaftliche Auseinandersetzung um verbraucherpolitische Konzeptionen mittlerweile eine gewisse Reife erreicht hat, liegt es nahe, die einzelnen Konzepte einer vergleichenden Analyse zu unterziehen. Darüber hinaus zeichnen sich in jüngster Zeit theoretische Entwicklungen in den Wirtschaftswissenschaften ab, die der Verbraucherpolitik neue Impulse zu geben versprechen. Die Bestandsaufnahme der (älteren) verbraucherpolitischen Konzeptionen kann deshalb jetzt nutzbringend ergänzt werden um eine Untersuchung neuerer Ansätze und deren verbraucherpolitische Bedeutung. Im Zuge einer Tendenz zu konsequent marktwirtschaftlicher und generell zurückhaltender Wirtschaftspolitik in vielen Staaten geriet auch die Verbraucherpolitik unter Rechtfertigungszwang und damit in das Blickfeld der Politik. So fragt sich, welche Erklärungen filr die Notwendigkeit und welche Möglichkeiten der Ausgestaltung von Verbraucherpolitik die Wissenschaft anzubieten hat.
2
A. Einleitung
Außerdem können die Erfahrungen mit konzeptionellen Änderungen der verbraucherpolitischen Praxis dargestellt und einer Bewertung unterzogen werden. Der vennutlich wichtigste Impuls für eine Wiederbelebung des Interesses an der Verbraucherpolitik geht von der Europäischen Union aus. Durch die fortschreitende Verwirklichung des europäischen Binnenmarktes treten verbraucherpolitische Fragestellungen wieder stärker in den Vordergrund. So ist im Maastricht-Vertrag von 1992 der Verbraucherschutz ausdrücklich als eigenständiger Politikbereich auf Gemeinschaftsebene vorgesehen. Die Europäische Union hat damit in den letzten Jahren ein neues Handlungsfeid gefunden, das seinen Ausdruck vor allem in einer Vielzahl von Richtlinien findet, die von den Mitgliedstaaten in nationales Recht umzusetzen sind. Dabei darf die Frage nach den grundsätzlichen, konzeptionellen Möglichkeiten einer Ausgestaltung von Verbraucherpolitik nicht aus den Augen verloren werden. Letztlich erfordern die Aktivitäten der Europäischen Union, in der verschiedene verbraucherpolitische Konzeptionen aufeinandertreffen, eine Bestandsaufuahme und besondere Auseinandersetzung mit diesem Politikbereich zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Der Aufbau der Studie ist viergeteilt. Der erste Teil ist den verbraucherpolitischen Konzeptionen gewidmet. Ausgehend vom Fachbegriff der "wirtschaftspolitischen Konzeption" in der theoretischen Wirtschaftspolitik wird zunächst dargestellt, was speziell unter einer "verbraucherpolitischen Konzeption" zu verstehen ist. Darauf aufbauend erfolgt die Abgrenzung und systematische Erörterung der wichtigsten verbraucherpolitischen Konzeptionen aus dem deutschsprachigen Schrifttum. Sie wird ergänzt um die verbraucherpolitischen Vorstellungen der "Economic Analysis of Law" (Chicago School), die eine herausragende Position in der US-amerikanischen Literatur einnimmt. Im zweiten Teil der Arbeit fmdet sich die Analyse der verbraucherpolitischen Praxis in ausgewählten Ländern. In fünf Länderberichten wird dargestellt, welche Ausprägung die Verbraucherpolitik in Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, in Schweden sowie in den Vereinigten Staaten gefunden hat und welche aktuellen Entwicklungen dort zu beobachten sind. Daran
A. Einleitung
3
schließt sich die Untersuchung der verbraucherpolitischen Aktivitäten internationaler Organisationen (Europäische Union, Vereinte Nationen und OECD) an. Im Anschluß daran werden im dritten Teil weitere, meist neuere theoretische Ansätze darauf untersucht, welche Impulse von ihnen auf die Verbraucherpolitik ausgehen können. Es ist dabei auf die Informationsökonomik, die sogenannte "Neue Institutionenökonomik", die Evolutionsökonomik sowie auf die Neue Politische Ökonomie und damit verwandte politische Ansätze einzugehen. Mit Hilfe der aus diesen theoretischen Ansätzen zusätzlich gewonnenen Erkenntnisse - aber auch unter Berücksichtigung der Erfahrungen internationaler verbraucherpolitischer Praxis - wird im abschließenden vierten Teil der Untersuchung die konzeptionelle Betrachtung des ersten Teils wiederaufgenommen. Ziel ist es dabei, Ansatzpunkte rur eine bessere theoretische Fundierung der Verbraucherpolitik aufzuzeigen und einen Beitrag rur die Weiterentwicklung bestehender verbraucherpolitischer Konzeptionen zu leisten.
B. Verbraucherpolitische Konzeptionen 1. Zum Begriff der wirtschaftspolitischen Konzeption In der deutschsprachigen Literatur zur Verbraucherpolitik wird der Begriff der verbraucherpolitischen Konzeption nur von einigen Autoren verwendet. In vielen Veröffentlichungen taucht der Begriff gar nicht auf oder wird nur als Synonym gleichzeitig mit den Ausdrücken Modell, Ansatz und Theorie der Verbraucherpolitik bzw. des Verbraucherschutzes benutzt. Selbst die Autoren, die den Begriff verbraucherpolitische Konzeption offensichtlich bewußt gewählt haben, wenden ihn nicht einheitlich an. Der Begriff wird an keiner Stelle erörtert, so daß lediglich aus den jeweiligen Ausftlhrungen indirekt hervorgeht, was man darunter zu verstehen hat. I Bei der verbraucherpolitischen Konzeption handelt es sich damit keineswegs um einen in der Wissenschaft eingeftlhrten und defmierten Ausdruck. Angesichts dieses Begriffwirrwarrs verwundert es nicht, daß wie im nächsten Abschnitt gezeigt wird - auch keine einheitliche Abgrenzung und Klassifizierung der Konzeptionen, Ansätze oder Modelle der Verbraucherpolitik vorzufmden ist. Dabei ist die fehlende Begrifflichkeit in der verbraucherpolitischen Literatur insoweit unverständlich, als in der theoretischen Wirtschaftspolitik mit dem Ausdruck wirtschaftspolitische Konzeption "nicht nur ein feststehendes Wortgebilde, sondern auch ein Begriff mit klar umrissenen Inhalt"2 verbunden ist. Die vorgenommene Klärung von Defmitionen erfolgt, weil sich darauf in den nachfolgenden Teilen der Studie aufbauen läßt. "Unter Berücksichtigung der spektralen Vielfalt (... ) ist die wissenschaftliche Wirtschaftspolitik darum I Vgl. dazu vor allem CZERWONKA, C., und SCHÖPPE, G., Verbraucherpolitische Konzeptionen und Programme in der Bundesrepublik Deutschland, in: ZfW, Jg. I (1977), S. 277-288, und REICH, N. u. a., Verbraucher und Recht. Überholte Konzeptionen, LÜcken und Mängel in wichtigen Verbrauchergesetzen und die Praxis der Rechtsprechung, Göttingen 1976, S. 19-24. Reichs frühe Verwendung des Konzeptionsbegriffs in der deutschen Literatur ist von besonderer Bedeutung, da seine Zweiteilung in marktkomplementllre und marktkompcnsierende Konzeptionen von vielen anderen Autoren aufgegriffen wird. 2 Vgl. SCHACHTSCHABEL, H. G., Wirtschaftspolitische Konzeptionen, 3. Aufl., Stuttgart u.a. 1976, S. 14.
J. Begriff der wirtschaftspolitischen Konzeption
5
bemüht, ( ... ) einen Überblick über den gesamten Komplex historisch feststellbarer wie aktuell praktizierter Wirtschaftspolitik zu erhalten, (00') [um] eine Systematik wirtschaftspolitischer Aktivität zu ermöglichen. Zur Bewältigung dieser Aufgabe bietet sich der Begriff der wirtschaftspolitischen Konzeption an. "3 Im folgenden soll zunächst der Fachbegriff der "wirtschaftspolitischen Konzeption" aus der theoretischen Wirtschaftspolitik mit seinen wesentlichen Merkmalen dargestellt werden. Danach wird der Begriff sinngemäß auf die "verbraucherpolitische Konzeption" übertragen und dessen Verwendung im weiteren Verlauf dieser Arbeit deutlich gemacht. Das "Denken in Konzeptionen" kann dabei als typisch deutsches Phänomen angesehen werden. Deshalb bleiben die Ausführungen zu den verbraucherpolitischen Konzeptionen in diesem Teil der Arbeit zunächst größtenteils auf die deutsche Literatur begrenzt. Dies bedeutet allerdings nicht, daß sich die Wissenschaft in anderen Ländern nicht ebenso intensiv mit verbraucherpolitischen Fragen beschäftigt.4 In der theoretischen Wirtschaftspolitik wird die wirtschaftspolitische Konzeption, die auf Pütz zurückgeht, als gedankliches und längerfristig gültiges Leitbild einer anzustrebenden Wirtschaftsgestaltung bezeichnet. Sie soll als möglichst widerspruchsfreies und geschlossenes System von Zielen, ordnungspolitischen Grundsätzen und Methoden den wirtschaftspolitischen Entscheidungsträgern als Orientierungsrahmen dienen, um rationale Entscheidungen zu erleichtern (Leitbild-Funktion).5 Die wirtschaftspolitische Konzeption ist vom Begriff des wirtschaftspolitischen Programms abzugrenzen. Das Programm stellt gegenüber der Konzeption einen konkreten Handlungsplan dar, der auf eine bestimmte Periode bezogen sowie in der Regel kurz- bis mittelfristig ausgerichtet
3 Ebenda, S. 12. 4 Dazu wird auf die neueren theoretischen Ansätze und die Lllnderkapitel an späterer Stelle der Arbeit verwiesen. 5 Vgl. zur Definition: GIERSCH, H., Allgemeine Wirtschaftspolitik - Band I Grundlagen, Wiesbaden 1961, S. 135; POTZ, T., Grundlagen der theoretischen Wirtschaftspolitik, 4. Aufl., Stuttgart, New York 1979, S. 224-230, sowie STREIT, M. E., Theorie der Wirtschaftspolitik, 4. Aufl., Düsseldorf 1991, S. 254.
6
B. Verbraucherpolitische Konzeptionen
ist und für diesen Zeitraum angestrebte, operationale Zielgrößen und zu treffende Maßnahmen enthält. 6 Auch in der vorliegenden Arbeit soll zwischen den meist von der Wissenschaft entwickelten Konzeptionen und den Programmen der politischen Praxis, z. B. einer Regierung, von Parteien oder anderen wirtschaftspolitisch tätigen Institutionen, unterschieden werden. Dabei kann - und sollte bei rationalem wirtschaftspolitischen Vorgehen - dem Programm eine Konzeption zugrunde liegen.' Nach Schachtschabel besteht jede wirtschaftspolitische Konzeption aus vier charakteristischen Merkmalen: Situationsanalyse, ordnungspolitische Prinzipien, wirtschaftspolitische Ziele und Methoden. 8 In der Situationsanalyse wird zunächst die wirtschaftspolitische Ausgangslage (Ist-Zustand) untersucht. Im Vergleich mit den wirtschaftspolitischen Zielvorstellungen (Soll-Zustand) können dann bestehende Mängel diagnostiziert und geeignete Therapien durch wirtschaftspolitische Methoden entwickelt werden. Die Methoden als Merkmal oder Bestandteil der wirtschaftspolitischen Konzeption sind dabei von den konkreten Maßnahmen (hier synonym verwendet mit Instrument und Mittel) zu unterscheiden, wie sie in Programmen oder in der politischen Praxis formuliert und eingesetzt werden. Die Methoden geben nur die Art und Weise des Vorgehens, den Weg zur Erreichung der Ziele an. 9 Die ordnungspolitischen Prinzipien beschreiben, wie das Verhältnis zwischen Individuum und Gesamtgesellschaft in einer Wirtschaftsordnung gestaltet ist bzw. wie die Kompetenzen zwischen dem einzelnen und dem Staat verteilt sind. Die Realität liegt dabei in Form von Mischsystemen zwischen den extremen Polen Individualprinzip und Sozialprinzip vor. Dabei führt das reine Individualprinzip mit dem Ideal uneingeschränkter Freiheit des einzelnen politisch zum Liberalismus und wirtschaftlich zur Ord6 Vgl. PüTZ, T., 1979, S. 230. 'Vgl. STREIT, M. E., 1991, S. 254. 8 Vgl. SCHACHTSCHABEL, H. G., 1976, S. 16-30. 9 Vgl. PüTZ, T., Die wirtschaftspolitische Konzeption, in: SERAPHIM, H. 1. (Hrsg.), Zur Grundlegung wirtschaftspolitischer Konzeptionen (Schriften des Vereins fIlr Socialpolitik, N.F., Bd. 18), Berlin 1960, S. 14.
J. Begriff der wirtschaftspolitischen Konzeption
7
nungsfonn der Marktwirtschaft. Die extreme Anwendung des Sozialprinzips dagegen ftlhrt politisch zum Sozialismus und bewirkt eine Hinwendung zur Zentralverwaltungswirtschaft. IO Alle vier aufgeftlhrten Merkmale sollten von einer wirtschaftspolitischen Konzeption angesprochen werden. Um dem Anspruch der Rationalität zu genügen, müssen Ziele, Methoden und ordnungspolitische Grundsätze aufeinander abgestimmt und widerspruchsfrei fonnuliert sein. Als wichtige wirtschaftspolitische Konzeptionen werden in der theoretischen Wirtschaftspolitik die historischen (klassischen) Konzeptionen des Liberalismus und Sozialismus behandelt und als aktuelle Konzeptionen wegen ihrer besonderen Bedeutung ftlr die Wirtschaftspolitik der Bundesrepublik Deutschland der Ordoliberalismus, die Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft und des Demokratischen Sozialismus. 11 Die vier vorgestellten Merkmale einer wirtschaftspolitischen Konzeption können ohne besondere Schwierigkeiten sinnvoll auf den Begriff der verbraucherpolitischen Konzeption übertragen werden, wie er in dieser Arbeit verwendet wird. Auch die verbraucherpolitische Konzeption sollte vollständig sein in dem Sinne, daß zu allen Merkmalen Aussagen getroffen werden. 12 Diese Überlegung hat in der vorliegenden Studie dazu geftlhrt, die "echten" verbraucherpolitischen Konzeptionen von solchen Ansätzen zu trennen und gesondert zu behandeln, die zwar ftlr die Verbraucherpolitik relevant sind, jedoch nicht dem zugrundegelegten Konzeptionsbegriff entsprechen. 13 Diese Ansätze vor allem 10 Vgl. SCHACHTSCHABEL, H. G., 1976, S. 18 f. 11 Vgl. im einzelnen SCHACHTSCHABEL, H. G., 1976, S. 39-104, oder GIERSCH, H., 1961, S. 181-190. 12 Die Verwendung des Konzeptionsbegriffs bei Vahrenkamp, der bei seiner Klassifikation nur den methodischen Aspekt aufgreift, ist deshalb abzulehnen. Vgl. VAHRENKAMP, K., Verbraucherschutz bei asymmetrischer Information. Informationsökonomische Analysen verbraucherpolitischer Maßnahmen, MUnchen 1991, S. 19. 13 Ein vergleichbares Vorgehen findet sich bisher nur bei FLEISCHMANN, G., Verbraucherpolitik, in: ISSING, O. (Hrsg.), Spezielle Wirtschaftspolitik, MUnchen
8
B. Verbraucherpolitische Konzeptionen
der Infonnations- und Institutionenökonomik sowie der Neuen Politischen Ökonomie sind nicht nur bisher erst vereinzelt auf den Bereich der Verbraucherpolitik angewendet worden, ihnen fehlen zudem Aussagen zu einzelnen Merkmalen der verbraucherpolitischen Konzeption, besonders zur Situationsanalyse. 14 Durch die Situationsanalyse im Rahmen einer verbraucherpolitischen Konzeption erfolgen Aussagen zur Notwendigkeit einer Verbraucherpolitik in der jeweiligen Ausgangslage sowie zur Beurteilung bisheriger Aktivitäten. Die Betrachtung der verbraucherpolitischen Ziele unterscheidet sich von denen der wirtschaftspolitischen Konzeption lediglich darin, daß es sich um Ziele eines Teilbereichs der Wirtschaftspolitik handelt. Außerdem hat eine verbraucherpolitische Konzeption zu den verbraucherpolitischen Methoden Stellung zu nehmen. Hier kann in Anlehnung an in der Literatur verbreitete Einteilungen z. B. in der ungefllhren Reihenfolge zunehmender Eingriffsintensität unterschieden werden zwischen Verbraucherinfonnation, Verbraucherbildung und -erziehung, freiwilligen Abkommen, Förderung von Verbraucherorganisationen und rechtlichem Verbraucherschutz (Zwang in Fonn von Verboten und Geboten). Das Merkmal der ordnungspolitischen Prinzipien schließlich soll Auskunft geben über die in der Konzeption vorgesehenen Akteure der Verbraucherpolitik. Es sollte gezeigt werden, wie die Kompetenzen zwischen dem Staat und den einzelnen Individuen, sowie zusätzlich den Interessenverbänden von Konsumenten und Produzenten verteilt sind. Bezüglich der Verbraucherorganisationen ist zu klären, ob diese primär privat oder staatlich fmanziert werden sollen. Bei der verbraucherpolitischen Konzeption handelt es sich um eine Teilkonzeption lS , die sich auf die Verbraucherpolitik als Teil1982, S. 63-79, der verbraucherpolitische Konzeptionen als normative Theorien von positiven Theorien, die rur die Verbraucherpolitik wichtig sind, unterscheidet. 14 Vgl. hierzu auch die Abgrenzung der wirtschaftspolitischen Konzeption von Modellen, denen die prinzipielle Realisierbarkeit und der Bezug zur historischen Ausgangslage fehle, bei: NEUHAUSER, G., Die wirtschaftspolitische Konzeption als Problem der theoretischen Wirtschaftspolitik, in: SERAPHIM, H. J. (Hrsg.), Zur Grundlegung wirtschaftspolitischer Konzeptionen, Berlin 1960, S. 30 f. 15 Vgl. PüTZ, T., 1960, S. 11, sowie SCHACHTSCHABEL, H. G., 1976, S. 35.
J. Begriff der wirtschaftspolitischen Konzeption
9
bereich der Wirtschaftspolitik und deren - in der wirtschaftspolitischen (Gesamt-)Konzeption implizit schon angelegten, aber noch nicht ausdrücklich berücksichtigten - Besonderheiten erstreckt. Aus der Übertragung des ursprünglich ft1r die Gesamtkonzeption entwickelten Begriffs auf eine Teilkonzeption ergibt sich als zusätzliches, ftlnftes Merkmal die "Einordnung in die Gesamtkonzeption" . Jede verbraucherpolitische Konzeption soll deshalb auf ihre Aussagen zum Stellenwert der Verbraucherpolitik innerhalb der Wirtschaftspolitik, zur Legitimation der Verbraucherpolitik und ihrem Verhältnis zu anderen Politikbereichen, besonders zur Wettbewerbspolitik, überprüft werden, um dem Postulat der Kompatibilität zu genügen. Nicht als eigenständiges Merkmal einer verbraucherpolitischen Konzeption, sondern aus der Aufgabenstellung und Zielrichtung dieser Studie - nämlich der Berücksichtigung und Zusammenschau der wissenschaftlichen Ansätze und der politischen Praxis - ergibt sich mit der praktischen Bedeutung und politischen Durchsetzbarkeit ein sechster und letzter Aspekt, der bei der Analyse jeder der im folgenden behandelten verbraucherpolitischen Konzeptionen beachtet werden soll. Auf dieser begrifflichen Klärung aufbauend, kann im nächsten Abschnitt eine geeignete Abgrenzung und Klassifizierung verbraucherpolitischer Konzeptionen erfolgen. Bei der anschließenden Erörterung der in der Wissenschaft entwickelten verbraucherpolitischen Konzeptionen trägt der Konzeptionsbegriff zu einer systematischen Darstellung bei, indern jeweils die oben besprochenen Merkmale sowie die Relevanz der Konzeption in der Praxis berücksichtigt werden. Außerdem lassen sich durch den Konzeptionsbegriff die Interdependenzen zwischen den wissenschaftlichen Ansätzen und der politischen Praxis verdeutlichen. So müssen nicht nur die von der Wissenschaft entwickelten Konzepte vor dem Hintergrund ihres Bezugs zur Praxis gesehen werden. Auch bei der Darstellung und Bewertung der tatsächlich vorgefundenen Verbraucherpolitiken muß stets hinterfragt werden, ob eine und wenn ja, welche Konzeption zugrunde liegt - soll doch gerade die Konzeption als Orientierungsrahmen ft1r wirtschaftspolitische Aktivitäten zur Erleichterung rationalen Vorgehens und damit zur Vermeidung nicht aufeinander abgestimmter Einzelrnaßnahmen
10
B. Verbraucherpolitische Konzeptionen
dienen. Bei einem in der politischen Auseinandersetzung untergeordneten und in den letzten Jahren weniger beachteten Politikfeld wie der Verbraucherpolitik ist darüber hinaus zu überprüfen, ob der verbraucherpolitischen Praxis überhaupt eigenständige Konzeptionen zugrunde liegen oder diese sich vielmehr an die allgemein vorherrschenden wirtschaftspolitischen Konzeptionen anlehnen. Dies erfordert, daß letztere in geeigneter Weise in die Betrachtung einbezogen werden. 2. Gliederungskriterien rür eine KlassifIZierung der verbraucherpolitischen Konzeptionen In der Literatur zur Verbraucherpolitik ist keine eindeutige Abgrenzung verbraucherpolitisch unterschiedlicher Konzeptionen und Ansätze erkennbar. Sie werden nach verschiedenen Gliederungskriterien klassifiziert, häufig ohne auf diese explizit einzugehen. Weitere sinnvolle Einteilungskriterien können hinzugeftlgt werden. Angesichts dieser möglichen Gliederungsvielfalt sollen in diesem Abschnitt die einzelnen Kriterien kurz diskutiert und die in der Studie benutzte Auswahl und Klassifizierung verbraucherpolitischer Konzeptionen vorgestellt und begründet werden. Ziel ist es, die Gliederungskontroverse voranzustellen, damit sich die anschließenden Kapitel weitgehend auf die Darstellung und Bewertung der einzelnen Konzeptionen beschränken können. Zunächst sollen die möglichen Kriterien mit ihren Vor- und Nachteilen besprochen werden. Eine brauchbare Klassifizierung ist zwar nach verschiedenen einzelnen Kriterien möglich, bei deren alleiniger Verwendung werden jedoch stets wichtige andere Aspekte vernachlässigt. Dies legt die gleichzeitige Berücksichtigung mehrerer Gliederungskriterien nahe. Das folgende methodische Vorgehen gründet auf der Feststellung, daß nahezu alle Kriterien einem der Merkmale des oben entwickelten Begriffs der verbraucherpolitischen Konzeption zugeordnet werden können. Der Konzeptionsbegriff soll in diesem Abschnitt als Hilfskonstrukt verwendet werden, um die Gliederungsvielfalt überschaubarer zu gestalten. Wenn jede verbraucherpolitische Konzeption gerade durch ihre Aussagen zu allen Merkmalen gekennzeichnet ist und sich dadurch von den anderen abgrenzt, erscheint eine Gliederung
~
~
~
~
- Abfolge der Konzeptionen im historischen Entwicklungs- und Entstchungsprozeß
Si~yse
- Zweiteilung in Markt-und Sozialmodell (marktkonforme und marktkompensatorische Verbraucherpolitik)
I
\
ordnungspolitische Prinzipien
,
Methoden n
_ _----.J
,
- Zuordnung zu wirtschaftspolitischen Konzeptionen - Verhlltnis zur Wettbewerbspolitik (Zuordnung zu "Leitbildern der Wettbewerbspolitik")
-verbraucherpolitische Ziele - Stellung des Verbrauchers (Verbraucherleitbilder)
----- ~~
/
- vorherrschende Strategie - Intcrventionsstarlc:e der Eingriffe
,--
Begriff der verbraueherpolitischen Konzeption
_
die Gesamtkonzeption
[8_;'
AbbilduDg 1: GliederungskriterieD fnr eiDe Klassif"lZierung verbraucberpolitiscber KonzeptioDeD uDd Merkmale eiDer KonzeptioD
~.
§ ~ 9: ~
~
~
~
12
B. Verbraucherpolitische Konzeptionen
nach nur einem Kriterium, das sich auf ein einziges Konzeptionsmerkmal bezieht, nicht erfolgversprechend. Gesucht wird deshalb im folgenden nach einer übergeordneten Betrachtungsweise. Abbildung 1 zeigt die möglichen Gliederungskriterien fl1r eine Klassifizierung verbraucherpolitischer Konzeptionen und ihre Zuordnung zu den Merkmalen des Konzeptionsbegriffs. 16 • Ordnungspolitische Prinzipien Weit verbreitet in der verbraucherpolitischen Literatur ist eine Zweiteilung der Konzeptionen, die sich begrifflich an den beiden reinen Formen ordnungspolitischer Prinzipien, dem Individualund dem Sozialprinzip, orientiert. Dabei wird unterschieden zwischen dem Markt- oder Informationsmodell und dem SozialmodelP' Damit vergleichbar ist die Aufteilung in marktkomplementäre (marktkonforme) und marktkompensierende (marktkorrigierende) Verbraucherpolitik, die aufN. Reich zurUckgeht. 18 Eine solche Zweiteilung verbraucherpolitischer Konzeptionen ist zu undifferenziert, um die konzeptionelle Vielfalt im Bereich der Mischformen zwischen beiden extremen Polen zu erfassen. Für eine genauere Anordnung auf einem Kontinuum vom reinen Individualprinzip zum reinen Sozialprinzip, die auch den fließenden Übergängen zwischen den verbraucherpolitischen Konzeptionen Rechnung trägt, ist es ratsam, weitere Kriterien hinzuzuziehen. • Verbraucherpolitische Methoden Auch die alleinige Abgrenzung der Konzeptionen nach ihrer Schwerpunktsetzung auf einzelne verbraucherpolitische Strategien ist unzureichend. Die Einteilung nach dem Merkmal Methode hat zu benutzten Bezeichnungen wie Wettbewerbs-, Informations-,
16 Diese Einteilung erhebt keinen Anspruch auf völlige Eindeutigkeit, sondern dient vor allem didaktischen Zwecken. Besonders das Kriterium Verbraucherleitbild könnte beispielsweise auch dem Merkmal Situationsanalyse zugeteilt werden. 17 Vgl. z. B. zuletzt LOHMANN, H., Verbraucherschutz und Marktprozesse: Versuch einer institutionentheoretisch fundierten Erklärung von Marktregulierungen, Freiburg 1992, S. 36-48. 18 Vgl. REICH, N. u. a., 1976, S. 19-24.
2. Gliederungskriterien
13
Gegenmacht- und Verbraucherschutzmodell geftlhrt. 19 Diese Terminologie ist insoweit mißverständlich, als sie zu dem Schluß verleiten könnte, die jeweilige Konzeption bediene sich nur der einen angesprochenen Methode. Tatsächlich ist erkennbar, daß mit zunehmender Ausweitung der Verbraucherpolitik neue Methoden zu den bereits vorhandenen hinzutreten bzw. vorgeschlagen werden. In diesem Sinne, nämlich bezogen auf die jeweilige Ausdehnung des Methoden- oder MaßnahmenbUndeis, sind diese Bezeichnungen brauchbar und werden auch teilweise in der vorliegenden Arbeit verwendet. Ebenfalls nach dem Merkmal Methode könnten die verbraucherpolitischen Konzeptionen in eine Rangfolge nach der Interventionsstärke der Eingriffe gebracht werden. • Verbraucherpolitische Ziele Eine Klassifizierung nach verbraucherpolitischen Zielen ist bisher nicht üblich. Da häufig genannten Zielen schwerpunktmäßig bestimmte Methoden zugeordnet werden können (z. B. Schutz der Wettbewerbsordnung und Wettbewerbspolitik, Erhöhung der Markttransparenz und Information), sind gegenüber dem zuvor genannten Merkmal kaum zusätzliche Erkenntnisse zu erwarten. Weiterhin ist eine Einteilung der Konzeptionen nach der angestrebten bzw. gegenwärtigen Stellung der Verbraucher in der Marktwirtschaft, den sogenannten Verbraucherleitbildern, denkbar. In der Reihenfolge zunehmender Abhängigkeit (geringerer Souveränität) der Konsumenten gegenüber den Produzenten kann zwischen drei Leitbildern unterschieden werden: Konsumentensouveränität, Konsumentenfreiheit und Produzentensouveränität. 2o Um zu einer genaueren Gliederung der verbraucherpolitischen Konzeptionen nach diesem Kriterium zu gelangen, ist es möglich, genauer zwischen Konzeptionen zu unterscheiden, die das Leitbild der Konsumentensouveränität für grundsätzlich realisierbar halten, und Konzeptionen, für die es ein nicht erreichbares, jedoch erstre-
19 Vgl. HANSEN, U. und STAUSS, 8., Marketing und Verbraucherpolitik - ein Überblick, in: dies. und RIEMER, M. (Hrsg.), Marketing und Verbraucherpolitik, Stuttgart 1982, S. 7 f.
20 Vgl. KUHLMANN, E., Verbraucherpolitik, München 1990, S. 29-39. 3'
14
B. Verbraucherpolitische Konzeptionen
benswertes Ideal darstellt. 21 Wenn sich auch das Kriterium der Verbraucherleitbilder nicht direkt in der gewählten Klassiftkation der Konzeptionen in dieser Studie wiederfmdet, so soll dennoch nicht zuletzt wegen seiner Bedeutung in der wissenschaftlichen Diskussion - im Rahmen der Einzeldarstellungen darauf Bezug genommen werden. • Einordnung in die Gesamtkonzeption Mit den "Leitbildern der Wettbewerbspolitik" und den wirtschaftspolitischen (Gesamt-)Konzeptionen liegen zwei interessante Gliederungskriterien vor, die dem Konzeptionsmerkmal "Einordnung in die Gesamtkonzeption" zugeschrieben werden können. Nach beiden Kriterien ist es schwierig, vorab eine Zuordnung vorzunehmen, so daß auch hier auf die Einzeldarstellungen verwiesen werden muß.
In der Wettbewerbstheorie werden in weitgehender Übereinstimmung mehrere sogenannter Leitbilder der Wettbewerbspolitik unterschieden: 22 - Neoklassisches Modell der "vollkommenen Konkurrenz" - Neuklassisches Leitbild der Wettbewerbsfreiheit (Hoppmann u. a.) Leitbild des funktionsfllhigen Wettbewerbs (workable competition-Ansatz der Harvard School, aber auch Konzept der optimalen Wettbewerbsintensität von Kantzenbach) - Konzept der Chicago School of Antitrust Analysis
21 Der Begriff der "Konsumentensouveränität" wird in der verbraucherpolitischen Literatur in so vielfl11tiger Weise verwendet wie kaum ein anderer. Auf eine eingehende Diskussion dieses Leitbildes, verbunden mit der Entscheidung filr eine spezielle Definition des Begriffs, wird in dieser Studie deshalb bewußt verzichtet. Versucht wird lediglich - und schon das ist wegen Ungereimtheiten bei einigen Autoren nicht immer möglich - klarzustellen, was in den jeweiligen Konzeptionen unter "Konsumentensouveränität" verstanden wird. 22 Vgl. als Überblick: BARTLING, H., Leitbilder der Wettbewerbspolitik, MUnchen 1980, S. 9-57, sowie SCHMIDT, 1., Wettbewerbspolitik und Kartellrecht, 4. Aufl., Stuttgart u. a. 1993, S. 1-24.
2. Gliederungskriterien
15
Eine Einteilung oder Zuordnung verbraucherpolitischer Konzeptionen nach diesen Leitbildern der Wettbewerbspolitik erscheint wegen des engen Zusammenhangs von Wettbewerbs- und Verbraucherpolitik reizvoll. Während einige Konzeptionen sich klar einem Leitbild zuordnen lassen (reiner Wettbewerbsansatz und Modell der vollständigen Konkurrenz; Ökonomische Analyse des Rechts und Chicago School) oder direkt daraus abgeleitet wurden (Konzept der Wettbewerbs- und Konsumfreiheit), ist dies bei anderen Konzeptionen nicht eindeutig möglich. Besonders die interventionsstarken Konzeptionen passen wegen ihrer distanzierten Haltung gegenüber der Wirksamkeit wettbewerbspolitischer Aktivitäten nicht in dieses Schema. Ähnliche Schwierigkeiten treten beim Gliederungskriterium der allgemeinen wirtschaftspolitischen Konzeption auf. Auch hier gelingen einige Zuordnungen (z. B. reiner Wettbewerbsansatz und Ordoliberalismus), während andere unbestimmt bleiben. Speziell fUr die in der politischen Praxis der Bundesrepublik Deutschland so bedeutsame wirtschaftspolitische Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft ist zu prüfen, ob sie zu einer speziellen verbraucherpolitischen Konzeption fUhrt oder mit verschiedenen Ansätzen vereinbar ist. • Situationsanalyse Als letztes Gliederungskriterium soll schließlich die Abfolge der verbraucherpolitischen Konzeptionen in ihrem historischen Entwicklungs- und Entstehungsprozeß betrachtet werden. Die Einteilung der Konzeptionen nach den historischen Bedingungen ihres Entstehens - der jeweiligen Ausgangslage mit erkannten Mängeln und entsprechender Beurteilung der praktizierten Verbraucherpolitik - kann zweifelsfrei dem fUnften Merkmal der verbraucherpolitischen Konzeption, der Situationsanalyse, zugeordnet werden. Dabei ist zu betonen, daß sich die zeitliche Abfolge nur auf die Entstehung der Konzeptionen bezieht. Es handelt sich deshalb nicht um ein striktes Aufeinanderfolgen einzelner Konzeptionen im Sinne von Verdrängung oder Ablösung, sondern um das Nebeneinander einer im Zeitablauf zunehmenden Anzahl unterschiedlicher Ansichten.
16
B. Verbraucherpolitische Konzeptionen
Analog zur üblichen Vorgehensweise in der Literatur wird die Reihenfolge, in der die verbraucherpolitischen Konzeptionen in dieser Studie dargestellt werden, von der zeitlichen Abfolge ihres Entstehens bestimmt. Dies ist schon deshalb erforderlich, weil die einzelnen Konzeptionen aufeinander aufbauen und oft gerade aus der Auseinandersetzung mit bereits bestehenden Ansätzen hervorgegangen sind. Die zeitliche Abfolge der Konzeptionen in ihrem Entwicklungsund Entstehungsprozeß wird von allen vorgestellten Kriterien für eine KlassifIkation verbraucherpolitischer Konzeptionen am ehesten als geeignet angesehen, eine übergeordnete Betrachtungsweise herzustellen. Dies führt im nächsten Kapitel dieser Arbeit zunächst zu einer Vierteilung der Konzeptionen (siehe Abbildung 2). Die Entwicklung der Verbraucherpolitik in der Bundesrepublik Deutschland beginnt mit dem reinen Wettbewerbsansatz, der auf Grundlage der neoklassischen Marktbetrachtung die Wettbewerbspolitik als Garant funktionsfllhigen Wettbewerbs als beste und ausreichende Verbraucherpolitik ansieht. Diese Konzeption wird seit Ende der 50er Jahre kritisiert, vor allem weil die Prämissen der "vollständigen Konkurrenz" zunehmend als realitätsfern erschienen. Dies führte zu Ansätzen einer eigenständigen Verbraucherpolitik, die sich als notwendige Ergänzung der Wettbewerbspolitik verstehen. Vor allem in den 70er Jahren bildeten sich darüber weit hinausgehende, interventionsstarke Konzeptionen aus. Als Reaktion auf Forderungen nach immer stärkerer Ausweitung verbraucherpolitischer Eingriffe entstanden schließlich ausgesprochen interventionsskeptische Ansätze, die seit etwa Anfang der 80er Jahre zunehmende Beachtung gefunden haben. Diese Vierteilung ist hilfreich, reicht jedoch nicht aus, um der Vielfalt verbraucherpolitischer Konzeptionen gerecht zu werden. Deshalb ist feiner zu differenzieren. Da sich jede Konzeption gerade durch die Zusammensetzung ihrer Aussagen zu den Konzeptionsmerkmalen von anderen abgrenzt, wird hier bewußt auf das Herausgreifen eines weiteren Gliederungskriteriums verzichtet. Nach den bisherigen Ausführungen ist es einleuchtend, daß bei der beabsichtigten inhaltlichen Abgrenzung und Klassifizierung nicht jede verbraucherpolitische Konzeption einem einzigen Autor zugeschrieben werden kann - ein Eindruck, dem in der Literatur
I
Wettbewerbs-
(reiner) Wettbewerbsansatz des Ordoliberalismus
politIk als einzige VerbrauchCtpOlitik
Varianten: - Simitis - Czerwonka u.a. - Ausdehnungsanslitze
Gegenrnachtmodell (Scherhom u. a.)
VerbrauchetpOlitik auf verhaltem;wissenschaftlicher Grundlage (Kroeber-Riel u. a.)
Konzept der Wettbewerbs- und Konsumfreiheit (Mähling)
emanzip.-partizip. Ansatzl Ex-anteVerbrauchetpOlitik (Biervert u. a.)
Liberales Wettbewerbsund Informationsmodell
Economic Analysis of Law I Chicago School (posner u. a.)
IntcfVentiom;kritischc Konzeptionen
I
intcrventionistischc Kom:eplioocn
V ~rbraucberpQlitik als notwendige ErgMZutig der Wetthewemsoolitik
VERBRAUCHERPOLITISCHE KONZEPTIONEN
Neue Politische Ökonomie und positive Theorie der Regulierung
EvolutionsOkonomik
Neue Institutionenökonomik
Informatiom;ökonomik
Sonstige ver-
brauchetpOlitisch relevante Ansätze (keine Konzeptionen)
Abbildung 2: Übersicht der in der Studie behandelten verbraucherpolitischen Konzeptionen und Ansitze
fs:
-»
-
~.
~
o.lI
!'-'
18
B. Verbraucherpolitische Konzeptionen
nicht immer deutlich genug entgegengetreten wird. 23 Auch wenn im folgenden viele Konzeptionen vor allem durch Bezug auf nur einen oder wenige Hauptvertreter beispielhaft vorgestellt werden (z. B. Scherhorn, Kroeber-Riel, Biervert, Posner), so darf daraus nicht gefolgert werden, daß die Konzeptionen nur von diesen Personen vertreten werden. Abgelehnt wird eine Trennung der Konzeptionen nach wissenschaftlichen Fachdisziplinen, z. B. in ökonomische und juristische Ansätze. 24 Auch hier liegt in der Regel eine Einteilung nach Autoren vor, obwohl sich bei inhaltlicher Betrachtung herausstellt, daß z. B. Rechts- und Wirtschaftswissenschaftler trotz ihrer spezifischen Sichtweise eine ähnliche Konzeption verfolgen. Besonders im Bereich der Verbraucherpolitik sollten die Vorteile einer interdisziplinären Betrachtungsweise genutzt werden. 3. Darstellung der in der Wissenschaft entwickelten verbraucherpolitischen Konzeptionen 3.1 Wettbewerbspolitik als einzige Verbraucherpolitik
Einzelne Maßnahmen, die von ihrer Wirkung her dem Verbraucherschutz zugerechnet werden können, lassen sich in der Wirtschaftsgeschichte lange Zeit zurückverfolgen. Dazu zählen vor allem die staatliche Kontrolle von Maßen und Gewichten, die Sicherung des Nahrungsmittelangebots sowie der Aufbau eines umfassenden Systems der Qualitätskontrolle im Mittelalter durch die Zünfte. 2S Diese Maßnahmen dienten zwar auch den Verbraucherinteressen, sie orientierten sich aber in den meisten Fällen ananderen Zielsetzungen (z. B. Förderung von Produktion und Handel durch den Staat, Sicherung der Einkommen der Zunftmitglieder). Ausgangspunkt einer Betrachtung verbraucherpolitischer 23 Vgl. beispielsweise STAUSS, B., Verbraucherinteressen: Gegenstand, Legitimation und Organisation, Stuttgart 1980, S. 30-45. 24 Vgl. eine solche Einteilung bei HEINBUCH, H., Theorien und Strategien des Verbraucherschutzes - am Beispiel des Fernunterrichtschutzgesetzes, Frankfurt 1983, S. 48-64. 2S Vgl. KUHLMANN, E., 1990, S. 17-21.
3. Darstellung der verbraucherpolitischen Konzeptionen
19
Konzeptionen und damit der Entwicklung einer Verbraucherpolitik in der modernen Marktwirtschaft bildet in der Regel die Idee des freien Wettbewerbs im klassischen Liberalismus. Grundgedanke der klassischen Wettbewerbsvorstellung ist schon bei Adam Smith die wettbewerbliche Selbststeuerung ("invisible hand" durch Wettbewerbsprozesse). Sie fUhrt zur Um lenkung des Eigennutzstrebens der einzelnen Wirtschaftssubjekte auf das Allgemeinwohl und damit auch auf das Verbraucherinteresse im Sinne einer günstigen Verbraucherversorgung. 26 Bereits in seinem 1776 veröffentlichten Werk "Wohlstand der Nationen" umschreibt Adam Smith das spätere Verbraucherleitbild der Konsumentensouveränität, wonach es die Verbraucher sind, die durch ihre Güternachfrage die Produktion steuern und auf diese Weise eine optimale Bedürfnisbefriedigung bewirken: "Der Verbrauch allein ist Ziel und Zweck einer jeden Produktion, daher sollte man die Interessen der Produzenten eigentlich nur soweit beachten, wie es erforderlich sein mag, um das Wohl des Konsumenten zu fördern. Diese Maxime leuchtet ohne weiteres ein, so daß es töricht wäre, sie noch beweisen zu wollen."27 Das hier begründete Vertrauen in die Souveränität der Verbraucher und - damit zusammenhängend - die sehr weitgehende Identität von freiem Wettbewerb und der ErfUllung des Verbraucherinteresses fmdet sich in fast allen liberal-marktwirtschaftlichen Konzeptionen der Verbraucherpolitik wieder. Die klassische Wettbewerbsvorstellung wird zu Beginn dieses Jahrhunderts im Rahmen der neoklassischen Wohlfahrtstheorie stark formalisiert und in das statische Gleichgewichtsmodell mit seinen realitätsfernen Prämissen einbezogen. Zu diesen restriktiven Annahmen gehören eine atomistische Angebots- und Nachfragestruktur, vollständige Markttransparenz, homogene, unbegrenzt mobile und teilbare Güter, unendliche Anpassungsgeschwindigkeiten, freier Marktzutritt sowie das rational handelnde Wirt26 Vgl. BARTLING, H., 1980, S. 9. 27 SMITH, A., Der Wohlstand der Nationen, 5. Aufl., München 1990, S. 558
[original: An Inquiry into the Nature and Causes ofthe Wealth ofNations, London
1776].
20
B. Verbraucherpolitische Konzeptionen
schaftssubjekt. Obwohl dieses Modell der "vollkommenen Konkurrenz" wegen der Realitätsferne seiner Prämissen leicht angreifbar erscheint, entwickelte es sich zu einem wichtigen Leitbild der Wettbewerbspolitik und steht damit auch als Referenzsystem fUr eine sich später ausbildende Verbraucherpolitik zur Verftlgung. In der Bundesrepublik Deutschland kann, auf dieser neoklassischen Grundlage aufbauend, etwa Ende der 40er und Anfang der 50er Jahre eine erste verbraucherpolitische Konzeption im Sinne der oben hergeleiteten Begriffsbestimmung identifiziert werden, die hier als reiner Wettbewerbsansatz bezeichnet wird. Er ist als integraler Bestandteil der wirtschaftspolitischen Konzeption der Ordoliberalen - auch "Freiburger Schule" genannt - anzusehen. 28 Die Ordoliberalen, vor allem vertreten durch Walter Eucken, greifen auf das klassisch-liberale Gedankengut zurück, versuchen dabei aber zu ergründen, woran die Konzeption des klassischen Liberalismus gescheitert ist. Auch aus der Erfahrung der Zwangswirtschaft des Krieges und der Auseinandersetzung mit dem Gegenmodell der Zentralverwaltungswirtschaft treten sie fUr wirtschaftliche Freiheit in einer Wettbewerbswirtschaft ein, die sie als die mit Abstand verbraucherfreundlichste Wirtschaftsordnung bezeichnen. 29 Zugrunde gelegt wird mit der "vollständigen Konkurrenz" ein im Vergleich zur Neoklassik weniger anspruchsvolles Wettbewerbsleitbild. 3o Wichtigste Erkenntnis der Ordoliberalen gegenüber dem klassischen Liberalismus ist es, daß die Freiheit in der angestrebten Wettbewerbsordnung nicht nur von staatlichen Eingriffen gefährdet ist, sondern auch durch Beschränkungen des
28 Der Ordoliberalismus wird hier - gemlß einer in der Wissenschaft üblichen Abgrenzung - ausschließlich auf diesen frühen Zeitraum bezogen. Splltcr aufkommende Forderungen nach einer Verbraucherinformation werden in dieser Arbeit als eigene Konzeption behandelt (vgl. 3.2.1), die auf den ordoliberalen Vorstellungen aufbaut. 29 Vgl. BOHM, F., Aufgaben der Verbraucherpolitik, in: Wirtschaft und Gesellschaft, Heft 5 (Schriftenreihe des Zentralverbandes deutscher Konsumgenossenschaften), Hamburg 1954, S. 23. 30 Gegenüber der "vollkommenen Konkurrenz" wird hierbei nach W. Eucken nur die Prämisse atomistischer Anbieter- und Nachfragerstruktur vorausgesetzt. Vgl. BARTLING, H., 1980, S. 13 f.
3. Darstellung der verbraucherpolitischen Konzeptionen
21
Wettbewerbs von seiten der Marktteilnehmer selbst. Folgerichtig ergänzt Eucken seine die Wettbewerbswirtschaft in Fonn einer Rahmenordnung konstituierenden Prinzipien durch weitere, die sogenannten regulierenden Prinzipien. Zur Gewährleistung von Wettbewerb wird deshalb vor allem eine aktive staatliche Politik gegen Wettbewerbsbeschränkungen als notwendig erachtet. 31 Gewisse Unvollkommenheiten in der Realität gegenüber dem neoklassischen Modell werden als unvenneidlich akzeptiert. Bei geeigneter Rahmensetzung und einer schlagkräftigen Wettbewerbspolitik zur Gewährleistung des Wettbewerbs werde dadurch aber die Konsumentensouveränität nicht wesentlich beeinträchtigt: "Die MarktsteIlung des Verbrauchers ist in einer freien Wirtschaft so stark, daß sie nicht einmal durch Entartungserscheinungen durch systemstörende Staatseingriffe und wettbewerbswidrige Monopolisierung ernstlich gefährdet werden kann."32
Aus diesen Grundgedanken des Ordoliberalismus kann direkt deren verbraucherpolitische Konzeption abgeleitet werden. Danach gibt es in der Marktwirtschaft keine Notwendigkeit ft1r eine eigenständige Verbraucherpolitik, sondern die Wettbewerbspolitik wird als einzige und ausreichende Verbraucherpolitik angesehen. Im ordoliberalen Schrifttum liegen aus diesem Grund auch kaum spezielle Veröffentlichungen zu diesem Bereich vor. Die Verbraucherpolitik, deren Begriff sich erst langsam etabliert, wird meist bei anderen Themen am Rande mitbehandelt. Ziele und Methoden dieser Konzeption orientieren sich folglich an denen der Wettbewerbspolitik. Oberstes Ziel ist ein funktionsfähiger Wettbewerb, der als Garant einer grundsätzlich realisierbaren Konsumentensouveränität gilt. Da eine wirkungsvolle Wettbewerbspolitik in Fonn von Kartellverbot, Fusionskontrolle und Mißbrauchsaufsicht als die beste Verbraucherpolitik gilt, erübrigt sich ein darüber hinausgehender Einsatz besonderer verbraucherpolitischer Methoden. So wird beispielsweise eine verbandsmäßi-
31 Vgl. EUCKEN, W., Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 4. Aufl., TUbingen 1968 (1. Aufl. 1952), S. 291.
32 BOHM, F., 1954, S. 25.
22
B. Verbraucherpolitische Konzeptionen
ge Organisation der Verbraucher (dem "vergessenen Sozialpartner") von vornherein als "völlig aussichtsloses Unterfangen" abgetan und dessen Interessenvertretung ganz der Wettbewerbsordnung anvertraut. 33 Trotz der heftigen Kritik an diesem reinen Wettbewerbsansatz bereits in den 50er Jahren34, die sich vor allem auf die Orientierung an den neoklassischen Prämissen und den Verzicht auf ein eigenständiges verbraucherpolitisches Instrumentarium bezieht, ist diese Konzeption in mehrfacher Hinsicht praxisrelevant. Zunächst ist der große Einfluß des ordoliberalen Gedankenguts auf die bundesdeutsche Wirtschaftspolitik in den ersten Nachkriegsjahren zu nennen, der mitverantwortlich sein dürfte ftlr die anfllnglich skeptische Haltung gegenüber diesem neuen Teilgebiet der Wirtschaftspolitik. 3s Weiterhin verleiht der in den letzten Jahren zunehmend erkennbare Rückbezug auf klassisch-liberale Vorstellungen auch im Bereich der Verbraucherpolitik der Betrachtung dieser frühen Konzeption eine gewisse Aktualität. Schließlich, und das muß als das eigentliche Verdienst dieser Konzeption angesehen werden, hat sie den engen Zusammenhang zwischen Wettbewerbspolitik und Verbraucherpolitik verdeutlicht. Auch wenn der Wettbewerbsbegriff im Zeitablauf einem starken Wandel unterlag, so ist bis heute die Wettbewerbspolitik als grundlegende Voraussetzung bzw. als fester Bestandteil einer marktwirtschaftlichen Verbraucherpolitik unumstritten. Bei der Beurteilung der ordoliberalen Konzeption muß die historische Situation beachtet werden. So erscheint aus heutiger Sicht das Wettbewerbs leitbild der "vollständigen Konkurrenz" zwar als überholt, zu Beginn der 50er Jahre aber erfreute es sich noch breiter Anerkennung. Auch die damalige verbraucherpolitische Beschränkung auf eine Politik gegen Wettbewerbsbeschränkungen ist 33 Vgl. BOHM, F., Das wirtschaftliche Mitbestimmungsrecht der Arbeiter im Betrieb, in: ORDO, Bd. 4 (1951), S. 194-205. 34 Vgl. besonders EGNER, E., Grundsätze der Verbraucherpolitik in: Zeitschrift rur das gesamte Genossenschaftswesen (1956), wieder abgedruckt in: BIERVERT, B. u. a. (Hrsg.), Verbraucherpolitik in der Marktwirtschaft, Reinbek 1978, S.17-31. 3S
Vgl. FLEISCHMANN, G., 1982, S. 60 f.
3. Darstellung der verbraucherpolitischen Konzeptionen
23
nachvollziehbar. Während eine Verbraucherpolitik als eigenständiger Politikbereich noch unbekannt war, stand die Wettbewerbspolitik erstmals im Mittelpunkt des wirtschaftspolitischen Interesses. Zunächst ging es deshalb in der Bundesrepublik Deutschland darum, eine Wettbewerbspolitik - institutionalisiert durch das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen - zu etablieren. 36 Daß dies alleine für einen Verbraucherschutz nicht ausreichend ist, ist eine erst spätere Erkenntnis, worauf im weiteren eingegangen wird. 3.2 Verbraucherpolitik als Ergänzung der Wettbewerbspolitik 3.2.1 Liberales Wettbewerbs- und Informationsmodell
Die Erkenntnis, daß die Wettbewerbspolitik allein filr die Gewährleistung von Wettbewerb und damit eine Verwirklichung der Verbraucherinteressen nicht ausreichend sein könnte, filhrte etwa Ende der 50er Jahre zur Herausbildung einer neuen verbraucherpolitischen Konzeption. ,
Über die bereits bei der ordoliberalen Konzeption berücksichtigten Wettbewerbsbeschränkungen und zunehmenden Untemehmenskonzentrationen hinaus soll nun weiteren, in der Realität zu beobachtenden Funktionsdefiziten des Wettbewerbs Rechnung getragen werden. Dabei werden vor allem die folgenden Gründe genannt, die die Markttransparenz beeinträchtigen: •
Wachsende Produktvielfalt und Produktdifferenzierung filhren zu immer unüberschaubareren Märkten.
•
Viele Güter sind technisch so kompliziert geworden, daß die vorhandenen Kenntnisse des Verbrauchers zur Qualitätsbeurteilung nicht mehr ausreichen.
•
Die Informationen der Hersteller sind oft unvollständig und einseitig. DarUberhinaus kann es durch die absatzpolitischen Maßnahmen der Anbieter zur Manipulation der Konsumenten kommen (z. B. suggestive Werbung, irrefilhrende Angaben, Mode, Verpackungen).
36 Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen - von Ludwig Erhard ausdrücklich als "Konsumentenschutzgesetz" bezeichnet - konnte 1957 verabschiedet werden. Vgl. ERHARD, L., Wohlstand rur alle, DUsseldorf 1957, S. 172 f.
24
B. Verbraucherpolitische Konzeptionen
Aufgabe der Verbraucherpolitik soll es deshalb sein, die Markttransparenz durch die Bereitstellung zusätzlicher Infonnationen rur den Verbraucher zu erhöhen, damit dieser seine Chancen als Marktteilnehmer besser nutzen kann. Die Konzeption knüpft damit direkt an den zuvor dargestellten "reinen Wettbewerbsansatz" an und entwickelt ihn weiter. Dies fllhrt zu fließenden Übergängen, die eine exakte Abgrenzung der Konzeptionen wie auch die Zuordnung einzelner Autoren erschweren. Nicht zuletzt die unterschiedlichen Bezeichnungen in der Literatur tragen zu dieser Unklarheit bei, indem beide Konzeptionen als Wettbewerbsansatz oder Marktmodell zusammengefaßt werden. Die vorgeschlagene Ausweitung der verbraucherpolitischen Methoden aufgreifend, hat sich ebenso der Begriff Infonnationsmodell etabliert. 37 Um beide Überlegungen zu berücksichtigen und um gleichzeitig auch sprachlich den Unterschied zum "reinen Wettbewerbsansatz" deutlich zu machen, wurde rur die an dieser Stelle zu besprechende Konzeption der Ausdruck "liberales Wettbewerbs- und Infonnationsmodell" gewählt. Diese Konzeption, die zu den wichtigsten in der Verbraucherpolitik gehört, ist nicht nur auf die ökonomische Literatur beschränkt, sondern wird auch von rechtswissenschaftlichen Autoren diskutiert. 38 Das Wettbewerbs- und Infonnationsmodell hält prinzipiell am Primat der Wettbewerbspolitik zum Schutz der Verbraucher fest. Dies wird besonders deutlich in Äußerungen wie "Wettbewerbspolitik ist die beste Verbraucherpolitik"39, "Die Verbraucherpolitik deckt sich zur Hälfte mit einer vernünftigen Marktwirtschaftspolitik" oder der Einschätzung des Kartellgesetzes als "Magna Charta der Verbraucherpolitik" .40
37 Die Bezeichnung geht auf Simitis zurück. Vgl. SIMITIS, K., Verbraucherschutz, Schlagwort oder Rechtsprinzip?, Baden-Baden 1976, S. 95. 38 Vgl. beispielsweise DAUNER-LIEB, B., Verbraucherschutz durch Ausbildung eines Sonderprivatrechts rur Verbraucher, Berlin 1983, S. 62-105. 39 Vgl. BIERVERT, B. u. a., Grundlagen der Verbraucherpolitik, Reinbek 1977, S.13. 40 Vgl. BOCK, J., Verbraucherpolitik und Wirtschaftsordnung, in: ders. und SPECHT, K. G. (Hrsg.), Verbraucherpolitik, Köln/Opladen 1958, S. SO-51.
3. Darstellung der verbraucherpolitischen Konzeptionen
25
Um die oben genannten Funktionsdefizite zu beseitigen, wird das wettbewerbspolitische Instrumentarium hier aber als ergänzungsbedürftig angesehen. Bei der Auswahl zusätzlicher verbraucherpolitischer Maßnahmen wird allerdings darauf geachtet, daß der Marktmechanismus selbst möglichst nicht beeinträchtigt wird. Dies geschieht durch eine Beschränkung auf Methoden geringer Eingriffsintensität und erklärt die Konzentration auf informationspolitische Maßnahmen. Wegen des bewußten Verzichts auf dirigistische Eingriffe in die Marktprozesse ist die Kennzeichnung dieser Konzeption als marktkonforme bzw. marktkomplementäre Verbraucherpolitik gerechtfertigt.41 Wie schon erwähnt wurde, liegt der Schwerpunkt der Methoden dieser Konzeption neben der Wettbewerbspolitik auf der Verbraucherinformation, um eine höhere Markttransparenz herzustellen. Dies kann z. B. durch die Veröffentlichung von vergleichenden Produkttests, durch die Einrichtung von Verbraucherberatungsstellen oder Kennzeichnungspflichten von Produkten geschehen. Aber auch Verbraucherbildung und -erziehung werden weitgehend positiv beurteilt, da auf diese Weise das rationale Verhalten der Verbraucher am Markt gefördert werden kann. Wenn auch nicht in strikter Ablehnung, so doch betont skeptisch steht das liberale Wettbewerbs- und Informationsmodell dagegen den Methoden der Verbraucherorganisation und dem rechtlichen Verbraucherschutz gegenüber. 42 Verbraucherinstitutionen werden nur unterstützt, soweit sie der Aufklärung und Information dienen (Testinstitute, Beratungsstellen). Der rechtliche Verbraucherschutz bleibt "ein auf gravierendste Beeinträchtigungen zu beschränkendes Instrument"43. Dabei strebt diese Konzeption die Stärkung der Konsumenten als Einzelperson, nicht dagegen als Gruppe an. Folgerichtig wird deshalb von verbraucherrechtlichem Individualschutz gesprochen. 44 Für notwendig werden gesetzliche Regelungen 41 Vgl. REICH, N., u. a., 1976, S. 20, und REICH, N., Markt und Recht, Darm-
stadt 1977, S. 198 f.
42 Vgl. STAUSS, B., 1980, S. 31 f. 43 Ebenda, S. 32. 44 Vgl. REICH, N., 1977, S. 210-214.
26
B. Verbraucherpolitische Konzeptionen
insbesondere zum Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Schädigungen sowie vor Täuschung und Übervorteilung durch die Anbieter erachtet. Die Bedingung der Marktkonformität verbraucherpolitischer Eingriffe im liberalen Wettbewerbs- und Informationsmodell fUhrt nicht nur zur gezielten Auswahl der Methoden, sondern verpflichtet auch zu zurückhaltender Dosierung und einer insgesamt möglichst geringen Anzahl von Eingriffen. So kann beispielsweise ein zu massiver Einsatz einer an sich marktkonformen Methode wie der Verbraucherinformation durchaus mit der Konzeption unvereinbar sein (z. B. eine Häufung gesetzlicher Informationspflichten rur Produzenten). Die enge Anlehnung an den reinen Wettbewerbsansatz zeigt sich auch bei der Betrachtung der Ziele. Oberstes Ziel bleibt eine Wettbewerbsordnung, die hauptsächlich eine geeignete Wettbewerbspolitik erfordert. Nur ergänzend sind speziell verbraucherpolitische Ziele zu verfolgen, von denen die Erhöhung der Markttransparenz eindeutig dominiert. Das liberale Wettbewerbs- und Informationsmodell hält an der Konsumentensouveränität fest, um die Stellung des Verbrauchers zu charakterisieren. Zwar wird die Konsumentensouveränität nicht mehr als grundsätzlich realisierbar angesehen, in der Funktion eines Leitbildes, eines anzustrebenden Ideals (normative Verwendung) bleibt sie jedoch auch weiterhin von großer Bedeutung rur die Verbraucherpolitik. 45 Bezüglich der ordnungspolitischen Prinzipien ist diese Konzeption durch eine starke Betonung des Individualprinzips gekennzeichnet. Dies wird mit den Vorzügen des Subsidiaritätsprinzips begründet, nach dem übergeordnete, staatliche Stellen nur dann eingreifen sollen, wenn die dezentralen Entscheidungsträger - hier die einzelnen Konsumenten und Anbieter - eine Aufgabe nicht selbst bewältigen können. 46 Um die Tätigkeit des Staates auch in der Verbraucherpolitik gering zu halten, setzt diese liberale Konzeption zunächst "auf eine Selbstkontrolle der Wirtschaft, eventu-
45 Vgl. HENNING-BODEWIG, F. und KUR, A., Marke und Verbraucher. Funktionen der Marke in der Marktwirtschaft, Band 1: Grundlagen, Basel u. a. 1988, S. 170 f. 46 Vgl. REICH, N., 1977, S. 199.
3. Darstellung der verbraucherpolitischen Konzeptionen
27
eIl unter Beteiligung von Verbrauchervertretern".47 Hier ist - sofern dies nicht zu Wettbewerbsbeschränkungen durch die Anbieter fUhrt - vor allem an die Ausarbeitung von freiwilligen Verhaltensregeln und an die Einrichtung von Schlichtungsstellen zu denken. Seitens der Verbraucher wird Eigeninitiative und Selbstorganisation zur Verbesserung der Markttransparenz begrUßt. Dem würden nach liberaler Vorstellung am besten private Warentestinstitute und Verbraucherberatungsstellen entsprechen, die sich durch den Verkauf ihrer Publikationen und durch Mitgliedsbeiträge selbst fmanzieren und somit nicht auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. 48 Wegen der prinzipiellen Schwierigkeiten, die bei der Organisation der Verbraucherinteressen zu überwinden sind, wird aber auch eine staatliche Unterstützung - allerdings nur im Sinne einer "Hilfe zur Selbsthilfe" - befürwortet. 49 Als Träger dieser Verbraucherpolitik sind deshalb nicht nur die staatlichen Instanzen anzusehen. Der Staat vertraut ebenso auf eigenverantwortliche Individuen und versucht, verbraucherpolitische Aktivitäten ihren Vertretungen, den Verbänden, zuzuweisen. Die Einordnung des verbraucherpolitischen Wettbewerbs- und Informationsmodells in eine Gesamtkonzeption kann durch das Verhältnis zur Wettbewerbspolitik verdeutlicht werden. Beide Politikbereiche sind eng verbunden, wobei die Verbraucherpolitik eine untergeordnete Rolle einnimmt. Sie "hat eine Ergänzungsfunktion gegenüber der Wettbewerbspolitik, bleibt auf die Funktion eines Korrektivs beschränkt, während die Wettbewerbspolitik in gewissem Sinne die 'eigentliche Verbraucherpolitik' bleibt."50 Aufgrund vieler Übereinstimmungen fällt es nicht schwer, diesen Ansatz der wirtschaftspolitischen Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft zuzuordnen. 51 Beide stellen eine Weiterent47 Ebenda. 48 Vgl. WIEKEN, K., Die Organisation der Verbraucherinteressen im internatio-
nalen Vergleich, Göttingen 1976, S. 4 f.
49 Vgl. STAUSS, B., 1980, S. 31. 50 MAlER, L., Verbraucherpolitik, Bonn 1987, S. 20. 51 Vgl. zu den folgenden Ausfilhrungen z. B.: ZOHLNHÖFER,
W., Soziale Marktwirtschaft als Leitbild filr die Wirtschaftsordnung der Bundesrepublik 4 Mitropoulos
28
B. Verbraucherpolitische Konzeptionen
wicklung ordoliberaler Gedanken dar, zu deren liberaler Komponente (Rahmensetzung zum Schutze des Wettbewerbs) nun eine soziale Komponente hinzutritt. In der Verbraucherpolitik folgt dies aus der Anerkennung einer schwächeren Position der Verbraucher auf dem Markt infolge einer eingeschränkten Markttransparenz. Die Marktsteuerung wird als ergänzungsbedürftig angesehen. Wie auch in der Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft haben sich die daraus abgeleiteten wirtschaftspolitischen Maßnahmen an den zentralen Begriffen wie Marktkonformität, Eigeninitiative, Hilfe zur Selbsthilfe und Subsidiarität zu orientieren. Das liberale Wettbewerbs- und Informationsmodell fUgt sich also in idealer Weise in die Soziale Marktwirtschaft ein. Dies bedeutet aber nicht, daß diese wirtschaftspolitische Konzeption zwangsläufig zu einer solchen Verbraucherpolitik fUhren muß. So wäre beispielsweise zu überprüfen, ob auch eine Ausweitung des Instrumentariums damit noch vereinbar ist. Die Relevanz dieser Konzeption in der Praxis ist groß. Sie hat die bundesdeutsche Verbraucherpolitik besonders in den ersten Jahrzehnten maßgeblich bestimmt. Dies zeigt sich z. B. in der Schaffung von Verbraucherberatungsstellen (Verbraucherzentralen ab 1958) und in der Gründung der Stiftung Warentest (1964) auf Initiative des damaligen Bundeswirtschaftsministers Erhard, der damit vor allem den Wettbewerb fördern wollte. 52 Die seit den 70er Jahren verstärkt geftlhrte Diskussion um eine geeignete verbraucherpolitische Konzeption ist wesentlich von der Auseinandersetzung um das liberale Wettbewerbs- und Informationsmodell geprägt. Aus der Sicht dieser Konzeption lassen sich die Kritiker vereinfachend zu zwei Gruppen zusammenfassen: Eine erste Gruppe lehnt die Konzeption wegen der Beschränkung des verbraucherpolitischen Instrumentariums und der starken Wettbewerbsorientierung grundsätzlich ab. Die andere Gruppe dagegen kann sich mit den liberalen Vorstellungen- weitgehend identifizieren und versucht, die Konzeption - z. B. durch die Berück-
Deutschland, in: DIEDERlCH, H. u. a. (Hrsg.), Die Deutsche Bundespost im Spannungsfeld der Wirtschaftspolitik, Mainz 1985, besonders S. 7-11. 52 Vgl. MAlER, L., 1987, S. 18 f.
3. Darstellung der verbraucherpolitischen Konzeptionen
29
sichtigung verhaltenswissenschaftlicher oder infonnationstheoretischer Erkenntnisse - weiterzuentwickeln. Beide Ansatzpunkte der Kritik werden bei der Betrachtung anderer Konzeptionen in den folgenden Abschnitten aufgegriffen. Bei der Bewertung des Wettbewerbs- und Infonnationsmodells sind pauschale Urteile zu venneiden. Die Stichhaltigkeit des Vorwurfs, die Vertreter dieser Konzeption seien so naiv zu glauben, man müsse den Konsumenten nur mit zahlreichen Infonnationen versorgen, um ihn zum homo oeconomicus zu machen s3 , ist fraglich. Zwar liegt der Schwerpunkt hier eindeutig auf der Verbraucherinfonnation, es sollen aber auch andere Methoden zum Einsatz kommen. Einem "so viel Infonnation wie möglich" steht zudem die Forderung einer möglichst geringen Interventionsdichte entgegen. Insgesamt ist diese Konzeption in ihrem historischen Umfeld zu sehen und damit als sinnvolle Weiterentwicklung des reinen Wettbewerbsansatzes zu würdigen. Durch die strenge Orientierung am Leitbild der Konsumentensouveränität, das sich am rationalen und infonnierten Verbraucher ausrichtet, verbleibt sie jedoch in ihrem Aussagegehalt begrenzt. 3.2.2 Programmatische Verbraucherpolitik (Scherhorn) und das Gegenmachtmodel/
In diesem Kapitel soll eine verbraucherpolitische Konzeption vorgestellt werden, die sich gegenüber dem liberalen Wettbewerbs- und Infonnationsmodell durch eine weitere Ausdehnung der Methoden und Ziele kennzeichnen läßt. Als Hauptvertreter dieser Konzeption in der wissenschaftlichen Verbraucherpolitik gelten Gerhard Scherhorn und seine Mitarbeiter, deren Auffassung in einer 1975 veröffentlichten Gesamtdarstellung zur Verbraucherpolitik dargelegt ist. s4 Der Ansatz von Scherhorn beinhaltet einige Besonderheiten. Es soll deshalb zunächst eine allgemeine Charakterisierung der verbraucherpolitischen Konzeption, die in der Studie Gegenmachtmodell genannt wird, erfolgen. Daran S3
Vgl. ebenda, S. 25.
S4 SCHERHORN, G., Verbraucherinteresse und Verbraucherpolitik, Göttingen
1975. 4'
30
B. Verbraucherpolitische Konzeptionen
schließen sich einige spezielle Erweiterungen von Scherhorn an, dessen Ansatz auch als programmatische Verbraucherpolitik bezeichnet wird. Die hier als Gegenmachtmodell bezeichnete Konzeption entstand aus der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem liberalen Wettbewerbs- und Informationsmodell und der Kritik an dem anfangs begrenzten Aufgabenbereich der praktizierten Verbraucherpolitik. Auch diese Konzeption orientiert sich am Wettbewerb. Neben der eingeschränkten Markttransparenz werden aber weitere Störungen des Marktmechanismus identifiziert oder stärker gewichtet. Neu ist vor allem die Betonung der - nicht mehr auf das einzelne Individuum in einer bestimmten Situation bezogenen, sondern generellen - wirtschaftlich unterlegenen Stellung des Verbrauchers gegenüber den Anbietern. Dieses Machtungleichgewicht auf dem Markt fil.hrt - in Anlehnung an J. K. Galbraiths Theorie der "countervailing power"55 - zur Forderung nach Machtausgleich. Der Staat müsse dem Konsumenten als schwächerem Marktteilnehmer bei der Gegenmachtbildung Hilfestellung leisten. Diese Überlegung, die sich wesentlich in der Auswahl der verbraucherpolitischen Methoden und Ziele niederschlägt, rechtfertigt die Bezeichnung als Gegenmachtmodell. 56 Diese Konzeption wird teilweise in der Literatur im Rahmen einer undifferenzierten Zweiteilung aller verbraucherpolitischen Konzeptionen als "Sozialmodell" bezeichnet. Es werden dann alle nicht mehr als liberal eingestuften Ansätze unter diesem Begriff subsumiert. Da aber die in ihrer Forderung nach Mitbestimmung der Verbraucher bei den Produktionsentscheidungen viel weitergehenden partizipatorischen Ansätze in dieser Studie als eigenständige Konzeption angesehen werden, ist der Ausdruck "Sozialmodell" hier mißverständlich und wird deshalb nicht verwendet. Bei den verbraucherpolitischen Methoden fmdet gegenüber der zuvor dargestellten Konzeption eine deutliche Ausweitung statt. 57 S5 Vgl. GALBRAITH, J. K., American Capitalism. The Concept of CountervaiIing Power, 2. Aufl., Cambridge 1956 (1. Aufl. 1952), besonders S. 108-154.
56 Vgl. HANSEN, U., und STAUSS, S., 1982, S. 8. 57 Vgl. zum folgenden SCHERHORN, G., 1975, S. 126-133.
3. Darstellung der verbraucherpolitischen Konzeptionen
31
In den Vordergrund rückt die Gegenmachtbildung durch Verbraucherorganisation. Die Stärkung der Verbraucher als Gruppe kann dabei durch fmanzielle Unterstützung von Verbraucherorganisationen, aber auch durch eine Verbesserung ihrer Position (z. B. Anspruch auf Gehör und Verhandlung, Schaffung von Möglichkeiten kollektiver Rechtsdurchsetzung) erfolgen. Eine größere Bedeutung wird auch der Verbrauchererziehung in der Schule und in der Erwachsenenbildung zugeschrieben. Angestrebt wird ein kritischer und mündiger Verbraucher, der Kenntnisse über die Funktionsweise der Marktwirtschaft, seine eigene Rolle darin sowie über die Entwicklung und mögliche Beeinträchtigungen seiner Bedürfnisse besitzt. Neben diese systematische Unterrichtung tritt ergänzend die Verbraucherinformation zur fallweisen Vermittlung aktueller Einzelinformationen - bewußt gekennzeichnet als Gegeninformation zu den Angaben der Produzenten. Die Wettbewerbspolitik soll durch eine stärkere Kontrolle des Anbieterverhaltens deutlicher auf die Zwecke der Verbraucherpolitik ausgerichtet werden. Staatliche Aufsichtsbehörden sollen die Überwachung und Durchsetzung eines intensivierten rechtlichen Verbraucherschutzes übernehmen. Gleichzeitig mit den verbraucherpolitischen Methoden erflUut auch deren Anwendungsbereich durch die Einbeziehung der öffentlichen Konsumgüter eine Ausweitung. 58 Zusammenfassend wird festgestellt, daß das Gegenmachtmodell fast das gesamte verbraucherpolitische Instrumentarium - mit Ausnahme der partizipatorischen Strategien - nutzt. Zur Methode einer "marktkomplementären" Verbraucherpolitik (Wettbewerbspolitik, Information, Individualschutz) treten solche einer "marktkompensatorischen" Verbraucherpolitik (Stärkung der Verbraucherorganisationen, Kollektivschutz) hinzu. 59 Mit der Ausdehnung der Methoden geht eine Veränderung im verbraucherpolitischen Zielsystem einher. Eine funktionsfähige Wettbewerbsordnung fmdet als wirtschaftspolitisches Oberziel auch in dieser Konzeption Verwendung. Den festgestellten Störungen des Marktmechanismus entsprechend wird das verbrau58 Vgl. ebenda, S. 58-66. 59 Vgl.
REICH, N., 1977, S. 219-225.
32
B. Verbraucherpolitische Konzeptionen
cherpolitische Unterziel Markttransparenz aber nicht mehr vorrangig verwendet, sondern es treten andere Ziele wie Machtausgleich oder gesundheitlicher Verbraucherschutz gleichberechtigt daneben. Der umfassende Katalog verbraucherpolitischer Zielsetzungen und Methoden dürfte zur Bezeichnung "programmatische Verbraucherforschung" geft1hrt haben, die speziell ft1r den Ansatz von Scherhorn verwendet wird. 6o Dieses mit dem Gegenmachtmodell ausgebildete "Programm" verbraucherpolitischer Ziele und Strategien hat sich auch in der politischen Praxis niedergeschlagen und spiegelt somit in gewisser Weise das Spektrum deutscher Verbraucherpolitik wieder. Einem abschließenden Überblick über das Zielsystem der Verbraucherpolitik dient Abbildung 3. Die Stellung des Konsumenten in dieser verbraucherpolitischen Konzeption wird schwächer eingeschätzt als in der liberalen Konzeption, d. h. eine größere Abweichung zwischen dem Ideal der Konsumentensouveränität und der Realität konstatiert. Die Frage, ob dennoch an diesem Leitbild festgehalten wird, ist nicht einfach zu beantworten. So distanziert sich Scherhorn in seinen AusfUhrungen verbal zwar von der Konsumentensouveränität, da sie nicht erreichbar sei61 , bleibt ihr insgesamt inhaltlich verbunden. Dies kann auf die grundsätzlich beibehaltene Orientierung am Marktparadigma zurückgeft1hrt werden. Wettbewerb wird als unbedingt notwendig angesehen, jedoch wird eine Reihe von Beeinträchtigungen gesehen und deren Beseitigung angestrebt. Nach Ansicht mehrerer Autoren ist deshalb auch das Gegenmachtmodell diesem Leitbild verpflichtet. 62 Trotzdem sind Scherhorn und seine Mitarbeiter um eine größere Realitätsnähe bemüht. Dies zeigt sich weniger in der rein sprachlichen Ersetzung des rationalen Verbrauchers der Neoklassik durch den "mündigen Verbraucher"63 als in der Verwendung des Begriffs der Konsumfreiheit zur Beschreibung der tatsächlichen Stellung des Verbrauchers in der Marktwirtschaft.
60 Vgl. BIERVERT, B. u. a., 1977, S. 57.
61 Vgl. SCHERHORN, G., 1975, S. 5. 62 Vgl. BIERVERT, B. u. a., 1977, S. 60, und LOHMANN, H., 1992, S. 44. 63 Vgl. SCHERHORN, G., 1975, S. 125.
I
I
I
I
- Langfristige Verbesserung der Kenntnisse z. B. über
Verbraucherbildung und -erziehung
- Güter und Dienstleistungen - Preise und Qualitäten - rationales Verbraucherverhalten - wirtschaftliche Zusammenhange - Verbraucherrechte
- Lösung aktueller Probleme durch Vermittlung von Informationen z. B. über
und -beratung
1Verbraucherinformation 1I
I
------
Verbesserung der Markttransparenz
~ I - Regulierung des Anbieterverhaltens, u. a. des absatzpolitischen Instrumentariums (auch durch freiwillige Selbstkontrolle möglich) - Regulierung des Verbraucherverhaltens
I
I
Ir
J
- Selbstorganisation - Fremdorganisation
Organisation von Verbraucherinteressen
1
Machtausgleich zwischen Produzenten und Konsumenten
~
J
(rechtlicher) Verbraucherschutz
I
Verbesserung der WettbewerbsOTdnung
I
Vgl. auch die Zielsysteme bei Kuhlmann, E., 1990, S. 75 und S. 78, Mllhling, F. W., Verbraucherpolitik in der Bundesrepublik Deutschland - Zielsystem und Instrumentarium, in: WISU-Studienblatt, April 1981, sowie Keitz, W. von, Verbraucherpolitik, in: Kaiser, F.-J. und Kaminski, H. (Hrsg.), Wirtschaft. Handbuch zur Arbeits- und Wirtschaftslehre, Bad Heilbrunn 1981, S. 321.
Verbraucherpolitische Methoden
Wirtschaftspolitisches Ziel 2. Ordnung
W irtschaftspolitisches Ziel 1. Ordnung
Abbildung 3: Zielsystem der Verbraucberpolitik
w
w
I'
~
~ i:I
~ ;:s
1:;'
~
~ ~
I:
~ ~ ~
~
~
ff
~
;::~
!-->
B. Verbraucherpolitische Konzeptionen
34
Während bei dem Begriff Konsumentensouveränität einseitig von einer Beherrschung der Produzenten durch die gegebenen Bedürfnisse der Konsumenten ausgegangen wird, impliziert das Verbraucherleitbild der Konsumfreiheit "die Gleichrangigkeit des Konsumenten- und Produzenteninteresses".64 Die Bedürfnisse der Konsumenten bilden sich erst durch die Interaktion mit den Produzenten. Abhängig von verschiedenartigen Beschränkungen kann die Konsumfreiheit und damit das Konsumenteninteresse in unterschiedlichem Maße verwirklicht werden. Der Begriff der Konsumfreiheit erlaubt damit eine realitätsnahe Beschreibung der tatsächlichen Verhältnisse, die zwischen den Extremen Konsumzwang und Konsumentensouveränität liegen. Darüber hinaus liefert dieses Verbraucherleitbild - bei unangemessenen Beschränkungen der Freiheit der Konsumenten - möglicherweise eine bessere Legitimation rur staatliches Handeln als die Konsumentensouveränität. 65 Bei den ordnungspolitischen Prinzipien ist in dieser verbraucherpolitischen Konzeption eine Hinwendung vom Individualprinzip in Richtung Sozialprinzip erkennbar. Mit den Aufgaben einer stärkeren Kontrolle des Anbieterverhaltens durch Verbraucherschutzbehörden und der Förderung der Verbrauchergegenrnacht (durch die Einrichtung von staatlichen Verbraucherinstituten oder die finanzielle Unterstützung von Verbänden) betraut, wird der Staat zum wichtigsten Akteur der Verbraucherpolitik erhoben. Die Möglichkeit einer wirksamen Selbsthilfe der Konsumenten wird aufgrund ihrer schwachen Position und einer geringen Organisationsfähigkeit bezweifelt. Mit dieser Rechtfertigung können dem Staat trotz Beachtung der Subsidiarität die wesentlichen Kompetenzen zugeteilt werden, die aber regelmäßig zu überprüfen sind.66 Einer Selbstregulierung der Wirtschaft, z. B. im Bereich der Werbung, steht die Konzeption skeptisch gegenüber. Da sie vor allem den Eigeninteressen der Anbieter diene oder gesetzliche Regelun-
64 Ebenda, S. 35 f. 65 Vgl. KUHLMANN, E., 1990, S. 32 und S. 35, sowie umfassend zum Begriff der Konsumfreiheit: MEYER-DoHM, P., Sozial ökonomische Aspekte der Konsumfreiheit, Freiburg 1965. 66 Vgl. SCHERHORN, G., 1975, S. 133 f.
3. Darstellung der verbraucherpolitischen Konzeptionen
35
gen abwenden solle, wird sie nur als Ergänzung, nicht aber als Alternative zur staatlichen Kontrolle befilrwortet. 67 Schon in den bisherigen Ausfilhrungen ist der höhere Stellenwert der Verbraucherpolitik in dieser Konzeption deutlich geworden. Sie ist nicht mehr der Wettbewerbspolitik untergeordnet, sondern wird als eigenständiger Teilbereich der Wirtschaftspolitik angesehen. Die Wettbewerbspolitik bleibt eine wichtige Voraussetzung filr die Verwirklichung verbraucherpolitischer Zielsetzungen. Sie ist aber von der Verbraucherpolitik wegen ihrer primären Ausrichtung auf das Verhältnis zwischen den Anbietern, unterschiedlichen Zielen und Instrumenten deutlich zu trennen und wird deshalb nicht mehr als die "beste Verbraucherpolitik" akzeptiert. 68 Die hier als Gegenmachtmodell bezeichnete Konzeption soll schließlich auf ihre Vereinbarkeit mit der wirtschaftspolitischen Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft untersucht werden. Das liberale Wettbewerbs- und Informationsmodell hatte sich - wie oben gezeigt wurde - problemlos in diese Gesamtkonzeption eingefilgt. Auch das Gegenmachtmodell einer umfassenderen Verbraucherpolitik ist damit nicht grundsätzlich unvereinbar. Die Betonung der schwächeren Position des Verbrauchers und die daraus abgeleitete Forderung nach einer stärkeren Stellung passen zur sozialstaatlichen Komponente der Sozialen Marktwirtschaft. Einzelne Methoden dieser Konzeption, beispielsweise die Förderung der Verbraucherorganisierung, können trotz ihrer Bezeichnung als marktkompensierende Verbraucherpolitik durchaus dem Kriterium der Marktkonformität entsprechen. Wird jedoch das nun sehr breite Spektrum verbraucherpolitischer Methoden in seiner Gesamtheit und entsprechend häufig eingesetzt, so sind Bedenken anzumelden. Insbesondere ein massiver Einsatz von Methoden hoher Eingriffsintensität wie eine umfassende rechtliche Regulierung und eine starke staatliche Kontrolle können zu einer hohen Interventionsdichte filhren, die den Grundgedanken der Sozialen Marktwirtschaft widerspricht. Ungeachtet möglicher Einwände
67 Vgl. ebenda, S. 154 f. 68 Vgl. ebenda, S. 122.
36
B. Verbraucherpolitische Konzeptionen
gegen eine solche stark vereinfachte Zuordnung soll deshalb das Gegenmachtmodell in den Grenzbereich zwischen der Sozialen Marktwirtschaft und wohlfahrtsstaatlichen Gesamtkonzeptionen eingeordnet werden. Bei letzteren ist speziell ft1r die Bundesrepublik Deutschland die wirtschaftspolitische Konzeption des Demokratischen Sozialismus bedeutsam, die sich auf der Grundlage des Bad Godesberger Programms der SPD von 1959 ausgebildet hat. 69 Im Zuge der zunehmenden Ausweitung der Verbraucherpolitik in der politischen Praxis, besonders unter der sozial-liberalen Bundesregierung von 1969-1982, ist die Relevanz dieser verbraucherpolitischen Konzeption unbestreitbar. 7o Die Forderung nach Gegenmachtbildung und Verbraucherorganisation fmdet neben der liberalen Idee einer Verbraucherpolitik durch Wettbewerbspolitik und Information Eingang in die meisten programmatischen Stellungnahmen der öffentlichen Stellen, Verbände und politischen Parteien, wenn auch in unterschiedlicher Gewichtung. 71
Auch das Gegenmachtmodell ist heftiger Kritik von Vertretern anderer verbraucherpolitischer Konzeptionen ausgesetzt. Nach manchen liberalen Vorstellungen ist dieser Ansatz bereits zu interventionsstark. Eine Orientierung am vollständigen Wettbewerb kann, um die "Unvollkommenheiten" der Realität zu beseitigen und damit dem Optimalzustand möglichst nahe zu kommen, zu ständigem Hineinintervenieren in den Marktmechanismus fUhren. Dabei wird die Gefahr gesehen, daß durch zu starke Eingriffe dem Wettbewerb und damit auch den Verbrauchern mehr geschadet als geholfen wird. Den Anhängern besonders interventionsstarker Konzeptionen geht dagegen das Gegenmachtmodell wegen des Verzichts aufpartizipatorische Maßnahmen nicht weit genug. Neben dieser Auseinandersetzung, die sich letztlich auf die Frage nach dem geeigneten Ausmaß staatlichen Handelns zurückführen läßt, steht die Kritik der Verbraucherpolitik auf verhaltens-
69 Vgl. zum Demokratischen Sozialismus: SCHACHTSCHABEL, H. G., 1976, S.85-104. 70 Vgl. MAlER, L., 1987, S. 20 f. 71 Vgl. CZERWONKA, C. und SCHOPPE, G., 1977, bes. S. 280-286.
3. Darstellung der verbraucherpolitischen Konzeptionen
37
wissenschaftlicher Grundlage. Sie sieht einen Hauptmangel der Konzeption von Scherhorn, aber auch der zuvor analysierten Ansätze, in einer unzureichenden empirischen Fundierung. Diese Konzeption, die der Verbraucherpolitik durch eine Berücksichtigung des tatsächlichen Verbraucherverhaltens zu größerer Realitätsnähe und Wirksamkeit verhelfen will, wird im folgenden Abschnitt untersucht. Wie bereits oben angekündigt, sollen wegen ihrer Bedeutung in der wissenschaftlich diskutierten Verbraucherpolitik zunächst noch einige Besonderheiten der Konzeption von Scherhorn und seinen Mitarbeitern kurz dargestellt werden. 72 Ausgangspunkt der Betrachtung bei Scherhom ist die Bestimmung des "wahren" Verbraucherinteresses. Hierzu greift er auf die von dem Psychologen Maslow aufgestellte Hierarchie menschlicher Bedürfnisse zurück, nach der ein Individuum auf dem Weg zur Entfaltung seiner Persönlichkeit Bedürfnisse in einer bestimmten Abfolge verspürt und zu befriedigen versucht. Diese Entwicklung beginnt mit den physiologischen Grundbedürfnissen (Nahrung, Kleidung), es folgen Sicherheitsbedürfnisse, soziale Zugehörigkeitsbedürfnisse (Geborgenheit und Liebe), Geltungsbedürfnisse und auf der höchsten Stufe schließlich die Befriedigung des Bedürfnisses nach Selbstverwirklichung. Das eigentliche Interesse des Verbrauchers wird nun darin gesehen, alle Hindernisse zu überwinden, die ihn auf den unteren Bedürfnisstufen festhalten, um sich, hier speziell im Konsumbereich, zu verwirklichen. Diese Selbstverwirklichung der Konsumenten wird als oberste, gesellschaftliche Zielsetzung noch über den ökonomischen Zielen angeordnet. Sie wird nach Ansicht Scherhorns durch die übermäßige Marktmacht der Produzenten behindert. Aufgabe der Verbraucherpolitik sei es deshalb vor allem, einen Machtausgleich im Sinne der Beseitigung unangemessener Einschränkungen der Konsumfreiheit herzustellen. 72 Vgl. zum folgenden ausftlhrlich SCHERHORN, G., 1975, S. 1-68, oder zusammenfassend z. B. HENNING-BoDEWIG, F. und KUR, A., 1988, S. 173 f; MAHLING, F. W., Werbung, Wettbewerb und Verbraucherpolitik, München 1983, S. 178-181; LEONHÄUSER, I.-V., Bedürfnis, Normen und Standards: Ansätze rur eine bedarfsorientierte Verbraucherpolitik, Berlin 1988, S. 34-40.
B. Verbraucherpolitische Konzeptionen
38
Mit Hilfe des Begriffs der Konsumfreiheit bzw. deren Einschränkungen werden dann systematisch die Problemfelder der Verbraucherpolitik herausgearbeitet. In der Terminologie einer Einteilung von E. Hoppmann folgend73 wird zwischen Beschränkungen der Handlungsfreiheit (wenn Handlungsmöglichkeiten, die dem eigenen Interesse entsprechen, versperrt oder erschwert werden) und der Entschließungsfreiheit (wenn das Individuum in den inneren Beweggründen seines Handelns einseitig beeinflußt wird) unterschieden. 74 Zu einem Überblick über die von Scherhorn diagnostizierten Einschränkungen der Konsumfreiheit und ihrer Struktur verhilft Abbildung 4. Die unterlegene Position der Verbraucher versucht Scherhorn auch durch die Analyse der ihnen prinzipiell zur VerfUgung stehenden Sanktionsmittel nachzuweisen. Auf einer Einteilung von Hirschman aufbauend,75 stellt er folgenden Katalog potentieller Machtmittel der Konsumenten auf, der seitdem in der verbraucherpolitischen Literatur häufig genutzt wird: • Abwanderung ("exit") - Austritt aus dem Markt (Bedarfseinschränkung) - Abwendung (Kaufverlagerung) - Ausstand (temporärer Käuferstreik) • Widerspruch (" voice") - Einspruch (gerichtliche Anklage oder öffentliche Anprangerung) - Kritik • Verhandlung 73 Vgl. HOPPMANN, E., Zum Problem einer wirtschaftspolitisch praktikablen Definition des Wettbewerbs, in: SCHNEIDER, H. K. (Hrsg.), Grundlagen der Wettbewerbspolitik, Berlin 1968, S. 33-36. Nicht Ubemommen werden damit dessen wettbewerbstheoretische Vorstellungen der "Wettbewerbsfreiheit". Eine Übertragung dieses Leitbildes der Wettbewerbspolitik auf den Bereich der Verbraucherpolitik wird in der Konzeption der Wettbewerbs- und Konsumfreiheit versucht (siehe Kapitel 3.4.1). 74 Vgl. SCHERHORN, G., 1975, S. 35. 75 Vgl. HIRSCHMAN, A. 0., Abwanderung und Widerspruch, TUbingen 1974 (original: Exit, Voice and Loyalty, CambridgelMass. 1970), und SCHERHORN, G., 1975, S. 36-40.
- wettbewerbsbeschränkende Verhaltensweisen
• Marktverhalten:
- reaktive Nachfragerrolle - Heterogenität des Angebotes
·
Handlungsfreiheit /
• Marktstruktur:
C
l
~
I
- unvollständige oder irrefilhrende Informationen der Anbieter - unzulängliches (unkritisches) Verhalten der Nachfrager
• Kommunikationsverhalten:
- von Anbietem beherrscht
• Kommunikationsstruktur:
----------Entschließungsfreihelt
L
~Pri"H""mg'''' .
__ J
~
~
Handlungsfreiheit
Produzenteninteressen privater Anbieter
• Bevorzugung der
interesse des öffentlichen Anbieters
• eigenes Autonomie-
C_
. l Öffe~~liche KOnSUmgut~
Einschränkung der Konsumfteiheit
---
Abbildung 4: Einschränkungen der Konsumfreiheit bei Scherhorn
J
W
'-0
I"
~
~ i!
0:;"
~ ~ ::s
~
~
i:!
~
~
.,
i§= ~
~
~
Ir;;:
40
B. Verbraucherpolitische Konzeptionen
Die Einschränkungen der Konsumfreiheit können somit auch anband der geringen Wirksamkeit dieser einzelnen Handlungsalternativen aufgezeigt werden, die damit als prinzipielle Ansatzpunkte ftlr Verbesserungsmaßnahmen zur Verftlgung stehen. 3.2.3 Verbraucherpolitik aufverhaltenswissenschaftlicher Grundlage (Kroeber-Riel u.a.)
Die folgende verbraucherpolitische Konzeption soll nach ihrem Hauptvertreter in Deutschland, Werner Kroeber-Riel, als Verbraucherpolitik auf verhaltenswissenschaftlicher Grundlage bezeichnet werden. Sie ist jedoch nicht auf diesen Autor beschränkt, sondern fmdet auch in anderen, meist ebenfalls der betriebswirtschaftlichen Marketinglehre nahestehenden Arbeiten Verwendung. 76 Ausgangspunkt bei Kroeber-Riel ist die Kritik an der praktizierten Verbraucherpolitik und den vorherrschenden verbraucherpolitischen Konzeptionen, insbesondere dem liberalen Wettbewerbsund Informationsmodell sowie dem Ansatz von Scherhorn. Er kritisiert neben einer ungeeigneten Zielfindung vor allem die geringe Wirksamkeit der Verbraucherpolitik und ftlhrt beides auf die fehlende Berücksichtigung verhaltenswissenschaftlicher Erkenntnisse zurück. Unter dem Begriff Verhaltenswissenschaft werden alle Wissenschaften verstanden, die sich auf das menschliche Verhalten beziehen. Dazu gehören besonders die Psychologie, Soziologie, Kommunikationsforschung und Verhaltensbiologie. Die Konsumentenforschung als eine spezielle Verhaltenswissenschaft sieht ihr Ziel darin, aus der Empirie Erkenntnisse zur Erklärung des Verhaltens im Konsumbereich zu gewinnen. 77 Die Konsumenten76 Vgl. grundlegend zu diesem Abschnitt: KROEBER-RIEL, W., Kritik und Neuformulierung der Verbraucherpolitik auf verhaltenswissenschaftlicher Grundlage, in: Die Betriebswirtschaft, Ig. 37 (1977), S. 89-103, und mit weitgehend gleichem Inhalt: ders., Konsumentenverhalten, 5. Aufl., München 1992, S.676-697. Zu anderen Autoren vgl. beispielsweise MEIER, B., Verbraucherpolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Theoretischer Bezugsrahmen, Bestandsaufnahme und Lückenanalyse, Frankfurt u. a. 1984, besonders S. 49-104. 77
Vgl. KROEBER-RIEL, W., 1992, S. 7 f.
3. Darstellung der verbraucherpolitischen Konzeptionen
41
forschung hat zwar ihre Wurzeln in der empirischen Marketingforschung, die sich seit etwa Mitte der 60er Jahre, ausgehend von den Vereinigten Staaten, entwickelt hat. Sie hat sich aber immer mehr über diesen Bereich hinaus als verselbständigter Forschungszweig etabliert. Entscheidend fUr die Übertragung auf den Bereich der Verbraucherpolitik ist nun die Überzeugung, daß sich eine allgemeine Theorie des Konsumentenverhaltens zugleich rur mehrere Anwendungen eignet, nämlich neben dem kommerziellen Marketing auch fUr die Zwecke der Verbraucherpolitik. 78 Kroeber-Riel bezeichnet seine Konsumentenforschung als interdisziplinär, empirisch und pragmatisch.19 Ein interdisziplinäres Vorgehen erscheine aufgrund der Komplexität des Konsumentenverhaltens, die von nur einer wissenschaftlichen Disziplin kaum zu erfassen sei, erforderlich. 8o Mit empirischen Methoden wird versucht, aus der Realität Gesetzmäßigkeiten über das Verhalten von Verbrauchern abzuleiten und zu überprüfen. Auf die Ausrichtung am empirisch abgestützten, tatsächlichen Verhalten und die starke Betonung der praktischen Umsetzbarkeit ist schließlich die Bezeichnung dieser Konzeption als "pragmatische Verbraucherpolitik"81 ZUTÜckzufllhren. Die Konsumentenforschung und mit ihr auch die darzustellende verbraucherpolitische Konzeption greifen auf den sogenannten Informationsverarbeitungsansatz als einfaches Grundmodell zurück, der das Konsumentenverhalten als einen Problemlösungsbzw. Entscheidungsprozeß erklärt. 82 Dieses läßt sich mit Hilfe des "S-O-R-Schemas" (Stimuli-Organismus-Reaktion) vereinfacht darstellen. Der Entscheidungsprozeß wird ausgelöst durch verschiedenartige Stimuli, die von außen an den Konsumenten herangefllhrt werden. Bezogen auf eine Kaufentscheidung kann es sich 78 Vgl. ebenda, S. 3 f. 79 Vgl. ebenda, S. 18. 80 Vgl. MEIER, B., 1984, S. 61 f.
81 Vgl. BIERVERT, B. u. a., 1977, S. 59. 82 Vgl. zum folgenden HEINEN, E., Detenninanten des Konsumentenverhaltens - Zur Problematik der Konsumentensouverllnität, in: KOCH, H. (Hrsg.), Zur Theorie des Absatzes, Wiesbaden 1973, S. 88 f., und MÄHLING, F.W., 1983, S. 90-95.
42
B. Verbraucherpolitische Konzeptionen
hierbei z. B. um Informationen des Herstellers (Preis, Qualität, Werbung) handeln, aber auch um Maßnahmen der Verbraucherpolitik (Verbraucherinformation, -erziehung, -beratung). Entscheidend ist, daß der Stimulus aufgenommen, d. h. die Wahrnehmungsschwelle überschritten wird. Erst dann kommt es innerhalb des "Organismus Mensch" zum eigentlichen Problemlösungsprozeß, der als Abfolge von Informationsaufuahme, -verarbeitung und -speicherung aufgefaßt werden kann. Der Konsument ist dabei aber nicht als reines Informationsverarbeitungssystem ähnlich einer EDV-Anlage anzusehen, sondern wird von zahlreichen psychologischen Variablen wie seinen Motiven, Einstellungen oder Gefühlen beeinflußt. Am Ende des Prozesses stehen die Reaktionen des Konsumenten. Sie gehen über die eigentliche Kaufentscheidung (Kauf oder Nichtkauf) hinaus und umfassen auch Änderungen der psychologischen Variablen, die erst durch den Verbrauch des Konsumgutes in der anschließenden Kontrollphase eintreten. Diese Erfahrungen (z. B. Einstellungsänderungen) wirken dann in Form einer Rückkopplung auf den Organismus zurück und beeinflussen damit das zukünftige Konsumentenverhalten. Ausgangspunkt der Verbraucherpolitik auf verhaltenswissenschaftlicher Grundlage bildet nun die Erkenntnis, daß sich das als Kaufentscheidungsprozeß verstandene Konsumentenverhalten in mehrere Grundtypen von Entscheidungen aufgliedern läßt. Diese Idee geht auf den Amerikaner Katona zurück, der zunächst zwischen echten Entscheidungen und habituellem Verhalten unterschied und später davon noch impulsives Kaufverhalten abgrenzte. 83 Wegen der großen Bedeutung innerhalb dieser verbraucherpolitischen Konzeption soll die von Kroeber-Riel verwendete und von anderen Autoren aufgegriffene Unterscheidung von vier Formen des Entscheidungsverhaltens kurz vorgestellt werden. Darauf aufbauend wurde ein System verbraucherpolitischer Ziele und Strategien entwickelt, das den verschiedenen Entscheidungssitua-
83 Vgl. KATONA, G., Das Verhalten der Verbraucher und Unternehmer. Über die Beziehungen zwischen Nationalökonomie, Psychologie und Sozialpsychologie, Tübingen 1960, S. 57-61 [original: Psychological Analysis of Economic Behaviour, New York 1951], und ders., Die Macht des Verbrauchers, Düsseldorf, Wien 1962, S. 194 [original: The Powernd Consumer, New York 1960).
3. Darstellung der verbraucherpolitischen Konzeptionen
43
tionen des Verbrauchers Rechnung tragen soll. Im einzelnen werden unterschieden: 84 • Impulsive Entscheidungen: Sie sind ungeplant und entstehen spontan durch die Kaufsituation vor Ort. Bei geringer Informations- und hoher Risikoneigung des Konsumenten sind hier die Möglichkeiten der Beeinflussung besonders groß. • Habituelle (gewohnheits- oder routinemäßige) Entscheidungen: Vor allem bei problemlosen Gütern des täglichen Bedarfs kommt es zu solchen wiederholten, programmiert ablaufenden Käufen gleicher Güter, ohne dabei über Alternativen nachzudenken. Voraussetzungen dafür sind gute Produkterfahrungen und das Fehlen sonstiger Störungen. •
Vereinfachte (limitierte) Entscheidungen: Hier wird der Entscheidungsaufwand aufgrund von Erfahrungen und Einstellungen herabgesetzt. Der Verbraucher beschränkt sich von vornherein auf wenige Alternativen und verringert seine Informationssuche, indem er sich auf einzelne Schlüsselmerkmale (z. B. Marke oder Preis) konzentriert.
• Extensive (" echte H) Entscheidungen: Sie sind gekennzeichnet durch eine hohe Bereitschaft zur Verarbeitung von Informationen, eine geringe Risikoneigung und den Vergleich einer größeren Zahl von Alternativen. Diese Aktivität kommt dem modelltheoretischen "Rationalverhalten" nahe. Dabei wird in der Realität aber wohl weniger die Optimierung einer Zielgröße angestrebt als die Befriedigung eines individuell-subjektiven Anspruchsniveaus, so daß auch hier nur von beschränkt rationalem Verhalten gesprochen werden kann. Den aufwendigen extensiven Entscheidungsprozeß nimmt der Konsument nur relativ selten auf sich, so vor allem bei subjektiv neuen, teuren oder besonders bedeutsamen Produkten.
Kroeber-Riel kritisiert die bestehenden Ziele der theoretischen und der praktizierten Verbraucherpolitik wegen ihrer Fixierung auf das rationale Kaufverhalten als einseitig und unzweckmäßig. 85 84 Vgl. KROEBER-RIEL, W., 1977, S. 94 f., und MEIER, B., 1984, S. 68-79. 85 Vgl. KROEBER-RIEL, W., 1992, S. 684-686. 5 MilfOpoulos
44
B. Verbraucherpolitische Konzeptionen
Damit werden nur die extensiven Entscheidungen als ein Teilbereich des tatsächlichen Konsumentenverhaltens berUcksichtigt und gefördert, die anderen Entscheidungstypen dagegen vernachlässigt oder sogar abgelehnt. In der verhaltenswissenschaftlich fundierten Konzeption wird nun versucht, rur die unterschiedlichen Formen der Entscheidungsbildung spezifische Teilziele zu formulieren. 86 Der herkömmlichen Orientierung der Verbraucherpolitik entsprechend wird als erstes Ziel die "Rationalisierung von Kaufentscheidungen" aufgestellt, allerdings nur rur den begrenzten Bereich der extensiven Entscheidungen. Habituelle und vereinfachte Entscheidungen, die wohl den größten Anteil am Konsumentenverhalten ausmachen, werden nicht abgelehnt, sondern sogar als besonders ökonomische Kaufentscheidungen begrUBt. Eine ausschließliche Förderung rationalen Verhaltens überfordere den zeitlich und in seiner Informationsverarbeitungskapazität begrenzten Verbraucher und fUhre zu einer Überbetonung des Konsumbereichs. Gerade weil die Selbstverwirklichung des Menschen auch in anderen Lebensbereichen erfolge, sei er auf entlastende Kaufprozesse angewiesen, um beispielsweise durch schnelleres, wenn auch weniger durchdachtes Einkaufen seine Freizeit zu erhöhen. 87 Somit gilt die "Unterstützung und Förderung von routinemäßigen und vereinfachten Kaufentscheidungen" als weiteres verbraucherpolitisches Teilziel. Ein letztes Teilziel bezieht sich schwerpunktmäßig auf den Bereich der impulsiven Entscheidungen. Durch die Marketingaktivitäten der Anbieter kann es zu einer rur den Konsumenten nicht immer durchschaubaren, nachteiligen Beeinflussung kommen. Um zumindest den groben Mißbrauch dieser Strategien zu verhindern, wird als drittes Ziel der "Schutz vor schädlichen Einwirkungen durch das Marketing" formuliert. 88 Die beschriebenen Teilziele einer verhaltenswissenschaftlichen Verbraucherpolitik sind eingebettet in ein "Drei-Stufen-Verfah86 Vgl. ebenda, S. 692-693. 87 Vgl. ebenda, S. 686. 88 Vgl. ebenda, S. 692 f.
3. Darstellung der verbraucherpolitischen Konzeptionen
4S
ren" der pragmatischen Zielableitung. 89 Bei der Ableitung des verbraucherpolitischen Oberziels wird auf abstrakte Nonnen wie "Selbstverwirklichung" oder auf die als fruchtlos bezeichnete Diskussion über die "echten" Bedürfnisse verzichtet. Kroeber-Riel wählt das Oberziel aus dem vorhandenen, marktwirtschaftlichen Zielsystem aus und nennt es, "die Konsumenten besser als bisher in die Lage zu versetzen, durch den Kauf von Gütern oder den Verbrauch von öffentlichen Leistungen ihre Bedürfnisse zu befriedigen"90. Die zweite Stufe des Verfahrens stellen die genannten drei Teilziele und ihnen zugeordnete Maßnahmen dar, mit denen das Oberziel rur die praktische Umsetzung operationalisiert wird. Innerhalb dieser Möglichkeiten eines politischen Eingreifens werden in der dritten Stufe schließlich Prioritäten gesetzt: Es sollen die Ziele und Maßnahmen ausgewählt bzw. gewichtet werden, die besonders zur Lösung aktueller sozialer Probleme beitragen können. Das Leitbild der Konsumentensouveränität wird in der Verbraucherpolitik auf verhaltenswissenschaftlicher Grundlage als Fiktion abgelehnt und scharf kritisiert, ohne es durch einen ähnlich schlagwortartigen Begriff zur Beschreibung der Stellung der Konsumenten zu ersetzen. Der Konsument wird so genommen, wie er tatsächlich ist, nämlich von GefUhlen und Motiven bestimmt und beeinflußbar. Angesichts der Betonung der rur den Konsumenten negativen Manipulationstechniken des Marketing und daraus folgend der Notwendigkeit des Verbraucherschutzes - besonders bei sozial schwachen Verbrauchergruppen - sowie der beschränkten Erziehbarkeit und Infonnationsverarbeitungskapazität des Verbrauchers läßt sich dessen Stellung in dieser Konzeption am besten mit dem Bild des hilfsbedürftigen Konsumenten beschreiben. Die AusfUhrungen der Konzeption zu den verbraucherpolitischen Methoden deuten gegenüber den zuletzt dargestellten Ansätzen nicht auf eine Ausweitung hin, sondern unterscheiden sich durch eine andere Gewichtung und das Bemühen um einen effektiveren Einsatz der vorhandenen Instrumente. 89 Vgl. ebenda, S. 688-690. 90 Ebenda, S. 689. S"
46
B. Verbraucherpolitische Konzeptionen
Den drei Teilzielen, die jeweils nur im zugehörigen Bereich des Kaufverhaltens gültig sind, werden zur Zielerreichung grundlegende Strategien zugeordnet. Durch die sinnvolle Unterscheidung jeweils nach dem Ansatzpunkt beim Konsumenten (also auf der Nachfragerseite) und beim Marketing (auf der Anbieterseite) erhält Kroeber-Riel ein Schema von insgesamt sechs verbraucherpolitischen Strategien. 91 Dabei können einzelne Methoden in mehreren Strategien eingesetzt werden. Verbraucherinformation und Verbraucherbildung wenden sich an die Konsumenten, während vor allem Gesetze und Verordnungen (rechtlicher Verbraucherschutz) und die Selbstkontrolle der Wirtschaft auf die Anbieter gerichtet sind. Zu einer Übersicht über die grundlegenden verbraucherpolitischen Ziele und Strategien bei Kroeber-Riel verhilft Abbildung 5. Der Schwerpunkt der bisher praktizierten Verbraucherpolitik wird in der umfassenden Information und Aufklärung der Verbraucher gesehen. Dies kann aber nur ein geeigneter Weg zur Rationalisierung der extensiven Kaufentscheidungen sein. Um auch die vereinfachten Kaufentscheidungen zu verbessern, sollen den Konsumenten verstärkt sogenannte Schlüsselinformationen bereitgestellt werden. 92 Zu solchen einfachen Beurteilungskriterien können beispielsweise die Gesamturteile vergleichender Warentests gezählt werden. Insgesamt sollten die Verbraucherinformationen leicht verständlich und nicht zu umfangreich sein. Durch die Anwendung der verhaltenswissenschaftlichen Methoden, denen sich gerade das Marketing so erfolgreich bedient, könne auch die Verbraucherinformation wirksamer eingesetzt werden: "Verbraucherpolitische Maßnahmen mUssen den Konsumenten ebenso wie andere Beeintlussungstechniken emotional ansprechen, sie müssen ihn 'aktivieren' und auf seine gedankliche Bequemlichkeit Rücksicht nehmen. Das bedeutet unter anderem, daß die zu vermittelnden Informationen wirksam 'verpackt' und dosiert werden mUssen".93
91 Vgl. KROEBER-RIEL. W., 1917, S. 99-102. 92 Vgl. ebenda, S. 100.
93 Ebenda, S. 91.
Quelle: Kroeber-Riel, W., 1992, S. 694.
Schutz vor schadlichen Einwirkungen durch das Marketing
Rationalisierung von Kaufentscheidungen
Unterstützung und Förderung routinemaßiger und vereinfachter Kaufentscheidungen
Grundlegende Ziele der Verbraucherpolitik
Strategien 31 (z. B. Immunisierung)
Strategien 21 (z. B. Verbraucherbildung, Gegeninformation)
Strategien 32 (wie 12)
Strategien 22 (wie 12)
Strategien 12 (z. B. Werbeselbstkontrolle und gesetzliche Vorschriften)
auf das Marketing bezogen
Grundlegende Strategien
Strategien 11 (z. B. SchlOsselinformationen aus Warentests)
auf den Konsumenten bezogen
Abbildung 5: Schema der Verbraucherpolitik bei Kroeber-Riel
~
~
l'
~
~
~ c;;.
!
tii:!
~
~
i:" ~
!t
~
!-'>
;::
B. Verbraucherpolitische Konzeptionen
48
Außer Verbraucherautklärung und -infonnation wird der rechtliche Verbraucherschutz als zweiter großer Bereich der Verbraucherpolitik aufgeftlhrt. Er umfaßt vor allem den Schutz von Gesundheit und Sicherheit sowie vor Täuschung und Übervorteilung des Verbrauchers. Kroeber-Riel ordnet hier auch die Regelungen zur Erhaltung des Wettbewerbs (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) ein. 94 Die Bedeutung der Wettbewerbspolitik fUr den Verbraucher wird sonst an keiner Stelle angesprochen. Neben einer gewissen Skepsis gegenüber den inzwischen zahllosen Einzelregelungen (geringe Wirksamkeit z. B. durch überforderte Kontrollbehörden) wird die Vernachlässigung des Schutzes vor Beeinflussung durch das Marketing als entscheidender Mangel des bisherigen Verbraucherschutzes angesehen. Da dieses dritte Teilziel auch durch umfassende Infonnation und Bildung nicht zu realisieren sei, besteht nach Kroeber-Riel hier ein besonderer verbraucherpolitischer Bedarf nach zusätzlicher Regulierung (z. B. bei Verstoß gegen gesellschaftliche Standards oder Werbung fUr schädliche Produkte).9s Wegen der Erkenntnis der Konsumforschung, daß Beeinflussungen alltäglich und nonnal sind, wird aber auf einen massiven Einsatz der vergleichsweise interventionsstarken gesetzlichen Regelungen verzichtet. Statt die Beeinflussungen durch das Marketing im einzelnen zu reglementieren, soll nur der grobe Mißbrauch verhindert werden. 96 Ebenfalls dem Schutz vor schädlichen Einwirkungen des Marketing kann eine Selbstregulierung der Wirtschaft dienen. Wie schon in der zuvor dargestellten verbraucherpolitischen Konzeption wird aber die Wirksamkeit dieser Selbstkontrolle so skeptisch beurteilt, daß sie die gesetzlichen Regelungen nicht ersetzen, sondern allenfalls ergänzen kann. 97
94 Vgl. hierzu und zum folgenden KROEBER-RlEL, W., 1992, S. 681 und S.683. 9S
Vgl. KROEBER-RlEL, W., 1977, S. 102.
96 Vgl. KROEBER-RlEL, W., 1992, S. 692 f. 97 Vgl. ebenda, S. 696 f.
3. Darstellung der verbraucherpolitischen Konzeptionen
49
Eine Neuerung im verbraucherpolitischen Instrumentarium stellt schließlich der Vorschlag dar, den Beeinflussungen durch das Marketing von der Nachfrageseite zu begegnen. Dabei soll auf Grundlage der verhaltenswissenschaftlichen Reaktanztheorie versucht werden, den Konsumenten durch die Ausbildung von "Trotzreaktionen" dagegen zu immunisieren. 98 Zu den Konzeptionsmerkmalen ordnungspolitische Prinzipien und Einordnung in eine wirtschaftspolitische Gesamtkonzeption macht Kroeber-Riel kaum direkte Aussagen. Diese verbraucherpolitische Konzeption ist damit in gewisser Weise unvollständig, es muß jedoch beachtet werden, daß vom Autor gar keine Gesamtdarstellung beabsichtigt ist. Er greift von vornherein nur die Punkte auf, bei denen eine verhaltenswissenschaftlich-empirische Fundierung Neuerungen verspricht. Eine Einordnung der Verbraucherpolitik in die allgemeine Wirtschaftspolitik scheint KroeberRiel - möglicherweise schon wegen seiner Herkunft aus dem Bereich der betriebswirtschaftlichen Marketinglehre - weniger zu interessieren. Wenn überhaupt, so besteht sein übergeordnetes Interesse in der Einordnung der Verbraucherpolitik in die Konsumforschung. Mangels direkter Aussagen zu diesen Punkten soll im folgenden nur ein grober Vergleich mit der Konzeption von Scherhorn erfolgen. Bei den ordnungspolitischen Prinzipien läßt sich bei KroeberRiel ebenfalls eine Hinwendung vom Individualprinzip in Richtung Sozialprinzip feststellen. Dies wird durch die Betonung der Hilfsbedürftigkeit der Konsumenten und die Forderung, verbraucherpolitische Prioritäten nach sozialen Aspekten zu setzen,99 deutlich. Da sich bei Kroeber-Riel keine Angaben zur Verteilung der Kompetenzen fmden, wird angenommen, daß er die vorhandenen Akteure akzeptiert. Auch der Stellenwert der Verbraucherpolitik innerhalb der Wirtschaftspolitik und speziell das Verhältnis zur Wettbewerbspolitik werden nicht problematisiert. Bei der Betrachtung der Ziele und Methoden dieser verbraucherpolitischen Konzeption wird jedoch 98 Vgl. ebenda. 99 Vgl. KROEBER-RIEL, W., 1977, S. 102.
50
B. Verbraucherpolitische Konzeptionen
deutlich, daß auch hier eine eigenständige Verbraucherpolitik angestrebt wird. Die Eingriffsintensität der verbraucherpolitischen Maßnahmen wird ähnlich wie in der Konzeption von Scherhom eingeschätzt. Einer geringeren Aktivität im Bereich der Aufklärung und Verbraucherinformation (geringere Quantität sowie niedrigeres Informationsniveau) steht mehr rechtlicher Verbraucherschutz durch zusätzliche Reglementierungen des Marketings gegenüber, die aber nur vorsichtig eingesetzt werden sollen. Bei der Darstellung der Verbraucherpolitik auf verhaltenswissenschaftlicher Grundlage hat sich an mehreren Stellen die Unvollständigkeit dieser Konzeption in dem Sinne gezeigt, daß nicht zu allen Merkmalen Aussagen getroffen wurden. Dies kann nicht unbedingt negativ beurteilt werden, da gerade diese Offenheit möglicherweise der Konzeption zu größerer Akzeptanz verholfen hat. Ihre zentralen Gedanken, wie die stärkere Nutzung verhaltenswissenschaftlicher Erkenntnisse und die Forderung nach größerer Realitätsnähe der Verbraucherpolitik, wurden von vielen anderen Autoren aufgegriffen. IOO Auch wenn dort nicht die gesamte Konzeption unkritisch hingenommen wird, so findet zumindest der Vorschlag einer verstärkten Verwendung ihrer verhaltenswissenschaftlich-empirischen Methodik breite Zustimmung. Sie kann als geeignet für die Weiterentwicklung der Verbraucherpolitik, insbesondere für einen wirksamen Einsatz der Verbraucherinformation angesehen werden. Die Verbraucherpolitik darf nicht dabei stehenbleiben, zur eigenen Rechtfertigung immer wieder die geringen Ausgaben für neutrale Produktinformationen den immensen Ausgaben der Unternehmen für kommerzielle Werbung gegenüberzustellen. IOI Gerade weil der Verbraucherpolitik als vergleichsweise untergeordnetem Politikbereich nur sehr begrenzte Mittel zufließen, sollte für sie das große Potential der Marketingforschung nutzbar gemacht werden. Hier gehen allerdings die Meinungen auseinander. Wäh100 Interessanterweise von Vertretern sehr unterschiedlicher Konzeptionen. Vgl. z. B. BIERVERT, B. u. a., 1977, S. 60 (interventionsstarke Konzeption), und MÄHLING, F. W., 1983, S. 343-354 (interventionsskeptische Konzeption). IOI So beispielsweise Maier, L., der das Verhältnis mit 1:\000 angibt. Vgl.
MAlER, L., 1987, S. 76.
3. Darstellung der verbraucherpolitischen Konzeptionen
51
rend die Vertreter der verhaltenswissenschaftlichen Konzeption den interdisziplinären Charakter der Konsumforschung betonen und ihre zweiseitige Anwendung filr Marketing und Verbraucherpolitik filr sinnvoll und möglich halten, wird dies besonders von den Autoren des partizipatorisch-emanzipatorischen Ansatzes abgelehnt. Sie halten nur eine rein verbraucherorientierte empirische Forschung rur geeignet und warnen vor einer Übernahme einseitig auf die Unternehmen ausgerichteter Forschungsergebnisse. I02 Die bisher geringe Anwendung verhaltenswissenschaftlicher Erkenntnisse in der praktischen Verbraucherpolitik filhrt KroeberRiel auf zwei Ursachen zurück: 103 einerseits auf Defizite in der Verbraucherforschung selbst und andererseits auf die ablehnende Haltung der verbraucherpolitisch Verantwortlichen wegen ihrer geringen verhaltenswissenschaftlichen Kenntnisse und weil sich diese "aus ideologischen Gründen scheuen, die gleichen Waffen wie die Werbung einzusetzen."I04 Die grundsätzlich sinnvolle, auch emotionale Ansprache des Verbrauchers durch die Verbraucherpolitik sollte aber nicht so weit gehen, daß sie sich in gleichem Maße wie das Marketing dem Vorwurf der manipulativen Beeinflussung aussetzt. Eine massive Manipulation des Konsumenten von dieser (zumindest staatlich unterstützten) Seite wäre ordnungspolitisch bedenklich und innerhalb eines marktwirtschaftlichen Rahmens kaum zu legitimieren. lOS Bei der Kritik der Verbraucherpolitik auf verhaltenswissenschaftlicher Grundlage muß auch die teilweise heftige Kontroverse zwischen Kroeber-Riel und Scherhorn kurz angesprochen werden. Die hier gefilhrte Auseinandersetzung dreht sich vornehmlich um
102 Vgl. BIERVERT, B. u.a., 1977, S. 21, und noch deutlicher HERHAUS, M., Methodo1ogische Implikationen neuerer verbrauchertheoretischer Ansätze rur die praktische Verbraucherpolitik, Hannover 1989, S. 68 f. 103 Vgl. KROEBER-RIEL, W., 1977, S. 90 f.
104 Ebenda, S. 91. lOS Vgl. KRUSE, J., Informationspolitik rur Konsumenten, Göttingen 1979, S. 53, der von einer faktischen "Aufhebung des marktwirtschaftlichen Selbstentscheidungspostulats" bei der Verwendung suggestiver Kommunikationsmethoden spricht.
52
B. Verbraucherpolitische Konzeptionen
das geeignete Verbraucherbild. Ohne die Frage abschließend zu klären, ob der "rationale Verbraucher" wegen seiner Realitätsferne abzulehnen oder als "konstruktive Utopie" seine Berechtigung hat, läßt sich zumindest übereinstimmend feststellen, daß die Verbraucherpolitik beides - das vernunftgemäße und das geftlhlsbetonte Handeln des Menschen - berücksichtigen sollte. 106 Schließlich kritisieren die Vertreter des partizipatorischen Ansatzes die Zielfmdung auch bei Kroeber-Riel als system immanent und konservierend. l07 Auf diesen Vorwurf einer unzureichenden Legitimation wird im nächsten Abschnitt über die interventionsstarken Konzeptionen genauer eingegangen. Kroeber-Riel umgeht diese "abstrakten, ideologischen Langzeitdiskurse" ausdrücklich, indem er auf sein betont pragmatisches Vorgehen verweist. 108
3.3 Interventionsstarke Konzeptionen 3.3.1 Partizipatorisch-emanzipatorischer Ansatz (Biervert u. a.) In den 70er Jahren entstand etwa zeitgleich mit den Ansätzen von Scherhorn und von Kroeber-Riel eine verbraucherpolitische Konzeption, die wegen ihrer zentralen Forderung nach einer Mitwirkung der Verbraucher bei den Produktionsentscheidungen als partizipatorisch-emanzipatorische Verbraucherpolitik bezeichnet wird. Die Hauptvertreter dieser interventionsstarken und systemkritisehen Konzeption gehören zu einer Gruppe von Wirtschaftswissenschaftlern an der Universität Wuppertal um Bernd Biervert (Arbeitsgruppe Konsumforschung und Verbraucherpolitik).109 Sie verwenden ftlr ihren Ansatz auch die Ausdrücke "Ex-anteVerbraucherpolitik" und "kritische Theorie der Verbraucherpolitik in praktischer Absicht". Bereits bei den Autoren des Gegenmacht106 Vgl. SCHERHORN, G., Realitatsfremdes Verbraucherbild oder konstruktive Utopie? in: Mitteilungsdienst der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Heft 3-4, DUsseldorf 1977, S. 34. 107 Vgl. BIERVERT, B. u. a., 1977, S. 62 f. 108 Vgl. KROEBER-RrEL, W., 1977, S. 96. 109 Vgl. grundsätzlich zu dieser Konzeption: BIERVERT, B., FISCHERWINKELMANN, W. F., und ROCK, R., 1977, besonders S. 217-235 sowie S. 55-57.
3. Darstellung der verbraucherpolitischen Konzeptionen
53
modells wurde eine Partizipation der Verbraucher ftlr vorteilhaft gehalten. Im Gegensatz zu der im weiteren darzustellenden Konzeption stehen dort solche Forderungen allerdings nicht im Vordergrund, sondern werden nur verhältnismäßig untergeordnet erwogen. l1O Es bestehen also auch hier in gewisser Weise fließende Übergänge. Die Darstellung soll wieder mit der Situationsanalyse beginnen. Der Partizipationsansatz kritisiert stark die Marktorientierung der praktizierten Verbraucherpolitik und nahezu aller anderen verbraucherpolitischen Konzeptionen. Es werden zunächst die schon von den bisher untersuchten Ansätzen genannten Gründe filr ein Wettbewerbsversagen 111 zuungunsten der Verbraucher angefilhrt wie unvollständige und irreftlhrende Informationen, manipulative Beeinflussung durch Werbung, zunehmende Produktdifferenzierung und technische Kompliziertheit der Güter oder zunehmende Konzentration auf der Anbieterseite. Sie werden nun aber in ihrer Bedeutung stärker bewertet und die Stellung des Verbrauchers entsprechend schwächer eingeschätzt. Diese Probleme können nach Ansicht der Vertreter dieser Konzeption nicht oder nicht hinreichend im Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung beseitigt werden. Der bisherigen Verbraucherpolitik wird vorgeworfen, nur an den Symptomen zu kurieren, ohne die eigentlichen Ursachen, die in der "kapitalistischen Wirtschaftsordnung" lägen, zu beseitigen. Die damit verbundene Forderung nach einer grundlegenden Umgestaltung des bestehenden Systems läßt sich in eine weit über den Bereich der Verbraucherpolitik hinausgehende umfassende Diskussion etwa Mitte der 70er Jahre einordnen. Im Zuge der zunehmenden gesamtwirtschaftlichen und sozialen Probleme in dieser Zeit (z. B. steigende Arbeitslosigkeit, Inflation, Ölkrise) 110 Vgl. SCHERHORN, G., 1975, S. 100, und REICH, N. u. a., 1977, S. 235-255. I I I Dem in der Literatur üblicherweise verwendeten Begriff "Marktversagen" wird in dieser Arbeit der Ausdruck "Wettbewerbsversagen" vorgezogen. Unter Markt wird zunächst nur der ökonomische Ort des Zusammentreffens von Angebot und Nachfrage verstanden, unabhängig von der Art des Wirtschaftssystems. Entscheidend rur eine marktwirtschaftliehe Ordnung ist aber der wettbewerbliehe Selbststeuerungsmechanismus, d.h. die Frage, ob Wettbewerb (oder Wettbewerbsversagen) vorliegt. Zudem ist der Ausdruck Marktversagen unserer Ansicht nach zu eng mit dem überholten Leitbild der vollkommenen Konkurrenz verbunden.
54
B. Verbraucherpolitische Konzeptionen
suchten einzelne Politiker und Wissenschaftler nach Lösungen in Fonn einer systemverändernden Wirtschaftspolitik. Hierzu gehören die Forderung nach Verstaatlichungen in einzelnen Bereichen der Wirtschaft und besonders die Diskussion um eine direkte Investitionslenkung. 112 Die Vertreter der Verbraucherpolitik in partizipatorischer Absicht sehen ihre Aufgabe weniger darin, ein fertiges verbraucherpolitisches Zielsystem aufzustellen. Ihr besonderes Interesse gilt vielmehr der Frage der Zielfmdung und ihrer Legitimierung, d. h. dem richtigen Weg zur Bestimmung der durch die Verbraucherpolitik anzustrebenden Ziele. ll3 Gelingt die Institutionalisierung des als geeignet angesehenen Zielfmdungsprozesses, dann dürfte die Ausfonnulierung einzelner Ziele (als dessen Ergebnis) weitgehend unproblematisch sein. Die Zielfindung und -legitimierung der praktizierten Verbraucherpolitik und der bisher untersuchten Konzeptionen bildet zugleich einen Kritikpunkt des Partizipationsansatzes. Die gegenwärtige Zielfmdung wird wegen ihrer ordnungspolitischen und elitären Legitimierung abgelehnt. Sie wird als ordnungspolitisch bezeichnet aufgrund der Orientierung am Marktmodell und seinen Leitbildern (Konsumentensouveränität, homo oeconomicus usw.). Diese Ausrichtung am Marktparadigma wird wegen der fehlenden Realitätsnähe und einer angeblichen Einseitigkeit (fehlende Berücksichtigung gesellschaftlicher und zukünftiger Bedürfnisse, Beschränkung auf den Bereich privater Konsumgüter) kritisiert. Einen elitären Charakter erhält die Verbraucherpolitik nach dieser Auffassung schließlich, indem die Operationalisierung der Ziele und Maßnahmen durch wissenschaftliche und politische Eliten, also ohne direkte Mitwirkung der betroffenen Verbraucher erfolgt. Hier setzt die vorgeschlagene partizipatorisch-emanzipatorisch legitimierte Zielfmdung an. 1l4 Die Verbraucher sollen Möglich112 Vgl. HAUTH, G., Verbraucherpolitik - trojanisches Pferd zur Systemveränderung? in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, Nr. 43 vom 28.10.78, S. 2l. 113 Vgl. zur Zielfindung im einzelnen: BIERVERT, B. u. a., 1977, S. 46-57. 114 Vgl. ebenda, S. 55-57.
3. Darstellung der verbraucherpolitischen Konzeptionen
55
keiten zur Einbringung ihrer Interessen erhalten, indem sie unmittelbar an einem Prozeß der Kommunikation über die sie betreffenden Fragen beteiligt werden. Durch die aktive Teilnahme der Verbraucher an der Entwicklung und Befriedigung ihrer Bedürfnisse glaubt man, das "echte" Verbraucherinteresse und damit auch legitimierte verbraucherpolitische Ziele identifizieren zu können. Diese Einbindung der Konsumenten in die Verbraucherpolitik soll in Form "geregelter Diskurse" durchgeführt werden. Als Grundlage der propagierten Neuorientierung und Legitimation der Verbraucherpolitik werden von den Vertretern dieser Konzeption allgemeine Diskursmodelle aus der Literatur herangezogen (Diskursmodell von Habermas und der Erlanger Schule).llS Charakteristisch rur diese Modelle ist die Annahme, daß es bei Einhaltung bestimmter methodischer Regeln in einer Gruppe stets möglich sei, rein argumentativ und ohne den Einsatz von Macht in der Diskussion Konflikte zu überwinden bzw. einen Konsens zu finden. Wegen der unrealistischen Prämissen ("eines 'grenzenlosen' Glaubens an die Konsensflihigkeit und -willigkeit der 'vernünftigen' Menschen"1l6) und der Schwierigkeiten bei der Umsetzung in die Praxis halten allerdings auch Biervert u. a. nur eine tendenzielle Verwirklichung eines solchen Diskurses rur möglich. Da die vorhandenen Modelle unzureichend sind, wird eine besondere Aufgabe in der Entwicklung realisierbarer Diskursmodelle rur die Partizipation der Verbraucher gesehen. In der partizipatorischen Konzeption der Verbraucherpolitik wird der Konsument als dem Anbieter generell wirtschaftlich unterlegen eingeschätzt. Die schwache Stellung des Verbrauchers wird nicht auf das Vorhandensein einzelner Mißstände zurückgefUhrt, sondern liegt in der Konstruktion der marktwirtschaftlichen Ordnung begründet. Durch das Marketing manipulieren die Anbieter vorhandene Bedürfnisse der Verbraucher und schafften sogar immer neue "künstliche" Bedürfnisse. In einer systemimmanenten Schwächeposition verbleibt dem Verbraucher nur ein reaktives Verhalten auf das Angebot der Produzenten. Dies kommt in 115 Vgl. ebenda, S. 218-224, und ausftlhrlich STAUSS, B., 1980, S. 74-97. 116 BIERVERT, B.
u. a., 1977, S. 223.
56
B. Verbraucherpolitische Konzeptionen
dem hier (nur deskriptiv, nicht normativ) zugrundegelegten Verbraucher(leit)bild der Produzentensouveränität zum Ausdruck. 117 Wie schon die Konsumentensouveränität als anderes Extrem zur Beschreibung der Stellung des Verbrauchers in der Marktwirtschaft ist auch die Produzentensouveränität dem Vorwurf ausgesetzt, zu einseitig und damit nicht realitätsgerecht zu sein. Der partizipatorisch-emanzipatorische Ansatz bildet den Schlußpunkt einer Entwicklung innerhalb der verbraucherpolitischen Konzeptionen zu einer Ausweitung sowohl des Anwendungsbereichs der Verbraucherpolitik als auch der eingesetzten Methoden. Die Verbraucherpolitik soll nicht auf den Konsumbereich (inklusive öffentlicher Güter) beschränkt bleiben, sondern auch den Produktionsbereich umfassen. Dies wird damit begründet, daß die verbraucherpolitisch bedeutsamen Funktionsstörungen im marktwirtschaftlichen System vom Produktionssektor zumindest mitverursacht werden und folglich ihre Beseitigung auch dort ansetzen muß. Biervert u. a. analysieren dazu die Interessenkonflikte zwischen Arbeit, Konsum und Kapital und versuchen, einen Interessenausgleich zu fmden. Die Rollendifferenzierung des Menschen in Arbeitnehmer und Konsument (Konflikt zwischen Arbeit und Konsum) soll überwunden und die angebliche Dominanz des Kapitalinteresses durch Veränderungen in den Produktionsverhältnissen beseitigt werden. I 18 Hier setzt die rur diese verbraucherpolitische Konzeption zentrale Forderung nach einer Partizipation der Verbraucher bei den Produktionsentscheidungen - zusätzlich zu den traditionellen Methoden der Verbraucherpolitik - an, "wobei das Spektrum der Mitwirkungsmöglichkeiten von der Mitbestimmung bis zur direkten Investitionslenkung reicht". I 19 Damit wird die Verbindung dieser Konzeption mit der Investitionslenkungsdebatte der damaligen Zeit sichtbar. 120 Aufgrund einer 117 Vgl. KUHLMANN, E., 1990, S. 36-39. 118 Vgl. BIERVERT, B. u. a., 1977, S. 229-231. 119 MEIER, B., 1983, S. 119. 120 Vgl. zum folgenden: KAUTNER, K., Zur Notwendigkeit direkter Investitionslenkung im Rahmen einer Ex-Ante-Verbraucherpolitik, in: BIERVERT, B. u. a. (Hrsg.), Plädoyer rur eine neue Verbraucherpolitik, Wiesbaden 1978, S. 237-253.
3. Darstellung der verbraucherpolitischen Konzeptionen
57
angeblich vergangenheitsorientierten Preisbildung bei marktwirtschaftlicher Steuerung könnten keine zukunftsorientierten Produktionsentscheidungen getroffen werden. Um dies zu vermeiden und zugleich die Produktion an den wirklichen gesellschaftlichen Bedürfnissen auszurichten, sollen die Verbraucher selbst im Diskursverfahren eine sogenannte Bedarfsrangskala entwickeln. Diese soll dann zur Direktsteuerung der Investitionen als entscheidende Determinante zukünftiger Produktion und damit der Bedürfnisbefriedigung eingesetzt werden. An die Stelle der bisher reinen Ex-post-Orientierung, die den Konsumenten und der Verbraucherpolitik lediglich eine reaktive Rolle zuweise, trete die frühzeitige Einflußnahme der Betroffenen. Dies führt zur Bezeichnung dieser Konzeption auch als Ex-ante-Verbraucherpolitik. Die angestrebte Partizipation sei in den gegenwärtig vorherrschenden Fremdorganisationen nicht realisierbar, sondern erfordere Selbstorganisationen der Verbraucher, "in denen diese ihre Interessen selbst artikulieren, im Kollektiv aushandeln und in gemeinsamen Aktivitäten durchzusetzen versuchen bzw. unmittelbar Repräsentanten mit ihrer Interessenvertretung beauftragen". 121 Eine schrittweise Einführung geregelter Diskurse könne sowohl im Produktionsbereich eingeleitet werden (z. B. durch selbstorganisierte genossenschaftliche Produktion, betriebliche Verbrauchermitbestimmung bis hin zur direkten Investitionslenkung) als auch im Konsumbereich (z. B. durch spontane Streiks oder Boykotte, basislegitimierte Verbraucherräte oder -vereine bis hin zu Formen des kollektiven Konsums wie der gemeinsamen Güternutzung im nachbarschaftlichen Raum).122 Die partizipatorische Konzeption hält eine solche Selbstorganisation der Verbraucher für nötig und - trotz immer wieder in der Literatur angeführter Organisationshemmnisse - bei hinreichender Aktivierung der Verbraucher auch für möglich. Die 121 BIERVERT, B., Zur Organisierbarkeit von Verbrauchern und ihren Interessen, in: NEUMANN, L. F. (Hrsg.), Sozialforschung und soziale Demokratie, Bonn 1979, S. 98. 122 Vgl. BIERVERT, B., 1977, S. 233 f., und ders., GrundzUge der Verbraucherpolitik in der Bundesrepublik Deutschland, in: HANSEN, U. (Hrsg.), Marketing und Verbraucherpolitik, Stuttgart 1982, S. 5I.
58
B. Verbraucherpolitische Konzeptionen
Aufgabe einer Emanzipation der Konsumenten vor allem durch die Verbrauchererziehung und -bildung wird deshalb als wesentliche Voraussetzung der Partizipation angesehen. Der Konsument soll durch die Vermittlung von kritischem Grundlagenwissen über die Defizite des marktwirtschaftlichen Systems, über den Konsum und damit zusammenhängende gesellschaftliche Probleme sowie über die eigenen Bedürfnisse ein Problembewußtsein erlangen, das ihn motiviert, selbst verbraucherpolitisch mitzuwirken. 123 Auch die anderen verbraucherpolitischen Methoden werden über ihre bisherige Anwendung hinaus dazu benutzt, die Ex-anteOrientierung der Verbraucherpolitik im Sinne einer frühzeitigen Einflußnahme der Konsumenten zu stärken. Die Verbraucherinformation soll beispielsweise rechtzeitig über die Entwicklung neuer Produkte und Technologien, über geplante Investitionen und über die gesellschaftlichen Folgewirkungen von Produktion und Konsum informieren. Der rechtliche Verbraucherschutz könne der Vermeidung von Fehlentwicklungen dienen, indem z. B. Mitwirkungsmöglichkeiten gesetzlich abgesichert werden oder umfangreiche Haftungsregelungen eingefUhrt werden. Mit den Vorschlägen einer Ausweitung des Werberechts zum Schutz vor manipulativer Beeinflussung durch das Marketing der Anbieter und der Immunisierung der Verbraucher im Rahmen der Verbraucherinformation werden Forderungen der verhaltenswissenschaftlich fundierten Verbraucherpolitik aufgegriffen. In der Berurwortung einer stärker manipulativen Verbraucherpolitik zur Verringerung sozial schädlicher und zur Förderung sozial erwünschter Konsumformen gehen die Vertreter des Partizipationsansatzes aber wohl weit über die Vorstellungen von Kroeber-Riel hinaus. 124 Der ablehnenden Haltung dieser verbraucherpolitischen Konzeption gegenüber der marktwirtschaftlichen Ordnung entsprechend werden wettbewerbspolitische Maßnahmen als völlig unzureichend zurückgewiesen. Wegen der systemimmanenten Tendenz 123 Vgl. hierzu und zu den folgenden Methoden: B1ERVERT, B., und FISCHERWINKELMANN, W. F., Das verbraucherpolitische Instrumentarium, in: MATTHOFER, H. (Hrsg.), Verbraucherforschung, Frankfurt 1977, S. 130-159 sowie BIERVERT, B., 1982, S.52. 124 Vgl. BIERVERT, B., und FISCHER-WINKELMANN, W. F., 1977, S. 140 f.
3. Darstellung der verbraucherpolitischen Konzeptionen
59
zur Selbstaufhebung des Wettbewerbs hinke die praktizierte Wettbewerbspolitik stets der fortschreitenden Vennachtung auf den Märkten hinterher. 125 Im Gegensatz zur Grundidee des Gegenmachtmodells, das nach einer Stärkung der ursprünglich schwächeren Marktseite durch die Verbraucherpolitik grundsätzlich auf den Marktprozeß vertraut, wird im Partizipationsansatz der Marktmechanismus nicht als Lösung angesehen, sondern durch einen politischen Entscheidungsprozeß ersetzt. Der Anwendungsbereich der Verbraucherpolitik umfaßt in dieser Konzeption auch die von staatlicher Seite angebotenen öffentlichen Güter. 126 Kritisiert werden die bestehenden Ansätze eines "Marketings öffentlicher Güter", da dies zu den gleichen Problemen führe wie das herkömmliche Marketing bei privaten Gütern. Auch hier besteht nach Ansicht Bierverts u. a. die Gefahr der Manipulation der Verbraucher, denen suggeriert würde, das Angebot an öffentlichen Gütern sei Ausdruck der politischen Entscheidung der Wähler und entspreche deshalb den Bedürfnissen der Konsumenten. Es handele sich dabei um eine Scheinlegitimation, da eine angemessene Partizipation der Verbraucher durch die in großen Abständen stattfmdenden allgemeinen Wahlen nicht möglich sei. Deshalb wird eine verstärkte Partizipation zur Verwirklichung der Verbraucherinteressen durch die Einrichtung entsprechender Institutionen auch in diesem Bereich gefordert. 127 Die Betrachtung der ordnungspolitischen Prinzipien zeigt in dieser Konzeption im Unterschied zu den anderen Ansätzen ein Vorherrschen des Sozialprinzips.128 Die Gemeinschaft steht hier im Vordergrund, während dem Individuum nur eine untergeordnete und dem gesellschaftlichen Ganzen dienende Funktion zukommt. Dies wird deutlich anband der mit umfassender Partizipation der Verbraucher einhergehenden gesellschaftlichen Einflüsse auf Produktion und Investition, die zumindest mit einer Einschränkung 125 Vgl. B1ERVERT, B. u.a., 1977, S. 50 f. 126 Vgl. ebenda, besonders S. 127-131. 127 Die Ausdehnung der Verbraucherpolitik wird nochmals in Kapitel 3.3.4 problematisiert. 128 Zum Sozialprinzip vgl. SCHACHTSCHABEL, H. G., 1976, S. 18-23. 6 Mitropoulos
60
B. Verbraucherpolitische Konzeptionen
von Wettbewerb und Privateigentum oder mit dem Übergang zu gemeinwirtschaftlichen und genossenschaftlichen Produktionsformen verbunden sind. In der Idealvorstellung des Partizipationsmodells stellen dann die diskursftlhrenden, selbstorganisierten Gruppen die wesentlichen politischen Akteure dar, weniger der Staat oder das einzelne Individuum. "Die Verbraucherpolitik fmdet sich ( ... ) im Zentrum gesellschaftspolitischer Auseinandersetzungen und Herausforderungen"129. Sie erfreut sich in dieser Konzeption eines sehr hohen Stellenwertes nicht nur innerhalb der Wirtschaftspolitik, sondern wird darüber hinaus als wichtiger Bestandteil einer umfassenden Gesellschaftspolitik verstanden. Angesichts der starken Ausdehnung des verbraucherpolitischen Handlungsbereichs auf den Produktionssektor und der damit zusammenhängenden Problematisierung der Beziehungen zwischen Arbeit, Kapital und Konsum drängt sich sogar der Verdacht auf, daß die Vertreter des partizi- . patorisch-emanzipatorischen Ansatzes die Verbraucherpolitik zur Gesellschaftspolitik schlechthin umfunktionieren möchten. Interessanterweise werden hier Parallelen zum reinen Wettbewerbsansatz genau am anderen Ende des Spektrums verbraucherpolitischer Konzeptionen erkennbar. In beiden Ansätzen wird ein Modell entworfen, in dem bei vollständiger Realisierung (dort der Wettbewerb - hier die umfassende Partizipation der Bürger) eine Verbraucherpolitik überflüssig ist. Die partizipatorische Verbraucherpolitik von Biervert u. a. soll deshalb vornehmlich zur schrittweisen Einftlhrung der völlig anderen Gesellschaftsordnung eingesetzt werden und beinhaltet als Endziel ihre eigene Abschaffung. 13o Die Zuordnung dieser interventionsstarken Konzeption zu einer allgemein wirtschaftspolitischen Konzeption ist auch in diesem Fall nicht einfach. Auf den ersten Blick scheint es naheliegend, einen Zusammenhang zum (freiheitlich-) Demokratischen Sozia129 BIERVERT, B., Entwicklungen und Perspektiven der Verbraucherpolitik aus der Sicht der Wissenschaft, in: Verbraucher 2000, Verbraucherpolitische Hefte Nr. 10, Stuttgart, Juli 1990, S. 9. 130 Vgl. BIERVERT, B. U.a., 1977, S. 230 undS. 235.
3. Darstellung der verbraucherpolitischen Konzeptionen
61
lismus herzustellen, der in der SPD seit den 60er Jahren als Orientierungslinie rur die Wirtschaftspolitik dient. 131 Bei den gemäßigteren Vorschlägen einer Mitwirkung der Verbraucher an den Produktionsentscheidungen (Mitbestimmung, Kooperation) sowie der stärkeren Betonung des Sozialprinzips und der Planung in der Wirtschaft besteht eine gewisse Übereinstimmung. Biervert u. a. sind jedoch gegenüber der marktwirtschaftlichen Ordnung deutlich kritischer eingestellt. Markt und Wettbewerb werden vom Demokratischen Sozialismus nicht grundsätzlich abgelehnt, sondern sollen - soweit wie nötig - um Elemente der Planung ergänzt werden. Die Vorschläge einer direkten Investitionslenkung vor allem innerhalb der Strukturpolitik entstammen den Reihen der SPD und wurden dort auch um das Jahr 1975 herum kontrovers diskutiert, schließlich jedoch weitgehend abgelehnt. Die direkte Investitionslenkung kann deshalb zwar nicht als Bestandteil der wirtschaftspolitischen Konzeption des Demokratischen Sozialismus gelten, diese Diskussion hat aber sicherlich die Formulierung der partizipatorischen Verbraucherpolitik maßgeblich beeinflußt. Insgesamt läßt sich festhalten, daß der Partizipationsansatz mit seiner Forderung nach einer Umgestaltung der bestehenden Wirtschaftsordnung über die wirtschaftspolitische Konzeption des Demokratischen Sozialismus hinausgeht. Zu letzterer paßt besser eine an der Idee der Gegenrnachtbildung orientierte und die Wettbewerbspolitik ergänzende Verbraucherpolitik. Der partizipatorisch-emanzipatorische Ansatz ist rur die marktwirtschaftliche Praxis kaum bedeutsam. Selbst wenn er in einer hinreichend konkreten Ausgestaltung vorliegen würde, wäre dieser Ansatz wegen seines systemkritischen oder sogar systemzerstörenden Charakters politisch nicht durchsetzbar. So werden die Chancen der Verwirklichung dieser verbraucherpolitischen Konzeption sogar von ihren Schöpfern äußerst skeptisch beurteilt. J32 Diese Konzeption konnte sich nur Ende der 70er Jahre im Gefolge der damaligen Investitionslenkungsdebatte einer größeren Aufmerksamkeit erfreuen. Seitdem ist es in der wissenschaftlichen Diskus131 Vgl. zum folgenden SCHACHTSCHABEL, H. G., 1976, S. 91-102, besonders S. 99 ff. J32 Vgl. BIERVERT, B. 6"
u.a., 1977, S. 235.
62
B. Verbraucherpolitische Konzeptionen
sion um diesen Ansatz zunehmend ruhiger geworden, auch wenn er immer mal wieder neu artikuliert wird. Die Kritik an der partizipatorischen Verbraucherpolitik konzentriert sich - neben dem grundsätzlichen Einwand der Zerstörung marktwirtschaftlicher Grundlagen - vor allem auf ihr methodisches Vorgehen. Zunächst einmal ist der Vergleich einer tatsächlichen Marktwirtschaft mit ihren Funktionsdefiziten mit einem theoretischen, idealtypischen Partizipationsmodell unzulässig. Der politische Prozeß, der in dieser Konzeption die marktwirtschaftliche Steuerung ersetzen soll, ist nämlich in seiner realen Ausgestaltung keineswegs vollkommen und damit nicht ohne weiteres dem Markt überlegen. \33 Darüber hinaus wird der geregelte Diskurs zwar als Verfahren zur Lösung der zentralen Probleme vorgestellt (z. B. Legitimation, Bedürfnisartikulation und -feststellung), selbst aber kaum konkretisiert. Damit verbleiben - mit dem unbefriedigenden Verweis auf zukünftig noch vorzunehmende Klärungen Operationalisierungs- und Legitimationsdefizite, die die Vertreter dieser Konzeption gerade den anderen Ansätzen vorgeworfen haben. 134 Zur Verdeutlichung der enormen Schwierigkeiten, die einer Konkretisierung des Diskursverfahrens und damit der Realisierung der gesamten Konzeption im Wege stehen, dient die folgende Aufzählung, die sicher noch erweitert werden könnte: \35 • Die Bedürfnisse der Verbraucher sind sehr heterogen, so daß die Ableitung und Durchsetzung einer sozialen Bedarfsrangskala rur viele mit einer deutlichen Einschränkung ihrer Konsumfreiheit verbunden wäre. • Das basisdemokratische Vorgehen, das nur in kleinen Gruppen möglich ist, fUhrt zu unlösbaren Koordinationsproblemen und verursacht hohe Organisationskosten. • Die Bereitschaft der Verbraucher zur Teilnahme am Diskurs ist fraglich, ein Teilnahme- und Informationszwang kaum vor133 Vgl. ISSING, 0., Investitionslenkung in der Marktwirtschaft, Göttingen 1975,S. 77. 134 Vgl. STAUSS, S., 1980, S. 45. l3S Vgl. ebenda, sowie ISSING, 0., 1975, S. 71-74, und MEIER, S., 1984, S. 121.
3. Darstellung der lIerbraucherpolitischen Konzeptionen
63
stellbar. Außerdem sind die Verbraucher auch in diesem politischen Entscheidungsprozeß der Beeinflussung durch andere ausgesetzt. • Es bestehen Widerspruche, wenn die Verbraucher vor Manipulationen durch das Marketing geschützt werden sollen und gleichzeitig durch die Verbraucherpolitik massiv bevormundet werden müssen, um ihre "wahren" Bedürfnisse zu erkennen, an deren Entwicklung sie doch selbst im Diskurs mitgewirkt haben. Im Anschluß sollen noch einige Ansätze untersucht werden, die in einem engen Zusammenhang mit der partizipatorisch-emanzipatorischen Verbraucherpolitik von Biervert u. a. stehen. Die Gemeinsamkeiten mit dem gerade vorgestellten Ansatz erlauben dabei eine verkürzte Darstellung. 3.3.2 Verbraucherschulzkonzeption bei Similis
Als Beispiel rur eine ausgesprochen interventionistische und systemkritische Konzeption in der juristischen Literatur kann die Arbeit von Simitis angesehen werden. 136 Hier besteht eine weitgehende Übereinstimmung mit der zuvor behandelten Konzeption, besonders in der Kritik an der bestehenden Verbraucherpolitik (rur die Simitis den Begriff "Informationsmodell" geprägt hat), der grundsätzlichen Ablehnung der marktwirtschaftlichen Ordnung und dem Verständnis der Verbraucherpolitik als Teil einer systemüberwindenden Gesellschaftspolitik. Passend zur Herkunft des Autors aus der Rechtswissenschaft liegt der Schwerpunkt der Ausfiihrungen allerdings auf dem rechtlichen Verbraucherschutz und dessen behördlicher Kontrolle. Das Verbraucherschutzrecht wird als punktuelles Abwehrrecht kritisiert, das nur auf die Beseitigung einzelner, bereits bestehender Mißstände ausgerichtet ist und auf eine umfassende Prävention sowie gestaltende Eingriffe verzichtet. Die Verbraucherpolitik und hier besonders der rechtliche Verbraucherschutz - soll als 136 Vgl. SIMITIS, K., 1976, sowie STAUSS, B., 1980, S. 40 f., und besonders kritisch dazu HEINBUCH, H., 1983, S. 61-64.
64
B. Verbraucherpolitische Konzeptionen
Mittel eingesetzt werden, um den Entscheidungsspielraum der Produzenten einzuschränken, die Nachfrageseite zu stärken und somit den gesellschaftlichen Interessen zum Durchbruch zu verhelfen. Dies soll durch ein umfassendes System rechtlicher Regelungen geschehen und muß durch eine direkte behördliche Kontrolle gesichert werden. Der Verbraucherschutzbehörde als der dominierenden verbraucherpolitischen Institution widmet Simitis seine besondere Aufmerksamkeit. 137 Die übermächtige Stellung, die diese Behörde durch die Übertragung nahezu des gesamten Spektrums verbraucherpolitischer Aufgaben gewinnt, wird durch die Partizipation der Konsumenten legitimiert. Die Mitwirkung der Verbraucher auf allen Ebenen der Behörde soll deren Unabhängigkeit von Staat, Produzenten und den Interessen der eigenen Bürokratie gewährleisten. Unter Bezugnahme auf die Arbeiten von Biervert u. a. wird eine Beteiligung der Betroffenen an den vielflUtigen verbraucherpolitischen Entscheidungsprozessen in der Behörde in Form des bereits oben erörterten Diskursverfahrens angestrebt. Die vielseitigen Aufgaben dieser Institution reichen von der Vertretung der Verbraucherinteressen gegenüber staatlichen Stellen, Aufklärungsund Erziehungsarbeit (besonders auf iokaler Ebene zur Mobilisierung der Verbraucher), Informationsvermittlung, Gefahrenvorbeugung, Ausarbeitung neuer gesetzlicher Vorschriften, Verbraucherforschung über Kontroll- und Überwachungsaufgaben bis hin zu produktionslenkenden Eingriffen. Insgesamt zeigt sich eine große Ähnlichkeit mit dem Partizipationsansatz, sieht man von der stärkeren Betonung des rechtlichen Bereichs aufgrund der juristischen Sichtweise ab. Dies ftlhrt auch zur gleichen Beurteilung der Verbraucherschutzkonzeption. Auf einen methodischen Unterschied soll jedoch abschließend noch hingewiesen werden. Im Partizipationsmodell steht zunächst die Entwicklung eines zu realisierenden Diskursverfahrens im Vordergrund, von dem dann die Klärung aller anderen Fragen erwartet wird. Die Verbraucherschutzkonzeption von Simitis legitimiert sich zwar ebenfalls durch die Partizipation der Verbraucher, \37
Vgl. SIMlTIS, K., 1976, S. 269-291.
3. Darstellung der verbraucherpolitischen Konzeptionen
65
vertraut aber beim Ersatz des Marktmechanismus nicht nur auf diese basisdemokratische Lösung, sondern auch auf bürokratische Elemente. Auf diese Weise kann diese Variante des Partizipationsansatzes besser auf bereits bestehende Regelungen und institutionelle Einrichtungen zurUckgreifen und scheint leichter realisierbar. Damit ist aber die Gefahr verbunden, daß ein umfassendes System ordnungspolitisch höchst bedenklicher staatlicher Interventionen und eine allmächtige Verbraucherbehörde auch ohne die in dieser Konzeption zwingend erforderliche Partizipation durchgesetzt werden könnte bzw. der Partizipationsgedanke sich im nachhinein als nicht tragfähig erweist. 3.3.3 Kommunikationsansatz von Czerwonka u. a.
Der im folgenden behandelte Ansatz der Autoren Czerwonka, Schöppe und Weckbach greift die Gedanken einer Ex-anteOrientierung der Verbraucherpolitik und einer Mitwirkung der Verbraucher in einer gegenüber dem Partizipationsmodell gemäßigten Form auf. 138 Die dem Ansatz zugrunde liegende Studie beabsichtigt keine verbraucherpolitische Gesamtdarstellung, sondern untersucht speziell die Möglichkeiten einer frühzeitigen Einflußnahme der Konsumenten auf das Güterangebot - und zwar ausdrücklich im Rahmen der bestehenden marktwirtschaftlichen Ordnung. Dabei wird auf das realitätsfremde diskursive Legitimationsverfahren und systemfremde Elemente wie eine direkte Lenkung der Investitionen verzichtet. Die praktizierte Verbraucherpolitik wird zwar wegen ihres Festhaltens am Paradigma "Markt und Wettbewerb" und der darauf zurUckzufUhrenden Beschränkung auf ex-post-orientierte, reaktive Maßnahmen kritisiert, aber fUr grundsätzlich ergänzungsfähig gehalten. Damit weist diese hier als Kommunikationsansatz bezeichnete Konzeption eine trotz vieler Gemeinsamkeiten höhere politische Durchsetzbarkeit und praktische Relevanz auf als die partizipatorisch-emanzipatorische Verbraucherpolitik von Biervert u. a.
138 Vgl. zu diesem Abschnitt CZERWONKA, C., SCHOPPE, G., und WECKBACH, S., Der aktive Konsument: Kommunikation und Kooperation, Göttingen 1976 (Zusammenfassung S. 265-288), sowie FLEISCHMANN. G., 1982, S. 70 f.
66
B. Verbraucherpolitische Konzeptionen
Den Ausgangspunkt der Überlegungen im Kommunikationsansatz bilden Informationslücken auch auf der Seite der Produzenten, die zu einem nicht bedarfsgerechten Güterangebot ruhren. Die Informationen, die der Anbieter benötigt, um seine Produkte besser den Verbraucherbedürfnissen anzupassen, werden angeblich weder vom Markt in hinreichender Form bereitgestellt, noch könnten sie durch die herkömmliche Marktforschung gewonnen werden. Auch sei die tatsächliche Position der Anbieter nicht so stark, daß über eine Manipulation der Verbraucherbedürfnisse stets der Absatz von nicht bedarfsgerechten Produkten gesichert werden könne. Dies zeigt, daß die Produzentensouveränität hier als Verbraucherbild ebenso als einseitig und unbrauchbar abgelehnt wird wie die Konsumentensouveränität. Um Fehlentwicklungen aufgrund dieser gegenseitigen Informationsdefizite zu vermeiden, wird es als besondere Aufgabe der Verbraucherpolitik angesehen, eine möglichst vielseitige Kommunikation und Kooperation zwischen den beiden Marktparteien zu initiieren. Dazu muß die Motivation aller Beteiligten erhöht werden. Auf der Seite der Verbraucher kann dies in Form eines umfassend und langfristig verstandenen sozialen Lernprozesses im Rahmen einer entsprechend umgestalteten Verbraucherinformation, -bildung und -erziehung geschehen. Dabei sollen die Bereitschaft und die Fähigkeit zu Kooperation, Kommunikation und Kreativität gestärkt werden. Ziel ist der "aktive Konsument", dessen Kenntnisse durch eine frühzeitige Einflußnahme bei der Neuentwicklung von Produkten genutzt werden können. Auch bei den Unternehmen ist die Kommunikationsbereitschaft anzuregen. Dies kann nach Czerwonka u. a. bereits weitgehend durch eine verschärfte Wettbewerbspolitik und eine ergänzende, aktive Strukturpolitik erreicht werden. Der von dieser verbraucherpolitischen Konzeption angestrebte Kommunikationsprozeß kann an vielen Stellen ansetzen. 139 Von staatlicher Seite kann eine Verbraucherbehörde neben der bisher dominierenden Verbraucherschutzfunktion umfangreiche Vermittlungstätigkeiten zwischen öffentlichen und privaten Anbietern,
139 Vgl.
zum folgenden CZERWONKA, C. u. a., 1976, S. 222-248.
3. Darstellung der verbraucherpolitischen Konzeptionen
67
Verbrauchern und ihren Verbänden übernehmen. Darüber hinaus sind andere Mittlerinstitutionen staatlich zu fördern bzw. einzurichten. Staatliche oder öffentlich kontrollierte Testinstitute können neue Produkte bereits frühzeitig prüfen, insbesondere hinsichtlich ihrer innovativen Leistung (echte Innovationen von rein "kosmetischen" Neuerungen trennen und bekanntgeben). Die bestehenden Verbraucherorganisationen sollen in Mitgliederverbände umstrukturiert werden, wobei als Folge der sozialen Lernprozesse eine höhere Organisationsbereitschaft der Verbraucher erhofft wird. Sie können Orte der Kommunikation zwischen den Verbrauchern bereitstellen, aber auch dem Kontakt mit den anderen Beteiligten dienen. Einen Ansatzpunkt bildet schließlich die Einfiihrung von Gruppengesprächen mit Verbrauchern innerhalb der Marktforschung der Unternehmen oder darüber hinausgehend institutionalisiert in sogenannten "Kreativzentren" . Die Verbraucher könnten auf diese Weise an der Entwicklung von Konsumgütern mitwirken - eine Kooperation, wie sie bei Investitionsgütern zwischen Hersteller und Anwendern bereits weit verbreitet seL140 Obwohl ihnen in der Regel das dazu erforderliche Spezialwissen fehle, sei doch im Zuge zunehmender Freizeit davon auszugehen, daß immer mehr Verbraucher zumindest in einzelnen Bereichen (z. B. ihren Hobbys) zu Experten würden. Dort könnten sie Ideen fiir neue oder verbesserte Produkte äußern, sollten allerdings fiir ihren Beitrag zur "Konsuminnovation" auch in angemessener Weise belohnt werden (z. B. Erfolgsbeteiligung fiir Erfmderkonsumenten, Aufwandsentschädigung rur aktive Teilnahme am Gruppengespräch).141 Es kann festgehalten werden, daß trotz aller Schwierigkeiten, die einer Realisierung dieser Vorschläge des Kommunikationsansatzes im einzelnen entgegenstehen, die Grundüberlegung sinnvoll ist. Eine verstärkte Kooperation zu beiderseitigem Nutzen, besonders auf dem Gebiet der Produktentwicklung, stellt einen interessanten Ansatzpunkt auch rur die praktische Verbraucherpolitik dar.
140 Vgl. FLEISCHMANN, G., 141 Vgl. ebenda, S. 71.
1982, S. 70 f.
68
B. Verbraucherpolitische Konzeptionen
3.3.4 Ökologisch orientierte Ansätze und Verbraucherpolitik im öffentlichen Bereich
In diesem Abschnitt soll nochmals den Bestrebungen nach einer immer stärkeren Ausweitung der Verbraucherpolitik nachgegangen werden. Die folgenden Ausführungen knüpfen damit unmittelbar an die Diskussion des partizipatorischen Ansatzes und dessen umfassendem Verständnis der Verbraucherpolitik als Gesellschaftspolitik an. Die Betrachtung konzentriert sich dabei beispielhaft auf den Bereich des Umweltschutzes sowie die Forderung· nach einer Verbraucherpolitik im öffentlichen Bereich. 142 Auch die Verbraucherpolitik kann sich den zunehmenden ökologischen Problemen (Umweltverschmutzung, Rohstoftknappheit, Energieversorgung usw.) nicht verschließen. Dies hat in der praktischen Verbraucherarbeit und in der Wissenschaft zu Vorschlägen rur eine stärker ökologische Ausrichtung der Verbraucherpolitik geftlhrt, die aber noch nicht zu einer eigenständigen Konzeption entwickelt wurden. Die Vereinnahmung umweltpolitischer Aktivitäten durch die Verbraucherpolitik ist in der Konstruktion des Partizipationsansatzes angelegt. Die Umweltproblematik wird als besonders anschauliches Beispiel in die Reihe der angeblich systemimmanenten Mängel der marktwirtschaftlichen Ordnung aufgenommen und dient somit als zusätzliche Rechtfertigung der geforderten radikalen gesellschaftlichen Umgestaltung. Dabei bereitet es den Vertretern dieser grundsätzlich konsumkritischen verbraucherpolitischen Konzeption keine Schwierigkeiten, die allgemeine Diskussion über eine "Überflußgesellschaft" und die "Grenzen des Wachstums" im Konsumbereich fortzusetzen. In diesen Zusammenhang ist auch die Forderung nach "qualitativem Konsum" (korrespondierend zum "qualitativen Wachstum") einzuordnen, wonach mengen- oder wertmäßig höherer Konsum allein keineswegs mit einer besseren Bedürfnisbefriedigung und höheren Lebensqualität verbunden sein muß.
142 Vgl. besonders STAUSS, ß., 1980, S. 49-59, und FISCHER, A., DGßVerbraucherpolitik zwischen Anspruch und politischer Praxis, Frankfurt u. a. 1990, S. 28-33.
3. Darstellung der verbraucherpolitischen Konzeptionen
69
Eine Beurteilung dieser Ausdehnungstendenz muß an der Frage nach dem geeigneten Verbraucherbegriff und damit dem verbraucherpolitischen Objektbereich ansetzen. 143 In der Literatur besteht eine gewisse Übereinstimmung darin, die Verbraucherpolitik auf die marktvermittelbaren Konsumgüter und Dienstleistungen zu beschränken. Dies ist unabhängig davon, ob die Güter von privaten oder öffentlichen Anbietem (z. B. öffentliche Verkehrsmittel, Post, Versorgungsunternehmen) bereitgestellt werden. Eine stärkere Ausweitung auf alle Kollektivgüter und sogar auf die natürliche Umwelt als Anbieter von Gütern wie Luft und Wasser kann dagegen aus mehreren Gründen abgelehnt werden. Durch die Ausweitung des verbraucherpolitischen Objektbereichs z. B. auf die Umweltpolitik wird die Heterogenität der Verbraucherinteressen erhöht, so daß deren Organisation und Durchsetzung noch schwieriger wird. Ohne einen vergleichsweise eng abgegrenzten Verbraucherbegriff werden Verbraucherpolitik und allgemeines politisches Handeln immer weniger unterscheidbar. Gerade ftlr die Verbraucherpolitik mit ihrem relativ geringen politischen Stellenwert ist deshalb zu beftlrchten, "daß das als klein empfundene politische Gewicht ... durch die Verteilung auf verschiedene Bereiche noch vermindert wird."144 Darüber hinaus hat sich die Umweltpolitik längst als eigenständiger Politikbereich mit einer wirksamen Interessenvertretung durch die Umweltschutzbewegung etabliert, dessen Stellenwert mittlerweile den der Verbraucherpolitik längst übertroffen hat. Da also weder besondere Vorteile ftlr die traditionelle Verbraucherpolitik zu erwarten sind noch dadurch die Durchsetzung ökologischer Belange spürbar erhöht werden kann, sollte auf eine weitgehende Vereinnahrnung der Umweltpolitik durch die Verbraucherpolitik verzichtet werden. Das bedeutet aber nicht, daß ökologischen Fragen keine Aufinerksamkeit geschenkt werden sollte. In der praktischen Verbraucherarbeit geschieht dies bereits, indern z. B. Verbraucherinformation und -beratung auf die Umweltverträglichkeit von Produkten hinweisen (Energieverbrauch und Le-
143 Vgl. zur Kritik STAUSS, B., 1980, S. 56-59, und MEIER, B., 1984, S. 43-45. 144 STAUSS, B., 1980, S. 59.
70
B. Verbraucherpolitische Konzeptionen
bensdauer von Elektrogeräten, Rückstände und Konservierungsmittel in Lebensmitteln usw.). Der rechtliche Verbraucherschutz sieht im gesundheitlichen Schutz des Verbrauchers schon immer einen seiner Schwerpunkte. Insgesamt wird deutlich, daß die Berücksichtigung von Umweltfragen in der Verbraucherpolitik keineswegs eine Neukonzeption oder Anlehnung an den Partizipationsansatz erfordert, sondern auch innerhalb der anderen verbraucherpolitischen Konzeptionen erfolgen kann. Die Verbraucherpolitik sollte die Interdependenzen zwischen den verschiedenen Politikbereichen beachten und mit diesen zusammenarbeiten. Als hilfreich erweist sich in diesem Zusammenhang die Unterscheidung von direkter und indirekter Verbraucherpolitik. 145 Während die direkte Verbraucherpolitik die traditionellen Bereiche der Verbraucherpolitik umfaßt, bezieht sich die indirekte Verbraucherpolitik auf die Berücksichtigung von Verbraucherinteressen durch eine Reihe anderer Politikbereiche. Die Frage nach einer geeigneten Abgrenzung bzw. einer Ausdehnung der Verbraucherpolitik stellt sich somit nicht nur bei der Umweltpolitik. Ähnliche Überlegungen wurden besonders bezüglich der Sozialpolitik angestellt (Verbraucherpolitik als Sozialpolitik versus sozialpolitische Orientierung der Verbraucherpolitik).146 Im Rahmen der AusfUhrungen über eine Ausdehnung der Verbraucherpolitik soll kurz die Forderung nach einer Verbraucherpolitik im öffentlichen Bereich diskutiert werden. Die Notwendigkeit einer Verbraucherpolitik im öffentlichen Bereich wird mittlerweile nicht mehr grundsätzlich bestritten. Allerdings gehen in den verschiedenen Konzeptionen die Meinungen darüber auseinander, wo hier die Grenze gezogen und wie diese Verbraucherpolitik ausgestaltet werden soll. Hier könnte sich eine grobe Unterscheidung von interventionsfreundlichen und interventionskritischen Kon145 Vgl. UUSITALO, L., Societal Change and Challenges for Consumer Policy, in: ZfV, Jg. 6 (1983), S. 149 f. 146 Vgl. FISCHER, A., 1990, S. 34-36, und WOLSING, T., Verbraucherarbeit als sozialpolitische Aufgabe, in: Theorie und Praxis der sozialen Arbeit, Nr. 10/1984, S.345-348.
3. Darstellung der verbraucherpolitischen Konzeptionen
71
zeptionen als sinnvoll erweisen. Eine weitgehende Übereinstimmung besteht darin, die privaten Güter aus den sogenannten wettbewerblichen Ausnahmebereichen in der Verbraucherpolitik zu berücksichtigen. Es handelt sich dabei vor allem um Bereiche, in denen (mit der Begründung einer angeblichen Tendenz zu "natürlichen Monopolen") öffentliche oder staatlich geschützte private Alleinanbieter den Markt versorgen. Die Einbeziehung der Güter aus diesen Bereichen in die Verbraucherpolitik kann zum einen mit deren quantitativer Bedeutung (z. B. ihrem Anteil an der Gesamtnachfrage), zum anderen mit ihrer qualitativen Bedeutung für den Verbraucher (Befriedigung vieler elementarer Bedürfnisse) gerechtfertigt werden. Ebenso kann eine Berücksichtigung der Dienstleistungen von Behörden befürwortet werden. Die erste Strategie einer Verbraucherpolitik im öffentlichen Bereich kann darin bestehen, die herkömmlichen verbraucherpolitischen Instrumente (z. B. Verbraucherinformation, rechtlicher Verbraucherschutz) zu übertragen. 147 Eine besondere Bedeutung kommt hier der Partizipationsforderung zu. Auf das Angebot privater Konsumgüter auf wettbewerblichen Märkten bezogen, wurden diese Vorschläge abgelehnt, da sie zu stark in die marktwirtschaftliehe Ordnung (z. B. in das Eigentumsrecht) eingreifen. Im öffentlichen Bereich und in den wettbewerblichen Ausnahmebereichen ist aber aufgrund der Monopolstellung der Anbieter fraglich, ob das Verbraucherinteresse bei fehlender marktwirtschaftlieher Selbststeuerung verwirklicht wird. Diese Aufgabe des Marktes soll deshalb vom politischen Wahlmechanismus übernommen werden, was aber - z. B. wegen der nur in großen Abständen stattfmdenden allgemeinen Wahlen - nur unzureichend gelingt. Aus diesem Grund ist die Forderung der partizipatorischen Verbraucherpolitik nach einer verstärkten Mitsprache der Konsumenten in Nicht-Wettbewerbsbereichen durchaus positiv zu beurteilen. Nach den Vorstellungen der prinzipiell interventionsfreundlichen Konzeptionen besteht also ein verbraucherpolitischer Handlungsbedarf auch im Bereich der öffentlichen Anbieter, die Berechtigung von Nicht-Wettbewerbsbereichen selbst wird kaum in Frage gestellt.
147 Vgl. hierzu DEIMER, K. u. a., Berücksichtigung von Verbraucherinteressen bei staatlichen Anbietern, FrankfurtlMain 1984.
72
B. Verbraucherpolitische Konzeptionen
Eine andere Strategie verfolgen die interventionsskeptischen Konzeptionen, die im nächsten Abschnitt untersucht werden. Die Durchsetzung des Verbraucherinteresses in Wettbewerbsbereichen ist ihnen zufolge weitgehend unproblematisch, so daß der Verbraucherpolitik höchstens ergänzende Funktionen zugewiesen werden. Als größtes Übel fUr die Verbraucher und damit eigentliches Handlungsfeld der Verbraucherpolitik werden die staatlichen (oder staatlich geschützten) Monopole angesehen. Hier wird nun aber weniger die Übertragung des herkömmlichen verbraucherpolitischen Instrumentariums angestrebt, sondern vielmehr die ÜberfUhrung der Nicht-Wettbewerbsbereiche in Wettbewerbsbereiche durch Privatisierung und Deregulierung. 3.4 Interventionsskeptische Konzeptionen 3.4. I Konzeption der Wettbewerbs- und Konsumfreiheit (Mähling)
Der Wechsel zu Beginn der 80er Jahre in der Wirtschaftswissenschaft von einer prinzipiell interventionsfreundlichen wohlfahrtsstaatlichen bzw. auf keynesianischen Grundlagen beruhenden Wirtschaftspolitik und -theorie zu streng marktwirtschaftlich-liberalen Ansätzen (z. B. angebotsorientierte Wirtschaftspolitik, Monetarismus, neuklassische Theorie) hat sich auch in der wissenschaftlichen Verbraucherpolitik niedergeschlagen. Als Reaktion auf Forderungen nach einer immer stärkeren Ausweitung verbraucherpolitischer Eingriffe bis hin zur Fundamentalkritik des marktwirtschaftlichen Wirtschaftssystems - wie in den zuletzt dargestellten verbraucherpolitischen Konzeptionen - entwickelten sich besonders interventionsskeptische Ansätze. Aus der deutschen Literatur soll im folgenden die Konzeption von F. W. Mähling untersucht werden, in deren Mittelpunkt die "Wettbewerbs- und Konsumfreiheit" als neues Leitbild fUr die Verbraucherpolitik steht. 148 Anschließend wird die radikale Position der US-amerikanischen "Economic Analysis ofLaw" (Chicago-School) erörtert.
148 Vgl. zum gesamten Abschnitt: MAHLING, F. W., Werbung, Wettbewerb und Verbraucherpolitik, München 1983.
3. Darstellung der verbraucherpolitischen Konzeptionen
73
Kennzeichnend ftlr die Arbeit von Mähling ist das Bestreben, Erkenntnisse des evolutorischen Markt- und Wettbewerbsverständnisses der "Österreichischen Schule" und der Verhaltenswissenschaft (Informationsverarbeitungsansatz) in die Verbraucherpolitik zu integrieren. Es handelt sich damit um einen ausgesprochen interdisziplinär ausgerichteten Ansatz. Die verhaltenswissenschaftlichen Überlegungen wurden von Kroeber-Riel in die verbraucherpolitische Diskussion eingeftlhrt und in dieser Arbeit bereits dargelegtl49, so daß an dieser Stelle auf weitere Einzelheiten verzichtet werden kann. Mit dem Aufgreifen des "Koordinationsansatzes" der Österreichischen Schule (vor allem nach von Hayek) und dem darauf aufbauenden wettbewerbspolitischen Leitbild der "Wettbewerbsfreiheit" (nach Hoppmann) betritt Mähling dagegen verbraucherpolitisches Neuland. lso Diese wettbewerbstheoretische Richtung setzt an der Kritik am neoklassischen Gleichgewichtsmodell an, das auch den meisten verbraucherpolitischen Konzeptionen als Referenzmodell dient. Im statischen Wettbewerbsbegriff der "vollkommenen Konkurrenz" wird nur ein Zustand optimaler Allokation das sogenannte Paretooptimum - beschrieben, nicht jedoch der Weg dorthin. Dieser Gleichgewichtszustand, der in der Realität wohl nie erreicht werden kann, zeichne sich aber gerade durch die Abwesenheit wettbewerblicher Aktivitäten aus, da bei einheitlichen Preisen und vollständigem Wissen alle Pläne und Handlungen so aufeinander abgestimmt sind, daß ftlr die dann völlig machtlosen Produzenten kein Anlaß mehr besteht, auf dem Markt um Geschäftsabschlüsse zu rivalisieren. Diesem Verständnis von Wettbewerb stellt die Österreichische Schule ihre Marktprozeßtheorie gegenüber, in der gerade das Vorhandensein von wirtschaftlicher Macht und unvollständigem Wissen (und damit Abweichungen vom Zustand vollkommener Konkurrenz) als Kennzeichen wettbewerblicher Vorgänge angesehen werden. Der Wettbewerb stelle einen evolutorischen Prozeß der kontinuierlichen Neubildung und Erosion wirtschaftlicher Macht 149 Vgl. ebenda, S. 90-145, und Kap. 3.2.3 dieser Studie. ISO Vgl. zum folgenden MÄHLlNG, F. W., 1983, S. 146-188.
74
B. Verbraucherpolitische Konzeptionen
dar, eine Methode zur Verarbeitung und Vermittlung von Informationen an die Marktteilnehmer und zur Entdeckung von unbekanntem Wissen {"Wettbewerb als Entdeckungsverfahren").151 In Anlehnung an die klassische Wettbewerbsvorstellung wird auf den Markt als unsichtbaren Mechanismus zur Koordination aller dezentralen Pläne und Handlungen vertraut. Unter Beachtung dieses prozessualen und evolutorischen Charakters von Markt und Wettbewerb entwickelt Mähling seine verbraucherpolitischen Vorstellungen, die sich vor allem auf den Bereich der Werbung konzentrieren. Trotz der weiteren Beschränkung des Untersuchungsgegenstandes auf die Ziele, Mittel und den Anwendungsbereich der Verbraucherpolitik {nicht behandelt werden ausdrücklich die Problemkreise Träger und Finanzierung)152 wird in seinen Ausfilhrungen durchaus eine eigenständige verbraucherpolitische Konzeption erkennbar. Mähling kritisiert das bestehende verbraucherpolitische Zielsystem als widersprüchlich und stellt ihm eine eigene Zielhierarchie gegenüber. 153 Als oberstes gesellschaftspolitisches Ziel sieht er die Sicherung der freiheitlichen marktwirtschaftlichen Gesellschaftsordnung an. Dieses Ziel wird in der Zielhierarchie schrittweise konkretisiert. Als oberstes wirtschaftspolitisches Ziel wird der Schutz der Wettbewerbsordnung aufgefaßt, da ein wesentliches Merkmal der Marktwirtschaft im Schutz der wirtschaftlichen Freiheit des einzelnen bestehe. Grundlegend für diese Konzeption ist nun die Feststellung, daß diese Freiheit im wirtschaftlichen Bereich zwei Seiten hat, die untrennbar miteinander verbunden sind: die Wettbewerbsfreiheit und die Konsumfreiheit. Die Wettbewerbsfreiheit bezieht sich auf den sogenannten Parallelprozeß zwischen den Anbietern, während die Konsumfreiheit (die Freiheit, aus mehreren angebotenen Alternativen nach eigenem Entschluß auszuwählen) den Austauschprozeß zwischen Produzenten und Verbrauchern betrifft. 151 Vgl. ebenda, S. 155-157 und die angegebene Literatur von v. HAYEK, F. A. 152 Vgl. ebenda, S. 45. 153 Vgl. zu den Zielen: ebenda, S. 336-342 und S. 217-222.
3. Darstellung der verbraucherpolitischen Konzeptionen
75
Mähling verbindet das bereits bei Scherhorn verwendete verbraucherpolitische Leitbild der Konsumfreiheit l54 mit dem bekannten wettbewerbspolitischen Leitbild der Wettbewerbsfreiheit von Hoppmann l55 zu einem gemeinsamen Leitbild der "Wettbewerbsund Konsumfreiheit" ftlr beide Politikbereiche. Von einem wettbewerblichen Marktprozeß kann nach dieser Ansicht erst gesprochen werden, wenn Freiheit - teilweise defmiert als Abwesenheit von Zwang durch andere Wirtschaftssubjekte - auf beiden Marktseiten gewährleistet ist. Damit wird den Inderdependenzen zwischen Wettbewerbspolitik und Verbraucherpolitik in hohem Maße Rechnung getragen. Aufgrund der geringen Beachtung dieser gegenseitigen Abhängigkeit erkennt Mähling im herkömmlichen verbraucherpolitischen Zielsystem Widersprüche, die eine Revision der beiden Ziele "Erhöhung der Markttransparenz" und "Machtausgleich zwischen Konsumenten und Produzenten" erfordern. Nach dem Verständnis der "österreichischen" Wettbewerbstheorie kann es kein Ziel der Wirtschaftspolitik sein, jede Machtentstehung zu verhindern. Der initiative und innovative Unternehmer muß durch Vorsprungsgewinne für seine Leistungen auf dem Markt belohnt werden. Die damit einhergehende temporäre Marktmacht wird aber durch den nachziehenden Wettbewerb (Imitation und neue Innovationen) wieder abgebaut. Es muß folglich zwischen kompetitiver Marktmacht, die als notwendiges Element von Marktprozessen sogar fl>rderungswUrdig ist, und zu bekämpfender wettbewerbsbeschränkender Marktmacht unterschieden werden. Ähnlich verhält es sich mit dem Ziel der Transparenzerhöhung, da auch eine gewisse Intransparenz auf dem Markt konstitutiv für den Wettbewerb ist. Das vollständige Zielsystem dieser verbraucher- (und wettbewerbs-)politischen Konzeption mit der weiteren Aufspaltung in Unterziele gibt Abbildung 6 wieder. Auffallend bei den Unterzielen sind die negativen Formulierungen (z. B. Verbot wettbewerbsbeschränkender Marktmacht), denen im Gegensatz zu Positivformulierungen (z. B. Machtausgleich) 154 Vgl. Kapitel 3.2.2. ISS Vgl. als Überblick z. B. BARTLlNG, H., 1980, S. 41-57. 7 Mitrop.
~
340
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer Ansatze
bieter kann dadurch Reputation aufbauen und sie mit Hilfe von Marktsignalen wie beispielsweise Markennamen, Warenzeichen oder freiwilligen Garantieleistungen unterstützen. Unter bestimmten Bedingungen können sogar ein hoher Werbeaufwand oder hohe Preise als Qualitätssignal dienen. 32 Nur wenn die Marktsignale glaubwürdig sind und von den Verbrauchern akzeptiert werden, können sie die negativen Folgen der Qualitätsunsicherheit verhindern. Dazu muß tatsächlich eine positive Korrelation zwischen dem Marktsignal und der Produktqualität bestehen. Für den Produzenten schlechter Qualität darf es deshalb nicht möglich oder zumindest nicht lohnend sein, falsche Marktsignale zu verbreiten. Bei andauernder Geschäftstätigkeit könnten die zu erwartenden Reaktionen enttäuschter Verbraucher diese Funktion übernehmen. Ob es auf einem Markt für Erfahrungsgüter zur adversen Selektion oder zu einem wirkungsvollen "Signaling" kommt, hängt von der konkreten Entscheidungssituation der Anbieter ab. Einerseits können eine verdeckte Qualitätsverschlechterung und der Mißbrauch von Qualitätssignalen die kurzfristigen Gewinne erhöhen. Andererseits wird durch dieses opportunistische Verhalten die Reputation des Anbieters zerstört, was langfristig zu einer Verminderung der Gewinne aufgrund geringerer Wiederholungskäufe fUhrt. Die Funktionsfähigkeit des Marktes hängt damit entscheidend davon ab, welche der Gewinnkomponenten (Reputationsprämie oder Opportunitätsprämie) überwiegt. Deren Bestimmungsfaktoren wird deshalb in der informationstheoretischen Analyse große Beachtung geschenkt. Die Wahrscheinlichkeit einer Beeinträchtigung des Marktmechanismus wird beispielsweise um so geringer eingeschätzt,33 • je häufiger ein Produkt gekauft wird und folglich je höher der Umsatzanteil ist, der auf Altkunden entfällt, • je schneller die Qualität des Gutes nach dem Kauf sichtbar wird, • je besser die Möglichkeiten sind, den Anbieter zu wechseln, • je länger der Anbieter beabsichtigt, im Markt zu bleiben.
32 Vgl. beispielsweise VAN DEN BERGH, R., und LEHMANN, M., 1992, S. 592.
33 Vgl. FRITSCH, M. u. a., 1993, S. 196 f., und HAUSER, H., 1979, S. 749-756.
2. Informationsökonomik
341
2.2.3 Verbraucherpolitische Maßnahmen
Sind die Bedingungen rur marktliche Lösungen ungünstig, so kann verbraucherpolitischer Handlungsbedarf bestehen. In manchen informationsökonomischen Arbeiten werden deshalb neben den Marktsignalen auch einzelne verbraucherpolitische Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit und ökonomische Effizienz untersucht. Um herauszufmden, unter welchen Bedingungen eine adverse Selektion auftreten kann und wie sie zu vermeiden ist, bedient sich die Informationsökonomik vornehmlich eines modelltheoretischanalytischen Instrumentariums. Ein umfassender Überblick über die verschiedenen Modelle fmdet sich in der deutschsprachigen Literatur bei Vahrenkamp.34 Aus informationsökonomischer Sicht sollen im folgenden zwei Ansatzpunkte staatlichen Eingreifens unterschieden werden. 3s Als erster verbraucherpolitischer Schwerpunkt kann die direkte Verbesserung der Informationsversorgung der Verbraucher angesehen werden. Besteht die Gefahr adverser Selektionsprozesse aufgrund asymmetrischer Informationsverteilung, so stellt die Verbraucherinformation ein naheliegendes und ursachenadäquates Eingreifen dar. Im allgemeinen kann von einer Senkung der Informationskosten ftlr die Verbraucher eine Verminderung ihrer Informationsdefizite erwartet werden. Der Staat kann selbst Informationen zur Verringerung von Qualitätsunsicherheit bereitstellen oder private Informationstätigkeiten subventionieren. Wegen der Kuppelprodukt-Eigenschaft von produktspezifischen Informationen dürfte in der Regel der Güterhersteller der günstigste Informationsanbieter sein. Deshalb sollte unter Effizienzgesichtspunkten die Anbieterseite zu bestimmten Kennzeichnungen verpflichtet werden. Da aber bei den Erfahrungs- und Vertrauensgütern .die Qualitätsunkenntnis nicht immer durch Informationen vor dem Kauf beseitigt werden kann, ist auch die möglichst schnelle Bildung richtiger Erwartungen nach dem Kauf zu fördern, z. B. im Rahmen der Verbraucherbildung. 34 Vgl. VAHRENKAMP, K., 1991, S. 43-153. Vgl. zum folgenden ebenda, S. 155-159, FRiTSCH, M., u. a., 1993, S. 198200, SINN, H.W., 1988, S. 9-11, sowie VAN DEN BERG, R., und LEHMANN, M., 1992, S. 593. 3S
342
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer Ansdtze
Dieser erste Ansatzpunkt ftlr verbraucherpolitische Maßnahmen bringt keine wesentlichen Neuigkeiten gegenüber der herkömmlichen verbraucherpolitischen Programmatik. Besondere Beachtung verdient allerdings der zweite Ansatzpunkt ftlr staatliches Handeln, der auf der Erkenntnis aufbaut, daß unter bestimmten Bedingungen marktinterne qualitätssichernde Signale Wettbewerbsversagen verhindern können. Die Förderung dieser Marktsignale und die Bekämpfung ihres Mißbrauchs bilden aus informationsökonomischer Sicht einen Schwerpunkt staatlicher Aufgaben im Verbraucherschutz, der in der bisherigen Verbraucherpolitik möglicherweise noch zu wenig berücksichtigt wurde. Durch verschiedene staatliche Aktivitäten kann die Wirkung der Marktsignale verstärkt oder sogar erst ermöglicht werden. 36 Der gesetzliche Schutz von Markennamen und Warenzeichen erschwert die Imitation dieser Marktsignale und dient damit der besseren Wiedererkennung von Qualitätsprodukten. Bilden sich aufgrund von ungünstigen Kosten- und Nutzenverhältnissen bei den Produzenten keine derartigen Signale auf dem Markt heraus, kann eine staatliche Vergabe geschützter Gütezeichen hilfreich sein. Adverse Selektionsprozesse können auch über eine Senkung der Anreize zur verdeckten Qualitätsverschlechterung erschwert werden. Der Gesetzgeber kann durch die Setzung von Mindeststandards die potentiellen Gewinne aus einer Qualitätsreduzierung verringern und zumindest erreichen, daß ein negativer Selektionsprozeß bereits auf einem höheren Qualitätsniveau beendet wird. Eine ähnliche Wirkung verspricht man sich vor allem bei Vertrauensgütern von Zulassungsbeschränkungen. Da beispielsweise die Dienstleistungen der sogenannten freien Berufe besonders schwierig zu beurteilen sind, soll ersatzweise die Güterqualität über Mindestqualiflkationen der Anbieter gesichert werden. Falsche Qualitätssignale in Form von irreftlhrender Werbung können durch das Gesetz, bei Zulassung vergleichender Werbung aber auch durch die Konkurrenz sanktioniert werden. Schließlich können gesetzlich vorgeschriebene Garantieleistungen und Haftungsregelungen die Qualität sichern, indem sie die Gewinnspannen von Anbietern schlechter Qualitäten reduzieren. Insgesamt ist zu prüfen, ob und inwieweit diese Maßnahmen zur Schaffung eines funktionsfähigen 36 Vgl. VAHRENKAMP, K., 1991, S. 155 f.
2. Injormalionsökonomik
343
"Signaling" geeignet sind, andere - vielleicht kostenträchtigere oder interventionsstärkere - staatliche Eingriffe zu ersetzen. 2.3. Kritische Beurteilung der Informationsökonomik aus verbraucherpolitischer Sicht
Die Bedeutung der Infonnationsökonomik rur die Verbraucherpolitik wird von ihren Vertretern teilweise sehr hoch eingeschätzt, bis hin zu der Aussage: "The economics of consumer protection is the economics of infonnation".37 Inwieweit diese Aussage gerechtfertigt ist, soll im folgenden Abschnitt untersucht werden. Mit Hilfe der Infonnationsökonomik scheint es möglich, der Verbraucherpolitik eine theoretische Fundierung zu geben, welche die Orientierung am strengen neoklassischen Modell nicht zu leisten vennochte. Sie könnte rur den Verbraucherschutz einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen Verbrauchertheorie und Verbraucherpolitik darstellen, wie sie in anderen Bereichen der Wirtschaftswissenschaft längst üblich ist (beispielsweise in der Beschäftigungstheorie und -politik oder Konjunkturtheorie und -politik). Die Vorgehensweise der Infonnationsökonomik - von den besonderen Eigenschaften des Gutes Infonnation über die These von der asymmetrischen Infonnationsverteilung zuungunsten der Verbraucher auf die Möglichkeit von Wettbewerbsversagen durch adverse Selektion zu schließen - eignet sich gut rur die Erklärung und Bestimmung eines bestimmten verbraucherpolitischen Handlungsbedarfs. Die aus Infonnationsmängeln resultierende adverse Selektion stellt damit eine eigenständige und speziell im Bereich des Verbraucherschutzes relevante Begründung filr Wettbewerbsversagen dar. Sie kann die fehlende Funktionsflihigkeit einzelner Märkte auch dort erklären, wo andere in der verbraucherpolitischen Diskussion vorgebrachte Thesen versagen. 38 Von besonderer Bedeutung ist es, daß die adverse Selektion auch auf Märkten mit geringer Konzentration, ja sogar im Polypol auftreten kann, in dem der einzelne Anbieter über keine nennenswerte Marktmacht 37 SHAPIRO, C., 1983, S. 528. 38 Vgl. VAN DEN BERGH,
VAHRENKAMP, K., 1991, S. 40.
R., und LEHMANN, M., 1992, S.591, sowie
344
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer Ansätze
verfUgt. Gerade unter wettbewerblichen Verhältnissen ist der beschriebene negative Selektionsmechanismus wirksam, da sich die Anbieter qualitativ hochwertiger Waren um so schneller an die durchschnittliche Qualität anpassen müssen, je härter die Konkurrenz und je geringer folglich die erwirtschafteten Gewinne sind. Positiv zu bewerten ist in diesem Zusammenhang, daß die informationsökonomische Analyse nicht bei der grundsätzlichen Möglichkeit des Wettbewerbsversagens stehenbleibt, sondern im Rahmen der Screening- und Signaling-Diskussion auch hinterfragt, inwieweit marktmäßige Mechanismen solchen Fehlentwicklungen entgegensteuern können, so daß gegebenenfalls die Notwendigkeit staatlichen Eingreifens entfällt. Als fruchtbar rur die Identifikation des verbraucherpolitischen Handlungsbedarfs hat sich schließlich die informationsökonomische Differenzierung nach Güterarten herausgestellt. Sie zeigt, daß sich die staatlichen Bemühungen auf besondere Problembereiche, namentlich die Erfahrungs- und Vertrauensgütennärkte, konzentrieren sollten. Das häufig modelltheoretisch~formale Vorgehen und die Anwendung des Marginalprinzips machen ebenso wie die individualistische Orientierung und das unterstellte Rationalverhalten der Wirtschaftssubjekte (wenn auch unter Unsicherheit) deutlich, daß die Informationsökonomik zwar noch in neoklassischer Tradition steht. Sie emanzipiert sich aber davon zusehends, indem bereits weithin wettbewerbstheoretisch argumentiert wird. Einerseits verhilft diese Forschungsrichtung mit der Aufhebung der Annahme vollständiger Information der Verbraucherpolitik zu einem gegenüber dem strengen neoklassischen Modell verbesserten Referenzsystem und kann deshalb als sinnvolle Weiterentwicklung der herkömmlichen Neoklassik angesehen werden. Andererseits macht gerade die Beibehaltung der neoklassischen Orientierung den Ansatz angreifbar durch Kritik von anderer Seite - allem voran durch die Vertreter der sogenannten Evolutionsökonomik. 39 Ein Verdienst der Informationsökonomik ist es, auf die Existenz und Bedeutung von InformationsdefIziten, auf Informationsaktivitäten der Wirtschaftssubjekte und auf dabei anfallende Informa39 Diese Diskussion wird in den Ausftlhrungen zur Evolutionsökonomik in Kapitel 4 vertieft.
2. lriformationsäkonomik
345
tionskosten aufmerksam gemacht zu haben. 4o Im Gegensatz zur ursprünglichen Neoklassik bleibt die Informationsökonomik nicht bei einer rein statischen Betrachtungsweise, der Untersuchung von Zuständen, stehen. Indem diese Forschungsrichtung Informationsaktivitäten wie Signaling und Screening analysiert, die als Prozeß einer Veränderung der Informationsstände von Wirtschaftssubjekten zu verstehen sind, weist sie begrenzt dynamische Aspekte auf.41 An dieser Stelle sind noch einige kritische Anmerkungen zum Verhältnis von informationsökonomisch fundierter Verbraucherpolitik und Wettbewerb angebracht. Wie bereits festgestellt wurde, ist die neoklassische Annahme vollständiger Information nicht mit einem wettbewerblichen Marktgeschehen vereinbar, da sie im Extremfall zu einem wettbewerbslosen Zustand mit einheitlichen Preisen und Qualitäten filhrt. Aufgrund ihrer neoklassischen Prägung besteht auch bei einzelnen informationsökonomischen Arbeiten die Gefahr, daß sie sich in den verfolgten Zielen und vorgeschlagenen Maßnahmen zu stark an diesem vermeintlichen "Idealzustand" orientieren. So fmden die Zielsetzung einer Minimierung der Informationskosten zur Erhöhung der Markttransparenz und damit das Ausmaß der Informationspolitik ebenfalls dort ihre Grenze, wo sie mit dem Wettbewerbsschutz kollidieren. 42 Zu beachten ist, daß die Beurteilung einer Erhöhung der Markttransparenz, wie sie bei sinkenden Informationskosten zu erwarten ist, von der jeweiligen Ausgangslage abhängt. Bestehen bereits wettbewerbliche Zustände, dann kann eine weitere Verbesserung der Informationslage überflüssig sein oder sogar unerwünschte, den Wettbewerb beeinträchtigende Auswirkungen haben. Wie gezeigt wurde, kann Qualitätsunsicherheit die Funktionsfilhigkeit von Märkten beeinträchtigen, aber auch gleichzeitig die Herausbildung von kompensierenden, qualitätssichernden Marktsignalen auslösen. Diese marktinternen Institutionen bzw. die damit einhergehenden Auswirkungen auf die Marktstruktur (z. B. markenbezogene Produktdifferenzierung, höhere Anbieterkonzen40
Vgl. SCHUMACHER, A., 1994, S. 86 f.
41
Vgl. HOPF, M., 1983, S. 59 f.
42 Vgl. VAN DEN BERGH, R., und LEHMANN, M., 1992, S. 590.
346
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer Anstitze
tration, Schaffung von Marktzutrittsschranken) stellen aus streng neoklassischer Sicht unerwünschte Abweichungen vom Modell vollkommener Konkurrenz dar. Aus der Sicht der Informationsökonomik und der Wettbewerbspolitik dagegen sind diese monopolistischen Elemente unter Umständen positiv zu bewerten.43 Diese Interpretation einzelner Marktsignale und daraus resultierender Marktstrukturen sollte aber nicht zur Rechtfertigung einer grundlegenden wettbewerbspolitischen Neuorientierung mißbraucht werden. Im Vertrauen in die "Selbstheilungskräfte des Marktes" (und hier insbesondere in die Funktionsfilhigkeit des "Signaling") könnte nahezu jede Konzentration als effiziente marktliche Lösung von Steuerungsproblemen bei Marktunsicherheit hingenommen und damit eine Wettbewerbspolitik als weitgehend überflüssig angesehen werden. 44 Diesen extremen Vorstellungen, wie sie vor allem von der Chicago School vertreten werden, wird hier nicht gefolgt. Es muß vielmehr darauf hingewiesen werden, daß eine verbraucherpolitisch wünschenswerte Herausbildung und Förderung von Marktsignalen durchaus zu Zielkonflikten mit der Wettbewerbspolitik ruhren kann (z. B. wenn der Marktzutritt neuer Anbieter wegen einer starken Markenbindung der Verbraucher erschwert wird). Wegen ihrer Ausrichtung auf den Informationsaspekt und der Betonung der Mechanismen marktwirtschaftlicher Selbststeuerung erscheint diese Forschungsrichtung besonders tauglich zur Begründung marktwirtschaftlich-liberaler Konzeptionen. Es wurde ebenfalls deutlich, daß durch die Informationsökonomik viele verbraucherpolitische Interventionen gerechtfertigt werden können. Deshalb soll an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen werden, daß eine Zuordnung dieses Ansatzes zu einer speziellen Konzeption nicht sinnvoll ist. Die informationsökonomische Analyse kann, je nachdem, wie wahrscheinlich eine adverse Se-
43
Vgl. HAUSER, H. 1979, S. 756-762.
44 Vgl. CZERWONKA, C. und SCHÖPPE, G., Verbraucherberatung und -information: Einkaufshilfe, Rechtsberatung und sonst nichts? in: ROCK, R., und SCHAFFARTZIK, K.-H. (Hrsg.), Verbraucherarbeit: Herausforderungen rur die Zukunft. Dialog zwischen Praxis und Wissenschaft, Frankfurt 1983, S. 90.
2. Injormationsökonomik
347
lektion und wie wirksam kompensierende Marktsignale eingeschätzt werden, zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Wie bereits oben erwähnt wurde, hat die neoklassische Orientierung die Informationsökonomik heftiger Kritik ausgesetzt. So ist beispielsweise das Marginalprinzip, nach dem das individuelle Informationsoptimum dort zu fmden sei, wo sich Grenzkosten und Grenznutzen der Informationen entsprechen, kaum anwendbar. Bei diesem Kalkül wird nämlich vorausgesetzt, daß dem Wirtschaftssubjekt schon vor Beginn der Informationssuche deren Ergebnisse in Form von Kosten und Nutzen bekannt sind. 45 Die Vertreter der Evolutionsökonomik bemängeln vor allem die der Informationsökonomik zugrunde liegende Auffassung von Wettbewerb, der sie den dynamischen Wettberbsbegriff gegenüberstellen. Schließlich wird dem Forschungsansatz vorgeworfen, die unvollständige Information der Marktteilnehmer nur auf objektive Ursachen, auf Probleme der Informationsbeschaffung, zufÜckzufUhren. Dabei werden die von der Verhaltenswissenschaft herausgestellten Schwierigkeiten der Informationsverarbeitung durch das Individuum, also subjektive Faktoren, vemachlässigt.46 Die bisherigen Ausftlhrungen haben gezeigt, daß die Informationsökonomik einerseits geeignet ist, der Verbraucherpolitik neue Impulse zu geben, indem sie wichtige Beiträge ftlr die in diesem Politikbereich zentrale Informationsproblematik leistet. Andererseits wurde deutlich, daß ihr Aussagewert ftlr die Verbraucherpolitik vor allem aufgrund der neoklassischen Orientierung beschränkt ist. Diese Überlegungen legen es nahe, die Informationsökonomik nicht länger in einem engeren Sinne - als eine neoklassisch geprägte Betrachtung, bei der lediglich die Prämisse vollständiger Information aufgehoben wurde - zu verstehen. Statt dessen sollte diese Forschungsrichtung zu einer umfassenderen Analyse der Informationsproblematik ausgebaut werden, die zur Erklärung der Realität auch andere wissenschaftliche Erkenntnisse nutzt, z. B. aus der Verhaltenswissenschaft zur Untersuchung nicht-rationalen Verhaltens und der individuellen Informationsverarbeitung. Auf diese Weise von den Zwängen der neoklassischen 45 Vgl. SCHUMACHER, A., 1994, S. 78 f. 46 Vgl. WESSLING, E., 1991, S. 99. 24 Mitropoulos
348
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer Ansatze
Fonnulierung befreit und auf einem dynamischen Wettbewerbsverständnis basierend, könnte der Ansatz möglicherweise den Kern einer zukünftig noch zu entwickelnden "Theorie der Verbraucherpolitik" bilden. Um Fortschritte bei der Beantwortung der Fragen zu erzielen, unter welchen Bedingungen und wie wahrscheinlich das Auftreten von Wettbewerbsversagen durch adverse Selektion ist bzw. wie wirksam die selbstheilenden Kräfte des Screening und des Signaling sind, müßte sich die Forschung sicherlich auch einer stärkeren empirischen Abstützung bedienen. 3. Neue Institutionenökonomik 3.1 Grundlagen der Neuen Institutionenökonomik
Die Neue Institutionenökonomik stellt eine vergleichsweise neue und stark in Entwicklung befindliche wirtschaftswissenschaftliche Forschungsrichtung dar, die ihren Schwerpunkt auf die Analyse des institutionellen Rahmens einer marktwirtschaftlichen Ordnung legt. Sie ist von teilweise sehr viel älteren Ansätzen zur Erklärung von Institutionen wie der Historischen Schule in Deutschland oder den amerikanischen Institutionalisten zu unterscheiden. 47 Erst die Neue Institutionenökonomik versucht, die Analyse von Institutionen in die traditionelle Neoklassik zu integrieren. Sie kann deshalb, wie schon die Infonnationsökonomik, als wichtige Weiterentwicklung der neoklassischen Theorie angesehen werden. In der neoklassischen Markt- und Preistheorie wurden die institutionellen Rahmenbedingungen trotz ihres entscheidenden Einflusses auf das Verhalten der einzelnen Wirtschaftssubjekte und damit auch auf den Ablauf und die Ergebnisse der gesamten Wirtschaft nicht problematisiert, sondern als vorgegebene Größe behandelt. Die institutionenökonomische Analyse versucht nun, die auf Abweichungen von den restriktiven Annahmen des neo47 Vgl. SEIFERT, E. K., und PRIDDAT, B. P., Einleitung, in: dies. (Hrgs.), Neuorientierungen in der ökonomischen Theorie. Zur moralischen, institutionellen, evolutorischen und ökologischen Dimension des Wirtschaftens, Marburg 1995, S. 24-28, sowie BONUS, H., und WEILAND, R., Die Welt der Institutionen, in: DIECKHEUER, G. (Hrsg.), Beiträge zur angewandten Mikroökonomik, Jochen Schumacher zum 65. Geburtstag, Berlin/Heidelberg 1995, S. 31.
3. Neue Institutionenökonomik
349
klassischen Modells beruhenden Transaktionskosten des ökonomischen Systems und die damit zusammenhängende Herausbildung von Institutionen zu erklären. Bevor die wichtigsten Elemente und Teilbereiche der "Neuen Institutionenökonomik" vorgestellt und auf ihre verbraucherpolitische Verwendbarkeit hin untersucht werden, wird diese zunächst von einer "Institutionenökonomik im weiteren Sinne" abgegrenzt und der zugrunde liegende Institutionenbegriff geklärt. Der Begriff der Institution wird in der Literatur so vielflUtig verwendet, daß eine einheitliche Defmition kaum möglich erscheint. Unter einer Institution kann zunächst eine Regel bzw. ein System von Regeln oder Normen verstanden werden, mit denen die Handlungs- und Verhaltensweisen von Individuen strukturiert werden. Ziel dieser von den Individuen selbst errichteten Beschränkungen ihrer Wahlmöglichkeiten ist es, die Bildung von verläßlichen Erwartungen zu ermöglichen und damit Unsicherheit zu verringern. Diese Funktion können Regeln aber nur erfilllen, wenn sie in einer Gesellschaft bzw. Wirtschaft allgemeine Anerkennung erfahren und wenn Sanktionsmöglichkeiten filr den Fall einer Verletzung der Regeln bestehen. Erst dann gibt die Institution den Individuen eine gewisse Sicherheit, daß auch die anderen ihr Verhalten danach ausrichten. 48 Diese noch sehr abstrakte Umschreibung des Begriffs wird leichter nachvollziehbar durch die Betrachtung konkreter Institutionen und ihrer Gliederungsmöglichkeiten. Eine verbreitete Einteilung unterscheidet zwischen informellen Institutionen (z. B. Sitten, Traditionen, Wertvorstellungen, Konventionen) und formellen Regeln. Letztere können weiter aufgeteilt werden in objektives Recht, das rur alle Individuen gleichermaßen gilt (z. B. Verfassung, Gesetze), und subjektives Recht, das nur filr einzelne Wirtschaftssubjekte in einer bestimmten Situation gilt (z. B. das Eigentum an einer Sache oder ein Anspruch aus
48 Vgl. ELSNER, W., Institutionen und ökonomische Institutionentheorie. Begriffe, Fragestellung, theoriegeschichtliche Ansätze, in: WiSt, Jg. 16 (1987), S. 5 f., und RICHTER, R., Institutionen ökonomisch analysiert. Zur jüngeren Entwicklung auf einem Gebiet der Wirtschaftsstheorie, Tübingen 1994, S. 2. 24*
350
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer Anstitze
einem Vertrag).49 Nützlich ist auch die Unterscheidung in innere und äußere Institutionen. 5o Während äußere Institutionen die unbedingt erforderlichen Voraussetzungen für eine marktwirtschaftliche Ordnung darstellen (z. B. das Recht auf Privateigentum), bilden sich die inneren Institutionen gemeinsam mit höher entwickelten Märkten heraus. Sie erlauben eine Steigerung der Komplexität in den Marktbeziehungen und erweitern die Handlungsmöglichkeiten auf dem Markt. Ein unmittelbarer Bezug zur Verbraucherpolitik läßt sich hier herstellen, da die verbraucherschutzrechtlichen Regelungen und qualitätssichernden Marktsignale zu diesen inneren Institutionen gezählt werden können (z. B. Markenzeichen, Garantien, Allgemeine Geschäftsbedingungen). Neben dieser Vielzahl von Regeln zur Konditionierung der zwischenmenschlichen Beziehungen wird der Begriff der Institution aber auch in einer weiteren Variante genutzt, nämlich für Organisationen, zu denen beispielsweise Unternehmen, Verbände und staatliche Einrichtungen zählen. 51 Dieser weit gefaßte Institutionenbegriff läßt schon darauf schließen, wie breit auch eine Institutionenökonomik als ökonomische Analyse von Institutionen angelegt sein kann. Aus diesem Grund soll in dieser Arbeit die sogenannte Neue Institutionenökonomik, der speziell dieser Abschnitt gewidmet ist, von einer "Institutionenökonomik im weiteren Sinne" abgegrenzt werden. Einer Einteilung von Richter folgend, können dann innerhalb einer sehr umfassend verstandenen Institutionenökonomik neben der Neuen Institutionenökonomik weitere Ansätze mit jeweils anderen Schwerpunkten unterschieden werden. 52 Hier ist zunächst wieder die Ökonomische Analyse des Rechts zu nennen, die sich (v. a. gemäß einer ersten Verwendungsvariante des Begriffs Institution als Regel) mit dem rechtlichen Bereich 49 Vgl. ebenda, und NORTH, D. C., Institutions, in: Journal of Economic Perspectives, Jg. 5 (1991), S. 97. 50 Vgl. zum folgenden LOHMANN, H., 1992, S. 17 f., und LACHMANN, L. M., Wirtschaftsordnung und wirtschaftliche Institutionen, in: ORDO, Bd. 14 (1963),
S.67.
51 Vgl. DIETL, H., Institutionen und Zeit, TUbingen 1993, S. 35 f. 52 Vgl. RICHTER,
R., 1994, S. 3.
3. Neue Institutionenökonomik
351
beschäftigt. Ein zweiter Ansatz, die Neue Politische Ökonomie, wendet die ökonomische Analyse auf politikwissenschaftliche Fragen an. Er konzentriert sich demnach stärker auf den Bereich öffentlicher Regeln, während sich die Property Rights-Theorie als Bestandteil der Neuen Institutionenökonomik mit privaten Normen auseinandersetzt. 53 Gemäß der zweiten Verwendungsvariante des Begriffs Institution analysiert die Neue Politische Ökonomie das Verhalten im politischen Willensbildungsprozeß agierender Organisationen wie Verbände, Parteien und staatlicher Bürokratie. Als dritter Bereich ist schließlich die Österreichische Schule zu nennen, die besonders die evolutorische, "spontane" Entwicklung von Institutionen auf dem Markt und den Markt selbst als Institution untersucht. Die Frage, wie sinnvoll es ist, die Institutionenökonomik so umfassend zu verstehen, kann hier nicht beantwortet werden. Die drei anderen Ansätze werden trotz ihres institutionenökonomischen Bezugs in dieser Studie als eigenständige Forschungsrichtungen berücksichtigt. Ebenfalls manchmal zu einer Institutionenökonomik gezählt,54 aber wegen ihres geringeren verbraucherpolitischen Bezugs im weiteren nicht behandelt, werden die "constitutional economics" (institutionelle Verfassungstheorie)55 und die wirtschaftshistorische Theorie des institutionellen Wandels von D. C. North. 56 Die Gemeinsamkeiten der genannten Bereiche, insbesondere das speziell institutionenökonomische Instrumentarium und die aus der neoklassischen Theorie abgeleiteten Grundannahmen, können
53 Vgl. BONUS, H., und WEILAND, R., 1995, S. 30. 54 So bei THIELE, M., Neue Institutionenökonomik, in: WISU, Jg.23 (1994),
S. 995 f., sowie SEIFERT, E. K., und PRIDDAT, B. P., 1995, S. 29.
55 Vgl. zu diesem Ansatz z. B.: BRENNAN, G., und BUCHANAN, 1. M., Die Begründung von Regeln: konstitutionelle politische Ökonomie, TUbingen 1993 [original: The reason of mies. Constitutional political economy, Cambridge 1985]. 56 Vgl. vor allem NORTH, D. C., Theorie des institutionellen Wandels. Eine neue Sicht der Wirtschaftsgeschichte, TUbingen 1988 [original: Structure and Change in Economic History, New York 1981], und ders., Institutionen, institutioneller Wandel und Wirtschaftsleistung, TUbingen 1992 [original: Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge 1990].
352
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer Ansdtze
und sollen aber an dieser Stelle im Rahmen der Neuen Institutionenökonomik vorgestellt werden. Zu den gemeinsamen, neoklassisch fundierten Grundannahmen dieser Ansätze (inklusive der zuvor dargestellten Informationsökonomik) gehören der methodologische Individualismus und das Rationalverhalten der Individuen. 57 Als methodologischer Individualismus kann der Versuch bezeichnet werden, soziale Gebilde wie Unternehmen, Verbände oder Bürokratien nicht als homogenes Ganzes anzusehen, sondern deren Verhalten aus dem ihrer individuellen Mitglieder zu erklären. Dies fUhrt zu einer "Mikrofundierung" dieser Gruppen und Organisationen. Das unterstellte rationale, eigennützige und nutzenmaximierende Verhalten der Individuen muß nicht der vollständigen Rationalität des neoklassischen "homo oeconomicus" entsprechen. Vielmehr greifen die modemen Ansätze meist auf die realistischere Annahme eines beschränkten Rationalverhaltens - im Sinne der "bounded rationality" von H. A. Simon58 - zurück. Damit wird den begrenzten Fähigkeiten des Menschen, seiner komplexen Umwelt und den bestehenden Unsicherheiten Rechnung getragen. Dabei können in ein umfassend verstandenes Kriterium der Nutzungsmaximierung durchaus auch nicht-materielle Werte wie Prestige oder Macht aufgenommen werden. Der Begriff der Institutionenökonomik spielt bisher in der verbraucherpolitisch bedeutsamen Literatur praktisch keine Rolle. Die unseres Wissens einzige deutschsprachige wissenschaftliche Arbeit zum Thema Verbraucherschutz, die sich als institutionentheoretisch versteht, stammt von H. Lohmann. 59 Sie soll aber nach der oben gewählten Abgrenzung nicht der Neuen Institutionenökonomik zugerechnet werden, sondern steht dem prozessualen Marktverständnis der Österreichischen Schule näher. Daß die 57 Vgl. hierzu RICHTER, R., 1994, S. 4, sowie TIETZEL, M., Die Ökonomie der Property Rights: Ein Überblick, in: Zeitschrift rur Wirtschaftspolitik, Jg. 30 (1981), S. 218-221.
58 Vgl. SIMON, H. A., A Behavioral Model of Rational Choicc, in: Quarterly Journal ofEconomics, Jg. 69 (1955), S. 99-118. 59 LOHMANN, H., Verbraucherschutz und Marktprozesse. Versuch einer institutionentheoretisch fundierten Erklärung von Marktrcgulierungen, Frciburg 1992.
3. Neue Inslitulionen(jkonomik
353
Bezeichnung (Neue) Institutionenökonomik bisher anscheinend nicht aufgegriffen wurde, heißt allerdings keinesfalls, daß nicht wesentliche Elemente dieser Forschungsrichtung längst Eingang in den Bereich der Verbraucherpolitik gefunden haben. So benutzt die bereits in einer speziellen Ausprägung als verbraucherpolitische Konzeption behandelte Ökonomische Analyse des Rechts den Transaktionskostenansatz. Auch zeigen sich bei der anschließenden Betrachtung der wichtigsten Bausteine der Neuen Institutionenökonomik mehrfach Verbindungslinien zur verbraucherpolitisch relevanten Informationsökonomik. Als wesentliche Elemente einer Neuen Institutionenökonomik i. e. S. gelten Transaktionskosten, Property Rights und (unvollständige) Verträge. Je nach Schwerpunktsetzung auf einen dieser Aspekte werden verschiedene Ansätze unterschieden: Der Transaktionskostenansatz, die Property Rights-Theorie und die ökonomische Vertragstheorie einschließlich des Principal-Agent-Ansatzes. Wegen der engen Verbindungen zwischen den einzelnen Bausteinen bzw. den daraus abgeleiteten Ansätzen ist es aber sinnvoll, sie "als Teile eines institutionenanalytischen Gesamtkonzepts zu sehen und zu behandeln".60 Ohne auf die sehr vielgestaltigen Ausformungen dieser Ansätze im Detail eingehen zu können, sollen diese institutionenökonomischen Komponenten im folgenden skizziert werden. 3.2 Transaktionskostenansatz
Das Konzept der Transaktionskosten geht entgegen den Annahmen der traditionellen Neoklassik davon aus, daß die Nutzung der Vielzahl von Institutionen in einer Marktwirtschaft nicht kostenlos, sondern mit Aufwendungen in beträchtlicher und unterschiedlicher Höhe verbunden ist. Damit erst wird die Frage nach der institutionellen Ausgestaltung relevant, d. h. die Institutionen werden zu Variablen im ökonomischen Modell.61 60 SCHENK, K.-E., Die neue Institutionenökonomie - Ein Überblick über wichtige Elemente und Probleme der Weiterentwicklung, in: ZWS, Jg. 112 (1992), S.354. 61 Vgl. KAAS, K. P., und FISCHER, M., Der Transaktionskostenansatz, in: WISU, Jg. 22 (1993), S. 689.
354
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer Ansätze
Allgemein fonnuliert lassen sich die Transaktionskosten als Kosten der Bereitstellung, Nutzung, Erhaltung und Umgestaltung von Institutionen zur Betreibung eines Wirtschaftssystems beschreiben und negativ von den (in der neoklassischen Theorie ausschließlich berücksichtigten) Produktionskosten abgrenzen. 62 Den Ausgangspunkt des modemen Transaktionskostenansatzes bildet ein Aufsatz von Ronald Coase, in dem er neben dem Markt die Unternehmung als zweite dauerhafte Institution zur Koordination wirtschaftlicher Aktivitäten untersucht. 63 Auch bei der Nutzung des Marktmechanismus fallen Transaktionskosten unterschiedlicher Art an. Sie können aufgegliedert werden in die Kosten filr die Anbahnung von Verträgen (filr die Suche nach Geschäftspartnern, filr Kommunikation und filr Infonnationen über Preise und Qualitäten), die Verhandlungs- und Entscheidungskosten bis zum Abschluß des Vertrages sowie die Kontrollkosten danach (Überwachung und Durchsetzung der vertraglichen Pflichten).64 Coase erklärt nun die Entstehung der Institution "Unternehmung" ökonomisch mit Einsparungen bei den Kosten der Marktnutzung. Die Verlagerung wirtschaftlicher Aktivitäten in eine Unternehmung hinein sei dabei so lange vorteilhaft, wie die Transaktionskostensenkung auf dem Markt nicht von den gleichzeitig auftretenden unternehmens internen Organisationskosten überkompensiert werde. Diese Überlegungen wurden erst viele Jahre später im Zuge der Weiterentwicklung zum Transaktionskostenansatz in angemessener Weise gewürdigt. Als wichtige Arbeiten dieses Ansatzes sind vor allem Veröffentlichungen von Williamson zu nennen. 65 Nochmals 1960 ist es Coase, der in seinem bekannten Artikel über 62 Vgl. RICHTER, R., 1992, S. 10. 63 Vgl. COASE, R. H., The Nature of the Finn, in: Economica, Jg. 4 (1937), S.386-405, und SCHUMANN, J., Grundzuge der mikroökonomischen Theorie, 6. Aufl., Berlin 1992, S. 434-436. 64 Vgl. RICHTER, R., Sichtweise und Fragestellungen der Neuen Institutionenökonomik, in: ZWS, Jg. 110 (1990), S. 577. 65 Vgl. besonders WILLIAMSON, O. E., Markets and Hierarchies, New York 1975, sowie ders., Die ökonomischen Institutionen des Kapitalismus, TUbingen 1990 [original: The Economic Institutions ofCapitaiism, New York 1985].
3. Neue Institutionenökonomik
355
"The Problem of Social Cost" wichtige Aussagen für die Neue Institutionenökonomik triffi. Diese Gedanken haben in der Wirtschaftstheorie ihren Platz unter der Bezeichnung "Coase-Theorem" gefunden. 66 Der Autor zeigt darin, daß in einer (neoklassischen) Welt ohne Transaktionskosten eine effiziente Ressourcenallokation unabhängig vom institutionellen Rahmen, insbesondere ohne einen Einfluß der ursprünglichen Verteilung der "Property Rights", von den Betroffenen selbst durch Verhandlungen erreicht wird. Dies bedeutet aber in der Realität, daß sich ein effizientes Marktergebnis nicht einstellen kann, wenn aufgrund zu hoher Transaktionskosten eine Verhandlungslösung unterbleibt. Aus der allgegenwärtigen Existenz von Transaktionskosten folgt, daß der institutionelle Rahmen des wirtschaftlichen Geschehens durchaus von Bedeutung ist. Daraus kann die zentrale Forderung des Transaktionskostenansatzes nach einer Minimierung der Transaktionskosten abgeleitet werden (Einsparungsthese).67 Der Transaktionskostenansatz führt also nicht nur die Herausbildung des institutionellen Rahmens einer Wirtschaftsordnung auf die Existenz von Transaktionskosten zurück, sondern erkennt ebenso, daß jede Gestaltung von Institutionen mit Wohlfahrtsgewinnen oder -verlusten verbunden sein kann. Die Transaktionskosten werden deshalb als wichtiges Beurteilungskriterium bei der Wahl zwischen alternativen Institutionen angesehen. Zu beachten ist allerdings, daß es letztlich auf die Summe aus Transaktionskosten und Produktionskosten ankommt. Was auf den ersten Blick so einleuchtend erscheint, wirft jedoch erhebliche praktische Probleme auf, da eine genaue Bestimmung der Transaktionskosten und ihre Abgrenzung von anderen Kostenarten auf größte Schwierigkeiten stößt. 68
66 Vgl. COASE, R. H., The Problem of Social Cost, in: Journal of Law and Economics, Jg. 3 (1960), S. 1-44. Siehe zum folgenden auch beispielsweise HENNINGBODEWIG, F., und KUR, A., 1988, S. 138 f. 67 Vgl. SCHENK, K.-E., 1992, S. 354. 68 Vgl. KIRCHNER, C., Zum Transaktionskostenansatz, in: SCHLIEPER, U., und SCHMIDTCHEN, D. (Hrsg.), Makro, Geld & Institutionen: Beiträge zu einem Saarbrücker Symposium, TUbingen 1993, S. 89 und S. 91, und SEWERIN, U., Transaktionskosten und Marktevolution: die Relevanz von Transaktionskosten und Trans-
356
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer Anstitze
Von den Teilansätzen der Neuen Institutionenökonomik hat das Konzept der Transaktionskosten die bisher stärkste Anerkennung im Bereich des Verbraucherschutzes erfahren. Dies ist auf die Arbeiten der Ökonomischen Analyse des Rechts zurückzuführen, die konsequent die Zielsetzung ökonomischer Effizienz auch bei der Ausgestaltung verbraucherschutzrechtlicher Regelungen verfolgen. 69 Aus der Forderung nach einer Minimierung der Transaktionskosten wurde dabei das rechtsökonomische Kriterium des "cheapest cost avoiders" abgeleitet und beispielsweise im Vertrags- und Schadensersatzrecht angewendet. So soll die Haftung in effizienter Weise demjenigen zugeordnet werden, der einen Schaden mit dem geringsten Aufwand verhindern kann - unabhängig von der Verschuldensfrage. Nach dem gleichen Prinzip sollen durch das Recht Informationspflichten dem kostengünstigsten Träger auferlegt werden. Darüber hinaus werden in der rechtsökonomischen Analyse einzelne verbraucherpolitisch relevante Institutionen wie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und ihre Regulierung durch das AGB-Gesetz unter dem Transaktionskosten-Aspekt in ihrer Entstehung nachvollzogen und dadurch legitimiert oder aber kritisch hinterfragt. Eine wichtige Verbindung zum Verbraucherschutz bildet die Informationsökonomik, die Informationskosten als einen wesentlichen Bestandteil der Transaktionskosten zum Ausgangspunkt der Betrachtung wählt. Andere spezielle Anwendungsgebiete des Transaktionskostenansatzes sind die Theorie der Unternehmung mit ihrer Bedeutung ftlr die betriebswirtschaftliche Organisationstheorie, die Erklärung des Phänomens vertikaler Integration sowie die öffentliche Regulierung von "natürlichen Monopolen".70
3.3 Property Rights-Theorie Die Property Rights-Theorie als zweiter Baustein der Neuen Institutionenökonomik stellt die "Property Rights" als wesentlichen Teil des institutionellen Rahmens in den Vordergrund der Beaktions-Ansatz ftlr dynarnisch-cvo1utorische Wettbewerbstheorien, Bayreuth 1993 [zug\. Diss. Univ. Marburg], S. 38-44 und S. 57-60. 69 Vg\. dazu die Ausftlhrungen in Teil B, Kap. 3.4.2, S. 60-69.
70 Vg\. SCHENK, K.-E., 1992, S. 358 f.
3. Neue lnstitutionentikonomik
357
trachtung. Für den Begriff der "Property Rights" hat sich in der deutschsprachigen Literatur keine einheitliche Übersetzung herausgebildet, so daß die Bezeichnungen Handlungs-, Verfügungsund Eigentumsrechte nebeneinander verwendet werden. Aus der Sicht dieses Ansatzes läßt sich eine Wirtschaft vereinfacht darstellen als eine Menge von Individuen und Gütern, die in Beziehungen zueinander stehen. Diese Beziehungen in Fonn von allgemein akzeptierten gesellschaftlichen Regeln (und damit Institutionen) bilden den weiten Bereich der Property Rights ab. Da der Wert eines jeden Gutes entscheidend von diesen Rechten mitbestimmt wird, gehen die Institutionenökonomen sogar so weit, das Gut selbst als Bündel von Rechten anzusehen. Damit wird nochmals die enge Verflechtung zwischen ökonomischer und rechtswissenschaftlicher Analyse deutlich. 71 Das Rechtsbündel besteht maximal aus vier Einzelrechten, die sich auf die Nutzung des Gutes, die Einbehaltung seiner Erträge, die Veränderung des Gutes sowie auf die Überlassung dieser Teilrechte an andere Wirtschaftssubjekte beziehen. Ein Individuum besitzt folglich erst dann das vollständige Eigentum an einem Gut im Sinne aller damit verbundenen Handlungsmöglichkeiten, wenn es über alle diese Property Rights verfügt.72 Bei einer solchen vollständigen Spezifizierung der Handlungsrechte und bei deren kostenloser Übertragbarkeit wird - um nochmals das Coase-Theorem aufzugreifen - ein effizientes wirtschaftliches Ergebnis unabhängig von der ursprünglichen Verteilung der Property Rights erreicht. Dem Eigentümer fallen dann alle' Kosten und Nutzen aus dem Gebrauch des Gutes zu, so daß es nicht zu externen Effekten kommt. Die herkömmliche Mikroökonomik hat sich nur mit dieser einen Art von Property Rights-Strukturen beschäftigt und dabei ignoriert, daß in der Realität eine "Verdünnung" der Rechte und damit die Existenz von Extemalitäten die Regel ist. Die Property Rights-Theorie untersucht den Einfluß, den unterschiedliche Ausgestaltungen von Property Rights über die Schaf71 Vgl. RICHTER, R., 1990, S. 571, und HEsSE, G., Der Property-Rights-Ansatz. Eine ökonomische Theorie der Veränderung des Rechts?, in: Jahrbücher rur Nationalökonomie und Statistik, Jg. 195 (1980), S. 481 f.
72 Vgl. SCHENK, K.-E., 1992, S. 350.
358
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer Ansätze
fung positiver wie negativer Anreize auf das Verhalten der Individuen ausüben. Die betont marktwirtschaftliche Ausrichtung des Ansatzes erklärt sich aus dem Prinzip des Privateigentums, dessen positiven Anreizeffekten über die Mobilisierung des Eigeninteresses der Wirtschaftssubjekte eine transaktionskostensenkende Wirkung zugesprochen wird. 73 Die Transaktionskosten beschränken die Bildung, Nutzung und Übertragung von Eigentumsrechten und können damit einer Internalisierung externer Effekte im Wege stehen. Musterbeispiel hierfUr ist das Umweltproblem als eines der wichtigsten Anwendungsgebiete des Ansatzes. Die gegenseitige Beeinflussung von Transaktionskosten und Handlungsrechten (institutionellem Rahmen) zeigt nochmals den engen Zusammenhang zwischen Property Rights-Ansatz und Transaktionskostenansatz, die sozusagen zwei Seiten der gleichen Medaille darstellen. Neben der Umweltökonomie bildet die Theorie der Unternehmung einen weiteren Anwendungsschwerpunkt des Ansatzes. Untersucht werden die Auswirkungen der unterschiedlichen Rechtsformen und der daraus abgeleiteten Anreizsysteme. So wird beispielsweise die Einzelunternehmung, bei der der Eigentümer über annäherungsweise vollständig spezifizierte Eigentumsrechte verfUgt, der managementgeleiteten Großunternehmung mit verdünnten Property Rights gegenübergestellt. Auch die vergleichende Analyse von Wirtschaftssystemen läßt sich mit diesem Instrumentarium durchfUhren. Allgemein ist zu begrüßen, daß der Property Rights-Ansatz die große Bedeutung der Rahmenordnung einer Volkswirtschaft und der davon ausgehenden Anreize, die das Verhalten der Menschen bestimmen, aufzeigt. Die Analyse der Property Rights74 könnte deshalb möglicherweise einer theoretischen Fundierung der Ordnungspolitik dienen und zu einer "Ordnungstheorie in neuer Begründung" ausgebaut werden. 73 Vgl. RICHTER, R., 1992, S. 13 f. 74 Vgl. GÄFGEN, G., Entwicklung und Stand der Theorie der Property Rights: Eine kritische Bestandsaufnahme, in: NEUMANN, M. (Hrsg.), Anspruche, Eigentums- und Verftlgungsrechte [Schriften des Vereins rur Socialpolitik, N. F., Bd. 140], Berlin 1984, S. 49 und S. 62, sowie RIBHEGGE, H., Der Beitrag der Neuen Institutionenökonomik zur Ordnungspolitik, in: Jahrbuch rur Neue Politische Ökonomie, Bd. 10, Tübingen 1991, S. 56.
3. Neue lnstitutionenäkonomik
359
Auf diese Weise könnte der Ansatz auch verstärkt rur die Verbraucherpolitik nutzbar gemacht werden, die im weiteren Sinne zur Wirtschaftsordnungspolitik gezählt werden kann. Die Property Rights-Theorie könnte geeignet sein, eine wieder stärker ordnungspolitische Orientierung im Verbraucherschutz zu unterstützen, welche die Rolle des Wettbewerbs und anderer Rahmenbedingungen hervorhebt, die noch vor den eigentlichen verbraucherpolitischen Maßnahmen ansetzen. Hier sollten z. B. aus institutionenökonomischer Sicht die Anreizsysteme beider Marktseiten einer genaueren Betrachtung unterzogen werden, um möglicherweise schon auf diesem Wege die verbraucherpolitische Problematik zu entschärfen. So kann der Property Rights-Ansatz zur Beurteilung des Partizipationsmodells der Verbraucherpolitik75 herangezogen werden, das entscheidend in die bestehende Struktur der Eigentumsrechte eingreifen möchte. Die dort vorgesehene Umverteilung von Property Rights (Verdünnung bei den Unternehmenseignern zugunsten einer verstärkten Mitbestimmung der Verbraucher) könnte mit negativen Auswirkungen auf das wirtschaftliche Ergebnis verbunden sein, die zusätzliche Argumente gegen diese verbraucherpolitische Konzeption liefern. Insgesamt lassen sich durch die ordnungstheoretische Ausrichtung der ökonomischen Analyse der Handlungsrechte Parallelen zur alten ordoliberalen Konzeption herstellen. Eine zweite Verbindungslinie zwischen Property Rights-Ansatz und Verbraucherschutz verläuft wiederum über die Informationsökonomik. Wie im entsprechenden Kapitel bereits ausgefUhrt wurde, können die unvollständige Spezifizierung der Handlungsrechte beim Gut Information und die dadurch ausgelösten externen Effekte als eine wesentliche Ursache der Verbraucherschutzproblematik angesehen werden. Bei den fUr die Verbraucher relevanten Marktinformationen ist es nicht möglich, Eigentumsrechte wie bei technischem Wissen durch Patente - zu schaffen. Gelingt hier auch keine Geheimhaltung, so besteht die Gefahr einer unzureichenden Versorgung mit Informationen von privater Hand. 76
75 Vgl. Teil B, Kap. 3.3.1, S. 39-47. 76 Vgl. HOPF, M., 1983, S. 93-96.
360
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer Ansdtze
Darüber hinaus untersucht die Property Rights-Theorie "auch und gerade die Rolle der Anreize, die sich bei asymmetrischer Information der Parteien und den daraus resultierenden Möglichkeiten versteckter Aktionen ergeben".77 Sie befmdet sich mit der Erklärung von opportunistischen Verhaltensweisen auf seiten der Anbieter (z. B. Qualitätsverschlechterung und Irrefllhrung der Verbraucher) im Zentrum des informationsökonomischen Interesses. 3.4 Principa/-Agent-Ansatz und ökonomische Vertragstheorie
Als dritter und letzter Baustein der Neuen Institutionenökonomik soll die ökonomische Vertragstheorie behandelt werden. Ein Vertrag kann, allgemein formuliert~ als zweiseitiges Rechtsgeschäft verstanden werden, das im Einverständnis beider Vertragsparteien abgeschlossen und dessen Einhaltung durch Sanktionen unterstützt wird. 78 Da die modeme Institutionenökonomik die Wirtschaft als Geflecht vielfältiger vertraglicher Beziehungen (im weiteren Sinne, also auch nicht-rechtlicher Art) begreift, räumt sie der ökonomischen Analyse des individuellen Vertragsverhaltens einen großen Stellenwert ein. Wieder läßt 'sich ein enger Zusammenhang zu den beiden anderen institutionenökonomischen Elementen herstellen. So erfolgen die Ausgestaltung, die Änderung und vor allem die Übertragung von Property Rights normalerweise über Verträge. Die Vertragsgestaltung in einer realen Welt geht bekanntermaßen mit einem Aufwand an Transaktionskosten einher. 79 Eine erste Annäherung an die Verbraucherschutzproblematik ergibt sich fllr die ökonomische Vertragstheorie schon aus dem Sachverhalt, daß auch das Verhältnis zwischen Anbieter und Konsument in der Regel auf vertraglicher Grundlage steht. Zunächst soll im Rahmen der Vertragstheorie der sogenannte Prinzipal-Agent-Ansatz vorgestellt werden, an den sich dann die Darstellung des Konzepts der relationalen (unvollständigen) Verträge anschließt. 77 RICHTER, R., 1990, S. 576. 78 Vgl. ebenda, S. 580. 79 Vgl. z. B. BONUS, H., und WEILAND, R., Transaktionskosten und Gleichgewicht, in: WISU, Jg. 21 (1992), S. 340.
3. Neue InstitutionenlJkonomik
361
Der Principal-Agent-Ansatz entwirft ein ökonomisches Modell der Vertretung, bestehend aus dem Principal (der Vertretene) und dem von ihm als Stellvertreter beauftragten Agenten. 8o Der Agent soll durch seine Aktivitäten den Nutzen beider Beteiligten erhöhen. Charakteristisch für die Agency-Beziehung ist aber, daß der Principal nicht genau die Handlungen seines Agenten beobachten kann, sondern nur deren Ergebnis (versteckte Aktion), oder der Agent schon vor Vertragsabschluß über Informationen verfUgt, die dem Principal fehlen (versteckte Information). Die wegen der Gefahr opportunistischer Verhaltensweisen des Agenten für den Principal ungünstige Situation wird noch komplizierter, weil das Ergebnis nicht nur vom Handeln des Agenten, sondern auch von anderen (z. B. zufallsbedingten) Einflüssen bestimmt ist. Dem Principal sind deshalb keine direkten Rückschlüsse vom Resultat auf die Handlungen des Agenten möglich. Damit beruhen die beschriebenen Agency-Beziehungen alle auf asymmetrischer Information, so daß die Principal-Agent-Theorie genau die Problembereiche aufgreift, die von der Informationsökonomik untersucht werden, nämlich die Fälle adverser Selektion und des "moral hazard". Erneut offenbart sich eine deutliche Parallele zwischen der Informationsökonomik und einem Teilbereich der Neuen Institutionenökonomik. 81 Aufgefilhrt werden die Standardbeispiele asymmetrischer Informationsverteilung wie die Bereiche Versicherung und Gebrauchtwagenmarkt, das Verhältnis zwischen Arzt und Patient oder im Rahmen einer Theorie der Unternehmung die Beziehung zwischen Aktionären und Management. Vertragliche Verhältnisse zwischen einem Principal und einem Agenten sind auch zwischen Anbietern und Verbrauchern weit verbreitet und 80 Vgl. zu diesem Ansatz: ELSCHEN, R., Gegenstand und Anwendungsmöglichkeiten der Agency-Theorie, in: Schmalenbachs Zeitschrift rur betriebswirtschaftliehe Forschung, Jg.43 (1991), S. 1004-1011; FISCHER, M., Agency-Theorie, in: WiSt, Jg. 24 (1995), S. 320-322; PRAlT, J. W., und ZECKHAUSER, R. J., Principals and Agents: An Overview, in: dies. (Hrsg.), Principals and Agents: The Structure of Business, Boston 1985, S. 1-24; RiCHTER, R., 1990, S.581 f., sowie SCHUMANN, J., 1992, S. 453-458. 81 Diesen engen Zusammenhang beachtet KIENER, S., Die Principal-AgentTheorie aus informationsökonomischer Sicht, Heidelberg 1990 [zug!. Diss. Univ. Regensburg 1989].
362
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer Ansätze
werfen Probleme bei den Erfahrungs- und besonders bei den Vertrauensgütem auf. Innerhalb der Principal-Agent-Theorie kann zwischen einer positiven und einer normativen Forschungsrichtung unterschieden werden. 82 Während die positive Theorie versucht, in der Realität vorgefundene vertragliche Beziehungen zu beschreiben und zu erklären, sind die normativen Arbeiten, auf denen mittlerweile der Schwerpunkt des Ansatzes liegt, bestrebt, Empfehlungen über die Gestaltung von Vertragsbedingungen abzuleiten. Im Gegensatz zu den anderen (Teil-)Ansätzen der Neuen Institutionenökonomik, die sich weitgehend auf eine verbale Darstellung konzentrieren, ist die normative Analyse von PrincipalAgent-Beziehungen durch einen hohen Grad mathematischer Formalisierung gekennzeichnet. 83 Zielsetzung des Ansatzes ist es, eine geeignete Vertragsgestaltung zu entwerfen, bei der der Verlust des Principals gegenüber einer Situation mit vollständiger Information minimiert wird. Das Problem der effizienten Vertragsform wird modellhaft als Suche nach einer Entlohnungsfunktion des Prinzipalen fUr den Agenten formuliert. Die Lösung in Form der optimalen Entlohnungsfunktion muß dabei sowohl ein geeignetes Anreizsystem fUr den Agenten enthalten als auch wegen der Zufallsabhängigkeit des Ergebnisses die Verteilung des Risikos auf beide Vertragspartner regeln. Die Vertreter des Ansatzes gelangen dabei zu recht komplizierten Entlohnungsformen, die im Gegensatz zu den oft vereinfachten Lösungen der wirtschaftlichen Praxis stehen. 84 Daran wird bereits deutlich, daß der Ansatz die zum Teil beträchtlichen Transaktionskosten unterschätzt, die bei den Verhandlungen über komplizierte vertragliche Regelungen entstehen können. Darüber hinaus wird kritisiert, daß die Principal-Agent-Theorie ursprünglich nur vollständige Verträge untersuchte, in denen alle Sachverhalte ex ante geklärt werden können und deshalb nach Vertragsabschluß keine weiteren Kosten anfal82 Vgl. ELSCHEN, R., 1991, S. 1006, oder FISCHER, M., 1995, S. 320. 83 Vgl. z. B. SCHUMANN, 1., 1992, S. 456-458. 84 Vgl. ARRow, K. J., The Economics of Agency, in: PRATI, 1. W., und ZECKHAUSER, R.1. (Hrsg.), PrincipaJs and Agenis: The Structure of Business, Boston 1985, S. 48 f., und SCHUMANN, J., 1992, S. 457.
3. Neue InstitutionenlJkonomik
363
len. Damit wurde von der Notwendigkeit nachträglicher Anpassungen abgesehen und implizit ein kostenloses Schieds- und Rechtssystem unterstellt. Dieser Vernachlässigung ganzer Kategorien von Transaktionskosten ist es wohl zuzuschreiben, daß dem Principal-Agent-Ansatz innerhalb der Neuen Institutionenökonomik nur ein begrenzter Aussagewert zugestanden wird. Eine größere Bedeutung hat eine Weiterentwicklung der Vertragstheorie im Rahmen des Transaktionskostenansatzes erlangt, die auf Williamson zurückgeht. Dieses Konzept der relationalen oder unvollständigen Verträge setzt direkt an der Kritik des Principal-Agent-Ansatzes an. 8S Der neuen Betrachtung liegt die Unterscheidung zwischen vollständigen ("klassischen") Verträgen und unvollständigen bzw. relationalen Verträgen zugrunde. Die neoklassische Wirtschaftstheorie behandelt gemäß ihrer Annahme einer Welt ohne Transaktionskosten nur vollständige Verträge. Diese klassischen vertraglichen Regelungen, die auch im Principal-Agent-Ansatz im Vordergrund stehen, sind aber in einer Wirklichkeit, die durch Transaktionskosten, beschränkte Rationalität und Unsicherheit geprägt ist, nur ausnahmsweise anwendbar. In den Mittelpunkt der institutionenökonomischen Betrachtung gerät aus diesem Grund die zweite Gruppe von Vereinbarungen. Das Konzept unvollständiger Verträge basiert auf der Erkenntnis, daß in einer komplexen Umwelt Unsicherheit zwar mittels komplizierter Vertragsbedingungen reduziert werden kann, dies jedoch zu einem Anstieg der Transaktionskosten filhren muß.86 Allein schon aus diesen Kostenüberlegungen heraus kann erklärt werden, daß die Wirtschaftssubjekte häufig unvollständige den vollständigen Verträgen vorziehen. Bewußt wird auf eine Regelung sämtlicher zukünftiger Eventualitäten im Vertrag verzichtet und statt dessen auf festgelegte Verfahren einer nachträglichen Vertragsanpassung (Neuverhandlung, Sanktionen, Schiedsverfahren, Gerichte) vertraut. Zu den in der neoklassischen Analyse ausschließlich und auch im Principal-Agent-Ansatz vornehmlich berücksichtigten Kosten, die bis zum Vertragsabschluß anfallen (Ex-ante-Transaktionskosten in der Terminologie des Transaktionskostenansat85 Vgl. hierzu z. B. RICHTER, R., 1990, S. 582-586.
86 Vgl. BONUS, H., und WEILAND, R., 1992, S. 340. 25 Mitropoulos
364
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer Ansätze
zes) treten hier die später anfallenden Kosten der Kontrolle, Durchsetzung und Änderung des Vertrages (Ex-post-Transaktionskosten). In seiner Vertragstheorie gelingt es Williamson, eine ökonomische Erklärung für die institutionelle Vielfalt der vertraglichen Beziehungen zu geben. 87 Auf den verschiedenen Eigenschaften ("Dimensionen") der zu regelnden Transaktionen aufbauend, entwikkelt er eine Systematik der Vertragsformen vom klassischen Vertrag bis hin zum unvollständigen Vertrag. Je nach Ausprägung der Dimensionen von Transaktionen - untersucht werden Häufigkeit, Unsicherheit und spezifische Investitionen - stellen jeweils unterschiedliche Vertragsformen die effiziente Lösung im Sinne einer Minimierung der Transaktionskosten dar. Diese breiter angelegte Vertragstheorie eignet sich besser als der Principal-Agent-Ansatz zur Analyse des verbraucherpolitisch relevanten opportunistischen Verhaltens bei asymmetrischer Information, da dieses Problem kaum allein durch die vertragliche Schaffung finanzieller Anreize für den Agenten zu bewältigen ist. 88 Insbesondere die zusätzliche Berücksichtigung der Häufigkeit von Transaktionen und der Unsicherheit als Determinanten der Vertragsgestaltung ermöglicht es, neben rechtlichen Maßnahmen auch private Vorkehrungen zur Abwehr opportunistischen Verhaltens zu erklären. Bei der Sicherung einer guten Vertragsausfilhrung spielen geschäftliche Dauerverbindungen eine wichtige Rolle. Den Vertragspartnem steht dabei eine Reihe von Institutionen zur Verfilgung, mit denen sie versuchen können, ihre Versprechen glaubhaft zu machen. Dazu zählen beispielsweise Reputation, Garantien und Markennamen. Hier befmden wir uns wieder inmitten der "Signaling"-Diskussion der Informationsökonomik. 3.5 Kritische Beurteilung der Neuen Institutionenäkonomik aus verbraucherpolitischer Sicht
Die Neue Institutionenökonomik, bestehend aus den drei vorgestellten Teilbereichen, kann insgesamt als sinnvolle Weiterent87 Vgl. WILLIAMSON, O. E., 1990, S. 59-91. 88 Vgl. RICHTER, R., 1992, S. 20 f., und SCHUMANN, J., 1992, S. 439.
3. Neue Institutionenäkonomik
365
wicklung der traditionellen Neoklassik angesehen werden. Die Analyse von Institutionen in einer Volkswirtschaft und die Beachtung damit zwangsläufig verbundener Transaktionskosten sind gegenüber den realitätsfernen Annahmen der rein neoklassischen Theorie in jedem Fall als Fortschritt zu bewerten. Darüber können auch beispielsweise der Mangel einer einheitlichen Defmition, die Probleme einer Quantifizierung sowie der Abgrenzung des zentralen Begriffs der Transaktionskosten nicht hinwegtäuschen. 89 Zudem distanzieren sich viele Beiträge der Neuen Institutionenökonomik vom strengen Optimierungsdenken und der Orientierung an theoretischen Idealzuständen, indem sie sich auf den institutionellen Vergleich realisierbarer oder realisierter Alternativen konzentrieren. 9o Da die Neue Institutionenökonomik die Ausgestaltung des institutionellen Rahmens in den Vordergrund ihrer Betrachtung stellt, bietet sie sich - wie oben bereits angedeutet wurde - zur theoretischen Fundierung einer Ordnungspolitik an. Ob sie diese Rolle in einem fortgeschrittenerem Entwicklungsstadium tatsächlich erfolgreich auszuftUlen vermag, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch offen. Ribhegge91 betont zwar, daß diese Forschungsrichtung über "ein umfassendes Instrumentarium zur Analyse wichtiger ordnungspolitischer Fragen" verftlgt und entscheidend "mit zur Überwindung des alten Dualismus: Markt versus Hierarchie" beigetragen hat. 92 Um einen bedeutsamen Beitrag nicht nur zur Ordnungstheorie, sondern in gleicher Weise rur die wissenschaftliche Verbraucherpolitik zu leisten, muß sich die Neue Institutionenökonomik allerdings von ihrer rein einzelwirtschaftlichen Sicht lösen. 93 Die Verfolgung einzelwirtschaftlicher Effizienz als alleinige oder dominierende Zielsetzung ist rur wirtschaftspolitische Fragestellungen 89 Vgl. SEWERlN, U., 1993, S. 27 f., S. 38-44 und S. 57-60. 90 Vgl. ebenda, S. 36, und RtBHEGGE, H., 1991, S. 41. 91 Vgl. zu dieser Fragestellung im folgenden: RtBHEGGE, H., 1991. 92
Ebenda, S. 39 und S. 40.
Vgl. RtBHEGGE, H., 1991, S. 39, der von einer "Mikro-Mikro-Perspektive" spricht. 93
25*
366
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer Ansätze
unzureichend, da sie Situationen zuläßt, in denen sich die unmittelbar Beteiligten auf Kosten Dritter einigen. Zudem ist die Höhe der Transaktionskosten als Effizienzkriterium dort fraglich, wo sie ordnungspolitisch erwünscht sind oder sogar bewußt geschaffen werden, um z. B. innerhalb des Verbraucherschutzes gesellschaftlich unerwünschte Verträge zu verhindem. 94 Die einseitige Orientierung am Effizienzkriterium läßt die Neue Institutionenökonomik andere wichtige gesellschaftliche Ziele vemachlässigen. 9s So ist anzunehmen, daß neben der Transaktionskostenhöhe auch die Verteilungsinteressen und Machtpositionen der politischen Interessengruppen die institutionellen Strukturen entscheidend mitbestimmen. Dies gilt in besonderem Maße fUr die Verbraucherpolitik, die durch das Aufeinandertreffen zweier unterschiedlich einflußreicher Gruppen, der Konsumenten und der Anbieter, gekennzeichnet ist. Daraus kann die Forderung abgeleitet werden, in der institutionellen Analyse außer rein allokativen auch verstärkt distributiven Aspekten Rechnung zu tragen. Bei der Darstellung der einzelnen Elemente der Neuen Institutionenökonomik - nämlich der Analyse von Transaktionskosten, Property Rights und von Verträgen - wurden immer wieder Verbindungslinien zur Informationsökonomik sichtbar. Speziell auf das Gebiet der Verbraucherpolitik bezogen, konnte die Neue Institutionenökonomik nur wenige grundsätzlich neue Ansatzpunkte liefern, die nicht schon von informationsökonomischen Arbeiten aufgegriffen worden sind. Die Informationsökonomik wurde bisher in stärkerem Maße für die Verbraucherpolitik ausgewertet und konnte dabei wichtige Impulse geben, während die institutionenökonomischen Bemühungen in diesem Bereich - dem insgesamt frühen Entwicklungsstadium des Ansatzes entsprechend noch sehr bescheiden sind.
94 Vgl. ebenda, S. 46. 9S Vgl. hierzu ebenda, S. 49-51, und besonders GROSSNER, 1., Der Transaktionskostenansatz der Neuen Institutionenökonomik. Versuch einer kritischen Verallgemeinerung, in: SEIFERT, E. K., und PRIDDAT, B. P. (Hrsg.), Neuorientierungen in der ökonomischen Theorie. Zur moralischen, institutionellen und evoIutorischen Dimension des Wirtschaftens, Marburg 1995, S. 253-261.
4. Evolutionsäkonomik
367
Deshalb ist es besonders für die Verbraucherpolitik bedauerlich, daß der enge Zusammenhang zwischen beiden Forschungsrichtungen in der Wissenschaft erst geringe Beachtung gefunden hat. 96 Anstelle eigenständiger institutionenökonomischer Bestrebungen erscheint deshalb ftlr die Zwecke des Verbraucherschutzes eine Integration und gemeinsame Weiterentwicklung beider Ansätze erfolgversprechender. Daftlr spricht nicht nur die konstatierte Schnittmenge im Untersuchungsgegenstand der zwei Ansätze, sondern auch eine vergleichbare Kritik an der angeblich eingeschränkten Leistungsfähigkeit beider Forschungsrichtungen. Wie der Informationsökonomik97 , so wird auch der Neuen Institutionenökonomik vereinzelt vorgeworfen, daß sie sich nicht deutlich genug von der neoklassischen Tradition löst. 98 Dies leitet zum Gegenentwurf der Evolutionsökonomen über.
4. Evolutionsökonomik 4.1 Einordnung des Ansatzes
Mit der Evolutionsökonomik wird eine weitere Forschungsrichtung, die noch auf einer relativ niedrigen Entwicklungsstufe steht99, auf ihre verbraucherpolitische Bedeutung hin überprüft. Trotz längerer Tradition erst seit wenigen Jahren verstärkt in das Blickfeld der Wirtschaftswissenschaften gelangt, kann allerdings noch nicht von einem einheitlichen Ansatz oder einer geschlossenen Theorie gesprochen werden. 100 Die Ursprünge der Evolutionsökonomik werden oft auf Schumpeters Theorie der wirtschaft-
96 Vgl. GÄFGEN, G., 1984, S. 47, und BOSSMANN, E., Volkswirtschaftliche Probleme der Transaktionskosten, in: ZgS, Jg. 138 (1982), S. 666 f. 97 Vgl. die AusfUhrungen im vorherigen Abschnitt, sowie WESSLING, E., 1991, S. 94-108, und SCHUMACHER, A., 1994, S. 72-90.
98 Vgl. z. B. KIWlT, D., 1994, S. 134. 99 Vgl. SCHUMACHER, A., 1994, S. 91, sowie BIERVERT, B., und HELD, M., Das Evolutorische in der Ökonomik: Neuerungen - Normen - Institutionen. Eine EinfUhrung, in: dies. (Hrsg.), Evolutorische Ökonomik. Neuerungen, Normen, Institutionen, Frankfurt 1992, S. 8. 100 Vgl.
auch WESSLING, E., 1991, S. 125.
368
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer Anstitze
lichen Entwicklung zurUckgefUhrt, eine evolutionsökonomische Sichtweise ist aber bereits in noch älteren Arbeiten erkennbar. 101 Als wichtige Gemeinsamkeit der noch recht unterschiedlichen Strömungen dieser Forschungsrichtung kann - dem Begriff Evolution entsprechend - eine auf (ökonomische) Veränderungen und Entwicklungen gerichtete Perspektive genannt werden. 102 Dabei wird Evolution im Sinne eines andauernden, allmählich fortschreitenden Wandels verstanden. Ein zweites, vermutlich noch wichtigeres gemeinsames Element evolutionsökonomischer Arbeiten - denn erst darin liegt der entscheidende Unterschied zur neoklassischen Analyse - ist die Annahme, "daß wesentliche Veränderungen und Entwicklungen in der Wirtschaft endogen verursacht werden und damit auch endogen zu erklären sind."103 Als bedeutendste Entwicklungslinien lassen sich in der evolutorischen Ökonomik gegenwärtig zum einen die Österreichische Schule, zum anderen verschiedene Ansätze, die sich stärker an der biologischen Evolutionstheorie orientieren, identifizieren. 104 Die folgenden Ausftlhrungen konzentrieren sich auf die Österreichische Schule (vor allem vertreten durch von Hayek, Mises und Kirzner), zu deren inhaltlichen Schwerpunkten die Erfassung von Information und Wissen gehört. Diese Beschäftigung mit individuellen Informationsmängeln und ihrer Beseitigung stellt - in ähnlicher Weise wie die beiden zuvor untersuchten Forschungsrichtungen - einen Bezug zur verbraucherpolitischen Grundproblematik her. Deshalb bietet sich ein unmittelbarer Vergleich von Informationsökonomik (teilweise auch der Neuen Institutionenökonomik) und Evolutionsökonomik an, der aufzeigt, wie unterschiedlich sich diese Ansätze der Informationsproblematik annehmen. Darauf aufbauend, erfolgt dann die Darstellung und kritische Be101 VgI. SCHUMPETER, J., Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, 7. Aufl., Berlin 1987 [deutsche Erstausgabe 1911]; zu den älteren Arbeiten vgI. SCHUMACHER, A., 1994, S. 93 f. 102 VgI. SCHUMACHER, A., 1994, S. 103. 103 SCHUMACHER, A., 1994, S. 102. 104 Vgl. zu den verschiedenen Strömungen: cbcnda, S. 92·99, insbesondere das Überblickschema S. 95.
4. Evolutions6konomik
369
urteilung der Evolutionsökonomik aus verbraucherpolitischer Sicht. In diesem Kapitel soll nochmals das prozessuale und evolutorische Marktverständnis der Österreichischen Schule aufgegriffen werden, das bereits im Rahmen der verbraucherpolitischen Konzeption von Mähling angesprochen wurde. 105 Die wichtigsten Merkmale dieser Konzeption waren die Betonung der Zielsetzung wirtschaftlicher Freiheit sowie die "Wettbewerbs- und Konsumfreiheit" als daraus abgeleitetes gemeinsames Leitbild fUr die Wettbewerbs- und Verbraucherpolitik. In diesem Kapitel soll nun die Evolutionsökonomik als eigenständige Forschungsrichtung untersucht werden, auch wenn damit Wiederholungen gegenüber der speziellen Berücksichtigung dieser Vorstellungen in der Konzeption der Wettbewerbs- und Konsumfreiheit verbunden sind.
Wie bereits dargelegt wurde, kann die Evolutionsökonomik oder zumindest ein Teil ihrer Forschungsaktivitäten einer Institutionenökonomik im weiteren Sinne zugeordnet werden, und dies in zweifacher Hinsicht. Zum einen beeinflussen Institutionen (rechtliche Regelungen, Property Rights) die als evolutorisch verstandenen Marktprozesse und damit auch die wirtschaftliche Entwicklung. Zum anderen sind die Institutionen selbst Gegenstand eines evolutorischen Geschehens, so daß auch ihre Entstehung durch das Prinzip der "unsichtbaren Hand" erklärt werden kann, und damit einen wichtigen Ansatzpunkt rur die evolutorische Ökonomik darstellt. 106 Beide Aspekte sind wegen der Interdependenz von institutionellem Rahmen, Marktprozeß und wirtschaftlichem Ergebnis kaum voneinander zu trennen. "Kennzeichen evolutorischer Systeme ist die wechselseitige Kausalität und Rückkopplung aller in die Evolution einbezogenen Größen mit der Folge hoher Komplexität der Kausalbeziehungen und weitgehender Indeterminiertheit der Entwicklung. Institutionelle Rahmenbedingungen sind damit nicht länger exogen."107 lOS Vgl. Teil B, Kap. 3.4.1, S. 75-84.
106 Vgl. BIERVERT, B., und HELD, M., 1992, S. 13 f. 107 GEISSLER, B., Produkthaftung. Eine ökonomische Analyse unter BerUck-
sichtigung wohlfahrtstheoretischer, wettbewerblicher und evolutorischer Aspekte, Wünburg 1993, S. 113.
370
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer Ansätze
4.2 Gegenüberstellung von Informations- und Evolutionsökonomik
Die Entstehung der Evolutionsökonomik erklärt sich nicht zuletzt aus der Kritik am neoklassischen Paradigma der Wirtschaftstheorie. Die evolutorische Ökonomik läßt sich deshalb vorzüglich durch ihre Auseinandersetzung mit konkurrierenden Forschungsrichtungen charakterisieren, die einen vergleichbaren Untersuchungsgegenstand aufweisen. Aus diesem Grund erfolgt eine kurze Gegenüberstellung von Evolutionsökonomik und der bereits in dieser Arbeit gewürdigten, neoklassisch geprägten Inforrnationsökonomik. I08 Wegen der oben aufgezeigten Parallelen zwischen Inforrnationsökonomik und Neuer Institutionenökonomik gelten die folgenden Ausführungen zum großen Teil auch für diese, insbesondere für den Transaktionskostenansatz. Die Inforrnationsökonomik ist von ihrem neoklassischen Ansatz her gleichgewichtsorientiert. Indern sie die Inforrnationsaufnahrne im Sinne einer Veränderung von Wissen berücksichtigt, weist sie zwar gegenüber der strengen Neoklassik durchaus dynamische Aspekte auf. Letztlich wird aber ein weitgehend statischer, d. h. auf einen (Gleichgewichts-)Zustand abgestellter Wettbewerbsbegriff verwendet. Demgegenüber konzentriert sich die Evolutionsökonomik als Marktprozeßtheorie auf die Erklärung, wie der Weg zum Gleichgewicht erreicht wird, und stellt dabei den dynamischen Charakter wettbewerblicher Vorgänge in den Vordergrund. Während die Inforrnationsökonomik partialanalytisch vorgeht, betont die Evolutionsökonomik die vielseitigen Interdependenzen im wirtschaftlichen Geschehen und gelangt dadurch zu einer übergeordneten Betrachtungsweise, die sogar über den rein ökonomischen Bereich hinausgeht. Die Inforrnationsökonomik stellt eine Weiterentwicklung der neoklassischen Mikroökonomie dar und ist durch die Berücksichtigung einzelner Inforrnationsmängel sozusagen eine Wohlfahrtstheorie auf (etwas) realistischerer Grundlage. Referenzrnodell bleibt aber die vollkommene Konkurrenz, von der lediglich durch 108 Die Ausfilhrungen orientieren sich dabei vor allem an KUNZ, H., Marktsystem und Information. "Konstitutionelle Unwissenheit" als Quelle von "Ordnung", TUbingen 1985. Vgl. auch GEISSLER, S., 1993, S.83-142, SCHUMACHER, A., 1994, und WESSLING, E., S. 83-108 und S. 125-139.
4. Evolutionsökonomik
371
die Annahme unvollständiger Infonnation Abstriche gemacht werden. 109 In eine große Anzahl verschiedenartiger Partialmodelle werden einzelne Infonnationslücken eingebaut und deren Auswirkungen mit den Methoden der Allokationstheorie analysiert. Die Infonnationsökonomik kann damit zwar den Sachverhalt der asymmetrischen Infonnation untersuchen, sieht sich aber mit der grundsätzlichen Schwierigkeit konfrontiert, ungleichgewichtige Phänomene mit einem gleichgewichtstheoretischen Instrumentarium analysieren zu wollen. llo Die Österreich ische Schule löst sich vom Referenzsystem der vollkommenen Konkurrenz und sieht gerade in Abweichungen von diesem Zustand die Voraussetzungen filr wettbewerbliche Verhältnisse. Dazu zählen das "konstitutionelle Unwissen" der Wirtschaftssubjekte wie auch vorübergehende Machtpositionen einzelner Anbieter aufgrund innovativer Vorstöße, die durch nachstoßenden Wettbewerb wieder abgebaut werden. Kennzeichnend filr die neoklassische Betrachtungsweise ist auch das Optimierungsdenken bzw. die Anwendung des Marginalprinzips. Zur Erreichung ökonomischer Effizienz wird versucht, die Infonnationskosten (bzw. in der Transaktionskostentheorie die Transaktionskosten) zu minimieren. Aus der Sicht der Evolutionsökonomik entspricht ein solches Vorgehen nicht dem Wesen der Marktwirtschaft als eines offenen, sich kontinuierlich fortentwikkelnden Systems. Optimierungskriterien lassen sich dieser Ansicht nach nur in einem geschlossenen System - eben aus der verkürzten Perspektive einer Einzelmarktbetrachtung - anwenden. 111 Entsprechend stellt sich auch das jeweils zugrunde gelegte Menschenbild dar: Während die Infonnationsökonomik dem rational handelnden, nutzenmaximierenden "homo oeconomicus" eng verbunden bleibt, stellt die evolutorische Ökonomik stark auf die kreativen, schöpferischen Fähigkeiten eines Wirtschaftssubjektes ab, das nutzenbzw. gewinnsuchend ein gesetztes Anspruchsniveau zu befriedigen versucht. 112 109 Vgl. z. B. SCHUMACHER, A., 1994, S. 72. 110 Vgl. KUNZ, H., 1985, S. 146. 111 Vgl. ebenda, S. 3. 112 Vgl. SCHUMACHER, A., 1994, S. 106 und S. 117f.
372
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer Anstitze
Beide Ansätze behandeln unvollständige Infonnation und die Mechanismen wettbewerblicher Selbststeuerung zu ihrer Beseitigung, allerdings aus einer unterschiedlichen Sichtweise und Methodik. Auch wenn man der Kritik von seiten der Evolutionsökonomik vor allem an den realitätsfemen Annahmen der Infonnationsökonomik folgt, so bleibt es doch deren Verdienst, frühzeitig auf die Bedeutung von Signaling und Screening aufmerksam gemacht und damit zum besseren Verständnis der rur den Verbraucherschutz grundlegenden Problematik beigetragen zu haben. Aufgrund der neoklassischen Vorgehensweise ist jedoch die Erklärungsfllhigkeit der Infonnationsökonomik begrenzt. Darüber können auch immer kompliziertere modelltheoretisch-fonnale Analysen nicht hinwegtäuschen, deren Aufwand schon längst nicht mehr in einem vertretbaren Verhältnis zu ihrem Ertrag zu stehen scheint. Kunz als Vertreter des Evolutionsansatzes lehnt die Infonnationsökonomik ab, hält aber die gleichgewichtsorientierte Betrachtung nicht generell rur überflüssig - womit er allerdings auf die allgemeine Gleichgewichtstheorie (volkswirtschaftliche Totalanalyse) abstellt. 1I3 Seiner Ansicht nach schließen sich zwar Gleichgewichtsanalyse und Evolutionsökonomik aus, sie sind aber trotzdem beide erforderlich. Die Gleichgewichtskonzepte eignen sich zumindest als methodisches Hilfsmittel, indem sie ein Maß ftlr die Abweichungen vom Gleichgewicht bieten. Darüber hinaus sind sie ftlr Analysen in Gleichgewichtsnähe unverzichtbar, z. B. in Bereichen mit niedrigen Infonnationskosten. Diese sind aber aus verbraucherpolitischer Sicht unproblematisch und deshalb wenig interessant. Die Stärke der Evolutionsökonomik wird dagegen in der Analyse der verbraucherpolitisch relevanten Fälle mit unvollständiger Infonnation bzw. asymmetrischer Infonnationsverteilung (also in Gleichgewichtsfeme) gesehen. Die einzelnen Kritikpunkte an der Infonnationsökonomik werden in dieser Arbeit zwar weitgehend geteilt, nicht jedoch die strikte Ablehnung der infonnationsökonomischen Ergebnisse schlechthin. Die Infonnationsökonomik stellt trotz ihrer Schwächen einen wichtigen Schritt zu einer besseren theoretischen Fundierung der Verbraucherpolitik dar, und wer sie - wie die Evoluti113 Vgl. hierzu KUNZ, H., 1985, S. 178 f. und S. 68.
4. Evolutionsökonomik
373
onsökonomen, speziell die Vertreter der Österreichischen Schule in ihrer Gesamtheit in Frage stellt, sollte gleichzeitig den Nachweis erbringen, daß andere wirtschaftswissenschaftliche Ansätze über eine höhere Leistungsflihigkeit verftlgen. Die folgenden Ausfilhrungen untersuchen deshalb, welchen Beitrag die Evolutionsökonomik in diesem Sinne zu leisten vermag.
4.3 Evolutionsökonomische Beiträge zur Verbraucherpolitik Die Informationsökonomik geht von einem festen Bestand an Regeln aus und behandelt damit den institutionellen Rahmen als Datum. In der Neuen Institutionenökonomik rückt die institutionelle Ausgestaltung einer Marktwirtschaft zwar in den Mittelpunkt der Betrachtung, aber erst speziell die Evolutionsökonomik ist bemüht, den Prozeß der Bildung von Institutionen in die Analyse des Marktgeschehens einzubeziehen. Damit scheint sich die Evolutionsökonomik besonders zur Erklärung der Entwicklung jener verbraucherpolitisch relevanten Institutionen zu eignen, deren Bedeutung schon von der Informationsökonomik zutreffend erkannt wurde. Deshalb ist im folgenden der Frage nachzugehen, wie aus evolutorischer Sicht der Prozeß der Ausbildung dieser Institutionen beschrieben wird. Ausgangspunkt der evolutionsökonomischen Betrachtung ist die "konstitutionelle Unwissenheit" aller Beteiligten, die einen ungleichgewichtigen Zustand schafft, in dem (zu) hohe Informationsund sonstige Transaktionskosten anfallen. 114 In dieser Situation sind Prozesse einer marktlichen Selbstorganisation zu erwarten, die informations- und transaktionskostensparende Institutionen hervorbringen und damit Unsicherheit vermindern. Am Beginn des evolutionären Prozesses steht die Innovation bzw. nach der Terminologie der biologischen Evolutionsforschung die Mutation. 115 Der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren bringt demnach vielgestaltige Innovationsformen hervor, neben der Entwicklung neuer Produkte oder Herstellungsverfahren eben auch neuartige Institutionen zur Einsparung von Transaktionskosten wie z. B. Si114 Vgl. 115
zum folgenden zusammenfassend ebenda, S. 149 f.
Vgl. zu den Phasen des Evolutionsprozesses z. B. GE1SSLER, B., 1993,
S. 113 f.
374
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer Anstitze
cherheitsstandards oder Garantien. Diese Innovationen können dabei als Folge des rein egoistischen, eigennützigen Verhaltens von Individuen angesehen werden. Der Evolutionsprozeß wird eingeleitet, weil sich einzelne Wirtschaftssubjekte von einer "Investition" z. B. in kostensparende Normen Gewinne versprechen. Der kreative, fmdige Unternehmertyp, der Signaling betreibt und Nachfragern Möglichkeiten des Screening anbietet, wird damit zur Schlüsselfigur des wettbewerblichen Geschehens. Von der Evolutionsökonomik bislang wenig beachtet, jedoch für die Verbraucherpolitik von Bedeutung, ist die Tatsache, daß entsprechend innovative Individuen auch auf der Nachfragerseite zu fmden sind. 116 Allerdings kann und darf nicht davon ausgegangen werden, daß die Mehrzahl der Konsumenten sich in dieser Weise verhält und z. B. neuartige Bedürfnisse an Informationen oder Produkten gegenüber den Anbietern artikuliert. Der weitere Ablauf des Evolutionsprozesses besteht nach Ansicht der Vertreter dieses Ansatzes darin, daß die besseren Innovationen von einzelnen Wirtschaftssubjekten ausgewählt werden (Selektion) und sich durch verstärkte Nachahmung (Imitation) schließlich durchsetzen. Mit diesem Schema kann die Herausbildung von Marktsignalen zur Bewältigung von Qualitätsunsicherheit, aber auch die spontane Entstehung von Informationsmärkten (z. B. Testzeitschriften, Beratungsangebote, Makler) erklärt werden. Durch die "unsichtbare Hand" des Wettbewerbs dient so letztlich das eigennützige Handeln des innovativen Unternehmers gleichsam den Interessen der Allgemeinheit. Die neu entstandenen Institutionen steigern die Eigenkomplexität des Marktsystems und stellen es auf eine höhere Entwicklungsstufe. Erkenntnisse der Evolutionsforschung wurden bereits nutzbringend auch fUr den Bereich des Verbraucherschutzes verwendet. Hierzu muß in erster Linie nochmals auf die verbraucherpolitische Konzeption von Mähling verwiesen werden. Außerdem können im folgenden zwei weitere konkrete Anwendungen des Ansatzes in
116 Vgl. ARNDT, H., Lehrbuch der Wirtschaftsentwicklung. Die Evolutorische Wirtschaftstheorie in ihrer Bedeutung rur die Wirtschafts- und Finanzpolitik, 2. Aufl., Berlin 1994, S. 30 f.
4. Evolutions6konomik
375
Veröffentlichungen aus jüngerer Zeit vorgestellt werden, die der Verbraucherpolitik zuzurechnen sind. Lohmann zeigt in seiner Arbeit am Beispiel des AGB-Gesetzes auf, wie rechtliche Regulierung im Bereich des Verbraucherschutzes entstanden sein könnte. 1I7 Dabei vermutet er, daß diese Regelung nicht das Ergebnis eines rationalen Kalküls aller Beteiligten z. B. zur Minimierung von Transaktionskosten - "darstellt, sondern im Verlauf einer Kette menschlicher Handlungen (also evolutorisch) entstanden ist" 118. Ausgangspunkt der Betrachtung ist das Konzept der spontanen Bildung von Regeln, wie es vor allem von Hayek entwickelt wurde.1\9 Grundgedanke dieser Theorie der Regelentstehung ist, daß ökonomisch vorteilhafte Problemlösungen - so die Einhaltung von Regeln in einer Gruppe von Individuen, die deren Situation verbessert - nachgeahmt werden und sich deshalb im Verlauf der kulturellen Evolution durchsetzen. Lohmann sieht nun eine mögliche Ursache rur die Entstehung speziell verbraucherschutzrechtlicher Regelungen in Erwartungsenttäuschungen von Wirtschaftssubjekten bei vertraglichen Bindungen. Sehen sich Individuen mit einer vermeintlichen Regelverletzung konfrontiert, verfUgen sie über mehrere Handlungsoptionen. 120 Neben dem Abbruch der Tauschbeziehungen und/oder einer zukünftig besseren Vorsorge (z. B. in Form von Screening oder Signaling) können beide Vertragsparteien versuchen, auf dem Verhandlungsweg zu einer Lösung zu gelangen. Gelingt auch dies nicht, werden sich die Beteiligten möglicherweise auf eine Schlichtung durch unabhängige Dritte einigen. Daraus bildet sich 117 Vgl. LOHMANN, H., 1992, S. 124-160. 118 Ebenda, S. 14l.
1\9 Vgl. ebenda, S. 124-140, bes. S. 125 f., sowie beispielsweise HAYEK, F. A. von, Bemerkungen Ober die Entstehung von Systemen von Verhaltensregeln, in: ders., Freiburger Studien, TObingen 1969, S. 144-160 und LESCHKE, M., Ökonomische Verfassungstheorie und Demokratie: das Forschungsprogramm der Constitutional Economics und seine Anwendung auf die Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1993 [zugl. Diss. Univ. MOnster 1992], S. 31-52. 120 Vgl. LOHMANN, H., 1992, S. 147-151.
376
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer Ans/Uze
spontan die Position des Richters, der Einzelfälle prüft und dabei bestimmte Verhaltensweisen als nicht norm gerecht sanktioniert. Die weitere Rechtsentwicklung kann darin bestehen, daß diese heterogene Rechtsprechung (Richterrecht) kodifiziert, d. h. durch einen konsistenten rechtlichen Rahmen ersetzt wird. 121 Diese Entwicklung hin zu staatlicher Regulierung ist aber ft1r die Vertreter dieses Ansatzes keineswegs selbstverständlich. Ebenso vorstellbar ist rur sie ein Wettbewerb der Anbieter eines Marktes um die beste Lösung. So wünschenswert es aus evolutionsökonomischer Sicht auch erscheinen mag, unterschiedliche Regelungen - bzw. auf supranationaler Ebene, wie in der Europäischen Union, voneinander abweichendes nationales Recht - "parallel evolvieren zu lassen, um durch den Wettbewerb der Systeme Mutationen und vor allem Selektion ... zu gewährleisten"122: In der politischen Praxis wird gewöhnlich eine staatliche Regulierung (bzw. in der Europäischen Union die Harmonisierung "von oben") bevorzugt. Wichtige Gründe, weshalb es nicht zu einem solchen Wettbewerb um Regeln kommt, sind nicht zuletzt im wirtschaftspolitischen Entscheidungsprozeß zu suchen. Dazu muß auch die Evolutionsökonomik auf das Instrumentarium der politischen Ökonomie zurllckgreifen. 123 Geißler untersucht speziell die Produkthaftung aus der wohlfahrtstheoretischen Sicht der "Ökonomischen Analyse des Rechts" und stellt sie der evolutorischen Sicht gegenüber. Dabei erfordert die evolutionsökonomische Betrachtung 124 eine umfassendere Analyse und filhrt nicht zu eindeutigen Ergebnissen in Form der Ableitung einer optimalen Haftungsregel. So ist bei den Haftungsregeln beispielsweise nicht mehr von einem gegebenen Informationsstand der Beteiligten auszugehen, sondern der Wissenserwerb ist in die Überlegungen selbst einzubeziehen. Besondere Beachtung wird den Anreizen rur beide Seiten geschenkt, selbst innova121 Vgl. ebenda, S. 139 und S. 151. 122 GEISSLER, B., 1993, S. 139. 123 Vgl. LOHMANN, H., 1992, S. 170; zu den politisch-ökonomischen Ansätzen vgl. das folgende Kap. 5. 124 Vgl. GEISSLER, B., 1993, vor allem S. 109-142.
4. Ellolutionsökonomik
377
tive Möglichkeiten zur Unfallverhütung bzw. zur Minderung des Schadensrisikos zu entwickeln. Als Ergebnis der Betrachtung werden unter anderem Anforderungen an eine geeignete Haftungsregel formuliert. 12S Dazu zählt die Gewährleistung der Vertragsfreiheit und die möglichst geringe Beeinträchtigung des Wettbewerbsprozesses.
4.4 Kritische Beurteilung der Evolutionsökonomik aus verbraucherpolitischer Sicht Indem die Evolutionsökonomik die Unvollkommenheiten des Marktes nicht von vornherein als mögliche Ursache von Wettbewerbsversagen ansieht, sondern gerade die Unwissenheit als Ursache spontaner Ordnung begreift, liefert sie eine gegenüber den Versuchen der Informationsökonomik weiterführende Erklärung von Signaling und Screening. Damit gelangt diese Forschungsrichtung zu einer sehr viel positiveren Einschätzung der Selbstheilungskräfte des Marktes. In ihrem übertriebenen "Evolutionsoptimismus" übersehen allerdings Vertreter der Österreichischen Schule dabei nur allzu leicht, daß Fehlentwicklungen auch aus dem Markt selbst heraus entstehen können, d. h. die Evolution durchaus in die falsche Richtung gehen kann. Diese Tatsache wird von der Evolutionsökonomik zwar nicht geleugnet, sie wird aber vor allem auf ungeeignete staatliche Eingriffe zuTÜckgefUhrt. Insgesamt bleiben die AusfUhrungen über evolutorische Prozesse in der Literatur meistens sehr abstrakt, so daß die Grenzen der marktwirtschaftlichen Selbststeuerung nicht deutlich genug herausgestellt werden und die Diskussion des verbleibenden staatlichen Regelungsbedarfs vernachlässigt wird. 126 Nur wenige Regeln sind in der Lage, sich allein durch Gebrauch zu verfestigen und damit selbst zu sichern. Viele Institutionen sind überwachungsbedürf!ig und erfordern einen dauerhaften Erhaltungsaufwand, um Rückschritte in der Evolution zu vermeiden. 127 l2S Vgl. ebenda, S. 152. 126 Vgl. BARTLlNG, H., National unterschiedliche Produktstandards und Pro-
dukthaftungen unter außenwirtschaftlichem Aspekt, in: Jahrbuch rur Sozialwissenschaft, Jg. 39 (1988), S. 153. 127 Vgl. KUNZ, H., 1985, S. 136.
378
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer Ansätze
Darin zeigt sich, daß es in diesem Ansatz nicht darum geht, in Fonn eines Optimierungskalküls das absolute Minimum an Transaktionskosten zu erreichen, sondern daß ein gewisser Aufwand an Transaktionskosten konstitutiv rur das marktwirtschaftliehe System ist. Dies belegt aber auch, daß zumindest eine staatliche Rahmensetzung unverzichtbar ist. Die Erkenntnis der hohen Komplexität, der Offenheit des marktwirtschaftlichen Systems, das Auftreten wechselseitiger Kausalbeziehungen und die Irreversibilität wirtschaftlicher Prozesse lassen die Vorhersage wirtschaftlicher Ergebnisse aus evolutorischer Sicht kaum möglich erscheinen (lndetenniniertheit).128 Dies erschwert konkrete Handlungsempfehlungen und erklärt die große Skepsis vieler Vertreter des Ansatzes gegenüber jeglicher staatlicher Intervention. Aus evolutorischem Verständnis ist nicht einzusehen, warum ausgerechnet die Träger der Wirtschaftspolitik als externe Beobachter gegenüber den Marktakteuren über bessere Infonnationen bzw. über eine geringere Unwissenheit verfUgen sollen, die ein staatliches Eingreifen rechtfertigen. In diesem Zusammenhang wird nach von Hayek oft von einer "Anmaßung von Wissen" gesprochen. 129 Wenn aber staatliches Eingreifen aus der Sicht der Evolutionsökonomen stets mit der Gefahr negativer Auswirkungen auf den selbststeuernden evolutorischen Marktprozeß verbunden ist, liegt es nahe, gänzlich darauf zu verzichten. Die konsequente Verfolgung dieses Gedankengutes kann deshalb zu einer Ökonomie des "laissez-faire" fUhren, ein Vorwurf, der den Vertretern der Österreichischen Schule nicht zu Unrecht immer wieder gemacht wird. Dies erscheint aber als Leitbild weder durchsetzbar noch wünschenswert. Es kann nicht die geeignete Strategie sein, vor allen Problemen der Realität mit dem Verweis auf eine zu komplexe Umwelt und die Unfähigkeit der Politik von vornherein zu kapitulieren. Trotz recht unterschiedlichem methodischem Vorgehen
128 Vgl. WESSLING, E., 1991, S. 127, und SCHUMACHER, A., 1994, S. 104 f. 129 Vgl. HAVEK, F. A. von, Die Anmaßung von Wissen, in: ORDO, Band 26 (1975), S. 12-21, aber auch z. B. GEISSLER, B., 1993, S. 91 f.
4. Evolutionsökonomik
379
zeigen sich hier im Ergebnis starke Parallelen zwischen der Österreichischen Schule und der Chicago School. 130 "Leider hat sich die evolutorische Ökonomik bisher hauptsächlich auf die Kritik und prinzipielle Ablehnung des neoklassischen Ansatzes beschränkt und weniger konkrete Weiterentwicklungen hervorgebracht."\31 Dies kann nicht zuletzt mit der distanzierten Haltung der Österreichischen Schule gegenüber empirischer Forschung erklärt werden: "Unfortunately, Austrian economics at its present stage of development looks very much like a programme without research. ( ... ), there has so far been no serious attempt to operationalize the ideas in a full-scale empirical research project."132 In der evolutionsökonomischen Literatur zur Informationsproblematik fmden sich aber durchaus Anregungen, in welche Richtung eine Weiterentwicklung des Ansatzes betrieben werden könnte, um die Erklärungsgrenzen der neoklassischen Analyse zu überwinden und die erforderliche Konkretisierung zu leisten: 133 "Auf jeden Fall steht mit verhaltenswissenschaftlichen Ansätzen ein Steinbruch zur Verfllgung, der Bausteine filr eine evolutorische Ökonomik anbietet".J34 Vor allem die individualistischen Grundlagen des Ansatzes - z. B. die Motivationshypothesen, die Annahmen beschränkter Rationalität, der begrenzten Informationsaufnahme, Informationsverarbeitungs- und -speicherungsfähigkeit des Menschen (Subjektivität von Informationen) - greifen auf verhaltenswissenschaftliches Repertoire zurück. Ein wichtiges Verb indungsglied beider Forschungsrichtungen ist die gemeinsame Ein130 Vgl. PAQUE, K.-H., How Far is Vienna from Chicago? An Essay on the Methodology ofTwo Schools ofDogmatic Liberalism, in: Kyklos, Jg. 38 (1985), S.414.
131 GEISSLER, S., 1993, S. 110. 132 PAQUE, K.-H., 1985, S. 426.
133 Vgl. SCHUMACHER, A., 1992, S. 116 und S. 130; WESSLING, E., 1991, S. 136-139, sowie SIERVERT, S., Was ist das Evolutorische, was das Ökonomische an der evolutorischen Ökonomik? in: SIERVERT, S., und HELD, M., (Hrsg.), Evolutorische Ökonomik. Neuerungen, Normen, Institutionen, Frankfurt 1992, S. 221 f. 134 SIERVERT, S., 1992, S. 222. 26 Milropoulos
380
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer Anstitze
sicht in das Erfordernis interdisziplinären Vorgehens, d. h. die Bereitschaft, über den rein ökonomischen Bereich hinauszugehen. In dem Maße, wie sich die Evolutionsökonomik den Vorwurf gefallen lassen muß, keine oder lediglich zu stark vereinfachte, radikale Handlungsempfehlungen fUr die politische Praxis anbieten zu können, ermangelt es der Verhaltenswissenschaft an theoretischem Unterbau. Auch wenn dies von orthodoxen Vertretern der Evolutionsökonomik, besonders der Österreichischen Schule, vermutlich abgelehnt werden würde, ist anzunehmen, daß eine stärkere Zusammenschau evolutorischer Überlegungen und verhaltenswissenschaftlicher Forschung zu fruchtbaren neuen Erkenntnissen fUhrt. Auf welche Weise dies geschehen kann, hat bereits Friedrich W. Mähling in seiner Arbeit aus dem Jahr 1983 gezeigt: er nutzt sowohl den "Informationsverarbeitungsansatz" der Verhaltenswissenschaft als auch den "Koordinationsansatz" der Österreichischen Schule als Orientierungsgrundlage der Verbraucherpolitik, um speziell den Bereich der Werbung zu analysieren. 5. Politisch-ökonomische Ansätze 5.1 Einordnung der politisch-ökonomischen Ansätze
An letzter Stelle innerhalb der Untersuchung neuerer theoretischer Ansätze wird eine Reihe von politisch-ökonomischen Beiträgen behandelt, die gewöhnlich unter Bezeichnungen wie Neue Politische Ökonomie, positive Theorie der Regulierung oder ökonomische Theorie der Politik subsumiert werden. Als schwierig erweist sich die Abgrenzung sowie die Zuordnung einzelner Beiträge vor allem zur Neuen Politischen Ökonomie und zur positiven Theorie der Regulierung. Beide Forschungsrichtungen stehen wegen eines ähnlichen Untersuchungsgegenstandes in einem engen Verhältnis zueinander und werden in der Literatur gelegentlich sogar synonym fUr die gleiche Gruppe von Ansätzen verwendet. Manchmal wird einer der beiden Bereiche dem anderen untergeordnet und auch der Übergang zu den (rein) politikwissenschaftlichen Ansätzen ist fließend. Um der ohnehin kaum zu beantwortenden Frage der genauen Zuordnung aus dem Wege zu gehen, werden die betreffenden Beiträge in dieser Arbeit unter dem Ober-
5. Politisch-ökonomische Ansatze
381
begriff "politisch-ökonomische Ansätze" zusammengefaßt. Die Grundüberlegungen und die Entstehungsgeschichte der Neuen Politischen Ökonomie und der positiven Theorie der Regulierung sollen trotzdem kurz nachgezeichnet werden, da auf diese Weise das Verständnis der politisch-ökonomischen Betrachtungsweise erleichtert und ihre Notwendigkeit verdeutlicht werden kann. Auch die Neue Politische Ökonomie kann als eine Weiterentwicklung der neoklassischen Theorie angesehen werden, wie in den Grundannahmen des methodologischen Individualismus und des unterstellten (beschränkten) Rationalverhaltens aller Beteiligten deutlich wird. Sie gewinnt aber ihre Bedeutung gerade dadurch, daß sie sich von den wirklichkeitsfremden Prämissen der Neoklassik entfernt - im Gegensatz zum Public-Choice-Ansatz aus dem angelsächsischen Sprachraum. Der Ansatz wendet das Instrumentarium der ökonomischen Analyse auf das Gebiet der Politikwissenschaft an, um damit die in der Volkswirtschaftslehre seit langem vorherrschende Beschränkung auf den wirtschaftlichen Bereich zu überwinden. 13S Denn zumindest in der praktizierten Wirtschaftspolitik sind Ökonomie und Politik so eng miteinander verbunden, daß letztlich nur eine gemeinsame Betrachtung erfolgversprechend sein kann. Während die traditionelle Neoklassik ihre Betrachtung einzig auf den Markt als Koordinationsmechanismus begrenzt, erweitert die Neue Politische Ökonomie den Untersuchungsgegenstand auf weitere, nicht-marktliche Mechanismen. Dazu zählen im politischen Raum vor allem Wahlen, Verhandlungen (zwischen Interessengruppen untereinander sowie zwischen diesen und staatlichen Instanzen) und die Abläufe in hierarchisch strukturierten Systemen (Bürokratien). Der Ansatz kann deshalb auch als "Lehre von der Vielfalt der Steuerungsmechanismen"136 charakterisiert werden. In der Terminologie der Systemtheorie ausgedrückt, untersucht die Neue Politische Ökonomie eine modeme Gesellschaft als Gesamtsystem, bestehend aus den wichtigsten Elementen Marktwirtschaft, 135 Vgl. - auch als Überblicksartikel - HERDER-DoRNEICH, P., Neue Politische Ökonomie: Eine kurzgefaßte Hinftlhrung; Rückblick - Anwendung - Ausblick, Baden-Baden 1992, S. 16. 136 Ebenda, S. 46. 26*
382
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer Ansdtze
Verbandswesen und Demokratie (die jeweils wiederum dezentral organisierte Subsysteme darstellen) und ihrer Vernetzung in Form vielseitiger rückkoppelnder Regelkreise. 137 Ausgangspunkt der Entwicklung der Neuen Politischen Ökonomie bildet die ökonomische Theorie der Demokratie, deren Grundgedanken erstmals von J. Schumpeter artikuliert und später vor allem von A. Downs ausgebaut wurden. 138 Als Wegbereiter der Forschungsrichtung im deutschsprachigen Raum ist HerderDomeich anzusehen. 139 Dabei wird versucht, eine Analogie zwischen dem marktwirtschaftlichen System und der Demokratie herzustellen. Der Politiker wird nicht mehr, wie in der klassischen Demokratietheorie unterstellt wurde, als Individuum ohne eigene Ziele angesehen, das nur die Interessen seiner Wähler verfolgt. Er verhält sich in ökonomischer Sichtweise vielmehr ähnlich einem Unternehmer. Anstelle des Gewinnzieles strebt der Politiker die Regierungsverantwortung an, um seinen Nutzen (Macht, Prestige, Einkommen) zu erhöhen. Er bietet dazu auf einem Markt für Wählerstimmen sein politisches Programm (analog: Produkt) an und verhält sich als Stimmenmaximierer (analog: Gewinnmaximierer). Unter restriktiven Annahmen, entsprechend der neoklassischen vollkommenen Konkurrenz, entsteht ein politischer Wettbewerb um die Gunst des Wählers (analog: Nachfrager). In diesem Modell einer Konkurrenzdemokratie verfolgt der Politiker zwar seine eigenen Ziele, er muß aber dazu die Bedürfnisse der Wähler berücksichtigen. Auf diese Weise wird sein Eigennutzstreben durch die "unsichtbare Hand" des Wettbewerbs auf das Gemeinwohl umgelenkt und schließlich das beste Wahlprogramm im Sinne einer optimalen Versorgung mit öffentlichen Gütern erreicht.
137 Vgl. ebenda, S. 17 und S. 20. 138 Vgl. SCHUMPETER, J. A., Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, 4. Aufl., München 1975 [original: Capitalism, Socialism and Democracy, New York 1942], S. 421-460, und DoWNS, A., Ökonomische Theorie der Demokratie, Tübingen 1968 [original: An Economic Theory ofDemocracy, New York 1957]. 139 Vgl. dessen erste Veröffentlichung: HERDER-DoRNEICH, P., Politisches Modell zur Wirtschaftstheorie, Freiburg 1959 [zugl. Diss. Univ. Freiburg 1957; 1. Aufl. unter dem Pseudonym F. O. Harding].
5. Politisch-ökonomische Ansätze
383
Diese einfachen Überlegungen gaben den Anstoß ftlr vielfliltige Verfeinerungen und Modiftkationen der politisch-ökonomischen Betrachtung in Richtung einer größeren Realitätsnähe. Dies filhrte nicht nur zur Weiterentwicklung der ökonomischen Theorie der Demokratie, sondern auch zur Entstehung neuer ökonomischer Theorien im politischen Bereich wie der ökonomischen Theorie der Bürokratie und der ökonomischen Verbandstheorie. Erst seit etwa Beginn der 80er Jahre werden diese Ansätze unter dem Begriff der Neuen Politischen Ökonomie zusammengefaßt. 140 Mit der Berücksichtigung von Verbänden, Parteien und staatlichen Instanzen geht die Untersuchung auch über die Individualebene hinaus. Indem das Verhalten dieser Aggregate aus dem nutzenmaximierenden Handeln seiner einzelnen Mitglieder heraus erklärt wird, bleibt die Analyse aber individualistisch geprägt. Zwischen der Neuen Politischen Ökonomie und der oben dargestellten Institutionenökonomik bestehen enge Zusammenhänge. Bei der bereits betonten Verflechtung zwischen Wirtschaft und Politik ist leicht nachvollziehbar, daß auch die ökonomische Analyse von Institutionen nicht auf den politischen Bereich verzichten kann. Die institutionenökonomische Betrachtung muß die politischen Organisationen wie Parteien, Verbände, Regierungen und Behörden - im Sinne der einen Verwendungsvariante des Begriffs Institution - einschließen. Aber auch die andere Verwendungsvariante von Institutionen als Regeln (z. B. Property Rights) erfordert die Berücksichtigung politischer Aspekte, da diese normalerweise in einem politischen Prozeß entstehen und durchgesetzt werden müssen. Wie bereits im entsprechenden Kapitel dargelegt wurde, kann deshalb die Neue Politische Ökonomie einer "Institutionenökonomik im weiteren Sinne" zugeordnet werden. Die Abgrenzung zur Neuen Institutionenökonomik erfolgt nicht über die Methodik, sondern vor allem über den anderen (nämlich den politischen) Anwendungsbereich. Die positive Theorie der Regulierung ist zu ihrer Charakterisierung zunächst in den größeren Zusammenhang der allgemeinen Regulierungstheorie zu stellen. Unter Regulierung können nach einer weiten Begriffsfassung alle staatlichen Eingriffe in die indi140 Vgl. HERDER-DoRNEICH, P., 1992, S. 23 f.
384
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer Ansdtze
viduelle Vertrags- und Gewerbefreiheit verstanden werden, ausschließlich der fiskalischen Aktivitäten des Staates. 141 Die Regulierungstheorie unterscheidet zwischen einer nonnativen und einer positiven Analyse. 142 Die ältere und besser ausgebaute nonnative Theorie versucht als angewandte (neoklassische) Wohlfahrtsökonomik, die bestehende Regulierung zu bewerten und Empfehlungen darüber zu geben, welche Wirtschaftsbereiche durch welche wirtschaftspolitische Maßnahmen reguliert werden sollten. Als Beurteilungskriterium dient dabei vor allem die ökonomische Effizienz. Regulierungen werden hier mit Wettbewerbsversagen begründet und dienen der Erhöhung der allgemeinen Wohlfahrt. Als wichtigste Fonnen von Wettbewerbsversagen, die zur Schaffung und Rechtfertigung sogenannter wettbewerblicher Ausnahmebereiche angefllhrt werden, gelten fehlendes Ausschlußprinzip bzw. gravierende, nicht internalisierbare externe Effekte sowie labile Marktgleichgewichte infolge inversen Angebotsverhaltens, das "natürliche Monopol" und die "chronisch-branchenruinöse Konkurrenz" .143 Die positive Theorie der Regulierung dagegen sieht in der Existenz staatlicher Regulierung nicht in erster Linie den Versuch, die gesellschaftliche Wohlfahrt zu erhöhen, sondern filhrt staatliches Eingreifen vor allem auf den Einfluß eigennutzorientierter Interessengruppen zurUck. 144 Hier werden die Parallelen zur Neuen Politischen Ökonomie deutlich. Die positive Theorie sucht nach Erklärungen, warum der Staat eingreift. Dabei stehen die Interaktionen zwischen den Regulierten und den Regulierenden sowie die Ko-
141 Vgl. WEIZS)l.CKER, C. C. von, Staatliche Regulierung - positive und normative Theorie, in: Schweizerische Zeitschrift ftlr Volkswirtschaft und Statistik, 1982, S. 326, sowie MüLLER, J., und VOOELSANG, 1., 1979, S. 19. 142 Vgl. zu dieser Unterscheidung: WEIZS)l.CKER, C. C. von, 1982, S. 326. 143 Vgl. z. B. BARTL1NG, H., Schlußfolgerungen aus Entwicklungstendenzen der Wettbewerbstheorie ftlr die Wettbewerbspolitik, in: Wirtschaft und Wettbewerb, Jg. 43 (1995), S. 16-30, bes. S. 18 ff. 144 Vgl. zu den folgenden Ausftlhrungen über die positive Regulierungstheorie: MüLLER, J., und VOOELSANG, 1., 1979, S. 101-120, WEIZS)l.CKER, C. C. von, 1982, S. 334-339, sowie WEBER, R. H., 1986, S. 92-97.
5. Politisch-ökonomische Anstitze
385
sten des Regulierungseingriffs im Vordergrund. Dem Wettbewerbsversagen der normativen Theorie wird das Politikversagen auf staatlicher Seite gegenübergestellt. Die Entwicklung einer positiven Theorie der Regulierung kann damit auch aus der Kritik an der Einseitigkeit der normativen Theorie heraus erklärt werden. Im Gegensatz zur normativen Regulierungstheorie stellt die positive Variante aber noch keine weitgehend geschlossene Theorie dar, sondern sie besteht bisher aus einer Reihe von einzelnen Ansätzen. Hier sind besonders die sogenannte "Capture Theory", die Krisenthese und wiederum bürokratietheoretische Überlegungen zu nennen. Maßgeblich an der Entstehung dieser Forschungsrichtung waren Vertreter der US-amerikanischen Chicago School (Posner, Stigler, Peltzman u. a.) beteiligt. Dadurch werden Verbindungslinien zur Ökonomischen Analyse des Rechts deutlich und daraus erklärt sich eine stärker interventionsskeptische Prägung der positiven Regulierungstheorie, als sie den Beiträgen zur Neuen Politischen Ökonomie zu eigen ist.
5.2 Vorgehensweise zur Ableitung eines politisch-ökonomischen Modells der Verbraucherpolitik Aufgrund der engen Verflechtung der beiden gesellschaftlichen Subsysteme Ökonomie und Politik ist die Berücksichtigung des politischen Entscheidungsprozesses auch fllr das Verständnis der Verbraucherpolitik unverzichtbar. Denn was nutzt die beste (theoretische) verbraucherpolitische Konzeption, wenn sie in der politischen Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Interessen zerrieben und damit nicht in praktische Politik umgesetzt werden kann? Dazu wird zunächst nach einem geeigneten Vorgehen gesucht, wie die einzelnen Ideen, Theorien und Ansätze politischökonomischer Natur kurz dargestellt und praktikabel auf den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit anzuwenden sind. In der Einteilung der Regulierungstheorie in normative und positive Ansätze wird ein sinnvoller Rahmen auch fllr die wissenschaftliche Untersuchung der Verbraucherpolitik gesehen. "Because consumer protection policies are govemment efforts to restrict the behaviour of individuals who seIl goods or services, they are classic examples of regulation. As such, well-established theories of regulation can be applied to the consumer protection area ... " .145
386
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer Ansdtze
Da die Verbraucherpolitik als typische staatliche Regulierung angesehen werden kann, spricht nichts dagegen, sie in regulierungstheoretische Überlegungen einzubeziehen. Diese Vorgehensweise ist jedoch in der deutschen Literatur zum Verbraucherschutz noch wenig gebräuchlich. 146 Wie in der allgemeinen Regulierungstheorie läßt sich auch rur die Verbraucherpolitik feststellen, daß der Schwerpunkt der bisherigen Forschung im Bereich der normativen Theorie liegt. Mit Ausnahme der betrachteten interventions skeptischen Konzeptionen beschränken sich die verbraucherpolitischen Konzeptionen und besonders die Informationsökonomik einseitig auf die Untersuchung von Wettbewerbsversagen - hier speziell durch Informationsmängel und Organisationshindernisse auf seiten der Verbraucher. Dagegen ist die positive Analyse noch unzureichend, so daß die Entwicklung einer "positiven Theorie der Verbraucherpolitik" eine wichtige Herausforderung an die Wissenschaft darstellt. Die bisherige Berücksichtigung positiver Erklärungsansätze besonders in der verbraucherpolitischen Konzeption der Ökonomischen Analyse des Rechts (Chicago School) hat durch die Überbetonung von Politikversagen und durch eine systematische Verharmlosung möglichen Wettbewerbsversagens jedoch zu einer ebenso einseitigen Betrachtungsweise gefUhrt. Deshalb muß mit allem Nachdruck gefordert werden, zur Beschreibung der Wirklichkeit beide Varianten - die normative und die positive Analyse heranzuziehen. Eine unvoreingenommene Analyse sollte weder die Existenz von Wettbewerbsversagen noch die von Politikversagen von vornherein ausschließen. Erst als Ergebnis der Untersu-
145 MEIER, K. J., The Political Economy of Consumer Protection: An Examination of State Legislation, in: The Western Political Quarterly, Jg. 40 (1987), S.344. 146 Vgl. SCHÖPPE, G., Consumer Protection by Law and Information: A View ofWestern German Practice and Experience, in: ZgS, Jg. 139 (1983), S. 545. Als Beispiele ftJr den Bereich der Versicherungswirtschaft können angeftJhrt werden: FINSINGER, J., Verbraucherschutz auf Versicherungsmarkten. Wettbewerbsbeschränkungen, Staatliche Eingriffe und ihre Folgen, München 1988, sowie EGGERSTEDT, H., Produktwettbewerb und Dienstleistungsfreiheit auf Versicherungsmarkten, Berlin 1987.
5. Politisch-ökonomische Anstitze
387
chung sind dann im konkreten Fall Aussagen darüber möglich, welcher von beiden Aspekten überwiegt und wie dementsprechend die Notwendigkeit staatlichen Eingreifens zu beurteilen ist. Bei der Übertragung politisch-ökonomischer Ansätze in den Bereich der Verbraucherpolitik sind einige Hindernisse zu überwinden. Die traditionelle Regulierungstheorie widmet ihre Aufmerksamkeit bisher vor allem dem staatlichen Eingreifen in wettbewerbliche Ausnahmebereiche. Diese branchenspezifische Regulierung von Nicht-Wettbewerbsbereichen (economic regulation) - in deren Kontext insbesondere die Capture Theory entstanden ist stellt die Problematik des "natürlichen Monopols" in den Vordergrund. In der US-amerikanischen Literatur wird der Verbraucherschutz manchmal gemeinsam mit dem Schutz von Umwelt und Gesundheit als "social regulation" bezeichnet. Charakteristisch fUr diese vergleichsweise neue Regulierungsform ist neben einem branchenunabhängigen Vorgehen der Versuch, bestimmte Formen des Wettbewerbsversagens (externe Effekte, Informationsmängel und ungleichgewichtige Verhandlungspositionen) zum Schutz eines "diffusen Allgemeininteresses" zu beseitigen. 147 Da die spezifischen Interessenkonstellationen dieser Sozialregulierung zu anderen Ergebnissen fUhren können, wäre es nicht nur fUr die Zwekke der Verbraucherpolitik nützlich, die Regulierungstheorie in dieser Hinsicht auszubauen. Eine zweite Schwierigkeit ergibt sich daraus, daß die Regulierungstheorie in den USA entstanden und deshalb stark auf das dortige Regierungs- und Verwaltungssystem ausgerichtet ist. Den Schwerpunkt vieler Untersuchungen bildet das speziell US-amerikanische System der "öffentlichen Regulierung" von privaten Unternehmen durch eine Vielzahl von der Regierung relativ unabhängiger Regulierungskommissionen (regulatory agencies). Da diese Regulierungsform vielen Ländern fremd ist, sind der Analyse jeweils andere Strukturen zugrunde zu legen. Während sich die institutionelle Betrachtung in den USA auf Regulierungskommissionen und Verbraucherschutzbehörden konzentrieren kann, sollte fUr die Bundesrepublik Deutschland sowie andere europäische In-
147 Vgl. REICH, N., 1984, S. 14 f.
388
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer Anstitze
dustriestaaten auch die Regulierungsfonn des "öffentlichen Unternehmens" berUcksichtigt werden. 148 Gerade die Bereiche, welche nicht dem Marktmechanismus unterliegen, sondern dem politischen Raum zugewiesen wurden (öffentliche oder staatlich geschützte Unternehmen, aber auch Dienstleistungen von Behörden), erfordern eine stärker politischökonomische Analyse, da keineswegs davon ausgegangen werden kann, daß dort das Verbraucherinteresse allein über (den Wettbewerb substituierende) politische Wahlmechanismen zu gewährleisten ist. Obwohl diesem wichtigen Themenkomplex in dieser Arbeit nicht gesondert nachgegangen werden kann, soll betont werden, daß von den politisch-ökonomischen Beiträgen wesentliche Erkenntnisse rur die Rechtfertigung und kritische Analyse einer "Verbraucherpolitik im öffentlichen Bereich" zu erwarten sind. Die vorhandenen Ansätze politisch-ökonomischer Prägung bilden gegenwärtig noch ein Sammelsurium von separaten Überlegungen, die von ihren Vertretern häufig einseitig überbetont oder verabsolutiert werden. Ein Musterbeispiel rur ein solches Vorgehen liefert die Capture Theory mit der naiven Vorstellung, alleine die Angebotsseite bestimme das Ausmaß der Regulierung. Für die Erklärung der komplexen Realität ist aber eine solche Betrachtung nur eines oder weniger Einflußfaktoren des politischen Entscheidungsprozesses unzureichend, da staatliche Interventionen auch in der Verbraucherpolitik nicht monokausal erklärbar sind. Eine politisch-ökonomische Theorie speziell in diesem Bereich sollte deshalb als wichtigste Detenninanten neben der Anbieterseite zumindest - trotz ihrer offenkundig unterlegenen Position - die Konsumenten und ihre Interessenvertretung, die staatliche Bürokratie sowie das Verhalten der Politiker berUcksichtigen. 149 Mit Hilfe politisch-ökonomischer Beiträge lassen sich zum einen manifeste Schwierigkeiten in der Durchsetzung von Verbraucherinteressen aufzeigen. Dem steht zum anderen die Tatsache gegenüber, daß sich dieser Politikbereich letztlich in allen entwik148 Vgl. dazu: KAUFER, E., Theorie der öffentlichen Regulierung, München 1981, S. I. 149 Vgl. MEIER, K. 1., 1987, S. 344 f. und S. 356.
5. Politisch-ökonomische Anstitze
389
kelten Marktwirtschaften etablieren konnte. Die im folgenden untersuchten Ansätze zeigen Bedingungen und Situationen auf, unter denen - vor allem wenn sie kumulativ auftreten - trotz gewisser "Handicaps" die Realisierung verbraucherpolitischer Aktivitäten und Maßnahmen erfolgversprechend sein könnte. Ziel des folgenden Abschnitts ist es in erster Linie, die verschiedenen politisch-ökonomischen Überlegungen hinsichtlich des verbraucherpolitischen Anwendungsbereichs strukturiert darzustellen, auszuwerten und zusammenzuftlhren, um einen Beitrag zur Entwicklung einer "ökonomischen Theorie der Verbraucherpolitik" zu leisten. Dazu wird ein politisch-ökonomisches Modell aus mehreren Bausteinen herangezogen, denen dann die einzelnen, verbraucherpolitisch relevanten Teilansätze aus der Literatur soweit möglich - inhaltlich zugeordnet werden. Diese Zuordnung zu den Elementen des Modells erfolgt zunächst in der Absicht, eine übersichtliche Darstellung zu gewährleisten. Sie sollte aber nicht zu einer Vernachlässigung der Interdependenzen verleiten, da die einzelnen Bausteine in der Realität selbstverständlich gemeinsam wirken und letztlich einer Verknüpfung bedürfen. Als einzelne Komponenten des Modells werden die Bereiche Demokratie, Interessenvertretung, Bürokratie und Wissenschaft betrachtet. lso Der Bereich Demokratie beinhaltet das bereits oben vorgestellte Basismodell, das vielflUtige Erweiterungen und Modifikationen erfllhrt. Dabei wird der Schwerpunkt der Analyse auf das Verhalten von Wählern, Politikern, Parteien und Regierungen gelegt. Die beiden Elemente Interessenvertretung und Bürokratie dehnen die Betrachtung auf weitere wichtige politische Akteure und Institutionen aus. Während bei diesen beiden Bausteinen ein verbraucherpolitisch relevanter Ausschnitt (spezielle Behörden und Verbände) möglich ist, stehen die grundlegenden Mechanismen des Bereichs Demokratie (v. a. Wahlen) gewöhnlich in einem größeren Zusammenhang. Eine "ökonomische Theorie der Verbraucherpolitik" sollte sich, da sie lediglich einen kleinen TeilbeISO Die~e Aufteilung ist in der Literatur zur Neuen Politischen Ökonomik nicht unüblich. Vgl. z. B. MEYER-KRAHMER, F., Politische Entscheidungsprozesse und Ökonomische Theorie der Politik, Frankfurt 1979 [zugl. Diss. Univ. Frankfurt 1978], S. 52 f.
390
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer Anstitze
reich der Wirtschaftspolitik untersucht, auch mit dessen Verhältnis zum politischen Gesamtprozeß sowie mit wesentlichen Einflußfaktoren "von außen" auseinandersetzen. Dies erfordert die zusätzliche BerUcksichtigung des (aus verbraucherpolitischer Sicht) politisch-ökonomischen Umfeldes als fUnfte Komponente des Modells. 5.3 Komponenten des politisch-ökonomischen Modells 5.3. J Demokratie
Wie bereits oben angesprochen wurde, bilden die einfachen Grundgedanken des Modells einer Konkurrenzdemokratie nur den Ausgangspunkt der politisch-ökonomischen Betrachtung. Schon Downs bleibt nicht bei einem polypolistischen Angebot - dargebracht von vielen einzelnen Politikern - stehen, sondern entwickelt unter der Annahme unvollständiger Information der Beteiligten ein Modell oligopolistischer Parteienkonkurrenz. 1S1 Die Aufhebung weiterer Annahmen fUhrt zur BerUcksichtigung strategischen Verhaltens (Möglichkeiten des Stimmentausches und der Bildung von Koalitionen), der Existenz von Interessenvertretungen, des großen zeitlichen Abstandes zwischen Wahlen und damit der Bedeutung von Wahlzyklen sowie der Tatsache, daß in der demokratischen Praxis meist nicht über Einzelfragen, sondern nur über Gesamtprogramme abgestimmt werden kann. Downs Überlegungen zum Wählerverhalten im politischen Bereich, die Strategien rationaler Unwissenheit der Wähler und die Existenz von Ideologien über ein Informationskostenkalkül erklären, entsprechen in ihren Grundlagen denen der Informationsökonomik fUr den wirtschaftlichen Bereich. Der Wähler agiert demnach als Nachfrager auf einem "Markt fUr politische Programme" und benötigt fUr seine Entscheidungen, ähnlich dem Verbraucher bei der Konsumgüterwahl, Informationen. Da diese nicht kostenlos zu erhalten sind, besteht auch hier eine Strategie rationalen Verhaltens in der Senkung seiner Informationskosten. Das einzelne Wirtschaftssubjekt wird deshalb - sozusagen nach dem Prinzip der Arbeitsteilung - eine Beeinflussung der staatlichen Politik zu sei151 Vgl. DOWNS, A., 1968, S. 202-271.
5. Politisch-ökonomische Ans(itze
391
nen Gunsten nicht in allen Bereichen anstreben, sondern nur dort, wo es sich den höchsten Ertrag verspricht. Die meisten Individuen beziehen ihr Einkommen nur aus einer oder wenigen Quellen, geben es aber in vielen Bereichen aus. Deshalb ist es wahrscheinlicher, daß sie in ihrer Eigenschaft als Einkommensempfllnger (vor allem Arbeitnehmer und Unternehmer) politischen Einfluß ausüben werden, als in ihrer Eigenschaft als Einkommensverwender (Verbraucher). Eine Informationstätigkeit im Bereich der Einkommensentstehung ist dabei nicht nur erfolgversprechender, sondern auch vergleichsweise kostengünstig, weil der einzelne mit diesem Bereich bereits vertraut iSt. 152 Ergebnis dieses Kalküls könnte ein stärkerer politischer Druck von der Produzentenseite auf die Regierung sein, die dann aus den genannten Gründen mehr Rücksicht auf die Anbieter als auf die Verbraucher nimmt. Dies bietet eine mögliche Erklärung dafUr, weshalb die Verbraucherpolitik innerhalb des politischen Willensbildungsprozesses nur eine untergeordnete Rolle spielt. Dieser Sachverhalt kann auch mit Hilfe des von Zohlnhöfer entwickelten Begriffs der Wählerbeweglichkeit verdeutlicht werden. 153 Unter wirtschaftspolitischer Wählerbeweglichkeit kann allgemein die Neigung von Wählern verstanden werden, aufgrund wirtschaftspolitischer Fehlleistungen die Partei zu wechseln. Je höher die bereichsspezifische - d. h. auf einen bestimmten Teilbereich der Wirtschaftspolitik wie die Verbraucherpolitik bezogene Wählerbeweglichkeit ist, desto stärker fällt der Parteienwettbewerb um die Gunst des Wählers und damit der Leistungsdruck aus, dem die Regierung auf einem Gebiet unterliegt. Eine hohe Wählerbeweglichkeit erhöht folglich die Chancen dafür, daß sich die praktische Wirtschaftspolitik den Problemen eines solchen Teilbereichs annimmt. 154 152 Vgl. DoWNS, A., 1968, S. 249-251 und kurz: FLEISCHMANN, G., 1982, S.78. 153 Vgl. zum folgenden ZOHLNHOFER, W., Das Steuerungspotential des Parteienwettbewerbs im Bereich staatlicher Wirtschaftspolitik, in: BOEITCHER, E., HERDER-DoRNEICH, P., und SCHENK, K. E. (Hrsg.), Neue Politische Ökonomie als Ordnungstheorie, TUbingen 1981, S. 82-102. 154 Vgl. ebenda, S. 86 f.
392
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer Anstifze
Als wesentliche Detenninanten speziell der bereichsspezifischen Wählerbeweglichkeit können der Infonnationsgrad und die (v. a. fmanzielle) Betroffenheit der Wähler identifiziert werden. 155 Bereits die Überlegungen von Downs weisen darauf hin, daß die Wähler hinsichtlich dieser beiden Faktoren verbraucherpolitischen Belangen gewöhnlich wenig Aufmerksamkeit widmen. Deshalb ist zu vennuten, daß es sich bei der Verbraucherpolitik um einen typischen Bereich mit niedriger Wählerbeweglichkeit und entsprechend schwach ausgeprägtem Parteienwettbewerb handelt. 156 Die Regierung ist in solchen Bereichen in der Regel keinem besonderen Leistungsdruck ausgesetzt und gewinnt prinzipiell an Entscheidungsspielraum. "Wie dieser d,er Regierung vom Parteienwettbewerb her verbleibende Spielraum faktisch ausgefUllt wird, hängt damit entscheidend von den Detenninanten der Feinsteuerung praktischer Wirtschaftspolitik ab"157, zu denen vor allem Verbände und Bürokratie zählen. Bei geringer Wählerbeweglichkeit, daraus resultierenden Gestaltungsspielräumen und den Organisationsproblemen der Konsumenten, die im folgenden Abschnitt genauer untersucht werden, ist eine Vernachlässigung der Verbraucherinteressen zu befUrchten. Erschwerend tritt die Tatsache hinzu, daß in demokratischen Wahlen gewöhnlich nur über politische Gesamtprogramme entschieden werden kann, die dann von wirtschaftspolitischen Teilbereichen mit vergleichsweise hoher Wählerbeweglichkeit bestimmt werden. Hier ist insbesondere an die Stabilisierungspolitik mit wichtigen Einzelfragen wie Arbeitslosigkeit, Preissteigerung oder Steuerbelastung zu denken. 158 Verbraucherpolitische Themen 155 Vgl. ebenda, S. 96 f. 156 In Anlehnung an Kantzenbachs "Konzept der optimalen Wettbewerbsintensität" fUr den marktwirtschaftlichen Wettbewerb zwischen Unternehmen sieht Zohlnhöfer die höchste wirtschaftspolitische Funktionsfllhigkeit des Parteienwettbewerbs (als Instrument zur Steuerung der demokratischen Willens- und Entscheidungsbildung im Sinne des Gemeinwohls) bei mittlerer Wählerbeweglichkeit und Wettbewerbsintensität. Vgl. ebenda, S. 87-89, und KANTZENBACH, E., Die Funktionsfllhigkeit des Wettbewerbs, 2. Aufl., Göttingen 1967, bes. S. 38-49. 157 ZOHLNHOFER, W., 1981, S. 100. Vgl. dazu auch S. 89. 158 Vgl. ebenda, S. 97-99.
5. Politisch-ökonomische Ansatze
393
dagegen sind nur selten wählerwirksam genug, um in den Vordergrund der politischen Auseinandersetzung treten zu können. Eine zentrale Figur im demokratischen Entscheidungs- und Willensbildungsprozeß stellt der Politiker als "politischer Unternehmer" dar. 159 Um die Zustimmung und Unterstützung einer möglichst großen Zahl von Wählern oder organisierten Gruppen zu gewinnen, muß er geeignete Probleme identifizieren und sie auf die politische Tagesordnung setzen. Vergleichbar einem Unternehmer im wirtschaftlichen Bereich werden so in einem evolutorisehen Prozeß durch kreative Ideen neue "politische Güter" entwikkelt und im Wettbewerb um die Gunst des Wählers angeboten. 160 Die Durchsetzungschancen gesellschaftlicher Interessen könnten sich auch in Abhängigkeit von politischen Zyklen verändern. In der Literatur werden hierzu Hypothesen aufgestellt bezüglich des Zyklus von Wahlterminen, eines Produktlebenszyklus von politischen Gütern und des gesamtwirtschaftlichen Konjunkturzyklus. Die unterstellten zyklischen Entwicklungsabläufe sind komplex, stehen vermutlich miteinander in Zusammenhang und beeinflussen sich gegenseitig. 161 So wird beispielsweise behauptet, Politiker und Parteien richteten ihr Verhalten maßgeblich an den Wahlterminen aus und berücksichtigten dabei die sich möglicherweise ebenfalls zyklisch verändernden Präferenzen der Wähler. Für den Bereich der Verbraucherpolitik aussagekräftiger könnte sich die These vom Produktlebenszyklus politischer Güter erweisen. 162 Die Überlegung, 159 Vgl.
TIEMSTRA, J. P., 1992, S. 21 f.
160 Vgl. zum "Wettbewerb als Entdeckungsverfahren" im politischen System DAUMANN, F., Zur Notwendigkeit einer Harmonisierung im Gemeinsamen Markt. Eine evolutionstheoretische Untersuchung, Bayreuth 1993 [zugl. Diss. Univ. Bayreuth], S. 145. 161 Vgl. SCHATZ, H., Verbraucherinteressen im politischen Entscheidungsprozeß, Frankfurt 1984, S. 221-224.
162 Vgl. WIDMAIER, H. P., Sozialpolitik im Wohlfahrtsstaat. Zur Theorie politischer GUter, Reinbek 1976, S. 81-86, der auf entsprechende Erklärungen rur den Bereich der Umweltpolitik verweist: DOWNS, A., Up and Down with Ecology The "Issue-Attention-Cycle", in: The Public Interest, No. 28/ Summer 1972, S. 3850, und FREY, B. S., Umweltökonomie, 2. Aufl., Göttingen 1985, S. 132-139.
394
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer Anstitze
politische Güter könnten einer Art Produktlebenszyklus unterliegen, wie er aus dem Bereich privater Güter gut bekannt ist, paßt einerseits zur Idee des politischen Unternehmers. Auf der Suche nach neuen "Produkten" werden einzelne Politiker auch Verbraucherschutzthemen aufgreifen, um sich zu profilieren. Andererseits liefert die These eine Erklärungskomponente filr das Auftreten sog. "Wellen der Verbraucherbewegung", wie sie in den USA bereits dreimal zu beobachten waren. 163 Sie lassen sich als Aufeinanderfolge einzelner Zyklen interpretieren, wobei die Thematik jeweils in größeren zeitlichen Abständen neu aufgegriffen wird. Im Produktlebenszyklus eines politischen Gutes lassen sich vereinfachend vier Phasen unterscheiden. l64 In der Anfangsphase besteht ein politisches Problem (z. B. mangelnder Schutz der Konsumenten) zwar schon, es hat jedoch noch nicht die öffentliche Aufmerksamkeit gefunden. In der zweiten Phase gelingt dies aufgrund besonderer Ereignisse, sich verschärfender Widersprüche oder offen auftretender Konflikte, nicht zuletzt durch die Initiative politischer Unternehmer und oft auch mit Hilfe der Medien. Das Problem kann und soll in dieser von Optimismus geprägten Wachstumsphase des politischen Gutes (z. B. Verbraucherschutz) durch die Bereitstellung staatlicher Regulierung gelöst werden. In der folgenden Reifephase wird die anflingliche Zuversicht von einer wachsenden Skepsis bezüglich der Lösungsmöglichkeiten und der Finanzierung staatlichen Eingreifens abgelöst. In der letzten Phase, die als Rückbildungsphase bezeichnet werden könnte, läßt schließlich das politische und öffentliche Interesse an diesem politischen Gut nach und wendet sich neuen Problembereichen zu. Es wird vermutet, daß gerade Politikbereiche wie die Verbraucherpolitik, die Interessen mit einer nur geringen Konflikt- und Organisationsfähigkeit dienen, solchen zyklischen Schwankungen des politischen Systems unterliegen. 16S 163 Zu Beginn dieses Jahrhunderts, in den 1930er Jahren und erneut in den 1960-70er Jahren. Vgl. z. B. RICHARDSON, S. L., Tbe Evolving Consumer Movement: Predictions for the 1990s, in: BLOOM, P. N., und SMITH, R. B. (Hrsg.), LexingtonIMass. 1986, S. 18. 164 Vgl. WIDMA1ER, H. P., 1976, S. 81-83. 165 Vgl. ebenda, S. 84.
5. Politisch-ökonomische Ansätze
395
5.3.2Interessenvertretung
Die ökonomische Theorie der Demokratie nach Downs und die Überlegungen von Zohlnhöfer konnten zur Erklärung der Schwierigkeiten herangezogen werden, auf die eine Durchsetzung von Verbraucherinteressen im politischen Prozeß stößt. Aber auch der politische Handlungsspielraum, den eine geringe Wählerbeweglichkeit im Bereich der Verbraucherpolitik organisierten Gruppen grundsätzlich eröffnet, scheint aufgrund von Organisationshindernissen nicht zugunsten der Konsumenten ausgerullt werden zu können. Die ungünstige Stellung der Verbraucher kann damit sowohl über den Ansatz von Downs erklärt werden, als auch über die ökonomische Theorie der Verbände nach Olson - dem rur den Bereich der Verbraucherpolitik vermutlich bedeutsamsten Ansatz innerhalb der Neuen Politischen Ökonomie. 166 Ausgehend von der Annahme, daß die Durchsetzung von Interessen im politischen Entscheidungsprozeß von ihrer Organisierbarkeit abhängt, eignen sich die Überlegungen von Olson besonders, um die Probleme einer Selbstorganisation der Verbraucher (im Gegensatz zur sog. Verbraucherfremdorganisation mit Hilfe staatlicher Unterstützung) zu analysieren und auf Verbesserungsmöglichkeiten aufmerksam zumachen. In seiner "Logik des kollektiven Handelns" entwickelt Olson eine Theorie über die Organisationsfähigkeit von Interessen in Auseinandersetzung mit älteren politikwissenschaftlichen Theorien der Gruppe, die als Pluralismustheorien bezeichnet werden. 167 Charakteristisch ftlr letztere ist die Hoffnung, daß es in einer Gesellschaft zu einem harmonischen Ausgleich zwischen den verschiedenartigen Interessen in Form "Gruppengleichgewichts" komme, weil jede momentan benachteiligte Gruppe eine Lobby zur wirksamen Vertretung ihrer Interessen bilden würde oder bereits die Existenz potentieller Gruppen andere von überzogenen Forderun166 Vgl. OLSON, M., Die Logik des kollektiven Handeins, Tübingen 1968 [original: Tbe Logic ofCollective Action, CambridgelMass. 1965], aber auch z. B. BRUNE, H. G., StlIrkung der kollektiven Verbraucherposition, in: SCHERHORN, G., 1975, S. 105-120. 167 Vgl. OLSON, M., 1968, S. 121-129. 27 MitropllUlos
396
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer Anstitze
gen abhalte. Dieser seiner Ansicht nach widersprüchlichen und unzureichenden Pluralismustheorie stellt Olson eine politischökonomische Erklärung gegenüber, die nach der Gruppengröße und anderen Kriterien der Organisationsflihigkeit von Interessen differenziert. Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist die Feststellung, daß die Bereitstellung von öffentlichen Gütern (Kollektivgüter) die charakteristische Leistung jeder Interessenvertretung darstellt. 168 Wichtigste Aufgabe eines Verbandes ist die politische Durchsetzung von Vorteilen rur die vertretene Gruppe, oft zu Lasten anderer Teile der Gesellschaft. Gemäß den Kennzeichen eines öffentlichen Gutes, nämlich der Nicht-Ausschließbarkeit und der NichtRivalität im Konsum, besteht die Möglichkeit zum Trittbrettfahrertum (Free-rider-Verhalten). Demnach kann ein Gruppenmitglied in den Genuß des öffentlichen Gutes gelangen, auch ohne einen Verbandsbeitrag zu leisten. Nach Olson wird deshalb die Bildung einer Interessenvertretung an einem individuellen Kosten-Nutzen-Kalkül scheitern, wenn nicht mindestens eine der folgenden Voraussetzungen erfllllt ist: • Kleine Gruppe. In einer kleinen Gruppe sind der Beitrag und der Nettonutzen aus der Bereitstellung des öffentlichen Gutes rur den einzelnen noch spürbar. Es besteht ein enger Zusammenhalt der Gruppe, eine hohe Reaktionsverbundenheit z. B. durch sozialen Druck zwischen den wenigen Beteiligten. Die Gruppengröße wird damit zu einem wesentlichen Bestimmungsfaktor der Durchsetzbarkeit von Interessen. Bei großen Gruppen ist eine vergleichbare Organisationsfähigkeit nicht von vornherein gegeben. Olson bezeichnet sie als "latente" Gruppen, zu denen er auch die Verbraucher zählt. 169 • Zwang. Die Organisationsflihigkeit kann durch rechtliche Sanktionen zur Gruppenstützung hergestellt werden. So können beispielsweise staatliche Organisationen über die Erhebung von Steuern und Gebühren finanziert oder eine Beitrittspflicht festgelegt werden. 168 Vgl. ebenda, S. 15. 169 Vgl. ebenda, S. 32-35.
5. Politisch-ökonomische Anstitze
397
• Selektive Anreize. Eine große Gruppe kann ohne Zwang organisationsfllhig sein, wenn sie ihren Mitgliedern neben dem öffentlichen Gut auch private Güter anbietet, deren Nutzen alleine schon die Kosten des Verbandsbeitritts übersteigen (z. B. Beratung, Zeitschriften, Versicherungsangebote). Olson spricht hier von der "NebenproduktTheorie der großen Pressure Groups". 170 Die Analyse des kollektiven Handelns bei Olson macht deutlich, daß die Gruppe der Verbraucher nur sehr begrenzt organisierbar ist. Von den oben genannten Voraussetzungen ftlr eine erfolgreiche Selbstorganisation in Verbraucherverbänden sind zumindest die ersten beiden nicht erfUllt. Es handelt sich bei den Verbrauchern zum einen um eine große und damit in der Terminologie Olsons "latente" Gruppe, die sehr allgemeine, schwer abgrenzbare und heterogene Interessen besitzt. Zum anderen ist Zwang als Organisationsmittel, z. B. in der Form einer staatlich verordneten Mitgliedschaft mit Ptlichtbeiträgen, nicht vorstellbar. So verbleibt für eine Selbstorganisation der Verbraucher zunächst nur die Möglichkeit, Verbandsmitglieder über selektive Anreize zu gewinnen. Wie die Untersuchung der praktizierten Verbraucherpolitik in ausgewählten Ländern gezeigt hat, verfolgen die bedeutendsten privaten Verbraucherverbände tatsächlich diesen Weg. 171 Über das Angebot von Testzeitschriften und weiteren Beratungsdiensten gelingt es, zahlreiche Verbraucher als Mitglieder zu gewinnen und einen hohen Selbstfmanzierungsgrad zu sichern, der auch Aktivitäten einer politischen Interessenvertretung ermöglicht. Ebenfalls über selektive Anreize sind Versuche zu erklären, Verbraucherinteressen durch andere Gruppen mit einer möglicherweise höheren Organisationsfllhigkeit (z. B. Gewerkschaften und Konsumgenossenschaften) mitvertreten zu lassen, sofern deren eigentliche Ziele mit denen der Konsumenten vereinbar sind. l72 Besser organ isierbar im Sinne der "Nebenprodukt-Theorie" sind ferner spezielle Verbraucherinteressen, was sich an den verhältnismäßig hohen 170 Vgl. ebenda, S. 130-133. 171 Vgl. zusammenfassend S. 307-309 dieser Arbeit. Vgl. zu dieser Kategorie existierender Verbraucherverbande zusammenfassend S. 310. 172
27"
398
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer Anstitze
Mitgliederzahlen von Mieterverbänden oder Automobilclubs ablesen läßt. Der Blick in die Empirie zeigt noch eine weitere Kategorie von Verbraucherselbstorganisationen. Hierbei handelt es sich aber um wenige, in der Regel nicht sehr einflußreiche Gruppen mit geringer Mitgliederzahl, die vor allem auf der Eigeninitiative und dem Engagement einzelner Verbraucher basieren. 173 Mit ihrem Ausnahmecharakter bestätigen diese Verbände zwar einerseits die Bedeutung der Voraussetzung "selektive Anreize" ftlr die Selbstorganisation von Verbrauchern. Andererseits weist ihre Existenz darauf hin, daß den drei Voraussetzungen ftlr die Bildung eines Verbandes zur Vertretung von Gruppeninteressen bei Olson mit "Idealismus" durchaus eine weitere hinzugefilgt werden kann. Da solchen Beitrittsmotiven nicht primär ein ökonomisches KostenNutzen-Kalkül zugrunde liegt, paßt der Idealismus allerdings nicht in Olsons Modell. Als Zwischenergebnis der ökonomischen Theorie der Verbände kann festgehalten werden, daß aufgrund unterschiedlicher Bedingungen keinesfalls ein automatischer Interessenausgleich in der Gesellschaft zu erwarten ist. Eine Selbstorganisation der Konsumenten ist zwar grundsätzlich möglich, ihre Erfolgschancen sind jedoch - besonders im Vergleich zur erheblich höheren Organisationsfähigkeit der Anbieterseite - als relativ gering zu beurteilen. Damit muß davon ausgegangen werden, daß die Gefahr einer einseitigen InteressenberUcksichtigung im Bereich der Verbraucherpolitik durch Verbandsaktivitäten nicht vennindert, sondern vielmehr verstärkt wird. Auch wenn der personelle Faktor ftlr die Durchsetzungsfähigkeit von Verbraucherinteressen nicht überbetont werden sollte und nicht allgemeingültig ist, kann doch die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt beachtliche Wirkung erzielen. Wie das Beispiel des Verbraucheranwalts Ralph Nader als maßgeblicher Protagonist des "Consumerism" in den USA beweist l74, kann die Tätigkeit einzelner, herausragender Persönlichkeiten, die sich erfolgreich filr 173 Vgl. S. 309 f.
174 Vgl. S. 261-264.
5. Politisch-ökonomische Ansdtze
399
den Verbraucherschutz engagieren, eine (weitere) wesentliche Ursache der Bildung von Verbraucherorganisationen sein. Die oben vorgestellte Figur des "politischen Unternehmers", der durch Überzeugung, Publikationen und öffentliche Diskussion danach strebt, die Zustimmung einer breiten Öffentlichkeit zu gewinnen, ist deshalb nicht auf Politiker im engeren Sinne beschränkt. Der Begriff kann ebenso auf einzelne Journalisten oder Verbandsaktivisten, hier speziell Verbraucherschützer, zutreffen. 175 Die offenkundige Schwäche organisierter Verbraucherinteressen scheint der Existenz mittlerweile umfassender Verbraucherschutzregelungen in allen entwickelten Industrieländern diametral gegenüberzustehen. Der Stand der Regulierung in diesem Politikbereich läßt sich aufgrund der aufgezeigten Organisationshindernisse nicht oder nur zu einem Teil auf die Aktivitäten der Verbraucherverbände zurückfUhren. Ein umfassender Erklärungsansatz sollte deshalb auch die Anbieterseite einbeziehen. Rechtliche Vorschriften zum Schutz der Verbraucher können nach Ansicht von Lohmann 176 nicht hinreichend durch die ökonomische Verbandstheorie erklärt werden, da sie in der Regel nicht kleinen, gut organisierten Gruppen auf der Anbieterseite, sondern der großen Gruppe der Verbraucher dienen. Die Durchsetzbarkeit dieser Regelungen setzt aber vermutlich zumindest die Duldung der Anbieterseite voraus. Eine Ursache fUr den fehlenden oder geringen Widerstand der organisierten Anbieterinteressen könnte in der besonderen Verteilung der durch Verbraucherschutz anfallenden Transaktionskosten liegen. So ist beispielsweise vorstellbar, daß die Unternehmenskosten zumindest teilweise auf die Verbraucher überwälzt und die Kosten der Rechtspflege vom Staat (und damit der Allgemeinheit) aufgebracht werden. Geringen Widerstand erregen die Kosten der Regulierung zudem, wenn sie möglichst unauffiUlig und auf verschiedene Stellen verteilt anfallen. Sehr viel weiter in der Argumentation geht die sogenannte "Capture Theory" (von englisch: capture = gefangennehmen, er175 Vgl. FORBES, J. D., 1987, S. 235-237, und TIEMSTRA,
J. P., 1992, S. 21 f.
hierzu LOHMANN, H., 1992, S. 173-179 filr das Beispiel der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 176 Vgl.
400
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer Ansätze
obern), die auch als Branchenkartelltheorie bezeichnet wird. 177 Grundgedanke dieser Überlegungen ist, daß die Regulierung von den zu regulierenden Interessengruppen wie den Unternehmen einer bestimmten Branche nicht nur toleriert, sondern von diesen sogar selbst durchgesetzt wird. Da dieser Ansatz davon ausgeht, das Verhalten der Bürokratie werde maßgeblich von der Anbieterseite bestimmt, kann zur Betrachtung dieses dritten Elements im politisch-ökonomischen Modell übergegangen werden. 5.3.3 Bürokratie
Die staatliche Bürokratie umfaßt nicht nur Regierung und Ministerialbürokratie, sondern vor allem auch eine Vielzahl nachgeordneter, ausftlhrender Behörden auf allen Ebenen des Staatswesens. Die ökonomische Theorie der Bürokratie 178 verabschiedet sich von der Leitvorstellung eines selbstlosen Behördenapparates, indem auch der Bürokrat als eigennutzorientiertes Wesen identifiziert und damit zu einer eigenständigen Determinante im politischen Entscheidungsprozeß erklärt wird. Sein Fachwissen sowie die Aufgabe, aus Gründen der Konsensmobilisierung oft unpräzise formulierte politische Vorgaben zu konkretisieren, verschaffen ihm nicht unerhebliche Handlungspielräume. 179 Bürokratietheoretische Überlegungen fmden sich sowohl in der Neuen Politischen Ökonomie als auch im Rahmen der positiven Regulierungstheorie. Unter der Annahme eines positiven Zusammenhangs zwischen dem politischen Einfluß, dem Ansehen und der Höhe des Einkommens einerseits und der Größe des Verwaltungshaushalts andererseits wird ein budgetmaximierendes Ver177 Vgl. als Originalquellen: STIGLER, G. J., The Theory of Economic Regulation, in: Bell Journal of Economics, Jg. 2 (1971), S.3-21, und PELTZMAN, S., Toward a More General Theory ofRegulation, in: Journal ofLaw and Economics, Jg. 19 (1976), S. 211-240. 178 Vgl. die "Klassiker" der BUrokratietheorie: NISKANEN, W. A., Bureaucracy and Representative Government, Chicago 1971, TuLLOCK, G., The Politics of Bureaucracy, Washington 1965, und DoWNS, A., Inside Bureaucracy, Boston 1967. 179 Vgl. ZOHLNHOFER, W., Die wirtschaftspolitische Willens- und Entscheidungsbildung in der Demokratie. Ansatze einer Theorie, Habilitationsschrift Universität Freiburg 1972 (nicht veröffentlicht), S. 163 f.
5. Politisch-ökonomische Ansatze
401
halten der Bürokraten unterstellt. Die Angehörigen der Behörde sind demnach an einer Ausweitung ihres Tätigkeitsbereiches und der Mitarbeiterzahl interessiert. Einer anderen Argumentationslinie zufolge ist das Verhalten von Behörden häufig durch Passivität gekennzeichnet, da ihre Mitglieder einen möglichst geringen Arbeitsaufwand, ein "ruhiges Leben" anstreben. 180 Da der speziell US-amerikanische Behördentypus der Regulierungskommission in der Wissenschaft besonders gründlich untersucht wurde, werden solche Erklärungsversuche in der Literatur oft unter einem Stichwort wie "eigennutzorientierte Kommission" behandelt. 181 Eine zusätzliche Erklärung fllr das vorsichtige und anbieterfreundliche Verhalten einzelner Regulierungsbeamter könnte die Möglichkeit einer späteren Karriere im regulierten Wirtschaftssektor bieten. Je stärker die Amtszeit der Kommissare begrenzt wird, desto größer ist vermutlich deren Interesse an einer späteren Beschäftigung gerade in der von ihnen regulierten Branche. Aus diesem Grund könnten sie danach streben, aus der Sicht der Regulierten unerwünschte Maßnahmen zu verhindern oder sie erst dann zu ergreifen, wenn der öffentliche Druck zu stark wird. In der Literatur wird auch das Auftreten verbraucherorientierter Kommissare nicht ausgeschlossen.1 82 Eine zukünftige Einstellung in Verbraucherverbänden ist zwar durchaus denkbar, die Zahl solcher potentieller Positionen dürfte aber im Vergleich zu Tätigkeiten in der Wirtschaft eng begrenzt und ihre Attraktivität deutlich geringer sein. Deshalb kann vermutet werden, daß hier weniger die externen Berufsaussichten, vielleicht aber die Herkunft der Regulierungsbeamten mitentscheidend dafllr ist, wie eine Behörde nach außen auftritt. Da das Verhalten der Verantwortlichen nicht zuletzt von ihrer Fachrichtung, der Art ihrer Ausbildung bzw. ihrem Berufsstand mit seinen spezifischen Vorstellungen, Werten
180 Vgl. HORN, M., KNIEPS, G., und MüLLER, J., Deregulierungsmaßnahmen in den USA: Schlußfolgerungen rur die Bundesrepublik Deutschland, Baden-Baden 1988, S. 57, sowie WEBER, R. H., Wirtschaftsregulierung in wenbewerbspolitischen Ausnahmebereichen, Baden-Baden 1986, S. 94. 181 Beispielsweise bei MüLLER, J., und VOGELSANG, I. 1979, S. 104-109. 182 Vgl. MÜLLER, J., und VOGELSANG, 1., 1979, S. 107.
402
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer AnstJtze
und Zielen geprägt wird, ist die Besetzung vor allem der Schlüsselpositionen bedeutsam. Die Besetzung der Spitzenpositionen in Verbraucherschutzbehörden ist aber weniger als ein Bestimmungsfaktor der Durchsetzungsflthigkeit von Verbraucherinteressen anzusehen denn als Folge der allgemeinen politischen Entwicklung. So konnten unter günstigen Bedingungen in den USA Vertreter von Verbraucherverbänden in wichtige Positionen gelangen und dort ihren Einfluß geltend machen. Später wurden dort infolge der konservativen Umorientierung den Gedanken der Chicago School nahestehende Bürokraten eingesetzt, was den bereits eingeleiteten Abbau von Verbraucherschutzregelungen verstärkte. l84 Die bereits angesprochene Capture Theory, die ursprünglich rur die "Economic Regulation" in wettbewerblichen Ausnahmebereichen formuliert wurde, sieht staatliches Eingreifen in diese Branchen ausschließlich im Interesse der Anbieter. Stigler, einer der Hauptvertreter des Ansatzes, geht sogar so weit, einen Markt rur Regulierung zu unterstellen, auf dem Anbieter und Nachfrager von staatlicher Begünstigung aufeinandertreffen. 18S Als Nachfrager nach Regulierung treten die Interessengruppen der Produzenten auf, die vor allem an der Einrichtung staatlich gesicherter (Branchen-)Kartelle zum Schutz vor dem Wettbewerb interessiert sind. Die Anbieter auf staatlicher Seite - Politiker, aber auch die Bürokratie - könnten als Gegenleistung rur die Gewährung von Vorteilen durch die Regulierung vielfiUtige Unterstützung zur Verbesserung oder Erhaltung ihrer politischen Position erhalten (z. B. finanzielle Hilfen, Mobilisierung von Wählerstimmen, wichtige Informationen oder die oben genannten Karriereaussichten). Dieser Mechanismus wird insbesondere mit verzerrten Informationsstrukturen zwischen den zu regulierenden Unternehmen und den Behörden einerseits sowie zwischen letzteren und der Wählerschaft andererseits erklärt. Als direkte Akteure im Marktgeschehen sind die Unternehmen in der Regel ihren Regulatoren informationsmäßig überlegen, was die Chancen der Beeinflussung erhöhe. Der Informationsvorsprung, den wiederum die Bürokratie gegen184 Vgl. dazu die Ausftlhrungen im Länderbericht USA, S. 245. 185 Vgl. STIGLER, G. J., 1971.
5. Politisch-ökonomische Anstltze
403
über den Wählern (bzw. den von ihnen gewählten Politikern) besitze, verschaffe ihr genügend Spielraum, um auf die Verlockungen der gut organisierten Interessengruppen einzugehen. Die Begründung der Capture Theory rur ein angeblich zu erwartendes, anbieterfreundliches Verhalten der Regulierer ist allerdings sehr einseitig und kann (alleine) nicht überzeugen. Neben diesen Ansatz, der primär eine Erklärung filr Politikversagen sucht, treten zumindest die Thesen einer budgetmaximierenden oder passiven Verwaltung. So ist beispielsweise damit zu rechnen, daß die Regulierungsbeamten unauffällig und nicht ausgesprochen anbieterschädlich handeln, weil sie risikoscheu sind und Unannehmlichkeiten - beispielsweise durch Negativ-Schlagzeilen in den Medien - vermeiden möchten. Da staatliche Interventionen auch in der Verbraucherpolitik nicht monokausal erklärbar sind, ist der naiven Vorstellung der Capture Theory, alleine die Anbieterseite bestimme stets die Art und das Ausmaß der Regulierung, entscheidend entgegenzutreten. Verbraucherpolitische Regelungen liegen zumindest zum Zeitpunkt ihrer Entstehung nur selten im Interesse der Anbieter. Dies läßt sich an deren teilweise heftigem Widerstand gegen verbraucherschutzrechtliche Vorschriften oder gegen die Errichtung von Verbraucherschutzbehörden ablesen. In Einzelfllllen könnte der Ansatz aber durchaus hilfreich sein, z. B. bei der Erklärung des Zustandekommens von Produktsicherheitsnormen. Es wird vermutet, daß die Durchsetzung dieser Standards zuweilen von etablierten Produzenten gefördert wird, die sich in protektionistischer Weise vor ausländischer Konkurrenz oder vor neuen inländischen Anbietern schützen möchten. 186 Dies zeigt aber, daß die Anbieterseite nicht als monolithischer Block mit homogenen Interessen verstanden werden darf, sondern es muß gegebenenfalls differenziert werden, z. B. zwischen großen und kleinen Anbietern oder zwischen exportorientierten und stärker auf den Inlandsmarkt ausgerichteten Produzenten. In den bisherigen AusfUhrungen wurde deutlich, daß - bei fehlender Allgemeingültigkeit - die Capture Theory einen gewissen 186 Vgl. FRIEDMAN, M., und FRIEDMAN, R., 1980, S. 228.
404
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer Anstitze
Erklärungsgehalt besitzt. Einen erfolgversprechenden Weg, deren Grundgedanken in einen umfassenderen Ansatz zu integrieren, weisen erste Überlegungen in der Literatur zu einem Lebenszyklus von Regulierungen. 187 Die Überlegung, daß es so etwas wie einen typischen Lebenszyklus von Regulierung geben könnte, steht in engem Zusammenhang mit dem bereits vorgestellten Produktlebenszyklus öffentlicher Güter. Vereinfachend lassen sich drei Entwicklungsphasen unterscheiden. Der Zyklus beginnt mit der GTÜndungsphase, in der die gesetzlichen Grundlagen der Regulierung geschaffen werden und eine Regulierungskommission eingesetzt wird. Dabei muß die Behörde nicht schon von Beginn ihrer Tätigkeit an im Dienste der gut organisierten Interessengruppen stehen, sondern es ist denkbar, daß sie erst nach und nach von den zu regulierenden Wirtschaftssubjekten eingenommen wird. In der folgenden Phase des Behördenausbaus und der Nachbesserungen im Gesetz werden die heftigsten Auseinandersetzungen zwischen Kommission und Regulierten erwartet. Sind schließlich die neuen Regulierungsmechanismen etabliert, die Aufgabenfelder geklärt und läßt das öffentliche Interesse nach, steigt die Wahrscheinlichkeit fl1r eine verstärkte Kooperation beider Seiten und damit fl1r ein "capture" der Behörde. Hier spielt das gegenseitige Kennenlernen infolge einer langjährigen engen Zusammenarbeit zwischen Regulierenden und Regulierten eine wichtige Rolle. Dazu paßt dann weniger eine nach neuen Aufgaben strebende, budgetmaximierende Behörde als das Bild der passiven Bürokratie. 5.3.4 Wissenschaft
In der politischen Ökonomie häufig vernachlässigt, aber dennoch von eigenständiger Bedeutung innerhalb des politischen Entscheidungsprozesses ist die Wissenschaft anzusehen. So haben sich die von der Wissenschaft entworfenen und in diese Studie analysierten theoretischen Ansätze und Konzeptionen teils mehr, teils weniger in der politischen Praxis ausgewirkt; insgesamt hatten sie auf jeden Fall maßgeblichen Einfluß auf die praktische 187 Vgl. zum folgenden allgemein FRITSCH, M., u. a., 1993, S. 272 f., und mit verbraucherpolitischem Bezug nEMSTRA, 1. P., 1992, S. 23 f.
5. Politisch-ökonomische Anstitze
405
Ausgestaltung der Verbraucherpolitik. Wie im empirischen Teil im einzelnen ausgefilhrt wurde, ist die wissenschaftliche Beratung der politisch Verantwortlichen in den verschiedenen demokratischen Systemen recht unterschiedlich institutionalisiert - darauf verzichtet wird in keinem der untersuchten Länder. Einflußmöglichkeiten der Wissenschaft auf die Politik ergeben sich nicht zuletzt aus der weithin üblichen Praxis der am politischen Prozeß Beteiligten, ihre Positionen durch Ergebnisse aus Forschung und Wissenschaft oft sogar durch eigens filr diese Zwecke in Auftrag gegebene Gutachten - zu untermauern. Außerdem dürfen die Wirkungen des personellen Austauschs sowie persönlicher Kontakte zwischen Angehörigen von Universitäten und sonstigen Forschungseinrichtungen auf der Seite und politischen Parteien, Bürokratie und Verbänden auf der anderen Seite nicht unterschätzt werden. 5.3.5 Politisch-ökonomisches Umfeld
"The consumer movement is a creature of its environment. It has flourished under the right conditions, yet it has been nearly invisible when out of vogue. Its current structure and recent history show again that its effectiveness and strength are beyond its own control." 188 Als letzte Komponente des politisch-ökonomischen Modells der Verbraucherpolitik ist das Umfeld zu analysieren. Im Verlauf der Untersuchung theoretischer und praktizierter Verbraucherpolitik hat sich gezeigt, daß ein relativ wenig bedeutsamer Politikbereich wie die Verbraucherpolitik in besonderem Maße von Entwicklungen "von außen" mitbestimmt wird und die verbraucherpolitischen Konzeptionen entsprechend stark von den jeweils vorherrschenden wirtschaftspolitischen (Gesamt-)Konzeptionen geprägt sind. Im folgenden sollen die bereits vorgestellten zyklischen Entwicklungsabläufe im politisch-ökonomischen Prozeß (Produktlebenszyklus öffentlicher Güter und Entwicklungsphasen der Regulierung) in einen Zusammenhang mit dem gesamtwirtschaftlichen Konjunkturzyklus gestellt sowie weitere Determinanten aus der verbraucherpolitischen Umwelt untersucht werden.
188 RICHARDSON, S. L., 1986, S. 17.
406
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer Ansatze
Der politische Produktlebenszyklus ist anscheinend eng mit der ökonomischen Gesamtsituation verknüpft, die sich in Form von Konjunkturzyklen abbilden läßt. Da sich in Zeiten des konjunkturellen Aufschwungs und im Boom die Finanzierungslage der öffentlichen Haushalte entschärft und damit die politischen Handlungsspielräume wachsen, besitzen dann auch die verhältnismäßig schwachen Verbraucherinteressen höhere Durchsetzungschancen, wenn sich Politiker wegen bevorstehender Wahlen der Sache annehmen. Die zweite Phase des Produktlebenszyklus (Expansionsphase des politischen Gutes) wird deshalb häufig in die Zeit des konjunkturellen Aufschwungs fallen. Entsprechend ist zu erwarten, daß die späten "Marktphasen" des politischen Gutes (Reifeund Rückbildungsphase) im konjunkturellen Abschwung liegen. Auch beim Gut "Verbraucherschutz" gibt es Anlaß zu der Vermutung, in Zeiten der Rezession und fiskalischer Engpässe sei es politisch opportun und auch durchsetzbar, wegen der damit verbundenen Kosten rur den Staat und die Unternehmen sowie angeblich investitionshemmender Wirkungen einen Abbau der Regulierung einzuleiten. 189 Entsprechende Aktivitäten konnten bei krisenhafter Entwicklung der Staatsfmanzen in der Verbraucherpolitik nahezu aller untersuchten Länder beobachtet werden. Die Krisenthese von Owen und Bräutigam schließlich versucht, im Zeitablauf zunehmende Regulierung mit dem Auftreten von Krisensituationen zu erklären. l90 Dieser Behauptung liegen zwei Annahmen zugrunde. Zum einen neige der Wähler dazu, bestehende Staatseingriffe als legitim anzusehen, was in "normalen" Zeiten, d. h. bei Abwesenheit von Krisen, zu einem relativ stabilen Regulierungsniveau fUhre. Von Zeit zu Zeit komme es aber zu Krisensituationen, in denen allgemein erkennbare Mißstände einen verstärkten politischen Druck erzeugten, auf den der Staat mit zusätzlicher Regulierung reagiere. Da die neuen staatlichen Eingriffe nach Überwindung der Krise nicht (oder nur unvollständig) beseitigt würden, steige insgesamt die Regulierungsdichte an. Als 189 Vgl.
SCHATZ, H., 1984, S. 224, und REICH, N., 1984, S.lIO.
Vgl. OWEN, B., und BRÄUTIGAM, R., The Regulation Game. A Strategie Use ofthe Administration Proeess, Cambridge 1978, und WEIZSACKER, C. C. von, 1982, S. 337 f. 190
5. Politisch-ökonomische Ansdtze
407
Musterbeispiel einer solchen Entwicklung können Branchenkrisen infolge eines strukturellen Wandels angesehen werden, in denen immer wieder der Ruf nach dem Gesetzgeber laut wird. Die Krisenthese der positiven Regulierungstheorie erinnert insofern an die Entwicklungsgesetze und Theorien zur Erklärung der wachsenden Staatsausgaben in der fmanzwissenschaftlichen Literatur. 191 Auch die Geschichte der Verbraucherpolitik zeigt, daß die Gründung von Verbraucherverbänden und die Einfilhrung neuer Verbraucherschutzregelungen häufig ein besonderes Problembewußtsein erfordern, das erst durch spezielle Anstöße entsteht. Als Störungen können spektakuläre Lebensmittel- oder Arzneimittelskandale (z. B. die Olivenöltragödie in Spanien 1981, Thalidomidefall 1962)192 oder aufsehenerregende Buchveröffentlichungen 193 in der Vergangenheit angesehen werden. Insofern bestehen Verbindungslinien zur Krisentheorie der Regulierung. Allerdings ist nicht davon auszugehen, daß der Ausbau des Verbraucherschutzes bzw. die zu beobachtenden "Wellen" der Verbraucherbewegung allein durch derartige Einzelereignisse eingeleitet werden. Nach Tiemstra fallen die Glanzzeiten der Verbraucherbewegung jeweils in Perioden, die durch einen allgemeinen Verfall im Ansehen der Wirtschaft gekennzeichnet sind. 194 Diese empirisch schwer belegbare Behauptung betont den Stellenwert eines filr die Umsetzung neuer verbraucherpolitischer Regelungen günstigen Umfeldes. Als mögliche Ursachen eines solchen Imageverlustes der Anbieter, der mit einem verstärkten Mißtrauen der Konsumenten einhergeht, werden eine ansteigende Konzentration wirtschaftlicher Macht (Fusionswellen), 195 Innovationsschübe bei Produkten, Technologien und Marketingpraktiken sowie schwierige ökonomische Bedingungen genannt. Die Durchsetzungschancen von Verbraucherinteressen scheinen dann in einem allgemein günstigen Klima filr Reformen erheblich anzusteigen, zumal in 191 Als kurzer Überblick vgl. PEFFEKOVEN, R., 1992, S. 506-509. 192 Vgl. zur "disturbance theory" als Erklärung rur das Entstehen von Verbrauchergruppen FORBES, J. D., 1987, S. 235-237.
193 Vgl. die Beispiele bei KUHLMANN, E., 1990, S. 24 f. 194 Vgl. TIEMSTRA, J. P., 1992, S. 13 f., und S. 22-24. 195 Vgl. ebenda, S. 13 f.
408
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer Ansdtze
dieser Situation eine erhöhte Kompromißbereitschaft der Unternehmen zu erwarten ist, die einen weiteren Ansehensverlust mit noch ungünstigeren Konsequenzen vermeiden möchten. 196 In Deutschland fiel die Zeit größter Aufmerksamkeit rur die Verbraucherpolitik in den 70er Jahren in eine solche Periode. Dazu paßt insbesondere der Versuch, die Verbraucherpolitik mit sehr weitgehenden Forderungen nach tiefgreifenden strukturellen Umgestaltungen einer scharf kritisierten Anbieterseite zu verbinden (Investitions lenkung). Auch in den USA kann die Ausbildung des Consumerism Ende der 60er Jahre gleichzeitig z. B. mit dem Erstarken der Bürgerbewegung gegen Rassismus, einer zunehmenden Kritik am Vietnamkrieg und dem Höhepunkt einer Fusionswelle in der Wirtschaft kaum als zufällig bewertet werden. 197 Die beschriebenen Auswirkungen des politisch-ökonomischen Umfeldes auf die Verbraucherpolitik sind aber nicht nur als Erklärungskomponente rur den Auf- und Ausbau von Verbraucherbewegung und Verbraucherschutz geeignet. Ist bereits ein sehr hoher Stand der Regulierung erreicht, kann infolge sozialer oder politischer Störungen bzw. unter krisenhaften ökonomischen Bedingungen eine gegenläufige Entwicklung einsetzen. Wenn die Mehrheit der Wähler beginnt, an der Leistungsfähigkeit des Staates zu zweifeln, die Forderung nach einem Abbau staatlicher Interventionen erhebt und eine umfassende Deregulierung politisch durchsetzbar wird, bleibt auch die Verbraucherpolitik davon nicht ausgenommen. Als wichtige Einflußgröße der Verbraucherpolitik aus dem politisch-ökonomischen Umfeld sind schließlich Entwicklungen im Ausland zu nennen. So haben günstige Bedingungen rur den Aufund Ausbau des Verbraucherschutzes den Vereinigten Staaten in diesem Bereich eine Führungsrolle verschaffi, die das Einbringen von Verbraucherschutzthemen in den politischen Prozeß anderer Staaten gefördert hat. Zu Beginn der 80er Jahre waren es erneut die USA, in denen zuerst Deregulierungstendenzen auftraten, die mit entsprechender Verzögerung in westeuropäischen Ländern 196 Vgl. ebenda, S. 24 f. 197 Vgl. ebenda, S. 12.
5. Politisch-ökonomische Ansdtze
409
aufgegriffen wurden. Einen steigenden Einfluß auf die Ausgestaltung nationaler Verbraucherpolitik haben auch die von den Mitgliedstaaten umzusetzenden Richtlinien der Europäischen Union. 5.4 Zusammenschau der Komponenten
Die vorgestellten politisch-ökonomischen Ansätze haben eine Vielzahl von möglichen Einflußfaktoren aufgezeigt, die auf den Untersuchungsgegenstand dieser Studie einwirken und ohne deren Berücksichtigung jede Theorie der Verbraucherpolitik unvollständig bleiben muß. Mit den angesprochenen verbraucherpolitischen Akteuren und ihrer unterschiedlichen Interessenlage, den politischen Organisationen und Entscheidungsmechanismen werden auf der einen Seite Sachverhalte angeschnitten, die einer Durchsetzung von Verbraucherinteressen im Wege stehen. Auf der anderen Seite wurden Bedingungen erkannt, die vermutlich einem verstärkten Verbraucherschutz ilirderlich waren oder sind. Da die einzelnen Überlegungen zu unterschiedlichen Ergebnissen fUhren können, ist es erforderlich, möglichst viele Komponenten des politischökonomischen Systems zu erfassen. Bei der Konzentration auf nur einen oder wenige Aspekte würde die Analyse - wie in der Literatur eindrucksvoll demonstriert - Gefahr laufen, ein ausgewogenes Urteil zu verfehlen. Die Darstellung und Auswertung der Bausteine des Modells, wie sie bisher hintereinander erfolgt ist, bildet allerdings nur einen ersten Schritt hin zu einer "ökonomischen Theorie der Verbraucherpolitik".
In einem zweiten Schritt sollte eine Zusammenschau durchgefUhrt werden, um den vielfältigen Interdependenzen zwischen den Komponenten Rechnung zu tragen. So werden beispielsweise wechselseitig beeinflussende Informationen zwischen Verbänden, Regierung, Bürokratie und Wissenschaft ausgetauscht, und es bestehen personelle Verflechtungen und Abhängigkeiten zwischen den politischen Akteuren. Eine Untersuchung von Schubert entspricht weitgehend der Forderung, bisher noch nebeneinander stehende Teilansätze in einer umfassenderen politisch-ökonomischen Analyse zusammenzuftlhren. 198 Die Studie versteht sich als kritische Auseinandersetzung und Weiterentwicklung von Olsons 198 Vgl. SCHUBERT, K., 1989.
410
D. Verbraucherpolitisch bedeutsame Impulse weiterer Ansätze
ökonomischer Theorie der Verbände und stellt dabei einen direkten Bezug zur Verbraucherpolitik her. 199 Schubert baut auf der Grundüberlegung Olsons auf, daß spezielle Interessen gegenüber allgemeinen Interessen Organisationsvorteile besitzen. Um genauere Aussagen über die tatsächlichen Einflußmöglichkeiten organisierter Interessen in realen politischen Systemen treffen zu können, sei es aber ebenso erforderlich, die vorhandenen, d. h. in der historischen Situation entstandenen, Organisationsstrukturen von Interessen in die Betrachtung einzubeziehen. 2OO Vereinfachend werden zwei Typen von Organisationsstrukturen unterschieden: Eine integrierte Interessenvertretung liegt vor, wenn z. B. das Verbraucherinteresse nur von einem einzigen (oder einem dominierenden) Verband vertreten wird. Eine fragmentierte Struktur dagegen besteht, wenn zahlreiche Verbände, Organisationen und Gruppen existieren, die entweder miteinander konkurrieren, nur Teile des Interesses vertreten, regional begrenzt sind oder auf verschiedenen politischen Ebenen agieren. Über die Struktur der Interessenvertretung (und damit den Rahmen der Olsonschen Analyse) hinaus wird in dieser Arbeit auch das politisch-administrative System - mit anderen Worten die Komponente Bürokratie - berücksichtigt, dem gegenüber diese organisierten Interessen durchzusetzen sind. Analog lassen sich hier integrierte Systeme (z. B. eine Verbraucherschutzbehörde oder ein Verbraucherministerium) und fragmentierte Strukturen (Verteilung der verbraucherpolitischen Kompetenzen auf mehrere Ministerien, Behörden und Ebenen) unterscheiden. Die jeweiligen Strukturen sind mit bestimmten Vor- und Nachteilen verbunden. Kleineren fragmentierten (dezentralen) Einheiten wird nachgesagt, daß sie administrative Aufgaben schneller, flexibler und effizienter bewältigen können, dafilr aber übergreifende Zusammenhänge vernachlässigen, was Externalitäten verursachen kann. Große, integrierte (zentrale) Einheiten dagegen sind 199 Durchgefilhrt wird bei Schubert eine vergleichende Analyse des Bankensektors (spezielle Interessen) und der Verbraucherpolitik (allgemeine Interessen) jeweils in der Bundesrepublik Deutschland und in den USA. 200 Vgl. ebenda, S. 37-48.
5. Politisch-ökonomische Ansätze
411
besser geeignet für übergreifende Problem lösungen, jedoch organisatorisch unbeweglicher, vermutlich ineffizienter und verursachen höhere Kosten. Entscheidend für die Durchsetzungsfähigkeit von Interessen im politischen Prozeß sei nun, welche Strukturen von Interessenvertretung und Bürokratie aufeinandertreffen. Schubert gelangt auf diese Weise zu einem Schema von insgesamt vier verschiedenen Interaktionsstrukturen zwischen den relevanten Akteuren (vgl. Abbildung 17), auf deren Grundlage dann weitere Überlegungen angestellt werden. 201 So wird die Hypothese aufgestellt, daß die Durchsetzungschancen von Interessen dort höher sind, wo sich die Strukturen auf beiden Seiten ähneln (Komplementarität der strukturellen Bedingungen). Das prinzipiell niedrige Einflußpotential von allgemeinen Interessen wie dem Verbraucherinteresse könne möglicherweise durch eine integrierte Organisationsstruktur erhöht werden. Das höhere Einflußpotential einer integrierten Interessenorganisation könnte aber tendenziell wieder reduziert werden, falls es auf ein fragmentiertes politisches System stößt. Die einzelnen Hypothesen sind zunächst spekulativ und nicht alle unmittelbar nachvollziehbar. Begrüßenswert ist jedoch, daß sie hinreichend konkret sind, um eine empirische Überprüfung durchzuführen. Zusammenfassend soll festgehalten werden, daß politische Faktoren für das Verständnis theoretischer wie auch praktizierter Verbraucherpolitik wichtig und grundsätzlich der ökonomischen Methodik zugänglich sind. Eine wirkungsvolle Verbraucherpolitik ist dauerhaft nur dann realisierbar, wenn sie von vornherein das politische Kräfteverhältnis zwischen den Handlungsträgern berücksichtigt. Der Ausbau und die Zusammenführung vorhandener politisch-ökonomischer Ansätze zu einer "ökonomischen Theorie der Verbraucherpolitik" verbessern die Kenntnisse der relevanten Wirkungszusammenhänge in diesem Politikbereich. Dies kann dazu genutzt werden, vorhandene Funktionsdefizite aufzuzeigen und zu bekämpfen, um insgesamt zu einer gleichmäßigeren Berücksichtigung aller beteiligten Interessen beizutragen.
201 Vgl. ebenda, S. 48-53. 28 MitropouJos
- -
fragmentiert
integriert
Organisierte Interessenvermittlung
i
i
j
!
;
I
!
I
Etatistische Steuerung staatliche Konfliktregulicrung Routinisierung von Problemlösungen Verrechtlichung
Korporatistische Steuerung kooperative Politikformulierung Verfestigung von Problemlösungen Immobilismus der Interessenberücksichtigung
",,,,"ort
r--
I
I ._. . -
._
-
_.~
-
.
Inkrementalistische Steuerung spontane Koordination ZufltIligkeit von Problemlösungen Verselbstllndigung von Entwicklungen
--_.
Selbststeuerung pluralistisches Aushandeln Privatisierung von Problemlösungen Partikularismus
_
..
fragmentiert
Politisch-administrative Problemverarbeitung
Abbildung 17: Interaktionsstrukturen der Regulierung bei Schubert
I
~
~
~ :... ::.
~.
'"~
~
...
~
~
s::
~ !:>
~
t
~ ~
t:
ti-
~
!::l
;::; """
E. Fazit
1. Vorbemerkungen In diesem letzten Teil der Untersuchung werden aus den bisherigen Ergebnissen - der Analyse bestehender verbraucherpolitischer Konzeptionen, der verbraucherpolitischen Praxis in ausgewählten Ländern sowie neuerer ökonomischer Ansätze - Anregungen ft1r eine Weiterentwicklung verbraucherpolitischer Konzeptionen gesammelt und dazu genutzt, eine eigene Konzeption zu skizzieren. Dabei wird zwischen Ergebnissen grundsätzlicher Art, die auf einer allgemeineren Ebene verbleiben, und speziellen Ergebnissen in Form von konkreten, politisch umsetzbaren Vorschlägen unterschieden. Eine verbraucherpolitische Konzeption sollte durch Aussagen zu den Merkmalen Situationsanalyse, verbraucherpolitische Ziele, ordnungspolitische Prinzipien und verbraucherpolitische Methoden gekennzeichnet sein. Da es sich um eine Teilkonzeption handelt, wurde als weiteres Merkmal die Einordnung in die wirtschaftspolitische (Gesamt-)Konzeption eingeftlhrt. 1 Wie deutlich wurde, ist das Spektrum verbraucherpolitischer Konzeptionen in der Literatur weitgehend ausgeftlllt, so daß aus der Wissenschaft kaum völlig neue Konzeptionen zu erwarten sind. Deshalb ist beabsichtigt, speziell die liberal-marktwirtschaftlich geprägten, nicht jedoch die stärker wohlfahrtsstaatlichen Varianten durch die folgenden Ausftlhrungen zu aktualisieren und weiterzuentwickeln. Als Ausgangspunkt kann dabei das liberale Wettbewerbs- und Informationsmodell dienen. 2. Ergebnisse grundsätzlicher Art 2.1 Einordnung in die Gesamtkonzeption
Die im folgenden skizzierte verbraucherpolitische (Teil-)Konzeption versteht sich als integrativer Bestandteil der Gesamtkonzeption "Soziale Marktwirtschaft", die als bewährtes wirtschaftspolitisches Leitbild ftlr die Bundesrepublik Deutschland weithin anerkannt ist. Diese Konzeption gründet auf der Zielvorstellung, "das Prinzip der Freiheit auf dem Markte mit dem des sozialen 1 Vgl. S. 4-18 dieser Arbeit.
28·
414
E. Fazit
Ausgleichs zu verbinden"2 . Aus dieser Grundidee lassen sich die beiden wesentlichen Komponenten der Sozialen Marktwirtschaft herauslesen: eine liberale Komponente, nach der das wirtschaftliche Geschehen primär der wettbewerblichen Marktsteuerung anvertraut werden soll, die allerdings eine Rahmensetzung erfordert und staatlich zu sichern ist; und eine soziale Komponente, nach der eben diese Marktsteuerung im Interesse sozialer Zielsetzungen eine Ergänzung durch staatliche Wirtschaftspolitik erfilhrt. 3 Im Verlauf der Analyse wurde festgestellt, daß ein verhältnismäßig kleiner Teilbereich wie die Verbraucherpolitik in besonderem Maße den Veränderungen in der allgemeinen Wirtschaftspolitik folgt und damit zu zyklischen Entwicklungverläufen neigt. So zeigte sich in allen betrachteten Ländern nach einer anhaltenden Phase des Auf- und Ausbaus des Verbraucherschutzes bis hin zu einer in den 70er Jahren vorherrschenden wohlfahrtsstaatlichen Gestaltung seit Anfang der 80er Jahre eine Tendenz zu einer stärker marktwirtschaftlich-liberalen Ausprägung.
Zwar schlagen sich diese Beobachtungen in der Praxis schon wissenschaftlich in Form betont interventionskritischer Konzeptionen nieder. Interpretierbar als Überreaktion auf einen wachsenden Interventionismus im Verbraucherschutz laufen diese allerdings Gefahr, "über das Ziel hinauszuschießen", indem sie einen übersteigerten Abbau von Regulierung und institutionellen Strukturen anregen, der dann möglicherweise auch bewährte Lösungen einschließt. Dies ist insbesondere im Zuge weiter um sich greifender fmanzieller Engpässe zu befilrchten. Eine stärkere Orientierung an der Sozialen Marktwirtschaft kann einen Beitrag zur Verstetigung der Verbraucherpolitik leisten, da diese gemäßigt liberale Konzeption sowohl interventionistischen Bestrebungen in diesem Politikfeld entgegensteuern als auch einem Aktionismus in umgekehrter Richtung vorbeugen kann. Allen Beteiligten, die sich bisher mit komplexen und sich häufig ändernden Regelungen auseinanderzusetzen haben, könnten durch eine 2 MüLLER-ARMAcK, A.,
1966, S. 243. 3 Vgl.
Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik, Freiburg
beispielsweise ZOHLNHÖFER, W., 1985, S. 7-11.
2. Ergebnisse grundsdtzlicher Art
415
Bestandsaufnahme, die im Ergebnis einen Bodensatz tätsächlich notwendiger verbraucherpolitischer Aktivitäten offenbart, der langfristig zu verbessern ist, verläßlichere Handlungsgrundlagen bereitgestellt werden. Dies gilt nicht nur fUr die Konsumenten, die sich heute kaum noch einen Überblick über ihre Verbraucherschutzrechte und Informationsangebote verschaffen können, sondern auch und vor allem fUr die Anbieter mit ihrem berechtigten Interesse an möglichst frühzeitig bekannten und langfristig kalkulierbaren Pflichten sowie daraus resultierenden Belastungen. 2.2 Situationsanalyse und verbraucherpolitische Ziele
Die gegenwärtige verbraucherpolitisch relevante Ausgangslage kann keinesfalls mehr als der weitgehend verbraucherpolitikfreie Raum verstanden werden, mit dem sich noch die frühen Konzeptionen konfrontiert sahen. Die aktuelle Situation ist vielmehr von einer Vielzahl verbraucherpolitischer Regelungen und Aktivitäten, Institutionen und Handlungsträgern geprägt, die einer auf mittlerweile langjährige Erfahrungen in diesem Politikbereich gestützten Beurteilung zugänglich sind. Wie im Verlauf der Untersuchung deutlich geworden sein sollte, sind einzelne Störungen des Marktmechanismus zum Nachteil der Verbraucher nicht auszuschließen. Besonders die Informationsökonomik weist auf individuelle Informationsmängel als verbraucherpolitisches Kernproblem hin, das unter ungünstigen Bedingungen zu wettbewerblichen Funktionsdefiziten fUhrt. Dies darf aber keinesfalls mit einem fundamentalen und umfassenden Wettbewerbsversagen verwechselt werden, zumal die Empirie fUr die Funktionsfähigkeit der überwiegenden Mehrzahl der Güter- und Dienstleistungsmllrkte spricht. Wettbewerb ist insoweit durch Verbraucherschutz ergänzungsbedürftig, aber auch ergänzungsfähig durch eine den Grundprinzipien der Sozialen Marktwirtschaft verpflichtete Verbraucherpolitik. Nach der These vom "Produktlebenszyklus öffentlicher Güter" läßt sich fUr den Verbraucherschutz Mitte der 90er Jahre eine relativ späte Phase konstatieren, die - nicht zuletzt wegen des mittlerweile beachtlichen Schutzniveaus - durch eine sich abschwächende öffentliche und politische Aufmerksamkeit gekennzeichnet
416
E. Fazit
ist. Eine zeitgemäße verbraucherpolitische Konzeption muß dieser Situation, in der es nicht mehr nur um einen weiteren Ausbau von Regulierung gehen kann, Rechnung tragen, indem sie Kostenaspekte und mögliche Funktionsdefizite auch im politischen Prozeß berücksichtigt. 4 Der Konsument ist weder als stets umfassend informiertes Wirtschaftssubjekt anzusehen, das ohne jede Unterstützung von staatlicher Seite seine Interessen gegenüber der Anbieterseite durchzusetzen in der Lage ist, noch als ein generell hilfsbedürftiger und unterlegener Teilnehmer am Marktgeschehen. Aufgrund unterschiedlicher Begriffsinhalte, vor aber wegen der realitätsfemen Prämissen sollte sich die wissenschaftliche Verbraucherpolitik endgültig vom Verbraucherleitbild der Konsumentensouveränität und von den der neoklassischen Theorie entnommenen Vorstellungen wie vollständiger Information oder polypolistischer Marktstrukturen verabschieden. Funktionsfllhiger Wettbewerb erfordert ein Mindestmaß an leistungsbedingter (kompetitiver) Marktmacht als Voraussetzung fUr vorstoßenden Wettbewerb, der eine Quelle von Innovation und damit von Produktverbesserungen ist. Entsprechend ist Abstand zu nehmen vom Ideal des rational handelnden, streng nutzenmaximierenden Verbrauchers (homo oeconomicus) zugunsten eines realitätsnahen Konsumentenbildes, das Erkenntnisse der verhaltenswissenschaftlichen Forschung (z. B. die beschränkte Informationsverarbeitungskapazität)S nutzt und anstelle eines Optimierungskalküls nur von allgemeinen Vorteilsüberlegungen ausgeht. Die Erhaltung der Wettbewerbsordnung ist als wirtschaftspolitisches (Ober-)Ziel zu begrüßen, da hiermit der Bezug zur Gesamtkonzeption hergestellt, die liberale Komponente der Sozialen Marktwirtschaft betont sowie der ergänzende Charakter verbraucherpolitischen Handelns anerkannt wird. Die oberste verbraucherpolitische Zielsetzung läßt sich dann - bewußt allgemein gehalten -
4 Vgl.
die politisch-ökonomischen Ansätze in Teil D, Kap. 5, S. 385-417.
S Vgl.
Teil B, Kap. 3.2.3, S. 41-54.
2. Ergebnisse grundsdtzlicher Art
417
damit umschreiben, daß die als teilweise schwach eingestufte Position der Verbraucher auf dem Markt zu verbessern sei. 6 Als hinreichend für die praktische Ausgestaltung verbraucherpolitischer Methoden werden die zwei verbraucherpolitischen (Unter-)Ziele "Verbesserung der Markttransparenz" und "Interessenausgleich zwischen Verbrauchern und Anbietern" gesehen wobei der in der Literatur zuweilen ideologisch behaftete Begriff Machtausgleich bewußt ausgetauscht wurde. Der Rückgriff auf diese beinahe schon als traditionell zu bezeichnende Zielformulierung ist zwar nicht sonderlich originell, dafür aber um so praktikabler. Mit der "Verbesserung der Markttransparenz" wird die asymmetrische Informationsverteilung als hauptsächliche verbraucherpolitische Problemursache angemessen gewürdigt. Daneben sollte als Ziel der "Interessenausgleich" zwischen beiden Marktseiten gestellt werden, wodurch nicht zuletzt die Grenzen verbraucherpolitischen Handelns abgesteckt werden. So ist zwar die Notwendigkeit gewisser verbraucherpolitischer Eingriffe unbestreitbar, um die Position des Konsumenten zu verbessern. Dies sollte aber nicht - und hier kommt die Distanz zur Konsumentensouveränität zum Ausdruck - auf dessen maximal möglichen Einfluß abzielen, sondern auf einen Ausgleich mit den oftmals entgegengesetzten Anbieterinteressen. Verbraucherpolitik darf, mit anderen Worten, eine für den Konsumenten nachteilige Situation nicht in ihr Gegenteil umkehren, indem sie eine einseitige (Über-)Belastung der Anbieter verursacht - die sich sowieso letztlich, z. B. in Form von Preiserhöhungen oder einem eingeschränkten Angebot, zu Lasten der Verbraucher auswirken kann. Eine Ausweitung der Handlungs- und Entschließungsfreiheit einzelner Wirtschaftssubjekte, der allgemein eine positive Wirkung auf das Marktergebnis nachgesagt wird, stößt nämlich stets dort an ihre Grenzen, wo die wirtschaftliche Freiheit anderer Marktteilnehmer beeinträchtigt wird. 6 Dies entspricht der pragmatischen Formulierung von Kroeber-Riel, der es als verbraucherpolitisches Oberziel ansieht, "die Konsumenten besser als bisher in die Lage zu versetzen, durch den Kauf von Gütern ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen". Vgl. KROEBER-RIEL, W., S. 97, sowie S. 46 f. dieser Arbeit.
418
E. Fazit
2.3 Beurteilungskriterien für verbraucherpolitische Methoden
Zunächst werden Beurteilungskriterien für die Wahl des wirtschaftspolitischen Mitteleinsatzes vorgestellt, wie sie die theoretische Wirtschaftspolitik diskutiert.' Indem mehrere dieser Kriterien in geeigneter Reihenfolge auf ein wirtschaftspolitisches Instrument bezogen werden, gelangt man zu einem vereinfachten, aber für die Praxis hilfreichen Prüfschema in mehreren Stufen, das uneingeschränkt auch auf das verbraucherpolitische Instrumentarium anwendbar ist. 8 Für die Eignung eines verbraucherpolitischen Mittels sind nacheinander dessen Wirksamkeit, Konzeptkonformität, Effizienz und schließlich politische Durchsetzbarkeit zu untersuchen. Beinahe selbstverständlich ist die Forderung, daß die gewählten Methoden grundsätzlich geeignet sein müssen, zur Lösung verbraucherpolitischer Probleme und damit zur Erreichung der gesetzten Ziele beizutragen. Diese erste Prüfung führt aber zunächst nur zu einer recht groben Auswahl an denkbaren, zweckmäßigen Maßnahmen. Weiterhin sollten die Methoden hinsichtlich ihrer ordnungspolitischen Zulässigkeit (Konzeptionskonformität) hinterfragt werden. Anknüpfend an die in dieser Arbeit immer wieder erhobene Forderung einer Einordnung der Verbraucherpolitik in die Gesamtkonzeption soll die Kompatibilität mit der Sozialen Marktwirtschaft gewährleistet sein. Die Beurteilung der Konformität hängt insbesondere von der Dosierung und der jeweiligen wirtschaftspolitischen Situation ab. In diesem zweiten Schritt sollte zumindest darauf geachtet werden, daß die wettbewerbliehe Selbststeuerung so gering wie möglich beeinträchtigt wird. Dies ist insbesondere durch die Wahl von Interventionen geringer Eingriffsintensität zu erwarten. In Befolgung dieses Kriteriums sollte der Verbraucherin, Vgl. dazu beispielsweise: STREIT, M. E., Theorie der Wirtschaftspolitik, 4. Auflage, Düsseldorf 1991, S. 265-275. 8 Die Idee, verbraucherpolitische Interventionen nach verschiedenen Gesichtspunkten auszuwählen, ist nicht neu. Schon Theisen nennt als Beurteilungskriterien ordnungspolitische Zulässigkeit, Effizienz und Organisierbarkeit. Vgl. THEISEN, W., Möglichkeiten und Grenzen des Konsumentenschutzes in der Sozialen Marktwirtschaft, Diss. Universität Köln 1967, S. 72-89.
2. Ergebnisse grundsätzlicher Art
419
formation und -beratung sowie der eher langfristig orientierten Erziehung und Bildung der Konsumenten als Instrumente mit vergleichsweise geringer Eingriffsintensität gegenüber dem rechtlichen Verbraucherschutz der Vorzug gegeben werden. Der Mitteleinsatz soll nicht nur wirksam, sondern auch wirtschaftlich erfolgen. Dies erfordert, neben dem Nutzen der Intervention im Sinne eines Beitrags zur verbraucherpolitischen Zielerreichung auch deren unerwünschte Nebenwirkungen und Kosten, z. B. in Form einer Verletzung anderer wirtschaftspolitischer Ziele, zu berücksichtigen. So sind gerade in Zeiten, in denen das Kostenbewußtsein der Öffentlichkeit steigt, Bemühungen um eine verstärkte Kostentransparenz zu begrüßen. Dabei ist es wichtig, über die direkten Kosten, die in der Regel den öffentlichen Haushaltsplänen zu entnehmen sind, hinauszugehen. Auch wenn es häufig nicht gelingt, indirekte Kosten der Intervention zu quantifizieren, dürfen sie nicht aus der Analyse ausgeschlossen werden. Hier ist vor allem an den durch Verbraucherschutzmaßnahmen verursachten Aufwand auf der Anbieterseite zu denken, an den Nutzenentgang der Konsumenten durch erhöhte Preise oder eine reduzierte Produktauswahl sowie an regulierungsbedingte Folgekosten für Durchsetzung und Gerichtsbarkeit. Der Effizienzgedanke wird aber nur als eines von mehreren Beurteilungskriterien verwendet, nicht aber als alleiniger Maßstab verabsolutiert. 9 Um dem verbraucherpolitischen Ziel eines Interessenausgleichs zwischen den Beteiligten gerecht zu werden, ist deshalb nicht nur die absolute Höhe, sondern auch die Verteilung der Kosten auf Staat, Anbieter und Verbraucher entscheidungsrelevant. Als letztes Kriterium ist die Durchsetzbarkeit im politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozeß zu untersuchen. Die vorgestellten politisch-ökonomischen Ansätze und der Versuch, sie in Richtung einer "ökonomischen Theorie der Verbraucherpolitik" auszubauen, zeigen dazu eine Reihe von Ansatzpunkten auf. 10 Um zeitaufwendige und ressourcenverzehrende politische Verfahren zu vermeiden, in deren Verlauf eine prinzipiell geeig9 Die war einer der Hauptkritikpunkte rur die Ablehnung der Konzeption der ökonomischen Analyse des Rechts. Vgl. Teil B, Kap. 3.4.2, S. 84-96. 10 Vgl. Teil D, Kap. 5, S. 385-417.
420
E. Fazit
nete Intervention absehbar zu scheitern droht, sollte von vornherein die politische Bedingungskonstellation, insbesondere das Kräftespiel der beteiligten Interessengruppen, beachtet und gegebenenfalls eine "second-best"-Lösung angesteuert werden. 2.4 Verbraucherpolitik im weiteren und im engeren Sinne
Im Rahmen der wirtschaftspolitischen Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft wird eine Zweiteilung der verbraucherpolitischen Methoden ftlr sinnvoll erachtet, die es ermöglicht, sich in mehreren Schritten dem eigentlichen verbraucherpolitischen Problembereich zu nähern. Danach kann zwischen einer Verbraucherpolitik im weiteren und im engeren Sinne unterschieden werden. Im Vorfeld der üblichen verbraucherpolitischen Instrumente lassen sich wirtschaftspolitische Aktivitäten identifizieren, deren überragende Bedeutung ft1r den Konsumentenschutz die Bezeichnung "Verbraucherpolitik Lw.S." rechtfertigt. Dazu werden die Aufrechterhaltung und Förderung des Wettbewerbs, insbesondere eine Politik gegen Wettbewerbsbeschränkungen, sowie die Unterstützung der "Selbstheilungskräfte" des Marktmechanismus gezählt. In der Literatur wird in diesem Zusammenhang manchmal allerdings mit unterschiedlichem Inhalt - von Rahmenbedingungen gesprochen. I I Die Verbraucherpolitik Lw.S. erhält ihren Stellenwert dadurch, daß durch ihre erfolgreiche Durchftlhrung die herkömmliche Verbraucherpolitik zwar nicht überflüssig wird, der verbleibende Handlungsbedarf aber erheblich reduzierbar ist. Dies würde eine Konzentration der diesem Politikfeld zur Verftlgung stehenden knappen Ressourcen auf die eigentlichen verbraucherpolitischen Problembereiche erlauben. Da diese Maßnahmen ganz wesentlich auf die wettbewerbliche Steuerung des Marktgeschehens setzen, können sie der "liberalen" Komponente der Sozialen Marktwirt11 Eine ähnliche Einteilung findet sich bei SCHOLTEN, S., Die ordnungspolitische Dimension der Verbraucherpolitik in der Sozialen Marktwirtschaft, in: PIEPENBROCK, H. (Hrsg.),Verbraucherpolitik in der Sozialen Marktwirtschaft. Hier wird der "ordnungspolitische Rahmen" der Verbraucherpolitik recht weit ausgelegt, umfaßt er neben der Weubewerbspolitik doch auch die "Sicherung der ökonomischen Basis" (Stabilitätspolitik) und weite Bereiche der Rechtsordnung. Vgl. S. 102-108.
2. Ergebnisse grundslJtzlicher Art
421
schaft zugerechnet werden. Zumindest soweit besteht Übereinstimmung mit Vorstellungen, die Verbraucherpolitik als Bestandteil der Ordnungspolitik anzusehen. Eine stufenweise Konkretisierung des verbraucherpolitischen Handlungsbedarfs hat sich zunächst der Frage zu stellen, was der Wettbewerb alleine zu leisten vermag. Die Suche nach Bedingungen, unter denen Wettbewerb funktionsfähig ist, und zwar auch und vor allem verstanden als dynamisches Phänomen, das Evolution ermöglicht ("Wettbewerb als Entdeckungsverfahren"), schärft den Blick rur die Bedeutung von Regelungen, die vor der eigentlichen Verbraucherpolitik ansetzen. Wenn auch eine genaue Abgrenzung kaum möglich erscheint, so läßt sich doch ein Basissatz an (teilweise uralten) elementaren Regeln der Moral feststellen, die (auch) dem Verbraucherschutz dienen. Dazu zählen beispielsweise Maße und Gewichte sowie Vorstellungen über die "guten Sitten" wirtschaftlichen Handelns. Unmittelbar dem Schutz des Wettbewerbs und der Bekämpfung seiner mannigfaltigen Beschränkungen hat sich die Wettbewerbspolitik verschrieben. Da eine Politik gegen Wettbewerbsbeschränkungen und gegen unlauteren Wettbewerb den Interessen der Verbraucher entspricht, sollte sie in engem Zusammenhang mit der Verbraucherpolitik gesehen werden. Wettbewerbspolitik und Verbraucherpolitik sind aber deshalb keinesfalls als gleichgewichtig zu betrachten. Da ein erfolgreicher Schutz des Wettbewerbs viele verbraucherpolitische Aktivitäten entbehrlich macht, kann letzteren lediglich ergänzender Charakter beigemessen werden. Im Bereich der Verbraucherpolitik hat sich die Informationsproblematik als der zentrale Aspekt eines möglichen Wettbewerbsversagens herauskristallisiert. Speziell die Screening- und SignalingDiskussion der Informationsökonomik hilft herauszufmden, welche Probleme der Wettbewerb selbst zu bewältigen vermag und wo verstärkt mit informationsbedingtem Wettbewerbsversagen zu rechnen ist. 12 Die Betonung der Selbstregulierungspotentiale sollte jedoch nicht - im blinden Vertrauen auf die "unsichtbare Hand" des Marktes - zur Rechtfertigung staatlicher Untätigkeit verleiten. 12 Vgl. S. 342-345 dieser Arbeit.
422
E. Fazit
Gerade diese marktmäßigen Mechanismen in Form von Informationsaktivitäten der Wirtschaftssubjekte bei Qualitätsunsicherheit stellen vielmehr weitere wichtige Ansatzpunkte für staatliches Eingreifen im Vorfeld der eigentlichen Verbraucherpolitik dar, besonders wenn sie zunächst nur begrenzt funktionsfiihig sind. Die Bedeutung einer staatlichen Förderung marktinterner qualitätssichernder Signale wurde in diesem Zusammenhang vermutlich bisher noch zu wenig beachtet. Aufgabe der politischen Entscheidungsträger ist es hier vor allem, den Beteiligten auf beiden Seiten des Marktes geeignete Rahmenbedingungen und Ameize anzubieten, innerhalb derer sie diese erwünschten Informationsaktivitäten entfalten. Wo Wettbewerbspolitik und Selbstheilungskräfte des Marktes nicht ausreichen, setzt das eigentliche verbraucherpolitische Instrumentarium des Staates an. Dieser Verbraucherpolitik i. e. S. können als grobe Kategorien die Verbraucherinformation und -beratung, die Verbraucherbildung und -erziehung sowie der rechtliche Verbraucherschutz zugerechnet werden. Davon zu trennen sind die (Förderung der) Verbraucherorganisation(en) und die Selbstregulierung, die in erster Linie eine Verlagerung eben dieser Aufgaben auf andere als die staatlichen Akteure bezwecken und damit allgemein die Frage nach den Handlungsträgern aufwerfen. Es können Anhaltspunkte genannt werden, auf welche (Problem-)Bereiche der Einsatz des verbraucherpolitischen Instrumentariums bevorzugt abzielen sollte. Sowohl die informationsökonomische GüterklassifIkation als auch die Einteilung der Kaufprozesse aus der Verhaltenswissenschaft haben sich in diesem Zusammenhang als brauchbar erwiesen. Sie lenken die Aufmerksamkeit der Verbraucherschützer zum einen auf Güter mit hohem Anteil an Erfahrungs- und vor allem Vertrauensgütereigenschaften, zum anderen auf die bisher vernachlässigten impulsiven, habituellen und vereinfachten Kaufentscheidungen. Gerade die verhaltenswissenschaftlich orientierte Verbraucherpolitik ist zudem geeignet, durch eine Unterscheidung verschiedener Käufertypen besonders hilfsbedürftige Konsumentengruppen zu identifIzieren und diese in den Mittelpunkt der staatlichen Aktivitäten zu stellen. \3 \3 Vgl. S. 44 f. und S. 336-339.
2. Ergebnisse grundsätzlicher Art
423
Wettbewerbliche Problemfelder weisen in der Regel auch auf verbraucherpolitisch sensible Bereiche hin. So rechtfertigen die sogenannten wettbewerblichen Ausnahmebereiche ("natürliche" oder staatlich geschützte Monopole) einschließlich der öffentlichen Dienstleistungen von Behörden wegen der eingeschränkten Wahlmöglichkeiten einen besonderen Schutz der Konsumenten. Auch die Marktphasenbetrachtung kann rur verbraucherpolitische Zwecke herangezogen werden. Sie lenkt die Aufinerksamkeit zum einen auf frühe Phasen im Produktlebenszyklus, da bei neuen Gütern die Konsumenten noch unerfahren sowie die verbraucherschutzrechtlichen Regelungen noch unvollständig oder unausgereift sein könnten, zum anderen auf späte Marktphasen, in denen die Anbieter auf stagnierenden Märkten zunehmend unter Druck geraten und deshalb stärker zu wettbewerbsbeschränkenden Verhaltensweisen neigen. 2.5 Träger der Verbraucherpolitik
Das Subsidiaritätsprinzip als grundlegendes marktwirtschaftliches Gestaltungskriterium überträgt zunächst jedem Wirtschaftssubjekt selbst die Pflicht, seine Probleme eigenverantwortlich zu lösen. Erst wenn und soweit dies nicht möglich ist, kann es Aufgabe staatlicher Instanzen sein, "Hilfe zur Selbsthilfe" anzubieten, die Eigeninitiative fördert, nicht aber hemmen soll. Dies führt zu einer klaren Betonung des Individualprinzips. Sind die einzelnen Konsumenten nicht selbst in der Lage, eine politisch als solche eingeschätzte - unbefriedigende Situation zu ändern, muß aber noch nicht der Staat direkt eingreifen. Im Rahmen der marktwirtschaftlichen Steuerungsmechanismen können den organisierten Interessen auf beiden Marktseiten selbstregulierende Funktionen zufallen bzw. von seiten des Staates bewußt übertragen und gegebenenfalls (z. B. fmanziell) gefördert werden. Ist der im öffentlichen Bereich verbleibende verbraucherpolitische Handlungsbedarf geklärt, sind schließlich die verbraucherpolitischen Aufgaben den verschiedenen Ebenen des Staates zuzuweisen. Dazu können einige Tendenzaussagen über eine sinnvolle Zuweisung von verbraucherpolitischen Instrumentenkategorien zu verschiedenen staatlichen Handlungsträgern abgeleitet werden. 14
424
E. Fazit
Herausragendes Kriterium rur die staatliche Aufgabenverteilung ist (wiederum) das Subsidiaritätsprinzip. Es vermutet "grundsätzlich die Aufgabenkompetenz bei der untersten Ebene. Nur wenn diese nicht imstande ist, eine Aufgabe zu übernehmen, oder die höhere Ebene diese Aufgabe besser wahrnehmen kann" 15, soll auf die nächsthöhere Ebene verlagert werden. Dies ftlhrt zu der Vermutung, daß die innerhalb der Verbraucherpolitik so zentralen Informations- und Beratungsangebote, also jene Instrumente, die unmittelbar beim Nachfrager ansetzen, besser dezentral zu gewährleisten sind. Bei lokalen Verbraucherberatungsstellen ist nicht nur anzunehmen, daß die entsprechenden Dienstleistungen durch den direkten Kontakt genauere Kenntnisse über die konkreten Probleme und Informationsbedarfe der Verbraucher vor Ort und somit eine größere "Konsumentennähe" erlangen. Ein geringer Aufwand an Zeit- und Wegekosten sorgt auch rur die erwünschte Nutzung des Angebots durch die Zielgruppen. Weiterhin ist eine Zuweisung dieser "öffentlichen Güter" zu nachgeordneten Ebenen auch deshalb geeignet, da hier eine "Produktion" in kleinen Einheiten möglich ist. Anders dagegen stellt sich die Situation bei verbraucherpolitischen Maßnahmen dar, die auf die Anbieter gerichtet sind. Bei den anbieterseitigen Instrumenten, denen vor allem die rechtlichen Regelungen zum Schutz der Verbraucher zuzurechnen sind, sprechen Kostenüberlegungen rur eine Trägerschaft auf höherer Ebene. Ist beispielsweise die Aufgabenkompetenz ftlr Regelungen zur Produktsicherheit nicht der obersten Ebene eines föderativen Staatswesens zugewiesen, so kann daraus eine unterschiedliche Regelungsdichte mit voneinander abweichenden Mindestnormen resultieren, die bei wirtschaftlicher Verflechtung in Form von interregionalem bzw. internationalem Handel räumliche externe
14 Hierzu kann auch die finanzwissenschaftliche Theorie der staatlichen Aufgabenverteilung herangezogen werden. Vgl. z. B. PEFFEKOVEN, R., Artikel "Finanzausgleich I: Wirtschaftstheoretische Grundlagen", in: Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaft, Bd. 2, Stuttgart u.a. 1980, vor allem S. 610-615. 15 Ebenda, S. 610.
3. Spezielle Ergebnisse
425
Effekte verursacht. Insbesondere die - ob unbeabsichtigt oder bewußt aus protektionistischen Gründen geschaffenen - handelshemmenden Wirkungen unterschiedlicher Schutzniveaus, die mit erheblichen Wohlfahrtsverlusten (unvollständige Ausschöpfung der Vorteile internationaler Arbeitsteilung, Abstimmungsprobleme, Koordinationskosten) einhergehen können, lassen eine Regelung auf höherer Ebene wünschenswert erscheinen. Der grundsätzliche Konflikt zwischen Verbraucherschutzerfordernissen und offenen Märkten stellt sich insbesondere auf internationaler Ebene, wo die Notwendigkeit einer Kooperation ein Aufgabenfeld für internationale Organisationen bildet.
3. Spezielle Ergebnisse
Primäres Ziel dieser mehr grundsätzlich orientierten Untersuchung war es nicht, präzise Verbesserungsvorschläge für die Ausgestaltung der deutschen Verbraucherpolitik auszuarbeiten. Dies hätte zusätzlich eine gründliche Analyse auch der inländischen verbraucherpolitischen Situation erfordert. Dennoch können als Ergebnis der Studie einige Maßnahmen angeregt werden, die interessante und wünschenswerte Veränderungen in der Verbraucherpolitik der Bundesrepublik Deutschland aufzeigen. Sie sollten durch spezifische und empirisch fundierte Untersuchungen aufgegriffen und weiter konkretisiert werden. (1) Wie die Analyse der internationalen Praxis gezeigt hat, wird dem engen Zusammenhang zwischen Verbraucherpolitik und Wettbewerbspolitik zunehmend institutionell Rechnung getragen - selbst in solchen Ländern, die traditionell der Wettbewerbspolitik weniger Aufmerksamkeit geschenkt haben, wie den Niederlanden. Um den Interdependenzen zwischen beiden Politikbereichen stärker als bisher gerecht zu werden, wird auch für das verantwortliche deutsche Wirtschaftsministerium eine organisatorische Zusammenfassung empfohlen. Ebenso sollte geprüft werden, ob nicht - dem Beispiel des britischen OFT, der französischen DGCCRF und der USamerikanischen FTC folgend - die Tätigkeit des Bundeskartellamts sinnvoll auf Aufgaben des Verbraucherschutzes aus-
426
E. Fazit
geweitet und dadurch eine gemeinsame Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde geschaffen werden kann. (2) Mit aller Deutlichkeit wird auf den empirischen Befund hingewiesen, daß den organisierten Interessen sowohl auf Verbraucher- als auch auf Anbieterseite durchaus eine bedeutsame Rolle als verbraucherpolitische Handlungsträger zufallen kann. Wenn es in anderen Ländern privaten Verbraucherverbänden gelingt, vornehmlich gestützt auf die DurchfUhrung und Veröffentlichung vergleichender Güter- und Dienstleistungstests, sich ohne staatliche Unterstützung lebensflihig und damit weitgehend unabhängig zu etablieren, so ist dies auch fUr die deutsche Stiftung Warentest zu fordern. Von einzelnen, projektbezogenen Zuschüssen abgesehen, sollte sich der Staat aus diesem selbständig funktionsflihigen Sektor der Verbraucherinformation zurückziehen und seine ohnehin knappen fmanziellen Ressourcen auf andere Bereiche konzentrieren. (3) Um einem weiteren, vor allem in der deutschen Literatur immer wieder geäußerten Vorwurf entgegenzutreten, nämlich der fehlenden Selbstorganisation der Konsumenten, sollten Warentestorganisationen generell ihre Möglichkeiten ausschöpfen, sich zu Mitgliederverbänden zu entwickeln. So sollte speziell die Gelegenheit genutzt werden, aus dem Kreis Hunderttausender Zeitschriftenabonnenten interessierte Konsumenten als Mitglieder zu werben. Die Kopplung von Abonnement und Mitgliedschaft, die durch weitere (z. B. Beratungs-)Angebote zusätzlich an Attraktivität gewinnen kann, eröffnet die Möglichkeit, besonders engagierte Einzelpersonen fUr eine ehrenamtliche Verbraucherarbeit zu gewinnen. Leider konnten sich die deutschen Verbraucherorganisationen - allen voran die Stiftung Warentest, aber auch die Verbraucherzentralen der Länder - diesen Ideen bisher nicht öffnen. Im Gegensatz zu einflußreichen Verbänden im untersuchten Ausland verzichten sie damit auf zusätzliche Legitimation als "echte" Interessenvertretung der Konsumenten auch im politischen Prozeß. Außerdem könnte die Wirksamkeit der angebotenen Verbraucherinformationen und die Erreichbarkeit von Verbrauchern vermutlich noch erhöht wer-
3. Spezielle Ergebnisse
427
den, indem kommerzielle Methoden z. B. in der Ausgestaltung der Materialien und der Mitgliederwerbung verstärkt angewandt werden. (4) Eine Intensivierung der Selbstregulierung ist nicht nur auf seiten der Verbraucher, sondern insbesondere auf der Anbieterseite erfolgversprechend. Freiwillige Verhaltenskodizes als Substitute zu gesetzlichen Verbraucherschutznormen, branchenspezifische Schlichtungsstellen und die selbstregulierenden Mechanismen des "Signaling" sind zwar in Deutschland nicht unbekannt. Vergleiche mit entsprechenden Einrichtungen vor allem in Großbritannien, in den USA sowie den Niederlanden begründen aber den Verdacht, daß in der Bundesrepublik Deutschland auf diesem Gebiet noch erhebliche Potentiale brachliegen, deren Nutzung nicht zuletzt staatliche Impulse und Unterstützung erfordern würde. Damit alle ,diese Komponenten einer Selbstregulierung von einer möglichst großen Zahl von Konsumenten in Anspruch genommen werden können, sind neben ihrer reinen Institutionalisierung erhebliche Anstrengungen in puncto Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Schließlich wäre es zu begrUBen, wenn - nach amerikanischem Vorbild - auch in deutschen Großunternehmen Verbraucherabteilungen als unternehmensinterne Kontaktstellen fllr unzufriedene Käufer selbstverständlich würden. (5) Die (Förderung der) Selbstregulierung im Verbraucherschutz ist zwar kein Allheilmittel; in vielen Fallen ft1hrt sie aber zu akzeptablen Lösungen, da die Anbieter selbst oft schneller, problemnäher und kostengUnstiger verbrauchernachteilige Probleme beseitigen können. Dabei ist einer zweiseitigen Selbstregulierung, an der auch Vertreter der Verbraucher beteiligt sind, der Vorzug zu geben. Wie z. B. einige Beratungsgremien des Auslandes vorfllhren, können Vorstellungen von einem intensiveren Dialog beider Marktseiten sinnvoll durch unterschiedliche Formen von Konzertierungsinstanzen umgesetzt werden. Allerdings muß beachtet werden, daß jede Verlagerung verbraucherpolitischer Aufgaben vom Staat auf die Privaten fllr diese mit zusätzlichen Belastungen verbunden ist, die es möglichst zu kompensieren gilt. Auf der Anbieterseite kann dies idealerweise durch Entlastungen in 29 Mitropoulos
428
E. Fazit
Form einfacher, transparenter Bestimmungen im rechtlichen Verbraucherschutz geschehen. Aufgrund ihrer relativen Schwäche ist eine Beteiligung der Verbraucher an den Institutionen einer Selbstregulierung vermutlich von einer fmanziellen Unterstützung des Staates abhängig. (6) Als zentrale staatliche Aufgabe wird der Ausbau und die Unterhaltung eines umfassenden Netzes von lokalen Verbraucherberatungsstellen angesehen. Während die in der Regel besser informierte Mittelschicht ihre Informationsbedarfe häufig über Warentestzeitschriften und andere Quellen deckt, sind vor allem die Problemgruppen der Konsumentenschaft auf Beratungsangebote vor Ort angewiesen. Um eine zufriedensteIlende Nutzung dieser Einrichtungen zu gewährleisten, sind ein hoher Bekanntheitsgrad sowie eine flächendeckende Versorgung (gute Erreichbarkeit) erforderlich. Die bundesweite Verbreitung der deutschen Verbraucherberatungsstellen wird gegenwärtig diesen beiden Kriterien gerecht. Wie beispielsweise die kontinuierlich steigende Nachfrage nach Schuldnerberatung und die daraus resultierenden, oft monatelangen Wartezeiten verdeutlichen, bestehen aber - oder sind im Zuge knapper öffentlicher Mittel absehbar - Defizite in der armuts- und problemgruppenspezifischen Orientierung dieser Verbraucherarbeit. Hier könnte das Vorbild der britischen Citizen Advice Bureaux mit ihrer Koppelung von Verbraucherberatung und Sozialhilfefunktionen, wie auch einer umfangreichen Inanspruchnahme ehrenamtlicher Helfer richtungsweisend sein. Unabdingbar ist zudem eine enge Zusammenarbeit und Arbeitsteilung mit den - gegebenenfalls erst zu konstituierenden - privaten Verbraucherverbänden. Eindringlich muß vor weiteren Einschränkungen gerade in diesem wichtigen Bereich der Verbraucherpolitik gewarnt werden. Sind die einzelnen Verbraucherberatungsstellen der deutschen Verbraucherzentralen aufgrund fehlender fmanzieller Mittel nicht mehr in der Lage, ihren Auftrag zu erftlllen, ist zumindest mit entsprechenden Mehrausgaben anderer staatlicher Institutionen (z. B. Sozialämter, Gerichte) zu rechnen.
3. Spezielle Ergebnisse
429
(7) Schließlich werden in der Bundesrepublik Deutschland wichtige Ansatzpunkte gesehen, die Wettbewerbsfreiheit zugunsten der Konsumenten zu erhöhen. Beispielhaft sei hier auf die jahrzehntelange Diskussion über eine Liberalisierung der Ladenschlußzeiten, die Zulassung von Werbung speziell ftlr Freiberufler und generell von vergleichender Werbung genannt, die bislang erst teilweise zu einem verbraucherfreundlichen Ergebnis gebracht werden konnte. Weiterhin liegen in einer Deregulierung sogenannter wettbewerblicher Ausnahmebereiche noch große Potentiale rur eine BessersteIlung (auch) der Verbraucher. Gerade die Fortschritte ftlr den Konsumenten auf dem deutschen Telekommunikationsmarkt oder bei der Deutschen Bahn - sei es durch ein breiteres Angebot, einen besseren Service oder niedrigere Preise lassen auch entsprechende Anstrengungen der politisch Verantwortlichen in anderen stark regulierten Bereichen (z. B. Versorgungsindustrien, Post) wünschenswert erscheinen. Darüber hinaus sollte auch die internationale Dimension von Wettbewerb nicht vernachlässigt werden, kommt doch in der Regel eine Liberalisierung der Märkte nach außen den Verbrauchern zugute.
29"
Literaturverzeichnis AKERLOF, G. A., The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism, in: Quarterly Journal of Economics, Jg. 84 (1970), S. 488-500. AMERICA COUNCIL ON CONSUMER INTERESTS (Hrsg.), Annual Report 1992 - 1993, o. O. 1993. AMERICAN BAR ASSOCIATION (Hrsg.), Report of the ABA Commission to Study the Federal Trade Commission, o. O. 1969. ANDEL, N., Nutzen-Kosten-Analysen, in: ders. und HALLER, H. (Hrsg.), Handwörterbuch der Finanzwissenschaft, Bd. 1, 3. Auflage, Tübingen 1977, S. 475-518. ARN (Hrsg.), The Swedish National Board for Consumer Complaints, o. O. und o. J. ARNDT, H., Lehrbuch der Wirtschaftsentwicklung. Die Evolutorische Wirtschaftstheorie in ihrer Bedeutung fllr die Wirtschafts- und Finanzpolitik, 2. Aufl., Berlin 1994. ARROW, K. J., The Economics of Agency, in: PRATT, J. W., und ZECKHAUSER, R. J. (Hrsg.), Principals and Agents: The Structure ofBusiness, Boston 1985, S. 37-51. ARTHUIS, J., Verbraucherpolitik in Frankreich, in: HAUPT, H. und PIEPENBROCK, H. (Hrsg.), Verbraucherpolitik international, Köln 1988, S. 9-15. ASSOCIATION FOR CONSUMER RESEARCH (Hrsg.), 35th Annual Report 1991-92, o. O. BAER, W. J., At the Turning Point: The Commission in 1978, in: MURPHY, P. E., und WILKlE, W. L. (Hrsg.), Marketing and Advertising Regulation: The Federal Trade Commission in the 1990s, Notre Dame / Indiana 1990, S. 94-108. BARTLING, H., Leitbilder der Wettbewerbspolitik, München 1980. BARTLING, H., National unterschiedliche Produktstandards und Produkthaftungen unter außenwirtschaftlichem Aspekt, in: Jahrbuch fllr Sozialwissenschaft, Jg. 39 (1988), S. 145-157.
432
Literaturverzeichnis
BECK-FRIIS, J., How Consumer Disputes Are Dealt With in Sweden: The Swedish National Board for Consumer Complaints, in: JCP, Jg. 13 (1990), S. 477-482. BERG, H., Wettbewerbspolitik, in: Vahlens Kompendium der Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik, Bd. 2, 5. Aufl., München 1992, S. 241-300. BERNITZ, U., Market and Consumer Law, in: STRÖMHOLM, S. (Hrsg.), An Introduction to Swedish Law, Stockholm 1991, S.267-296. BEUC (Hrsg.), Annual Report 1992, BrUsse11993. BIERVERT, B., Zur Organisierbarkeit von Verbrauchern und ihren Interessen, in: NEUMANN, L. F. (Hrsg.), Sozialforschung und soziale Demokratie, Bonn 1979, S. 97-106. BIERVERT, B., Grundzüge der Verbraucherpolitik in der Bundesrepublik Deutschland, in: HANSEN, U. (Hrsg.), Marketing und Verbraucherpolitik, Stuttgart 1982, S. 43-53. BIERVERT, B., Entwicklungen und Perspektiven der Verbraucherpolitik aus der Sicht der Wissenschaft, in: Verbraucher 2000, Verbraucherpolitische Hefte Nr. 10, Stuttgart, Juli 1990, S. 9-20. BIERVERT, B., Was ist das Evolutorische, was das Ökonomische an der evolutorischen Ökonomik?, in: BIERVERT, B., und HELD, M., (Hrsg.), Evolutorische Ökonomik. Neuerungen, Normen, Institutionen, Frankfurt 1992, S. 216-230. BIERVERT, B., und FISCHER-WINKELMANN, W. F., Das verbraucherpolitische Instrumentarium, in: MATTHÖFER, H. (Hrsg.), Verbraucherforschung, Frankfurt 1977, S. 130-159. BIERVERT, B., FISCHER-WINKELMANN, W. F., und ROCK, R., Grundlagen der Verbraucherpolitik, Reinbek 1977. BIERVERT, B., und HELD, M., Das Evolutorische in der Ökonomik: Neuerungen - Normen - Institutionen. Eine Einftlhrung, in: dies. (Hrsg.), Evolutorische Ökonomik. Neuerungen, Normen, Institutionen, Frankfurt 1992, S. 7-22. BOCK, J., Verbraucherpolitik und Wirtschaftsordnung, in: BOCK, J., und SPEClIT, K. G. (Hrsg.), Verbraucherpolitik, Köln/Opladen 1958, S. 50-69.
Literaturverzeichnis
433
BÖHM, F., Das wirtschaftliche Mitbestimmungsrecht der Arbeiter im Betrieb, in: ORDO, Bd. 4 (1951), S. 21-250. BÖHM, F., Aufgaben der Verbraucherpolitik, in: Wirtschaft und Gesellschaft, Heft 5 (Schriftenreihe des Zentralverbandes deutscher Konsumgenossenschaften), Hamburg 1954, S. 23-39. BONUS, H., und WEILAND, R., Transaktionskosten und Gleichgewicht, in: WISU, Jg. 21 (1992), S. 340-348. BONUS, H., und WEILAND, R., Die Welt der Institutionen, in: DIECKHEUER, G. (Hrsg.), Beiträge zur angewandten Mikroökonomik, Jochen Schumacher zum 65. Geburtstag, BerlinlHeidelberg 1995, S. 29-52. BÖSSMANN, E., Volkswirtschaftliche Probleme der Transaktionskosten, in: ZgS, Jg. 138 (1982), S. 664-679. BOURGOINIE, T., und TRUBEK, D., Consumer Law, Common Markets and Federalism in Europe and the United States, Berlin, New York 1987. BRAULT, D., Pour un second souffle du mouvement consommateur, Paris 1989. BRENNAN, G., und BUCHANAN, J. M., Die Begründung von Regeln: konstitutionelle politische Ökonomie, Tübingen 1993 [original: The reason of roles. Constitutional political economy, Cambridge 1985]. BRITISCHE BOTSCHAFf BONN, Verbraucherschutz in Großbritannien, in: HAUPT, H., und PIEPENBROCK, H. (Hrsg.), Verbraucherpolitik International, Köln 1988, S. 16-22. BRUNE, H. G., Stärkung der kollektiven Verbraucherposition, in: SCHERHORN, G., 1975, S. 105-120. BSI (Hrsg.), Some Information about BSI and Consumer Representation, o. 0. und o. J. CALAIS-AULOY, J., Droit de la consommation, 3. Aufl., Paris 1992. CES-FACHGRUPPE UMWELTSCHUTZ, GESUNDHEITSWESEN UND VERBRAUCH, Anlage zu dem Entwurf einer Stellungnahme zum Thema "Dialog zwischen Lieferant und Verbraucher", Brüssel, 28.11.1993.
434
Literaturveneichnis
COASE, R. H., The Nature of the Finn, in: Economica, Jg. 4 (1937), S. 386-405. COASE, R. H., The Problem ofSocial Cost, in: Journal ofLaw and Economics, Jg. 3 (1960), S. 1-44. CONGRESSIONAL QUARTERLY INC. (Hrsg.), Federal Regulatory Directory, 6. Aufl., Washington 1990. CONSUMENTENBOND (Hrsg.), Jaarverslag Directie 1992, s' Gravenhage 1993. CONSUMENTENBOND (Hrsg.), The many faces of the Consumentenbond, o. J. und o. O. CONSUMER PRODUCT SAFETY COMMISSION (Hrsg.), Who we are, what we do ... , Washington 1988. CONSUMERS IN THE EUROPEAN COMMUNITY GROUP (Hrsg.), Annual Report 1993, London 1993. CONSUMERS UNION (Hrsg.), President's Report to the Membership ofthe Annual Meeting ofConsumers Union, o. 0.,16.10.1993. CONSUMERS' ASSOClATION (Hrsg.), Thirty Years of Which? Consumers' Association 1957-1987, London 1987. COUNCIL OF BETIER BUSINESS BUREAUS (Hrsg.), 1992, Annual Report, o. O. 1993. Cox, E., FELLMETII, R., und SCHULZ, J., The Nader Report on the Federal Trade Commission, New York 1969. CZERWONKA, C., und SCHÖPPE, G., Verbraucherpolitische Konzeptionen und Programme in der Bundesrepublik Deutschland, in: ZfW, Jg. 1 (1977), S. 277-288. CZERWONKA, C., und SCHÖPPE, G., Verbraucherberatung und -information: Einkaufshilfe, Rechtsberatung und sonst nichts? in: ROCK, R., und SCHAFFARTZIK, K.-H. (Hrsg.), Verbraucherarbeit: Herausforderungen ftlr die Zukunft. Dialog zwischen Praxis und Wissenschaft, Frankfurt 1983, S. 77-95. CZERWONKA, C., SCHÖPPE, G., und WECKBACH, S., Der aktive Konsument: Kommunikation und Kooperation, Göttingen 1976. DARBY, M. R., und KARNI, E., Free Competition and the optimal Amount of Fraud, in: Journal of Law and Economics, Jg. 16 (1973), S. 67-88.
Literaturverzeichnis
435
DAUMANN, F., Zur Notwendigkeit einer Hannonisierung im Gemeinsamen Markt. Eine evolutionstheoretische Untersuchung, Bayreuth 1993 [zugl. Diss. Univ. Bayreuth]. DAUNER-LIEB, B., Verbraucherschutz durch Ausbildung eines Sonderprivatrechts ft1r Verbraucher, Berlin 1983. DEIMER, K. u. a., BerUcksichtigung von Verbraucherinteressen bei staatlichen Anbietern, FrankfurtlMain 1984. DGCCRF (Hrsg.), Rapport d' Activite 1992, Paris 1993. DGCCRF (Hrsg.), Rapport d' Activite 1993, Paris 1994. DICHTL, E., und ISSING, O. (Hrsg.), Vahlens Großes Wirtschaftslexikon, Bd. 4, München 1987, Stichwort "Verbandspluralismus", S. 1916 f. DIETL, H., Institutionen und Zeit, Tübingen 1993. DOWNS, A., Inside Bureaucracy, Boston 1967. DoWNS, A., Ökonomische Theorie der Demokratie, Tübingen 1968 [original: An Economic Theory of Democracy, New York 1957]. DOWNS, A., Up and Down with Ecology - The "Issue-AttentionCycle", in: The Public Interest, No. 28 (Summer 1972), S. 38-50. DTI (Hrsg.), Consumer Protection in the UK, o. J. und o. O. DTI (Hrsg.), OECD Biennial Report 1991/92 (über die Verbraucherpolitik in Großbritannien). DUVALL, J. F., Die Verbraucherpolitik der Vereinigten Staaten von Amerika - aus der Sicht einer amerikanischen Beamtin, in: HAUPT, H., und PIEPENBROCK, H. (Hrsg.), Verbraucherpolitik international, Köln 1988, S. 23-40. EGGERSTEDT, H., Produktwettbewerb und Dienstleistungsfreiheit auf Versicherungsmärkten, Berlin 1987. EGNER, E., Grundsätze der Verbraucherpolitik in: Zeitschrift rur das gesamte Genossenschaftswesen (1956), wieder abgedruckt in: BIERVERT, B. u. a. (Hrsg.), Verbraucherpolitik in der Marktwirtschaft, Reinbek 1978, S. 11-52. EKLUND, P., The Effect ofthe EEA Agreement on Consumer Protection Interests in Sweden, in: JCP, Jg. 17 (1994), S. 123-133.
436
Literaturverzeichnis
ELSCHEN, R., Gegenstand und Anwendungsmöglichkeiten der Agency-Theorie, in: Schmalenbachs Zeitschrift rur betriebswirtschaftliche Forschung, Jg. 43 (1991), S. 1002-1012. ELSNER, W., Institutionen und ökonomische Institutionentheorie. Begriffe, Fragestellung, theoriegeschichtliche Ansätze, in: WiSt, Jg. 16 (1987), S. 5-14. ERHARD, L., Wohlstand ftlr alle, Düsseldorf 1957. EUCKEN, W., Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 4. Aufl., Tübingen 1968 (1. Aufl. 1952). FALKE, J., Perspektiven der Verbraucherpolitik im Europäischen Binnenmarkt, in: Verbraucher 2000, Verbraucherpolitische Hefte Nr. 10, Düsseldorf 1990, S. 35-58. FINSINGER, J., Verbraucherschutz auf Versicherungsmärkten. Wettbewerbsbeschränkungen, staatliche Eingriffe und ihre Folgen, München 1988. FISCHER, A, DGB-Verbraucherpolitik zwischen Anspruch und politischer Praxis, Frankfurt u. a. 1990. FISCHER, M., Agency-Theorie, in: WiSt, Jg. 24 (1995), S. 320-322. FISCHER, W. C., Verbraucherpolitik in Kalifornien, in: ZfV., Jg. 4 (1980), S. 30-43. FLEISCHMANN, G., Verbraucherpolitik, in: ISSING, O. (Hrsg.), Spezielle Wirtschaftspolitik, München 1982, S. 59-82. FORBES, J. D., The Consumer Interest. Dimensions and Policy Implications, London u. a. 1987. FREY, B. S., Umweltökonomie, 2. Aufl., Göttingen 1985. FRIEDMAN, M., und FRIEDMAN, R., Chancen, die ich meine, Berlin 1980 [original: Free to Choose, New York 1980]. FRITSCH, M. u. a., Marktversagen und Wirtschaftspolitik, Mikroökonomische Grundlagen staatlichen Handelns, München 1993. FRÖHLINGSDORF, J., Das neue spanische Verbraucherschutzgesetz, in: Recht der Internationalen Wirtschaft, Heft 2/1985, S. 99-104. FULOP, C., The Consumer Movement and the Consumer, London 1977.
Literaturverzeichnis
437
GÄFGEN, G., Entwicklung und Stand der Theorie der Property Rights: Eine kritische Bestandsaufnahme, in: NEUMANN, M. (Hrsg.), Ansprüche, Eigentums- und Verftlgungsrechte [Schriften des Vereins rur Socialpolitik, N. F., Bd. 140], Berlin 1984, S.43-62. GALBRAITH, J. K., American Capitalism. The Concept of Countervailing Power, 2. Aufl., Cambridge 1956 (1. Aufl. 1952). GEIDEL, R.-P., Der Sozial-Ökonomische Rat der Niederlande. Institutionalisierte Wahrnehmung organisierter Interessen, Diss. Universität Würzburg 1982. GEISSLER, B., Produkthaftung. Eine ökonomische Analyse unter Berücksichtigung wohlfahrtstheoretischer, wettbewerblicher und evolutorischer Aspekte, Würzburg 1993. GIBSON, L., Subsidiarity: The Implications for Consumer Policy, . in: JCP Jg. 16 (1993), S. 323-344. GIERSCH, H., Allgemeine Wirtschaftspolitik - Band 1: Grundlagen, Wiesbaden 1961. GROSSER, J., Der Transaktionskostenansatz der Neuen Institutionenökonomik: Versuch einer kritischen Verallgemeinerung, in: SEIFERT, E. K., und PRIDDAT, B. P. (Hrsg.), Neuorientierungen in der ökonomischen Theorie. Zur moralischen, institutionellen und evolutorischen Dimension des Wirtschaftens, Marburg 1995, S. 241-270. HAENSCH, G., und TüMMERS, H. J., Frankreich - Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, [Beck'sche Reihe Aktuelle Länderkunden, Bd. 831], München 1991. HÄNDEL, H., und FRIEDEL, 1., Großbritannien, 2. Aufl., München 1991 [Beck'sche Reihe Aktuelle Länderkunden, Bd. 835]. HANSEN, U., und SCHOENHEIT, 1., Consumer Affairs Departments: AReport on Their Development in the United States and Their Transferability to the Federal Republic of Germany, in: JCP, Jg. 9 (1986), S. 445-468. HANSEN, U., und STAUSS, B., Marketing und Verbraucherpolitik ein Überblick, in: HANSEN, U., STAUSS, B., und RIEMER, M. (Hrsg.), Marketing und Verbraucherpolitik, Stuttgart 1982, S.2-20.
438
Literaturverzeichnis
HARLAND, D., The United Nations Guidelines ftlr Consumer Protection, in: JCP, Jg. 10 (1987), S. 245-266. HARVEY, B. W., und PERRY, D. L., The Law of Consumer Protection and Fair Trading, 4. Aufl., London 1992. HAuSER, H., Qualitätsinformationen und Marktstrukturen, in: Kyklos, Jg. 32 (1979), S. 739-763. HAUTH, G., Verbraucherpolitik - trojanisches Pferd zur Systemveränderung? in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, Nr. 43 vom 28.10.78, S. 21-25. HAYEK, F. A. von, Bemerkungen über die Entwicklung von Systemen von Verhaltensregeln, in: ders., Freiburger Studien, Tübingen 1969, S. 144-160 [erstmals veröffentlicht als: Notes on the Evolution of Systems of Rules of Conduct, in: ders., Studies in Philosophy, Politics and Economics, London u. a. 1967, S.66-81]. HAYEK, F. A. von, Die Anmaßung von Wissen, in: ORDO, Bd. 26 (1975), S. 12-21. HEINBUCH, H., Theorien und Strategien des Verbraucherschutzesam Beispiel des Fernunterrichtschutzgesetzes, Frankfurt 1983. HEINEN, E., Determinanten des Konsumentenverhaltens - Zur Problematik der Konsumentensouveränität, in: KOCH, H. (Hrsg.), Zur Theorie des Absatzes, Wiesbaden 1973, S. 81-130. HENNINO-BODEWIG, F., und KUR, A., Marke und Verbraucher. Funktionen der Marke in der Marktwirtschaft, Band I: Grundlagen, Basel u. a. 1988. HENNINGSEN, B., Der Wohlfahrtsstaat Schweden, Baden-Baden 1986. HERDER-DoRNEICH, P., Politisches Modell zur Wirtschaftstheorie, Freiburg 1959 [zugl. Diss. Univ. Freiburg 1957]; zuerst erschienen unter dem Pseudonym F. 0. Harding. HERDER-DORNEICH, P., Neue Politische Ökonomie: Eine kurzgefaßte Hinftlhrung; Rückblick - Anwendung - Ausblick, BadenBaden 1992. HERHAUS, M., Methodologische Implikationen neuerer verbrauchertheoretischer Ansätze ft1r die praktische Verbraucherpolitik, Hannover 1989.
Literaturveneichnis
439
HESSE, G., Der Property-Rights-Ansatz. Eine ökonomische Theorie der Veränderung des Rechts?, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Bd. 195 (1980), S. 481-495. HIpPEL, E. von, Verbraucherschutz, 3. Aufl., Tübingen 1986. HIRsCHMAN, A. 0., Abwanderung und Widerspruch, Tübingen 1974 (original: Exil, Voice and Loyalty, CambridgelMass. 1970). HOLTFRERICH, c.-L., Wirtschaft USA: Strukturen, Institutionen und Prozesse, München 1991. HONDIUS, E. H., Consumer Legislation in the Netherlands, New York u. a. 1979. HONDIUS, E. H., Non-Legislative Means of Consumer Protection: The Dutch Perspective, in: JCP, Jg. 7 (1984), S. 137-156. HOPF, M., Informationen für Märkte und Märkte für Informationen, Frankfurt 1983. HOPPMANN, E., Zum Problem einer wirtschaftspolitisch praktikablen Defmition des Wettbewerbs, in: SCHNEIDER, H. K. (Hrsg.), Grundlagen der Wettbewerbspolitik, Berlin 1968, S. 9-49. HORN, M., KN!Eps, G., und MÜLLER, J., Deregulierungsmaßnahmen in den USA: Schlußfolgerungen für die Bundesrepublik Deutschland, Baden-Baden 1988. HUOELMAIER, W., Die neuere Praxis zur vergleichenden Werbung in Deutschland, Belgien, Frankreich, Großbritannien und USA, München 1991 [zug!. Diss. Univ. München 1990]. HÜNERBEIN, U. von, Der organisierte Verbraucher in der Europäischen Gemeinschaft, in: HAUPT, H., und PIEPENBROCK, H. (Hrsg.), Verbraucherpolitik international, Köln 1988, S. 93-116. INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION (Hrsg.), Rapport d'Activite 1992, Paris o. J. ISSING, 0., Investitionslenkung in der Marktwirtschaft, Göttingen 1975. KAAS, K. P., und FISCHER, M., Der Transaktionskostenansatz, in: WISU, Jg. 22 (1993), S. 686-693. KANTzENBACH, E., Die Funktionsflhigkeit des Wettbewerbs, 2. Aufl., Göttingen 1967.
440
Literaturverzeichnis
KATONA, G., Das Verhalten der Verbraucher und Unternehmer. Über die Beziehungen zwischen Nationalökonomie, Psychologie und Sozialpsychologie, Tübingen 1960, S. 57-61 [original: Psychological Analysis ofEconomic Behaviour, New York 1951]. KATONA, G., Die Macht des Verbrauchers, Düsseldorf, Wien 1962, S. 194 [orig.: The Powernd Consumer, New York 1960]. KAUFER, E., Theorie der öffentlichen Regulierung, München 1981. KAUTNER, K., Zur Notwendigkeit direkter Investitionslenkung im Rahmen einer Ex-Ante-Verbraucherpolitik, in: BIERVERT, B. u. a. (Hrsg.), Plädoyer ft1r eine neue Verbraucherpolitik, Wiesbaden 1978, S. 237-253. KEMPER, R., Verbraucherschutzinstrumente, Baden-Baden 1994 [zugl. Diss. Universität Münster 1993] . KENNEDY, J. F., Special Message to the Congress on Protecting the Consumer Interest, 15.03.1962, abgedruckt in: HIPPEL, E. von, 1986, S. 281-290. KIENER, S., Die Principal-Agent-Theorie aus informationsökonomischer Sicht, Heidelberg 1990 [zugl. Diss. Univ. Regensburg 1989]. KIRCHNER, C., Zum Transaktionskostenansatz, in: SCHLIEPER, U., und SCHMIDTCHEN, D. (Hrsg.), Makro, Geld & Institutionen: Beiträge zu einem Saarbrücker Symposium, Tübingen 1993, S.89-94. KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFfEN, Erstes Programm der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ft1r eine Politik zum Schutz und zur Unterrichtung der Verbraucher, Amtsblatt der EG Nr. C92 vom 25.04.1975. KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFfEN, Die Verbraucherorganisationen und der Staat, Luxemburg 1977. KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN, Zugang der Verbraucher zum Recht [Beilage 2/85 des Bulletins der Europäischen Gemeinschaften], Brüssel, Luxemburg 1985. KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFfEN, Zehn Jahre Verbraucherpolitik der Gemeinschaft. Ein Beitrag zum "Europa der Bürger", Luxemburg 1985a.
Literaturverzeichnis
441
KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN, Neuer Impuls. fllr die Politik zum Schutz der Verbraucher. Mitteilung der Kommission an den Rat, Luxemburg 1985b. KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN, Dreijähriger verbraucherpolitischer Aktionsplan fllr die EWG (1990-1992), BTUssel, 3.5.1990, KOM (90) 98 endg. KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN, Verbraucherpolitik im Binnenmarkt, 2. Ausgabe, Luxemburg 1991 [Reihe: Europäische Dokumentation, 11/1991]. KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN, GrUnbuch: Zugang der Verbraucher zum Recht und Beilegung von Rechtsstreitigkeiten der Verbraucher im Binnenmarkt, KOM (93) 576 endg., BTUssel, 16.11.1993. KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN, Verbraucherpolitik - Zweiter dreijähriger Aktionsplan der Kommission (1993-1995). Der Binnenmarkt im Dienst der europäischen Verbraucher. BTUssel, 28.7. 1993 (1993a), KOM (93) 378 endg. KONSUMENTVERKET / KO (Hrsg.), Das schwedische Amt fllr Verbraucherschutz, Vällingby o. O. und o. J. KONSUMENTVERKETIKO (Hrsg.), Vad Vi Gör 1993-94 (Jahresbericht), September 1993. KOOPMAN, J., Organisation der Vertretung der Verbraucherinteressen in den Niederlanden, in: HAUPT, H., und PIEPENBROCK, H. (Hrsg.), Köln 1988, S. 117-134. KROEBER-RIEL, W., Kritik und Neuformulierung der Verbraucherpolitik auf verhaltenswissenschaftlicher Grundlage, in: Die Betriebswirtschaft, Jg. 37 (1977), S. 89-103. KROEBER-RIEL, W., Konsumentenverhalten, 5. Aufl., MUnchen 1992. KRUSE, J., Informationspolitik fllr Konsumenten, Göttingen 1979. KUHLMANN, E., Verbraucherpolitik, MUnchen 1990. KUNZ, H., Marktsystem und Information. "Konstitutionelle Unwissenheit" als Quelle von "Ordnung", Tübingen 1985. LACHMANN, L. M., Wirtschaftsordnung und wirtschaftliche Institutionen, in: ORDO, Bd. 14 (1963), S. 63-77.
442
Literaturveneichnis
LAMBSOORFF, J. Graf, Adverse Selection und Moral Hazard, in: WISU, Jg. 23 (1994), S. 193 f. LAWLOR, E., Freie Auswahl und größeres Wachstum. Das Ziel der Verbraucherpolitik im Binnenmarkt '92, 2. Aufl., Brüssel, Luxemburg 1990. LEHMANN, M., Verbraucherschutz und Schutz des Schwächeren im Zivilrecht. Eine juristische und ökonomische Analyse, in: FINSINGER, 1., und SIMON, 1. (Hrsg.), Recht und Risiko: juristische und ökonomische Analysen, München 1988, S. 365-389. LEIPOLT, H., Die EG im Spannungsverhältnis zwischen Konsens und Effizienz, in: GRÖNER, H., und SCHÜLLER, A. (Hrsg.), Die europäische Integration als ordnungspolitische Aufgabe, Stuttgartu. a. 1993, S. 41-71. LENZEN, R., Verbraucherpolitik in der EG unter Berücksichtigung der Verbrauchererziehung, Frankfurt 1981a. LENZEN, R., Verbraucherbeiräte in Großbritanniens verstaatlichten Industrien: Ein Beispiel effektiver Verbrauchervertretung gegenüber Anbietem öffentlicher Güter und Dienstleistungen?, in: ZfV., Jg. 5 (1981 b), S. 244-256. LEONHAUSER, I.-U., Bedtlrfuis, Normen Und Standards: Ansätze fllr eine bedarfsorientierte Verbraucherpolitik, Berlin 1988. LESCHKE, M., Ökonomische Verfassungstheorie und Demokratie. Das Forschungsprogramm der Constitutional Economics und seine Anwendung auf die Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1993 [zugl. Diss. Univ. MUnster 1992). LOHMANN, H., Verbraucherschutz und Marktprozesse. Versuch einer institutionentheoretisch fundierten Erklärung von Marktregulierungen, Freiburg 1992. LÖPEZ SANCHES, M. A., Implementation of EEC Consumer Protection directives in Spain, in: JCP, Jg. 17 (1994), S. 83-99. MAGGS, P. B., Access to Justice for the Consumer in the USA, in: JCP, Jg. 13 (1990), S. 65 - 78. MAGGS, P. B., Recent Developments in Product Liability Law in the USA, in: JCP, Jg. 14 (1991), S. 29 - 33.
Literaturverze ichnis
443
MAGOULAS, G., Zur ökonomischen Analyse des Konsumentenschutzes - unter besonderer Berücksichtigung informations- und risikobezogener Probleme von Konsumentenmärkten, in: MAGOULAS, G., und SIMON, J., (Hrsg.), Recht und Ökonomie beim Konsumentenschutz und Konsumentenkredit, Baden-Baden 1985, S. 23-57. MÄHLING, F. W., Werbung, Wettbewerb und Verbraucherpolitik, München 1983. MAlER, L., Verbraucherpolitik, Bonn 1987. MAlER, L., Institutional Consumer Representation in the European Community, in: JCP, Jg. 16 (1993), S. 355-374. MAlER, L., Verbrauchervertretung in der europäischen Normung, in: ARBEITSGEMEINSCHAFT DER VERBRAUCHERVERBÄNDE (Hrsg.), Verbraucherrundschau Nr. 10-1111994, S. 18-25. MAYER, R. N., The Consumer Movement. Guardians of the Marketplace, Boston 1989. MEIER, B., Verbraucherpolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Theoretischer Bezugsrahmen, Bestandsaufnahme und Lückenanalyse, Frankfurt u. a. 1984. MEIER, K. J., The Political Economy of Consumer Protection: An Examination of State Legislation, in: The Western Political Quarterly, Jg. 40 (1987), S. 343-359. MEYER-DOHM, P., Sozialökonomische Aspekte der Konsumfreiheit, Freiburg 1965. MEYER-KRAHMER, F., Politische Entscheidungsprozesse und Ökonomische Theorie der Politik, Frankfurt 1979 [zugl. Diss. Univ. Frankfurt 1978]. MICKLITZ, H.-W., und WEATHERILL, S., Consumer Policy in the European Community: Before and After Maastricht, in: JCP, Jg. 16/1993), S. 285-32l. MINISTERlE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (Hrsg.), Consumer Policy in the Netherlands, Den Haag 1991. MINISTERlE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (Hrsg.), OECD-Report 1991-1992 (noch unveröffentlicht, 1993). MÜLLER, J., und VOOELSANG, 1., Staatliche Regulierung, BadenBaden 1979. 30 Miuopoulos
444
Literaturverzeichnis
MÜLLER-ARMACK, A., Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik, Freiburg 1966. NATIONAL ASSOCIATION OF CmZENS AOVICE BUREAU (Hrsg.), Working fllr Change, Annual Report 1992/93, o. O. NATIONAL ASSOCIATION OF CITIZENS AOVICE BUREAU (Hrsg.), Taking the Strain, Annual Report 1991192, o. O. NATIONAL CONSUMER COUNCIL (Hrsg.), Strategy Plan 1991, o. O. NATIONAL CONSUMER COUNCIL (Hrsg.) NCC Annual Report 1992,0.0.
NATIONAL FEOERATION OF CONSUMER GROUPS (Hrsg.), Annual Report 1992-3, o. O. NELSON, P., Infonnation and Consumer Behaviour, in: Journalof Political Economy, Jg. 78 (1970), S. 311-329. NEUHAUSER, G., Die wirtschaftspolitische Konzeption als Problem der theoretischen Wirtschaftspolitik, in: SERAPHIM, H. J. (Hrsg.), Zur Grundlegung wirtschaftspolitischer Konzeptionen, Berlin 1960, S. 23-58.
NISKANEN, W. A., Bureaucracy and Representative Government, Chicago 1971. NORTH, D. C., Theorie des institutionellen Wandels. Eine neue Sicht der Wirtschaftsgeschichte, Tübingen 1988 [original: Structure and Change in Economic History, New York 1981]. NORTH, D. C., Institutions, in: Journal of Economic Perspectives, Jg. 5 (1991), S. 97-112. NORTH, D. C., Institutionen, institutioneller Wandel und Wirtschaftsleistung, Tübingen 1992 [original: Institutions, Institutional Change and Economic Perfonnance, Cambridge 1990]. o. V., Britische Kohle ist privatisiert, in: FAZ vom 02.01.1995, S.9. o. V., Britische Wasserwerke in der Kritik, in FAZ vom 18.07.1994, S. 11.
o. V., Clark überrascht mit drastischen Ausgabenkürzungen, in: FAZ vom 01.12.1994, S. 18. o. V., Dark Days for Consumer Agencies, in: Consumer Reports, Mai 1993, S. 312 - 314.
Literaturverzeichnis
44S
o. V., Der neue Beratende Verbraucherrat ist eingesetzt, in: INFo-C, Infonnationen des Dienstes Verbraucherpolitik der Europäischen Kommission, Jg. 4 (Nr. 5/1994), S. 2. o. V., Die britischen Gleisanlagen stehen zum Verkauf, in: FAZ vom 30.11.1994, S. 27. o. V., Die französische Staatsschuld steigt auf 850 Milliarden DM, in: FAZ vom 09.07.1994, S. 12. o. V., Die niederländischen Regierungsparteien verlieren die Mehrheit in der zweiten Parlamentskammer, in: FAZ vom 04.04.1994, S. 1. o. V., Die Regierung Balladur wagt nicht die versprochenen Refonnen, in: FAZ vom 02.05.1994, S. 16. o. V., Dem britischen Finanzminister fehlen 15 Milliarden Pfund, in: FAZ vom 30.11.1993, S. 19. o. V., Englands privatisierte Monopole sind an der Preis-Kandare, in: FAZ vom 06.01.1994, S. 14. o. V., Erstes europäisches Verbraucherforum, in: INFO-C, Infonnationen des Dienstes Verbraucherpolitik der Europäischen Kommission, Jg. 4 (Nr. 6/1994), S. 9-11. o. V., Frankreich - Erlaß des Code de la Consommation, in: GRUR Int., 1994, S. 87. o. V., Großbritannien privatisiert die Züge und Loks von British Rail, in: FAZ vom 02.11.1994, S. 22. o. V., GD XXIV aus der Taufe gehoben!, in: INFO-C, Infonnationen der GD XXIV "Verbraucherpolitik" der Europäischen Kommission, Jg. 5 (Nr. 3/1995), S. 1. o. V., Holland bekommt flexible Ladenschlußzeiten, in: FAZ vom 20.12.1994, S. 11. o. V., In Schweden deutliche Zeichen ftlr eine wieder wachsende Wirtschaft, in: FAZ vom 26.09.1994, S. 18. o. V., Keine Privatisierung der Royal Mail, in: FAZ vom 05.11.1994, S. 13. o. V., Kok bildet sozial-liberale Regierung in Den Haag, in: FAZ vom 15.08.1994, S. 2.
30·
446
Literaturverzeichnis
o. V., Ladenschlußzeiten in England weitgehend freigegeben, in: FAZ vom 06.12.1994, S. 18. o. V., Parteitagsvotum in Schweden fllr die EU, in: FAZ vom 09.05.1994, S. 6. o. V., Refonn des Beratenden Verbraucherrates, in: INFo-C, Infonnationen des Dienstes Verbraucherpolitik der Europäischen Kommission, Jg. 4 (Nr. 2/1994), S. 5. o. V., Zwölf Jahre Amtszeit - eine Ära?, in: FAZ vom 04.05.1994,
S.7.
OECD (Hrsg.), Consumer Policy in OECD Countries 1983, Paris 1985. OECD (Hrsg.), International Trade and the Consumer, Report on the 1984 OECD Symposium, Paris 1986. OECD (Hrsg.), Consumer Policy in OECD Countries 1985-1986, Paris 1987. OECD (Hrsg.), Consumer Policy in OECD Countries 1987-1988, Paris 1990. OECD (Hrsg.), Consumer Policy in OECD Countries 1989-90, Paris 1993. OFFICE OF FAIR TRADING (Hrsg.), OFT Looking after Consumers and encouraging Competition, o. O. und o. J. OFFICE OF MANAGEMENT AND BUDGET, (Hrsg.), Budget of the United States Govemment, Fiscal Year 1994. OLSON, M., Die Logik des kollektiven Handelns, Tübingen 1968 [original: Tbe Logic of Collective Action, CambridgelMass. 1965]. OWEN, B., und BRÄUTIGAM, R., Tbe Regulation Game. A Strategie Use ofthe Administration Process, Cambridge 1978. PAQuE, K.-H., How far is Vienna from Chicago? An Essay on the Methodology of Two Schools of Dogmatic Liberalism, in: Kyklos, Jg. 38 (1985), S. 412-434. PEFFEKOVEN, R., Öffentliche Finanzen, in: Vahlens Kompendium der Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik, Bd. 1, 5. Aufl., München 1992, S. 481-560.
Literaturverze ichnis
447
PEFFEKOVEN, R., Artikel "Finanzausgleich I: Wirtschaftstheoretische Grundlagen", in: Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaften, Bd. 2, Stuttgart u.a. 1980, S. 608-636. PELTZMAN, S., Toward a More General Theory of Regulation, in: Journal ofLaw and Economics, Jg. 19 (1976), S. 211-240. PESTOFF, V. A., Exit, Voice and Collective Action in Swedish Consumer Policy, in: JCP, Jg. 11 (1988), S. 1-27. PESTOFF, V. A., Swedish Consumer Policy as a Welfare Service Organizations in a Negotiated Economy [Studies in Action and Enterprise, Department of Business Administration], Stockholm 1989. PESTOFF, V. A., Consumer Influence and Consumer Organization in the 1990s in Sweden, o. 0., Oktober 1992. PESTOFF, V. A., Towards a new Swedish Modell, in: HAUSNER, J. u. a. (Hrsg.), Institutional Frameworks of Market Economies, Scandinavian and Eastem European Perspectives, Brookfield 1993, S. 133-167. PETERSON, E., The United Nations and Consumer Guidelines, in: WHEELWRIGHf, T. (Hrsg.), Consumers, Transnational Corporations and Development, Sydney 1986, S. 343-351. POSNER, R. A., The Federal Trade Commisssion, in: University of Chicago Law Review, Jg. 37 (1969), S. 47-89. POSNER, R. A., Economic Analysis of Law, 2. Aufl. (1. Aufl. 1972), Boston 1977. PRATI, J. W., und ZECKHAUSER, R. 1., Principals and Agents: An Overview, in: dies. (Hrsg.), Principals and Agents: The Structure ofBusiness, Boston 1985, S. 1-35. PuBLIC CITIZEN (Hrsg.), Annual Report 1993, Washington. PÜTZ, T., Die wirtschaftspolitische Konzeption, in: SERAPIßM, H. J. (Hrsg.), Zur Grundlegung wirtschaftspolitischer Konzeptionen (Schriften des Vereins fUr Socialpolitik, N.F., Bd. 18), Berlin 1960, S. 9-21. PÜTZ, T., Grundlagen der theoretischen Wirtschaftspolitik, 4. Aufl., Stuttgart, New York 1979. QUIRK, P. J., Food and Drug Administration, in: WILSON, J. Q (Hrsg.), The Politics ofRegulation, New York 1980, S. 190-235.
448
Literalurverze ichnis
RAWLINGS, P., und WILLETI, C., Ombudsman Schemes in the United Kingdom's Financial Sector: The Insurance Ombudsman, the Banking Ombudsman, and the Building Societies Ombudsman, in: JCP, Jg. 17 (1994), S. 307-333. REICH, N., Markt und Recht, Darmstadt 1977. REICH, N., Staatliche Regulierung zwischen Marktversagen und Politikversagen. Erfahrungen mit der amerikanischen Federal Trade Commission und ihre Bedeutung fUr die Entwicklung des Verbaucherschutzrechtes, Heidelberg 1984. REICH, N., Diverse Approaches to Consumer Protection Philosophy, in: JCP, Jg. 14 (1992), S. 257-292. REICH, N., Europäisches Verbraucherschutzrecht. Binnenmarkt und Verbraucherinteresse, Baden-Baden, 1993. REICH, N., und MICKLITZ, H.-W., Consumer Legislation in the EC Countries. A Comparative Analysis, New York u. a. 1980. REICH, N., TONNER, K., und WEGENER, H., Verbraucher und Recht. Überholte Konzeptionen, Lücken und Mängel in wichtigen Verbrauchergesetzen und die Praxis der Rechtsprechung, Göttingen 1976. RICHARDSON, S. L., The Evolving Consumer Movement: Predictions for the 1990s, in: BLOOM, P. N., und SMITH, R. B. (Hrsg.), The Future ofConsumerism, LexingtonIMass. 1986, S. 17-22. RICHTER, R., Sichtweise und Fragestellungen der Neuen Institutionenökonomik, in: ZWS, Jg. 110 (1990), S. 571-591. RICHTER, R., Institutionen ökonomisch analysiert. Zur jüngeren Entwicklung auf einem Gebiet der Wirtschaftsstheorie, Tübingen 1994. RINGSTEDT, N., Die Organisation der Verbraucherinteressen in Schweden, in: HAUPT, H., und PIEPENBROCK, H. (Hrsg.), Verbraucherpolitik international, Köln 1988, S. 147-161. RINGSTEDT, N., OECD and Consumer Policy, in: JCP, Jg. 13 (1990), S. 267-475. ROSE, L. E., Consumer Protection in Skandinavia, in: GROTH, A. J., und WADE, L. L. (Hrsg.), Public policy across nations, Greenwich 1985, S. 151-180.
Lileraturverzeichnls
449
SAKOWSKY, D., Die Wirtschaftspolitik der Regierung Thatcher, Göttingen 1992 [zugleich Diss., Universität Göttingen 1990]. SAUER, M., Zur Abgrenzung der Verbraucherpolitik und ihren Zielen, in: PIEPENBROCK, H. (Hrsg.), Verbraucherpolitik in der Sozialen Marktwirtschaft [Schriftenreihe des Vereins fllr wirtschaftliche und soziale Fragen e. V. Stuttgart, Bd. 17], Bonn 1984, S.83-93. SCHACIITSCHABEL, H. G., Wirtschaftspolitische Konzeptionen, 3. Aufl., Stuttgart u.a. 1976. SCHATZ, H., Verbraucherinteressen im politischen Entscheidungsprozeß, Frankfurt 1984. SCHENK, K.-E., Die neue Institutionenökonomie - Ein Überblick über wichtige Elemente und Probleme der Weiterentwicklung, in: ZWS, Jg. 112 (1992), S. 337-378. SCHERHORN, G., Verbraucherinteresse und Verbraucherpolitik, Göttingen 1975. SCHERHORN, G., Realitätsfremdes Verbraucherbild oder konstruktive Utopie? in: Mitteilungsdienst der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Heft 3-4, Düsseldorf 1977, S. 32-34. SCIßLLING, J., Niederlande [Beck'sche Reihe Aktuelle Länderkunden, Bd. 817], München 1988. SCHMIDT, 1., Wettbewerbspolitik und Kartellrecht, 4. Aufl., Stuttgart u. a. 1993. SCHMIDT, 1., und RrITALER, J. B., Die Chicago-School of Antitrust Analysis. Wettbewerbstheoretische und -politische Analyse eines Credos, Baden-Baden 1986. SCHOLTEN, S., Die ordnungspolitische Dimension der Verbraucherpolitik in der Sozialen Marktwirtschaft, in: PIEPENBROCK, H. (Hrsg.), Verbraucherpolitik in der Sozialen Marktwirtschaft [Schriftenreihe des Vereins ft1r wirtschaftliche und soziale Fragen e.V. Stuttgart, Bd. 17], Bonn 1984, S. 95-119. SCHÖPPE, G., Consumer Protection by Law and Information: A View of Western German Practice and Experience, in: ZgS, Jg. 139 (1983), S. 545-567. SCHUBERT, K., Interessenvermittlung und staatliche Regulation, Opladen 1989.
450
Lite1'alurverzeichnls
SCHUMACHER, A., Unvollkommene Infonnation in der neoklassisehen Infonnationsökonomik und im evolutionsökonomischen Ansatz, Frankfurt a. M. u. a. 1994. SCHUMANN, J., Grundzüge der mikroökonomischen Theorie, 6. Aufl., Berlin 1992. SCHUMPETER, J. A., Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, 7. Auflage, Berlin 1987 [deutsche Erstausgabe 1911]. SCHUMPETER, J. A., Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, 4. Aufl., München 1975 [original: Capitalism, Socialism and Demokracy, New York 1942]. SCHWEDISCHES INSTITUT (Hrsg.), Tatsachen über Schweden: Die schwedischen Ombudsmänner, Januar 1993. SEIFERT, E. K., und PRIDDAT, B. P., Einleitung, in: dies. (Hrsg.), Neuorientierungen in der ökonomischen Theorie. Zur moralischen, institutionellen, evolutorischen und ökologischen Dimension des Wirtschaftens, Marburg 1995, S. 7-54. SELTER, G., Idee und Organisation des Konsumerismus, in: HANSEN, U., STAUSS, B., und RIEMER, M. (Hrsg.), Marketing und Verbraucherpolitik, Stuttgart 1982, S. 22-42 (Erstveröffentlichung des Aufsatzes in: Soziale Welt, Jg. 24 (1973), S. 185-205). SERVICES FINANCIERS, Budget Vote de 1993. SERVICES FINANCIERS, Budget Vote de 1994. SEWERIN, U., Transaktionskosten und Marktevolution: die Relevanz von Transaktionskosten und Transaktions-Ansatz tl1r dynamisch-evolutorische Wettbewerbstheorien, Bayreuth 1993 [zugl. Diss. Univ. Marburg 1993]. SHAPIRO, C., Consumer Protection in the United States, in: ZgS, Jg. 139 (1983), S. 527-544. SIMITIS, K., Verbraucherschutz, Schlagwort oder Rechtsprinzip?, Baden-Baden 1976. SIMON, H. A., A Behavioral Model of Rational Choice, in: Quarterly Journal ofEconomics, Jg. 69 (1955), S. 99-118. SINN, H. W., Verbraucherschutz als Problem asymmetrischer Infonnationskosten [Münchner wirtschaftswissenschaftliche Beiträge Nr. 6/88], München 1988.
Literaturveneichnl8
451
SMITH, A., Der Wohlstand der Nationen, 5. Aufl., München 1990, [original: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth ofNations, London 1776]. SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD (Hrsg.), The Social and Economic Council in the Netherlands, Den Haag o. J. SOLMSSEN, P. Y., Die Verbraucherpolitik der USA - aus Sicht eines Anwalts, in: HAUPT, H., und PlEPENBROCK, H. (Hrsg.), Verbraucherpolitik international, Köln 1988, S. 162-182. STATISTISCHES BUNDESAMT (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch 1993 ft1r die Bundesrepublik Deutschland, Wiesbaden 1993. STAUSS, B., Verbraucherinteressen: Gegenstand, Legitimation und Organisation, Stuttgart 1980. STIGLER, G. J., The Economics of Information, in: Journal of Political Economy, Jg. 69 (1961), S. 213-225. STIGLER, G. J., The Theory of Economic Regulation, in: Bell Journal ofEconomics, Jg. 2 (1971), S. 3-21. STIGLER, G., Can Regulatory Agencies Protect the Consumer, in: STIGLER, G., The Citizen and the State, ChicagolLondon 1975, S.178-188. STREIT, M. E., Theorie der Wirtschaftspolitik, 4. Aufl., Düsseldorf 1991. STRENlO, A. J., The FTC in 1988: Phoenix or Finis?, in: MuRPHY, P. E., und WILKlE, W. L. (Hrsg.), Marketing and Advertising Regulations: The FTC in the 1990s, Notre Dame I Indiana 1990, S.120-146. STURM, R., Großbritannien: Wirtschaft - Gesellschaft - Politik, Opladen 1991. SWEDISH INSTITUTE (Hrsg.), Fact Sheets on Sweden: Law and Justice in Sweden, Mai 1990. SWEDISH INSTITUTE (Hrsg.), Fact Sheets on Sweden: Swedish Consumer Policy, Januar 1993. SWOKA (Hrsg.), SWOKA and the Changing Consumer, o. o. und o. J.
452
Lileraturveneichnis
THEISEN, W., Möglichkeiten und Grenzen des Konsumentenschutzes in der Sozialen Marktwirtschaft, Diss. Universität Köln, 1967. THIELE, M., Neue Institutionenökonomik, in: WISU, Jg. 23 (1994), S. 993-997. THORELLI, H. B., und THORELLI, S. V., Consumer Information Handbook: Europe and North America, New York u. a. 1974. TIEMSTRA, J. P., Theories of Regulation and the History of Consumerism, in: International Journal of Social Economics, Jg. 19 (1992), S. 3-27. TIETZEL, M., Die Ökonomie der Property Rights: Ein Überblick, in: Zeitschrift fUr Wirtschaftspolitik, Jg. 30 (1981), S. 207-243. TREIS, M., Recht des unlauteren Wettbewerbs und Marktvertriebsrecht in Schweden, Köln u. a. 1991 [Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtschutz, Bd. 85, mgl. Diss. Universität München]. 1'uLLOCK, G., The Politics ofBureaucracy, Washington 1965. UNION FEDl~RALE DES CONSOMMATEURS (Hrsg.), UFC - Le Traitement des Litiges A L'UFC 1992 (Jahresbericht), 0:0. und o. J. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (Hrsg.), Fiche d' Identit6 de L' UNAF, Paris 1992. UNITED NATIONS, Report of the Secretary General of the United Nations, in: JCP, Jg. 16 (1993), S. 97-121. UNITED STATES OmCE OF CONSUMER AFFAIRS (Hrsg.), Consumer's Resource Handbook, 6. Aufl., Washington 1992. UUSITALO, L., Societal Change and Challenges for Consumer Policy, in: ZfV, Jg. 6 (1983), S. 149-160. VAHRENKAMP, K., Verbraucherschutz bei asymmetrischer Information. Informationsökonomische Analysen verbraucherpolitischer Maßnahmen, München 1991. VAN DEN BERGH, R., und LEHMANN, M., Informationsökonomie und Verbraucherschutz im Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, in: GRUR Int., 1992, S. 588-599.
Literawrverzeichnis
453
VEREINTE NATIONEN, Resolution Nr. 39/248 der Generalversammlung vom 09.04.1985 über Richtlinien ftlr den Verbraucherschutz, abgedruckt bei: HIPPEL, E. von, 1986, S. 485-493. VERENIGING ALTERNATIEVE KONSUMENTENBOND, Financieel Jaarverslag 1993, Amsterdam o. J. WAGNER, H., Einfllhrung in die Weltwirtschaftspolitik, München 1991. WEATHERILL, S., A General Duty to Supply only Safe Goods in the Community: Some Remarks From a British Perspective, in: JCP, Jg. 13 (1990), S. 79-89. WEBER, R. H., Wirtschaftsregulierung in wettbewerbspolitischen Ausnahmebereichen, Baden-Baden 1986. WEIBER, R., und ADLER, J., Informationsökonomisch begründete Typologisierung von Kaufprozessen, in: Schmalenbachs Zeitschrift ftlr betriebswirtschaftliche Forschung, Jg. 47 (1995), S.43-65. WEIZSÄCKER, C. C. von, Staatliche Regulierung - positive und normative Theorie, in: Schweizerische Zeitschrift ftlr Volkswirtschaft und Statistik, 1982, S. 325-343. WERNER, L., Verbraucherpolitik in der EG und OECD, in: HAUPT, H., und PIEPENBROCK H., (Hrsg.), Verbraucherpolitik international, Köln 1988, S. 183-199. WESSLING, E., Individuum und Information. Die Erfassung von Information und Wissen in ökonomischen Handlungstheorien, Tübingen 1991. WIDMAIER, H. P., Sozialpolitik im Wohlfahrtsstaat. Zur Theorie politischer Güter, Reinbek 1976. WIEKEN, K., Die Organisation der Verbraucherinteressen im internationalen Vergleich, Göttingen 1976. WILLIAMSON, O. E., Markets and Hierarchies, New York 1975. WILLIAMSON, O. E., Die ökonomischen Institutionen des Kapitalismus, Tübingen 1990 [original: The Economic Institutions of Capitalism, New York 1985]. WOLSING, T., Verbraucherarbeit als sozialpolitische Aufgabe, in: Theorie und Praxis der sozialen Arbeit, Nr. 1011984, S. 345-351.
454
Literaturverzeichnis
ZOHLNHÖFER, W., Die wirtschaftspolitische Willens- und Entscheidungsbildung in der Demokratie. Ansätze einer Theorie, Habilitationsschrift Universität Freiburg 1972 (unveröffentlicht). ZOHLNHÖFER, W., Das Steuerungspotential des Parteienwettbewerbs im Bereich staatlicher Wirtschaftspolitik, in: BOETICHER, E., HERDER DORNEICH, P., und SCHENK, K. E. (Hrsg.), Neue Politische Ökonomie als Ordnungstheorie, Tübingen 1981, S.82-102. ZOHLNHÖFER, W., Soziale Marktwirtschaft als Leitbild ftlr die Wirtschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland, in: DIEDERICH, H. u. a. (Hrsg.), Die Deutsche Bundespost im Spannungsfeld der Wirtschaftspolitik, Mainz 1985, S. 3-29. ZOHLNHÖFER, W., Von der Sozialen Marktwirtschaft zum Minimalstaat? Zur politischen Ökonomie des Wohlfahrtsstaates in: OROO, Bd. 43 (1992), S. 269-284.
ANHANG
Forschungsinstitut fUr Wirtschaftspolitik an der Univenitlt MaiD e. V
SURVEY: CONSUMER POLICY IN MARKET ECONOMIES CONCEPTIONS AND INTERNATIONAL PRACTICE
COMMISSIONED BY THE MINISTRY OF ECONOMICS OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
Institution:
Name: Position:
Telephone number:
For questions please contact: Dipl.-Volkswirt Stefan Mitropoulos Forschungsinstitut rur Wirtschaftspolitik an der Universitat Mainz e. V. 55099 Mainz Tel. 0 6131- 37 47 70 Telefax: 06131- 37 23 23
Anhang
456
Ifthe space is insufficient, please continue writing on the back ofthe paper. 1. Describe the development of consumer policy in your country in the past three years and estimate its future development: deercasing unehanged inercasing with average budget growth rate
inercasing above the budget average
In the past three yean: Amountofpublie expendirure on consumer poliey
0
Number of consumer policy measurcs
0
0
Amountofpublie expendirure on consumer poliey
0
0
Number of consumer poliey measurcs
0
0
0 0
0
future development:
0 0
0
List the most important institutional ehanges rcalized in the past thrce years or planned for the furure:
Anhang
457
2. Gin marks for tbe followiDglDstrumeDtal strategles, from 1 (most ImportaDt) to S (least ImportaDt), wbleb IDdleate tbe role tbe strategies ...
... play in eurrent consumer poliey (column a) ... will play in futurc consumer poliey (column b) ... should play in consumer poliey in your opinion (column e) column (a): till DOll'
column (b): ID future
column(e): OWD judgemeDt
give Marks from I to 5 in eaeh ease PoIiey «competition
[
[
Consumer infonnation Consumer protcction legislation
[
Business self-regulation or cooperation
[
Support of consumer organizations
]
[
]
[
]
[
] ]
3. IDdlcate tbe degree to wbleb eODlumer polley ID your eouDtry I1 IDßueD-
ecd by tbe followlDllutitutiou aDd Irou,.: no influencc
noticcable influencc
elearly noticcable influencc
sometimes dominant influencc
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl Cl Consumer Assoeiations Cl Business Assoeiations Cl Trade Unions Cl
Cl Cl Cl Cl Cl
Cl Cl Cl Cl Cl
Cl Cl Cl Cl Cl
Special government ageneies·
Cl
Cl
Cl
Central Government Sta1c or regional Governments Cornmunities
Cl
458
Anhang
• Please list them:
4. Please gin some actuallaCormatioa about your orgaalzatloa (associatloas, aleaeles aad lastltutes) Tbc data reCer to the ycar 199.... Numbcr ofmcmbcrs: (only associations) in total:
for consumer policy only:
Budgct: Hcreof public funds: Personal staff: (convertcd into full time) Have thcre bccn important changcs in thcse figures during thc previous ycars or do you expect thcm to do so in the ncar future? Plcase St8tc thc reasons.
5. Ban tbe Collowlal Caeton led (or will tbey lead) to cbaages ia aatioaal coalumer pollcy la your couatry: no cffccts
changcs changes clearly noticeablc· noticeable·
Change of govcmmcnt:
Cl
Cl
Cl
Deregulation discussion:
Cl
0 0
0 0
(De-)Centralisation:
0 0 0
Cl
Othcrs:
Cl
Cl
Cl
Budgct cuts:
Anhang
459
(please specify) ·Ifso, please explain:
6. Amount of publle expenditure on eonsumer polley In your eountry: 1992: ...................... ..
1993: .................... .
1994: ........................ .
Do tbese ßlures Include expenditure on otber polley ßelds sueb IS c:ompetition pollc:y, nutrition or envlronmental pollc:y? Uso, please spec:lf'y Ind quantif'y.
Tbe total Imount of expendlture on c:onlumer pollc:y Is spent on different levels of administration (c:entrallovemment, states or regions, eommunities) IS folIows: level:
amount:
Struc:ture of total expenditure - Rec:iplena: Grants for consumer associations: Grants for consumer proteetion agencies or public institutes (please name):
31 Mitropou1os
460
Anhang
7. Wbo is responslble ror c:onlumer pollc:y In your c:entrll lovunment? Plelse live I brief deseriptlon (mlnlstry or deplrtment, orglnization, number or staß):
Indicate wbicb tasles of consumer policy are assigned to subordinate levels (state or regional govemments, communities):
8. Indlelte bow Independent or otber InstitutIons you c:onlider to be (a) your own institution (b) and (c): other selected institutions (please name):
(a):
(b):
(c):
o o o o
o o o o
own institution very independent independent notveryindependent dependent
o o o o
Anhang
461
Specify the type of dependenee (personal designation, expendlture, responslbllities to government or parliament) If any:
9. Indleate whether the eonsumer polley of International organlzations Is of any slgnlfieanee to the eonsumer poliey ofyour eountry:
no int1ucnee Europcan Community UN
0 0
OECD
0
Europcan Council:
0
int1ucnee cxisting·
0 0 0 0
unknown
0 0 0
0
·ifso, picasc charactcrizc this int1ucnee:
10. Whieh faets do you eonsider as special sueeesses and weaknesses in your national eonsumer polley?
31·
462
Anhang
Please Indleate partieular ebaraeterlltlcs of eonlumer polley In your eountry in eomparilOn wltb otber eountrles.
11. Flnally ",e yould alk you to name lome publleatlonl on eODlumer polley ",bleb ban heen publilbed In your eountry reeendy.
Thank you very much for your cooperation. Should 1here be any suggestions or supplements which you would Iike to offer us, please use the space below.
![Vom Zentralplan zur Sozialen Marktwirtschaft: Erfahrungen der Deutschen beim Systemwechsel [Reprint 2019 ed.]
9783110509601, 9783828253476](https://dokumen.pub/img/200x200/vom-zentralplan-zur-sozialen-marktwirtschaft-erfahrungen-der-deutschen-beim-systemwechsel-reprint-2019nbsped-9783110509601-9783828253476.jpg)




![Strukturdiagnose in der Marktwirtschaft [1 ed.]
9783428440481, 9783428040483](https://dokumen.pub/img/200x200/strukturdiagnose-in-der-marktwirtschaft-1nbsped-9783428440481-9783428040483.jpg)

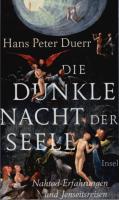

![Gesalbter und König: Titel und Konzeptionen der königlichen Gesalbtenerwartung in frühjüdischen und urchristlichen Schriften [Reprint 2013 ed.]
3110169371, 9783110169379](https://dokumen.pub/img/200x200/gesalbter-und-knig-titel-und-konzeptionen-der-kniglichen-gesalbtenerwartung-in-frhjdischen-und-urchristlichen-schriften-reprint-2013-ed-3110169371-9783110169379.jpg)
![Verbraucherpolitik in der Marktwirtschaft: Konzeptionen und internationale Erfahrungen [1 ed.]
9783428490523, 9783428090525](https://dokumen.pub/img/200x200/verbraucherpolitik-in-der-marktwirtschaft-konzeptionen-und-internationale-erfahrungen-1nbsped-9783428490523-9783428090525.jpg)