Taschenbuch der Fernmelde-Praxis 1974 3794902238
339 102 173MB
German Pages 508 Year 1973
Polecaj historie
Citation preview
ah... Electronic
Treffen Sie uns doch mal im Weltraum. Vielleicht
auf einer geostationären Umlaufbahn oder noch weiter draußen, ein Stück Richtung Sonne. Sie kennen die Namen der Erd-Satelliten und Raumflugkörper, In denen unsere elektronischen Bordelnrichtungen arbeiten: Azur, Aeros, Esro TD 1, Esro IV, Hellos, Symphonie, Intelsat IV.
AEG-TELEFUNKEN Ist eines der führenden Unternehmen für Raumfahrt-Elektronik in Europa. Wir liefern Bordelektronik für alle Satellifentypen. Auch die dazugehörenden Test- und Kontrolleinrichtungen oder komplette Bodenstationen werden von uns entwickelt und gebaut.
International wie unsere Partnerschaften sind
unsere Spezlalistenteams. Fähige Ingenieure aus vielen Ländern arbeiten bei uns als Electronic-Stars. Lassen Sie uns zusammen starten.
AEG-TELEFUNKEN Fachbereich Weitverkehr und Kabeltechnik 715 Backnang Gerberstraße 34 AEG Postfach 129
Forschung Entwicklung Fertigung
... damit auch morgen ein zuverlässiges Fernsprechnetz für die Deutsche Bundespost erhalten bleibt.
kronetechnik
....
Ideen werden
Wirklichkeit KRONE GmbH 1000 Berlin 37 Goerzallee 311
11
Multilayer Laminäte
TROLITAX kupferkaschierte Epoxidharzlaminate der 2. Generation Elektronische
Vermittlungstechnik,
Datenübertragung, Kommunikationssysteme der Zukunft, verlangen eine zukunftweisende Schaltungstechnologie. Dynamit Nobel entwickelte hierfür die Multilayer-Laminate TROLITAXDN9010ML
und TROLITAX DN 9020 ML sowie die dazu geeigneten Prepregs. Im Trolitax Technikum auf Herz und Nieren geprüft und in der Serienverarbeitung erprobt. Damit Sie eine sichere Basis für Ihre Zukunftsentwicklungen haben.
Trolitax
ein Produkt von Dynamit Nobel Nobel Aktiengesellschaft
Verkauf TROLITAX 5210 Troisdorf, Postfach 1209 Telefon: 022 41/151
DN 73/5
Dynamit
Geschäftsbereich Industrielle Halbzeuge
OSKAR VIERLING GMBH + CO.KG
8553 Ebermannstadt Fernruf (09194) 161
Wir liefern an die Deutsche
Bundespost
:- Pretzfelder Straße 21
Meßgeräte u.a. Meßkoffer für Nebenstellenanlagen MKN-dB Transistor-Pegelmesser TVM 30 Transistor-Pegelsender TVS 20 Pegeisender 800 Hz 4 mW Pegelsender 800 Hz 10 mW Pegelsender 800 Hz 140 mW Relaisprüfgestell EPrG 1/20 Fehlersuchgerät FSG 800 Selektiver Vorsatz SelVoGt für Pegelmesser Hochohmiger Vorsatz HoVoGt für Impulsschreiber Meßeinsatz für den Prüftisch 59 Meßeinsatz für den Ferngesteuerten Prüfplatz FPrPI 68 Ladegerät für Kleinstsammler Steuerteile für Automatische Meßübertragung AMeßUe Prüfgeräte u.a. PrüfgerätNr.3a für Zwei- und Vierdrahtleitungen Prüfgerät Nr. 4a für Betriebsvermittlungen Prüfgerät Nr. 7 Suchtongenerator Prüfgerät Nr. 8 für Telegrafenrelais Prüfgerät Nr.10 Kurzprüfgerät für HD-Wähler PrüfgerätNr.30 für Prüftisch 59 und FPrPI 68 Prüfgerät Nr. 34/1 für EMD-Wähler Zeitmeßzusatz ZMZ 34 zu den Prüfgeräten Nr. 34 und 34/1 PrüfgerätNr.41b für 16-kHz-Zählimpulse Prüfgerät Nr.85 halbautomatisch für Verbindungswege
IV
KunststoffKlemm-Muffe Für Verbindungen und Abzweige von geschnittenen und ungeschnittenen, bewehrten und unbewehrten Kabeln mit Blei-, Stahlwell-, Aluminium-, Kunststoff- oder Schichtenmantel, auch Kombinationen unterschiedlicher Mantelbauformen möglich, für alle Spleißarten. Kein Eindringen von Feuchtigkeit, da neuartiges Dichtungssystem aus dauerplastischer Masse sowie Wasserdampfsperre. Einfache und einheitliche Montage ohne Anwendung von Wärme, Gießharz. oder Kleber. Leicht zu öffnen. Keine aufwendigen Werkzeuge. Wiederverwendung nach Reinigung möglich.
Dluante
FERNMELDETECHNIK
56
Telefon
WUPPERTAL
1
UELLENDAHLER STRASSE 353 (02121) 4121 - Telex 8 591542 (wqd)
Mehr
als
vielleicht bekannt ist kommt von REHAU, An den größten Knotenpunkten kreuzen sich Kabelschutzrohre von
REHAU.
Hier an der Hauptwache
in
Frankfurt. Aber vergessen Sie nicht, was REHAU dem Fernmeldewesen weiter bietet: Verdrahtungskanäle, Isolierschläuche, Installationskanäle, Kabelabdeckleisten, Abstandhalter und Dichtungen in jeder gewünschten Form. Von allen REHAU-Erzeugnissen stehen technische Unterlagen zur Verfügung. Bitte nutzen Sie die jahrelange Erfahrung von REHAU! Verwaltung Rehau 8673 Rehau Rheniumhaus P_AS':KS
(Mr
DeleWe
ıst dabei.
Von Anfang an. Seit mehr
als 80 Jahren
bauen
wir
Fernsprech-
anlagen. In jeder Fernsprechanlage von DeTeWe steckt also eine lange Erfahrung. Und das spüren Sie. Egal, ob es sich um eine kleine Nebenstellenanlage für 1 Amtsleitung und 2 Sprechstellen oder um eine Ver-
mittlungsstelle für die Deutsche Bundespost mit 10000
Teilnehmern handelt. Wir ruhen uns nicht aus. Im Gegenteil, wir planen
und entwickeln weiter. Hauptsächlich für die Deutsche Bundespost. 80 Jahre Partnerschaft verpflichten.
Deutsche Telephonwerke und Kabelindustrie AG In Berlin und in jedem Telefonbuc.
Es spricht sich gut mit DeTeWe
Anzeige
Das Leistungsmerkmalsgewicht Eine
neue
Meßgröße
in der
Nachrichtentechnik
Viele Zweige der Nachrichtentechnik sind erst durch elektronische Bauelemente ermöglicht worden. Das beste Beispiel dafür ist auch das bekannteste: der Computer. Die Entwicklung des Computers in den letzten 25 Jahren wäre nicht denkbar gewesen ohne die immer weitere Vervollkommnung der Halbleitertechnik. Wer könnte sich die Leistungen heutiger Computer verwirklicht vorstellen auf der Basis der Relaistechnik und welche Leistungen, z. B. in der Raumfahrt, wären erreichbar gewesen, hätte man nicht als Basis moderne Computer für ihre Verwirklichung gehabt?! Merkwürdigerweise hat auf einem der ältesten Gebiete der Nachrichtentechnik die moderne Technologie erst recht schüchtern Einzug gehalten: der Telefonie. Abgesehen von einigen fertigungstechnischen Finessen bauen und verwenden wir heute noch Telefonapparate und Nebenstellenanlagen, deren Ursprung 50 Jahre zurückliegt. Für die Funktion der einfachsten Nebenstellenanlage werden heute Dutzende von Relais gebraucht, deren Wirksamkeit eher in Kilogramm Gewicht als in Schaltleistung gemessen zu werden verdient. Die jetzt noch überwiegend angewendete Technologie verhindert geradezu, daß die Leistungsmerkmale der Geräte entsprechend erhöht werden, weil damit die Geräte nicht mehr wirtschaftlich wären. Auf dem Sektor des Automobilbaus kennt man schon seit langem das Leistungsgewicht — eine Größe, die darüber eine Aussage macht, wieviel Kilogramm pro Leistungseinheit bei einem bestimmten Wagentyf beschleunigt wird — eine, wie man weiß, sehr aufschlußreiche Größe. die sowohl etwas über die Motorleistung als auch über die gesamte Konzeption des Fahrzeuges aussagt. Es wird deshalb vorgeschlagen, eine ähnliche Größe auch in der Draht: nachrichtentechnik einzuführen, die es erlaubt, eine gleichartige Aussage
zu
machen:
das
LEISTUNGSMERKMALSGEWICHT.
Diese
Meßgröße,
die
wir zunächst für einen recht genau definierten Sektor der Drahtnachrichtentechnik, nämlich den der Nebenstellenanlagen, vorschlagen, hätte der Vorteil, einem potentiellen Käufer die Information zu geben, wieviele definierte Leistungsmerkmale pro Gewichtseinheit geboten werden ode: umgekehrt,
erfordert.
wieviel
Gewicht
eine
definierte
Leistungsmerkmalseinhei
Anders nämlich als bei der Relaistechnik ist man bei der moderner Schaltkreistechnik ja geradezu verpflichtet, pro Schaltkreis so viele Lei stungsmerkmale wie möglich zu integrieren, damit eine maßgeschnei derte Entwicklung sich überhaupt amortisiert. Durch die Einführung de:
4
Te Fu
ehe
ı
@eKabelverlegung und Einziehen von Röhrenkabeln eSchaltanlagenbau Überlandfunkdienst:
Duisburg
Fernsprechanschluß:
Rheinhausen
231 40 68 (02135)
3572
VERTRETUNG IN DEN NIEDERLANDEN Amsterdam-Ost, Linnaeusparkweg 54 Fernsprechanschluß: Amsterdam 020-35 06 34 Putten (Gid), Emmalaan 18 Fernsprechanschluß: 03418/19 31
taschenbuch der fernmelde praxis
1974 Herausgeber Ing. (grad.) Heinz Pooch, Darmstadt
Fachverlag
Schiele & Schön
1 Berlin 61,
GmbH
Markgrafenstraße
11
Nachrichtenverbindungen vonLandzuLand
Entfernungen zwischen Erdteilen werden von der Nachrichtentechnik
in Sekundenbruchteilen
über-
brückt. Einwandfreie Bild- und Tonwiedergabe
werden erwartet. kabelmetal bietet die Voraussetzungen dazu. Mit FLEXWELL-HF-Kabeln,
FLEXWELL-Hohlleitern und Fernmeldekabeln entstehen sichere und zuverlässige Nachrichten-
Fachbereich 3 Nachrichten-Erzeugnisse 3000 Hannover - Postfach 260 - Telefen“X0511) 6861
Vorwort
Im Laufe der Jahre haben wir aus der Redaktionsarbeit und dem Erfahrungsaustausch mit den Benutzern dieses Buches gelernt, daß jeder neue Jahrgang bei der Fülle der Themen nur über den neuesten Stand der wichtigsten Fachgebiete der Fernmeldetechnik informieren kann und dabei mittelbar auf Beiträge früherer Jahrgänge aufbauen muß. Es erschien uns deshalb vordringlich, den Beziehern unseres Jahrbuches den Zugriff zu den Informationen früherer Jahrgänge zu erleichtern, und wir haben dem Buch ein neues Gesamt-Inhaltsverzeichnis aller bisher erschienenen elf Jahrgänge beigegeben. Wir hoffen, daß das von uns gewählte Ordnungssystem, die grafische Gestaltung und die auffallende Papierfarbe die Ansprüche unserer Bezieher an dieses Inhaltsverzeichnis befriedigen. Vorschläge für Verbesserungen wollen wir gern prüfen. In diesem Jahr haben wir u.a. den Themen aus der Übertragungstechnik, die in den letzten Jahren zu kurz gekommen sind, mehr Raum gegeben und mußten dementsprechend andere Fachgebiete, wie z.B. die Linientechnik, etwas vernachlässigen. Als neuen Redakteur konnten wir Herrn Ing. (grad.) Alfons Kaltenbach gewinnen, der bereits die vorliegende Ausgabe mitgestaltet hat. Herr Ing. (grad.) Günter Glaeser gehört der Redaktion als Berater, besonders für das Fachgebiet „Vermittlungstechnik“, weiterhin an. Wünsche
und
Anregungen
aus
dem
Leserkreis
nehmen
wir auch künftig gern entgegen, und wir werden uns bemühen, diese bei der Gestaltung der kommenden Jahrgänge gebührend zu berücksichtigen. . „Heinz Pooch
Verantwortlich für die Redaktion: Ing. (grad.) Heinz Pooch 61 Darmstadt, Nieder-Ramstädter Str. 186a Telefon: (06151) 44 668 Redaktionsmitarbeit: A. Kaltenbach, Traisa, Ludwigstr. 133
Mitarbeiter des „taschenbuch der fernmelde-praxis 1974“ Ing. (grad.) Herbert Baehr, Darmstadt, Bartningstr. 14 Ing. (grad.) Helmut Benzing, Darmstadt, Pupinweg 16 Ing. (grad.) Herrmann Cassens, Darmstadt, Pupinweg 31 Ing. (grad.) Ulrich Gierz, Reinheim, Am Mühlberg 23 Oberpostrat Werner Hammermann, Roßdorf, Taunusstr. 24 Ing. (grad.) Friedrch Hautsch, Darmstadt/Braunshardt, Jahnstr. 14 Ing. (grad.) Philipp Henß, Darmstadt, Pupinweg 5 Ing. (grad.) Jörg Heydel, Hähnlein, Industriestr. 6 Ing. (grad.) Klaus Hintze, Darmstadt, Bartningstr. 8 Ing. (grad.) Gerd Jeromin, Darmstadt, Pupinweg 26 Dr. Rudolf Kaiser, Darmstadt, Soderstr. 45 Ing. (grad.) Josef Kleinewillinghöfer, Dieburg, Erlenweg 8 Ing. (grad.) Hermann Leibeck, Darmstadt, Karlstr. 75 Ing. (grad.) Ernst Mohr, Mainz, Starenweg 13 Ing. (grad.) Günter Pankow, Goddelau, Herzgraben 1 Techn. FOAR Hermann Sauermilch, Darmstadt, Martinstr. 64/66 Ing. (grad.) Günter Schallert, Darmstadt, Kranichsteiner Str. 82 Dr.-Ing. Karl-Otto Schmidt, Darmstadt, Oppenheimer Str. 3 Ing. (grad.) Dieter Simon, Darmstadt, Bartningstr. 10 Ing. (grad.) Helmut Scherenzel, Dieburg, Dessauer Str. 31 Ing. (grad.) Ernst-Günter Stölting, Jugenheim, Wiesenstr. 4 Dipl.-Ing. A. Traeger, Darmstadt Dipl.-Phys. Rüdiger Treschau, Seeheim 1, Birkenweg1 Ing. (grad.) Manfred Wenzel, Darmstadt, Wiener Str. 70
Für die in diesem Buch enthaltenen Angaben wird keine Gewähr hinsichtlich der Freiheit von gewerblichen Schutzrechten (Patente, Gebrauchsmuster, Warenzeichen) übernommen. Auch die in diesem Buch wiedergegebenen Gebrauchsnamen, Handelsnamen und Warenbezeichnungen dürfen nicht als frei zur allgemeinen Benutzung im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung betrachtet werden. Die Verletzung dieser Rechte ist im Rahmen der geltenden Gesetze strafbar und verpflichtet zu Schadenersatz. ISBN ©
3 7949 0223 8
1973 Fachverlag Schiele & Schön GmbH 1 Berlin 61, Markgrafenstraße 11 Telefon-Sammelnummer: 030 / 251 60 29 Druck: R. Schröter, 1 Berlin Printed in Germany
12
61
IBM kündigt an:
Entscheidende Verbesserungen beim Vermittlungssystem IBM 3750.
Von der Nebenstellenanlage zum Kommunikationssystem. Auf die Frage, wie man die meist ortsgebundene Leistung des zentralen Computers
dezentral streuen kann, wurde eine neue elegante Antwort gefunden.
Sie heißt IBM 3750.
Die Begriffe Vermittlungssystem oder
Nebenstellenanlage beschreiben sie nur unvoll-
kommen. Die IBM 3750 benutzt als einfachstes Terminal für die Ein- und Ausgabe das Telefon. Gleichzeitig aber steht eine
breite Palette von Datengeräten zur Verfügung. Sie reicht vom Anwesenheits-Erfassungs-
gerät über Datensichtgeräte, Drucker und
Lochkartengeräte bis hin zur Sprachausgabe.
Die IBM 3750 nımmt alle Funktionen einer modernen elektronisch arbeitenden
Nebenstellenanlage für den Telefonverkehr wahr. Gleichzeitig aber kann sie z.B. an das IBM System /370 angeschlossen werden. Damit stehen dem Computer die Übermittlungswege des Telefonnetzes zur
Verfügung. Und den Benutzern die Leistung
des Computers.
Jetzt wurde die IBM 3750 mit einer Reihe neuer Funktionen und Datenstationen
ausgestattet.
Fordern Sie bitte ausführliche tionen darüber an.
Informa-
IBM Deutschland GmbH, 7000 Stuttgart 80, Postfach 800880, Abt. 3990. IBM
BIDFY%
13
Das Geheimnis des
BHW-Bausparens heißt schneller einziehenlangsamer abzahlen...
...das
bieten
nur wir Ihnen, well Öberschüsse
zufließen. Deshalb: Billiges
Baugeld
- nur 4'%
unseren Bausparern Darlehnszinsen
seit
1956 bei 3% Guthabenzinsen. Schnelleres Bauen ohne 40% ansparen
zu müssen. Mini-Monatsraten für Bausparverträge bis zu 25 Jahren Laufzeit. Erstklassiger Service — von uns erhalten Sie zusätzliche günstige Finanzierungshilfen. Hohe Prämien oder Steuervortelle für Ihre jährlichen Sparleistungen. Bauen zum Festpreis mit unserem für Sie entwickelten Familien-Fertighaus-Programm von OKAL. Und vieles andere mehr. Sofort Prospektmaterlal anfordern.
BHW Ihr
Vorrecht
|"BAU-SCHNELI-COUPON An
auf
Haus+Vermögen
BHW
- 325
Hameln
Vorname:
Bausparkasse für alle
: 2
Wohnort:
Kreis:
das Beamtenheimstättenwerk
: :
Beruf:
, Dienststelle:
im öffentlichen Dienst —
14
das
- Postfach
666
Senden Sie mir kostenlos Ihre „BHW-Bauspar-Information” Name:
:
Straße:
Inhaltsverzeichnis
Entwicklungstendenzen, Breitbandnetze der Zukunft (R. Kaiser) .........snoesereeeneseenen nee r nern en en nen nun Stand der Hohlkabeltechnik (K. O. Schmidt u. A. Traeger) ........2cse2ecnseeeenen en Allgemeiner Überblick .........222ercsereeseneeesnereene Übertragungseigenschaften von Hohlkabeln .......... Aufbau, Form und Verlegung des Hohlkabels ........ Übertragungsverfahren ........escscussensnaneneenenrene Zusammenfassung und Ausblick ......eeeescsesenenennen Die Bedeutung der Dokumentation bei der Bereitstellung von EDV-Anwendungen (H. Benzing) ........ Einführung ........2.22222200seseneanneeseenerseennennnen nee Zielsetzung für die Dokumentation bei der Bereitstellung von Objekten im besonderen .......:...e.00: Problemstellung ..........z2esceesossesenenerensenenennn nee Zusammenfassung .....2.@s0essenenee nern eesen nennen nenne
58— 58
74
Empfehlungen für die Abfassung technischer Veröffentlichungen (H. Baehr) .........serenereneeeeneenne Allgemeines ......seeeseenensrsoneenennnen rent nneenenen nn Gestaltung des Textes ......-seerenereenrene nennen ren ne Druckvorlagen ......ereeceneesenoneennenenn nennen ernennen ne N Verkehr mit der Schriftleitung ........eceerserseocrsne Doppelveröffentlichungen _........ecsesereeeesenenennene Buchstaben, Ziffern und Zeichen im Formelsatz ...... Schrifttum .........cersesesesenrensereonen nenne sonen nennen Erläuterungen zu den Richtlinien für das Errichten von lüftungstechnischen Einrichtungen bei der DBP (E.-G. Stölting) ........verecsereeronneessennnne nennen nen Einleitung ........2:222esosonssseneenensnee rennen ernennen Aufgabe und Aufbau der Richtlinien ............c22.0. Teil 1, RichtiLüftung AD .........c:sceeceeenenesennnenen Teil 2, Richt!Lüftung VSt .........22scssoserseennnennnnen Teil 3, RichtlLüftung EDS .......c:scssesennneserenennnn Teil 4, RichtlLüftung DV .........ccsescssorsnenernnennen Neuerungen beim Aufbau und der Verkabelung von Fernvermittlungsstellen (H. Leibeck) .................. Einführung .........eecesececseseesseneeseeen seen nenn nenne Die Grundsätze der „geschlossenen“ Bauweise ........ Aufstellungsgrundsätze .......... Vereneeneunennenenne nee . Die Verteiler .......ereesssesenneonennenone nn e nennen nenne. Die Schaltkabel und Leitungen .......s...... onen nnone Der Kabelplan ........cosccseeeseeensenenenernennenenenene Schrifttum ......seseseneneonnentenuerenn nn nenn nen .oorsene
15
Unterhaltung von Fernsprechvermittlungseinrichtungen bei der DBP (W. Hammermann) ..........c.e.20. Einleitung ......2.202c0oeenneenensenenensen ers r ernennen nn Grundsätze des Arbeitsverfahrens ..........2:2-2.2.0000 Arbeitsabläufe des Unterhaltens ..........ccesescreenn Organisation der Fernsprechunterhaltungsbezirke .... Ausstattung der Einsatzplätze ........csccceeeecennenons Datenverarbeitung aus dem Bereich des Unterhaltens von FeVSt .......:2ceseseseneonneenurneensn nennen nenn nenne Zusammenfassung und Ausblick ......2.22s2eeseerenennnn Die Fernsprechentstörungsstelle als Partner anderer Dienststellen (W. Simon) .......2:s2eecererenennenen nenn Einleitung und Überblick ...........2sceenceseeneenenenen Von anderen Dienststellen ausgelöste Abläufe ........ Von der Fernsprechentstörungsstelle bei anderen Dienststellen ausgelöste Arbeiten ..........cccscscc000. Schlußbetrachtungen ......2.ereesueesseeseennenenste nenne Fernsprechnetzgestaltung unter Berücksichtigung des Dämpfungsplans 55 (G. Jeromin) .........2ceseseesescree Einleitung .........ceesessesenennesssnrersaeenenere rennen Die Vierdrahtleitungskette .........essescseseseernerunne Die Schnittstelle zwischen der 4Dr-Leitungskette und 2Dr-Endleitungskette ........2.2cseeeeseseseererne nenn nn Querleitungen .......:22eseeseenesrsreesesrsenen nenn nen Die Zweidrahtendleitungskette ........csceesesereeecnnen Zentrale Betriebsbeobachtung für das TF-Netz (H. Sauermilch) ........zeeseesessenesesenenenenenee nenne Vorbemerkung .........e2ereesesseesteenereen nero nnen nn Bisherige Betriebsbeobachtungsverfahren .............. Forderungen an ein neues TF-Netzbeobachtungsverfahren .......2.2seeeeeesneenneeeneenen en none nn en nenne Geplantes Verfahren zur Beobachtung des TF-Netzes Schrifttum .......2essesereneeneneneneneeen een n nenn nennen Die Frequenzgenauigkeit in der Trägerfrequenztechnik (G. Pankow) ....2c:eneeenennunenennnen nennen een re en en Verfahren der Nachrichtenübertragung .............. Die Einseitenband-Übertragung ..........eeceeeeecsunnn Frequenzversatz bei einstufiger Umsetzung ............ Frequenzversatz bei mehrstufiger Umsetzung ........ Auswirkungen des Frequenzversatzes .......cccccn.. Notwendige Frequenzgenauigkeit der Trägererzeuger Erreichte Frequenzgenauigkeit der Trägerergeuger .. Frequenzmeßtechnik ........szeeresosenenenerrenenenn nen Das Vergleichsfrequenznetz der DBP .............2.... Schrifttum .....e.2.22000enennnen nun ner ernennen der nnnne . Autamatische
gruppen
Ersatzschaltung
u. -Sekundärgruppen
Grundforderungen
Grund-Primär-
(J. Kleinewillinghöfer)
...ccorsonnononoennonnnnnohenununeenunne
Umschaltungseinsätze
16
von
Pa
122—137
138—157 138 140 156 156 158—175 158 159 165 167 174 176—211 176 176 177 178 211 212—226
226 227—250 227 227
Für die Stromversorgung
von
Nachrichtenanlagen
natürlich
Denn
seit Jahren
und iiefert N]
cteichrichter. Wechselrichter und
Netzersatz-Anlagen.
Erfahrung
Funktionsgarantie: Bei (für Geräteversorgung,
Hochspannung) richtern
entwickelt, plant
Gleichrichteranlagen Pufferung, Batterieladung oder
genau so, wie bei
Wechsel-
in Einzel- u. Synchronbetrieb;
Steuerungen,
bedeutet
Reglern, Siebkreisen
tungen; bei
bei
oder Meßeinrich-
Hochspannungs- und
Nieder-
spannungsschaltanlagen.
Fragen Sie W\NZgspeziaiisten.
Die Adresse:
AEG Stromversorgung 61 Darmstadt,
von
Nachrichtenanlagen
Elisabethenstr. 29, Tel. (06151) Telex:
26425 4 196 79
ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS-GESELLSCHAFT AEG-TELEFUNKEN
ZWA 3204
Konstruktive Lösung Anwendungsfälle Elektrische Werte Schrifttum .—_—
er
01000
Tr
ee
Neue TF-Meßgeräte (H. Scherenzel) Allgemeines .......:22ecsenesesennenreeeenennernrennne nun TF-Meßplatz PSM-8 ......2:2cencnenaeneenseenennnnenne en TF-Meßplatz W 2007 /D 2000 der Firma Siemens AG .. Wobbelzusatz G 2022 /G 2025 der Firma Siemens AG .. Das Pegelbildgerät SG-2 der Firma Wandel & Goltermann Schrifttum ...
.
00000
| 10 100100001,“
Three
Rechnergesteuerte Tonleitungsschalteinrichtung (F. Hautsch und K. Hintze) Allgemeines .......2ceeseseneenenneenennennenerrenesennnne Das Koppelfeld der DBP mit Rechnersteuerung ...... Das Bestellund Schaltsystem im ARD-HörfunkSternnetz mit DBP-Rechner Schrifttum Öffentliche Datennetze (H. Cassens) Fernschreib- und Datendienste Datexnetz (200 bit/s) ..........-oeesseeeeneneenenenennene nen Öffentliches Direktrufnetz für digitale NachrichtenÜbertragung .......2220ceeneeneennnrenennrnnrnneee nenne nen Öffentliches Fernschreibund Datennetz mit EDSVermittlungstechnik Schrifttum vorn
Anschluß
von
Fernschreib-
und
00010010.
Datenstationen
(M. Wenzel) .......z2eeosseensunrestenneenenennenen ernennen Anschlußschaltungen ........eresseseensennneneerennn en ne Anschluß von Fernschreib- und Datenendeinrichtungen an das Telexnetz .......ceceeseeseseeneenseeenennn nn Anschluß von Fernschreib- und Datenendeinrichtungen an eine DxVSt in TW39- oder TW100-Technik .... Anschluß von Fernschreib- und Datenendeinrichtungen an eine DVSt in EDS-Technik .........sseserercccc. Anschluß von Fernschreib- und Datenendeinrichtungen an das Öffentliche Direktrufnetz .................. Anschluß von Datenendeinrichtungen an das Öffentliche Fernsprechnetz ........sercseeserneneseererneene nen Schrifttum
.......osecoroeeon nn enen nenn rennen nn rer en nn
Anschlußtechnik für Fernschreib- und Datennetze {G7 Schallert) ........rcsesseesensnenee erunennerenennennnen . Einführung .......::c220c2n0enen nn .onnen Wererrenereen rc ED100-Anschlußtechnik .........ze2csoeenonnsenereeenonne Gleichstrom-Datenübertragungseinrichtung mit niedriger Sendespannung — GDN .......cscreseereeeresnene Schrifttum .....ccccccencrcee Deonensneneenenennee
18
268 275 276—285 276 278 279 280 285 286—314 286 293 296 299 308 309 313 315—341
315 316
Sprechfunkgeräte Mobile und stationäre Wechselund Gegensprechgeräte für alle
Frequenzbereiche
im nöbL-Dienst
Handsprechfunkgeräte, Überleit-
einrichtungen, Anlagentechnik und -planung.
Robert Bosch Elektronik GmbH 1 Berlin 33, Forckenbeckstr. 9-13
BOSCH
Nachrichtentechnik
19
Automatischer Datenverkehr auf dem Fernsprechwählnetz (R. Treschau) ........2.22ccccececenn Nereneneree Modems für das Fernsprechwählnetz ...........:..2... Bedienter — unbedienter Betrieb ..............eccsec0: Automatische Wähleinrichtung für Datenverbindungen Automatisch antwortende (gerufene) Datenstation .... Anwendungsbeispiel: Umweltschutz .........2.cerc0.0. Schrifttum ....2eceseneeseneneeenenernenenenrenene ren en en en
342—358 342 346 348 354 356 327
Notruftechnik (E. Mohr) ............sscesceseeeseessenen Allgemeines .....cceesenereseneneneennesenseeeenenennen nen Notrufverbindungen ........222seeeesssesesenerennerne nn Technische Gestaltung ........222eee0reeenesennene nenne Aufbau der technischen Einrichtungen ................ Prüfen der NRML .......se:esecseeseneeneeneseeennnn nn
359—374 359 362 366 372 374
Planung von Richtfunknetzen (U. GierZ) ..........:.:.. Einleitung .......eeeeeeuseeesseeeseneneneneeeneeneneene nn Planungsregeln zur Begrenzung des Geräusches .... Planung einer Linie ...... NV eeneeeennenenenneneeneeeenenne Planung eines Netzes .......sceeseesneenneneneenenennnnne Ausblick .....222ecesseneneneseseneenn nee oruone Leronseorne Schrifttum ........22esseesessenneenune Sanesnese PER
375—391 375 375 387 389 390 391
RF-Frequenzversatz (Offset) für Fernsehkanalsignale (J. Heydel) ....:.cceceeeneeennesseeesseesneren nn een en Allgemeines .....2ereseusenenessersseseeeneneneeeen nennen Frequenzversatz und Störabstandsverbesserung ...... Frequenzversatzforderungen ........:sse2esseserenesenne Der Präzisionsversatz ....eeeeeesensneenrenneseenne nenne Der Normalversäatz ......2ccessesenesoeonenteneeneen nenne nen Schluß ..eeereeerreeesseesnennne essen enn nennen ne nenn une Schrifttum ......2sc0sseseneneeneenennse nenn nenne rennen nee
392—408 392 394 402 403 404 407 408
Begriffe der Antennentechnik (P. Henß) .............. Allgemeines ......cecseuesersonsnenseneeeneen een en nun une Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen ........ Strahlungsleistung ........eeeeeonserseeereserennerenen nn Der Strahlungswiderstand ..........eeoseeonennnreeennne Die effektive Antennenhöhe ........ccecesseenenernenunn Die wirksame Antennenfläche ......scesscceseeereenenen Die wirksame Antennenlänge ......seerereerereennrenee Berechnung der Empfangsspannung ..........scerscosee Einfluß durch Bodenreflektionen im Bereich IV/V .... Praktische Gewinnbestimmung ....ceosererensernnsnene Aufbau und Funktion der Meßempfänger ............ Schrifttum .......sesesesereonenenee Sonneneeeneeneeneonunen
409—426 409 410 411 411 412 414 414 415 419 424 425 426
Automatische
Ansage
geänderter
Gesamt-Inhaltsverzeichnis Bezugsquellennachweis
20
der
Rufnummern
Jahrgänge
..........
1964
bis
......
427—432
1974
433—448
oreneeseereerenenrenenn
FW 3739LD
Telefonieren Sie mit uns, wenn es sich um Fern-
meldeprobleme
handelt
Gefahrenmeldesysteme Lichtruf- und Personensuchsysteme Bauelemente und Baugruppen
Wir fertigen und liefern: Fernsprechsysteme Datensysteme Zeitdienstsysteme Zeiterfassungssysteme
&
TELEFONBAU UND NORMALZEIT 6 Frankturt 1- Postfach 4432 -Tel.(08113 2661
>
21
SIEMENS
Von der Planung bis zur Montage
Das sind über 10 Millionen Erfahrungskilometer auf dem Gebiet der Nachrichtenkabel den Nervensträngen der Kommunikation. Darüber hinaus hat Siemens in 28 Ländern der Erde bedeutende Kabelanlagen gebaut. Dazu gehören: © Komplette Fernsprechortsnetze, ® Fernkabelanlagen für den öffentlichen Nachrichtenweitverkehr,
@ Fernwirk- und Fernsprechkabelstrecken für Pipelines,
@ Anlagen in Betriebsnetzen von Eisenbahnen, Autobahnen, Wasserstraßen, von U- und S-Bahnen,
Flughäfen,
zur Steuerung
des
Straßenverkehrs, in Energieversorgungsnetzen und Industriebetrieben. Siemens-Nachrichtenkabeltechnik heißt Sicherheit durch große internationale Erfahrung und ein umfassendes Lieferspektrum. Projektierung und Planung, Fertigung, Montage und Wartung - alles aus einer Hand. Denken Sie daran, wenn schwierige und komplexe Aufgaben zu lösen sind. Siemens Aktiengesellschaft Bereich Nachrichtenkabeltechnik
8000 München 70, Postfach 700079
Nachrichtenkabeltechnik von Siemens
N 31/7301-6a
Mehr als 10 Millionen Kilometer symmetrische Ortskabelpaare lieferte Siemens in den vergangenen zehn Jahren in alle Welt.
Breitbandnetze
Entwicklungstendenzen Breitbandnetze Bearbeiter:
der Zukunft
Dr. phil. Rudolf
Kaiser
Jede wissenschaftlich einigermaßen fundierte Betrachtung komplexer Probleme der Fernmeldetechnik sollte mit einer klaren Festlegung der verwendeten Begriffe beginnen; anderenfalls würden durch unvermeidliche Fehlinterpretationen beim Lesen Mißverständnisse auftreten, die den Zweck der Aussage in Frage stellen könnten. Unsere Überschrift enthält gleich drei Begriffe, die zu Fragestellungen Anlaß geben könnten und die deshalb besser von vornherein definiert werden sollten. Eine solche klare Definition bietet darüber hinaus den Vorteil, daß die notwendige Diskussion hierüber mitten in die Problematik des Themas hineinführt. Die Fragen lauten: Was verstehen wir hier, im Zusammenhang des Themas, unter Breitband -Netzen, unter Netzen im allgemeinen und unter dem Begriff Zukunft? Der Vorsatz „Breitband-“ (in Wörtern wie Breitbandkabel, Breitbandsignal, Breitbandsystem u.ä.) ist für sich selbst ohne jede Aussagekraft; er nimmt seine Bewertung aus dem jeweiligen Stand der Technik, ähnlich wie der Vorsatz „Höchst-“ (in Wörtern wie Höchstfrequenz, Höchstspannung u.ä.). Will man also Breitbandnetze der Zukunft betrachten und definieren — dabei aber zunächst offenlassen, wann diese Zukunft beginnt —, so empfiehlt es sich, zunächst zu untersuchen, was man heute unter einem Breitbandsystem, einem Breitbandmedium, einem Breitbandnetz versteht; es wird dann sehr viel leichter sein, den Sprung in die Zukunft gedanklich auszuführen. Das klassische Beispiel für ein Breitbandsystem der Gegenwart bietet die Trägerfrequenztechnik des Vielkanal-Fernsprechens. Hier wird in international normier-
23
Entwicklungstendenzen . ten Stufen über Primär-, Sekundär-, Tertiär-, Quartärusw. Stufen eine imposante hierarchische Struktur aufgebaut, die, wenigstens auf dem Papier, keineswegs mit dem Stand der Technik ein Ende findet. Stehen entsprechende leistungsfähige Breitbandmedien zur Verfügung (beispielsweise Koaxialkabel größeren Durchmessers, Richtfunksysteme, Hohlkabel, Lichtfaserkabel), so könnten, rein technisch gesehen, ohne weiteres eine oder mehrere hierarchische Stufen angefügt werden. Was gegen eine solche Lösung spricht, also gegen ein Breitband-Trägerfrequenzsystem
der
Zukunft
mit
um
ein
Vielfaches
erweiterter
Bandbreite, sind, von wirtschaftlichen Überlegungen abgesehen (Vorfinanzierung, langfristige Bedarfsvorhersage, Kosten der Maintenance u.ä.), vor allem größte Bedenken in bezug auf Sicherheit und Zuverlässigkeit. Das Führen von mehr als schätzungsweise 3000 Fernsprechkanälen in einer Trasse erscheint auch in Friedenszeiten als höchst bedenklich, betrachtet man die stets existente Gefahr von Totalstörungen durch Berg- und Tiefbau-Tätigkeit, durch Ausfälle der Stromversorgung und durch ähnliche Einwirkungen, Störungen, die zu katastophalen Ausfällen der Fernmeldeversorgung ganzer Kreise oder Provinzen führen könnten, von der Einwirkung auf Industriezentren und Ballungsgebiete ganz abgesehen. Dazu kommt, daß durch unvorhersehbare Umschichtung der volkswirtschaftlichen und bevölkerungspolitischen Struktur auf lange Sicht (Probleme Stadt-Land, Neue City, Ballungsgebiete) in dieser schnellebigen Zeit das Planungsrisiko und die Planungsverantwortung übermäßig groß werden können. Bei der Betrachtung von Breitbandnetzen der Zukunft soll also von Systemen der Trägerfrequenztechnik abgesehen werden. Dazu kommt die Tatsache, daß, im Grunde genommen, ein solches Breitbandsystem gar kein echtes Breitbandsignal trägt, sondern dieses aus einer bloßen Aneinanderreihung von 4-kHz-Fernsprechbändern besteht. Wir haben gar keine zwingende Veranlassung, ein solch breites Band ungeteilt zu übertragen; man kann es, wenn es aus irgendwelchen Gründen einmal notwendig geworden
war
weiteres
24
(beispielsweise
in
zwei
oder
internationale
mehrere
Anlieferung),
Teilbänder
ohne
entsprechend
Breitbandnetze
der hierarchischen Gliederung zerlegen und diese Teilbänder auf verschiedenen Trassen übertragen; vielleicht weniger wirtschaftlich, aber mit einer um ein Vielfaches erhöhten Zuverlässigkeit und mit voneinander unabhängigen Ersatzkanälen. Ein wenig anders liegen die Verhältnisse bei den verschiedenen Datendiensten. Lassen wir die reinen Schmalbanddienste außer Betracht, da sie nicht zu unserem Themenkreis gehören (Telex-, Datex-Netze), so gleicht zunächst die Datentechnik mittlerer Bandbreite (Breite des Fernsprechkanals, Verwendung von Daten-Modems) völlig der der Fernsprechtechnik. Auch hier werden die DatenEinzelkanäle, zusammen mit denen der Fernsprechdienste, in gemeinsamen Trägerfrequenzsystemen hierarchisch gebündelt, wobei durch Zufallsgesetze der jeweiligen Verkehrsaufkommen Fernsprech- und Datenleitungen untereinander gemischt werden. Eine solche Mischung erscheint ohne Bedenken nur so lange tragbar, als nicht durch Überwiegen der digitalen Anteile am Summenvolumen der jeweiligen Multiplexstufen die zulässige Lastverteilung entsprechend des Holbrook-Dixon-Gesetzes überschritten wird und damit die Qualität des gesamten gesetzt wird. Im Rahmen internationaler
Bündels herabOrganisationen
(Studienkommission Special C der CCITT/CCIR) wird versucht, sowohl durch theoretische Ansätze als auch durch konsequente Auswertung empirischen Materials, geliefert als Erfahrungswerte in den Netzen der verschiedenen Teilnehmer-Verwaltungen und Betriebsorganisationen, Erfahrungen darüber zu erhalten, welcher Prozentsatz digitaler Datenkanäle für die verschiedenen Hierarchiestufen eines größeren Trägerfrequenzsystems tragbar ist; dabei spielen bei der Betrachtung des Breitbandnetzes natürlich die höheren Stufen der Multiplexbildung die größte Rolle. Weitgehend unbekannt ist zur Zeit noch der Datenverkehr auf Kanälen höherer Bandbreite als der des Fernsprechbandes; sowohl was den zu erwartenden Umfang (Bedarf) als auch was die informationstheoretische, verkehrstheoretische und technisch-technologische Beherrschung anbelangt. Eine echte Gegenwart gibt es hier eigentlich noch gar nicht, wenigstens was ganze Netze an-
25
Entwicklungstendenzen betrifft; nur zahlreiche Einzelverbindungen (starr geschaltete Punkt-zu-Punkt-Leitungen) und Versuchsausführungen von Wählverbindungen (Bandbreite 48 kHz) sind bekannt bzw. in Ländern der Europäischen Gemeinschaft beschrieben worden. Ein echter Denkansatz mit konstruktiven Lösungen schon für die nähere Zukunft erscheint aber mehr als wünschenswert, betrachtet man die große Anzahl von Organisationen der gewerblichen Wirtschaft, aber auch des öffentlichen Lebens, die sich von sich aus vorgenommen haben, den Datenfernverkehr zur Durchführung ihrer Aufgaben nutzbar zu machen. Aus dieser Sicht heraus ist es zu begrüßen, daß das Fernmeldetechnische Zentralamt vom Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen beauftragt wurde, im Rahmen eines Sondergremiums, in dem die Spitzenorganisationen der genannten Art vertreten sind, nach Mittel und Wegen zur Erfassung
und
Beherrschung
des
zukünftigen
Bedarfs
an
Datenleitungen, auch höherer Bandbreite, zu suchen und rechtzeitig Vorschläge zur technisch-organisatorischen Beherrschung dieses Neulandes zu machen. Um es vorwegzunehmen: Es besteht kaum ein Zweifel daran, daß schon wegen der hohen volkswirtschaftlich-gesellschaftspolitischen Bedeutung der Breitband-Datentechnik Forderungen nach Schaffung eines entsprechenden Breitband-Netzes erhoben werden, natürlich nicht mit Beschränkung auf Staatsgrenzen, sondern mindestens im europäischen Wirtschaftsraum. Ein großer Teil der Daten-Breitbandkanäle (als Teile von entsprechenden zukünftigen Breitbandnetzen) werden wohl auch hier, ebenso wie im Fernsprechnetz, nur höhere Hierarchiestufen einer Multiplextechnik (Frequenz- oder Zeit-Multiplex) sein. Das bedeutet, sie werden nicht „primär“ die hohe Bandbreite von beispielsweise einigen Megahertz belegen, sondern die Summenkanäle aus zahlreichen einzelnen, nebeneinandergelegten oder ineinandergeschachtelten schmalen Einzelkanälen darstellen. Hier gilt das oben Gesagte: bestehen nicht zwingende, z.B. wirtschaftliche oder planungsmäßige Gründe zur Zusammenfassung, so wird man lieber in Hinsicht auf höhere Zuverlässigkeit die Übertragung auf mehrere räumlich
26
Breitbandnetze
verschieden geführte Trassen vorsehen und damit ein ausgesprochenes Breitbandnetz vermeiden. Für eine solche Lösung sprechen auch technische Gründe, beispielsweise die Schwierigkeit der Schaffung schneller elektronischer Schalter für Daten-Wählsysteme, Schwierigkeiten, die mit der Erhöhung der zu übertragenden Bandbreite steil anwachsen. Sicherlich wird es aber auch eine, wenn auch zahlenmäßig beschränkte Gruppe von echten Daten-Breitbandkanälen schon ihrer Genese nach geben. Zu erwähnen wären vielleicht die großen Arterien zwischen Rechenzentren, dazu bestimmt, die Inhalte von Großspeichern, unabhängig von der Kontinuität ihrer Teilinhalte, gegeneinander
auszutauschen,
und
zwar
in
kürzester
Zeit.
Wei-
ausgeschlossen
(was
ter kann man an wissenschaftliche digitale Meßreihen hoher Geschwindigkeit oder Komplexität oder an digitalisierte Fernsehsignale denken. Zwar ist bei solchen „primären“ Breitbandsignalen eine Unterteilung auf mehrere Teilbänder
rein
theoretisch
verbunden
(Laufzeiten,
nicht
ganz
bringt der wissenschaftliche Fernmeldeingenieur nicht alles fertig!), jedoch sicherlich wesentlich teurer als die Schaffung und Unterhaltung einer Breitbandlinie und außerdem mit größten Schwierigkeiten bei der Zusammenfügung der auf verschiedenen Wegen laufenden Teilbänder flüsse,
Stabilität
der
Nichtlinearitäten
Pulsrahmen
usw.).
durch
Filterein-
Sollte es sich als notwendig erweisen, derartige „echte“ Breitband-Datenleitungen nicht allein als festgeschaltete Punkt-zu-Punkt-Verbindungen vorzusehen, sondern einen Teil von ihnen, vielleicht sogar mit einer eingeschränkten Möglichkeit zur freien Partnerwahl, in einem Sammeloder Ring-Kanal zusammenzufassen, so wäre damit der Ansatz und die Notwendigkeit zu einem Daten-Breitbandnetz gegeben. Da ein solches reines Datennetz mit Sicherheit aufwendig sein würde, erhöbe sich, ähnlich wie bei einem Binnen-Wasserstraßen-Netz, die hier fernmelderechtlich bedeutsame Frage, ob sich das Fernmeldenetz nach der Lage der anzuschließenden Unternehmen (Firmen, Organisationen)
zu
richten
hätte
oder
umgekehrt
diese
sich
27
Entwicklungstendenzen
an oder in der siedeln hätten.
Nähe
eines
solchen
Breitbandkanals
anzu-
Hier drängt sich einem Fachmann der Fernmeldetechnik sofort die starke Verwandtschaft zu zwei anderen Diensten bzw. technischen Möglichkeiten auf, nämlich einerseits die Übertragung des digitalisierten Fernsprechsignals (PCM), andererseits die Übertragung des Fernsehsignals, sei es in der Videolage oder mit einer geeigneten Trägerung. Beide Varianten sind heute schon in hohem Maße aktuell, so daß sich die Forderung nach je einem (oder einem gemeinsamen) Breitbandnetz der Zukunft unmittelbar stellt. So ähnlich diese beiden Dienste in bezug auf zu übertragende Bandbreiten auch zu sein scheinen (mehrere Megahertz), so verschieden sind sie in bezug auf die zukünftige Netzstruktur. Das erstere ist, dem Charakter des Fernsprechens als Zwei-Richtungs-Individualverkehr entsprechend, ein in beiden Richtungen zu betreibendes Wählnetz (doppelte Bandbreite, saubere Pegeltrennung gegen Nebensprechen), das zweite ein im wesentlichen nur in einer Verstärkungsrichtung arbeitendes Verteilungsnetz. Dieser grundlegende Unterschied macht es mehr als fraglich, ob es richtig und möglich sein wird, für überbreite Datenkanäle, für PCM-Fernsprechkanäle höherer Hierarchie und für Verteilkanäle mit Fernsehcharakter ein einziges Breitbandnetz vorzusehen; hierüber wird noch zu sprechen sein. Damit
„neuen“
ist gedankenmäßig Dienst
gegeben,
der
einen
Anschluß Dienst,
an
der
einen
aber
absolut wegen
seiner unbestreitbaren publizistischen Attraktion und durch die gezielte Aktivität einiger Interessentengruppen ein hohes Maß an Aktualität auch weit außerhalb der Expertenwelt gewonnen hat, das Bildfernsehen. Hier verbinden sich hohe volkswirtschaftlich-gesellschaftspolitische Vorteile (Sprechen und Sehen in beiden Richtungen, freie Partnerwahl, Übertragung auch von Daten) mit starken fernmeldetechnischen — besser gesagt fernmeldenetztechnischen — Nachteilen (sehr teures Breitbandnetz mit Breitband-Wähleinrichtungen, dabei aber nur geringe Möglichkeit, kostendeckende Gebühren zu er-
28
Breitbandnetze
zielen). Auf jeden Fall aber ist der hypothetische Bildfernsprechdienst in die Reihe der Forderer nach einem Breitbandnetz der Zukunft einzubeziehen. in
Ein besonderes Breitbandnetz der vielen Staaten, besonders auch in
eine
große
Rolle
spielt,
ist das
Gegenwart, welches der Bundesrepublik,
Richtfunknetz
zur
Über-
tragung von frequenzmodulierten Signalen der Fernsehtechnik (Modulationsnetz). Hier gibt es, wirtschaftlich und qualitätsmäßig gesehen, keine echte Alternative, etwa durch Übertragung auf Koaxialkabeln. Durch die bei einer Funkübertragung notwendig gewordene Verwendung geräuschmindernder Modulationsarten (Frequenzmodulation mit spezieller TV-Preemphase) wird eine hohe Bandbreite benötigt, nämlich ein „unteilbares“ Band von bis zu 30 MHz. Im Gegensatz zur Übertragung des Videobandes (entsprechend geträgert) vom Fernsehsender zum Teilnehmer, zur Zeit noch auf den UKW-Bereichen zwischen 100 und 900 MHz abgewickelt, wobei aber eine konsequente Verkabelung aus verschiedenen Gründen dringend erwünscht
ist
(Kabelfernsehen),
wird
die
Übertragung
der
Fernseh-Modulation vom Aufnahme-Studio bis zum Fernsehsender (über eine zentrale Schaltstelle hinweg) auch in der Zukunft ein besonderes Netz erfordern, welches wohl zum größten Teil auch nach zu erwartendem weiterem starken Ausbau im Funkbereich (Dezimeter- und Zentimeterwellen) liegen wird.
Was
fehlt
noch
auf
der
Palette
unserer
Dienste,
die
eventuell noch eine Rolle in einem (?) zukünftigen Breitbandnetz spielen können? Sei es, daß sie schon „primär“ die hohe Bandbreite erfordern, oder daß sie durch Multiplexbildung vieler an sich schmaler Einzelkanäle breitbandig werden? Es könnte noch eine ganze Reihe von Stich- und Schlagwörtern der einschlägigen Futurologen genannt
werden:
Elektronische
Zeitung,
Faksimile
neuer
Art, Unterschriftsvergleich bei Banken, Schulfernsehen, Umweltbeobachtungskanäle, Satellitenfunk und ähnliches. Sie alle stellen, genau betrachtet, nichts wesentlich Neues dar (höchstens in quantitativer Hinsicht) und können sämtlich leicht in eine der genannten Positionen eingeordnet werden. Nicht unerwähnt jedoch soll die Möglichkeit
29
Entwicklungstendenzen bleiben, daß die DBP auch für andere Verwaltungen und Organisationen — nicht zu vergessen die des europäischen Raumes — tätig sein kann; erwähnt sei nur die Übertragung des überbreiten Sekundär-Radar-Bildes (fast 10 MHz) für Zwecke der Flugsicherung. Auch sollte bei der Planung von Breitbandnetzen die zu erwartende Notwendigkeit der Einfügung von Transit-Kanälen nicht übersehen werden. Haben wir damit die Liste der zukünftigen Breitbanddienste im
sen
und
den
Begriff
schon existierenden oder wesentlichen abgeschlos-
„Breitband“
aus
dem
heutigen
Stand der Technik heraus entwickelt, so ergibt sich die weitere Frage, was wir unter „Netz“ verstehen wollen. Wir allekennen die Stern-Maschen-Struktur des weltweiten Fernsprechnetzes mit der Möglichkeit, nahezu alle Punkte unserer Erde — charakterisiert durch Fernsprechteilneh-
mer,
öffentliche
Sprechstellen
und
bewegliche
Land-
und
Seefunkstellen — in unvorstellbar kurzer Zeit paarweise miteinander zu verbinden. Wie sieht es bei einem Breitbandnetz aus? Angenommen, wir verbinden in unserem Lande die drei Städtepaare Hamburg-Hannover, KölnFrankfurt und München-Stuttgart wegen der hohen Zahl der Fernsprech-Verkehrsbeziehungen jeweils durch eine Hohlkabel-Strecke, ist das schon ein Hohlkabelnetz? Wird
es ein solches, wenn alle Großstädte dieser Art durch einen
Hohlkabel-Ring oder eine Acht verbunden werden? Sicher doch dann, wenn alle Zentralvermittlungsstellen miteinander vermascht werden! Die Definition eines Netzes ist nicht leicht, besonders nicht dann, wenn man sich vor Augen hält, daß in einem hypothetischen zukünftigen Verbundnetz — um das oft mißbrauchte Wort integral zu termeiden —, je nach Bedarfslage und Ausbauzustand an einigen Stellen vorwiegend Datensammelleitungen, an anderen starke Fernsprech-PCM-Bündel, an dritten vielleicht ausschließlich Kabelfernseh-Adern geführt sein können. Dabei ist sicher, daß die „Schwerpunkte“ der verschiedenen Dienste (resultierend in Gesamt-Bandbreite der Arterie) an ganz verschiedenen Stellen liegen können, und daß Majoritäts-Trassen nicht unbedingt neben- und aufeinander liegen müssen (hoffentlich!). Wir wollen also
30
Breitbandnetze
an dieser Stelle den Begriff offenlassen,; eine Einengung werden.
„Netz“ so wird erst
weit viel
wie möglich später nötig
Leicht dagegen ist die Antwort auf die Frage, was wir unter dem Begriff „Zukunft“ verstehen wollen. Wir meinen natürlich nicht das trübe Dämmerlicht der Science fiction, den Ausblick auf ein „Technotronisches Zeitalter“, in dem Resourcen (Energie, Rohstoffe, Technologien, aber auch Freizeit) in unbegrenzter Menge zur Verfügung stehen, wenn also wirtschaftliche Gesichtspunkte bei der Realisierung von Großprojekten keine Rolle mehr spielen werden. Wir meinen aber auch nicht eine etwas fernere Zukunft, die Möglichkeiten und Überraschungen enthalten wird, die noch völlig außerhalb unserer heutigen Vorstellungswelt realer Zielsetzungen liegen. Unter Zukunft sei hier der Zeitraum verstanden, der noch einigermaßen, wenn auch mit fachlich gebändigter Phantasie, überschaubar ist; natürlich unter Einbeziehung der stetig steigenden Erkenntnisse auf unserem Gebiet der Technik und ihrer Nebenbereiche, unter steter Berücksichtigung der politisch-sozialen Gegebenheiten und unserem Land und Kontinent, sowie der Gesamt-Anforderungen an die Haushalte des Bundes und der europäischen Länder
(Umwelt,
Entwicklungshilfe,
Bildung,
bleibt ein Zeitraum von knapp 30 etwa bis zur Jahrtausendwende.
Kultur
Jahren,
usw.).
das
heißt
Übrig
also
Nicht einbeziehen in unsere Betrachtungen wollen wir andererseits die Technik der allernächsten Jahre, die ja als bereits geplant und vorbestimmt noch der Gegenwart zuzurechnen ist. Das betrifft beispielsweise die Einbeziehung von neuen Koaxialkabellinien der klassischen Trägerfrequenztechnik, selbst dann, wenn — was durchaus im Rahmen der Möglichkeiten der bewährten Technik liegt — der Umfang dieses Netzes auf das Doppelte oder Dreifache steigen würde. Treten wir nun der Planung eines oder mehrerer zukünftiger Breitbandnetze näher, so erhebt sich als erste die Frage, welche technischen Möglichkeiten zur Realisierung bestehen, und zwar heute schon, denn bei dem
3l
Entwicklungstendenzen
nötigen Forschungs-Entwicklungs-Vorlauf müssen die Übertragungs- und, falls erforderlich, auch die Vermittlungseinrichtungen heute schon bereitstehen. Vielleicht nicht in aller Perfektion, nicht völlig durchentwickelt, aber sie müssen wenigstens so weit technisch und wirtschaftlich beherrscht sein, daß eine Unternehmensleitung die Verantwortung
übernehmen
kann;
der
Chef-Ingenieur
für
die
technisch-technologische, der Chef-Manager für die finanziell-wirtschaftliche Seite. Die Frage, ob bei den bekannten Anforderungen an zukünftige Breitbandnetze — wie oben geschildert — überhaupt die Möglichkeit besteht, sie zu realisieren, muß von seiten der Technik aus unbedingt bejaht werden. Es ist schon oft beschrieben worden, welche hohe Entwicklungsreife die Medien der Übertragungstechnik (Kabel, Funklinien, Hohlkabel, Lichtfaserkabel) entweder schon aufweisen oder bei entsprechend forcierter Aktivität erwarten lassen. Das gleiche gilt für die zugehörigen Endgeräte, Multiplexer (Frequenz und Zeit), Modems, Coder-Decoder, Verstärker und Regeneratoren, Entzerrer und all die zahlreichen Sondergeräte, wie sie für die Übertragung breitester Frequenzbänder oder kürzester Elementarimpulse erforderlich sind. Nicht anders ist es bei den Elementen, Baugruppen und Geräten der Vermittlungstechnik, die zwar zum Teil ihre letzte Bewährungsprobe in Hinsicht auf Lebensdauer und Zuverlässigkeit noch nicht ablegen konnten, die aber bei Investition eines gesunden Vertrauensvolumens als realisierbar angesehen werden müssen. Keinerlei Bedenken bestehen weiter auf der organisatorisch-planungsmäßigen
Übertreibung Technik
(hard
festgestellt ware
plus
Seite
(soft
soft
ware)
werden
ware),
kann,
daß
nicht
so
von
daran
daß
seiten
ohne
der
gezweifelt
werden kann, daß sich die oben geschilderten Breitbandnetze, falls über ihre volkswirtschaftliche Bedeutung Klarheit herrscht, wenn notwendig, in kürzester Zeit realisieren lassen. Auch wirtschaftliche Gründe sprechen, von Ausnahmen abgesehen, nicht gegen eine baldige Realisierung; sicherlich werden einige der neuen Dienste bald zu kostendeckenden Gebühren führen. Fast aussichtslos dagegen
Breitbandnetze
erscheint aus heutiger Sicht eine Verwirklichung angesichts der riesigen notwendigen Investitionen, die größtenteils als langfristige Vorleistungen aufgebracht werden müssen, ehe ein entsprechender Rückfluß durch Gebühreneinnahmen erwartet werden kann. Doch hier müssen strenge Unterschiede gemacht, müssen Maßstäbe angelegt werden, und es ist vielleicht ganz nützlich, daß wir uns einige Gedanken darüber machen. Welche Gründe sprechen überhaupt für die Schaffung eines Breitband-Teilnetzes, d.h. eines Netzes für einen bestimmten Dienst? Ein strenger Unterschied besteht hier zwischen Diensten, die „primär“ ein breites Band zwingend erfordern (z.B. Kabelfernsehen), und solchen, die erst in ihren höheren Multiplexstufen breitbandig werden (z.B. Trägerfrequenzfernsprechen). Als ein spezieller Fall muß das PCM-Fernsprechen angesehen werden, welches schon in seinen unteren Multiplexstufen breitbandig sein: kann, seine Rechtfertigung in höheren Hierarchiestufen aber darin findet, daß Medien verwendet werden (Hohlkabel, Lichtfaser),
bei
deren
fast
unbegrenzter
Bandbreite
diese
nicht allein als Wertmaßstab angenommen werden darf (abundante Systeme). Für die „primär“ breitbandigen Dienste gibt es zwei Kriterien: die Gebührenträchtigkeit, d.h. die Wahrscheinlichkeit, mit zumutbaren Gebühren in vernünftiger Zeit die Investitionen abzudecken, und der volkswirtschaftlichgesellschaftspolitische Nutzen. Steht die Gebührenträchtigkeit außer Frage, kann auf den Nachweis der Bedeutung für die Volkswirtschaft verzichtet werden. Umgekehrt: bei absolutem Zweifel daran müssen unabhängige Gutachten die Bedeutung des Dienstes nachweisen, die aber auch Vorschläge enthalten, wie dann die Investitionen aufzubringen und abzudecken sind (Staatshaushalt, private Initiative?). Der letzte Fall dürfte höchstwahrscheinlich bei der Beurteilung des Bildfernsprechens eine Rolle spielen.
Vor
einer
übersteigerten
Ausdehnung
der
Multiplex-
technik in immer höhere Hierarchiestufen ist schon gewarnt worden. Wenn auch oft wirtschaftliche Gesichtspunkte bestechend sind — fast stets kostet eine Verdoppe2
Fernmelde-Praxis
33
Entwicklungstendenzen lung der Kapazität nur 30 bis 40 Yo mehr —, wird manchmal übersehen, daß diese höhere Kapazität auch gebührenbringend ausgenutzt werden muß. Häufig gründen sich laienhafte Wirtschaftlichkeitsberechnufgen auf eine Vollbelegung und Vollbezahlung von Anfang an. Das ist eine absolute Utopie, da ja in einer echten Zeitplanung ein Belegungszeitraum (z.B. 10 Jahre) enthalten sein muß, und da eine „Vollbelegung von Anfang an“ zwangsläufig anderen älteren Netzen die Wirtschaftlichkeit entziehen muß. Dazu kommen die schon erwähnten Bedenken in bezug auf Sicherheit und Zuverlässigkeit, die gegen eine unkritische Ausweitung des Multiplexprinzips sprechen. Ein weiterer Grund gegen die Einführung eines neuen Breitbandnetzes kann darin liegen, daß ja neues und altes System eine lange Zeit nebeneinander und miteinander arbeiten müssen. Sie sollen also bis zu einem gewissen Grade kompatibel sein. Aus dieser Lage heraus erklärt sich die Kritik an der Notwendigkeit der Einführung der digitalen Fernsprechtechnik (PCM-Breitband-Systeme), die ja, ohne „Neues“ zu bringen (außer in Quantität), in Konkurrenz zur tausendfach bewährten Trägerfrequenztechnik tritt, welche selbst, wie schon gezeigt, noch um ein Vielfaches ausbau- und erweiterungsfähig ist. Es ist sehr schwer,
verantwortlich gehen“
wußten
dieser
zu entscheiden,
aktuellen
Verzicht
auf
ob nicht
durch
Entwicklungslinie,
Einführung
der
d.h.
ein
„Über-
durch
PCM-Technik
be-
des
Fernsprechens, ein später nicht wiedergutzumachender Fehler gemacht wird, oder ob es sich wirklich um eine freie Entscheidung zwischen gleichwertigen Varianten handelt. Bei einer kritischen Beurteilung der Lage ist es schwer, sich nicht von gefühlsmäßigen Gedankengängen beeinflussen zu lassen, wie sie von Vorträgen und Veröffentlichungen ausgehen, denen die Apostrophierung neuer Dienste (wie PCMund Bildfernsprechen) als „fortschrittlich“, „modern“, „progressiv“ oder „zukunftsträchtig“ genügt, um daraus eine Existenzforderung abzuleiten. Jeder Fernmeldeingenieur, der von der Schönheit neuer Techniken begeistert ist, würde gern sehen, daß sie auch betrieblich genutzt werden; ein Unternehmen jedoch, selbst wenn es 34
Breitbandnetze
nicht auf Gewinnmaximierung, sondern allein auf Bilanzsicherung ausgerichtet ist, muß kühl und leidenschaftslos
urteilen. Eine weitere Gefahr für die Unbefangenheit im Urteil liegt in der Überschätzung erzielter Forschungsund Entwicklungsergebnisse. So stolz man beispielsweise über die Resultate der Hohlkabelentwicklung sein kann und so richtig es auch ist, nach Anwendungsmöglichkeiten zu suchen, so falsch und gefährlich wäre es, daraus eine Existenz- Notwendigkeit abzuleiten, etwa nach dem Motto: Jetzt haben wir soviel hineingesteckt und schon soviel erreicht, jetzt muß es auch eingeführt werden. Hier gilt das oben Gesagte. Nach diesen (sehr notwendigen) kritischen Bemerkungen wollen wir uns einige Gedanken über die sich schon andeutenden Breitbanddienste machen, deren volkswirtschaftlich-gesellschaftspolitische Bedeutung so groß ist, daß ein (bundesweites) Netz von allgemeinem Nutzen sein könnte. Beginnen wir mit dem einfachen Typ eines Verteil-Netzes, so wird das Industriefernsehen wohl kaum je zu einer echten Netzbildung führen. Hier werden für technische, kaufmännische oder wissenschaftliche Zwecke bewegte Schwarzweißoder Farbbilder übertragen, die Bandbreite (analog) liegt beträchtlich unter 10 MHz. Für Unterrichts- oder Konferenzzwecke können örtlich begrenzte Sternnetze kurzzeitig geschaltet werden, kaum aber je die Bandbreite vergrößert werden. Von weitaus größter Bedeutung ist dass Kabelfernsehen, welches in absehbarer Zeit, wenigstens teilweise, wertvolle Funkfrequenzen freimachen und den üblen Antennenwald auf unseren Dächern beseitigen soll. Angestrebt sind bis zu 12 unabhängige Kanäle, die GesamtBandbreite betrüge dann rund 100 MHz. Die Zahl der Teilnehmer wird sehr groß sein (mehrere Millionen), so daß eine hohe Gebührenträchtigkeit zu erwarten ist. Der Aufwand ist nicht übermäßig hoch (nur eine Richtung betrieben, die Teilnehmerwahl liegt im Empfangsgerät, Kanalschalter). Noch nicht absehbar ist der Bedarf an Daten-Leitungen höherer Kapazität, sei es als primäre oder als Multi2°
35
Entwicklungstendenzen
plexsysteme. Es kann angenommen werden, daß der größte Teil des Bedarfs durch feste Verbindungen abgedeckt werden kann; für ein bundesweites Wählnetz bestehen noch keine festen Vorstellungen, dagegen ist anzunehmen, daß sich der Trend nach Dialogleitungen (in beiden Richtungen zu betreiben) verstärken wird. Was Multiplex-Dialognetze für das Fernsprechen anbelangt, so sollen hier verabredungsgemäß Trägerfrequenznetze nicht behandelt werden. Dagegen ist es nötig, sich einen Begriff von der Struktur eines PCMFernsprechnetzes zu machen, das ja dann, aber auch nur dann, eingeführt werden muß, wenn der Bedarf an Fernleitungen so stark ansteigt, daß die erforderliche Bündelstärke in den Hauptarterien auch von mehrfach parallelgeschalteten Trägerfrequenzsystemen über Koaxialtuben oder Richtfunklinien nicht mehr zu bewältigen ist. Einige Werte für eigene Überschlagsrechnungen: Abtastfrequenz 9MHz, 9 bit, Pulsfolgefrequenz 81 MHz für 900 F-Kanäle, bei zwei Bündeln 162 MHz. Pulsdauer rund 6 Nanosekun-
den, zugehörige
Filter-Bandbreite
etwa 200 MHz.
Von
nun
an ergibt sich nach oben hin ein reines Trägerfrequenzsystem: 6 solche Untergruppen zu je 1800 F-Kanälen bilden eine Gruppe (mit Filterlücken rund 1700 MHz), 7 Gruppen zu je 10800 F-Kanälen eine Obergruppe (mit Filterlücken rund 16 GHz) und mit 4 solcher Obergruppen zu je 75 600 F-Kanälen (je 2 in jeder Richtung) könnte man mit rund 150 000 F-Sprechkanälen das gesamte nutzbare Frequenzband eines Hohlkabels (angenommen 35 bis 105 GHz) belegen. Dies nur als Beispiel, man kann auch ganz andere Anordnungen wählen. Als letztes großes Breitband-Dialognetz wäre noch das des hypothetischen Bildfernsprechens zu erwähnen. Hier rechnet man im Einzelkanal häufig mit einer Bandbreite von etwa 1 MHz, jedoch werden die Qualitätsanforderungen
der
Zukunft
eine
Erweiterung
auf 5, besser 10 MHz erzwingen. Im Gegensatz zum PCMHohlkabelnetz treten hier hohe Bandbreiten nicht erst bei den extremen Bündelungen in den Hauptarterien auf, sondern schon am Rande der Peripherie, fast bis zum Teilnehmer hin. Selbst wenn die Verkehrstheorie des Bild-
36
Breitbandnetze
fernsprechens noch nicht geschrieben ist (wieviel Teilnehmer eines Gebäudes, eines Gebäudekomplexes werden gleichzeitig bildfernsprechen dürfen?), werden hier bei Bandbreiten von rund 20 MHz für den Einzelkanal schon „weit draußen“ erheblich breite Bänder von mehreren 100 MHz benötigt, will man nicht auf Qualität in einem Maße verzichten, das für einen Menschen des Jahres 2000, für den das System ja konzipiert werden muß, unerträglich sein dürfte. Viel zu teuer für Koaxialkabel (Hohlkabel scheiden in Stadtnähe ohnehin aus) scheint es zur Zeit, nur eine einzige einigermaßen wirtschaftliche Lösung zu geben, nämlich die Verwendung von Richtfunk hoher, bisher nicht genutzter Frequenzen (25 bis 31 und 36 bis 40 GHz). Nicht verschwiegen werden darf die außerordentlich niedrige Gebührenträchtigkeit, die die Übernahme der Investitionskosten durch den Staat notwendig machen könnte. Schon aus diesen wenigen Angaben erkennt man, daß jedes dieser an sich nützlichen und wünschenswerten Teilnetze so aufwendig sein wird (am wenigsten noch das Kabelfernsehen), daß an eine Realisierung allein aus dem Investitionsfonds der DBP kaum gedacht werden kann. Man muß sich noch die Frage vorlegen, ob nicht durch Vereinigung
der
Teilnetze
zu
einem
einzigen
Verbundnetz
zentrale
Arterien—
die Chancen steigen würden. Betrachtet man aber die so heterogenen Forderungen (Verteilnetz-Dialognetz, Massenversorgung—fTeie
Partnerwahl,
Peripherieversorgung), so erkennt man kaum eine Möglichkeit zur Kostenreduktion. Sieht man von Trägerfrequenzund Hohlkabelnetzen ab, so könnte am ehesten ein weitvermaschtes Bildfernsprech-Wählnetz alle anderen Breitbanddienste als „quantites negligeables“ in sich aufnehmen; aber dieses als das aufwendigste würde wohl stets den Investitionsrahmen der DBP sprengen... Höchstwahrscheinlich werden die aufgezeigten Gedankengänge, die so wenig von Technik handeln, gerade den Fernmeldeingenieur, der seinen Beruf liebt, enttäuschen, aber er wird erkennen müssen, daß schöne und gute Technik allein nicht genügt, um realisierbare Systeme oder gar Netze zu schaffen.
37
Entwicklungstendenzen
Stand der Hohlkabeltechnik Bearbeiter:
K.O.
Schmidt
und
A.
Traeger
1. Allgemeiner Überblick Die Entwicklung der Nachrichtenübertragungstechnik umfaßt immer weitere Gebiete, und man bedient sich
z.T.
auch
neuer,
bisher
nicht
angewendeter
Übertragungs-
mittel. Zur bisherigen Tonfrequenz- und Trägerfrequenztechnik des Fernsprechwesens können in Zukunft die Hohlkabeltechnik, die Lasertechnik im Lichtwellenbereich und für spezielle Fälle evtl. die My-Mesonentechnik aus dem
auf
elektronischen
die
Arbeiten
verweisen.
Bereich
über
das
hinzukommen.
supraleitende
|
Im
übrigen
Koaxialkabel
ist
zu
In dieser Abhandlung soll der Stand der Hohlkabeltechnik erläutert werden, die gegenüber der bestehenden Koaxialkabeltechnik wesentlich breitere Übertragungsbänder zur Verfügung stellt [1, 2, 3}. Auf diese Weise kann die Zahl der Kanäle für das Fernsprechen, das Fernsehen und später einmal für das Bildfernsprechen den kommenden Anforderungen angepaßt werden. Als Übertragungswelle im Hohlkabel dient die Hoı-Welle, deren Dämpfung theoretisch mit steigender Frequenz ständig abnimmt. Die Störungen, deren zulässige Werte wegen ihrer Auswirkungen auf die Übertragungsqualität durch die CCITTBedingungen begrenzt sind, werden mit dem Übertragungsverfahren, insbesondere der Pulscodemodulation (PCM),
in
den
Abschnitten
2 und
4 erörtert.
Im
Teil
3 wer-
den der Aufbau, die Form und die Verlegung des Hohlkabels beschrieben. Der Abschnitt 5 bringt die Zusammenfassung und den Ausblick auf die Einfügung des Hohlkabels in das Netz unter Hinweis auf die noch im Versuchsstadium befindlichen neuen Übertragungsverfahren. Die
Entwicklung
Notwendigkeit 38
in
den
USA
weist
von Übertragungssystemen
ebenfalls
auf
die
mit großer Fre-
Hoblkabeltechnik quenzbandbreite hin. So wird in den letzten Jahren dort das Kabelfernsehen (CATV = Cable Television) stark vorangetrieben. Die besonderen Vorteile liegen in einem störungsfreien Bild und einer fast unbegrenzten Kanalkapazität, die außer einer großen Anzahl von Sendern noch vielseitige andere Informationen, z.B. Spielfilme, Sportprogramme usw., bietet. Allerdings ist hierfür eine Monatsgebühr von etwa 5 Dollar (Stand 1972) zu zahlen, während der sonstige Fernsehempfang gebührenfrei ist. Die Aufnahmefähigkeit für ein Koaxialpaar ist inzwischen auf 10800 Sprechkanäle mit dem System V 10800 angewachsen, so daß der Abstand zu der bisher wesentlich größeren Kanalkapazität des Hohlkabels um den Faktor 4 (V 2700) verringert wurde. So können mit einem Kabel (Typ 32c), das 12 (= 2:6) Koaxialtuben enthält, 64 800 Ferngespräche übertragen werden. Trotzdem kann auch heute noch, selbst bei der 12fach bandaufwendigeren Pulscodemodulation, ein Hohlkabel den Nachrichtenfluß von bis zu etwa 50 Koaxialtuben aufnehmen. 2. Übertragungseigenschaften von Hohlkabeln
21.
Dämpfung
und
breite
Hon-Wellen
deren Felder men, sondern
im
Kreishohlleiter
sind
zirkulare
Wellen,
in idealen Hohlleitern nicht mit Längsströnur mit axialsymmetrischen Kreisströmen in
der
Rohrinnenwand
und
wird
„Eigenwellen“
Übertragungsband-
hat
daher
verknüpft
die
H,,-Welle
sind
die
(Bild
1).
geringste
als Übertragungswelle
Von
für den
diesen.
Dämpfung
Weitver-
kehr mit Hohlkabeln benutzt. Geringe Dämpfungen, die Verstärkerabstände von 30 bis 50km zulassen, kann man nur mit Hohlkabeln erreichen, deren Innendurchmesser groß gegenüber der Wellenlänge ist (Abschnitt 3). Es werden daher Millimeterwellen angewendet. Die Grunddämpfung ändert sich dann theoretisch mit der dritten Potenz des Innendurchmessers und f£°/., wenn f die Betriebsfrequenz bedeutet.
39
Entwicklungstendenzen
Die
oberen
realisierbaren
Dämpfungen
Übertragungsfrequenzband
liegen
wegen
allerdings
der
im
Instabilitä-
ten der Hyj-Welle durch die Existenzmöglichkeit vieler anderer Wellentypen bedeutend höher. Doch hat man im Forschungsinstitut des FTZ im Frequenzbereich von 30 bis 70 GHz eine Dämpfung von t2-4___ —
%
7
dampfungen durch Elhiptizitat und Krıicke sowie Achsver-
" 1
+ — N > SS
0
Summe der Zusatz-
y.
60
70
80
Zusatzdämpfung 17725
90
durch Schicht
_
.
Theor: Dampfung des unbeschichteter Rohres
700 GHz
d; =7cm; diel. Schicht: Dicke 200um, e=2,5, tarı d=2-10°#; Mittl. Krümmungsradius R= 1000 m ; Mittl. Knickwinkel an derı Flanschert: 2' und Achsversatz 100um; Elliptizität: 5oum; Material: Aluminium. Bild 3.
Kilometr.
Dämpfung eines dielektr. Hohlkabels nach [12]
beschichteten
ztupa}9qeNIgoH
2,9
abjkm
Entwicklungstendenzen
Stirnflächen Knickwinkel
der von
Hohlkabeleinzellängen 2 Minuten zu kommen.
Durchmesserschwankungen,
gelang
Achsversätze
es,
und
auf
Abwei-
chungen von der Kreisform lassen sich mit den üblichen Präzisionsfertigungsverfahren so niedrig halten, daß hierdurch kein ins Gewicht fallender Dämpfungszuwachs entsteht. In [12] wird angegeben, wie sich die Einzelstörungen bei jetzt realisierbaren Toleranzen auswirken (Bild 3). 3. Aufbau, Form und Verlegung des Hohlkabels 31. Aufbau und Form des 311. Entwicklungsstufen
Hohlkabels
Die Entwicklungsstufen des Hohlkabels die Tabelle 1 beschreiben.
lassen
sich durch
Tabelle]1: Entwicklungsstufen des Hohlkabels (Die mit * gekennzeichneten Hohlkabel wurden in den letzten Jahren getestet. Für die mit * bezeichneten Hohlkabel existieren Pläne für den betrieblichen Einsatz) Aufbau Einfaches Metallrundrohr
Innen-
durchmesser cm 12
Land USA BRD
Verschiedene Zwischenstufen wie z.B. Ringhohlleiter Hohlkabel mit dielektrischer Beschichtung auf der Innenwand* Wendelhohlkabel** Hohlkabel mit dielektrischer Schicht und Folienfilter
44
5 5,1 6 7
BRD England, Japan USA BRD
5 5,1 7
BRD, Frankreich England, Japan, USA BRD
17
BRD
Hohlkabeltechnik Tandemhohlkabel (kombiniertes Hohlkabel aus dielektrisch beschichtetem und Wendelhohlkabel im Verhältnis 4:1 bis 20:1)
5,1 6
Japan USA
7
BRD
Die Entwicklung vollzog sich hiernach vom einfachen Rundhohlleiter relativ großen Durchmessers bis zu dem aus dielektrisch beschichteten und Wendelhohlkabeln zusammengesetzten Tandemhohlkabel mit 5 bis 7cm Innendurchmesser. Sowohl für Wendelhohlkabel von 5 und 5,1 cm Innendurchmesser wie für Tandemhohlkabel existieren Pläne für den späteren betrieblichen Einsatz, für das erste in Frankreich und England und für das letzte in Japan und in den USA [13, 14]. 312.
Struktur des dielektrisch teten Hohlkabels
beschich-
Die Struktur eines dielektrisch beschichteten Hohlkabels geht aus Bild 4 hervor. Wie in Abschnitt 2.2 erwähnt, dient der dielektrische Belag inbesondere dazu, die starke Umwandelung der Hy,-Welle in die E,,-Welle in Krümmun-
PT]
Dielektrisch beschichtetes Hohlkabel
Aluminiumlegierung GP Qielektrikum
D4= 78mm
D;=70mm
I=5bzw 6m
Glasfaser- mit Gießharzschichten
Wendelhohlkabel
L
Da-80mm D;-70mm l-5m
Bild 4. Diel. beschichtetes und Wendelhohlkabel
Entwicklungstendenzen gen zu vermindern. Dies geschieht dadurch, daß die Phasenkonstanten der beiden „Eigenwellen“, die ohne Beschichtung fast gleich wären, durch diese unterschiedlich gemacht werden. Drei Beispiele für den Aufbau dielektrisch beschichteter Hohlkabel nach dem letzten Stand gibt die Tabelle 2.
Tabelle
Da
em.
Strukturen
7
dielektrisch beschichteten
Diel. Belag
Rohres
Mat.
Stahl
Poly-
dto.
dto.
innen verkupfert
6
von
Hohlkabeln
Dn, Mat. des
em.
5,1
7,8
2:
AIMgSi
Dicke
d. Einzelrohre
5m
äthylen
175 ım
dto.
Mittl. Länge
200 um
18 m 5m
Land Japan USA
BRD
Zur besseren Haftung der dielektrischen Schicht am inneren Kupferbelag ist dieser mit einer dünnen Oxydschicht (Dicke =z1 um) versehen. Große Einzelrohrlängen haben den Vorteil, daß die Anzahl der Flanschverbindungen und damit die hierdurch möglichen Störungen geringer werden. Stahl hat einen größeren Elastizitätsmodul als Aluminium und seine Legierungen sowie einen größeren Hookeschen linearen Bereich der Dehnungskurve bei Belastung. Daher ist eine größere Formstabilität anzunehmen. Dagegen haben AlMgSi-Rohre den Vorteil des kleineren Gewichts und können daher billiger transportiert und montiert werden. Für in Zukunft aufzubauende Betriebshohlkabelleitungen müssen diese Alternativen noch eingehend überprüft werden. Der Übergang von 5,1 auf 6cm Innendurchmesser war in den USA dank verbesserter Fertigungsmethoden
möglich.
Rohre
von 7cm
©
[15], wie sie beim FTZ
ange-
wendet werden, können in ihren Krümmungstoleranzen ebenfalls noch verbessert werden. Ihre Vorteile sind vor allem die Verschiebung des Übertragungsfrequenzbereiches
nach unten lung
46
und
auf Stahl
damit Kostenersparnis
größere
Formstabilität.
sowie bei Umstel-
Hohlkabeltechnik 313.
Struktur
des
Wendelhohlkabels
Den Aufbau eines Wendelhohlkabels zeigt Bild4. Wendelhohlkabel sind „selbstreinigend“, d.h. Störwellen wer-
den mit Ausnahme der H,„-Wellen (n > 1) stark gedämpft,
da der Widerstand der Wendel in axialer Richtung im Gegensatz zum Widerstand in zirkularer Richtung sehr groß ist. Die Tabelle 3 zeigt die Aufbaudaten eines Wendelhohlkabels, das vom Forschungsinstitut des FTZ getestet wird [16]. Tabelle
3:
eines Aufbau
1. 2.
von
innen
nach
Dimensionen
und
Aufbau
Wendelhohlkabels außen:
Wendel aus Kupferlackdraht Drahtdurchmesser
Lichte Weite
(Doppelwendel) 0,3 mm
70
3.
Glasfaserbandschichten Im Vakuum mit Epoxydharz getränkt übereinander: 1 Lage Glasfaserband 1 Lage Glasfaserband graphitiert 1 Lage Glasfaserband Stahlrohr (nahtlos gezogen)
4. 5.
Korrosionsschutz (Corotheneband) Fertigungslängen 5m
Außendurchmesser Innendurchmesser
mm (& + 0,01 mm
80 mm + 0,1mm 73/74 mm + 0,3 mm
außen innen
Zunächst konnte man die Wendel, die den wichtigsten Bestandteil dieser Hohlkabelart bildet, wesentlich genauer herstellen als dielektrisch beschichtete Hohlkabel, deren Rohr-Halbzeug im Ziehprozeß gefertigt wurde, In jüngster Zeit gelang es in den USA, dielektrisch beschichtete Hohlkabel mit Hilfe von längsgeschweißten Stahlrohren mit noch engeren Toleranzen zu produzieren. 314.
Tandemhohlkabel
Tandemhohlkabel sind aus dielektrisch beschichteten und Wendelhohlkabeln zusammengesetzt, wobei z. Z. inter-
47
Entwicklungstendenzen national das Mischungsverhältnis noch unterschiedlich ist und zwischen 4:1 und 20:1 liegt. Das Wendelhohlkabel spielt hier die Rolle eines Wellenfilters. Das günstigste Mischungsverhältnis und die optimalen Filterlängen wären noch festzustellen. In kurzen, gekrümmten Trassenabschnitten sollte man möglichst wenig bzw. keine Wellenfilter anwenden, da die Dämpfung durch starke Absorption erhöht wird und keine Rekonversion mehr möglich ist [17]. Wenn die Krümmung im Bogen allmählich zu- und wieder abnimmt, so ist die entstehende zusätzliche Dämpfung minimal.
In
langen
Krümmungen
kommt
man
wegen
der
sonst entstehenden Laufzeitverzerrungen ohne Wellenfilter nicht aus. Die Anzahl der einzusetzenden Wellenfilter ist letzten Endes durch die bei Anwendung von PCM noch zuzulassenden Fehlerraten bestimmt. 315.
Hohlkabelverbindungselemente
Hohlkabelverbindungselemente sollen gewährleisten, daß möglichst geringe geometrische Störungen an den zu verbindenden Enden der Einzellängen entstehen. Sie sollen außerdem gasdicht sein, da Wasserdampf und Sauerstoff Absorptionsmaxima im Übertragungsfrequenzbereich besitzen und die Hohlkabel daher mit trockenem Stickstoff gefüllt werden müssen. Im FTZ wurde auf Grund der Erfahrungen mit verschiedenen Verbindungselementen eine einheitliche Flanschkupplung für unterschiedliche Hohlkabel konzipiert [18]. Durch verbesserte Fertigung auch in bezug auf die Stirnflächenwinkel gelang es, bis auf mittlere Knickwinkel von 2 Minuten zu kommen [12]. 32.
Verlegung
des
Hohlkabels
Verlegeverfahren für Hohlkabel sollten die Übertragungseigenschaften nur unwesentlich beeinflussen, d.h. die geometrischen Toleranzen müssen nach der Verlegung weitgehend erhalten bleiben. Dies sollte auch noch nach Jahrzehnten der Fall sein. Außerdem muß die anzuwendende Verlegemethode praktikabel und wirtschaftlich sein.
48
Hohlkabeltechnik Aus diesen Forderungen ergibt sich, daß die Hohlkabelverlegung so durchgeführt werden muß, daß keinerlei Beschädigungen oder ins Gewicht fallende Formänderungen zu befürchten sind. Die Brauchbarkeit für die Praxis kann durch eine relative Unabhängigkeit der Montage vom Wetter und den Erdarbeiten wesentlich erhöht werden. Darüber hinaus sollen die Reparaturmöglichkeiten recht gut sein. Nach diesen Gesichtspunkten wurde im Forschungsinstitut des FTZ ein Verlegeverfahren konzipiert, das 1966 - erstmals beim Aufbau einer 3X 3 km langen Hohlkabelversuchsstrecke in Darmstadt zur Anwendung kam [15, 19]. Dieses Verlegeverfahren hat als wichtigste Aufbauphasen folgende Arbeitsgänge: —
—
—
Nach Planung und Einmessung der Trasse werden an geeigneten Punkten Schächte aus Fertigbauteilen montiert. Ihre Entfernung kann nach dem bisherigen Stand etwa 800m betragen. Größere Abstände werden angestrebt. Die Schächte bestehen aus zwei Arten: den 6 bis 7 m langen „Verlegeschächten“ und den etwa 15 m langen „Zwischenschächten“, die auf der Trasse abwechselnd montiert sind. Nach Herstellung eines Planums in 1,20 bis 1,60m Tiefe werden ein oder mehrere Schutzrohre aus Kunststoff (Hart-PVC) bzw. Stahl zwischen den Schächten gasdicht verlegt. Mit Hilfe von elektrisch betriebenen Winden wird das Hohlkabel von den Verlegeschächten aus, in denen die Hohlkabel-Einzellängen miteinander verbunden werden, bis zu den Zwischenschächten eingeschoben. Hier werden die beiden dort ankommenden Hohlkabelstränge verflanscht.
Ein besonderes Merkmal dieser Verlegemethode ist die Anwendung des Rollenprinzips zur Verminderung der Einschubkräfte. In Abständen von durchschnittlich 1 m werden um die Rohre Rollenkränze mit je 6 Rollen gelegt, auf denen das Hohlkabel in das Schutzrohr „gerollt“ wird.
Die
erforderlichen
zulässigen Werten aus AlMgsSi).
Einschubkräfte
(z.B.
etwa
liegen
500kp
für
weit
1km
unter
den
Hohlkabel
49
Entwicklungstendenzen Dieses Verlegeverfahren hat sich für unsere Versuchsstrecken bereits bewährt und scheint sich auch international für geplante Betriebsstrecken durchzusetzen. Zum Ausgleich von temperaturbedingten Liängenänderungen werden speziell konstruierte Dehnungsglieder eingebaut [20]. Durch eine Gasbeschickungsanlage wird sowohl das Hohlkabel in zwei separaten, langsamen Umläufen mit trockenem Stickstoff, der von Wasserdampf und Sauerstoff gereinigt wird, gefüllt als auch das Schutzrohr [21]. 4. Übertragungsverfahren 41.
Modulation
Als Modulationsverfahren, das den Anforderungen für eine störungsarme Übertragung mit Hohlkabeln genügt, hat sich Pulscodemodulation mit Zwei- oder Vierphasentastung eingeführt. Gegenüber Amplitudentastung hat Phasentastung den Vorteil, mit kleinerem Rauschabstand auszukommen. Im Forschungsinstitut des FTZ wurde eine Methode entwickelt, bei der eine Varaktordiode, die in einen Rechteckhohlleiter eingebaut ist, als schneller HFSchalter dient [22]. Je nach Schaltung kann man hiermit Amplitudenoder Phasen-Pulsmodulation erzeugen. Zusammen mit PCM-Simulatoren und -Empfängern für hohe Bitraten [23] wurden über eine 6km lange Schleife der 3X 3 km langen FTZ-Hohlkabelversuchsstrecke, mit einer
SINN ww NV
Impulsfolge am
Hohlkabelanfang
Entzerrte Impulsfolge
am
Hohlkabelende
Nicht entzerrte Impulsfolge am Hohlkabelerıde Bild5. Übertragung von 320 Mbit/s — Impulsfolgen über einen Abschnitt der 9km langen FTZ-Hohlkabel-Versuchsstrecke (Abschnittslänge 6 km)
50
Hoblkabeltechnik Mäanderleitung im ZF-Teil, entzerrte Pulsmuster mit einer Bitrate von 320 Mbit/s zunächst amplitudenmoduliert im 16-GHz-Bereich übertragen (Bild5). Zur Zeit werden Untersuchungen im 38-GHz-Bereich mit 640 Mbit/s und Phasentastung durchgeführt [24]. In den USA wurden verlustarme Modulatoren mit PINDioden für Trägerfrequenzen von 55 GHz und höher aufgebaut und untersucht [25]. PIN-Dioden haben den Vorteil, höhere Grenzfrequenzen als Varaktordioden zu besitzen, während letztere keine Treiberstufe benötigen. Ein Ziel der FTZ-Untersuchungen ist es, festzustellen, bis zu welchen Bitraten Hohlkabelübertragung noch möglich ist. Durch Übertragung sehr breiter Signalbänder steigt die Wirtschaftlichkeit des Übertragungsverfahrens.
42. Hohlkabelrepeater
(HK-Wiederholverstärker)
Im Hohlkabelrepeater werden die im Frequenzmultiplexverfahren gesendeten digitalen Breitbandsignale über Band- und Kanalweichen empfangen [26] und in einen Zwischenfrequenzbereich, dessen Mittenfrequenz z.B. bei 1,2 GHz liegt, umgesetzt. Nach Verstärkung, Laufzeitausgleich, Begrenzung, nochmaliger Verstärkung und Phasendemodulation findet die Regenerierung der PCM-Signale
im
Basisband
statt. Diese
bilden
die Modulation
Sendeteil des Wiederholverstärkers, HF-Leistung mit etwa 10 bis 100 mW quenz wie die Empfangsfrequenz zum teilabschnitt weitergeführt wird (Bild des Repeaters können nach Bedarf gezweigt oder zugeführt werden.
für
den
von dem aus die bei der gleichen Frenächsten Hohlkabel6). Im Basisbandteil Breitbandkanäle ab-
Zur Zeit wird in der BRD im Rahmen eines staatlich geförderten Entwicklungsauftrages von zwei Firmen und zwei Hochschulinstituten ein Hohlkabelrepeater aufgebaut, der ab 1974 an der FTZ-Versuchsstrecke getestet werden soll. In England, Frankreich, Japan und in den USA werden ebenfalls Hohlkabelrepeater entwickelt bzw. sind bereits in Erprobung [27, 28].
Sl
u9zu9pus4sZunpIMyJug
75
Kanalweichen
Kanalweichen
STH u
u
scher
AUFL
ZF-
Verstärker
u
Hohl- _
kabel
Bandweichen
Frea.-
| re9=
Lauf-
zeif - u
ausgl.
Regenerator
Ver-
u
Begrenzer stärker
u
u
Phasen-
1 PnoduPhasen-
u
lafor
| Jdemo-
dulator. |
u
Bandweichen
facher
Quarz -
ı
u Oszill. Bild 6.
Blockschaltbild
| eines
Hohlkabelrepeaters
L
_
=
Hohl-
kabel
Hohlkabeltechnik
43.
Einsatz von Hohlkabeln als Erweiterung des konventionellen Fernmeldenetzes
Mit dem Einsatz von Hohlkabeln als Leitungen hoher Kanalkapazität zur Entlastung von Netzabschnitten könnte bereits in einigen Jahren begonnen werden. Die an einem Netzknotenpunkt ankommenden Analogsignale werden in diesem Falle digital codiert und durch Zeitmultiplex zu einem Informationsfluß hoher Bitrate vereinigt. Mit diesem wird der Millimeterwellensender moduliert und die HFEnergie über die entsprechenden Kanal- und Bandweichen dem Hohlkabel zugeführt. Nach der Hohlkabelübertragung werden die PCM-Signale zunächst wie im Empfangsteil eines Repeaters verarbeitet und über einen Demultiplexer sowie Digital-Analogwandler und die sonstigen Überleitgeräte zum nächsten Netzabschnitt weitergeleitet. Entsprechend würde die Signalverarbeitung, Hohlkabelübertragung und der Anschluß an das konventionelle Netz in der anderen Richtung erfolgen. 5. Zusammenfassung und Ausblick Aus den Abschnitten 2 bis 4 ergibt sich, daß der Stand der Versuche auf dem Gebiete der Hohlkabeltechnik so weit gediehen ist, daß im Laufe der nächsten Jahre die Einführung dieses neuen Übertragungsmittels in das bestehende Fernmeldenetz möglich wäre. Bei der zur Verfügung stehenden Frequenzbandbreite von rund 70 GHz ist es vor allem der Weitverkehr mit starken Fernsprechbündeln und in Zukunft auch wohl mit vielen Fernsehverbindungen, der eine wirtschaftliche Ausnutzung des Hohlkabels ermöglichen wird. Die technischen Voraussetzungen sind bereits weitgehend geklärt, da die Verlegung und der Betrieb im Rahmen der Bedingungen des CCITT keine Schwierigkeiten erwarten läßt. Auf der höchsten Netzebene müssen zweckmäßigerweise noch Vereinbarungen mit den Nachbarstaaten wegen der Weiterführung der starken Nachrichtenbündel getroffen werden. Im Inland wird man voraussichtlich zusätzlich auch noch ein Verbindungsnetz für Großkomputer zur Datenverarbei-
53
Entwicklungstendenzen tung schaffen. Ebenso wird das Bildfernsprechen im Rahmen dieser Entwicklung Aussicht auf eine Einführung neben anderen Breitbandsystemen gewinnen. Außer der oben dargestellten Hohlkabeltechnik wurde bereits die Lasertechnik (Laser = Light amplification by stimulated emission of radiation) erwähnt. Die Entwicklung hat hier bereits zu einsatzfähigen Versuchsmustern . geführt. Ein Laser-Glasfaserkanal bietet in Zukunft vielleicht die Möglichkeit, breitbandige Teilnehmerverbindungen auf der untersten Netzebene (Anschlußleitungsnetz) zu schaffen. Das „Kabelfernsehen“ würde bei einem günstigen Ausgang der laufenden Entwicklungsarbeiten eine technisch realisierbare und wirtschaftlich zu vertretende Lösung im Teilnehmerbereich finden können. Ebenso bietet sich für das Bildfernsprechen die Glasfaser-Lasertechnik an. Die Dämpfung einer Glasfaser von 1...3 um Durchmesser erreicht nach den Arbeiten in den USA 4dB pro km. Bei den Arbeiten in der BRD rechnet man z.Z. mit wesentlich verlustreicheren Fasern. Die dabei übertragbaren Nachrichtenflüsse liegen heute in der Größe von 1 Gbit/s. Der Verstärkerabstand könnte 3km oder sogar 10 km betragen. Bei einem Krümmungsradius der Faser von 7cm ist eine Dämpfungszunahme noch nicht nachweisbar. Ein Nebensprechen zwischen den einzelnen Glasfaserleitungen eines Bündels ist infolge der totalen Reflexion innerhalb der Glasfaser so gering, daß die vorgeschriebenen CCITT-Werte eingehalten werden können. Das Glasfaserkabel eignet sich daher bei seinem geringeren Verstärkerabstand für den Zubringerverkehr zum HohilkabelWeitverkehr und gestattet im Anschlußbereich der Teilnehmer einen bequemen Zugriff zu sehr breitbandigen Übertragungskanälen. Da die technologischen Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Glasfasertechnik noch im vollen Fluß und die Lebensdauer von Festkörper-Lasern noch nicht ausreichend sind, kann mit einem Einsatz von Glasfaserkabeln kaum vor 1980 gerechnet werden. Bis dahin wird die Koaxialkabeltechnik bzw. der Einsatz von symmetrischen Leitungen die Anforderungen an Über-
54
Hohlkabeltechnik tragungswegen auf der unteren Netzebene erfüllen müssen [28, 29]. Die My-Mesonentechnik, mit der in den letzten Jahren Versuche unternommen wurden [30], bietet gegenüber den
konventionellen
und
in
Entwicklung
befindlichen
Über-
tragungsmedien ganz neue Möglichkeiten. My-Mesonen (oder abgekürzt Myonen) sind negativ oder positiv geladene Atomteilchen, die 207mal schwerer als ein Elektron sind. Sie können im Gegensatz zu Funkwellen Materie, z.B. zwei Meter dicke Betonwände, durchdringen, so daß man sogar damit rechnet, den Erdkörper mit Myonenstrahlen durchdringen zu können. Sender- und Empfängertechnik sowie Fragen der Modulation, der Demodulation und der Verstärkung sind noch weiter zu klären. Auch hat man bisher keine Untersuchungen angestellt, welcher Geräuschabstand zur einwandfreien Übertragung von Nachrichten erzielbar ist. Die zum Betrieb notwendige Strahlungsenergie beträgt einige Milliarden Elektronenvolt, um eine zu starke Streuung in der Luft zu vermeiden. Eine Anwendung dürfte sich daher auf wenige Sonderfälle beschränken und kaum vor 1980 zu erwarten sein. Auch die Untersuchungen von supraleitenden Koaxialkabeln sind noch im Anfangsstadium, so daß vorläufig nicht mit einer Anwendung für die Nachrichtentechnik zu rechnen ist [31]. 6.
Schrifttum
[1] [2]
[5
ud
[4
ud
[3]
A. Traeger: Das Hohlkabelprojekt der DBP. Zeitschrift für das Post- und Fernmeldewesen 1971 Nr. 21, S. 799... 807. A. Traeger, W. Lorek: Untersuchungen für ein Hohlkabelsystem, Manuskript eines Vortrages, gehalten auf der Konferenz „Trunk Telecommunications by Guided Waves“ (vom 29.9. bis 2.10.1970 in London). Techn. Bericht des Forschungsinstituts des FTZ A 333 TBr 6 Sept. 1970. Lorek, W.: Internationaler Stand der Hohlkabel- und Glasfasertechnik. NTZ 1971 H.3 S. 152... 156. Richter, H.: Dämpfungsmessungen an Wendelhohlkabeln im Frequenzbereich 30 bis 30 GHz. Techn. Bericht FTZ A 333 TBr Nov. 1972. Pregla, R.: Gruppenlaufzeitausgleich mit Mäanderleitung für Nachrichten-Übertragung mit Rundhohlleitern. AFÜ, Bd. 24, 1970, Heft 9, S. 381... 388.
55
Entwicklungstendenzen
[6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]
[117]
Sedlmair, S.: H,ı-Reiniger mit dünner metallisierter Folie für Hoı-Weitverkehrsleitungen. Frequenz 20 (1966) H.11, S. 372—377. Miller, S. E.: Waveguide as a Communication Medium. Bell Syst. Techn. Journ. 33 (1954) H.6, S. 1209—1265. Unger, H.-G.: Circular electric wave transmission in a dielectrice coated waveguide. Bell Syst. Techn. Journal 36, (1957) S. 1253—1278. Unger, H.-G.: Normal mode bends for circular electric waves. Bell Syst. Techn. Journal 36 (1957) S. 1292—1307. Kindermann, H.P.: Optimierte H,ı-Krümmer mit dielek-
trischer
Schicht.
Archiv
der
elektrischen
Übertragung
(1965), S. 699701. Katsenellenbaum, B. Z.: Berechnung der Wellen auf einem flachen Spiegel im Knick eines breiten Hohlleiters. Radiotechnik und Elektronik, Heft 7, Juli 1963 S. 1111—1119. Jansen, W., Odemar, N.: Toleranzen bei Hohlleitern der Weitverkehrstechnik. Frequenz 26 (1972), H. 9, S. 258—265. ... Postes et Communications, Febr. 1973, S.7. ..„. Erste kommerzielle Hohlleiterstrecke in den USA. NTZ (1973) H.1S.KB8. Traeger, A.: Eine H,1ı-Hohlkabelversuchsstrecke für Millimeterwellenübertragung über 9km. Techn. Bericht FTZ A 333 TBr4, Mai 1968. Kluge, K.: Weitverkehrs-Wendelhohlleiter. Techn. Mitt. AEG-Telefunken 58, 1968, H.3, S. 193. Garlichs, G.: Dämpfungsberechnungen an kreisförmig gekrümmten, dielektrisch beschichteten Hohlkabeln. Techn. Bericht FTZ A. 333 TBr 16, Nov. 1972.
[18]
Traeger, A., Fehn, B.: Eigenschaften von Hohlkabelverbindungselementen. Techn. Bericht FTZ A 333 TBr18, Okt. 1972.
[19]
Schmidt, H., Favreau, H.-J., Bierwirth, R.: Hinweis auf die Verlegung von Hohlkabeln (Entwurf eines Merkblattes zur Fernmeldebauordnung). Techn. Bericht FTZ A 333 TBr. 13, Apr. 1971.
[20]
Richter, H.: richt FTZ A
[21]
Vorwerk, W.: Gasbeschickungsinlage für eine 3x3 kmHohlkabelversuchsstrecke. Techn. Bericht FTZ A 333 TBr 10, März 1972.
[22]
Lorek, W.: Eine Erweiterung des quasistationären Hohlleiter-Ersatzschaltbildes auf Steghohlleiter und seine Anwendung bei der parametrischen Steuerung des H,n-Wellenfeldes. Techn. Bericht FTZ A 333 TBr 12, Febr. 1971.
[23]
Hanke, G., Lorek, W.: 640 Mbit/s waveguide transmitter 38 GHz, Electronics Letters Vol. 9, No. 4 Febr.. 1973.
Dehnungsglieder für Hohlkabel. 333 TBr 11, Sept. 1971.
Techn.
Be-
at
Hohlkabeltechnik [24]
[25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]
Miyauchi, K., Kita, S., Shimada, S., und Sushi, N.: Design and performance of an experimental 400 Mbit — 4 PSK guided millimeter wave transmission system. IEEE Conference publication Nr. 71, Sept./Okt. 1970, S. 21—26. (Conference on „Trunk Telecommunications by Guided Waves“.) Hutchison, P.T.: A digital millimeter waveguide transmission system. Trunk telecommunications by guided waves. IEE Conference Publication No. 71 Sept./Okt. 1970. Kühn, F.: Mikrowellen-Kanalweichen, Dissertation Techn. Universität Braunschweig 1972. Ohnsorge, H.: Anwendungsmöglichkeiten von Glasfaserleitungen in herkömmlichen Nachrichtennetzen. NTZ (1973) H.1, S.K2. Muslowski, S.: Komponenten des Glasfaser-Nachrichtenübertragungssystems. Techn. Mitt. PTT 1/1973, S. 26/27. Ohnsorge, H.: Neue Möglichkeiten für Nachrichtensysteme auf der Basis des Laser-Glasfaserkanals. Bulletin technique PTT 1/1973, S. 19—25. Weiss, G.: Die Mesonenfabrik von Los Alamos. Elementarteilchen-Ströme für Forschung, Technik und Medizin. Darmstädter Echo v. 19. 2.1973, S. 3. Hoshiko, Y., Chiba, N.: Super conductive cable communication system. J. Inst. Electron. Commun., Eng. Japan B55
1972
No. 2
(Febr.)
S. 184-189.
57
Entwicklungstendenzen
Die Bedeutung der Dokumentation bei der Bereitstellung von EDV-Anwendungen Bearbeiter:
Helmut
Benzing
1. Einführung Der Datenverarbeitungsfachmann versteht unter Dokumentation insbesondere das systematische Registrieren und Aufbewahren von Befehlfolgen (Programmen) [1]. Mit der Zunahme des Umfangs und der Vielfalt von programmierten Anwendungen und dem Ziel der Integration (dem vervollständigenden Zusammenschluß dieser Anwendungen) wird die Dokumentation für die EDV immer bedeutungsvoller. Sie ermöglicht es, auf bereits erarbeitete Lösungen immer wieder zurückzugreifen und sie so besser nutzbar zu machen. Unter dieser gesamtheitlichen Betrachtung genügt es nicht, nur die Programme selbst zu dokumentieren, sondern alle Regelungen für das Gesamtsystem müssen einheitlich dokumentiert werden. Dies geschieht sinnvoll von Anfang an, also schon während der Entwicklung. Andererseits kann während der anschließenden Betriebsphase bei großen Objekten auf eine Dokumentation für die Lenkung und eine Qualitäts- und Ablaufkontrolle auch nicht verzichtet werden. 11.
Allgemeines
zur
Dokumentation
Im Großen Brockhaus [2] wird die Dokumentation als die Sammlung, Ordnung und Nutzbarmachung von Dokumenten, das heißt, aller Gegenstände, die zum Studium, zur Belehrung und Beweisführung dienen, bezeichnet.
Weiterhin
ist es nach
Brockhaus
die Aufgabe
der
Doku-
mentation, möglichst rationelle Methoden, Normen und Richtlinien für die Organisation und Technik der geistigen Arbeit anzuwenden. Im Brockhaus wird die Aufgabe der Dokumentation hinsichtlich der Methodik zur Entwicklung
58
Dokumentation von Software [1] Gesagte ebenso. 12.
nicht
erwähnt.
Hierfür
Entwicklungstendenzen der Dokumentation
gilt
im
das
EDV
vorher
Bereich
Die stürmische Entwicklung der Informationsverarbeitung eröffnet nicht nur eine Fülle von Möglichkeiten zur Verbesserung der Dokumentationsverfahren, sondern führt auch zu einer unübersehbaren Flut von Nachrichten (Daten), deren richtige Nutzung und Verknüpfung zu brauchbaren Informationen für den einzelnen immer problematischer wird. Die weitere Entwicklung der Informationsverarbeitung mag zu Verfahren führen, mit denen man diese Probleme elegant lösen kann, schon jetzt müssen jedoch zum Stand der Technik passende, wirtschaftliche Lösungen erarbeitet werden. 13.
Lösungsmöglichkeiten
Dokumentation
von
organisatorischen
Lösungen
ist
nicht
Selbstzweck. Sie darf daher nicht erst am Ende der Projektierungsphase entstehen, sondern muß bereits bei der Bearbeitung, während der Planung und der Entwicklung der Lösungen erarbeitet werden. Bei rein technischen Entwicklungen wird bekanntlich schon während der ersten Versuchsphasen dokumentiert und nicht erst am Ende der Versuchsreihen. Schließlich ist die Dokumentation nur sinnvoll, wenn sie dazu beiträgt, den Informationsfluß zu verbessern. Was ist aber zu tun, um den Irrweg zum unerreichbaren Ideal der Dokumentation aller möglichen Informationen in einem einzigen integrierten Informationssystem zu vermeiden? 131.
Aufteilung
\
Die Aufteilung in Informations-Teilsysteme und deren eindeutige Abgrenzung untereinander, nötigenfalls noch die Festlegung der wichtigsten Integrationsbeziehungen zwischen ihnen, läßt brauchbare Teillösungen erwarten. Ein besonderes Problem bleibt die Tatsache, daß die
59
Entwicklungstendenzen Wirtschaftlichkeit von Informationssystemen allgemein sehr schwer zu ermitteln ist. Das Teilsystem ist deshalb anzustreben, weil es eine wesentliche Einschränkung des Umfanges gestattet. Dadurch wird es möglich, nur die für das Problem selbst und die für die Integrationsbeziehungen zu den anderen Teilsystemen wesentlichen Nachrichten zu
verarbeiten. 132.
Abgrenzung
Bei der DBP besteht bereits ein Dokumentationssystem „zentrale Dokumentation und Information“ (ZDI). Sein Ziel ist gemäß Hinweisblatt: „Informationsdienste der ZDI“ [3], durch schnelle, umfassende und zeitsparende Informationen eine Leistungssteigerung zu bewirken. Eine eindeutige Abgrenzung gegenüber der hier zu beschreibenden Dokumentationsaufgabe für die Bereitstellung von Objekten ist zu formulieren. Unter dem Oberbegriff Dokumentation sind also bei der DBP mindestens zwei Teilaufgaben (im Hinblick auf systemtheoretische Betrachtungen auch Information-Teilsysteme genannt) zu lösen. —
Aufgabe a: Zentrale Dokumentation und Information, mit den beiden Teilen: A = Post- und Fernmeldebetrieb und Verwaltung B = Post und Fernmeldetechnik. Über diese Gebiete werden in zwei Zeitschriften Informationen in Form von ausgewählten Kurzauszügen aus den Post- und Fernmeldetechnischen Zeitschriften sowie aus anderen Fachzeitschriften des In- und Auslandes (Literaturdokumentation) angeboten. Außerdem werden Kurzfassungen der wesentlichen Verfügungen des BPM ausgearbeitet (Verfügungs-Dokumentation). Diese Kurzauszüge werden von besonders dazu ausgesuchten Dokumentatoren erarbeitet. Dieses soll zur Beschreibung der Abgrenzung genügen.
—
Aufgabe b: Dokumentation mittels genormter Formen und Verfahren als Grundlage für möglichst rationelle Methoden zur Bereitstellung von Objekten.
60
Dokumentation
Bei
diesem
Informations-Teilsystem
kann
anstelle
EDV
der
Kurzauszüge beim Teilsystem unter a) eine Begriffskurzfassung in Verbindung mit der Schlüsselzahl des jeweiligen Anwendungsbereichs treten. Letztere soll, im Gegensatz
zur
Lösung
tionsunterlage
unter
selbst
a),
vom
geliefert
Verfasser
werden.
der
Dokumenta-
Die Integrationsbeziehungen zwischen diesen beiden Teilsystemen sind relativ unbedeutend. Sie können im
einzelnen, soweit überhaupt
erforderlich, bei der Entwick-
lung der Aufgabe unter b) festgelegt werden. Doppelerhebungen von Daten sind kaum zu erwarten. Man kann die Dokumentationsaufgabe unter b) als eine ständig wahrzunehmende mittelbare Aufgabe beim Durchführen von Veränderungen an Objekten, d.h. beim Ändern oder Verbessern organisatorischer Lösungen ansehen. Diese Aussage muß man präzisieren, um zu vermeiden, daß weder zu viel.noch zu wenig dokumentiert wird. Auch die Frage, wie zu dokumentieren ist, muß noch geklärt werden. 2.
Zielvorstellungen
stellung
von
für
Objekten
die
Dokumentation
im besonderen
bei
der
Bereit-
Ausgehend von den vorher genannten Bedingungen wird nachfolgend eine Präzisierung der Aufgabe: „Dokumentation mittels genormter Formen und Verfahren als Grundlage für möglichst rationelle Methoden zur Bereitstellung von Objekten, die mit EDV realisiert werden sollen“, vorgenommen. Die auftretenden Kommunikationsprobleme bei der Ausarbeitung von großen Objektlösungen sind zu verringern. Der Informationsbedarf der weitverstreuten Team-Mitglieder und insbesondere des Managements, ist zu decken,
denn
in der
Entwicklungsphase
von
Objektlösungen
ent-
stehen wesentliche Daten über die künftige Entwicklung der Organisationsstruktur von Teilen des Unternehmens. Wenn man die Betriebsphase einbezieht, werden sogar Daten über die Qualität und den Arbeitsfortschritt geliefert.
61
Entwicklungstendenzen Im Zusammenhang mit der Aufgabe unter b) sollten alle Rahmenvorschriften für das Bereitstellen und Betreiben von EDV-Anwendungen gesehen werden. Dort müssen die grundsätzlichen Bedingungen für dieses Dokumentations-Teilsystem enthalten sein. Da ein brauchbarer Thesaurus für das Spezialproblem der Aufgabe b) nur mit einem sehr großen Personalaufwand und hohen Kosten aufgestellt und gepflegt werden kann, sollte angestrebt werden, vorerst mit frei gewählten Begriffskurzfassungen zu arbeiten, die alphabetisch sortiert werden. Weitere Organisations-, Gliederungs- und Suchkriterien sind: Eine einstellige Kennzeichnung des Entwicklungsstandes. Hier ist die Einordnung nicht unproblematisch, weil Entwicklungsphasen sehr schwer genau zu bestimmen sind. Sie laufen nicht kontinuierlich ab und überlappen sich.
—
Die vom BPM neu festgelegten vierstelligen AGNummern (Gliederung nach Anwendungsbereichen) und die weitere dreistellige Unterteilung der Anwendungsbereiche (AG) mittels einer Zählnummer nach Einzelaufgaben.
—
Die der Aufgabe neten Unterlagen
HE
DRUM HEB
Wb
—
62
— bei der sie entstehen (Dokumentationen) über:
—
zugeord-
andere (sonstige) Daten-Träger und -Gruppierungen Bänder (Magnetbänder, nicht jedoch aus Bandreihen) Dateien Elemente (Datenelemente, Informationselemente) Filme (Mikrofilme und Bilder) Input-(Eingabe-)Belege aller Art, ohne F,K, S
Jobs (Runs, Steuerflüsse usw.) Karten (Lochkarten) Listen (Ausgaben aller Art,
ohne
B,F,K,M,R,S,T,
Magnetkarten, Magnetstreifen usw. Programme und Programm-Segmente oder -Teile Reihen (Magnetbänder, die zu Bandreihen gehören)
NANgedHu
Dokumentation
EDV
Streifen (Lochstreifen und Lochstreifenkarten) Trommelspeicher Unterprogramme Virtuelle Speicher Wechselplattenspeicher (auswechselbare Platten) Worte (besonders bei Wortmaschinen) Felder (Datenfelder) Sätze (Datensätze)
Sie sind unterteilt nach diesen Buchstabengruppen und können weiter nach einer zweistelligen Zählnummer gegliedert werden. Dadurch ist es möglich, hundert verschiedene — unter Zuhilfenahme von Buchstaben mehr als 1000 weitere — Jobs, Programme, Unterprogramme, Dateien, Magnetbänder, Datenelemente usw. pro Aufgabe je für sich zu beschreiben, zu ordnen, zu suchen und verschieden zu gliedern. Die dreistellige Zählnummer aus der Formblattnummer der DBP. Dazu ist es nötig, alle wesentlichen zu dokumentierenden Unterlagen zu normieren und dafür Lagerformblätter herauszugeben, die alle in einer Formblattgruppe zusammenzufassen sind. Dann hätte jedes Formblatt, z.B. das Formblatt, das als Gliederungsunterlage für Nummernsysteme dient, oder jenes, das der Beschreibung eines Datenelementes dient usw., eine bestimmte dreistellige Zählnummer gemäß den Numerierungsregeln für Lagerformblätter bei der DBP. Dieses dreistellige Gliederungsmerkmal ist vorgedruckt, wodurch Verschlüsselungsarbeit und Verschlüsselungsfehler vermieden werden. Man kann mit dieser dreistelligen Adresse unter anderem eine Liste aller bei der DBP entwickelten Nummernsysteme gewinnen. Voraussetzung ist, daß ein einheitliches Formblatt angewendet wird und die Daten aus dessen nachfolgend beschriebenem Formblattkopf verarbeitet werden. Selbstverständlich ist eine Gliederung dieser Liste nach den ersten drei beschriebenen Kriterien möglich. Wendet man nach diesen Regeln gestaltete Formblätter als einheitliche Unterlagen für die Beschreibung von Datenelementen an, können Listen erstellt werden, die
63
Entwicklungstendenzen den Entwicklern neuer EDV-Lösungen über benötigte Datenelemente aus anderen EDV-Bereichen Aufschluß geben. Die Möglichkeiten dieses verblüffend einfachen Verfahrens sind so umfangreich, daß sehr genau überlegt werden muß, welche Daten verarbeitet werden sollen. Diese Tatsache sollte jedoch nicht zu der Entscheidung führen, ein Dokumentationsformblatt deshalb nicht nach dem vorgeschlagenen Verfahren zu gestalten, weil noch geprüft werden muß, ob die EDV-Verarbeitung der Kopfbeschriftung wirtschaftlich ist. Die erzielten Nebenwirkungen, wie die nötige Eingruppierung und die damit erforderliche Abgrenzung jedes einzelnen Bausteins einer EDV-Entwicklung, die Verbesserung der Kommunikationsmöglichkeiten und der Normierungseffekt, sind Grund genug für die Anwendung der vorgeschlagenen Lösungen. —
Eine weitere dreistellige Unterteilungsmöglichkeit, ebenfalls mit Hilfe einer Zählnummer, die eine fast beliebige Gliederung nach weiteren Sachzusammenhängen gestattet. Bleibt die vorher genannte Gliederungsgruppe für die Unterlagen der Datengruppierungen und Datenträger leer oder wird in der ersten Stelle statt eines Buchstabens eine Ziffer gesetzt, können nach weiteren, hier noch nicht festgelegten Gliederungsgesichtspunkten, unabhängig von den Datengruppierungen, je 999 Unterschei-
dungen
usw. Zur
von
z.B.
vorgenommen
Kennzeichnung
Beschreibungen,
Berichten,
werden.
der
Herkunft
der
Dokumentations-
unterlage wird die Adresse des Ausstellers falls dessen Vertreters (Zuname — maximal
Amtskennzahl
Bildern
und nötigen18 Stellen —,
oder Kurzzeichen der Firma — 4 Stellen —,
Dienststelle — Ortskennzahl —
14 Stellen —, Fernsprechnummer maximal 12 Stellen —) benötigt.
mit
Für die bereits erwähnte Begriffskurzfassung zur Beschreibung des Inhaltes bzw. des Zwecks der Dokumentationsunterlage genügen 35 Stellen. Weitere 12 Stellen für eine Identnummer oder eine Kettenadresse sowie ein ein-
64
Dokumentation
EDV
stelliger Hinweis darauf, ob es sich um eine Änderung = A, eine Aufhebung (Löschung) = L oder um die erste Dokumentation dieser Art (Neueintrag) = N handelt, rundet das Spektrum der Möglichkeiten ab. Die vorher beschriebenen Merkmale müssen als Kopfoder Rand-Beschriftung (nur soweit, wie im Einzelfall nötig) auf jedem zur Dokumentation vorgesehenen Formblatt verarbeitungsreif vermerkt werden. Das Verschlüsseln des
Kopfes
(s. Bild 1) dient
nicht
nur
der
Datenaufbereitung
für Dokumentationszwecke. Der Bearbeiter wird gleichzeitig genötigt, eine Entscheidung über die rechtzeitige Zuordnung seines Problems und die Eingruppierung in den Gesamtrahmen der EDV-Lösungen bei der DBP zu treffen. Die Gliederungsmerkmale in der Kopfbeschriftung können zudem als Sortierkriterium für das Abheften der Unterlagen dienen. Die Adresse des Ausstellers ermöglicht eine wesentliche Verbesserung des Informationsflusses bezüglich Nachfragen durch andere Beteiligte, die ebenfalls mit dieser Unterlage arbeiten. 3.
Problemstellung
Wie kann der Informationsbedarf optimal gedeckt werden? Bei der zentralen Dokumentation (ZDI) hat man eine große Gruppe von Dokumentatoren angesetzt, die aus den Dokumentationsgegenständen Kurzfassungen erarbeiten. Dies ist nötig, weil es nicht möglich ist, schon den Verfasser irgendeiner Veröffentlichung zur Lieferung der für ZDI geeigneten Kurzfassungen zu veranlassen. Das ist bei der Dokumentationsaufgabe für die Bereitstellung von EDV-Anwendungen bei der DBP jedoch einfach zu bewerkstelligen. Jeder Verfasser eines Dokumentes verwendet einheitliche Formblätter, die ihm das Einordnen nach den unter Punkt 2 genannten Organisations- und Gliederungsgesichtspunkten erleichtern. Eine Kopie des ersten Blattes einer Dokumentationsunterlage mit einem einheitlichen Formblattkopf wird zum Ablochen für eine anschließende EDV3 Fernmelde-Praxis
65
Entwicklungstendenzen
Verarbeitung der Gliederungsinformationen und, soweit erforderlich, auch des dazu gehörenden Inhalts der Dokumentationsunterlage selbst, gegeben. Das verarbeitende Rechenzentrum verschickt monatlich die Listen über Ergänzungen und verschiedenartig gegliederte
Zusammenstellungen
der
EDV-Auswertung
über
neue und geänderte Dokumentationen von Objektlösungen. Neben einer Dokumentationsdatei auf Magnetband entstehen gleichzeitig vorzügliche Informationen über den Projektfortschritt hinsichtlich seiner Entwicklung und der organisatorischen Abwicklung. Beim FTZ soll dieses Verfahren versuchsweise für die dokumentarische Bearbeitung der Magnetbandregistrierung von Testbändern für Benutzer im Teilnehmerrechendienst eingeführt werden. Es sind monatlich Listen zu drucken, die einen Überblick über die Belegung von mehr als 1000 Testbändern, hinsichtlich der Zuordnung zu den Anwendungsgebieten, den Einzelaufgaben, hinsichtlich des Verwendungszwecks und der Freigabedaten geben. Man kann die Dokumentation als eine permanente mittelbare Aufgabe bei der Bereitstellung von EDV-Anwendungen betrachten. Nachfolgend werden deshalb die wichtigsten Punkte genannt, die — unterteilt nach unmittelbaren und mittelbaren Aufgaben — als Problemkreise
anzusehen
31.
sind.
Dokumentation
bei
der
Lösung
als
Informationshilfe
unmittelbarer
gaben zur Bereitstelllung Anwendungen
von
Auf-
EDV-
Betrachtet man den Ablauf der unmittelbaren Aufgaben zur Bereitstellung von Objekten, so ergeben sich grobe Phasen, innerhalb derer wesentliche Abschnitte zu nennen sind, die Gegenstand einer Dokumentation sein Sollten. Diese Phasen werden aufgezählt und zu den einzelnen Problemkreisen werden Vorschläge zu notwendigen Dokumentationsformblättern gemacht. Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Frage, aus welchen Formblättern die Daten der Randoder Kopfbe-
66
Datenstationen
schriftung in eine EDV-Verarbeitung wird nicht erörtert. 311.
Dokumentation von Objekten
bei
der
zu übernehmen
sind,
Planung
Betrachtet man die „Entscheidung über eine EDV-Anwendung“ als ersten Problemkreis, so wären hierzu als notwendige Dokumentationsformblätter die „EDV-Projektmeldung“ und die „Anmeldung des Hardware-Bedarfs“ zu nennen. Die „EDV-Projektmeldung“ ist ein im FTZ probeweise eingeführtes Formblatt für die Dokumentation, das als Teil des Genehmigungsvorgangs zu betrachten ist. Auf diesem Blatt sind im Kopf ablochfähig eingetragen: Die Nummer der Aufgabe innerhalb des Anwendungsbereiches, die vorgesehene EDV-Anlage, das Datum der Antragstellung, der Name des Auftraggebers mit Dienststelle und Fernsprech-Nummer, in gleicher Form die Adresse des Auftragnehmers, n.F. ein Identifizierungsmerkmal für den Auftrag und die Begriffskurzfassung über den Inhalt des Auftrags. Eine Angabe darüber, ob es sich um eine Neumeldung, eine Änderung oder eine Löschung handelt, ist ebenfalls erforderlich. Sie wird nachfolgend als selbstverständlich betrachtet und deshalb nicht mehr erwähnt. Im Formblatt „EDV-Projektmeldung“ befinden sich außerdem im Hauptteil ablochfähige Daten über den Beginn-Termin, den Abschlußtermin und den geschätzten Zeitbedarf für Organisation und Programmierung in Mannwochen. Vorgedruckt in der Kopfoder Randbeschriftung ist die Ziffer 19 als Zählnummer dieses Sonderformblattes. Ein Formblatt für die Anmeldung des Hardware-Bedarfs muß noch vereinbart werden. Wird ein neuer Anwendungsbereich festgelegt, findet das Formblatt „AG-Nummern-Festlegung“ Anwendung. Die einzutragenden Daten im Kopf sind: Die AG-Nummer, die vorgesehene erste EDV-Anlage, das Datum der Festlegung, der Name des verantwortlichen Bearbeiters für (diesen Bereich mit Dienststelle und Fernspr.-Nr. und die Begriffskurzfassung über den Umfang des Anwendungsbereichs. Als zweiter 3*
67
Entwicklungstendenzen Problemkreis wäre die „Entscheidung über die Projektund Arbeitsgruppen“ zu nennen. Die hierfür vorgesehenen Dokumentationsformblätter
sind
im
Rahmen
des
vorge-
sehenen Projektsteuerungsverfahrens zu entwickeln. Hier sollte die Dokumentation als Abfallprodukt eines EDVTeilsystems „Projektsteuerung“ gewonnen werden. Der nächste Problemkreis in der Phase „Planung von Objekten“ ist der „Vergleich von alternativen Lösungen“. Soweit nicht bereits vor dieser Entscheidung über die EDV-Anwendung eine Istaufnahme vorlag, muß sie hier nachgeholt werden. Die Dokumentationsformblätter für die Mengengerüste der Ein- und Ausgabedaten, für die Graphische Beschreibung, Listenbilder und Dateibeschreibungen, ZEntscheidungstabellen und Aufgaben-Gliederungen wären als einheitliche Formblätter mit einem ähnlichen Datensatz, wie nachfolgend beschrieben, als Rand- oder Kopfbeschriftung zu versehen. Hierzu gehört auch noch die „Nummern-Schlüssel-Gliederung“, ein Sonderformblatt des PTZ, das nach Auffassung des Verfassers mit einer entsprechenden Giederung für die bereits erwähnte Kopfbeschriftung auszustatten ist. Im Bild 1, einem Kopf dieses Formblatts, ist die Ziffer 33 als Zählnummer dieses Dokumentationsformblattes vorgedruckt.
1 EERZING
3,3 ’
1
.
1738
151-383 441
-HAMRUFG
LASSIPIZIEHUNG
ß -2293-
OBJIEKTDOKUYENTATIIO
Nummername
: Klassi fizierungsnummer für Dokumentations-Formblätter (Feld 1.1 bis 1.5 dieses Formblattkopfcs) Geltungsbereich: noch nicht festgelegt
angeordnet mit
_Vorschine
Bild 1. Formblattkopf
Dokumentation
EDV
Wird der Datensatz voll ausgefüllt, so können alle zu einer bestimmten Datei, Liste oder zu einem bestimmten Datensatz usw. gehörenden Schlüssel beschrieben werden. Es können Listen über alle entwickelten Schlüssel mit Hinweis auf den Anwendungsbereich und den Entwickler erstellt werden. Schließlich ist noch der „Netzplan“ zu nennen, der jedem der bisher genannten Problemkreise zugeordnet werden kann und ebenfalls mit einem Dokumentationskopf zu versehen wäre. Es folgt der Abschnitt „Entscheidung über die Durchführung des Objektes“, entweder als Betriebsversuch oder in endgültiger Form. Hier sind Dokumentationsformblätter für den Programmplan und den Personal-Einsatzplan erforderlich. 3.12.
Dokumentation
führung
von
bei
der
Durch-
Objekten
Ein Abschnitt ist hier die „Arbeitsvorbereitung und die Verteilung der Ausgabedaten“ Die hierfür notwendigen Dokumentationsformblätter sind weitgehend abhängig von der Betriebsstruktur des jeweiligen Rechenzentrums und vom EDV-System. Welche Formblätter mit einem einheitlichen Dokumentationskopf zu versehen sind, muß sehr genau geprüft werden. Als ein Beispiel ist das im FTZ verwendete Formblatt für die Magnetbandregistrierung zu nennen. Für den Abschnitt Gesagte genauso. Als
das
letzter
Abschnitt
„Arbeitsergebnis“
„Arbeitsabwicklung“ in der
zu
Phase
nennen,
der
über
gilt
das
vorher
Durchführung
das
berichtet
ist
wer-
den muß. Für die Berichte über den Arbeitserfolg sind noch brauchbare Dokumentationsformblätter festzulegen. 313. Zu
Dokumentation Kontrolle von
bei der Lenkung Objekten
diesem
gehört
Hinsichtlich
Problemkreis
der
Termine
und
der
des
und
„Arbeitsfortschritt“.
Personal-Einsatzes
Entwicklungstendenzen ist zu prüfen, wie man zu einer brauchbaren Dokumentation kommt, die den Erfordernissen beider Funktionen, sowohl der Lenkung, als auch der Kontrolle gerecht wird. 32.
Dokumentation mittelbarer
stellung
von
bei
der
Aufgaben
Objekten
Lösung zur
Bereit-
Mittelbare Aufgaben zur Bereitstellung von Objekten sind nach zwei verschiedenen Gesichtspunkten zu betrachten. So fallen zum Beispiel die Aufbauorganisation, die Ablauforganisation, die Steuerung, das Berichtswesen und die Archivierung, sowie alle übrigen nachfolgend genannten mittelbaren Aufgaben, sowohl bei der Entwicklung des Objektes als auch bei seiner Realisierung an. Diese Aufgaben gewinnen immer mehr an Bedeutung. Sie sind ein Teil der Entwicklungsaufgaben für immer komplexere Systeme. Künftig werden auch die winzigsten EDV-Aufgaben Teile solcher Systeme sein, Deshalb muß
besonders
mierung,
hierbei
die Dokumentation
Organisation
und
Ordnung
als Mittel
herangezogen
der Norwerden.
Auch bei den mittelbaren Aufgaben kann man eine Unterteilung nach Phasen vornehmen und die hervorzuhebenden Punkte als Problemkreise ansehen. Sie müssen ebenfalls Gegenstand einer Dokumentation sein. Zum Zweck der Normierung ist der gleiche Datensatz, wie vorher beschrieben, als Formblattkopf oder Randbeschriftung zu verwenden. 32.1.
Dokumentation
stellung
der
bei
der
Bereit-
Organisation
Erster Problemkreis in diesem Rahmen ist die „Aufbauorganisation“. Hier sind sowohl die Festlegung der aufbauorganisatorischen Regelungen für die Projektund Arbeitsgruppen, als auch die der aufbauorganisatorischen Regelungen des zu entwickelnden Objektes zu nennen.
Einheitliche ten die
70
Dokumentationsformblätter
Datensatz als nachfolgend
mit dem
erwähn-
Kopfbeschriftung sind hierfür und genannten Punkte anzustreben.
für Ein
Dokumentation
EDV
weiterer Problemkreis ist die „Ablauforganisation“, für deren Darstellung die bereits beim „Vergleich der alternativen Lösungen“ angesprochen einheitlichen Formblätter für graphische Beschreibungen, Entscheidungstabellen und Aufgabengliederungen anzuwenden sind. Schließlich sind die „Steuerung“ und das „Berichtswesen“ zu nennen. Die hierfür notwendigen Unterlagen können sowohl Dokumentationsformblätter, als auch Ergebnisse aus der EDV-Verarbeitung der Randbeschriftungen und Formblattköpfe der hier beschriebenen Dokumentationsformblätter sein. 3.22.
Dokumentation Bereitstellung
bei
der
Mittel-
Der eindeutige Nachweis der Mittel-Bindungen, sowohl hinsichtlich der Kosten für die Entwicklung, als auch der Kosten des Objektes selbst, wird mit Hilfe der Dokumentation zu einer wesentlichen Basis für eine erfolgreiche Durchführung
Formblätter
von
mit
Objekten.
Dazu
Dokumentationskopf
gehören
für
die
einheitliche
Dokumen-
tation der Personalkosten, unterteilt nach Löhnen und Gehältern, Reisekosten und Ausbildungskosten, sowie einheitliche Formblätter für die Ermittlung und Dokumentation der Kosten für Sachmittel insbesondere für Hardware, Software und Gebäude. 3.23.
Dokumentation
Bereitstellung
bei
der
Personal-
Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist hier die Normierung der Dokumentationsformblätter mit der genannten Kopf- oder Randbeschriftung. Man benötigt sie in den verschiedensten Phasen von der Ermittlung des Sachmittelbedarfs bis zur Bereitstellung der Sachmittel und danach noch zur Qualitätskontrolle. Insbesondere bei der Software ist die Dokumentation von sehr großer Bedeutung, weil es sich hierbei um ein Sachmittel handelt,
das
sich
dem
gespeichertes Sinnesorganen
Überblick
leicht
Programm kann nur über Umwege
entzieht.
Ein
elektronisch
von den menschlichen wahrgenommen werden,
al
Entwicklungstendenzen
während ein Auto, eine Maschine oder ein anderes Gerät sofort ins Auge fällt. Hier hilft nur noch eine gut organisierte und transparente Dokumentation. Schließlich sind für die technischen Einrichtungen noch einheitliche Belege für die datenverarbeitungsreife Erfassung des Bedarfs und der Bestände festzulegen. Nicht zuletzt ist die Dokumentation von Dateien und sonstigen Betriebsmitteln zu nennen. 4. Integration mit EDV-systemeigener und Generatoren
Dokumentation
Zur Integration mit systemeigener Dokumentation kann der jeweilige Dokumentationsgegenstand über eine Identnummer im Formblattkopf mit den Daten dieses Teils des Betriebssystems verkoppelt werden. Dies kann bei UNIVAC-Anwendungen über die Formblatt-Datensätze aus den bereits gebräuchlichen Formblättern „Dateinamen-Vereinbarung“ und „Qualifier-Vereinbarung“
(Qualifier
ist vergleichbar
mit der Identnummer
einer zu-
sammengehörenden Gruppe von Programmen und Dateien) geschehen. Voraussetzung hierzu ist jedoch die beim FTZ bereits praktizierte verdeckte Verschlüsselung des Qualifiers in der ersten Stelle der Zählnummer in Feld 1.22 der Kopfbeschriftung. Die Identnummern, bei UNIVAC der Dateiname oder der Qualifier, bei anderen EDV-Systemen entsprechende Kennungen bis maximal 12 Stellen, werden im Feld 4.1 der Kopfoder Randbeschriftung auf dem Dokumentationsformblatt vermerkt. Dieses Beispiel zeigt die Beweglichkeit des beschriebenen Dokumentations-Teilsystems.
Unabhängig
davon
wird
es
eine
nicht
geringe
Anzahl von Dokumentationen über Objektteile geben, die nicht in dieses System integriert sein sollen. Die Dokumentare, (hier die Bearbeiter selbst) können durch die Beschreibung von Grenzfällen und Ausnahmen und mit Hilfe von Checklisten Hinweise erhalten, wie sie die Abgrenzung zwischen Formblatt-Dokumentation und anderen erforderlichen Dokumentationen zweckmäßig vornehmen.
72
Dokumentation
5.
EDV
Zusammenfassung
Die Beschreibung hat deutlich gemacht, daß Dokumentation von großer Bedeutung ist. Die Dokumentationsprodukte die während der einzelnen Stufen bei der Bereitstellung von Objekten ohne großen zusätzlichen Aufwand entstehen, helfen die Kommunikation zwischen den Beteiligten zu verbessern. Bei dem vorgeschlagenen Verfahren erhalten die Bearbeiter unter anderem Inhaltsverzeichnisse über die von ihnen bearbeiteten Dokumentationsformblätter. Das EDV-Verfahren berichtigt ihnen laufend dieses Verzeichnis. Gleiches gilt für die TeamMitglieder und Programmiergruppen- oder Projekt-Leiter. Sie erhalten Inhaltsverzeichnisse über die Dokumentation ihrer Teilaufgaben-Bereiche, und es entsteht ein Gesamtverzeichnis aller Dokumentationen, das nach AufgabenBereichen und vielen anderen Kriterien gegliedert werden kann. Anstelle eines Thesaurus entsteht ein alphabetisches Verzeichnis der Begriffs-Kurzfassungen, die später noch thesauriert werden können. Durch Zuordnung der Klassifizierungs-Nummern und der Adressen der Bearbeiter hat jeder Benutzer dieses Vezeichnisses Zugriff auf jeden einzelnen mit diesem Verfahren erfaßten Dokumentationsgegenstand, ohne das aufwendige Verfahren einer zentralen Dokumentation aller Unterlagen. Es ergibt sich eine Normierung der Abläufe und der Verfahren zur Entwicklung organisatorischer Lösungen. Schließlich ist noch zu erwähnen, daß dieses Dokumentationsverfahren auch besonders gut für die Anwendung bei der Entwicklung modularer Software-Pakete und einer, dem Stand der Entwicklung anzupassenden Einfügung von Generatoren z.B. für normierte Programmierung
geeignet
ist.
Das beschriebene Verfahren ist ein Mittel zur Organisation der Organisationsarbeit. Mit seiner Hilfe werden die Tätigkeiten der an der Bereitstellung von Objekten Beteiligten gestrafft, systematisiertt und genormt. Die Hilfsmittel sind einheitliche Methoden, Dokumentationsrichtlinien und einheitliche Formularketten. Vorteil dieser Arbeitsweise ist,
73
Entwicklungstendenzen —
durchsichtige Methodik und die Vermeidung wegen durch schnelleres, gezieltes Vorgehen,
—
rechtzeitige Abstimmung der erreichten Teilziele mit den Auftraggebern, klare Dokumentation und personenunabhängige Lösun-
—
gen,
wodurch
Kräften
der
erleichtert
Einsatz
wird,
von
neuen
oder
von
Um-
fremden
— ein vereinfachter Änderungsdienst, —
—
eine Verbesserung der Kommunikation zwischen den Mitgliedern der Entwicklungs-Teams, insbesondere, wenn sie über das ganze Bundesgebiet verstreut sind, erhöhte
Produktivität
Lösungen.
und
Wirtschaftlichkeit
der
EDV-
6. Schrifttum [1]
[2] [3] [4] [5] [6]
74
H. Benzing, H. Birner: Begriffe und Erläuterungen aus der Elektronischen Datenverarbeitung, taschenbuch der fernmeldepraxis 1971, Fachverlag Schiele & Schön, Berlin, Seite 126..139. Der Große Brockhaus, F. A. Brockhaus, Wiesbaden 1954. ZBDI, Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen, Ausgaben von 1973. Fachwörterbuch der Fernmeldetechnik, Fachverlag Schiele & Schön, Berlin (erscheint Anfang 1974). DIN-Taschenbuch 25, Informationsverarbeitung, Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30, Köln, Frankfurt (Main), DIN 44300 S.7. Volker Pawlitzki, Planung und Kontrolle von DV-Aufgaben. adl-nachrichten (Zeitschrift für Informationsverarbeitung, Heft 78/73.
Gestaltung
von
Veröffentlichungen
„Empfehlungen für die Abfassung technischer Veröffentlichungen“ Bearbeiter:
Herbert
Baehr
1. Allgemeines
DerWerdegang einer Veröffentlichung von der Vorbereitung bis zur Gestaltung der Druckvorlage und der Weg über die Schriftleitung bis zur Druckerei soll so zweckmäßig wie möglich sein. Die technische Abhandlung selbst soll so abgefaßt sein, daß der Leser den Inhalt ohne
besondere Mühe erfassen kann. Hierbei helfen kurze, klare
Texte, folgerichtige Gedankengänge, ein flüssiger Stil und eine gute äußere Form. Darüber hinaus erleichtern genormte Begriffe, Formelzeichen, Einheiten usw. die Arbeit. Daran und an das Urheberrecht sollte der Verfasser bei der Abfassung von technischen Veröffentlichungen denken. 2. Gestaltung
des Textes
Der Titel einer Veröffentlichung soll kurz und treffend: sein; notfalls sollte er durch Untertitel ergänzt werden. Für die Dokumentation werden zusätzliche Angaben benötigt, z.B. DK-Nummern, Schlüsselwörter und Angaben über
den
Verfasser
(Vorname,
Name,
Wohnort).
Umfang-
reichen Veröffentlichungen sollte man eine Inhaltsübersicht voranstellen und eine Zusammenfassung anfügen. Gliederungen sollten wenigstens die Überschriften der Hauptabschnitte erhalten. Alphabetische Sachverzeichnisse sollte man nur in besonderen Fällen vorsehen. Ferner empfiehlt es sich, einen Anhang für Tabellen, Schrifttumshinweise und Formeln mit deren Ableitungen aufzunehmen. Hierbei ist auch auf die bibliographisch richtige Schreibweise der Angaben zu achten, z.B.: [23]
Kilkowski, J.; Sieler, W.: Nanosekundentechnik in einem Puls-Code-Modulator für 1200 Gesprächs-
75
Fachbeiträge kanäle. bis
[4]
Nachrichtentechn.
Z.
20
(1967),
H.1.
S.
11
15.
v. d. Waerden, B. L.: Mathematische Statistik (Die Grundlagen der mathematischen Wissenschaften in Einzeldarstellungen, Bd. 87). Berlin-Göttingen-Heidelberg: Springer-Verlag 1957.
Die Darstellungsform soll gedrängt aber deutlich sein. Am besten wirken kurze Sätze mit klaren und genauen Angaben. Unverständliche Abkürzungen, übertriebene Ausdrücke und unbekannte Fremdwörter sind zu vermeiden. Das Thema ist in sich geschlossen und erschöpfend zu behandeln. Größere mathematische Abhandlungen sollte man auf Ansatz und Lösung beschränken. Überhaupt sollte man das Niveau der Arbeit dem Leserkreis anpassen und sich die Schritte vom Leichten zum Schweren genau überlegen. Abschnittsnumerierungen und Zwischenüberschriften fördern die Übersichtlichkeit und erleichtern das Wiederauffinden einzelner Textstellen. Zahlenmäßige Zusammenhänge werden gut durch Bilder und Grafiken erklärt. Grundsätzlich braucht man nichts zu beschreiben, was man bereits bildlich klar ausgedrückt hat. Dabei sollte man zur Erläuterung eines Gedankens mindestens ein Bild aufwenden. Die Bildvorlagen sollten so ausgelegt sein, daß sie auch als Vorlagen für Diapositive verwendet werden können. Für die Darstellung von Bauteilen und Geräten sind am besten Realfotos geeignet. 3. Druckvorlagen Die Druckvorlagen bestehen aus dem eigentlichen Text mit Zusammenfassung und einigen besonderen Blättern für: —
Titel,
—
Inhaltsübersicht
Verfasser
mit
Wohnort
—
Schrifttumsverzeichnis
—
Zusammenstellung
—
Zusammenstellung schriften
76
der der
zum
Text
gehörenden
Bildnummern
und
Fußnoten Bildunter-
Gestaltung
—
Bilder
—
Tabellen Die
mit
Überschriften,
Druckvorlagen
format A4) beschrieben
eineinhalb
sollen
von
Veröffentlichungen
Nummern aus
festem
und Papier
Fußnoten. (Norm-
bestehen und nur einseitig mit der Maschine sein. Der Zeilenabstand sollte mindestens
Zeilen betragen und eine Seite sollte höchstens
aus 30 Zeilen bestehen. Links wird ein etwa 50 mm breiter Rand benötigt. Absätze sind durch Leerzeilen kenntlich zu machen. Wörter sollte man nicht durch Formelzeichen ersetzen, und Sätze sollten nicht mit Einzelbuchstaben, Ziffern
oder
Formeln
beginnen.
Unterstreichungen
im
Text sind zu vermeiden. Die Blätter sind oben fortlaufend zu benummern. Es sind nur leicht lösbare Heftmittel, zum Beispiel Büroklammern zu verwenden. Die Blätter müssen glatt und ungefaltet bleiben und dürfen nicht gerollt werden.
Für die Rechtschreibung ist der „Duden“ maßgebend. Die Schreibweise wiederkehrender Wörter, Abkürzungen usw. muß einheitlich sein. Bei der ersten Anwendung sind Abkürzungen auszuschreiben und die Kürzungen dahinter in Klammern zu setzen. Zu beachten ist die Schreibweise physikalischer Gleichungen. Die Druckvorlagen sollen so setzgerecht wie möglich vorbereitet sein, damit auch komplizierte Formeln übersichtlich und ohne Mißverständnisse vom Setzer gelesen werden können. Kursive Buchstaben sind zu kennzeichnen. Auf die Mehrdeutigkeit einzelner Buchstaben ist zu achten. Sollen Formeln im Text durchlaufend mit Nummern versehen werden, so sind die Nummern in runden Klammern hinter die Formeln zu setzen und gegebenenfalls im Anhang zu wiederholen. Literaturstellen werden dagegen in eckigen Klammern durchnume-
riert. Fußnoten werden am Werden Formeln und Bilder auch
hier
die
Formelzeichen
Ende der Sätze .angebracht. im Text erläutert, so sollten kursiv
geschrieben
werden.
Bildvorlagen sind den Wünschen der Schriftleitung entsprechend zu liefern, z.B. als Weißpausen. Kleinere Bildvorlagen sollen im Umschlag beigefügt werden. Lichtbildabzüge sind nicht zu beschriften. Gebrochene, gelochte oder gestempelte Lichtbilder sind unbrauchbar. Bilder und
77
Fachbeiträge deren Unterschriften sollen so vollständig sein, daß man sie auch ohne Text verstehen kann. Jedes Bild muß im Text genannt sein und seine eigene Unterschrift und Nummer haben. Im Manuskript sind Hinweise erwünscht, an welchen Textstellen die Bilder eingefügt werden sollen. Formelzeichen werden auf Bildern kursiv geschrieben. Auch Tabellen sollen nicht größer als eine DIN A 4-Seite sein. Im Text ist an der richtigen Stelle auf jede Täbelle hinzuweisen, sie sind wie Bilder gesondert zu liefern. 4.
Verkehr
mit
der.
Schriftleitung
Der gesamte Schriftwechsel ist nur mit der Schriftleitung zu führen. Es empfiehlt sich, ein Doppel der Druckvorlagen für sich zurückzubehalten. Korrekturabzüge sind genau zu prüfen und mit dem Vermerk „druckfertig“ zu versehen und zu unterschreiben. Korrekturen sind nur auf dem
Rande
zu vermerken.
Der
Satz darf nicht überklebt
wer-
den. Die offiziellen Korrekturzeichen findet man u.a. im Duden. Umfangreiche Änderungen sollen auf .besonderen
Blättern
kenntlich
gemacht
und
an
den
entsprechenden
Stellen der Korrekturabzüge angeklebt werden. Im Umbruchbogen sind nur Druckfehlerverbesserungen zulässig. Umfangreichere Änderungen des Textes bei der Korrektur verursachen zusätzliche Kosten, die dem Autor evtl. vom Verlag in Rechnung gestellt werden können. 5.
Doppelveröffentlichungen
Das Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte schützt Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst. Werke sind persönliche geistige Schöpfungen. Damit wird das geistige Eigentum des Urhebers an seinem Werk anerkannt und geschützt. Auch ein Werk der technischen Literatur ist ein literarisches Werk. Das Urheberrecht kann im Prinzip nicht vom Nichtschöpfer erworben werden, ihm können lediglich Nutzungsrechte eingeräumt werden. Dies geschieht häufig automatisch. Steht z.B. ein Urheber in einem Arbeitsverhältnis, so hat er sich in der Regel durch den Arbeitsvertrag verpflichtet, urheberrechtlich geschützte. Werke zu
18
Gestaltung
von
Veröffentlichungen
schaffen. Anders liegt der Fall, wenn der Autor sein Werk einer Zeitschrift als Beitrag liefert. In diesem Falle erwirbt der Verlag ein Nutzungsrecht zur Vervielfältigung und Verbreitung des Werkes. Wird nichts anderes vereinbart, so ist dies ein ausschließliches Nutzungsrecht im Sinne des Urheberrechts und Verlagsgesetzes. Es berech-
tigt den Inhaber, das Werk
unter Ausschluß
6. Buchstaben,
Zeichen
aller anderen
Personen einschließlich des Urhebers auf die ihm erlaubte Art zu nutzen. Um Doppelveröffentlichungen zu vermeiden, wird bei Bestellung oder Annahme von Abhandlungen auf DIN 1422 hingewiesen. Es gelten dann folgende Bedingungen: Die Abhandlung darf noch an keiner anderen Stelle erschienen sein oder bis zur Veröffentlichung erscheinen. Der Verfasser darf ohne Zustimmung der Schriftleitung oder des Verlages die Abhandlung bis zum Ablauf des folgenden Jahres an keiner anderen Stelle veröffentlichen. Der Verlag ist andererseits verpflichtet, den anderweitigen Abdruck des Beitrages innerhalb der genannten Frist nur mit Erlaubnis des Verfassers zu genehmigen. Ziffern
und
im
Formelsatz
Die gemeinsame Arbeit aller an einer Veröffentlichung Beteiligten erfordert Absprachen, um die sehr unterschiedlichen Bedüfnisse von Mathematik, Lehrkunst und Satztechnik aufeinander abzustimmen. Diese Absprachen verpflichten den Verfasser bereits seine Druckvorlagen satztechnisch zu fertigen. Er muß z.B. wissen, wie Formeln übersichtlich gestaltet und ohne Mißverständnisse gesetzt werden, damit ein augenfälliger Formelsatz entsteht. Ferner sollte er wissen, daß nachträgliche Änderungen erhebliche Mehrkosten verursachen, vor allem dann, wenn freistehende Formeln im Handsatz von allen Seiten durch Ausschluß festgelegt werden müssen. Überhaupt sollte er auf
Änderungen
nur
in
wichtigen
Fällen
bestehen,
z.B.
dann, wenn sich durch die technische Entwicklung die Aussage überholt hat. Ein guter Formelsatz setzt die richtige Wahl von Buchstaben, Ziffern und Zeichen sowie die richtige Schreibweise physikalischer Gleichungen voraus. Letztlich be-
19
Fachbeiträge stehen jedoch die Gleichungen mit Namen, Formelzeichen und 6.1.Das Das sieben
aus physikalischen Einheiten.
„Internationale
Einheitensystem“
„Internationale
Einheitensystem“
Basiseinheiten:
Das
Meter
Größen
(m),
(SI) das
stützt sich auf
Kilogramm
(kg),
die Sekunde (s), das Ampere (A), das Kelvin (K), die Kandela (cd) und das Mol (mol). Von diesen Basiseinheiten werden in den meisten Fällen nur die ersten vier benötigt. Zum Beispiel läßt sich die Leistung mit 1 Watt = 1kg m? s-3 darstellen. Diese umständliche Schreibweise wird vermieden, wenn man aus den Basiseinheiten abgeleitete Einheiten verwendet. Hierzu gehören u.a. die Krafteinheit Newton (N), die Arbeit in Joule (J) und die elektrische Spannung
in
Volt
(V).
Die
Einheiten
der
weiteren
elek-
trischen Größen pflegt man allgemein als Potenzprodukte der Einheiten V, A, m, s auszudrücken, So wird 1 Watt = 1 VA und die magnetische Feldkonstante
u, = 42-107 Vs A-Im-ı, Einheitengleichungen geben die zahlenmäßigen Beziehungen zwischen Einheiten an. Im allgemeinen werden Einheitengleichungen so aufgestellt, daß der Zahlenwert auf der linken Seite gleich eins wird. Die Zahlenwerte auf der rechten Seite werden zu einem Umrechnungsfaktor vereinigt. Sollen Einheiten verschiedener Größensysteme untereinander verglichen werden, dann wird dies durch „entspricht“ gekennzeichnet, beispielsweise 1pF
Beispiele ıIN
=
2
0,9 cm.
Einheitengleichungen
1kgms
1 Gauß
Nm
für
=z
=
mm?
1
=1
Maxwell m? Q 10-6 m?
—
m
_
—
10-8Vs am:
_—_.
= 100m
=
-4 10-Vsm
-2
Gestaltung
6.2. Physikalische
von
Veröffentlichungen
Größen
Unter physikalischen Größen versteht man meßbare Eigenschaften physikalischer Objekte, Vorgänge oder Zustände, z.B. Länge, Zeit, Energie, Feldstärke. Eine Größe messen heißt, sie durch eine Zahl darstellen, welche angibt, wie oft die zugehörige Einheit in der zu messenden Größe enthalten ist. Größe und Einheit müssen von derselben Art sein. Größen gleicher Art sind solche, von denen physikalisch sinnvoll Summen oder Differenzen gebildet werden können. Eine Größe ist das Produkt aus Zahlenwert und Einheit.
Größe Die
Formelzeichen
=
Zahlenwert für
und die Kurzzeichen gedruckt: U Ist der
=
220V;
Zahlenwert
Größen
für
X Einheit. werden
Einheiten
in
in
kursiver
senkrechter
Schrift
Schrift
E=-5%
m
einer
auch als Verhältnis von geschrieben werden:
Größe
Größe
Zahlenwert ahlenwer
=
nicht
und
U —er
=
bekannt, so kann
Einheit
in
er
Bruchform
U U/kV
Größengleichungen sind Gleichungen, in denen die Formelzeichen physikalische Größen bedeuten; sie gelten unabhängig von der Wahl der Einheiten. Aus diesem Grunde sind sie für die Darstellung physikalischer Zusammenhänge besonders geeignet. Bei der Auswertung von Größengleichungen sind für die Formelzeichen der Größen der Produkte aus Zahlenwert und Einheit einzusetzen und wie selbständige Faktoren zu behandeln.
81
Fachbeiträge
Beispiele
für die
Schreibweise
Größe
Formelzeichen
Kraft
F
Arbeit Leistung Elektrische Spannung Elektrischer
W P U
physikalischer
Größen
Kurzzeichen der Einheit
Größengleichung
N
F=-ma
J, VAs W,VA V
wW=|{rFds P= dWldt uU= [Eds
Widerstand
R
2, V/A
R=-Ul
Elektrische Stromstärke Elektrische Kapazität
I C
A F
I= —dodt CC = QIU
Elektrische
E
V/m
E
6.3.
Schreibweise Gleichungen
Ein guter füllen: — —
—
Feldstärke
Formelsatz
=
FiQ
physikalischer soll
folgende
Forderungen
er-
Der mathematische Zusammenhang der Formelteile soll schon in ihrem typographischen Bild augenfällig hervortreten. Gleiche Formelbuchstaben sollen sich bei unterschiedlicher mathematischer Bedeutung durch Schriftart, durch Indizes oder dgl. unterscheiden, soweit dies allgemeinen Vereinbarungen entspricht. Die Schriftzeichen sollen in Form und Größe aufeinander abgestimmt sein und sich — auch wenn sie einzeln stehen — leicht und eindeutig lesen lassen.
Diese Forderungen lassen sich am ehesten erfüllen, wenn der Verfasser bereits in seiner Druckvorlage Formeln augenfällig gliedert und für die Kurzzeichen unterschiedliche Schriftarten verwendet. In der Regel beherrscht der Verfasser die senkrechte und schräge Normschrift. Werden andere Schriftarten, z.B. Fraktur, verlangt, so muß er darauf hinweisen.
82
Gestaltung Senkrecht
geschrieben
werden
von
Veröffentlichungen
u.a.
Zahlen in Ziffern, Mathematische Zeichen mit feststehender Einheiten und ihre Vorsätze. Kursiv (schräg) geschrieben werden Zahlen in Buchstaben (außer 7, ei), Physikalische Größen.
Beispiele Zahlen
in
anlen ın
für
Ziffe
senkrechte
u.a.:
Schrift :
n
1,25 100; 2 . 2/8: 5r?; 32fach;
Zeichen mit
feststehender
Bedeutung,
Bedeutung
y-ı
lim; sin; 18; In; a;[;&
Einheiten und ihre Vorsätze
m; 8; s, A, Hz; DM km; kg; us; mA; kHz
Chemische
Fe;
Elemente
Beispiele
für
Zahlen
Buchstaben
durch
dargestellt
kursive
H2SO4 Schrift
r _
v3; n-fach !
m
Dk,fürh=1,2%...,n
i=]
Physikalische
Größen
Zeichen, deren Bedeutung frei gewählt werden Komplexe
Größen
m; C; F} u; U; I; R, W; P f (x); y’; y“ | U,
g
U*,Z=RH+jX
+jb 83
Fachbeiträge Beispiele für Gliederung mathematische Zeichen
durch
Ausschluß
und
Der kleinste drucktechnische Ausschluß (Abstand) beträgt 1p => 0,38mm. Schreibmaschinen dagegen lassen als kleinsten Abstand nur etwa 25mm => 7p zu. Beispiele:
k
=
xcosa
442
oder
k
=
+
ysina
13
3
zcosa
+
5353 -
24
2
1]
p Ausschluß
ysina 4
3
2
p Ausschluß
Gliederung durch Ausschluß
(5-3 + 4-2); 9 876,543
Einheiten
ms kg pF MeV
Millisekunden Kilogramm Pikofarad Megaelektronenvolt
VA
Scheinleistung Voltampere Voltsekunde
mit
Vorsatz
Einheitenpaar ohne Vorsatz
Vs ms ms
N
Einheitenpaar
kVA
mit Vorsatz
kp: m kpm
Produkt
abc
(allgemein)
Multiplikationspunkt
Meter
Kilovoltampere }
Kilopond
n!=1-2-.3...n 2-16a?b jw-10,8mH
A Cc+D B
E+HF
kg.
Ss
84
X Sekunde
«m.
s-i
X Meter
\
Gestaltung ohne
von
Veröffentlichungen
kg m? ss”?
Multiplikationspunkt
ab—ac(c+c)
Multiplikationskreuz
5cmX
Klammern
b+da _ (1+.a)/(b+d) tan(—-b)+1=1+ttan(-b)
Brechen
17cm
1+
einer
Summe
S=-U+V+B+Htc S=-U+rV+ +B+tCc
Brechen
eines
Produktes
S=U:V:B’-C S=U'VX
xB’-C rechen Brech
eines 1
Bruches Bruch
S =
U+V+TW A+BrFC
S=-(U+VTW)X x(A+tB+rCc" Zahlenwerte werden
und
nicht
Verbindungen
Einheiten
getrennt
P = 432 kg m? s-3 —_u..neneenerenene P = 432 KEM?ST® ....22ceneeeennn ...%, y-Achsen... ...P, W-Kurven Weg-Zeit-Diagramm
T Integralzeichen
U = 7 [ 0
Udt
Fachbeiträge
Beispiele
guter
Formelsätze
Einheitengleichung
s
1V-17
107 0
107 un
107 uokgm _ 7
2 yet BoN
‚m
47
7
Größengleichung
Ton _
ol? I - IT =
1
. 0
2
rt
{DB
(2, —x,)
Y
n—1
7. Schrifttum [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
DIN DIN DIN DIN
1301 1302 1304 1313
-
Einheiten Mathematische Zeichen Allgemeine Formelzeichen Schreibweise physikalischer Gleichungen in Naturwissenschaft und Technik DIN 1338 Buchstaben, Ziffern und Zeichen im Formelsatz DIN 1421 Abschnittsnumerierung in Schriftwerken DIN 1422 Technisch-wissenschaftliche Veröffentlichungen DIN 1505 Titelangaben von Schrifttum Baehr, H.: Größen, Beziehungen und Einheiten der Fernmeldetechnik, taschenbuch der fernmelde-praxis, Berlin, 1972, S. 21—55. Kohlrausch, F.: Praktische Physik. 22., neubearb. Auflage Stuttgart, B. G. Teubner, 1968.
Klimatechnik
Erläuterungen zu den Richtlinien für. das
Errichten von lüftungstechnischen Einrichtungen bei der DBP (RichtlLüftung) Bearbeiter:
Ernst-Günter
Stölting
1. Einleitung Am 30.11.1972 hat das BPM die Herausgabe der „Richtlinien für das Errichten von lüftungstechnischen Einrichtungen bei der DBP“ (RichtlLüftung) genehmigt. Diese Richtlinien treten an die Stelle der „Richtlinien für den Bau von lüftungstechnischen Anlagen bei der DBP“ (LüftungsRichtl 1968). Die Richtlinien sind für den mit der Planung der lüftungstechnischen Einrichtungen beauftragten Ingenieur bestimmt. Diese Ausführungen sollen dem Nutzer der mit den Einrichtungen ausgestatteten fernmeldetechnischen Räume den Umgang mit den Richtlinien erleichtern. 2. Aufgabe
und
Aufbau
der
Richtlinien
Mit diesen Richtlinien wird festgelegt, wann und in welchem Umfang lüftungstechnische Einrichtungen bei der DBP einzusetzen sind. Darüber hinaus werden Einzelheiten nur festgelegt, wenn es zur Lösung bestimmter Probleme unerläßlich ist. Durch diesen Grundsatz soll erreicht werden, daß für neue Techniken und für das Können der Planungsingenieure ein möglichst großer Spielraum bleibt. Der Grundsatz hat den Nachteil, daß bestimmte wiederkehrende Aufgaben doppelt bearbeitet werden und starre Festlegungen für bestimmte wiederkehrende Fälle schwer möglich sind. Dafür wird aber der wesentlich höher einzuschätzende Vorteil gewonnen, daß neue Lösungen der stark in der Entwicklung befindlichen Lüftungstechnik ohne Verzögerungen bei der DBP eingesetzt werden können und daß die Planungsingenieure ihre Planungen so
87
Fachbeiträge flexibel wie möglich an die mitunter sehr ungünstigen örtlichen Verhältnissen anpassen können. Es ist nicht möglich, alle lüftungstechnischen Probleme der DBP sofort zu erfassen. Deshalb wurden die Richtlinien so aufgebaut, daß alle bestehenden Regelungen der LüftungsRichtl 1968 in den Teil 1 als „Richtlinien für das Errichten von lüftungstechnischen Einrichtungen für allgemeine Diensträume“ (RichtlLüftung AD) aufgenommen werden. Lüftungstechnische Probleme für Sonderräume oder in Sonderfällen werden fortlaufend als weitere Teile eingefügt werden. Bei der ersten Herausgabe enthalten die Richtlinien neben dem Teill den Teil2 mit den — „Richtlinien für das Errichten von lüftungstechnischen Einrichtungen für Räume, in denen Einrichtungen der Vermittlungstechnik mit luftoffenen Kontakten betrieben werden“ (RichtlLüftung VSt) und den Teil3 mit den — „Richtlinien für das Errichten lüftungstechnischer Anlagen für Räume in denen Vermittlungsstellen des elektronischen Datenvermittlungssystems (EDS) betrieben werden“
(RichtlLüftung
EDS).
Jedem Richtlinienteil ist ein Anlagenteil zugeordnet. Anhänge sind nicht vorgesehen, um den Umfang der Richtlinien nicht zu sehr wachsen zu lassen und um den Be-
richtigungsdienst
für
die
Anhänge
zu
ersparen.
Der gewählte Aufbau hat den Nachteil, daß in den einzelnen Teilen Wiederholungen erforderlich werden oder Verweise auf andere Teile nötig sind, die das Arbeiten mit den Richtlinien etwas erschweren. Das ist z.Z. nicht vermeidbar, damit alle neuen Probleme (z.B. für neue Fernmeldetechniken) einfach durch Einfügen eines weiteren Teils ohne ständige Überarbeitung des Gesamtwerks und damit ohne Zeitverlust gelöst werden können. 3. Teill, 31.
RichtlLüftung
AD
Allgemeines
In den RichtlLüftung AD sind die LüftungsRichtl fast unverändert übernommen worden. Wie bisher
88
1968 sind
Klimatechnik
also
die
Festlegungen
für
die
personenbesetzten
Fern-
melderäume (Fernsprechauftrags-, Fernsprechauskunfts-, Fernsprechentstörungsund Telegrafendienststellen) und für die thermisch hochbelasteten Räume (Räume für Verstärkerstellen (VrSt), Telegrafenübertragungsstellen (TÜSt), Funkübertragungsstellen (FuÜSt) u.a.m.) in diesem Teil der Richtlinien enthalten. An den Festlegungen für diese Räume hat sich nichts geändert. Erläuterungen, die zu diesen Festlegungen nötig waren, sind in dem Beitrag „Die Lüftung fernmeldetechnischer Betriebsräume der DBP“ im taschenbuch der fernmelde-praxis 1970 gegeben worden.
Nach wie vor wird für die aufgeführten thermisch hochbelasteten Räume keine Luftbefeuchtung vorgesehen, obwohl sie aus Unkenntnis über die Zusammenhänge immer wieder verlangt wird. Es gibt keine ausreichenden medizinischen Untersuchungsergebnisse, aus denen die Forderung nach einer Mindestfeuchte abgeleitet werden kann. Luftbefeuchtung für diese Räume wird die Arbeitsverhältnisse eher erschweren als verbessern. Eine Änderung ist deshalb auch für die Zukunft nicht vorgesehen. 32.
Umfang
der
Änderungen
LüftungsRichtl
gegenüber
1968
Gegenüber den LüftungsRichtl 1968 mußte die Abschnittsnumerierung und teilweise auch die Abschnittsbezeichnung geändert werden, damit eine Gleichwertigkeit durch alle Teile der Richtlinie erzielbar war. Die führten
unter
seitigen.
den
Räume
Neu
thermisch wurden
aufgeführt
—
Notstromanlagen
—
Konzentratoren
— — —
hochbelasteten
erweitert
wurden
um
die
Räumen
Zweifelsfälle
Räume
für
aufgezu
be-
dafür
der
(NSA)
Sende- und Empfangsfunkstellen Funkkontrollmeßstellen VSt
mit
der
EDS-Technik
EWS-Einrichtungen
auch
3.3.).
Entfallen ist der Abschnitt „Wählerräume“, Teil2 neu geschaffen wurde.
(siehe
weil
89
Fachbeiträge Der Abschnitt „Rechenzentren und Datenaufbereitungsstellen“ mußte neu gefaßt werden, da inzwischen die VDIRichtlinie 2054 erschienen ist und die bisherigen unter 7.1 aufgeführten „Richtlinien über die Ausführung der lüftungstechnischen Anlagen für Räume, in den Datenverarbeitungsanlagen aufgestellt werden (PTZ IV A 2)“ überholt sind. Im PTZ werden dazu z.Z. neue Richtlinien erarbeitet (siehe unter 6). Weiterhin wurde der Abschnitt „Diensträume in Hochhäusern“ geändert. Es heißt jetzt nur noch, daß Diensträume in Hochhäusern mit mehr als 40 qm im allgemeinen Klimaanlagen nach DIN 1946 erhalten. Durch diese neue Fassung soll erreicht werden, daß die Entscheidung nicht mehr starr an eine willkürlich gewählte Grenze gebunden ist. Es gibt Hochhäuser, die aufgrund ihrer Lage und Bauausführung auch unter 40m klimatisiert werden müssen. Ebenso ist es jedoch bei ge-
eigneter
höheren
Bauausführung
Gebäuden
auf
möglich,
auch
Klimatisierung
bei
wesentlich
zu verzichten.
Die Maßeinheiten der Wärmetechnik wurden dem „Gesetz über Einheiten im Meßwesen“ angepaßt. Als Übergangslösung wurden die alten Größen in Klammern angegeben. Da die Grenzen willkürlich gebildet sind, wurden die neuen Zahlen abgerundet. Die Diagramme wurden im neuen und im alten Maßsystem dargestellt. Der wurde
Abschnitt „Planung, Ausschreibung und Vergabe“ zur Anpassung an den Aufbau der Richtlinien ohne
wesentliche
sachliche Änderungen
neu
gefaßt.
Im Abschnitt „Sondervorschriften und Richtlinien“ wurde auf die einzelne Aufzählung der Normenund Typenhausrichtlinien verzichtet, da sich die Normen- und Typenhausrichtlinien häufig ändern. Durch die neue Form werden ständige Berichtigungen vermieden. 33.
Lüftungstechnische Anlagen für EWS-Einrichtungen
Bei den Verhandlungen über das Umgebungsklima (DIN 50010) für die EWS-Einrichtungen wurde das Problem der Umweltbedingungen so ausführlich behandelt, daß es möglich wurde ein Rahmenpflichtenheft „Umweltbedingungen 90
Klimatechnik
für
fernmeldetechnische
Einrichtungen
des
FTZ)
Dieses
und
die
zu
erarbeiten.
der
Pflichtenheft
DBP
(1Pfli
soll
in
Zu-
kunft soweit wie möglich für alle neuen Fernmeldetechniken angewendet werden. Es trifft heute bereits für alle unter dem Abschnitt thermisch hochbelastete Räume aufgeführten Techniken zu. Ausnahmen bilden nur noch die Vermittlungseinrichtungen mit luftoffenen Kontakten Rechnerräume.
Durch
diese
Vereinbarungen
ist
es
möglich geworden, die Räume für EWS-Einrichtungen unter dem entsprechenden Abschnitt der RichtlLüftung AD mit aufzunehmen. Die Räume werden deshalb lüftungstechnisch in Zukunft wie VrSt ausgerüstet werden. Auch die raumbezogene spezifische Wärmebelastung entspricht etwa den der VrStn. Ein besonderes Problem wird die Umrüstung der bisherigen VStn in den Typen- und Normengebäuden auf EWS-Technik bilden, da hier keine lüftungstechnischen Anlagen der üblichen Art eingebaut werden können, weil die Raumhöhe nicht ausreicht. Vom PTZ werden 2z.Z. Musterlösungen für solche Fälle erarbeitet, die den Oberpostdirektionen sofort nach Fertigstellung zur Verfügung gestellt werden sollen. Für EWS-VStn ist eine Luftbefeuchtung wie für die anderen thermisch hochbelasteten Räume ebenfalls nicht erforderlich und deshalb auch nicht vorgesehen. 4. Teil2, 41.
RichtiLüftung
VSt
Allgemeines
Die Zuständigkeit für das Errichten lüftungstechnischer Einrichtungen für VStn mit luftoffenen Kontakten ist vom
FTZ
auf
das
PTZ
Die
Richtlinien
übergegangen.
Dadurch
wurde
es
nötig,
die in den Richtlinien VStW, Abschnitt XIV festgelegten Regelungen für die Haustechnik neu zu fassen. Diese Neufassung liegt mit dem Teil2, RichtlLüftung VSt nun vor. Lüftungssysteme: — —
Anlagen Anlagen
enthalten
zwei
verschiedene
technische
mit Luftaufbereitung in Einzelgeräten mit zentraler Luftaufbereitung.
91
Fachbeiträge 42.
Anforderungen
Wegen der Anlagen mit zentraler Luftaufbereitung es nötig, die Anforderungen neu zu fassen, da diese lagen nicht nur die Luft für das Personal erneuern
war Anund
die Luft be- und entfeuchten, sondern auch die Temperatur beeinflussen. Dadurch werden die Verhältnisse in den VStn so verändert, daß die Festlegung einer absoluten Feuchtegrenze nicht mehr ausreicht und auch eine Abgrenzung der relativen Feuchte gemacht werden muß. Angaben
zur
relativen
Feuchte
sind
immer
an
bestimmte
Temperaturen gebunden. Die oft zu lesende Festlegung für einen bestimmten Raum wie z.B. 18 bis 32 °C, 40 bis 80 v.H. relative Feuchte sind unsinnig, da 32°C und 80 v.H. relative Feuchte zusammen in einem Raum nicht auftreten und von keinem Menschen längere Zeit ertragen werden können. Beide Werte treten einzeln im Zusammenhang mit anderen Temperatur- oder Feuchtewerten jedoch auf. Um diese Schwierigkeit zu vermeiden und auf lange Erklärungen verzichten zu können, wurden die zulässigen Temperaturund Feuchtewerte durch ein schraffiertes Feld im h-x-Diagramm dargestellt (Anlage 1 und 2 der RichtlLüftung VSt). Aus diesen Diagrammen ist auch zu ersehen, daß die bisherige absolute Feuchtegrenze nicht mehr ausreicht, um die zulässigen Raumluftzustände zu kennzeichnen. 43.
Auswahl
der
Lüftungssysteme
Die Anlagen mit Luftaufbereitung in Einzelgeräten sind nur für Räume geeignet, in denen keine wesentliche Wärmeentwicklung stattfindet, da die Temperatur durch diese Anlagen nicht wesentlich beeinflußt werden kann. Rein theoretisch ergibt sich eine mögliche Belastung von etwa 40 W/m?. Die Praxis hat aber gezeigt, daß je nach den
örtlichen Verhältnissen Spitzenwerte bis 80 W/m? noch mög-
lich sind, wenn die Spitzenwerte relativ kurz auftreten. Durch die Speicherwirkung der Masse der Fernmeldegeräte und durch die lange nächtliche Schwachlastzeit werden die hohen Spitzen so abgebaut, daß zunächst Schwierigkeiten trotz der hohen Spitzen relativ. selten aufgetreten sind.
92
Klimatechnik Durch neue Aufstellungspläne richtung in VStn vermindert,
wurde der Anteil der Einder keine Wärme abgibt
(z.B. Aufstellung des Zwischenverteilers verteillerraum (HVT-Raum). Die Anzahl
(ZVT) im Hauptder Anschlußein-
heiten je Raumfläche wurde erhöht. Außerdem haben die Verkehrswerte zugenommen. Dadurch treten seit einiger Zeit relativ hohe Belastungswerte für längere Zeit ein. Das führte in den letzten Jahren in vielen VStn zu Temperaturen, die die Umrüstung auf eine zentrale Luftaufbereitung mit ihren Möglichkeiten zur Temperaturbeeinflussung nötig machten. Die neuen RichtlLüftung VSt berücksichtigen diese neuen Erkenntnisse im Abschnitt 3.2.3, in denen festgelegt ist, daß die VStn eine zentrale Luftaufbereitung erhalten, wenn aufgrund der zu erwartenden Wärmebelastung der technischen Einrichtungen im Raum eine Wärmemenge anfällt, die ohne die zentrale Luftaufbereitung nicht abgeführt werden kann. Unter neuen
Berücksichtigung Normen-
und
dieser
Erkenntnisse
Typenhäuser
für
VSt
werden der
die
Ausgabe
1973 alle mit zentraler Luftaufbereitung ausgerüstet. Da Fern-VStn im allgemeinen in Kernbauten untergebracht werden, die nach Abschnitt 3.2.2 ebenfalls eine zentrale Luftaufbereitung erhalten, wird die Luftaufbereitung mit Einzelgeräten in Zukunft keine wesentliche Bedeutung mehr haben. 4.4.
44.1.
Bemessung
der
Anlagen
Bemessung der Einzelgeräten
Anlagen
mit
In der Anlage4 der Richtlinien ist eine Aufstellung enthalten, aus der die für die einzelnen Raumgrößen nötigen Geräte entnommen werden können. 442.
Bemessung der Anlagen mit zentraler Luftaufbereitung
Die Anlagen mit zentraler Luftaufbereitung werden nach den Kühllastregeln VDI 2078 bemessen. Bei der Berechnung ist der für die Fernmeldestromversorgung er-
93
Fachbeiträge rechnete Leistungsbedarf einzusetzen. Der Fernmeldeleistungsbedarf und die außenklimatischen Verhältnisse sind jeweils Spitzenbelastungswerte. Die Addition dieser Werte führt zu überdimensionierten lüftungstechnischen Anlagen, da die beiden Spitzen nur sehr selten zusammentreffen werden. Da die Masse der Fernmelde-Einrichtungen
sehr
gut
als
Wärmespeicher
arbeitet,
ist
es
ausrei-
chend, wenn die Haustechnik bei der Berechnung deı lüftungstechnischen Anlagen die Fernmeldewärme nur zu 70 v.H. berücksichtigt. 45.
Ausführung
der
Anlagen
45.1.
Anlagen mit Luftaufbereitung in Einzelgeräten
Die Ausführung der Anlagen mit Luftaufbereitung in Einzelgeräten hat sich gegenüber den bisherigen Ausführungen nicht geändert. Das Programm der Geräte wurde unverändert vom FTZ übernommen. Lediglich auf die Anzeige der Außen- und der Raumfeuchte an der Bedienungs- und Überwachungstafel wird in Zukunft verzichtet. Wegen der in Zukunft zu erwartenden geringen Stückzahlen werden die Tafeln voraussichtlich jedoch nicht mehr geändert. Die Lampen bleiben dann lediglich ohne Funktion. Die Fühler sind nicht mehr zu montieren oder zu erneuern. Den RichtlLüftung VSt ist als Anlage 3 ein Verzeichnis aller zugelassenen Geräte beigefügt. 452.
Ausführung der Anlagen mit zentraler Luftaufbereitung
Bei diesen Anlagen handelt es sich um lüftungstechnische Anlagen nach DIN 1946. Die Kühler werden im allgemeinen so gewählt, daß eine gesteuerte Entfeuchtung nicht nötig ist. Der nach 1946 festgelegte Begriff „Klimaanlagen“ trifft deshalb für diese Anlagen nicht zu. Die Anlagen sollen möglichst für eine Temperaturdifferenz von 10K zwischen Zu- und Abluft bemessen sein. Die relative Feuchte wird beim Lufteintritt je nach Wärmebelastung zwischen 60 und 80 v.H. relativer Feuchte
94
Klimatechnik liegen, damit sie bei gleicher absoluter luft noch 40 v.H. relativ feucht ist. Wegen Filterung war.
Bis
zu
der größeren nötig, als sie
B2
in der Ab-
Luftumwälzung ist eine bessere in den Einzelgeräten vorgesehen
10000 m?/h Luftumwälzung
der Filterklasse Filterklasse C.
Feuchte
vorzusehen,
sind
darüber
deshalb
hinaus
Filter
Filter
Zum wirtschaftlichen Betrieb sind grundsätzlich luftregelungen für die Zuluft vorzusehen.
der
Misch-
Auch bei den zentralen Anlagen ist vollentsalztes Wasser zur Befeuchtung zu verwenden. Vom PTZ werden z.Z. Vertragsbedingungen für entsprechende Befeuchtungseinrichtungen erarbeitet, damit die sich daraus ergebenden Probleme ohne Schäden und in wirtschaftlichster Weise gelöst
werden
5. Teil 3,
5.1.
können.
RichtiLüftung
EDS
Allgemeines
An 10 Standorten werden die ersten Vermittlungsstellen der elektronischen Datenvermittlungssysteme (EDS-RVStn) errichtet. Zur Lösung der sich aus den Besonderheiten dieses Systems ergebenden lüftungstechnischen Probleme wurde der Teil3, RichtlLüftung EDS, erarbeitet. 52.
Anforderungen
Die EDS-R-VSt und die TÜSt gehören zu den thermisch hochbelasteten Räumen. Mit Ausnahme des Plattenspeicherraums, für den die Bedingungen der Räume für Datenverarbeitungsanlagen gelten, können für diese Räume die gleichen Temperaturwerte gewählt werden, wie sie in den LüftungsRichtl AD für die thermisch hochbelasteten Räume vorgesehen wurden. Auch Luftbefeuchtung ist nur für den Plattenspeicherraum nötig. Wegen der hohen Luftumwälzung und da ein Teil der Luft unter Umständen ohne weitere Filterung direkt in die Fernmeldegeräte eingeführt wird, sind auch für diese Räume
95
Fachbeiträge Feinfilter der Filterklasse B2 speicherraum erhält Feinstfilter
zu wählen. Der Plattender Filterklasse C.
5.3. Bemessung der Anlagen Die Anlagen sind nach den VDI-Kühllastregeln zu bemessen. Es ist nicht möglich, einen .Speicherfaktor einzusetzen, da die Anlagen fast konstante Wärmeabgabe haben. Wegen der hohen Wärmebelastung ist es unerläßlich, für die EDS-R-VSt Reserveanlagen vorzusehen. Die Reserveanlagen können auch für die Lüftung anderer Räume genutzt werden, wenn entsprechende Kanalverlegungen möglich und wirtschaftlich sind. 54.
Luftführung
In allen Räumen ist aufgrund der Wärmebelastung ausschließlich die Luftführung von unten nach oben zu wählen. Im Plattenspeicherraum ist ein Doppelboden mit Schlitzplatten oder Drallauslässen vorzusehen. In dem Bedienungsraum, Prüfraum, Verteiler- und Meßraum ist bei der Wahl der Luftführung auf die Arbeitsplätze Rücksicht zu nehmen. In den EDS-R-VStn und in der TÜSt sind wegen der hohen thermischen Belastung keine festen Arbeitsplätze anzuordnen. 55.
Ausführung
der
Anlagen
Wegen der unterschiedlichen Umgebungsbedingungen ınüssen aus wirtschaftlichen Gründen für den Plattenspeicherraum immer eigene Anlagen vorgesehen werden. Die Betriebssicherheit hängt für diesen Raum auch von der Kälteversorgung ab. Neben der Reserveanlage für die Lüftungstechnik ist deshalb auch immer eine Reservekälteversorgung erforderlich. Die Kabel in EDS-R-VSt werden mit einem HF-Schirm umgeben. Dieser HF-Schirm macht die Kanalführung — vor allem des Abluftkanals — schwierig. Die Planung der Fernmeldetechnik und die Planung der Lüftungstechnik kann deshalb nur in enger Zusammenarbeit zwischen den Planern der Fernmeldeanlagen und den Planern der Haustechnik vorgenommen werden.
96
Klimatechnik Da die Eintrittstemperatur an den Ansauggittern der Gerätekühlung 35 °C nicht überschreiten darf, ist es bei zweiseitiger Aufstellung unerläßlich, Luft auch im Mittelgang der EDS-R-VSt einzuführen. Um Lüftungskästen im Mittelgang zu vermeiden, wurde ein direkter Anschluß der Lüftungskanäle an die Seitenteile der F-Schränke vorgesehen. Das Gitter wird nicht geschlossen. Durch dieses offene System ist es möglich, die Nachteile ähnlicher Lösungen zu vermeiden: —
—
Die Lüftung in den Seitenteilen ist auch betriebsbereit, wenn die Raumlüftung kurze Zeit nicht zur Verfügung steht, da die Luft jederzeit über das Gitter aus dem Raum angesaugt werden kann. Es gibt keine wesentlichen Einregulierungsschwierigkeiten, da das offene Gitter als Ausgleichsöffnung zur Verfügung steht.
Die bei mehr als vier Schränken für den Mittelgang unbedingt nötigen Kanalanschlüsse können bei einseitiger Aufstellung der Fernmeldeschränke auch dazu verwendet werden, den Luftdurchsatz durch die Aufenthaltszone so zu vermindern, daß sich für das Personal in dieser Stelle bessere Verhältnisse ergibt. Diese Lösung macht es möglich, auf die zunächst aus lüftungstechnischen Gründen vorgesehenen größeren Gangbreiten wieder zu verzichten. Die Kabel innerhalb der EDS-R-VSt dürfen bestimmte Längen nicht überschreiten. Durch die geringeren Gangbreiten ist die Kabelverlegung erleichtert worden.
6. Teil4 RichtlLüftung DV 6.1.
Allgemeines
Diese Richtlinien werden anhand der Probleme für die Bedienungsrechner des EWSO-Systems vom PTZ erarbei-tet. Die Herausgabe wird wegen der vielen grundsätzlich nötigen Klärungen noch einige Zeit dauern. Angestrebt wird, für alle Datenverarbeitungsanlagen gleiche Bedingungen festzulegen, da es für die Betreiber auf die Dauer unzumutbar ist, daß jede Rechnerfirma eigene Umgebungsbedingungen festlegt. 4
Fernmelde-Praxis
97
Fachbeiträge Die zum jetzigen Zeitpunkt bekannten Angaben reichen im allgemeinen für die Planung der Anlagen bereits aus. Bis zur Herausgabe der Richtlinien ist deshalb das PTZ zu beteiligen. 6.2.
Anforderungen
Die Anforderungen an den Rechnerraum entsprechen etwa denen des Datenspeicherraums der EDS-R-VSt. Die in den Richtlinien hierfür aufgeführten Bedingungen können zunächst für die Planung unterstellt werden. 6.3.
Bemessung
der
Anlagen
Für die Bemessung gelten wieder die VDI-KühllastRegeln (VDI 2078). Die Wärme der DV-Einrichtungen ist wegen
der
nahezu
konstanten
Belastung
voll
einzusetzen.
Wegen der für die DBP allein zulässigen Luftführung von unten nach oben ist es möglich, die Beleuchtungswärme
für
der
den
Raum
außer
Gesamtanlage
Ansatz
muß
diese
zu
lassen.
Wärme
Bei
jedoch
der
Bemessung
berücksichtigt
werden.
64.
Ausführung
der
Anlagen
Für die DV-Anlagen muß der Nutzer angeben, ob ein unterbrechungsfreier Betrieb nötig ist. Danach ist zu entscheiden, in welcher Form die Reserve für die lüftungstechnischen Anlagen zu gestalten ist. Für die Bedienungsrechner ist immer eine Reserveanlage erforderlich. Da der Bedienungsrechner aus zwei parallel geschalteten Einheiten besteht, ist es in den meisten Fällen zweckmäßig, auch die Lüftung auf zwei Einheiten aufzuteilen. Eine dritte Einheit ist dann als Reserve aufzustellen. Die Anlagen sind so anzuordnen, daß eine vierte Anlage montiert werden kann, bevor die anderen einzeln ausgewechselt werden. Der für die vierte Anlage nötige Platz kann als Lager
(z.B.
für
Papier)
Auswechselung steht der wieder zur Verfügung.
98
voll
genutzt
gleiche
Platz
werden.
(an
Nach
anderer
einer
Stelle)
Klimatechnik Die Auswahl der richtigen Kälteversorgung kann nur nach den örtlichen Verhältnissen getroffen werden, da auch die Kälte mit Reserve und bei Netzausfall betrieben werden muß. Das erfordert besonders bei großen Kälte-
zentralen,
die bei Netzausfall
nur teilweise
benötigt
wer-
den, besondere Wirtschaftlichkeitsüberlegungen, damit die Summe aus Kälteanlagen und Netzersatzanlagen (NEA) möglichst niedrige Anlagekosten ergibt. Zur — —
Auswahl
Das System Vorteile: — —
—
zwei
Lüftungssysteme:
mit
variablem
mit mit
Außenlufthat
stehen
folgende
folgende
Nachteile:
mit
konstantem
Es erfordert geringen Befeuchtungsaufwand. Es hat einen geringeren Platzbedarf. Es erfordert einen geringeren Filterbedarf. Es erzielt bessere Regelergebnisse (weniger der
Dagegen
“
konstantem
Es erfordert einen höheren Platzbedarf. Es erfordert einen höheren Regelaufwand, wobei erzielbare Genauigkeit meist geringer ist (Pendeln Anlagen). Es erfordert einen hohen Luftbefeuchtungsaufwand.
gen
—
Außenluft-
Außenluftanteil
Die zentrale Luftaufbereitung luftanteil hat folgende Vorteile: — — — —
variablem
Es ist wirtschaftlicher, da im Winter die Kälteanlagen nicht betrieben werden müssen und in der Übergangszeit der Kühlbedarf stark herabgesetzt ist. Es wird die überwiegende Zeit des Jahres mit hohem Außenluftanteil gelüftet. Dagegen
— —
stehen
Zentrale Luftaufbereitung anteil und zentrale Luftaufbereitung anteil.
Es wird benötigt Jahres).
die der
Außen-
Pendelun-
Anlagen).
stehen ständig (hohe
folgende
Nachteile:
eine fast gleichbleibende Stromkosten während
Kälteleistung des ganzen
99
Fachbeiträge — —
Es sind besondere Vorkehrungen für den Kühlbetrieb im Winter nötig. Es wird ständig mit minimalstem Außenluftanteil gefahren.
Welches der beiden Systeme zu wählen ist, muß unter Abwägung aller örtlichen Gegebenheiten bei jedem Bauvorhaben neu ermittelt werden.
100
Aufbau
Fernvermittlung
Neuerungen beim Aufbau und der Verkabelung von Fernvermittlungsstellen Bearbeiter:
Hermann
Leibeck
1. Einführung Im Landesfernwahlnetz der Deutschen Bundespost (DBP) sind derzeit 474 Fernvermittlungsstellen (FernVSt) aufgebaut. Nach der Netzhierarchie gliedern sie sich in 8 Zentralvermittlungsstellen (ZVSt) 55 Hauptvermittlungsstellen (HVSt) 411 Knotenvermittlungsstellen (KVSt). Die technischen Einrichtungen der FernVSt bestehen derzeit aus Schaltgliedern des Fernwählsystems Technik 54 (FWS T 54) und Schaltgliedern des Fernwählsystems Technik 62 (FWS T62). Bei Neueinrichtungen von FernVSt werden nur noch Schaltglieder des FWS T 62 geliefert und aufgebaut. Die DBP beabsichtigt, in absehbarer Zeit ein neues Fernwählsystem Technik 69 (FWS T69) einzuführen, mit dem die Raumnot in den Fernmeldedienstgebäuden gelindert und die Personalkosten gesenkt werden können. Die Schaltglieder des FWS T 69 sind dann sowohl für die Neueinrichtung von FernVSt als auch für die Erweiterung bestehender FernVSt vorgesehen. Mit der Einführung der neuen Fernwähltechnik ergeben sich neue Gesichtspunkte für die Aufstellung und Verkabelung der technischen Einrichtungen in den Fernvermittlungsstellen. Die neuen Gesichtspunkte für die Aufstellung sollen aber auch prophylaktisch die Maßnahmen umfassen, die für die Einführung eines neuen elektronischen Fernwählsystems (EWSF 1) aufbautechnisch getroffen werden müssen. Da das FWS T 69 organisch in den Aufbaukomplex der einzelnen Schaltgliedgruppen einer FernVSt eingefügt
101
Fachbeiträge
werden kann, muß als Aufbauraum für das neue tronische Fernwählsystem eine zusammenhängende Fläche verfügbar sein.
elekfreie
Vorsorglich werden deshalb die konventionellen Einrichtungen der Fernwähltechnik so „geschlossen“ wie möglich aufgebaut. Diese Bauweise wird nachfolgend als „geschlossene Bauweise“ bezeichnet. Außer den vorerwähnten Notwendigkeiten bietet die schlossene Bauweise aber auch verkabelungstechnische betriebliche Vorteile, wie kurze Betriebswege und Verminderung der Vorleistungen am Schaltkabel Gestellreihenmaterial. 2.
Die
Grundsätze
der
„geschlossenen“
geund eine und
Bauweise
Bei FernVSt mit Schaltgliedern des FWS T 62 sind stets 120 Zählimpulsgeber (ZIG) über Relaissuchwähler (RSW) zu einer Knotenregistergruppe (KRG-Gruppe) zusammengefaßt und als Ausbaustufe bezeichnet. Die weiteren Ausbaustufen sind stets Vielfache einer ZIG-Gruppe mit 120 ZIG. Beim Aufbau von FernVSt mit Schaltgliedern des FWS T69 bilden analog 240 ZIG eine ZIG-Gruppe, weil hier 240 ZIG in einer RSW-Gruppe an die KRG angeschlossen sind. Die FernVSt sind deshalb baustufen entsprechend den RSW-Gruppen Anzahl
der
1 ZIG
bei FWS T 62 Tabelle
1:
RSW-Gruppen Anzahl
bei
FWS
der
Tabelle
102
T
69ZIG
2:
120
grundsätzlich in den EndausTabellen 1 und 2 zu planen.
2
5 0
24
36
Ausbaustufen
1/2
1
120
240
4 0
in
4
80
6
72
8 0
FernVSt
96
10 0
mit
2
3
4
360
480
720
960
in
FernVSt
mit
00
FWST
11/2
Ausbaustufen
12
62
5 1200
FWST
69
Aufbau
Fernvermittlung
Aus den Tabellen 1 und 2 ist zu ersehen, daß die obere Ausbaugruppe bei 1200 ZIG erreicht ist; danach sind neue 1200er-Gruppen mit ZIG in sich geschlossen aufzubauen. Bei der geschlossenen Bauweise wird der für 20 Jahre geplante Vermittlungsraum (V-Raum) in ein, zwei oder drei Aufstellungsblöcke unterteilt. Je nach Endausbaugröße der FernVSt wird im 1. Aufstellungsblock bei zwei Blöcken nur die Hälfte und bei drei Blöcken nur jeweils ein Drittel der technischen Einrichtungen des Endausbaus aufgestellt (siehe Tabelle 3). FWS
T
62
1.Aufstellungs-
block
Aufbau- | 1.Drittel des richtung Endausbaus
Tabelle
3:
FWS
T
69
FWS
T
69
2,
Aufstellunzs-
3.
Aufstellungs-
2.
Drittel des Endausbaus
3,
Drittel des Endausbaus
block
Blockschema der Aufstellung ner Bauweise (Beispiel)
block
in geschlosse-
In jedem einzelnen Aufstellungsblock können dann entsprechend dem derzeitigen Planungszeitraum von zwei Jahren die technischen Einrichtungen in der jeweils vorgesehenen Technik aufgebaut werden. Die restlichen Flächen bleiben im Gegensatz zur bisherigen Aufbauweise frei verfügbar. Damit wird bei der geschlossenen Bauweise immer jeweils nur ein Drittel oder höchstens (bei zwei Aufstellungsblocks) die Hälfte der für den Endausbau notwendigen Gestellreihen aufgestellt. 3. 31.
Aufstellungsgrundsätze Raumbedarf
Die Vermittlungsräume der Fernsprechvermittlungstechnik sind für einen Aufbauzeitraum von 20 Jahren zu planen. Für die Raumgröße (Aufstellungsfläche) ist der Endausbau der jeweiligen FernVSt zugrundezulegen. Aus Aufstellungsbeispielen ergeben sich die Mittelwerte nach Tabelle 4, wobei auf volle 5m? aufgerundet wurde und die Aufstellung von OGW nicht mit einbezogen ist.
103
Fachbeiträge
Anzahl zIg
FWS Anzahl GRH
T 62
Maße (m)
FuS Flächel]| ne
T
62
Anzahl GRH
+
VUe
Maße (m)
69
FwS
Fläche | Anzahl 2 GRH
T 69
Maße (m)
Fläche m® +
120
g &
a |
L
a| 1
ı7 2ı
|22,20 x ı2 | 270 |26,60 x 12 | 3% 360
22
840 960
20 22
|25,50 x 16 | 410 |27,70 x 16 | 445
25 28
29,90
31,00 34,30
x
x x
12 12
5 | e,60 x
480 600
24
x x
105
14,10 17,40
1080 1200
|
8,60 x 12 |
10 13
720
|
5
240 360*
12
16 16
170 210
500 550
8,600 x12|
|E
8 10
11,90 14,10
12 12
145 170
15 19
120,00 x 12 | 240 124,40 x 12 | 295
13 16
[17,40 x 12| [21,10 x 12|
215 255
18 20
|23,30 x ı6 | 375 125,50 x 16 | 410
1 17
20,00 x 16| |22,20 x 16|
320 |” 360 |
23 26
8,80 32,10
x x
12
16 16
335
465 515
18
23,30
19 21
24,40 26,60
x x
105
160 200
x
12 12
5
13,00 16,30
27,70
x x
ı2 | 105
9 12
x
x x
12
16 16
280
y
r
395 440
ıD
Tabelle 4: Aufstellungsfläche bei der Neueinrichtung von KVStW in FWST62 und FWST 69 (Fläche auf volle 5m? aufgerundet) Bei
breiter breiter 32.
den
Raumgrößen
ist bis
V-Raum und über V-Raum zu wählen.
720
720
ZIG
ZIG
Endausbau
Endausbau
Regeln für die Aufstellung geschlossener Bauweise
Im
wisse
Rahmen
zentrale
des
ersten
II. Richtungswähler als gleich beim Erstaufbau
Zwischenverteiler
Vorleistung für den aufgestellt werden.
12m
16m
in
Aufstellungsblocks
Einrichtungen,
ein
ein
sollen
und
ge-
die
Endausbau
Die Gebührenerfassungeinrichtungen einer RSW-Gruppe sind zusammen in einer Gestellreihe aufzustellen und starr (d.h. ohne Zwischenverteiler) miteinander zu verkabeln. Die einer teiler mäßig stellt KRW
Knotenrichtungswähler werden im 12-m-Raum in eigenen Gestellreihe unmittelbar am Zwischenver(ZVt) angeordnet, während sie im 16-m-Raum anteilim Anschluß an die ZIG-RSW-KRG-Gruppe aufgewerden. Dabei sind dann jeweils 120 ZIG mit 128 in einer Gestellreihe kombiniert angeordnet.
Nach den II. RW, ZIG und KRW folgt in Aufbaurichtung die Aufstellung des Zwischenverteilers (ZVt). Mit dieser Anordnung ist eine optimale Kabelführung von den Gestellrahmen zum ZVt gewährleistet,
104
"Aufbau
Art der
veieinen Endaubbau der Fornv5t mit PWS T 62
Gestellrahmen
120
GR: ZIG/RSW/KRg GR:KRW GR:II. GRı FGW @R:Ue
ZIG
240
17 8
2IG
360
ZIG | 480
ZIG
720
2IG
34 15
51 23
68 30
102 45
960
ZIG
1200
136 60
RW (EGW,OCW)
8
16 15
24 23
32 30
48 48
69 60
82 15
15
26
40
55
77
116
151
Gale)
GR:5bL
GR:RSM/GSR,ZIG, zvt M 27/5 GestAni
GR:HDUe 4Dr GRıStörsig 65 GRıAPrUe, ZuW,
PrSW 4Dr II,
2 (3)
2 (3)
2 (3)
3 (4)
3
4
4
4
4
3
3
5
5
4
6
10
16
24
36
44
2
2
2
2
e
4
&
1 1
1 1
1 1
1 2
1 2
1 2
1 2 4
Tabelle
2
2
2
2
4
4
4
-
-
2
3
5
5
65
126
185
251
365
504
624
Bedarf
Art der Gestellrahmen
an Aufstellungsplätzen mit FWST 62 v
120
ZIG|
240
8 8 8 10
Gale)
3
-
5:
GR:ZIG/RSW/KREg GR:KRW GR:II. RW GR:FGW (EGW,OGW) GR:Ue (TFue,WUe,
2 (3)
3
2 Zul
Gesantı
.
ı (2) 4
2
TVert
GRıZuSE,
ZIG
ei
für
Aufstellungsplätze für Geutellrahmen einem Endausbau der FernVSt mit FWS T 69 360 2IG 480 ZIG 720 2IG 960 ZIG
13 15 16 15 13
21 23 24 23 16
4
4
20)
2
2
2
2
3
3
3
3
zvt M 27/5 IGR:ZuSE, GestAnl prenoue 4Dr R:StörSig 65 GR:APrVe, PrSW 4Dr GR:I. Zuw, II. ZuW
4 2 1 1 2 -
6 2 1 1 2 -
10 2 1 1 2 -
16 2 1 2 4 2
24 e 1 2 4 3
36 4 1 2 4 5
44 4 1 e 4 5
52
94
131
172
253
358
417
Tabelle
6:
Anschluß
lichen Aufbau
Bedarf
an
den
4
(3)
2
4
(3)
5
an Aufstellungsplätzen mit FWST 69 ZVt
zu erreichen,
Ferngruppenwähler
2
ZIG
65 75 82 75 so
4
Gesant;
(3)
1200
52 60 69 65 50
203)
TVert
2
39 45 48 46 30
GR:RSM/OSR, ZIG,
GR:öbL
20)
26 30 32 30 18
KVStW
GR:Umw
Im
ZIG
170 75
(TFUe,WUe,
GR: Umw
GRıI.
Fernvermittlung
(FGW)
werden,
um
einen
für
die Übertragungen
gemeinsam
im
5
(3)
KVStW
kontinuier-
(Ue)
und
entsprechenden
105
Fachbeiträge Verhältnis in den Gestellreihen untergebracht. Damit wird ein Aufstellungsblock abgeschlossen. Im zweiten Aufstellungsblock wird dann mit dieser Gestellreihenbelegung fortgefahren, so daß auf diese Art und Weise sämtliche Ue und FGW geschlossen beisammen stehen. Die in den einzelnen Ausbaustufen benötigten Aufstellungsplätze sind in den Tabellen 5 und 6 jeweils für das FWS T62 und FWST 69 aufgeführt. Ein Aufstellungsbeispiel für eine FernVSt mit einem Endausbau von 360 ZIG mit FWS T69 ist im Bildl, mit
720 ZIG
Endausbau
im Bild2 und
dargestellt.
mit 1200 ZIG
im Bild 3
| |
Ne | ssel|
Ss
/
| Z
|
388
|
S
|
zZ
3
|
|
|
"0b o
ZIG
08
RSW HR,
VER
U
—
|
a fü N
17 wi
—
|
en
07
en
05
Umw
nl 7
02+
|
zvt Res
no AMeh
-
Z.RW-
1 Bm zei je
m
r KRW
Bild1i1.
106
12.000
|
7
|
Ss
4
KAW ——
| =
—
4
I
(Raum: Vorderseite 0 ___| me
&
| S
——YRIRARE—ÄRH
I AN———
S
|
T
S
(zulässige Bodenbelastung::
5
-
Aufstellungsbeispiel einer KVStW mit Fernwählsystem T 69. Endausbau 360 ZIG. Raumbreite 12 m
Aufbau
|
|
|
SS
Sc
Z
$ So
|
;
SNK
ssgeIj| SsSuQ & =
|
rar. A rer.Bi 16
an
fs
5
sen
ef ZT
IT
uU— ——Hll— — Per dran Farurural/\l arrararn 71
||
a 09
|
|
| | |
RSWÄRI— en
,
|
KRW.
08
a
my
fl
en
05
ZVt 09 m
Res Tl ZVt
07-4
a 06H
|
HH
— Res.
ea a
|
——-FiW
|
9
1
|
v7.
——— 116 rn
|
| |
HH
|
|
Aufstellungsblock 1 240 ZIG FWS T69
RSW-KRO— rt 7
a
aan ann aan m
PFSW APrle
A AÜrHLZU
9
EZUW
or
zT
KRW
mW
\fles,
a
»————[lG
|
— 1300
S
[6
RSWHR
er
8% 1100
|
(zulässige Bodenbelastung 1000 kg/m?)
f
‘3
5x 7700 ———
S SS
Fernvermittlung
|
1900 1
—
|
FO .
——
11 —72000
Ä
1170
Bild 2. Aufstellungsbeispiel einer KVStW mit Fernwählsystem T 69. Endausbau 720 ZIG. Raumbreite 12 m
107
18
8
—,
Res.
6 In -
Ue
KRW
/KRW.
\
RN NG
KRW.
RSW ! "MR
KRW
\ =
Fi FGW-
N/
\
08
07 06
4x 1300
ZVt 09 }
oe - Res. U:
HRW.
———[/lG /
ZVt 05 5
AW-
G
ZIG
ASW ———
„Arn-
z
r
ji
KR
AN.-
\ KRW-
\
KRW.
r HE
\
IR
N
04 MH nz eb
I.
AW-
_
76000
|
Fe
02
(zul äss ige Bodenbelasturg:
FWS, 69
Aufstellungsblock 7 480 ZIG
Nz/
kg/m?)
15
RSW-K
Hl G
16
Fi FGW
1100 —oIe-2x 1300-=[e2x
—
Na
FWS
Yan
———/I0
7
T69
Aufstellungsblock 2 480 ZIG
[e
527000 ——le 2 300-=- 1100 =-
20 er
m
Aufstellu bL 3 480 ü FWS T69
Fachbeiträge
Bild 3. Aufstellungsbeispiel einer KVStW mit Fernwählsystem T 69. Endausbau 1200 ZIG. Raumbreite 16 m
108
Aufbau 33.
Die
Fernvermittlung
Gestellreihen
In den FernVSt ist einheitlich die Gestellreihe 67 mit den Gestellreihenendrahmen (GER) zu verwenden. Aus Stabilitätsgründen werden in Abständen von 5 bis 6m Mittelstützen eingebaut, falls die Gestellreihe nicht voll ausgebaut ist. Als Gestellreihenlänge haben sich in chend den Raumbreiten von 12m und gestellreihen herausgebildet. Raumbreite 12 m 16 m Diese
Norm-GRh-Länge 9130 mm 13 380 mm
Normgestellreihenlängen
Lichtes Einbaumaß 8900 mm 13 150 mm
errechnen
a) 2X linke/rechte Endstütze 16X GR:FGW/RW
linke/rechte GR:ZIG GR:RSW GR:KRg GR:KRW
GRH
Endstütze
lassen 23 23 27 26 18
sich auch
folgt:
> =
150 mm 8880 mm 9030 mm 9050 mm 80 mm 9130 mm
40 mm 55mm 475mm 580 mm 560mm 555mm
Rundung auf volle 50 mm Zuschlag für GER links/rechts * In dieser
sich wie
55mm 555mm
Rundung auf volle 50 mm Zuschlag für GER links/rechts b) 2X 10X 1X 6X 8X
FernVSt entspre16m zwei Norm-
40 mm
> => = = =
150 4750 580 3360 4440
13 280
mm mm mm mm mm mm
13 300 mm 80 mm 13 380 mm*
aufstellen:
GRFGW GRRW GR Ue GR Ue 69 ZVt-Einheiten
109
Fachbeiträge 34.
Der
Der
von
“
Gestellreihenabstand
Gestellreinenabstand
Gestellreihenmitte
zu
>
im Vermittlungsraum
Gestellreihenmitte
beträgt
1,10 m.
Bei
eingebauten Gestellreihenzwischenverteilern soll der Abstand 1,30 m betragen. Der Abstand von der ersten Gestell-
reihe zur Stirnwand ist einheitlich 1,90 m, ebenso der freie Raum zwischen der letzten Gestellreihe und der Endwand
des
Raumes.
Der Betriebsgang hat eine Breite gang von 1,17m (im 12-m-Raum) Raum). 35.
Die
Baubreiten
der
von 1,70 m, der Nebenund 0,92m (im 16-m-
Gestellrahmen
Die Gestellrahmen für die Schaltglieder des FWST 62 ‚(und FWST69) haben verschieden große Einbaubreiten. Dabei versteht man unter Einbaubreite das äußere Kan-
Peamyeite
mn
GR-Breite
Schaltglied
362 460
495 505 515 555
460 460 505 545
560 565 580
548 548 548
Zentrale GR für GZ und JZ Alle Ue der Flachrelaistechnik, RSM, ZIG 55, StörSig 65, ZusE, APrEZIG, APrERg, APrUe, APrEF, AnGR HDUe RWS 69, alle GR der Ue 69 FGW 1006 (GR 1), 2Dr-OGW le FGW außer 1005, 1006 (GR 1), 1010, HRW, KRW, II HRg, KRg, ZTG, KRe . TonUe JSEP-Umw, APrEL RMW 62, RSW 62, ZIG 69
585
545
PrSW,
595
585
FGW
745 780 785 839
585 710 1750 825
II. ZuW Gt-GR Umw 69 Relais-Umw
675
Tabelle
-
585
GZuw,
7: Baubreiten und
110
Eingebautes
380 475
der des
Zusatz-GR
1003,
8.
1006
(14)
zum
(GR
Umw
2),
I. ZuW
Gestellrahmen FWST
69
1010,
I.
ZuW
des FWS T
62
Aufbau
Fernvermittlung
tenmaß des Gestellrahmens einschließlich der lichten Weite für das Unterbringen der Schaltkabel. In der Fernvermiittlungstechnik sind folgende Baubreiten vorzufinden: 4.
Die
Verteiler
Die Verteiler in den FernVSt dienen dem „Rangieren“, d.h. dem Zuordnen der Ausgänge von Schaltgliedern zu den Eingängen anderer Schaltglieder, sowie dem Herstellen von Mischungen (durch Parallelschalten, Verschränken usw.). Der Funktion nach werden unterschieden: Hauptverteiler Eingangsverteiler
NF-Verteiler Zwischenverteiler
In den FernVSt
befinden
(Bauart (Bauart
M 27) 51 bzw.
(Bauart (Bauart
52 bzw. M 27)
sich vornehmlich
71)
7R)
nur ein Zwi-
schenverteiler der Bauweise Modell 1927 mit 5 Holmen (ZVt M 27/5). Je nach Größe der FernVSt besteht der Bedarf nach Tabelle 8 an ZVt M27/5 unter Einbeziehung
einer Beschaltungsreserve von 20 %o.
s
a) Gemeinsamer ZVt für Sprechrichtung I und I 1... n Reihen
:OLTTTT] 1...
n Buchten
Sprechrichtung I = obere Rangierebene
Sprechrichtung I = untere Rangierebene b) Gefrennter ZVt für Sprechrichtung Iund 7 s
w | s
T....
I
w u
1..
Bild 4.
|
r
Sprechrichtung I
|
n Reihen
Ä
1DBuc fer
_
Sprechrichtung I
Anordnung
der
ZVt
ı2 Reihen
r
|
nn Buchten
in
FernVSt
111
Fachbeiträge Endausbau der KVStW
427/5
rassungsvernögen je ZVt Reihen Buchten
(senkrechte Seite)
ZIG
1
240
2IG
360 480
ZIG ZIG
2
|je ı2
120
960 1200
ZIG ZIG
2 2 2
je je je
180 220
8:
Bedarf
Tabelle
5. Die
anzahl der Einheiten
120
720 ZIG
51.
zvVt
waagrechte Seite)
4
20
15
1
6
30
23
1 e
10 je 8
50 80
Schaltkabel
18 18 4
bei
und
(2x40)
(2x60) (2x90) (2x90 + 2x20)
an ZVt-Einheiten
4Dr-Verkabelung
39 62
(2x31)
94 142 172
(2x47)
(2x71) (2x71 + 2x15)
in FernVSt
Leitungen
Schaltkabel
In den FernVSt werden als Verbindungskabel zwischen den Gestellrahmen untereinander und zwischen den Gestellrahmen und den Verteilern Schaltkabel der Form nach
S— VDE
Y(St)Y...X086vznBd 0813 verlegt. Die Kurzbezeichnungen
Ss— Y
= =
(St)
=
Y vzn Bd
= = =
bedeuten:
Schaltkabel Isolierung der Adern aus Polyvinylchlorid (PVC) Statischer Schirm aus Metallband oder (kunststoffkaschierter) Metallfolie (Aluminium) Mantel aus Polyvinylchlorid (PVC) verzinnt Bündelverseilung (je 5 Verseilelemente zum Bündel verseilt)
Beispiel: S— Y(St)Y15xX3x086vznBd 15 = 15 Verseilelemente 3 = Adern zu Dreiern verseilt.
Es handelt sich um
verseilung
112
mit
0,6 mm
ein 45adriges Schaltkabel Aderndurchmesser.
in Dreier-
Aufbau
Fernvermittlung
Da die Schaltkabel alle mit 0,6 mm Aderndurchmesser geliefert werden, wird diese Bezeichnung oft weggelassen und dafür an erster Stelle die Anzahl der Schaltkabel angegeben: Beispiel: 6xX56xX2
Es handelt sich um 6 Schaltkabel 112adrig in Paarverseilung. In den Regelverkablungsplänen für die einzelnen Schaltglieder und in den Kabelführungsplänen für die FernVSt wird stets diese Schreibweise verwendet. Anzahl x Art der Verseil-
elemente
Außendurchmesser
_
Außen|durchmesser
(mn)
5,5 7,0 7,0 8,5
5x3x0,6 10x3x0,6 #15x3x0,6 16x3x0,6
7,5 9,5 11,5 11,5
#15x2x0,6 16x2x0,6 20x2x0,6 25x2x0,6 *30x2x0,6 40x2x0,6 50x2x0,6 56x2x0,6
10,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,5 16,0 17,0
21x3x0,6 25x3x0,6 28x3x0,6
13,0 14,0 14,0
Diese
8,5
Schaltkabeltypen
Tabelle
52.
elemente
3x2x0,6 5x2x0,6 * 6x2x0,6 10x2x0,6
12x2x0,6
#*
Anzahl x Art der Verseil-
(mm)
20x3x0,6
10x5x0,6
werden
Schaltdrähte
litzen —
beide
selten
13,5
verwendet.
9: Schaltkabel für die Verkabelung Fernsprechvermittliungsstellen
Zum Beschalten Fernmeldeanlagen
Schaltdrähte
nur
12,5
und
nach
YV LiY YV (St) Y YVO (St)Y
und
von
Schaltlitzen
von Gestellrahmen und Geräten in werden ungeschirmte und geschirmte
für
bewegliche Verbindungen
VDE
0812 —
verwendet.
Schalt-
ungeschirmt geschirmt
113
‘Fachbeiträge
5.3.
Rangierdraht
Der Rangierdraht wird verwendet und trägt nach
zum VDE
Beschalten von Verteilern 0812 die Bezeichnung
YV...X 0,6 Die
Kurzbezeichnungen
Y Vv
Isolierung verzinnter
Rangierdrähte 5adrig. 6.
Der
bedeuten:
aus Polyvinylchlorid Kupferleiter gibt
es
in
den
(PVC)
Ausführungen
ladrig
bis
Kabelplan
Die Art der für den einzelnen Gestellrahmen anzuwendenden Verkabelung ist in der jeweiligen „Regelverkabelung“ (Abkürzung Lp für Leitungsplan) schaltgliedgebunden
aufgeführt.
Die
in
einer
FernVSt
insgesamt auszulegenden Schaltkabel sind im anlagengebundenen Kabelplan (Kp) für eine ganz bestimmte FernVSt zusammengefaßt. Der Kp wurde 1970 umgestaltet und vom FTZ in Tabellenform erstmals für FernVSt herausgegeben. Er besteht aus drei Teilen
(Bilder 5, 6,7).
Der Kabelplan in Tabellenform umfaßt alle Schaltglieder des FWS T 62. Für das FWS T69 wird ein neuer Kp-Vordruck ebenfalls in drei Teilen zusammengestellt, sobald die Regelverkabelungen für die einzelnen Schaltglieder vom FTZ genehmigt sind.
7. Schrifttum 1]
FTZ-Richtlinie für die Aufstellung und Verkabelung technischen Einrichtungen des Fernwählsystems T62
[2]
Siemens-Druckschrift
114
über
Schaltkabel.
von und
Lfd N r
Verteiler
Kabel-
Verteiler
onzahi v.or
Ud
Nr.
Verteiler
Kabel -
anzahl
mit Schaltkabel 6S/ES
mıt Formkobel OR
Verteiler
6S/ES
Z I Z < ı
S
nm
GT
>
Bild5.
Kabelplan
FWS
T62
„Wahlstufen“
(siehe
auch
Seiten
116
und
117)
15
3 Verteiler we woogrech!
91T
Sr senkrecht
V : Worderseite
Hınweise
|.
R sRuckserte
Verteiler }
Aderr.bererrung
Regeiverkabeiung
Adern-
Fo-Rr
berenrung
LK» Kader tur‚e 26R Ohne
138 305 7 1p Zum veria beit
16 HRW 535 ıp 8701
verkabelt.
Tabeiie poroleigeschaltet 8557-1112. 2Vi verkabeit
16 KRW
3
535 19 87028
ES 2- I11 zu benachbarten Gl nach untenstehender Tabelle porolleigeschollet.
ZI.RW-Gruppe
6 LRW
Übersicht der aufgebauten
I. RW-GR siehe Iobelle
unter Hinweise
535 198702 a6
ws woayrecht s » senkrecht V = iorderselte R : Ruckserte
147 014 “n
LIT
Verteiler
Kobd-
u. mongrech! s „senkrecht V » Vorder seile
anzon
u
A
Ws
.
benennung
R = Rückseite
w:800:
Ss:
Anzahl
Bild5.
Kabelplan
Verleder
6R- Nr.
Fa-Rv
K_= Mader turye20R
FWS
T 62.
„Wahlstufen“
Ma
V x Vorderseite R ı Rückseite
Ar
E-Rr
K_: mel tur je 26R
161 0444 ip Bi!
Gole 4/2 141 0444 [p 9}
535 ip 8666 B11
535 ıp 8666 81.1
WVe-g4Dr 141 0541 ip
141 0541 Lp
k 535 1p 8665 81? -k
535 LP 8665 Bi’ -k 141 0542
ip
-k 1:1 0542
Ip
Verteiler
125/197
Adern benennung
w= sz = R =
I
8TT
Hınweise
anzanı | denerrung „Ademu-or
| Ural
ws woogrecht
Ss = senkrecht Vs Vordersate R = Rückseite
woogrech! senkrech! ierderseitd Ruckserte
em
41 16? 0641
Ip
535 ip 8675
535 ıp 8678
61T
Nr |
Verteiler
w: s : V : R =
4Dr
Schaltglied
woogrech! senkrecht! Vorderseite Ruckserte
Kabel-
anzahl |
vr
Bild 6. Kabelplan
Verteiler
FTZ- Ip Regelverkobelung
Adern-
benernurg
Aderrdenerr.rg
Fo-Rv
K_: Kae: tur je 2 6R Ohne Hırweis =
FWS
T 62.
Anzahl
„Übertragungen“
Kobel-
onzuhl
u.on
w.: wongrech!
Ss = senkrech!
V: Vordersele
R: Ruckseite
021
Fa-Rv
L_- oder fürje20R
Hinweise
147 05102 io
5 HRg
Ringteitung/Ume.] Mg - OR: WR
102110 ip
- GR:
der Bundelobsch.
Ringtertung/Ume.2
v
z Um
je Grp.
HRG- GR:
sKRg 62 141.020
v.d.2iG Hinweise zu DieP uPZ sınd uber je mit 2x 0.6 zu schalten.
Rel-Urmi (SEP) 141 211E Au2
LId.Nr 6-9 .. Adern 8 ZI6-GR poroliei
ZE.An (Anz)
256«?
|1-EH.Anz
12513
|E
Zui6x2 2u56r2
‘1 1p
17 051 01 ip
12 ZIG 2/4 11 001 1p Bi!
0o,5c
2 I2 216 4/ 161 000°. Mi!
_
Adernbenennung
R » Ruchsarte
I156r2
1
I 2042
E o.bc
Ir 16x?
p
Ix56x2
-
Al A
I2 ZI6 2/4
- IR, Anı
09
"11001 1p Rt!
12 216 4/%
ixl2ı2 141 070110 Br 2
!r!2k ix!6x2
VLU 14709997 1p
vo 2IG-GR
x21x3
TIn.- Takte Mrz -
ı21x3
IIn.- Torte MnZ.-
Zeittaktgeber
Grunagestel! | > Zusatzgestes
1x50x2
Zusgtges:ei I v brundgesiel
15012
Adern benennung
Kobeionzohl son
uaz Pun 9/2 -uoJd/agDy
I
tet
Verteiler
w. s = V = Rs
Bild 7.
waagrech! senkrecht! Vorderseite Ruckseite
Kabelplan
Kobelonzoh u-an
FWS
Verteiler
FI £
Aderr-
Regelverkadelung
benerrung
Av
L_: Kader turje 26R Ohne Hırwas »
T 62.
„ZIG
Kodel fur ‚e! GR
Anzohl
und
Schaltglieder“
zentrale
w:woogrecht! Ss x senkrech! V = Vorderseite R = Rudseite
Fachbeiträge
Unterhaltung von Fernsprechvermittlungseinrichtungen bei der DBP
Bearbeiter:
1.
Werner
Hammermann
Einleitung Die
DBP
praktizierte
bisher
für
die
Unterhaltung
der
Fernsprechvermittlungsstellen (FeVSt) ein präventives Verfahren. Es hatte zum Grundsatz, Abweichungen (Abw) bereits im Entstehen zu erkennen und zu beseitigen, bevor sie sich nachteilig auf den Betrieb auswirken konnten. Zielsetzung des Verfahrens war, durch vorbeugende Unterhaltungsmaßnahmen die Fehlerrate möglichst gering zu halten. Ohne Zweifel war die Methode des präventiven Unterhaltens Systeme) die
für die Hebdrehwähler-Systeme (HDWwirkungsvollste; das Verfahren ist aber sehr
personalaufwendig. Die
ständige Steigerung
meldewesen
und
der
der Verkehrsleistungen
damit
verbundene
Aufbau
im Fernumfang-
reicher technischer Einrichtungen bedingt eine stetige Vermehrung des sehr personalintensiven Unterhaltungsaufwandes. Um einerseits die wirtschaftliche Forderung nach möglichst geringem Aufwand für die Unterhaltung der Anlagen zu erfüllen, andererseits aber dem ständig steigenden
Personalfehlbestand
mit
seinen
für
das
Personal
bestehenden negativen Auswirkungen zu begegnen, wurde Jas Fernmeldetechnische Zentralamt (FTZ) seinerzeit beauftragt, ein weniger personalaufwendiges Unterhaltungsverfahren zu entwickeln. Die Ergebnisse der vorausgegangenen langjährigen Betriebsversuche bildeten die Grundlage des neuen Konzeptes. Das so entstandene neue Unterhaltungsverfahren (NUV) mit seiner zentral gelenkten, bedingt korrektiven Arbeitsweise wurde seit 1969 in 7 Fernmeldeämtern (FÄ) praktiziert. Die daraus resultierenden positiven Ergebnisse veranlaßten das Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen (BPM),
122
Unterhaltung
das Verfahren erproben. Der 2.
Grundsätze Die
DBP
Vermittiungstechnik-
in größerem Umfang bei 22 weiteren FÄ zu Erprobungsbetrieb begann um den 1.5. 1973. des
wird
Arbeitsverfahrens 1975
17
Mill.
Anrufeinheiten
(AE)
mit
dem zugehörigen Fernanteil zu unterhalten haben; 15 Mill. AE werden davon in Edelmetall-Motor-Drehwähler-Technik
(EMD-Technik)
und
2 Mill.
in
HDW-Technik
S 50
sein.
Die EMD-Einrichtungen haben sich als sehr gering im Verschleiß erwiesen. Auch nach jahrelangem Betrieb sind nur wenige präventive Maßnahmen erforderlich. Diese Tatsache ebnet den Weg in Richtung auf ein korrektives Arbeitsverfahren, bei dessen Anwendung nur noch fehlerbeseitigende Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. In der Anwendung ist das korrektive Verfahren wegen des geringsten Aufwandes natürlich die wirtschaftlichste Lösung. Es bedingt jedoch, daß die zu unterhaltenden Einrichtungen so zuverlässig sind, daß die geforderte Dienstgüte gehalten werden kann, ohne daß vorbeugende Maßnahmen notwendig sind. Aufgrund der vorhandenen Zuverlässigkeit des EMD-Systemes ist es möglich, ein im wesentlichen korrektives Unterhaltungsverfahren zu praktizieren, welches durch wenige sinnvolle präventive Maßnahmen unterstützt wird. Dieser Grundsatz, der zugleich auch die Wirtschaftlichkeit des Unterhaltens von FeVSt beinhaltet, findet seinen Niederschlag in der Gestaltung aller Arbeitsabläufe des Unterhaltens. Der Unterhaltungsaufwand wird dann wirtschaftlich sein, wenn die Dienstgüte mit einem minimalen Kostenaufwand im vorgeschriebenen Toleranzbereich gehalten wird. In einem Arbeitsverfahren mit gezielt angesetzten Tätigkeiten ist eine optimale Betriebslenkung nur denkbar, wenn alle anfallenden Daten sinnvoll aufbereitet werden. Ferner sind umfangreiche Betriebsstatistiken notwendig, um den Bereich des Unterhaltens transparenter zu gestalten als bisher. Die Menge der anfallenden Daten zwingt zu einer maschinellen Verarbeitung. Wesentlicher Bestandteil des Unterhaltungsverfahrens ist daher die EDV-mäßige Unterstützung der für die Lenkung verant-
123
Fachbeiträge wortlichen Kräftegruppen. Das Konzept des Verfahrens mußte daher berücksichtigen, daß das Erfassen der Daten aus dem gesamten Betriebsgeschehen ohne großen Aufwand möglich ist. Insbesondere die Gestaltung der erforderlichen Arbeitszettel (Az) für die Erteilung der Arbeitsaufträge hatte dies zu berücksichtigen. 3. Arbeitsabläufe
des
Unterhaltens
Die Vielzahl der von den Unterhaltungskräften zu erledigenden Arbeiten läßt sich in unmittelbare und mittelbare Unterhaltungstätigkeiten aufgliedern. Die unmittelbaren Unterhaltungstätigkeiten kommen der Dienstgüte zugute, sei es die Wiederherstellung der geforderten Dienstgüte oder die Erhaltung der Dienstgüte. Die mittelbaren Unterhaltungstätigkeiten sind in den FeVSt nowendige Arbeiten, die nicht die Dienstgüte beeinflussen, wie z.B. Schalten von Leitungen, Bearbeiten von Gebührenbeanstandungen, Erledigen von Sonderarbeiten. Der Anteil der mittelbaren Unterhaltungstätigkeiten ist beträchtlich: 55 v.H. des Istarbeitszeitaufwandes! Nur 45 v.H. des Istarbeitszeitaufwandes dient also der Dienstgüte! 31.
Entstören
Das Entstören in FeVSt umfaßt alle Tätigkeiten, die zum Wiederherstellen der Betriebsfähigkeit der technischen Einrichtungen notwendig sind. \ Beim Entstören werden Abw aufgrund von Störungsmeldungen (StöM) beseitigt. Dieser Arbeitsablauf ist die eigentliche korrektive Komponente des Verfahrens. Eine Störung (Stö) liegt vor, wenn die Funktion einer technischen Einrichtungen ausgesetzt hat, beeinträchtigt worden ist oder noch beeinträchtigt wird. Dabei ist es unerheblich, ob der Fernsprechbenutzer die Beeinträchtigung als störend empfindet oder nicht. Das EMD-System ist hinsichtlich des Arbeitsaufwandes für Entstören sehr bescheiden. Ermittlungen haben ergeben, daß nur 15 v.H. des Gesamtaufwandes auf den Arbeitsablauf Entstören entfällt. Wenn das Unterhalten nur das
124
Unterhaltung
Vermittlungstechnik
Entstören unserer technischen Einrichtungen würde, könnte eine Betriebskraft etwa 14000 halten. Die „Arbeitsanweisung für (ArbAnw Entstören 383/01)“ Regelungen. 32.
beinhalten AE unter-
den Arbeitsablauf Entstören enthält alle erforderlichen
Einzelprüfen
Aus wirtschaftlichen Gründen und zur Verbesserung der Dienstgüte soll das Einzelprüfen möglichst automatisch durchgeführt werden. Automatische Prüfeinrichtungen (APrE) gestatten es, daß die Einrichtungen mit kurzen Fristen geprüft werden. Die Wirkbreite eines Fehlers wird damit gering gehalten. In Verbindung mit der exakten Durchführung des Prüfvorganges ergibt sich somit eine Verbesserung der Dienstgüte. Für Ortsvermittlungsstellen (OVSt) stehen die APrE 50 (für große OVSt S50), die APrE55 (für große OVSt S55 und S55v) und die APrE55vk (für OVSt S55v) zur Verfügung. Ein großer Nachholbedarf an APrE ist noch zu bewältigen. Während 1972 1258 APrE50 und APrE55 in Betrieb waren, sind bis 1976 4607 APrE 50/55/55vk erforderlich. Damit wird das Ziel erreicht, daß die technischen Einrichtungen in OVSt im wesentlichen automatisch geprüft werden. Für FernVStW ab 66 ZIG stehen die APrE für Zählimpulsgeber (APrEZIG) und für Register (APrERg) zur Verfügung. Ferner können unter bestimmten Einsatzbedingungen die APrE für Leitungen (APrEL) und für FernVStW (APrEF) eingesetzt werden. Damit kann auch ein großer Teil der Einrichtungen in FernVStW automatisch geprüft werden. Leider können Einrichtungen des FwS T54 (Übergangstechnik) nicht automatisch geprüft werden. Mit dem Einsatz der APrE sind einsparungen verbunden.
erhebliche
Personal-
Aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen verbleibt ein nicht zu vernachlässigender Anteil an manueller Prüfarbeit. Unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze wurde
125
Fachbeiträge die Abwicklung des manuellen Einzelprüfens neu geregelt. Um den Arbeitsaufwand zu mindern, wird nach Kurz- und Vollprüfungen unterschieden. Kurzprüfungen mit geringem
Zeitaufwand
werden
in
kurzen
Fristen
durchgeführt, während Vollprüfungen Wochen und länger) angesetzt werden.
(etwa
langfristig
8 Tage)
(24—48
Die nach bisheriger Erfahrung neu festgelegten und wesentlich gedehnten Fristen sollen sich künftig nach dem Prüferfolg und dem durchschnittlichen Arbeitszeitaufwand für eine beim Prüfen ermittelte Störung orientieren. Für die Berechnung der Prüffristen tp, gilt folgende Formel: p
_
" SchGl
=
Aprüfling k =
— =
. SchGl
der
Wenn
ist tp,
in
vorhandenen
des
je Prüfling SchGl
angestrebter Anzahl
. Aprüfline
K apıgoy) ' StÖM
Prüfdauer
Wertigkeit
aprsoı] StöM
Anzahl ”
48
der 48
im Verbindungsaufbau
=
ap, APrüfling
SchGl
StöM
je StöM
je Prüfvorschrift
Kapısoll
=
Schaltglieder in Minuten
Prüfzeitaufwand
StöM
: Wochen
--C
C gesetzt in
in Minuten
in einem
Jahr
wird,
Wochen.
Die Werte für C sind dem „Verzeichnis der Prüfvorschriften für Orts- und FernVStW“ zu entnehmen. Mit der Berechnung der Prüffristen für bestimmte Prüfvorschriften wurde der erste Schritt getan, um den Arbeitszeitaufwand für Einzelprüfen dem tatsächlichen Bedarf anzupassen. Die manuellen Einzelprüfungen sind präventive Unterhaltungsmaßnahmen, deren Arbeitszeitaufwand so gering wie möglich gehalten werden sollte. Durch den Ein-
satz der APrE
und
beitsanweisung für Einzelprüfen 383/02)“ gen gegeben. 126
durch
die neue
Regelung
in der
„Ar-
den Ablauf Einzelprüfen (ArbAnw sind die erforderlichen Voraussetzun-
Unterhaltung
33.
Technisches
Vermittlungstechnik
Überprüfen
Im Arbeitsablauf Technisches Überprüfen (TÜp) sollen abgenutzte Teile sowie Fehleinstellungen oder sonstige Abw an den technischen Einrichtungen erkannt, vorbeugend beseitigt und damit zu erwartende Störungen mit wirtschaftlichem Aufwand vermieden werden. Während bisher die technischen Überprüfungen nach vom FTZ festgelegten Fristen durchgeführt wurden, ist es künftig den FÄ überlassen, die TÜp nach Bedarf durchzuführen. Nur wenige zentrale Einrichtungen werden noch nach Fristen technisch überprüft. Der Bedarf einer TÜp muß von den Aufsichten ermittelt werden. Hinweise hierzu werden aus dem Betriebsgeschehen abgeleitet. Die Aufsichten fertigen Befundberichte über den Zustand der technischen Einrichtungen. Hiernach werden genau definierte TÜp-Aufträge erteilt. Neu eingeführte Normen für das technische Überprüfen (TÜ-Normen) geben Hinweise auf störungsanfällige Teile und die durchzuführenden Arbeiten. Vorbeugende Instandhaltungsmaßnahmen sind erst dann anzuordnen, wenn das Funktionsverhalten oder der Zustand der technischen Einrichtung es erfordern. Mit Hilfe von Positionen der TÜ-Normen kann der Umfang der TÜp betriebsgerecht abgegrenzt, der Auftrag ausgefertigt und die Betriebskraft eindeutig angewiesen werden.
Der
Arbeitszeitaufwand
für
das
TÜp
wird
so
auf
ein
z. Z. mögliches Minimum reduziert. Später soll die Datenverarbeitung auf dem Gebiet der Unterhaltung von FeVSt für die Lenkung der TÜp-Maßnahmen nützliche Dienste leisten, indem ein Bedarf aufgrund objektiver Ergebnisse ermittelt wird, während heute. noch der Befundbericht mit seinen subjektiven Komponenten den Ausschlag gibt.
Da die TÜp nach der „Arbeitsanweisung für den Arbeitsablauf Technisches Überprüfen (ArbAnw Techn. Überprüfen 383/03)“ „nach Bedarf“ durchgeführt wird, werden einerseits erhebliche Personaleinsparungen erzielt, andererseits muß aber gerade der Lenkung dieses Arbeitsablaufes erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet werden. Es kommt darauf an, die richtigen Instandhaltungsmaßnahmen
zur
rechten
Zeit
zu
veranlassen.
Das
ist
eine
verant-
127
Fachbeiträge wortungsvolle Aufgabe für die Kräfte des Fernsprechunterhaltungsbezirkes (FeUBz), welche die Betriebsarbeiten zu lenken haben. 34. Sonstige Betriebsarbeiten Im Arbeitsablauf Sonstige Betriebsarbeiten werden die mittelbaren Unterhaltungstätigkeiten abgewickelt. Sie haben auf die Wiederherstellung oder Erhaltung der Dienstgüte keinen Einfluß. Auftraggeber für diese Betriebsarbeiten sind im wesentlichen andere Dienststellen (DSt). Der Umfang der auszuführenden Arbeiten kann daher von der DSt Unterhaltung von Fernsprechvermittlungsstellen (UFe) nicht merkbar beeinflußt werden. Die sonstigen gegliedert: 341.
Betriebsarbeiten
Sonstige
Hierunter
werden
Betriebsarbeiten
werden
Leitungsschaltungen,
wie
folgt
auf-
UFe
Schalten
von
Zweieranschluß (ZAs), Wählsternanschluß (WstAs), Sammelanschluß (Sammel-As) und Gebührenanzeige sowie Änderung von Mischungen und technischen Einrichtungen usw. verstanden. Ferner fallen hierunter die Betriebsarbeiten für andere
Dienststellen, wie z.B. tragungsbetrieb (FeÜ). 342.
Meßhilfe
für
NF-
und
TF-Über-
Verbundarbeiten
Aus organisatorischen Gründen müssen für andere Dienststellen Arbeiten ausgeführt werden. Für diese „Verbundarbeiten“ werden Bemessungsanteile der DSt UFe übergeben. Hauptsächlich machen die Dienststellen Fernsprechentstörung (FeE), Maschinentechnische Stelle (M) und Fernmeldestromversorgung (Sv) von dieser Möglichkeit Gebrauch. 34.3.
Sonderarbeiten
Sonderarbeiten für andere Dienststellen sind nicht durch Bemessungsanteile gedeckt. Sie lassen sich im Betriebsablauf nicht immer vermeiden. So gibt es umfangreiche
128
Unterhaltung
Vermittlungstechnik
Sonderarbeiten im Rahmen von Bauvorhaben. Der Anteil schwankt von 10 v.H. bis gelegentlich 25 v.H. Insbesondere in großen FernVStW wird ein beachtlicher Anteil an Sonderarbeiten geleistet, weil die Baustellen F den zeitlichen Anforderungen nicht gewachsen sind. Da Sonderarbeiten in der Personalbemessung nicht enthalten sind, dürfen sie nur mit Zustimmung der Dienststellen UFe durchgeführt werden, wenn dadurch Betriebs- und Verbundarbeiten nicht zurückgestellt werden müssen. Nähere Einzelheiten über die Gestaltung dieses Arbeitsablaufs regelt die „Arbeitsanweisung für den Arbeitsablauf Sonstige Betriebsarbeiten (ArbAnw SoBetr 383/04)“. 35.
Überholen
Der Arbeitsablauf Überholen ist nur für HDW-OVSt und HDW-FGW in FernVStW vorgesehen. Das Überholen ist eine Teilaufgabe des Instandhaltens. Es sind Drehwähler (DW) und Hebdrehwähler (HDW), deren Abnutzungsgrad zum erhöhten Störungsanfall führt, mit einem wirtschaftlich vertretbaren Aufwand für einen möglichst langen Zeitraum wieder betriebssicher herzurichten. Nach den neuen
Regelungen
für
den
Arbeitsablauf
nach
der
„Ar-
beitsanweisung für den Arbeitsablauf Überholen (ArbAnw Überholen 383/05)“ sind die Einrichtungen nach Bedarf zu überholen. Die bisherige Überholung nach Fristen (4 Jahre HDW, 8 Jahre DW) entsprach nicht dem Wirtschaftlich-
keitsgrundsatz.
Die
Überholung
nach
Bedarf
erfordert
aber wie im Arbeitsablauf TÜp eine optimale Lenkung. Auf der Grundlage von Überholungsmerkmalen hat der Stellenvorsteher (StV) UFe zu entscheiden, welche Schaltgliedergruppen (SchGlGr) zu überholen sind und wie die Überholung zeitlich einzugliedern ist. Um
zu
erkennen,
daß
eine
sind die Betriebsergebnisse
Überholung
aus den
notwendig
Arbeitsabläufen
ist,
Ent-
stören und TÜp zu berücksichtigen. Ein Hinweis auf die Notwendigkeit des Überholens wird immer dann gegeben sein, wenn neben hohen Fehlerkennwerten und hohem Arbeitszeitaufwand für Entstören die entsprechenden Ergebnisse aus dem Arbeitsablauf TÜp, wie Kennwerte für Unregelmäßigkeiten, Arbeitszeitaufwand TÜp und TÜp5 Fernmelde-Praxis
129
Fachbeiträge
Erfolg bestimmte Grenzwerte überschreiten. Ferner sind die von den Aufsichten erstellten Befundberichte über den Zustand der technischen Einrichtungen zu berücksichtigen. Die Ergebnisse aus der Kontrolle der Dienstgüte (Störgrad bei Probeverbindungen und Verkehrsbeobachtungen) sind für die Beurteilung der Betriebsgüte heranzuziehen. Darüber hinaus sind die Beanstandungen von Teilnehmern und die besonderen Hinweise auf Az zu beachten. °
Die beschriebenen Grundsätze für die Gestaltung des Arbeitsablaufes Überholen haben zur Folge, daß bei gleichbleibender Dienstgüte der Umfang der Überholungsarbeiten wesentlich geringer wird und der Grundsatz nach Wirtschaftlichkeit erfüllt wird. Dem Einsatz von Überholungsgruppen (U-Gruppen) ist der Vorzug zu geben, weil sich die Arbeitsgänge des Überholens dann rationeller abwickeln lassen. Vielfach wird aber der Arbeitsumfang für Überholen je FA so klein werden, daß keine ständige U-Gruppe gebildet werden kann. Es ist dann zur Erledigung der Überholungsaufträge eine
Ü-Gruppe auf Zeit zu bilden, die nach gleichen Regelungen
arbeitet, wie sie für die U-Gruppen gelten. Kann das vorgesehene Überholungsprogramm nicht mit eigenen Kräften abgewickelt werden, sind Firmen zu beauftragen. Im Rahmen des Arbeitsablaufes Überholen sind die technischen Einrichtungen zwischenzeitlich zu behandeln, um den Verschleiß der Teile möglichst gering zu halten. Das zwischenzeitliche Behandeln umfaßt das Schmieren der Schaltglieder im eingebauten Zustand nach Fristen (HDW 2 Jahre, DW 4 Jahre). EMD-Wähler werden nicht über-
holt. Die 4.
Instandhaltung
Organisation
der
geschieht
im Arbeitsablauf
TÜp.
Fernsprechunterhaltungsbezirke
Die bisherige Organisation des Unterhaltens sah die feste Besetzung der FeVSt vor, sobald eine Unterhaltungskraft erforderlich war. Die kleineren FeVSt wurden zu Fernsprechunterhaltungsbezirken (FeUBz) zusammengefaßt und von einer Kraft unterhalten. Die starre Zuordnung wird den künftigen Anforderungen nicht mehr gerecht.
130
Unterhaltung
Vermittlungstechnik
Während bisher die Unterhaltungsarbeiten im wesentlichen nach Fristen durchgeführt wurden, die eine Anpassung an die jeweilige Situation erschwerten, ist für die beschriebenen 5 Arbeitsabläufe eine entsprechende Betriebslenkung erforderlich. Als Grundsätze der Organisation der FeUBz gelten demnach: Einsatz der BetrKr im gesamten FeUBz in Anpassung an die jeweilige betriebliche Situation und Lenkung aller Betriebsarbeiten durch eine besondere Kräftegruppe. 41.
Bildung von Fernsprechunterhaltungsbezirken
Das Gebiet des FA wird nach bestimmten Grundsätzen in FeUBz aufgeteilt. Anzahl und Konzentration der technischen Einrichtungen, die technischen Abgrenzungen (ONBereich, KVSt-Bereich) und die Verwaltungsgrenzen (FABereich, Fernmeldebezirk) sind bei der Bildung von FeUBz zu berücksichtigen. Die Abgrenzungen sind mit anderen DSt (z.B. Fernsprechentstörung) abzustimmen. 1. 2. 3.
Es es es es
entstehen FeUBz mit folgenden Strukturen: sind nur OVSt zu unterhalten, sind OVSt und FernVStW zu unterhalten und ist eine große FernVStW zu unterhalten.
Nach der fassen:
I12nPWMN
l.
technischen
Abgrenzung
kann
der
FeBUz
um-
ein ON, Teile eines großen ON, Teile eines großen ON und angrenzende ON, mehrere ON, ein KVSt-Bereich (OVSt und FernVStW), mehrere KVSt-Bereiche und eine große FernVStW.
Die Anzahl der Arbeitsposten (Ap) je FeUBz ist ebenfalls recht unterschiedlich. Sie beläuft sich z.Z. von 13 Ap in ländlichen FeUBz bis 35 Ap in FeUBz mit größerer Konzentration der technischen Einrichtungen. Einige FeUBz
5°
131
Fachbeiträge mit einer großen desgebiet müssen
FernVStW haben über 100 Ap. Im etwa 450 FeUBz gebildet werden.
Bun-
42. Einsatzplatz Als Kernstück der Organisation der FeUBz ist der „Einsatzplatz für Unterhalten der Fernsprechvermittlungen (EPI UFe)“ zu betrachten. Er ist notwendig, weil die Unterhaltungsarbeiten nicht mehr planmäßig, sondern nach Bedarf durchgeführt werden. Der EPI lenkt die Unterhaltungsarbeiten und den Einsatz der Kräfte. Hierbei gilt als Grundsatz: Der EPI-Leiter lenkt im kooperativen Zusammenwirken mit den Aufsichten vollverantwortlich den Betriebsablauf im FeUBz und trifft die hierfür erforderlichen Dispositionen. Er soll sich insbesondere mit der Auswertung der Daten und der sich daraus ergebenden Betriebslenkung sowie der Arbeitsvorbereitung befassen. Zur Erledigung aller für die Disposition notwendigen Arbeiten kann er Arbeitsaufträge, die zur Beurteilung des Betriebsgeschehens erforderlich sind, den Aufsichten zuweisen. 43.
Aufsichten
Die Aufsichten unterstützen den EPI-Leiter bei der Abwicklung aller Betriebsarbeiten. Sie haben in ihrem Aufsichtsbereich auf die ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten nach den Arbeitsanweisungen für das Unterhalten von FeVSt zu achten. Der Einsatz der Aufsichten muß vorrangig dem Ablauf des Betriebsgeschehens angepaßt werden. Ihre vornehmliche Aufgabe ist es, das Betriebsgeschehen genau zu beobachten, damit die richtigen Unterhaltungsmaßnahmen (z.B. TÜp) zur rechten Zeit angesetzt werden können. Die Aufsichten melden ihre Feststellungen (z.B. mittels Befundbericht) dem EPI. Der EPI entscheidet über die zeitliche Einordnung der einzuleitenden Maßnahmen. 44. Betriebskräfte Die Betriebskräfte (BetrKr) erhalten träge im allgemeinen schriftlich mittels
132
ihre ArbeitsaufAz. Die Aufträge
Unterhaltung
Vermittlungstechnik
können auch fernmündlich erteilt werden, wenn es vorteilhafter ist. Die BetrKr können im gesamten FeUBz eingesetzt werden. Je nach Arbeitsanfall werden sie beauftragt, bestimmte Arbeiten in einer FeVSt zu erledigen. Um die Wegezeiten kurz zu halten, sind die Kräfte von einem günstig gelegenen Standort aus einzusetzen. Es ist zweckmäßig, um die Ortskenntnisse der BetrKr zu nutzen, Aufträge für die einzelnen FeVSt möglichst immer den gleichen Kräften zu erteilen. FeVSt erhalten eine Grundbesetzung, wenn durch den ständigen Arbeitsanfall eine BetrKr ausgelastet ist. Zusätzlicher zeitlicher Arbeitsanfall wird auf Anweisung des EPIl abgedeckt. Die DSt-Leitung UFe entscheidet, wieviel Kräfte in der Grundbesetzung einzusetzen sind. Der tatsächliche Arbeitsanfall ist von vielen Faktoren abhängig, er muß daher fallweise ermittelt und danach die Grundbesetzung angepaßt werden. Der EPI kann bei Bedarf auch Kräfte der Grundbesetzung zu einer anderen FeVSt entsenden, wenn dort vorübergehend dringende Arbeiten zu erledigen sind. Für den Einsatz der Kräfte ist die Dringlichkeit des Auftrages und die Wirtschaftlichkeit maßgeblich. So sind nichtdringende Aufträge für eine FeVSt ohne Grundbesetzung zu sammeln und erst zu erledigen, wenn entweder eine dringende Arbeit aufkommt oder die Entsendung einer BetrKr sich dem Arbeitsumfang der vorliegenden Aufträge nach lohnt. 5.
Ausstattung
der
Einsatzplätze
Beim Einsatzplatz als Zentrale des FeUBz laufen alle Fäden zusammen: schriftliche oder fernmündliche Aufträge werden erteilt, Störungssignale werden angezeigt, Störungsdrucke der APrE sind auszuwerten, Anfragen anderer DSt sind zu beantworten, Arbeiten sind mit anderen DSt abzusprechen, BetrKr sind anzuweisen, Besprechungen mit Aufsichten und BetrKr durchzuführen, Unterlagen aufzustellen, zu ändern oder zu ergänzen u.a.m. Die: Ausstattung des EPl muß den Anforderungen entsprechend ausgelegt werden. Die Räume für die EPI sollen neuzeit-
133
Fachbeiträge lich und zweckmäßig hergerichtet werden. Zur Dienstausstattung gehören vor allem Organisationsmöbel nach Baukastenart, um einen schnellen Zugriff zu den Dispositionsmitteln und insbesondere zu den Az zu haben. Die
fragt
beim
EPl
werden.
eingehenden
Daher
sind
die
Anrufe
müssen
zügig
Abfragemöglichkeiten
abge-
ent-
sprechend zu wiederholen und Rückfragemöglichkeiten vorzusehen. Zur Erfüllung dieser Forderungen werden beim EPIl Makler-Fernsprechanlagen eingesetzt. Namenbzw. Zieltaster entlasten die EPl-Kräfte von der umfangreichen Wählarbeit.
Während der Regelarbeitszeit soll der EPl die Störungssignale der ihm unterstellten FeVSt beobachten können. Der Drucker der Störungssignalisierung muß daher im Raum der EPI untergebracht sein. Die Forderung kann z.Z. in vielen Fällen nicht erfüllt werden. Eine betrieblich befriedigende Lösung ist erst mit der Einführung der Störungsmeldeeinrichtung 1 (StöME 1) 1975 möglich. Aus FeVSt ohne Grundbesetzung mit APrE55 oder APrE 55vk sollen die Drucke mittels Fernübertragung zum EPI übermittelt werden. Hierzu ist beim EPI ein zentrales Druckgerät erforderlich, welches wie ein Fensprechteilnehmer angeschaltet wird. 6. Datenverarbeitung von FeVSt
aus
dem
Bereich
des Unterhaltens
Der für eine FeVSt wirklich erforderliche Unterhaltungsaufwand war von jeher umstritten. Eine Untersuchung ergibt ein komplexes Gebilde. Die Beeinflussungsfaktoren, wie Zuverlässigkeit der technischen Einrichtung, verkehrsmäßige Beanspruchung, Umweltverhältnisse usw. sind bekannt. Das jeweilige Ausmaß des Einflusses läßt sich jedoch nicht ermitteln. Somit kann der erforderliche Unterhaltungsaufwand nicht allgemeingültig durch eine Größe festgelegt werden. Da eine subjektive Beurteilung nicht befriedigt, kann man den Unterhaltungsaufwand objektiv nur untersuchen, wenn man den Wert möglichst vieler Größen ermittelt. Diese müssen gegeneinander ab-
134
Unterhaltung
Vermittlungstechnik
gewogen werden, um daraus Schlüsse für die künftige Unterhaltung zu ziehen. Die Vielzahl der hierzu erforderlichen Daten aus den Arbeitsabläufen zwingt zu einer maschinellen Verarbeitung. Die bisher durch mühsame Kleinarbeit erstellten Fehlerübersichten für Ortsund Fernvermittlungsstellen waren auf diesem Wege ein bescheidener Anfang. Aus dem gesamten Bereich des Unterhaltens sollen Daten erfaßt und verarbeitet werden mit dem Ziel, die für die Lenkung erforderliche Transparenz des Betriebsgeschehens zu erhalten. Hierzu sind Grundlagen und Regelungen erforderlich, welche Daten aus den Arbeitsabläufen und welche allgemeinen Daten erfaßt werden sollen, damit eine einheitliche Defi-
nition
der
Begriffe
vergleichbare
Ergebnisse
liefert.
Wei-
tere Voraussetzungen für die Datenverarbeitung sind die Einführung eines neuen Numerierungssystems und das Erfassen des Bestandes an technischen Einrichtungen der FeVSt. 6.1.
Numerierungssystem
Das Erfassen der Betriebsdaten beruht darauf, daß. für jede Information der Ort des Geschehens durch eine Nummernfolge angegeben wird. Diese setzt sich wie folgt zusammen: 1.
Kenn-Nr.
der
FeVSt
(VSt-Kenn-Nr.)
2.
Nummer des Gestellrahmenplatzes (GRPI-Nr.); sie ist 6-stellig und besteht aus der jeweils 2-stelligen RaumNr., Gestellreihen-Nr. und Platz-Nr. 3. Feld-Nr. (F-Nr.); sie ist 1- bis 3-stellig und bezeichnet z.B. die laufende Nr. des Wählers oder der Übertragung in einem Gestellrahmen. Die technischen Einrichtungen der FeVSt müssen so beschriftet werden, daß die GRPIund F-Nrn. von den BetrKr leicht festzustellen sind. 6.2.
Bestandsdatei
Aufgrund
der
Bestandsdatei
angegebenen
Auskunft
über
Nummernfolge alle
weiteren
gibt dann festen
die
Daten
135
Fachbeiträge
der bezeichneten technischen Einrichtung wie Art, Lieferfirma, Datum der 1.Inbetriebnahme, zugehörige Stromlaufzeichnung, Bauschaltplan, Verwendungszweck usw. Das System hat den Vorteil, daß alle festen Daten nur einmal mit entsprechender Genauigkeit erfaßt werden müssen. Viele Daten (z.B. 1.Inbetriebnahme) wären den BetrKr auch nicht bekannt. Es muß aber erwähnt werden, daß die Pflege der Bestandsdatei viel Aufwand erfordert, was jedoch dadurch aufgewogen wird, daß künftig diese Bestandsdatei auch für andere Bereiche (Entwicklung, Planung, Inventur usw.) benötigt wird. 6.3.
Erfassen
der
Daten
in
Betriebsstellen
den
Für das Erfassen der Daten in den Betriebsstellen hat es sich als günstigste Lösung erwiesen, wenn die Az für die Arbeitsaufträge auch als Datenerfassungsbelege fungieren. Das gelingt leider nicht in jedem Fall. So müssen die umfangreichen Daten über Abw aus dem Arbeitsablauf Entstören vom EPlauf Markiererhebungsblätter übertragen werden. Andererseits hat das Markiererhebungsblatt den Vorteil, daß im Rechenzentrum die Lochkaten maschinell gefertigt werden können. Für das Erfassen der numerischen Daten werden Lochbelege verwendet, weil sie für die Betriebsstellen einfacher zu bearbeiten sind. Der Datenfluß zum Rechenzentrum des FTZ unter Verwendung der Markiererhebungsblätter und der Lochbelege ist recht umfangreich und muß später dezentralisiert werden. 6.4.
EDV-Ergebnisse
Unterhaltung
der
aus
der
FeVSt
Die EDV-Ergebnisse dienen einerseits der Lenkung der unmittelbaren und der mittelbaren Unterhaltungsarbeiten, während andererseits statistische Ergebnisse als Entscheidungsgrundlagen für künftige Maßnahmen gewonnen werden. Der Ermittlung von Orientierungszahlen kommt eine große Bedeutung zu; erst dann können Kennwerte des Unterhaltens von FeVSt mit annähernd gleichen Merk-
136
Unterhaltung
Vermittlungstechnik
malen verglichen werden. Regelergebnisse werden den Dienststellen nach vorgegebenen Fristen geliefert. Folgeergebnisse werden erstellt, wenn ein ermittelter Kennwert von der Orientierungszahl abweicht. Das Folgeergebnis liefert dann detailliertere Ergebnisse als das Regelergebnis, damit ohne Schwierigkeiten betriebliche Folgerungen festgelegt werden können. Ferner können Bedarfsergebnisse unter bestimmten Voraussetzungen abgefordert werden. Hierzu sind in den meisten Fällen Programmierarbeiten erforderlich, 7. Zusammenfassung
und
Ausblick
Mit zunehmendem Ausbau des Fernsprechnetzes gewinnt die Unterhaltung der technischen Einrichtungen allgemein immer mehr an Bedeutung. Wirtschaftliche Gesichtspunkte stehen im Vordergrund. Es gilt, das Optimum zwischen Unterhaltungsaufwand einerseits und geforderter Dienstgüte andererseits zu finden. Hierzu wurde ein Unterhaltsverfahren mit entsprechender Zielsetzung aufgezeichnet: bedingte korrektive Arbeitsweise mit zentraler Lenkung durch EDV-Unterstützung. Die Unterhaltung des in wenigen Jahren einzuführenden elektronischen Wählsystems (EWS) wird betrieblich neuartige Probleme bringen, die es vorrangig zu lösen gilt.
137
Fachbeiträge
Die Fernsprechentstörungsstelle als Partner anderer Dienststellen Bearbeiter:
Werner
Simon
1. Einleitung und Überblick Der außerordentlich große Umfang gleichartiger Arbeiten in einem Fernmeldeamt hat die Möglichkeit eröffnet, die Arbeitsabläufe in eine Vielzahl einzelner Abschnitte zu zerlegen und ihre Erledigung spezialisierten Arbeitsplätzen zu übertragen. Darüber hinaus können vielfach gleiche oder ähnliche Arbeitsabschnitte, die bei der Erledigung unterschiedlicher Aufgaben anfallen, an gemeinsamen. spezialisierten Arbeitsplätzen zusammengefaßt werden. Die Verteilung der abschnittsweisen Aufgabenerledigung auf sehr verschiedenartige Arbeitsplätze hat die bekannten verzweigten Arbeitsplatzund Dienststellenstrukturen (Aufbauorganisation) als Gegenstück. Wegen der verteilten
Erledigung
einzelner Aufgaben
auf mehrere
Arbeitsplätze
verschiedener Dienststellen kommt aus der -Sicht einer wirtschaftlichen und zielgerechten Aufgabenerledigung dem reibungslosen Verknüpfen der verschiedenen Arbeitsplätze gesteigerte Bedeutung zu. Ein besonders markantes Beispiel für die Vielfalt der an einer Aufgabenerledigung beteiligten Dienststellen ist die Einrichtung, Änderung bzw. Aufhebung von Fernsprechhauptanschlüssen. Bild1 gibt einen Überblick über die Verknüpfung der beteiligten Arbeitsplätze und Dienststellen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind in Bildi seltene Verknüpfung und Beteiligung weggelassen worden. Neben dem aus dem weiten Bereich der Teilnehmerdienste herausgegriffenen Beispiel lassen sich beim Planen und Bauen sowie bei der Unterhaltung noch eine Vielzahl ähnlich übergreifende Arbeitsabläufe nennen. Diese vielfältigen Verknüpfungen verschiedener Dienststellen zwingen dazu, bei allen dienststelleninternen Maßnahmen die
158
HBA 2!
Gel
HBA2 ablegen u Bild1.
ch richtigen
Übersicht über das Einrichten, Ändern von Fernsprechhauptanschlüssen
J und
Aufheben
ZUNIOISYJU3TWJIIdSUIaJ
HBA2
Fachbeiträge
Auswirkung bei den Partnerdienststellen zu berücksichtigen. Eine Berücksichtigung setzt jedoch einen Einblick in das Wie und Warum des Ablaufs in der Partnerdienststelle voraus. 2.
Von
in
21.
anderen
Dienststellen
ausgelöste
Fernsprechentstörungsstellen
Abläufe
Übersicht
In Fernsprechentstörungsstellen lassen sich wichtiger Arbeitsabläufe zusammenfassen: —
—
2
Gruppen
die Arbeitsabläufe, bei denen die Fernsprechentstörungsstelle unmittelbar Kundenwünsche befriedigt; es handelt sich hierbei um das Bearbeiten von Störungsmeldungen, das Bearbeiten von Prüfverlangen und das
Überprüfen und Überholen von Nebenstellenanlagen, Münzfernsprechern und Wählsterneinrichtungen, sowie
die Arbeitsabläufe, deren Schwergewicht in der Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen liegt, d.h. Abläufe, an deren Erfüllung die Fernsprechentstörungsstelle nur in begrenztem Umfang beteiligt ist; Arbeitsabläufe dieser Art werden im allgemeinen von anderen Dienststellen ausgelöst. Bei den letztgenannten Abläufen handelt es sich im wesentlichen um das Bearbeiten von Hauptanschlußbauaufträgen, das Bearbeiten von Nebenstellenbauaufträgen und das Ausführen von Betriebsschaltungen. Unter Betriebsschaltungen ist in diesem Sinne das Ausführen und Aufheben von Fernsprechauftragsdienst(FeAD)-Schaltungen, Gebüh-ren- und Wunschsperren zu verstehen.
22.
Bearbeiten von HauptanschlußBauaufträgen (HBA)
In Bild1 ist der Gesamtüberblick über die Verknüpfung der an der Einrichtung, Änderung und Aufhebung beteiligten Dienststellen gezeigt. Bemerkenswert hierbei ist es, daß die verschiedenen Dienststellen in den einzelnen Zweigen zum Teil mehrfach auftreten und daß verschie-
140
Fernsprechentstörung
dene, im allgemeinen nicht dargestellte ereignisbedingte Verknüpfungen vorhanden sind. Um die beim Bearbeiten von Bauaufträgen zu beachtenden Probleme der Dienststelle (DSt) Fernsprechentstörung (FeE) erkennen zu können, muß der Ablauf allein aus der Sicht der DSt FeE mit allen wesentlichen Verknüpfungen betrachtet werden. Bild 2a bis 2g geben darüber einen Überblick. In der Darstellung in Bild 2a bis 2g sind neben dem Bauauftrag auch die wichtigsten damit zusammenhängenden weiteren Unterlagen wie z.B. der Anschlußkabel (Ask)Schaltauftrag enthalten. Da eine umfassende Darstellung aller Einzelheiten des betrachteten Ablaufs den Rahmen eines Überblicks sprengen würde, sind in Bild2a bis 2g seltene Vorkommensfälle (Vorausbauauftrag, Umwandlung, Bauauftrag über Münzfernsprecher) weggelassen worden. Der Ablauf in Bild2a bis 2g beschreibt die Abwicklung der Arbeiten in der Fernsprechentstörungsstelle ausreichend. Ergänzend dazu sollen daher nur die Zielsetzungen dieser Arbeiten und einige organisatorische Probleme angemerkt werden. Folgende Ziele und organisatorische Gegebenheiten sind für die beschriebene Beteiligung der Fernsprechentstörungsstelle am Bearbeiten von Bauaufträgen von Bedeutung: —
Die sichere Funktionsfähigkeit neu geänderter Fernsprechanschlüsse.
—
Die Zuständigkeit der DSt FeE für den Hauptverteiler und somit für die Herstellung bzw. den Abbruch von Schaltverbindungen beim Einrichten, Ändern von Rufnummern und Aufheben sowie für Hinweisschaltungen. Die Zuständigkeit für das Unterhalten der Teilnehmereinrichtungen und somit auch für das Führen der dafür erforderlichen Bestandsunterlagen, der Störungskartei FeE,.
—
eingerichteter
oder
Bei der dargestellten Ablauforganisation ergibt sich als besonderes Problem, daß wegen des Umfangs der Arbeiten praktisch alle Arbeitsträger Platzgruppen sind. Die Verteilung der Arbeit zwischen den einzelnen Arbeitsplätzen innerhalb einer Platzgruppe erfolgt nach dem Grundsatz
141
Fachbeiträge
nein/
HB4 noch beizufügen?, ja /D
BA 4 den ande: Unferiggen gleicher f-N,
lorafm
IHBRA 5! Fr T
fra ein nen
F
Verke verteilen
/ HBASnoc) OU in an? J
Q
nehmen,
rr11134 RA 5S|
Ü
fetSt, AbrYPi_ 110 HBA 5 den anderen Interlagen gleicher rur-
zuorane
nach Bild 2b Bild2a.
Bearbeiten
‚nach Bild 2d von
HBA,
Eingang
bei
der
FeESt
\
142
Fernsprechentstörung
1) Nur soweit in HBA-Unterlagen vorhanden
D nach Bild 2c %
Bild2b.
Bearbeiten
von
HBA,
Abnahme
143
‘Fachbeiträge
von Bild 2b u.2e
==
3 Monate
eESt,_KPI Anderung des Hinweis-
fextes_veranlasse
EV besetzt”
FeESt_KPI
29]
BEST, KP
Auftrag zur Umschaltung erteilen
Auftragszettel ausfertigen
Po 3h
K BAlu. HBA3 obzeichn
ggf. StöK ablegen
von Bild
haltausführung
2eu2r (HBA1]
6 FR
datum
BINSO
130
TS
_
zetfel
prüfen
PER Schaltung richtig"
(Re|
n. Allg Ausfü
EPI: Entstörer-
nach Bild 2g
eESt, KPI
Fe
-
geordn. ablegen
inweisünderg. forderlich nein ==r 6 Monate HBA 3 vernichten
Bild 2c.
Bearbeiten
von
HBA,
Blatt
1/Blatt 3-Kontrolle *
144
31
von Bild 2a
P
Teilnehmer unterrichten
Am unterrichten 'BA-Unterlagen in Terminablage einsort.
FeESt,
|-
[34]
Teiln. fragen, ob Aufhe bungstermin unveränd.
Anruf) w„ren/
Teilnehmer Pla ai
ich
Antwort
Termin unver-"_rein a
fecot,
äF
Unterl
wieder i Terminabl.
ermerk auf HBA, FBA-
|
neuem Termin wieder
einsortieren
3]
Termin
feitKPI 1361 HBA-Unterlagen d. Terminablage
Rufnunmermänderug
entnehmen
—
Übernahme
Aufhebung
we?
Ten ER
befragt
FeestK PD Ei
IH
U
(F)
nach Bild 2f 137]
ragen.bAuffe unveründ. Anruf
Ten
Teilnehmer
meldet
sich
E nach Bild 2e
Bild 2d.
Bearbeiten von HBA, Aufhebung, beim Teilnehmer
Rückfrage
145
Fachbeiträge
von Bild 2d
Dmensänderg nen
|
>"
ja
Feet KF__ KO] Ausführungsauftrag erteilen
VeEst,KPı Auftragszettel FeE ausfertige cette
einsatz
| |
KP StöK ändern, HBA3 inzen
|
G nach Bild 2e
_
zettel feE
7
FeESt, KPI 43] StöK berichtigen, er\gänzen, HBA 3 und HBA 4 ergänzen, HBA 3 in Ablage HBA/HBA 3-Kontroll
nach Bild 2c
Bild 2e.
146
Bearbeiten
von
HBA,
Aufhebung,
Abschalten
Fernsprechentstörung
BESE, KPI
47
Die 148 ühlerstandablesung u. ‚ggf. Sperre /FeAD -Aufhebung veranlassen
SföK berichtigen,
HBA3 u. HBA4 ergän(&
Bild 2f.
Bearbeiten
von
HBA,
Übernahme
147
Fachbeiträge
LAskTl t-Schaltkraft 0.5
Tauswerten (Art des Auftrages)
_|50)
Einrichtung Jet iq AYH-schaltkraft
0
ählerstand ablesen
153
= rs
von Bild Ze u. 2f
nach Blatt 1
FVESchaltkraft 058
von Bild 2c
einsortieren Unterlagen
auswerten
KSchalfkraftoS 191 Schaltung aufheben, HD anschaffen, Zähler ables.
nein
JL
(Re |
Auftr.v. EPL
a
[Rückruf
ung uU
|
sk 1 zu HBA-Unterlagen
Anruf
EPI FeE
k
HVk-Schaltkraft o.S_160 zue Ruf -Nr. schalten
Bild 2g.
148
Bearbeiten
von
HBA,
HVt-Arbeiten
= r
Fernsprechentstörung
der Mengenteilung. Diese Form der Arbeitsteilung läßt sich bei den Karteiplätzen relativ leicht durch die Zuordnung von Rufnummerngruppen zu den einzelnen Plätzen durchführen. Durch die für die Verteilung erforderlichen Arbeiten wird jedoch der gesamte Aufwand erhöht. Bei den Abnahmeprüfplätzen ergibt sich wegen des stark schwankenden Arbeitsangebots bei kleinen Gruppen die Möglichkeit einer festen Mengenverteilung nicht. Hier muß die Verteilung von Fall zu Fall von einem Spezialplatz (Abnahmeverteilplatz) durchgeführt werden. Eine weitere Schwierigkeit liegt in der sachgerechten Ausführung der Hinweisschaltung. Hier müssen unter Berücksichtigung der verschiedenen Bauauftragsvarianten die nach der Anschlußtechnik unterschiedlichen Formen der Schaltausführung berücksichtigt werden. Die nur begrenzte Belastungsfähigkeit der Hinweisübertragung bringt zusätzliche Probleme. 23.
Bearbeiten von Bauaufträgen postund teilnehmereigene Nebenstellenanlagen (NBA)
über
NBA stellen eine Sonderform der Bauaufträge dar, die neben den HBA (s. Abschnitt 2.2) für Arbeiten an postund teilnehmereigenen Nebenstellenanlagen benutzt werden. Das Bearbeiten der NBA ist in Bild3a bis 3c dargestellt.
Aus Gründen
der Übersichtlichkeit wurde in den Bildern
3a bis 3c auf die Darstellung der verschiedenen Verknüpfungsmöglichkeiten zwischen HBA und NBA (HBA allein, HBA und NBA, NBA allein) verzichtet. In der praktischen Arbeitsabwicklung ergibt sich keine besondere Problematik durch die Verknüpfung, da beim Vorliegen von HBA und NBA entweder die jeweiligen Blätter gemeinsam von den Ursprungsstellen eingehen oder in den Ablagen durch das Suchkriterium Rufnummer jederzeit gemeinsam abgelegt bzw. aufgefunden werden können. Für das Bearbeiten von NBA in FeESt gelten die in Abschnitt 2.2 für HBA genannten Ziele und organisatorisczen Probleme in grundsätzlich gleicher Weise. Darüber
149
Umwandl.NAs Verleg. NAs
Teit- /Aufhebung Einrichtung Erweiterung
nach Bild3c
a
feEStKPI 12] NBA 3 vernichten n.Bild 3b
nein / UK mittl. o. große
eE St, Außenaufs. N
4 FeESt, KPI NBA3 u.ggf. n.Ruf-Nr. geordnet ablegen _
19|
UK aussondern bzw. bei
Teilaufheb. berichtii
[Zufeilplan berichtigen NBA4
FeEStN fassen u.0
0
Kenntnis nehmen , NBA 4 vernichten
Unterlagen zusarmmen- | erten
feEStKPI16 KPI anderer FeESt LIKE
er!
Anruf 'e
Avt besetzp
e
Fe&St_KPI
[6a
Auftrag zur Ausführ. d. ‘halfarbeiten
erteile
eESt, KPI
Bild 3a.
150
Bearbeiten
8)
Unterlagen weiterleiten
Anrufl
von
NBA,
Vorarbeiten
von Bild 3a
7] M
|
FeESt befeilig ja
ecSt AbnPrPi__|
Fe
Abnahme_ablehnen
Interlagen nach Ruf-Nr. geordnet ablegen.
| Einrichtung, Erweiterung Umwandlung, Verlegung NmZ2.
NBA 3 in Terminablage Era
VETEN!
r
6 Monate
FeESt, KPI NBA3
vernichte VD
Bild 3b.
Bearbeiten
von NBA,
Abnahme
151
Fachbeiträge
von Bild 3a
C
über NSt Anl. UK
fallweise)mit d.
U
Bild3
152
c. Bearbeiten
von
NBA,
Blatt
Fernsprechentstörung hinaus müssen jedoch bei NBA die durch die besonderen Formen der Unterhaltung von Nebenstellenanlagen sich ergebenden Gesichtspunkte berücksichtigt werden. Es sind dies: — — —
24.
die individuelle Zuordnung der Nebenstellenanlage zu dem Nebenstellenentstörer und das Führen des Unterhaltungsplanes für Nebenstellenanlagen durch die Außenaufsicht. das Führen erweiterter Bestands- und Unterhaltungsunterlagen. Bearbeiten
von
Betriebsschaltungen
Unter Betriebsschaltungen werden die Maßnahmen verstanden, die zum Ausführen oder Aufheben von Sperren oder FeAD-Schaltungen führen. Im allgemeinen werden Sperren aus technischen Gründen (z.B. bei Störungen) nicht wie die sonstigen Betriebsschaltungen bearbeitet; sie sind daher im folgenden nicht betrachtet. Der Arbeitsablauf für das Bearbeiten von Betriebsschaltungen in Fernsprechentstörungsstellen ist in Bild4a und 4b dargestellt. Bei der Ausführung von Betriebsschaltungen ist die Fernsprechentstörungsstelle beteiligt, weil sie zum Bearbeiten von Störungsmeldungen und Prüfverlangen stets aktuelle Unterlagen über die zur Zeit bestehenden Betriebsschaltungen benötigt. Ferner sind bei der Fernsprechentstörungsstelle die für die Ausführung und Aufhebung von Betriebsschaltungen wichtigen Unterlagen über die technischen und organisatorischen Einzelheiten in den Vermittlungsstellen vorhanden. Die Innendienstkräfte der Fernsprechentstörungsstelle sind daher ohne Zuhilfenahme anderweitiger Unterlagen in der Lage, die Ausführung der Arbeiten je nach Art der Technik (Wählsystem, Art der Beschaltungseinheit (BE)) im Wählerraum bzw. im Hauptverteiler (HVt) durch Unterhaltungsoder Bedienungskräfte oder durch Entstörer anzuordnen. Die als organisatorischer Umweg erscheinende Beteiligung der Fernsprechentstörungsstelle an der Ausführung von Betriebsschaltungen ist daher eine optimale, d.h. Aufwand sparende Form der Aufgabenerledigung.
153
Fachbeiträge
trSchPi 3 Auftragszettel FeE ausfertigen
Sperrausführung nach LIZA
nein 7 TIyf besel 2
sofortige
Ausführ
io
Q
Betr SchP! 4 Auftragszettel FeE in Terminablage einsort. Termin
Betr Sch Pl
siehe oben
(@)
StoK dem Auftrags zettel FeE beifügen
5]
Betr SchPI 6] Auftrag erteilen, Auftragszettel fe£ ergänzen
Hvt
Schaltarbeiten
aus-
12
führen und prüfen
J
von Bild 4b
Berk PD
19
StöK wieder einsort.
Bild
154
4a.
Bearbeiten
von
Betriebsschaltungen:
Einzelschaltung
Fernsprechentstörung
Re
von Bild 4a
N 1 LIZA in ‚Terminablage i
A Sch_PI u u sperrende FeAs in LIZA kennzeichnen Sperrauftrag_erteilen Anruf Pl
StöK dem Karteitrog
1
entnehmen; StöK und LIZA ergänzen; LIZA ablegen
u
Zu sperrende FeAs in LIZA Ichnen Sperre ausführen und üfen LIZA weglegen U
nach Bild 4a 1) Bei unbesetzten HVf sucht der zuständige Entstörer am Sperrtag (Terminüberwachung durch Entstörer) den HVt auf und ruft den Befr SchPi an. Bild 4b.
Bearbeiten
von
Betriebsschaltungen:
LIZA
155
Fachbeiträge 3.
Von der Fernsprechentstörungsstelle Dienststellen ausgelöste Arbeiten
bei
anderen
Von den unmittelbaren Aufgaben der Fernsprechentstörungsstelle ist es das Instandsetzen, das die meisten Arbeitsabläufe bei anderen Dienststellen auslöst. Es handelt sich hierbei überwiegend um solche Arbeiten, die im Rahmen des Instandsetzens in den Zuständigkeitsbereich anderer Dienststellen fallen. Hierbei sind 2 Verfahrensschemata zu beachten: —
Der fernmündliche Anstoß bei der anderen DSt, wie er beim Bearbeiten von Kabelfehlern oder von Fehlern in Fernsprechvermittlungsstellen üblich ist und der schriftliche Anstoß durch den Instandsetzungsauf-
—
trag
FeE.
Instandsetzungsaufträge FeE werden zum Auslösen von Folgearbeiten bei den DSt Hochbautechnische Stelle (H) und Maschinentechnische Stelle (M) (für Fernsprechhäuschen und Fernsprechzellen),, Fernmeldebaubezirk (FBBz) (z.B. für Innenleitungen von Sprechstellen), Fernmeldestromversorgung
und
4.
für das Lager
(Sv)
benutzt.
(für
Stromversorgungsanlagen)
Schlußbetrachtung
Bei den geschilderten Abläufen handelt es sich zum Teil um Sollvorstellungen, zum Teil sind die im allgemeinen üblichen Verfahrensweisen beschrieben. Anders als bei technischen Gegebenheiten werden organisatorische Gegebenheiten im Einzelfall häufig leicht abgewandelt. Für weiterführende Überlegungen können daher nur jeweils die grundlegenden Organisationsstrukturen der im vorstehenden Text beschriebenen Abläufe zugrunde gelegt werden. Für Einzelfragen muß in jedem Fall der IstAblauf ermittelt werden.
156
Fernsprechentstörung AbnPrPil AbnVP1l Am ASK BetrAkPI BetrSchPil
Abnahmeprüfplatz Abnahmeverteilplatz Anmeldestelle für Fernmeldeeinrichtungen Anschlußkabel Betriebsauskunftsplatz FeE Betriebsschaltungsplatz FeE Fernsprechbuchstelle Fernsprechbuchverlagsstelle Einsatzplatz Fernmeldebaubezirk Fernsprechanschluß Fernsprechauftragsdien st Fernsprechentstörung Fernsprechentstörungsstelle Bauauftrag für Fernsprechhauptanschlüsse Hinweisdienst Hauptverteiler Karteiplatz Liste der Zahlungsrückstände Längenzettel Nebenstelle Nebenanschluß Bauauftrag für post- und teilnehmereigene Nebenstellenanlagen Ortsverbindungskabel Fernmelderechnungsstelle Sprechstellenentstörer Störungskarte FeE Störungsunterlagen Störungszettel Unterhalten von Fernsprechvermittlungsstellen Unterhaltungskarte Erläuterungen
zu
den
Bildern
1 bis 4b
157
Fachbeiträge
Fernsprechnetzgestaltung unter Berücksichtigung des Dämpfungsplans 55 (dB) Bearbeiter:
Gerd
Jeromin
1. Einleitung Damit zwischen zwei beliebigen Anschlüssen im Fernsprechnetz der Deutschen Bundespost (DBP) eine. gleichmäßig gute Sprechverständigung erreicht wird, müssen bestimmte übertragungstechnische Forderungen erfüllt sein. Die Übertragungsgüte kann durch verschiedene Einflüsse wie z.B. durch Nebensprechen Geräusche lineare Verzerrungen Laufzeitverzerrungen zu geringe Übertragungsbandbreite zu hohe Dämpfung beeinträchtigt
und
werden.
Aus diesem Grunde muß auf die richtige Gestaltung des Fernsprechnetzes ein besonderer Wert gelegt werden, um die übertragungstechnischen Forderungen gemäß den Empfehlungen des CCITT mit einem wirtschaftlich vertretbaren Aufwand realisieren zu können. Die eine ausreichende Sprechverständigung garantierenden Parameter sind im Dämpfungsplan 55 (dB) zusammengefaßt; er gewährleistet, daß das gesamte Fernsprechnetz zweckmäßig und nach einheitlichen Gesichtspunkten geplant und ausgebaut wird. Der Dämpfungsplan enthält im wesentlichen Dämpfungsund Pegelwerte für die Vierdrahtleitungskette, für Querleitungen und für die Zweidraht-Endleitungskette.
158
Fernsprechnetze
2. Die
Vierdrahtleitungskette
Die an einer Verbindung über den Kennzahlweg beteiligten vierdrähtig geführten Leitungsabschnitte bilden die sog. 4Dr-Leitungskette. Definitionsgemäß kette: — —
beginnt
und
endet
die
4Dr-Leitungs-
am 4Dr-Wähler, wenn dieser mit seinem Ein- oder Ausgang fest mit der Gabel zusammengeschaltet ist und am 2Dr-Wähler, wenn die 4Dr-Leitung ohne Zwischenschaltung eines 4Dr-Wählers in derselben VSt fest mit der Gabel verbunden ist.
----/ nn
/
\/L
|
2Dr| “Dr| ZDr-Endleitungsketfe — Endleitungskeffe Leitungskelfe Bild1.
Die
Schnittstelle zwischen 4Dr-Leitungskette Endleitungskette am 4Dr-Wähler
ZDrEndleitungskette Bild
2.
Die
4 Dr-Leitungsketfe
Schnittstelle
zwischen
Endleitungskette
am
— [_
und
2Dr-
ZDr-
Endleitungskefte
4Dr-Leitungskette
2Dr-Wähler
und
2DrT-
Im Fernsprechnetz der DBP beginnt und endet die 4DrLeitungskette in der Regel in der Knotenvermittlungsstelle; nur in wenigen Ausnahmefällen reicht die 2Dr-
159
Fachbeiträge, Endleitungskette
bis zur Hauptvermittlungsstelle
oder
die
4Dr-Leitungskette bis zur Endvermittlungsstelle oder Gruppenvermittlungstelle. Damit für die meist ohne Verstärker versehenen 2DrEndleitungsketten ein großer Dämpfungsbetrag verbleibt, soll die grundsätzlich Verstärker enthaltende 4Dr-Leitungskette einen möglichst geringen Dämpfungswert aufweisen. Eine beliebige Verstärkungserhöhung in der 4Dr-Leitungskette ist jedoch aus Stabilitätsgründen nicht möglich. 4DrLeitungen, die beidseitig an 4Dr-Wählern enden, werden nach dem Dämpfungsplan 55 (dB) mit OdB Restdämpfung betrieben.
-4aB
-17dB
+9dB
-4dB
-17d8 KU
VId
Fean
Fzab
VIE
vIF
Fi 2ab
-YdB |
Vld
VId
.
Vif
VA
+9aB
5:25 ar 0
—— ———
-17dB
_
-4dB +9dB 11,26 B—|
Bild 3. Beispiel für die Schaltung von Leitungen Leitungskette bei Verwendung von Kanalumsetzern weise 52 und Bw7
der der
4DrBau-
Die bei dieser Leitungsführung nicht ausnutzbare Verstärkung des Übertragungssystems muß durch geeignete Dämpfungsglieder, sog. Verlängerungsleitungen (Vlf und Vld) kompensiert werden. Die Kanalverstärkung, die sich aus der Pegeldifferenz zwischen den Aus- und Eingangsklemmen
(F2
ab
und
F2
an)
des
Kanalumsetzers
errechnen
läßt, beträgt 26 dB; bei neuen Übertragungseinrichtungen der Bauweise 7R 18dB. Die in Stufen einstellbare VIl£f bietet die Möglichkeit, die Dämpfung der Verbindungskabel zwischen den Übertra-
160
Fernsprechnetze
+4dB
-HdB
-MaB
KU
KU
vif
-4dB
-MdB
.
Vld
Vd
Vif
-4dB
| 4.=18d8
+4aB
.
Bild 4: Beispiel für die Schaltung Leitungskette bei Verwendung von weise 7R
von Leitungen Kanalumsetzern
der der
4DrBau-
gungs- und Vermittlungseinrichtungen auszugleichen. Ein Dämpfungsausgleich zwischen den einzelnen Fernwahlstufen innerhalb einer Zentralvermittlungsstelle (ZVSt) oder Hauptvermittlungsstelle (HVSt) ist mit der VI£ nicht möglich, da hierbei eine Veränderung des Durchschaltepegels auftreten würde. Ist die Dämpfung zwischen den Fernwahlstufen der gleichen Fernvermittlungsstelle (FernVSt) größer als 0,5dB — diesen Dämpfungswert erhält man oft, wenn infolge Raummangels eine örtliche Trennung der Fernvermittlungsstellen notwendig wird — so müssen besondere Maßnahmen zur Entdämpfung der Verbindungsleitungen getroffen werden. Zur Verfügung stehen Gabelverstärker (in 4Dr/4DrSchaltung) oder Puls-Code-Modulation (PCM)-Übertragungssysteme. Maßgebend für die Wahl sind die technischen Voraussetzungen und die Wirtschaftlichkeit. TFÜbertragungssysteme dürfen wegen des zu berücksichtigenden Schwankungsbetrages nicht eingesetzt werden. Wird der Gabelverstärker benutzt, so kann ggf. auf den Einsatz von Wechselstromübertragungen verzichtet werden, wenn auf dem Übertragungsweg keine Starkstrombeeinflussung auftritt; es ist jedoch zu berücksichtigen, daß Bß Fernmelde-Praxis
161
Fachbeiträge
KVSTkH Bild5:
Beispiel
für
eine
EVSTen; aus der HVStH KVSt,
ausgelagerte
zweite
je 4Dr-Leitung 7 Einzeladern geschaltet werden müssen, von denen die Signaladern ohne Verstärker bleiben. Eine Aufteilung großer FernVSt ist trotz der übertragungstechnischen Probleme zur Einhaltung der Forderungen für die 4Dr-Leitungskette von großem übertragungstechnischen Vorteil für die 2Dr-Endleitungskette. Da der Gabelpunkt näher zum Teilnehmer hin verschoben wird, kann die 2Dr-Endleitungskette mit geringeren Leiterquerschnitten ausgebaut werden. Besondere übertragungstechnische Anforderungen sind zu erfüllen, wenn die Verstärkerstelle und die 4Dr-Fernvermittlungsstelle nicht in einem gemeinsamen Gebäude untergebracht sind, sondern örtlich getrennt und durch Fernverbindungskabel oder Fernanschlußkabel miteinander verbunden sind.
162
Fernsprechnetze Im beschriebenen Fall ist nicht nur der Wert der Restdämpfung des NF-Ausläufers der 4Dr-Leitung von Bedeutung, sondern auch der frequenzabhängige Verlauf dieser * Restdämpfung. Damit der zulässige Wert der Restdämpfungsverzerrung von 0,25 dB nicht überschritten wird, muß die Grenzlänge für die zu verwendenden NF-Fernverbindungskabel (NFFVk) von Fall zu Fall ermittelt werden. Man unterscheidet dabei: —
geringe Längen: Hierunter sind Entfernungen, die mit unbespulten Stromkreisen ohne besondere Entzerrungsmaßnahmen überbrückt werden können, zu verstehen.
—
mittlere Längen: Man versteht darunter Entfernungen, die mit unbespulten Stromkreisen überbrückt werden können, jedoch besondere Entzerrungsmaßnahmen erfordern.
—
große Längen: Man versteht darunter Entfernungen, die mit bespulten Stromkreisen überbrückt werden müssen.
Der zulässige Wert der Restdämpfungsverzerrung von 0,25 dB wird bei Verwendung unbespulter Stromkeise — unabhängig vom Leiterdurchmesser — bei einer Länge von etwa 1km erreicht. Da zwischen den Stromkreisen (Hin- und Rückrichtung) einer 4Dr-Leitung — gemessen in der Verstärkerstelle — eine Pegeldifferenz von 26 dB bzw. bei neuen Verstärkereinrichtungen von 18 dB wirksam ist, würde unerwünschtes Nebensprechen auftreten, wenn nicht durch eine geeignete Beschaltung der Kabel (Lagentrennung, Trennviererseile usw.) diese Beeinflussung verhindert würde. Das Einschalten von NF-Leitungsübertrager (NFlÜ) in die für die Sprachübertragung verwendeten Stromkreise ist aus übertragungstechnischen Gründen, z.B. zur Anpassung oder Symmetrierung nicht notwendig. Sollten die durch Starkstrombeeinflussung hervorgerufenen Fremd6*
183
Fachbeiträge spannungen den zulässigen Grenzwert überschreiten, so wären Reduktionsmaßnahmen zu treffen, etwa das Verlegen von Kabeln mit geringerem Reduktionsfaktor oder der Einsatz von aktiven Reduktionsschutzeinrichtungen. Um eine bei mittleren Längen, d.h. Längen zwischen lkm und 3km, wirtschaftlich nicht vertretbare Adernbespulung zu vermeiden, muß der Frequenzgang der unbespulten Stromkreise linearisiert werden. Dies erreicht man durch das Herstellen sog. „Entzerrender Verlängerungsleitungen“, indem man zu den im a- und b-Zweig liegenden Längswiderständen der VIf je einen zusätzlichen Kondensator parallelschaltet. Sind die Entfernungen zwischen Verstärkerstelle und Fernvermittlungsstelle größer als 3km, so müssen die für die Sprachübertragung verwendeten Stromkreise bespult
werden.
Da
bespulte
Stromkreise
einen
von
600 Ohm
ab-
weichenden Wellenwiderstand aufweisen, sind zur Widerstandsanpassung an beiden Enden des Stromkreises NFIÜ einzuschalten. Die zur Übertragung von Steuerzeichen zu verwendenden Signalstromkreise brauchen jedoch nicht bespult und deshalb auch nicht durch Übertrager galvanisch abgeriegelt zu werden. Da der Frequenzgang der heute verwendeten g-bespulten Stromkreise für den Frequenzbereich 300 — 3400 Hz nahezu linear ist, hängt hier die Reichweite nicht von der Restdämpfungsverzerrung sondern vom Gleichstromwiderstand des Signalstromkreises ab. Zur sicheren Signalübertragung darf der Gleichstromwiderstand der Einzelader den Wert von 400 Ohm nicht überschreiten. Aufgrund dieser Forderung darf die Reichweite maximal betragen: Für
Kabel
mit
0,6mm
Leiterdurchmesser
6,8km
für
Kabel
mit
0,8mm
Leiterdurchmesser
11,9 km
für
Kabel
mit
0,9 mm
Leiterdurchmesser
15,3 km.
Die vorstehenden Grenzlängen wurden so festgelegt, daß grundsätzlich volle Spulenfelder mit einer Spulenfeldlänge von s = 1700 m entstehen.
164
Fernsprechnetze 3. Die Schnittstelle zwischen der 2Dr-Endleitungskette
der
4Dr-Leitungskette
und
Nach dem Dämpfungsplan 55 (dB) kennt man zwei unterschiedliche Schnittstellen zwischen der 4Dr-Leitungskette und der 2Dr-Endleitungskette (Definition siehe Abschnitt 2). Die unterschiedlichen Schnittstellen sind bedingt durch die beiden möglichen Arten der Durchschaltung von der bzw. in die Endleitungskette. Wird die triebsarten
4Dr-Durchschaltung möglich: Betrieb Betrieb
angewandt,
so
sind
2 Be-
mit Entdämpfung und ohne Entdämpfung.
Welche der beiden Betriebsarten zur Anwendung kommt, hängt von der Gestaltung und der Dämpfung der Endleitungskette ab. Bei Betrieb mit Entdämpfung werden die in der TFÜbertragung befindlichen Vld durch ein K-Relais unwirksam geschaltet. Um den beim Ausschalten der Vld in der 4Dr-Leitungskette erhaltenen Betrag der Verstärkungserhöhung (Entdämpfung) kann zusätzlich der Dämpfungswert für die Endleitungskette erhöht werden.
ZIG 2/4Dr
TFUe-g 4Dr
K KLIOK
VIg
K
KU
K
KOAX
K Beispiel
VUe-g4Ddr
vIf Vld
Vid Vir
K Bild 6.
KU
’Fle-k4Or
K VIg
A für
eine 4Dr-Leitung Entdämpfung
bei
Betrieb
K mit
165
Fachbeiträge Mit ausgeschalteter Vld weist die negativen Restdämpfungswert auf.
4Dr-Leitung
einen
Läßt die Endleitungskette keinen Betrieb mit Entdämpfung zu (z.B. fehlende Stabilisierungsstrecke), so kann in 4Dr-Vermittlungsstellen auch der Betrieb ohne Entdämpfung angewendet werden. Hierbei wird nach dem Zusammenschalten der 4Dr-Leitungskette mit der 2Dr-Endleitungskette das zum Betätigen des K-Relais notwendige Potential nicht angeboten, so daß die Vld mit ihrem Dämpfungswert von 2x 3,5 dB im Rückkopplungskreis wirksam bleibt.
ZIG 2/4Dr
Vig Bild 7.
Endet
TFVe-g 4Dr
Rh
KU
KU
VId VIf
Beispiel
die
Gale 4/2Dr
vr Mid.u!
vg
4Dr-Leitungskette
TFle-k4Dr
Vd
in
einer
so ist nur
u "H
KU Vld
durch-
ohne
TFUe-k 2Dr
----
Vi
KU
7 vIf
----
166
2drähtig
der Betrieb
TFUe-g4Dr
,
Bild 8.
)
für eine 4Dr-Leitung mit 4Dr-Durchschaltung und Betrieb ohne Entdämpfung
schaltenden Vermittlungsstelle, Entdämpfung möglich.
Vf
/FVe-k4Dr
’)—-
7
Beispiel für eine 4Dr-Leitung mit 2Dr-Durchschaltung im Zielbereich und Betrieb ohne Entdämpfung
Fernsprechnetze
Da die 4Dr-Leitung fest mit dem 2Dr-Wähler verbunden ist, kann auf die Verwendung zweier unterschiedlicher Verlängerungsleitungen Vld und VI£f verzichtet werden. Man setzt in die TF-Übertragung eine VIf ein, die um den Wert der Vld größer dimensioniert ist.
In offenen KVStgp
litätsbedingungen die 14 dB erhöht werden.
muß Vl£
zwecks Einhaltung der Stabi-
um
1dB,
also
von
13dB
auf
Wegen der geringen übertragungstechnischen Reichweite in der Endleitungskette ist die 2Dr-Durchschaltung für Leitungen des Kernnzahlweges unvorteilhaft. 4. Querleitungen Querleitungen werden zur Abwicklung hoher Verkehrsflüsse eingerichtet. Maßgebend für die Schaltung von Querleitungsbündeln ist eine vorhergegangene Verkehrsmessung. Querleitungen haben den Vorteil, daß sie stets mehrere Abschnitte des Kennzahlweges umgehen, so daß immer eine geringere Zahl von TF-Abschnitten an einer Fernsprechverbindung beteiligt sind.
Ausgangspunkt
für
Querleitungen
sind
die
Leitweg-
steuerstufen der Knoten- und Hauptvermittlungsstellen: die Knotenrichtungswähler (KRW) und die Hauptrichtungswähler (HRW). Im Zielbereich enden Querleitungen auf Gruppenwählern, hier können HGW, KGW, EGW, OGW oder II. GW — letztere jedoch nur in Ortsnetzen mit dreistelliger Ortsnetzkennzahl — angesteuert werden. Die vermittlungstechnischen Vorteile, z.B. Einsparung von Vermittlungseinrichtungen und Leitungen des Kennzahlweges und die übertragungstechnischen Vorteile, die im nachfolgenden noch näher erläutert werden, haben dazu geführt, daß heute etwa 80 %/ı des gesamten Fernsprechverkehrs über Querleitungen abgewickelt wird. es
Im Gegensatz zu den Leitungen des Kennzahlweges gibt bei Querleitungen eine Vielzahl von Schaltvarianten.
167
Fachbeiträge
&
Im nachstehenden
lichen
Arten
der
Bild9
ist eine Übersicht über die mög-
Querleitungen
gegeben.
NF-Fahrung
TF-(PCM)-Führung
| |
|
2Dr
mit
Verstärker
gemischt
4I
ome
Verstärker
mt
Verstärker
ohne"
Verstärker
Durchschaltung im Ausgangsbereich
Durchschaltung im Zielbereich
ZDr
2Dr
yor Bild 9. Arten
der
dor Querleitungen
TFQ1l mit 4Dr-Durchschaltung im Ausgangsbereich und 2Dr-Durchschaltung im Zielbereich können zusätzlich ohne oder mit verminderter Restdämpfung betrieben werden. Gehen von einer 4Dr-KVSt zweidrähtig geführte NFQI aus, so wird in dieser Ausgangs-KVSt die sog. Gegengabelschaltung wirksam. Bemerkenswert ist, daß bei dieser Zusammenschaltung nur eine geringfügige Zusatzdämpfung in Höhe von 1dB auftritt. Die in der ersten Gabel am Klemmenpaar 1 ankommende SprechleistungP wird zu gleichen Teilen aufgeteilt auf die Klemmenpaare 3 und 4; die Nachbildung am Klemmen-
paar2 bleibt 168
in dieser
Übertragungsrichtung
stromlos.
KV FZuRz.Ku
u
————
gg
Q, + 0
a ———
A _— — —
.
U End
mit
| s)}----------
h
rd 1
Bild 10 . 2Dr NFQl
691
...0W
Vig
79 dB
ag
4Dr-Durchschaltung
92 uwJ1IdsuIsd
SpVSt
SEI} 0qwed
01T
Im Normalfall bleibt Nachbildung stromlos, da im Nachbildstrormkreis zwei gleichgroße Spannungen (%) entgegengesetzt gerichtet sınd.
Bei a/b-Vertauschung
(dünm) steht die
die volle Sparırung an der Nachbildung 2, es fließt kein Strom im Leitungsstromkreis. Bild 11. Die
Gegengabelschaltung
Fernsprechnetze }
Werden die in der zweiten Gabel an den Klemmenpaaren 3‘und4‘ ankommenden Teilleistungen phasenrichtig vereinigt, so steht am Klemmenpaar !‘ theoretisch die volle Leistung wieder zur Verfügung. Da jedoch die Gabelübertrager verlustbehaftet sind (Eisen- und Kupferverluste), wird dieser theoretische Wert nicht erreicht. Die beiden Gabelübertrager, von denen jeder 0,5 dB Streuverluste aufweist, bewirken somit 1 dB Einfügungsdämpfung. Welche der zahlreichen Arten von Querleitungen geschaltet wird, hängt von der netztechnischen Lage des Zielbereichs zum Ausgangsbereich ab. Die größte Zahl von Ql muß aus diesem Grunde über TF-Systeme geführt werden. Zwischen benachbarten KVSt können jedoch auch NFQL, die gegebenenfalls mit Gabelverstärkern verstärkt werden, geschaltet werden. In neuerer Zeit nimmt die Zahl der zwischen KVSt und offener EVSt fremder KVSt zu schaltenden Ql zu. Da nur zwischen den KVSt TF-Einrichtungen zur Verfügung stehen, müssen diese @l aus einem TF-Abschnitt mit nachfolgendem NF-Abschnitt zusammengesetzt werden. (Die gleiche Schaltungsart wird auch für Ql auf II. GW in Zielortsnetzen mit 3stelliger Ortsnetzkennzahl angewandt.) Da an Verbindungen mit den vorgenannten Ql nur ein TFAbschnitt beteiligt ist — nur das Knotenregister 62 ist in
KRW
KU
KU
15 di —
— Bild 12,
ag Beispiel
Vf
te
Zielervst
VollV5t
I.GW
IZ GW..LW
—
15 ——
tr
Ay —e
lite,
für eine aus einem TFschnitt zusammengesetze
und Ql
einem
NF-Ab-
171
Fachbeiträge der Lage, 4 Kennziffern zu unterdrücken —, kann der TFmäßig geführte Abschnitt mit 1,5dB Restdämpfung betrieben werden. Für den NF-Abschnitt dieser gemischt geführten QL kann man keinen festen Dämpfungswert angeben, er muß individuell ermittelt werden. Gefordert wird jedoch, daß dieser NF-Ausläufer zusammen mit der nachfolgenden Endleitungskette den Dämpfungswert von 7,5dB nicht überschreitet. Querleitungen, die rein TF-mäßig geführt sind, beginnen größtenteils im Ausgangsbereich am 4Dr-Richtungswähler und enden an einem 4Dr- oder 2Dr-Wähler. Bei vierdrähtiger Durchschaltung an beiden Leitungsenden wird die Querleitung wie eine Leitung des Kennzahlweges behandelt und eingepegelt. Endet die Ql jedoch an einem 2Dr-Wähler, z.B. 2DrOGW, so kann diese Leitung mit verminderter Restdämpfung betrieben werden. Hierdurch erzielt man folgende Vorteile: Es können preiswerte und raumsparende 2DrWähler für den Einstieg der Querleitungen in den Zielbereich verwendet werden und es steht trotzdem noch ein Dämpfungsbetrag von 75dB für die Leitungen der 2DrEndleitungskette zur Verfügung. Wendet man für die Leitungen des Kennzahlweges den Betrieb mit Entdämpfung an, so können die weiterführenden Bündel im gleichen Kabel verlaufen, da für beide der gleiche Maximalwert für die Dämpfung der Endleitungskette gilt. Der einzustellende Restdämpfungsnennwert für Querleitungen mit verminderter Restdämpfung hängt von der Zahl der an einer Verbindung möglicherweise beteiligten TF-Abschnitte ab. Bei einem TF-Abschnitt muß 1,5 dB eingestellt werden, während für zwei und drei TF-Abschnitte aus Stabilitätsgründen 2dB eingestellt werden muß. Können mehr als drei TF-Abschnitte an einer Verbindung beteiligt sein, so ist keine Verminderung des Restdämpfungswertes von 3,5 dB möglich. Die Vorteile für die Endleitungskette können somit ebenfalls nicht in Anspruch genommen werden.
172
Spvst
KlStzykzurn KRW.
-----—
vg
Ku
--
Spvst
KU
id vor |\1 zrar I\| vr
OGW
dd ------ 2
=
elf
Bild 13.
L
Beispiel
für
agı =15dB
Ognd=9z=73dB
BD=19dB eine
Qi mit verminderter auf GW
Restdämpfung
>| 9Zz73uwJa1dsu1lad
I End
Fachbeiträge
5. Die
Zweidraht-Endleitungskette
Wie bereits aus den vorausgegangenen Abschnitten hervorgeht, werden schon in der Fernnetzebene vermittlungsund übertragungstechnische Maßnahmen getroffen, um günstigere Bedingungen für die Endleitungskette zu erhalten. Diese Aktionen sind größtenteils berechtigt, da die Durchführung linientechnischer Bauvorhaben (z.B. Verlegung von Kabeln mit großem Leiterdurchmesser) immer kostenaufwendiger wird. Die Ausdehnung der Ortsnetze und die damit verbundene Entstehung neuer Ortsvermittlungsstellen an der Peripherie der Städte führte dazu, daß der beim Betrieb ohne Entdämpfung verfügbare Dämpfungsbetrag für die Ortsverbindungskabel nicht mehr ausreicht. Hier bieten die Einführung des Betriebes mit Entdämpfung und die gleichzeitige Schaltung von Ql mit verminderter Restdämpfung eine wirtschaftlich vertretbare Abhilfe. |
Voraussetzung
jedoch
das
EVSt 00GW —/)
für
den
Vorhandensein
Grvst
Betrieb
mit
Entdämpfung
ausreichend
langer
frühere arVSt
IGW SL
frühere Gl _
Vol
Qs
I
—— %
Vol
I.GW
Damm.
nur wenn a5t : — Bild 15.
Beispiel
für
die Entdämpfung sehr Gabelverstärkern
langer
öElg
mit
Aufgrund der zahlreich vorhandenen und verschiedenartig aufgebauten Ortsnetze ist eine allgemein gültige Empfehlung für die Gestaltung der Endleitungskette nicht möglich. Es sollte jedoch bei allen fernsprechnetztechnischen Planungen der Dämpfungsplan 55 (dB) eine gewichtige Rolle spielen.
175
Fachbeiträge
Zentrale Betriebsbeobachtung für das TF-Netz Bearbeiter:
Hermann
Sauermilch
1. Vorbemerkung In der Folge wird ein Überblick über ein neues vor der Einführung stehendes Verfahren zur Beobachtung des TFNetzes von einer zentralen Stelle aus gegeben. Vorbehalte müssen dabei hinsichtlich einiger bei Drucklegung dieses Aufsatzes noch nicht endgültig festgelegter Fachausdrücke gemacht werden. So wurde der in der Fachsprache bisher in vielen Verbindungen (z.B. mit Leitung, System, Einrichtung, Gestell, Platz, Pilot, u.a.) übliche Ausdruck „Überwachung“ in diesem Aufsatz bereits durch „Beobachtung“ ersetzt. Die hier beschriebene „Zentrale Betriebsbeobachtung für das TF-Netz“ stellt nur einen Teil des Netzbeobachtungsplatzes (NBeoPl) dar. Zu diesem gehören noch die Störungsannahme und der Sammelmeldeplatz. Wegen des sehr komplexen Aufgabenbereichs des NBeoPl muß sich dieser Aufsatz auf das Verfahren zur Zentralen Betriebsbeobachtung des TF-Netzes beschränken. 2. Bisherige
Betriebsbeobachtungsverfahren
Das von der DBP zur Beobachtung der Verstärkerstellen (VrSt) im Zuge von TF-Fernkabeln eingesetzte Fernbeobachtungssystem ist inzwischen überaltert. Es entspricht weder dem Stand der heutigen Technik, noch den für das derzeitige und für das künftige TF-Netz zu fordernden Bedingungen.
Die zwischenzeitlich entwickelte und bei einigen VrSt versuchsweise eingesetzte „Automatische TF-Netzüberwachungseinrichtung“*“ (ATFNÜw) ermöglicht das praktisch lückenlose Registrieren und Speichern von Störungsmeldungen aus Übertragungswegen. Eine Fehlerortbestim-
176
Betriebsüberwachung TF mung
der
und
eigenen
eine
VrSt
Lokalisierung
ist durch
die
von
Störungen
ATFNÜw
nicht
außerhalb
möglich.
Der Betriebsversuch mit dieser technischen Einrichtung hat die in das Verfahren gesetzten Erwartungen nicht erfüllt. Von einer generellen Einführung hat die DBP deshalb Abstand genommen. Zur Beobachtung der unbesetzten bzw. zeitweise besetzten VrSt des regionalen TF-Netzes ist bis heute von der DBP keine Standardeinrichtung eingeführt worden. Bei verschiedenen VrSt betriebene Einrichtungen sind meist aus Eigeninitiative des Betriebspersonals erstellt wordenund von unterschiedlicher Struktur. 3.
Forderungen verfahren
an
ein
neues
TF-Netzbeobachtungs-
—
Das Verfahren und die erforderlichen technischen Einrichtungen sollen nicht nur dem heutigen Ausbau des TF-Netzes, sondern auch der für die nächsten Jahre zu erwartenden Netzerweiterung entsprechen.
—
Die Signale aus einer. möglichst großen Zahl von unbesetzten und zeitweise besetzten Verstärkerstellen sowie die Signale aus der eigenen Verstärkerstelle sollen zu einer zentralen Beobachtungsstelle übertragen und dort angezeigt werden können. Die Anzeige soll Zustandsänderungen erkennen lassen. Nach Behebung bzw. Verschwinden des Fehler- oder Störungssignals soll auch dieser Zustand so lange erkannt werden, bis er registriert worden ist.
—
Die übersichtliche Anordnung Signalen muß möglich sein.
—
Störungen und Fehler sollen schnell erkannt werden können. Der Überblick über ihre Auswirkungen sowohl auf den eigenen Beobachtungsbezirk als auch auf andere Beobachtungsbezirke soll gewährleistet sein.
—
Ein Störungsabschnitt oder Fehlerort soll möglichst nau ermittelbar sein, um einen. gezielten Einsatz verfügbaren Personals zu ermöglichen.
einer
großen
Zahl
von
gedes
177
Fachbeiträge —
Das Verfahren tragenden und
weiterungsfähig
soll bezüglich der Anzahl der zu überanzuzeigenden Signale weitgehend er-
und flexibel sein.
—
Die für ein neues Netzbeobachtungsverfahren benötigten Signalübertragungssysteme müssen in das Konzept eines in Aussicht genommenen Quartärgruppen-Ersatzschaltverfahrens und eines rechnergesteuerten Sammelmeldeverfahrens eingefügt werden können.
—
Die technischen Einrichtungen sollen dem technischen Entwicklungsstand entsprechen,
4. Geplantes
Verfahren
zur
Beobachtung
neuesten
des TF-Netzes
Das unmittelbar vor der Einführung stehende künftige TF-Netzbeobachtungsverfahren soll den unter 3. aufgezählten Forderungen gerecht werden. Es unterscheidet sich in nahezu allen Punkten wesentlich von den bisher für die TF-Netzbeobachtung angewandten Verfahren. 41.
Netzbeobachtungsbezirke
Die Beobachtung richtet werden. 411.
wird
in
zunächst
zwei
Ebenen
einge-
Beobachtungsebenen
Die untere Beobachtungsebene entspricht geografisch gesehen in etwa einem Hauptvermittlungsstellen(HVSt)Bezirk. Die Signale aus den zu diesem Beobachtungsbezirk gehörenden Verstärkerstellen werden mittels eines Fernbeobachtungssystems zu einem zentralen Betriebsbeobachtungsplatz übertragen und dort angezeigt. Ein zentraler Beobachtungsplatz in dieser Ebene wird im allgemeinen bei der Verstärkerstelle am Sitze einer HVSt eingerichtet. Er ist während der Tagesstunden durch Personal besetzt und bearbeitet während dieser Zeit die Signale aus den Verstärkerstellen seines Beobachtungsbezirks. Zwei oder mehrere unteren Ebene bilden
178
zentrale Beobachtungsbezirke der einen Beobachtungsbezirk der obe-
Betriebsüberwachung TF ren Ebene. Einer der einem solchen Bezirk angehörenden Beobachtungsplätze wird den noch verbleibenden Plätzen übergeordnet. Dieser Beobachtungsplatz wird bei einer Verstärkerstelle am Sitze einer Zentralvermittlungsstelle (ZVSt) bzw. einer großen HVSt eingerichtet. Er ist auch nachts besetzt. Seinen eigenen Beobachtungsbezirk in der unteren Ebene beobachtet und bearbeitet er selbstverständlich ständig. Die Signale aus den Verstärkerstellen der
ihm
untergeordneten
412.
Festlegung
Bezirke
kann
der
Platz
außerdem
jederzeit mit beobachten. Der Beobachtungsplatz ist somit über den Betriebszustand des ihm zugeordneten TF-Netzes in der oberen Ebene stets unterrichtet. Während der Nichtbesetzungszeit der ihm untergeordneten Beobachtungsplätze übernimmt er auch die Bearbeitung der Signale aus deren Beobachtungsbereich. In Bild1 ist das Prinzip der TF-Netzbeobachtung in den beiden Beobachtungsebenen in vereinfachter Form dargestellt. der
Bezirksgreinzen
Bei der Festlegung der Netzbeobachtungsbezirksgrenzen können Fernmeldeamts(FA) und Oberpostdirektions(OPD)-Bezirksgrenzen nicht immer berücksichtigt werden. Grundsätze bei der Festlegung der Bezirksgrenzen sind: —
Fernspeiseabschnitte im Zuge von TF-Fernverbindungskabeln (TFFVk) der Kabelform 17a dürfen hauptsächlich aus Sicherheitsgründen nicht aufgeteilt werden.
—
Die Beobachtungsbezirke dürfen mit Rücksicht auf die zu erwartende Personalknappheit und aus Rationalisierungsgründen nicht zu klein werden. Ein Beispiel für die Zusammenfassung von 3 Beobachtungsbezirken der unteren Ebene zu einem Beobachtungsbezirk der oberen Ebene ist in Bild2 dargestellt.
42.
Signale
und
Voraussetzung
Betriebszustandes stellen
ist die
für
ihre eine
Bewertung ausreichende
einer größeren
Einschränkung
des
Anzahl
Beobachtung
des
von Verstärker-
Signalumfanges
aus
die-
179
Fachbeiträge
‚Sn
Signale aus dem eigenen Beobachtungsbezirk
S{BeoPl
HL: (SIAZT)
TTTTTTOT
| ipmale aus weiteren Beobachtungs -
Sf
_bezirken der unteren Ebene
Pop”
andere Pt *} SLAB(CR) Q
S =
(2):
StE
-
u
IE rn
S
SS
&
|
fBeoh,
&
30 Ö° S S|s
|
Beobachfungsbezirk der oberen Ebene
Z"V
___ ____
kxGIPt* _ KkxGiPt* Kur AB
2 GlPt6ym)
AB
unbesefzfe VrSt— *) ZA-Konfakte der Pilotempfänger Bild1.
180
Prinzip
A,B
Pre"
AB
Bw PM AB SiAzT
zeitweise besetzte VrSt
der zentralen Betriebsbeobachtung beiden Beobachtungsebenen
in
den
Betriebsüberwachung TF sen Verstärkerstellen. Ein Signal erfüllt bereits seinen Zweck, wenn es eine Aussage darüber abzugeben vermag, ob —
ein Fehler ob
in der technischen
— eine Störung reren
an einem
Übertragungsweg
Übertragungswegen
Haupfzentrale
Nebenzentrale
Einrichtung
vorliegt,
vorliegt,
oder
oder an meh-
D Unterstation
(T)Beobachtungsbezirk
—— Bez.-Grenze (obere Fbere) --- Bez.-Grenze (untere Fbene) Bild 2. Beispiel gebildeten
für einen aus 3 Bezirken Beobachtungsbezirk der
der „unteren“ Ebene „oberen“ Ebene
181
Fachbeiträge
und darüber, ob
—
7
Sofortmaßnahmen zu ergreifen sind, oder ob die Bearbeitung während der normalen erfolgen kann.
—
Dienststunden
Die Entscheidung, ob es sich empfiehlt, die Signale aus der technischen Einrichtung schließlich noch auf zuständige Kräftegruppen (TF-Technik, Stromversorgungstechnik und Maschinentechnik) aufzuschlüsseln, wird von den praktischen Erfahrungen abhängen. 42.1.
Mit
Das
dem
neue
Signalschema
Signalschema
7R,
dem
die
modernen
TF-Ein-
richtungen der Bauweisen 7 und 7R entsprechen, wird grundsätzlich zwischen Fehlersignalen und Störungssignalen unterschieden. Fehlersignale zeigen immer Mängel oder Ausfälle von technischen Einrichtungen an. Je nach ihrer Bedeutung werden sie als A- (dringendes) oder B- (nicht dringendes) Signal bereits am Ursprungsort (d.h. in der Verstärkerstelle) fest bewertet. Störungssignale sind immer auf den Übertragungsweg (Grundleitungen, Gruppen) bezogen. Sie werden durch Pilotausfall oder unzulässigen Pilotspannungsabfall ausgelöst. Störungssignale sind im allgemeinen dringend zu bearbeiten. Eine Ausnahme bilden die von Primärgruppenpiloten (PGPt) ausgelösten Störungssignale. Während der verkehrsschwachen Zeit (z.B, während der Nachtstunden) kann der Ausfall einer Primärgruppenverbindung (PGV) oder auch mehrerer PVG die Bedeutung einer schwerwiegenden Verkehrsbeeinträchtigung verlieren. Ein sonst als dringend zu bearbeitendes Störungssignal und ein evtl. erforderlicher Personaleinsatz können dann bis zum Beginn der normalen Dienststunden zurückgestellt werden. Mit Hilfe einer zur Bewertung des PGV-Ausfallumfanges entwickelten technischen Einrichtung (siehe auch unter 4.6. Bewertungseinrichtung) wird der Ausfall von PGV als „dringend“ oder als „nicht dringend“ bewertet werden. Die
182
Betriebsüberwachung TF Bewertung erfolgt aufgrund einer den örtlichen nissen angepaßten Schwellwerteinstellung.
Verhält-
Die Verstärkereinrichtungen der älteren Bauweisen (Bw 52 Rö, 52tr) sind nicht nach dem neuen Signalschema ausgelegt. Um die zentrale Betriebsbeobachtung in der geplanten Weise betreiben zu können, müssen sie auf das neue Signalprinzip umgestellt werden. Die Vertärkereinrichtungen der neuen Bw7 und 7R sind bereits nach dem neuen Signalprinzip ausgelegt. Einschübe und Einsätze signalisieren Fehler je nach eingelegten Brückenverbindungen als A- oder B-Alarm. Die fehlerhafte Einrichtung wird durch Signallampen in der Lichtzeicheneinrichtung (LZE), durch Alarmlampen im Signalfeld der Gerätegruppe und durch die Leuchtdiode im Einschub gekennzeichnet. Außerdem sind die Signalleitungen (A, B und EL) zum Signalzuordnungsverteiler geführt. Dort werden sie entweder zum Fernbeobachtungssystem (im Falle einer abgesetzten VrSt — hier aber nur A,B —)
oder zur Steuerelektronik (in VrSt mit eigenem Beobachtungsplatz)
geschaltet.
Störungssignale (Pilosignale) werden nach dem Signalschema 7R nicht mehr an der LZE angezeigt. Sie sind vom Gerät zum Signalzuordnungsverteiler geführt. Dort können sie sowohl zu zentralen Anzeigeeinrichtungen als auch zum Fernbeobachtungssystem geschaltet werden. 422.
Zum zentralen Beobachtungsplatz zu übertragenden Signale
Zur zentralen Betriebsbeobachtung werden sowohl Signale aus den VrSt des Beobachtungsbezirks als auch die Signale aus der eigenen VrSt übertragen. In Tabelle 1 sind die aus den zu beobachtenden VrSt zum zentralen Beobachtungsplatz zu übertragenden Signale zusammengestellt. Wie aus der Tabelle entnommen werden kann, werden die Pilotsignale aus koaxialen TF-Grundleitungen : (KxTFGI) sowie Quartärgruppenpilotsignale (nach Einführung der Quartärgruppen(QG)-Technik für QG-Ersatzschaltungen erforderlich) einzeln übertragen.
183
Fachbeiträge
Fehlersignale (techn.
TFVrSt
vrshh
sv
AIB| | TFZwVrSt_
&|TFZ & 2
(ferngespeist)
A
xIx | -
(speisend) _(speisend
wVrSt
Ein-
richtungen - nur Sammelsignale
TFSchalt VrSt
3 |TFVrSt mit endenden PGV
x
_|x
x
x
|x
x
M
-
B
A
B
-
-
.717-
31,9]x
-
x
-
N
9
MERERIERZEREER
S |TFVrSt mit endenden PGV
xIx | .21.2].2 | .2
a
x
|x
-
x
|x
-
9
Ö
2
=
n
TFV
.
rSt mit
endenden
PGV
|und SiAZT für eigene VrSt . . . |TFVrSt
am
Sitze
eines
achtungsplatzes FeÜ [untergeordneten
Netzbeob-
für einen
2) 2)
2)
-
[7 2) -
-
2)
-
-
2)
-
2) 2)
Beobachtungsbezirk
1) Signale von Kabelbeobachtungseinrichtungen sind hier einbezogen 2) Signale aus diesen Anlagen sollen künftig in die SV-Signalisierung für die VSt übernommen und von dort weitergeleitet werden 3) Zunächst nur versuchsweise
4).Nur für Einkanal-Datenübertragungseinrichtung mit Frequenzmultiplex) arbeitet im 2Dr-Getrenntlageverfahren. Es ist somit duplexfähig (dx). Bei Datenverbindungen des öffentlichen Direktrufnetzes mit Schrittgeschwindigkeiten bis 200 Bd werden auch für die SEU-A Anschlußgeräte (AGT) mit obigen EAP eingesetzt 2. 21.
(s. Pkt. 6.1.).
Anschluß von Fernschreiban das Telexnetz Anschluß
von
einrichtungen
und
Datenendeinrichtungen
Fernschreib-
Für ausschließlichen Fernschreibverkehr werden an eine Telexvermittlungsstelle (TxVSt) angeschlossen (Bild3 [1] und [4])
293
S3e1}13qgpe
962
l ]
TÜST
_ ferrstreche _
TÜST
5
&
3
Endstreche 7AnTW
I
S
I
=>
Kanal}-|=
Ss Ss Ss
L
y
=S 4DrD
=
—
J
Bild3.
Anschluß an eine
_
< zZ S
=
11Kanal
TAnTW
Iposfeigene &polige Anschlußdase oder privater Verteiler |
SS
‚88X
Fernmeldeeinrichtunger
ISIS
DrE-Asl
SS S
private
N,
SS
4
S
Wermiftlungseinrichtungen in TW39- TWS6- oder TW00-Technik
7
Anschlußleitung
Tx St
rien Bezeichnung er
ee
AE
von Fernschreiboder Dateneinrichtungen TxVSt in TW39- oder TW100-Technik
m
FsvE u)
Datenstationen
— private Fernschreibgeräte (FsGt) in 2DrE-Schaltung, — private Fernschreibvermittlungseinrichtungen (FsVE; Verteil- oder Nebenstellenanlagen) in 2DrE- oder 4DrDSchaltung. Die Anschlußleitung (Asl) kann innerhalb der Reichweite der Teilnehmerschaltung (TS; überbrückbarer Leitungswiderstand etwa 2,4kOhm) rein gleichstromgetastet oder über einen WT-Kanal mit einer gleichstromgetasteten Endstrecke geführt sein. Bei Starkstromgefährdung der Gleichstromstrecken oder vorübergehendem Kabeladernmangel können Einkanal-WT-Einrichtungen eingesetzt werden
(z.B.
WT1-FM800/1800
oder
Überlagerungstelegrafie
ÜTT.
56/1). Die Übergabestelle von Post- und Privatzuständigkeiten ist bei Einzelanschlüssen die 8polige Anschlußdose (ADoT8), bei Mehrfachanschlüssen der private Verteiler (Vt)
der
Telexstelle.
Die
übliche
Ausstattung
einer
Telex-
stelle besteht aus einem Fernschaltgerät (FGt) für den Verbindungsaufund -abbau und einer Fernschreibmaschine. Im Telexnetz darf nur der CCITT-Code Nr.2 (Start-Stop)
nationen sperrt.
F,
benutzt
G
und
H
werden.
sowie
Die
die
ziffernseitigen
Kombination
32
Kombi-
sind
ge-
22.
Anschluß von Datenendeinrichtungen Für ausschließlichen Datenbetrieb werden an eine TxVSt angeschlossen (Bild3 [2]) Datenverarbeitungsanlagen (DVA) in 4DrD-Schaltung. DVA besitzen im allgemeinen 4Dr-Datenschnittstellen (4Dr-DSS) nach den CCITT-Empfehlungen V 24/V 28. Zur Leitungsanpassung sind private Anschalteeinheiten (AE; =. B. Multiplexer) mit 4Dr-DSS/4DrD-Umsetzung erforderlich. Den Verbindungsauf- und -abbau steuert die DVA selbst. Zur Prüfung der Telexstelle mit direktem DVAZugang ist eine Fernschreibmaschine erforderlich. 23. Anschluß von Fernschreib-/ Datenendeinrichtungen Für zeitweisen Fernschreiboder Datenbetrieb einer Endstelle kann das Fernschreibgerät (FsGt) und das
295
Fachbeiträge
Datenendgerät (DEGt) gemeinsam mit einer Asl verbunden werden. Der Anschluß an die TxVSt erfolgt in 2DrESchaltung (Bild 3 [3]). Voraussetzung für zeitweisen Fernschreiboder Datenbetrieb ist, daß der Datenbetrieb gegenüber dem Telexbetrieb nicht bevorrechtigt ist und ankommende Verbindungen zugunsten des Telexbetriebes entschieden werden. Die Zusammenschaltung der Datenendeinrichtung
(DEE
=
DEGt
oder
DVA)
und
des
FsGt
geschieht über eine manuelle, halbautomatische oder automatische Umschalteeinrichtung (UmE). Bei der manuellen Umschaltung werden die Anschlüsse von FsGt und DEE am FGt umgesteckt (z.B. wie beim FGt D200S2), bei der halbautomatischen Umschaltung wird ein Schalter bedient (z.B. wie beim ZbT-U), bei der automatischen Umschaltung wird ein Fernschreibzeichenerkenner (FZE) benutzt. Der Beginn und das Ende einer Datenübertragung wird durch das Datenumschaltesignal angekündigt. Es wird, von der sendenden Stelle übermittelt und besteht aus der Zeichenfolge „Viermal Strombild 19“ (SSSS) des CCITT-Code Nr.2. Nach der Umschaltung auf Datenbetrieb sind andere Codes als der CCITT-Code Nr. 2 erlaubt. Maximal zulässig sind 7 Informationsbits und 1 Paritätsbit. Wird der CCITTCode Nr. 2 benutzt, so sind alle Kombinationen einschließlich der Kombination 32 freigegeben. Die zeitweise Anwendung des Datenbetriebs hat der Teilnehmer der DBP mitzuteilen (Änderung der TS in der TxVSt wegen möglicher Benutzung der Kombination 32 erforderlich). 3.
Anschluß von Fernschreib- und Datenendeinrichtungen an eine DxVSt in TW39- oder TW100-Technik
Im Datexnetz werden die privaten Fernmeldeeinrichtungen über posteigene Datexfernschaltgeräte (DxFGt) mit der Anschlußleitung verbunden (Bild4).. Das DxFGt ist hierbei Datenübertragungseinrichtung (DÜE) und Leitungsabschlußeinrichtung. Leitungsseitig hat das DxFGt
eine 4DrD-Schaltung,
laubt,
FsE
und
oder
Schaltung
296
die
endgeräteseitig
DEE
mit
in
2DrE-,
Steuer-
und
+ 60 Veine
oder
+ 20 V-Betrieb
definierte
4DrE-,
4DrD-
Schnittstelle
Meldeleitungen.
oder
er-
für
4Dr-DSS-
Einfachstrom-
Dxvst
Dotenubertragungsgerüte
|
|E .Q
S
Ss
[WT-Kandt Asl
1 ——
pe
L6G
Bild 4.
4
IW3-15
Fe
mit A-Bor TÜst
Fernstrecke ‘
S
S
Pe
SzZ
Endstrecke
WTUES mit r
ID
Anschluß von Fernschreib- oder Datenendeinrichtungen an eine DxVSt in TW39- oder TW100-Technik
U9UOTJEISUSIeAL
: EWT-As
a 7
7
Fernschreib- oder
B
40
Datenendeinrichtung
Word-Ası
DrD-
s2 SE YDrD-Asl
3 8
GDN-
private Fernmelde-
einrichtungen
l
|aon-Ası
>
u.
Datexstelle posteigene
_—_ IL
S
H>
&
3
Anschlußleitung
I
S
|5 2
|
| posfeigerre Bpolige Anschlußdase oder privater Verteiler
a1 ı
TÜSt
DxAsi
|Vermiftlungseinrichtunger in TW39- oder TW100-Techrik|
| heit
|
Schnittstelle
Anschhul 5. Ä möglich Bezeichnung
Fachbeiträge schaltungen sind 200 Bd zulässig.
bis
100 Bd,
Doppelstromschaltungen
bis
Im Datexnetz können die Datexvermittlungsstellen (DxVSt) Voll- oder Teilvermittlungsstellen sein. VollVSt sind DxVSt in TW39-Technik, TeilVSt die DxVSt in TW100-Technik. Die Teilnehmerschaltungen (Vorwähler mit Anschlußschaltung) sind bei TW39-Technik symmetrisch, bei TW100-Technik asymmetrisch, d.h. nicht erdfrei (Adern b1 und b2 der 4DrD-Schaltungen sind geerdet). Asymmetrischer 4DrD-Betrieb bewirkt bei Schrittgeschwindigkeiten über 50 Bd Geräuschspannungsbeeinflussungen der Nachbaradern im Kabelnetz. Deshalb muß eine Umsetzerschaltung zwischengeschaltet werden. Das geschieht durch die Umsetzerschaltungen der GDN- oder der TAnD200-Einrichtungen (GDN = Gleichstrom-Datenübertragungseinrichtung mit niedriger Sendespannung; TAnD 200 = Telegrafenanschlußschaltung für 200 Bd-Betrieb). Welche der beiden Einrichtungen benutzt wird, hängt von der Ausstattung der TÜSt am Sitze der DxVSt ab. Die Reichweite der 2Dr-GDN-Anschlußsysteme wird bei einer Sendespannung von etwa + 300 mV durch den maximalen
Schleifenwiderstand
von
1,2kOhm,
bei etwa
+ 600 mV
von
2,4kOhm bestimmt. Über die TAnD200-Einrichtung kann mit + 60 V oder + 20 V getastet werden. Bei + 60 V-Betrieb kann ein Leitungswiderstand von etwa 2,2kOhm, bei +20 V-Betrieb ein Leitungswiderstand von etwa 500 Ohm überbrückt werden. Die TW39-TS entspricht in ihrer Ausführung und Reichweite der TAnD200-Schaltung für + 60 V-Betrieb. 2Dr- oder 4Dr-Einkanal-WT-Systeme werden nur eingerichtet, wenn die Anschlußstrecke starkstromgefährdet ist, im Anschlußkabel vorübergehender Kabeladernmangel besteht oder die Reichweite der 4DrD-Schaltung überschritten wird und Mehrkanal-WT-Systeme nicht vorhanden sind. Bei NF-Leitungen ohne Verstärker wird die 2Dr-
Führung,
bei
NF-Leitungen
mit
Verstärker oder
TF-Lei-
tungen die 4Dr-Führung benutzt. Bei Einkanal-WT-Anschlußleitungen (EWT-Asl) wie bei GDN-Asl wird der Endsatz des Übertragungssystems (WTI/ES mit B-Bgr oder GDN-Tischgehäuse) bei der Datexstelle aufgebaut.
298
Datenstationen
4. Anschluß von an eine DVSt
Fernschreib- und in EDS-Technik
Datenendeinrichtungen
Für den Anschluß von FsE oder DEE an eine Datenvermittlungsstelle (DVSt) werden für die Übertragungsge-
schwindigkeiten
— —
benutzt
(Bild5):
bis 200 bit/s das EDF-Anschlußsystem, 24 und 9,6kbit/s Datenübertragungssysteme
chronbetrieb,
Innerhalb der Reichweite der den angeschaltet: — Anschlüsse der Telexklasse 2DrE-Schaltung
—
für
Syn-
EDF-Anschlußsysteme
wer-
die z.Z. entwickelt werden.
über
das
mit
Endstellenanpassung
AGT10,
in
in
4DrD-Schaltung
über das AGT30, Anschlüsse der Datexklasse bis 200 Bd mit Endstellenanpassung in 4DrD-Schaltung über das AGT30, in 4DrDSS-Schaltung über das D-AGT (D-AGT = Datenanschlußgerät).
Bei größeren Reichweiten werden WT-Kanal-Anschlußleitungen mit EDF-Endstrecken eingerichtet. Die Endstellen werden mit den gleichen AGT angepaßt wie vorher beschrieben. Steht in der Übergangszeit bei WT-Kanal-Asl kein EDF-Anschlußsystem für die Endstrecke zur Verfügung, so können diese auch gleichstrommäßig wie in Bild 3 und 4 geschaltet werden. 5. Anschluß von Fernschreiban Telegrafen-Stromwege
und
Datenendeinrichtungen
An posteigene Telegrafen-Stromwege angeschlossen werden in — 2DrE- oder 4DrE-Schaltung — 4DrD- oder 4DrD/2-Schaltung Für EE mit Datenschnittstelle schaltungen beizustellen.
sind
können
private
nur
EE
Umsetzer-
Die EE können unmittelbar mit dem Telegrafen-Stromweg verbunden werden, wenn sie einen Motorfernschalter oder eine Fernsteuereinheit besitzen. In allen anderen Fällen sind private FGt oder AE erforderlich. 7
299
Fachbeiträge
EM
———)
. , [Bezeichnung mascoh- der Asl 1
(
Dvst
ZorAl| [TU Ä|
m: | [Enasesti4 u
2 J
si
|
S|
WT-Karal-Asl mut EDF-
Endstrecke
L
Ss SS
|SISH
SSH roo
S|
SIBı
LI
Si
As! mit
DÜ-System
| |
6
|
|
| Anschluß
an
8 fernstrecke
S°
SH Sy
5
300
Lt
ash
/
Bild5.
|
407
Wr
Kana|S|
Bm a UR
u)
DÜE
Dar
VrSt
S
2}+IS zZ
_
S
8
2 Z|-
° |8|zS
S
IS
—
-
>
&
:IS5
von Fernschreib- oder Datenefideinrichtungen eine DVSt in EDS-Technik
Datenstationen
Telex- oder. Datexstelle DÜE.
private Fornmelck
pasteigene
Anschlußleitung
einrichtungen
mn Bd 'ZDrE/50
Bu > AUT
—
Z0rz
\
Sr
pr AUTA
[
4DrD/50Bd
Oxfütn
vDrD/50-200Bd
(pr &| 2 — IT
E
El
|
055/200 Bd
Q
n
o
3 Endstrecke | Fi S
T05t WT-
Dooo-SE
2ör=
2
gun T
Kanal
D&D |
3 x
c
Sl | a
[=
IrSt
—{
S
SH
#ör=
3
< 5
S
SQ
S
8%
& S
‚S S
DÜE ..
g
Endstrecke
&
Anschaltung wie bei Tbis4
8°52
Erz
zur 7 5 L
sol
Fachbeiträge 5.1.
Telegrafen-Stromwege mit Endpunkten im selben Fernsprechortsnetzbereich
Telegrafen-Stromwege mit Endpunkten im selben Fernsprechortsnetzbereich werden für — Standbetrieb (Punkt-zu-Punkt-Betrieb), — Vermittlungsbetrieb, — Knotenbetrieb bis zu einer Schrittgeschwindigkeit von 200 Bd überlassen. Bild 6 erläutert die Anschlußmöglichkeiten zwischen — zwei privaten Endstellen mit End- oder Vermittlungseinrichtungen (obere Bildhälfte), — einer privaten Endstelle und einer posteigenen Knoteneinrichtung (KnE) in der TÜSt (untere Bildhälfte). Für Telegrafen-Stromwege zwischen zwei Endstellen werden überlassen — Zweidrahtwege für EE mit 2DrE- oder 4DrD/2-Anschaltung, — Vierdrahtwege für EE mit 4DrE- oder 4DrD-Anschaltung.
Bei Schrittgeschwindigkeiten über 75 Bd müssen die Geräuschspannungsbedingungen nach Pkt. 1.1. erfüllt werden. Knotenanschlußleitungen (KnAsl) werden je nach der vorhandenen Anschlußtechnik der TÜSt als gleichstromgetastete Asl oder wechselstromgetastete As] mit EDFAnschlußsystem geschaltet. Gleichstromgetastete Asl werden bis 100 Bd in 2DrE- oder 4DrD/2-Schaltung, bei Schrittgeschwindigkeiten über 100 bis 200 Bd ausschließlich in 4DrD/2-Schaltung eingerichtet. Bei Schrittgeschwindigkeiten über 75Bd sind Abflacher einzusetzen. In der TÜSt werden bei KnAsl-4DrD/2 bis 100 Bd die herkömmlichen TAnHV/St, bei Schrittgeschwindigkeiten über 100 bis 200 Bd die TAnD200 benutzt.
KnAsl-EDF
werden
geschaltet, wenn
die TÜSt
am
Sitze
der Rundsendeeinrichtung (RSE) oder Fernschreibkonferenzeinrichtung (FsKE) mit ED1000-Einrichtungen ausgestattet ist. Leitungsabschlußeinrichtung ist dann je nach der Einfachstromoder Doppelstromendstellenanpassung das AGT10 oder AGT30.
302
private
se»!
vDrE
3
22
|
me
|
Ss
oder
2
I
|
Endstelle ‚private
Fernmelde-
|R& 85 IB
ES
sı
nAsI-2DrE |
r
Sell
ZDrE_oder. 4Ord/2
tl sy
f
is 1
8 "R
|
DüE
|
S
‚SIFsKE | TAndzm wuSZ RSE
8 8
S&
ED1000-SEU-A
l
DB] pasteigene
&|
ZörE oder 4DrD/2
S| 20rz
„S
ı SE |; &8
IR
S
g S & =
58
S DI
asjrarı SS Sl 138
#DrE_oder 4Drd
S
TAnHV/St
ı
N gi
8
|Rg
|
\
SE
BB
&.S 58
1
Q N
einrichtungen
I g
SS
RK, ei 28 [©
40rD
r
Ortsstrecke
einrichtungen
ZDrE
1
|
Fernmelde-
ıs 1
AE
o
ı SZ | +S
m | Fe ı®28SI ı 52
8 Arm NA & &| AUTO
.
€
Bild6. Anschluß von Fernschreib- oder Datenendeinrichtungen an Telegrafen-Stromwege mit Endpunkten im selben Fernsprechortsnetzbereich
ıeS IS 15 |
|
|
U3uUorEIsusJeq
£0E
Endstelle
des
Fachbeiträge
Endstelle Krschluß
niöglich
Bezeichnung | private des
keit _|T-Strom 7 TrStrammeg mit
Iiichstram -
1
2
j
Feer melde -
EINFICHTUNGENT L
_ZOrE
a
DrDi
.
4 |b
|
Aoıao
C
AQT3O
R
Ss
.S SSIEL über © | = RS Für bwl | 3 8 | "Sromegmil | 5 |
AT|
TUSt
TAniVSf
&
|
At 74
Z\SS |S &
Ada
|”
|
Äire
DS
|
94; Urs
ol.
1
_
| . ge
|
posteigene DUE
|
\Endsirecke
_UDrE YDrDod.
| Endstrecke i
|
Ä
l
Evo
7
&
g
8 S|2 = wr-r|
Besondere Anordnung der nur der direkte Strahl
Empfangsantenne, empfangen wird
bei
der
Ort der Empfangsantenre
TRRUTLTTTRRTTETLTETTTREETIN | STEEEEREEEEEEEE a Bild7T.
AILLLLLLSISLLSLT SS r
Maßnahmen
bei
der
Sendeantenne,
unterdrücken
TT 7 >
um
Reflexionen
zu
421
Fachbeiträge Anhand von statistischen Messungen wurden für verschiedene Bodenstrukturen und Bodenverhältnisse Ausbreitungsdämpfungen ermittelt, die aber für die Bestimmung der Funkfeldparameter nicht ausreichen. Um dennoch zuverlässige Meßergebnisse zu erhalten, müssen, will man z.B. das Diagramm oder den Gewinn einer Antenne messen, besondere Vorkehrungen getroffen werden. Die unter 8 beschriebene Berechnung läßt sich nur für den Fall der Freiraumausbreitung anwenden, d.h. für den von der Sendeantenne ausgehenden und von der Empfangsantenne empfangenen direkten Strahl. Zwischen beiden Antennen muß optische Sicht bestehen. Eine in der Höhe h, angeordnete Empfangstantenne wird entsprechend Bild5 den direkten und den mit dem Einfallswinkel % einfallenden reflektierten Strahl empfangen. Ebenes Gelände vorausgesetzt, läßt sich die Lage und Entfernung r’ des Reflexionspunktes mit folgender Gleichung bestimmen r’=
h,
tan}
Soll nun bei der Empfangsantenne nur der direkte und nicht der reflektierte Strahl eintreffen und empfangen werden, so müssen Sende- und Empfangsantenne so angeordnet werden, daß in den Reflexionspunkt (seine Lage wird durch die geometrischen Verhältnisse der beiden Antennen zueinander bestimmt) keine Energie abgestrahlt
wird.
In Bild6
sind die geometrischen
Verhältnisse
einer
solchen Anordnung dargestellt. Als Sendeantenne sollte eine gebündelte Antenne verwendet werden. Die Höhen h, und h, sind im Verhältnis zur Entfernung so einzu-
richten, daß
den
der Nullwertswinkel
angenommenen
»
Reflexionspunkt
der Sendeantenne weist.
Der
in
Zusam-
menhang zwischen h, bzw. h, und der Entfernung r ist mit folgender
422
Gleichung
gegeben
A
Schaltung A
Pe]
Kabel,
Kabel
Pl£ichleitung
£] [st Schaltung B Kabel,
,
Kabel,
Kurzschlußschaltung
25H
Bild8. A/B Meßschaltung für die Bestimmung des Gewinns für zwei gleiche Antennen als Sende- und Empfangsantenne
h
e,8
=
;
r-tany
(23)
(y = Nullwertswinkel der Sendeantenne). Eine weitere Möglichkeit der Anordnung der Sendeantenne ist im Bild7 gezeigt. Hierbei kann man mit kleineren Höhen h, und h, auskommen. Die Hauptstrahlungsrichtung der Antenne wird um den Winkel 9 angehoben, so daß auch hier der Nullwertswinkel in den angenomme-
423
Fachbeiträge nen Reflexionspunkt weist. Allerdings wird bei dieser Anordnung nur der Vektor E,,;, des Diagramms der Sendeantenne wirksam. Für Gewinnermittlungen ist deshalb mit einer gewissen Ungenauigkeit im Resultat zu rechnen, wenn die Größe dieses Vektors nicht genau bekannt ist. Relative Diagramm-Messungen an der Empfangsantenne dagegen sind mit großer Genauigkeit durchführbar. 10. Praktische
Gewinnbestimmung
Eine einfache, mit geringem Aufwand mögliche Gewinnbestimmung läßt sich durchführen, wenn als Sende- und Empfangsantenne gleiche Antennen benutzt werden. Da sie den gleichgroßen Gewinn haben, läßt sich aus den Gleichungen (10), (11) und (15) folgender Zusammenhang ableiten:
Ps
Pr
Das kann
=
4a
Verhältnis in der
Praxis
DL.
P D
E
R?
12. Gg?
auch
.
(24)
Streckendämpfung
meßtechnisch
einfach
ermittelt
genannt, werden.
Sendeund Empfangsantenne werden entsprechend Bild 6 angeordnet. Als Meßschaltung dient Bild 8 A/B. Beide Antennen haben den gleichen Wellenwiderstand, die Meßschaltung ist entsprechend diesem Wellenwiderstand aufzubauen. Auf gute Anpassung ist zu achten. Es kann . dann die Empfangs- und Sendeleistung als Spannung über dem Wellenwiderstand gemessen und in dB ausgedrückt werden. Mit Schaltung Bild8A wird die Empfangsleistung bzw. Spannung und mit Schaltung Bild 8B die Sendeleistung bzw. Spannung ermittelt. Durch Verändern der Eichleitung kann leicht der Unterschied zwischen beiden Spannungen in dB ermittelt werden. Dieser Betrag entspricht der Streckendämpfung.
424
Antennentechnik Die Gleichung (24) wird zur einfacheren Handhabung die logarithmische Form gebracht. Es ist dann 10 log
Ps DB.
0,5 A/dB 10log
=
E
=
G£
2log4rn
+
1Wlog4r =
10log
+
4
10log +
R
20 log
7
R
R 10log 7
—201log
7 10log
in
Gg
(25)
Gg
(26)
— 0,5 A/dB.
(27)
Anhand Gleichung (27) ergibt sich der Gewinn einer Antenne, bezogen auf den Kugelstrahler, wenn durch Messung die Streckendämpfung ermittelt wird. Bei Bezugnahme
auf
den?
-Dipol
muß
die
Gleichung
(27) durch
das
Glied — 10 log 1,64 & — 2,15 dB ergänzt werden. Besitzen die Antennen und die Meßschaltung einen Wellenwiderstand von 60 Q, dann ergibt sich der Gewinn einer
Antenne
genannten 10log
(auf
den 4 -Dipo!
Meßvorschlag Gn
11. Aufbau
und
=
bezogen)
nach
dem
vor-
zu
19,5 dB
— 10logA
Funktion
— 0,5 A/dB.
(28)
der Meßempfänger
Als Meßempfänger werden selektiv abstimmbare Mehrfachüberlagerungsempfänger benutzt, weil sich bei diesem
£ingong
%
r,
n,
Anzeige
SP
|N
| Spannungsmeßbereich Bild 9.
Prinzipschaltbild
der
gebräuchlichsten
Meßempfänger
425
Fachbeiträge
Prinzip eine hohe Selektivität erreichen läßt. Bild9 zeigt das Schaltungsprinzip eines derartigen Gerätes. Die Eingangsspannung U} (Meßfrequenz) wird einem Frequenzumsetzer zugeführt und in eine Zwischenfrequenz f, umgesetzt. Die Höhe der f, ist so gewählt, daß die notwendigen Verstärker, Demodulationen und Regelschaltungen mit dem geringsten Aufwand realisierbar sind. Außerdem kann der zum Umschalten des Spannungsmeßbereichs notwendige Teiler, da er bei der festen Frequenz f, betrieben wird, ohne größeren Aufwand mit großer Genauigkeit gebaut werden. Beim Mehrfachüberlagerungsempfänger müssen besondere Maßnahmen getroffen werden, um möglichst keine Mehrdeutigkeit zu erhalten. Eine Mehrdeutigkeit ist gegeben, wenn neben der Meßfrequenz andere Frequenzen durch Summen- oder Differenzbildung mit den Oszillatorfrequenzen oder deren Oberwellen die Zwischenfrequenzen bilden. Diese Mehrdeutigkeit läßt sich durch Selektionsmittel im Signalweg vor dem Umsetzer und durch entsprechende Wahl der Zwischenfrequenz vermeiden. Der Maximalpegel für eine lineare Umsetzung liegt zwischen 10 und 100 mV. Größere Eingangsspannungen werden durch Spannungsteiler herabgesetzt. Zur Erzielung der notwen-
digen Selektion wird besonders bei Geräten für hohe Meß-
frequenzen eine zweite Umsetzung auf eine niedrigere Zwischenfrequenz erforderlich, wo sächlichen Selektionsmittel eingesetzt sind.
wesentlich die haupt-
Bei einigen Geräten wird die Durchlaßfrequenz der vor dem ersten Frequenzumsetzer angeordneten Filter im Gleichlauf mit der Frequenz des Umsetzeroszillators abgestimmt. Bei dieser „mitlaufenden Vorselektion“ besteht der Nachteil einer nicht konstanten Durchlaßdämpfung für die Meßfrequenzen. Daher müssen Meßempfänger, die nach diesem Prinzip arbeiten, bei jeder Meßfrequenz nachgeeicht werden. 12. Schrifttum [1J [2] [3] [4]
426
Antennas, John F. Rider, New York Meinke/Gundlach, Taschenbuch der Hochfrequenztechnik. Hütte IV B, I. Antennen Dr. R. Becker, Berlin. Funktechnik, Deckers-Verlag Hamburg.
Rufnummernansage
Automatische Rufnummernansage 1. Allgemeines Im Rahmen ihrer Fernsprechkundendienste erteilt die Bundespost Auskünfte über die Rufnummern der in ihrem Bereich vorhandenen Fernsprechteilnehmer. Dieser Dienst ist sehr personalintensiv und erfordert spezielle Karteiunterlagen, um ein Auskunftsbegehren — bei rund 11 Mio. Fernsprechteilnehmern — möglichst schnell beantworten zu können. Mit der stetig zunehmenden Zahl der Fernsprechanschlüsse wächst die Zahl der Auskunftsersuchen. Um mit dem gegebenen Personalbestand eine ausreichende Dienstgüte auch bei der Fernsprechauskunft sicherzustellen, sind besondere Einrichtungen entwickelt worden, die einen Teil der Anfragen durch automatisch arbeitende Sprachansagen erledigt. Verlegt zum Beispiel ein Fernsprechteilnehmer seinen Wohnsitz, so ist zu einem bestimmten Zeitpunkt sein alter Fernsprechanschluß abzuschalten. Danach ist der Teilnehmer unter einer anderen Rufnummer zu erreichen. Nach dem Abschalten müssen Anrufer, sofern ihnen die
neue
kunft
Rufnummer erfragen.
nicht
bekannt
ist,
diese
bei
der
Aus-
„Die Automatische Rufnummernansageeinrichtung“ dagegen ermöglicht, zu einem beliebigen Zeitpunkt von einem Schaltplatz aus fernsteuerbar das Abschalten des alten Anschlusses vorzunehmen. Danach erhalten Anrufer statt der bisherigen Ansage „Bitte erfragen Sie die neue Rufnummer bei der Auskunft“ nun die neue Rufnummer — gegebenenfalls mit Ortskennzahl — als Ansage mitgeteilt. Diese Einrichtung erlaubt außerdem fernsteuerbar Fernsprechanschlüsse zu sperren, beispielsweise bei Zahlungsverzug der Fernsprechgebühren und wieder zu entsperren nach Begleichen der Gebührenschuld. Während des Sperrzustandes wird die bisher schon verwendete Standardansage: „Dieser Anschluß ist vorübergehend nicht erreichbar“ angeschaltet. |
427
Fachbeiträge‘ 2.
Vorbereiten
der
Umschaltung
Dem LW-Ausgang eines Teilnehmeranschlusses, der in absehbarer Zeit abgeschaltet werden soll, wird vorbereitend eine Ansage-Teilnehmerschaltung (Ansage-TS) für Fernumschaltung zugeordnet. Die erforderliche Rangierung wird am Hauptverteiler der Ortsvermittlungsstelle (OVSt)
vorgenommen.
Ebenso
wird
verfahren,
wenn
ein
Anschluß gesperrt werden soll. Wie aus dem Übersichtsplan hervorgeht, tritt mit dem Zwischenschalten der Ansage-TS zunächst keine Änderung im Verbindungsaufbau ein; es sind lediglich die a/b-Adern zum Teilnehmeranschluß über Umschaltkontakte sowie vorbereitend zur I. AS-Stufe
richtung
der
automatischen
geführt.
|
OVvSt
|
von weiteren
|
Tin
DD;
|
ZA
I.AS-Stufe
Ansage-TS |
F
| |
IIn
|
Rufnummernansageein-
|
|
T
AS
3. Ablauf
o
A
LW|Schait-W|1.
der
Umschaltung
Zu einem vorgegebenen Zeitpunkt wird zum Umschalten eines Teilnehmeranschlusses auf eine automatische Ansage
428
Rufnummernansage ein besonderer Schaltwähler (Schalt-W) angesteuert, der sich mit den Ansage-TS und der I. AS-Stufe in einem gemeinsamen Gestellrahmen in der OVSt befindet. Das Ansteuern vollzieht sich von einem Schaltplatz über das Gleichstrom-Wählprüfnetz. Um Fehlschaltungen zu vermeiden, muß vor jeder Änderung eines Schaltzustandes eine Kontrollverbindung durchgeführt werden. Fällt diese positiv aus, dann schaltet ein Haftrelais in der Ansage-TS — vom Schaltplatz gesteuert — die a/b-Adern des LW-Ausgangs vom Teilnehmeranschluß auf ein Rufauswerte-Relais um. 4. Verbindungsaufbau auf
nach
dem
Umschalten
Rufnummernansage
Beim Belegen des LW-Ausgangs spricht durch den Rufstrom das Rufauswerte-Relais in der Ansage-TS an. Dieses
gibt
ein
Anlaßpotential
auf
die
Stufe sowie zur Zählunterdrückung c-Ader des LW-Ausganss.
nachgeschaltete
Erdpotential
I. AS-
auf
die
Nach Aufprüfen des AS wird die Lage der Ansage-TS identifiziert und deren Daten in einem Speicher des AS eingeschrieben. Am Ende des ersten Rufes belegt der AS eine Verbindungsleitung zu einer Zentralen Ansagestelle. An deren Eingang befindet sich eine Kopplungsübertragung (K-UE), die zur c-Aderanpassung dient und die Belegung zur II. AS-Stufe weitergibt. Nach dem Aufprüfen sendet die II. AS-Stufe ein Abrufzeichen über die a/bAdern zur I. AS-Stufe. Daraufhin gibt die I. AS-Stufe in Form von Wahlimpulsen die Daten der TS-Lage als zweistellige Zahl aus. Diese Impulse werden zusammen mit der Leitungsbündelnummer der II. AS-Stufe vom Ansagekoppler, welcher der II. AS-Stufe nachgeordnet ist, aufgenommen. Vom Ansagekoppler gelangt die Information über Datenumsetzer und Datenstrecke zu einer Datenverarbeitungsanlage, welche die alte Rufnummer (Lage- und Bündeldaten) in die neue Rufnummer umsetzt. Aufgrund der eingegangenen Information gibt die Datenverarbeitungsanlage die neue Rufnummer — falls erforderlich mit Ortsnetzkennzahl — aus. Die neue Ruf-
429
Fachbeiträge nummer wird über Datenstrecke und Datenumsetzer dem Ansagekoppler übermittelt, der sie speichert. Anschließend gibt dieser ein Beginnzeichen über die a/b-Adern zur I. AS-Stufe. Am Ende des Beginnzeichens bietet sie eine Schleife zum LW-Ausgang an und leitet damit den Gesprächszustand ein. Die Steuerung des Ansagekopplers schaltet nun entsprechend den eingespeicherten Ziffern die Leitung zur OVSt auf ein l6spuriges Ansagegerät. Die einzelnen Spuren haben die Ansage der Ziffern 1 bis 0 sowie einige Kurztexte gespeichert. Somit wird durch das jeweilige Umschalten auf eine andere Spur ein Ansagetext zusammengestellt, der aus Kurztexten und Ziffernangaben besteht, zum Beispiel: „Die Rufnummer hat sich geändert“ — „Bitte wählen Sie“ — „vier“ — „acht“ — „drei“ — „fünf“ — „zwo“ — „sieben“ — „Ich wiederhole“ usw. | Die Wiederholungen der Ansage können beliebig oft angehört werden. Erst nach dem Auflegen des Handapparates wird durch den Teilnehmer die Verbindung ausgelöst. 5. Verbindungsaufbau nach Gebührensperrenansage
dem
Umschalten
auf
Wird ein Teilnehmer angerufen, dessen Anschluß über die Ansage-TS gesperrt ist, wird der Anruf über den Ausgang der I. AS-Stufe nach dem Identifizieren auf ein bestimmtes Ansagegerät in der OVSt umgeleitet. Am Ende des ersten Rufes wird von der I. AS-Stufe der Gesprächszustand sofort veranlaßt. Der Teilnehmer hört dann die bereits erwähnte Standardansage. Auch diese Ansage ist wie die Rufnummernansage gebührenfrei und wird erst mit dem Auflegen des Handapparates durch den Teilnehmer ausgelöst. Telefonbau Anmerkung
der
und
Normalzeit
Redaktion
Die Entwicklung des Verfahrens wurde unter weitgehender Verwendung bereits vorhandener und bewährter technischer Einrichtungen durchgeführt. In ca. 1V/sa Jahren wurde in einer Gemeinschaftsentwicklung zwischen dem FTZ und den Firmen Siemens AG, Standard Elektrik Lo-
430
\
ZLAI vonewulojumzıny renz AG und Telefonbau und Normalzeit GmbH die am 8.11.1973 im FTZ Darmstadt der Presse vorgestellten Lösung realisiert. Nach erfolgreichem Betriebsversuch kann diese Technik ab 1975 verwendet werden. Die vorstehende Kurzbeschreibung hat uns die Firma Telefonbau und Normalzeit freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Wir bitten unsere Leser, daraus keinerlei Schlüsse hinsichtlich der Bewertung der Entwicklungspartner zu ziehen. Aus terminlichen Gründen konnten wir keine gemeinsam verfaßte Darstellung der Beteiligten mehr erstellen lassen.
Kurzinformation
über das Fernmeldetechnische Zentralamt
1. Allgemeines Das Fernmeldetechnische Zentralamt (FTZ) ist die größte zentrale Mittelbehörde der Deutschen Bundespost. Ihr Zuständigkeitsbereich ist das Bundespostgebiet. Den Kern der Zentralamtsaufgaben bilden die Vorarbeiten für die Leitungsentscheidungen des Bundesministeriums für das Post- und Fernmeldewesen über die technische, betriebliche und verwaltungsmäßige Weiterentwicklung des Fernmeldewesens in der Bundesrepublik Deutschland. 2. Aufgabenbereiche 2.1. Steuerung der Entwicklung neuer Einrichtungen Fernsprech-, Telegrafen- und Funktechnik.
der
2.2. Zentrale Planung, Organisation und Lenkung des Fernmeldebetriebes 2.3. Zentrale Beschaffung (Vergabevolumen im Rj. 1971: 3,2 Mrd. DM; 1972: 3,6 Mrd. DM). 2.4. Vertretung der Fernmeldebelange in über 100 technisch-wissenschaftlichen Gremien des In- und Auslandes (ca. 80 Experten des FTZ sind Berichter oder Mitberichter in Studienkommissionen des „Internationalen Beratenden Ausschusses für den Fernsprech- und Telegrafendienst“
431
Fachbeiträge oder des „Internationalen Beratenden Ausschusses für den Fernsprech- und Telegrafendienst“ oder des „Internationalen Beratenden Ausschusses für den Funkdienst“). 2.5. Zentrale Ausbildung im Fernmeldewesen (jährlich ca. 180 Ausund Fortbildungslehrgänge für insgesamt 6300 Diplomingenieure, Ingenieure und Techniker aus dem
ganzen
Bundesgebiet).
2.6. Nachrichtentechnische Forschung (wahrgenommen in eigenem Forschungsinstitut, zu dessen Personalkörper nicht weniger als rd. 100 Wissenschaftler und ebenso viele Ingnieure gehören; Gesamtausgaben für die Forschung 1971: 23 Mio. DM). 3.
Gegenwärtige
—
Entwicklung ten
Schwerpunktsaufgaben
und
Einführung
Wählsystemen
für
Dateldienste
der
digitalen
von
elektronisch
Fernsprech-,
gesteuer-
Telegrafen-
und
—
Erprobung
—
Einführung eines einheitlich integrierten elektronischen Datenverarbeitungssystems für alle Dienstzweige des Fernmeldewesens (Milliardenprojekt!)
Übertragungsverfahren
—
Vermehrter Einsatz von Nutzsatelliten (Intelsat-Programme, deutsch-französischess Gemeinschaftsprojekt „Symphonie“)
4. Personaldaten Personalbestand Struktur:
Von
den
(Stand
Beamte Angestellte Arbeiter Beamten sind Akademiker graduierte
432
31. 10.1973):
über
2200
1 306 154 158
59 %/o 34 %/o 7°%/o
2 218
100 °/o
Ingenieure
186 352
Kräfte
(darunter 157 Diplomingenieure) Referat
Öf
des
FTZ
taschenbuch der fernmelde-praxis
Gesamt-Inhaltsverzeichnis der
Jahrgänge 1964 bis 1974
15 Fernmelde-Praxis
433
Ordnungssystem Math., physik. Akustik
] | Grundlagen
? | Allgemeine Themen
Grundlagen
1.1. 1.2.
Verkehrstheorie
1.3,
Netzplantechnik
1.4.
Entwicklungstendenzen Zuverlässigkeit
2.1
Umweltbedingungen passive
Bauelemente
Relais, Schalter, Wähler, Koppelfelder
3.
elektronische
3.3,
Bauelemente
Apparate der Fernmeldetechn.
7
| Vermittlungstechnik
Übertragungstechnik Funk
und Draht
4.2,
Magnetische öffentliche
‘ x
Speicher 4.3,
Netze
5.1.
Sondernetze Planung,
5.2,
Beschaltung
Grundlagen,
5.3.
Begriffe
Ortsvermittlungstechnik Fernvermittlungstechnik
6.1. 6.2. 6.3.
rechnergesteuerte Fernsprechvermittlungstechnik
6.4.
Vorfeldeinrichtungen
6.5.
Sprechstellen-, technik
6.6.
Nebenstellen-
Daten- und Telegrafenvermittlungstechnik Grundlagen,
Begriffe
NF- und TF- Übertragungstechnik Ton- und Fernsehübertragungstechhn. Puls-
Code-
Modulations- Technik
Richtfunkübertragungstechnik Daten-, Telegrafen-, Fernwirkund Faksimileübertragungstechnik Fernmeldesatellitentechnik
Übertragung auf Hohlkabelund Lichtwegen
I. =
E
Fernmeldenetze
Funktionsgruppen
3.4,
-]
5
Digitale Schaltkreistechnik
4.1.
ano N
L
Schaltungsgrundlagen
an
Bauteile,
mn
Bauelemente, Apparate
—]
3
für
Inhaltsverzeichnis Grundlagen, feste
8
Funk-
und Fernsehtechnik
Begriffe,
bewegliche
Aufbau
techn.
'
Einrichtungen
8.3.
und Umsetzer
8.4.
Antennen und Energieleitungen
8.5.
Funkkontroll- und Funkstörungs-Meßdienst
8.6.
Vermittlungstechnik , Übertragungstechnik
9.1. 9.2.
Funktechnik Begriffe Tinienfechnik inientechni
10] schutzmaßnahmen
111]
[12]
10.1.
Netzplanung
(Orts-
u.
Bauweisen,
Fernmeldezeug
Verzweigungseinrichtungen
4%
10.5.
Technik
und Betrieb
Datenverarbeitung
Grundlagen, Hardware
Grundlagen,
13]
Fernmeide
°
-Meßtechni
11.1.
11.2.
Begriffe
Meßtechnik
12.1. 12.2. 12.3,
Begriffe in der Ver-
mittlungstechnik
13.1, 13,2.
Meßtechnik in der Über- 13.3.
tragungstechnik
Meßtechnik in der Funkund Fernsehtechnik
13.4,
Technischer
Fernmeldebetrieb
AAN
Fernsprechbetrieb
14
Fernmeldegebäude
14.1.
Daten- und Telegrafenbetrieb
14.2.
Übertragungsbetrieb
14.3.
Funk- Übertragungsbetrieb
14.4.
Hochbau
| 5|
10.4.
10.6.
Starkstromschutz
1de-Meßtechnik
10.3,
Korrosions- und Starkstromschutz in der Linientechnik
versorgung
F
10.2.
Inneninstallation
Software
3
Fern-)
Kabel-, Abschluß- und
Fernmeldestrom-
8.1. 8.2.
Funkdienste
Fernsehsender
9
Frequenzen
Funkdienste
Haustechnik
15.1. 15. 2,
Maschinentechnik
15.3.
Blitzschutz
15.4.
Grundlagen
Jahrgang
1.1. Mathematische,
physikalische
Seite
Grundlagen
Wechselstromlehre und komplexe Rechnung ......ecceseeseonensnrsnerernr nen Maßeinheiten der Elektrotechnik ........ Größen, Beziehungen und Einheiten der Fernmeldetechnik .....c.:.ereeseenennnne Empfehlungen für die Abfassung von technischen Veröffentlichungen ..........
1964 1970
19 21
1972
21
1974
75
1965
43
1969
39
1972
39
1964
111
1965
215
1966
227
1967 1967
173 207
1971
229
1.2. Akustik Elektroakustik — Begriffe und Definitionen — Sprachwandler — Schallsynthese und -analyse ............. Fernsprech-Akustik — Grundbegriffe — Spracherzeugung und -wahrnehmung —
Übertragungsgüte
Begriffe Akustik
—
Verständlichkeit
...
und Erläuterungen aus der ...20esereeneenertenenen nennen une
1.3. Verkehrstheorie Verkehrstheorie — Begriffe und Definitionen — Mischungstechnik — Formeln und Tabellen .........c.sccce... Verkehrstheorie — Begriffe und Definitionen — Mischungstechnik — Formeln und Tabellen ................... Bemessung von Schaltgliedern und Leitungen ......ccseceesenesenennenr nenn ne Bemessung von Schaltgliedern und Leitungen ......cceccsceeesseenennnn nennen Ermittlung von Planungsverkehrswerten Verkehrstheorie — Verlustberechnung — Mischungen — Verkehrsteste — Bemessung von Leitungen und Koppelanordnungen .....:.:2.2220cre re 1.4.
436
Netzplantechnik
Allgemeine
Themen
Jahrgang
Seite
2.1. Entwicklungstendenzen Zukunftsentwicklung der Fernmeldetechnik — Eine Einführung .............. Entwicklungstendenzen der Fernmeldetechnik — Zukunft des Fernverkehrs .... Entwicklungstendenzen der Fernmeldetechnik — Zukunftsprobleme der Teilnehmerversorgung ........2.cscsrsr00 Einige Voraussetzungen für das Bildfernsprechen — Allgemeine —, Technische —, Wirtschaftliche ............ Entwicklungstendenzen — Breitbandnetze der Zukunft .......2ceeeeeeeeenenenn
1971
195
1972
439
1973
23
1973
39
1974
23
1968
21
1969
21
1970
124
1971
187
2.2. Zuverlässigkeit Zuverlässigkeit in der Fernmeldetechnik (I) — Definitionen — Begriffe — Technisch-mathematische Erfassung — Einflußfaktoren .....eceeereeeeeeeeneneunn Zuverlässigkeit in der Fernmeldetechnik (II) — Klassifizierung von Bauelementen und Geräten — Zustandsschema — Zustandswahrscheinlichkeiten . Zuverlässigkeit in der Fernmeldetechnik (III) — Stichproben — Verkürzte Prüfzeit — Erhöhung der Prüfzeit ....... Begriffe und Erläuterungen zum Thema „Zuverlässigkeit“ ......ceeseeeeeseeeenenen 2.3. Umweltbedingungen
437
Bauelemente,
Bauteile,
3.1. passive
Bauelemente
3.2. Relais,
Schalter,
Apparate
Wähler,
451
1973
223
1964
69
1970
536
1965
415
1966
339
der Fernmeldetechnik
Fernschreibapparatetechnik — mechanischer Fernschreiber — techn. Daten von Schreibern und Lochstreifengeräten .........--..ce.0r.0 Fernschreibapparate (überarbeiteter Inhalt des Jg. 1965) .....22-2cccseneeencn
438
1964
Bauelemente
Daten der wichtigsten WeitverkehrsTöhren ....e:2c000e essen ernennen nn nn Halbleiterbauelemente in der Fernmeldetechnik — Halbleitermaterial — Halbleiterdioden — Transistoren ............. 3.4. Apparate
Seite
Koppelfelder
Eine Neukonstruktion des NummernSchalters ....eeceseensernerennne nennen ne Die Weiterentwicklung der Schaltglieder der Fernvermittlungstechnik (Inland) .... 3.3. elektronische
Jahrgang
Digitale
Schaltkreistechnik
Jahrgang
Seite
1971
517
1972
489
1972
451
4.1. Schaltungsgrundlagen Digitale Schaltungen in der Fernmeldetechnik — Schaltungsgrundlagen ........ Digitale Schaltungen mit integrierten TTL-Bausteinen — Tips für den Praktiker 4.2. Funktionsgruppen Digitale Schaltungen in der technik — Funktionsgruppen 4.3. magnetische
Fernmelde............
Speicher
439
Fernmeldenetze 5.1. Öffentliche
Jahrgang
Seite
1965 1966 1966 1974
395 315 341 276
1966
389
1968
497
1969
253
1969
321
1972 1974
254 359
1972
393
Netze
TelexnetzZz ...cosoroooeoernunn nenn n nennen nn Telexnetz ....oerornsenenen nee nennen nenn. Bild- und Faksimilenetze .......cccerer0. Öffentliche Datenübertragungsnetze ..... 5.2. Sondernetze Fernwirknetze .....ceeoeconnrenernnnne nen Fernsprechanlagen der Elektrizitäts-Versorgungsunternehmen — Netzgestaltung — Aufbau der EVU-Anlagen — Netzgruppenverkehr — Dämpfungsplanung — Abzweigleitungen — rechtliche Bestimmungen ......secseeseesensennnnnne Fernsprechsondernetze — TeilnehmerNetzgruppen mit Wählunterlagen — Querverbindungsnetze — verbundene Fernsprechsondernetze ........rserercru0. Fernschreib- und Datensondernetze — Gliederung der Netze — Netzprojektierung — Anschlußtechnik .............. Fernschreib- und Datensondernetze — Netzgestaltung — Vermittlungs- und Knoteneinrichtungen — Anschlußtechnik. Einheitliche Notruftechnik ......:......... 5.3. Planung,
Beschaltung
Beschalten des Fernliniennetzes — Begriffe — Planung — Beschaltung
440
......
Vermittlungstechnik 6.1. Grundlagen,
Jahrgang
Seite
1964 1964
154 200
1965 1965 1965 1966
255 290 261
1970
3l
1971
21
1972
85
1964
141
1965
182
1966
89
1967
65
1968
205
1969
197
Begriffe
Begriffe der Ortsvermittlungstechnik .... Begriffe der Fernvermittlungstechnik ... Verkehrsmessungen — Meßdauer — Meßverfahren .......cseeeeserenoneennenne Begriffe der Ortsvermittlungstechnik .... Begriffe der Fernvermittlungstechnik ... Begriffe aus der Nebenstellentechnik .... Begriffe und Erläuterungen aus der Fernsprech-Vermittlungstechnik ......... Begriffe und Erläuterungen aus der Fernsprech-Vermittlungstechnik ......... Impulskennzeichen 50 und sonstige Zeitbedingungen der FernsprechVermittlungstechnik .....ceeesseresenrnne 6.2. Ortsvermittlungstechnik Ortsvermittlungstechnik — Fernsprechhauptanschlüsse — Vorfeldeinrichtungen — Ortsvermittlungssysteme — Schaltglieder — Schaltkennzeichen — Begriffe — Verbindungsverkehr .......c.sccerc0r. Ortsvermittlungstechnik (überarbeiteter Inhalt von Jg. 1964) — Planung von OVStn Ortsvermittlungstechnik — Planung und Aufbau von OVStn — Einrichtung einer VollVSt mit S55 v — Aufbauunterlagen für OVSt S55V ....oncneeennerenenenennnn Ortsvermittlungstechnik (Kurzfassung aus früheren JENn.) ....:ceceeeeersenreeenee nn Ortsvermittlungstechnik (überarbeiteter Inhalt früherer Jg.) .....scccresecserenee Planung und Aufbau von FernsprechOVStn — Rufnummernplanung für ein ON — Wählsystem 55 v — Planungsbeispiel für ein OVSt S5E5V ....cccccc0n
441
Vermittlungstechnik
Jahrgang
6.3. Fernvermittlungstechnik
Inland
und
Ausland
Fernvermittlungstechnik, SWFD — Kennzahlenplan — Leitweglenkung — Gebührenerfassung — Übergangstechnik — Fernwahlsystem 62 — Handbediente Systeme ...sorerssenreennner een n nn nenne Fernvermittlungstechnik, SWFD — handbediente Systeme — SWFD vereinfachter Technik — Auslandstechnik — Statistik ...ce0r00cceseennnnnene en een nn. Fernvermittlungstechnik — Planung von FernVStW — Einrichtung einer KVStW— Aufbauunterlagen — SWFD nach dem Ausland ......ceeeeseneenneennneene nun n nn Fernvermittlungstechnik (Kurzfassung aus früheren JEN.) ....cerrereeeennennenun. Fernvermittlungstechnik-Auslandsverkehr Verbindungsaufbau — Schaltglieder ..... Wirtschaftliche Bemessung der Verbindungswege von Wählnetzen mit Leitweglenkung ......cec0eessenennnnnnen Prüftechnik in Fernvermittlungsstellen mit Wählbetrieb (FernVStW) ............ Die Weiterentwicklung der Schaltglieder der Fernvermittlungstechnik (Inland) — Technisch-betriebliche Forderungen — Leitungs- und Gabelsätze — Schaltglieder für Leitweglenkung und Verzonung ..... 6.4. Rechnergesteuerte
1964
169
1965
319
1966
149
1967
135
1967
231
1970 1971
285 204
1971
264
1973
223
Fernsprechvermittlungstechnik
Merkmale der zukünftigen elektronisch gesteuerten Fernsprech-Vermittlungssysteme — EWSO1 — EWSF1 .......... Versuchsvermittlungsstellen mit dem elektronisch gesteuerten Ortswählsystem 1 (EWSO 1) — Systemkonzept — Bedienungsrechner — Versuchsvermittlungen .......ccssseeerersennren nen
442
Seite
1972
65
1973
267
Vermittlungstechnik
Jahrgang
Seite
1964 1965
142 282
1970
311
1972
139
1972 1973
157 164
1964
229
1966
261
1967
21
1969
93
1971
307
6.5. Vorfeldeinrichtungen Vorfeldeinrichtungen .........::2ccceec0.. Vorfeldeinrichtungen ......cscressoonneennn Die gebräuchlichsten Gemeinschafts- und Wählsternanschlüsse der DBP — Koppelelemente — Gemeinschaftsanschluß 53 — Wählsterneinrichtung 53, 62 und 63 ...... Praxis der Störungsbeseitigung bei der Wählsterneinrichtung 63 .......cscssc00.. Aufbau und Wirkungsweise der Wählsterneinrichtung 4/20 ....o.zcorseeecscnnne Unterhalten von Wählsterneinrichtungen 6.6. Sprechstellen-,
Nebenstellentechnik
Nebenstellentechnik ......:seesenereenenn Fernsprech-Nebenstellentechnik — Begriffe — Reihenanlagen — handbediente Vermittlungseinrichtungen — Wählanlagen ........220ccessenessennnen en Sprechstellentechnik — Apparate mit Impulswahl — Tastwahl — ZB-OBApparate — Hör- und Sprechkapseln — Zusatzeinrichtungen . ......ccscrcsserece. Sprechstellentechnik (überarbeiteter Inhalt von Jg.1967) .....»zreceocconenncns Fernsprech-Nebenstellenanlagen mit zentraler Steuerung — CrosspointTechnik — MULTIREED-Anlagen — HERKOMAT-Anlagen ......ceesccecscnen
443
Vermittlungstechnik 6.7. Daten-
und
Jahrgang
Seite
Telegrafenvermittlungstechnik
Fernschreibvermittlungstechnik — Kennzahlen — Netzgestaltung — Leitweglenkung — Gebührenerfassung — Schaltkennzeichen ......:.cescseeresreren Fernschreibvermittlungstechnik — Telexnetz — Verkehrslenkung — Vermittlungssysteme .......22c0c0rsc en Telegrafenvermittlungstechnik (überarbeiteter Inhalt von Jg. 1965) ............ Telegrafenvermittlungstechnik — Datenübermittlung im Telex- und Datexnetz .....ccoscenesn orten nennen nn nenn Telegrafen- und Datenvermittlungstechnik (überarbeiteter Inhalt von Jg. 1967) — Fehlererkennungsverfahren ............ Das Elektronische Datenvermittlungssystem (EDS) — Leistungsmerkmale — Aufbau — Struktur — Programme — Bedienung — Konstruktion .............. Planung und Aufbau von EDS-Vermittlungsstellen — Konfiguration — Anschlußtechnik — Konstruktion — Stromversorgung — Aufbau — Belüftung — Bemessung ....vceescsucreertentennnene
1964
245
1965
395
1966
315
1967
249
1968
253
1972
184
1973
295
Übertragungstechnik Funk 7.1. Grundlagen,
und Draht
Übertragungs-
Seite
1964
3
1965
21
1966 1966 1968
421 459 37
1969
77
Begriffe
Übertragungstechnik — Leitungstechnik — Kabeldaten — Übertragungsgrößen — Pegel — Dämpfung — Geräusch — Verzerrungen ....eseneeenenenurernennennnn Übertragungstechnik — Leitungstechnik — Begriffe — Schaltung von Wechselstromwiderständen ......e.eseeneneereneen Übertragungstechnik — Leitungstechnik — Übertragungsgrößen — Begriffe — Wechselstromwiderstände ...........e.0.. Begriffe und Definitionen der TF-Technik Fernmeldefernleitungen .....cec.sccsce.. Grundbegriffe der Übertragungstechnik — Pegel — Dämpfung .........:.cccccc00. Begriffe und Erläuterungen aus der Datenübertragungs- und Fernschreibtechnik .....2220ss000senes onen nenen een en Begriffe und Erläuterungen aus der Faksimileübertragungstechnik ........... Begriffe und Definitionen aus der Einige
Jahrgang
und Meßtechnik
Verfahren
zur besseren
..........
Aus-
nutzung des Übertragungsweges beim
Fernsprechen .....:»zsseeseseesornenennune Begriffe und Erläuterungen aus der Übertragungs- und Meßtechnik ..........
1970
49
1970
66
1970
76
1970
490
1971
12
Übertragungstechnik 72
NF-
und
Funk
und Draht
Jahrgang
Seite
TF-Übertragungstechnik
NF- und TF-Übertragungssysteme —
Übertragungsbedingungen — Allverstärker — Zweibandsysteme — TF-Systeme — Leitungsbezeichnungen ... NF- und TF-Übertragungssysteme — Bedingungen an Fernsprechkreis — NF-Verstärker — TF-Technik — TF-Systeme .....22eesseeseonerennnennn nenn NF- und TF-Übertragungssysteme (erweiterter Inhalt von Jg. 1965) — Vertikalbauweise .....222eeseererennnnnne NF- und TF-Übertragungssysteme — TF-Systeme nach CCITT — Beschalten der TF-Systeme — NF-Sprechkreise — Übertragungsgrößen ......ercsreereren en
NF- und TF-Übertragungssysteme
(erweiterter Inhalt von Jg. 1967) ......... Übertragungsqualität im FernsprechWeitverkehrsnetz — Netzaufbau — Qualitätsforderungen — Meßmethoden und Auswertungsverfahren — Untersuchungsergebnisse ......ercrrescne. Dämpfungs- und Stabilitätsprobleme im nationalen Fernsprechnetz — Bezugsdämpfung — Struktur des Netzes — Stabilität — Betriebsarten ..........:..... Fernsprechnetzgestaltung unter Berücksichtigung des Dämpfungslanes55 ....... Zentrale Betriebsüberwachung des TF-Netzes ....22ceeceneernenseenernnnn nenn Automatische Ersatzschaltung von Primär- und Sekundär-Gruppen ......... Die Frequenzgenauigkeit in der Trägerfrequenztechnik ................0. .
1964
41
1965
5l
1966
447
1967
407
1968
41
1969
423
1973
201
1974
158
1974
176
1974
227
1974
212
Übertragungstechnik 7.3. Ton-
und
Funk
und
Draht
Jahrgang
Seite
Fernsehübertragungstechnik
CCITT-Empfehlungen über RundfunkSySteme ...ucueeeeenee een en e nn nennen en en Grundlagen der Tonübertragungstechnik — Programmpegel — Pegelpläne — Meßpegel — Übertragungsbereich — Übertragungsgüte ......occcesereerenentnn Das TF-Tonkanal-System 68 für monound stereophonische Tonübertragung — Frequenzumsetzungsplan — Pegelplan — Entzerrung — Geräuschminderung — Pilotregelung ..........serorceeneesneennnn Rechnergesteuerte Tonleitungsschalteinrichtung .......cercesereenesenenerenne
1964
67
1965
103
1971
371
1974
251
1970
515
7.4. Puls-Code-Modulations-Technik Puls-Code-Modulationstechnik — Digitalübertragung durch PCM — Bildung des Zeitvielfaches — Aufbau- und Merkmale von PCM-Systemen ...........
447
Übertragungstechnik
Funk
und Draht
Jahrgang Seite
7.5. Richtfunkübertragungstechnik Richtfunktechnik — Empfehlungen — Richtfunksysteme — Systembegriffe — Antennen
—
Frequenzraster
—
Energieleitungen — Planung und Berechnung von Rifu-Verbindungen ..... Richtfunktechnik — Selbsttätige Ersatzschaltung von Geräten und Leitungen (überarbeiteter Inhalt von Jg. 1964) ...... Richtfunktechnik — Gerätetechnik — Zusatzeinrichtungen
—
Frequenzraster
71
1965
131
1967
437
1968
95
1972
314
1974
375
—
Richtfunkantennen — Energieleitungen — Betriebsgebäude ......z.2e2ucseeesennr nn Planung und Berechnung von Richtfunkverbindungen — Planungsgrundlagen — Funkfelddämpfung — Störgeräusch — Frequenzplanung — Richtfunkgrundleitungen .......2c.20scnesresnnnernne Planung, Berechnung und Aufbau von Richtfunkverbindungen — Empfehlungen — Systemdämpfung — Geländeschnitte — Geräusche — Richtfunksysteme ....... Netz- und Frequenzplanung für Richtfunknetze ........2e20ceusessesnenrne
448
1964
Übertragungstechnik
Funk
und
Draht
7.6. Daten-, Telegrafen-, FernwirkFaksimileübertragungstechnik
Seite
1964
233
1965
381
1966
361
1966
389
1967
259
1967
281
1968
267
1968 1969
283 341
und
Fernschreibtechnik — Begriffe — T-Übertragungssysteme ....2ccccceeeene Telegrafenübertragungstechnik — Begriffe — Übertragungssysteme — Bauarten ...o2o2c0eeenonnnene nn en en eu nun Telegrafenübertragung, Datenübertragung — digitale Übertragung — T-Übertragungssysteme — Anschlußtechnik an T-Leitungen ........ceresec.0. Fernwirktechnik — Verfahren und Methoden — Fernwirknetze — Fernwirkanlagen und -geräte ......vsccerereennenn Datenübertragung über T-Leitungen — Anschlußtechnik — digitale Übertragung — WT-Netz — Betriebsverfahren ........ Datenübertragung über Fernsprechleitungen — Begriffe — Aufbau eines DU-Systems — Betriebsverfahren — Fehlerschutzverfahren — Datenübertragungsgeräte (DÜE) ......er.rc200.. Bild- und Faksimile-Übertragungstechnik
— Prinzip der Übermittlung — Arbeits-
weise der Geräte — technische Daten .... Datenübertragung auf Fernsprechleitungen (erweiterter Inhalt von Jg. 1967) — Eigenschaften der Leitungen — Pegelplan .......ceseeceneerereeneenne nn Bild- und Faksimilienetze ........:.:c.22..: Datensammelsysteme mit Modems D20P — Systemarten — Außenstation D20P-A — Zentralstation D20P-Z ......sseeserese Fernschreib- und Datenendgeräte bis 200 bit/s ...2222ceeeneeneeeennee nennen nenne Datenübertragung über Breitbandstromwege — Leitungsarten — Übertragungstechn. Forderungen — Aufbau der
Übertragungswege
Jahrgang
— Breitbandmodems
.
1969
373
1970
341
1970
347
449
Übertragungstechnik
Funk
und Draht
Jahrgang Seite
Begriffe und Erläuterungen aus der Datenübertragungs- u. Fernschreibtechnik Übertragungssysteme für Telegrafenwege — Systeme — Kanäle — Einrichtungen — WT 1000 — Datenumsetzer — Anschlußtechnik ......s2esereereesrnnennn Faksimileübertragung auf Fernmeldewegen — Telefoto — Telefax — Pressfax Modems der DBP für Fernsprechwege — Schnittstelle — Modem D200S, D1200S, D2400S, D20P-Z, D20P-A ........scccc000. WT-Ersatzschaltungsverfahren ........... Anschlußtechnik für Fernschreib- und Datenanschlüsse an das EDS ............. Anschluß von Fernschreib- und Datenstationen ........seesereeerenennenen Automatischer Datenverkehr im öffentlichen Fernsprechnetz ............. 7.2.
106
1972
205
1972
266
1972 1973
277 327
1974
315
1974
286
1974
342
1964
409
1964
431
1970
457
Fernmeldesatellitentechnik
Fernmeldeübertragung über künstliche Satelliten — Zweck — Arten der
Satelliten — Übertragungsfragen
........
Endefunkstelle Raisting — Antenne — Übertragungsanlagen ........:-ereeccccc Satelliten-Fernmeldeverbindungen — Passive — Aktive Satelliten — Modulationsverfahren — Flugbahnen — Synchronsatelliten — Lagestabilisierung . 7.8. Übertragung Stand
450
1971
der
auf Hohlkabel-
Hohlkabeltechnik
und
Lichtwegen
.............
1974
38
Funk-
und
Fernsehtechnik
8.1. Grundlagen,
Begriffe,
der
Funktechnik
..........:::s22220.
Aufteilung der Frequenzbereiche von 10 kHz bis 40 GHz in der BRD ........... Begriffe und Erläuterungen aus der Funktechnik (mit Richtfunktechnik) Begriffe und Erläuterungen aus der Fernsehtechnik .......seeccseeesseeerennn Bezeichnung der Frequenz- und Wellenbereiche ......„zscsoeseserennennne Physiologische Voraussetzungen für die Übertragungstechnik beim Fernsehen 8.2. Feste
Seite
1965
499
1968
181
1970
106
Frequenzen
Funkdienste in der BRD — Fernmeldehoheit im Funkwesen — Arten der Funkanlagen — Frequenzbereiche — Arten der Funkdienste — Funküberwachung ..........2ceccreen Funkdienste — (überarbeiteter Inhalt von Jg. 1965) Begriffe und Erläuterungen aus
Jahrgang
1970
399
1971
140
1971
168
1972
36
1972
49
1968
163
Funkdienste
8.3. Bewegliche
Funkdienste
Ein Verfahren zum Einsatz der UKWFrequenzen im beweglichen Landfunkdienst .....:2o2coneeneeseenneenerenenenenn
451
Funk8.4.
und
Fernsehtechnik
Fernsehsender
und
Seite
1964 1964
291 441
1965
465
1965 1966
487 509
1966
549
1967 1968
503 141
1970
415
1970
440
1971
488
1974
392
Umsetzer
Fernsehsendertechnik — Deutsche Fernsehnorm — Fernsehsender 1., 2. u. 3. Programm — Typen der Fernsehsender im Bereich IV/V .... Farbfernsehtechnik .........ssercreenene: Fernsehsender — Bildsender — Tonsender — Kontrollgeräte — Antennen .....ccerceerescncnnnen Fernseh-Frequenzumsetzer — Übertragungsbedingungen für Umsetzer, für Bild, für Ton — Antennen .......... Aufbau von Fernsehsendern der DBP .. Aufbau von Füllsendern (Frequenzumsetzern) für das 2. und 3. FernsehProgramm ....u0creenenerens rennen en Fernseh-Füllsender (Frequenzumsetzer) der DBP ......eereeeeeenneneeneenerenenne Fernsehsender der DBP .......serrccr.. Fernsehsender für das I., II. und III. Programm .......cssscsseensernn rn Fernsehumsetzer mit transistorisierten Vorstufen — Vor- und Nachteile — Aufbau — Ausblick .....:22eeeceeenereren Kleinst-Fernsehumsetzer — Modell — Einsatzmöglichkeiten — Meßtechnik .... Rf-Frequenzversatz für Fernsehkanalsignale ....2ceecceseeesrsenenen een
452
Jahrgang
Funk-
und
Fernsehtechnik
8.5. Antennen
und
Seite
Energieleitungen
Antennen und Energieleitungen der Rifu-Technik ........2:ccccoceeereeen Antennen und Energieleitungen der Rifu-Technik .........zceecesssenercen Fernsehsendeantennen ...e..srreecrrn00. Antennenanlagen .....sesseneeesrereeennn Antennen von Füllsendern für das 2. und 3. Fernsehprogramm ........serc:00. Richtfunkantennen und Energieleitungen Grundbegriffe der Antennentechnik — Anpassung — elektr. Länge — Strahlungswiderstand — Strahlungsdiagramme — Gewinn — Begriffe ...... Grundbegriffe der Antennentechnik ..... 8.6. Funkkontroll-
Jahrgang
und
1964
81
1965 1965 1966
142 482 542
1966 1967
554 471
1973 1974
405 409
Funkstörungs-Meßdienst
Funkstörungsmeßdienst — Organisation— Aufgaben — Meßverfahren — FunkStÖrungsgrenzwerte ...2uceeneeernenenenen Der Funkkontrollmeßdienst — Grundlagen — Aufgaben — Organisation ......
1969
567
1971
460
453
Aufbau
technischer
Einrichtungen
Jahrgang
Seite
1966 1966
103 191
1969
167
1974
101
1966 1967
499 447
..
1966
509
....:000sereennereernenene nenne
1966
549
9.1. Vermittlungstechnik Aufbau von OVSt mit S55V ....cccc... Einrichtung einer KVStIW .............. Amtsbautechnik für Vermittlungsstellen — Betriebliche Anforderungen — Typenhäuser Fe — Normengebäude FeN — Typenreihe .......ccceseererseeneeeenn en. Neuerungen in der Aufstellung und Verkabelung von Fernvermittlungsstellen 9.2. Übertragungstechnik Vertikalbauweise für Gestelle der Übertragungstechnik .....2escseeersernersnnnn Geräteaufbauplanung im Richtfunk .... 9.3. Funktechnik Aufbau von Fernsehsendern der DBP Aufbau von Füllsendern (Frequenzumsetzern) für das 2. und 3. Fernseh-
PTIOgTamm
Linientechnik,
Schutzmaßnahmen
Jahrgang
Seite
10.1. Begriffe Begriffsbestimmungen der Fernnetzplanung ......cseecsenrsenesnenenennen nenne Begriffe und Erläuterungen aus der Linientechnik .........:c.s.cces0.. 10.2. Netzplanung
Orts-
und
355 39
1964 1965
259 429
1966
21
1967
39
1967
355
1964
259
1965
429
1966
49
1968
361
1970
178
1970
205
Fernnetz
Ortsnetzplanung — Baulängen — Anschlußnetz — Leitungsdichte — Ausbauabschnitte .......o:2ee0s0senennene Ortsnetzplanung — (Inhalt wie Jg. 1964) . Ortsnetzplanung — Bedingungen — Ortsnetzstrukturen — Bedarfsschätzungen — Entwicklungsplanungen — Ausbauplanungen ....ececcersesreeneenen nennen Ortsnetzplanung — (überarbeiteter Inhalt des Jg. 1966) „2.222 oeeeneneeeeneenennn nee Bezirksliniennetzplanung — Begriffsbestimmungen — Ausbauplanung — Unterlagen der Netzplanung ............ 10.3. Bauweisen,
1967 1971
Fernmeldezeug
Linientechnik — Dämpfungsplan 55 — unterirdischer und oberirdischer Linienbau — Kabelkanalanlagen — Muffen .... Linientechnik — (überarbeiteter Inhalt des Jg. 1964) ...... Linientechnik — unterirdischer und oberirdischer Linienbau .......cceerr0.. Kabelkanäle aus PVC-Rohren — Bauteile — Hilfsmittel — Planung — Herstellung Kabelschächte in Kabelkanalanlagen — Anforderungen — Aufbau — Bauweisen — statische und dynamische Beanspruchung .......2.cseeesrereenennnn Gasansammlungen in Kabelkanalanlagen — Gefahren — Entlüften — Abdichten ..
455
Linientechnik,
Schutzmaßnahmen
Das oberirdische Anschlußnetz — Fernmeldebauzeug — Statik — Wirtschaftlichkeit — Entwicklung ............ Kabelkanäle in Sonderbauweise ........ Trassenfestlegung für Kabelkanäle aus PVC-Rohren ......serceseeesecnnnenn 10.4. Kabel-,
Abschluß-
und
Jahrgang
Seite
1971 1973
342 60
1973
94
Verzweigungseinrichtungen
Ortskabel — Bezirkskabeltypen ........ Ortskabel — Bezirkskabeltypen ........ Kabel, Installationsdrähte, Verbindungsund Abschlußeinrichtungen im Ortsnetz .
1964 1965
270 434
1972
335
1964 1965
289 463
1973
113
10.5. Inneninstallation Sprechstellenbau ........22cecererecnnence Sprechstellenbau ........22sesesseerennne Fernmeldeinstallation in Gebäuden — Kabel — Drähte — Installationseinrichtungen — Einführungen — Einbaubeispiele — Schutzmaßnahmen .......... 10.6. Korrosions-
und
Starkstromnetz
in der
Starkstrombeeinflussung von Fernmeldeanlagen — Grundlagen — Ermittlung der induzierten EMK — Schutzmaßnahmen .. Korrosion und Korrosionsschutz — Substanzverlust durch Korrosion — Ursachen der Korrosion — passiver und aktiver Korrosionsschutz — Meßtechnik — Planungswerte . .....eeerccsesenernenne nee
456
Linientechnik 1968
443
1970
136
Fernmeldestromversorgung 11.1. Technik
und
Seite
1964 1966
341 564
1966
575
1970
479
1971
506
1964
402
1968
443
1968
485
Betrieb
Fernmeldestromversorgung — Betriebsarten — Stromversorgung in Vermittlungsstellen — Bemessung u. Berechnung von Leitungen — Batterien ............ Netzanschluß für Fernseh-Füllsender Fernmeldestromversorgung — (überarbeiteter Inhalt des Jg. 1964) — Stromversorgung der Übertragungsstellen Anwendung der Halbleitertechnik in der Fernmeldestromversorgung ...... Periodische Überlagerungen auf der Versorgungsspannung 60 Volt ............ 11.2.
Jahrgang
Starkstromschutz
Starkstromschutzmaßnahmen in Fernmeldeanlagen ........2c2eesereneseeeenennn Starkstrombeeinflussung von Fernmeldeanlagen — Grundlagen — Ermittlung der induzierten EMK — Schutzmaßnahmen .. Starkstromschutzmaßnahmen beim Errichten und Betreiben von elektrischen Anlagen und Geräten — VDE-Bestimmungan — Schutzmaßnahmen von Gebäuden — Erdungsanlagen ............
457
Datenverarbeitung,
Datenfernverarbeitung
12.1. Grundlagen, Begriffe Elektronische Datenverarbeitung — Definitionen — Grundlagen — Zahlendarstellung — Aufbau eines Digitalrechners — Programmierung — Entwicklungsstand .....seeseceeeeeeeeenn Formen der Betriebsorganisation für elektronische Datenverarbeitungsanlagen Elektronische Datenverarbeitung — (erweiterter Inhalt von Jg. 1967) — Hybrid-Rechner .......c2ceceeceeeeerernn Begriffe und Erläuterungen aus der elektronischen Datenverarbeitung ...... Datenfernverarbeitung — Aufgaben — Systeme — Verfahren — Anwendungen . Die Bedeutung der Dokumentation bei der Bereitstellung von EDV-Anwendungen .. 12.2. Hardware Datenendgeräte bis 200bit/s ............ Aufbau eines programmgesteuerten Digitalrechners ......22eeseeereeeeneen nen Datenendeinrichtungen (DEE) an Modems — Schnittstelle — DEE bis 1200 bit/s — DEE bis 200 bit/s .....2.ceeeeeeeereerenen Datenendeinrichtungen im Datexnetz — Datensicherungsverfahren — DEE bis 200 bit/s .....2.2.22se0eeeeeeenen Datenendeinrichtungen an Modems — (Fortsetzung des Inhalts von Jg. 1968) .. Aufbau eines programmpgesteuerten Digitalrechners ..........2222ceceeeeeren Hybrid-Rechner ...........222ceseeeeseenn Datenendgeräte bis 200 bit/s im Datexnetz Datenendeinrichtungen an Modems — (Fortsetzung des Inhalts der Jg. 1968, 1969) 12.3. Software Programmierung Programmierung
548
Jahrgang
Seite
1967
323
1968
345
1969
389
1971
126
1973
314
1974
58
1967
309
1967
330
1968
305
1968
327
1969
359
1969 1969 1970
399 419 345
1970
361
1967 1969
345 413
Fernmelde-Meßtechnik 13.1.
Grundlagen,
Meßinstrumente
technik — technische
der
Fernmelde-
Kurzzeichen — Sinnbilder — Daten ........cccceeeeeeeeseenn
13.2. Meßtechnik
in
der
1965 1969
87 535
1970
76
1971
72
1973
372
1965
255
1969
523
1971
264
1972
110
1973
150
1973
244
Vermittlungstechnik
Verkehrsmessungen — Meßdauer — Meßhäufigkeit — Meßverfahren ........:.:..... Prüf- und Meßtechnik in Fernschreibund Datennetzen — automatische Prüfeinrichtung TW 39 — Prüfsender Prüfempfänger
Seite
Begriffe
Grundbegriffe der Meßtechnik .......... Einführung in die digitale Meßtechnik .. Begriffe und Definitionen aus der Übertragungs- und Meßtechnik .............. Begriffe und Erläuterungen aus der Übertragungsund Meßtechnik ........ Die
Jahrgang
—
Fernschreibmeßplatz
Prüftechnik in Fernvermittlungsstellen mit Wählbetrieb (FernVStW) — handbediente Prüfgeräte — automatische Prüfeinrichtungen .......2:cescesererennn Geräte für Fernsprechverkehrsuntersuchungen (I) — Verkehrsmenge — Größe — Aufteilung ........:c2ccceecnn. Prüfgerät für die Wählsterneinrichtung 4/20 — Prüfkonzept — Aufbau — Funktionen ........:c.crr.... Geräte für Fernsprechverkehrsuntersuchungen (II) — Verkehrsgüte — Verkehrsbeobachtung — Probeverbindungen
.
459
Fernmelde-Meßtechnik 13.3. Meßtechnik
in
der
Jahrgang Übertragungstechnik
NF- und TF-Meßtechnik — Begriffe — Meßverfahren — Messungen an NF- und TF-Übertragungssystemen ....2se2sc001.Richtfunkmeßtechnik — Sendeleistung — Frequenz — Frequenzhub — Dämpfung — Antennen — Messungen an RifuSyStemen ....e22eereer tens sn n nenne ne Richtfunkmeßtechnik — (überarbeiteter und erweiterter Inhalt von Jg. 1965) — registrierende Messungen .......2cs0rer. Digitale Meßgeräte der Übertragungstechnik — Analog-Digital-Umsetzer — Digitalvoltmeter — Pegelmesser — Frequenzmesser — Kurzzeitunterbrechungsmesser . ......2cc0sccsner0s Moderne TF-Meßgeräte — Aufbau — Beispiele ..oec2oereeererenene nennen een une TF-Meßgeräte und TF-Wobbelmeßgeräte Der Störimpulszähler für Datenleitungen Die Meßgeräte der NF-Übertragungs-
technik — Aufbau — Einsatz — Über-
sicht der Meßgeräte .........c.220cecrs0n. Datenübertragungsmeßtechnik — Problemstellung — telegrafentypische und fernsprechtypische Messungen ...... Neue TF-Meßgeräte .........csccceeescsnn 13.4. Meßtechnik
Meßgeräte
im
in der
Funk-
und
1965
87
1965
191
1969
477
1969
535
1970 1971 1971
382 404 420
1971
426
1973 1974
349 236
Fernsehtechnik
Fernseh-Übertragungs-
betrieb — Prüfsignalgebersatz — Fernseh-Spezialoszillograph — Verzerrungsmeßgerät — Video-Meßgeräte — Laufzeitmesser .....o200000e een neneeen nn Messungen an Antennen der Fernsehfüllsender — Meßverfahren ............ Prüfzeilen im Fernseh-Übertragungsbetrieb — Prüfzeile 17, 18, 330 und 331 — Prüfzeilenauswertung . ....cecccorecseren
460
Seite
1972
364
1973
383
1973
430
Technischer
Fernmeldebetrieb
Jahrgang
Seite
1967 1973
107 164
1973
183
1974
122
1974 1974
138 359
1974
427
1974
176
14.1. Fernsprechbetrieb Fernsprechsonder- und Ansagedienst — Hinweisdienst — Ansagedienst — Notrufeinrichtungen — Auftragsdienst — Entstörungsdienst — Auskunftsdienst Unterhalten von Wählsterneinrichtungen Die Fernsprechentstörungsstelle als kundenorientierte Dienststelle — Organisation — Arbeitsabläufe .......... Das Verfahren der Unterhaltung von Fernsprechvermittlungseinrichtungen
bei
der
DBP
........ccceersesneeeeneennen
Die Fernsprechentstörungsstelle als Partner anderer Dienststellen ........... Einheitliche Notruftechnik ............... Automatische Ansage geänderter Rufnummern ......s2csseeeeessenerreenene 14.2.
Daten-
und
Telegrafenbetrieb
14.3. Übertragungsbetrieb Zentrale Betriebsüberwachung des TF-Netzes .....2c22eceeeerenereen nenn 14.4. Funk-Übertragungsbetrieb
461
Fernmeldegebäude
Jahrgang
Seite
1966
113
1966
512
1966
559
1967
490
1969
167
1972
420
1974
87
1966
573
1969
127
15.1. Hochbau Hochbauten für OVSt ...........222:22200. Aufbau der Fernsehsender in den Betriebsgebäuden .........2reerscreenrnen Betriebsgebäude von Füllsendern für das 2. und 3. Fernsehprogramm ............ Betriebsgebäude und Antennenträger in der Richtfunktechnik ................ Gebäude für Vermittlungsstellen — Typenhäuser Fe — Normgebäude FeN .. Planung von Fernmeldegebäuden — Raumnutzung — Anforderungen — Lüftung .......22:22ceeseeeeeeneneene nenn 15.2. Haustechnik Klimatechnik
betriebsräume 15.3.
für
Fernmelde-
.......cccnneneennneene
Maschinentechnik
15.4. Blitzschutz Erdung und Blitzschutz von FernsehFüllsendern ...........222oeseeeeereeeennn Blitzschutz — Nenngrößen und Auswirkungen des Blitzes — Erdungsanlagen — Gebäude-Blitzschutz — Blitzschutz von Fernleitungen und Kabeln ..............
Vom „taschenbuch der fernmelde-praxis“ gende Jahrgänge lieferbar:
1970 1972 1973
DM DM DM
noch
fol-
11,— 21,— 23,—
Da es sich um Restbestände handelt, Zwischenverkauf vorbehalten.
462
sind
müssen
wir
uns
den
Alles fürden
abelschutz
Welche Aufgaben auch gestellt sind... COROPLAST liefert ein vollständiges Programm für den Schutz, die Kennzeichnung und Verlegung der Kabel und Leitungen. Unsere Marken: COROPLAST und COROTHENE. Materlalproben stehen zur Verfügung — fordern Sie ausführliche technische Informationen an. Isollerbänder zur Kennzeichnung mit VDE-Prüfzeichen Korrosionsschutzbandagen mit VDE-Prüfzeichen zur Bandagierung von Löt- und Endstellen bzw. Vertellungen bei Erdverlegung, ebenso zur Montage von Fernmeldekabeln mit PE-Mantel Warn- und Trassenband als Frühwarnung bei erdverlegten Postkabeln Gruppenringe und Isolierhülsen auf Basis Weich-Polyäthylen nach DIN 47661, Blatt 2 Kabelführungskanäle aus HartPVC sowie Isollerschläuche Er
„COROPLAST” FRITZ MÜLLER KG 56 Wuppertal 2 - Postfach 201130 Telefon (02121) *695-1 - Telex 08591632 cor d
Betonwaren für den gesamten unterirdischen Fernmelde-Kanalbau, sowie für Versorgungs- und Energiebetriebe. Stahlbeton-Fertigschächte eckig und oval, DBP Nr. 912465 und 913165, Sonderschächte, nach den Brückenklassen der DIN 1072. Stahlbeton-Fertigdecken, DBP Nr. 804665, Schachtabdeckungen viereckig und dreieckig mit Grauguß- bzw. Stahleinfassungen nach den Brückenklassen der DIN 1072. Kabelverteiler-Gehäuse aus Kunstgranit, Sockel für Schaltschränke aus Kunststein oder Kunststoff, Endverteilersäulen, Abzweigkästen, Kabelkanal-Formsteine, Kabel-Abdeckplatten, Schalterwangen für Umspannanlagen.
FRANZ KOHLER [7 7 4 HAMBURG
BERLIN
BETONWERK
2000 NORDERSTEDT
1
Schützenwall 19-23 Telefon (040) 5 25 20 21
1000
BERLIN
52 (Reinickendorf)
Auguste-Viktoria-Allee 12-13 Telefon (030) 4121027 464
Bezugsquellen-Nachweis der Nachrichtentechnik Für Maschinen und Bedarfsartikel, die hier nicht aufgeführt sind, weisen wir gern Lieferfirmen nach. Bei Anfragen und Bestellungen bitten wir auf das Taschenbuch der Fernmelde-Praxis Bezug zu nehmen.
Fachverlag
Schiele
&
Schön
GmbH,
1 Berlin 61,
Markgrafenstraße
Abdichtschalen
Anrufbeantworter
Dr. Franz & Rutenbeck 5885 Schalksmühle
KRONE GmbH 1 Berlin 37, Goerzallee 311
Abspannklemmen Dr. Franz & Rutenbeck 5885 Schalksmühle
11
Ansagegeräte Assmann GmbH 638 Bad Homburgi Pf. 1147 (für Hinweise, Zeit, Wetter, Rufnummern-Ansagen etc.)
Akkumulatoren Accumulatorenwerk Hoppecke Carl Zoellner & Sohn 5798 Hoppecke/Westfalen Vertrieb durch: Accumulatorenwerk Hoppecke Carl Zoellner & Sohn 5 Köln, Barbarossaplatz 2 Tel.: 219016 Telex: 08 881326 (Blei-Akkumulatoren für alle Anwendungsgebiete) VARTA Batterie AG Werk Hagen 5800 Hagen Dieckstr. 42 T.: (02331) 3931 FS: 0823841 Ortsfeste- und Fahrzeugantriebsbatterien in Blei und Stahl
Anschlußdosen KRONE GmbH 1 Berlin 37, Goerzallee 311 QUANTE-Fernmeldetechnik 56 Wuppertal Telegärtner 7031 Steinenbronn, Hohewartstr. 9
Anschlußleisten Analag-Digital-Umsetzer
WANDEL
u. GOLTERMANN
16 Fernmelde-Praxis
KRONE GmbH 1 Berlin 37, Goerzallee 311 QUANTE-Fernmeldetechnik 56 Wuppertal
465
Antennenleitungen
Batterien
„COROPLAST“ Wuppertal 2 Pf. 201130
Accumulatorenwerk Hoppecke Carl Zoellner & Sohn 5798 Hoppecke/Westfalen Vertrieb durch: Accumulatorenwerk Hoppecke Carl Zoellner & Sohn 5 Köln, Barbarossaplatz 2 Tel.: 219016 Telex: 08 881326 (Blei-Akkumulatoren für alle Anwendungsgebiete) VARTA Batterie AG 7090 Ellwangen/Jagst Tel.: (07961) 831 FS: 074715 (Trockenbatterien)
Antennenmaste
aus
Hein, Lehmann AG 4 Düsseldorf, Postf.
Tel.
Telex
(0211) 7701-1 8582740
Lehmann
4 Düsseldorf,
4109
hld
Antennenmaste, Hein,
Stahl
mobile
AG
Postf£f.
Tel. (0211) 7701-1 Telex 8582740 hid
4109
Bauelemente für Nachrichtengeräte Telegärtner 7031 Steinenbronn, Hohewartstr. 9
Antennen-Rotore Wilhelm Winter Maschinenfabrik
Befestigungsmaterial
403 Ratingen Postf. 1766 Ruf (02102) 43068 FS: 08 585 183 (zum mobilen und stationären
Einsatz)
Antennenträger
aus Stahl
Hein, Lehmann AG 4 Düsseldorf, Post£. 4109 Tel. (0211) 7701-1 Telex 8582740 hid
Automatische Abisolierzangen Steidinger Lubac 77142 St. Georgen/Schwarzw. Hans-Thoma-Str. 5
466
C. Schniewindt K.G. 5982 Neuenrade (Westf.)
Betonbauteile für den Fernmeldebaudienst Franz 2000
Köhler,
Betonwerk
Norderstedt 1
Schützenwall 19-23 Tel.Sa.Nr. (040) 525 20 21 i Berlin 52 Reinickendorf Auguste-Viktoria-Allee 12-13 Tel.Nr. (030) 412 10 27 STEWING Beton- u. Fertigteilwerk KG 427
Dorsten
Barbarastr.
50
Tel.: 28-1 FS: 0829 714 STEWING Beton-u.FertigteillwerkGmbH 6096 Raunheim/Rüsselsheim Tel.: 51059 FS: 0415 726
Verkäufer Meier’s heißer Draht nach Zimmer 3 Zimmer 3: Telefonzentrale. Da sitzt seine Angebetete. Morgens zwischen 8 und 9 läßt Verkäufer Meier den Draht glühen. Bis der Chef kommt und Müller & Müller verlangt. Der Draht erkaltet, wird eiskalt. Bis die beiden Müller zahlen wollen. Liebesschwüre, Lottozahlen, Geschäfte, Glückwünsche, Versprechungen, Verwünschungen. Gesäuselt, geschrien, gesprochen. Anstrengend, ein Telefonkabel zu sein. Braucht ein solides Innenleben. Nach dem neuesten Stand der Technik. Wir liefern Kabel, Leitungen und Schaltgeräte in alle Welt, projektieren und erstellen durch eigene Fachkräfte komplette Anlagen.
E «> ©) 25:1d3 VF
FELTENs&GUILLEAUME KABELWERKE AG
Betonteile für den Fernmeldedienst
Druckluftüberwachungsanlagen
BETONWERK HIRSCHAU Stoellger & Co. 8452 Hirschau, Postfach 12 Ruf: 09622/444 FS: 63 851
Peter Lancier KG Maschinenbau-Hafenhütte 4401 Wolbeck ü. Münster/i.W. Tel. (02506) 2041 Telex 892553 (für Fernmeldekabel)
Bildtelegrafengeräte Dr.-Ing. D-2300
Rudolf Hell GmbH Kiel 14 Postf£. 6229
Dükerverlegungen/ Flußkreuzungen Elskes
Dämpfungsmeßgeräte
WANDEL
Wasserbau
41 Duisburg Wanheimer Str. 211 Telefon: 6021
u. GOLTERMANN
DatenverarbeitungsAnlagen MDS-DEUTSCHLAND GMBH 5000 Köln 30 Oskar-Jäger-Str. 175 MDS DATA-RECORDER für Datenerfassung, -konvertierung, -fernübertragung, -ausgabe; intelligente Datensammelsysteme; periphere Processor Systeme
Eichleitungen WANDEL u. GOLTERMANN
Elektro-Installationsrohre DRAKA-PLAST GmbH. Berlin Verkaufsleitung 5600 Wuppertal 21
Elektronik Diktiergeräte Assmann GmbH 638 Bad Homburg 1 Pf. 1147 MEMOCORD Diktiergeräte STUZZI, A 1152 WIEN
Engel & Kornmann OHG H.F. Gerätebau-Industrieelektronik 6100 Darmstadt Weinbergstraße 5 T: (06151) 61272
Endverschlüsse für Fernmeldekabel
Drähte
KRONE
„COROPLAST“ Wuppertal 2 Pf. 201130
QUANTE-Fernmeldetechnik 56 Wuppertalil
468
ı Berlin
GmbH 37,
Goerzallee
311
Kabel
_
im Dienste der
Verkehrs-
sicherheit
Sicherheit auf Straßen,
Schienen und Wasserwegen. Menschenleben sind davon abhängig und wertvolles Wirtschaftsgut.
VDK garantiert hier die Sicherheit für.... eine gute Verbindung: durch Signalund Steuerkabel,
Fernsprechkabel, Streckenfernmeldekabel.
Vereinigte Draht- und Kabelwerke GmbH Rheydt 469
Endverzweiger
Feinwerkzeuge
KRONE GmbH 1 Berlin 37, Goerzallee 311 W. Kücke & Co. GmbH. 56 Wuppertal, Postfach QUANTE-Fernmeldetechnik 56 Wuppertall
für die
Fernmeldetechnik
W. Kücke & Co. GmbH. 56 Wuppertal 1, Postfach
Fernmeldeanlagen Ing. H. Kusterer & Co. Westmontage KG. 43 Essen-1l
Endverzweigersäulen Franz
Köhler,
Cathostr.
Beton-
1-3 Ruf
663045
Betonwerk
2000 Norderstedt 1 Schützenwall 19-23 Tel.Sa.Nr. (040) 525 20 21 1 Berlin 52 Reinickendorf Auguste-Viktoria-Allee 12-13 Tel.Nr. (030) 412 10 27 KRONE GmbH 1 Berlin 37, Goerzallee 311 STEWING
u. Fertigteilwerk KG
427 Dorsten Barbarastr. Tel.: 28-1 FS: 0829 714
50
Fernmeldebaugeräte W. Kücke & Co. GmbH. 56 Wuppertal 1, Postfach Peter
Lancier
KG
Maschinenbau-Hafenhütte 4401 Wolbeck ü.Münster/i.W. Tel. (02506) 2041 Telex 892553
Fernmelde-Kabel Fahrgestelle Fernsprech- und Signalbaugesellschaft mbH Schüler & Vershoven 4300 Essen 15, Fahrenberg 6 f
Faksimilegeräte Dr.-Ing. D-2300
Rudolf Hell GmbH Kiel 14 Postf. 6229
Federwaagen Hahn
470
& Kolb 7
Stuttgart, P£f.333
Kabel- und Metallwerke Gutehoffnungshütte AG Fachbereich 3 NachrichtenErzeugnisse 3000 Hannover Postf£. 260, Tel.: (0511) 6861 Nordd. Seekabelwerke AG, 289 Nordenham, Postf. 80
FernmeldeKabelgarnituren Dr. Franz & Rutenbeck 5885 Schalksmühle Kabel- und Metallwerke Gutehoffnungshütte AG Fachbereich 3 NachrichtenErzeugnisse 3000 Hannover Post£. 260, Tel.: (0511) 6861 KRONE GmbH 1 Berlin 37, Goerzallee 311 QUANTE-Fernmeldetechnik 56 Wuppertali
Der
robuste
Felmeo
rüfhandapparat IV im Weichgummigehäuse mit Spezial-Nummernschalter, Ein- und Ausschalter und Erdtaste
für Störungssucher und Bautrupps
ELMEG
Bitte, verlangen Elektro-Mechanik Postfach
Sie Prospekt von GmbH
1240, Telefon:
+
315 Peine
(05171) 441
Telex: 09 2651 471
Fernmelde-Montagen
Fernsprechhäuschen
Fernmelde-Montage G.m.b.H. 4140 Rheinhausen-Bergheim
QUANTE-Fernmeldetechnik 56 Wuppertall
Tel.:
(02135)
3572
Montage v. TF-u. NF-Kabeln sowie Bespulungs- u. Ausgleichsmessungen derselben STEFFES + HEYNITZ Fernmeldemontagen 3551 Niederweima r Sonnenstr. 13 T.: (064272)180 507 Bergisch Gladbach 1
Pf. 425 T.:
(02202) 3919
RIETH
&
SOHN
1 Berlin 52 Telefon 030/41 20 31
Fernsprechtechnik Joseph Junker Elektro-Apparatebau GmbH 543 Bad Honnef 1, Lohfelder Str. 17a Tel.: (02224) 5001
Fernmelde-Stromver-
.. sorgungseinrichtungen AEG-TELEFUNKEN
Darmstadt
Elisabethenstr.
29
Fernwirkanlagen FUNKE + HUSTER 43 Essen, Postfach 529 Tel.: (0201) 22091 FS: 857637 KRONE
\
Apparatebau W. Heibl GmbH., 8671 Selbitz Fernsprech- und Signalbaugesellschaft mbH Schüler & Vershoven
4300 Essen 15, Fahrenberg 6 FÜNKE + HUSTER 43 Essen,
Postfach
529
Tel.: (0201) 22091 FS: 857637 (wetterfest ex geschützt) KRONE GmbH 1 Berlin 37, Goerzallee 311
GmbH
1 Berlin 37,
Fernsprechapparate
Goerzallee
311
.
Filter WANDEL
u. GOLTERMANN
Frequenzmesser WANDEL u. GOLTERMANN
Fernsprechhauben aus Plexiglas QUANTE-Fernmeldetechnik 56 Wuppertal ti
472
Frequenzzähler
WANDEL
u. GOLTERMANN
kabel,
leitungen drähte..
Unser Programm seit über 70 Jahren: Kabet, Leitungen und Drähte, Das alles lieferten wir auch schon gestern. Vorgestern. Und wenn dies noch das Programm von morgen sein mag, so ist. das einzelne Produkt von 1980 nicht mehr das von 1960.
und
Wir folgen den Zeichen der Zeit. Basierend auf Erfahrung, auf der reifen Erfahrung, die unser Haus in über 70 Jahren angesammelt hat. Erfahrung ist gut. Aber
unsere Techniker
und
Kaufleute
haben
noch
mehr, Sie haben auch Wagemut und Phantasie,
a KABELWERK
RHEYDT
GMBH
473
Gebühren- Anzeiger
Handapparate
EL-ME-WE Elektro-Mechanisches Werk Hamburg, s. Anzeige S. 477
Telegärtner 7031 Steinenbronn, Hohewartstr. 9
Handlampen
Generatoren WANDEL u. GOLTERMANN
VARTA Batterie AG 7090 Ellwangen/Jagst Tel.: (07961) 831 FS: 074715
Gleichrichter AEG-TELEFUNKEN Darmstadt Elisabethenstr.
29
Heißleiter E. Meyer-Hartwig 5106 Mulartshütte Tel.: (02408) 7294 'Tx:
0832683
GruppenlaufzeitMeßplätze
WANDEL u. GOLTERMANN
Gruppenringe Weich-PE
HF-Kabel
und
-Stecker
Suhner Elektronik GmbH 8000 München 90 Pfälzer-Wald-Straße 68 Teil.: (089) 404037-38 FS:5-29767 (auch in Subminiaturaustf. nach MIL-, IEC- u.a.Normen)
aus
„COROPLAST“ Wuppertal 2 Pf. 201130
HF-Kabel und -Steckverbindungen
Halbleiterwerkstoffe und -halbzeuge W.C.
6450
Heraeus Hanau,
GmbH.
Postfach
169
Hochreine Edelmetalle 99,999 %/o; Feinstdrähte aus Au und AISi für Transistoren und integrierte Schaltkreise; Präzisionsstanzteile (Lead Frames) auch selektiv veredelt; Leiter- und Widerstandspasten für die Dickfilmtechnik; Iridiumtiegel
474
Kabel- und Metallwerke Gutehoffnungshütte AG Fachbereich 3 NachrichtenErzeugnisse 3000 Hannover Post£.
260,
Tel.:
(0511)
6861
Telegärtner 7031 Steinenbronn, Hohewartstr. 9
Hochfrequenz-Meßgeräte WANDEL u. GOLTERMANN
liradex
Stecktafeln in vielen Abmessungen für die Planung und Darstellung von STELLENBESETZUNG PERSONAL-EINSATZ Einfache, praktische und preiswertePlantafeln, in der Fernmeldeverwaltung seit vielen Jahren erprobt. Ausführliche Informationen mit kleiner Mustertafel bitte anfordern.
ULTRADEX-PLANUNGSGERÄTE 788 SÄCKINGEN
Postfach 106 - Tel. (07761) 334 u.8837 - FS. 07-92302 475
Hohblleiter
Isolierschläuche
Kabel- und Metallwerke Gutehoffnungshütte AG Fachbereich 3 NachrichtenErzeugnisse 3000 Hannover Postf£. 260, Tel.: (0511) 6861
„COROPLAST“ Wuppertal 2 Pf. 201130
Hörkapseln für Fernsprechapparate Fernsprech- und Signalbaugesellschaft mbH Schüler & Vershoven 4300 Essen 15, Fahrenberg 6 KRONE GmbH ı Berlin 37, Goerzallee 311
Installationsmaterial Dr. Franz & Rutenbeck 5885 Schalksmühle
Kabelabdecksteine -hauben
und
BETONWERK HIRSCHAU Stoellger & Co. 8452 Hirschau, Postfach 12 Ruf: 09622/444 FS: 63 831 DRAKA-PLAST GmbH. Berlin Verkaufsleitung 5600 Wuppertal 21 (aus Kunststoff) Franz Köhler, Betonwerk 2000 Norderstedt 1 Schützenwall 19-23 Tel.Sa.NTr. (040) 525 20 21 1 Berlin 52 Reinickendorf Auguste-Viktoria-Allee 12-13 Tel.Nr. (030) 412 10 27 STEWING Beton- u. Fertigteilwerk KG 427 Dorsten Barbarastr. Tel.: 28-1 FS: 0829 714
50
Isolationsmaterial „COROPLAST“ Wuppertal 2 Pf. 201130
Kabeladerprüfgeräte QUANTE-Fernmeldetechnik 56 Wuppertall
Isolierband „COROPLAST“ Wuppertal 2 Pf. 201130
Kabelarmaturen Dr. Franz & Rutenbeck 5885 Schalksmühle
Isolierröhrchen Weich-PE „COROPLAST“ Wuppertal
476
aus
2 Pf. 201130
Kabelauslese-Geräte DYNATRONIC,
8601
Baunach
ELEKTRO-MECHANISCHES 21 Hamburg
HAMBURG 90, Postfach 507, Tel.-Sa.-Nr.
WERK 771311, Telex 02-1773
Zweigniederlassungen: 3300 6000
Braunschweig, Hamburger Straße 44 Telefon 33 22 52 Frankfurt/M. NO 14, Roederbergweg 114 Telefon 444010 und 44 30 10 6200 Wiesbaden, Lessingstr. 10 Telefon 37 28 30
Geräte und Apparate des Fernmeldewesens - Meß- und Regeltechnik - Kabelmontage - Amts-, Nebenstellen- und Sprechstellenbau - Ausgleichsund Bespulungsarbeiten an OVK-, BZKund TF-Kabeln - industrielle Fernsehanlagen - Starkund Schwachstrominstallation
MER
Sie
A
her
rn
| Card)
Mini-Dremometer 10-120-.kpcm und 10-100 Ibf.-in. damit auch bei kleinen Schrauben die Anzugswerte stimmen. Höchste Genauigkeit - Mikro-Feineinstellung - eingebaute Knarre 1/4” automatische Auslösung - leichtes glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse aus Polyamid - öl-, benzin-, säurefest - keine metallische Verbindung von der Hand zum Werkstück. Rahsol hat das große Dremo-Programm. Für jeden Verwendungszweck. Von 0,1-1700 kpm. Nennen Sie uns Ihre Probleme. Wir beraten Sie gern.
YTTEL Teen
Kabelbearbeitungswerkzeuge
Kabelmarken Kunststoff
W.Kücke & Co. GmbH. 56 Wuppertalil, Postfach
Josef Attenberger GmbH. Vermessungsmaterial 825Dorfen/Obb.
Kabelendverschlüsse KRONE
1 Berlin
GmbH 37,
Goerzallee
KabelfehlerOrtungsgeräte DYNATRONIC, 8601
aus
Tel. :(08081)552
Kabel-Montagen 311
Baunach
Kabel- und Metallwerke Gutehoffnungshütte AG Fachbereich 3 NachrichtenErzeugnisse 3000 Hannover Postf£. 260, Tel.: (0511) 6861
Kabel-Muffen-Suchgeräte DYNATRONIC,
8601
Baunach
Kabelformsteine Franz Köhler, Betonwerk 2000 Norderstedt 1
Kabelpritschen, -roste
Schützenwall 19-23 Tel.Sa.Nr. (040) 525 20 21 1 Berlin
52
Reinickendorf
Auguste-Viktoria-Allee 12-13 Tel.Nr. (030) 412 10 27 STEWING Beton- u. Fertigteilwerk KG 427 Dorsten
Tel.:
28-1
Barbarastr.
FS:
0829 714
-rinnen,
RIETH & CO. 7312 Kirchheim/Teck Telefon 07021/64 51
50
Kabelsuchgeräte DYNATRONIC, Hermann
Kabelkanalformsteine BETONWERK HIRSCHAU Stoellger & Co. 8452 Hirschau, Postfach 12 Ruf: 09622/444 FS: 63 851
8601
Sewerin
483 Gütersloh
Kabelschachtabdeckungen Franz
Köhler,
Betonwerk
2000 Norderstedt1i
Kabellöterzelte W. Kücke & Co. GmbH. 56 Wuppertall, Postfach
478
Baunach
Postfach 2940
Schützenwall 19-23 Tel.Sa.Nr. (040) 525 20 21 1 Berlin 52 Reinickendorf Auguste-Viktoria-Allee 12-13 Tel.Nr. (030) 412 10 27
ABSTANDHALTER für
AA
erdverlegte
Kabelkanalrohre
110/4 110/6 nach
aus
PVC
hart
110/8 50/3x110/2
FTZ-Vornorm
736 953 TVI
CARBOPLAST Kunststoffwerk GmbH 437 Marl, Brassertstr. 251 . Tel. (02365) 67 36
FERNMELDEBAUZEUG FÜR AUSSEN- UND INNENBAU Abspannklemmen
AKL, Abdichtschalen AdS,
Verbindungs- und Verteilungsdosen VVD, Verbinderdosen VDo, Verlängerungsleitungen VL v.ca.m.
Rutenbeck
Dr. FRANZ & RUTENBECK 5885 SCHALKSMÜHLE
Postfach 1220 » Fernruf (02355) *6696 Fernschreiber 08263218 rutbd 479
Kabelschächte BETONWERK HIRSCHAU Stoellger & Co. 8452 Hirschau, Postfach 12 Ruf: 09622/444 FS: 63 851 Franz Köhler, Betonwerk 2000 Norderstedt i Schützenwall 19-23 Tel.Sa.Nr. (040) 525 20 21 1 Berlin 52 Reinickendorf Auguste-Viktoria-Allee 12-13 Tel.Nr. (030) 412 10 27 STEWING Beton- u. Fertigteilwerk KG 427
Dorsten
Barbarastr.
50
Tel.: 28-1 FS: 0829 714 STEWING Beton-u.FertigteilwerkGmbH 6096 Raunheim/Rüsselsheim Tel.:
51059
FS:
Kathodische Korrosionsschutzgeräte QUANTE-Fernmeldetechnik 56 Wuppertalil
Klemmen Alois Schiffmann GmbH, Spezialfabrik der Elektrotechnik 8 München 80, Streitfeldstraße 15 Tel.: 45 50 66 Kabelklemmenm.T-Abzweig
0415 726
Klirrmeßgeräte WANDEL u. GOLTERMANN Kabelschutzrohre aus Kunststoff DRAKA-PLAST GmbH. Berlin Verkaufßsleitung 5600 Wuppertal 21 STEWING Kunststoffbetrieb GmbH 427 Dorsten Barbarastr. 50 Tel.: 28-1 FS: 0829 714
Koaxialkabel „COROPLAST“ Wuppertal 2 Pf. 201130
Kolophonium-Lötdraht
Kabeltrassenband „COROPLAST“ Wuppertal 2 Pf. 201130 Hermann Sewerin 483 Gütersloh Postfach 2940
Kabelverlegungsgeräte Peter Lancier KG Maschinenbau-Hafenhütte 4401 Wolbeck ü.Münster/i.W. Tel. (02506) 2041 Telex 892553
480
STANNOL Lötmittelfbk. Wilhelm Paftf 56 Wuppertal 2, Pf. 202002
Kontakte W.C. Heraeus GmbH. 6450 Hanau, Postfach 169 massiv und plattiert; Kontaktbimetallbänder; Kontaktfedern und Präzisionsstanzteile aus Federwerkstoffen mit Edelmetall-Kontaktschichten plattiert, bedampft, geschweißt und galvanisiert
WIR LIEFERN FÜR DEN KABELKANALBAU DER FERNMELDETECHNIK
NACH
FTZ-
UND
DIN-NORMEN
Kabelschächte, rechteckig und oval Kabelkleinschächte und Kabelabzweigkästen Wasserdichte Schächte, Sonderschächte Schachtdecken In allen Größen Kabelschachtabdeckungen, 3- und 4-eckig Kabelverlegungsmaterlal: Kabelkanalformsteine (100 und 120 mm Zugdurchmesser) — Kabelabdeckplatten — Kabelschutzhauben — Betonkanäle
in Trogbauform
Betonsockel für Kabelverzweigergehäuse und Schaltschränke
- Endverzweigersäulen
Begehbare Versorgungskanäle Beton-Fertigsockel für Fernsprechhäuschen Kabelschutzrohre
aus
Kunststoff
ETEWINE
BETON- UND FERTIGTEILWERK 427 DORSTEN/WESTF., BARBARASTR. 80 TEL, 28-1 — FS 0829714
KG
ETEWINE BETON- UND FERTIGTEILWERK KG 6098 RAUNHEIM/RUSSELSHEIM KELSTERBACHER STRASSE 38-46 TEL. ROSSELSHEIM 51059 — FS 0415726 ETIEWINEs
KUNSTSTOFFBETRIEB GMBH WESTF. TR._50 TEL. 28-1 — Fs0 0 829 714
481
Kontakt-Reinigungsmiittel E. Lauber 8835 Pleinfeld (Reinigungsstäbchen für Wählerkontakte)
Lötmittel STANNOL Lötmittelfbk. Wilhelm Paff 56 Wuppertal 2, Pf£. 202002
Lötösenstreifen
Kontaktwerkstoffe -,.W.cC. Heraeus GmbH. 6450 Hanau, Postfach 169
KRONE GmbH 1 Berlin 37, Goerzallee 311
Meßautomaten WANDEL u. GOLTERMANN
Kopfhörer Telegärtner 7031 Steinenbronn, Hohewartstr. 9
Meßgeneratoren WANDEL u. GOLTERMANN Korrosionsschutzbandagen „COROPLAST“ Wuppertal 2 Pf. 201130
Meßgeräte
Lampenhalter für Fernsprechkleinlampen Telegärtner 7031 Steinenbronn, Hohewartstr. 9
Hahn & Kolb 7 Stuttgart, Pf.333 METRAWATT GmbH, Nürnbg. OSKAR VIERLING GmbH + Co. KG 8553 Ebermannstadt Pretzfelder Str. 21 WANDEL u. GOLTERMANN
Meßinstrumente METRAWATT GmbH, Nürnbg.
Lötkolben LOTRING, Kantstr.
STANNOL
1 Berlin 12
115
Lötmittelfbk.
56 Wuppertal
482
Tel.
312 50 27
Wilhelm
2,
Paff
Pf. 202002
Meßsender WANDEL u. GOLTERMANN
Kabelmarken
aus Kunststoff
zur Kennzeichnung der Kabelstrecken der
Bundespost Kopfgröße 85x85x60 mm gelb — Aufschrift „BP” KNr. 736830001 KNr. 736830002
KNr. 736 830003
Zum
Eindrehen:
Länge Länge
600 mm 800 mm
Länge 1000 mm
Handschlüssel Ratschenschlüssel
JOSEFATTENBERGER
GMBH
Vermessungsmaterial
825 DORFEN/OBB. Postfach 265 - Telefon (08081) 552
Fernmelde - Bauzeug
«ID
Fernmelde - Baugerät
Kehrmaschinen Streuautomaten Schneepflüge Schneefrässchleudern Hydraulik-Plattformen Straßen - Markierungsmaschinen
FAHRZEUGE
GmbH & CoKG.
UND
GERÄTE
3 HANNOVER-RICKLINGEN Stammestraße 44
-
Telefon:
(0511) 424017
.
Telex:
09-232 15
483
Meßwiderstände
Oszillographen
W.C.
HAMEG K. Hartmann K.G. 6 Frankfurt/Niederrad Kelsterbacher Str. 15-17 Tel. (0611) 676017 FS: 04-13866
Heraeus
GmbH.
6450 Hanau,
Postfach 169 /
Morsegeräte Dr.-Ing. D-2300
Rudolf
Kiel
14
Hell
Postf.
GmbH
6229
WANDEL
Netzersatzanlagen AEG-TELEFUNKEN Darmstadt Elisabethenstr. 29
AEG-TELEFUNKEN
Darmstadt Elisabethenstr. VARTA Batterie AG Werk Hagen 5800 Hagen T.:
(02331)
u. GOLTERMANN
Pegelmesser WANDEL u. GOLTERMANN
Pegelsender WANDEL u. GOLTERMANN
Notstrom-Aggregate
Dieckstr. 42 FS: 0823841
Pegelbildgeräte
29
3931
Pinsel Madel & Winker
7134 Knitt-
lingen, Pinsel + Bürsten für das Fernmeldewesen
Nummernschalter für Fernsprechapparate Apparatebau W. Heibl GmbH., 8671 Selbitz KRONE GmbH 1 Berlin 37, Goerzallee 311
Ohmmeter METRAWATT
484
Plantafeln Ultradex-Planungsgeräte Joachim Friedrich KG 788
Säckingen,
Tel. 334 —
FS:
Postf.
106
07-92302
Potentiometerdrähte GmbH, Nürnbg.
W.C. Heraeus GmbH. 6450 Hanau, Postfach 169
Abstandshalter
aus PVC hart für Kabelschutzrohre vereinfachen das Verlegen und beschleunigen das Verlegetempo, ermöglichen einen lageweisen Aufbau und nachträgliche Erweiterungen. Abstandshalter- und Kabelschutzrohr-Informationen und Lieferungen durch Kunststoffwerk
Gebrüder Anger GmbH
ein
Unternehmen
der
+ Co
Rheinstahl-Bau-
und
Wärmetechnik - 8 München 80, Einsteinstr.104 Postfach
800 140
- Telefon
WALTER 58
Hagen,
Lütkenheider
41 351
ROSE
Straße
2,
Ruf
- Telex
KG
(02331)
6 40 01,
05 22938
Telex
823 588
Spezialunterneh der Elektro- und Fernmeldetechnik: Durchführung von Kabelausgleich, Druckluftüberwachungsund Lötarbeiten. Bau von Sprechstellen und oberirdischen Linien. Kabelverlegung jeglicher Art: u.a. Röhrenkabel, Kabelpflug, Industrieverkabelung, Gasdruckkabel 110 kV., Fabrikation und Vertrieb von Aderverbindungshülsen, Quetschzangen, Kabelhaltern, Kabelschellen, Kabelschneidern, Kabelader-und Isolationsprüfgeräten, Schrumpfkappen. Vormontagen, wie z.B.
Endverschlüsse mit Kabel. ZWEIGWERKE: 5880
Lüdenscheid,
Am
Lehmberg
3, Ruf (02351)
243 74
5885 Schalksmühle-Heedfeld, Unterm Eichholz 15, Ruf 6101 Gräfenhausen, Industriestraße 4, Postfach 150, Ruf
5) 5 14 09 (06150) 70 11
ZWEIGSTELLEN: 1000
Berlin 20, Klärwerkstraße,
3000
Hannover,
Ruf (030) 3 31 60 01/9
2000 Hamburg 26, Ausschläger Weg 73, Ruf vr Große
Barlinge 24,
Ruf
(0511)
25 38 58
81 20 77
5074 Heidberg/Post Odenthal, Hoher Wald, Ruf (02202) 7 84 65 8000
München
7000
Stuttgart 60, Dietbachstraße
82, Toni-Schmid-Straße 26, Ruf
(089) 42 52 45
6050 Offenbach, Mühlheimer Straße 115, Ruf (0611) 86 22 00 23, Ruf (0711)
33 33 93
485
Preßteile aus Kunststoff
Sicherheitsgürtel
Apparatebau W. Heibl GmbH., 8671 Selbitz QUANTE-Fernmeldetechnik 56 Wuppertall
W.Funcke 433 Mülheim-Ruhr, Pf£. 010610 W. Kücke & Co. GmbH. 56 Wuppertal 1, Postfach
Prüfgeräte OSKAR
GmbH
VIERLING +
Co.
Signalgeräte,
KG
8553 Ebermannstadt Pretzfelder
Str.
21
Prüfhandapparate ELMEG Elektro-Mechanik GmbH. 315 Peine Postf. 1240 Ruf-Nr. 441 Telex 092651
akustische
Apparatebau W. Heibl GmbH., 8671 Selbitz Fernsprech- und Signalbaugesellschaft mbH Schüler & Vershoven 4300 Essen 15, Fahrenberg 6 FUNKE + HUSTER 43 Essen, Postfach 529 Tel.: (0201) 22091 FS: 857637 (akustische u. optische)
Prüfkopfhörer Telegärtner 7031 Steinenbronn, Hohewartstr. 9
Sonderwerkzeuge W. Kücke & Co. GmbH. 56 Wuppertal l, Postfach
Rauschklirrmeßplätze
WANDEL
u. GOLTERMANN Spannbänder
Ruf-
und
Signalmaschinen
W.cC. Heraeus GmbH. 6450 Hanau, Postfach 169
Fernsprech- und Signalbaugesellschaft mbH Schüler & 4300 Essen
Vershoven 15, Fahrenberg
6
Sprechkapseln für Fernsprechapparate Seekabel Nordd. Seekabelwerke AG. 289 Nordenham, Postf. 80
486
Fernsprech- und Signalbaugesellschaft mbH Schüler & Vershoven 4300 Essen 15, Fahrenberg 6
KABELDUKER aus Kunststoffrohren Stahlmantelrohren
oder
im Einzug- und Verlegeverfahren
Sichere Ausführung in allen Bodenarten, auch Fels, auf Grund
umfangreicher
Erfahrungen
Beratung,
Entwurf und Ausführung
HEINR. ELSKES
K.CG.
Wasserbauunternehmung
41
DUISBURG
Wanheimer Straße 211 Postfach 183, Telefon 60 21
ING. H. KUSTERER & CO WESTMONTAGE KG ESSEN
43 ESSEN 11, POSTFACH RUF 66 30 45/48
270025,
CATHOSTR.
1-3
FERNMELDEANLAGEN Montage-, Spleiß- und Lötarbeiten an Fernmelde- und Signalkabel aller Art, NF-, TF-Ausgleich an Orts- und Fernkabel. Druckluftanlagen und Überwachung, Kabelzieh- und Verlegungsarbeiten, Schachtinstandsetzung, Kabelfehlerortung, autorisierte Ausbildungsfirma für PE/PJ-Technik.
BE STARKSTROMANLAGEN HochHoch-
und und
Niederspannungskabelmontagen, Niederspannungs-Schaltanlagen,
tionen, Kabelzieh- und Verlegungsarbeiten.
Kabelfehlerortung, Starkstrominstalla-
Alles in einer Hand Planung
» Lieferung
- Ausführung
487
Spulenkasten-OrtungsGeräte DYNATRONIC, 8601 Baunach
Stahlgittermaste Hein, Lehmann AG 4 Düsseldorf, Postf. 4109 Tel. (0211) 7701-1 Telex
8582740
hld
Synchronmotoren
SUEVIA Uhrenfabrik GmbH 7032 Sindelfingen Pf. 309
StahlwellenmantelkabelBearbeitungswerkzeuge Schaltdrähte
und
-litzen
W. Kücke & Co. GmbH. 56 Wuppertal 1, Postfach
„COROPLAST“ Wuppertal 2 Pf. 201130
Starterbatterien
Schaltfelder, -schränke u. tafeln f. Stromversorgungsanlagen
VARTA Batterie AG Werk Niedersachsen 3 Hannover Stöckener Str. 351 T.: (0511) 79031 FS: 09 22233
AEG-TELEFUNKEN
Darmstadt Elisabethenstr. 29
KRONE
GmbH
1 Berlin 37,
Goerzallee
311
Stecker Telegärtner 7031 Steinenbronn, Hohewartstr. 9
Schaltungen, R.
gedruckte
GOOSSENS HILDEN Gedruckte Schaltungen 401 Hilden Hans-Sachs-Straße 8 Tel. 02103/52989
Steigeisen W. Kücke & Co. GmbH. 56 Wuppertal 1, Postfach
Schraub-Klemmuffen KRONE GmbH 1 Berlin 37, Goerzallee 311 QUANTE-Fernmeldetechnik 56 Wuppertall
488
Stöpsel Telegärtner 7031 Steinenbronn, Hohewartstr. 9
rn
Gebr. Potthast KG
2300 Kiel, Herzog-Friedrich -Straße 92 Tel. (0431) 62671
Messer- und Federleisten, Universal-Anschlußleisten, Umschaltstecker mit Kugel-Löse-Kontakt für Trennleiste 55, 69, 71
PUK-WERK:
KUNSTSTOFF-STAHLVERARBEITUNG GMBH & CO 1000 BERLIN 44 »NOBELSTRASSE 45-53 TELEFON (030) 6846031 - TELEX 0184360
489
Stromversorgungsanlagen für die Fernmeldetechnik AEG-TELEFUNKEN Darmstadt
Elisabethenstr.
Transistor-Meßgeräte WANDEL u. GOLTERMANN 29
Trennleisten, Trennstecker
Styroflex
Fernsprech-
gesellschaft
Nordd. Seekabelwerke AG. 289 Nordenham, Postf. 80
und
Signalbau-
mbH
Schüler & Vershoven 4300 Essen 15, Fahrenberg
6
Telefon-Diktat-Anlagen Assmann
.638
Bad
GmbH
Homburgi
Überführungs-
Pf. 1147
endverschlüsse
KRONE
1ı Berlin
Teleskop-Kurbelmaste GEROH-Apparatebau 1 Berlin
44,
Ruf:
Werk
6233052
I:
GmbH 37,
Goerzallee
311
QUANTE-Fernmeldetechnik 56 Wuppertall
Maste aus Stahl u. Alu Werk II: 8551 Waischenfeld Ruf: (09202) 258
Umformer-Maschinen AEG-TELEFUNKEN
TF-Meßgeräte WANDEL u. GOLTERMANN
Heraeus GmbH. Hanau, Postfach
Elisabethenstr.
Umschalter
Thermoelemente W.C. 6450
Darmstadt
QUANTE-Fernmeldetechnik 56 Wuppertali 169
Transistoren-Zubehör
Verbinderdosen
W.cC. Heraeus
Dr. Franz
6450
490
Hanau,
GmbH.
Postfach
169
5885
& Rutenbeck
Schalksmühle
29
Fernsprechtischapparate,
akustische
Signalgeräte,
NF- u. TF-Übertrager, fernmeldetechnische
Bauteile — Eigenes Kunststoffpreß- und Spritz-
gußwerk
Apparatebau WILHELM HEIBL GmbH. 8671 Selbitz, Telefon (09280) 3 58, Telex 0643808
Fritz
Kuke
Fabrik für Fernmeldetechnik 3511
Volkmarshausen Telefon:
ü. Hann.
Münden
Hann. Münden 5015 und Telex: 965 813 fkuke d
Herstellung von
Bauelementen
5016
für
das Fernmeldewesen
seit 25 Jahren:
Gebrüder Stove GmbH Niederlassung 6 Frankfurt/M., Obermainstr. 30 Ruf (0611) 492307, 443036 -37
@ @ @
®
Fermeldebau - Kabelmontage Kabelverlegung - Verkehrssignalanlagen Kabelmeßtechnik - Horizontalbohrungen
Stammhaus Köln-Nippes, Longericher Straße 177 Ruf (0221) 735054 - 56, Telex 8882245 491
Verbindungs- und Verteilungsdosen
Vielfachstecker Telegärtner 7031 Steinenbronn, Hohewartstr. 9
Dr. Franz & Rutenbeck 5885 Schalksmühle
Vielspur-MagnetbandGeräte
Vergußmasse für Kabelendverschlüsse Copalit GmbH 2 Hamburg Ottensener Str. 2—4
54
Verlängerungsleitungen Dr. Franz & Rutenbeck 5885 Schalksmühle
Vermessungsmaterial
Assmann GmbH 638 Bad Homburg 1
Pf. 1147
Wechselrichter AEG-TELEFUNKEN Darmstadt Elisabethenstr.
Josef Attenberger GmbH. Vermessungsmaterial 825Dorfen/Obb. Tel. :(08081)552
WechselspannungsStabilisatoren WANDEL u. GOLTERMANN
Verstärker,
Werkzeuge
WANDEL
mobile
u. GOLTERMANN
Verteilerkästen (Auf- u. Unterputz) KRONE GmbH 1 Berlin 37, Goerzallee 311 QUANTE-Fernmeldetechnik 56 Wuppertal.
Vielfachmeßinstrumente METRAWATT GmbH, Nürnbg.
492
29
W. Kücke & Co. GmbH. 56 Wuppertal 1, Postfach
Werkzeugschränke Hahn
& Kolb7 Stuttgart, Pf.333
Werkzeugtaschen und -koffer W. Kücke & Co. GmbH. 56 Wuppertal 1, Postfach
WICKMANN Aus unserem
Sicherheit, wo Ströme fließen
m
Herstellungsprogramm:
—
UMKEHRAUSLÖSER - RÜCKLÖTAUSLÖSER -
SICHERUNGEN MIT KONTAKTMESSERN »SICHERUNGSHALTER FÜR FERNMELDE- UND SIGNALANLAGEN WICKMANN-WERKE AG : 581 Witten-Annen
- Telefon (02302) 66 21 - Teiex 08229145
Fabrikation von gewebehaltigen, gewebelosen Glasseidensilicon und Silicon-KautschukIsolierschläuchen f. d. Elektro-, Radio- und Metorenindustrie Eikoflex Isolierschlauchfabrik Dipl.-Ing. HELMUT EBERS Werk 1 Berlin 21, Huttenstr. 41-44, Tel.: (030) 391 7004, FS 01-81885 Zweigwerk 8192 Geretsried, Rotkehlchenweg 2, Tel.: (08171) 60041,
FS 05-26330
Kabelverlegemaschinen und -geräte aller Art, Druckluftüberwachungsanlagen in stationärer und tragbarer Ausführung für Fernmeldekabel liefert
PETER
LANCIER
KG
= Bull
:C S
u
Masehinenbau-Hafenhütte - 4401 Wolbeck bei Münster /W. Postfach 1160 - Tel. (02506) 2041 - Telex 892553
493
Widerstände
Beyschlag GmbH Spezialfabrik für Widerstände
Wobbelmeßplätze WANDEL u. GOLTERMANN
2280 Westerland Postfach 128 ' Telefon 5055 — Telex 0221227 2240 Heide, Postfach 1220 Telefon 95-1 Telex 028801
Widerstandsthermometer W.C. 6450
Heraeus GmbH. Hanau, Postfach
169
Zeitschalter SUEVIA Uhrenfabrik GmbH 7032 Sindelfingen Pf£. 309
WILHELM WINTER MASCHINENFABRIK 403 Ratingen, Dechenstraße, Postfach 1766 Ruf (02102) 430 68, FS 08 585 183
Antennen-Rotore
zum
mobi-
len und stationären Einsatz. Fordern Sie bit’e unseren
Sammelprospekt an! WIR
LIEFERN:
DYNAMISCHE HORKAPSELN Güteklasse Il-IV SPRECHKAPSELN der Güteklasse | u. Il nach FTZ-Zulassung RUF- UND SIGNALMASCHINEN 2,5 VA und 5 VA FERNSPRECHAPPARATE (EX) explosionsgeschützt (WS) wettersicher
FERNSPRECH- u. SIGNALBAUGESELLSCHAFT MBH SCHULER & VERSHOVEN 43 Essen-15 - Tel.: Essen 4 87 51/52/53 Fernschreiber 08579 052
JOSEPH
JUNKER Eiektro- Apparatebau
GmbH
534 Bad Honnef/Rhein 1, Postf. 147, Tel. (02224) 5001 Fernmeldetechnik
Feineisenbau Feinmechanik Fertigung: Hauptverteiler - Zwischenverteiler - Gestellreihenmaterial und Zubehör - Rolleitern für HVt - Morsetasten
Überholung von:
Wählervermittlungseinrichtungen -
Nebenstellenanlagen
- Fernsprechapparate
Firmenverzeichnis zum Anzeigenteil AEG-Telefunken,
AEG-Telefunken,
Backnang
Darmstadt
......:::cceoererreeen
............22222200.
Gebr. Anger GmbH & Co. München ............... Attenberger GmbH., Josef, Dorfen/Obb. ...........
I
17
485 483
Beamtenheimstättenwerk, Hameln ................ 14 Bosch Elektronik GmbH, Robert, Berlin ........... 19 Bosse Telefonbau GmbH, Berlin ................ 4+5 Carboplast Kunststoffwerk GmbH, Marl .......... 479 COROPLAST Fritz Müller KG, Wuppertal ........ 463 DeTeWe, Berlin ...........ccocooeneran rare Draka-Plast GmbH, Berlin, Wuppertal ............
3 494
Elkoflex, H. Ebers, Berlin ..........:.cccceceeeen ELMEG GmbH,, Peine ..........:. scene nn EL-ME-WE, Elektro-Mechanisches Werk, Hamburg Elskes K.G., Heinr., Duisburg ..............2222... ‘Fahrzeuge und Geräte GmbH & Co. KG, Hannover-Ricklingen .........::.ccoonreereeee nn Felten & Guilleaume, Kabelwerke AG, Köln ...... Fernmelde-Montage-GmbH, Rheinhausen-Bergheim
493 471 477 487
Dynamit Nobel AG, Troisdorf
..........ccccccncc
Fernsprech- und Signalbauges. mbH, Essen ........ Dr. Franz & Rutenbeck, Schalksmühle ...... ern Goossens, R., Hilden .............22c.c.oceeeeserenn Heibl IBM
GmbH,
Wilhelm,
Deutschland
Selbitz
....................
494 479 493 491
13
...................
494
Kabelmetal, Hannover ..........:cccoeeeeeerunenn Kabelwerk Rheydt GmbH (AEG-Telefunken), Rheydt ..........:ccooooeoee ones essen Krone GmbH, Berlin ..............occrooeeeeeenn Kuke, Fritz, Volkmarshausen .........2cccccsss0.. Köhler, Franz, Norderstedt ............:2srccc000.
10 473 II 491 464
NFT-Niederfrequenzprüftechnik GmbH, Hennef/Sieg
497
Josef, Bad
Honnef
Stuttgart
483 467 8
................
Junker,
GmbH,
III
a.Rh.
Kusterer & Co., Ing. H., Essen .........cuccccc000n 487 Lancier KG, Peter, Wolbeck/Münster .............. 493 METRAWATT Gesellschaft m.b.H., Nürnburg 6 + 498
495
Gebr. Potthast KG, Kiel
Puk
AG,
Quante,
Berlin
.................uccccc0n
.........:..cccunenee een rrr nn
Wilhelm, Wuppertal-Elberfeld
............
489
489
1
Rahsol, Solingen .........:ccccoeeneseeesee nenn 477 REHAU plastiks GmbH, Rehau ................... 2 Rohde & Schwarz, München ............. 4. Deckelseite Rose KG, Walter, Hagen ............cc.ccccccrc cn 485 Siemens AG .....cceeeereernn een 2. Deckelseite + 22
Standard Elektrik Lorenz AG,
Stuttgart-Zuffenhausen ............. 3. Deckelseite Stewing, Dorsten, Raunheim ...........: cc cr. 481 Gebr. Stoye GmbH, Köln ..........cccccneeeese en 491 Telefonbau und Normalzeit GmbH, Frankfurt ..... 21 Ultradex-Planungsgeräte, Säckingen ............. 475 Vereinigte Draht- und Kabelwerke GmbH (AEG-Telefunken), Rheydt .......s cc. 469 Vierling GmbH & Co. KG, Oskar, Ebermannstadt . IV Wainwright, Chr., Oberalting-Seefeld ............. 7 Wickmann-Werke, Witten ......:ccoc oe eeereen 493 Winter, Wilhelm, Ratingen ................cc22.00 494
Der beste Kabelschutz
ist Kunststoff
Wir
haben
uns
zur Aufgabe
gestellt, Ihneı
den besten Kabelschutz zu liefern. Das Ergebnis ist in mehr als 10 Jahren zum Begriff geworden für sichere, rationelle und leichte Kabelverlegung:
beroplast: |
Kabelschutzrohre — Kabelabdeckhauben DRAKA-PLAST GMBH - BERLIN
Verkaufsleitung 56 Wuppertal-Ronsdorf
Arbeitserleichterung
Zeit- und Kostenersparnis
und Sicherheit für den Monteur
für den Unternehmer
Universelle Kabeladerprüfgeräte mit Prüf- und Wählmöglichkeit für Fernmeldeanlagen in Selbstwählnetzen Kombinierte Kabeladerprüfgeräte mit Teilnehmerruf für Prüfung und Störungsbeseitigung bei Umschaltungen an Fernmeldenetzen
Meßleitungs-Umschalter für Kopplungsmesser — spez. KKM-1 — Halbautom. Nebenvierer-Schalter mit
Reed-Kontakten für
Dämpfungs-Meßplätze, Dämpfungstester und Kopplungsmesser
Geschirmte und ungeschirmte Meßleitungen jeder Art und
Länge mit Spezialsteckern
für alle Trennleisten und
KEG, auch als Sonderanfer-
tigungen.
Montageböcke für die
PJ-(Klemmuffen-)Technik
Außerdem führen wir in unserem Programm viele nützliche Hilfsmittel für die Fernmeldemontage z.B. Sicherheits-Batteriekästen mit Deckel für PE-Schweißbatterien, preisgünstige Klein-Ladegeräte, handliche Kleinkabelscheren für hochpaarige Kabel
N
Bitte fordern Sie unsere Unterlagen an
gr
NFT-Niederfrequenzprüftechnik 5202
Hennef/Sieg
1
: Happerschoß
Hauptstr.
2
: Telefon
(02242)
3051
T GmbH - Telex 889634
‚.
.
Vielfach-
messer
können
m
iel — aber ‚viele Können
mehr.
Deshalb bringt METRAWATT das “ ickenlose Vielfachmesser-Programm Für Heimwerker und Profis, für Werkstätten und Labors, für Prüffeld und Service. Für einfache und komplizierte Messungen. Für n Gleich-
und
Wechselstrom.
2.....,trom,
Zum
Messen
von
Spannung und Widerstand.
Möglichkeiten.
Mehr sagen Ihnen dies
Datenblätter, die wir Ihnen auf! Wunsch gerne zusenden. Schreiben Sie an die METRAWATT GmbH, 85 Nürnberg,
Schoppershofstraße 50, Telefon
METRAWATT
11105!
Absender:
An
den
FACHVERLAG
SCHIELE
& SCHON
GMBH
Ihre Buchhandlung:
u
1 BERLIN
61
Markgrafenstr. 11 (West-Berlin)
- Aus.dem Lieferung
Fachverlag
Schiele & Schön GmbH,
Berlin 61, wird zur
sofortigen
bestellt
Bei Beträgen bis DM 25,— wird der Rechnungsbetrag zuzügl. Versandspesen (jedoch ohne Nachnahmespesen) durch Nachnahme erhoben. Name
Anschrift
Datum


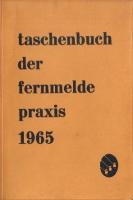


![Taschenbuch der mikroskopischen Technik [14. Aufl. Reprint 2019]
9783486764369, 9783486764352](https://dokumen.pub/img/200x200/taschenbuch-der-mikroskopischen-technik-14-aufl-reprint-2019-9783486764369-9783486764352.jpg)
![Taschenbuch der Physik [4., korr. Aufl. [Elektronische Ressource]]](https://dokumen.pub/img/200x200/taschenbuch-der-physik-4-korr-aufl-elektronische-ressource.jpg)
![Taschenbuch der Messtechnik [7 ed.]
9783446445116, 3446445110](https://dokumen.pub/img/200x200/taschenbuch-der-messtechnik-7nbsped-9783446445116-3446445110.jpg)
![Casopis Vasiona 1974 N3 [1974 / N3]](https://dokumen.pub/img/200x200/casopis-vasiona-1974-n3-1974-n3.jpg)

