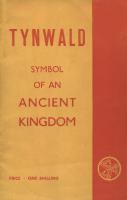Symbol, Traum, Psychose 9783666490866, 3525490860, 9783525490860
133 62 3MB
German Pages [148] Year 2006
Polecaj historie
Citation preview
1
Im Andenken an meine Frau
2
Gaetano Benedetti
Symbol, Traum, Psychose Unter Mitarbeit von Alice Bernhard-Hegglin
Mit 2 Abbildungen
Vandenhoeck & Ruprecht 3
Umschlagabbildung: Hieronymus Bosch, Visionen aus dem Jenseits (Ausschnitt), um 1490 oder später, Öl auf Holz, 87 x 40 cm, Venedig, Palazzo Ducale.
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über abrufbar. ISBN 10: 3-525-49086-0 ISBN 13: 978-3-525-49086-0 © 2006, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen. Internet: www.v-r.de Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Hinweis zu § 52a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne vorherige schriftliche Einwilligung des Verlages öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch bei einer entsprechenden Nutzung für Lehr- und Unterrichtszwecke. Printed in Germany. Satz: Text & Form, Garbsen. Druck und Bindung: Hubert & Co. Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.
4
Inhalt
Vorwort ...........................................................................................
7
Das Symbol in der Entstehung des menschlichen Geistes und in der Psychotherapie der Psychosen ..................................
11
Das Symbol in der Entstehung des menschlichen Geistes .... Das Symbol in der Psychotherapie der Psychosen ................
11 18
Das Symbol in der Religion, im Mythos und im religiösen Wahn .............................................................................
24
Der Traum in der Psychotherapie der Psychosen ......................
32
Einleitung ................................................................................... Der erhabene Traum ................................................................. Der Traum als Spiegel der existentiellen Tragik – Träume von Patienten in der Psychotherapie ........................ Die Verpflanzung der Existenz im Traum .............................. Drei Funktionen des Traums in der Geschichte der Psychiatrie ........................................................................... Die Verwandlung des Wunschs im Traum ............................. Träume von Therapeuten ......................................................... Der therapeutische Traum als Korrektur oder Regulierung der Gegenübertragung ....................................... Der therapeutische Traum als doppelte »Via regia« zum Unbewussten ..................................................................... Die Zwillingsträume ................................................................. Die Aktivität des Unbewussten des Therapeuten in der Wahrnehmung des Unbewussten des Patienten ....................
32 33 35 42 44 46 49 54 58 62 65
5
Die unbewusste Dimension der Beziehung zwischen Therapeut und psychotischem Patienten, wie sie sich in den therapeutischen Träumen und den Zwillingsträumen offenbart ..................................................................................... Die Beziehung zwischen Traum und Wachen ....................... Die doppelte Botschaft des Traums ......................................... Der stellvertretende Traum ...................................................... Der prophetische Traum .......................................................... Die Halluzination als verdrängter Traum ............................... Der negative Traum: Das Konzept der reintrojizierten Projektion ................................................................................... Der metaphysische Traum ........................................................
67 71 74 76 77 80
Der Dialog mit dem psychotischen Patienten ............................
89
82 86
Interpretation und Imagination im Dialog ............................ 94 Introjektion und Projektion im Dialog ................................... 100 Soziale Psychopathologie und psychotherapeutische Verantwortung ............................................................................... 103 Die Psychose des genialen Menschen als Ausdruck und als Zerstörung seiner Kreativität – am Beispiel von Friedrich Nietzsche ....................................................................... 109 Psychose und Kreativität ............................................................... 124 Zwei Formen der psychotischen Kreativität und der imaginativen Therapie .............................................................. 127 Die Vielfalt des Schöpferischen und die therapeutische Persönlichkeit ............................................................................ 138 Literatur .......................................................................................... 141
6
Vorwort
Zunächst möchte ich die Stellung und Bedeutung dieses Texts im Rahmen meiner bisherigen Veröffentlichungen präzisieren, die der Psychotherapie und den psychisch Kranken gewidmet waren. Es handelt sich nicht um eine Wiederholung, Zusammenfassung oder Synthese meiner Arbeiten zur Psychotherapie der Psychosen, auch wenn sich gewisse Grundideen, im Streben nach immer größerer Klarheit, wiederholen mögen. Vielmehr sucht dieser Text eine Progression, die vergleichbar ist mit meinem Konzept einer »progressiven Psychopathologie«. Ich bin der Überzeugung, dass die Psychotherapie nur unter der Voraussetzung lebendig bleibt, dass sie sich in der Begegnung mit immer anderen Patienten stets entfaltet, erneuert und neu konstituiert – denn jeder neue Patient ist immer eine einmalige Erscheinungsform des existentiellen Leidens. Mögen frühere Erfahrungen noch so tief gehend sein, wenn wir bei ihnen stehen bleiben, ohne sie und uns erneut zu hinterfragen, so bedeutet dies den Tod jeder wahren Psychotherapie. Die Auseinandersetzung mit dem existentiellen Leiden in der Person und in der Personifizierung der psychotischen Hölle führt mich – und dies ist das zentrale Thema des Buches – über den einzelnen Patienten hinaus (z. B. in der Problematik des Symbols als Psychogenese des menschlichen Geistes), um dann, im Licht der Reflexion über die Universalität der Probleme, zum Patienten zurückzukehren. So erhellt sich das schizophrene Symbol, die Wahnidee, die ich eher als »Präsymbol« oder als »Protosymbol« bezeichnen würde, ungeachtet ihrer grundlegenden Unverständlichkeit, im Licht des mythischen Denkens und, vor allem, im Lichte des Dialogs, der von diesem Bezug ausgehend, in die Dualität der Begegnung mündet, dem wahren Quell der Genesung. Und da das Symbol nirgends so grundlegende Bedeutung besitzt 7
wie im Traum, liegt hier ein Schwerpunkt der Studie: Im psychotischen Traum, der uns die grenzenlose Einsamkeit des Kranken enthüllt ebenso wie einen neuen Zugang zu dieser Einsamkeit. Nicht nur weil hier, im »Schleier des Traums«, der Patient gewisse Konflikte, die für ihn im Wachzustand allzu schmerzlich sind, dank den Metaphern und den Allegorien des Traums aufnehmen und meditieren kann, sondern auch weil hier, im Reich des Unbewussten, dem der Traum entspringt, wir uns selbst als Mit-Patienten entdecken, gewissermaßen als Reisegefährten in den Symmetrien der gegenseitigen Traumbotschaften. Daher widme ich meine Aufmerksamkeit nicht nur den Träumen der Patienten, sondern auch jenen ihrer Therapeuten. Ein Thema, das ich bereits in früheren Schriften behandelt habe, das aber ein unerschöpfliches Thema ist, in seltsamem Kontrast zum Schweigen der einschlägigen Literatur. Die psychoanalytische Zurückhaltung in der Behandlung neurotischer Patienten bedingt, dass diese vom Unbewussten ihrer Therapeuten keinerlei Kenntnis erhalten. In der Therapie der geistig schwerkranken Patienten dagegen, deren sozial grundlegend asymmetrisches Verhältnis zu den Therapeuten sie veranlasst, sich durch Verweigerung der Psychotherapie zur Wehr zu setzen, ist die Mitteilung der Botschaften des Unbewussten ein grundlegendes Konstitutiv jener »Intersubjektivität«, von der man heute in der Psychoanalyse zu sprechen beginnt. Diese psychotherapeutische Welt der Begegnung, der Dualität, der Freiheit von psychoanalytischen Dogmen, öffnet sich zu zwei verschiedenen Dimensionen: einerseits die philosophische Dimension, die mit der Bedeutung befasst ist, die der Kranke aus anthropologischer Sicht gewinnt (inwiefern ist die Psychose ein Beitrag zur Kenntnis des Menschen?); anderseits die soziale Dimension. Welches sind die sozialen Voraussetzungen des existentiellen Leidens, welches ist unsere Verantwortung diesem Leiden gegenüber? Eine Thematik, die in den Siebzigerjahren diskutiert wurde und heute fast verstummt ist angesichts des Triumphs biologischer Konzepte, die, so bedeutsam sie sein mögen, doch die Gefahr bergen, uns blind zu machen für die geistigen Werte und Unwerte, deren Opfer unsere Patienten sind. Anders als in den Siebzigerjahren, als man der Psychopathologie der Familien ein übermäßiges Gewicht beimaß und letztere »schuldig« sprach, den Ausbruch der Psychose unbewusst 8
durch bestimmte biographische Konstellationen verursacht zu haben, gehen wir das Thema der Pathologie der Gesellschaft aus der Perspektive einer gemeinsamen Verantwortung an. Die Mitautorin dieses Buches, Frau Dr. Alice Bernhard-Hegglin, hat nicht nur meine früheren, noch nicht auf deutsch publizierten Schriften ins Deutsche übertragen, sondern in der Dualität unserer Reflexion dieses Buch überhaupt erst möglich gemacht.
9
10
Das Symbol in der Entstehung des menschlichen Geistes und in der Psychotherapie der Psychosen
Das Symbol in der Entstehung des menschlichen Geistes Die Hypothese ist bekannt, nach der die aufrechte Haltung, die den Anthropoiden eigen ist, den Beginn der Menschwerdung darstellt, indem sie die Vorderglieder von der Aufgabe der Fortbewegung befreite und ihnen so die Manipulation der Dinge ermöglichte; Manipulation, die in der Erfindung der Steinwerkzeuge gipfelte, deren Gebrauch wiederum im Verlauf der Generationen die Funktionen und die Entwicklung des Vorderhirns wachsen ließ. Während die konkrete Manipulation der Welt in der prähistorischen Zeit des Menschen, des Homo erectus und Homo habilis, auf einem bescheidenen Niveau blieb, das beim Erschaffen der ersten Behausungen, dem Gebrauch des Feuers und dem Ausüben der Jagd blieb, entwickelte sich im Menschen die Symbolisation der Welt. Diese Symbolisation, von noch größerer evolutiver Bedeutung als die konkrete Manipulation der Dinge, gründete auf der Entdeckung der Darstellung. Durch den Gebrauch der Instrumente entdeckte der Mensch die Möglichkeit, die Dinge darzustellen und nicht nur zu manipulieren, sich selbst und die Tiere darzustellen – Beispiele dafür zeigen uns die Zeugnisse der paläolithischen Kunst der ersten menschlichen Kulturen, Einritzungen auf den Felsen, bis hin zum Gebrauch der Farben in den herrlichen Darstellungen des Menschen von Cromagnon. Neben der bildlichen Darstellung entwickelte sich, vielleicht noch älter als diese, die sprachliche Darstellung, oder die Benennung der gebrauchten und für das Leben notwendigen Dinge, durch typische gutturale Laute, was schließlich zur Benennung der Dinge führte. Bildliche und verbale Darstellung stellten den Menschen in eine figurative Symmetrie mit der Welt. Es scheint, dass diese Erfahrung 11
den menschlichen Machtsinn vervielfältigt hat, der schon begründet wurde in der utilitaristischen Manipulation. Hier war das Nützliche nicht mehr der Genuss der konstruierten oder erbeuteten Sache, sondern die psychische Erfahrung, etwas zu beeinflussen, indem man dessen Darstellung besitzt. So ereignete sich, nach Auffassung der Alten Ägypter, die »zweite Schöpfung« (vom Gott Ptah), indem den Dingen Namen gegeben wurden. Das Symbol war zu Beginn die magische Identität der vom Menschen geschaffenen Darstellung mit der Gestalt des beobachteten Objekts, das auf diese Weise vom Intellekt in Besitz genommen wurde. Unter »magischer Identität« verstehe ich das Bewusstsein, dass zwischen der Darstellung des Objekts und dem Objekt selbst ein geheimnisvolles Netz der Macht besteht. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass das Antike Ägypten so naiv war zu glauben, dass die »Sonnenbarke«, konstruiert und begraben, um die Seele des Verstorbenen ins Jenseits zu führen, auf dem Nil fahren könne; aber ich habe Grund zu glauben, dass diese Darstellung »die Wirklichkeit der Reise sichern sollte«. Auf die gleiche Art wurden die Speisen, die das Weiterleben des Verstorbenen garantieren sollten, effektiv nicht von der Mumie gebraucht; in einer späteren Zeit waren es nicht mehr wirkliche Speisen, sondern nur in Stein dargestellte. Aber sie sicherten dennoch das Überleben des Verstorbenen, das einerseits nicht mehr streng materiell war, aber andererseits nicht vorstellbar ohne die Konservierung des Leichnams durch die Mumifikation. Das geheimnisvolle Band, das die Darstellung in die Seele selbst der Sache verwandelte, war das Protosymbol, die Fähigkeit des Menschen, die innere Welt nach seinem Bild und Gleichnis zu schmieden, wie dies auch auf die Funktion des Gottes projiziert wurde. Das ist der erste »Hinweis« auf den Menschen, die Ankunft des Geistes im Symbol, die Geburt des Homo symbolicus, was von mehr als einem Anthropologen als existenzielles Vorrecht des Menschen betrachtet wird. * Der Mensch ist nicht nur der Homo erectus, der Homo habilis, sondern auch der Homo symbolicus und deswegen sapiens. 12
Aber was ist das Symbol, dieses wunderbare psychische Phänomen, das im Verlaufe der Evolution des Lebens das Tier in eine geschichtliche Form der Existenz umwandelt, nämlich in die menschliche? Es ist vor allem der sich entwickelnde Schritt zur Erschaffung des Bildes von Seiten des lebenden Wesens. Die Fähigkeit, Bilder der Dinge zu erschaffen (bildliche, akustische, taktile, olfaktive), Bilder, die die Wahrnehmungen wiederholen, von denen sie ursprünglich stammen, die das Überleben der Dinge im Geiste erlauben, auch wenn die Wahrnehmungen verschwunden sind, und die damit die »raum-zeitliche Objektkonstanz« konstituieren – diese Fähigkeit entspricht dem wirklichen Beginn des psychischen Lebens. Ohne diese gäbe es keine innere Welt; die Wahrnehmungen erkunden die äußere, aber sie schaffen noch kein Objekt. In der Welt der Bilder gestaltet sich das, was sonst nur Automatismus der nervösen Reflexe wäre, zu einem autonomen Subjekt. Es ist durchaus möglich und wahrscheinlich, dass auch die Tiere Bilder haben. Der Hund, der nach einer langen Abwesenheit seinen Meister freudig wieder erkennt, der Argo der Fabel, der, dem Tod nahe vor Altersschwäche, mit dem Schwanz wedelte bei der Rückkehr von Ulysses ins Heimatland, bewahrte in der Stille und der Abwesenheit das lebendige Bild eines Partners und wartet auf ihn sogar bis zum Tod. Jedoch nur der Mensch entwickelt Symbole. Oder vielmehr die Fähigkeit, Bilder als Hinweis auf andere zu gebrauchen. Schon im Bereich der höher entwickelten Tiere, die schon differenziert denken wie der Hund oder der Schimpanse, erscheint das elementarste Symbol, die Bilder eines anderen konkreten Bildes im bekannten konditionierten Reflex von Pavlow. Aber nur der Mensch spricht. Gerade in der verbalen Sprache wird es möglich, dass ein sonores oder graphisches Bild, das Wort, dazu dient, ein Ganzes zu bezeichnen, auch das, was nicht sichtbar, hörbar, tastbar ist. In der Evolution des Menschen, sind die komplexeren Symbole Bilder, die auf Bilder hinweisen, die viel größer sind als sie, auf komplexe existentielle Erfahrungen, nicht mehr direkt wahrnehmbar in der bildgenerierenden Dimension, sondern nur im symbolischen Hinweis: Gott, das Universum, die Liebe. »Das ist die wahre Symbo13
lik«, sagte Goethe, »wo das Besondere das Allgemeine repräsentiert«. Eine Voraussetzung dafür liegt schon in der erlebten Zeit, wo der Augenblick der Gegenwart symbolisch die Vergangenheit und die Zukunft wachrufen kann. Beim Tier kann das nicht geschehen. Das Tier hat eine Zeiterfahrung, wie wir zum Teil zu wissen glauben, die »zeitlos« ist, es erforscht seine Vergangenheit nicht, stellt sie sich nicht vor; es befragt weder seine Zukunft noch nimmt es sie ahnungsweise wahr; es lebt in einer unbegrenzten Gegenwart. Der Tod ist eine spezifische Vorstellung des Menschen. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, dem die Natur das Erleben von Ewigkeit versagt hat. Aber die Fähigkeit, ein Bild in ein anderes zu verwandeln, die Erschaffung des Symbols, hat dem Menschen als Konzept der Transzendenz eine neue, ausgeweitete Ewigkeit gegeben. Die Tatsache, dass im Menschen jedes mögliche Bild auf ein anderes verweist, das Symbol eines anderen wird (wie die Rose das Symbol der geliebten Frau wird, diese das Symbol der Mutter wird, von der das Leben entspringt, und diese wiederum kann auch das Symbol der himmlischen Mutter werden), macht es dem Menschen unmöglich, in irgendeinem Symbol zur Ruhe zu kommen. Das Symbol trennt uns, wie Lacan sagt, für immer von der vollen Stillung des Wunschs. Wenn das Zeichen auf eine Gegenwart verweist, wie Susanne Langer (1942) sagt, verweist das Symbol auf eine Abwesenheit. Das Symbol, das auf eine Sache verweist, beraubt den Menschen der Sache selbst; seines symbolischen Kleides enthüllt, gibt es keinen Zugang zu dem, was Kant das »Noumenon« nennt, das heisst das Ding an sich; so wird die Unersättlichkeit des Menschen begründet, die ihn vom Hunger jedes anderen Tieres unterscheidet. Aber es begründet auch, zusammen mit diesem, die ständige, bewusste oder unbewusste menschliche Sehnsucht nach der vollen Erfüllung des Ideals in Gott. Das Auftauchen des Symbols im Geist des primitiven Menschen, wie wir es in seinen Felsenmalereien wahrnehmen können, hat die Erschaffung einer inneren Welt ermöglicht, in der die einen Bilder wie die Rückseite von anderen erscheinen. Um die psychologische und kulturelle Bedeutung dieses Prozesses zu ermessen, muss bedacht werden, dass die symbolischen Vernetzungen, die sich aus der Zuordnung und Überordnung der verschiedensten Bilder ergeben, 14
nicht mehr wie die Wahrnehmung und das Gedächtnis, ein Abbild des Universums darstellen, sondern die Erschaffung eines zweiten Universums, das nur in unserem Geiste existiert. Das ist die phantasmatische Dimension des Symbols. An diese fügt sich eine zweite an, die im eigentlichen Sinn kognitiv ist: Das Auftauchen des Symbols in der menschlichen Vorgeschichte, in der in Bezug auf die Kausalverkettungen der Ereignisse noch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse verfügbar waren, ermöglichte dem Geist, sie in figurativen Entsprechungen zu verbinden. Für die Strukturierung eines inneren psychischen Raums war dies ein so wesentliches Phänomen, dass sogar einige moderne Autoren wie C. G. Jung sagen, dass gewisse geistige Vorstellungen, die einen Irrtum ausdrücken, wenn sie als Entsprechung zu realen Fakten interpretiert werden, vom Gesichtspunkt der psychischen Wirklichkeit aus gesehen dennoch wahr sind. Der analoge Spiegel von symbolischen Verknüpfungen der Dinge, von ihrem Zusammenklingen und ihrer Ähnlichkeit, lieferte den ersten Schlüssel für ein ganzheitliches magisches Verständnis des Universums: Wer in dessen Besitz war, hatte schon eine priesterliche Funktion; die Anfänge der Wissenschaft liegen, wie im Antiken Ägypten, in den Händen der Priester. Die dritte Dimension des Symbols war affektiver Natur. Ich sehe diese letzte vor allem in der Möglichkeit, den Schmerz der Existenz zu verarbeiten, der mit der Entwicklung der nervösen Strukturen und der Differenzierung der Zivilisationen ständig zunahm. Die Symbolisierung hilft uns, Ereignisse, die uns verwirren oder uns erniedrigen, im Spiegel ihrer Symbole zu betrachten. Mit ihren weitesten Resonanzen, die an die großen Chiffren der Existenz heranreichen, erlauben sie uns, uns zu überschreiten. Jede Religion ist in ihrem Wesen symbolisch; niemand sieht Gott, in keinem Sand ist seine Spur eingegraben, außer im Symbol. Die für diese drei Dimensionen des Symbols grundlegende gemeinsame Eigenschaft ist immer die gleiche: Das Symbol stellt in einer Aufeinanderfolge von Bildern die einen mit den anderen in eine semantische Verbindung und erfasst die den verschiedenen Bildern gemeinsamen semantischen Segmente. Indem so das Bild der Bilder als Symbol erschaffen wird, kann sich der psychische Raum, in welchem sich die Erfahrung des Lebens konfiguriert, ausweiten 15
und vertiefen. Das Symbol fügt der Wahrnehmung und der Erinnerung die Metapher an, die Allegorie, die Ähnlichkeit, die Vorstellung von Dingen, die nicht gesehen werden können, fügt der äußeren Welt eine innere Welt an, die nicht wiederholbar ist ohne diese geistige Schöpfung. Darin besteht der wirklich große evolutive Sprung, der den Menschen vom Tier unterscheidet, dem nur elementare psychische Vorstellungen eigen sind. Wenn wir weiter bedenken, dass das Symbol auch das Sich-Spiegeln des Selbst im Anderen ausdrückt und des Anderen im Selbst; wenn wir weiter bedenken, dass das Selbst zu Beginn des Lebens diesem psychischen Austausch nicht voraus existiert, sondern sich in ihm erschafft, im Raum zwischen Mutter und Kind; weiter, dass der biologische Raum in der Identifikation mit dem Anderen Geschichte wird, Zeit wird; dass das Neugeborene in den Gedanken der Mutter eine Seele gewinnt, dann können wir sagen, dass das Symbol an der Wurzel der Menschwerdung ist. Obwohl wir keinen präsymbolischen Menschen kennen, können wir doch über die evolutive Entstehung des Symbols nachdenken, indem wir drei große phylogenetische Entwicklungsrichtungen des menschlichen Geistes annehmen. 1. Der prähistorische Mensch befindet sich noch am Beginn des rationalen Bewusstseins, so wie der Mensch, der träumt. Er versteht rational nicht das, was wir verstehen. Er glaubt an die konkrete Wirklichkeit der Mythen. Noch taucht hinter ihnen nicht das auf, was wir heute ihre Bedeutung nennen würden. Die Bedeutung ist ganz im Symbol selbst, das darum der einzig mögliche Ausdruck der Bedeutung ist. Diese Bedeutung muss auch gegenwärtig sein im Unbewussten wie im Traum. Die Wahrheit erschien im Lauf der Evolution vor allem durch das Symbol hindurch, und noch heute sagt ein Spruch des Talmud, dass die Wahrheit nicht nackt zur Welt gekommen ist, sondern bekleidet mit dem Schleier des Symbols. So haben wir als Kinder in Bildern denken gelernt und durch sinnliche Wahrnehmungen, von denen wir uns im Denken noch nicht entfernen konnten. In dieser Schmiede von Bildern (zuerst unter allen das Gesicht der Mutter, die uns liebte, uns mit Namen nannte, und uns in ihre Welt der Symbole hineinnahm) entwickelte unser Selbst sein erstes Sym16
bol, das Bild des Selbst, das Bild aller Bilder des Selbst, die sich durch die ersten sozialen Interaktionen bildeten. 2. Das Verbundensein der primitiven Psyche mit der Welt der Bilder, das dem rationalen Denken wie eine Begrenzung des Denkens selbst erscheinen kann, war jedoch ein Akt der Befreiung. Denn es ersetzte die kausalen Zusammenhänge der Zeichen, die schon von den höheren Tieren wahrgenommen werden, durch das Reich des Möglichen, der Phantasie, der kreativen Kraft des menschlichen Geistes. Der Mensch konstruiert seine Welt und nimmt sie nicht einfach nur wahr. 3. Das Symbol repräsentiert so die Möglichkeit des Selbst, die Bilder von sich selbst und von der Welt zu vermehren durch fast unbegrenzte Variationen. Wir sehen das in den Träumen, wo irgendein mentaler Inhalt, zum Beispiel ein existentielles Elend, als Gefängnis, als undurchdringliche Mauer, als Graben, als Sumpf oder anderes erscheinen kann. Die immer größere Strukturierung der Psyche im Lauf der Evolution erfand das System von analogen Bildern als eine Möglichkeit der Selbstkonstruktion und Selbstreflexion. Der Schmerz des Lebens, der mit der Ausweitung der Komplexität des menschlichen Geistes in gleichem Maß an Tiefe zunimmt, findet so im Werk der Symbolisation auch eine größere Möglichkeit der Verarbeitung. Der Schmerz wird nicht nur durch die großen Symbole der Existenz verwandelt, sondern auch dadurch, dass er in den Traumbildern des täglichen Lebens reflektiert und vom schlafenden Ich angeschaut wird, das sich im gleichen Akt des Anschauens außerhalb stellt. Das Symbol ist die erste wirkliche Ausweitung des Geistes, noch vor dem Bewusstsein und der fundamentalen Dualität der Existenz. Das Tier, das diese Ressource nicht oder nur in sehr begrenztem Maße zur Verfügung hat, kann, um zu überleben, nur eine begrenzte Anzahl von Objekten haben, die ihm durch die sensoriellen Wahrnehmungen zugänglich sind. Es kann die Unermesslichkeit der Objekte nicht haben, die sich in der symbolischen Aktivität erschließen, die, indem sie gewisse Vorstellungen bewegt, immer neue erschafft. Das immerwährende Erschaffen von Objekten ist eine Funktion jenes gleichen Ich, das mit seiner Fähigkeit, die Handlung zu verzögern, anzuhalten und in Prozesse zu kanalisieren, die die Welt zu 17
wandeln vermögen, deren Vielfältigkeit möglich und zugleich tragbar macht.
Das Symbol in der Psychotherapie der Psychosen Symbol und Mythos Die Entwicklung des Symbols im menschlichen Geist erlaubte dem Menschen, sein eigenes Innenleben gegenüber der Welt wahrzunehmen. Dieses innere Leben in Worte fassen, ausdrücken und erinnern, es in den großen Zeugnissen des Wortes weitergeben oder es sich voll aneignen, war der wirkliche Beginn der Geschichte. Dieser Beginn setzte schon lange vor der ersten Geschichtsschreibung ein, er begann in den Mythen, die in der frühesten Epoche der menschlichen Geschichte die eigentliche Wiege der Symbole sind. Denken wir kurz über die Entstehung des Mythos nach. Ich bin der Ansicht, dass seine letzte Wahrheit in der Tatsache liegt, dass in seinem Spiegel der Mensch sein inneres Leben wie die Geschichte der Welt erfährt. Hier ist noch nicht die Spaltung zwischen Subjekt und Objekt, die das Bewusstsein des »modernen« Menschen ausmacht. Das, was die menschliche Seele stark bewegt, ist die Wirklichkeit der Götter und der Helden. Der moderne Mensch schreibt Gedichte und Romane, und er unterscheidet seine symbolische Produktion von dem äußeren Lauf der Ereignisse; der mythische Mensch macht diese Unterscheidung noch nicht. Die Zeugnisse seines inneren Lebens, die Mythen, sind kollektiv; die einzelne schöpferische Persönlichkeit existiert noch nicht, der Sänger ist anonym, und seine Gesänge, neu gebildet von Mal zu Mal durch die Inspiration, gestalten sich alle nach einer gemeinsamen Matrix. Die Dokumente des inneren Lebens, die »zweite Wirklichkeit« nach der Wahrnehmung der Welt, müssen als objektive Wahrheit einem Glauben anvertraut werden, einem Kanon, einer Tradition, der kollektiven und objektivierenden Struktur des Mythos. So haben sich die großen Archetypen der menschlichen Seele gebildet, die die entsprechenden Mythen überleben. In der Geschichte sind sie nun verblasst, hingegen finden wir sie wieder in den Träu18
men, in den Halluzinationen und in den Wahngebilden unserer Patienten. Es scheint mir, dass der wichtigste Beitrag C. G. Jungs, des großen Psychotherapeuten der Psychosen, nicht so sehr in der Gelehrsamkeit liegt, mit der er die Produktionen seiner Patienten mit den Mythen vergleicht, als vielmehr in der Entdeckung, die in seinem ganzen Werk implizit vorhanden ist, dass die Archetypen in der psychotischen Auflösung des Ich den letzten Anker darstellen, den die menschliche Existenz braucht, um im nicht mehr Verstehbaren sich selbst noch zu verstehen.
Die Entstehung des Symbols in der Psychotherapie der Psychosen Ich kenne eine Grundsituation, in der ich das Sich-Erschaffen des Symbols gesehen habe: der Traum und die Wahnvorstellung in der psychotherapeutischen Begegnung. Bevor ich diesen Gedanken entwickeln möchte, um dessen Keim in der menschlichen Ontogenese zu erkennen, werde ich ihn mit einigen unmittelbaren Bildern aus der Therapie veranschaulichen. Ich tue dies mit drei Beispielen. Ein Patient, der sich von fremden Stimmen verfolgt fühlte, die aus dem Inneren der Erde und aus den Ecken zu kommen schienen und dann wieder vom Himmel herab, hörte unerwartet die Stimme seines Therapeuten, der ihm im Schlaf sagte: »Fürchte dich nicht, gehe in den Garten und höre die Stimmen der Vögel, sie sind die Stimme Gottes.« Er kann nicht unterscheiden: Spricht sein Therapeut zu ihm oder spricht einfach sein neues Selbst, das aus der psychotherapeutischen Begegnung hervorgegangen ist und das sich nun siegreich bestätigt im Kampf gegen die Psychose – und das so die Verfolgung in eine Segnung verwandelt? Ein Traum eines anderen Patienten: Der Patient träumt, dass eine Interpretation seines Therapeuten, die ihm seine wirkliche, sonst durch die Psychose verfälschte Identität zeigte, »ein Sonnenstrahl ist, der in sein Haus eindringt, nicht von einem Fenster her, sondern vom Dach her bis hinunter zum Funda19
ment«. Er erwacht mit der Frage: War das die Botschaft meines Therapeuten, oder mein neues Selbst, das gekommen ist, um sich wie ein Sonnenstrahl anzukündigen? Und ein dritter Traum eines weiteren Patienten: Der Patient träumt von einem angeketteten Lamm, das nahe am Sterben ist vor Hunger und Durst. Er bindet es los, gibt ihm zu trinken und zu essen und dabei weiß er plötzlich nicht mehr: Ist er das Lamm oder sein Retter? Und wer ist diese Person, die das Lamm losbindet und es nährt: Ist er es oder sein Therapeut? Wir sehen in diesen Träumen, wie das Subjekt des Träumers sich im Spiegel des therapeutischen Objekts wahrnimmt. Es identifiziert sich mit diesem und bezieht aus dieser Identifikation seine existentielle Stärke, seine Lebenskraft. Es unterscheidet sich dann aber auch von diesem und grenzt sich in der Begegnung, die ihn Person werden lässt, als Person ab. Wir haben dieses Bild des Selbst »Übergangssubjekt« genannt: Es ist auch das Bild eines Du, in dessen Antlitz das Selbst sich (wieder) erkennt und sich neu erschafft. In einem ersten vorsymbolischen Stadium ist das Übergangssubjekt noch nicht voll seiner selbst bewusst. Es stellt sich noch nicht die Frage: »Wer bin ich?«, sondern existiert vor allem, bevor es über die eigene Existenz reflektiert. Erst danach wird im Prozess der vollen Heilung die »intersubjektive« Beziehung eine »interpersonale«. Dies geschieht dann, wenn die Beziehung nicht nur aus Identifikation, Fusion, Symbiose lebt, sondern auch aus Unterscheidung und Differenzierung, das heißt, wenn die »Personifikation« möglich geworden ist. Hier wird das Selbstsymbol geschaffen. Dieses Symbol ermöglicht dem Selbst, sich zu erkennen, Subjekt zu sein und mit der Reflexion das eigene Selbst-Objekt zu erschaffen. Ich habe diesen Prozess mit verschiedenen Metaphern bezeichnet: Ich spreche von »dualisierender Symmetrie«, welche die »psychotische Fusion«, die ein Quell des Leidens ist, in die »therapeutische Symbiose« verwandelt. In dieser identifiziert sich der Therapeut in seinem Unbewussten mit seinem Patienten. In seinen Träumen durchwandert er die psychotischen Landschaften seines Patienten, zieht seine Kleider an, trägt seine Lasten, wird mit seinem Namen genannt. 20
Im Unterschied zu seinem Patienten, der zu Beginn seine Identität unbewusst in der »Nische« der Identität eines Anderen konstruiert, geht ihm der Therapeut voraus im Erschaffen des Symbols. Er erkennt sich als Stellvertreter seines Patienten, als seinen Weggefährten, und so verwirklicht er von Beginn an die »Subjekt-Objekt-Komplementarität«. In dieser Komplementarität ist das Objekt nicht nur der wahrgenommene Inhalt, sondern die Grundlage der Wahrnehmung selbst. So ist das Symbol Ausdruck einer Symmetrie, die sich in der Asymmetrie erschafft, und die zu jener Unterscheidung führt, die wir in der menschlichen Ontogenese auch als »Individuation« bezeichnen. Die Entstehung des Selbst und, genauer ausgedrückt, des Selbstsymbols in der therapeutischen Begegnung, in dieser schwierigen Phase zwischen der psychotischen Auflösung des Selbst und seiner Rekonstruktion in der Dualität, führt mich zu einigen Überlegungen in Bezug auf die menschliche Ontogenese.
Überlegungen zum Ursprung des Symbols in der Ontogenese 1. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Entstehen des Selbst und dem Entstehen des Symbols. Unser Konzept des »Selbstsymbols« umfasst beide, in dem Sinne, dass das Selbst nicht anders im Bewusstsein aufsteigt außer als Symbol des Selbst oder als Ich. Es ist eine Tatsache, dass die Wiederherstellung des Ich, des Selbstsymbols, in der Therapie der schizophrenen Psychose gleichbedeutend ist mit der Wiederherstellung der symbolischen Aktivität des Subjekts. Während im Stadium der psychotischen Konfusion das Band zwischen den Dingen und den Worten, zwischen den Objekten und ihren verbalen Repräsentationen verloren geht (weshalb die Worte mit den Dingen verwechselt werden), baut sich mit der Wiederherstellung des Selbst auch die normale symbolische Aktivität wieder auf. Während die so genannten »schizophrenen Symbole« nichts anderes als »Protosymbole« sind, denn sie erlauben die Unterscheidung zwischen symbolisierendem Bild und symbolisierter Sache nicht, erscheint das Auftauchen des Selbstsymbols zusammen mit der symbolischen Rekonstruktion der Welt. Es ist eine Welt, die nicht mehr 21
eindringt in das Subjekt, es spaltet und auflöst, sondern im Gegenteil von diesem kognitiv »in Besitz« genommen wird. 2. Es stellt sich die Frage, ob aufgrund der Erkenntnisse aus der Psychotherapie der Psychosen auf etwas Grundlegendes geschlossen werden kann, das die ganze menschliche Ontogenese betrifft? Wir wissen sehr wenig über das innere Leben des Neugeborenen, da dieses ja nicht verbalisieren kann. Aber aus den verschiedenen Forschungen, die von Margaret Mahler (1975) bis zu Daniel N. Stern (1985) reichen, scheint mir mit Klarheit hervorzugehen, dass wir von Anfang an von einer Integration von postnataler Symbiose und Individuation sprechen müssen. Diese Integration erlaubt, die Phänomene mehr unter dem Gesichtspunkt der Symbiose zu beobachten, wie es Margaret Mahler getan hat, oder vor allem unter dem Gesichtspunkt des frühen Auftauchens des Selbst, auf das sich die Forschungen und Beobachtungen von Stern ausgerichtet haben. Integration von Symbiose und Abgrenzung – das ist das Wesen, die Struktur des Selbstsymbols. Im Moment, da sich das Kind im Gesicht, im Lächeln, in der Gebärde der Mutter erkennt, haben wir die Identifikation mit der Welt, die nie so vollständig, glücklich, unzweifelhaft ist wie in der postnatalen Erfahrung. (Zu der vielleicht, nach der Theorie von Rank, der Künstler regrediert, der sein Kunstwerk gleichzeitig als Ausdruck seines Selbst und als Offenbarwerden der Welt erfährt.) Aber in dem zeitlich damit zusammenfallenden Moment, da das Kind die Erfüllung seiner vitalen Bedürfnisse als von einem anderen abhängig erlebt (und diese Abhängigkeit in so totaler Weise erfährt wie nie in den folgenden Jahren), lernt es in grundlegender Art die Unterscheidung zwischen Selbst und Nicht-Selbst. Das gute Selbst, angenommen und geliebt, ist also nicht die Mutter, sondern ihr Symbol, das Symbol der mütterlichen Liebe, das zugleich das positive Symbol des Selbst ist. So erkennen wir das Entstehen des menschlichen Symbols in der ersten und grundlegenden dualen Beziehung, die die gesamte menschliche Existenz strukturiert. Den eigentlichen Ursprung des Selbst, der uns in den Träumen als Wiege der Symbole und auch in der psychotherapeutischen Begegnung erscheint, erkennen wir in letzter Analyse in der Grundlage der psychischen Struktur des Menschen, in der Beziehung, in der Dualität. 22
Von daher ergibt sich die Bedeutung der Partizipation des Therapeuten an der psychischen und symbolischen Welt des psychotisch Leidenden. In dieser Teilnahme, bestehend aus Zeit, Geduld, Hinhören, Interesse, Sympathie, Vorschlag, Botschaft, Interpretation, Phantasie, Kunst, wird das psychotische Protosymbol verwandelt in das allgemeine Symbol. Der Patient erschafft in der Begegnung das Selbstsymbol, das Wiederfinden seiner selbst, die Entdeckung der eigenen Identität: Die Intersubjektivität der Beziehung (wo die Beziehung noch intrapsychisch ist, phantasmatisch, Bildern anvertraut, die dem Bewusstsein der eigenen Person und derjenigen des Therapeuten vorausgehen) wird verwandelt in die Interpersonalität.
23
Das Symbol in der Religion, im Mythos und im religiösen Wahn
Der Begriff »Symbol« ist griechischen Ursprungs und entspricht dem Verb »symballein«, das heißt zusammenfügen, »verbinden«. Es entstammt einem uralten Brauch: Wenn zwei Freunde sich für lange Zeit trennten, teilten sie eine Münze, eine Drachme, in zwei Teile, von der dann jeder die Hälfte für sich behielt; im Augenblick der neuen Begegnung, nach Jahren des Fernseins, wurden die beiden Teile der Münze ineinander gepasst: Symbol der Begegnung, der wiederhergestellten Einheit. In der Begegnung mit der Transzendenz ist das Symbol das Konzept, das wir uns von ihr erschaffen, ist das Wort, mit dem sie uns entgegenkommt. Die Transzendenz ist nur erfassbar für den, der sie liebt, selbst wenn er nicht an einen persönlichen Gott glaubt: »Da ich Dich liebe, oh Ewigkeit«, ruft Nietzsche (1976) in seiner Suche nach ihr aus. Das Symbol ist gleichzeitig der Widerschein des Selbst und des geliebten Objekts: So wie das Kind sich selbst im Lächeln der Mutter sieht und sich als Objekt ihrer Liebe entdeckt, so entdeckt es im selben Maß die Mutter, und umgekehrt. Die Transzendenz, wie sie von der Psychoanalyse interpretiert wird, als reine Projektion des Wunsches, ist nicht mehr Transzendenz, sie sagt nichts mehr, ist nur Teil des Selbst. Die Projektion ist nur eine Hälfte der Münze. Die Transzendenz, so angerufen, kommt auf uns zu mit der anderen Hälfte der Münze, und sie spricht uns an mit der gleichen Sprache, mit der wir sie gerufen haben. So wie sich uns Gott im Bild des Kreuzes kundtut, auf welchem Er sich für uns geopfert hat, so tat Er sich den Alten Griechen kund, zum Beispiel im Rauschen des Windes, der durch die Zweige der Zeus geweihten Eiche Dodona wehte. Damit die Begegnung sich ereignen kann, ist also unsere »Projek24
tion« notwendig – Maria zeigt sich nur in den Ländern des katholischen Glaubens, und die Phänomene der Seelenwanderung, die anscheinend auch wissenschaftlich nachweisbar sind, ereignen sich nur in der buddhistischen Kultur. Die Transzendenz ist immer bereit, sich uns zu offenbaren durch das, womit wir sie anrufen: Es ist »der kategorische Imperativ Kants«, der, nach dem Nachweis, dass es nicht möglich ist, die Existenz Gottes mit der rationalen Vernunft zu beweisen, Gott mit der »praktischen Vernunft« wahrnahm. Aber unsere Projektion ist nicht nur das, was die Transzendenz ruft, das ihre Botschaft möglich macht, sondern, unvermeidbar, auch das, was sie verdunkelt, was sie verbirgt. Nur der Tod wird uns die Augen öffnen, um sie zu sehen. Unsere menschliche Projektion bedeckt die Transzendenz mit unserem Bild von ihr. Wir nehmen diese »Dunkelheit« nicht wahr, wenn wir uns im Glauben völlig mit unserer Sprache, mit unserem Bild identifizieren. Aber kaum sind wir jenseits der Epoche, die die soziologischen Voraussetzungen dieses Glaubens geschaffen hatte, werden wir des Ungenügens des Bildes gewahr. Als die Zeit des Zeus, dessen Tempel in Ruinen ich überall in Griechenland bewundert habe, vorbei war, blieben nur noch die Ruinen; indem wir die menschliche Hälfte der Münze in die Hand nehmen, sehen wir, dass sie nicht mehr mit der anderen Hälfte zusammenpasst. Als Kaiser Julian der Apostat (360 n. Chr.) dem Orakel des Apollo in Delphi eine Botschaft schickte, ließ ihn die Pythia wissen: »Zerstört ist der Heilige Ort; Phoibos hat keine Stätte mehr, und keine prophetische Krone, ihm gehorcht die Quelle nicht mehr, verstummt ist das Murmeln des Heilgen Wassers.«
Dann wird aus dem Symbol einer existentiellen Wahrheit der »Mythos« der folgenden Epoche; die Quelle ist vertrocknet. Das, was den Mythos vom lebendigen Symbol unterscheidet, ist die Abwesenheit existentieller Wahrheit in ihm; an dessen Stelle tritt ein psychologischer Gehalt. Auch wenn der psychologische Gehalt, der daraus entsteht, heute immer noch interessant ist, so ist er nicht mehr der »Dekalog«, ist nicht mehr »die Stimme Gottes«; so sehr, dass einige 25
protestantische Theologen, die befürchten, dass die Stimme des christlichen Gottes in der Welt der Wissenschaft nicht mehr vernehmbar ist, wie Bultmann (1954) versuchen, das Christentum zu »entmythologisieren«, das heißt, es auf das zu reduzieren, was heute die Präsenz Gottes in seiner evangelischen Botschaft bezeugt. Der Mythos, im Unterschied zum Symbol, ist rational interpretierbar. Im Mythos von Prometheus, der von Zeus an einen Felsen gekettet ist, weil dieser ihm nicht verzeiht, ihm das Feuer gestohlen zu haben, um es den Menschen zu geben, erkennen wir zum Beispiel die Angst der antiken Religion, dass die Befreiung der Ratio, die Autonomie des Menschen gegenüber Gott, schließlich zu seiner Verleugnung führt; erkennen den »Homme révolté« von Camus (1951). Der Mythos erscheint da, wo die Wissenschaft voran schreitet. Als Kind lehrte man mich, dass der Tod mit der Sünde Adams und Evas in die Schöpfung kam. Heute weiß ich, dass der Tod ebenso alt ist wie das Leben, dass er mindestens eine halbe Milliarde Jahre vor der Evolution des Homo erectus aus den Hominiden auf unserem Planeten erschienen ist Als Darwin die Gesetze der Evolution entdeckte, empfand er auch ein tiefes Schuldgefühl, weil er das Symbol der Erschaffung der Menschen durch die Hand Gottes in einen Mythos verwandelt hatte. Der Übergang vom Symbol zum Mythos ist gekennzeichnet von einem Konflikt, den wir mit dem Vergrößerungsglas der Psychoanalyse gut beobachten können. Der Konflikt kann sich kundtun als »Trauer« über den Verlust eines Liebesobjekts; wir fühlen sie beispielsweise in den Versen des Euripides (zitiert nach Durant 1950): »Gibt es jemanden, der noch glauben kann, dass da oben die Götter existieren? Sie sind nicht dort! Sie sind nicht dort! Keiner darf euch mehr täuschen mit dieser alten Fabel, die uns vom rechten Weg abbringt.«
Der Konflikt ist vernehmbar im Protest, mit dem man sich noch an den alten Glauben anklammert. So lesen wir in den ersten zwei Versen einer verlorenen Tragödie von Euripides, Melanippe: »O Zeus, wenn Er überhaupt existiert, denn ich kenne ihn nur vom Hörensagen« Das Publikum bricht in Rufe des Protestes aus.
26
Das verlorene Liebesobjekt ist auch ein Objekt enttäuschender Liebe, wie uns die Psychoanalyse lehrt, und dann wird es zur Zielscheibe der Aggressivität des enttäuschten Ich. So wird erzählt, dass Hippokrates auf der Insel Kos die Stele des Asklepios, des Gottes der Medizin, zerstörte. Die ganze Ambivalenz des Konflikts ist spürbar in den Werken des Aristophanes, der zwar einerseits sarkastische Anspielungen auf die amouröse Freizügigkeit der antiken Götter macht und von ihnen sagt, dass sie »im Himmel Bordelle eröffnet haben«, aber anderseits den Philosophen vorwirft (die wie Xenophanes und Parmenides die Götter als Mythen betrachteten und an ihrer statt das Sein, das Eine setzten), den Glauben zu zerstören. Wenn hingegen der Zusammenhalt zwischen der menschlichen Hälfte der Münze, die unsere geschichtliche Existenz darstellt, und der anderen Hälfte, dem Bild der Transzendenz, vollkommen ist, dann ist das Symbol nicht mehr in der Lage, sich selbst zu sehen; dann wird die existentielle Wahrheit, die in ihm liegt, als absolut objektives Geschehen betrachtet, außerhalb des Subjekts; dann tritt an die Stelle der Ratio die Erfahrung des Wunders. Das Brot wird zum Leib Christi, der Wein wird zu seinem Blut; die körperliche Krankheit löst sich in den Wassern von Lourdes auf wie im Tempel des Artemides in Ephesus; die indische Erfahrung der Erleuchtung verwandelt für immer die menschliche Existenz. Ich habe in Epidaurus den Tempel des Asklepios besucht, des »Gottes des Erbarmens«, zu dem Kranke aus der ganzen antiken Welt Zuflucht nahmen; die antiken Stelen sprechen von wunderbaren Heilungen, die Blinden sahen, die Krüppel konnten gehen, die Kranken wurden auch aus der Ferne geheilt: Wunder wie im Evangelium. Mir ist die Erfahrung des Wunders, das die Griechen »en theos« nannten und die Christen »Gnade«, nicht erlaubt; ich darf nicht an das Unglaubhafte glauben, soll mein Denken für mich selbst glaubhaft bleiben. Mir ist es hingegen möglich, wie C. G. Jung die ganze Schönheit und Tiefe der großen existentiellen Symbole zu erfahren, als »Chiffren« der Transzendenz, ohne die Vernunft umzustürzen. Manchmal ist diese Schönheit und Tiefe des psychologischen Gedankens auch gegenwärtig in einem historisch vergangenen Mythos; zum Beispiel in dem, der uns erzählt, wie der Gott Asklepios schließ27
lich gestorben ist, weil er gewagt hatte, das Menschliche dem Tod zu entreißen. »Das Gefühl riecht und hört, der ganze Rest ist blind und taub«, sagt uns der Poet Epiharmos (1978); es ist in Wahrheit das existentielle Erleben, das sieht und hört und noch heute gegenwärtig ist. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Traum eines Psychotherapeuten, der, um mit seiner Patientin zu sprechen, die sich in ihrem Wahn für tot hielt, in die Kammer des Todes stieg und selbst für einige Zeit tot war. Andere Male ist der psychologische Gehalt des Mythos wie »ausgetrocknet«, es ist kein Symbol mehr darin, da die soziologischen Voraussetzungen dieses Denkens verschwunden sind. Zum Beispiel im Mythos der Athene, die von Zeus gezeugt wurde, aus einem »Bein« des Gottes. Der psychologische Gedanke ist hier wahrscheinlich die Allmacht dessen, der so zeugt, und die Einzigartigkeit dessen, der so gezeugt wird. Allmacht und Einzigartigkeit waren lange Zeit Ziele der menschlichen Sehnsucht. Brunhilde wurde aus dem Haupt des Wotan gezeugt, Maya war in Indien die Jungfrau und Mutter, wie es Maria für Katholiken zum Teil heute noch ist. Unser Geist entwickelt sich jedoch. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem camaldolensischen Mönch, für den die Kreuzigung Christi, unter anderem auch der Verzicht Gottes auf seine Allmacht bedeutete. Und wenn wir im Bruder, der leidet, Christus sehen, gehen wir damit auch über die Einzigartigkeit hinaus. Markus Barth, der Sohn Karl Barths, erzählte mir von einem Gespräch, das zwischen Paul Tillich, dem bekannten liberalen protestantischen Theologen, und Mircea Eliade, dem großen Religionswissenschafter, stattfand. Auf die Frage Eliades, ob heute das Christentum bereit sei, auf das Dogma der Einzigartigkeit zu verzichten, antwortete Tillich: »Gewiß. Jede Religion ist ein Weg zu Gott. Aber das christliche Symbol ist das tiefste von allen.« Ich bin damit einverstanden. Die innere Wahrnehmung, dass die Welt nicht in sich selbst eingeschlossen ist, dass über ihr und ihrem grenzenlosen Leiden nicht ein »pan theos« ist, sondern eine Person, die uns so sehr liebt, dass sie sich in unser Leiden inkarniert – das ist der erhabenste Gedanke, den ich je gekannt habe. Diesem erhabenen Gedanken gegenüber verstehe ich auch die Situationen, von denen ich mich ausgeschlossen fühle, wo die Spal28
tung zwischen den beiden Teilen der Münze aufgehoben scheint, wo zum Beispiel die Hostie von Bolsena, zerbrochen, blutet. Wir haben vom Symbol in drei verschiedenen Bedeutungen gesprochen: Erstens in der Situation der existentiellen Wahrheit, in der das Symbol im Geiste lebt, ohne die Notwendigkeit, die Naturgesetze aufzubrechen. Zum Beispiel in der Erinnerung an das letzte Abendmahl, wo Christus gegenwärtig und mit uns ist, ohne dass wir seine Gegenwart hinter den Hüllen von Brot und Wein suchen müssen: Es genügt, wenn er in unseren Herzen gegenwärtig ist. Zweitens im Mythos, wo das Symbol dessen psychologischer Gehalt ist. Dieser Gehalt ist nicht mehr der Akt des Glaubens, kann aber ein bedeutungsvolles archetypisches Erleben sein. Sichtbar zum Beispiel im Bild des Gottes Asklepios, der sein Leben hergibt, um die Toten zu erwecken, und der sich so der Gestalt des Christus annähert. Es kann auch ein Symbol sein, das schon vergangen ist und das uns nur als historisches Phänomen interessiert: so in den verschiedenen Mythen, in denen als Ausdruck der göttlichen Allmacht die Geburt durch die Jungfrau möglich ist. Drittens im vollkommenen Symbol, wenn die zwei Hälften der Münze, die menschliche Existenz und die göttliche Transzendenz, in der Begegnung in so vollständiger Weise zusammenfallen, dass daraus das Wunder entsteht (z. B. die Auferstehung Christi oder auch die Hostie von Bolsena, die blutet). Nachdem wir diese drei Dimensionen des religiösen Symbols kurz beleuchtet haben, wollen wir abschließend vom religiösen Wahn sprechen. Sein Hauptcharakteristikum zeigt sich darin, dass im Erleben des Wahnkranken der Wahn eine Gewissheit hat, die als solche selbst über den Glauben hinausgeht. Der Glaube erweist sich als Wahrheit, die den Zweifel übersteigt und besiegt. Die wahnhafte Gewissheit hingegen ist hart wie Granit, sie lässt sich nicht ritzen, auch wenn ihr alle möglichen logischen Argumente entgegen gehalten werden. Zugleich ist sie in den Augen dessen, der sie von außen beobachtet, eine Absurdität. Diese Absurdität verblasst jedoch, sobald wir es verstehen, uns dem psychotischen Symbol anzunähern, um dessen Tragödie und Schmerz zu spüren. Der psychotische Kranke ist ein tragisches Wesen. Er hat die Hälfte der Münze nicht, die der mensch29
lichen Existenz entspricht, hat nicht, wie wir alle, ein wirkliches Selbst, er hat nur Scherben, ein Fragment von sich selbst. Aber er hat dennoch, wie der Psychiater Ideler (1941) vor 150 Jahren formulierte, die Tiefe einer Sehnsucht, die vom Schmerz eines ganzen Lebens kommt: Er bietet eine Scherbe seiner selbst der Transzendenz an, die dann auch in seinem religiösen Wahn ihm entgegenkommt. Die Griechen drückten dies in den Worten aus, dass das Individuum »außer sich« sei. Lacan formulierte, dass im Nichtvorhandensein des Symbols das so genannte »Reale« (das wir uns als etwas dem Kantschen Noumenon Ähnliches vorstellen könnten) das Bewusstsein umkehrt und überflutet. Ich selbst würde dies metaphorisch so ausdrücken: Die Fusion eines Scherbens des Selbst mit einer Erfahrung, die nicht anders ausgedrückt werden kann, schafft die autistische Welt, den schrecklichen Wahn. In diesem erahnen wir, zusammen mit der Absurdität der Psychose, ein verzweifeltes Suchen und eine einzigartige existentielle Erfahrung, außerhalb derer für den Patienten nur mehr das Nichts ist. Das ist dann eine zutiefst traurige Erfahrung der Transzendenz, denn sie ist in ihrer Bedeutung nicht mitteilbar. So bleibt sie ausgeschlossen vom Erleben jener Dualität, die durch eine mögliche gemeinsame Bedeutung entsteht und in der allein sich das Selbst bilden kann. Ich erinnere mich an eine Patientin, die sich in beständigem Kontakt mit der »Sonne« fühlte und in einer von allen Menschen verschiedenen Weise an ihrer Existenz teil hatte. Die Patientin wurde durch die Psychotherapie von ihrer Psychose geheilt, mit Ausnahme der Wahnidee. Diese begleitet sie nun in ihrem sozialen Leben; sie arbeitet als Lehrerin und spricht mit niemandem über ihr großes Geheimnis, das für sie außerhalb jeder Diskussion steht. Nicht einmal in der Psychotherapie will sie noch darüber sprechen. Unsere Aufgabe als Psychotherapeuten besteht darin, solchen Patienten das Erleben der Dimension von Dualität auch in dem Ausdruck des Wahns zu ermöglichen, ohne den Wahn zu bestätigen, aber auch ohne ihn als Absurdität zu negieren. Es ist dann möglich, dem Patienten zu sagen: »Es ist etwas Wahres in dem, was du sagst, das wir noch zusammen meditieren müssen, um es zusammen tiefer zu verstehen.« Solche einfachen Sätze wären jedoch ohne jede psychotherapeuti30
sche Wirksamkeit, wenn wir in diesem »etwas«, das im Wahn verborgen ist, nicht den Schatten des wirklichen Symbols erahnen würden. Das heißt, wir dürfen den Wahn nicht nur auf den Konflikt, den Komplex, auf die Projektion, auf die psychodynamische Gegebenheit, auf den »Widerstand« des Patienten reduzieren. Ich erinnere mich an einen Patienten, der 15 Jahre älter war als ich, mit dem ich nur innerhalb des Wahns kommunizieren konnte (in welchem er eine Geschichte Christi schrieb, und er selbst war Christus). Er war 80-jährig, aber im Akt der Kommunikation entdeckte er im Therapeuten seinen Vater, und er lernte, seinen Vater zu lieben.
31
Der Traum in der Psychotherapie der Psychosen
Einleitung Der Traum ist eine tiefe Selbstwahrnehmung in Bildern, eine bildhafte Wahrnehmung, die, wenn sie aufgenommen wird, einen Prozess des Denkens in Gang bringt, in dem kein Versiegen droht wie im rationalen Denken. Der Traum ist eine komplexe Form von verschiedenen Wahrnehmungen des Selbst, in der visuelle, somästhetische, akustische Bilder in räumliche und zeitliche Kategorien integriert werden. Das entspricht einem Inhalt, der im Bewusstsein seine Definition hat, der aber in der mehrphasischen Eigenart des Traumsymbols eine vitale Potentialität besitzt, die für den Träumenden als Erfahrung seiner selbst wirkt, auch wenn sie später nicht von der dem Traum folgenden Reflexion aufgenommen wird. Sehr oft geben die Träume sowohl bei klinisch gesunden Personen wie auch bei Geisteskranken interpersonale Situationen des alltäglichen Lebens wieder, aber auch Situationen aus der Therapie, wenn es sich um Leidende in der Therapie handelt. Diesen Träumen werden wir den Hauptteil unserer Dokumentation und unserer Reflexionen widmen. Aber die Träume können auch davon abstrahieren und in großartigen Bildern die ganze Existenz der Träumenden darstellen. An den beiden Extremen dieses Traumbogens befinden sich einerseits die »erhabenen« Träume jener Menschen, denen es gewährt wird, sich in ihren Träumen in die kreativen Aspekte der menschlichen Existenz einzusenken – und andererseits die tragischen Träume der schwer psychisch Leidenden. Natürlich schließen sich die beiden Extreme nicht aus, sie können in derselben Person zusammen existieren, aber schon statistisch ge32
sehen finden wir an den beiden Extremen verschiedenartige Lebensschicksale.
Der erhabene Traum Als Beispiel des Gesagten möchte ich zuerst drei Träume einer neunzigjährigen Therapeutin wiedergeben, die dank ihrer guten psychischen Gesundheit ihr Leben ihren Patienten widmen konnte, und anschließend einige Träume von Patienten.
Drei Träume einer Therapeutin (Elisabeth) Ich reiste in einem hölzernen Boot zur Mitte der Welt. Zwei dunkle Gestalten begleiteten mich. Es war nicht möglich zu erkennen, wer die zwei »Boten« waren. Ich kam mit ihnen in die Mitte eines unendlichen, offenen Meeres. Über mir das Gewölbe des Himmels, ebenso unendlich. Die zwei Begleiter verschwanden, und ich befand mich allein zwischen zwei Ufern, die gegenseitig unendlich entfernt voneinander waren, wie zwischen Europa und Amerika. Auch das Boot aus Holz (ein Jahrtausende altes Holz) verschwand; ich brauchte es nicht mehr unter diesem unendlichen Himmel, der sich immer mehr mit Licht füllte. Ich bin erwacht mit einem Gefühl der Dankbarkeit für diesen Traum, trotz der großen Einsamkeit am Ende des Lebens. 2. Ich befand mich in einer antiken Stadt, schritt auf einem Boden dahin, den Tausende von Menschen in vergangenen Jahrhunderten durchschritten haben. Ich ging auf den Tempel zu. Und das war ein unendlicher Tempel, in den man nur durch ein kleines, schmales Tor aus Holz eintreten konnte. Ich fand dieses Tor und trat in den Tempel ein. Niemand war hier, und ein übernatürliches metaphysisches Licht brach in den gewaltigen Raum ein, der zwischen zwei unendlichen Wänden eingeschlossenen war. Ich konnte nur die eine Wand sehen, da die andere, die linke, in Dunkel gehüllt war. 33
Zur rechten erhoben sich gewaltige Gestalten von Königen, Pharaonen und Helden aus anderen Zeiten und auch aus der Gegenwart. Die Träumerin hat dazu assoziiert, dass nicht alle Menschen das kleine Tor aus Holz finden und dass sie dann lange warten müssen, vielleicht durch andere Leben hindurch, um es schließlich zu finden. Die linke dunkle Wand wurde von mir und Elisabeth assoziativ in Verbindung gebracht mit dem, »was wir noch nicht kennen«, wie auch mit dem Dunkel und dem Bösen im Leben (Elisabeth hat als Jüdin eine Vergangenheit des Leidens gehabt). 3. Ich befinde mich in einem Tempel zusammen mit vielen anderen Personen, die an einer Bestattungszeremonie teilnehmen. Jemand war gestorben und war schon im Sarg eingeschlossen. Aber auf dem Fußboden erschien seine Gestalt und leuchtete azurblau und silbern – die Gegenwart seiner unsterblichen Seele – in einem außergewöhnlichen Glanz. Die Situation der Einsamkeit stellte sich in der Topographie des Traums dar: Während alle anderen Personen an einem Pol um das Bild des Verstorbenen standen, befand ich mich allein am anderen Pol. Jemand sagte mir, dass ich einige Stufen hinaufsteigen müsse, um eine Homelie in der Synagoge zu halten. Ich versuchte, mich dem zu verweigern, da ich keine Worte hatte, aber der Befehl war unumgänglich, es war unmöglich, mich ihm zu entziehen. Da stieg ich hinauf und sprach. Jemand sprach durch mich hindurch, denn die notwendigen Worte strömten durch mich hindurch aus meinem Mund. (Elisabeth hat zu diesem Traum ihre Vergangenheit als Therapeutin assoziiert: Sie hatte keine Ausbildung, aber seit ihrer Jugend hatte sie ein Gespür für die Transzendenz gehabt, und sie hat mit dem Pinsel Mandalafiguren gemalt, noch ohne etwas von ihrer Bedeutung zu verstehen.)
34
Der Traum als Spiegel der existentiellen Tragik – Träume von Patienten in der Psychotherapie Eine Patientin befindet sich im Traum in einer menschenleeren Heidelandschaft, die von einem alten Zug durchquert wird. Dieser besteht nur aus einer verrosteten Lokomotive, die ein Gefängnis zu sein scheint. Aber die Lokomotive ist das einzige Zeichen von Leben in dieser toten Landschaft, in der ohne Wasser kaum Pflanzen wachsen. Zwei Frauen zeichnen sich in diesem Ort ab. Die eine ist die Patientin selbst, die andere eine unbekannte Frau, die als verrückt betrachtet wird. Diese kommt jeden Tag hierher und wartet auf den Zug in der verrückten Hoffnung, in ihn einzusteigen. Aber niemand nimmt sie mit, niemand hilft ihr, in den Zug einzusteigen. Doch, hier ist jemand, der sie sieht, der sie einlädt und ihr unter Anstrengung beim Einsteigen hilft. Der Zug hat keine Tür, die sich öffnet, sondern nur ein kleines Fenster, durch das man klettern muss. Die Lokomotive fährt schnaufend davon, in eine Richtung ohne Ziel. Die Lokomotive sieht aus wie ein Gefängnis, und sie wird von der Patientin mit der Depression assoziiert. Die Patientin erkennt in der Frau, die allein bleibt, eine Hälfte ihrer Person; diejenige, die immer versucht, von den anderen verstanden, angenommen, geliebt zu werden und die schließlich immer verlassen wird. So ist zumindest ihr inneres Erleben, das jedoch in ihrem tragischen Leben auf ein wirkliches und grausames Schicksal projiziert zu sein scheint. Wer möchte die Patientin sein? Diejenige, die allein gelassen wird und die vielleicht in dieser verlassenen Heidelandschaft sterben wird, oder jene, die sich einkerkert in der Lokomotive, in einer depressiven Beziehung? Beide Ausgänge sind trostlos. Der einzige Trost ist nur jener, sich im Traum »zu sehen«, die Absurdität der Existenz mit Händen zu greifen, ohne Illusion. Das ist »der Trost der Wahrheit«, eine Version der Aussage: »Man kann dem Menschen die Wahrheit zumuten«. * Ein schizophrener Patient wird, wie in Sartres Philosophie, vom menschlichen Blick verfolgt. Aber in wahnhafter Art: Alle Blicke treffen auf ihn, auf seinen schwachen und kümmerlichen Körper, 35
Objekt des allgemeinen Spotts und der Verachtung. Tag für Tag gaffen sie ihn an und äußern ihre Kommentare mit ihren Gesten, mit halblauten Worten, mit Blicken, sprechen hörbar von ihm auf der Straße mit anderen, sprechen von ihm am Handy und erwähnen ihn in den Zeitungen. Der Mann ist in Wirklichkeit kräftig. Aber er nimmt es nicht wahr. Er denkt nur an eine Sache. Und das ist so unerträglich, dass er vor einigen Monaten einen Suizidversuch gemacht hat, indem er sich von einer Brücke hinunterstürzte. Aber das Leben, nicht der Tod, hat ihn verschlungen, damit er leidet. – Er will keine Medikamente nehmen, keine Sedativa, und so leidet er noch mehr. Ein Teil seines Selbst ist auf der Seite der Verfolger, die ihn verachten, wie er sich selbst verachtet. Aber ein anderer Teil seines Selbst ist auf seiner Seite, verteidigt ihn. Doch die Verteidigung zeigt leider nicht den geringsten Anschein von Liebe für seinen »schwachen« Körper, den er verachtet; seine einzige Verteidigung besteht darin, sich vor den Verfolgern schützen zu wollen. Aber wie kann er sich schützen, wenn doch die andere Seite des Selbst mit den Verfolgern ist? Und wenn sein ganzes Tun darin besteht zu beweisen, dass die Verfolgung objektiv, wirklich ist? Daher dieses Bedürfnis nach Überprüfung, die aber, wenn sie ihm im Wahn gelingt, seine erschreckende Einsamkeit nur vergrößert. Offensichtlich ist jedoch etwas in ihm, das ihm helfen will. In einem Traum sieht er sich unter enormer Anstrengung einen sehr schweren Schrank wegschieben – um im Staub eine arme kleine Pflanze zu entdecken, die noch nicht ganz vertrocknet ist. Und der Therapeut kümmert sich um diese. Sein Blick ist nicht wie jener der anderen, auch wenn der Patient in der Übertragung in ihm gelegentlich einen Verfolger sieht, der »alles von ihm weiß«, aber es ihm nicht enthüllen will. Nur ein Therapeut, der vor allem die leidende menschliche Person im Patienten liebt und mit ihm die »absolute Kommunikation« erfährt, das unbedingte Mit-Sein, das durch keine Psychodynamik bedingt ist, kann einem solchen Patienten einen »Auftrag der Liebe« geben. Das heißt hier: die Möglichkeit einer »Herausforderung« aller Verfolger im heroischen Entschluss, den zerbrechlichen, schwachen Körper zu lieben, der zur Erde gefallen ist wie Jesus unter der Last des Kreuzes. 36
Auch wenn er den Vorschlag nicht annehmen konnte, schien der Patient erschüttert. Er brachte nun einen »seltsamen« Traum, wie er sich ausdrückte, in die Analyse. Im Traum war er im vergangenen Krieg der Kommandant eines nazistischen Konzentrationslagers. Und er schaute mit Verachtung auf die leblosen Körper der Opfer, abgemagert durch den Hunger und die Torturen. Auf der Basis dieses Traums wurde ihm bewusst, dass er unter seinen Verfolgern war. Und er fragte sich bestürzt: »War ich wirklich dieser Nazikommandant? Und ist das meine Bestrafung, jetzt das Opfer und nicht mehr der Mörder zu sein?« Das sind die großen Augenblicke der Psychotherapie, denn stark verwurzelt in der Psychodynamik, berühren sie mit ihrer Spitze die Metaphysik. Sie brechen auf in unserer Erfahrung, dass wir durch das Mit-Sein mit dem Patienten im Universum der Liebe sind. Sie strömen aus dem Entdecken des Patienten, dass jemand – Jemand? – mit ihm ist. Auch in dieser Therapie schloss die existentielle Begegnung mit dem Patienten die spätere Analyse seiner psychotischen Phobie des Blicks nicht aus, sondern ermöglichte sie erst. Es war schließlich der Patient selbst, der aufgrund des Vertrauens, das er in der Beziehung zu seinem Therapeuten gefunden hatte, nach und nach fähig wurde, den Verfolger in der Tiefe zu lokalisieren, oder vielmehr ihn auf die Gestalt eines frühen Vertrauten zurückzuführen, den Vater des Jungen, der, obwohl er ihn auf seine Art liebte, die »Kastrationsangst« in seiner Kindheit und Jugend in ihm anspringen ließ. Der Patient erinnerte sich jetzt an eine wirkliche Begebenheit, die seinem Wahn, einen schwachen Körper zu haben, zugrunde lag: sein Vater betastete ihn am Hals, an den Armen, um dann festzustellen, dass er eben schwach und mager sei. Wir folgen nicht den einzelnen analytischen Anhaltspunkten seines Erzählens, sondern beschränken uns auf die wesentliche Feststellung, dass hier die psychoanalytische Interpretation des Wahns ihre volle positive Wirkung haben konnte. * Ich erinnere mich an eine Patientin, Ursula, die, bevor sie im jugendlichen Alter an einem Borderline-Syndrom erkrankte, in der Kindheit unter einem äußerst schmerzlichen repetitiven Traum gelitten hat. Im Schweigen des Traums erhoben sich unvorhergesehen neben 37
ihr »menschliche Gestalten ohne Gesicht«. Ein Gefühl des Entsetzens, der unendlichen Einsamkeit kam dann über sie. Während ich ihren Erinnerungen zuhörte, bewegten mich einige Fragen: Stellten diese unwirklichen Wesen in der Zukunft liegende psychotische Erlebnisweisen dar, die nicht in Worten fassbaren Erfahrungen der Depersonalisation, die ihre Jugend charakterisieren werden? Oder waren es Alpträume der Vergangenheit, erschreckende Leerstellen, die sich in ihrer Selbstidentität öffneten angesichts einer krankhaft symbiotischen Kindheit, in der es ihr, »überschwemmt von den Anderen«, von den Verschmelzungsbedürfnissen der Familienangehörigen, nicht gelungen ist, sich abgegrenzt von den Anderen wahrzunehmen und sie selbst zu sein? Vergangenheit oder Zukunft, Erinnerung oder Voraussage, etwas schien mir gewiss: In diesen Wesen ohne Gesicht, die im Traum ihre Person umringten, war ihre eigene Person ohne Gesicht. Verborgen während des alltäglichen Wachzustands hinter den Gesichtern der Dinge, zeigte sich im Traum in den gesichtslosen Wesen ihre tiefste Wirklichkeit. Während der Psychotherapie tauchte dieser alte Traum in einem besonderen Kontext wieder auf. Ursula hatte sich unvorhergesehen um ein magersüchtiges, fast psychotisches Mädchen kümmern müssen, das von einem Tag auf den anderen aus dem Ausland unter besonderen Umständen gekommen war, und das ihr nun keine freie Zeit mehr ließ. Diese Arbeit, die sich in die Länge zog und ihr die wenigen freien Stunden wegnahm, führte sie in eine völlige Erschöpfung. – Im Traum muss sie sich einmal mehr um diese andere Patientin, Maria, kümmern. Sie tut etwas für sie, weiß aber nicht mehr was. Die Einzelheit ist nicht wichtig. Aber plötzlich ist SIE in einem Winkel des Zimmers: die geheimnisvolle Frau aus der Kindheit, erschreckend größer als jede menschliche Gestalt und ohne Gesicht. Im Traum kümmert sich Ursula weiter um Maria. Und dann ist es, wie wenn sich etwas in der reglosen Gestalt zu bewegen begänne. Dieser Traum ist für die Patientin nicht verständlich, außer als Wiederholung aus der Vergangenheit. Eine ausschließlich aus der Analyse abgeleitete Interpretation des Traums könnte nicht viel aussagen. Die Vermutung, dass die Begegnung mit einer schwer kranken Patientin die eigene latente Psychose mobilisiert haben könnte, wäre therapeutisch nutzlos, wenn nicht 38
sogar gefährlich gewesen. Ich habe die »Bewegung« wahrgenommen, die zum ersten Mal die verfolgende Gestalt durchlief und sie gleichsam verwandelte und habe sie »amplifiziert« mit der Aussage: »Mit Ihrem großen Einsatz für Maria haben Sie diesem aus Ihrer Vergangenheit auftauchenden Wesen das Gesicht wiedergegeben.« Das ist ein einfaches Beispiel von »Positivierung«. Sie gehört nicht im engeren Sinn der Psychoanalyse an, denn sie beinhaltet nicht die Interpretation eines Konflikts oder das Bewusstmachen eines verdrängten Affekts. Sie ist jedoch in der Psychoanalyse angesiedelt, als Bewusstmachen einer »Möglichkeit«: die Wiederherstellung des Gesichts. Aber diese Möglichkeit findet sich nicht in der Struktur des Traums selbst, sie ist nur angedeutet durch die »Bewegung« der Gestalt ohne Gesicht; es geschieht vielmehr eine Weiterentwicklung dieser Bewegung im Geiste des Therapeuten und deren Projektion auf den Traum und auf die Patientin. Eine solche »therapeutische Projektion« entsteht nicht nur aus der Wahrnehmung der Psychopathologie der Patientin, nicht nur aus der Feststellung, wie der existentielle »Ort« in der Welt der Patientin psychopathologisch eingeengt ist. Sie bildet sich im Erleben des Therapeuten, der den vom psychischen Symptom dargestellten »Ort« auf einer anderen Ebene der Psychopathologie ausweitet – und nicht nur einengt.Hier wird der Patient der Träger eines menschlichen Schmerzes, der potentiell auch der unsrige ist, denn er ist uns wegen der Unteilbarkeit des Lebens gemeinsam. Ursula gibt sich selbst wieder ein Gesicht, weil sie Maria ein Gesicht gibt – und der Therapeut, indem er so denkt, gibt Ursula ein Gesicht. Das Wohlbefinden, das Ursula in der Folge dieser »Interpretation« des Traums erlebt, ist ein Zeichen seiner positivierenden Wirkung. Eine solche therapeutische Ausweitung, stimuliert durch die Bewegung des Traums, entsteht nicht nur aus dem Traum und nicht nur aus der Reflexion des Therapeuten, sondern aus der strukturierenden Begegnung zwischen ihm und der Patientin – einer »dritten Wirklichkeit« –, die ich das »Übergangssubjekt« nenne. Die therapeutische Positivierung wäre nicht möglich ohne die psychoanalytische Reflexion über die Psychopathologie; aber sie wäre auch nicht möglich ohne ein tieferes »Wissen« des Therapeuten, das als »Religio« die menschlichen Fragmente zu ihrer Einheit zusammenfügt. * 39
Ich erinnere mich an eine psychotische Patientin, deren Destruktivität gegen sich selbst darin bestand, sich ständig zu betrinken, ständig zu verunfallen, aber auch in Anfällen von Gewalt gegen den eigenen Körper, mit ausgeprägter Selbstverletzung. Hinter ihr stand eine Erinnerung aus der Kindheit: Sie war auf einem Strohhaufen, zehnjährig, wurde heftig beschimpft von ihrem grausamen Vater, einem Bauern, für ein Nichts. Auf die Drohung des Kindes, sich vom Strohhaufen, der mehrere Meter hoch war, hinunterzustürzen, antwortete der Vater, indem er sie dazu herausforderte. Sie stürzte sich hinunter und verletzte sich schwer an einer Sense. So war es auch in ihrem weiteren Leben: die »Sense des Verfolgers« verwundete sie in ihren ständigen Selbstverletzungen. Es war nicht möglich, diese Patientin dazu zu verpflichten, irgendein Setting anzunehmen. Für sie hatte keine Regel Gültigkeit. Sie erschien nicht zu den abgemachten Zeiten, telefonierte zu den unmöglichsten Zeiten, unterbrach bei den ersten Begegnungen die Sitzungen nach Belieben mit ihren Widerständen. In einem Traum war sie am Strand des Meeres und hielt in der Hand einen Polypen, den sie hinunterschlucken wollte. Aber die Tentakel des Polypen waren bedrohlich und giftig. Es erschien die Therapeutin, die die Tentakel abschnitt, damit die Patientin sich von »etwas Lebendem und Pulsierendem« ernähren konnte – das war ihr eigenes Selbst. Aber nachdem sie versucht hatte, dieses Selbst physisch zu »appersonieren«, hatte sie den Mund voller Blut, und das Blut wurde zu einem Strom und sie starb – verblutet. Nachdem sie ihren Traum erzählt hatte, rief die Patientin aus: »Ich hätte diese Therapie nie beginnen sollen!« Hatte sie recht? Eine anderer Traum zeigt die dramatische Situation der Begegnung mit der Therapeutin: Die Patientin befindet sich neben einem kleinen Kanal auf einer sumpfigen Straße. Ihr gegenüber ist ihre alte Mutter, das einzige Liebesobjekt – wenn auch sehr ambivalent – im Leben der Patientin. Die Mutter versinkt im Schlamm. Die Patientin versucht, sie zu halten, aber auch sie selbst sinkt ein. In diesem Augenblick erscheint die Therapeutin, die ihr befiehlt: »Gehorche«. Die Therapeutin stützt sich auf die Patientin, wie vorher die Mutter, aber der Ausgang ist anders: Die Patientin hält das Gewicht aus. Das ist der Traum, in dem der unbewusste Versuch der Patientin 40
sichtbar ist, die Therapeutin in die eigene Mutter zu introjizieren, aus ihr ein verlässliches Liebesobjekt zu machen, das die Patientin nicht rettet, indem sie diese nur einfach unterstützt, sondern auch indem sie sich unterstützen lässt. In der Tat hasste diese Patientin jegliches Hilfsangebot, beneidete jeden, der stärker als sie und fähig war, sie zu unterstützen. Der Therapeutin gelang es, im Traum der Patientin deren Widerstand zu akzeptieren, indem sie dieser in der für sie einzigen möglichen Art half, das heißt, sich helfen ließ wie die schwache Mutter. Auf diesen Traum der Patientin folgte ein Traum der Therapeutin, den wir »Zwillingstraum« nennen können: Die Therapeutin ist mit ihrer alten Mutter unterwegs, wie die Patientin. Sie verliert sie aus den Augen (wie die Patientin ihre Mutter im Sumpf verliert). Jemand warnt die Therapeutin und sagt: »Achte darauf, dass deine Mutter folgt«. Sie fragt: »Ist sie gefallen?« – »Vielleicht.« Die Therapeutin findet ihre Mutter wieder und umarmt sie, »um sie zu unterstützen«. Im Traum ist die Mutter kleiner als sie, und die Therapeutin denkt an ihre Patientin. Wenn wir die beiden Träume vergleichen, können wir sagen: Die Patientin lässt die Therapeutin in ihre eigene Mutter eingehen, die Therapeutin lässt gleicherweise in die Patientin die eigene Mutter eingehen. Die Mutter ist das Übergangssubjekt, über das die beiden Frauen kommunizieren, oder sie kommunizieren über das, was die einzige emotionale Beziehung der Patientin war, wenn auch in der Ambivalenz erlebt. In einem Traum wird die Mutter von der Patientin unterstützt, im anderen von der Therapeutin. Das Unbewusste bewirkt also eine wunderbare Symmetrie. Es ist, als ob das Unbewusste selbst vorausgehen wollte auf dem therapeutischen Weg, ungeachtet des Bluts, das aus den Wunden der Patientin strömt. Sind das die Fälle, in denen der Therapeut in das existentielle Drama des Patienten hineingenommen wird, in denen er für ihn oder sie das Wagnis übernimmt und so wird wie er oder sie in der Herausforderung des Todes?
41
Die Verpflanzung der Existenz im Traum Wir sind alle miteinander in Kontakt, ohne es zu wissen. Der ursprüngliche Zustand der Symbiose – damals mit der Mutter –, unterbrochen durch das Wachstum des separaten Selbst und durch den Prozess der Individuation, lebt als symbiotisches Offensein im Schlaf weiter, wo das Unbewusste dominiert, und manifestiert sich manchmal im Traum. Und eben in diesem Zustand nehmen wir zuweilen Situationen des Anderen wahr, von denen wir nicht die geringste Kenntnis haben, und reagieren darauf. Das gilt vor allem für Personen, mit denen wir in einer tiefen gefühlshaften Verbindung stehen, die, obwohl klar getrennt von uns im Wachen, im Schlaf an unserem symbiotischen Selbst teilhaben. Als Psychotherapeut kann ich das vor allem in den Beziehungen mit meinen Patienten feststellen. Aber das Phänomen ist universell und betrifft nicht einen bestimmten Beruf, und es kann in jedem sich wirklich vertraut gewordenen Paar beobachtet werden. Ich gebe ein Beispiel davon, das sich auf einen Traum meiner Frau bezieht, der für sie absolut unverständlich blieb bis zu dem Augenblick, da ich ihn interpretierte, indem ich ihn in Beziehung zu mir brachte. Ich schicke voraus, dass ich am Tag vor der Nacht, in der der Traum stattfand, sehr bekümmert und voller Schmerz war wegen des Zustands eines meiner Patienten. Meine Beziehung zu ihm war zu dem Punkt gelangt, an dem sich gewisse identifikatorische Phänomene einmischten. Er war ein junger Arzt und war unter anderem nicht im Stande, den Schmerz seiner somatischen Patienten zu ertragen: Er hatte den Eindruck, dass der leidende Patient in ihn eintrete und dass er verantwortlich sei für das Leiden des Patienten, obwohl er Internist war und nicht Psychiater. Ich fühlte mich meinerseits »in Schuld« in Bezug auf meinen Patienten: In der Angst, dass ich mich getäuscht hatte, weil ich ihm ein gewisses Medikament verschrieben hatte, konsultierte ich meine Handbücher der Psychopharmakologie, ohne meine Zweifel auszuräumen – obwohl ich mir darüber im Klaren war, dass das Leiden meines Patienten zum Teil psychologisch begründet war. Meine Frau träumte in der folgenden Nacht von einem gemeinsamen Freund und erlebte in ihrem Traum, wie dieser starb. Dieser Freund, der große spirituelle Gaben hatte, wurde in ihrem Traum als 42
Künstler wahrgenommen. Der Freund starb in ihren Armen, während sie versuchte, ihn zu stützen. In einer zweiten Traumszene tischte sie Teller auf und bemerkte mit Erstaunen, dass unter diesen einige von verschiedener Größe waren; es waren die Teller ihrer Mutter. Meiner Frau kam keine Assoziation in den Sinn. Aber ich erinnerte mich sogleich, als ich den Traum hörte, dass meine Frau, treue Begleiterin meiner psychotherapeutischen Arbeit, mich öfter mit einem Künstler verglichen hatte. Unversehens und sicher blitzte in meinem Geist die Interpretation auf, dass ich im Traum in ihren Armen starb (der Freund, von dem der Traum handelte, war bei guter Gesundheit). Meine Frau, der ich keine Andeutung über meine Besorgtheit in Bezug auf den jungen Patienten gemacht hatte, hat diese dennoch im Traum wahrgenommen. Und im Traum hat sie diese auch vergrößert, wie es nicht selten in den Traumphänomenen geschieht. Bewegend war für mich außerdem der zweite Teil ihres Traums, wo sie mit Tellern umging, die ursprünglich ihrer Mutter gehörten (die ich sogleich assoziiert habe mit meiner Mutter). Es war in ihr also nicht nur die Wahrnehmung meines »Todes«, sondern sie erlebte auch ihren Wunsch, mich zu nähren wie eine Mutter, mit Nahrung, die auf den mütterlichen Tellern bereitet ist. Alles das ist wohl Interpretation und ist möglicherweise zum Teil suggestiv. Aber die Tatsache, dass keine andere Interpretation als diese, die unversehens in meinem Geist aufblitzte, weder für meine Frau noch für mich möglich war, ließ mich an ihrer Richtigkeit nicht zweifeln. Das Wohlergehen, das ich aus dem Traum meiner Frau bezog und ihr Empfinden, dass ihr Unbewusstes richtig entziffert wurde, verstärkten diese Gewissheit. Wie meine Frau im Traum einen symbiotisch mit ihr verbundenen Teil von mir wahrgenommen hat, so habe ich einen Traum verstanden, der unverständlich war ohne meine Teilhabe an ihm. Das zeigt das Problem, wie wir Therapeuten uns verhalten müssen mit unseren Patienten, wenn sie in unverständlicher Weise von sich selbst träumen: Wir müssen bereit sein, Mit-Patienten von ihnen zu sein.
43
Drei Funktionen des Traums in der Geschichte der Psychiatrie 1. Der Wunsch (Freud) 2. Die Kompensation (Jung) 3. Die Erschaffung von Identität (Benedetti) Dieser dritte Gesichtspunkt ist das Thema meiner Untersuchung. Erschaffung von Identität als: a) Übersetzung von Ereignissen, die sich am Rande der Aufmerksamkeit abspielen, in bildhafte Darstellungen, meist traumhaft (oder halluzinatorisch), die das Feld des Bewusstseins überraschend erweitern, in positivem oder negativem Sinn. Die Hypothese ist berechtigt, dass dies auch geschieht, wenn der Traum in den Schlaf »eingetaucht« bleibt: Auch in diesem Fall geschieht eine vorübergehende Ausweitung des Wissens um sich selbst, das der menschlichen Person erlaubt, sich selbst anders als im Wachen wahrzunehmen. In der Sphäre des Unbewussten kann sie die eigenen Möglichkeiten entfalten oder das eigene Schicksal wahrnehmen, das sie oft auch auf die Zukunft hin projiziert oder das sie herauslöst aus den entferntesten und vergessensten Winkeln der Kindheit. b) Lokalisation der eigenen Identität in einem Bewusstsein des Seins, das das individuelle Bewusstsein relativiert und übersteigt. Das Unbewusste bindet uns tatsächlich tief an andere Individuen, es ist nicht nur der »Ort« der »unterschwelligen« Kommunikation mit ihnen – die manchmal so tief ist wie zwischen Patient und Therapeut –, sondern auch der »Ort«, dem »Übergangssubjekte« entspringen, die uns die Existenz einer »umfassenden Seele« vorausahnen lassen – eines »kollektiven Unbewussten« oder wie Teilhard de Chardin voraussagt, eines kollektiven Geists. Das Werk der Relativierung im Traum, wo sich das Unbewusste vielleicht machtvoller als anderswo manifestiert, besteht in der Tatsache, dass während ein Teil des Ich (der gekennzeichnet ist durch eine zunehmende Frequenz der elektrophysischen Impulse des Kortex, die sich dem Alpha-Rhythmus des Wachens annähern) auf der »Bühne« des Schlafs »handelt« und durch seine dramatischen visuellen Bilder auch in tragische Situationen von Tod, von Gefahr und 44
von Angst eingetaucht wird, ein anderer Teil des Ich (der durch die muskuläre Entspannung gekennzeichnet ist und der so das »Paradox des Schlafs« zeigt, wie es Jouvet nennt) wie von außen den Film des Traums betrachtet. Das Ich, das beobachtet, umfängt das handelnde und erleidende Ich in einer Umarmung, die durch das, was ich »physiologische Dissoziation« nenne, ermöglicht wird. So erfährt eine Patientin in ihrem Traum, in dem sie sich selbst sieht, wie sie in einem verfallenen Heuschober – dramatisches Symbol des eigenen Lebens – zwischen verfaulten, zerbrochenen, in Unordnung herumliegenden Brettern herumwankt und schließlich in eine tiefe Grube fällt. Nach ihren eigenen Aussagen, auch ein Erleben von »Harmonie«, die selbst die Tragik des Traums relativiert. c) Erschaffung von psychischer Wirklichkeit. Das ist die gewagteste Hypothese meiner Überlegungen. Im Feld des Bewusstseins geschieht »Erschaffung von psychischer Wirklichkeit« vor allem durch den Akt der Entscheidung, der uns voll annehmen lässt, was vor dem Akt der Entscheidung nur eine »Möglichkeit« war, der eine mögliche Verneinung gegenüberstand. Indem wir uns entscheiden, erhöhen wir das Gewicht jener Alternative, mit der wir uns identifizieren, und sie wird dadurch die unsere. Auf welche Weise geschieht eine »Erschaffung von psychischer Wirklichkeit« im Unbewussten? Die »Wunscherfüllung«, die große Entdeckung Freuds, ist vielleicht nur ein oberflächlicher und deshalb auch auffälliger Aspekt. Ich möchte versuchen, in eine größere Tiefe zu gelangen, und stütze mich dabei auf das, was mir eine der größten Erkenntnisse scheint, die uns von der neuesten Entwicklung der subatomaren Physik zukommen. Gemäß dieser gibt es keine »Realität an sich« (und deshalb auch nicht ein »Ding an sich«, wie Kant annahm), sondern es ist im Gegenteil der Akt der menschlichen Beobachtung der Realität, der die Wirklichkeit erschafft. Die Wirklichkeit ist also verschieden, wenn der Akt der menschlichen Beobachtung anders ist: »Das Paket« von Wellen »kollabiert« nur im Augenblick der Beobachtung. (Ich verweise für das Studium dieser Phänomene auf die einschlägigen wissenschaftlichen Publikationen.) Während der Brennpunkt der bewussten Beobachtungen an die strukturalen Kategorien des Bewusstseins gebunden bleibt, ist das Unbewusste außerhalb dieser: Es ist außerhalb der Kausalität, wie 45
auch außerhalb des Raumes und der Zeit. Auch wenn der Traum sich raumzeitlicher Metaphern bedient, empfängt er darin Fakten, die jenseits der Möglichkeit des Erinnerns liegen (vorgeburtliches Leben) und jenseits der möglichen Vorausschau (Vorwegnahme der Zukunft). Aber es ist möglich zu vermuten, dass darin nicht nur Erinnerung und Voraussage geschehen, sondern auch die Möglichkeit, sich auf neue Art zur Existenz in Beziehung zu stellen – in eine Beziehung, die die Struktur dieser Existenz selbst neu definiert. So geschah es im Traum einer Patientin, die aufgefordert wurde, den eigenen Leichnam auf den Friedhof zu schleppen: Sie trug ihn, umarmte ihn, und nachdem sie den Ekel überwunden hatte, spürte sie zum ersten Mal dessen ganze Wärme.
Die Verwandlung des Wunschs im Traum Die größte Entdeckung der Psychoanalyse ist möglicherweise diejenige Freuds, dass der in den Bildern des Traums dargestellte Wunsch als Verkleidung eines unbewussten Triebs an der Wurzel des seelischen Lebens des Menschen ist. Niemandem vor Freud ist es gelungen, die Traumsymbole – seit Jahrhunderten Objekt so vieler religiöser wie auch philosophischer Reflexionen – als Gestaltungen von Wünschen zu entziffern, die durch die sozialen Normen zensuriert werden, die sich im Über-Ich des Individuums verdichten und dessen Verhalten bestimmen. Die Geburt der Psychoanalyse beginnt hier, im Wiederfinden dieser Fragmente des Bewusstseins, vor allem der Traumfragmente und ausgehend von diesen in der Rekonstruktion der »versunkenen Zivilisation«, die eben das Leben des Unbewussten ist und die nicht weniger als das Bewusstsein, unsere Haltungen und unsere Verhaltensweisen bestimmt. Auf dieser Grundlage meine ich, dass der Traum – oder vielmehr das »dunkle Bewusstsein des Schlafs«, wo der Mensch seinem Unbewussten näher ist als im Wachen – auch einen »archaischen Ort« der menschlichen Freiheit darstellt: Der schlafende Mensch, der im Wachen durch seine gesamte soziale Umwelt bedingt wird, entzieht sich ihr. Diese macht ihn wohl einerseits durch die Verinnerlichung der gemeinsamen Werte zum Menschen, entfremdet ihn jedoch 46
anderseits sich selbst – wie Lacan durch das Studium des Symbols richtig erkannte –, entfremdet ihn dem »Realen«, das wir in der Unmittelbarkeit des instinktiven Lebens wahrnehmen können. Der Traum ist der symbolische Ort, wo das instinktive Leben, das sich befreit hat aus so vielen Regeln, die seinen Ausdruck begrenzen, sich in symbolischen Darstellungen unmittelbar ausdrücken kann. Diese erfüllen sich schon durch die Tatsache allein, dass sie bewusst werden – sei es auch nur für Augenblicke –, den Banden der Über-IchZensur zum Trotz. Das Gesagte stellt die erste Ebene meiner Überlegungen dar; dieser werde ich eine zweite anfügen und schließlich eine dritte. Zuerst möchte ich betonen, dass eine authentische anthropologische Sicht des Menschen nicht nur reduktiv sein kann. Das Über-Ich ist eine Reduktion der moralischen Ordnung, die in der Kontinuität der menschlichen Existenz und ihrer Transzendenz gründet. Diese aber wird durch vorwiegend zensurierende Instanzen abgeflacht. Unzweifelhaft begegnen wir vor allem in der Neurose und auch in der Psychose dem zensurierenden Über-Ich in seiner auch destruktiven Aktivität. Freud erkannte zu Recht im Über-Ich gewisser depressiver Patienten eine Vermengung mit ihrem Todestrieb. In der Psychotherapie dieses negative Über-Ich aufzudecken, heißt, die ursprünglichste und authentischste Freiheit des Menschen zu bestärken – die Freiheit, sein eigenes Selbst zu leben. Aber gibt es im Menschen nicht auch eine andere Freiheit? Jene, in der »Nicht-Freiheit« sich selbst zu sein, im Annehmen der Endlichkeit der menschlichen Existenz? Sie begrenzt uns immer, denn sie strebt danach, uns mit den Anderen zu vereinen und aus uns allen ein einziges Sein zu machen, was in der absoluten Freiheit des Einzelnen nicht möglich ist. Die Intervention dieser anderen Kraft in den Gestaltungen des Traums kann selbst gegenüber dem Aufbrechen des Instinkts die moralische Freiheit des Menschen begründen. Ich werde das am Beispiel eines Traums aufzeigen, der mir außerhalb jeder analytischen Reflexion berichtet wurde. Es handelte sich um einen betagten Mann, Vater zweier Söhne. Der zweite von ihnen war sein bevorzugter Sohn. Der erste, schon erwachsene Sohn, begann eine Liebesbeziehung mit einer Frau, die sozial und ökonomisch nicht den ehrgeizigen Zielen des Vaters entsprach, der darum 47
mehr oder weniger bewusst hoffte, dass diese Beziehung vorübergehender Natur sein würde. Jedoch ging aus dieser Verbindung ein Sohn hervor. Bei der Nachricht von der Schwangerschaft reagierte der Vater mit einem Traum, in dem er ein kleines Kind begrub. Die Tatsache, dass dieses Kind anonym war und dass es dem Vater nicht möglich war, den eigenen Traum zu verstehen als Ausdruck seines unbewussten Wunschs, das kleine Kind zu töten, entspricht genau dem freudschen Begriff der Über-Ich-Zensur. Aber der Traum hörte nicht hier auf: In einer zweiten Szene begegnete er seinem zweiten Sohn, jenem, den er bevorzugte, und bemerkte mit großer Bestürzung, dass dieser im Sterben lag. Ich hütete mich, den Traum außerhalb einer Analyse zu interpretieren. Aber ich konnte in der Folge beobachten, dass der Traum, auch wenn er nicht verstanden wurde, einen tiefen Einfluss auf die Seele des Träumers ausgeübt hatte: Von da an überwand er seine tiefe Ambivalenz gegenüber der Verbindung seines Sohns, welcher das Kind entsprang, das er im Traum beerdigt hatte. Warum? Weil der Traum ihm metaphorisch gesagt hatte: »Wenn du dieses Verbrechen, sei es auch nur in der Phantasie, begehst, bist du deines Sohnes nicht wert und verlierst sogar schließlich jenen, den du besonders liebst.« Und dadurch wird der spirituelle Adel des Menschen wieder hergestellt, der ohne Zweifel Teil der moralischen Größe des Träumers war. Seine volle »Freiheit des Traums« hätte sich durch das »Feiern der Beerdigung« erfüllt – er jedoch fand im zweiten Teil des Traums zu der größeren Freiheit in der »Nicht-Freiheit«, im Annehmen der vorgegebenen Grenzen. Ich werde nun zu einer dritten Ebene meiner Überlegungen übergehen und von der »Interpretation des Traums im Traum« sprechen. Ich habe ausgeführt, dass ich mich vor der Interpretation des Traums von der Beerdigung außerhalb einer Analyse hüten werde. In einer Analyse wäre das möglich gewesen unter der Bedingung, dass sich der Analytiker identifiziert hätte, sei es mit der aggressiven Seite des Selbst oder mit dessen Überwindung durch das andere Selbst, das sich verbunden weiß mit der moralischen Ordnung der Transzendenz. Ich komme nun zum Traum eines Psychoanalytikers, der bei mir in Analyse ist. Dieser Analytiker ist fähig, die eigenen Träume und 48
die darin ausgedrückte Traum-Freiheit zu verstehen, er kann aber auch über diese Freiheit des Traums hinaus seine Bindung an eine das Ich übersteigende Transzendenz wahrnehmen. Der Traum übernimmt aus dem Tagesgeschehen die Tatsache, dass der Träumer von der Verlobung einer Frau, die er heimlich liebte, mit einem anderen Mann erfahren hatte. Im Traum geschieht in ähnlichen Situationen oft etwas, was die Befreiung der aggressiven Valenz ausdrückt, die im Wachen verdrängt wird. Der Verlobte der Geliebten erkrankt an einer tödlichen Krankheit (entsprechend der »Beerdigung des kleinen Kindes« im zuvor besprochenen Traum). Aber unvermittelt stürzen sich äußerst gefährliche Wölfe durch die Fenster ins Haus. Wie sich vor ihnen verteidigen? Unser Träumer geht ihnen entgegen und sagt: »Ihr existiert nicht außerhalb von mir. Ihr seid nur Gestalten meiner aggressiven Triebe, die ich zu überwinden gedenke und die bewirkt haben, dass dieser junge Mensch erkrankte«. Augenblicklich verschwinden die Wölfe, und der Kranke wird wieder gesund. Das war die Auflösung des Traums; sie ist begründet in einer tiefen Freiheit des Selbst, das seine im Traum erlaubte triebhafte Freiheit transzendiert!
Träume von Therapeuten Ein eigener Traum 1. Ich glaubte mich in einem unterirdischen Ort von unermesslichem Schmerz zu befinden – neben Seelen, die unendlich leiden. Wenn ich das in die Sprache, die ich als Kind hörte, übersetzen müsste, würde ich sagen, dass ich mich – nicht verdammt – in der Hölle befand, als dantesker Besucher von spirituellen Situationen, die nicht die meinen sind, sondern diejenigen von »verdammten« Seelen. Seltsamer Traum! Und was mich davon am meisten beeindruckt hat, war nicht die Angst und auch nicht das Entsetzen, die ich auch gar nicht empfand. Dante hatte kein Mitleid mit den Verdammten, er schrieb sogar, dass es verboten sei, solches zu empfinden, da ihr Schicksal von einer »Ewigen Gerechtigkeit« herkomme. Hingegen war das einzige Gefühl, das ich von diesem sonst im Vergessen verlorenen Traum empfand, dasjenige des tiefsten Mitleids für diese 49
Leidenden. Und ich habe mir dann beim Erwachen, noch nicht ganz aus dem Traum herausgekommen, gesagt, dass sie nicht Verdammte sein konnten; denn wie ist es möglich, dass ein Geist verdammt sein kann, wenn er dennoch Objekt der Liebe ist? So denke ich, dass mein Gedanke, dass die Hölle nicht existiert, Recht hat. Aber der Traum ist mir auch in einem anderen Sinn bedeutungsvoll: Im Wissen, dass der menschliche Geist durch den Schmerz reift, wie ein glühendes Eisen im Feuer, und dass ich mich vielleicht jenem unbewusst immer gesuchten Ideal annähere, im Verbundensein mit den Anderen zu existieren. Wie kann ich das noch mehr verwirklichen, wie klein ist mein Ich noch! Doch der Traum zeigt mir, dass in mir oder um mich herum oder über mir etwas ist, das zu mir gehört und zugleich größer ist als ich. Vielleicht ist meine Existenz nicht weniger in der Tiefe meines Unbewussten, aber vor allem über mir; so sehr darüber, dass ich hinabsteigen kann zum Niedrigsten und – wie im Traum – die große Pietas empfinden. 2. Es gibt gewisse Bedürfnisse unserer Patienten, die nicht symbolisch erfüllbar sind, auch wenn die Technik der »symbolischen Realisation« – wie im berühmten Fall von Renée – in der Therapie von psychotischen Patienten nützlich sein kann. Dies ist der Fall, wenn gewisse Grundbedürfnisse wie jenes nach leib-seelischem Ernährtwerden in der frühesten Kindheit nie erfüllt wurden. Der wirkliche Verzicht auf diese Erfüllung ermöglicht die Bildung von Identität – ihre Nichterfüllung zur rechten Zeit hat sie zerstört. Es ist nicht leicht, in der Therapie von erwachsenen Patienten gewisse kindliche Bedürfnisse zu erfüllen, die einerseits, genau weil sie zur richtigen Zeit nicht erfüllt worden sind, bis ins Erwachsenenalter weiter bestehen, die aber andererseits keine »geschichtliche Physiognomie« haben und deshalb in Kontrast zur erwachsenen Person stehen, die nicht nach dem Maßstab eines Kindes behandelt werden will. Außerdem verlangt die aktuelle Situation, wie sie sich in der Therapie zeigt, nach der Bildung eines Ich, das lernen soll, ohne Regression die tragische Abwesenheit der kindlichen Erfüllung zu ertragen. Aber wie ist dies möglich, ohne die Hilfe der mächtigen Bilder, die die ersten »Übergangssubjekte« im menschlichen Leben darstellen, die sich mit der Welt verbinden noch vor der Entstehung der Gedanken und der Symbole? 50
Meine Erfahrung sagt mir, dass therapeutische Träume solche Bilder erschaffen können und dass sie – unglaubliche Tatsache – einen Patienten erreichen können, dem der Traum nicht erzählt wird. Aus einer Supervision erinnere ich den Fall einer jungen Frau, die in den ersten drei Jahren ihres Lebens von ihrem Vater mütterlich betreut und dann unversehens von ihm verlassen wurde. In einem Gespräch hat der Vater einmal das Verlassen seines Kindes mit den folgenden Worten gerechtfertigt: »Ich hatte Angst, an meine Tochter angeklammert zu bleiben, ihr zu nahe zu sein.« Ödipale Angst also. Die Konsequenz des frühen Verlassenwerdens war verheerend: Keine Beziehung war mehr vertrauenswürdig für die Patientin, die mit ihrem Verdacht und mit ihrem Anspruch jede beginnende Beziehung zerstörte und so das Verlassenwerden der Kindheit wiederholte. Der Therapeut (der, wie er mir in der Supervision sagte, nie eine Schwester gehabt hat) träumte von einer Schwester (die symbolisch die Patientin darstellte), mit der er ohne jede physische Anziehung eine sexuelle Beziehung haben musste. »Musste«, weil es vom Unbewussten und vom Schicksal diktiert wurde. Der Therapeut trat träumend in die ödipale Welt der Patientin ein und (an Stelle des Vaters, der sich zu seiner Zeit verflüchtigt hatte) erfüllte er ein archaisches Bedürfnis (von Verlässlichkeit, aber auch von ödipaler Gefährdung) der Patientin. Nur so konnte er ihr nahe sein in der Abstinenz und in der Neutralität der Therapie. Unser Unbewusstes entwickelt in der Therapie eine »komplementäre« Aktivität zur Abstinenz und Neutralität, die eine notwendige Grundlage unserer Arbeit ist – es entfaltet sie in sprechenden Bildern und teilt sie ohne Worte auf unbekannten Kommunikationswegen mit. 3. Es handelt sich um Träume, die der Therapeut während der dramatischen Phase einer Therapie hatte, in der die paranoide Patientin eine Lawine von Anschuldigungen auf den Therapeuten wälzte, seinen Blick fürchtete (so sehr, dass sie hinter einem Wandschirm verborgen in die Therapie kommen wollte), mit Suizid drohte, sich in einer psychiatrischen Klinik behandeln lassen wollte und vor allem den Therapeuten nicht zu Wort kommen ließ, ohne ihm mit sarkastischem Kommentar und voller Verachtung zu widersprechen. Der Therapeut gab sich intellektuell Rechenschaft darüber, dass dieser Ausbruch von Wut in der Übertragung für die Patientin die Ex51
plosion eines Hasses bedeutete, der während vieler Jahre in den Blicken der Mutter war; und dass er deshalb eine wirkliche und eigentliche Katharsis ermöglichte. Aber emotional fühlte er sich gleichsam zerschmettert durch den Hass seiner Patientin und hatte Angst um sie. Er fühlte sich auch physisch schlecht, empfand für Tage Bauchschmerzen. Er hatte gleichsam das böse Objekt, das in der Patientin eingeschlossen war, vorübergehend in sich aufgenommen und teilte es mit ihr. Diese Situation spiegelte sich in einem ersten Traum, wo zwei Gestalten (offensichtlich Symbole der Patientin und ihres Therapeuten) sich mit allen Kräften bemühen, einen riesigen Felsbrocken vorwärts zu schieben! In einem zweiten Traum fährt der Therapeut mit dem Fahrrad auf einer gefährlichen Straße, die für den allgemeinen Verkehr geöffnet ist, und er bemerkt, als er sich umdreht, dass sich hinter ihm ein Unfall ereignet hat: Eine Leiche liegt, von blutigen Zeitungen bedeckt, auf der Straße und neben ihr hat ein Tram angehalten. Die bedeutungsvolle Tatsache war jedoch diese, dass der Therapeut im Traum zu sich selbst sagte: »Und doch fährt in dieser Straße gar kein Tram!«. Dieser Traum scheint mir bedeutungsvoll wegen der Kraft, mit der er einerseits den im Therapeuten erlebten Tod spiegelt, aber auch das gegenteilige Prinzip – das Leben. Das zeigt sich darin, dass ein Teil des therapeutischen Selbst über den Unfall hinausgeht, jener Teil, der den Tod der Patientin wie den eigenen Tod erlebt (der Leichnam scheint mir ein Übergangssubjekt zu sein) und auch darin, dass eine Verdinglichung des Todesprinzips, das Tram, erscheint (visuell) und verschwindet (in der Reflexion). In einem dritten Traum sieht der Therapeut auf dem Boden seine Katze, die sadistisch mit einer noch lebenden Maus spielt, und er empfindet ein Gefühl von Abscheu. Dieser Traum scheint mir vor allem wegen seiner Spiegelstruktur bedeutsam. Die sadistische Katze ist der Therapeut im Erleben der Patientin und ist die Patientin im Erleben des Therapeuten. Die Maus ist das eigene Selbst im Erleben der Patientin und das eigene Selbst im Erleben des Therapeuten. Dieser durchlebt und erfährt also im Traum gleichzeitig das eigene Erleben und jenes der Patientin. 52
Das Prinzip des Todes liegt in der Eigenschaft dieses Erlebens, das Prinzip des Lebens in der Fähigkeit des Therapeuten, die Erfahrung der Patientin zu dualisieren. Diese Dualisierung, die dem Supervisor wie eine Synthese erscheint, wurde dennoch wie eine Spaltung erlebt – zwischen dem Körper und dem Geist, zwischen der Reflexion und der Emotion, zwischen sich und der Patientin, und sie war symmetrisch zum Erleben der Spaltung der Patientin in dieser Phase der Therapie. Das wiederholt sich im vierten Traum. In diesem befindet sich der Therapeut an einem unbekannten Ort, in einem verstaubten Haus, in einem »Hotel vierter Kategorie«. Er scherzte mit jemandem und fragte ihn, ob er glaube, Nietzsche von neuem sehen zu können. Unversehens wird der Therapeut von panischer Angst gepackt, dass ihm Nietzsche wirklich erscheinen könnte, hier gegenüber, im Spiegel. Er erwacht in einem Zustand von Panik. Die Spaltung ist evident in den beiden Teilen des Selbst, von denen einer im Träumenden drinnen ist und scherzt, der andere im Wahnsinn der Patientin und deshalb das Gespenst von Nietzsche sieht (den der Therapeut gleich nach dem Erwachen mit dem Wahnsinn selbst assoziiert). Das alles scheint noch einmal das Prinzip des Todes zusammenzubringen, das in der Tat seinen Schatten der Panik auf das Erwachen wirft. Aber das Prinzip des Lebens ist sichtbar in zwei Besonderheiten: vor allem in der Traumgewissheit, dass der Spiegel leer bleibt, dass in ihm nicht der Schatten, das Profil von Nietzsche erscheint. An zweiter Stelle ist die Bewunderung zu erwähnen, die der Therapeut immer für den Philosophen empfand, der im Traum den Wahnsinn der Patientin personifiziert. Während die Patientin mit ihrer Verachtung auch die schreckliche Angst ausdrückte, vom Therapeuten verachtet zu werden, bewunderte dieser etwas im Wahnsinn selbst. Im Gespräch mit der Patientin war der Entschluss des Therapeuten entscheidend, der Patientin die eigenen Schmerzen mitzuteilen; nicht die Träume, aber den auch physischen Schmerz, der ihnen zugrunde lag. Die Mitteilung brachte eine Wende in der Situation!
53
Der therapeutische Traum als Korrektur oder Regulierung der Gegenübertragung Die Begegnung mit psychotischen Patienten, die chronisch aggressiv und entwertend sind, stellt vielen Therapeuten nicht geringe Probleme. Nach Alanen (1997) ist dieses psychotische Verhalten, auch wenn es analytisch verständlich ist, der größte Störfaktor der Gegenübertragung. Es ist in der Tat im aggressiven psychotischen Patienten eine Symbiose des Opfers mit dem Verfolger, die sich nun gegen den Therapeuten wendet. Dieser empfindet dann gegenüber dem Patienten zuweilen eine Wut, die an jene erinnert, die der verfolgte Patient gegenüber seinem phantasmatischen Verfolger empfindet. In solchen Fällen ist es häufig die Supervision, die die therapeutische Gegenübertragung zu regulieren vermag. Das Gefühl, vom Supervisor gut aufgenommen und verstanden zu werden, die Erfahrung von Dualität zwischen den beiden Therapeuten, trägt dazu bei, die Sackgasse in der Beziehung zu überwinden. Aber zuweilen ist es das Unbewusste des Therapeuten selbst, das dem Ich mit einer bildhaften Botschaft zu Hilfe eilt, wie sie eben der Traum darstellt. Hier ein Beispiel dafür: Es handelte sich um eine paranoide Patientin, die nicht müde wurde, mit ihrer Kritik alles zu vernichten, was immer ihr als Interpretation oder Imagination angeboten wurde. Auf diese Weise kompensierte sie ihre tiefen Erlebnisse von Minderwertigkeit mit einer aggressiven und arroganten Grandiosität, die den therapeutischen Raum gänzlich ausfüllte. Es gibt ähnliche Fälle, in denen das kohärente Schweigen des Therapeuten dort einen Weg zu finden vermag, wo alle Interpretationen scheitern. In anderen Fällen kann die Spontaneität der therapeutischen »Empörung«, respektive die gut dosierte Gegenaggressivität, und daher die Bereitschaft des Therapeuten, auf die gleiche emotionale Stufe herabzusteigen, den Weg freimachen. Aber in diesem Fall war es am therapeutischen Traum, sein großes Wort zu sprechen. Die erste Szene desselben wiederholte die Wirklichkeit, zeichnete die Patientin in einer ihrer unerträglichen Verhaltensweisen. An diesem Punkt trat die Frau des Therapeuten auf die Traumbühne. Ohne ein Wort zu sagen, setzte sie sich auf den Schoß der Patientin und begann, sie zu liebkosen. Die Patientin küsste sie dann und flüsterte ihr ins Ohr: »Hast auch du den Schmerz des Ver54
lassenwerdens erlitten?« In der dritten Szene, die rein assoziativ ist, sagt der Therapeut im Traum nachdenklich zu sich selbst: »Dies sind die beiden Frauen, die ich am meisten geliebt habe in meinem Leben.« Überrascht durch seinen eigenen Traum, erzählte ihn der Therapeut in der Sitzung der Supervision, worauf ich nicht zögerte zu antworten, dass das Verhalten der Patientin sich in den nächsten Tagen verändern werde, ohne dass es zweckmäßig wäre, ihr etwas von der Traumepisode zu erzählen. So geschah es auch. Die Patientin hatte schließlich ihre Destruktivität überwunden und schien heiter und kooperativ. Schließlich wurde eine Analyse möglich. Die Regulierung der Gegenübertragung ist in anderen Fällen als ein Beitrag des therapeutischen Traums zu verstehen, um sich auf die »gleiche emotionale Wellenlänge« zu begeben, auf der sich das Unbewusste des Patienten bewegt. Ich möchte dieses Konzept verdeutlichen am Beispiel des Größenwahns, wie er sich in vielen paranoiden Formen beobachten lässt, wo die latente Verfolgung kompensiert – aber nicht aufgehoben – wird durch eine unrealistische Expansion des Ich des Patienten. Manchmal, ja ziemlich oft, fallen die beiden Aspekte der Verfolgung und der Grandiosität zusammen: Der Patient fühlt sich verfolgt, weil er wegen seiner außergewöhnlichen Gaben beneidet wird. Die kausale Relation zwischen den beiden Termini ist in Wirklichkeit umgekehrt: Er oder sie müssen sich groß fühlen, um aktiv die Verfolgung zu ertragen, die in letzter Analyse aus dem eigenen minderwertigen Selbst hervorbricht. Es ist Aufgabe des Therapeuten, sich dem Opfer der Verfolgung zur Seite und der grandiosen Phantasie zu Füßen zu stellen. Aber natürlich kann und darf das nicht geschehen, indem man den Wahn teilt! Die Übernahme der Wahnidee durch den Therapeuten wäre eine Ansteckung oder ein Mangel an Aufrichtigkeit seitens des Therapeuten. Und sie würde darüber hinaus eine große Lücke in der »Konfrontation mit der Realität« hinterlassen, die nach und nach, vielleicht mit dem Tropfenzähler, den Felsen der Wahnidee einritzen muss wie stetig tropfendes Wasser. Durch die »folie à deux« wird diese hingegen verstärkt. Wie ist dann – in Gegenwart eines Größenwahns – diese progressive Konfrontation mit der Realität möglich, ohne dabei den Nar55
zissmus eines Patienten zu verletzen, dessen narzisstischer Mangel hinter dem Wahnbild der Größe erahnt werden kann? Manchmal ist es die »Überzeugung« (vgl. die »persuasion« bei Dubois 1901 und 1904), das Wunder zu vollbringen, wenn sie auch vom »Respekt für den Wahn« begleitet ist. Oder vielmehr die Fähigkeit des Therapeuten, dem Patienten ein vertretbares Konzept der Wirklichkeit zur Verfügung zu stellen, das ihn rational »erhebt«, so dass das Ich des Patienten, emotional von seinem Therapeuten genährt, sich mit diesem Prinzip der menschlichen Vernunft zu identifizieren vermag, das uns alle an Größe wachsen lässt, während wir mit Schmerzen gewisse kindliche Träume loslassen. Aber ist das psychotische Ich imstande, dieses »rationale Prinzip« in seiner Tiefe und Menschlichkeit zu erfassen, die reine Schönheit in der Bescheidenheit der eigenen Existenz zu verstehen? Wenn das möglich wäre, wenn die kognitiven Vermögen wenigstens teilweise präsent wären im Patienten, dann wäre er nicht schwer psychotisch. Und hier zeigt sich ein Dilemma der Therapie: Konfrontation mit der Realität: ja, aber Diktat der logischen Realität: nein. Neben allen Wegen, die sich in diesem Dilemma zwischen Emotionalität und betonter Rationalität dem aufmerksamen und bilderreichen Therapeuten öffnen, sich seinem »Intellekt der Liebe« (Dante 1998: Purgatorio XXIV, v. 51, s. dazu den Kommentar in der angeführten Ausgabe) öffnen, gibt es den therapeutischen Traum. Er erlaubt manchmal »die gemeinsame symbolische Nutzung des Wahns« sogar im realistischen Raum des Wachens, erlaubt die Identifikation mit der »Seele des Deliriums« im Raum des Traums. Ich erinnere mich aus einer Supervision an eine Patientin, die an einem Größenwahn erkrankt war. »Livia hatte eine wunderbare Stimme, sie hätte als eine große Sängerin erkannt werden sollen, eine Sopranistin, aber sie wurde im Gegenteil missachtet und für gering gehalten in einer elenden und neidischen Gesellschaft.« Mit einer emotional abwesenden Mutter aufgewachsen, an den Vater gebunden, war sie nach dessen Tod erkrankt. Die Therapeutin war bemüht, die Analyse mit einer praktischen Hilfe zu verbinden, indem sie danach strebte, der Patientin einen bescheidenen Weg zur Sängerin zu öffnen, der einen Kompromiss zwischen Realisation und Selbsterkenntnis ermöglichen würde. Die Selbsterkenntnis wurde angeregt durch die realistische Erkenntnis der Grenzen der 56
eigenen Stimme, zum Beispiel durch Tonaufnahmen, die die Patientin, nicht ohne negative Emotionen, anhörte und bei denen sie sich darüber Rechenschaft ablegte, dass ihre Stimme »nicht mehr diejenige von einst war«. Konfrontation mit der Realität also. Aber dies war wirksam vor allem vor dem Hintergrund einer »gemeinsamen Nutzung des Wahns« auf der symbolischen Ebene durch den therapeutischen Traum. Wir Therapeuten müssen unserem Unbewussten danken, wenn es unserem therapeutischen Ich zu Hilfe kommt, indem es uns das Werk erleichtert. Das ist nicht Sache aller Therapeuten, und es ist ein Glück, wenn dies möglich ist. Die Therapeutin hatte einen Traum von der Patientin, wie diese hätte sein wollen: auf einer Bühne, elegant in Schwarz gekleidet, mit einer wunderschönen Stimme. Die Therapeutin hatte im Traum vergessen, dass Livia ihre Patientin war; sie erschien ihr im Gegenteil wie eine Königin! Die Erzählung dieses Traums bewegte die Patientin. Sie gab sich plötzlich Rechenschaft (auch vor dem Hintergrund der Realitätsprüfung, die nicht aufhörte, die analytischen Sitzungen zu begleiten), dass ihre Therapeutin nicht beabsichtigte, sich mit ihrem Größenwahn zu identifizieren. Aber sie hatte dies geträumt! »Aber wirklich«, sagte die Patientin, »haben Sie mich so gesehen, so gehört wie ich es erträume?« Im Traum war die Größenidee wie aus dem autistischen Raum herausgezogen, aus ihrem Gehege von Einzigartigkeit und eingetaucht in einen dualen symbolischen Raum, wie eben der Traum ist, Symbol einer Realität, die sich im Bild widerspiegelt, um sich im Wachen davon zu trennen. Das Erschaffen des Symbols, das die »Seele des Wahns« realisiert, aber nicht den Wahn selbst, ist die große therapeutische Aufgabe, die oft unsere rationale Kraft übersteigt, manchmal auch jene unserer Imagination, aber nie diejenige des »Übergangsubjekts«, wie dies manchmal – Deo concedente – im therapeutischen Traum erscheint. Ich möchte dieses Kapitel schließen mit einer Reflexion über die symbolische Struktur des therapeutischen Traums. Ich gehe vom Konzept aus, dass das symbolische Bild gewöhnlich auf etwas Größeres verweist, das hinter dem Bild steht wie das Allgemeine hinter dem Besonderen. Die rote Rose ist das Blumensymbol 57
der Liebe, aber die Liebe ist viel mehr als die Blume, als der Duft, als die lebendige Farbe, und in ihr verbergen sich die unendlichen Schwingungen des Unbewussten. Gehen wir nun zum therapeutischen Traum und nehmen wir als Beispiel den oben erwähnten. Hier ist die Idee, die hinter dem Bild steht, wie das Allgemeine hinter dem Besonderen, ganz einfach eine ethische Idee, nämlich die unbedingte Solidarität mit dem eigenen Patienten. Das ist eine herrliche Idee, jedoch unzweifelhaft viel bleicher als das Bild, mit dem die Therapeutin sich der Patientin mitteilte; so sehr, dass nur dieses Bild die Kraft hatte, sich deren Unbewusstem mitzuteilen. Das Bild, das lebendig aus dem therapeutischen Unbewussten hervorbricht, ist mehr als seine rationale Reflexion über die »Objektbeziehung«. Das »Allgemeine« ist hier nur der Auszug von dem, was sich im Hier und Jetzt des Unbewussten konstituiert, von dem gewissen Etwas, das sich an den Ausdruck bindet und auf das Nichtausgedrückte verweist und dieses als solches in seiner Ganzheit bewahrt. Das symbolische Bild des Traums ist sozusagen die »Inkarnation« der existentiellen Wahrheit, die im Bild nicht weiter verweist, sondern sich selbst bedeutet. Das Bedeutungsgebende und das Bedeutete sind ganz eins, und wenn wir sie konzeptual trennen, wissen wir nicht, ob das Bild die Idee symbolisiert, oder diese das Bild von dem, was im Unbewussten geschieht. In diesem Zusammenfallen liegt das Wesen des therapeutischen Traums.
Der therapeutische Traum als doppelte »Via regia« zum Unbewussten In der Situation der therapeutischen Symbiose, der die therapeutischen Träume entspringen, entstehen diese aus der Instanz, die wir »Übergangssubjekt« genannt haben – aus einer Instanz also, die gleicherweise dem Patienten und dem Therapeuten gehört, sich als Übergang zwischen den beiden konstituiert und genährt und verstärkt wird durch ein gegenseitiges Spiel von unbewussten Botschaften. Der therapeutische Traum, der dieses Übergangssubjekt zum Ausdruck bringt, ist oft eindeutig in seiner Kommunikation, denn eben diese Eindeutigkeit braucht der psychotische Patient in seinem extremen Zustand von Verlassenheit, Einsamkeit und Ungewissheit. 58
Aber der therapeutische Traum kann auch die Probleme des Therapeuten zum Ausdruck bringen: Ob diese aus einem archaischen Rest seiner Kindheit oder aus der gegenwärtigen Gegenübertragung hervorgehen – immer ist es wesentlich, dass diese Probleme sich nicht zwischen den Therapeuten und den Patienten stellen und nicht das Wirken des ersten und den Empfang des zweiten beeinträchtigen, sondern umgekehrt »Wegbereiter« sind für die Lösung der großen gegenwärtigen therapeutischen Aufgabe. In der Ausbildungsanalyse jedoch kann die Seite des Therapeuten gemeinsam mit seinem Analytiker meditiert werden, auch unabhängig von der therapeutischen Botschaft. Es ist dann der Patient im Therapeuten, der spricht. Sein Traum ist daher, in dieser Botschaft an das Ich des Therapeuten und an dasjenige des Patienten, ein »doppelter Weg« zum Unbewussten, auf der Ebene des Subjekts und auf der Ebene des Objekts, wie Jung sagen würde, oder eine Manifestation des Übergangssubjekts, das analytisch aufgespalten wird in seine beiden Komponenten. Nach diesen Reflexionen, die aus der Erfahrung hervorgehen, die aber gleichzeitig auch in sie einführen, gehen wir nun zu dieser über und fassen sie in einem Beispiel zusammen. In einem Traum befindet sich eine Therapeutin »von Angesicht zu Angesicht« mit einer verrückten Patientin, die von zwei Polizisten zu ihr geführt wird. Diese bestehen darauf, dass die Therapeutin sich sofort um die Patientin kümmert, auch wenn der Zeitpunkt ungünstig ist, denn es ist schon eine Konsultation mit einer anderen Kranken vorgesehen. Diese letzte ist in Wirklichkeit die Patientin der Therapeutin, während die erste, die von den beiden Polizisten geführt wird, ihr in Wirklichkeit unbekannt ist. Sie ist Opfer einer Aggressivität mit depressivem Hintergrund. Die Patientin der Wirklichkeit ist hingegen Francesca, die seit langem an Depression erkrankt ist und sich jetzt gegen Ende der Analyse auf dem Wege der Heilung befindet. Meine Interpretation des Traums in der Lehranalyse der Therapeutin war die folgende: Die »unbekannte« Patientin ist die unbewusste Identität der Therapeutin, die sich schon als Kind exzessiv verantwortlich fühlte für ihre Eltern (Parentifikation), dann für ihre Freunde, für die Kollegen und schließlich für psychiatrische Patienten. Diese übersteigerte Selbstverantwortlichkeit – die natürlich dem ganzen Ursprungsklima angemessen war – ist tatsächlich 59
in eine depressive Tönung der Persönlichkeit übergegangen. Aber warum wurde eine solche depressive Tönung im Traum personifiziert durch eine aggressive Patientin, geführt von zwei Polizisten? Diese stellten in meiner Interpretation die Fesseln des Zwangs der Selbstverantwortlichkeit dar. Die Aggressivität war eine Vertreterin der kindlichen Vergangenheit, war ein »Vorschlag« des Traums. Ein Vorschlag, der einerseits unmöglich anzunehmen war, aber anderseits doch aufgenommen und sublimiert wurde, wie das Verhalten der Therapeutin im Traum zeigt: Sie »schlug den beiden Polizisten die Türe vor der Nase zu.« So war meine Interpretation: Sie erklärte meiner Analysandin besonders auch ihre verborgene Depressivität, die von ihr nicht genügend »erkannt« wurde (es handelte sich tatsächlich um eine »unbekannte« Patientin). Und vor allem erwies sich die verdrängte Aggressivität (als Reaktion gegen die exzessive Übernahme von Verantwortung) als fruchtbar in der Analyse, und sie nutzte den Traum als einen »königlichen Weg« zum Unbewussten. Aber war das der einzige legitime Weg? Unter den Assoziationen meiner Patientin war auch die, dass »Francesca« eine wirkliche Person sei, deren Problem eine Depression war, die sich in der Kindheit entwickelt hatte, als sie von einem Knaben zu gewissen erotischen Spielen verführt wurde, für die sie sich verantwortlich fühlte. In einer dann folgenden psychotischen Entwicklung Francescas wurde der verführende Knabe zu einem Verfolger, der seinem Opfer ständig »auflauerte«. Können wir an diesem Punkt sagen, dass nicht nur die »innere Francesca«, sondern auch die »äußere Francesca« an der Wurzel des Traums der Therapeutin sind? Unzweifelhaft ja, aber ich würde diesen Traum nicht darauf zurückführen, wenn die doppelte Interpretation sich darauf begrenzen würde, die Konvergenz eines Aggressivitätsproblems in der Therapeutin und eines Libidoproblems in der Patientin aufzuzeigen. Die interessante Tatsache war aber die, dass Francesca in der therapeutischen Sitzung, die dem Traum meiner Analysandin folgte, einen Traum berichtete, der mir wie die Spiegelgestalt des therapeutischen Traums erschien – und zwar in einem Moment, als ihr die Therapeutin den eigenen Traum noch nicht mitgeteilt hatte. In diesem Traum war Francesca in einer Sitzung mit der Therapeutin. Jemand (wie im Traum der Therapeutin) klopfte an die 60
Tür und wollte unbedingt eintreten. Dieser Jemand – im Traum der Therapeutin das »verrückte, von zwei Polizisten begleitete Mädchen« – war in jenem Francescas umgekehrt der verfolgende Knabe, den ich eben erwähnt habe. Die zwei Polizisten wurden durch eine andere Über-Ich-Gestalt ersetzt, nämlich den Vater des Knaben. Wie im eigenen Traum »schlug« die Therapeutin dem Belästiger »die Tür vor der Nase zu«. Francesca, die sich in ihrer problematischen Kindheit »ohne jeden Schutz« gefühlt hatte, fühlte sich nun tief beschützt von dieser therapeutischen Geste, die die Sitzung umgrenzte, die das Interesse der Therapeutin für sie anzeigte, die den Raum der Dualität von jenem des Wahns trennte. Die eindrückliche Symmetrie endete in einem identischen Schluss: In beiden Träumen dankte Francesca »mit Zärtlichkeit« (gleiches Wort) der Therapeutin für ihr Verhalten im Traum. Die Therapeutin entschloss sich dann (in der Realität), ihrer Patientin den eigenen Traum zu erzählen. Sie erklärte ihn der Patientin als eine Verwirklichung des »Wunschs nach Symmetrie« zwischen den beiden Unbewussten. Francesca war natürlich glücklich über den Zwillingstraum, über die »Verwirklichung von Symmetrie«, über die »geheimnisvolle Übereinstimmung« zwischen den beiden Unbewussten. Wenn wir nun zum Traum der Therapeutin zurückkehren, halte ich es für unmöglich, ihn nur auf der »Ebene des Subjekts« zu betrachten. Im Lichte der unbewussten Übermittlung würde man sagen, dass die therapeutische Symmetrie wichtiger ist als der intersubjektive Prozess. Das Phänomen der Synchronizität und der Dualität hat, um sich zu aktualisieren, sich eines Traums bedient, der auch auf der rein subjektiven Ebene bedeutungsvoll ist. Wir sehen also an diesem Beispiel, das schon in sich selbst einen entscheidenden Beweis für ein gemeinsames Unbewusstes darstellt, dass die beiden Beziehungsrichtungen von Subjekt und Objekt strukturell Teil der menschlichen Existenz sind. Von diesem einzelnen Traum können wir übergehen zum umfassenderen Konzept, dass das kindliche Selbst – das größte mögliche subjektive Phänomen – sich im objektiven Spiegel der Mutter verwirklicht. Aus dieser Wirklichkeit entspringt das religiöse Bild, dass der Mensch von Gott »nach seinem Bild und Gleichnis« geschaffen wurde. 61
Die Zwillingsträume Ich beginne mit der Gegebenheit. Es handelt sich um eine Patientin, die an einer psychotischen Trennungsphobie litt. Sie konnte sich von niemandem trennen – nicht vom Gatten, den sie nicht mehr liebte, nicht vom Freund, der sie frustrierte, nicht vom Kollegen, der sie sexuell manipulierte und dem sie sich nicht im geringsten widersetzen konnte, ja den sie hasste. Jedes Mal, wenn sie sich zu trennen versuchte, kam es zu psychotischen Krisen, in denen sie »sich auflöste«, sie war niemand mehr. Eingeklemmt zwischen dem Gefühl, an irgendeinen Partner, der sie unterwarf, angekettet zu sein und dem Gefühl, fragmentiert zu werden im Freisein von ihm, war diese arme Patientin ständig depressiv und suizidal. Warum war es ihr nicht möglich, sich zu verteidigen, nicht einmal in Bezug auf den Mann, der sie unverschämt berührte? Offensichtlich waren die symbiotischen Bedürfnisse dieser Patientin sehr stark, sie kamen aus einer unbewussten Kraft, der gegenüber das kümmerliche Ich sich vollkommen machtlos fühlte. Diese symbiotischen Bedürfnisse wurden vom Ich nicht wahrgenommen, nicht einmal als »Bedürfnisse«, sondern wurden als schwerste Ketten erfahren. In unserer Interpretation waren die symbiotischen Bedürfnisse der Patientin eine Abwehr nicht nur, wie auf der bewussten Ebene, der Gefahr der Auflösung, sondern auch – unbewusst – ihrer Umkehrung, des destruktiven Impulses einer radikalen Separation von allen. Dieser Impuls war sichtbar in der ständigen Versuchung sich umzubringen, oder besser gesagt, alle aus ihrer inneren Welt hinaus zu schaffen; und er war auch klar sichtbar in der Übertragung. Nach einer analytischen Sitzung mit einer Therapeutin, der es gelungen war, mit der Patientin zusammen die Dynamik des Symptoms zu verstehen, »sah« sie auf dem Weg nach Hause halluzinatorisch das Gesicht der Therapeutin, deformiert in eine teuflische Maske. Die destruktive Separation! Diese Patientin berichtete im Lauf der Therapie einen bedeutungsvollen Traum, in dem sie ein Mann war, einen Knüppel schwang und dabei war, an einer Orgie von Gewalt teilzunehmen (die destruktive Separation von den anderen). Es gelang ihr jedoch zu entfliehen, indem sie in Begleitung einer Frau (ihr weibliches Ich, 62
die Therapeutin) zuerst auf die Dächer der Häuser kletterte, dann über schroffe Felsen, bis sie eine verlassene Heide erreichte. In dieser von den Menschen und von jedem lebenden Wesen verlassenen Heide, die verbrannt und trocken war, hatte sie die Gewissheit, für lange bleiben zu müssen, hier einen ganze Spanne des Lebens durchlaufen zu müssen. Und dennoch fühlte sich die Patientin innerlich erleichtert durch diesen Traum. Es war ihr die »gute Separation« gelungen, nicht diejenige, die der Zerstörung anderer gleichkam (der Faschismus, die teuflische Verwandlung der Therapeutin) oder der Zerstörung des eigenen Selbst (die Selbstauflösung). In der gleichen Nacht, in der die Patientin diesen Traum träumte, hatte die Therapeutin ihrerseits einen Traum, den ich »Zwillingstraum« nennen möchte, denn er war ganz zentriert auf das Thema der Separation: Sie kümmerte sich in einem Spital um die Patientin und empfand das Bedürfnis, ihr nahe zu sein, weil sie deren plötzlichen Suizid befürchtete. Die beiden Frauen gingen zusammen zu einem Haus, vor dem die Patientin sich unversehens von ihr trennte, da sie eine Toilette aufsuchen musste, die sich in jenem Haus befand. Nach einigen Augenblicken des Zweifelns entschied die Therapeutin, sie gehen zu lassen: Sie wartete lange auf sie, vergeblich, und fürchtet deshalb im Traum, dass die Patientin nie mehr zurückkehren werde; aber siehe, sie kam zurück! Nach einer Weile wiederholte sich die Szene: Die Patientin schaute ihre Therapeutin fest und intensiv an und wollte sich von ihr trennen. Noch einmal ließ die Therapeutin sie gehen. Und noch einmal kehrte die Patientin zurück. Und so ein drittes Mal. Die Therapeutin teilte ihren Traum der Patientin nicht mit, auch weil sie ihn nicht voll verstand. Aber in der folgenden Sitzung wurde die Beziehung bedeutungsvoller. Zum Beispiel brachte die Patientin der Therapeutin gewisse ihrer Zeichnungen mit, auf denen sie wie eingekerkert war in Kreise, die sie einwickelten und erstickten (im Traum hatte die Therapeutin von einer »Hölle« gesprochen, die die Patientin einwickelte). In der Sitzung begann ein Dialog um das Thema der »möglichen Nähe«. Auf die Frage, wie die Patientin sich fühlen würde, wenn die Therapeutin in den Umkreis ihrer »Kreise« einträte, antwortete diese, dass sie sich sofort auflösen würde. Dann also außerhalb der Kreise, aber immer neben ihr. Schließlich wurde nach und nach die richtige Distanz gefunden, 63
und die Patientin konnte dann »ohne Todesgefahr« die Stimme der Therapeutin hören. Gleichsam wie in einem Traum oder in einem gemeinsam geschaffenen Drama begann die Beziehung, die zugleich band und befreite. Es gibt Gegenübertragungsträume, die dem Patienten nicht erzählt werden und die dennoch eine psychotherapeutische Aktivität ausüben, wie es sich ergibt aus der engen zeitlichen Verbindung zwischen ihrem Erscheinen im Geiste des Psychotherapeuten und dem deutlichen klinischen Fortschritt des Patienten. Auch wenn es keinen sicheren Beweis gibt für ihre unbewusste Übermittlung an das Unbewusste des Patienten, muss angenommen werden, dass eine solche Möglichkeit plausibler erscheint als andere Hypothesen und dass die häufige Skepsis in Bezug auf die Übermittlung von geistigen Gestaltungen über den unbewussten Weg zu einem großen Teil von unserem Unwissen, was diese betrifft, abhängt. Zahllos sind die »Übereinstimmungen« zwischen therapeutischem Traum und darauf folgendem Verhalten des Patienten. Ich habe keinen Grund zu glauben, dass die Wirkung einem nach seinem Traum veränderten Verhalten des Therapeuten zuzuschreiben ist, und ich habe keinen Beweis, dass dieses eventuell veränderte therapeutische Verhalten, auch wenn es theoretisierbar ist, einen so plötzlichen Effekt haben kann, wie es sich umgekehrt in diesen Fällen ergibt. Ein anderes Beispiel ist das Folgende: Ich erinnere mich an die Supervision eines Patienten, der schwer beeinträchtigt war in seiner Emotionalität. Er war unfähig, Übertragungsgefühle irgendwelcher Art auszudrücken und deswegen in seinen analytischen Mitteilungen durch einen rigiden Pseudo-Rationalismus eingeschränkt – wie auch in seinen Beziehungen außerhalb der Analyse. Einige Wochen nach dem Beginn der Therapie träumte die Therapeutin – zu ihrem Erstaunen –, dass der Patient in ihr Bett kam, um neben ihr zu ruhen. Der Traum war vollkommen unerotisch. Im Traum nahm die Therapeutin das Verhalten des Patienten an, ohne sich Rechenschaft über seine analytische Absurdität zu geben. In der folgenden Sitzung war der Patient wie verwandelt. Seine Hemmung war stark zurückgegangen. Der Patient teilte der Therapeutin die Phantasie mit, dass sie in seinen Augen »verführerisch« sei. Aber sie hatte gar keine Angst davor, sie fühlte sich im Gegenteil erleichtert, 64
wie befreit von Fesseln, die sie gefangen hielten. Die Therapeutin hatte in ihrer strengen Introspektion nicht den geringsten Eindruck, dass ihr Verhalten in Bezug auf den Patienten vom Traum beeinflusst worden wäre.
Die Aktivität des Unbewussten des Therapeuten in der Wahrnehmung des Unbewussten des Patienten Ich berichte den Traum eines Patienten und einen folgenden Traum seines Therapeuten während der Psychotherapie. Es war ein depressiver Patient, während langer Jahre einem überbehütenden Vater und einer possessiven Mutter unterworfen, ein in seiner Aggressivität zutiefst gehemmter Patient (unfähig, sich gegen seine Eltern aufzulehnen oder sich zumindest von ihnen zu distanzieren, obwohl er schon eine eigene Familie gegründet hatte), der deshalb durch die »Abwesenheit der Aggressivität« zu einer negativen Form von Selbstidentität neigte (»Ich bin ein Unfähiger, bin ein Versager« etc.). Im Traum des Patienten tötet ein extrem gewalttätiger Samurai einen guten und milden Samurai und verschwindet dann. Die Polizei eilt herbei, der Patient wird von der Angst ergriffen, die Polizei könnte den Verdacht hegen, dass er der Mörder sei, und er verbirgt deshalb das von Blut triefende Messer, das Beweisstück des Verbrechens. Aber er wird dennoch verhaftet. Die Angst ist so groß, dass sie eine Enuresis auslöst. Offensichtlich »weiß« das Unbewusste des Patienten, dass er der Mörder ist und dass er vergeblich versucht, sein »wahres Selbst« vor sich zu verbergen. Betrachten wir nun den Traum des Therapeuten. Dieser befindet sich im Zentrum eines orientalischen Tempels, wo eine heilige Zeremonie vollzogen wird. Aber da unterbricht ein großer, furchterregender, in Schwarz gekleideter Mann die Zeremonie, indem er ein schwarzes Schälchen gegen eine mit einem Teppich geschmückte Wand schleudert. Die Priester führen den Ritus weiter, wie wenn nichts geschehen wäre. Der schwarze Mann erhebt sich ein zweites Mal und wiederholt die gleiche Geste. Die Priester, als einzige Antwort, küssen einander. Der Therapeut beobachtet die Szene gleichmütig. 65
Mir scheint, dass der therapeutische Traum eine Weiterführung des Traums des Patienten im Unbewussten des Therapeuten ist, der das Erleben des Patienten »appersoniert«, aber es gleichzeitig weiterentwickelt. Was die teilweise Symmetrie der beiden Träume betrifft, können wir sagen, dass der niederträchtige Samurai hier dargestellt wird durch den schwarzen Mann und dass der gute Samurai dargestellt ist durch die tibetanischen Priester. Was die Weiterentwicklung im Traum betrifft, ist zu sagen, 1. dass der schwarze Mann nicht mehr Mörder ist, 2. dass der Therapeut, der an der Stelle des Patienten steht, fähig ist, an der »schrecklichen Szene« ohne jede emotionale Verwirrung teilzunehmen. Warum diese positive Weiterentwicklung? Einerseits ist es möglich anzunehmen, dass eine positive Weiterentwicklung im Patienten stattgefunden hat und dass der Therapeut sich durch den Traum darüber Rechenschaft gibt. Anderseits ist es auch möglich anzunehmen, dass der Therapeut eine solche Weiterentwicklung »erschafft«, in dem er in sich mit seinem Traum die Szene des Patienten wiederholt und sie verwandelt, sei es inhaltlich, sei es auch mit seiner Art, auf sie zu reagieren, indem er nämlich ruhig bleibt. Wir können auch eine reziproke Beziehung zwischen dem Symbol der Aggressivität (der böse Samurai, der schwarze Mann) und dem Symbol der Milde (der gute Samurai, die tibetanischen Priester) sehen. Einerseits ist es möglich zu sagen, dass die »historische« Milde des Patienten eine Abwehr der im Unbewussten verborgenen destruktiven Aggressivität ist (die vom Therapeuten in seinem Traum als eine »zeitlose« Destruktivität, als Todestrieb erlebt wird). Anderseits kann auch gesagt werden, dass die latente Aggressivität selbst eine Abwehr ist gegen die unterwürfige Milde, die die Vitalität des Lebens zugrunde richtet. Ein dritter Aspekt des Traums ist jener der Übertragung und der Gegenübertragung. Sowohl die Milde wie die Aggressivität sind auf den Therapeuten gerichtet, die erste bewusst (Idealisierung), die zweite unbewusst. Der Therapeut reagiert auf diese Letztere mit dem Kuss, er umarmt den Patienten.
66
Die unbewusste Dimension der Beziehung zwischen Therapeut und psychotischem Patienten, wie sie sich in den therapeutischen Träumen und den Zwillingsträumen offenbart Ich beginne mit der Beschreibung eines »Zwillingstraums«, der auf den ersten Blick nicht als solcher erscheint, aber dessen »Zwillingscharakter« schon daraus hervorzugehen scheint, dass die beiden Träume, jener der Patientin und der ihrer Therapeutin, sich in der gleichen Nacht ereigneten. Betrachten wir zuerst den Traum der Patientin. Diese, eine schizophrene Frau auf dem Weg der Remission, hatte den besagten Traum in einer Phase des Übergangs zwischen Autismus und dem Suchen nach Kommunikation. Vor dem Traum war sie isoliert in einer autistischen Welt, die im Spiegel der Träume manchmal als »verzaubertes Schloss, von Flammen umgeben« erschien, manchmal als »Spalt zwischen zwei auseinander klaffenden Welten«, als »bodenloser Abgrund«, in welchen die Patientin sich hineingeworfen fühlte »seit Ewigkeit«. Die Auflösung dieser Phase wurde von einem Traum dargestellt, der sich von allen vorhergehenden unterschied durch seine »Vermenschlichung«. Menschen, zahllose Personen, bewegten sich an Stelle der Abgründe und der verlassenen Schlösser. Diese Menschen waren im Unterschied zu den vorhergehenden Traumbildern, die sich scharf abzeichneten in einer ewigen Todesstille, erschreckend bewegt: Sie schrien alle und ihr Schrei erfüllte unendlich den ganzen Traum, war sein einziger Inhalt. Und warum schrien sie? Wegen einer »Abwesenheit«, die die Patientin nicht präzisieren konnte: eine »menschliche Abwesenheit«. In diesem Schrei drückte die Patientin entweder das negative Gesicht des Autismus aus oder, in der Übertragung, die psychotische Unmöglichkeit eines Zugangs zur Therapeutin. Völlig verschieden war der Traum, den die Therapeutin in derselben Nacht hatte: Es war ein Traum von einer ungewohnten Nähe zur Patientin. Die Therapeutin besuchte diese »in ihrem Garten der Kindheit« (der in der vorhergehenden Erzählung der Patientin der einzige bedeutsame Ort während ihrer Kindheit war). Die Therapeutin fand ihre Patientin »auf einem Baum sitzend und 67
dieser Baum ›lebte‹, war ein einziges Keimen von Blättern und Blüten.« Die Therapeutin entschloss sich, ihren Traum der Patientin zu erzählen. Diese war darüber zutiefst erstaunt, da sie in der Therapie nie von diesem Baum gesprochen hatte und erst jetzt erinnerte sie sich, wie sie als kleines Mädchen, eingeschlossen in ihre Schwermut, Stunden auf diesem Baum sitzend verbrachte. Der Traum war nicht nur die unbewusste Vision einer bedeutsamen Situation in der Vergangenheit ihrer Patientin, sondern auch eine Umwandlung dieser Situation durch das Blühen und Grünen des Baums – und der Traum war auch eine Umwandlung des »Schreis der Abwesenheit«: Das Traumgeschehen offenbarte ein Gegenwärtigsein der Therapeutin in der Welt ihrer Patientin und eine Begegnung mit ihr. In diesem Augenblick konnte sich die Patientin an ein Detail ihres eigenen Traums erinnern, das sie vollständig vergessen hatte: Der Schrei brach aus einer verzweifelten Suche heraus, die Patientin befand sich »auf der Straße des Suchens nach der Therapeutin«. Lassen wir das unlösbare Problem beiseite, ob dieses Detail in Wirklichkeit Teil des Traums war und dann verdrängt wurde oder ob es im Gegenteil eine unbewusste Schöpfung der Patientin war im Augenblick, da sie »berührt« wurde von der therapeutischen Kommunikation. Auf jeden Fall scheint mir eine »topographische« Symmetrie im Traum der Therapeutin und der Patientin zu bestehen. Die Patientin befand sich im Traum der Therapeutin »auf einem Baum« sitzend; in ihrem eigenen Traum befand sie sich »auf dem Weg« zur Therapeutin und nicht einfach »unterwegs«. Ich schließe mit dem Hinweis, dass der Traum der Patientin nur scheinbar »negativ« ist. Im Ausschreien der Abwesenheit wird diese bewusst und weitet sich aus zur Bewusstwerdung der eigenen Abwesenheit von sich selbst, die dem Ich vervielfacht erscheint im Schrei der vielen Gestalten, im Schrei der leidenden Menschheit. Zudem ist die Erfahrung dieser Abwesenheit das spiegelbildliche Gesicht des Zwillingstraums, die Erfahrung der geträumten und auch wirklichen Gegenwart der Therapeutin in ihrer Welt. Das Problem besteht nun darin zu erkennen, wie solche Entsprechungen und Symmetrien entstehen können. Es handelt sich um Beobachtungen, die nie genügend erforscht wurden in der Geschich68
te der Psychoanalyse und der Psychiatrie und die somit zurzeit nicht erklärbar sind. Wir können nur einige Hypothesen anführen: Gewöhnlich fühlt sich der Therapeut, der in ähnlicher Weise wie sein Patient träumt, »aufgesucht« durch diesen. Er erschafft den Traum nicht von sich aus, sondern empfängt ihn sozusagen als Gabe seines Patienten. Seinerseits fühlt sich der Patient nicht einfach verstanden, sondern »aufgesucht« von seinem Therapeuten in seinem eigenen Selbst, das sich nicht mit Worten mitteilen kann. Ist es also möglich anzunehmen, dass die Übermittlung durch jene psychische Begegnungsdimension geschieht, die wir »Übergangssubjekt« nennen? In meinen Schriften habe ich oft darauf hingewiesen, dass das Übergangssubjekt eine autonome Existenz hat, dass es ein Drittes ist neben dem Paar Therapeut / Patient. Es drückt sich in autonomer Weise aus als Stimme, Ahnung, Phantasie, Bild. Es erscheint nicht nur dem Patienten, sondern auch dem Therapeuten. Es entsteht aus einer sympathetischen Übereinstimmung von Therapeut und Patient als »Transzendenz«, als Überstieg der zwei Personen. Die Traumgestaltung des Übergangssubjekts ist gewiss die am meisten überraschende, denn in dieser Gestaltung geschieht offensichtlich eine »Öffnung« des Geheimnisses, das nicht mit Worten mitgeteilt wird. Aber die Phantasie des Wachens hat die gleiche Struktur wie das Traumbild, auch wenn sie leichter als Kreativität der therapeutischen Psyche rational verstanden werden kann. Der Traum aber scheint uns hinzuweisen auf eine »transzendente Dimension«, die selbst über die Kreativität hinausreicht. Während jedoch der therapeutische Traum als Traumzugang zum Geheimnis des Patienten eine seltene und einzigartige Erfahrung ist, wirkt die schöpferische therapeutische Phantasie immer mit, ist allgegenwärtig. Die Wirkungsweise dieser Phantasie zeigt uns gleichsam im Grenzgebiet zum therapeutischen Traum die grundlegende Eigenschaft, dass unser gemeinsames Unbewusstes wesentlich therapeutisch ist. Ich möchte nun das Thema der unbewussten Übermittlung ausweiten auf therapeutische Träume, die sich nicht in einer Situation von »Zwillingshaftigkeit« in Entsprechung mit denjenigen des Patienten ereignen, sondern vielmehr den Therapeuten aufmerksam machen auf tiefe Prozesse des Patienten, die nicht zum Bewusstsein 69
aufsteigen, aber in der Folge bestätigt werden durch die Symbole und Fakten der Psychotherapie. In einem solchen Traum fühlte sich die Therapeutin bedroht von einem schizophrenen Patienten, der in Wirklichkeit während der Sitzungen unterwürfig, unsicher, ohne jede Aggressivität erschien. Dennoch träumte die Therapeutin, dass der Patient sie mit dem Telefonkabel – also mit dem konkreten Symbol der Kommunikation – erwürgte. Nicht zufällig hatte die Therapeutin diesen Traum: Die Weiterentwicklung der Therapie begann recht schnell zu zeigen, dass hinter der demütigen »Fassade« des Patienten eine versteckte Destruktivität lag, die entweder völlig abgespalten wurde vom Ich oder psychotisch durchbrach in paranoiden Delirien, in denen der Patient der gewalttätige Übermensch war, der die anderen unterwarf. Erst als »die zweite Seite« des Selbst nach und nach ins Bewusstsein des Patienten aufsteigen konnte – der psychotisch geworden war, weil er unfähig war, den Übermenschen mit dem Unterwürfigen zu integrieren –, konnte die Therapeutin nach einem Jahr Distanz einen zweiten Traum über ihren Patienten haben. In diesem tauchte das alte Symbol der Leitung, des Stricks, des Telefonkabels unter einem völlig anderen Aspekt wieder auf. Dieses Symbol war nämlich, wie wir beim Erzählen des Traums hören werden, eine Nabelschnur geworden. Nun der Traum: Die Therapeutin befand sich allein mit ihrem Patienten an einem unbekannten Ort. Ihr gegenüber war ein Spiegel, in dem ein Doppelbild des Patienten erschien. Dieser war verdoppelt in zwei enorme Bäuche, offensichtlich schwanger, aus denen zwei Kinder geboren wurden. Eines von ihnen hatte seine eigene Mutter und stellte jenen Teil des Selbst dar, der schließlich in das Ich des Patienten integriert wurde. Das andere Kind – die andere Hälfte des Selbst – hatte weder eine Mutter noch irgendeinen Beistand in der Geburt. Eine fatale Blutung drohte das Neugeborene zu töten. Die Therapeutin sprang als medizinische Assistentin ein, und es gelang ihr, die Blutung zu stoppen und die Wunde zu vernähen. Sie bettete dann das Kind in die Arme des Patienten, der bis dahin in der Szene gegenwärtig war, ohne in irgendeiner Weise an ihr teilzunehmen. Und sie machte sich auf den Weg mit ihm. 70
Aber nach einigen Kilometern bemerkte die Therapeutin unversehens, dass das Kind aus den Armen des Patienten verschwunden war: Dieser hatte es vergessen. Wo? Sie fand es wieder in einer Spielzeugkiste, die im Haus der Therapeutin war, in der Nähe ihres Sohnes. Dieser Traum zeigt die Umkehrung der Gegenübertragung. Das Telefonkabel, das die Therapeutin im ersten Traum erwürgte, ist zur Nabelschnur des Patienten-Neugeborenen geworden. Während die Therapeutin in ihrem ersten Traum selbst vom Tod bedroht war, erlebt sie in diesem zweiten Traum den drohenden Tod ihres Patienten (Übergang vom intransitiven zum transitiven Erleben). Das Neugeborene, das vom erwachsenen Selbst des Patienten noch nicht integriert werden kann, wird zwar verdrängt und geht scheinbar unterwegs verloren. Aber es fällt nicht ins Leere, sondern findet vorübergehend Platz unter den Spielsachen des kleinen Sohnes der Therapeutin. Dieser Platz in der Nische der Mütterlichkeit der Therapeutin, die dem Neugeborenen vorübergehend Schutz und »Wohnung« gewährt, ist der gemeinsame Ort, der Therapeutin und Patient in einer neuen Wirklichkeit verbindet, ist ein Drittes, ein »Übergangssubjekt«. Zusammenfallend mit diesem neuen Traum der Therapeutin wurde der Patient fähig, kritisch über die Psychodynamik der vergangenen Psychose nachzudenken, die innere Spaltung definitiv aufzugeben mit der Einsicht, nicht mehr »psychotisch werden zu wollen«.
Die Beziehung zwischen Traum und Wachen Gewöhnlich ist der Traum die Entdeckung dessen, was vom Wachen verborgen wird; und diese Entdeckung geschieht in der Psychotherapie durch die Interpretation des Traums. Diese Reihenfolge kann sich jedoch in der Psychotherapie der Psychosen umkehren, dann, wenn der Patient durch die fortschreitende Kreativität dem Traum das entzieht, was dieser verdunkelte und verbarg. In diesen Fällen ist nicht nur die Beziehung zwischen Traum und Wachen umgekehrt, sondern auch zwischen Therapeut und träumendem Subjekt; in dem Sinn, dass der Therapeut nicht in den Traum des Patienten ein71
tritt, um ihm etwas zu enthüllen, wie in der Interpretation des Traums, sondern um die Kreativität des Patienten anzuregen, die vom eigenen Traum ausgeht. Ein Beispiel soll dies erklären. Eine postpsychotische Patientin träumte von einer Ausstellung von Skulpturen, die alle ihre Kreationen sind. Der Therapeut erscheint im Traum der Patientin, um unter ihren Kreationen jene, die ihm die schönste scheint, auszuwählen und sagt ihr dann: »Trage sie mit dir herum.« Dieser Satz des Therapeuten wird von der wachen Patientin wieder aufgenommen, die eine Figur entsprechend der geträumten formt und die sie dann identifiziert als »Reiter und Pferd«. Was bedeutet diese Gruppe? Der Traum hatte es ihr nicht gesagt. Es ist das Wachen, das die Physiognomie einer Gestalt entdeckt, die verdunkelt durch den Traum, nun vor der Patientin steht. Sie entdeckt, dass ihre Skulptur eine Karikatur ihrer Beziehung mit der Mutter ist, dargestellt als der Reiter, während sie das Pferd ist. Armes kleines Pferd, so klein unter der wuchtigen Masse der Mutter! Sein Kopf baumelt am Körper und scheint gleichsam der Penis der Mutter zu sein! Das ist die Assoziation des Therapeuten beim Anblick der Skulptur, die die Patientin ihm zeigt. Wie im Traum der Patientin der Therapeut absolut keine Interpretation geliefert hat, sondern sie nur motiviert hat, diese Skulptur mit sich zu tragen, selbst die »Reiterin« zu sein, so interpretiert er auch jetzt nichts. Er nimmt die Interpretation der Patientin auf, die vom armseligen kleinen Pferd, das sie war, nun ein Gefühl der lebhaften Befriedigung darüber empfindet, in ihrer Skulptur das ausgedrückt und aus sich herausgestellt zu haben und dadurch selbst die »Reiterin« geworden zu sein. Der Therapeut war nur das schweigende Ferment eines seelischen Prozesses, der sich aus dem Traum als seiner ersten Manifestation herausbewegt hat, um von da aus im Wachen zu einer Art von Selbstentzifferung zu gelangen. Interpretationen von Träumen haben gewöhnlich die Funktion, dem Ich, Autor der Träume, eine größere Vertiefung in die Traumbotschaft zu ermöglichen. Von mir durchgeführte Beobachtungen von verschiedenen Patienten in Analyse, deren Träume nicht interpretiert wurden, ließen mich schließen, dass die Traumbotschaft unbewusst vom Ich vernommen wurde. Und das erklärt die Universalität des Traums oder seine physiologische Wichtigkeit. Die inter72
pretative Erarbeitung erlaubt jedoch bei einer anderen Gruppe von Patienten eine größere »Bereicherung des Ich«. Dies alles betrifft jedoch nur das wache Ich, das Ich, das, indem es die Interpretation hört und mit dem entsprechenden Traum vergleicht, ihn besser versteht und stärker aufnimmt, als im Fall einer schweigenden Botschaft des Traums oder gar einer nicht memorisierten. Das Problem, das ich hier in Angriff nehmen möchte, ist abzuklären, ob die Interpretation, wenn sie vom wachen Ich einmal vernommen worden ist, die Macht hat, im Fall von wiederkehrenden Träumen, deren Verlauf zu beeinflussen. Ich schicke voraus, dass ich unter wiederkehrenden Träumen das Sich-Wiederholen mit kleinen Variationen von gewissen für ein bestimmtes Individuum typischen Träumen verstehe, die also auf die gleiche Art enden, ohne dass das träumende Ich in irgendeiner Weise die Lösung des Traums verändern kann. Diese Situation führt zur Frage, ob nicht nur das wache Ich des Patienten, sondern auch sein schlafendes Ich einen Gewinn ziehen kann aus einer Interpretation, die vorausgehend dem wachen Ich gemacht wurde. Ob zwischen wachem Ich und schlafendem Ich eines gleichen Individuums eine Kontinuität der Tätigkeit ist, für die eine gegebene Interpretation das kognitive Wissen des schlafenden Ich bereichert und es befähigt, seinen Traum zu »lenken«. Dies könnte sich darin zeigen, dass es den wiederkehrenden Traum verwandelt in einen »verstehbaren Traum«, oder dass es Traumlösungen findet, die vorausgehend durch die Interpretation suggeriert worden sind. Ich weiß noch nicht, in welchem Maß dieses Phänomen vorkommen kann, ob häufig oder selten, denn die wiederkehrenden Träume sind nicht häufig und waren nicht Objekt von systematischen Untersuchungen von mir. Aber einzelne interessante Beobachtungen sprechen klar zugunsten der Möglichkeit des Hinübergehens einer Interpretation vom Wachen zum Schlafen. Ich erinnere mich in dieser Beziehung an einen Wiederholungstraum eines psychotischen Patienten, der in seinem Wohnhaus überrascht wurde von der anonymen Gestalt eines Verfolgers, der ihm auflauerte, bald vom Fenster aus, bald vom Garten her, oder hinter einer Mauer, und ihn lähmte vor Entsetzen. Der sehr einfache Traum endete immer auf die gleiche Art, in einer Panik, aus der der Patient 73
verwirrt aufwachte. In meiner Interpretation, die ich ihm ein einziges Mal gegeben habe, aber die für ihn höchst bedeutungsvoll war, sagte ich ihm, dass der Verfolger in der realen Welt nicht existiere, sondern dass er nur ein Schatten seiner Vergangenheit sei; und dass, um den Traum zu modifizieren, es notwendig sei, den Verfolger in einen Gast zu verwandeln, indem er ihn in sein Haus einlädt. Einige Tage später wiederholte sich der Traum, der Patient erinnerte sich jedoch im Traum an meine Interpretation, und er lud den Verfolger ein, in sein Haus einzutreten, um sich mit ihm zu unterhalten. Das genügte, damit der Verfolger verschwand – er hörte auf, ein »abgespaltener Teil« von ihm zu sein, so dass der Patient schließlich aus seinem Traum mit einem starken Gefühl von Frieden aufwachen konnte.
Die doppelte Botschaft des Traums Eine Patientin begegnete im Traum ihrem »Doppel« und bemerkte zuerst mit Schrecken, dass diese Frau völlig blind war. Nicht nur sie, sondern auch ihre Angehörigen waren blind; sie stammte aus einer Familie von Blinden. Das war der ganze Traum; aber die interessante Tatsache, die für die doppelte Botschaft des Traums spricht, ist das Gefühl von Wohlbefinden, von Freiheit, von Individuation, mit welchem die Patientin nach diesem Traum erwachte. Offensichtlich konnte sie im Traum ihre Unfähigkeit, sich selbst zu beobachten, in sich hineinzuschauen, sich und die Welt in den richtigen Proportionen anzuschauen, so gut projizieren, dass sie durch die Projektion selbst einen Akt der scharfen Selbstbeobachtung vollbringen konnte: Sie war nicht mehr blind in dem Augenblick selbst, da sie ihre eigene Blindheit im Traum entdeckte, sie »sah«. Diese Blindheit war dann im Spiegel des »Doppels« so wahrhaftig dargestellt, dass es der Patientin dadurch möglich wurde, sich sozusagen »hinter« dem Spiegel zu finden: Sie wurde von ihrem Spiegelbild nicht absorbiert, sondern überstieg dieses im Augenblick selbst, da sie es sah. Und genau in diesem Augenblick, nicht etwa im Akt des Verstehens nach dem Traum und nicht in demjenigen der Interpretation, sondern im Akt des Träumens, wur74
de ihr gleichzeitig ihre Blindheit und ihre Fähigkeit zu sehen offenbart. Ein anderes Beispiel: Eine 78-jährige Patientin träumte, einen 20 Jahre jüngeren – mittlerweile verstorbenen – Freund aus früherer Zeit wiederzusehen, von dem sie einst verlassen worden war. Sie lächelt ihm zu, aber er tanzt mit einer anderen Frau. Sie begegnet dann einem anderen Mann, der sich jedoch nur oberflächlich für sie interessiert und mit einer anderen tanzen geht. Das Problem dieser Patientin war unter anderem die starke ödipale Bindung an den Vater und das Erleben von Verlassenwerden durch ihn. Aber jetzt ist im Traum nicht mehr nur die regressive Bewegung. Sie sieht im Traum ihren gealterten Leib, sie bemerkt, dass sie 78 Jahre alt ist, realisiert die tragische Dimension der menschlichen Existenz, die auch im Altern besteht, im Erleben dieser Situation, in der wir selbst von unserem Leib verlassen werden. Darum ist die andere Botschaft des Traums, die sie selbst beim Erwachen aus dem Traum herausholt, die Verwirklichung des eigenen Selbst in der Erinnerung der Vergangenheit. Diese Bewusstwerdung ist progressiv, sie wirkt mit, die Grenze des Lebens zu akzeptieren und ermöglicht auch, das kindliche Verlassenwerden im Annehmen des existentiellen Schicksals umzukehren. Und tatsächlich empfindet sie nach dem Erwachen ein Erleben von Frieden und fühlt, dass sie sich versöhnen kann mit ihrem früheren Partner, durch den sie sich sonst nur enttäuscht fühlte. Positivierende Phantasien des Patienten: Eine Patientin fühlt sich von ihrem Therapeuten jedes Mal verlassen, wenn das Problem der Beendigung ihrer langen Analyse im Gespräch auftaucht. In einem Traum begibt sie sich in die Praxis des Analytikers, um dessen Abwesenheit festzustellen. An seiner Stelle ist eine »Therapeuten-Frau«, die mit dem Gatten der Patientin spricht. Bei ihrem Erscheinen schweigen die beiden. Offensichtlich sprechen sie kritisch über sie. Die Patientin fühlt sich zutiefst beleidigt. In der zweiten Szene des Traums erscheint die Mutter der Patientin, die ihr sagt: »Du solltest daran denken, für deinen Analytiker ein Abschiedsgeschenk zu machen.« 75
Die Patientin erwacht und empfindet eine Regung von Zorn gegen ihre Mutter, die sie verlassen hatte, erkennt jedoch, dass die Mutter des Traums verschieden ist von der wirklichen, die Traummutter ist wohl streng, aber auch neutral und liebevoll. In meiner Interpretation zeigt sich das Doppelwesen des Traums in der Tatsache, dass eine regressive und eine progressive Bewegung sowohl in der ersten wie in der zweiten Szene des Traums ist. Die regressive Bewegung der ersten Szene besteht im Wiederinszenieren der Situation des kindlichen Verlassenwerdens, aber der »latente« Gedanke der manifesten Regression ist die »Therapeuten-Frau«, die der Patientin gleicht. Sie ist ein Ausdruck der Progression, ein Übergangssubjekt zwischen ihr und dem Therapeuten, also jener Teil von ihr, der die Trennung vom Therapeuten akzeptiert und jener Teil des Therapeuten, der sie loslässt, ohne dass sie von ihm verletzt wird. Auch in der zweiten Szene haben wir die gleiche Doppelbedeutung: Die Regression besteht im Erscheinen der wirklichen Mutter, immer noch in Verbindung mit dem Verlassenheitserleben der Patientin. Die Progression besteht in der metaphorischen Gestalt der Mutter, die also den erwachsenen Teil der Patientin darstellt, die sich Rechenschaft gibt über die Notwendigkeit der Grenze und diese Grenze nicht mit der Erfahrung des Verlassenwerdens verbindet. In diesem Verbinden von Regression und Progression können wir alle gemeinsam mit unseren Patienten jene Aspekte der Vergangenheit überwinden, die uns zu Gefangenen dieser Vergangenheit machen. So können wir das Gefängnis als einen Übergang zu einer ausgeweiteten Existenz erfahren – ohne die Erinnerung an und die metaphorische Gegenwart dieses Gefängnisses wäre sie nicht von dieser Weite.
Der stellvertretende Traum Unter stellvertretendem Traum verstehe ich ein Traumphänomen, das ziemlich selten ist, denn ich habe es nie bei einem meiner Patienten festgestellt (oder ich erinnere mich nicht, es festgestellt zu haben), während ich es bei mir bereits einmal bemerkt habe. Bevor ich es schildere, will ich das Konzept erläutern: Es handelt sich um einen Traum, in dem das Subjekt den Traum einer anderen Person ver76
nimmt. Anstatt das Traumbild direkt zu träumen, überträgt das Subjekt die Aktivität des Traums auf einen Anderen; dieser »Andere« wäre dann der Autor des Traumes. Hier also mein stellvertretender Traum: Nachdem ich mit Bestürzung und Trauer vernommen hatte, dass der Patient eines Therapeuten kürzlich Suizid begangen hat, habe ich in der folgenden Nacht geträumt, der Therapeut habe von ihm geträumt. Der Traum, der mir im Schlaf vom Therapeuten berichtet wurde, war folgender: Er habe geträumt, dass der Suizidpatient »zum ersten Mal« unter den Füßen einen Boden gefunden habe, der anders ist als jener, auf dem er immer gehen musste. Das ist alles. Der Traum des Therapeuten (von mir appersoniert) scheint den Wunsch auszudrücken, dass für den Patienten nicht alles zu Ende sei; dass er jetzt ein anderes Leben beginne, in dem er endlich mit den Füßen einen anderen Boden berühre. Diese Interpretation lässt die Frage offen, ob der Traum nur einen Wunsch des Träumers ausdrückt, oder ob er seiner »transzendenten Wahrnehmung« entspricht. Es bleibt die Frage, warum ich die Botschaft des Patienten nicht direkt empfangen habe, sondern durch den Therapeuten. Meine Rolle in dieser Therapie ist diejenige des Supervisors, in der ich in der Wirklichkeit alle Botschaften des Patienten durch seinen Therapeuten empfangen habe. Dieser Traum ist offensichtlich selten, weil er die nicht häufige Situation der Supervision eines Suizid-Patienten widerspiegelt. Es ist auch möglich, dass ich den Traum dem Therapeuten als Autor attribuiert habe, weil ich weiß, mit welcher Häufigkeit er von seinen Patienten träumt. Der Traum dokumentiert also auch die intensive Teilnahme meines Unbewussten an dieser Therapie. In diesem Bereich verstehe ich auch die Tatsache, dass meine Frau an dem Abend weinte, als sie von mir die Nachricht vom Tod des Patienten erfuhr.
Der prophetische Traum Eine Patientin, die an einer psychoreaktiven Depression erkrankt ist, träumt, dass ihr Haus brennt. Sie sucht vergeblich, das Feuer zu bändigen, die Feuerwehr zu ru77
fen. Doch der Rauch dringt in alle Zimmer ein, das Telefon funktioniert nicht. Der Freund schlägt ihr vor zu fliehen; aber sie will ihre Katzen nicht verlassen, für die sie eine große Zuneigung hegt. In einer zweiten Szene des Traums ist sie in einem Hotel, wo alles, im Unterschied zur ersten Szene, normal ist; aber die Patientin fragt sich mit Angst: »Wo sind meine Katzen?« In der analytischen Bearbeitung des Traums wurden die Katzen als Symbole der kreatürlichen Vitalität der Patientin interpretiert, die vom Verlauf ihres Lebens bedroht ist, das ihr härteste Schicksalsschläge nicht ersparte: Enttäuschung von Seiten ihres Vaters, mit dem sie sehr verbunden war in ihrer Kindheit, der Mutter und Tochter verließ, um sich mit einer Prostituierten zu verbinden. Enttäuschung durch ihren drogenabhängigen und sozial unfähigen Partner, der sie belog wie der Vater; eine depressive Mutter, die sie mit ihrem Jammern belastete, und um die sie sich dennoch kümmerte; Enttäuschung in der Arbeit. In der Analyse ging es darum festzustellen, welches der unbewusste Anteil des Ich war, der mit seinem Verhalten die pathogene Situation des Lebens und die reaktive Depression hervorrief. Die Interpretation des Traums löste diese Fragen nicht, sondern begrenzte sich darauf, die Traumkatastrophe als Symbol der realen zu verstehen. Ich zeigte, wie das bildhafte Denken des Traums die Erlebnisse der Gegenwart und der Vergangenheit in Bilder übersetzt, die manchmal entmutigend sind wie die Realität des Wachens. Sie geben jedoch dieser Wirklichkeit, die wie ein diffuser grauer Nebel die innere Welt verdunkelt, die Farben und die Formen des einzelnen Ereignisses, wo sich das dringende Problem stellt: Was ist zu tun? Aber das Unbewusste hat nicht nur die Funktion, die Gegenwart zu bearbeiten und ein Fenster zur Vergangenheit zu öffnen, damit diese Vergangenheit im dem Maße im Symbol erkennbar wird, als sie dazu beiträgt, die Gegenwart zu gestalten. Das Unbewusste hat auch ein verborgenes Fenster, das sich bisweilen auf die Zukunft hin öffnet, von der unser Bewusstsein im Gegensatz dazu hermetisch getrennt ist. Der oben erzählte Traum hatte tatsächlich eine prophetische Dimension. Zwei Monate später brannte das Haus der Patientin wie im Traum, aus zufälligen Gründen, und die Katzen erstickten, 78
wie die Patientin es in ihrem Traum zwei Monate zuvor befürchtet hatte. Welches ist die Funktion von solchen »Träumen mit zwei Gesichtern«, offen auf die Vergangenheit hin wie auf die Zukunft, gewiss nicht häufig, aber dennoch beeindruckend, sei es für uns, die wir sie hören, sei es für deren Gestalter? Verschiedene Hypothesen sind möglich. Eine ist die, dass eine besondere »Dichte« der Vergangenheit oder die besondere »Stärke« der Konflikte und der Emotionen, die sie erfüllen, die Kraft haben, den Verlauf der Ereignisse zu beeinflussen, sie zu bestimmen. Dies geschieht auch in gewissen Wahnvorstellungen des Wachens, die, obwohl sie offensichtlich absurd sind, eine seltene Bestätigung finden in nachfolgenden Ereignissen. Ich erinnere hier eine paranoide Patientin, die träumte, verfolgt zu werden, früh morgens aufstand, unruhig wegen der Phantasmen, die sie schlaflos machten, zum Fenster ging und von hier aus beobachtete, wie Vandalen ihr Auto beschädigten, das im Freien geparkt war. Das Geschehen wurde dann durch den objektiv vorliegenden Schaden bestätigt. Eine andere, jedoch von einem anderen Gesichtspunkt aus formulierte Hypothese, ist jene der Prognose. Die zwei Katzen, für die die Patientin wie auch ihr Partner Zuneigung empfanden, starben im Traum wie in der Realität: Ist das ein Signal einer erotischen Beziehung, die tief geschädigt ist, an die das Unbewusste nicht mehr glaubt und auf deren Scheitern es uns hinweisen will? Die Träume führen unter sich einen Dialog. Ihre Katastrophen sind nie, oder fast nie, definitiv wie gewisse Katastrophen des Wachens. Vielleicht besteht eine Funktion des Katastrophen-Traums auch darin, die Katastrophe in einem Medium »abzuspielen«, das ihr ermöglicht, sich in einem späteren Traum zu wenden. So geschah es in diesem Fall. Auf den Tod der zwei Katzen im Traum folgte ein weiterer, in dem die Patientin in einer unbekannten, trostlosen Stadt umherging, wo man aber die Sprache ihrer Kindheit sprach, die Sprache des verlorenen Vaters und wo sie unversehens bemerkte, dass sie ein Diadem auf dem Kopf trug, eine silberne Hand, die sie beschützte. Ich schließe daraus: Positivierende Phantasien bilden sich im Unbewussten unserer Patienten oft erst, nachdem sie den »unbewussten Mut« gehabt haben, sich in ihren Träumen den Katastrophen 79
auszusetzen, die sich im Unbewussten skizzieren. Dieser »unbewusste Mut« ist der positive Aspekt des negativen Traums, ist die »Bereitschaft« des Patienten, sich in der Therapie dem Tod auszusetzen, bis zu dem Punkt, wo der Traum in die Realität des Wachens mündet wie im prophetischen Traum: Aber dieser »Mut des Unbewussten« ist ein gemeinsamer Mut des Patienten und seines Therapeuten, der eingetaucht ist in das Drama des Patienten.
Die Halluzination als verdrängter Traum Bevor ich dieses Konzept entwickle, will ich von einem klinischen Beispiel ausgehen. Ich erinnere mich an eine psychotische Patientin, die mit Entsetzen bemerkte, dass sie halluzinierte. Sie war nicht so krank, dass sie ihre Halluzinationen völlig mit der Realität verwechselte und sich daher überhaupt nicht mehr darum gekümmert hätte, ob die halluzinierten Bilder von anderen Menschen verifizierbar waren oder nicht. Nein, sie lebte am Rande der Psychose wie gewisse Borderline-Patienten oder auch schizophrene Patienten am Anfang der Psychose, von denen uns Arieti (1979) erzählt, der an die »heroischen Anstrengungen« erinnert, die solche Patienten vollbringen, um in unserer einvernehmlichen Realität zu bleiben. Die Patientin, von der ich spreche, berichtete mit Entsetzen, ein kleines, elendes und wehrloses Kind auf dem Absatz ihrer Treppe gesehen zu haben. Das war die ganze Halluzination. Es war ihr nicht der Teufel oder der Tod erschienen oder das eigene Skelett, wie in anderen Fällen. Aber die Patientin hatte nachher bemerkt, dass die Vision verschwand, dass sie also etwas Gespenstisches hatte: Sie allein konnte gewisse Dinge sehen, die andere nicht sahen. Die Patientin bemerkte daher, dass sie halluzinierte, an der Grenze des Wahnsinns war und schon dies war ein Grund zur Angst. Aber ein anderer Grund, den sie zuerst nicht bekannte, war der Inhalt der Halluzination selbst. Es war für sie, wie wenn etwas Schreckliches, etwas Namenloses sich im Aussehen des Kindes ausdrückte. Meine direkte Interpretation, dass dieses Kind existiere, dass ihre Vision daher nicht eine absolut irreale war, wurde zuerst zurückgewiesen – dieses Kind durfte nicht existieren, es hatte kein Recht zu 80
existieren. Meine Antwort war, dass genau darin das Elend des Kindes und seine entsetzliche Wehrlosigkeit bestand. Es gab keine Möglichkeit, dass jemand es aufnehmen, es in die Arme schließen, ihm einen »Ort«, einen »Namen« geben würde. Es ist klar, dass ich, als ich dies sagte, sogleich in dem Porträt dieses Kindes ein inneres Bild der Patientin sah und dass ich, indem ich von der absoluten Einsamkeit dieses Kindes sprach, mich dadurch in seine Nähe stellte. Die Einsamkeit wäre tatsächlich nicht so absolut gewesen, wenn die Patientin von dem Kind geträumt hätte, so angsterfüllt der Traum auch sein mag, das Kind hätte einen Platz gehabt im träumenden Ich. Aber ein solcher Traum konnte und durfte für die Patientin nicht sein. Der eigene kindliche Anteil war so gefährlich, dass er amputiert werden musste. Ohne die Psychose wäre dies vielleicht gelungen. Die Patientin wäre eine jener Personen geblieben, die anscheinend geistesgesund, sich hinter einer Maske bewegen und nicht wissen, wer sie sind. In diesen Fällen ist eine Psychose eine Gelegenheit zu leben, ist eine Chance der Existenz, auch wenn sie schrecklich verzerrt ist. Unsere Patientin hatte diese Gelegenheit gehabt. Aber sie war darüber von Entsetzen erfüllt. In den Träumen werden wir konfrontiert mit den Schattenaspekten unseres Selbst, damit wir sie sehen und assimilieren können. Und ich denke, dass die Assimilation schweigend geschieht – schon allein dadurch, dass es in der Psyche einen Ort gibt, wenn auch nur im Traum, wo das Verdrängte existiert. Der Traum ist dann gleichsam die Wiege des Verdrängten; aber paradoxerweise kann selbst der Traum verdrängt, ja vom Ich verboten werden. Dann ist der einzige Weg, auf dem er sich manifestieren kann, die Halluzination, oder der vom Wachen erzwungene Traum. Meine Patientin sollte durch die Psychotherapie lernen, dass dieses Kind sich mit ihr in Beziehung setzen konnte, weil ich mich zunächst mit ihm in Beziehung gesetzt hatte.
81
Der negative Traum: Das Konzept der reintrojizierten Projektion In der Psychotherapie habe ich öfter bemerkt, dass der Patient nicht nur das Opfer, sondern auch der Urheber seines psychischen Leidens ist und manchmal sind es seine eigenen Träume, die uns dies sagen. In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an eine Patientin, die ich durch die Supervision kannte: Sie war an einer latenten Psychose erkrankt, durch die sie alles, was sie begonnen hatte, in einem kontinuierlichen tragischen Bedürfnis von Selbstdestruktion zerstörte, von der Freundschaft zur Ehe, von der eigenen beruflichen Aktivität zur wichtigen sozialen Beziehung. Auch in der Therapie versuchte sie, das Gleiche zu machen und die Therapeutin zur Aussage zu zwingen, dass mit ihr nichts zu machen sei. Eine solches Bekenntnis von Unmöglichkeit wäre, gemäß der Patientin, »die todbringende Umarmung« zwischen ihr und der Therapeutin, aus der vielleicht etwas »Lebendes« geboren würde. Unter den verschiedenen Träumen dieser Patientin, die alle schrecklich waren, erinnere ich mich an einen, der in Symbolen im Sinne meiner These von der partiellen Autogenese der Psychose spricht: »Sie ist von Würmern befallen, die sich überall in ihrem Körper einnisten. Da und dort öffnet sich die Haut, die Würmer kommen heraus, aber sie gehen wieder hinein, weil es ihnen gut geht drinnen, und weil die Patientin im Traum sie veranlasst, wieder hereinzukommen, insofern diese in ihrem Erleben Selbstanteile darstellen«. Es geschieht nicht oft, dass es einer Patientin gelingt, im Traum ein solches Konzept des Objekts als Teil des Selbst zu formulieren, noch kann ich sagen, dass die Patientin beim Erwachen das eigene Traumerleben rationalisiert hätte. Es lag darin die Angst, diese Würmer zu verlieren. Ein anderer Patient, der gelegentlich ohne die täglichen Schmerzen, über die er sich immer beklagte, in die Therapiesitzung kam, fühlte sich dennoch verstört, »seines gewohnten Selbst beraubt«, das eben diesen Schmerzen anvertraut war. Das schlechte Objekt, der zerstörerische Kern, die negative Identi82
tät wurde in diesen Individuen zum brüchigen Boden, auf den sie die Füße stellen konnten, die vergiftete Luft, in der sie atmeten, die verfluchte Nahrung, die allein in den Stoffwechsel aufgenommen werden konnte. Es gibt ein »unheilvolles Ich«, das das »soziale Ich« des Patienten beherrscht. Dieser versucht vielleicht, sich davon zu befreien, kommt in die Analyse, in die Psychotherapie, er möchte anders sein, aber da dieser Andere verborgen die Zügel des Lebens hält, scheinen sich alle möglichen Interpretationen an der Tatsache zu brechen, dass alle Dinge, wenn auch visualisiert, analysiert, interpretiert, im Grund so sind, wie dieses andere Ich es will. Wenn sich der Patient, trotz alledem, ein wenig besser fühlt und es ihm gelingt, im Kielwasser einer guten Interpretation, in eine luftigere Gasse vorzudringen, dann scheint es ihm, er höre eine Stimme »hohnlachen«, die »sich vergnügt beim Sehen dieser Illusionen«, die ihm heimlich sagt: »Gut, warte ein wenig und du wirst sehen«. »Steige nur diese Treppen empor, wir wissen ja bestens, dass es dir nie gelingen wird.« Dieser innere Feind, gegen den alle unsere Reden sich brechen wie Wellen an den Felsenklippen, scheint uns unbesiegbar. Der Schatten der negativen Instanz wird manchmal vom Patienten auf unsere eigenen Gesichtszüge und Worte projiziert, weswegen wir ihn sagen hören, dass auch wir gegen ihn sind, ihn versetzen, ihn nicht verstehen, seiner überdrüssig sind, schlecht über ihn denken. Der Patient »interpretiert uns« auf seine Art. Er behauptet, unser Unbewusstes zu erspüren, den mehrdeutigen Ton gewisser unserer Sätze zu hören, sich an gewisse Worte zu erinnern, die wir selbst in unseren therapeutischen Erinnerungen jedoch nicht wiederfinden können und die uns seine amnestischen Halluzinationen zu sein scheinen. Aber der Patient ist penetrant: Warum sollen nur wir im Unbewussten lesen können? Kann nicht auch er es tun, im umgekehrten Sinn, indem er das unsere aufdeckt? Der Therapeut befindet sich bei diesem Verlauf oft in einer mehrdeutigen Situation. Manchmal – das ist meine Erfahrung – ist es nützlich, fest zu bleiben und dem Patienten die Stirn zu bieten, ihm nicht nachzugeben, die Herausforderung anzunehmen. Manchmal ist es therapeutischer, dem Patienten den Raum zu lassen, den er im Wettstreit sucht und ihm die »Möglichkeit« zu lassen, dass auch er 83
imstande sei, unsere »unbewussten Aggressionen« zu lesen, von denen die seinen nur »Introjektionen« seien. An dieser Stelle in der Dynamik der Übertragung möchte ich über die kommunikative Bedeutung der Projektion nachdenken, die auf den ersten Blick die Kommunikation zu zerbrechen scheint. Betrachten wir zwei entgegengesetzte Gesichter der Projektion, die manifeste Bedeutung und die latente. Um die dialektische Struktur zu beleuchten, bediene ich mich der Traumprojektion, sei es, weil im Schlaf die Unterscheidung zwischen manifestem und latentem Gedanken klassisch ist, sei es, weil da die affektive Komponente des Prozesses genügend dezentralisiert ist vom Ich des Wachzustands, sosehr, dass davon mit dem Patienten gesprochen werden kann, ohne übermäßige Widerstände hervorzurufen. Oft sind wir einem Traum begegnet, in welchem der Therapeut, der Gefährte, mit dem der Patient im Wachzustand eine positive Beziehung unterhält, als Verfolger erscheint: Er spioniert den Patienten aus, lockt ihn in eine Falle, mindestens lässt er ihn in seinem Wartezimmer vergeblich warten, indem er anderen den Vortritt gibt. In nicht wenigen Fällen erlauben uns die Assoziationen der Patienten zu diesen Träumen, Enttäuschungen und Aggressionen, narzisstische Verletzungen und andere versteckte Missverständnisse der positiven Übertragungsbeziehung zu entdecken. In anderen Fällen jedoch kommt ein solcher »latenter Gedanke« nicht nach außen, er scheint nicht zu existieren. Man könnte dann an ein Bedürfnis des Patienten denken, sich die Maske des Angreifers auf das Gesicht zu legen, um uns fern zu halten, mindestens auf der unbewussten Ebene. Es mag effektiv so sein. Aber mir ist auch eine andere Möglichkeit aufgegangen, die mir im späteren Gespräch mit einigen Patienten klar geworden ist. Ich möchte hier von der »introjizierten oder vielmehr der wieder introjizierten Projektion« sprechen, wenn ich diesen Neologismus einführen darf. Ich möchte Folgendes sagen: Das gute therapeutische Objekt ist mindestens so weit vom Selbst des Patienten entfernt, dass dessen Introjektion illusorisch wird. Die Asymmetrie ist zu groß, nicht nur weil das therapeutische Objekt »nur gut ist«, während das Selbst des Patienten »nur schlecht ist« (hier würden unsere Aggressionen genügen, um den Unterschied auszugleichen), sondern weil in letzter Analyse das therapeutische 84
Objekt nährend ist, es stellt sich in diese Rolle, es konstelliert sich in dieser Intention, während das Selbst des Patienten mehr oder weniger selbstdestruktiv ist. Wenn wegen einer solchen Unähnlichkeit (oder auch wegen der Angst vor der Symbiose mit diesem) das therapeutische Objekt nicht introjiziert und integriert werden kann, dann kann es einer Trägerstruktur anvertraut werden, einem »carrier«, wie man in der Biologie sagt, die fähig ist, die Schwellenbarriere zu überwinden. Um eine andere Analogie zu brauchen, können wir uns vorstellen, dass das »fremde Protein«, dargestellt durch den Therapeuten, schließlich das »invariante Selbst« des Patienten fragmentieren würde, oder umgekehrt von dessen defensiven Antikörpern zerstört würde. Gemäß dieser Metapher kann es nur in seinen Kreislauf eingeführt werden, wenn es maskiert ist von und verbunden mit einem dem Patienten vertrauten Protein. Das heißt mit einer seiner Repräsentationen, die eben das gut bekannte Gesicht des Verfolgers ist. Wenn wir diese Hypothese anerkennen, müssen wir uns auch vorstellen, dass der Akt der Verbindung, der »Negativierung« des Therapeuten, vollbracht wird nicht von diesem, von seinen Worten, von seinen Interpretationen, sondern vom Unbewussten des Patienten als Autor des Traums. Wir können auch sagen, von jener Seite des Unbewussten, die sich insgeheim mit dem Therapeuten verbindet und ihn wie ein »trojanisches Pferd« in das eigene Lager eintreten lässt (natürlich, wenn die Bewegung des Patienten noch defensiver ist, dann gibt es auch diese heimliche Verbindung nicht mehr, sondern nur die Kraft der Ejektion von der Seite des »autodestruktiven Selbst«). Indem wir unsere Metapher weiter ausführen, können wir auch vermuten, dass das positive Bild des Therapeuten (das dem positiven symbiotischen Bedürfnis anvertraute) von dem internen Verfolger »angesteckt« wurde, von der destruktiven Imagination, dessen Kleider angezogen hat, sich den negativierenden Gespenstern gleichgemacht hat. Dies nicht, um die Distanz zu vergrößern (obwohl es manchmal so ist), sondern vielmehr für eine Beziehung von Nähe, die eine gegenseitige »Ansteckung« im Guten erlaubt. So erscheint einerseits das therapeutische Bild »verdunkelt«, »angesteckt«, »deformiert« vom Gesicht des Verfolgers, kann aber dadurch seinerseits dieses »anstecken« und positivieren. 85
Das projizierte Bild mit dem defensiven Ziel erfährt dann im projektiven Raum, an dem der Therapeut teilnimmt, eine solche Modifikation, die es möglich macht, dass es – wie der Titel dieser Ausführungen sagt – schließlich re-introjiziert werden kann.
Der metaphysische Traum Der Traum, den ich »metaphysisch« nenne, ist nicht häufig. Er verwirklicht sich in jenen Menschen, deren Grundbedürfnis im Leben das Suchen nach Wahrheit ist. Da kein Über-Ich diesen Wunsch zensuriert, ist der metaphysische Traum nie zensurierbar; sein »Nachteil« liegt aber darin, dass die Suche der Wahrheit immer problemhaft ist; die Verwirklichung im Traum ist immer bruchstückhaft. Unter den vielen sehr schlechten Fragen des Pilatus an Christus ist eine einzige, die wir alle aussprechen: »Was ist Wahrheit?« Das Suchen nach Wahrheit im »metaphysischen Traum« ist ferner immer unvollkommen, denn das Denken im Traum wird nie so klar artikuliert wie im Wachen, es ist voller Irrtümer. Aber warum denn treten metaphysische Träume auf? Weil viele Emotionen im Traum jeweils viel intensiver sind als im Wachen. Der metaphysische Traum, hat er sich einmal ereignet, wird nie mehr vergessen. Eine andere Eigenart des metaphysischen Traums besteht darin, dass sein Erinnern gleichsam immer eine »Rekonstruktion« ist, die Neuerschaffung einer »Vision«, und zwar im logischen Denken, das auf den Traum folgt. Es geschieht mir manchmal, dass ich einen metaphysischen Traum habe. Der jüngste stammt aus jener Nacht, in der ich während meiner Rückkehr von Florenz nach Basel im Eurostar schlief. Hier also der Traum, der aus echten Traumvisionen und aus Gedanken im Dämmerzustand zwischen Schlafen und Wachen besteht. Erste Szene: Ich fragte meinen Bruder Calogero, welches die mentale Funktion des Symbols sei. Ich suchte mich zu erklären, indem ich in einem Satz eine (recht unvollkommene) Definition der Psychotherapie wagte. Die Psychotherapie – sagte ich im Traum – ist im Wesentlichen ein Übersetzen von existentiellem Erleben in Symbole (kognitive, verbale, figurative). Aber diese Symbole wirken nur dann 86
in der Tiefe, wenn sie, einmal geformt, in präverbale Chiffren der Freude zurückverwandelt werden. Es ist die Freude und nicht so sehr das Wissen, die dem Patienten hilft. Nun ist mein Bruder Mathematiker. Ich sagte ihm, immer noch im Traum, dass die Mathematik eine Umwandlung des Seins in Symbole ist, eben in mathematische Symbole. (Ich glaube übrigens nicht, dass er mit meinem Traumgedanken einverstanden wäre!) Aber erschafft diese Umwandlung oder Reduktion, wie immer man sie nennen will, tatsächlich universelle Freude? Wenn nicht, dann ist die Mathematik nur eine Grundlage der Technik – oder die Grundlage der Naturwissenschaft. Diese dient einerseits der Entwicklung der Zivilisation, aber anderseits stellt sie sich auch zum großen Teil in den Dienst der menschlichen Bedürfnisse nach Macht, nach Gewalt, die egoistisch und narzisstisch sind und die das Unglück von Millionen und Milliarden von Menschen verursachen, die Opfer der Technologie werden. So, dass unsere Epoche nicht wirklich glücklicher ist als die griechisch-römische oder als das Mittelalter. Auf diese gewiss unvollkommene Frage gab mir mein Bruder Calogero gar keine Antwort. Es folgte im Traum eine Periode des Halbwachens, in welcher mich das Thema des menschlichen Unglücks bedrückte. Ich befand mich wieder in meiner Kindheit. Man hatte mir beigebracht, dass der Mensch vor dem Sündenfall vollkommen gewesen sei – das Unglück war also eine Konsequenz seiner Schuld. Schon in meiner Kindheit hatte ich verschiedenen Priestern eine Frage gestellt, auf die keiner antworten konnte: Wenn Adam und Eva vor dem Sündenfall zwischen Gut und Böse nicht unterscheiden konnten, warum wurden sie schuldig, als sie den Ungehorsam nicht vom Gehorsam gegenüber Gott unterschieden? Später als Jugendlicher sagte ich mir: Nehmen wir an, dass die mythischen Figuren von Adam und Eva die Repräsentanten der ersten Exemplare des Homo sapiens sind, der auf der Erde vor hunderttausend Jahren erschienen ist. Waren sie sosehr verschieden von ihren Vorgängern, den Hominiden, die vor drei Millionen Jahren lebten? Nein, sie waren immer noch rohe und primitive Wesen. Und da Gott alles voraussieht, warum hat er mit der Gabe der Freiheit, von der der Mensch einen ganz 87
anderen als vollkommenen Gebrauch macht, die Grundlage des menschlichen Unglücks erschaffen? Aber schon holt mich der Traum wieder ein und lässt mich denken, dass am Grund des menschlichen Unglücks und Elends, hinter allen Unvollkommenheiten der Natur, eine »ungeschaffene Ur-Destruktivität« liegt, von der der große Philosoph Zarathustra sprach. Die Schöpfung ist im Grund ein göttlicher Kampf gegen diese ursprüngliche Destruktivität, die wie das Gute, wie die Liebe, als eine »Einmaligkeit« betrachtet werden kann. Dieser Kampf hat in drei »Phasen« stattgefunden: 1. Gott hat die Zeit erschaffen. Das ist die große prähistorische Explosion, der Urknall. Die ersterschaffenen Sterne explodieren ständig während fünf Milliarden Jahre: Welche Zerstörung! Aber damit werden die Grundlagen unseres Planeten erschaffen. 2. Die Erschaffung des Lebens. Wer kann ausschließen, dass hinter den chemischen Prozessen, die das Leben selbst ermöglichten, »Jemand« steht? Aber hier muss man eine zentrale Tatsache sehen: Seit einer Milliarde von Jahren leben Individuen verschiedenster Arten und sie vermehren sich, indem sie Individuen einer anderen Art verschlingen. Ein schönes Leben, wie Schopenhauer sagte! 3. Aber daraus hat sich jene Evolution ergeben, die den Menschen hervorbrachte und mit ihm das Wissen um die Destruktivität, das Wissen um das Böse – und auch das Mitleid und die Liebe. Die Unterscheidung zwischen Gut und Böse ist nicht Frucht der Sünde, sondern – wenn wir gläubig sind – die höchste Gabe Gottes an den Menschen, damit in der Liebe, die göttliche Liebe ist, die Destruktivität überwunden wird, die sich selbst zerstört. Damit die Vorhersage von Teilhard de Chardin verwirklicht werde, dass das menschliche Bewusstsein sich erheben wird bis zum Bewusstsein Gottes. An diesem Punkt vertiefte sich mein Traum: Ich dachte nicht mehr, sondern »erlebte«. Es war wie die Botschaft der Transzendenz: Ich hörte eine erhabene Musik, von unvergleichlicher Schönheit; und fuhr mit dem Zug durch eine Landschaft von unbeschreiblicher Schönheit, die ich noch nie gesehen hatte! Nur Wunsch? Aber das ist ein Wunsch, der schon als Wunsch, auch ohne seine Verwirklichung, aus uns einen Funken der göttlichen Liebe macht! 88
Der Dialog mit dem psychotischen Patienten
Das Grundanliegen meiner Schriften ist es nicht nur, einen psychotherapeutischen Zugang zur Behandlung der Geisteskrankheiten zu erschließen oder zu erweitern, sondern auch zu zeigen, wie die Psychosen, wenn auch auf tragische Weise, wesentlich zum Menschsein gehören und uns helfen, das Wesen des Menschen zu verstehen, wie auch umgekehrt der Patient, wenn wir auf ihn eingehen, uns bei unserer eigenen Individuation behilflich ist. Es gibt verschiedene Arten, dies zu erproben und aufzuzeigen; die heutige Gruppentherapie ist eine der grundlegendsten. Sie ist unverzichtbar, weil sie für viele Patienten anwendbar ist, denen wir, schon wegen ihrer großen Zahl, zu wenig Zeit widmen können. Meine Methode ist die der individuellen Psychotherapie, die auf die inneren Erfahrungen des Patienten eingeht, indem wir sie in uns selbst nachvollziehen, sie introjizieren, sie verwandeln durch unsere Reaktionen auf das, was sich im Akt der Identifikation in uns ereignet, und sie schließlich als mögliche Seinsweisen jenen Menschen zurückgeben, die außerhalb der Möglichkeit menschlichen Daseins zu stehen scheinen. Diese, meine Einstellung ignoriert keineswegs die wirksamen Hilfsmöglichkeiten, die die biologische und die Sozialpsychiatrie heute dem Kranken bieten. Mein ständiges Bestreben während meines ganzen Wegs als Psychiater war es vielmehr, meine eigene Arbeit in die anderer zu integrieren. Ich zweifle nicht daran, dass die vorherrschend biologische Ausrichtung der heutigen Psychiatrie – wenn nicht einseitig betont – ihre Berechtigung hat. Ich zweifle auch nicht, dass die unablässige Entwicklung der Psychopharmakologie – vorausgesetzt, sie wird nicht, wie das in vielen Institutionen leider der Fall ist, nahezu exklusiv gesetzt – nicht nur die Leiden Tausender von Kranken lindern kann, die psychotherapeutisch aus den ver89
schiedensten Gründen nicht behandelt oder erreicht werden können, sondern bin der Auffassung, dass sie auch bei »unseren« Patienten einen besseren Boden für die Psychotherapie legen kann. Was heißt nun aber Psychotherapie? Ich möchte versuchen, dies in einem möglichst weiten Sinne auszudrücken: 1. Während alle »medizinischen« Arten der Behandlung in der klassischen psychiatrischen Ideologie der Gegenüberstellung von gesunder Normalität und krankhafter Abweichung wurzeln, die immer aus einem Defekt der ersteren entsteht, bemüht sich die Psychotherapie, aus dem psychischen Leiden selbst das Wesen der Existenzverwirklichung des Kranken zu erschließen und damit auch seine mögliche Entwicklung. Die Keime dazu sind verborgen in den Symptomen selbst, als Verneinung des Gesunden, und sie können sich nur entfalten, wenn sie von uns zusammen mit dem Patienten aufgedeckt werden. 2. Unsere Interpretationen der klinischen Fakten und der pathologischen Erlebnisweisen des Patienten sind ihrerseits Symbole, mit denen wir seine pathologischen Symbole wiedergeben. Seine Symbolwelt ist sehr oft verzerrt; die Art, wie wir diese Deformation verstehen, entspricht nie seinem wirklichen Erleben, das nur ihm selbst zugänglich ist, sondern ist ein Symbol seines Symbols. Die Modelle, die wir uns von einer geistigen Krankheit, einem seelischen Leiden, einer Schizophrenie oder einer schweren Neurose machen, sind zahlreich, nie ganz verifizierbar, nie auf einen Nenner zu bringen und nie definitiv, eben weil es Symbole von Symbolen sind – unsere Symbole der pathologischen Symbole der Patienten. 3. All dies bedeutet nicht nur, den Patienten zu verstehen, seine Ausdrucksweise zu lernen, sie zu unserer eigenen zu machen, ihm seine eigenen Worte wieder herzustellen und zurückzugeben, mit ihm sein. Es setzt auch voraus, dass wir zum Teil in uns selbst das Drama des Anderen nachvollziehen, dass wir es internalisieren. Genau gesagt, erleben wir es im Rahmen eines anderen Bewusstseins, das gewissen Erlebnisweisen offensteht, die im Patienten eingeschlossen oder verschlossen sind; von daher wird, was bei ihm abgespalten, sprachlos und unbewusst blieb, in uns selbst zu Bewusstsein, zu Sprache, zu Schmerz. Wir nehmen in uns selbst wahr, was der Patient nicht anders als in den Bildern des Wahns wahrnehmen kann, oder zumindest hinter dem Schleier oder der Mauer seiner Psycho90
pathologie. Wir weiten den Horizont, auf dem sich seine Symptome, das heißt seine verzerrten Wahrnehmungen abzeichnen, um ihn an der Art, wie wir sie erleben, teilnehmen zu lassen. Alles das weist zurück auf den Prozess der teilweisen Identifikation mit dem Patienten, darauf, dass wir mit einem Teil unserer Person mit ihm und in ihm sind und seiner Welt in dieser »Hälfte« unserer selbst Gastrecht gewähren. Eine solche Form der Nähe kann sehr schön oder bedrückend sein, je nach Persönlichkeit des Therapeuten und des Patienten. Das wesentliche Problem besteht jedenfalls immer darin, dem Kranken einen Teil unserer Person zur Verfügung zu stellen und zugleich fähig zu sein, die andere Hälfte für uns zu behalten, ja sie wenn nötig gegen ihn zu verteidigen, sollte sein Suchen nach Symbiose maßlos sein. Der »freie« Teil des Therapeuten wird durch diesen Vorgang gestärkt, weil er, in ständiger Berührung damit, zugleich außerhalb steht und deshalb fähig ist, jene tiefen Verwandlungen zu bewirken, die sich gleichzeitig auf der Ebene des Objekts und des Subjekts vollziehen und die wir beschreiben können, indem wir sie den drei großen Zeitachsen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft zuordnen. a) Die Dimension der Vergangenheit: Wir verwandeln die Vergangenheit des Patienten – also das, was endgültig scheint – indem wir dem Patienten ihre Perspektive, ihre Last, ihre Bedeutung, ihren Stellenwert aufzeigen, das heißt, indem wir sie für ihn deuten. Das ist eine große Verwandlung, die von uns auch eine kognitive Leistung verlangt und nicht mehr ausschließlich eine einfühlende, identifikatorische. Vor den bald ungläubigen, bald erstaunten Augen des Patienten wird seine Vergangenheit durch unsere Deutung zu dem, was sie noch nie sein konnte in den Erfahrungsgrenzen seiner Krankheit: eine Vergangenheit, der der Patient sich nun selbst stellen kann, statt erdrückt zu bleiben unter ihrer Last; die er nun in sich umgrenzen kann und in der er die ganze Irrationalität, die Widersprüchlichkeiten, die Ungerechtigkeiten, die Heucheleien, die Unwirklichkeit und die Absurditäten entdeckt. Darin besteht die gemeinsame Arbeit des Umwandelns, die für alle Methoden der Tiefendeutung des Unbewussten gilt, die aber auch in allen, wie immer gearteten, Therapieformen präsent ist, insofern diese Therapieformen Arbeit an der 91
krankmachenden Vergangenheit sind, die durch ihre Dualisierung zur geteilten Vergangenheit wird. b) Die Dimension der Gegenwart: Mit diesem Begriff möchte ich keineswegs wiederholen, was ich schon sagte, dass nämlich die Deutung der Vergangenheit immer in einer therapeutischen Gegenwart geschieht. Nein, unter »Vergegenwärtigung«, »Aktualisierung« und Unmittelbarkeit verstehe ich jene besondere, meist schmerzhafte Form von Wiederholung der Vergangenheit, die wir sowohl in den Träumen des Patienten als auch in vielen Formen der Übertragung beobachten, in denen der Leidende nicht zwischen Vergangenheit und Gegenwart unterscheiden kann, weil er diese letztere ausschließlich im Licht der Vergangenheit erlebt. Dieses Wiedereintauchen in die Vergangenheit, wie schmerzvoll es auch immer sein mag, ist stets viel mehr als ein bloßes Gedenken, ein Erinnern, eine Beurteilen. Es ist vielmehr eine einmalige Möglichkeit, ihr im Hier und Jetzt ein zweites Mal zu begegnen, um in ihr eine Wende zu bewirken, zu der die Vernunft allein nicht fähig wäre. c) Wir gelangen so zum letzten Punkt unseres Vorhabens, zur Verwandlung der Pathologie in der Perspektive der Zukunft: Die Perspektive der Zukunft wird durch den Therapeuten eingeführt in eine zusammengeschrumpfte Welt, die vorwiegend das vergangene Leiden zu kennen scheint und kaum dessen mögliche Überschreitung. Die therapeutische Umwandlung ist auf vielfache Art der Zukunft zugewendet: – Die aufmerksame Beobachtung der Träume des Patienten gibt uns zum Beispiel Aufschluss darüber, wie er seine Zukunft angehen soll. So träumte eine stark aggressionsgehemmte (nicht psychotische!) Patientin, dass eine ihrer Ahnen, die bekannt war wegen ihres sanften und friedliebenden Charakters, ihr eine Pistole, die noch warm war vom letzten Schuss, in die Hand legte und dazu sagte: »Sei aggressiv!« oder auch: »Vermeide dies und jenes. Lerne, was in dir an möglicher Bewegung, an möglicher Weiterentwicklung ist!« – Aber nicht nur Träume können uns über solche Möglichkeiten Aufschluss geben. Die ganze Methode der gemeinsamen »Bildgestaltung als progressive therapeutische Spiegelung« (Peciccia u. Benedetti 1992) baut auf der Progression auf, auf dem Bestreben des Therapeuten, das sehr schnell zum Bestreben des Patienten wird, aus den unentwirrbaren Knoten, aus den Schatten, den Flecken und den 92
ungelenken Entwürfen von heute die Gestalten, die Bewegungen, die Hoffnungen von morgen herauszuholen und zu formen. – Das Wort Hoffnung ist folglich der Leitfaden des therapeutischen Geschehens: Hoffnung des Therapeuten, die zugleich ein Glaube an die Möglichkeiten des Patienten ist, Hoffnung, die dadurch auch die einzige »Caritas« ist, deren er bedarf. Alle therapeutischen Phantasien, ob sie nun zeichnerisch oder verbal sind, ob sie ausgedrückt oder ihm schweigend auf dem Weg des Unbewussten übermittelt werden, sind ausgespannt auf eine Umwandlung hin, die sich bereits im Wagnis vollzieht, und die wir, Patient wie Therapeut, als Kreativität wahrnehmen. In einem solchen universellen Rahmen findet die Therapie des eigentlich psychotischen Menschen ihren Platz. Ich schlage vor, diese Therapie in ihren großen Linien durch die folgenden drei Punkte zu charakterisieren: 1. Die Verwirrung, die der Patient zeigt, wird als ein Mangel an Symbolisationsfähigkeit »gelesen«. Das psychotische Bild wird vom Therapeuten als Symbol erlebt und behandelt und wird so, durch dessen kreative Antwort, zum Ursymbol des Patienten. 2. Die psychoanalytische Abstinenzregel muss für diese Therapien abgewandelt werden. Sie bleibt grundsätzlich gültig als Selbstdisziplin, als Selbstreflexion, als ständige Überprüfung der unbewussten Motivationen, als Verzicht auf narzisstische Interventionen. Aber die so verstandene Abstinenz öffnet sich der Möglichkeit des Handelns, zum Beispiel des spiegelbildlichen Zeichnens, der Dramatisierung, der gemeinsamen Phantasie, des Einfügens der Wirklichkeit in die dialogische Beziehung. 3. Die Übertragung: Was die therapeutische Bearbeitung der Übertragung wesentlich von jener der klassischen Psychoanalyse unterscheidet, ist die Tatsache, dass in der Psychose die Einsicht ungenügend, ja oft unmöglich ist, wegen der psychotischen Beeinträchtigung der kognitiven Kräfte und der Heftigkeit gewisser Übertragungserfahrungen, selbst wenn diese halluziniert sind. Die Auflösung der Übertragung bedingt in diesen Therapien, auf mehr oder weniger symbolische, aber auch reale Weise – insofern es sich um eine affektive Interaktion handelt – die Wiedergutmachung der Gewalt, als deren Opfer sich der Patient empfindet. Es geht hier nicht nur um die Frage, ob der Patient tatsächlich ein 93
Opfer der sozialen Gewalt und der Existenz im Allgemeinen ist, wie er es glaubt, oder ob es sich eher um eine Projektion handelt. Es geht vielmehr darum, in seine Erfahrung einzutauchen wie in eine Tatsache, um sie wieder gut zu machen durch eine psychotherapeutische Hingabe, die sich natürlich auf methodisches Können, auf Deutungen, auf imaginatives Erschaffen von Symbolen stützt, die aber ihre Wurzeln in einer besonderen Gegenübertragung hat, wie sie in uns angesichts des psychischen Todes entsteht. So erinnere ich mich an einen Patienten, der an Verfolgungswahn litt und mir am Ende der Psychotherapie einen Traum erzählte, in welchem der Verfolger, der das Gesicht des Therapeuten hatte, ihn im Namen aller Verfolger seines Lebens um Vergebung bat.
Interpretation und Imagination im Dialog Sowohl die Interpretation wie die Imagination entstammen einer synergetischen Polarität; vielleicht mit dem einen Unterschied, dass die Interpretation, die schon während eines Jahrhunderts von der Psychoanalyse eingehend untersucht wurde, sich besser eignet für die theoretische Reflexion, die Imagination hingegen zum kreativen Potential des Therapeuten gehört. Diese Polarität kann unter den verschiedensten Gesichtspunkten betrachtet werden. In einer Beschreibung, die allein aus Platzgründen auf einen Abschnitt beschränkt ist, werde ich deshalb einen Gesichtspunkt »wählen«, der mir besonders wichtig erscheint, der es aber, absolut betrachtet, nicht unbedingt sein muss. Den von mir gewählten Gesichtspunkt kann man mit Verstehen versus Symbolisation bezeichnen. Damit will ich sagen, dass die Interpretation den Patienten immer mit einem Akt des Verstehens konfrontiert, den er annehmen oder abweisen kann. Eine solche Entscheidung fehlt bei der therapeutischen Imagination, die den Patienten vielmehr symbolisch konfrontiert mit der Art, wie das therapeutische Unbewusste, dem das Bild entspringt, seine Situation empfindet, indem es dieses positiviert und dem Patienten seine Gegenübertragung ausdrückt. Beide Arten der Intervention sind von zentraler Bedeutung in bestimmten Situationen. 94
Sehr oft ist eine psychotherapeutische Intervention gleichzeitig interpretativ und imaginativ. Aber es ist gut, sich wenigstens grundlegend über die verschiedene Akzentuierung Rechenschaft zu geben. Ich möchte dies versuchsweise so formulieren, dass die Interpretation vor allem eine Übersetzung ist und die Imagination ein Ansprechen des Patienten in der Sprache seiner eigenen Bilder. Die Interpretation übersetzt diese in Bedeutungen, die zwar vom Therapeuten konstruiert, jedoch im latenten Gedanken der Symbole des Patienten vorgefunden werden. Die Imagination dagegen ist bestrebt, mittels therapeutischer Beiträge die Figuren des Patienten mit einer Dualität zu erfüllen, die es diesen ermöglicht, sich weiterzuentwickeln, sich zu überschreiten und sich dem Anderen zu öffnen. Diese »Ent-deckung«, wenn sie möglich ist, hat eine wesentliche Bedeutung, weil das grundlegende, wenn auch häufig unbewusste Erleben des psychotischen Patienten dasjenige einer »verfehlten Existenz« ist. Es steckt wohl unbewusst in jedem psychotischen Patienten eine Art »negativer Selbstverantwortlichkeit«, die von einem destruktiven Über-Ich induziert ist und überdies von einem alles durchdringenden Erleben der Wertlosigkeit, das aus dem Subjekt ein lebensunfähiges Geschöpf macht. Die Interpretation ist somit im Grund eine Befreiung, sie kann auch jene paranoischen Patienten befreien, die umsonst versuchen, sich zu verteidigen, indem sie absurderweise die anderen anklagen. Die wahre Befreiung ist dem Aufdecken wirksamer Verstrickungen zuzuschreiben, die den Patienten fesselten, ohne dass er sich dessen bewusst war. Ich erinnere mich, wie einer jener Patienten, der sich selbst verachtete, sich nach einer solchen Interpretation in einer Skulptur des deutschen Bildhauers Riemenschneider spiegelte: Es war die Gestalt eines Opfers, das ganz in schwere Stricke eingebunden war. Aber die Interpretation kann auch, zu Recht, den Patienten verantwortlich machen. Es gibt auch eine »analytische Verantwortlichkeit«, die Konfrontation. Die tiefe Verschiedenheit der analytischen Verantwortlichkeit von derjenigen die, destruktiv, von einem oft unbewussten Über-Ich ausgeht, besteht in der unterschiedlichen Bestätigung der Person des Patienten. Dieser muss bisweilen dazu gelangen, eben durch die Interpretation, zu erkennen, dass nicht nur die Welt, sondern seine ir95
rige Art, sich ihrer Gegenwart zu stellen, an der Wurzel seiner Leiden ist; dass er, in seiner »parataktischen« Art, die Dinge wahrzunehmen und zu unterscheiden, unbewusst selbst dazu beiträgt, psychotisch zu werden. Wenn die Interpretation, öfter wiederholt in den passenden Kontexten, in die Tiefe geht, wird der Patient Distanz gewinnen können von gewissen fatalen Entscheidungen und gefährlichen Tendenzen. Ich erinnere aus einer Supervision den Fall einer psychotischen Patientin, die, mit der Hilfe der Analytikerin, die Wurzel ihrer Leiden in der Existenz einer psychotischen Mutter erkennen musste. Die Psychose der Mutter wurde nach dem Willen des Vaters als »Familiengeheimnis« behandelt, zu dem sie entschieden beigetragen hatte, indem sie viele Einstellungen der Mutter und viele familiäre Konsequenzen ihres Verhaltens auf sich genommen hatte. Ich erinnere mich auch an den ausgesprochenen Sinn für Humor, den diese Patientin nach einem scheinbar negativen Traum zeigte, in welchem sie einer Frau begegnete (die sie selbst unter falschem Namen war), die aus ihrem eigenen Schlafzimmer die Totenkammer ihres Vaters gemacht hatte. So wurde sie schließlich der eigenen ödipalen Verzerrung inne. Die Alternative zur Interpretation ist, nach meiner Erfahrung, diejenige einer Psychotherapie, die dem Patienten das interpretierende Symbol nicht anbietet, sondern dessen Konstruktion im Patienten selbst fördert. Das geschieht so, dass die im Unbewussten des Patienten fehlende symbolische Transkription sich in entscheidenden Phasen der Psychotherapie im Unbewussten des Therapeuten vollzieht und danach in einer intermediären Zone zwischen dem Patienten und dem Therapeuten selbst. Die Übersetzung der psychotischen Situation des Patienten im Unbewussten des Therapeuten bedeutet das »Reale«, wie es Lacan nennen würde, wieder ins Symbol zurückzuführen, so wie es Séchehaye (1947) getan hat. Auf diese Art verwirklichen wir für den Patienten, und manchmal in uns, das, was er in sich selbst nicht verwirklichen kann. Wie kann dies geschehen? Erstens vor allem durch die Möglichkeit, die Sprache des Geisteskranken so aufzunehmen, dass wir in ihr unaufhörlich die Einheit der gespaltenen Welt, die Wahrheit der ver-rückten Existenz heraushören. Es geht darum, so zu hören, dass wir alles, was der unbedarfte, 96
halluzinierende, unverständliche Patient uns sagt, für uns kontinuierlich in Symbole übersetzen, die es uns ermöglichen, auch ohne rationale Mitteilungen bei ihm zu sein. Zweitens durch die Möglichkeit, uns nach und nach, und zuweilen ganz plötzlich in einem Traum, in einer Phantasie, einer mentalen Assoziation, dem psychotischen Erleben des Patienten auszusetzen. Wie sehr wir von solchen Erlebnissen überrascht werden können, hat mir die Erfahrung eines Therapeuten bewiesen, dessen Unbewusstes auf den Willen seiner psychotischen Patientin, die Therapie zu unterbrechen, mit einem Traum reagierte, in dem sie ihn zu ermorden drohte! An dritter Stelle bieten wir in unserem Gespräch dem Patienten die Bausteine an, die er nutzen kann, um mit ihnen sein eigenes Symbol zu erschaffen. Einer Patientin zum Beispiel, die im Wahn lebte, gestorben zu sein, und die sich darüber beschwerte, dass sie beim Lesen der Morgenzeitung keine Traueranzeige fand, zeigte der Therapeut ihre Suche nach einer öffentlichen Trauer um sie und äußerte das Gefühl, an dieser Trauer teilnehmen zu können. Wie die Todesanzeige das konkrete Bild war, so war die Trauer des Therapeuten das Symbol des inneren Todes der Patientin. Viertens, indem wir in dieser Weise teilnehmen, öffnen wir uns dem Patienten so, dass die symbolische Übersetzung, die in seinem Unbewussten nicht möglich ist, allenfalls in unserem geschehen kann. Der Patient wird dann nicht so sehr die symbolische Interpretation erfahren, sondern das Erschaffen des Symbols in uns. Ich erinnere mich an einen Fall, wo der Psychotherapeut es mit einer Patientin zu tun hatte, die in einem Delirium des Todes lebte; sie verschickte per Post ihre Todesanzeige und meinte, sie sei die »Rose von Jericho«, die Wüstenrose, die ihre Blütenblätter dem Wasser öffnet, wenn es regnet, um sie wieder zu schließen in der Dürre. Ein ergreifendes, poetisches Symbol möchten wir sagen; aber die Patientin ging natürlich über das Symbol hinaus, in die konkrete Realität des Bildes; sie verpflichtete ihre Bekannten, ihre neue Adresse anzunehmen, da ja »Renata« nicht mehr existierte, und sie instruierte den Postboten, ihr Briefe auszuhändigen, die ihre Bekannten gemäß ihren Instruktionen an die »Rose von Jericho« adressierten. 97
Sie empfand sich nicht nur als tot, sondern nahm diesen Tod wahr in den Würmern, die sie von innen zerfraßen. Da ihr diese halluzinierten Würmer unerträglich waren, schnitt sie sich jede Woche die Haut auf, um sie aus dem Körper zu entfernen. Im Gespräch mit mir sprach sie von diesen Erlebnissen als von »Halluzinationen«. Sie hatte diesen psychiatrischen Begriff gelernt. Aber sie fügte bei, dass das Wissen um den halluzinatorischen Charakter ihrer Erlebnisse ihr nichts helfen würde, weil die Erlebnisse konkret da seien, ihre Haut zerfraßen, heftiger waren als jeder Versuch, sie mit Interpretationen zu umkreisen. Der Tod musste vor allem als Symbol im Unbewussten des Therapeuten übersetzt werden. Dieser fand sich in einem Traum selbst in der »Todeskammer«, einem engen, dunklen Raum, voll von den Würmern, die die Patientin unter ihrer Haut halluzinierte. In diesem Raum begegnete der Therapeut dem Tod, so wie ihn die Patientin selbst in ihrer Psychose beschrieben hatte, und der Tod sprach ihn an und sagte ihm, dass es für ihn gar keine Möglichkeit der Rettung gäbe, um aus diesem Raum zu entkommen – so wie sich die Patientin ohne Rettung fühlte. Aber das im Unbewussten des Therapeuten übersetzte Symbol ist immer positivierend. In der Tat antwortete der Therapeut dem Tod, dass es die Möglichkeit einer telefonischen Verbindung mit zwei Personen gebe, die draußen auf ihn warteten. Als er mir diesen Traum in der Supervision berichtete, assoziierte der Patient-Therapeut mit diesen zwei Personen seine Patientin selbst, die dadurch in der Umkehrung des Traums die Personifikation des Lebens wurde, und mich, den Supervisor. Die Erzählung des Traums ergriff die Patientin: Das war nicht eine Interpretation, sondern die Verpflanzung des Todesbildes in das Unbewusste des Therapeuten, der ihn im Unterschied zur Patientin als Symbol erlebte – als Symbol seiner Teilnahme am Tod der Patientin. An diesem Punkte kann ich sagen, dass das Symbol im Patienten erschaffen wird durch die identifikatorische Introjektion seinerseits mit dem therapeutischen Unbewussten und seinen Symbolen. Während die logische Wirklichkeit dem Patienten nicht zugänglich ist, nicht von ihm internalisiert werden kann, ist dies möglich für das gelebte Symbol des Therapeuten. Das therapeutische Symbol ist also etwas, das zugleich dem The-
98
rapeuten und dem Patienten gehört und die Identität dieser beiden in einer intermediären positivierenden Zone begründet. Es ist ein Symbol wie »die Rose von Jericho«, ursprünglich ohne Wurzel, aber die, in einer spontanen Zeichnung der Patientin, ihre Wurzeln gefunden hat in der Gegenübertragung, ihre Hand in seiner Hand. Ein weiteres Beispiel von Positivierung: Der Therapeut eines schizophrenen Patienten, der sich vor ihm in seinem Autismus verbirgt, träumt vom Patienten als von einer »Mauer« und von sich als von einem »Samen, der die Mauer durchdringt«. Darauf beschließt der Therapeut, seinen Traum dem Patienten mitzuteilen, und er sagt ihm auch, dass er zufrieden sei, im Traum so das Erleben des anderen zu fühlen. (Hinter oder in dieser Mitteilung stand das Erleben des Therapeuten, nicht nur die steinerne Erstarrung des Patienten wahrzunehmen, sondern auch die Dynamik des Samens, die Dynamik einer Vitalität des anderen, die er in seiner Annäherung an den Patienten introjizierte.) Dieser erwiderte: »Nun ja, ich bin ein Stein, der bearbeitet werden muss. Aber es ist schwierig, diesen Stein zu bearbeiten, der schon unauslöschbar alle Zeichen der Gedanken der anderen trägt.« Nun entwickelten sich im Geist des Therapeuten zwei verschiedene Phantasien und Imaginationen, die er in den folgenden Gesprächen dem Patienten je nach den Schwankungen der Übertragungssituation vorlegte. Dort, wo der Patient sich mit dem Therapeuten identifizierte (bis hin zur Aussage: »Ich bin du«) und daher seine Gegenwart als Schutz erlebte vor jenen, die ihn mit ihren Zeichen durchdrangen, entwickelte der Therapeut sein Bild des Steins, der Erde wird, damit in ihr der Samen wachsen kann. Da, wo hingegen der Patient dazu neigte, den Therapeuten mit den »Leuten« zu identifizieren, die sich in seine Gedanken einmischen und ihn an seiner Individuation behindern, fühlte der Therapeut die Notwendigkeit des Patienten, »Stein« zu sein, schon eine Struktur zu haben; und er sprach daher von einigen Spalten im Stein, die dem Samen erlauben, ihm nahe zu sein. Er verteidigte die Getrenntheit in der Symbiose und schlug die Symbiose in der Getrenntheit vor. Das Modell der Desintegration des symbiotischen Selbst und des separaten Selbst wirkte im Geist 99
des Therapeuten und aktivierte so seine kommunikative Imagination. Das ist die positivierende Funktion des Modells und darin liegt auch seine eigentliche Rechtfertigung – nämlich als Ferment in unserer therapeutischen Sprache zu wirken. Wir können in einem weiten Sinne sagen, dass die Interpretation sich vorwiegend auf die Art bezieht, wie gewisse Symptome oder aktuelle Verhaltensweisen ihre tiefe Bedeutung von der Vergangenheit beziehen, während sich die therapeutische Imagination bemüht, diese Symptome der Zukunft zu öffnen, indem sie in ihnen die Keime einer möglichen Entwicklung sieht. In Wirklichkeit schließen sich die beiden Möglichkeiten des Verstehens gegenseitig nicht aus. Wir beobachten nicht nur, dass sowohl die eine wie die andere Technik abwechselnd gebraucht werden kann in ein und derselben Sitzung; sondern auch, dass das gleiche Symptom auf die eine oder andere Weise angegangen werden kann, je nach dem geistigen Zustand des Patienten und auch je nach der Persönlichkeit und der psychoanalytischen Ausbildung des Therapeuten.
Introjektion und Projektion im Dialog In meiner Erfahrung besteht der tiefste therapeutische Akt darin, die Projektion des Patienten sich vertiefen zu lassen, um daraus die »Erzählstruktur« zu gewinnen, deren er bedarf und »die psychotische Phantasie«, die es uns erlaubt, mit ihm so zu arbeiten, dass wir sie gemeinsam zu einem Gewebe knüpfen können. Ursprünglich scheint der Wahn eine absurde Maske auf das Gesicht jedes Gesprächspartners legen zu wollen; aber im psychotherapeutischen Gespräch verwandelt er sich in etwas, das, wenn auch in psychotischer Sprache, das Suchen, die Sehnsucht, die Angst des Patienten in so ausdrucksstarker, bildreicher, chiffrierter Weise ausdrückt, dass es uns möglich wird, den Wahn zu verstehen. Wenn der Patient beispielsweise erlebt, dass wer immer mit ihm in Beziehung tritt, sterben muss, kann beim Therapeuten das Gefühl entstehen, dass dieses Erleben nicht gänzlich absurd ist. Der Therapeut bleibt zwar im Leben verankert, aber es kann geschehen, dass er sich in einem Traum von seinem Patienten bedroht fühlt. Er partizi100
piert so an dessen »bösem Objekt«, statt ihn in dessen Gewalt allein zu lassen. Wenn das böse Objekt in die Seele eines Therapeuten eingedrungen ist, dessen innere Kohäsion sich gerade aufgrund dieses dualen Akts erhöht, bewirkt dies eine große Erleichterung im Patienten, der fühlt, ohne dass es ihm erklärt werden muss oder kann, dass das böse Objekt in eine Psyche eingetreten ist, die sich mit der seinen identifiziert, sich aber von ihm nicht wie seine eigene spalten lässt. Dadurch wird das böse Objekt für den Therapeuten zu einem gutem Objekt, um es nach und nach, indirekt und spiegelbildlich, auch für den Patienten zu werden. Zuweilen gelingt die Integration des bösen Objekts mit dem guten Objekt, der wahnhaften Vorstellung mit der positivierenden, ohne dass dies durch eine klare Mitteilung ausgedrückt werden muss. Der Patient zeigt es in seinem Verhalten des Ruhigerwerdens, in einem Traum, in einer Zeichnung. Er begreift seine Produktion nicht als Darstellung dessen, was im Inneren des Therapeuten geschehen ist; vielmehr ist es der Therapeut, der wahrnimmt, wie die Integration gleichzeitig in ihm und im Patienten geschehen ist. Während der psychotische Patient einer enormen Anstrengung bedarf (falls er sie leistet!), die Argumente eines Therapeuten zu introjizieren, der versucht, ihn von der Absurdität seiner Wahnidee, oder von deren rationaler Bedeutung zu überzeugen, introjiziert er unbewusst die Synthese, die der Therapeut in sich selbst verwirklicht hat. Das wird verständlich, wenn wir bedenken, dass in der logischen Argumentation eine enorme Asymmetrie zwischen Patient und Therapeut herrscht, während dieser sich umgekehrt in eine Symmetrie mit ihm setzt, indem er Teile des Patienten introjiziert und dadurch an der Entwicklung einer gemeinsamen narrativen Struktur partizipiert. Das Werk der Introjektion setzt sich dann in umgekehrter Richtung fort: Es wirkt nicht mehr nur die Introjektion des Patienten durch den Therapeuten, sondern auch diejenige des Therapeuten durch den Patienten. Die Introjektion auf Seiten des Patienten kann doppelt sein. Einerseits Introjektion des integrativen Introjekts des Therapeuten – 101
in dem Fall werden wir eine größere Toleranz des Patienten gegenüber sich selbst antreffen, gegenüber seinen negativen Seiten. Er hat sie jetzt durch den therapeutischen Akt hindurch als integrierbar erfahren und verurteilt sie deshalb nicht mehr wie vorher zur projektiven Ausstoßung. Oder es wird das positive Bild des Patienten introjiziert, das der Therapeut in sich selbst erschaffen hat. Dieses positive Bild ist für den Patienten noch keine »eigene Möglichkeit«, aber es ist auch nicht einfach die idealisierte Person des Therapeuten, es ist vielmehr, wie ich es nenne, ein »Übergangssubjekt«. Für den Patienten artikuliert sich das Übergangssubjekt als eine Erscheinung des Unbewussten – wie bei meiner Patientin, die an einem gewissen Punkt ihrer Therapie begann, Engel zu malen. Oder umgekehrt, wie im Fall einer Patientin, die eingeladen wurde, ihre Übertragungswut in einer Zeichnung auszudrücken: Sie spiegelte sich in einem Selbstporträt, wo das wütende Gesicht eines Dämonen den Ohrring der Therapeutin trug und dadurch, trotz der heftigen Ablehnung, bildlich mit ihr verbunden war. Die volle Integration des bösen Objekts mit dem positivierenden geschieht meistens erst, nachdem das »Übergangssubjekt« das Ich des Patienten mit seiner Substanz genährt hat. Dann wird die Integration über die noch archaische Gestalt hinausgehen, wo zwei gegensätzliche Hälften zusammengeschweißt sind im Bild des psychotischen Fetisch (als einem halb dämonischen, halb engelhaftem Wesen) und wird vielleicht zu einem Ausdruck der existentiellen menschlichen Tragik – die eine solche Integration darstellt. Bei einer meiner Patientinnen erreichte die Integration die Tiefe des religiösen Bildes: das Gesicht des Barabbas zwischen demjenigen von Christus und Maria. In ihrer Zeichnung, die nur demjenigen als »wahnhaft« erscheinen wird, der sie oberflächlich betrachtet, waren Christus und Barabbas Brüder, weil Söhne der gleichen Maria. In diesem erhabenen Augenblick war sich die Patientin auch des Symbols bewusst.
102
Soziale Psychopathologie und psychotherapeutische Verantwortung
Meine grundlegende These ist die Folgende: Der Mensch, das Subjekt, das in der Psychiatrie als Objekt der Beobachtung und als klinischer Fall untersucht wird, drückt mit seinen Symptomen eine Leidensgeschichte aus, die er zu Beginn nicht mit sich hatte und die er nicht beendigen kann mit sich oder in sich allein. Seine Krankheit, seine psychische Zerrüttung (heute so gerne ausschließlich zurückgeführt auf sein Genom wie früher auf seine psychopathologische Konstitution) entsteht nicht nur aus individuellen, sondern auch aus sozialen Dilemmata. Werden diese nicht aufgelöst, ziehen sie sich manchmal über mehrere Generationen weiter und werden auch kulturell übertragen. Da sie störend und gefährlich sind, werden sie von den Gesunden verdeckt, verdrängt oder auch mystifiziert durch eine Delegation an den einzelnen Kranken, der wegen seiner Disposition und seiner sozialen Rolle ihr Stellvertreter wird. Jedoch wird oft angenommen, dass die Lösung seiner Konflikte und Probleme, seines Betroffenseins und seiner Verwicklungen, seiner Symptome und Paradoxe eine »Behandlung« sei, die »außerhalb« stattfindet und über der die Institution, der Arzt, der Psychologe steht. Aber auf diese Art, in diesem unserem »Sich-außerhalb-Stellen«, wird noch einmal auf jenen, der offensichtlich vom Übel geschlagen ist, der Komplex von verzerrten Beziehungen abgewälzt, die an dessen Ursprung liegen. Diese begründen ja auch die Psychopathologie unserer Gesellschaft – eine Psychopathologie, die vorgibt, gesund zu sein in ihren grausamen Kriegen, Verfolgungen, Korruptionen, in ihren Terrorakten, die sie zu verbergen sucht hinter dem Mantel der Gerechtigkeit, der Freiheit, der Solidarität. Aber in unserer kranken und perversen Gesellschaft geschehen 103
und wiederholen sich jene fatalen Prozesse der Spaltung und des Ausschlusses, der Verdrängung und Projektion, der Pseudorationalisierung und Mystifikation, die sich auf der anderen, der klinischen Ebene, in der nosologischen Psychopathologie des einzelnen Patienten manifestieren. Diese Prozesse, die im Grunde genommen uns alle betreffen, bleiben außerhalb des Bewusstseins, das – nicht nur in der Psychiatrie, sondern in jeder Institution – die Psychopathologie des Einzelnen beschreibt, indem es sie objektiviert. Dadurch wirken jedoch solche Prozesse mit einer fortgesetzten und auch gesteigerten Gewalt weiter. Zahllose Psychotherapiegeschichten zeigen, was mir fünfzig Jahre psychodynamischer Erfahrung klar sagen, dass unsere Patienten mit ihren Symptomen diese universale Psychopathologie erfahren und zum Ausdruck bringen, die die »Gesunden« in ihrer egoistischen Suche nach einer höheren Lebensqualität als schmerzhafte Bewusstwerdung abwehren. Sie wehren sie ab als ein in Anspruch nehmendes Problem, als Anruf des Gewissens und als Aufgabe, die zu lösen ist, als Bereitschaft, sich durch die Verhaltensweisen der »Verrückten« in Frage stellen zu lassen. Jener »Verrückten«, die in früheren Zeiten als Hexen und Hexenmeister verbrannt wurden; oder die dem Gespött jener ausgesetzt wurden, die sich durch die Bezahlung eines Eintrittbillets in den Zoo der Verrückten damit vergnügen konnten, sie zu begaffen wie im barocken Wien. Da müsste das Motto zur Anwendung kommen: »Tua res agitur«! Es ist für mich klar, dass dieser Prozess des Ausschließens, der Verdrängung, der Negativierung, Abspaltung, der Delegation in all den Fällen abläuft, in denen die Gesellschaft – wie vor allem in den vergangenen Jahrhunderten – sich um die kranken Appelle nicht anders kümmerte, als indem sie diese unterdrückte oder bagatellisierte. Aber auch in der heutigen Zeit, wo das öffentliche und bewusste Bemühen vorherrscht, den Kranken durch Rehabilitation in seinen Arbeitsbereich und die eigenen funktionierenden sozialen Strukturen zu reintegrieren, sollte etwas nicht übersehen werden: Ohne ein adäquates Verstehen der psychischen Erfahrungen des Kranken und ohne die Begegnung mit ihm verewigt sich im Bereich der von ihrer psychotherapeutischen Basis losgelösten sozialen Psychiatrie selbst die versteckte Entfremdung. 104
Ich meine: Unsere psychiatrischen Patienten sind nicht nur Opfer ihrer phantasmatischen Erzeugnisse, die so zu ihrem Verfolgungswahn führen; sie sind, in den meisten Fällen, wirklich psychisch Traumatisierte, nicht nur als Erwachsene, sondern auch in ihrer Vergangenheit als Kinder. Jede Familie – auch wenn sie sich engagiert in der Rehabilitation und Kur der eigenen leidenden Glieder – birgt in sich ohne Ausnahme und in jeder Kultur und Gesellschaft unmenschliche Traditionen und Verhaltensweisen und schränkt so die Entwicklungsmöglichkeit ihrer Glieder ein. In dem Maß, wie diese oft verschwiegene Verletzung der Menschenrechte, ohne Übernahme einer gemeinsamen Verantwortlichkeit, zur Bürde eines Einzelnen wird, lastet sie auch auf der ganzen Generation, der ganzen sozialen Schicht. In deren Bewusstsein bleibt zwar das Leiden ihrer Stellvertreter stumm, aber ihr gemeinsames Unbewusstes ist davon durchdrungen und verdunkelt. Darum ist das psychopathologische Leiden des Einzelnen, auch in seinen verzerrten Manifestationen als »Symptome«, ein impliziter Anruf anzuerkennen, dass die Bürde eine gemeinsame ist, die gemeinsam ertragen und damit zu einem Ende getragen werden soll. Dennoch wird seine fundamentale Botschaft nur selten gehört und aufgenommen: Das Leiden wird häufig objektiviert als individuelle Erbbelastung (auch wenn der alte Begriff des »erblichen Defekts« heute euphemistisch ersetzt wird durch passendere Ausdrücke). Wenn jedoch eine solche Situation zu einer Psychotherapie führt, erscheint die »Bürde« in der Form der so genannten Gegenübertragung, die von uns auf Grund dessen, was wir gesagt haben, nicht nur als Projektion verstanden wird (zum Beispiel einer »kastrierenden« elterlichen Gestalt auf den Therapeuten), sondern als implizite Anerkennung der transindividuellen Qualität der Bürde. Das Auf-sich-Nehmen der Bürde nennen wir Teilnahme. Dazu gehören Empathie, Interpretation, Bewusstmachung des Unbewussten, Phänomene der Gegenübertagung, die alle eine Art der Teilnahme sind. Teilnahme bedeutet also nicht nur Verstehen, sondern ein »gemeinsames Tragen«, bedeutet geteiltes Leiden. Aus diesem allem geht die Hoffnung hervor, die nicht nur Erwartung der Heilung meint, sondern auch Übergang der Bürde aus der Wüste und Dunkelheit in das Licht und die Kommunion, aus der 105
Entfremdung des zum Objekt gemachten Leidenden zu seiner Belebung im gemeinsamen Erschaffen von kreativer Entwicklung. Auf diese Weise wird die »Empfangswelt« geschaffen, die in ihrer Tiefe eine Form und ein fundamentaler Modus von »religio« ist. Wir wollen diese Situation nicht einfach idealisieren, auch wenn sie in der Praxis, in ihrer Intention auf jeden Fall ein ideales, jedoch schwer zu erreichendes Ziel ist. Denn mit den Manifestationen seines Schmerzes ruft uns der Patient nicht nur an und lädt uns nicht nur zum Mittragen seiner Bürde ein; er sucht auch in der Begegnung (in jeder therapeutischen Begegnung) die ursprüngliche Entfremdung, deren Opfer er war, zu wiederholen. Er versucht daher seinen Therapeuten mit seinem Verhalten zu zwingen, das Bild seines ursprünglichen Partners zu reproduzieren. Das ist also der projektive Aspekt der Übertragung, der im Grund eine Tendenz ist, die eigene intrapsychische Bürde in das Innere des Therapeuten zu verstoßen. In dieser Situation erkennen wir den verzweifelten Widerstand des Patienten und zugleich die Schwierigkeit des Therapeuten, innerlich neben seinem Patienten zu bleiben, ohne sich verletzt zu fühlen und ohne ihn unbewusst »zum Teufel zu jagen«! Das Eintreten des Psychiaters, der sich als Psychotherapeut versteht, auch außerhalb einer schulorientierten Psychotherapie, in diesen Bereich der gegenseitigen Verweigerung (die ertragen wird von der verbindenden Grundkraft unseres Unbewussten) bedeutet nicht nur Teilnehmen an der psychotischen Psychopathologie, sondern auch an der Einsamkeit, die von den Geistesgesunden hervorgerufen wird rings um denjenigen, der sich hineinbegibt und Verantwortung übernimmt in der »schizophrenen Situation«. Diese Einsamkeit konkretisiert sich in den zahlreichen administrativen Anordnungen, die unsere Arbeit schwierig machen und ebenso in der Entwertung unserer Arbeit von Seiten der akademischen Psychiatrie. Den Wahnbildungen der Patienten stellt Siirala (1983) den »wahnhaften Besitz der Realität« gegenüber, und er meint jene, die die fundamentale dialogische Dimension der Existenz in der Psychose nicht anerkennen. In dieser Situation, in der der Therapeut an der Einsamkeit des Patienten nicht nur durch die Gegenübertragung, sondern in bescheidenem Ausmaß auch in der sozialen Wirklichkeit partizipiert, entsteht noch stärker das Bewusstsein, dass der »Mangel« gerade in 106
seiner Grenze seine positive Möglichkeit in sich trägt – diejenige, mit dem Patienten zusammen durch die therapeutische Begegnung den »verborgenen Schatz im Grab« zu entdecken (wie in der Sprache eines Patienten von Siirala, der sich in einer ägyptischen Pyramide begraben glaubte). Daraus resultiert, wenn es gelingt, viel mehr als die klinische Restitution zum »quo ante«; es resultiert eine Bereicherung in der Erhellung von dem, was sonst für den Patienten und die Gesellschaft verloren wäre. Hier hat sich mein Konzept der »Positivierung« entwickelt: Positivierung verwirklicht sich in der Übernahme der Symbole des Todes in einem Therapeuten, der sie, indem er sie aufnimmt, in sich umwandelt und der so bis in sein Unbewusstes und bis in seine eigenen Träume in den Bereich des Todes, in dem der Patient lebt, hineingeht, neben ihm geht und mit ihm darüber hinausgeht. Diese existentielle Bereicherung geht über das hinaus, was die »Follow up« der Patienten sind, die Katamnesen, die Statistiken der klinischen Verläufe. Gewiss ist das ein wichtiger Aspekt der Psychiatrie. Es ist wichtig nachzuweisen, dass die Krankheitsverläufe günstig beeinflusst werden durch die Erfahrung der therapeutischen Begegnung. Diese Begegnung hat jedoch eine »vertikale Dimension« und nicht nur eine horizontale. Die horizontale Dimension studiert die Verläufe, die Katamnesen, studiert vielleicht die differenzielle Validität der verschiedenen Therapiemethoden: Aber die erstere, die vertikale Dimension, stellt Patient und Therapeut durch das gemeinsame Tragen der Bürde in Beziehung mit jener Transzendenz, die nach Henri Maldiney (mündliche Mittelung) in der Schizophrenie »kollabiert« hat. Zusammenfassung: Wenn wir mit dem psychotischen Patienten zusammenarbeiten, übernehmen wir in uns seine »Todeslandschaften«, um sie in uns für ihn zu verwandeln und mit ihm die entfremdete und entfremdende Bürde wieder zu finden, wie buchstäblich jene Träume zeigen, in denen der Therapeut sich konkret in der Welt des Patienten befindet und diese Welt dadurch in sich wiederholt. Die Besserung (oder die Heilung) des Patienten geschieht nicht nur durch das Annehmen einer psychodynamischen Einsicht (wie 107
wichtig und notwendig diese auch sein mag), sondern auch und vor allem, weil der Patient selbst, seinerseits, in sich die Absicht des Therapeuten übernimmt und in dieser Übernahme eine Nische seiner Identität findet. Aus dieser gegenseitigen Übernahme habe ich mein Konzept des »Übergangssubjekts« entwickelt. Der Welt des »therapeutischen Empfangs« steht die Welt der Entfremdung gegenüber. Sie hat ihre Fundamente in der sozialen Pathologie, die aus verschieden Schichten gebildet ist, unter denen die Beziehung des Kindes mit den Eltern nicht die einzige, wenn auch die erste ist. Die traumatisierenden Schichten sind Teil des Schicksals ganzer Generationen; sie überlagern einander und bestimmen – gemäß der besonderen Empfindsamkeit des Gefäßes – die unterschiedliche Struktur des Syndroms. Der Welt der Entfremdung stellen wir die »Welt des therapeutischen Empfangs« entgegen, wo die traditionellen Konzepte der Übertragung und Gegenübertragung eine Vertiefung erfahren, die über die projektiven Elemente hinausschreitet: In ihrer Gegenseitigkeit entsteht eine neue Wirklichkeit, die nicht nur Objekt der Interpretation ist, sondern Erfahrung einer existentiellen Dualität.
108
Die Psychose des genialen Menschen als Ausdruck und als Zerstörung seiner Kreativität – am Beispiel von Friedrich Nietzsche
In einem Brief an Paul Deussen schreibt Nietzsche 1888 von sich selbst als einem »aus hundert Gründen problematischen Sein« (KSB 1986, Bd. 8, S. 222). In seiner Schrift »Nietzsche contra Wagner« bemerkt er: »Und was mein langes Siechtum angeht, verdanke ich ihm unsäglich viel mehr als meiner Gesundheit [...] Ich verdanke ihm auch meine Philosophie [...] erst der große Schmerz ist der letzte Befreier des Geistes« (Schlechta 1954, Bd. 2, S. 1059). Noch radikaler drückt sich hier der leidende Blaise Pascal aus: »Eine Stunde Schmerzen lehrt uns mehr als alle Philosophien zusammen« (zit. bei Durant o. J., S. 122f.). Aus Nietzsches vielen Bemerkungen dieser Art möchte ich nur noch eine auswählen: »Meine Existenz ist eine fürchterliche Last: ich hätte sie längst von mir geworfen, wenn ich nicht die lehrreichsten Proben und Experimente auf geistig-sittlichem Gebiete [...] machte – diese erkenntnisdurstige Freudigkeit bringt mich auf Höhen, wo ich über alle Marter und alle Hoffnungslosigkeit siege« (an Otto Eisner, Januar 1880, Schlechta 1954, Bd. 3, S. 1162). Um welches Kranksein handelt es sich hier? Wir Ärzte neigen freilich zu medizinischen Diagnosen. Diese können aber, besonders bei Geistesgrößen, grob reduzierend sein, wie sich an dem Psychiater Möbius zeigt, der den Lesern Nietzsches sagte: »Seid misstrauisch, denn dieser Mann ist ein Gehirnkranker« (Möbius 1902, S. 106). Meine Aussführungen sind ein Versuch, von der Psychopathologie Nietzsches zu sprechen, ohne ihm durch irgendwelche Simplifikationen ein Unrecht anzutun – auch wenn ich wegen der Abwesenheit des »Patienten Nietzsche« manches nur hypothetisch rekonstruieren kann. Bei vorsichtiger Diagnosestellung geht es mir um den Versuch, Gegensätzlichkeiten in der Persönlichkeit Nietzsches aufzuzeigen, 109
die in meiner Sicht Krankheitswert haben. Drei davon hebe ich besonders hervor; einer jeden widme ich einen Abschnitt dieses Kapitels. Am Ende werde ich dann noch von meiner unbewussten Rezeption einiger seiner Gedanken sprechen. 1. Die ungeheure Willensstärke Nietzsches steht einer lebenslangen sowohl in der leiblichen Konstitution wie in Erlebnissen der Kindheit wurzelnden »Nervenschwäche« gegenüber. Er strebte ein Leben lang nach der »großen Gesundheit«. Diese – so schrieb er in »Die fröhliche Wissenschaft« – »ist eine solche, welche man nicht nur hat, sondern auch beständig noch erwirbt und erwerben muss, weil man sie immer wieder preisgibt, preisgeben muss!« (Schlechta 1954, Bd. 2, S. 258). Im selben Text lesen wir außerdem die Worte: »Es ist wahr, dass es Menschen gibt, welche beim Herannahen eines großen Schmerzes gerade den entgegengesetzten Kommandoruf hören und welche nie stolzer, kriegerischer und glücklicher dreinschauen, als wenn der Sturm heraufzieht; ja, der Schmerz selber gibt ihnen ihre größten Augenblicke!« (Schlechta 1954, Bd. 2, S. 185f.). Nietzsche klagte über viele Jahre in Briefen an Freunde und Verwandte über Magen-Darm-Leiden, Kopfweh, Erbrechen, Husten, Mattigkeit, grippeartige Zustände, Augenschwäche, Angst, Gallenerbrechen, Anfälle von Migräne; er musste das Bett hüten und spürte oft Ankündigungen eines Zusammenbruchs. Wir verstehen, wenn er in »Götzen-Dämmerung« schreibt: »Die rechte Stelle ist der Leib, die Gebärde, die Diät, die Physiologie, der Rest folgt daraus« (Schlechta 1954, Bd. 2, S. 1023). Als ich mit 18 Jahren das Buch »Also sprach Zarathustra« las, wusste ich von alledem noch nichts. Aber ich ahnte schon, dass die Vision vom »Übermenschen« mit ihrer Ablehnung des »heutigen Menschen«, der eine »Schande« ist, vor allem aus persönlicher tief greifender Erschütterung des Autors hervorgegangen sein musste. Geistesgeschichtliche oder lebensgeschichtliche Erschütterung? Ich erinnere mich an ein Gespräch mit deutschen Studenten, die 1942 ihren Militärdienst auf Sizilien machten und die sich in ihrer Ideologie auf die Worte Nietzsches beriefen: »Die Schwachen und Missratenen sollen zugrunde gehen: erster Satz unserer Menschenliebe. Und man soll ihnen dazu helfen. Was ist schädlicher als irgendein Laster? – Das Mitleiden der Tat mit allen Mißratenen und Schwachen« (»Der Antichrist«, Schlechta 1954, Bd. 2, S. 1166). Ich 110
erwiderte, dass Nietzsche auch geschrieben habe: »Wahrlich, eine schmutziger Strom ist der Mensch« (»Zarathustras Vorrede«, Schlechta 1954, Bd. 2, S. 280). Und dieser Schmutz müsse überwunden werden. Gehört aber nicht die Ausrottung der Schwachen auch zu solchem Schmutz? Dürfen wir nicht vermuten, dass Nietzsche unbewusst die eigene Schwäche verabscheute, verdrängte, abspaltete, auf die Schwachen projizierte und in ihnen eine eigene Seite zugrunde gehen ließ? – Meine Gesprächspartner schwiegen; sie wurden nachdenklich. Damals kannte ich noch nicht den Satz Nietzsches aus der allerletzten Zeit seiner Produktivität, der meine Ahnung indirekt bestätigen sollte: » [...] ich möchte durchaus nicht als Prophet, Untier und Moral-Scheusal vor die Menschen hintreten« (1888 an Peter Gast, Schlechta 1954, Bd. 3, S. 1328). Was war nun der Grund der »Nervenschwäche«, unter der Nietzsche ein Leben lang litt? Seine vielfältigen Symptome scheinen mir zwischen zwei verschiedenen ätiopathogenetischen Polen eingespannt. Einerseits spielt der psychogenetische Pol, aus dem Neurosen und psychosomatische Leiden stammen und der in psychoanalytischer Sicht im Erleben der Kindheit und der früheren Jugendzeit wurzelt, eine Rolle; anderseits muss der somatische Pol bei Nietzsche, die luetische Hirnerkrankung, deren jahrelange neurasthenische Symptomatik der älteren Psychiatrie sehr bekannt war, mit betrachtet werden. Ich möchte freilich nicht ausschließen, dass ein grundlegender Faktor des somatischen Leidens Nietzsches schon früh in einer Lues Cerebri liegen könnte, die (als so genannte 2. Phase) der primären syphilitischen Infektion folgte; wurde doch die chronische »Augenschwäche« Nietzsches von Augenarzt Vulpius rückblickend auf eine chronische Uveitis zurückgeführt und diese als Indiz für die Lues gedeutet. Es ist ferner möglich, dass die während der Schulzeit in Pforta auftretenden, als »rheumatisch« bezeichneten Beschwerden später in jene rheumatoiden Beschwerden des Sommers 1865 übergingen, die im Zusammenhang mit der venerischen Infektion gedeutet wurden. Man vergleiche zu diesem ganzen Komplex die ausführliche Untersuchung von Pia Daniela Volz »Nietzsche im Labyrinth seiner Krankheit«. Mit solchen Vermutungen möchte ich die Frage berühren, inwie111
weit leibliche pathologische Vorgänge in den Dienst der Lebensgeschichte treten und unter besonderen Umständen die Kreativität eines genial veranlagten Menschen, der sie psychisch bewältigt, sogar steigern können. Der körperliche Schmerz, den man im unbewussten Zusammenhang mit lebensgeschichtlichen Verlusten erleidet, ist oft ein Maß für die Lebenshoffnung, die man vorher gehabt hat. Man denke etwa an die Worte Nietzsches aus »Morgenröte«: »Der Schwerleidende sieht aus seinem Zustand mit einer entsetzlichen Kälte hinaus auf die Dinge: alle jene kleinen lügnerischen Zaubereien, in denen für gewöhnlich die Dinge schwimmen, wenn das Auge des Gesunden auf sie blickt, sind ihm verschwunden« (Schlechta 1954, Bd. 1, S. 1088). Sogar die tertiäre Phase der Syphilis, die dann das cerebrale Parenchyma angreift und die progressive Paralyse verursacht, kann im Anfang als Herausforderung erlebt werden. Es ist interessant, dass zur selben Zeit, als die durch sie bedingte manische Stimmung sowohl die Selbstwahrnehmung der somatischen Beschwerden aufhob als auch die Illusion der Gesundheit schenkte, eine Epoche der großen Schaffenskraft bei Nietzsche begann – nicht weniger als sechs Schriften wurden in einem halben Jahr entworfen. Noch konnte Nietzsche in einem Brief vom 4. Januar 1888 an Jacob Burckhardt, unmittelbar vor dem Zusammenbruch, »vom goldenen Gleichgewicht aller Dinge« schreiben! (Schlechta 1954, Bd. 3, S. 1350). In welcher Zeit die Symptome der einen Phase in die der anderen übergingen, lässt sich in Abwesenheit des Patienten kaum rekonstruieren. Letzten Endes scheint das ganze Schicksal wie aus einem Guss zum Wesen Nietzsches zu gehören, subsumiert unter dem Wort: »Der Kampf mit dem Dämon« – wie Stefan Zweig es formulierte. Es gibt freilich die vierbändige Studie von Hermann Josef Schmidt über die Kindheit Nietzsches, so dass wir über die Fakten gut informiert sind. Doch was aus dieser Zeit besitzt für uns eine solche psychoanalytische Relevanz, dass wir daraus Erscheinungen des Erwachsenenalters ableiten könnten? Mich hat vor allem folgender Befund beeindruckt: Als Erwachsener registrierte Nietzsche in seinen hinterlassenen Notizen einen »Verlust der Kindheit« im Alter von nur sieben Jahren. Weniger der mögliche, mir unbekannte Anlass zu dieser Äußerung als vielmehr das erschreckende Wort von 112
Nietzsche beeindruckt mich: »In einer absurd frühen Zeit, mit sieben Jahren, wusste ich bereits, dass mich nie ein menschliches Wort erreichen würde« (»Ecce homo«, Schlechta 1954, Bd. 2, S. 1098). Wie sollen wir das verstehen? Aus der Biographie erfahren wir, dass das Kind in einer innigen Verbundenheit mit seiner Familie, besonders mit seiner Mutter, aufgewachsen war. Merkwürdig klingt deshalb der Satz des erwachsenen Nietzsche: »Wenn ich den tiefsten Gegenpol zu mir suche, finde ich diesen in meiner Mutter« (KSA 1980, Bd. 6, S. 268). Es gibt nun manche Episoden in der Kindheit Nietzsches, die zeigen, wie außerordentlich groß sein Streben nach Selbständigkeit, Mut und starkem Willen war. Hätte sich eine solche Persönlichkeit in der Obhut von schützenden und verfügbaren Liebesobjekten wie Mutter und Schwester so entwickeln können, dass eine alles niederreißende, umwertende Philosophie wie die Nietzsches möglich geworden wäre? Bedeutet der »Verlust der Kindheit« den ersten radikalen Riss in der Mutterbeziehung, ausgelöst wahrscheinlich durch irgendeinen lebensgeschichtlichen Anlass, aber vollzogen in der unbewussten Ahnung, dass die Familienkonstellation hemmend war? Nietzsche muss sich in seiner Familie unfrei gefühlt haben, denn 1883 schrieb er an Overbeck: »Ich mag meine Mutter nicht, und die Stimme meiner Schwester zu hören, macht mir Missvergnügen; ich bin immer krank gewesen, wenn ich mit ihnen zusammen war« (Schlechta 1954, Bd. 3, S. 1373). Schon 1866, mit 22 Jahren, setzte er dem Familienbild sein Ideal entgegen: »Wie anders der Blitz, der Sturm, der Hagel, freie Mächte, ohne Ethik! Wie glücklich, wie kräftig sind sie, reiner Wille, ohne Trübungen durch den Intellekt!« (Schlechta 1954, Bd. 3, S. 962; Janz 1978, Bd. 1, S. 98); so eine briefliche Äußerung Carl v. Gersdorff gegenüber. Und wie stand es mit dem Verhältnis zum Vater? Zu meiner jugendlichen Nietzsche-Rezeption gehört es, dass ich zur gleichen Zeit sowohl das Buch »Totem und Tabu« las, in dem Freud den Mord des später zum Gott erhobenen Urvaters durch seine Nachkommen phantasiert, als auch, in einer italienischen Nietzscheanthologie, die berühmten Verse Nietzsches: »Wohin ist Gott? Ich will es euch sagen! Wir haben ihn getötet! Ihr und ich! Wir alle sind seine Mörder! – Hören wir noch nichts vom Lärm der Totengräber, welche Gott begraben? Riechen wir noch nichts von der göttlichen Verwesung? – 113
auch Götter verwesen! Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn getötet! Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß, ist unter unseren Messern verblutet, – wer wischt das Blut von uns ab? Mit welchem Wasser könnten wir uns reinigen?« (zit. bei Lou Andreas-Salomé 1894/1983, S. 66). Ich fragte mich: Lag hier eine zu große ödipale Abhängigkeit von der Mutter vor, die das Kind den Mord des (kastrierenden) Vaters phantasieren ließ? Bedeutete dem Kind der tatsächliche frühe Tod des Vaters eine Art Verifizierung seiner Phantasie, da Kinder oft magisch an die Allmacht der Gedanken glauben? Reagierte Nietzsche später auf die ins Unbewusste verdrängte Phantasie sowohl mit der Qual des schlechten Gewissens als auch mit dem Trotz der Auflehnung, die schon den Zwölfjährigen philosophieren ließ, Gott habe sich denkend den Teufel erschaffen? Könnte man den berühmten Traum (vgl. Schlechta 1954, Bd. 3, S. 17), den Nietzsche als Kind hatte und in dem der Vater dem Grab im Sterbekleid entsteigt, in die Kirche eilt und dann mit einem kleinen Kind auf dem Arm in das Grab zurücksteigt, und den er als Voraussage des baldigen Todes seines Brüderchens auslegte, nicht auch auf der Subjektstufe deuten? Das Traumkind wäre dann Nietzsche selbst, der später, als Erwachsener, immer wieder vor einem geahnten eigenen Untergang stand, im gemeinsamen Tod mit dem abwesenden Vater verbunden? – Nun, ich habe später als Psychoanalytiker gelernt, auf die Analyse abwesender Patienten zu verzichten. Nur im Zusammenhang mit der Darstellung meiner jugendlichen Nietzsche-Rezeption erwähne ich diese Überlegungen. Unabhängig davon bin ich mit psychoanalytischen Reduktionen philosophischer Gedanken und Anschauungen vorsichtig. Es gehört zur »Würde« einer »denkenden Gegenwart«, dass man sie nicht nur als Folge einer »komplexen Vergangenheit« deutet. Die Erfahrung einer tiefen Einsamkeit schon als Kind ist sehr wahrscheinlich und dürfte den Grundstein zu jener später im Erwachsenenleben sowohl erlittenen als auch bejahten Einsamkeit gelegt haben, von der viele Schriften Nietzsches Kunde geben. 1886 schreib Nietzsche an Overbeck: »Wenn ich dir einen Begriff meines Gefühls von Einsamkeit geben könnte! Unter den Lebenden so wenig als unter den Toten habe ich jemanden, mit dem ich mich 114
verwandt fühlte. Dies ist unbeschreiblich schauerlich (Brief vom 5.8.1886, Schlechta 1954, Bd. 2, S. 1242). 1874 schrieb er an Gersdorff: »Könntest Du wissen, wie verzagt und melancholisch ich im Grunde von mir selbst, als produzierendem Wesen denke.« Und 1886: »Ich habe jetzt 43 Jahre hinter mir und bin genau so allein wie ich es als Kind gewesen bin.« Und im gleichen Jahre schrieb Rohde an Overbeck, nach einem Wiedersehen mit Nietzsche: »[...] eine unbeschreibliche Atmosphäre der Fremdheit, etwas mir damals völlig Unheimliches, umgab ihn[...] als käme er aus einem Lande, wo sonst niemand wohnt.« Diese Einsamkeit mag auch jenen depressiven Kern der Persönlichkeit gestiftet haben, mit dem Nietzsche lebenslang im Kampf lag und den er immer wieder durch hypomanische Bilder der »großen Gesundheit« und des »jauchzenden Übermuts« kompensierte. Der »Verlust der Kindheit«, der freiwillige und unfreiwillige Verzicht auf Liebesobjekte bedeutete zugleich ein Verzicht auf Geliebtwerden – eine Armut, die als Reichtum rationalisiert wurde: »O Zarathustra! [...] Aber wer sollte dich auch lieben, du Überreicher?« (DionysiosDithiramben, Schlechta 1954, Bd. 2, S. 1266f.). Welche Einsamkeit tönt in den Worten, mit denen Nietzsche sein »Nachtlied« kommentiert: »Auf einer loggia hoch über der genannten piazza, von der aus man Rom übersieht und tief unten die fontana rauschen hört, wurde jenes einsamste Lied gedichtet, das je gedichtet worden ist, das Nachtlied; um diese Zeit ging immer eine Melodie von unsäglicher Schwermut um mich herum, deren Refrain ich in den Worten wiederfand: »Tot vor Unsterblichkeit« (»Ecce homo«, Schlechta 1954, Bd. 2, S. 1133). Diese Selbstprophetie ging buchstäblich in Erfüllung. Während seines zehnjährigen Siechtums im Verlauf der progressiven Paralyse sagte Nietzsche mehrmals: »Ich bin tot.« Hermann Bahre, der ihn 1895 besuchte, schilderte, wie Nietzsche »den ganzen Tag nur immer leise vor sich hin weinte [...] kaum ein Wort sagte, wimmerte nur und stöhnte aus tiefer Qual«. Bahr schloss seine Schilderung mit den Worten: »Er ist tot« (Volz 1990). Bei Nietzsche dehnt sich die Spannung zwischen zwei Polen, die am Ende zusammenfallen: Unausweichlichkeit des eigenen Untergangs durch Kranksein und die Mittäterschaft an ihm. Einerseits wird das drohende Schicksal tapfer erlitten, aber nicht geradezu ge115
wollt: eine Alternative zu ihm ist in der Hoffnung möglich. Man denke an die erschütternden Worte, die Nietzsche am Schluss von »Morgenröte« schrieb: »Warum doch gerade in dieser Richtung, dorthin, wo bisher alle Sonnen der Menschheit untergegangen sind? Wird man vielleicht uns einstmals nachsagen, dass auch wir, nach Westen steuernd, ein Indien zu erreichen hofften, – dass aber unser Los war, an der Unendlichkeit zu scheitern? Oder, meine Brüder? Oder?« (Schlechta 1954, Bd. 1, S. 1279). Anderseits: Beim Bewusstwerden, dass es kein »Oder« gibt, wird der unausweichliche Untergang nicht nur bejaht, sondern geradezu gefordert, wie in »Zarathustra«: »Verbrennen musst du dich wollen, in der eigenen Flamme; wie wolltest du neu werden, wenn du nicht erst Asche geworden bist!« (Schlechta 1954, Bd. 2, S. 327). Oder etwas anders: »Gewisse Menschen haben nämlich ein so hohes Bedürfnis, ihre Gewalt und Herrschaft auszuüben, dass sie [...] endlich darauf verfallen, gewisse Teile ihres eigenen Wesens [...] zu tyrannisieren« (Schlechta 1954, Bd. 1, S. 536). Und dasselbe mit anderen Worten: »[...] der Mensch hat eine wahre Wollust darin, sich durch übertriebene Ansprüche zu vergewaltigen und dieses tyrannisch fordernde etwas in seiner Stelle nachher zu vergöttern« (Schlechta 1954, Bd. 1, S. 537). Nietzsche scheint mir hier von einem Selbstverwundungstrieb ergriffen, der mich an meine masochistischen Patienten erinnert: Das vorausgenommene Scheitern wird dann in einem exaltierten Leidenwollen zur Selbstheroisierung, Selbstübersteigerung und Selbstidealisierung, bis hin zu Eitelkeit und zum Größenwahn, wo Schmerz und Wonne ununterschieden ineinander fließen. Vergleiche zu diesem Aspekt auch den Philosophen Giordano Bruno: »Aus Liebe zur echten Wahrheit und aus Eifer zu wahrer Betrachtung ermüde, quäle und kreuzige ich mich« (Durant o. J., Bd. 22, S. 323). Lou Andreas-Salomé sieht Nietzsche »in seinen leidvollen Erkenntnissen seinem Haupt die Dornenkrone flechten« (Andreas-Salomé 1894/1983, S. 181), und sie hört »den Schrei nach Erlösung von sich selbst, – nach einem Wesensgegensatz, nach vollständiger und endgültiger Verwandlung, Umwandlung« (S. 177). Ferner lesen wir bei ihr ein Beispiel dafür, wie das Grauenhafte bei Nietzsche zu seinem Gegensatz werden kann. Einmal wurde die Wiederkunfts-Idee 116
– eine Vorstellung, die er plante, naturwissenschaftlich zu untersuchen – für den schwer Leidenden eine Befürchtung [...] nur mit leiser Stimme und mit allen Zeichen des tiefsten Entsetzens sprach er davon« (S. 255) und etwas weiter: »[...] in dem Augenblick, wie eine bange Vermutung unbeweisbar und unhaltbar wird, erhärtet sie sich ihm, wie durch einen Zauberspruch, zu einer unwiderleglichen Überzeugung« (S. 257), die ihm gestattet, sie heroisch als die höchste Bejahung des Lebens zu wollen. 2. Die zweite Gegensätzlichkeit: Leidenschaftlicher, lebenslanger Einsatz für die Zukunft des Menschen gegenüber einer schmerzlichen Grenze des Lieben-könnens. Es geht hier um zwei Pole seines Bewusstseins, die auf eine unbewusste Ambivalenz hinzuweisen scheinen. Lassen wir Nietzsche selbst sprechen. Zuerst gebe ich einen Satz wieder, den ich dem Nachlass entnehme: »Eine volle und mächtige Seele wird nicht nur mit schmerzhaften, selbst furchtbaren Verlusten, Entbehrungen, Beraubungen, Verachtungen fertig: sie kommt aus solchen Höllen mit größerer Fülle und Mächtigkeit heraus: und, um das Wesentliche zu sagen, mit einem neuen Wachstum in der Seligkeit der Liebe.« Und er erwähnt in diesem Zusammenhang Dante, der »über die Pforten seines Inferno schrieb: auch mich schuf die ewige Liebe« (Schlechta 1954, Bd. 3, S. 893). Aber er kehrt dann in einer destruktiven Weise das danteske Wort wie folgt um: »[...] über dem Tore des christlichen Paradieses und seiner ›ewigen Seligkeit‹ würde jedenfalls mit besserem Rechte die Inschrift stehen dürfen ›auch mich schuf der ewige Hass‹ « (»Zur Genealogie der Moral«, Schlechta 1954, Bd. 2, S. 793). Und in »Zarathustra« sagt Nietzsche: »Diesen Menschen von heute will ich nicht Licht sein, nicht Licht heißen. Die – will ich blenden. Blitz meiner Weisheit! Stich ihnen die Augen aus!« (Schlechta 1954, Bd. 2, S. 525). Wie sehr Nietzsche unter seinem Hass gelitten hat, zeigen die Worte an Emma Guerreri-Gonzague aus dem Jahre 1874: »Inzwischen muss ich erst alles Polemische, Verneinende, Hassende, Quälende aus mir herausziehen« (Safranski 2000, S. 378). Doch es gelang ihm nicht. Gegen Ende seines Schaffens, im Jahr 1888 wurde der »polemische Ton seiner Schriften schärfer und aggressiver als je zuvor, nahezu alle noch bestehenden Freundschaften wurden abgebrochen« (Volz 1990, S. 303). Wie sollen wir diesen Gegensatz verstehen? 117
Das Denken Nietzsches ist nicht selten widerspruchsvoll; es ist nicht systematisch, sondern leidenschaftlichen Gefühlsregungen folgend. Hier geht es aber um einen grundsätzlichen Gegensatz, der aus der psychologischen Ambivalenz Nietzsches dem Menschen gegenüber stammt. Die verzehrende Sorge um das Menschsein, in die er sich ganz hineinnehmen ließ, ist auch Auflehnung gegen den »schmutzigen Strom« im Menschen, der seinen »Ekel« erregt. Die Auflehnung ist Vorstufe der »großen Gesundheit«, aber »der Ekel am Menschen ist meine Gefahr« (»Ecce homo«, Schlechta 1954, Bd. 2, S. 1156). Hören wir Nietzsche selbst zu diesem Spannungsverhältnis: »Leben wir nahe mit einem Menschen zusammen, so geht es uns so, wie wenn wir einen guten Kupferstich immer wieder mit bloßen Händen anfassen; eines Tages haben wir schlechtes, beschmutztes Papier und nichts weiter in den Händen« (»Menschliches, Allzumenschliches«, Schlechta 1954, Bd. 1, S. 659f.). In »Ecce homo« lesen wir außerdem: »Mir eignet eine vollkommen unheimliche Reizbarkeit des Reinlichkeits-Instinktes, so dass ich die Nähe oder – was sage ich? – das Innerliche, die ›Eingeweide‹ jeder Seele physiologisch wahrnehme – rieche [...] Ich habe an dieser Reizbarkeit psychologische Fühlhörner, mit denen ich jedes Geheimnis betaste und in die Hand bekomme; der viele verborgene Schmutz auf dem Grunde mancher Natur, vielleicht in schlechtem Blut bedingt, aber durch Erziehung übertüncht, wird mir fast bei der ersten Berührung schon bewusst« (Schlechta 1954, Bd. 2, S. 1080). – Wie kann man also lieben – so frage ich mich –, wenn diese Erfahrungen sich wiederholen, und zwar nicht bloß im Umgang mit dem »Pöbel«, sondern im alltäglichen Verkehr mit den Menschen? So hören wir nachdenklich die Klage Zarathustras: »[...] durch die Überfülle von Licht und Macht [...] verurteilt zu sein, nicht zu lieben« (Schlechta 1954, Bd. 2, S. 1136). Und im »Nachtlied« heißt es: »Meine Hand wurde zu hart für das Zittern gefüllter Hände« und »mein Glück im Schenken starb im Schenken« (Schlechta 1954, Bd. 2, S. 363). Dass die Überfülle an Licht liebesunfähig macht, ist nicht nachvollziehbar – sowohl die Menschheitsgeschichte als auch die bescheidene eigene Erfahrung sprechen dagegen. Die Erklärung liegt tiefer: »Weh tun möchte ich denen, welchen ich leuchte; berauben möchte ich meine Beschenkten – also hungere ich nach Bosheit« (»Zarathustra«, Schlechta 1954, 118
Bd. 2, S. 363). Und dieser »Hunger nach Bosheit« schafft die Wüste: »Ach, Eis ist um mich, meine Hand verbrennt sich am Eisigen!« (»Zarathustra«, Schlechta 1954, Bd. 2, S. 364). Es scheint also, dass das Streben nach dem Übermenschen auch aus einer allzu starken Menschenverachtung stammt. »Ist eure Seele nicht Armut und Schmutz und ein erbärmliches Behagen?« ruft Zarathustra (Schlechta 1954, Bd. 2, S. 280). Diese Menschenverachtung vermag zwar durch die prophetische Ahnung des kommenden großen Krieges – in »Ecce homo« – gerechtfertigt sein, sie fällt aber durch ihre Intensität, zum Beispiel durch die Verurteilung der Schwachen, derselben Destruktivität zum Opfer, die sie überwinden möchte. Nun stellt sich die Frage, ob das alles aus dem »Ekel« stammt, der, so Nietzsche, »meine Gefahr ist«. Eine andere Wurzel der Krankheit scheint mir in einem Erleben zu gründen, das ich nur bei meinen Schwerkranken wahrnehme: in der Verfolgungsangst. In »Morgenröte« lesen wir die bedeutungsvollen Sätze: »Nach einiger Zeit ist mir dann immer (Hervorhebung G. B.) als wolle man mich aus mir verbannen und mir die Seele rauben – und ich werde böse auf jedermann und ich fürchte jedermann. Die Wüste tut mir dann Not, um wieder gut zu werden« (Schlechta 1954, Bd. 1, S. 1244f.). – Die Einsamkeit also nicht nur als Not und Entbehrung, wie wir oben erkannten, sondern auch als Refugium, wie wir jetzt erkennen. Nietzsche leidet aber unter keinem Wahn. Er ist einsichtig genug, um zu erkennen, dass die bösen Einflüsse, die angeblich von außen kommen, im Innern angesiedelt sind; daher seine Klage: »Das Sichwälzen in Selbstverachtung und Zerknirschung ist eine Krankheit mehr, aus der nimmermehr das ›Heil der Seele‹ [...] entstehen kann« (»Nachlass«, Schlechta 1954, Bd. 3, S. 725). Für diese Krankheit hat Nietzsche einen alle solchen Zustände umgreifenden Namen gefunden: »das schlechte Gewissen«. Zwar glaubt er, eine allgemein menschliche Situation zu schildern; aber diese anthropologische Situation ist der Spiegel, in dem er sich immer wieder erkennt. »[...] der ›Gewissensbiss‹ als solcher ist ein Hindernis der Genesung, – man muss alles aufwiegen durch neue Handlungen, um möglichst schnell dem Siechtum der Selbsttortur zu entgehen« (»Nachlass«, Schlechta 1954, Bd. 3, S. 725). Oder wir lesen an anderer Stelle: »Zudem ist es ein quälerisches, gefährliches Beginnen, sich 119
selbst derartig anzugraben und in den Schacht seines Wesens auf dem nächsten Wege gewaltsam hinabzusteigen. Wie leicht beschädigt er sich dabei so, dass kein Arzt ihn heilen kann« (»Unzeitgemäße Betrachtungen«, Schlechta 1954, Bd. 1, S. 289). Und noch ein drittes Beispiel: »[...] dieser Narr, dieser sehnsüchtige und verzweifelte Gefangene wurde der Erfinder des ›schlechten Gewissens‹. Mit ihm war aber die größte und unheimlichste Erkrankung eingeleitet, von welcher die Menschheit bis heute nicht genesen ist, das Leiden des Menschen am Menschen, an sich« (»Zur Genealogie der Moral«, Schlechta, Bd. 2, S. 825f.). Nietzsche selbst aber, trotz aller Auflehnung, trotz allem Willen zur Macht, war ein solcher »Gefangener«. Hören wir Schoeps (1960), der von einer »vollständigen Kontrastideologie« bei Nietzsche spricht: »Der schonungslose Bekämpfer jeder absolut geltenden Moral, insonderheit aller Mitleidsmoral, ist ein Mensch der peinlichst korrekten, praktischen Moral, von überempfindlicher Rücksicht und Mitleidigkeit in jeder konkreten Lebenssituation.« Und zur weiteren Veranschaulichung zitiert er Harald Landrys Ausführungen über Nietzsche: »Der Entdecker und Verkünder des Wertes ungebrochenen, rauschhaften dionysischen Lebens ist ein Mann, der jedem wirklichen Erlebnis in dem repräsentativsten, geladensten, paradoxesten Lebensbereich: dem des geschlechtlichen Eros, aus dem Wege ging« (Harald Landrys, »Nietzsche«, Berlin 1931, zit. bei Schoeps 1954, S. 114). Das unterdrückende Über-Ich Nietzsches schuf im Gegensatz zu sich selbst den Übermenschen und damit die eschatologische Hoffnung. »Dieser Mensch der Zukunft [...], der der Erde ihr Ziel und dem Menschen seine Hoffnung zurückgibt, dieser Antichrist und Antinihilist, dieser Besieger Gottes und des Nichts, er muss einst kommen« (»Zur Genealogie der Moral«, Schlechta 1954, Bd. 2, S. 837). Die ungeheure Spannung zwischen dieser kühnen, fast messianischen Hoffnung und dem tragisch richtigen prophetischen Wort »tot vor Unsterblichkeit« ließen mich in meinen jungen Jahren die schmerzliche Gegensätzlichkeit der Existenz Nietzsches wahrnehmen, die ich später, auf anderen Ebenen, bei so vielen Menschen fand; sie weckte mein erstes Interesse für die Psychiatrie. 3. Die dritte Gegensätzlichkeit in meiner Rezeption Nietzsches 120
heißt: Redliche, leidenschaftliche Suche nach Wahrheit neben narzisstischer Selbstbezogenheit im Entwurf der Wahrheit. Einerseits opferte sich Nietzsche der Wahrheit als einer Idealmacht, indem er sich selbst dauernd in Frage stellte, »auf Leben und Tod dachte«, unerbittlich in sich grub, auf die Gefahr hin, dass die »dunklen Männer« seines Unbewussten Recht bekommen würden, dass in der Tiefe nur Hölle, keine Quelle gefunden werde. Ausgedrückt wird dieses Risiko in dem Vierzeiler: Unverzagt Wo du stehst, grab tief hinein! Drunten ist die Quelle! Lass die dunklen Männer schrein: »Stets ist drunten Hölle!« (Schlechta 1954, Bd. 2, S. 17)
Und Nietzsche fragt sich bang: »Wann finde ich die Stärke, dich graben zu hören und nicht mehr zu zittern?« (»Zarathustra«, Schlechta 1954, Bd. 2, S. 413). Kennzeichnend für die gegen sich Selbst unerbittliche Wahrheitsliebe Nietzsches sind zum Beispiel seine Worte aus der »Morgenröte« (S. 370): »Nie etwas zurückhalten oder Dir verschweigen, was gegen Deine Gedanken gedacht werden kann. Gelobe es Dir! Es gehört zur ersten Redlichkeit des Denkens. Du musst jeden Tag auch Deinen Feldzug gegen Dich selber führen – ein Sieg und eine eroberte Schanze sind nicht mehr Deine Angelegenheit, sondern die der Wahrheit.« Anderseits wird sein Urteil, wie Lou Andreas-Salomé treffend sagt, immer wieder »zum Weltgesetz dekretiert, zu einem Befehl an die ganze Menschheit« (Andreas-Salomé 1983, S. 175) und sie formuliert noch pointierter: »Ich, Nietzsche-Zarathustra, bin die Welt, sie ist, weil ich bin, sie ist, wie ich will« (S. 198). Und Nietzsche selbst fragt in »Jenseits von Gut und Böse«: »Warum durfte die Welt, die uns angeht, nicht eine Fiktion sein und durch einen Gewaltakt umzuschaffen sein.« Und in »Die fröhliche Wissenschaft« stellt er fest: »[...] ich kann aus den Dingen nichts anderes herausnehmen, als was mir schon gehört« (Schlechta 1954, Bd. 2, S. 155). So kommt Lou Andreas-Salomé schließlich zu dem Resümee: »Mit gewaltiger Hand hat er das, was ihn erwartete, hereingezwungen in den Plan des Ganzen« (1983, S. 289). Jede Philosophie, wie schon Nietzsche erkannte, hat eine subjekti121
ve Dimension, wo die Wahrheit – in meiner psychotherapeutischen Formulierung – ein »Übergangssubjekt« ist, das heißt: Sie entsteht in der Begegnung der eigenen Existenz mit derjenigen anderer. Die Existenz Nietzsches ist paradoxerweise sowohl offen auf das leidvolle Schicksal des Menschen hin, als auch gefangen im eigenen Leiden. Diese Gegensätzlichkeit sprengt seinen Geist. Wenn Lou AndreasSalomé schreibt: »Die Menschheit musste von ihm aufgefasst werden als eine an sich selbst leidende, an ihrer eigenen Entwicklung hoffnungslos krankende Zwittergattung, deren Daseinsberechtigung gar nicht in ihr selbst, sondern in einer schlechthin anderen, höheren Übermenschen-Gattung liege, zu der sie nur eine Brücke bilden solle« (1983, S. 278), so darf man dieses Bild nicht als bloße Projektion abtun. Es gibt Millionen leidender Menschen auf dieser Erde. Die Sorgen Nietzsches um sie alle ist spürbar in einem seiner letzten Briefe, in dem an Carl Fuchs vom 27. Dezember 1888: »Man soll sich fürderhin nie um mich bekümmern, sondern um die Dinge, derentwegen ich da bin« (Schlechta 1954, Bd. 3, S. 1346). Man darf aber dennoch fragen: Inwieweit schwankt die eschatologische Hoffnung Nietzsches zwischen Selbsttäuschung und Wahnsinn? Die Selbsttäuschung ist Lou Andreas-Salomé im Gespräch mit Nietzsche immer wieder erschütternd aufgefallen. »Oft aber, während man seinen Reden [...] zuhört, empfindet man ein Grauen, dass er als Gegenstand der Anbetung hinstellt, was in Wahrheit auch für ihn nicht vorhanden ist« (1983, S. 179). Der Wahnsinn als eine mögliche Quelle der Erkenntnis interessierte Nietzsche sehr. Und das Urteil Gottfried Kellers, der 1884 von Nietzsche besucht wurde: »Ich glaube, dä Kerl ischt verruckt« (zit. bei Safranski 2000, S. 384) lässt mich Nietzsche im Bund mit jenen meiner visionären Patienten sehen, die auf Leben und Tod philosophieren. Der tragische Wahnsinn aber – den ich freilich von der paralytischen terminalen Demenz unterscheide – liegt für mich in dem Widerspruch, dass ein Mann, der schreiben kann: »Zu Bett. Heftigster Anfall. Ich verachte das Leben« (zit. bei Lou Andreas-Salomé 1983, S. 256) gerade aus der Vergötterung des Lebens das Heil erwartet. Ich habe im Vorhergehenden drei wesentliche Gegensätzlichkeiten im Erleben und Denken Nietzsches geschildert, aber ich könnte noch weitere ausführlich beschreiben (wären mir nicht Grenzen ge122
setzt). Beispielsweise wird die Maske als »Lüge« in der Entlarvungspsychologie durchschaut, aber auch als Refugium und Sehnsucht des »Wanderers« Nietzsche erbeten wie in Sätzen: »Eine Maske mehr! Eine zweite Maske!« (Schlechta 1954, Bd. 2, S. 747) oder. »Jeder tiefe Geist braucht eine Maske« (Schlechta 1954, Bd. 2. S. 604). Darf ich am Schluss fragen: Was wäre aus Nietzsche geworden, wenn er sich nicht mit Syphilis angesteckt hätte? Wäre er durch die Spannungen solcher Gegensätzlichkeiten zerrissen worden, oder hätte die Stärke seiner Persönlichkeit, die mit seiner Schwäche eigenartig kontrastierte und wiederum einen Gegensatz zu dieser bildete, ihn vor psychotischen Erfahrungen bewahrt? Die Psychose von Nietzsche – sicher eine hirnorganische, eine progressive Paralyse, aber auch eine lebensgeschichtlich bedingte (Lou Andreas-Salomé sah den Wahnsinn Nietzsches als den notwendigen Ausgang seiner Zerrissenheit) – ist zunächst der Ausdruck seiner Kreativität, die ohne die Überspannung der Konflikte in einem Kampf auf Leben und Tod nicht in dieser Tiefe zum Ausdruck gekommen wäre. Aber die Psychose hat schlussendlich die Kreativität Nietzsches zerstört. Hier, in solchem doppelten Sinn der Psychose, erblicke ich einen Ausdruck der Tragik menschlicher Existenz. So möchte ich mit einem Wort von Nietzsche schließen. Unter dem Motto »vorwärts« sagt er in »Menschliches, Allzumenschliches«: »Und damit vorwärts auf der Bahn der Weisheit, guten Schrittes, guten Vertrauens. Wie du auch bist, diene dir selber als Quell der Erfahrung. Wirf dein Missvergnügen über den Wesen auf, verzeih dir dein eigenes Ich. Denn in jedem Falle hast du an dir eine Leiter mit 100 Sprossen, auf welchen du zur Erkenntnis steigen kannst.« (Schlechta 1954, Bd. 1, S. 623f.).
123
Psychose und Kreativität
Was ist psychotische Kreativität? Bei welchen Psychosen und wie häufig kommt sie vor? Diejenige Psychose, bei der sie am häufigsten beobachtet worden ist, ist bekanntlich die Schizophrenie. Nun, angesichts der Tatsache, dass ihre Häufigkeit variiert zwischen 4 Prozent der Fälle (Arnold 1953) und 100 Prozent (Navratil hat den Satz formuliert: »Jeder Schizophrene ist ein Künstler«), muss man sagen, dass psychotische Kreativität nicht »an sich«, wie ein Symptom vorkommt, sondern in Zusammenhang mit unserer Beziehung zu den Kranken steht. Daher ist jede objektive Definition unmöglich. Ich darf von meiner Erfahrung ausgehen. In meiner Erfahrung ist Kreativität kein globales Phänomen: Es gibt verschiedene »Schichten« der psychotischen Kreativität, die verschieden häufig beim selben Kranken vorkommen können und immer mit unserer Rezeption zusammenhängen. Wo es keine psychiatrische Rezeption gibt, kommt keine Kreativität vor. In diesem komplexen Phänomen kann ich drei Schichten unterscheiden: 1. Die schizophrene Bildnerei. Seit Prinzhorn (1922) ist sie die häufigste und wird allgemein, mindestens in ihren Höchstleistungen, von der Psychiatrie anerkannt. Darüber werde ich ausführlich berichten. 2. Die verbale Kreativität. Diese wird viel mehr als die erste von der Zerfahrenheit des Denkens limitiert. Sie besteht in der stellenweise höchst dramatischen Schilderung der eigenen Zustände und zeugt von einer Sensibilität für die bedrohlichen Aspekte der Existenz, die vom schizophrenen Prozess sehr häufig nicht zerstört wird. Aber sie, wie die erste, hängt mit unserer Rezeptivität zusam124
men, damit also, ob wir von den Worten und Emotionen der Kranken berührt, ja ergriffen werden oder distanziert bleiben. Als Psychotherapeut gehöre ich zu den Ergriffenen. Das folgende Beispiel kann den Sachverhalt klären: »Seit Wochen habe ich wieder dieses Gefühl eines inneren Lochs. Loch ist eigentlich ungenau, weil dem, was ich erlebe, wahrscheinlich das fehlt, was ein Loch ausmacht – ein Eingang, Wände, ein Boden. Einen Eingang wird es wohl geben, ein Boden und daher eine Begrenzung ist aber nicht vorhanden. Vielleicht ist dies deshalb so furchtbar, weil es erst der Anfang ist zu einer endlosen Tiefe, in der es zunehmend kälter wird. Es ist wohl auch so, dass dieses innere Loch auf unangenehmste Weise mit der Außenwelt in Verbindung steht und es hoffnungslos ist, die Kälte dieser Distanz zu überwinden. Wenn man sich vorzustellen versucht, was da geschieht, wenn eine selbst schadhafte Schale als dünne Grenze zwischen der inneren und äußeren Kälte verlorengeht ... – vielleicht werden dann irgendwelche Mächte insgeheim auf grässlichste Weise tuscheln und schließlich in ein furchtbares Gelächter ausbrechen, bis man zu Staub zerfällt.« 3. Die dritte Dimension der psychotischen Kreativität wird vornehmlich in der Psychotherapie erfahren. Sie kommt nur bei gut verlaufenden Therapien vor und wird von mir die Kreativität der Kommunikation genannt. In meiner Sicht übertrifft sie alles, was Philosophen über Kommunikation mit erhabenen Begriffen geschrieben haben, denn sie ist die Kreativität von Menschen, die in den Wechselfällen der Kommunikation mit Therapeuten um ihr Dasein kämpfen – es geht bei ihnen um Leben und Tod. Kommunikation ist das Leben, ihre Erstarrung ist der psychische Tod. Einige wenige Zeilen von einer Patientin, die eine solche Kommunikation erfahren hatte, genügen, um sie zu veranschaulichen. Sie sagte mir: »Durch die Ausstrahlung Ihrer Wärme entstand bei mir zwei Millimeter unter meiner abgestorbenen Haut eine schmale, aber lebendige Schicht, so dünn und fragil wie eine Membran des Lebens, die mich doch vor der Kälte draußen und drinnen schützte. Erstaunlicherweise kann ich innerhalb dieser Membran leben, aber Ihre Anwesenheit ist doch sehr nötig, damit sie von Ihnen autonom wird.« Diese drei Dimensionen der psychotischen Kreativität können 125
einzeln erscheinen, meistens überschneiden sie sich. Ich kann das an einem Beispiel zeigen, wo sie alle gemeinsam vorkommen. Manche von Ihnen kennen vielleicht das von der Patientin entworfene Bild. Es geht um eine Patientin, deren Psychose mit einer Halluzination des Todes begonnen hatte. Der Tod als Skelett war ihr im Treppenhaus erschienen. Damals konnte sie nicht verstehen, dass dieser »Außenwelttod« die Projizierung des »lnnenwelttodes«, also der Psychose selbst war. Diese Patientin lernte im Lauf einer langen Psychotherapie den inneren Tod durch eine geduldige Analyse aller todbringenden Zusammenhänge ihres Daseins zu bewältigen. In der Wanderung durch ihre psychotische Hölle hatte sie, wie Dante, einen Vergil: den auslegenden und ermutigenden Therapeuten. Gegen Ende ihrer Höllenfahrt malte sie ein Bild von ihm. Sie malte ihn nicht etwa als einen Bezwinger des Todes, sondern merkwürdigerweise als den Tod selbst; als denselben Tod, der ihr einst, vor fünf Jahren, im Treppenhaus erschienen war. Mit einem wesentlichen Unterschied: Er bedrohte sie nicht mehr, er trug sie vielmehr in den Armen, von der Hölle zum Paradies. Warum nenne ich dieses Bild schöpferisch? Nicht unbedingt, weil es ein kleines Kunstwerk ist. Was psychotische Kunst ist, darüber werde ich später noch schreiben. Schöpferisch ist das Bild aber, weil es ein gewaltiges Symbol ist. Es ist symbolischer, als wie wenn die Patientin ihren Therapeuten etwa als den Ritter Georg im Kampf mit dem Drachen dargestellt hätte. Die schöpferische Tiefe dieses Symbols ergibt sich nämlich daraus, dass ein Bild des Lebens und der Liebe sich mit dem Urbild des Todes überschneidet, von diesem ausgeht, dieses in sich aufnimmt, um es zu verwandeln. In diesem sich Überschneiden, welches das alte Bild einschließt, mit neuem Sinn erfüllt und so bewältigt, liegt die Wirkung des großen, heilenden Symbols. Ich habe nun gesagt, dass psychotische Kreativität von unserer Rezeptivität abhängt, abgesehen von der Bildnerei der frühen Anstaltspatienten, die noch in keinem Atelier wirken konnten und in stiller Einsamkeit manchmal Wunderwerke schaffen konnten, wie das Buch »Insania pingens« (Cocteau u. a. 1961) uns zeigt. Da unsere Rezeptivität die psychotische Kreativität steigert, wie besonders Navratil (mündliche Mitteilung) festestelllen konnte, 126
möchte ich die bildnerische und die verbale psychotische Kreativität als Therapien verstehen.
Zwei Formen der psychotischen Kreativität und der imaginativen Therapie Die bildnerische Therapie Die erste ist die klassische bildnerische Therapie, wo der psychisch Kranke – nicht nur der psychotische – dazu angeregt wird, seine Innenwelt, und so seine inneren und äußeren, seine bewussten und unbewussten Konflikte über wache Vorstellungen in bildnerische Gestaltungen umzusetzen. Von der alten Maltherapie bis zum modernen katathymen Bilderleben, von den Gestaltungen mit Tonerde bis zum Sandspiel mit Holzfiguren spannt sich hier seit Jahrzehnten ein großes Erfahrungsfeld. Es reicht dokumentarisch von den alten psychiatrischen Pionieren, wie Rey und Prinzhorn bis zu den vielen späteren, von denen ich nur wenige Namen aus meinem engeren Umkreis nennen will, wie Frau von Staabs, M. Erismann, G. Waser, M. Peciccia. Die nicht psychotherapeutisch tätigen Psychiater, wie Prinzhorn, sprechen hier, angesichts der Gestaltungen von geisteskranken Patienten, von einer »Psychopathologie des Ausdrucks« (Prinzhorn 1922), während wir Psychotherapeuten allerdings eine Psychotherapie über den Ausdruck meinen. Denn der psychopathologische Ausdruck in der Beziehung zu einem wohlwollenden, zusehenden und zuhörenden Therapeuten, der sich als ein stiller Verbündeter des Kranken in seinen inneren Kämpfen versteht und von ihm verstanden wird, der seine Erzeugnisse deutet, ermutigt, lobt, der Vorlagen bringt, sowohl kommentiert wie auch den Patienten in der Wahl seiner Ausdrucksmittel frei lässt, ist heilsam. Die Passivität des Patienten verwandelt sich so in Aktivität; das Ich wird sich klarer über all das Erlittene und gestaltet es neu. Neue Lösungen der Konflikte werden entweder spontan oder über die Anregungen des Therapeuten gesucht und gefunden. Die Möglichkeit, in konkreten Imagines zu denken, fördert eine Teilregression auf die eigene Kindheit, wo man einmal begonnen hat, die Welt in Bildern zu erfassen; die Umsetzung der Phantasien in mate127
riale, in konkrete Bilder, öffnet eine Möglichkeit des Einwirkens auf sie, und in der Gestaltung verändern sich auch die inneren Bilder. Die Erkenntnis, dass die Bildgestaltung durch die verschiedensten Patienten therapeutisch wirken kann, ist also nicht neu in der Geschichte der Psychiatrie. Schon vor der Entwicklung einer spezifischen psychiatrischen Therapie haben die frühen Anstaltpatienten bereits im vorletzten Jahrhundert gezeichnet, gemalt, geschrieben, geschnitzt und, im besten Fall sich so »gesund ausgedrückt«. Mit ihren unbewussten Selbstheilungsversuchen haben sie uns Psychiater auf den Gedanken gebracht, dass in der Ermutigung, Pflege und Ausbildung ihres »Formentriebs« eine therapeutische Möglichkeit enthalten ist. Seit vielen Jahrzehnten befasst sich deshalb eine wesentliche Seite der Psychiatrie mit diesem Gedanken. Die Zeit ist zum Glück längst vorbei, wo mancher Psychiater seinen Patienten ihre geisteskranken Produktionen vor deren Augen zerstörte, in der Meinung, sie auf diese Weise von ihren krank machenden Vorstellungen abzulenken. Diese Psychiater meinten, die bildhafte Projektion von inneren Urbildern mache diese Kranken noch autistischer. Heute wissen wir, dass es gerade umgekehrt ist, dass das Erleben der bildgestaltenden Aktivität die Kommunikation stimuliert, das schwer Sagbare ausdrückt, die negativen Introjekte verarbeiten lässt. Anlässlich eines Besuchs der bekannten Prinzhorn-Ausstellung vor vielen Jahren in Basel fiel mir auf, dass einzelne psychotische Autoren ihre eigenen Malereien durch Gedanken erklärten, die sie am Rand der Bilder aufgeschrieben hatten. Meistens handelte es sich um Wahnkranke, die ihren Wahn gleichzeitig im Bild und im Wort ausdrückten. Beim Vergleich des bildlichen mit dem wörtlichen Ausdruck war auffallend, wie großartig der erste im Vergleich zum zweiten war. Das Bild wirkte surrealistisch, farbig, kühn, erschütternd – ja, kam gelegentlich an die Grenze des Kunstwerks heran. Die wörtliche Erklärung daneben wirkte verworren, geisteskrank. Diese Beobachtung führte mich zur Idee, dass es therapeutisch sein könnte, wenn man den psychotisch Kranken dazu motivieren würde, seine Innenwelt ins Bild zu übersetzen. Was ist der Unterschied zwischen den zwei Ausdrucksformen desselben Wahns? Der verbale Ausdruck ist einfach wahnhaft; er vermittelt dem 128
wahnhaft Denkenden das aussichtslose Gefühl, uns nicht überzeugen zu können, er lässt uns den Kranken als einen ent-rückten und ver-rückten Menschen erleben, von dem uns das Fehlen jeglicher kognitiven Kommunikationsbrücke trennt. Die graphische Darstellung drückt wie jedes Bild nur ein Symbol aus; sie will nichts beweisen (sie könnte sogar von einem nicht kranken zeitgenössischen Maler stammen). Sie ist nicht irrealistisch, sondern surrealistisch. »Zwischen meinen Bildern und denjenigen eines Verrückten liegt einzig der Unterschied, dass ich nicht verrückt bin«, meinte einmal der berühmte Maler Dalí (nach dem Gedächtnis notiert). Warum ist der Schizophrene in seinem bildlichen Ausdruck oft weniger verrückt als in seiner Rede und in seinem sozialen Verhalten? Im Versuch, »das Gefühl in seinem Begriffe zu erfassen« (Heine 2005), also den nicht erklärbaren Grund dennoch zu verstehen, möchte ich sagen: Der schizophrene Prozess zerstört vermutlich nicht die ganze Psyche. Er schont gerade die Paleopsyche, aus der unsere Imaginationen stammen. Das kollektive Unbewusste ist nie geisteskrank, weil es jenseits des bewussten Geistes liegt. Die Imagines des psychotischen Menschen wirken krank und absurd, wenn sie in krankhaften logischen Zusammenhängen eingebettet sind, die sie verzerren. Als Urbilder der Seele können sie auch in der Psychose ergreifend sein. Wie eindrucksvoll konnte etwa eine Patientin, die sich tot wähnte, ihr inneres Totsein durch ein Bild (Abb. 1) ausdrücken und somit selbst das Symbol einsehen, das Symbol des Todes, das im konkreten Wahn des Todes fehlte!
129
Abbildung 1
130
Abbildung 2
Diese Patientin hat später ihre Psychose als einen Traum verstanden, aus dem man nicht erwachen könne. Sie hat sich deshalb als schlafend porträtiert, aber mit vier Augen (Abb. 2). Oberhalb der zwei geschlossenen Augen, die den Schlaf darstellen, in dem der Traum entsteht, öffnen sich die zwei Augen ihres Therapeuten, die wach bleiben. Sie sind nun auch für die Patientin die Augen der Einsicht geworden. Die besondere Kreativität dieses Bildes liegt nicht nur in der Darstellungskunst, sondern in der Verdichtung ihrer »oberen« Einsichtsaugen mit den Augen des Therapeuten; in einer solchen Verdichtung lese ich das von mir genannte »Übergangssubjekt«: Die Patientin wird sie selbst »im Übergang zum Therapeuten«. Wir alle haben zuerst in Bildern gedacht, zu einer Zeit, da die gedankliche Kommunikation nicht möglich war und die soziale Welt uns noch nicht durch die realen Aspekte der Existenz einengte. Das Gespräch mit dem psychotischen Menschen zeigt uns sofort, dass er gerade die realen Aspekte der Existenz nicht bewältigen kann. Im Bild fallen sie von vornherein aus, dort weht jene Urfreiheit, die wir alle am Anfang des Lebens hatten. Der Psychoanalytiker Otto Rank (1932) meint, dass Kunst eine 131
schöpferische Regression auf den pränatalen Zustand sei, wo das Kunstobjekt zu einer Fortsetzung des eigenen Selbst und zum mütterlichen Universum werde. Aber es gibt noch weitere Momente, die für die therapeutische Bedeutung des Bildentwurfs sprechen: die relative Distanzierung des zeichnenden Patienten von seinem quälenden psychischen Inhalt durch die Projektion desselben auf das Bild, also auf eine Fläche, die gleichzeitig außerpsychische und spiegelbildliche Qualität hat. Das Ungeheuer im Bild ist zwar Symbol des inneren Ungeheuers, aber es erscheint draußen vor den Augen (man könnte sagen, dass die Bild-Projektion die gesunde Alternative zu der halluzinatorischen Projektion ist). Des Weiteren die Möglichkeit, im projektiven Raum des Bildes das psychotische Objekt, welches das Ich überrennt und auflöst, zu gestalten. Schon die zeichnende Kontur ist eine Beherrschung des bildhaft Erfassten. Dabei erlernt der Kranke eine eigene Schöpferkraft, er erlebt Produktivität und Ich-Aktivität. Aber nicht nur das Ungeheuer, nicht nur das Entsetzliche kommt als Gestalt zum Ausdruck. Auch die Sehnsucht, etwas Positives in sich zu entdecken, wird erfüllt, wenn ein im Inneren erschüttertes Ideal-Ich draußen gesehen und in der Bild-Projektion appersoniert wird, etwa als eine sich mehrfach in vielen Bildern wiederholende Gestalt des Engels erfasst wird. Man hat also erkannt und in zahllosen Arbeiten nachgewiesen, dass das, was uns als eine »Psychopathologie des Ausdrucks« erscheint, für die meisten produktiven Kranken eine wesentliche Form der Selbstverwirklichung und der Selbsttherapie ist. Ich möchte dies in drei Punkten zusammenfassen: Erstens ist es das Prinzip der Gestaltung: Das von der Psychose überwältigte, von malignen lntrojekten zerrissene, im Verlust der Gestalten fragmentierte Ich kann sich schaffend und gestaltend zum Teil rekomponieren; es kann das Ungeheuerliche, das es nicht beim Namen nennt, immerhin in einem selbst gewählten Bild erfassen, abgrenzen, »physiognomieren«. Zweitens kann das kranke Ich auf diese Weise innerpsychische Geschehnisse – also Stimmen und Stimmungen aller Art – aufs Papier, aufs Holz, aufs Ausdrucksmaterial bringen – kurz, auf die Welt projizieren und so zum Teil loswerden. 132
Und drittens kann der Patient so beginnen, auch mit dem Betrachter seiner Kunstwerke zu kommunizieren – wie Carlo, der chronische, autistische, aber bildnerisch sehr begabte Schizophrene, der mit niemandem sprach, außer mit den Betrachtern seiner Ausstellungen. Er hoffte, diese würden ihm den Sinn seiner ihm selbst unverständlichen Gestaltungen erklären. Ja, manchmal spürt der Kranke, was er sagen möchte, und findet doch keine Worte – das Präverbale ist dann unsagbar, aber bewusst und dem Bild nicht ganz entrückt. Andere Male drückt sich im psychotischen Bild das Unbewusste so unmittelbar aus, dass das kranke Bewusstsein nicht einmal eine Ahnung davon hat, was da zum Vorschein kommen will. Das Gestaltende, das Projektive, das Kommunikative: Reicht das aus, um von einer Kunst des leidenden Menschen zu sprechen? Manche Autoren haben dies bejaht, andere verneinen es. Ein mir persönlich bekannter führender italienischer Phänomenologe, Ferdinand Barison, der neunzigjährig gestorben ist, verneinte eine schizophrene Kunst. Wie wenige Psychiater in Italien hatte er sich aber um die Erkenntnis der Originalität und Produktivität der schizophrenen Bildnerei bemüht. Den Grund, weshalb Barison nicht von Kunst reden wollte, kann ich so interpretieren: Der eigentliche Künstler identifiziert sich beim Ausdruck seines Selbst mit dem Selbst zahlloser Menschen, welche sich bei der Betrachtung seiner Kunstwerke vielleicht wie im Spiegel erkennen. Wohl ist der schizophrene Patient in seinem »kollektiven Unbewussten« fähig, archtetypische Bilder auszudrücken, aber – so Barison – er ist autistisch. Um die autistische Andersartigkeit des sich nicht einfühlenden und also mit uns nicht wirklich kommunizierenden Schizophrenen auszudrücken, bediente sich Barison eines Wortes, das banal wäre, würde es nicht wie ein Fremdkörper in der italienischen Sprache emporragen: »lo schizofrenico è anders«. Er brauchte in der italienischen Formulierung das Fremdwort, um das Psychotische zu betonen. Bei aller Verehrung, die mich jahrelang mit dem Meister der italienischen Phänomenologie verbunden hat, konnte ich seine These nicht übernehmen und zwar aus drei Gründen. Erstens: Ich kenne schizophrene Bildnereien vor allem aus dem psychotherapeutischen Umgang mit den Patienten und weiß, welche 133
Tiefe der Kommunikation da doch entstehen kann. Das »barisonsche Anders« scheint mir auch eine Abwehr der Kranken durch den Gesunden und nicht bloß die Abwehr des Kranken gegen die Gesunden zu sein. Zweitens: In der Psychotherapie wird eine Kommunikationstiefe erreicht, wo der Therapeut im Spiegel der Kunstwerke seiner Patienten seinen eigenen psychotherapeutischen Weg mit ihnen überblickt, erkennt und erfasst. Er ist selbst davon ergriffen. Das aber, was das Wesen eines Kunstwerks ausmacht, ist nicht nur das Werk an sich, sondern auch unsere Rezeption. Gäbe es ein Kunstwerk, das für immer, nicht nur für seine Generation, unerkannt bliebe, keine Rezeption je fände, so wäre es kein Kunstwerk mehr. Wenn also menschliche Rezeption zum Wesen des Kunstwerks gehört, so ist hier die Rezeption des Therapeuten – und aller, die sich mit ihm identifizieren – eine Dimension seiner Qualität. Und schließlich ein dritter Grund: Durch das Bild wollen manche Patienten ihre Innenwelt in einer uns nicht befremdenden Weise ausdrücken; sie spüren selbst, dass ihr Bild anstelle des irrealistischen Worts symbolisch ist, sie lernen die Symbolsprache, die sie im Wahn vergessen haben. Das sprachlich Absurde macht durch die »Verbildlichung« einen Sprung nach vorn und wird kommunikativ. Ein Beispiel dazu: Eine bereits in Heilung begriffene Patientin entwarf gegen Ende der Therapie ein wunderschönes Bild, das sie »Die Dreieinigkeit von Jesus, Barabbas und Maria« nannte. Wir wissen, dass Barabbas vom Volk, das die Kreuzigung von Jesus verlangte, freigesprochen wurde. Die Patientin identifizierte nun Jesus mit ihrer eigenen guten Seite und Barabbas, den Verbrecher, mit ihrer bösen Seite. Sie hatte als Malerin den merkwürdigen, in der geschichtlichen Realität wohl absurden, aber psychologisch sinnvollen Einfall, dass Jesus und Barabbas dieselbe Mutter hätten, Maria. Damit meinte sie unbewusst, dass die beiden gegensätzlichen Hälften ihres Selbst nun durch die eine Mutter, die beide liebte, integriert seien. Nur durch das Bild konnte sie das ergreifend sagen. Die Psychose hat an diesem Punkt nach vielen Jahren tatsächlich aufgehört.
134
Die verbale Imagination Wir haben bis jetzt vom »Bild« in einem konkreten Sinn des Worts gesprochen. Der zweite Weg des Schöpferischen ist aber auch die therapeutische verbale Imagination, also die Übersetzung der negativen Imagines der Kranken (welche sich entweder aus Träumen, Wahnideen ergeben oder im wachen Zustand spontan entstehen) in therapeutische Vorstellungen, die nicht nur aus dem Intellekt, sondern auch aus dem schöpferischen Unbewussten des Therapeuten stammen. Diese sind eine Reaktion auf die Absorbierung des Leidens, sie konstellieren dieses positivierend, sie entstehen immer dort, wo der Kranke steht, aber sie weisen über die Krankheit hinaus. Ein Patient träumt zum Beispiel davon, dass er im Schlamm ertrinkt. Wir sagen dem Patienten, dass er uns seinen Traum geben soll, dass wir seinen Traum in uns spüren, mit ihm in der Meditation des Traums in den Schlamm sinken, aber schließlich tief darunter einen uns haltenden Boden finden. Wir spüren den uns gemeinsam haltenden Boden, wir halten den Patienten. Ein anderes Mal können wir mit ihm von den Lebenskeimen reden, die im Schlamm sind, von den Wurzeln, die dort wachsen. Wenn wir üben, so zu denken, finden wir immer lnspirationen. Unser kollektives Unbewusstes inspiriert uns. Heißt es nicht im alten Ägypten, dass die böse Schlange Anophis das heilige Wasser aussaugt, um die Sonnenbarke, die den Toten durch die Unterwelt trägt, trockenzulegen? Dann verwandelt sich die Barke selbst in eine Schlange, die auf dem trockenen Flussbett vorwärts kriechen kann. Das Böse wird durch das Spiegelbild des Bösen überwunden – eine uralte Weisheit! Oder: Wenn der böse Seth dem Horus, der gegen ihn kämpft, das eine Auge entreißt und dieses in vierzehn Stücke zerfetzt, dann verwandelt sich das verlorene Auge, das in seinem Untergang das Opfer des in vierzehn Teile zerstückelten Leibes des Gottes Osirides wiederholt, in das magische Auge der Toten, mit welchem diese die unsichtbaren Dinge sehen können. Wir sollen uns dem Unbewussten überlassen, wenn es die Not des Patienten aufgenommen hat, um dann im Gespräch mit ihm – oder auch in eigenen Nachtträumen – die heilenden Bilder auftauchen zu lassen. Die imaginativ bildhafte Psychotherapie ist also nicht auf das gra135
phische Bild angewiesen. Das Bild kann rein verbal entwickelt werden. Schon die psychotherapeutische Deutung hat oft, entsprechend ihrem Objekt, eine bildhafte Komponente. Ich denke etwa an einen Patienten, der in seiner Psychose sexuelle Orgien halluzinierte, die im Nebenraum seines Schlafzimmers stattfanden. Der Psychotherapeut verteidigte die Sexualität des Patienten, die ihn verfolgte, weil sie von seinem unterdrückenden Über-Ich verboten und abgespalten war. Diese verkannte, unbewusste Sexualität hatte sich deshalb als fremde Handlung in einem unwirklichen gespenstischen Nebenraum entfaltet, weil ihr seit jeher jeglicher reale mitmenschliche Raum versperrt worden war; die Tür zum abgespaltenen Raum musste jetzt geöffnet werden, damit die Verfolgung aufhören konnte. Tür, Raum, Öffnung sind »Bildelemente« der verbalen Deutung, auch wenn sie nur rational ist. Die therapeutische Phantasie geht aber einen Schritt weiter. Sie deutet, indem sie ein verbales therapeutisches Bild demjenigen des Patienten entgegen setzt. Ich greife als Beispiel das schöne Sinnbild eines Mitarbeiters auf. Da ist eine chronische schizophrene Kranke, die sich unter einer Eisdecke begraben wähnt. Sie spricht nicht metaphorisch, sie halluziniert das Eis, die Höhle, den Tod; durch ihre Bilder drückt sie nicht nur ihre depressive aussichtslose Situation aus, sondern auch ihre autistische Ablehnung der Nähe. Der Therapeut antwortet mit einer Parabel: »Er wartet auf sie, unendlich lange, aber mit einem brennenden Zündholz in der Hand«. – Eigentümliches Symbol! Wie kann das Zündholz, das normalerweise nur ganz kurz brennt, so lange brennen? Der Wahn spiegelt sich in einem surrealistischen therapeutischen Spiegel wider. Die Spiegelung ist eindrücklich darum bemüht, das Bedürfnis der Patientin nach Abgeschlossenheit, Unerreichbarkeit, Menschenferne teilweise zu respektieren; denn alles, was der Therapeut der Eis-Welt der Kranken entgegenhält, ist lediglich ein kleines Zündholz. Es kann sein, dass der Patient das therapeutische Sinnbild ablehnt; aber auch dann wird sein Unbewusstes merken, dass der Therapeut nicht spielt, hat er sich doch mit einer verborgenen Sehnsucht des Kranken identifiziert, er hat die »Seele des Wahns« aufgespürt. Der therapeutische Einfall stammt aus seinem Unbewussten und kann nur deshalb zum Unbewussten des Kranken sprechen. Die Erfahrung zeigt, dass die Antwort auf den psychotischen 136
Traum nicht selten ein therapeutischer Traum ist. Ein psychotischer Patient erzählt von einem Traum, den er schon als Kind hatte. Er träumte damals von einem Feuer, das zu einem riesigen Brand wurde, dem er nur mit Mühe entkommen konnte. War jener Traum, der als eine einzige Erinnerung in der traumlosen Landschaft der Vergangenheit emporragte, vielleicht eine unbewusste Ahnung der kommenden Psychose? Man kann sich das denken, doch das therapeutische Unbewusste dachte nichts, sondern antwortete mit einem umgekehrten »Feuertraum«: In seinem Traum konnte der Therapeut an einem Feuer, das wie in der Urzeit der Menschheit brannte, mit archaischen Steinwerkzeugen Fleisch für seinen Patienten braten. Dieser war im therapeutischen Traum nicht einmal imstande zu essen; der Therapeut aß stellvertretend für ihn. Diese Art verbale Psychotherapie, die ich seit Jahrzehnten entwickelt habe, berührt die Bildgestaltung in der heutigen »Kunsttherapie«. Wir sehen an diesem Beispiel, wie die psychotische Kreativität (eines Traums, eines Wahns) oft gleichzeitig die Kreativität des Kranken und diejenige seines Therapeuten ist. Sie entsteht in einem Raum, der zu Beginn beiden gehört, in einem Feld, das beide Pole als »Übergangssubjekt«, wie ich mich ausdrücke, verbindet. Das, was die therapeutischen Antworten unter anderem charakterisiert, und zwar sowohl auf der verbalen wie auf der zeichnerischen Ebene, ist das Merkmal der Regression. Auch der Therapeut ist regrediert, nicht nur der Patient. Auch der Therapeut lässt Urbilder aus seinem Unbewussten auftauchen. Wenn man die Bilder des Patienten als »Träume« bezeichnen will, muss man sagen, dass auch der Therapeut mit-»träumt«. Das bedeutet, dass der Therapeut den Traum des Patienten mitgestalten kann. Er bringt positivierende Einfälle in die Bilder des Patienten, verwandelt sie, anstatt dass er sie, wie in der Analyse, deutet.
137
Die Vielfalt des Schöpferischen und die therapeutische Persönlichkeit Ich habe versucht, verschiedene Ebenen des Schöpferischen in der Therapie aufzuzeigen. Die Verschiedenheit allein ist bereichernd. So liegt die Erkenntnis meiner Übersicht darin, dass gerade das Schöpferische in keiner Sondermethode, aber auch in keiner fassbaren Persönlichkeitsstruktur liegt. Der Geist weht, wie und wo er will, heißt es schon in einer Parabel des Evangeliums. Er muss vom Menschen in jedem Augenblick seiner Besinnung angerufen werden, um ihn dann auch zu erfahren. Und die verschiedensten Therapeuten können diesen Geist des Schöpferischen erfahren! Es gibt Therapeuten, die viel schweigen, zuschauen und höchstens hie und da kommentieren. Sie überlassen dem Patienten die ganze bildnerische Aktivität. Aber sie wirken therapeutisch auf zweierlei Ebenen: einmal dadurch, dass sie sich in das Bild des Patienten einfühlen, gewissermaßen dem Patienten auch ohne Worte in seinem Bild begegnen. Dann auch, indem sie das Bild reflektieren, deuten, auslegen, also wieder nach innen nehmen, so dass der Patient sich über das eigene Bild und das therapeutische deutende Wort selbst tiefer kennen lernt. Diese Therapeuten meinen, dass es besser ist, in den kreativen Prozess nicht einzugreifen, um ihn nicht zu stören. Sie vertrauen der Eigendynamik der Patientenprojektion, sie gehen von der Erfahrung aus, dass der Patient durch seine Tiefenperson zum Ausdruck des Wesentlichen geleitet wird. Es gibt aber auch andere Therapeuten, die mit den Bildern des Patienten durch eigene Bilder »sprechen«, die Bilder der Patienten durch eigene »beantworten«, oft ohne die Vermittlung des Worts, sondern im Sinn einer visuellen Begegnung. Diese visualisierenden Therapeuten haben es oft mit schwereren Kranken zu tun als die Erstgenannten. Sie behandeln Patienten, die entweder von sich aus nicht zeichnen, nicht malen, nicht gestalten oder den inneren gestaltenden Plan bald verlieren und draußen im selben Chaos versinken wie drinnen, weil ihr Ich allzu desorganisiert ist, als dass es im konstruktiven Verhältnis mit dem eigenen Werk sein könnte. Es gibt also verschiedene Therapeuten, verschiedene Arbeitsmodelle, verschiedene Schultraditionen. Ich glaube nicht, dass eine ge138
genseitige Konfrontation auf Grund von vergleichenden Erfolgsstatistiken die echte Antwort auf die pluralistische Psychotherapie ist. Die Persönlichkeit des Therapeuten, seine Denkweise, sein Erfahrungsschatz sollen in dem Sinne respektiert werden, dass man nicht versuchen darf, die eine Methode im Vergleich zur anderen zu entwerten. Schließlich haben auch die alten Pioniere der Psychotherapie am Anfang des 20. Jahrhunderts und sogar im 19. Jahrhundert mit ihren heute in unserer Sicht veralteten Modellen und Methoden einen konstruktiven Zugang zu ihren psychiatrischen Kranken gefunden und ihnen geholfen. Vielleicht liegt etwas gemeinsames all diesen Wegen zugrunde, etwas, das einigt: der Zugang zum Unbewussten. Das Unbewusste kann inhaltlich nie endgültig erfasst werden, weil seine sich sowohl offenbarenden wie auch verschleiernden Bilder immer Übergangssubjekte sind, also etwas, in dem die Regungen des Patienten sich mit unserer Art sie wahrzunehmen, treffen. Wir entdecken im Bild etwas Objektives, das wir also wissenschaftlich untersuchen, das aber zudem mit unserer Art der Zuwendung, der Anschauung, mit unserer Subjektivität zu tun hat. Diese Verschränkung von Objektivität und Subjektivität, die der Psychopathologie des Ausdrucks eigen ist, nimmt noch zu, wenn das Bild des Patienten in einer psychotherapeutischen Intersubjektivität entstanden ist, von uns beeinflusst, nicht weniger als auch uns beeinflussend. Das Bild ist dann nicht bloß Ausdruck einer Psychopathologie, sondern ebenso unserer Erfahrungen mit dem Patienten. Wir finden uns im Bild – sei es, weil wir uns selbst mit unseren Theorien, mit dem Patienten identifiziert haben, sei es, weil der Patient seinerseits unsere identifikatorischen Züge internalisiert hat, sich damit verwandelnd. Aus der Psychopathologie des Ausdrucks ist dann die »Kunst-Therapie«, wie man sie heute nennt, entstanden. Sie ist eine gestaltende Therapie, die die Bezeichnung »Kunst« weniger der ästhetischen Form ihrer Produkte verdankt, als vielmehr dem Umstand, dass dem miterlebenden Therapeuten diese Objekte so wichtig und ergreifend sind, wie die Kunstobjekte für den ergriffenen Zuschauer. Das Schöpferische in der Therapie scheint mir in einem Punkt zu entstehen, wo die Spannung zwischen dem Unbewussten und dem bewussten Geist, zwischen Objektliebe und Selbstverwirklichung zunimmt und zum Ausdruck drängt. Selbstverwirklichung ge139
schieht in der Ausformung des Lebensdrangs durch das Symbol. Die Selbstverwirklichung schließt aber gleichzeitig Patient und Therapeut mit ein. Ich meine hier freilich nicht, dass der Therapeut immer eine selbstverwirklichte Persönlichkeit sein muss: Dieser Wunsch wäre einerseits unrealistisch und würde anderseits im Widerspruch stehen zu der Erfahrung, dass auch der vom Leiden Herausgeforderte heilen kann, wie auch eine alte Sage erzählt, dass der Kentaur Chiron, der Achilles in die medizinische Kunst einweihte, selbst an einer Wunde litt. Viel eher meine ich, dass jede gute Psychotherapie ebenso eine Selbstverwirklichung des Therapeuten ist und dass sie nicht wirklich gelingt, wenn der Therapeut nicht auch von seinem Patienten lernt. Was kann der Therapeut lernen und sich aneignen? Vor allem ist es der Respekt vor der immer anderen, in keinem Lehrbuch enthaltenen Persönlichkeit seines Patienten, und noch mehr als dies: sogar die Einsicht, dass er seine Einfälle, seine Vorstellungen nicht nur aus sich selbst bekommt, sondern aus einer Dualität, an der der Patient teilnimmt, aus dem Unbewussten der beiden. Sogar der widerstrebende Patient kann mit seinem Unbewussten dem Therapeuten helfen, indem er ihm auf dieser tiefen Ebene die richtigen Intuitionen verleiht. Wir lernen von unseren Patienten und wir werden durch sie bereichert.
140
Literatur
Alanen, Y. A. (1997): Schizophrenia. Its Origins and Neeadapted Treatment. London. (Dt.: Schizophrenie. Entstehung, Erscheinungsformen und bedürfnisangepasste Behandlung. Stuttgart, 2001) Andreas-Salomé, Lou (1894): Friedrich Nietzsche in seinen Werken. Frankfurt a. M., 1983. Arieti, S. (1979): Understanding and Helping the Schizophrenic. New York. Aristophanes, in: Durant, W. (1950): Das Goldene Zeitalter. Lausanne. Arnold, O. H. (1953): Über schöpferische Leistungen im Beginn schizophrener Psychosen. Wiener ZS für Nervenklinik und deren Grenzgebiete, 7. Bader, A.; Navratil, L. (1970): Zwischen Wahn und Wirklichkeit. Luzern. Balint, M. (1968): Therapeutische Aspekte der Regression. Stuttgart. Benedetti, G. (1975): Psychiatrische Aspekte des Schöpferischen. Göttingen. Benedetti, G. (1998): Botschaft der Träume. Göttingen. Benedetti, G. (1998): Psychotherapie als existentielle Herausforderung. 2. Auflage. Göttingen. Bion, W. R. (1956): Development of Schizophrenic Thought. Int. J. Psychoanal. 37, S. 344–346. Bleuler, E. (1911): Dementia Praecox oder die Gruppe der Schizophrenien. In: Aschaffenburg, B. (Hg.), Handbuch der Psychiatrie. Leipzig u. Wien. Bleuler, M. (1972): Klinik der schizophrenen Geistesstörung. In: Psychiatrie der Gegenwart, Band II/1. Berlin, S. 7–78. Bollas, C. (1987): The Shadow of the Object. Psychoanalysis of the Unthought Known. London. Bordi, S. (2000): Il pluralismo in psicoanalisi. Setting 10. Bultmann, R. (1954): Zur Frage der Entmythologisierung. In: Jaspers, K.; Bultmann, R.: Die Frage der Entmythologisierung. München. Camus, A. (1951): L’homme révolté. Paris. Cocteau, J.-G.; Schmidt, H.; Steck, A.; Bader, A. (1961): Insania pingens. Basel.
141
Dante (1998): Divina commedia, vol. II (Purgatorio). 3. Aufl. Milano, Mondadori. Dubois, P. (1901): De l’influence de l’esprit sur le corps. Bern Dubois, P. (1904): Les psychonévroses et leur traitement moral. Paris. Durant, W. (1950): Kulturgeschichte der Menschheit. Band V: Das Leben Griechenlands. Lausanne. Durant, W. (o. J.): Kulturgeschichte der Menschheit. Bd. 22. Zürich. Epidaurus, in: Papadakis, Th.; Meletzis, S. (1978): Archäologisches Nationalmuseum Athen. Zürich. Epiharmos, Papadakis, Th.; Meletzis, S. (1978): Archäologisches Nationalmuseum Athen, Zürich, S. 14. Euripides, in: Durant, W. (1950): Das Goldene Zeitalter. Lausanne. Federn, P. (1953): Ego Psychology and the Psychosis. London. Freud, S. (1924): Neurose und Psychose. In: Gesammelte Werke, Bd. XIII. London, S. 387–391. Heine, H. (2005): Reisebilder. München, Goldmann. Ideler, K. W. (1941): Biographien Geisteskranker in ihrer psychologischen Entwicklung. Berlin. Janz, C. P. (1978): Friedrich Nietzsche. Biographie in 3 Bänden. München. Jaspers, K. (1948): Der philosophische Glaube. Zürich. Jung, C. G. (1907): Über die Psychologie der Dementia praecox. Halle. Jung, C. G. (1966): Über das Phänomen des Geistes in Kunst und Wissenschaft. Olten. Klein, M. (1946): Notes on Some Schizoid Mechanism. International Journal of Psychoanal. 27, S. 99–110. Kohut, H. (1971): The Analysis of the Self. New York. Krause, R. (2002): Psycho-Affektforschung. In: Psychoanalyse im Dialog der Wissenschaften. Stuttgart. Kris, E. (1952): Psychoanalytic Explorations. In: Art. New York, S. 12–150. Lacan, J. (1966): Ecrits. Paris. Langer, S. (1942): Philosophy in an New Key: A Study in the Symbolism of Reason, Rite, and Art. Havard. Lempa, G. (2001): Desymbolisierung, Versprachlichung – Modifikation der Behandlungstechnik auf Grund des schizophrenen Dilemmas. In: Schwarz, F.; Maier, C. (Hg.): Psychotherapie der Psychosen. Stuttgart. Lichtenberg, J. D.; Lachmann, F. M.; Fosshage, J. L. (1996): The Clinical Exchange. Hillsdale, N. J. Mahler, M. (1975): The Psychological Birth of the Human Infant. New York. (Dt.: Die psychische Geburt des Menschen. Symbiose und Individuation. Frankfurt a. M., 1978) Mentzos, S. (1992): Psychose und Konflikt. Göttingen.
142
Mitchel, S. A. (2000): Relationality. From Attachement to Intersubjectivity. Hillsdale, N. J. Möbius, P. J. (1902): Über das Pathologische bei Nietzsche. Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens. Wiesbaden. Müller Suhr, H. (1970): Zur Frage der Beziehung zwischen Schizophrenie und Kunst. In: Hofer, G.; Wiechert, K., Imaginäre Welten – Gestalteter Wahn. Hannover. Navratil, L. (1968): Schizophrenie und Kunst. München. Nietzsche, F. (1954): Werke in 3 Bänden. Hg. von Karl Schlechta. München (Zitiert: Schlechta). Nietzsche, F. (1976): Du sollst werden, der Du bist. Psychologische Schriften. Ausgewählt und hg. von Gerhard Wehr. München. Nietzsche, F. (1980): Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden. Hg. von Giorgio Colli u. Mazzino Montinari. Berlin u. München (Zitiert: KSA). Nietzsche, F. (1986): Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe in 8 Bänden. Hg. von Colli und Montanari. Berlin / New York / München (Zitiert: KSB). Odgen, T. H. (1994): The Analytic Third. Working with intersubjective Clinical Facts. Int. Journal of Psychoanalysis, 78, 2, S. 219–225. Peciccia, M. (1998): Bildgestaltende Psychotherapie. In: Benedetti, G.: Psychotherapie als existentielle Herausforderung. 2. Auflage. Göttingen. Peciccia, M.; Benedetti, G. (1992): Progressive Mirror Drawing as a Factor Fostering the Psychotherapy of Psychotic Disturbances in Verbal Communication. In: P. Borri; R. Quiartesan; P. Moretti (Hg.): USA-Europe Conference on Facilitating Climate for the Therapeutic Relation in Mental Health Services. Perugia. Plöcker, J. H. (1969): Zerrbilder. Stuttgart. Prinzhorn, H. (1922): Bildnerei der Geisteskranken. Berlin. Rank, O. (1932): Kunst und Künstler. Studie zur Genese und Entwicklung des Schaffensdranges. Gießen, 2000. Réja, M. (1907): L’art chez les fous. Paris. Rennert, H. (1966): Die Merkmale schizophrener Bildnerei. Jena. Safranski, R. (2000): Nietzsche. Eine Biographie seines Denkens. München. Schoeps, H.-J. (1960): Was ist der Mensch. Philosophische Anthropologie als Geistesgeschichte der neuesten Zeit. Göttingen / Berlin / Frankfurt a. M. (darin: Friedrich Nietzsche oder das Ringen um eine neue Welt, S. 97–118). Séchehaye, M. A. (1947): La réalisation symbolique. Bern. Siirala, M. (1983): From Transfer to Tranference. Helsinki.
143
Stern, D. N. (1985): The Interpersonal World of the Infant. New York. Die Lebenserfahrung des Säuglings. Stuttgart. Sullivan, H. S. (1962): Schizophrenia as a Human Process. New York. Vollmat, R. (1956): L’art psychopathologique. Paris. Volz, P. D. (1990): Nietzsche im Labyrinth seiner Krankheit. Eine medizinisch-biographische Untersuchung. Würzburg. (Diss. Tübingen 1988) Waser, G. (1997): Differentielle Indikation der Kunsttherapie. In: Baukus, P.; Thies, J. (Hg.): Kunsttherapie. Stuttgart. Zweig, S. (1925): Der Kampf mit dem Dämon. Hölderlin – Kleist – Nietzsche. Leipzig.
144
Wenn Sie weiterlesen möchten ... Gaetano Benedetti Botschaft der Träume Unter Mitarbeit von Elfriede Neubuhr, Maurizio Peciccia und J. Philip Zindel. Die fünfzigjährige Erfahrung als Psychotherapeut – insbesondere psychotischer Patienten, die ihn weltweit in Fachkreisen berühmt gemacht hat – ist der Fundus, den Gaetano Benedetti in diesem Buch für ein tieferes klinisches Verständnis von Trauminhalten einschließt. Aber er ist auch fast ebenso lang Lehranalytiker, und darum kann er aus einem gleichfalls weiten Erfahrungshorizont von Träumen Gesunder schöpfen. Als Drittes kann er die Bedeutung von Therapeutenträumen während der Behandlung psychisch Kranker erschließen. Die Botschaft der Träume ist damit das umfassendste und bestfundierte Werk über die Träume des Menschen in den verschiedenen psychischen Zuständen, eine Anthropologie des Traums. Benedetti erfüllt einen integrativen Anspruch in der Traumforschung. Er und seine Mitarbeiter untersuchen den Traum, seine Mitteilungen an den Träumenden und an den Therapeuten, seine diagnostische und therapeutische Verwertbarkeit vor dem Hintergrund der tiefenpsychologischen Lehren Freuds, Jungs und Adlers, der existenzanalytischen Theorien und der Hypnotherapie. Träume, so hat Benedetti erkannt, sind doppelgesichtig. Die Traumsprache teilt sich in Polaritäten mit; jedes einzelne Bild, jedes Symbol erhellt verschiedene, ja gegensätzliche Seiten der Wahrheit. Dadurch kann es zu einer wesentlichen Ergänzung des wachen, bewussten Denkens werden. Träume haben nicht nur einen wichtigen Anteil am Erleben des Menschen, sie sind oft auch der lebendigere.
Gaetano Benedetti Todeslandschaften der Seele Psychopathologie, Psychodynamik und Psychotherapie der Schizophrenie »Jede Seite ist voll von Anregungen, Ideen, überraschenden Sichtweisen. Benedetti entwickelt mögliche Verstehenszugänge, Übersetzungshilfen bizarrer Äußerungen, Anforderungen an den Therapeuten. Das Buch ist eine Ermutigung, sich auf das Unverständliche, Verrückte, zunächst Angstmachende einzulassen.« Rundbrief der DGSP »Keiner, der in irgendeiner Form therapeutisch mit Schizophrenen umzugehen hat, wird an diesem Werk des Verfassers vorbeigehen können.« Zeitschrift für Individualpsychologie
Gaetano Benedetti Psychotherapie als existentielle Herausforderung Gaetano Benedetti hat unser Verständnis von psychotischem Leiden nachhaltig erweitert. In diesem Buch entfaltet er seine Lehre von der Psychotherapie der Psychosen. Sein theoretisches und therapeutisches Instrumentarium verschafft Zugang zu Vorstellungswelten, die zuvor allenfalls ahnbar waren. »Das Buch beeindruckt vor allem in dem tiefen Wissen um die psychotische Welt und in dem angstfreien Sich-darauf-Einlassen ... Der Verlag Vandenhoeck & Ruprecht hat gut daran getan, sich um die Zusammenstellung und Durcharbeitung der Erkenntnisse Gaetano Benedettis in Form dieses Buches zu bemühen.« Soziale Psychiatrie
Bernd Rachel (Hg.) Die Kunst des Hoffens Begegnung mit Gaetano Benedetti Schüler und ehemalige Mitarbeiter Gaetano Benedettis, die sich sein Denken für ihre klinische Arbeit erschlossen haben, zeigen in ihren eigenen Zugangsweisen den Reichtum seines Werkes und seiner Persönlichkeit. Verwurzelt in verschiedenen Kulturräumen, machen sie die breitgespannte Geisteswelt deutlich, aus der Benedetti schöpft und in der er wirksam ist – das humanistische Abendland mit weiter Ausstrahlung. Hoffnung als Grundprinzip der Psychotherapie Benedettis findet sich wie ein Leitstern in seinem ganzen Lebenswerk. Seine Kernsätze dazu, auch von hoher poetischer Kraft, sind hier zusammengetragen. In einem kurzen Glossar werden am Schluss die wichtigsten therapeutischen Konzepte Gaetano Benedettis erläutert.
Schriften des Sigmund-Freud-Instituts Klaus Herding / Gerlinde Gehrig (Hg.) Orte des Unheimlichen Die Faszination verborgenen Grauens in Literatur und bildender Kunst
Marianne Leuzinger-Bohleber / Stephan Hau / Heinrich Deserno (Hg.) Depression – Pluralismus in Praxis und Forschung
Schriften des Sigmund-Freud-Instituts. Reihe 2: Psychoanalyse im interdisziplinären Dialog, Band 2. 2006. Ca. 270 Seiten mit ca. 70 Abb., kartoniert. ISBN 3-525-45176-8
Schriften des Sigmund-Freud-Instituts. Reihe 1: Klinische Psychoanalyse: Depression, Band 1. 2005. 353 Seiten mit 17 Abb. und 26 Tab., kartoniert. ISBN 3-525-45164-4
Unverzichtbare Lektüre für jeden, der sich mit dem Phänomen des Unheimlichen in den verschiedenen Medien auf interdisziplinärem Niveau beschäftigen will.
Der Dialog zwischen Psychoanalytikern, Verhaltenstherapeuten, Psychiatern, Psychopharmakologen, Genetikern und Sozialwissenschaftlern erhöht die Chance professioneller Möglichkeiten, Menschen aus dem unerträglichen Dunkel der Depression herauszuführen.
Stephan Hau / Hans-Joachim Busch / Heinrich Deserno (Hg.) Depression – zwischen Lebensgefühl und Krankheit Schriften des Sigmund-Freud-Instituts. Reihe 1: Klinische Psychoanalyse: Depression, Band 2. 2005. 254 Seiten mit 17 Abb., kartoniert. ISBN 3-525-45163-6 Die zunehmende Verbreitung von Depression spiegelt den Seelenzustand unserer Epoche. Das Spektrum reicht von depressiven Stimmungslagen bis zu lang anhaltenden Störungen mit Krankheitswert.
Ulrich Moser Psychische Mikrowelten – Neuere Aufsätze Herausgegeben von Marianne Leuzinger-Bohleber und Ilka v. Zeppelin. Schriften des Sigmund-Freud-Instituts. Reihe 2: Psychoanalyse im interdisziplinären Dialog, Band 1. 2005. 498 Seiten mit 10 Abb. und 2 Tab., kartoniert ISBN 3-525-45165-2 Früchte lebenslanger psychoanalytischer Forschung
Psychoanalyse und Empirie Band 1: Christoph Werner / Arnold Langenmayr Das Unbewusste und die Abwehrmechanismen
Band 3: Christoph Werner / Arnold Langenmayr Die Bedeutung der frühen Kindheit
2005. 203 Seiten, kartoniert ISBN 3-525-45005-2
2006. 438 Seiten, kartoniert ISBN 3-525-45007-9
Ein Überblick über empirische Untersuchungen zu unbewussten Erlebnissen und ihren Auswirkungen auf bewusstes Erleben und Verhalten sowie zu freudschen Abwehrmechanismen.
Freudsche Konzepte zu Auswirkungen der frühen Kindheit auf die Persönlichkeitsentwicklung werden empirisch untersucht. Die Ergebnisse zeigen, welche psychoanalytischen Annahmen gestützt werden können und welche nicht.
Band 2: Christoph Werner / Arnold Langenmayr Der Traum und die Fehlleistungen 2005. 242 Seiten, kartoniert ISBN 3-525-45006-0 Empirische Untersuchungen der freudschen Konzepte zum Traum und den Fehlleistungen bestätigen seine Annahmen, die ein je zufälliges Zustandekommen ausschließen.
Band 4: Christoph Werner / Arnold Langenmayr Psychoanalytische Psychopathologie 2006. 188 Seiten, kartoniert ISBN 3-525-45008-7 Die empirische Überprüfung freudscher Aussagen zur Psychopathologie bestätigen diese einerseits, andererseits regen sie zu weiteren Untersuchungen an.





![Schönheit: Traum - Kunst - Bildung [1. Aufl.]
9783839408315](https://dokumen.pub/img/200x200/schnheit-traum-kunst-bildung-1-aufl-9783839408315.jpg)