Seipel, der „Bürgerblock“ und die „Genfer Sanierung“ 1922: „Größter Fehler ist nervös zu werden“ [1 ed.] 9783205216834, 9783205216810
125 20 3MB
German Pages [208] Year 2022
Polecaj historie
Citation preview
Lothar Höbelt
»Größter Fehler ist nervös zu werden« Seipel, der »Bürgerblock« und die »Genfer Sanierung« 1922
Schriftenreihe des Forschungsinstitutes für politisch-historische Studien der Dr.-Wilfried-Haslauer-Bibliothek, Salzburg Herausgegeben von Robert Kriechbaumer · Franz Schausberger · Hubert Weinberger Band 84
Lothar Höbelt
Seipel, der »Bürgerblock« und die »Genfer Sanierung« 1922 »Größter Fehler ist nervös zu werden«
Böhlau Verlag Wien · Köln
Veröffentlicht mit der Unterstützung durch den Zukunftsfonds der Republik Österreich und den Parlamentsklub der Österreichischen Volkspartei
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek : Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie ; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © 2023 Böhlau, Zeltgasse 1, A-1080 Wien, ein Imprint der Brill-Gruppe (Koninklijke Brill NV, Leiden, Niederlande ; Brill USA Inc., Boston MA, USA ; Brill Asia Pte Ltd, Singapore ; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland ; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich) Koninklijke Brill NV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Hotei, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau, V&R unipress und Wageningen Academic. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Korrektorat : Volker Manz, Kenzingen Einbandgestaltung : Michael Haderer, Wien Satz : Michael Rauscher, Wien Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com ISBN 978-3-205-21683-4
Gewidmet meinen Studenten, die sich ihre Freude an der Geschichte bewahrt haben, allem bürokratischen Spießrutenlaufen zum Trotz !
Inhaltsverzeichnis
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 I. Österreich nach 1918 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »Der Rest ist Österreich …«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zahlungsbilanz und Inflation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Die Regierung: Verfassung versus »politische Kultur«.. . . . . . . . . . . Die Parteien : Weltanschauliche Lager und soziale Integrationsparteien . .
. . . . .
. . . . .
. 13 . 13 . 15 . 20 . 24
II. Die Übergangszeit 1920–1922. . . . . . . . . . . . . . . . . . . »Tingel-Tangel-Politik« : Der virtuelle Bürgerblock mit beschränkter Haftung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »Beamte unserer Richtung« : Schober als Retter . . . . . . . . . . . . . Linkswende ? Das Intermezzo Gürtler . . . . . . . . . . . . . . . . . . Der Pyrrhussieg der Großdeutschen : Schober als Stolperstein . . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
III. Der Bürgerblock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seipel ante portas : Die Dolchstoßlegende . . . . . . . . . . . . . . . . . . Die Bildung des Kabinetts Seipel I : »Personalien immer Towuhabohu«. . Die ersten 100 Tage : Kein Veni, vidi, vici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Der »Autrichelieu« – Seipel auf Reisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
. . . . .
. 61 . 61 . 69 . 74 . 82
IV. Der Weg nach Genf.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »Seipels Geschoß« ? Kredite und Kontrolle.. . . . . . . . . . . . . . . . . Zwischen Bauer und Balfour : »Mit 15 Millionen könnte jeder Esel sanieren …« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Das Dilemma der Opposition : Zwischen Sabotage und Kollaboration. . . Das »Wiederaufbaugesetz« : Beim Geld hört sich die Gemütlichkeit auf.. Das Feigenblatt : Der außerordentliche Kabinettsrat. . . . . . . . . . . . .
. . . 94 . . . 94
. . . . . 30 . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
30 37 43 50
102 110 115 125
V. Resümee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Anhang I : Das Aufbauprogramm Dr. Seipels (›Reichspost‹, 26. Mai 1922) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Anhang II : Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen . . . . . . . . . . . . 150
8
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Quellen- und Literaturverzeichnis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Personenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Vorwort Die Genfer Protokolle 1922 waren ein Wendepunkt in der Geschichte der Ersten Republik. Otto Bauer hat sie als Revanche für den 12. November 1918 beschrieben, als die österreichische Gegenrevolution, in demselben koketten Sinn, wie Bauer auch seine »Österreichische Revolution« charakterisierte, die eigentlich keine österreichische und nicht die seine, nämlich keine proletarische war, sondern eine Revolution der bürgerlichen Nationalbewegungen der nicht-deutschen Völker der Monarchie, möglich gemacht durch den Sieg der Entente-Armeen. Auch die österreichische Gegenrevolution vier Jahre später war ein Sieg der Entente-Mächte, oder doch beinahe der Entente, nicht der Armeen, sondern der Finanz – insofern eine »bürgerliche Revolution« im klassischen Sinne. Hermann Kandl als Obmann der Großdeutschen Volkspartei hat das Dilemma des heimischen Bürgertums deutlich zum Ausdruck gebracht : »Wir verfügen über keine Gewalt. Wir brauchen darum den auswärtigen Druck.«1 Sein christlichsoziales Pendant Ignaz Seipel hat diese Logik früh erkannt – und seine Folgerungen daraus gezogen : »Wenn wir auf reale Macht warten, gehen wir zugrunde. Man muß an einem Eck anfangen.«2 Wenn er es auch nie in langatmigen Memoranden ausführte, geht doch aus vielen Zwischenbemerkungen recht deutlich hervor, dass es sich für ihn beim Engagement des »Auslandes« in erster Linie nicht um die Kredite handelte, sondern mindestens ebenso sehr um die Kontrolle, die mit den Krediten notwendigerweise einherging. Genau dieser Aspekt der »Fremdherrschaft« als Verstoß gegen die nationale Würde und weiterer Sargnagel des Selbstbestimmungsrechts war ein Hauptangriffspunkt der Sozialdemokraten, der auch im bürgerlichen Publikum beträchtlichen Widerhall fand. Die eigentliche Leistung Seipels, die Instrumentalisierung der Siegermächte, wurde auch von den »eigenen Leuten« und von seinen Bewunderern in der Historiographie deshalb meist verschämt in den Hintergrund gerückt – kurioserweise und doch politisch verständlich … Bewundert wurde die Zickzackdiplomatie, die Seipel auf dem Höhepunkt der Inflation, im August 1922, in Szene setzte, die Art und Weise, wie er Italien und die französische Klientel der Kleinen Entente gegeneinanderhetzte – und dabei auf das stillschweigende Einverständnis Englands setzte. Mit Recht wurde, von Seipel selbst und von der jüngeren Historiographie, der schottische Elder Statesman Arthur Balfour als zentrale Figur im Hintergrund vor den Vorhang gebeten. Die Archive des Völkerbundes, der diversen Außenministerien und der Bank of England sind längst zur Erhellung der internationalen Dimension der Sanierung herangezogen 1 AdR, GDVP 39, Reichsparteileitung 10.10.1922. 2 KvVI, CS-Klub 12.6.1922.
10
Vorwort
worden. Auch die vulgärkeynesianische Orthodoxie der siebziger Jahre, die das, was später einmal als »Norman Conquest of Central Europe« beschrieben wurde, mit progressivem Abscheu betrachtete, ist im Zuge jüngster Erfahrungen, so hat es den Anschein, einer differenzierten Betrachtung gewichen. Seltsam unterbelichtet bleibt weiterhin die innenpolitische Umsetzung des Sanierungswerkes – die Bildung eines stabilen »Bürgerblocks«, der für ein Jahrzehnt die Geschicke des Landes lenkte. Der Weg, der von der parlamentarischen Demokratie hinwegführte, war nun ganz augenfällig von der Weltwirtschaftskrise geprägt, die 1931/32 zum Zerbrechen dieser Koalition und zur Bildung der Minderheitsregierung Dollfuß führte. Dennoch hat die propagandistische Inszenierung des Jahres 1934 auch auf der bürgerlichen Seite tiefe Spuren hinterlassen. Man ließ sich ein auf den Streit um den Phantomschmerz : Wer denn die Schuld daran trage, dass die angeblich so fruchtbare Zusammenarbeit der Großen Koalition 1919/20 nicht weitergeführt worden war, bis Kunschak und Seitz – die es ja beide noch erlebten – den Stab dann an Figl und Schärf übergeben konnten. Da mussten dann Otto Bauer und Ignaz Seipel als Sündenböcke herhalten, allenfalls mit dem verständnisheischenden Zusatz, sie seien beide »zu groß für Österreich« gewesen. An der für alle Zeitgenossen selbstverständlichen Realität, dass beide Lager in ihrer überwältigenden Mehrheit eine solche Koalition nicht wünschten, wollte sich keiner mehr erinnern – oder wenn, dann doch nur, um sie mit warnendem Unterton als tragische Verirrung zu bezeichnen. Der Bürgerblock ist von der Sozialdemokratie damals jedoch keineswegs als Verirrung angesehen worden, sondern als logischer Ausfluss des Klassencharakters der Politik. Diese Analyse ist grobschlächtig, aber nicht prinzipiell falsch. Die »Bourgeoisie« wurde 1920 zusammengeschweißt durch die Erfahrungen der Umbruchszeit, durch die Furcht vor der Revolution, oder vielleicht besser gesagt : durch das Ressentiment gegen die Profiteure dieser Furcht, die ihre Hegemonie nicht auf Mehrheiten aufbauten, sondern auf der Furcht vor der »Heugabel-Variante« der Revolution, wie sie nicht bloß in der Sowjetunion, sondern auch in der unmittelbaren Nachbarschaft, in Bayern und im Burgenland, zu beobachten gewesen war. Der Großdeutsche Sepp Straffner brachte diese Stimmung bei der Einbringung der »Wiederaufbaugesetze« im November 1922 auf die Formel : Man wolle dem Zustand ein Ende setzen, »dass die Sozialdemokraten auch dann in Österreich herrschen zu können glauben, wenn sie nicht in der Regierung sind.«3 Über die Furcht vor der Revolution hinaus war der gemeinsame Nenner der »Bürgerlichen« kein so großer. Wenn es ums Geld geht, hört die Gemütlichkeit auf, soll Bismarck – Marx in dem Punkt keineswegs widersprechend – eine Binsenweis3 Zitiert nach RP, 7.11.1922, 2. Die Zeitung des niederösterreichischen Bauernbundes (›Bauernbündler‹) sprach am 24.10.1922 vollmundig und etwas gröber davon, dass »insgeheim im Lande versteckter Bolschewismus kommandiert«.
Vorwort
11
heit auf den Punkt gebracht haben. Die Sozialdemokratie beklagte, die Lasten der Sanierung würden in den Genfer Protokollen einseitig auf die Schultern der Arbeiterklasse abgewälzt. Doch damit allein war es nicht getan. Die Verteilungskämpfe erfassten ganz massiv auch die Klientel der bürgerlichen Parteien. Die Fronten verliefen dabei keineswegs zwischen den Koalitionspartnern – den Christlichsozialen und den Großdeutschen –, sondern quer durch beide Parteien. Seipels Leistung und die seines Juniorpartners Dinghofer (unterstützt durch ihre Sekundanten Fink und Frank) waren das Finassieren zwischen diesen Interessengruppen, das Jonglieren mit mehreren Bällen, im Sinne des größeren Ganzen. Seipel war natürlich alles andere als ein Ökonom. Er war das »Mastermind« der Ersten Republik, aber er hatte deshalb nicht unbedingt einen »Masterplan«, den er systematisch umsetzte. Sein Mitarbeiter Richard Schüller verglich den Weg zur Genfer Sanierung deshalb nicht mit einer Schach, sondern mit einer Billardpartie, wo man auf die sich kaleidoskopisch verändernde Lage reagieren muss. Das Urteil des aus einer jüdischen Brünner Industriellenfamilie stammenden Volkswirtschaftlers und bürokratischen Routiniers Schüller über den Kollegen von der theologischen Fakultät lautete : »Er hatte keine wirtschaftlichen Kenntnisse.« Aber er setzte sofort hinzu : »Wenn ich ihm eine Frage zehn Minuten erklärte, verstand er sie vollkommen, wobei er nicht selten zu einem anderen Resultat kam als ich und manchmal frappant Recht hatte.«4 Glücklicherweise findet sich zur Analyse der Vorgänge, die zur Bildung des »Bürgerblocks« und zur Verabschiedung der Genfer Protokolle führten, ein zwar nicht lückenloses, aber dennoch recht reichhaltiges Material aus der Hinterlassenschaft beider Koalitionspartner. Die Großdeutschen haben die Protokolle ihrer Klubsitzungen und Reichsparteileitungsberatungen in Reinschrift übertragen ; leider klafft hier gerade für Mai 1922 eine Lücke, und auch die Protokolle ihres Grazer Parteitages haben sich nicht erhalten. Bei den Christlichsozialen finden sich im Karl von Vogelsang-Institut die Mitschriften eines Großteils der Klub- und Klubvorstandssitzungen, auf großen Bögen in Gabelsberger-Kurzschrift. Hier ist die Lücke im Frühjahr 1921 angesiedelt, während Seipels »Auszeit« kurz vor seiner Wahl zum Parteiobmann. Es ist mir an dieser Stelle ein Bedürfnis, sowohl meinem Studienkollegen – und jetzigen Direktor des Archivs der Republik – Rudolf Jerabek zu danken, der mich schon vor Jahrzehnten auf die Nützlichkeit des Umgangs mit der GabelsbergerKurzschrift hingewiesen hat, als auch Johannes Schönner, dem Archivar des Karl von Vogelsang-Instituts, der meine Recherchen mit großem Engagement und viel Geduld unterstützt hat. Im Österreichischen Staatsarchiv bin ich insbesondere Generaldirektor Helmut Wohnout und Harald Fiedler für ihre stete Hilfsbereitschaft 4 Nautz (Hg.), Schüller 133, 129.
12
Vorwort
zu Dank verpflichtet ; von meinen ehemaligen Studenten Susanne Bauda und Johannes Kalwoda ; für wichtige Hinweise John Boyer, Gerhard Hartmann, Gerald Kohl, Nathan Marcus, Paul Mychalewicz und Graf Christian Ségur-Cabanac ; Michael Rauscher, Julia Roßberg und Sarah Stoffaneller vom Böhlau-Verlag ; last, not least den Kollegen Robert Kriechbaumer und Landeshauptmann Franz Schausberger von der Salzburger Wilfried-Haslauer-Stiftung, der inzwischen wohl vornehmsten Initiatorin und Herausgeberin zeitgeschichtlicher Publikationen in Österreich. Lothar Höbelt, Pardubitz im Sommer 2022, 100 Jahre nach Seipels Rundreise durch Mitteleuropa
I. Österreich nach 1918 »Der Rest ist Österreich …« Die schönsten Zitate sind leider oft nicht belegt. So wie das angebliche Wort Clemenceaus, das den Sachverhalt doch so treffend umschreibt : »Der Rest ist Österreich.«1 Die Republik Deutsch-Österreich, das war das, was übrig blieb, sobald alle anderen Nachfolgestaaten der Habsburgermonarchie ihre Ansprüche befriedigt hatten (oder doch beinahe – ab und zu gebot ihnen die Entente dabei Einhalt). Von 12 Millionen Deutschen in der Monarchie wurde so nur knapp mehr als die Hälfte dem neuen Staat zugeschlagen, der sich anfangs bekanntlich ebenso wenig mit Österreich identifizieren wollte wie seine Nachbarn. Während in Prag der neue Präsident Tomáš Garrigue Masaryk von der »Entösterreicherung« sprach, fauchte in Wien der AltJustizminister, Delegierte bei der Friedenskonferenz und Beinahe-Abgeordnete Franz Klein : »Uns einfach Österreich nennen ! Man kann sich keine größere Unverschämtheit denken.«2 Masaryks Tschechen bildeten insofern eine Ausnahme, weil sie das böhmische Staatsrecht wiederbelebten und einen neuen Staat bildeten. Die übrigen Nationalitäten der Monarchie (Polen, Rumänen, Serben, Italiener) schlossen sich ihren KoNationalen jenseits der alten Grenzen an. Nur den Ukrainern blieben beide Optionen verwehrt. Slowaken, Slowenen und Kroaten schlugen einen Mittelweg ein : Sie wechselten von einem Vielvölkerstaat zum anderen und entwickelten sich zu Junior partnern unter der Ägide slawischer Verwandter. Die Rest-Österreicher wollten dem Beispiel der Polen folgen, sobald sich alle Hoffnungen auf einen Fortbestand der Monarchie – allenfalls auch ohne Monarch – zerschlagen hatten. Als Zusatzreiz stand anfangs dabei auch die Überlegung Pate, mit dem Anschluss an das Deutsche Reich vielleicht doch noch die Sudetengebiete retten zu können. Der Anschluss ist in der Zwischenkriegszeit nahezu schon ad nauseam beschworen worden, mit jener Penetranz, wie sie allen Formen von Berieselung mit politisch korrekten, zeitgeistigen Vorstellungen nun einmal eigen ist, um danach – nicht zuletzt infolge der Tätigkeit des gebürtigen Österreichers Adolf Hitler – in Misskredit zu geraten und späteren Generationen deshalb bald als unerklärliche Verirrung zu gelten. Gegenüber all diesen Wertungsexzessen pro und contra ist zu betonen : Für die Zeitgenossen handelte es sich unter den gegebenen Umständen um eine Selbstverständlichkeit : Ob man ihn jetzt enthusiastisch als Wiedervereinigung nach der Teilung von 1866 begrüßte, wie Otto Bauer, oder einfach nüchtern konstatierte : 1 Zollinger, »L’Autriche, c’est moi«. 2 Fellner/Maschl (Hgg.), Briefe Franz Kleins 102 (31.5.1919).
14
Österreich nach 1918
»Es wird uns nichts anderes übrig bleiben«, wie der christlichsoziale Obmann Johann Nepomuk Hauser, mit vielen Abstufungen dazwischen, er galt als alternativlos – und doch binnen kurzem als ebenso aussichtslos. Denn nicht bloß die Hoffnung auf die Rettung Reichenbergs und Karlsbads erwies sich als Illusion. Das Sudetenland wurde von der Friedenskonferenz ohne Wenn und Aber der Tschechoslowakei zugeschlagen, der Anschluss verboten – oder besser gesagt : an die Zustimmung des Völkerbundrates gebunden. Dort aber besaß Frankreich, das diese Bestimmung durchgesetzt hatte, ein Vetorecht. Damit war zumindest ein klares Feindbild gegeben : Frankreich und seine Verbündeten in Mitteleuropa, die Tschechoslowakei (und Jugoslawien, auch wenn es damals noch nicht so hieß). Die Briten und Amerikaner hatten Frankreich nachgegeben. Sie waren in dieser Frage Agnostiker. Sir William Goode als Vertreter der Reparationskommission versicherte den Großdeutschen, er sei kein prinzipieller Gegner des Anschlusses, doch dieser sei eben nicht durchführbar. Wenn die Deutschen alle Schulden der Österreicher zahlten, dann wäre er vielleicht von Vorteil, spann er den Gedanken weiter, doch man dürfe es den Gläubigern auch nicht verdenken, dass sie einem Staat keine Kredite geben wollten, den es demnächst vielleicht nicht mehr gab.3 Der britische Premier David Lloyd George meinte gelegentlich, der Anschluss werde früher oder später sicher kommen, bis dahin aber rate er den Österreichern, darüber besser den Mund zu halten.4 Diesen Rat beherzigten die Österreicher nicht, im Gegenteil : Der Anschluss und das Unrecht von Saint-Germain durften in kaum einer Sonntagsrede fehlen. Man vermied es freilich peinlich, das vielleicht größte Hindernis des Anschlusses offen anzusprechen : das Deutsche Reich selbst, das sich alle Experimente in dieser Richtung verbot. Sicher, man wollte sich die Option für die Zukunft offenhalten, aber die Franzosen jetzt nicht überflüssig reizen. Berlin wollte keineswegs das Risiko eingehen, um der Österreicher willen das Rheinland zu verlieren oder etliche Milliarden mehr an Reparationen zu zahlen. Alle reichsdeutschen Staatsmänner und Kanzler, von Fehrenbach über Wirth bis Stresemann, wurden nicht müde, zumindest unter vier Augen ihren österreichischen Gesprächspartnern diese Haltung immer wieder zu »verdeutschen«.5 Mit dem Anschluss war vorerst also nichts zu machen, da konnte man noch so viele Resolutionen verabschieden, Volksabstimmungen veranstalten und die »Zivilgesellschaft« in ihrer Empörung über das verweigerte Selbstbestimmungsrecht bestärken. Die österreichische Politik zog – über alle Lagergrenzen hinweg – aus diesem Befund eine verblüffende Schlussfolgerung : Der verweigerte Anschluss wurde zum All3 AdR, GDVP 2, Klub 28.10.1920, 9.11.1920. 4 AdR, GDVP 2, Klub 3.5.1922 ; Ladner, Staatskrise 66. 5 AVA, E/1791/5, Tagebuch Heinrich Wildner, 8.2.1921 ; ADÖ IV 340 (23.8.1922).
Zahlungsbilanz und Inflation
15
heilmittel stilisiert für alle Probleme der jungen Republik. Sobald die Entente den Österreichern diesen Weg versperrte, hätte sie die moralische Verpflichtung übernommen, aus Eigenem für die Österreicher zu sorgen. 1922 warnte der britische Gesandte in Wien : »Austrians are fond of using the Entente’s fear of Anschluss as a means of pressure.«6 Dieses Argument ist berühmt-berüchtigt geworden unter dem Schlagwort von der Lebensfähigkeit Österreichs in seinen neuen Grenzen, die ganz einfach nicht gegeben sei. Nun gaben selbst passionierte Anschlussanhänger zu, dass Österreich selbstverständlich lebensfähig sei. Fragt sich nur, auf welchem Niveau ? Demjenigen Albaniens vielleicht ? Karl Renner formulierte es einmal eleganter : Lebensfähig, ja, aber nicht entwicklungsfähig …7 Damit kommen wir zum Kern des Problems. Das neue Österreich verfügte über eine gewaltige Lücke in seiner Zahlungsbilanz : Die Industrie lag jetzt in der Tschechoslowakei, die Landwirtschaft in Ungarn. Die Dienstleistungen aber, die Wien bisher bereitgestellt hatte, von der k. k. Zentralverwaltung über die Großbanken bis zum Luxuskonsum vor imperialer Kulisse, waren nicht mehr nachgefragt. Die Alpenregionen waren – von vereinzelten Industrie-Solitären wie Alpine und Steyr abgesehen – bestenfalls Selbstversorger, meist nicht einmal das. Ihre Trümpfe, Wasserkraft und Tourismus, entwickelten sich erst Jahrzehnte später – im Zeichen von Kriegskonjunktur, Marshall-Plan und Wirtschaftswunder – zu einem Devisenbringer. Ein Beobachter beschrieb Österreich als den ärmsten Teil der Monarchie, der zufällig die Hauptstadt enthalte.8 Dinghofer variierte den Topos vom »Wasserkopf« Wien, eine Stadt von zwei Millionen Einwohnern, die man in ein Gebirgsland gepresst habe, dessen übrige Bevölkerung nur doppelt so viel Einwohner zähle.9
Zahlungsbilanz und Inflation Österreich mangelte es vor allem an Energie und Nahrungsmitteln, Kohle und Getreide. Die internationale Konjunktur der ersten Nachkriegsjahre (bis zum ersten Einbruch Mitte 1921) war gar nicht so schlecht. Aber es gab nicht annähernd genügend Exporte, um die notwendigen Einfuhren mit deren Erlösen zu finanzieren. Ein vertraulicher Bericht der Briten bezifferte den Importbedarf an Nahrungsmitteln auf nicht weniger als eine Million Pfund pro Monat.10 Wie konnte 6 DBFP XXIV 240 (Akers-Douglas 23.6.1922). 7 ADÖ IV 390, 411 (13.9.1922). 8 Bansleben, Reparationsproblem 135 f. (All Verantw). 9 AdR, GDVP 3, Klub 20.6.1922. 10 PRO, T 160/62/2073/04/1, Keeling 22.9.1921.
16
Österreich nach 1918
man das Loch stopfen ? Man konnte eine Zeitlang »von der Substanz leben«. Das Wort vom Ausverkauf Österreichs machte die Runde : Kunstschätze wurden an Neureiche verhökert – oder zumindest als Sicherheit für Kredite verpfändet. Denn Sicherheit(en) waren Mangelware. Die Relief-Kredite, die Österreich in den nächsten Jahren eingeräumt wurden, trugen vielfach den Charakter milder Gaben. Auch wenn die Entente noch bis weit in das Jahr 1919 hinein ihre Blockade aufrechterhielt, es gab danach auch jede Menge reiner Hilfslieferungen, bis hin zum Kinderverschickungsprogramm durch wohlwollende Neutrale wie z. B. Schweden oder die Niederlande. Die Reparationskommission, eigentlich dazu gedacht, von Österreich die Kriegsentschädigung einzutreiben, die ihm im Vertrag von Saint-Germain auferlegt worden war, erfuhr binnen kurzem eine Art von Schubumkehr, als »Schaf im Wolfspelz«.11 John Maynard Keynes, als Berater der britischen Delegation in Paris, wurde schon bald mit dem Satz zitiert : »How long shall we pay reparations to Austria ?«12 Die »Rep-Ko« verwaltete die Gelder, die als »Relief Credits« zur Versorgung vor allem der Wiener Bevölkerung eingingen. Ihrem Vorsitzenden, Sir William Goode, wurde hinter vorgehaltener Hand bald der Vorwurf gemacht, er sei dabei zu großzügig vorgegangen und habe nicht hinreichend auf die Einhaltung der Bedingungen geachtet. Die Jugoslawen klagten darüber, die Verbündeten der Entente müssten unter dem Titel Befreiungskosten sehr wohl Reparationen zahlen für die Teile der Monarchie, die sie übernommen hatten, während die eigentlichen Schuldigen auf ihre Kosten gefüttert würden.13 Seipel gab ihnen dabei in gewisser Weise sogar recht, wenn er intern einräumte : Niemand habe eine so große Kriegsentschädigung bekommen wie Österreich, nur in ungeschickter Form und zu schlechten Bedingungen, so dass man davon nicht den richtigen Gebrauch machen konnte.14 Österreich musste am Weltmarkt dennoch eine große Menge zukaufen. Dafür benötigte das Land Devisen, über die es nicht verfügte. Die Preise der Nahrungsmittel erreichten in einheimischer Währung deshalb bald unerschwingliche Höhen, die man den Konsumenten weder zumuten wollte noch konnte. Die Lebensmittel wurden deshalb aus dem Budget subventioniert – bis diese Zuschüsse 1921/22 dann schon rund ein Viertel der staatlichen Ausgaben ausmachten, sprich : die Hälfte des Defizits ! Es entsteht ein völlig falsches Bild, wenn man den gängigen sozialkritischen Tiraden der einschlägigen Belletristik folgt, die darüber Klage führen, die »da oben« hätten sich um das Elend der Massen einfach nicht gekümmert. Das Problem bestand vielmehr darin, dass sie es sehr wohl taten (ob jetzt aus Caritas oder Revolu11 Bansleben, Reparationsproblem 163 ; vgl. auch ebd. 88 ff. 12 Nautz (Hg.), Schüller 120. 13 Bansleben, Reparationsproblem 146. 14 KvVI, CS-Klub 11.10.1922.
Zahlungsbilanz und Inflation
17
tionsfurcht, sei dahingestellt), aber mit unzulänglichen Mitteln, die geeignet waren, die Misere auf lange Sicht sogar noch zu verschlimmern. Was sowohl die fallende Währung als auch das explodierende Budgetdefizit antrieben, war die Inflation. Nathan Marcus hat zweifelsohne recht : »The mechanisms of inflation were poorly understood.«15 (Die gar nicht so unaktuelle Frage, ob sich daran in den letzten hundert Jahren allzu viel geändert hat, wollen wir in einer historischen Studie lieber nicht aufwerfen.) Man konnte jetzt lange darüber streiten, ob es in erster Linie die Tatsache war, dass der Staat zur Deckung seine Ausgaben in immer stärkerem Maß Geld drucken und in Umlauf bringen ließ, oder ob der Impuls zu steigenden Preisen von den hohen Devisenkursen ausging. Auf ihrem Höhepunkt im Sommer 1922 war die Inflation dann sogar noch ärger als der Kursverfall (und behinderte deshalb die Exporte). Im September und Oktober 1922 kam es wiederum zu einem Intermezzo, das beide Theorien zu widerlegen schien : Stark steigender Notenumlauf und Zahlungsbilanzdefizit waren weiterhin zu beobachten, doch die Stabilisierung gelang. Bundeskanzler Seipel hätte die Falsifizierung aller Theorien, die ihm die Experten vortrugen, gefallen, nicht bloß, weil die Sanierung politisch ihm gutgeschrieben wurde, sondern auch, weil er ökonomischen Dogmen mit großer Skepsis gegenüberstand : »Man sieht, wie alle Theorien nicht wahr sind. Es kommt nicht auf Quantitätstheorie [an] und nicht auf Bedeckung, das Um und Auf ist Vertrauensfrage.«16 Die Dinge waren zweifellos kompliziert, wie ein Amtsnachfolger Seipels konstatierte, dennoch : Zwischen dem Loch in der Zahlungsbilanz und dem Loch im Budget bestand unzweifelhaft ein inniger Zusammenhang. Die Arbeiter-Zeitung (AZ) als Zentralorgan der Sozialdemokratie widersprach dieser Orthodoxie keineswegs : »Die wahre und letzte Ursache der Geldentwertung ist die Passivität unserer Zahlungsbilanz.«17 Dahinter stand eine plausible Rechnung : Um die Importe zu finanzieren, mussten der Staat (oder seine Bürger) Devisen kaufen. Durch die Nachfrage stieg der Preis der Fremdwährungen. Die steigenden Preise wurden durch die Notenpresse gedeckt. Daraus ergab sich ein circulus vitiosus, der sich immer schneller drehte. Als Ausweg – zumindest für eine Übergangsperiode – setzte man auf Auslandskredite : Dann brauchte man ein, zwei Jahre keine Fremdwährungen mehr am freien Markt einzukaufen. Inzwischen konnte man die Notenpresse stilllegen und den Umlauf stabilisieren. Freilich : Auch da waren Reformen angesagt, um nicht sofort wieder in den alten Schlendrian zu verfallen. Die Debatte drehte sich immer wieder darum : Gab es ohne Kredite überhaupt einen Anreiz, die schmerzhaften Reformen in Angriff zu nehmen ? Oder umgekehrt : Warum sollten Geldgeber überhaupt Kredite 15 Marcus, Reconstruction 45. 16 KvVI, CS Klub 18.10.1922. 17 AZ, 29.1.1922.
18
Österreich nach 1918
zur Verfügung stellen, wenn vor Ort keine entsprechende Reformbereitschaft auszumachen war ? Ein amerikanischer Beobachter soll gescherzt haben, das österreichische Verlangen nach immer mehr Krediten komme ihm vor wie Menschenfresser, die sich für eine Belebung des Tourismus einsetzten.18 Schließlich, aber das wollten sich die Österreicher am allerwenigsten eingestehen : War das österreichische Pro blem für die Großmächte nicht vielleicht »too complicated and at the same time too insignificant« ?19 Die Ideallösung bestand selbstverständlich in der Synchronisierung der inneren Reformen und der äußeren Hilfe. Seipels Leistung bestand vielleicht mehr als alles andere darin, dass er diesen Aspekt – und diese Wechselwirkung – konsequent im Auge behielt, gerade weil er das Problem in erster Linie immer als ein politisches betrachtete, als eine Frage des Vertrauens – ein Vertrauen, das gerade er seinen Landsleuten, ja auch seinen Gesinnungsgenossen nicht in uneingeschränktem Maße entgegenbrachte. Vielleicht hatte er – der Priester im Elfenbeinturm – gerade deshalb ein gutes Sensorium für die Haltungen der Großmächte, die er mit großer Unvoreingenommenheit betrachtete. Er verfügte über ein Wertgerüst, das von einer überzeitlichen Institution geprägt und über den spießbürgerlichen Ehrenstandpunkt der Zeitgenossen erhaben war : Ob die Entente jetzt eine Verbrechergesellschaft war, wie Hauser klagte, oder ein imperialistisches Kartell, wie die Sozialdemokraten analysierten, war eine Frage, die ihn nicht allzu sehr beschäftigte.20 Inflation war ein Übel, das auf die Dauer untragbar war und den Wiederaufbau der Wirtschaft blockierte, zweifellos – aber auch hier lag der Teufel im Detail, ja, dieser Teufel erwies sich für manche zuweilen sogar als ein Teil jener »faustischen« Kraft, die stets das Böse will und doch das Gute schafft. Ihre fatalste gesellschaftliche Auswirkung, die Enteignung eines Großteils des Mittelstandes, hatte die Inflation bei Kriegsende bereits bewerkstelligt. Der Wert der Vorkriegsvermögen in Geld – oder Kriegsanleihe – war Ende 1918 bereits auf ein Sechzehntel geschrumpft, sprich : auf ca. 6 %. Alles, was nachher kam, die galoppierende Inflation der Jahre bis 1922, fiel insofern bereits unter das Verdikt : »Ist der Ruf einmal ruiniert, lebt sich’s gänzlich ungeniert.« Helmut Heiber hat das Verhältnis von Kriegs- und Nachkriegsverlusten für das Bürgertum einmal mit dem Verlust eines Zwanzig-Mark-Scheins verglichen, der auf den Verlust eines Vermögens folge.21 Die Inflation wurde verschärft durch die stille Enteignung der Hausbesitzer über den Mieterschutz, der nicht bloß Kündigungen verbot, sondern durch kaiserliche Verordnung vom Frühjahr 1917, angesichts der Jänner-Streiks von 1918 dann auf ganz 18 AVA, GDVP 3, Klub 31.8.1922. 19 Marcus, Reconstruction 87. 20 Höbelt/Kalwoda/Schönner (Hgg.), Klubprotokolle 420 (6.5.1919). 21 Heiber, Republik von Weimar 99.
Österreich nach 1918
19
Österreich ausgedehnt, den sogenannten Friedenskronen-Zins festlegte.22 »Kriegsund Inflationsgewinnler« waren in diesem Sinne nicht bloß die (meist städtischen) Mieter, sondern alle Schuldner überhaupt : Zu diesen Schuldnern aber gehörte als Massenphänomen in erster Linie ein guter Teil der Landwirtschaft, der Bauern. ExFinanzminister Gürtler – damals schon ganz auf Seiten der Agrarier – gab in einer Nebenbemerkung 1922 zu, die Landwirtschaft sei »in gewissen Sinne durch den Krieg saniert« worden.23 Freilich : Die Bauern litten auf der anderen Seite wiederum darunter, dass ihnen im Rahmen der staatlichen Bewirtschaftung die Ernte konfisziert wurde, und das zu Preisen, die schon lange nicht mehr kostendeckend waren. Die Höchstpreise für Lebensmittel waren als Sofortmaßnahme im ersten Kriegswinter dekretiert worden, um die Konsumenten – wie z. B. die Angehörigen der Soldaten – vor Preissteigerungen zu schützen. Für ein halbes Jahr mochte dieser Eingriff als patriotisches Notopfer durchgehen. Doch auf lange Sicht erwies sich die staatliche Bewirtschaftung als kontraproduktiv, weil für die Bauern kein Anreiz gegeben war, mehr anzubauen und zu ernten – es sei denn, man konnte auf den Schwarzmarkt ausweichen. Das Problem war Regierung und Bürokratie sehr wohl bewusst, doch niemand wollte – weder vor 1918 noch danach – den Zorn der Konsumenten auf sich laden, wenn man zum freien Markt zurückkehrte – und dabei zumindest in der Übergangszeit mit exorbitanten Preissteigerungen rechnen musste. Die galoppierende Inflation, die in der Nachkriegszeit immer mehr an Fahrt aufnahm, war ein Desaster für alle »Festbesoldeten«, vor allem Beamte und Pensionis ten. (Arbeiter konnten da wenigstens streiken !) Alle Gehaltserhöhungen, wenn sie überhaupt zustande kamen, hinkten der Geldentwertung stets hintennach. Eine Statistik beziffert den Wert des durchschnittlichen Beamtengehalts 1922 bloß noch auf ein Viertel des Vorkriegswertes. Das gleiche Muster begünstigte auf der anderen Seite alle Steuerzahler, die ihre Verbindlichkeiten am Ende des Jahres in längst entwerteten Kronen bezahlen konnten. Josef Kollmann, ein Geschäftsmann aus Baden, später dann selbst kurz Finanzminister, erinnerte seine Kollegen im christlichsozia len Klub in einem Anfall von Ehrlichkeit : »Wir zahlen alle miteinander keine Steuern mehr.«24 Das Budgetdefizit wurde infolgedessen natürlich weiter vergrößert. Der Staat nahm seine Zuflucht zur Notenpresse. Der Kreislauf der Inflation begann sich immer schneller und schneller zu drehen. Die Bürger traten die vielbeschworene »Flucht in die Sachwerte« an. (Nur Immobilien fielen wegen des Mieterschutzes da aus !) Langfristige Investitionsentscheidungen wurden von derlei kurzfristigen Fluchtbewegungen abgelöst. Auf die Dauer 22 Gulick, Habsburg to Hitler 424. 23 KvVI, CS-Klub 27.10.1922. Auch die günstige Nachkriegskonjunktur gab Buresch zu (StPNR I 4590, 7.11.1922). 24 KvVI, CS-Klub 18.10.1922.
20
Österreich nach 1918
war ein solches »System«, das keines war, tatsächlich nicht »lebensfähig«. Nur : Wer sollte die Kosten der Sanierung tragen, die inzwischen jeder auf den anderen zu überwälzen suchte ? Auch und gerade in den Reihen des Bürgertums, was immer davon übrig war, bestand da zwar eine gewisse Sehnsucht nach »Vorkriegsqualität«, aber weder eine Übereinstimmung der Interessen noch der Methoden, wie man dem Problem zu Leibe rücken sollte.
Die Regierung: Verfassung versus »politische Kultur« Gefragt war da die Regierung – nicht bloß im Sinne der Pawlow’schen Reaktion, der Staat solle sich um alles kümmern. In diese Richtung einer immer engmaschigeren, wenn auch immer weniger effektiven Bewirtschaftung hatten sich die Dinge ohnehin jahrelang bewegt. Doch gerade dann, wenn man eine Umkehr in Richtung »Vorkriegsqualität« und eine Rückkehr zur freien Wirtschaft, sit venia verbo : zu einer Liberalisierung, die nicht bloß am Schwarzmarkt stattfand, für nötig hielt, gerade dann war eine politische Kraftanstrengung unumgänglich. Wer war die Regierung und wie kam sie zustande ? Österreich war vor 1918 eines der Paradebeispiele für eine konstitutionelle Monarchie gewesen. Wohlgemerkt : eine konstitutionelle Monarchie im engeren Sinne, nicht bloß als Befund über die Existenz von Krone und Verfassung, sondern als Gegensatz zur parlamentarischen Monarchie mit ihrem leuchtenden Vorbild in Großbritannien. In England entschieden seit geraumer Zeit die Wahlen über die Zusammensetzung der Regierung. In Österreich ernannte der Kaiser den Ministerpräsidenten, der sich dann im Parlament eine Mehrheit suchen musste. In beiden Fällen konnten der Monarch und sein Kandidat Neuwahlen ausschreiben, um sich vom Volk ein Vertrauensvotum geben zu lassen. Der entscheidende Unterschied lag weniger in den Paragraphen der Verfassung. (Notabene : Gerade das vielbewunderte Vorbild England verfügte über kein solches Grundgesetz.) Er lag im Parteiensystem. Bei einem Zwei-Parteiensystem wie in England hatte der Monarch – unabhängig von seinen persönlichen Präferenzen – kaum eine andere Wahl, als den Wahlsieger mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Im österreichischen Reichsrat, mit seinen acht bis neun Nationalitäten, mit ihren jeweils eigenen Parteiensystemen, gab es solche kompakten Mehrheiten nicht, oder zumindest im 20. Jahrhundert nicht mehr. Dazu kam die Gefahr : Beteiligte man die Vertreter einer Nationalität allzu prominent an er Regierung, beschwor man damit die Fundamentalopposition ihrer nationalen Rivalen herauf, die dann womöglich zur Obstruktion griffen und jegliche parlamentarische Arbeit unmöglich machten. Es kristallisierte sich deshalb die Praxis heraus, ein Beamtenkabinett zu ernennen, das allenfalls den einen oder anderen Vertrauensmann der größeren Blöcke in seine
Die Regierung: Verfassung versus »politische Kultur«
21
Reihen aufnahm. Parlamentarier als Minister genossen Seltenheitswert (allenfalls in Ehren ergraute Mitglieder des Herrenhauses mit Vordienstzeiten in der Bürokratie kamen da öfter zum Zug). Es gab daher seit 1895 auch keine förmlichen Koalitionen mehr, sondern bestenfalls lockere Arbeitsmehrheiten, die einem Kabinett – oder zumindest dem einen oder anderen Minister – einen gewissen Vertrauensvorschuss einräumten, sich im Einzelfall aber jederzeit freie Hand vorbehielten. Diese Arbeitsmehrheiten waren nicht sehr belastbar. Standen unpopuläre Maßnahmen auf der Tagesordnung, war es ihnen vielfach lieber, dass die Regierung unter einem Vorwand das Parlament auf einige Monate heimschickte – und die bittere Medizin per Notverordnungsparagraph verabschiedete. Im Herbst 1918 war Deutsch-Österreich dann über Nacht in das andere Extrem gefallen. Die Regierungsverantwortung übernahm ein proporzmäßig zusammengesetzter Ausschuss der Nationalversammlung (der deutschen Mitglieder des Abgeordnetenhauses des alten Reichsrates). Dieser »Vollzugsausschuss« legte sich den Namen Staatsrat zu (und beschäftigte zur Leitung der Behörden ein paar Unterstaats sekretäre). Von Gewaltenteilung zwischen Exekutive und Legislative war da keine Spur mehr. Die Machtfülle dieses Staatsrates war in der Theorie beängstigend, in der Praxis mehr als enden wollend. Die Länder erkannten ihn zwar an, gehorchten ihm aber deshalb nicht unbedingt. Von außen waren ihm durch die übermächtigen Nachbarn und die Entente Grenzen gesetzt, im Innern durch die »Macht der Straße«, die revolutionären Protuberanzen, deren tatsächliches Gefahrenpotenzial nicht präzise einzuschätzen war. Aber die Probe aufs Exempel wollte niemand so recht wagen. Der Staatsrat war nach gängigem Muster eine Konzentrationsregierung, im Sinne eines Zusammenstehens gegen äußere Gefahren, einer Einheitsfront gegenüber der Entente. Nach den ersten Wahlen vom Februar 1919 ließ man den Staatsrat fallen : Die Nationalversammlung wählte jetzt direkt einen »Kabinettsrat«. Geplant war eine Fortsetzung der Konzentrationsregierung, doch die Deutschnationalen scherten aus. Sie hatten in der alten Nationalversammlung die stärkste Gruppe gestellt, waren jetzt aber nur noch das »dritte Lager«. Ursache dafür war der Wegfall ihrer Hochburgen im Sudetenland. Eine endgültige Entscheidung über die Zugehörigkeit des Sudetenlandes war noch nicht gefallen, denn die Friedenskonferenz hatte ja noch gar nicht begonnen. Doch die Tschechoslowakei hatte das Gebiet besetzt und Wahlen verhindert. Für diesen Fall hatte die alte »provisorische« Nationalversammlung vorausschauend beschlossen, zunächst einmal provisorisch Abgeordnete nach dem Schlüssel der letzten Wahlen von 1911 zu ernennen. Doch die neu gewählte »konstituierende« Nationalversammlung bekam kalte Füße. Würde es der Legitimität der Versammlung nicht ein schlechtes Zeugnis ausstellen, wenn ein Drittel seiner Mitglieder bloß kooptiert würde ? Die Sozialdemokratie war im Sudetenland immer schon stark vertreten gewesen. Sie hätte bei diesem Handel wenig zu verlieren gehabt. Aber ihr deutschböhmischer Obmann Josef
22
Österreich nach 1918
Seliger setzte sich mit der Auffassung durch, die Abgeordneten sollten es sich nicht in den Fauteuils in Wien bequem machen, sondern vor Ort für die Selbstbestimmung ihres Volkes kämpfen. Die verschiedenen nationalen Gruppen, die sich zur Großdeutschen Vereinigung zusammenschlossen, nahmen ihren Kollegen die plötzliche Kehrtwendung bei der Vertretung der Sudetendeutschen übel und beschlossen deshalb, der Regierung fernzubleiben (wurden aber dennoch zur Teilnahme an der Friedensdelegation eingeladen). Den Christlichsozialen war zwar nicht ganz wohl beim Gedanken, den Sozialdemo kraten im Kabinettsrat künftig allein gegenüberzusitzen. Aber das gewohnte Muster, ein Beamtenkabinett mit den Geschäften zu betrauen und ihm vom Parlament her auf die Finger zu sehen, war augenblicklich nicht machbar. Man brauchte die Sozial demokraten in der Regierung als Bollwerk gegen ihre eigenen Anhänger – inklusive jener, die sich vielleicht lieber den Kommunisten anschließen würden, die bald darauf in Ungarn und Bayern die Macht übernahmen. Da hieß es ohne besondere Begeisterung in den sauren Apfel beißen, der später – mit ganz anderen Konnotationen – als Vorgänger der Großen Koalition der Zweiten Republik ausgeschildert wurde. Eine Parallele zwischen der Situation 1919 und 1945 gab es nun allerdings : Die Große Koalition der Nachkriegszeit verdankt ihre Existenz der Notwendigkeit, den Besatzungsmächten (und den Kommunisten) gegenüber mit einer Stimme zu sprechen und sich nicht auseinanderdividieren zu lassen. Dieses Jahrzehnt begründete eine Eigendynamik, oder wenn man will : ein eigenes Trägheitsmoment – und verhalf der Großen Koalition damit zu einer Verlängerung um ein weiteres Jahrzehnt, das erst ab 1966 durch Zufallstreffer wechselnder Alleinregierungen abgelöst wurde. 1919 war der Großen Koalition keine so lange Notwendigkeit beschieden : Der Staatsvertrag ließ zehn Jahre auf sich warten, der Friedensvertrag von SaintGermain – weitaus weniger enthusiastisch begrüßt – wurde bereits im Herbst 1919 mit zusammengebissenen Zähnen verabschiedet. Als gemeinsame Aufgabe blieb jetzt noch die Ausarbeitung der republikanischen Verfassung. Hans Kelsen übernahm als Fachmann, der mit beiden Seiten »konnte«, die Aufgabe, nicht etwa eine Verfassung nach eigenem Gusto zu konzipieren, sondern als Architekt die Wünsche der Bauherren umzusetzen, sprich : die vorgegebenen politischen Prinzipien in »einer rechtstechnisch möglichst einwandfreien Weise zu kodifizieren«.25 Es war nicht als Liebesbeweis zu werten, sondern als Ausdruck des Misstrauens, wenn die Christlichsozialen für diese zweite Phase der Regierung Renner im Oktober 1919 auf einem Ehevertrag, sprich : Koalitionspakt bestanden. Kurz bevor die Verfassungsberatungen abgeschlossen waren, brach die Koalition dann im Frühjahr 1920 auseinander. 25 Olechowski, Kelsen 296.
Die Regierung: Verfassung versus »politische Kultur«
23
Der Bruch war – genau genommen – eine der selten gewürdigten Sternstunden des Parlaments, denn der Anlass war ein Schlagabtausch im Hohen Haus. Leopold Kunschak als Parteiobmann der Christlichsozialen bekämpfte eine Verordnung des sozialdemokratischen Staatssekretärs und schloss daran die Drohung : Wenn das die Auffassung der Sozialdemokraten sei, dann habe die Koalition mit heutigem Tage aufgehört. Worauf er von beiden Seiten des Hauses mit donnerndem Applaus bedacht wurde. Freilich : Dabei handelte es sich nicht um einen Betriebsunfall mit tragischen Auswirkungen, wie oft angedeutet worden ist, sondern um die Vorwegnahme einer Entscheidung, die ohnehin bald angestanden wäre. Der sozialdemokratische Klub hatte bereits zwei Wochen vorher Oktoberwahlen in Aussicht genommen. Im christlichsozialen war schon im Vorjahr davon die Rede gewesen, man müsse bloß noch über den Winter kommen. Fink resümierte auf dem Parteitag Ende Februar 1920 über die Verfassungsdiskussionen : »Sind diese Werke vollbracht, dann hat die Koalition ausgedient.«26 Man schrieb für den Oktober 1920 Neuwahlen aus – und wählte für die Übergangsperiode über den Sommer wiederum ein Konzentrationskabinett, allerdings versehen mit einer ausdrücklichen Dispens vom Prinzip der Kabinettsverantwortlichkeit, nämlich der Versicherung, dass die Parteien nur für die Tätigkeit ihrer eigenen Minister die Verantwortung tragen wollten. Die Wahlen endeten mit einem Stellungswechsel an der Spitze : Die Sozialdemokraten (bisher 40 %, jetzt 35 %) wurden als stärkste Partei von den Christlichsozialen (bisher 35 %, jetzt 40 %) abgelöst – und erklärten daraufhin umgehend, sich an der nächsten Regierung nicht beteiligen zu wollen. Der boshaft-akribische Chronist am Ballhausplatz, der Gesandte Heinrich Wildner, notierte : »Die Sozi wollen nicht in die Laube gehen.«27 Gerade noch rechtzeitig, zwei Wochen vor den Neuwahlen, hatte die »konstituie rende« Nationalversammlung ihre Aufgabe doch noch gelöst und die neue Verfassung verabschiedet, oder zumindest den Teil davon, über den sie sich einigen konnte. (Kulturkampffragen mussten ausgeklammert werden !)28 Ganz so neu war die neue Verfassung nun auch wieder nicht. Das Ergebnis war ein Resultat der Parteienverhandlungen und ließ deutlich die Handschrift der Sozialdemokratie erkennen. Die Verfassung hielt sich in wesentlichen Punkten an das Provisorium, wie es seit März 1919 bestanden hatte. Sie kam einer Konvents-Verfassung nach dem Muster der Großen Französischen Revolution ziemlich nahe. Das Prinzip der Volkssouveränität behielt Vorrang vor der Gewaltenteilung.
26 Kriechbaumer (Hg.), Protokolle 91 ; Höbelt/Kalwoda/Schönner (Hgg.), Klubprotokolle 874 (2.12. 1919) ; Höbelt, Provisorium 152 f. 27 AVA, Wildner-Tb. X.10.1922. 28 Vgl. dazu zuletzt : Olechowski, Kelsen 290.
24
Österreich nach 1918
Die »Kammer«, der Nationalrat, wählte weiterhin die Regierung. Die zweite Kammer, der Bundesrat, und der Bundespräsident waren als Konzession an bürgerliche Befindlichkeiten geschaffen worden, verfügten aber kaum über Befugnisse. Der Bundesrat konnte Beschlüsse des Nationalrates nur um wenige Wochen verzögern (er kam in Zukunft ironischerweise meist dann zur Geltung, wenn er ausgerechnet der bürgerlichen Mehrheit hin und wieder Verlegenheiten bereitete). Der Präsident fungierte als ein bloßer Staatsnotar, der das rechtmäßige Zustandekommen von Gesetzen zu beurkunden hatte. Er wurde nicht vom Volk, sondern von beiden Kammern des Parlaments gewählt. Karl Seitz als Obmann der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Deutsch-Österreichs (SDAPÖ) sagte bei Gelegenheit, die Position reize ihn nicht, sie eigne sich für einen senilen Trottel.29 Die Geschichte der nächsten zwei Jahre war gekennzeichnet von dem Zwiespalt zwischen der Verfassung, die sich Österreich soeben gegeben hatte, und der »politischen Kultur« des Landes, die in der Geschichte der ausgehenden Monarchie wurzelte. Renner warf Seipel später einmal vor, er habe das »Talent, sich als kaiserliche Regierung ohne Kaiser zu empfinden«.30 Die Bemerkung war auf Seipels überhöhte Auffassung von staatlicher Autorität gemünzt. Doch was die Zusammenstellung der Regierung betrifft, war es gerade Seipel, der sich auf den Geist der Kelsen-Verfassung berief : »Die österreichische Regierung ist jetzt ein Ausschuß der Mehrheit des Parlaments.« Freilich : Die Parteien, zumindest die bürgerlichen Parteien, waren es nicht gewohnt, selbst zu regieren. Diese Befindlichkeit wurde gleich im Oktober 1920 deutlich, sobald die Sozialdemokraten sich aus der Regierung zurückzogen. Hätten die Bürgerlichen jetzt nicht die Führung an sich reißen müssen ? Doch nichts dergleichen geschah.
Die Parteien : Weltanschauliche Lager und soziale Integrationsparteien Von den drei großen Lagern konnte die Sozialdemokratie als Partei auf die längste Tradition zurückblicken : Ihre organisatorische Kontinuität war seit dem Hainfelder Einigungsparteitag 1889 ungebrochen. Sie verfügte über eine Massenbasis, überholt noch vom rasanten Wachstum der freien Gewerkschaften, die von der Inflation profitierten, weil da fast stündlich Tarifverhandlungen auf der Tagesordnung standen. Dreißig von 32 Jahren hatte die SDAPÖ unter der Schirmherrschaft Viktor Adlers verbracht, ihres »Übervaters«, der noch wenige Stunden vor seinem Tod stolz im Staatsrat verkündet hatte : »Ich bin überzeugt, dass wir Deutsche auch dafür der Welt 29 AdR, GDVP 2, Klub 4.12.1920 (Mitteilung Schürff). 30 ADÖ IV 464, 477 (12.10.1922).
Die Parteien : Weltanschauliche Lager und soziale Integrationsparteien
25
das Vorbild geben werden, wie man am glattesten, klassischesten, einfachsten Revolution macht und durchführt.« Beunruhigt zeigte er sich bloß über die Feigheit des Bürgertums : »Mich beunruhigt nur, dass wir auf keinen Widerstand stoßen. Wo ist die Reaktion ?«31 Die Sozialdemokratie, auch wenn sie freisinnige Mitläufer rekrutierte und Intellektuelle von bürgerlichem Zuschnitt zu ihren Anhängern zählte, verstand sich als Arbeiterpartei, als historisches Werkzeug des Proletariats. Die bürgerlichen Parteien hingegen waren stolz auf ihren Charakter als Weltanschauungsparteien. Die Kehrseite dieser Medaille war ihr sozial vielfach sehr heterogener Charakter. Sie waren notgedrungen »Integrationsparteien« : Für die Christlichsozialen war die Bezugsgröße das »christliche Volk«. Christen – wie es Helmut Qualtingers Herr Karl ausdrückte : nicht sehr, aber doch – waren fast alle, die 3 % Juden einmal ausgenommen. Die Reichspartei war 1907 entstanden aus dem Zusammenschluss von Luegers Christlichsozialen mit den katholisch-konservativen Volksparteien der Alpenländer, vor allem Oberösterreichs und der Steiermark, die sich lange Zeit ein Eigenleben bewahrten. Niederösterreich und Tirol – vor allem Nordtirol – waren schon vorher, um die Jahrhundertwende, in das christlichsoziale Fahrwasser eingeschwenkt. Man gewinnt den Eindruck : Diese beiden Länder, die sich schon früh Lueger angeschlossen hatten, verfügten über einen privilegierten Zugang zu den Entscheidungsfindungs mechanismen, oder wie es Engländer ausdrücken würden : »They were punching above their weight …« Die »Länder« verkörperten unterschiedliche politische Traditionen, z. B. die Oberösterreicher, die im Lande schon seit den achtziger Jahren über die Mehrheit verfügten, im Gegensatz zu den Steirern, die erst seit 1919 den Landeshauptmann stellten. Aber was sie alle ganz selbstverständlich verband, war : Die starken Bataillone stellten überall die »Agrarier«, die innerparteilich auch als solche bezeichnet wurden, mit dem Reichsbauernbund als Rückgrat. (Nur in Oberösterreich gab es bis 1918/19 bloß den Katholischen Volksverein.) Unter den christlichsozialen Abgeordneten des Jahres 1920 zählten die »Agrarier« 40 % – zusammen mit den Priestern vom Lande schon gut die Hälfte der Fraktion. Am deutlichsten ausgeprägt war die agrarische Ausrichtung im größten Land, in Niederösterreich, das sich erst jetzt von Wien trennte. In Niederösterreich war die Partei 1919 auch noch mit zwei getrennten Listen angetreten : dem Bauernbund und den städtischen Christlichsozialen. Hier war die Phalanx der »Bauerngeneräle« beheimatet : Josef Stöckler, Rudolf Buchinger, Josef Zwetzbacher, Josef Reither, die einen ganz spezifischen Typus verkörperten : scharf »rechts« in der Wirtschaftspolitik, wie sich bald herausstellte, aber »links« in Verfassungsfragen. Da war republikanische Irritation mit dem bürokratischen Korsett der Monarchie zu spüren : Man 31 Enderle-Burcel/Haas/Mähner (Hgg.), Staatsrat I 327 (9.11.1918) ; Höbelt, Provisorium 130.
26
Österreich nach 1918
verlangte – gegen die Juristen in den eigenen Reihen (und noch mehr gegen die Großdeutschen !) – eine Demokratisierung der Bezirksverwaltungen. Freilich : Die Traditionspflege des »schwarzen« Lagers konzentrierte sich mit Vorliebe auf die christliche Soziallehre und die tapfere Minderheit katholischer Arbeiter, mit Leopold Kunschak und Franz Spalowsky als Galionsfiguren. Als Schüler und Nachfolger Franz Schindlers ließe sich natürlich auch Ignaz Seipel in dieser Tradition verorten, der sich von ihren antikapitalistischen Ressentiments allerdings so weit frei machte, bis Otto Bauer in seinem Nachruf schrieb : »Von der Denkweise der Lueger, Geßmann, der Schraffl und Schöpfer war nichts in ihm.«32 Das war richtig beobachtet. Seipel selbst hat Schöpfer während der Debatten über Genf gestanden, er werde ihm jetzt etwas sagen müssen, was ihn nicht freue.33 Aber eine »bürgerliche« Sammlungspolitik hatte schließlich auch Lueger praktiziert (der dabei nur die Juden ausnahm), hatte auf Reichsebene Geßmann angepeilt, was vor 1914 nur auf die Schwierigkeit stieß, dass man sich bei einem Bündnis mit dem Nationalverband automatisch das ganze böhmische Problem aufhalste.34 Noch aber galt das städtische Bürgertum überwiegend als Bastion und Rückzugsgebiet des »Freisinns«, der in Entstehung begriffenen Großdeutschen Volkspartei bzw. der Bürgerlichen Demokraten in Wien : Industrielle wurden erst im Laufe der Zeit zugekauft. Die Fraktion der Christlichsozialen zählte ein halbes Dutzend Gewerbetreibende und ein halbes Dutzend Freiberufler, genauso wie sie ein halbes Dutzend »Arbeitervertreter« und ein halbes Dutzend Eisenbahner und Postler in ihren Reihen beherbergte. Sie alle waren geschätzte Mitglieder, jedoch in ihren Milieus Minderheiten. Nur in Wien gab es die »Greißler«, die davon schwärmten, dass ihnen der Dr. Lueger einmal die Hand gedrückt hatte. Doch gerade in Wien war die Partei zerstritten : Die Tradition der bürgerlichen Allerweltspartei im Stile von Bürgermeister Richard Weiskirchner, später dann von Heeresminister Vaugoin, stand dem betont katholischen Flügel um Heinrich Mataja und Richard Schmitz, aber auch Kunschak gegenüber. Als Parteiobmann, zumindest als Galionsfigur, fungierte nach Luegers Tod der schwarze, einst »rote Prinz« Alois Liechtenstein ; ab 1918 dann der Klubobmann im Parlament schon seit 1917, der oberösterreichische Landeshauptmann Johann Nepomik Hauser, der freilich schon 1919 das Handtuch warf, nicht zuletzt wegen seiner Auseinandersetzungen mit Seipel. 1920/21 übernahm für knapp ein Jahr Kunschak, der als Elder Statesman noch die Zweite Republik erleben sollte. Dann wurde Seipel auf den Schild gehoben. Weiskirchner wurde (1.) Präsident des Nationalrats. Seipels Stellvertreter im Klub war Jodok Fink, der als Vizekanzler Renners gedient 32 AZ, 3.8.1932, 3. 33 KvVI, CS-Klub 18.10.1922. 34 Dazu Boyer, Culture and Political Crisis 141–146.
Die Parteien : Weltanschauliche Lager und soziale Integrationsparteien
27
hatte, aber zu Unrecht oft pauschal für die »Großkoalitionäre« reklamiert wird. Der Bregenzer Wälder-Bauer, der sich gern auf die – vermeintlich – republikanische Tradition seiner Gegend berief,35 erwies sich als kongenialer Mitarbeiter Seipels und als Verbindungsoffizier zu den Agrariern, die auch den Obmannstellvertreter in der Partei stellten, das Schwergewicht, dem es gleich war, wer unter ihm Obmann oder Landeshauptmann war : Josef Stöckler, der Gründer des niederösterreichischen Bauernbundes, mit seinen inzwischen fast 100.000 Mitgliedern. Das Bürgertum vertrat die Großdeutsche Volkspartei, die sich erst im August 1920 zusammengefunden hat. Oft werden die 17 Gruppen, die hier zusammenkamen, als Symbol der Uneinigkeit des Lagers hervorgehoben. Diese statistische Arabeske ist irreführend, weil es sich dabei um Länderparteien von recht ähnlichem Zuschnitt handelte. Spannungen ergaben sich da aus dem Gegensatz von »Alten« und »Jungen« : Die Alten waren die Routiniers der ausgehenden Monarchie, die sich ihre Sporen im Reichsrat verdient hatten : Franz Dinghofer, Emil Kraft, Hans Schürff, dazu Leopold Waber, die allesamt noch zu Ministerehren kommen sollten. Die »Jungen« wurden durch die Nationaldemokraten verkörpert, eine Wiener Sondererscheinung, die sich als erstaunlich aktiv und durchsetzungsfähig erwies : Ihre Exponenten stellten die ersten beiden Parteiobleute (Hermann Kandl und August v. Wotawa) und den ersten Vizekanzler (Felix Frank). Gesellschaftspolitisch waren sie links von den »Alten« angesiedelt. Sie hatten Probleme mit der Etikettierung als bürgerliche Partei. Die »Alten« verkörperten (bis auf Waber) zumeist das Wirtschaftsbürgertum in der Provinz, die »Jungen« die Beamten – in Wien.36 Dazu kamen zwei exponierte Flügel, die sich im Laufe der Jahre von der Partei abwandten bzw. ausgesiebt wurden : Am rechten Flügel war das die großdeutsche Version der Agrarier. Die nationale Bauernschaft hatte durch das Verhältniswahlrecht enormen Auftrieb erfahren, insbesondere in der Steiermark, wo Leopold Stocker eine Neugründung vornahm und dann auch die Kärntner hinter sich versammelte. Die Oberösterreicher und Salzburger schlossen sich seiner Partei »Landbund für Österreich« erst 1923/24 an.37 Die Bauern stellten in der konstituierenden Versammlung – wie bei der »schwarzen« Konkurrenz – noch die Hälfte der großdeutschen Abgeordneten. Doch ihre Riege wurde bei den ersten Nationalratswahlen 1920 dezimiert, vor allem in den bisherigen Hochburgen, wie z. B. im Waldviertel oder im Innviertel. (Auch Stocker selbst verfehlte in der Oststeiermark das Mandat.) Die Überlebenden zogen daraus den Schluss, dass eine zu enge Verbindung mit den städtischen Konsumenten und ihren kulturkämpferischen Allüren lebensgefährlich sei. 1920 waren dann schon nur mehr acht von 26 deutschnationalen Abgeordne35 Niederstätter, Wäldär 48–52. 36 Höbelt, Deutschnationale 105 ff. 37 Haas, Bauernpartei 116 ff.
28
Österreich nach 1918
ten Bauern, sechs von ihnen bildeten als Deutschösterreichische Bauernpartei unter Schönbauer eine eigene Fraktion – und waren damit im Nationalrat vielfach zum Zünglein an der Waage geworden. Den linken Flügel stellten die alten Schönerianer : Sie hatten im Reichsrat bloß vier Abgeordnete gestellt und waren als Parias außerhalb des Nationalverbands mit seinen hundert Mandataren verblieben. Die »Alldeutschen« fühlten sich in ihren irredentistischen Überzeugungen durch den Zerfall der Monarchie bestätigt. An den Neugründungen des Jahres 1918 hatten sie einen großen Anteil, freilich ohne Schönerer selbst, der zwar erst 1921 starb, aber keinerlei Briefe mehr beantwortete. Ihr Schwerpunkt lag in Niederösterreich : Als Gralshüter und Nachlassverwalter Schönerers, sprich : Obmann des Vereins der Alldeutschen, fungierte Josef Ursin. Eine gewisse Rolle spielte Friedrich Waneck, ein Bohemien, mit einer Schauspielerin verheiratet, der sich mit Gott und der Welt zankte. Aus der entfernteren Provinz kamen mit Hans Angerer und Sepp Straffner noch zwei weitere Abgeordnete aus dem Umfeld der Schönerianer, die jedoch bald eine völlig andere Richtung einschlugen und sich als Verfechter des Bürgerblocks hervortaten. Straffner wurde bald Stellvertreter Dinghofers, der als sein »Lehrmeister« galt.38 Auch Emmy Stradal, die einzige Frau der Fraktion, stand dem schönerianischen Klüngel nahe. Diese Funktion von Frauen als Gralshüter der reinen Lehre hatte System : Denn als bürgerliche Allerweltspolitiker mit ihrer Basis in den wirtschaftlichen Interessenvertretungen gab es für Frauen kaum den entsprechenden Wurzelboden – es sei denn für Gewerkschafterinnen, wie z. B. die Christlichsoziale Aloisia Schirmer, die Vorsteherin der christlichen Heimarbeiterinnen von Wien. Aber bekannt wurde auch bei den »Schwarzen« nicht sie, sondern die gebürtige Reichsdeutsche und 2012 selig gesprochene Hildegard Burjan (bei der auch Seipel häufig zu Gast war). Die Konvertitin Burjan galt als katholische »Hardlinerin« mit dem sprichwörtlichen Eifer des Konvertiten und war z. B. 1919 maßgeblich daran beteiligt, zum Ärger der pragmatischen Agrarier einen wiederverheiraten Staatssekretär aus der Fraktion zu drängen.39 Die alten Schönerianer verwiesen allein schon ihre antihabsburgische, anfangs sogar kriegsskeptische Tradition und ihr kulturkämpferischer Eifer, ihre Gegnerschaft zu Thron und Altar, nach allen zeitgenössischen Kriterien auf den linken Flügel, selbst wenn ihr Antisemitismus sie für Nachgeborene nach rechts außen rückte. Die Sozialdemokraten sahen es genauso : Sie gingen 1911 ein reichsweites Stichwahlbündnis mit den Alldeutschen ein ; die AZ bedauerte ausdrücklich das Ausscheiden Ursins, der 1923/24 das Handtuch warf. Waneck († 1923) und Stradal († 1925) verstarben früh. Mit dem Wegfall beider Flügel – der Schönerianer und der 38 Langoth, Kampf 56. 39 Höbelt/Kalwoda/Schönner (Hgg.), Klubprotokolle 748, 751 f. (16.10.1919).
Die Parteien : Weltanschauliche Lager und soziale Integrationsparteien
29
Bauern – reduzierte sich das Tauziehen innerhalb der Reihen der Großdeutschen auf ein Ringen zwischen Beamten und Industrie. Von der Fraktion waren schon 1920 mehr als die Hälfte Beamte, allein ein Viertel Lehrer. Freilich, auch von den Beamten zählte der eine oder andere (Hampel, Straffner) bald in erster Linie als Sprecher der Wirtschaft.
II. Die Übergangszeit 1920–1922
»Tingel-Tangel-Politik« : Der virtuelle Bürgerblock mit beschränkter Haftung Wie war es im Herbst 1920 um die Regierungsbildung bestellt ? Die Großdeutschen zierten sich weiterhin. Die Christlichsozialen wollten sich nicht mit einer Minder heitsregierung belasten. Leider fehlen uns für das Jahr 1920 die Protokolle des christlichsozialen Klubs. Doch die Lage war zweifelsohne nicht so beschaffen, dass eine Regierung mit großem Popularitätsgewinn rechnen konnte. Das Kalkül der Großdeutschen lässt sich leichter nachvollziehen, von den Quellen her wie vom Inhalt. Die Partei war erst im August gegründet worden. Ihre internen Gewichte mussten erst noch austariert werden. Hervorzuheben war ein Strukturelement, das zwar der Gewaltenteilung alle Ehre machte, der Partei das Leben jedoch nicht erleichterte. Parlamentsklub und Parteivorstand sollten nach den Statuten bewusst nicht zur Übereinstimmung gebracht werden, vielmehr sollte der Vorstand als Stimme der Basis die Geschäftsführung des Klubs kontrollieren. Bestenfalls ein Drittel der Vorstandsmitglieder durfte deshalb auch dem Parlament angehören. Es wird keinen Praktiker verwundern, dass dieses System zu einer Reihe enervie render Auseinandersetzungen und Reibereien führte : Den Klub führte Franz Dinghofer, der letzte Klubobmann der Deutschnationalen schon in der Monarchie, doch Parteiobmann war Hermann Kandl, Vertreter einer Neugründung der Umsturztage, der Wiener Nationaldemokraten. Die Basis, das waren die Aktivisten, die vielleicht überproportional ideologisch motiviert waren. Diese Art der Zivilgesellschaft schwärmte für vollmundige Resolutionen und symbolische Gesten, ohne allzu viel auf praktische Erfordernisse Rücksicht zu nehmen. Einer der Vorkriegsabgeordneten, Albert von Mühlwerth, brachte es auf den Punkt : »Immer wenn bei den Natio nalen der Schritt von der Opposition zum Eintritt in die Regierung gemacht wird, kommen viele Parteigenossen auf die Idee, dass irgendeine Lumperei im Gange sei.«1 Dieses Misstrauen vor Parteiregierungen mochte bei der Minderheit der schöne rianischen 150-Prozentigen nicht wundernehmen. Hier waren Überlegungen zu finden wie : Man müsse das Scheitern des Systems abwarten. Erst wenn die Ketten der Friedensverträge gesprengt und der Anschluss in greifbare Nähe gerückt sei, sei konstruktive Arbeit wiederum möglich und sinnvoll. Bis dahin solle man sich die Finger besser nicht schmutzig machen. Diese Katastrophenstrategie, die auf tugendhafte Abstinenz setzte, war auf Dauer keine sehr überzeugende Methode zur 1 Höbelt, Deutschnationale 129.
»Tingel-Tangel-Politik« : Der virtuelle Bürgerblock mit beschränkter Haftung
31
Mobilisierung der eigenen Anhänger. Doch diese betonte Reserve gegenüber einer Regierungsbeteiligung wurde durch eine hintergründige Komponente verstärkt, die sich nicht abstrakt-prinzipiellen, sondern im Gegenteil ganz pragmatischen Überlegungen verdankte. Die Schönerianer mochten das Habsburgerregime verteufeln und stolz darauf sein, immer schon dagegen gewesen zu sein. Doch für den Großteil des Lagers galt : Man war unter der Monarchie nun allerdings sehr gut gefahren, zuallererst was die Besetzung der Beamtenposten anbelangte. Man mochte noch so sehr den beliebt-unbeliebten Topos des aristokratischen Protektionskinds bemühen, aber das Bildungsbürgertum, das sich aus den Absolventen der Universitäten rekrutierte, entstammte ganz überwiegend einem antiklerikal-freisinnigen und ganz selbstverständlich nationalbewegten Milieu. Die höhere Beamtenschaft wies daher unzweifelhaft ein Naheverhältnis zum nationalen Lager im weiteren Sinne auf, wenn schon nicht unbedingt zur Großdeutschen Volkspartei, wie sie 1920 aus der Taufe gehoben worden war. Ein Beamtenkabinett, das durch parteipolitische Vorgaben von Rot und Schwarz möglichst wenig eingeschränkt war, konnte unter diesen Umständen als eine Regierungsform gelten, die – ceteris paribus – den Großdeutschen sehr genehm war. Franz Dinghofer, nie Parteiobmann der Großdeutschen (ein halbherzig unternom mener Anlauf in dieser Richtung versandete 1924), aber doch ein Jahrzehnt lang ihr führender Kopf, vereinte im Herbst 1920 beide Überlegungen in seinem Resümee : Eine Regierungsbeteiligung erschien auch ihm damals noch wenig verlockend. Er wiederholte hier bloß Finks Lamento vom 26. Juli 1919 : Der eigentliche Herr der Republik seien ja doch die Siegermächte mit ihrer Reparationskommission.2 Man wolle sich deshalb freie Hand vorbehalten. Parlamentarier sollten nach Möglichkeit nicht als Minister fungieren. Freilich : »Etwas anderes ist es, wenn Beamte unserer Richtung in die Regierung kommen.« Dann könne man sich schon zumindest zur »wohlwollenden Neutralität« verpflichten.3 Am 5. November 1920 einigten sich Seipel und Dinghofer (im Beisein ihrer Stellvertreter, von Fink und Weiskirchner, Straffner und Frank) auf ein »Fachmännerkabinett«. Die Sozialdemokraten, so berichtete Seipel, hätten versprochen, keinerlei »Sabotage« zu betreiben, allerdings unter der Bedingung, dass keine Gesetze der vorangehenden zwei Jahre rückgängig gemacht würden.4 Auch über den Wunschkandidaten als Kanzler herrschte sofort Einigkeit : Polizeipräsident Johannes Schober, der von seiner politischen Sozialisation genau dem Typus entsprach, wie er oben angesprochen worden war. Seipel nannte den Sängerschafter später einmal den »Unab2 Höbelt/Reiter, Drittes Lager 331 f.; Bansleben, Reparationsproblem 142. 3 AdR, GDVP 2, Klub 28.10.1920. 4 AdR, GDVP 2, Besprechung 5.11.1920 (beim Protokoll vom 9.11.1920).
32
Die Übergangszeit 1920–1922
hängigen mit der Kornblume«. Besorgnisse äußerte Dinghofer bestenfalls wegen des Risikos, dass ein Talent wie Schober sich »zu rasch verbrauchen« könne. In seinem Klub gab Dinghofer daraufhin die Linie vor : Wir stimmen für Schober. Parteiobmann Kandl widersprach ihm dabei nicht direkt, forderte aber begleitende Maßnahmen, um den Eindruck zu vermeiden, dass »wir im Schlepptau der Christlichsozialen« segeln. Man solle deshalb auch mit den Sozialdemokraten in Fühlung treten. In dem Fall befürchtete wiederum Dinghofer, dass ein schlechter Eindruck entstehen werde. Die Sozialdemokraten würden eine solche Initiative als Zeichen der Schwäche ansehen, die Christlichsozialen als Hinterlist. Waneck und Stradal waren für Äquidistanz, wie sie einer Mittelpartei zukäme (»Eindruck der Parität«), und gegen eine bürgerliche Phalanx. Frank profilierte sich für seine Karriere als Vizekanzler. Als Nationaldemokrat zählte er zum linken Flügel der Partei, doch er nahm eine vermittelnde Position ein : Kandl habe prinzipiell recht, aber worüber solle man mit den Sozialdemokraten im Moment denn eigentlich reden, es gebe kein »Verhandlungssubstrat« ? Doch Schober war mit der Rolle des bloßen »Masseverwalters« damals und später nicht so recht zufrieden. Der Polizeipräsident, der gerne seine Rolle als unpolitischer Beamter hervorstrich, entwickelte im Lauf der Zeit mehr Ehrgeiz und Raffinesse als so mancher Parlamentarier. Schober zählte zur Elite der alten kaiserlichen Beamten. Aus ihren Reihen wollte er sich auch seine Minister wählen. Dabei stieß er auf Schwierigkeiten : Redlich war der letzte kaiserliche Finanzminister gewesen. Das machte ihn verdächtig als Anhänger einer Donauföderation. Seine Herkunft aus einer jüdischen Familie galt ebenso wenig als Empfehlung. Außenminister Karl Emil Fürstenberg, während des Krieges kaiserlicher Gesandter in Spanien, erweckte wiederum das Misstrauen der Reparationskommission (es kam der Verdacht auf, man könnte ihn dort mit seinem Cousin Max Egon verwechselt haben, einem Freund Kaiser Wilhelms II.). Dinghofer stellte ein mögliches Junktim in den Raum : Wenn die einen Fürstenberg schluckten, könnten die anderen für Redlich – den er gegen gewisse Vorwürfe ausdrücklich in Schutz nahm – eine Ausnahme machen. Doch dieses Risiko wollte keiner seiner Parteifreunde eingehen. Die Belastungsprobe wäre für die erst wenige Wochen alte Partei zu groß gewesen. (Tempora mutantur : Zehn Jahre später bejubelten die Großdeutschen dann die Ernennung Redlichs, weil er versprach, den Beamteninteressen nicht zu nahe zu treten !5) Zwei weitere kaiserliche Minister – Banhans (Verkehr) und Homann (Handel) –, die aufgefordert wurden, in ihre alten Ressorts zurückzukehren, lehnten Schobers Einladung mit Bedauern ab, weil sie darin eine Illoyalität ihrem Monarchen gegenüber erblickten. Schober legte daraufhin den Auftrag zurück, »weil er die Fachleute, die er will, nicht durchsetzen kann«.6 5 Höbelt, Provisorium 248. 6 AdR, GDVP 2, Klub 18./19.11.1920.
»Tingel-Tangel-Politik« : Der virtuelle Bürgerblock mit beschränkter Haftung
33
Die ›Neue Freie Presse‹ flocht ihm Kränze, auch wenn sie das Ergebnis bedauerte. Sie leitartikelte mit Bezug auf Fouché : »Festigkeit des Charakters ist nicht häufig bei Polizeipräsidenten. […] Schober ist jedoch so veraltet, eine Gesinnung zu haben.«7 Wenn es tatsächlich das Veto gegen Redlich war, das Schober die Lust am Kanzler amt verdarb, so erwies sich der Kotau vor den antisemitischen Grundsätzen der Parte als Eigentor. Denn die Alternative zum Beamtenkabinett war eine christlichsoziale Minderheitsregierung : Zunächst war die Idee lanciert worden, beide Parteien sollten je einen Minister entsenden, doch von großdeutscher Seite blieb es bei Verkehrsminister Pesta, der zur Kategorie »Beamte unserer Richtung« zählte. Auch über Finanzminister Ferdinand von Grimm, den rangältesten Sektionschef, Burschen schafter und einst Instruktor Kaiser Karls, hieß es im großdeutschen Klub, er »steht uns als Gesinnungsgenosse nahe«.8 Schließlich wurden neben Bundeskanzler Mayr – und sechs Beamten – nicht weniger als drei christlichsoziale Vollblutpolitiker in die Regierung aufgenommen (Heinl für Handel, der Tiroler Haueis für Ackerbau, Resch für soziale Verwaltung). Die ›Neue Freie Presse‹ sprach von einem »schwächlichen Mittelding zwischen Beamtenkabinett und parlamentarischem Ministerium«, die AZ in einem Rückblick später, es wäre eine »unverdiente Ehre, wenn man sie als zweite Garnitur bezeichnete«.9 Dinghofer erklärte resignierend, die Großdeutschen übernähmen für die Regierung keine Verantwortung, sie »ermöglichten« sie nur durch ihre Stimmen. Einzelne Minister sollte man besser nicht ablehnen, so die kuriose Logik der freien Hand, die unter der Hand Gefahr lief, zu einer Art Selbstbindung zu verkommen, weil man sonst jemand anderen vorschlagen und damit erst recht wieder eine Bindung hätte eingehen müssen !10 Bundeskanzler Mayr hatte schon das Übergangs- und Proporzkabinett im Sommer 1920 geleitet. Er war kein politisches Schwergewicht. Der Rechtshistoriker und Archivar hatte in Tirol im Kampf zwischen Konservativen und Christlichsozialen durch einen Seitenwechsel diverse Blessuren erlitten. Aber er hatte die Verfassungsberatungen der letzten Monate moderiert – und sich in dieser Eigenschaft als »einer der wenigen ministrablen Männer« der jungen Demokratie den Respekt Kelsens erworben.11 Schon drei Wochen später stand neuerlich eine Wahl an – diejenige des Bundespräsidenten. Da rechneten sich die Großdeutschen gewisse Chancen aus, nicht ganz zu Unrecht, denn die Sozialdemokraten ließen wissen, sie würden unbedingt nur für jemanden mit großdeutschen Traditionen stimmen. Dinghofer mit seinen Vordienst 7 NFP 21.11.1920. 8 AdR, GDVP 2, Klub 12.4.1921. 9 NFP 20.11.1920, Abend. 10 AdR, GDVP 2, Klub 20.11.1920. 11 NFP, 27.5.1922, 3 (Nachruf).
34
Die Übergangszeit 1920–1922
zeiten als 1. Vorsitzender der provisorischen Nationalversammlung, die sich zum Gründungsvater der Republik hochstilisieren ließen, hatte da relativ gute K arten. Dinghofer wollte freilich nur als Kandidat aller Parteien gewählt werden. Leider setzen die Protokolle des christlichsozialen Klubs erst wieder ein paar Wochen später ein. Bei den Großdeutschen hieß es, der Flügel der Christlichsozialen, der für Dinghofer war, sei zu schwach gewesen, um sich durchzusetzen. Als Sündenbock geriet insbesondere Dinghofers engerer Landsmann Hauser ins Visier. Seine persönliche Gegnerschaft habe die Entscheidung für Dinghofer verhindert. Diese Animosität beruhte freilich auf Gegenseitigkeit. Seipel hätte offenbar nicht ungern einen der beiden Landeshauptleute, Hauser oder Rintelen, auf den Posten des Staatsoberhauptes »weggelobt«. Zu Rintelen – wie Seipel selbst erst seit knapp zwei Jahren in der Spitzenpolitik tätig – fiel Dinghofer nichts ein, er kenne ihn nicht. Hauser hingegen lehnte er absolut ab : Der stehe den Sozialdemokraten näher als den Großdeutschen ; man warf ihm »gehässige Angriffe« vor. Nachdem die beiden Oberösterreicher einander aus dem Rennen geworfen hatten, war der Weg frei für Michael Hainisch, einen Privatgelehrten und Gutsbesitzer. Er ließ dem großdeutschen Klub nach seiner Wahl auch prompt ausrichten, er »fühlt sich als einer der unsrigen«.12 Bekannt war Hainisch nicht zuletzt wegen seiner energischen Mama, Marianne Hainisch, einer Frauenrechtlerin, die politisch bislang öfter hervorgetreten war als ihr Sohn. Anstoß nahmen die alten Schönerianer nicht an ihr, sondern an ihrer Schwiegertochter, Hainisch’ Frau, die angeblich jüdischer Abstammung sei. Bei der Abstimmung im Klub blieb Ursin freilich – wie öfters in ähnlichen Fragen – mit seiner Opposition allein. Auch der Antrag auf Freigabe der Abstimmung wurde mit allen gegen drei Stimmen abgelehnt.13 Die Großdeutschen hatten die Regierung mitgewählt. Sie wurden in so manchen Fragen auch konsultiert, z. B. bei der Besetzung des Gesandtenpostens in Berlin.14 Aber sie wollten jeden Anschein vermeiden, sich von den Christlichsozialen »ins Schlepptau« nehmen zu lassen. Um ihre Unabhängigkeit unter Beweis zu stellen, war es ihnen gar nicht unrecht, bei diversen Gelegenheiten nahezu justament gegen die Christlichsozialen stimmen zu können, z. B. bei der Abstimmung darüber, ob Geistliche weiter dem Stadtschulrat beigezogen werden sollten : Endlich eine Gelegenheit, »einem unserer Grundsätze zum Durchbruch zu verhelfen …« (Die ›Reichspost‹ grollte über »Vorgefechte eines Kulturkampfes«.) Als die Sache im Plenum verhandelt wurde, bekamen vor allem die beiden letzten Bauern im großdeutschen Klub Bauchweh : »Wir sind für das Gesetz, doch es ist taktisch für uns von Nachteil.«15 12 AdR, GDVP 2, Klub 14.12.1920. 13 AdR, GDVP 2, Klub 4., 7. & 9.12.1920. 14 AdR, GDVP 2, Klub 12.1. & 14.2.1921 ; Brettner-Meßler, Riedl. 15 AdR, GDVP 2, Klub 15.4.1921.
»Tingel-Tangel-Politik« : Der virtuelle Bürgerblock mit beschränkter Haftung
35
Mehr einem internen Zwiespalt geschuldet war offenbar die Unterstützung für die Sozialdemokraten bei der Erhöhung der Arbeitslosenunterstützung. Im Plenum fanden die Großdeutschen zu keiner einheitlichen Linie. Kraft war dagegen : Es sei schädlich, den Sozialdemokraten auch noch nachzulaufen. Zwei Dissidenten (Straffner und Hampel) wurden sanft gerügt, weil sie in einem gemeinsamen Antrag den Beschluss des Ausschusses gekippt hatten.16 Das Gewicht der Christlichsozialen in der Regierung wurde im Frühjahr sogar noch verstärkt. Baron Egon Glanz von Eicha, selbst Neffe eines kaiserlichen Ministers (im berühmt-berüchtigten Kabinett des Grafen Badeni !), hatte ein Monsterressort verwaltet : Heerwesen und Inneres – da zählte damals auch noch der Unterricht dazu. Wie vielen alten Beamten wurden ihm Sympathien für die Monarchie nachgesagt, wohl nicht zu Unrecht. Als Kaiser Karl nach seinem ersten »Restaurationsversuch« durch Österreich in die Schweiz zurück eskortiert wurde, bestanden die Sozialdemokraten und ihre Eisenbahner darauf, der Zug dürfe überhaupt nur fahren, wenn der Transport von ihren Vertrauensleuten kontrolliert und begleitet würde. Diesen Eingriff in seine Befugnisse ließ sich Glanz nicht gefallen und trat am 5. April zurück. Die AZ titelte : »Karl fährt und die Monarchisten gehen«.17 Bundeskanzler Mayr hatte im Parlament erklärt, Österreich müsse eine Restauration in Ungarn als Bedrohung seiner friedlichen Entwicklung ansehen. Eine entsprechende Resolution wurde einstimmig verabschiedet. Doch innerhalb der christlichsozialen Partei rumorte es : Im erweiterten Vorstand – dessen Protokoll leider nicht erhalten ist – wurde Mayr heftig angegriffen. Friedrich Funder als Herausgeber der ›Reichspost‹ erbat sich von Seipel die Zustimmung, von Mayr abzurücken. Doch Seipel notierte : »Mahne zur Mäßigung.« Die AZ mutmaßte, Seipel hätte wegen der Erklärung Mayrs einen demonstrativen Rückzug angetreten. Doch Seipel hatte sich bereits am 1. April als Klubobmann beurlauben lassen und die Sache bereits am Vorabend mit seinen Stellvertretern besprochen, also noch vor dem Tod des Kaisers und allen sich daraus ergebenden Debatten und Verdächtigungen. Er hielt im Klub am 5. April dann noch einen Nachruf auf Karl – und verbrachte die Zeit von 21. April bis 14. Mai auf Reisen im Rheinland.18 Die Reichspost meldete am 23. April : Der Parteitag der Christlichsozialen, ursprünglich für den 3. bis 5. Mai angesetzt, werde um einen Monat verschoben ; er fand dann erst Anfang Juni statt – und endete mit der Wahl Seipels, der als Partei, nicht bloß als Klubobmann das christlichsoziale Urgestein Leopold Kunschak ablöste.19
16 AdR, GDVP 2, Klub 16.3. & 18.3.1921 ; AZ, 18.3.1921. 17 AZ, 6.4.1921. 18 DAW, Seipel-Tb. 31.3., 1.4., 6./7.4.1921. 19 RP, 23.4.1921, 6 ; Kriechbaumer (Hg.), Protokolle 152 ff.
36
Die Übergangszeit 1920–1922
Die Regierungsumbildung vom 26. April beobachtete Seipel folglich bloß aus der Ferne. Das Ressort von Baron Glanz wurde auf zwei zusätzliche Christlichsoziale aufgeteilt : Die beiden Steirer Gürtler und Ahrer lehnten dankend ab ; zum Zug kamen zwei künftige Schwergewichte, die späteren Bundeskanzler Rudolf Ramek und Carl Vaugoin, der seine Karriere als Langzeit-Heeresminister begann.20 Notabene : Die Großdeutschen, die in der Parlamentsdebatte laut ›Reichspost‹ die Sozialdemo kraten noch an republikanischem Eifer übertroffen hatten, hielten Vaugoin zwar erst recht für einen Monarchisten, aber für »sehr geschickt«. Über den Restaurations versuch gab Straffner mit einer Anleihe bei Talleyrand als Leitlinie vor : Er sei mehr als ein Verbrechen, nämlich eine Dummheit.21 Der gewisse Vorbehalt machte sich in der Semantik bemerkbar. Während die Sozialdemokraten pauschal gegen die »elenden Monarchisten«22 vom Leder zogen, sprachen die Großdeutschen mit Vorliebe von der »karlistischen« Gefahr. Das klang verrucht nach den spanischen Ultras des 19. Jahrhunderts, aber es nahm weder die Anhänger der Hohenzollern ins Visier noch die Mandarine der Franz-Josephs-Zeit (oder die Mitarbeiter Franz Ferdinands, die wie Bardolff, Hamburger oder Riedl im nationalen Lager angesiedelt waren). Im Vorfeld der Regierungsumbildung waren die Christlichsozialen übrigens ein weiteres Mal an Dinghofer herangetreten und hatten ihm eine offene Koalition angeboten. Als Verfechter dieser Option profilierte sich im großdeutschen Klub Leopold Waber : Ganz anders als Kraft war er kein Vertreter des Wirtschaftsflügels und sichtlich auch kein Freund Dinghofers, sondern war ursprünglich als »Beamtenkandidat« gewählt worden, der mit kaiserlichen Finanzministern seine Sträuße ausgefochten hatte. Waber war nicht ganz frei von antikapitalistischen Allüren und einer gewissen querulantischen Ader. (Gürtler nannte ihn später einmal einen »Hanswurst«.23) Vielleicht könnte man seine Haltung auf die Linie bringen : Gerade weil er Staatseingriffe nicht von vornherein ablehnte, erwärmte er sich frühzeitig für die Beteiligung an der Macht. »Die Bevölkerung versteht nicht, daß wir nicht an der Regierung teilnehmen. […] Die Partei befände sich auf einer schiefen Bahn, denn sie werde von Doktrinären geleitet.« Doch so weit war selbst der Klub noch nicht, geschweige denn die Partei. Die Reichsparteileitung entschied sich am 27. April weiterhin für eine Politik der freien Hand : Man werde die Regierung unterstützen, »soweit sie unseren Grundsätzen entspricht«24 – was Waber wiederum als »Lakaiendienste« abqualifizierte, die nicht honoriert würden, der Agrarier Bichl als »Tingel-Tangel-Politik«.25
20 Schausberger, Ramek 117 f. 21 AdR, GDVP 2, Klub 1.4.1921 ; RP, 18.3.1921 ; vgl. auch Höbelt, Deutschnationale 130. 22 AZ, 24.4.1921, 3. 23 KvVI, CS-Klubvorstand 29.5.1922. 24 AdR, GDVP 2, Klub 28.4.1921. 25 AdR, GDVP 2, Klub 11.5.1921.
»Beamte unserer Richtung« : Schober als Retter
37
Unter diesen Umständen war die numerische Verstärkung für das Kabinett Mayr ein zweifelhafter Gewinn. Doch mehr als das (temporäre) innerparteiliche Vakuum durch die Abwesenheit Seipels brachte die nationale und internationale Situation Mayr in Bedrängnis. Im Frühjahr 1921 standen zum ersten Mal ernsthafte Kreditverhandlungen mit dem »Westen« an. In diesem Zusammenhang sollte – quasi als Vorleistung – auch das »Länderbank-Gesetz« verabschiedet werden, die Übernahme der Großbank durch ihre französischen Gläubiger, deren Vorkriegsanteile aufgewertet wurden. Das Gesetz wurde wegen des Widerstands der Sozi zunächst einmal zurückgezogen, dann wieder eingebracht. Finanzminister Grimm, der »Gesinnungsgenosse«, redete den Großdeutschen ins Gewissen, er müsse zurücktreten, wenn sie die Vorlage nicht billigten. Auch der Wirtschaftsflügel der Partei – mit Kraft als üblichem Verdächtigen – machte sich dafür stark, noch viel mehr natürlich für die Anglo-Bank als für die Länderbank mit ihrer Zentrale in Paris.26
»Beamte unserer Richtung« : Schober als Retter Wenn sich die Großdeutschen bei den Bankgesetzen schon empfänglich zeigten für den diskreten Charme der Bourgeoisie, dann hielten sie auf der anderen Seite bloß umso mehr an ihren propagandistischen »Hochzielen« fest, sprich : dem Mantra des Anschlusses : Der Nationalrat hatte schon in einer seiner ersten Sitzungen frohgemut eine Volksabstimmung über den Anschluss als vollmundige Demonstration des Selbstbestimmungsrechtes beschlossen. Da rechnete sich natürlich niemand irgendwelche konkreten Erfolgschancen aus. Die Entente würden auch noch so einhellige Kundgebungen unbeeindruckt lassen, darüber konnte kein Zweifel bestehen. Aber es war Teil eines innenpolitischen Lizits : In dieser Frage wollte sich niemand eine Blöße geben und zurückstehen. Die erste Abstimmung fand am Wochenende der Regierungsumbildung im »Heiligen Land« Tirol statt, mit seiner schwarzen ZweiDrittel-Mehrheit. Der Ruf nach dem Anschluss war darüber hinaus Teil einer inzwischen bereits wohlbekannten Strategie : Man betonte die Notwendigkeit des Anschlusses als Allheilmittel – um umgehend finanzielle Kompensationen zu fordern, wann immer dieser Herzenswunsch (vorhersehbarerweise) verweigert wurde. Inzwischen mehrten sich freilich die Bedenken, ob dieses Ritual nicht längst am Ende seiner Nützlichkeit angekommen war. Denn es ging ja nicht länger um einen Appell an das zarte Gewissen der Großen Drei (Wilson, Lloyd George und Clemenceau), die ihre Plätze längst geräumt hatten für eine Botschafterkonferenz. Sondern es ging um den Appell an die potenziellen Anleger, die von der Aussicht vermutlich nicht begeistert waren, ihr Geld in eine Firma zu stecken, die ständig von ihrer Auf26 AdR, GDVP 2, Klub 1./2.3. & 12.4.1921 ; März, Bankpolitik 442, 459 ff.
38
Die Übergangszeit 1920–1922
lösung schwärmte. Selbst im großdeutschen Klub stellte Dinghofer deshalb schon im April zur Debatte, ob man die Anschluss-Abstimmungen nicht verschieben solle, bis die Kreditverhandlungen abgeschlossen seien.27 Ganz abgesehen von den Reaktionen der deutschen Brüder : Denn das Deutsche Reich stand eben in heiklen Verhandlungen wegen der Festsetzung der Reparationssumme, die Anfang Mai 1921 in einem Ultimatum der Entente gipfelten. »Wenn wir jetzt gewaltsam oder länderweise den Anschluß propagieren, so bringen wir das Deutsche Reich in Verlegenheit«, gab Dinghofer zu bedenken.28 Hauser formulierte es bei den Christlichsozialen noch drastischer : »Tödliche Verlegenheit für die Deutschen«.29 Aber so ganz wollten sich selbst die Realpolitiker vor ihren Anhängern keine Blöße geben : Man werde doch wohl noch fragen dürfen ? Es handle sich schließlich nur um eine unverbindliche Feststellung, wie es um den Willen der Bevölkerung bestellt sei, ohne jede staatsrechtlichen Folgerungen. Doch Mitte April wurde Mayr vorstellig : Die »Entente« verlange, dass er alle Anschluss-Abstimmungen »unterdrücke«, sonst werde die Reparationskommission alle Zugeständnisse zurücknehmen, die sie in den letzten Wochen in Aussicht gestellt hatte. Dabei ging es in erster Linie um das später noch viel erörterte Problem der Freigabe der österreichischen Aktiva, wie z. B. der Zölle oder Salinen, die als Pfänder für Reparationszahlungen herhalten mussten – und deshalb nicht als Sicherheiten für Auslandskredite dienen konnten.30 Die darauffolgende Debatte am 29. April und 3. Mai ist denkwürdig nicht bloß als Sargnagel für das Kabinett Mayr, sondern als erste ausführliche Auseinandersetzung über die Meriten der Sanierung – der auswärtigen Anleihen und der Belastungen im Inneren – im Kreise der Großdeutschen. Vorhersehbar war die Position Ursins, der prophezeite : Wenn wir zustimmen, sind wir unseren Wählern gegenüber fertig. Hingegen : »Mit dem Zugrundegehen dieses Staates beginnt unsere Rettung.« Genau dieser Perspektive konnte Dinghofer keine solch optimistischen Prognosen entlocken : Man müsse die Zerrüttung des Staates verhindern, denn die Alternative sei keineswegs der Anschluss, sondern der Zerfall und die Aufteilung unter die Nachbarn. Vielfach wurde in dem Zusammenhang später auf die Jugoslawen verwiesen, die im Frühjahr 1921 schon im Miestal aufmarschiert seien.31 Auch das »Finanzkapital« erschien bei Dinghofer mit einem Schuss von Zweck optimismus in ganz anderer Beleuchtung : »Unser Gläubiger wäre Amerika, nicht Frankreich – und dadurch erhalten wir Hilfe für den Anschluß.« Auch in Berlin sei man dieser Ansicht und rate : »Holt aus der Entente heraus, was möglich ist !« Doch 27 AdR, GDVP 2, Klub 12.4.1921. 28 AdR, GDVP 2, Klub 4.3.1921. 29 KvVI, CS-Klub 12.6.1922. 30 AdR, GDVP 2, Klub 14.4.1921 ; Kuprian, Mayr. 31 AdR, GDVP 2, Klub 12.5.1921 (Frank unter Berufung auf eine Mitteilung Mayrs).
»Beamte unserer Richtung« : Schober als Retter
39
was war möglich ? Parteiobmann Kandl entgegnete : Die Völkerbunddelegierten, die damals gerade eine »fact finding mission« in Österreich absolvierten, stünden mit leeren Händen vor uns. Sie legten den Österreichern vielmehr eine lange Liste von »Hausaufgaben« vor, von Reformen, die in Angriff genommen werden müssten. Unter den Ersparungen im Staatshaushalt stand der Abbau der Lebensmittelsubventionen an erster Stelle. Auch um die Erschließung neuer Einnahmequellen – vom Tabakpreis bis zu den Bahntarifen – werde man da nicht herumkommen. Für die Umsetzung des Programms verlangten die Herren politische Garantien. Damit waren die Eckpunkte der Genfer Sanierung bereits umrissen. Doch über die Reihenfolge gab es ein Tauziehen : Joseph Avenol, das französische Mitglied des Völkerbund-Kleeblatts, bestand auf Vorleistungen zur Sanierung – einer inneren Anleihe und einem Stopp der Notenpresse –, bevor das »Ausland« den Österreichern helfend unter die Arme greifen könne. Die Steirer ließen verlauten, sie hätten wegen dieser harten Bedingungen eine Mitarbeit im Kabinett abgelehnt.32 Die Österreicher hingegen betrachteten umgekehrt die Auslandshilfe als notwendige Voraussetzung für jegliche Reformbemühungen. Das gegenseitige Misstrauen war deutlich greifbar – und nicht unberechtigt. Es war gut vorstellbar, dass die Österreicher, wie bisher, jegliche Hilfe bloß als willkommene Chance betrachten würden, schmerzhafte Reformen weiter aufzuschieben ; genauso wie es plausibel erschien, dass Kredite trotz allen Reformwillens ausbleiben würden, weil sich die Mächte untereinander uneinig waren. Bei den Großdeutschen kristallisierte sich als Ausgangsposition im Mai 1921 eine mittlere Linie heraus : Man verwarf die Katastrophenstrategie der Schönerianer und schloss sich Frank an, der – ganz im Gegensatz zu Ursin – argumentierte : Die Bevölkerung habe den Wunsch, dass etwas geschehe. »Tun wir nicht mit, so haben wir vollständig ausgespielt.« Parteiobmann Kandl vermochte ihm dabei durchaus zu folgen : Diesem Vorwurf dürfe man sich nicht aussetzen. Aber man könne Bedingungen stellen : Die Kredithilfe müsse sofort einsetzen – und die Partei solle sich nicht exponieren : Die Sanierungsaktion müsse von den anderen Parteien mitgetragen werden. Damit waren ausdrücklich auch die Sozialdemokraten gemeint. (Nur Bichl – einer der zwei »Rest-Bauern« – warnte vor einer Konzentrationsregierung, dabei werde man von den beiden Großen an die Wand gedrückt !) Die Verfechter des Kompromisses kamen mit Frank und Kandl aus der Gruppe um die Wiener Nationaldemokraten, die innerparteilich eher links von der Mitte angesiedelt waren. Ihre vorsichtig-unverbindliche Linie des »Ja, aber …« hatte den Vorteil, innerparteilich konsensfähig zu sein. Vorerst musste noch die leidige Frage der Anschluss-Abstimmungen abgewickelt werden. Fink soll den Großdeutschen ein Gesetz in ihrem Sinne zugesichert haben. 32 RP, 26.4.1921, 2/3.
40
Die Übergangszeit 1920–1922
Doch auf Betreiben Gürtlers hätten die Christlichsozialen diesen Beschluss revidiert. Mayrs Kompromissvorschlag lautete, man werde ein solches Gesetz einbringen, ohne dabei aber irgendwelche konkreten Termine zu nennen. Wabers Antrag, sich schlimmstenfalls auch mit einem solchen zahnlosen Gesetz zufrieden zu erklären, blieb in der Minderheit, aber nur mehr mit fünf zu neun Stimmen. Dinghofer folgte der Mehrheit, mit dem Stoßseufzer : Wenn man auf alle Termine verzichte und sich auf den Sankt-Nimmerleins-Tag vertrösten lasse, laufe man Gefahr, nicht mehr ernst genommen zu werden. Nach außen hin hatte man die Spannungen noch einmal verkleistert und sich alle Optionen offengehalten, doch intern machte sich der Unmut über die innerparteiliche Blockade unübersehbar Luft : Das Klubpräsidium mit Dinghofer an der Spitze drohte mit seinem Rücktritt und musste durch ein Vertrauensvotum besänftigt werden. Dinghofers Stellvertreter Straffner – damals zwar noch nicht Syndikus des Tiroler Industriellenverbandes, aber wohl schon als Vertreter des Wirtschaftsflügels anzusprechen – legte den Finger in die Wunde der institutionalisierten internen Gewaltenteilung. Die Politik des Nebeneinanders von Reichsparteileitung und Klub könne so nicht weitergehen. »Die Christlichsozialen haben sich ein Wirtschaftsprogramm zurecht gelegt, zu dem wir nur ja sagen können.«33 Auch Kraft machte deutlich, er sei mit der Politik der Reichsparteileitung nicht einverstanden. Hier werde Studentenpolitik betrieben und die bürgerliche Richtung verdrängt. Man müsse endlich einmal Rücksicht nehmen auf »jene Anhänger, die real denken«, sonst werden wir bald sagen können : »Es war einmal eine großdeutsche Volkspartei«.34 Seipel wies einen Ausweg aus der Sackgasse, in die sich die Großdeutschen mit der Abstimmungspolitik hineinmanövriert hatten : Die Abstimmungen könnten nicht stattfinden, doch die Christlichsozialen wären zu einem »Mea culpa !« bereit, weil sie ihre ursprüngliche Zusage nicht mehr einhalten konnten. Mayr sollte als Sündenbock herhalten. Die Christlichsozialen wollten Mayr für ihren Wortbruch opfern. So kam es denn auch, nicht zuletzt auf Grund des Verhaltens der steirischen Christlichsozialen, die ebenfalls auf ihrer Abstimmung bestanden. In Graz liebäugelte man damals mit einer »CSU-Lösung«, sprich einem Verhältnis zur Bundespartei wie zwischen Bayerischer Volkspartei und Zentrum. Der Justament-Standpunkt der Steirer hatte seine eigene Logik : Nirgendwo hatten die Christlichsozialen seit dem Umsturz im nationalen Lager solche Eroberungen gemacht wie gerade in der Steiermark. (Da zählte auch Gürtler dazu, der sich augenblicklich allerdings gegen Länder-Ultimaten verwahrte). Da wollte Rintelen nicht als »Umfaller« dastehen
33 AdR, GDVP 2, Klub 12.5.1921. 34 AdR, GDVP 2, Klub 15.6.1921.
»Beamte unserer Richtung« : Schober als Retter
41
vor den steirischen Großdeutschen, die ihrerseits zugaben, sie hätten ihre Anhänger nicht mehr in der Hand.35 Das Bauernopfer Mayr war als konziliante Geste gedacht ; doch das Abtreten Mayrs erwies sich für die Großdeutschen als ein klassischer Pyrrhus-Sieg. Denn wer sollte dem Professor folgen, der zwischen die Mühlräder der nationalen und internationalen Politik geraten war ? Die Fixierung auf außenpolitische Präferenzen erwies sich für die Großdeutschen einmal mehr als Stolperstein und verstellte den Blick auf Optionen. Frank fasste den Befund zusammen : »Jeder Nachfolger Mayrs ist für uns schlecht.« Kandl führte die Bedenken näher aus : Wenn wir Mayr stürzen, helfen wir dem anschlussfeindlichen, karlistischen Flügel. Sogar Waber blies in dasselbe Horn : Gürtler sei ein Franzosenfreund – und Seipel (der in Sachen Anschluss immer wieder gegen den Stachel der Political Correctness löckte) noch schlechter. Mayr aber reichte am 1. Juni seine Demission ein. Sein Kabinett schleppte sich noch drei Wochen dahin. Was tun, oder besser : Wen wählen ? Jetzt war guter Rat teuer. Seipel schlug den Großdeutschen am Vorabend seiner Wahl zum Parteiobmann eine Koalition vor. Er stellte allerdings auch klar : Mit den Anschluss-Abstimmungen sei nichts zu machen. Eine Koalition schied daher für diesmal noch aus. Auf eine Wiederholung des Modells Mayr unter einem anderen Namen, sprich ein christlichsoziales Minderheitskabinett, wollten sich die Großdeutschen ebenfalls nicht einlassen. Sogar Waber als beständiger Rufer nach Minister-Portefeuilles wehrte ab : Jetzt werde »reine Entente-Politik« betrieben, »da können wir nicht mittun.«36 Vor diesem Hintergrund erschien als Retter in der Not, wie die US Cavalry im Western, einmal mehr Johannes Schober, der inzwischen bereit war, sich doch noch als Bundeskanzler zur Verfügung zu stellen.37 Seitz hatte einem Konzentrationskabinett eine Absage erteilt. Straffner argumentierte deshalb, man solle das Fachmännerkabinett »durch parlamentarischen Einschlag gegenüber den Sozialdemokraten stärken«. Seipel soll ursprünglich sogar je zwei Minister für jedes der beiden Lager vorgesehen haben, einen davon für die Bauernbündler, doch Schönbauer lehnte ab. Es blieb bei bloß einem Vertrauensmann von Schwarz und Blau im Kabinett. Die Parteien nahmen sich insbesondere der Exekutive im engeren Sinne an. Die Christlichsozialen entsandten schließlich Vaugoin ins Heeresressort, der auch bei Schürff auf Zustimmung stieß. Heinl musste das Handelsressort räumen. Notabene : Dinghofer versicherte seinem Klub : Bei der Schulaufsicht bleibe man bei der Ablehnung konfessioneller Vertreter im Schulrat. Jede andere Haltung würde »uns lächerlich« machen. Der entsprechende Erlass von 35 AdR, GDVP 2, Klub 7. & 15.6.1921 ; vgl. auch Ableitinger, Unentwegt Krise 79 f. 36 AdR, GDVP 2, Klub 15.6.1921. 37 Hubert, Schober 101 ff.
42
Die Übergangszeit 1920–1922
Vizekanzler Breisky wurde von Pauly als berufenem Sprecher der freiheitlichen Lehrer umgearbeitet.38 Bei den Großdeutschen entschied man sich für Waber als Überzeugungstäter, mehr nolens als volens : Alle Klubmitglieder zierten sich pflichtschuldigst : Frank und Schürff, später langjährige Minister des Bürgerblocks, galten wegen ihrer Fehden mit den Agrariern als zu kontrovers. (Schürff war in eine Kontroverse mit Stöckler wegen umstrittener Holzablöseverträge in dessen Amtszeit verwickelt.) Waber wurde zum Schluss mit zehn Stimmen über sechs für den Salzburger Clessin ins Innenministerium entsandt. Das war kein überwältigendes Vertrauensvotum. Aber immerhin hatte man mit der Nominierung eines Ministers den ersten Schritt getan. Frank räsonierte, die Christlichsozialen hätten eine Niederlage erlitten – und sie bei der Regierungsbildung in einen Sieg umgemünzt, bei »uns« verhalte es sich umgekehrt. Aber er tröstete sich damit, durch die Wahl Schobers habe man mehr erreicht als durch dreißig Anschluss-Versammlungen.39 Mehr noch als Waber – der mit Schober ganz offensichtlich nicht »konnte«, wie sich bald herausstellte – galt immer noch Finanzminister Grimm als geheimer Vertreter der Großdeutschen in der Regierung (so wie auf der anderen Seite Grünber ger als Vertrauensmann Seipels). Wenn Grimm mit Rücktritt drohte, gaben die Großdeutschen regelmäßig nach. Das galt vor allem für die Bankgesetze, die eine Übernahme zweier Großbanken durch ihre auswärtigen Gläubiger absegneten, nicht zuletzt als Captatio Benevolentiae an die Adresse der westlichen Finanzkreise. Der Anglo-Österreichischen Bank – Rosenbergs Institut – wurden auch im großdeutschen Klub immer wieder Kränze geflochten. Ihre Flottmachung sei vom nationalen Standpunkt aus wichtig. Zwischen der »französischen« Länderbank und der Anglo-Bank stand freilich ein Junktim im Raum. Selbst der Lehrer Pauly sah ein : »Wenn wir das Länderbankgesetz glatt ablehnen, so ist auch der Weg für das deutsche Kapital nach Österreich schwierig gemacht.«40 Handelskammersekretär Conrad argumentierte : »Nach dem Gefühl würde jeder von uns für die Ablehnung der Bankgesetze eintreten, aber man dürfe sich nicht vom Gefühl, sondern vom Verstand leiten lassen.« August von Wotawa, ab 1924 dann selbst Parteiobmann, winkte ab : Das Chaos lasse sich ohnehin nicht aufhalten, doch Kandl entgegnete ihm : Es sei »taktisch nicht klug, deshalb die Lunte ans Pulverfaß zu legen«.41 Schließlich gab sogar die als doktrinär verrufene Reichsparteileitung am 3. Oktober 1921 mit 38 zu 17 Stimmen ihren Sanktus zum
38 AdR, GDVP 2, Klub 24.6.1921. 39 AdR, GDVP 2, Klub 15., 20., 21. & 22.6.1921 ; Hubert, Schober 101 ff. 40 AdR, GDVP 2, Klub 12.7.1921. 41 AdR, GDVP 2, Klub 29.9.1921.
Linkswende ? Das Intermezzo Gürtler
43
Länderbankgesetz. Als Ventil wurde fünf Abgeordneten – die für die Mehrheit nicht notwendig waren – Dispens zur Stimmenthaltung erteilt.42
Linkswende ? Das Intermezzo Gürtler Im Oktober befand sich Grimm allerdings schon in statu abeundi. Die Großdeutschen traf daran freilich keine Schuld. Ihr Eindruck, dass die Christlichsozialen »alles auf die Kreditaktion gesetzt« hätten,43 galt für Grimm nicht minder. Die Großdeutschen hatten ihm dabei auch keine Hindernisse in den Weg gelegt. Das Pech war bloß : Die Kredite kamen nicht. Eduard März hält eine Notiz in der ›Chicago Tribune‹ für das entscheidende Datum, mit dem alle Erwartungen auf demnächst zu gewährende Kredite gedämpft wurden. Wo immer die Hiobsbotschaft auch ihren Ausgang nahm, jedenfalls lautete die Schlagzeile der ›Neuen Freien Presse‹ am 26. Juli : »Katastrophenhausse wegen der Kreditfrage« : Infolge der »sanguinischen Auffassung über den Zeitpunkt der Kreditgewährung« habe es naturgemäß zu einem »Gegenstoß« kommen müssen, auch wenn sich an den »Eckdaten«, an den grundlegenden Tendenzen seit der Vorwoche, ja seit Monaten nichts geändert habe. Wenn man die einschlägigen Tabelle betrachtet, handelte es sich dabei freilich um eine Erscheinung, die sich alljährlich im Frühherbst wiederholte : Der Dollarkurs – im ersten Halbjahr noch verhältnismäßig stabil – stieg zwischen August und Dezem ber viel stärker an als der Banknotenumlauf und der Index der Lebenshaltungskos ten.44 Die verteuerten Importe – die wegen der geringen Nachfrageelastizität bei Getreide oder Kohle schwer einzuschränken waren – wirkten dann natürlich auf die heimische Inflation zurück. Doch im Herbst 1921 mchte sich dieser Trend noch viel stärker bemerkbar als in den Jahren zuvor. Damit schien eine neue Qualität der Inflation erreicht. 1919 und 1920 hatten die Preise im zweiten Halbjahr um rund 50 % angezogen. Schüller meinte, Renner als Kanzler habe diese Entwicklung »im modernen Sinne« damals noch durchaus goutiert, denn die Inflation verbürge Vollbeschäftigung (Scheinkonjunktur !) und das Dahinschmelzen der Kriegsschulden.45 Doch 1921 handelte es sich im zweiten Halbjahr bereits um 500 %, nicht mehr 50 %. Man stand vor dem Übergang zur galoppierenden Inflation. Es fehlte nicht mehr viel und die österreichische Krone würde auf den Finanzmärkten überhaupt nicht mehr gehandelt. Damit waren dann selbst die notwendigsten Importe in Frage gestellt.
42 AdR, GDVP 2, Klub 4.10.1921. 43 AdR, GDVP 2, Klub 22.6.1921. 44 März, Bankpolitik 587. 45 Nautz (Hg.), Schüller 125.
44
Die Übergangszeit 1920–1922
Die Politik stand deshalb nach der Sommerpause vor schwerwiegenden Entscheidungen. »Es muss etwas geschehen, sonst geschieht etwas.« Wenn das Ausland keine helfende Hand reichte, musste man sich eben – wie einst Münchhausen – am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Auslandskredite wurden gebraucht als Deckung für eine neu zu gründende Nationalbank – und um den Bedarf der Übergangszeit zu finanzieren, bis die notwendigen Reformen auch tatsächlich griffen. Otto Bauer veröffentlichte am 4. Oktober in der AZ ein Programm, das selbst bei den christlichsozia len Experten wie Kienböck (»zu ¾ vernünftig«) oder Schmitz beifällige Aufnahme fand. Die Sozialdemokratie war bereit zum Abbau der Lebensmittelsubventionen,46 freilich nur, wenn es dafür auch den Privilegien der Bourgeoisie an den Kragen ging, eine strikte Devisenbewirtschaftung einsetzte und eine Zwangsanleihe ausgeschrieben würde. Die rhetorische Frage der AZ lautete : Warum solle die Republik »auch in Zukunft in der ganzen Welt um die armseligen paar Millionen Franken betteln, während im eigenen Land ungleich größere Beträge an ausländischen Zahlungsmitteln in den Kassen der Kapitalisten liegen bleiben.«47 Bemerkenswert waren zwei Aspekte des Finanzplanes, die in ganz anderer Aufmachung noch lange durch die österreichische Politik geisterten. Bauer und die Sozialdemokraten waren sich nämlich sehr wohl im Klaren, dass ein Anziehen der Steuerschraube (samt dem Wegfall der Inflationsprämie) die Exportchancen der österreichischen Industrie in Mitleidenschaft ziehen könnte, auf die es ja in erster Linie ankam, wenn man das Loch in der Zahlungsbilanz stopfen wollte. Um die unvermeidlichen Belastungen adäquat zu verteilen, schlug Bauer daher die Schaffung von »Industrieverbänden« vor, die alle Steuern in Eigenregie unter sich aufteilen sollten. (So weit sollte es der »Ständestaat« ein Dutzend Jahre später nie bringen …!) Als knalliges Schlagwort für die geforderten, einschneidenden Maßnahmen aber bürgerte sich bei Freund und Feind der Ausdruck »Finanzdiktatur« ein. Als Sündenbock für die Versäumnisse der Vergangenheit wurde diesmal von allen Seiten nicht der Kanzler ausgeschildert, sondern Finanzminister Grimm (dem anders als in den Zeiten der Monarchie freilich die Rückkehr auf den Posten des Sektionschefs offenstand). Nun waren die fälligen Reformschritte mitnichten bloße Ressortangelegenheiten, die ein zum Minister beförderter Sektionschef ohne politischen Rückhalt in eigener Machtvollkommenheit umsetzen konnte. Grimm verteidigte sich mit dem Hinweis auf das Generalpfandrecht der Reparationsgläubiger, das in den USA wegen der Sommerpause des Kongresses noch nicht aufgehoben werden konnte.48 Doch die ›Reichspost‹ stimmte in das »Crucifige« ein, als sie dem scheidenden Minister den Eselstritt versetzte : »Zu lange schon dauert die Tatenlosigkeit 46 Nautz (Hg.), Schüller 125. 47 AZ, 12.10.1921. 48 AdR, GDVP 2, Klub 14.9.1921.
Linkswende ? Das Intermezzo Gürtler
45
in dem derzeit wichtigsten Staatsamte, während die Ausschreitungen der Valutahausse immer höher klettern.«49 Die Enttäuschung über die Kaltherzigkeit nicht bloß der Entente, sondern auch der unpolitischen Hochfinanz – die als heimliche Verbündete betrachtet worden war – musste als Anlass herhalten für eine potenzielle Linkswende der österreichischen Politik. Selbst Viktor Kienböck, ein Jünger Seipels, später als Finanzminister und Nationalbankpräsident berühmt-berüchtigt als die fleischgewordene finanzielle Orthodoxie, gab im christlichsozialen Klub zu Protokoll : »Jetzt muss auch Banken gegenüber das Staatsinteresse ganz energisch gewahrt werden. Ist nicht ganz unrichtig Gefühl des Volkes. Eine Bank nach der anderen retten, nach allen Seiten geschont. Wenn westliche Hilfe gekommen wäre, ganze Politik ganz richtig. Nur ist Hilfe nicht gekommen und wir müssen Zwangsmaßnahmen ergreifen.« Man solle Otto Bauer ruhig beim Wort nehmen : »Diktatur auf finanziellem Gebiet, die müssen sie mitstützen.« Man solle die Opposition einbinden und die »Verantwortlichkeit der Sozi festlegen«. Die Weichenstellung war eng verbunden mit dem Tauziehen über die Person von Grimms Nachfolger : Wie schon beim Sturz Mayrs stolperten die Großdeutschen, ja vielleicht beide bürgerliche Parteien über ihre weltanschaulichen Scheuklappen und Vorurteile. Direktoren der Anglo-Bank waren schon während der Gesprächsrunden im Laufe des Krieges bevorzugte Ansprechpartner des Nationalverbandes gewesen. Bezeichnend war, dass die Drohung der Christlichsozialen, ohne das Länderbankgesetz auch die Anglo-Bank nicht neu aufzustellen, ihre Wirkung nicht verfehlte. Als Emissär der Regierung in London war der leitende Direktor der Anglo-Bank tätig, Wilhelm Rosenberg. War er nicht der richtige Mann am richtigen Platz ? Dinghofer lobte ihn am 6. Oktober vor seinen Leuten auch über den grünen Klee : Rosenberg sei »zweifellos ein äußerst tüchtiger Mann«. Er »hat aber den Fehler, Jude zu sein und scheidet deswegen für uns aus.« Auch als Staatssekretär scheute man sich deshalb ihn zu nominieren, wohl aber sollte er »in irgend einer anderen Form für das Finanzministerium gewonnen werden.«50 Seipel schlug in diesem Sinne vor, ihn an »die Spitze eines kleinen Beirats zu stellen, der das Vertrauen der Finanzwelt ebenfalls erreichen wird.«51 Die AZ machte sich über den selektiven Antisemitismus der bürgerlichen Parteien lustig, die Rosenberg kein Toleranzpatent ausstellen wollten, doch nichts dabei fanden, in einem Aufwasch einen Juden sogar zum Minister zu wählen, nämlich Seipels Vertrauensmann Grünberger, an dem nicht einmal die Schönerianer irgendeinen Anstoß nahmen, dessen Stammbaum der AZ aber ganz offenbar verdächtig erschien. Die Anklage der Sozialdemokraten lautete auf Wähler49 RP, 7.10.1921. 50 AdR, GDVP 2, Klub 6./7.10.1921. 51 KvVI, CS-Klub 6.10.1921.
46
Die Übergangszeit 1920–1922
betrug : »Der Antisemitismus der Christlichsozialen ist ebenso echt wie ihre republikanische Gesinnung. […] Ganz so mögen es sich vor einem Jahr die Wähler der beiden antisemitischen Parteien, die uns regieren, gerade nicht vorgestellt haben …«52 Wer aber zog tatsächlich ins Finanzministerium ein ? Ein ehemaliger Schönerianer – nämlich der Volkswirtschaftsprofessor Alfred Gürtler, ein Sudetendeutscher, der – ganz wie Rintelen – von der Universität Prag nach Graz berufen worden war. Gürtler war als Los-von-Rom-Jünger evangelisch (und blieb es auch als christlich sozialer Präsident des Nationalrates ab 1928). 1914 hatte er kurz vor Kriegsausbruch dem Inoffizium am Tag der deutschen Burschenschaft präsidiert, bei Kriegsende dann vollmundig verkündet, die Schönerianer hätten ja doch recht behalten. Doch die Streitigkeiten der Grazer nationalen Szene hatten ihn schon kurz darauf zu den Christlichsozialen getrieben. Mit Chefredakteur Christian Fischer vom ›Grazer Volksblatt‹ verbanden ihn gute, mit Landeshauptmann Anton Rintelen auf die Dauer sehr viel weniger gute Beziehungen. Seipel hatte mit Gürtler im Klub schon öfters seine Sträuße ausgefochten. Die beiden Professoren als intellektuelle Galionsfiguren, dabei beide »Quereinsteiger«, die mit dem unterschwelligen Anspruch auftraten, dem Fußvolk der Partei – oder doch zumindest den Hinterbänklern im Klub – die Welt zu erklären, empfanden einander ganz offensichtlich als natürliche Rivalen. Als Vorsitzender des Finanzausschusses war Gürtler in gewisser Weise der offensichtliche Kandidat. Die Großdeutschen waren auf ihn als »Renegaten« zwar prinzipiell schlecht zu sprechen (was auf Gegenseitigkeit beruhte), aber doch bereit, ihn zu wählen. Sie wollten die Zahl der parlamentarischen Minister jedoch nicht auf je zwei aufstocken : Vaugoin musste deshalb aus dem Kabinett ausscheiden und für Gürtler Platz machen. Notabene : Irrig ist die Auffassung, bei Vizekanzler Breisky habe es sich formell um einen Christlich sozialen gehandelt. Er war zweifelsohne kein kämpferischer Freigeist, sonst hätte man ihm kaum das heikle Unterrichtsressort anvertraut, aber er war genauso wenig ein Parteimann wie auf der anderen Seite Grimm. Im April hatte sich Gürtler noch geziert, weil ihm die Bedingungen der Völkerbunddelegierten nicht geheuer waren. Jetzt war er es, der Bedingungen stellte : Bedingungen, die nicht von schlechten Eltern waren – und gar nicht so weit entfernt von den Ideen Otto Bauers, mit dem ihn, wie immer wieder angedeutet wurde, eine ausgesprochen gute Gesprächsbasis verband. Der Finanzplan der Sozi sei ein Zeichen von Mut, erklärte er im christlichsozialen Klub. Er sei nicht »dazu da, das Kabinett Schober, das ich von Anfang für verfehlt gehalten habe, eine bestimmte Zeit zu halten. Es muß endlich etwas geschehen.« Man dürfe sich nicht täuschen : Ein Beamtenabbau sei allenfalls beim Verkehr möglich. Diese Einschätzung verdankte sich der Resignation, nicht der Sympathie für die öffentlichen Angestellten : Im De52 AZ, 12.10.1921.
Linkswende ? Das Intermezzo Gürtler
47
zember ließ er sich zu einer Philippika hinreißen, die Regierung solle alles hinwerfen, denn in Österreich regierten nun einmal die Beamten …53 Als gefährliche Drohung musste vom bürgerlichen Publikum seine Ankündigung aufgefasst werden : »Scharfe Erfassung der Steuerquellen. […] Es gibt allerlei, wo man kräftiger zupacken muß. Müßte mit Vorlagen herantreten, die tatsächlich etwas vorstellen. Wegen Veränderung Katastralreinertrag. Und gewisse progressive [Steuern]. Der Kleinbauer, der nur so viel erzeugt, als er braucht, hat von Preisen gar nichts. Die anderen kann man heranziehen. Da müsste wirklich etwas einschneidendes geschehen.« Spalowsky als Obmann der christlichen Gewerkschafter sekundierte dem Ketzer : »Freut mich, dass kein Wort über Kredithilfe !« In politischer Beziehung wies Gürtler – trotz seines kolportierten direkten Drahtes zu Otto Bauer – zwar die Vermutung zurück, die Sozis würden ihm irgendetwas zuliebe tun. »Trotzdem weiß ich, dass ich gewisse Steuergesetze nur mit Sozi machen kann. Durchführen wichtiger als das Beschließen. Man wird halt zusammenkommen müssen.« Der Klub müsste sich bereit erklären, auf derartige Dinge einzugehen ! »Bringen wir Courage nicht auf, Katastrophe kommt dann schon. […] Ich verlange von Ihnen, daß Sie mich draußen verteidigen. Sie müssen Belastung übernehmen. Ich gehe nicht hin. Sie müssen mit mir sterben, […] sind nicht außer obligo.« Von seinen ehemaligen Gesinnungsgenossen bei den Großdeutschen hielt Gürtler offenbar wenig. Er verlangte von ihnen einen schriftlichen Vertrag : »Wie soll man zielbewusst arbeiten, wenn man nur [an] geraden Tagen Mehrheit hat.« Anders stand er als Steirer zu den Landbündlern, die sich erst 1922 endgültig als Partei konstituierten und damals im politischen Jargon verwirrenderweise meist noch unter der Bezeichnung deutschösterreichische »Bauernbündler« firmierten. Sie vertraten in den südlichen Ländern, Kärnten und Steiermark, gut die Hälfte der Bauernschaft. Ihre sechs Abgeordneten im Nationalrat hatten den Christlichsozialen schon ab und zu, wenn die Großdeutschen absprangen, eine hauchdünne Mehrheit verschafft. Sie könnten ein »ernsthafter Konkurrent« werden : »Wenn wir sie nicht sehr fest an Regierung binden, haben sie [es] leicht demagogische Politik zu machen.« Gürtler hoffte, dass »sie es vertragen, daß einer von ihnen Dinge macht, die draußen sehr unangenehm sein werden.« Ihren Guru, den Jus-Professor Ernst Schönbauer, könnte er sich gut als Justizminister vorstellen.54 Die Frage erhebt sich : Was sagte Seipel als Parteiobmann zu all dem ? Nun, seine Ausführungen enthalten keine Spur von »Wir schaffen das«, keine Aufbruchsstimmung von Blut, Schweiß und Tränen. Er widmete sich der nüchternen politischen Arithmetik : »Wir können nicht allein Regierung bilden, ebenso wenig können wir uns ganz entziehen.« Wenn halbwegs ruhige Verhältnisse herrschten, wenn nicht 53 AdR, MRP 53, 15.12.1921. 54 Kalwoda, Schönbauer.
48
Die Übergangszeit 1920–1922
Panik wäre, hielte er eine Gesamtdemission der Regierung für die geeignete Lösung. Er fügte allerdings sofort hinzu : »Es gibt keine andere Mehrheit als jetzt.« Fink unterstrich diese Position noch viel deutlicher. »Sozi werden sich kaum auf etwas Konkretes verpflichten.« Allerdings sei mit Gürtler vielleicht am ehesten etwas bei ihnen zu erreichen. In welche Richtung Finks Überlegungen eigentlich gingen, wird vielleicht aus seiner Replik auf die wegwerfenden Bemerkungen Gürtlers über die Großdeutschen deutlich : »So weit waren wir nie, wie wir heute mit ihnen sind …« Kunschak wollte Gürtler nicht als politisches Kanonenfutter verheizen, sondern ihn erst zum Finanzminister designieren, wenn sich in den Parteienverhandlungen herausstellte, dass seine Vorstellungen auf Zustimmung stießen. Doch Seipel war dafür, Gürtler – als hintergründigen Vertrauensbeweis – gleich hic et nunc zu nominieren : Der Klub stimmte dem Obmann mit 23 über 6 Stimmen zu. So wurde Gürtler als Reserve in die Bresche geworfen, weil eine durchgehende Rekonstruktion des Kabinetts auf Grund der finanziellen Panik nicht am Platz war. Am Prüfstand befand sich nicht bloß Gürtler, sondern auch die Linie der stillschweigenden Koalition mit den Sozialdemokraten, vergleichbar vielleicht dem tschechischen »Oppositionsvertrag« der Jahrtausendwende. Sachlich übernahm Gürtler eine gewaltige Hypothek : Das »mobile Kapital« zur Kassa zu bitten – da waren alle dafür. Aber es war schwer machbar. Beim »immobilen« Kapital hingegen mochte man im Rückblick leicht den Eindruck gewinnen, dass man Gürtler mit seinen Forderungen, militärisch gesprochen, wissentlich vor die Gewehrläufe der Agrarier gejagt habe. Darauf lässt sich noch keine Verschwörungstheorie aufbauen und keine der Dolchstoßlegenden, wie sie z.B. das Verhältnis Seipels zu Schober im Laufe der Jahre dann noch zur Genüge kennzeichnen sollten. Gürtler hat bei seinem Rücktritt Seipel überraschenderweise auch ausdrücklich gedankt. Aber der Eindruck, dass Seipel die Erfolgschancen des Gürtler’schen Ansatzes nicht allzu hoch einschätzte, ist nicht von der Hand zu weisen. Die Haltung des Führungsduos Seipel/Fink – die Fink im Klub sogar noch viel deutlicher artikulierte als Seipel – war sichtlich an Plan B orientiert. Seipel behielt die Idee der Finanzdiktatur im Talon, die freilich augenblicklich ohne die Sozi nicht möglich erschien – und mit den Sozi nicht wünschbar. Seipel ließ sich selten auf persönliche Fehden ein. Vielleicht noch enervierender, er gab sich immer den Anschein, über den Dingen zu stehen. Auf Angriffe im Klub reagierte er selten cholerisch : »Alte Kämpfer« wie Kunschak oder Schöpfer wurden bei ihren zuweilen temperamentvollen antikapitalistischen Ausfällen mit ausgesuchter Höflichkeit behandelt. Kunschaks Philippika gegen den Vertrag von Saint-Germain würdigte er 1919 als einen »achtenswerten Ausdruck des Schmerzes, aber das Rezept nicht empfehlen …«55 Bei Gürtler fällt auf, dass er – zum Unterschied von 55 Höbelt/Kalwoda/Schönner (Hgg.), Klubprotokolle 553 (4.6.1919).
Linkswende ? Das Intermezzo Gürtler
49
seinem Nachfolger Ségur – nach seiner Eingangsvorstellung seine Vorlagen fast nie selbst im Klub verteidigte ; einmal, so ist vermerkt, kam er zumindest ans Telefon. Als er schließlich doch einmal höchstpersönlich ein längeres Exposé entwickelte, sei sein Bericht mit eisigem Schweigen quittiert worden, vermeldeten zumindest die ihm wenig wohlgesonnenen Tiroler.56 Die unbestreitbare Leistung Gürtlers – und seines direkten Drahts zu Otto Bauer – war der Abbau der Lebensmittelsubventionen, der kurz vor Weihnachten beschlossen wurde. Die sozialdemokratische Presse, z. B. der Grazer ›Volkswille‹57, ging mit erstaunlich leichter Hand über dieses Zugeständnis hinweg. Der Abbau erfolgte gestaffelt in vier Etappen bis zum Frühjahr. Dafür wurde das System der Indexlöhne, das bisher nur besonders begünstigte Gruppen, wie z. B. die Metallarbeiter, hatten durchsetzen können, auf die gesamte Arbeiterschaft ausgedehnt (was natürlich die Inflationsspirale wiederum vorantrieb). Die Industrie wurde verpflichtet, die Löhne um einen entsprechenden Betrag hinaufzusetzen. Eduard März, ein Wirtschaftshistoriker, der selbst aus der Arbeiterbewegung kam, hat die Folgen harsch kritisiert : »Löhne und Preise schienen miteinander zu einer Art von Veitstanz angetreten zu sein.«58 Bei den Bürgerlichen verfestigte die Reform bloß den Eindruck : »Die Industriearbeiter führten das große Wort.« Der Übergang vom Gießkannenprinzip der Lebensmittelzuschüsse zur »Subjektförderung« nach Branchen öffnete die Pandorabüchse der Verteilungskonflikte : Die Verteuerung der Produkte hatte jeder Staatsbürger zu tragen, nicht nur der Industriearbeiter. Doch was war mit den Selbständigen, mit den Beamten und Staatsangestellten, die – mit ihren Angehörigen – auf bis zu 600.000 Personen geschätzt wurden ? Wenn auch die Beamten entsprechend alimentiert wurden, war die Erleichterung für das Budget illusorisch. Es gab längere Debatten über die komplizierten Regelungen, die für die Armenfürsorge vorgeschlagen wurden. Im christlichsozialen Klub war Kritik aus unerwarteter Richtung zu v ernehmen : von den Agrariern. Niederösterreich galt üblicherweise als das Bollwerk und die Hochburg der Getreideproduzenten. Doch eine Woche vor der Debatte im Haus schwang sich ausgerechnet der Niederösterreicher Stöckler zum Anwalt der Gebirgs bauern auf, die selbst kein Getreide produzierten und für ihre Milch nur ein Spottgeld erwirtschafteten. »Das für uns parteimäßig von ungeheurer Bedeutung. Unsere bravsten Leute haben wir im Gebirge. Die dürfen wir nicht umbringen. Ist Ast, auf dem wir sitzen. Wenn wir auch angegriffen werden, das ist Lebensnerv unserer ganzen Bewegung.«
56 Tiroler Anzeiger, 25.1.1922. 57 Volkswille, 20./21.12.1921 ; RP 21.12.1921. 58 März, Bankpolitik 419.
50
Die Übergangszeit 1920–1922
Seipel griff die Kritik sofort auf und gab ihr einen anderen Drall. Er schilderte das Junktim ausdrücklich als eine Arbeit des Parlaments, nicht als eine Regierungsvorlage. Er habe Verständnis dafür, wenn die Bauern jetzt Forderungen stellten, weil »man« (war hier das Tête-à-Tête Gürtler/Bauer gemeint ?) sie vorher ja auch nicht zu Beratungen herangezogen habe. Als Fink einwarf, wenn die »Bündler« einen entsprechenden Antrag einbrächten, dürften es die Städter den christlichsozia len Bauern nicht verübeln, wenn sie sich ihnen anschlössen, ging Seipel gleich einen Schritt weiter. Warum nicht selbst aktiv werden ? Wenn schon Abbau der Bewirtschaftungsmaßnahmen, dann konsequent. Er stellte in den Raum : Die wirtschaftliche Freiheit für den Grundbesitz – er nannte als Beispiel die Erleichterung der Vermarktung durch Aufhebung der lokalen Ausführverbote – wird ziemliche Zustimmung finden.59 Das Zugeständnis der Bürgerlichen für die Aufhebung der Lebensmittelzuschüsse bestand nicht zuletzt in einem System der Steuervorauszahlungen, das Inflationsgewinne abschöpfen sollte, und – als Vorgeschmack auf eine mögliche Devisenbewirtschaftung – in einer Anmeldungspflicht für alle »gehorteten« Bestände von Fremdwährungen, wenn auch verbunden mit einer Steueramnestie für alle Einkünfte, die auf diesem Wege offengelegt wurden. Die Steueramnestie war das Zuckerbrot, die Peitsche bestand in einer raffinierten Zusatzbestimmung, einem Anreizsystem für Denunziantentum : Wer einen verstockten Devisenbesitzer anzeigte, wurde mit e inem Drittel der konfiszierten Bestände belohnt. Natürlich müsse man ein solches Gesetz wegen akuter »Verdunklungsgefahr« über Nacht durchpeitschen, argumentierte die AZ und frohlockte : »Schritt für Schritt setzt sich unser Finanzplan durch.«60 Die ›Neue Freie Presse‹ weinte Rosenberg, der erklärt hatte, er sei gegen »jede Zwangsmaßregel, weil sie bolschewistischen Charakter besitze«, sichtlich Tränen nach und stellte die rhetorische Frage : »Wer regiert in Österreich ? Die jetzige Parteiengestaltung oder die Sozialdemokratie, die alle Freuden der Koalition genießt, ohne die Verantwortung zu teilen.«61
Der Pyrrhussieg der Grossdeutschen : Schober als Stolperstein Die jetzige Parteiengestaltung ? Als bürgerliche Regierung konnte das Kabinett Schober nur mit Einschränkungen gelten. Fink hatte im Oktober frohlockt : »So weit waren wir nie, wie wir heute mit ihnen [den Großdeutschen] sind …« Aber der Patient erlitt wieder Rückfälle. Als bösartiger Virus erwiesen sich – wie so oft – die 59 KvVI, CS-Klub 13.12.1921. 60 AZ, 22.12.1921. 61 NFP, 22.12.1921.
Der Pyrrhussieg der Großdeutschen : Schober als Stolperstein
51
Fallstricke der Außenpolitik, wo die Erfordernisse der Realpolitik auf apodiktische Ehrenstandpunkte und sorgsam gepflegte Illusionen stießen. Das nächste halbe Jahr bis zur Fixierung des Bürgerblocks war durch Interferenzen der Außenpolitik bestimmt, die dem Trend der Innenpolitik zuwiderliefen. Ein erster Vorgeschmack darauf war der zweite Restaurationsversuch Kaiser Karls, gleich im Oktober 1921, der bei den Großdeutschen wiederum Schnappatmung auslöste – und einmal mehr die Fühlungnahme mit den Sozialdemokraten in den Vordergrund rückte, ja sogar die Anlehnung an die Tschechoslowakei.62 Karl war bei seiner abenteuerlichen Rückkehr in Westungarn gelandet, ein paar Kilometer östlich von Ödenburg. Daran schloss sich beinahe nahtlos das Dilemma der Burgenlandfrage : Sollte man auf den italienischen Kompromissvorschlag eingehen, 300.000 Deutsche ohne weitere Zores in Empfang zu nehmen, wie Dinghofer es befürwortete, aber Ödenburg den Ungarn zu überlassen (mit oder ohne Volksabstimmung) ? Auch da verliefen die Fronten anders als bei den innenpolitischen Themen mit ihrem Unterton von »Klassenkampf«. Die Kirche galt als magyarophil, die Sozi als kämpferisch anti-ungarisch. Dinghofer blieb mit seinem Antrag im großdeutschen Klub mit vier zu sieben in der Minderheit. Schober entschied sich dennoch für den Kompromiss. Sollte man ihm deshalb die Freundschaft aufkündigen ? Dinghofer verstand die Welt nicht mehr : »Wir haben den Mann selbst gemacht und sollen ihn nun stürzen ?«63 Doch es kam noch ärger : Schober hatte an der internationalen Politik und Reisediplomatie inzwischen Gefallen gefunden. Er hatte alle Schalmeienklänge aus Prag verworfen, der Kleinen Entente beizutreten und sich danach von Ungarn zu holen, was immer er wolle ; aber er fuhr in die tschechoslowakische Hauptstadt, um den wirtschaftlichen Austausch in Gang zu bringen. Und siehe da : Dieselben Leute, die ihn vor wenigen Wochen zu militärischen Absprachen mit der Tschechoslowakei gedrängt hatten, warfen ihm jetzt die Reise nach Prag vor, die im Vertrag von Lana gipfelten (der Österreich immerhin einen Kredit von 500 Millionen Kronen in Aussicht stellte, schon einmal deshalb, weil der tschechoslowakische Export sonst einbrach, wenn die Österreicher gar nicht mehr zahlen konnten).64 Die AZ goss Öl ins Feuer, wenn sie argwöhnte, Österreich werde »gewissermaßen zum beschränkten Teilnehmer der Kleinen Entente«65. Die Großdeutschen gingen prompt in die Falle und verteufelten den Vertrag als Verrat an den Sudetendeutschen, weil man sich gegenseitig die Grenzen garantierte, die Österreich ohnehin schon in Saint-Germain anerkannt hatte. Konsequenz und 62 Höbelt, Deutschnationale 130. 63 AdR, GDVP 2, Klub 20.10.1921. 64 Diese Überlegung laut AZ, 31.1.1922. 65 AZ, 21.12.1921, 2.
52
Die Übergangszeit 1920–1922
Prinzipientreue waren ganz offensichtlich nicht deckungsgleich. Nach der Ödenburger Abstimmung vom 14./16. Dezember 1921, die programmgemäß für Ungarn ausfiel, war Schober mit dem Vertrag von Lana bei den Großdeutschen endgültig in Ungnade gefallen. Seipel hielt die erste Kundgebung der Großdeutschen in der Sache zwar für »auffallend gemäßigt«, bedauerte aber die starke Wendung gegen Schober als »hässlich und unangenehm«.66 Die großdeutsche Reichsparteileitung hatte im Sommer mehrmals den geordneten Rückzug antreten müssen, z. B. bei den Bankgesetzen. Sie bäumte sich ein letztes Mal auf. »Die See raste und will ihr Opfer haben.« Kandl sprach das Urteil, Schober habe sich als ein unredlicher Mensch entpuppt. Und nicht nur er … Kandl fuhr fort, er habe den Eindruck, der Parlamentsklub sabotiere die Politik der Parteileitung. Wie immer beriefen sich alle Beteiligten auf die Stimme der »Basis«. In Wien war der sudetendeutsche Einschlag am stärksten. Aus dem Westen erscholl es, man möge doch auf die Länder Rücksicht nehmen. Die Stellungnahme gegen Schober sei ganz einfach ein Fehler. Der oberösterreichische Parteichef Langoth ließ ausrichten, das sei auch sein Eindruck. Die ›Linzer Tagespost‹, das nationalliberale Blatt Oberösterreichs, wetterte gegen das »starre Parteidogma, das schon so viel Schaden angerichtet habe«. Dinghofer lavierte und drohte mit dem Rücktritt als Klubobmann : Er könne eine solche Politik auf Dauer nicht mittragen.67 Geradezu begeistert waren auch die Christlichsozialen nicht über den Vertrag. Vaugoin seufzte : »Für uns geradezu unerträglich. Gerade mit jenem Volk, das am Zusammenbruch die meiste Schuld hat, die besten und ersten Freunde werden sollen.« (Er wollte aus Gründen der politischen Balance da zumindest auch einen Vertrag mit Ungarn abschließen – was aber wegen der Burgenlandfrage im Augenblick auch kein allzu populäres Vorhaben war.) Auch bei den Christlichsozialen waren die Wiener besonders kritisch, doch auch im Westen verabschiedete der Tiroler Landtag eine Manifestation gegen Lana. Seipel und Fink versuchten ihren Leuten das Misstrauen zu nehmen, hier würde über ihre Köpfe hinweg Politik gemacht, um dann das ungeliebte Kind mit dem Hinweis schmackhaft zu machen, mit Lana hätten wenigstens die »viel unerträglicheren Bindungen« des ominösen Geheimvertrages, den Renner schon 1920 mit Beneš abgeschlossen habe, ihre »Gültigkeit eingebüßt«.68 Jetzt wisse man wenigstens, woran man sei. Wie immer man auch zu den einzelnen Klauseln stehen mochte, einen unterschriebenen Vertrag nachträglich im Hause zu verwerfen, wäre eine Brüskierung des Nachbarn, die man besser unterlassen solle. Als moralische Unterstützung hatte Sei66 KvVI, CS-Klub 16.1.1922. 67 AdR, GDVP 2, 25. & 27.1.1922 ; Linzer Tagespost, 28.1.1922. 68 RP, 27.1.1922.
Der Pyrrhussieg der Großdeutschen : Schober als Stolperstein
53
pel vorsorglich zwei Vertreter der sudetendeutschen Christlichsozialen, Bobek und Luschka, nach Wien eingeladen, die ihren Gesinnungsgenossen pflichtschuldigst versicherten, ein Votum für Lana würde ihnen keinen Schaden bringen (es sei denn, man könne durch die Ablehnung des Vertrags Beneš stürzen).69 Als der Klub weiter lavierte und alle möglichen Tricks anvisierte, um ein paar harmlose Demonstrationen in Szene zu setzen, appellierte der Prälat an die professionelle »Ehre« und die weltmännische Ader seiner Kollegen : Müsse er die Herren daran erinnern, dass sie von Beruf Demagogen seien ?70 Bloß die hartnäckigen Tiroler – schon wegen Südtirol immer allergisch, wenn es um Reminiszenzen an Saint-Germain ging – verließen bei der Abstimmung dann doch den Saal.71 Schober wartete ab, bis eine schwarz-rote Mehrheit am 26. Jänner dem V ertrag von Lana ihren Segen gab (nicht ohne durch »authentische Interpretationen« allen »üblen Folgen« vorzubeugen !). Dann inszenierte er einen formvollendeten Abgang. Sein Vizekanzler Walter Breisky stand vierundzwanzig Stunden lang an der Spitze des »Kabinettsrates«, eine beliebte Quizfrage – vor allem seit sein BeinaheNamens vetter diesen Posten ein halbes Jahrhundert später ungeahnt lange innehatte. Schober – der in puncto Marketing so manchen Berufspolitiker in den Schatten stellte – warf inzwischen nach allen Richtungen mit wohl dosierten Vertraulichkeiten um sich : Emmy Stradal verlas im Klub eine Meldung, der getreue Schober wolle ohne die Großdeutschen keine Regierung mehr bilden. Im christlichsozialen Klub berichtete Gürtler, man habe mit Schober »moralische Eroberungen« gemacht, der sich jetzt ganz als »unseren Mann« betrachte ; Fink steuerte die Meldung bei, Schober habe ihm zugeflüstert, die Sozialdemokraten hätten ihn gebeten, doch zu bleiben.72 Eine christlichsoziale Minderheitsregierung – eventuell unter dem Vorarlberger Landeshauptmann Otto Ender, der immer wieder als papabile galt – wurde als Alternative diskutiert und verworfen. Die AZ schwärmte davon, es sei bei den Christlichsozialen zugegangen wie im Dorfwirtshaus nach der Kirchweih, weil einige gerne wieder Minister geworden wären : Das Klubprotokoll unterstützt diese Vermutung nicht. Das Thema war bald abgehakt. Neuwahlen – nach wenig mehr als einem Jahr – waren für Parteigranden wie Mayr oder Weiskirchner erst recht eine Horrorvision. Weiskirchner deponierte aber auch ganz unmissverständlich : »Eine Koalition mit den Sozialdemokraten bei Wählern ganz ausgeschlossen.«73 Zumindest in diesem Punkt bestand Einigkeit. Denn auch die AZ erklärte klar und deutlich : »Unsere Ge69 KvVI, CS-Klub 13.1.1922. 70 KvVI, CS-Klub 16.1.1922. 71 Tiroler Anzeiger, 27.1.1922. 72 KvVI, CS-Klub 24./25.1.1922 ; AVA, GDVP 2, Klub 25.1.1922. 73 KvVI, CS-Klub 24./25.1.1922.
54
Die Übergangszeit 1920–1922
nossen lehnten selbstverständlich jede Einladung zur Teilnahme an der Regierungs bildung ab.«74 Schließlich ergab sich ein Ausweg : Die nationalen Bauern, die »Bündler«, waren zwar nicht für den Vertrag, erklärten sich aber bereit, Schober noch einmal zu wählen. Sie ließen ihren siebzigjährigen Senior Franz Altenbacher diese Entscheidung im Nationalrat mit einem untadeligen nationalen Motivenbericht begründen : Man müsse das Gemeinwesen schließlich »vor dem Zerfall bewahren in einer Zeit, in der das Deutsche Reich keine wirksame Hilfe bieten kann«. Schönbauer lehnte einmal mehr das Justizministerium ab, das ihm Seipel angeboten hatte. Er sei gegen eine Parlamentarisierung des Kabinetts und nahm sich selbst dabei nicht aus, empfahl dafür aber Koryphäen seines Faches von Schwind über Walter bis zu Gleispach, die freilich – zumindest damals – allesamt nicht zum Zug kamen.75 Damit war die gewisse hauchdünne Mehrheit gegeben : 82 Christlichsoziale und sechs »Bündler«, das waren 88 – mit dem Grafen Czernin von der Bürgerlichen Arbeitspartei 89 – von 175 Stimmen. Allenfalls in den Ausschüssen, z. B. im Hauptausschuss, wo die Mini-Fraktion der »Bündler« nicht vertreten war, konnten sich da Schwierigkeiten ergeben. Waren die nationalen Bauern den Großdeutschen in den Rücken gefallen ? Oder hatten sie bloß ihren Rückzug gedeckt ? Denn auf diese Weise waren die Großdeutschen vorerst außer Obligo. Sie konnten ihrem JustamentStandpunkt frönen, ohne eine Krise heraufzubeschwören. Die Sozialdemokraten, so berichtete Dinghofer, würden ein paar ihrer Leute »abkommandieren«, um unliebsame Überraschungen zu vermeiden. So geschah es dann auch : Schober wurde am 27. Jänner mit nicht bloß drei, sondern acht Stimmen Mehrheit (80 zu 72) wiedergewählt. Die Schlussfolgerung lag auf der Hand : Die Sozi waren mehr denn je stille Teilhaber der Regierung. Gürtler war jetzt der einsame »Parlamentarier« im »Kabinettsrat«. Weder ein Großdeutscher noch ein (Land)»Bündler« leisteten ihm Gesellschaft. Die Tiroler mutmaßten missgünstig, ihm habe vermutlich bloß sein Intimfeind Waneck das Portefeuille gerettet, der ihn mit ehrenrührigen Vorwürfen überschüttet habe, die inzwischen einen Untersuchungsausschuss beschäftigten (und bald danach auch eine Disziplinaruntersuchung der eigenen Partei gegen Waneck). Angesichts dieser Angriffe habe ihn der eigene Klub doch nicht fallen lassen können.76 Wahrscheinlicher war : Kontinuität ist Trumpf. Wegen eines Kabinetts von so beschränkter Lebensdauer wollte man sich nicht den Aufregungen einer Rekonstruktion aussetzen. Nur ein Revirement erfolgte notgedrungen : Um den Stein des Anstoßes zu beseitigen, gab Schober das Außenamt ab und übernahm von Waber das Innenressort, das ihm 74 AZ, 27.1.1922. 75 KvVI, CS-Klub 25.1.1922 ; AdR, GSVP 2, Klub 25.1.1922. 76 Tiroler Anzeiger, 25./26.1.1922.
Der Pyrrhussieg der Großdeutschen : Schober als Stolperstein
55
ohnehin viel besser auf den Leib geschneidert war. Mit dem Außenamt wurde der Landwirtschaftsminister Baron Leopold Hennet betraut, ein alter Diplomat und, wie viele seiner Zunft, im Herzen ein Legitimist – was an der Führung der Außenpolitik nichts änderte, aber einen ironischen Schlussakkord für den Furor teutonicus und seine kontraproduktiven Wirkungen darstellte.77 Auf der Börse war in den Tagen der Regierungskrise ein wildes Auf und Ab zu verzeichnen. Am 23. Jänner erreichte der Dollarkurs 10.000 Kronen (vor dem Krieg ganze 5 K), eine Woche später war der Kurs wieder um mehr als ein Viertel gefallen. Bezeichnend war, dass niemand – auch nicht die Opposition – derlei extreme Kursschwankungen mit den Manövern der heimischen Politik, mit Schober und Kandl, Gürtler oder Seipel in Verbindung brachte. Die AZ machte für den Fall der Krone vielmehr den »französischen Imperialismus« verantwortlich, insbesondere der Wechsel von Briand zu Poincaré als Premier habe den Hoffnungen auf eine einvernehmliche Lösung der schwebenden Fragen einen schweren Schlag versetzt ; eine Woche später hieß es dann, das Ende der Washingtoner Flottenkonferenz habe den Weg frei gemacht für eine wohlwollende Haltung der USA gegenüber dem alten Kontinent, die eine baldige Aufhebung der Pfandrechte erhoffen ließ ! Es bestehe deshalb Aussicht auf einen Vorschusskredit aus England.78 Der englische Kredit und seine Begleiterscheinungen standen dann auch im Zentrum der nächsten Regierungskrise, die sich mit all ihren nie ganz geklärten Verschwörungstheorien herrlich als Vorlage eines politischen Thrillers eignet. Lloyd George hatte am 7. Februar zwei Millionen Pfund zugesagt – eine beachtliche Summe, aber immer noch zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben ? Seipel fand die Information »nicht sehr erfreulich«, dass sowohl Briten als auch Franzosen vorher Beneš um seinen Rat gefragt hätten. Auf alle Fälle stellte sich die Frage : Wozu sollte das Geld verwendet werden ? Womöglich nicht bloß zum Stopfen der Löcher. Seipel selbst seufzte, man werde den Österreichern dabei ziemlich freie Hand lassen, und fügte hinzu : »Mir wäre lieber, wir hätten sie nicht.«79 Immerhin : Die Geldgeber bestanden auf Reformmaßnahmen der Österreicher. Die Kredite sollten Zug für Zug flüssig gemacht werden, sobald dafür zumindest gewisse Anzeichen vorlagen. Schober legte dem Nationalrat am 3. März ein entsprechendes Programm vor. (Gürtler hielt sich im Hintergrund – ob dafür jetzt sachliche Differenzen verantwortlich waren oder bloß Rivalität ums Rampenlicht ?) Die Engländer hatten George Malcolm Young nach Wien entsandt, einen jungen Beamten, der 1917 den Labour-Minister Henderson nach Russland begleitet hatte – und seine Tage als Historiker in Oxford beschloss. Young fungierte offiziell als Berater 77 Vgl. seine Erinnerungen : AVA, E/1751. 78 AZ, 24. & 31.1.1922. 79 KvVI, CS-Klubvorstand 8.2.1922.
56
Die Übergangszeit 1920–1922
der Anglo-Bank und hatte über die Auszahlung der Gelder zu wachen. Er schrieb dem Kanzler am 10. März einen Brief, er könne den Kredit nur freigeben, wenn die angekündigten Reformen vom Parlament auch tatsächlich akzeptiert würden ; allerdings sei er bereit, eine Ausnahme zu machen, solange man ihm nur garantieren könne, dass Schober an der Spitze der Regierung erhalten bleibe.80 War das jetzt eine flagrante Einmischung in die inneren Angelegenheiten Österreichs ? Aber hatte Seipel diese Kontrolle nicht geradezu herbeigesehnt ? Oder war es eben keine Kontrolle, sondern ein Schachzug im Sinne persönlicher Protektionswirtschaft ? Vor allem aber : Wieso kam Young auf die Idee, dass Schobers Position akut gefährdet war ? Das war der Chef einer Beinahe-Minderheitsregierung natürlich tatsächlich. Hatte er sich deshalb den Brief bestellt, um seinen Landsleuten zu beweisen, welches Aktivum er darstelle ? Oder wenn schon nicht er selbst, hatte seine Umgebung bei Young antechambriert ? Oder gar, wenn man den Faden weiterspann, standen dahinter seine Gegner, um Schober als verlängerten Arm des Auslands in Misskredit zu bringen ? Die Gerüchteküche brodelte … Die Vermutung, Schober sei nur auf Abruf bestellt, war ja nun keineswegs abwegig. Hinter den Kulissen fanden seit dem ersten Tag – oder doch zumindest seit den ersten 14 Tagen – des Kabinetts Schober II Parteienbesprechungen statt, um die Regierung auf eine verlässliche Grundlage zu stellen. Damit war voraussichtlich auch eine Änderung ihrer Zusammensetzung verbunden, denn so ganz ohne Personalwechsel würde diese Stabilisierung nicht über die Bühne gehen. Schon Mitte Februar berichtete Seipel seinem Klub, bei den Großdeutschen werde an einer Konsolidierung gearbeitet. Bereits nächste Woche könne man mit der Mehrheitsbildung fertig werden. Bei den Großdeutschen arbeitete man tatsächlich an einem Forderungskatalog bzw. Programmentwurf. In der Partei prallten die Gegensätze frontal aufeinander : Die Wiener drohten mit einer Parteispaltung, wenn man bei Schober zu Kreuz krieche, die Oberösterreicher, wenn man in der Opposition verharre. Bei einer Aussprache im Klub am 21./22. Februar war freilich Bewegung zu erkennen : Die Ländern bildeten eine ziemlich geschlossene Front für eine Regierungsbeteiligung : Dinghofer und Bichl (Oberösterreich), Kraft (Steiermark), Straffner (Tirol) und Angerer (Kärnten). Sogar bei den Schönerianern kamen unterschiedliche Rückzugslinien zum Vorschein : Nur Ursin verharrte auf dem Standpunkt der unbedingten Opposition ; Waneck plädierte – wie schon öfter – für eine Konzentrationsregierung. Zeidler klagte, der Bevölkerung fehle die Opferbereitschaft ; daher werde man eine Koalition eingehen müssen, doch nur ohne Schober. Auch Emmy Stradal meinte, eine Regierungsbeteiligung werde sich nicht umgehen lassen. Kandl fasste den Konsens zusammen : Koalition ja, aber, als Konzession an die Skeptiker,
80 DBFP XXIV 164 (10.3.), 168 f. (17.3.1922) ; Batonyi, Britain and Central Europe 49, 58.
Der Pyrrhussieg der Großdeutschen : Schober als Stolperstein
57
ein Nein zu Schober. Am 2. März wurde diese Linie auch von den Parteigremien (Länderkonferenz und Reichsvollzugsausschuss) abgesegnet.81 Am 9. März – am Tag vor Youngs Brief, aber bereits begleitet von allerlei Gerüchten der »Sensationspresse« – besprach Seipel die Aussichten im christlichsozialen Klub. Man wolle den gegenwärtigen Zustand beenden. Solange man über keine feste Mehrheit verfüge, sei man ja doch »ununterbrochenen Erpressungen der Sozialdemokratie« ausgesetzt. Diese Plage könne man sich ersparen, wenn man zusammenkomme und gemeinsam Dämme errichte. Er dachte dabei sichtlich nicht an eine Augenblickskonstellation, sondern wörtlich »an ein Programm für eine Regierung auf 10–12 Jahre«. Bloß bei der Außenpolitik werde es nicht ganz so glatt gehen. Die Anschlusspropaganda könne man nicht weiter ins Kraut schießen lassen. Auch die geforderte politische Abstimmung mit dem Deutschen Reich sei eine Illusion : »Die deutsche Regierung, die sich von uns beeinflussen läßt, muß erst erfunden werden.«82 In der Innenpolitik tat man sich viel leichter : Am 10. Februar war das Lizit neu eröffnet worden bei einem Thema, das zwar nicht zu den unmittelbaren Sanierungsaufgaben zählte, aber wirtschaftlich deshalb nicht weniger folgenschwer war : Die Regierung brachte einen Entwurf über die Reform des Mieterschutzes ein ; die Sozialdemokratie konterte mit der Verabschiedung einer Wohnbausteuer im Wiener Landtag. Jetzt konnte die Regierung gegen einen Landtagsbeschluss binnen acht Wochen Beschwerde einlegen. Diese Waffe wollte man in der Hinterhand behalten. Die angepeilte Reform des Mieterschutzes ging den meisten Christlichsozialen nicht weit genug. Dabei handle es sich um eine Augenauswischerei. Der Wert der Mieten sei auf ein Tausendstel gefallen ; eine Aufwertung auf das Vier- oder Zehnfache mache das Kraut da nicht fett. Die AZ zitierte aus Papieren ihrer Gegner : Um den Hausbesitz als Anlage wiederum attraktiv zu machen, müsse eine Anhebung auf das 600-fache erfolgen. Sei es da nicht besser, die Verdoppelung infolge der Wohnbausteuer zu schlucken – und der Gemeinde mit dem Erlös das Bauen zu ermöglichen ?83 Wie auch immer, Seipel resümierte : »Für allgemeine politische Lage halte ich diesen Kampf für nützlich. Denn dabei finden sich die Großdeutschen und wir und ist für Verhandlungen zwischen Parteien günstig.«84 Das Thema lockerte zumindest die Fronten innerhalb der Großdeutschen auf : Dort gab es Skeptiker einer allzu weitreichenden Reform, wie Kandl oder Waber. Aber gerade Ursin und Waneck waren nicht bloß erklärte Gegner Schobers, sondern auch des Mieterschutzes, der den Mittelstand ruiniere.85 81 AdR, GDVP 3, Klub 21.2. & 3.3.1922 ; Höbelt/Reiter, Drittes Lager 317 f. 82 KvVI, CS-Klub 9.3.1922. 83 AZ, 11.2. & 20.3.1922 ; vgl. auch Benesch, Zerrissenheit 144, 166. 84 KvVI, CS-Klubvorstand 8.2.1922. 85 AdR, GDVP 3, Klub 9.2.1922.
58
Die Übergangszeit 1920–1922
Geplant war ein parlamentarisches Ministerium, vielleicht immer noch mit einem gewissen Hauch von Fachmännerkabinett. Interessanterweise tauchte damals schon Ségur in den Überlegungen Seipels als Ministerkandidat auf. Er sei mit Ségur allerdings auf heftigen Widerstand gestoßen – vielleicht weil der »schwarze« Landesrat der lokale Rivale des großdeutschen Bürgermeisters Schürff in Mödling war ? Als Vizekanzler hatte sich offenbar Waber ins Spiel gebracht, denn Dinghofer sei oft nicht in Wien. Kanzler und Finanzen sollten von den Christlichsozialen gestellt werden. Als Kanzlerkandidaten schlug Seipel einen der beiden Vorarlberger vor, Fink oder Ender, der am 10. März in Wien eintraf. (Die AZ spottete als Reminiszenz an die Bestrebungen eines Anschlusses an die Schweiz über die Vorarlberger als »Öster reicher auf Kündigung«.)86 Aus Seipels Bericht und den Reaktionen im Klub ging jedenfalls hervor, dass sich die Christlichsozialen, je fester das Einverständnis mit den Großdeutschen war, desto weniger veranlasst sahen, unbedingt an Schober festzuhalten. Anders ausgedrückt : Schober wurde weder einzementiert noch fallen gelassen, er war zum Verhandlungspfand geworden. Seipel legte seiner Partei am 10. März fünf Alternativen vor, mit oder ohne Schober, als Beamtenkabinett oder parlamentarische Regierung, allenfalls auch gänzlich unverändert. Weiskirchner argumentierte : Man könne doch nicht von einer Niederlage reden, wenn der eigene Mann ins Kanzleramt einziehe. Im Hintergrund war ein kurioser Stimmungsumschwung zu beobachten : In dem Maße, wie Schober für die Großdeutschen zum »Popanz« geworden war, betrachteten ihn plötzlich gerade in der Wolle geeichte Christlichsoziale wie Spalowsky als Prestigeobjekt ihrer Partei, das unbedingt gehalten werden müsse. Dahinter stand ein strategischer Dissens. Seipels hatte sein Ideal so formuliert : »Es muß vor der Welt dastehen, alles ist gegen Sozi.« Spalowsky begehrte dagegen auf, übrigens gegen die Wiener Liberalen mehr noch als gegen die »Pangermanisten« : »Die bürgerliche Einheitsfront mit Czernin das allerböseste …«87 Doch der 13. März gilt nicht zu Unrecht als ein besonderer Tag in der österreichischen Geschichte. Über Nacht war alles anders : Offenbar war Youngs Brief doch nicht ganz so unverbindlich gemeint gewesen, wie er ihn der Öffentlichkeit gegenüber darstellte. Aus Seipels Tagebuch geht hervor, dass er am Morgen mit Schober bei Young gewesen war. Zwar scheint der Brite – erst seit wenigen Wochen in Österreich – keinen besonders positiven Eindruck auf ihn gemacht zu haben : Seipel bezeichnete ihn später einmal als »selten dummen Menschen«.88 Dabei war Young keineswegs ein Österreich-Verächter : Er machte sich über die Gerüchte lustig, die in England kursierten, »invented by shopkeepers, reported by Passport Controllers, 86 KvVI, CS-Klub 9. & 11.3.1922 ; AZ, 14.3.1922. 87 KvVI, CS-Klub 10. & 12.3.1922. 88 DAW, Seipel-Tb. 13.3.1922 ; KvVi, CS-Klub 23.5.1922.
Der Pyrrhussieg der Großdeutschen : Schober als Stolperstein
59
and believed by MI5«. Hingegen war er voll von Bewunderung für das Geschick und die Integrität der Führer der Arbeiterbewegung in Österreich und hielt Otto Bauer für den intelligentesten Politiker Österreichs. Gürtler charakterisierte er als »umständlichen, aber couragierten Trinker (tortuous, but plucky drunkard)«.89 Aber Young war sich seines Einflusses nur allzu sehr bewusst : In seinen informellen Berichten an Sir Basil Blackett im Schatzamt hat er seine Intervention keineswegs schamhaft geleugnet. Er sonnte sich in der Überzeugung, dass allein von ihm abhänge, ob die Krone jetzt falle oder steige. Um Ersparungen zu erzielen, müsse man den Druck auf die Österreicher aufrechterhalten. Die Politiker umkreisten den Beamtenabbau wie das Kätzchen den Igel. Man dürfe da nicht locker lassen : »The trouble is not only that all these officials draw pay and have to have their offices heated and equipped for them. What is worse is that they have to justify their existence, and the only way they can do it is by writing superfluous minutes, issuing regulations and in general by keeping the old machine running.«90 In der Sache stieß er da bei Seipel kaum auf Widerspruch. Politisch war der Prälat von Youngs Interventionen wohl weniger entzückt, aber nach dem Treffen jedenfalls von dem Junktim zwischen Schober und den Krediten überzeugt. Die Regierungskrise wurde abgeblasen, bevor sie noch so recht begonnen hatte. Schober verfasste ein Demissionsgesuch, das – wie so viele andere in seiner Laufbahn – dann doch nicht abgeschickt wurde.91 Die AZ schwankte zwischen Spott und Empörung über den »gemeingefährlichen Skandal« der bürgerlichen Politik, die über eine Mehrheit verfügte, die sie aus »frivolen«, nichtigen Gründen nicht zur Geltung zu bringen vermochte : »Das Kennzeichen dieser Krise ist eben, dass sie keinen zureichenden Grund hat.«92 Die Sozialdemokraten boten sich als Retter in der Not an. Auch wenn sie eine Beteiligung an einer bürgerlichen Regierung weiter ablehnten, seien sie doch bereit mitzuarbeiten, selbstverständlich nur auf der Basis ihres Programms vom Oktober, inzwischen angereichert mit der Forderung nach Bekämpfung der steigenden Arbeitslosigkeit. Die Großdeutschen erklärten säuerlich, auch sie würden die Sanierung selbstverständlich mittragen. Am 17. März hieß es deshalb Schober redivivus – und mit ihm Gürtler, der während der Krise dafür plädiert hatte, doch noch einmal mit den Sozialdemokraten zu verhandeln und bei der Wohnbausteuer nachzugeben, die Wiener wie Heinl oder Weiskirchner zur Weißglut brachte.93
89 PRO, T 160/64/2073/018, Berichte Youngs an Basil Blackett, 18. & 31.3.1922 ; T 160/58/2073/8, 16.6.1922 ; zu Bauer auch DBFP XXIV 240 n. 90 PRO, T 160/64/2073/018, Berichte Youngs vom 24.2., 15.3. & 6.4.1922. 91 Linzer Tagespost, 16.3.1921, 2 ; Hubert, Schober 140. 92 AZ, 11. & 14.3.1922. 93 KvVI, CS-Klub 9. & 10.3.1922.
60
Die Übergangszeit 1920–1922
Die Episode hinterließ einen schalen Nachgeschmack : Schober hatte sich mit seiner vermeintlichen Unentbehrlichkeit nicht beliebt gemacht. Er war – wider Willen ? – zum Hindernis der Politik geworden, die er verfolgte. Die Orientierung Österreichs an England war prominent im Forderungskatalog der Großdeutschen vertreten. Dennoch sah sich Dinghofer veranlasst, im Nationalrat sein Befremden über die Intervention Youngs auszudrücken. Schober stand im Wege, nicht weil er eine andere Politik vertrat, sondern weil er dieses Terrain für sich monopolisieren wollte – oder zumindest diesen Eindruck erweckte. Sein Biograph Rainer Hubert hat recht mit Einschätzung, Schober sei weder gescheitert, noch habe er wegen seines Erfolgs eine Gefahr für andere gebildet, schon gar nicht für Seipel, der an Schober festhielt, ihn jedoch – wenn man so will – »domestizieren« wollte.94 In dieser Beziehung handelte es sich nicht um einen Dolchstoß – diese Polemik war erst das Resultat späterer Konflikte –, sondern um eine sanfte Landung.
94 Hubert, Schober 148, 150.
III. Der Bürgerblock
Seipel ante portas : Die Dolchstosslegende Die Bildung des Bürgerblocks war aufgeschoben, nicht aufgehoben : Ein Wechsel im Sinne einer Befestigung der Mehrheit war angesagt. Freilich : Allzu rasch konnte man diese Transformation nach dem Schattenboxen vom März auch wieder nicht über die Bühne bringen. Die politische Klasse gönnte sich nach den Osterferien eine Pause – die Schober nicht im heimatlichen Perg verbrachte, sondern an der ligurischen Küste, bei der Konferenz von Genua, die Lloyd George zusammengetrommelt hatte, um die wirtschaftliche Zusammenarbeit der Europäer anzukurbeln. Die Konferenz stand allerdings unter keinem allzu glücklichen Stern : Die USA beschränkten sich auf einen Beobachterstatus ; der französische Premier Poincaré schickte bloß seinen Außenminister Barthou als misstrauischen Aufpasser. Selbst der Völkerbund sah in der Veranstaltung ein Konkurrenzunternehmen. Berlin und Moskau verblüfften die Öffentlichkeit durch ihren Rapallo-Vertrag, eine Blamage für den »Westen«, aber insofern im Sinne der Erfinder, weil die beiden großen Verlierer des Krieges auf alle gegenseitigen Ansprüche verzichteten, die einem das Leben schwer machen konnten.1 In Österreich hatte G. M. Young vorausgesagt, Lloyd George und Schober würden einander gut verstehen.2 Die persönliche Chemie dürfte tatsächlich gestimmt haben. Schober erzählte nach seiner Rückkehr über seine Gespräche mit dem Waliser auf alle Fälle allen das, was sie hören wollten. Im großdeutschen Klub kolportierte Frank, Lloyd George habe für den Anschluss durchaus Verständnis gezeigt : Die Österreicher müssten sich gedulden, aber ihre Zeit werde kommen. Bei den Christlichsozia len hingegen erzählte Seipel, Schober habe ihm berichtet, Lloyd George habe sich noch viel stärker gegen die Anschlusspropaganda gewandt als die Franzosen, doch Schober habe beruhigt, die Großdeutschen machten zwar viel Lärm, wie die Frösche, aber seien eben doch sehr klein.3 Zu einem finanziellen Alleingang war London allerdings keineswegs bereit. Doch Schober winkte bei seiner Rückkehr verheißungsvoll mit den sechs bis zehn Millionen Pfund, über die das Haus J. P. Morgan und die City Bank mit Rosenberg verhandeln wollten. (Als Kontrollor war übrigens damals schon von Zimmermann, 1 Vgl. den Sammelband Fink/Frohn/Heideking (Hgg.), Genoa ; insbesondere Fink, Beyond Revisionism 14, 24 ; Kraus, Versailles und die Folgen 48 f., 51. 2 PRO, T 64/2073/018, Bericht 7.4.1922 ; ein Reflex dieser Stimmung bei Fink, Beyond Revisionism 27. 3 AdR, GdVP 3, Klub 3.5.1922 ; KvVI, CS-Klub 27.4.1922 ; vgl. auch ADO IV 276 (13.4.1922).
62
Der Bürgerblock
dem Bürgermeister von Rotterdam, die Rede !) Der Kanzler ließ auch verlauten, die Aufhebung der Pfandrechte sei eine beschlossene Sache. Diese Frohbotschaft war vielleicht etwas voreilig : Belgrad und Bukarest bestanden auf ihrem Schein, solange die Entente ihnen »Befreiungskosten« verrechnete – ein blendendes Beispiel für die kontraproduktive Wirkung all dieser juristischen Fiktionen und Briefe an den Osterhasen, die sich im Friedensvertrag fanden. Erst im Sommer fand man dann zu einer Lösung, einem befristeten Verzicht, der gewisse Aktiva (wie Zölle und Salinen) zumindest so lange freigab, wie die Laufzeit der projektierten Kredite betrug.4 Schober hat den Kontrast später gerne farbig ausgemalt : Während er in der Ferne für das Vaterland stritt, hätten die heimischen Kleingeister an seinem Sturz gearbeitet, vielleicht gar, um ihn – hundert Meter vor dem Ziel, wie es ein reichsdeutscher Amtskollege später einmal ausdrückte – seiner Lorbeeren zu berauben. Fama crescit eundo : Daraus entstand die Legende, er habe auf der Rückfahrt aus Genua aus der Zeitung erfahren, dass Seipel ihn abgelöst hätte.5 Der »Dolchstoß« gegen das Kabinett Schober, der schließlich den Anstoß lieferte für seinen definitiven Sturz, kam jedoch aus einer ganz anderen Richtung : Nicht Seipel intrigierte gegen Schober, sondern Otto Bauer ließ gegen seinen Freund, den Finanzminister Gürtler, Ende April einen Missbilligungsantrag vom Stapel. Sachlich war der sozialdemokratische Vorstoß gerechtfertigt : Gürtler hatte – ganz im Einklang mit dem Programm, das Schober am 3. März vorgestellt hatte – die Zölle erhöht und damit den Konsum verteuert. Der Teufel steckte, wie so oft, im Detail : Auch ein noch so couragierter Finanzminister konnte selbstverständlich nicht die Zölle so einfach mit einem Federstrich erhöhen. Aber er konnte vorschreiben, wie der Betrag zu bezahlen sei – in Papierkronen oder in Goldkronen, oder wie er es jetzt tat : mit 1000 Papierkronen (was immer noch weniger war als die »Goldparität«). Die Zollsätze waren 1906 das letzte Mal revidiert worden, in einem politisch und wirtschaftlich ganz anders gearteten Umfeld, in einem Großstaat mit einer unverkennbaren Neigung zum Schutzzoll. Die Tarife, die Österreich geerbt hatte, einfach linear anzuheben, erschien da wenig sinnvoll. Inzwischen waren es die Finanzzölle, die im Vordergrund standen, ergab sich doch bei den Verhandlungen um die Kredite ein Zielkonflikt. Von den Geldgebern kamen widersprüchliche Signale : Der »Westen« – Leute wie Lloyd George – wollten den Austausch zwischen den Nachfolgestaaten beleben, da waren Zölle kontraproduktiv ; sie wollten endlich Schritte in Richtung eines ausgeglichenen Budgets sehen, da waren Zolleinnahmen selbstverständlich erwünscht.6
4 ADÖ IV 281 (22.5.1922). 5 Kaufmann, Sozialdemokratie 151. 6 KvVI, CS-Klub 28.4.1922.
Seipel ante portas : Die Dolchstoßlegende
63
Über etwaige politische Hintergründe und Motive des Bauer’schen Antrags geben die im Wesentlichen nur aus Beschlussprotokollen bestehenden Aufzeichnungen des sozialdemokratischen Parlamentsklubs leider keine Aufschlüsse. Seipel mutmaßte, es gehe dabei um ein Junktim mit dem Wohnungsanforderungsgesetz in Wien, das vom Verfassungsgerichtshof beeinsprucht wurde : »Wenn sie die nicht kriegen, sind sie wildeste Opposition«, wenn ja, »sind sie über alles wieder gut.«7 Es handelte sich im Übrigen auch um keinen formellen »Misstrauensantrag« im Plenum des Parlaments, sondern um einen »Missbilligungsantrag« im Rahmen des Finanzausschusses.8 Dort verfügten Sozialdemokraten und Großdeutsche – im Unterschied zum Nationalrat, wo Schönbauer und Czernin das Zünglein an der Waage bildeten – über eine klare Mehrheit von 14 zu 12. Der Ball lag daher einmal mehr bei den Großdeutschen, die sich bekanntlich in die Sackgasse verrannt hatten, für die Sanierung und gegen Schober zu sein. Nun waren die Großdeutschen genauso wenig Freunde Gürtlers wie Schobers. Waber – der großdeutsche Sprecher im Finanzausschuss – nahm das Geplänkel zunächst nicht sehr ernst und plädierte für Vertagung. Bei den intimen Beziehungen zwischen Bauer und Gürtler werde sich die Sache wohl leimen lassen.9 Das Problem wurde bei den Großdeutschen am 3. Mai ausführlich diskutiert, gerade unter den Koalitionsbefürwortern : Waber gab zu Protokoll, Gürtler sei ein viel gefährlicheres Element als Schober. Sein Fall wäre dem Großteil der Christlichsozialen überdies bloß recht. Straffner, der sich schon im März mit der Aussage vorgewagt hatte, das »gemeinsame Vorgehen dürfe an der Person Schobers nicht scheitern«,10 gab zu bedenken, mit Angriffen von außen würde man Gürtler bloß stützen. Dinghofer wiederum sah mit dem Sturz Gürtlers im einen wie im anderen Fall nichts erreicht : Die Linie der Partei sei schließlich eine Koalition ohne Schober. Gefechte an Nebenfronten könnten da nur Komplikationen heraufbeschwören.11 Kraft hatte Seipel anvertraut, ein Teil der Großdeutschen plädiere zumindest für Stimmenthaltung im Finanzausschuss. Doch Waber wurde schließlich doch ermächtigt, sich am 10. Mai dem Votum der Sozialdemokraten anzuschließen. Er entledigte sich des Auftrags in ungewohnt maßvoller Weise : Er warf seinem alten Ministerkollegen Gürtler keine Überschreitung seiner Kompetenzen vor, bloß »Eigenmächtigkeiten«. Die Reaktionen im christlichsozialen Klub waren aufschlussreich : Gürtler – von der ›Neuen Freien Presse‹ als »miles gloriosus der Finanzpolitik« verabschiedet – ver-
7 KvVI, CS-Klubvorstand 9.5.1922 ; vgl. auch die Erläuterung in AdR, GDVP 4, Klub 17.5.1922. 8 Diese Differenzierung nicht ganz deutlich bei Hubert, Schober 148 (»im Nationalrat«), richtig bei Marcus, Reconstruction 96. 9 KvVI, CS Klub 28.4.1922. 10 AdR, GDVP 41, Reichsvollzugsausschuß 2.3.1922. 11 AVA, GDVP 3, Klub 3.5.1922.
64
Der Bürgerblock
band seinen Schwanengesang mit einer Lobeshymne auf Schober, den man als »Fassade für das Ausland« wohl noch brauchen werde (aber auch mit ausdrücklichen Dankesworten an Seipel, mit dem er »nicht immer in bestem Einvernehmen gelebt«, den er aber jetzt schätzen gelernt habe).12 Einige der Granden, wie Mayr oder Weiskirchner, ergingen sich schon am Tag vor der Abstimmung in Pessimismus : »Die Leute glauben uns nicht mehr !« Seipel gab sich fatalistisch : Das Wahrscheinliche sei eben, »dass immer alles anders geht.« Vor allem aber ermahnte er die Zweifler : »Größter Fehler ist nervös zu werden !« Seine Lesart war, die Krise bringe die Großdeutschen bloß in Zugzwang : »Wenn die Sozi es auf sich nehmen, Vorstoß zu machen, dass Konsequenzen für die Regierung, bin ich nicht unglücklich.«13 Als sich nach der Abstimmung am nächsten Tag dann Empörung über die Großdeutschen breitmachte und Seipel um seine Meinung gefragt wurde, antwortete er kühl : Er stehe auf dem Standpunkt, die »beiden Parteien sollten sich einmal den Kopf zerbrechen.«14 Seipel und Dinghofer hatten dieses »Brainstorming« ganz offensichtlich schon hinter sich. Der Plan B war sichtlich in der Schublade. Wenn eine bürgerliche Koalition mit Schober zu machen gewesen wäre, wäre Seipel damit wohl einverstanden gewesen ; doch er wollte es an ihm nicht scheitern lassen. In der Beziehung war er ganz der Meinung der AZ : »Ob Mayr oder Schober, ist keine welterschütternde Frage.«15 Am 18. Mai musste sich die Regierung mit einem Ansuchen um Kredit ermächtigung im Finanzausschuss neuerlich von den Großdeutschen vorführen lassen, die ihr nur eine deutlich herabgeminderte Summe bewilligten. Die AZ erklärte, die heutige Abstimmung mache die »Regierung Seipel, genannt Schober« vollends unmöglich, selbst wenn sich das Malheur im Plenum durch die Hilfstruppen Schönbauers und Czernins reparieren ließe. Zur Bestätigung wies die AZ in elegant verschleiernden Wendungen auf die Obstruktion der Genossen hin, die in zwei weiteren Ausschüssen eingesetzt habe – gegen die Reform des Mieterschutzes und gegen den Versuch, »den monarchistischen Rechnungshof des Herrn Wladimir Beck zu einer Überregierung der Republik« zu machen.16 Der Vorschlag der AZ, der in fetten Lettern auf der Titelseite vom 20. Mai prangte, klang auf den ersten Blick paradox : »Wählet Herrn Seipel !« Denn »ein Zustand, daß jemand herrscht und diktiert, ohne in aller Form die Verantwortung zu übernehmen, ist einfach unerträglich.« Die ›Neue Freie Presse‹ ergänzte diese Charakterisierung ein paar Tage später süß-säuerlich mit einem Vergleich : Seipel »wollte 12 KvVI, CS-Klub 10.5.1922 ; NFP, 11.5.1922, 5. 13 KvVI, CS-Erweiterter Klubvorstand 9.5.1922. 14 KvVI, CS Klub 10.5.1922. 15 AZ, 27.1.1922. 16 AZ, 19.5.1922.
Seipel ante portas : Die Dolchstoßlegende
Abb. 1 : Ein Plädoyer für Seipel von besonderer Seite … in : Arbeiter-Zeitung, Nr. 137, Wien 20.5.1922.
65
66
Der Bürgerblock
rechts dasselbe sein, was Otto Bauer links, eine Macht ohne die äußeren Attribute, ein Führer, der stärker ist als die leitenden Persönlichkeiten.«17 Die AZ behauptete, es getraue sich ohnehin schon kein Minister, ohne den Sanktus des Prälaten eine Entscheidung zu treffen : »Wenn ohne seinen Willen kein Blatt vom Baum fallen darf, so trete er vor und regiere selbst !« Seipel bezog sich in seiner Regierungserklärung dann prompt auf diese Aufforderung : »[I]ndem sie [die Opposition] so oft – nun ich will, da es sich um meine Person handelt, nicht gerade sagen, den Teufel – an die Wand malte, hat sie wohl dazu beigetragen, dass er nun wirklich kam.«18 Die AZ hatte ihre Aufforderung am 20. Mai mit dem Hinweis unterstrichen, dass die bürgerlichen Parteien »innerlich« längst zur Arbeitsgemeinschaft entschlossen seien : »Möge Ihnen dieser Wunsch erfüllt werden.« Da lag das Blatt richtig. Tatsächlich hatte Seipel schon am Vortag – nach der Abstimmung über die 120 Milliarden, die er nicht sehr ernst nahm, die aber seine Argumentation bestätigte – seinem Klub das Ergebnis seiner Vieraugen-Gespräche mit Dinghofer präsentiert : »Bleibt uns allein das Zusammengehen mit den Großdeutschen. […] Wenn jetzt miteinander Regierung bilden. Absicht wirkliche Rettungsaktion durchführen.« Bloß die Details seien noch zu klären, weil er es für »unanständig« gehalten habe, formelle Parteienverhandlungen noch in Abwesenheit Schobers beginnen zu lassen. Seipel begann seine Ausführungen mit der ironischen Bemerkung, es fänden sich »unter uns solche, die glauben, es gibt nur ein Heil, das in Verbindung mit Sozi.« Doch er sei überzeugt, dass es für die Sozi ganz unmöglich sei, in eine Regierung hineinzugehen. Allein Renner glaube, dass »uns nichts anderes übrig bleibe« und er dabei wieder eine große Rolle spielen werde. Deshalb sei er dafür, die »schleichende Krise hinauszuziehen«, bis er bei seinen Leuten etwas zustande bringe. Die P artei strebe hingegen allenfalls »eine wohlwollende Opposition« an, die ihr weiterhin Einfluss ohne Verantwortung verbürge. Otto Bauer habe sich in ein Wespennest gesetzt und schlage wild um sich. Für ihn – so ließ Seipel durchblicken – sei die halbschlächtige Position unbefriedigend. Die Sozi würden klare Fronten und eine starke Regierung begrüßen. Mehr noch : »Wenn starke Regierung da ist, würden sie manches schlucken.«19 Mit Schober als Kanzler wurde offenbar nicht mehr gerechnet. Was keineswegs heißen soll, »für ihn sei kein Platz mehr gewesen.«20 So viel geht schon aus dem Bericht hervor, den Seipel in derselben Sitzung über die burgenländischen Christlichsozialen erstattete, die gerade ihre Kandidatenlisten für die Nachwahl zum Nationalrat zusammenstellten. Überregional bekannte Persönlichkeiten seien im 17 NFP, 26.5.1922. 18 Geßl (Hg.), Seipels Reden 17 (31.5.1922). 19 KvVI, CS-Klub 19.5.1922. 20 Hubert, Schober 150.
Seipel ante portas : Die Dolchstoßlegende
67
Lande keine vorhanden, die Burgenländer wollten die Spitzenplätze an den Vorarlberger Bundesrat Drexel – und an Schober vergeben ! Seipel vermochte dem Gedanken durchaus etwas abzugewinnen – im Gegensatz zu Gürtler, der einwarf, er könne dann schwerlich Polizeipräsident bleiben, weil jede Maßnahme sonst als parteipolitische Schikane ausgelegt würde ; allenfalls »parlamentarischer« Innenminister könne er sein. Freilich : Schober lehnte ab.21 »Karriere« als burgenländischer Abgeordneter machte er erst 1930, mit seiner eigenen Liste – und den Großdeutschen, die ihn 1922 so heftig ablehnten. Schober kam am 21. Mai aus Genua zurück. Bei seinem abendlichen Treffen mit Seipel dürfte der Prälat denselben Eindruck gewonnen haben wie die AZ : »Schober hält sich für unentbehrlich.« Die ›Neue Freie Presse‹ führte für den Kanzler ein Rückzugsgefecht. Das bürgerliche Blatt par excellence war für bürgerliche Politik ; aber es liebte die bürgerlichen Parteien nicht. Schober versprach das eine ohne das andere. Die Verdienste des Kanzlers in Genua wurden groß herausgestrichen : »Neue Hoffnungen in der Kreditfrage« – verbunden mit der rhetorischen Frage : »Die Parteien werden entscheiden müssen, ob dieser Erfolg Österreich zugute kommen soll oder der Staat in seiner heutigen Lage darauf verzichten kann ?« Die Devise lautete : Lasst Schober arbeiten (von »seinem Team« war allerdings nicht die Rede !). Es müsse sich doch ein »Mittelweg« finden lassen, um den Großdeutschen »Genugtuung« zu geben – und Schober dennoch zu halten.22 Der Großdeutsche Emil Kraft – der häufig für die ›Neue Freie Presse‹ schrieb – präzisierte zwei Tage später, die »prinzipielle« Zustimmung zur Aufhebung des Generalpfandrechts, mit der Schober prunkte, sei keineswegs sicher, weil an allerlei Bedingungen geknüpft.23 Unmittelbar nach Krafts Richtigstellung fand sich im Blatt der Bericht über die Demission des Kabinetts am 24. Mai. Die ›Neue Freie Presse‹ widmete sich der Trauerarbeit : Der »parlamentarische Coriolan« sei gefallen, weil er nicht um Stimmen betteln wollte – eine Behauptung, die auf der Gerüchtebörse diskontiert wurde, wo es sehr wohl hieß, Schober habe die großdeutschen Abgeordneten einzeln überreden wollen.24 Auf alle Fälle : »Der Abschied von Schober fällt uns schwer«, am Tage der Regierungserklärung Seipels dann : »Der Sturz Schobers hat uns hart getroffen. Seipel muß jetzt die Folgen tragen.«25 Schon am Tag vor Schobers Rücktritt, am 23. Mai, legte Seipel dem christlichsozialen Klub ein »Rettungsprogramm« vor. Sein »Motivenbericht« lautete : Vor einem Jahr sei eine Sanierung ohne auswärtige Hilfe vielleicht noch möglich gewesen, 21 RP, 27.5.1922, 2. 22 NFP, 22./23.5.1922. 23 NFP, 25.5.1922, 4/5. 24 AVA, E/1791, Wildner-Tb 12.3.1922. 25 NFP, 26. & 31.5.1922.
68
Der Bürgerblock
heute sicherlich nicht mehr. Deshalb werde sich auch die Gründung einer neuen Notenbank nicht mehr aufschieben lassen. »Es könne Sanierung nur erreicht werden, wenn man sofort an Notenbank geht.« (Da bestand ein auffälliger Gleichklang mit dem Gesinnungsumschwung, zu dem sich Rosenberg am nächsten Tag in der Öffentlichkeit bekannte.)26 Das Programm enthielt sachlich nicht allzu viel Neues, wie ein steirischer Pfarrer das Urteil der ›Neuen Freien Presse‹ vorwegnahm.27 Allerdings bestand Seipel auf einem Paukenschlag, einer Synchronisierung der verschiedenen Schritte, die nötig waren. Er sei gegen einzelne Maßnahmen allein. Es müsse alles gleichzeitig beschlossen und durchgeführt werden. Aufhorchen ließ allerdings die Schlussfolgerung, die Seipel aus dieser Notwendigkeit ableitete : Um die prompte Durchführung zu garantieren, sei eine besondere Körperschaft mit der Umsetzung zu betrauen, bestehend aus einigen Ministern und Fachleuten, eine »Art Finanzdiktatur«, wohlgemerkt : eine Diktatur nicht der Finanz, sondern über die Finanzen. Das Gremium müsse über Entscheidungsbefugnis verfügen, es dürfe kein bloßer Beirat sein. Es handelte sich um keine Selbstausschaltung des Parlaments, aber um eine »Selbstbindung« : Das Parlament dürfe nicht mit ständigen Querschüssen dazwischenfahren, sondern müsse sich an das einmal beschlossene Programm halten, an »eine festgeschriebene politische Tagesordnung«28, wie die ›Reichspost‹ erläuterte – aber es könne die Regierung selbstverständlich jederzeit austauschen. (Da stiegen den Pessimisten bei den Christlichsozialen angesichts der binnen zwei Jahren fälligen Neuwahlen die sprichwörtlichen »Grausbirnen« auf.) Seipel verlangte von seiner Partei keine blinde Gefolgschaft. Er werde das Programm in eigenem Namen veröffentlichen, nicht »im Auftrag der Partei«. Der Entwurf wurde auf Anraten Kienböcks dann noch etwas gekürzt und am 26. Mai in der ›Reichspost‹ veröffentlicht. Sachlich waren im Klub keine gravierenden Einwände zu vernehmen : Die meisten Bedenken rankten sich als Illustration zu Youngs Parabel vom Kätzchen und dem Igel um den Beamtenabbau, der sich nicht von heute auf morgen bewerkstelligen lasse. Schöpfer war ein verlässlicher Konservativer – aber er hatte noch 30 Jahre zuvor gegen die Einführung des Goldstandards gekämpft und verkündete stolz, er »bleibe bei den alten Grundsätzen der Partei«. In der anderen Richtung wünschte sich Ender bei einer durchgreifenden Sanierung auch eine Berücksichtigung der Hausbesitzer und »Rentner« (gemeint waren nicht die Pensionisten, sondern die Besitzer von Kriegsanleihen, die um ihr Vermögen gekommen waren). Seipel entwarf im Klub – wie immer – mehrere mögliche Szenarien : Natürlich sei die Möglichkeit des Scheiterns gegeben. Natürlich werde es Kämpfe geben. Aber, so erhöhte er das Lizit, sollte man wegen der Opposition der Sozi scheitern, 26 So Seipel schon KvVI, CS-Klub 19.5.1922 ; Rosenbergs Ausführungen in NFP, 24.5.1922. 27 NFP, 26.5.1922. 28 RP, 27.5.1922.
Die Bildung des Kabinetts Seipel I : »Personalien immer Towuhabohu«
69
so habe man »die Verantwortung von uns abgelenkt« – und dann stehe der Weg für Neuwahlen offen. Am 25. Mai, pünktlich nach der Demission Schobers, traten die Verhandlungsteams zusammen : Waren es Dinghofer, Kandl, Frank und Straffner für die Großdeutschen, so mochte auffallen, dass es sich bei den vier Christlichsozialen ausschließlich um Wiener handelte : Seipel, sein Gefolgsmann Mataja, sein alter Widersacher Weiskirchner und dazu noch Franz Odehnal (ein Schulkollege Renners, ursprünglich Novize in Klosterneuburg, der als Beamter der Postsparkasse die öffentlichen Bediensteten vertrat). Am 27. Mai begann im Rittersaal des Landhauses in Graz der großdeutsche Parteitag. Die Gegner einer Koalition hatten sich schon immer gern auf die Stimme der vielzitierten Basis berufen, die zu keinem Gesichtsverlust bereit sei. Dinghofer nahm sie jetzt beim Wort. Seine Oberösterreicher stellten unter den Delegierten – dank ihres bäuerlichen Anhangs – das größte Kontingent. Leider hat sich im Parteiarchiv kein Wortprotokoll erhalten, nur ein Redemanu skript Dinghofers und die Presseberichte. Dinghofer trat für einen »ehrlichen, klaren, grundlegenden Pakt« ein, nicht für »eine Scheinregierung, wo die Sozialdemokraten im Hintergrund herrschen und wir nur als Aufputz« dienten. Als er gefragt wurde, wie er zum Punkt »Finanzdiktatur« stehe, antwortete er : Er wolle den Klub nicht präjudizieren, aber er persönlich sei dafür ! »Das ist ein Weg, dem wir nicht ausweichen können, ob Sie das dann Diktatur oder anders nennen.« Die Regie funktionierte auf alle Fälle. Als Contra-Redner zu Wort gemeldet war mit Ursin der Außenseiter vom Dienst, als Pro-Redner der oberösterreichische Landesobmann Franz Langoth. In den Parteigremien hatte es ein mühsames und zähes Ringen gegeben. Das Abstimmungsergebnis am Parteitag hingegen fiel mit 307 zu 58 beruhigend deutlich aus.29
Die Bildung des Kabinetts Seipel I : »Personalien immer Towuhabohu« Nach seiner Rückkehr traf sich Dinghofer in Wien noch einmal mit Seipel, der am 29. Mai seinem Klubvorstand das Ergebnis mitteilte. »Gut angelassen, weil gesehen, daß Großdeutsche Ernst machen, daß wirklich starke Regierung zu bilden geneigt sind, die in unerläßlichen Punkten entschieden vorgeht und wenn sie nicht erreicht, die Sache hinwirft, nicht geneigt Schwierigkeiten zu verkleistern.« Noch viel enthusiastischer schilderte Fink die Perspektiven, die sich jetzt ergaben : »Lage leider nie so, daß Großdeutsche erklärt, mit uns zu regieren wie jetzt. Bedaure sehr, daß Moment so spät gekommen ist. Ich immer gesagt, wenn man einmal nicht-sozialistisch 29 NFP, 29.5.1922, 4 f.
70
Der Bürgerblock
regieren kann, dann gehört unser Obmann an Spitze. Der Moment ist gekommen. Möchte ich fragen, wie es bisher war. Es war immer nur so, daß wir nichts getan haben, was Sozi irgend weh getan hat, dies ist nicht möglich.« Über die prinzipielle Frage der Bildung eines »Bürgerblocks« konnte nach all den Vorberatungen kaum mehr Zweifel bestehen. Als Anhänger eines Arrangements mit den Sozialdemokraten im Sinne eines Konzentrationskabinetts »outete« sich als »üblicher Verdächtiger« einzig und allein der Gewerkschafter Spalowsky (nicht aber Kunschak !), der diese Möglichkeit zumindest gerne noch weiter ausgelotet hätte und hier Versäumnisse ortete. Allenfalls Miklas war als Bedenkenträger einzustufen, der kurz vorher als Alternative am Weg zu einer starken Regierung eine Vorwegnahme der Verfassungsnovelle von 1929 in den Raum gestellt hatte, nämlich die Ernennung des Kanzlers durch einen vom Volk gewählten Präsidenten, »ähnlich wie in fast allen Staaten«. Aber dass die gegenwärtige »politische Impotenz« in die »Katastrophe« führe, stand gerade für ihn fest : »Das halten wir keine 3 Wochen mehr aus …«30 Einige Wortmeldungen in der Vollversammlung des Klubs am 30. Mai waren von einem pessimistischen Unterton geprägt : Ob es sich denn überhaupt lohne, in der verfahrenen Situation den Obmann zu »opfern« und die »letzte Karte« auszuspielen, über die man verfüge ? Der Topos der affektierten Bescheidenheit feierte wahre Triumphe. Auch Seipel zollte ihm seinen Tribut, wenn er zunächst einige andere Namen als Kanzlerkandidaten ins Spiel brachte. Eine gewisse Koketterie, das »nil petere, nil recusare« im Hinterkopf, war da zweifellos im Spiel. Die Insistenz, mit der über »Verluste« des Klubs geklagt wurde, sobald einer ihrer Koryphäen in ein Ministeramt weggelobt wurde, dürfte allerdings auch auf gewisse Besonderheiten der damaligen politischen Kultur zurückzuführen sein. Man ging offenbar davon aus, dass ein Minister zu einer gewissen Unparteilichkeit zumindest im Auftreten nach außen verpflichtet sei – und als Agitator in der Öffentlichkeit oder auch im Parlament deshalb ausfalle. Umso auffälliger mussten nach der euphorischen Stimmung im Vorstand die zermürbenden Dauerberatungen der nächsten achtundvierzig Stunden wirken. Der Teufel steckte im Detail, in der Ressortverteilung und den Personalfragen. Hausers Kassandraruf aus dem Jahr 1919 bewahrheitete sich aufs Neue : »Personalien immer Towuhabohu«.31 Die Großdeutschen konnten in dieser Beziehung überraschende Erfolge erzielen. Leider weisen ihre Protokolle gerade für die kritischen Tage eine bedauerliche Lücke auf. Wir sind daher auf Rückschlüsse aus den Berichten der Christlichsozialen angewiesen. Schematisch betrachtet, stellte sich die Lage so dar : Die Großdeutschen hatten im Vorfeld nicht unwesentliche inhaltliche Konzessionen gemacht : Sie hatten das Prinzip der festen Koalitionsvereinbarungen akzeptiert und 30 KvVI, CS-Klub 17.5.1922. 31 Höbelt/Kalwoda/Schönner (Hgg.), Klubprotokolle 272 (14.3.1919).
Die Bildung des Kabinetts Seipel I : »Personalien immer Towuhabohu«
71
intern durchgesetzt. Sie hatten bei ihren Leib- und Magenthemen den Rückzug angetreten : Der Kulturkampf wurde auf Eis gelegt, Seipel berichtete stolz, man sei sogar bereit, den »ultraklerikalen« Miklas als Leiter des Unterrichtsressorts zu »schlucken«. Seipel hatte den Großdeutschen auch klargemacht, dass sie sich – entgegen ihrem ursprünglichen Forderungskatalog – bei der Anschlusspropaganda gewisse Zügel auferlegen lassen müssten. Die Schlussfolgerung aus dieser Lagebeurteilung lautete unweigerlich : Wenn sich schon keine ideologischen Höhenflüge mit der Regierungsbeteiligung verbinden ließen, dann eben bürgerliche Klientelpolitik für ihre Anhänger, vor allem für jene, »die real denken«, wie es Kraft ausgedrückt hatte. Bei diesem Tauziehen hatten die Großdeutschen insofern gute Karten, weil sie sich den Verbleib Schobers teuer abkaufen ließen. Denn die zweite Kardinalforderung Seipels – neben dem Unterrichtsressort – war ein Arrangement, das Schobers Mitarbeit im Sicherheitsbereich garantierte. Schober als Minister lehnten die Großdeutschen ab ; Schober wiederum lehnte seinen ehemaligen Kabinettskollegen Waber als Innenminister ab. Unter ihm würde er nicht dienen – so behauptete er zumindest. Die offenkundige Lösung war, Vizekanzler Frank mit dem Innenressort zu betrauen. Doch wohin dann mit Waber, der von seinem Klub fast einstimmig als Minister kandidiert wurde ? Schließlich ging es darum, die Großdeutsche Partei zu »binden« : Gürtler hielt Waber zwar für einen Hanswurst, aber er gab auch zu bedenken, dass es besser sei, ihn innerhalb des Kabinetts zu versorgen, als ihn zum Kritiker von außen zu machen. Damit war ein weiteres Ressort fällig, nicht mehr bloß zwei, sondern drei – was selbst Seipel zu viel erschien, der viel von seinem anfänglichen Faible für Waber eingebüßt hatte. Der eigentliche Knackpunkt, um den erbittert gestritten wurde, war aber das Handelsministerium. Da ging es weder um gesellschaftspolitische Inhalte noch um persönliche Vorbehalte : Der großdeutsche Kandidat Emil Kraft war als Freund der Koalition bekannt, niemand zweifelte daran, dass er eine bürgerliche Politik betreiben werde, die im Mittelstand auf Anklang stieß. Kraft wurde abgelehnt, nicht weil man ihm in der Sache nicht traute, sondern ganz im Gegenteil : Gerade jetzt, wo man auf diesem Gebiet endlich gewisse Erfolge erzielen könne, dürften doch nicht die Großdeutschen die politische Rendite »einheimsen«. Das Gewerbe gehöre zum christlichsozialen »Besitzstand«, Eduard Heinl müsse das Ministerium führen. Gerade die engagiertesten Verfechter der Koalition meldeten sich da einer nach dem anderen zu Wort, um den »Verlust« des Ressorts abzuwenden. Mochten sich die Großdeutschen doch lieber das Verkehrs- oder Heeresressort unter den Nagel reißen, nicht aber den Handel. Das Verkehrsministerium hätte Seipel gern Straffner überlassen, auf den er große Stücke hielt, doch der weigerte sich (genauso wie Miklas bei den Christlichsozialen). Mit einem seiner Vorschläge stieß Seipel bei den eigenen Leuten auf unerwarteten Widerstand. Er hatte sich zwei Vertraute als Mitarbeiter ausgebeten : Grünberger
72
Der Bürgerblock
als Außenminister und Schmitz, den er als Arbeitskraft im Kabinett nicht missen wollte. Als Ressort war ihm – mangels Alternativen – soziale Verwaltung zugedacht, nicht zur Freude der christlichen Gewerkschafter, die an »ihrem« Resch festhalten wollten. Vor allem aber : Seipel hatte sich als Finanzminister auf den Landesrat Graf August Ségur versteift, den »christlichsozialen Breitner«32, wie ihn die ›Neue Freie Presse‹ mit Verweis auf sein sozialdemokratisches Wiener Pendant süßsauer vorstellte. Ségur war neben Stöckler immerhin der zweite Niederösterreicher im Parteivorstand. Zwar gab Seipel sich in gewohnter Manier den Anschein, dem Klub eine Wahl zwischen zwei Alternativen zu lassen, zwischen Ségur als Parlamentarier (der er eigentlich nicht war !) und Sektionschef Viktor Hornik als Beamtem (der später dann als Ersparungskommissar ein Comeback feierte). Aber die Diskussion ließ bald erkennen, dass er seine Entscheidung längst getroffen hatte.33 Ségur sollte auch nicht als Unterhändler mit der Hochfinanz eingesetzt werden : Das behielten sich Seipel, Grünberger und das »Triumvirat«34 aus dem AnglobankDirektor Rosenberg, Seipels Vertrautem Kunwald und Sektionschef Hermann Schwarzwald selbst vor. Was Seipel vorschwebte, war vielmehr ein »Mordssteher«, der gegenüber allen Forderungen hart bleiben und auf der Kassa sitzen sollte. Gegen Ségur wurde – wie sich herausstellte, mit gewissem Recht – sein angegriffener Gesundheitszustand geltend gemacht. (In einer bezeichnenden Randbemerkung erklärte Kunschak, für den Unterricht – »ein kleines Werkel« – würde es vielleicht gerade noch reichen.) Dahinter standen vermutlich noch andere Vorbehalte : Beide Kandidaten wurden regelrecht durch den Kakao gezogen. Das Gegensatzpaar Seipel/ Kunschak lief in dieser Frage zu großer Form auf. Die Fronten verliefen dabei quer durch alle innerparteilichen Lager, mit einer Ausnahme : Ausnahmslos begeistert von Ségur waren die niederösterreichischen Agrarier – in der Regel nicht gerade Seipels natürliche Klientel ! Ségur musste dann im November tatsächlich aus Gesundheitsrücksichten zurücktreten. Dabei handelte es sich mit ziemlicher Sicherheit nicht um eine diplomatische Krankheit. Bei seinen Kollegen hatte er sich inzwischen einen gewissen Respekt erworben. Spitzmüller als Gouverneur der Österreichisch-Ungarischen Bank in ihren letzten Zügen bescheinigte ihm schon zu Beginn : »Sympathisch, energisch und in der Administration erfahren«, bei den Großdeutschen hielt ihn sein Mödlinger Rivale Schürff zwar als Fachmann für unbedeutend, aber als »Repräsentant und Redner für erstklassig«.35 32 NFP, 31.5.1922. 33 Im Ministerrat ließ Seipel später durchblicken, er misstraue Hornik wegen seiner Umgebung (AdR, MRP 69, 5.12.1922, fol. 57). 34 HHStA, Spitzmüller-Tb. 29.5.1922. 35 HHStA, Spitzmüller-Tb. 26.6.1922 ; AVA, GDVP 3, Klub 14.11.1922.
Die Bildung des Kabinetts Seipel I : »Personalien immer Towuhabohu«
73
Im Laufe des 30. Mai verdüsterte sich der Horizont : Die Großdeutschen bestanden auf Waber, die Christlichsozialen auf Heinl. Seipel war ganz offensichtlich in erster Linie Waber ein Dorn im Auge, seine Partei hingegen beauftragte ihn, in erster Linie den Handel zurückzuerobern. Das Ergebnis war : Die Großdeutschen setzten sich letztendlich in beiden Fragen durch. Kunschak verschärfte die Angriffe – und ging dabei vielleicht eine Spur zu weit. Wie viele Ressorts die Großdeutschen bekämen, sei ihm gleich, aber Handel und soziale Verwaltung müssten im Einklang miteinander geführt werden. Die Christlichsozialen seien nicht die Hausknechte, die für die Großdeutschen die Schmutzarbeit erledigten in den Ressorts, wo mit sozial demokratischem Widerstand gerechnet werden müsse. Außerdem wiederholte er sein Ceterum censeo : Ségur sei für ihn unmöglich. Seipel reagierte auf die Angriffe seines Vorgängers am Morgen des 31. Mai mit der Ankündigung, dann werde er den Auftrag zur Regierungsbildung eben zurück legen : Er könne »keine Regierung bilden, wenn solcher Klub hinter mir.« Die Taktik wirkte : Alle Granden der Partei – Fink und Weiskirchner, aber auch Miklas und Gürtler – scharten sich um den Obmann. Jetzt könne man nicht mehr zurück. Miklas resümierte : Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn das reinigende Gewitter schon früher losgegangen wäre. Die Vollmacht für Seipel wurde einstimmig beschlossen. Kunschak hatte sein Blatt überreizt, und die Solidaritätskundgebung als Retourkutsche auf seine Ausfälle erlaubte es Seipel sogar, eine weitere Hürde gleichsam im Vorbeigehen zu bewältigen. Seipel legte Wert darauf, dass seine Regierung auch wirklich von allen nicht-sozialistischen Parteien getragen wurde. Mit dem Grafen Czernin gab es keine Schwierigkeiten. Den »Bündlern«36 hätte er gerne ein Ressort eingeräumt (z. B. Schönbauer als Justizminister statt Waber ?). Aber die »Bündler« beschränkten sich stattdessen auf ein Veto gegen den designierten »Ackerbauminister« Florian Födermayr, der ihnen »nicht scharf genug [war], wie alle Oberösterreicher«. Das Veto hatte aus der Rückschau durchaus paradoxe Folgen : Die »Bündler« erfreuten sich bei Teilen der Partei eines guten Rufes, weil sie auch nach Lana Schober und Gürtler weiter unterstützt hatten. Die beiden Steirer Rintelen und Gürtler betrachteten die »Bündler« als eine Art Versicherungsprämie – mit ihnen habe man zur Not immer noch eine Mehrheit (auch ohne die Großdeutschen). Födermayr wurde zum Verzicht gedrängt. Seipel wies jede »Einmischung« bezeichnenderweise von sich. Födermayr sei von den Niederösterreichern nominiert worden, die jetzt in letzter Minute nach einem Ersatz suchten. Karl Buresch, so hieß es, sei ganz einfach nicht zu finden gewesen. (Er wurde stattdessen bald danach Landeshauptmann.) 36 Am 19. Mai analysierte Seipel im Klub die Zusammensetzung der »Bündler«-Fraktion : Vier von ihnen seien Bauern, »mit denen durchaus zu reden ist« ; dazu kam Schönbauer – und der Oberst Kollarz, eine »gute Seele, von Politik keine Ahnung«.
74
Der Bürgerblock
Gewählt wurde schließlich Rudolf Buchinger, ein Multifunktionär, der als klassischer Vertreter der Körndl- und Weinbauern ein paar Jahre später im Streit mit den Landbündlern aus dem Amt schied, die auf die Interessen der alpinen Viehzüchter pochten – und dabei mit Födermayr vermutlich viel besser gefahren wären. Was dem Vorstoß der »Bündler« eine so besondere Qualität verlieh, war der Verdacht, das Veto gegen Födermayr sei gar nicht auf ihrem eigenen Mist gewachsen, sondern ihnen bloß von missgünstigen Christlichsozialen suggeriert worden. Für die Oberösterreicher machte Landeshauptmann Hauser aus seiner Verbitterung bei aller Loyalität keinen Hehl. Schlimmer noch : Aigner, als Obmann des Katholischen Volksvereins in gewisser Weise der Parteichef der Oberösterreicher, wollte gewisse Herren im vertraulichen Gespräch mit verdächtigen Gestalten von außerhalb gesehen haben, möglicherweise Journalisten, die als Verbindungsleute fungierten. Die Wogen gingen hoch. Fink musste ausdrücklich zur Ruhe mahnen. Doch leider : Namen wurden keine genannt. Fazit : Die Regierungsbildung des Kabinetts Seipel I vollzog sich nach anfänglicher Harmonie im Krach mit den »üblichen Verdächtigen«, sprich Hauser und Kunschak, dafür unterstützt von Gürtler und den niederösterreichischen Agrariern, die normalerweise nicht zu Seipels besonderen Fans zählten. Die AZ hatte diese Allianz schon in den letzten Tagen des Kabinetts Schober erkannt und vorhergesagt. »Bei uns ist der Kanzler ein Werkzeug des Herrn Prälaten, seitdem sich die Bauernvertreter wieder von den Wiener Christlichsozialen kommandieren lassen.«37 Bei der Nachbesprechung am 1. Juni wurde – kurz bevor Seipel seinen Vizekanzler Frank im Klub einführte – aus beiden Richtungen über die lieblose Behandlung des Klubs geklagt : Spalowsky sprach von »Verstimmungen, die vermieden hätten werden können«, der Vorarlberger Bundesrat Drexel von einem »Klub, der keine Meinung mehr hat«. Gürtler gab ihnen im Prinzip recht, setzte aber hinzu : Je größer die Verantwortung, die einer trägt, desto mehr Spielraum muss man ihm geben. Quod erat demonstrandum : Im Ministerrat warnte Seipel seine Kollegen, man solle auch mit den Parteien nur in Verbindung treten, wenn das Kabinett diesen Schritt gutheiße. War da bloß die Opposition gemeint oder auch die eigenen Leute ?38
Die ersten 100 Tage : Kein Veni, vidi, vici 100 Tage nach seinem Amtsantritt, am 6. September, absolvierte Seipel seinen berühmten Auftritt vor dem Völkerbund in Genf. Von da an ging’s bergauf. Davor
37 AZ, 19.5.1922. 38 AdR, MRP 60, Nr. 191, 1.6.1922.
Die ersten 100 Tage : Kein Veni, vidi, vici
75
war das Gegenteil der Fall.39 Von der sprichwörtlichen Schonfrist für neugewählte Würdenträger konnte 1922 keine Rede sein. Verantwortlich dafür war nicht die Opposition, sondern die Finanzmärkte. Die AZ konnte sich bereits nach zwei Wochen auf die lakonische Schlagzeile beschränken : »Wahnsinnskurse« und »Panikpreise«. In den ersten zwölf Tagen der Regierung Seipel war der Kronenkurs auf die Hälfte gefallen.40 Der Leitartikel fuhr fort : »Solche Kursbewegungen sind aus der wirtschaftlichen Lage nicht mehr zu erklären«, um zur ironischen Schlussfolgerung zu gelangen : »Die Bourgeoisie als Klasse hat sich die Prälatenregierung erkoren, aber jeder einzelne Kapitalist sucht sein Kapital in wilder Flucht vor den Wirkungen dieses Regierens zu retten.« Das Sündenregister der »Prälatenregierung« bestand freilich in erster Linie aus Unterlassungssünden : »Die Herren Seipel und Ségur müssen endlich handeln oder sie müssen gehen.«41 Seipel hatte alle Hände voll zu tun, seinen Klub zu beruhigen. Der Bericht Youngs für das Haus Morgan werde günstig ausfallen, aber »dass wir aber darauf einen Kredit kriegen, glaube ich nicht.« Ein Teil des Klubs stieß daraufhin ins selbe Horn wie die AZ : Die Entente habe ihre Versprechen gebrochen, man solle auf sie keine Rücksicht mehr nehmen, meinte ein Steirer (Gimpl). Seipels Stellvertreter Stöckler formulierte es brutal offen, als er den verpönten Slogan wiederholte ; »Österreich ist nicht lebensfähig«, gerade noch mit der Einschränkung versehen, wenn man »nicht außerordentliche Mittel« ergreife.42 (Nur Seipels Vertrauter Mataja brach eine Lanze für das Festhalten an der Kreditpolitik.) Otto Bauer hatte als Lösung die Währungsunion mit dem Deutschen Reich gefordert, die vom Friedensvertrag ja nicht ausdrücklich verboten worden sei. Kunschak interpretierte die Rede als einen propagandistischen Ausritt, um »den Großdeutschen das Haus anzuzünden«. Darauf stiegen die Deutschnationalen inzwischen nicht mehr ein. Dinghofer war an solchen Experimenten nicht interessiert – Deutschland müsse ja doch abwinken. Das aber wäre eine schwere Enttäuschung und ein nie wieder gut zu machender Schaden für den Anschluss-Gedanken.43 Seipel machte seinem Klub keine vollmundigen Versprechungen ; er hielt sich an die Warnung : »Die Frage ist, ob wir über diese Tage aushalten. Wenn wir es nicht aushalten, wegen des vorlauten Trubels, dann halten wir’s nicht aus. Etwas anderes, wenn wir selbst nun nervös würden, das ist DER Fehler !« Aber er sah sich veranlasst, Alternativen zu skizzieren : Zum ersten Mal klang hier die Möglichkeit einer Bündnispolitik an, mit Italien als Ansprechpartner, wie sie auch Czernin in 39 Dieselbe Beobachtung bei Ausch, Banken 72. 40 Tabellen zur Entwertung der Krone bei Ladner, Staatskrise 21 ; Marcus, Reconstruction 350 f. 41 AZ, 13.6.1922. 42 KvVI, CS-Klubvorstand 12.6.1922. 43 AdR, GDVP 3, Klub 20.6.1922.
76
Der Bürgerblock
der Presse vertrat, der sich mit Seipel gut verstand (auch wenn dieser ihn einmal einen »Ichthyosaurus« nannte, der in seiner Urzeit stehen geblieben sei). Czernin argumentierte gegen die Neutralität : »Mit allen gut heißt mit keinem gut.«44 Seipel hatte es offener formuliert : Auf alle Fälle »eine aktive Politik, wodurch man auf uns schauen wird.« Voraussetzung für jegliche Alternative, so stellte er in den Raum, sei natürlich, dass die bisherige Politik scheitere, aber wohlgemerkt : »offensichtlich an anderen scheitere …«45 Seitens der Sozialdemokraten suchte Seitz den Kanzler am 12. Juni auf und teilte ihm mit, er habe die Massen nicht länger in der Hand.46 Wieder war bei ihrem Gespräch von der »Finanzdiktatur« die Rede. Seipel hatte den Eindruck, es sei für die Sozialdemokraten leichter, »draußen« zu bleiben, schon einmal mit Rücksicht auf ihren linken Flügel. Aber als Seipel und Ségur dem Nationalrat eine Woche später ihren Finanzplan vorlegten, jubelte – oder höhnte – die AZ, es handle sich dabei um die Verwirklichung alter sozialdemokratischer Forderungen. Josef Redlich – als Seipels Kollege Finanzminister im letzten Kabinett Kaiser Karls – hat sein Urteil in die berühmten Worte gekleidet : »Die Finanzpolitik des Herrn Dr. Bauer, in den Falten der Soutane Seipels drapiert, wird traurig enden.«47 Der Sinn der vieldiskutierten »Finanzdiktatur« war ein ganz offensichtlicher : Die verschiedenen Maßnahmen, die für eine Sanierung nötig waren, mussten zur gleichen Zeit erfolgen, wenn sie nicht nutzlos verpuffen sollten. Dazu gehörten – um das Budgetloch zu stopfen – Steuererhöhungen und Einsparungsmaßnahmen. Beides war schwerlich binnen vierundzwanzig Stunden über die Bühne zu bringen. Als unmittelbar wirksame Medizin war an ein Junktim zwischen zwei Maßnahmen gedacht, die offenkundig einen gewissen Zwangscharakter aufwiesen : Die österreichischen Großbanken sollten »überredet« werden, genügend Kapital – in Schweizer Franken – zur Verfügung zu stellen (oder dessen Aufbringung zumindest zu garantieren), um eine eigenständige Notenbank zu gründen. Ségur versprach dafür feierlich, von dem Moment an keine ungedeckten Kredite mehr in Anspruch zu nehmen, sprich : die Banknotenpresse stillzulegen. Doch wie sollte der Staat sein Defizit decken, bis die langfristigen Reformen ihr Ziel erreicht hatten und das Defizit verschwunden war – ein Zeitraum, den man optimistisch immer noch mit mindestens einem halben Jahr veranschlagte. Dazu benötigte man 400 Milliarden (Papier)Kronen. So viele Nullen klangen imposant, in Pfund damals vielleicht immerhin noch um die vier Millionen, zwei Wochen später 44 AVA, E/1791, Wildner-Tb. 1.7. & 22.7.1922 ; NFP, 18.7.1922, 2 ; vgl. auch Malfer, Wien und Rom 105. 45 KvVI, CS-Klub 12.6.1922. 46 DBFP XXIV 248 (Phillpotts Bericht Juni 1922) ; Fellner/Corradini (Hgg.), Redlich-Tb. II 600 (20.6.1922) ; vgl. auch Hanisch, Bauer 215. 47 AZ, 21.6.1922.
Die ersten 100 Tage : Kein Veni, vidi, vici
77
wiederum sechs Millionen, am Höhepunkt des Währungsverfalls zwei Monate später freilich kaum mehr als eine Million.48 Dazu sollte eine innere Anleihe dienen, die nun freilich als Zwangsanleihe konzipiert war : Der Grundgedanke war eine Generalhypothek auf den gesamten Grundbesitz. Wer dieser Belastung ausweichen wollte, war herzlich eingeladen, den auf seinen Hof entfallenden Beitrag selbst zu zeichnen – und dafür noch Zinsen zu kassieren. Immerhin die Hälfte des Betrages sollte auf die Landwirtschaft entfallen. Die Summen, um die es sich handelte, wurden von der AZ zwar bloß auf das Vierfache der jährlichen Grundsteuer der Vorkriegszeit berechnet.49 Doch Bauern verfügten meist über wenige Reserven an Bargeld, das man auf diese Weise abschöpfen und aus dem Verkehr ziehen konnte. Daran knüpften sich allerlei weitergehende Erwägungen : Wenn die Bauern für die Zwangsanleihe erst wiederum Kredite aufnehmen müssten, stieg die Geldmenge erneut an. Die Grundbesitzer mussten dann zumindest die Zinsendifferenz bezahlen zwischen dem Satz, den ihnen die Bank vorschrieb, und den Zinsen, die ihnen der Staat versprach. 6 % klang in normalen Zeiten ganz gut, aber nicht nach einem Monat, der eine Geldentwertung von nicht weniger als 71 % aufwies. Natürlich : Genau dieser Entwicklung sollte mit der Operation ja Einhalt geboten werden. Da war nun allerdings Gottvertrauen angesagt : Wenn die Sanierung klappte – und der Kronenkurs eventuell sogar wieder anstieg –, hatte man ein gutes Geschäft gemacht. Doch dieses Vertrauen war ganz offensichtlich nicht gegeben. In der Republik amtierte kurioserweise immer noch die Österreichisch-Ungarische Bank, die knapp vor der Liquidation stand. Das entscheidende Datum für den Beginn der neuen Ära sollte die Gründung der Notenbank sein – und die versprochene Einstellung der Notenpresse. Über die Reihenfolge tobte seit langem ein Streit der – mehr oder weniger – Gelehrten. Als gängige Meinung galt, die neue Bank sollte den krönenden Abschluss des Sanierungswerks darstellen, der ähnliche Sünden in Zukunft unmöglich mache. Der Verfall der Währung im Sommer 1922, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellte, führte zu einer Umstellung des Programms. Die Notenbank hatte jetzt Vorrang. Vizekanzler Frank verdeutlichte es dem großdeutschen Klub mit dem Vergleich : »Das Pferd mußte aber beim Schwanz aufgezäumt werden und rasch, weil sonst überhaupt kein Pferd mehr da« gewesen wäre.50 Tatsächlich – so war zu beobachten – führte allein schon die Ankündigung der Bankgründung Mitte Juni 1922 zu einer gewissen Erholung der Kurse. Aber vielleicht vermittelte der Vorrang der Bankgründung immer noch einen falschen Eindruck : Das eigentliche Ziel war und blieb die Synchronisierung all der Maßnahmen, die nur gemeinsam den Erfolg verbürgen konnten. Sowohl Seipel als 48 Vgl. Kurse in NFP, 22.6.1922, 14 ; 26.8.1922, 9. 49 AZ, 5.7.1922. 50 AdR, GDVP 3, Klub 4.7.1922.
78
Der Bürgerblock
auch Dinghofer versicherten ihren Klubs, in einem »Mantelgesetz« werde festgelegt, dass alle diese Maßnahmen nur gemeinsam in Kraft treten würden.51 Die Bankgründung errang im Katalog der politischen Prioritäten insofern eine Vorrangstellung, weil sich hier vermeintlich am raschesten Ergebnisse erzielen ließen, da es um vertrauliche Verhandlungen hinter verschlossenen Türen ging. Dieses Verfahren gab freilich zu Misstrauen Anlass, ob man mit einer Notenbank – die ihrerseits von den Banken getragen würde – nicht die Katze im Sack kaufte. Nicht bloß die AZ spottete über die Firma »Seipel, Rothschild & Komp.«, bei der Rothschild das Sagen habe,52 auch Gürtler konnte sich des Beifalls sicher sein, wenn er sich im christlichsozialen Klub die Frage erlaubte, ob man »das Wirtschaftsleben wirklich einer Bank anvertrauen solle, deren Statuten wir nicht kennen«.53 Das Misstrauen gegen die Bankwelt war endemisch und weitverbreitet, über die Verteilung der Sitze im Generalrat der zu gründenden Notenbank wurde genauso gefeilscht wie über die Kontrollrechte des Staates, die seit jeher einer Quadratur des Kreises gleichkamen : Missbrauch durch die privaten Aktionäre sollte verhindert werden, gleichzeitig aber die Unabhängigkeit der Bank über jeden Verdacht erhaben sein. Um es euphemistisch zu umschreiben : Das Problem ist seither ganz offenbar einer befriedigenden Lösung nicht näher gerückt. 1922 begann es sich an den Ansprüchen der beiden Großbanken zu spießen, die inzwischen in ausländischen Besitz übergegangen waren : der Anglo-Bank und der Länderbank, die im Generalrat ein Vetorecht verlangten. Der britische Gesandte schrieb, die Länderbank halte sich wohlweislich im Hintergrund, um das Odium ganz auf die Engländer fallen zu lassen.54 Vor »Erpressungen der Großbanken« hatte die AZ schon vom ersten Tag an gewarnt, doch ihre Befürchtungen griffen zu kurz : Dahinter stand die Skepsis der Bank of England, dass sich ohne ausländische Kredite und ausländische Kontrolle eine Sanierung ohnehin nicht bewerkstelligen lasse.55 Doch als Sündenbock kamen die Bank of England und ihr sagenumwitterter Gouverneur Sir Montagu Norman (dessen Amtszeit später einmal als zweiter »Norman Conquest«56 Englands bezeichnet wurde) in gewisser Weise zu spät : Inzwischen waren in Österreich die Verteilungskonflikte in einer geradezu klassischen Art und Weise zum Ausbruch gekommen, die jeden Verfechter der »Finanzdiktatur« – ob jetzt von links oder von rechts – bloß in seinen Überzeugungen bestätigen konnten. Mit der Synchronisierung der Sanierungsschritte war es nicht weit her – oder besser
51 KvVI, CS Klubvorstand 20.6.1922 ; AdR, GDVP 3, Klub 30.6.1922 ; Kritik bei März, Bankpolitik 478 f. 52 AZ, 15.6.1922. 53 KvVI, CS Klubvorstand 7.7.1922. 54 PRO T 160/64/2073/020/1, Bericht Akers 14.8.1922. 55 Natmeßnig, Finanzinteressen 90 ff. 56 Batonyi, Britain and Central Europe 49.
Die ersten 100 Tage : Kein Veni, vidi, vici
79
und böser gesagt : Sie gelang insofern über alle Erwartungen gut, weil eben so ziemlich alle Maßnahmen auf die lange Bank geschoben bzw. bis zur Unkenntlichkeit verwässert wurden. Am 21. Juni hatte Ségur seinen Finanzplan im Nationalrat vorgestellt und seinen Rütlischwur geleistet, die Notenpresse mit der Gründung der Nationalbank stillzulegen. Bereits am nächsten Tag titelte die AZ : »Die Kriegserklärung des Reichsbauernrates«, weil die Agrarier ihre Zustimmung zur Zwangsanleihe von allen möglichen Forderungen abhängig gemacht hatten.57 Über den diskreten Charme der Bourgeoisie mochte man sich in diversen Verschwörungstheorien ergehen ; bei den Agrariern brauchte man keine Zuflucht zu Hintertreppeneinflüssen zu nehmen. Ihre Stärke lag offen zutage : Gut die Hälfte der bürgerlichen Phalanx im Nationalrat bestand aus Bauern oder bäuerlichen Standesvertretern. Als Katalysator der Revolte traten die »Bündler« in Aktion, die betonten, sie hätten die Regierung gewählt, sich dabei aber freie Hand vorbehalten.58 Schönbauer versicherte Seipel seines ungebrochenen Vertrauens – aber er werde gegen das Gesetz stimmen. Der Kanzler antwortete, umgekehrt wäre es ihm lieber …59 Auch auf der linken Seite war man nicht untätig : Achtundvierzig Stunden nach der »Kriegserklärung« der Agrarier machte die AZ mit der Schlagzeile auf : »Der Streik des Herrn Seipel«. Nun, es streikte nicht der Prälat, der pünktlich um 5 Uhr früh seine Messe las, sondern Bahn- und Postbedienstete, weil man sich über die Erhöhung der Juni-Gehälter nicht einig geworden war. Das Ergebnis war ein PyrrhusSieg der Regierung, die ihrem Prestigestandpunkt treu blieb, den Forderungen nicht nachzugeben, dafür aber das System der Indexlöhne jetzt auch auf den öffentlichen Dienst ausdehnte. Das entsprechende Gesetz wurde dann auch tatsächlich – ganz ohne Finanzdiktatur – im Schnellverfahren durchgezogen und über Nacht erledigt – gegen die nur allzu verständlichen Bedenken des Finanzministers.60 Seipel redete das Ergebnis schön, es gehe »um die Beseitigung des unerträglichen Zustands, dass ununterbrochen verhandelt werden muß«.61 Ein Blick in die Tagesordnung der Ministerratsprotokolle gibt ihm da zweifelsohne recht. Für die Bekämpfung der Inflation war der Kompromiss allerdings kontraproduktiv. Selbst Waber, der seine Karriere als Beamtenkandidat begonnen hatte, schlug die Hände über dem Kopf zusammen : Das Gesetz sei eine ungeheure Gefahr. Die Regierung habe mehr bewilligt, als von den Beamten verlangt worden sei.62 Da war er mit
57 AZ, 23.6.1922. 58 KvVI, CS Klubvorstand 7.7.1922 (Bericht Miklas). 59 KvVI, CS Klubvorstand 10.7.1922. 60 AZ, 25./27./28.6.1922 ; KvVI, CS Klubvorstand 14.9.1922 (Ségur). 61 KvVI, CS Klubvorstand 27.6.1922. 62 AdR, GDVP 3, Klub 27.6.1922.
80
Der Bürgerblock
dem Vorzeige-Bankier Rosenberg einer Meinung, der klagte, das Indexgesetz sei »der Nagel zu unserem Sarg«.63 Es sei denn – wie bei der Zwangsanleihe –, der Sanierung war ein durchschlagender Erfolg beschieden und der Index sank : Dann konnte die Regierung Gehaltskürzungen mit dem einfachen Hinweis auf das Gesetz anordnen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit aber stand die Zwangsanleihe : Die AZ kommentierte schadenfroh : »Der Prälatenregierung droht die Rebellion ihrer eigenen Gefolgsleute«.64 Die Koalitionsparteien hatten ein eigenes Komitee einberufen : Fink und Heinl von den Christlichsozialen, Schürff und der Salzburger Clessin von den Großdeutschen. Aus dieser Ecke drohten keine Schwierigkeiten, allenfalls von Größbauer, dem Vertreter der »Bündler«, der ebenfalls beigezogen wurden. Die Großdeutschen wollten »nichts tun, was die innere Anleihe schädigt«. Miklas zollte ihnen das Kompliment, sie seien »sehr loyal«. Dinghofer kommentierte philosophisch, ein gerechter Schlüssel werde sich nicht finden lassen, allein schon, weil das nötige statistische Material fehle. Selbst von den zwei Bauernvertretern waren keine Gegenstimmen zu vernehmen. Nur vom linken Flügel sah Pauly den Finanzplan im Juli schon als »totgeborenes Kind«. Doch der Klub hielt mit zwölf zu zwei Stimmen an ihm fest,65 vor allem an dem Junktim zwischen Notenbank und Zwangsanleihe. Bei den Christlichsozialen gingen die Wogen höher. Die Bauern lehnten die Anleihe nicht pauschal ab, aber sie verlangten eine ausgewogene Verteilung der Lasten. Mit der Heranziehung des mobilen Kapitals (das man aber gleichzeitig anlocken wollte !) liefen sie bei den Sozialdemokraten natürlich offene Türen ein. Doch Stöckler fuhr von Anfang an viel schwerere Geschütze auf : Den wertvollsten Teil des Grundbesitzes mache der Hausbesitz aus, der vom Mieterschutz vollkommen entwertet sei. Dort müsse man den Hebel ansetzen. Außerdem gehe es nicht bloß um das Budget, sondern um die Zahlungsbilanz, die passiv sei, weil Österreich gezwungen sei, einen großen Teil seiner Lebensmittel einzuführen. Aber wie solle man die Intensivierung der heimischen Landwirtschaft vorantreiben, wenn »dem Bauern niemand mehr bei der Arbeit hilft« ? Als Ausweg forderte er kurzerhand ein Junktim der Anleihe mit dem Zehn- anstelle des Achtstundentages.66 Hinter dieser Ansage verbarg sich eine exquisite Ironie. Noch zwei Jahre früher hatten die städtisch-akademischen Eliten der Partei scheelen Auges auf die niederösterreichischen Bauern geblickt, die hinter dem Rücken der Parteiführung mit den »Roten« packelten, als es um die Demokratisierung der Bezirksverwaltungen ging – eine Horrorvorstellung für die Juristen von Schwarz und Blau, die darin »eine 63 März, Bankpolitik 573 (3.8.1922). 64 AZ, 21.6.1922. 65 AdR, GDVP 3, Klub 4.7.1922 ; KvVI, CS Klubvorstand 7.7.1922 (Bericht Miklas). 66 KvVI, CS Klubvorstand 20.6.1922.
Die ersten 100 Tage : Kein Veni, vidi, vici
81
Zerschlagung in einzelne Republiken« witterten.67 Jetzt überholten die Bauern die zögernden Städter in weitem Bogen rechts. Natürlich : Mieterschutz und Achtstundentag waren auch in bürgerlichen Kreisen immer wieder Steine des Anstoßes. Aber man wollte hier doch keine frontalen Attacken riskieren. Seipel hatte das Thema nicht aus den Augen verloren – er kam dann zu einem vielleicht ungünstigen Moment im Wahlkampf 1923 darauf zurück –, aber er wollte im Ringen um die Sanierung keine zusätzlichen Konflikte heraufbeschwören.68 Ségur zog schon am 7. Juli die resignierende Schlussfolgerung : »Der psychologische Moment für den Finanzplan ist vorbei.« Als er vor einem Monat von den 400 Milliarden gesprochen habe, die als Überbrückungshilfe notwendig seien, stand die Krone noch um soundso viel Prozent höher. Jetzt könne man mit dieser Summe schon nicht mehr das Auslangen finden.69 Die Sozialdemokraten forderten deshalb auch eine »Valorisierung« der Zwangsanleihe.70 Wenn das Instrumentarium nicht greife, so fürchtete Ségur, werde nur ein »ganz geringer Bruchteil« überhaupt bezahlen. Nach der Sommerpause klagte er über seinen eigenen Apparat : »Vollständige Anarchie. […] Erlässe hagelt es ; aber es geschieht doch nichts.« Selbst die Agrarier, die in dieser Frage auf der anderen Seite standen, stimmten in diesen Chor ein : Die Finanzverwaltung lasse in den Ländern ganz aus, pflichtete ihm auch Fink bei ; Stöckler sprach von »vollständigem Versagen«, das einem Angst und Bange mache.71 Bei den Großdeutschen teilte Schürff diese Bedenken : Die innere Anleihe sei »legistisch ein Schundwerk ersten Ranges«. Dennoch wolle er unbedingt daran festhalten.72 So geschah es dann auch, nach außen hin zumindest : Die innere Anleihe wurde zusammen mit den anderen Vorlagen am 24. Juli beschlossen. Der »Bauernbündler« – die Zeitung der christlichsozialen niederösterreichischen Bauern (nicht der »Bündler« !) – feierte, nicht ganz zu Unrecht, als großen Erfolg, dass die erste Rate der Anleihe – ursprünglich im ersten Überschwang schon für Juli vorgesehen – erst am 16. Oktober fällig sei. In diesem Vierteljahr könne viel passieren : Wenn die Sanierung bis dahin auf den Weg gebracht sei, würden die Bauern ihren Beitrag leisten. Doch »unnütze Opfer« werde man nicht bringen, das sei jeder Regierung ins Stammbuch geschrieben.73 Als es dann soweit war, schrieb die christlichsoziale
67 So Frank in AdR, MRP 66, Nr. 236, 23.10.1922, vgl. auch Höbelt/Kalwoda/Schönner (Hgg.), Klubprotokolle 842, 850 (Verfassungskomitee 25./27.11.1919) ; Kriechbaumer (Hg.), Protokolle 179. 68 Gulick, Habsburg to Hitler 462 ; Benesch, Zerrissenheit 182 f. 69 KvVI, CS-Klubvorstand 7./8.7.1922. 70 AZ, 11.7.1922. 71 KvVI, CS Klubvorstand 14.9.1922. 72 AdR, GDVP 3, Klub 11.7.1922. 73 Bauernbündler, 1.8.1922.
82
Der Bürgerblock
›Salzburger Chronik‹ mitleidig, die gesamte Zwangsanleihe könne doch bestenfalls eine Woche Notenumlauf decken.74 Das Ergebnis war : Die Statuten der Bank, die auf sich warten ließ (was am 24. Juli noch gar nicht so klar war, weil die Zusatzforderungen der Anglo-Bank da noch gar nicht auf dem Tisch lagen), wurden zusammen mit der Zwangsanleihe beschlossen, die ebenfalls ein, sagen wir einmal : Termingeschäft darstellte. Der Beschluss über die Einführung der Warenumsatzsteuer – von damals erst 2 % – wurde nach langen Debatten, ob sie jetzt phasenweise oder pauschal einzuheben sei, überhaupt gleich auf die Herbstsaison vertagt. Als Ausrede diente, administrativ sei da vor Dezember ohnehin nichts zu machen.75 Ähnliches galt schließlich auch für die Zwangsanleihe : Die Einzahlung der ersten Rate scheitere schon einmal daran, so hieß es im Herbst, weil die nötigen Verordnungen noch nicht erlassen worden seien.76 Bei den geplanten Zoll- und Tariferhöhungen waren ebenfalls gewisse Abstriche vorgenommen worden. Seipel referierte zum Abschluss der Parlamentssession über diverse lobenswerte Sparmaßnahmen – die 25 Milliarden Papierkronen pro Jahr betrugen, nicht allzu beindruckend im Vergleich mit den 400 Milliarden Zwangsanleihe, die man auf den Herbst verschoben hatte. Was immer man auch über den guten Willen zumal Ségurs sagen wollte : Der große Wurf war allenfalls angedeutet oder in den Raum gestellt worden.
Der »Autrichelieu« – Seipel auf Reisen Das enttäuschende Ergebnis der ersten zehn Wochen der Regierung Seipel I wurde zum Ausgangspunkt der Heldenlegende, die sich um den Prälaten rankt – nicht als das innenpolitische und innerparteiliche »Mastermind«, das er unbestritten war, sondern als »Autrichelieu«, als listenreicher Odysseus, der sich souverän auf der europäischen Bühne bewegte. Mit seiner sommerlichen Reisediplomatie, die ihn mit ganz kurzer Vorbereitungszeit nach Prag, Berlin und Italien (Verona) führte, hob er die Finanzmisere der Alpenrepublik auf die politische Ebene und rollte »die mitteleuropäische Frage« auf.77 Der Verweis auf Mitteleuropa wurde im Kabinett übrigens zuerst von Ségur gebraucht, der Seipel begleitete. Mitteleuropa ist als Begriff seit jeher umstritten : Als Beneš dieselbe Formel verwendete, war die ›Reichspost‹ gleich mit der Dis tanzierung bei der Hand, der Terminus sei »einigermaßen ergänzungsbedürftig«.78 74 Salzburger Chronik, 3.11.1922, 2. 75 RP, 20.7., 25.7.1922, 2. 76 AdR, GDVP 3, Klub 6.9.1922. 77 AdR, MRP 64, Nr. 218, 17.8.1922. 78 RP, 24.8.1922.
Der »Autrichelieu« – Seipel auf Reisen
83
Die diplomatischen Schachzüge Seipels sind relativ gut erforscht, die Protokolle seiner Unterredungen seit langem bekannt. Man muss sie deshalb hier nicht im Detail verfolgen, sondern nur darauf hinweisen, dass es sich dabei um eine zweigleisige Strategie handelte, ja handeln musste. Seipel wollte die Nachbarn aufrütteln, ihr Interesse am Schicksal Österreichs wecken. Dem Kabinett gegenüber begründete er alle drei Besuche mit im Wesentlichen defensiven Motiven : Mit dem Deutschen Reich sei an »ein aktives Vorgehen nicht zu denken«, man wolle sich bloß ins Einvernehmen setzen ; ein Treffen mit Beneš wäre gut, »damit wir mit Deutschland ungestörter sprechen können« ; bei Italien gehe es darum, »einen Schutz gegen tschechische und jugoslawische Besetzung« zu gewinnen.79 Dahinter stand natürlich die Absicht, die Nachbarn gegeneinander auszuspielen. Diese Strategie konnte den Betreffenden auch kaum verborgen bleiben. Das Kalkül ging dennoch auf. Die Einladung aus Italien traf dann sogar so überstürzt ein, dass Seipel aus Berlin gar nicht zurück nach Wien fuhr, sondern unmittelbar über den Brenner nach Verona, dem alten Hauptquartier Radetzkys. Notabene : Einen – noch näher gelegenen – Ort in Südtirol als Treffpunkt auszuwählen, vermied man aus Rücksicht auf die Sensibilitäten der österreichischen Öffentlichkeit. Seipel nützte die Gelegenheit, in Verona zwischen der morgendlichen Messe und dem Beginn der Beratungen zusammen mit Ségur noch schnell die Scaliger-Gräber zu besichtigen.80 Ein Element ist dabei schwer einzuschätzen : Seipel operierte nach innen und außen stark mit dem Argument, der finanzielle Kollaps des Staates werde mit einer Aufteilung unter seinen Nachbarn enden. Vor allem dem Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen (SHS-Staat, auch damals schon oft Jugoslawien genannt) wurden immer wieder derlei Absichten unterstellt, die sich dann zu einem Flächenbrand ausweiten könnten. Im Rückblick erzählte Seipel seinem Klub, Jugoslawien habe in dieser Richtung schon einmal in Paris »angeklopft«. Diese Anfrage sei zwar nicht erledigt, aber auch nicht strikt zurückgewiesen worden. Auch andere Nachbarn hätten solche Absichten geäußert – für den Fall, dass es »bei uns drunter und drüber geht.«81 Bei den Großdeutschen sprach Straffner davon, die Jugoslawen hätten bereits »Teile der Wrangel-Armee« (der weißrussischen Exiltruppen, die bei ihnen Zuflucht gesucht hatten) an die österreichische Grenze verschoben.82 Schon im Juni hatte Seipel die Gefahr an die Wand gemalt : Wenn die Krone völlig abwirtschafte, »tritt automatisch an Stelle der Krone irgendeine andere Währung.« Ob das jetzt die tschechische Krone sein werde, darüber wolle er nicht streiten. Aber damit verbun79 AdR, MRP 64, Nr. 218, 17.8.1922. 80 DAW, Seipel-Tb. 24.8.1922. 81 KvVI, CS Klub 11.10.1922 ; vgl. auch Malfer, Wien und Rom 108 f. bzw. einen Bericht aus Budapest vom 5.9., zitiert bei Ladner, Staatskrise 101. 82 AdR, GDVP 3, Klub 31.8.1922.
84
Der Bürgerblock
den sei die Gefahr der Separation einzelner Bundesländer – mit dem Endergebnis : »In Wien übernimmt halt Breitner die ganze Sache.«83 Ob Seipel diese Gefahr tatsächlich für so akut hielt oder ob ihm die Gerüchte als Argument nur allzu gelegen kamen, lässt sich schwer mit Sicherheit sagen. Die Wahl zwischen Breitner und Beneš, die er seinen Getreuen ließ, wenn sie nicht brav spurten, entbehrte nicht einer gewissen Demagogie. Andererseits : Erfahrung im Zerfall von Staaten, gleichsam über Nacht, hatte seine Generation nun allerdings. Seipel selbst sagte im August dann, er habe vor dem Besuch bei Beneš am meisten Scheu gehabt. Das Hauptaugenmerk lag zweifellos auf Italien, dem Seipel – mehr oder weniger spontan – nicht bloß eine Zoll, sondern eine Währungsunion vorschlug, die als einzige unmittelbare Abhilfe schaffen könne. Der Gedanke stieß – entgegen allen Stereotypen – weniger beim italienischen Außenminister Schanzer als beim Finanzminister Bertone auf Resonanz. Die Details dieses Projekts sollten von dem über Nacht aus dem Urlaub nach Italien zitierten Sektionschef Richard Schüller weiter verfolgt werden. Damit war eine Drohkulisse geschaffen, der Kleinen Entente und ihren Protektoren in Paris die Rute ins Fenster gestellt. Die Botschaft sollte lauten : Lieber solle Europa in Verwirrung geraten, als dass wir zugrunde gehen. Seipel schmückte die Szene im Ministerrat genüsslich aus, als der französische Gesandte in Wien, Pierre Lefèvre-Pontalis, ein Indochina-Spezialist, der aber schon vor dem Krieg in Griechenland erste Erfahrungen mit Finanzkontrolle gesammelt hatte, gereizt wie ein Hahn bei ihm erschienen sei und die Federn aufgestellt habe : Österreich müsse dem Völkerbund vertrauen, der »unsere Unabhängigkeit schützen würde«. Seipel will ihm kühl beschieden haben : »Der Schutz der Unabhängigkeit nützt uns nichts, denn wir brauchen Geld.«84 Die AZ fasste denselben Gedanken in der Woche darauf in die Formel von der »Prostitutionspolitik der Prälatenregierung, die die Republik für ein paar Millionen Franken jedem Kauflustigen feilbietet.«85 In Prag soll Masaryk seinerseits eine Währungsunion mit Österreich angeregt haben, ein Vorschlag, der allerdings weder von Beneš noch von den Entente-Mächten aufgegriffen wurde.86 Seipel resümierte zufrieden, »England und Amerika sind die einzigen Staaten, die sich nicht aufgeregt haben. Sie freuen sich nur darüber, dass wir einen solchen Wirbel gemacht haben.«87 In England erkundigte sich Außenminister Lord Curzon angelegentlich beim öster-
83 KvVI, 12.6.1922. 84 AdR, MRP 64, Nr. 220, 28.8.1922 ; vgl. auch Röglsperger, Politik Frankreichs 225 und Malfer, Wien und Rom 107, 111 ff. über die vorausgehenden Fühlungnahmen mit Italien schon im Juni und Juli. 85 AZ, 30.8.1922. 86 Lojko, Meddling in Middle Europe 180. 87 AdR, MRP 64, Nr. 220, 28.8.1922 ; vgl. auch ADÖ IV 356 ff.
Der »Autrichelieu« – Seipel auf Reisen
85
reichischen Gesandten Baron Franckenstein bloß, wieso Seipel nicht auch Belgrad einen Besuch abgestattet habe.88 Zwischen Prag und Verona war der Abstecher nach Berlin in gewisser Weise ein Pflichttermin. Peinlich war bloß, dass die reichsdeutsche Antwort mit der Einladung anderthalb Tage auf sich warten ließ.89 Der Besuch endete mit dem erwarteten Ergebnis : Reichskanzler Wirth, als Zentrumsmann theoretisch ein Parteifreund Seipels, steckte mitten in außen- und innenpolitischen Turbulenzen und bat inständig, dass »unter keinen Umständen der Versuch gemacht werde, die Anschlussfrage in diesem Augenblick direkt oder indirekt aufzurollen«. Selbst konservative Militärs, so Seipel, hätten diese Meinung geteilt.90 Hilfe war von Deutschland augenblicklich keine zu erwarten : Die Mark setzte gerade dazu an, die österreichische Krone auf ihrem Sinkflug zu überholen. Auch aus der »Gratiskohle«, die sich Ségur erhofft hatte, wurde nichts.91 Als Ratschlag gab man Seipel mit auf den Weg, im Zweifelsfall sei die Orientierung an Italien der an Frankreich und der Tschechoslowakei natürlich vorzuziehen. (Kurioserweise war es im Ministerrat vom 28. August dann ausgerechnet der Großdeutsche Waber, der riet, man solle nicht von vornherein auf einen Anschluss an die Kleine Entente verzichten !) In Deutschland lag in einer ganz anderen Hinsicht der Schlüssel zur Situation, braute sich hier doch die große internationale Krise zusammen, welche die Aufmerksamkeit der Großmächte – und der internationalen Finanzwelt – in erster Linie in Anspruch nahm und Österreich auf die hinteren Plätze verwies. Das Defizit der Sechs-Millionen-Republik Österreich mochte beachtliche Ausmaße erreichen, es handelte sich dabei aber immer noch um »Peanuts« im Vergleich zu den 132 Milliarden Goldmark, die von Deutschland als Reparationen gefordert wurden. Wenn man die Summe »kapitalisierte«, sprich : als Anleihe auflegte, die sich am freien Markt verkaufen ließ, brauchte das Reich bloß die Zinsen zu berappen – was für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Erde im Prinzip machbar erschien. Doch für eine solche Anleihe war – ebenso wie im Fall Österreichs – Vertrauen in die politische Stabilität erforderlich, sprich : in die deutsche Zahlungsmoral.92 Solange diese Voraussetzungen nicht gegeben waren, behalf man sich mit willkürlich festgelegten Ratenzahlungen. Der Effekt war ein ähnlicher wie in Österreich, auch wenn der Zweck ein anderer war. Die Deutschen steigerten um fremde Währungen : Der Kurs der Mark fiel, die Inflation stieg. Argwöhnische Gemüter hatten
88 DBFP XXIV 314 (25.8.1922). 89 Franks Bericht in AdR, GDVP 3, Klub 31.8.1922. 90 RP, 24.8.1922, 2 unterstrich diesen Aspekt mit einer Blattlese der reichsdeutschen Rechtspresse. 91 Die Sache wurde dann später doch noch verhandelt ; vgl. AdR, MRP XX, Nr. 226, 19.9.1922. 92 Vgl. Schuker, Debts and Reconstruction ; Link, Amerikanische Stabilisierungspolitik 126 ff.; Kraus, Versailles und die Folgen 41 ff.
86
Der Bürgerblock
das Reich im Verdacht, diese Schwierigkeiten bewusst zu verschärfen – einerseits als Exportprämie, andererseits als sichtbaren Beweis, dass die Reparationen unmöglich zu zahlen seien. Wenn die Deutschen nicht zahlten, wie sollten dann die Franzosen ihre Kriegsschulden bei den Briten, diese wiederum ihre bei den Amerikanern abstottern ? Keynes – dem eine gewisse Bosheit gegenüber Sparern und Investoren keineswegs fremd war – hatte auch da einen beunruhigenden Hinweis parat : In diesen Fällen hat der Schuldner immer das letzte Wort.93 Der deutsche Wirtschaftsexperte Walter Rathenau – bald darauf auch Außenminister und Opfer eines Attentates – hatte im Herbst 1921 mit den Franzosen ein Übereinkommen ausgehandelt : Warum lieferten die Bergwerke an der Ruhr, um das leidige Währungsproblem zu umgehen, die Kohle nicht einfach direkt an die französische Industrie ? Aber auch dieser Ausweg war nicht als Dauerlösung gedacht. Deutschland verlangte nach spürbaren Erleichterungen – und biss damit bei Frankreich auf Granit : Das war der Hintergrund des schon kurz erwähnten Wechsels von Briand zu Poincaré in Frankreich zu Anfang des Jahres 1922, den die AZ als Grund für den Sturz der Krone angeführt hatte. In Frankreich bestand seit 1919 – erstmals seit fast einem halben Jahrhundert – eine kompakte Mitte-rechts-Mehrheit. Vor einem echten Konservativen – einem gläubigen Katholiken oder gar Krypto-Monarchisten – als Premier scheute die Dritte Republik immer noch zurück. Um die Gunst der Parlamentsmehrheit bewarben sich stattdessen zwei laizistische Republikaner : Aristide Briand, der bewunderte Wortkünstler, der die Rechte mit der Wiederaufnahme der Beziehungen zum Vatikan bezirzn wollte, und Raymond Poincaré, der ihr eine harte Haltung gegenüber Deutschland versprach. Am Personal und an der Mehrheit hinter der Regierung änderte sich durch den Wechsel an der Spitze nichts, am außenpolitischen Kurs schon. Wie aber lautete die Kritik Poincarés an seinem Vorgänger ? Nicht dass er eine deutsche Politik betrieben hätte. So ehrenrührig wollte man nun auch wieder nicht sein. Das Urteil Poincarés – wie sein Urteil über den Friedensvertrag im Allgemeinen – gipfelte vielmehr im Vorwurf einer »englischen Politik«. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte : In Cannes hatte Lloyd George seinem Kollegen Briand horribile dictu sogar Lektionen im Golf erteilt ! Großbritannien war für einen Schuldenschnitt, der den wechselseitigen Drohgebärden ein Ende bereiten, Ressourcen freisetzen und den Handel beleben würde. Als die Deutschen im Juli 1922 ein einseitiges Moratorium verkündeten, hegte man in Paris den Verdacht, die Engländer hätten sie dazu angestiftet. Eine Konferenz in London Mitte August ging ergebnislos auseinander. Nach seiner Rückkehr hielt Poincaré am 16. August – Seipel war gerade am Weg nach Prag – einen Ministerrat ab, der erstmals die Besetzung sogenannter
93 Höbelt, Policemen 65.
Der »Autrichelieu« – Seipel auf Reisen
87
»produktiver Pfänder« im Ruhrgebiet in Erwägung zog, zu der es im Jänner 1923 dann auch tatsächlich kam.94 Die leidigen Krisen um die Reparationen warfen unweigerlich ihren Schatten auf die österreichische Frage. Denn Lloyd George war der Auffassung, zuerst müsse das deutsche Problem einer Lösung zugeführt werden, dann erst werde sich alles andere – nahezu von selbst – ergeben. Auch den Bankiers erschien diese Reihenfolge plausibel. Man habe Vertrauen zu Seipel, dem man attestierte, dass er mit größerer Energie und Entschiedenheit vorgehe, als man es bei österreichischen Staatsmännern gewohnt sei, aber das deutsche Problem genieße ganz einfach Priorität. Young konnte Anfang Juni – Seipel war erst einige Tage im Amt – gerade noch erreichen, dass die Morgan-Gruppe nicht sofort abwinkte, sondern ihn noch mit einem weiteren Gutachten beauftragte, das am 23. Juni vorlag, aber auch keinerlei Chance auf eine internationale Anleihe eröffnete.95 Frankreich wich allen britischen Versuchungen aus, in der Reparationsfrage einen Kompromiss herbeizuführen. Man könne Konferenzen anberaumen, soviel man wollte, jedes Vierteljahr eine : Cannes im Jänner, Genua im April, London im August – aber Frankreich war nicht bereit, ein Jota von seinen Forderungen abzugehen : »Wir müssen bezahlt werden und wir werden bezahlt werden.« Selbst die Tschechen als Vormacht der Kleinen Entente wiegten bedenklich ihre Häupter über so viel Hartnäckigkeit : Präsident Masaryk vertraute dem britischen Gesandten in Prag an, er halte diese Shylock-Politik (»pound of flesh doctrine«) für verfehlt.96 Einem Gipfeltreffen in Form eines vertraulichen Tête-à-Tête wichen »der Lothringer« und »der Waliser«, Poincaré und Lloyd George, das ganze Jahr über wohlweislich aus. Für die Österreicher ergab sich da ein Dilemma, das Straffner so umschrieb : »Wir haben immer die Zertrümmerung der Entente gewünscht, müssen aber augenblicklich zugeben, dass für die nächste Zeit weder Deutschland noch Österreich aus der Haltung Englands gegenüber Frankreich einen Vorteil erwarten können.«97 England nahm genau jene Position ein, die »man« – die Großdeutschen vor allem, aber die anderen nicht minder – immer herbeigesehnt hatte : Es hatte sich von Frankreich getrennt. Aber das Resultat war, dass es den Kontinent abgeschrieben zu haben schien. Oder vielleicht doch nicht ganz : Die Regierung mochte zumindest vorübergehend auf dem isolationistischen Standpunkt angekommen sein, aber mit London verband man schließlich nicht bloß Westminster und Downing Street, sondern auch die »City« und die Bank of England. Vielleicht betrieben Lloyd George und Montagu Norman ein Spiel mit verteilten 94 Roth, Poincaré 381, 398, 400, 402, 416 f.; Keiger, Poincaré 273, 283 f. 95 Vgl. PRO, T 160/58/2073/8, Bericht Akers vom 9. & 16.6.1922 ; DBFP XXIV 220 (9.6.1922), 256–258 (23.6.1922). 96 DBFP XXIV 341 (Clark 12.9.1922) ; vgl. auch Lojko, Meddling in Middle Europe 169. 97 AdR, GDVP 3, Klub 31.8.1922.
88
Der Bürgerblock
Rollen. Wie bei Seipel und Lord Balfour im Herbst mochte man sich fragen : War das alles abgesprochen oder handelte es sich um »prästabilierte Harmonie« ? Montagu Norman hatte den Österreichern in gewissem Sinne ins Handwerk gepfuscht, als er der Anglo-Bank – 30 % davon gehörten inzwischen der Bank of England – den Rat erteilt hatte, das Notenbankprojekt nicht zu unterstützen, weil ohne ausländische Kredite (und die damit einhergehende Kontrolle) an eine Sanierung ohnehin nicht zu denken sei. Wie ursprünglich auch die meisten Österreicher hielt er an dem Grundsatz fest : Die Bank sollte den Schlussstein der Sanierung bilden, nicht den Startschuss. Aber Norman ließ es nicht bei seinem Njet zur Nationalbank im gegenwärtigen Stadium bewenden. Er ermunterte die österreichische Regierung Anfang August über Sir Basil Blackett vom Schatzamt und den getreuen Rosenberg, sie möge aus Anlass der Londoner Konferenz noch einmal an Lloyd George appellieren.98 Die Initiative war von Young schon im Juli angeregt und von Lloyd George abgesegnet worden, allerdings verbunden mit der Warnung, man wolle damit keine falschen Hoffnungen wecken.99 Die österreichische Regierung kam dieser Anregung umgehend nach, ja sie hatte bereits einige Tage vor der Verständigung aus London – am 3. August – über einem solchen Memorandum gebrütet. Als Ausgangspunkt diente die langerwartete Frohbotschaft : Jetzt scheine die Rückstellung der Pfandrechte endlich gelungen zu sein. Sie war am 22. Juli von der Reparationskommission unter gewissen Bedingungen in Aussicht gestellt worden und wurde am 5. August formell bestätigt. Jugoslawen und Tschechen hatten sich diesmal der Stimme enthalten.100 Doch inzwischen habe sich die ursprünglich, im Vorjahr, in Aussicht genommene Hilfsaktion des Völkerbundes »verflüchtigt und niemand zweifelt daran, daß der Plan des Völkerbundes heute nicht mehr durchführbar ist.« Das Dokument zitierte eine Menge Statistiken und endete mit der melodramatische Wendung : »Die österreichische Regierung schuldet sich selbst, der Bevölkerung des schwergeprüften Landes, ja ganz Europa, volle Wahrheit und Aufrichtigkeit. Sie müsste daher, falls die Hilfeleistung nicht baldigst erfolgt, den Nationalrat einberufen und im Angesicht der Öffentlichkeit die Verantwortung für die weiteren Ereignisse ablehnen.« Keine Angst : Im Protokoll der Sitzung vom 3. August war ausdrücklich vermerkt : »Jedenfalls muss trotz der im Schlusssatz des Memorandums zum Ausdruck kommenden Drohung vermieden werden, dass die Regierung abtritt.«101 Im großdeutschen Klub war Straffner ähnlichen Überlegungen, einfach
98 Clay, Norman 185. 99 DBFP XXIV 272–274 (Young 10.7.1922), 280 (Lloyd George 12.7.1922). 100 PRO, T 160/64/2073/020/1 ; Norman an Blackett, 25.7. & 5.8.1922 ; DBFP XXIV 294 (Akers-Douglas 28.7.1922), 298 (5.8.1922), 300 (Curzon 14.8.1922) ; RP, 23.7.1922, 2 ; März, Bankpolitik 479 ; Marcus, Reconstruction 103. 101 März, Bankpolitik 573 f., 576.
Der »Autrichelieu« – Seipel auf Reisen
89
alles hinzuwerfen, schon im Juli mit dem unwiderleglichen Argumenten entgegengetreten : Gerade wenn der Zusammenbruch tatsächlich bevorstehe, sei es doch zweifellos besser, wenn »wir die Regierung in der Hand haben …«102 Dieser Appell wurde von Lloyd George bedauernd, aber abschlägig beschieden. Oder besser gesagt : Die Konferenz verwies das Problem an den Völkerbund zurück. Allenfalls konnte man darunter eine nur allzu wörtliche Reaktion auf die Klage sehen, die Hilfsaktion des Völkerbunds habe sich »verflüchtigt«. Die ›Reichspost‹ grollte : Das Anliegen Österreichs sei in London »nach fünf Minuten Debatte beiseite geschoben« worden.103 Der britische Außenminister Lord Curzon gab immerhin zu, man habe den Österreichern zwei Jahre lang Selbsthilfe gepredigt und könne sie jetzt schwer im Stich lassen, wenn sie endlich erste Anstrengungen unternahmen. Dieses Odium solle man besser nicht auf sich nehmen.104 Doch dabei handelte es sich nur um einen internen Aktenvermerk. Diese Absage aus London war es, die Seipel bewog, zwar nicht tatsächlich seinen Rücktritt einzureichen, aber achtundvierzig Stunden später zu seiner Rundreise in Europa aufzubrechen. Die Vorgeschichte mochte den Insidern aber sehr wohl die Überzeugung verschafft haben, dass Österreich in London über eine Lobby verfügte. Rosenberg berichtete aus London : »Gewisse Kreise in England hätten es gewiß nicht ungern, wenn die zentraleuropäische Frage aufgerollt« und dadurch Frankreich in Schwierigkeiten gebracht würde.105 Seipels Aktivitäten verfolgten ganz offenkundig nicht bloß den Zweck, die italienisch-französischen Eifersüchteleien für Österreich zu nützen, sondern die Briten aus der Reserve zu locken, die Österreich wohlgesonnen waren. Mit den Rivalitäten der Mächte im Zusammenhang stand auch die Wahl der internationalen Organisation, die als Ansprechpartner, in weiterem Sinne als Kontrollor – oder doch zumindest Auftraggeber des Kontrollors – in Frage kam. Die Reparationskommission, die bisher diese Geschäfte übernommen hatte, war ein Werkzeug der Entente, das von Streitigkeiten lahmgelegt zu werden drohte. Die Franzosen konnten sich dort aber – wie sich anlässlich der Ruhrkrise herausstellte – immer noch am ehesten durchsetzen, mehr noch als bei den Gipfelkonferenzen.106 Der Völkerbund war natürlich – ohne die USA, Deutschland und die Sowjetunion – eine Organisation, die in ihren wesentlichen Elementen der Entente verdammt ähnlich sah, aber formal doch nichts mit ihr zu tun hatte und über diverse Mitglieder verfügte, die, wie die Schweiz, Schweden oder die Niederlande, im Krieg nicht bloß neutral ge102 AdR, GDVP 3, Klub 11.7.1922. 103 RP, 24.8.1922. 104 DBFP XXIV 301 (14.8.1922). 105 AdR, MRP 64, Nr. 218, Anhang (16.8.1922), fol. 94 v. 106 Schuker, Debts and Reconstruction 104.
90
Der Bürgerblock
blieben waren, sondern für die Mittelmächte sogar gewisse klammheimliche Sympathien empfunden hatten. Montagu Norman z. B. hielt ein Eingreifen der Entente bei der finanziellen Rekonstruktion Mitteleuropas für kontraproduktiv, der Völkerbund stellte für ihn immerhin eine Möglichkeit dar, wenn man ihn entsprechend aufputze (»would have to be dressed up in somewhat different garments«).107 Norman setzte seine Hoffnungen in erster Linie natürlich auf »das Finanzkapital« : Da waren die Amerikaner inbegriffen, selbst wenn England die Führungsrolle vorbehalten bleiben sollte. Das Haus J. P. Morgan, auf das Schober solche Hoffnungen gesetzt hatte, war während des Weltkrieges der Agent Frankreichs und Englands an der Wall Street gewesen (Spitzmüller grollte : »diese gigantischen Wucherer, die den Weltkrieg finanziert haben«108), aber doch in erster Linie dem Spruch verpflichtet, den Vizepräsident Calvin Coolidge berühmt machte : »The business of America is business.« Ihre Konkurrenten an der Wall Street, die Firma Kuhn, Loeb & Co, versuchte Handelsminister Kraft schon für den Ausbau der österreichischen Wasserkräfte zu interessieren. Politische Vorgaben waren aus dieser Ecke eher nicht zu befürchten, freilich auch kein politisch motiviertes Entgegenkommen. Echte Verhandlungen mit Morgan, wie in österreichischen Blättern gerne kolportiert, dürfte es im Frühjahr und Sommer 1922 nicht wirklich gegeben haben, allenfalls unverbindliche Fühlungnahmen. G. M. Young war in seinem Gutachten vom 23. Juni zu dem Schluss gekommen, mit bloßen Krediten sei keine Umkehr zu erhoffen, es bedürfe da schon des Eingreifens »unserer« Regierungen.109 Zwar hatte die Reparationskommission endlich die Pfandrechte aufgehoben, besser gesagt : nicht aufgehoben, sondern für einige wesentliche Aktiva (wie z. B. Zölle, Tabakgefälle oder Salinen) auf 90 Jahre zurückgestellt. Österreich konnte Anlegern also wieder rechtlich einwandfreie Sicherheiten bieten. Doch ging es bei den Bedenken der internationalen Finanz wirklich um das Kleingedruckte und um die Vorbehalte z. B. der Rumänen, die für ihr Einverständnis zur Rückstellung der Pfandrechte so gerne auch etwas herausgeschlagen hätten ? Montagu Norman war offenbar nicht dieser Meinung.110 Oder war es nur ein technischer Vorwand, um die Sache zumindest hinauszuschieben ? Zu diesem Schluss kam Seipel nach seiner Rückkehr aus Genf – ganz wie Young im Juni. Trotz der positiven Entscheidung über die Pfänder sei wegen der politischen Unsicherheit in Mitteleuropa und besonders in Österreich nichts zu machen, wenn sich die Mächte nicht zu einer Garantie aufrafften.111
107 Lojko, Meddling in Middle Europe 68 (Norman an Strong 14.11.1921). 108 HHStA, Spitzmüller-Tb. 13.6.1922 ; Burk, Morgan Grenfell 127 ff., 140 f. 109 Der Bericht Youngs vom 23.6.1922 in PRO, T 160/58/2073/9 (= DBFP XXIV 256 ff.) ; Marcus, Reconstruction 102. 110 Clay, Norman 183 (13.7.1922). 111 KvVI, CS-Klub 20.9.1922.
Der »Autrichelieu« – Seipel auf Reisen
91
Die Londoner Konferenz der Entente-Gewaltigen hatte das österreichische Ansuchen, das Lloyd George nicht positiv beantworten konnte, an den Völkerbund weitergereicht. Auch Beneš hatte Seipel zugesagt, sich für Österreich zu verwenden. Der Völkerbundrat war es auch, der Seipel – kaum war er von seinem Sommertrip zurückgekehrt – aufforderte, seine Sache persönlich in Genf zu vertreten. (Die Zugsfahrt nahm damals immerhin einen Tag und zwei Nächte in Anspruch !) Da kamen ganz offensichtlich zwei Handlungsstränge zusammen, vielleicht zeichnet sich auch noch ein weiteres Motiv im Hintergrund ab, wie Nathan Marcus vermutet : Wie alle neugegründeten Organisationen mit weitgespannten Zielen und unklaren Kompetenzen hatte der Völkerbund als Organisation – nicht als Botschafterkonferenz der Ratsmitglieder, aber als hochqualifizierte und unterforderte Mannschaft – ein gewisses Interesse daran, sein Können und seine Bedeutung unter Beweis zu stellen. Das Reparationsproblem wäre da zweifellos eine Nummer zu groß gewesen. Österreich mochte als Problem gerade die richtige Größenordnung darstellen.112 In der Heimat war Seipel nach seiner Rundreise – gerade von seinen eigenen Leuten – mit Kassandrarufen empfangen worden : Ségur meldete : »Wir befinden uns nicht einmal in der Verfassung, von heute auf morgen zu leben.« Man werde vom Nationalrat eine neue Kreditermächtigung verlangen müssen, sprich : eine weiteres Mal die Notenpresse anwerfen, von ihm könne das allerdings niemand verlangen, das müsse ein anderer Finanzminister machen. Die Krone nähere sich in Zürich immer mehr dem Nullwert. Die Bauern weigerten sich inzwischen überhaupt schon, Kronen anzunehmen, berichteten die Briten.113 Am 25. August hatten die Kurse den Tiefstand von 375.000 Kronen pro Pfund erreicht. Buchinger zog die Folgerungen : Devisennot = Hungersnot, die Ernährungssituation sei unhaltbar. Der Völkerbund erschien den Ministern keineswegs als Deus ex Machina, nur als eine weitere Etappe im Ringen um Kredite. Seipel gab den Skeptikern durchaus recht : »Auch ich setze alle meine Hoffnungen auf das, was nach der Völkerbundtagung geschieht.«114 Als Ausgangspunkt für die letztendlich erfolgreiche Völkerbundaktion stellte der Ministerrat vom 28. August rein formal natürlich die richtige Wahl dar. Er endete mit der Entscheidung, Grünberger noch in derselben Nacht in den Zug nach Genf zu setzen. Aber man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, die Fahrt wurde als Pflichttermin betrachtet, den es zu absolvieren gelte, nicht als die große Chance. Seipel formulierte : »Aus den Besprechungen mit Schanzer [wohlgemerkt : der Währungsunionsskeptiker in Italien !] ist uns klar geworden, dass wir den 112 Marcus, Reconstruction 88, 146, 150 ; vgl. auch Balfours Meinung, der Völkerbund könne nur dann etwas Gutes bewirken, »if saved from rabid enthusiasts who expected too much of it.« (Adams, Balfour 346). 113 DBFP XXIV 297 (Akers-Douglas 4.8.1922). 114 AdR, MRP 64, Nr. 220, 28.8.1922.
92
Der Bürgerblock
Völkerbund ernst nehmen müssen, so gut wir können.« Die Tagung sei abzuwarten, bevor man – als Plan B – die Währungsunion in Angriff nehmen könne. Grünberger selbst sah sich bereits zu der Bitte veranlasst, das italienische Projekt nicht so ausschließlich zu betonen, damit sich der Völkerbund nicht »gefrozzelt« fühle. Nach der Unterzeichnung der Genfer Protokolle erging sich Seipel in Reminiszenzen : »Wir haben einige Mächte so interessiert, dass wenn Völkerbund versagt, werden wir mit anderen Gruppen etwas machen können. Das hat unsere Stellung vor Völkerbund vom ersten Tag an verändert.«115 Der Plan B hatte seine Schuldigkeit getan. Aber es wäre wohl verfehlt, ihn deshalb von vornherein bloß als gelungene Finte anzusehen. Wildner notierte in seinem Tagebuch : Seipel wolle sich »Italien in die Arme werfen«, wenn die Londoner Konferenz ergebnislos verlaufe. Aber auch der routinierte Diplomat, der Seipel auf seiner Reise begleitete, fügte resignierend hinzu : Ich »bin mir nicht darüber im klaren, was er eigentlich vor hat.«116 Seipel selbst charakterisierte seine »Strategie« im Rückblick ironisch : »Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg.«117 Österreich wäre im Rahmen einer Währungsunion deshalb nicht notwendigerweise auf »den bescheidenen Status einer italienischen Provinz« reduziert worden, wie es Eduard März einmal formuliert hat.118 Doch in der Not frisst der Teufel fliegen. Die Geschichte hat seither mehrere Beispiele geliefert, dass Staaten sehr gut mit Fremdwährungen leben können (oder müssen). Das Experiment wäre interessant gewesen. Im Abessinienkrieg der dreißiger Jahre hätte Österreich dann vielleicht wieder um den Kurs der Währung zittern müssen. Aber in den zwanziger Jahren verfolgte Mussolini eine Hartwährungspolitik (»Quota Novanta«) und sorgte für ein ausgeglichenes Budget. Seine erste Regierung war übrigens ein Koalitionskabinett, in dem erstmals auch Seipels italienische Parteifreunde, die katholischen Populari, vertreten waren. Wie auch immer : Die Probe aufs Exempel blieb aus. Am 2. September langte die Einladung – oder Aufforderung – ein, Italiener und Franzosen hätten den dringenden Wunsch geäußert, Seipel selbst solle nach Genf kommen. Aus Italien telegraphierte Schüller zur gleichen Zeit, das italienische Interesse nehme sichtlich zu. Seipel sprach vor seiner Abreise von der Befürchtung, in Genf bloß zu einem faulen Kompromiss gedrängt zu werden, aber es bleibe ihm nichts anderes übrig, als heute noch abzufahren. So trat er gottergeben die Reise zu seinem Triumph an. Am 6. September absolvierte er seinen großen Auftritt vor dem Völkerbund. Auch dort klangen im Schlussakkord die Alternativen an : »Ehe das Volk 115 KvVI, CS Klub 11.10.1922. 116 AVA, E/1791, Wildner-Tb. 27.7. & 15.8.1922 ; vgl. auch die Erwägungen bei Malfer, Wien und Rom 103 f., 114. 117 Höbelt, Provisorium 167. 118 März, Bankpolitik 488.
Der »Autrichelieu« – Seipel auf Reisen
93
Österreichs in seiner Absperrung zugrunde geht, wird es alles tun, um die Schranken und Ketten, die es beengen und drücken, zu sprengen. Dass dies ohne Erschütterung des Friedens und ohne die Beziehungen der Nachbarn Österreichs untereinander zu trüben, geschehe, dafür möge der Völkerbund sorgen !«119
119 Geßl (Hg.), Seipels Reden 32 ; vgl. auch AVA, E/1791 Wildner-Tb. 6.9.1922 (»Zerbrechen der Ketten unserer Unabhängigkeit«).
IV. Der Weg nach Genf
»Seipels Geschoss« ? Kredite und Kontrolle Seipel war durch die »Valutenhausse« des Junis und den Handlungsbedarf, den sie auslöste, bis zu einem gewissen Grad aus der Bahn geworfen worden. Natürlich, er dachte stets in Alternativen und er hatte die Nerven behalten, aber … Der Zwang zur Aktion hatte ihn zumindest auf Wege geführt, die sich von seinem ursprünglichen Ansatz entfernten. Sein Finanzminister Ségur, ein »Büffel«, wir ihn der Gesandte Wildner bezeichnete,1 verbiss sich in den Kurs der Selbsthilfe, die andere verdächtig an die Ideen Otto Bauers erinnerte. Die AZ brüstete sich damit, wie ihre Leute Seipel am 12. Juni gleichsam an der Hand genommen hätten.2 Die Regierung hatte – von dem mehr oder weniger sanften Druck auf die Banken bis zur Devisenbewirtschaftung – den Eindruck erweckt, auf Zuruf der Sozialdemokratien zu agieren und zu reagieren. Innerhalb der christlichsozialen Partei waren daraufhin gewisse Spannungen sichtbar geworden : Aus dem Kreis der Agrarier, die ihren »Landsmann« Ségur anfangs so sehr favorisiert hatten, waren bereits deutliche Missfallensbekundungen zu vernehmen gewesen. Die Klubsitzungen nach der Sommerpause, am 12. und 14. September, vermitteln da bereits ein ganz anderes Bild : Wenn man die technischen Details und die rhetorischen Arabesken außer Acht lässt, so waren es vor allem zwei Fragenkomplexe, die bei Seipels Ausführungen – und in der Debatte danach – hervorstachen. Seipel war immer noch weit davon entfernt, im Stile Schobers mit allzu vollmundigen Erklärungen eine Erwartungshaltung zu nähren, die, wie die Erfahrung lehrte, nur allzu bald in Katzenjammer umschlagen konnte. Er betonte deshalb ausdrücklich, man dürfe nicht hundertprozentig alles auf Genf setzen, aber er konstatierte genüsslich den Gleichklang der Ansichten mit den britischen Finanzleuten und Politikern. Seipels Schilderung liest sich ein wenig wie die Eingangsszene von »My Fair Lady«, als einander – im Regen vor der Oper – Professor Higgins und Colonel Pickering treffen, die schon lange voneinander gehört haben und jetzt endlich ihre Übereinstimmung zelebrieren können. Hinter dieser »prästabilierten Harmonie« verbarg sich die damals und später immer wieder geführte Kontroverse um den Ursprung der Kontrolle, die Österreich in Genf auferlegt wurde. Die AZ war sich sicher : »Wer hat es erfunden ? […] Das war Seipels Geschoß !«3 Seipel hat dieser 1 AVA, E/1791.Wildner-Tb. 12.7.1922. 2 AZ, 1.9.1922 ; vgl. auch Ausch, Banken 55. 3 AZ, 10.10.1922.
»Seipels Geschoß« ? Kredite und Kontrolle
95
Kontroverse durch eine Palette von Aussagen, die auf die Zuhörer und die Situation zugeschnitten waren, immer wieder neue Nahrung verliehen. Gerade seine biederen Bewunderer, die ihn vom Vorwurf des »Hochverrats« freisprechen wollten, wie ihn Otto Bauer und die AZ erhoben,4 haben immer wieder betont, wie sehr Seipels Zustimmung bloß einer Zwangslage geschuldet gewesen sei – und damit sein Licht als listenreicher Politiker unter den Scheffel gestellt. Am 2. September, vor seiner Abreise, hatte Seipel vor dem Ministerrat noch vorsichtig anklingen lassen, dass die Frage, wie »wir uns« die Finanzkontrolle vorstellten, zwar sehr verfänglich sei, es aber nicht zu verkennen sei, dass uns eine gewisse Kontrolle ja schließlich nur erwünscht sein könne. Nach seiner Rückkehr erklärte er dann, mit deutlich positiveren Zwischentönen, Frankreich und England hätten sofort mit der Frage der Kontrolle begonnen. Die Frage sei dann »in sympathischer Weise« besprochen worden.5 Bisher hätten die Engländer geglaubt, dass »wir von einer solchen Kontrolle nicht viel wissen wollten«,6 ja, dass Österreich keine Kontrolle wolle, damit es sozialistisch weiterwirtschaften könne.7 Denn bisher hatten österreichische Emissäre – wie Finanzminister Grimm und selbst Rosenberg – diese Zumutung immer pflichtschuldigst von sich gewiesen. Allenfalls der private Geschäftsmann Julius Meinl, mit Seipel schon aus den Friedensinitiativen der Kriegszeit her bekannt, hatte gesprächsweise das zugespitzte Bonmot fallen gelassen, das im Herbst dann auch Grünberger wiederholte : Im Zweifelsfall sei die Kontrolle sogar wichtiger als die Kredite.8 Die Engländer, ob jetzt Montagu Norman oder Sir Basil Blackett, bedurften freilich nicht erst der Anregungen Meinls, die Young mit seinen Beobachtungen in Wien illustrierte : Alle Nichtpolitiker würden eine solche Kontrolle von außen geradezu herbeisehnen.9 Dass Kredite mit einer Kontrolle verbunden sein müssten, die einen gewissen Eingriff in die vielbeschworene Souveränität darstellte, hatte sich spätestens dann herausgestellt, als die Vorschüsse in einem dunklen Loch verschwunden waren. Je schärfer die Kontrolle ausfalle, desto besser – in dieser Beziehung waren sich alle Briten einig. Der Handelsattaché Owen S. Phillpotts schrieb im Juni : Die Bedeutung der Anleihe bestehe darin, dass sie eine Kontrolle sowohl rechtfertigen und ihr zugleich auch die notwendige Autorität verleihen würde. Die Kontrollore müssten strikt und vielleicht sogar ziemlich rücksichtslos vorgehen und sich auf ein gehöriges Maß an Beschimpfungen (»abuse«) gefasst machen.10 Der Gesandte in 4 AZ, 7.10.1922 : »Der Hochverrat des Prälaten«. 5 KvVI, CS-Klub, 16.9.1922. 6 AdR, MRP 65, Nr. 224, 14.9.1922. 7 KvVI, CS-Vorstand, 12.9.1922. 8 PRO, T 160/62/2073/04/2, Goschen an Blackett 14.2.1922 ; Marcus, Reconstruction 107, 415. 9 DBFP XXIV 392 (8.11.1922) ; Marcus, Reconstruction 95. 10 DBFP XXIV 249 f. (Phillpotts Juni 1922).
96
Der Weg nach Genf
Wien notierte unmittelbar nach der Unterzeichnung der Genfer Protokolle, man könne nur hoffen, dass die Kontrolle tatsächlich so rigoros (»severe«) ausfallen werde, wie es die Presse an die Wand male.11 Seipels Auftritt in Genf bedeutete insofern einen Durchbruch, als er den Engländern die willkommene Botschaft vermittelte, dass diese Ansicht inzwischen auch für die österreichische Politik kein Tabu mehr darstellte, ganz im Gegenteil. Die auswärtige Kontrolle und die Umsetzung des Sanierungsprogramms in Form der vielbeschworenen Finanzdiktatur bildeten ein Paket, wie es Seipel ja schon im Mai in den Raum gestellt hatte. Sah die Sozialdemokratie in den Bestimmungen der Genfer Protokolle »eine Verpflichtung des österreichischen Nationalrats zum Selbstmord«12, konterte Seipel, er könne darin keinen Verstoß gegen den Geist der Demokratie erblicken. Die Regierung bleibe dem Parlament für den Gebrauch der Vollmachten verantwortlich – und könne jederzeit gestürzt werden. Eine Souveränitätseinbuße könne er darin nicht erblicken. Über das Prinzip der Kontrolle herrschte zwischen dem Finanzkomitee in Genf, den Delegierten, die der Völkerbund Mitte Oktober ein weiteres Mal nach Wien entsandte, und der Regierung Seipel infolgedessen Einigkeit. Wesentlich war für Seipel die »Paketlösung« : Der Umfang der Vollmachten für die Regierung und der Wirkungskreis der Kontrolle sollten sich möglichst decken. »Ohne ausreichende Vollmachten gibt es keine Sanierung«, erklärte er im November vor dem Hauptverband der Industrie – freilich ein Publikum, bei dem kaum mehr allzu viel Überzeugungsarbeit nötig war.13 Den wünschenswerten Umfang der Vollmachten definierte er überzeugend und nichtssagend, er müsse so beschaffen sein, dass damit wirklich etwas getan sei.14 Dahinter verbarg sich eine Dialektik, die er später einmal genüsslich ausmalte : Die Westmächte hätten den Umsturz in Mitteleuropa – nicht direkt, aber indirekt – unterstützt. Die Verlierer seien schwächer geworden, aber nicht nur so, wie die Sieger es sich wünschten, nämlich weniger widerstandsfähig gegen ihr Diktat, sondern letztlich zu schwach, um die Verträge zu erfüllen.15 Mit der effizienten Kontrolle müsse daher eine Erweiterung der eine Zeitlang verteufelten Autorität der Regierungen einhergehen. Die Kontrolle sei nicht von den Geldgebern verlangt worden, sondern von den Großmächten, die jede ein Fünftel des aufgebrachten Kapitals garantierten. Sie solle im Namen des Völkerbundes ausgeübt werden, in der Praxis nicht von einem Komitee, sondern von einer Einzelperson : »Hauptsache, dass er eine große Persönlichkeit ist […]. Kontrolle kann 11 DBFP XXIV 366 (Akers-Douglas 6.10.1922). 12 AZ, 10.10.1922. 13 Geßl (Hg.), Seipel Reden 50 (9.11.1922). 14 KvVi, CS-Klub 11.10.1922. 15 Geßl (Hg.), Seipels Reden 182 (Köln 2.3.1925).
»Seipels Geschoß« ? Kredite und Kontrolle
97
schlecht werden, wenn schwacher Generalkommissar kommt«. Sprich : In Genf könne wohl eine Kommission sitzen – in der Italien dann den Vorsitz reklamierte –, aber in Wien sollte ein Generalkommissar amtieren, mit dem Seipel direkt verhandeln wollte. Dieser Generalkommissar sollte im Idealfall aus einem neutralen Land kommen, allenfalls noch von einer der Großmächte entsandt werden, doch nicht von den Nachbarstaaten.16 Otto Bauer sah in dieser Konstruktion die Regierung Seiner Majestät des Generalkommissars, die er bei einer anderen Gelegenheit mit dem »Bey von Tunis« verglich, als Galionsfigur eines französischen Protektorats.17 Doch vielleicht verband Bauer als berufener Verteidiger der Republik damit überhöhte Vorstellungen von den Prärogativen eines Monarchen. Seipel sah in dem Gegensatz von Monarchie und Republik bloß eine Formsache : Im Deutschen Reich hätten vor 1918 beide nebeneinander bestanden. Mannigfaltigkeit der Staatsformen sei das einzig Vernünftige, weil den Umständen Angepasste. Von der Überspannung des Staatsbegriffes und der Übertreibung des Souveränitätsbegriffes hielt er nicht viel, betonte auch immer wieder die Differenz von Staat und Nation.18 Er sollte mit, ohne und gegen den Generalkommissar arbeiten, in der Art, wie Bismarck seinen König behandelt hatte. Oder um es mit Chamissos berühmtem Epigramm zu sagen : Der Generalkommissar absolut, wenn er unseren Willen tut – und nicht umgekehrt, wie die AZ prophezeit hatte.19 Das bedeutete noch nicht notwendigerweise Übereinstimmung im Detail. In diesem Zusammenhang notierte Phillpotts, Seipel hätte bei der zweiten Runde der Verhandlungen in Genf Ende September eine noch viel weitergehende Fassung der Kontrolle vorgeschlagen als die Engländer.20 In den Protokollen findet sich dazu die Bemerkung Seipels : »Ich für meine Person stelle mich auf diesen Standpunkt : Überzeugung, dass Kommissar und Kredit und Reform uns nicht helfen werden, wenn Kontrolle nur auf Erträgnis der Salinen etz. beschränkt.«21 Die Frage, ob derlei Bedingungen für ein selbstbewusstes Volk nicht eine Schande darstellten, drehte er einfach um : Eine wirkliche Schande wäre es vielmehr, durch schlechte Wirtschaft zugrunde zu gehen.22 Sobald die Genfer Protokolle einmal unterzeichnet waren, ließ er sich zu der Bemerkung hinreißen : »Immer große Furcht, daß er [der Kontrollor] zu wenig verlangt.«23
16 KvVI, CS-Klub 18.10.1922. 17 AVA, E/1791, Wildner-Tb. 11.10.1922 ; Bauer, Werke II 480. 18 Geßl (Hg.), Seipels Reden 180 f., 191, 194, 323. 19 AZ, 6.10.1922. 20 DBFP XXIV 359 (30.9.1922) ; Marcus, Reconstruction 108. 21 KvVI, CS Klub 20.9.1922. 22 KvVI, CS Klub 11.10.1922. 23 KvVI, CS-Klub 18.10.1922.
98
Der Weg nach Genf
Als die Sozialdemokraten den Vorwurf erhoben, die einschlägigen Bestimmungen der Genfer Protokolle seien ein durch ihn re-importierter hinterhältiger Anschlag, erwiderte Seipel im Ausschuss, das sei zwar nicht zutreffend, aber er würde sich dessen nicht schämen.24 Dem Vorwurf, dieses Vorgehen zeige einen schockierenden Mangel an Vertrauen in die eigenen Landsleute, begegnete er in einer Versammlung mit der ehrlichen Replik, nun, gewissen Leuten traue er tatsächlich nicht.25 Viel härter traf ihn bezeichnenderweise die launige Nebenbemerkung Renners, der konzedierte, der Kanzler selbst in Person habe »dieses Ding« – die verschärfte Kontrolle – nicht gemacht, weil er in Genf ja überhaupt kaum präsent gewesen sei, sondern »die meiste Zeit« im französischen Chamonix auf der anderen Seite des Sees Urlaub gemacht habe. Tatsächlich hatte es sich nur um einen Tagesausflug am Wochenende gehandelt, doch in Wien vermutete man hinter der Sottise gleich sinistre Querschüsse missgünstiger Diplomaten.26 Der »Wahrheit« viel näher kommen dürfte da schon die Vermutung, dass Seipel die Vorbehalte seiner Freunde gegen das Diktat von außen kannte und bei diversen Stellungnahmen auch berücksichtigte, dass derlei Erwägungen für ihn aber keine besondere Bedeutung hatten. Er erinnerte in Genf nach der anderen Richtung hin, mit Verweis auf den letzten altösterreichischen Ministerpräsidenten und Völkerrechtler Heinrich Lammasch, dessen Kabinett er angehört hatte, an seine Sympathien für eine über die Selbständigkeit der Einzelstaaten hinausreichende internationale Organisation.27 Auch dem Klub versuchte er in diesem Sinne schmackhaft zu machen, es sei ja nicht so, dass es sich um eine »pure Fremdherrschaft« handle, sondern um eine Organisation höherer Art, der auch Österreich angehöre.28 Seipels Wertgerüst hing nicht an derlei Fragen. Er dürfte die Kontrolle als praktischer Politiker in erster Linie danach beurteilt haben, ob sie seinen Absichten entgegenkam oder hinderlich erschien. Schon im September schwärmte er im Klub von den Andeutungen des Genfer Finanzkomitees. Es »fängt so an, als wenn Programm unserer Partei ist.« Darunter falle z. B. die Abstoßung der »Verstaatlichten«, der ärarischen Betriebe, an die Privatwirtschaft, wenn sie keine Einnahmenquelle darstellten. Allzu optimistisch nahmen sich allerdings die Annahmen über die Eisenbahnen aus, die wegen des großen Transitverkehrs – in einer geographischen Lage, wo man nicht ausweichen könne – sogar zu einer »Geldquelle« werden könnten.29
24 ADÖ IV 458 (11.10.1922). 25 KvVI, CS-Klubvorstand 14.9.1922 ; AZ, 18.9.1922. 26 StPNR I 4600 (7.11.1922) ; DAW, Seipel-Tb. 24.9. & 7.11.1922 ; KvVI, CS Klub 8.11.1922 ; RP, 8.11.1922. 27 Geßl (Hg.), Seipels Reden 25. 28 KvVI, CS-Klub 11.10.1922. 29 KvVI, CS Klub 20.9.1922.
»Seipels Geschoß« ? Kredite und Kontrolle
99
Im Oktober beruhigte Seipel dann : »Wenn wir selbst das Möglichste tun, wird der Generalkommissar nicht viel dreinreden.«30 In ein, zwei Punkten freilich hat Seipel die Wünsche seiner neuen englischen Freunde – oder ihrer französischen Alliierten – tatsächlich gezügelt. So war ursprünglich von einem Passus die Rede, Österreich dürfe ohne die Zustimmung der Garantiemächte keine Verträge mit anderen Staaten mehr abschließen. Seipel setzte eine mildere Fassung durch : Von der Klausel betroffen waren bloß Verträge, die den Friedensverträgen zuwiderliefen.31 Das »Anschlussverbot« wurde wiederholt. Auch da gab es spitzfindige Erörterungen um verschiedene Textvarianten. Seipel überzeugte die Großdeutschen, die von ihm vorgeschlagene Version mit der ausdrücklichen Berufung auf den entsprechenden Paragraphen 88 des ungeliebten Vertrages von Saint-Germain käme ihren Vorstellungen mehr entgegen als ein simples Verbot. In England – und insbesondere bei Sir Basil Blackett als »Controller of Finance« im Schatzamt, einer zentralen Figur im Netzwerk – herrschte ein abgrundtiefes Misstrauen gegenüber den österreichischen Sicherheitskräften, zumal der Volkswehr, die eine Gefahr darstelle, keinen Schutz.32 Nach einem langen Gespräch mit Balfour, Norman und Young schrieb Blackett im Juli : »We have the alternatives of doing nothing or spending more than we can afford, the latter course being useful only if we can somehow take over the whole Government of Austria and police here from the outside.«33 Es war Blackett, den Balfour als britischer Vertreter im Völkerbundrat dann Ende August zu seiner Unterstützung anforderte. Blackett war weiterhin skeptisch, aber er folgte der Aufforderung und fuhr nach Genf, denn schließlich könne man Balfour nicht im Stich lassen. Blackett war gegen jede »temporizing measure«. Das österreichische Problem sei keine finanzielle Frage mehr. »If any good is to be done, Austrian sovereignty must be put aside for the time being, and some supersovereign with an armed police behind him must take over.« Als »Kontrollor« stellte er sich – natürlich – einen Engländer vor, eine Figur wie Milner oder Curzon, britische Hochkommissare bzw. Vizekönige in Südafrika und Indien.34 Als im August ängstliche Bankiers schon anfragten, ob sie – »in certain eventualities« – ihr Gold und ihre Wertpapiere nicht in der britischen Gesandtschaft in Sicherheit bringen könnten, soll Außenminister Grünberger gescherzt haben, wenn England es gut mit Österreich meine, warum schicke es dann nicht einfach ein paar Bataillone, damit auch wirklich nichts passiere.35 Eine »non-national gendarmerie«, 30 KvVi, CS-Klub 18.10.1922 ; Ségur formulierte es zwei Tage später ganz ähnlich bei der Vorstellung seines Programms im großdeutschen Klub (AdR, GDVP 3, 20.10.1922). 31 KvVI, CS Klub 20.9.1922. 32 PRO, T 160/584/2073/021/1, Blackett Resümee 15.9.1922. 33 PRO, T 160/58/2073/8, Blackett an Mc Farlane 5.7.1922. 34 PRO, T 160/584/2073/021/1, Blackett an Niemeyer 30.8. & 12.9.1922. 35 PRO, T 160//58/2073/9, Bericht Akers 17.8.1922 (= DBFP XXIV 302 f).
100
Der Weg nach Genf
so Blackett, könnte vielleicht einem amerikanischen General unterstellt werden. Das Beispiel des osmanischen Mazedoniens der Vorkriegszeit bot sich da als Vorbild für eine solche »peace-keeping mission« an, war aber mit keinerlei freundlichen Konnotationen verbunden. Ein Pariser Sensationsblatt lancierte auf dem Höhepunkt der Krise, während Seipels Rundreise, eine entsprechende Meldung.36 Renner griff das Gerücht später noch einmal auf, als er – noch vor der Ruhrkrise, als die französischen Kolonialtruppen am Rhein Furore machten, nicht zuletzt in den USA – eine farbige Gendarmerie an die Wand malte.37 Vor diesem Hintergrund sah Seipel sich veranlasst, in Genf die eigenen Vorbehalte zurückzustellen und zu betonen, in Österreich bestehe eigentlich gar keine Umsturzgefahr, die Wehrmacht sei besser als ihr Ruf,38 nicht zuletzt deshalb, wie er später ausführte, weil »die Geldgeber der ganzen Welt nicht Courage haben, wenn [sie] nicht versichert seien, dass kein Umsturz geschieht.«39 Auch Schober scheint sich in diesem Zusammenhang wieder ins Spiel gebracht zu haben : Wenn er alle Polizeikräfte zusammenfasse, verfüge er über 20.000 Mann. Damit ließe sich die Ordnung aufrechterhalten, ja im Fall der Fälle vielleicht sogar eine Diktatur errichten. Der britische Berichterstatter kommentierte freilich, Schober sei ein Mann, mit dem ab und zu die Phantasie durchgehe …40 In Österreich war das Misstrauen in die Volkswehr nicht weniger weit verbreitet, auch wenn ihr Minister inzwischen Vaugoin hieß. Die AZ lobte die Neutralität der Volkswehr im Klassenkampf, der allein die Bourgeoisie ihr Überleben verdanke.41 Die Bauernschaft konnte dieser Form von »Neutralität« wenig abgewinnen. Da hieß es : »Weg mit dem Bundesheer !«42 Ségur brachte es auf dem Parteitag 1920 auf die Formel : Er »habe kein Vertrauen zu einem Söldnerheer, das trotz aller Kautelen immer die Gefahr eines Parteiheeres hat.«43 Selbst die »schwarze« Soldatengewerkschaft, der christlichsoziale Wehrbund, der 1922 seine ersten Gehversuche unternahm, beschwerte sich, er werde von den eigenen Abgeordneten nicht unterstützt, sondern die Soldaten würden bloß »pauschal verdächtigt«.44 Die Reformvorstellungen der Christlichsozialen bewegten sich in eine andere Richtung : Es gehe um den radikalen Abbau der verrufenen Truppe – oder um ihre Ersetzung durch eine aus Wehrpflichtigen bestehende Miliz. Derlei Überlegungen 36 AZ, 27.8.1922. 37 Vgl. die Notizen AZ, 30.11.1922, 1 ; RP, 1.12.1922, 3 ; ADÖ IV 484 (12.10.1922). 38 AdR, MRP 65, Nr. 221, 14.9.1922. 39 KvVI, CS Klub 18.10.1922. 40 DBFP XXIV 303 (17.8.1922). 41 AZ, 3.9.1922. 42 KvVI, CS-Klub 18.10.1922 (Luttenberger). 43 Kriechbaumer (Hg.), Protokolle 121. 44 KvVI, CS-Klub 12.6.1922 (Steinegger).
»Seipels Geschoß« ? Kredite und Kontrolle
101
galten im Mai ganz offenbar noch als aktuell, als anlässlich der Regierungsbildung im Klub überlegt wurde, ob Vaugoin das Heeresressort sofort übernehmen solle oder ob man damit nicht lieber zuwarten wollte, bis der richtige Augenblick für eine grundlegende Wandlung gekommen sei. Denn für die Einführung der Miliz war das Einverständnis der Entente vonnöten, weil die Friedensverträge von Versailles, SaintGermain und Trianon die allgemeine Wehrpflicht ausdrücklich verboten hatten. Im Herbst tauchten dann in den Klubprotokollen erstmals auch die Heimwehren auf, die – in einer Vorwegnahme späterer Frontstellungen – Mataja und die Tiroler als Gegengewicht für nützlich hielten, während Drexel und die Oberösterreicher ihre Skepsis bzw. ihr Desinteresse bekundeten.45 Bei den Großdeutschen war Schürff mit der Verbindung zu den »Selbstschutzverbänden« beauftragt. Sein Urteil fiel harsch aus : Ludendorff und Konsorten, die hier als Anführer auftraten, hätten in Deutschland allesamt nichts zu sagen. Man mache sich lächerlich, wenn »wir in Österreich uns von diesen Herren ködern lassen«. Er könne sich nur wundern, dass sich die Industrie durch leere Versprechungen für diese »Luftgebilde« gewinnen lasse. Es sei für die Partei ganz unmöglich, mit diesen Leuten in ein offizielles Verhältnis zu treten. »Wir können die Bewegung nur dulden.« Regierung und Parteien müssten die Kontrolle über diese Verbände erlangen, oder doch zumindest ein Mitspracherecht.46 Seipel hatte das Milizsystem am 2. September selbst noch als einen der Punkte genannt, die er in Genf aufs Tapet bringen wollte. Doch inzwischen hatte die Konfrontation zwischen Deutschland und Frankreich an Brisanz zugenommen. Eine Debatte über die Wiedereinführung der Wehrpflicht – aus welchen Beweggründen auch immer – schien Seipel da alles andere als hilfreich. Frankreich wolle sich mit Blick auf die Reichswehr auf keinerlei Diskussionen über eine Änderung des Wehrsystems einlassen.47 In der Wehrfrage – und beim Mieterschutz – war Seipel mit dem Status quo keineswegs zufrieden. Das Stichwort vom »Revolutionsschutt« (oder vielleicht handelte es sich doch mehr um die Erbschaft des Krieges ?) traf da ins Schwarze. Der Kanzler betonte nach seiner (ersten) Rückkehr aus Genf, man solle den Kampf mit der Sozialdemokratie keineswegs scheuen.48 Aber er wollte sich im Augenblick ganz offensichtlich auf die Hauptfront beschränken. Ein Angriff auf die Volkswehr könne als rein parteiische Maßnahme ausgelegt werden. »Jetzt solle man über derartige Dinge nicht reden.«49 Gut sei es allerdings, so gab er zu, wenn sich die Sozi vor dem § 7 im Teil III der Genfer Protokolle fürchteten, der die österreichische Regierung verpflichtete, »alle 45 KvVI, CS Klub 12. & 25.10.1922. 46 AdR, GDVP 3, Klub 18.10.1922 ; vgl. auch Rape, Heimwehren 340 ff. 47 AdR, MRP 66, 7.10.1922 ; KvVI, CS-Klub 18.10.1922. 48 KvVI, CS Klub 12.9.1922. 49 KvVI, CS Klub 11. & 18.10.1922.
102
Der Weg nach Genf
Vorsorge zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung zu treffen«. Im Teil I hatten sich die Mächte ihrerseits verpflichtet, die Unabhängigkeit Österreichs zu wahren. Dieser Passus schloss einen Einmarsch – die »paar Bataillone«, auf die Grünberger mehr oder weniger ironisch zurückgreifen wollte – selbstverständlich aus. Es bestünden auch keinerlei geheime Zusatzabkommen, wie Seipel im Klub wiederholt betonte. Dennoch ließ er zwischen den Zeilen durchblicken, dass man sich im Falle einer ernsthaften Bedrohung (z. B. eines Generalstreiks ?) wohl auf auswärtige Unterstützung verlassen könne …50
Zwischen Bauer und Balfour : »Mit 15 Millionen könnte jeder Esel sanieren …« Die Sozialdemokraten hatten auf dem Höhepunkt der Krise, am 22./23. August – als Seipel gerade am Weg von Berlin nach Verona war –, ein allerdings sehr verklausuliertes »verstecktes Koalitionsangebot«51 beschlossen, das in die Form eines Aufrufes an ihre Anhänger gekleidet war. Darin war zunächst einmal des Langen und Breiten davon die Rede, dass eine gewaltsame Lösung in Form einer Machtergreifung des Proletariats zurzeit unmöglich sei, sondern nur in einer »Konterrevolution durch fremde Bajonette« enden könne. Die Sozialdemokratie sei deshalb zur Mitarbeit bereit, nicht um die »bürgerliche Schandwirtschaft mitzuverantworten«, sondern »dann, aber nur dann«, wenn die Furcht vor der Katastrophe die Bourgeoisie zwinge, »unsere Forderungen anzuerkennen« und ihre »Sabotage gegen die wirtschaftlichen Notwendigkeiten aufzugeben«. Blieben die Bürgerlichen uneinsichtig, dann verlangte die Partei, mit Verweis auf die »Erbitterung der Volksmassen«, schleunigste Neuwahlen !52 Der Tonfall war zweifelsohne schroff. Die ›Neue Freie Presse‹ kommentierte, die Bedingung der Konzentrationsregierung sei offenbar, dass sich »das Bürgertum auf Gnade und Ungnade ergebe«. Die AZ antwortete im Bewusstsein materialistischer Dialektik, »es ist nicht unser Terror, es ist die unerbittliche Diktatur der äußersten Notwendigkeit«, die dem Bürgerblock einen neuen Kurs aufzwingen werde.53 Wenn ihre Redakteure beim Ministerrat vom 28. August hätten Mäuschen spielen dürfen, hätten sie sich in ihrem Glauben vermutlich bestätigt gefühlt. Der reichsdeutsche Gesandte Max Pfeiffer, ein Zentrumsmann, aber kein Seipel-Freund, berichtete brühwarm, in der Stadt liefen bereits Gerüchte um über den sozialistischen Wiener Stadtrat Hugo Breitner oder den Volkswirt Anton Stolper als Finanzminister. 50 KvVI, CS-Klub 18.10.1922. 51 Leser, Reformismus und Bolschewismus 361 ; Ausch, Banken 68. 52 VGA, PV 3, 22.8.1922 ; AZ, 24.8.1922. 53 AZ, 26.8.1922.
Zwischen Bauer und Balfour : »Mit 15 Millionen könnte jeder Esel sanieren …«
103
Otto Bauer erging sich am Parteitag im Oktober in Reminiszenzen, Ende August habe auch er einen Moment lang an eine Regierungsbeteiligung geglaubt.54 Man konnte natürlich auch argumentieren, das sozialistische Ultimatum beinhalte keine allzu konkreten Forderungen, da gäbe es durchaus noch Spielraum für Verhandlungen. Am 27. August war Seipel aus Verona zurückgekehrt, am 28. August empfing er – nach dem Ministerrat – Seitz, Bauer und Adler. Doch bereits im Morgenblatt desselben Tages hatte die AZ verkündet : Da die Bourgeoisie die sozialdemokratischen Bedingungen ganz offensichtlich nicht erfüllen wolle, erübrigten sich alle Verhandlungen mit dem Herrn Seipel.55 Zwei Tage später bekräftigte sie noch einmal : »Ein Koalitionsangebot an sie liegt nicht vor.« In ihrer Sieges- oder besser Krisengewissheit wagte sich die Sozialdemokratie freilich einen entscheidenden Schritt zu weit vor. Sie spekulierte ganz offensichtlich auf Baisse. »Das Ergebnis ist also : Wir warten auf den Völkerbund.« Das tue man schließlich schon seit geraumer Zeit. Dieser Weg sei gepflastert mit dem »schamlosen Bruch von Dutzenden feierlicher Versprechungen der kapitalistischen Westmächte«. Warum sollte es diesmal anders kommen ? Natürlich, »mit 15 Millionen Pfund in der Hand könnte jeder Esel unsere Volkswirtschaft sanieren. Also wird es auch der Herr Ségur können.« Hinter dieser wegwerfenden Prophezeiung stand eine Erwartungshaltung : Die Sozialdemokratie glaubte nicht, dass tatsächlich jemand Ségur diese 15 Millionen zur Verfügung stellen würde. Diese Fehlspekulation stellte sie vor ein veritables Dilemma, als Seipel beim nächsten, nein : übernächsten Mal dann mit den Millionen in der Tasche heimkam, zum Schluss waren es dann sogar 22 (oder 27, je nachdem, ob man die Rückzahlungen für die Relief Credits einbezog oder nicht) und nicht bloß 15 … Nach seiner Rückkehr aus Genf ging Seipel ohne Umschweife auf die »große innenpolitische Frage« ein : »Sozi, dass Eintreten in Konzentration angeboten haben und sehr stark urgieren. Meine Haltung = Kaltes Wasser auf diese Begeisterung.« In dieser Auffassung sehe er sich bestärkt durch die Vorarlberger und Tiroler Landesregierungen, die ihn beschworen hätten, »die Sozi nicht hinein zu lassen.« Er höre von Kollegen, dass der Reichsbauernbund der gleichen Meinung sei. Aber das Angebot müsse selbstverständlich in Beratung gezogen werden : »Ich natürlich kein Hindernis, wenn Parteien für gut finden. Bei Großdeutschen Kandl große Neigung hinüber. Die anderen auf meinem Standpunkt mit Ausnahme des Waber, der immer zwei Standpunkte hat.«56 In den eigenen Reihen war Gürtler für ambivalente Stellungnahmen gut, die Seipel letztendlich aber nicht widersprachen : »Entweder
54 AZ, 15.10.1922, 3 ; Bauer, Werke II 479. 55 DAW, Seipel-Tb. 28.8.1922 ; AZ, 28. & 30.8.1922. 56 KvVI, CS-Klubvorstand 14.9.1922.
104
Der Weg nach Genf
wir haben Schneid und machen gegen Sozi oder wir suchen uns ehrlich mit Sozi zu verständigen. Das Hin und Her Pendeln ist schlecht.«57 Seipel unterließ es auch nicht, die Richtungsentscheidung mit dem vielleicht nicht untypischen Hinweis auf den Eindruck im Ausland zu untermauern. »In ganzer Welt ungeheurer antisozialistischer Zug ist und uns schadet, dass noch so viel bei uns davon vorhanden ist. Ein Einschwenken nach der Richtung draußen keinen guten Eindruck ausüben. So große und ernste Frage, dass ich Partei bitte, sich mit ihr zu beschäftigen. Es handelt sich im Hintergrund um Fragestellung : Sollen wir, wenn Kontrolle verlangt wird, ausländische Hilfe akzeptieren oder sollen wir erklären, Österreich braucht keine ausländische Hilfe, wie Sozi glauben.«58 Der Hinweis war zweifelsohne nicht falsch, aber in seinen Zwischentönen – wie viele derartige Andeutungen – vielleicht doch irreführend. Die Vertreter der Westmächte waren natürlich keine Sozialisten. Aber sie hatten auch kein Ultimatum in dieser Richtung erlassen. Mit ihrer prinzipientreuen Polemik gegen die »Prostitutionspolitik der Prälatenregierung« hatten sich die Sozialdemokraten in eine Sackgasse begeben. Es mangelte in den nächsten Wochen auch nicht an Hinweisen ihrer Genossen, z. B. aus der Tschechoslowakei, doch lieber vom hohen Ross herabzusteigen.59 Schließlich sei der Völkerbund doch ein Instrument, das man als »Internationalist« nur gutheißen könne. Die »maßlose Agitation« gegen die Genfer Protokolle war keine so »zügellose Demagogie«, wie zuweilen beklagt, aber sie war ein Fehler, weil sie Seipel das Spiel erleichterte, der keineswegs beleidigt war, sondern das Dilemma der Sozialdemokraten durchschaute.60 Bauer hat das Wagnis betont, das Seipel eingegangen sei, als er – bei allen Alternativen im Hinterkopf – ab Mitte September doch auf Genf setzte : Die Kehrseite der Medaille war das Wagnis, das Bauer einging, als er gegen das Zustandekommen von Genf gewettet hatte. Ein Wagnis blieb es natürlich auch für Seipel : Am 14. September wurde im Ministerrat immer noch die Eventualität besprochen, dass die Völkerbundanleihe in den Beratungen der diversen Komitees in Genf versanden könnte. Frankreich und die Tschechoslowakei waren bereit, einen Teil des Kredits zu garantieren, um den Alternativen – Anschluss oder Anlehnung an Italien – auszuweichen. Insofern hatte Seipels Strategie gewirkt. Italien war zum Schluss ein wenig pikiert, dass es ganz offenbar nur als Vogelscheuche benützt worden war, um seinen Rivalen einen heilsamen Schrecken einzujagen. Aber es wollte nicht völlig ausgeschlossen werden und lenkte daher ein. Mussolinis Machtübernahme, die »marcia su Roma« am 22. Okto57 KvVI, CS-Klub 4.10.1922. 58 KvVI, CS Klubvorstand 14.9.1922 ; ähnlich auch die Argumentation am 18.10.1922, mit einer Konzentrationsregierung hätte man dieses Ergebnis nicht erreicht. 59 So berichtete es zumindest Seipel mit Bezug auf Tusar seinem Klub (25.10.1922). 60 Vgl. Hanisch, Bauer 214, 217.
Zwischen Bauer und Balfour : »Mit 15 Millionen könnte jeder Esel sanieren …«
105
ber, noch vor der Ratifikation der Genfer Protokolle, verstärkte diese Tendenz, um jeden Preis mitspielen zu wollen, dann sogar noch. Aber alles hing – schon einmal im Hinblick auf die Finanzmärkte – davon ab, ob England, wie Seipel es formulierte, überhaupt noch Kontinentalpolitik treiben wolle. Das Empire war zu allem Überfluss auch noch mit einer Orientkrise konfrontiert : An den Dardanellen drohte Kemal Atatürk den ersten der Friedensverträge zu werfen (und die Griechen ins Meer). Dort war es zur Abwechslung Frankreich, das nun seinerseits die Briten im Stich ließ, die auf dem Buchstaben des Friedensvertrages bestanden. Lloyd George war ein Bewunderer des griechischen Premiers Venizelos, während Frankreich seinen Frieden mit Atatürk machte.61 Wenn England sich nicht mit Frankreich solidarisch erklärte gegen Deutschland, warum sollte Frankreich sich dann gegen die Türkei exponieren ? Wenn diese Krise aus dem Ruder lief, wurde das mitteleuropäische Problem auf der Tagesordnung der Weltpolitik vielleicht bald wieder auf die hinteren Plätze verdrängt. Grünberger hegte deshalb schon die ärgsten Befürchtungen. Falls Lloyd George selbst in Genf auftauche, werde alles »durch die Orientfrage erschlagen«.62 Hier lief Lord Arthur Balfour – als britischer Vertreter im Völkerbundrat – zu großer Form auf. Er schickte Sir Basil Blackett in spezieller Mission nach London, der am 27. September mit dem erlösenden Bescheid zurückkam, Großbritannien werde sich sehr wohl engagieren.63 Balfour wurde von Seipel im Ministerrat zu Recht gewürdigt als »Hauptschöpfer des Genfer Sanierungswerks« und dann auch auf dem Parteitag ausdrücklich als erster »unserer Freunde« apostrophiert.64 Grünberger holte weiter aus : Die ersten Tage der zweiten Genfer Reise seien geradezu niederschmetternd verlaufen. Man habe im Österreich-Komitee stundenlang über Formalitäten diskutiert – bis Balfour den Vorsitz übernommen habe, ein »in jeder Hinsicht bewunderungswürdiger Staatsmann, eine außerordentliche Persönlichkeit, die unserer Sache unendlich genützt hat.«65 Über die persönliche Chemie zwischen den beiden konservativen Politintellektuellen ist wenig überliefert. Seipel hat Balfour 1922 vermutlich nur ein einziges Mal, am 5. September, im kleinen Kreis getroffen, zusammen mit Blackett und Phillpotts, dem Attaché in Wien. Der schottische Elder Statesman war als Ex-Premier (und Neffe eines weiteren Premiers, des Marquess of Salisbury) ein Mann des Ancien Régime, wie er im Buche steht : Sein jüngster Biograph, R. J. Q. Adams, bezeichnet ihn als »the last grandee«. Balfour, der sich in seinen jungen Jahren mit gefällig61 Mango, Atatürk 327, 337. 62 AdR, MRP 65, Nr. 225, 16.9.1922. 63 Schmitz verbreitete die Frohbotschaft am 27.9. auch gleich im Klub. 64 AdR, MRP 66, Nr. 235, 20.10.1922 ; Kriechbaumer (Hg.), Protokolle 207. 65 AdR, MRP 66, Nr. 231, 7.10.1922 ; vgl. auch Ladner, Staatskrise 127, 135, 149.
106
Der Weg nach Genf
raffinierter philosophischer Erbauungsliteratur (die sich noch dazu gut verkaufte) als Amateurtheologe versucht hatte, erwies sich als kongenialer Partner des Prälaten.66 Im Winter war Seipel dann bereits so weit, in diffizilen Fragen damit zu drohen : »Kommt die Sache nicht vom Fleck, werde er sich an Balfour wenden.«67 Wieder scheint die österreichische Frage die richtige Größenordnung gehabt zu haben. Sie war auf der einen Seite nicht wichtig genug, um die Aufmerksamkeit der Großmächte allzu lange zu fesseln. Insofern hatten die fünf Minuten, über die sich die ›Reichspost‹ beschwerte, etwas für sich. Im Index all der gängigen Biographien über Poincaré, Lloyd George und Balfour sucht man die Namen Seipel, geschweige denn Grünberger oder Ségur vergeblich. Aber die Summen, um die es da ging, waren auch nicht so gewaltig, dass seine Kollegen Balfour diese kleine Gefälligkeit abschlugen. Als vorteilhaft könnte sich auch erwiesen haben, dass der Gesandte in Wien, Aretas Akers-Douglas, der Sohn eines engen Mitarbeiters Balfours war, seines alten Innenministers Viscount Chilston. Seipel hatte Fortune, denn Österreich vermochte ein »window of opportunity« zu nutzen : Drei Wochen nach der Unterzeichnung der Genfer Protokolle stürzte das Kabinett Lloyd George über die Orientfrage. Balfour war ein Tory, aber er hatte zu Lloyd George und zur Kriegskoalition gehalten, zum britischen »Bürgerblock«, wenn man so wollte. Beim Nachfolger Andrew Bonar Law – einem gebürtigen Kanadier, der mit der Ansage angetreten war : Wir sind nicht der Weltpolizist, der für alles zuständig ist – hatte er augenblicklich keinen solchen Stein im Brett.68 Fortes fortuna adiuvat. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Doch in Genf und in der Welt ging alles gut. Innenpolitisch war es allein die leidige Bankfrage, die innerhalb der Koalition für Spannungen sorgte : Bei den Christlichsozialen brachten Drexel und Schöpfer ihren ideologisch motivierten Unwillen zum Ausdruck. Aemilian Schöpfer war ein konservatives Urgestein aus dem Brixner Priesterseminar, das schon in der Monarchie als Hochburg der »schärferen Tonart« bekannt war. Karl Drexel hatte sich einen Namen als Seelsorger in den russischen Kriegsgefangenenlagern gemacht – als »Engel von Sibirien« ein schwarzer Burghard Breitner. Der Vorarlberger Bundesrat – beruflich in Wien beheimatet – war um diese Zeit übrigens auch als Interims-Chef und Spitzenkandidat der Christlichsozialen im Burgenland im Gespräch. Schöpfer galt als überzeugter Monarchist, Drexel als Repräsentant des nationalen Flügels der Christlichsozialen. Insofern bildeten sie auf den ersten Blick ein Gegensatzpaar. Aber im Unbehagen am Kurs der Partei waren sich die beiden Theologen einig : Die Partei habe die Prinzipien ihres Programms aufgegeben. Schöpfer hielt 66 DAW, Seipel-Tb. 5.9.1922 ; Adams, Balfour 116 ff., 266 f. 67 HHStA, Spitzmüller-Tb. 11.12.1922. 68 Adams, Balfour 173, 355 ff.; Höbelt, Policemen 55.
Zwischen Bauer und Balfour : »Mit 15 Millionen könnte jeder Esel sanieren …«
107
an der Vorstellung vom »dritten Weg« fest. Da sei immer nur von Kapitalismus und Marxismus die Rede, als ob es nichts dazwischen gäbe. Nie habe es solche Orgien des Kapitalismus gegeben wie jetzt. Das sei für ihn eine Gewissensfrage. Drexel lamentierte : Es würden hier »widerspruchslos Reden gehalten, die ganz kapitalistisch sind.« Drexel war es auch, der erklärte, er sei »ganz konsterniert, dass wir alle im Jubel drinnen sind, dass Sozi in Verlegenheit und keiner denkt nach, ob wir Kräfte haben, das durchzuführen. Habe große Sorge. Wir selbst haben keine Initiative.«69 Seipel leugnete die Differenzen nicht. Er gestand Schöpfer, er müsse jetzt »ein Wort [sagen], mit dem ich ihm wenig Freude mache.«70 Aber die Bedenken der Gralshüter waren harmlos, weil keine organisierte Fronde dahinterstand. Die Landesparteien im Westen versicherten Seipel ihrer Solidarität. Ein schlechter Ruf verpflichtet : Bei den Großdeutschen war es Waber, der im Ministerrat vom 16. September seine Querschüsse gegen die Bankstatuten vom Stapel ließ. Ségur war Ende August schon knapp daran gewesen, den eingefrorenen Posthornton des verzögerten Entwurfs zurückzuziehen ; doch Seipel hielt einen solchen Rückzug für eine »unerträgliche Niederlage der Regierung«, die man vermeiden müsse.71 Der Völkerbund bestehe auf der umgehenden Errichtung der Notenbank, die schließlich auch als Zwischenglied zwischen Regierung und Auslandskapital gebraucht werde. Stein des Anstoßes war immer noch die Verankerung des Einstimmigkeitsprinzips im Generalrat, die Anglo- und Länderbank ein Vetorecht verschafft hätten – und nicht nur ihnen, wie Dinghofer und Kienböck monierten : Schließlich hatte dort auch ein Vertreter der Arbeiterkammern Sitz und Stimme. Der Passus könne auf diese Weise demnächst auch von den Sozialdemokraten gegen die Regierung instrumentalisiert werden.72 Bei den Großdeutschen hielt Parteiobmann Kandl die Statuten gar für die »Tat eines Wahnsinnigen oder Verbrechers«.73 Aufsehen erregte außerdem die Bestimmung, das Kapital der Bank sei im Ausland aufzubewahren. Schmitz erläuterte : »Das Ausland sieht uns nicht anders an, als die gewissen süd- und mittelamerikanischen Republiken, deren Nationalbanken ihr Kapital im Ausland haben müssen, wegen ihrer erschütterten inneren Verhältnisse.«74 Die Großdeutschen waren völlig uneins : Kraft stand unbedingt hinter der Bank, Frank war nachdenklich (»vielleicht eine Mausefalle, aus der wir nicht mehr heraus kommen«), Waber war dagegen : Er hatte im Klub polemisiert, »die österreichische 69 KvVI, Klub 11.10.1922 & 9.11.1922. 70 KvVI, CS Klub 18.10.1922. 71 AdR, MRP 64, Nr. 220 (28.8.1922). 72 KvVI, Gemeinsame Sitzung CS-Klubvorstand & GD, 15.9.1922 (Dinghofer) ; CS-Klub 20.10.1922 (Kienböck). 73 AdR, GDVP 3, Klub 14.9.1922. 74 AdR, MRP 65, Nr. 225, 16.9.1922.
108
Der Weg nach Genf
Volkswirtschaft werde hier nicht verkauft, wie Otto Bauer behauptete, sondern umsonst ausgeliefert«.75 Für diskutabel halte er einen solchen Handel bloß, wenn man dafür tatsächlich ausreichend Kredite erhalte. Er sei sich nicht sicher, ob er unter diesen Bedingungen im Kabinett verbleiben könne – Seipel beruhigte ihn, er sehe da keinen solchen Widerspruch, dass es zu Konsequenzen kommen müsse. Seipel hatte seine Pappenheimer richtig eingeschätzt : Waber habe immer zwei Meinungen – er machte immer Schwierigkeiten und tat letztlich doch nichts … Die Bankvorlage wurde vom Ministerrat durchgewinkt, doch man behielt sich Abänderungsanträge vor. Die Vorlage wurde im Nationalrat vorerst nicht eingebracht.76 In diesem Fall zahlten sich die Verzögerungen doch noch aus. Anglo- und Länderbank hatten mit ihren Pfunden wuchern können, solange sie die einzige Verbindung zur City verkörperten. Sobald die wahren Giganten auf der Wallstatt erschienen und Genf abgesegnet hatten, musste man auf sie keine besondere Rücksicht mehr nehmen. Blackett und Otto Niemeyer, der ihn in der Wiener Völkerbunddelegation ablöste, waren sich Ende Oktober einig, die Anglo-Bank müsse ihre Blockade aufgeben. Ihr Widerstand könnte sonst als hinterhältiger Versuch der Engländer aufgefasst werden, sich ihrer Verpflichtungen zu entledigen.77 Seipel punktete bei der endgültigen Erledigung im November dann bereits mit den Erfolgen von Genf. Die anstößigen »Virilstimmen« der ausländischen Banken im Generalrat und das Erfordernis der Einstimmigkeit bei allen wichtigeren Beschlüssen waren nicht mehr gegeben. Vizekanzler Frank konnte im großdeutschen Klub erklären, seine »Hauptbestrebung war darauf gerichtet, das alte Nationalbankprojekt umzubringen. Das ist mir gelungen.«78 Die Regierung zeichnete auf dem Weg über die Postsparkasse ein größeres Aktienpaket ; das »Ausland« verfügte im Generalrat über keine Mehrheit ; die Sparkassen – ein wesentlicher Teil der großdeutschen Klientel – waren angeblich »sehr zufrieden«. Frank versicherte ihnen, sie könnten sich durch eine entsprechende Zeichnung von Aktien maßgeblichen Einfluss sichern.79 Am 4. Oktober wurden die drei Genfer Protokolle unterzeichnet : Teil I umfasste die politische Garantie der Mächte, die österreichische Unabhängigkeit nicht zu beeinträchtigen (und Österreichs, sie nicht aufzugeben),80 Teil II enthielt eine Liste von Verpflichtungen des Völkerbundes, Teil III eine Liste der Verpflichtungen der Öster reicher. Die ›Reichspost‹ erging sich in Zahlenmystik und sprach von den »Genfer
75 AdR, GDVP 3, Klub 14.9.1922. 76 AdR, GDVP 3, Klub 27.9.1922. 77 DBFP XIV 381 f. (Niemeyer an Blackett 24. & 29.10.1922). 78 AdR, GDVP 3, Klub 23.10.1922. 79 AdR, GDVP 3, Klub 14.11.1922 ; Kernbauer, Währungspolitik 75. 80 Text bei ADÖ IV 428–431 ; Ladner, Staatskrise 176 f., auch 158 f.; Marcus, Reconstruction 357–366.
Zwischen Bauer und Balfour : »Mit 15 Millionen könnte jeder Esel sanieren …«
109
Billionen« ; genau gesagt waren es 7800 Milliarden (Papier)Kronen, sprich 650 Millionen Goldkronen alias 27 Millionen Pfund.81 (Davon waren dann allerdings 130 Millionen Goldkronen als Rückzahlungen abzuziehen.) Wie groß das Wagnis auch immer gewesen war, es hatte sich rentiert, auch wenn Seipel Jahre später in einem Brief an Mataja spöttisch notierte : »Schulden machen ist die einzige dem Volk imponierende wirtschaftliche Leistung.«82 Quod erat demonstrandum : Seipel wurde bei seiner Rückkehr in Wien wie ein Triumphator empfangen. Ohne das Atmosphärisch-Zeremonielle über Gebühr zu betonen, auffällig war, mit welch überschwänglichen Lobeshymnen diesmal gerade sein Stellvertreter Stöckler den Kanzler im Klub begrüßte : In Worten seien seine Gefühle nicht zu schildern. Was menschenmöglich war, sei in Genf erreicht worden. »Unseren besten Mann hatten wir in Genf, und sind nicht enttäuscht worden.« 83 Wir stehen »treu und unerschütterlich an seiner Seite, mag kommen, was da wolle.« Da war es kein Wunder, wenn Seipel von einem unheimlichen Gefühl sprach, das ihn an Czernins Rückkehr aus Brest-Litowsk erinnere – ein Siegfriede der Habsburgermonarchie, der einer ganz anderen Welt angehörte – und doch erst vier Jahre her war. Auf alle Fälle ein Memento mori, wie schnell sich die Konjunkturen wandeln konnten.84 Die Großdeutschen kamen am 10./11. Oktober zu erstaunlich raschen und eindeutigen Schlussfolgerungen. Klubobmann Dinghofer sprach für den Flügel, der eigentlich nicht mehr überzeugt zu werden brauchte. Er hatte schon drei Wochen früher – anlässlich einer Streikwelle – sein Verständnis für das Verlangen nach e iner auswärtigen Kontrolle bekundet, denn »das Ausland weiß, daß Österreich unter dem Terror der Sozialdemokratie lebt.«85 Bisher habe bloß der Mittelstand Opfer gebracht. »Ich habe die Überzeugung, daß die österreichische Bevölkerung einer derartigen Peitsche bedarf, wie sie die Kontrolle darstellt.« Man müsse den einmal eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen. Parteiobmann Kandl sprach für die bisherigen Skeptiker, wenn er die Argumentation Wabers in der Bankfrage aufgriff und einräumte : »Niemand würde es verstehen, wenn wir jetzt auf die Kredite verzichten, wo wir sie erhalten sollen.«86 Selbst die stets misstrauische Reichsparteileitung verabschiedete »Genf« einen Tag später mit nur zwei Gegenstimmen. Die Alt-Schönerianer Ursin und Zeidler baten den Klub, als Ausweg aus ihrem »seelischen Dilemma« sich bei der Abstimmung 81 RP, 10.10.1922 ; DBFP XXIV 354 (23.9.1922). 82 AVA, E/1784 :15, Seipel an Mataja (8.2.1931). 83 Seine Zeitung, der ›Bauernbündler‹, ließ am 24.10. da auch andere Töne zu Wort kommen : Die Lage sei »äußerst niederschmetternd«, es sei »uns nicht froh zumute«, aber jetzt heiße es : Primum vivere, deinde philosophari. 84 KvVI, CS-Klub 11.10.1922. 85 AdR, GDVP 3, Klub 14.9.1922. 86 AdR, GDVP 3, Klub 10.10.1922.
110
Der Weg nach Genf
im Nationalrat wenigstens der Stimme enthalten zu dürfen. Das Ansinnen wurde abschlägig beschieden : Die Minderheit müsse sich fügen. Ursins niederösterreichischer Parteiobmann Schürff antwortete mit einem Zornausbruch : »Eine Partei, die nicht geschlossen auftritt, ist keine Partei, sondern ein Sauhaufen.« Man dürfe nicht in die Fehler des Nationalverbandes unseligen Angedenkens verfallen (»Der eine saß, der andere stand / das war der Nationalverband …«). Den Dissidenten gab Schürff den guten Rat : Wer mit seinen inneren Konflikten nicht zu Rande komme, möge einfach sein Mandat niederlegen.87 Seipel hatte allen Grund zur Feststellung, »dass sich die Großdeutschen sehr brav halten.«88 Selbst der britische Legationsrat Keeling, der ihrer Partei seit den Tagen des Schober-Rummels jede Eselei zutraute (»usually remarkable for its stupidity«), zeigte sich angenehm überrascht : Die Großdeutschen hätten sich »logically and sensibly« benommen.89 Den eigenen Leuten erteilte Seipel nach der entscheidenden zweiten Lesung des »Wiederaufbaugesetzes« am 24. November dann allerdings eine Rüge. Nur 103 von – mit den Burgenländern inzwischen – 114 bürgerlichen Abgeordneten hatten auch tatsächlich ihre Stimme abgegeben.90 Notabene : Ursin und Zeidler hatten sich der Klubdisziplin unterworfen, doch acht christlichsoziale Hinterbänkler glänzten durch Abwesenheit, wohl mehr aus Bequemlichkeit denn aus Widerspruchsgeist …91
Das Dilemma der Opposition : Zwischen Sabotage und Kollaboration Das »Wiederaufbaugesetz« war ein Paket aus Kredit und Kontrolle. Nicht ganz so klar war : Was genau sollte darin verpackt werden ? Und wie wollte man das Paket versenden ? Auf leisen Pfoten, zerlegt in allerlei Einzelbestimmungen, die jede für sich keine Zwei-Drittel-Mehrheit benötigten – oder mit offenem Visier, als Kampfansage mit einem Entweder-oder ? Die Auffassungen über die Notwendigkeit einer Zwei-Drittel-Mehrheit waren keineswegs einhellig. Vizekanzler Frank meinte, nur eine Blankovollmacht für die Regierung, wie von Balfour ursprünglich gewünscht, wäre als Verfassungsänderung anzusehen ; nicht ein konkretes Sanierungsprogramm, 87 AdR, GDVP 3, Klub 12.10.1922. 88 KvVI, CS-Klub 11.10.1922. 89 DBFP XXIV 436 (8.12.1922). 90 KvVI, CS-Klub 25.11.1922 ; NFP, 25.11.1922, 7. 91 StPNR I 4750 (24.11.1922). Von den »Bündlern« fehlte Schönbauer, von den Großdeutschen war Waneck wegen Krankheit beurlaubt, ein zweiter Abgeordneter fehlte. Unter den christlichsozialen Absenzen waren mit Diwald und Parrer immerhin auch zwei der rebellischen niederösterreichischen Bauern.
Das Dilemma der Opposition : Zwischen Sabotage und Kollaboration
111
das man dem Parlament vorlege.92 Bei den Christlichsozialen hielt Kienböck die Notwendigkeit einer Zwei-Drittel-Mehrheit – im Unterschied zu Fink93 – für wahrscheinlich.94 Auch die Opposition war sich darüber keineswegs im Klaren. Seipel mischte sich in die juristischen Spitzfindigkeiten nicht ein. Im Ministerrat vom 7. Oktober beschränkte er sich noch auf die beruhigende Versicherung, man sei auf die Opposition dabei nicht angewiesen. Den eigenen Leuten gegenüber servierte er am 18. Oktober dieselbe Auffassung bereits als Überraschung : »Unsere Sachverständigen zu meiner Überraschung der Meinung, dass man sie [die Zwei-DrittelMehrheit] nicht braucht. Sie wüssten eine Formel dafür.« Seipel vertrat diese Auffassung nach außen auch noch bei der ersten Lesung des »Wiederaufbaugesetzes« im Nationalrat am 6. November, ließ aber auch immer wieder durchblicken, dass es ihn überhaupt nicht geniere, das gesamte Paket den Sozialdemokraten hinzuwerfen nach dem Muster : Friss, Vogel, oder stirb ! Die Sozialdemokraten würden sich »schwer tun, definitiv nein zu sagen.«95 Noch Ende August, auf dem Höhepunkt der galoppierenden Inflation, waren es die Sozialdemokraten gewesen, die mit Neuwahlen gedroht und sich davon ganz offenbar Erfolge versprochen hatten. Nun war es Seipel, der – nicht immer zur Freude seiner Parteifreunde – als Alternative bei jeglichem Anzeichen von Obstruktion den Appell an die Wähler in den Raum stellte.96 Zweifellos würden dabei die Termine für die Vollzugsmeldungen in Gefahr geraten, die man dem Völkerbund und seinen Delegierten versprochen hatte, aber, wie es Seipel in der Schlussphase der Verhandlungen kryptisch-volkstümlich ausdrückte : »Wer weiß, wofür es gut ist …« Der alte Notenbankpräsident Alexander von Spitzmüller, das unwahrscheinliche Exemplar eines – nach eigener Definition – tiefgläubigen, schwarz-gelben »Staatssozialisten«, beschrieb das Dilemma, vor dem die Sozialdemokratie stand, mit einem Hauch von Sympathie : »Lehnen sie ab, geben sie ›ihren Staat‹ dem Chaos preis, nehmen sie an, so honorieren sie Seipels Erfolg und gefährden sich parteitaktisch aufs Schwerste.«97 Seipel teilte diese Einschätzung : »Die Sozi haben Furcht, dass die Sache durch sie gestört werden könnte.«98 Am 11. Oktober tagte auch der Parteivorstand der Sozialdemokratie. Er knüpfte an die Resolution von Ende August an und wiederholte die Weigerung, in eine un92 AdR, GDVP 3, Klub 10.10.1922. 93 Fink hielt die Zwei-Drittel-Mehrheit nur für den Finanzausgleich mit den Ländern (»Aufhebung der Doppelgleisigkeit«) für notwendig (KvVI, CS-Klub 27.10.1922), den er deshalb verschieben wollte. 94 KvVI, CS-Klub 23.10.1922. 95 KvVI, CS-Klub 18.10.1922. 96 Übrigens auch in der Öffentlichkeit, vgl. NFP, 4.11.1922, 7 ; vgl. die kritischen Fragen Drexels in KvVI, CS-Klub 8.11.1922. 97 HHStA, Spitzmüller-Tb. 9.10.1922. 98 KvVI, CS Klub 11.10.1922.
112
Der Weg nach Genf
reformierte bürgerliche Regierung einzutreten. Man beschloss, wie nicht anders zu erwarten, gegen den Knechtungsvertrag von »Genf« aufzutreten, aber keine Gewalt anzuwenden. Über Details und Nuancen der Debatte oder allfällige Spitzen Bauers oder Renners hüllt sich das knapp gehaltene Beschlussprotokoll zum Leidwesen des Historikers in Schweigen. Die Grenzen dieser geharnischten Opposition wurden jedoch damals schon in dem bezeichnenden Passus deutlich : Was zu geschehen habe, wenn zur Verabschiedung der Protokolle eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich sei, bleibe offen.99 Auf einem vorverlegten Parteitag am Wochenende sollte geklärt – oder vielleicht doch bloß besprochen – werden, »welche Mittel wir anwenden müssen, damit die Verteidigung unserer Freiheit nicht zum Zusammenbruch unserer Wirtschaft führt.«100 Otto Bauer legte dort eine tiefschürfende Analyse des Dilemmas vor, in dem sich die Sozialdemokratie befand, mehr noch : der Aporie, der ausweglosen Situation. Der Auftritt legte unwillkürlich den Vergleich mit Hamlets Monolog nahe. Sein erster Gedanke, seine erste Reaktion auf Genf sei gewesen : Das müssen wir verhindern, koste es, was es wolle. Doch dann holte er zu einem Seitenhieb gegen die Linksüberholer aus, gegen jede Selbsttäuschung, gegen jede »Politik der gefälschten Landkarten«. Selbsthilfe sei ökonomisch möglich, doch nicht politisch, weil die starke Regierung, die dafür notwendig wäre, nicht zu finden sei : »Eine Zwangslage ist da, weil die Kraft nicht da ist, die diese Rettung in Angriff nimmt.« (Den Satz hatte Seipel noch vor einem halben Jahr wohl ganz ähnlich formuliert.) Um in der militärischen Terminologie zu bleiben, die Bauer liebte : Die Sozialdemokratie werde eine Schlacht verlieren. Um den Krieg dennoch siegreich zu beenden, müsse der Parteitag das Signal zu einer »großen Aufweckung der Seelen« werden. (Notabene : Auch Seipel sollte bald danach von einer »Sanierung der Seelen« als bevorstehender, noch größerer Aufgabe sprechen.101) Dahinter verbarg sich das Bewusstsein, dass sich die Stimmung in den letzten Wochen gedreht hatte : Der Verweis auf den Volkszorn griff nicht mehr. Die Krone war seit drei Wochen stabil. Seipel hatte soeben den Jubel seiner Anhänger gebremst und darauf verwiesen, es handle sich erst um »Teilerfolge«. Doch niemand glaubte so sehr an sein Genie – oder an den Kapitalismus – wie seine Gegner. Bauer malte schon das Steigen des Kronen-Kurses an die Wand, das erst recht wieder zur Arbeitslosigkeit und einer Aufweichung der Kampfkraft des Proletariats führen werde. Auf die eigenen Gläubigen war da kein Verlass, gab er sich missmutig, denn viele betrachteten die Partei bloß als »Lohnerhöhungsmaschine«. (Das Protokoll verzeichnet Zwischenrufe : So ist es !) 99 VGA, PV 3, 11.10.1922. 100 AZ, 14.10.1922. 101 Geßl (Hg.), Seipels Reden 97 (16.1.1924).
Das Dilemma der Opposition : Zwischen Sabotage und Kollaboration
113
Akademisch war Bauers Darlegung unanfechtbar, als politische Handlungsanleitung gab sie wenig her, davon abgesehen, dass ihr dialektisch einwandfreies Sowohlals-auch dafür sorgte, dass seine Resolution einstimmig angenommen wurde. Man hatte nach den Jahren, da alles oder doch vieles möglich schien, zurück zum »Attentismus« gefunden, der Politik auf lange Sicht : Erst in einem langen Prozess könne es gelingen, die Hunderttausende Angehöriger proletarischer und halbproletarischer Schichten, die heute noch hinter den bürgerlichen Parteien standen, zur Erkenntnis ihrer wahren Interessen zu bringen. Der Salzburger Obmann Robert Preußler wandelte das oft zitierte Wort Massimo d’Azeglios, man habe zwar Italien geschaffen, aber noch keine Italiener, auf die Republik um. Renner höhnte : »Gibt es in diesem Lande noch deutschnationale Burschenschaftler ?« Oder seien sie alle unter die römischen Chorknaben gegangen ?102 Seinen Eindruck von dem Ganzen fasste der boshafte Gesandte Wildner in seinem Tagebuch zusammen und bezeichnete es als »ein Wischi-Waschi«.103 Ihre weitere Taktik wollte die Partei davon abhängig machen, welche Früchte der von ihr angekündigte und herbeigesehnte Mobilisierungsschub zeitigte. Ein eigens dazu gewählter 31-köpfiger Parteirat sollte darüber entscheiden : Er war so konstruiert, dass er über eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Länder verfügte – vielleicht ein Indiz, dass hier dem rechten Flügel der Partei ein Forum geboten werden sollte, das ihm ein optimales Agieren ermöglichte. Am 26. Oktober beschwor der Parteivorstand den verfassungsmäßigen Komment : Die Regierung habe die Pflicht, das Parlament zu konsultieren, bevor sie mit den Völkerbunddelegierten paktiere. Seipel sah es anders : Zuerst müsse man mit den Delegierten einig sein, dann erst das Parlament informieren und gewissermaßen vor vollzogene Tatsachen stellen.104 Erst am 31. Oktober, wenige Tage vor der Einbringung der Vorlagen, konstatierte er in einem Schreiben an Seitz, er habe seit der Vorstellung des Programms am 19. Oktober von den Sozialdemokraten keinerlei Vorschläge erhalten und schlage wegen der Kürze der Zeit mündliche Verhandlungen und ein persönliches Treffen vor.105 Um dieselbe Zeit sahen sich die Sozialdemokraten mit einer weiteren Hiobsbotschaft konfrontiert : Seipel und der Völkerbund forderten jetzt angeblich sogar noch viel weiter gehende Vollmachten als ursprünglich angenommen.106 Dahinter stand – wie aus den Ministerratsprotokollen hervorgeht – das begreifliche Interesse der Völkerbunddelegierten, die Rechtmäßigkeit der verlangten Vollmachten über
102 Parteitagsberichte in AZ, 15.10.1922, 1–7 ; Text der Rede in Bauer, Werke II 461-487 ; vgl. Hanisch, Bauer 216 f. 103 AVA, E/1791, Wildner-Tb. 16.10.1922 ; vgl. auch DBFP XXIV 373 f. (20.10.1922). 104 KvVI, CS-Klub 25.10.1922. 105 Abgedruckt in AZ, 2.11.1922. 106 VGA, PV 3, 26.10. & 2.11.1922.
114
Der Weg nach Genf
jeden Zweifel erhaben zu sehen. Die Besprechungen Seipels mit den Delegierten am Abend des 3. November kulminierten jedenfalls in der Aufforderung, für eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Nationalrat zu sorgen, mit der Begründung : »Wir haben eine so komplizierte Verfassung, dass sich niemand auskennt«.107 Bisher hatten die Berater der Regierung – Klubobmann Fink, aber auch Beamte wie Grimm oder Juristen wie Egbert Mannlicher – immer nach Mitteln und Wegen gesucht, dieser Notwendigkeit auszuweichen. Doch ein Wunsch der Völkerbunddelegierten war in dieser Situation natürlich Befehl. Seipel quittierte die zusätzliche Hürde, die hier zu nehmen war, mit Nonchalance, ja vielleicht sogar mit einer Prise Bosheit. Denn damit war die Sozialdemokratie endgültig vor die Wahl zwischen Scylla und Charybdis gestellt, in der Öffentlichkeit als Kollaborateure oder als Saboteure dazustehen. Denn wie hatte Bauer auf dem Parteitag argumentiert : Die bloße Verwerfung der Kredite sei nichts als Selbstmord. Für Sonntag, den 5. November, wurde der Parteirat zu seiner ersten Sitzung einberufen, der prompt das Steuer herumwarf und eine neue Strategie einschlug, die auch tatsächlich »einschlug« und in den Reihen der Gegner für Verwirrung sorgte : Es war offenbar Robert Danneberg, der Primus inter Pares unter den Parteisekretären,108 der jetzt die Regie übernahm – und die Stelle fand, an der die Regierung verwundbar war. Was bisher nur als Seitenmelodie erklungen war, wurde jetzt Hauptthema : Am 6. November erschien ein weiterer flammender Aufruf in der AZ : Gegen die Kapitulation der Regierung vor dem Diktat – und jetzt kam’s : wohlgemerkt nicht mehr des Finanzkapitals oder »Seiner Majestät des Generalkommissars«, sondern der Agrarier !109 Bei den Christlichsozialen wurde diese Frontveränderung von Drexel schon am nächsten Tag thematisiert : »Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit. […] Sozi bisher ganz falsch operiert, indem von Unterjochung gesprochen haben, damit keinen Eindruck gemacht. Am letzten Parteirat konnte man schon merken, dass dieses Schlagwort aufgeben. Gegensatz zwischen Stadt und Land. Darin schon große Gefahr.« Schmitz analysierte die Offensive Dannebergs zutreffend als ein Symptom, dass bei den Sozialdemokraten »die radikale Richtung anscheinend zurückgedrängt« worden sei. »Mit Danneberg kommen die kleinen Juden zur Geltung.« (War Bauer für ihn also ein großer ?) Auch er hielt den Frontwechsel der Sozialdemokraten – von ihrem Standpunkt aus – für richtig : »Das zeigt Wirkung auch im Lande.«110
107 AdR, MRP 66, 3.11.1922, fol. 85 ; 4.11.1922, fol. 8 v. 108 Höbelt, Provisorium 66 ; vgl. auch Kane, Danneberg.137, 183. 109 Vgl. auch schon 3.11.1922 die Schlagzeile : »Voller Sieg der Agrarier«. 110 KvVI, CS Klub 7.11.1922.
Das »Wiederaufbaugesetz« : Beim Geld hört sich die Gemütlichkeit auf
115
Das »Wiederaufbaugesetz« : Beim Geld hört sich die Gemütlichkeit auf Bei seiner triumphalen zweiten Rückkehr aus Genf hatte Seipel befriedigt konstatiert, dass »wir einig sind«. Doch dieses schöne Gefühl war nicht von langer Dauer. Am 11. Oktober hatte Seipel die Genfer Protokolle im Klub vorgestellt, am 18. dann über sein erstes Treffen mit der Delegation des Völkerbunds111 berichtet, mit all den schillernden Andeutungen und gelegentlichen Beschwichtigungen über die Form der Kontrolle, die sie im Schilde führten. Da war Widerstand bloß von den üblichen Verdächtigen zu spüren – dem äußersten linken Flügel oder den Altvorderen, die Luegers Polemik gegen den Goldstandard nachtrauerten. Dann ging es an die Mühen der Ebene. Am 19. Oktober legte Ségur sein mit Zahlen gespicktes Exposé über den erneuerten Finanzplan vor. Wie heißt es so schön : Beim Geld hört sich die Gemütlichkeit auf. Bereits am nächsten Tag ließ Miklas das erste Warnsignal ertönen : Vollmachten, gut und schön, aber in der Zollpolitik könne man dem Finanzminister doch keine »carte blanche« geben. Damit war eine Pandorabüchse geöffnet : In ihrer Eigenschaft als Arbeitgeber mochte sich die Bourgeoisie einer gewissen Solidarität befleißigen, in der Zollpolitik war sie seit jeher gespalten, zunächst einmal in Industrie und Agrarier, aber wenn man es genau betrachtete, natürlich auch innerhalb der beiden Blöcke. Wirtschaftspolitik war gerade im liberalen 19. Jahrhundert – neben dem Eisenbahnbau – in erster Linie Zollpolitik gewesen : Die Polemik gegen das »Manchestertum« bezog sich nicht auf den Mangel an sozialen Reformen, sondern auf das Für und Wider um den Freihandel. Freihandel hatte die Monarchie in ihrer Endphase praktiziert, weil sie ihn eben nicht praktizieren durfte und die Blockade alle Importe ohnehin illusorisch machte. Seither war der Devisenmangel als Importbremse an ihre Stelle getreten. Die Zölle waren während des Krieges zum Teil suspendiert worden, der Rest durch die Inflation auf lächerliche Beträge geschrumpft. Jetzt sollte die Zollpolitik wieder einsetzen, als Folge der sanierten Währung, mehr noch : als Voraussetzung, um die Lücke im Budget zu stopfen. Gürtler war als Finanzminister im Frühjahr bereits über eine entsprechende Verordnung gestolpert. Jetzt ging die Debatte erst so richtig los. Insofern war eine geradezu schon nostalgische Rückkehr zu den Vorkriegsdebatten zu beobachten, die ›Reichspost‹ sprach von der »Verbraucherdemagogie von Anno Dazumal«.112 Während Seipel den Klub mit wöchentlichen Erfolgsmeldungen fütterte, erfolgte ab dem 23. Oktober der Generalsturm der Agrarier, natürlich nicht gegen den Kanzler, dem Stöckler keine zwei Wochen zuvor solche Lorbeerkränze geflochten hatte, 111 Zur Zusammensetzung der Delegation vgl. Pietri, Reconstruction 69 f.; Marcus, Reconstruction 115. 112 RP, 7.11.1922.
116
Der Weg nach Genf
vielleicht gegen Ségur, den sie vor wenigen Monaten ebenfalls noch enthusiastisch begrüßt hatten, aber zumindest gegen seinen Apparat, der ihm einen so verheerenden Entwurf souffliert habe. Ségurs Vorgänger Alfred Gürtler steuerte hilfreich bei, der Entwurf sei eine reine Beamtenarbeit, die Führung durch den Minister habe da offensichtlich völlig gefehlt. Leopold Diwald, als Bürgermeister von Hohenwarth in der Weinbaugegend an der burgenländischen Grenze beheimatet, preschte vor : Er sehe keinen Grund mehr, Ségur zu vertrauen.113 Am 28. Oktober erklärte er ohne jede Umschweife : Die Sache sei »ganz einfach« : Wenn die Vorlage nicht abgeändert werde, »können wir nicht dafür stimmen«. Nicht zufällig kommentierte Wildner : Die sozialdemokratische Opposition »bereite längst nicht die Schwierigkeiten, wie sie der Kanzler von seinen eigenen Leuten erfährt.«114 Als besonderer Stein des Anstoßes kristallisierte sich bald ein Punkt heraus, den Stöckler zur »Kardinalfrage für die Partei«115 erklärte – vielleicht auch in dem Bewusstsein, dass es die Regierung daran sicherlich nicht scheitern lassen würde, nämlich : die Besteuerung des »Haustrunks«. Sogar Fink rückte zur Verteidigung des Getränks aus, oder – vom vinologischen Standpunkt aus betrachtet – zu seiner »Verharmlosung«. Der Haustrunk sei doch nicht mit Wein gleichzusetzen, sondern bloß »Zuckerwasser«, das noch niemand betrunken gemacht habe, sondern an die Mitarbeiter verteilt werde, damit sie mehr als acht Stunden arbeiteten.116 Jegliche Steuer würde da bloß die Produktionskosten erhöhen und die Lebensmittel verteuern. Was den wirklichen Wein betraf, wurde am 28. Oktober der Antrag Diwalds und seines Mitstreiters Weigl, die vorgesehene Steuer auf die Hälfte zu kürzen, im Klub in einer der seltenen internen Abstimmungen nur ganz knapp mit 21 zu 18 verworfen (wie die Zahlen belegen, bei Anwesenheit von weniger als der Hälfte der Mitglieder : Da machten sich die Absenzen unter den »Landboten« bemerkbar !). Außerdem : Warum sollte gerade die Grundsteuer als einzige »valorisiert« werden ? War der ehrwürdige »Katastralreinertrag«, der auf die Zeiten Maria Theresias und Franz II. (I.) zurückging, tatsächlich noch eine geeignete Bemessungsgrundlage, oder sollte man – wie Gürtler und Stöckler unisono argumentierten – zu einer »Bodenwertabgabe« übergehen, die landwirtschaftliche Flächen vermutlich entlastet und Bauland belastet hätte ?117 Von der Warenumsatzsteuer, die im Frühjahr noch einmal auf die lange Bank geschoben worden war und sich jetzt nicht mehr vermeiden ließ, waren alle Konsumenten gleichermaßen betroffen. Die Landwirtschaft 113 KvVI, CS Klub 27.10.1922. 114 AVA, E/1791, Wildner-Tb. 27.10.1922. Als Routineangelegenheit abgehakt wurde inmitten dieser Turbulenzen der außerordentliche christlichsoziale Parteitag am 28./29. Oktober ; vgl. Kriechbaumer (Hg.), Protokolle 205 ff.; RP, 30.10.1922, 2. 115 KvVI, CS Klub 27.10.1922. 116 KvVI, CS Klub 7.11.1922 ; vgl. auch DBFP XXIV 394 (8.11.1922). 117 KvVI, CS Klub 28.10.1922.
Das »Wiederaufbaugesetz« : Beim Geld hört sich die Gemütlichkeit auf
117
machte dennoch eine besondere Belastung geltend, die ihr damit auferlegt werde. Schließlich ritt der Tiroler Karl Niedrist unablässig sein »Steckenpferd«, das lange versprochene »Kulturförderungsgesetz«, das nichts mit den schönen Künsten zu tun hatte, sondern mit Subventionen für die Agrarier. Den roten Faden der Debatte – und das rote Tuch für die Agrarier – bildete dennoch die Zollfrage. Seipel selbst zog sich da elegant, vielleicht zu elegant aus der Affäre : Er brachte nicht die Ultima Ratio ins Spiel, das Diktat aus Genf, sondern berichtete wahrheitsgemäß, den Völkerbunddelegierten seien die Einzelheiten der Zollgesetzgebung ziemlich gleichgültig, es müssten bloß summa summarum 80 Milliarden Papierkronen an Einnahmen herausschauen.118 An dem Tag, als Danneberg im Nationalrat – über dreieinhalb Stunden – seine fulminanten Angriffe gegen die Agrarier startete, dem 6. November, erklärte Seipel dann mit einer Unverblümtheit, die ihm von manchen der eigenen Leute als Kaltschnäuzigkeit übel genommen wurde : Ja, so sei das eben. »Wer mit mir verhandelt hat, hat etwas erreicht.« Die offizielle Version lautete : Jeder sei eingeladen gewesen, seine Abänderungsanträge vorzubringen. »Jene Gruppen, die wirklich verhandelt haben, konnten natürlich bisher mehr durchsetzen.«119 Aber die in Umlauf gebrachte Kurzversion traf den Kern der Aussage vielleicht noch besser. Die Debatte zeichnete bei aller Erbitterung eine gewisse hypothetische Qualität aus. Denn wie Stöckler ausführte, dachte niemand ernsthaft daran, dass Österreich auf der Stelle Zölle auf Lebensmittel einheben würde, »solange die Landwirtschaft auskommt.«120 Die Agrarier wollten bloß für die Zukunft vorsorgen – denn wer konnte schon voraussagen, wie sich die Kurse entwickeln würden ? Und sie forderten Kompensationen für den Schutzzoll, den die Industrie sehr wohl schon hic et nunc beanspruchte, weil die Mark ins Bodenlose fiel und reichsdeutsche Billigprodukte den einheimischen Markt überschwemmten.121 Wenn man ihre Anliegen missachte, drohte Zwetzbacher als frischgewählter Präsident der niederösterreichischen Landwirtschaftskammer, dann müsse man eben beim Freihandel bleiben, aber Freihandel für alle.122 Kurzfristige taktische Erwägungen und langfristige gesellschaftspolitische Weichenstellungen waren da beide im Spiel. Bei den Großdeutschen geriet die Zolldebatte zwischen Prinzipien- und Realpolitik zu einer der klassischen Demonstrationen für die Republik mit dem Großherzog an der Spitze. Vizekanzler und Handelsminister, Frank und Kraft, erklärten sich
118 KvVI, CS Klub 15.11.1922. 119 KvVI, CS Klub 7.11.1922 (Drexel) ; RP, 7.11.1922, 2–3. 120 KvVI, CS-Klub 9.11.1922. 121 Vgl. dazu die Rede Krafts in RP, 21.10.1922, 7. 122 Vgl. auch die Forderungen der Tagung der landwirtschaftlichen Hauptkörperschaften im Landhaus unter Zwetzbachers Vorsitz am 27. Oktober ; RP, 29.10.1922, 3 ; Kluge, Bauern 184 f.
118
Der Weg nach Genf
unisono natürlich prinzipiell für den Freihandel, doch ach : Es kann der beste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. »Gegen Staaten, die sich gegen uns absperren, bedürfen wir der Einfuhrverbote«, entschied der Handelsminister. Ernst Hampel, der von den liberalen Bürgerlichen Demokraten kam und sich immer mehr zum Mann für alle Jahreszeiten mauserte, warnte vor einem »einseitigen Konsumentenstandpunkt«.123 Der Klub votierte am 28. Oktober überraschenderweise für ein Schutzzollsystem, zumindest zu Verhandlungszwecken. Die Christlichsozialen gerieten da leicht zwischen zwei Fronten. Ihre Agrarier hatten da auch die Konkurrenz von rechts zu befürchten, denn die (Land)»Bündler« – so grollte Stöckler – »loben Seipel, aber kneifen«. Auch Gürtler empfahl, das Äußerste zu unternehmen, um »diese Burschen einzufangen«. Er argumentierte : »Gegen die Sozi haben wir es leicht.« Aber nach zwei Seiten hin sei Demagogie schwer zu ertragen.124 Stöckler formulierte am 9. November ein Ultimatum, auch wenn er es nicht so nannte : Wenn eine Bindung erfolge, die Agrarzölle in den nächsten zwei Jahren nicht zu erhöhen, würde das nichts anderes bedeuten als »die Zerschlagung des Klubs«. Seine Geduld sei am Ende : Die »ganze Bagage« – sprich die Kollegen von den Großdeutschen, aber auch die Städter in den eigenen Reihen – hätten sich in der Debatte bisher ganz passiv verhalten.125 »Die Larven werden wir ihnen vom Gesicht reißen.« Denn : »Wir verteidigen die Grundlage unserer Partei. Eine konservative Partei ohne den Bauernstand wird nicht bestehen.«126 Die Unzufriedenheit der Agrarier schwappte über auf ein weiteres Gebiet, die Debatte um den Mieterschutz. Die Forderungen nach Abbau des Mieterschutzes waren keineswegs auf den harten Kern der Hausbesitzerverbände beschränkt. Die Vertreter der Wirtschaft verlangten eine Anhebung auf mindestens das 1000-Fache des Friedenszinses (nicht das 150-Fache).127 Die Bauern standen all diesen Eingriffen in das freie Verfügungsrecht des Besitzers mit – um es euphemistisch zu formulieren – äußerstem Misstrauen gegenüber. (Da ging es oft mehr um das Kündigungsrecht als um die Höhe der Miete !128) Selbst Spalowsky, der im Klub den äußersten linken Flügel der Partei repräsentierte, rechnete vor, dass er eigentlich zu wenig für seine Wohnung bezahle, selbst wenn er zu bedenken gab, die Mehrzahl »unserer städtischen Anhänger seien Mieter«.129 Kunschak ergänzte, vor dem Krieg habe ein 123 AdR, GDVP 3, Klub 23.10.1922. 124 KvVI, CS Klub 15.11.1922. 125 Im ›Bauernbündler‹ vom 15.11.1922 las sich dieser Rundumschlag folgendermaßen : »Wir werden den Volksvertretern genau auf die Finger sehen. Wehe denen, die in dieser entscheidenden Stunde den Bauernstand verraten !« 126 KvVI, CS-Klub 9.11.1922. 127 KvVI, CS-Klub 27.9.1922. 128 KvVI, CS-Klub 11.10.1922 (Neuhofer, Niedrist, Kollmann). 129 KvVi, CS Klub 11.10.1922.
Das »Wiederaufbaugesetz« : Beim Geld hört sich die Gemütlichkeit auf
119
Maurer ein Fünftel seines Einkommens für die Wohnung bezahlt, jetzt nur mehr einen Stundenlohn.130 Gürtler als Volkswirt setzte das Tüpfelchen auf das i, wenn er einwarf, der Mieterschutz komme in erster Linie gar nicht dem heimischen Arbeiter zugute, sondern dem ausländischen Konsumenten, der billig in Österreich einkaufe.131 Dass hier ein gewisser Handlungsbedarf gegeben war, gestanden – zumindest hinter vorgehaltener Hand – auch führende Wiener Sozialdemokraten ein.132 Diese Situation hatte dazu geführt, dass seit der Einbringung eines Entwurfes im Februar, noch unter Schober, recht konstruktive Verhandlungen eingesetzt hatten. Als Ergebnis kristallisierte sich da allerdings keine »Valorisierung« der Mieten heraus, die im Herbst 1922 nur mehr ¹/14.000 des Vorkriegswertes betrugen, sondern ein Paket, das außer dem lächerlich geringen »Grundzins«– neben den Abgaben und den Betriebskosten – noch einen »Instandhaltungsbeitrag« vorsah.133 Heiß umstritten blieb, ob zur Kontrolle der Verwendung dieser Gelder (»Ausgleichsfond«) ein Mieterausschuss installiert werden sollte, der als Basis für sozialdemokratische Agitationsarbeit dienen könnte und misstrauische Bürgerliche sofort an die »Rätewirtschaft« in Armee und Betrieb erinnerte. Kunschak sah da eine Tributpflicht kommen, bis hin zu Umlagen für die Mieter, Kollmann sprach von einer »Zwangswirtschaft neuer Art«.134 Schönsteiner warnte : »Das ist sozialistische Organisation in jedem Haus.«135 Alle offenen Fragen über eine mögliche Erhöhung der Mieten sollten an Landeskommissionen ausgelagert werden, die unter dem Vorsitz eines Richters paritätisch aus Mietern und Vermietern zusammengesetzt waren. Die Politik hoffte ganz offensichtlich, sich das Problem auf diese Weise zumindest eine Zeitlang vom Leib zu halten. Seipel hielt diese Mini-Reform zweifellos nicht für das letzte Wort, war aber daran interessiert, mit der Mieterschutzfrage die Sozi hic et nunc nicht zu reizen. Es waren seine emsigen »Technokraten«, Leute wie Schmitz und Resch, daneben vor allem Ramek als Justizsprecher, die diese Vorlage ausverhandelt hatten – und sich gegen Zusatzanträge in letzter Minute wehrten. Der Klub erteilte am 19. Oktober, wenn auch widerwillig, seine Zustimmung – formell ohne Gegenstimmen, doch unter der Oberfläche rumorte es.136 Die Agrarier waren empört über das Einlenken gegenüber der Opposition. Bei den Großdeutschen war die Stimmung keineswegs einheitlich, doch diesmal rückten selbst die Schönerianer – sonst meist am linken Flügel angesiedelt – zur Verteidigung des Mittelstandes aus, einmal ganz abgesehen 130 KvVI, CS-Klub 3.10.1922. 131 KvVi, CS-Klub 27.10.1922. 132 Lukan, Mieterschutz 60 ; AZ, 1.11.1921, 5. 133 Lukan, Mieterschutz 85. 134 KvVI, CS-Klub 3.11.1922. 135 KvVI, CS Klub 3.10.1922. 136 KvVI, CS-Klub 11. & 19.10.1922.
120
Der Weg nach Genf
von Dinghofer, der im Klub unumwunden erklärte : Die Mieterschutz-Verordnung habe ihre Berechtigung verloren. Der Mietertrag sollte wenigstens die Hälfte des Vorkriegsniveaus erreichen ; Straffner war da zurückhaltender und hielt ein Fünftel für realistisch.137 Die Hausbesitzer waren inzwischen schon einen Schritt weitergegangen und hatten am 2./3. Oktober zum Streik geblasen, der für den Laien allerdings die Fragen aufwarf : Wie bitte soll ein solcher Streik der Hausbesitzer aussehen ? Nun : Man wollte die Haustore sperren und die Gangbeleuchtung ausschalten. Für diesen »Dienst nach Vorschrift« – oder sogar schon jenseits der Vorschrift, wie die Gemeinde Wien argumentierte – hatte man sich rechtzeitig der Mitwirkung der Hausmeister versichert. Für die Regierung war dieser Ausritt – in den Stunden, als in Genf die Entscheidung herannahte – natürlich eine Peinlichkeit. In den Parlamentsklubs fanden die »Bereichssprecher«, die Kummer gewohnt waren, kein gutes Wort über die Wortführer der Hausherren, die mit ihrer Unverlässlichkeit und Uneinigkeit ihre Position nicht gerade erleichtert hätten. Die Partei solle sich da völlig heraus halten.138 In der Regierung war die Stimmung weniger eindeutig. Vizekanzler Frank und Sozialminister Schmitz hatten die Hausbesitzer abgemahnt, doch erfolglos. Die Behörden würden strikt nach der Gesetzeslage vorgehen. Doch im Stenogramm werden gewisse Differenzierungen deutlich. Vaugoin und Waber warnten : »Wir können schwer gegen die Hausbesitzer vorgehen«, oder auch : »Ich bin der letzte, der diesen Streik gut heißt, aber man muss sich die Lage der Hausherrn vor Augen halten.«139 Die Gemeinde Wien kündigte inzwischen an, jeden Verstoß gegen geltende Bestimmungen seitens der Hausherren streng ahnden zu wollen, vor allem, wenn auch die Wasseranschlüsse in Mitleidenschaft gezogen werden sollten. Die AZ druckte bereits vorsorglich Formulare für Besitzstörungsklagen gegen rebellische Hausherren ab.140 Die Aktion der Hausherren brach schnell zusammen. Der christlichsoziale Verhandler Ramek lud später durch einen Vortrag, der offenbar weiter ging, als mit dem Klub abgesprochen war, den Ingrimm seiner Kollegen auf sich. Er verteidigte den Kompromiss mit den Sozialdemokraten, mit der allzu optimistischen Prognose : »Bei Landeskommissionen werden wir zu praktischem Abbau des Mieterschutzes kommen.«141 Die Reform – oder das Reförmchen – des Mieterschutzes wurde unbeschadet aller sonstigen Querelen am 7. Dezember 1922 vom Nationalrat verabschie-
137 AdR, GDVP 3, Klub 4. & 13.10.1922. 138 KvVi, CS Klub 3.10.1922. 139 AdR, MRP 66, Nr. 230, 2.10.1922, fol. 12. 140 AZ, 3.10.1922, 2. 141 KvVI, CS-Klub 3.11.1922. Der von Fink monierte anstößige Pressebericht war in den wesentlichen Blättern leider nicht zu finden.
Das »Wiederaufbaugesetz« : Beim Geld hört sich die Gemütlichkeit auf
121
det. Das Thema blieb am Köcheln und wurde spätestens dann wiederum akut, als die Landeskommissionen 1924/25 erste umstrittene Entscheidungen fällten – worauf die Sozialdemokraten jede weitere Reform hohnlachend durch systematische Obstruktion im zuständigen Ausschuss blockierten.142 Ein Umschwung vollzog sich hinter den Kulissen auch bei der Warenumsatzsteuer, auf Heller und Pfennig gerechnet, einem der zentralen Punkt des Finanzprogramms. Wie hoch durfte sie ausfallen ? Sollte sie bei jeder Phase der Produktion anfallen oder als »Finalsteuer« erst beim Verkauf an den Konsumenten eingehoben werden, was freilich die Einnahmen reduziert hätte ? Die Interessenlage war diffus : Kraft als Handelsminister schien ursprünglich im Interesse der Industrie der Finalsteuer den Vorzug zu geben, dafür vielleicht mit einem etwas höheren Satz von 3 %.143 Der Klub stimmte ihm dabei nicht unbedingt zu. Zum Schluss schob man die Schuld den Christlichsozialen in die Schuhe, die – unter dem Druck der Handelskammern – »umgefallen« seien : Schon einmal wegen des höheren Ertrags wurde die Umsatzsteuer als Phasensteuer beschlossen, allerdings mit einem Satz von bloß 1 %, ab nächstem Jahr dann 2 %.144 Der Kampf ums Kleingedruckte forderte – direkt oder indirekt – ein Opfer, das meist unter seinem Wert geschlagen wird : den Finanzminister Grafen Ségur, der im November zurücktrat. Ségur wurde von Seipel als Person und Kollege wirklich hoch geschätzt. Der »Nachruf«, den er ihm hielt, im Klub, im Kabinett und im Nationalrat, ging weit über die Floskeln hinaus, die bei solchen Gelegenheiten an der Tagesordnung waren. Er lobte seine Loyalität und die Energie, die Ségur an den Tag gelegt hatte. Es war als Kompliment – für beide – gedacht, wenn er Viktor Kienböck als Nachfolger Ségurs mit den Worten präsentierte : In Frage komme »nur der, der Opposition noch zuwiderer ist. Diese Eigenschaft besitze Dr. Kienböck.« Wenn in absehbarer Zeit wieder eine wichtige Position zu besetzen wäre, würde er sich über eine Rückkehr Ségurs freuen.145 Dabei war möglicherweise an eine Position in der Notenbank gedacht. Dazu kam es nicht. Es ist leider auch kein amüsanter Briefwechsel überliefert, wie zwischen Seipel und anderen Vertrauten, z. B. Grünberger und Mataja. Ségur hatte eine wichtige Funktion übernommen. Am Beginn seiner Ministerschaft hatte Seipel das Anstellungserfordernis so umschrieben : Finanzminister müsse einer werden, vor dem sich die Leute fürchten. Diese Bedingung hatte Ségur erfüllt, besser als es der Bankier Rosenberg oder der Sektionschef Schwarzwald getan hät142 Lukan, Mieterschutz 81. 143 AdR, GDVP 3, Klub 23.10.1922 ; vgl. auch die Ausführungen der NFP, 1.11.1922, 3 f. gegen die Phasensteuer. 144 AdR, GDVP 3, Klub 23.11.1922. 145 KvVI, CS Klub 14.11.1922.
122
Der Weg nach Genf
ten, die in den höheren Sphären der internationalen Finanz schwebten. Ungerecht und undankbar war daher der Leitartikel der AZ vom 16. September : »Das größte Verbrechen des Dr. Seipel heißt Ségur.« Im Gegenteil : Wenn Bauer dem Bürgertum vorwarf, es habe die Unabhängigkeit des Landes verkauft, um der Zwangsanleihe zu entgehen, dann war Ségur der Mann, der unerschütterlich an ihr festgehalten hatte, während Seipel diese Hartnäckigkeit nur deckte, um die Autorität der Regierung nicht zu gefährden. Ségur kam aus einer alten französischen Adelsfamilie, die vor 1789 eine große Rolle gespielt hatte – deshalb war während der Revolution ein Zweig nach Österreich ins Exil gegangen. Es waren diese Familien, ohne allzu großen Grundbesitz, ohne generationenlange Verankerung in Österreich, die als Habsburgs getreue Diener Karriere machten. Ségur verkörperte jenes Beamtenethos, das übernommene Aufgaben zu Ende brachte, ohne Rücksicht auf persönliche Präferenzen. In England wäre seine Haltung vielleicht als »bloody mindedness« rubriziert worden. Wenn es im Kabinett des Jahres 1922 einen »Pflichtmenschen« gab, der ohne Rücksicht auf Verluste seinen Weg ging, dann bei Gott nicht der kokette Schober, dem Karl Kraus ein paar Jahre später diese Worte in den Mund legte, sondern Ségur, der in Mähren geborene »Franzose« und Mödlinger Stadtrat. Ségur war keine »Notlösung«146, sein Rücktritt Anfang November war nicht auf eine unter Anführungszeichen gesetzte »diplomatische Krankheit« zurückzuführen, sondern ganz offenbar auf einen gesundheitlichen Kollaps, wie ihn Kunschak – aus welchen Motiven auch immer – vorhergesagt hatte. Er dürfte am 6. November im Nationalrat einen Herzanfall erlitten haben, zog sich in ein Sanatorium in Baden zurück und reichte am 11. November seinen Rücktritt ein.147 Im Kontext der agrarischen Fronde, die ihn im Stich gelassen hatte, war sein Rücktritt andererseits auch wiederum eine logische Folge. Ségur war nicht gescheitert : Er hatte die Steuerzahler und Zwangsanleiheverpflichteten das Fürchten gelehrt, bis sie Genf als Rettung empfanden, nicht als Belastung. Er hatte damit eine Front aufgebaut, die es Seipel ermöglichte, anderswo zu seinen Umgehungsmanövern auszuholen. Darin lässt sich ein Anklang an das Szenarium erblicken, das Seipel am 12. Juni so skizziert hatte : Bevor man mit einer »alternativen Politik« reüssieren könne, müsse die bisherige scheitern, aber nicht wegen Inaktivität. Aus einer übergeordneten Warte kam Ségur im Kalkül des »Autrichelieu« eine ähnliche Funktion zu wie den Italienern, die als Schreckgespenst hofiert worden waren, bis sich in Genf hoffnungsvollere Perspektiven auftaten. Unter all den Kontroversen, die im Schoße des Bürgerblocks ausgefochten wurden, über den Primat des Primärsektors, das antikapitalistische Gewissen der Partei 146 Ladner, Staatskrise 39. 147 RP, 14.11.1922, 2.
Das »Wiederaufbaugesetz« : Beim Geld hört sich die Gemütlichkeit auf
123
oder das Unrecht, das an den Hausherren verübt worden war, blieb eine Frage merkwürdig unterbelichtet, die sich in den nächsten Jahren zur vielleicht umstrittensten der »Sanierungsfolgen« entwickelte : der Abbau der öffentlichen Angestellten, der »100.000 Beamten«, die laut Schema F entlassen werden sollten. Nicht, dass das Thema nicht immer wieder erörtert worden wäre. Es war bekannt als die Maßnahme, auf die alle westlichen Ratgeber am meisten Wert legten. Aber es wurde von fast allen Beteiligten auf die leichte Schulter genommen. Der Beamtenabbau wurde als eine Maßnahme gesehen, die sich – einigen guten Willen vorausgesetzt – in erster Linie gegen die »anderen« richten würde, gegen den politischen Gegner. Die AZ nahm den Obrigkeitsstaat der Monarchie ins Visier und prophezeite jedem ein »dankbares Echo«, der dem »Beamtenungetüm, dessen Umschlingungen der Bevölkerung die Luft zum Atmen raubten«, ernsthaft zu Leibe rücken würde. Die Sozialdemokraten forderten in erster Linie, dass den Personalvertretungen beim Abbau ein Mitspracherecht eingeräumt werde.148 Die Bürgerlichen sahen den aufgeblähten Apparat der Bundesbahnen oder die ärarischen Betriebe als vornehmstes Ziel des Abbaus, wenn schon nicht die Volkswehr. Es waren gerade die Finanzminister, Ségurs Vorgänger Gürtler und sein Nachfolger Kienböck, die als Erste – und lange Zeit nahezu Einzige – vor derlei Gefahren und Illusionen warnten. »Sehr dankbar, wenn gelingt, dieses Gesetz nicht durchzuführen. Würde auf bürgerliche Schichten entsetzlich wirken. […] Dieses Beamtenabbaugesetz ist für uns furchtbares Unglück. […] Noch immer gescheiter, es wird nicht gemacht. Es ist ehrlich gesagt ein Schwindel.« Außerdem : Wenn ein Beamter von der Entlassung bedroht sei, »werde sein ganzes Wohl und Wehe von Organisationen abhängen.« Die Abfindungen und Pensionen seien zu hoch, die Einsparungen die Aufregung nicht wert. Das Anreizsystem schaffe eine negative Auslese, denn die Tüchtigsten würden in die Privatwirtschaft abwandern.149 An einer Nebenfront, dem Abbau der weiblichen Bediensteten, »outete« sich Schmitz gegen den Trend als »Frauenbewegungsanhänger«, den diese Tendenz schmerzte.150 Auffallend war die Nonchalance, mit der anfangs gerade die Großdeutschen als die Beamtenpartei par excellence die Frage behandelten : Man stieß sich hie und da an Details, aber es gab wenig Anzeichen für ein Bewusstsein, welche Probleme sich die Partei damit bei ihrer Stammklientel einhandelte. Ressortzuständig für das Thema Verwaltungsreform war Vizekanzler Frank : Auf ihn ließe sich Youngs Formel anwenden, die Parteien strichen um das Problem herum wie die Katze um den Igel. Dinghofer überlegte laut, im Justizbereich müsste man von der Sache her eigentlich am besten die Kreisgerichte einsparen oder zusperren, aber gerade dort säßen »un148 AZ, 17.6.1922, 1 ; 23.7.1922, 2. 149 KvVI, CS Klub 20.9.1922. 150 KvVI, CS-Klub 28.9.1922.
124
Der Weg nach Genf
sere Anhänger«. Hampel – der als Lehrer begonnen hatte, doch inzwischen zum Handels- und Gewerbebund gewechselt war – meinte, 100 Abgeordnete seien eigentlich genug, doch Frank entgegnete, dann ginge es uns »an den Kragen«, der Klub sei jetzt schon überlastet.151 Schneider als Unterrichtsminister trat der Forderung nach dem pauschalen Abbau bei den Lehrern – wie er aus bäuerlichen Kreisen immer wieder erhoben wurde152 – mit dem für seine Zuhörer schlagenden Argument entgegen, wenn man so vorgehe, werde es in zehn Jahren nur mehr eine jüdische Intelligenz und Mittelschulen nur mehr in sozialistisch regierten Städten geben. Gerade die Landbevölkerung sei auf die Schulen angewiesen, die vom Einzugsbereich her vielleicht eine prekäre Existenz führten. Er rate zur Vorsicht. Auch auf den Hochschulen könne man nicht einfach Lehrstühle unbesetzt lassen, nur weil sich im Inland kein geeigneter Bewerber melde oder finde.153 Bei den Großdeutschen wollte Zeidler schon die Flinte ins Korn werfen : Wenn die Bevölkerung der Meinung sei, dass Schulen überflüssig seien, so werde kein Formalismus sie halten können. »Die Kulturgüter sind in großer Gefahr.«154 Wohlgemerkt : Die Kulturgüter waren in Gefahr, weil der Sparstift drohte, nicht irgendwelche klerikalen Ränke. Der Kulturkampf als Sollbruchstelle der Koalition blieb tatsächlich fast durchgehend ausgeblendet. Die Kritik der Großdeutschen an Schneider lautete vielmehr, er wisse sich in seinem Ressort nicht durchzusetzen. Emmy Stradal zitierte das Verslein : »Auf dem Dache sitzt ein Greis / Der sich nicht zu helfen weiß.« Max Pauly als Lehrer empfand Mitleid mit dem Minister, der ihm gestand, er habe keine Beamten, denen er vertrauen könne, denn überall säßen »Glöckel-Leute«. Der Präsidialist mache, was er wolle, und »die Gewerkschaft der Akademiker wehrt sich gegen jede Veränderung«.155 Ob das eine Jahr sozialdemokratischer Amtsführung 1919/20 tatsächlich so tiefgreifende Spuren im Ministerium hinterlassen hatte, sei dahingestellt. Dem Koalitionsfrieden war dieses gemeinsame Feindbild freilich bloß förderlich. Erst im Laufe des Herbstes – vielleicht vom Konjunktureinbruch beeinflusst, der mit dem Verfall der Mark einherging – nahmen die kritischen Stimmen zu, zum Teil ganz allgemein in die Formel gehüllt, die Schöpfer genauso enthusiastisch aufgriff wie Miklas, man müsse nicht allein die Finanzen sanieren, sondern in erster Linie die Volkswirtschaft. Oder wie es Kunschak formulierte : »Die Kuh muss auch Futter bekommen.«156 Seipel äußerte sich dazu später in einem Vortrag : Er erkenne die
151 AdR, GDVP 3, 28. & 23.10.1922. 152 Vgl. z. B. KvVI, CS-Klub 20.10.1922 (Lieschnigg). 153 KvVI, CS Klub 28.10.1922. 154 AdR, GDVP 3, Klub 6.11.1922. 155 AdR, GDVP 3, Klub 5.10.1922. 156 KvVI, CS-Klub 25.10.1922.
Das Feigenblatt : Der außerordentliche Kabinettsrat
125
Berechtigung des Einwands vollkommen an, aber das eine habe das andere zur Voraussetzung, die Gesundung des Patienten die schmerzhafte Operation.157
Das Feigenblatt : Der ausserordentliche Kabinettsrat Die Völkerbunddelegierten hatten Ende Oktober auf einer weiteren Garantie bestanden, diesmal einer innenpolitischen in Gestalt einer Zwei-Drittel-Mehrheit, um die Anleihe gegen alle möglichen politisch-juristischen Querschüsse abzusichern. Die Westmächte waren auch bereit, dafür eine gewisse Überzeugungsarbeit zu leisten. Am 2. November besuchte Phillpotts, der britische Attaché, Renner und redete ihm gut zu. Beim ehemaligen Staatskanzler, der für pragmatische Lösungen immer zu haben war, lief er offene Türen ein. Renner beschwerte sich über die eine oder andere Maßnahme : Die Warenumsatzsteuer belaste die Konsumvereine, im öffentlichen Dienst würden voraussichtlich vor allem Sozialdemokraten abgebaut. Seipel habe die ganze Operation bewusst so aufgebaut, um die Sozialdemokraten in die Opposition zu drängen. Aber Renner skizzierte einen Ausweg, eine parlamentarische Kommission, aus der sich nach einiger Zeit eine Koalition entwickeln könne – sobald der rechte Flügel in seiner Partei die Oberhand gewonnen habe. Seitz soll angeblich schon von einigen Genossen als Minister ohne Portefeuille gesprochen haben.158 Zumindest konnte der Vorschlag den Sozialdemokraten helfen, das Gesicht zu wahren. Frank referierte das Offert im großdeutschen Klub : Wenn es einen »parlamentarischen Beirat« gäbe, würden die Sozialdemokraten auf Obstruktion verzichten. Seitz habe auf die »Einladung« Seipels vom 31. Oktober reagiert und sich bei der Gelegenheit »äußerst bescheiden« benommen. Die Initiative wurde – zu Recht oder zu Unrecht ? – als Niederlage Otto Bauers interpretiert.159 Ein bloßer »Beirat« war Renner allerdings noch zu wenig.160 Aus seiner »parlamentarischen Kommission« wurde der »außerordentliche Kabinettsrat«. »Kabinettsrat«, das war die offizielle Bezeichnung für die Regierung. Doch nicht die Regierung wurde mit Vollmachten betraut, sondern ein Gremium, das aus einigen nach dem Proporz entsandten Parlamentariern bestand (der endgültige Schlüssel lautete bis zu den nächsten Wahlen : 12 Christlichsoziale – 10 Sozialdemokraten – 3 Großdeutsche – 1 Landbündler). Der Bundeskanzler präsidierte auch diesem außerordentlichen Kabinettsrat, doch weder er noch die anderen Regierungsmitglieder waren stimmberechtigt. Am Rande 157 Geßl (Hg.), Seipels Reden 61 (27.3.1923). 158 DBFP XXIV 386 f. (Bericht Keeling 3.11.1922) ; vgl. auch März, Bankpolitik 494 ; Marcus, Reconstruction 125. 159 AdR, GDVP 3, Klub 3.11.1922. 160 AdR, MRP 67, 9.11.1922.
126
Der Weg nach Genf
wurden damals schon von Schöpfer und Miklas schüchtern Überlegungen geäußert, dieses »Parlament im kleinen«161 als Keimzelle eines »Wirtschaftsparlaments« anzusehen, das diese Agenden dem Nationalrat später einmal abnehmen könnte. Doch das – damals und später – schlagende Argument dagegen lieferte Schöpfer gleich mit : Mit dem Parteienproporz hätte die Regierung das Gremium viel besser in der Hand als mit der Berufung von noch so klugen Ökonomen oder Wirtschaftsvertretern. Der »Ständestaat« sollte ein Dutzend Jahre später nicht anders verfahren : Selbstverwaltung war gut, Kontrolle noch besser …162 Die Bezeichnung des Gremiums und der politische Zweck, der damit verbunden war, gaben Anlass zu einem Kampf mit verkehrten Fronten : Die Sozialdemokratie war an einem möglichst beeindruckenden Titel interessiert, wollte den »Außerordentlichen« aber bewusst als parlamentarische Institution bewerben, nicht als Anhängsel der Regierung (der laut Genfer Protokoll die Vollmacht eigentlich hätte eingeräumt werden sollen). Seipel schloss sich dieser Interpretation nach anfänglichen Bedenken ebenfalls an. Auch wenn er ursprünglich von einem »Staatsrat« sprach, war es ihm vor allem darum zu tun, im Zusammenhang mit dem »außerordentlichen Kabinettsrat« den Eindruck zu vermeiden, man bilde hier zusammen mit den Sozi eine Regierung (oder auch »Nebenregierung«).163 Dinghofer war mit ihm in dieser Beziehung völlig einer Meinung : Die Frage einer Konzentrationsregierung dürfe man auf keinen Fall aufrollen, denn die Sozialdemokraten würden »Bedingungen stellen, die wir nicht annehmen können«.164 Seipel hatte seinen Parteifreunden immer wieder geschildert, dass man im Westen auf eine Regierung ohne Sozialisten besonderen Wert lege. Interessanterweise findet sich in den Berichten des britischen Gesandten ein Satz, der etwas anders klang. Am 26. Oktober überlegte Akers-Douglas, die Sozialdemokraten würden als Gegenleistung für die Bereitstellung der notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit wohl eine Koalition ohne Seipel fordern. Er selbst sei einer solchen Lösung keineswegs abgeneigt (»not myself unfavourably inclined towards the idea of such a coalition«).165 Dazu passte eine Karikatur, die in der Woche danach im Satireblatt ›Muskete‹ erschien : »Österreichs Schutzengel« – die vier Mächte, die Prälat und rote Proletarier doch noch unter eine Decke bringen.166 Selbst der Nuntius hielt einen Rückzug Seipels damals noch für durchaus akzeptabel. Bloß sein Vorgesetzter in Rom, Kardinal-
161 AdR, GDVP 3, Klub 3.11.1922. 162 KvVI, CS-Klub 15.11.1922. 163 Ebd.; Kohl, Theorie und Praxis 323 ; irreführend in diesem Zusammenhang der Eindruck bei Fellner/ Corradini (Hgg.), Redlich-Tb. II 612 (9.11.1922). 164 AdR, GDVP 3, Klub 10.10.1922. 165 DBFP XXIV 379 (26.10.1922). 166 Die Muskete, 1.11.1922.
Das Feigenblatt : Der außerordentliche Kabinettsrat
127
Abb. 2 : Die Großmächte als Katalysator der Zusammenarbeit ? Aus : Die Muskete, Bd. XXXV, Nr. 12, Wien, 1.11.1922.
128
Der Weg nach Genf
Staatssekretär Pietro Gasparri, war da anderer Meinung : Seipel müsse unbedingt bleiben.167 Derlei halblaute Zwischenbemerkungen innerhalb des diplomatischen Korps waren jedoch nicht als Misstrauensvotum gegenüber Seipel aufzufassen, der von den Briten durchwegs hervorragende Zensuren erhielt : Akers-Douglas selbst schrieb zu Weihnachten, er glaube nicht, dass irgendjemand anderer mit den gegenwärtigen Zuständen in Österreich fertig werden könne.168 Otto Niemeyer, der Nachfolger Blacketts als Vertreter des britischen Schatzamtes in Genf (und als Völkerbunddelegierter in Wien), formulierte es noch deutlicher : Er bescheinigte den österreichischen Ministern zwar ein hohes intellektuelles Niveau, aber was ihnen allen abgehe, und zwar total abgehe, sei »driving power« : »The only force in the country is clearly the Chancellor himself.«169 In Rom aber folgerten Pius XI. und Gasparri ein Jahr später, während der Ruhr-Krise in Deutschland : »In Berlin fehlt ein Seipel !«170 Der »außerordentliche Kabinettsrat« war nicht jenes »Kriegskabinett« – zusammengesetzt aus den führenden Politikern und ein paar ausgesuchten Fachleuten –, dem Seipel ursprünglich die »Finanzdiktatur«, sprich : die Durchführung der Sanierung hatte übertragen wollte. Ganz im Gegenteil es war ein Feigenblatt, das in der Praxis nur äußerst selten zusammentrat, wie Gerald Kohl in der bisher einzigen Studie über diese oft en passant zitierte und selten näher erforschte Institution festgestellt hat.171 Seine erste Sitzung fand noch kurz vor Weihnachten 1922 statt und befasste sich im Rahmen einer sehr technischen, juristisch hochwertigen Debatte mit Verordnungen des Finanzministers über die Pensionsbeiträge der öffentlichen Bediensteten. »Kapazunder« der Christlichsozialen, wie Rintelen oder Zwetzbacher, die ursprünglich vehement das Recht der Bundesräte auf Mitsprache in diesem Gremium verfochten hatten, verloren bald die Lust an der weiteren Teilnahme.172 Aber der außerordentliche Kabinettsrat verkörperte zumindest den Anschein, das Parlament habe sich seiner Kontrollrechte nicht völlig begeben. Damit war das Prinzip der Gewaltenteilung bestätigt, ein Punkt, der bei den Verfassungsberatungen zwei Jahre zuvor der Sozialdemokratie nicht gerade ein besonderes Anliegen gewesen war. Eine politische Rendite warf der »Außerordentliche« darüber hinaus für die Arbeiterbewegung nicht ab.173 167 Steinmair, Priesterpolitiker 166. Ab 1923 kam mit Enrico Sibilla dann ein Bewunderer Seipels als Nuntius nach Wien. 168 DBFP XXIV 451 (24.12.1922). 169 DBFP XXIV 399 (10.11.1922). 170 Engel-Janosi, Vatikanische Gespräche 62. 171 Kohl, Theorie und Praxis 323 ff.; Marcus, Reconstruction 137. 172 Ich danke Gerald Kohl und Johannes Kalwoda für die Überlassung der Protokolle der Sitzungen vom 20.12.1922 und 25.1.1923 ; zur Debatte über die Teilnahme von Bundesräten vgl. KvVI, CS-Klub 21.11.1922. 173 Vgl. Kohl, Theorie und Praxis 328.
Das Feigenblatt : Der außerordentliche Kabinettsrat
129
Außerordentlich war am Kabinettsrat in erster Linie, dass er nicht – wie der ordentliche Kabinettsrat – nach dem Einstimmigkeitsprinzip der Ministerverantwortlichkeit funktionierte, sondern – wie das Parlament, aus dem er hervorging – mit einfacher Mehrheit entschied. Die Sozialdemokraten hatten ihre theoretisch vorhandene, aber politisch verderbliche Blockademöglichkeit im Nationalrat gegen eine zahnlose Opposition getauscht. Als Erfolg der Opposition war zu verbuchen, dass die Sitzungen des »Außerordentlichen« nicht vertraulich waren, wie ursprünglich vorgesehen, als Erfolg der Regierung, dass im Außerordentlichen keinerlei Obstruktionsmöglichkeit gegeben war, wie sie in normalen Ausschüssen des Nationalrats immer wieder praktiziert wurde. Der »Außerordentliche« musste seine Aufgaben vielmehr innerhalb eng gesteckter Fristen erledigen. Kam er binnen acht Tagen zu keiner Entscheidung, so traten die Verordnungen der Regierung automatisch in Kraft.174 Die Sozialdemokraten griffen nach dem Strohhalm, den Renners Initiative verkörperte. Jedenfalls war eine deutliche Entspannung zu konstatieren, »politics as usual«, wenn schon keine »Era of Good Feelings«. Auch die Offensive Dannebergs gegen die Agrarier, die um diese Zeit einsetzte, wies in dieselbe Richtung. Die Opposition war keineswegs so »fierce, irrational and personal« (Klemperer), wie es nach außen hin vielleicht den Anschein hatte.175 Seipel bemerkte im Ministerrat vom 9. November ironisch, Otto Bauer habe im Ausschuss so »kurz und sachlich« gesprochen, dass er sich veranlasst gesehen habe, »meine Parteigenossen zu warnen, sich von ihm nicht faszinieren zu lassen«.176 Zwei Tage später erzählte er dann, Wilhelm Ellenbogen – der sich vor allem um Garantien für den Fortbestand der »gemeinwirtschaftlichen Anstalten« bemühte – habe dem italienischen Mitglied der Völkerbunddelegation versichert, es bestehe keine ernste Absicht, das Genfer Werk tatsächlich zu Fall zu bringen.177 Am 13. November erschien die Führungsriege der Sozialdemokraten dann ganz offiziell bei den Delegierten.178 Diesmal delegierte der Parteivorstand das Problem auch nicht wie eine heiße Kartoffel resignierend an den Parteirat, sondern legte ihm bereits einen konkreten, konstruktiven Vorschlag vor : Die Fraktion werde selbstverständlich gegen die »Knechtungsverträge« stimmen, aber für das Verfassungsgesetz über den außerordentlichen Kabinettsrat, »welches unser Erfolg ist«. Otto Bauer lieferte die theoretische Untermauerung : Er wiederholte, was er schon am Parteitag gesagt habe : »Wir können
174 KvVI, CS Klub 24.11.1922 ; Kohl, Theorie und Praxis 325. Zur Debatte um die Obstruktion vgl. die Parteitagsrede vom November 1921 in Bauer, Werke V 255 f. 175 Klemperer, Seipel 203. 176 Vgl. Hanisch, Bauer 219. 177 AdR, MRP 67, 11.11.1922. 178 DAW, Seipel-Tb. 13.11.1922.
130
Der Weg nach Genf
Genf bei Strafe einer Hungersnot nicht werfen«. Die ›Muskete‹ brachte ganz in diesem Sinne auf der Titelseite eine Karikatur : »Adam Österreicher im Genfer Para deis«. Eva reicht ihm die (verbotene ?) Frucht, begleitet von den Worten : »Du hast keine andere Wahl, Männchen. Entweder Du beißt in diesen sauren Apfel – oder ins Gras !«179 Widerstand wäre allenfalls dann möglich gewesen, so Bauer, wenn sich infolge der »Weckung der moralischen Energien des Landes« eine bürgerliche Kraft gefunden hätte, die für eine Alternative zur Verfügung stand. Doch wie die Dinge lagen, habe zwar das Proletariat seine Pflicht getan, doch die besitzenden Klassen hätten »schmählichen Verrat« begangen. »Was, Travnicek, haben Sie sich denn erwartet ?«, konnte ihm jeder rechtgläubige Marxist da nur zurufen. Doch Bauer zollte Seipel das Kompliment, eine Ausnahmesituation herbeigeführt zu haben : Man stehe einer »Einheitsfront« gegenüber, »wie wir sie noch nie gehabt haben«. All die disparaten Gruppen der Bürger und Bauern seien zu einer »reaktionären Masse« zusammengeschweißt worden. (Ob er bei den Zolldebatten im schwarzen Klub vielleicht keine so optimistische – oder auch pessimistische – Ansicht gewonnen hätte ?)180 Berühmt geworden ist der Nachruf Bauers auf Seipel zehn Jahre später, im August 1932, als er ihn als den »einzigen Staatsmann europäischen Formats« würdigte, den die bürgerlichen Parteien hervorgebracht hätten : »So schicken auch wir dem großen Gegner drei Salven über die Bahre.«181 Wenn man zwischen den Zeilen las, hatte Seipel schon 1922 keinen größeren Bewunderer. Selbst die Formel vom »Verrat von Verona und Genf« war ein Kompliment in diesem Sinne. Seipel war gerade als gläubiger Katholik ein Agnostiker, was Regierungsformen anging. Ob ihn der Vorwurf des Landesverrats an der Republik wirklich so hart traf, besonders wenn er von Leuten erhoben wurde, die aus ihren Sympathien für den Hochverrat an der Monarchie keinen Hehl machten, steht dahin.182 (Renner formulierte es im Nationalrat dann unverbindlich-raffinierter : Paktieren »mit den Landesfeinden von gestern«.183) Vor allem aber, gipfelte Bauers Anklage in der bewundernden Sentenz, ohne Seipels Reisediplomatie – das »waghalsig-kühne, aber überaus geschickte außenpolitische Manöver« – wäre die Sanierung unter dem Diktat von außen eben doch nicht zustande gekommen. Für Bauer lag darin der Trost : Er hatte nur deshalb nicht recht behalten, weil hier unerwartete, außerordentliche Faktoren im Spiel waren. Seipels Biograph Klemens von Klemperer zollte dem Kanzler fünfzig Jahre später ein ähnliches, 179 Muskete, 20.10.1922. 180 VGA, PV 3, 21.11.1922 ; AZ, 23.11.1922, 1–3. 181 AZ, 3.8.1932, 3. 182 Vgl. Hanisch, Bauer 216. Der ›Bauernbündler‹ vom 24.10.1922 bemühte in diesem Zusammenhang die »Dolchstoßtheorie« : Nur dem Hochverrat der Sozialdemokraten vor 1918 habe man die jetzige Lage zuzuschreiben. 183 StPNR I 4599 (7.11.1922).
Das Feigenblatt : Der außerordentliche Kabinettsrat
Abb. 3 : (K)eine Qual der Wahl ? Aus : Die Muskete, Bd. XXXV, Nr. 11, Wien, 20.10.1922.
131
132
Der Weg nach Genf
ebenso mit einem Schuss von Bitterkeit gemischtes Kompliment : Seipel »played his hand well – almost too well.«184 Am 20. November verabschiedete der Ministerrat die Vorlage über den »außerordentlichen Kabinettsrat«. Bis zum 27. November musste das gesamte Programm erledigt sein. Seipel resümierte, die Sozialdemokraten stellten zwar immer weitere Forderungen, aber er hielt es für unwahrscheinlich, dass sie das Sanierungswerk »werfen« könnten. Er wolle sicherstellen, dass weder die Parteien noch die Völker bunddelegierten sich da auf weitere Zugeständnisse einließen. Wenn die Sozial demokraten irgendwelche Schwierigkeiten machten, werde er sofort Neuwahlen ausschreiben.185 In einer Nachtsitzung am Wochenende, bis Sonntag um halb sechs Uhr morgens, wurde das »Wiederaufbaugesetz« – und alles, was damit zusammenhing – am 25./26. November beschlossen. Die bürgerlichen Parteien hatten sich aus Termingründen während der Debatte äußerste Zurückhaltung auferlegt : Die AZ spottete über ihre Hauptredner, Miklas (»der das Pathos so liebt und eigentlich immer im höchsten Diskant redet«) und den Alt-Schönerianer Zeidler, der (»psychologisch hatte die Rede schon ihren Sinn«) dem heiklen Anschlussthema durch Exkurse in die Kriegs- und Vorkriegspolitik auszuweichen suchte.186 In letzter Minute ergaben sich Schwierigkeiten dann ausgerechnet im Bundesrat, der von den Bürgerlichen so herbeigesehnten zweiten Kammer, wo zwischen Regierung und Opposition damals ein Patt herrschte, 24 zu 24. Bei Stimmengleichstand galt jeder Antrag als abgelehnt. Die Geschäftsordnung sah vor, dass eine Vorlage als angenommen galt, wenn der Bundesrat binnen acht Wochen keinen Einspruch erhob. Doch so lange konnte man nicht warten. Aber Seipel gab sich völlig ungerührt. Er interpretierte das Vorgehen der Opposition als Obstruktion und folgerte : »Wer sich wie Opposition benimmt, wird wie Opposition behandelt.« Zwar müsse man den Sozi »zugute halten, dass sie in einer sehr schlechten Lage« seien. Aber er gab zu, er habe seine Freude daran, dass sie sich in eine Sackgasse manövriert hätten.187 Man solle sich da nicht auf irgendwelche Tricks einlassen oder zu Seitz pilgern. Er »stehe unbedingt auf dem Standpunkt, man dürfe den Sozialdemokraten jetzt nicht heraushelfen.« Er sei »in diesem Falle mehr Fatalist. Wenn sie es aber doch werfen wollen, wer weiß, wozu es gut ist.«188 Doch von der Bundesratsepisode gingen so oder so keine großartigen Weichenstellungen mehr aus. Die Debatte wiederholte sich als Farce. Seipel erschien im Bundesrat und fand verständnisvolle Worte für die Opposition. Die AZ höhnte : 184 Klemperer, Seipel 210. 185 AdR, MRP 67, 20.11.1922. 186 AZ, 25. & 27.11.1922. 187 KvVI, CS Klub 26.11.1922 (14 h). 188 AdR, MRP 67, 28.11.1922 (fol. 132 v).
Das Feigenblatt : Der außerordentliche Kabinettsrat
133
»Am Sonntag hat der Prälat gedonnert. Am Mittwoch säuselte er.«189 Die Sozialdemokraten taten der Regierung den Gefallen, einen Ablehnungsantrag zu stellen. Damit auch tatsächlich ein gültiger Beschluss zustande kommen konnte, verließen die Bürgerlichen den Saal. Denn der Einspruch des Bundesrates konnte umgehend durch einen Beharrungsbeschluss des Nationalrats zurückgewiesen werden. Eine Unklarheit entstand dann noch darüber, ob ein solcher Beschluss bei einem ja schon einmal durchberatenen Gesetz eine dritte Lesung erforderlich mache. Präsident Weiskirchner hielt das für nicht nötig, wollte es daran aber auch nicht scheitern lassen. So wurde das »Genfer Werk« in einer »Fünfminutensitzung« am Sonntag, 3. Dezember 1922, in aller Form endgültig verabschiedet.190 Wie sich die Genfer Protokolle und das Wiederaufbaugesetz in der Praxis auswirkten, darauf werfen die Debatten des Ministerrats in den nächsten Wochen ein bezeichnendes Licht – bezeichnend deshalb, weil sich aus ihnen ganz unterschiedliche Schlussfolgerungen ableiten ließen. Bereits achtundvierzig Stunden nach der »Fünfminutensitzung« hielt Seipel seinen Ministern eine Standpauke, die allen Klischees Marke Finanzdiktatur gerecht wurde : Avenol und die anderen Völkerbunddelegierten wollten Taten sehen. Man müsse jetzt durch eine »eklatante Tat den ernstlichen guten Willen zu einer durchgreifenden Verwaltungsreform und einschneidenden Ersparungsmaßnahmen unter Beweis stellen.« Dazu gehöre auch die »Schaffung einer mit Imperium ausgestatteten Instanz zur Durchsetzung eines einheitlichen Ersparungsplanes«.191 Hornik kam auf diesem Weg als Ersparungskommissar wieder zu Ehren, allerdings nicht wirklich zu einem Imperium. Sein Imperium vergrößerte vielmehr Kienböck : Ausdrücklich war die Rede von einer vermehrten Ingerenz des Finanzministeriums. In einer Frontstellung, die sich in den nächsten Jahren noch oft wiederholen sollte, krachte Kienböck auch prompt bereits in den nächsten Tagen mit Buchinger zusammen, dem Ackerbauminister, der sich mit der Weinbausteuer nicht abfinden wollte, sondern bestenfalls ein Viertel der vorgeschriebenen Höhe zu akzeptieren bereit war. In der Fraktion mochten die Agrarier die Hälfte der Abgeordneten ausmachen, im Kabinett blieb Buchinger isoliert. Vizekanzler Frank sekundierte Kienböck : »Wenn die Regierung gleich beim ersten Schritt zur Verwirklichung des Wiederaufbaugesetzes am Widerstand der Agrarier scheitere, so wäre das ganze Sanierungsprogramm damit überhaupt abgetan.« Seipel hatte die Agrarier bisher wohlweislich pfleglich behandelt (man erinnere sich an das »Wer mit mir verhandelt, erreicht etwas !«), aber jetzt war »Schluss mit lustig«. Seipel votierte für Kienböck. Buchinger drohte mit seinem Rücktritt, trat dann den Rückzug vom Rücktritt an, er werde sich vorher mit 189 AZ, 30.11.1922. 190 RP, 30.11.1922, 2 ; 1.12.1922, 1 ; 3.12.1922, 2 ; 4.12.1922 ; Marcus, Reconstruction 129, 428. 191 AdR, MRP 68, 5.12.1922.
134
Der Weg nach Genf
Fink und Stöckler besprechen. Das Kabinett hielt fest, man hätte selbstverständlich nichts gegen eine solche Rücksprache, aber der Beschluss falle bereits jetzt.192 Zwei Tage später, knapp vor Weihnachten, ging es um die Konstituierung der Nationalbank, genauer gesagt um die Frage, wer das Präsidium übernehmen solle. Die Engländer und der Generalkommissar wollten an diese Stelle – zumindest für einen gewissen Beobachtungszeitraum – einen Ausländer hinsetzen.193 Kienböck hielt diesen Wunsch vom geschäftlichen Standpunkt aus für begreiflich, Handelsminister Kraft fügte schüchtern hinzu, auch bei der Industrie würde eine solche Ernennung viel Anklang finden (wenn auch nicht bei seiner Partei). Doch Seipel nahm Frank als berufenem Vertreter großdeutscher Bedenken das Wort aus dem Mund : Ein Ausländer komme nicht in Frage. »Es ist die neue Linie unserer Politik, dem Auslande gegenüber nicht als Bettler dazustehen, sondern ihm zu zeigen, dass wir eine eigene Meinung haben.« Die »Formel Seipel« lautete : Der Belgier Janssen als Berater der Nationalbank – mit seinen »Vordienstzeiten« als Vorsitzender der Völkerbunddelegation in Wien – genüge vollkommen. (Zum Schluss trat an seine Stelle ein Schweizer.) Präsident sollte entweder Ministerialrat Thaa werden (ein ehemaliger Regierungskommissar der Österreichisch-Ungarischen Bank, den beide Parteien schon früher in der Bankfrage konsultiert hatten194) oder noch besser Richard Reisch, der Direktor der Bodencreditanstalt. Anfangs habe er auch an seinen ehemaligen Kollegen im letzten Kabinett Kaiser Karls, den Handelsminister Friedrich von Wieser gedacht, den letzten Ausläufer der österreichischen Schule der Nationalökonomie, doch einer solchen Koryphäe könne man keinen ausländischen Fachmann als »Koadjutor« zumuten. (Außerdem wäre er als ehemaliger Professor in Brünn bei den Tschechen nicht beliebt.) Waber dürfte gegen den Koadjutor in seiner üblichen Art und Weise »der zwei Meinungen« ebenfalls »gemeckert« zu haben. Aber auf die direkte Frage des Kanzlers antwortete er erwartungsgemäß, das sei alles nur ein Missverständnis : »In der jetzt dargelegten Weise kann man es schon machen …« Im Hintergrund stand die Sorge um das pünktliche Eintreffen nicht des großen Kredits, sondern der Überbrückungskredite, die bis dahin die Lücken füllen sollten. Seipel gab eine Probe seiner von Schüller gerühmten Fähigkeit zu überraschenden Schlussfolgerungen. »Ich bin in der Sache nicht im geringsten beunruhigt. Es gehört zu den Sorgen des Finanzministers, wie er von einer Woche zur anderen kommt.« Ein Inländer würde sich noch viel skrupulöser an die Vorgaben halten müssen, auf keinen Fall wiederum neue Banknoten drucken zu lassen. Unter Berufung darauf werde es ihm deshalb im Notfall leichter fallen, »die Westmächte zu Aushilfen zu 192 AdR, MRP 70, 19.12.1922. 193 DBFP XXIV 384 (Blackett an Niemeyer 31.10.1922). 194 KvVI, CS-Klubvorstand zusammen mit GD, 15.10.1922.
Das Feigenblatt : Der außerordentliche Kabinettsrat
135
zwingen«. Außerdem kam dem Prälaten der neue italienische Ministerpräsident Mussolini zu Hilfe, der gegen einen Ausländer als Notenbankpräsidenten sein Veto einlegte (es sei denn, er wäre Italiener). Kienböck fand diesen Protest der Italiener zwar »nicht berechtigt und ungehörig«, aber es galt, wenn auch in einem ganz anderen Sinne als bei Klerikern meist üblich : Roma locuta, causa finita.195 Reisch blieb Präsident der Nationalbank. Ob er tatsächlich immer so viel skrupulöser vorging als jeder ausländische Kandidat, ist fraglich. Montagu Norman jedenfalls war mit ihm schon bald äußerst unzufrieden, weil er die Bankrate 1924 auch nach den Turbulenzen an der Börse niedriger hielt, als es die Bank of England für gut hielt.196 Allzu »billig« waren Kredite in Österreich freilich auch dann nicht. Der Staat durfte ohne Zustimmung des Generalkommissars keine neuen Anleihen aufnehmen (einen Teil der Völkerbundanleihe aber sehr wohl für Investitionen verwenden). Die Bestimmung war vom Standpunkt der Gläubiger aus verständlich, nährte allerdings den Verdacht (oder die Verschwörungstheorie ?), die Tschechoslowakei habe diesen Paragraphen durchgesetzt, weil der Ausbau der österreichischen Wasserkraft ihren Kohleexport schädige.197 Die Unternehmer beschwerten sich, die Wiener Großbanken verliehen ihr Kapital nicht an sie, sondern lieber nach Galizien oder Rumänien, um ihre Vorkriegspositionen dort aufrechtzuerhalten, koste es, was es wolle. Das sanierte Österreich war in den Mühen der Ebene angekommen, eine Sanierung nicht allein der Finanzen, sondern der gesamten Volkswirtschaft, vielleicht sogar der Seelen …
195 AdR, MRP 70, 21.12.1922 ; DBFP XXIV 443, 449 (Berichte Keelings & Akers-Douglas 21. & 22.12.1922) ; Marcus, Reconstruction 147–150, 433 f.; Malfer, Wien und Rom 130 f. 196 Marcus, Reconstruction 179 f., 231 ff.; Berger, Rost van Tonningen 98 ; Kernbauer, Währungspolitik 77. 197 AdR, GDVP 3, Klub 23.10.1922 ; Weber, Krach 49.
V. Resümee Die »Genfer Sanierung« war ein Pilotprojekt nicht bloß des jungen Völkerbunds, der sich nach Aufgaben sehnte, die zu bewältigen waren, sondern auch in der Disziplin der Inflationsbekämpfung, die seither noch viele Durchgänge erlebt hat. Der Verfasser hatte das Glück, vor bald einem halben Jahrhundert in der Vorlesung von Erich Streißler zu landen, und hat sich ein nostalgisches Interesse an Nationalökonomie bewahrt. Es wäre dennoch mehr als vermessen, zu Lektionen in angewandter Inflationstherapie auszuholen. Seipel wäre der erste gewesen, der all solches Theoretisieren verworfen hätte. Freilich, auch sein Primat der Psychologie, des Vertrauens, kommt auf sich gestellt der Theoriebildung schon wieder bedenklich nahe. Feststellen lässt sich auf alle Fälle : Die Hyperinflation wurde gestoppt, die Notenpresse ab dem 18. November 1922 – nach über acht Jahren angestrengter Tätigkeit – endlich stillgelegt.1 Beckmesser könnten einwenden : Die Inflation war schon zwei Monate vorher rückläufig ; obwohl die alte Bank fleißig weiter Noten druckte, blieben die Kurse ab dem 2. September – wie Seipel gerne betonte – stabil, etwa 10 % über dem Tiefststand.2 Die Inflation zog 1923 dafür auch wieder etwas an. Für das erste Halbjahr 1923 verzeichnete man immerhin einen Preisanstieg von 25 %. Das Fluchtkapital, das in die Heimat zurückströmte, befeuerte eine Aktienhausse, die 1924 – nach dem Scheitern der Spekulation gegen den Franc – dann wiederum mit Katzenjammer endete.3 Über die Fähigkeiten der Österreicher, welche die große Anleihe verhandeln sollten, fällte Niemeyer ein vernichtendes Urteil. Die eigentliche Arbeit habe Montagu Norman leisten müssen. Doch die Anleihe erwies sich als Erfolg, der alle Erwartungen übertraf. Die finanzielle Garantie hatten zu gleichen Teilen England, Frankreich, Italien und die Tschechoslowakei übernommen ; das Kapital zeichnete zu über einem Drittel die Bank of England, danach kam das Haus Morgan.4 Für die Anleger war die Anleihe – bei einem Zinssatz von fast 10 % – ein gutes Geschäft. Österreich hatte freilich auf dem Recht bestanden, die Anleihe zu »konvertieren«, sprich : das Geld frühzeitig zurückzuzahlen, wenn einem jemand das Kapital zu niedrigeren Zinsen zur Verfügung stellte. So könne man vorgehen, trösteten sich die Großdeutschen
1 Kernbauer, Währungspolitik 59. 2 DBFP XXIV 425 (Phillpotts 30.11.1922) ; Geßl (Hg.), Seipels Reden 40, 320. 3 DBFP XXIV 720 (Bericht Akers-Douglas 15.6.1923) ; Kernbauer, Währungspolitik 112 ; Weber, Krach 113, 133. 4 DBFP XXIV 520 (Niemeyer an Zimmermann 24.2.1923), 719 (Akers-Douglas 15.6.1923) ; vgl. auch Clay, Norman 189 ; Lojko, Meddling in Middle Europe 70.
Resümee
137
zwischen den Zeilen, sollte sich z. B. über Nacht der Anschluss doch als möglich erweisen.5 Mit oder ohne Anschluss, zu solchen großen Sprüngen war Österreich nicht in der Lage. Doch der »Alpendollar« – der 1925 neue eingeführte Schilling – erwies sich als stabile Währung. Das Budget wurde saniert, ausgeglichen – freilich auf einem viel höheren Niveau als von den Völkerbundexperten gefordert, sprich : Es wurde »einnahmenseitig« saniert, beim Sparen »haperte« es nach wie vor. Die ›Neue Freie Presse‹ kritisierte eine »Politik, die darauf ausging, brutal die Einnahmen zu erhöhen und Einsparungen so gut wie gänzlich zu vermeiden.«6 Vor allem die »Ausgliederung« der Bundesbahnen erwies sich in dieser Beziehung als Fehlschlag. Unter dem Budget war im ersten Durchgang bloß der Haushalt des Bundes verstanden worden, das Problem des Finanzausgleichs und der Länderfinanzen bewog Seipel dann 1924–1926 zu einem taktischen Rückzug aus dem Kanzleramt.7 Das Zahlungsbilanzdefizit blieb erhalten, und das in einem gar nicht einmal so viel kleineren Ausmaß als 1921/22 – ein weiteres Argument gegen alle monokausalen Erklärungsmuster, warum es denn so weit hatte kommen müssen … Seipels Rezept war ganz einfach, aber wenig populär, wie er es seinen Zuhörern bei einem Vortrag in Paris erläuterte : »Steuern erhöhen, Ausgaben herabsetzen, das ist das ganze Geheimnis.«8 Das »Versagen des Auslandes«, das einer seiner Bewunderer ins Treffen führte, kam bei ihm nur in einem Punkt ins Spiel : Die Nachbarn hätten bei dem »seit 1922 geführten Kampf um die Wirtschaftsfreiheit« nicht mitgezogen und die Wirtschaft der jungen Staaten damit zum bloßen »Vegetieren« verurteilt. Verantwortlich machte er dafür in erster Linie das politische Misstrauen, das jeder wirtschaftspolitisch sinnvollen Maßnahme gleich irreversible außenpolitische Weichenstellungen unterstellte, vom Anschluss bis zur Donaukonföderation. »Die Tatsachen des Wirtschaftslebens sind die stärksten Widersacher der jetzigen Ordnung in Europa«9 – und umgekehrt. An die Genfer Sanierung hat sich in Zeiten des Vollgefühls keynesianischer Machbarkeitsphantasien, in Good King Bruno’s Golden Days, die Polemik geknüpft, das Budget sei zwar saniert, die Volkswirtschaft aber kaputtgespart worden, bis zum Schluss der ganze Nibelungenschatz der Nationalbank dem großen Bruder im Norden anheimgefallen sei, der auf Teufel komm raus Vollbeschäftigungspolitik betrieben und damit die Massen bezirzt habe. Les extrêmes se touchent : Schöpfer, vermutlich sogar Miklas hätten beifällig genickt – und damit vielleicht doch nicht ganz 5 6 7 8 9
KvVI, CS-Klub 18.10.1922 ; AVA, GDVP 3, Klub 23.10. & 3.11.1922. NFP, 3.4.1923 (Nachruf Rosenberg !). Zu diesen Jahren vgl. die Studien von Fiedler und Schausberger. Geßl (Hg.), Seipels Reden 319. Geßl (Hg.), Seipels Reden 183, 186.
138
Resümee
das Gleiche gemeint. Denn »deficit spending« stand weder bei ihnen noch bei den Sozialdemokraten der zwanziger Jahre in hohem Ansehen. Seipels ursprüngliches Programm vom Mai hatte allerdings mehr auf die Belebung von Exporten und Produktion gesetzt – doch gerade in diesen Punkten stießen seine Vorschläge, wie zu erwarten, auf den besonderen Widerstand der Sozialdemokratie. Seipel berief sich wie Bismarck, doch in einem ganz anderen Kontext und aus einer zwangsläufig ganz anderen Perspektive, auf »Realpolitik« – im Gegensatz zur »Prestigepolitik«. »Wir stellten uns entschlossen auf den Boden der Realpolitik. Eine Politik des Träumens und Trutzens durfte es nicht mehr geben.«10 Realpolitik hieß Offenheit : über die Mittel und Wege. Man müsse bereit sein, jene Wege zu gehen, die sich am raschesten eröffneten, ohne »uns vor dem Tag der Reife eigensinnig auf eine gewisse Formel festzulegen«. Seipels Gottvertrauen war kein rein passives : Man dürfe sich nicht auf die Vorsehung verlassen – und auch nicht »irgendwelchen Einrichtungen, die vorübergegangen sind, nachtrauern und warten, bis sich alles ändert. So will es Gott nicht.« Man dürfe nicht beiseitestehen, denn »Gott hat uns eine besondere Aufgabe zugewiesen, indem er uns einen solchen Zeitenbruch miterleben ließ.«11 Es ist leicht, die politischen Legenden und Schlagworte zu »dekonstruieren«, die sich an Genf knüpfen und zum Teil wiederaufgewärmte zeitgenössische Polemiken darstellen. Natürlich hält das weinerliche, allenfalls AZ-Polemiken geschuldete und von Apologeten der Christlichsozialen kurioserweise gern übernommene »Narrativ« von Österreich, das auf den Status einer Kolonie zurückgefallen sei, einer genauen Überprüfung nicht stand. Blacketts lockere Bemerkungen wurden keineswegs eins zu eins in die Praxis umgesetzt. Wie Seipel selbst später spottete : »Schulden machen ist offenbar nicht gegen die nationale Würde. Wenn das Geld zurückverlangt wird, das ist gegen die nationale Würde.«12 Seipel war ein Bewunderer der »elastischen Konstruktion des britischen Weltreiches«.13 Als Generalkommissar »regierte« freilich kein britischer Vizekönig, sondern Alfred Zimmermann, ein Bürgermeister von Rotterdam, der von Montagu Norman favorisiert wurde, aber schon im Frühjahr im Gespräch gewesen war.14 In vieler Beziehung vertrat Zimmermann österreichische Interessen (gegen seine Auftraggeber ?) ; in anderen Fragen wurde er ignoriert oder umgangen. 10 Geßl (Hg.), Seipels Reden 318 ; Balfour hatte sich im Vorfeld von Versailles und Saint Germain ganz ähnlich geäußert : »We have to guard against the danger of being supposed to use our principles to further our fancies.« Er sprach sich damals übrigens auch gegen das Anschlussverbot aus ! Adams, Balfour 342, 447 f. 11 Geßl (Hg.), Seipels Reden 187, 324, 272, 86. 12 Freiheit, 10.10.1931 ; vgl. auch die Schlußfolgerungen bei Marcus, Reconstruction 111 f. 13 Geßl (Hg.), Seipels Reden 180. 14 Clay, Norman 187.
Resümee
139
Die Regierung Seipel war keineswegs der »Musterknabe« des Völkerbundes, als die sie gerade ihre Kritiker hinstellten. Als Zimmermann am Beginn seiner Mission, als esh um die Überbrückungskredite ging, die mangelnde Bereitschaft der Österreicher zu Einsparungen im öffentlichen Dienst beklagte, appellierte Seipel bei der Pariser Tagung des Völkerbundrates Ende Jänner 1923 über seinen Kopf hinweg an die Kameraderie der Kollegen, die er einst als berufsmäßige Demagogen bezeichnet hatte. Er spreche hier als Politiker zu Politikern, die seine Schwierigkeiten verstehen würden. Als Kanzler müsse ihm ein gewisser Spielraum eingeräumt werden, was den Zeitpunkt und die Methode der Reformen betreffe. Der alte Fuchs Balfour ging auf die Eröffnung ein : Es gebe keinen Grund zum Pessimismus. Er bestätigte, Seipel habe alles getan, was nur möglich sei. Gerade deshalb bitte man ihn jetzt, auch das Unmögliche zu bewerkstelligen – und er sei sich sicher, dass Seipel auch das zustande bringen werde.15 Die Finanzdiktatur war am effektivsten dann, wenn Seipel und Zimmermann einer Meinung waren – so war es auch gedacht. Der Bluff mit der Drohung, er werde die Auszahlungen der Kredite sperren, den Young noch für Schober in Stellung gebracht hatte, verlor immer mehr von seiner Wirksamkeit. Gewiss, es gab Beschwerden z. B. der Großdeutschen, Zimmermann lege ein »kleinliches Gebaren an den Tag«. Doch wenn man den Klagen nachgeht, so wurde dafür keineswegs der Hochmut des Generalkommissars verantwortlich gemacht, sondern der Einfluss seiner »Hintermänner« – österreichischer Beamter wie Hornik, die sich um die kleinsten Dinge kümmerten.16 Selbst wenn Seipel und Zimmermann einmal nicht einer Meinung waren, konnte der Völkerbund immer noch als Sündenbock wertvolle Dienste leisten, als Ausrede, warum das eine oder andere sich leider nicht machen lasse. Dieser politische Mechanismus wird Beobachter der schizophren-hintergründigen Europhilie unserer Tage nicht wirklich überraschen. Viktor Reimann hat Seipel (und Bauer) »als zu groß für Österreich« bezeichnet. Natürlich, sie waren beide in der alten Monarchie aufgewachsen und einer »Internationale« verpflichtet, die nicht in Legislaturperioden dachte, sondern in Jahrhunderten.17 Aber Seipel hatte dabei doch die Metamorphose vom ohnmächtigen Reichsreformer zum Anwalt eines nahezu ebenso ohnmächtigen Kleinstaates überzeugend bewältigt. In der Habsburgermonarchie waren imperiale Außenpolitik und cisleithanische Innenpolitik streng getrennte Welten gewesen. Seipel entwickelte sich zum Virtuosen in der Kunst, die beiden Sphären gegeneinander auszuspielen und wechselseitig zu instrumentalisieren. Er manipulierte nie ganz so durchsichtig wie Schober, aber er gab seiner Analyse
15 DBFP XXIV 491 f. (Phillpotts an Akers-Douglas 31.1.1923). 16 AdR, GDVP 3, Klub 27.3.1923 (Schürff, Hampel). 17 Vgl. Engel-Janosi, Vatikanische Gespräche 40.
140
Resümee
von Genf in der Heimat einen gewissen Spin – und vice versa.18 Die jüngste Analyse der Rekonstruktionspolitik kommt deshalb auch zu dem Schluss : »In a way, Seipel and Kienböck had managed to both have their cake and eat it.«19 »Seipel als Überwinder der Staatskrise vom Sommer 1922«, so lautet der Titel der ersten wissenschaftlichen Studie zum Thema, die Gottfried Ladner in den sechziger Jahren auf Grund der Völkerbundakten verfasste. (Für die Ministerratsprotokolle bedurfte er damals noch spezieller politischer Schützenhilfe.) Mit einem gehörigen Schuss patriotischer Empörung sprach Ladner von der »Staatskrise im August, die durch das Versagen des Auslands ausgelöst wurde«.20 Versagen des Auslandes ? Da konnte er sich auf die einschlägigen Klagen Hausers und an derer berufen, die sich von der Entente »gefoppt« fühlten. Doch die Alimentierung von Ländern, die ihre Finanzen nicht in Ordnung zu bringen vermögen, gehörte zumindest damals nicht zu den Pflichten der »internationalen Gemeinschaft«. Es scheint, als habe Ladner da Gefallen gefunden an der Fixierung auf Opferrollen, die in unseren Tagen solch unfröhliche Urständ feiert. Der Nimbus des »Mannes der Vorsehung«21, den Seipel nicht bloß in kirchlichen Kreisen genoss, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, ja vielleicht sogar unterstreichen, dass es sich bei seinen außenpolitischen Erfolgen um Nischenprodukte handelte, die im richtigen Moment in die Scheune gebracht werden mussten, um Brosamen, die vom Tisch der Mächtigen fielen, wenn sie gerade einmal nicht von wichtigeren Materien in Anspruch genommen wurden. Seipel ließ sich in dieser Beziehung nicht in die Karten schauen. Wie es ein Heimwehrführer später prägnant formulierte, wisse man ja nie, auf welches Pferd der Prälat wirklich setze.22 Das war als ambivalentes Kompliment für seine taktische Raffinesse gedacht. Freilich : Zumindest in der Situation des Jahres 1922 konnte es sich der Kanzler auch gar nicht leisten, alles auf eine Karte zu setzen. Er bat seine Parteifreunde in der »Valutahausse« vom Juni 1922 ausdrücklich um Entschuldigung : »Für mich ist die Frage nicht gelöst, für mich gibt es verschiedene Varianten …«23 Überwunden hat Seipel die Staatskrise nicht zuletzt, indem er sie in einem ersten Zug dramatisiert hat. Seipel setzte nicht auf Frankreich, wie es den Christlichsozialen oft vorgeworfen wurde, aber er war in dieser Beziehung unvoreingenommen. Mit England ergab sich inhaltlich die meiste Übereinstimmung, aber auch die größte Herausforderung, weil das Empire sich durch die Aussicht auf Turbulenzen in Mit-
18 Diese Überlegungen auch schon bei Höbelt, Provisorium 366. 19 Marcus, Reconstruction 174. 20 Ladner, Staatskrise 7, 105. 21 Engel-Janosi, Vatikanische Gespräche 94 ; Iber, Sotto il fascino 313. 22 Kerekes, Abenddämmerung 65. 23 KvVI, CS-Klub 12.6.1922.
Resümee
141
teleuropa am allerwenigsten ins Bockshorn jagen ließ. Wer zwischen Krisen von den Meerengen bis Shanghai wählen durfte, nahm den geheimnisumwitterten jugoslawischen Aufmarsch im Miestal nicht ganz so tragisch. Es erscheint dabei übrigens keineswegs völlig ausgeschlossen, dass Seipel die Währungsunion mit Italien als Alternative – als Plan B – nicht doch ernsthaft ins Auge gefasst hat. Gegenüber seinen oft etwas verklärten außenpolitischen Aktionen hat Seipel als Innenpolitiker viel weniger Zuspruch erfahren – zu Unrecht. Gerade die Bewunderer der »Schönheit« der »Kelsen-Verfassung« müssten ihm Kränze flechten. Denn er strebte ziemlich konsequent die einzig mögliche stabile Regierung an, die sich auf der Grundlage dieser Verfassung – und der politischen Realverfassung des Landes – bilden ließ. Ins Treffen geführt wird dagegen – meist unterschwellig und doch stets präsent – die Große Koalition oder eine »Konzentration«, die eben nur ein Rezept für Ausnahmesituationen war. In allen Parteien finden sich genügend Hinweise, dass man eine solche Alternative bisweilen in Betracht gezogen, aber verworfen hat, nicht zuletzt mit Rücksicht auf die Stimmung der Anhänger und Wähler. Als Alternative blieb nach Lage der Dinge bloß der »Bürgerblock«, der so selbstverständlich schien, wie er danach oft verteufelt wurde. Damit einher ging eine weitgehende Emanzipation des österreichischen Bürgertums vom sozialdemokratischen Kuratel der unmittelbaren Nachkriegszeit. Wenn Seipel seinem Klub immer wieder suggerierte, dass es den Sozialdemokraten ja eigentlich lieber wäre, »draußen« zu bleiben, hat er eine Komponente ihrer Politik möglicherweise überbetont. Leider sind wir über die Entscheidungsfindungsprozesse bei den Sozialdemokraten in diesen Jahren weit weniger gut informiert als bei den bürgerlichen Parteien. Renner als dem »üblichen Verdächtigen« wurde sehr wohl nachgesagt, er peile wiederum eine Koalition an. Seitz scheint im Herbst eine Zusammenarbeit in Erwägung gezogen zu haben, sobald sich die sozialdemokratische Annahme vom Scheitern der Genfer Aktion als Fehlspekulation herausstellte, vor allem aber, seit die Taktik nicht mehr aufging, die sich in den letzten Jahren so bewährt hatte – als stiller Teilhaber auch bei formell bürgerlichen Kabinetten ein großes Maß an Mitsprachemöglichkeiten zu bewahren. Genau diesem Zustand wollten Seipel und Dinghofer aber ein Ende setzen – und Seipel ging davon aus, auch Otto Bauer wären derlei klare Fronten eigentlich lieber als »schlampige Verhältnisse«. Eine Große Koalition oder Konzentrationsregierung war zumindest theoretisch jederzeit möglich, eine zentristische Koalition (nach dem schwarz-rot-goldenen Muster von Weimar) war es nicht, weil die Lager in Österreich dafür zu festgefügte Einheiten darstellten, oder wie Seipel einmal sagte : »Wir haben zu wenige Parteien.« In Deutschland oder Frankreich blieben Kommunisten und Monarchisten, überzeugte Linke und Rechte außen vor. Da blieb dann gerade noch eine knappe Mehrheit in der Mitte übrig. Eine solche Regierung war keineswegs sehr stabil, sie
142
Resümee
musste an den Rändern stets nachjustiert werden, die Gewichte innerhalb der Koalition verschoben sich ständig. In Österreich gab es nur ein Entweder-oder : Die großen Parteien der Linken und der Rechten konnten entweder ganz oder gar nicht in eine Regierung eintreten. Die österreichischen Lager waren nicht wie die deutschen in mehrere Fraktionen gespalten, nicht wie die französischen Mitte-rechts-Fraktio nen in ständiger Auflösung und Neuformierung begriffen oder wie die Radikalen Mitte-links zu einem »getrennten Marschieren« bereit.24 Auffallend war weniger die Bildung des Bürgerblocks, sondern wie lange es gebraucht hatte, um diese Konstellation zustande zu bringen. Die Debatten des Jahres 1922 belegen zweifelsfrei : Der Bürgerblock konnte auf die Unterstützung der überwältigenden Mehrheit beider Parteien zählen (und auf die kokette Zustimmung der dritten, der »Bündler«). Es waren nur die ideologischen Gralshüter, die Schönerianer auf der einen Seite, christlichsoziale Arbeitervertreter auf der anderen Seite, die mit dieser Lösung nicht zufrieden waren – in beiden Fällen übrigens weniger, weil man einander in Kulturkampf- oder Anschlussfragen misstraute, sondern weil beide – das war beinahe wieder ein verbindendes Element – von antikapitalistischen Ressentiments erfüllt waren. Eine Pikanterie am Rande war, dass in letzter Minute gerade die prädestinierten Anhänger des Bürgerblocks, die »Wirtschaftslobby« hüben und drüben, Sand ins Getriebe streuten, weil sie einander das Handelsministerium nicht gönnten. Seipels Leistung war es, diese Kombination nicht bloß als Augenblickskonstellation zu realisieren, sondern über ein Jahrzehnt beisammen zu halten. Der oberösterreichische Landesobmann der Großdeutschen, Franz Langoth, als einer der vornehmsten Befürworter der Koalition schrieb noch Jahrzehnte später : »Seipel besaß das Format eines Staatsmannes, der wusste, dass sein Partner das Koalitionsverhältnis nur tragen kann, wenn auch seinen politischen Bedürfnissen entsprechend Rechnung getragen wird.«25 Dieser Balanceakt gelang Seipel, weil er zwar der unbestrittene Führer der Christlichsozialen war, aber bis zu einem gewissen Grad über den Parteien schwebte. Hauser berief sich auf dem Parteitag 1920 auf den Gründervater Lueger : »Er ist nicht der Schutzgeist einer Strömung in der Partei. Er gehört uns allen.«26 Über Seipel – auch wenn er als Versammlungsredner unermüdlich war – ließe sich zugespitzt sagen : Er gehörte keiner Strömung. Ein Beobachter kam ein paar Jahre später zu dem paradoxen Schluss, Seipel genieße keine rechte Unterstützung in seiner Partei, aber manchmal »kommt [es] mir vor, dass gerade darin seine Stärke liegt …«27 24 Poincaré z. B. wurde von einem Flügel (unter Albert Sarraut) der Radicaux unterstützt, das Gros (unter Edouard Herriot) enthielt sich der Stimme ; vgl. Roth, Poincaré 400 ff. 25 Langoth, Kampf 53. 26 Kriechbaumer (Hg.), Protokolle 80 (28.2.1920). 27 AVA, E/1791, Wildner-Tb. 30.9.1924.
Resümee
143
Er war nicht unbestritten, weil alle immer seiner Meinung waren – die eigene Partei hat ihm in dieser Beziehung auf die Dauer wohl mehr Kopfzerbrechen bereitet als der Koalitionspartner –, sondern weil es zu ihm keine Alternative gab ; weil er die verschiedenen Gruppen und Strömungen in einer souveränen Weise beherrschte. Bei den Großdeutschen war es von vornherein klar, wo die Schwierigkeiten lagen : Beim Kulturkampf und bei jeglicher allzu vollmundigen Demonstrationspolitik in puncto Anschluss. Man hatte sich auf einen Waffenstillstand in beiden Fragen geeinigt, der grosso modo hielt. Nur im ganz anders gearteten Biotop des Burgenlandes waren Kulturkampffragen ab und zu Thema, in außenpolitischen Fragen wahrte die Partei Disziplin, nicht einmal diverse sozialdemokratische Initiativen während der Ruhrkrise vermochten da Unruhe hervorzurufen. Als das Kabinett im Frühjahr 1923 um zwei Minister verkleinert wurde, gewann die Koalition ihre bleibende Gestalt.28 Seipel wurde Waber jetzt doch noch los (und übernahm selbst das Innere), und er wurde auch das Verkehrsressort los, das mit dem Handel zu einem Monsterressort vereinigt wurde, das Schürff übernahm, dem schon im Mai 1922 solche Kränze geflochten worden waren (bis auf die Leute Stöcklers).29 Die unentwegten letzten Schönerianer schieden nach den Wahlen 1923 aus der großdeutschen Fraktion aus, auch die letzten Bauern schlossen sich dem Landbund an. Die Bauern hatten in Oberösterreich und Salzburg eine wichtige »pressure group« gebildet, die für eine bürgerliche Koalition eintrat – doch sie galten schon als Landbündler, seit mit der Stabilisierung der Krone die Landwirtschaft in die Krise geriet und die Kritik an der Regierung aus dieser Ecke zunahm. Die großdeutsche Politik drehte sich in Zukunft fast ausschließlich um die Brennpunkte Industrie und Beamtenschaft. Die Industrie im Westen, in Oberösterreich, Kärnten, Tirol und Vorarlberg, war eng mit den Großdeutschen verknüpft ; in der Steiermark sollte Seipel ihnen dann 1923 den besten Mann für den Nationalrat abwerben, Emanuel Weidenhoffer. Das Handelsressort war inzwischen doch fixer Besitzstand der Großdeutschen geworden. Die Beamten hatten manche bittere Pille zu schlucken, doch gerade Beamte waren empfänglich dafür, dass es für sie ohne Rückendeckung innerhalb der Regierung bloß noch ärger werden würde. Es gab Intrigen und Querelen – wie Wabers Fehden mit Gott und der Welt oder die Revolte gegen Seipels getreuen Dinghofer, die ihn 1928 zum Rückzug in den Obersten Gerichtshof bewegte –, aber die Koalition hielt, bis sie in der Weltwirtschaftskrise am 13. Monatsgehalt zerbrach (und einmal mehr an Schober, diesmal – tempora mutantur ! –, weil ihn die Großdeutschen nicht im Stich lassen wollten).
28 Über die diversen Überlegungen in diesem Zusammenhang vgl. AVA, GDVP 3, Klub 21.3., 27.3. & 17.4.1923. 29 KvVI, CS-Klub 30.5.1922.
144
Resümee
Viel farbiger und faszinierender noch verliefen Seipels Beziehungen mit der eigenen Partei : Die Protokolle der ersten Jahre lassen dabei ein Bild entstehen, das von den gängigen Stereotypen abweicht, die sich aus den Kontroversen der Jahre ab 1929 ableiten, als Heimwehr und Verfassungsnovelle neue Herausforderungen boten. Bei den Großdeutschen blieb Dinghofer als Obmann im Klub, Frank ging in die Regierung ; bei den Christlichsozialen ging Seipel in die Regierung, Fink übernahm den Klub. Fink ist allzu oft bloß als Vizekanzler Karl Renners 1919/20 in Erinnerung geblieben. Aus dieser Perspektive erschien er zuweilen als Gegenpol Seipels. Doch der Eindruck täuscht : Die Zusammenarbeit mit Seipel war harmonisch und eng. Der Vorarlberger fungierte darüber hinaus als Verbindungsoffizier zu den Agrariern, der – nicht immer – schweigenden Mehrheit des Klubs. Allenfalls Miklas als Stellvertreter Finks – der eben nicht in die Regierung ging – war für manche der weltanschaulichen Bedenken empfänglich, wie sie Schöpfer zuweilen vortrug. Doch von den hochkatholischen Konservativen ging für Seipel keine Gefahr aus. Als Wortführer einer bewussten Alternative lässt sich nur der Gewerkschaftsboss Spalowsky ausmachen, der als Einziger immer wieder die Warnung erschallen ließ, mit der Politik des Bürgerblocks treibe man die Leute den Sozi in die Arme. Ob er damit recht behielt, ist fraglich : Die christlichsozialen »Arbeiter« waren mehrheitlich Beamte, Eisenbahner und Postler, die sich zwar über die Arroganz der Agrarier ärgerten (oder über jüdische Industrielle und Bankiers), aber gerade ihr politischer Alltag bestand erst recht im Kampf gegen die übermächtige Sozialdemokratie in ihrem ureigenen Umfeld. Von unterschwelligen Spannungen geprägt war Seipels Verhältnis zu den Wiener Granden, dem Alt-Bürgermeister und Präsidenten des Nationalrats, Richard Weiskirchner, und seinem Vorgänger als Parteiobmann, Leopold Kunschak. Weiskirchner war – mehr noch als Seipel – immer schon ein Anhänger der bürgerlichen Zusammenarbeit gewesen – in seine Fußstapfen traten in dieser Beziehung Heinl und Vaugoin –, doch in der unmittelbaren Nachkriegszeit gedämpft durch allerlei verständliche Vor- und Rücksichten. Kunschak gilt – mehr noch als Spalowsky, mit dem er oft in einem Atemzug genannt wird – als die Galionsfigur der katholischen Arbeiterbewegung und der christlichen Soziallehre. Doch seine Wortmeldungen verraten viel mehr einen sehr konsequent am Interesse der Partei orientierten Profi, der kaum linke Allüren durchblicken ließ. Erst der Konflikt mit der Heimwehr in der Spätzeit mochte ihn da zu einer Wendung gegen »den Feind von rechts« veranlasst haben. Einen ganz eigenen Typus von Politikern zog (sich) Seipel mit dem Klüngel von katholischen Technokraten heran, die seine Umgebung dominierten : Mataja, Schmitz, Kienböck, vielleicht auch Odehnal (der schon 1928 starb). Mataja – der 1913 ein eigenes Mandat ergattert und die Opposition gegen Weiskirchner angeführt hatte – war ein Agent Provocateur des Prälaten, der Dinge zugespitzt auf den Punkt brachte, die Seipel nicht so ausgesprochen hätte. Schmitz – als Präsident des Katho-
Resümee
145
lischen Volksbunds ein Politiker aus eigenem Recht – wurde im Klub mehr in die Rolle des Fachmanns gedrängt, der komplexe Materien in ausführlichen Referaten sezierte, sich dabei zweifellos den Respekt seiner Kollegen erwarb, aber vermutlich nicht allzu viele Freunde. Viktor Kienböck war von der AZ als »Judenstämmling«30 vorgestellt worden ; für Christlichsoziale las sich sein Stammbaum anders : Lueger war bei seinem Vater einst Konzipient gewesen. Er wurde von Seipel im Mai – vielleicht nicht ganz ernst gemeint – als Kanzlerkandidat lanciert und im November dann ohne viel Federlesens zum Finanzminister ernannt. 1932 übersiedelte er als Nachfolger von Reisch in die Nationalbank, wo er seine Macht genoss : »Die Nationalbank muß nicht müssen.«31 Kienböck und Schmitz standen zweifellos loyal zu Seipel, der auf Schmitz ganz ausdrücklich bestanden hatte, in welchem Ressort auch immer – und nicht zögerte, bei erstbester Gelegenheit Kienböck nachzunominieren. Aber nach den Wortmeldungen im Klub zu schließen, konnte niemand ihnen vorwerden, als Ja-Sager zu fungieren. Schmitz vertrat als Sozialminister einen Kurs, der z. B. in der Mieterschutzfrage an konkreten Ergebnissen orientiert war, nicht an einem »Rollback« ; und keiner kritisierte so scharf wie Kienböck die oberflächlich-optimistischen Annahmen über das Ersparungspotenzial im öffentlichen Dienst. Beide verfügten über Netzwerke oder bauten sich zumindest welche auf, Schmitz im katholischen Vereinswesen, Kienböck – von dem es leider im Unterschied zu Schmitz keinen Nachlass gibt – in der Finanzwelt. Aber über eine politische Basis im klassischen Sinn verfügten sie nicht. Der Einzugsbereich der Wiener Partei war für die Zahl der unterschiedlichen Talente, die hier zusammenkamen, zu klein. Die Seipel-Jünger waren Generäle ohne Armee. An der Spitze der Partei wurde 1930 mit Seipels Zustimmung dann der Heeresminister Vaugoin berufen, ein Wiener, aber ein konservativer Bürgerlicher, ohne allzu tiefgehende christlichsoziale Prägung. Auch Friedrich Schönsteiner, den Seipel 1924 zum Generalsekretär beförderte, kam aus dem »Stall« Weiskirchners.32 Die Massenbasis der »schwarzen« Politik – es ist schon oft angeklungen –, das waren die Agrarier. Allein bildeten sie natürlich auch keine Mehrheit mehr, aber ohne sie waren die Christlichsozialen eine Gruppierung, die nicht viel größer als das nationale Lager war, nur mit weniger Rückhalt im Establishment. Die Agrarier, das waren im Klub Stöckler, im Kabinett Buchinger, in der Kammer und im Land Zwetzbacher. Als Scharfmacher verdienten sich der Weinbauer Diwald, dann der Tiroler Niedrist ihre Sporen. Dazu kam vielleicht noch der eine oder andere Oststeirer, kaum ein Oberösterreicher (die Schönbauer als Agrarier nicht zufällig für nicht scharf genug hielt). Die niederösterreichischen Bauern stellten immerhin ein Dutzend Abgeord30 AZ, 28.11.1922 ; vgl. Benesch, Zerrissenheit 83 31 Höbelt, Provisorium 364. 32 Vgl. Gerhard Hartmanns Kurzbiographie im Internet ; Benesch, Zerrissenheit 94, vgl. auch 77 ff., 89.
146
Resümee
nete, waren auf Grund der Nähe zu Wien – wo sich ihre Landesregierung befand – wohl auch präsenter als ihre Kollegen aus den (anderen) Bundesländern. Die Haltung des Reichsbauernbundes und insbesondere der Niederösterreicher zu Seipel war gleichermaßen von Respekt und Distanz geprägt : Beide wussten, was sie aneinander hatten, aber von besonderer Sympathie war keine Rede. Seipels umstrittene Aussage »Wer mit mir verhandelt, erreicht etwas« konnte man in dieser Beziehung auch umdrehen : Wer auf die Agrarier setzte, setzte etwas durch. Do ut des – anders als bei Schöpfer, der mit Seipel auf einer ganz anderen, gemeinsamen Ebene stritt, war das Verhältnis zu den Agrariern auf beiden Seiten von Nützlichkeitserwägungen bestimmt. Es wäre zu kurz gegriffen, wenn man sagen wollte, Seipel hätte den Niederösterreichern zuliebe Ségur gemacht – und ihn den Niederösterreichern zuliebe auch wieder fallen gelassen. Seipel hätte Ségur ohne dessen gesundheitlichen Zusammenbruch nicht fallen gelassen – und Kienböck erwies sich den agrarischen Forderungen gegenüber keineswegs als kulanter. Aber der Ablauf der Debatten wäre geeignet, eine solche Lesart zu stützen. Die Agrarier waren der Motor, um die Sanierung in dieser Form durchzuziehen. Sie mochten Republikaner sein, die nichts dabei fanden, zusammen mit den Sozial demokraten die Eliten der Monarchie zu depossedieren, den Sozi aber auch bald darauf »frei und offen« zu sagen : »Die Republik ist gewesen, wenn die roten Herren nicht in letzter Stunde einlenken !«33 Die Wirtschaft der Arbeiterwehren und der Zwangsanleihe, des Mieterschutzes und des Achtstundentages waren die Bauern auf die Dauer nicht bereit hinzunehmen. Die Allianz mit Seipel bekam bald ihre Sprünge, sobald die Agrarier das Gefühl bekamen : Der Mohr hatseine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen. Bereits im nächsten Jahr standen die »Bauerngeneräle« wie Stöckler und Zwetzbacher im Ruf, gegen Seipel zu »wühlen« (was ihnen nicht gut bekam).34 Seipel wiederum – mit seiner bekannten Skepsis gegen Massenorganisationen aller Art – hielt ihnen den Spiegel vor : »Es geht nicht an, dass eine Klasse diktiert«.35 Eine Sonderrolle innerhalb der Christlichsozialen Reichspartei nahmen die Steirer und die Oberösterreicher ein, ganz einfach, weil sie erst sehr spät »Christlich soziale« geworden waren. Das Substrat ihrer Partei waren die alten Konservativen, wie es sie in Wien und Niederösterreich nur in Spurenelementen gegeben hatte.36 Die Steirer hatten ihren christlichsozialen Flügel vor 1914 zum Teil sogar an den Nationalverband verloren, sie setzten unter Rintelen – der jedoch selbst aus dem konservativen Milieu stammte – zu einer Aufholjagd an und rekrutierten – jetzt, wo 33 Bauernbündler, 15.11.1922. 34 AVA ; E/1791, Wildner-Tb. 3.11.1923, 21.1.1924 ; Höbelt, Provisorium 89. 35 Geßl (Hg.), Seipels Reden 69, 87 ; vgl. auch das Urteil bei Kluge, Bauern 161. 36 Ableitinger, Unentwegt Krise 56 f.; Höbelt, Konservative und Christlichsoziale.
Resümee
147
in der Grazer Burg erstmals ein schwarzer Landeshauptmann residierte – mit besonderer Nachhaltigkeit bürgerliche Aufsteiger aus dem nationalliberalen Lager. Da raus resultierten Konflikte, die für Außenstehende – und Historiker – nicht immer leicht zu durchschauen sind. Einer der prominentesten dieser Quereinsteiger – und Querschläger – war Alfred Gürtler, ein gebürtiger Sudetendeutscher, ein kaustischer Kritiker, klug, kontrovers, unberechenbar und – wie Seipel – in seinen Schlussfolgerung oft überraschend, aber mit ihm meist über Kreuz, eine Rivalität, die gerade 1922 jedoch nicht ohne eine gewisse wechselseitige Bonhomie ausgetragen wurde. Die Oberösterreicher verkörperten konservative Kontinuität. Konservativ im Sinne von Konsens und Katholizismus – kein Land zählte so viele Priester unter seinen Spitzenpolitikern. Prälat Hauser war ein Mann des mehr passiven Gottvertrauens und des »aggiornamento«, der nichts dabei fand, vor 1918 im Schlepptau des Nationalverbandes zu segeln und nach 1918 im Schlepptau der Sozialdemokraten. Der Klub, dem er 1917/18 vorstand, war noch (fast) ohne Wiener ausgekommen. Die schärfere Tonart, die sich mit der Wiener Renaissance 1919/20 bemerkbar machte, im internen Verkehr wie gegenüber den Sozialdemokraten, behagte ihm wenig. Seipel hatte ihn 1919 tief beleidigt, als er ihm durch die Blume vorwarf, durch seine Blauäugigkeit außenpolitische Chancen verspielt zu haben ;37 die Oberösterreicher waren erneut beleidigt, als Seipel – aber auch Fink und die Steirer – 1922 »ihren« Födermayr dem Wohlwollen von Professor Schönbauer opferten. Hauser wurde auf der Gerüchtebörse immer wieder als Anhänger einer Koalition mit links gehandelt, doch er betrieb nie offen Opposition.38 Wenn Seipel einmal beiläufig bemerkte, es gebe in Österreich zu wenige Parteien, mochte man das Bedauern mitschwingen hören, es gäbe zu wenige Bälle, mit denen man jonglieren konnte. Aber der Mangel an politischer Vielfalt verbürgte Stabilität : Der Bürgerblock – als Kontrastprogramm zum Linksruck der Anfangsjahre der Republik – hielt. Seipel hätte ihn gerne nach dem Muster »ever closer union« neuen Herausforderungen entgegengeführt. Dabei unterschätzte der Organisationsskeptiker vielleicht das Beharrungsvermögen von Parteiapparaten. Innerhalb der Christlichsozialen Partei selbst gab es nun allerdings genügend viele, nun ja, nicht gerade Parteien, aber Fraktionen und Fraktiönchen. Der Prälat verstand es, auf dieser Klaviatur zu spielen. Die Konstellationen wechselten, die Konflikte wurden zuweilen schärfer, doch die Dominanz blieb gewahrt. Der »Autrichelieu« zog als »Mastermind« der Ersten Republik die Fäden bis kurz vor seinem Tod 1932.
37 Höbelt/Kalwoda/Schönner (Hgg.), Klubprotokolle 432, 437 (7.5.1919). 38 AVA, E/1791, Wildner-Tb. 3.11.1921, 7.6.1922.
Anhang I : Das Aufbauprogramm Dr. Seipels (›Reichspost‹, 26. Mai 1922) 1. Die Lage unseres Staates verlangt gebieterisch, daß Regierung und Parlament alle Kräfte auf die Rettung unserer Staats- und Volkswirtschaft konzentrieren. Zur Rettung ist es notwendig, daß der von den bisherigen Regierungen eingeschlagene Weg, vom Ausland die für die Sanierung unseres Geldwesens notwendigen Kredite zu erhalten, weiterverfolgt werde. Die Kredite allein werden uns aber nicht helfen, noch werden wir sie überhaupt erlangen, wenn wir nicht wirklich, koste es, was es wolle, unseren Staatshaushalt in Ordnung bringen und zugleich die heimische Produktion so weit beleben, daß sie wieder mit der des Auslandes konkurrenzfähig ist. 02. Die Regierung wird daher zunächst bei der Reparationskommission in Paris die notwendige, von allen Staaten zugesicherte Rückstellung der Pfandrechte zu erreichen haben und sich bemühen müssen, in Fortsetzung der zu diesem Behufe bereits eingeleiteten Verhandlungen eine ausländische Anleihe zu beschaffen, die in erster Linie dazu bestimmt ist, den Grundstock für die zu errichtende neue Notenbank beizustellen. 3. Der Bund übernimmt es a) die Bundesverwaltung, namentlich aber die Finanzverwaltung so zu reformieren, daß sie ihren Aufgaben voll gerecht werden kann ; b) die Bundeseinnahmen und öffentlichen Abgaben und Monopole in einem im geeigneten Zeitpunkt endgültig festzusetzenden Ausmaße zu erhöhen ; c) die sämtlichen Bundesbetriebe nach dem Prinzip der Selbstkostenbedeckung außer Defizit zu setzen ; d) darüber hinaus innerhalb kürzester Frist ernsthafte Ersparungen im Bundeshaushalt durchzuführen ; e) der neu zu errichtenden Notenbank, die den gesamten Notenumlauf der Österreichisch-Ungarischen Bank übernehmen wird, alle hierfür erforderlichen Sicherheiten zu gewähren ; f) weder selbst Geld mit Zwangskurs auszugeben, noch die neue Notenbank zu staatsfinanziellen Zwecken direkt oder indirekt in Anspruch zu nehmen. 4. Die oben genannten Ersparungen sind durch den Abbau der überzähligen Ämter und Bundesangestellten und durch rascheste Abstoßung der ständige Zuschüsse aus Bundesmitteln beanspruchenden Bundesbetriebe zu erzielen.
Das Aufbauprogramm Dr. Seipels
149
5. Um alle Bundesangestellten geneigt zu machen, an der Reform der Verwaltung und dem Angestelltenabbau mitzuwirken, müssen die dem Besoldungsgesetz widersprechenden Bevorzugungen einzelner Kategorien rasch beseitigt werden. 6. Den Folgen der überhandnehmenden Arbeitslosigkeit kann weder durch fortwährende Erhöhungen der Arbeitslosenunterstützung, noch auch durch Investitionen für öffentliche Arbeiten allein wirksam gesteuert werden. Die Ursache der steigenden Arbeitslosigkeit liegt nicht im Mangel an Aufträgen für die heimische Industrie, sondern darin, daß diese die Aufträge wegen mangelnder Fähigkeit, in der Preiserstellung mit den Nachbarländern zu konkurrieren, nicht übernehmen kann. Deshalb müssen vor allem unter Mitwirkung der Arbeitgeber und der Arbeiter die Produktionsbedingungen durch Nachholung technischer Rückständigkeiten, durch bessere Ausnützung der Arbeitszeit, durch Anpassung der Löhne an die allgemeine Wirtschaftslage usw. verbessert werden. 7. Die vorstehend genannten Maßnahmen müssen je nach ihrem natürlichen Zusammenhange untereinander möglichst gleichzeitig beschlossen und durchgeführt werden. 8. Die finanzpolitischen Maßregeln im engeren Sinne sollen, damit nicht der ihre Wirksamkeit verbürgende Zeitpunkt durch ein umständliches parlamentarisches Verfahren versäumt werde, von einer, durch ein Bundesverfassungsgesetz für die Zeit des Überganges zur normalen Staatswirtschaft mit besonderen Vollmachten auszustattenden Körperschaft verfügt werden, falls man nicht vorzieht, die Regierung selbst oder ein Ministerkomitee damit zu betrauen. Diese Körperschaft könnte etwa aus einem parlamentarischen Kontrollausschuß für das Kreditverwendungsgesetz, dem Bundeskanzler, dem Bundesminister für Finanzen und drei durch den Bundeskanzler zu ernennenden, nicht vom Parlamente angehörigen Sachverständigen in Finanz- und Währungsfragen gebildet werden.
Anhang II : Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
Erweiterter Vorstand, 29. Mai 1922 Seipel : Bericht über Stand der Verhandlungen. Mit Großdeutschen am Vortag. Weiskirchner, Mataja, Odehnal ; Dinghofer, Frank, Straffner. Gut angelassen, weil gesehen, daß Großdeutsche Ernst machen, daß wirklich starke Regierung zu bilden geneigt sind, die in unerläßlichen Punkten entschieden vorgeht und wenn sie nicht erreicht, die Sache hinwirft, nicht geneigt Schwierigkeiten zu verkleistern. Darauf sehr stark eingelassen. Meinung aller nicht sozialistischen Parteien, daß die von mir als Aufbauprogramm bezeichneten Grundsätze persönlich veröffentlicht werden sollen. Auch heute wieder nach Parteitag ausdrücklich gesagt worden, eine solche Regierung zu bilden. Vorgestern und gestern mit Seitz. Vorgestern lang und gestern zu Ende. Es ist aus dem vielen hervorzuheben, daß Sozi Ernst der Lage erwägen. Daß sie dazu kommen zur Konzentration, nicht möglich, könnten nur tun, wenn man ihnen in Menge Punkten nachgibt, was sie einsehen, daß nicht geht. Keinerlei Sturm von Seite der Sozi zu befürchten. Heute wieder Großdeutsche. Von beiden Seiten : Mitteilung über Verhandlungen in Graz. Von beiden Seiten besondere Bedenken gesprochen worden. Was schon vorgekehrt wegen französischem Kredit, über burgenländische Gesetzgebung. Es lassen sich Wege finden, die sich ganz gut anlassen. Von uns vorgebracht werden. Für uns untunlich, indem der Posten des Unterrichtsministers nicht von einem Christlichsozialen besetzt sein, sonst geht ganzer Ansturm der Ungeduldigen am Kanzler aus. Für unerläßlich, daß neues Kabinett das Privatvermögen der Krone gleich ehestens freigibt. Wenn diese Ungerechtigkeit aus der Welt geschafft, wird monarchistische Bewegung leichter zu behandeln sein. Hier ganz einverstanden. Da keine große Schwierigkeit gezeigt. Wir absichtlich am späten Mittag abgebrochen, um beiden Seiten Gelegenheit zu geben, sich selbst mit Fragen zu beschäftigen. Es bleibt nur Hauptsache, wie es mit Verteilung der Ressorts ist. Verschiedene Rücksprachen gepflogen. Donnerstag Großdeutsche gesagt, sie wollen zwei Minister. Mehr verlangen sie nicht. Dies auch unser Interesse, weil wir sie binden müssen. Von diesen soll einer Vizekanzler werden. Wir dann Frage aufgeworfen, ob man nicht neues Kabinett Schober bilden will. Absolute Ablehnung gestoßen. Nicht auf dieselbe Ablehnung, wenn auch Bedenken, daß Schober in einem Ressort behalten
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
151
und so Eindruck nach außen auch verbessert wird. Wir großes Gewicht darauf gelegt, wenn wir den Kanzler stellen, Straffner in Verkehr schicken, da soll sich hinsetzen, man würde damit gewisse Energie zeigen. Straffner weigert sich beharrlich, aber so ganz unüberwindlich schien uns der Zustand heute nicht. Spieß umgedreht und unseren Odehnal vorgeschlagen. Glaube, es wird sich machen lassen. Großdeutsche denken daran, daß Frank Inneres und Vizekanzler und daß Schürff oder Kraft den Handel besetzt. Wir gesagt, daß wir großes Gewicht legen und Heinl in Vorschlag gebracht wird. Nun Inneres. Niederösterreicher finden, jetzt kann man Inneres Großdeutschen lassen. Vom Länderstandpunkt große Besorgnis wegen Innerem. Klar, wenn Inneres, von wem Justiz besetzt, darauf bestehen, daß Schober [ein Wort unleserlich] möchte Polizei und die Sektion im Inneren, wo Polizei- und Gendarmerie ressortiert. Schober : Gesagt geht dahin, daß er sowohl Inneres nehme als auch Polizei und Gendarmerie wieder übernehmen, wenn anderer Inneres übernimmt, nicht wenn es wieder der Waber ist. Wir leichter, daß von uns Kanzler gestellt werden muß, der kann immer sagen, mit dem tue ich es nicht. Wenn wir den Großdeutschen nicht Inneres überlassen, sondern Schober bleibt, müssen wir Großdeutschen anderes geben und es bleibt nichts anderes über als Justiz (Frank) mitsamt Vizekanzler. Bezüglich Unterricht schon gesagt, wir bestehen auf Besitz durch Unsrigen und haben Miklas in Vorschlag gebracht. Bedeutende Stütze des neuen Kabinetts und verläßliche Nummer [?]. Ackerbau den Kollegen Födermayr in Vorschlag gebracht mitsamt Ernährung mit. Äußeres im Sinn aller gepflogenen Besprechungen an Minister Grünberger. Allgemeine Zustimmung. In der Erwägung, daß faktisch formale Verbindung wegen Krediten hat. Einige Aussprachen über Heerwesen, schließlich vorliegende Entschließung, daß wir natürlich Absicht haben, möglichst rasch große Veränderung herbeizuführen. Können mitteilen, daß die Verhandlungen bei [zwei Worte unleserlich] gut stehen und überraschende Aktionsmöglichkeiten kommen können. Sehr gut, jetzt davon gar nicht zu reden. Kommt es dann dazu, kann man immer hinsetzen, wen man will, insbesondere Offiziere warm halten. So müssen wir Wunsch berücksichtigen, sie bitten, nicht einen Zivilisten zu bekommen. Fink macht mich auf Schwierigkeit aufmerksam : Unterricht formal beim Inneren, das kein Hindernis – ohne Portefeuille, der mit Leitung betraut wird. Daß man separiert, halte ich für wichtig. Noch zu reden soziale Verwaltung, wo Schmitz vorgeschlagen ; dann Frage Finanzminister, die sehr schwer ist. Es sprechen hier (wenn nicht ganz klar sind) sehr viele Gründe, Parlamentarier hinsetzen. Gewisse Herren haben Idee gehabt, Kraft dahin kommen zu lassen, was unglücklich gewesen wäre. Nun Frage des Parlamentariers unserem Sachverständigen in Beamtenfrage usw., daß Odehnal als Beamtenvertreter sehr schwerer tun wird als irgendein anderer. Parlamentarier müßte jemand sein, den Leute fürchten oder man setzt jemand hin, der aus Finanzministerium
152
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
selbst stammt. Ich bin der Meinung, entweder Landesrat Ségur, auf der starken Hand, oder meine Neigung, doch wieder Beamten und dann Sektionschef Hornik, der bei Durchführung der Liquidierung sehr gut gemacht hat. Auch von Schneider gesprochen worden. Auch gesagt worden, Schmitz auf diesen Posten zu schicken. Wir halten Schmitz für Zukunftshoffnung, insbesondere für soziale Verwaltung. Wenn Schmitz anderes Ressort, so Resch soziale Verwaltung, da sind wir nicht in Verlegenheit. Größte Schwierigkeit bleibt Kanzlerfrage. Bei früheren Verhandlungen sehr stark an Ender gedacht. Es werden solche Gründe angeführt, private und Landes, daß ausgeschlossen erscheint. Zweite Person, die immer wieder, ist Landeshauptmann Rintelen, der erklärt hat, er kann dies nicht. Außerdem mein Kandidat Kienböck. Kunschak sagt, den müssen wir uns gleich aus dem Kopf schlagen. K ienböck : Seipel doch Führer in der inneren Politik. Bisher Fehler, daß der führende Mann in der Politik der Kanzler sein muß. Finanzminister muß einer sein, der auf Kassa sitzt und kein Geld hergibt. Von allen Seiten wird jetzt geschröpft. Muß aufrichtig sagen, ohne besondere Absicht, finde daß Hornik am ehesten verspricht dies zu werden. Sehr [ein Wort unleserlich] und Amtskenntnis hat und wie ich glaube auch Finanzmächten gegenüber unabhängig fühlt. Dieser Vorschlag richtet sich nicht gegen Ségur. Anderes Ressort übergeben. Gerade Finanzministerium nicht Landesvertreter. Seipel : Wenn man sagt, Finanzminister Versuch machen, dies allerdings am ehesten mit Nichtparlamentarier, der am leichtesten zu stürzen ist. Kunsch ak : Mir scheint am wesentlichsten, daß Kanzler entschieden ist. Ohne Parlamentarisierung läßt es nicht mehr machen. Daher finde ich mich damit ab. Person Vorsitzender anlangt, möchte vorher erklärt haben, wie er Lage beurteilt. Ist Lage so, daß eine Hoffnung noch besteht ? Zu positivem Erfolg zu gelangen ? Wenn noch Erfolg, dann gibt es nichts anderes als Seipel, wenn sie noch besteht. Wenn Dinge so liegen, daß wirklich heißt, an Stelle der Regierung andere zu setzen. Schmitz gebeten haben, um dies zu vermeiden, im Interesse der Partei und Interesse des Mannes. Zukunftsmänner läßt man sich entwickeln, bis Entscheidung naturgemäß ergibt. Finanzminister halte mir Stellungnahme gegen Hornik. Entscheidung zugunsten Hornik ungeschaut. Mann, der Nerven ganz in der Hand hat. Einer, der krank ist, taugt physisch nicht. Seipel : Ich kann nicht anders sagen, als daß ich feste Überzeugung habe, man kann etwas machen. Dazu kommt, daß wenn ich es tue, daß ich aus Parteigenossen hier, den ich für nützlich halte, den einfach an mich ziehe. Dazu gehört der Schmitz. Fink : Lage leider nie so, daß Großdeutsche erklärt, mit uns zu regieren wie jetzt. Bedaure sehr, daß Moment so spät gekommen ist. Ich immer gesagt, wenn man einmal nicht Sozi regieren kann, dann gehört unser Obmann an Spitze. Der Moment ist gekommen. Möchte ich fragen, wie es bisher war. Es war immer nur so, daß wir nichts getan haben, was Sozi irgend weh getan hat, dies ist nicht möglich. Bei Eisen-
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
153
bahn Tomschik regiert etz. Arbeiterfrage, Löhne immer weitergetragen. Wir müssen Obmann bitten, Aufgabe zu unterziehen. Er bekommt als Kanzler kein Ressort, eigentlich nicht mehr Arbeit als er bisher gehabt hat. Kunschak sagen, wir müssen das letzte Stück gehen. Miklas : Wichtigst zweifellos Bundeskanzler. Bin der Meinung, daß die Berufung Seipels in der Richtung der Politik des Klubs liegt. Fink ganz treffend. Doch Zweifel, ob Wagnis unternehmen soll. Erst wenn Echo aus Ländern gehört haben, endgültig Entscheidung zu fällen, wenn wir auch heute sagen können, daß ungefähr in der Richtung läuft. Schneider für Unterricht nennen. Seipel : Charakteristisch für veränderte Lage. Jetzt ist Zeit, wo man Miklas erträgt. Posten im Kabinett, wo Kampf ansagt, viel besser in ruhiges Übergangskabinett. Partik [Kaufmann, Wien] : Finanzportefeuille. Geklagt über Zollbeamte. Resch : Hornik sehr stark und stärker als Ségur.
Klub, 30. Mai 1922 Seipel : Bericht über Regierungsbildung : Nicht nur darum handelt, überhaupt Regierung zu bilden, sondern so wie angedeutet = starke. Es haben sich gestern mit Vorbehalt der heute entscheidenden Beratung Bauernbündler bereit erklärt, bei jeder Regbildung mitzutun und mitzuwählen und unterstützen. So daß Aussicht, daß alle Nicht-Sozi neue Reg wählen würden. Erscheinung, die noch nicht da war. Es wird sich nicht machen lassen als daß Kanzler von uns beigestellt wird. Frage, ob ich Regierung als Obmann übernehmen soll. Dafür spricht, daß schwer ist, einen zu finden, der es im Augenblick tut und Schein vermeiden, daß wir nicht Courage haben. Habe auf alle Gegengründe aufmerksam gemacht, aber kann Lage geben, wo man nicht nein sagen kann. Unpraktisch ist, daß Geistlicher und daß Obmann der Partei. Die anderen lauern, daß Partei so rasch abwirtschaftet. Gefahr ist wirklich vorhanden. Ich muß gewisse Bedingungen stellen. Großdeutsche und Bauernbündler sehr deutlich gesagt und zum Teil auch Sozi hauptsächlich vor eigenem Klub erörtert werden. Ich gerade als Geistlicher eher aus Prinzip soll Kulturkampffragen ausschlachten um für Wirtschaft Platz zu haben. Ihm sehr verübelt, wenn nicht da und dort Kampf losgeht. Man muß mir zugeben, daß Unterrichtsministerium cs wird. Das von Großdeutschen eingesehen worden. 2) Aufmerksam, daß gerade meine Stellung unseren katholischen Kreisen gegenüber, wo Monar[chisten ?] in weiteren Vordergrund treten. Stellung, die gewissen Vorstößen, die unpraktisch, ein Ende nimmt. Großdeutschen gesagt, die neue Reg würde in ganz kurzer Zeit darangehen, das beschlagnahmte Privatvermögen der Kaiserfamilie freigeben. Großdeutsche sofort gesagt, dies sei ganz ihr Standpunkt. 3) und wichtigste : Maßnahmen, die zum Aufbau und Rettung für notwendig erachtet werden, daß dazu die Partei mithilft.
154
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
Reihe von Vorschlägen akzeptiert sind. Vizekanzler soll Großdeutscher sein : Frank. Wir uns sehr bemüht Straffner hinzuzwingen für Verkehr. Offen Minister des Inneren. Wir, daß in Hand des Schober bleiben soll. Wir so weit gegangen, könnte mir noch vorstellen, Inneres = Großdeutsche mit Sicherung für Stellung Schober, wenn der Großdeutsche Frank ist. Äußeres allgemeine Übereinstimmung, daß Grünberger betraut. Ackerbau Agrarier schon letztes Mal vorgeschlagen Födermayr, der Agenden Ernährung mitbekam. Dann wenn Frank nicht Justiz nimmt, Ramek. Heerwesen lange Gespräche. Möglichst wenig zu reden. Meinung, daß man jetzigen Minister sitzen läßt, oder aber wieder Vaugoin. Beinahe dafür, Wächter sitzen zu lassen. Seine Schwäche durch Umgebung etwas ausgeglichen worden, besonders bei [ein Wort unleserlich]. Soziale Verwaltung Schmitz, auf den ich jetzt Gewicht legen muß wegen Stellg in allgemein politischen Angelegenheiten. Wenn Schmitz für etwas anderes, klar, daß an Resch denken. Unterricht Ternavorschlag : Miklas, Ségur, Schneider. Hier ist mir jeder der Herren sehr lieb. Bisher Miklas ablehnt und Schneider nicht gefragt werden konnte. Sonderstellung Unterricht wieder normal gemacht wird. Allerwichtigstes Ressort ist Finanzministerium. Haben uns mit folgenden Gedanken beschäftigt. Frage, ob Parlamentarier oder Nichtparlamentarier. Schwächezeichen, wenn dieses Ressort nicht mit einem der unseren besetzen. Wenn Politiker gesetzt werden soll, schlage ich vor : Ségur, hätte man sich entschieden für Beamten, wäre unter genannten gewesen Sektionschef Hornik. Wir wissen, daß Großdeutsche mit uns gehen. Gürtler hier maßgebend [ein Wort unleserlich]. Mein konkreter Vorschlag : Ich der Meinung, doch besser politisch zu besetzen und schlage daher Ségur vor. Bei Verkehr immer noch versucht Straffner, dagegen gestern so weit, daß ausschaut wie Bitten. Es wurde vorgeschlagen von Straffner über unsere Aufforderung = Odehnal genannt, welcher uns hier sehr abgehe. Ist klar, dornenvolle Aufgabe. Habe Eindruck, Wagnis auf sich, wenn von Partei aufgefordert. Nun, meine Herren, Hauptstreitpunkt der, nachdem Großdeutsche Verkehr nicht, aber 2 Ressorts haben wollen, Forderung, daß Kraft Handel bekommen soll. Wir, daß wieder unser Heinl. Gürtler : Nur mit Personen beschäftigen. Meine Herren, tun Sie den Wächter weg. Vaugoin. Der will die ganze Zeit aufbauen. Ségur Unterricht Klagen aus Niederösterreich, bitte Aufklärung zu geben. Wenn Erklärung, würde ihn für sehr gut halten. Hornik mit sämtlichen Beamten des Finanzministeriums verfeindet. Geistige Abhängigkeit von Wladimir Beck = radikal. Wie Leute in Ersparungskommission ganz weltfremd. Wenn Ségur gesund bleibt, ob Niederösterreich hergibt ? Aus prinzipiellen Gründen Mitglied Nationalrates lieber gewesen. Am liebsten ist mir der Kraft gewesen. Aber genügt mir, daß angeboten und abgelehnt hat. Für Verhandlung mit Morgan Gruppe Kraft nicht schlecht gewesen. Eventuell auch Heinl. Sehr begrüßt, wenn Odehnal in Verkehr. Rodler Geschicklichkeit in Verhandlung mit
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
155
Organisationen ganz guter Eisenbahnfachmann. In letzter Zeit nicht mehr gefallen. Bedaure nicht, daß Straffner nicht hingeht, weil für gefährlichen Demagogen halte. Unsicherer Kantonist in allen Ausschüssen. Überall wird Begünstigungswirtschaft aufhören. In zwei nicht, weil im Wesen gelegen, daß in Ackerbau und Handel, daß Subventionen vorgesehen sind und gegeben werden müssen. Den Schlüssel zu diesem Geldkasten, möchte ich schon schauen, daß wir selbst in der Hand behalten werden. Gewisse Gefahr, daß eigene Gewerbepartei. Heinl geschickt diese zu verhindern. Kraft kann sich nicht beschweren, man hat ihm Finanz angeboten. Was Inneres betrifft, bitte mit Rintelen zu sprechen (ist geschehen !) Mit großer Genugtuung, daß Waber nicht mehr in Kombination (steht so stark, daß wir noch Kampf haben werden) Mit dem Hanswurst schlechte Erfahrungen gemacht. Für mich Gesichtspunkt in Betracht, man will jetzt ohne Sozi regieren. So gebieterisch nicht Bedürfnis, würde wie rotes Tuch wirken, aus rein persönlichem Grund größte Schwierigkeiten machen. Seipel : Mein Vorschlag lautet ausschließlich Ségur, infolgedessen für Unterricht nicht mehr. Frage Vaugoin, bitte wenn mir Klub gibt, ist es mir sehr recht, auch Gemeinderats-Klub. Nun Frage mit Handel, Großdeutsche als absolute Forderung Heinl. Daher müßte man Großdeutschen anderes anbieten. Weil sie 2 bekommen müssen. H aider [Werkmann ÖBB, Wien] : Weiß jetzt schon, daß bezüglich einer Person meine Meinung nicht angenehm berühren wird. Ohne jede Umschweife Seipel genannt Soziale Verwaltung Schmitz. Empfinden, daß hochverdienter Resch ausgeschlagen. Uns zumindest gesagt, wenn warum dies getan wurde. Meines Wissens gar keine Beschwerden vor. Wenn schon Parlamentarier, warum nicht Resch. Eisenbahn = gern durch Rodler besetzt bleiben. In letzter Zeit sehr viel durch Minister bekommen. Wenn Parlamentarier, sicherlich nichts gegen Odehnal. Seipel : Frage aufgeworfen Resch. So kann man Frage nicht stellen. Ich aus ganz anderen Gründen, die nicht im Ressort liegen, Schmitz dazu brauche, habe gar nichts gegen Resch. Was Haider gesagt hat gegen meine Person, ist absolut richtig. Nur muß ich bitten zu sagen, wer dann. Wenn einen haben, wird ganze Partei sicher dafür sein, daß wir anderen dafür hinstellen. Stöckler : Erster Linie Standpunkt Gürtler, daß unbedingt Sache des Mannes ist, der Kabinett bilden muß, daß er sich seine Leute aussucht. Wenn zum Kanzler übergehe, der besetzt werden soll durch Seipel, weiche ich entschieden ab. Weil Geistlicher ist, ist gar kein Grund, heute Einfluß lächerlich. Ich habe ganz andere Gründe, wir geben diesmal das beste her, wir setzen die letzte Karte ein. Ich habe ganz ungutes Gefühl in der schweren Sache, ob jemand Karren herausziehen kann. Wir setzen diesmal alles ein. Auch keine andere Kraft. Gerade Verkehrsressort. Mit Odehnal
156
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
leisten wir für den Staat ungeheures Opfer. Da können wir gewiß auch Bedingungen stellen. Handel bildet größte Überlegung. Partei gibt dem Staat einfach alles. Vaugoin : Bezüglich Kanzler auf der Linie Stöckler. Bin mir bewusst, daß es Nacht wird, ein Mensch kann kaum mehr herausfinden, wenn nicht Gottes Hilfe dazu kommt, weiß ich nicht, was geschehen wird. Einige Stimmen sagen, man soll gar nichts mehr machen. Meinung, daß wir dieses Opfer bringen müssen. Wenn nicht anders wird, gleich verlieren, andererseits doch noch Hoffnung. Wer kann in solchem Moment Mitarbeiter vorschreiben, höchstens Meinung sagen. Heerwesen, jeder Offizier muß schwach sein, darum sage ich, lassen wir ihn jetzt. Vorsitzender denkt nicht daran, ihn längere Zeit zu behalten, sondern weil Miliz vor der Tür steht und ihn dann ausschaffen kann. Daher gar nicht dringend, Wächter auszuwechseln. Zusammenarbeit Klub mit Regierung wird nötig sein und da wird man auch Kräfte brauchen. Zwetzbacher : Gürtler hingewiesen wo auf Präsidiumsfrage. Daß Land NÖ durch irgendeinen Herrn vertreten sein soll. Seipel unseren Kollegen Ségur hervorgezogen, ehrt uns sehr. Obwohl es für uns großes Opfer. Arbeitskraft, wie wir selten eine gehabt haben. Großzügig und entsprechend starke Hand. Schul- und Finanzreferat. Länderkonferenz ist Land Tirol etwas zu weit vorgegangen, wo wir nicht Vorlagen kannten und Ségur damals gelungen, daß Mittellinie gefunden haben, die von allen Ländern akzeptiert. Ségur ist für Finanz geeignete Person. Wenn Klub zustimmt, uns sehr freuen. An Spitze Handel würde uns in NÖ sehr wehe tun. Man kann nicht an eine Person allein klammern. Jeder, der ehrlich meint, muß Fragen vorlegen, was dann, wenn auch nichts leistet. Wir Niederösterreicher stehen auf Standpunkt, wenn schon Opfer, bitte Land Niederösterreich zu berücksichtigen. Kunsch ak : Obmann an Spitze, erst als Seipel Überzeugung, noch Rettung möglich. Recht und Pflicht Vorschlag, Recht und Pflicht Klub seine Meinung. Neuer Bundeskanzler nicht mit 3. u 4. Garnitur aufmarschieren. Beste Kräfte zur Seite stellen. So auch verstanden Schmitz. Nur Bedenken : Politisches Prestige unheilbar havariert werden kann. Ein Vorschlag mit aller Schärfe Stellung nehmen. Ségur für mich völlig unannehmbar. Sei mir erlassen, eingehende Gründe anzuführen. Wesentlich der, daß Ségur ein schwerkranker Mann ist. In einem Beispiel erlebt, wie Finanzministerium auf physische, auf physische Gestaltung Finanzminister wirkt. Gürtler sehr robuste Nerven. Wir haben gesehen, wie wesentlich sich der Zustand in ½ Jahr verändert gehabt hat. Das bedeutet Fiasco. Wenn sie ihn umbringen wollen, geben sie ihn hinein. Rede ni gleichzeitig für Hornik, kenne ihn nicht. Kienböck ihn warm empfehlen. Nicht einbilden, gönne den Niederösterreichern nicht den Freudentag. Unterricht mit seiner Gesundheit zustande bringen. Dieses kleine Werkel wird er gut im Gang halten. Als Finanzminister stark und unbeugsam sein. Spalowsk y : Schon vorige Woche Standpunkt alles aufgewendet werden muß, nicht nur Koalition, sondern Konzentration, damit wir Sozi nicht Möglichkeit der
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
157
Opposition. Mitgeteilt, daß Sozi abgelehnt haben. Bedaure, daß uns über eventuelle Forderungen der Sozi keine Mitteilung gemacht wurde und glaube, daß man sich keine ernste Mühe gegeben hat sie zu gewinnen. Scheint, daß Plan schon fertig war. Programm macht nicht einmal Versuch, ungeheuren Wucher einzuschränken. Wir haben sehr schwere Lage. Wir insbesondere ungeheure starke Mitteln Monarch[isten], die Seipel entsetzlich befetzt haben, daß für uns furchtbare Lage wird. Verschärft, wenn gleich 5 Wiener ins Kabinett eintreten sollen. Wenn Lage so, klar, daß Obmann an Spitze. Wir müssen ihn unterstützen, ich werde dies loyal tun. Sage heute schon, daß ich als Vertreter Arbeiterschaft niemals Hand dazu bieten werde, ihnen Schildfolge (?) mit arbeiterfeindlichen Maßnahmen. Wir wissen, daß alle Kreise Opfer bringen müssen und uns wehren, wenn einzig Arbeiter Opfer bringen müssen. Bedaure, daß Seipel uns nicht in der Weise entgegenkommt, daß Resch wiederkommt. Darüber kann man reden, was man will, mache aufmerksam, starke Organisationen werden bitter beklagen, daß Resch – werden Schmitz nachtragen. Finanz – habe gehört, daß Hornik cs sein soll. Wenn nicht Mann christlichsozial, durch möglichst viele Konzessionen an Sozi sich aufrecht erhalten will. Partik : Uns bisher immer ausreden können, jetzt unseren 1. Mann ins Treffen führen. Handel für Großdeutsche großen Wert. Wissen genau, daß letzte Regierung ist. Nachher gehen wir in Neuwahlen. Wenn Großdeutschen überlassen, damit sie Gnaden austeilen können. Gerade Heinl beim Gewerbe besondere Beliebtheit, nicht Großdeutschen geben, damit sie Früchte einheimsen können. Vom Grundsatz nicht abgehen, daß Handel bei uns bleibt. Gürtler J [Kaufmann, OÖ] : Ministerium keine allzu lange Lebensdauer. Frage, ob wir Obmann opfern sollen. Für uns Gewerbetreibende gibt es keinen anderen Namen wie Heinl. Unbedingt daran festhalten. Nicht so notwendig vielleicht Justiz. Bäuerliche Bevölkerung von Richtern hergenommen. Stöckler : Erlaube mir Scheffauer [neu angelobter Abgeordneter] begrüßen. Gürtler J : Weiteren Wunsch : Großdeutsche Vizekanzler, Verkehr und Finanz. Kraft soll zeigen, was er machen kann. Gürtler A : Für Vaugoin. Verkehrt halten, Systemwechsel mit Personalwechsel vorzunehmen. Nur möglich, wenn jeder Verdacht vermieden wird, parteitaktisch. Das kann nur jemand tun, der schon konsequent auf Ziel losarbeitet. Gegen Hornik nicht polemisieren, weil ein Christlichsozialer ist. Habe mit ihm gearbeitet und als Beamten kennengelernt. Meine Pflicht gehalten zu warnen. Sind nicht gezwungen auf ihn zu hören. Zum Fall Resch : Gibt kein erworbenes Recht auf Ministerium. Habe nicht das Gefühl, daß auf Organisationsstandpunkt stehen soll. Unsere Arbeiterschaft am fortgeschrittensten und daher am größten demokratisch. Ein Minister darf nur über sein Ressort reden, Finanzminister daher am schlechtesten dran. Mundtot wird ein Minister nicht.
158
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
Gimpl [Pfarrer, Steiermark] : Ob Seipel Regierung, hängt davon ab, ob noch etwas zu retten ist. Starke Regierung nur, wenn stärkster Mann an Spitze. Das ist Seipel. Wahrscheinlich gibt es nicht mehr viel zu retten ; Belastung schließlich und endlich nicht nur Sache der Partei. Wir müssen Heldenmut bewundern. Stärkstes Talent ; wir uns freuen, daß er noch Hoffnung hat. Unterricht. Gehört, daß Miklas abgelehnt. Speziell als Geistlicher bitten zu übernehmen. Keiner so gut wie er. Wenn andere sich opfern, er auch. Schädlich, jedenfalls für Steiermark Belastung, wenn Kraft Handel. Heinl bei uns guten Klang. Finanzminister. Schätze jeden, der unserer Partei angehört. Wenn ich aber höre, daß kranker Mann und gereizter, Nervosität auch gegenüber den Beamten, nicht der richtige Mann. Hornik kenne ich als charakterfesten Mann, weiß, daß im Ministerium starke Opposition finden wird, die regieren sehr schwer machen wird. Wenn ernstliche Verwaltungsreform wollen, Odehnal. Kein Beamtenabbau ohne grundlegende Verwaltungsreform. Glaube, daß wir zukünftigem Kanzler niemand aufoktroyieren können, sondern nur Ratschläge. Fink : Möchte jetzt nicht auf Personen eingehen, weil diese Dinge noch im Fluß sind. Wissen nicht, was wir mit Großdeutschen noch machen können. Erstes Wort Kanzler überlassen. Gewiß nicht mit Unrecht auf Wagnis hingewiesen, unseren besten Mann in Regierung. Wenn wir es machen, kann es nur Seipel sein. Bisher, und zwar seit Umsturz Lage so, daß wir eine feste Mehrheit mit einem Programm nicht gehabt haben. Großdeutsche haben es hinausgezogen. Seit Sonntag ist jetzt geändert worden. Bündler Standpunkt, daß mitwählen und helfen auch ohne Ressort und Czernin geht auch mit (82 + 20 + 6 + 1 = 109). Alle Nichtsozi tun sich zur Mehrheit zusammen. Wir nicht bei jedem Beschluß von Sozi abhängig. Es wird und muß etwas zu machen sein. Es steht nicht ungünstig wegen Einführung der Miliz. Das Wichtigste, daß man Macht hinter der Regierung hat. Nicht ungünstig, wenn Ausland sieht, alle Nichtsozialisten scharen sich zusammen, um Österreich wirtschaftlich aufzurichten. Frage, ob man soviel Leute von uns hingeben soll. Wenn wir parlamentarisieren, hineingeben, soviel wir können. Auch aus parteipolitischen Gründen. Wichtig, daß Beamtenschaft sieht, daß nicht mehr alles von Sozi abhängt. Wir müssen Großdeutschen etwas lassen. Wir wissen, was wir am nötigsten brauchen. Schließlich Kabinettschef am wichtigsten. Mut haben. Seipel : Nun ist die Lage so, daß Möglichkeit für Augenblick da ist, daß nichts aus dem wird, aber wir müssen bereit sein. Sehe ein, daß Klub auf Standpunkt, daß Handel christlichsozial. Dies unser fester Entschluß. Für Verhandlungen sehr wichtig. Möglich, daß ich ablehne, wenn wesentliche Forderungen, die ich zu stellen habe, nicht angenommen werden. Wesentlich ist, daß Sicherheit und Gendarmerie unter Schober bleiben + christlichsozialer Unterrichtsminister. Wenn dies nicht akzeptiert würde, würde ich ruhig scheitern lassen. Ein Herr : Man sollte doch Konzentration bilden, man hat sich zuwenig Mühe gegeben. Das Urteil muß ich allen überlassen, und Verhandlungen den Betreffenden übergeben.
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
159
Steinegger [Postbeamter, Tirol, Vertrauensmann Wehrbund] : Überzeugung, Rettungsaktion noch möglich. Bürgerliche Einheitsfront begrüßenswert. Betrachte als Übergangskabinett für Neuwahlen. Glaube Frühjahrswahlen. Bei Neuwahlen mit Rückgang ganz bestimmt zu rechnen. Begrüße, daß Seipel erklärt Unterricht mit uns zu besetzen. Dafür, daß auch Heer. Nach außen gut wirken. Persönlich wünschen, daß auch Verwaltungsreform einer der unseren. Odehnal Kenntnis und Kraft zutrauen würde, wenn überall nötige Unterstützung findet, daß Verwaltungsreform und Beamtenabbau durchführen würde. Sicher ist, daß durch Parlamentarisierung die Kräfte, die hineinkommen, mit allen Mitteln rechnen müssen, wenn auch nur Sozi die Türen offen sind. Seipel : 2h endgültige Stellungnahme. Handel, Unterricht, Inneres, so daß Schober bleiben kann. Miklas : Glaube an letztes Wort anknüpfen und formellen Antrag stellen : Der Klub muß in formeller Form sagen, daß sind einverstanden, daß wir Obmann dafür hergeben, daß Kanzleramt übernimmt. 2) Sind einverstanden, daß 3 Bedingungen stellt. Ich muß aufrichtig sagen, es tut mir unendlich leid, daß Seipel diese Rolle übernehmen muß, aber es ist (ein Wort unleserlich] aus Lage des Vaterlandes und aus unserer Politik. Vorläufig müssen wir diesen Weg jetzt gehen. Zweite Konsequenz wir müssen parlamentarisieren. Verquickung dieses atheistischen Staates mit katholischem Geistlichen. Habe Überzeugung, daß Finanzministerium im parlamentarischen Ministerium Parlamentarier sein muß ! Beim Äußeren macht Politik immer der Bundeskanzler. Gestern im Vorstand ausdrücklich erklärt, daß ich aus verschiedenen gesundheitlichen und sachlichen Gründen nicht in der Lage bin, Unterricht zu nehmen und erklärt, dass westlichen Ländern jemand sein soll, Schneider genommen werden soll. […] Buchinger : Erkläre, daß Hornik glatte Unmöglichkeit ist für uns. Aus ganz einfachem Grund. Gerade er, der aus unseren Aufgaben, hat Streik machen wollen. Hat das Zeug, dem Einzelnen seinen Willen aufoktroyieren. Geisler [Bauer und Wirt, Salzburg] : Sehe mich verpflichtet zur Bildung neuen Kabinetts zu erwähnen : Ministerium des Inneren erwähnt. Man wird trachten so zu besetzen, daß Schober bleiben kann. Will von Personen vollends Abstand nehmen, aber ich sehe es nicht ein, warum das Ministerium des Inneren nicht mit Unsrigem (?) besetzt werden soll. Wir machen draußen immer Erfahrung, daß Beamtenschaft, wenn sie hier einigermaßen Rückhalt hat, sind alle sofort in der großdeutschen Faust. Wenn Miklas Äußerung, daß er für den Posten, wo er in Aussicht war, nicht zusagen kann, so glaube, so soll dies nicht als endgültige Absage betrachtet werden. Wir alle wünschen nichts sehnlicher als das Unterrichtsministerium mit diesem edlen Menschen besetzt wird. Auch vom Handel gesprochen worden. Vollkommen einver-
160
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
standen, daß wir speziell mit Kabinettschef vollauf sympathisiert ; ist das selbstverständlichste von allem. Seipel : Bitte eines zu bedenken : Etwas muß man den Großdeutschen geben. Nichts zu geben, damit ist nichts getan. 2 Ressorts. Große Frage, welche ? Verkehr hätten wir ihnen sehr stark angeboten. Finanz bin ich anderer Meinung. Das Ressort muß eng mit Kanzler zusammenarbeiten. Am besten ist, wir brauchen keine andere Partei. So kann man es auch nicht machen, daß einfach überlassen, die wollen doch aussuchen. Schließlich werden wir 2 Ressorts ihnen lassen müssen. Unmöglich scheint mir die Geschichte, daß Inneres so besetzt, daß nicht einmal Schober in Polizei und daß sie Unterricht uns nicht lassen. Großer Teil noch großes Gewicht, daß wir ihnen Handel abknöpfen. Niedrist [Bauer, Tirol] : Jede Parlamentarisierung liegt mir im Magen. Heute heißt : Vogel, friß oder stirb. Wenn unser Obmann diese Eisenbart Praxis anwenden will, soll er sich Leute aussuchen und wir tun nicht lange reden. Wüßte gleich verschiedene Ministerien, die man aufgeben muß, z. B. Sozialpolitik. Kleines Österreich mit geringem Apparat auskommen. Möchte, daß wir nicht viel dreinreden. Schober hat noch nicht überall ganz ausgeklungen. Weiskirchner : Neigung besteht dem Obmann Ermächtigung nach besten Wissen und Gewissen zum Abschluß. Wie es je steht, 6–8 in Portefeuilles. Die werden uns im Haus sehr abgehen. Gar so rosig ist Sache nicht. Noch für Agitation Männer haben. Schluß der Debatte daher ! Seipel : Wünsche sind alle ausgesprochen. Entscheidung Klubsitzung heute nach Haus. Einstimmig. Mir lieber Regierungserklärung möglichst rasch. […] Fortsetzung ¾ 6 h Seipel : Heute so machen, daß mit verschiedenen Unterbrechungen, weil gleichzeitig wieder darüber verhandelt werden muß. Mit Großdeutschen und Bauernbündlern ¾ 3 h zusammengekommen. Bisherige Ergebnisse. Dabei noch sehr wenig Annäherung gezeigt. Mehrheit bei Großdeutschen für Waber (11 : 7) als Innenminister ausgesprochen. Paar, die für Waber waren, haben Frank für Justiz gestimmt. Mit 15 : 1 alle dafür gestimmt, daß Kraft Handel bekommen soll. In Frage Finanzminister auch durcheinander gestimmt. Beim Unterrichtsministerium noch Schwierigkeiten. In einiger Zeit hören, ob Annäherung stattgefunden hat. Alles Gewicht darauf gelegt, Lösung, die Schober ermöglicht, beizubehalten. Unterricht, wären sie zu haben. Finanzminister auch nicht. 2 große Dinge sind Justiz und Handel. Aus verschiedenen Gründen halte dafür, daß wir in paar wesentlichen Punkten nicht nachgeben können. Lieber geht Lösung nicht. Natürlich darf es nicht auf Namen und Personen zugespitzt sein, weil man sonst uns die Schuld gibt. Zweitens, wie lange Verhandlungsspiel treiben ? Hätte Meinung, wenn man nicht im Laufe heute zur Be-
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
161
reinigung kommt, daß wir morgen Hauptausschuß, daß ich meine Mission beendet betrachte. Vielleicht Regierung, die Übergang für andere Aktion. Paar Herren, die nicht präjudiziert, morgen weitergeführt wird. Werden wir aber sehen, wie Sache sich macht. Hätte auch Interesse, daß Communique herauskommt. Will noch nicht bestimmtes sagen. Früher als bis wir durch wiederholten Notenwechsel ernstlich Verhandlungen weitergeführt haben. Nur Frage, ob man über heute hinüberschiebt. Angenehm, wenn heute unter uns bereinigt wäre. Morgen 10 h Klub. [Jutz : Meinungen über Bekämpfung der Trunksucht sehr verschieden.] Seipel : Zum Gegenstand niemand zu Wort gemeldet. Muß selbst nachtragen, was Ackerbauminister anlangt. Schönbauer und Lanner gefunden, sie hätten nichts einzuwenden. Nur Födermayr, er sei ein glänzender Abgeordneter, liebenswürdiger Kollege, nur sei er nicht scharf genug als Agrarier, wie alle Oberösterreicher. Wir gesagt, die niederösterreichischen Agrarier haben ihn präsentiert und können nichts machen. Weiskirchner : Vorsitzender eventuell Notwendigkeit Ultimatum hingewiesen. Möchte bitten, noch zuzuwarten. Großdeutsche denselben Standpunkt angedeutet. Gesagt, besetzt alle Portefeuilles, wir brauchen keines. Wir Wert darauf gelegt, daß sie mit 2 Männern drinnen sitzen. Ein schwaches Kabinett bilden, dann treiben wir in Wahlen, da muß ich guten psychologischen Moment haben und der ist heute nicht gegeben. Bei Verhandlungen mit Großdeutschen Vorsicht und nicht alles mit unseren Leuten besetzen. Seipel : Ich möchte noch eventuell zur Diskussion stellen. Nicht als Antrag der Großdeutschen, sondern als Frage, ob einverstanden sein könnten, wenn Justiz Schürff. Ich zwei Bedenken : Glaube, unseren Herrn aus den Ländern gerade noch Frank verträglich, dagegen Schürff nicht. Fürchte starken Widerstand von draußen. Hätte Geschichte nicht ernst genommen. Partik sagt, daß Odehnal vom Frank wieder gebracht wurde. Wenn wir verlangen, daß Schürff Frank auf Justiz setzen und auf Handel verzichten. Drexel : Wir hätten Frank so gelobt, daß der linke Flügel bei ihnen Schürff losgehe (?). Fink : Jetzt dies wäre wieder neue Lage. Weiskirchner : Schürff ein Deutschnationaler, der uns immer näher gestanden. Zu gemeinsamen Aktionen. Von meinem Standpunkt hätte nichts gegen Schürff. Länder weiß ich nicht. Wenn gelingt, Handel für uns zu retten, so entschieden wertvoller, wenn Schober keinen Einspruch erhebt. Schürff zweifellos im alten Haus nicht bei Radikalen gewesen, sondern bei vernünftigen Deutschnationalen. Seipel : Komme mit Schober zusammen. Möchte wissen, welche Meinung die Herren haben. wenn sie alle anderen Kompensationen geben. Geisler : Straffner zu mir gekommen, und ganz gleiche Töne angeschlagen hinsichtlich Frank. Eindruck, daß da ein Trick ausgespielt werden soll. Ihr habt Generalfehler, ihr tut unsere Leute zu viel loben und dies bringt sie bei uns um.
162
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
Vaugoin : Ich arbeite mit Schürff tagtäglich gemeinsam gegen Deutsch. Muß sagen, daß er sich hochanständig aufgeführt hat. Nicht einmal sein Wort gebrochen und keine Intrige gesponnen. Gürtler A : Frage die : Justiz so machen, daß gesamter Sicherheitsdienst in Händen Schober bleibt. Frank traue zu, daß als Minister nichts unternimmt, um Schober anzuzünden. Kenne Schürff zuwenig. Wenn Schürff, dann doch sehr deutlich reden, daß er Schober dann nicht abschiebt. Mir macht Holzgeschichte keinen guten Eindruck. War doch gewisse Animosität. Partik : Wenn Frank Anregung gegeben hat. Es fragt sich, ob parteimäßig nicht mehr haben sein können, wenn wir Handel auslösen oder Schürff. Ich gefunden bei Wöllersdorf, daß er will, daß wir diesen Wöllersdorfer Vertrag, daß beide Parteien ihn verteidigen können. Ich immer gefunden, daß er einer der loyalsten Großdeutschen ist. Fink : Obmann mit Schober. Weiter sollen wir nicht gehen. Kann sein, daß man uns benützen will, um einen gegen anderen auszuspielen. Wenn Schober akzeptiert, müssen wir weiterreden. Gürtler : Ist nicht möglich, daß Frank Inneres und Schürff Justiz. Geisler : Daß in Linz geheimen Parteitag gehalten und Beamten nach links (?) gezogen haben. Wir werden bei Wahlen schwer büßen. Miklas : Kenne Schürff als Deutschnationalen, der am rechten Flügel steht, uns am nächsten. Sehr scharf gegen Sozi losgeht, so daß nach der Seite unmöglich gemacht. Aber gerade wegen der maßvollen Haltung für uns am gefährlichsten. Es würden sofort alle politischen Beamten hinter ihm stehen. Erinnere an Bombenerfolg, den Schürff am großen Weinhauertag in Wien erhalten hat. Stöckler : Wenn Großdeutsche Schürff nicht hätten, ist diese Partei auch da vollständig verschwunden. Muß leider sagen, so gemein und so gehässig wie Schürff, Klub wenig interessiert. Sein Bericht hat so viele Lügen gegen uns wie kein Mensch, frech auszustreuen. Die Zeit ist vor der Tür, dies zu besprechen. Dieser Retter Österreichs sehr rege in Verbindung gebracht zu manchen Verhandlungen, die mehr dem Verbrechen ähnlich sehen als was in Vergangenheit. Ich schaue Schürff als einen der gefährlichsten Deutschnationalen an. Heinl : Zu Schürff folgendes sagen. Vollkommen richtig, was Stöckler gesagt hat. Kultur gewiß Sache des Ausschusses gewesen, wäre zu sagen, daß Bericht anders ausfällt. Was festgelegt ist, ist eigentlich Meinung des Ausschusses, z. B. Untersuchungsausschuß Fischamend und Blumau. Wurde gesagt, daß es nicht so ausfällt. Was Verhalten Schürf anbelangt, ich persönlich immer sehr gut ausgekommen. Daß bei Holzabstockung eigentümlich benommen, ist richtig, hat aber von Partei Auftrag bekommen, sich so zu verhalten. Föderm ayr : Wenn meine Person Schwierigkeit, bitte abzusehen.
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
163
Fink : Ruhig sein ; so weit sind wir nicht. Die ganze Stimmung hat mir Eindruck gemacht, daß Klub bereit ist, am Födermayr festzuhalten. Frage, ob andere Meinung hier wäre. A igner : Habe heute Klubkollegen im angelegentlichen Gespräch mit Herrn Herwei getroffen. Finde dies geradezu unverantwortlich. Geisler : Diese Mitteilung empörend ! Erinnere mich, wie Fink Obmann, wo nicht mehr hat gesprochen werden können. Nicht zu viel verlangt, Klubbeschluß : Dieser Kollege muß genannt werden. Wie kommen wir dazu, daß wir uns schief anschauen lassen. M ataja : Jedes Mitglied Klub selbstverständlich Verpflichtung diesem Haderlumpen Mitteilung zu machen. Halte dies für ganz unzulässig. Lut tenberger [Bauer, Oststeiermark] : Wenn wir noch zurückerinnern, wie 1. Regierung Schober, wie dort durch Unzukömmlichkeiten, die für Volk ungeheuren Schaden gebracht haben. Nun wäre es Pflicht von uns allen, wenn wir so einen Verräter unter uns haben, hinausschmeißen. Gürtler A : Ein dummer Mensch ist gefährlicher wie ein Lump. Fink : Aigner überlegen, ob nicht bereit ist, Obmann Namen zu nennen. Meint, dies könnte er machen. […] Seipel : Dinghofer mitteilen, was sie als letztes herausgebracht haben. Inneres und Vizekanzler Frank. Grünberger und Födermayr, Schmitz, Unterricht Schneider, Finanz Ségur, Verkehr Odehnal, Vaugoin. Justiz Waber, Handel Kraft. 7 Christlichsoziale und 3 Großdeutsche im Kabinett wären. Mit Schober, würde unter verschiedenen, nur nicht unter Waber. Waber in Justiz geniert ihn gar nicht. Da keine Schwierigkeit. Wunsch [Präsident Tiroler Gewerbebund] : Ich glaube, wir haben jetzt 1½ Jahre im Parlament während des ganzen Hierseins als Handel, Gewerbe daß Existenzmöglichkeiten fast fraglich geworden ist. Kurz Heinl gehabt, der uns noch Hoffnung gegeben hat. Daß Handel, Gewerbe noch eine Bedeutung hat. Glaube, daß wir uns doch wieder an diese Seite anklammern können. Wir haben ganze Woche Gewerbetag abgehalten und ausgedrückt, wie Handel denkt. Immer und bei allen Wünschen ist Name Heinl zum Ausdruck gekommen, wir erwarten, wenn nichts anderes, diesen Posten wieder mit Heinl besetzt zu sehen. Wir haben Überzeugung, daß ein Mann, der in einem Ressort groß geworden ist und so viel geleistet hat und wir duldend alle Lasten auf uns genommen. Gerade in diesem Moment werden wir Einkehr halten müssen. Wenn wir dies einem Freiheitlichem überantworten, der alles für sich ausschrotten kann. Kann mit [ein Wort unleserlich] durch Volk an sich ketten und die Erfolge für sich herausschlagen wird. Kein anderes Portefeuille ist so wichtig. Steinegger : Ersehe in neuer Mitteilung, wo Verhältnis 3 : 7 ist, gewissen Ernst der Großdeutschen zur Lösung zu kommen. Hätte viel eher gefürchtet, daß wei-
164
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
gern würden, mehr Stellen anzunehmen, weil Belastung ungleich für sie größer ist, als wenn weniger besetzen würden. Frage, ob bezüglich Bauernpartei schon gewisse Abmachungen bestehen, daß die nicht gebunden erscheinen ? Mir scheint, daß wir in erster Linie Staatsinteressen im Auge haben und diese gewahrt, wenn raschest Lösung zustande kommt. Wenn Kanzler sich abfindet, so Personen sekundäre Bedeutung. Muß z. B. offen sagen, daß mit Ségur begreiflich ist, wie Kunschak geschildert hat. Eindruck, daß es sich um Schiebung handelt, wo der Partei im Ende gewisser Dienst erwiesen wird. Seipel : Hätte gerne gehabt, wenn Bauernpartei Wünsche haben. Bauern sich sehr interessiert erklärt als Bedenken gegen Födermayr haben. Ich habe hier zu berichten, was Großdeutsche hier vorschlagen. Ich habe Dinghofer in Anerkennung, daß Frank hingegeben habe, sofort gesagt, dies setze bei meinen Leuten schwer durch. Ich mache auch keinen Vorschlag dies zu akzeptieren. Möchte eines bitten, lieber ist, wenn jetzt über großdeutsche Vorschläge gesprochen würde. An unsrigen dürfen wir nicht mehr rütteln. Gürtler A : Geht nicht, daß man alles wieder von vorne anfängt, so werden wir alle nervös. Konkreter Vorschlag, der ist aufs Handeln ausgerichtet. Glaube, sie calculieren. Ihnen ist der Handel sehr wichtig. Infolgedessen probieren für Justiz einen, den wir nicht fressen werden. Glauben, daß wir uns noch eher für Kraft entscheiden werden, um Kraft zu erhalten. Nun heißt es abwägen. Jetzt Frage : Kraft oder Waber. Ich Gefühl, es bringt Bindung der Großdeutschen, worauf es uns ankommt, eher mit Waber. Glaube, daß durch Waber stärker an Kabinett gebunden als durch Kraft. Weil er auf der linken Seite steht. Kraft einer von Vernünftigeren. Wenn wir hineinnehmen, haben wir Interesse, Leute zu binden. Wenn Waber nicht hereinkommt, wird er in seinem Klub immer herumstänkern. Frank und Kraft nicht die, die sich im Klub durchsetzen werden. Frage, hält Justiz politisch noch für harmlosestes. Versteht nicht ziemlich viel, wird dort sehr ernst nicht genommen werden. Wenn ich eine Kröte fressen muß, möchte mich eher noch für Waber entscheiden. Führende Rolle doch Frank haben, wenn Frank drinnen sitzt. Waber ist sehr faul. Schön ist es nicht, schön ist aber kein Kabinett. Aber an Handel (denke nur an Käse) sollten wir unter allen Umständen halten. Seipel : Sehr dafür, daß wir auf dem Wege herauskommen. Meine Meinung Waber weitaus stärkere Belastung als alles andere. Das ganze Kabinett wird in [Wert ?] Schätzung herabgedrückt. Außerdem große Belastung für mich und uns, wir hätten guten Ländervertreter drinnen – Ramek – habe wiederum Ländervertreter weniger und Wiener mehr drinnen. Sache schaut viel schlechter aus. Dazu bekommt Kabinett viel großdeutscheren Anstrich, natürlich noch mehr, wenn wir drei drinnen haben. Aber wenn wir noch zu guter Stunde Kabinett zusammen und das Opfer bringen, das für mich ein sehr starkes ist, Opfer an Ansehen und Personal, bin ich dazu bereit. Wenn wir Handel dafür herausschlagen, auch ich dafür, daß weitere Verhandlungen
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
165
so geführt werden, weil ich Wünschen des Klubs Rechnung trage. Alles was mehr gefühlsmäßig ist, und meine eigene Stellung anlangt, würde nach anderer Seite Ausschlag geben müssen. Schließlich und endlich will ich an mir nicht scheitern lassen. Muß zufrieden sein, daß ich zwei Sachen erledigt habe. Halte für sehr gut, sobald Meinung geklärt haben, man zu Großdeutschen ginge zu verhandeln. Halte für sehr gut, wenn Fink und Weiskirchner gingen und ich nicht dabei wäre. A igner [Präsident Katholischer Volksverein, OÖ] : Dinghofer gesagt, als letzter Vorschlag. Wenn Ultimatum wäre (Seipel : Von Ultimatum weiter keine Rede) Unterschreibe jedes Wort, was Wunsch über Heinl gesagt hat. Was Heinl ist, darüber kein Wort zu verlieren. Heinl auf allen Tagungen als Programm erschienen. Wort gesprochen, daß ganze Lage beleuchtet. Wir stehen auf ½ 12 h. Möglichkeit Staat noch einmal heraus zu reißen. Da opfern wir Seipel. Weiß nicht, ob wir an Personenfrage Sache scheitern lassen sollen. Habe Gefühl, daß wir draußen vor Wählerschaft nicht bestehen werden können. Wenn Möglichkeit der Rettung ist, dann gibt es für uns keine Neuwahlen. Wenn Staat Neuwahlen aushalten würde, Zeit nicht gekommen, Seipel zu opfern. Um Schober zu bekommen, haben wir viel geopfert. Und jetzt an Personenfrage. Da müßte man sagen, Partei spielt kein klares Spiel. Klub bitten, Seipel vollständig freie Hand zu geben. Wir sind Volkspartei. Sonderinteressen unterordnen. Seipel : Sehr lieb, angenehm nicht, wenn Verantwortung überläßt. Kann mir vorstellen, daß Moment kommt : Entweder – oder. Glaube nicht, daß wir in diesem Augenblick schon so nervös zu sein brauchen. Vom Privileg später einmal Gebrauch machen. Kunsch ak : Will nur meiner Verwunderung Ausdruck geben, wie schlau Großdeutsche gewesen sind. Verlangen politische Verwaltung, Rechtspflege und ganzes Wirtschaftsleben, uns überlassen sie soziale Verwaltung, Kraft wird anti machen. Überlassen uns Finanz, wo wir uns auch Kopf zerbrechen können. Wir müssen uns sagen, dies ist für uns unannehmbar. Eines müssen sie uns überlassen : Ohne Heinl keine Gewerbepolitik. Wir müssen Handel und Soziales in der Hand haben, wenn es vernünftige Politik geben soll. Wenn Großdeutsche Handel haben wollen, geben wir ihnen auch soziale Verwaltung. Frage, ob 3 Großdeutsche, für mich untergeordnete Bedeutung. Aber Kombination wie vorliegt, absolut unannehmbar. Noch einmal in aller Feierlichkeit (?) bekannt geben, für mich Ségur glatte Unmöglichkeit, von vornherein aussprechen. Heigl [Dachdecker, Wien] : Im großen ganzen Kunschak anschließen. Wenn Gewerbebewegung betrachten, in allen Ländern eigentlich ein großer Zug gegen uns, weil wir bis heute tatsächlich nichts gemacht haben als soziale Gesetze. Wir haben es ertragen. Ich war einer, der dafür war. Wir haben 10 Jahre Gewerbeförderung und nicht einziges ist durchgeführt. Jetzt soweit, Programm aufgestellt. Niemand wird sagen, Christlichsoziale haben gemacht. Gewerbe : 10 Jahre nichts geschehen
166
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
und Kraft paar Monate dort und dies und das ist geschehen. Sehe ab von der Person. Mir ist ganz gleich : Wir müssen Ressort für Christlichsoziale haben. Obmann sehr bitten, wenn möglich, Ressort erhalten. Diwald [Bauer, NÖ] : Für außen sehr schlecht, wenn Deutschnationalen nicht 3 Stellen geben würden. Würde nicht verstehen, daß man Deutschnationale Ministerien aussuchen läßt. Handel müssen wir haben. Kombination Handel mit sozialer Verwaltung hat Hand und Fuß. Vaugoin mich hingewiesen, ob man Schürff nicht Heerwesen geben könnte. Inneres, Heer, Justiz = ganze Hoheitsverwaltung. 8 : 2 entspricht der Relation. Glaube nicht, daß auf 3 bestehen würden. Handel ungeheure Verfügungsgewalt. Seipel : Auf Bemerkung zurückkommen, in der Großdeutschen Heerwesen anzubieten. Wir wissen, wie Schürff in der Beziehung ist. Er will die Wehrmacht aufbauen. Starke Rücksicht auf Offiziere. Es heißt nicht, daß wir Kraus Leute fördern. Begreiflich, daß Vaugoin dies vorbringt, weil ihm erspart bleibt. Will nicht so boshaft sein. Weiskirchner : Gürtler hat sich im Irrtum befunden, daß zum Handeln eingerichtet ist, Aigner hat vollständig richtig empfunden. Dinghofer mit aller Deutlichkeit gesagt, es ist ein Ultimatum. Er außerstande Großdeutsche zu bringen. Großdeutsche der Meinung, daß Vaugoin schon einstimmig aufgestellt ist. Habe Eindruck gewonnen, daß wir diesen Vorschlag akzeptieren sollten, sonst Verhandlungen gegenstandslos und gehen mit mißlungenem Kabinett hervor. Fink : Es ist sogar das Wort Ultimatum gefallen, nicht so, daß wir bei unseren nichts ändern könnten. Seipel : Frage für uns eine mehrfache : 1) Ob wir uns auf Standpunkt stellen sollen, daß wir uns auf Grund der Mitteilungen entscheiden sollen oder ob wir uns noch vorbehalten möchten weiter zu reden und nicht Entscheidung zu fällen. Hat etwas für sich, wenn man in Morgenblättern verkünden kann, Wahl gesichert, schaut besser aus, als wenn bestürzt hineingegangen sind. Andererseits für sich, sich nicht zu entscheiden, sondern Möglichkeit des letzten Tages vorzubehalten. Für die, die gestern Opfer bringen müssen, die hineingehen müssen und die, die Wunsch nicht erfüllt sehen. 2) meritorisch. Ob uns ein so zusammengesetztes Kabinett Bürgschaft zu bieten scheint, daß man dies probieren kann, was wir vorhaben. Dagegen, daß sehr starken großdeutschen Einschlag hat. Weiskirchner : Soll ich für morgen Hauptausschuß einberufen. Wenn wir heute Hauptausschuß einberufen, haben weitere Verhandlungen nicht viel Sinn, weil sie dann nur tapfer aushalten müssen. Seipel : Aus dem Nichts heraus ist Verständigung sehr schwer. Vielleicht Mittelweg. Parteien verständigen, daß er Hauptausschuß morgen einberufen. Sie sollen sich bereit halten, Im zweiten Fall kommt Unsicherheit in Zeitung. Gürtler : Weiß, nicht gut heute zu Ende bringen. Jetzt sind wir erst in der Lage Stellung zu nehmen. Wenn Hauptausschuß, nachher Haussitzung machen. Ob mor-
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
167
gen oder übermorgen, sehe ich nichts besonderes. Mein Gefühl, wir sollten doch noch versuchen, Seipel selbst noch einmal reden, persönliche Stellung zu Trifolium. Ob Großdeutsche darauf ankommen lassen, daß Seipel seine Mission als beendet, das wird nicht so heiß gegessen werden. Fink : Bin sehr einverstanden, die Sache taktisch sehr gut erwägen werden. Meine Meinung geht dahin, daß wir bei Großdeutschen nichts mehr erreichen. Daß Seipel nicht sagen kann, er kann nicht so übernehmen. Weil wir immer von zwei Bedingungen gesprochen haben. Diese 2 Bedingungen sind erfüllt. Jetzt glaube nicht, daß wir so starkes Mittel einsetzen dürfen zu sagen, es geht nicht. Schwache Mittel nützen uns nichts. Wäre ganz dafür heute abschließen, aber eines hindert mich, das sind Bündler. Wenn wir fest ausgeben, würde morgen 12 h im Hauptausschuß. Taktisch dürfen wir nicht so besuchen, Müssen mit ihnen noch reden. Heute wird es nicht mehr möglich sein. Würde sagen, Großdeutschen gegenüber ist es abgeschlossen. Jeder Tag ist ein Verlust. Dagegen würde sagen, wir dürfen nicht fest den Ausschuß einberufen wegen der Bündler. Daher entweder Mittel wählen, daß wahrscheinlich Sitzung um 12 h sei. Weiß nicht, ob man anderen Gegenstand setzen könnte, es notwendiger Gegenstand. Vielleicht fest einberufen mit dem anderen Gegenstand. Es sind die Steuereinheiten, das wollen alle haben. Seipel : Unter diesen Gesprächen bilde ich mir eine Meinung. Aus anderen Gründen ganz unmöglich, daß ich Großdeutsche sehe. Ich kann nicht in die Hand nehmen. Es handelt sich um Frage, welches Ressort von Christlichsozialen besetzt und welche Deutschnationale hineinkommen. Keiner hat so etwas verbrochen, daß wir dies sagen können, wir können auch nicht sagen, daß Christlichsoziale noch einen wollen. Klub kann Beschluß fassen, er sieht, daß das mögliche genannte Kabinett wegen der ungünstigen Verteilung der Ressorts nicht geeignet, Aufgabe zu erfüllen. Klub hat seinen Auftrag an mich zurückgegeben. Das geht. Öffentlichkeit würde sagen, wegen eines Namens läßt er es scheitern. Nun meine Meinung : Wir sollen heute auf keinen Fall abschließen ; es ist im Klub nicht die Stimmung. Ich mache mich nicht schöner als ich bin. Habe für Technik Verhandlungsleitung Sinn. In der Sache will ich nicht drängen. Wir müssen mit Bauernbündlern und sicher mit Czernin reden, der mitwählen will. Mit dem Aufschub stellt sich Frage, was verpflichtet uns dann, Hauptausschuß um 12 h zu halten. Wenn wir 3 h Haussitzung haben und wir sind fertig. Dann können ausgesuchte Minister vorher zusammensetzen. Es hindert uns nichts, daß wir ½ 3 h Haus machen. Da haben wir Sozi schon munter. Wir werden jetzt noch versuchen, ob von Großdeutschen und Bauernbündlern noch jemand zu finden ist. Man sieht und nicht glatt [ein Wort unleserlich] des Ultimatums Eindruck macht. Wunsch : Im Klub Verpflichtung Eindrücke von draußen wiederzugeben. Selbstverständlich, daß Seipel im letzten Zuschriften (?) so treffen, wie nötig, aber wir Pflicht Wünsche bekannt zu geben. Ausdruck gegeben, weil Sache dienen. Ob nicht möglich, die 3 zu verschieben, daß sie andere Portefeuilles wollen.
168
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
Steinegger : Hauptpunkt überhaupt zur Lösung zu kommen. Kunsch ak : Großdeutschen Mitteilung über Meinung des Klubs machen. Neige Ansicht zu, 3 Mandate sollen sie haben. Personenfragen sind für uns nicht interessant. Verteilung Ressorts wichtigstes. Ihr Plan aus sachlichen Gründen unannehmbar. Wir übernehmen ganze Verantwortung : Kanzler, Finanz, soziale Verwaltung, ohne Möglichkeit, daß Handel auf gleicher Linie wie soziale Verwaltung. Wir haben Kampf mit Tomschik und Zelenka, Großdeutsche alles bequem im Handel. Wenn das Arbeitsgemeinschaft ist, so ist zu dumm, sie wollen uns hineinlegen, Schmutzarbeit in des Wortes schlimmster Bedeutung. Ein solches Spiel ist nicht zu führen. Antrag Klub vertagt auf morgen. Seipel gebeten, mit Großdeutschen in dem Sinn zu sprechen. Seipel : Wenn andere Verteilung der Ressorts wäre, würden wir ähnliches auch hören. Besonders von Miklas. Man kann es nie allen recht machen. Die Taktik ist ganz unmöglich, das setzt voraus, daß wir nicht verhandelt haben und erst heute anfangen. Immer auf Standpunkt gestanden : Es handelt sich uns um Personen, die sind unerwünscht. So wie jetzt ist, ist ungünstige Verteilung = Person und Ressorts. Wir sagen daher, kein Hauptausschuß ein. Gürtler : Gefühl, wir sind müde, wir reden heute nichts mehr.
Klub, 31. Mai, 10 h v.m. Fink : Von letzten Verhandlungen von Großdeutschen verärgert hergekommen. Bei Großdeutschen ausgesagt, sobald man von Innerem geredet hat, »nur bedingungsweise ist es erledigt«. Wenn nicht Inneres, Justiz und Handel bekommen, daß dann alles zusammenfällt und dazu ein Ultimatum. Wir haben Handel nicht als Handelsobjekt behandelt. Dann Art der Vorbringung Wenn schon 3, schauen, ob man es nicht beim Heeresamt machen können. Gesagt, wir haben hier einstimmig Vaugoin verlangt. Dinghofer : »Ich sehe auch sonst, daß unsere und ihre Leute selbst miteinander verhandeln.« Ich habe doch gedacht, ich muß alles sagen, daß Ordnung wird. Doch wir tun könnten, wenn wir es machen wie Großdeutsche. Klubbeschluß fassen : Handel und einziger ist der Heinl. Wenn nicht akzeptiert, auf totem Punkt angekommen. Dann sind wir schlechter dran. Unbedingt müssen wir verlangen 1) Von Großdeutschen unserem Vorstand Versicherung geben lassen, daß das Handelsministerium bei Parlamentarisierung unser Besitzstand ist. Vorsorgen, daß jemand von uns Subventionen mit kontrolliert. Das auch bei Ackerbauministerium machen. Wir müssen auch Portefeuillefrage miteinander ordnen. Verlangen, daß Bugermann (?) unbedingt in seiner Stellung bleibt. Seipel : Ein Wort selbst erlauben. Wir wissen, daß immer so ist, daß neben offiziellen Verhandlungen andere geführt werden, wodurch Sache erschwert worden
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
169
ist. Mir ist recht, daß Herren wissen, warum es nicht nach Wunsch ausgegangen ist. Noch Vorschlag dazu machen : Eines zu sagen, aber nicht viel Hoffnung. Wenn wir so viele ins Kabinett schicken, werden uns um Kräfte bringen, die wir sehr notwendig brauchen. Wir haben keinen Beamtenvertreter mehr. Vorschlag : Um 2 weniger ins Kabinett. Beim Verkehr Rodler lassen. Unter Voraussetzung, daß sie auch Reduktion vornehmen. Uns einen Platz lassen. Handel vielleicht frei kriegen. M ataja : Bin betroffen, daß wir Heerwesen übernommen haben. Sehr dagegen, daß wir jetzt Heer übernehmen. Seipel : Gemeint taktisch oder sachlich ? (M ataja : Ich meine im Ernst !) Weiskirchner : Erster Linie Worte Finks bestätigen. Ich habe Eindruck, daß mit Großdeutschen weitere Verhandlungen zu keinem Zweck. Höchste Zeit zum Abschluß. Wir dürfen an Personen nicht Kabinett scheitern lassen. Das ist letztes Kabinett, das wir stellen können. Wir haben kein anderes Kabinett mehr. Geben Übermaß. Sage, daß Vaugoin glänzend ist. Ist Stütze für Seipel im Kabinett. Durch Vaugoin verstärken wir das Kabinett. Warum redet niemand über unseren ausgezeichneten Ramek. Befreien wir uns von Gefühlsmomenten. Wenn wir heute nicht fertig werden, ist Kabinett nahezu gescheitert. Seipel : Wenn 3 Großdeutsche geschluckt werden müssen, bin doch dafür, beiderseits Verminderungsversuch zu machen. Garantiere nicht, daß morgen noch Sinn zu wählen hat, wir wissen es ja jetzt nicht. Daher heute alles im Haus machen. Wenn 3 Großdeutsche, dann bitte auch Odehnal und Vaugoin. Im Moment, wo wir Courage haben müssen, möchte nicht mehr auf Rodler zurück, außer ich bekomme dafür Handel. Vaugoin : Stelle mich zur Verfügung. Heinl : Ich der Meinung, daß wir abschließen müssen. Ich unter keinen Umständen schuld, daß Kabinettsbildung gestört würde. Paulitsch : Wenn man Liste unbefangen liest, so gewinnt unwillkürlich Eindruck, daß diese Liste bei Parteigenossen manche Bedenken hervorrufen wird. Wir erwarten irgendeine Tat, daß zugegriffen wird, dann wird wieder Vertrauen einziehen. Unsere Leute haben auch Parteiminister zu sein. A igner : Stellt fest, daß ich den Namen nicht genannt, der mit Herwei gesprochen hat. Diwald : Ich den Herrn gewarnt, daß er es stehen lassen soll. Seipel : Wir brauchen Zeit für Verhandlungen. Mir überlassen abzuschließen. Bitte ½ 12 wieder hier zu sein. Einstimmig angenommen ! ! ! Gürtler J : Regierung Schober ist gegangen und Seipel kommt. Schließe Bilanz : Wir haben nichts über Kreditaktion gehört ; wissen nicht, haben wir etwas bekommen, sind sie verausgabt worden. Finanzminister alle Wochen über die Lage im Klub gesprochen worden.
170
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
Seipel : Meine Absicht über alle Angelegenheiten Klub sehr genau zu informieren. Die Antwort auf die Frage bekommt Gürtler nicht. Streng verboten durch das Gesetz. Fortsetzung ½ 12 h : Weiskirchner : Zuerst zu deutschnationalen Bauern gegangen. Zuerst aber 2. Akt des Dramas. Seipel und ich bei Dinghofer. Trotz aller Argumente kein Erfolg. Großdeutsche nicht in der Lage Änderung vorzunehmen. Dabei bereit, die Bedingungen Finks akzeptieren. Erklärung, daß nicht als Besitzstand betrachten und daß vollkommene Freiheit herrscht. Bezüglich Subventionen im Handelsministerium Einvernehmen mit der Partei gepflogen wird, Partei Vertrauensmann nominieren und daß Bugermann (?). Auf Grund der Auseinandersetzung Seipel mich ersucht, ½ 1 h Hauptausschuß einberufen. Bauernbündler : Darum unisono gegen Födermayr. Nicht imstande für Liste zu stimmen, wenn Födermayr darin bleibt. Es handelt sich aber, daß heute gezeigt wird, daß antisozialistische Arbeitsgemeinschaft zustande gekommen. Da ist Sache noch ausständig. Unsere Sache Erwägung anstellen, was ist uns wertvoller oder daß wir statt Födermayr anderen nominieren. Fink : Gefragt, ob nicht Buresch kandidiert. Hätte jemand, der uns gut vertreten würde und Bündler nichts sagen können. Wenn zusagt, daß für nächste Zeit übernimmt, für uns großer Gewinn. A igner : Oberösterreicher stehen auf demselben Standpunkt. Unseren sehr vermissen. Nun ist er einmal genannt worden. Schon bitten, daß man nicht opfert. Es ist Prestigefrage von Partei. Die Stellungnahme Bauernbündler sehr freuen würde. Ersuche alles zu tun, Födermayr zu halten. Wir vertragen nicht, daß Schönbauer unseren Födermayr wirft. Lut tenberger [Bauer, Oststeiermark] : Wie Aigner. Wir kann man sich von kleiner Gruppe terrorisieren lassen. Irsa [OÖ. Bauernbund] : Glaube doch bei letzter Frage Halstarrigkeit an Tag legen. Wäre eine Schande für uns. Halte ganz belanglos, ob mitgehen oder nicht. Schönsteiner [Generalsekretär, Wien] : 6 Bauernbündler Verdienste bei Abstimmung über Wiener Stadtschulrat. Ansprüche darauf, daß wir ihnen entgegen kommen, wenn wirklich für uns eine Frage ist. Meine aber, daß keine Frage sein darf. Wir sind in Nachgiebigkeit so weit gegangen, als mit Ehre noch verträglich ist. Klub bitten nicht abzugehen (Bravo !) Seipel : ½ 1 h Hauptausschuß. Auf 6 Stimmen verzichten ist schreckliche Sache. Spott der Sozi und auch politische Folgen. Föderm ayr : Bitte vielmals von meiner Person abzusehen. Seipel : Habe Debatte unterbrochen. Kunsch ak : Aber wer hat Regierung gestürzt ? Wer hat Verpflichtung Regierung zu bilden ? Frage : Sind wir Hausknechte.
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
171
Seipel : Damit Frage erledigt : Ich kann keine Regierung bilden, wenn ich solchen Klub hinter mir habe. Rintelen : Nach noblen Erklärung Födermayrs Ausführungen erleichtert. Heute zwischen Bauernbündlern und Großdeutschen große Unterschiede. Bauernbündler vollständig objektiv verhalten. Schober gehalten bis zum letzten Moment, Gürtler gehalten. Verlangen Portefeuille nicht für sich. Stehe schon auf Standpunkt, daß nicht dieselben Gesichtspunkte. Verbrechen in dieser Lage in bürgerliche Parteien Uneinigkeit hineinbringen würde. »Bauernbündler werden nie für uns Bedeutung haben.« Das glaube ich nicht. Burgenland 2 Bauernbündler. Sehen, daß wir auch Vermehrung und zusammen in der Not Regierung werden bilden können. Dann viel besseren Standpunkt, als wenn Konflikt mit Bauernbündlern. Niedrist : Daß werden Landwirte Blamage erleben. Wenn Überzeugung hätte, daß auf dem Mist der Bauernbündler gewachsen ist, dann gebe ich es zu. Fink : Möchte alle Herren bitten, möglichst ruhig zu sein. Aufregung nützt uns nichts. Steinegger : Vorläufig scheint mir Sache noch im Klub selbst zu sein. Glaube, daß wir doch ruhig behandeln müssen. Das Volk ist zugänglich für Eindrücke und Gegner werden sagen, daß draußen Ansicht, die Christlichsozialen haben aus Versorgungssucht im letzten Augenblick Kabinettsbildung verhindert. Wenn Kabinett gebildet ist, ersten Anlaß benützen, um Sache auseinander gehen zu lassen. Gegenwärtiger Augenblick sehr schädlich und unnütz. A igner : Wir der Ansicht sind, daß über Frage der Personen niemals Kabinettsbildung scheitern darf. Namens der Oberösterreicher erklärt, fügen wir uns selbstverständlich der staatlichen Notwendigkeit. Föderm ayr : Durch Beharren Partei und mich in schlimmste Lage bringen. Miklas : Ganzer Klub Födermayr außerordentlich dankbar. Antrag : Dank aussprechen. Er möge überzeugt sein, daß er völliges Vertrauen hat, wenn nicht durchsetzen, nur Gewalt der politischen Umstände, die uns zwingt, auf ihn zu verzichten. Jetzt Stimmung des Klubs : Belastungsprobe geht nicht mehr weiter. Bedaure, daß erst in letzter Minute zum Ausdruck gekommen ist nach Rede Kunschak. Vielleicht gut schon bei früherer Lage, den elementaren Ausbruch zu zeigen. Wir müssen eingebrockte Suppe auslöffeln bis zur Neige. Antrag : Möchte nicht, daß Erregung auf Parteiführer übergreift. Bedaure, daß Seipel gleich so rasch bei der Hand war. Dringend bitten, daß restlicher Vorstand bezüglich Landwirtschaft andere Lösung findet. Seipel : Ich erklärt, daß wir jetzt keine Lüge brauchen können. Gürtler : Wir uns langsam angewöhnen, Benehmen wie erwachsene Menschen. Solcher Temperamentsausbruch gegen einen Mann, der so angespannt arbeiten mußte, das geht nicht. (Spalowsky : Hofmeisterei) Wir müssen ins Klare kommen, in welcher Lage wir stehen. Mit ungeheurer Selbstverleugnung mit Großdeutschen, die hätte keinen Sinn, wenn wir im letzten Moment mit Gruppe, die immer loyal,
172
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
auf einmal Erregung, die Leute stellen auch Forderungen. Da hat man von Haus aus im klaren sein müssen. Sie verlangen einen etwas radikaleren Agrarier als Födermayr. Das hieße Födermayr politisch umbringen. Infolgedessen schauen, daß man jemand hinbringt, den sie in Ruhe lassen, und das sogenannte Vertrauen hat. Bei uns gewisser Teil gegen Kraft und er wird sterben müssen. Bitten, geben wir der Sache nach. Bei allen Dingen, die man tun muß, man Idee hat. Seipel : Es ist viel wesentlichere Frage Besetzung des Ackerbaues, da haben wir uns nie hineingemischt. Viel wichtiger ist, nach Äußerung Kunschak ist es zweifelhaft, ob Klub will, daß wir Regierung bilden oder nicht. Bitte endgültig um Entscheidung. Einstimmig Wille, daß wir Regierung bilden. Fink : Buresch finden wir nicht. Stöckler : Für uns Lage furchtbar schwer. Wir haben nie gedacht, daß Widerstand sein wird. Weiskirchner : 6 Abgeordnete genannt, daß sie 6 zustimmen. Fortsetzung ½ 3 h Fink : Regierung Wahl und gleich Erklärung und Debatte. Wir haben einen Redner bestimmen. Frage, ob Herren einverstanden, daß Mataja als Redner kommt. Wir brauchen einen, der auch glaubt, daß man etwas machen kann. Weiski : ¾ 3 h Schober Abschied. Freundlichen Empfang bereiten. H auser : Möchte nur vor ganzem Klub ausgesprochen haben, daß wir Oberösterreicher mit bitterem Gefühl zur Regierungswahl schreiten. Von uns noch nie jemand gehört, daß wir einige gesagt hätten, daß wir austreten oder Stellung beziehen. Immer treu und redlich zum Klub gehalten. Für uns äußerst schmerzlich, daß Födermayr heute allein gelassen worden ist. Um der schönen Augen des Schönbauer willen ist unser Bauer Födermayr fallen gelassen worden. Buchinger bringen wir sicher alles Vertrauen entgegen. Auf der anderen Seite muß ich sagen, einen Mann durch alle Zeitungen schleifen und in letzter Minute ihn auf einmal lahm legen, es tut uns bitter weh. Fink : Begreife dies sehr wohl. Alle sehr schmerzlich finden. Der Fehler ist vielleicht schon zu Ostern gemacht, daß man nicht gleich von allem Anfang an mit Bündlern gesprochen hat. Wahrscheinlich ein Übersehen gewesen, dann wäre unangenehme Lage nicht gekommen. Kanzler Standpunkt, daß großes Interesse, daß alle Nichtsozialisten einen Block bilden und daß dies bei der Wahl in Erscheinung tritt. Alle sehen ein, daß schmerzlich, aber wir müssen schauen, wie wir weiter kommen und vielleicht kann man es etwa gut machen. Weiskirchner : Frage, für wann morgen Haussitzung. 11 h einverstanden. […] Gürtler : Persönliche Erklärung abgeben. Gebe zu, daß ich mit meinen Äußerungen in Form über Maß hinausgewagt habe. Nur meine Freundschaft für Seipel mich zur Äußerung gebracht hat. Bitte aufrichtig und ehrlich um Entschuldigung.
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
173
Schönsteiner : Auch meinerseits. […] Seipel : Danke sehr für Begrüßung, weiß, daß Entschluß schmerzlich für ganze Partei, eben großes Wagnis, daß wir jetzt hineingehen. Regierungserklärung heute Nacht schnell verfaßt, wie erste Rede, die ich früher geschrieben habe. Schober erscheint. Lang dauernder Beifall. Seipel : Dank, weil so treu zu unserer Partei gestanden ; nehmen an, daß Eindruck gehabt haben, daß noch die erträglichste politische Partei die christlichsoziale ist, daß Sie als alter, echter österreichischer Beamter bereit erklärt haben, Sicherheit in der Hand zu behalten ! ! Schober : Habe selbstverständlich das Bedürfnis gehabt, nicht zu scheiden, ohne der Partei für treue Unterstützung herzlich zu danken. Gerade wie vor 11 Monaten dem Ruf gefolgt bin, auch jetzt dem Wunsch Seipels folgend, selbstverständlich gesagt, daß ich gar nichts anstrebe, wenn man aber wünscht, bin ich bereit. (Beifall) Bitte um freundliches Andenken.
Klubvorstand, 12. Juni Seipel : Ich bin leider schon wieder abberufen worden. Von dem Bericht, was ich mit Seitz zu reden gehabt habe. Rede davon, was macht man, um in diesen Tagen gefährliche Erscheinungen zu vermeiden, wobei Besorgnisse bei Seitz ziemlich groß sind. 4, 5 Mal Erscheinungen gehabt, an die, die heute erinnern, nur daß nicht solchen Grad erreicht haben. Gefährlichst waren einerseits die Angstkäufe, dazu versucht, selbst im Detailhandel in ausländischen Valuten Preis gefordert und gezahlt wird. Jedes Verkaufen jetzt bedeutet, für Geschäftsleute großer Verlust. Nun droht nach diesen Erscheinungen etwas anderes, daß die Geschäftsleute vielleicht morgen sperren, wenn dies eintritt, erhöht es damit Panik. Es heißt dann gleich, es sind Plünderungen angekündigt, wie diese Gerüchte immer vorauslaufen, Nervosität, böser Willen. Gestern Vormittag in Bregenz Nachricht, daß in Wien Revolution, so wird gearbeitet. Wenn die Geschäfte gesperrt werden und Gerüchte sind, Sperre allein Anlaß, daß Leute zusammenrotten und Ausschreitungen folgen können. Seitz seine Leute zusammenberufen auf ½ 9 h. Seitz mich gefragt, was ich mir denke, ich sofort auf zweite Gefahr aufmerksam, daß man sich hinreißen läßt, die Aktionen, die Lage verschlimmern, nicht verbessern. Anschluß der Krone an die Mark. Im übrigen suchte Bauer am Schluß der Rede eigentlich zu beruhigen, töricht 1. XII. zu wiederholen. Das ganze wirkt aber im entgegengesetzten Ende. Ich finde derartiges Drängen zur alternativen Politik gefährlich, weil solche Gedanken Wurzel fassen und Leute glauben, es sollte geschehen. Poincaré läßt sagen, daß sie rasch arbeiten, hofft, daß rasch geschieht. Aufrichtig gesagt, daß Kredit von Franzosen kommt wahrscheinlich. Italien bin ich sehr mißtrauisch.
174
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
Eines ist nicht geschehen, was auch angeregt worden ist, daß wir System Mayr wiederholen und hinausfahren. Nun habe Seitz gesagt, was meine Meinung ist und was ich für einzig richtig halte. Politik Verlängerung der großen Kredite ist am entscheidenden Wendepunkt. Bei allen Verhandlungen schaut nicht viel heraus. Bin von zwei Dingen überzeugt, der Bericht wird uns sehr günstig sein. Daß wir aber darauf werden Kredite kriegen, glaube ich nicht. Trotz der günstigen Berichte. Dagegen etwa Interimskredite. Wir kommen wirklich zur alternativen Politik, entschlossen unserer Politik Wendung zu geben, wobei ich aufmerksam mache, bei der ersten Unterredung mit Young schon gesprochen. Wenn man mit diesem Schlagwort oder mit etwas ähnlichem, wenn mit solcher Sache jetzt herausrückt hätte – Gefahr ! ! Die bisherige Politik hätten wir zum Scheitern gebracht. Stimmung im Volk würde sofort umschlagen und uns Schuld gegeben werden. Das darf auf keinen Fall geschehen. Wenn wir anderen Weg, so muß es unsere Aufgabe sein, die bisherige Kreditpolitik offensichtlich an anderen scheitern zu lassen. Daher alles in Aktion treten lassen. Morgen fangen Verhandlungen an. So daß man bald entsprechende Frage stellen kann. Damit angedeutet, daß Zeitmaß abwarten kann, andere Alternativen liegen in nichts anderem als in einem Übergang zu einer sehr aktiven Politik, wodurch man auf uns schauen wird. Muß Außenpolitik, muß aber bei der inneren Politik anfangen, namentlich bei der finanziellen Seite. Freitag Finanzpläne durcharbeiten. Sobald diese fertig sind, unsere Aufgabe, daß wir uns mit diesen Dingen mit Parteien in Verhandlungen setzen, natürlich auch mit Sozdem. Nur mit Bauer und Seitz über diese Geschichten reden. Vorher mit anderen Parteien sprechen. Dann erst, glaube ich, haben wir diesen im Kabinett formell Sanktion geben, am Mittwoch an der Zeit damit hervorzutreten. Gleich Seitz gesagt, was ich mir denke = die von ihm angekündigte Finanzdiktatur. Stehe auch jetzt wieder am Standpunkt, über alle formellen Einzelheiten lasse ich reden, im Augenblick kommt mir vor, daß am richtigsten zu machen ist, ohne daß man sie hineinzieht. Wirklich nur einem Ausschuß aus dem Kabinett, Kanzler, Vizekanzler, Finanzminister oder auch anderes. Und dabei mit Parteien ausmachen, daß man mit Vertrauensmännern der Parteien alle Sachen durchbespricht. Den Sozi viel leichter mit zu machen als wenn sie drinnen sitzen. Im letzten Augenblick Parteien dazu zu bringen, daß sie sich vereinigen, halte jedoch für unwahrscheinlich, Lage Sozi – Seitz = Meine eigenen Leute sagen, Kommunisten sind nichts, aber im Moment der Verzweiflung werden Leute zu Kommunisten, die nur negieren. Eintreten in einen Block, der etwas gleicht = Außenpolitik. Frage ist, ob wir über diese Tage aushalten. Wenn wir es nicht aushalten, wegen des vorlauten Trubels, dann halten wir’s nicht aus. Etwas anderes, wenn wir selbst nun nervös würden, das ist DER Fehler ! Glaube, daß ich Seitz auf diese Linie gebracht und was ich zu tun gedenke, um über diesen Tag hinwegzukommen. Die Ratschläge, die gegeben wurden, gehen immer sehr weit auseinander.
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
175
Vorschlag durch Gewährung der größten Freiheit Besserung auf Valutenmarkt herbeizuführen. Man schätzt Valuten mindestens 3 x so viel als der ganze Banknotenumlauf, man glaubt aber auch daß Schätzung zu nieder. Industrie zwingen, etwa 1/3 ihrer Exportvaluten herzugeben. Ist politisch bedenkliche Maßregel, bin dafür möglichst schnell Devisen Terminhandel, das muß aber im Zeitpunkt sein, wenn absteigende Tendenz sich wirklich zeigt. Nun Frage nach kleineren Maßregeln. Was man tun kann, beruhigende Mitteilungen machen, ist geschehen. Was Kreditverhandlungen anlangt, Hauptausschuß Mitteilung gemacht. Gestern verboten dem Pressedienst, auch nur über Äußerlichkeiten zu schreiben. Jetzt bin dafür, selbst mit diesen Tatsachen zurückhalten. Bin dafür, daß man lieber gar nicht davon redet. Dann noch eine Maßregel, Frage, ob man heute oder morgen auf Warnung vor Angstkäufen hinausgeben ? Es ist auch möglich, daß Regierung und alle Parteien gemeinsam hinausgeben. Seitz nicht ablehnend. Das schlechteste wäre der börselose Tag. Heute schon vor Freitag fürchten, weil Donnerstag keine Börse ist. Der Ausbruch der Hausse angekündigt in Sonn- u Montag[szeitung]. Man kann nicht mehr tun als auf Urteil der Sachverständigen hören. Das wäre, was ich mitzuteilen hätte, ich bitte Klub diese Politik zu genehmigen. Nicht reden, mit Young paar Tage verhandeln, Freitag wird und Sonntag, Montag mit Parteien und es dann Kabinett bringen und unsere Vorschläge machen. Wenn angenommen wird, erwarte mir Wirkung für Öffentlichkeit. Dann kann man zur alternativen Politik eingehen, ev[entuell] Bündnispolitik. K ienböck : Kanzler mit Recht aufmerksam gemacht, daß wir vor großen Entscheidungen stehen. Glaube, daß Erörterungen nicht beruhigend gewirkt, doch nicht abhalten uns klar zu machen, was bevorsteht. Wir müssen hier Hauptsache selbst erörtern. Da ich nun glaube ist doch das hinzuzufügen : Wenn wir Meinung haben, daß mit großem Kredit absehbar nichts ist, wir doch Konsequenzen ziehen. Klar, daß internationale Anleihe da unbestimmt hinausgeschoben ist. Von allen Leuten gesprochen, was dann eintreten kann, wenn wir Kredite nicht bekommen. Das Sinken der Valuta allein ist keine Katastrophe. Kann mir nicht vorstellen, daß Bolschewismus ausbricht. Höchstens denkbar, daß Wiener Stadtvertretung prononziert auftreten. Kann mir dramatische Szenen nicht vorstellen. Aber denkbar, daß Ausland eingreifen wird. Sei es Mandat oder Form des Aufteilungplans. Das ist etwas, womit wir rechnen müssen. Daher muß diese Frage irgend angeschnitten werden. Glaube, daß Kanzler nicht mehr sagen wollte als er gesagt hat. Möchte ausschließen, wäre das unsererseits zu erklären. Auch ausschließen zuzusehen, passiv warten, bis Welle einfach über den Kopf geht. Das würde ich für Volk ein Unglück halten. Frage die, ob angesichts solcher Zustände Finanzdiktatur eine genügende Betätigung erscheint. So sehr ich dafür war, Dinge haben sich seitdem wieder zugespitzt. Was kann man eigentlich erwarten. Steuermaßnahmen. Ist jemand, der sich der Lage verspricht. Ich zweifle daran. Man müßte Finanzmaßnahmen, ganz gleich welcher Art, strikter (?) verstehen.
176
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
In zwei Punkten entschiedene Meinung. Sperrung der Börse ist ganz unzweckmäßig. Das hätte höchstens demonstrativen Zweck. 2. Was Freigabe der Devisen anlangt, möchte ich warnen, jetzt aufreizend wirken, aber auch sachlich schlecht. Nicht gerade jetzt die Schranken öffnen. Glaube wohl, daß Betätigung auf diesem Gebiet allein als nicht genügend erkannt werden kann, sondern schon gleich Haltung nach außen, diesbezüglich nur Andeutungen erfolgt. Man soll Anschluß an Deutschland proklamieren. Sicher Ausbruch des Gefühls. Nun kommt Geschichte Bauer. Möchte gerne wissen, ob Schachzug oder nur gedrücktes Gemüt entlasten, ob er über Tragweite erwogen hat. Mir ist diese Form nicht plausibel, das muß Deutschland ganz ungelegen sein. Frage des Anschlusses an Deutschland, was man nicht bloß vom Standpunkt Versammlung auffassen muß. Ich muß sagen, wenn wir eine Okkupation von fremden Mächten dulden müßten, dann ist es mir innerliche Erleichterung, daß man vorher doch noch dieses Wort ausgerufen hat, in einer Form, die doch das Volk ganz vertritt. Stöckler : Wir müssen unter uns sprechen, wie jeder denkt und fühlt. Ausführungen Kanzler früher immer mehr befriedigt. Fürchte, daß alle Maßregeln zu spät kommen. Jetzt sehe in keiner Beziehung sehr klar, wo wir uns wiederholt haben täuschen lassen, so wie unsere Partei Opfer gebracht hat. Diese Lammsgeduld und gefügt, wie sie es gerne gehabt hätten. Wir alles getan und sehen, daß es leere Versprechungen waren. Ob bewußt und ob sie nicht können, lasse ich dahingestellt. Für Teil Kredite nützen uns einen Schmarren. Rettung Österreichs habe ich nur aufgefaßt mit unserer energischen Arbeit verbunden mit großer Kreditaktion. Österreich ist nicht lebensfähig, wenn nicht außerordentliche Mittel. Erscheinungen am Valutenmarkt sind natürlich. Valuten freigeben wirkt nur vorübergehend. Wie wir Vertrauen ganz verloren haben, hat es auch Ausland ganz verloren. Wer österreichische Krone hat, wirft weg, wo er kann. Panik wird immer größer. Zudem kaufen Fremde, was sie können. Wir müssen uns in diesem Kreis vor Augen halten, was wir machen wollen. Kommt mit Oktobertagen 18 gleich vor. Fürchte, daß uns Verhältnisse überrennen. Plan Bauer für uns nicht ungefährlich. Man wird uns sagen, von unserer Seite ist kein Wort der Rettung gefallen und der zeigt uns, wie es zu machen ist. Hunderte werden uns fragen, was zu tun ist. Wir müssen sagen, wir wissen überhaupt nichts. Müssen uns auf Gewaltstreiche vorbereiten, sonst machen es andere. Bolschewismus nicht so fern, wie das Kind heißt, ist gleich. Was macht der Mensch in der Verzweiflung. Leute, die in 14 Tagen nichts mehr zu essen haben. Gewiß werden die Führer der Sozi Angst haben, aber zwei Eisen haben sie sicher immer im Feuer gehabt. Bauer : Daß er noch einen Ausweg gewußt hätte. Was Hunger anrichten wird, kann man sich leicht täuschen. Für nächste Zeit auch einen Plan aushecken. Gimpl : Jede Ankündigung, daß man in nächster Zeit andere Politik machen will, auch in unserer Politik ganz gewiß mit dankbarem Herzen begrüßt. Ganze Öffent-
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
177
lichkeit, ob etwas von neuer Regierung, was wieder Hoffnungsschimmer. In nächster Zeit in neue Bahnen gelenkt werden. Manche werden nicht übereinstimmen, daß man noch warten müsse, daß es klar, daß Kredite nicht kommen werden. Es glaubt kein Mensch mehr daran, daß Entente uns ernstlich helfen wird. Jetzt schon gegebener Moment, wo neue Politik zu inaugurieren ist, Außenpolitik nur sein : Nehmen wir keine Rücksicht mehr auf Entente. Anschluß beim Völkerbund ansprechen. Volk sieht dann, daß wir entschlossen, andere Wege zu gehen. Innenpolitisch angedeutet, daß man sich helfen wird mit Finanzdiktatur, die fordert sehr starke Hand, gewisse Macht. Finanzdiktatur tut Volk wehe. Steuerersparungsmaßnahmen. Gar mancher im Klub, daß wir wenigstens gesetzgeberisch auch Tat setzen alle, ohne Rücksicht auf Entente einmal. Gesetzesvorlage Einführung der allgemeinen Wehrpflicht durch Miliz. Sehr leicht möglich, daß von Sozi verhindert wird, aber Volk sieht, Christlichsoziale wollen das richtige. Heute belastet, weil Volk sagt, ihr legt Hände in den Schoß. Stand der Krone ist nicht bloß unter Inflation, sondern daß man zum Staat kein Vertrauen hat. Dann Finanzdiktatur und gesetzgeberische Tat setzen. Die Leute sagen, ärger kann es auch nicht sein als was sonst kommt. Fink : So wie Vorredner fasse ich Sache nicht auf. Kanzler : Young 2–3 Tage liefern, was er verlangt hat. Derweil Regierung Vorbereitungen, selbst eine Aktion machen. Das zweite mit der Macht. Ich fasse so auf, daß wir mit Beschluß des Hauses etwas ausrichten. Ist Demonstration, die uns nicht einmal etwas nützen würde. Halte für viel wichtiger, daß wir Weg gehen, wie Kanzler angedeutet hat. Was man mit Sozdem machen muß, das muß unsere Macht sein. Etwas anderes haben wir momentan unmöglich. Wenn man zu Taten kommt, daß man auch mit Sozi 1–2 reden muß. Wenn Parteien zusammenwirken, für uns noch die beste Kraft. Steinegger : Frage, ob nicht ganze Entwicklung dadurch in Fluß, daß wir lange regierungslose Zeit haben. Gesetzgebung hat sich nach Ausgabenseite hinbewegt. Beim früheren Finanzminister rasch Gesetze, die tatsächlich auch immer eine gewisse Erleichterung gebracht haben. Schade, daß Nationalrat nicht beisammen ist. Um Volk zeigen, daß bei uns der Wille, etwas zu leisten, vorhanden ist. Mit Kredit haben wir draußen Mißtrauen erweckt. M ataja : Redner von Erwägung ausgegangen, daß wir mit Krediten genarrt wurden, daß Entente Versprechen nicht gehalten hat. Die traurige und kraftlose Politik ist klar ; aber wir können diese Behauptung nicht aufstellen, daß wir mit 6 Minister nichts anzufangen gewußt haben. Müssen wir uns selbst an der Nase nehmen. Frage heute wieder : Was ist mit Kreditvorschuß geschehen ? Daß der Vorschußgeber, wenn er sieht, daß Schuldner nichts anfangen kann, ist klar. Entente denkt nicht anders darüber : Schlecht angewendet. Wenn sich Weg finden läßt, daß alle Schuld Entente, sehr einverstanden. Die Vorschläge, die nach anderer Richtung hier gemacht, da ziehe Politik des Kanzlers bei weitem vor. Werden wenigstens keine Schritte machen, daß Zusam-
178
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
menbruch kommt. Vorschlag Bauer hypothetisch : In Berlin kann man nicht darauf eingehen. Deutsche können dies nicht machen. Weder Kredit geben noch tschechische Krone durch Mark verdrängen. Ganz falsch, auf Sachen hin pointieren, die nicht gemacht werden kann und Entente endgültig abstößt. Kann mir teilweise Besetzung schon vorstellen, aber kann mir auch vorstellen, daß Konflikt im Burgenland. Höchst unwahrscheinlich Einmarschieren in Wien. Wenn man glaubt, daß Entente Sache selbst in Hand nimmt, daran ist gar nicht zu denken. Was wir an Lebensmitteln ziehen (?), würde sofort ausbleiben, wenn Gesetz gegen Friedensverträge. Prognose ist außerordentlich schwer. Rad kann nicht ewig weiter gedreht werden. Mit jeder Umdrehung wird es schwerer. Sagt, daß wir wieder immensen Teil durchgebracht haben, weil wir Überkonsum haben. Sage, kein anderer Weg Finanzen sanieren als Kreditpolitik weiter zu machen. Ich bin überzeugt, daß an amerikanische Kredite nicht zu denken ist. Wenn ich an etwas glaube, dann an europäische Anleihe. Natürlich Staaten, die an uns interessiert sind, Tschechei und Frankreich. Wir ganz bestimmt keine große Staatsanleihe mehr bekommen. Wir müssen an Privatanleihen denken ! Zuerst müßte Vorschlag kommen, der Vorteile bringen würde. H auser : Kann mir schon vorstellen, daß man auch darauf hinarbeiten muß, solchen von Druck zu befreien. Es kann Momente geben, die Psyche des Volkes zu entlasten. Aber nach Ausführungen des letzten Redners sehe ich gar nichts mehr, wenn es so trostlos ist ! Habe von keinem Redner befriedigt. Am besten gefällt mir noch Vorschlag des Kanzlers. Bleibt uns nichts über als mit gewisser Ruhe. Es ist etwas sehr bedenkliches, wenn zu [ein Wort unleserlich] umsatteln muß, noch schlechter, wenn man in Politik umsatteln muß. Lächerlich jetzt ernst von Anschluß reden, wenn wir nicht wissen, was Deutschland mit uns anfangen kann. Wir bringen sie in tödliche Verlegenheit. Wir haben kein Beispiel in der Geschichte ; in diesem Umfang war noch keine Katastrophe. Recht sehr bitten, daß wir Standpunkt der Ruhe nicht verlassen. Und schließlich und endlich noch auf Herrgott vertrauen. Wir haben gewiß getan, was wir konnten. Entente hat uns schon sehr stark gefoppt, vom ersten Augenblick an. Entente besteht aber nicht aus solchen Menschen, die uns Kredite geben, um uns gutes zu erweisen. Durch jede Unruhe und Hast können wir nur schlechter machen. Gewaltpolitik können wir nicht treiben, weil wir keine Gewalt haben. Mit Leidenschaftlichkeit können wir es nicht machen. Fink : Die nächsten Tage am [ein Wort unleserlich]. Gerne sehen, alle Parteien Kundgebung hinausgeben können, damit Volk sieht, daß Regierung und Parteien zusammenhalten. Vielleicht noch erwägen, ob man nicht früher als Mittwoch Haussitzung halten könnte. Kunsch ak : Ich erinnere, daß im Hauptausschuß gesprochen, wann nächste Sitzung. Ob man im [ein Wort unleserlich] Wege Sitzung. Entschieden hat morgen nächste Sitzung zu halten. Schon am Dienstag Nationalrat zusammentreten ist sehr
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
179
gut. Jetzt läßt man das Volk ganz allein in diesen Sorgen. Man soll das Haus reden lassen. Abgeordnete gewöhnen sich reden ab. Ich bin der vollen Überzeugung, daß Bauer planmäßiger Versuch, den Großdeutschen das Haus anzuzünden. Hiebe parieren, daß man das Sachliche heraus kennen und ganze Unmöglichkeit des Gedankens dem Volk vor Augen zu führen. Die Masse will irgend etwas sehen. Heute durch ganz Wien Frage, warum schreitet man gegen Börse nicht ein. Das ist Stimmung im Volk, wer sich widersetzt, wird beiseite geschoben. Das Volk will optische Wirkung, die nicht schaden. Wir haben Gürtler losgelassen und ein bißchen hat Börse schon eingelenkt. Börse sperren und Schober mit ganzen Leuten auf Kaffeehäuser losgelassen werden, Erteilung der [ein Wort unleserlich] anderes Vorgehen. Panik in Wien ist der Sturm der Ausländer, weil es ihn nichts kostet. Ob in der Frage der Teuerung Stellung genommen werden kann. Gimpl : Ich meine Worte nicht gegen Kanzler. Gürtler : Parlamentarische Pause peinlich, kann nicht nach Hause fahren, weil man mich fragt, was macht neue Regierung. Regierung Möglichkeit geben soll, uns in Wien zu beschäftigen, das wäre große Erleichterung geworden. Ich bin gewiß kein Demagoge, aber schlechte Lage, wenn wir hinauskommen. Was wir sagen können, ist, daß Regierung guten Mut hat, dies aber sehr schwierig. Auf Psychologie muß man schauen, sonst geraten Leute einem aus der Hand. Kanzler Wort alternative Politik geprägt. Klub hineingesprungen. Ich warte vorläufig ab. Fällt mir nicht ein, über Anschluß an Deutschland zu ereifern. Kanzler wird so leicht gelungen, die Unterhändler einzukreisen, zu erklären, bitte jetzt ist klar, daß Kredite gescheitert sind. Die Leute haben kolossales Talent sich zu ziehen. Kanzler Boden Kreditpolitik nicht früher verlassen, bis Wirklichkeit für Alternative gegeben ist. Können Verschiedenes versuchen. Grund der Verstimmung des englischen Kapitalmarkts dürfte anderen Grund haben. Wir sind Wöllersdorfer Werke losgeworden. Die Tschechen haben in viel besserer Lage als hier, haben mit Anglobank Frieden schließen müssen. Benesch hat Ungezogenheit einstecken müssen um Kredit zu bekommen. Wir für Gegenprotest entschieden, wenn Anglobank an der anderen Seite interessiert war. Die Leute wollen bei uns verdienen. Fürchte nur, daß wir sehr schwer in Alternativfall gelangen werden. Vorher so wenig als möglich sprechen. Anschluß ist nur möglich, wenn Poincaré nicht recht behält. Dann aber Kreditaussicht für uns günstiger. Wenn bis Freitag herausbringt, so größter Politiker 20. Jahrhunderts. Bauer etwas gesagt, was politische Phantasie beschäftigt hat. Die Regierung etwas zu wenig beschäftigt. Gedanke, daß sie Keil hineintreiben wollten, halte Bauer nicht für einen so guten Politiker. Wenn sich diese Möglichkeit zeigt, wird es sicher geschickt ausgenützt werden. Bauer Protest ist nur Verlängerung der [ein Wort unleserlich] und gar nicht ernst zu nehmen. Gefährlich wird ganze Sache nur, weil es in Gehirn Vorstellungreihen auslöst und Gedanke immer gegen Regierung verwendet. Das war in Österreich immer so. Jetzt doch erwägen, ob nicht im Zusammenhang mit Bauer
180
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
jetzt etwas erfolgen sollte, was dazu Stellung nimmt, darstellt, wie unmöglich ist. Jemand aus Kreisen der Regierung selbst. Oder man läge politische Phantasie durch etwas anderes abzulenken. Man erwartet vom Finanzminister bei anderem Anlaß zu anderen Problemen Stellung nimmt. Wir müssen, so lange als möglich ist, müssen wir ihn stützen. Zu schweigsamer Ressortminister gegen einen beredsamen Kanzler, kommt Finanzminister schlecht weg. Es würde ihm sehr schaden, wenn Juden Gefühl hätten, er ist nicht der eigentliche, der zu reden hat. Wir müssen bei Kreditverhandlungen vor etwas hüten. Nie den Eindruck erwecken, als wenn wir im Verzug wären. Unsere Aktivität muß man Entente unter die Nase reiben. 6 Mio Pfund wäre schöne Sache gewesen, wenn wir sie gehabt hätten. Die Verwen dung hat er ausgesprochen von uns verlangt. Hätte Gesetz nie zugestimmt, wenn nicht auf dieser Verwendung bestanden hätte. Unsere Lage dem Tschechenkredit gegenüber war viel günstiger. In anderen Ländern ist Geld noch Geld. Sie drucken keine Noten, sie sind gezwungen Betrag aus Wirtschaft herauszuziehen. Ich Praktiker der starken Hand, wenn ich sie wirklich habe. An Diktatur wird Volk starke Erwartungen knüpfen. Unter allen Umständen Seitz hineinbringen. Seitz hat bei Sozi jetzt besseres Ansehen als Bauer. Wenn diese Diktatur auch nicht zum Ziel führt, wenn nicht vorher Sicherheit, daß gewisse Erfolge da sind. Seipel : Eine Sache feststellen, wie unangenehm es ihm ist, daß keine Haussitzung. In formalen Dingen müssen wir Sozi entgegenkommen. Hauptsache, die denken, was wir jetzt tun sollen. Wir können Sitzung etwa am Dienstag einberufen. Das wäre auch recht beruhigend. Frage einer Proklamation. Heute oder für morgen nicht machen lassen. Rage, ob man kommen soll. Wir haben Montag Bundesrat und Kabinett das erste Mal erscheinen. Die Gelegenheit nützen und im Bundesrat etwas zu sagen. Es soll aber Finanzminister reden. Lage morgen, besonders wenn man nicht mit Finanzplan herausrücken will. Öffentlich ist es nie Finanzdiktatur genannt worden. Dann erst wären wir in der Lage, die alternative Politik einzuleiten. Stelle mir vor, daß Finanzminister morgen redet, darf gar nicht kommen mit Dingen, die in Nationalrat gehören. Wenn er nicht so konkrete Sachen sagen kann, so bin der Meinung, daß nicht wirksam, umso mehr als formal schon schwer sein wird. Ließe sich eher erklären, wenn der Kanzler reden würde. Klub farbloses Kommunique hinausgeben. Bauer Urteil das : Richtig erfaßt, daß für Agitationszwecke sehr gut ist, wenn in einer Zeit hervortreten, wo Regierung schweigen muß. Absicht Keil zu treiben mute ihm nicht zu, daß es so wirkt, andere Sache. Richtig mit psychologischem Moment ; wenn ich ungefährliche Maßregeln wüßte, wäre ich gleich dabei. Sachlich schädlichen Maßnahmen kann ich nicht zustimmen. Wiederholt gesprochen von der Macht, die man haben müßte. Ist einmal circulus vitiosus. Wenn wir auf reale Macht warten, gehen wir zugrunde. Man muß an einem Eck anfangen. Mit Reaktion (?) Gimpl gesprochen : Wir kümmern uns nicht
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
181
um Friedensvertrag. Beim Völkerbund Sache gar kein Vorteil und stoße auf Zurufe. Wehrpflicht einzuführen halte ich absolut unmöglich. Volk wird nicht danken. Man muß erreichen, daß man nichts derartiges getan, was ernstlich [ein Wort unleserlich], und dennoch ist es geschehen. Besetzung ist Pflanzschule für Sozdem. Besetzung halte ich für das größte Unglück. Das das einzige, was uns der Weltkrieg erspart hat. Das Einmarschieren ist ernst, aber ist schon längst beantragt geworden. Nicht abgelehnt, die Sache liegt dort. Daß so etwas automatisch eintreten würde, ist klar. Wahrscheinlich Wien nicht, sondern nur die anderen, da nur das rote Wien. Was Alternative ? Muß noch einmal um Entschuldigung bitten, für mich ist Frage nicht gelöst, für mich gibt es verschiedene Varianten, es gibt künftige Varianten z. B. eine Bündnispolitik machen, die der Kleinen Entente entgegensteht. (Italien – Österreich – Ungarn, irgendein Zollverein z. B.) Proklamation des Anschlusses schlechtweg kann es auf keinen Fall sein. Frage Kienböck, was wird eintreten, wenn Kredite nicht kommen. 2 Dinge. a) wenn wir aushalten, nicht Zusammenbruch. Taumel von Volk wegnehmen. b) wenn wir nicht aushalten. Wenn a) interne Finanzmaßnahmen eine Sache und Anlehnung nach außen. Wir werden anders dastehen als jetzt. Wenn b) Wenn Krone verlassen, automatisch tritt an Stelle der Krone irgend andere Währung ein. Schwören, daß irgend andere, daß tschechische Krone, darüber will ich nicht streiten. Außerdem Gefahr der Separationen. (Hauser : In Linz erzählt, daß morgen in Innsbruck Anschluß an Deutschland erklärt wird.) In Wien übernimmt halt Breitner die ganze Sache. Pfeiffer starker Anschlußmann. Ihn hätte man gestern hören sollen, wie vorsichtig er geworden ist ! ! !
Vorstand mit Fraktion, 12. September Drexel führt Vorsitz. Seipel : Bei meiner Abreise darauf hingewiesen, daß meine erste Reise zu 3 Nachbarn doppelten Zweck, durch Konferenz London gezwungen, neuerdings vor Völkerbund zu gehen. Damals schon Kenntnis der Methoden. Jetzt selbst überzeugt, was er gilt, Versammlung sehr würdiger ausgedienter [ein Wort unleserlich] ein paar Sehenswürdigkeiten der Welt. Methode Kommission über Kommission. Ergebnis immer Verhandlungen über Prinzipien mit möglichster Zeitversäumnis. Schweiz will unbedingt 4 Grenzen, Stimmung im Bundesrat geteilt, Motta sehr für uns. Dagegen Schultes, der will, daß wir in die Kleine Entente hinein sollen. Zweite interessante Gruppe sind Engländer. Immer Vorbehalt, daß unwahrscheinlich, daß Regierung überhaupt noch Kontinentalpolitik macht. England wird sich abseits stellen, daher keine gemeinsame Aktion. England hat formalen Ablehnungsgrund. Große Verstimmung und man gibt Schuld, daß bisherige Aktionen nicht wei-
182
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
ter gediehen sind. Der Ablehnung der Völkerbundkontrolle durch Grimm. Österreich will keine Kontrolle, damit sozialistisch weitergewirtschaftet werden kann. Das nächste Beschwerde über Absperrung der Länder. Gut informiert. Sehr interessiert immer Frage unserer Wehrmacht. Damit meine Besorgnis, daß man zu kritischer Frage kommen kann, nicht unberechtigt. Wehrmacht auch bei Franzosen. Hanotaux aktiv 1) Wehrmacht 2) Finanzkontrolle 3) Warum ist Frage politische Frage. Franzosen nicht herauszubringen gewesen, ob Vollmacht haben, sich an politischer Finanzkontrolle zu beteiligen. Sehr stark bestrebt, das Heft in der Hand zu haben. Nincic und Benesch bevollmächtigt für alle Kleine Entente zu reden. Benesch großen Hofstaat in Genf. Benesch mit vorigem Plan gekommen. 1) Staatsgarantien für Kredite zu übernehmen, wobei nicht darauf besteht, daß alle Mächte mittun. 2) Er bringt dazu die Banquiers. Italien : Sind mit Tschechen in engster Verbindung. Verhandlungen ununterbrochen. Keine Gruppe etwas unternimmt, ohne daß andere Gruppe davon weiß. Es wird 3. Akt folgen müssen, was ich angeregt habe, mitteleuropäische Herauslösung und wir mit Nachbarn zusammen Angelegenheiten ordnen. Dabei zum Ausgleich der Interessen kommen muß. Zusammenwirken It[alien] und Tschechen nicht ganz aufrichtig. Kontrolle kritische Frage. Wir sollen selbst verlangen und auch etwas gegen Wehrmacht verlangen. Organ, Objekt von Form der Kontrolle kommt darauf an. Kontrolle nur dann, wenn wirklich das Geld da ist. Über intern[ationale] Gendarmerie ist nicht gesprochen. Es muß große Wirtschaftsgemeinschaft geschaffen werden. Das gefällt der Schweiz. Art Handelsvertrag, der über Meistbegünstigung hinausgeht ! Italien, Kleine Entente, Schweiz entschlossen uns Kredit zu geben, Wir müssen dann mit Ungarn mitteleuropäische Konferenz abhalten. Finanzen, Währung, Verwaltung innere, Kredit vom Ausland. Das ökonomische Frage der parlamentarischen Verhandlung, erschwert, daß wir verschiedene Akte haben. Bin dafür, daß offene und starke Debatte im Haus. Wie in Öffentlichkeit über Völkerbund reden, glaube so wie ich es in Genf getan habe. Nicht zu freundlich ! Haltung der Opposition sehr zu achten, glaube starke Angriffe der Sozi z. B. Abg. Eisler in Graz. Ich bin nicht der Meinung, daß man Kampf scheuen soll. (Beifall !) Drexel : Zweifellos das größte Problem aufgerollt. Sehr wünschen, daß wir im inneren Kreis Meinung austauschen können. Nationalrat, müssen die Herren in Debatte eingreifen. Notwendig, daß wir für unsere Redner halbwegs einheitliche Auffassung gewinnen.
Vorstand, 14. September 1922 Fink begrüßt Seipel. Seipel : Reihe der schwerwiegendsten Fragen zu entscheiden. Heute wird große und lebhafte Debatten im Nationalrat geben. Vorstand u Klub Vorkehrungen treffen.
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
183
Nach meiner Meinung muß morgen ganz bestimmt Haussitzung. Regierung Bedürfnis. Ségur Vorlagen einbringen und Frage der Notenbank. Sozi sind überhaupt dagegen. Stolper in AZ. Sagt selbst, daß etwas anderes als Notenbank jetzt nicht möglich ist. Paar große Debatte im Nationalrat angenehm. Wir sollen Erörterung nicht ausweichen. Es handelt sich nicht nur um Beträge. Frage, ob wir auslassen, als ob wir uns vor Welt hinstellen als Leute, die strengere Kontrolle fordern, uns nicht kontrollieren lassen sollen. Große innenpolitische Frage dazu. Sozi daß Eintreten in Konzentration angeboten haben und sehr stark urgieren. Meine Haltung = Kaltes Wasser auf diese Begeisterung. In dieser Auffassung bestärkt durch Ansturm von außen. Vorarlberger und Tiroler Landesregierung mich beschworen, die Sozi nicht hinein zu lassen. Ich höre vom Kollegen Weiß Eindruck, daß Reichsbauernbund ebenfalls. Eindrücke in Genf durchaus die, daß in ganzer Welt ungeheurer antisozialistischer Zug ist und uns schadet, daß noch so viel bei uns davon vorhanden ist. Ein Einschwenken nach der Richtung draußen kann guten Eindruck ausüben. So große und ernste Frage, daß ich Partei bitte, sich mit ihr zu beschäftigen. Es handelt sich im Hintergrund um Fragestellung : Sollen wir, wenn Kontrolle verlangt wird, ausländische Hilfe akzeptieren oder sollen wir erklären, Österreich braucht keine Auslandshilfe (wie Sozi). Sozi glauben, Konzentration ist imstande, alle Schichten der Bevölkerung zu zwingen, mit allem heraus zu rücken. Seitz Gegensatz zwischen Sozi und ihm formuliert, daß sie das Vertrauen zu unserem Volk haben, während Seipel keines hat. Der Setzerstreik, wo AZ allein erscheint, zeigt, daß man kein Vertrauen haben kann. Angebot der Mitarbeit muß aber in Beratung gezogen werden, ich natürlich kein Hindernis, wenn Parteien für gut finden. Bei Großdeutschen Kandl große Neigung hinüber. Die anderen auf meinem Standpunkt mit Ausnahme des Waber, der immer 2 Standpunkte hat. Es ist Frage, was wir zuerst behandeln sollen. Wäre dafür, daß auch Samstag Sitzung. Aber dazu notwendig, daß man auch weiß, was Ségur will. Ségur : Finanzpolitik fast unlösbarer Zusammenhang mit allgemeiner Politik. Art Staatsbankrott ungünstigste Wirkung auf Politik. Wir alles vermeiden, irgendwelche Rückschlüsse im Ausland hervorzurufen. Finanzielle Lage : Außerstande, mit den bisherigen Einnahmen auch nur halbwegs Ausgaben zu decken. Spannung ist ungeheuer. Letzte Reserven, die für Zukunft gebraucht, bereits jetzt in Anspruch genommen werden. Entschuldigung : Verzögerung der Notenbank und der Index. Regierung beschlossen ein Gesetzentwurf, mit dem Index suspendiert wird. Es soll nur 50 % ausgezahlt werden. Index erfahrungsgemäß verteuernd wirkt. Daß Beamtenschaft nichts hat, weil Teuerung größer. Es muß eben auch Opfer der öffentliche Angestellte bringen, daß aber günstige Wirkung auf Preis zeigen wird. 2) Es ist klar, daß nicht dieses Gesetz allein vor Haus kommen kann. Klar, daß neue Umsatzsteuern. Erhöhung der Einnahmen Staat möglichst rasch herbeizuführen. Das Mantelgesetz, Bindung der Verbrauchssteuern außer Kraft gesetzt wird.
184
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
3) Laufende Vermögenssteuer 4) Frage, ob nicht Erhöhung der inneren Anleihe = zweischneidiges Schwert. Nach Entwertung der Krone würde ungünstig wirken, weil Inflation mit sich führen würde. Aber etwa um 50 % erhöhen. Meine, daß dies erträglich genannt werden könnte. Könnte herbeiführen, daß Staat noch X Einnahmen bekommt, daß großes Defizit einigermaßen abbaut. Stabilisierung letzte 3 Wochen bemerkbar. Für diesen Monat Index mit 120 % als höchst gegriffen angenommen. Unter Zugrundelegung dieser Ziffer 879 Mrd. Wirkliche Eingänge ungefähr 220 Mrd gegenüber. Großen Teil der Sorge habe hinter mir. Jeder verlangt außer Gehalt täglich 8–10 Mrd. Weiß, daß Kredite nicht am Tisch liegen. Aber dringendst bitten, daß wir wenigstens ½ Kredite in die Hand bekommen. Fink : Was Mantelgesetz betrifft, wird keine Schwierigkeit haben. Lostrennen von Errichtung der Bank. Index von unserem Standpunkt aus nichts einzuwenden. Frage, ob man mit Organ[isationen] gesprochen hat. Letzteres kann man nur beurteilen, wenn man V[ermögens]Steuer kennt. Über Anleihe beurteilen. Man will mit 15. Oktober einen Teil einzahlen. Es ist bedauerlich, daß keine Steuervorschrift da ist. Nirgends ist Steuer vorgeschrieben. Landwirtschaft schon lange gezahlt, wenn neue Grundsteuer vorgeschrieben wäre. In 8 Wochen auch Vermögensabgabe. Nichts gemacht worden. Finanzverwaltung läßt in Ländern ganz aus. Eines der größten Hindernisse zur Durchführung der Anleihe und Einhebung der Anleihe. Seipel : Mir kommt vor, daß es unmöglich wäre, das V[ermögens]steuergesetz einzubringen, wenn man nicht sogleich Index herabsetzt. Es darf nicht eine Schichte Volkes ausgelassen werden. Wichtige Frage wegen der Organisation und der Partei. Sehr bitten, bevor sich ganz fest entschlossen haben, womöglich nichts herauskommen zu lassen. Mit Parteien bisher nicht gesprochen ! Dann morgen ins Haus treten, heute im Lauf des Tages Parteien mitteilen. Frage mit Organisationen. Frank mit Wissen Kabinetts Fühler ausgestreckt. Und dabei bei Sozi (Eisenbahn) Antwort bekommen, das müsse und könne gemacht werden, aber jetzt noch, wenn gleichzeitig neues Opfer für die Besitzenden, so daß nicht allein sind. Die nicht Sozi sind spießiger. Kollm ann [Kaufmann, NÖ] : Finanzminister muß anweisen, daß über Zeit arbeiten und keine Überstundenentschädigung zu gewähren. Gefährlich ist Frage. Einbringung des Indexgesetzes momentan katastrophal. Meine für September noch lassen. Innere Anleihe Ausdehnung nach der Richtung, daß nicht nur Zwang, sondern auch freiwillig. Es sind viel da, z. B. gesamter Gewerbestand fällt aus. Index [ein Wort unleserlich] Sozi werden sabotieren. Stöckler : Meiner Ansicht nach ohne Indexregelung weiterwirtschaften unmöglich geworden, V[ermögens]abgabe heute noch nicht abgeschlossen. Kein Fall bekannt, daß mit Interessenten verhandelt wird. Das Gesetz machen hat keinen Sinn und Wert, wenn nichts durchgeführt wird. Vollständiges Versagen der Welt, daß einem Angst und Bange wird.
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
185
Fink : Glaube, wir werden im Klub fortsetzen. Ségur : Vorwürfe Finanzverwaltung sind berechtigt. Es ist vollständige Anarchie, Produkt von Jahren. Es ist nur möglich, Änderung schaffen. Ein Mensch müßte sich ausschließlich damit beschäftigen. Erlasse hagelt es ; aber es geschieht doch nichts. Leute haben politisches Bewußtsein verloren. Es ist kritischste Gefahr Rückstände sind ungeheuer. Aber Eingang auch und zeigt, was eingehen könnte. Für Finanzministerium Staatssekretär, der ausschließlich diese Frage behandeln soll. Dieser Mensch fast notwendig als Ersparungskommissar. Es hat mit Kockstein begonnen. Debatte ihm sehr angenehm. Frage nähertreten jemand verfassungsmäßig bestellen. Auswahl der Personen sehr sorgfältig.
Klub, 4. Oktober Steinegger : Frage der Parlamentsrestauration anschneiden = der jetzige Zustand unhaltbar. Fink : Wenn jemand einen weiß, der bereit sei, Wirtschaft zu übernehmen, sei er froh. Lut tenberger : Unglaubliche Protektionswirtschaft. Wollek [Obmann CV, Bauernbund NÖ] – GÜRTLER A : Wenn wir neuen Wirtschafter hernehmen und so verhalten wie der alten Wirten, Sitzungsirrsinn etc., ist auch das neue Geschäft nicht zu machen. Mit Personenwechsel allein nichts gemacht, sondern System ändern. Persönliche Beziehungen gehen uns gar nichts an. Kupka nicht hinaus geben. Kollm ann : Das Geschäft ist hundsmiserabel. Diwald : So kann es nicht bleiben. Heinl : Stock von Gästen muß da sein. Aus umliegenden Ministerien Beamte bekommen. Schwierigkeit, daß entsprechende Kapitalien zur Verfügung stehen. Steinegger : Am Anfang Restauration gut besucht. Haben es verstanden, die Gäste langsam hinauszuwerfen. Wo wir kämpften, genug finden. Wir schon vor einem Jahr Namen genannt. Kunsch ak : Woran es liegt, daß Restaurant an sich nicht rentabel ist, weil gar keine Kontinuität. In diesem Haus wird überhaupt nichts mehr gearbeitet. Es arbeitet kein Ausschuß mehr, das vereinigte Tagdiebe.
Klub, 11. Oktober 1922 Stöckler begrüßt Bundeskanzler. In Worten nicht möglich schildern. Unser Vertrauen hält uns aufrecht. Was menschenmöglich war, in Genf erreicht worden. Un-
186
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
seren besten Mann haben wir in Genf. Wir sind nicht enttäuscht. Mit stolzen Blicken auf Arbeiten zurück. Wir treu und unerschütterlich an seiner Seite stehen. Mag kommen, was da soll, wir tun es für Volk und Land. (Viel Beifall.) Begrüßen teures Mitglied Schoiswohl (Beifall). Seipel : Dank formlos für freundliche Begrüßung und Äußerungen von Parteiseite in Öffentlichkeit. Ich unheimliches Gefühl gehabt. Es erinnern auftauchen »Brotfriede von Brest-Litowsk«. Einen Teilerfolg haben wir erzielt. Wäre verkehrt über Teilerfolg die ganze Schwere der Aufgabe zu übersehen. Die gute Stimmung hat aber auch guten Wert. Beweis, daß wir einig sind. Muß feststellen, daß sich Großdeutsche sehr brav halten. Sozi haben Furcht, daß Sache durch sie gestört werden könnte. Finanzprogramm des allein Machens war sehr schwächlich. Werden wir im Haus einiges Geschrei erleben ; aber schon überstehen. Folgerungen für Politik der Partei ist Frage für sich allein. Für heutigen Ausschuß des Äußeren erwarte ich nicht viel. Dann morgen ohnehin das Haus. Morgen sofort Wir in der Lage, die Vorlage jetzt schon einzubringen. Morgen so machen, daß jemand von unserer Seite sofort Antrag auf 1. Lesung stellt, damit wir hinter uns haben, welchem Au. Meinung neigt sich meistens zu eigenem Ausschuß zu. H auser : Unsere Leute sollen gleich, daß unsere Leute einen Antrag in Au mitbringen. Seipel : Glaube gut, nach Bericht zuerst einer von uns reden und gleich Antrag bringen. Vereinbarungen in Genf in Zeitungen veröffentlicht. Übersetzung stellt sich einiges etwas anders dar. Im Ausschuß schon Abzüge. Am 4. in Genf unterzeichnet. Konvention einheitliches Ganzes – kein Teil kann in Kraft bleiben ohne das andere. Was 2/3 Mehrheit erfordert, ist offene Frage. Es gibt gewichtige Gründe für den Augenblick, das Ganze was im Haus, so aufzuzeigen, daß es nicht ohne 2/3 Mehrheit gemacht werden kann. Ich habe nirgends auf der Reise um jeden Preis Kredit verlangt, sondern Österreich aus dem Elend herauszuhelfen, zu einem Sanierungsprojekt zu kommen. Die ganze Aktion. Wir haben einige Mächte so interessiert, daß wenn Völkerbund versagt, werden wir mit anderen Gruppen etwas machen können. Das hat unsere Stellung vor Völkerbund vom ersten Tag an verändert. Nun Hilfsaktion für Österreich selbst. Jeden Teil der Protokolle nach beiden Seiten anschauen. Aufteilungsabsichten der Nachbarn waren nicht mehr Gerüchte. SHS Vorschlag in Paris aufgelegt und der nicht erledigt, aber auch nicht abgelehnt wurde. Es bestand solche Gefahr. Es haben sich andere zu solchen Absichten entschlossen für den Fall, daß es bei uns drunter und drüber gehen sollte. Politische Garantie Bedeutung für Grünberger und für uns. Verkettung der Mächte und Geldgeber. Ausnahme gibt es, wenn öffentlich Ruhe aufrecht erhalten werden kann.
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
187
II. Protokoll handelt von finanzieller Garantie. Politische schon in Prag und Verona angeboten worden. Das Ermächtigungsgesetz an Regierung kommt 3 x vor. Kontrolle durch Generalkommissär ausgeübt. Kontrolle möchte außerhalb Wiens sitzen. Mit unserer Regierung nichts zu verhandeln. Es muß mit 20jähriger Laufzeit der Pfänder gerechnet werden. Andere Kontrolle zum Zweck der Sanierung. Wird verlangt nicht von Geldgebern. Die garantierenden Mächte müssen sagen. Ausgeübt durch Völkerbund. Einzige Person. Hauptsache, daß große Persönlichkeit ist. Wir müssen Sicherheit haben, daß in 2 Jahren Sanierung gelingt. Es kann Kontrolle schädlich sein. Es wird sehr auf Regierung, Parlament und Volk ankommen. Gehen wir daran, jetzt selbst das Möglichste zu tun, dann wir Generalkommissär nicht viel dreinreden können. Wenn wir sagen, daß der Generalkommissär diktiert = wäre unwürdiges Verhältnis. Fragen, wieso man dazu kommt, diese Kontrolle zu verlangen. Hauptgrund, daß man Sanierung haben will. Das andere die Erfahrung, die mit bisher gegebenen Krediten gemacht wurde. Niemand hat so große Kriegsentschädigung bekommen wie wir, nur in ungeschickter Form und schlechten Bedingungen. Wir nicht dazu gekommen, den richtigen Gebrauch zu machen. Diese Kontrolle wird so lange dauern, bis wir erklären können : »Österreich ist saniert«. Das soll in 2 Jahren der Fall sein. Verlangen, daß Regierung besondere Vollmachten bekommt. Frage, wer Erteilung von Vollmachten angeregt hat. Das sei der Kanzler gewesen. Ich nicht getan, aber in Regierungserklärung schon von Finanzdiktatur gesprochen. Alle haben gefunden, es muß eine solche Vollmacht gegeben werden. Parlamentarischer Kampf wird sich ganz um diese Vollmachten drehen. Vollmachten gar nicht gegen Geist der Demokratie. Regierung bleibt für Gebrauch der Vollmachten verantwortlich. Parlament kann immer Regierung stürzen. Sehr wichtige Frage wünschenswerter Umfang der Vollmachten. Muß solchen Umfang haben, daß damit wirklich etwas getan ist. Glaube Vollmacht das Abbaugesetz zu ändern. Regelung der Länderfinanzen = Finanzverfassungsgesetz. Möglichkeit gewisse Dinge doch vor Parlament zu bringen. Nun Frage, ob Bedingungen ist dies eine Schande, die es unmöglich macht selbstbewußtem Volk. Ich für meine Person nicht der Meinung entziehen ; es wäre eine wirkliche Schande durch schlechte Wirtschaft zugrunde zu gehen. Es ist nicht so, daß pure Fremdherrschaft, sondern Organ höherer Art, der wir auch angehören. Was ist zu tun ? 1.) Annehmen 2.) Rasch annehmen. Wir dürfen keine Zeit verstreichen lassen, weil Parlamente beschließen müssen. Bis 1.XI. das Ganze unter Dach zu bringen. Genehmigung der Vereinbarungen, Ermächtigungsgesetz, Finanzprogramm und Notenbankgesetz, 3.) So annehmen, daß Sanierung Hoffnung hat. Einzelheiten Menge zu erwähnen. Noch hinzufügen, gebe Klub feierliche Erklärung, neben Vereinbarung keine Geheimabkommen (Beifall !) Stöckler : Glaube, am besten unterbrechen. Bundeskanzler wird 3 h hier sein.
188
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
Fortsetzung 3 h Fink : Steinegger : Ausführungen Kanzler gehört. Alle Überzeugung, daß möglicher Weg um zur Sanierung zu kommen. Der Weg 2 Jahre- Ist eigentlich Notwendigkeit vorhanden, daß Regierung und Parlament den ganzen Weg gehen könnten. Stellung zu dem Problem für den Abgeordneten und glaube für einzelnes Regierungsmitglied, wenn weiß, daß mit Ende der Tätigkeit in Periode, wo auch Ende des dornenvollen Weges vorhanden ist. Wir werden einschneidendes Gesetz machen müssen. Seipel : Es scheint, daß in Tirol Lebensversicherung geplant ist. Man kann aber auch gleich wählen, bevor man zu anderen Themen übergeht. Erinnerung, was aktuell ist. Gürtler : Weiskirchner mit Seitz gesprochen, ob Debatte morgen 1. Lesung. Seipel : Auf jeden Fall morgen Obmännerkonferenz. Fink : Wir können vielleicht 14er Ausschuß machen, damit ein Bündler hineinkommt. Steinegger : Eigener Ausschuß zweckmäßig. Fragen finanzieller Natur, ohne daß geglückt ist, Finanzminister zu positiven Äußerungen auf diese Frage zu bekommen. Heute vorgenommen weiter nicht einzugehen. Dann Wort zur Restaurantangelegenheit. Gürtler : Wenn parlamentarische Tagung nicht möglich, so verliert Sonderausschuß Bedeutung. Finanzausschuß Person des Obmanns bedenklich (Renner !) Seipel : Ich hätte Vorstellung, daß man Sonderausschuß alles zuweist. Stelle vor, daß Präsident selbst mitgewählt wird und auch Vorsitz bekommt. Das sehr wertvoll. Fink : So kommen wir am besten durch. Gürtler : Die ganze Genfer Frage selbstverständlich Sonderausschuß. Finanzausschuß fortlaufend andere Fragen zu behandeln hat. Fink : Es müßte auch Budget im Sonderausschuß. Also Sonderausschuß wird ein großer sein ! Wenn heute eingebracht wird. Streng genommen kann man bis zur 2. Sitzung Anträge stellen. Vielleicht gleich unsere Mitglieder bestimmen. Steinegger : Ungefähr wieder die Mitglieder des Finanzausschusses entsendet werden. Fink : Ich denke mir so : Mindestens äußeren Ausschuß berücksichtigen müssen. Pirchegger [Bauer, Steiermark] : Ziemlich Blick gewahrt für wichtige Aufgaben der nächsten Zukunft. Ich neugierige Frage, muß aber vorbringen. Jetzt bemühen die Wählerschaft aufmerksam machen auf Opfer. Nichts so sehr in Frage als Durchführungsmöglichkeiten. Welche Exekutivgewalt, die Gesetze durchzuführen. Fink : Kanzler uns gesagt, daß Miliz nicht möglich ist. Ob Gendarmerie vergrößern, weiß ich nicht.
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
189
Gürtler J : Verträge, die ratifiziert werden sollen. Man soll Gewißheit haben, daß man Verträge auch halten kann. Ruhe und Ordnung. Ganzes Volk aufatmen, wenn Abbau des Bundesheeres zugesichert würde. Seipel : In diesem Stadium etwas derartiges, wie angenommen, mache es unmöglich Sachen durchzubringen. Wäre dann Kampf gegen bestimmte Partei. Ich habe Überzeugung, daß wir aufrecht erhalten können. Wenn System angenommen ist, wenn dann Stockung eintreten soll, wird Regierung ergänzende Verträge abzuschließen haben. Jetzt ist über derartige Dinge nicht zu reden. [Fortsetzung mit Referat Ramek über Mieterschutz] Drexel : Das ist der Mangel, daß wir im Klub keine einheitliche Auffassung von Finanzen haben. In bezug Grundtendenz, muß der Staat alles abweisen, jeder muß aus sich heraus alles leisten. Kollm ann : Der Klub muß zuerst reorganisiert werden. Bei Sozi eingerichtet, ganzer Klub in Partien eingeteilt, jede Partie hat eigene Aufgabe. Allen Partien steht das Parteisekretariat zur Verfügung. 72 wissen nicht, daß Parteisekretariat da ist. Sehen wir beispielsweise Mieterschutz. Geldfrage ist keine Frage. Vorsitzenden Weg weiter beschreiten. Drexel : Das bedauerlichste für uns, daß Klub nicht funktioniert. Man muß 2 Tage zusammen, um Klub zu reorganisieren, Pflichtteile im Verteilen der Arbeiten. Nur wöchentlich z. B. einmal Vollsitzung, wo sämtliche da sein müssen. Zweimal hergekommen und beide Male Ergebnis ideale Gelegenheit gewesen, zu sagen, Klubfrage zu besprechen. Ganz konsterniert, daß wir alle im Jubel drinnen sind, daß Sozi in Verlegenheit und keiner denkt nach, ob wir Kräfte haben, das durchzuführen. Habe große Sorge. Wir selbst haben keine Initiative. Die Sache ist viel ernster als jetzt ausschaut. Voraussetzung, die erfüllt werden könnte, daß unser Klub in anderes Funktionieren kommt. Wäre dafür, daß auch Art Diktatur in der Partei. Heinl : In Wien Gemeinderat genau bewährt. Drexel : Wien ist zweifellos ein Stück voraus. Wir werden in Linz Versuch machen. Wir haben kein Sekretariat, das ist das traurigste Kapitel. Wir müssen nur intelligente Leute haben, die fleißig sind. Jetzt Möglichkeit da. Dazu brauche ich schließlich etwas Geld. Wir haben [ein Wort unleserlich], Voraussetzungen nicht vorhanden. Partei hat überhaupt keine Kräfte. Generalsekretär ist nicht einmal [ein Wort unleserlich] Führer. Möchte ersuchen Stimmung zu machen. Schoepfer : Es sind dabei Momente schuld, die sehr eingenistet haben. 1.) Partei Prinzipien des Programms verloren. Wir machen nicht christlichsoziale Politik. Man hat im Volkswohl gelesen, nur Kapitalismus, nicht Marxismus kann aufbauen, als ob es nichts dazwischen gäbe.
190
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
2.) Man hat den Mitgliedern des Klubs Denken und Verantwortung abgewöhnt. Demokratie größter Schwindel des Jahrhunderts und jetzt wird sich furchtbar rächen, wenn man es so macht wie in Ministerien gemacht wird. Genfer Konvention keine Bedeutung. Es kann kein Interesse aufkommen. Wir müssen eingreifen, sonst alles verloren. Ich oft etwas angeregt und dann gesehen, es ist ganz einerlei, dann bin ich still geworden. Wenn Parteitag nicht dazu bringt, programmatisch festen Boden zu gewinnen, ist alles vergebens. Dann soll man auch Programm ändern. Drexel : Demokratie aus Partei heraus, Männer brauchen, die parteimäßig denken und wenn auf Platz hinstellen, christlichsozial arbeiten. Im Klub Reden widerspruchslos, die ganz kapitalistisch sind. Manchmal direkt verzagt. Diwald : Bauernkammer Druck ausüben. Warum wir nichts gemacht. Klubaufbau bin ich ganz einverstanden. Wir haben schon lange beschlossen, wir sollen Umänderung im Klub z. B. Kinderschutz, Krankenkassen soll man auch [ein Wort unleserlich]. Finanzminister interpellieren, in Steuerämtern aufräumen. Kann Leuten die Ohrwascheln auf einmal abschneiden. Heinl : Wir müssen ohne Stellungnahme in Ausschuß gehen. Mir ist nicht gelungen, die Gewerbeabgeordneten zusammenzubringen. Vielleicht kann jetzt durchgeführt werden. Kontrolle der Frequenz. Referat für Ausschuß. Kollegen, die man gar nicht sieht. Statisten brauchen wir nur geringe. Sehr empfehlen, daß wir darauf hinarbeiten, daß Gruppeneinteilung gemacht, in Wege geleitet wird. Anträge, Vorlagen nach Gruppen aufteilen. Termin stellen wegen Beschlußfassung. Weigl [Musterkeller NÖ] : Wegen Kulturförderungsgesetz. Gürtler immer gesagt, es ist keine Bedeckung da. Dauernde Sanierung, wenn Produktion gehoben wird. Drexel : Morgen Fink sagen. Zweckmäßig zu sagen, daß Klub lediglich zum Zweck, daß Verhältnisse im Klub zu verbessern und in andere Arbeitsleistung hinzubringen. Es ist gefährlich zu kritisieren, es heißt gleich, dann probier das.
Klub, 18. Oktober Fortsetzung 5 h Seipel : Freue mich so guten Klub zu haben. Wir konnten aber nicht warten, bis so gut besucht, daher schon früh Bericht. Zunächst hinzufügen, was es neues zu sagen gibt. Delegation eingetroffen und hatten heute lange Besprechung. War nach üblichen Begrüßungsworten Erörterung, was für Aufgaben prov. (?) Deleg zu erfüllen haben wird. Welches Tempo und spezielle Fragen übergegangen. Meine Feststellung recht, dass jetzt mit größter Eile wir mitzuarbeiten haben an Feststellung Finanz- und Reformplan. Formulierung des Ermächtigungsgesetzes. Dann eine Ver-
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
191
handlung über Änderung an Notenbankstatut. Und endlich Frage der Übergangswirtschaft. Sozi stehen noch immer, daß in Finanzausschuß kommen muß. Gestern gesehen, daß nicht Sozi Obmann ist. Soll Verschleppungstaktik, die wir nicht brauchen können. 2. Frage : Wie wir uns in nächsten Tagen in diesem Ausschuß verhalten ? Zu Abstimmung womöglich unter einem kommen soll. Man muß alles zusammen können. Man soweit, daß morgen Vormittag umfangreichen Entwurf wird vorlegen können. Dann sollen wir Vorstand und Klub vorlegen. Wir weigern uns, im Genfer Ausschuß heraus zu rücken, es muß zuerst hier Beratung stattfinden. Besonders kritisch : Nicht anders gehen als ganze Frage Länder und Gemeindefinanzen einbezieht, denn es muß Vorsorge getroffen werden. Alle Subventionen an Landgemeinden einstellen. Weiter heute gesprochen über Übergangszeit, wie man hinweg kommen soll. Ergebnis Kreditermächtigung, die heute eingebracht wurde. Banknotenumlauf ungeheuerliche Steigerung, aber nicht Wirkung der Teuerung. Aber gerade in der Zeit [ein Wort unleserlich] verzeichnen. Index : Man sieht, wie alle Theorien nicht wahr sind. Es kommt nicht auf Quantitätstheorie und nicht auf Bedeckung, das Um und Auf ist Vertrauensfrage. Kreditermächtigung ist empfängliche Sache. Ségur sollte etwa 500 Mrd ansprechen (während Genf auch). Ich habe sehr bedauert damals, hätten 500 Mrd. auch nichts geschadet, jetzt abzustellen, daß wir nicht mit 500 Mrd über einen Stoß bedeuten, sondern mit 750 Mrd. Das glaube ich leichter zu ertragen, die genau errechnet sind. Annex A zum Prot. II steht darin, die Kredite französisch und italienisch in österreichisch-ungarische Bank gelegt als Vorschuß an Notenbank. Wir von dieser Bedingung befreit, dies wieder herausnehmen können gegen Schatzbons und neuerdings verwenden können. Dazu bedarf es 750 Mrd Papierkronen. Wir haben guten Grund in Gesetz nichts hineinzunehmen von der Zweckbestimmung nach Annex A, weil 1.) vom Parlaments Standpunkt nicht geht, wäre Vorgriff der Genehmigung der Protokolle. 2.) daß man in Zwischenzeit einiges schon auf normalem Wege herausnehmen kann. Zustimmung der Völkerbunds-Delegierten, die nicht legal ist, heute zur Kenntnis gebracht, nur bitten öffentlich nicht ihre Ankunft als Ursache bezeichnen. Prov. Delegierte von mir verlangt worden. Zu beachten wird, daß aus prov. Delegierten etwas wird, was uns unbequem werden kann. Verliert alle Autorisation, wenn Generalkommissär kommt. Überhaupt beschränkt mit 4 Punkten. Zwei Bestimmungen vielleicht eine bedenklich. Wenn Anleihe abgeschlossen ohne Zustimmung Generalkommissär andere abzuschließen. Wir können vielleicht billigeres Geld bekommen und konvertieren. Aber wir können solche Anleihe schon im Finanzprogramm vorsehen. Kein Mensch wird uns hindern an Konvertierung Anleihe. Gestern im Ausschuß über einzelne Dinge gesprochen. Beginn der Verpflichtung, voraussichtliches Ende. Herausfischen, was für uns wichtiger ist, was wird Anleihe kosten. Noch nicht ganz abgeschlossen. Jährlich etwa 70 Mio. Goldkronen. Etwas
192
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
mehr als 10 %, inbegriffen Annuität und indirekte Verzinsung, die in niedrigem Emissionskurs drinnen ist. Glaube, wir werden Emissionskurs von 94 bekommen, dies ist unglaublich gut, Tschechen 91. Zinsfuß durchschnittlicher Zinsfuß zwischen denen, die in garantierenden Staaten gelten. Man glaubt ungefähr 8 %. Mir absolute Sicherheit, daß wir Kredite nicht bekommen ohne Garantien der fremden Staaten. Absolut sicher, daß Garantien nicht ohne Kontrolle. Man findet nirgends, daß man uns besonders verachtet, vielleicht vom Gegenteil reden. Freilich geschenkt wird es uns nicht. Die 800 Mio. Gold, die wir bisher bekommen haben. Diese Sache werden wir zurückzahlen müssen und wollen. Kontrolle kann schlecht werden, wenn schwacher Generalkommissär kommt. Habe Zusicherung bekommen, schriftlich, wir werden bei der Auswahl mitsprechen können. Auch schlecht, wenn wir hier schwächlich sind. Die parteipolitische Behandlung des Gegenstandes und taktisch im Parlament. Es ist wahr, ich bin kein Freund der Konzentration gewesen, glaube, hätte die Genfer Ergebnisse nicht. So lang scharf ablehnend gegen Sozi einnehmen als ein größeres Entgegenkommen draußen schlecht sich ausnehmen würde. Wir sollen bis Ende Monats fertig werden. Sozi in Wien öffentliche Agitation eingeleitet. Heute Res[olution ?], die nicht böse ausschaut. Es steht nichts drin, das jederzeit umfallen kann. Die Wiener Christlichsozialen machen man falls große Aufklärungsversammlungen. Die Presse soll auch sehr mit der Aufklärung anzufangen. Es gibt eine Menge Punkte, worüber sich reden läßt. Ich werde es nicht fehlen lassen. (Beifall !) Miklas : Wir danken für Ausführungen : Versteht Seitz, immer alte Sache in neues Licht zu rücken. Frage : Vorgesehen Bevollmächtigung der Regierung. Ob die Sache Verfassung tangiert oder nicht. Im Klub Aufklärung geben, weil unsere Mitglieder verschieden darüber reden. Seipel : Die Sache ist nicht einfach zu beantworten. Unsere Sachverständigen zu meiner Überraschung der Meinung, daß man sie nicht braucht, sie wissen die Formeln dafür. In Wahrheit ist es so, es kommt darauf an, wieweit Ermächtigung geht und wie Finanzplan ausschaut. Wenn Finanzverfassungsgesetz, ist klar, daß 2/3 Mehrheit braucht. Auch möglich dann selbst wenn Gesetz abgeändert werden soll, ohne 2/3 durchzukommen, wenn mit Ermächtigungsgesetz gleichzeitig Änderung des Verfassungsgesetzes vom Haus geändert wird. Politisch und taktisch wir alle uns bei Beratung nicht vom Anfang durch Frage bestimmen lassen, wie kommen wir leichter mit Sozi durch, sondern rein sachliche Vorlagen. Für Sozi sehr schwer definitiv nein zu sagen. Jerzabek [Arzt, Wien, Obmann Antisemitenbund] : Frage : Kommt der Generalkommissär nicht mit Stab sachverständiger Beamter. Seipel : Vorgesehen, daß er nötiges technisches Hilfspersonal zur Seite haben wird. Es wird ihm unser Beamtenapparat zur Verfügung gestellt. Finanzplan ist vom Finanzplan [sic !] zu genehmigen. Dies ist Rahmen für ihn.
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
193
Miklas : Ob volle Ermächtigung der Regierung innerhalb des Finanzplans vorgesehen. Generalkommissär nicht gerade an Finanzplan gebunden. Insbesondere auch Abbaumaßregeln. Seipel : Kann mir nicht vorstellen, daß Finanzplan besteht und Generalkommissär unmögliches verlangen kann. Ich immer große Furcht, daß der zu wenig verlangt. Paulitsch [Priester, Chefredakteur ›Kärntner Tagblatt‹] : Wir sollten draußen Versammlungen abhalten und aufklären. Ich dafür dankbar, wenn andere Länder mitteilen würden, wie draußen Stimmung in Ländern ist. Stimmung in Kärnten ist eine äußerst zuversichtliche. Tagblatt mitgeteilt, daß Völkerbunddelegierte Mitteilung über Finanzprogramm gemacht wird. Weiß nicht, ob nicht Sozi viel früher bekommen als wir. Landeshauptleute werden einberufen. Klubpräsidium und Reichsparteileitung ersuchen, daß wenn verhandelt wird, die Landesparteileitung und Klubmitglieder gemeinsam beraten sollen. Daher mit uns gemeinsam hier sein, damit nicht Länder eigene Wege gehen können. Mit vom Bundeskanzler gemachten Vorschlag, was geredet worden ist, alles dem stimmen wir bei. Nicht schwer Erhöhung für Einnahmen zu finden. Aber ich sage aus Erfahrung : Mißtrauen wegen Ersparungen. Wir müssen Sicherheit haben, daß eine entsprechende Ersparung wirklich gemacht wird. An Regierung freundliches Ersuchen stellen. Retten wird uns Ersparung der Ausgaben. Es muß uns ganz genau vorgerechnet werden. Miklas : Im Klub Vorstand schon gesprochen, wie Klub Stellung zu nehmen hat. Bevor halbwegs spruchreif vorliegt. Seipel : Ich glaube schon, daß gleichzeitig zu machen ist. Miklas : Beabsichtigt für diese Klubsitzung alle Landesparteileitungen einzuladen und dringlich zu verständigen. Wir nicht allein ganze Verantwortung tragen können. Schöpfer : Ich habe gehört, daß von jedem Ministerium einem Herrn beigegeben werden soll. Wenn ihm überhaupt beigegeben wird, von größter Wichtigkeit, was für Leute beigegeben werden. Auf Ministerien selbst habe kein großes Vertrauen. Wenn Minister in ihren Ämtern keine Änderung machen können, tun wir überflüssige Arbeit. Erfahren, daß im Finanzministerium in sehr wichtigen Abteilungen 5½ Stunden gearbeitet wird. Es wird mit Beispiel vorangegangen, daß ganz schrecklich ist. Einnahmen werden uns nicht retten. Z. B. Eisenbahntarife und Defizit immer größer. Glaube zwar, daß im Budget Defizit auf Jahr ausgerechnet worden zu hoch gegriffen ist. Wenn dies so ist, so wird bei Stimmung, die in Eisenbahnerangestelltenkreisen ist, nicht zur Sanierung kommen. Sch. (?) selbst gesagt, es sei schrecklich, was in Innsbruck bei Bahn für rote Wirtschaft ist. Arbeiten nur 5 Stunden. Sanierung wird von Beamten hintertrieben werden. Hauptschuld Sozi, die ihren Geist hineingetragen haben. Noch etwas : Bin erschrocken, als Seipel noch in Genf war, aber seine Aktion als geglückt gemeldet wurde, in Reichspost stand, daß Sanierungsplan oder das Pro-
194
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
gramm übereinstimmt mit dem Finanzplan, der im Sommer verhandelt wurde. Ausgeschlossen, daß wir durch finanzielle Maßnahmen Staat retten können, Das Problem ist volkswirtschaftlich. Hat mich gefreut, daß in P[rotokoll ?] wiederholt drinnen ist. Es handelt sich vor allem um Sanierung der Volkswirtschaft. Vorgelesen, daß Finanzminister in einigen Punkten große Aufgaben dargestellt hat. Man muß auch schauen, welche Rückwirkungen finanzielle Maßnahmen auf Volkswirtschaft haben können. Aber Pferd an der falschen Stelle aufgezäumt. Es handelt sich darum, daß Volkswirtschaft in Stand gesetzt, Lasten zu tragen. Mit dem Beamten Entlassen ist nicht saniert. Denn die Hinausgeworfenen müssen wieder essen. Wertvoll ist, daß gewisses Vertrauen hineingekommen ist. Aber dies muß gerechtfertigt werden. Bitte dringend, dass soziologische Folgen nicht unterschätzen und Volkswirtschaft nicht vergessen. A igner : Wunsch Paulitsch nachkommen. Stimmungsberichte aus Ländern. In Oberösterreich nach langen Jahren wieder Zuversicht. Sehnsucht nach Exekutive. Wunsch nach volkswirtschaftlichen Flugblättern. Etwas anders durchführen. Bin überzeugt, daß ihn Landeshauptleute für schicken wird. Wir Herzenswunsch, wenn Seipel nach Linz kommen würde. Seipel : Aktuell würde ich sehr gern an möglichst vielen Orten reden. Ob ich bis Linz bringe, weiß ich nicht. Unser ordentliches Mittel der Aufklärung ist Sache, die schon morgen Reichsparteileitung besprechen sollte. Hundertausende falsch oder nicht orientiert. Jetzt anders, weil wir doch die ganze Presse haben. Im geeigneten Zeitpunkt Proklamation anschlagen. Glaube, daß mit normalen Mitteln durchkommen werden. Große Frage der Autorität. Habe schon Gelegenheit gehabt anzudeuten. Kann sagen, daß das, was er als einziger. Was Zweifel nicht verstummen läßt, hat Hindernisse in Genf. Vom ersten Tag an gesagt worden, werden sie diese machen können. Vor 4 Wochen neuerdings Miliz abgelehnt. Aber wir sollen nicht neuerdings ansuchen wegen Verhältnis Frankreich zu Deutschland. Geschehe es nicht. Nun anderer Ausweg. Im § 7 durfte nichts stehen. Daher so wenig. Darf nicht ausschauen wie Aktion gegen Partei. Weil es bei ihnen auch Sozi gibt. Ja kein Mißverständnis. Geldgeber der ganzen Welt nicht Courage haben, wenn nicht Versicherung, daß hier kein Umsturz geschieht. Es schließt sich kein Geheimabkommen an. Das sage ich offen. Bitte im 1. Protokoll, daß nicht einmarschieren, wenn aber Generalstreik, dann garantiert uns niemand. Maßregeln kann ich dann nicht verhindern. Vom § 7 fürchten sich Sozi sehr. Daß sie sich fürchten, ist gut. Das sage ich offen, ich glaube, es wird gehen. Wenn sie das ihrige leisten und wird dann Streik kommen, so werden wir dann einen Vertrag abschließen. Wenn wir diesen Weg beschritten haben, haben wir festeren Boden und man wird nicht umfallen dürfen. Lut tenberger : Stimmungsbild Steiermark. Leute im allgemeinen große Zuversicht, aber immer Furcht, ob Maßnahmen durchführbar sind. Denn Um und Auf
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
195
dreht sich um Sicherheitsmaßnahmen. Volk will immer : Weg mit der Wehrmacht. Aber anderer Plan : die Gendarmerie. Ihm gesagt, was wäre es, wenn Gendarmerie wieder militarisiert. Die Alten sehr froh, wenn wieder zu Dienstverhältnis. Weil mit jungen Leuten nichts anzufangen wissen. Seit 8. X. die Einnahmen weniger hoch sind als früher. Abbau das zweckmäßigste. Auf der anderen Seite werden immer wieder Leute aufgenommen. D[irektio ?]n Villach letzter Zeit 300 Frauen aufgenommen. Versammlungstätigkeit ungeheuer nötig. Miklas : Taktisch ganz gefehlt, wenn draußen über Ordnungs § reden würden. Es kommt auf Tat an. Kollm ann : Es kommt auf Ausschuß an, daß fleißig arbeitet. Notwendig, daß auch Ersatzmitglieder hier sind. Sozi alle da gehabt. Was Änderung anbelangt. Wir haben nicht so eine Unordnung. Es ist im Laufe der Zeit nicht so viel geschehen. In Italien und England viel mehr. Zwecklos, wenn jeder im Klub über Reformen redet. Alle Wünsche an Ministerien brieflich zustellen soll. Wir müssen zusammenhalten. Habe nicht Angst, daß wir finanziell nicht aushalten. Wir zahlen alle miteinander keine Steuer mehr. Im Sommer werden Züge auf Bahn wieder voll sein wie früher. Wenn Handel, Gewerbe, Industrie schreien, so nur wegen Herabsetzung der Tarife. Wir haben nur zu glauben, was Ministerium uns vorlegt. Binder [Polizist, Burgenland] : Stimmung im Burgenland. Bei uns gehässige Sachen vorhanden. Volk Wunsch nach Änderung. Im Burgenland die junge Gendarmerie das gleiche wie Volkswehr. Gewerkschaft ist Schaden ! ! A igner : Tatsächliche Berichtigung durch Gewerkschaft wegen Gendarmerie wird folgen. Binder : Geisler : Gratuliere Oberösterreich zur Gendarmerie, bei uns nicht so.
Klub, 4. November Fink : Vor Tagesordnung Sache zur Sprache bringen, wegen der mir verschiedene Beschwerden : Zeitungen im Klub. Tatsache, wenn man im Laufe des Tages herkommt, keine Zeitung mehr bekommt. Die Zeitungen werden von einzelnen einfach weggenommen. Antrag Klub beschließen : Auf Klubkosten Zeitungen halten. Diener die Zeitungen in Halter zu geben. Rahmen anbringen. Dann einen der beiden Kästen frei machen und jeden Abend die Zeitungen legen. Auf jedes Blatt Klubstempel hindrücken. Jeder, der sie wegnimmt, bestiehlt den Klub und die anderen Mitglieder. Jeden Tag fast ausnahmslos fast alle der Halter wegkommen. Es muß im Klub nicht gut ausschauen.
196
Transkription ausgewählter Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen
Thullner [Priester, Burgenland]/Niedrist : Draußen Handschuhe gestohlen worden. Fink : Bei Sozi weit besser, besonders Garderobe. Kunsch ak : Sozi wesentlich anders, in vielen Belangen besser. Drüben ist alles tadellos eingerichtet. Wie mit Diener machen, weiß ich nicht, aber man kommt in Klub nicht hinein. Bei uns überhaupt keine Ordnung. Es gehen Leute herum. Abteilung 9 als Sprechzimmer einrichten. Hier niemand etwas zu suchen. Weiskirchner : Die Diebstähle im Haus mehren sich. Auftrag nach Hausdieben suchen. Die erbärmliche Freizügigkeit, die von Abgeordneten gefordert wird. Garderobe : Bei Bauernbündlern Rock aus Kasten gestohlen worden. Auch bei Sozi ist gestohlen worden. Jeden Abgeordneten verpflichten in der Garderobe abzulegen. Das ist ideales Mittel. Wir leben in einer Zeit, wo Stehlen ein gutes Geschäft ist. Der Diener ist gegen Abgeordnete machtlos. Stärkere Disziplin. Nicht durchzuführen. Fink : Abstimmung wegen Zeitungen : Angenommen. Steinegger : Antrag, daß Zutritt von Fremden ausnahmslos verboten wird und IX als Sprechlokal verwendet wird. Gimpl-Hem ala : Da müßte eigener Diener angestellt, der Abgeordnete holt. Hofer [Bauer, NÖ] : Mit Vorschlag Präsidenten einverstanden. Garderobe hinaufgehen. Niedrist/Paulitsch : Wer darf das Lokal betreten. Weiskirchner : Dieses Lokal ständig Parteirat und Wiener Gemeinderatsklub. Eisenhut [Bauer, NÖ] : Ablegen der Garderobe nicht haltbar sein. Weiskirchner : Mein Antrag : Garderobe. Angenommen. Antrag Steinegger 18 pro = angenommen. Ich wünsche Durchführung viel Glück. Kunsch ak : Bitten, was man im Rathaus gemacht. Das Betreten der Vorräume (?) absolut verboten. Geregelt Vergebung von Lokalen überhaupt. Mit Anarchie geht es nicht. Kommt vor, daß bis in Nacht hinein. Organisation anmelden.
Abkürzungsverzeichnis ADÖ Außenpolitische Dokumente der Republik Österreich AdR Archiv der Republik AVA Allgemeines Verwaltungsarchiv AZ Arbeiter-Zeitung BKA Bundeskanzleramt CS Christlichsozial DAW Diözesanarchiv Wien DBFP Documents on British Foreign Policy GD(VP) Großdeutsch(e Volkspartei) Hg(g). Herausgeber HHStA Haus, Hof- und Staatsarchiv KvVI Karl von Vogelsang-Institut MRP Ministerratsprotokolle NFP Neue Freie Presse OÖLA Oberösterreichisches Landesarchiv PRO Public Record Office (später in National Archives umbenannt) PV Parteivorstand RP Reichspost StPNR Stenographische Protokolle des Nationalrates T Treasury Tb. Tagebuch VGA Verein für Geschichte der Arbeiterbewegung
Quellen- und Literaturverzeichnis I. Archive 1) Österreichisches Staatsarchiv a) Haus, Hof- und Staatsarchiv Nachlaß Alexander von Spitzmüller Tagebuch 1922/23 Nachlaß Mensdorff-Pouilly 4 Tagebuch 1922/23 b) Archiv der Republik Bundeskanzleramt, Ministerratsprotokolle (MRP) 49–70 Großdeutsche Volkspartei 2, 3 (Klubprotokolle 1920–1923), 39 (Reichsparteileitung) c) Allgemeines Verwaltungsarchiv E/1751 : Nachlaß Leopold v. Hennet E/1784 : Nachlaß Heinrich Mataja E/1791 : Tagebuch Heinrich Wildner 2) Public Record Office (London) T (Treasury) 160 League of Nations 58/2073/7, 58/2073/8, 58/2073/9, 58/2073/021/1+2 Austrian Reconstruction Loan 64/2073/04/1+2, 64/2073/018, 64/2073/019, 64/2073/020 3) Karl von Vogelsang-Institut Klub- und Klubvorstandsprotokolle der Christlichsozialen Partei 1921–1922 4) Verein für Geschichte der Arbeiterbewegung Parteiarchiv vor 1934, Mappe3 (Parteivorstand 1922) 5) Diözesanarchiv Wien Tagebuch Ignaz Seipel
II. Quelleneditionen Außenpolitische Dokumente der Republik Österreich (= ADÖ), Bd. IV & V (Wien 2015). Documents on British Foreign Policy (= DBFP), 1st Series, Bd. XXII (London 1980) & XXIV (London 1983). Gertrude Enderle-Burcel, Hanns Haas & Peter Mähner (Hgg.), Der Österreichische Staatsrat. Die Protokolle des Vollzugsausschusses, des Österreichischen Staatsrates und der geschäftsführenden Staatsratsdirektion 21. Okt. 1918 bis 14. März 1919, Bd. 1 (Wien 2008).
Quellen- und Literaturverzeichnis
199
Fritz Fellner & Doris Corradini (Hgg.), Schicksalsjahre Österreichs. Die Erinnerungen und Tagebücher Josef Redlichs 1869–1936, Bd. 2 (Wien 2011). Fritz Fellner & Heidrun Maschl (Hgg.), Saint Germain im Sommer 1919. Briefe Franz Kleins aus der Zeit seiner Mitwirkung in der österreichischen Friedensdelegation von Mai bis August 1919 (Salzburg 1977). Josef Geßl (Hg.), Seipels Reden in Österreich und anderwärts (Wien 1926). Lothar Höbelt, Johannes Kalwoda & Johannes Schönner (Hgg.), Klubprotokolle der Christlichsozialen und Großdeutschen 1918/19 (Wien 2022). Robert Kriechbaumer (Hg.), »Dieses Österreich retten …« Die Protokolle der Parteitage der Christlichsozialen Partei in der Ersten Republik (Wien 2006). Jürgen Nautz (Hg.), Unterhändler des Vertrauens. Aus den nachgelassenen Schriften von Sektionschef Dr. Richard Schüller (Wien 1990).
III. Sekundärliteratur Alfred Ableitinger, Unentwegt Krise. Politisch-soziale Ressentiments, Konflikte und Kooperationen in der Politik der Steiermark 1918 bis 1933/34. In : Ders. (Hg.), Bundesland und Reichsgau : Demokratie, »Ständestaat« und NS-Herrschaft in der Steiermark 1918–1945 (Wien 2015) 21–176. R. J. Q. Adams, Balfour. The Last Grandee (London 2007). Karl Ausch, Als die Banken fielen (Wien 1968). Manfred Bansleben, Das österreichische Reparationsproblem auf der Pariser Friedenskonferenz (Wien 1988). Gabor Batonyi, Britain and Central Europe 1918–1933 (Oxford 1999). Otto Bauer, Die Österreichische Revolution [1923]. In : Werkausgabe, Bd. 2 (Wien 1976) 489–866 ; Bd. 5 : Parteitagsreden (Wien 1978). Markus Benesch, Die Wiener Christlichsoziale Partei 1910–1934. Eine Geschichte der Zerrissenheit in Zeiten des Umbruchs (Köln 2014). Peter Berger, Im Schatten der Diktatur. Die Finanzdiplomatie des Vertreters des Völkerbundes in Österreich, Meinoud Marinus Rost van Tonningen 1931–1936 (Wien 2000). –, The League of Nations and Interwar Austria : Critical Assessment of a Partnership in Economic Reconstruction. In : Contemporary Austrian Studies 11 (2003) 73–92. Robert Blake, The Unknown Prime Minister. The Life and Times of Andrew Bonar Law, 1858–1923 (London 1955). Gustav Blenk, Leopold Kunschak und seine Zeit. Portrait eines christlichen Arbeiterführers (Wien 1966). John Boyer, Culture and Political Crisis in Vienna. Christian Socialism in Power, 1897–1918 (Chicago 1995). –, Wiener Konservativismus vom Reich zur Republik – Ignaz Seipel und die österreichische Politik. In : Ulrich F. Zellenberg (Hg.), Konservative Profile (Graz 2003) 341–361. –, Richard Schmitz and the Tradition of Imperial Catholic Politics in Austria 1907–1934. In : Demokratie und Geschichte 13/14 (2009/10) 95–134. Gerald Brettner-Meßler, Richard Riedl – ein liberaler Imperialist (unveröff. Diss. Wien 1999).
200
Quellen- und Literaturverzeichnis
Ernst Bruckmüller, Richard Schmitz als Minister. In : Demokratie und Geschichte 13/14 (2009/10) 135–157. Kathleen Burk, Morgan Grenfell 1838–1988. The biography of a merchant bank (Oxford 1989). Fritz Butschek, Die österreichische Wirtschaft im 20. Jahrhundert (Stuttgart 1985). Sir Henry Clay, Lord Norman (London 1957). Victor Dillard, Eine Stunde mit Msgr. Seipel. In : Österreich in Geschichte und Literatur 6 (1962) 447–454. Friedrich Engel-Janosi, Vom Chaos zur Katastrophe. Vatikanische Gespräche 1918 bis 1938 (Wien 1971). Harald Fiedler, Die politischen Folgekosten der Genfer Sanierung. Bürgerliche Politik in Österreich 1924–1926 (unveröff. Diss. Wien 2016). Caroline Fink, Beyond Revisionism : The Genoa Conference of 1922. In : Fink/Frohn/Heideking (Hgg.), Genoa 11–27. Caroline Fink, Axel Frohn & Jürgen Heideking (Hgg.), Genoa, Rapallo, and European Reconstruction in 1922 (Cambridge 1991). Charles Gulick, Austria from Habsburg to Hitler, Bd. 1 (Berkeley 1948). Alexander Haas, Die vergessene Bauernpartei. Der Steirische Landbund und sein Einfluß auf die österreichische Politik 1918–1934 (Graz 2000). Frank Hadler, The European Policy of Czechoslovakia on the Eve of the Genoa Conference of 1922. In : Fink/Frohn/Heideking (Hgg.), Genoa 171–185. Ernst Hanisch, Die Politik und die Landwirtschaft. In : Franz Ledermüller (Hg.), Geschichte der österreichischen Land- und Forstwirtschaft im 20. Jahrhundert (Wien 2002) 15–189. –, Der große Illusionist. Otto Bauer (1881–1938) (Wien 2011). Gerhard Hartmann, Richard Schmitz. Der Beginn einer Karriere im politischen Katholizismus Österreichs. In : Demokratie und Geschichte 13/14 (2009/10) 75–94. Helmut Heiber, Die Republik von Weimar (München 1966). Charlotte Heidrich, Burgenländische Politik in der Ersten Republik (Wien 1982). Lothar Höbelt, Prag, Wien und London in der ersten Nachkriegszeit : Eine politisch-ökonomische Dreiecksbeziehung am Beispiel der Anglo-Österreichischen Bank 1921. In : Great Britain, the United States and the Bohemian Lands 1848–1938, hg. von Eva SchmidtHartmann & Stanley B. Winters (München 1991) 269–276. –, Konservative und Christlichsoziale : Phasen des Übergangs – und seine Folgen. In : Brennpunkt Mitteleuropa. Festschrift für Helmut Rumpler zum 65. Geburtstag, hg. von Ulfried Burz, Michael Derndarsky & Werner Drobesch (Klagenfurt 2000) 345–352. –, Deutschnationale – Nationaldemokraten – Großdeutsche – Bauernpartei. Das »nationale Lager« 1918–1922. In : Niederösterreich 1918 bis 1922 (= Studien und Forschungen aus dem Niederösterreichischen Institut für Landeskunde 39, St. Pölten 2007) 101–135. –, (K)eine liberale Partei 1918 – Deutschnationale und Liberale. In : 1918 – Der Beginn der Republik (= politicum 102, Graz 2007) 17–20. –, Anmerkungen zur politischen Laufbahn Franz Dinghofers. In : Christian Neschwara & J. Michael Rainer (Hgg.), 100 Jahre Republik Österreich. Die provisorische Nationalversammlung und ihre Rolle bei der Entstehung der Republik Deutschösterreich (Graz 2018) 204–213.
Quellen- und Literaturverzeichnis
201
–, Die Erste Republik Österreich (1918–1938). Das Provisorium (Wien 2018). –, Die Gliederung der Provisorischen Nationalversammlung : Kronländer und Parteien. In : Christian Neschwara & J. Michael Rainer (Hgg.), 100 Jahre Republik Österreich. Die provisorische Nationalversammlung und ihre Rolle bei der Entstehung der Republik Deutschösterreich (Graz 2018) 55–69. –, Austria, the Anschluss and the Entente : How to Make Money from Oppression. In : Dariusz Makilla & Milos Reznik (Hgg.), After the Peace Treaty of Versailles (1919) : New Order of Central Europe (Wiesbaden 2020) 197–206. –, «We alone cannot act as the policemen of the world”. Das Empire und der Kontinent in der Zwischenkriegszeit. In : Franziska Bartl, Frank-Lothar Kroll & Stefan Schieren (Hgg.), Britannien und Europa (= Prinz-Albert-Studien 36, Berlin 2022) 55–74. Lothar Höbelt & Christian Reiter, Die Parteien des »dritten Lagers« in Oberösterreich 1918– 1933. In : OÖLA (Hg.), Oberösterreich 1918–1938, Bd. VI (Linz 2020) 273–442. Josef Honeder, Johann Nepomuk Hauser (Linz 1973). Rainer Hubert, Schober. »Arbeitermörder« und »Hort der Republik«. Biographie eines Gestrigen (Wien 1990). Walter M. Iber, Sotto il fascino del politico sacerdote. Il partito cristiano-sociale nella Prima Repubblica austriaca. In : Römische Historische Mitteilungen 52 (2010) 303–322. Johannes Kalwoda, Ernst Schönbauer (1885–1966). In : Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs 2 (2012) 282–316. Leon Kane, Robert Danneberg. Ein pragmatischer Idealist (Wien 1980). Österreich. 90 Jahre Republik. Beitragsband zur Ausstellung im Parlament (Innsbruck 2008). Stefan Karner & Lorenz Mikoletzky (Hgg.), Österreich. 90 Jahre Republik. Beitragsband der Ausstellung im Parlament (Innsbruck, Wien & Bozen 2008). Fritz Kaufmann, Sozialdemokratie in Österreich (Wien 1978). J. F. V. Keiger, Raymond Poincaré (Cambridge 1997). Lajos Kerekes, Abenddämmerung einer Demokratie. Mussolini, Gömbös und die Heimwehr (Wien 1966). Hans Kernbauer, Währungspolitik in der Zwischenkriegszeit. Geschichte der österreichischen Nationalbank von 1923 bis 1938 (Wien 1991). Klemens von Klemperer, Ignaz Seipel. Christian Statesman in a Time of Crisis (Princeton 1972). Anton Klotz, Dr. Aemilian Schoepfer : Priester und Volksmann (Innsbruck 1936). Ulrich Kluge, Bauern, Agrarkrise und Volksernährung in der europäischen Zwischenkriegszeit (Stuttgart 1988). Klaus Koch, Zwischen Staatsbankrott und Genfer Sanierung. In : ADÖ IV 9–25. Gerald Kohl, Die außerordentliche Gesetzgebung im Rahmen der Genfer Protokolle, 1922– 1924. Theorie und Praxis des »außerordentlichen Kabinettsrates« 1922–1924. In : Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs 8 (2018) 318–343. Hans-Christof Kraus, Versailles und die Folgen. Außenpolitik zwischen Revisionismus und Verständigung 1919–1933 (Berlin 2013). Gottfried Ladner, Seipel als Überwinder der Staatskrise vom Sommer 1922. Zur Geschichte der Entstehung der Genfer Protokolle vom 4. Oktober 1922 (Graz 1964). Franz Langoth, Kampf um Österreich (Wels 1951).
202
Quellen- und Literaturverzeichnis
Norbert Leser, Zwischen Reformismus und Bolschewismus. Der Austromarxismus als Theorie und Praxis (Wien 1968). –, Der Sturz des Adlers. 120 Jahre österreichischer Sozialdemokratie (Wien 2008). Werner Link, Die amerikanische Stabilisierungspolitik in Deutschland 1921–1932 (Düsseldorf 1970). Miklos Lojko, Meddling in Middle Europe. Britain and the ›lands between‹ 1919–1925 (Budapest 2006). Walter Lukan, Der Kampf um den Mieterschutz in der Ära Seipel (unveröff. Diss. Wien 2005). Stefan Malfer, Wien und Rom nach dem Ersten Weltkrieg. Österreichisch-italienische Beziehungen 1919–1923 (Wien 1978). Andrew Mango, Atatürk. The Biography of the Founder of Modern Turkey (London 2002). Nathan Marcus, Austrian Reconstruction and the Collapse of Global Finance, 1921–1931 (Cambridge, Mass. 2018). Eduard März, Österreichische Bankpolitik in der Zeit der großen Wende 1913–1923 am Beispiel der Creditanstalt für Handel und Gewerbe (Wien 1981). Christian Mertens, Die christlichsoziale Partei Wiens vom Tode Luegers bis in die Frühzeit der Republik. In : Demokratie und Geschichte 7/8 (2003/04) 157–181. –, Richard Weiskirchner (1861–1926). Der unbekannte Wiener Bürgermeister (Wien 2006). Charlotte Natmeßnig, Britische Finanzinteressen in Österreich : Die Anglo-Österreichische Bank (unveröff. Diss. Wien 1995). Jürgen Nautz, Die österreichische Handelspolitik der Nachkriegszeit 1918 bis 1923 (Wien 1994). Alois Niederstätter, Wäldar ka nüd jedar sin ! Eine Geschichte des Bregenzerwaldes (Innsbruck 2. Aufl. 2020). Thomas Olechowski, Hans Kelsen. Biografie eines Rechtswissenschaftlers (Tübingen 2. Aufl. 2021). Anne Orde, British Policy and European Reconstruction after the First World War (Cambridge 1990). Anton Pelinka, Die gescheiterte Republik. Kultur und Politik in Österreich 1918–1938 (Wien 2017). Nicole Pietri, La Reconstruction financière de l’Autriche, 1921–1926 (Genf 1970). Ludger Rape, Die österreichischen Heimwehren und die bayerische Rechte 1920–1923 (Wien 1977). Walter Rauscher, Karl Renner. Ein österreichischer Mythos (Wien 1995). –, Österreichs Außenpolitik im Zeichen von Besuchsdiplomatie und bilateralen Handelsbeziehungen. In : ADÖ V 11–26. Viktor Reimann, Zu groß für Österreich. Seipel und Bauer im Kampf um die Erste Republik (Wien 1968). Friedrich Rennhofer, Ignaz Seipel. Mensch und Staatsmann (Wien 1978). Helga Röglsperger, Die Politik Frankreichs gegenüber Österreich von 1918 bis 1922 (phil. Diss. Wien 1973). Francois Roth, Raymond Poincaré. Un homme d’Etat républicaine (Paris 2000). Roman Sandgruber, Ökonomie und Politik. Österreichische Wirtschaftsgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart (Wien 1995).
Quellen- und Literaturverzeichnis
203
Franz Schausberger, Rudolf Ramek 1881–1941. Konsenskanzler im Österreich der Gegensätze (Wien 2017). Stephen Schuker, American Policy Towards Debts and Reconstruction at Genoa, 1922. In : Fink/Frohn/Heideking (Hgg.), Genoa 95–122. Günther Steinbach, Kanzler, Krisen Katastrophen. Die Erste Republik (Wien 2006). Jürgen Steinmair, Der Priesterpolitiker Ignaz Seipel und der Heilige Stuhl. Ein Konflikt der Loyalitäten ? (unveröff. Diss. Wien 2012). Adam Tooze, The Great War, America and the Remaking of the Global Order, 1916–1931 (New York 2014). Richard Voithofer, »Drum schließt Euch frisch an Deutschland an …« Die Großdeutsche Volkspartei in Salzburg 1920–1936 (Wien 2000). Fritz Weber, Vor dem großen Krach. Österreichs Banken in der Zwischenkriegszeit am Beispiel der Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe (Wien 2016). Andrew Williams, The Genoa Conference of 1922. Lloyd George and the Politics of Recognition. In : Fink/Frohn/Heideking (Hgg.), Genoa 29–47. Manfred Zollinger, »L’Autriche, c’est moi« ? Georges Clemenceau, das neue Österreich und das Werden eines Mythos. In : Karner/Mikoletzky (Hgg.), 90 Jahre Republik 621–632.
IV. Nachschlagewerke Gertrude Enderle-Burcel & Michaela Follner (Hgg.), Diener vieler Herren. Biographisches Handbuch der Sektionschefs der Ersten Republik und des Jahres 1945 (Wien 1997). Parlamentsdirektion (Hg.), Biographisches Handbuch der österreichischen Parlamentarier 1918–1993 (Wien 1993).
Personenregister
Notabene: Nicht extra angeführt wird Ignaz Seipel Adams, R(alph) J.Q. 105 Adler, Friedrich 103 Adler, Viktor 24 Aigner, Josef 74, 163–166, 169–171, 194 f. Akers-Douglas, Aretas (jun.) 15, 78, 87 f., 96, 106, 126, 128 Altenbacher, Franz 54 Angerer, Hans 28. 56 Avenol, Joseph 39, 133 D’Azeglio, Massimo 113
Clessin, Heinrich 42, 80 Conrad, Otto 42 Coolidge, Calvin 90 Curzon, 1st Marquess, George Nathaniel 84, 89, 99 Czernin, Graf Ottokar 54, 58, 63, 73, 75 f., 109, 158, 167
Danneberg, Robert 114, 117, 129 Dinghofer, Franz 11, 15, 27 f., 30–34, 36, 38, 40 f., 45, 51 f., 54, 56, 58, 60, 63–66, 69, 75, 78, 80, Badeni, Graf Kasimir 35 107, 109, 120, 123, 126, 141–144, 150, 163–166, Balfour, Lord Arthur 9, 83, 91, 99, 102, 105 f., 110, 168, 170 138 f. Diwald, Leopold 110, 116, 145, 166, 169, 185, 190 Banhans, Karl v. 32 Drexel, Karl 67, 74, 101, 106 f., 114, 161, 181, 183, Bardolff, Carl v. 36 189 f. Barthou, Louis 61 Bauer, Otto 10, 13, 26, 44 f., 47–50, 69, 62 f., 66, Eisenhut, Josef 196 75 f., 95, 97, 102–104, 108, 112, 114, 122, 129 f., Ellenbogen, Wilhelm 129 139, 141, 174, 176–181 Ender, Otto 53, 58, 68, 152 Beck, Max Wladimir v. 154 Beneš, Edvard 52–55, 82–84, 91, 171, 182 Fehrenbach, Konstantin 14 Bertone, Giovanni 84 Figl, Leopold 10 Bichl, Felix 36, 39, 56 Fink, Jodok 11, 23, 26, 31, 39, 48, 50–53, 58, 69, Binder, Franz 155 73 f., 80 f., 111, 114, 116, 120, 134, 144, 147, Bismarck, Otto v. 10, 97, 138 151–153, 158, 161–172, 177, 179, 183–185, Blackett, Sir Basil 59, 88, 95, 98–100, 105, 108 188–190, 196 Bobek, Emil 53 Fischer, Christian 46 Bonar Law, Andrew 106 Födermayr, Florian 73 f., 147, 151, 154, 161–164, Breisky, Walter 42, 46, 53 170–172 Breitner, Burghard 106 Fouché, Joseph 33 Breitner, Hugo 72, 84, 103, 181 Frank, Felix 11, 27, 31 f., 39, 41 f., 61, 69, 71, 74, Briand, Aristide 55, 86 77, 81, 107–10, 117, 120, 123–125, 133 f., 144, Buchinger, Rudolf 25, 74, 91, 133, 145, 159, 172 150f., 154, 160–164, 184 Buresch, Karl 19, 73, 170, 172 Franz I. (II.) 116 Burjan, Hildegard 28 Franz Ferdinand, Erzherzog 36 Fürstenberg, Prinz Karl Emil 32 Chamisso, Adalbert v. 97 Fürstenberg, Fürst Max Egon 32 Chilston, Viscount Aretas 106 Funder, Friedrich 35 Clemenceau, Georges 13, 37
Personenregister Gasparri, Pietro 128 Geisler, Simon 159, 162 f., 195 Geßmann, Albert 26 Gimpl, Georg 75, 158, 177, 179, 181, 196 Glanz v. Eicha, Egon 35 f. Gleispach, Graf Wenzel 54 Goode, Sir William 14, 16 Grimm, Ferdinand v. 33, 37, 42–44, 46, 95, 114, 182 Größbauer, Philipp 80 Grünberger, Alfred 42, 45, 71 f., 91 f., 95, 99, 102, 105 f., 121, 151, 154, 163, 187 Gürtler, Alfred 19, 36, 40 f., 46–50, 53–55, 59, 61–63, 67, 71–74, 78, 103, 115–119, 123, 147, 154–157, 162–168, 171–173, 19, 185, 188–190 Gürtler, Johann 157, 170, 189 Haider, Franz 155 Hainisch, Marianne 34 Hainisch, Michael 34 Hamburger, Fritz 36 Hampel, Ernst 29, 35, 118, 124, 139 Haueis, Alois 33 Hauser, Johann Nepomuk 14, 18, 26, 34, 38, 70, 74, 140, 142, 147, 171, 178, 181, 186 Heiber, Helmut 18 Heinl, Eduard 33, 41, 60, 71, 73, 80, 144, 151, 154–158, 162–165, 168 f., 186, 190 Hemala, Franz 196 Henderson, Arthur 55 Hennet, Leopold v. 55 Herriot, Edouard 142 Hitler, Adolf 13 Homann, Emil v. 32 Hornik, Viktor 72, 133, 139, 152–154, 156–159 Hubert, Rainer 60 Irsa, Karl 170 Janssen, Albert-Edouard 131 Jerzabek, Anton 193 Kandl, Hermann 9, 27, 30, 32, 39, 41 f., 52, 55–58, 69, 103, 107, 109, 183 Karl I. 35, 51, 76, 134 Kelsen, Hans 22, 24, 33, 141 Keynes, John Maynard 16, 86
205
Kienböck, Viktor 44 f., 107, 111, 121, 123, 133– 135, 140, 144–146, 152, 156, 175, 181 Klein, Franz 13 Klemperer, Klemens v. 129 f. Kollarz, Friedrich 73 Kollmann, Josef 19, 118 f., 185, 189, 195 Kraft, Emil 27, 35–37, 40, 56, 63, 67, 71, 78, 90, 107, 112, 117, 121, 134, 151, 154–160, 163, 165 f., 172 Kraus, Karl 122 Kreisky, Bruno 53, 137 Kunschak, Leopold 10, 23, 26, 35, 48, 70, 72–75, 118 f., 122, 124, 144, 152 f., 156, 164 f., 168, 171 f., 179, 186, 196 Kunwald, Gottfried 72 Ladner, Gottfried 140 Lammasch, Heinrich 98 Langoth, Franz 69, 142, 152 Lanner, Anton 161 Lefèvre-Pontalis, Pierre 84 Liechtenstein, Prinz Alois 26 Lieschnigg, Karl 124 Lloyd George, David 14, 37, 55, 61 f., 86–91, 105 f. Ludendorff, Erich 101 Lueger, Karl 25 f., 142, 145 Luschka, Felix 53 Luttenberger, Franz 100, 163, 170, 185, 195 März, Eduard 43, 49, 92 Marcus, Nathan 12, 17, 91 Maria Theresia 116 Marx, Karl 10 Masaryk, Tomáš Garrigue 13, 84, 87 Mataja, Heinrich 26, 69, 75, 101, 109, 121, 144, 150, 163, 169, 172, 175 Mayr, Michael 33, 35, 37–41, 53, 64, 174 Miklas, Wilhelm 70–73, 80, 115, 124 f., 132, 137, 144, 151–154, 158 f., 162, 168, 171, 192–195 Meinl, Julius 95 Milner, Viscount Alfred 99 Morgan, J.P. (Bank) 87, 90, 136, 154, 161, 175 Mühlwerth, Albert v. 30 Mussolini, Benito 92, 135 Niedrist, Karl 117, 145, 160, 171, 196
206
Personenregister
Niemeyer, Otto 108, 128, 136 Norman, Sir Montagu 10, 78, 87–90, 95, 99, 135 f., 138 Odehnal, Franz 69, 144, 150 f., 154–159, 161, 163, 169 Parrer, Franz 110 Partik, Matthias 153, 157, 161 f. Paulitsch, Michael 169, 193 f., 196 Pauly, Max 42, 80, 124 Pfeiffer, Max 102, 181 Phillpotts, Owen 95, 97, 105, 125 Pius XI. (Achille Ratti) 128 Poincaré, Raymond 55, 61, 86 f., 106, 142, 176, 180 Preußler, Robert 113 Radetzky, Graf Wenzel 83 Ramek, Rudolf 36, 119 f., 154, 164, 169, 189 Redlich, Josef 32 f., 76 Reimann, Viktor 139 Reisch, Richard 134 f., 145 Reither, Josef 25 Renner, Karl 15, 22, 24, 43, 52, 66, 100, 113, 125, 130, 141, 188 Resch, Josef 33, 72, 119, 152–155, 157 Rintelen, Anton 34, 40, 46, 73, 128, 146, 152, 155, 171 Rodler, Walther 155, 169 Rosenberg, Wilhelm 45, 50, 61, 68, 72, 80, 88 f., 95, 121, 132 Rothschild, Baron Louis 78 Salisbury, 3rd Marquess (Robert Gascoyne-Cecil) 105 Sarraut, Albert 142 Schärf, Adolf 10 Schanzer, Carlo 84, 91 Schindler, Franz 26 Schirmer, Aloisia 28 Schmitz, Richard 26, 44, 76, 107, 114, 119 f., 123, 144 f., 151 f., 157, 163 Schneider, Emil 124, 152–154, 159, 163 Schober, Johannes 31–33, 37–42, 46, 48, 50–64, 66 f., 71–74, 90, 100, 110, 119, 122, 139, 144, 150 f., 154, 158–163, 165, 170–173, 179
Schönbauer, Ernst 28, 41, 47, 54, 63, 73, 79, 110, 146 f., 161, 170, 172 Schönerer, Georg v. 28 Schönsteiner, Friedrich 119, 145, 170, 173 Schöpfer, Aemilian 26, 48, 68, 106 f., 124, 126, 137, 144, 146, 190, 193 Schraffl, Josef 26 Schüller, Richard 11, 43, 84, 92, 134 Schürff, Hans 27, 41 f., 58, 72, 80 f., 101, 110, 143, 151, 161 f., 166 Schwarzwald, Hermann 72, 121 Schwind, Ernst v. 54 Ségur, Graf August 49, 58, 72–76, 79, 81–85, 91, 94, 99 f., 103, 106 f., 115 f., 121 f., 146, 152–156, 163–165, 183–185, 191 Seitz, Karl 10, 24, 41, 76, 103, 113, 125, 132, 141, 150, 173–175, 180, 183, 188, 192 Seliger, Josef 22 Sibilla, Enrico 128 Spalowsky, Franz 26, 47, 58, 70, 74, 118, 144, 157, 172 Spitzmüller, Alexander v. 72, 90, 111 Steinegger, Hans 100, 159, 164, 168, 171, 177, 185, 188 f., 196, Stresemann, Gustav 14 Stocker, Leopold 27 Stöckler, Josef 25, 27, 42, 49, 72–75, 80 f., 109, 115–118, 134, 143–146, 155–157, 162, 172, 176, 185 f. Stolper, Anton 103, 183 Stradal, Emmy 28, 32, 56, 124 Straffner, Sepp 10, 28 f., 31, 35 f., 40 f., 56, 61, 69, 71, 83, 87 f., 120, 150 f., 154 f., 162 Talleyrand-Périgord, Charles Maurice de 36 Thaa, Gustav v. 134 Thullner, Johann 196 Tomschik, Josef 168 Ursin, Josef 28, 34, 39, 56, 58, 69, 109 f. Vaugoin, Carl 26, 36, 41, 46, 52, 100 f., 120, 144 f., 154–157, 162 f., 166–169 Waber, Leopold 27, 36, 41 f., 54, 58, 63, 71, 73, 79, 85, 103, 107 f., 120, 134, 143, 151, 155, 160, 163 f., 183
Personenregister Wächter, Josef v. 154, 156 Walter, Friedrich 54 Waneck, Friedrich 28, 32, 54, 56, 58, 110 Weigl, Richard 116, 190 Weiskirchner, Richard 26, 31, 53, 58, 60, 64, 69, 73, 133, 144 f., 150, 160 f., 165 f., 169–173, 188, 196 Wiesner, Friedrich v. 134 Wildner, Heinrich 23, 27, 92, 94, 113, 116 Wilhelm II. 32 Wilson, Woodrow 37 Wirth, Joseph 14, 85
207
Wollek, Richard 185 Wotawa, August v. 27 Wunsch, Oskar 163, 168 Wrangel, Baron Pjotr 83 Young, George M. 55–59, 61, 87–90, 95, 99, 139, 174 f., 177 Zeidler, Viktor 56, 109 f., 124, 132 Zelenka, Franz 168 Zimmermann, Alfred 61, 138 f. Zwetzbacher, Josef 25, 117, 128, 145 f., 156

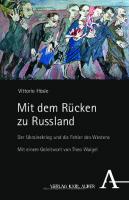



![Ist der gerichtliche Eigensanierungsrahmen nach dem Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen besonders geeignet für die Sanierung mittelständischer Unternehmen?: Eine Untersuchung über die Anreizwirkung des Sanierungsvorbereitungsverfahrens [1 ed.]
9783428544561, 9783428144563](https://dokumen.pub/img/200x200/ist-der-gerichtliche-eigensanierungsrahmen-nach-dem-gesetz-zur-weiteren-erleichterung-der-sanierung-von-unternehmen-besonders-geeignet-fr-die-sanierung-mittelstndischer-unternehmen-eine-untersuchung-ber-die-anreizwirkung-des-sanierungsvorbereitungsverfahrens-1nbsped-9783428544561-9783428144563.jpg)
![Nah ist und schwer zu fassen der Gott: Die ambivalente Beschreibung der Nähe Gottes in Jer 20,7-18 und Ps 139 [1 ed.]
9783788734176, 9783788734152](https://dokumen.pub/img/200x200/nah-ist-und-schwer-zu-fassen-der-gott-die-ambivalente-beschreibung-der-nhe-gottes-in-jer-207-18-und-ps-139-1nbsped-9783788734176-9783788734152.jpg)
![Zum neuen Jahrhundert: Ein alter Bericht über die Gestaltung- der pathologischen Anatomie in Deutschland, wie sie ist und wie sie werden muss [Reprint 2021 ed.]
9783112607084, 9783112607077](https://dokumen.pub/img/200x200/zum-neuen-jahrhundert-ein-alter-bericht-ber-die-gestaltung-der-pathologischen-anatomie-in-deutschland-wie-sie-ist-und-wie-sie-werden-muss-reprint-2021nbsped-9783112607084-9783112607077.jpg)


![Seipel, der „Bürgerblock“ und die „Genfer Sanierung“ 1922: „Größter Fehler ist nervös zu werden“ [1 ed.]
9783205216834, 9783205216810](https://dokumen.pub/img/200x200/seipel-der-brgerblock-und-die-genfer-sanierung-1922-grter-fehler-ist-nervs-zu-werden-1nbsped-9783205216834-9783205216810.jpg)