Schicksale: Menschen in der Geschichte. Ein Lesebuch 9783412215651, 9783412209339
279 118 8MB
German Pages [472] Year 2012
Polecaj historie
Citation preview
Schicksale Menschen in der Geschichte Ein Lesebuch
von Heiko Haumann
2012 BÖHLAU VERLAG WIEN KÖLN WEIMAR
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Umschlagabbildungen: Vorne: Familie Glücksmann, Zürich ca. 1910/11, Fotograf: Vladimir I. Lenin (Privatarchiv Hans und Denise Taussky) Hinten: Tatjana Salogub und Pavel Žigaljuk, Atelieraufnahme Elzach Mai 1944 (Privatarchiv Heiko Haumann) / Spielende Bauernkinder in Russland 1902, Fotograf: Charles Schindler (© Sammlung Herzog, Basel)
© 2012 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Wien Köln Weimar Ursulaplatz 1, D-50668 Köln, www.boehlau-verlag.com Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig. Satz: Peter Kniesche Mediendesign, Weeze Druck und Bindung: Finidr s.r.o., Český Těšín Gedruckt auf chlor- und säurefreiem Papier Printed in the Czech Republic ISBN 978-3-412-20933-9
Inhaltsverzeichnis Vorwort ....................................................................................................... 7 »Schnapskasinos« auch im Siegerland. Beobachtungen und Fragen zur Umbruchzeit der Industrialisierung .................................................. 9 »Ein Wald von Fabriken, Fabrikantenvillen und Arbeiterwohnungen« Probleme der Industrialisierung im Elztal (1850–1914).......................... 18 Von Karl Neff zu Aleksej Stachanov. Arbeiter und technischer Fortschritt in der Anfangsphase der Industrialisierung – Ein regionaler Vergleich .... 36 Eine inszenierte Friedensaktion. Deutsch-französische Frontkämpfertreffen in Freiburg i. Br. und Besançon 1937–1938 ........................................... 55 »Lieber ’n alter Jud verrecke als e Tröpfle Schnaps verschütte«. Juden im bäuerlichen Milieu des Schwarzwaldes zu Beginn des Nationalsozialismus ............................................................................... 87 »Ich habe gedacht, dass die Arbeiter in den Städten besser leben«. Arbeiter bäuerlicher Herkunft in der Industrialisierung des Zarenreiches und der frühen Sowjetunion.......................................................................... 95 »Das Land des Friedens und des Heils«. Rußland zur Zeit Alexanders I. als Utopie der Erweckungsbewegung am Oberrhein............................... 114 Lebensformen im mittelalterlichen Freiburg. Von Ordnungen und Unordnungen ........................................................................................ 139 Zachor – Erinnere Dich! Zum Gedenken an die Deportation der jüdischen Insassen des Friedrichsheims in Gailingen am 22. Oktober 1940............ 175 Wie einer in der Nazi-Zeit unter die Räder kam. Der »Fall« Reinhold Birmele und seine Verarbeitung in der Bundesrepublik Deutschland...... 185 »Heimat ist keine Sache, die sich heute verlieren und morgen wieder gewinnen läßt ...« Der Lebensweg des Freiburger Kaufmanns Max Mayer (1873–1962) ....................................................................... 202 Von Pocahontas zu Pylmau. Familienpolitik als Friedensstrategie bei indianischen und sibirischen Völkern? Ein Diskussionsbeitrag ............... 224 Fußball, Veit Harlan und die Volkspolizei 1953. Ein Fall von Hooliganismus im Elztal? ....................................................................... 236 Ein Besuch beim Genossen Kirow. Die Geschichte der Familie Dmitrewski – eine Fallstudie von den Anfängen der Slawistik in Freiburg i. Br. bis zum stalinistischen Terror und zur Aufarbeitung der Erinnerung ...................................................................................... 242 Suworow und Kos´ciuszko. Zwei osteuropäische »Helden« in der Schweiz..... 271 »Eine sozialistische Lebensweise der Zukunft«? Schicksale im Stalinismus zwischen 1929 und 1939 ...................................................................... 281
6
|
Inhaltsverzeichnis
»... dass er einem Juden auf diese Weise Vorschub leistete« Erwin Stengler und Max Bloch – die Geschichte einer Dienstpflichtverletzung im »Dritten Reich« ...................................................................................... 299 Hermann Diamanski. Ein deutsches Schicksal zwischen Auschwitz und Staatssicherheitsdienst. Perspektiven der Erinnerung .............................. 318 »Wir waren alle ein klein wenig antisemitisch« Ein Versuch über historische Massstäbe zur Beurteilung von Judengegnerschaft an den Beispielen Karl von Rotteck und Jacob Burckhardt ......................... 343 Heinrich Bieg. Ein deutscher Nazi in der Schweiz (unter Mitarbeit von Martin J. Bucher) ............................................................................ 365 »Die Gegend wimmelt dort von Wilddieben«. Ein Förstermord 1891 im Wittgensteinischen ........................................................................... 394 Miniaturen ................................................................................................ 426 Stefan, der Gottesnarr, oder: Spiegel der sündigen Welt ............................... 426 Jakobiner am Oberrhein .............................................................................. 430 Theodor Herzl: »In Basel habe ich den Judenstaat gegründet« ..................... 436 Joseph Goebbels in Freiburg. Wie der spätere Propagandaminister des »Dritten Reiches« vom Katholiken zum Rechtsradikalen wurde ............. 442 Albert Leo Schlageter. Aus kommunistischer Sicht ein »mutiger Soldat der Konterrevolution«: Eine Generation auf der Suche nach politischen Ideen .................................................................................... 445 Ernestine und Wilhelm Liebknecht. Vom Freiburger Gefängnis ins Zentrum der Arbeiterbewegung ............................................................. 450 Vom »Lederstrumpf« zum Freund Lenins. Das abenteuerliche Leben Carl Lehmanns ...................................................................................... 454 Leonid Hasenson und Oskar Hartoch. Zwei Mediziner im Stalinismus........ 457 Philipp Martzloff. Ein Pionier der Arbeiterbewegung in Baden ................... 462 Max Faulhaber und der Sturm auf das Gewerkschaftshaus. Ein ungewöhnliches Ereignis in der Freiburger Nachkriegsgeschichte ........... 465
Vorwort Fragen nach der Lebenswelt und den Schicksalen von Menschen, die die Geschichte machen und sie erleiden, haben mich seit meiner Schulzeit begleitet und standen im Mittelpunkt meiner Lehr- und Forschungstätigkeit. So lag es nahe, nach meiner Pensionierung einige Aufsätze zusammenzustellen, die verstreut erschienen und nicht immer leicht zugänglich sind. Ergänzt habe ich sie mit unveröffentlichten Beiträgen. Im Band »Lebenswelten und Geschichte – Zur Theorie und Praxis der Forschung« steht der theoretische Ansatz im Mittelpunkt, die Geschichte von einzelnen Menschen und ihrer Lebenswelt aus zu erschließen. Es geht mir darum, den Begriff der Lebenswelt neu zu fassen und daraus Überlegungen zu methodischen Verfahren abzuleiten, die Alltags- und Sozialgeschichte miteinander verbinden und einen mehrperspektivischen Weg, eine »integrierte Geschichte« (Saul Friedländer), ermöglichen. Thematisiert wird dabei nicht zuletzt der Umgang mit Erinnerungen in Selbstzeugnissen – Autobiographien und Interviews – sowie mit Fotografien als Quellen. Hier sind auch Erfahrungen aus dem »Projekt Erinnerung« eingeflossen, das ich über viele Jahre hinweg zusammen mit Studierenden sowie mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der Universität Basel durchgeführt habe. An Arbeiten zur Regionalgeschichte, zur Geschichte Russlands und der Sowjetunion, zur Geschichte und Kultur der Juden sowie zur Bedeutung der Geschichte in der öffentlichen Auseinandersetzung entwickle und erprobe ich den lebensweltlichen Zugang. Der Band »Schicksale – Menschen in der Geschichte« ist als ein Lesebuch entworfen worden. Ich berichte von Menschen in verschiedenen Regionen Deutschlands, in Russland und in der Sowjetunion, in Polen und in der Schweiz. In ihren Schicksalen werden erstaunliche Zusammenhänge sichtbar. Auf diese Weise kann Geschichte nicht nur spannend erzählt werden, sondern Autor wie Leserinnen und Leser unternehmen anregende Entdeckungsreisen in unterschiedliche Lebenswelten, vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Sie ermöglichen es, sich im Nachvollzug des Lebens bekannter Persönlichkeiten und »ganz normaler Menschen« besonders eindringlich mit Geschichte auseinanderzusetzen. Wie eng die beiden Bücher zusammengehören, zeigt sich auch daran, dass die Umschlagabbildungen des Bandes »Schicksale« im Band »Lebenswelten« behandelt werden. Die Aufsätze sind – manchmal zu thematischen Blöcken zusammengefasst – in der Regel chronologisch nach ihrem ursprünglichen Erscheinungsdatum geordnet. Sie werden unverändert abgedruckt, so dass in einigen Fällen auch die Entwicklung der Argumentation verfolgt werden kann. Ebenso ist die Schreibund Zitierweise beibehalten worden, wie sie für die jeweiligen Publikationsorte gefordert war. Einige wenige zusätzliche Erläuterungen habe ich durch Sternchen
8
|
Vorwort
(*) oder eckige Klammern kenntlich gemacht. Eindeutige Tipp- oder Satzfehler sind stillschweigend korrigiert. Peter Rauch vom Böhlau Verlag hat mich bei meinem Publikationsvorhaben ermutigt. Dorothee Rheker-Wunsch und Julia Beenken haben die Drucklegung – wie immer – sorgfältig betreut. Ihnen sei herzlich gedankt. Ferner danke ich all denjenigen, die mir Abbildungen zur Verfügung gestellt und den Wiederabdruck bereits veröffentlichter Aufsätze gestattet haben. Meine Studien wären ohne die vielfältigen Diskussionen und Projekte sowie ohne die Unterstützung von Studenten, Mitarbeiterinnen, Kollegen, Archivarinnen und vielen anderen, die beteiligt waren, nicht denkbar gewesen. Ihrer erinnere ich mich in Dankbarkeit. Bei der jetzigen Druckvorbereitung war mir Anna K. Liesch sehr behilflich. Letztlich ist eine solche Arbeit, wie sie in den beiden Bänden sichtbar wird, nicht möglich, ohne von anderen Menschen Ermunterung und Kritik, Halt und Stütze zu erfahren. Ich habe das Glück, dass mir dies zuteil geworden ist. Elzach-Yach / Basel, im Mai 2012
Heiko Haumann
»Schnapskasinos« auch im Siegerland Beobachtungen und Fragen zur Umbruchzeit der Industrialisierung* Am 15. September 1888 beschlossen 17 Personen in Grund bei Hilchenbach die Statuten des Consum-Vereins »Eintracht«, zwei Tage später beantragten sie die Eintragung in das Genossenschaftsregister1. Der Zweck des Vereins wurde im § 2 des Statuts genau definiert: »Da in hiesiger Gemeinde Specerei- und Manufakturwaren selten oder wohl gar nicht zu haben sind; da bei den hiesigen Verhältnissen der Genuss von ähnlichen Lebensbedürfnissen als Bier, Wein, Branntwein und Liqueuren aller Art eine Nothwendigkeit zu nennen, solche aber vielfach verfälscht und übertheuert sind, solche auch in unserer Gemeinde gar nicht zu kaufen sind, so bezweckt der Verein, solche durch gemeinschaftliche Mittel im Großen einzukaufen und in kleinen Parthien an seine Mitglieder abzulassen, um diesen Übelständen vorzubeugen. So lange es der Vorstand nicht untersagt, ist auch der Genuß im Geschäftslocal erlaubt.« Dieses »Geschäftslocal« befand sich im Hause eines gewissen Heinrich Röchling (§ 1), der in verschiedenen Berichten oft als Gastwirt, hin und wieder aber auch als Drahtnägelfabrikant oder Landwirt bezeichnet wird. Unter den Vereinsgründern finden sich vier Dreher, drei Bergleute, drei Landwirte, ein Maschinenwärter, ein Maurer und ein Gerber; bei vier Personen fehlt die Berufsangabe. Sie wählten einen Vorstand und regelten die Mitgliedschaft, das Verfahren der Generalversammlung, die Vermögensverhältnisse sowie die Bilanz. Den Beitrag setzten sie auf eine Mark fest, von der jedoch zunächst lediglich 25 % erhoben werden sollten (§ 14). Damit hatte auch das Siegerland ganz offiziell ein »Schnapskasino«, wie der in Keppel residierende Amtmann Fuß am 5. Januar 1897 den Verein klassifizierte. Gegeben hat es diese Einrichtung offenbar schon früher, denn am 4. Januar 1887 hatte der Gastwirt Röchling vor der Polizei erklärt, er sei seit vier Monaten von der »Casino-Gesellschaft« angestellt. * Erstpublikation in: Siegerland 58 (1982) S. 62–66. 1 Stadtarchiv Hilchenbach, Nr. 1132, Acta spec. betreffend den Consum-Verein Eintracht zu Grund. 1886–1900. Aus dieser Akte auch die folgenden Angaben. – Mein Dank gilt der Stiftung Volkswagenwerk, die im Rahmen ihres Habilitierten-Förderungsprogramms mein Forschungsvorhaben »Stadt und Land während der Industrialisierung. Vergleichende Untersuchungen zu Deutschland, Ostmitteleuropa und Russland« finanziert und damit auch diese Studie ermöglichte. Sie bildet den Auftakt für weitere Arbeiten über die Sozial- und Wirtschaftsstruktur sowie die Lebensweise im Siegerland während der Industrialisierung. Den Herren Stadtarchivaren Klein (Hilchenbach) und Menk (Siegen) sowie ihren Mitarbeitern bin ich für ihre großzügige Hilfsbereitschaft sehr verbunden.
10
| »Schnapskasinos« auch im Siegerland
Schnapskasinos sind bisher vor allem aus dem Ruhrgebiet2 und dem Saarland3 als Selbsthilfe-Organisationen meist von Bergleuten bekannt. Sie entstanden seit dem Ende der achtziger Jahre – im Saarland seit Sommer 1890 – nicht nur deshalb, weil es zuwenig Kneipen gab, sondern auch, weil sich die Arbeiter kaum noch unkontrolliert treffen konnten und sich darüber hinaus zunehmend über die Versorgung mit Lebensmitteln und Alkohol durch den bürgerlichen Kleinhandel beklagten. Auch wenn nicht alle Schnapskasinos Konsum-Vereine mit breiterem Angebot waren, drückt sich in dieser Bewegung eine Abkehr von den Läden aus, die bisher von den Unternehmen organisiert und von den Behören unterstützt worden waren. Wie groß die Bedeutung des Alkohols war, verdeutlicht der Entschluss des 1890 gegründeten »Konsumvereins rheinisch-westfälischer Bergleute Glückauf«, in seinen Verkaufsstellen Branntwein auszuschenken. Weil dadurch der Verkauf anderer Waren zurückging – Frauen und Kinder mieden die Läden, um nicht von Betrunkenen belästigt zu werden –, musste der Verein allerdings 1894 Konkurs anmelden4. 2 Franz J. Brüggemeier, Lutz Niethammer: Schlafgänger, Schnapskasinos und schwerindustrielle Kolonie. Aspekte der Arbeiterwohnungsfrage im Ruhrgebiet vor dem Ersten Weltkrieg. In: Fabrik – Familie – Feierabend. Beiträge zur Sozialgeschichte des Alltags im Industriezeitalter. Hrsg. von Jürgen Reulecke und Wolfgang Weber. Wuppertal 1978, S. 135–175, hier bes. S. 158–165 (S. 160 Anm. 47 werden auch Schnapskasinos in Oberschlesien, Sachsen und Hessen-Nassau erwähnt); Gerhard Huck: Arbeiterkonsumverein und Verbraucherorganisation. Die Entwicklung der Konsumgenossenschaften im Ruhrgebiet 1860–1914. Ebd., S. 215–245. 3 Klaus-Michael Mallmann: »Saufkasinos« und Konsumvereine. Zur Genossenschaftsbewegung der Saarbergleute 1890–1894. In: Der Anschnitt 32, 1980, S. 200–206. Vgl. zum sozialgeschichtlichen Zusammenhang ders.: Die Anfänge der Bergarbeiterbewegung an der Saar (1848–1904). Saarbrücken 1981 (hier bes. S. 213–216). 4 Huck, S. 230–232; Mallmann: »Saufkasinos«, S. 200 ff. – Soweit mir bisher Unterlagen bekannt sind, haben andere Konsumvereine im Siegerland nichts mit Schnapskasinos zu tun. Am 13.4.1894 reichte ein »Consum-Verein der Beamten und Arbeiter der Staatseisenbahnverwaltung zu Siegen und den benachbarten Orten« einen Antrag auf Genehmigung ein (Stadtarchiv Siegen, Magistrat Siegen, Polizeiverwaltung, vorl. Nr. 189, Vereine 1878–1896). Das Statut war am 7.1.1894 beschlossen worden. Als Zweck dieser Genossenschaft wurde »der gemeinschaftliche Einkauf von Lebens- und Wirthschaftsbedürfnissen im Großen und Ablaß im Kleinen an die Mitglieder« bezeichnet (§ 1). Anlass zur Gründung dürfte ebensowenig die Versorgung mit Alkohol gewesen sein wie bei der am 27.4.1902 von 27 Personen gebildeten »Siegener Fleisch- und Warengenossenschaft«, die sich fünf Jahre später in den »Allgemeinen Konsumverein für Siegen und Umgebung« umwandelte: »Ursache zur Gründung (...) war die Aufhebung eines herkömmlichen Gebrauchs der Siegener Metzgermeister, wonach dieselben ihren Kunden alljährlich in der Weihnachtszeit eine Wurst gratis spendeten« (Allgemeiner Konsumverein für Siegen und Umgebung, eGmbH: Rückblick auf das 25jährige Bestehen des Vereins 1902 bis 1927. Hamburg o. J. [1927], S. 3). Erst nach 1909 begann der Verein zu expandieren; 1914
Zur Umbruchzeit der Industrialisierung
|
11
Schnapskasinos boten die Möglichkeit, als »geschlossene Gesellschaften« unkontrolliert zusammenzukommen und auch noch nach der Polizeistunde Alkohol zu trinken. Dies war gerade für Schichtarbeiter wichtig, die nach der Mittags- und Nachtschicht vor verschlossenen Kneipen standen und somit von einem wichtigen Teil des Gemeinschaftslebens ausgeschlossen waren. Hinzu kam, dass gerade nach dem großen Bergarbeiterstreik von 1889 die Wirtschaften strenger überwacht sowie insbesondere Versammlungen scharf reglementiert und kontrolliert wurden. Immer häufiger weigerten sich Wirte, ihre Räume für Treffen der Arbeiter zu Verfügung zu stellen, und achteten sehr auf die Einhaltung der Polizeistunde. Manchmal erwiesen sich allerdings auch Wirte selbst als Triebkräfte zur Gründung eines Kasinos, nämlich dann, wenn ihnen die Schankkonzession entzogen worden war5. Dies dürfte auch in Grund – diesem »kleinen Dörfchen« »in einem sehr bergichten Landstriche« (Jung-Stilling) – den Ausschlag gegeben haben. Der Wirt des Consum-Vereins »Eintracht«, Heinrich Röchling, war mindestens seit 1883 schon mehrmals wegen unerlaubten Branntweinausschankes und Übertretens der Polizeistunde zu Geldbußen verurteilt worden. 1886 hatte ihm das Regierungspräsidium die Konzession entzogen. Röchlings Widerspruch lehnte das Innenministerium ab. Ein Antrag auf erneute Konzessionserteilung war 1887/1888 von mehreren Instanzen abschlägig beschieden worden. Hier dürfte sich zusätzlich Röchlings Tätigkeit für die »Casino-Gesellschaft« negativ ausgewirkt haben, zumal er laut einer Zeugenaussage vom 3. Januar 1887 auch an Nichtmitglieder der »geschlossenen Gesellschaft« Getränke gegen Bezahlung ausgegeben hatte. Dass das Verhalten Röchlings kein Einzelfall war, veranschaulicht ein Beispiel aus Eiserfeld: Am 1. Juni 1905 wird die Schenkwirtschaft Schmidt wegen Übertretung der Polizeistunde angezeigt. Bei den Nachforschungen stellt sich heraus, dass ein anderer Gastwirt – vielleicht aus Konkurrenz? – die Anzeige veranlasst hatte, ohne sichere Beweise in der Hand zu haben. Die Anklage lässt sich dann auch nicht halten, ein als Zeuge vernommener Bergmann weiß von nichts. Doch der zuständige Gendarm hält nun ein wachsames Auge auf die Wirtschaft und stellt schon am 17. Juni 1905 fest, dass ein Mann, den er hineingehen sah, bis zwei Uhr nachts nicht wieder herausgekommen sei. Aber wieder muss sich der Gesetzeshüter geschlagen geben: Der Mann war der Bräutigam der Wirtstochter, die Verlobung wird knapp einen Monat später der Amtsverwaltung angezeigt und zugleich um Verlängerung der Polizeistunde gebeten ... schloss er sich mit dem Konsumverein »Selbsthilfe« in Kirchen (Sieg), nach dem Krieg mit weiteren Organisationen zusammen (ebd., S. 4–6). Vgl. Anm. 7. 5 Brüggemeier, Niethammer, S. 159–162; Mallmann: »Saufkasinos«, S. 201–202. Vgl. hierzu allgemein James S. Roberts: Wirtshaus und Politik in der deutschen Arbeiterbewegung. In: Sozialgeschichte der Freizeit. Untersuchungen zum Wandel der Alltagskultur in Deutschland. Hrsg. von Gerhard Huck. Wuppertal 1980, S. 123–139.
12
| »Schnapskasinos« auch im Siegerland
Bald darauf wechselt der Besitzer der Wirtschaft, aber die Polizei hat erneut Grund zur Klage: Am 16. Dezember 1911 schreibt der Amtmann dem neuen Wirt Heinrich Schiffner: »Wiederholt hat die Ehefrau Wilhelm Schlemper darüber Beschwerde geführt, dass ihrem Mann geistige Getränke auf Borg verabfolgt werden und er auch noch über die gebotene Polizeistunde in dem Lokal geduldet wird. Da dieses Verhalten dem Schlemper gegenüber dessen Familie in Not bringt, werden Sie hiermit aufs Neue verwarnt und aufgefordert, solches zu unterlassen. Im Wiederholungsfall wird das Conzessions-Entziehungs-Verfahren unweigerlich eingeleitet werden.« Dies scheint dann doch nicht erfolgt zu sein, hingegen finden sich Anzeigen, Untersuchungen und Kontrollen auch in der nächsten Zeit bis in die zwanziger Jahre hinein. Immer wieder wird dem Wirt vorgeworfen, er habe die Polizeistunde überschritten und sogar »hin und wieder der Völlerei Vorschub geleistet« (so der Siegener Landrat am 15. Oktober 1923)6. In Grund hat sich wahrscheinlich das spezifische Interesse eines verhinderten Gastwirtes mit den Bedürfnissen von einigen Arbeitern und Bauern – das ist ein wesentlicher Unterschied zu anderen Regionen – verbunden, auch noch nach der Polizeistunde zusammenzutreffen und Alkohol sowie andere Waren durch Großeinkauf billiger, reichhaltiger und in besserer Qualität zu erwerben. Näheres könnten wir nur erfahren, wenn wir mehr über die beteiligten Personen wüssten. Dann wäre vielleicht auch Aufschluss darüber zu erhalten, wie die Gründer überhaupt auf die Idee kamen, die Form einer »Casino-Gesellschaft« und anschließend eines Konsum-Vereines zu wählen: so früh (1886 bzw. 1888) sind sie anderswo kaum belegt7. Über politische oder gewerkschaftliche Motive liegen jedenfalls keine Anhaltspunkte vor, wie sie im Ruhrgebiet und Saarland immer wieder von den Behörden vermutet wurden und in einigen Fällen wohl auch zutrafen: im saarländischen Bergarbeiterstreik 1892/93 »bildeten die Kasinos die örtlichen Kommunikationszentren der Ausständischen«8, im Ruhrgebiet hielt die SPD ihre Versammlungen häufig in den Räumen von Schnapskasinos ab9. 6 Stadtarchiv Siegen, Amt Eiserfeld, vorl. Nr. A 35, Wirtschaft des Heinrich Schiffner in der Oberen Hengsbach 1899–1933 (als Beispiel für zahlreiche ähnliche Fälle). 7 Seit 1890 entwickelten sie sich dann allerdings im Ruhrgebiet massenhaft, 1894 wurden 110 Kasinos mit 16 640 Mitgliedern gezählt (Brüggemeier, Niethammer, S. 160). Im Saarland wandelten sich seit 1891 die Kasinos in Konsumvereine um, Anfang 1893 gab es über 160 (Mallman: »Saufkasinos«, S. 203). – In Siegen stellte am 7.12.1889 ein »Katholisches Casino« einen Antrag auf Genehmigung der zwei Tage zuvor beschlossenen Statuten zwecks »gemüthlicher Zusammenkunft« (§ 1), »politische Angelegenheiten sind ausgeschlossen« (§ 2) (Stadtarchiv Siegen, wie Anm. 4). Ein Zusammenhang mit einem Schnapskasino ist nicht ersichtlich. Vgl. auch Anm. 4. 8 Mallmann: »Saufkasinos«, S. 204, vgl. S. 201 ff. 9 Brüggemeier, Niethammer, S. 161
Zur Umbruchzeit der Industrialisierung
|
13
Trotz der vermutlichen Harmlosigkeit der »Eintracht« in Grund entkam sie nicht staatlichen Unterdrückungsversuchen. Am 27. Februar 1890 fragte das Arnsberger Regierungspräsidium an, ob sich auch im Siegerland »unter den Arbeitern (...) geschlossene Gesellschaften gebildet« hätten wie im Dortmunder Bezirk, »welche verdächtig sind, lediglich zum Zweck der Umgehung der für das Schankwirtschaftsgewerbe geltenden Vorschriften gegründet zu sein«. Der Keppeler Amtmann meldete umgehend am 24. März 1890 den Konsum-Verein und machte auch auf die besonderen Umstände im Fall des Gastwirtes Röchling aufmerksam. Daraufhin wurde ein offizielles Untersuchungsverfahren eingeleitet. Versuche von Vorstandsmitgliedern des Vereins, den Ausschank in eigener Regie zu übernehmen oder den Handel auf Tabak und Zigarren unter Anmeldung zur Gewerbesteuer auszudehnen, scheiterten 1891 und in den folgenden Jahren ebenso wie 1897 ein Antrag des Vereins, Röchling den Betrieb einer Schankwirtschaft und eines Kleinhandels mit Branntwein zu genehmigen. Der Gemeindevorsteher in Grund erklärte, es bestehe kein Bedürfnis, weil bereits eine Gastwirtschaft vorhanden sei. Über eine offizielle Auflösung des Konsum-Vereines wird nicht berichtet, seine letzte Erwähnung findet er am 19. August 1897 in der »Nachweisung der im Amte Hilchenbach bestehenden ›geschlossenen Gesellschaften‹«. Aber am 19. Januar 1900 wurde die Ehefrau Röchlings zu einer Geldstrafe wegen unbefugten Kleinhandels mit Branntwein verurteilt, wenige Monate später kam es erneut zu einer Anzeige. Die genaueren Umstände und die weitere Entwicklung in den folgenden Jahren gehen aus der behördlichen Akte leider nicht hervor. Die Regierung hatte inzwischen Mittel in der Hand, die unliebsamen »Schnapskasinos« zu kontrollieren. Nach verschiedenen Erörterungen, Erlassen und Gesetzesinitiativen beschloss der Reichstag am 10. Juni 1896, dass auch der Alkoholausschank in Genossenschaften der Konzessionspflicht unterliege10. Damit war diesen Selbsthilfeorganisationen die Existenzgrundlage entzogen. Wie sehr der Obrigkeit der Alkoholausschank und die Übertretung der Polizeistunde ein Dorn im Auge war, zeigen die Beispiele aus Grund und Eiserfeld. Selbst Tanzveranstaltungen und ähnliche Geselligkeiten unterlagen strenger Überwachung. Sie mussten angemeldet werden, die Behörde erteilte manchmal besondere Auflagen und zog eine Stempelgebühr sowie eine »Lustbarkeits«-Abgabe ein. Und gewissenhaft kontrollierte der Polizeisergeant das Fest und berichtete anschließend seinem Vorgesetzten: »Die Tanzbelustigung wurde kurz nach 10 Uhr 10 Min. Abends beendet. Ausschreitungen sind nicht vorgekommen11.« Aber auch Gendarmen waren nicht gegen Anfechtungen gefeit. Derselbe Polizeisergeant, der diesen Bericht verfasste, musste mehrmals wegen Trunkenheit disziplinarisch bestraft 10 Mallmann: »Saufkasinos«, S. 204–205, 206 Anm. 82; Brüggemeier, Niethammer, S. 163 Anm. 54. 11 So als Beispiel am 13.6.1905 (2. Pfingstfeiertag), Nachweis wie Anm. 6.
14
| »Schnapskasinos« auch im Siegerland
werden, bis er 1906 – wahrscheinlich erneut angetrunken – eine Gruppe von Arbeitern im Dienst tätlich angriff und einen von ihnen dabei verletzte. Das Gericht sah sich gezwungen, ihn am 13. November 1906 zu drei Monaten Gefängnis und 100 Mark Schadenersatz zu verurteilen. 1907 ist er dann selbst Arbeiter auf der Charlottenhütte in Niederschelden und gerät später offenbar in Not12. Fiel den Behören jemand wegen häufiger Trunkenheit auf oder wurde deswegen angezeigt, setzte sich eine bürokratische Maschinerie in Gang: Zunächst erging eine Verwarnung »Trunkenbold betreffend«. Nützte sie nichts, wurde der Betreffende vom Amtmann zum »Trunkenbold« erklärt und sein Name zugleich sämtlichen Wirten und Kleinhändlern mit Branntwein im Amtsbezirk sowie benachbarten Ortspolizeibehörden mitgeteilt. In den Gasthäusern hing dann die »Säuferliste« aus: den »Trunkenbolden« war das Betreten der Lokale und den Wirten der Ausschank »geistiger Getränke« an sie untersagt. Allerdings war das Netz der Kontrolle nicht lückenlos. Wer z. B. in Müsen wohnte und als »Trunkenbold« gebrandmarkt wurde, ging hinüber nach Littfeld in den angrenzenden Amtsbezirk, wo sein Name nicht mehr auf der »Säuferliste« erschien. In manchen Fällen konnte der »Trunkenbold« allerdings nicht dieser Maschinerie entwischen, und er wurde in eine Heilanstalt eingewiesen. Dort wurde versucht, ihn von seiner Suchtkrankheit zu befreien. Überwiegend sind es Bergleute und Tagelöhner – zumindest im Hilchenbacher Bereich –, die in den Akten erscheinen. Bürgermeister, Magistrat und Stadtverordnete in Hilchenbach empfanden das Problem offenbar als so wesentlich, dass sie die Aktivitäten der »Commission des westfälischen Städtetages zur Förderung der Bestrebungen des deutschen Vereins gegen den Missbrauch geistiger Getränke« – u. a. gehörte ihr Friedrich v. Bodelschwingh an – unterstützten und auf deren Anregung hin am 10. November 1885 den Reichstag baten, die Branntweinsteuer zu erhöhen (dies hätte natürlich auch die Gemeindefinanzen aufgebessert). Aber auch Bürger wurden aktiv und gründeten z. B. 1903 in Dahlbruch einen »Blau-Kreuz«-Verein, der sich die »Rettung der Opfer der Trunksucht und des Wirtshauslebens« (§ 1 seiner Satzung) zum Ziel gesetzt hatte und dabei auf die Kraft Gottes vertraute13. 12 Stadtarchiv Siegen, Amt Eiserfeld, vorl. Nr. A 448: Personal-Akten betreffend Polizei-Sergeant Heider in Eiserfeld; vgl. auch Siegener Zeitung, 14.11.1906. – In diesem Zusammenhang sind auch die vielfältigen Kontrollen der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zunehmend gegründeten Gemütlichkeits- und Geselligkeitsvereine (die aber offenbar nicht überall die spezifischen Bedürfnisse von Arbeitern trafen) zu beachten. 13 Stadtarchiv Hilchenbach, Nr. 212: Acta spec. des Magistrats zu Hilchenbach. Verhinderung des Genusses geistiger Getränke und (... überklebt ...) auf Trunkenbolde; Nr. 1130: Acta spec. des Amtes Hilchenbach bereffend die Verhinderung des Branntweintrinkens und die desfallsige Errichtung von Mäßigkeits-Vereinen. 1843–1910; Nr. 1131: Acta spec. des Amtes Hilchenbach betr. Vereine, Gesellschaften, Volks-Versammlungen, Festlichkeiten. 1898–1906. Der Deutsche Verein gegen den Missbrauch geistiger Getränke
Zur Umbruchzeit der Industrialisierung
|
15
Mäßigkeits- und Nüchternheitsvereine entfalteten ihre Aktivitäten vor allem in einer Zeit, als der Alkoholkonsum eine auffallende Erscheinungsform des industriellen Lebens geworden war, sich aber immer weniger mit den Anforderungen des Arbeitsplatzes vertrug. Sie trafen dabei nicht nur auf Widerstand innerhalb der Arbeiterschaft selbst, sondern sogar bei Vertretern des Staates. So lehnte Reichskanzler Bismarck noch 1881 eine stärkere Branntweinbesteuerung ab, weil er die Interessen der schnapsproduzierenden ostelbischen Junker bedroht sah und Schnaps ihm für hart Arbeitende mehr galt als Bier. Sieht man einmal davon ab, dass sich in der Geringschätzung des Bieres auch eine Furcht vor der die Agitation der Sozialdemokratie begünstigenden Geselligkeit verbarg, drückt sich in der Befürwortung des Branntweins für Arbeiter eine typische Einstellung der Frühindustrialisierung aus: Bei der schweren körperlichen Anstrengung (und vielleicht auch bei der Eingewöhnung an den neuartigen Rhythmus der Fabrikarbeit) erschien der hochprozentige Alkohohl als Mittel, in Erschöpfungszuständen Kräfte zu mobilisieren und zu weiterer Leistung anzuregen; vielfach diente er auch als Nahrungsersatz. In dieser Phase wurde der Branntweingenuss von vielen Unternehmern durchaus befürwortet14. Der Säufer, der sich selbst betäuben wollte oder trank, um seinem Elend und seinen Problemen zu entfliehen, war dabei die Ausnahme. Doch je komplizierter die Maschinen und der Arbeitsablauf wurden, um so energischer versuchten die Betriebsleitungen, den Alkoholkonsum am Arbeitsplatz, dessen Funktionen sich jetzt überholt hatten, einzuschränken. Der Alkohol galt nun als das Gift, von dem alles Übel des Arbeiterlebens komme. Notwendi-
wurde 1883, der evangelische Blau-Kreuz-Verein 1892 gegründet (James S. Roberts: Der Alkoholkonsum deutscher Arbeiter im 19. Jahrhundert. In: Geschichte und Gesellschaft 6, 1980, S. 220–242, hier S. 242). Zum Einfluss der spezifisch Siegerländer Frömmigkeit auf das Alkoholverhalten siehe auch Eduard Schneider-Davids: Flennersch Richard. Läwensgeschechte van’m Seejerlänner Jong. 2Siegen 1927 (11913), S. 165–166. Vgl. auch Stadtarchiv Siegen, Magistrat Siegen, Polizeiverwaltung, vorl. Nr. 456: Liste über die der Arbeitsanstalt Benninghausen überwiesenen Personen 1899–1907 (als Begründung wird hier häufig »dem Trunk ergeben« vermerkt, daneben Bettler, Landstreicher u. ä.; die 10 Personen – 9 Männer und 1 Frau –, die in der Akte verzeichnet sind, waren meist vorher im Gefängnis, vier von ihnen waren Arbeiter, fünf Handwerker, einer Kaufmann). 14 Utz Jeggle: Alkohol und Industrialisierung. In: Rauch – Ekstase – Mystik. Hrsg. Von Herbert Cancik. Düsseldorf 1978, S. 78–94 (auch zum folgenden). Vgl. die Beispiele von Krupp und der Gutehoffnunghütte bei Alf Lüdtke: Arbeitsbeginn, Arbeitspausen, Arbeitsende. Skizzen zu Bedürfnisbefriedigung und Industriearbeit im 19. und frühen 20. Jahrhundert. In: Sozialgeschichte der Freizeit (Anm. 5), S. 95–122, hier S. 107–110 (so hielt Alfred Krupp 1865 Schnaps für notwendig, damit den Schmelzern ihr Guss gerät, und noch 1874 wird verschiedenen Arbeiterkategorien Branntwein gratis verabreicht).
16
| »Schnapskasinos« auch im Siegerland
gerweise musste man deshalb auch das Trinken nach Feierabend bekämpfen, das zur Geselligkeit im Familien- und Freundeskreis oder im Wirtshaus gehörte15. Im Siegerland erforderte die schwere Arbeit des Berg- und Hüttenmannes immer schon ein kräftiges Essen und einen herzhaften Trunk16. Aber gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist hier – wie anderswo – ein Umschwung in den Verhaltensweisen zu beobachten. Während die Behörden ihre Kontrollen des gesellschaftlichen Lebens ausweiteten und die Bestrebungen der Mäßigkeitsvereine förderten, wurde auch in zahlreichen Betrieben dem Alkohol – vorab dem Schnaps – der Kampf angesagt. Seinen äußeren Ausdruck fand er in Arbeitsordnungen: »Es ist ferner streng untersagt, betrunken auf die Arbeit zu kommen, sich auf der Arbeit zu betrinken, geistige Getränke in das Werk zu bringen oder das Einbringen derselben zu veranlassen. Es hat dies sofortige Entlassung zur Folge«, heißt es im § 20 der Arbeitsordnung der Maschinenfabrik Paul Hoffmann u. Co. zu Eiserfeld vom 15. Mai 1901, und die Ordnung der AG Bremerhütte zu Geisweid vom 15. Juni 1900 verbietet im gleichen Paragraphen zusätzlich, »während der Arbeitszeit außerhalb des Werkes Branntwein zu trinken«17. Allerdings hielten sich die Arbeiter nicht unbedingt daran, und die Unternehmensleitung 15 Vgl. hier und im folgenden Jeggle, S. 87 ff., und Roberts: Alkoholkonsum (Anm. 13), passim, zum instrumentalen, sozialen und narkotischen Trinken, S. 222–223. Inwieweit sich auch im Siegerland Zusammenhänge mit »vorindustriellen Formen des sozialen Trinkens« (Roberts: Alkoholkonsum, S. 235; vgl. Jeggle, S. 81–82) nachweisen lassen, müsste eine eigene Untersuchung ergeben. Wie schwierig allgemeine Aussagen gerade bei Ess- und Trinkgewohnheiten sind, zeigt auch Günter Wiegelmann: Tendenzen kulturellen Wandels in der Volksnahrung des 19. Jahrhunderts. In: Arbeiter in Deutschland. Studien zur Lebensweise der Arbeiterschaft im Zeitalter der Industrialisierung. Hrsg. von Dieter Langewiesche und Klaus Schönhoven. Paderborn 1981, S. 173–181, hier S. 174–176. Alkoholismus als Fluchtreaktion betont Dieter Kramer: Soziokulturelle Lage und Ideologie der Arbeiterschaft im 19. Jahrhundert. In: Kultureller Wandel im 19. Jahrhundert. Hrsg. von Günter Wiegelmann. Göttingen 1973, S. 112–134, hier S. 117 (mit einigen Belegen). 16 So schon Jung-Stilling 1778 in seiner berühmten Arbeit über das Hammerschmiede-, Eisenund Stahlgewerbe des Siegerlandes, hier zit. bei Paul Ficker: Achenbach Buschhütten. Festschrift aus Anlaß der Gründung des Buschhütter Eisenhammers vor 500 Jahren. 1452–1952. Ein Beitrag zur Industriegeschichte des Siegerlandes. Buschhütten 1952, S. 73 (in diesem Zusammenhang danke ich Herrn Stähler von der Firma Achenbach vielmals für seine Unterstützung). Vgl. Schneider-Davids: Flennersch Richard (Anm. 13), S. 135–139, 165–166; ders.: Jongejoahrn. Siegen 1936, S. 26–35 (vom Essen und Trinken in der Familie: kein Alkohol!). Beide Bücher berichten anschaulich und weitgehend autobiographisch vom Leben Siegerländer (Bergmanns-) Familien; sie harren noch einer detaillierten Auswertung (hier wie an anderen Stellen habe ich Herrn Alfred Lück für viele wichtige Hinweise und Anregungen zu danken). 17 Stadtarchiv Siegen, Amt Eiserfeld, vorl. Nr. A 72: Acta spec. betreffend die Maschinenund Munitionsfabrik von Paul Hoffmann u. Comp. zu Eiserfeld 1894–1919; Gemeinde Klafeld-Geisweid, Nr. A 145: Sonder-Akten betreffend Reichsunfallversicherung der La-
Zur Umbruchzeit der Industrialisierung
|
17
bestand nicht in jedem Fall auf der Durchsetzung der Bestimmungen. So war es in der Firma Achenbach/Buschhütten »allgemein üblich, als mal abends in der letzten Stunde – auch samstags wurde bis 7 Uhr gearbeitet – ein Schnäpschen zu trinken. Die Leute in den einzelnen Abteilungen legten zu einem Umtrunk zusammen, und einer mußte dann das Herbeiholen besorgen. Das Schnapstrinken während der Schicht war zwar verboten, doch wurde es stillschweigend geduldet, nur durfte sich keiner dabei erwischen lassen«18. Die neue Fabrikdisziplin konnte nicht sofort wie gewünscht durchgesetzt werden. Ebenso gelang es Arbeitern und Bauern immer wieder, die behördlichen Kontrollen ihrer Geselligkeit zu unterlaufen. All diese Erscheinungen zeigen jedoch an, welcher Umbruch sich in dieser Zeit vollzog, wie tiefgreifend er in die Lebensverhältnisse eingriff. Weitere Untersuchungen werden dies – über die besonders extreme Erscheinungsform der »Alkoholfrage« hinaus – deutlich machen.
gerei-Berufsgenossenschaft 1907–1936, inliegend: Arbeitsordnung der Aktiengesellschaft Bremhütte, Geisweid, vom 15.6.1900. 18 Karl Roth: Allen Gewalten zum Trotz sich erhalten. Geschichte der Firma Engelhard Achenbach sel. Söhne, Buschhütten. Rückblick und Erinnerungen nach einer 62-jährigen Dienstzeit bei der Firma Achenbach Söhne. Buschhütten 1944 (Ms.); eine Abschrift wurde mir von Herrn Ernst Leicht (Fa. Achenbach) zur Verfügung gestellt, wofür ich ihm herzlich danke (Zitat, das sich auf die hier behandelte Zeit bezieht, S. 10 der Abschrift, deren Rechtschreibung und Zeichensetzung überarbeitet wurde). Auch Karl Roth, der Oberingenieur in der Firma war, meint im Anschluss an die zitierte Stelle, dass das Trinken während der Arbeitszeit ein Überbleibsel der alten Hammerschmieden gewesen sei. Vgl. auch die mir von Herrn Lück mitgeteilte Anekdote: Friedrich Flick sah in der Charlottenhütte einmal Hochofenarbeier, die Alkohol tranken. Als er befahl, damit aufzuhören, antworteten sie sinngemäß: »Wenn wir arbeiten, arbeiten wir, und wenn wir saufen, saufen wir«. Da Flick wusste, dass der Hochofen derzeit nicht betreut zu werden brauchte, hatte diese Antwort keine Konsequenzen für die Arbeiter. – Wie schwierig es war, in den saarländischen Gruben den – offenbar vor allem seit den achtziger Jahren auftretenden – Alkoholgenuss vor und nach der Schicht einzuschränken, beschreibt Hort Steffens: Arbeitstag, Arbeitszumutungen und Widerstand. Bergmännische Arbeitserfahrungen an der Saar in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In: Archiv für Sozialgeschichte 21, 1981, S. 1–54, hier S. 6–7 (vgl. auch Mallmann: Anfänge, S. 41–42). Lothar Machtan zeigt, wie wenig zunächst das Branntweinverbot in den Fabriken befolgt wurde; dabei hatten anscheinend die Stahlwerks-, Hütten- und Gießereiarbeiter das größte Alkoholbedürfnis. Biergenuss in den Fabriken wurde gang und gäbe und ersetzte allmählich den Schnaps (vgl. Roberts: Alkoholkonsum, S. 228); Verbotsversuche zogen mehrfach Streiks nach sich (Zum Innenleben deutscher Fabriken im 19. Jahrhundert. Die formelle und die informelle Verfassung von Industriebetrieben, anhand von Beispielen aus dem Bereich der Textil- und Maschinenbauproduktion [1869–1891]. Ebd., S. 179–236, hier S. 209–213).
»Ein Wald von Fabriken, Fabrikantenvillen und Arbeiterwohnungen« Probleme der Industrialisierung im Elztal (1850–1914)* »Eine kleine artige Stadt«
Dem Reisenden, der am Ende des 18. oder am Anfang des 19. Jahrhunderts durch das Elztal zog, bot sich in einer lieblichen Landschaft das Bild eines beschaulichen bäuerlichen Lebens, das seine Existenzgrundlage allerdings häufig schon nicht mehr allein aus der Landwirtschaft erzielen konnte. So schreibt der Karlsruher Gymnasialprofessor Heinrich Sander, nachdem er 1781 das Prechtal besucht hat: »Die Männer machen hölzerne Uhren, und die Weiber und die kleinsten Kinder lernen alle von Jugend auf Strohhüte flechten, aus weißem und feinem Roggenstroh. Jeder Bauer braucht alle Jahre einen Strohhut, aber viele tausend werden nach der Schweitz verkauft. (...) Sie brennen Kohle, verkaufen Bauholz, Dielen, Planken, Latten etc.; daher sind an der Elz gar viele Sägemühlen erbaut. (...) Im Oberthal machen sie aus Ahorn hölzerne Schuhe und Pantoffeln, und verkaufen was sie nicht brauchen.«1 Auch die Städtchen des Elztales wirkten offenbar auf manche Betrachter recht idyllisch. »Eine kleine artige Stadt« nennt Johann Baptist Kolb in seiner Beschreibung des Großherzogtums Baden 1813 Waldkirch.2 Um so nachhaltiger musste die seit Mitte des 19. Jahrhunderts rasch aufeinanderfolgende Ansiedlung von Fabriken namentlich der Textilindustrie den Druchreisenden beeindrucken. Heinrich Hansjakob bemerkt 1902 nach einer Kutschfahrt durch das Elztal, den Vergleich mit seiner Jugendzeit vor Augen: Das Städtchen Waldkirch »hat sich neuzeitig herausgeputzt, und eiserne Brücken, mir die widerwärtigsten Zerstörerinnen einer Landschaft, Fabrikantenvillen und sonstige neumodische Prachtbauten ›verschönern‹ es. In und um Waldkirch feiert die liebe Industrie eine wahre ›Kirchweih‹ – und Fabrik an Fabrik verkündet den ›Fortschritt‹ unseres Jahrhunderts. Ich war ordentlich froh, als ich eine Stunde
* Erstpublikation in: »s Eige zeige«. Jahrbuch des Landkreises Emmendingen für Kultur und Geschichte 1 (1987) S. 107–128. 1 Heinrich Sander: Reise nach St. Blasien um Michaelis 1781. Berlin, Dessau 1782, 234– 237. 2 Johann Baptist Kolb: Historisch-statistisch-topographisches Lexicon von dem Großherzogthum Baden ... 1. Bd. Karlsruhe 1813, hier zit. nach: Vier Jahrzehnte Bauunternehmen Karl Burger. Festschrift der Karl Burger KG, Waldkirch. Waldkirch 1967, 7.
Probleme der Industrialisierung im Elztal (1850–1914)
|
19
oberhalb Waldkirchs aus dem Wald von Fabriken, Fabrikantenvillen und Arbeiterwohnungen draußen war.«3 Diese Eindrücke aus Reiseberichten dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass trotz des tiefen Einschnitts, den die Industrialisierung für die äußere Gestalt der Landschaft, für die Sozialstruktur, für die Lebensverhältnisse und Verhaltensweisen der Bevölkerung bedeutete, das Elztal ein traditionsreiches Gewerbegebiet war. Im Hoch- und Spätmittelalter spielte der Erzbergbau – vor allem die Silberförderung im Suggental und Bleibach – eine nicht unwichtige Rolle.4 Seit 1683 befand sich ein Hammerwerk in Kollnau, das die vorderösterreichische Regierung aus Simonswald nach hier verlegt hatte. Nach dem Übergang an Baden 1806 nahm es zunächst sogar einen Aufschwung, weil das Roheisen nun ohne größere Probleme aus dem Markgräfler Land geliefert werden konnte. Für die Feuerung des Hochofens bezog man verhältnismäßig billiges Holz aus der Umgebung, obwohl die Vorräte keinesfalls unerschöpflich waren und immer wieder vor Raubbau gewarnt wurde; schwere Schäden am Wald waren nicht zu übersehen. Als jedoch neue technologische Verfahren in der Eisenverarbeitung aufkamen, die zudem Steinkohle und Koks als Brennstoff bedingten, geriet die Schwarzwälder Eisenindustrie – und mit ihr das Kollnauer Hammerwerk – in einen nicht mehr ausgleichbaren Standortnachteil und sank um die Jahrhundertmitte zur Bedeutungslosigkeit herab.5 Ein einträgliches Gewerbe stellte im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit die Edelsteinschleiferei in Waldkirch dar. Vor allem seit dem 16. Jahrhundert wurde die Verarbeitung böhmischer Granaten eine weltbekannte Spezialität, mit der in einer allerdings harten und gesundheitsschädlichen Tätigkeit eine Vielzahl von Arbeitskräften – oft im Heimgewerbe – beschäftigt werden konnte. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts setzte hier ein wirtschaftlicher Niedergang ein, hauptsächlich infolge zunehmender Konkurrenz, die den sich lockernden Zunfzwang
3 Heinrich Hansjakob: Verlassene Wege. Stuttgart 1902, hier zit. nach: Rund um den Kandel. Texte und Bilder zu einer Landschaft aus fünf Jahrhunderten. 75 Jahre Volksbank Waldkirch 1906–1981. Waldkirch 1981, 64–65. 4 Eberhard Gothein: Wirtschaftsgeschichte des Schwarzwaldes und der angrenzenden Landschaften. Bd. 1. Straßburg 1892, 587–639; Rund um den Kandel, 109–115; Hermann Rambach: »Do blieb ich«. Zur Geschichte des Dorfes Bleibach. Von den Anfängen bis zum Zusammenschluß mit Gutach und Siegelau zur Gemeinde Gutach im Breisgau. In: Aus der Geschichte von Bleibach. Gemeindepolitische, kirchengeschichtliche und volkskundliche Entwicklung des Dorfes im Elztal. Waldkirch 1978, 17–194, hier 88–89. 5 Erika Schillinger: Kollnau – ein vorderösterreichisches Eisenwerk des 18. Jahrhunderts. Eine Studie aus dem Forstgeschichtlichen Institut der Universität Freiburg. In: Alemannisches Jahrbuch 1954, 279–340. Vgl. auch Hermann Rambach: Aus der Geschichte von Kollnau. Waldkirch 1975.
20
| »Ein Wald von Fabriken, Fabrikantenvillen und Arbeiterwohnungen«
nutzte.6 Dafür trugen die Waldkircher Orgelbauer im 19. Jahrhundert den Namen ihrer Stadt in alle Welt.7 Daneben entfaltete sich schon früh eine differenzierte Gewerbestruktur. Strohflechten für Schuhe und Hüte, Anfertigen von Holzschuhen, Korbflechten, Herstellung von Uhren, Holzverkauf und verschiedene Handwerkszweige bildeten die wichtigsten Erwerbsquellen außerhalb der Landwirtschaft. Besonders zahlreich waren dabei die Weber und Färber vertreten, die auf eine lange Tradition zurückblicken konnten; 1686 zählten in Elzach über 100 Mitglieder zur neu gründeten Weberzunft.8 1813 erwarben die Gebrüder Johann Anton und Johann Joseph Castell aus Gressoney in Savoyen ein Anwesen in Elzach für ihre bereits seit 1801 in Riegel bestehende Handelsfirma. Während sie bisher vorwiegend Seiden- und Wollwaren aus Oberitalien importiert und im Breisgau verkauft hatten, traten sie nun zusätzlich in unmittelbare Beziehungen zu den einheimischen Handwebern: Sie lieferten diesen die benötigten Rohmaterialien – aber auch alle möglichen Gegenstände des täglichen Bedarfs – und erhielten dafür deren Erzeugnisse, die sie dann weiterverkauften. Daraus entwickelte sich ein reges Geschäft in- und außerhalb Badens. Auf dieser Grundlage entstand 1867 eine mechanische Leinenweberei, in der schon 1875 25 Webstühle liefen und rund 30 Arbeitskräfte beschäftigt waren; das Färben wurde von einheimischen Spezialisten besorgt. Castell war das erste Industrieunternehmen im oberen Elztal.9 6 Gothein: Wirtschaftsgeschichte, 571–581; Max Wetzel: Waldkirch im Elztal. Stift, Stadt und Amtsbezirk. Nach den geschichtlichen Quellen dargestellt in Wort und Bild. 1. Teil. Freiburg 1912, 305 ff.; Rudolf Metz: Edelsteinschleiferei in Freiburg und im Schwarzwald und deren Rohstoffe. Lahr 1961. Vgl. Heinrich Hansjakob: Bauernblut. Erzählungen. Haslach i. K. 14. Aufl. 1974, 32–33. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts eröffneten sich neue Möglichkeiten für die Edelsteinschleiferei, vgl. z.B. Staatsarchiv Freiburg (StAF), Gewerbeaufsichtsamt, Nr. 1204 (Moser, Prechtal-Elzach); Landratsamt Emmendingen (Bezirksamt Waldkirch), Nr. 3711 (Wintermantel, Waldkirch). 7 Hermann Rambach, Otto Wernet: Waldkircher Orgelbauer. Zur Geschichte des Drehorgel- und Orchestrionbaus. Kirchenorgelbauer in Waldkirch. Waldkirch 1984. 8 Josef Weber: Zur Geschichte der Stadt Elzach. Elzach 1978, 69–76; Kolb: Hist.-stat.-topogr. Lexicon (wie Anm. 2), 7–8; Gothein: Wirtschaftsgeschichte, 530. 9 Seit 175 Jahren Gebrüder Castell in Elzach. Ein echt Schwarzwälder Familienbetrieb bewährte sich in den Stürmen der Zeit. In: Waldkircher Anzeiger / Elztäler Wochenbericht vom 25.11.1976; Karl Martin: Die Einwanderung aus Savoyen nach Südbaden. Ein Beitrag zur Erforschung der blutmäßigen Zusammensetzung unserer Bevölkerung. In: Schau-insLand 65/66 (1938/39) 3–118, hier besonders 53–54, auch 51, 62. Die Geschäftsbeziehungen der Firma zwischen 1814 und 1830 gehen aus dem erhalten gebliebenen »Hauptbuch« hervor, das ich ebenso einsehen durfte wie eine handgeschriebene »Geschichte der Familie Castell von ungefähr 1500 bis 1936«, verfasst vom Enkel Johann Anton Castells. Für diese Möglichkeit wie für weitere Berichte und Hinweise danke ich dem jetzigen Inhaber der Firma Gebr. Castell, Herrn Karl Gysler, herzlich. – Heinrich Hansjakob schreibt in sei-
Probleme der Industrialisierung im Elztal (1850–1914)
|
21
Hier lässt sich beispielhaft ein bedeutsamer geschichtlicher Wandlungspozess nachzeichnen: Ursprünglich wirtschafteten die Handweber in Produktion und Verkauf völlig selbständig. Dann wurden sie in ein Verlagssystem einbezogen: Ein Unternehmer, meistens ein Kaufmann, organisierte Produktion, Beschaffung der Rohstoffe und Absatz, während die Erzeugnisse dezentral bei Handwerkern oder im Hausgewerbe hergestellt wurden. Schließlich ging diese Wirtschaftsreform im mechanisierten Industriebetrieb auf. Aufgrund der günstigen Voraussetzungen im Elztal wundert es nicht, dass die hiesige Industrialisierung während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an erster Stelle ein Vordringen der Textilindustrie bedeutete. Für den Wiener Kaufmann Max Gütermann, der einen geeigneten Standort für eine Fabrik suchte, in der Rohgarne gefärbt und zu gebrauchsfertiger Nähseide verarbeitet werden sollten, war entscheidend, Wasser in guter Qualität und ausreichender Menge sowie eine Anzahl fachlich ausgewiesener Arbeitskräfte vorzufinden. Das gab den Ausschlag für Gutach, dort wurde im Frühjahr 1867 mit dem Bau des Unternehmens begonnen. Später kamen noch eine Spinnerei und Zwirnerei von Schappeseide hinzu. Daraus entwickelte sich der größte Industriebetrieb des Elztales: 1867 beschäftigte er 30 Arbeitskräfte, am Vorabend des Ersten Weltkrieges waren es bereits 1800.10 Daneben entstanden seit der Jahrhundertmitte in rascher Folge zahlreiche weitere Textilfabriken: Haager und Hofer, Sonntag, Ringwald, Genthe, Eckert und nicht zuletzt die Kollnauer Baumwollspinnerei und Weberei, die der Lahrer Fabrikant Groß und sein Schwiegersohn Jeanmaire 1869 an der Stelle des stillgelegten Hammerwerkes gründeten. Auch hier war das Wasser der Elz für die Standortwahl bestimmend. Die erste Maschiner Erzählung »Der Wälder-Xaveri«, die von seinem Grossvater Xaver Kaltenbach handelt: »Einmal war der Xaveri drüben in Elze gewesen beim Savoyarden Castelli, um seidene Halstücher für die Wibervölker auf dem Land zu kaufen, und hatte der Kellnerin im Kreuz (seiner späteren Frau, H. H.) auch eins mitgebracht. Das war dreimal größer als ein Bauernhalstuch und gelb und rot gefärbt. Nur die besten Bürgersfrauen trugen solche.« (Der Wälder-Xaveri und andere Erzählungen. Stuttgart 1953, 37). – Wenige Jahre nach den Gebr. Castell nahm 1876 die Mechanische Weberei Richard Störr in Elzach ihre Tätigkeit auf: der erfolgreiche Versuch eines mechanisiserten handwerklichen Kleinbetriebs (das Inventar samt hauseigenem Wasserrad wurde vor einiger Zeit vom im Aufbau befindlichen Landesmuseum für Technik in Mannheim erworben). Vgl.: Das Wasserrad klappert nicht mehr. Zeugnis früher Industrialisierung kann nicht am angestammten Platz bleiben. In: Badische Zeitung (Elztal-Ausgabe) vom 12.1.1984. 10 100 Jahr Gütermann. O.O.u.J. (1964), 6, 10. Zur Expansion Gütermanns vgl. die Bauakten 1867–1919 (StAF, Landratsamt Emmendingen / Bezirksamt Waldkirch, Nr. 350) sowie die Erweiterungen der technischen Anlagen 1875–1920 (ebd., Nr. 2287–2296; Gewerbeaufsichtsamt, Nr. 670; Kreisarchiv Emmendingen [KAE], Gutach VII, Gütermann 1890 [Turbinenanlage 1889–1891], Färbereigebäude Gütermann 1898).
22
| »Ein Wald von Fabriken, Fabrikantenvillen und Arbeiterwohnungen«
nenausstattung kam aus dem elsässischen Mühlhausen. Schon nach zwei Jahren liefen 20.000 Spindeln und 380 Webstühle.11 Fabriken als »Erziehungsanstalt der Armen«
Das Elztal bildet somit – neben dem Wiesental12 – ein sehr anschauliches Beispiel eines Industrialisierungsprozesses in Südbaden, der auf den Strukturen einer traditionsreichen Gewerbelandschaft aufbaut13, einen deutlich vorherrschenden Industriezweig kennt14 und sich dezentral vollzieht.15 Karl Mez, der Freiburger
11 Vg. Ulrike Ahlers: Die Industrialisierung des Elztals in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts (an ausgewählten Beispielen). Zulassungsarbeit zur 1. Dienstprüfung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen im Fach Geschichte. Schwäbisch-Gmünd 1982 (ich danke Frau Ahlers für die Möglichkeit, ihre Arbeit zu lesen, und für weitere wichtige Hinweise); Cord Gewebe. Kollnauer Baumwollspinnerei und Weberei. Waldkirch-Kollnau o.J. (Werbeschrift); Paul Kowollik (Hg.): Das schöne Elztal an der Jahrhundert- und Jahrtausendwende 2000. Ettenheim 1985; sowie die in Anm. 2 genannte Literatur in meinem Artikel: »Ein Hang zum Putz und Wohlleben macht sich bemerkbar.« Die Industrialisierung verändert das Elztal. In: Waldkircher Heimatbrief Nr. 110, März 1985, 1–2. – Zur Kollnauer Fabrik auch außer den im folgenden zit. Quellen: KAE, Kollnau VII, Bau einer neuen Werkstätte 1891; StAF, Landratsamt Emmendingen (Bezirksamt Waldkirch), Nr. 2708; Gewerbeaufsichtsamt, Nr. 1343. 12 Vgl. Gisela Müller: Die Entstehung und Entwicklung der Wiesentäler Textilindustrie bis zum Jahre 1945. Schopfheim 1965. 13 Eine vergleichende Untersuchung des Zusammenhanges von Proto-Industrialisierung und Industrialisierung in solchen Landschaften wie dem Elztal ist eine dringende Aufgabe. Vgl. zur Problemstellung Peter Kriedte, Hans Medick, Jürgen Schlumbohm: Industrialisierung vor der Industrialisierung. Gewerbliche Warenproduktion auf dem Land in der Formationsperiode des Kapitalismus. Göttingen 1978. 14 1912 beschäftigte die Textilindustrie im Amtsbezirk Waldkirch 67,2% der Arbeitskräfte (Hugo Ott: Der Schwarzwald. Die wirtschaftliche Entwicklung seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert. In: Ekkehard Liehl, Wolf Dieter Sick (Hg.): Der Schwarzwald. Beiträge zur Landeskunde. Bühl 1980, 390–406, hier 402). 15 Zur Einordnung neben Ott (Anm. 14) ders.: Die wirtschaftliche und soziale Entwicklung von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. In: Badische Geschichte. Vom Großherzogtum bis zur Gegenwart. Stuttgart 1979, 103–142; Wolfram Fischer: Der Staat und die Anfänge der Industrialisierung in Baden. Bd. 1. Die staatliche Gewerbepolitik. Berlin 1962; ders.: Ansätze zur Industrialisierung in Baden 1770–1870. In: ders.: Wirtschaft und Gesellschaft im Zeitalter der Industrialisierung. Göttingen 1972, 358–392; »Die Freiheit ist noch nicht verloren ...« Zur Geschichte der Arbeiterbewegung am Oberrhein 1850–1933. Hrsg. vom Arbeitkreis Regionalgeschichte Freiburg, 15–30 (Eva-Maria Gawlik-Sutter, Wolf-Dieter Sutter).
Probleme der Industrialisierung im Elztal (1850–1914)
|
23
Seidenfabrikant, der 1868 auch eine Filiale in Prechtal einrichtete16, begründete sein Vorgehen, sich nicht mit einem großen Betrieb in der Stadt zu begnügen, sondern mit Filialen aufs Land zu gehen, mit mehreren Argumenten. Zum einen seien dort häufig aufgrund der Veränderungen und Krisen in der Landwirtschaft Arbeitskräfte überflüssig oder bei manchen Bauern unter sehr erbärmlichen Bedingungen in Stellung. Die Konkurrenz einer ordentlich geleiteten Fabrik wirke sich deshalb vorteilhaft auf die Lage der Bevölkerung aus. Zum anderen sah er ernste Gefahren für die gesellschaftliche Ruhe und Ordnung voraus, wenn immer größere Arbeitermassen in wenigen Firmen zusammengeballt würden. Für ihn bildete die Fabrik auch eine »Erziehungsanstalt der Armen«, vor allem der Mädchen vom Land, die er – soweit sie nicht am Ort oder in der Nähe beschäftigt werden konnten – in Freiburg in einem besonderen Wohnheim unterbrachte, um ihre sittliche Betreuung zu gewährleisten. Arbeitskräfte in den dezentralen Betrieben könnten nebenbei auch noch ihrer gewohnten Haus- und Feldarbeit nachgehen und würden ihrer Familie und Heimat nicht entfremdet.17 Diese Rechtfertigung einer dezentralen Industrialisierung dürfte die unternehmerischen Überlegungen treffend widerspiegeln, auch wenn nicht jeder Firmeninhaber einen Erziehungsauftrag verspürte, sondern mehr daran dachte, dass die Arbeitskräfte auf dem Land im Durchschnitt billiger als in der Stadt waren und die »Arbeiter-Bauern« weniger anfällig für gewerkschaftliche und sozialdemokratische Organisationen schienen.18 Durch »gute Taten« zum Erfolg
Ähnlich wie Mez verhielt sich etwa die Firma Gütermann. Auch sie nutzte nicht nur den Vorzug aus, dass im Elztal schon Fachleute zur Verfügung standen, sondern konnte auf zahlreiche verhältnismäßig billige Arbeitskräfte zurückgreifen, 16 Franz Kistler: Die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse in Baden 1849–1870. Freiburg 1954, 126. 17 Johannes Korber: Karl Mez. Ein Vorkämpfer für christlichen Sozialismus. Basel 1892, 72–84. Vgl. Wolfram Fischer: Karl Mez (1808–1877). Ein badischer Unternehmer im 19. Jahrhundert. In: ders.: Wirtschaft und Gesellschaft, 443–463; auch Franz Herz: Karl Mez – Seidenfabrikant, Pietist, Sozialpolitiker (erscheint demnächst in einem von Thomas Schnabel und mir hrsg. Sammelband). 18 Vgl. zum Zusammenhang Josef Mooser: Arbeiterleben in Deutschland 1900–1970. Klassenlage, Kultur und Politik. Frankfurt 1984, 167–178. Eine lokale Detailanalyse von »Arbeiter-Bauern« findet sich bei Wolfgang Kaschuba, Carola Lipp: Dörfliches Überleben. Zur Geschichte materieller und sozialer Reproduktion ländlicher Gesellschaft im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Tübingen 1982. Interessant sind in diesem Zusammenhang die Ausführungen des Waldkircher Amtsvorstandes v. Theobald 1878 (zit. in meinem Artikel wie Anm. 11).
24
| »Ein Wald von Fabriken, Fabrikantenvillen und Arbeiterwohnungen«
die sich bislang als saisonale Tagelöhner auf den größeren Höfen durchgeschlagen hatten. Dies galt insbesondere für Mädchen und Frauen: Während die Männer weiterhin vorwiegend über ihr »Nebengewerbe« – das oft die Haupteinnahmequelle bildete – Geld verdienten, verdingten jene sich bei Gütermann, weil sie hier einen höheren Lohn als bei den Bauern erhielten und für sie die geregelte Fabrikarbeit einen Fortschritt darstellte. In »mündlicher Geschichte« ist die regelrechte »Prozession« fröhlich singender Frauen aus dem oberen Elztal zur Gütermannschen Firma und zurück überliefert. Gütermann brachte gerade für die Ärmeren eine Alternative zur harten, wenig einträglichen Tagelöhnerei und zudem Geld ins Tal.19 Schon bald reichten die einheimischen Arbeitskräfte für das expandierende Unternehmen nicht mehr aus. Gütermann musste Auswärtige anwerben. Auf diese Weise kamen damals »Gastarbeiter« ins Elztal, nähmlich Mädchen und Frauen aus Oberitalien, wo Gütermann 1884 in Perosa bei Turin eine Seidenkämmerei gekauft hatte. Die Arbeiterinnen verpflichteten sich zunächst in der Regel für zwei Jahre, um danach wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Ende 1893 wurde bekannt, dass Italienerinnen wegen Auseinandersetzungen um die Lohnhöhe ihre Arbeit verweigert hatten. Offenbar Waldkircher Sozialdemokraten berichteten darüber in der Zeitung »Der Volksfreund«, den ihr linksstehender Offenburger Parteigenosse Adolf Geck herausgab. Gütermann klagte gegen Geck wegen Verleumdung, der auch in erster Instanz zu sechs Wochen Gefängnis verurteilt wurde. Das Berufungsverfahren endete im Juli 1894 jedoch mit einem Vergleich.20 Wenngleich demnach Arbeitskonflikte nicht ausblieben, zogen es doch viele Italienerinnen vor, länger als zwei Jahre im Elztal zu verweilen. Dies geht etwa aus einem sich in den Akten niedergeschlagenen Versuch von vier Vätern hervor, 1894 über das italienische Konsulat in Mannheim ihre Töchter zur Heimkehr zu veranlassen. Gütermann konnte dem Waldkircher Bezirksamt anscheinend nachweisen, dass die Mädchen nicht nach Hause wollten und er sie nicht zwingen könne.21 1903 liess er, ähnlich wie Mez in Freiburg, ein großes Mädchenheim bauen.22 19 Berichte aus Interviews im oberen Elztal, die ich für meine Untersuchungen zur Elztäler Geschichte durchgeführt habe. 20 KAE, Gutach VII, Arbeiterverhältnisse in der Fa. Gütermann 1894 (1893–1900). Zu Geck: Erwin Dittler: Adolf Geck. 1854–1942. In: Die Ortenau 1982, 212–301, 1983, 234–273. Zu weiteren Arbeitskonflikten bei Gütermann vgl. StAF, Gewerbeaufsichtsamt, Nr. 670. 21 KAE, wie Anm. 20. 22 100 Jahre Gütermann, 11 (vgl. 6 zur Filiale in Perosa). Gütermann war wie Mez Protestant. Leider liegen mir keine Quellen darüber vor, ob er ebenfalls versuchte, sittliche Grundsätze erzieherisch zu verwirklichen.
Probleme der Industrialisierung im Elztal (1850–1914)
|
25
Dies war keine fürsorgerische Einzelmaßnahme. Zahlreiche Werkswohnungen kamen hinzu. Den Arbeitskräften wurden Waren des täglichen Bedarfs in einem »Consumgebäude« angeboten. Zur Stabilisierung der Lebenshaltungskosten erwarb Gütermann einen Gutshof, um die Belegschaft mit Milch versorgen zu können. Später erweiterte er die landwirtschaftliche Nutzfläche; auch einige Gastwirtschaften fielen in seinen Besitz.23 Als der Firmengründer Max Gütermann am 30.8.1985 starb, erhielt jeder Beamte, Angestellte und Arbeiter nicht nur ein Bildnis des Verstorbenen mit Widmung, sondern auch ein Legat bis zum dreifachen Tagesverdienst pro vollendetem Dienstjahr. Vor allem aber wurde zum Andenken 1897 eine Krankenanstalt – das »Maxhaus« – errichtet, die allen Beschäftigten, einschließlich der Dienstboten, und ihren Angehörigen zur Verfügung stand. Die Mittel zum Unterhalt setzten sich aus Zahlungen der Firmenkrankenkasse oder Verpflegungsgeldern der Kranken selbst, wenn sie der Kasse nicht anghörten, zusammen, daneben aus Beiträgen des Gutacher Krankenschwesternvereins und freiwilligen Zuwendungen von »Wohlthätern und Freunden der Anstalt«. Finanzierungslücken deckte die Firma »gutthatsweise«. Familienangehörige wurden im übrigen »zu einem sich nach ihrem Vermögensstande richtenden, jeweils zu vereinbarenden Preise verpflegt.« Allerdings: »Wer sich Widersetzlichkeit oder ungebührliches Betragen zu schulden kommen läßt, kann sofort ausgewiesen werden.«24 „Um die noch nicht schulpflichtigen Kinder während der Arbeitszeit ihrer Angehörigen gut aufbewahrt zu wissen«, richtete Gütermann 1894 einen Kindergarten ein. Er fand vorläufig im »Consumgebäude« seinen Platz, für Spiele im Freien war »ein abgesonderter Wiesengrund am Walde vorgesehen.« Eine geprüfte Kindergärtnerin, die aus Ostpreußen stammte, betreute die Kinder. 1896 reichte Gütermann dann ein Baugesuch für ein Kindergartengebäude ein, in dem noch Wohnzimmer für Angestellte der Firma mit eingeplant waren. Ein Jahr später konnte die Einweihung stattfinden.25 Auch um die Freizeit der Belegschaft kümmerte sich die Firma. So erstellte sie für den Turnverein Kollnau-Gutach 1905/1906 eine Turnhalle. Dieser hatte seit seiner Gründung 1885 auf dem Tanzboden des Vereinslokals »Adler« oder im Speisesaal der Kollnauer Baumwollspinnerei und Weberei geübt, von dessen Direktor August Jeanmaire auch die ersten Geräte angeschafft worden waren. Gütermann förderte darüber hinaus weitere Sportarten sowie Gesang- und Musikvereine.26 23 100 Jahre Gütermann, 26, 38; StAF, Gewerbeaufsichtsamt, Nr. 670. 24 KAE, Gutach XVIII. 5, Krankenhaus der Fa. Gütermann 1896/97 (1895–1905), Zitate aus dem Bericht über die »Entstehung der Krankenanstalt ›Maxhaus‹« (undadiert, ca. Jan. 1898). 25 KAE, Gutach XXXIV. 2, Kleinkinderbewahranstalt der Fa. Gütermann 1894 (–1897), Zitate aus einem Brief Gütermanns an das Bezirksamt Waldkirch vom 23.6.1894. 26 KAE, Kollnau XXXIV. 1, Turnhalle der Fa. Gütermann 1904 (1905–1906); 100 Jahre Gütermann, 40; 100 Jahre Turnverein Kollnau-Gutach e.V. 1885–1985. (Kollnau 1985),
26
| »Ein Wald von Fabriken, Fabrikantenvillen und Arbeiterwohnungen«
Die eindrucksvollen Sozialleistungen des Unternehmens verstärkten die Bindung der Arbeitskräfte an den Betrieb, ihre Integration und soziale Kontrolle. Daneben festigten der umfangreiche Grundbesitz, ein eigenes Sägewerk, eine Ziegelei, ein eigenes Elektrizitätsnetz, durch das auch die Gemeinde Gutach mit Strom versorgt wurde, den Einfluss Gütermanns.27 Später wurden sogar 30 Gemeinden bis nach Oberprechtal, Neukirch und zur Gegend um die »Kalte Herberge« beliefert. Das Zweribach-Wasserkraftwerk (Plattensee) sorgte mit seinem Gefälle von fast 500 Metern bis zum Simonswälder Tal für Berühmtheit. Gütermann setzte diesen Einfluss durchaus auch für seine Interessen ein. So geriet er mehrmals in Konflikt mit dem Gutacher Gemeinderat wegen der Höhe der Gemeindeumlage bzw. der Gewerbesteuer. Am 7.3.1880 machte er eine Rechnung auf: Von seinen Arbeitskräften seien 48 in Gutach gebürtig oder wohnten dort, 38 lebten in Kollnau – davon 24 »in meinen Häusern« –, 8 in Niederwinden, Oberwinden und Siegelau. Daraus könne man ersehen, dass gerade die Gutacher auf eine Beschäftigung bei ihm angewiesen seien. Folgerichtig wurde dann die Steuer auch ermäßigt, obwohl sich Gütermann nicht immer in vollem Ausmaß mit seinen Vorstellungen durchsetzen konnte.28
9–28, 36 (Autor: August Vetter). Als Gegenleistung für die Erstellung der Turnhalle und eines Turnplatzes – die den Verein nichts kostete – verlangte Alexander Gütermann, dass der bisher auf Kollnau beschränkte Vereinsname auf Gutach ausgedehnt werden sollte. 1906 wurden die Herren Gütermann – wie früher schon Jeanmaire – zu Ehrenmitgliedern ernannt. 1936 – nachträglich zum 50jährigen Jubiläum – pflanzte der Verein vor der Turnhalle eine »Alexander-Gütermann-Eiche« zu Ehren des Förderers, dem man 1956 mit der Pflanzung einer weiteren Eiche gedachte. Neben Jeanmaire und Gütermann unterstützte auch der Leimfabrikant Ernst Fehr (s.u. bei Anm. 47/48) die Vereinsaktivitäten. – So wie Gütermann das Musikleben begünstigte – etwa mit seiner Werkskapelle –, gehörten die Direktoren Groß und Jeanmaire von der Kollnauer Fabrik zu den Gönnern der 1871 gegründeten Musikkapelle Kollnau: Festschrift zur Feier des 80jährigen Jubiläums der Musikkapelle Kollnau am 14. und 15. Juli 1951. 1871–1951. (Kollnau 1951, ohne Seitenzählung; Autor: Fritz Ebner). – Für die Beschaffung dieser und anderer Festschriften danke ich Herrn Paul Kaltenbach, Kollnau, herzlich. 27 100 Jahre Gütermann, 26, 39, 40; vgl. die Beurteilung in einem Artikel der sozialdemokratischen »Volkswacht« vom 30.8.1912 („Fabrikantenherrschaft«), in: StAF, Gewerbeaufsichtsamt, Nr. 670. Es wäre zu untersuchen, wie die Arbeiter darauf reagierten und ob es Ansätze gab, sich aus der Bindung zu lösen. 28 StAF, Landratsamt Emmendingen (Bezirksamt Waldkirch), Nr. 2279, vgl. 2280. Die »Volkswacht« (wie Anm. 27) wies darauf hin, dass der Gutacher Bürgermeister ein Angestellter der Firma sei und auch im Gemeinderat »dieser Personenkreis dominiert«.
Probleme der Industrialisierung im Elztal (1850–1914)
|
27
Verboten: Ungehorsam, grobes Benehmen, Unsittlichkeit, Trunkenheit, Aufstiftung, Beschädigung von Maschinen
Die äußere Integration der Arbeiterschaft durch Sozialleistungen und beherrschende Stellung des Unternehmers wurde durch die innere Disziplinierung und moralische Erziehung in dessen Sinne ergänzt, wie sie sich etwa in den Vorschriften der Fabrikordnung ausdrückte.29 Bereits 1868 war die erste Ordnung erlassen worden. Sie regelte die Arbeitszeit – damals 12 Stunden –, das Fernbleiben von der Arbeit, Lohnauszahlung und Kündigung oder Entlassung, Strafen bei Verstößen gegen die Ordnung. Unerwünschte Verhaltensweisen wurden dabei genau benannt: Fast von selbst versteht es sich, dass der Arbeiter »seinem Vorgesetzten Gehorsam und Höflichkeit schuldig und verpflichtet (ist), die Arbeiten vorschriftsmäßig auszuführen« (§ 9). Schon mehr verwundert es, dass es dem Arbeiter verboten wird, »während der Arbeitszeit zu plaudern oder zu schlafen« (§ 12). Reagierte man hier auf tatsächliche Vorfälle, die den Produktionsrythmus störten, oder übernahm man vorbeugend solche Hinweise aus anderen Ordnungen? Das Verbot für die Arbeiter, Maschinen in Gang zu setzen, wenn sie nicht besonders dazu beauftragt sind (§ 11), soll Unglücksfälle verhüten; es findet sich ebenfalls in vielen Fabrikordnungen. Man kann es jedoch auch im Zusammenhang damit sehen, dass häufig beim Hantieren an den Maschinen bewusst ein Ausfall hervorgerufen wurde, um die Produktion anzuhalten und eine Pause zu gewinnen.30 In § 6a werden die Vergehen bezeichnet, die die »alsbaldige Entlassung« nach sich ziehen oder bei »minderer Natur« mit einer Geldstrafe belegt werden, die in die Fabrikkrankenkasse fließt (§ 16 und 17): »hartnäckiger Ungehorsam, grobes Benehmen, Unsittlichkeit in- oder außerhalb der Fabrik, Faulheit oder schlechte Arbeit trotz mehrfachen Ermahnens, vorsätzliche Versäumniß der Arbeitszeit, Diebstahl, Trunkenheit, Aufstiftung, boshafte oder nachlässige Beschädigung von anvertrauten Maschinen, Geräthschaften und Materialien.«31 Für den heutigen 29 Vgl. Rainer Wirtz: Die Ordnung der Fabrik ist nicht die Fabrikordnung. Bemerkungen zur Erziehung in der Fabrik während der frühen Industrialisierung an südwestdeutschen Beispielen. In: Heiko Haumann (Hg.): Arbeiteralltag in Stadt und Land. Neue Wege der Geschichtsschreibung. Berlin 1982 (= Argument-Sonderband 94), 61–88. Er weist insbesondere darauf hin, wie über Fabrikordnungen versucht wurde, gegenüber dem »moralischen Wirtschaften« in der vorkapitalistischen Gesellschaft neue, bürgerlich-moralische Tugenden, wie sie die fabrikindustrielle Produktion erforderte, durchzusetzen. 30 Wirtz: Ordnung, 77; Alf Lüdtke: Arbeitsbeginn, Arbeitspausen, Arbeitsende. Skizzen zu Bedürfnisbefriedigung und Industriearbeit im 19. und frühen 20. Jahrhundert. In: Gerhard Huck (Hg.): Sozialgeschichte der Freizeit. Untersuchungen zum Wandel der Alltagskultur in Deutschland. Wuppertal 1980, 95–122. Vgl. auch die im folgenden zit. Bestimmungen des § 6a. 31 StAF, Landratsamt Emmendingen (Bezirksamt Waldkirch), Nr. 2286.
28
| »Ein Wald von Fabriken, Fabrikantenvillen und Arbeiterwohnungen«
Betrachter ist es fast unvorstellbar, wie stark damals in das persönliche Leben der Arbeiter eingegriffen wurde. Trinken am Arbeitsplatz war im übrigen seinerzeit eine weit verbreitete Erscheinung, die aus Gewohnheiten der vorindustriellen Zeit herrührte und bei der neuartigen körperlichen Anstrengung sowie dem vielfach als fremd empfundenen Produktionsrythmus zunächst eine mobilisierende Funktion besaß. Je komplizierter die Maschinen und der Arbeitsablauf wurden, um so energischer versuchten die Unternehmer, den Alkoholkonsum der Arbeiter einzuschränken.32 Die Gütermannsche Fabrikordnung blieb bis zum Ersten Weltkrieg im wesentlichen unverändert. Die Arbeitszeit sank auf 11, dann auf 10 Stunden im Durchschnitt, hin und wieder kam es mit der Großherzoglich Badischen Fabrikinspektion zu Konflikten über vorgesehene Nachtarbeit oder »Überarbeit«.33 Als 1905 die Fabrikordnung neuen gesetzlichen Bestimmungen angepasst werden musste, forderte die Fabrikinspektion zugleich zeitgemäße Änderungen bei den Entlassungsgründen. Während die Unternehmensleitung der Empfehlung, dass die Vergehen von Trunkenheit und Arbeitsversäumnis nur im Wiederholungsfall zur Entlassung führen sollten, ohne weiteres zustimmte, widersprach sie dem vorgeschlagenen Verzicht auf die Gründe »grobes Benehmen« und »Aufstiftung«. In diesem Fall könnten »wir uns den notwendigen Respect der Arbeiter im Betriebe nicht erhalten.« Die Fabrikinspektion machte in ihrer Antwort deutlich: »Wir suchen allgemein drauf hinzuwirken, dass nur greifbare, in klarer Weise festzustellende Vergehen als Gründe sofortiger Entlassung in den Arbeitsvertrag aufgenommen werden.« Die beiden umstrittenen Begriffe seien jedoch so unscharf, dass sie »der subjektiven Auslegung, z.B. seitens eines Werkmeisters, den weitesten Spielraum lassen.« Gütermann ersetzte dann 1906 »grobes Benehmen« durch »grobe Beleidigung«; »Aufstiftung« war er hingegen nicht bereit, fallen zu lassen. Die Fabrikinspektion verlangte auch, dass die Bestimmung des § 7, bei fristloser Entlassung falle eine Kaution und der noch nicht ausbezahlte Lohn der Krankenkasse zu, zu streichen sei, weil sie den gesetzlichen Bestimmungen zuwiderlaufe. Dies wollte Gütermann nicht akzeptieren: »Dem Mißbrauch der Fabrikordnung wäre Thür und Thor geöffnet, denn sobald ein Arbeiter seine Stelle verlassen will ohne Kündigung, wird er einfach nur seine Entlassung seitens der Firma provozieren, und müßte auch beim sofortigen Austritt vollen Lohn erhal32 Vgl. meine Bemerkungen in anderem Zusammenhang: »Schnapskasinos« auch im Siegerland. Beobachtungen und Fragen zur Umbruchzeit der Industrialisierung. In: Siegerland 59 (1982) H. 1–2, 62–66; sowie die Diskussion in: Geschichte und Gesellschaft 6 (1980) und 8 (1982). Eine regionalvergleichende Analyse dieses Problems steht noch aus. 33 KAE, Gutach VII, Arbeitsordnung der Fa. Gütermann 1892 (–1910); StAF, Gewerbeaufsichtsamt, Nr. 670. Zur Fabrikinspektion vgl. Wolfgang Bocks: Die badische Fabrikinspektion. Arbeiterschutz, Arbeitsverhältnisse und Arbeiterbewegung in Baden 1879–1914. Freiburg 1978.
Probleme der Industrialisierung im Elztal (1850–1914)
|
29
ten. Wie vielerlei Unannehmlichkeiten und Zwietracht würde dadurch künstlich erzeugt, wie vielen Rohheiten den Meistern gegenüber Vorschub geleistet!« Die Fabrikinspektion maß dieser Argumentation keine »praktische Bedeutung« zu, weil das befürchtete Arbeiterverhalten »uns bisher niemals begegnet« sei. Gütermann fand jedoch die gesetzliche Bestimmung »eigenartig und im vorliegenden Falle wie dazu geschaffen, ein friedliches, geordnetes Arbeiten zu stören.« Seine Vorschläge, das Gesetz in irgendeiner Weise zu umgehen, lehnte die Fabrikinspektion natürlich ab, so dass die unhaltbare Formulierung – in recht unauffälliger Weise – aus der Ordnung verschwand.34 Die Firma Gütermann wurde hier als herausragendes Beispiel für die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse und die Wirkungen der Industrialisierung im Elztal ausführlicher behandelt, zumal sie verhältnismäßig gut dokumentiert ist. Die meisten anderen Unternehmen erreichten nicht die finanzielle Kraft, um in ähnlicher Größenordnung tätig zu werden. Lediglich die Kollnauer Baumwollspinnerei und Weberei wies in dieser Zeit vergleichbare Sozialleistungen vor. Deren Arbeiterwohnungen mit jeweils drei Zimmern und Küche sowie einem Gartenanteil, dazu einem Schul- und einem Waschhaus in der Nähe konnten sich im Vergleich durchaus sehen lassen.35 Konflikte mit den Gemeinden, Streitigkeiten über das Ausmaß der Bindung von Arbeitskräften an den Betrieb, Probleme der Fabrikordnungen und soziale Auseinandersetzungen zwischen Arbeiterschaft und Unternehmern gab es jedoch nicht nur in den größeren Betrieben des Elztales, sondern traten verbreitet auf. Ihre Gemeinsamkeiten und Besonderheiten sind im einzelnen noch zu untersuchen.36 Über den Pfennig »die Liebe zur Sparsamkeit mehr und mehr wecken«
Eine Folge davon, dass nun »Geld ins Tal« gebracht wurde, war die Entfaltung eines Bank- und Kreditwesens, nicht nur für Unternehmer, sondern für breite Kreise der Bevölkerung. Herausgegriffen sei hier die Sparkasse, die in enger Ab34 KAE, Gutach VII, wie Anm. 33, Briefwechsel Gütermann – Fabrikinspektion (über Bezirksamt Waldkirch) 12.9., 6.10., 14.12., 21.12.1905, 10.3., 26.3., 4.4.1906. Vgl. zu einem ähnlichen Problem KAE, Waldkirch VII, Getreidemühle Wilhelm Seifried 1905–1908, besonders das Schreiben der Fabrikinspektion vom 18.6.1908. 35 KAE, Kollnau VII, Arbeiterwohnungen der Kollnauer Baumwollspinnerei & Weberei 1891 (1889–1891); vgl. ebd., XXXVIII, Errichtung einer Kranken- und Unterstützungskasse der Kollnauer Baumwollspinnerei & Weberei 1871. Zu den Aktivitäten der Kollnauer Fabrik und ihrer Direktoren s. auch Anm. 26. 36 Eine Studie über Arbeitsordnungen und Arbeitskonflikte befindet sich in Vorbereitung. Ebenso bleibt die Entwicklung der einzelnen Betriebe im Elztal einer späteren Untersuchung vorbehalten.
30
| »Ein Wald von Fabriken, Fabrikantenvillen und Arbeiterwohnungen«
stimmung mit der Gemeinde gegründet wurde, um kleinere Einlagen zu schützen und zu mehren. Die Waldkircher Sparkasse eröffnete 1855 in den Räumen des Gasthauses »Zum Adler« ihren Geschäftsverkehr, die Elzacher 1873. In deren Satzung, 1888 von Gemeinderat und Bürgerausschuss bewilligt und anschließend gedruckt, hiess es in § 1: »Zweck der Sparkasse ist es, die kleineren Ersparnisse der Einleger zu sammeln, sicher anzulegen und durch Zinsenzuwachs zu vermehren. Die Benützung der Sparkasse steht jedermann frei.« Die Stadtgemeinde Elzach übernahm die Bürgschaft für Verbindlichkeiten (§ 2). Die Einzahlungen sollten sich zwischen 1 und 3000 Mark bewegen. Pro Person durfte sich nicht mehr als 10.000 Mark ansammeln, nur die Gemeinde konnte bis 30.000 Mark gehen (§ 22). Gleichzeitig richtete man eine »Pfennigsparkasse« ein. Ihr Zweck verdeutlicht den Zusammenhang mit den neuen Tugenden, wie sie sich auch in den Fabrikordnungen niederschlugen: »Um den Sinn und die Liebe zur Sparsamkeit mehr und mehr zu wecken und thunlichst fördern zu helfen, wurde dahier eine Pfennigsparkasse gegründet. Dieselbe bezweckt, den Bewohnern des Bezirks Elzach, insbesondere den arbeitenden Klassen, sowie auch Kindern und Minderjährigen Gelegenheit zu geben zur Ansammlung und nutzbringenden Anlage selbst der kleinsten Ersparnisse (...).« Dazu wurden in verschiedenen Verkaufsstellen Sparmarken zu 10 Pfg. ausgegeben, die auf eine Sparkarte für 10 Marken aufgeklebt werden mussten. War die Sparkarte voll, erhielt man ab 1.-- Mark ein »Sparbüchlein« und war damit in der Sparkasse selbst einlageberechtigt. In der neuen Satzung von 1904 (gedruckt 1905) fehlte dann diese Sonderregelung für die »Pfennige«. 37 „Anständige, wahrhaft erholende und belehrende Unterhaltung«
Ausdruck des Industrialisierungsprozesses waren auch die Gründungen eines Gewerbevereins, eines Arbeiterbildungsvereins oder des katholischen Gesellenvereins der Kolpingfamilie, die z.B. in Elzach 1900, 1902 und 1907 erfolgten.38 Unter dem Arbeiterbildungsverein darf man sich allerdings keinen Verein von Arbeitern vorstellen. Zum 1. Vorsitzenden der Elzacher Organisation wählten die 20 Gründer den Kaminfegermeister Friedrich Beck, der 1904 von Steinmetz Adam Bartholomä abgelöst wurde. Auch die weiteren Vorstandsmitglieder zählten zu den 37 KAE, Elzach XII, Sparkasse Elzach 1874 (1873)–1934; Sparkasse Elztal: 125 Jahre Sparkasse in Waldkirch. 1855–1980. Geschäftsbericht 1979. Waldkirch o.J. (1980) Text: Eduard Keil, Redaktion: Max Schätzle: hier waren die Satzungen natürlich ähnlich, vgl. z.B. 28 zur »Pfennigsparkasse«. 38 Weber: Elzach (Anm. 8), 89–90 (seine Angabe, der Arbeiterbildungsverein sei 1905 gegründet worden, muss aufgrund der in Anm. 39 zit. Quellen korrigiert werden).
Probleme der Industrialisierung im Elztal (1850–1914)
|
31
Handwerksmeistern, Zum Zweck des Vereins bestimmte das Statut von 1902 in § 1: »Der Verein gibt in geistiger Hinsicht seinen Mitgliedern Gelegenheit zum Austausch und zur Weiterbildung in allen Kenntnissen, welche das Gewerbe zum richtigen Betrieb, der Staat und die Gemeinde von tüchtigen Bürgern fordern. In sittlicher Beziehung weckt und nährt er durch anständige, wahrhaft erholende und belehrende Unterhaltung, namentlich auch durch Pflege der Gesangund der Redekunst, den Sinn für das Schöne und Gute, die Liebe zum Vaterland.« Dieser Zweck sollte durch Zusammenkünfte, Vorträge, Unterricht »in den für das bürgerliche und gewerbliche Leben unentbehrlichen Kenntnissen«, Benutzung von Büchersammlungen und Zeitschriften sowie durch »gemeinschaftliche Gesangs-, Redeübungen, Ausflüge, öffentliche Beteiligung an allen freudigen Ereignissen der Stadt und des Vaterlandes« gefördert werden (§ 2). Schließlich wollte man eine »Wanderunterstützungs- und Krankenkasse« einrichten, um den Mitgliedern jene Vorteile zuzuwenden, »welche auf Grundlage der Gegenseitigkeit der große deutsche Arbeiterverband für jeden ehrenfesten Arbeiter ohne Unterschied des Bekenntnisses erstrebt« (§ 3). In diesen Formulierungen schimmert durch, dass in dem Kreis jene Werte schon fest verankert waren, die man den Industriearbeitern über die Fabrikordnungen und andere Maßnahmen noch zu vermitteln suchte. Als erstes baute man eine Bibliothek auf, die aber anscheinend vernachlässigt wurde, dann bis 1910 auf immerhin 500 Bände anwuchs. Hier wirkte sich aus, dass man nicht nur dem Verband Badischer Arbeiterbildungsvereine, sondern auch der Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung in Berlin beigetreten war, von der man die Bücher bezog. 1905 organisierte der Verein einen Tanzkurs, 1906 beschloss er die Anschaffung einer Fahne; die »Bannerweihe« fand am 16. 6. 1907 statt. In das Zentrum des Vereinslebens rückte schnell die Sangespflege, so dass dann auch das fünfundzwanzigjährige Stiftungsfest im Juni 1926 mit einem Preis-Wettsingen verbunden wurde.39 Fischsterben durch Industrieabwässer?
Die Industrialisierung veränderte die äußere Gestalt der Elztäler Landschaft durch Fabrikgebäude, vermehrten Wohnungsbau, eine Eisenbahnstrecke – 1874 erreichte sie Waldkirch, 1901 Elzach – oder die Errichtung besonderer technischer Anlagen wie etwa einer Transportleitung der Mühle Seifried in Waldkirch 39 StAF, Landratsamt Emmendingen (Bezirksamt Waldkirch), Nr. 1921; Arbeiterbildungsverein Elzach: Festschrift zum 25jährigen Stiftungsfest. (Elzach 1926). Vgl. zur Geschichte der badischen Arbeiterbildungsvereine: »Die Freiheit« (Anm. 15), 37–39 (Sabine und Hans Imlau, mit weiteren Nachweisen).
32
| »Ein Wald von Fabriken, Fabrikantenvillen und Arbeiterwohnungen«
über die Elz zur Bahnlinie 1907.40 Ebenso wandelten sich die Arbeits- und Lebensverhältnisse der Menschen. Die Mechanisierung und Maschinisierung bedeutete aber nicht nur für die Arbeiterinnen und Arbeiter eine neue Situation, auf die sie sich einstellen mussten – wobei Probleme sichbar wurden, die uns heute recht bekannt vorkommen41 –, sie belastete auch in bisher nicht bekannter Weise die Umwelt.42 Wie in jüngster Zeit, so beschäftigte auch damals plötzlich auftetendes Fischsterben die Gemüter. Als etwa Anfang März 1898 eine größere Menge toter Forellen im Kollnauer Bereich der Elz entdeckt wurde, lag es nahe, das rot gefärbte Abwasser der Gütermannschen Färberei dafür verantwortlich zu machen. An der Anzeige beteiligte sich auch Direktor Jeanmaire von der Kollnauer Baumwollspinnerei und Weberei, der um die Güte des Wassers fürchtete, obwohl seine Fabrik selbst schon mehrmals wegen ihrer Ableitungen angegriffen worden war.43 Des weiteren wurde erklärt, das Wasser sei oft nicht hell genug für die Leimbereitung in einer Kollnauer Leimfabrik. Gütermann wies am 27.6.1893 die Vorwürfe zurück, »da das Wasser völlig unschädlich ist.« »In den 25 Jahren, seit die Färberei besteht, ist durch das Abwasser noch kein Fisch umgekommen (...).« Die Färberei werde ohne giftige Stoffe vorgenommen. Man sei bereit, den Beweis dafür anzutreten. Die Behörden – das Waldkircher Bezirksamt wie die badische Fabrikinspektion – gaben sich mit dieser Versicherung allerdings nicht zufrieden und veranlassten umfangreiche Untersuchungen und Gutachten der Großherzoglichen Chemisch Technischen Prüfungs- & Versuchs-Anstalt. In der Tat stellte sich dabei heraus, dass das Färbereiabwasser unschädlich war. Ein Unsicherheitsfaktor blieb: Bei plötzlicher Einleitung einer größeren Menge Abwasser in den Gewerbekanal, vor allem wenn niedriger Wasserstand herrsche, sei eine Verunreinigung möglich. Da dies hinsichtlich des Fischsterbens nicht mehr nachprüfbar war, musste sich die Fabrikinspektion zufreiden geben. Am 21.2.1894 droht sie jedoch an, bei den geringsten neuen Unregelmäßigkeiten auf einem Klärbassin für die Färbereiabwässer zu bestehen.44 40 KAE, Waldkirch XXXVII, Weizentransportanlage der Fa. Seifried 1907 (–1909); vgl. StAF, Gewerbeaufsichtsamt, Nr. 337. 41 Vgl. meinen Aufsatz: Arbeiter und technischer Fortschritt in der Anfangsphase der Industrialisierung. Vergleichende Regionaluntersuchungen (erscheint demnächst in einem Sammelband). [Dieser Aufsatz ist im vorliegenden Band abgedruckt.] 42 Das soll natürlich nicht heißen, dass es vorher keine Umweltbelastungen gegeben habe: Ich verweise nur auf den Raubbau am Wald durch das mittelalterliche und frühneuzeitliche Bergwesen. Jetzt erhielten sie aber eine neue Größenordnung, hinzu kamen neue Erscheinungsformen und Probleme. 43 KAE, Kollnau VII, Wintermantel gegen Baumwollspinnerei und Weberei wegen Wasserbenützung 1869/70 (–1871), Runzkanal und Anbringung eines Abzugsgrabens 1879 (1873–1888). 44 KAE, Gutach VII, Färbereiabwässer der Fa. Gütermann 1893/94 (–1934).
Probleme der Industrialisierung im Elztal (1850–1914)
|
33
1898 reichte die Firma Gütermann dann ein Gesuch zum Bau eines neuen Färbereigebäudes ein, für das auch ein Klärbecken vorgesehen war. Dagegen gab es Einsprüche – einiger Gemeinden, wiederum der Kollnauer Fabrik und einiger Einzelpersonen, die den Fischbestand gefährdet sahen –, denen jedoch kein Erfolg beschieden war. Die Vorwürfe hörten auch nach dem Bau des Klärbassins nicht auf. 1909 und 1911 etwa warfen erneut einige Firmen in Kollnau – hier die Baumwollspinnerei und Weberei – und Waldkirch Gütermann vor, trotz niedrigen Wasserstandes größere Abwassermengen in den Gewebekanal eingeleitet zu haben. Die durchgeführten Prüfmaßnahmen blieben ohne Ergebnis – im Normalzustand war das Abwasser unschädlich. Gütermann hatte bereits in seiner Antwort auf Einsprüche am 26.10.1898 drauf hingewiesen, dass die Abnahme des Fischbestandes in der Elz weniger durch seine Abwässer als vielmehr durch die gestiegene Nachfrage und das dadurch bedingte Ausfischen sowie vor allem durch die vorgenommenen Elzregulierungen zu erklären seien, »wodurch die am Ufer gewesenen Schlupfwinkel und Brutstätten der Fische durch glatte Uferungen in Wegfall kamen.«45 Und die Fabrikinspektion hatte am 7.8.1900 hinzugefügt, als es wieder einmal einen Konflikt um das Färbereiabwasser gab, man dürfe nicht jedes Fischsterben »ohne weiteres« mit der Firma Gütermann in Verbindung bringen: »Wir vermuten, dass das Absterben eine Folge der großen Hitze war.«46 Als eindeutig giftig erwiesen sich – im Unterschied zu Gütermann – die Abwässer der Leimfabrik von Ernst Fehr in Kollnau. Der Kalkgehalt, so stellte ein Gutachten der Großherzoglich Badischen Lebensmittel-Prüfungsstation an der Technischen Hochschule Karlsruhe am 16.11.1900 fest, sei so hoch, dass er den Fischtod hervorrufen könne. Fehr wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. Die Lösung des Problems bereitete allerdings erhebliche Schwierigkeiten. Ein Überpumpen in den Gewerbekanal – um durch die dortigen höheren Wassermengen eine Verminderung des Giftes zu erreichen – verbot sich wegen der Auswirkungen auf das Wasser der Badeanstalt. Schliesslich eingte man sich auf die Anlage von Teichen, in denen das Abwasser so lange stehen sollte, bis sich der Kalk gesetzt
45 KAE, Gutach VII, Errichtung eines neuen Färbereigebäudes der Fa. Gütermann 1898; die Vorwürfe 1909/1910 in der Akte wie Anm. 44. Erst heute scheint im übrigen allmählich ein Umdenken bei Elzregulierungen und -sanierungen einzusetzen, an die Schlupfwinkel und Brutstätten der Fische denkt man oft noch zu wenig. 46 KAE, Gutach VII, (Färbereiabwässer der Fa. Gütermann 1900). Allerdings war durch ein Fehler im Röhrensystem damals das Klärbecken übergelaufen. Probleme wegen der Wassernutzung hatten auch – ohne dass ich hier genauer darauf eingehe – die Lohmühle des Gerbers Gustav Wisser (1874–1891) und die angestrebte Zündhölzchenfabrik Fettig (1868–1873), beide in Elzach (KAE, Elzach VII). Vgl. zu Umweltschutzfragen bei der Fa. Gütermann und anderen Betrieben auch meinen in Anm. 11 zit. Artikel.
34
| »Ein Wald von Fabriken, Fabrikantenvillen und Arbeiterwohnungen«
hatte. Die Klagen rissen jedoch nicht ab, weil offenbar die Teiche nicht häufig genug gereinigt wurden.47 »Nicht unerhebliche Belästigungen«
Neben dem Abwasser erzeugte die Firma weitere Umweltschutzprobleme. 1900 ersuchte sie um Erlaubnis zur Errichtung einer Knochenstampfe und -siederei. Die Fabrikinspektion machte am 10.10.1901 auf »nicht unerhebliche Belästigungen« durch »üble Gerüche« und große Massen Fliegen, die angezogen würden, aufmerksam. Mehrere Einsprüche, auch der Kollnauer Baumwollspinnerei und Weberei nicht zuletzt wegen ihrer Arbeiterwohnungen, wandten sich gegen das Projekt, das dann doch am 21. 2. 1902 mit einigen Auflagen genehmigt wurde.48 Neuartige Belastungen der Umwelt stellten außerdem eine starke Rauchentwicklung – so in Elzach durch die Firma Gebr. Castell in der Nähe des Schulhauses, wie eine Beschwerde von 1886 zeigt49 – oder zu hohe Stauberzeugung und zu geringe Frischluftzufuhr innerhalb der Fabrikhallen dar: Damit mussten sich die Behörden etwa 1886 und 1889 bis 1891 bei der Firma Gütermann, aber auch bei den Textilfabriken von Sonntag und Haager und Hofer sowie bei der Edelsteinschleiferei Winterhalter beschäftigen.50 Liest man all diese Akten, so kann man nur darüber staunen, wie wenig bis heute aus den Problemen gelernt wurde. »Eine neue Epoche wirtschaftlicher Entwicklung für das Elztal?«
Die Textilindustrie blieb im Elztal für lange Zeit die bestimmende Branche. Nach dem Ersten Weltkrig unternahm der Ingenieur Carl Schantz einen – breits 1891 einmal erwogenen – Versuch, in Bleibach den früheren Bergbau wieder zu beleben und den Abbau von Blei, Zink, vielleicht auch Silber voranzutreiben. 1920 begann er mit den Prüfungen und ersten Bauten. 1922 und 1924 erhielt er die notwendigen Genehmigungen der Bergbehörde, die Grube »Gottessegen« zu betreiben. 1924 bildete er zusammen mit Graf Octav von Andlaw aus Bellingen und Paul Bassermann aus Freiburg die Gewerkschaft »Bleibacher Erzbergwerke«. Die Aussichten schienen vielversprechend. Am 16.3.1925 schrieb K. Bode über-
47 KAE, Kollnau VII, Abwasserableitung der Leimfabrik von Ernst Fehr 1900–1909 (1914). 48 KAE, Kollnau VII, Gesuch des Ernst Fehr ... 1900–1902. Dabei stellte sich übrigens heraus, dass Fehr bereits zuvor illegal Knochen gekocht hatte. 49 KAE, Elzach VII, Fa. Gebr. Castell 1885–1943. 50 KAE, Gutach VII, Revision der Fa. Gütermann 1886 (1885–1891).
Probleme der Industrialisierung im Elztal (1850–1914)
|
35
schwenglich im »Elztäler«: »Damit wird zweifellos eine neue Epoche wirtschaftlicher Entwicklung für das Elztal anbrechen.« Schon kurz darauf konnte davon nicht mehr die Rede sein. Seit Ende des Jahres ging es nur noch darum, die Verluste der Firma aufzufangen. Die alten Schächte, denen man folgte, standen voll Wasser. Das Weitergraben, wenngleich auf lange Sicht erfolgversprechend, war zu teuer. Auch ein Auswechseln der Unternehmensleitung half nichts mehr. 1926 wurden die Arbeiter entlassen und das Konkursverfahren eingeleitet. Auch spätere Ansätze zur Wiederinbetriebnahme ließen sich nicht verwirklichen.51 Damit waren alle Hoffnungen auf eine Umstrukturierung der Elztäler Industrie mit neuen Beschäftigungsmöglichkeiten aussichtslos geworden. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg setzten allmählich tiefer greifende Wandlungen ein.
51 KAE, Bleibach II, Bergwesen 1920 (–1955); Rambach: »Do blieb ich« (Anm. 4), 89–92.
Von Karl Neff zu Aleksej Stachanov Arbeiter und technischer Fortschritt in der Anfangsphase der Industrialisierung – Ein regionaler Vergleich* Auf dem Wege von Siegen über Kreuztal ins Wittgensteiner Land, nach Laasphe und Berleburg, liegt die kleine Stadt Hilchenbach. Hier war früher die Zollstelle zum Wittgensteinschen gewesen, hier wurden die Pferde und Fuhrwerke gewechselt, bevor sie den steilen Anstieg in das Rothaargebirge begannen. Daraus hatte sich ein Verwaltungsmittelpunkt und Marktflecken entwickelt, der vorübergehend sogar als Residenz eines der Fürsten von Nassau diente. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, auf die ich die Aufmerksamkeit richten möchte, gehörte Hilchenbach wie das gesamte Siegerland (und auch Wittgenstein) zur preußischen Provinz Westfalen. Das Siegerland machte in dieser Zeit einen tiefgreifenden Strukturwandel durch. Es zählt zu den ältesten Industrielandschaften Europas. Schon aus vorchristlicher Zeit ist die Nutzung der reichhaltigen Erzvorkommen nachgewiesen. Einige Forscher wollen Belege dafür gefunden haben, daß hier der sagenumwobene Wieland der Schmied wirkte. Im Mittelalter betrieb man einen intensiven Bergbau. Vor einiger Zeit hat man auf dem Altenberg, ganz in der Nähe von Hilchenbach, eine Bergbausiedlung aus dem 13. Jahrhundert freigelegt, mit Schmelzöfen, einer Erzwaschanlage, einer Schmiedewerkstatt, anderen Handwerksbetrieben, einzelnen Pingen – also Gruben für den Oberflächenabbau –, vor allem aber mit einer tiefen, kunstvoll abgestützten Schachtanlage, die der Forschung über den Bergbau im Mittelalter wertvolle Aufschlüsse vermittelt hat.1 Unterhalb des Altenbergs liegt das Dorf Müsen – heute nach Hilchenbach eingemeindet –, mit außerordentlich ergiebigen, bis ins 20. Jahrhundert hinein bedeutsamen Erzgruben. Die berühmte Grube Stahlberg wurde 1311 erstmals urkundlich erwähnt.2 * Erstpublikation unter dem Titel: Arbeiter und technischer Fortschritt in der Anfangsphase der Industrialisierung. Ein regionaler Vergleich. In: Neue Technologien – Neue Gesellschaft? Gewerkschaftliche Überlegungen und Antworten. Hg. von Josef Fuckerieder u. a. (GEW Forum). Freiburg i. Br. 1988, S. 54–72. 1 Die Bergbausiedlung Altenberg. Hrsg. vom Verein Altenberg e. V. 1979. – Der Vortragscharakter des Beitrages wurde beibehalten, die Nachweise sind auf ein Minimum beschränkt. Die Ausführungen beruhen zu einem großen Teil auf Forschungen, die ich während eines von der Stiftung Volkswagenwerk finanzierten Projektes »Stadt und Land während der Industrialisierung. Vergleichende Untersuchungen zu Deutschland, Ostmitteleuropa und Rußland« angestellt habe. 2 Vgl. Ich gab dir mein Eisen wohl tausend Jahr ... Beiträge zur Geschichte, speziell zur Wirtschafts- und Kulturgeschichte des Bergbezirkes Müsen und des nördlichen Siegerlandes.
Arbeiter und technischer Fortschritt in der Industrialisierung
|
37
Überall im Siegerland fanden sich solche Gruben und Pingen, in denen zum großen Teil Bauern als selbständige Gewerke auf eigene Rechnung je nach Anteilen Erz suchten. In der Nähe der Förderungsstätten entstanden Hütten- und Hammerwerke, die als Antriebskraft das Wasser der zahlreichen Bäche nutzen konnten. Zum Feuern bei der Erzverhüttung nahm man Holzkohle, die über eine besondere Form der Waldrodewirtschaft, den genossenschaftlich organisierten »Hauberg« gewonnen wurde: Die Eichen und Birken des Niederwaldes schlugen die Bauern in einer bestimmten Reihenfolge jeweils nach 15–20 Jahren. Das Holz kam, soweit man es nicht zu Hause als Brennmaterial benötigte, in den Kohlenmeiler. Mit der Eichenrinde oder Lohe, die früher einen unersetzlichen Grundstoff für die Lohgerberei bildete, stand noch eine zusätzliche Verdienstmöglichkeit zur Verfügung. Der abgehauene Schlag regenerierte sich von selbst. Für eine gewisse Zeit konnten die berechtigten Genossen hier auch Korn ernten – als Dünger diente die Asche des verbrannten Abfallholzes – oder ihr Vieh weiden lassen.3 Noch um die Mitte des 19. Jahrhunderts lag das Siegerland bei der Stahlerzeugung an vorderster Stelle in Deutschland; die Qualität des Stahles war weltberühmt. Doch die Anzeichen des Abstieges ließen sich bereits nicht mehr übersehen. Das 1784 in England entwickelte Puddelverfahren ersetzte das Holz durch Steinkohle und Koks als Brennstoff, produzierte mehr als bei den bisher üblichen Methoden und trotzdem guten Stahl und senkte die Herstellungskosten. Davon profitierte nicht nur die englische Eisen- und Stahlindustrie, sondern auch das Ruhrgebiet mit seinem Standortvorteil hinsichtlich der Kohle. Im Siegerland erkannte man darüber hinaus zu spät die Notwendigkeit einer verbesserten Verkehrserschließung. Erst 1861 konnte die Eisenbahnverbindung ins Ruhrgebiet und ins Bergische Land in Betrieb genommen werden. Den Ruhrunternehmen gelang es dann auch noch aufgrund ihres Einflusses in der Eisenbahngesellschaft, die Frachttarife zu Lasten des Siegerlandes zu gestalten. Hilchenbach mußte übrigens noch bis 1884 auf den Bahnanschluß warten. Durch weitere neue Technologien, vor allem das Bessemer- und Thomasverfahren, geriet das Siegerland immer mehr ins Hintertreffen. Obwohl zwischen 1861 und 1913 die Produktion der Hüttenwerke außerordentlich gesteigert wurde, konnte der übermächtigen Konkurrenz bei der Massenstahlherstellung nicht standgehalten werden. Die Chance für die Zukunft lag bei qualitativ hochwertigen Roheisen- und Stahlspezialsorten, bei denen in der Tat heute noch Siegerländer Betriebe eine gewisse Bedeutung einnehmen.4 Zur 900-Jahr-Feier zusammengetragen und bearbeitet von Wilhelm Müller-Müsen. Hrsg. vom Kulturverein Müsen e. V. Müsen (1979). 3 Winfried Ranke, Gottfried Korff: Hauberg und Eisen. Landwirtschaft und Industrie im Siegerland um 1900. München 1980. 4 Jürgen H. Schawacht: Standortprobleme des Siegerländer Wirtschaftsraumes dargestellt am Beispiel der Eisenwirtschaft. In: Natur- und Landschaftskunde von Westfalen (1976)
38
|
Von Karl Neff zu Aleksej Stachanov
Die neuen Bedingungen führten seit Mitte des 19. Jahrhunderts zu Veränderungen der betrieblichen Organisation: An die Stelle der Gewerkschaften – der Vereinigungen von einzelnen Bergarbeiter-Unternehmern – traten Aktiengesellschaften. Große Hüttenwerke siedelten sich entlang der Bahnlinien an. Erst jetzt wurde das Siegerland »industrialisiert«, so daß ich im folgenden noch von einer Anfangsphase sprechen kann. Viele Dorf- und Kleinstadtbewohner versuchten, ihre Doppelexistenz als Bauer und Arbeiter beizubehalten. Allerdings wurde das Leben in der Regel wesentlich härter. Die Gewöhnung an neue Arbeitsmethoden und den Produktionsablauf im Großbetrieb sowie die häufig viel weiteren, normalerweise zu Fuß zurückgelegten Wegstrecken zu den nun ja nicht mehr wie früher meist im Ort liegenden Fabriken erhöhten die Belastungen des Arbeiterbauern. Am kurzen »Feierabend« wartete die Tätigkeit auf seinem kleinen Hof auf ihn, den ansonsten stärker als zuvor seine Frau und Kinder sowie weitere Familienangehörige bewirtschaften mußten. Hinzu kam, daß der Hauberg jetzt für die Hüttenwerke keine Funktion mehr hatte und die Preise für Lohe stark fielen, weil inzwischen ausländische Gerbmittel, dann allmählich auch chemische Mittel, bevorzugt wurden. Das Holz diente überwiegend nur noch dem häuslichen Eigenbedarf. Die für das Siegerland charakteristische Wirtschaftsform verfiel, den Niederwald des Hauberges ersetzten mehr und mehr schnell wachsende Fichtenkulturen, von denen man sich größeren wirtschaftlichen Nutzen versprach.5 Diese Skizze mag genügen, um die Rahmenbedingungen des Umbruchs anzudeuten, in dem sich das Siegerland in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts befand. Kehren wir nach Hilchenbach zurück. Hier erreichte damals das Gerbereigewerbe einen Höhepunkt seiner Bedeutung. Rohhäute und Gerberlohe kamen zum großen Teil aus dem Ausland. Gegen Ende des Jahrhunderts setzte jedoch Nr. 3, 65–71. Zum Eisenbahnanschluß Hilchenbachs: Siegener Zeitung, 30.5.1973 (Jubiläumsausgabe). Vgl. Richard Utsch: Die Entwicklung und volkswirtschaftliche Bedeutung des Eisenerzbergbaues und der Eisenindustrie im Siegerland. Ein Beitrag zur deutschen Wirtschaftsgeschichte. Görlitz 1913. 5 Matthias Eisen: Der Wandel in den Arbeitsverhältnissen in der Siegerländer Erz- und Eisenindustrie, insbesondere in den Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Diss. Köln 1925 (masch.); Walther Katz: Die soziale Lage der Siegerländer Bergarbeiter. Diss. Gießen 1931; Harald v. Schenckendorff: Die Entwicklung des Siegerländer Bergbaus – unter besonderer Berücksichtigung des Bergbaureviers Müsen. Schriftl. Hausarbeit für das Lehramt an Volksschulen. 0. 0. u. J. (1971); Heidrun Schmidt: Die kulturlandschaftliche Prägekraft des ehemaligen Eisenerzbergbaus, untersucht am Beispiel der Siedlung Müsen im Siegerland. Schriftl. Hausarbeit zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an der Grundund Hauptschule. Hüttental-Weidenau 1971; Rudolf lrle: Die Entstehung des Cöln-Müsener-Bergwerks-Actien-Vereins. Hausarbeit für die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an der Grund- und Hauptschule. Gesamthochschule Siegen 1975. Vgl. allgemein (mit Hinweisen zum Siegerland): Rolf Peter Sieferle: Der unterirdische Wald. Energiekrise und Industrielle Revolution. München 1982.
Arbeiter und technischer Fortschritt in der Industrialisierung
|
39
ein Niedergang ein, weil Betriebe in anderen Gegenden schneller und preisgünstiger produzieren konnten. Konkurse häuften sich. Anscheinend nicht unmittelbar davon betroffen war eine Folgeindustrie, die Leimsiederei, die aus der bei der Lederherstellung nicht verwertbaren Fett- oder Unterhaut Leim erzeugte. Um 1850 gab es in Hilchenbach 4 solche Betriebe, in denen 5 Arbeiter jährlich rund 290 Zentner Leim produzierten. 1904 waren es 6 Fabriken mit 110 Arbeitern und 25.000 Zentnern Leim.6 In einem dieser Werke spielt die folgende Episode. Am 28.6.1897 meldet der Hilchenbacher Leimsieder-Fabrikant Fritz Weiss der Polizei, der Fabrikarbeiter Karl Neff aus Helberhausen – einem Dorf ganz in der Nähe – habe vor zwei Tagen ohne vorherige Aufkündigung seine Arbeit verlassen und sei nicht wiedergekehrt. Dem Vernehmen nach sei er jetzt als Hirte tätig. Herr Weiss fordert von der Polizei Rückführung und Bestrafung des Arbeiters, weil gemäß der ausgehängten Arbeitsverordnung eine achttägige Kündigungsfrist bestanden habe. Karl Neff ist schnell gefunden, schon einen Tag später befragt ihn die Polizei zu den Beschuldigungen. Er bestätigt die Angaben des Fabrikherren, glaubt jedoch zu seinem Verhalten berechtigt gewesen zu sein, »weil ich – wie er laut Protokoll ausführt – die Fabrikordnung nicht anerkannt und nicht unterschrieben habe«. Die Behörde sieht von einer Bestrafung ab, belehrt den Arbeiter über die gesetzlichen Bestimmungen und empfiehlt ihm, sich mit der Firma Weiss gütlich auseinanderzusetzen. Dies gelingt offenbar, denn am 2.7.1897 zieht Herr Weiss seine Anzeige zurück und erklärt, er habe den Arbeiter Neff auf dessen Ersuchen hin entlassen.7 Vermutlich kehrt dieser als Hirte auf die Weide zurück. Der Vorgang war keinesfalls ein Einzelfall, und nicht immer ging es so glimpflich ab wie hier: Hin und wieder mußten Strafen und Zwangsmittel angewendet werden, weil der Unternehmer auf der »Rückführung«, zumindest bis zum Ablauf der Kündigungsfrist, bestand, der Arbeiter einer entsprechenden behördlichen Anordnung keine Folge geleistet hatte. Konfliktherde waren unterschiedliche Auslegungen der Arbeitsordnung, ja deren vollständiges Ignorieren durch die Arbeiter sowie Auseinandersetzungen um die Lohnbemessung. Besonders heftig fielen 1898 Streitigkeiten in einem Hilchenbacher Dampfsägewerk aus, als der Besitzer den Akkordlohn einführte, dem sich viele Tagelöhner verweigerten.8 Offenbar fiel einer ganzen Reihe von Arbeitern die Gewöhnung an die wachsende Disziplinierung und betriebliche Umorganisation schwer, die mit der Einführung neuer Technologien und der Produktionserweiterung zusammenhingen und sich etwa in neuen Lohnformen und Arbeitsordnungen ausdrückten. Gewiß zog nicht jeder eine solch radikale Konsequenz wie Karl Neff (wenngleich man 6 Stadtmuseum Hilchenbach: Museumsführer, Blatt 12. 7 Stadtarchiv Hilchenbach, Nr. 375. 8 Ebd.
40
|
Von Karl Neff zu Aleksej Stachanov
eine Dunkelziffer unterstellen muß). Er hatte wahrscheinlich – leider läßt sich seine Biographie zumindest aus den Akten nicht mehr genau rekonstruieren – keine Möglichkeit, in Helberhausen auf einem Hof wenigstens einen Teil seines Bedarfs zu decken. Früher hätte sich ihm ein gerade in diesem Dorf verbreitetes und einträgliches Gewerbe als Alternative angeboten: Seit Ende des 17. Jahrhunderts wurden hier schöne hölzerne Löffel geschnitzt, pro Tag und Schnitzer durchschnittlich 60 Stück (übrigens entstanden aus einem Zeitvertreib beim Viehhüten). Ein guter Teil ging über den Export in alle Welt. 1819 verdienten von den 370 Einwohnern Helberhausens 80 ihren Lebensunterhalt auf diese Weise.9 Inzwischen waren hölzerne Löffel kaum noch begehrt. Nur noch wenige Helberhäuser gaben sich mit dem Schnitzen ab. Karl Neff war nicht der einzige aus diesem Dorf, der in Hilchenbach Arbeit und Verdienst suchte. Und interessanterweise tauchen gerade in der Akte, die sich mit Streitigkeiten zwischen Arbeitskräften und Unternehmern beschäftigt, erstaunlich viele Helberhäuser auf. Offenbar empfanden sie den Druck, den die Fabrik für ihre traditionelle Lebenswelt bedeutete, besonders stark. Werfen wir einmal einen Blick in die Arbeitsordnungen dieser Jahre, inwieweit sie das ungewohnte, fremdartige System spiegeln. Leider sind mir keine Ordnungen von den Hilchenbacher Firmen bekannt geworden, in denen sich die erwähnten Konflikte abspielten. Aber diejenigen, die sich aus anderen Orten des Siegerlandes erhalten halben, geben durchaus aufschlußreiche Fingerzeige. Zunächst einmal wurde der Rahmen der Arbeitsverhältnisse geregelt: die Arbeitszeit (in diesen Jahren meist 12–13 Stunden einschließlich insgesamt zwei Stunden Pausen), die Lohnformen, das »Arbeitsnachweisbuch«, die Kündigungsgründe und -fristen – ein Stein des Anstoßes gerade für bisherige Tagelöhner, wie Beispiele aus Hilchenbach zeigen –, Strafvorschriften, teilweise auch Unterstützungsleistungen in Krankheitsfällen. Selbst die hygienischen Verhältnisse werden oft angesprochen. Die Benutzung von Aborten ist anscheinend noch nicht unbedingt üblich; manchmal mußte die Gewerbeinspektion auf die Einrichtung entsprechender Anlagen drängen. Daneben geht es um das persönliche Verhalten des Arbeiters im Betrieb. Gerade in diesem Bereich weichen die Fabrikordnungen, die sonst in der Regel einem Muster folgen, an einzelnen Punkten voneinander ab, greifen besondere Probleme in ihrer Firma auf. Wenn bestimmte Punkte in späteren Fassungen nicht mehr auftauchen, weist dies auf deren Bedeutung in einer Anfangs- oder Um9 Stadtmuseum Hilchenbach: Museumsführer, Blatt 11; vgl. Johann Heinrich Jung (-Stilling): Über die Nassau-Siegensche hölzerne Löffel-Manufaktur zu Helberhausen. Neudruck in: Siegerland 37 (1960) 41–50; ders.: Der brave Hirt. In: ebd., 69–73; KarlFriedrich Menn: Wirtschaftliche und soziale Strukturwandlungen in Landgemeinden des Siegerlandes. Siegen 1957.
Arbeiter und technischer Fortschritt in der Industrialisierung
|
41
stellungsphase hin. Im Zentrum steht dabei die Disziplin des Arbeiters. Streng verboten ist es, die Arbeit außerhalb der Ruhepausen zu unterbrechen. In zwei Ordnungen aus den Jahren 1900 und 1901 wird sogar »untersagt, während der Arbeitszeit zu schlafen«. Es ist natürlich schwer zu beurteilen, ob hier die Unternehmensleitungen zu detailbesessen waren oder ob tatsächliche Vorkommnisse zugrunde lagen. Möglicherweise reagierten einige Arbeiter dadurch auf einen Umstellungsprozeß, der sie überforderte. Zehn Jahre später ist der betreffende Halbsatz jedenfalls aus der Arbeitsordnung getilgt.10 Harte Strafen wurden für Verspätungen und unentschuldigtes Fernbleiben angedroht – und auch praktiziert. Ein Fall beschäftigte die breite Öffentlichkeit. Die Charlottenhütte in Niederschelden – ein bedeutendes Werk, in dem Friedrich Flick ab 1915 die Grundlage für seine spätere Expansion legte – verweigerte ihren Arbeitern 1913 die Erlaubnis zur Teilnahme an der Jahrhundertfeier zum Jubiläum der Befreiungskriege gegen Napoleon. Anscheinend dachten jedoch einige Arbeiter sehr patriotisch und besuchten die Feier trotzdem. Die Firma betrachtete dieses Verhalten als schwere Pflichtverletzung und verhängte hohe Geldstrafen. Die Entrüstung in der Öffentlichkeit über eine solche Mißachtung vaterländischer Gesinnung – die von der Unternehmensleitung ansonsten natürlich gern gesehen wurde – galt weniger als die exemplarische Durchsetzung der Disziplin.11 Wer schlecht arbeitet, muß kostenlos ein Ersatzstück anfertigen, Abfälle und andere Materialien dürfen nicht privat angeeignet werden. Besuch am Arbeitsplatz ist streng untersagt. Auch darf der Arbeiter sich nicht mit »Fremden« unterhalten und nicht einmal mit Kollegen »unnöthige Gespräche« führen. Verboten sind »Ruhestörungen, ungebührliches Benehmen gegen Vorgesetzte und Mitarbeiter«, Streitereien, »Thätlichkeiten«. Den Vorgesetzten muß unbedingt Gehorsam geleistet werden. Die Vielzahl der Regelungen zu diesem Punkt und der Nachdruck, der auf ihn gelegt wurde, deuten darauf hin, daß die Einfügung in eine straffe Hierarchie und ein quasi-militärisches Verhältnis nicht selbstverständlich waren 10 Stadtarchiv Siegen: Amt Eiserfeld, vorl. Nr. A 72; Gemeinde Klafeld-Geisweid, Nr. A 145. Zu den Konflikten um Aborte vgl. ebd.: Amt Eiserfeld, vorl. Nr. A 184, 230, 328; Stadtarchiv Hilchenbach, Nr. 1263. Daß das Schlafverbot am Arbeitsplatz nicht auf das Siegerland beschränkt war, zeigen viele Beispiele, etwa die Arbeitsordnung der Fa. Krupp, Essen, 1892, bei Alf Lüdtke: Arbeitsbeginn, Arbeitspausen, Arbeitsende. Skizzen zu Bedürfnisbefriedigung und Industriearbeit im 19. und frühen 20. Jahrhundert. In: Sozialgeschichte der Freizeit. Untersuchungen zum Wandel der Alltagskultur in Deutschland. Hrsg. von Gerhard Huck. Wuppertal 1980, 95–122, hier 104; Arbeitsordnung der Fa. Gütermann, Gutach/Elztal, 1868, bei Heiko Haumann: Ein Wald von Fabriken, Fabrikantenvillen und Arbeiterwohnungen! Probleme der Industrialisierung im Elztal (1850–1914). In: »s Eige zeige«. Jahrbuch des Landkreises Emmendingen für Kultur und Geschichte 1 (1987) 107– 128, hier 116. 11 Stadtarchiv Siegen: Amt Eiserfeld, vorl. Nr. A 142.
42
|
Von Karl Neff zu Aleksej Stachanov
und »Widersetzlichkeiten« zumindest befürchtet wurden. Sogar bei einem Unfall durfte der Arbeiter nicht eher die Fabrik verlassen, bis er seinem Vorgesetzten Meldung gemacht hatte. Nie mehr als drei Personen gleichzeitig sollten sich bei diesem einfinden, wenn es um »Anliegen, Wünsche oder Beschwerden« ging.12 Fabrikordnungen hatten vielerlei Funktionen, und sie entsprachen nicht unbedingt der tatsächlichen Verfassung im Betrieb. Sie sagen etwas aus über das »Erziehungskonzept« der Unternehmer, über ihr Bild vom Arbeiter. Weiter sind sie Versuche, dazu beizutragen, die Arbeiter an den Rhythmus des Produktionsablaufs zu gewöhnen – was in der Praxis viel nachhaltiger von den Maschinen selbst besorgt wurde. Zugleich sollen sie helfen, die Arbeiter in die Firma einzubinden, damit sich allmählich ein fester, auf die betrieblichen Bedürfnisse zugeschnittener Stamm an Arbeitskräften herausbildet.13 Aber sie weisen ab und zu auch auf wirkliche Probleme beim Anpassungsprozeß der Arbeiter an neue Bedingungen hin. Neben den erwähnten Beispielen ist dafür der Kampf gegen Trunkenheit am Arbeitsplatz symptomatisch. In den eben herangezogenen Arbeitsordnungen drohte dafür sofortige Entlassung. Das ist auf den ersten Blick verwunderlich, weil nicht nur der Alkoholkonsum der Bauern in der Erntezeit oder bei Festen, teilweise auch der von Handwerkern zu bestimmten Gelegenheiten als »normal« galt, sondern bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein der Schnapstrunk bei schwerer körperlicher Arbeit in der Industrie von einigen Unternehmern geradezu gefördert wurde, um bei Erschöpfungszuständen Kräfte zu mobilisieren und zu weiterer Leistung anzuregen. Vielfach diente er gar als Nahrungsersatz. Offenbar waren jetzt aber Maschinen und Arbeitsablauf in manchen Bereichen so kompliziert geworden, daß der Alkohol am Arbeitsplatz seine Funktion verloren hatte, ja schädlich geworden war. Dafür spricht auch, daß man durchaus differenzierte und die Verbotsbestimmung nicht unbedingt durchsetzte. So wurde es in einer Firma geduldet, daß die Arbeiter hin und wieder in der letzten Stunde Schnaps besorgten und auf diese Weise zum Feierabend überleiteten. Friedrich Flick – so wird berichtet – drückte in der Charlottenhütte ein Auge zu, wenn Hochofenarbeiter, deren Ofen derzeit nicht betreut zu werden brauchte, Alkohol tranken. Allerdings spiegelte sich in jener Vorschrift der Arbeitsordnung nicht allein das Bestreben, den Alkohol je nach dem Stand der Produktionsorganisation zu verbannen oder lediglich verbal einen neuen bürgerlichen Tugendkanon aufzustellen. Der Alkoholismus nahm, den behördlichen Meldungen nach zu schlie12 Stadtarchiv Siegen, wie Anm. 10. 13 Vgl. Rainer Wirtz: Die Ordnung der Fabrik ist nicht die Fabrikordnung. Bemerkungen zur Erziehung in der Fabrik während der frühen Industrialisierung an südwestdeutschen Beispielen. In: Arbeiteralltag in Stadt und Land. Neue Wege der Geschichtsschreibung. Hrsg. von Heiko Haumann. Berlin 1982, 61–88.
Arbeiter und technischer Fortschritt in der Industrialisierung
|
43
ßen, erheblich zu – starker Alkoholkonsum eben nicht mehr zu bestimmten Anlässen wie in der bäuerlich-handwerklichen Welt, sondern als ständiges Problem. Die Zahl der »Trunkenbolde« wuchs an, jener Menschen, die von der Behörde erfaßt und in die »Säuferliste« eingetragen wurden. In den Gasthäusern, wo diese aushing, durften keine »geistigen Getränke« an die betreffenden Personen ausgegeben werden. Zumindest im Hilchenbacher Bereich sind es vorwiegend Bergleute und Tagelöhner, die in den Akten genannt werden. Es scheint so, als ob hier der erhöhte Alkoholgenuß eine Fluchtreaktion auf Veränderungen war, die manch einer nicht oder nur schwer verkraftete. Auch dem sozialen Trinken, in Geselligkeit, kam nun als möglichem Gegengewicht gegen jene Veränderungen eine neue Bedeutung zu. Darauf weist etwa das »Schnapskasino« in dem Dörfchen Grund bei Hilchenbach (dem Geburtsort Jung-Stillings) hin. Schnapskasinos sind bisher vor allem aus dem Ruhr- und Saargebiet bekannt. Sie entstanden seit Ende der achtziger Jahre als Selbsthilfe-Einrichtungen meist von Bergleuten, um unabhängig vom bürgerlichen Kleinhandel oder von durch die Unternehmer kontrollierten Läden nicht nur Alkohol, sondern auch Lebensmittel billig und in guter Qualität zu besorgen. Diese Sonderform von Konsumvereinen bot darüber hinaus die Möglichkeit, als »geschlossene Gesellschaft« unkontrolliert und auch nach der Polizeistunde zusammenzukommen. Dies war für die Schichtarbeiter wichtig, die sonst oft vor verschlossenen Kneipen standen und damit von einem bedeutsamen Teil des Gemeinschaftslebens ausgeschlossen blieben. Zugleich dienten manche Schnapskasinos als Ort politischer Versammlungen, zur Besprechung von Arbeitskämpfen und anderer betrieblicher Fragen. Davon konnte in Grund allerdings nicht die Rede sein. Hier trafen sich 1888 – mit einem Vorläufer seit 1886 – Interessen eines Gastwirtes, dem die Konzession entzogen worden war, mit den Bedürfnissen einiger Arbeiter – vorwiegend aus der Metallbranche und dem Bergbau – sowie Bauern, sich im Großeinkauf Alkohol zu beschaffen und als »geschlossene Gesellschaft« auch noch nach der Polizeistunde zusammenzusitzen. Warum sie gerade die Form des Schnapskasinos wählten, die aufgrund der Vorgänge im Ruhrgebiet anrüchig war und 1890 auch zur Einleitung einer behördlichen Untersuchung führte, geht aus den Akten nicht hervor.14 Auf dem Hintergrund der strukturellen Wandlungen, die tief in das Leben jedes Einzelnen eingriffen, liegt jedoch die Vermutung nahe, daß das Schnapskasino ein Teil jener Versuche darstellte, neue Arten der Kommunikation und der Geborgenheit zu finden. Die Folgen der neuen Technologien bedeuteten für viele Menschen im damaligen Siegerland gleichsam eine »neue Gesellschaft«, auf die sie sich nicht 14 Vgl. zu dem ganzen Komplex (mit weiteren Nachweisen) Heiko Haumann: »Schnapskasinos« auch im Siegerland. Beobachtungen und Fragen zur Umbruchzeit der Industrialisierung. In: Siegerland 59 (1982) H. 1–2, 62–66.
44
|
Von Karl Neff zu Aleksej Stachanov
ohne weiteres umstellen konnten. Eine dezentrale Industrialisierung gilt als vorteilhaft, weil die meisten Arbeiter mit ihrer kleinen Landwirtschaft nicht nur eine ökonomische Reserve für den Notfall besitzen, sondern durch ihre Verhaftung im dörflichen Milieu die Belastungen in der Fabrik leichter verkraften können als jene, die sich bindungslos in einem völlig neuen Milieu zurechtfinden müssen. Wie man sieht, gingen die Veränderungen trotzdem nicht spurlos an den Betroffenen vorüber. Die neuen Verhältnisse beeinflußten die sozialen Beziehungen, die Wertvorstellungen, die Lebensweise auch im Dorf. Die alte, gesicherte Welt löste sich auf, neue Sicherheiten waren noch nicht überall angeeignet. Die Doppelexistenz als Arbeiter und Bauer vermag allerdings einen Teil der Erklärung dafür zu liefern, warum es im Siegerland zu keinen größeren organisierten Arbeitskämpfen kam. Der oft lange Heimweg und die landwirtschaftliche Tätigkeit am Abend behinderten zudem eine enge Kommunikation der Betriebsangehörigen. Darüber hinaus förderte die hier verbreitete spezifische Form des Pietismus, die Erweckungs- und Gemeinschaftsbewegung,15 den Verzicht auf eine offene Austragung von sozialen Konflikten ebenso wie der Patriarchalismus vieler Unternehmer. Diese strebten häufig ein verhältnismäßig enges persönliches Verhältnis zu »ihren« Arbeitern an, gaben Ratschläge in Familienangelegenheiten und halfen dem »treuen, fleißigen und zuverlässigen Arbeiter« auch schon einmal in einer Notlage.16 Im Siegerland, das ich nun allmählich verlassen will, verliefen die Konflikte über den technologischen und gesellschaftlichen Wandel in der Regel nach außen hin friedlich. Kann man deshalb diese Region als wenig interessant für den Geschichtsverlauf abtun und mit einem Lächeln über die Entscheidung Karl Neffs, Hirte zu werden, hinweggehen? Ich glaube nicht. Was hier geschah, hat durchaus seinen »Eigenwert«, nicht allein für die Siegerländer selbst, sondern auch für uns. Wir können uns, gewiß nur tastend, Formen der inneren Problemverarbeitung nähern, die gleichberechtigt neben anderen zu stehen haben.
15 Vgl. hier nur: Unter dem Wort. Das evangelische Siegerland in Vergangenheit und Gegenwart. Siegen 1967. 16 Vgl. Stadtarchiv Siegen: Amt Eiserfeld, vorl. Nr. A 504 (Arbeitsordnung); Karl Roth: Allen Gewalten zum Trotz sich erhalten. Geschichte der Firma Engelhard Achenbach sel. Söhne, Buschhütten. Rückblick und Erinnerungen nach einer 62jährigen Dienstzeit bei der Firma Achenbach Söhne. Buschhütten 1944 (Ms.), 24–25. Insgesamt gehe ich hier auf diese Probleme ebensowenig ein wie auf das Verhalten von Arbeitern in Vereinen, Gewerkschaften, Politik u. ä. Verwiesen sei lediglich auf Helmut Busch: Die Stoeckerbewegung im Siegerland. Ein Beitrag zur Siegerländer Geschichte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Siegen 1968; (dis)harmonien. Fotos und Dokumente zur Siegerländer Gesellschaftsgeschichte 1830–1945. Katalog zur Ausstellung, 4.–31.1.1980. Hrsg. von der Arbeitsgruppe Regionalgeschichte Siegen. 0. 0. u. J. (Siegen 1980).
Arbeiter und technischer Fortschritt in der Industrialisierung
|
45
Als heftigste Reaktion auf die Einführung neuer Technologien, die ich hier wenigstens streifen will, gilt der »Maschinensturm«. Dies war keineswegs die ziellose, unüberlegte gewaltsame Ausschreitung, als die sie von zeitgenössischen Kritikern hingestellt wurde und bis heute von manchen Historikern gesehen wird. Die Formen der Aktionen entstammten den symbolischen Ritualen der »plebeischen Kultur« im Dorf und in der Stadt, die teilweise magische Züge trugen – vom Ritual wurde eine konkrete Wirkung erwartet – und leicht handfest werden konnten. Sie deuten darauf hin, daß es hier um die Frage des Lebenszusammenhangs ging. Nicht gegen die Maschinen als solche richteten sich Wut und Protest, auch wenn zahlreiche Maschinen beschädigt oder zerstört wurden. ln vielen Fällen waren die Anführer durchaus schon an Maschinen gewöhnt und machten sich ihre Vorteile zunutze. Diese stellten jedoch – neben Häusern, Haushaltsgegenständen, Rohstoffen oder Fertigwaren – Gegenstände dar, deren man habhaft werden konnte und über deren Vernichtung man den Unternehmer und seine Organisation der Arbeitsprozesse – für die die Maschine Symbolcharakter annahm – unter Druck setzen wollte. Anlaß gaben meistens Arbeitsbedingungen im Rahmen eines Verlagssystems, in dem die Arbeiter dezentral zu Hause produzierten und von einem »Verleger« Rohstoffe und häufig auch Produktionsmittel erhielten, der dafür den Hauptteil des Ertrages behalten konnte. Die Arbeiter begehrten auf, wenn sie die Verhältnisse – Anforderungen an die Qualität, Bezahlung, Art der Beschäftigung, Übergang zur Fabrikorganisation – für ungerecht und ihre »Ehre« für verletzt hielten. Diese Ehre, das war die Summe der überkommenen sittlichen Ordnung, in der Beruf, Status, Interesse, persönliche Identität und Lebensweise eine Welt bildeten. Wenn die Unternehmer um ihres Profits willen an Sitte und Gewohnheit rührten, dann drohten sie eben diese Lebenswelt zu zerstören. Die Arbeiter antworteten darauf nach vertrautem Muster. Sie forderten das »alte Recht« und wandten sich gegen einen »Fortschritt«, den sie nicht als solchen verstanden. Waren sie deshalb rückwärtsgerichtet, reaktionär? Mit einer solchen – immer noch verbreiteten – Einschätzung macht man es sich zu einfach. Es ging den Menschen damals schließlich um ihre Existenz, um die Gestaltung ihrer Gegenwart und ihrer Zukunft. Daran wollten sie selbst im Rahmen dessen, was sie für richtig hielten, mitwirken und sich nichts völlig Neues, das ihr Dasein einschneidend verändern würde, von außen aufzwingen lassen. Dabei gab es durchaus Versuche, etwa über das Organisationsmodell der Assoziation – das Bedeutung bis in die spätere marxistische Arbeiterbewegung hinein erlangte –, die überlebte hierarchisch-ständische Zunftverfassung zu überwinden. Gegen den Zugriff von Kapitalismus – und Staat, muß man hinzufügen – sollten autonome Lebensbereiche gesichert werden.17 17 Vgl. Ralf Peter Sieferle: Fortschrittsfeinde? Opposition gegen Technik und Industrie von der Romantik bis zur Gegenwart. München 1984, 65–82 (auch insgesamt in unserem Zu-
46
|
Von Karl Neff zu Aleksej Stachanov
Nicht immer stieß die Einführung des kapitalistischen Fabriksystems auf Widerstand. Vielfach wurde es als Verbesserung angesehen und geradezu begrüßt. Diese Reaktion auf technischen Fortschritt und gesellschaftlichen Wandel möchte ich hier nur kurz an einem Beispiel aus unserer näheren Umgebung vorstellen. 1867 gründete der Wiener Unternehmer Max Gütermann in der Elztalgemeinde Gutach eine Nähseidenfabrik, die heute noch besteht. Die Wahl fiel auf diesen Standort, weil das – damals – klare und weiche Wasser der Elz zum Färben besonders geeignet war und die Wasserkraft zudem zur Energieversorgung genutzt werden konnte. Auch die Verkehrsverbindungen erwiesen sich als recht günstig: Die nächste Bahnstation – Denzlingen – lag zehn Kilometer entfernt. Ende 1874 erreichte dann die Elztalbahn Waldkirch, 1901 wurde das letzte Teilstück bis Elzach eingeweiht. Darüber hinaus erhoffte sich Gütermann ein ausreichendes Reservoir an billigen Arbeitskräften aus der ländlichen Umgebung. Facharbeiter standen ebenfalls zur Verfügung, da schon früher einige kleinere Textilfirmen in der Umgebung ihre Tätigkeit aufgenommen hatten. Gütermann expandierte außerordentlich schnell und beschäftigte am Vorabend des Ersten Weltkrieges bereits 1800 Personen. Er hielt damit auf dem Arbeitsmarkt zumindest des oberen Elztales eine fast uneingeschränkte Monopolstellung. Obwohl man keineswegs die Sozialleistungen der Firma übersehen darf, die teilweise über das seinerzeit jeweils Übliche hinausgingen, waren die Fabrikordnung und die Arbeitsorganisation gewiß nicht minder straff als anderswo. Soziale Konflikte wurden auch hier nicht vermieden. Und doch: bis in unser Jahrhundert hinein – zu Zeiten, als es keinen Werksverkehr gab – zogen morgens und abends Mädchen und Frauen aus dem oberen Elztal fröhlich singend zur Fabrik und wieder nach Hause – wie eine »Prozession«, wird mündlich überliefert. Für sammenhang lesenswert}; Handwerker in der Industrialisierung. Lage, Kultur und Politik vom späten 18. bis ins frühe 20. Jahrhundert. Hrsg. von Ulrich Engelhardt. Stuttgart 1984; Andreas Grießinger: Das symbolische Kapital der Ehre. Streikbewegungen und kollektives Bewußtsein deutscher Handwerksgesellen im 18. Jahrhundert. Frankfurt, Berlin, Wien 1981; Eric J. Hobsbawm: Labouring men. London 1965; George Rudé: Die Volksmassen in der Geschichte. Unruhen, Aufstände und Revolutionen in England und Frankreich 1730–1848. 2Frankfurt, New York 1979; E. P. Thompson: The Making of the English Working Class. Harmondsworth 1968; ders.: Plebeische Kultur und moralische Ökonomie. Aufsätze zur englischen Sozialgeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts. Hrsg. von Dieter Groh. Frankfurt, Berlin, Wien 1980; Pierre Caspard: Die Fabrik auf dem Dorf. In: Wahrnehmungsformen und Protestverhalten. Studien zur Lage der Unterschichten im 18. und 19. Jahrhundert. Hrsg. von Detlev Puls. Frankfurt 1979, 105–142; Carlo Poni: Maß gegen Maß: Wie der Seidenfaden lang und dünn wurde. In: Robert M. Berdahl u. a.: Klassen und Kultur. Sozialanthropologische Perspektiven in der Geschichtsschreibung. Frankfurt 1982, 21–53; Klaus Tenfelde: Lesegesellschaften und Arbeiterbildungsvereine: Ein Ausblick. In: Lesegesellschaften und bürgerliche Emanzipation. Ein europäischer Vergleich. Hrsg. von Otto Dann. München 1981, 253–274.
Arbeiter und technischer Fortschritt in der Industrialisierung
|
47
sie bedeutete die dortige Arbeit eine Erleichterung und einen Aufstieg. In der Landwirtschaft konnten sie nicht mehr alle auskömmlich beschäftigt werden. Die Erträge der kleinen Höfe reichten zur Sicherung der Existenz kaum aus. Auch der Nebenerwerb – Strohschuhflechten, Besenbinden, Bienenzucht, bis hin zum Verkauf von Maulwurfsfellen als Kragen – brachte keine durchgängige Besserung. Gütermann zahlte einen höheren Lohn als die Großbauern und bot auch nicht nur – wie diese vielfach – Saisonarbeit an. Die traditionelle Welt, die überkommene Lebensweise, befand sich hier, so ist zu vermuten, bereits derart in der Krise und in einem Umwandlungsprozeß, daß der Industriebetrieb nicht als Eindringen einer gefährlichen, zerstörerischen, allzu fremden Kraft empfunden wurde. Es mag hinzugekommen sein, daß der betriebliche Arbeitsprozeß gar nicht so sehr als tiefer Bruch gegenüber der bisherigen Tätigkeit wirkte. Der große Bauernhof sei wie eine Fabrik, lautete die Meinung eines Elztäler Bauern, der später in einem Industrieunternehmen beschäftigt war – eine verständliche Einschätzung, wenn man an die strenge, hierarchische, höchst disziplinierte Arbeitsordnung eines großen Hofes namentlich während der Stoßzeiten in der Landwirtschaft denkt.18 Die sozialistische Arbeiterbewegung versuchte im Grunde, beide Reaktionen auf die Industrialisierung zu vereinen: die Ablehnung des den bisherigen Lebenszusammenhang von außen durchbrechenden kapitalistischen Systems wie die Akzeptierung eben dieses Kapitalismus, wenn er die bestehenden Verhältnisse zu verbessern schien. Ohne daß ich dies hier im einzelnen ausführen will, setzte sich die Auffassung durch, daß der technische Fortschritt ebensowenig wie die Ausbreitung des Kapitalismus verhindert werden könnten. Sie böten im übrigen den Vorteil, daß durch sie die Schranken der alten Welt, die der Befreiung des Menschen im Wege stünden, eingerissen und der gesamte Produktionsprozeß mehr und mehr vergesellschaftet würden. Gewerkschaftlicher Druck könne eine Verbesserung der materiellen Lebensverhältnisse erreichen, ohne daß allerdings schon die »Verelendung« der Arbeiter – im Verhältnis zu den Kapitalisten – grundsätzlich aufgehoben werde.19 Wenn sich schließlich die gesellschaftlichen Widersprüche so zugespitzt hätten, daß die sozialistische Revolution stattfinde und im letzten Akt des Klassenkampfes das Proletariat siege, werde es möglich sein, mit Hilfe einer bewußten, planmäßigen Nutzung der modernsten Technologie wie der ökonomischen Gesetze alle Nachteile des Kapitalismus zu überwinden: die Ausbeutung des Menschen, den rücksichtslosen Umgang mit der Natur und die Verschwendung der Ressourcen, die Entfremdung des Menschen von seiner Arbeit und deren Ergebnissen sowie von sich selbst. 18 Dieses Beispiel ist mir bei meinen Arbeiten zur Geschichte des Elztales bekannt geworden. Vgl. meinen in Anm. 10 zitierten Aufsatz. 19 Vgl. zu diesem umstrittenen Problem Werner Hofmann: Verelendung. In: Folgen einer Theorie. Essays über »Das Kapital« von Karl Marx. 2Frankfurt 1967, 27–60.
48
|
Von Karl Neff zu Aleksej Stachanov
Diese Vorstellungen regten die Phantasie an, konkrete Utopien zu entwerfen. Eine davon stammte von Karl Ballod, Professor der Nationalökonomie an der Berliner Universität und Mitglied der SPD. 1898 verfaßte er unter dem Pseudonym »Atlanticus« ein Buch über den »Zukunftsstaat«, das er 1920 in einer zweiten, völlig umgearbeiteten Auflage herausgab.20 Gestützt auf eine Auswertung der Statistiken und eine Berechnung der wirtschaftlichen Möglichkeiten kam er zu dem faszinierenden Schluß, der Stand der Produktivkräfte – also nicht zuletzt der Technik – erlaube es, alle Deutschen nach ihrer Schulpflicht nur noch fünf Jahre – nach seinen Vorschlägen bis zum Alter von 22 Jahren – arbeiten zu lassen. Anschließend könnten sie eine staatliche Pension erhalten, die sie bis an ihr Lebensende von jeglichen materiellen Sorgen befreien werde. Ballods Studie wurde gerade in Rußland stark beachtet, wo man eine besondere Variante der eben skizzierten Vorstellungen entwickelte (und wohin uns nun der letzte Weg führen soll). Hier fand 1917 eine sozialistische Revolution statt, obwohl die Gesamtgesellschaft noch keineswegs das höchste Stadium des Kapitalismus erreicht hatte, sondern lediglich einige Teilbereiche namentlich in der Industrie im internationalen Vergleich mithalten konnten. Innerhalb der organisierten russischen Arbeiterbewegung war schon lange zuvor umstritten gewesen, ob man überhaupt unter diesen Umständen eine sozialistische Revolution anstreben solle oder ob man nicht abwarten müsse, bis der Kapitalismus voll entfaltet sei und seine historische Mission erfüllt habe. Verschiedene Theoretiker, darunter auch Lenin und Trotzki, hatten dabei die Ansicht vertreten, es sei verantwortungslos, die Chance der Revolution vorbeigehen zu lassen. Man brauche durchaus nicht alle Stadien des Kapitalismus schematisch zu durchlaufen. Da man die Erfahrungen der weiter fortgeschrittenen kapitalistischen Länder wie die ökonomischen Gesetzmäßigkeiten kenne, könne man die weitere Entwicklung planen und mit Hilfe der modernsten Technologie einzelne Stadien überspringen, so daß man verhältnismäßig rasch – jedenfalls schneller, als wenn man erst die Entfaltung des Kapitalismus abwarte – die wirtschaftlichen Grundlagen des Sozialismus errichten werde. Wie sollte dies nach 1917 verwirklicht werden? Karl Marx hatte einmal geschrieben: »Die Handmühle ergibt eine Gesellschaft mit Feudalherren, die Dampfmühle eine Gesellschaft mit industriellen Kapitalisten«. Die Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse war für ihn eng mit dem Erwerb neuartiger Produktionsmittel verbunden.21 Nachhaltige Wirkung erzielte nun in Sowjetrußland ein unter den russischen Kommunisten verbreiteter Analogieschluß: Die Elektrizität ergebe die Gesellschaft mit Proletariern, den Sozialismus. »Kommunismus – das ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes«, rief Lenin Ende 1920 20 Karl Ballod: Der Zukunftsstaat. Produktion und Konsum im Sozialstaat. 2Stuttgart 1920. 21 Karl Marx: Elend der Philosophie. In: MEW 4, 130; vgl. MEW 23, 194–195.
Arbeiter und technischer Fortschritt in der Industrialisierung
|
49
aus.22 Während einst Zeit tiefster Not, ökonomischer Zerrüttung und politischer Unsicherheit entstand die Idee, die sich 1920 auch in dem ersten langfristigen Gesamtwirtschaftsplan niederschlug, mit Hilfe der Elektrifizierung als Schlüsselglied der zerstörten Wirtschaft von Anfang an eine neue industrielle Struktur zu geben, in zehn bis fünfzehn Jahren das Land zu industrialisieren und die Voraussetzungen für den Übergang zum Sozialismus zu schaffen. Die planmäßig vorangetriebene Elektrifizierung werde zunächst einmal die krisenhaften Engpässe beseitigen, vor allem das Brenn- und Rohstoffproblem lösen; die Arbeitsproduktivität werde ungeheuer steigen. Auch in der Landwirtschaft biete sich ein weites Feld der Anwendung. Letztlich trage die Elektrifizierung zur Aufhebung des Gegensatzes zwischen Stadt und Land bei. Darüber hinaus diene sie der »Aufklärung durch Licht«, verbessere die Möglichkeiten der Bildungsarbeit und kulturellen Aktivitäten. Vor den Planern und den sie unterstützenden Politikern stand das Bild einer voll elektrifizierten Wirtschaft, in der die Maschinen den größten Teil der Arbeit übernommen haben und die Menschen lediglich organisieren, lenken und kontrollieren. Der Mensch sei dann der Herr der Maschine geworden, die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen wie die entfremdende Arbeitsteilung23 gänzlich beseitigt. Endlich werde er seine Anlagen voll entwickeln und seinen Neigungen nachgehen können. 15 Jahre nach diesem Plan – 1935 – waren zwar wichtige Kennziffern erfüllt, der soziale Inhalt jedoch aufgrund der zwischenzeitlich eingetretenen politischen und gesellschaftlichen Veränderungen weitgehend in den Hintergrund getreten. Die Sowjetunion hatte den Sprung in einen Industriestaat getan. Dabei waren allerdings schwerwiegende Disproportionen entstanden, die im Zusammenhang mit dem sich seit Ende der zwanziger Jahre neu bildenden Machtsystem »Stalinismus« gesehen werden müssen und die sowjetische Gesellschaft bis in die Gegenwart hinein belasten. Offiziell sprach man davon, daß das Stadium des Sozialismus erreicht sei – in Wirklichkeit herrschten jedoch materielle Not, straffe, von oben gelenkte Arbeitsdisziplin, Unterdrückung und Terror. Gesellschaft und Wirtschaft befanden sich in einem tiefgreifenden Umbruch. Fabriken, ja ganze Städte wurden aus dem Boden gestampft, Millionen von neuen Arbeitskräften zogen von den durch die Kollektivierung durcheinander gerüttelten Dörfern in die Industriezentren. Ich kann deshalb noch von einer Anfangsphase der Industrialisierung sprechen, wenn ich nun ein Ereignis aus dem DonecBecken herausgreife, dem südrussischen Kohle- und Stahlrevier.
22 Vgl. W. l. Lenin: Werke 31, 510–515. Hier und im folgenden zum Zusammenhang Heiko Haumann: Beginn der Planwirtschaft. Elektrifizierung, Wirtschaftsplanung und gesellschaftliche Entwicklung Sowjetrußlands 1917–1921. Düsseldorf 1974. 23 MEW 3, 33; 19, 21.
50
|
Von Karl Neff zu Aleksej Stachanov
In einem der Kohlenschächte arbeitete der junge Bergmann Aleksej G. Stachanov. Durch eine verhältnismäßig einfache Änderung der Arbeitsorganisation, nämlich eine stärkere Spezialisierung der einzelnen Arbeitsvorgänge, gelang es ihm mit seiner Gruppe in der Nacht auf den 31. August 1935, während einer Schicht das Dreizehnfache der bisher üblichen Norm an Kohle abzubauen. Weitere Rekorde von ihm und seinen Kollegen folgten. Die Partei- und Staatsführung erkannte die Chance, die in einer Verallgemeinerung dieser Leistung lag und entfachte einen allumfassenden Wettbewerb, die »Stachanov-Bewegung« (stachanovščina), um die Arbeiter zu höchsten Anstrengungen anzustacheln. Am 14. November 1935 berichtete Stachanov auf der ersten Allunions-Konferenz der Stachanov-Arbeiter über seine Lebensgeschichte: »Unser Dorf war sehr arm. Unsere Familie schlug sich gerade so durch. Mein Großvater und mein Vater gingen in die Stadt, um Geld zu verdienen. Von meinem 12. Lebensjahr an begann ich, ein selbständiges Leben zu führen, als ich anfing, beim Kulaken [also einem reichen Dorfbewohner, H.H.] in der Mühle zu arbeiten. Vom Morgengrauen bis in die Nacht schleppte ich Säcke, und in der Nacht sah ich nach den Pferden, und davon gab es bei ihm 40 Stück. Das war hart. Mein Leben begann erst hier, im Schacht. Hierher, nach Irmino, kam ich 1927. Anfangs war ich mit Aufräumarbeiten beschäftigt – keine hohe Qualifikation. Ich sage es offen: Ich fürchtete mich vor den Schächten. Die ganze Zeit erinnerte ich mich an die Worte des Großvaters: ›Schacht – das ist Zwangsarbeit (katorga), du zerstörst deine Kraft für nichts, du gehst zugrunde ...‹. Ich stieg einmal, zweimal in den Schacht hinunter – es machte nichts, ich hielt es aus, und dann wurde ich vertraut damit, gewöhnte mich daran. Bald wurde ich Pferdetreiber. Diese Arbeit war mir bekannt. Seit der Kindheit war ich damit vertraut, Pferde zu pflegen. Es verstrich einige Zeit. Dann ging ich über zur Arbeit vor Ort. Zuerst baute ich mit der Hacke ab, dann – nach Einführung der Abbauhämmer – mit dem Hammer. lch stellte mir die Aufgabe: so gut wie irgend möglich mit dem Abbauhammer zu arbeiten. Ich begann zu lernen. Ich paßte auf, wie die anderen arbeiteten, und nach und nach eignete ich mir die Arbeitsweise an (...). Später legte ich das staatliche technische Examen mit ›ausgezeichnet‹ ab.«24 Hier wird deutlich, wie beim Eintritt des Dorfbewohners Stachanov in die Industrie zwei fremde Welten aufeinanderstoßen. Über ein vertrautes Element – das Pferd – beginnt die Eingewöhnung, der Aufbau einer neuen Welt. Insofern spricht es für das Einfühlungsvermögen der Vorgesetzten, wenn Stachanov nach seinem Rekord als Prämie ein Pferd übereignet wurde.25 Dies dürfte im Rahmen jener Be24 Sbornik dokumentov po istorii SSSR. Ėpocha socializma. Vyp. 3. 1933–1941 gg. Pod red. V. Z. Drobiževa. Moskva 1980, 108–113, hier 111–112. Deutsch in: Die Sowjetunion. Von der Oktoberrevolution bis zu Stalins Tod. Band 2: Wirtschaft und Gesellschaft. Hrsg. von Helmut Altrichter und Heiko Haumann. München 1987 (dtv-dokumente), 411–416. 25 Daran erinnerte sich die Teilnehmerin eines Gesprächs alter und neuer »Bestarbeiter« zum Jubiläum der Stachanov-Leistung 1985, auf der im übrigen Parteichef Gorbačev es als Ak-
Arbeiter und technischer Fortschritt in der Industrialisierung
|
51
strebung zu sehen sein, den Massen von Bauern, die in die Industrie strömten, den Übergang zu erleichtern, »moralische« und »materielle Anreize« zu bieten. Man hatte gemerkt, daß allein eine strenge Arbeitsverfassung und der Rhythmus der Maschine nicht ausreichten, um Bauern zu Arbeitern umzuwandeln. Eine hohe Fluktuation, Störungen des Betriebsablaufs, unsachgemäße Behandlung der Maschinen und eine niedrige Arbeitsproduktivität waren seit 1929, dem Beginn des 1. Fünfjahrplans, der forcierten Industrialisierung und Kollektivierung, die Folge gewesen. Daß man sich überhaupt auf ein solches Konzept eingelassen hatte, lag an einer Veränderung der Strategie. Die voll elektrifizierte und automatisierte Wirtschaft war in eine ferne Zukunft gerückt, den sozialen oder gar sozialistischen Inhalt, dem die Elektrifizierung und die Technik insgesamt in den Plänen von 1920 auch genügen sollten, bedachten die Verantwortlichen kaum noch. Inzwischen ging es, damit man die aufgetretenen ökonomischen Probleme lösen könne, im wesentlichen zunächst einmal um eine Steigerung der Produktion, um eine Erhöhung der materiell-technischen Kennziffern. Allerdings wirkte dabei durchaus die Denkweise nach, daß der Einsatz modernster Technologie das Zaubermittel sei, um vorwärtszukommen. Als Ende der zwanziger Jahre eine längerfristige Strukturkrise mit einer aktuellen Wirtschaftskrise zusammenfiel und sich chaotische Zustände ausbreiteten, behauptete sich in harten Auseinandersetzungen die Meinung, man müsse auf radikale Weise ein für allemal den Durchbruch schaffen. Bei dem extremen Voranpeitschen des Industrialisierungs- und Kollektivierungstempos und bei der Konzentration der Mittel auf einige Schwerpunktbereiche – selbst wenn das tiefe Disproportionen nach sich zog – stand das »amerikanische Modell« Pate: In Riesenbetrieben, ausgerüstet mit der modernsten Technologie, könne in hoher Stückzahl und so mit verhältnismäßig niedrigen Herstellungskosten produziert werden. Die Anfangsinvestitionen würden sich deshalb rasch amortisieren, und der Selbstfinanzierungsgrad der Industrie werde sich bald erhöhen. Darüber hinaus sei es nicht mehr nötig, zunächst einmal nach und nach die Masse der Bauern sorgfältig zu qualifizierten Arbeitern auszubilden – dies war bislang das vorherrschende Konzept gewesen. Die Kontrolle der Arbeitsdisziplin im Großbetrieb und das einfache Erlernen der Tätigkeit an der Maschine, am Fließband etwa, würden den sofortigen Einsatz großer Mengen von nicht speziell ausgebildeten Arbeitskräften ermöglichen. Dabei stützte man sich nicht zuletzt auf die Erfahrungen mit der »wissenschaftlichen Arbeitsorganisation«, der sowjetischen Variante von Taylorismus und Fordismus, deren Vertreter über eine genaue Aufgliederung der Arbeitsabläufe die Tätigkeit erleichtern, aber auch eine bessere Anlernung neuer Arbeiter erreitualität der Stachanov-Bewegung bezeichnete, »der Technik das Meistmögliche abzuzwingen« (nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung, 23.9.1985).
52
|
Von Karl Neff zu Aleksej Stachanov
chen wollten. Ansätze bis in die zwanziger Jahre hinein, diese Rationalisierung »von unten« durchführen zu lassen, hatten sich nicht durchsetzen können. Bei manchen Befürwortern dieses Verständnisses von Technik und Arbeitsorganisation mag die Hoffnung mitgespielt haben, durch das Auf-die-Spitze-Treiben der Arbeitsteilung und durch den radikalen Bruch des Arbeiters mit seiner bisherigen Lebenswelt, mit allen gewachsenen Traditionen werde der neue Mensch als Teil eines Kollektivs entstehen, das dann den Sozialismus aufbauen könne. In der Praxis bedeutete diese Konzeption allerdings, daß der Arbeiter vollständig verfügbar und der Maschine wie der Anweisung »von oben« unterworfen war.26 In Einzelfällen, wie bei Stachanov, scheint es geglückt zu sein, den Bruch beim Übergang in den Industriebetrieb zu überbrücken, so daß eine neue Identität entstehen konnte. Viele Arbeiter akzeptierten auch die Industrialisierung der dreißiger Jahre, weil sie ihnen Verdienst und eine – wenngleich bescheidene – Verbesserung ihrer materiellen Lebensverhältnisse, ja vielleicht sogar einen gewissen Aufstieg ermöglichte. Zu einem erheblichen Teil scheiterte das Konzept jedoch, ganz abgesehen von den rein ökonomischen Problemen, die es hervorrief. Nur zwei Hinweise mögen dies veranschaulichen: Im letzten Quartal des Jahres 1930 sank die Zahl der Tage, an denen tatsächlich gearbeitet wurde, im Vergleich zum Vorjahresquartal um 7 %. Das lag hauptsächlich daran, daß der Arbeitsausfall wegen »unbegründeten Fernbleibens« um 162 % anstieg. Und Ende 1938 prangerten die höchsten Gremien des Sowjetstaates diejenigen Menschen an, die »mit ihrer nachlässigen Arbeit, ihrem Schwänzen, dem Zuspätkommen zur Arbeit, dem ziellosen Herumgehen im Unternehmen während der Arbeitszeit und anderen Verletzungen der Regeln der inneren Arbeitsordnung, darüber hinaus dem häufigen eigenmächtigen Überwechseln von einem Unternehmen zum anderen die Arbeitsdisziplin durcheinander(bringen)«. Deshalb wurde der Arbeiter oder Angestellte mit strenger Strafe bedroht, »der ohne stichhaltigen Grund zu spät kommt oder vorzeitig zum Mittagessen geht oder verspätet vom Mittagessen zurückkehrt oder zu früh das Unternehmen oder die Behörde verläßt oder seine Arbeitszeit mit Nichtstun verbringt«.27 Den Arbeitern blieb nichts anderes übrig, als ihren Widerstand gegen eine solche Unterwerfung unter den Produktionsprozeß mit Verweigerung und mit Ausdehnung von Pausen auszudrücken, um sich wenigstens kleine Freiräume zu 26 Vgl. zum gesamten Zusammenhang Walter Süß: Die Arbeiterklasse als Maschine. Ein industrie-soziologischer Beitrag zu Sozialgeschichte des aufkommenden Stalinismus. Berlin 1985; Melanie Tatur: »Wissenschaftliche Arbeitsorganisation«. Arbeitswissenschaften und Arbeitsorganisation in der Sowjetunion 1921–1935. Wiesbaden 1979. 27 Industrializacija SSSR 1929–1932 gg. Dokumenty i materialy. Moskva 1976, 250–252; Rešenija partii i pravitel‘stva po chozjajstvennym voprosam. T. 2, 1929–1940 gody. Moskva 1967, 665–672 (beide deutsch in dem in Anm. 24 erwähnten Dokumentenband, 336, 437–438).
Arbeiter und technischer Fortschritt in der Industrialisierung
|
53
erkämpfen. Hier schließt sich der Kreis mit dem Verhalten von Arbeitern im Siegerland, wo die Fabrikordnungen ebenfalls Probleme der Arbeitsdisziplin angezeigt hatten.28 Was dahintersteht, sind demnach keine isoliert auftretenden Anpassungsschwierigkeiten, sondern Massenerscheinungen, die den Gang der wirtschaftlichen und betrieblichen Entwicklung ernsthaft stören und zugleich für den betroffenen Arbeiter den Kern seiner Existenz berühren können. Neue Technologien, die tief in das bestehende gesellschaftliche Gefüge eingreifen, rufen in der Anfangsphase der Industrialisierung die unterschiedlichsten Reaktionen hervor: Die Tagelöhnerin im Elztal begrüßt sie, weil sie einen Ausweg aus ihrer schlechten materiellen Lage und aus ihrem nicht mehr befriedigenden bäuerlichen Dasein verheißen; Aleksej Stachanov im Donec-Becken identifiziert sich mit seiner neuen Aufgabe, wobei ihm der Übergang in eine fremde, abschreckende Welt durch vertraute Bestandteile seines früheren Wahrnehmungsbereiches erleichtert wird; Karl Neff im Siegerland weigert sich, die Neuerungen anzuerkennen und wählt das weniger eingezwängte, gleichwohl keineswegs idyllische Leben eines Hirten; viele finden sich ab, sehen die Vorteile gegenüber ihrer bisherigen Situation und nutzen sie, kämpfen möglicherweise für konkrete Verbesserungen; vielen bleibt das neue Leben für lange Zeit fremd, sie gewahren jedoch keine Alternative und versuchen, sich Freiräume zur autonomen Gestaltung zu erhalten, in die dann oft traditionelle Verhaltensweisen einfließen; bei vielen mischen sich Elemente der hier skizzierten Reaktionen. Neue Technologien und mit ihnen einhergehende gesellschaftliche Veränderungen bedeuten einen einschneidenden Bruch mit der bisherigen Lebenswelt des Einzelnen, der bis zu deren »Kolonialisierung«29 führen kann. Der Arbeitsplatz ist völlig anders, das Verhältnis zwischen dem Arbeiter und dem Produkt seiner Tätigkeit wandelt sich, neue menschliche Beziehungen entstehen, der ganze bisherige Lebenszusammenhang wird zerrissen oder doch erschüttert, die Umwelt mit anderen Augen gesehen, frühere Erfahrungen reichen nicht aus, um mit dem jetzigen Dasein fertig zu werden. Strategien, die die Summe aus dem eingetretenen gesellschaftlichen Zustand ziehen und »von außen« den Arbeitern Modelle für ihr Verhalten und für die Zukunft nahebringen wollen, die dem System ein anderes System entgegenstellen, ohne die unterschiedlichen lebensweltlichen Zusammenhänge der einzelnen Menschen zu berücksichtigen, treffen lediglich Bedürfnisse und Interessen eines Teiles. Ja, sie laufen Gefahr, über viele Menschen hinwegzugehen und ihnen damit neues Leid zuzufügen. Die Geschichte liefert keine unmittelbaren Nutzanwendungen für die Gegenwart. Ich glaube aber doch, daß uns die Erfahrungen aus der Anfangsphase der 28 Vgl. zu diesem Aspekt den in Anm. 10 zitierten Aufsatz von Alf Lüdtke. 29 Vgl. Jürgen Habermas: Theorie des kommunikativen Handelns. 2 Bände. Frankfurt 1981, hier Band 2, 522 und passim.
54
|
Von Karl Neff zu Aleksej Stachanov
Industrialisierung helfen können, Antworten auf die gegenwärtige Situation zu finden.30 Die Aufgabe der Geschichtswissenschaft scheint mir dabei in folgendem zu bestehen: Sie darf sich nicht in die Ecke der bloßen »Diskussionswissenschaft« – im Sinne von Bla-Bla-Wissenschaft – drängen lassen, aber sich auch nicht damit zufrieden geben – wie es unser Landesvater gerne möchte –, eine Rolle als »Akzeptanz«- oder (abgemildert) »Erklärungswissenschaft« zu spielen.31 Eine unkritische Akzeptierung des technischen Fortschritts, zu dem es keine Alternative gebe, dient letztlich dazu, uns in einer – wie es Ernst Bloch unnachahmlich formuliert hat – »eia, popeia, Sozialpartnerschaft« einzulullen, die die Geschichtswissenschaft ideologisch-therapeutisch abzusichern hätte, indem sie die Richtigkeit und die Vorzüge der bisherigen Entwicklung aufzeigen würde. Dagegen kommt es darauf an, vom einzelnen Menschen auszugehen, die Wirkungen neuer Technologien kritisch und differenziert zu analysieren, zu versuchen, die Zerstörung gewachsener Lebenszusammenhänge zu verhindern oder bei der Suche nach einer neuen Identität zu helfen, die Entfremdung des Menschen zu überwinden. Die Antwort auf die Herausforderung unserer Zeit wird dadurch nicht leichter, weil sie nicht global und pauschal ausfallen kann, sondern unterschiedlich und differenziert lauten muß. Wenn uns dafür die Erfahrungen der Arbeiter in der Anfangsphase der Industrialisierung sensibilisieren können, ist viel gewonnen.
30 Anders Gert Zang: Die unaufhaltsame Annäherung an das Einzelne. Reflexionen über den theoretischen und praktischen Nutzen der Regional- und Alltagsgeschichte. Konstanz 1985, 94. 31 Vgl. dazu Welf Schröter: Die neue Forschungs-/Struktur-Politik im Land Baden-Württemberg 1982–1985. In: Straffung – Formierung – lndienstnahme. Hochschule und Forschung in Baden-Württemberg. Hrsg. von der GEW Baden-Württemberg, Fachgruppe Hochschulen. Stuttgart 1985, 5–14.
Eine inszenierte Friedensaktion Deutsch-französische Frontkämpfertreffen in Freiburg i. Br. und Besançon 1937–1938* I.
»Wenn Gegner von einst die Welt des Mißtrauens in sich beseitigen und zusammentreffen, um sich verstehen zu lernen und gemeinsam der Opfer des Krieges zu gedenken, so ist in diesem Ereignis eine Demonstration für den Frieden zu erblicken, die Ehrfurcht gebietet und die ihre Wirkung auf die Völker trotz allem, was sich trennend dazwischen stellt, nicht verfehlen kann.« Mit diesen Worten begrüßte Oberbürgermeister Dr. Franz Kerber in der Presse das Internationale Frontkämpfertreffen am 4. Juli 1937 in Freiburg i. Br., und einen ähnlich »bewegten Willkommensgruß« entbot er den etwa 1000 Franzosen, als sie kurz nach ½ 11 Uhr morgens am Hauptbahnhof angekommen waren.1 „Ein Groß-Ereignis für unseren Gau« war angekündigt, ein denkwürdiger Tag, »der im Zeichen der Freundschaft der Frontkämpfer und Arbeiter von links und rechts des Rheines steht, die nichts anderes wünschen, als in Frieden ihre Pflicht zu tun.«2 Die Stadt Freiburg hatte – in Zusammenarbeit mit verschiedenen Dienststellen, namentlich der Nationalsozialistischen Kriegsopferversorgung (NSKOV)3 – alles getan, um diesen Tag eindrucksvoll zu gestalten.4 Als die * Erstpublikation unter dem Titel: Eine inszenierte Friedensaktion. Freiburg i. Br. und Besançon als Schauplätze deutsch-französischer Frontkämpfertreffen 1937–1938. In: Zeitschrift des Breisgau-Geschichtsvereins »Schau-ins-Land« 108 (1989) S. 289–316. 1 Der Alemanne, 3./4.7.1937, leicht verändert: Freiburger Tagespost, 3.7.1937. Entwurf der Begrüßungsworte in: Stadtarchiv Freiburg (StadtAF), C 4/XVI/29/8. Dort auch das vom Verkehrsamt zusammengestellte Programm des Tages. Zitat aus der Begrüßung am Bahnhof: Le Petit Comtois, 6.7.1937 (StadtAF, C 4/XVI/30/1, Übersetzung für den Oberbürgermeister: StadtAF, C 4/XVI/29/8). 2 Der Führer, 30.6.1937. 3 Die NSKOV e. V., in der die verschiedenen früheren Kriegsopferverbände gleichgeschaltet worden waren, galt nach dem »2. Gesetz zur Sicherung der Einheit von Staat und Partei« vom 29.3.1935 (RGBI. 1935 I, S. 502) als ein der NSDAP »angeschlossener Verband« mit eigener Rechtspersönlichkeit und eigenem Vermögen, der der Aufsicht des NSDAPReichsschatzmeisters unterstand (M. Broszat, Der Staat Hitlers. Grundlegung und Entwicklung seiner inneren Verfassung, 91981, S. 263). Sie beanspruchte die Federführung bei der Vertretung der ehemaligen Frontsoldaten, auch gegenüber dem Reichskriegerbund Kyffhäuser. 4 Ich folge dem Schriftwechsel der Stadtverwaltung und den Berichten, die ihr zugingen (StadtAF, C 4/XVI/29/8), sowie den gesammelten Zeitungsausschnitten (StadtAF, C 4/
56
|
Eine inszenierte Friedensaktion
Reichsleitung der NSKOV dem Oberbürgermeister am 28. Juni 1937 offiziell das Treffen mitteilte, sagte dieser eine Beihilfe der Stadt zur Verpflegung in Höhe von 1000 RM zu. Darüber hinaus ordnete er an, sämtliche öffentlichen Gebäude und die Straßenbahnen zu beflaggen sowie den Bahnhofsausgang und den Platz am Denkmal des Infanterie-Regiments 113 auszuschmücken. Auch sonst sollten möglichst viele Wimpel und Transparente ausgehängt – dafür gab die Stadt noch einmal 200 RM aus – sowie ein Aufruf an die Einwohnerschaft erlassen werden. Die Ratsherren wurden gebeten, sich am Sonntag, dem 4. Juli, kurz nach 10 Uhr in »Zivil, dunkler Anzug« am Südausgang des Hauptbahnhofs einzufinden.5 Die Bevölkerung wurde entsprechend von der Presse eingestimmt. Dabei knüpfte man sogar an Traditionen des badischen Selbstbewußtseins an: »Daß Freiburg zum Ort dieses Treffens ausersehen wurde, ist für uns von großer Bedeutung, denn dadurch wird seine Stellung als Brückenpfeiler zwischen Deutschland und Frankreich besonders hervorgehoben.«6 Die Freiburger sollten die »Kameraden vom anderen Graben« herzlich begrüßen und sich »zahlreich zu diesem feierlichen, hier noch nie erlebten Akt, zu dieser friedlichen Parade der einstigen Gegner, einfinden«.7 Am Vorabend des Treffens begibt sich Friedrich Hartmann, Verwaltungsoberinspektor beim Städtischen Verkehrsamt, nach Besançon, wo er bereits am 28. Juni über die Organisation verhandelt hat: Von dort aus nämlich wird die französische Beteiligung ausgerichtet. Man überrascht ihn mit der Bitte, am anderen Morgen, unmittelbar vor der Abfahrt nach Freiburg, an einer Gedenkfeier beim Gefallenen-Ehrenmal teilzunehmen und ein Blumengebinde niederzulegen. Dabei hält er eine, noch in der Nacht vorbereitete, kurze Ansprache, die mit folgenXVI/30/1). Vgl. außerdem die ausführliche Darstellung von R. Dutriez, Un cinquantenaire à méditer: Les rencontres entre anciens combattants franc-comtois et badois, en 1937, in: Journal des Victimes de Ia Guerre et des Anciens Combattants du Doubs 55, 1987, Nr. 310, S. 1–4. Ich danke Herrn Dutriez für die Übersendung seines Beitrages und seine freundliche Unterstützung. Vielmals zu danken habe ich des weiteren Frau Hélène Richard, Directeur de Ia Bibliothèque et des archives municipales de Besançon, die mir Materialien aus dem dortigen Stadtarchiv (AMB) zur Verfügung stellte, Frau Elizabeth Pastwa, Conservateur au Museé de Ia résistance et de Ia déportation de Franche-Comté (MRD) in Besançon, die mir Photographien von den Frontkämpfer-Treffen überließ, sowie für Auskünfte Herrn Jean Courtieu, Conservateur en Chef des Archives de Ia Région de Franche-Comté et Directeur des Services d’Archives du Doubs. Zum folgenden auch J. M. Maître, Die französischen Frontkämpfer in Freiburg im Breisgau, in: Alemannenland. Ein Buch von Volkstum und Sendung, hg. v. F. Kerber (Jahrbuch der Stadt Freiburg im Breisgau 1), 1937, S. 171–176, Nachwort des Hg. S. 177. 5 StadtAF, C 4/XVI/29/8. 6 Der Alemanne, 29.6.1937. Auch Maître hob die günstige Lage Freiburgs für das Treffen hervor (wie Anm. 4). 7 Freiburger Zeitung, 29.6.1937.
Deutsch-französische Frontkämpfertreffen 1937–1938
|
57
den Worten schließt: »Wir wollen keinen Krieg mehr, das ist unsere gemeinsame Parole, und das wollen wir, die wir in treuer Pflichterfüllung für unser Vaterland 1914/18 einander gegenüberstanden, in der Hauptstadt des Schwarzwaldes, in Freiburg im Breisgau, vor aller Welt bekunden. Es lebe Frankreich! – Es lebe Deutschland! Beide müssen Freunde werden!« Während die französische Seite von diesen Ausführungen sehr angetan ist, reagiert das Oberbürgermeisteramt etwas irritiert mit der Anfrage, wer denn Herrn Hartmann beauftragt habe. Erst als dieser einen ausführlichen schriftlichen Bericht erstattet und sich Verkehrsamtsleiter Denzlinger hinter ihn stellt, sieht man die Sache als erledigt an; das Blumengebinde hat Herr Hartmann ohnehin aus eigener Tasche bezahlt.8 Nach diesem Auftakt fahren die Franzosen, unterwegs durch weitere Abteilungen verstärkt, zunächst zur Grenzstation Breisach. Eine »brausende Welle von Heilrufen« empfängt sie dort um 9.15 Uhr.9 »Sobald wir aus dem Zug gesprungen waren, eilten junge Hitlermädchen, kleine Gretchen in Uniform herbei, ihre klaren Augen lächelten uns an, und sie steckten uns Blumen ins Knopfloch. (...) Knaben mit nackten Schenkeln, kurzen Hosen, braunem Hemd, mit dem kleinen Dolch der Hitlerjugend im Gürtel, schmückten den Zug mit Zweigen.«10 Vertreter des NSKOV, der Freiburger Verkehrsamtsleiter und der Breisacher Bürgermeister Herr heißen die Gäste willkommen. Ein »riesiger Humpen Kaiserstühler« für den »Führer der französischen Frontkämpfer Dr. Maître – Besançon« darf nicht fehlen.11 Erste freundschaftliche Gespräche werden auf dem Bahnsteig angeknüpft, viel zu schnell verstreichen die vorgesehenen 45 Minuten Aufenthalt. In Freiburg sind die Kameradschaften der NSKOV des deutschen Südwestens und ein Ehrensturm der SA angetreten, Hakenkreuzbanner, Trikoloren und Transparente zieren den Bahnhof. Als der Sonderzug einläuft, erklingen ein »schwungvoller« französischer Marsch und wieder »stürmische Heilrufe«. Ihringer Trachtenmädchen überbringen den Delegationsleitern einen »flüssigen Gruß«. Nach der Aufstellung am Südausgang des Bahnhofs folgen die Ehrenbezeugungen. »In der eindrucksvollen Stille ruft ein junger Abteilungsführer der SA, ein großer nerviger Mann mit sonnenverbrannter Haut, der seine Leute mit seinen graublauen Augen scharf fixiert, die rauhen deutschen Kommandos.«12 Die Begrüßungsreden der Prominenz schließen sich an. Nach dem Gauhauptstellenleiter der NSKOV in Baden, Reinhardt, spricht der Reichskriegsopferführer, Hanns Oberlindober. Er war schwer kriegsverletzt aus dem Ersten Weltkrieg heimgekehrt, zählte zur »alten Garde« der bayerischen NSDAP, der er sich 1922 8 9 10 11
Vorgang in: StadtAF, C 4/XVI/29/8. Bericht in: Le Petit Comtois, 6.7.1937. Der Alemanne, 5.7.1937. Le Petit Comtois, 6.7.1937. Der Alemanne, 5.7.1937. Le Petit Comtois berichtet, der Weinbecher sei dann von Hand zu Hand gekreist. 12 Le Petit Comtois, 6.7.1937.
58
|
Eine inszenierte Friedensaktion
1 Empfang der französischen Frontkämpfer am 4. Juli 1937 auf dem Freiburger Bahnhof. Reichskriegsopferführer Oberlindober begrüßt den Leiter der französischen Abordnung. (Völkischer Beobachter vom 6.7.1937; StadtAF, C 4/XVI/30/1)
2 Abmarsch vom Freiburger Bahnhof. (StadtAF, K 1/49)
Deutsch-französische Frontkämpfertreffen 1937–1938
3 Die Marschkolonnen in der Bertoldstraße. (StadtAF, M 75/1)
4 Die »Führer« nehmen die Formationen ab: Reichsstatthalter und Gauleiter Wagner, Reichskriegsopferführer Oberlindober, der Freiburger Standortkommandant Oberst Richter, Dr. Maître (1. Reihe von links). (StadtAF, M 75/1)
|
59
60
|
Eine inszenierte Friedensaktion
angeschlossen hatte, und war NS-Stadtrat von Straubing gewesen. Seit 1930 gehörte er dem Reichstag an. Von 1932 an gab er das NS-Blatt »Der Dank des Vaterlandes« heraus, das dann die Basis für die 1933 gegründete Sonderorganisation NSKOV gebildet hatte.13 Er ruft den »Kameraden von der anderen Seite des Rheins« entgegen: »Der deutsche und der französische Soldat sind die besten auf der Erde, und wenn die beiden zueinanderstehen, dann sind diese zwei stärker als alle anderen.« Danach ergreift der Reichsstatthalter von Baden, Gauleiter Robert Wagner, das Wort. Er hält sich eng an die Wortwahl seines »Führers«: »Ein für uns wohl immer unergründliches Schicksal hat uns einst auseinander geführt und zu Gegnern im furchtbarsten, opferreichsten aller Kriege gemacht. Allein die Vorsehung führt uns wieder als Kameraden zusammen!« Oberbürgermeister Dr. Kerber begrüßt die Franzosen besonders herzlich und hofft, »der heutige Tag möge für Sie das bedeuten, was Sie sich und wir alle uns wünschen: Ein Markstein auf dem langwierigen Weg der Befriedung zweier Völker (...)«. Nach einem Vertreter des Reichskriegerbundes Kyffhäuser antwortet schließlich der Führer der französischen Frontkämpfer, Dr. Joseph Maître. Er zeigt sich »aufs tiefste ergriffen von dem herrlichen Empfang« und ersehnt ebenfalls eine Verständigung als »notwendige Vorbedingung des Friedens (...). Den Frieden aber betrachten wir als das größte Gut der Menschheit.«14 Nun formieren sich die Marschsäulen der französischen und deutschen Frontkämpfer mit ihren Fahnen, angeführt vom Spielmanns- und Musikzug der SA-Standarte 113, und ziehen – »stürmisch bejubelt« von den Zuschauern am Straßenrand – durch die Berthold-, Adolf-Hitler- (heute: Kaiser-Joseph-) und Schlageter-Straße (heute: Leopoldring) zum Ehrenmal der 113er am Stadtgarten (es stand damals – anders als heute – an der Ecke zum Karlsplatz). Transparente wie »Die alten Frontsoldaten zeigen der Jugend den Weg des Friedens« oder »Wir wissen das Opfer der Mütter zu schätzen« weisen auf die Bedeutung des Tages hin. Die »Führer« begeben sich derweil in ihr »Standquartier«, das Hotel Römi13 Broszat (wie Anm. 3) S. 75; E. Stockhorst, Fünftausend Köpfe. Wer war was im Dritten Reich, 1967, S. 311; Degeners Wer ist’s? Hg. v. H. A. D. Degener, 10. Ausgabe 1935, S. 1155. – U. a. gehörte Oberlindober auch dem »Zentralkomitee zur Abwehr der jüdischen Greuel- und Boykotthetze« an, das am 31.3.1933 mit dem Aufruf zum Boykott der Juden am 1.4.1933 an die Öffentlichkeit trat (K. D. Bracher, W. Sauer, G. Schulz, Die nationalsozialistische Machtergreifung. Studien zur Errichtung des totalitären Herrschaftssystems in Deutschland 1933/34, 1960, S. 278 Anm. 86). 1934 trat er für eine Eingliederung aller Frontkämpferorganisationen in einen übergreifenden Bund ein und trug damit auch zur Auflösung des »Stahlhelm« bei (V. R. Berghahn, Der Stahlhelm. Bund der Frontsoldaten, 1918–1935 [Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien 33], 1966, S. 271). 14 Der Alemanne, 5.7.1937.
Deutsch-französische Frontkämpfertreffen 1937–1938
5 Ansprache des Reichskriegsopferführers Oberlindober. (StadtAF, M 2/3)
|
61
6 Ansprache Dr. Maîtres. (StadtAF, M 2/3)
7 Ansprache des Freiburger Oberbürgermeisters Dr. Kerber zum Abschluß des Treffens. Neben der Rednertribüne sind Dr. Maître, Oberlindober und Wagner zu erkennen. (StadtAF, M 75/1)
62
|
Eine inszenierte Friedensaktion
scher Kaiser, von wo sie abgerufen werden, als die Formationen gegen 12 Uhr am Ehrenmal Aufstellung genommen haben. Dort stehen bereits Abteilungen der SA, der SS, des Arbeitsdienstes, des NSKraftfahrerkorps und auch der Wehrmacht. Alles ist reich beflaggt und geschmückt. Die »Führer« schreiten die Ehrenformationen ab. Dann schlagen Flammen aus zwei am Denkmal errichteten »Opferschalen« hervor. Abordnungen legen Kränze nieder, die Kapelle spielt »Ich hatt’ einen Kameraden«. Reichskriegsopferführer Oberlindober hält eine »packende Ansprache«. Wieder betont er den Willen zum Frieden und begründet die deutsche Aufrüstung in diesem Geiste: »Wir sind heute stark in Waffen und Gesinnung. Jetzt können wir ehrenvoll vom Frieden sprechen«. Nach der Saarabstimmung gebe es, wie »unser Führer und Kanzler« gesagt habe, keine territorialen Fragen zwischen Deutschland und Frankreich mehr. Er wünsche, daß auch Frankreich – wo damals eine Volksfront-Koalition regierte – »zum inneren Frieden finde«. Beide Völker seien »gefeit gegen den asiatischen Irrsinn« (der französische Berichterstatter verstand die Worte so, daß Deutschland die Völker des Westens gegen den Kommunismus verteidige). Man werde keinen Angriff auf die Ehre der Nation zulassen, sei aber bereit zur Freundschaft. Dr. Maître dankt in seiner Erwiderung für die Sympathiebeweise der Bevölkerung, lobt die Organisatoren und die Führer, insbesondere Oberlindober, und erinnert an dessen Freundschaft mit dem Präsidenten der Union Fédérale, der Dachorganisation der französischen Frontkämpfer, Henri Pichot (er war wegen eines Todesfalles in der Familie an der Teilnahme verhindert). Er beschwört die »Geste freiwilliger Verbrüderung zwischen ehemaligen Gegnern (...) zu gemeinsamer Ablehnung des Krieges und des Völkerhasses, der den Krieg nährt. Was die Diplomaten zu tun unfähig sind, könnten die geeinten Frontkämpfer verwirklichen«. Die Feindschaft zwischen beiden Völkern sei »künstlich« gewesen. Die Menschen müßten »ihre Macht und ihre Verantwortlichkeit begreifen«, zukünftige Kriege zu verhindern. Er fordert alle auf: »Laßt uns gute Werkleute des Friedens sein!« Um das immer noch vorhandene Mißtrauen weiter abzubauen, lädt er die deutschen Frontkämpfer zu einem Besuch nach Besançon ein. »Es lebe Deutschland, es lebe Frankreich, beide geeinigt für immer in Frieden und Freundschaft!« Anschließend verteilen sich die französischen und deutschen Teilnehmer auf verschiedene Gaststätten. Auch das vollzieht sich in geregelter Ordnung. Jeder hat eine Essensmarke in einer bestimmten Farbe erhalten und sammelt sich um denjenigen Kameraden, der ein gleichfarbiges Schild trägt und die Gruppe dann zur Wirtschaft führt. Die Prominenz speist im Römischen Kaiser. Oberbürgermeister Dr. Kerber hatte das Gedeck Nr. 2 für 4,50 Mk. ausgewählt: »Ochsenschwanzsuppe; Zanderschnitten gebacken, Sauce Remoulade, Kartoffelsalat; junge Mastente, Gefüllte Äpfel, Gurkensalat, Petersilien-Kartoffeln; Vanille-Eise mit warmer Chocoladentunke«.
Deutsch-französische Frontkämpfertreffen 1937–1938
|
63
Robert Wagner, Hanns Oberlindober und Dr. Maître senden ein Telegramm an den »Führer und Reichskanzler Adolf Hitler« – »selbst ein Frontkamerad«, wie der französische Berichterstatter vermerkt: »Über 2000 deutsche und 1000 französische Frontsoldaten entbieten vom Frontsoldatentag in Freiburg kameradschaftliche Grüße. Die Frontsoldaten sind sich einig in ihrem Wollen und ihrer Arbeit für die Verständigung ihrer Völker und für den Frieden«. Hitler antwortet: »Den zum Frontsoldatentag in Freiburg versammelten deutschen und französischen Frontsoldaten danke ich für die Grüße, die ich in kameradschaftlicher Gesinnung herzlich erwidere«. Der Nachmittag gehört der Stadt- und Münsterbesichtigung, im Stadtgarten spielt die Freiburger Regimentskapelle, Deutsche und Franzosen flanieren gemeinsam durch die Straßen oder besuchen Lokale, »um bei einem Glase Bier den Durst zu löschen und Erinnerungen an gemeinsam erlebte Schlachten auszutauschen«. Die »Führer« erleben im Stadion noch »Kampfspiele« der nationalsozialistischen Jugend. Schnell ist die Zeit des Abschieds gekommen. Um 16.30 Uhr trifft sich alles wieder im Stadtgarten. Reichskriegsopferführer Oberlindober, Oberbürgermeister Dr. Kerber und Dr. Maître drücken in bewegten Worten ihre Freude über den Tag aus. Oberlindober greift noch einmal das zentrale Thema auf und unterstreicht, »daß Kriege nicht dazu angetan sind, internationale Spannungen zu lösen, und nicht mehr notwendig sind, zu beweisen, daß deutsche und französische Soldaten die besten der Welt sind.« Kerber überreicht »einen mächtigen Strauß von Tannenzweigen und Tannenzapfen« für das Ehrenmal in Besançon. Verabredet wird ein Treffen der Frontkämpfer bereits für Ende Oktober in Belfort. »Der Abschied am Bahnhof gleich darauf war ein Abschied einer einzigen Familie.« Der Reichskriegsopferführer drückte »fast jedem« [!] der französischen Frontkämpfer die Hand. Beinahe – aber nur beinahe – hätte sich die Abfahrt des Sonderzuges verspätet. Deutsche und Franzosen »waren wirklich Freunde geworden«. Alles freut sich auf Belfort, obwohl – wie der Berichterstatter des »Alemannen« einen Franzosen vorbeugend zitiert – es dort »wohl nicht ganz so schön werden« wird. Der Kollege vom »Petit Comtois« beschreibt die Abfahrt des Zuges aus Freiburg – eine kleine deutsche Abordnung begleitet die Gäste noch bis Breisach –, als die Taschentücher flattern: »Die Unseren, welche sich an die Wagentüren drängen, antworten mit mächtigem ›Heil‹, das sie heute richtig auszusprechen gelernt haben (...).15 15 Der Alemanne, 5.7.1937; vgl. Le Petit Comtois, 6.7.1937. Programm des Treffens: StadtAF, C 4/XVI/29/8. Das Antworttelegramm Hitlers: Der Alemanne, 6.7.1937. Le Matin, 6.7.1937, referiert Oberlindobers Rede sogar so, daß er vom »deutschen Volk, dem Wall gegen den Bolschewismus«, gesprochen habe. Möglicherweise ging Oberlindober in seiner Ansprache über den Redetext hinaus, der im »Alemannen« veröffentlicht wurde. –
64
|
Eine inszenierte Friedensaktion
ll.
Dieser Tag stellte eine brillante Inszenierung der Nazis dar, wie sie dies so glänzend beherrschten.16 Die Balkenüberschrift des »Alemannen« – des »Kampfblattes der Nationalsozialisten Oberbadens« – am 5. Juli 1937 traf das Motto dieser Veranstaltung: »Frontsoldaten sind Wächter des Friedens! (...) Ein gewaltiges Bekenntnis zur deutsch-französischen Freundschaft«. Der Zeitpunkt war keineswegs zufällig und reihte sich in eine langfristige Strategie ein, Frankreich vom Willen des Deutschen Reiches zu Frieden und Freundschaft zu überzeugen, während gleichzeitig eine durchaus expansive Außenpolitik betrieben wurde. Dem Frontkämpfertreffen kam dabei eine herausragende Bedeutung zu. Die Ambivalenz des Vorgehens symbolisierte auch »Der Alemanne« in seinem erwähnten Bericht, als er auf derselben Seite, auf der Dr. Maîtres Rede wiedergegeben wurde, einen Artikel über »spanische Bolschewistenhäuptlinge in Paris« brachte, die dort »geheimnisvolle Gespräche mit dem französischen Ministerpräsidenten« geführt hätten. Die Verwirklichung der Strategie begann spätestens Anfang 1934.17 Zu dieser Zeit fanden erste Gespräche mit französischen Frontkämpferverbänden statt. Eine Zeitzeugin berichtete mir am 13.2.1989, daß der Verkehrsamtsleiter Nachzügler im Auto nach Breisach gefahren habe, damit sie dort noch den Zug erreichten. 16 Als exemplarische Analysen: M. Behrens, Ideologische Anordnung und Präsentation der Volksgemeinschaft am 1. Mai 1933, in: Ders. u. a., Faschismus und Ideologie 1 (Projekt Ideologie-Theorie. Argument-Sonderhand 60), 1980, S. 81–106 (vgl. auch die übrigen Beiträge dieses und des 2. Bandes); W. Elfferding, Von der proletarischen Masse zum Kriegsvolk. Massenaufmarsch und Öffentlichkeit im deutschen Faschismus am Beispiel des 1. Mai 1933, in: Inszenierung der Macht. Ästhetische Faszination im Faschismus, hg. v. der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst, 1987, S. 17–50. 17 Das folgende, soweit nicht anders zitiert, nach A. Prost, Les anciens combattants et la société française 1914–1939. 3 Bde., 1977, hier Bd. 1, S. 177–187 (ein insgesamt beeindruckendes Werk zu Geschichte, Soziologie, Mentalitäten und Ideologie der französischen Frontkämpfer, dem auf deutscher Seite nichts Vergleichbares zur Seite steht); Dutriez (wie Anm. 4) S. 3–4; J. Piekalkiewicz, Ziel Paris. Der Westfeldzug 1940, 1986, S. 22–45; W. Wette, Ideologie, Propaganda und Innenpolitik als Voraussetzungen der Kriegspolitik des Dritten Reiches, in: W. Deist u. a., Ursachen und Voraussetzungen der deutschen Kriegspolitik (Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg Bd. 1, hg. vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt), 1979, S. 23–173, bes. 113 ff., 128 ff., 137 ff., 166 ff. Die genaue Bezeichnung der französischen Frontkämpferorganisationen erfolgt in den einzelnen Werken unterschiedlich. Ein Zeitzeuge teilte am 13.2.1989 mit, 1935/36 hätten über Mittelsmänner der Katholischen Studentenverbindung »Arminia« in Freiburg Gespräche sowie ein mehrfacher Austausch von Schriftstücken zwischen einem Münchner Bankier und einem Rechtsanwalt aus Mulhouse stattgefunden. Als Ziel dieser Kontakte sei ihm genannt worden, aufgrund einer Idee von Heß die Frontkämpferverbände zusammenzuführen. – Allgemein zu verschiedenen Aspekten der deutsch-französischen Beziehungen: Deutschland und Frankreich 1936–1939. 15. Deutsch-französisches Historikerkollo-
Deutsch-französische Frontkämpfertreffen 1937–1938
|
65
Besonderes Geschick zeigte dabei der Schwetzinger Otto Abetz, Frankreich-Referent des Reichsjugendführers Baldur von Schirach und Vertrauter Joachim von Ribbentrops, der damals das Außenpolitische Amt der NSDAP leitete, mit dem die Partei am Auswärtigen Amt vorbei internationale Politik zu betreiben suchte. Abetz, der zum Dank für seinen Einsatz 1940 Botschafter in Frankreich werden sollte, hatte bereits vor 1933 gute Kontakte zu französischen Jugendorganisationen geknüpft. Nun nahm er eine Rede des Führer-Stellvertreters Rudolf Heß, in der dieser die Solidarität der Frontkameraden beschworen hatte, zum Anlaß, um die verschiedenen französischen Verbände aufzusuchen und sie vom Friedenswillen Deutschlands zu überzeugen. Am 2. August 1934 kam es zu ersten offiziellen Verhandlungen deutscher und französischer Frontkämpfer-Organisationen, an denen auch schon Reichskriegsopferführer Oberlindober teilnahm. Wenig später, am 2. November 1934, empfing Hitler Vertreter der »Union Nationale des Anciens Combattants«, und noch vor Weihnachten war dann unter Führung ihres Präsidenten Henri Pichot die – stärker links orientierte – »Union Fédérale des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre« zu Gast – jener Verband, der die französischen Delegierten beim Freiburger Treffen von 1937 stellte. Die Wirkung dieser neuen Beziehungen wurde auch nicht dadurch getrübt, daß das Deutsche Reich den Versailler Vertrag zu durchbrechen begann. Am 16. März 1935 verkündete Hitler die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, am 7. März 1936 marschierte die deutsche Wehrmacht im entmilitarisierten Rheinland ein. Die Befürchtungen, die in Frankreich aufkamen, wurden überdeckt durch die Versicherung Hitlers, nach der Rückkehr des Saarlandes zum Reich – als Ergebnis der Volksabstimmung vom 13. Januar 1935 – gebe es keine territorialen Ansprüche mehr. Und auch die weitergeführten Verhandlungen mit den französischen Frontkämpferverbänden, die immerhin mehrere Millionen Mitglieder umfaßten, taten das ihre. Hitler sprach im März 1935 mit dem Vorsitzenden des französischen Kriegsblindenverbandes, Georges Scapini, erinnerte an seine eigene vorübergehende Erblindung im Weltkrieg und meinte: »Eine mittlere Granate kostet 3500 Mark. Ein kleines Eigenheim für eine Arbeiterfamilie ebenfalls 3500 Mark.« Im Herbst 1935 wurde in Berlin die »Deutsch-Französische Gesellschaft« gegründet, mit Oberlindober als Vizepräsidenten. Kurz darauf folgte in Paris das »Comité France – Allemagne«, mit Henri Pichot als einem der Generalsekretäre. Diese Organe tagten häufig unter Beteiligung beider Seiten. quium des Deutschen Historischen Instituts Paris (1979), hg. v. K. Hildebrand und K. F. Werner (Beihefte der Francia 10), 1981; zur Politik Ribbentrops gegenüber Frankreich W. Michalka, Ribbentrop und die deutsche Weltpolitik 1933–1940. Außenpolitische Konzeptionen und Entscheidungsprozesse im Dritten Reich, 1980, bes. S. 50–69, 123–129, 259–269. Reichskriegsopferführer Oberlindober machte sich im übrigen mit seinen oft eigenmächtigen Kontakten beim Auswärtigen Amt unbeliebt (H.-A. Jacobsen, Nationalsozialistische Außenpolitik 1933–1938, 1968, S. 290).
66
|
Eine inszenierte Friedensaktion
Damit war der Rahmen gezimmert, um gemeinsame Frontkämpfer-Tagungen zu veranstalten – sogar am 8. März 1936, einen Tag nach der Besetzung des Rheinlandes, in Mannheim. Am 12. und 13. Juli 1936 fand ein bewegendes internationales Frontkämpfertreffen in Verdun statt. Alle Anwesenden schworen, den Frieden bewahren zu wollen. Die Olympiade in Berlin 1936 und die deutsche Beteiligung an der Pariser Weltausstellung, die am 26. Mai 1937 eröffnet wurde, schienen die Verständigungsbereitschaft des NS-Regimes zu betonen.18 Im Februar 1937 hatten Vertreter der Frontkämpferorganisationen in Berlin ein Ständiges Internationales Komitee gegründet. Am 16. Juni 1937 besuchte zum erstenmal seit dem Ersten Weltkrieg eine deutsche Militär-Delegation Paris, angeführt vom Generalstabschef Ludwig Beck und dem Leiter der Abteilung Fremde Heere West, Major i. G. Dr. Hans Speidel (dem späteren Oberbefehlshaber der NATO-Landstreitkräfte in Mitteleuropa). All dies wurde von deutscher Seite vorangetrieben, um ein Gegengewicht gegen den ungünstigen Eindruck zu schaffen, den die unübersehbare deutsche Aufrüstung und die massive Hilfe zugunsten der Franco-Truppen im Spanischen Bürgerkrieg – worüber das Deutsche Reich in Konflikt mit der französischen Volksfront-Regierung geraten war – hinterließen. Daß hier die französische Öffentlichkeit selbst gespalten war, konnte weidlich ausgenutzt werden. Intern gab es keinen Zweifel, daß der Friedenswille seitens der NS-Führung nur gespielt war: Der im August 1936 von Hitler vorgelegte »Vierjahresplan« sollte in diesem Zeitraum die Armee »einsatzfähig« und die Wirtschaft »kriegsfähig« machen. Richtete sich dabei auch der Stoß eindeutig gegen den »Bolschewismus«, schloß Hitler – etwa in der Besprechung am 5. November 1937, überliefert im »Hoßbach-Protokoll« – einen Konflikt »mit den beiden Haßgegnern England und Frankreich« nicht aus, obwohl er ihn für unwahrscheinlich hielt. Allerdings hatte gerade der Kreis um Ribbentrop daran gedacht, ernsthaft um Frankreich als Bündnispartner zu werben, ohne damit jedoch eine Kehrtwendung in der Außenpolitik durchzusetzen. Insofern kann man nicht ausschließlich von einer Politik der Täuschungen sprechen. Hitler offenbarte seine Absichten, die hinter den Friedensbekundungen standen, dann am 10. November 1938 vor deutschen Pressevertretern: »Die Umstände haben mich gezwungen, jahrzehntelang fast nur vom Frieden zu reden. Nur unter der fortgesetzten Betonung des deutschen Friedenswillens und der Friedensabsichten war es mir möglich, dem deutschen Volk Stück für Stück die Freiheit zu erringen, und ihm die Rüstung zu geben, die immer wieder für den nächsten Schritt als Voraussetzung notwendig war.« Viele Menschen könnten dadurch glauben, »daß das heutige Regime an sich identisch sei mit dem Entschluß und dem Willen, den Frieden unter allen Umständen zu 18 Bei der Eröffnung der Olympiade bekam Hitler einen Ölzweig überreicht, »Friedenstauben« wurden in die Lüfte entsandt (J. C. Fest, Hitler. Eine Biographie, 1973, S. 708).
Deutsch-französische Frontkämpfertreffen 1937–1938
|
67
bewahren.« Dies sei natürlich falsch, deshalb habe man derart in der Propaganda vorgehen müssen, »daß die innere Stimme des Volkes selbst langsam nach der Gewalt zu schreien begann.«19 III.
Vor diesem Hintergrund ist das Freiburger Treffen vom 4. Juli 1937 zu sehen. Die Veranstaltung sollte in einer durchaus noch labilen außenpolitischen Situation Frankreich zeigen, daß Deutschland Frieden wolle, aber dabei nicht auf militärische Stärke verzichte. Es kennzeichnete die Nationalsozialisten, daß sie die Bevölkerung – und in diesem Fall auch die Öffentlichkeit Frankreichs – hinter sich zu bringen und dienstbar zu machen – »zu erobern« – versuchten, indem sie durch gezielte Inszenierungen gerade in solche Bereiche, Themen, Begriffe eindrangen, die an sich nicht mit ihnen verbunden wurden. So wie man in den Veranstaltungen zum 1. Mai 1933 bestrebt gewesen war, die Arbeiterschaft – deren Organisationen die schärfsten Gegner der Nazis waren – vom KlassenkampfDenken abzubringen und in die »Volksgemeinschaft« zu integrieren, so sollte jetzt ein Thema »besetzt« werden, das bisher nicht eben als Ziel der NSDAP gegolten hatte: Frieden.20 Bereits im November 1933 hatte Hitler in einem Interview für den französischen Pressedienst »Information« betont, daß er als Reichskanzler anders handeln 19 Zitate aus: Das Dritte Reich. Dokumente zur Innen- und Außenpolitik. Bd. 1. »Volksgemeinschaft« und Großmachtpolitik 1933–1939. hg. v. W. Michalka, 1985, S. 188–190 (Vierjahresplan), 234–236 (Hoßbach-Protokoll), 261 (Hitler-Rede am 10.11.1938). Wette (wie Anm. 17) zitiert u. a. S. 114 einer geheime Goebbels-Rede vom 5.3.1940, in der er die »Politik der Täuschungen« zusammenfaßte und gerade die Haltung Frankreichs unverständlich fand, Hitler gewähren zu lassen. 20 Hier und im folgenden verdanke ich manche Anregungen den in Anm. 16 genannten Beiträgen. Behrens, S. 81, zitiert Goebbels: »Durch wohlüberlegtes Inszenieren ist alles zu erreichen«. Vgl. auch Fest (wie Anm. 18) S. 698–708: Er betont den Einfluß des Rituals der katholischen Kirche und der »Theaterliturgie« Richard Wagners auf die NS-Veranstaltungen (S. 699), »Hitlers Vorstellung ästhetisierter Politik« (S. 700) und die »Magie der Kulisse« (S. 705); H.-U. Thamer, Verführung und Gewalt. Deutschland 1933–1945 (Die Deutschen und ihre Nation, Bd. 5), 1986, S. 417–434. – Im übrigen beschränkten sich die Friedensoffensiven keineswegs auf den Westen. Gegenüber Polen schien man mit dem Nichtangriffsvertrag von 1934 zu einem Ausgleich kommen zu wollen, und auch hier spielten die Kriegsveteranen eine wichtige Rolle: Noch am 6.7.1938 legte Reichskriegsopferführer Oberlindober beim deutsch-polnischen Frontkämpfertreffen in Krakau einen Kranz am Grab Marschall Piłsudskis nieder (M. Overesch, W. Saal, Das Dritte Reich 1933–1939 [Drostes Geschichtskalendarium. Chronik deutscher Zeitgeschichte. Politik – Wirtschaft – Kultur, Bd. 2,1], 1982, S. 458).
68
|
Eine inszenierte Friedensaktion
8 Eine Erinnerung an das Frontkämpfertreffen in Freiburg. (StadtAF, M 2/126)
werde, als er in »Mein Kampf« mit seinen Haßtiraden auf Frankreich und seinen Kriegswünschen angekündigt habe. Er berichtige seine Ausführungen gegenüber Frankreich am besten dadurch, daß er für eine deutsch-französische Verständigung eintrete.21 Davon mußten nun die Franzosen überzeugt werden – und die Deutschen, denn die Inszenierungen des Friedens- und Verständigungswillens waren nicht nur für das Ausland gedacht. Sie sollten auch die eigene Bevölkerung glauben machen, das NS-Regime wolle den Frieden, allerdings nicht als schwaches, abhängiges Land wie die Weimarer Republik, sondern als starkes Reich, das gemäß seiner Ehre handele. Ja, die Planung des Treffens in Freiburg ging sogar gezielt auf das Bewußtsein in der Region ein, wenn die Stellung der »Schwarzwaldmetropole« als »Brückenpfeiler zwischen Deutschland und Frankreich« her21 Piekalkiewicz (wie Anm. 17) S. 23. Diese Argumentation wiederholte Hitler häufig.
Deutsch-französische Frontkämpfertreffen 1937–1938
|
69
vorgehoben wurde. In den Ansprachen und Berichten versäumte man auch nicht, immer wieder auf die Schönheit von Stadt und Umgebung hinzuweisen. Veranstaltungen zum Frieden waren bislang eine Domäne der Pazifisten sowie demokratischer und kirchlicher Verbände gewesen. So hatte in Freiburg vom 4. bis 10. August 1923 der 3. Internationale Demokratische Friedenskongreß getagt, und am 11. März 1928 waren die beiden Friedensnobelpreisträger Ferdinand Buisson und Ludwig Quidde in einer Kundgebung des Badischen Landesverbandes der Deutschen Friedensgesellschaft im Stadttheater geehrt worden. Auch damals hatte der Freiburger Oberbürgermeister – Kerbers Vorgänger Dr. Bender – gesprochen, es fielen schöne und hoffnungsvolle Worte, man zeigte sich über den Ablauf zufrieden, beanspruchte sogar eine »historische Bedeutung« für das Treffen, »da sich wohl zum erstenmale breite Kreise des deutschen Volkes in so starker Weise mit der Friedensbewegung identifizierten.«22 Die Nazis legten ihre Inszenierung sehr viel offensiver an. Ihr Vorstellungsrahmen war die geschlossene, militarisierte »Volksgemeinschaft«. Sie wollten nicht in erster Linie durch das Argument das jeweilige Individuum ansprechen, um es über den Verstand zur Einsicht und dann zum Handeln zu bringen. Statt dessen zielten sie auf die Gefühle der Masse durch die Art des Ablaufs der Veranstaltung. Diese sollte die Teilnehmer zur Aktivität bewegen – zur Einordnung in die Marschkolonne, zum Jubeln am Straßenrand, zum Zeigen von Symbolen. Den Reden und den sie begleitenden Schauformen kam die Aufgabe zu, die Wünsche und Sehnsüchte der Massen aufzugreifen, damit sich bei diesen das Empfinden einstellte, hier gehe es um ihre eigene Sache. Auf diese Weise sollten sie bereit sein, sich mit dem Vorgegebenen zu identifizieren. Zunächst einmal wurde bereits im Vorfeld des Treffens die Einwohnerschaft aufgefordert, sich an der Ausschmückung der Stadt zu beteiligen und sich zu dem »noch nie erlebten Akt« einzufinden. Über die Medien sowie durch die Beflaggung, die Transparente, den Aufmarsch der Verbände, der Parteigliederungen und des Militärs, schließlich auch durch die Reden mußte der Eindruck entstehen, daß tatsächlich ein »Groß-Ereignis für unseren Gau« stattfand, dem man sich nicht entziehen konnte. Die Inszenierung vermittelte das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Man tat, indem man an diesem Tag in irgendeiner Weise mitmachte, gemeinsam etwas Richtiges. Dieses Gefühl kam um so leichter auf, als es um Frieden und deutsch-französische Verständigung ging, also um ein Thema, das 22 StadtAF, Dwe 5300, Die Friedens-Warte 28, 1928, H. 4, S. 107–112, Zitat S. 107 (im übrigen wurde auch hier die besondere Rolle Freiburgs als Grenzstadt hervorgehoben). Zum Kongreß 1923, der ein Ausdruck der Bestrebungen des Friedensbundes deutscher Katholiken war, die Aussöhnung gerade mit Frankreich voranzutreiben, und zur allgemeinen Entwicklung D. Riesenberger, Geschichte der Friedensbewegung in Deutschland. Von den Anfangen bis 1933, 1985, hier S. 206. Zu Empfängen von Kriegsopferverbänden in den zwanziger Jahren vgl. StadtAF, C 4/XVI/26/2 (z . B. 1927).
70
|
Eine inszenierte Friedensaktion
den Wünschen vieler Menschen entsprach. Für die Zeit während der Sudetenkrise wurde in einem internen Bericht festgestellt: »Überall herrschte große Spannung und Beunruhigung, und überall wurde der Wunsch laut: Nur keinen Krieg. Besonders scharf wurde dieser Wunsch von den Frontkämpfern des Weltkrieges ausgesprochen«.23 Diese Wünsche setzte man dann um in Symbole – gewiss nicht in pazifistische, aber doch in Wimpel, Fahnen, Transparente, Blumen, Opferschalen, die Beschwörung der »Frontkameradschaft« – und in die öffentliche Manifestation: die ritualisierten Begrüßungen mit Marschmusik24, Heil-Rufen und militärischen Ehren, die Uniformen, das feierliche Gedenken,25 die immer wiederholten Redewendungen und vor allem die soldatischen Formationen. Sieht man einmal von dem »freien Nachmittag« ab, vollzog sich alles wohlorganisiert und möglichst in »Marschsäulen«. Die Wünsche der Massen wurden in eine Form gebracht. Die Masse handelte und tat ihren Willen kund, aber nur scheinbar aus eigenem Antrieb und schon gar nicht unordentlich. Die Organisationsleitung hatte alles im Griff. Indem der Einzelne sich in diese Darstellungsform seiner Wünsche einordnete, akzeptierte er das Vorgegebene. Hinter der Inszenierung stand die Absicht, daß er sich darüber hinaus auch damit identifizierte. Durch das Erlebnis dieses Tages sollten sein Gefühl und seine ganze Persönlichkeit so beeindruckt werden, daß er freiwillig die übermittelten Inhalte als seine eigenen ansah.26 23 Wette, (wie Anm. 17), S. 140. 24 Hitlers Lieblingsmarsch, den Badenweiler, konnte man allerdings schlecht spielen, da er nach der Erstürmung von Badonviller durch deutsche Truppen am 12.8.1914 komponiert worden war. (Mitteilung des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes Freiburg; Transfeldt, Wort und Brauch in Heer und Flotte, hg. von H.-P. Stein, 91986, S. 324). – Bald darauf wurde ohnehin von Reichsminister Goebbels bestimmt, daß der Badenweiler Marsch »nur bei Veranstaltungen, an denen der Führer teilnimmt, und nur in seiner Anwesenheit öffentlich gespielt werden« dürfe (Polizeiverordnung gegen den Mißbrauch des Badenweiler Marsches vom 17.5.1939, in: Landespolizeidirektion Freiburg, 27/1026, Randbemerkung: «Oho!«). 25 Behrens (wie Anm. 16) S. 105 zitiert im Zusammenhang des »Totenfeier-Rituals« und der damit verbundenen Aufmärsche das bewußte Einsetzen des Liedes »Ich hatt’ einen Kameraden«, »dessen Ich-Form jeden Einzelnen anrief« (nach H. Schrade, Der Sinn der künstlerischen Aufgabe und politischer Architektur, in: Nationalsozialistische Monatshefte, Juni 1934, S. 508–514). Freiburg hatte erst kurz zuvor, am 23.4.1937, ein solches Ritual anläßlich des Staatsbegräbnisses für den Weltkriegsgeneral, ehemaligen Reichstagsabgeordneten und Ehrenbürger Max v. Gallwitz erlebt (StadtAF, C 4/ Il/23/5). 26 Dieser Vorgang dürfte sicher auch für manche Nationalsozialisten selbst zutreffen, von denen man nicht annehmen kann, daß jeder bewußt den kommenden Krieg herbeisehnte. Sogar Oberbürgermeister Kerber scheint es, wie viele Äußerungen zeigen, ernsthaft um eine Aussöhnung mit Frankreich gegangen zu sein (vgl. Anm. 41; auch W. Middendorff, Kerber, Franz Anton Josef, in: Badische Biographien. Neue Folge Bd. 2, hg. v. B. Ottnad, 1987, S. 157–158). – Die Friedenshoffnungen der deutschen Bevölkerung wurden anläß-
Deutsch-französische Frontkämpfertreffen 1937–1938
|
71
Bei dieser Gelegenheit war es dann leicht möglich, Ziele des Nationalsozialismus hinzuzufügen, die an sich, von der Sache her, nicht zum Thema Frieden und deutsch-französische Verständigung rechneten. Das traf nicht nur für die Hervorhebung des Führerkultes auf jeder Ebene zu. Durch die Teilnahme der Wehrmacht unter ihrem Freiburger Standortkommandanten, Oberst Richter, wurde diese in die Friedensdemonstration eingebunden. Die deutschen Redner, namentlich der Reichskriegsopferführer, rechtfertigten die Politik der Aufrüstung und der militärischen Stärke, ja betonten die Gemeinsamkeit des Kampfes gegen den Bolschewismus, den »asiatischen Irrsinn«. Der Antikommunismus kann als ideologisches Bindemittel gegenüber der deutschen Bevölkerung wie gegenüber dem nichtsowjetischen Ausland gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.27 Der Frieden sollte demnach keineswegs durch Pazifismus oder Abrüstungsmaßnahmen erreicht werden. Der Soldat, diese Vorstellung galt es zu vermitteln, wache über den Frieden. Nur von einer Position der Stärke aus sei der Frieden zu erhalten. Wesentlich schwächer als die französische Seite lehnten die Nazis für die Zukunft den Krieg ab. Man ließ die Bereitschaft durchblicken, den Westen gegen die angebliche Bedrohung aus dem Osten zu verteidigen – Deutschland als Bollwerk zur Bewahrung der abendländischen Kultur –, und erklärte ganz deutlich, man werde keinen Angriff auf »die Ehre der Nation« zulassen – auch nicht von Frankreich. Der Inszenierung in Freiburg gelang es sogar, die französischen Gäste einzubinden. Sie schienen es dem Reichskriegsopferführer nicht verübelt zu haben, daß er ihnen Ratschläge für ihre Innenpolitik erteilte. Die Begeisterung über den Ablauf des Tages, über die beschworene Frontkameradschaft – zumal in dem Sinn, daß die Deutschen und die Franzosen die besten Soldaten der Welt seien –, über die Verbrüderung war so stark, daß man die NS-Symbolik mitakzeptierte, ein Telegramm an Hitler – über die »Führer« – mitunterzeichnete und sogar in die Heil-Rufe einstimmte. Die Nazis hatten einen vollen Erfolg erzielt. Selbstverständlich lag dies nicht einfach an der Naivität französischer Frontkämpfer. In ihren Organisationen war ein patriotischer und militanter Pazifismus verbreitet, für den der Frieden einen absoluten Wert darstellte. Deshalb weigerte man sich zu glauben, der Weg in den Krieg sei unvermeidlich, und unternahm immer wieder Versuche, ihn zu verhindern. Dabei hoffte man, die Meinung des lich der außenpolitischen Expansionen des Reiches, ja auch anläßlich des Kriegsausbruchs 1939 in internen Berichten immer wieder betont, eine Begeisterung für den Krieg war nicht zu spüren; vgl. Wette (wie Anm. 17) S. 137–142 (s. Zitat bei Anm. 23), zur geschlossenen, militarisierten »Volksgemeinschaft« S. 166 ff. 27 Zur Antibolschewismuskampagne gerade zur Zeit des Spanischen Bürgerkrieges vgl. auch A. Kuhn, Hitlers außenpolitisches Programm. Entstehung und Entwicklung 1919–1939, 1970, S. 196–198; Michalka (wie Anm. 17) S. 113–122; Wette (wie Anm. 17) S. 116– 117, 120–121, 144 ff.
72
|
Eine inszenierte Friedensaktion
deutschen Volkes werde mächtiger sein als die Regierung. Der Jubel der Freiburger und ihr herzlicher Empfang für die Franzosen dürften diese darin bestärkt haben, so daß sie zu einer Fehleinschätzung der NS-Diktatur und der Inszenierungsabsichten gelangten.28 IV.
In der weiteren Geschichte der deutsch-französischen Frontkämpfer-Treffen wurde die Ambivalenz dieser Beziehungen, die Verbindung zur »großen Politik« und die Instrumentalisierung von Gefühlen und Wünschen durch die Nazis offenbar. Zunächst entwickelte sich alles wie geplant. Noch vor dem ins Auge gefaßten nächsten großen Treffen fuhren Oberbürgermeister Kerber, die Freiburger Ratsherren sowie weitere prominente Persönlichkeiten – wie der Rektor der Universität, Professor Metz – am 7. und 8. Oktober 1937 nach Besançon, Montbéliard und Belfort, mit einem Abstecher zum Hartmannsweilerkopf. Die Reise wurde hauptsächlich in den »repräsentativsten« Wagen der Firma AutoUnion durchgeführt. Die Firma stellte auch die meisten Chauffeure. Unterwegs besuchte man französische Aéro-Clubs, in denen sich damals die Autofreunde 28 Vgl. Prost (wie Anm. 17) Bd. 1, S. 186, ausführlich Bd. 3 zu Mentalitäten und Ideologie. Auch Maître hatte seinerzeit das Gefühl, der Friedenswille bei den Deutschen sei echt. Er bewunderte darüber hinaus den Rahmen: »Alles wurde mit dem Organisationstalent, mit dem Sinn für Ordnung und Methode ausgeführt, die alle deutschen Veranstaltungen auszeichnen« (wie Anm. 4, S. 174, zum Friedenswillen ff.). – In welcher Weise Inszenierungen eingesetzt wurden, zeigte auch folgendes Beispiel. Am 18.4.1936 war eine englische Schülergruppe auf dem Schauinsland überraschend in einen Schneesturm geraten. Fünf Jugendliche fanden den Tod. Die HJ organisierte sofort eine Totenwache und ein Ehrengeleit bis nach England. Dies wurde dort – neben der Einsatz- und Hilfsbereitschaft der Bevölkerung – sehr hervorgehoben. Oberbürgermeister Kerber schrieb daraufhin am 9.6.1936 an den Vater eines der Toten, der zugleich Präsident der örtlichen Vereinigung ehemaliger Frontsoldaten war und sich in Freiburg wie bei Hitler bedankt hatte: »Die armen Jungen sind nicht umsonst gestorben, nicht das Opfer eines unverständlichen Zufalls geworden, sondern sie wurden zu Vorkämpfern für die wichtige Sache der Verständigung zweier großer Nationen.« Die Reichsjugendführung nahm sich der Sache an. Sie ließ erklären: die Schüler »fielen im Kampf für ein offenes, ehrliches und anständiges Verhältnis der Völker untereinander« (Der Alemanne, 24.3.1937). In diesem Sinne wurde ein Denkmal geplant. Baldur v. Schirach lehnte die erste Fassung ab und beauftragte einen Architekten seiner Wahl, eine würdigere, d. h. monumentalere, Form vorzusehen. Es wird deutlich: als sich herausstellte, daß die inszenierten Rituale und Symbole ihre Wirkung nicht verfehlten, gaben die Nazis dem Unglücksfall eine politische Deutung, mit der sich die Menschen gefühlsmäßig identifizieren sollten (im Krieg mußte dies natürlich wieder rückgängig gemacht werden – die Inschrift des Denkmals wurde entfernt) . Vgl. StadtAF, C 4/XII/4/10, auch M 2/104.
Deutsch-französische Frontkämpfertreffen 1937–1938
|
73
organisierten. Der »Nebenzweck« war deutlich: Man wollte die Erzeugnisse der aufstrebenden deutschen Autoindustrie vorführen – auch das gehörte zur Inszenierung. Der Oberbürgermeister bedankte sich am 18. Oktober 1937 beim Direktor der Freiburger Auto-Union-Filiale: »Wir konnten unterwegs wiederholt Ausrufe der Bewunderung über die prächtigen Wagen vernehmen, und auch die Presseberichte haben besonders auf die imponierenden deutschen Wagen, welche der Auto-Union entstammten, abgehoben.« Die Fahrer sollten jeweils 10 RM aus der Stadtkasse erhalten, die die Firma allerdings der Kameradschaftskasse zukommen ließ, »um damit auch denen eine kleine Freude zu bereiten, die nicht an dieser Fahrt teilnehmen konnten.«29 In den Ansprachen bildeten die Friedensbemühungen wieder das zentrale Thema. Oberbürgermeister Kerber meinte in Besançon, wenn die Deutschen und die Franzosen unmittelbar in Berührung kämen – so wie bei diesem Treffen –, dann würden sie sich nicht mehr als Feinde aufeinander hetzen lassen. Die Geschichte lehre, daß das Glück der beiden Völker in der Verständigung und nicht in der verhängnisvollen Feindschaft liege. Dr. Maître hob hervor, daß Freiburg und Besançon – nach den Worten eines deutschen Kameraden – die beiden ersten Städte seien, »die in Frankreich und Deutschland das Feuer des Friedens entzündet hätten.« Beim Empfang spielte ein französischer Pianist »die beiden deutschen Nationalhymnen«, das Deutschland- und das Horst-Wessel-Lied. Als symbolische Handlung legte Oberbürgermeister Kerber das Blumengebinde, das er in Montbéliard erhalten hatte, am Freiburger Kriegerdenkmal nieder.30 Dieser Besuch der Freiburger stellte eine besondere Geste dar. Daß die Spitzen der Stadtverwaltung und herausragende Persönlichkeiten offiziell in eine französische Stadt reisten, war zu dieser Zeit außergewöhnlich. Zugleich unterstrichen sie damit, wie sehr ihnen die Begegnungen am Herzen lagen, auch wenn sie sich für das Frontkämpfer-Treffen in Besançon, das dann am 24 . Oktober 1937 hier und nicht in Belfort stattfand, entschuldigen mußten: Die Eröffnung der Lehrund Leistungsschau badischer Gemeinden in Karlsruhe gehe bedauerlicherweise vor. Der Bürgermeister von Besançon, Siffert, und die Führer der FrontkämpferOrganisationen grüßten den Freiburger Oberbürgermeister in einem herzlichen Telegramm, Teilnehmer sandten eine Postkarte an die Stadtverwaltung, Dr. Maître schrieb noch einmal gesondert an Dr. Kerber und kündigte einen weiteren Besuch in Freiburg während des kommenden Jahres an.31 29 StadtAF, C 4/XVI/29/8. In der Tat berichtete Le Petit Comtois am 8.10.1937 recht enthusiastisch über die »prächtigen« Autos. 30 Le Petit Comtois, 8.10.1937; Le Nouvelliste, 8.10.1937 (StadtAF, C 4/XVI/30/1, Übersetzung in: StadtAF, C 4/XVI/29/8); vgl. Der Alemanne, Freiburger Zeitung und Freiburger Tagespost, 11.10.1937; Der Führer, 13.10.1937; Elsaß-Lothringer Zeitung, 15.10.1937; Neue Basler Zeitung, 15. und 20.10.1937. 31 StadtAF, C 4/XVI/29/8 (sowie einschlägige Zeitungsberichte in C 4/XVI/30/1).
74
|
Eine inszenierte Friedensaktion
Über den Verlauf des Treffens am 24. Oktober 1937 zeigte man sich wieder allgemein befriedigt. Die Stadt Besançon und der Conseil Général des Departements hatten, als Antwort auf den »freundschaftlichen und enthusiastischen Empfang« in Freiburg, beträchtliche Zuschüsse zur Verfügung gestellt. Die »Verbrüderung« sollte die deutsch-französischen Beziehungen »glücklich« beeinflussen.32 Am Vorabend war eine französische Abordnung aus Besançon in Freiburg eingetroffen, hatte – in Anwesenheit von Reichskriegsopferführer Oberlindober – einen Kranz am Ehrenmal der 113er niedergelegt und am Sonntag dann die deutschen Frontkämpfer in ihrem Sonderzug nach Besançon begleitet. Insgesamt beteiligten sich etwa 1500 Deutsche. Diese waren durch einen Artikel von Gauamtsleiter Julius Weber darauf eingestimmt worden, daß ihre »Liebe zum Frieden« keineswegs mit Pazifismus gleichzusetzen sei. Sie wollten die Verständigung, weil Kriege, die sie nicht fürchteten, »auf die Dauer« die »Lebensfragen der Völker« nicht lösen könnten und weil die Annäherung dazu beitrage, die im Ausland vorhandenen »Vorurteile« abzubauen.33 Schriftleiter Artur Keser vom »Alemannen« wertete das Treffen als »Friedenskundgebung gewaltigen Ausmaßes« und »Meilenstein der Verständigung«. »Frontkämpfer marschieren für den Frieden«, überschrieb er seinen Bericht. Die Bevölkerung begrüßte, so Keser, die Deutschen begeistert in Montbéliard wie in Besançon. Abordnungen der französischen Armee waren angetreten. Der Marsch durch die Stadt glich einem »Triumphzug«. Neben den deutschen waren rund 2000 französische Frontkämpfer angetreten. Am Ehrenmal, das von der Hakenkreuzflagge und der Trikolore überragt wurde, legten zunächst »die französischen Kriegsopferführer Maître und Pichot ihr Bekenntnis zum Frieden ab«, während danach Reichskriegsopferführer Oberlindober »namens der gesamten deutschen Frontkämpfer das Gelöbnis anfügte, den Geist dieses Treffens nie in den Herzen erlöschen zu lassen.« Alle Redner der folgenden Kundgebung beschworen den Frieden, den – wie sich Henri Pichot ausdrückte – unsere beiden Völker »leidenschaftlich wünschen«. Er verurteilte einen zukünftigen Krieg auch klipp und klar als »Totengeläut der Zivilisation«. Oberlindober war hier etwas vorsichtiger. Zwar betonte er ebenfalls den Friedenswillen Deutschlands. Das neue Reich brauche eine »lange Zeit wahren Friedens und freundschaftlicher Nachbarschaft«, um seine großen Aufgaben zu bewältigen. Auch wolle man es den »Söhnen und Töchtern, für deren Leben und 32 Bulletin officiel de la Commune de Besançon. Année 1937, Délibération du Conseil municipal du 11 août 1937 (AMB, C 2000); Procès-verbaux des délibérations du Conseil général 1937, S. 166: Séance de 20 octobre 1937 (AMB, C 6173). 33 Freiburger Zeitung, 21.10.1937 (Programm), 22.10.1937 (Franzosen in Freiburg, Artikel J. Webers, ebenso in: Der Führer, 23.10.1937), 25.10.1937 (Franzosen in Freiburg); Der Alemanne, 24.10.1937 (Bericht von A. Millot über »Besançon, die alte Reichsstadt« einschließlich Darstellung von Gemeinsamkeiten mit Freiburg), 25.10.1937 (Franzosen in Freiburg).
Deutsch-französische Frontkämpfertreffen 1937–1938
|
75
9 Vor dem Bahnhof in Besançon am 24. Oktober 1937. In der Mitte: der Präsident der Union Fédérale des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre, Henri Pichot, und Reichskriegsopferführer Oberlindober. (Musée de la résistance et de la déportation de Franche-Comté, Besançon [im folgenden: MRD], F I 364)
für deren Zukunft wir Glück und Sonne als Eltern wünschen müssen«, ersparen, so wie ihre Väter gegeneinander zu fechten. Aber er hob darüber hinaus hervor, daß Deutschland »von der Natur nicht mit jener Fruchtbarkeit und jenen Bodenschätzen gesegnet ist, die nach dem Willen des Schöpfers und der Vorsehung allen Völkern gemeinsam gehören sollen.« Man erwarte deshalb, daß die Welt Deutschland an ihren Gütern beteilige. Der Vorbehalt für Frieden und Freundschaft war unüberhörbar. Alle Frontkämpfer leisteten dann gemeinsam den Schwur von Verdun: den Frieden, der dem Opfer der Toten zu verdanken sei, zu schützen und zu erhalten. Entsprechende Transparente grüßten überall in der Stadt. An den Führer des Deutschen Reiches, Adolf Hitler, und an den Präsidenten der Republik, Albert Lebrun, sandte man gleichlautende Telegramme mit der Hoffnung auf eine deutsch-französische Annäherung. Deutschland- und Horst-Wessel-Lied sowie die Marseillaise beschlossen die Kundgebung. Im Anschluß daran standen wieder gemeinsame Mahlzeiten, Promenadenkonzerte und Stadtrundgänge auf dem Programm. Der Abschied übertraf dann alles bisher Dagewesene. Die Bevölkerung zeigte in herzlicher Weise ihre Freundschaft. Die NS-Kreiskapelle Freiburg, die die deutschen Frontkämpfer begleitete, wurde wiederholt von Beifall überschüttet. Überall rief man: »Vive la paix – es lebe der Frieden!«
76
|
Eine inszenierte Friedensaktion
10 Blick vom Heldendenkmal in Besançon auf die zur Kundgebung angetretenen französischen Frontkämpfer. (StadtAF, M 75/1)
»Am Bahnhof spielten sich unbeschreibliche Szenen ab. Starke Männer standen hier einander im Abschiedsschmerz gegenüber, und nur das Versprechen eines baldigen Wiedersehens ließ ihnen den Abschied leichter werden.« Noch lange nach der Abfahrt des Zuges saßen die französischen Frontkämpfer beisammen und »kannten nur ein Thema: Versöhnung und Friede mit Deutschland.«34 34 Der Alemanne, 25.10.1937; vgl. Freiburger Zeitung, 25.10.1937; Der Führer, 25.10.1937 (hier wieder neben dem Artikel über Besançon ein Bericht über die »Bolschewiki« in Spanien); Freiburger Tagespost und Der Alemanne, 26.10.1937 (Aufruf der französischen Jugend an die deutsche für Frieden und Verständigung; es war »mit besonderer Freude« vermerkt worden, daß Dr. Bran als Vertreter der HJ an der Reise teilgenommen hatte: Freiburger Zeitung, 25.10.1937); Der Alemanne, 30./31.10.1937 (Nachklang vom Treffen – »Freiburg und Besançon, Patenstädte des Friedens« – und Bericht über die Rede des französischen Außenministers Delbos, der unter Hinweis auf die Frontkämpfertreffen die deutsch-französische Verständigung forderte).
Deutsch-französische Frontkämpfertreffen 1937–1938
11 Kundgebung für den Frieden. (MRD, F I 371)
12 Die Wiederholung des Schwures von Verdun. (StadtAF, M 75/1)
|
77
78
|
Eine inszenierte Friedensaktion
So überschwenglich die NS-Berichterstattung auch ausfiel und so berechtigt das Urteil über den Erfolg der deutschen »Friedensoffensive« auch sein konnte: die Vorahnung am 4. Juli, daß das Treffen in Frankreich »wohl nicht ganz so schön« sein werde, hatte nicht völlig getrogen. Unter der Oberfläche gab es einige Irritationen. Die französischen Frontkämpfer weigerten sich etwa, wie die Deutschen nach Rangordnung und im Gleichschritt zu marschieren. Der Friedenswille wurde durch einen betont zivilen statt militärischen Charakter des Treffens unterstrichen: Den französischen Journalisten fiel auf, daß weniger Uniformen zu sehen waren, daß sich Besançon nicht wie »Nürnberg im Fieberwahn« präsentierte. In der Tat: sieht man von den Ehrenformationen der französischen Armee und von der Polizei ab, überwog die zivile Kleidung. Selbst Reichskriegsopferführer Oberlindober erschien nicht in seiner SA-Uniform, sondern in der wesentlich weniger martialischen des NSKOV. Im Unterschied zu Freiburg fanden auch ein offizieller Empfang im Rathaus und eine Messe in der Kathedrale statt, bei der der Segen des Papstes verkündet wurde. All dies hatte den Planern des Freiburger Treffens offenbar nicht in ihr Konzept der formierten Ordnung des Individuums gepaßt. Völlig undenkbar war gewesen, daß wie in Besançon anläßlich des Treffens auch ein Gottesdienst in der Synagoge stattfand – wenngleich man ihn auf den Vorabend verlegt hatte.35 Die Kommunistische Partei verspottete in ihrem Aushängekasten Dr. Maître und tat damit – gewiß vorsichtig – ihre Opposition zu jenen Treffen kund. Der Berichterstatter der »Freiburger Zeitung« ging – ebenso wie die der übrigen deutschen Zeitungen – darauf nicht ein, versuchte aber seinerseits, die Kommunisten lächerlich zu machen: »Was tat es, daß in der Menge der Tausenden hier und da ganz verschwindend und völlig in den Hintergrund gedrängt eine finstere, arme, von Moskau verführte Gestalt versuchte, die Faust zu ballen. Lachend antworteten die deutschen Frontkämpfer mit dem Ruf nach Frieden und mit einem Heil auf Frankreich, und doppelt herzlich klang der Beifall der Massen empor. Immer wieder versuchten französische Frontkämpfer es uns zu sagen, daß der Bolschewismus in Frankreich auf verlorenem Posten steht (...).«36 Obwohl demnach durchaus eine herzliche und freundschaftliche Atmosphäre herrschte, die Teilnehmer einig waren in ihrem Wunsch nach Frieden und Versöhnung, ließen sich unterschiedliche Akzente gegenüber dem Treffen in Freiburg nicht übersehen. Die Einbindung in die Vorstellungen der Nazis gelang weniger vollkommen, selbst wenn das Ziel, die französische (und die deutsche) Bevölkerung von den angeblich friedlichen Absichten des Deutschen Reiches zu überzeu35 Nach Dutriez (wie Anm. 4) S. 2–3 (er zitiert zahlreiche französische Zeitungen). Über die Messe berichtete auch das St. Konradsblatt am 7.11.1937. Julius Dorneich vom HerderVerlag sandte dem Freiburger Oberbürgermeister am 18.6.1959, nach vollzogener Partnerschaft beider Städte, eine Kopie (StadtAF, C 5/135). 36 Freiburger Zeitung, 25.10.1937.
Deutsch-französische Frontkämpfertreffen 1937–1938
|
79
13 Verabschiedung der deutschen Frontkämpfer vor dem Bahnhof in Besançon. (MRD, F I 370)
gen, gewiß erreicht wurde. Die NS-Berichterstattung ließ diese unterschiedlichen Aspekte unter den Tisch fallen und beschrieb den Tag so, wie er eigentlich hätte verlaufen sollen: Deutlicher kann nicht werden, wie sehr hier in Kategorien der Inszenierung gedacht wurde. Der Öffentlichkeit nicht bekannt wurde übrigens auch der Ärger, den es intern in Freiburg im Anschluß an das Treffen gab. Die französische Abordnung, die die Deutschen hier abgeholt hatte, war, wie es in den Zeitungen hieß, als »Gast der Stadt Freiburg« bewirtet worden, und man hatte ihr ein volles Programm geboten.37 Die Stadt wußte jedoch nichts von ihrem Glück. Das Verkehrsamt hatte zwar für die Organisation gesorgt, zeigte sich jedoch ebenso wie der Oberbürgermeister sehr überrascht, daß man nun noch seitens der NSKOV Hotelkosten vorgelegt bekam. Ihre Begleichung wurde abgelehnt.38 V.
Zunächst sah es auch 1938 so aus, als könne die gemeinsame Friedensoffensive der deutsch-französischen Frontkämpfer in gleichem Geiste wie zuvor fortgesetzt 37 Der Alemanne, 25.10.1937; Freiburger Zeitung, 25.10.1937. 38 Stadt AF, C 4/XVI/29/8.
80
|
Eine inszenierte Friedensaktion
werden. So besuchten im Januar Franzosen ihre Kameraden in Gaggenau.39 Mit Schreiben vom 11. Juni 1938 kündigte die Vereinigung der Reserve-Unteroffiziere von Bruyères und Umgebung (Vogesen) beim Freiburger Oberbürgermeister ihren Besuch an und bat um Übermittlung der Anschrift des einschlägigen hiesigen Verbandes. Zu diesem Zeitpunkt war die Harmonie jedoch bereits verflogen. Die »große Politik« machte die Hoffnungen der ehemaligen Frontkämpfer endgültig zur Illusion.40 Bei dem Besuch der Freiburger Delegation in Besançon war im Oktober des Vorjahres ein Gastspiel des Freiburger Stadttheaters in Besançon verabredet worden, worüber offenbar allgemein Freude geherrscht hatte. Zunächst sollte der »Troubadour« gespielt werden, auch »La Traviata« war im Gespräch. Das Reichspropagandaministerium, von lntendant Nufer unterrichtet, erkannte jedoch sofort, daß das Gastspiel trefflich in die Inszenierungskette hineinpaßte. Es erklärte sich am 6. Dezember 1937 grundsätzlich zur Übernahme der Kosten bereit und sorgte mit Schreiben vom 12. Januar 1938 dafür, daß statt einer italienischen Oper »deutsche Kultur« dargeboten werden sollte. Die Intendanz schlug nun »Fidelio« vor, wodurch allerdings der erforderliche Zuschuß, zumal man die bekannte Sängerin Martha Fuchs verpflichten wollte, von 2500 RM auf 5102 RM anstieg. Zahlreiche Ehrengäste wurden geladen, als Termin der 24. März 1938 vorgesehen. Als der »Alemanne« am 18. März 1938 seine Leser auf das große Ereignis hinwies und eine Direktübertragung im Rundfunk ankündigte, war diese Mitteilung aber bereits überholt (und die Schriftleitung der Zeitung erhielt deshalb einen Rüffel): Am 12. März hatte Dr. Maître die Aufführung abgesagt. »Die jüngsten und so ernsten Ereignisse in Österreich« ließen das Gastspiel undenkbar erscheinen, weil diese in der französischen Bevölkerung, die »in der Stunde der Gefahr« einmütig zusammenstehe, »Unruhe und Mißtrauen« hervorgerufen hätten. Es bleibe zu hoffen, »daß das Nichtwiedergutzumachende sich nicht ereignet« und eine günstige Entwicklung dann die Fortsetzung der Bemühungen um Annäherung erlaube. Der handstreichartige »Anschluß« Österreichs an das Deutsche Reich an diesem Tag hatte auch die bisher so begeisterten französischen
39 Der Alemanne, 22.1.1938. In dieser Zeit kam es zu zahlreichen Treffen deutscher und französischer Veteranen. Am 6.12.1938 wurde sogar eine deutsch-französische Freundschaftserklärung von den beiden Außenministern unterzeichnet (Piekalkiewicz, wie Anm. 17, S. 40–44; Prost, wie Anm. 17, S. 184 ff.). Vgl. auch Tagespost, 14.11.1938. 40 Hier und im folgenden – soweit nicht anders vermerkt – nach: StadtAF, C 4/XVI/29/8; Der Alemanne, 9.3., 17.3., 18.3., 21.9., 24.9.1938; Der Führer, 26.9.1938. Zum geplanten Gastspiel in Besançon außerdem ausführlich: StadtAF, C 4/V/7/2; vgl. die Examensarbeit von Th. Salb über das Freiburger Stadttheater in der Zeit des Nationalsozialismus (masch. schriftl. Freiburg i. Br. 1989). Zum »Ende der Illusionen« auf französischer Seite Prost (wie Anm. 17) S. 184 ff.
Deutsch-französische Frontkämpfertreffen 1937–1938
|
81
Frontkämpfer betroffen gemacht und ihnen die Augen über den Friedenswillen der NS-Führung geöffnet. Oberbürgermeister Kerber reagierte, rückversichert durch eine Anfrage beim Büro von Ribbentrop, am 25. März 1938 kalt und beleidigt. Die von Dr. Maître mitgeteilte Meinung des französischen Volkes sei unverständlich, da die Österreicher lediglich ihr Selbstbestimmungsrecht wahrgenommen hätten und »Deutschland von diesem deutschen Land jetzt endlich Besitz« ergriffen habe. Das sei eine rein innerdeutsche Angelegenheit, niemandem entstehe dadurch Schaden, und »jeder fremde Einspruch« verletze »die Ehre unseres Volkes«. Eine Angriffsabsicht gegen Frankreich bestehe nicht, man wisse sich aber »vor fremden Angriffen zu schützen«. Kerber bedauerte, daß es nun nicht möglich sei, »den französischen Kriegsopfern in der von mir gedachten Form ein Geschenk zu machen« (ein vom Reichspropagandaministerium finanziertes Geschenk, muß man hinzufügen). Seine Absichten seien »von tiefstem Ernste erfüllt« und »großmütig« gewesen. Von deutscher Seite habe man alle Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit geschaffen, in Frankreich sei dies – »wie sich hier zeigt« – noch nicht der Fall. Man werde sich nur verstehen können, wenn die Franzosen »Freiheit, Ehre und (...) Lebensansprüche von 75 Millionen Deutschen« vorbehaltlos achten würden. Erst wenn dies gegeben sei, könne man die Verständigungsbemühungen weiterführen. In einer Rede im Stadtrat betonte Kerber, ebenfalls am 25. März 1938, noch einmal seine Enttäuschung über die Absage. »Sie sprechen eben als Franzosen, sehr politisch denken sie nicht, sie sind naiv und vor allen Dingen haben sie über die wahre internationale Lage eine sehr schlechte Kenntnis.« Er unterstellte, man komme wieder mit der »Mentalität von Versailles«. Dennoch werde er sich weiter um Verständigung bemühen, ohne übertriebene Hoffnungen, »stolz auf unsere Wehrmacht und unsere eigene Kraft«, dem Führer begeistert folgend, »wenn er sagt, daß unsere Wehrmacht als Instrument des Friedens gestärkt werden muß, daß es keinem einfällt, unsere Grenze irgendwie anzutasten«.41
41 StadtAF, C 4/V/7/2. Ähnlich argumentierte Kerber auch in einem wohl 1938, nach der Eingliederung Österreichs, geschriebenen Artikel und betonte dabei, daß den Frontkämpfer-Treffen eine Vorreiter-Rolle bei dem »friedlichen Ausgleich alter Gegensätzlichkeiten« zukomme (F. Kerber, Reichsstraße 31, in: Reichsstraße 31. Von der Ostmark zum Oberrhein. Natur – Volk – Kunst, hg. v. F. Kerber [Jahrbuch der Stadt Freiburg i. Br. 3], 1939, S. 9–16, Zitat S. 15). Drei Jahre später setzte der Oberbürgermeister, auch nach dem militärischen Sieg über Frankreich, auf die Aufgabe Freiburgs, Mittler zum Nachbarn zu sein und »an der Schaffung einer Atmosphäre freundschaftlicher Zusammenarbeit in bescheidenem Maße mitzuwirken« (F. Kerber, Blick auf Burgund, in: Burgund. Das Land zwischen Rhein und Rhone, hg. v. F. Kerber [Jahrbuch der Stadt Freiburg i. Br. 5], 1942, S. 7–14, Zitat S. 11).
82
|
Eine inszenierte Friedensaktion
Friede, Freundschaft, Verständigung konnte es demnach nur geben, wenn die andere Seite die deutsche Auffassung dieser Werte akzeptierte. In den Inszenierungen der Treffen war dies durchaus schon zum Ausdruck gekommen, die Franzosen hatten sich, ohne daß ihnen dies wohl bewußt wurde, in diese Interpretation einbinden lassen. Jetzt, im internationalen Konfliktfall, wurden ihnen die deutschen Bedingungen in schonungsloser Offenheit aufgezeigt. Vor diesem Hintergrund ging auch der angekündigte Unteroffiziersbesuch nicht mehr ohne weiteres über die Bühne. Oberbürgermeister Kerber fragte am 15. Juni 1938 beim Auswärtigen Amt in Berlin an, wie er sich verhalten solle, und regte bei dieser Gelegenheit an, »bei einer späteren Wiederaufnahme besserer Beziehungen« darauf zu dringen, daß von französischer Seite die Zurückweisung seines »Geschenkes« in irgendeiner Form »wieder gutgemacht« werden müsse. Das Auswärtige Amt seinerseits leitete die Anfrage an das Oberkommando der Wehrmacht weiter, weil es sich bei den Franzosen nicht um ehemalige Frontkämpfer, sondern Teile der jetzigen Armee handele. Gleichzeitig gingen entsprechende Mitteilungen aus Freiburg an Reichskriegsopferführer Oberlindober, an die Deutsch-Französische Gesellschaft in Berlin und an den Freiburger Standortältesten, den inzwischen zum Generalmajor beförderten Richter, der wiederum seine Vorgesetzten einschaltete. Von militärischer Seite – auch »abwehrmäßig« – wurden schließlich gegen den Besuch keine Einwendungen erhoben. Obwohl auch die Vereinigung Deutscher Frontkämpfer-Verbände – die seit 1936 für die gesamte Auslandsarbeit der Soldatenbünde zuständig sei, wie am 1. Juli 1938 deren Vizepräsident, SS-Brigadeführer von Humann-Hainhofen mitteilte – keine Bedenken geltend machte, beteiligte sich die Gebietsinspektion Baden des NS-Reichskriegerbundes (Kyffhäuserbund) nicht an den Veranstaltungen. Inzwischen war es nämlich September geworden, und die internationalen Beziehungen hatten erneut einen bedrohlichen Spannungszustand erreicht: Die Forderung des NS-Regimes nach Eingliederung des Sudetenlandes brachte die Welt an den Rand des Krieges. Auch die Stadt Freiburg verzichtete aus diesem Grund auf einen offiziellen Empfang der französischen Reserve-Unteroffiziere, die mit 12 Mann eine Reise durch den Süden Deutschlands unternahmen und am 23./24. September 1938 – anscheinend noch mit 9 Personen – in Freiburg weilten. Eine gewisse organisatorische Betreuung lag bei der NSKOV, offenbar eine Verlegenheitslösung. Wie Verkehrsamtsleiter Denzlinger am 6. Oktober dem Oberbürgermeister mitteilte, habe die Stadt die Hälfte der Musikkosten beim Kameradschaftsabend in Höhe von 15 RM getragen und eine Stadtführung organisiert. Außerdem hätten »die Gäste je einen geschnitzten Flaschenkorken und die teilnehmenden Damen eine kleine Parfumflasche mit aufgemalten Trachten« erhalten. Einer Einladung zu dem Kameradschaftsabend hatte Oberbürgermeister Kerber wegen »Urlaubs« nicht folgen können, und auch Bürgermeister Hofner war
Deutsch-französische Frontkämpfertreffen 1937–1938
|
83
»durch anderweitige Dienstgeschäfte« verhindert gewesen. Immerhin: über das Gartenamt war kostenlos eine Trikolore zur Verfügung gestellt worden. Wenige Tage nach dem Besuch hatte sich die internationale Lage vorübergehend beruhigt: Am 29. September 1938 wurde das Münchner Abkommen unterzeichnet, das die Tschechoslowakei verpflichtete, die Sudetengebiete an das Deutsche Reich abzutreten. Schon am 1. Oktober schrieb der Bürgermeister von Montbéliard – zugleich Generalrat der Doubs – an den Freiburger Oberbürgermeister, wie glücklich das französische Volk über die friedliche Lösung sei. Das deutsche Volk teile diese Gefühle, wie »die enthusiastischen Beifallskundgebungen« in München für Präsident Daladier gezeigt hätten. Deshalb könne man doch jetzt die gegenseitigen Verständigungsbemühungen wieder aufnehmen. Am 6. Oktober 1938 stimmte ihm Kerber zu: »Ich habe den Glauben, daß damit zum letzten Male unseren beiden Völker die Gefahr des Krieges gedroht hat.« Zugunsten der deutsch-französischen Freundschaft, der »sichersten Garantie für den europäischen Frieden«, deren Ausgestaltung er »als Oberhaupt der deutschen Grenzstadt Freiburg« immer als seine »vornehmste Amtspflicht« angesehen habe, lud er den Bürgermeister und die Ratsherren von Montbéliard zu einem Besuch nach Freiburg ein. Ebenfalls am 6. Oktober meldete sich Dr. Maître wieder. Auch er begrüßte das Münchner Abkommen und insbesondere die Worte Feldmarschall Görings: »da, wo die alten Frontkämpfer sind, herrscht der Friede und die Gerechtigkeit.« Es sei nun Zeit, die früheren Kontakte wieder aufzunehmen, um dadurch Frieden zu stiften sowie die internationale Zusammenarbeit zu sichern. Kerber antwortete ihm am 12 . Oktober in ähnlichem Sinne wie zuvor dem Bürgermeister von Montbéliard, wenngleich er vorsichtig noch einmal seine Enttäuschung über die vorübergehende Unterbrechung der Beziehungen andeutete. »Wir schlagen ehrlichen Herzens in Ihre Hand ein, und Sie finden in uns die zuverlässigsten Bundesgenossen, wenn es sich darum handelt, für den Frieden zwischen Deutschland und Frankreich zu arbeiten.« Er erneuerte sein Angebot, als »Geschenk« auf Kosten der Stadt Freiburg eine »Vorstellung des Freiburger Theaters in Besançon zugunsten Ihrer schwerkriegsbeschädigten Kameraden« zu veranstalten. Dr. Maître nahm am 25. Oktober 1938 dieses Angebot mit großer Freude an und schlug den 15. März 1939 als Termin vor (später wurde er auf den 25. März verlegt). Diesmal wollten die Städtischen Bühnen »La Bohème« aufführen, die Kosten würden sich auf 5050 RM belaufen. Wieder wäre das Reichspropagandaministerium der Geldgeber gewesen, ja es war daran gedacht, das Gastspiel auf weitere französische Städte auszudehnen. Um dies gründlich vorzubereiten, beantragte der Oberbürgermeister für sich und den Intendanten Devisen für eine Dienstreise nach Paris und anderen Städten Frankreichs. Am 28. Dezember 1938 wandte sich Kerber noch einmal an Maître mit guten Wünschen für das kommende Jahr. »(...) ich wäre glücklich, wenn die Stadt Frei-
84
|
Eine inszenierte Friedensaktion
burg an ihrem bescheidenen Platze auch im neuen Jahre in die Lage käme, wieder Positives zu diesem Friedenswerk beizutragen.« Diese Wünsche gingen nicht in Erfüllung. Obwohl sogar die Vermittlung von Madame Solvay, Gattin eines belgischen Industriellen, mit besten Verbindungen zum Büro Ribbentrop – wie Oberbürgermeister Kerber im Auftrag Otto Abetz’ am 23. Februar 1939 bestätigt wurde – und zu französischen Stellen eingeschaltet wurde, auch Montbéliard am 6. März 1939 um eine Aufführung bat, kam das Gastspiel wiederum nicht zustande. Peinlich berührt mußte Kerber am 14. März 1939 Dr. Maître mitteilen, daß die deutschen Behörden keine Devisen genehmigten (das Reichspropagandaministerium hatte dies mit Nachricht vom 13. Februar 1939 deutlich gemacht). Dieser Brief kreuzte sich mit einem Schreiben Dr. Maîtres vom 20. März 1939, indem er seinerseits die Opernvorstellung absagte. Soeben, am 15. März, hatte die deutsche Wehrmacht die Rest-Tschechoslowakei besetzt und Hitler damit sein – im Anhang zum Münchner Abkommen auch schriftlich niedergelegtes . – »Versprechen« gebrochen, nun keine territorialen Forderungen mehr zu stellen. »Wir sind Zeugen eines Aktes brutaler Erpressung und Unterdrückung eines Staates und einer zynischen Verletzung des Völkerrechtes«, schrieb Dr. Maître. »Die Welt kennt jetzt den Wert der Versprechungen des Führers und seine wirklichen Absichten. Wir übrigen, die ehemaligen Frontkämpfer, die für das große deutsche Volk nur Gefühle der Achtung und des Respektes genährt haben, sind tief berührt durch die offenkundige Ungerechtigkeit dieses Gewaltstreiches (...).« »Mit tiefer Trauer« stellte er fest, wie sehr sie getäuscht worden seien. Dem Freiburger Oberbürgermeister versicherte er dennoch »ein treues Gedenken an unsere angenehmen persönlichen Beziehungen«.42 Die Sperrung der Devisen deutete schon darauf hin daß die Kriegsvorbereitungen in die entscheidende Phase getreten waren. Friedensdemonstrationen wurden nicht mehr benötigt. Am 1. September 1939 marschierte die deutsche Wehrmacht in Polen ein, zwei Tage später erklärte Frankreich dem Deutschen Reich den Krieg, mußte jedoch am 22. Juni 1940 kapitulieren. Aus einem Kriegsgefangenenlager schrieb Capitaine Georges Leroy am 20. März 1941 an den Freiburger Bürgermeister: »Seltsame Verhältnisse veranlassen mich, mich in Ihr Gedächtnis zurückzurufen. Als Stadtrat von Besançon war ich bei Ihrem Empfang im Rathaus anwesend und auch bei dem Essen, welches bei dieser Gelegenheit 42 Schriftwechsel, Sondierungen und Planungen zwischen 1.10.1938 und 20.3.1939 in: StadtAF, C 4/V/7/2 und C 4/XVI/29/8. Der Übersetzer des Schreibens vom 28.12.1938, Prof. Dr. Greiner, verzichtete sogar auf ein Honorar, weil ihm Dr. Maître und Besançon »in lieber Erinnerung sind und mir die Beziehungen zu unseren Frontkameraden von drüben selbst sehr am Herzen liegen«. – Der endgültige formale Bruch zwischen den deutschen und französischen Frontkämpferorganisationen vollzog sich am 24.5.1939 (Prost, wie Anm. 17, S. 185).
Deutsch-französische Frontkämpfertreffen 1937–1938
|
85
den Freiburger Ehrengästen gegeben wurde; ich freute mich in jener Zeit über die Einladung, Ihren Besuch bei Ihnen zu erwidern; die Umstände haben es anders entschieden. Ich bin gegenwärtig Kriegsgefangener, und ich bin am 2. Juli vormittags durch Freiburg marschiert; dies war nicht die Art, wie ich hoffte, mit Deutschland und im besonderen mit Freiburg Kontakt aufzunehmen.«43 VI.
Der Krieg zerstörte die Hoffnungen und Wünsche der Menschen, ihr Friedenswille werde stärker sein als die Absichten der NS-Politiker. Henri Pichot zog sich aus der öffentlichen Tätigkeit zurück, Dr. Maître schloß sich der Résistance an. Andere führende Persönlichkeiten der französischen Frontkämpfer-Verbände mußten ebenso Soldat werden, gerieten in Gefangenschaft, wurden verletzt oder getötet wie viele ihrer deutschen Kameraden.44 Reichskriegsopferführer Oberlindober, zum SA-Obergruppenführer – vergleichbar einem General – aufgestiegen, überlebte das »Dritte Reich« und starb 1949.45 Reichsstatthalter und Gauleiter Robert Wagner konnte im 2. Weltkrieg seinen Amtsbereich auf das Elsaß ausdehnen. Unter seiner Verantwortung wurden am 22 . Oktober 1940 die Juden aus Baden – zusammen mit denen aus der Pfalz und dem Saarland – deportiert. Ein französisches Kriegsgericht verurteilte Wagner zum Tode. Am 14 . August 1946 wurde er in Straßburg hingerichtet.46 Oberbürgermeister Kerber nahm 1940 am Westfeldzug teil und kehrte erst 1943 in sein Amt zurück. 1945 von den Franzosen verhaftet, wurde er am 4. September 1945 am Schauinsland tot aufgefunden. Die Umstände seiner Ermordung konnten bis heute nicht vollständig aufgeklärt werden.47 Die Beziehungen zwischen Freiburg und Besançon waren mit dem Krieg glücklicherweise nicht auf Dauer gestört. Am 12 . März 1957 ergriff – nach in43 44 45 46
StadtAF, C 4/XVI/29/8. Dutriez (wie Anm. 4) S. 4. Ploetz, Das Dritte Reich, hg. von M. Broszat und N. Frei, 1983, S. 247. R. Wistrich, Wer war wer im Dritten Reich. Anhänger, Mitläufer, Gegner aus Politik, Wirtschaft, Militär, Kunst und Wissenschaft, 1983, S. 287. Otto Abetz – als Botschafter bei der Regierung Pétain u. a. auch für die antijüdischen Maßnahmen verantwortlich – wurde 1949 zu 20 Jahren Zwangsarbeit verurteilt, 1954 freigelassen und 1958 bei einem Autounfall mit seltsamen Begleiterscheinungen getötet (ebd. S. 9). 47 W. Middendorff, Ein unaufgeklärter Mord. Der Fall Dr. Franz Kerber, in: Freiburger Almanach 27, 1976, S. 81–85 ; Ders. (wie Anm. 26). Vgl. für die letzte Periode seiner Amtszeit Th. Schnabel, Stadtverwaltung und Kriegsalltag in Freiburg 1944/45, in: Ders. und G. R. Ueberschär, Endlich Frieden! Das Kriegsende in Freiburg 1945 (Stadt und Geschichte. Neue Reihe des Stadtarchivs Freiburg i. Br. 7), 1985, S. 41–66.
86
|
Eine inszenierte Friedensaktion
formellen Kontakten – Oberbürgermeister Dr. Brandel die Initiative zu einer Städtepartnerschaft Freiburgs mit Besançon. Dabei wies er auch auf die engen Beziehungen vor dem 2. Weltkrieg hin. Der Stadtrat von Besançon billigte die Partnerschaft am 30. Juni 1958 mit 18 gegen 11 Stimmen bei 4 Enthaltungen. Fast ein Jahr später, am 6. Juni 1959, wurde in Freiburg der offizielle Verbrüderungseid geleistet.48 Wenn wir jetzt den 30. Jahrestag dieser Partnerschaft begehen, so liegt es nahe, zurückzudenken an jene denkwürdigen Treffen vor über 50 Jahren, die von so vielen Menschen beider Städte – und darüber hinaus – mit großen Hoffnungen begleitet wurden, jedoch lediglich Teil einer inszenierten Aktion zur Unterstützung der NS-Politik waren.
48 Dutriez (wie Anm. 4) S. 4 mit Anm. 31; StadtAF, C 5/135 (vgl. auch die folgenden Faszikel sowie D. Ve. 14–17). Bei den offiziellen Veranstaltungen wurde immer wieder an die Treffen von 1937 erinnert. – Die Vorgeschichte der Partnerschaft wäre eine eigene Untersuchung wert.
»Lieber ’n alter Jud verrecke als e Tröpfle Schnaps verschütte« Juden im bäuerlichen Milieu des Schwarzwaldes zu Beginn des Nationalsozialismus* Die Schwarzwälder Bauern kannten Juden vor allem als Viehhändler. Andere handelten mit Textilien oder gingen mit allerlei Waren als Hausierer von Hof zu Hof. In den Städten gab es darüber hinaus jüdische Geschäfte, namentlich wiederum im Textilbereich, in denen die Bauern häufig ihre Einkünfte tätigten. Man kam in der Regel gut miteinander aus. Teilweise bestand sogar ein Vertrauensverhältnis zwischen dem Bauern und «seinem» Juden, den er beim An- und Verkauf von Vieh als Experten schätzte. Nur selten unternahm der Jude einen Betrugsversuch, denn dies hätte die weiteren Geschäftsbeziehungen erschwert oder gar beendet. Im Zuge eines solch vertrauensvollen Verhältnisses wurde der Jude oft der »Bankier« des Bauern, der ihm auch sonstige Geschäfte, ja selbst Behördengänge überliess. Der jüdische Händler brachte als Mittler zwischen Stadt und Land Nachrichten aus der städtischen Welt, bot Neuigkeiten der Mode an oder führte technische Errungenschaften vor, die für die Modernisierung des bäuerlichen Betriebes – in der Landwirtschaft wie im Haushalt – von Interesse waren. Er beriet den Bauern bei der Einführung neuer Geräte oder Bewirtschaftungsmethoden ebenso wie in Versicherungsfragen.1 Deshalb griffen die ersten Boykotte und Verbotsmaßnahmen der Nazis nur bedingt. Ende April 1933 wurden Veranstalter und Händler jüdischer Herkunft nicht mehr zur Freiburger Frühjahrsmesse zugelassen. Ähnlich sollten die Juden von regionalen Viehmärkten ausgeschlossen werden. Schon im Februar hatte Der Alemanne – das »Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens« – alle Bauern, «die durch jüdische Viehhändler oder andere Schmarotzer betrogen» worden seien, dazu aufgerufen, dies vertraulich der Zeitung mitzuteilen.2 Allerdings * Erstpublikation in: Menora. Jahrbuch für deutsch-jüdische Geschichte 3 (1992) S. 143– 152. 1 Vgl. Monika Richarz, Viehhandel und Landjuden im 19. Jahrhundert. Eine symbiotische Wirtschaftsbeziehung in Südwestdeutschland, in: Menora, Bd. 1 (1990), S. 66–88; dies., Landjuden – ein bürgerliches Element im Dorf?, in: Idylle oder Aufbruch? Das Dorf im bürgerlichen 19. Jahrhundert. Ein europäischer Vergleich, hrsg. von Wolfgang Jacobeit, Josef Eiooser und Bo Sträth, Berlin 1990, S. 181–190; Utz Jeggle, Judendörfer in Württemberg, Tübingen 1969; Robert Uri Kaufmann, Jüdische und christliche Viehhändler in der Schweiz 1780–1930, Zürich 1988. 2 Der Alemanne, 10.2.1933; Freiburger Tagespost, 28.4.1933. Vgl. Stadtarchiv Freiburg, C 4/ IX/20/11 (auch zum folgenden); Verfolgung und Widerstand unter dem Nationalsozialismus in Baden. Die Lageberichte der Gestapo und des Generalstaatsanwalts Karlsruhe
88
| »Lieber ’n alter Jud verrecke als e Tröpfle Schnaps verschütte«
scheint die Verdrängung jüdischer Viehhändler nicht ohne weiteres durchsetzbar gewesen zu sein. Am 11. April 1935 meldete die NS-Zeitung, der Freiburger Frühjahrspferdemarkt sei immer noch »in Händen der Juden«. Dies dürfe nicht sein, da die Pferdezucht «auf die Erbhöfe gehöre». Selbst das Verbot des Viehhandelsberufes für Juden 1936 hielt viele Bauern nicht davon ab, weiterhin bei jüdischen Händlern zu kaufen. Auf deren Erfahrungen konnten sie sich verlassen, und vor allem: Die Juden boten in der Regel bessere Ware bei niedrigeren Preisen als ihre christlichen Kollegen.3 Auf welche Schwierigkeiten die Verdrängung der Juden stiess, zeigte beispielhaft ein Vorfall im Hotzenwald. Am 5. September 1934 fand in Görwihl ein Viehmarkt statt, den Der Alemanne als »richtungweisend« feierte. Man habe, so schrieb der Autor des Zeitungsartikels, nicht wie bisher »den Marktverlauf dem freien hemmungslosen Spiel von Angebot und Nachfrage« überlassen, sondern durch eine Kommission, bestehend aus dem Kreisbauernführer, einem Metzgermeister und einem Großhändler, das Großvieh in drei Klassen eingeteilt und Richtpreise festgesetzt. Dadurch hätten die Bauern endlich wieder gute Preise erzielen können und wären »der Profitgier des jüdischen Geldsacks« nicht mehr «ohnmächtig» ausgeliefert gewesen. »Gemeinnutz geht vor Eigennutz!« stand in »Flammenschrift« über dem Görwihler Markt. Und weiter hiess es: »Heil unserem Befreier und Führer!“ Die Begeisterung über diesen «richtungweisenden Viehmarkt» wurde allerdings nicht allgemein geteilt. Wenige Tage später, am 12. September 1934, erstattete der Landwirt O. S., zugleich Geschäftsführer der Viehverwertungsgenossenschaft in Säckingen, Anzeige. Er hatte nach seinen Angaben mündlich von der Viehverwertungszentrale die Genehmigung erhalten, auch im Bezirk Waldshut Vieh aufzukaufen. Mit dem dortigen Aufkäufer der Genossenschaft sowie mit 1933–1940, bearb. von Jörg Schadt, Stuttgart u. a. 1976, S. 254. Allgemein zu den NSMassnahmen gegen Juden in Baden: Franz Hundsnurscher/Gerhard Taddey, Die jüdischen Gemeinden in Baden. Denkmale, Geschichte, Schicksale, Stuttgart 1968; Paul Sauer, Die Schicksale der jüdischen Bürger Baden-Württembergs während der nationalsozialistischen Verfolgungszeit 1933–1945, Stuttgart 1969 (mit Beiband: Die Opfer der nationalsozialistischen Judenverfolgung in Baden-Württemberg 1933–1945. Ein Gedenkbuch, Stuttgart 1969); Dokumente über die Verfolgung der jüdischen Bürger in Baden-Württemberg durch das nationalsozialistische Regime 1933–1945, bearb. von Paul Sauer, 2 Bde., Stuttgart 1966. Lesenswert zu diesem Thema ist auch Thomas Strittmatters »Viehjud Levi«; das Begleitheft des Freiburger Theaters 1986/87 enthält zusätzliche Dokumente und Texte. 3 Vgl. für Bayern: Falk Wiesemann, Juden auf dem Lande: Die wirtschaftliche Ausgrenzung der jüdischen Viehhändler in Bayern, in: Die Reihen fast geschlossen. Beiträge zur Geschichte des Alltags unterm Nationalsozialismus, hrsg. von Detlev Peukert und Jürgen Renlecke unter Mitarbeit von Adelheid Gräfin zu Castell Rüdenhausen, Wuppertal 1981, S.381–396; für Württemberg: Thomas Schnabel, Württemberg zwischen Weimar und Bonn 1928–1945/46, Stuttgart u.a. 1986, S. 533–568, bes. S. 547–551.
Juden im bäuerlichen Milieu zu Beginn des Nationalsozialismus
|
89
zwei jüdischen Viehhändlern, L. und B., sei er in Feindschaft geraten, weil er den Bauern höhere Preise gezahlt habe. Nun wollte er auch den Görwihler Viehmarkt besuchen. Doch bereits vor der offiziellen Eröffnung habe ihm der Kreisbauernführer A. A. mitgeteilt, dass er nichts kaufen dürfe; er solle sich auf Säckingen beschränken. Er musste dann erleben, dass der »Jude L.« Mitglied der Kommission wurde, die das Vieh in Preis- und Güteklassen einteilte, und dass dieser anschließend selbst Vieh bei den Bauern kaufte. O. S. erhob den Vorwurf, dass die beiden Juden L. und B. sowie der Kreisbauernführer A. zusammengearbeitet hätten, »ohne Rücksicht ob der Bauer dabei zugrunde geht oder nicht«. Dies sei ein »Judenmarkt« gewesen, und er könne verstehen, dass der Kreisbauernführer zum Juden L. gesagt habe: »Kauf noch mehr, wer weiss, ob wir wieder einmal so schön zusammenkommen, die Gelegenheit kommt nicht mehr.« Noch während des Marktes hätten sich mehrere Bauern bei ihm beschwert, fuhr O. S. in seiner Anzeige fort. Die Einteilung der Viehklassen sei falsch gewesen, außerdem dürfe doch heutzutage wohl nicht ein Jude darüber bestimmen, der dann auch noch anschließend als Hauptkäufer auftrete. O. S. sah während des Marktes keine Möglichkeit, den Bauern, »die bis aufs innerste erbittert waren«, zu helfen, weil ihn der Kreisbauernführer »ausgeschaltet« habe. Doch er drohte nun unverhohlen: Über die Abwicklung des Viehmarktes »haben sich außer mir der größte Teil der Marktteilnehmer, insbesondere derjenige Teil der deutsch und nationalsozialistisch denkt und fühlt – es ist dies ziemlich die ganze Bauernschaft – in ihrem nationalen Empfinden aufs tiefste verletzt und gekränkt gefühlt und ich möchte sagen, daß deren Zutrauen, zumal wenn noch ähnliche Sachen vorkommen würden, sehr ins Schwanken geraten würde und müßte. Die Juden hätten dann allerdings ihr internationales Ziel erreicht, das Deutsche Volk aber müßte die Rechnung, die verantwortungslose Menschen gemacht haben, bezahlen. Ich glaube, daß ein solches Handeln wie es sich auf dem Markt in Görwihl abspielte, nicht im Sinne der deutschen Aufbauarbeit und der Regierung liegt und nur das Gegenteil von dem ist, was unser großer Führer Adolf Hitler will und tut.« O. S. empfand es als besonders schwerwiegend, dass im Jahr zuvor in Görwihl ein «brauner Viehmarkt» ohne Juden stattgefunden habe. Jetzt müsse der Eindruck entstehen, als hätten sich die Juden doch wieder durchgesetzt. Ein Bauer habe ihm gesagt, es wundere ihn nicht, woher die vielen Nein-Stimmen bei der letzten Wahl hergekommen seien. Das «Treiben» des Kreisbauernführers und der beiden Juden wirke »in der Bevölkerung zersetzend und staatsfeindlich«. Mit seiner Anzeige wolle er dem Einhalt bieten, damit »der Bauer vor solchen Volksausbeutern geschützt« werden könne. Sonst werde »das Volk auf dem flachen Lande durch solche Elemente verhetzt und gegen die Regierung aufgestachelt«. Oberwachtmeister T., der die Anzeige entgegengenommen hatte, leitete sie, wegen ihrer Bedeutung mit zusätzlichen, von ihm ermittelten Details über den Viehmarkt, die beiden Juden und den Kreisbauernführer angereichert, nicht nur
90
| »Lieber ’n alter Jud verrecke als e Tröpfle Schnaps verschütte«
an den Staatsanwalt, sondern auch an die Gestapo weiter.4 Deutlich wird, wie gefestigt die Stellung der jüdischen Viehhändler war und wie schwer sich die christlich-nationalsozialistischen Viehhändler taten, die unerwünschte Konkurrenz auszuschalten. Selbst NS-Funktionsträger, wie der Kreisbauernführer, waren noch nicht so stark von der Rassenideologie überzeugt, dass sie deshalb ihr gutes Verhältnis zu Juden abgebrochen hätten. O. S. sah offenbar nur den Weg über die Denunziation, um den Platz der jüdischen Händler einnehmen zu können. Vorgeschoben haben dürfte er diejenigen Bauern, die mit ihrem Verkaufsergebnis unzufrieden waren. Eher unwahrscheinlich ist, dass die Einteilung der Viehklassen auf Betreiben von L. tatsächlich falsch vorgenommen wurde. Anscheinend war er ein anerkannter Großhändler, der vermutlich nicht gerade in dieser Zeit versucht haben wird, die Bauern zu betrügen. Auch im Elztal berichten Zeitzeugen davon, dass die jüdischen Viehhändler noch verhältnismäßig lange zu den Bauern kamen – so wie jüdische Textilienund Sackhändler bis 1936/37 Geschäftsverbindungen mit ansässigen Leinenwebereien unterhielten. Sie verstanden etwas von der Sache, machten annehmbare Preise und galten als zuverlässig. Als Geschäftspartner waren zu ihnen vorerst keine Alternativen sichtbar. Darüber hinaus gab es vielfältige menschliche Kontakte, und man registrierte durchaus mit – möglicherweise ironisch gefärbter – Sympathie, dass der eine oder andere jüdische Händler im Hinterzimmer des Gasthauses eine Bauernbratwurst nicht verschmähte. Als dann die Juden nach und nach nicht mehr auftauchten, hat man das bedauert, und man hat sich auch über die Verfolgungen unterhalten. Allerdings: Es wurde nur »geflüstert, nit lut gschwätzt«, wie erzählt wird. Seit 1936 verstärkten die Nazis den Druck auf die Bevölkerung, mit Juden keine Geschäfte abzuwickeln, ja jeglichen Kontakt mit ihnen abzubrechen. Spätestens 1938 seien keine jüdischen Händler mehr ins Elztal gekommen, heißt es in den Erinnerungen.5 Das Verhältnis zwischen jüdischen Händlern und christlichen Bauern wies im Elztal insofern noch eine Besonderheit auf, als in Elzach selbst ein allseits geschätzter jüdischer Tierarzt wohnte. Er hatte sich hier, übrigens als einziger jüdischer Bürger im oberen Elztal, 1919 niedergelassen. Sein Rat zur Einschätzung des Viehs war gefragt, und er verstand sich offenbar mit beiden Seiten – Händlern wie Bauern – gut. Dies änderte sich auch in den ersten Jahren des «Dritten Reiches» keineswegs, obwohl die örtlichen Nazis massiv gegen ihn vorzugehen suchten. So wandte sich der Elzacher Bürgermeister am 13. Dezember 1934 in 4 Staatsarchiv Freiburg, Landeskommissär Konstanz, Bd. II, 6002. VII (Orthographie und Zeichensetzung wie im Original); den Hinweis auf diese Quelle verdanke ich Klaus Hoggenmüller. 5 Mündliche Berichte von Karl Gysler und Hildegard Wernet (mehrfach zwischen 1982 und 1988). Das Frömmigkeitsverhalten der jüdischen Händler müsste einmal systematisch untersucht werden (vgl. Monika Richarz, Viehhandel und Landjuden [wie Anm. 1], S. 84–85).
Juden im bäuerlichen Milieu zu Beginn des Nationalsozialismus
|
91
einem Schreiben an die Kreisleitung der NSDAP dagegen, dass der »Nichtarier« Bezirkstierarzt werden könne. Im Gegenteil müsse ihm ein Parteigenosse «etwas scharf auf die Finger» sehen: »Denn gerade der Tierarzt hat Verbindung mit der Landwirtschaft. Unsere Bauern sind aber ihrer früheren zentrümlichen Einstellung immer noch – größtenteils wenigstens – treu geblieben. Dann noch ein Jude dazu, der nie sein Mauscheln lassen wird und der ewig ein Jude bleiben wird, und der Bauer wird sich in seiner Gesinnung dann nur noch schwer umstellen lassen. Wir wollen in bezirksamtlicher staatlicher Stellung keinen von jenem Typ, der den Arier als Goi – als Tier bezeichnet. (s. Talmud).« Am 28. Oktober 1935 beantragte der Bürgermeister, den Tierarzt des Amtes als Fleischbeschauer zu entheben. Am 5. März 1936 sprach die zuständige Behörde das betreffende Verbot aus. Damit gab sich der Bürgermeister jedoch noch nicht zufrieden. In mehreren Schreiben an übergeordnete Stellen hetzte er weiter. So hob er am 30. März 1937 gegenüber dem Bezirksamt Emmendingen hervor, dass der Jude beträchtliches Vermögen besitze. »Auch sein Auftreten – Auto, Jagdpaß – läßt nicht auf Bedürftigkeit schließen. Das Auto benützt er nur zum Privatvergnügen. Dienstlich fährt er Motorrad.« 1938 schrieb er Elzacher Tierhalter an und verwarnte sie, weil sie ihr Vieh immer noch vom jüdischen Tierarzt behandeln ließen. Er drohte mit der Einstellung von Aufträgen seitens der Stadt. Obwohl die Mehrzahl der Bauern ihrem Tierarzt verbunden blieb, zeitigten die nationalsozialistische Propaganda und der sich verstärkende behördliche Druck doch Wirkungen. Die Kinder des Tierarztes wurden verprügelt, und im November 1938 – die genaue Datumsangabe wechselt in den Akten – meinten auch Elzacher Nazis, unter Einsatz von Volksschülern eine »Kristallnacht« herbeiführen zu müssen: Sie warfen der Tierarztfamilie die Fensterscheiben ein, drangen – mit dem Bürgermeister an der Spitze – ins Haus und verhafteten Frau und Tochter. Der Tierarzt selbst befand sich gerade unterwegs bei Bauern. Er wurde nach seiner Rückkehr ebenfalls verhaftet und, während man seine Angehörigen wieder entließ, zur Sammelstelle für die Deportation in das KZ Dachau abtransportiert. Diese Vorgänge und die dortige demütigende Behandlung veranlassten ihn, mit seiner Familie in die USA zu emigrieren.6 Die Tochter eines angesehenen Bauern in einem Dorf nahe Donaueschingen berichtete, dass ihr Vater, nach 1933 Ortsbauernführer, enge Kontakte zu jüdi6 Stadtarchiv Elzach, 26, 38 (Zitat 1934), 246, 360, 363 (Zitat 1937), 1090, 1187; mündliche Berichte [wie Anm.5]. Die Interpretation der Vorgänge wird dadurch kompliziert, dass der jüdische Tierarzt über seine Schwester und der Bürgermeister über seine Frau mit derselben Elzacher Fabrikantenfamilie verwandt waren. Der Bürgermeister hatte darüber hinaus mit ihr einmal in geschäftlichen Beziehungen gestanden, die zu Spannungen führten. Zur Situation im Elztal während des »Dritten Reiches« (mit weiteren Literaturhinweisen): Waldkirch 1939 – davor und danach. Beiträge des Arbeitskreises Regionalgeschichte Elztal zu den Kulturtagen 1989, Waldkirch 1989.
92
| »Lieber ’n alter Jud verrecke als e Tröpfle Schnaps verschütte«
schen Viehhändlern aus Freiburg unterhalten habe.7 Trotz eines Prozesses mit einem von ihnen – der Staatsanwalt meinte, es geschehe ihm ganz recht, warum mache er auch noch Geschäfte mit Juden – konnte er nicht über schlechte Erfahrungen klagen. Das offenbar bestehende Vertrauensverhältnis drückte sich etwa darin aus, dass einer der Händler, als er seinen Beruf nicht mehr ausüben durfte, auf den Hof kam, um sich vom Vater zu verabschieden. »Du gehst einen Irrweg», warnte er den verlegen werdenden Bauern. Dieser hoffte jedoch auf Besserung und betrachtete die Maßnahmen gegen die Juden als vorübergehende Auswüchse. »Adolf ist nicht so schlimm, schlimmer sind die Adölfle.« Den Verlust, den die jüdischen Händler bedeuteten, empfand man durchaus. Über die neuen christlichen hieß es: »Die sind ja schlimmer als die Juden.« Eine Erschütterung des bisherigen Weltbildes verursachten die Pogrome am 9./10. November 1938. Die Familie hörte, dass in Donaueschingen die Textilgeschäfte der Juden demoliert worden waren, bei denen man gern eingekauft hatte: Man wurde gut bedient, die Zahlungsmodalitäten waren großzügig, die Ware – so die Aussteuer für die Töchter – hatte beste Qualität. Jetzt sagte man nicht mehr nur: »Das ist nicht recht«, jetzt erklärte die Mutter bestürzt: »Wenn das nicht aufhört, wird uns das noch bitter aufstoßen.« Ihr Bruder trat sogar aus der Partei aus und meinte: »Das wird uns das Genick brechen.« Was mit den Juden geschah, wusste man zunächst nicht. Weit verbreitet war die Überzeugung: »Die sind jetzt alle in Jerusalem.« Allmählich drangen dann Gerüchte über Konzentrationslager durch. Ein Cousin brachte 1941 Nachrichten darüber, was in Polen vorging. Das Ausmaß der Judenvernichtung konnte sich aber niemand vorstellen. 1945 kam es noch einmal zu einer Begegnung mit einem Juden, der sich bisher verborgen gehalten hatte, auf der Suche nach einem neuen Versteck war und – zerlumpt und ausgemergelt – Kunstblätter gegen Lebensmittel verkaufte. Er erhielt ein Mittagessen und ein Esspaket. Kurz darauf kehrte er ein weiteres Mal ein. Über sein weiteres Schicksal ist nichts bekannt. Die jüdischen Händler trugen – zumindest teilweise – schwarze Kleidung und vor allem, das war völlig ungewohnt, auch als junge Männer einen schwarzen Hut. Ansonsten scheinen sie sich nicht abgesondert zu haben. Auffallende Gebräuche und Essensgewohnheiten blieben nicht in Erinnerung, wohl aber, dass ein Pferdehändler ganz «normal» mitgevespert und dabei auch den guten Speck nicht verachtet habe. Trotzdem waren dieser dörflichen Gesellschaft judenfeindliche Tendenzen nicht fremd. Sicherlich gab es hier und da einen Anlass durch betrügerisches Verhalten eines Juden. Nicht zu unterschätzen ist außerdem die Einstellung der katholischen Kirche gegenüber den Juden – noch nach 1945 erklärte ein Ka7 Mündlicher Bericht von Emilie Meyer, 26. Mai 1987.
Juden im bäuerlichen Milieu zu Beginn des Nationalsozialismus
|
93
tholik: Hitler «war die Strafe für die Juden, weil sie Jesus ans Kreuz geschlagen haben». Und gewiss spielte der örtliche Lehrer eine wichtige Rolle. Vor 1933 Zentrumsanhänger und Organist in der Kirche, trat er dann aus der Kirche aus und wurde ein glühender Propagandist der Nazis. Gerade auf die Kinder übte er einen starken Einfluss aus und prägte auch deren Judenbild mit. Noch heute hat sich im Gedächtnis erhalten, dass die Karikaturen im Stürmer wie Comics gelesen wurden und man darüber lachte, bis die Eltern die Zeitschrift verschwinden ließen. Daneben dürfen unterschwellig vorhandene Einstellungen nicht vergessen werden, an die eine judenfeindliche Agitation anknüpfen konnte. Man spottete lange vor der Nazizeit über die Juden, «ohne viel dabei zu denken». So sprach die Mutter, die doch eher freundlich über Juden dachte und dies auch nach 1933 unter Beweis stellte, gerne bei der Bewirtung von Gästen das Verslein: »Lieber ’n alter Jud verrecke als e Tröpfle Schnaps verschütte.« Oder wenn bei der Feldarbeit schwere Erdklumpen kleinzuhacken waren, hiess es anfeuernd: »Hau druff, ’s isch en Jud.« Und obwohl die Juden keineswegs besonders raffinierte Geschäftemacher waren, galt die stehende Redewendung, wenn man eine Arbeit umsonst machte und ein Belohnungsangebot ablehnte: »Ich bin doch kein Jud!« Wie kann man sich diesem ambivalenten Verhältnis nähern? Natürlich haben die traditionellen, von der Kirche lange geförderten Vorurteile gegen Juden die Einstellung vieler Dorfbewohner beeinflusst. Vielleicht kann aber ein zusätzlicher Gedanke einen Schritt weiter führen. Die Mittlerfunktion des jüdischen Händlers – als des vorherrschenden Typus, mit dem die Landbevölkerung in Kontakt kam – bedingte auch eine mehrschichtige gesellschaftliche Stellung. Der Jude hatte seinen Platz in der dörflichen Gesellschaft, er gehörte dazu: Er war notwendig, um Geschäfte abzuwickeln, er brachte Nachrichten aus der Stadt mit, er vermittelte Waren samt Informationen über Neuentwicklungen in der Viehzucht, in der landwirtschaftlichen Produktion oder über die Marktverhältnisse, und er vermittelte gleichzeitig kulturelle Einflüsse zwischen Stadt und Land. Aber selbst wenn der Jude gemeinsam mit den Bauern vesperte, war er doch nicht völlig integriert. Er kam letztlich «von außen», er war kein Mitglied der dörflichen Gemeinschaft und gliederte sich nicht in das – noch stark religiös bestimmte – Autoritätsgefüge des Dorfes ein. Bei aller möglichen Vertrautheit war er zugleich ein »Fremder im Dorf«.8 Die Marktkenntnisse des Juden und sein ökonomisches 8 Zu diesem Problem anregend: Rex Rexheuser, Der Fremde im Dorf. Versuch über ein Motiv der neueren russischen Geschichte (17.–19. Jahrhundert), in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, Jg. 25 (1977), S. 494–512. – Interessant wäre hier zu untersuchen, wie sich das Zusammenleben von christlichen und jüdischen Bauern ausgewirkt hat. So
94
| »Lieber ’n alter Jud verrecke als e Tröpfle Schnaps verschütte«
Verhalten machten ihn dem Bauern unheimlich: Der – wenngleich damals bereits vielfältig gebrochenen – »moralischen Ökonomie« des Dorfes stand die Wirtschaftsweise der Existenzsicherung, die wenigstens scheinbar überlieferten Normen folgte, näher als die profitorientierte kapitalistische Wirtschaft. Schnell haftete den Juden deshalb der Ruch an, sie seien »geldgierig«. Insofern empfand man sie als Eindringlinge.9 Die Neugier auf das Neue, das der »Fremde«, auf den man sich in der Regel verlassen konnte und mit dem man sich gut verstand, mit ins Dorf brachte, war deshalb vermutlich mit einem unterschwelligen Bedrohungsgefühl verbunden. Man fürchtete, selbst wenn sich der Jude immer ehrlich und anständig verhielt, einen Betrugsversuch, um mehr Profit zu erzielen. Manch einer der Bauern mag hin und wieder gedacht haben, ob nicht doch etwas dran sei an den Legenden vom Christusmord, vom Hostienfrevel, vom Ritualmord an Christenkindern, um rituelles Blut für das Pessach-Fest zu erhalten. Vertraut und fremd zugleich – aus dieser Dialektik erklären sich möglicherweise die unbewusst antisemitischen Spottverse und schließlich die auch auf dem Land anzutreffende Bereitschaft, sich zu judenfeindlichen Aktionen mobilisieren zu lassen. Zu untersuchen wäre, wie die Juden ihre Stellung im bäuerlichen Milieu empfanden, wie auf sie diese Verbindung von Vertrautheit und Fremdheit wirkte, auf ihr Denken und Verhalten, auf ihre Lebenswelt.
arbeiteten jüdische Praktikanten 1924 gemeinsam mit Bauernsöhnen aus der Gegend in der Landwirtschaftsschule Hochburg bei Emmendingen. In einem Bericht des jüdischen Wanderbundes Blau-Weiß über dieses Praktikum hiess es, es habe keinen Antisemitismus gegeben, der gegenseitige Zusammenhang sei »recht fest« gewesen (Hinweis von Ulrich Tromm; vgl. Hubert Schilling, Juden in Emmendingen von 1862 bis 1933, in: »s Eige zeige.« Jahrbuch des Landkreises Emmendingen für Kultur und Geschichte, Jg. 3 [1989], S. 127–137, hier S. 135). 9 Inwieweit die von Edward P. Thompson eingeführte und charakterisierte Kategorie der »moralischen Ökonomie« bei der Analyse dörflicher Verhältnisse in den zwanziger und dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts weiterhilft, muss noch im einzelnen erforscht werden. Es soll hier nur darauf aufmerksam gemacht werden, dass sich die Dorfgesellschaft immer noch, trotz aller Marktbeziehungen, als eigenständig verstand.
»Ich habe gedacht, dass die Arbeiter in den Städten besser leben« Arbeiter bäuerlicher Herkunft in der Industrialisierung des Zarenreiches und der frühen Sowjetunion* 1897 zog der dreizehnjährige Bauernsohn Boris Ivanovič Frumkin aus seinem Heimatdorf im Gouvernement Vladimir in das Nachbargouvernement Moskau und dann in die Metropole selbst, um Arbeit zu suchen. Mit der Hilfe bereits ansässiger Landsleute gelang ihm eine Anstellung in einer Metallfabrik, in der er sich nach und nach zu einem Facharbeiter weiterqualifizierte. Er heiratete eine Bauerntochter, die aus derselben Gegend wie er kam, eine Analphabetin. Mitte der zwanziger Jahre hatte die Familie drei Söhne und eine Tochter. Inzwischen lebte sie jedoch nicht mehr zusammen. 1920 hatte Boris seine Frau und seine Kinder, damit sie nicht länger unter dem damaligen Elend in Moskau leiden mussten, in sein Heimatdorf geschickt. Dort bewirtschafteten nach wie vor seine Eltern und seine Schwester einen Hof mit drei Desjatinen Feld (das sind etwas mehr als drei Hektar). Boris besass einen Anteil daran. Er selbst blieb in Moskau, arbeitete weiter in seiner Fabrik und engagierte sich in seiner Gewerkschaft, der er 1917 beigetreten war. 1924 erklärte er auch seine Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei. Zu dieser Zeit – die Neue Ökonomische Politik hatte eine deutliche Besserung der Wirtschaft bewirkt – waren seine Frau, seine fünfjährige Tochter und sein vierzehnjähriger Sohn nach Moskau zurückgekehrt und hatten noch den Grossvater, 63 Jahre alt, mitgebracht. Frau und Tochter pendelten allerdings zwischen Dorf und Stadt hin und her. Offenbar half Boris’ Frau ebenso auf dem Hof aus wie die beiden verbleibenden Söhne, 19 und 12 Jahre alt, die noch ständig im Dorf wohnten. Fast 20 Prozent seines Lohnes schickte Boris regelmässig nach dort, aufgrund der Familienverhältnisse mehr als in der vorrevolutionären Periode.1
* Erstpublikation in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 43 (1993) S. 42–60. Es handelt sich um die überarbeitete Fassung meines Vortrages, den ich am 21.5.1990 im Rahmen des Berufungsverfahrens an der Universität Basel gehalten habe. 1 E. Kabo: Očerki rabočego byta. Opyt monografičeskogo issledovanija domašnego rabočego byta, Moskau 1928, S. 103–107. Der im Original anonymisierte Name ist hier wie in den später folgenden Beispielen aus dieser Untersuchung von mir erfunden. Die »Fälle« wurden ebenfalls verwertet von William J. Chase: »Moscow and its Working Class, 1918–1928: A Social Analysis«, Ph. D. Boston 1979, S. 102, 164–165, 97, vgl. 90ff. (inzwischen auch als Buch: Workers, Society, and the Soviet State. Labor and Life in Moscow, 1918–1929, Urbana/Chicago 1987). Vgl. die Lebenserinnerungen: A Radical Worker in Tsarist Russia.
96
| »Ich habe gedacht, dass die Arbeiter in den Städten besser leben«
Dies ist ein Beispiel aus einem reichhaltigen Bestand an Untersuchungen, die in den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts über Herkunft, Lebenslauf, materielle Umstände, Alltag und Verhalten von Arbeitern angestellt wurden.2 Diese Längsschnittforschungen, im Stalinismus abgebrochen, knüpften an Studien engagierter Sozialwissenschaftler in der Endphase des Zarenreiches an und thematisierten eine zentrale Frage im gesellschaftlichen Umbruch der Industrialisierungsperiode: die Beziehungen zwischen Stadt und Land, dabei insbesondere den Übergang vom Bauern zum Arbeiter. Sie ermöglichen es uns, im Vergleich zahlreicher Biographien sowie der Verhältnisse in verschiedenen Industriezentren und ländlichen Regionen Besonderes und Allgemeines zu trennen, die Brücke von der individuellen und lokalen zur gesamtgesellschaftlichen Ebene zu schlagen. Auf der Grundlage des einzigartigen, bislang erst punktuell ausgewerteten Materials können wir nachzeichnen, wie sich für die Betroffenen der Übergang vom Dorf in die Stadt darstellte, wie die Prägungen ihrer alten Heimat, der bäuerlichen Lebenswelt nachwirkten, in welcher sich Denk-und Verhaltensweisen änderten. Dieser Wandel der Lebensweise, in Beziehung gesetzt zum Wandel sozialer, ökonomischer, kultureller und politischer Strukturen, gibt Aufschluss über Hintergründe historischer Abläufe im Zarenreich und in der frühen Sowjetunion. Wenn Boris Ivanovič Frumkin 1897 aus seinem Dorf nach Moskau zog, um dort Arbeit zu suchen, ohne seine Bindung an die alte Heimat aufzugeben, so war dies beileibe kein Einzelfall und stand zugleich in einer langen Tradition. Bauern bildeten in den Industrialisierungsphasen des Zarenreiches wie der Sowjetunion die wichtigste Rekrutierungsschicht für die Industriearbeiterschaft. Sie ersetzten auch, anders als im Westen, das nur in geringem Umfang vorhandene Reservoir an städtischen Handwerkern, weil manche von ihnen Kenntnisse aus einem dörflichen Handwerk oder der ländlichen Hausindustrie, dem Kustar’-Gewerbe, mitbrachten. Hier wirkte sich aus, dass es – im Unterschied zu weiten Teilen Mittel- und Westeuropas – in Russland keine rechtliche Scheidung zwischen Stadt und Land gegeben hatte. Deshalb waren hier keine feste Stadtbürgergemeinde The Autobiography of Semen Ivanovich Kanatchikov, hg. von Reginald E. Zelnik, Stanford 1986. Für Hinweise zu diesem Beitrag danke ich Thomas Held. 2 Vgl. von Elena O. Kabo (1888–1968), der Leiterin der Abteilung Arbeiterbudget im Zentralbüro für Arbeitsstatistik von 1921 bis 1929, ausser der in Anm. 1 zitierten Untersuchung: Pitanie russkogo rabočego do i posle vojny, Moskau 1924. Wichtige Budgetforschungen: Bjudžety rabočich i služaščich, Vyp. 1, Bjudžet rabočej sem‘i v 1922–1927 gg. Moskau 1929 (der Text wurde von G. S. Polljak verfasst). Weitere Titel von Kabo, Polljak und anderen sind zusammengestellt und ausgewertet von Gert Meyer: »Alltagsleben sowjetischer Industriearbeiter Mitte der zwanziger Jahre«, in: Beiträge zur Sozialismusanalyse, Bd. 2, hg. von Peter Brokmeier und Rainer Rilling, Köln 1979, S. 244–292. Eine bahnbrechende Dorfstudie: M. Ja. Fenomenov: Sovremennaja derevnja. Opyt kraevedčeskogo obsledovanija odnoj derevni, Leningrad/Moskau 1925.
Arbeiter bäuerlicher Herkunft
|
97
und keine Handwerkerzünfte entstanden. Bauern wanderten immer wieder in die Städte, um landwirtschaftliche wie handwerkliche Erzeugnisse zu verkaufen.3 Ländliches Gewerbe spielte auch in Mittel- und Westeuropa eine wesentliche Rolle. Dies haben die Forschungen zur Proto-Industrialisierung deutlich gemacht. Ebenso waren hier die »Bauern-Arbeiter« während der Industrialisierung eine durchaus häufig vorkommende Erscheinung.4 Insgesamt übertraf jedoch das Ausmass der bäuerlichen Zuwanderung in die Städte und Industriezentren Russlands vergleichbare westliche Entwicklungen. Noch um die Jahrhundertwende stammte beinahe jeder Arbeiter aus einer bäuerlichen Familie.5 Die Migration der russischen Bauern in die Industrie zwischen den achtziger Jahren des 19. bis in die dreissiger Jahre unseres Jahrhunderts lässt sich in einer wellenförmigen Linie nachzeichnen. Konjunkturaufschwünge schwemmten immer wieder neue Massen heran. Ivan Bunin schilderte in seinem autobiographischen Roman »Das Leben Arsenjews« – ungefähr in derselben Zeit, in der Frumkin nach Moskau wanderte – eine solche Szene. »Ich brach in einem solchen Gedränge, in einer so abscheulichen Umgebung auf, wie ich noch keine erlebt hatte, mit einem Nachtpostzug, dessen Länge geradezu beängstigend wirkte. Er traf bereits überfüllt in Charkow ein, wo eine unübersehbare Menge auf dem Bahnsteig wartete und voll Hoffnung auf Verdienstmöglichkeiten nach dem Süden [in die Kohlengruben des Donec-Beckens] strebte; sie stürzte auf ihn zu – mit Beuteln und Schultersäcken, mit den an ihnen festgebundenen Bastschuhen nebst Fusslappen, Teekannen und stinkender Wegzehrung: groben Roggenbrötchen und gebratenen Eiern.«6 3 Ich verweise hier nur auf meinen Überblick: »Die russische Stadt in der Geschichte«, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 27 (1979), S. 481–497. 4 Als Beispiele: Martin Schaffner: Die Basler Arbeiterbevölkerung im 19. Jahrhundert. Beiträge zur Geschichte ihrer Lebensformen, Basel, Stuttgart 1972; Heiko Haumann: »Arbeiter und technischer Fortschritt in der Anfangsphase der Industrialisierung. Ein regionaler Vergleich«, in: Neue Technologien – Neue Gesellschaft? Gewerkschaftliche Überlegungen und Antworten, hg. von Josef Fuckerieder u. a., Freiburg i. Br. 1988, S. 54–72; ders.: »Ein Wald von Fabriken, Fabrikantenvillen und Arbeiterwohnungen.« Probleme der Industrialisierung im Elztal (1850–1914), in: »s Eige zeige.« Jahrbuch des Landkreises Emmendingen für Kultur und Geschichte 1 (1987), S. 107–128. 5 Robert Eugene Johnson: Peasant and Proletarian. The Working Class of Moscow in the Late Nineteenth Century, New Brunswick, N. J. 1979, S. 31. Vgl. ders.: »Peasant Migration and the Russian Working Class: Moscow at the End of the Nineteenth Century«, in: Slavic Review 35 (1976), S. 652–664; Joseph Bradley: Muzhik and Muscovite. Urbanization in Late Imperial Russia, Berkeley, Cal. u. a. 1985, hier S. I03ff. Für die Verhältnisse in St. Petersburg und für die Rahmenbedingungen ist die in Anm. 7 und 17 genannte Literatur heranzuziehen. 6 Iwan Bunin: Das Leben Arsenjews. Eine Jugend im alten Russland, Frankfurt a. M. 1982, S. 197.
98
| »Ich habe gedacht, dass die Arbeiter in den Städten besser leben«
Depressionen verstärkten die Rückflutung in die Dörfer. Zum tiefsten Einbruch kam es in den ersten Jahren nach der Oktoberrevolution, als aufgrund der katastrophalen Bedingungen Millionen Menschen die Städte verliessen, um auf dem Land eine Überlebenschance zu finden. Petrograd und Moskau verloren zwischen 1918 und 1920 etwa die Hälfte ihrer Einwohnerschaft. Auch die Familie Frumkins war davon betroffen gewesen, wie wir gesehen haben. In den zwanziger Jahren füllten sich dann die Reihen des Proletariates wieder. Die sprunghafte Stalinsche Industrialisierungs- und Kollektivierungspolitik führte schliesslich nach 1929 zu einem drastischen Anwachsen der – nun oft erzwungenen – bäuerlichen Zuwanderung in die Industrie. Innerhalb weniger Jahre veränderte sich die wirtschaftliche und soziale Struktur radikal. Dieser Verlauf von Migration und demographischem Wandel führte dazu, dass sich die Industriearbeiterschaft unter erschwerten Bedingungen formieren musste. Die Fluktuation war ausserordentlich hoch. Die vielfach unzureichende Qualifikation der »Bauern-Arbeiter« zog ein Sinken der Arbeitsproduktivität nach sich. Vor allem in Zeiten starken Zustroms vom Land kam der Produktionsablauf erheblich in Unordnung.7 Ich greife zwei weitere biographische Beispiele aus dem verfügbaren Material heraus, um einige Aspekte des Lebens von Arbeiterinnen und Arbeitern bäuerlicher Herkunft zu vertiefen. Sie stammen erneut aus der Region Moskau, in der die Probleme am deutlichsten hervortreten und auch am besten erforscht sind. In den anderen Industrieregionen waren die Verhältnisse ähnlich, mit Abstufungen und Unterschieden im Detail. Wie Frumkin stammte die Bauerntochter Ol’ga Semënovna Nikulina, die – achtzehnjährig – im Jahre 1900 nach Moskau zog, aus einer Nachbarprovinz, dem Gouvernement Kaluga. Vorher hatte sie auf dem elterlichen Hof gearbeitet und war inzwischen verheiratet. In Moskau fand sie eine Anstellung in einem Textilbetrieb, dem sie bis zum Ende des Untersuchungszeitraumes 1924 treu blieb. Ihr Mann starb infolge seiner Trunksucht. Sie heiratete dann einen Fabrikarbeiter, der immerhin – im Gegensatz zu ihr – die Zeitung lesen konnte. Seine berufliche Qualifikation scheint nicht besonders hoch gewesen zu sein. Für kulturelle und politische Aktivitäten interessierten sich beide nicht, obwohl sie Mitglieder einer Gewerkschaft waren. Während sie dafür 1924 weniger als 0,1 Prozent ihres gemeinsamen Einkommens ausgaben, belief sich der Anteil für Alkohol und Tabak auf fast 7 Prozent. Die Familie – der Mann hatte einen Sohn und eine Tochter mit in die Ehe gebracht – lebte in einer Einzimmer7 Allgemein zu diesen Migrationsbewegungen und demographischen Wandlungen – mit weiterer Literatur – Ralph Melville, Thomas Steffens: »Die Bevölkerung«, in: Handbuch der Geschichte Russlands, Bd. 3: »Von den autokratischen Reformen zum Sowjetstaat (1856–1945)«, hg. von Gottfried Schramm, 2. Halbband, Stuttgart 1992, S. 1009–1191; zur Bedeutung der Bauern für die Industrialisierung Heiko Haumann: »Die Wirtschaft«, in: ebd., S. 1193–1297, bes. S. 1239–1247, 1270–1279.
Arbeiter bäuerlicher Herkunft
|
99
wohnung und kannte kaum eine andere Zerstreuung als Alkohol. Der Mann ging hin und wieder ins Kino, einmal besuchte er das Bol’šoj Theater. Ol’ga behielt einige religiöse Gebräuche bei.8 Aus dem Gouvernement Moskau selbst kam Nikolaj Sergeevič Badaev, der 1888 geboren wurde. Sein Vater war ein Dorfhandwerker mit etwas Feld, seine Mutter arbeitete in einer nahegelegenen Fabrik: Die Gegend um Moskau gehörte zu den am frühesten industrialisierten Gebieten Russlands. 1901 wanderte Nikolaj in die Hauptstadt selbst, wo er in einer kleinen Metallgiesserei Arbeit fand. Im selben Jahr verschlug es auch die ebenfalls dreizehnjährige Sof ’ja Petrovna Preobraženskaja mit dem gleichen Ziel nach Moskau. Sie stammte von einem kleinen Bauernhof aus der Gegend wie Nikolaj. Jetzt wurde sie in einer Textilfirma eingestellt. Später heirateten die beiden und hatten bis 1924 vier Kinder. Ihre Fabrikarbeit gaben sie während des ganzen Zeitraumes nie auf, wohl aber kehrten sie für 30 bis 40 Tage im Jahr zu ihren jeweiligen Eltern zurück, um dort bei der Ernte zu helfen.9 Aus den Beispielen geht hervor – und darin sind sie repräsentativ –, dass meistens die Not die Bauernsöhne und -töchter oft schon als Jugendliche vom Dorf in die Stadt mit ihrem grossen Angebot an Arbeitsplätzen trieb. Das Land war, im Verhältnis zur verfügbaren agrarischen Nutzfläche, übervölkert. Die kleinen Landstücke reichten immer weniger aus, die grossen Familien zu ernähren. Ausserdem verminderten sich die Einkünfte aus dem dörflichen Hausgewerbe durch die Konkurrenz der modernen Industrie, selbst wenn es seine Bedeutung noch keineswegs verlor. Neben diesen ärmeren Bauern gab es eine Reihe wohlhabender Landbewohner, die bereits über gute Kontakte zur Stadt verfügten und sich von einem Wechsel nach dort den grossen Aufstieg erhofften.10 Weiter fällt auf, dass die hier geschilderten Personen aus der näheren Umgebung Moskaus kamen. Dies gilt für etwa zwei Drittel der Zuwanderer. Die entfernter liegenden Provinzen hatten entweder selbst ein breites Angebot an industriellen Arbeitsplätzen aufzuweisen oder noch etwas günstigere landwirtschaftliche Bedingungen.11 8 Kabo: Očerki, S. 29–34. 9 Kabo: Očerki, S. 47–51. 10 Chase: Moscow, S. 74ff.; Johnson: Peasant and Proletarian, passim; Bradley: Muzhik, S. 122ff., 133; Anita B. Baker: »Deterioration or Development? The Peasant Economy of Moscow Province Prior to 1914«, in: Russian History 5 (1978), S. 1–23, hier bes. S. 23; auch Pitrim Sorokin, Carle C. Zimmerman, Charles Galpin: A Systematic Source Book in Rural Sociology, 3 Bde., Minneapolis 1932, hier Bd. 3, S. 494–498, 509 (Budgetstudien aus den zwanziger Jahren). 11 Chase: Moscow, S. 71 ff.; vgl. wieder Johnson: Peasant and Proletarian, passim. Zum Vergleich: James H. Bater: »Transience, Residential Persistence, and Mobility in Moscow and St. Petersburg, 1900–1914«, in: Slavic Review 39 (1980), S. 239–254; Natalija Vasil’evna Juchnëva: »Die Migrationsbewegungen nach Petersburg und ihre ethnischen Strukturen
100
| »Ich habe gedacht, dass die Arbeiter in den Städten besser leben«
Ein falsches Bild vermitteln – aufgrund der Fragestellung der hier benutzten Quelle – allerdings die von mir aufgeführten Fälle, wenn bei allen von gemeinsam in Moskau lebenden und arbeitenden Ehepaaren die Rede ist. In der Zarenzeit wanderten überwiegend verheiratete Männer in die Stadt. Deren Frauen blieben jedoch meist zu Hause. Mädchen und Frauen, die vom Land nach Moskau kamen und im allgemeinen in der Textilindustrie eine Beschäftigung fanden, waren zum grössten Teil ledig. Dies brachte Probleme für die Lebensweise in der Stadt mit sich, hatte aber auch für die Verhältnisse auf dem Land Konsequenzen. Kinder und ältere Männer sowie zurückgebliebene Frauen bildeten nun die Mehrheit der Dorfbewohner. Die Intensität der landwirtschaftlichen Arbeit litt unter dieser Familienstruktur auf dem Hof. Und das Zusammenleben gestaltete sich, wie wir aus vielen Lebensgeschichten wissen, auch nicht gerade einfach. Hinzu trat, dass die männlichen »Bauern-Arbeiter« nicht nur früher als die in der Stadt geborenen Arbeiter, sondern auch früher als die »reinen« Bauern heirateten und damit mehr Kinder als üblich hatten. Dadurch verschärfte sich der Bevölkerungsdruck in den Dörfern.12 Ein erheblicher Teil der »Bauern-Arbeiter« behielt des weiteren noch Landanteilsrechte. Diese Tatsache, die ursprünglich mit der solidarischen Steuerhaftung der Dorfgemeinde zusammenhing, aber auch als »Rückversicherung« diente, ist uns schon in den Fallbeispielen begegnet. Während der Abwesenheit der Männer nahmen deren Frauen die Anteilsrechte faktisch wahr, indem sie bei der Bewirtschaftung mithalfen. Zur Ernte, manchmal auch zu anderen Feldarbeiten, kehrten viele Männer vorübergehend ins Dorf zurück. Saisonarbeit war weit verbreitet; das Ehepaar Nikolaj und Sof ’ja stand dafür stellvertretend. In Notzeiten, wenn die Unternehmer sie nicht mehr beschäftigen wollten oder den Lohn verringerten, konnten die Anspruchsberechtigten ihren Platz im Familienhaushalt wieder einnehmen. Insofern gewährte die fortdauernde Landbindung zahlreichen Arbeitern einen erheblichen Schutz.13 Verfolgen wir diese Entwicklung in die Sowjetperiode, so zeigt sich, dass in den zwanziger Jahren nun ebenso viele Frauen wie Männer nach Moskau zoam Ende des 19. Jahrhunderts«, in: Bildungsgeschichte, Bevölkerungsgeschichte, Gesellschaftsgeschichte in den böhmischen Ländern und in Europa. Festschrift für Jan Havránek zum 60. Geburtstag, hg. von Hans Lemberg u. a. Wien/München 1988, S. 350–369. 12 Robert Eugene Johnson: »Family Relations and the Rural-Urban-Nexus: Patterns in the Hinterland of Moscow«, in: The Family in Imperial Russia. New Lines of Historical Research, hg. von David L. Ransel, Urbana u. a. 1978, S. 263–279; vgl. Bradley: Muzhik, S. 133ff. 13 Neben der zuvor zitierten Literatur auch Chase: Moscow, S. 96ff.; Barbara Alpern Engel: »The Woman‘s Side. Male Out-Migration and the Family Economy in Kostroma Province«, in: Slavic Review 45 (1986), S. 257–271; dies.: »Women, Work and Family in the Factories of Rural Russia«, in: Russian History 16 (1989), S. 223–237.
Arbeiter bäuerlicher Herkunft
|
101
gen. Die Attraktivität für ganze Familien, den Schritt in die Grossstadt zu wagen, hatte beträchtlich zugenommen. Daneben vergrösserten junge ledige Mädchen und Kriegerwitwen, die im Dorf kein Auskommen mehr fanden, das Kontingent weiblicher Zuwanderer. Unter der Arbeiterschaft stellten die Männer indessen immer noch die Mehrheit.14 Nach wie vor behielten viele Industriearbeiter, die aus dem Dorf stammten, ihre Landanteilsrechte bei. In der Regel bewirtschaftete ein Familienmitglied – wie in der Zarenzeit – für den Abwesenden den Hof. Wer mit dem Dorf verbunden blieb, unterstützte üblicherweise – wie bei unseren Beispielen Frumkin – seine dort lebenden Angehörigen. Der umgekehrte Fall trat nur selten ein. Der Geldumlauf im Dorf erhöhte sich aufgrund dieses Transfers von der Stadt aufs Land – wie bereits in der vorrevolutionären Periode – kräftig.15 Hier deutet sich schon an, dass ein Dorfbewohner, der seine Heimat verliess, um in der Stadt Arbeit zu suchen, keineswegs lediglich seine Landanteilsrechte sozusagen für alle Fälle beibehielt. Was ihn geprägt hatte, schüttelte er nicht von heute auf morgen ab. Was erwartete er in der Industrie und in der Stadt? Vielfach war es ganz einfach das Bedürfnis nach Verdienst, weil es zu Hause hinten und vorne nicht reichte. Daneben spielte der Reiz der Grossstadt eine Rolle, von der es hiess, hier könne man leicht sein Glück machen oder doch wenigstens ein besseres Leben als im Dorf führen. Dass man in der Stadt schöner leben werde als auf dem Land, zieht sich als Leitmotiv durch die Lebensgeschichten. Dies ist uns auch aus anderen Kulturen und Industrialisierungsprozessen bekannt. In Russland hat es darüber hinaus eine lange Tradition, weil es einzelnen Dorfbewohnern selbst als Leibeigenen immer wieder gelungen war, durch die Verbindung mit der Stadt – als Händler oder gar Unternehmer – den sozialen Aufstieg zu schaffen.16 Die Träume von einem besseren Leben erfüllten sich allerdings überwiegend nicht. Natürlich verdiente man, einmal in der Industrie untergekommen, mehr bares Geld als auf dem Bauernhof zu Hause. Man konnte sogar etwas zurücklegen 14 Chase: Moscow, S. 72, 86. Vgl. V. P. Danilov: »Krest‘janskij otchod na promysly v 1920-ch godach«, in: Istoričeskie zapiski 94 (1974), S. 55–122. 15 Chase: Moscow, S. 99ff., 103; Bradley: Muzhik, S. 112; Gert Meyer: Sozialstruktur sowjetischer Industriearbeiter Ende der zwanziger Jahre. Ergebnisse der Gewerkschaftsumfrage unter Metall-, Textil- und Bergarbeitern 1929, Marburg 1981. Vgl. N. Semenov: Lico fabričnych rabočich proživajuščich v derevnjach i politprosvetrabota sredi nich. Po materialam obsledovanija rabočich tekstil’noj promyšlennosti central’no-promyšlennoj oblasti, Moskau/Leningrad 1929; M. Krasil’nikov: »Svjaz’ naselenija g. Moskvy s nadel’noj zemlej«, in: Statističeskoe obozrenie 1928, Nr. 2, S. 103–107; ders.: »Svjaz’ leningradskogo rabočego s zemlej«, in: ebd. 1929, Nr. 4, S. 107–110. 16 Vgl. – mit weiterer Literatur – Heiko Haumann: »Unternehmer in der Industrialisierung Russlands und Deutschlands. Zum Problem des Zusammenhanges von Herkunft und politischer Orientierung«, in: Scripta Mercaturae 20 (1986), S. 143–161, hier bes. S. 149– 150.
102
| »Ich habe gedacht, dass die Arbeiter in den Städten besser leben«
und der Familie ins Dorf senden. Aber: vor allem nach der Jahrhundertwende stiegen die Lebenshaltungskosten schneller als die Löhne. Ebenso wurde die reine Arbeitszeit nach der Revolution von 1905 zwar auf 10 Stunden im Durchschnitt gesenkt, lag damit aber immer noch höher als in Westeuropa und stellte keine erstrebenswerte Alternative zur Landarbeit dar. Am schlimmsten dürften jedoch die Wohnungsprobleme gewesen sein. Die zur Verfügung stehenden Unterbringungsmöglichkeiten waren in einem unvorstellbaren Ausmass überfüllt, in Moskau etwa wesentlich stärker als in westlichen Industriezentren.17 Leo Tolstoj kam 1882 als Volkszähler in Moskauer Arbeiterhäuser, Gemeinschaftswohnungen und Nachtasyle. Er schrieb: »Alle Wohnungen waren voll, alle Kojen waren belegt, und nicht von einer Person, sondern oft von zwei. Schrecklich war der Anblick der Enge, in der sich dieses Volk kauerte, und wie sich die Frauen mit den Männern vermischten (...) Schrecklich war der Anblick der Armut, des Schmutzes, der Abgerissenheit ( ... ) Und überall derselbe Gestank, dieselbe stickige Luft und Enge (...).«18 All dies besserte sich auch in der Sowjetperiode nicht grundlegend. Nach dem tiefen Einbruch in die materiellen Lebensbedingungen während Weltkrieg, Revolutionszeit und Bürgerkrieg ging es anschliessend zwar aufwärts. Mitte der zwanziger Jahre war das Niveau von 1913 im grossen und ganzen wieder erreicht, die Wohnungsversorgung sogar ein wenig besser. Der rasche Zuzug neuer Arbeitskräfte verschärfte dann allerdings dieses Problem ein weiteres Mal. Schlafgänger und Wohnungsteilungen waren an der Tagesordnung. Bei der Wohnungssuche, dem Tausch oder dem Versuch, den Anteil an der Wohnung zu vergrössern, kam es häufig zu Bestechungsfallen und Denunziationen.19 Die oft untragbaren Zustände wurden zu einem zentralen Thema der Sowjetliteratur. Ilf und Petrov, Soščenko, Kataev und viele andere, auch Filme und volkstümliche Lieder griffen auf, wie etwa die Inanspruchnahme der Küche durch mehrere Familien zu ständigen Reibereien führte, wie durch die Überfüllung der Wohnungen an ein 17 Vgl. die in Anm. 7 genannten Beiträge zum Handbuch der Geschichte Russlands sowie die zitierten Arbeiten zu Moskau. Zu St. Petersburg Thomas Steffens: Die Arbeiter von Petersburg 1907 bis 1917. Soziale Lage, Organisation und spontaner Protest zwischen zwei Revolutionen, Freiburg i. Br. 1985; Ė. Ė. Kruze: Peterburgskie rabočie v 1912–1914 godach, Moskau/Leningrad 1961; dies.: Uslovija truda i byta rabočego klassa Rossii v 1900–1914 godach, Leningrad 1981; ausserdem die in Anm. 23 zitierten Arbeiten von Desjeans und Bonnell. 18 Lev N. Tolstoj: »Tak čto že nam delat’?«, in: ders.: Polnoe sobranie sočinenij, Bd. 13, Moskau 1913, S. 49; drastische Berichte auch bei Wladimir Giljarowski: Kaschemmen, Klubs und Künstlerklausen. Sittenbilder aus dem alten Russland, 3. Aufl. Berlin 1988. 19 Vgl. Meyer: Alltagsleben, passim. Wichtige Hinweise bei Hans-Henning Schröder: Arbeiterschaft, Wirtschaftsführung und Parteibürokratie während der Neuen Ökonomischen Politik. Eine Sozialgeschichte der bolschewistischen Partei 1920–1928, Berlin (Wiesbaden) 1982 (Forschungen zur osteuropäischen Geschichte Bd. 31).
Arbeiter bäuerlicher Herkunft
|
103
ungestörtes Privatleben nicht zu denken war. In einem der populärsten Filme der zwanziger Jahre – »Bett und Sofa« – entschliesst sich ein Moskauer Arbeiterehepaar, trotz der Enge in seinem einzigen Zimmer einen neu vom Dorf ankommenden Landsmann als Kost- und Schlafgänger aufzunehmen. Er soll auf dem Sofa übernachten. Unvermeidbar folgen Verwicklungen in diesem Dreiecksverhältnis, bis am Ende die beiden männlichen Personen Bett und Sofa getauscht haben. Auch aufgrund dieser Verhältnisse wundert es nicht, wenn viele zugezogene Arbeiter die Bindung an ihre alte Heimat nicht ohne weiteres abbrachen. Sie stellte eine gewisse soziale Sicherheit dar, gab aber auch Kraft, in den wenig anheimelnden Umständen der Industriearbeit und des städtischen Lebens auszuharren. Die ohnehin vorhandene Tendenz, nicht all das sofort über Bord zu werfen, in dem man gross geworden war, wurde dadurch noch verstärkt. Immer wieder finden wir Traditionen der bäuerlichen Welt bei den Verhaltensweisen von Arbeitern in der Stadt. Wenn Boris seinen Grossvater bei sich in Moskau aufnahm, lässt sich dies wohl auch darauf zurückführen, dass man herkömmlich gemeinsam in einer Grossfamilie wohnte. Die Heiratstermine vieler Arbeiter richteten sich bis weit in die Sowjetzeit hinein nach dem liturgischen Kalender und nach den überlieferten landwirtschaftlichen Erfordernissen: Während der Fasten-, der Aussaat- und der Erntezeit wurde auch in der Stadt höchst selten geheiratet. Die meisten Kinder kamen – ebenfalls als Reflex dieses Verhaltens – zwischen September und Januar zur Welt.20 Bäuerliche Gepflogenheiten schimmerten durch, wenn sich eine ganze Reihe von Arbeiterfamilien – selbst in Moskau – Vieh hielten: Hühner, Schweine, Schafe. Man denkt unwillkürlich an ähnliche Fälle im Westen – etwa an die berühmte »Bergmannsziege« im Ruhrgebiet –, doch eine solche Arbeiterzusammenballung wie Moskau dürfte hier einen Ausnahmerang eingenommen haben. Auf diese Weise konnte man sich vor allem in Notzeiten besser mit Lebensmitteln versorgen, aber für viele Arbeiter scheint auch bedeutsam gewesen zu sein, etwas vom gewohnten Umfeld beizubehalten. Wie sich dies bei den beengten Wohnverhältnissen und den hygienischen Zuständen ausgewirkt haben muss, ist für uns heute kaum nachvollziehbar.21 Das Rollenverständnis von Mann und Frau hielt sich ebenfalls an überkommene Muster. Gerade bei den vom Land stammenden Industriearbeitern herrschte ein starker Patriarchalismus vor. Haushalt und Kindererziehung blieben die Domäne der Frau, selbst wenn diese in der Ehe der Hauptverdiener war. Insgesamt bestätigt sich der Eindruck, den die Fallbeispiele bereits vermittelten: Ein Gutteil der Zuwanderer wurde in der Stadt auch bei längerer Verweildauer nicht heimisch. Dazu trug die Enttäuschung bei, dass das Leben hier nicht 20 Chase: Moscow, S. 105ff. 21 Chase: Moscow, S. 166–167.
104
| »Ich habe gedacht, dass die Arbeiter in den Städten besser leben«
derart verlief, wie man es sich vorgestellt hatte. Man versuchte, nach der Arbeit, soweit es eben ging, wie früher zu leben, kümmerte sich kaum um das, was in der Stadt geschah, nahm selten an Aktivitäten ausser Haus teil. Die überwiegend schlechte Vorbildung, ja das Analphabetentum vieler »Bauern-Arbeiter« und »-Arbeiterinnen« mag diese Haltung verstärkt haben.22 Der verbreitete Alkoholverbrauch könnte ein weiterer Beleg für diese Zusammenhänge sein. Allein rund um die weitläufige Anlage der PutilovWerke in Petersburg, eines der bedeutendsten Industriebetriebe Russlands, fanden sich zu Beginn unseres Jahrhunderts über 50 Kneipen, in denen es trotzdem am wöchentlichen Zahltag für manche Arbeiter keinen Platz mehr gab. Die unzähligen Berichte über das Ausmass des Alkoholgenusses werden von den Budgetuntersuchungen unter Arbeitern bestätigt; bei unseren drei Fällen gab es auch ein Beispiel, die Familie Ol‘ga Semënovna Nikulinas. Die Trinksitten sind zunächst einmal als Reaktion auf die unbefriedigenden Lebensumstände, aus den elenden Wohnverhältnissen und der schweren Arbeitssituation zu erklären. Schnaps tranken namentlich die körperlich besonders hart Arbeitenden. Will man weiter eine Linie zum Dorf ziehen, muss man natürlich – wie überhaupt bei der Interpretation von Verhaltensweisen – vorsichtig sein. Aus Untersuchungen zu westlichen Industrialisierungsprozessen wissen wir, dass sich das Trinkverhalten der Bauern von dem der Arbeiter unterschied; in Russland dürfte es ähnlich gewesen sein, auch wenn der Forschungsstand noch nicht weit gediehen ist. Fest steht hingegen, dass vor und nach der Revolution von 1917 grosse Mengen des selbstgebrannten Wodkas (samogon) vom Dorf in die Stadt flossen, wobei offenbar die ehemaligen Landsleute als erste beliefert wurden. Dass auch die Sowjetregierung im Kampf gegen den hochprozentigen, durch das einfache Destillierverfahren besonders gesundheitsschädlichen samogon kaum Erfolge vorweisen konnte – selbst den Verkauf des staatlichen Wodkas hätte sie lieber gesehen, zumal sie daran gut verdiente –, ist bekannt.23 In unnachahmli22 Chase: Moscow, S. 167ff., 173ff. Wichtige Materialien bei Meyer und Schröder (wie Anm. 19). Vgl. aus den Forschungen zur Situation der Frauen Rose Glickman: Russian Factory Women: Workplace and Society, 1880–1914, Berkeley 1984; Barbara Evans Clements: »Working-Class and Peasant Women in the Russian Revolution (1917–1923)«, in: Signs 8 (1982), S. 215–235. Eine Analyse des Alltagslebens, des Bewusstseins und Verhaltens von Mann und Frau im Vergleich zwischen Stadt und Land liegt allerdings noch nicht vor. 23 Chase: Moscow, S. 176ff.; Meyer und Schröder (wie Anm. 19); Neil Weissmann: »Prohibition and Alcohol Control in the USSR: the 1920s Campaign against Illegal Spirits«, in: Soviet Studies 38 (1986), S. 349–368; Helena Stone: »The Soviet Government and Moohnshine, 1917–1929«, in: Cahiers du monde russe et soviétique 27 (1986), S. 359–380. Als Beispiel einer zeitgenössischen Auseinandersetzung: Protiv alkogolizma. Sbornik materialov. Pod redakciej Bjuro ob-va bor‘by s alkogolizmom Volodarskogo rajona, Leningrad 1929. Zum Alkoholkonsum in der Vorkriegszeit etwa Mary Frances Desjeans: The Common Experience of the Russian Working Class: The Case of St. Petersburg 1892–1904, Ph.
Arbeiter bäuerlicher Herkunft
|
105
cher Weise verdeutlicht Valentin Rasputin, der Dichter der »Dorfprosa«, diese Kontinuität, wenn er den »Arbeiter-Bauern« Ilja in seinem Roman »Die letzte Frist«, eine zentrale Losung der kommunistischen Ideologie – jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen – abwandelnd, sagen lässt: »Wir trinken nach unseren Fähigkeiten und zugleich nach unseren Bedürfnissen. Soviel in uns rein geht.«24 Ein Nachwirken bäuerlicher Tradition drückte sich auch in Esssitten, religiösen Gewohnheiten und bestimmten Bräuchen aus. Wenn Vorarbeiter, die sich bei ihren Untergebenen unbeliebt gemacht hatten, von diesen in einem Schubkarren, einen dreckigen Sack über den Kopf gestülpt, herumgefahren wurden, dann erinnert das stark an rituelle Rügebräuche im Dorf, wie wir sie auch aus anderen Ländern kennen, etwa das Charivari. Über Verhaltensweisen am Arbeitsplatz wissen wir allerdings insgesamt noch viel zu wenig. Häufig gerieten die Neuankömmlinge vom Dorf in Konflikt mit den fest im städtischen Milieu verhafteten Arbeitern. Dass sie als »Kuhbauern« verspottet wurden, war das Mindeste. Ernsthafte Streitigkeiten entstanden, wenn sie als Streikbrecher auftraten. Dabei wurden oft Einzelfälle verallgemeinert. Das abgesonderte Leben vieler Zuwanderer liess jedoch eine solche Agitation auf fruchtbaren Boden fallen.25 Doch das ist nur eine Seite. Eine ganze Anzahl der ehemaligen Dorfbewohner konnte sich recht gut an das städtische Leben anpassen oder setzte sich zumindest bewusst damit auseinander, versuchte, die Bedingungen zu verbessern. Eine D. Duke Univ. 1978, S. 174–178; Victoria E. Bonnell: Roots of Rebellion. Workers’ Politics and Organizations in St. Petersburg and Moscow, 1900 – 1914, Berkeley u. a. 1983, S. 70. Vgl. R. E. F. Smith, David Christian: Bread and Salt. A Social and Economic History of Food and Drink in Russia, Cambridge u. a. 1984. Zur allgemeinen Einordnung Utz Jeggle: »Alkohol und Industrialisierung«, in: Rausch – Ekstase – Mystik, hg. von Herbert Cancik, Düsseldorf 1978, S. 78 – 94; James S. Roberts: »Der Alkoholkonsum deutscher Arbeiter im 19. Jahrhundert«, in: Geschichte und Gesellschaft 6 (1980), S. 220–242; Jakob Tanner: »Die ›Alkoholfrage‹ in der Schweiz im 19. und 20. Jahrhundert«, in: Drogalkohol 10 (1986), S. 147–168 (das gesamte Heft 3 ist für dieses Thema interessant); Heiko Haumann: »›Schnapskasinos‹ auch im Siegerland. Beobachtungen und Fragen zur Umbruchzeit der Industrialisierung«, in: Siegerland 59 (1982), S. 62–66. 24 Valentin Rasputin: Die letzte Frist. Roman. Übers. von Alexander Kaempfe, Frankfurt a. M. 1985, S. 75. 25 Bonnell: Roots, S. 65; vgl. die zitierten Untersuchungen von Bradley, Chase, Johnson und Steffens (Zitat »Kuhbauern« bei Steffens in: Handbuch, S. 1149). Zum Vergleich der Rügebräuche nenne ich hier nur Edward P. Thompson: »›Rough Music‹ oder englische Katzenmusik«, in: ders.: Plebeische Kultur und moralische Ökonomie. Aufsätze zur englischen Sozialgeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts, hg. von Dieter Groh, Frankfurt a. M. u. a. 1980, S. 131–168; Martin Scharfe: »Zum Rügebrauch«, in: Brauchforschung, hg. von Martin Scharfe, Wiss. Buchgesellschaft, Darmstadt 1991, S. 184–215; Ernst Hinrichs: »›Charivari‹ und Rügebrauchtum in Deutschland. Forschungsstand und Forschungsaufgaben«, in: ebd., S. 430–463.
106
| »Ich habe gedacht, dass die Arbeiter in den Städten besser leben«
grosse Hilfe stellte dabei eine Organisationsform dar, die wiederum aus der dörflichen Welt herrührte: die Landsmannschaft (zemljačestvo) oder die Genossenschaft (artel‘). Gewiss ist dies keine russische Besonderheit. Landsmannschaftliche Verbindungen finden wir auch in Mittel- und Westeuropa, nicht nur unter wandernden Handwerksgesellen. Gerade bei Wanderungsbewegungen liegt es nahe, sich in der Fremde auf Landsleute zu stützen.26 Schon unter den Bedingungen der Leibeigenschaft war es auch in Russland üblich gewesen, dass sich als Händler, Handwerker oder Arbeitsuchende umherziehende Bauern in der genossenschaftlichen Institution des artel’ zusammenfanden. So blieb es, als die Industrialisierung einsetzte. Gemeinsam verliess man das Dorf, gemeinsam suchte man einen Arbeitsplatz, gemeinsam wurde man eingestellt. Der Unternehmer zahlte den Lohn an die Gruppe insgesamt, ein gewählter Ältester (starosta) verteilte ihn dann unter den Mitgliedern. Häufig wohnte man auch zusammen.27 Wichtiger wurde mit fortschreitender Industrialisierung die informelle Form der Landsmannschaft. Boris Ivanovič Frumkin, von dem ich vorhin sprach, fand in Moskau eine sehr gute Anstellung durch Vermittlung bereits ansässiger Landsleute; das Arbeiterpaar im Film nahm einen Zuwanderer aus der alten Heimat auf. So war es vielfach: Wer sein Dorf verliess, wusste, dass er in der Stadt einen Landsmann, den zemljak, aus demselben Dorf oder wenigstens aus der näheren Umgebung antreffen würde, der ihm bei Arbeits- und Wohnungssuche sowie allen auftretenden Problemen zur Seite stehen konnte. Damit nicht genug: Man hielt untereinander auch nach Überwindung der Anfangsschwierigkeiten eng zusammen, tauschte Nachrichten aus der alten Heimat aus oder übermittelte nach dort Eindrücke aus der Stadt. Aufgrund des Umfanges und der Bedeutung, die die bäuerliche Zuwanderung für die Formierung der Industriearbeiterschaft hatte, entfaltete sich auf diesem Wege ein Informations- und Kommunikationsnetz, das seinesgleichen suchte. Aus Moskau wiederum sind wir darüber informiert, dass solche Landsmannschaften oft den organisatorischen Kern bei Streiks oder anderen sozia26 Vgl. z.B. Gisela Tschudin: Schweizer Käser im Zarenreich. Zur Mentalität und Wirtschaft ausgewanderter Bauernsöhne und Bauerntöchter, Zürich 1990; Roman Bühler: Bündner im Russischen Reich. 18. Jahrhundert – Erster Weltkrieg. Ein Beitrag zur Wanderungsgeschichte Graubündens, Disentis 1991; Hans-Ulrich Wehler: »Die Polen im Ruhrgebiet bis 1918«, in: Moderne deutsche Sozialgeschichte, hg. von Hans-Ulrich Wehler, Königstein/ Düsseldorf 1981, S. 437–455; Christoph Klessmann: Polnische Bergarbeiter im Ruhrgebiet 1870–1954. Soziale Integration und nationale Subkultur einer Minderheit in der deutschen lndustriegesellschaft, Göttingen 1978; Richard C. Murphy: Gastarbeiter im Deutschen Reich. Polen in Bottrop 1891–1933, Wuppertal 1982. 27 Bradley: Muzhik, S. 122, betont das häufige Pendeln der Bauern. Zu den genossenschaftlichen Organisationsformen findet sich Material in den zitierten Werken von Bonnell, Bradley, Johnson und Steffens.
Arbeiter bäuerlicher Herkunft
|
107
len Konflikten bildeten. Vermutlich gelang es gerade ihnen häufig, diejenigen, die sonst eher gleichgültig oder gar misstrauisch gegenüber der Stadt vor sich hinlebten, mitzureissen. Die ehemaligen Bauern waren eben nicht immer die Streikbrecher, sondern wegen der Erfahrung des Ungewohnten besonders empfindlich gegen unzumutbare Arbeitsbedingungen. Die landsmannschaftlichen Bindungen verstärkten die Solidarität. Zugleich drangen durch solche Gruppen Berichte über Streiks, über die Forderungen der Arbeiterbewegung, über die Reaktion von Unternehmern und über die Politik der Regierung ins Dorf. Sie dürften dort zur Radikalisierung der Bauern seit der Jahrhundertwende und namentlich gerade zwischen Februar- und Oktoberrevolution beigetragen haben.28 Aus Petersburg ist sogar eine enge Verbindung mit der organisierten Arbeiterbewegung überliefert. Die (Untergrund-)Tätigkeit des Rayon-Komitees der Bolschewiki im Stadtteil Vyborg wurde zwischen 1907 und 1917 weitgehend von einer Landsmannschaft geleitet.29 Die Aktivitäten zumindest eines Teils der vom Dorf stammenden Arbeiter – aus unseren Beispielen gehört Boris Ivanovič Frumkin dazu – waren demnach keineswegs nur spontanes Aufbegehren, schnell entflammt und ebenso schnell wieder erloschen, sondern durchaus zielgerichtet, bewusst und auf Dauer angelegt. Von hier kam, so scheint es mir, in vielen Fällen ein vorwärtstreibendes Element im sich verschärfenden Konflikt mit Unternehmern und Regierung, das auch die Arbeiterparteien zur Aktion drängte, ohne sich einer von ihnen – auch nicht den Bolschewiki – völlig unterzuordnen. Auf jeden Fall machte es die spezifische Stärke der russischen Arbeiterbewegung in den beiden Hauptstädten wie in anderen Industriezentren aus, dass sich ländliche und städtische Verhaltens- und Kampfformen verbanden, statt in einen schwer überbrückbaren Gegensatz zu geraten. Darüber hinaus erleichterte es diese Verbindung aufgrund der fortbestehenden Kontakte vieler Arbeiter zum Dorf, Arbeiter- und Bauernbewegung teilweise anzunähern: Erst dadurch wurde die Revolution von 1917 möglich.30 28 Hier speziell Bradley: Muzhik, S. 116–117, 194ff., 270ff., 347; Chase: Moscow, S. 82; S. A. Smith: Red Petrograd. Revolution in the Factories 1917–1918, Cambridge u. a. 1983, S. 14–23 (hier bes. S. 15), 196–197; Diane Koenker: Moscow Workers and the 1917 Revolution, Princeton, N.J. 1981, S. 48–50; Graeme J. Gill: Peasants and Government in the Russian Revolution, London/Basingstoke 1979, S. 130–131. Ein Beispiel aus der Fabrik Cindel’: V. V. Ložkin: »K metodike izučenija ›cernych knig‹ kapitalističeskich predprijatij konca XIX – nacale XX v«, in: Istočnikovedenie otečestvennoj istorii. Sbornik statej, Moskau 1980, S. 80–111, hier bes. S. 106–107. Auch: Ura A. Šuster: Peterburgskie rabočie v 1905–1907 gg, Leningrad 1976, z. B. S. 20–21. 29 I. P. Lejberov: Na šturm samoderžavija. Petrogradskij proletariat v gody pervoj mirovoj vojny i fevral‘skoj revoljucii. (Ijul’ 1914–mart 1917 g.), Moskau 1979, S. 75–76. Vgl. Bonnell: Roots, S. 427–438. 30 Ausser der zuvor zitierten Literatur als Hinweis: O. I. Moiseeva: Sovety krest‘janskich deputatov v 1917 godu, Moskau 1967, S. 79–80, 156.
108
| »Ich habe gedacht, dass die Arbeiter in den Städten besser leben«
In den zwanziger Jahren veränderte sich die Funktion der Landsmannschaften und dörflichen Genossenschaften in gewisser Hinsicht. Nach wie vor konnten sich zahlreiche Abwanderer aus dem Dorf darauf verlassen, dass ihnen in der Stadt Landsleute zur Seite stehen würden, um bei den katastrophalen Wohnverhältnissen einen Unterschlupf zu finden, einen annehmbaren Arbeitsplatz zu erhalten oder über die Zeit einer Erwerbslosigkeit hinwegzukommen.31 Eine Renaissance erlebten unter den Bedingungen der teilweise privatwirtschaftlichen Neuen Ökonomischen Politik solche Landsmannschaften, die ihre Verbindung zwischen Stadt und Land nicht nur zur Vermittlung und Integration von Arbeitskräften, sondern auch für Spekulationsgeschäfte nutzten. Der selbstgebrannte Wodka, der samogon, spielte dabei, wie erwähnt, eine wichtige Rolle. Sowjetische Behörden kritisierten immer wieder, dass Händler an der Spitze von Landsmannschaften stünden. Sie versuchten, dem dadurch entgegenzuwirken, dass sie diese in ein System von Patenschaftsbeziehungen zwischen Stadt und Land, zwischen Industriebetrieb und Dorf, eingliedern wollten. Die Patenschaften (šefstvo) sollten das materielle und kulturelle Bündnis zwischen Arbeitern und Bauern stärken, das die Bolschewiki als Basis der Sowjetmacht betrachteten. Dabei wiesen sie besonders seit dem 13. Parteitag von 1924 den Landsmannschaften die Aufgabe zu, als Quasi-Einheimische bei der Erforschung dörflicher Verhältnisse, insbesondere regionaler Besonderheiten, zu helfen, die Dorfarbeit im Rahmen der Patenschaften zu organisieren und überhaupt den Boden für ein Zusammenwachsen zwischen Stadt und Land im Sinne der Kommunisten zu bereiten. Diese Absicht schlug offenbar weitgehend fehl: In schöner Regelmässigkeit finden wir Klagen darüber, dass sich die Landsmannschaften selbständig organisierten, sich einer Anleitung durch Sowjet- und Parteiorgane verweigerten, sich dem Patenschaftssystem entzögen.32 Wie schon vor 1917 hielten sich somit viele Landsmannschaften getrennt von festen Organisationen und verfolgten ihren eigenen Kurs. Erneut war es ihr Ziel, das sie mit der Masse der vom Dorf in die Stadt Wandernden verband, ein besseres Leben, ob als Händler oder als Arbeiter, zu sichern. Die Forschungen stehen erst am Anfang, wie sich jetzt – unter den gewandelten Rahmenbedingungen – die Kontakte zwischen alteingesessenen Arbeitern und ehemaligen Dorfbewohnern vollzogen, wie diese die Eindrücke der Stadt und der kommunistischen Poli31 Chase: Moscow, S. 81 ff., 250ff., 331ff., 336ff., 342. Vgl. auch die Rolle des Landsmanns in dem bei Anm. 19 erwähnten Film »Bett und Sofa«. 32 Gert Meyer: Studien zur sozialökonomischen Entwicklung Sowjetrusslands 1921–1923. Die Beziehungen zwischen Stadt und Land zu Beginn der Neuen Ökonomischen Politik, Köln 1974, S. 472–482; N. Matorin: Kul‘turnaja smyčka s derevnej. (Opyt Leningradskich rabočich), Leningrad 1924, bes. S. 49ff., 65–67, 74ff., 89; D. S-ckij: »Vospitanie novych sloev rabočich i sezonnikov«, in: Pod znamenem kommunizma 1927, Nr. 7, S. 48–52; zahlreiche Artikel in: Voprosy šefstva 1925ff.
Arbeiter bäuerlicher Herkunft
|
109
tik verarbeiteten, was sie, und namentlich die Landsmannschaften, davon zurück ins Dorf vermittelten. Doch soviel lässt sich sagen, dass trotz aller Missbilligung einzelner Massnahmen der Regierung und der Partei bei vielen, die in die Stadt zogen, die Erwartung verbreitet war, das neue Regime werde eher als das zarische bessere Arbeits- und Lebensbedingungen schaffen. Schliesslich war das ja das Versprechen der Oktoberrevolution gewesen. Und so, wie man 1917 zum Teil die Bolschewiki zur Aktion bewegt hatte, so wollten manche auch jetzt den Politikern von unten »Dampf machen«. Dies zeigte sich besonders deutlich gegen Ende der zwanziger Jahre. In einer sich verschärfenden wirtschaftlichen und sozialen Krisensituation trat die Parteiführung um Stalin 1929 die Flucht nach vorn an und leitete eine radikale Wende in der Industrialisierungs- und Kollektivierungspolitik ein. Was als Fiasko mit verheerenden politischen und gesellschaftlichen Folgen enden sollte, wurde als Durchbruch zum Sozialismus verkündet. Noch einmal spielten die Bauern für diese Phase der Industrialisierung eine massgebliche Rolle. Die massenhafte Eingliederung von Dorfbewohnern in den industriellen Arbeitsprozess überstieg alles bisher Dagewesene. Höchst aufschlussreich ist die Bedeutung, die den bäuerlichen Organisations- und Verhaltensweisen namentlich zu Beginn dieses Umbruchs zukam. Es waren gerade die jüngeren, häufig vom Dorf neu in die Betriebe gekommenen Arbeiter, die jetzt besonders lautstark und unter Berufung auf die Ziele des Sozialismus die Zustände in den Fabriken wie im täglichen Leben heftig kritisierten und die Parteiführung zu energischerer Aktivität gegen die »kapitalistischen Elemente« in Wirtschaft und Gesellschaft, zu stärkerer Forcierung des Übergangstempos zum Sozialismus aufforderten. Diese jungen Arbeiter waren teilweise zunächst begeistert, als die Führung den neuen Kurs verkündete, der wie der ersehnte Sprung nach vorn aussah. Sie bemängelten aber auch die Art und Weise, wie dieser Kurs verwirklicht wurde. Das Lebensniveau der Bevölkerung verschlechterte sich drastisch, die Bedingungen in den Betrieben wirkten nicht eben motivierend. So beklagte sich Mitte 1929 ein junger Arbeiter namens Eliseev in einer Zeitung: „Wie arbeiten wir heute? (...) Nach meiner Meinung bedeutet sozialistischer Wettbewerb ›quetsche die letzten Tropfen aus den Arbeitern‹. ( ... ) es ist falsch zu sagen, dass ich vielleicht ein Konterrevolutionär bin, dass ich gegen die Sowjetmacht bin, und so weiter. ( ...) Aber ich kann nicht verstehen, was jetzt in unserem Land vorgeht. Ich bin erst seit einem Jahr in der Produktion. Vorher habe ich auf dem Land gelebt und gedacht, dass die Arbeiter in den Städten besser leben. ( ... )«33 33 Hiroaki Kuromiya: »The Crisis of Proletarian Identity in the Soviet Factory, 1928–1929«, in: Slavic Review 44 (1985), S. 280–297, Zitat S. 289; ders.: Politics and Social Change in Soviet Industry During the »Revolution from Above«. 1928–1931, Ph. D. Princeton Univ. 1985, Zitat S. 125–126. Vgl. Lynne Viola: The Best Sons of the Fatherland. Workers in the
110
| »Ich habe gedacht, dass die Arbeiter in den Städten besser leben«
In beträchtlichem Ausmass schlossen sich gerade »Bauern-Arbeiter« über ihre landsmannschaftlichen Organisationstraditionen in Produktionsartelen und Arbeits-Kommunen – der Zeit entsprechend so genannt – zusammen, um besonders aktiv den Aufbau des Sozialismus voranzutreiben. Mit grossem Enthusiasmus wollten sie sofort eine sozialistische Lebensweise verwirklichen – oft bei ganz verschwommenen oder gar verworrenen Vorstellungen, manchmal kritisch gegenüber der kommunistischen Politik –, ohne ein bestimmtes Wirtschaftsniveau abzuwarten.34 Zunächst gab es in der Führung durchaus Stimmen, die auf diese Initiativen positiv reagierten. Ja, man versuchte ähnlich wie bei der Patenschaftskampagne, die traditionellen Verbindungen von Arbeitern zum Dorf zu nutzen, um für die Kollektivierung zu werben. Noch im Oktober 1929 beschloss das Präsidium des Zentralrates der sowjetischen Gewerkschaften: »(...) mit Hilfe von Landsmannschaften sind Kontakte mit jenen landwirtschaftlichen Regionen zu knüpfen, mit denen Gruppen der Arbeiter des jeweiIigen Betriebes verbunden sind; (...) Es ist ein Wettbewerb zwischen einzelnen Landsmannschaften, Gruppen von Arbeitern und einzelnen Betrieben um die besten Erfolge bei der Kollektivierung der Landwirtschaft zu organisieren.«35 Doch bald setzte sich die Ansicht durch, dass die organisatorischen Selbständigkeiten zu weit gingen, ja gefährlich seien in dieser chaotischen Umbruchphase. Eine »Revolution von unten« war nicht erwünscht. Deshalb deklarierte man Kritiker der Industrialisierungspolitik aus der Arbeiterschaft – vereinzelt gab es sogar Streiks – als »fremde«, »klassenfeindliche«, »konterrevolutionäre Elemente«, wie es Eliseev befürchtet hatte. Zugleich machte man auf administrativem Wege ein Ende mit Kommunen, Produktionsartelen und Landsmannschaften, die man entweder als »kleinbürgerlich« und Relikte der »alten Ordnung« oder als egalisierende »linksradikale Abweichung« bezeichnete. Selbstorganisation und Initiative von unten waren nun kaum noch möglich. Im Hintergrund stand der Terrorapparat in Bereitschaft.36 Doch dauerhafter Widerstand war auch deshalb schwer zu organisieren, weil seine mögliche Basis – wie die Landsmannschaften – selbst zunächst zu stark auf den Umbruch gesetzt hatte. Viele glaubten, dass eine soziVanguard of Soviet Collectivization, New York/Oxford 1987, S. 68–71; Chase: Moscow, S. 365. Zum Hintergrund Donald Filtzer: Soviet Workers and Stalinist Industrialization. The Formation of Modern Soviet Production Relations, 1928–1941, London u. a. 1986; Heiko Haumann: »Sozialismus als Ziel: Probleme beim Aufbau einer neuen Gesellschaftsordnung (1918–1928/29)«, in: Handbuch, 1. Halbband, Stuttgart 1983, S. 623–780, hier bes. S. 746ff. 34 Etwa Kuromiya: Politics, S. 306, 320ff. ; vgl. Haumann: Sozialismus, S. 757. 35 Trud, Nr. 236 vom 13.10.1929. 36 Vgl. Kuromiya: Politics, S. 162ff., 171, 287ff., 298ff., 324ff., 360ff.; Chase: Moscow, S. 351.
Arbeiter bäuerlicher Herkunft
|
111
alistische Führung jetzt endlich tiefgreifende materielle Verbesserungen erzielen werde. Die Industrialisierungsoffensive versprach darüber hinaus beträchtliche soziale Aufstiegsmöglichkeiten. Und schliesslich: anders als zur Zeit vor der Oktoberrevolution standen keine organisierten politischen Gruppierungen bereit, mit denen man sich hätte verbünden können.37 Durch die Zerschlagung der traditionellen Organisationsformen errichtete die Stalinsche Politik neue Barrieren zwischen Stadt und Land. Natürlich hatte es auch vorher Unterschiede zwischen beiden Bereichen gegeben, aber die Hürden waren wesentlich leichter zu überspringen gewesen. Viele »Bauern-Arbeiter« standen im Zarenreich wie in der frühen Sowjetzeit mit »einem Fuss im Dorf und einem in der Fabrik«.38 Sie nahmen an beiden Welten teil, ohne in einer von ihnen ganz aufzugehen. Dies alles wurde nun gewaltsam abgebrochen und zerstört. Das ursprüngliche Ziel der Bolschewiki, den Gegensatz zwischen Stadt und Land aufzuheben, rückte in weite Ferne. Die vom Dorf zuwandernden Arbeiter hatten es nun schwerer, sich in der Stadt und der Industrie zurechtzufinden; die Rückkehr in die Heimat war ihnen verwehrt. Entsprechend verstärkten sich die Turbulenzen im Betrieb, mit negativen Folgen für die Planerfüllung. Häufiger Arbeitsplatzwechsel, Bummelei, Schwänzen und Krankfeiern, Arbeitsverweigerung, Pausenverlängerung und ähnliche Störungen des Produktionsablaufs wurden zu ständig beklagten Erscheinungen. Gesellschaftspolitisch wirkte sich dies zu einer allgemeinen Apathie aus. Wie in einem Teil unserer Beispiele hatten gewiss auch früher Arbeiter gerade vom Land so reagiert, die ihre Hoffnungen nicht erfüllt sahen. In den zwanziger Jahren war von aufmerksamen Beobachtern eine solche Apathie zusätzlich unter den älteren, erfahrenen Arbeitern ausgemacht worden, die sich immer weniger an Produktionskonferenzen oder Initiativen beteiligten. Jetzt galt sie massenhaft.39 Im Zusammenhang einer an Marx orientierten Analyse konnte dies nur auf die Entfremdung der Arbeiter im Produktionsprozess zurückgeführt werden, die zudem keine Aussicht auf eine 37 Hans-Henning Schröder: Arbeiterschaft; ders.: Industrialisierung und Parteibürokratie in der Sowjetunion. Ein sozialgeschichtlicher Versuch über die Anfangsphase des Stalinismus (1928–1934), Berlin (Wiesbaden) 1988 (Forschungen zur osteuropäischen Geschichte Bd. 41); Hinweise auch bei Kuromiya: Politics. Differenziert zum Agrarsektor: Stephan Merl: Sozialer Aufstieg im sowjetischen Kolchossystem der 30er Jahre? Über das Schicksal der bäuerlichen Parteimitglieder, Dorfsowjetvorsitzenden, Posteninhaber in Kolchosen, Mechanisatoren und Stachanowleute, Giessen (Berlin) 1990. 38 Johnson: Peasant and Proletarian, S. 50. Vgl. Theodore H. von Laue: »Russian Labor Between Field and Factory«, in: California Slavic Studies 3 (1964), S. 35–65. 39 Beispiele für die Probleme im Betrieb etwa in: Die Sowjetunion. Von der Oktoberrevolution bis zu Stalins Tod, Bd. 2: Wirtschaft und Gesellschaft, hg. von Helmut Altrichter und Heiko Haumann, München 1987. Zur Apathie in den zwanziger Jahren: Haumann: Sozialismus, S. 752 mit Anm. 8.
112
| »Ich habe gedacht, dass die Arbeiter in den Städten besser leben«
Veränderungsmöglichkeit mehr erblickten. Nicht Lebenswelt und Lebensweise des Einzelnen waren der Ausgangspunkt, von dem aus eine bewusste Gestaltung der Arbeitsbedingungen und eine Planung der Produktion angegangen werden konnte und wie es einem sozialistischen Verständnis von Politik entsprochen hätte, sondern Vorgaben von oben und von aussen, die den Menschen fremd blieben. Bis heute sind, wie schmerzlich erfahren wird, die Folgen jenes tiefen Einschnittes nicht überwunden. Ein Beispiel mag den Wandel veranschaulichen. Der 1916 geborene Aleksej Stachanov stammte aus einem Dorf im Gouvernement Orël, einem hauptsächlich landwirtschaftlich genutzten Gebiet auf halbem Weg zwischen Moskau und dem Schwarzen Meer. Sein Vater und sein Grossvater hatten bereits vorübergehend den Weg in die Stadt gesucht, um Geld zu verdienen, weil die Möglichkeiten im Dorf nicht ausreichten. Aleksej verdingte sich mit zwölf Jahren bei einem reichen Müller, bei dem er tagsüber Säcke schleppte und des Nachts vierzig Pferde betreute. 1927 gab er diese Plackerei auf und ging ins Kohlenrevier des DonecBeckens. Landsleute waren ihm behilflich, eine Arbeitsstelle in einer Grube und eine Wohnung zu finden. Anfangs wurde er mit Hilfsarbeiten beschäftigt – nicht zuletzt, weil er sich vor dem Schacht fürchtete. Er dachte an die Worte seines Grossvaters: »Der Schacht – das ist Zwangsarbeit, du zerstörst deine Kraft für nichts, du gehst zugrunde ...« Den Durchbruch schaffte er, als man ihn im Schacht als Pferdetreiber für den Abtransport der Kohle einsetzte. Diese Tätigkeit war ihm vertraut, er verlor seine Angst vor der Arbeit unter Tage. Bald galt er als einer der besten Bergleute in der Zeche. Wiederum war es dabei ein Landsmann gewesen, der mit ihm zunächst zusammengearbeitet hatte.40 Ganz deutlich wird hier die entscheidende Rolle landsmannschaftlicher Hilfe beim Übergang vom Dorf in die Stadt, beim Fuss-Fassen in der Industrie, bei der Eingewöhnung in das städtische Leben, bei der Überwindung ländlicher Vorstellungen über die bergmännische Arbeit. Als Aleksej Stachanov dann 1935 seinen berühmten Rekord beim Kohleabbau erzielte, mit dem er die geltende Norm bei weitem übertraf, erinnerte man sogar daran, wo ein Schlüssel zu seinem Erfolg gelegen hatte: Als besondere Prämie erhielt er neben den üblichen Zuwendungen – worauf Zeitzeugen noch 50 Jahre später hinwiesen – ein Pferd.41 Mit diesem Bindeglied zur alten Heimat hatte Stachanovs Aufstieg zum Bestarbeiter begonnen. Äusserlich kam man hier der Vorstellungswelt des ehemaligen Dorfbewohners entgegen, weil man dies trefflich nutzen konnte, um das Einvernehmen zwischen Arbeiter und stalinistischer Macht hervorzukehren. In Wirklichkeit dachte man keineswegs daran, wie früher auf Anpassungsprobleme sowie besondere Denk40 Die Sowjetunion, S. 411–416, Zitat S. 415. Vgl. A. Stachanow: Mein Lebensweg, Münster 1972. 41 Süddeutsche Zeitung, 23.9.1985.
Arbeiter bäuerlicher Herkunft
|
113
und Verhaltensweisen Rücksicht zu nehmen. Statt dessen wurde Stachanov zum Vorbild für alle Arbeiter hochstilisiert, das den Anlass für eine beispiellose Mobilisierungskampagne zur Produktionssteigerung gab. Die »Stachanov-Bewegung« überschwemmte in kurzer Zeit das ganze Land, die Fabriken und Abteilungen überschlugen sich, mehr oder weniger gezwungen, in Selbstverpflichtungen beim »sozialistischen Wettbewerb«. Landsmannschaften, Übergangshilfen, Selbstorganisationen und Initiativen hatten dabei nichts zu suchen.42 Was Eliseev 1929 gesagt hatte, dass nämlich »sozialistischer Wettbewerb« bedeute: »quetsche die letzten Tropfen aus den Arbeitern«, bewahrheitete sich jetzt in extremer Form. Strengste Disziplin und harte Strafen bedrohten jede Abweichung von den vorgegebenen Richtlinien. Von einem »besseren Leben« in der Stadt und in der Industrie konnte keine Rede mehr sein.
42 Vgl. Die Sowjetunion, S. 416–423. Umfassend: Lewis H. Siegelbaum: Stakhanovism and the Politics of Productivity in the USSR, 1935–1941, Cambridge 1988; Robert Maier: Die Stachanov-Bewegung 1935–1938. Der Stachanovismus als tragendes und verschärfendes Moment der Stalinisierung der sowjetischen Gesellschaft, Stuttgart 1990.
»Das Land des Friedens und des Heils« Rußland zur Zeit Alexanders I. als Utopie der Erweckungsbewegung am Oberrhein* Am 15. und 20. Juli 1814 berichtete Johann Heinrich Jung, genannt Stilling, seinem Schwiegersohn, dem Heidelberger Theologie- und Pädagogikprofessor Friedrich Heinrich Christian Schwarz (1766–1837) sowie dem Sekretär der Basler Christentumsgesellschaft Christian Friedrich Spittler (1782–1867), daß ihn kurz zuvor, am 10. Juli, der russische Zar Alexander I. in Bruchsal zu einem Gespräch unter vier Augen empfangen habe. »Ich habe nie mit jemand gesprochen, der in allen Punkten vom kleinsten bis zum grösten so einstimmig mit mir denkt als der Kayser Alexander, er ist ein wahrer Christ, im strengsten Sinn; ...« Und Jung-Stilling fügte hinzu: »Dann schlossen wir einen Bund zusammen, dem Herrn treu zu seyn bis in den Tod. Er küste mich, und ich ihn. Dann schieden wir von einander.«1 * Erstpublikation in: Pietismus und Neuzeit. Ein Jahrbuch zur Geschichte des neueren Protestantismus 18 (1992, erschienen 1993) 132–154. 1 Die Christentumsgesellschaft in der Zeit von der Erweckung bis zur Gegenwart. Texte aus Briefen, Protokollen und Publikationen, hg. v. Ernst Staehelin, Basel 1974 (Theologische Zeitschrift Sonderband 4), 280–283 (Zitate: 280, 282); s. auch Johann Heinrich JungStilling, Sämmtliche Werke. Neue vollständige Ausgabe, 8. Band (1841), 577–578. Vgl. zum Zusammenhang: Walter Reimer, Jung-Stilling in Karlsruhe. Eine Erinnerung an Johann Heinrich Jung, genannt Stilling 1740–1817, in: Badische Heimat 45, 1965, 93–101; Wolfgang Leiser, Jung-Stilling und Karl Friedrich von Baden, in: Alemannisches Jahrbuch 1970, 273–279; Gustav Adolf Benrath, Karl Friedrich von Baden und Johann Heinrich Jung-Stilling, in: Ekkhart. Jahrbuch für das Badner Land (Badische Heimat) 1972, 73–82; ders., Jung-Stillings Frömmigkeit, in: Jahrbuch für Westfälische Kirchengeschichte 85, 1991, 185–203, hier bes. 199–201; Gerhard Schwinge, Jung-Stilling am Hofe Karl Friedrichs in Karlsruhe: Zu seinem 170. Todestag, in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 135, 1987, 183–205; ders., Jung-Stilling und seine Beziehungen zur Basler Christentumsgesellschaft, in: Theologische Zeitschrift 44, 1988, 32–53; Max Geiger, Aufklärung und Erweckung: Beiträge zur Erforschung Johann Heinrich Jung-Stillings und der Erweckungstheologie, Zürich 1963, zum Treffen mit dem Zaren 320 ff.; auch Julius Studer, Jung Stilling in der Schweiz, in: Zürcher Taschenbuch auf das Jahr 1914 (NF 37), Zürich 1914, 113–165; Erich Mertens, Max von Schenkendorf und Johann Heinrich Jung-Stilling, in: Johannes Harder, Erich Mertens, Jung-Stilling-Studien, 2. Aufl., Siegen 1987, 27–125, hier bes. 97 ff. – Zur Basler Christentumsgesellschaft nenne ich noch: PuN [Pietismus und Neuzeit] 7, 1981, darin hier bes. Gustav Adolf Benrath, Die Basler Christentumsgesellschaft in ihrem Gegensatz gegen Aufklärung und Neologie 87–114, zur Verbindung mit Jung-Stilling 100–103, 108–109; auch: Peter Weidkuhn, Strukturlinien des baslerischen Pietismus, in: Schweizerisches Archiv für Volkskunde 62, 1966, 160–192.
Rußland zur Zeit Alexanders I.
|
115
Dieses Ereignis und die damit zusammenhängenden Entwicklungen, denen ich mich zuwenden möchte, beleuchten schlaglichtartig eine Haltung, die uns angesichts der heutigen Zustände vielleicht ungewöhnlich vorkommen mag: die Hoffnung auf Rußland als Hort der geistig-religiösen wie politischen Erlösung. Jung-Stilling, ein 1740 im Siegerland geborener berühmter Augenarzt und Professor für Kameral- und Staatswissenschaften, sah nach langen Wanderjahren seine Berufung in der religiösen Sinnsuche.2 Er wollte der Erweckung der Menschen dienen, die Schlafenden wieder wach machen für das Wesentliche, den wahren Glauben. So nahm er Verbindung mit der Basler Christentumsgesellschaft und der Herrnhuter Brüdergemeine auf, korrespondierte mit angesehenen Theologen – mit Johann Caspar Lavater (1741–1801) etwa – und ging 1803, 63jährig, als Berater des badischen Markgrafen und späteren Großherzogs Karl Friedrich an dessen Hof in Karlsruhe. Johann Peter Hebel nannte ihn einen »ächten Jünger Jesu«, aber auch einen »sonderbaren Heiligen«.3 Als Überblick zum folgenden immer noch nützlich Rudolf Kayser, Zar Alexander I. und die deutsche Erweckung, in: Theologische Studien und Kritiken 104, 1932, 160–185. Das Treffen und der Bund werden nicht erwähnt in der wenig erhellenden vordergründigerzählenden Biographie: M. K. Dziewanowski, Alexander I. Russia’s Mysterious Tsar, New York 1990; auch nicht in: Allen McConnell, Tsar Alexander I: Paternalistic Reformer, New York 1970. Das Zitat in der Überschrift bei Tatjana Högy, Jung-Stilling und Rußland. Untersuchungen über Jung-Stillings Verhältnis zu Rußland und zum «Osten« in der Regierungszeit Kaiser Alexanders I., Siegen 1984, 46, zum Treffen 15 ff. (die Studie ist die kaum veränderte Druckfassung der Marburger Dissertation Tatjana Lankos von 1954). Der Nachlaß Jung-Stillings aus der Hinterlassenschaft seines Schwiegersohnes Schwarz befindet sich in der Öffentlichen Bibliothek der Universität Basel. – Der Text ist die nur leicht veränderte Fassung meiner Basler Antrittsvorlesung am 31. Januar 1992. Ich danke Hans-Jochen Müller (Müsen) für die Anregung, mich mit dem Thema zu beschäftigen, und für tatkräftige Unterstützung, Stefan Plaggenborg für wichtige Hinweise, Peter Fäßler und Anton Seljak für Hilfen bei der Literaturbeschaffung sowie Ulrich Gäbler für Kritik und Ermutigung zur Veröffentlichung. 2 Vgl. Jung-Stillings Autobiographie, die in mehreren leicht zugänglichen Ausgaben vorliegt. 3 Die Hebel-Zitate bei Schwinge, Jung-Stilling am Hofe, 194, 198. Vgl. neben den in Anm. 1 zitierten Titeln zusammenfassend – auch zum folgenden –: Rainer Vinke, Jung-Stilling und die Aufklärung: Die polemischen Schriften Johann Heinrich Jung-Stillings gegen Friedrich Nicolai (1775/76), Wiesbaden 1987; Gerhard Merk, Jung-Stilling-Lexikon Religion, Kreuztal 1988; ders., Jung-Stilling: Ein Umriß seines Lebens, Kreuztal 1989; Otto W. Hahn, Jung-Stilling zwischen Pietismus und Aufklärung: Sein Leben und sein literarisches Werk 1778 bis 1787, Frankfurt a. M. u. a. 1988; ders., Johann Heinrich Jung-Stilling, Wuppertal/Zürich 1990; Reinhard Arhelger, JungStilling – Genese seines Selbstbildes: Untersuchungen zur Interdependenz von Religiosität, Identität und Sozialstruktur zur Zeit der »Jugend«, Frankfurt a. M. u. a. 1990; Jung-Stilling. Arzt – Kameralist – Schriftsteller zwischen Aufklärung und Erweckung: Eine Ausstellung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe in Zusammenarbeit mit der Stadt Siegen/Siegerlandmuseum und in Verbindung mit dem Generallandesarchiv Karlsruhe, hg. von der Badischen Landesbibliothek Karls-
116
| »Das Land des Friedens und des Heils«
Daß dieser angesehene Geheime Hofrat, Arzt und Wissenschaftler sowie »Patriarch der Erweckung«, wie er aufgrund seiner Schriften genannt wurde, 1814 zunächst bei der Zarin Elisabeth (1779–1826) – einer Tochter des Großherzogs –, dann beim Zaren selbst eine Audienz erhielt, als diese im Zusammenhang mit dem Feldzug gegen Napoleon nach Bruchsal kamen, verwundert nicht. Doch daß daraus ein »Bund« entsprang, bedarf der Nachforschung. Das Zusammentreffen zwischen Jung-Stilling und Alexander hatte eine Ehrendame der Zarin, die damals 28jährige Roxandra Scarlatovna von Stourdza (1786–1844) vermittelt. Sie zählte auch zu den Erweckten, kannte Jung-Stillings Schriften und drängte darauf, ihn persönlich sprechen zu können, als der Hof der Zarin im März 1814 in Bruchsal Station machte. Der religiöse Gleichklang ließ die beiden bald einen Freundschaftsbund schließen. In ihn trat Zar Alexander (1777–1825) während seiner Unterredung mit Jung-Stilling ein. Roxandra von Stourdza war, von der Zarin verständlicherweise nicht eben freundlich beobachtet, seit 1812 und vor allem seit seinem Aufenthalt in Bruchsal seine engste Vertraute geworden, die ihn in seiner Gläubigkeit und in seinem Sendungsbewußtsein stärkte.4 Für diesen Dreier-Bund ist eine weitere Persönlichkeit wichtig, nämlich die baltische Baronin Juliane von Krüdener (1764–1824), eine der ungewöhnlichsten Frauengestalten jener Zeit. Hochgebildet und vermögend, hatte sie schon früh ausgedehnte Reisen unternommen, die in der Öffentlichkeit nicht zuletzt durch ihre verschiedenen Liebesverhältnisse ebenso Aufsehen erregten wie ihr 1803 erschienener Bekenntnisroman »Va!érie«, der bereits pietistische Züge erkennen ließ. 1804 erlebte sie eine Bekehrung und fühlte sich fortan mehr und mehr zur Prophetin berufen. Daneben entfaltete sie eine intensive karitative Tätigkeit. Anfang 1808 trat sie mit ihren Kindern vorübergehend in die Karlsruher Hausgemeinschaft Jung-Stillings ein, dessen Erweckungstheologie sie teilte und der ihr seine Erlösungshoffnungen vermittelte. Die enge Verbindung zwischen beiden blieb auch nach ihrer Abreise bestehen, obwohl es durchaus Irritationen gab: ruhe, Karlsruhe 1990; Rainer Vinke, Jung-Stilling-Forschung von 1983 bis 1990, in: PuN 17, 1991, 178–228; Gerhard Schwinge, Neueres Schrifttum zu Jung-Stilling. Veröffentlichungen der Jahre 1979 bis 1991, in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 139, 1991, 514–520. Eine scharfe schweizerische Polemik gegen Jung-Stilling: Samuel Ringier, Mein Blick auf Jung- Stilling (Der Schweizerische Stillings-Bote. Erster Gang), Basel 1807. Zu Lavaters Beziehungen mit Rußland (nicht zuletzt mit den Eltern Alexanders I.) Edmund Heier, Studies on Johann Caspar Lavater (1741–1801) in Russia, Bern u. a. 1991; zu seiner Verbindung mit Jung-Stilling Gustav Adolf Benrath, Karl Friedrich, 76–77; ders., Die Freundschaft zwischen Jung-Stilling und Lavater, in: Bleibendes im Wandel der Kirchengeschichte: Kirchenhistorische Studien, hg. von Bernd Moeller und Gerhard Ruhbach, Tübingen 1973, 251–305; Schwinge, Jung-Stilling am Hofe, 190–191, 197. Zum Erweckungsbegriff vgl. die in Anm. 7 und 17 zitierten Schriften von Ulrich Gäbler. 4 Geiger, 298–324; Francis Ley, Alexandre 1er et sa Sainte-Alliance (1811–1825): Avec des documents inédits, Paris 1975, 85–105.
Rußland zur Zeit Alexanders I.
|
117
Jung-Stilling empfand sie manchmal als überspannt, war befremdet darüber, daß sie Gehorsam verlangte, weil sich Gott in ihr offenbare. Als verhängnisvoll sah er die wachsende Beherrschung Frau von Krüdeners durch zwei ebenfalls erweckte Personen an: den Pfarrer Johann Friedrich Fontaines (1769–1845), der früher einmal Anhänger des Straßburger Jakobiners Eulogius Schneider (1756–1794) gewesen war, sich zum religiösen Fanatiker gewandelt hatte und dabei nicht vor Exorzismen zurückschreckte, sowie dessen Schwägerin, die ehemalige Bäuerin und jetzige selbsternannte Prophetin Marie Gottliebin Kummer (1756–1828). Deren Gefühl der Auserwähltheit war so weit gegangen, daß sie in den neunziger Jahren einen Pfarrer verführt hatte, um einen Zeugen der Apokalypse zu gebären. Regelmäßig fiel sie in Ekstase und schaute dabei in die Zukunft. Trotz dieser von Jung-Stilling abgelehnten Beziehungen Frau von Krüdeners, die sich in einem Grenzbereich zwischen Frömmigkeit, Aufbruchstimmung, Hysterie und Scharlatanerie, aber auch sozialrevolutionärer Elemente bewegten, dauerte ihre gegenseitige Verehrung an.5 Ab 1812 weilte Juliane von Krüdener wieder länger in Karlsruhe und erneuerte ihre persönliche Verbindung mit Jung-Stilling. 1814 lernte die Baronin auch Roxandra von Stourdza kennen und befreundete sich mit ihr. Indirekt war die Baronin deshalb schon dem Bund nahe, als sie 1815 in Heilbronn mit dem Zaren zusammentraf und sozusagen assoziiert wurde. Das Treffen fand unter mystischen Zeichen statt: Frau von Krüdener ließ sich überraschend in der Morgendämmerung beim Zaren melden. Dieser weilte allein in seinem Gemach und dachte gerade in diesem Augenblick an sie. Er grübelte über ihre eingetroffene Weissagung nach, Napoleon werde von Elba zurückkehren. Sie mahnte ihn an sein bisheriges sündiges Leben, rief ihn zur Umkehr auf und ließ ihn beichten. »Als ob sie in meiner Seele gelesen hätte, richtete sie starke und tröstende Worte an mich und beschwichtigte den Sturm, der seit lange m in meinem Innern wütete.« Frau von
5 Georg v. Rauch, Juliane v. Krüdener, in: Neue Deutsche Biographie. Band 13, Berlin 1982, 95–96; Geiger, 264–282. Aus der reichhaltigen Literatur nenne ich Charles Eynard, Vie de Madame de Krüdener, 2 Bände, Paris 1849; A. N. Pypin, Re!igioznyja dviženija pri Aleksandre I. (Issledovanija i stat‘i po ėpoche Aleksandra I. Tom 1), Petrograd 1916, 295– 395; Georg Leibbrandt, Die Auswanderung aus Schwaben nach Rußland 1816–1823: Ein schwäbisches Zeit- und Charakterbild, Stuttgart 1928, 70–73, 79–81; Emest John Knapton, The Lady of the Holy Alliance: The Life of Julie of Krüdener, New York 1939; Francis Ley, Madame de Krüdener et son temps: 1764–1824, Paris 1961; Mertens, 44 ff.; Rolf Lippoth, Maria Gottliebin Kummer aus Cleebronn – eine Prophetin im Umkreis der Frau von Krüdener. in: Pietismus-Forschungen: Zu Philipp Jacob Spener und zum spiritualistisch-radikal pietistischen Umfeld, hg. v. Dietrich Blaufuß. Frankfurt a. M. u. a. 1986, 295–383.
118
| »Das Land des Friedens und des Heils«
Krüdener erinnerte Alexander an seine Mission. ernannte sich zu seiner von Gott gesandten Führerin und folgte ihm auf seinem Siegeszug nach Paris.6 Der Freundschaftsbund zwischen Jung-Stilling, Roxandra von Stourdza und dem Zaren Alexander sowie der Einfluß Juliane von Krüdeners spielten sogar eine weltpolitische Rolle, nämlich bei der Entstehung der Heiligen Allianz. Der Zar ließ sich, ohne die außenpolitischen Interessen Rußlands ganz zu vernachlässigen, von mystisch-religiösen Friedensideen und von dem Bestreben leiten, in der Politik stärker als bisher christliche Überzeugung zur Geltung zu bringen. Neben verschiedensten Überlegungen – vor allem deutscher Philosophen, namentlich Franz von Baaders – sind hier Prägungen durch Erweckungsvorstellungen unverkennbar. In der Allianz zwischen Rußland, Österreich und Preußen sah Alexander die Möglichkeit, eine Weltfriedensordnung auf christlicher Grundlage zu errichten. Seine Initiative besprach er nicht nur mit seinen Beratern – etwa mit seinem Kanzleivorsteher und Diplomaten Johannes Capo d‘lstria (1776–1831) oder dessen Sekretär Alexander von Stourdza (1791–1854), dem selbst vom Geist der Erweckung erfaßten Bruder Roxandras –, sondern auch mit dem Erwecktenkreis in Paris um Frau von Krüdener, zu dem damals Henri-Louis Empaytaz aus der Genfer Erweckungsbewegung gestoßen war. Eine Detailanalyse von Alexanders Allianz-Entwurf zeigt, daß er bei einigen Passagen bis in die Wortwahl hinein Gedankengängen der Erweckten folgte, die in manchem erstaunliche Querbezüge zu Jakobinern und Freimaurern hatten. Die Menschen als Brüder stehen im Mittelpunkt. Quellen der Freiheit sind Brüderlichkeit, Zuneigung, Gerechtigkeit und Frieden, zusammengefaßt in der gegenseitigen christlichen Liebe. Ziel der Allianz ist die einzige christliche, brüderlich geeinte Nation. Man könnte interpretieren, daß in bewußter Abkehr vom Alten mit seinen Irrwegen ein Bund für die bevorstehende Heilszeit geschaffen werden sollte, der alle Menschen umfaßte. Es scheint so, als habe Alexander davon geträumt, kleine Freundschaftsbünde könnten die Keimzelle des Menschheitsbundes bilden, und es spricht vieles dafür, daß der Dreier-Bund zwischen der Ehrendame, dem »Patriarchen der Erwe6 Zitat: Hildegard Schaeder, Autokratie und Heilige Allianz: Nach neuen Quellen, 2. Auflage, Darmstadt 1963 (Nachdruck von: Die dritte Koalition und die Heilige Allianz, Königsberg 1934), 61. Siehe Geiger, 308 ff., 371 ff.; Knapton, 138–146; Karl Stählin, Ideal und Wirklichkeit im Ietzten Jahrzehnt Alexanders I., in: Historische Zeitschrift 145, 1932, 90–105, hier 93–94 (auch zum folgenden). Vgl. die Darstellung in den konstruierten angeblichen Erinnerungen des Starec Fedor Kuźmič, in der die Ausschreibung einiger Quellen unübersehbar ist: Michael Klimenko, Notes of Alexander I., Emperor of Russia, New York u. a. 1988, 252–263. Es ist zu bedauern, daß Tolstojs Vorhaben nur ein Fragment blieb: Leo N. Tolstoj, Nachgelassene Aufzeichnungen des Greises Fjodor Kusmitsch, in: ders., Sämtliche Erzählungen, 8. Band, hg. von Gisela Drohla, Insel-Ausgabe, Frankfurt a. M. 1980, 191–216. Die Beziehungen zwischen Alexander und Juliane von Krüdener anekdotisch, zum Teil fehler- und lückenhaft bei Dziewanowski, 295–306.
Rußland zur Zeit Alexanders I.
|
119
ckung« und dem Zaren in diesem die Idee des Dreier-Bundes der Monarchen reifen ließ. Daß hier, ebenso wie bei den drei Artikeln des Vertrages, die göttliche Dreieinigkeit, verstärkt durch freimaurerische Symbolik, anklingt, kommt hinzu. Jung-Stilling jedenfalls rühmte die Allianz als Verbrüderung der vornehmsten Fürsten der drei wichtigsten christlichen Bekenntnisse: des griechischen, des katholischen und des protestantischen. Sie würden Europa von den Folgen der »falsch aufgeklärten Vernunft« befreien. Fürst Metternich (1773–1859), der österreichische Außenminister, der den Umgang des Zaren mit den Erweckten genau beobachtete, hielt dessen Verstand für getrübt und seine Überlegungen für religiöse Spintisiererei. Er strich einige aus dem Vokabular der Erweckten stammende Formulierungen, vor allem aber den von Alexander vorgesehenen brüderlichen Bund der Menschen. Übrig blieb in der am 26. September 1815 in Paris unterzeichneten Heiligen Allianz ein bloßer Bund der Monarchen. Metternich zielte auf die Befestigung der bestehenden Ordnung, und es gelang ihm, den Zaren von der Gefahr sozial-revolutionärer Bestrebungen zu überzeugen, die auch von religiösen Fanatikern und vom Mystizismus ausgehe.7 7 Geiger, 333–436; Schaeder, Autokratie, hier bes. 59 ff.; Ley, Alexandre; Dieter Groh, Rußland im Blick Europas: 300 Jahre historische Perspektiven, Frankfurt a. M. 1988, 135–147. Alexanders universale Ideen und auch die zumindest scheinbare Bevorzugung der Polen vor den Russen gerade 1815 riefen Unmut bei den von nationalen Gedankengängen beeinflußten Gardeoffizieren hervor, der zur Verschwörung der Dekabristen beitrug: Hans Lemberg, Die nationale Gedankenwelt der Dekabristen, Köln/Graz 1963, 60. Zur Haltung Metternichs auch Ernst Benz, Die abendländische Sendung der östlich-orthodoxen Kirche: Die russische Kirche und das abendländische Christentum im Zeitalter der Heiligen Allianz, in: Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Geistesund sozialwiss. Klasse, Wiesbaden 1950, H. 1–8, 559–852, hier bes. 687; ähnlich dachte der britische Außenminister Castlereagh über Alexanders Plan: Nicholas V. Riasanovsky, A Parting of Ways: Government and the Educated Public in Russia 1801–1855, Oxford 1976, 78. Zu Alexander Stourdza Högy, 6, 137 Anm. 10; Benz, Sendung, 785–807; ders., Die Ostkirche im Lichte der protestantischen Geschichtsschreibung von der Reformation bis zur Gegenwart, Freiburg/München 1952, 137–138. Henri-Louis Empaytaz hat – wie viele der hier erwähnten Personen – Erinnerungen hinterlassen: Notice sur Alexandre, Empereur de Russie, Genf 1828. Frau von Krüdener war bereits 1813 in Genf gewesen und hatte dabei einen tiefen Eindruck auf kirchenkritische Theologiestudenten gemacht. Empaytaz verband seine religiösen Vorstellungen ebenfalls mit politischen Ideen eines wahrhaft christlichen Gemeinwesens. Vgl. Ulrich Gäbler, Pietistische Erweckung um 1820 als europäisches Phänomen, in: Westfälische Forschungen 35, 1985, 1–11, hier 24; ders., »Auferstehungszeit.« Erweckungsprediger des 19. Jahrhunderts: Sechs Porträts, München 1991, 59–60, 177. Von von Krüdeners Kreis gab es auch Beziehungen zu Franz Anton Mesmer (1734–1815), dem Verfechter des »animalischen Magnetismus« und der Hypnosetherapie. Diese Querverbindungen mit ihren Hintergründen, die etwas mit veränderten
120
| »Das Land des Friedens und des Heils«
Wenn Alexander sich davon beeindrucken ließ, hing dies nicht nur damit zusammen, daß er sich den Realitäten fügte, mehr nicht durchsetzen zu können, sondern auch mit ganz persönlichen Erfahrungen: In seiner Begeisterung für den Erwecktenkreis um Juliane von Krüdener hatte er darum gebeten, daß ihm die Prophetin Marie Kummer von ihren Eingebungen berichte. Frau Kummer bekam auch tatsächlich in des Zaren Gegenwart einen ekstatischen Anfall und gab Gottes Anweisungen weiter, allerdings nicht, wie Alexander gehofft hatte, zur Stärkung des Christentums und des Weltfriedens, sondern zur Förderung einer von ihr in Württemberg gebildeten Gemeinde. Sie wollte ganz einfach Geld. So weit war Alexander jedoch nicht in mystischen Nebeln versunken, daß er diesen Schwindel nicht durchschaut hätte. Er brach mit dem Erwecktenkreis. Selbst zu Frau von Krüdener trat eine tiefe Entfremdung ein.8 Der Freundschaftsbund mit Jung-Stilling überdauerte indessen jenes Zerwürfnis. Noch 1814 hatte diesem die Zarin eine jährliche Pension gewährt, außerdem waren ihm aus der Umgebung des Zaren – so von dessen Ratgeber Fürst Alexander N. Golicyn (1773–1844), der uns noch beschäftigen wird – beträchtliche finanzielle Zuwendungen zugegangen. Sein Sohn Friedrich stand, vermittelt durch Roxandra von Stourdza, unter besonderer Protektion des Zaren. Dieser holte ihn 1816, ein Jahr vor Jung-Stillings Tod, nach Rußland. Später, nachdem er 1827 sogar in den erblichen Adelsstand erhoben worden war, diente er als Oberpostmeister zunächst in Mitau, ab 1838 dann in Riga.9 Juliane von Krüdeners weiterer Lebensweg vermag einige Aspekte zu vertiefen, die der Beachtung wert sind. Bereits in Paris lebte sie in einer brüderlichschwesterlichen, der Nächstenliebe verpflichteten Gemeinschaft, die weithin als anstößig empfunden wurde. Die Kritik an ihr verstärkte sich, nachdem sie in die Schweiz und nach Baden gereist war und dort die Gründung religiöser Gemeinschaften angeregt hatte. In Basel wie an ihren übrigen Aufenthaltsorten hielt sie Versammlungen und Andachten ab, zu denen Menschen aller sozialen Schichten kamen, manchmal an die 1000 Personen. Sie predigte von der nahen Erlösung, vom bevorstehenden Tausendjährigen Reich, und forderte deshalb zur Buße, zur inneren Einkehr und Erneuerung auf der Grundlage des reinen Christentums und im besonderen der Nächstenliebe auf. Das jeweilige Religionsbekenntnis brauche man hingegen in den zu bildenden Gemeinschaften nicht zu ändern. Aus Basel, wo sie auch bei der Christentumsgesellschaft wegen »ungeordneter Schwärmerey« und »ansteckender Auswanderungslust« auf Gegnerschaft stieß, wurde sie – nicht zuletzt auf Betreiben des ehemaligen helvetischen DirektoriEinstellungen zum Körper und mit dem Stellenwert der Hysterie in der damaligen Zeit zu tun haben, verdienen eine eigene Untersuchung. 8 Geiger, 423; Leibbrandt, 85–86. 9 Geiger, 325–327; Katalogband der Jung-Stilling-Ausstellung 1990, oben Anm. 3.
Rußland zur Zeit Alexanders I.
|
121
umsmitglieds Peter Ochs (1753–1821) – schon nach kurzer Zeit ausgewiesen. Sie ließ sich im Januar 1816 zunächst am Grenzacher Horn nieder und setzte hier ihre Tätigkeit fort. Dabei blieb sie nicht bei frommen Reden stehen. Sie half Bedürftigen, wo sie konnte, und linderte die Not, soweit es ihre finanziellen Mittel gestatteten. Namentlich im Hungerjahr 1816/17 empfanden viele dankbar ihre Wohltätigkeit. So verwunderte es nicht, daß sich gerade Arme, Hungernde, Krüppel, Bettler und Prostituierte um sie sammelten. In ihrer Schrift »An die Armen« begrüßte sie diese Anhängerschaft, weil das herannahende Heilsreich die Bruderschaft mit den Unterdrückten und Elenden zum höchsten Gebot mache. Die Reichen könnten sich nur retten, wenn sie ihren Reichtum unter den Armen verteilten und sich ganz unter Gottes Gesetz stellten. Kritik übte sie an einem Zustand, wo man »nicht den Hungrigen das Brot bricht, die Nackenden nicht kleidet, die Elenden nicht ins Haus nimmt, wo man die Wittwen und Waisen drücket, Fremdlingen die Herberge versagt, wo man euch von Ort zu Ort treibt, auch die Heimath raubt, wenn Mann und Frau nicht aus dem gleichen Lande sind, wo man euch verbiethet ehlich zu werden, wenn ihr nicht ein eignes Haus, oder eine gewissen Summe Geldes habt, kurz, wo die menschlichen Gesetze den Göttlichen entgegengesetzt sind.« Auch mit einer »Zeitung für die Armen«, von der allerdings wohl nur eine Nummer im Frühjahr 1817 erschienen ist, versuchte sie, die Unterschichten unmittelbar anzusprechen. Dies reichte, sie der revolutionären Umtriebe zu verdächtigen. Zeitgenossen warfen ihr vor, den Aufruhr »gegen die begüterten Klassen« zu predigen und die gottgewollte Ordnung, zu der die Scheidung von Arm und Reich gehöre, zu bedrohen.10 Da man zugleich leicht Vorwände fand, in ihrem Gefolge herrsche zu wenig »Zucht und Sittlichkeit«, wurde auch sie bald »von Ort zu Ort« getrieben. Im April 1817 erfolgte ihre Ausweisung vom Grenzacher Horn. Frau von Krüdener wandte sich wieder in die Schweiz – aber kein Kanton wollte sie aufnehmen. In Bern versuchte sie, über ihren Sohn, den russischen Geschäftsträger in der Schweiz, einen Aufenthalt zu erreichen. Doch auch er konnte – oder wollte – nichts ausrichten, nachdem ihm die Regierung mitgeteilt hatte, seine Mutter schare »so viel herrenloses Gesindel und Bettelvolk« um sich, daß gefährliche »Unordnungen« zu befürchten seien. So mußte sie – immer wieder von großen Volksaufläufen begleitet – weiterziehen, nach Zürich, Schaffhausen, Gailingen 10 Geiger, 396–399, Zitate 397, 398. Zur Haltung der Basler Christentumsgesellschaft Staehelin, Christentumsgesellschaft, 10, 339; Benrath, Christentumsgesellschaft, 109. In der Schweiz gründeten von Frau von Krüdener Erweckte 1828 die Société d‘utilité publique, die sehr wohltätig wirkte und u. a. 1837 die erste wissenschaftliche Arbeit über die Trunksucht herausgab: Markus Mattmüller, Der Kampf gegen den Alkoholismus in der Schweiz: Ein unbekanntes Kapitel der Sozialgeschichte im 19. Jahrhundert, Bern/Wuppertal 1979, 23. Zum Zusammenhang sind auch die Titel der folgenden Anmerkung heranzuziehen.
122
| »Das Land des Friedens und des Heils«
und Randegg – wo sie den dort lebenden zahlreichen Juden »als dem auserwählten Volke Gottes, wenn die Dinge, die da kommen würden, in Erfüllung giengen, grosse Verheissungen machte«, und diese sie deshalb umjubelten –, nach Radolfzell und Konstanz, wieder in die Schweiz, wieder nach Baden. In ihrem engeren Gefolge von 40 bis 50 Personen befanden sich ihre Tochter Juliette und ihr Schwiegersohn, Freiherr Franz Karl von Berckheim (1785–1833), ehemaliger Polizeichef von Mainz und späterer Staatsrat in Rußland, dann Empaytaz sowie ihr neuer »Haustheologe«, der vormalige Mitarbeiter Spittlers in der Basler Christentumsgesellschaft Johann Georg Kellner (?–1823), und nicht zuletzt eine damals sehr bekannte Persönlichkeit Basels: der Professor der Logik und Metaphysik Friedrich Lachenal (1772–1854), Besitzer des »Schönen Hauses« und engagiertes Mitglied der Christentumsgesellschaft. Anfang 1817 war er nicht nur als Professor, sondern auch als Rektor der Universität zurückgetreten, um sich auf andere Weise der »Humanität und Religion« zu widmen: Seine Frau und er stellten Juliane von Krüdener und der karitativen Tätigkeit der Erweckten ihr Vermögen zur Verfügung, ja sie gaben selbst Armensuppen aus und organisierten Andachten. Sie folgten dem Krüdener-Kreis »aus Anhänglichkeit und Hang zur Mystik, von welcher bekanntlich sehr viele Einwohner Basels ergriffen sind«, wie der badische Gesandte in der Schweiz, Joseph Albrecht v. Ittner, bemerkte. Im September 1817 verhaftete die badische Polizei den als »gemütskrank« bezeichneten Lachenal und führte ihn nach Basel zurück. Ende Oktober 1817 gelangte Frau von Krüdener nach Freiburg im Breisgau, wo sie ebenfalls begeistert begrüßt wurde. Dort teilten ihr die Behörden mit, sie müsse das Großherzogtum endgültig verlassen. Im November brachte sie dann eine polizeiliche Eskorte an die Grenze.11 11 Karl Obser, Frau von Krüdener in der Schweiz und im badischen Seekreis. Nach Mitteilungen des badischen Staatsrates J. A. v. lttner, in: Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung 39, 1910, 79–93, Zitate 84, 81–82, 83, vgl. 90–91; Knapton, 167–194; Ernst Staehelin, Professor Friedrich Lachenal 1772–1854, Basel 1965, bes. 39 ff., Zitate 59, 93. Zu Kellner Staehelin, Christentumsgesellschaft, 85 und zahlreiche Briefstellen. Siehe auch Willy Wuhrmann, Frau von Krüdener in Romanshorn und Arbon: Nach der »Lebenswanderung« von J. H. Mayr in Arbon mitgeteilt, in: Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung 54, 1926, 243–257; Leibbrandt, 90–96; Tagebuch des Melchior Kirchhofer aus Schaffhausen, hg. von Ingeborg Schnack, Marburg 1988, XI f. Zum Verhältnis von Erweckungsbewegung und Sozialkonflikt vgl. Josef Mooser, Religion und sozialer Protest. Erweckungsbewegung und ländliche Unterschichten im Vormärz am Beispiel von Minden-Ravensberg, in: Sozialer Protest: Studien zu traditioneller Resistenz und kollektiver Gewalt in Deutschland vom Vormärz bis zur Reichsgründung, hg. von Heinrich Volkmann und Jürgen Bergmann, Opladen 1984, 304–324; Frommes Volk und Patrioten: Erweckungsbewegung und soziale Frage im östlichen Westfalen 1800 – 1900, hg. von Josef Mooser u. a., Bielefeld 1989 (darin bes. Josef Mooser, Erweckungsbewegung und Gesellschaft, 10–14; ders.; Konventikel, Unterschichten und Pastoren: Entstehung, Träger und Leistungen der Erweckungsbewegung
Rußland zur Zeit Alexanders I.
|
123
Welche Furcht die Regierungen vor ihr und vor der Erweckungsbewegung hatten, belegt beispielhaft ein Memorandum Metternichs vom 28. Juni 1817 für den Zaren Alexander. Allgemein bedrohten mystische Gruppen und Sekten, namentlich in der Schweiz, in Baden und in Württemberg, die Ruhe und Ordnung in Europa. Man bemerke bei ihnen teilweise »auffällige Nüancen einer politischen Erkrankung«, die extremer als der Jakobinismus sei und nicht zuletzt eine gleichmacherische Agrarreform nach angeblich biblischen Grundsätzen anstrebe. »Gefährlicher als alle anderen« sei aber Frau von Krüdener, weil sie beabsichtige, »die besitzlosen Klassen gegen die Besitzenden aufzustacheln. Sie läd die Armen ein, sich an den Platz der Reichen zu setzen ...«12 Frau von Krüdener kehrte nach Rußland zurück. Doch ihre Überzeugung gab sie nicht auf. Von ihrem livländischen Gut aus unterstützte sie, etwa mit Massenspeisungen, Bedürftige, vor allem dann Bauern, die nach den dortigen Freilassungsgesetzen von 1819/20 in wirtschaftliche Not geraten waren. Sie setzte sich für die Ansiedlung von Erweckten – vornehmlich aus Südwestdeutschland – in Südrußland ein und förderte die Gründung von entsprechenden Gemeinschaften ebenso wie eine »christliche Besserungsanstalt« für Straffällige. Mit Fürst Golicyn blieb sie in gutem Kontakt, während sich Zar Alexander einer Erneuerung ihrer Beziehungen entzog. Daß eine Bindung bestehen blieb, wird sich noch zeigen.13 Erweckung, Mystizismus, heilsgeschichtliche Erwartung und zugleich sozialrevolutionäre Bestrebungen, massenhafter Zulauf, der Zar vorübergehend als Vollstrecker der Bewegung, Rußland als Ort der Erlösung – wie reimt sich das zusammen? Hier können uns Jung-Stillings Theorien und ihre Folgen weiterhelfen. Er nahm nicht zuletzt deshalb mit Frau von Krüdener freundschaftliche Beziehungen auf, weil sie aus Rußland kam. Dieser Raum hatte für ihn eine besondere Bedeutung. Betroffen durch die Auswirkungen der Französischen Revolution sah er den »letzten Kampf zwischen Licht und Finsternis« nahen. An die Stelle der Aufklärung, die in der bisherigen Form zum Bösen führe, setzte er die Erweckung. Ausdruck dieser Wende in seinem Leben war der in den neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts verfaßte »allegorische Schlüsselroman« »Heimweh«,
in Minden-Ravensberg, ca. 1820–1850, 16–52; Roland Gießelmann, Regine Krull, Posaunenchöre in der Erweckungsbewegung. Traditionsbildung zwischen musikalischer Religion und religiöser Musik, 288–338, hier bes. 324–325); auch Martin Scharfe, Subversive Frömmigkeit. Über die Distanz unterer Volksklassen zur offiziellen Religion. Beispiele aus dem württembergischen Protestantismus des 18. Jahrhunderts, in: Kultur zwischen Bürgertum und Volk, hg. von Jutta Held, Berlin 1983 (Argument-Sonderband 103), 117–135. 12 Zitiert nach Benz, Sendung, 682–683, vgl. 686–687, 689; vgl. Geiger, 399; Ley, Alexandre, 243 ff. 13 Wie Anm. 5; dazu Geiger, 423; Leibbrandt, 96, Anm. 2. Vgl. Anm. 35 und 36.
124
| »Das Land des Friedens und des Heils«
den man als »Programmschrift der Erweckung in Deutschland« bezeichnen kann und der eine beträchtliche Massenwirksamkeit erzielte.14 In diesem Roman erzählt Jung-Stilling die Reise des Christian von Ostenheim und zugleich der christlichen Kirche durch die Welt hin zur himmlischen Heimat. Geleitet vom Grauen Mann, dem Gewissen, besteht Ostenheim zahlreiche Prüfungen, bevor er in Jerusalem seine – sinnigerweise aus der Schweiz stammende – Braut Urania, die himmlische Wahrheit, heiraten und weiter in das Land der Verheißung ziehen kann. Gerufen hat der große Monarch des Ostens, dessen Herrschaft von Frankreich aus bedroht ist. In aller Welt sammelt ein geheimer Orden Kreuzritter, die diese Gefahr abwehren und sich am Erlösungsort Solyma im Osten sammeln sollen. Ihr Fürst wird Christian von Ostenheim. Gemeinsam erwarten die Erweckten in Solyma, wo sie eine landwirtschaftliche Siedlung aufbauen, die Ankunft Christi und den Beginn des wahren Gottesreiches.15 Gewiß hat Jung-Stilling diese Geschichte allegorisch gemeint und durchaus nicht als Aufforderung an alle wahren Christen, sich nun zum Zug in die Gegend von Samarkand im heutigen Uzbekistan, wo Solyma angesiedelt ist, aufzumachen. Doch abgesehen von den geographisch wirklich lokalisierbaren Reiseorten begünstigten verschiedene Entwicklungen den Schritt von der Fiktion zur Erwartung, das Heil der Welt werde nicht nur mystisch, in einem transzendenten Seelenzustand, sondern auch tatsächlich aus dem Osten und im Osten kommen. Die Französische Revolution und ihre Folgen hatten die überkommenen Normen und Werte zutiefst in Frage gestellt. Gesellschaftliche Umwälzungen traten ein oder rückten zumindest in den Bereich des Möglichen. Die zahlreichen Kriege sowie anhaltende Wirtschaftskrisen brachten Elend über viele Menschen, namentlich der unteren sozialen Schichten. Ihre Lebenswelt geriet aus den Fugen. Unter diesen Umständen verstärkten sich Stimmungen, die die Endzeit herannahen fühlten. Gerade Menschen, die in einer Glaubenstradition standen und jetzt angesichts der gesellschaftlichen Krise nach einer neuen Orientierung suchten, nahmen ein Erklärungsangebot an, das ihrem Leben Sinn verleihen konnte. Dies war keineswegs nur eine kurzfristige, rückwärtsgewandte Reaktion, sondern zielte zumindest teilweise durchaus auf neue Lebensformen. Die ›gottlosen Zustände‹ 14 Otto W. Hahn, Jung-Stillings Weg zur Erweckung, in: Jung-Stilling (Katalogband), 165– 182, Zitate 170; vgl. ders., Jung-Stilling zwischen Pietismus und Aufklärung. 15 Der Roman »Das Heimweh« ist abgedruckt in Band 4 von Jung-Stilling, Sämmtliche Schriften, hg. von Verwandten, Freunden und Verehrern des Verewigten, 14 Bände, Stuttgart 1835–1838. Vgl. Geiger, 287–290; Högy, 34 ff.; Hahn, Jung-Stilling zwischen Pietismus und Aufklärung, 144–164; Emst Benz, Ost und West in der christlichen Geschichtsauffassung (1935), in: ders., Endzeiterwartung zwischen Ost und West: Studien zur christlichen Eschatologie, Freiburg 1973, 90–117, hier 107–111; ders., Das Reich Gottes im Osten. Jung-Stilling und die deutsche Auswanderung nach Rußland (1935), in: Ebd., 118–133.
Rußland zur Zeit Alexanders I.
|
125
wie die persönliche Sündhaftigkeit verlangten nach Umkehr – nach persönlicher Buße und der Bitte um die Gnade des Herrn, aber vielleicht auch nach Umkehr der gesellschaftlichen Verhältnisse, um ›gottgefällig‹ dem Anbruch des Tausendjährigen Reiches entgegenzusehen.16 So fand die Auslegung der Apokalypse des Johannes, die schon vor Jung Stilling mehrfach den Osten und im besonderen Rußland als Ort dieses Ereignisses angenommen hatte, neuen Anklang. Das Weib, das Christus gebärt, ist »mit der Sonne bekleidet« – wie es in der Offenbarung 12,1 heißt –, leuchtet also von Osten her, flieht vor dem Drachen auf den »zwei Flügeln des großen Adlers« (12,14) – dem Symbol für Rußland – in die Wüste, der Stunde der Erlösung entgegen. Der Antichrist hingegen steigt aus dem Meer, erscheint demnach im Westen (13, 1). Bewegungen wie die Gemeinden der Erweckten reagierten höchst bewußt auf die Erschütterung des herkömmlichen Weltbildes durch die Französische Revolution. Für sie bestätigte ihre Erfahrung der Zeitereignisse die biblischen Vorhersagen. Ebenso wie sie interpretierten etwa die Freimaurer den Satz, daß das Licht aus dem Osten komme, wo auch der Siegeszug der göttlichen Wahrheit begonnen habe, sehr konkret.17 Jung-Stilling gehörte eine Zeitlang einem freimaurerischen Orden an, der Geheimorden im »Heimweh«-Roman bezieht sich eindeutig auf die Freimaurerei. Er hatte auch einmal daran gedacht, eine christliche Geheimgesellschaft nach dem Muster der Illuminaten, wenn auch mit entgegengesetzter Stoßrichtung, zu gründen. Bei ihm wie bei den Freimaurern insgesamt gewannen damals die mystisch-religiösen Gedankengänge des Theosophen Louis Claude de Saint-Martin (1743–1803) an Einfluß, die christliche Erlösungshoffnungen mit revolutionären Befreiungsvorstellungen verbanden. Ebenso wirkten jüdisch-messianische Strömungen. Und schließlich, so paradox es scheinen mag: Obwohl die Französische Revolution als ein Werk des Antichristen galt, flossen deren Ideen und Werte – wie Gleichheit, Brüderlichkeit, Emanzipation – in die Suche nach dem wahren Christentum und in die Forderungen an die Lebensweise ein, wie man sich auch
16 Vgl. die Arbeiten von Mooser, Anm. 11; Hartmut Lehmann, Pietismus und weltliche Ordnung in Württemberg vom 17. bis zum 20. Jahrhundert, Stuttgart 1969. 17 Högy, 34 ff.; Geiger, 290–297; Benz, Ost und West, 111–117; Ulrich Gäbler, Erweckung im europäischen und amerikanischen Protestantismus, in: PuN 15, 1989, 24–39, hier bes. 26–29, zur Verbindung von Erweckungsbewegung und Freimaurerei 38 (dazu auch exemplarisch Hugh R. Boudin, Erweckung und Freimaurerei im Lichte der Lage in Genf, in: Erweckung am Beginn des 19. Jahrhunderts, hg. von Ulrich Gäbler und Peter Schram, Amsterdam 1986, 73–86). Zur Bedeutung der Zeitereignisse für die Interpretation des heilsgeschichtlichen Weges bei den Erweckten etwa Gäbler, »Auferstehungszeit«, 161 ff., 169–174; vgl. Anm. 11 und 16.
126
| »Das Land des Friedens und des Heils«
schon vor dem Kommen des Erlösers zu verhalten habe.18 Wie ernst dies von den Regierungen genommen wurde, zeigte deren Reaktion auf die Reise Frau von Krüdeners. Der württembergische Pietist Johann Albrecht Bengel (1687–1752), auf dem Jung-Stilling in vielem fußte, hatte 1740 den Zeitpunkt des Beginns der Tausend Jahre (Offenbarung 20,1) auf 1836 berechnet. Jung-Stilling korrigierte diese Rechnung auf 1816 oder 1819. Man brauchte also nicht mehr lange zu warten. Ohnehin mehrten sich die Anzeichen, daß die allegorischen Ahnungen im »Heimweh«-Roman sich bewahrheitende Prophezeiungen gewesen waren. Gewisse, im Roman geschilderte Vorgänge in Rußland ereigneten sich tatsächlich. Besonders wichtig war, daß schottische Missionare, die auch mit Jung-Stilling in Kontakt standen, mit Erlaubnis des Zaren am Nordrande des Kaspischen Meeres eine Kolonie errichten durften, um die dort lebenden Tataren zu bekehren und zugleich Land für das Leben während der Wartezeit auf die Erlösung zu erschließen. Jung-Stilling schrieb 1809: »Sie sehen also, daß auch dem Sonnenweib in der Wüste ihr Ort zubereitet wird; der russische Adler wird ihr also die Flügel leihen, mit denen sie dorthin fliegt.« Die religiöse Entwicklung Alexanders schien dem Bild eines christlichen Herrschers zu entsprechen. Immer mehr sah Jung-Stilling seine allegorische Welt als Abbild der wirklichen Welt. 1810 bekannte er: »Was ich also ehmals im ›Heimweh‹ gedichtet habe, das macht der Herr zur Wahrheit; Hallelujah!« Mit den Befreiungskriegen, in denen sich vor allem Frankreich und Rußland, Napoleon und Alexander, gegenüberstanden, erreichte diese Sichtweise ihren Höhepunkt. Zar Alexander erschien als der Vollstrecker des göttlichen Willens gegen das Werkzeug des Antichristen, als Auserwählter Gottes, als Autokrator, der »König der Könige«, der die Völker »mit Gerechtigkeit« und »mit eisernem Stabe« regiere, wie man die Offenbarung 19, 11, 15 und 16 auslegte: Rußland erstand nun faßbar als Schutzmacht der wahren Gläubigen in Solyma, als »das Land des Friedens und des Heils«. Jung-Stilling bat den Zaren in ihrem Gespräch 1814 »um einen Bergungsplatz in seinen Staaten, wenn die Versuchungsstunde kommen
18 Högy, 58 ff.; Geiger 394–396; Leiser, 279; Mertens, 70–72; Benz, Ostkirche, 137–143. Zu den Einflüssen des jüdischen Messianismus vgl. Heiko Haumann, »Das Erhabenste der Menschlichkeit.« Adam Mickiewicz und der jüdisch-polnische Messianismus, in: Fenster zur Geschichte. 20 Quellen – 20 Interpretationen: Festschrift für Markus Mattmüller, hg. von Bernard Degen u. a., Basel/Frankfurt a. M. 1992, 247–259. Hier gab es im übrigen auch eine weit verbreitete Auffassung, die Polen oder Rußland als das Land ansah, wo die Erlösung stattfinden werde: vgl. ders., Geschichte der Ostjuden, 3. Aufl., München 1991, 17 u. ö.,; Abraham G. Duker, Polish Frankism’s Duration: From Cabbalistic Judaism to Roman Catholicism and from Jewishness to Polishness, in: Jewish Social Studies 25, 1963, 287–333, hier 306 mit Anm. 108.
Rußland zur Zeit Alexanders I.
|
127
würde«.19 Die Utopie des Erlösungsortes Rußland – gewiß kein wirkliches Land, dazu gingen die Vorstellungen viel zu sehr an der Realität vorbei – schien eine gesellschaftliche Möglichkeit zu bieten, schien konkret zu werden. Viele hofften, daß das – in der Blochschen Terminologie – Noch-Nicht-Gewordene in Rußland gut werden könne.20 Obwohl Jung-Stilling mehrfach vor einem verfrühten und überstürzten Zug in das Land des Jüngsten Gerichts warnte und seine Andeutungen etwa bei der Basler Christentumsgesellschaft auf heftigen Widerspruch stießen21, mußten seine Lehren gerade innerhalb chiliastischer Strömungen, die an das anbrechende Tausendjährige Reich glaubten, auf fruchtbaren Boden fallen und als Aufruf zur Auswanderung verstanden werden. Frau von Krüdeners Werbezug durch die Schweiz und durch Süddeutschland gab einen weiteren Anstoß. Sie rief zur Bildung von Erweckungsgemeinschaften auf und pries Rußland als Zufluchtsstätte an. Die Hungersnot von 1816/17 und die Verfolgungen seitens der Behörden interpretierte sie als Beweis für die Zustände, die der Zeitenwende vorausgingen. Die Hoffnung auf Rußland als »Bergungsplatz« traf sich mit dem Wunsch der russischen Regierung, mehr ausländische Kolonisten anzusiedeln, namentlich in den vor kurzem eroberten Gebieten am Rande des Schwarzen Meeres, in der Gegend von Odessa und in Taurien. Zar Alexander förderte das Projekt der Erweckten besonders. Sein Beauftragter für die Auswanderung wurde vorübergehend
19 Högy, 42–56 (Zitat 1809: 55), 145, Anm. 157; Staehelin, Christentumsgesellschaft, 281 (Zitat 1814); Studer, 134 ff. (Zitat 1810: 163); Geiger, 293–294; Leibbrandt, 56–63. Zu Bengel, seinem Umfeld und Jung-Stilling hier nur Ernst Benz, Verheißung und Erfüllung. Über die theologischen Grundlagen des deutschen Geschichtsbewußtseins (1935), in: ders., Endzeiterwartung, 38–89, hier 66–85; Zur neueren Pietismusforschung, hg. von Martin Greschat, Darmstadt 1977, bes. 397–433. Bengel stand auch mit dem bedeutenden russischen Kirchenpolitiker Feofan Prokopovič (1681–1736) in brieflicher Verbindung: D. Čyževśkyj, Fritz Lieb, Die deutsche Mystik bei den Ostslaven, in: Zeitschrift für slavische Philologie 9, 1932, 399–403, hier 400–401. Auch die Basler Mission beschäftigte sich später mit der Bekehrung der »Tataren«, vgl. die in Anm. 34 zitierten Aufsätze von Joseph Ehret. 20 Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, Kapitel 1–32 (Werkausgabe Band 5), Frankfurt a. M. 1959, hier bes. 166. Bloch zitiert auch aus Hölderlins Gedicht »Am Quell der Donau«, in dem sich das hier Geschilderte spiegelt: »... Nun aber erwacht ist, nun, aufsteigend ihr, / Der Sonne des Fests antwortet / Der Chor der Gemeinde, so kam / Das Wort aus Osten zu uns, / Und an Parnasses Felsen und am Kithäron hör ich / O Asia, das Echo von dir, und es bricht sich / Am Kapitol, und jählings herab von den Alpen / Kommt, eine Fremdlingin, sie / Zu uns, die Erweckerin, / Die menschenbildende Stimme« (136–137, vgl. Hölderlin, ausgewählt von Peter Härtling, Köln 1984, 477–479). 21 Geiger, 294; Högy, 51–54; Benz, Ost und West, 111–117; ders., Reich Gottes, 130–131; Staehelin, Christentumsgesellschaft, 215 ff.; Benrath, Christentumsgesellschaft, 102–103.
128
| »Das Land des Friedens und des Heils«
Frau von Krüdeners Schwiegersohn von Berckheim – ein Zeichen für die trotz der Entfremdung fortbestehende Bindung. Die bedeutendste Auswanderergruppe leitete der schwäbische Erweckte Johann Jakob Koch, der mit Frau von Krüdener befreundet war. Eines der von Koch verbreiteten Gedichte lautete: »Von Osten scheint die Sonne. Da ist der Zufluchtsort (s). Dort erwarten uns Freude und Wonne, daher eilt der Christ (nach dort).« Ende 1816 trafen dann die ersten von Koch geworbenen Auswanderer in der Nähe Odessas ein, 1817 folgten ihnen zahlreiche weitere, darunter Koch selbst. Den Schwaben hatten sich dabei Badener und Schweizer angeschlossen, geleitet von religiösen und ökonomischen Motiven. Ihr Rußlandbild war meist verschwommen und unrealistisch. Neben dem Glauben an die baldige Erlösung spielten Berichte über den angeblich in Rußland herrschenden Überfluß und den dort anzutreffenden Reichtum an fruchtbarem Land eine Rolle, die durch Zar Alexanders Hilfsgelder zur Linderung der Hungersnot in der Schweiz unterstrichen wurden. Manche Auswanderer kehrten unterwegs wieder um, weil sie über zu wenig Geld verfügten, sich von Betrügern hatten verführen lassen oder von Krankheiten befallen wurden. Insgesamt langten rund 10 000 Kolonisten in Rußland an – nicht nur Erweckte, aber meist von diesen geleitet – und gründeten bei Odessa zahlreiche Siedlungen: Hoffnungsthal etwa, Alexandersdorf, Petersdorf, Kolonie der zwölf Apostel, Kornthal. Über die Hälfte der Auswanderer waren Handwerker, daneben gab es viele Bauern, Winzer, Taglöhner und Hirten. Die Gemeinschaften organisierten sich vielfach in »Harmonien« auf christlichkommunistischer Grundlage. Anfang 1818 erreichte Koch zusammen mit einem weiteren Delegierten in einer Audienz beim Zaren, daß dieser trotz Bedenken, hier den Schutz garantieren zu können, zusätzliche Kolonien im Kaukasus, in Georgien, zuließ. Viele der Ausgewanderten starben, am ungewohnten Klima, an den rauhen Verhältnissen und an schwierigen materiellen Umständen. Dennoch folgten ihnen noch bis in die zwanziger Jahre hinein weitere Wellen, wobei die des katholischen Erweckten Ignaz Lindl (1774–1845), der wiederum von JungStilling sowie Frau von Krüdener beeinflußt war und zu Basel in engen Beziehungen stand, besonderes Aufsehen erregte. Die russische Regierung erleichterte den Kolonisten manche Widrigkeit. Diejenigen, die überlebten und nicht aufgaben, konnten im Laufe der Zeit kräftige und verhältnismäßig wohlhabende Gemeinden bilden.22 Der Messias kam allerdings nicht, sie mußten sich auf eine längere Wartezeit einrichten. 22 Heinz H. Becker, Die Auswanderung aus Württemberg nach Südrußland 1816–1830, Diss. Tübingen 1962, hier bes. 97 ff.; Lehmann, Pietismus, 175 ff.; Leibbrandt, 70–72, 75–76, 88–200 (Gedicht 97); Roman Bühler u. a., Schweizer im Zarenreich: Zur Geschichte der Auswanderung nach Rußland, Zürich 1985, 60–63, 114–122; Johannes Harder, JungStilling, Rußland und die endzeitliehen Erwartungen bei rußlanddeutschen Kolonisten im 19. Jahrhundert, in: ders., Mertens, Jung-Stilling Studien, 9–25; Benz, Reich Gottes,
Rußland zur Zeit Alexanders I.
|
129
Das galt im übrigen für Rußland selbst, wo ebenfalls Erlösungshoffnungen weit verbreitet waren. Auch diese Seite der Utopie verdient Aufmerksamkeit. Im Land gärte es. Seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts hatte die verfestigte Leibeigenschaft eines Großteils der Bauern zusehends die Krone mit dem gutsbesitzenden Adel verbunden, der staatliche Aufgaben auf dem Land wahrnehmen sollte. Wer jetzt an einen dieser Bereiche rührte – an die Stellung des Adels, an die Staatsverwaltung, an die Leibeigenschaft –, zog alle anderen in Mitleidenschaft. Dies mußte jede Reform erheblich erschweren. Die Bauern gaben jedoch die Hoffnung nicht auf, daß der Zar ihnen die Freiheit und den Boden, der ihnen nach ihrer Rechtsüberzeugung gehörte, zurückgeben werde. Gerade mit Alexanders Thronbesteigung 1801 wuchsen die Erwartungen. Immer wieder kam es zu Unruhen gegen Adlige, von denen man annahm, daß sie dem Volk den Willen des Zaren vorenthielten. Zugleich richteten sich die Blicke der Reformkräfte in den höheren Schichten, die das erstarrte System kritisierten und über Möglichkeiten alternativer Entwicklungen nachdachten, auf Alexander. Dieser war von dem Waadtländer Frédéric César de La Harpe (1754–1838) in liberalem Geiste erzogen worden. In einem Brief vom 27. September 1797 hatte er ihm sogar versprochen, alles zu tun, daß Rußland ein »freies Land« mit einer »freien Verfassung« werde.23 130–133; ders., Sendung, 603–610; Hans Petri, Schwäbische Chiliasten in Südrußland, in: Kirche im Osten 5, 1962, 75–97 (zu Basel 85–88); Staehelin, Lachenal, 79 ff. Nach Hermann Baier, Die Auswanderung nach Rußland und Polen, in: Mein Heimatland 24, 1937, 65–73, hier 70 mit Anm. 3, sei die Auswanderung aus Baden behindert, ja zeitweise völlig gesperrt gewesen, so daß die Werbungen Kochs hier keinen Erfolg gehabt hätten. Zu Lindl und der Basler Christentumsgesellschaft Staehelin, Christentumsgesellschaft, 8, 97–98, 283–284 (weitere Stellen s. Register); siehe auch Hans Petri, Ignaz Lindl und die deutsche Bauernkolonie Sarata in Bessarabien, in: Südostdeutsches Archiv 8, 1965, 78–112. Aus der reichhaltigen allgemeinen Literatur vgl. Karl Stumpp, Die Auswanderung aus Deutschland nach Rußland in den Jahren 1763 bis 1862, Tübingen o. J. (1972); Detlef Brandes, Die Ansiedlung von Ausländern im Zarenreich unter Katharina ll., Paul l. und Alexander l., in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 34, 1986, 161–187; ders., Die Deutschen in Rußland und der Sowjetunion, in: Deutsche im Ausland – Fremde in Deutschland: Migration in Geschichte und Gegenwart, hg. von Klaus J. Bade, München 1992, 85–134; Die Deutschen in der UdSSR in Geschichte und Gegenwart, hg. von Ingeborg Fleischhauer und Hugo H. Jedig, Baden-Baden 1990; auch Hans-Christian Diedrich, Siedler, Sektierer und Stundisten: Die Entstehung des russischen Freikirchentums, Berlin 1985, hier bes. 25–30; Rex Rexhäuser, Der Fremde im Dorf: Versuch über ein Motiv der neueren russischen Geschichte (17.–19. Jahrhundert), in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 25, 1977, 494–512. 23 Bühler u. a., 278–280, 285–286, 410, Anm. 36 (Brief von 1797); vgl. Arthur Boehtlingk, Der Waadtländer Friedrich Caesar Laharpe: Der Erzieher und Berater Alexanders I. von Rußland, des Siegers über Napoleon I., und Anbahner der modernen Schweiz, 2 Bände, Bern/Leipzig 1925; A. N. Pypin, Die Geistigen Bewegungen in Rußland in der ersten
130
| »Das Land des Friedens und des Heils«
Und tatsächlich holte der Zar seinen Erzieher, der soeben im Direktorium der revolutionären Helvetischen Republik gewirkt hatte, zurück an seinen Hof. Ein weiterer Berater wurde Alexander Radiščev (1749–1802), der mit seinem 1790 publizierten Buch »Reise von Petersburg nach Moskau« die erniedrigenden Zustände der Gesellschaft schonungslos offengelegt hatte. In ihm drohte er dem Zaren – nicht zuletzt unter Berufung auf Wilhelm Tell, weshalb er in die Wirkungsgeschichte Schweizer Mythen miteinbezogen werden sollte – einen Volksaufstand und das Schaffott an, wenn sich die Verhältnisse nicht änderten. Dafür war er seinerzeit von Katharina II. (1729–1796) zum Tode verurteilt, dann zur Verbannung begnadigt worden.24 Die radikalen Vorschläge der beiden – wie auch anderer – Reformer stießen jedoch auf heftigen Widerstand konservativer Gegner. Zar Alexander griff nicht eindeutig zu ihren Gunsten ein. Resigniert verließ La Harpe im Mai 1802 wieder Rußland25, Radiščev wählte im September des gleichen Jahres enttäuscht den Freitod.26 Ein Teil der Reformer gab allerdings nicht auf. Nach ihrer Überzeugung hing alles vom Einfluß auf den Selbstherrscher ab. Nur wenn der Autokrator mit seiner Autorität und seiner Macht die Umgestaltung Rußlands einleite, habe sie eine Chance. Beeinflußt waren sie dabei von Vorstellungen, die sie in ihren Freimaurerlogen – ihrer wichtigsten Organisationsform – kennengelernt und erörtert hatten. Schon am Ende des 18. Jahrhunderts hatten sich hier westliches Gedankengut mit altrussischer Frömmigkeit, Sozialkritik mit Moralvorstellungen verbunden. Man wollte sich persönlich vervollkommnen, nach Weisheit streben und dem Vaterland dienen, den reinen Rationalismus der Aufklärer durch Gefühl und Phantasie ergänzen.27
24
25 26 27
Hälfte des XIX. Jahrhunderts, 1. Band, Die russische Gesellschaft unter Alexander I., Berlin 1894, 25 ff.; in russischer Sprache: Obščestvennoe dviženie v Rossii pri Aleksandre I. (lssledovanija i stat‘i po ėpoche Aleksandra I. Tom 3), 5. Ausgabe, Petrograd 1918. A. N. Radistschew, Reise von Petersburg nach Moskau, Berlin 1952, Zitate 247, 245, Tell: 241. Zum »Mythos Schweiz« im damaligen Rußland Bühler u. a., 276–278. Zu Radiščev hier nur: Andrzej Walicki, A History of Russian Thought from the Enlightenment to Marxism, Stanford/Cal. 1979, 35–52. Siehe auch Anm. 27 und 28. Boethlingk, Bd. 2, 25–44. Radistschew, 20 (Vorwort von Anneliese Bauch); Walicki, 38–39, 50. A. N. Pypin, Russkoe masonstvo XVIII i pervaja četvert‹ XIX v., red. G. V. Vernadskogo, Petrograd 1916; ders., Geistige Bewegungen, passim; G. Vernadskij, Beiträge zur Geschichte der Freimaurerei und des Mystizismus in Rußland, in: Zeitschrift für slavische Philologie 4, 1927, 162–178; Ho L. Ryu, Moscow Freemasons and the Rosicrucian Order: A Study in Organization and Control, in: The Eighteenth Century in Russia, ed. by J. C. Garrard, Oxford 1973, 198–232; Walicki, 1–34. Zum Einfluß Lavaters (vgl. Anm. 3) auf die russischen Freimaurer Pypin, Masonstvo, 39, 42, 183, 211, 283, 292, 295, 297, 306; Heier, 6 ff., speziell zu Radiščev und Karamzin 37–72; vgl. Radistschew, 102, 112. Einen Niederschlag finden diese geistigen Strömungen auch in Leo N. Tolstoi, Krieg und Frie-
Rußland zur Zeit Alexanders I.
|
131
Von hier aus war kein weiter Schritt zur Welt der Erweckten. Insofern verwundert es nicht, daß ab 1805 die Schriften Jung-Stillings in Rußland übersetzt, weit verbreitet und sogar dem Zaren selbst bekannt waren. Ebenso stieß die Begründung des Gottesgnadentums, wie sie Saint-Martin geliefert hatte, auf große Resonanz: Wer als Herrscher die Kraft zu besonderer Tugend, Weisheit und Gerechtigkeit besitze, über dem leuchte Gottes Gnade, und er sei auserwählt, die Menschen im Zeitalter ihres Sündenfalls zu leiten, bis der Urzustand wiederhergestellt sei, in dem es keine Herrschaft von Menschen über Menschen gebe. Namentlich Oberhofmeister Rodion A. Košelev (1749–1827) brachte diese Theorie auch dem Zaren nahe. Angesichts des von ihm tief empfundenen Widerspruchs zwischen seinen Ideen und seinem ›sündigen‹ Lebenswandel – »ich, ... der gemeine Lüstling und Bösewicht, ... hielt mich für den Retter Europas, den Wohltäter der Menschheit«, läßt Leo Tolstoi ihn von sich selbst sagen – war er von dieser Mischung aus göttlicher Erwähltheit, moralischer Rigorosität und sozialem Reformgeist sehr beeindruckt. Sie entsprach seinem Denken und Fühlen noch besser als die Theorie vom rechtgläubigen Rußland als dem »Dritten Rom«: Nach dem Scheitern von Rom und Byzanz, das wahre Christentum zu verwirklichen, sei dazu Rußland berufen und der Zar Gottes Werkzeug auf diesem Weg. Völlig unbeeinflußt dürfte Alexander aber auch von dieser für die Herausbildung der zarischen Selbstherrschaft so wichtigen Auffassung nicht geblieben sein, zumal in ihr schon Rußland als der Ruheort des Sonnenweibes aus der Offenbarung des Johannes gedeutet worden war und der Heilige Synod – das Leitungsorgan der orthodoxen Kirche – 1806 diese Theorie den Ansprüchen des »falschen Messias« Napoleon entgegengestellt hatte.28 Der Zar erwies sich jedenfalls als empfänglich für die Fixierung auf seine Person. Zunächst gelang es den Reformkräften, den Selbstherrscher stark zu machen für Maßnahmen, die eine Erneuerung der Gesellschaft einleiten sollten. Diese deuteten darauf hin, daß am Ende eines längeren Weges eine konstitutionelle Monarchie mit Rechtsstaatlichkeit, Sicherung der Menschenrechte und Bauernbefreiung stehen werde. Insbesondere die Projekte des als Sohn eines Popen zum den. Roman, ins Deutsche übersetzt von Wemer Bergengruen, Buchgemeinschaftsausgabe, Gütersloh o. J., z. B. 11, 27 ff., 1125. 28 Zitat: Tolstoj, Aufzeichnungen, 194. Vgl. Geiger, 413–416; Ley, Alexandre, 87; Schaeder, Autokratie, 49 ff.; dies., Moskau das Dritte Rom: Studien zur Geschichte der politischen Theorie in der slawischen Welt, Bad Homburg v. d. H. 1963 (Nachdruck der 2. Aufl., Darmstadt 1957), zur Verwendung der Offenbarung des Johannes 76–77, 204–205, 212– 213. Materialien zur Nachwirkung der Theorie vom »Dritten Rom« auf apokalyptisch-eschatologische Strömungen in Rußland bei Emanuel Sarkisyanz, Rußland und der Messianismus des Orients. Sendungsbewußtsein und politischer Chiliasmus des Ostens, Tübingen 1955, z. B. 95, 145 ff., 169 ff., 186 ff., 195–196. Auch Walicki, 52–77; Čyževśkyj/Lieb; sowie die verschiedenen Schriften Pypins (Anm. 5, 23 und 27).
132
| »Das Land des Friedens und des Heils«
Sekretär des Zaren aufgestiegenen Michail M. Speranskij (1772–1839), der religiös-mystischem Denken nicht fern stand und auch die Schriften Jung-Stillings gelesen hatte, wiesen weit in die Zukunft. Seine konservativen Gegner konnten jedoch schließlich den Zaren davon überzeugen, daß eine Verwirklichung der Pläne den Kern der russischen Staatsverfassung – eben die wechselseitige Abhängigkeit von Krone, Adel, Bürokratie und Leibeigenschaft – in Frage stelle und deshalb revolutionäre Unruhen drohten. Im Frühjahr 1812 wurde Speranskij gestürzt und verbannt.29 Doch damit hatten die Konservativen keineswegs endgültig gesiegt. Über die künftigen Grundsätze der Politik war noch nicht abschließend entschieden, zumal sich der schwankende Autokrator immer wieder alle Möglichkeiten offenhielt und es den verschiedenen gesellschaftlichen Kräften recht machen wollte. Den liberalen Ansätzen standen die Militärkolonien und Leibeigenschaftsgüter gegenüber, die nach den Regeln Aleksej A. Arakčeevs (1769–1834) – des Zaren ergebener Kriegsminister – auf brutaler Zucht und rücksichtsloser Unterordnung aufbauten. Die Gesellschaft verharrte in einem eigenartigen Schwebezustand. Die Strömung, die religiösen Mystizismus mit Humanismus und politischem Liberalismus verband, blieb stark. Unterschwellig steigerte sich die Spannung. Durch die Auseinandersetzung mit dem napoleonischen Frankreich wurde sie auf die Spitze getrieben. Im Volk verbreitete sich die Stimmung, das Tausendjährige Reich sei nahe, Rußland spiele im Plan Gottes eine besondere Rolle. Es scheint so, als habe der Geist der Erweckung den Nerv der russischen Gesellschaft getroffen. Orientalische Kulte und mystisch-geheime Praktiken griffen um sich. Eine katholische Erwecktengruppe fand Anklang. Aufsehen erregten die Prophezeiungen der gebürtigen Deutschbaltin Ekaterina Tatarinova (1783–1856), die sie in mystischer Ekstase und während fiebriger, rauschhafter Kultfeiern von sich gab. Die von der russisch-orthodoxen Kirche abgespaltenen Altgläubigen verstärkten ihre Aktivitäten. Mitglieder einer Sekte der Geißler (chlysty) kasteiten sich, weil sie die Endzeit nahe fühlten. Die skopcy, Angehörige einer weiteren Sekte, kastrierten sich gar, um sündenfrei das Paradies zu erwarten. Ihr Führer Selivanov scharte täglich 300 bis 400 Frauen und Männer aus allen Schichten um sich. Seine Anhänger hielten ihn für Zar Peter III., den Gatten Katharinas II., der seinen Mördern entkommen sei und ihnen die Erlösung bringen werde. Alexander habe ihm die Zarenkrone angeboten, er jedoch das Armenhaus vorgezogen.30 29 Marc Raeff, Michael Speransky: Statesman of lmperial Russia, 1772–1839, 2. Aufl., The Hague 1969; Pypin, Geistige Bewegungen, 162 ff.; zu Speranskij und den Freimaurern ders., Masonstvo, 359–360, 388, 390, 459, 472, 524, 525. Vgl. Riasanovsky, 54–78; McConnell, 68–79. 30 Peter K. Christoff, The Third Heart: Some lntellectual-Ideological Currents and Cross Currents in Russia 1800–1830, The Hague 1970, 74–75, 77; Stählin, 100–101; Sarki-
Rußland zur Zeit Alexanders I.
|
133
Die Spannung, die von dem gesellschaftlichen Schwebezustand und der gleichzeitigen Aufbruchstimmung ausging, verfehlte nicht ihre Wirkung auf den Zaren. Der Einfall der Grande Armée Napoleons in Rußland und namentlich der Brand von Moskau im September 1812 führten dann zu einem Schlüsselerlebnis. »Der Brand von Moskau hat meine Seele erleuchtet . . . Seit dieser Zeit bin ich ein anderer geworden; der Erlösung Europas vom Verderben verdanke ich meine Erlösung und Freimachung«, äußerte er später einmal. Und in Anspielung auf den Leidensweg Christi, der damit die Welt erlöste, bekannte er 1814: »Der Allmächtige, der Lenker der Geschichte, hat sie (die Stadt Moskau) auserwählt, um durch ihr Leiden nicht nur Rußland, sondern auch ganz Europa zu retten. Ihr Feuer war eine Freiheitsfackel für alle irdischen Reiche.« In dieser messianischen Deutung der Ereignisse war er von Roxandra von Stourdza bestärkt worden, so wie ihm sein Jugendfreund und enger Berater Golicyn empfohlen hatte, die Bibel zu lesen, als dieser die seelische Erschütterung des Zaren bemerkte. Alexander fühlte sich erweckt, den Weg des wahren Christen zu gehen. Seine bisherigen Auffassungen, die Lehren La Harpes reichten angesichts der Größe der Herausforderung und der Aufgaben nicht mehr aus, das Vertrauen auf Gott schien eine neue Richtung zu weisen. Die messianischen Erwartungen im Volk fanden ihre Entsprechung im Zaren. Er fühlte sich als Vollstrecker eines spezifisch russischen Messianismus, der für einen kurzen historischen Augenblick auch auf die konkrete Befreiung der Menschheit abzielte. In Paris soll er öffentlich verkündet haben, daß er die Leibeigenschaft in Rußland aufheben werde.31 Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum Alexander 1814 mit JungStilling einen Freundschaftsbund schloß, warum er die Nähe Frau von Krüdeners syanz, 81–82, 123; Joseph Ehret, Der Rückzug der Basler Mission aus Rußland, in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 53, 1954, 159–204, hier 190–195. Die Sekten gewannen durchaus Anhänger unter den Bauern: Geroid Tanquary Robinson, Rural Russia under the Old Régime: A History of the Landlord-Peasant World and a Proloque to the Peasant Revolution of 1917, Berkeley/Los Angeles 1969, 45–47. Zu Arakčeev Michael Jenkins, Arakcheev: Grand Vizir of the Russian Empire, New York 1969. Vgl. die zeitgenössische Satire, die 1814 zu erscheinen begann, dann aber verboten wurde: Wassili Nareshny, Der russische Gil Blas oder Die Abenteuer des Fürsten Gawrila Simonowitsch Tschistjakow, Berlin 1990, z. B. 444–469. 31 Stählin, 91 ff. (Zitat 1812: 91); Sarkisyanz, 133 (mit Zitat 1814); Geiger, 312–315; Högy, 18–20; Ley, 54; vgl. Pypin, Religioznyja dviženija, passim; ders., Geistige Bewegungen, 412–413, 416 (zur Aufhebung der Leibeigenschaft). Zum Hintergrund Titzhak Yankel Tarasulo, The Napoleonic Invasion of 1812 and the Political and Social Crisis in Russia, Ph. D. Yale Univ. 1983. Alexander war im übrigen über frankistisch-messianistische Ideen gut informiert: Duker, 290, 313–314, 319–320. Zum Einfluß Franz von Baaders auf dieses Gedankengut in Rußland (mit Hinweis auf Jung-Stilling und seinen Kreis) Benz, Sendung, 573–714. Die Krise, in der sich Alexander 1812 befand, spiegelt sich bei Tolstoi, Krieg und Frieden, 1244–1245.
134
| »Das Land des Friedens und des Heils«
suchte, warum er die Befreiungskriege und die Heilige Allianz als Wege zu einem brüderlichen Bund aller Menschen verstand. Rußland und er, der Zar, hatten den Auftrag Gottes zu erfüllen, um die Menschen der Erlösung nahezubringen. So nahm er im Januar 1814 in Basel wohlwollend die Huldigung Johann Heinrich Pestalozzis (1746–1827) entgegen, der sich mit dem Befreiungskampf identifizierte und den Zaren für seine pädagogischen Projekte gewinnen wollte. In einem Brief an Capo d’Istria vom 13. Dezember 1814 sprach Pestalozzi – typisch für eine damals weit verbreitete Haltung – von der historischen Mission Alexanders »als Wiederhersteller und Erneuerer der Civilisation und Kultur von Europa«.32 Ebenso ließ sich Alexander noch einmal von La Harpe beraten, als es auf dem Wiener Kongreß um die Neugestaltung Europas ging. Dieser wirkte dabei mit, daß die Selbständigkeit der Kantone Waadt und Aargau gegenüber Bern erhalten werden konnte und die Schweiz in ihrem territorialen Umfang sowie in ihrer Neutralität von den europäischen Mächten garantiert wurde.33 Doch letztlich fühlte sich Alexander zu Höherem berufen. Der russische Messianismus war für ihn mehr als eine historische Mission – er war eine religiöse, göttliche Sendung. Einen Ausdruck dieser Sendung, die sich unmittelbar auf die Heilige Schrift berief, stellte die 1812 – unter dem Eindruck der damaligen Geschehnisse – gegründete Bibelgesellschaft für Ausländer und Andersgläubige dar, die sich 1814 zur Russischen Bibelgesellschaft erweiterte und ihr Vorbild in der entsprechenden britischen und auch der darauf aufbauenden Basler Organisation sah. Präsident wurde Fürst Alexander Golicyn, der sich vom Voltairianer und Epikureer zum erweckten Christen gewandelt hatte. Der Autokrator verband sich mit ihm und 32 Johann Heinrich Pestalozzi, Sämtliche Briefe, hg. vom Pestalozzianum und von der Zentralbibliothek Zürich. 9. Band, Briefe vom Herbst 1813 bis Ende 1815, bearb. von Emanuel Dejung, Zürich 1968, 210, vgl. 56–58, 133, 208–212, 256–257, 296, 298–299, 397–398, 446–447; Peter Stadler, Pestalozzi und die geschichtliche Wende von 1813/14, Vortrag im Historischen Seminar Zürich am 2.9.1991 (ich danke Herrn Stadler für wichtige Hinweise). Zu den Beziehungen zwischen Jung-Stilling und Pestalozzi Studer, 118; Hahn, Jung-Stilling, 134. Zur Begegnung zwischen Frau von Krüdener und Pestalozzi im April 1816 Staehelin, Lachenal, 52. Ähnlich etwa Ernst Moritz Arndt, zum Beispiel bei Pypin, Geistige Bewegungen, 407 ff.; Schenkendorf bei Mertens, 97–98. Baron UngernSternberg widmete Alexander 1813/14 mehrere Gedichte, in denen er ihn als »Vaterlandsbefreier«, »der Freiheit Genius«, »milder Friedebringer« u. ä. bezeichnete. In einem der Gedichte heißt es: »Du, versöhntest, Alexander, / Erd’ und Himmel mit einander, / Giebst der Welt den Friedenskuß« (G. J. Fr. Baron Ungern-Sternberg, Harfentöne. Hg. zum Besten der in Reval durch die Cholera zu Waisen gewordenen, Reval 1832, z. B. 56–59, 74–83, Zitat 75 ). Vgl. auch Jaan Kross, Der Verrückte des Zaren: Historischer Roman, Berlin 1988. In beiden Fällen verdanke ich den Hinweis meinem Basler Kollegen Jürgen von Ungern-Sternberg. 33 Boethlingk, Band 2, 330–364; Bühler u. a., 286. Allgemein hier nur: Der Wiener Kongreß 1814/15: Die Neuordnung Europas, hg. von Hans-Dieter Dyroff, München 1966.
Rußland zur Zeit Alexanders I.
|
135
Košelev zu einem religiös begründeten Freundschaftsbund, ähnlich wie mit Roxandra von Stourdza und Jung-Stilling. 1805 hatte er Golicyn zum Oberprokuror des Heiligen Synods, 1810 zusätzlich zum Leiter der Oberverwaltung der geistlichen Angelegenheiten fremder Konfessionen ernannt, 1816 wurde dieser dann Minister für Volksaufklärung und geistliche Angelegenheiten. Der Bibelgesellschaft gehörten Mitglieder aus verschiedenen Nationen und Glaubensrichtungen an, auch aus der russisch-orthodoxen Kirche. Die erweckten, wahren Christen kannten keine konfessionellen Schranken. Golicyn wollte nicht nur alle christlichen Religionen, sondern auch die Sekten und Kulte vereinen. Zahlreiche Freimaurer finden sich darüber hinaus in der Bibelgesellschaft oder in ihrem Umkreis. In Verbindung mit der Bibelgesellschaft und unter dem Einfluß der Erweckungsbewegung entfalteten sich wichtige Reformansätze. Besonders hervorzuheben ist die Tätigkeit der 1819 mit Protektion des Zaren gegründeten Gefängnisgesellschaft, die in den folgenden Jahren wesentliche Verbesserungen im Strafvollzug erreichte. Zum Vorsitzenden ernannte der Zar wiederum den Fürsten Golicyn, einer der aktivsten Vizepräsidenten war Baron Burchard Christoph von Vietinghoff (1767–1828), ein führendes Mitglied der Evangelisch-Lutherischen Gemeinde zu Moskau – und ein Bruder Juliane von Krüdeners! Insbesondere der überkonfessionelle Charakter der Bibelgesellschaft rief den konservativen Flügel der orthodoxen Kirche auf den Plan, traf aber auch auf Gegnerschaft in aufgeklärten Kreisen, die durch den immer mehr frömmelnd-einseitig werdenden Golicyn und die Bibelgesellschaft eine Einschränkung der Toleranz und der Meinungsfreiheit in Literatur, Kunst und Wissenschaft befürchteten. Die Konservativen stellten bald den Zusammenhang von religiösem Mystizismus und sozialer Revolution her und versuchten damit, den Zaren zu beeindrucken.34 34 Högy, 67–102 (zum Bruder Frau von Krüdeners: 14); Geiger, 311–312, 324–325; Christoff, 65 ff.; Pypin, Religioznyja dviženija, 1–293; R. A. Klostermann, Probleme der Ostkirche: Untersuchungen zum Wesen und zur Geschichte der griechisch-orthodoxen Kirche, Göteborg 1955, 382–383, 392. Interessantes Material zu Golicyn und vielen anderen Vorgängen, die hier eine Rolle spielen: Peter von Goetze, Fürst Alexander Nikolajewitsch Galitzin und seine Zeit: Aus den Erlebnissen des Geheimraths Peter von Goetze, Leipzig 1882, speziell zur Bibelgesellschaft 86–106. Vgl. – auch im folgenden – Werner Krause, Die Bibel in Rußland, in: Kirche im Osten 1, 1958, 11–23, hier 15–17; Judith Cohen Zacek, The Russian Bible Society, 1812–1826, New York 1964; dies., The Russian Bible Society and the Russian Orthodox Church, in: Church History 35, 1966, 411–437. Zur Verbindung der Basler mit der Russischen Bibelgesellschaft Benz, Sendung, 575 (zu Golicyn 591–599). In diesen Zusammenhang gehört auch die Basler Mission in Rußland: Joseph Ehret, Die Anfänge der Basler Mission in Rußland 1820–1825, in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 50, 1951, 113–145; ders., Rückzug. Zum Freundschaftsbund des Zaren: Schaeder, Autokratie, 60; Stählin, 91 ff., 94–95. Zur Gefängnisgesellschaft Rolf Steinberg, Die Anfänge der Strafvollzugsreform in Rußland in den Jahren 1818–1829: Eine Untersuchung zur Entstehungsgeschichte der Russischen Gefängnisge-
136
| »Das Land des Friedens und des Heils«
In der Tat wuchs, verstärkt durch seine persönlichen Erfahrungen mit Erweckten und durch Metternichs Warnungen, dessen Mißtrauen gegenüber Bestrebungen, die religiösen Aufbruch mit politisch-sozialer Veränderung verbanden. Mehr und mehr sah Alexander seine Sendung darin, im Bunde mit anderen Monarchen die bestehende, von Gott legitimierte Ordnung zu erhalten, bestenfalls vorsichtige Reformen auszuüben, um auf diese Weise das Wohl der Menschen, das Heil und den Frieden zu sichern, bis Gott die Zeit des Tausendjährigen Reiches anbrechen lasse. Revolutionäre Umtriebe in Europa – Spanien, Neapel, später Piemont – und nicht zuletzt die Meuterei seines geliebten Garderegimentes 1820 sowie die Anzeichen einer geheimen politischen Opposition – Vorläuferin des Dekabristenaufstandes von 1825 – verstärkten seine Abwehrhaltung gegenüber sozialen und politischen Reformen. 1820 verbot er die Jesuiten, 1822 die Freimaurer. In dieser Vorstellungswelt mußten die Stimmen russischer Konservativer mit der Zeit Gehör finden. Die Angriffe gegen die Erweckten, die Bibelgesellschaft und Golicyn häuften sich. 1820 bildete sich gar die »Rechtgläubige Gefolgschaft«, eine Art Verschwörerorganisation, die in einem Bündnis von reaktionären adligen Politikern und Geistlichen – an ihrer Spitze der zwielichtige Mönch Fotij – ihr Ziel erreichen wollte. Der Durchbruch gelang ihnen im Zusammenhang mit dem Aufstand der Griechen, die sich 1821 gegen die türkische Herrschaft erhoben. Anfang Mai 1822 wandte sich Frau von Krüdener mit einem Brief an den Zaren und bezeichnete ihn als Werkzeug Gottes gegen die türkischen Antichristen. Alexander sympathisierte mit den griechischen Glaubensbrüdern und wurde hierin von Capo d’Istria bestärkt. Metternich überzeugte ihn jedoch von den revolutionären Gefahren, die ganz Europa von den Aufständischen drohten. Deshalb stützte der Zar auf dem Kongreß von Verona 1822 die Entscheidung der Heiligen Allianz, Bestrebungen zur Veränderung der bestehenden Ordnung zu bekämpfen und sich damit gegen den Aufstand auszusprechen. Zugleich bedeutete dies, daß Rußlands Einfluß auf dem Balkan begrenzt wurde, während sich Österreich jetzt hier engagierte: Zukünftige Konflikte waren vorprogrammiert. Capo d’Istria mußte zurücktreten. Später wurde er der erste Regent des freien Griechenland. In einem ausführlichen Schreiben an Frau von Krüdener rechtfertigte der Zar seine Haltung und befahl ihr, in Zukunft zu schweigen. Eine Kritik am Selbstherrscher werde ihr nicht mehr gestattet. Aus Petersburg war Juliane von Krüdener Ende 1821 ohnehin ausgewiesen worden, weil die russische Kirchenführung in ihr eine Bedrohung sah. Ein erneuter Versuch, die frühere Beziehung zum Zaren wieder aufleben zu lassen, scheiterte 1824. Erst jetzt, unter dein Eindruck diesellschaft und ihrer Komitees unter besonderer Berücksichtigung britischer und deutscher Einflüsse, Frankfurt a. M. u. a. 1990, hier z. B. XI (Gründung), 74 ff. (Vietinghoff ), 86 ff., 120, 149 u. ö. (Freimaurer); vgl. ders., Friedrich Joseph Haass und der russische Strafvollzug im 19. Jahrhundert, Frankfurt a. M. u. a. 1984.
Rußland zur Zeit Alexanders I.
|
137
ser Vorgänge, erzielten – offenbar gegen seine Gewissensüberzeugung – die Einflüsterungen bei Alexander eine Wirkung, daß Jung-Stilling ein »Lügenprophet« sei, der »gotteslästerliche«, antichristliche Lehre verbreite, daß Frau von Krüdener eine »Teufelstochter« und Ketzerin sei, daß Golicyn die Feinde des Christentums unterstütze. Am 15. Mai 1824 enthob der Zar Golicyn seines Amtes. 1825 setzte dessen Nachfolger das Verbot »schädlicher Bücher«, darunter diejenigen JungStillings, durch, 1826, nach dem Tod Alexanders, auch die Auflösung der Bibelgesellschaft.35 Die Umstände des Zarentodes schließen den Kreis, in dem wir uns bewegt haben. In Begleitung der Fürstin Golicyna war Juliane von Krüdener 1824 nach Südrußland gereist, um sich über die Gemeinschaften der Erweckten zu unterrichten. Dort starb sie am 13./25. Dezember 1824. Jetzt wurde deutlich, wie stark das Band noch war, das den Zaren mit ihr verknüpft hatte. Im Herbst 1825 fuhr Alexander zur Fürstin Golicyna und ließ sich von den letzten Tagen Juliane von Krüdeners berichten, besuchte dann ihre Grabstätte und betete dort lange. Auf dem Rückweg hatte er einen Fieberanfall. Am 19. November/1. Dezember 1825 starb er in Taganrog am Asowschen Meer. Bis heute nicht verstummt sind die Gerüchte, er habe sich in Wirklichkeit in den Mönch Fedor Kuz’mič verwandelt und, zurückgekehrt zu seinem mystischen Glauben, unerkannt bis 1864 in einer sibirischen Einsiedelei gelebt, um Buße für die Entfernung von seinen religiösen Überzeugungen zu tun.36
35 Wie Anm. 13; außerdem Ley, Alexandre, 271 ff.; Knapton, 194–227; Högy, 102–134; Stählin, 95 ff., 101 ff.; Benz, Sendung, 681–706, 717–718, vgl. 723 ff.; Christoff, 21 Anm. 2, 24 ff., 32 ff., 70 ff.; Joseph L. Wieczynski, The Mutiny of the Semenovsky Regiment in 1820, in: The Russian Review 29, 1970, 167 – 180; Irby C. Nichols jr., The European Pentarchy and the Congress of Verona, 1822, The Hague 1971, 5–8, 48–54, 66, 244–258, 321. Zum Nachwirken Jung-Stillings und der hier geschilderten Vorgänge in Rußland vgl. Högy; Ernst Benz, Russische Endzeiterwartung: Studien zur Einwirkung der deutschen Erweckungsbewegung in Rußland, in: ders., Endzeiterwartung, 211–240; Klostermann, 268; Sarkisyanz, 141–147, 187 ff., 204–205; Klaus Pfeifer, Beitrag zu einer Jung-Stilling-Bibliographie, in: Das achtzehnte Jahrhundert 14, 1990, 122–130, hier bes. 123. Zu den Opfern der Verhärtung gehörte auch Franz von Baader (s. Anm. 31), vgl. Schaeder, Autokratie, 65 ff.; Benz, Ostkirche, 151–160. Zu den Dekabristen Lemberg, Gedankenwelt; Pypin, Geistige Bewegungen, 657 mit Anm. 1, zitiert ein Gedicht des Dekabristen Kondratij F. Ryleev (1795–1826) von 1821, das noch die Hoffnungen auf den Zaren als Erlöser ausdrückt: »... O Car! die ganze Welt sieht auf uns, / Und erwartet entweder Knechtschaft oder Freiheit! / Nur Alexanders Stimme vermag / Vor Stürmen und Nöten die Völker zu retten ...« 36 Wie Anm. 13 und 35; außerdem die Zarenbiographien sowie Tolstojs Fragment (Anm. 1 und 6). Dazu: Nochmals – Alexander I. und Fedor Kuźmič, hg. von Peter Scheibert, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 15, 1967, 365–370.
138
| »Das Land des Friedens und des Heils«
Im Mystizismus und Messianismus lagen Befreiung und Unterdrückung nahe beisammen. Die Erfahrung der Ereignisse ließ viele Menschen, auf der Suche nach einer neuen Orientierung, eine Erweckung erleben, die sie zur Umkehr im persönlichen Lebenswandel bereit machte, aber auch zur Schaffung ›gottgefälliger‹ gesellschaftlicher Verhältnisse, um im Sinne der biblischen Aussagen die Erlösung zu erwarten. Doch das sozial-reformerische oder gar revolutionäre Element in der Erweckungsbewegung konnte leicht umschlagen in eine konservative Haltung, wenn nämlich durch gesellschaftliche Veränderungen der christliche Glaube und Gottes Ordnung bedroht schienen. Dann blieben nur die persönliche Vervollkommnung und die Hoffnung auf ein besseres Leben im Jenseits. Dieses Doppelgesicht der Erweckungsbewegung erklärt, warum sich zahlreiche Anhänger vom sozialen Protest dem politischen Konservatismus zuwandten, andere jedoch der Revolution zugeneigt blieben. In den Personen, die uns ausführlicher begegnet sind, bündelten sich diese Widersprüche. Für alle aber, die in Rußland das »Land des Friedens und des Heils« sahen – am Oberrhein wie in Rußland selbst – gilt: Aus dieser Utopie erwuchs Kraft für einen ungeheuren Aufbruch zu neuen Ufern. Von Rußland sollte die Befreiung der Menschheit ausgehen, so hofften viele. Es sollte nicht das letzte Mal in der Geschichte sein.37
37 Vgl. nur aus der neuesten Zeit den Schweizer Sozialisten Walther Bringolf, der seine Eindrücke von einer Reise nach Sowjetrußland 1920 so zusammenfaßte: «Aber ich sah in ihren Augen das heilige Feuer glimmen ... Eine ganze Gesellschaftsklasse, ein ganzes Volk trägt heute die Leiden zur Erlösung der Menschheit. – Christus ist wiedererstanden – aber er ist erstanden in einem ganzen Volk ...« (zitiert in der noch unveröffentlichten Zürcher Dissertation Christiane Uhligs von 1992 über westliche Reiseberichte zu den Verhältnissen in der Sowjetunion). Einigen russischen Sekten galt Lenin als der »Messias des 20. Jahrhunderts«: Sarkisyanz, 95, vgl. ff. und 168–196 zu den Zusammenhängen von christlich-russischem Chiliasmus, Marxismus und Bolschewismus. Andrej Belyj begrüßte 1917 die Revolution mit den Worten: «Rußland, Messias des kommenden Tags!» (ebd., 134). Auch die Vorstellungen, daß die künftigen Revolutionen aus dem Osten kämen – wie sie sich etwa auf dem 1. Kongreß der Völker des Ostens in Baku 1920 ausdrückten –, wären in diesem Zusammenhang zu untersuchen. Und selbst in der gegenwärtigen Krise nach der Auflösung der UdSSR spielen messianistische Ideen eine erstaunliche Rolle: Tatiana Schtscherbina, Die ganz gewöhnliche russische Katastrophe, in: Süddeutsche Zeitung, 4./5.4.1992, 10.
Lebensformen im mittelalterlichen Freiburg Von Ordnungen und Unordnungen* Moses – oder Mössin in der damaligen Schreibweise – war, zumindest in den zwanziger Jahren des 14. Jahrhunderts, einer der reichsten und angesehensten der Freiburger Juden.1 Seiner Stellung gemäß führte er in den Quellen den Beinamen »Herr«, eine Bezeichnung, die für Juden dieser Zeit nur selten auftritt. In Analogie zur Verwendung dieses Beinamens in anderen – nichtjüdischen – Fällen im Freiburger Umfeld könnte man vermuten, daß sein Inhaber nicht nur zur Oberschicht gehörte, sondern vor allem über Grundbesitz verfügte.2 Seine Tochter war mit Süßkind verheiratet, der sich ebenfalls in Geldgeschäften betätigte. Mössin und Süßkind liehen der Stadt wie dem Grafen von Freiburg beträchtliche Summen. Dabei arbeiteten sie teilweise mit dem Patrizier Konrad Dietrich Snewlin zusammen. Geldhandel und Kreditgeschäft gehörten zu den beinahe einzigen Möglichkeiten für Juden, einen Beruf auszuüben – alle anderen Wege waren ihnen inzwischen versperrt. Zugleich trafen sie jetzt jedoch auf eine aufstrebende Schicht christlicher Großkaufleute, die auch den immer wichtiger werdenden Geldverkehr unter Kontrolle bringen wollten. Die Kirche folgte diesen Interessen und lockerte das Zinsverbot für Christen. Damit wurden die Juden zu lästigen Konkurrenten, deren man sich nicht nur rechtlich, sondern auch sozial zu entledigen suchte. So begannen sie, mehr und mehr unter starken Verdrängungsdruck zu geraten. Der einflußreiche Jude Mössin hatte dies vielleicht noch nicht so sehr zu spüren bekommen – die blutige Entladung der angestauten Spannungen auch in Freiburg Anfang 1349 erlebte er vermutlich nicht mehr.3 * Erstpublikation unter dem Titel: Von Ordnungen und Unordnungen. Lebensformen in der Stadt. In: Geschichte der Stadt Freiburg im Breisgau. Bd. 1. Von den Anfängen bis zum »Neuen Stadtrecht« von 1520. Hg. von Heiko Haumann und Hans Schadek. Stuttgart 1996, S. 501–523, 676–687. 1 Vgl. im folgenden den Beitrag von Peter Schickl über die Geschichte der Juden in Freiburg in diesem Band [Geschichte der Stadt Freiburg, Bd. 1, S. 524–551]; Hermann Nehlsen: Die Freiburger Familie Snewlin. Rechts- und sozialgeschichtliche Studien zur Entwicklung des mittelalterlichen Bürgertums (VAF 9). Freiburg 1967, S. 125 ff.; Adolf Lewin: Juden in Freiburg i. B. Trier 1890, S. 12–13. – Für Hinweise danke ich Werner Meyer und Achatz Frhr. v. Müller. 2 Erika Schillinger: Die frühen Turner von Freiburg. Vom Bürgertum zum Ritterstand. In: SiL [Schau-ins-Land. Zeitschrift des Breisgau-Geschichtsvereins]106 (1987) S. 9–30, hier S. 19–20. 3 Inwieweit auch in Freiburg die wachsende Marienverehrung zur Aufhetzung der Bevölkerung gegen die Juden genutzt wurde, muß hier offen bleiben. Vgl. Hedwig Röckelein: Ma-
140
|
Lebensformen im mittelalterlichen Freiburg
Wie sich die Geschäftsbeziehungen zwischen Mössin und Konrad Dietrich Snewlin gestalteten, erfahren wir nicht. Möglicherweise standen sie auf gutem Fuße, da sich in diesen Jahrzehnten die Juden in Freiburg auf dem Höhepunkt ihrer Anerkennung befanden. Mössin und sein Schwiegersohn Süßkind waren wohl die Vorsteher der autonomen jüdischen Gemeinde in Freiburg, die etwa acht Familien umfaßte. Sie unterhielt eine eigene Synagoge in der Tromlosen- (jetzt Wasser-)gasse mit der Rückseite zur Webergasse. Wahrscheinlich war auch ein Lehrer tätig, der gleichzeitig die Aufgaben des Vorbeters und Schächters übernahm. Die Funktionen eines Rabbiners übte wahrscheinlich ein gelehrtes Mitglied der Gemeinde aus, vielleicht sogar »Herr« Mössin. Konrad Dietrich Snewlin, der 1291 erstmals erwähnt wird und 1354 starb, gehörte zu einem der führenden Patriziergeschlechter Freiburgs.4 Er selbst war – seit 1314 – Ritter, mehrfach Bürgermeister, ein bedeutender Grundbesitzer und ein äußerst rühriger Geschäftsmann. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts vergrößert er die Besitzungen seines Hauses in Kirchhofen, Krozingen und Ehrenstetten, erwirbt die Burg Wiger bei Emmendingen – das spätere Weiherschloß – und Ländereien in dieser Gegend; sein Freiburger Wohnhaus liegt in der Turnergasse, der heutigen Franziskanerstraße. Während sich der alte Adel – beispielhaft die Grafen von Freiburg – durch Fehden und Unfähigkeit, mit den neuen wirtschaftlichen Erfordernissen zurechtzukommen, mehr und mehr ruiniert, steigern die verschiedenen Linien der neuadeligen Snewlins in dieser Zeit ihre Einnahmen und verwenden sie dazu, ihren Grundbesitz zu erweitern. Neben den daraus fließenden, äußerst ergiebigen Einkünften erzielt Konrad Dietrich, ebenso wie einige seiner Verwandten, vermutlich erhebliche Erträge aus der Beteiligung am Silberbergbau im Todtnauer Gebiet. Am 21. März 1341 verleiht ihm die Gewerkschaft »zum Gauch« der dortigen Bergleute, als Unternehmer Froner genannt, entsprechende Rechte.5 Als Gegenleistung wird er sich an der Kapitalbeschaffung für den immer aufwendiger werdenden Erzabbau beteiligt haben – ein Hinweis darauf, wie rienverehrung und Judenfeindlichkeit in Mittelalter und früher Neuzeit. In: Maria und die Welt. Hg. von Claudia Opitz u. a. Zürich 1993, S. 279–307. Daß antijüdische Klischees nicht ursprünglich im Volk verwurzelt waren, sondern von der Kirche erzeugt wurden, zeigt Jacques Le Goff: Le Juif dans les exempla médiévaux: le cas de l’Alphabetum Narrationum. In: Pour Léon Poliakov: Le racisme. Mythes et sciences. Hg. von Maurice Olender. Paris 1981, S. 209–220. 4 Hier und im folgenden Nehlsen: Die Freiburger Familie Snewlin, bes. S. 64–68, 89, 94– 98, 102–103, 109, 115–116, 123–131, 137–138, 146–161, 172–173, Tafel II. 5 Vgl. Der Landkreis Lörrach. Bd. 2, B: Gemeindebeschreibungen Kandern bis Zell im Wiesental. Bearb. von der Abteilung Landesbeschreibung des Staatsarchivs Freiburg i. Br. Hg. von der Landesarchivdirektion Baden-Württemberg in Verbindung mit dem Landkreis Lörrach (Kreisbeschreibungen des Landes Baden-Württemberg). Sigmaringen 1994, S. 7, 13, 719. S. auch in diesem Band die Beiträge zur wirtschaftlichen Entwicklung und zum Silberbergbau [Geschichte der Stadt Freiburg, Bd. 1, S. 320–342].
Von Ordnungen und Unordnungen
|
141
jetzt allmählich im Bergbau unternehmerische und ausführende Tätigkeiten auseinandertreten. Daneben ist Konrad Dietrich Snewlin Pfandherr der gräflichen Bergwerkseinkünfte. Nach anfänglichen Schwierigkeiten entwickelt er sich zu einem der wichtigsten Geldvermittler im Umfeld von Freiburg. Seit Ende des 13. Jahrhunderts tritt auch in Freiburg das Kreditgeschäft zunehmend neben Verpfändung, Verkauf oder Erbleihe als Möglichkeiten, sich notwendige Mittel zu beschaffen, ja, schiebt diese allmählich in den Hintergrund. Das kanonische Zinsverbot, das ohnehin durch Rentenkauf – die Gülte – und andere Mittel mehr und mehr umgangen wurde, verliert an Geltung.6 Konrad Dietrich scheint all diese Geschäftsarten zu beherrschen und weiß sich gerade die modernen Formen zunutze zu machen. So nimmt es nicht Wunder, daß er den Grafen von Freiburg bei ihren Geldproblemen immer wieder unter die Arme greifen kann und dafür beträchtliche Zinsleistungen erhält; das Grafengeschlecht ist schließlich hochverschuldet. Hier kommt es – etwa 1323 – zu Quergeschäften mit Freiburger Juden, namentlich mit Mössin und Süßkind. Vielleicht war die Konkurrenz der neuen Finanzherren mit den traditionellen Geldvermittlern, den Juden, ein Grund dafür, daß 1349 Johann Snewlin der Grüninger – ein Neffe des Konrad Dietrich – zu denjenigen gehört, der den Haß auf die Juden besonders schürt und sich am jüdischen Gut zu bereichern sucht.7 Das Ansehen, das Konrad Dietrich Snewlin in Freiburg genoß, drückte sich auch darin aus, daß ihn der Rat 1309/10, 1320/21, 1323/24, 1326/27 und 1330/31 zum Bürgermeister wählte. Diese Würde ging im 14. Jahrhundert besonders häufig an Mitglieder jener Familie. Sie beherrschte in gewisser Weise das städtische Geschehen. Am nachhaltigsten wirkte, fast ununterbrochen von 1327 bis 1347, Johann Snewlin der Gresser, der nicht nur durch persönliche Stiftungen die Ansiedlung der Kartäusermönche und den Einbau eines Fensters in das Münster ermöglichte, sondern auch den politischen Einfluß Freiburgs zu einem Höhepunkt führte.8 Im Unterschied zu anderen Angehörigen des Geschlechtes verzichtete Konrad Dietrich darauf, vom Grafen das Schultheißenamt zu kaufen. Vielleicht wollte er seine Geschäftsbeziehungen nicht mit derartigen Funktionen verquicken; darüber hinaus übte zu dieser Zeit ohnehin ein Verwandter, Snewli Bernlapp, das Amt aus. 1331 schloß Konrad Dietrich, obwohl doch Bürger der Stadt, für seinen 6 Zur Ambivalenz des Rentenkaufs vgl. Hans-Jörg Gilomen: Volkskultur und Exempla-Forschung. ln: Modernes Mittelalter. Neue Bilder einer populären Epoche. Hg. von Joachim Heinzle. Frankfurt a. M., Leipzig 1994, S. 165–208, hier S. 200–202. 7 Vgl. den Beitrag von Peter Schickl in diesem Band. 8 Zum Münsterfenster vgl. in diesem Band den Beitrag von Rüdiger Becksmann [Geschichte der Stadt Freiburg, Bd. 1, S. 359–366].
142
|
Lebensformen im mittelalterlichen Freiburg
Besitz, die Burg Wiger, ein Bündnis mit Freiburg; sie solle niemals als feindlicher Stützpunkt dienen (sein Sohn brach dann allerdings dieses Gelöbnis 1366).9 Elli von Breitnau war allem Anschein nach eine Freiburger Schneiderin.10 Wir wissen wenig über sie. 1385 wird sie in einer Steuerliste erwähnt, und in einer Wein-Ungeld-Liste von 1390 gehört sie zu den 22 abgabepflichtigen weiblichen Mitgliedern der Schneiderzunft; insgesamt werden hier 160 Frauen und 1403 Männer aufgeführt. Gute Gründe sprechen dafür, daß Elli von Breitnau nicht als passives Zunftmitglied auftrat, das sich eingekauft hatte, um dadurch bestimmte Vorrechte zu erhalten – ein ehrenhaftes Begräbnis etwa, Einladungen zu geselligen Anlässen oder Hilfe in der Not. Ebensowenig dürfte sie als mithelfende Ehefrau eines Meisters in die Zunft geraten sein. Vermutlich war sie alleinstehend 9 UBF [Urkundenbuch der Stadt Freiburg] 1, S. 281–283 Nr. 143. Zum Aufstieg eines reichen Bürgers zum Ritter s. Ulrich Eckers Schlaglicht zu Martin Malterer [Geschichte der Stadt Freiburg, Bd. 1, S. 279–284], der sich im übrigen – ebenso wie der junge Snewlin – 1366 gegen die Stadt stellte. Vgl. zu einer weiteren bedeutenden Familie Schillinger: Die frühen Turner. 10 StadtAF [Stadtarchiv Freiburg], E 1 A II a 1 Nr. 1 S. 21; E 1 A III h Nr. 1 fol. 17v, 74v. Vgl. Sully Roecken, Carolina Brauckmann: Margaretha Jedefrau. Freiburg 1989, S. 107– 116. Das dort angeführte Beispiel der Gysel Zöbellin für eine Frau, die als selbständige Meisterin arbeitet, ist grundsätzlich zu korrigieren, da es sich bei ihr um eine Begine handelt. Vgl. auch den Beitrag über die Klöster in diesem Band [Geschichte der Stadt Freiburg, Bd. 1, S. 421–467]. Für 1497 lassen sich bei rund 15 Prozent der Haushalte Frauen nachweisen, vornehmlich alleinstehende und Witwen. Vgl. Peter-Johannes Schuler: Die Bevölkerungsstruktur der Stadt Freiburg im Breisgau im Spätmittelalter. Möglichkeiten und Grenzen einer quantitativen Quellenanalyse. In: Voraussetzungen und Methoden geschichtlicher Städteforschung. Hg. von Wilfried Ehbrecht. Köln, Wien 1979, S. 139–176, hier S. 151–153. Kritische Anmerkungen hierzu von Rosemarie Merkel: Bemerkungen zur Bevölkerungsentwicklung der Stadt Freiburg zwischen 1390 und 1450. In: SiL 108 (1989) S. 83–91. Hieraus – S. 87 – auch die gegenüber Schuler korrigierten Zahlen für 1390. Auf den Zusammenhang von Stadtentwicklung und Veränderungen der Funktionen von Frauen wie der Geschlechterbeziehungen weist hin Heide Wunder: Überlegungen zum Wandel der Geschlechterbeziehungen im 15. und 16. Jh. aus sozialgeschichtlicher Sicht. In: Wandel der Geschlechterbeziehungen zu Beginn der Neuzeit. Hg. von Heide Wunder und Christina Vanja. Frankfurt a. M. 1991, S. 12–26; dies.: Die »Krise des Spätmittelalters« im Spiegel der Geschlechterbeziehungen – Zum gesellschaftsgeschichtlichen Phasenmodell Ferdinand Seibts. In: Von Aufbruch und Utopie. Perspektiven einer neuen Gesellschaftsgeschichte des Mittelalters. Für und mit Ferdinand Seibt aus Anlaß seines 65. Geburtstages. Hg. von Bea Lundt und Helma Reimöller. Köln u. a. 1992, S. 73–85. Allgemein zu den verschiedensten Aspekten des Frauenlebens (auch im folgenden heranzuziehen): Claudia Opitz: Frauenalltag im Mittelalter. Biographien des 13. und 14. Jhs. (Ergebnisse der Frauenforschung 5). Weinheim, Basel 1985; Geschichte der Frauen. Hg. von Georges Duby und Michelle Perrot. Bd. 2: Mittelalter. Hg. von Christiane Klapisch-Zuber. Frankfurt a. M. u. a. 1993; Stadt der Frauen. Szenarien aus spätmittelalterlicher Geschichte und zeitgenössischer Kunst. Hg. von Annette Kuhn und Marianne Pitzen. Zürich, Dortmund 1994.
Von Ordnungen und Unordnungen
|
143
und verdiente ihren Lebensunterhalt als Meisterin. In ihrer Werkstatt beschäftigte sie »ein lertÖhterli«. Von ihrer Pflicht als aktive Zunftgenossin, Wach- und Verteidigungsdienst zu leisten, hatte sie sich freigekauft oder stellte Gesellen als Vertretung. Einen Vogt, der – wie in der Regel bei verheirateten und ledigen Frauen – die Vormundschaft bei Rechtsgeschäften ausübte, benötigte sie nicht: Zumindest bei den alltäglichen Rechtsfällen – Geschäftsabschlüssen, kleineren Streitigkeiten – konnte sie sich selbst vertreten. Wer als Frau ein selbständiges Gewerbe ausübte, war – anders als seit dem 16. Jahrhundert – nicht auf eine Versorgungsehe angewiesen.11 Schon 1491 sind in Freiburg wesentlich weniger zünftige Schneiderinnen – wie überhaupt zünftige Frauen – zu finden.12 Peter Sprung wurde 1457 geboren, als Sohn des Kürschnermeisters Heinzmann Sprung, der 1427 nach Freiburg gekommen war, und der Hildegard Nüwmeister, die ebenfalls aus einer Kürschnerfamilie stammte.13 Sein Haus, das das Heiliggeist-Spital in seinem Geburtsjahr dem Vater in Erbpacht gegeben hatte, stand in der Kaiserstraße zwischen den Häusern »zum Schwert« und »zur Meinwartin«, gegenüber dem Gesellschaftshaus »zum Gauch«. 1492 verlegte er sein Wirken nur wenig weiter in das Haus »zum roten Kopf«, an der Ecke zur Franziskanerstraße. Dieser Wechsel dokumentierte den Aufstieg vom Handwerker zum Großhandelsherrn. Seit 1491 – in einer unruhigen Zeit, als es in der Stadt wegen anstehender Reformen und Druck der habsburgischen Obrigkeit rumorte –14 übte Sprung das Amt des Zunftmeisters der Kaufleute »zum Falkenberg« aus. Die unangefochtene Stellung der adligen Patriziergeschlechter – wie der Snewlins – war inzwischen gebrochen, eine neue Schicht an ihre Stelle getreten. Seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts hatten Zünftige immer stärker in die Oberschicht vordringen können – im Hinblick auf ihr Vermögen wie auf ihre politische Position. Hingegen waren Angehörige der alten Adels- und Kaufleutefamilien mehr und mehr in das Umland abgewandert.15 Peter Sprung verstand offenbar zu wirtschaften: Nach den Steuerregistern und Stiftungsurkunden zu schließen, gelang es ihm bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts, in die Schicht der 11 Zu den Veränderungen s. auch die Stadtreche von 1293 und 1520. Vgl. Claudia Opitz: Emanzipiert oder marginalisiert? Witwen in der Gesellschaft des späten Mittelalters. In: Auf der Suche nach der Frau im Mittelalter. Fragen, Quellen, Antworten. Hg. von Bea Lundt. München 1991, S. 25–48. 12 Roecken, Brauckmann: Margaretha Jedefrau, S. 127, vgl. S. 100, 130, 132. 13 Eher erzählend: Balthasar Wilms: Die Kaufleute von Freiburg im Breisgau 1120–1520. Bilder aus alten Tagen. Freiburg 1916, bes. S. 227–266 (auch im folgenden). Die Daten zu Sprungs Leben und Wirken nach Angaben von Frau Rosemarie Merkel. 14 Tom Scott: »Der Walzenmüller-Aufstand« 1492. Bürgeropposition und städtische Finanzen im spätmittelalterlichen Freiburg im Breisgau. In: SiL 106 (1987) S. 69–93. 15 Willy Schulze: Die Freiburger Ratsänderung 1388–1392. In: SiL 104 (1985) S. 57–75, hier S. 66–68.
144
|
Lebensformen im mittelalterlichen Freiburg
reichsten Bürger vorzustoßen. Seine Besitzungen reichten weit über Freiburg hinaus, so wie auch seine Geschäfte nicht auf die Stadt beschränkt blieben. Sein Ansehen und seine Fähigkeiten brachten ihm zahlreiche Ämter und Aufträge ein: Von 1494 bis 1511 ernannte ihn der Rat zum Pfleger des Waldheiligtums von St. Ottilien, das ihm und seiner Frau Elisabeth Zehenderin eine großzügige Förderung verdankte.16 Zwischen 1504 und 1510 gehörte er zu den drei »Heimlichen Räten«, die die Ankläger beim »Malefizgericht« stellten und zugleich Untersuchungsrichter waren. 1490 rückte er selbst in den Rat ein und war aktiv an den Vorbereitungen und der Durchführung des Reichstages 1498 beteiligt. Die Interessen der Zünfte scheint er energisch und wirksam im Rat vertreten zu haben. So verwundert es nicht, daß ihn die Zünfte 1503 zum Obristzunftmeister kürten, neben Bürgermeister und Schultheiß der dritthöchste Amtsträger in der Stadt. In seiner Position setzte er sich für mehr – und vor allem für eine neue – Ordnung in der Stadt ein. Die übermütigen Studierenden solle man besser im Zaum halten, desgleichen diejenigen Adligen, die bislang ungestraft allerlei Freveltaten begingen. Genauer seien die städtischen Rechnungen zu überprüfen (später wurde er dann auch zu einem der Verwalter der städtischen Finanzen bestellt). Interessant ist seine Forderung, im Münster müsse wieder Andacht herrschen; anscheinend hatte die Art und Weise, wie von der Kanzel – durchaus nach alter Tradition – öffentliche Dinge verkündet wurden, Formen angenommen, die ihm zu weit gingen. Hier zeigt sich, am Vorabend der Reformation, welche Sitten eingerissen waren und wie Menschen, die sich um die Religion und um die Stabilität in der Stadt sorgten, dagegen anzukämpfen suchten. Folgerichtig trat Sprung nicht nur für eine Neufassung der Zunftordnungen ein, sondern vor allem auch für die Ausarbeitung eines neuen Stadtrechtes.17 Wie ernst er diese Aufgabe nahm, drückte sich nicht zuletzt darin aus, daß er und seine Frau zu den besonders großzügigen Stiftern des Münsters zählten sowie die Armen tatkräftig unterstützten; bei Peter Sprungs Tod am 7. Mai 1512 wurde sogar ein Teil seines Vermögens unter ihnen verteilt. In diesem Zusammenhang ist es wohl auch zu sehen, daß er die Bruderschaft der »Meistersinger« mitbegründete, deren Mitglieder hauptsächlich aus sozial niederen Schichten kamen und deren Ziel es war: »Gott zu loben, die Seelen zu trösten und die Menschen zu Zeiten, da sie dem Gesange zuhören, vor Gotteslästerung, Spiel und anderer weltlicher Üppigkeit abzuziehen.«18 16 Vgl. Ulrich Eckers Schlaglicht zu St. Ottilien [Geschichte der Stadt Freiburg, Bd. 1, S. 464–467]. 17 S. Peter Fäßlers Schlaglicht über Maximilian, Zasius und das Neue Stadtrecht von 1520 [Geschichte der Stadt Freiburg, Bd. 1, S. 297–301]. 18 Vgl. Jan Gerchow: Bruderschaften im spätmittelalterlichen Freiburg i. Br. In: FDA [Freiburger Diözesan-Archiv] 113 (1993) S. 5–74, hier S. 31–39, sowie den Abschnitt über
Von Ordnungen und Unordnungen
|
145
Diese knapp skizzierten, über rund zwei Jahrhunderte verstreuten Biographien von vier Personen, über die etwas mehr bekannt ist als nur der Name oder ein bestimmtes Datum, sollen einführen in einen Überblick über Lebensformen in der Stadt Freiburg. Was fällt auf? Es gibt deutliche soziale Hierarchien und klare Ordnungen aller Dinge; es gibt Gruppen, die am Rande der Gesellschaft stehen; offensichtlich wandelten sich wirtschaftliche, soziale und politische Strukturen im 14. Jahrhundert; die Stellung der Frauen unterschied sich noch erheblich von späteren Verhältnissen; die Religion bestimmte stark den Lebensablauf und das Alltagshandeln; religiöses war zugleich mildtätiges Handeln und drückte sich in Stiftungen aus; allmählich veränderte sich jedoch – wie sich im 15. Jahrhundert zeigte – das Verhältnis von Religion und Weltlichkeit.19 Die alles umfassende Ordnung, deutlich gestaffelt nach Rang und Stand der städtischen Bewohner, stand in Spannung zur Freiheit in der Stadt – gegenüber dem Land – und zur Autonomie genossenschaftlicher Organisationen. Ordnungsvorstellungen wie ihre konkrete Umsetzung in politische Herrschaft bedurften insofern immer wieder der Zustimmung der Beteiligten – in unterschiedlichem Grad und in der Regel vermittels der Korporationen ausgeübt – und unterlagen deshalb auch Veränderungen.20 Seit dem 14. Jahrhundert kam bisher Selbstverständliches ins Rutschen: Die Unterschiede zwischen einzelnen sozialen Gruppen waren fließend geworden, die Städte größer und damit unübersichtlicher; Herrschaftsformen und Wirtschaftsweisen wandelten sich. Der »Schwarze Tod«, die große Pestwelle von 1348/49, traf zusammen mit anderen Katastrophen wie dem furchtbaren Erdbeben von 1348 mit seinem Zentrum in Kärnten, auf das weitere folgten, die teilweise für Zünfte und Bruderschaften in diesem Band [Geschichte der Stadt Freiburg, Bd. 1, bes. S. 183–189]. Zu den Anfängen des Theaters im 16. Jh. vgl. Ernst Julius Leichtlen: Zur Geschichte des Freiburger Theaters. In: SiL 11 (1884) S. 25–31; Heinrich Schreiber: Das Theater zu Freiburg. In: Freiburger Adreßkalender für das Jahr 1837, S. 27–68. 19 Grundsätzlich zum Problem der Erfassung von Wandel: Sozialer Wandel im Mittelalter. Wahrnehmungsformen, Erklärungsmuster, Regelungsmechanismen. Hg. von Jürgen Miethke und Klaus Schreiner. Sigmaringen 1994, darin bes. Otto Gerhard Oexle: »Die Statik ist ein Grundzug des mittelalterlichen Bewußtseins.« Die Wahrnehmung sozialen Wandels im Denken des Mittelalters und das Problem ihrer Deutung, S. 45–70. Vgl. hier im folgenden den Überblick von Klaus Schreiner: Frömmigkeit in politisch-sozialen Wirkungszusammenhängen des Mittelalters. Theorie- und Sachprobleme, Tendenzen und Perspektiven der Forschung. In: Mittelalterforschung nach der Wende 1989. Hg. von Michael Borgolte (Beihefte der HZ 20). München 1985, S. 177–226. 20 Vgl. Ulrich Meier, Klaus Schreiner: Regimen civitatis. Zum Spannungsverhältnis von Freiheit und Ordnung in alteuropäischen Stadtgesellschaften. In: Stadtregiment und Bürgerfreiheit. Handlungsspielräume in deutschen und italienischen Städten des Späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Hg. von Klaus Schreiner und Ulrich Meier (Bürgertum. Beiträge zur europäischen Gesellschaftsgeschichte 7). Göttingen 1994, S. 11–34.
146
|
Lebensformen im mittelalterlichen Freiburg
Freiburg bedrohlich nahe lagen: 1356 wurde ein Großteil Basels zerstört, 1357, 1363 und 1372 bebte es in Straßburg. 1378 geschah Unerhörtes: Die Kirche spaltete sich – im »Großen Schisma« standen sich für längere Zeit zwei, vorübergehend sogar drei Päpste gegenüber. Traditionelle Wertvorstellungen schienen nicht mehr zur Wirklichkeit zu passen und wurden brüchig. Zweifel kamen auf. Viele Menschen reagierten mit Verunsicherung und Angst. Furcht, aber auch Hoffnungen richteten sich in diesen Zeiten der Not und der Orientierungslosigkeit auf den erwarteten Anbruch des Tausendjährigen Reiches, das die Erlösung bringen werde. Unruhen und Aufstände standen mit all dem im Zusammenhang. Die Gesellschaft durchlebte eine Krise.21 Ein Versuch, damit fertig zu werden, stellten die zunehmenden Reglementierungen dar, die weite Teile des Alltagslebens umfaßten und in neuer Form auch das private Leben kontrollieren sollten. Zahlreiche Erlasse des Rates beschäftigten sich mit ökonomischem Verhalten, mit den Pflichten der Zunftangehörigen oder mit der Form der Klage vor ihm.22 Nicht immer ließen sich die Betroffenen die Entscheidungen widerstandslos gefallen: Im September 1355 drohte eine Gruppe, die der Stadt verwiesen worden war, mit Brandstiftung und Mord.23 Um 1500 ging der Rat mehrfach gegen Frie21 Vgl. Europa 1400: Die Krise des Spätmittelalters. Hg. von Ferdinand Seibt und Winfried Eberhard. Stuttgart 1984; František Graus: Randgruppen der städtischen Gesellschaft im Spätmittelalter. In: Zeitschrift für historische Forschung 8 (1981) S. 385–437, hier S. 414–415, 424, 434–437; Norman Cohn: Das neue irdische Paradies. Revolutionärer Millenarismus und mystischer Anarchismus im mittelalterlichen Europa. Reinbek 1988; Arno Borst: Barbaren, Ketzer und Artisten. Welten des Mittelalters. München, Zürich 1988, S. 528–563, vgl. 284 ff.; Jean Delumeau: Angst im Abendland. Die Geschichte kollektiver Ängste im Europa des 14. und 15. Jhs. Reinbek 1989; Werner Meyer: Das Basler Erdbeben von 1356 und die angerichteten Schäden. In: Unsere Kunstdenkmäler 41/2 (1990) S. 162–168; Joachim Wollasch: Hoffnungen der Menschen in der Zeit der Pest. In: Historisches Jb. 110/1 (1990) S. 23–51; Klaus Bergdolt: Der Schwarze Tod in Europa. Die Große Pest und das Ende des Mittelalters. München 1994, bes. S. 107–119. Wenn Le Goffs Interpretation zutrifft, daß während der großen Aufschwungphase im 12. Jh. für die Christen das Jüngste Gericht wichtiger wurde als die Apokalypse des Johannes – man richtete sich im Diesseits ein und traf Vorkehrungen für das Jenseits, nicht zuletzt durch die »Erfindung« der Übergangszeit im Fegefeuer –, so könnte man folgern, daß im 14. Jh. beide Vorstellungen verschmolzen (Jacques Le Goff: Die Geburt des Fegefeuers. Vom Wandel des Weltbildes im Mittelalter. München 1990, hier bes. S. 157–284). 22 UBF 1, S. 180 Nr. 76 (19.7.1308), 251–252 Nr. 122 (21.1.1324), 336–337 Nr. 170 (10.7.1338), 393–394 Nr. 203–204 (31.7./29.12.1349), 427 Nr. 217 (8.5.1353); UBF 2, S. 106–107 Nr. 351 (21.4.1396). 23 StadtAF, A 1 XI g 1355 Sep. 4. Vgl. dazu Monika Spicker-Beck: Räuber, Mordbrenner, «umbschweifendes Gesind«. Zur Kriminalität des 16. Jhs. im Südwesten des Reiches. Unveröffentl. Diss. Freiburg 1993; auch das Schlaglicht in Bd. 2 der Stadtgeschichte, S. 368– 370.
Von Ordnungen und Unordnungen
|
147
densbrecher, Gotteslästerer und mutwillige Trinker vor.24 Zu Beginn des 16. Jahrhunderts wurden auch die Tätigkeiten von Ärzten, Hebammen und Apothekern in Ordnungen gebracht.25 Ebenso faßte man die Vorschriften für die Brotschauer und Kornmesser sowie überhaupt für das Marktwesen systematisch zusammen.26 Bereits 1402 war geregelt worden, an welchen Tagen nicht gehandelt und zu welchen Zeiten nicht gearbeitet werden durfte.27 Großes Augenmerk richtete der Rat auf die Reinhaltung der Stadt. Nicht nur die Menschen, sondern auch die noch in großer Zahl gehaltenen Haustiere – bis hin zu Kühen, Schweinen und Ziegen – verursachten Dreck. Am 26. Januar 1399 verbot er, Mist länger als drei Tage in der Stadt liegen zu lassen oder in den Bach zu werfen, am 20. Mai 1403, ohne Erlaubnis des Baumeisters Erde irgendwohin in die Stadt zu schütten.28 Damit sollte nicht zuletzt verhindert werden, daß die seit Ende des 12. Jahrhunderts angelegten »Stadtbäche« verunreinigt wurden, weil diese für ausreichendes Brauchwasser unentbehrlich waren.29 Auf eine gesicherte, vermutlich ebenfalls seit dem 12. Jahrhundert zentral organisierte Wasserversorgung achtete man streng. Für sie war ein Brunnenmeister zuständig.30 Über Wasserrechte, Bach- und Grabenflüsse sowie die jeweilige Nutzung gab es immer wieder Streit, so daß ausführliche Vorschriften erlassen werden mußten.31 24 StadtAF, A 1 X b um 1500, o. D. u. ö. Vgl. Bd. 2 der Stadtgeschichte, S. 389/390. 25 StadtAF, A 1 X c. Vgl. Roecken, Brauckmann: Margaretha Jedefrau, S. 135–152 (S. 141– 143 Abdruck der Hebammenordnung von 1510), sowie den Beitrag von Ulrich Ecker über Armut und Krankheiten in diesem Band [Geschichte der Stadt Freiburg, Bd. 1, S. 468– 493]. 26 Stadt AF, A 1 X d. Vgl. die kaiserliche Verordnung wegen der Jahrmärkte vom 22.8.1465, in: UBF 2, S. 489–490 Nr. 548. Wiederum ist der Beitrag von Ulrich Ecker heranzuziehen. 27 UBF 2, S. 176–178 Nr. 376 (10.10.1402). 28 UBF 2, S. 126 Nr. 358. Vgl. hier und im folgenden: Stadtluft, Hirsebrei und Bettelmönch. Die Stadt um 1300. Hg. vom Landesdenkmalamt Baden-Württemberg und der Stadt Zürich. Hg. und Redaktion: Marianne und Niklaus Flüeler. Stuttgart 1992, S. 351–374. 29 Vgl. in diesem Band den Beitrag von Matthias Untermann über archäologische Funde in der Frühzeit der Stadt [Geschichte der Stadt Freiburg, Bd. 1, S. 88–119]. 30 UBF 1, S. 101–103 Nr. 37; FUB 2, S. 23–25 Nr. 15 (Verkauf einer Wasserleitung 20.6.1284); UBF 1, S. 301–302 Nr. 151 (Brunnenmeister 29.11.1333). Vgl. den Beitrag Ulrich Eckers über Armut und Krankheiten sowie den Beitrag Matthias Untermanns und sein Schlaglicht über Brunnen und Wasserleitungen [zusätzlich zum schon Genannten: Geschichte der Stadt Freiburg, Bd. 1, S. 496–500]. 31 Vgl. zusätzlich FUB 1, S. 218- 220 Nr. 246–247 (Wasserrechte des Klosters Adelhausen 1272); FUB 2, S. 23–25 Nr. 15 (Kloster St. Märgen verkauft am 20.6.1284 wegen Schulden einen Freiburger Wasserfluß an das Kloster Tennenbach), S. 147–148 Nr. 131 (29.11.1292 gemeinsame Wasserrechte). S. auch Johannes Werner: Die Zisterzienser von Tennenbach und der Wasserbau im mittelalterlichen Freiburg. In: ZGO [Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins] 140 (1992) S. 425–432.
148
|
Lebensformen im mittelalterlichen Freiburg
Ein besonders anschauliches Beispiel für die neuen Regelwerke sind die Kleiderordnungen. Sie wurden vor allem seit dem 15. Jahrhundert erlassen, etwa 1498 auf dem Reichstag zu Freiburg, und sollten nicht zuletzt Aufwand und Luxus beschränken. Aus dem Jahr 1359 wissen wir, daß der Münsterbaumeister alle zwei Jahre von der Stadt ein Gewand mit einem Pelz beanspruchen konnte. Das Tragen von Pelzwerk, abgestuft nach dem Wert des Tieres, war ein wichtiges Zeichen des sozialen Status. 1514 wurden die »schantlichen latzen« – wohl die modischen Brustlätze der Frauen – verboten. Ebenso regelte man die Zahl der Ringe, die getragen werden durften. Die Bestimmungen wiesen nach klaren Standes- und Vermögenskriterien den einzelnen Bevölkerungsgruppen zu, wie kostbar ihre Kleidung sein durfte. So symbolisierten sie unter Verweis auf eine göttliche Standes- und Weltordnung den Rang und die Zugehörigkeit der Menschen zu bestimmten Gruppen ebenso wie die Angemessenheit des jeweiligen Aufwandes. Niemand sollte durch übertriebenen Luxus in Not geraten, damit der Gemeinde zur Last fallen und die Ordnung stören. Darüber hinaus galt es, den jeweiligen Sittlichkeitsvorstellungen Nachdruck zu verleihen. Die neue Ehrbarkeit schloß eine Kontrolle der Körper ein.32 Selbst das Trinken spiegelte die soziale Hierarchie wider. Der Genuß von Wein blieb den vornehmen und wohlhabenderen Schichten vorbehalten, die ärmeren mußten sich mit Schwachbier oder Wasser, bestenfalls mit einem sauren Trestertrunk begnügen.33 In diesen Zusammenhang gehören schließlich die Hochzeitsord32 Liselotte Constanze Eisenbart: Kleiderordnungen der deutschen Städte zwischen 1350 und 1700. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des deutschen Bürgertums (Göttinger Bausteine zur Geschichtswissenschaft 32). Göttingen u. a. 1962; Helmut Hundsbichler: Kleidung und Norm. In: Alltag im Spätmittelalter. Hg. von Harry Kühnel. 3. Aufl. Graz u. a. 1986, S. 248–253; Neithard Bulst: Zum Problem städtischer und territorialer Kleider-, Aufwands- und Luxusgesetzgebung in Deutschland (13. bis Mitte 16. Jh.). In: Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’état. Hg. von André Gouron und Albert Rigaudière (Publications de Ia société d‘histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit 3). Montpellier 1988, S. 29–57; Zwischen Sein und Schein. Kleidung und Identität in der ständischen Gesellschaft. Sonderheft Saeculum 44/1 (1993). S. zu den Sittlichkeitsvorstellungen Ernst Ziegler: Sitte und Moral in früheren Zeiten. Zur Rechtsgeschichte der Reichsstadt und Republik St. Gallen. Sigmaringen 1991. Die Nachrichten von 1359 und 1514 bei Friedrich Hefele: Von alten Sitten und Bräuchen. In: Oberrheinische Heimat 28 (1941) S. 311–368, hier S. 350. Der Beschluß des Reichstages 1498: Deutsche Reichstagsakten. Mittlere Reihe: Reichstagsakten unter Maximilian I. Bd. 6: Reichstage von Lindau, Worms und Freiburg 1496–1498. Bearb. von Heinz Gollwitzer. Göttingen 1979, S. 718–746 Nr. 119, hier S. 735–736. Vgl. für die frühe Neuzeit Roecken, Brauckmann: Margaretha Jedefrau, S. 312–316. 33 Roland Bitsch: Trinken, Getränke, Trunkenheit. In: Essen und Trinken in Mittelalter und Neuzeit. Hg. von Irmgard Bitsch u. a. Sigmaringen 1987, S. 207–216, hier S. 209. Allgemein zu Essen und Trinken: Stadtluft, Hirsebrei und Bettelmönch, S. 289–345 (dabei S. 293–295 zu Nahrungspflanzenfunden in der Latrine 10, Gauchstraße); Speisen, Schlemmen, Fasten.
Von Ordnungen und Unordnungen
|
149
nungen. Auch sie sollten den um sich greifenden Luxus steuern, zuviel Müßiggang verhindern und zugleich die soziale Abstufung sinnfällig machen. So wurden die Zahl der Gäste je nach Stand reglementiert, das Ausmaß der Speisen und Getränke, der Wert der Geschenke, die Erlaubnis zum Tanz. 1380 beschloß der Rat, daß weder bei einer weltlichen noch bei einer geistlichen Hochzeit – damit dürfte die Primiz gemeint sein – mehr als zwölf »fahrende Leute« anwesend sein sollten, deren Geld- oder Naturalentlohnung ebenso wie Ausnahmen genau festgelegt wurden. 1424 und 1425 hieß es, neben Braut und Bräutigam seien nur noch die nächsten Verwandten einzuladen. Nach einer Verordnung von 1484 durften endlich in der Regel nicht mehr als 20 Personen geladen werden, die Feier selber nicht länger als zwei Tage dauern. Am Morgen solle es höchstens vier gekochte Essen geben, zum Nachtmahl drei. Fleisch und Fisch müßten dabei getrennt sein. Bestätigt wurde das Verbot, am Tag nach der Hochzeit Eier zu sammeln.34 Ähnliche Regelungen finden wir für Feste anläßlich von Kindstaufen oder Totenfeiern.35 Nach den häufigen Wiederholungen der Bestimmungen zu schließen, waren Übertretungen nicht eben selten.36 Eine Kulturgeschichte des Essens. Hg. von Uwe Schultz. Frankfurt a. M., Leipzig 1993. Vgl. B. Ann Tlusty: Das ehrbare Verbrechen. Die Kontrolle über das Trinken in Augsburg in der frühen Neuzeit. In: Zeitschrift des historischen Vereins für Schwaben 85 (1992) S. 133–155. 34 UBF 2, S. 359–360 Nr. 567–569 (31.10.1424); StadtAF, A 1 X b 1521 Nov. 27; B 2 Nr. 1 S. 170; B 5 XIII a Nr. 12 fol. 138v 1543 Okt. 1, Nr. 35 fol. 250v 1590 Jan. 29, Nr. 57 fol. 9v und fol. 27v 1624, vgl. Nr. 37 fol. 486v 1594 Sept. 30: Abschaffung des 2. Tages bei Hochzeitsfeiern; M 30 (um 1620); Heinrich Schreiber: Die Sittengeschichte der Stadt Freiburg. In: Freiburger Adreß-Kalender für das Jahr 1870, S. I–XVI, hier S. IV–V; Hefele: Von alten Sitten, S. 321–327. 35 UBF 2, S. 359–360 Nr. 567–569; eine Patenordnung gab es schon seit 1332: Ebd. 1, S. 283–284 Nr. 154; vgl. Schreiber: Sittengeschichte, S. V; Hefele: Von alten Sitten, S. 317–318. Roecken, Brauckmann: Margaretha Jedefrau, S. 139, interpretieren die Einschränkung der Tauffeste als Maßnahme gegen das ungezwungene Zusammentreffen von Frauen im Rahmen des sich wandelnden Frauenbildes. Dies hält auch Petronella Bange für möglich, weist aber daraufhin, daß doch der größere Zusammenhang der Verhaltensreglementierung von Männern wie von Frauen gesehen werden müsse (Frauen und Feste im Mittelalter: Kindbettfeiern. In: Feste und Feiern im Mittelalter. Paderborner Symposion des Mediävistenverbandes. Hg. von Detlef Altenburg, Jörg Jarnut und Hans-Hugo Steinhoff. Sigmaringen 1991, S. 125–132, hier bes. S. 131–132). Eine doppelte Disziplinierung der Frauen ist wohl nicht auszuschließen. 36 S. Anm. 34–35. Vgl. Bd. 2 der Stadtgeschichte, S. 390; Roecken, Brauckmann: Margaretha Jedefrau, S. 311–312. Ein späteres Beispiel für Übertretungen ist 1665 eine Auseinandersetzung zwischen der Stadt und dem Schaffner des Klosterhofes Schuttern, der eine Geldstrafe zahlen soll, weil an seiner Hochzeit zu viele Gäste teilgenommen hätten. Der Abt schreitet dagegen ein und erklärt, er könne in seinem Klosterhof tun und lassen, was er wolle, die Stadt habe ihm nicht hineinzureden (StadtAF, C 1 Criminalia 26 Nr. 10 1665 Juli 1; zu den Beziehungen zwischen Freiburg und dem Kloster Schuttern vgl. in diesem
150
|
Lebensformen im mittelalterlichen Freiburg
Aus all den Ordnungen gewinnen wir ein Bild der gesellschaftlichen Gliederung. Zugleich nehmen wir teil an den immer stärker werdenden Bestrebungen der geistlichen und weltlichen Obrigkeit, das Verhalten der Menschen zu regeln. Dabei sollte wohl auch der sich abzeichnenden Tendenz entgegengewirkt werden, die eigene Person und den Luxus, den man sich erlauben konnte, zur Schau zu stellen und dabei den religiösen Sinn der Feier in den Hintergrund treten zu lassen. Neben der Ruinierung ganzer Familien befürchtete man vermutlich mögliche Konflikte zwischen einzelnen Gruppen. Hinter dem Kampf gegen »Ausschweifungen« steckte oft die Furcht, das Fest könne außer Kontrolle geraten. Die Disziplinierung der Körper war somit Teil der sozialen Disziplinierung.37 Zu diesem Prozeß gehörte die Ausgrenzung solcher Personen und Gruppen, die nicht den gesetzten Normen entsprachen oder sie nicht einhalten wollten. Um die Gesellschaft neu zu festigen, mußte sie sich von »Anderen« abgrenzen. Erst jetzt wurden Gruppen, die eine eigene Gesellschaft und Kultur bildeten – wie die Juden38 und in gewisser Weise auch die »Zigeuner« –, sowie Personen, die einen als minderwertig angesehenen, jetzt »unehrlich« genannten Beruf ausübten, die man sozial verachtete oder die außerhalb der Gesellschaft lebten, zu Außenseitern und Randgruppen.39 Aussätzige sollten mit »Gesunden« nicht in
Band Jürgen Treffeisens Beitrag über Klöster und Orden als Bürger und Einwohner der Stadt [Geschichte der Stadt Freiburg, Bd. 1, S. 449–457]). 37 Vgl. Roger Chartier: Phantasie und Disziplin. Das Fest in Frankreich vom 15. bis 18. Jh. In: Volkskultur. Zur Wiederentdeckung des vergessenen Alltags (16.–20. Jh.). Hg. von Richard van Dülmen und Norbert Schindler. Frankfurt a. M. 1984, S. 153–176, hier bes. S. 158–161; Neithard Bulst: Feste und Feiern unter Auflagen. Mittelalterliche Tauf-, Hochzeits- und Begräbnisordnungen in Deutschland und Frankreich. In: Feste und Feiern, S. 39–51 (er weist auch darauf hin, daß aufgrund der Öffentlichkeit der Feste und der hohen Strafgelder der Druck sehr hoch war und dadurch die Durchsetzbarkeit der Ordnungen – trotz aller Übertretungen – letztlich erleichtert wurde). 38 Vgl. den Beitrag von Peter Schickl in diesem Band. 39 Grundlegend: Graus: Randgruppen, passim, hier bes. S. 395; vgl. (mit einigen Differenzierungen) Wolfgang Hartung: Gesellschaftliche Randgruppen im Spätmittelalter. Phänomen und Begriff. In: Städtische Randgruppen und Minderheiten. 23. Arbeitstagung in Worms, 16.–18.11.1984. Hg. von Bernhard Kirchgässner und Fritz Reuter (Stadt in der Geschichte. Veröffentlichungen des Südwestdeutschen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung 13). Sigmaringen 1986, S. 49–114, zum Begriff bes. S. 111 ff. (s. ebenfalls die übrigen Beiträge des Bandes); Randgruppen der spätmittelalterlichen Gesellschaft. Ein Hand- und Studienbuch. Hg. von Bernd-Ulrich Hergemöller. Warendorf 1990. Die Titel sind auch im folgenden heranzuziehen. Als anschauliches Beispiel: Franz Irsigler, Arnold Lassotta: Bettler und Gaukler, Dirnen und Henker. Außenseiter in einer mittelalterlichen Stadt. Köln 1300–1600. München 1989.
Von Ordnungen und Unordnungen
|
151
Berührung kommen.40 Müller, Weber und Schäfer genossen keine besondere Achtung, weil es sich um Berufe agrarischen Ursprungs handelte und man bei ihnen nicht zu kontrollierende Betrügereien oder Verstöße gegen sittliche Normen vermutete. Die Bader und ebenso die Scherer zählten – im Gegensatz zu anderen Städten – in Freiburg nicht zu den »unehrlichen Leuten«; sie waren Mitglieder der Malerzunft. Als »unrein« galt dagegen der Scharfrichter. So verbot ihm der Rat in der Dienstordnung vom 20. März 1577, auf dem Markt oder auf der Metzig etwas anzugreifen oder zu nehmen, was er nicht kaufte, »damit er niemand kein abscheuhen gebe«.41 »Fahrende Leute«, Gaukler und Spielleute – Bärenführer, Artisten, Schauspieler, Pfeifer und Trommler – standen unter dem Verdacht, leicht die Ordnung zu stören und einen unsittlichen Lebenswandel zu führen.42 Trotz aller ausgrenzenden Vorschriften waren die Randgruppen teilweise fest in das städtische Leben integriert. Seit dem 14. Jahrhundert versuchte man zunehmend, die Prostitution zu überwachen und zu organisieren. Deshalb sollten etwa die öffentlichen Badehäuser, in denen Frauen und Männer nicht getrennt waren, verboten werden. Eine vollständige Unterdrückung solcher Badstuben erwies sich allerdings als unmöglich. Ein Zeichen der Reglementierungstendenz ist das zumindest Anfang des 16. Jahrhunderts in der Vorstadt Neuburg bestehende »Frauenhaus« »zur kurzen Freud«. Der Frauenwirt, der recht gut verdiente, hatte bei Dienstantritt dem Aufsicht führenden Stadtknecht und dessen Frau beträchtliche Abgaben zu leisten.43 40 Vgl. in diesem Band Ulrich Eckers Beitrag über Armut und Krankheiten. Anregend im Vergleich: Anna Althaus: Die Aussätzigen – eine Randgruppe im mittelalterlichen Basel. Unveröffentl. Lizentiatsarbeit. Basel 1995. 41 StadtAF, A 1 X b 1577 März 20. Vgl. ebd., C 1 Diener und Dienste 20 Nr. 18, 33 Nr. 2; UBF 2, S. 85 Nr. 339 (Besoldung um 1390). Der Scharfrichter hatte auch die Abtritte zu leeren (vgl. in diesem Band Ulrich Eckers Beitrag über Armut und Krankheiten). Zur Rolle des Henkers in der Fastnacht: Peter Weidkuhn: Fastnacht – Revolte – Revolution. In: Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte 21 (1969) S. 289–306, hier S. 293–294. Vgl. Jutta Nowosadtko: Scharfrichter und Abdecker. Der Alltag zweier »unehrlicher Berufe« in der Frühen Neuzeit. Paderborn 1994. 42 StadtAF, B 2 Nr. 1 S. 170 (1380: »varende lùte« bei Hochzeiten); B 5 XIII a Nr. 26 fol. 140v 1575 Juni 3, fol. 313v 1576 Jan. 27: Verbote im Zusammenhang mit der Pest, Nr. 44 fol. 376 1608 Juli 28: Michel Lützen kann das Vaterunser in 30 oder 40 Sprachen vortragen, Nr. 57 fol. 484v 1626 Febr. 20: Peter Stadellman schreibt mangels anderer Glieder mit den Füßen, vgl. ebd. fol. 488. 43 Hefele: Von alten Sitten, S. 351; vgl. wieder Ulrich Eckers Beitrag. Allgemein s. Ernst Schubert: Gauner, Dirnen und Gelichter in deutschen Städten des Mittelalters. In: Mentalität und Alltag im Spätmittelalter. Hg. von Cord Meckseper und Elisabeth Schraut. 2. Aufl. Göttingen 1991, S. 111–126. Die Tendenz der Unterdrückung von gemeinsamen Badstuben wird bei vergleichender Betrachtung deutlich: s. etwa Stadt der Frauen, S. 127– 131. Die Institutionalisierung der Prostitution hängt auch mit dem relativ hohen Heiratsalter der Männer – gerade der Gesellen – zusammen, man wollte sie von den »ehrbaren«
152
|
Lebensformen im mittelalterlichen Freiburg
Die Bettler organisierten sich – wie in der ersten »Bettlerordnung« vom 29. April 1517 festgeschrieben wurde – in einer Zunft mit eigener Gerichtsbarkeit. An der Spitze stand der Bettelvogt, der selbst Bettler war.44 Vorher wurden die Bettler keineswegs nur geduldet, sondern geradezu als Mittler, gute Werke zu tun und damit das Seelenheil zu gewinnen, angesehen. Öffentliches wie privates Armen- und Almosenwesen waren weit entwickelt. Dafür gab es zahlreiche Anlässe. So hatte sich der »Weihnachtspfennig« eingebürgert, den der Rat 1332 nur noch als Gabe innerhalb des Hauses zuließ. Im 16. Jahrhundert, als die Zahl der Bettler sprunghaft anstieg, wandelte sich die Einstellung: Armut wurde zu einem sozialen Ärgernis. Ein frühes Zeichen für diese neue Sichtweise war schon das Verbot vom 31. Oktober 1424 gewesen, ohne ausdrückliche Erlaubnis des Rates vor oder in einer Kirche zu betteln. Darüber hinaus suchte man jetzt die Zuwanderung von Bettlern zu verhindern und band die Unterstützungsleistungen an konkrete Kriterien.45 Die »Zigeuner« wollte man hingegen von vornherein nicht haben: Sie zogen in Gruppen seit Beginn des 15. Jahrhunderts auch durch Deutschland; im Markgräflerland werden sie erstmals 1422 erwähnt. Sehr rasch schob man ihnen alle Diebstähle und Betrügereien in die Schuhe und verdächtigte sie der Spionage für die Türken. Der Reichstag zu Freiburg erklärte sie 1498 für vogelfrei, wenn sie nicht das Land verließen. Offenbar konnte dieser Beschluß nicht durchgesetzt werden: 1510 lagerte eine Anzahl im Dreisamtal, und der städtische Magistrat befahl seinem Kirchzartener Talvogt, bei ihnen zu überprüfen, ob dort nicht die einer Freiburgerin entwendeten Schmuckstücke zu finden seien. 1535 wurde in Freiburg ein »Haufen« verhaftet und mußte Urfehde schwören, daß er nie wieder in das Stadtgebiet und die vorderösterreichischen Lande zurückkehren werde. Oft
Töchtern fernhalten; vgl. Wunder: Überlegungen, S. 17. Zum Prozeß der Marginalisierung der Prostitution: Graus: Randgruppen, S. 404–410. 44 StadtAF, A 1 X a 1517 April 29; Anton Retzbach: Die Freiburger Armenpflege im 16. Jh., besonders die Bettlerordnung vom 29. April 1517. In: ZGGF [Zeitschrift der Gesellschaft für Beförderung der Geschichts-, Altertums- und Volkskunde von Freiburg, dem Breisgau und den angrenzenden Landschaften] 33 (1917) S. 107–158, hier S. 124, 137 ff., 151 ff. Vgl. Friedrich Hefele: Vom Pranger und verwandten Strafarten in Freiburg. Eine topographische und rechtsgeschichtliche Untersuchung. In: SiL 62 (1935) S. 56–79, hier S. 69; ders.: Von alten Sitten, S. 321. Vgl. im einzelnen in diesem Band Ulrich Eckers Beitrag zu Armut und Krankheiten. Zum Vorgang der Marginalisierung und zu Bettlerbruderschaften s. Graus: Randgruppen, S. 410–411, 430–431. 45 UBF 2, S. 360 Nr. 567 (31.10.1442). Zum »Weihnachtspfennig« s. Hefele: Von alten Sitten, S. 313, vgl. 340–342. Insgesamt ist wieder Ulrich Eckers Beitrag heranzuziehen. Zum Wandel der Einstellung gegenüber Armut und Armen vgl. Bd. 2 der Stadtgeschichte, S. 354–367.
Von Ordnungen und Unordnungen
|
153
wird man zwischen den »Zigeunern«, anderen »fahrenden Leuten«, Vaganten und Brandstiftern nicht besonders unterschieden haben.46 Für viele dieser Randgruppen war im übrigen eine besondere Kleidung selbstverständlich. Sie konnte Identität stiften, »stigmatisierte« als Vorschrift aber auch die betreffende Bevölkerungsgruppe als körperlich behinderte, soziale, moralische oder religiöse Außenseiter der Gesellschaft. Die Juden hatten ihre Tracht, die sie von Christen unterschied – namentlich den spitzen Hut und die Art, den Bart zu schneiden –, selbst gewählt. Als sich die Moden anzugleichen begannen, verstärkte sich seit dem 13. Jahrhundert der Druck weltlicher Obrigkeiten, die kirchlichen Beschlüsse über Judenabzeichen in die Praxis umzusetzen. Neben die Festschreibung des spitzen Hutes und spezieller Schleier für Frauen traten im 15. und vor allem im 16. Jahrhundert Kennzeichen wie der gelbe Ring, der an das Oberkleid geheftet werden mußte. Prostituierte sollten hervorstechende, auffällige Kleidung tragen, und seit dem 15. Jahrhundert wurde ihnen mehr und mehr verboten, sich derart kostbar zu kleiden, wie es auch »ehrbare« Frauen taten. Vorschriften für Aussätzige bezweckten, daß diese, um die Ansteckungsgefahr zu bannen, leicht erkannt werden konnten – die Leprosen etwa durch den langen schwarzen Mantel und die Klapper, mit der sie um Almosen betteln durften. Die Bettler trugen ein Symbol an ihrer Kleidung, das sie als »berechtigte« Almosenempfänger auswies, von ihnen dennoch eher als diskriminierend denn als ehrend empfunden wurde. In Freiburg war es in der Regel ein »spenglin«. Auch der Scharfrichter hatte sich mit einem Zeichen kenntlich zu machen.47 Wenngleich es gewiß verschiedenartige Ausprägungen von Lebensformen gab, erscheint eine prinzipielle Unterscheidung zwischen Elite- und Volkskultur fragwürdig. Die Teilhabe an kulturellen Ausdrucksweisen verlief quer zu allen Ständen und Schichten.48 46 Adolf Poinsignon: Die Zigeuner am Oberrhein. In: SiL 14 (1887) S. 68–77. Der Beschluß des Reichstages: Deutsche Reichstagsakten. Mittlere Reihe: Reichstagsakten unter Maximilian I. Bd. 6, S. 736–737. Zur Türkengefahr vgl. auch den Ratsbeschluß vom 16.9.1502 bei Hefele: Von alten Sitten, S. 353. 47 Robert Jütte: Stigma-Symbole. Kleidung als identitätsstiftendes Merkmal bei spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Randgruppen (Juden, Dirnen, Aussätzige, Bettler). In: Saeculum 44 (1993) S. 65–89. Zu den Freiburger Abzeichen s. Hefele: Von alten Sitten, S. 341, 351. Vgl. den Abschnitt über Kleiderordnungen sowie Ulrich Eckers Beitrag in diesem Band. 48 Ich gehe hier von einem »weiten« Kulturbegriff aus. Vgl. Gilomen: Volkskultur, passim; auch Dieter Scheler: Inszenierte Wirklichkeit: Spätmittelalterliche Prozessionen zwischen Obrigkeit und »Volk«. In: Von Aufbruch und Utopie, S. 119–129; Volkskultur des europäischen Spätmittelalters. Hg. von Peter Dinzelbacher und Hans-Dieter Mück (Böblinger Forum 1). Stuttgart 1987. Anschauliche Einführungen in verschiedene Lebensbereiche, die allerdings für Freiburg nicht in jedem Fall zutreffen: Arno Borst: Lebensformen im Mittelalter. Frankfurt a. M. 1979; Otto Borst: Alltagsleben im Mittelalter. Frankfurt a. M. 1983; Alltag im
154
|
Lebensformen im mittelalterlichen Freiburg
Der Mittelpunkt des städtischen Lebens, der all diese Aspekte symbolisierte, war das Münster und der es umgebende Platz. Wer sich der Kirche näherte, wurde nicht nur an die Glorie Gottes erinnert, sondern auch an die Ordnung der Welt, die man auf diesen zurückführte. Wenn er oder sie durch das Hauptportal schritt, wurden ihm oder ihr diese Ordnung des himmlischen und irdischen Reiches sowie die Erwartung des Jüngsten Gerichts im Tympanon sinnfällig vor Augen geführt. Jeder Stein des Münsters redete und brachte – ebenso wie die erzählenden bildlichen Darstellungen – den Menschen symbolisch Deutungsmuster für ihr Leben nahe. Zugleich konnten sich die Bürger der Stadt mit dem Bauwerk identifizieren. Zwar hatte es der Stadtherr in Auftrag gegeben und war auch an der Finanzierung beteiligt, doch die Bürger trugen ebenfalls einen guten Teil dazu bei. Nicht zuletzt bezeugten dies die Stiftungen zahlreicher Bürger und der Zünfte. Das Münster drückte somit das Heil und das Wohlergehen der gesamten Stadt aus und gewährte zudem allen Menschen den Schutz Gottes.49 Die Funktionen der Kirche erfaßten beinahe sämtliche Bereiche des Alltags. Im Zentrum stand selbstverständlich der Gottesdienst. Wichtig war auch die Beichte, um seine Sünden zu bekennen, Buße und Absolution zu erhalten. Die für 1627 belegte Ablieferung der Beichtzettel, um zu beweisen, daß man seiner Pflicht nachgekommen sei, war vermutlich in früheren Zeiten nicht üblich.50 Daneben verbanden sich die wichtigsten Abschnitte des Lebens mit dem Münster. Die Taufe nahm der Pfarrer hier vor – die schönen Taufsteine geben davon Zeugnis –, und wahrscheinlich vor der Nordpforte des Chores – vor 1600 jedenfalls nicht in der Kirche – wurden die Ehen geschlossen: Das Portalrelief stellt Gottvater dar, der die Hände von Adam und Eva ineinander legt.51 Die Ehe war erst im Spätmittelalter; Hartmut Boockmann: Die Stadt im späten Mittelalter. München 1986; Zur Lebensweise in der Stadt um 1200. Ergebnisse der Mittelalter-Archäologie. Bericht über ein Kolloquium in Köln vom 31.1. bis 2.2.1984. Hg. von Heiko Steuer (Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters. Beiheft 4). Köln, Bonn 1986; Werner Meyer: Hirsebrei und Hellebarden. Auf den Spuren des mittelalterlichen Lebens in der Schweiz. 2. Aufl. Olten, Freiburg 1986; Gerhard Jaritz: Zwischen Augenblick und Ewigkeit. Einführung in die Alltagsgeschichte des Mittelalters. Wien, Köln 1989; Stadtluft, Hirsebrei und Bettelmönch. 49 Konrad Kunze: Himmel in Stein. Das Freiburger Münster. Vom Sinn mittelalterlicher Kirchenbauten. Freiburg u. a. 1986. Vgl. die Beiträge über das Münster in diesem Band; Michael Brunner: Zum Tympanon am südlichen Querhausportal des Freiburger Münsters. In: SiL 113 (1994) S. 7–13; Norbert Ohler: Das Freiburger Münster. Ein Literaturbericht. In: Ebd., S. 15–44. 50 Hans Schadek: Bürgerschaft und Kirche. Das Freiburger Münster im Leben der mittelalterlichen Stadt. In: 100 Jahre Freiburger Münsterbauverein 1890–1990. Hg. von Hugo Ott. Freiburg 1990, S. 95–124, hier S. 116. 51 Wolfgang Müller: Mittelalterliche Formen kirchlichen Lebens am Freiburger Münster. In: Freiburg im Mittelalter. Vorträge zum Stadtjubiläum 1970. Hg. von Wolfgang Müller (VAlemInst 29). Bühl/Baden 1970, S. 141–181, hier S. 176.
Von Ordnungen und Unordnungen
|
155
12. Jahrhundert zu einem Sakrament erklärt worden, und die damit verbundenen Vorstellungen deuteten auf einen Wandel der Frauenrolle hin.52 Die Jungfräulichkeit Marias erhielt zusehends einen neuen Stellenwert. In wachsendem Maße, wenngleich von heftigen Auseinandersetzungen begleitet, gingen Theologen nun davon aus, daß nicht erst die jungfräuliche Empfängnis Jesus vor der Erbsünde bewahrt habe, sondern daß Maria bereits im Schoße ihrer Mutter von dieser befreit worden sei. Während immer stärker die Übertragung der Erbsünde durch die menschliche Sexualität betont wurde, blieb jetzt Maria seit ihrer Geburt von allen Schwächen, die aus der Erbsünde herrührten, verschont.53 Entsprechend breitete sich die Marienverehrung aus (und verband sich mit der Verehrung der der Gottesmutter geweihten Kirchen).54 Jungfräulichkeit selbst wurde zum Ideal der Brautschaft mit Jesus Christus und führte zur Aufwertung der Nonnen. Zwar wurde auch die Ehe religiös erhöht, da sie die Fortpflanzung gläubiger Christen ermöglichte, doch zugleich die Sexualität auf diese Funktion beschränkt und damit die Frau als bedrohliche »Versuchung« für den Mann sittlich diesem untergeordnet. »Ein zurückgezogenes Leben, Dienstfertigkeit, Demut, uneigennütziges Wirken in Familie und Gesellschaft« formten die neue Frauenrolle und verbanden sich mit der Forderung nach Buße für die Sünden.55 Das nun verbreitete Bild Mariens bot vielen Frauen die Möglichkeit, sich mit ihr zu identifizie52 Vgl. Claudia Opitz: Hunger nach Unberührbarkeit? Jungfräulichkeitsideal und weibliche Libido im späten Mittelalter. In: Feministische Studien (1986) S. 59–75. 53 Elisabeth Gössmann: Reflexionen zur mariologischen Dogmengeschichte. In: Maria – Abbild oder Vorbild? Zur Sozialgeschichte der mittelalterlichen Marienverehrung. Hg. von Hedwig Röckelein, Claudia Opitz und Dieter R. Bauer. Tübingen 1990, S. 19–36. 54 Vgl. Gabriela Signori: Marienbilder im Vergleich: Marianische Wunderbücher zwischen Weltklerus, städtischer Ständevielfalt und ländlichen Subsistenzproblemen (10. bis 13. Jh.). In: Ebd., S. 58–90. Das Freiburger Münster war – entgegen anderen Annahmen – von Anfang an Maria geweiht, und ihre Darstellungen in der Kirche sind überdurchschnittlich hoch (Brunner: Zum Tympanon, S. 7–8). Vgl. Jutta Held: Marienbild und Volksfrömmigkeit. Zur Funktion der Marienverehrung im Hoch- und Spätmittelalter. In: Frauen – Bilder, Männer – Mythen. Kunsthistorische Beiträge. Hg. von Ilsebill Barta u. a. Berlin 1987, S. 35–68. S. auch in diesem Band die Beiträge zum Münster, namentlich die Ausführungen Peter Kurmanns zu Maria und Ecclesia (auch im folgenden). 55 Opitz: Hunger (S. 66 weist sie allerdings auch darauf hin, daß aufgrund der Sakramentalisierung der Ehe Forderungen nach Gleichstellung der Geschlechter im Rahmen der ehelichen Beziehungen aufkamen). Das Auftreten der Beginen wie die Zuschreibung barmherziger Werke als Aufgabe der Frau, um der Last der Sünde entgegenzuwirken, hingen ebenfalls mit dieser Bewegung zusammen: Martina Wehrli-Johns: Haushälterin Gottes. Zur Mariennachfolge der Beginen. In: Maria – Abbild oder Vorbild, S. 147–167, Zitat S. 161. Nur hingewiesen sei hier darauf, daß der Wandel des Marien- und Frauenbildes mit den Ursprüngen des Hexenwesens im 15. Jh. in Beziehung steht. Vgl. Bd. 2 der Stadtgeschichte, S. 398–417.
156
|
Lebensformen im mittelalterlichen Freiburg
ren, damit ihren Protest gegen Zwänge zu zeigen oder zumindest einen eigenen Raum in der Gesellschaft zu finden. Andererseits nutzte es die Kirche, die sich symbolisch mit Maria in eins setzte, um ihren Einfluß zu erhöhen. Das Freiburger Münster versinnbildlicht diesen Anspruch. Seit dem 14. Jahrhundert wurden auch in Freiburg, jedenfalls nach den schriftlichen Zeugnissen zu schließen, die Ehe und mit ihr zusammenhängende Probleme mehr und mehr zu einem Gegenstand öffentlichen Interesses.56 Am 11. Januar 1339 erließ der Rat der Stadt eine Verordnung zu einem Sonderfall, der – so könnte man indirekt vermuten – eben zu dieser Zeit Anstoß erregte: Wer eine heimliche Ehe schließe oder ein betrügerisches Eheversprechen leiste, solle seines Vermögens verlustig gehen und auf ewig der Stadt verwiesen werden. Mitwisser und Helfer, seien es Geistliche oder Laien, verfielen ebenfalls der Strafe.57 Im Laufe der Zeit, besonders gegen Ende des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts, nahmen desgleichen die Streitigkeiten über die Eheführung und über eine mögliche Trennung zu, die vor den Rat oder das Gericht kamen. Mehrfach versuchten Frauen, deren Männer »verschwunden« waren, die Ehe für ungültig erklären zu lassen. Doch in der Regel hieß es, die Ehe sei so lange gültig, bis sich Genaueres über Leben oder Tod des Mannes herausstelle – die Frau blieb somit möglicherweise auf Dauer an eine längst nicht mehr bestehende Ehe gebunden.58 Während bei einem Ehebruch durch die Frau die Gemeinschaft ohne weiteres gelöst werden konnte,59 hatte es die Frau schwerer, sich im Konfliktfall gegen ihren Mann durchzusetzen. Immerhin konnte sie, so in einem Fall von 1493, gegen Beleidigung und Mißhandlung seitens des Mannes klagen.60 Schwierig wurde es, wenn sie die Scheidung wegen Impotenz erreichen wollte. Der Bischof verlangte – etwa im Verfahren der Anna Müllerin gegen Andreas Franck 1485 – vor einer Zustimmung, die Impotenz müsse erst hinreichend erwiesen sein, was natür56 Vgl. allgemein Opitz: Frauenalltag, S. 86 ff., 114 ff., bes. S. 136 ff. Wie eine Heiratsvermittlung in großbürgerlichen Kreisen aussah, schildert Hefele am Beispiel Peter Sprungs (Von alten Sitten, S. 319–320). Inwieweit es institutionelle Anbahnungsbräuche, vergleichbar den Lichtstuben, gab und ob das »Bosseln« (Fensterklopfen) vor Weihnachten dazu gehörte (Friedrich Hefele: Alte Sitten und Bräuche in Freiburg und im Breisgau. In: BH [Badische Heimat] 16 (1929) S. 132–144, hier S. 133), muß offen bleiben (vgl. Wörterbuch der deutschen Volkskunde. 3. Aufl. Stuttgart 1974, S. 454–455). Hin und wieder gab es offenbar Entführungen, um eine Hochzeit zu erzwingen: Heinrich Schreiber: Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg im Breisgau. Bd. 2. Freiburg 1859, S. 92–93 (1516). 57 StadtAF, A 1 X b 1339 Jan. 11; vgl. UBF 1, S. 341–342 Nr. 173. 58 Als Beispiel: StadtAF, A 1 Xll f 1510 März 27. 59 Etwa ebd., 1522 April 7. Zur »ehebrecherischen Unzucht« vgl. auch A 1 XI e 1467 April 13 u. ö. 60 StadtAF, A 1 XI e 1493 Sep. 14. Vgl. Opitz: Frauenalltag, S. 140 ff.
Von Ordnungen und Unordnungen
|
157
lich auf erhebliche Probleme gestoßen sein dürfte.61 Wollte eine Frau, die ihren Mann verlassen hatte, sich mit diesem versöhnen – so Anna Habernerin mit Hans Stöcklin 1510 – und wurde von ihm wieder in Gnaden aufgenommen, so mußte sie gute Führung geloben, da sie andernfalls jegliche Erbansprüche verlor.62 Kehren wir zum Münster zurück. Hier fand des weiteren die Messe aus Anlaß des Todes statt. Zahlreiche Bürger hatten mit ihren Stiftungen zugleich das Recht erworben, daß zu ihrem Gedenken und Seelenheil immer wieder Messen gelesen wurden.63 Hervorgehobene Persönlichkeiten und Geschlechter wurden auch im Münster bestattet, die übrigen Bürger auf dem unmittelbar angrenzenden Friedhof. Erst 1515 mußte er geschlossen werden, weil er nicht mehr erweitert werden konnte.64 Ob schon vorher, wie für 1560 berichtet, niemand etwas dabei fand, wenn dort Wäsche aufgehängt wurde, wissen wir nicht. Ohnehin spielte sich auf dem Friedhof viel Leben ab: Er war Treffpunkt des »gemeinen Volkes«, und hier herrschte Rechtsfriede, so daß bestimmte Rechtsakte vollzogen werden konnten und er bis 1641 als Gerichtsort für schwere Strafsachen, als »Blutgericht« diente. Wurde Alarm gegeben, versammelte sich hier die Bürgerschaft.65 An Palmsonntag veranstaltete man ein besonderes Schauspiel: Ein auf Rollen gestellter und in Schienen laufender hölzerner Esel wurde auf der Friedhofsmauer – die deshalb bis in spätere Zeiten selbst »Esel« hieß – hin und hergezogen. Kinder durften gegen Bezahlung darauf reiten.66 61 StadtAF, A 1 XII f 1485 Sep. 5, vgl. 1468 Mai 11. 62 Ebd. 1510 Mai 2. Einen Sonderfall stellten die – wohl im Zusammenhang mit der Reformation – von Basel und Straßburg nach Freiburg »entlaufenen« Frauen dar, die hier u. a. bei den Priestern »sitzen« wollten, vgl. ebd. 1531, mehrfach. Hingewiesen sei auf einen Fall von lesbischer Liebe 1547, der mit Pranger und Ausweisung bestraft wurde (Hefele: Vom Pranger, S. 67–68; Roecken, Brauckmann: Margaretha Jedefrau, S. 295–298). 63 Schadek: Bürgerschaft, S. 100–114; vgl. Das Jahrzeitbuch des Münsters zu Freiburg im Breisgau (um 1455–1723). Ed. und kommentiert von Erwin Butz. 2 Bde. (FoLg 31). Freiburg, München 1983. 64 Schadek: Bürgerschaft, S. 106–109, 119. 65 Hefele: Von alten Sitten, S. 361; Joseph Willmann: Die Strafgerichtsverfassung und die Hauptbeweismittel im Strafverfahren der Stadt Freiburg i. Br. bis zur Einführung des neuen Stadtrechts (1520). Ein Beitrag zum deutschen Strafprozeßrecht im Mittelalter. 1. Teil: Die Strafgerichtsverfassung. In: ZGGF 33 (1917) S. 4–106, hier S. 73, 75. Vgl. Jacques Heers: Vom Mummenschanz zum Machttheater. Europäische Festkultur im Mittelalter. Frankfurt a. M. 1986, S. 57–61. Umfassend: Martin Illi: Wohin die Toten gingen. Begräbnis und Kirchhof in der vorindustriellen Stadt. Zürich 1992. Vgl. in diesem Band Ulrich Eckers Schlaglicht »Andreas-Kapelle, Esel und Bäckerlicht« [Geschichte der Stadt Freiburg, Bd. 1, S. 376–379]. 66 Adolf Poinsignon: Die alten Friedhöfe der Stadt Freiburg i. B. ln: Adreßbuch der Stadt Freiburg i. Br. für das Jahr 1890, S. 1–23, hier S. 1 mit Anm. 1; Hefele: Alte Sitten, S. 137. Vgl. Heers: Mummenschanz, S. 156–164.
158
|
Lebensformen im mittelalterlichen Freiburg
Bei der Fronleichnamsprozession, die für Freiburg seit der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts belegt ist, gingen »lebende Bilder« mit, die die Heilsgeschichte darstellten. Dabei wurde jeder Zunft nach einer festen Platzordnung ein Bild zugewiesen. Nach einer Prozessionsordnung von 1516 etwa zog die Malerzunft an der Spitze. Ihre Mitglieder waren verkleidet als Teufel mit dem Adamsbaume, als Adam und Eva sowie als Engel mit dem Schwerte. Am Schluß hatten sich die Angehörigen der Rebleutezunft als Teufel mit den verdammten Seelen zu maskieren. An einzelnen Stationen der Prozession wurden die Szenen auch gespielt. Solche Spiele sind erstmals für 1479 nachgewiesen. Entsprechend lang dauerte die Prozession und verband sich mit einem Volksfest, das zahlreiche Besucher von auswärts anzog und nicht selten in Händel und Unfug ausartete. Die Teilnahme der Zünfte an Prozessionen wies – ebenso wie der Schmuck der Stadt aus Anlaß des Umzuges – augenscheinlich darauf hin, daß diese eine Sache der gesamten Bürgerschaft waren, was den Bitten gegenüber Gott mehr Nachdruck verleihen sollte.67 Sinnfällig dokumentierte sich im Münster – durch bildliche und figürliche Darstellungen wie durch Reliquien – die Verehrung der Heiligen, die man zum Schutz oder zur Hilfe in der Not anrufen und über die man unmittelbar mit Gott in Kontakt treten konnte. Welche Bedeutung dies im täglichen Leben einnahm, zeigt sich schon darin, daß sich bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts die Praxis durchsetzte, die Tage nach dem Heiligenkalender zu zählen.68 In der Heiligen67 Eva Kimminich: Prozessionsteufel, Herrgottsmaschinen und Hakenkreuzflaggen. Zur Geschichte des Fronleichnamsfestes in Freiburg und Baden (StuG 14). Freiburg 1990, S. 7–12; Gerchow: Bruderschaften, S. 52–53; Hefele: Alte Sitten, S. 139–142. Vgl. Heinrich Müller: Das Freiburger Fronleichnamsfest und seine geschichtliche Entwicklung. Freiburg 1926. Dietz-Rüdiger Moser interpretiert die Einführung des Fronleichnamsfestes zwischen 1264 und 1311 letztlich als kirchlich beabsichtigtes Gegenfest zur Fastnacht im Rahmen von Augustinus‹ Zwei-Staaten-Modell (Fasnacht und Fronleichnam als Gegenfeste. Festgestaltung und Festbrauch im liturgischen Kontext. In: Feste und Feiern, S. 359–376). Auf die grundsätzlichen Probleme dieses Ansatzes, der nur den Blick »von oben« auf kulturelle Erscheinungen richtet und dabei einen möglichen »Eigen-Sinn« der Menschen bei ihren Haltungen nicht in Betracht zieht, weist u. a. Norbert Schindler nachdrücklich hin (Widerspenstige Leute. Studien zur Volkskultur der frühen Neuzeit. Frankfurt a. M. 1992, hier S. 121–174). Allgemein zur Funktion von Prozessionen: Scheler: Inszenierte Wirklichkeit. Interessant wäre es, einmal den Gang der Inszenierungen – von den mittelalterlichen Prozessionen und öffentlichen Ritualen bis hin zu den Umzügen der NS-Zeit –, wie sie in den drei Bänden der Stadtgeschichte dokumentiert sind, zu verfolgen und zu analysieren. 68 Vgl. die Abschnitte über das Münster in diesem Band oder auch das Beispiel der Schutzfunktion des heiligen Nikolaus im Beitrag von Peter Schickl über die Juden in Freiburg. Allgemein: Werner Bergmann: Die Heiligen und das Profane. Zur Bedeutung der Heiligenverehrung und des Patroziniums in der mittelalterlichen Gesellschaft. In: Von Aufbruch und Utopie, S. 107–118. Allgemein auch: Aaron J. Gurjewitsch: Mittelalterliche Volkskultur. München 1987. Zum Vergleich: Hans Reinhardt: Die Schutzheiligen Basels. In: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 65 (1965) S. 85–93; Hans Georg Wacker-
Von Ordnungen und Unordnungen
|
159
verehrung wie bei den Prozessionen drückte sich im übrigen besonders deutlich die magische Komponente der Religion aus.69 Auch in vielen Bräuchen – das sei hier nur am Rande vermerkt – schimmern magische Erwartungshaltungen durch. So schenkten Bürgermeister und Rat 1519 der Frau des vorderösterreichischen Kanzlers Nikolaus Bapst einen Trinkbecher im Hinblick auf das Kindbett und einen Ring, »der zu probierung der eebrecher vast gut sein wird (wiewohl wir uwern gemahel nit dafür halten)«. Trotz mehrfacher Verbote war die Sitte des Eiersammelns am Tag nach der Hochzeit – wohl ebenfalls ein Fruchtbarkeitssymbol – nicht auszurotten. Selbstverständlich glaubte man auch an den Teufel. 1511 hieß es vom »Frauenwirt« Hans aus Augsburg, der einen Priester hatte schlagen wollen, er sei »on zwivel vom tüfel«.70 Das Münster hatte aber auch wichtige öffentliche Aufgaben, die von den geistlichen nicht unbedingt getrennt wurden. Schon in seinem Vorgängerbau predigte 1146 Bernhard von Clairvaux den Kreuzzug, begeisterte die Anwesenden und soll zugleich einige Wunderheilungen bewirkt haben.71 Von der Kanzel – später, seit etwa 1508/09, vom Ausrufhäuschen auf dem Friedhof – wurden Bekanntmachungen verkündet, weltliche Verordnungen bis hin zu Versteigerungen, Strafmaßen und Bußauflagen. 1494 mußte ein Hufschmied, der zwei Ratsherren verleumdet hatte, an der Kanzel des Münsters Widerruf leisten. Offenbar ging die Praxis mindestens Ende des 15. Jahrhunderts derart ins Geschäftliche, daß Peter Sprung eine Reform verlangte.72 Die Einheit von christlicher Gerechtigkeit und weltlichem Recht sollte wohl die hohe Bedeutung dokumentieren, die dem Münster für das Rechtsleben der
69
70
71 72
nagel: Die Stadt Basel in der sakralen Welt des Mittelalters. In: Basel. Denkschrift zur Erinnerung an die vor 2000 Jahren erfolgte Gründung der Colonia Raurica 44 v. Chr.–1957 n. Chr. Hg. unter dem Patronat des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt. Olten, Basel, Lausanne 1957, S. 55–64 (hier wird der magische Charakter sichtbar). Vgl. die vorangegangenen Anmerkungen zu Prozessionen und Heiligenverehrung sowie Peter Assion: Literatur zwischen Glaube und Aberglaube. Das mittelalterliche Fachschrifttum zu Magie und Mantik. In: Glaube im Abseits. Beiträge zur Erforschung des Aberglaubens. Hg. von Dietz-Rüdiger Moser. Darmstadt 1992, S. 169–196 (und weitere Beiträge des Bandes). Hefele: Von alten Sitten, S. 322–323, 353. Zum »Frauenwirt« Berent Schwineköper: Bemerkungen zum Problem der städtischen Unterschichten aus Freiburger Sicht. In: Gesellschaftliche Unterschichten in den südwestdeutschen Städten. Protokoll über die 5. Arbeitstagung des Arbeitskreises für südwestdeutsche Stadtgeschichtsforschung. Schwäbisch Hall 11.–13.11.1966. Hg. von Erich Maschke und Jürgen Sydow. Stuttgart 1967, S. 134–149, hier S. 148. Die Zähringer. Anstoß und Wirkung. Hg. von Hans Schadek und Karl Schmid (Veröffentlichungen der Zähringer-Ausstellung 2). Sigmaringen 1986, S. 235–237. Schadek: Bürgerschaft, S. 117–118. Das Beispiel von 1494 bei Hefele: Vom Pranger, S. 73; weitere bei dems.: Von alten Sitten, S. 352.
160
|
Lebensformen im mittelalterlichen Freiburg
Stadt zukam. In der Vorhalle befinden sich auf Bänken zweimal zwölf Plätze für die Schöffen der Stadt, die vielleicht als Marktrichter tätig werden sollten. In Wirklichkeit wurde dieser Ort allerdings nie für Gerichtszwecke genutzt. Hingegen dienten die in die Strebepfeiler des Turmes eingelassenen Richtmaße für Backsteine, für Holzkohle, für das Tuchgewerbe, den Holz-, Kohle- und Getreidehandel – Elle, Klafter, Sester und Zuber – sowie für die Größe von Broten in guten und schlechten Erntejahren, in denen »kleinere Brötchen gebacken« werden durften, dazu, daß bei Markt- und bei Handelsgeschäften alles seinen rechten Gang ging.73 Der Stadtherr pflegte im Chor des Münsters Gericht in Erb- und Eigentumssachen zu halten. Am 24. Dezember 1356 lud etwa Gräfin Klara von Freiburg zum Gericht »uf dem kor ... umb eigen und umb erbe«. Nach Ablösung der Grafen übernahm das Schultheißengericht deren Funktion.74 Auf dem Münsterplatz mußten die zum Tod Verurteilten ihren Gang durch die Stadt zum Galgen – ursprünglich möglicherweise am Markt, zumindest seit dem 14. Jahrhundert an der heutigen Basler Landstraße – antreten, wo der Henker seines Amtes waltete.75 Die Glocken des Münsters – vorab die große Hosannaglocke von 1258, die älteste Angelusglocke Deutschlands – läuteten Anfang und Ende der Arbeitszeit ein, luden zu Gottesdienst und Versammlungen, riefen zur Ratssitzung, wiesen auf die Steuereintreibung hin, verkündeten am Abend, daß die Stadttore geschlossen wurden, zeigten Sturm, Gewitter, Feuer oder Krieg an.76 Der Markt bildete einen zentralen Bestandteil des Alltagslebens. Hier handelte man nicht nur und kaufte die wichtigsten Dinge des täglichen Bedarfs, sondern man traf sich auch, tauschte Nachrichten aus und schloß Verabredungen. 1311 findet sich erstmals die Erwähnung einer Geldwechselstube. Außerdem wurde hier das Schultheißengericht abgehalten. Ursprünglich fand der Markt nicht vor dem Münster, aber ganz in der Nähe, in der Marktstraße – der heutigen Kaiser-JosephStraße –, statt. Entsprechend stand auch hier – am Fischbrunnen, heute Standort des Bertoldsbrunnens – die Schupfe: ein Korb oder Käfig am Ende eines Querbalkens, der an einem Pfahl befestigt war. In ihr wurden straffällige und sündige Menschen zur Schau gestellt, namentlich bei Betrügereien mit Lebensmitteln oder bei Handel zu verbotenen Zeiten. Die Strafe ist im Stadtrecht von 1275 faßbar. Im 73 Schadek: Bürgerschaft, S. 116–119; Hermann Flamm: Die Längen- und Hohlmaße in der Münstervorhalle. In: FMBl [Freiburger Münsterblätter] 9 (1913) S. 45–47; Willmann: Strafgerichtsverfassung, S. 72. Vgl. Irmgard Birsch: Gesundheitsschädigung und Täuschung im mittelalterlichen Lebensmittelverkehr. In: Essen und Trinken, S. 191–200. 74 UBF 1, S. 443 Nr. 227 (1356). 75 Schadek: Bürgerschaft, S. 99, 116–118; Hefele: Vom Pranger, S. 58, 60–61. Zum Scharfrichter vgl. Anm. 41. 76 Schadek: Bürgerschaft, S. 116–117; Hefele: Von alten Sitten, S. 356–357. Vgl. Peter Fäßlers Schlaglicht über die Turmuhren in Band 2 der Stadtgeschichte, S. 156–158.
Von Ordnungen und Unordnungen
|
161
15. Jahrhundert wurde sie dann vom Pranger abgelöst, der im Sprachgebrauch mit der Schupfe verschmolz. Er stand zunächst ebenfalls am Fischmarkt. Die Schaustellung verband sich nun zunehmend mit Körperstrafen – vom Aufbrennen eines Zeichens über Auspeitschen bis hin zum Abschneiden der Haare bei »Unzucht« und Abhauen der Ohren. Anscheinend traf der Pranger vornehmlich arme Leute, die eine Geldbuße nicht bezahlen konnten. Wer am Pranger gestanden hatte, verlor seine Ehre und war damit nicht mehr zur Zeugenschaft fähig.77 Seit dem 14. Jahrhundert verlagerte sich der Markt jedoch mehr und mehr auf den Münsterplatz, wo er dann seit dem 16. Jahrhundert endgültig verblieb.78 Neben den Wochenmärkten fanden zwei Jahrmärkte statt, 1516 kam ein dritter hinzu. Seit 1473 durften nur noch an diesen auswärtige Kaufleute ihre Waren feilbieten. Zum Verkauf kamen namentlich Tuche und Stoffe, Kleidungsstücke, Kramwaren, einige Luxusgegenstände, Güter des täglichen Bedarfs, aber auch Waffen. Die Besucher reisten vor allem aus dem näheren Umland an, soweit sie nicht aus der Stadt stammten, doch reichten die Handelsbeziehungen bis nach Köln, Fribourg, Genf, Savoyen und Oberitalien.79 All diese Beispiele weisen darauf hin, wie sehr das Münster – und damit die Religion und die Kirche als Organisation – die Lebensbereiche durchdrang und ihnen einen eigenen Rhythmus gab. Zugleich deutete sich auch an, daß diese Ordnungen nicht statisch waren, sondern sich – bei vielen gleichbleibenden Gegebenheiten – veränderten. Das wird selbst bei den Stiftungen für das Münster deutlich. Es wandelte sich nicht nur ihre Art, es drückte sich auch nicht nur die soziale Hierarchie in ihnen aus. Die Stiftungen umfaßten oft ganz bescheidene Summen, etwa um ein Licht vor dem heiligen Kreuz in der Kirche des Klosters Sölden zu erhalten, hin und wieder aber auch die Hälfte oder gar das gesamte Vermögen reicher Einwohner. Wenn ärmere Leute ihren Besitz oder ein Teil davon an das Spital vermachten, so diente dies oft der Alterssicherung: Sie wurden dafür aufgenommen und verpflegt. Stiftungen waren somit durchaus Teil des ökonomischen Denkens.80 Und dazu gehörte ebenfalls die Fürsorge für die Toten und das 77 Hefele: Vom Pranger, passim. Zum erstmals 1549 erwähnten »Narrenhäuslein« als Gefängnis vgl. Hefele: Von alten Sitten, S. 335. 78 Schadek, S. 117, 119; vgl. Hefele: Vom Pranger, passim. 79 Vgl. Berent Schwineköper: Beobachtungen zum Lebensraum südwestdeutscher Städte im Mittelalter, insbesondere zum engeren und weiteren Einzugsbereich der Freiburger Jahrmärkte in der zweiten Hälfte des 16. Jhs. In: Stadt und Umland. Protokoll der 10. Arbeitstagung des Arbeitskreises für südwestdeutsche Stadtgeschichtsforschung. Calw 12.– 14.11.1971. Hg. von Erich Maschke und Jürgen Sydow. Stuttgart 1974, S. 29–53, bes. S. 41–53. Zu den Bräuchen an den Jahrmärkten vgl. Hefele: Von alten Sitten, S. 315–316. 80 Vgl. exemplarisch Valentin Groebner: Ökonomie ohne Haus. Zum Wirtschaften armer Leute in Nürnberg am Ende des 15. Jhs. (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 108). Göttingen 1993, zusammenfassend S. 267. Ob das auch in Freiburg zu-
162
|
Lebensformen im mittelalterlichen Freiburg
Seelenheil. Teilweise stifteten die noch Lebenden entsprechende Summen für Gebete nach ihrem Tod, teilweise wurde ihrer durch Stiftungen von Verwandten und Nachkommen gedacht. Exemplarisch drückte 1386 der Freiburger Ritter Rudolf Statz den Sinn eines solchen Verfahrens aus: »Das ich mit der hilfe gottes das ewig leben finden und niessen möge in dem himel, und darumb, dem almehtigen gotte ze lobe und ze eren und miner, mins vaters, miner muoter, miner elichen wirtin und mines sunes seligen und aller anderre miner vordern seligen selen und allen glöbigen selen ze troste und ze heil, han ich ... gestiftet ... ein pfruonde zuo einer messe ... in sant Nicolaus chörlin.»81 Zugleich schloß man meist alle armen Seelen in die Fürbitten ein. Derartige Stiftungen mehrten sich seit dem 14. Jahrhundert. Zur selben Zeit – vordergründig im Zusammenhang mit der Pest, doch wichtiger dürfte die Ausweitung bürgerlichen Lebens gewesen sein – rückte zusehends die stiftende Person in den Vordergrund: Das Religiöse veräußerlichte und individualisierte sich. In dieselbe Richtung weist, wenn statt üppiger Totenmähler – um die Speisenden zum Gedenken anzuregen – nun Geldzuwendungen gestiftet wurden.82 Dies rührte nicht zuletzt von einer wachsenden Verbreitung der Lehre vom Fegefeuer her: Gebete und gute Werke, die durch das gestiftete Geld finanziert wurden, konnten auch Verstorbene daraus erlösen. Es entstand die Vorstellung von einer Art wechselseitiger Hilfeleistung zwischen Lebenden und Toten – diese würden sich für die Wohltaten dankbar erweisen –, die mit einer Veränderung des Frömmigkeitsbewußtseins, der »Volksreligiosität«, einherging. Der fast schon magische Charakter der Gebete, der Glaube an das Fegefeuer wie die Betonung der Passion Christi und der Jungfräulichkeit Marias ließ die Zahl der Messen erheblich ansteigen, ebenso Wallfahrten, das Ausmaß der Feierlichkeiten an hohen Festtagen oder sonstige Initiativen.83 nehmend zu Konflikten mit den Nachkommen führte, die den Verlust an Familienkapital nicht akzeptieren wollten, müßte systematisch geprüft werden. S. in diesem Band Ulrich Eckers Beitrag über Armut und Krankheiten. 81 Zit. nach Schadek: Bürgerschaft, S. 103. 82 Vgl. hier und im folgenden Otto Gerhard Oexle: Mahl und Spende im mittelalterlichen Totenkult. In: Frühmittelalterliche Studien 18 (1984) S. 401–420; ders.: Die Gegenwart der Lebenden und der Toten. Gedanken über Memoria. In: Gedächtnis, das Gemeinschaft stiftet. Hg. von Karl Schmid. München, Zürich 1985, S. 74–107; Karl Schmid: Stiftungen für das Seelenheil. In: Ebd., S. 51–73; Joachim Wollasch: Gemeinschaftsbewußtsein und soziale Leistung im Mittelalter. In: Frühmittelalterliche Studien 9 (1975) S. 268–286; ders.: Toten- und Armensorge. In: Gedächtnis, S. 9–38; ders.: Hoffnungen. Zur Umwandlung der Totenmähler in Geldzuwendungen s. Gerd Althoff: Der frieden-, bündnis- und gemeinschaftstiftende Charakter des Mahles im frühen Mittelalter. In: Essen und Trinken, S. 13–25, hier S. 22. 83 Le Goff: Geburt des Fegefeuers. Vgl. Wehrli-Johns: Haushälterin Gottes, S. 155–156; Himmel, Hölle, Fegefeuer. Das Jenseits im Mittelalter. Eine Ausstellung des Schweizerischen Landesmuseums mit dem Schnütgen-Museum und der Mittelalterabteilung des
Von Ordnungen und Unordnungen
|
163
Dies traf sich mit einer verstärkten Propaganda der Seelsorger für derartige Stiftungen und Aktivitäten. So konnten auch ihre Einkünfte wie die finanziellen Grundlagen der Kirche erhöht werden. Individualisierung der Frömmigkeit und »Berechnung« frommer Werke verbanden sich.84 Dem entsprach, daß seit Ende des 13. Jahrhunderts in den Quellen Erbschaftsregelungen und Verkäufe zunehmen, die nicht mehr unbedingt mit Stiftungen zu tun haben. Immer häufiger ist von Schulden oder von Verkäufen »aus Not« die Rede. Ja, es tauchen Fälle auf, bei denen Geschäfte mit Stiftungen gemacht wurden: So verkaufte das Heiliggeist-Spital am 13. Januar 1300 einen Zins von einem Saum Rotwein und drei Mark Silber von einer Jahrzeit-Stiftung.85 Allerdings erlosch dadurch nicht die Verpflichtung zur Abhaltung der Jahrzeit. Dies stand im Zusammenhang damit, daß das Geld eine immer größere Rolle spielte. So stritten sich die Münsterkapläne – die ebenso wie Nonnen und Mönche eine genossenschaftlich organisierte Lebensform für sich bildeten – um die Zuweisung von Erträgen.86 Die sich mehrenden Funktionen von Geldgeschäften sowie die wachsende Bedeutung der Zünfte und Bruderschaften und die sinkende der alten Patrizier zeigten die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Veränderungen an. Für alle geordneten Genossenschaften war die Religion der Ausgangspunkt gewesen. Das in der Wohltätigkeit sichtbar gemachte religiöse Handeln symbolisierte zugleich das jeweilige soziale Ansehen und die Stellung in der Stadtgesellschaft. Niemand, der ihr angehörte, konnte sich deshalb dem entziehen. So boten die Genossenschaften Halt und Geborgenheit für alle Mitglieder und gleichzeitig für die Einzelnen die Möglichkeit, sich hervorzutun und dadurch etwa für die Wahl in ein Amt qualifiziert zu werden, schufen also einen Wallraf-Richartz-Museums der Stadt Köln. Katalog von Peter Jezler. Hg. von der Gesellschaft für das Schweizerische Landesmuseum. Zürich 1994 (darin bes. Martina WehrliJohns: »Tuo daz guote und lâ daz übele.« Das Fegefeuer als Sozialidee, S. 47–58). 84 Vgl. Das Jahrzeitbuch. S. auch Mireille Othenin-Girard: Ländliche Lebensweise und Lebensformen im Spätmittelalter. Eine wirtschafts- und sozialgeschichtliche Untersuchung der nordwestschweizerischen Herrschaft Farnsburg (Quellen und Forschungen zur Geschichte und Landeskunde des Kantons Basel-Landschaft 48). Liestal 1994. 85 Im Detail dazu FUB passim, hier zum Beispiel FUB 1, S. 133 Nr. 160; FUB 2, S. 124–125 Nr. 109, S. 252–257 Nr. 215, S. 347–348 Nr. 278. S. auch Peter P. Albert: Urkunden und Regesten zur Geschichte des Freiburger Münsters. In: FMBl 3 ff. (1907 ff. ); ders. : Die Ewiglicht-Stiftungen im Münster 1301–1767. In: Ebd. 4 (1908) S. 38–40; Hefele: Von alten Sitten, S. 327, 342. Vgl. Schadek: Bürgerschaft, S. 100–114; Wollasch: Hoffnungen. 86 Beispiele bei Albert: Urkunden und Regesten. Vgl. Schadek: Bürgerschaft, S. 115; Müller: Mittelalterliche Formen, S. 159 und passim; außerdem die Beiträge über Bruderschaften und Klöster in diesem Band. Zu den Lebensverhältnissen eines damaligen Münsterpfarrers s. Friedrich Hefele: Ein Allgäuer als Pfarrer am Freiburger Münster (1349–1353). In: SiL 69 (1950) S. 53–59.
164
|
Lebensformen im mittelalterlichen Freiburg
Ausgleich zwischen innerständischer Gleichheit und Individualität.87 Daß dies nicht immer harmonisierte und die Zeitumstände einen Einfluß auf die jeweilige Praxis ausübten, versteht sich von selbst. Die Ordnung aller Lebensverhältnisse darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß es tiefgreifende soziale Unterschiede gab, wie sie schon in den vier kurzen exemplarischen Biographien aufleuchteten. Nur vereinzelt kam es allerdings zu »Vorwehen eines Klassenhasses« zwischen Arm und Reich.88 Unterhalb der kleinen Schicht wirklich reicher Bürger gestaltete sich das Leben einfach. Viele Familien – selbst in hochgeachteten Handwerkerkreisen – achteten darauf, sich soweit wie möglich selbst zu versorgen, und hielten sich Vieh im Haus, das Milch, Eier, Fleisch und andere Nahrungsprodukte lieferte. Der Hausstand fiel in der Regel recht schlicht aus.89 Die Handwerker arbeiteten meist in Ein- oder Zwei-Mann-Betrieben, gegebenenfalls kamen Taglöhner hinzu. Hier fielen oft Produktionsstätte und Haushalt zusammen. Die Familien umfaßten überwiegend das Elternpaar mit Kindern, die Großfamilie scheint selten vorgekommen zu sein. Häufig waren Kinder unter 15 Jahren in den Arbeitsprozeß integriert. Verarmte Verwandte halfen vielfach im Haushalt.90 Zumindest seit Ende des 14. Jahrhunderts – über die Zeit zuvor verfügen wir nur über punktuelle Angaben – mußten die meisten Handwerker mit ihren Arbeitseinkünften auskommen und konnten kein Vermögen bilden. Ende des 15. Jahrhunderts waren sogar Zunftangehörige zum Bettel- oder Almosenempfang zugelassen; bei der Zunft der Rebleute betraf dies etwa zehn Prozent der Mitglieder. Mitte des 15. Jahrhunderts hatten zahlreiche Handwerker ihre Grundstücke wegen Verschuldung versteigern lassen müssen.91 Die Zahl der Handwerksgesellen, Tagelöhner, Mägde und Knechte sowie sonstiger Dienstleute, die der Unterschicht zuzurechnen sind, wird für 1497 auf rund 750 Personen, also zwölf Prozent der Stadtbevölkerung, geschätzt. Dagegen um87 Dazu ausführlich in diesem Band der Beitrag von Gerchow. Vgl. ders.: Bruderschaften; Gerd Althoff: Verwandte, Freunde und Getreue. Zum politischen Stellenwert der Gruppenbindungen im früheren Mittelalter. Darmstadt 1990, bes. S. 85–133. 88 Scott: Walzenmüller-Aufstand, S. 84, vgl. S. 80. 89 Vgl. noch das Inventar von 1592: Hermann Flamm: Der Nachlaß des Werkmeisters Hans Beringer. In: FMBl 8 (1912) S. 46–47. Auch: Steven W. Rowan: Die Jahresrechnungen eines Freiburger Kaufmanns 1487/88. Ein Beitrag zur Handelsgeschichte des Oberrheins mit einem Nachwort von Berent Schwineköper. In: Stadt und Umland, S. 227–277 (Schwineköper identifiziert Marx Hoff, »den Scherer«, als den betreffenden Kaufmann). Zum Vergleich mit Nürnberg: Groebner: Ökonomie. 90 Schuler: Bevölkerungsstruktur, S. 150, 154, 163–166; vgl. Juliane Kümmel: Alltag und Festtag spätmittelalterlicher Handwerker. In: Mentalität und Alltag, S. 76–96. 91 Hier und im folgenden Schwineköper: Bemerkungen, bes. S. 142–148. Vgl. Schubert: Gauner.
Von Ordnungen und Unordnungen
|
165
faßte eine Liste derjenigen, die 1500 nicht von Zünften aufgenommen wurden, 40 Personen. Insgesamt wird man von ungefähr 100 Personen ausgehen können, um die Stadtarmen und die ärmeren Teile der Randgruppen im Blick zu haben. Zwölf Frauen und fünf Männer auf der Liste ernährten sich, wie ausdrücklich erwähnt wurde, vom Betteln; fünf Prostituierte sind – indirekt – nachweisbar.92 Auch wenn das Haus in der Regel die Zugehörigkeit zum Stadtbürgertum auswies und ihm damit ein zentraler Stellenwert zukam:93 Privatleben wurde in der Stadt eingebettet in »Öffentlichkeit«, fast alles spielte sich »auf der Gasse« ab oder konnte von dort her miterlebt werden. Die Form der Geselligkeit war in weiten Bereichen gebunden an den sozialen Ort, an dem man stand. Jede Genossenschaft hatte ihren eigenen Treffpunkt; ein besonderes Beispiel ist die Trinkstube der Gauch-Gesellschaft. Nicht zuletzt aufgrund ihrer Bedeutung als Statussymbol wurden die Zugehörigkeit zu den Trinkstuben und das Verhalten in ihnen seit dem 14. Jahrhundert vermehrt reglementiert. Seit dieser Zeit feierten auch die Handwerksgesellen ihren »guten« oder »blauen Montag« in ihrer Trinkstube. Prozessionen folgten den sozial bestimmten Ordnungen, Feste wurden danach gefeiert.94 Einen wichtigen Teil der Geselligkeit – und zwar in allen sozialen Schichten – bildete das gemeinsame Mahl. Dies förderte die Gemeinschaft, ihren Zusammenhalt, ihr Gruppenbewußtsein, und stiftete Frieden. Insofern war das Essen in einem solchen Kreis, wenngleich nicht mehr so ausgeprägt wie im Frühmittelalter, ein Ritual, das jedoch Heiterkeit und Ausgelassenheit nicht verhinderte. Im Ge92 In Auswertung der Zahlen Schulers Knut Schulz: Handwerksgesellen und Lohnarbeiter. Untersuchungen zur oberrheinischen und oberdeutschen Stadtgeschichte des 14. bis 17. Jhs. Sigmaringen 1985, S. 41–42, vgl. ff. zu späteren Zeiten. Zum Vergleich (auch im folgenden): Katharina Simon-Muscheid: Basler Handwerkszünfte im Spätmittelalter. Zunftinterne Strukturen und innerstädtische Konflikte (Europäische Hochschulschriften III/348). Bern 1988; Dorothea Rippmann: Bauern und Städter: Stadt-Land-Beziehungen im 15. Jh. Das Beispiel Basel, unter besonderer Berücksichtigung der Nahmarktbeziehungen und der sozialen Verhältnisse im Umland (Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft 159). Basel, Frankfurt a. M. 1990. 93 Vgl. in diesem Band die Beiträge von Marita Blattmann über das Rechtswesen, von Rosemarie Merkel über die Freiburger Bevölkerung und das Bürgerrecht [Geschichte der Stadt Freiburg, Bd. 1, S. 552–561 bzw. 565–596] sowie von Matthias Untermann über archäologische Funde aus der Frühzeit der Stadt. S. auch Stadtluft, Hirsebrei und Bettelmönch, S. 225–287 (speziell zu Freiburg S. 232–239). 94 Vgl. hier den Beitrag Gerchows in diesem Band. Außerdem Albrecht Cordes: Stuben und Stubengesellschaften. Zur dörflichen und kleinstädtischen Verfassungsgeschichte am Oberrhein und in der Nordschweiz (Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte 38). Stuttgart u. a. 1993 (Freiburg wird allerdings nicht detailliert behandelt); Schulz: Handwerksgesellen, S. 72, 137–138, 156, 172–173 mit Anm. 47. S. auch die folgenden Anmerkungen.
166
|
Lebensformen im mittelalterlichen Freiburg
genteil gingen ausgiebiges, oft als maßlos und verschwenderisch angeprangertes Essen und Trinken in der Regel mit Singen, Scherzen und Tanzen einher.95 Als städtischer Tanzsaal wurde lange Zeit das Haus der Krämerzunft »zum Falkenberg« genutzt, in dem etwa 1496 ein Fest für den österreichischen Erzherzog Philipp den Schönen stattfand. 1497 begann man mit dem Bau des Kornhauses, das für den Reichstag im folgenden Jahr als neuer großer Fest- und Tanzsaal gedacht war, aber nicht rechtzeitig fertig wurde. Ansonsten feierte man in den Stuben der Zünfte.96 Tänze im Freien unterlagen wiederum zunehmend strengen Auflagen. Das galt vor allem, wenn die Obrigkeit die Sittlichkeit bedroht sah. Beim »Kränzleinsingen« etwa, das für das 16. Jahrhundert überliefert ist, durften die Gesellen den Jungfrauen nur bis zum »Salve« – dem Abendgebet vor Mitternacht – den »Reigen springen«.97 Ein Beispiel für die politische Bedeutung des Mahles bildet das »Große Fest« zu Freiburg vom 3. bis 8. Juni 1454 – neben dem Reichstag von 1498 wohl das glanzvollste Ereignis in der mittelalterlichen Geschichte der Stadt. Hier trafen sich Herzog Philipp der Gute von Burgund, Erzherzog Albrecht VI. von Österreich, die Herzöge und Pfalzgrafen von Bayern, Otto und Ludwig, Markgraf Albrecht Achilles von Brandenburg, die Markgrafen Karl und Bernhard von Baden, der Bischof von Straßburg, sechs weitere Fürsten, teilweise die Gattinnen der hohen Herren sowie zahlreiche Begleiterinnen und Begleiter. Zur Unterhaltung der edlen Gäste dienten nicht nur Jagdveranstaltungen, Musik und Gaukelspiel, sondern auch Turniere, wahrscheinlich in der Marktstraße. Reichhaltige Geschenke wurden gegenseitig ausgetauscht. Sicher nutzten die Anwesenden das Fest zu politischen Verhandlungen. Nur vermuten lassen sich die aktuellen Themen: der Türkenkrieg, das Verhältnis zur Eidgenossenschaft, territoriale Fragen. Möglicherweise wurden aber auch für Freiburg unmittelbar wichtige Vorgänge – 95 Althoff: Der frieden-, bündnis- und gemeinschaftstiftende Charakter; ders.: Fest und Bündnis. In: Feste und Feiern, S. 29–38; ders.: Verwandte, Freunde und Getreue, S. 203– 211; Harry Kühnel: Spätmittelalterliche Festkultur im Dienste religiöser, politischer und sozialer Ziele. In: Feste und Feiern, S. 71–85. Vgl. Anm. 33 und 42. Daß das Trinken im Mittelalter anders als später vorwiegend soziale Funktion hatte, weniger eine Reaktion auf Orientierungslosigkeit oder schlechte materielle Zustände war, betont Roland Bitsch: Trinken, bes. S. 209–211. 96 Peter Kalchthaler: Freiburg und seine Bauten. Freiburg 1990, S. 56; Hefele: Von alten Sitten, S. 322, 328–333. 97 StadtAF, B 5 XIII a Nr. 11 fol. 113 und 134 1541 mehrfach: Tanzverbot wegen Pest, Nr. 18 fol. 131 v–132 1559 Juni 6: Kränzleinsingen, Nr. 21 fol. 132 1565 Juni 4: Verbot von Abendtänzen, Pfeiffer und Trommler sollen wegen des Lärms in den Turm kommen, Nr. 26 fol. 140v 1575 Juni 3: Tanzverbot wegen Pest, Nr. 41 fol. 392 1602 Juli 19 und fol. 396 1602 Juli 26: Winkeltänze u. ä.; vgl. C 1, Polizeisachen 20 Nr. 8 (1663–1811). S. auch Hefele: Von alten Sitten, S. 328–330.
Von Ordnungen und Unordnungen
|
167
wie die von Erzherzog Albrecht versuchte Abschaffung der Zünfte und die Gründung der Universität – bei dieser Gelegenheit vorbereitet.98 Neben derartigen Festen zu besonderen Anlässen war der gesamte Jahresablauf von einem Festkalender geprägt. Feste, die sich meist in Gottesdienst, Mahl und Tanz gliederten, dienten der Erinnerung an ein für die Stadt wichtiges Ereignis, wurden regelmäßig an herausgehobenen Tagen des Kirchenjahres und besonderen jahreszeitlichen Anlässen gefeiert – dabei oft mit festgelegten Bräuchen verbunden – oder erfüllten eine repräsentative Funktion. Zu unterscheiden sind Feste, die nur von einer sozialen Gruppe oder einer Genossenschaft – etwa einer Zunft, so der »Lichtbraten«, ihr Jahresfest – getragen wurden, und solche, die schichtübergreifend die Stadtgesellschaft erfaßten. Darüber hinaus beging man Einschnitte im privaten Leben mit einem Fest, vor allem Taufe, Hochzeit – dieser Begriff kam erst seit dem 13. Jahrhundert für die Vermählungsfeier auf –, Tod, auch die Erhebung zum Handwerksmeister oder die Wahl in den städtischen Rat.99 Eine widerwillig geduldete Ausnahme von der Ordnung der Gesellschaft scheint auf den ersten Blick die Fastnacht zu bilden. Zwar war sie Teil eines jahreszeitlichen Brauchtums, und nach Ablauf der Narrentage nahm das gewohnte 98 Berent Schwineköper: Das »Große Fest« zu Freiburg (3. – 8. Juli 1454). In: Geschichte – Wirtschaft – Gesellschaft. Fs. für Clemens Bauer zum 75. Geburtstag. Hg. von Erich Hassinger, J. Heinz Müller und Hugo Ott. Berlin 1974, S. 73–91. S. auch StadtAF, B 1 Nr. 6 S. 121–122: 1442 wurde am St. Verenentag (1.9.) König Friedrich III. samt einem Kardinal, dem Bischof von Augsburg und vier Grafen empfangen; u. a. mußte jede Zunft 2 Kerzen und 100 Mann in Harnisch stellen. Vgl. Heinrich Schreiber: Geschichte der Stadt Freiburg im Breisgau. Bd. 3. Freiburg 1857, S. 330–332 (Kaiser Ferdinand I. 1562 in Freiburg); Hefele: Von alten Sitten, S. 362. Vgl. die Empfänge der Landes- oder Reichsherrschaft mit ähnlichen Ereignissen, die in Bd. 2 und 3 der Stadtgeschichte geschildert sind. Dazu auch Klaus Tenfelde: Adventus: Die fürstliche Einholung als städtisches Fest. In: Stadt und Fest. Zur Geschichte und Gegenwart europäischer Festkultur. Hg. von Paul Hugger u. a. Stuttgart 1987, S. 45–60; Alois Niederstätter: Königseinritt und -gastung in der spätmittelalterlichen Reichsstadt. In: Feste und Feiern, S. 491–500. Zu den Turnieren s. Das ritterliche Turnier im Mittelalter. Beiträge zu einer vergleichenden Formen- und Verhaltensgeschichte des Rittertums. Hg. von Josef Fleckenstein (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 80). Göttingen 1985. 99 Vgl. Ludwig Schmugge: Feste feiern wie sie fallen – Das Fest als Lebensrhythmus im Mittelalter. In: Stadt und Fest, S. 61–87 (neben den Sonntagen gab es 40–45 Kirchenfeste im Jahr; hinzu kam der »blaue Montag«); Thomas Zotz: Die Stadtgesellschaft und ihre Feste. In: Feste und Feiern, S. 201–213. Zu den Essen bei der Rats- und Zunftmeisterwahl sowie zu den »Ratssuppen« s. Hefele: Alte Sitten, S. 142–144; ders.: Von alten Sitten, S. 347, 366–368. Insgesamt sind trotz der wichtigen Materialien, die Friedrich Hefele vorgelegt hat (allerdings vorwiegend aus der Zeit nach 1520 stammend), die Quellen zu den Bräuchen noch lange nicht ausgeschöpft. Zum »Lichtbraten« s. auch Schreiber: Sittengeschichte, S. VII–VIII.
168
|
Lebensformen im mittelalterlichen Freiburg
Alte wieder seinen Platz ein – aber: Hier kehrten sich alle Werte um, konnten die sozial Untersten an die Spitze der Hierarchie treten und damit wenigstens symbolisch ausdrücken, daß die Endzeit jeden Augenblick anbrechen könne und alle Menschen gleich machen werde. Das Bewußtsein der Apokalypse und des Antichristen war stark verankert.100 Für Freiburg ist der Begriff »Fastnacht« – vasinaht – erstmals für 1283 belegt. Im 14. und – zunehmend – im 15. Jahrhundert wird dann von der Fastnacht meistens im Zusammenhang mit der Datierung von Urkunden gesprochen. Deutlich werden dabei in den Einträgen zwei Fastnachtszeiten. Mit der »Pfaffenfastnacht« ist der siebente Sonntag vor Ostern – Estomihi – gemeint, bei der die klerikale Lustbarkeit im Mittelpunkt stand, die in anderen Quellen auch als »Herrenfastnacht« bezeichnet wird. Die »rechte Fastnacht«, an der sich das »Volk« vergnügte – in den Freiburger Quellen auch »Jungfrauenfastnacht« genannt –, bezieht sich auf den Dienstag danach, der vielfach auftauchende Begriff der »alten vasnacht« jedoch auf Invocavit, den sechsten Sonntag vor Ostern, also auf die Zeit nach Aschermittwoch. Daß die Kirche diese Störung der Fastenzeit nicht gerade gern sah, läßt sich denken. Von einem regelrechten Narrentreiben wird zum erstenmal 1496 berichtet, als am 12 . Februar »des kanzlers karreknecht« wegen eines »fasnachtspihls« in den Turm geworfen wurde. Anfang des 16. Jahrhunderts sind das Butzenlaufen und der Sturm des Butzenturms mehrfach erwähnt (und in der Regel verboten). Unter Butzen hat man Masken und Schreckgestalten zu verstehen. Wie die Verkleidung und die Bräuche im einzelnen aussahen, läßt sich allerdings nicht rekonstruieren. Offenbar wurde die Fastnacht in erheblichem Maße von den Genossenschaften getragen, namentlich von den Zünften und Bruderschaften, daneben von den Studenten. Aufgrund des reichlichen Alkoholgenusses, den man immer wieder einzuschränken suchte, kam es häufig zu gewalttätigen Streitereien. 1539 wurde im Zusammenhang mit der Fastnacht auch ein – später noch mehrfach erwähntes – »königreich« verboten. Vermutlich hatten sich die Narren oder die einzelnen Genossenschaften, wie es auch andernorts Sitte war, einen König gewählt, der ihrem Treiben vorstand. Dies läßt darauf schließen, daß es zumindest zu dieser Zeit auch in Freiburg üblich war, an Fastnacht die politische Ordnung umzukehren. Aus Einträgen in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts können wir folgern, daß Heischebräuche, nämlich das Küchleinholen an der Jungfrauenfastnacht, eine Gewohnheit geworden waren, ein Schwerttanz aufgeführt wurde und Frauen unter sich vor Aschermittwoch eine Mahlzeit hielten. Später ist auch an Invocavit ein Scheibenschlagen auf dem Schloßberg als althergebrachter Brauch überliefert. 100 Bob Scribner: Reformation, Karneval und die »verkehrte Welt«. In: Volkskultur. Zur Wiederentdeckung des vergessenen Alltags (16. bis 20. Jh.). Hg. von Richard van Dülmen und Norbert Schindler. Frankfurt a. M. 1984, S. 117–152, hier S. 150. Vgl. Anm. 21.
Von Ordnungen und Unordnungen
|
169
Die Obrigkeit nutzte zwar die Fastnacht, soweit möglich, zur Selbstdarstellung, betrachtete aber all diese Mummereien und Bräuche mit Mißtrauen und reagierte ständig mit Verboten. Neben unmäßigem Essen und Trinken sowie den Ausschreitungen störte sie wohl die – versteckte wie offene – Kritik an der bestehenden Ordnung, die sich an Fastnacht Luft verschaffte.101 Hier zeigte die Fastnacht ihr Doppelgesicht. Sie diente der Kanalisierung von Unzufriedenheit und wurde insofern durchaus gefördert. Rebellion als Ritual konnte Spannungen spielerisch abbauen. Aber man bewegte sich auf einem schmalen Grat. Die herrschenden Kreise fühlten sich gewarnt durch Vorfälle in anderen Städten, wo aus dem spielerischen Umsturz Ernst geworden war, sogar ganz in der Nähe: 1376 hatte es an der »bösen Fastnacht« in Basel einen Aufruhr der Bürger gegen die Adligen in der Stadt – mit Herzog Leopold III. von Österreich an der Spitze – gegeben; 1529 bewaffneten sich an Fastnacht protestantische Basler Bürger und veranstalteten in den Kirchen einen großen Bildersturm, der zugleich politische Ziele verfolgte.102 101 Rolf Süß: Zur Geschichte und Gegenwart der Freiburger Fasnacht. In: Masken zwischen Spiel und Ernst. Beiträge des Tübinger Arbeitskreises für Fasnachtsforschung (Volksleben 18). Tübingen 1967, S. 107–133, bes. S. 107–111; hier auch die Quellen für die Erstbelege. Vgl. Hefele: Alte Sitten, S. 135–136; Zotz: Stadtgesellschaft, S. 207–212; Schindler: Widerspenstige Leute, S. 121–174; Weidkuhn: Fastnacht, passim; Harry Kühnel: Die städtische Fastnacht im 15. Jh. Das disziplinierte und öffentlich finanzierte Volksfest. In: Volkskultur des europäischen Spätmittelalters, S. 109–127, hier bes. S. 118 ff. (Reglementierung und Selbstdarstellung), S. 121–124 (Fastnachtsspiele). »Königreiche« als Spiele gab es auch bei anderen Anlässen, vgl. StadtAF, B 5 XIII a Nr. 11 fol. 113 1541: Verbot von Königreichen wegen »sterbends«, Nr. 26 fol. 313v 1576 Jan. 27: Verbot von Königreichen in Wirtshäusern und Zunftstuben während der Pestzeit, Nr. 28 fol. 260 1579 Dez. 18: Verbot von Mummerei, Fastnachtsbutz und Königreichen seitens Studenten und Bürgern. Dazu Hefele: Von alten Sitten, S. 333; Heers: Mummenschanz, S. 230–242 (Närrische Gesellschaften – Bruderschaften – wählten sich einen König oder eine Königin, das Fest verlief nach eigenen Zeremonien), s. das ganze Buch zur Fastnacht (u. a. S. 285–296 zu Fastnachtsspielen, die zum Teil mit den Meistersingern verbunden waren). Hinzuweisen ist auch auf das »kunigreich varender lute«, der Pfeiffer von Rappolsweiler, aber auch in Zürich und Bern (Graus: Randgruppen, S. 428–429; Hartung: Gesellschaftliche Randgruppen, S. 82, 84). Allerdings muß man sich vor einer Überinterpretation hüten: Auch geachtete Gesellschaften – wie die Rittergesellschaft »zum Löwen« – hatten ihren »König« (s. in diesem Band das Schlaglicht zu Martin Malterer). Vergleichbar mit den übrigen hier erwähnten Bräuchen, kommen in den Königreichen eine geregelte Inszenierung wie eine symbolische Forderung nach Änderung der Verhältnisse zum Ausdruck. – Ob es auch in Freiburg – wie in Basel – an Fastnacht zu einer Umkehrung der Geschlechterordnung kam, ist bisher nicht bekannt geworden, jedoch nicht auszuschließen (vgl. Stadt der Frauen, S. 202–204) 102 Zotz: Stadtgesellschaft, S. 210–212; Kühnel: Die städtische Fasnacht, S. 110–111, 113– 114; Scribner: Reformation, S. 121, 137–142. Vgl. Emmanuel Le Roy Ladurie: Karneval in Romans. Von Lichtmeß bis Aschermittwoch 1579–1580. Stuttgart 1982.
170
|
Lebensformen im mittelalterlichen Freiburg
Im übrigen kehrte sich die Welt nicht nur an Fastnacht um. 1508 wurde ein gewisser Hans aus dem elsässischen Oberehnheim (Obernai) bestraft, weil er als Darsteller eines der Teufel bei der Fronleichnamsprozession »unzüchtig« gegenüber Frauen und Jungfrauen geworden war – ein Versuch, die durch die Verkleidung ausgedrückte spielerische Verwandlung Wirklichkeit werden zu lassen.103 In dem erwähnten Beschluß von 1539 wurde auch das » brunnentragen« verboten. Dahinter verbarg sich ein älterer Rügebrauch, das Charivari: Wer die Vorstellungen von ehrbar und gerecht mißachtete, die vorgegebene, vor allem sittliche Ordnung durcheinanderbrachte, dem wurde eine »Katzenmusik« dargebracht oder man setzte ihn – real oder symbolisch – auf einen Esel, einen Holzbalken oder einen Karren, stellte ihn, verbunden mit bestimmten Ritualen, öffentlich zur Schau und warf ihn schließlich in einen Brunnen.104 In Freiburg scheint man diesen Brauch – auch außerhalb der Fastnacht – dazu benutzt zu haben, um Übermut zu treiben. So ließen sich adlige Studenten 1531 nach einem Gelage unter allgemeiner Belustigung auf einem Karren durch die Stadt fahren und am Fischmarkt in den Bach stürzen. Wie sehr sie dabei zugleich provozieren wollten, läßt sich daran ablesen, daß sie ein andermal unter Gesang und Lautenschlag frühmorgens im Münster umherzogen.105 Hier schimmert eine wichtige Funktion solcher Bräuche durch. Für (männliche) Jugendgruppen bedeuteten sie eine Einübung in die gesellschaftlichen Normen, bereiteten den Übergang in das Erwachsenenalter vor und dienten – wie Feste und Fastnacht – zugleich dazu, dem jugendlichen Ungestüm und Mutwil103 Hefele: Alte Sitten, S. 141. Zur Ambivalenz der Sexualität zwischen Sünde und ungenierter Offenheit vgl. Otto Borst: Alltagsleben, S. 338–446. 104 Vgl. Edward P. Thompson: »Rough Music« oder englische Katzenmusik. In: ders.: Plebeische Kultur und moralische Ökonomie. Aufsätze zur englischen Sozialgeschichte des 18. und 19. Jhs. Hg. von Dieter Groh. Frankfurt a. M. u. a. 1980, S. 131–168; Natalie Zemon Davis: Humanismus, Narrenherrschaft und die Riten der Gewalt. Gesellschaft und Kultur im frühneuzeitlichen Frankreich. Frankfurt a. M. 1987, S. 106–135 (auch zum folgenden). Das »Bengelreiten« in der Elzacher Fastnacht ist noch ein deutliches Überbleibsel dieses Rügebrauches. 105 Schreiber: Geschichte der Universität, S. 106–107; vgl. S. 66–127. Inwieweit hier die Aufweichung der überkommenen Ordnung durch die Reformation eine Rolle spielt, muß offen bleiben. In Basel waren, nach einer Aussage Oekolampads 1526 zu schließen, die Versuche Jugendlicher, die Andacht in der Kirche zu stören, offenbar auffällig (Norbert Schindler: I tutori del disordine: Rituali della cultura giovanile agli inizi dell’ età moderna. In: Storia dei giovani. Bd. 1. Dell’ antichità all’ età moderna. Hg. von Giovanni Levi und Jean-Claude Schmitt. Rom, Bari 1994, S. 303–374, hier S. 332 (ich danke Norbert Schindler herzlich für die Überlassung des deutschen Manuskriptes: Die Hüter der Unordnung. Rituale der Jugendkultur in der frühen Neuzeit; s. ders.: Widerspenstige Leute, hier bes. S. 215–257). Vgl. das Schlaglicht »Studentische Nachtschwärmereien« von Ulrich Ecker im zweiten Band der Stadtgeschichte, S. 507–509.
Von Ordnungen und Unordnungen
|
171
len einmal Raum zu geben. Dabei fällt auf, daß die Jugendlichen – namentlich die Gesellen und Studenten – wiederum bruderschaftlich organisiert waren. Insofern vermittelte die Gruppe Geborgenheit und eröffnete gleichzeitig Möglichkeiten der kontrollierten Entfaltung. Die Disziplinierung schloß nicht aus, daß das Verhalten auch einmal »über die Stränge« schlagen durfte, und war noch mit einem freizügigen, »libertären« Auftreten vereinbar. In den Jugendbünden wurde weitergegeben, was als erlaubt zu gelten hatte und welche sozialen Regeln zumindest zukünftig beachtet werden mußten. Gerade dann, wenn, wie bei den Gesellen, erst verhältnismäßig spät geheiratet werden durfte, vollzog sich dies vor dem Hintergrund sexuell besetzter Erzählungen und Scherze, ja konnte in sexuelle Gewalttätigkeit, insbesondere gegenüber nicht »ehrbaren« Frauen, ausarten.106 All diese Aktionen bedrohten letztlich nicht die gesellschaftliche Ordnung, es entfaltete sich nicht unbedingt eine Gegenkultur, aber die Jugendlichen erprobten doch die Grenzen ihrer Möglichkeiten in Auseinandersetzung mit der älteren Generation. Deshalb wurde die Obrigkeit immer wieder zum Eingreifen provoziert. So verbot der Freiburger Rat 1559, daß die Jungen am Fest Johannes des Täufers – also am 24. Juni – auf den Gassen Feuer machten und mit Stecken gegeneinander zogen. Für dieses offenkundige Ritual wurde sogar Spitalgefängnis angedroht.107 Eine Gegenreaktion auf Sitten der Jugendlichen drückte auch das Programm der 1513 gegründeten Meistersinger-Bruderschaft aus, das sich gegen die »jetzt loufender nuwangenomner lüderly, üppiger, unnutzger, unerlicher und verdammter wort und werck« richtete, zu denen »die jungen« neigten. Dem sollte ihre Tätigkeit entgegenwirken, die die »guoten« Bräuche bewahren wollte.108 Zwar stimmten die Generationen in den grundlegenden Werten weitgehend überein, aber die Jugendlichen forderten die Älteren gerne heraus und stellten damit zumindest punktuell diese Werte in Frage, veränderten sie dabei vielleicht auch ein wenig. Diese Ambivalenz erweist sich, ähnlich wie bei der Fastnacht,
106 Vgl. Scribner: Reformation, S. 130–133; Schindler: I tutori; Robert Muchembled: Die Jugend und die Volkskultur im 15. Jh. Flandern und Artois. In: Volkskultur des europäischen Spätmittelalters, S. 35–58. Schon Norbert Elias hat auf den »Zusammenhang von Gesellschaftsaufbau und Affektaufbau« hingewiesen, bei dem sich in der spätmittelalterlichen Gesellschaft Spannungen sehr viel unmittelbarer entladen hätten als in der »zivilisierten« (Der Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. 2 Bde. 5. Aufl. Frankfurt a. M. 1978, hier Bd. 1, S. 276) . 107 StadtAF, B 5 XIII a Nr. 18 fol. 131v–132 1559 Juni 14. 108 StadtAF, A 1 XIII f 1513; vgl. Gerchow: Bruderschaften, S. 32 mit Anm. 103; Schreiber: Geschichte der Stadt, S. 322–323. Daß die Gesellenbruderschaften die Ordnung grundsätzlich keinesfalls in Frage stellten, zeigt Gerchow: Bruderschaften, S. 39–45. Zu den Meistersingern und zur latenten Gewaltsamkeit der Gesellen s. auch Jan Gerchows Beitrag in diesem Band.
172
|
Lebensformen im mittelalterlichen Freiburg
ebenfalls bei den Formen der Aktivitäten: Symbolische Gewalt konnte leicht in manifeste umschlagen. Wie leicht Festlichkeiten in Tätlichkeiten enden konnten, zeigte sich im August 1495 anläßlich der Kirchweih in Ebringen. Eine seit längerem aufgestaute Spannung aufgrund der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Stadt und Land entlud sich dort, als bewaffnete Ebringer eine Gruppe von Freiburger Gesellen nach Tanz und Zeche überfielen, einen töteten und mehrere schwer verletzten. Hier zeichnete sich eine Konfliktlinie im Alltagsleben ab, die mit den Bauernunruhen und -aufständen dieser Zeit zusammenhing.109 Bei den Geselligkeiten beliebt waren Spiele. Neben Karten- und Würfelspielen oder auch dem Kegeln fanden zu bestimmten Anlässen auch immer wieder Kraft- und Gewandtheitsproben zwischen jungen Männern statt. Das konnten sportliche Wettkämpfe sein, ja sogar Turniere, an denen sich im Spätmittelalter zunehmend Bürger zumindest der Oberschicht beteiligten. Schützenfeste erfreuten sich wachsender Beliebtheit.110 Ein Beispiel für eine Kraftprobe ist »Katzenstriegel«, das im 14. Jahrhundert aus St. Georgen bei Freiburg überliefert ist, aber offenbar in weiten Teilen Europas bekannt war: »Zwei Burschen, jeder mit einem kleinen Stock im Munde, legen sich, die Köpfe gegeneinander, auf den Bauch. Ein Riemen wird um die beiden Nacken unter die Stöcke geführt und zusammengespannt, und nun gilt es, ob einer den andern mittelst des Riemens, indem er sich rücklings schiebt, an sich ziehen kann.«111 Viel Gefallen fanden offenbar besonders Kinder und Jugendliche am Vogelfang, namentlich von Lerchen und Meisen. 1555 verbot der Rat, Meisen zu fangen, damit die Vögel der Raupenplage Herr würden. Schon 1508 hatten die Kartäuser ein Verbot des Vogelfangs auf der 109 UBF 2, S. 602–619 Nr. 772–776. Vgl. dazu ausführlich den Beitrag von Tom Scott in diesem Band [Geschichte der Stadt Freiburg, Bd. 1, hier S. 267–268]. Zum Vergleich sowie zum Zusammenhang von Maskierung, fastnächtlichem Brauchtum (auch zum häufigen Ausbruch von Unruhen an Fastnacht) und – oft gewalttätigen – (Heische-)Zügen Jugendlicher s. Hans Georg Wackernagel: Altes Volkstum der Schweiz. Gesammelte Schriften zur historischen Volkskunde (Schriften der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde 38). 2. Aufl. Basel 1959, S. 222–265 (dabei zu einem Vorfall an der Kirchweih 1513 S. 259–265) . 110 Zwei Schützen-Gilden werden erstmals 1491 bzw. 1522 erwähnt. Vgl. in diesem Band den Beitrag Jan Gerchows über die Bruderschaften. 111 H. F. Feilberg: Katzenstriegel. In: ZGGF 23 (1907) S. 126–128, hier S. 127. Er bezieht sich auf Fridrich Pfaff: Katzenstriegel, ein altes Volksspiel. In: Volkskunde im Breisgau. Hg. vom Badischen Verein für Volkskunde durch Fridrich Pfaff. Freiburg 1906, S. 35–44 (das Spiel wird auch ohne Stock oder Knebel im Mund durchgeführt). Vgl. Schmugge: Feste feiern, S. 78–85. Zu den Spielen insgesamt Hefele: Von alten Sitten, S. 331–332. S. auch das Schlaglicht zu den Latrinenfunden [Geschichte der Stadt Freiburg, Bd. 1, S. 209–214].
Von Ordnungen und Unordnungen
|
173
nahe bei ihnen gelegenen Gemarkung bewirkt.112 Nicht gern sah es der Rat, wenn auf Spielplätzen in- und außerhalb der Stadt um Geld gespielt wurde. Weil dabei »Gotteslästern und Üppigkeit getrieben« würden, ließ er mehrfach das Geld beschlagnahmen und die Plätze schließen.113 Spezifische Formen der Kindheit treten uns in den Quellen im übrigen nicht entgegen. Obwohl vielfach durch indirekte Schlüsse Unterteilungen des kindlichen Lebensalters bis sieben und dann bis zwölf oder vierzehn Jahre vorgenommen werden, ist es als eigenständige Phase gegenüber der Jugend sprachlich kaum faßbar. Man kann darunter jene Zeitspanne verstehen, die vor der Einübung gesellschaftlicher Normen – etwa in Jugendbünden – liegt. In der Kleidung unterschieden sich die Kinder nicht wesentlich von den Erwachsenen. Ebenso scheint es spezielle Kinderspiele nur bis zum dritten oder vierten Lebensjahr gegeben zu haben. Allerdings läßt sich dies schwer beurteilen, da kein »Markt« für Kinder bestand. Beinahe alles, womit sie spielten, stammte aus dem Haus. Hier waren sie in das jeweilige Leben eingebunden. Je nach sozialem Stand bedeutete dies auch, sich bereits sehr früh am Erwerb der Familie beteiligen zu müssen. Insofern liegt es auf der Hand, daß man kaum von einer besonderen Kindererziehung sprechen kann.114 Eine städtische Schule wurde in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts eingerichtet. In ihr stand die Vermittlung des Lateinischen im Mittelpunkt. Konkurrenz machten ihr weniger die Klosterschulen, die hauptsächlich den eigenen Nachwuchs ausbildeten, als private Wanderlehrer, die Schüler im Deutschen unterrichteten. Ende 1425 forderte deshalb der Rat die Bürger auf, ihre Knaben ab acht Jahren in die »rechte Schule« zu schicken – eben in die städtische Lateinschule. Dafür bot er an, auch in ihr zu ermöglichen, Deutsch zu lernen. Mädchen besuchten vereinzelt die deutschen oder die Klosterschulen.115 Das lange vorherrschende Bild vom Leben im Mittelalter als eines wohlgeordneten Daseins mit statischem Denken har sich längst als einseitig erwiesen.116 Gewiß wurde das Leben entscheidend von der Religion geprägt – bei den Christen wie bei den Juden – und folgte damit in gewisser Weise vorgegebenen Richtlinien. Doch die Interpretationen dieser religiösen Vorgaben wandelten sich beträchtlich; das Freiburger Münster ist ein großartiges Beispiel dafür. Zugleich reagierten die Menschen auf die sie beeinflussenden Umstände und versuchten diese gege112 Hefele: Von alten Sitten, S. 318, 358, 360. 113 So am 30.9.1594: StadtAF, B 5 XIII a Nr. 37 fol. 486v, vgl. Nr. 21 fol. 132r–v 1565 Juni 4, fol. 408v 1566 Juni 14. 114 Philippe Ariès: Geschichte der Kindheit. 2. Auf. München 1979; Opitz: Frauenalltag, S. 42–67. Vgl. Anm. 111–112. Zu Kinderspielen, die aber auch von Älteren genutzt wurden, s. Stadtluft, Hirsebrei und Bettelmönch, S. 392–395. 115 Ausführlich dazu Hans Schadek im 2. Band der Stadtgeschichte, S. 461–481. Der Beschluß von 1425: UBF 2, S. 360 Nr. 569. 116 Vgl. Oexle: Statik.
174
|
Lebensformen im mittelalterlichen Freiburg
benenfalls zu verändern. Besonders deutlich wurde dies in der Krise des 14. Jahrhunderts, die einen folgenreichen Einschnitt für das Denken und Verhalten der Menschen wie für die Politik der Obrigkeiten bedeutete. So blieben die Grenzen der Ordnungen fließend. Es wechselte die Art und Weise, nach welchen Kriterien jemand oder eine Gruppe an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurde. Und nie erlosch der Wunsch, die Ordnungen umzukehren oder zumindest ihre Flexibilität zu erproben. Deshalb müssen Ordnungen und Unordnungen zusammen gesehen werden, um eine Vorstellung vom Leben in der Stadt zu erhalten.
Zachor – Erinnere Dich! Zum Gedenken an die Deportation der jüdischen Insassen des Friedrichsheims in Gailingen am 22. Oktober 1940*1 Zachor – Erinnere Dich! Diese Aufforderung ist ein Kernbestandteil jüdischer Tradition seit der Tora. Insbesondere das fünfte Buch Mose begründet in vielen Passagen eine Form kollektiver Gedächtnisarbeit, die sich als prägend erwies. Immer wieder sollen die Juden nach den Schöpfungswerken Gottes fragen, aber auch nach den Taten der Vorfahren, ihrer Verbündeten wie Feinde. Die Augenzeugen der Ereignisse sind berufen, ihre Erinnerung weiterzugeben. Alles Entscheidende, das verbindet und verpflichtet, soll im Gedächtnis aufbewahrt werden, möglichst in täglicher Übung. Erst danach geht das individuelle Gedächtnis in das gemeinsame, das kulturelle Gedächtnis über, das über die Generationen hinweg lebendig bleibt. Gebete und Feiertage halten die Erinnerung ebenso wach wie die regelmässige Verlesung der Tora in der Synagoge während des Jahreszyklus. Diese gehört zum Wesen des Selbstverständnisses, der Identität, ist sozusagen eher »Heimat« als ein bestimmtes Territorium. Die Frage nach dem Wirken Gottes und nach seinen Gesetzen ist zugleich eine Frage nach dem Versagen des Menschen vor diesen Anforderungen, nach seiner »Schuld«. Sie erklärt nach dem Verständnis der Tora, warum es zu den geschichtlichen Katastrophen kommt. Die Tora ist voll von Mahnungen, nicht aufgrund günstiger Lebensverhältnisse und verführerischer Perspektiven Gott und seine Gesetze zu vergessen. Schon im Babylonischen Exil und dann im Exil nach der Vertreibung der meisten Juden aus Israel durch die Römer seit 70 u. Z. (und vor allem seit 135) haben die Juden die Erinnerung an ihre Ursprünge und an ihre Lebensform bewahrt, damit auch ihre Zusammengehörigkeit. Zunächst orientierten sie sich dabei fast ausschliesslich an den religiösen Überlieferungen. Auch die einzigartigen Memor-Bücher der jüdischen Gemeinden, die uns teilweise seit dem Mittelalter erhalten sind, stehen in diesem Zusammenhang. Die mystische Gedankenwelt der Kabbala versuchte, der besonderen Situation der Juden gerecht zu werden: Es gehe darum, die Schöpfung aus ihrem Exil, in dem das Böse Macht über den Menschen gewinne, zu erlösen und die ursprüngliche Harmonie wiederherzustellen. Dazu müssten die Menschen das Böse durch Frömmigkeit und gute Werke überwinden. Der Erinnerung kam bei dieser Aufgabe eine entscheidende Funktion zu. Vor jenem Hintergrund ist der oft zitierte Ausspruch Baal Schem Tows, des Begründers des Chassidismus, in der ersten Hälfte des 18. Jahrhun* Erstpublikation in: Erinnern und Begegnen. Forum Christlicher Gedenkarbeit 4 (2000) Nr. 2 [erschienen 2001], ohne Seitenzählung.
176
|
Zachor – Erinnere Dich!
derts zu verstehen: »Das Vergessenwollen verlängert das Exil, das Geheimnis der Erlösung heisst Erinnerung.« Seitdem zwangen soziale und wirtschaftliche Umschichtungen, die abnehmende Bedeutung der Religion, der Kampf um die rechtliche Gleichstellung und die Auseinandersetzung mit gewandelten Formen des Antisemitismus die Juden dazu, ihren Platz in der Gesellschaft und ihr eigenes Selbstverständnis neu zu bestimmen. Auch dabei spielte die Erinnerung an die kulturellen Traditionen eine wegweisende Rolle. »Leben heisst, sich erinnern«, lässt Isaak Bashevis Singer im Roman »Das Visum« sein alter ego David Bendiger sagen. Dieser wartete auf ein Visum, das ihm die Ausreise aus Polen nach Palästina ermöglichen sollte. Der wachsende und lebensbedrohende Antisemitismus veranlasste zahlreiche Juden in vielen Ländern, einen Ausweg in der Emigration zu suchen, hoffend, in einem anderen Land eine sichere Zuflucht zu finden. Wieder nahm dabei die Erinnerung einen hohen Stellenwert ein. Vor einigen Jahren erhielt ich den Nachlass eines Juden aus Freiburg i. Br., dem es am 1. September 1939, dem Tag des Kriegsausbruches, gerade noch gelungen war, mit einem gültigen Visum in die Schweiz auszureisen, und der dann später in die USA emigrierte. Dieser Nachlass bestand aus zwei grossen Koffern voll mit Briefen, Bildern, memoirenartigen Schriften zu verschiedenen Aspekten seines Lebens und ähnlichen Unterlagen. Er hatte sie mit in die Emigration genommen – die Dokumente der Erinnerung waren ihm wichtiger gewesen als zusätzliche Kleidungsstücke oder Haushaltsgegenstände, die er zurückliess. Hier zeigt sich: je weniger man den Juden erlaubte, einen räumliche Heimat zu behalten, um so wichtiger wurde für sie die Erinnerung als Heimat ihrer Existenz. Viele Juden wollten nicht emigrieren, wollten trotz der immer bedrückenderen Massnahmen des Nazi-Regimes Deutschland nicht verlassen, mit dem sie sich verwurzelt fühlten. Andere erhielten nicht rechtzeitig ein Visum, das sie zur Ausreise berechtigte, oder sie waren dazu gesundheitlich nicht in der Lage. Wir erinnern uns heute der Deportation der badischen und saarpfälzischen Jüdinnen und Juden vor sechzig Jahren – am 22. Oktober 1940 und in den folgenden Wochen – nach Gurs oder in ein anderes Lager in Frankreich. Nur wenige überlebten diese Aktion. Zahlreiche starben bereits auf dem Transport oder dann in Gurs, die meisten mussten den Weg weitergehen bis nach Auschwitz, wo sie umgebracht wurden. Hier vor dieser Stele gedenken wir der 108 Insassen des Friedrichsheims, die an diesem Tag abgeholt wurden: vorwiegend alte, sieche und gebrechliche Menschen, aber auch Gailinger Juden, die zwangsweise aus ihren Wohnungen in das Heim umquartiert worden waren. Am Platz der ehemaligen Synagoge mahnen zwei Stelen, die insgesamt 210 Jüdinnen und Juden nicht zu vergessen, die damals von Gailingen aus den schweren Gang antreten mussten. Zu danken ist allen, die diese Mahnmale ermöglicht haben – diejenigen, die die Ideen hatten, die die Stelen geschaffen haben und die zu ihrer Finanzierung beigetragen haben.
Zum Gedenken an die Deportation am 22. Oktober 1940
|
177
Zu danken ist nicht zuletzt der Gemeinde Gailingen, den Bürgern, dem Gemeinderat und dem Bürgermeister, die zu dieser Form der Erinnerung gefunden haben, ebenso dem Förderverein Bürgerhaus Gailingen, der mit grossem Einsatz bestrebt ist, die jüdische Geschichte und Kultur in dieser Region lebendig zu erhalten. Für die Gedenkstele vor dem Friedrichsheim haben sich zusätzlich besonders engagiert Landrat Hämmerle und seine Mitarbeiter, der Verein «Gegen Vergessen – Für Demokratie» sowie das Komitee zum Schutz der Zeugnisse jüdischen Lebens in Gailingen und Umgebung. Bernd Renner, der diese Idee unermüdlich vorangetrieben hat und dessen Verdienste um die Bewahrung der jüdischen Tradition Gailingens – bei allen Kontroversen, die seine Tätigkeit hervorgerufen hat – nicht hoch genug gewürdigt werden kann, hat den heutigen Tag leider nicht mehr erleben können. Gailingen war einmal die grösste jüdische Landgemeinde Badens, vielleicht sogar ganz Deutschlands. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts hatte der Ort mit über 50 Prozent den höchsten Anteil von Juden an der Bevölkerung innerhalb Südwestdeutschlands. Über lange Zeit bestand eine friedliche, gute Nachbarschaft zwischen Juden und Christen. Im Gemeinderat sassen jahrzehntelang jeweils vier jüdische und christliche Männer. Von 1870 bis 1884 übte gar der jüdische Kaufmann Leopold Hirsch Guggenheim das Amt des Bürgermeisters aus, nach dem nun ein Saal im Bürgerhaus benannt worden ist. Einträchtig wirkten Juden und Christen in mehreren Vereinen zusammen. Sie trafen sich in der Schule, in der Tanzstunde, bei Bällen und Festen, auf der Strasse oder im Ladengeschäft. Zwar hatten beide Bevölkerungsteile ihre eigenen kulturellen Praktiken, aber sie waren zugleich über vielfältige Berührungspunkte, Kommunikationsorte und gemeinsame Interessen miteinander verflochten. Gewiss traten Konflikte auf, waren judenfeindliche Klischees spürbar, doch von einer grundsätzlichen Ausgrenzung, Absonderung oder Feindseligkeit kann man nicht sprechen, ebensowenig allerdings von einer vollständigen Integration. Trotz mancher Freundschaften und der Vertrautheit im Zusammenleben blieb ein Rest Fremdheit, eine Distanz. Vertraut und fremd zugleich – dieses Begriffspaar charakterisiert wohl am besten das wechselseitige Verhältnis. Jacob Picard, der Dichter des Landjudentums, hat in seiner Erzählung «Die alte Lehre» ein schönes Beispiel für das jüdisch-christliche Zusammenleben gegeben. In einer Gemeinde des Oberelsass war es – wie wohl meistens in den »Judendörfern« – üblich, an den Feiertagen diejenigen, die den Segensspruch zur Tora sprechen durften, nach der sozialökonomischen Rangordnung, nach der Höhe ihrer Wohltätigkeitsspende aufzurufen. Den Armen blieb daher diese Ehre versagt. An Simchat Tora, dem Fest der Freude an der Tora, ereignete es sich nun, dass der – christliche – Bürgermeister des Ortes die Synagoge während des Gottesdienstes betrat und für den armen Barbier Moischele spendete, damit er aufgerufen werden könne. Dies gab den Anstoss zu einem neuen Brauch, dass
178
|
Zachor – Erinnere Dich!
nämlich immer an Simchat Tora auch der ärmste Mann in der Gemeinde aufgerufen wurde, für den zuvor ein anderer gespendet hatte. 1940 war die Nachbarschaft zwischen Juden und Christen zerbrochen. An Simchat Tora dieses Jahres wollten die Juden in Gailingen und unter ihnen die Insassen des Friedrichsheims – die regulären Bewohner wie die zwangsweise dorthin umgesiedelten – das Fest wie üblich trotz aller Bedrückungen, Diskriminierungen und Verfolgungen freudig begehen. Nachdem die Synagoge am 10. November 1938 gesprengt worden worden war, diente der Betsaal des Friedrichsheimes auch als Raum für die Gottesdienste. Am 22. Oktober 1940 feierte man Schemini Azeret, den achten und letzten Tag von Sukkot, dem Laubhüttenfest, an dem der vierzigjährigen Wanderschaft der Juden durch die Wüste und der Hütten, mit denen sie damals hatten vorlieb nehmen müssen, gedacht und zugleich für eine gute Ernte gebetet wird. Für den nächsten Tag – eben Simchat Tora – bereitete die Oberschwester des Altersheimes, wie wir durch das Zeugnis von Berty Friesländer-Bloch wissen, eine kleine Feier vor allem für die Kinder vor. Doch dazu kam es nicht mehr. Beamte der Gestapo und ihre Helfershelfer drangen in die Wohnungen der Juden und in das Friedrichsheim ein und befahlen den Anwesenden, innerhalb einer halben Stunde für den Abtransport bereit zu sein. Nur das Nötigste dürfe mitgenommen werden, dazu pro Person eine Wolldecke und 100 Mark. Alle mussten schriftlich «freiwillig» auf ihr Eigentum verzichten. Ähnlich erging es an diesem Tag allen Juden in Baden und in der Saarpfalz, derer die Nazis habhaft werden konnten. Die Sicherheitspolizei meldete bis Ende Oktober die «reibungslose Abschiebung» von 6504 Juden; weitere kamen in der folgenden Zeit hinzu. Was war mit dieser Aktion beabsichtigt? Die Nationalsozialisten hatten seit 1933 systematisch ihr Ziel verfolgt, die Juden aus der deutschen Gesellschaft auszuschalten. In ihren Massnahmen gingen sie durchaus pragmatisch vor, richteten sich nach den Möglichkeiten und nicht zuletzt den aussenpolitischen Bedingungen. In den ersten Jahren wurden die Juden durch Gesetze ausgegrenzt und in ein gesellschaftliches Ghetto gedrängt. Schrittweise verloren sie ihre Rechte und wurden – wie durch die «Rassengesetze» von 1935 – unter Sonderrecht gestellt. Gewaltakte gegen sie waren in der Regel inszeniert, um den Radau-Antisemiten ein Ventil zu geben und darüber hinaus gesetzliche Regelungen vorzubereiten, indem diese als Wunsch des «gesunden Volksempfindens» bezeichnet und damit legitimiert wurden. Die Brandstiftung der Synagogen und die Pogrome vom 9. und 10. November 1938 leiteten auf diese Weise zur endgültigen Ausschaltung der Juden aus dem Wirtschaftsleben über und damit auch zur »Arisierung« jenes Restes von Betrieben, die sich noch im Besitz von Juden befanden. Selbst im Alltag sollte den Juden jede Freude genommen werden. Sie konnten sich nicht mehr frei bewegen, waren von nicht-jüdischen Veranstaltungen und Einrichtungen ausgeschlossen, durften keine Autos oder Motorräder fahren, keine Haustiere halten, mussten alle Wertgegenstände abliefern. In Gai-
Zum Gedenken an die Deportation am 22. Oktober 1940
|
179
lingen hatte der Bürgermeister unter anderem angeordnet, dass die Juden nur noch während zweier Stunden am Tag einkaufen und lediglich morgens von sechs bis sieben Uhr vor dem jüdischen Friedhof spazierengehen durften. Rechtlosigkeit, Diskriminierung im Alltag und Verlust des Vermögens machten es den Juden praktisch unmöglich, selbständig zu existieren. Sie drohten, der staatlichen Fürsorge zur Last zu fallen. Die Nazis verstärkten deshalb ihre Bemühungen, die Juden zur Ausreise zu bewegen (und sich bei dieser Gelegenheit den Rest des Vermögens anzueignen). Sie traten zu diesem Zweck sogar in Verhandlungen mit ausländischen Staaten ein, nachdem an der Konferenz von Evian 1938 deutlich geworden war, dass im Ausland an sich kein besonderes Interesse an der Aufnahme jüdischer Flüchtlinge bestand. Der Kriegsausbruch 1939 machte diesen Verhandlungen ein Ende. Statt dessen erwogen nun die zuständigen Reichsstellen eine zwangsweise Aussiedlung der Juden. Zunächst dachte man an ein Reservat in Polen, das sich aber nicht als geeignet erwies. Dann zog man ein Projekt aus der Schublade, das seit dem völkischen Antisemiten Paul de Lagarde im 19. Jahrhundert immer wieder, nicht nur in Deutschland, als Mittel zur Lösung der »Judenfrage« auftauchte: die Bildung eines Judenstaates auf Madagaskar. Himmler favorisierte diesen Plan, Hitler sondierte bei Mussolini, und nach dem militärischen Sieg über Frankreich schien die Verwirklichung möglich. Die beiden Gauleiter für Baden und die Pfalz, denen auch die eroberten Gebiete Elsass und Lothringen unterstanden, – Robert Wagner und Josef Bürckel – sahen in dem Plan eine Möglichkeit, dem Befehl Hitlers vom 25. September 1940 nachzukommen, ihre Gaue innerhalb von zehn Jahren «rein deutsch» zu melden; er werde sie nicht fragen, «welche Methoden sie angewandt hätten». Zu dieser Zeit wurden bereits »unerwünschte« Personen, darunter etwa 3000 Juden, aus Elsass und Lothringen in das unbesetzte Frankreich abgeschoben. Die dortige Vichy-Regierung warnte allerdings vor den Folgen weiterer Ausweisungen. So entschieden sich die Gauleiter – die Hauptinitiative ging wohl von Wagner aus – mit Billigung Hitlers dafür, die Juden ihrer Gaue in einer kurzfristigen Aktion mit Transportzügen nach verschiedenen Lagern in Südfrankreich zu deportieren, wo sie die französischen Behörden internieren sollten, bis die Weiterreise nach Madagaskar möglich sei. Gurs am Pyrenäenrand vor allem und daneben kleinere Lager in der Nähe von Toulouse – Noé, Récébédou, Rivesaltes und einige weitere – waren also die Ziele der Transportzüge. Für die Gailinger Juden begann diese Fahrt in Singen. Dorthin waren sie mit Lastwagen gebracht worden. Vor dem Rathaus hatten sie sich versammeln müssen, nachdem sie in einem Schulzimmer registriert und mit einer Anhängenummer versehen worden waren. Frau Friesländer erinnerte sich, wie der damals amtierende Bürgermeister zu ihrem Mann sagte: »So Friesländer, jetzt geht’s ins gelobte Land.« Neben ihm sei »seine Hoffotografin« gestanden und habe Aufnahmen gemacht, die später zufällig in ihren Besitz gekommen seien. In mehreren Veröffentlichungen sind diese Fotos zu sehen, und sie belegen, dass
180
|
Zachor – Erinnere Dich!
nicht nur der Bürgermeister, sondern zahlreiche Gailinger Bürger und Bürgerinnen, viele mit ihren Kindern auf dem Arm oder an der Hand, der Deportation zuschauten. Der Anblick auf den Bildern wirkt nicht so, als wollten sie traurig von ihren früheren Nachbarn Abschied nehmen, als litten sie mit, weil sie gegen diese Demütigungen und Misshandlungen seitens der Staatsmacht nichts ausrichten könnten. Die Fotos zeigen eher – Ausnahmen mag es gegeben haben –, dass die Jüdinnen und Juden wie durch eine unsichtbare Grenze von den Christen getrennt waren, noch nicht einmal ein Blickkontakt ist dokumentiert. Nur Kinder drängten nach vorn, grinsten, freuten sich, wollten sich diese Sensation nicht entgehen lassen. Nachdem die Lastwagen abgefahren waren, «flog», wie Frau Friesländer berichtet, »noch mancher Stein an unsere käfigartige Behausung«. Obwohl in Gailingen länger als anderso nach 1933 ein einigermassen auskömmliches Zusammenleben beider Bevölkerungsteile möglich gewesen war, sich auch Christen für ihre jüdischen Nachbarn eingesetzt hatten, war die Politik der Nazis schliesslich doch erfolgreich gewesen und hatte die Ausgrenzung der Juden durchgesetzt. Die traditionelle Kommunikation war zerstört worden. Indem die christlichen Einwohner dies hinnahmen, liessen sie es zu, dass ein Teil ihrer eigenen Geschichte und Kultur, damit auch ein Teil ihrer Identität vernichtet wurde. Und was geschah mit dem Eigentum, das die Juden hatten zurücklassen müssen, auf das sie gezwungenermassen »freiwillig« verzichtet hatten? Soweit es nicht der Staat beanspruchte, ging es in die Hände christlicher Einwohner Gailingens über. Hierüber ist weitgehend der Mantel des Schweigens gebreitet worden. Nur wenige Eintragungen in den Grund- und Lagerbüchern verzeichnen einen Besitzerwechsel, aber Anträge und Prozesse nach 1945 weisen daraufhin, dass darüber hinaus Aneignungen vollzogen worden waren. Keine Akte gibt darüber Auskunft, was mit der beweglichen Habe der Gailinger Juden geschehen ist. Einen Fingerzeig, was in den nichtjüdischen Bewohnern vorgegangen sein mag, liefert ein Ereignis 1945: Nach Kriegsende musste die Bevölkerung vorübergehend den Ort verlassen, weil die alliierten Streitkräfte ein militärisch kontrolliertes Sperrgebiet entlang der Schweizer Grenze schaffen wollten. Dieser Hintergrund war den Gailingern nicht bekannt. Zumindest ein Teil von ihnen sah in dieser Massnahme, wie aus einem Bittgesuch der katholischen Pfarrer von Gailingen und umliegenden Ortschaften hervorgeht, eine Vergeltung für den Terror gegenüber den Juden. Vorsorglich wurde deshalb in dem Brief hervorgehoben, dass die Einwohnerschaft damit nichts zu tun gehabt habe und alles «nur das Werk von fremden Elementen» gewesen sei, die auch die «damals führenden Leute» unter Strafandrohung mit sich gerissen hätten. Gewiss: die Organisatoren des Transports, die Beamten, die die Aktion ausführten, kamen von ausserhalb – meist aus Radolfzell –, aber der Bürgermeister und viele andere Gailinger waren keineswegs unschuldiggezwungene Mitläufer oder gar hilflos-unbeteiligte Zuschauer. Der Ablauf des Geschehens wie die Vorgeschichte machen deutlich, dass sie die judenfeindlichen
Zum Gedenken an die Deportation am 22. Oktober 1940
|
181
Massnahmen aktiv unterstützten. Der Bittbrief drückt das schlechte Gewissen aus, die Furcht vor Rache. Als die Lastwagen den Ort verlassen hatten, gab es nur noch wenige Juden in Gailingen, die an diesem Tag nicht transportfähig waren und deshalb einige Zeit später, am 16. November 1940, deportiert wurden. Der Beamte, der im Gailinger Rathaus die nach 1933 erstellte »Judenkartei« führte, vermerkte bei den Personen, die auf die Lastwagen verladen worden waren: »Durch Aktion nach Frankreich ausgewandert« oder »verz.(ogen) 22.10.1940 nach Frankreich«. Diese angeblich auswandernden und umziehenden Menschen sassen ab Singen dichtgedrängt in streng bewachten Eisenbahnwaggons und wussten nicht, was mit ihnen geschehen werde. In Mulhouse übergaben die deutschen Bewacher ihre «Fracht» der französischen Miliz. Von Bahnhof zu Bahnhof ging es weiter. Frau Friesländer schreibt: »Die Hochbetagten, Taubstummen und Geistesschwachen aus dem Altersheim Gailingen, die unsere traurigen Reisegefährten waren, wußten überhaupt nicht, was all dies zu bedeuten hatte. Sie bekamen Schreikrämpfe, verlangten zu essen und zu trinken (...).« Endlich, «nach zwei jammervollen Tagen und Nächten», durften alle aussteigen. Einige der Älteren und Kranken konnten allerdings nur noch tot aus den Waggons geholt werden. Der Schrecken war auch noch keineswegs zu Ende: Männer, Frauen und Kinder wurden getrennt und wiederum auf Lastwagen verladen. In Gurs fanden sie sich wieder. Männer und Frauen wurden jedoch in unterschiedlichen, weit voneinander entfernten Baracken untergebracht, die Familien auseinandergerissen. War den Menschen schon die Fahrt entsetzlich vorgekommen, so übertrafen die Verhältnisse im Lager alle Vorstellungen von Elend und Leid. Gurs hatte zuvor als Internierungsstätte für Asylsuchende aus Spanien gedient, die nach dem Sieg der Putschisten unter General Franco im Bürgerkrieg geflohen waren. Darüber hinaus wurden in diesem Ort seit Sommer 1940 weibliche politische Flüchtlinge aus Deutschland untergebracht. Insgesamt hielt man hier bis zur Befreiung des Lagers im Sommer 1944 rund 20’000 Menschen fest. Jeweils etwa 25 der insgesamt ungefähr 300 Baracken waren zu einem Block, einem »ilot«, zusammengefasst und mit Stacheldraht abgesperrt. In jeder Baracke hausten 50 bis 100 Menschen auf engstem Raum. Niemand konnte sich in eine Privatsphäre zurückziehen. Es gab keine Fenster, der Boden bestand grossenteils aus festgestampftem Lehm, die Menschen lagen auf Strohsäcken, später erhielten sie dünne Decken. Ratten huschten herum. Allgegenwärtig war der morastige Schlamm im Lager, in den Briefen und Berichten ist ständig davon die Rede. Einer, Hans Hanauer aus Karlsruhe, schreibt: »Man musste seine Schuhe sorgfältig festschnüren, damit sie nicht vom Fuß glitten, wenn man sie aus dem saugend quatschenden, tiefen Schlamm zog.« Ältere Menschen, die nachts die Baracke verliessen, um die Toilette aufzusuchen – ein Gerüst, unter dem grosse Fässer
182
|
Zachor – Erinnere Dich!
standen und auf das man hinaufklettern musste –, rutschen oft im Schlamm aus und konnten aus eigener Kraft nicht wieder aufstehen. Man fand sie morgens tot im Matsch. In Badehütten konnte man kalt duschen. Manche Mütter erhitzten auf den Öfen in den Baracken Wasser, um ihre Kinder baden zu können. Wäsche waschen war anfangs nicht möglich, da keine Seife vorhanden war. Die Essrationen reichten in der ersten Zeit nicht, weil das Lager nicht auf so viele Deportierte eingerichtet gewesen war. Als Nahrung dienten vor allem Wassersuppen mit ein wenig Gemüse darin, dazu Topinambur als Kartoffelersatz, etwas Brot. Nach und nach trafen dann Hilfspakete ein, vor allem aus der Schweiz. Die Quäker sorgten im übrigen dafür, dass die Kinder besser versorgt wurden. Immerhin: diese konnten sich einigermassen frei im Lager bewegen, also zwischen Mutter und Vater oder anderen Verwandten und Bekannten hin und her gehen. Erlaubt waren auch jüdische Gottesdienste. In beeindruckender Weise organisierten die Gefangenen ihr Lagerleben, versuchten, etwas Freude in die Trostlosigkeit zu bringen, führten kulturelle Veranstaltungen durch. Viele bewahrten sich durch Schreiben, Malen oder Komponieren ihre Selbstachtung. Nicht zu übersehen sind allerdings auch die negativen Auswirkungen der Extremsituation, die menschliche Schwächen um so stärker hervortreten liessen. Täglich zog der Totenkarren im Lager seine Kreise. Aufgrund der unzulänglichen medizinischen Versorgung – die internierten jüdischen Ärztinnen und Ärzte taten, was sie konnten –, der schlechten sanitären Zustände und der Unterernährung starben in den ersten Monaten in Gurs bei einer Ruhrepidemie und einer ansteckenden Gehirnhautentzündung über 1000 Menschen. Ein kleiner Teil der Deportierten konnte gerettet werden: Hilfsorganisationen, Bekannten und Verwandten gelang es, ihnen rechtzeitig Visa zu besorgen, die ihnen die Ausreise ermöglichten. Eine Anzahl Kinder und Ältere kam in Kinder-, Waisen- und Altersheimen unter und blieb teilweise von weiteren Verfolgungen verschont. Wenige konnten fliehen und untertauchen. Zu ihnen gehörte Berty Friesländer, und auch ihr kleiner Sohn blieb am Leben, während ihr Mann die extremen Belastungen nicht überstanden hatte. Die meisten erwartete noch eine Steigerung des Leids. Am 10. Mai 1941 wies der badische Innenminister die Gestapo-Leitstelle Karlsruhe an: »(...) die Ausreise reichsdeutscher Juden aus dem unbesetzten Gebiet Frankreichs nach Übersee (ist) nicht erwünscht.« In der Politik der Nazis gegenüber den Juden war eine Wende eingetreten. Die Einsicht, dass Grossbritannien vorerst nicht militärisch zu besiegen und auch nicht zu einem Friedensschluss zu bewegen war, sowie der Entschluss, die Sowjetunion zu überfallen, um auf diese Weise den Sieg im Weltkrieg zu erzwingen, liessen den Madagaskar-Plan völlig unrealistisch werden. Damit trat die immer schon mitbedachte Variante in den Vordergrund: die physische Ausrottung aller Juden, die «Endlösung der Judenfrage». Bereits seit 1939 hatten SS-Kommandos, besondere Einsatzgruppen, Polizeibataillone und Wehrmachts-
Zum Gedenken an die Deportation am 22. Oktober 1940
|
183
einheiten in Polen Juden in Massenaktionen ermordet. Nach dem Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 gingen die Massenexekutionen und Massaker an der jüdischen Zivilbevölkerung weiter. Eine Idee, die verbliebenen Juden in unbewohnte Gebiete der eroberten Sowjetunion zu deportieren, stellte sich bald als nicht verwirklichbar heraus. So reifte im Sommer und Herbst 1941 die Entscheidung zur systematischen Massenvernichtung der Juden in besonderen Lagern heran, die dann ab Frühjahr 1942 in die Tat umgesetzt wurde. Vom Sammellager Drancy bei Paris aus rollten ab 27. März 1942 Zug um Zug nach Auschwitz bei Krakau oder in ein anderes Vernichtungslager im Osten. Neben den in Frankreich selbst aufgespürten Juden waren in diesen Transporten seit August 1942 die in Gurs und anderswo internierten Juden aus Baden und der Pfalz zusammengepfercht. Kaum jemand überlebte das Lager. Die Deportation der badischen und saarpfälzischen Juden ist ein Teil der Schoa, der »Katastrophe« des Völkermords an den Juden. Die Erinnerung daran muss die Ereignisse und ihre Ursachen immer wieder re-präsent machen, zurückholen, vergegenwärtigen. Das jüdische Geschichtsverständnis, das ich eingangs skizziert habe, kann dabei als Herausforderung für uns dienen. Ein derartiger Prozess ist schmerzlich – für diejenigen, die mit den Menschen der damaligen Zeit in irgendeiner Weise verbunden sind, aber auch für uns alle heute, wenn wir sehen, was Menschen anderen Menschen angetan haben, und wissen, dass derartige Verhaltensweisen immer wieder möglich sind. Vor Schmerzen haben wir aber alle Angst, wir wollen sie vermeiden, und deshalb wird die Erinnerung an die schlimmen Vorgänge der Nazi-Zeit leicht verdrängt. Es ist kein Zufall, dass es in Deutschland heute noch «weisse Flecken» und Sperren bei der Aufarbeitung der Geschichte des «Dritten Reiches» gibt. Es ist kein Zufall, dass erst heute in der Schweiz und in anderen Ländern die Diskussion über die eigene Verantwortung am Schicksal der Juden oder sonstigen Ereignissen der Zeit in aller Schärfe geführt werden. Und es ist auch kein Zufall, dass wir erst jetzt in Gailingen so würdige Gedenkorte haben, dass der Weg hierhin nicht einfach und mit verletzenden Kontroversen verknüpft war. Aber die Erinnerung schmerzt nicht nur, sie befreit uns auch. Sie kann nicht zuletzt von den unterdrückten Schuldgefühlen befreien, die zu Verdrängungen geführt haben. Sie kann weiterhin denjenigen, die unermessliches Leid ausgestanden haben, helfen, sich aus ihren traumatischen Bedrückungen zu lösen und ihre Erfahrungen weiterzugeben. Nur was erinnert wird, ist bewusste Geschichte, mit der sich die Menschen auseinandersetzen können. Das heisst auch, dass sich die Erinnerung nicht in einer Stele, einer Gedenktafel, einem würdig gestalteten Platz oder einem Museum erschöpfen darf. Diese Zeichen können als Gedächtnisorte Anlass und Anstoss zum Gedenken geben und zusätzliche Formen anregen. Die Erinnerung muss lebendig erhalten werden, damit die Geschehnisse nachvollzogen werden können und in die Zukunft wirken. Wenn wir dadurch
184
|
Zachor – Erinnere Dich!
einen unmittelbaren Bezug zur Geschichte herstellen können, wenn sie »unsere« Geschichte wird, wird es interessierten Gruppen nicht so leicht fallen, uns mit Hinweis auf angebliche historische Entwicklungen für ihre Zwecke zu vereinnahmen. Die Nazis haben, auf Vor-Einstellungen aufbauend, durch ihre Feindbilder und namentlich durch die antisemitische Ideologie, die sie scheinbar historisch begründeten, einen Mechanismus in Gang gesetzt, der zahlreiche Menschen zu Verbrechern werden liess. Und wir wissen es alle: bis heute werden die meisten kriegerischen Konflikte durch einen Verweis auf die Geschichte gerechtfertigt und die Menschen damit mobilisiert, Gewalt auszuüben. Auch davon können wir uns befreien. Verbunden damit ist ein weiterer Aspekt. Erinnerung soll eine Art Probehandeln ermöglichen. Wir sind keine Richter, die über Schuld und Unschuld urteilen. Wer weiss denn, wie wir uns in der damaligen Situation verhalten hätten. Hätten wir ein Abschiedswort zu den Juden vor den Lastwagen gesprochen? Hätten wir versucht, etwas zu unternehmen, etwas zu ändern, ihnen zu helfen? Indem wir über die Erinnerung im damaligen Geschehen mit-leben, können wir immerhin geistig auch mit-handeln, überlegen, welche Möglichkeiten und Alternativen es gab, was vor dem 22. Oktober 1940 hätte getan werden können, damit es nicht so weit gekommen wäre. Vielleicht kann ein solches Probehandeln uns selbst stärken, damit wir einmal, wenn es darauf ankommt, eingreifen und etwas tun. Deshalb: Zachor – Erinnere Dich!
22. Oktober 2000
Wie einer in der Nazi-Zeit unter die Räder kam Der »Fall« Reinhold Birmele und seine Verarbeitung in der Bundesrepublik Deutschland* Der 15. Juli 1942 war ein Mittwoch. Reinhold Birmele, achtundzwanzigjähriger Gehilfe in der Gärtnerei Rappenecker, bearbeitete ein Grundstück in der Freiburger Beethovenstraße. Wegen epileptischer Anfälle in der Vergangenheit hatte er nicht als Soldat in den Krieg ziehen müssen. Nebenan, Nr. 9, lag der Garten, der zur Villa des ehemaligen Bankdirektors Hein gehörte. Birmele hatte schon oft dort gearbeitet. Nur flüchtig war er hingegen bisher der achtundfünfzigjährigen Hausgehilfin der Familie Hein, Maria Weber [Name geändert, H. H.], begegnet, die gerade in den Garten trat; er wußte nicht einmal ihren Namen. Sie kamen ins Gespräch. Dabei stellte sich heraus, daß Frau Weber in St. Peter beheimatet war und Reinhold Birmele ihre dort verheiratete Schwester kannte. Sie habe jetzt Ferien und wolle ihre Schwester wieder einmal besuchen, meinte Birmele die Hausgehilfin zu verstehen. Ihm kam die Idee, sie zu fragen, ob sie nicht gemeinsam dorthin wandern wollten. Er war ein großer Naturfreund und jeden Sonntag draußen in den Bergen. Birmele wollte dann, nach dem Besuch der Bekannten in St. Peter, über den Kandel zurück nach Kollnau laufen, wo er wohnte. Eine richtige Verabredung war es wohl nicht, aber Birmele dachte, Maria Weber habe seinem Plan zugestimmt.1 So verabschiedete er sich am Sonntag früh – es war der 19. Juli – von seiner Frau Luise und fuhr um acht Uhr mit der Elztalbahn nach Freiburg. Gegen 9.30 Uhr läutete er in der Beethovenstraße an der Tür von Nr. 9. Zunächst rührte sich nichts. Nach mehrmaligem Läuten wurde durch das Türmikrophon gefragt, wer dort sei. Birmele läutete wieder. Zu seiner großen Überraschung erschien dann jedoch nicht die Hausgehilfin, sondern er hörte durch die Tür die Stimme von Frau Hein, die ihn nach seinem Begehren fragte. Birmele bekam einen Riesenschreck Er wollte nicht, daß Frau Hein von seiner beabsichtigten Wanderung mit Maria Weber erfuhr, zumal sie diese, wie sie ihm erzählt hatte, grob behandelte. Um abzulenken, rief er: »Polizei!« Vielleicht war ihm dieser Einfall gekommen, weil seine Frau am Morgen, als er sich seinen Regenmantel anzog, gesagt hatte, er sehe aus »wie ein Kriminaler«.2 Frau Hein wollte wissen, was das * Erstpublikation in: Zeitschrift des Breisgau-Geschichtsvereins »Schau-ins-Land« 119 (2000, erschienen 2001) S. 171–186. 1 Alle Ausführungen, soweit nicht anders vermerkt, nach: Staatsarchiv Freiburg, B 18/21, Nr. 80, C 2 Cs. 74/72 (Amtsgericht Freiburg [Breisgau]. Strafsache »gegen Reinhold Birmele, Gärtnergehilfe in Kollnau wegen Amtsanmassung«). 2 So Frau Birmele in einem Gespräch am 12.1.1998.
186
|
Wie einer in der Nazi-Zeit unter die Räder kam
bedeute. Er wiederholte: »Polizei!« Als sie den Hausschlüssel holen wollte, rief Birmele, er werde in einer Stunde mit dem Auto wiederkommen. Er entfernte sich, ging zu einer befreundeten Familie und kehrte später nach Hause zurück, erzählte allerdings nichts von dem Vorfall.3 Fanny Hein sah die Geschichte etwas anders. 1879 in Hamburg geboren, war sie mit ihren Eltern, Ferdinand und Marie Wibel, 1893 nach Freiburg gekommen. Seit 1941 lebte sie in der Beethovenstraße.4 Sie war an dem Sonntagmorgen bereits auf, während der bei ihr einquartierte Sanitätssoldat Dr. Hans Schindler, der damals als Arzt in der Augenklinik Dienst tat, noch im Bett lag; er hörte den Vorfall von dort aus mit. Frau Hein ging wegen des mehrmaligen Läutens hinunter an die Haustür und schaute durch das verschlossene Fenster. Sie erkannte einen Mann, der einen grauen Regenmantel sowie einen grünen Hut mit einer Kordel rundherum und eine dunkle Brille trug. Gleich vermutete sie, dies sei der Gärtner, der schon häufig bei ihnen gearbeitet hatte. Als er »Polizei!« rief, bekam sie es mit der Angst zu tun: Ob er sich auf diese Weise Zugang zu ihrem Haus verschaffen wollte, um dort – vielleicht sogar unter Gewaltanwendung – Wertgegenstände an sich zu nehmen? Sie empfand jedenfalls sein Rufen als Brüllen und als Drohung. Nachdem er sich entfernt hatte, rief sie den Gärtner Rappenecker an und fragte ihn, ob sein Gehilfe, der schon bei ihnen beschäftigt gewesen sei, einen grünen Hut mit Kordel besitze. Rappenecker wußte dies nicht, meldete sich aber am nächsten Morgen und bestätigte Frau Heins Verdacht. Sie erstattete Anzeige. Einen Tag später, am 21. Juli 1942, wurde Reinhold Birmele um zehn Uhr an seiner Arbeitsstelle bei der Gärtnerei Rappenecker in der Brombergstr. 23 verhaftet und noch am selben Tag durch Kriminalsekretär Frohn verhört.5 Birmele leugnete den Vorfall nicht, bestritt aber jegliche aggressive Absicht und versuchte, das 3 Ebenda. 4 Der Bankdirektor i. R. Hermann Hein ist im Freiburger Adreßbuch von 1941 bis 1943 eingetragen. Eine Meldekarte hat sich weder von ihm noch von seiner Frau Fanny erhalten. Es liegt im Stadtarchiv Freiburg lediglich eine Karte vor, die folgenden Vermerk trägt: »Lt. Feststellung der Schutzpolizei vom 22.1.1947 befindet sich im Haus Beethovenstr. 9 eine franz. Dienststelle. Nach Aussagen der Nachbarschaft ist Bankdirektor Hermann Hein vor längerer Zeit nach Düren i./Westf. verzogen, Nähere Anschrift ist nicht bekannt« (Schreiben vom 2.7.1996). Weder das Stadtarchiv in 52348 Düren noch in 58449 Witten – mit dem Ortsteil Düren – konnten jedoch eine Familie Hein nachweisen (Schreiben vom 15.7.1996 bzw. 5.8.1996). Die Angaben zu Hamburg sind einem Schreiben des dortigen Staatsarchivs vom 18.7.1996 entnommen. Uber den Aufenthalt der Familie Wibel in Freiburg liegen Meldekarten vor (Schreiben des Stadtarchivs Freiburg vom 26.7.1996). Ich danke Frau Anita Hefele, Frau Dr. Martina Kliner-Fruck, Herrn Dr. Domsta und Herrn Bollmann von den genannten Archiven für ihre Recherchen. 5 In den Akten wird als Verhaftungstag der 21. und der 22. Juli angegeben, doch da auch ein Einlieferungsschein in das Gerichtsgefängnis vom 21.7. vorliegt, dürfte dieses Datum richtig sein.
Der »Fall« Reinhold Birmele
|
187
Ganze als einen Scherz hinzustellen, der die Hausgehilfin habe schützen sollen. Dem Verhörprotokoll ist anzumerken, daß der Kriminalbeamte über Birmeles Verhalten empört war. Zu dessen Werdegang erfahren wir, daß er katholischer Konfession war und am 10. Juni 1914 in Luxemburg geboren wurde, wo sein Vater August als Mechaniker wohl in einer Zeche tätig gewesen war. Später sei er nach Essen zu Krupp gewechselt und 1920 nach Waldkirch gezogen. Die Eltern seien – »angeblich«, wie der Beamte vermerkte – »deutschblütig«. Nach acht Jahren Volksschule habe er den Gärtnerberuf erlernt.6 Seit dem 6. Lebensjahr habe er durchschnittlich alle vier Wochen epileptische Anfälle. 1934 leistete er seinen Arbeitsdienst ab,7 trat aber, wie Frohn ausdrücklich festhielt, nicht in die NSDAP ein. 1938 kam er zu Rappenecker, 1940 heiratete er. Frohn fügte seinem Protokoll noch hinzu: »angebl. einmal mit 7 Monate Gefängnis wegen Diebstahl. Besitzt angebl. kein Vermögen.« Die Hausgehilfin Maria Weber8, am 22. Juli befragt, bestätigte im wesentlichen die Darstellung Birmeles über ihr Gespräch im Garten. Allerdings wies sie 6 Frau Birmele berichtete am 12. Januar 1998, er habe in der Waldkircher Gärtnerei Maier gelernt. Später habe er über zwei Jahre in der Elzacher Gärtnerei Reichenbach und dann auch in der Gärtnerei der Kollnauer Fabrik gearbeitet. 7 Nach Erinnerung von Frau Birmele am 12.1.1998 wurde er bei Arbeiten im KZ Dachau beschäftigt. Vgl. Birmeles später zitierten Hinweis. Nach den Gerichtsakten leistete er den Arbeitsdienst vom Herbst 1934 bis Frühjahr 1935 in »Gerolving« (gemeint ist wohl Gerolfing bei Ingolstadt). Aus seinem »Arbeitsdienstpaß« geht hingegen hervor, daß er vom 22.6. bis 31.10.1934 im Arbeitsdienst war. Entlassen worden sei er wegen »Stellungsuche«, wie die entlassende Dienststelle Geisenfeld bescheinigte. Weitere Einzelheiten konnten noch nicht belegt werden. In der KZ-Gedenkstätte Dachau liegen keine Unterlagen zu einem derartigen Arbeitsdiensteinsatz vor (schriftliche Mitteilung vom 23.3.1998). Auch in den Beständen der Stadt Geisenfeld konnte kein Hinweis auf Birmele gefunden werden. Ich danke dem 1. Bürgermeister, Herrn Max Steinberger, und dem Standesbeamten, Herrn Helmberger, für ihre Recherchen (schriftliche Mitteilung vom 11.11.1998). Zum Arbeitsdienstlager Geisenfeld vgl. Helmut Weinmayer: Geisenfeld. Ein Streifzug durch die Vergangenheit. 2. Aufl. Pfaffenhofen 1995, S. 114 – 115. Ebenfalls erfolglos blieben Nachforschungen des Stadtarchivs Ingoldstadt, für die ich Herrn Edmund Hausfelder herzlich danke (schriftliche Mitteilung vom 11.1.1999), sowie seitens des Bundesarchivs in den Beständen des Reichsarbeitsministerium (R 3901), des Reichsarbeitsdienst (R 77) und des ehemaligen Berlin Document Centers (BDC); hier danke ich Herrn Zarwel sehr für seine Unterstützung (schriftliche Mitteilung vom 27.4.1999). 8 Die Hausgehilfin, deren Name hier verändert wurde, kam am 27.4.1884 in St. Peter als Tochter eines Tagelöhners zur Welt und ging bereits als junges Mädchen zur Arbeit nach Freiburg. Dort starb sie auch, ledig und ohne Kinder, am 28.9.1967. Beerdigt ist sie in St. Peter. Zur Zeit des geschilderten Ereignisses wohnte sie nicht weit von ihrem Arbeitsplatz, nämlich in der Goethestraße. In St. Peter Iießen ich keine weiteren Erinnerungen an den »Fall« erschließen. Für ihre Nachforschungen danke ich Herrn Bürgermeister G. Rohrer und Herrn Klaus Weber, beide St. Peter, sowie Herrn Dr. Ulrich P. Ecker vom Stadtarchiv Freiburg.
188
|
Wie einer in der Nazi-Zeit unter die Räder kam
es weit von sich, daß sie jemals mit ihm eine Wanderung unternommen hätte, selbst wenn sie von ihm dazu eingeladen worden wäre. Auf ihre Tugend wollte sie nichts kommen lassen. Aber zwischen ihr und Birmele hatte es tatsächlich ein Mißverständnis gegeben: Während er an Ferien und eine – wenn auch lockere – Verabredung glaubte, hatte sie gemeint, daß sie an dem fraglichen Mittwoch ihren letzten Beschäftigungstag bei der Familie Hein verbringe. Am 16. Juli 1942 war sie aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden. Trotz ihrer Distanzierung von Birmele unterließ sie es nicht, ihre frühere Dienstherrin anzuschwärzen: »Sie ist sehr hungerig [ein sprechender Ausdruck für geizig, gemünzt auf eine Arbeitgeberin!] und gönnt einem andern Menschen nichts. Mir ist es in der Zeit, in der ich bei ihr in Stellung war [ungefähr zwei Jahre], nicht gerade gut gegangen. Das Essen war sehr knapp und ich kam in meinen Kräften sehr herunter. Wie ich durch ein früheres Mädchen erfahren habe, soll die Frau Hein nicht ganz arisch sein. Man sagte mir, ihre Mutter sei eine Jüdin gewesen. Ihr ganzes Wesen deutet auch darauf hin.« Die Denunziation ist ein Musterbeispiel, wie ein antijüdisches Klischee – eine »Arierin« kann nicht geizig sein – mit einem Gerücht zusammengebracht wird, um nicht selbst den Wahrheitsbeweis antreten zu müssen. Sie hätte Frau Hein in tödliche Gefahr bringen können, spielte aber in deren Befragungen keine Rolle.9 Da der Fall weiterer Aufklärung bedürfe und Verdunkelungsgefahr bestehe, erging nun Haftbefehl wegen »Amtsanmaßung«, und noch am selben Tag, dem 22. Juli, wurde Birmele dem Haftrichter Dr. Kretschmer vorgeführt. Wiederum ist das Verhörprotokoll keineswegs neutral gehalten. Diesmal läßt es die Sympathie des Richters für den Beschuldigten erkennen: Er legt ihm durch seine Fragen die Antworten geradezu in den Mund. Birmele betonte die Harmlosigkeit seiner Absicht – er wollte nur unerkannt entkommen. Eine Amtsanmaßung habe nicht vorgelegen, »weil ich keine Amtshandlung vortäuschen wollte. Ich habe nicht etwa gerufen, daß ich eine Haussuchung oder etwas derartiges vornehmen wolle.« Auf Nachfragen de Richters berichtete er, er habe zuvor im Bahnhof zwei Glas Bier getrunken. Wegen seiner epileptischen Anfälle sei er schon drei Monate im Emmendinger Krankenhaus zur Beobachtung gewesen. Gärtner sei er geworden, »weil ich immer in freier Luft arbeiten soll«. Dr. Kretschmer versuchte auch, das Gewicht seiner Vorstrafe, die der Kriminalbeamte für eine schwere Belastung angesichts des Verdachts auf Diebstahl bei der Familie Hein gehalten hatte, zu entkräften: »Ich wollte damals mir einen Anzug
9 Vermutlich erkannte der Kriminalbeamte sofort die Absicht. Ob dennoch Erkundigungen eingezogen wurden, geht aus den Akten nicht hervor. Nach Mitteilung des Staatsarchivs Hamburg vom 18.7.1996 waren Frau Heins Eltern evangelisch-lutherisch getauft; für eine Mitgliedschaft in der jüdischen Gemeinde gab es keine Hinweise.
Der »Fall« Reinhold Birmele
|
189
1 Arbeitsdienstpaß (Arbeitsgau 30, Bayern-Hochland, Abt. 6/300), der Reinhold Birmele bescheinigt, ein »guter Arbeiter« zu sein. Die Entlassung erfolgte am 31. Oktober 1934 aus Geisenfeld wegen »Stellungsuche«. (Photo Privatbesitz)
holen, der einem Freunde meiner Schwester gehörte. Ich war damals arbeitslos und hatte keine Kleider.«10 Die Strategie des Richters ging zunächst auf. Obwohl Frau Hein ihre Anzeige am 28. Juli aufrecht erhielt, weil Birmeles Verhalten für sie »durchaus keinen harmlosen Charakter« hatte, erließ das Freiburger Amtsgericht am 5. August 1942 auf Antrag des Oberstaatsanwaltes eine Strafe von einem Monat Gefängnis unter Anrechnung der Untersuchungshaft. Der Strafgrund lautete, Birmele habe sich »unbefugt mit Ausübung eines öffentlichen Amts befasst oder eine Handlung vorgenommen, die nur kraft eines öffentlichen Amts vorgenommen werden darf« (§ 132 Strafgesetzbuch). Einen Tag später wurde Birmele das Urteil eröffnet. Er nahm es widerspruchslos an. Die auferlegten Kosten konnten nicht eingetrieben werden, da er tatsächlich kein Vermögen besaß. Bereits am 23. August 1942 war die Haftzeit abgelaufen. Morgens um elf Uhr wurde er entlassen – jedoch nicht in die Freiheit. Auf Reinhold Birmele wartete die Gestapo und nahm ihn in »Schutzhaft«.11 Was war geschehen? Hatte 10 Der eingeholte Auszug aus dem Strafregister ergab eine Verurteilung durch das Amtsgericht Waldkirch am 4.5.1934 wegen Diebstahls in zwei Fällen zu zwei Monaten Gefängnis, erlassen durch die Amnestie vom 7.8.1934, sowie zwei weiteren Verurteilungen durch das Amtsgericht Emmendingen am 9.5.1935 wegen versuchten Einbruchdiebstahls zu vier Monaten Gefängnis und am 13.6.1935 wegen versuchten gemeinschaftlichen Diebstahls – unter Einbeziehung des vorherigen Urteils – zu sieben Monaten Gefängnis. 11 Der Schutzhaftbefehl oder sonstige Unterlagen zu diesem Vorgang konnten weder im Bestand Reichssicherheitshauptamt (R 58) noch in anderen einschlägigen Beständen des Bundesarchivs ermittelt werden (schriftliche Mitteilung des Bundesarchivs vom 24.6.1998;
190
|
Wie einer in der Nazi-Zeit unter die Räder kam
2 Wehrpaß (Innenseite), ausgestellt am 23. Dezember 1939 in Freiburg, der Birmele als »beschränkt tauglich« der Ersatzreserve II zuwies. (Photo Privatbesitz)
die Polizei recherchiert und herausgefunden, daß ein August Birmele Ende Januar 1919 Mitglied des Arbeiterrates für den Bezirk Waldkirch gewesen war?12 War ihr bekannt geworden, daß Reinhold Birmele zu einem Bekannten, der mit der Kommunistischen Partei sympathisierte, gesagt hatte: »Wenn wir an der Macht sind, wird alles besser«?13 Gab es sonst einen Verdacht auf politische Betätigung? Die Akten, soweit sie erhalten geblieben sind, geben darüber keine Auskunft. Nach ihnen bildete die Grundlage für die »Schutzhaft« ein Runderlaß des Chefs der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes vom 13. Juli 1941. Dieser sah vor die »Inschutzhaftnahme von Personen, die sich fälschlicherweise als Beamte der Geheimen Staatspolizei bzw. Kriminalpolizei oder allgemein als Polizeibeamte ausgeben«. Auch bei einem richterlichen Haftbefehl sei die Gestapo zu verständigen. Der diensttuende Kriminalbeamte hatte sich an diese Vorschrift gehalten ich danke Herrn Zarwel herzlich für seine intensiven Nachforschungen). Eine sicherheitshalber erfolgte Anfrage nach Hinweisen in Akten der Gestapoleitstelle Berlin – die an sich nicht zuständig war – blieb ebenfalls ergebnislos (schriftliche Mitteilung des Landesarchivs Berlin vom 15.10.1998; Herrn Martin Luchterhandt ist für seine Recherchen zu danken). 12 Stadtarchiv Waldkirch, Xlll/1, Fasz. 4848; abgedruckt in: Wolfram Wette: Politik im Elztal 1890–1990. Ein historisches Lesebuch. Waldkirch 1990, S. 69. 13 Frau Birmele am 12. Januar 1998.
Der »Fall« Reinhold Birmele
|
191
und das unbedachte, aber wohl kaum die Autorität des Staates bedrohende Verhalten Birmeles gemeldet. Der Hilfeversuch des Richters konnte daran nichts mehr ändern. Hier zeigt sich, dass derartige Meldungen, die ohne negative Folgen für den Beamten hätten unterbleiben können, neben den zahlreichen Denunziationen die entscheidende Zuarbeit für die Gestapo darstellten. Erst dadurch war es ihr möglich, auch im Alltag in unerwarteter Weise gegenwärtig zu sein sowie Urteile der Justiz zu ergänzen oder zu korrigieren.14 Nun war Reinhold Birmele in das Räderwerk des nationalsozialistischen Terrorapparates geraten. Er wußte zunächst gar nicht, was mit ihm geschehen war. 14 Diese Hilfsdienste der Polizei, der Verwaltung und anderer Ämter für den Verfolgungsund Unterdrückungsapparat im »Dritten Reich« sind ansatzweise untersucht für die Ausplünderung und Deportation der Juden, bedürfen aber insgesamt noch der systematischen Erforschung. Vgl. Eberhard Kolb: Die Maschinerie des Terrors. Zum Funktionieren des Unterdrückungs- und Verfolgungsapparates im NS-System. In: Nationalsozialistische Diktatur 1933–1945. Eine Bilanz. Hg. von Karl Dietrich Bracher u. a. Düsseldorf 1983, S. 270–284, hier S. 281–282; Ralph Angermund: »Recht ist, was dem Volke nutzt.« Zum Niedergang von Recht und Justiz im Dritten Reich. In: Deutschland 1933–1945. Neue Studien zur nationalsozialistischen Herrschaft. Hg. von Karl Dietrich Bracher u. a. Düsseldorf 1992, S. 57–75. Den ideologischen Hintergrund für das systemnützliche Verhalten vieler Menschen, der die Umdeutung der Rechtsordnung und die Proklamation einer neuen Rechtsidee einschloß, hat Bernd Rüthers dargestellt, vgl. z. B.: Die unbegrenzte Auslegung. Zum Wandel der Privatrechtsordnung im Nationalsozialismus. 4. Aufl. Heidelberg 1991; ders.: Carl Schmitt im Dritten Reich. Wissenschaft als Zeitgeist-Verstärkung? 2. Aufl. München 1990. Eine Zusammenfassung des Forschungsstandes zur Gestapo in der damaligen deutschen Gesellschaft: Die Gestapo – Mythos und Realität. Hg. von Gerhard Paul und Klaus-Michael Mallmann. Darmstadt 1995. Vor allem Robert Gellately hat aufgrund seiner Forschungen zur Sozialgeschichte der Gestapo darauf hingewiesen, daß Deutschland »zu einer sich selbst überwachenden Gesellschaft wurde« (ebd., S. 67). Zur polizeilichen Zusammenarbeit in diesem Band: Peter Nitschke: Polizei und Gestapo. Vorauseilender Gehorsam oder polykratischer Konflikt? Ebd., S. 306–322. Knappe Einführung in die Problematik: Klaus-Michael Mallmann: Denunziation, Kollaboration, Terror: Deutsche Gesellschaft und Geheime Staatspolizei im Nationalsozialismus. In: Sowi 27 (1998) S. 132–137. Vg!. auch: Im Namen des Deutschen Volkes. Justiz und Nationalsozialismus. Katalog zur Ausstellung des Bundesministers der Justiz. Köln 1989, hier bes. S. 246–271. – Bereit am 3.9.1939 hatte der Chef der Sicherheitspolizei, Reinhard Heydrich, in seinem Erlaß über »Grundsätze der inneren Staatssicherheit während des Krieges« alle Gestapo-Stellen angewiesen, jeden »Versuch, die Geschlossenheit und den Kampfeswillen des Deutschen Volkes zu zersetzen, von vornherein mit rücksichtsloser Härte und Strenge« zu unterdrücken. Allerdings, so fügte er am 20.9.1939 hinzu, »sind jene Fälle mit psychologischem Verständnis und erzieherisch bestärkendem Bemühen zu behandeln, die auf innere oder äußere Not oder auf Augenblicksschwächen zurückzuführen sind« (Martin Broszat: Zur Perversion der Strafjustiz im Dritten Reich. In: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 6, 1958, S. 390–443, hier S. 399, 405–406 [Zitate]). Selbst derartige Differenzierungen waren nun weggefallen.
192
|
Wie einer in der Nazi-Zeit unter die Räder kam
Am 30. August 1942 schrieb er aus dem Freiburger Gefängnis an seine Frau, er »habe es gut gemein und ist schlecht raus« gekommen. Er bat sie, doch einmal nach Karlsruhe zu schreiben und anzufragen, warum er eigentlich eingesperrt sei. Seine Strafe habe er doch schon lange abgesessen und »doch sonst nichts gemacht«.15 Zwei Wochen später, am 13. September 1942, wunderte er sich in einem neuen Brief an seine Frau, warum man ihn so lange in »Schutzhaft« behalte. Aber er habe ein »gutes Gewissen«, und so werde alles wieder gut werden. Immerhin wußte er jetzt, warum man ihn nicht freigelassen hatte. Die Gestapo Berlin16 habe ihm geschrieben, er gefährde »nach dem Ergebnis der staatspolizeilichen Feststellungen durch sein Verhalten den Bestand und die Sicherheit des Volkes und Staates, indem er dadurch, daß er sich als Beamter der Polizei ausgibt, das Vertrauen der Bevölkerung zu den Organen des Staates erschüttert«. Nun war ihm klar geworden: »Luis, wäre ich an dem Sonntag lieber bei Dir geblieben oder auf den Kandel gegangen und Beeren geholt, als so einen dummen Streich zu machen, was ich ja nicht so gemeint habe (und) jetzt mein Lebtag lang daran büßen muß.« Geradezu verzweifelt beschwor Birmele seine Frau, ihn möglichst rasch noch einmal zu besuchen und ihm den Ehering sowie ein Bildchen mitzubringen, »daß ich doch ein kleines Andenken habe«. Denn: soeben hatte er erfahren, daß er in das KZ Dachau verlegt werde – »nicht weit von dort, wo ich anno 34 den Arbeitsdienst mitgemacht habe; wer hätte das geglaubt, daß ich einmal dahin komme, bin als öfters daran vorbei gelaufen und habe gesungen und gejohlt«.17 Nach Zwischenaufenthalten im Gefängnis Karlsruhe vom 18. bis 25. September sowie in der Haftanstalt Augsburg vom 28. September bis 7. Oktober wurde Reinhold Birmele am 8. Oktober 1942 mit der Häftlingsnummer 37198 in Dachau eingeliefert.18 Er meldete ich am 18. Oktober bei seiner Frau in der 15 Die Briefe Reinhold Birmeles an seine Frau wie auch später erwähnte Korrespondenz wurden mir von ihr und ihrer Schwiegertochter, Frau Annette Kunz, zur Verfügung gesteilt. Orthographie und Satzzeichen habe ich vorsichtig korrigiert. 16 Wohl das Geheime Staatspolizeiamt (Gestapa) Berlin, das als Abteilung IV des Reichssicherheitshauptamtes für die Ausstellung des Schutzhaftbefehls zuständig war. 17 Vgl. Anm. 7. 18 Schriftliche Mitteilung des Internationalen Suchdienstes Bad Arolsen vom 16.11.1999; K. Meschkat danke ich für die Nachforschungen (Gefangenen-Buch-Nummer 340/42 in Freiburg; Vermerk in Karlsruhe: V.H. R.S.H.A. Berlin 3.9.42 IV C 2–B 25 449; Gefangenen-Buch-Nummer 404 in Augsburg; keine Angabe über die Zeit vom 25. bis 28.9.); Schreiben des Generallandesarchivs Karlsruhe vom 22.12.1999 – mit Dank an Herrn Amtsinspektor Hennhöfer (Gefangenen-Buch-Nummer 232, Aufenthalt vom 18.9.1942, 9 Uhr, bis 25.9.1942, 9 Uhr, »abgel. K.Z Lager Dachau«, ansonsten Bestätigung der Angaben aus Arolsen; Herr Hennhöfer löst die Abkürzung «VH« als »Vorbeugungshaft« auf, angeordnet vom Reichssicherheitshauptamt); Schreiben des Staatsarchivs Augsburg vom 10.12.1999 (Aufenthalt Birmeles vom 28.9. bis 7.10.1942, zusammen
Der »Fall« Reinhold Birmele
|
193
Hoffnung, daß alles wieder gut werde. Immerhin gebe es hier eine Kantine, in der er im Monat für 40 Mark einkaufen könne, »wenn ich welches habe und verbrauchen kann«. Luise möge ihm doch bald schreiben, denn er »habe so Heimweh nach Dir«. Ob er einen Antwortbrief erhalten hat, wissen wir nicht. Schon am 2. November 1942 wurde er in das KZ Neuengamme bei Hamburg »überstellt«.19 Warum bereits nach so kurzer Zeit eine Verlegung erfolgte, kann nicht geklärt werden. Möglicherweise lag eine Anforderung aus Neuengamme vor, da 1942 auf dem dortigen Lagergelände der Bau von Firmen begann, die im wesentlichen Rüstungszwecken dienten. Dafür wurden zusätzliche Arbeitskräfte benötigt. Im selben Jahr sanken allerdings die Verpflegungssätze für die Häftlinge, so daß sich deren Existenzbedingungen zunehmend verschlechterten. Die Sterblichkeit stieg drastisch an. mit Lagerführer Heinrich Sturm), Herrn Archivdirektor PD Dr. Reinhard Heydenreuter ist für seine Unterstützung zu danken; Auszug aus der Häftlingskartei, mitgeteilt am 13.6.1996 und – ergänzt – am 20.1.2000 von der KZ-Gedenkstätte Dachau, Barbara Distel und Albert Knoll danke ich für ihre Unterstützung. Der Verbleib Birmeles zwischen dem 25. und 28.9. konnte bislang nicht geklärt werden. – Zu den Lebensbedingungen im KZ Dachau vgl. neben den Hinweisen, die die von Wolfgang Benz und Barbara Distel hg. »Dachauer Hefte« enthalten, Edgar Kupfer-Koberwitz: Dachauer Tagebücher. Die Aufzeichnungen des Häftlings 24814. München 1997. Kupfer-Koberwitz (1906–1991) war von 1940 bis 1945 in Dachau (1941 auch vorübergehend in Neuengamme); sein Tagebuch beginnt Ende November 1942 und endet am 29.4.1945. Birmeles Haft wird insofern nicht erfaßt. Das gilt auch für die übrigen, eher erzählenden Erinnerungen, s. die Erstveröffentlichung, die nicht vollständig übernommen wurde: Die Mächtigen und die Hilflosen. Als Häftling in Dachau. Band 1: Wie es begann. Stuttgart 1957 (behandelt seine Häftlingszeit von November 1940 bis November 1941); Band 2: Wie es endete. 2. Aufl . Stuttgart 1960; auch Nico Rost: Goethe in Dachau. Hamburg 1981 (zuerst 1946, eine weitere Neuausgabe erschien Berlin 1999; Rost, 1898–1967, verarbeitete hier seine Notizen von Juni 1944 bis April 1945). 19 Häftlingskartei Dachau und Transportliste des KL Dachau vom 2.11.1942. Nach Unterlagen der KZ-Gedenkstätte Neuengamme könnte Birmele schon im Oktober mit einem Transport aus Dachau angekommen sein. Da jedoch am 2.11.1942 ein Transport mit 600 Männern aus Dachau eintraf, dürfte die erwähnte Angabe richtig sein (Arbeit und Vernichtung. Das Konzentrationslager Neuengamme 1938–1945. Katalog zur Ausstellung im Dokumentenhaus der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Außenstelle des Museums für Hamburgische Geschichte. Hg. von Ulrich Bauche, Heinz Brüdigam, Ludwig Eiber, Wolfgang Wiedey. 2. Aufl. Hamburg 1991, S. 118). Hans-Joachim Höhler und Leonie Güldenpfennig von der Gedenkstätte sowie Joachim Szodrzynski von der Forschungsstelle für die Geschichte des Nationalsozialismus in Hamburg danke ich für ihre Nachforschungen (Schreiben vom 20.5.1996, 10.6.1996 und 7.2.2000). Daraus auch die im folgenden mitgeteilten Angaben zur Verlegung und die Häftlingsnummer. Zu den Arbeits- und Lebensbedingungen vgl . die hier sowie in Anm. 20 und 21 genannte Literatur.
194
|
Wie einer in der Nazi-Zeit unter die Räder kam
3 Das letzte Lebenszeichen: eine Postkarte (Rückseite) aus dem Konzentrationslager Neuengamme. (Original in Privatbesitz)
Birmele erhielt die Häftlingsnummer 11328. Am 15. Dezember 1942 schrieb er seiner Frau eine Postkarte, aus der hervorging, daß er im Block 3 untergebracht war: »Liebe Frau, wie geht es Dir, hoffentlich gut, mir geht es so weit auch recht, was ich von Dir auch hoffe, und zu Hause ist alles auch noch in Ordnung. Luis, sei doch so gut und schreibe mir einmal, wie es allen geht. Auch Lebensmittelpakete kann ich unbeschränkt von Dir Lulu empfangen. Lege mir auch ein paar Briefmarken bei, und von meinem ersparten Geld kann ich auch ein kleinwenig brauchen. Auf Wiedersehen Lulu, bleibe gesund, und auch ein frohes Weihnachtsfest.« Doch das Weihnachtsfest wurde nicht froh. Der Brief klang schon nicht mehr wie früher, die Schrift war kaum lesbar. Kurz vor dem Heiligen Abend erhielt Luise Birmele auf dem Kollnauer Rathaus die Nachricht vom Tod ihres Mannes. Der Neuengammer Lagerkommandant teilte ihr mit einem Schreiben vom 23. Dezember mit, daß Reinhold Birmele am 21. Dezember 1942 im Krankenbau des Lagers »an Versagen von Herz und Kreislauf bei Magen- und Darmkatarrh verstorben« sei. Die beiliegende Todesbescheinigung bestätigte diese Angabe und gab die Todesstunde mit 12.30 Uhr an. Vielleicht gab sich Frau Birmele mit dieser Auskunft nicht zufrieden, denn am 14. Januar 1943 ergänzte SS-Sturmbannführer Pauly, der Verstorbene habe sich am 14. Dezember 1942 krank gemeldet. »Trotzdem ihm die bestmögliche medikamentöse und pflegerische Behandlung zuteil wurde, gelang es den Bemühungen des Arztes nicht, der Krankheit Herr zu
Der »Fall« Reinhold Birmele
|
195
4 Auszug aus dem Totenbuch des Krankenreviers im KZ Neuengamme. Reinhold Birmele wird als „Polit.“ bezeichnet. (Original in KZ-Gedenkstätte Neuengamme)
werden, sodaß es zum Ableben mit ihm kam. Ich spreche Ihnen zu diesem Verlust mein Beileid aus.«20 Das Totenbuch des Krankenreviers vermittelt allerdings einen anderen Eindruck. Am 21. Dezember 1942 beginnen die Eintragungen auf der betreffenden 20 Während das Schreiben vom 23.12.1942 noch von einem Kriminal-Sekretär (Name unleserlich) in Vertretung unterzeichnet war, unterschrieb Max Pauly (1907–1946) am 14.1.1943 persönlich. Er war im September 1942 Lagerkommandant geworden und blieb es bis Kriegsende; zuvor hatte er diese Funktion schon im KZ Stutthof in der Nähe Danzigs wahrgenommen. Seine Grausamkeit ist in vielen Zeugenaussagen überliefert. 1946 wurde er in einem Hamburger Prozeß zum Tode verurteilt und hingerichtet (Arbeit und Vernichtung, S. 201, 247: Hermann Kaienburg: Das Konzentrationslager Neuengamme 1938–1945. Hg. von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Bonn 1997, S. 88–89, 143, 213, 278, 284, 296 Anm. 71, 313). Zu Block 3 vgl. die Lagepläne in Kaienburg, S. 66, 70–71. – Im Kollnauer Bürgermeisteramt wurde bereits am 22.12.1942 eine Aktennotiz über die schriftliche Mitteilung von Birmeles Tod durch die Gestapo und über die Aufforderung, die Witwe sofort mündlich zu verständigen, angefertigt (August Vetter: Kollnau. Die Geschichte einer mittelalterlichen Ausbau- und ländlichen Streusiedlung, einer Industrie- und Wohnsiedlung im Elztal. 700 Jahre Kollnau 1290–1990. Hg. von der Stadt Waldkirch. Waldkirch 1990, S. 418). Der in der Notiz erwähnte Karl Traub (1888–1945) von der Gestapo war der Dienststellenvorgesetzte des Freiburger Amtes; vgl. Geschichte der Stadt Freiburg im Breisgau. Hg. von Heiko Haumann und Hans Schadek. Bd. 3: Von der badischen Herrschaft bis zur Gegenwart. Stuttgart 1992, S. 331, 338.
196
|
Wie einer in der Nazi-Zeit unter die Räder kam
Seite um 7. 50 Uhr mit dem Tod eines Holländers (Listennummer 2689), gefolgt von acht Russen, die um 7.55, 8.00, 8.05, 8.10, 8.20, 8.25, 9.00 und 9.10 Uhr starben. Nach einer Pause wurde um 12.00 Uhr der Tod eines weiteren Holländers vermerkt und an anschließend, um 12.30 Uhr, jener Reinhold Birmeles mit der Listennummer 2699. Er ist als »Polit.« bezeichnet. Nach dem Tod eines Russen um 13.00 Uhr endet die Liste für diesen Tag. Birmele ist der einzige auf der Seite, als dessen Todesursache Herz- und Kreislaufversagen bei Magenund Darmkatarrh angegeben wird. Wir finden sonst für den 21. Dezember vier Fälle von »Cordialer Insuffizienz« und jeweils zwei von »Herzmuskelschwäche«. »Anaemie« und »Lungenoedem.«21 Daß hier nicht alles mit rechten Dingen zuging, fällt auf den ersten Blick in Auge. Eine genauere Aufklärung der Vorgänge ist aber aufgrund der vorhandenen Unterlagen nicht möglich.22 Nach dem Zusammenbruch des »Dritten Reiches« war es zunächst selbstverständlich, daß Birmele als ein Opfer des Nationalsozialismus anerkannt wurde und seine Witwe eine Entschädigung erhielt. Am 15. Oktober 1945 wurden zum
21 Auszug aus dem Totenbuch, Kopie übersandt von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme am 20.5.1996. Zu den entsetzlichen Haftbedingungen, bei denen Erkrankungen an der Tagesordnung waren, zu medizinischen Versuchen, Strafen und Exekutionen vgl. Arbeit und Vernichtung, S. 125–168; Kaienburg: Konzentrationslager Neuengamme, S. 94–155, 248–265 . Insgesamt kamen von rund 106.000 registrierten Häftlingen 40.00–55.000 ums Leben (Arbeit und Vernichtung, S. 7, 233; Kaienburg, S. 266–268; kurz auch: Gudrun Schwarz: Die nationalsozialistischen Lager. Frankfurt a. M. 1996, S. 215). Außerdem: Hermann Kaienburg: »Vernichtung durch Arbeit«. Der Fall Neuengamme. Die Wirtschaftsbestrebungen der SS und ihre Auswirkungen auf die Existenzbedingungen der KZ-Gefangenen. Bonn 1990; ders.: Funktionswandel des KZ-Kosmos? Das Konzentrationslager Neuengamme 1938–1945. In: Die nationalsozialistischen Konzentrationslager – Entwicklung und Struktur. Hg. von Ulrich Herbert, Karin Orth und Christoph Dieckmann. 2 Bde. Göttingen 1998, hier Bd. 1, S. 259–284; Fritz Bringmann: KZ Neuengamme. Berichte, Erinnerungen, Dokumente. Aukrug 1993 (Erstausgabe 1981); Lebensläufe. Lebensgeschichtliche Interviews mit Überlebenden des KZ Neuengamme. Ein Archiv-Findbuch. Hg. von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Hamburg 1994. 22 Gewiß ist es möglich, daß Birmele an den Folgen einer Erkrankung starb. Angesichts der Zustände in Neuengamme traten Epidemien außerordentlich häufig auf. Auf einem Teil der Todeslisten ist auch vermerkt, wenn die betreffende Person ermordet worden war (Kaienburg: Konzentrationslager Neuengamme, S. 254), so daß die Richtigkeit der angegebenen Todesursache nicht auszuschließen ist. Andererseits wurden zwischen 1940 und 1943 arbeitsunfähige Häftlinge in das KZ Dachau geschickt, wo Birmele gerade hergekommen war. 1942 begann auch die Ermordung arbeitsunfähiger oder mißliebiger Personen in Neuengamme selbst (ebd., S. 121, 253–265). Die Art und Weise der Listeneintragung ist jedenfalls höchst auffällig. – Die Anfrage beim Internationalen Suchdienst in Arolsen brachte keine weiteren Informationen, in den dortigen Unterlagen ist aber als Kategorie ebenfalls vermerkt: »Sch., Polit« (=Schutzhaft, Politisch; schriftliche Mitteilung vom 16.11.1999).
Der »Fall« Reinhold Birmele
|
197
erstenmal ihre Personalia erhoben und die Umstände des »Falles« erfragt.23 Zahlreiche weitere Formulare, auf denen Frau Birmele detailliert über ihre Arbeitsund Vermögensverhältnisse sowie über die durch den Tod des Mannes entgangenen Einkünfte Auskunft geben mußte, sollten folgen. Luise Birmele, geboren am 2. September 1912, war nach verschiedenen Arbeitsplätzen als Dienstmädchen in der Firma Gütermann als Seidenarbeiterin eingestellt worden.24 Während sie als Grund für dessen KZ-Aufenthalt seine »nichtnationalsozialistische Einstellung« anführte,25 teilte ein Mitglied der »Betreuungsstelle« Emmendingen für die Opfer des Nationalsozialismus, der offenbar selbst verfolgt gewesen war, am 29. Januar 1946 mit, Birmele sei zwar »sehr wahrscheinlich (...) auf gewaltsame Art beseitigt«, hingegen »nicht aus polit. Gründen, sondern wg. Amtsanmassung verhaftet u. verurteilt« worden. Anscheinend sollte der Kreis der »politisch Verfolgten« eng begrenzt werden, vermutlich, um daraus auch besondere Ansprüche ableiten zu können. Jedenfalls war hier schon das Muster der künftigen Argumentation angelegt. Durch einen Beschluß vom 1. Juli 1946 hatte Frau Birmele als »ehemlg. pol. Verfolgte« eine »laufende Barunterstützung von RM 99,50 monatl.« zugesprochen erhalten. Obwohl die Kollnauer Ortsverwaltung am 9. Juli die Auszahlung anordnete, protestierte wenige Tage später der juristisch geschulte Kollnauer Bürgermeister Georg Schindler.26 Birmele sei wegen Amtsanmaßung, nicht aus politischen Gründen in das KZ gekommen. Wie sehr er noch vom Denken der gerade zu Ende gegangenen Zeit beeinflußt war, zeigt sein gleichzeitiger Widerspruch gegen eine Entschädigung für einen Soldaten, der wegen Volltrunkenheit in ein KZ eingeliefert worden war: Er habe »in betrunkenem Zustand vielleicht staatsgefährliche Aeusserungen gemacht«. Kühl stellte der Sachbearbeiter zu Birmele richtig: »Normalerweise wäre er ja nicht ins K. Z. gekommen, deshalb Anerkennung.« Diese eigentlich selbstverständliche Sichtweise konnte sich jedoch letztlich nicht allgemein durchsetzen. Der Stein war ins Rollen geraten. Die Badi23 Hier und im folgenden, soweit nicht anders vermerkt, nach: Staatsarchiv Freiburg, F 196/1, Nr. 8674 (Landesamt für Wiedergutmachung Karlsruhe). 24 Mündliche Mitteilung am 12.1.1998; Fragebögen der Badischen Landesstelle für die Betreuung der Opfer des Nationalsozialismus vom 1.7., 29.7. und 1.8.1946. 25 So in den erwähnten Fragebögen. 26 Gemeindearchiv Kollnau, A I 106 (hier die Zustimmung der Auszahlung); die beiden weiteren einschlägigen Bestände, A I 678 und 1068, in denen es um die Unterstützung von ehemaligen Opfern des Nationalsozialismus sowie um Wiedergutmachung für Nazi-Opfer geht, sind laut Leihschein am 22.2.1994 vom Waldkircher Stadtarchiv ausgeliehen worden, aber derzeit nicht auffindbar. Ich danke dem Ortsvorsteher von Kollnau, Herrn Wisser, und dem Stadtarchivar von Waldkirch, Herrn Allgaier, für ihre Unterstützung. Der Protest des Bürgermeisters in: Staatsarchiv Freiburg, F 196/1, Nr. 8674. Zu Schindler vgl. Vetter: Kollnau, S. 585–586, s. auch S. 448 ff. Zu Birmele hier kurz: S. 418–419, 437 (er hat offenbar die fehlenden Akten einsehen können).
198
|
Wie einer in der Nazi-Zeit unter die Räder kam
sche Landesstelle in Karlsruhe begann eine Überprüfung des Falles und forderte Belege. Was hatte Frau Birmele schon vorzuweisen außer der letzten Karte ihres Mannes, auf der natürlich nichts von einer Haft aus politischen Gründen vermerkt war. Der Emmendinger Sachbearbeiter versuchte zu retten, was zu retten war. Man könne nicht ausschließen, daß Birmele »sich pol. Äusserungen zu schulden kommen liess. Pol. ist der Fall nicht, jedoch kann er als ›Opfer‹ gerechnet werden und die Frau unterstützt werden, da sie in armen Verhältnissen lebt.« Ein selbsternannter »Lagerspezialist« gutachtete dagegen, die von Frau Birmele erwähnte politische Abteilung, in der ihr Mann inhaftiert gewesen sei, sei nichts anderes als »Büroräume der Gestapo« gewesen, die man so genannt habe und wo natürlich alle Gefangenen einmal hätten vorsprechen müssen. Und als dann noch der Landesstelle die Vorstrafen Birmeles bekannt wurden, war die Angelegenheit erledigt: Am 19. September 1946 mußte die Emmendinger Zweigstelle der Witwe mit dem Ausdruck des Bedauerns mitteilen, daß ihr Mann nicht als Verfolgter anerkannt werden könne. Immerhin durfte sie die bereits erfolgten Unterstützungszahlungen »als Beweis der Hilfsbereitschaft« behalten. Gewiß kann aus dem Schreiben vom 23. Dezember 1942, das als Absender die »Politische Abteilung« des Lagers vermerkte, nicht ohne weiteres geschlossen werden, Birmele sei ein politischer Häftling gewesen. In der Tat erfolgte in der »Politischen Abteilung« die Registrierung der Häftlinge. Andererseits arbeiteten auch Häftlinge in dieser Abteilung oder verschwanden dort.27 Man hätte sich vielleicht die Mühe machen können, die Totenliste einzusehen: Während alle Akten von der Gestapo und der SS bei der Räumung des Lagers Ende April 1945 vernichtet worden waren, hatten Gefangene die Totenbücher versteckt und damit den Nachweis der Verstorbenen ermöglicht.28 Bei Reinhold Birmele war die Bezeichnung »Polit.« nicht zu übersehen. Daß er ein Opfer des politischen Systems geworden war, konnte nicht bezweifelt werden. Doch: Eine unheilige Allianz aus Menschen, die sich die juristische Sichtweise des NS-Regimes zu eigen gemacht hatten, und solchen, die den Alleinanspruch auf politische Verfolgung erhoben, ließ die Einsicht nicht zu, daß in einem demokratischen Rechtsstaat Birmele niemals in ein Konzentrationslager eingeliefert worden wäre. Luise Birmele versuchte es in den folgenden Jahren immer wieder, den Beschluß überprüfen zu lassen. Ein Erfolg blieb ihr versagt. 1954 bemühte sie sich um ein Wiedergutmachungsverfahren. Auf der Rückseite eines Schreibens des Landesamtes für die Wiedergutmachung Freiburg vom 12. Oktober 1954 war in einem Aktenvermerk niedergelegt, Ministerialrat Leiser vom Regierungspräsidium Südbaden sei der Ansicht, Birmele sei »aus kriminellen Gründen« in das KZ gekommen. Der Öffentliche Anwalt für die Wiedergutmachung in Freiburg 27 Lebensläufe, S. 187, 196. 28 Arbeit und Vernichtung, S. 7.
Der »Fall« Reinhold Birmele
|
199
stellte nach Akteneinsicht fest, er könne den Fall nicht übernehmen, denn Birmele sei verurteilt worden »aus allgemeinpolizeilichen Erwägungen, insbesondere im Hinblick auf den damals bestehenden Kriegszustand und um das Vertrauen der Bevölkerung in die Organe des Staates nicht gefährden zu lassen«. Die Gestapo hatte also ganz recht. Insofern wundert es, daß er am 18. April 1955, als er Frau Birmele seine Entscheidung mitteilte, immerhin von »erheblichem Unrecht« sprach, das ihrem Gatten zugefügt worden sei; ein Entschädigungsantrag sei allerdings aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen aussichtslos.29 Das Landesamt für Wiedergutmachung bat am 24. April 1955 dennoch um eine Prüfung, da es für den seinerzeitigen »groben Unfug« Birmeles doch eine auffallend strenge Maßnahme gegeben habe. Es wurde dann nach Möglichkeiten gesucht, wenigstens aus »übergesetzlichen Mitteln« der Witwe zu helfen, die unter materiell schwierigen Bedingungen lebte. Selbst der Öffentliche Anwalt setzte sich nun ein.30 Er strebte zunächst einen ablehnenden Bescheid des Landesamtes an, der am 18. April 1956 erfolgte und den aufschlußreichen Satz enthielt: »Nicht jedes nationalsozialistische Unrecht unterliegt aber der Wiedergutmachung; dies würde viel zu weit führen.« Auf dieser Grundlage versuchte der Anwalt nun, Leistungen aus dem Härtefonds zu erwirken. Frau Birmele zögerte, weil sie sich in diesem Fall mit der rechtlichen Beurteilung des Falles durch das Landesamt einverstanden erklären mußte. Schließlich kam es doch zu einem entsprechenden Antrag, aber offenbar auch zu Unstimmigkeiten zwischen Frau Birmele und dem Öffentlichen Anwalt. Nachdem am 30. Januar 1957 auch ein Härteausgleich abgelehnt worden war, schrieb am12. April 1957 die frühere Waldkircher KPDGemeinderätin Carla Cuntz-Kaiser (1894–1988), die während des »Dritten Reiches« mehrfach inhaftiert gewesen war, an den Anwalt.31 Sie wies darauf hin, daß Reinhold Birmele bei jeder Gelegenheit seine Gegnerschaft zum Nationalsozialis29 Frau Birmele und Frau Kunz haben mir den umfangreichen Briefwechsel zur Verfügung gestellt, aus dem ich im folgenden noch mehrfach zitiere. Die Bemerkungen des Ministerialrates und des Öffentlichen Anwalts finden sich in: Staatsarchiv Freiburg, F 196/1, Nr. 8674. Abgesehen von dem Geist, der aus ihnen spricht, ist die Argumentation für Juristen doch verwunderlich: Für sein Vergehen war Birmele verurteilt worden und hatte seine Strafe abgesessen, die Deportation in das KZ erfolgte nicht auf der Grundlage eines Urteils. 30 Das Zitat stammt aus seinem Schreiben vom 14.7.1955 an das Landesamt für Wiedergutmachung. 31 Zu Carla Cuntz-Kaiser vgl. Wette: Politik, S. 104, 110, 111, 236; Vetter: Kollnau. S. 418. Zu ihrem früheren Mann, dem zwischen 1910 und 1935 in Waldkirch tätigen Rechtsanwalt Erwin Cuntz (1878–1977), s. Geschichte der Stadt Freiburg, Bd. 3, S. 249–250, 294; Manfred Bosch: Es wird auch ohne mich gehen, aber nicht ohne meine Ideen. Eine Erinnerung an den »Waldkircher« Erwin Cuntz – im Hauptberuf unverbesserlicher Weltverbesserer. In: »s Eige zeige«. Jahrbuch des Landkreises Emmendingen für Kultur und Geschichte 8 (1994) S. 109–122: ders.: Cuntz, Erwin Wilhelm Sebald. ln: Baden-Württembergische Biographien. Bd. 1. Hg. von Bernd Ottnad. Stuttgart 1994, S. 52–54. Eine
200
|
Wie einer in der Nazi-Zeit unter die Räder kam
mus zum Ausdruck gebracht habe – dafür nannte sie Zeugen –, daß sein Vater der SPD nahegestanden und seine Mutter den Bibelforschern angehört habe und daß es insofern naheliege anzunehmen, die Gestapo habe die »Verulkung« genutzt, um »den Verurteilten unschädlich zu machen«. Deshalb forderte sie eine Wiederaufnahme des Verfahrens. Der Öffentliche Anwalt lehnte dies ab, weil nicht nachzuweisen sei, daß Birmele »als Gegner des Nationalsozialismus erkannt« worden sei. Er legte am 2. September 1957 die Vertretung Frau Birmeles nieder. Am 24. Oktober 1966 unternahm der in Kollnau wohnende CDU-Bundestagsabgeordnete Albert Burger durch ein Schreiben an den Bundesfinanzminister 5 Reinhold Birmele, undatiertes Photo (Privatbesitz) einen neuen Vorstoß. Dieser ließ am 29. November 1966 mitteilen, für den KZ-Aufenthalt und Tod Birmeles gebe es rechtlich keine Wiedergutmachungsmöglichkeit, wohl aber seien die entstandenen materiellen Schäden zu ersetzen. Die Frist für die Anmeldung der Schadenersatzansprüche sei zwar schon 1959 verjährt – merkwürdig, daß seinerzeit niemand Frau Birmele darauf aufmerksam gemacht hatte –, man könne jedoch ersatzweise ihr Verfahren um Wiedergutmachung anerkennen. Sie möge bei der Oberfinanzdirektion Freiburg vorsprechen. Nach einigem Hin und Her gewährte diese am 30. März 1967 »als Schmerzensgeld für den vier volle Monate dauernden rechtswidrigen Freiheitsentzug« einen Betrag von insgesamt DM 500,–, der dann mit Entscheidung vom 21. Juli 1967 jeweils zur Hälfte an Luise Birmele und an Reinhold Birmeles Vater ausgezahlt wurde. Am 12. Januar 1968 teilte die Oberfinanzdirektion Frau Birmele ergänzend mit, es stehe ihr eine Hinterbliebenenrente von DM 330,- zu, die jedoch entfalle, weil ihre bisherigen und jetzigen Einkünfte diesen Betrag überstiegen. Frau Birmeles Anfrage bei der Rechtsstelle des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Freiburg ergab am 9. April 1968, daß diese Entscheidung nicht beanstandet werden könne. »Vielleicht wird der Ge-
Nachfrage bei Carla Cuntz-Kaisers Sohn Donald Cuntz ergab am 17.7.1996, daß in den noch vorhandenen Unterlagen nichts über Birmele vorhanden ist.
Der »Fall« Reinhold Birmele
|
201
setzgeber eines Tages in solchen Härtefällen großzügiger bei einer gesetzlichen Regelung verfahren. Sie sollten deshalb die Sache doch nicht endgültig ablegen.« Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Selbst das am 28. Mai 1998 vom Deutschen Bundestag endlich beschlossene »Gesetz über die Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile in der Strafrechtspflege« erfaßt die KZ-Deportation aufgrund des Schutzhaftbefehls nicht.32 Der Petitionsausschuß des Deutschen Bundestages lehnte mit Schreiben vom 8. April 1999 eine Gleichsetzung ab, weil das Gesetz nicht für »Willkürmaßnahmen« gelte, »die keinen verurteilenden strafgerichtliehen Charakter haben«. Die »Inschutzhaftnahme« sei »von vornherein Unrecht« gewesen, wie »dies für jedermann zu erkennen« gewesen sei. Allerdings könne trotzdem keine offizielle Rehabilitierung erfolgen, »da die tatsächlichen Folgen derartiger Willkürmaßnahmen rückwirkend nicht beseitigt werden können«. Diese Argumentation kann nicht überzeugen. Wenn sie zuträfe, hätte auch bislang niemand rehabilitiert werden dürfen, der an den Folgen von Unrechtshandlungen zu Tode gekommen war. Auf meinen Einspruch hin wiederholte jedoch der Petitionsausschuß mit Schreiben vom 22. Juni 1999 seine Ablehnung. Das Bundesministerium der Justiz hatte in seiner entsprechenden Stellungnahme vom 9. Juni 1999 erklärt, nur nationalsozialistische Urteile könnten aufgehoben werden, während es bei Maßnahmen der Exekutive, deren Unrechtscharakter offenkundig sei, »einer besonderen Unrechtserklärung oder einer offiziellen Aufhebung derartiger Maßnahmen des Verwaltungshandelns nicht bedarf«. Die Vermischung von regulärer Justiz und irregulärem, korrigierendem staatlichen Handeln, die geradezu ein Kennzeichen des nationalsozialistischen Regimes war, bleibt hier außerhalb des Blickfeldes. Dennoch: Abgelegt hat Luise Birmele die Sache bis heute nicht. Der »Fall« Reinhold Birmele ist ein Beispiel für den Mechanismus des nationalsozialistischen Herrschaftssystems und zugleich für die Prägungen durch dieses System wie für die Verdrängungen jener Zeit in der Bundesrepublik Deutschland. Selbst die juristische Aufarbeitung ist noch nicht beendet.
32 Deutscher Bundestag, 13. Wahlperiode, 238. Sitzung, Bonn, Donnerstag, den 28. Mai 1998, Protokoll S. 21946–21961; vgl. 221 . Sitzung, Bonn, Mittwoch, den 4. März 1998. Protokoll S. 20191 bis 20205, sowie die Drucksachen 13/9747, 9774, 10013 und 10484. Ich danke Gernot Erler MdB sowie Dirk Sawitzky und Peter Fäßler, wissenschaftliche Mitarbeiter beim Deutschen Bundestag, für ihre Hilfe bei der Beschaffung der Materialien und für die Unterstützung der im folgenden geschilderten Petition. – Diese Geschichte ist sicher kein Einzelfall. Die »Badische Zeitung« berichtete am 28.1.2000 von einer Frau, die wegen »Rassenschande« mit einem polnischen Zwangsarbeiter in das KZ Ravensbrück kam und dort gesundheitlich ruiniert wurde. lhr wurde eine Entschädigung ebenfalls mit dem Argument verweigert, sie sei nicht politisch verfolgt gewesen.
»Heimat ist keine Sache, die sich heute verlieren und morgen wieder gewinnen läßt ...« Der Lebensweg des Freiburger Kaufmanns Max Mayer (1873–1962)* Erinnerung gehört zum Wesen des Judentums. Vielleicht war das der Grund, warum Max Mayer drei Erinnerungsschriften hinterließ und zahlreiche Dokumente mit in die Emigration nahm – sie waren ihm offenbar wichtiger als manches andere, das er zurückließ.1 Unwillkürlich kommt der Gedanke: Je weniger man Juden erlaubte, eine räumliche Heimat zu bewahren, um so wichtiger wurde für sie die Erinnerung als Heimat ihrer Existenz. Herkunft und Anfänge
Als Max Mayer am 12. April 1873 in Freiburg geboren wurde, war es Juden noch nicht lange – seit dem badischen Emanzipationsgesetz von 1862 – erlaubt, sich hier als gleichberechtigte Bürger niederzulassen. Kurz zuvor, am 23. September
* Erstpublikation in: Alemannisches Judentum. Spuren einer verlorenen Kultur. Hg. von Manfred Bosch. Eggingen 2001, S. 376–391. 1 Überarbeitete Fassung meines Beitrages: »Mein Judesein ist meine Trutzburg«. Der Lebensweg des Freiburger Kaufmanns Max Mayer (1873 – 1962), in: Rolf Böhme, Heiko Haumann: Das Schicksal der Freiburger Juden am Beispiel des Kaufmanns Max Mayer und die Ereignisse des 9./10. November 1938. In der Vergangenheit liegt die Kraft für die Zukunft (= Stadt und Geschichte. Neue Reihe des Stadtarchivs Freiburg i.Br. H. 13). Freiburg i. Br. 1989, 2. Auflage 2000. Ich danke Herrn Stadtarchivdirektor Dr. Hans Schadek für die Erlaubnis, den Beitrag wieder verwenden zu dürfen. Zu den Umständen, Hintergründen und Zusammenhängen vgl. neben dem genannten Heft: Geschichte der Stadt Freiburg im Breisgau. Band 3: Von der badischen Herrschaft bis zur Gegenwart. Hg. von Heiko Haumann und Hans Schadek. Stuttgart 1992, bes. S. 325–339, 507– 512. Soweit nicht anders angegeben, stammen die folgenden Informationen (und Zitate) aus den Hinterlassenschaften Max Mayers (Stadtarchiv Freiburg [StadtAF], K 1/ 83, Nachlaß Max Mayer), die hier nur in einem ersten Überblick ausgewertet werden. Die Erinnerungsschriften tragen die Titel: Familie Leser-Mayer (letzte Datierung 1953), Wanderungen (abgeschlossen am 30.1.1951), Musik auf dem Nebengleis (handschriftliche Datierung 1951). Neben Lotte und Dr. Peter Paepcke, die 1988 den Nachlaß dem Stadtarchiv übergaben, habe ich zu danken: Edith Kunowski und Andreas Kirchgäßner, die Materialien aus den Hinterlassenschaften ihres Vaters bzw. Großvaters Eugen Rees zur Verfügung stellten, sowie Robert Krais und Bernhard Uttenweiler für Nachforschungen zu Altdorf.
Der Lebensweg des Freiburger Kaufmanns Max Mayer
|
203
1870, hatte die neue israelitische Gemeinde ihre Synagoge einweihen können.2 Max Mayers Mutter Jeanette stammte aus Altdorf bei Ettenheim. Sie war mit ihren Eltern, Lazarus und Henrike (Hendel) Leser, 1865 nach Freiburg gezogen. Diese hatten sich hier bessere Geschäftsmöglichkeiten erhofft. Jeanette war schon zuvor zur Schule im Schwarzen Kloster geschickt worden und hatte hier in Pension gelebt. Werfen wir einen kurzen Blick zurück auf Altdorf. Lazarus Leser betrieb in dieser jüdischen Landgemeinde ein Geschäft für Manufaktur- oder »Ellenwaren«, war jedoch oft abwesend, weil ihn seine Leidenschaft für Antiquitäten zu ausgedehnten Suchreisen veranlaßte. Dann führte seine Frau das Geschäft. Sie mußte sich alle Vorgänge auswendig behalten, denn sie konnte nur hebräische Buchstaben lesen und schreiben. Am 7. Januar 1833 schloß Lazarus mit seinem Vater Jesaias einen Vertrag, in dem er sich verpflichtete, seine Eltern »lebenslänglich und so anständig als es zu jeder Zeit seine Vermögensverhältnisse erlauben, zu unterhalten«. Dies war die Bedingung, daß die offenbar armen Eltern in Altdorf wohnen bleiben durften. Zuvor hatte Jesaias Leser als »Schutzjude« des Freiherrn von Türckheim diesem regelmäßig ein »Schirmgeld« gezahlt. Ein Quittungsbuch für die Zeit von 1789 bis 1833 gibt darüber Auskunft. Zwei Schwestern des Lazarus Leser, Mathilde Schuller und Jeanette Stiebel, wanderten mit ihren Familien in die USA aus. Am 5. August 1849 schrieben sie aus Easton an Lazarus mit der dringenden Aufforderung, angesichts des schlechten Ausgangs der Revolution von 1848 ihnen nachzukommen: » (...) denn wir leben hier Gott sei Dank wie die Freiherren, da es hier durchaus keinen Unterschied macht, ob er Jude oder Goj [Nicht-Jude] ist, und man ist Bürger von Amerika und hat mithin alle Rechte so gut als ein hiesig Geborener. (...) Ich bitte dich, sieh zu, daß du dich aus Deutschland machst, ehe du es bereuen wirst.«3 Lazarus Leser folgte dem Rat nicht. Er kaufte ein Haus in der Freiburger Schusterstraße und richtete dort ein Herrenkonfektionsgeschäft ein. Der Rabbiner von Sulzburg vermittelte eines Tages eine Einladung an Moritz (Moses) Mayer aus seiner Gemeinde, damit dieser Jeanette kennenlernen könne. Die bei2 Gabriele Blod: Die Entstehung der israelitischen Gemeinde in Freiburg 1849–1871 (= Stadt und Geschichte. Neue Reihe des Stadtarchivs Freiburg i.Br. H. 12). Freiburg i. Br. 1988. 3 Übersetzung des jiddischen Briefes mit hebräischen Buchstaben von Ruben Frankenstein. – Vgl. zur Familie Leser: Albert Köbele, Hans Scheer: Ortssippenbuch Altdorf. Stadt Ettenheim, Ortenaukreis in Baden (= Deutsche Ortssippenbücher. Reihe A, Bd. 63). Grafenhausen 1976, S. 626–627. Zu den Juden in Altdorf auch: Schicksal und Geschichte der jüdischen Gemeinden Ettenheim, Altdorf, Kippenheim, Schmieheim, Rust, Orschweier. 1938–1988. Ein Gedenkbuch. Hg. vom Historischen Verein für Mittelbaden, Mitgliedergruppe Ettenheim. Ettenheim 1988, besonders S. 43–45, 285–319, zum Verbandsfriedhof Schmieheim 166–187.
204
|
»Heimat ist keine Sache, die sich verlieren und wieder gewinnen läßt ...«
den gefielen sich und heirateten am 20. Dezember 1871. Mayer eröffnete schräg gegenüber vom Geschäft des Schwiegervaters eine Lederhandlung. Diesen Beruf hatte er in St. Johann bei Saarbrücken erlernt. 1890, nach dem Tod Lazarus Lesers, wurden beide Unternehmen in dessen Haus als »Lederhandlung Leser & Mayer« zusammengelegt. Die Familien Leser und Mayer waren in Freiburg hoch angesehen. Sogar mit dem Erzbischof hatten sie einen guten Kontakt.4 Max Mayer erinnerte sich später: »Unser Elternhaus war Nachbar des Münsters, und rund um uns herum wohnten die Katholiken der Oberstadt, auch der Erzbischof in seinem Palais. Unsere Familie war geachtet und in nachbarlicher Gunst, ungeachtet ihres Judentums. Wir mußten nicht als Fremdlinge und Feinde im katholischen Lebenskreis stehen, sondern die Poesie seiner Formen, der Kirchgang durch unsere Gasse, die Glockenansagen des Gottesdienstes, die Messen im Münster, das Pathos der Prozessionen und die uns vertraute Zeitfolge des Glockengeläutes ergaben eine liebreiche, mystische Gesamtstimmung, von welcher wir nicht minder angerührt waren als die Katholiken selbst. Und unsere Herzen standen weit offen zum Empfang der deutschen Kultur.« Doch daneben stand die Poesie der vom Judentum geprägten Welt: »Die ganze Familie war dem Sabbath-Zauber hingegeben, wir Kinder waren tief von ihm berührt. Das Geschäft war geschlossen, wir kamen aus der Synagoge, unsere Mutter mit ihren schönen Händen ließ sie betend und segnend vor dem Leuchter vorbeischweifen. (...) Die Freitagabende im Elternhaus waren wundervolle Stunden, unvergeßlich.«5 Jeanette Mayer wurde in der Wohlfahrtspflege aktiv. Für ihre Verdienste erhielt sie am 12. Juli 1909 durch Entschließung des Großherzogs von Baden die Friedrich-Luisen-Medaille. Dem Vorstand des Israelitischen Frauenvereins gehörte sie als Rechnerin an. Nach ihrem Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen ernannte dieser sie am 9. April 1917 zum Ehrenmitglied. Ein Jahr später starb sie, ihr Mann Moritz folgte ihr 1924. Eigentlich sollte Max’ jüngerer Bruder Julius die Lederhandlung weiterführen. Als er jedoch schon früh schwer erkrankte und 1894 mit 19 Jahren starb, mußte Max einspringen – höchst ungern, denn seine Liebe galt der Musik, vor allem dem Klavierspiel, auch dem Komponieren.6 Max Mayer trat – unterbrochen von Lehrjahren und Zwischenstationen in Speyer, Artern bei Erfurt und Berlin – in das väterliche Geschäft ein. Er wurde 4 Lotte Paepcke: Ein kleiner Händler, der mein Vater war. Heilbronn 1972, S. 10. Vgl. Wilhelm Kiefer: Der Jude Leser-Meyer [sic!]. In: Die Nation (Bern), 12. und 19.11.1936. Dieser Artikel wurde dem Ehepaar Mayer kurz nach Erscheinen zugänglich gemacht (Max Mayer: Familie, S. 162–163). Er befindet sich im Nachlaß. 5 Max Mayer: Familie, S. 12, 11. 6 Max Mayer: Musik, S. 27–28.
Der Lebensweg des Freiburger Kaufmanns Max Mayer
|
205
dann Teilhaber, schließlich Alleinbesitzer. Die Lederhandlung führte vor allem Schuhmacherbedarf. Dazu bereiste der Vater, wie später auch Max, in regelmäßigen Abständen den Schwarzwald, die Oberrheinebene und das Ober-Elsaß, mit der Postkutsche, dem Pferdeschlitten oder zu Fuß, bis dann die Entwicklung der Eisenbahnlinien etwas Erleichterung verschaffte. Mehr als das mühselige Anbieten der Ware genoß Max Mayer die Naturschönheiten des Schwarzwaldes, etwa wenn er mit der Postkutsche das Simonswälder Tal heimfuhr: »Wie berückend hat sich mir dieses herrliche Tal idealisiert zum Inbegriff des Heimwegs. Die Arbeit war getan, das Tal wurde mein ungestörtes Erlebnis. Noch heute im hohen Alter, wenn ein Druck von mir weicht, erscheint mir das Bild des Simonswälder Tals. Wenn je ein Nachkomme von den Bergen herab dieses Tal passieren sollte, möge er mein gedenken und sagen: hier ist der Max immer glücklich gewesen.«7 Mit der Zeit entwickelte sich Max zu einem tüchtigen und erfolgreichen Geschäftsmann. Er ergriff sogar kurz nach der Jahrhundertwende die Initiative zur Zusammenarbeit der Freiburger Lederhändler über die Preisgestaltung, aus der später der »Verband badischer Lederhändler« hervorging. Am 22. Mai 1906 heiratete Max Mayer Olga Nördlinger aus Stuttgart. Der Schwiegervater betrieb dort ein Geschäft für Weißwaren, Schneiderartikel und Perlmutterknöpfe. 1907 wurde das erste Kind, die Tochter Ruth, geboren, die infolge eines organischen Fehlers schon nach zwei Jahren starb, 1910 folgte die Tochter Lotte, 1911 der Sohn Hans. Jude, Patriot, Sozialdemokrat
Max Mayer war in einem bewußt jüdischen Elternhaus aufgewachsen. Sein Großvater »war sehr religiös, nicht nur im rituellen, sondern auch im Sinne streng ehrbarer, gottesnaher Lebensführung«.8 Die Eltern lebten ebenfalls als fromme Juden, ohne daß sich die Familie dabei fremd in Freiburg gefühlt hätte.9 Diese Integration in Freiburg, die wohl für die jüdische Gemeinde insgesamt gelten dürfte, verstärkte die Tendenz zur Assimilation. Religiös wirkte sich das dahingehend aus, daß sich Max Mayer dem Reformjudentum zugehörig fühlte. Olga kam ohnehin aus einer liberalen Familie. So wurden nun die religiösen Vorschriften nicht mehr streng befolgt – am Samstagvormittag war das Geschäft geöffnet. Max vermied es allerdings, wenn möglich, im Laden anwesend zu sein. An hohen Feiertagen blieb der Laden nach wie vor geschlossen.10 7 8 9 10
Max Mayer: Familie, S. 73. Max Mayer: Familie, S. 8. Vgl. Böhme, Haumann: Das Schicksal, S. 22 – 23. Mitteilung von Lotte Paepcke, 24.11.1988.
206
|
»Heimat ist keine Sache, die sich verlieren und wieder gewinnen läßt ...«
Als Jude und deutscher Patriot zog Max Mayer in den Ersten Weltkrieg. Nach der Grundausbildung hätte er eigentlich zum Offiziersunterricht abkommandiert werden sollen. Weil er Jude war, verhinderte dies sein Vorgesetzter. Immerhin wurde er nun Kornettist in der Kapelle des Landsturm-Infanterie-Bataillons Pforzheim. So konnte er doch ein wenig wieder seiner Musikliebe nachgehen. Sein Patriotismus und überhaupt sein Selbstverständnis wurden während des Krieges auf eine harte Probe gestellt. »Aber auch meine Verdun-Bereitschaft war erschüttert, wenn ich der Judenzählung gedachte, mit welcher in Prozenten die Juden und Nicht-Juden hinter der Front konfrontiert werden sollten. Von jenem Vorfall ab war mir meine Pflicht nur noch eine Pflicht, ohne innere Beteiligung.«11 Die Frage, wo für ihn der größere Zusammenhalt lag – im Judentum oder im Deutschtum –, verließ ihn nun nicht mehr. Zu dieser Zeit war Max Mayer längst Sozialdemokrat geworden. Eingeführt in die Gedankengänge des Marxismus und Sozialismus hatte ihn sein Freund, der Freiburger Rechtsanwalt (und spätere Ehrenbürger)12 Robert Grumbach. Vertieft wurden die Lehren durch Ludwig Frank aus Nonnenweier, der vorübergehend in Freiburg Jura studierte, später dann Reichstagsabgeordneter der SPD für Mannheim war und als Kriegsfreiwilliger schon am 3. September 1914 in seinem ersten Gefecht fiel. Nach dem Gastbesuch einiger Parteiversammlungen »im Nebenzimmer der ›Stadt Belfort‹ bei geschlossenen Fensterläden«13 trat Mayer unter dem Einfluß Franks der SPD bei. 1911 wurde er zum ersten Mal als Stadtverordneter in den Bürgerausschuß gewählt, dem er bis 1933 angehörte.14 Robert Grumbach gestaltete die Atmosphäre des Kreises um Ludwig Frank in seiner Erzählung »Die Freie Burg«, die 1917 in Freiburg erschien. Neben Frank, verschlüsselt als Ludwig Eckert, traten darin der Philosoph Woltmann (»Wolters«) und der Dichter Emil Gött („der Poet«) auf. Als die sozialdemokratische »Volkswacht« mit dem Abdruck dieser Schrift begann, leitete sie Max Mayer am 16. April 1918 ein. Auch veröffentlichte er in der »Volkswacht« häufig neben Kurzgeschichten Artikel über sein »Nebengleis«, die Musik. Zum ersten Mal hatte er am 26. September 1899 im »Badischen Anzeiger« eine Kritik über eine Opernaufführung im Freiburger Theater – Richard Wagners »Lohengrin« – geschrieben. Seine Aufgabe nahm er sehr ernst. »In meiner Mission lag so viel Verantwortung und Verpflichtung, daß ich keine Vorstellung besuchte ohne gute Vorbereitung. (...) Ich hatte den Ehrgeiz, die Leser mehr über das Werk zu unterrichten und die Personal- und Aufführungskritik zweitrangig zu behandeln. Da ich für den 11 Max Mayer: Familie, S. 131. Vgl. zu einem weiteren erschütternden Erlebnis Lotte Paepcke: Ein kleiner Händler, S. 37–38. 12 StadtAF, C 5/298. 13 Max Mayer: Familie, S. 69. 14 StadtAF, C 4/VI/10/4; vgl. C 3/84/2a,b, 85, 86, C 4/VI/7/4–7.
Der Lebensweg des Freiburger Kaufmanns Max Mayer
|
207
Kritiker-Beruf nicht vorgebildet war, fehlten mir auch seine Schlagwörter. Infolgedessen bekamen meine Kritiken mein individuelles Gesicht. Dieses Gesicht ließ offenbar den anonymen Lehrling nicht ahnen, sondern es verschaffte meinen Kritiken alsbald einigen Respekt.«15 Als einmal Richard Strauß, der mehrfach hier dirigierte, als Gast der Stadt in Freiburg weilte, gehörte Max Mayer der Delegation an, die ihn auf einer Fahrt durch den Schwarzwald begleitete. Er hoffte auf die Wirkung der Natureindrücke: »Warum sollte der Schöpfer der Alpen-Symphonie nicht auch eine Schwarzwald-Symphonie komponieren (...)?« Strauß kümmerte sich jedoch kaum um die Umgebung, ließ sich immer wieder ablenken. »Endlich verließ ich mich auf den Belchen-Gipfel. Der würde es schon schaffen. Ha, diese Schau da oben, dieses Frei-Schweben im All, und ringsherum der blühende Notensatz aus Erikas und Silberdisteln, ihren Meister erwartend. Nach Tisch wird er botanisieren gehen. Wir Anderen, welche dies alles schon kannten, ließen uns erneut davon beeindrucken ... Wo aber hat sich der Meister für die ihm zugedachte Ergriffenheit stationiert? Er saß zum Skat im Rasthausnebenzimmer.«16 Im Bürgerausschuß der Stadt, der Max Mayer 1915 in den geschäftsleitenden Vorstand, 1919 sogar zum stellvertretenden Obmann wählte, hielt er für die SPD-Fraktion regelmäßig die Rede zum Theater-Etat. Nach zeitgenössischen Berichten zu schließen, empfand man sie allgemein als Höhepunkt der Haushaltsberatungen.17 Nicht nur mit Musik und Theater beschäftigte sich der SPD-Politiker Mayer. Mit zahlreichen wichtigen städtischen Themen war er befaßt, ob es sich nun um die Schauinslandbahn – deren Aufsichtsrat er von 1928 bis 1933 angehörte –, um das Volksbad, um Ladenschlußzeiten, Schulfragen, städtische Sammlungen und Konservatorien, um die Messe oder um den Flugverkehr handelte. Neben anderen Funktionen übernahm er die Mitgliedschaft im Industrie- und Disziplinarausschuß der Stadtverordneten.18 Darüber vergaß er nicht, daß er Jude war. Die Integration der jüdischen Gemeinde schien in Freiburg gelungen. Dem Umbau der Synagoge, der 1926 abgeschlossen war, legte die Stadt, anders als seinerzeit bei ihrer Errichtung, keine Schwierigkeiten in den Weg.19 Max Mayer empfand jedoch, wacher als viele andere, sehr genau, wie labil und gefährdet die Eingliederung war. Daß man als Jude immer noch mit Vorbehalten 15 16 17 18
Max Mayer: Familie, S. 91, Musik S. 21. Max Mayer: Musik, S. 50. StadtAF, C 3/86/4a, C 4/VI/10/3, C 4/VI/14/2L, vgl. C 4/V/1/8. Vgl. StadtAF, C 4/VI/12/15, C 4/VI/13/12, C 4/VI/14/26. Auch Olga Mayer engagierte sich öffentlich, so -– über den Israelitischen Frauenverein – in der Fürsorge für Tbc-Kranke (StadtAF, D. So.-Tbc.10). 19 StadtAF, C 4/I/16 /10.
208
|
»Heimat ist keine Sache, die sich verlieren und wieder gewinnen läßt ...«
betrachtet wurde, galt im Elternhaus beinahe als selbstverständlich. »Man muß sich besonders gut benehmen, damit man nicht auffällt«, wurde den Kindern als Regel eingeprägt.20 Auf antisemitische Äußerungen und Tendenzen reagierte Mayer äußerst scharf. Im »Volksfreund« vom 5. Dezember 1905 prangerte er die Berichterstattung des katholischen Volksblattes »Freiburger Bote« über die Revolution in Rußland an. Nicht nur, daß es sich auf die Seite der zarischen Regierung gegen die »Meuterei in Sewastopol« gestellt hatte: »Und dann legt der Herr Redakteur die Feder weg und schreibt dafür mit dem Zaunpfahl. ›Auch in Sewastopol ist das revolutionäre Judentum zu einem Drittel der Bevölkerung vertreten‹. – Besser hätte es der Polizeichef von Kischinew und Anführer der Mordbuben [beim dortigen Judenprogrom im April 1903, H. H.] auch nicht machen können. Die russische Regierung und der Freiburger Bote sind einander wert.« Die »Volkswacht« veröffentlichte am 24. März 1914 einen Artikel über eine Bürgerausschußsitzung, demzufolge Mayer sich dagegen verwahrte, daß man das »Zahlenverhältnis zwischen christlichen und jüdischen Stimmbändern« am Theater zum Thema mache. In derselben Zeitung warnte Mayer am 14. Dezember 1920 vor Tendenzen im Bühnenvolksbund, der für Freiburg Vorschläge zum »Wiederaufbau der deutschen Kultur« gemacht hatte, »das deutsche Volk in gute und schlechte Deutsche, in Patrioten und Vaterlandslose, in Arier und Fremde, in Christen und Mindersittliche zu spalten.« Als Überzeugung des Bundes sah er an: »Das alte Kulturvolk der Juden ist Plebs. Die tiefe ernste Sittlichkeit der Freireligiösen ist ebenfalls verpönt. Auch die sozialistischen Arbeiter aller Schattierungen stehen natürlich außerhalb dieser völkischen Aristokratie.« Der Vertreter des Bühnenvolksbundes erklärte dazu in der » Freiburger Tagespost« vom 28. Dezember 1920, man wolle den Mitgliedern deutsche und christliche Aufführungen – oder solche, die zumindest auf dieser Grundlage beruhten – bieten. Dies stelle keine Spitze gegen die jüdischen Mitbürger dar, ebensowenig wie die Existenz christlicher Kirchen gegen die Synagoge.21 Im Laufe der zwanziger Jahre verschärften sich Konflikte dieser Art. Am 30. Mai 1920 kündigte Mayer seine Geschäftsanzeigen in der »Süddeutschen Schuhund Lederzeitung«, weil diese einen antisemitischen Artikel veröffentlicht hatte. »Das von ihm entworfene Bild und die angewandte Technik sind so beleidigend, daß es mir die Selbstachtung verbietet, künftig ein Organ zu unterstützen, welches einen solchen Geist verbreiten hilft.« In der »Volkswacht« erschien am 15. 20 Mitteilung von Lotte Paepcke, 24.11.1988. 21 Weitere Zeitungsartikel zu dieser Auseinandersetzung finden sich im Nachlaß Mayers. Vgl. StadtAF, C 4/VI/14/2: Am 12.12.1922 stellte der christliche Bühnenvolksbund einen vergeblichen Antrag, unterzeichnet von Dr. Adolf Sütterlin – Prof. in Freiburg –, der 1. Vorsitzende in Freiburg, Prof. Dr. Franz Reich, solle im Theaterausschuß vertreten sein.
Der Lebensweg des Freiburger Kaufmanns Max Mayer
|
209
August 1932 eine Besprechung des in Wien publizierten Buches »Der Jud’ ist schuld?«, in der Max Mayer seiner Hoffnung Ausdruck gab, daß vielleicht doch noch Argumente die Judengegner überzeugen könnten.22 Mit großer Klarsicht und Schärfe reagierte er gleichzeitig in einem Redeentwurf auf den erwarteten Antrag der NSDAP, das Schächten wegen Tierquälerei zu verbieten. Mayer beschrieb zunächst den Schächtungsvorgang und widerlegte den Vorwurf der Tierquälerei. Er wies dann darauf hin, daß der Antrag »weniger den Tieren als den Juden gilt«. Für den Tierschutz gebe es ganz andere Aufgaben. »Vielleicht darf ich noch auf das nat. soz. Aktionsprogramm aufmerksam machen, in dem [es] sich um das Köpferollen bei Menschen handelt, um Rache = Exekutionen, um die Nacht der langen Messer. In Bezug auf die Achtung und Schonung der lebendigen Kreatur ziehe ich den Boxheimer Erfahrungen die biblischen immer noch vor.« Die »Boxheimer Dokumente«, eine interne Aufzeichnung hessischer Nazis für Maßnahmen nach der Machtübernahme, darunter die »Liquidierung« politischer Gegner, waren Ende 1931 bekannt geworden. In Freiburg blieb der Antrag gegen das Schächten damals aus, Max Mayer brauchte seine Rede nicht zu halten. Doch bereits am 21. April 1933 verbot die neue Reichsregierung unter Adolf Hitler im »Gesetz über das Schlachten von Tieren« das Schächten.23 Die Abwehr der Nazis war erfolglos geblieben. Max Mayer, der keineswegs zum linken Flügel der SPD gehörte – mit seiner Tochter Lotte, die bei der »Roten Studentengruppe« in Freiburg Mitglied war, führte er oft heftige politische Diskussionen24 –, trat energisch für eine vorübergehende Zusammenarbeit mit der KPD ein. »Die gegebene Abwehrfront der Sozialdemokraten mit den Kommunisten kam nicht zustande. Ich erinnere mich einer internen SPD-Sitzung, in welcher ich diese Co-Operation mit der Mahnung angeraten habe, es sei 5 Minuten vor 22 Bezeichnend für die damalige Atmosphäre ist ein Vorgang 1931, bei dem städtischerseits die Gemeinnützigkeit des Israelitischen Frauenvereins in Frage gestellt wurde: StadtAF, C 4/IX/10/9. 23 Philo-Lexikon. Handbuch des jüdischen Wissens. Königstein 1982 (Nachdruck der Ausgabe von 1936), Sp. 655. Vgl . Kurt Quilitzsch: Die antisemitische Politik des Nationalsozialismus im Spiegel der Freiburger Tageszeitung »Der Alemanne«. Eine Dokumentation. Zulassungsarbeit zur ersten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen Freiburg 1968 [StadtAF, Dwe 625], hier S. 10–11; StadtAF, C 4/VI/6/9. – Textauszug der »Boxheimer Dokumente« in: Die ungeliebte Republik. Dokumentation zur Innen- und Außenpolitik Weimars 1918–1933. Hg. von Wolfgang Michalka und Gottfried Niedhart. München 1980, S. 308–311. 24 Mitteilung von Lotte Paepcke, 24.11.1988. Zur Roten Studentengruppe Wolfgang Kreutzberger: Studenten und Politik 1918–1933. Der Fall Freiburg im Breisgau (= Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 2). Göttingen 1972, S. 125–126, 138, 141, 142, 154 ff., 159, 173. Vgl. Anm. 33 und 34.
210
|
»Heimat ist keine Sache, die sich verlieren und wieder gewinnen läßt ...«
zwölf. Ich sagte ihnen leidenschaftlich, es sei ja nur eine Gelegenheits-Front, nachher könne man wieder die eigenen Wege gehen. – An meinem bescheidenen Teil habe ich mich auch agitatorisch betätigt. Ich habe in St. Georgen auf dem Schwarzwald gesprochen, und in Schmieheim und Altdorf. Diese seltsame Einkehr am Ort meiner Ahnen hat meinem Vortrag ein besonderes Kolorit gegeben. Mein Vetter Louis war anwesend, der Sohn meiner verstorbenen Tante Auguste.«25 Der erwähnte Vetter wurde 1936 wegen angeblicher »Rassenschande« verhaftet, zu 18 Monaten Zuchthaus verurteilt und anschließend ins KZ Dachau deportiert, wo er im Juli 1941 umkam.26 Ende der Integration im Nazi-Terror
Max Mayer und seine Familie wurden, wie alle anderen Juden auch, durch den Sieg der Nazis in ihren gesamten Lebensumständen tief getroffen. Der erste Schlag folgte wegen Mayers politischen Aktivitäten: Am 20. März 1933 wurde er, zusammen mit allen anderen Freiburger Stadträten und Stadtverordneten der SPD, in »Schutzhaft« genommen.27 Mayer kam ins Landesgefängnis, Ende März wurde er wieder entlassen. Nach seiner Rückkehr mußte er am 31. März in der Tageszeitung »Der Alemanne«, dem »Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens«, lesen, daß für den kommenden Tag zum Boykott aller jüdischen Geschäfte und Einrichtungen aufgerufen war. Auch sein Firmenname stand auf der Liste. Am anderen Morgen hielt dann ein Posten vor dem Ladeneingang Wache. Trotzdem kamen zahlreiche Kunden, die sich nicht abschrecken ließen und ihre Sympathie bekunden wollten. Um sie – und seine Angestellten – nicht zu gefährden, entschied sich Mayer nach Warnungen durch zwei SA-Offiziere, sein Geschäft zu schließen. Wenige Tage später, am 10. April 1933, legte er seine Funktionen im Verband badischer Lederhändler nieder, um einer zu erwartenden Enthebung zuvorzukommen. Seine politischen Aufgaben konnte er ohnehin nicht mehr wahrnehmen. Bereits am 29. März 1933 hatte er an Oberbügermeister Dr. Bender geschrieben: »Mit Rücksicht auf die veränderten politischen Verhältnisse erkläre ich hiermit, daß ich mein Mandat zum Bürgerausschuß und damit zugleich das Amt des stellv. 25 Max Mayer: Familie, S. 148. 26 Max Mayer: Familie, S. 148; Franz Hundsnurscher, Gerhard Taddey: Die jüdischen Gemeinden in Baden. Denkmale, Geschichte, Schicksale. Stuttgart 1968, S. 36. 27 StadtAF, C 4/VI/6/9. Vgl. hier und im folgenden Ernst Otto Bräunche u. a.: 1933. Machtergreifung in Freiburg und Südbaden (= Stadt und Geschichte. Neue Reihe des Stadtarchivs Freiburg i. Br. H. 4). Freiburg i. Br. 1983, S. 36 – 37.
Der Lebensweg des Freiburger Kaufmanns Max Mayer
|
211
Obmanns der Stadtverordneten niederlege.«28 Von nun an war die Bedrohung durch die Nazis ständig gegenwärtig. Konsequenzen blieben nicht aus. Wie die meisten deutschen Juden harrten auch die Mayerschen Familienangehörigen zunächst überwiegend aus, in der Hoffnung, die NS-Herrschaft werde bald wieder vorübergehen. In Freiburg lag der Anteil derjenigen, die vorerst blieben, sogar über dem Reichsdurchschnitt: 1933 lebten hier 1.138 Juden, das waren 1,15% der Einwohnerschaft, gegenüber 1,55% oder 1.400 Personen 1925. Bis 1939 ging diese Zahl lediglich auf 800 zurück, die jetzt 0,73% der Bevölkerung ausmachten.29 Die Integration schien doch derart fest gewesen zu sein, daß eine antisemitische Regierung sie letztlich nicht erschüttern könne.30 1936 entschlossen sich Max Mayers Schwester Lilly und ihr Gatte Gustav Feldmann zur Auswanderung. Gustav war ursprünglich, als überzeugter Assimilationsanhänger, im Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens aktiv gewesen. Die Ernüchterung durch die Nazis wandelte ihn zum Zionisten. Folgerichtig wählten sie Palästina als neue Heimat. Ende der dreißiger Jahre emigrierten Alice, die Schwester Olga Mayers, und ihr Mann, der Maler Reinhold Nägele, nach England und dann weiter nach New York.31 Max Mayer selbst dachte lange nicht an Auswanderung, obwohl auch Sohn Hans bereits 1934 diesen Schritt vollzogen hatte, weil er seinen Beruf als Optiker nicht mehr ausüben konnte. Er ging zunächst nach Italien, und dann, als auch dort die Bedrohung für die Juden größer wurde, weiter in die USA.32
28 StadtAF, C 4/VI/7/7. Nach seinen Erinnerungen wurde Max Mayer am 31.3.1933 entlassen (Familie, S. 154) , nach Unterlagen im Hauptstaatsarchiv Stuttgart (HStAS) am 28.3. (J 355, Bu 31, 26854/EF 3216) , so daß nicht eindeutig geklärt ist, ob er den Brief noch aus dem Gefängnis oder unmittelbar nach seiner Rückkehr schrieb; der Briefkopf enthält seine Privatadresse. – Ein Boykott am 11.3.1933 war wenig erfolgreich gewesen (Bräunche u. a.: 1933, S. 38). 29 Berent Schwineköper, Franz Laubenberger: Geschichte und Schicksal der Freiburger Juden. Aus Anlaß des 100jährigen Bestehens der israelitischen Gemeinde in Freiburg (= Freiburger Stadthefte 6). Freiburg i. Br. 1963 (unveränderter Nachdruck 1983), S. 13. Als Jude galt in dieser Statistik, wer sich zum jüdischen Glauben bekannte. 30 Zur allmählichen gesellschaftlichen Isolierung vgl. Max Mayer: Familie, S. 160. – »Judenfreunde« wurden häufig denunziert und auch überregional angeprangert, vgl. etwa mit Freiburger Beispielen in »Der Stürmer« Nr. 22/Mai 1934, Nr. 26/Juni 1936, Nr. 45/Nov. 1936, Nr. 47/Nov. 1936, Nr. 14/April 1937, Nr. 1/Jan. 1938, Nr. 3/Jan. 1938, Nr. 19/ Mai 1938, Nr. 23/Juni 1938 (Hinweise auf diese Stellen verdanke ich Mitarbeitern der Stadtbibliothek Nürnberg). 31 Max Mayer: Familie, S. 138–139, gibt einmal 1938, ein andermal 1939 als Datum der Emigration an. Reinhold Nägele genießt auch heute noch einen hohen Rang als Künstler. 32 Neben Unterlagen im Nachlaß Mayers Mitteilung von Lotte Paepcke, 24.11.1988.
212
|
»Heimat ist keine Sache, die sich verlieren und wieder gewinnen läßt ...«
Seine Schwester Lotte war bereits seit Februar 1934 verheiratet. Sie hatte in Freiburg und Berlin Jura studiert.33 Aufgrund ihrer Aktivitäten in der Roten Studentengruppe wurde sie im Frühjahr 1933 nach ihrem Referendarexamen verhaftet. Sie saß zwei Wochen im Gefängnis und mußte bei ihrer Entlassung unterschreiben, daß sie sich nicht mehr politisch betätigen werde. Eine Berufsausübung wurde ihr verwehrt. Sie durfte schon nicht mehr den Vorbereitungsdienst an einem Amtsgericht ableisten. Wie ihr Bruder siedelte sie deshalb nach Italien über und fand in einem Anwaltsbüro, das für die deutsche Botschaft arbeitete, eine Anstellung. Als jedoch die Nachrichten durchsickerten, demnächst würden »Mischehen« zwischen Juden und »Ariern« verboten, kehrte sie nach Deutschland zurück und heiratete – trotz aller Warnungen – den Philologen Dr. Ernst August Paepcke. 1935 wurde der erste Sohn Peter geboren (die übrigen Kinder, Michael, Max und Andreas, folgten nach Kriegsende), so daß die Familie nach der Einstufung durch die NS-»Rassengesetze« vom selben Jahr als »privilegierte Mischehe« einen gewissen Schutz genoß, der durch die Tätigkeit Paepckes in der Industrie noch vergrößert wurde. Während des Krieges reichte dann auch dieser Schutz nicht mehr. Im März 1943 wurde Lotte Paepcke wieder einmal behördlicherseits »erfaßt«. Nach einer Krankheit tauchte sie in Freiburg unter und überlebte schließlich mit ihrem Sohn unter dramatischen Umständen im Kloster Stegen.34 Max und Olga Mayer blieben vom Nazi-Terror nicht verschont. Die Firma Leser & Mayer konnte dem wachsenden Druck nicht standhalten. Vor 1933 hatte sich das Geschäft, nach vorübergehenden Schwierigkeiten wegen der Inflation, stabilisiert, so daß das Sortiment erweitert worden war. Jetzt stellte ein Kunde nach dem anderen seine Aufträge ein, obwohl nicht mehr Mayer selbst, sondern sein Angestellter Eugen Rees die Reisen übernommen hatte. 1935 entschloß sich Max Mayer schließlich, diesem seine Lederhandlung in der Schusterstraße 23 zu verkaufen. Er hielt auch in der Nazi-Zeit treu zur Familie, wickelte die Geschäfts33 Vgl. Hinweise Lotte Paepckes vom 24.11.1988 über ihr Studium und das Umfeld an der Freiburger Universität in Anm. 33 der ursprünglichen Fassung dieses Beitrags (s. Fußnote 1). 34 Vgl. Lotte Paepckes eigenen Bericht: Unter einem fremden Stern. Frankfurt a. M. 1952 (Neuauflage: Ich wurde vergessen. Bericht einer Jüdin, die das Dritte Reich überlebte. Freiburg i. Br. etc. 1979) sowie ihre Mitteilungen im Gespräch am 24.11.1988. Frau Paepcke und Herr Dr. Peter Paepcke haben mir darüber hinaus persönliche Unterlagen über die hier ausgeführten Zusammenhänge zugänglich gemacht. Außerdem: Teresa Andlauer u. a.: »Eigentlich habe ich nichts gesehen, aber...« – (Verdrängte) Geschichte der Judenverfolgung in Freiburg. In: »Eigentlich habe ich nichts gesehen...«. Beiträge zu Geschichte und Alltag in Südbaden im 19. und 20. Jahrhundert. Hg. von Heiko Haumann und Thomas Schnabel. Freiburg i. Br. 1987, S. 125–142, hier 132–138. Zur Verhaftung zweier als kommunistisch geltender Studentinnen und zur Auflösung der Roten Studentengruppe Kreutzberger: Studenten, S. 173. Zur NS-Politik gegenüber »Mischehen« vgl. etwa Uwe Dietrich Adam: Judenpolitik im Dritten Reich. Königstein, Düsseldorf 1979, S. 316–333.
Der Lebensweg des Freiburger Kaufmanns Max Mayer
|
213
übergabe unter fairen Bedingungen ab und erwies sich in den folgenden Jahren weiterhin als Stütze. Die Familien Mayer und Rees blieben sich in Freundschaft verbunden.35 Eine bescheidene Export-Lederhandlung führte Max Mayer vorerst fort. Dazu besuchte er seinen alten Kundenstamm im Elsaß und hoffte, daß die Nazis ihn bei diesen Auslandsgeschäften in Ruhe ließen. Doch die Entrechtung der Juden ging weiter. Am 9. Mai 1938 brachte Max Mayer seine Schlußfolgerungen in einem Brief an seinen Enkel Peter zu Papier. Dieser war am 3. Mai drei Jahre alt geworden und – wie der Vater – am 8. Mai evangelisch getauft worden. Mayer hielt den Brief zunächst zurück, sandte ihn erst am 26. April 1948 an Peters Eltern und überließ es diesen, ob und wie sie ihn dem Enkel bekanntmachen wollten. Im »Peterbrief« drückte Max Mayer aus, daß ihm die Taufe zwar verständlich sei, ihm die Gründe auch zwingend erschienen, um den Enkel zu schützen, daß sie ihn aber dennoch in seinem »Judesein« tief getroffen habe. Früher sei dieses Judesein eher bagatellisiert worden, jetzt aber, »in den letzten Jahren der Judenverfolgung«, sei es »meine Trutzburg« geworden. Klarsichtig rechnete er mit der Politik der vergangenen fünf Jahre ab und betonte, daß sich in der Ahnenreihe der Mutter niemand finde, dessen Peter sich – im Vergleich mit »irgendeiner arischen Ahnentafel« – zu schämen brauche. In den Mittelpunkt rückte Max Mayer seine Frau, die »jüdische Großmutter« Olga. Ihre Eigenschaften faßte er derart zusammen, daß er sie als einen »wirklich sittlichen Menschen« bezeichnete. »(...) Du kannst auf deine jüdische Großmutter stolz sein (...), in keinem arischen Ahnenpaß ist eine höhere Großmutter eingeschrieben.« Die Besinnung auf das Judesein, das in der Zeit der Integration zu einer Nebensächlichkeit geworden war, gab Max Mayer die Kraft, dem Druck der Nazis zu widerstehen. Die völlige Ausschaltung der Juden aus dem öffentlichen Leben war inzwischen angesagt. Am 23. September 1938 wurde das verbliebene Ledergeschäft als »jüdischer Gewerbebetrieb« eingetragen. Zum 1. Januar 1939 mußten Juden eine besondere Kennkarte – mit dem »J-Stempel« – besitzen sowie die zusätzlichen Vornamen »Sara« oder »Israel« annehmen. In Olgas und Max Mayers Geburtsurkunden wurde dies am 12. und 26. Januar 1939 vermerkt. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich ihre Situation ohnehin grundlegend verändert. Am Morgen des 10. November 1938, zwischen drei und vier Uhr, war auch in Freiburg die Synagoge am Werderring, neben dem Kollegiengebäude der Uni35 Die Umstände der Geschäftsübergabe stellen eine Ausnahme dar. Zur bislang nicht systematisch aufgearbeiteten »Arisierung« in Freiburg vgl. StadtAF, C4/I/26/2, M2/127; Quilitzsch: Die antisemitische Politik. [Inzwischen: Andrea Brucher-Lembach: ... wie Hunde auf ein Stück Brot. Die Arisierung und der Versuch der Wiedergutmachung in Freiburg (= Alltag & Provinz 12). Bremgarten 2004; Kathrin Clausing: Leben auf Abruf. Zur Geschichte der Freiburger Juden im Nationalsozialismus (= Veröffentlichungen aus dem Archiv der Stadt Freiburg i. Br. 37). Freiburg i. Br. 2005.]
214
|
»Heimat ist keine Sache, die sich verlieren und wieder gewinnen läßt ...«
versität, niedergebrannt worden. Noch während die Synagoge in Flammen stand, begannen, als Teil der Aktionen in der »Reichskristallnacht«, die Verhaftungen von Freiburger Juden. 137 wurden in das Konzentrationslager Dachau deportiert. Max Mayer holten morgens um sieben Uhr zwei Detektive. Als man ihn zusammen mit den anderen zum Bahnhof transportierte, hatte sich eine große Menschenmenge angesammelt. »Ich werde nie vergessen, in welcher teilnehmenden würdigen Haltung in Freiburg die Menge dem infamen Schauspiel beiwohnte. Es war eine Kritik in tiefem Schweigen.« Die entwürdigende, demütigende Behandlung in Dachau ließ in ihm den Entschluß zur Emigration reifen. Unter diesen Umständen wollte er kein Deutscher mehr sein.36 Nach seiner Entlassung vier Wochen später, die aufgrund seines Alters früher als bei anderen erfolgte, betrieb er mit Olga zusammen energisch die Vorbereitungen zur Emigration. Bei Bekannten und Verwandten wurden verschiedene Möglichkeiten erkundet, ob ein Aufenthaltsort in Frankreich, in England, in Palästina, in den USA oder in der Schweiz am günstigsten sei. Schließlich schälte sich heraus, daß es am angemessensten sei, zu Maxens Schwester Helene nach Zürich zu ziehen. Sie stellten die entsprechenden Anträge, und nun begann der Kampf um die Erledigung der »Formalitäten«. Als »Sühneleistung« für das Attentat Grynszpans auf vom Rath – dem Vorwand für die »Kristallnacht« – mußten die Juden deutscher Staatsangehörigkeit, so war am 12. November 1938 verordnet worden, insgesamt eine Milliarde RM abliefern. Auf Mayers entfielen 15.000 RM, die in fünf Raten zu zahlen waren. Außerdem wurde nun eine »Reichsfluchtsteuer« in Höhe von 10.300 RM fällig.37 Diese Mittel aufzubringen, erwies sich für die Familie Mayer als keineswegs einfach. Am 22. Mai 1939 war die Firma Leser & Mayer im Handelsregister erloschen. Max Mayer hatte keinen Paß mehr erhalten, um seine Kunden im Elsaß aufsuchen zu können. Jetzt fehlte also auch dieses bescheidene Einkommen. Doch es kam noch schlimmer. Mit verschiedenen Bestimmungen seit Ende 1938 hatte die Regierung die Juden verpflichtet, sämtliche Edelmetalle, Schmuckstücke und Kunstgegenstände – bis auf wenige Dinge für den persönlichen Gebrauch – an staatliche Stellen zu deren Preisen zu »verkaufen«. Das Ehepaar Mayer verlor darüber nicht nur sämtliche Wertsachen, aufgrund eines angeblichen Formfehlers wurde ihm auch noch das Konto gesperrt.38 36 Zu den Zusammenhängen vgl. wieder die in Anm. 1 genannten Titel. Zitate: Max Mayer: Familie, S. 165, 168. 37 Zur Geschichte der »Reichsfluchtsteuer« Avraham Barkai: Vom Boykott zur »Entjudung«. Der wirtschaftliche Existenzkampf der Juden im Dritten Reich 1933–1943. Frankfurt a. M. 1988, S. 111–112. 38 Unterlagen in dieser Sache – auch zum Verfahren über die Schadenersatzansprüche Mayers nach 1945 – außer im Nachlaß: StadtAF, D. Li. 247, 254, 255, sowie HStAS, J 355, Bu 31,
Der Lebensweg des Freiburger Kaufmanns Max Mayer
|
215
Um die Auswanderung zu finanzieren, blieb nichts anderes übrig, als das Anwesen in der Schusterstraße 23 zu verkaufen. Eugen Rees hätte es gern übernommen. Ein Vorvertrag war bereits Mitte Dezember 1938 geschlossen worden. Rees erklärte sich bereit, insgesamt 36.900 RM zu zahlen. Die Stadt Freiburg genehmigte den Vertrag jedoch nicht, sondern bestand auf ihrem Vorkaufsrecht an diesem städtebaulich interessanten Gebäude: Es bildete die Rückfront des Historischen Kaufhauses und sollte bei dessen »künftiger baulicher Erweiterung (...) unbedingt beigezogen werden«, wie das Liegenschaftsamt intern vermerkte.39 Mayer bot das Haus daraufhin für 40.000 RM an. Längere Verhandlungen folgten. Unter dem Druck, daß die Frist zur Ausreise in die Schweiz ablief, ermäßigte Max Mayer gezwungenermaßen im Juli 1939 sein Verkaufsangebot auf 33.402 RM, das dann auch dem Kaufvertrag zwischen ihm und der Stadt Freiburg am 27. Juli 1939 zugrunde gelegt wurde. Die »Reichsfluchtsteuer« und der Rest der noch fälligen »Sühneleistung« sollten sofort an die zuständigen Stellen überwiesen sowie eine Hypothek abgelöst werden. Den verbleibenden Betrag, rund 18.500 RM, zahlte die Stadt auf das gesperrte Konto Max Mayers, der somit auch hierüber nicht frei verfügen konnte. Immerhin setzte sie sich dafür ein, daß er 3.500 RM erhielt, um seine Kosten begleichen zu können, und daß sein Auswanderungswunsch beschleunigt behandelt wurde. Die Devisenstelle beim Oberfinanzpräsidenten genehmigte den Kaufvertrag am 14. Oktober 1939. Schon am 25. September hatte sie zugestimmt, daß ein Teilbetrag »zur Bezahlung der Auswandererabgabe« an den Oberrat der Israeliten in Karlsruhe abgetreten werden durfte.40 Immer noch mußten zahlreiche Hürden für die Auswanderung genommen werden. »(...) Durch die vielen bürokratischen Einmischungen ging so viel Zeit verloren, daß wir den von Bern vorgeschriebenen Mai-Termin nicht einhalten konnten, wir brauchten 3 Monate Verlängerung. Lonny hat diese für uns erwirkt. (...) anfangs August (hatten wir) immer noch nicht die deutsche AusreiseErlaubnis (...), weil die Stadt mit ihrer Verpflichtung im Verzug war (...) Endlich konnte ich vermuten, daß das Freiburger Paß-Amt autorisiert sei zur Ausfertigung unserer Pässe. Zwei Nachfragen dort waren negativ. Da – am 1. September 1939 früh um 9 Uhr erhielt ich unsere Pässe. Sie zitterten in meiner Hand, ich konnte das Wunder, das keines mehr war, kaum fassen. (...) Ich eilte heim und befahl: Packen! Um 12 Uhr mittags mußten wir im Zug nach Mannheim sitzen zur Empfangnahme der Schweizer Visa. Jene paar Stunden werden wir nie verges26854–26855/EF 3216, 12086. Die von Juden abgelieferten Wertgegenstände wurden zumindest teilweise versteigert (StadtAF, D. Li. 235). 39 StadtAF, C 4/VII/11/11 (teilweise auch zum folgenden). 40 StadtAF, D. Li. 1010 a und b; hier außerdem Einzelheiten der Verhandlungen. Vgl. auch D. Li. 249, 252.
216
|
»Heimat ist keine Sache, die sich verlieren und wieder gewinnen läßt ...«
sen, sie waren der Ausbruch des zweiten Weltkriegs und damit höchste Zeit für uns. Wir berannten unsere Treppen zum Packen. Auf der dritten Etage wohnte der Nazi-Mieter. Er hielt seine Tür offen, damit wir aus seinem Radio Hitlers Kriegserklärung an Polen aus dem Reichstag vernähmen. (...) Unter der Peitsche einer Frist von nur zwei Stunden verblieb kein Raum für tragische Gefühle. Sie waren da, wir wußten, daß wir unser geliebtes Heim in jener Stunde für immer aufgaben. Aber die Uhr und unser Fahrplan waren unsere Erlöser. Nach einem raschen Abschied von meinem Nachfolger Eugen und von unserer Putzfrau enteilten wir schneller, als unsere Empfindungen uns folgen konnten. Im Schnellzug nach Mannheim erjagten wir das Schweizer Visum. Der Konsul war im Zweifel, ob wir auf der Rückreise nach Basel noch bis zur Grenze gelangen oder zu Fuß dorthin marschieren müßten. Als wir des Nachts noch einmal Freiburg passierten, flüsterte mir Olga den Wunsch, dort noch einmal zu übernachten. Ich lehnte ab. Wie der Konsul prophezeit hatte, machte der Schnellzug in Weil, der letzten deutschen Station, Halt. Aber alsbald konnten wir alle wieder einsteigen und in den Badischen Bahnhof Basel einfahren.«41 In der Emigration
Außer ihrem Handgepäck hatten Olga und Max Mayer jeweils nur 10 RM mitnehmen können. Ordnungsgemäß aufgegebenes Frachtgut, adressiert an Sohn Hans in den USA, kam nie an. Bitten, das Geld auf dem gesperrten Konto für Zahlungen an Tochter Lotte und andere Verwandte verwenden zu dürfen, wurden abgelehnt. Ebenso schlug ein weiterer Versuch fehl: Am 13. Februar 1940 teilte Julius Bloch vom Synagogenrat Freiburg, ein alter Freund der Familie, mit, die von Max Mayer beabsichtigte finanzielle Zuwendung sei »aus bekannten Gründen« nicht eingegangen.42 Wegen der Finanzen gab es überhaupt noch viel Ärger mit den deutschen Behörden. So schikanierten diese Max Mayer mit der Zahlungsabwicklung der »Reichsfluchtsteuer«, auf die er eigentlich gar keinen Einfluß mehr hatte, weil die Stadt Freiburg im Kaufvertrag für das Anwesen Schusterstraße 23 die Verpflichtung eingegangen war, den Betrag unmittelbar anzuweisen. Des weiteren wurde die zum 15. November 1939 fällige fünfte Rate der »Judenabgabe (Sühneleistung)« trotz Auswanderung angemahnt, diese aber nicht mehr auf sein früheres 41 Max Mayer: Familie, S. 176–177; vgl. ders.: Wanderungen, S. 1–2. Nach einer Mitteilung Andreas Kirchgäßners, des Enkels von Eugen Rees, fuhr dieser das Ehepaar Mayer zum Bahnhof. Vgl. zur damaligen Praxis Landespolizeidirektion Freiburg (LPDF), 27/2201, 27/2285/4. 42 Mitteilung von Lotte Paepcke, 24.11.1988. Julius Bloch war am 21.10.1874 geboren worden, zu seinem Schicksal vgl. Anm. 44.
Der Lebensweg des Freiburger Kaufmanns Max Mayer
|
217
Vermögen angerechnet – dann hätte die Steuer gesenkt werden müssen –, weil er zu diesem Termin bereits im Ausland wohnte. Auf jede nur mögliche Weise bereicherte sich das NS-Regime an den Juden. Letztlich ging auch das gesperrte Konto in dessen Verfügung über: Indirekt erfuhren Olga und Max Mayer, daß im Reichsanzeiger vom 18. Mai 1940 und im Reichssteuerblatt vom 22. Mai ihre »Ausbürgerung«, die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit, datiert auf den 15. Mai 1940, bekannt gemacht worden sei. Dasselbe Los traf ihren Sohn Hans. Und zugleich hieß es: »Das Vermögen vorstehender Personen wird beschlagnahmt.«43 Einige Monate später erreichte die Emigranten die Nachricht, daß am 22. und 23. Oktober 1940 die meisten Juden aus Baden – wie aus der Pfalz und dem Saargebiet (Saarpfalz) – nach Gurs in den Pyrenäen sowie in einige weitere kleinere Lager in Südfrankreich deportiert worden waren.44 Unter ihnen befand sich 43 Dazu gehörten auch Anteile an weiteren Grundstücken in Freiburg: StadtAF, D. Li. 252 sowie K 1/83; HStAS, J 355, Bu 31, 26854/EF 3216. 44 Sie sind nicht vergessen. Bericht über die letzten Ruhestätten der am 22. Oktober 1940 nach Südfrankreich deportierten badischen Juden. Hg. vom Oberrat der Israeliten Badens. Karlsruhe 1958; Hanna Schramm: Menschen in Gurs. Erinnerungen an ein französisches Internierungslager (1940–1941). Mit einem dokumentarischen Beitrag zur französischen Emigrantenpolitik (1933–1944) von Barbara Vormeier (= Deutsches Exil 1933–45. Eine Schriftenreihe. Hg. von Georg Heintz. Bd. 13). Worms 1977; Jacob Toury: Die Entstehungsgeschichte des Austreibungsbefehls gegen die Juden der Saarpfalz und Badens (22./23. Oktober 1940 – Camp de Gurs). In: Jahrbuch des Instituts für Deutsche Geschichte Tel Aviv 15 (1986) S. 431–464; Oktoberdeportation 1940. Die sogenannte »Abschiebung« der badischen und saarpfälzischen Juden in das französische Internierungslager Gurs und andere Vorstationen von Auschwitz. 50 Jahre danach zum Gedenken. Hg. von Erhard R. Wiehn. Konstanz 1990; Lager in Frankreich. Überlebende und ihre Freunde. Zeugnisse der Emigration, Internierung und Deportation. Hg. von Edwin M. Landau und Samuel Schmitt. Mannheim 1991. Zum Zusammenhang mit den Madagaskar-Plänen Adam: Judenpolitik, S. 256–257, 304 ff.; Raul Hilberg: Die Vernichtung der europäischen Juden. Die Gesamtgeschichte des Holocaust. Berlin 1982, S. 424, vgl. 434 u. ff. Zu Freiburg Schwineköper, Laubenberger: Geschichte, S. 12–13. Vgl. den Erlebnisbericht von Freiburgerinnen: Martha und Else Liefmann: Helle Lichter auf dunklem Grund. Erinnerungen. Bern 1966; Abgeschoben. Jüdische Schicksale aus Freiburg 1940–1942. Briefe der Geschwister Liefmann aus Gurs und Morlaas an Adolf Freudenberg in Genf. Hg. von Dorothee Freudenberg-Hübner und Erhard Roy Wiehn. Konstanz 1993. Robert Liefmann war 1933 seine Lehrbefugnis an der Universität Freiburg aberkannt worden. Er starb am 21.3.1941 in Gurs (Die Opfer der nationalsozialistischen Judenverfolgung in Baden-Württemberg 1933–1945. Ein Gedenkbuch. Hg. von der Archivdirektion Stuttgart [Veröffentlichungen der Staatlichen Archivverwaltung Baden-Württemberg, Beibd. zu Bd. 20]. Stuttgart 1969, S. 206). In das Haus der Familie – Goethestraße 33 – zog nach mündlicher Mitteilung und einem Vermerk im Adreßbuch (ab 1942) die Freiburger Gestapo ein, die vorher im Basler Hof residiert hatte (Adolf-Hitler-Str. 167). Ebenso war dann dort die SS-Standarte 65 untergebracht (StadtAF, C 5/188, Schreiben der französischen
218
|
»Heimat ist keine Sache, die sich verlieren und wieder gewinnen läßt ...«
auch das Ehepaar Grumbach. Robert Grumbach hatte vor der Abreise, wie er in seinen Erinnerungen berichtet, Bücher von Hebel und Hansjakob eingesteckt. »Diese Bücher mußten mir in diesen Tagen die Berge, die Wälder, die Lieder und die Freunde der Heimat ersetzen.«45 Als die Mayers in Zürich vom Schicksal Grumbachs und der übrigen Juden erfuhren, taten sie alles, um Hilfeleistungen zu organisieren. Sie versuchten über schweizerische und internationale Institutionen, vorab das Rote Kreuz, Wege der Unterstützung zu finden. Der Kontakt zu den Grumbachs riß dann nicht mehr ab. Sie blieben von der Deportation in den Osten verschont und kehrten 1945 nach Freiburg zurück.46 Bald nach der Ankunft in Zürich hatten Mayers ihre Bemühungen fortgesetzt, in die USA zu ihrem Sohn weiterreisen zu können. Max Mayers Schwester Helene, die nach Zürich geheiratet hatte und seit 1934 Witwe war, wollte ebenfalls die Schweiz verlassen und zu ihrer Tochter Ilse ziehen, deren Mann in den USA wieder eine Arztpraxis eröffnet hatte. Erneut waren alle möglichen Formalitäten zu erledigen. Nicht nur Sohn Hans, auch weitere Verwandte und Bekannte gaben ein »Affidavit of Support« ab, eine Erklärung, daß sie die Einwanderer unterstützen und diese niemals der öffentlichen Fürsorge zur Last fallen würden. Auch das Polizeiamt der Stadt Zürich stellte am 5. Mai 1941 ein Leumunds-Zeugnis aus. Schließlich konnten die Koffer abermals gepackt werden. Eine genaue Liste wurde angefertigt, die ihren Inhalt präzise festhielt, von Stricknadeln und Bügeleisen über »Schürzle« bis hin zu Anzügen, Kleidern und Mänteln – und nicht zuletzt: »Akten und Briefe, Famil.Photos«, das Archiv der Erinnerung reiste mit, über Lissabon nach New York, wo sie am 13. August 1941 von Sohn Hans in Empfang genommen wurden. Obwohl es an Unterstützung nicht fehlte, war der Aufbau einer neuen Existenz in den USA nicht eben einfach. Olga Mayer trug mit Strick- und Näharbeit Militärregierung vom 19.12.1946). – Unter den Opfern der Deportation befand sich auch Julius Bloch (vgl. Anm. 42): Er starb am 13.10.1941 in Cours Dillon (Die Opfer, S. 30). – Als die Kriegsentwicklung die bisherigen NS-Pläne durchkreuzte, wurde die Politik einer Förderung der Auswanderung aufgegeben (Adam: Judenpolitik, S. 306 ff.; vgl. Hilberg: Die Vernichtung, S. 435 ff.). So heißt es in einem Schreiben des badischen Innenministers an die Gestapo-Leitstelle Karlsruhe vom 10.5.1941: »(...) die Ausreise reichsdeutscher Juden aus dem unbesetzten Gebiet Frankreichs nach Übersee (ist) nicht erwünscht« (LPDF, 27/2201, Beiheft »Reisepässe für Juden«). Das Vermögen der »evakuierten« Juden wurde beschlagnahmt. Kunstgeschichtlich interessante Gegenstände bot man Museen an (vgl. StadtAF, D. Sm. 26/4). 45 Heinrich-Hansjakob-Brief Nr. 57, September 1987 (Hinweis von Dr. Franz Flamm). 46 Zur Rückkehr Grumbachs: StadtAF, C 5/298. Der Briefwechsel Grumbach – Mayer bleibt einer späteren Auswertung vorbehalten. [Dazu jetzt Hans Schadek: Robert Grumbach 1875–1960. Jüdischer Rechtsanwalt, Sozialdemokrat und Stadtrat, Ehrenbürger von Freiburg (= Stadt und Geschichte. Neue Reihe des Stadtarchivs Freiburg i. Br. H. 20). Freiburg i. Br. 2007]
Der Lebensweg des Freiburger Kaufmanns Max Mayer
|
219
zum Lebensunterhalt bei. Max mußte zunächst verschiedene Gelegenheitsarbeiten annehmen – Reißverschlußreinigung zur Wiederverwendung, Photokopieren, Botengänge –, bis er schließlich eine längere Anstellung als Notenschreiber – zur Vorlage für den Druck – erhielt. So wurde er doch wieder mit der Musik verbunden, zumal er sein ganzes Talent benötigte, um die oft kaum lesbaren Notenhandschriften »richtig« zu schreiben. Ein Klavier hätte die Sache erleichtert, und es fand sich auch ein edler Spender. Allerdings war das Instrument so groß, daß es kaum in den kleinen Raum der Mayerschen Wohnung hineinpaßte.47 Mit Entsetzen verfolgten Max und Olga Mayer – und nicht sie allein – die Zeitungsberichte über die »Endlösung der Judenfrage«. So meldete etwa am 2. Dezember 1942 die »New York Times«, daß vermutlich bereits zwei Millionen Juden ermordet und fünf Millionen in Gefahr seien, ausgerottet zu werden. Die sozialdemokratische Zeitung in den USA, die »Neue Volkszeitung«, berichtete am 3. Juli 1943 über das Vernichtungslager Treblinka und rief zur Rettung überlebender Juden auf.48 Unter den Opfern befand sich auch Olgas Mutter Helene. Am 18. Oktober 1941 hatten die Mayers noch telegraphieren können, das Visum zur Einwanderung in Kuba sei erwirkt. Auch die Reisefinanzierung konnte gesichert werden. Doch die Auswanderung war nicht mehr möglich. Am 15. August 1942 sandte die Mutter eine Postkarte, mit der sie die »bevorstehende Wegverlegung des Heims«, in dem sie lebte, und »den Antritt einer großen Reise« mitteilte.49 Sie kam nach Theresienstadt und wurde von dort weiter deportiert. Danach war sie »verschollen«,50 am 8. Mai 1947 wurde sie offiziell für tot erklärt. Im selben Jahr, 1947, erhielt das Ehepaar Mayer die Staatsangehörigkeit der USA. 1943 war es aus einem möblierten Zimmer in eine Wohnung mit zwei Zimmern, Küche und Bad umgezogen. Hier übernahm Olga Mayer die Geschäftsführung eines Ausschusses, der eine Ehrung für den befreundeten Dichter Oskar Maria Graf vorbereitete. Graf wurde am 22. Juli sechzig Jahre alt, und der Ausschuß, dem neben Olga Manfred George, Kurt Pinthus, Claire Goll, Fenja und Marc Ginsberg sowie Sarah und Bernhard Springer angehörten, gaben dazu 47 Max Mayer: Musik, S. 57–58. »Eine kleine Sammlung von Drucken meiner Arbeiten wird hoffentlich in meinen Nachlaß eingehen« (Max Mayer: Familie, S. 194). Dies ist in der Tat der Fall. Nach dem Krieg verlor Mayer seine Stelle, weil Maschinen seine Arbeit ersetzen konnten. Er erhielt dann eine bescheidene Rente. 48 Zum Verhalten der USA gegenüber der NS-Judenpolitik David S. Wyman: Das unerwünschte Volk. Amerika und die Vernichtung der europäischen Juden. Ismaning 1986; Leon Weliczker Wells: Und sie machten Politik. Die amerikanischen Zionisten und der Holocaust. München 1989. 49 Max Mayer: Familie, S. 196. 50 Die Opfer, S. 259: 22.8.1942 Theresienstadt, 29.9.1942 Maly Trostinec. Vgl. Lotte Paepcke: Ein kleiner Händler, S. 82.
220
|
»Heimat ist keine Sache, die sich verlieren und wieder gewinnen läßt ...«
seinen Gedichtzyklus »Der ewige Kalender« in einer Luxusausgabe von 500 numerierten Exemplaren heraus, von denen der Dichter und die Illustratorin die Hälfte signierten.51 Zurück in Freiburg
Deutsche Staatsbürger wollten Max und Olga Mayer nicht mehr werden. Nicht ganz zu Unrecht befürchteten sie, daß nun in Deutschland das große »Vergessen« einsetzen werde. Am 16. Mai 1945 schrieb Max Mayer skeptisch an Lilly und Gustav Feldmann: »Und ihrer [der Nazis, H.H.] Millionen wollen es jetzt nicht gewesen sein. Sogar jene werden sich von den Nazis distanzieren wollen, welche ihnen die jüdischen Häuser, Geschäfte, Praxis und die potenten Stellungen zu verdanken hatten.« Korrespondenten berichteten von einer Überheblichkeit der Deutschen gegen die Russen, eine Folge der Goebbelsschen Propaganda. »Sie merken noch nicht, daß sie jede Legitimation verloren haben, sich über irgend ein Volk zu überheben.« Nicht zuletzt die Professoren hätten es an Urteilskraft fehlen lassen. »Eine geschlagene kapitulierte Wehrmacht ist noch lange kein erwachtes Deutschland. Es wird Sache einer freien Presse sein, die Ursachen und Schuldposten in diesem furchtbaren Zusammenbruch aufzuhellen und ihn als verdientes Schicksal anzuerkennen. (...) Man kann nicht einfach sagen: alle 70 Millionen sind verantwortlich«, aber leider würden nun auch diejenigen verantwortlich gemacht, die in Opposition gegen das Regime gestanden hätten, »weil man sie nicht sortieren kann und leider auch fürs erste nicht zuverlässig examinieren kann. (...) Ich habe die Zahl der Nazi-Gegner immer sehr hoch geschätzt, und entsprechend die Zahl der verhinderten Rebellen. Und wenn man heute als sicher annimmt, daß die Nazis gesinnungsmäßig noch weitere 20 Jahre Nazi bleiben werden, warum soll man dann nicht folgern dürfen, daß die Sozialdemokraten in großer Zahl gesinnungsfest geblieben sind? Deswegen bleibt es aber doch eine leider wieder verlorene Schlacht, eine Front, die nicht marschieren konnte, der wir aber trotzdem unsere Sympathie schulden. Ich habe sie in Dachau gesehen, und man weiß das Nötige aus anderen camps. Und man weiß von den trefflichen Menschen, welche Juden bei sich verborgen hielten auf eigene Gefahr.« Im Sommer 1950, nach Abschluß der Vergleichsverhandlungen mit der Stadt Freiburg, kam dann doch der Tag, an dem sich das Ehepaar Mayer zu einem Besuch in der alten Heimat aufmachte. »Eugen Rees, mein Geschäftsnachfolger, der uns ein wirklicher Freund geworden war, hat uns sagen lassen, in der Sorge 51 New Yorker Staatszeitung und Herold, 30.6.1954 (im Nachlaß Max Mayers). Lotte Paepcke teilte mir am 24.11.1988 mit, ihre Eltern und Graf hätten auf demselben Stockwerk gewohnt (34 Hillside Avenue, Apt. 6 H, New York 34).
Der Lebensweg des Freiburger Kaufmanns Max Mayer
|
221
um seine seelische Haltung habe er nicht an die Bahn kommen können. Beim Verlassen des sehr nett umgebauten Stationsgebäudes erwartete uns schon ein von Eugen spendiertes Taxi . Wir gelangten zur Dependance des Hotels Hohenzollern in der Lorettostraße, wo ein sehr schönes Zimmer für uns bestellt und mit dem Eugenschen Imperativ belegt war, daß wir seine Gäste seien mit einem strikten Zahlverbot für uns. Der Tisch war überwölbt von zwei Blumen-Arrangements. Das eine war gestiftet vom Oberbürgermeister der Stadt Freiburg mit einem sehr herzlichen, ehrenvollen Willkommschreiben für uns. – Das zweite war ein unter Blumen verborgener Korb von Eugen Rees, mit einer Riesenwurst darinnen, einer Flasche Champagner und Likör und Brezel, einer Fülle von Gaben. Wie damals Robert [Grumbach] bei seiner Ernennung zum Ehrenbürger habe auch ich diesen schönen Empfang durch das Stadtoberhaupt nicht auf meine Person allein bezogen, sondern auf den sympathischen Wunsch der jetzigen Stadtverwaltung, einen symbolischen Akt moralischer Wiedergutmachung zu vollziehen. Aber welche Interpretation auch immer diesem Willkommen zukommt – ich freue mich darüber.«52 Eugen Rees und die Grumbachs kümmerten sich vor allem um die Gestaltung des Freiburg-Aufenthaltes. Mayers besuchten auch ihr früheres Haus in der Schusterstraße 23, das inmitten der allgemeinen Zerstörung einigermaßen unversehrt stand. Rees hatte das Sortiment des Geschäftes erweitert, insbesondere Lederhosen erwiesen sich als »Renner«. Im Wohnzimmer stieß Max Mayer auf seinen alten Schiedmaier-Flügel. Er konnte nicht widerstehen, einige Weisen zu spielen. »Es war ein ergreifendes Wiedersehen mit unserem geliebten Freiburg.«53 Familie Rees fuhr Mayers zu Ausflügen in die Umgebung Freiburgs, in den geliebten Schwarzwald, auch zu ihrer Hütte. Besonders bei einer Fahrt durch das Simonswälder Tal kam die Erinnerung an die frühere Zeit der Heimkehr von einer Reise. Manchmal waren Grumbachs dabei. Aber es gab noch andere Gelegenheiten. »Durch einen Zufall wurden wir Gäste von Herrn und Frau Oberbürgermeister Dr. Hoffmann. Er fuhr uns und Grumbachs im Auto gegen Abend nach St. Ottilien, dereinst ein Refugium in der Hitlerzeit. Die Rückfahrt über den Hirzberg und Schloßberg, Jägerhaus über den Lichtern der Stadt, diese vertrauten Bilder in ihren episodischen Verknüpfungen von ehedem sammelten wieder im Bann dieser Stunde, was Zeit und Geschehen und Schicksal zerrissen hatte.«54 Bis zur Abreise am 25. August 1950 machten Mayers noch viele Besuche. Mit alten Freunden traf man sich, die in der Nazi-Zeit standhaft geblieben waren, darunter das ehemalige Dienstmädchen und der Hausbursche. Auch die SPD gedachte 52 Max Mayer: Wanderungen, S. 31. 53 Max Mayer: Wanderungen, S. 34. 54 Max Mayer: Wanderungen, S. 44.
222
|
»Heimat ist keine Sache, die sich verlieren und wieder gewinnen läßt ...«
des alten Genossen und veröffentlichte am 26. August 1950 in ihrer Zeitung »Das Volk« einen Artikel »Willkommen in der Heimat!« Eugen Rees bot Max und Olga Mayer eine mietfreie Wohnung bis an ihr Lebensende an, und die meisten Bekannten hofften, daß sie endgültig nach Freiburg zurückkehren würden. Max Mayer legte sich über die Gründe, die sie davon abhielten, noch einmal Rechenschaft ab. »Wir stammten aus einem Lande, wo wir ein Recht hatten zu sein, dieses Recht wurde uns vordem genommen. Amerika hat uns eine Zuflucht und nach fünfjähriger Bewährung das Bürgerrecht gegeben, mit der selbstverständlichen und beschworenen Verpflichtung zur Treue zum Lande. Ist es denkbar, daß wir ohne zwingenden Grund dieses Recht wieder freiwillig dahingeben (...)?« Einen zwingenden Grund sah Max Mayer nicht. »Darüber hinaus wird es mir aber doch nicht mehr die alte Heimat mit ihrem Ideen- und Gefühlsgehalt sein können. Heimat ist keine Sache, die sich heute verlieren und morgen wieder gewinnen läßt, um sie vielleicht übermorgen abermals zu verlieren. Gewiß, die gesetzliche Wiedergutmachung in allen Ehren. Sie ist ein Staatsakt im Geist der Versöhnung und der Reue. Aber weder die vergiftete Jugend, noch die ›echten‹ Parteimitglieder, noch die ehemaligen SS, noch die früheren Mörder gewähren uns in Aufrichtigkeit eine geringste Regung von Wiedergutmachung. Und ihrer sind viele Millionen. (...) Unsere im Dritten Reich treu und sauber gebliebenen Mitbürger haben nichts gutzumachen. Und wenn Einer der Anderen uns die Hand wieder reicht und damit eine Art Selbstreinigung ausdrücken will, so würde ich die Hand nicht zurückweisen. Daß aber in seiner Person, symbolisch, sich die Mitschuld mitmanifestiert an der Ermordung von sechs Millionen Juden, wird durch meinen Handschlag nicht entkräftet. Denn ich weiß, daß jede angebotene Versöhnung mit dem Anspruch auftritt, man soll vergeben und vergessen. (...) Das ist eine Angelegenheit unserer Nachfahren; aber in der Gegenwart, während die Tränen der Hinterbliebenen-Opfer noch fließen, ist dieses weichliche, all-liebende Vergeben und Vergessen nichts anderes, als eine neue Kapitulation. (...) Welches ist die Wirklichkeit des Deutschland von morgen?« Ganz bewußt stellte Max Mayer seine Erinnerungen gegen diejenigen, »welche einfach alles vergessen und dieses Vergessen kommandieren möchten, oder welche alberne Gegenrechnungen zu Lasten des Feindes aufmachen. Wenn es aber einen Maßstab für die Echtheit meines früheren Deutschseins gibt, so ist es meine Trauer um den Verlust an Glauben an die hohen Werte, deren Besitz und Pflege den Deutschen anvertraut war. (...) Die schönen Worte von der Kultur, vom Weltgewissen, von der Humanität, von der Menschenwürde kann ich nicht mehr hören.«55 Dennoch lebten in Freiburg »sicher (...) noch so viele Gerechte, um meine Stadt-Liebe zu rechtfertigen. Im Bunde mit ihnen dauert sie fort.«56 55 Max Mayer: Wanderungen, S. 40–42; ders.: Familie, S. 197. 56 Max Mayer: Wanderungen, S. 48.
Der Lebensweg des Freiburger Kaufmanns Max Mayer
|
223
Deshalb kam das Ehepaar Mayer noch mehrmals aus den USA nach Freiburg. Die »Freiburger Zeitung« gratulierte Max Mayer am 11./12. April 1953 zum achtzigsten Geburtstag, den er bei seiner Tochter Lotte in Karlsruhe verbrachte, am 14. April 1953 begrüßte wiederum »Das Volk« den »alten Freund« in der »Heimat«. 1955 war ein weiterer Aufenthalt möglich. Am 13. Juni 1960 starb Olga Mayer in New York. Lotte Paepcke holte nun ihren Vater nach Freiburg zurück.57 Seinen Lebensabend verbrachte Max Mayer im Heiliggeiststift, Karlsstraße 18. Wie seine letzte Meldekarte ausweist, hatte man zunächst seine US-Staatsangehörigkeit vermerkt, dann jedoch festgestellt, daß er »zum Personenkreis des Art. 116 Ziff. 2 des Grundgesetzes« gehörte: Seine »Ausbürgerung« war rückgängig gemacht worden, er hatte nun doch wieder die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten. Für das im »Dritten Reich« erlittene Unrecht bekam er eine Entschädigung, die zum 1. Januar 1961 auf 559 DM monatlich festgesetzt wurde. Darüber hinaus waren ihm – neben der Nachzahlung für den Verkauf des Anwesens in der Schusterstraße – rund 3.600 DM für seine Vermögensverluste erstattet worden. Max Mayer starb am 3. November 1962. Er ruht auf dem Friedhof der Israelitischen Gemeinde in Freiburg.
57 Lotte Paepcke: Ein kleiner Händler, S. 92–93.
Von Pocahontas zu Pylmau Familienpolitik als Friedensstrategie bei indianischen und sibirischen Völkern? Ein Diskussionsbeitrag* I.
Susanna Burghartz hat in ihrem Aufsatz über den »grossen Wilden« und die »Unvergleichliche« überzeugend eine neue Sichtweise auf John Smiths (1580–1631) Geschichtsschreibung zu den Anfängen Virginias begründet.1 Sie liest seine Texte von 1608, 1612 und 1624 als Teil eines »frühen Kolonialdiskurses« (187), der im Zusammenhang mit der gleichzeitigen Begegnung zwischen englischen Kolonisten und dem nach Häuptling Powhatan – eigentlich Wahunseneka oder Wahunsonacock – benannten Reich von mehr als 30 Algonkin-sprechenden Stämmen entstand. Im Zentrum steht die Rolle der Häuptlingstocher Pocahontas, die mehrfach zugunsten der Engländer intervenierte, sich 1614 während eines Waffenstillstandes taufen liess, den Tabakpflanzer John Rolfe heiratete, 1616 mit diesem nach England reiste, dort als Lady Rebecca am Hof vorgestellt wurde und auf der Rückreise ein Jahr später an einer Infektionskrankheit, möglicherweise den Pocken, starb. Offensichtlich wurde Pocahontas von beiden Seiten, den Einheimischen wie den Kolonisten, politisch als Objekt einer Tauschbeziehung instrumentalisiert. »Der Frauentransfer diente hier der Verständigung der beiden Herrscher. Er erlaubte es, die Beziehungen zwischen den beiden Kulturen als freundschaftlich und prinzipiell gleichwertig zu imaginieren« (179). Allerdings wurden dabei durchaus unterschiedliche Tausch-Vorstellungen sichtbar.2 Häuptling Powhatan nahm die Gleichwertigkeit ernst und bestand immer wieder auf Reziprozität – ebenso wie Pocahontas dies während ihres Aufenthaltes in England deutlich zum Ausdruck brachte. Für die Engländer hingegen galt die Indianerin mit ihrer Taufe und Heirat als »zivilisiert« und damit in ihre Wertvorstellungen integriert: Sie war von einer fremden »Wilden« zu einem »Menschen« und insofern »gleichwertig« geworden, hatte sich aber nun dem Mann zu unterwerfen. Entsprechend wurde durch diesen »symbolischen Tausch« zwischen Eingeborenen und Kolonisatoren das herrschaftliche Verhältnis geregelt: Beide waren jetzt freundschaftlich verbunden, die Indianer hatten sich jedoch unterzuordnen. Die* Erstpublikation in: Historische Anthropologie 9 (2001) H. 2, S. 290–298. 1 Susanna Burghartz, Der «grosse Wilde» und die »Unvergleichliche« – Figuren kolonialer Annäherung. John Smiths Geschichtsschreibung zu den Anfängen Virginias, in: Historische Anthropologie 8 (2000), 163–188. 2 Vgl. Sabine Schülting, Wilde Frauen, fremde Welten. Kolonisierungsgeschichten aus Amerika, Reinbek 1997, z. B. 184 f.
Familienpolitik als Friedensstrategie
|
225
ses kulturelle Missverständnis musste zu einem Zusammenstoss führen. Schon 1614 hatte Powhatan das Ersuchen des Gouverneurs von Virginia, Sir Thomas Dale, abgelehnt, eine seiner Töchter zu heiraten, vermutlich weil er über das Verhalten der Engländer enttäuscht war. 1622, nach Powhatans Tod, kam es zu einem Massaker an den Kolonisten. Der Anführer der Indianer, Powhatans jüngerer Bruder Opechancanough, war bereits früher für eine härtere Haltung gegenüber den Engländern eingetreten und mehrfach mit John Smith aneinandergeraten. 1644 leitete er einen weiteren blutigen Krieg, der zwei Jahre später mit seiner Ermordung endete. Die Rachefeldzüge der Engländer vernichteten die Stämme des Reiches fast vollständig.3 Pocahontas wurde dennoch aufgrund ihrer »Unvergleichlichkeit«, ihres Ausnahmeranges, zu einem entscheidenden Bestandteil des US-amerikanischen Mythos. Als einzige Indianerin – und sogar als einzige Frau in einer zentralen Rolle – erhielt sie auf einem Gemälde John Gadsby Chapmans von 1840, das ihre Taufe und damit ihre »Zivilisierung« darstellte, einen Platz in der Rotunde des Capitols.4 II.
Die wechselseitigen Auffassungen über Herrschaftsbeziehungen, die Rolle von Taufe und Verheiratung der Häuptlingstochter und insbesondere die koloniale Strategie der Engänder tritt uns in den Texten John Smiths klar entgegen. Die 3 Vgl. James Axtell, After Columbus. Essays in the Ethnohistory of Colonial North America, New York and Oxford 1988, 182–221; Peter Lampe, Pocahontas. Die Indianer-Prinzessin am Englischen Hof, München 1995; Alvin M. Josephy, 500 Nations. Die illustrierte Geschichte der Indianer Nordamerikas, 2. Aufl. München 1997, 194–206; Daniela Gülicher, Integration – Assimilation – Rebellion: Indianer und Engländer in Virginia bis zum »Jamestown-Massaker« (1622), in: Europäisch-indianischer Kulturkontakt in Nordamerika. Hrsg. von Jürgen Bellers und Horst Gründer, Münster 1999, 27–51. Wie sehr an die Stelle des Austausches zwischen Gleichwertigen, den die Indianer immer noch einforderten, Feindschaft und Vernichtungswillen seitens der Kolonisten getreten war, zeigt Michael J. Puglisi am Beispiel der Kriege in Virginia und Massachusetts in den 1670er Jahren: »Wether They Be Friends or Foes:« The Roles and Reactions of Tributary Native Groups Caught in Colonial Conflicts, in: International Social Science Review 70 (1995), 76–86. 4 Klaus Theweleit, Pocahontas in Wonderland. Shakespeare on Tour. Indian Song, Frankfurt/M. und Basel 1999, 184–188, vgl. 46, 672: Bereits 1825 wurde Smiths Rettung durch Pocahontas von Antonio Capellano in einem Sandsteinrelief über der Westtür der Rotunde verewigt; eine weitere Darstellung – von Constantino Brumidi, 1877 beendet – enthält das sog. Rotunda-Fries mit Szenen aus der Eroberung Amerikas (187). Theweleits Buch ist insgesamt für die vielfältigen Mythen heranzuziehen. Dazu gehört auch, dass Präsident Woodrow Wilson 1917 eine Nachfahrin von Pocahontas und John Rolfe, Edith Bolling, heiratete (490–510).
226
|
Von Pocahontas zu Pylmau
Denkweisen und Strategien der Indianer sind weniger eindeutig zu entschlüsseln – sie haben uns keine Selbstzeugnisse hinterlassen. Vielleicht können wir uns ihnen aber indirekt ein wenig nähern. Dabei helfen möglicherweise die Beschreibungen Smiths über seine unmittelbaren Kontakte mit den Powhatans. Susanna Burghartz geht darauf nicht näher ein, weil für sie die »Bilder« des Eroberers Smith (181 A. 64) und der koloniale Diskurs im Vordergrund stehen. Die berühmte Schüsselszene, in der Smith 1608, von den Powhatans gefangengenommen, nach anfänglich guter Behandlung erschlagen werden sollte und Pocahontas ihn rettete, indem sie seinen Kopf in ihre Arme nahm und ihren Kopf auf seinen legte, hat zu zahllosen Diskussionen und Spekulationen Anlass gegeben. In der Tat macht es uns Smith hier nicht einfach. Die wundersame Rettung taucht in seinen ersten Schriften nicht auf, sondern erst in seiner »Generall History of Virginia« von 1624, also nach der Heirat Pocahontas’ und auch nach dem Massaker von 1622. Insofern liegt die Vermutung nahe, dass er jetzt mit der Konstruktion des Mythos begann und Pocahontas als Symbol für ein mögliches harmonisches Zusammenleben zwischen Engländern und Eingeborenen stilisierte, wenn diese sich denn »zivilisieren« liessen und unterordneten. Pocahontas beschrieb er in einer weiteren Szene nach seiner Rettung als eine bedrohlich-sexualisierte Wilde, die ihn zusammen mit ihren Gefährtinnen nach einem ekstatisch-leidenschaftlichen Tanz während des Ernte-Festes zu verführen suchte – vergeblich natürlich.5 Indem sie sich taufen liess und heiratete, gab sie das Bedrohliche auf und wurde zum Sinnbild eines Brückenschlages zwischen Fremdem und Eigenem. Nicht auszuschliessen ist, dass sich Smith’s Erzählung doch zugetragen hat. Vielleicht war ihm zunächst die Rettung durch eine junge «Wilde» peinlich, vielleicht befürchtete er aufgrund der dadurch erfolgten Integration in den Stamm einen Ausschluss aus der englischen Gesellschaft. 1624 hatte seine Geschichte einen anderen Stellenwert erhalten, so dass er sie nun ohne weiteres mitteilen konnte. Ändern wir einmal die Blickrichtung und versuchen, aus der Sichtweise der Indianer nach dem sozialen Sinn des Vorgangs, nach seiner Bedeutung für die Beziehungen innerhalb der Gruppe wie nach aussen zu fragen. Danach könnte es sich um »eine rituelle Scheinexekution [gehandelt haben], [um den] symbolischen Tod eines Stammesfremden. Dem rituellen Tod des Fremdlings folgten seine Adoption und Initiation in die Stammesgemeinschaft«.6 Der Stamm spielte Smiths Tod, damit das neue Mitglied symbolisch seine Vergangenheit hinter sich 5 Vgl. Burghartz, 182; Lampe, 74 ff. Das Bild von Pocahontas als der sexualisierten, verführerischen Wilden erscheint auch im Bericht William Stracheys von 1612, dazu Burghartz, 179 A. 53. Angesichts der verhältnismässig reichhaltigen Quellengrundlage würde es sich lohnen, die Empfindungen Pocahontas’ im kulturellen Kontext zu rekonstruieren. 6 Lampe, 53. Ähnlich Christian F. Feest, Der Siedler und die Prinzessin, in: Kulturen der nordamerikanischen Indianer. Hrsg. von Christian F. Feest, Köln 2000, 116–117.
Familienpolitik als Friedensstrategie
|
227
lassen konnte. Der spätere »verführerische« Tanz hätte dann möglicherweise die Funktion gehabt, Smith im Rahmen des Fruchtbarkeitsfestes in den Stamm zu integrieren, indem er sich mit einer Frau verbinden konnte. Selbst wenn die Rettungsszene nachträglich erfunden worden wäre, könnte dieser Ansatz weiterführen. In seinem ersten Bericht von 1608 stellte Smith seine Begegnung mit Häuptling Powhatan anlässlich seiner Gefangenschaft so dar, dass dieser ihm die Grösse seines Herrschaftsgebietes erläutert und er im Gegenzug den Umfang des britischen Königreiches dargelegt habe. Powhatan sei davon derart beeindruckt gewesen, dass er ihm angeboten habe, fortan in seinem Stamm zu leben und sich in ihn zu integrieren.7 Auch dieser Vorschlag beinhaltete eine Adoption.8 Dass diese im Verständnis des Stammes tatsächlich stattgefunden hatte, legt Pocahontas’ Verhalten in England 1617 nahe: Empört suchte sie Smith auf, um ihn an seine Pflicht als »Vater« zu erinnern. Er habe sie nicht sofort nach ihrer Ankunft besucht und sich auch sonst nicht genug um sie gekümmert. Ebenso verlangte der von Powhatan mit nach England gesandte Schamane des Stammes, Smith solle seine verwandtschaftlichen Pflichten wahrnehmen. Diesem war überhaupt nicht bewusst, was von ihm in familiärer Hinsicht erwartet wurde.9 Nehmen wir die Adoption Smiths ernst und betrachten wir vor diesem Hintergrund Pocahontas’ Verheiratung, ergeben sich einige weiterführende Überlegungen zur indianischen Perspektive. III.
Bei verschiedenen Indianerstämmen ist durch ethnologische Forschungen festgestellt worden, dass Kriegsgefangene von anderen Stämmen nach einem bestimmten Ritual – oft durch die Entscheidung von Frauen – entweder hingerichtet oder adoptiert wurden: Tod oder Adoption galt als Kompensation für die gefallenen Stammesmitglieder und für den Schmerz der Frauen. Lautete die Entscheidung auf Adoption, ersetzten die neuen Stammesmitglieder die toten in all ihren Rechten und Pflichten. Jegliche Feindschaft endete damit.10 Berühmt ist die Geschichte 7 8 9 10
Burghartz, 171–172 A. 33. Vgl. Josephy, 199; Gülicher, 34, 40–41 (mit anderer Interpretation). Vgl. Burghartz, 185–186; Lampe, 149–151. Z. B. Kulturen der nordamerikanischen Indianer, 138–139 (Sylvia S. Kasprycki: Völker im Nordosten) 213 (Liane Gugel: Völker der Prärie und Plains); David Hurst Thomas u. a., Die Welt der Indianer. Geschichte, Kunst, Kultur von den Anfängen bis zur Gegenwart, 4. Aufl. München 1998, 161 (Irokesen); Hermann Lehmann, Nine Years among the Indians, Reprint Albuquerque/New Mexico 1993 (Apachen). Zur Adoption gefangener «weisser» Frauen: Evelyne Keitel, Als Geisel bei den Indianern, in: Basler Zeitung, Magazin Nr. 14/8.4.1995, 6–7. Im amerikanischen «Zivilisierungsdiskurs» wurde dies zeitweise
228
|
Von Pocahontas zu Pylmau
von Mary Jemison, die um die Mitte des 18. Jahrhunderts als Mädchen zu den Seneca – einem Stamm des Irokesen-Bundes – verschleppt wurde, zunächst als Rache für den Tod eines Indianers sterben sollte, dann jedoch als «Ersatz» in den Stamm aufgenommen wurde. Nach einiger Zeit gelang ihr die Flucht, doch sie kehrte zu den Seneca zurück und heiratete einen späteren Häuptling.11 Adoptionen und Heiraten waren darüber hinaus Mittel, um durch Krankheiten oder Kriege dezimierte Stämme mit anderen zu verbinden und dadurch das Überleben zu sichern.12 Auch Smith hatte vor seiner Gefangennahme zwei Indianer erschossen. Seine Adoption könnte ein solches Ersatzritual gewesen sein. Jedenfalls erhielt er einen indianischen Namen, wurde später als Häuptling bezeichnet, und die Indianer kümmerten sich um ihn und seine Gefolgsleute in Jamestown, als seien sie Verwandte. Offensichtlich war es nicht einmal erforderlich, dass der Adoptierte ständig in der Stammesfamilie, in seinem Clan, lebte. Auch dazu gibt es zahlreiche Beispiele. Walter McClintock (1870–1949) etwa, ein amerikanischer Ethnologe, wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts von den Schwarzfuss-Indianern adoptiert. Es war kein Problem, dass er immer wieder in sein Institut und seine dortigen Lebensverhältnisse zurückkehrte – seine Indianerfamilie hielt mit ihm Kontakt, und deren Ältester fragte ihn bei wichtigen Angelegenheiten um Rat.13 Wenn wir davon ausgehen – und Smiths Werke bestätigen dies –, dass die Indianer ihre Kultur als zumindest gleichwertig gegenüber der europäischen ansahen, dann konnten sie nicht ohne weiteres bereit sein, sich dieser zu assimilieren. Entweder lehnten sie die Kultur der Kolonisatoren ab, bekämpften sie und versuchten, diese wieder zu vertreiben, oder sie strebten ein friedliches Nebeneinander an. Darüber hinaus finden wir aber auch Ansätze, die fremde Kultur in die eigene zu integrieren. So versuchten etwa die Huronen, als die Franzosen seit Ende des 16. Jahrhunderts von der Mündung des St. Lorenz-Stromes aus ein Handelsnetz aufbauten, eine Arbeitsteilung zu erreichen, indem sie selbst die dergestalt interpretiert, dass die Indianer keine «kultivierten» familiären Gefühle entwickelten. Vgl. Roy Harvey Pearce, Rot und Weiß. Die Erfindung des Indianers durch die Zivilisation, Stuttgart 1991, 143. Die Entführung »weisser« Frauen trug ebenso wie die Geschichte Pocahontas’ zur kulturellen Konstruktion des «Indianers» bei: Hans-Peter Rodenberg, Der imaginierte Indianer. Zur Dynamik von Kulturkonflikt und Vergesellschaftung des Fremden, Frankfurt a. M. 1994, 17–27. 11 James E. Seaver, A Narrative Of The Life Of Mary Jemison, 1824; eine neuere romanhafte Darstellung: Rainer Maria Schröder, Mein Feuer brennt im Land der Fallenden Wasser, Würzburg 1998. Vgl. Thomas u. a., 250, 253. 12 Thomas u. a., 137 (Mississippi-Kulturen), 178–179 (Irokesen). Vgl. zu Krieg, Marter und Heiraten bei den Irokesen vor der hier behandelten Zeit Brian M. Fagan, Das frühe Nordamerika. Archäologie eines Kontinents, München 1993, 423–424. 13 Walter McClintock, The Old North Trail or Life, Legends and Religion of the Blackfeet Indians, Lincoln/Nebraska and London 1992 [zuerst 1910], hier bes. Kap. 2 und 5.
Familienpolitik als Friedensstrategie
|
229
Pelztiere jagten und verarbeiteten, während die Franzosen die Felle dann in den Handel brachten.14 Samuel de Champlain (1567–1635), einer der wichtigsten Organisatoren auf französischer Seite, knüpfte daran an und bemühte sich um eine kulturelle Annäherung, indem er französische Jugendliche in indianische Familien schickte, damit sie dort die Sprache und die Bräuche erlernten. Dies schien zunächst erfolgversprechend zu sein. Der umgekehrte Weg erwies sich allerdings als Fehlschlag: Indianische Jugendliche, die nach Frankreich gebracht wurden, waren dem dortigen Leben nicht gewachsen und starben meist rasch. Champlain verhielt sich auch religiös tolerant, obwohl zur gleichen Zeit die dortigen Indianer Objekte der »Heidenmission« waren, die einer auf Unterordnung zielenden »Zivilisierungsstrategie« folgte. Einige Missionare strebten immerhin an, den Indianern die Bewahrung ihrer Kultur zu ermöglichen.15 Aus den Verbindungen von Pelzhändlern und Trappern mit Indianerinnen, an sich gedacht zur Festigung der Freundschaft wie guter geschäftlicher Beziehungen, gingen die Métis hervor, die versuchten, beide Welten miteinander zu vereinen. Doch das Vordringen der Trapper-Unternehmer, die der Arbeitsteilung mit den Indianern ein Ende machten, erschwerte zunehmend die Formen des kulturellen und ökonomischen Tausches. Die ausgedehnten Ansiedlungen der Europäer, die die Indianer verdrängten, liessen das Experiment vollends misslingen. Trotzdem spielten die Métis noch lange Zeit eine wichtige Rolle und versuchten, sich eine gewisse Selbständigkeit zu bewahren.16 Weitere bekannt gewordene Ehen zwi-
14 Thomas u. a., 156–165. 15 Thomas u. a., 165–179. Vgl. Urs Bitterli, Die ›Wilden‹ und die ›Zivilisierten‹. Grundzüge einer Geistes- und Kulturgeschichte der europäisch-überseeischen Begegnung, 2. Aufl. München 1991, 106–130, hier bes. 109–125; Sven Kuttner, Handel, Religion und Herrschaft. Kulturkontakt und Ureinwohnerpolitik in Neufrankreich im frühen 17. Jahrhundert, Frankfurt/M. etc. 1998; auch Axtell, 47–121. Spätere Beispiele für die Problematik: Herrnhuter Indianermission in der Amerikanischen Revolution. Die Tagebücher von David Zeisberger 1772 bis 1781. Hrsg. von Hermann Wellenreuther und Carola Wessel, Berlin 1995; Robert Craig, Christianity and Empire: A Case Study of American Protestant Colonialism and Native Americans, in: American Indian Culture and Research Journal 21 (1997), 1–41. 16 Kulturen der nordamerikanischen Indianer, 16 (Christian F. Feest);Thomas u. a., 165, vgl. 253–258. 1869/70 und 1885 kam es sogar zu zwei Aufständen unter Führung Louis Riels (1844–1885) gegen die Einbeziehung der Gebiete der Hudson’s Bay Company in das Dominion Canada. 1982 wurden die Métis in der kanadischen Verfassung als indigene Nation anerkannt. – Einen späteren Versuch einer «Mischkultur» auf dem Gebiet der Muskogee (Creek), der vorübergehend sogar von der US-amerikanischen Regierung gefördert wurde, dann aber in den Aufstand unter Führung Tecumsehs 1812 mündete, behandelt Theweleit, 412–450.
230
|
Von Pocahontas zu Pylmau
schen KolonistInnen und IndianerInnen wären in lebensweltlicher Orientierung auf die mit ihnen verbundenen Denkweisen zu untersuchen.17 Adoption und Heirat sind in vielen Gesellschaften verbreitete Strategien, etwa um ein Geschlecht zu erhalten, es zu stärken, sein Territorium auszudehnen oder eben um Frieden zu stiften. Sie lassen sich auch bei den Powhatans in den Zusammenhang der Kulturbegegnung einordnen. Beides eröffnete ihnen die Möglichkeit, eine in ihren Augen sichere, nämlich familiäre Grundlage für ein dauerhaft friedliches Zusammenleben mit der Kolonie der Europäer, für einen Tausch der jeweiligen Waren und zukünftig vielleicht sogar für eine Vereinigung beider Gruppen zu schaffen.18 Die englische »Zivilisierungsstrategie« richtete sich auf die vollständige Übernahme der eigenen Kultur seitens der Indianer und auf deren Unterordnung. Die familiäre Integrationsstrategie der Indianer ging hingegen grundsätzlich von einer tatsächlichen Gleichwertigkeit aus. Gewiss sollten die adoptierten Kolonisten an der indianischen Kultur teilhaben und sich ihr nicht widersetzen. Aber sie konnten, wenn sie wollten, in ihrer europäisch geprägten kulturellen Umgebung bleiben, und die Indianer zögerten nicht – wie wir aus vielen Beispielen wissen –, für sie neue Sitten, Gerichte oder Haustiere zu übernehmen.19 Eine Verschmelzung beider Kulturen erschien langfristig durchaus möglich. Allerdings: angesichts der Wirtschaftsweise der Europäer und ihrer durch die Religion noch verstärkten Überlegenheitsgefühle war die indianische Strategie zum Scheitern verurteilt. Sie wurde von jenen im Rahmen ihrer eigenen Vorstellungen interpretiert und nur so 17 So ging etwa aus der Ehe zwischen einem niederländischen Pelzhändler und einer SenecaFrau der Irokesen-Häuptling Cornplanter (ca. 1746–1836) hervor, der 1784/89 mit George Washington einen Friedensvertrag schloss (Indianer-Lexikon. Zur Geschichte und Gegenwart der Ureinwohner Nordamerikas. Hrsg. von Ulrich van der Heyden, Wiesbaden 1996, 68–69; Thomas u. a., 288). Vgl. Carol Cooper, Native Women of the Northern Pacific Coast: An Historical Perspective, 1830–1900, in: Revue d’études canadiennes / Journal of Canadian Studies 27 (1992/93), 44–75, hier 53–56. – Die Herausforderung, die von derartigen sexuellen Beziehungen oder Ehen ausging, spiegelt sich auch in zahlreichen literarischen Verarbeitungen: Evelyne Keitel, Fremdheitserfahrung und Erotik, in: Basler Zeitung, Magazin Nr. 38/30.9.1995, 6–7 (in James Fenimore Coopers »Der letzte Mohikaner«, 1826 veröffentlicht, wird z. B. deutlich, dass zu dieser Zeit eine interkulturellte Heirat unerwünscht ist: die Beziehungen zwischen Cora, Uncas und Magua enden in einem Blutbad). S. auch Eve Kornfeld, Encountering «the Other»: American Intellectuals and Indians in the 1790s, in: The William and Mary Quarterly 52 (1995), 287–314. 18 Ob Häuptling Powhatan sich davon auch erhoffte, den Irokesen und anderen Stämmen überlegen zu werden oder die Prophezeiung von Schamanen zu unterlaufen, es werde ein Volk kommen, das sein Reich auflösen werde, kann hier offen bleiben (vgl. Lampe, 22, 44). 19 Das ist gerade wieder aus den Kulturkontakten der Huronen und ihrer Verbündeten überliefert: Thomas u. a., 173. Auch die Europäer griffen ihnen nützlich erscheinende Errungenschaften der Indianer auf, aber in der Regel mit einer anderen Einstellung.
Familienpolitik als Friedensstrategie
|
231
lange geduldet, wie sie ihren Interessen nicht zuwiderlief. John Smiths Verhalten liefert uns dafür ein bezeichnendes Beispiel.20 IV.
Zur Vertiefung dieser Erwägungen könnte es sinnvoll sein, vergleichend nach entsprechenden Strategien bei den sibirischen Völkern zu fragen, die in vieler Hinsicht strukturell ähnliche Verhältnisse wie die Indianer aufweisen.21 Eine erste Durchsicht bringt jedoch ein enttäuschendes Ergebnis: Die zugänglichen Quellen lassen keine derartigen Strategien erkennen. In den zahlreichen Reiseberichten von Kolonisatoren in Sibirien ist von Adoption oder Heirat keine Rede.22 Das heisst natürlich noch nicht, dass es Derartiges nicht gab. Die Tabuisierung war – zumindest anfangs – vermutlich stärker als in Nordamerika. Während dort eine Indianerin durch die Taufe »zivilisiert« wurde und interkulturelle Ehen keineswegs selten waren, versuchte der zarische Staat lange Zeit, eine Taufe der einheimischen Bevölkerung, selbst wenn sie dazu bereit gewesen wäre, zu verhindern. Dabei spielten offenbar Vorstellungen der russisch-orthodoxen Kirche über die »Unreinheit« der »Heiden« eine Rolle, aber auch der Wunsch des Staates, die Abgabepflichtigkeit der unterworfenen Eingeborenen zu erhalten, die nach einer Taufe nicht mehr gegeben gewesen wäre. Aus russischer Sicht kann man aus diesem Grund nicht von einer Heiratsstrategie sprechen, denn sie hätte die Taufe der »Heiden« vorausgesetzt. Im 18. Jahrhundert hob die Regierung jenen Zusammenhang auf, und infolgedessen kam es vermehrt zu Zwangstaufen. Kriegsgefangene wurden als Sklaven oder Sklavinnen gehalten, auch wenn das offiziell verboten war. Ebenso sind zahlreiche Beispiele von Frauenraub und Konkubina20 Ähnlich hat Inga Clendinnen herausgearbeitet, dass auch hinter dem Verhalten der Azteken eine eigene Logik stand, deren Signale für Cortés unverständlich waren, so dass es zum Zusammenstoss und zur Vernichtung des Reiches kam: »Fierce and Unnatural Cruelty«. Cortès and the Conquest of Mexico, in: New World Encounters. Hrsg. von Stephen Greenblatt, Berkeley/Cal. 1993, 12–47. Zu einigen Interpretationsmodellen des «kulturellen Missverständnisses» Jürgen Osterhammel, Wissen als Macht: Deutungen interkulturellen Nichtverstehens bei Tzvetan Todorov und Edward Said, in: »Barbaren« und »Weiße Teufel«. Kulturkonflikte und Imperialismus in Asien vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. Hrsg. von Eva-Maria Auch und Stig Förster, Paderborn etc. 1997, 145–169. 21 Die Vergleichbarkeit betont auch Frances Svensson, Comparative Ethnic Policy on the American and Russian Frontiers, in: Journal of International Affairs 36 (1982), 83–103. 22 Dies hat mir Dittmar Dahlmann (Bonn) bestätigt, der sich intensiv mit diesen Reiseberichten auseinandergesetzt hat. Vgl. Dittmar Dahlmann, Von Kalmücken, Tataren und Itelmenen: Forschungsreisen in Sibirien im 18. Jahrhundert, in: »Barbaren« und »Weiße Teufel«, 19–44; Johann Georg Gmelin, Expedition ins unbekannte Sibirien. Hrsg. von Dittmar Dahlmann, Sigmaringen 1999.
232
|
Von Pocahontas zu Pylmau
ten überliefert.23 1630 und 1637 hatte die zarische Regierung zunächst versucht, den »Frauenmangel« durch die Rekrutierung von Frauen aus dem europäischen Russland auszugleichen. Dies erwies sich als unzureichend, so dass die Soldaten und Siedler zur »Selbsthilfe« griffen. Ähnlich verhielten sich die russischen Kolonisatoren dann in deren nordamerikanischen Niederlassungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Aufgrund des hier noch stärker spürbaren »Frauenmangels« gab es etwa in Alaska eine grössere Zahl interkultureller Ehen oder Konkubinaten als in Sibirien. Offenbar integrierten sich die Russen zunächst in die Clans der Alëuten und übernahmen deren Lebensweise. Dies hielt aber nicht lange an, Abhängigkeitsverhältnisse und Versklavung wurden wieder zur Regel.24 Anscheinend gingen insgesamt die russischen Trapper-Unternehmer, die promyšlenniki, von Anfang an stärker mit brutalen Massnahmen vor als die nordamerikanischen, um die Pelzabgaben der Eingeborenen zu erzwingen.25 Neben dem Pelzhandel war der Handel mit Frauen – einheimischen wie aus dem europä
Weitere neue Editionen, die sich teilweise überschneiden: Forschungsreise nach Kamtschatka. Reisen und Erlebnisse des Johann Karl Ehrenfried Kegel von 1841 bis 1847. Hrsg. von Werner Friedrich Gülden, Köln/Weimar/Wien 1992; Die Große Nordische Expedition von 1733 bis 1743. Aus Berichten der Forschungsreisenden Johann Georg Gmelin und Georg Wilhelm Steller, München 1990; Georg Wilhelm Steller, Von Sibirien nach Amerika. Die Entdeckung Alaskas mit Kapitän Bering 1741–1742. Hrsg. von Volker Matthies, Stuttgart und Wien 1986. 23 Hier verdanke ich Gabriele Scheidegger (Zürich) wichtige Hinweise. Einen guten Eindruck vermitteln die von ihr übersetzten und eingeleiteten Quellen in: Dokumente zur Geschichte der europäischen Expansion. Hrsg. von Eberhard Schmitt. Bd. 2: Die großen Entdeckungen, München 1984, 497–521, Bd. 4: Wirtschaft und Handel der Kolonialreiche. Hrsg. von P. C. Emmer u. a., München 1988, 346–355, dabei 349–351 zur Gewalt gegenüber Frauen, 353 zur Taufe; vgl. Gabriele Scheidegger, Die »Indianer« des Wilden Ostens. Opfer der Geschichte und Opfer der Geschichtsschreibung, in: Tages-Anzeiger, Magazin Nr. 13/2.4.1983, 29–44; Andreas Kappeler, Russland als Vielvölkerreich. Entstehung – Geschichte – Zerfall, München 1992, 36–42. Zur Gewalt gegenüber Frauen auch: Die Große Nordische Expedition, 222–225. Zu den Missionierungsstrategien s. Svensson, 88–89. 24 James Forsyth, A History of the Peoples of Siberia. Russia’s North Asian Colony 1581– 1990, Cambridge etc. 1992, 67–69, 218; James R. Gibson, Russian Expansion in Siberia and America: Critical Contrasts, in: Russia’s American Colony. Ed. by S. Frederick Starr, Durham 1987, 32–40, 371–374, hier 38; ders., Russian Dependence upon the Natives of Alaska, ebd., 77–104, 381–388, hier bes. 102–103, 387–388 Anm. 156; R. G. Liapunova, Relations with the Natives of Russian America, ebd., 105–143, 388–391, hier 120–121,125. 25 Vgl. etwa Bruce W. Lincoln, Die Eroberung Sibiriens, München 1996, 106 ff. Ähnlich: Cornelius H. W. Remie, Changing Contexts, Persistent Relations. Inuit-White Encounters in Northern Canada, 1576–1992, in: European Review of Native American Studies 7 (1993), 5–11, hier 6, 7.
Familienpolitik als Friedensstrategie
|
233
ischen Russland deportierten oder verwitweten – »das einträglichste Gewerbe unter den Russen Sibiriens«.26 Den daraus herrührenden Verbindungen lagen, selbst wenn einige stabile Beziehungen nicht ausgeschlossen werden können, gewiss keine Vorstellungen einer irgendwie gearteten »Zivilisierung«, Gleichwertigkeit oder gar kulturellen Integration zugrunde.27 Auch der Vergleich mit den nordamerikanischen Métis trifft höchstens teilweise zu.28 Es entstand keine neue, eigenständige Bevölkerungsgruppe, die versucht hätte, die verschiedenen Kulturen zu vereinen. Zu gemischten Gemeinschaften kam es hin und wieder im 19. und 20. Jahrhundert, wenn zuwandernde russische Bauern von den Einheimischen die Techniken des Überlebens lernen mussten.29 Inwieweit dabei die Einheimischen Vorstellungen von zielgerichtet organisierten Adoptionen und Heiraten mit Kolonisten entwickelten, wissen wir nicht. Heiraten zwischen Angehörigen verschiedener Stämme waren durchaus üblich. Überliefert sind vor allem ökonomische Gründe. Weitergehende Strategien – wie bei den Indianern – treten nicht hervor. Hier bedarf es noch genauerer Untersuchungen.30 Ein Ansatzpunkt könnte die bei verschiedenen Völkern anzutreffende »Gruppen-Ehe« mehrerer Clan-Mitglieder sein. Sie sollte als ergänzende Gemeinschaft den Zusammenhalt des Clans verstärken. Manchmal wurde sie sogar durch Nicht-Familienangehörige erweitert.31 Weiterhin finden sich immer wieder Hinweise, ein Gast erhalte in der Regel das Angebot, mit einer der Frauen eine sexuelle Beziehung einzugehen. Wenn Forschungsreisende Gerüchte verbreiteten, die Einheimischen »gäben ihre Weiber und Mädchen den Reisenden zum Beischlaf«32, 26 Lincoln, 109. Vgl. Forsyth, A History, 67–69. 27 Zur russischen »Zivilisierungsstrategie« vgl. hier nur Willard Sunderland, The ›Colonization Question‹: Visions of Colonization in Late Imperial Russia, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 48 (2000), 210–232. 28 Vgl. James Forsyth, The Siberian native peoples before and after the Russian conquest, in: The History of Siberia. From Russian conquest to Revolution. Ed. by Alan Wood, London/New York 1991, 69–91, hier 82. 29 Svensson, 88. Seine Einschätzung, die russische Politik habe sich auf die einheimischen Stämme insgesamt günstiger ausgewirkt als die amerikanische (z. B. 101–102), halte ich von den Quellen her für nicht begründet. Es lässt sich lediglich sagen, dass die zarische wie die sowjetische Regierung zeitweise nicht auf eine gewaltsame Uniformierung der Nationalitäten setzte, sondern pragmatisch ein Nebeneinander mit gewisser Autonomie zugestand (vgl. Kappeler, 140–141, 168–174, 217 u. ö.). 30 Zu den sexuellen und Heiratsgewohnheiten sibirischer Völker vgl. M. A. Czaplicka, Aboriginal Siberia. A Study in Social Anthropology, Oxford 1914, 70–128; Forsyth, A History, 50–51 (Tungusen/Evenken), 73–75 (Eskimos/Jupigit, Čukčen, Korak/Korjaken, Itelmenen, Jugakiren). 31 Czaplicka, 78–79, 86, 96; Forsyth, The Siberian native people, 76. 32 Forschungsreise nach Kamtschatka, 318 (vgl. Theweleit, 632–636 in Bezug auf Stracheys Beschreibung der sexuellen Zügellosigkeit indianischer Frauen gegenüber Fremden).
234
|
Von Pocahontas zu Pylmau
könnte dies noch als Wunschprojektion gedeutet werden. Andere schilderten, für die Itenmen/Itelmenen-Frauen sei es eine Ehre, von den Kosaken geliebt zu werden, obwohl diese sich gewalttätig gegenüber dem Stamm verhielten33, und sie verrieten ihren Liebhabern bevorstehende Überfälle ihres Stammes.34 Auch später werden mehrfach ähnliche Vorgänge beschrieben. Möglicherweise wurde diese Form der Gastfreundschaft eingeführt, um Zwangsmassnahmen und Gewalt seitens der Kolonisatoren zu entgehen, und sie festigte sich mit der Zeit zu einem Brauch. Auszuschliessen sind ältere Sitten allerdings nicht, die darauf abzielten, auf diese Weise die wechselseitige Verbundenheit zu stärken.35 Im späteren Fortgang des Kolonisationsprozesses in Sibirien scheinen Heiraten zwischen KolonistInnen und Einheimischen häufiger geworden zu sein. Nach zeitgenössischen Berichten gingen etwa die Čukčen derartige Ehen ein, um die andere Kultur zu integrieren, während die Russen eher an ihr Überleben dachten.36 So wie John Smiths mit fiktionalen Elementen angereicherte Erinnerungen uns Hinweise auf die Sichtweise der Indianer geben konnten, vermag uns auch eine literarische Verarbeitung den Weg zu weisen, die Perspektive der sibirischen Völker zu rekonstruieren. Jene kann als Quelle dienen, wenn der situative Kontext, der Bezug zu den Lebenswelten im Vergleich mit anderen Quellen und mit Forschungen sichtbar zu machen, wenn soziale und kulturelle Praktiken zu entschlüsseln sind.37 Juri Rytchëu, der 1930 als Sohn eines Jägers auf der Čukčenhalbinsel geboren wurde, greift in seinen Werken das Thema der Kulturbegegnung immer wieder auf und nimmt dabei häufig tatsächliche Vorgänge zum Ausgangspunkt. Als Beispiel mag hier Pylmau in seinem Roman »Traum im Polarnebel« stehen. Diese Čukčen-Frau heiratet zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen Kanadier, der in ihrer Siedlung eine Verletzung auskurieren musste, also dort geblieben war, um zunächst einmal zu überleben. Der Schamane des Clans rechtfertigt diese Beziehung gegenüber Kritikern nicht zuletzt damit, dass jener den Čukčen nicht nur in vielen Dingen nützlich sein, sondern gerade in der Begegnung mit einer
33 Die Große Nordische Expedition, 229, vgl. 222–225. 34 Steller, 229, 236 (hier könnte ein Vergleich zu Pocahontas’ Warnung der Siedler hergestellt werden, vgl. Burghartz, 177), s. auch 238–239, 241. 35 Czaplicka, 79, 86, 90–91, 106–107; Forsyth, A History, 73. 36 Czaplicka, 74–75. Sie stützt sich dabei vor allem auf die Feldforschungen des bedeutenden russischen Ethnologen Vladimir G. Bogoraz Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die er teilweise als politischer Exilant unternommen hatte. 37 Vgl. zum Umgang mit fiktionalen Texten als historischen Quellen Monica Rüthers, Tewjes Töchter. Lebensentwürfe ostjüdischer Frauen im 19. Jahrhundert, Köln etc. 1996, 30–37. Sprachpragmatische Verfahren sind dabei sehr hilfreich: Martin Schaffner, Fragemethodik und Antwortspiel. Die Enquête von Lord Devon in Skibbereen, 10. September 1844, in: Historische Anthropologie 6 (1998), 55–75, hier bes. 62, 64–65, 70–71.
Familienpolitik als Friedensstrategie
|
235
neuen Welt als kultureller Vermittler dienen werde.38 Vielleicht müssen wir die Quellen neu lesen und auch nach indirekten Zeugnissen suchen. Dann könnte es sein, dass wir auch hier eine Strategie genauer bestimmen können, sich mit dem »Fremden« auseinanderzusetzen und es in das »Eigene« einzugliedern.
38 Juri Rytchëu, Traum im Polarnebel, Zürich 1991, 96–97, 139, 175–177; vgl. z. B. ders., Unter dem Sternbild der Trauer, Zürich 1992; ders., Die Reise der Anna Odinzowa, Zürich 2000, 255–256. S. auch Forsyth, A History, 401–402.
Fußball, Veit Harlan und die Volkspolizei 1953 Ein Fall von Hooliganismus im Elztal?* Am 28. Juni 1953, einem Sonntag, weihte der Fußballverein Buchholz seinen neuen Sportplatz ein. Aus Anlass dieses freudigen Ereignisses fand ein Pokalturnier statt. Die 1. Mannschaft der Sportfreunde Oberwinden, die daran teilnahm, errang den zweiten Platz und erhielt dafür auch einen Pokal. So hatte man doppelten Grund zum Feiern. Abends war ein gemütliches, kameradschaftliches Beisammensein im Gasthaus Rebstock vorgesehen. Alle saßen in froher Runde, besprachen noch einmal die einzelnen Spiele, genossen die gute Stimmung und nicht zuletzt den ausgezeichneten Buchholzer Wein. Im Nebenzimmer konnte getanzt werden. So wurde es im Laufe des Abends immer heiterer. Besonders einem der Oberwindener Spieler, dem 24-jährigen Erwin Maier (Name geändert), stieg der Wein in den Kopf. Seine Kameraden versuchten ihn etwas zu bremsen, denn einige der Gasthausbesucher, die nicht zu den Sportlern gehörten, fühlten sich offensichtlich gestört. Allmählich, inzwischen war es 22 Uhr geworden, dachte man dann an die Heimfahrt. Maier erklärte, mit seinem Motorrad fahren zu wollen. Sein Spielführer wollte ihm das ausreden, denn er sah, dass man ihn bei seinem Zustand nicht mehr in den Straßenverkehr lassen durfte. Als Maier ihn zum Tanz aufforderte, ging er darauf ein, zog ihn anschließend beiseite und versprach ihm, einen Wagen zu besorgen, in dem nicht nur die Oberwindener Fußballer, so weit sie so lange geblieben waren, Platz fänden, sondern auch Maiers Motorrad. Maier war zufrieden und begab sich in die Runde zurück.1 Plötzlich, gegen 22.30 Uhr, war es mit der guten Stimmung vorbei. Während der Spielführer gemeinsam mit einem Kameraden noch versuchte, telefonisch in Oberwinden jemanden zu erreichen, der sie in Buchholz abholen könne, standen auf einmal zwei Polizisten des Gendarmerie-Postens Waldkirch in der Gaststube, zwei weitere des Gendarmerie-Postens Denzlingens blieben im Eingangsbereich stehen. Beide Trupps befanden sich auf Nachtstreife und wollten nachsehen, ob bei der Tanzveranstaltung alles mit rechten Dingen zugehe. Als sie sich dem »Rebstock« genähert hatten, waren sie von Gästen, die nach Hause gehen wollten, darauf aufmerksam gemacht worden, dass sich drinnen ein Betrunkener aufhalte, der die Gäste belästige und trotz seines Zustandes mit * Erstpublikation in: »s Eige zeige«. Jahrbuch des Landkreises Emmendingen für Kultur und Geschichte 16 (2002) 111–116. Die Geschichte spielt im Elztal, einer Gegend nordöstlich von Freiburg i. Br. 1 Alle Angaben stammen, soweit nicht anders vermerkt, aus der Akte: Kreisarchiv Emmendingen, Gemeinde Oberwinden 22/3/17.
Ein Fall von Hooliganismus im Elztal?
|
237
dem Motorrad fahren wolle. Die beiden Waldkircher Polizisten stießen auch sofort auf Maier, der den Ieitenden Beamten gleich entsprechend begrüßte: »Du Depp, auf dich habe ich gerade noch gewartet!« Es kam zu einem Handgemenge. Maier ließ sich nicht freiwillig hinausführen, schlug um sich und verletzte zwei der Polizisten. Zwar gelang es, ihn auf die Straße hinauszudrängen, doch er leistete weiter heftig Widerstand. Um diesen zu brechen, nahm einer der Beamten den Gummiknüppel zu Hilfe. »Brüllend wie ein Scheusal« – so beschrieb es der ranghöchste Polizist in seinem Bericht – warf sich Maier auf die Straße und schrie, er sei niedergeschlagen worden. Die Polizisten verzichteten darauf, ihn in den Ortsarrest abzuführen, sondern wollten ihn mit einem Krankenwagen abtransportieren und ausnüchtern lassen. Vorerst brachten sie ihn in der Waschküche des Lokals unter. Dort ging aber die Auseinandersetzung weiter, in deren Verlauf sich einer der Gendarmen des tobenden Oberwindeners nicht anders zu erwehren wusste, als ihn so zurückzustoßen, dass dieser über die in der Waschküche abgestellten Fahrräder fiel. Die vier Polizisten hatten es nicht nur mit einem Betrunkenen zu tun, der sich kräftig wehrte, sondern auch mit wütenden Sympathisanten. Schon in der Gaststube hatten sich mehrere von Maiers Kameraden bemüht, ihn frei zu bekommen, und die Beamten in die Defensive gedrängt. Draußen – vor allem, nachdem Maier mit dem Gummiknüppel geschlagen worden war – wuchs die drohende Menge auf 30 bis 50 Personen an. Angesichts der turbulenten Vorgänge, die sie zwangen, sich zu verteidigen, war es den Polizisten nicht möglich, eine präzise Zahl anzugeben. »Nur dem unerschrockenen und überlegenen Benehmen meiner Kameraden ist es zu verdanken, dass nicht von der Schusswaffe Gebrauch gemacht wurde«, hieß es im Bericht. Der Zuruf, sie würden alle »wegen Auflaufs« angezeigt werden, hielt die Aufgebrachten zurück. Diese verschafften ihrer Erregung dadurch Luft, indem sie die Beamten wüst beschimpften: Das seien Nazi-Methoden, es gehe zu wie bei Veit Harlan, sie führten sich auf wie Volkspolizisten, und man müsse es ihnen geben wie denen in Berlin. Mit dem Auftauchen des Krankenwagens beruhigte sich die Menge. Allerdings schickte sie dem Wagen ein lautes »Pfui!« hinterher, und der Gendarm, der sicherheitshalber vor dem Gasthaus zurückblieb, musste sich anhören, wie er immer wieder als Volkspolizist betitelt wurde. Maier wurde nach Waldkirch gebracht. Offenbar kam ihm jetzt seine Lage zum Bewusstsein, und er bat die Polizisten dringend, ihn nicht in Gewahrsam zu behalten. Er müsse zu seiner Frau nach Hause und morgen an seiner Arbeitsstelle sein, sonst bekomme er Probleme. Die Beamten hatten ein Einsehen, und da sie meinten, er sei wieder nüchtern genug, ließen sie ihn um 0.30 Uhr gehen. Er machte sich zu Fuß auf den Heimweg. Kurz vor Kollnau lasen ihn seine Oberwindener Kameraden auf, die inzwischen einen Lastwagen aufgetrieben hatten und am Waldkircher Rathaus von seiner Freilassung erfahren hatten.
238
|
Fußball, Veit Harlan und die Volkspolizei
Gegen Erwin Maier »und andere« erging dann seitens des leitenden Gendarmen am 29. Juni 1953 Strafanzeige wegen »Körperverletzung, Widerstand, Beamtenbeleidigung, groben Unfugs«. Bei den Vernehmungen waren die Beteiligten bestrebt, die Vorkommnisse zu verharmlosen. Maier, der offenbar in schwierigen Verhältnissen lebte, schob alles auf den Weingenuss, er könne sich an nichts mehr erinnern. Die Übrigen schilderten den Tathergang weitgehend übereinstimmend, stritten aber jegliche Bedrohung der Polizisten ab. Nur einer gab zu, die Polizisten als »Volkspolizisten und Ostberliner« bezeichnet zu haben. Von Nazis und Veit-Harlan-Methoden habe er hingegen nicht gesprochen. Alle anderen wollten die umstrittenen Beschimpfungen bestenfalls gehört haben. Der Freiburger Staatsanwalt beantragte am 19. Januar 1954 für Maier wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt, körperlicher Misshandlung und Beleidigung eine Geldstrafe in Höhe von 150,– DM sowie für zwei Buchholzer, die die Beamten als »Volkspolizisten« beschimpft hätten, wegen Beleidigung eine Geldstrafe je 50,– DM.2 Handelt es sich hier um einen mehr oder weniger harmlosen Fall von Hooliganismus, wie er im Zusammenhang mit Fußballspielen immer wieder vorkommt und seitdem längst auffälligere Formen angenommen hat? Der Begriff »Hooligan« wurde erstmals in Irland gebraucht und breitete sich seit Ende des 19. Jahrhunderts in viele Länder aus. Allgemein verstand man Rowdies und Randalierer darunter, oft in Verbindung mit Trunkenheit und mit fließenden Grenzen zur Kriminalität. Da die Hooligans häufig in Gruppen auftraten, regten sich rasch Bedrohungsgefühle. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Wahrnehmung von Hooligans weniger eine Zunahme von Normabweichungen oder gar Gewalttätigkeiten anzeigte als eine gesteigerte Sensibilität für solche Handlungsformen in Zeiten gesellschaftlicher Krisen und Unsicherheiten.3 Manchmal empfand man das Auftreten der Hooligans gar als Ausdruck oppositionellen Verhaltens gegen die Obrigkeit. Im Gegenzug diskriminierten etwa die Behörden im zaristischen Rußland vor dem Ersten Weltkrieg Hooligans als sozial und kulturell verkommene Gruppen, um sie auf diese Weise zu isolieren und etwaige Sympathisanten, ja die Jugend insgesamt zu disziplinieren. Und in der Sowjetunion wurde seit den zwanziger Jahren der Hooligan zum Feind der Gesellschaft stilisiert. Dadurch sollten Einstellungen, die von den gewünschten Idealen abwichen, verhindert oder zumindest unter Kontrolle gebracht werden.4 2 Über das Ergebnis und den Gerichtsbeschluss gibt die Akte leider keine Auskunft. 3 Geoffrey Pearson: Hooligan. A History of Respectable Fears. London 1983; Stephen Humphries: Hooligans or Rebels? An Oral History of Working Class Childhood and Youth, 1889–1939. Oxford 1981. 4 Mehrere Beiträge in: Sowjetjugend 1917–1941. Generation zwischen Revolution und Resignation. Hg. von Corinna Kuhr-Korolev, Stefan Plaggenborg und Monica Wellmann. Essen 2001.
Ein Fall von Hooliganismus im Elztal?
|
239
In dieses Spektrum passt unser Fall aus dem Elztal. Im Zustand der Trunkenheit wird randaliert, und das Rowdytum steigert sich, bis die Polizei eintrifft. Ihr Erscheinen führt keineswegs zur Beruhigung, sondern stößt auf den Widerstand einer größeren Gruppe, die mit ihren Worten das rüpelhafte Benehmen auf eine politische Ebene zieht. Eben diese Schimpfworte fordern die Polizeibeamten heraus, sie sehen hierin eine Missachtung der Staatsgewalt, anstatt locker darüber hinwegzusehen und die Rufe aus einer angeheiterten Gesellschaft nicht weiter ernst zu nehmen. Die drohende Haltung der Menge trägt das ihre dazu bei. In der Tat sind die als beleidigend verstandenen Vorhaltungen auffällig. Wenige Tage vor diesem Zwischenfall, am 17. Juni 1953, hatte der Aufstand in der DDR, »die erste Volkserhebung im Stalinismus«,5 die Menschen auch in der noch jungen Bundesrepublik Deutschland tief erregt. Sie sahen Aufnahmen der riesigen Demonstrationszüge, die die Ketten der Volkspolizei durchbrachen, ihre Wachhäuser in Brand steckten. Für einen Augenblick hatte es den Anschein, als werde der Sowjetblock nach Stalins Tod am 5. März 1953 auseinanderbrechen, als könne es eine deutsche Wiedervereinigung geben. Daneben gab es allerdings auch Zeichen der Angst: Könnte der Funke aus der DDR nicht zusammen mit dem noch anhaltenden Korea-Krieg einen neuen Weltenbrand entfachen? In allen Medien wurden die dramatischen Ereignisse immer wieder in Szene gesetzt. Politiker jeder Richtung heizten die Leidenschaften an und suchten die Stimmung für ihre Ziele zu nutzen, zumal die Bundestagswahl im Herbst vor der Tür stand. Umso stärker mussten die Bilder von der Niederschlagung des Aufstandes wirken: von den hilflosen Menschen vor sowjetischen Panzern und Maschinengewehren, von Demonstranten, die nicht nur von Soldaten, sondern eben auch von Volkspolizisten niedergeknüppelt wurden.6 Dass sich die Wirtshausgäste in Buchholz, als einer der Gendarmen mit dem Gummiknüppel auf Erwin Maier einschlug, an die Reportagen im Radio sowie an die Bilder in Wochenschauen und Zeitungen von DDR-Volkspolizisten erinnerten und ihnen deshalb dieses Schimpfwort auf der Zunge lag, ist somit nicht verwunderlich. Aber was hat Veit Harlan damit zu tun? Harlan (1899–1964) war seit den dreißiger Jahren als Filmregisseur hervorgetreten. Namentlich hatte er mit Streifen wie »Jud Süß« (1940) oder »Kolberg« (1944/45) die antisemitische Propaganda des Nationalsozialismus und die erwünschte Bereitschaft zum Durchhalteopfer im Krieg aktiv unterstützt. Nach 1945 konnte er uneingeschränkt weiter 5 Manfred Hagen: DDR – Juni ’53. Die erste Volkserhebung im Stalinismus. Stuttgart 1992. Ich nenne aus der umfangreichen Literatur nur noch: Der Tag X. 17. Juni 1953. Die »innere Staatsgründung« der DDR als Ergebnis der Krise 1952/54. Hg. von Ilko-Sascha Kowalczuk, Armin Mitter und Stefan Wolle. Berlin 1995. 6 Vgl. zu den unmittelbaren Reaktionen Edgar Wolfrum: Geschichtspolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Der Weg zur bundesrepublikanischen Erinnerung 1948–1990. Darmstadt 1999, S. 65–107.
240
|
Fußball, Veit Harlan und die Volkspolizei
tätig sein, nachdem ihn ein Gericht freigesprochen hatte. Im Januar 1952 kam es in Freiburg zur Aufführung des Farbfilms »Hanna Amon«, mit der populären Schauspielerin Kristina Söderbaum, Harlans Frau, in der Titelrolle. Innerhalb von sechs Tagen sahen sich 18.000 Besucher diesen Kassenschlager an. Doch es gab auch Gegenstimmen. Nach der Ankündigung des Films waren sofort Proteste laut geworden, von der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, von studentischen und gewerkschaftlichen Organisationen. Die Polizei war gegen Flugblattverteiler hart vorgegangen, hatte aber nichts gegen Passanten unternommen, die jene als »Judenlümmel« bezeichneten. Das Rektorat der Universität und viele Professoren solidarisierten sich mit den Studierenden. Die Situation spitzte sich zu. Am 16. Januar 1952 fand in der Universität eine Protestversammlung statt. Redner prangerten nicht nur die nationalsozialistische Vergangenheit Harlans an und verlangten ein Berufsverbot für ihn, sondern wiesen auch auf Sympathien in der Bevölkerung für antisemitische und rechtsradikale Tendenzen hin, die von der Aufführung des Stückes begünstigt würden, sahen Anzeichen für eine Restauration konservativ-autoritärer Strukturen in Westdeutschland. Anschließend zogen 250 bis 300 Studierende vor den Friedrichsbau in der Kaiser-Joseph-Straße, wo der Film gezeigt wurde – möglicherweise war dies die erste Studentendemonstration in der Bundesrepublik. Plötzlich entstanden an einigen Stellen Krawalle, die anscheinend von mitmarschierenden nichtstudentischen Zivilisten provoziert worden waren. Schnell eilten bereitstehende Polizisten herbei, auch die Zivilisten zogen Gummiknüppel aus ihren Taschen – später stellte sich heraus, dass es Kriminalbeamte waren – und hieben auf die Demonstranten ein. Mehrere Studentinnen und Studenten wurden zusammengeschlagen und, auf dem Boden liegend, schwer misshandelt. Es gab zahlreiche Verletzte. Der badische Staatspräsident, Leo Wohleb, verbot weitere Aufführungen des Films. Die Ereignisse fanden ein weites Echo. Nicht nur die Repräsentanten von Universität und Stadt stellten sich hinter die Studierenden und verurteilten das Verhalten der Polizei; der Freiburger Polizeidirektor musste seinen Abschied nehmen. Aus der ganzen Bundesrepublik, von den bekanntesten Politikern, trafen Solidaritätsadressen ein. Allerdings regten sich durchaus auch Befürworter der Filmaufführung, teilweise wieder mit rechtsradikalen Aussagen. Und natürlich gingen die Bilder und Berichte von der Demonstration durch alle Zeitungen und Illustrierten. Nach Untersuchungen und Prozessen wurde das Aufführungsverbot aufgehoben. Am 16. Juni 1952 gab es dazu erneut eine Protestveranstaltung und einen Schweigemarsch. Doch die Stimmung war inzwischen umgeschlagen. Die Politiker wollten keine Störung des bevorstehenden Wiedergutmachungsvertrages zwischen Israel und der Bundesrepublik, und waren deshalb nicht an weiterem öffentlichen Aufsehen interessiert. In der Be-
Ein Fall von Hooliganismus im Elztal?
|
241
völkerung schienen die Argumente der Film-Gegner ohnehin keinen Widerhall mehr zu finden.7 Offenbar hatten die Bilder und Berichte aber doch stärker gewirkt, als es die abwiegelnden Reden mancher Politiker wahrhaben wollten. Ein deutlicher Beleg ist der Vorfall in Buchholz. Noch über ein Jahr nach den Tumulten in Freiburg waren zumindest einigen der Gasthausbesucher die prügelnden Polizisten im Kopf. Provoziert durch das Verhalten der Waldkircher und Denzlinger Gendarmen verbanden sich diese Vorstellungen mit den soeben gesehenen aufwühlenden Bildern aus Ostberlin und in einer weiteren Assoziationskette mit den Nazis – vermutlich vermittelt durch die Erinnerung an Veit Harlans nationalsozialistische Propagandafilme, vielleicht aber auch durch die damals, im Vokabular des Kalten Krieges, massiv verbreitete Gleichsetzung von »Rot und Braun«, von kommunistischer und nationalsozialistischer Diktatur. Zugleich wirkte ein durch den Sturm auf die ostdeutschen Volkspolizisten erzeugtes Gefühl, man könne es »denen« einmal geben. Wahrscheinlich hätten die Fußballfreunde zu einer anderen Zeit nicht in jener Weise reagiert. Das überlieferte Verhalten eines der Oberwindener Spieler deutet dies an: Nach dem Schlag mit dem Gummiknüppel klopfte er dem Gendarmen auf die Schulter und sagte: »Höre mal, Kamerad, so geht das nicht.« Diese Strategie dürfte sich darauf gerichtet haben, das Problem unter sich, möglichst auf gütliche Art zu lösen, so wie es in der Dorfgemeinschaft üblich ist, wo sich alle kennen – auch die Polizisten waren natürlich zumindest den Buchholzern namentlich bekannt. Doch die emotional aufgeladene Stimmung war stärker. In dieser besonderen historischen Situation, in der die Menschen durch die politischen Geschehnisse des Aufstandes in der DDR und die stürmischen Konflikte um die künftige Stellung der Bundesrepublik bewegt und erschüttert waren, brachte die Erfahrung eines zuschlagenden Polizisten einen Mechanismus von Bildfolgen in Gang, der sich auf die Wahrnehmung von den Gendarmen übertrug sowie in deren Beleidigung und Bedrohung verdichtete. An dem Verhalten der Elztäler »Hooligans« am 28. Juni 1953 lässt sich exemplarisch nachzeichnen, wie sich Erinnerungsbilder in politisches Handeln umsetzen können
7 Hermann Schäfer: Studentendemonstration 1952. In: Freiburg im Breisgau – Universität und Stadt 1457–1982. Hg. von Hugo Ott und Hans Schadek (= Stadt und Geschichte. Neue Reihe des Stadtarchivs Freiburg i. Br. H. 3). Freiburg i. Br. 1982; Thomas Groß, Holger Wegemann: Der »Fall Harlan«. Die Geschichte eines politischen Skandals in der jungen BRD. In: »Eigentlich habe ich nichts gesehen ...« Beiträge zu Geschichte und Alltag in Südbaden im 19. und 20. Jahrhundert. Hg. von Heiko Haumann und Thomas Schnabel (= Alltag & Provinz 1). Freiburg i. Br. 1987, S. 173–200; Frank Noack: Veit Harlan. Des Teufels Regisseur. München 2000.
Ein Besuch beim Genossen Kirow Die Geschichte der Familie Dmitrewski – eine Fallstudie von den Anfängen der Slawistik in Freiburg i. Br. bis zum stalinistischen Terror und zur Aufarbeitung der Erinnerung* Zum Sommersemester 1910 schrieb sich ein junger russischer Student, Michael v. Dmitrewski (Michail Simeonowitsch Dmitrewski), an der Universität Freiburg i. Br. ein.1 Er stammte aus einer alten russischen Adelsfamilie, seine Vorfahren hatten hohe Ämter am Zarenhof oder in der Staatsverwaltung ausgeübt. Wasili Dmitrewski war Gouverneur von Stawropol während der blutigen Kaukasuskriege gewesen. Sein Sohn, Michail Wasiljewitsch Dmitrewski, wurde als Freund des Dichters Michail Ju. Lermontow (1814–1841) bekannt. Er lernte ihn 1837 in Tiflis kennen, wo er in der Zivilkanzlei des Oberkommandierenden für den Kaukasus diente. 1841 traf er ihn in Pjatigorsk wieder und gehörte dort zum engsten Kreis um den Dichter, trug ihm auch eigene Gedichte vor, die dieser sehr geschätzt haben soll. Im selben Jahr begleitete er ihn zu seinem für ihn tödlichen Duell. Darüber hinaus war er mit einem Kreis verbannter Teilnehmer des Dekabristen-Aufstandes von 1825 – namentlich mit Alexander A. Bestuschew (1797–1837) – eng befreundet.2 Der Vater des neuen Freiburger Studenten, Si* Erstpublikation in: Zeitschrift des Breisgau-Geschichtsvereins »Schau-ins-Land« 120 (2001, erschienen 2002) 121–144. 1 Diese Arbeit ist nur möglich geworden durch ein ausführliches Gespräch, das ich am 11. Oktober 1994 mit Simeon Michailowitsch Dmitrewski – dem Sohn des hier erwähnten Studenten – und seiner Gattin Nadja in Kirchhofen unter Vermittlung des Ehepaares Weisbrod führen konnte. Dafür bin ich außerordentlich dankbar. Herrn und Frau Weisbrod danke ich weiterhin dafür, daß sie mir Unterlagen ihrer eigenen Nachforschungen zur Geschichte der Familie Dmitrewski sowie Bildmaterial zugänglich gemacht haben, Herrn Dr. Adolf Weisbrod (Freiburg) für Unterstützung bei der Drucklegung. Wichtige Hilfestellung haben dabei geleistet das Stadtarchiv Freiburg i. Br., das Universitätsarchiv Freiburg i. Br. sowie das Universitätsarchiv Heidelberg. Den dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gilt deshalb ebenfalls mein Dank. Wenn nicht anders zitiert wird, stammen die Angaben aus dem erwähnten Gespräch. Für die Hilfe bei der Übertragung der Gesprächsaufzeichnung in eine schriftliche Fassung danke ich Marianne Grossmann, für die Unterstützung bei einigen Recherchen Nina Klingler. – Die Schreibweise russischer Namen und Begriffe folgt aus Gründen der Lesbarkeit der vereinfachten Umschrift nach den Regeln des Duden. 2 Lermontowskaja Enziklopedija. Moskau 1981, S. 140. Dmitrewskis Gedichte wurden teilweise 1842 in der Zeitschrift »Syn otetschestwa« („Sohn des Vaterlandes«) veröffentlicht. Zur russischen Behördenstruktur im Kaukasus Erik Amburger: Geschichte der Behördenorganisation Russlands von Peter dem Grossen bis 1917. Leiden 1966, hier S. 418.
Die Geschichte der Familie Dmitrewski
|
243
meon Michailowitsch, hatte die diplomatische Laufbahn eingeschlagen und erhielt den Titel eines Kammerjunkers und Hofrates. So schien Michail eine glänzende Karriere sicher, als er am 26. April 1887 – nach russischem Kalender am 14. April – in St. Petersburg geboren wurde.3 Zunächst verlief auch alles planmäßig. Nach dem Besuch einer Schweizer Vorbereitungsschule wurde er 1899 in die allgemeinbildende Klasse der Kaiserlichen Schule für Rechtskunde in Petersburg aufgenommen, an der er 1906 die Reifeprüfung mit Auszeichnung bestand. Er begann ein Jurastudium an der Petersburger Universität. Nachdem er ein Jahr später die für die Fortsetzung dieses Studiums erforderlichen Prüfungen mit »summa cum laude« bestanden hatte, entschloß er sich, zusätzlich Geschichte und Nationalökonomie zu studieren. »Die politischen Universitätswirren«, wie er in seinem Lebenslauf schrieb, »haben aber die Ausführung meines Planes verhindert.« Wegen seiner Beteiligung an der revolutionären Studentenbewegung mußte er 1907 ins Gefängnis und wurde dann aus Rußland ausgewiesen.4 Im Wintersemester 1908/09 nahm Michail Dmitrewski in Heidelberg das Studium der Geschichte auf. Er wohnte dort in der Ladenburgerstr. 3 und gab bei seiner Anmeldung an, daß seine Mutter, Hofrätin Alexandra Dmitrewskaja geborene Kasatkin, noch in Rußland, in Zarskoje Selo – also immer noch in der Umgebung des Zaren –, lebe.5 Der Vater war bereits verstorben. Kurz darauf muß die Mutter, wohl aus gesundheitlichen Gründen, fortgezogen sein. Sie ging nach Locarno und traf dort ihren Sohn wieder. Dieser hatte sich inzwischen entschieden, sein Studium der Geschichte und Philosophie in Freiburg fortzusetzen. Seine Mutter folgte ihm nach hier. Am 17. Oktober 1910 wurden sie beide mit einer Wohnung in der Zasiusstraße 24, 2. Stock, in das Melderegister eingetragen. Und noch jemand kam ins Haus: Rosa Graf aus Schwarzach. Am 27. September 1884 als Tochter des Landwirts Ferdinand Graf und seiner Ehefrau Maria Anna geboren, hatte sie als Hausdame im Badenweiler Hotel »Bellevue« gearbeitet und 3 In manchen Quellen wird als Geburtsdatum 27. April 1887 angegeben, so auf der Freiburger Meldekarte oder im Lebenslauf, der in der Dissertation abgedruckt wurde. Möglicherweise handelte es sich um einen Umrechnungsfehler: Im 20. Jahrhundert, zwischen 1900 bis zur Kalenderumstellung am 1./14. Februar 1918, waren dem russischen Datum 13 Tage hinzuzurechnen, um vom Julianischen zum Gregorianischen Kalender zu gelangen, für das 19. Jahrhundert jedoch nur zwölf. 4 Angaben nach Michail Dmitrewskis Lebenslauf vom 24.11.1919 zu Händen des Akademischen Senats der Freiburger Universität, nach dem Curriculum vitae in seiner Dissertation sowie nach dem Gespräch von 1994. Zur damaligen Studentenbewegung in Rußland vgl. Silke Spieler: Autonomie oder Reglementierung. Die russische Universität am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Köln, Wien 1981; Samuel D. Kassow: Students, Professors, and the State in Tsarist Russia. Berkeley 1989. 5 Auskunft des Universitätsarchivs Heidelberg.
244
|
Ein Besuch beim Genossen Kirow
1 Michail und Rosa Dmitrewski mit ihren Kindern Simeon und Alexandra (Photo aus Familienbesitz)
Frau v. Dmitrewski kennengelernt, als diese dort zur Kur weilte. Sie stimmte zu, mit nach Freiburg zu gehen, um hier den Haushalt zu führen. Daß sie dabei Michail Dmitrewski kennenlernte, blieb nicht ohne Folgen: Die beiden verliebten sich ineinander.6 Bevor an weiteres zu denken war, mußte das Studium abgeschlossen werden. Am 31. Juli 1912 bestand Michail Dmitrewski vor der Philosophischen Fakultät der Freiburger Universität seine Doktorprüfung mit dem Prädikat »magna cum laude«. Die 1913 veröffentlichte Dissertation behandelte »Die christliche freiwillige Armut vom Ursprung der Kirche bis zum 12. Jahrhundert« – eine auch heute noch lesenswerte Arbeit.7 Referent war Professor Heinrich Finke (1855–1938), Historiker und später am Ende des Ersten Weltkrieges Rektor der Universität,8 als Korreferenten wurden der Jurist Richard Schmidt (1862–1944) und Heinrich Rickert (1863–1936) beigezogen. Der neukantianische Philosophieprofessor Rickert war nicht nur ein Anziehungspunkt reformbewegter Studenten, sondern gerade auch der Russen in Freiburg. Er hatte die Einrichtung einer Lesehalle für die russischen Studenten unterstützt – aus Furcht vor »revolutionären Umtrieben« wurde sie erst nach mehreren Anläufen genehmigt –, und beteiligte sich an 6 Meldekarten im Stadtarchiv Freiburg i. Br.; Auszug aus dem Standesamtsregister Schwarzach. Die Familie zog noch mehrfach um. Hans Brandeck: Der Schwarzwald und angrenzende Gebiete. Reise- und Wanderbuch. Leipzig 1925, S. 311, erwähnt in Badenweiler ein »Hotel Bellevue (israelitisch), 20 B.« [Betten]. 7 Michael v. Dmitrewski: Die christliche freiwillige Armut vom Ursprung der Kirche bis zum 12. Jahrhundert. Berlin, Leipzig 1913. Dort im Curriculum vitae die folgenden Angaben zu den Referenten. Das Doktordiplom wurde Simeon Dmitrewski vom Universitätsarchiv Freiburg zugänglich gemacht. 8 Vgl. Geschichte der Stadt Freiburg i. Br. Hg. von Heiko Haumann und Hans Schadek. Bd. 3: Von der badischen Herrschaft bis zur Gegenwart. Stuttgart 1992 (2. Aufl. 2001), S. 257, 263, 265, 269.
Die Geschichte der Familie Dmitrewski
|
245
der Gründung der legendären philosophischen Zeitschrift »Logos«. Sie erschien ab 1910, vereinigte bedeutende russische und deutsche Philosophen und diente als wichtiges Vermittlungsorgan zwischen der deutschen und russischen Kultur.9 Dmitrewski zählte zu jenem Kreis von Russen, die unter den Bedingungen des zaristischen Systems nicht das studieren konnten, was sie wollten, und die nach Deutschland kamen, weil sie von der hiesigen Kultur und dem Universitätsangebot angezogen wurden. Nach der Promotion wandte sich Michail Dmitrewski »selbständigen Arbeiten auf dem Gebiete der Kultur- und Religionsgeschichte« zu, wie er es in seinem späteren Lebenslauf formulierte. Offenbar hatte er eine weitere wissenschaftliche Laufbahn im Sinn. Nach seinen Angaben über die behandelten Themen führte er zunächst seine Dissertationsforschungen insofern fort, als er Abhandlungen über die Katharer und die Inquisition verfaßte. Seine Fragen nach der »Bedeutung der Familie in der Katharersekte«, nach dem »Volksaufstand gegen die Inquisition in der Languedoc (im 14. Jht.)« oder nach den »Frauen in der Languedoc in ihrem Kampf gegen die Inquisition« klingen höchst modern.10 Vergleichend beschäftigte sich Dmitrewski dann mit den russischen Waldensern und Anabaptisten, mit den Ideen der Brüder des Freien Geistes in Rußland, mit den russischen Pilgern und Mönchen des Mittelalters, mit dem Bettel und der Armenpflege in Altrußland sowie mit den »Spuren des abendländischen Einflusses im ältesten Kirchenstatut Russlands«. Die Erfahrungen seines Studiums sind spürbar, wenn er den »Geist des Kapitalismus« bei den russischen Altgläubigen untersuchte – eine Problemstellung, die heute noch diskutiert wird.11 Ebenfalls kulturwissenschaftlich von hohem Interesse sind die Studien zur Zauberei sowie zu »Trunksucht und Abstinenz« in Rußland. Dmitrewski hegte Ende 1919 »begründete Hoffnungen, dass
9 Vgl. ebd., S. 246, 250; Dittmar Dahlmann: Bildung, Wissenschaft und Revolution. Die russische Intelligencija im Deutschen Reich um die Jahrhundertwende. In: Intellektuelle im Deutschen Kaiserreich. Hg. von Gangolf Hübinger und Wolfgang J. Mommsen. Frankfurt a. M. 1993, S. 141–157, hier bes. S. 146, 148–155 (Dahlmann erwähnt Dmitrewski nicht). Auskünfte zu Lebensdaten und Fachrichtung von Richard Schmidt verdanke ich dem Universitätsarchiv und dem Stadtarchiv Freiburg. 10 Emmanuel LeRoy Ladurie: Montaillou. Ein Dorf vor dem Inquisitor 1294 bis 1324. Frankfurt a. M., Berlin, Wien 1980; vgl. ders.: Die Bauern des Languedoc. Stuttgart 1983; Malcolm Lambert: Geschichte der Katharer. Aufstieg und Fall der großen Ketzerbewegung. Darmstadt 2001. 11 Vgl. Manfred Hildermeier: Alter Glaube und neue Welt: Zur Sozialgeschichte des Raskol im 18. und 19. Jahrhundert. In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 38 (1990) S. 372–398, 504–525; ders.: Alter Glaube und Mobilität. Bemerkungen zur Verbreitung und sozialen Struktur des Raskol im frühindustriellen Rußland (1760–1860). In: ebd. 39 (1991) S. 321–338.
246
|
Ein Besuch beim Genossen Kirow
2 Die Großfamilie Graf in Schwarzach ca. 1915. Unten in der Mitte Landwirt Ferdinand Graf und seine Ehefrau Maria Anna, die Eltern der Rosa Dmitrewski (Photo aus Familienbesitz)
diese Arbeiten in absehbarer Zeit im Druck erscheinen werden«.12 Vermutlich kam es jedoch nicht dazu. Bereits der Ausbruch des Ersten Weltkrieges hatte Michail Dmitrewskis Forschungen beeinträchtigt. Als russischer Staatsbürger wurde er interniert und mußte sich dann jede Woche im Polizeirevier melden. Nach Kriegsende ging er für kurze Zeit nach Straßburg, kehrte jedoch schon bald nach Freiburg zurück. 1919 starb seine Mutter,13 und im selben Jahr, am 12. Juni, heiratete er Rosa Graf. Die Trauung fand in Schwarzach statt, als Zeugen fungierten zwei Verwandte der Braut. Die Religion spielte keine Rolle: Rosa Graf war katholisch, »Michael Dmitrewski« – auf den Adelstitel scheint er bei dieser Gelegenheit keinen Wert gelegt zu haben – »griechisch–katholisch«.14 Ganz Schwarzach soll geweint ha12 Lebenslauf vom 24.11.1919. 13 Die Meldekarte verzeichnet für den 13.11.1918 ihren Abgang in die Psychiatrische Klinik. 14 Auszug aus dem Standesamtsregister Schwarzach. Bei der Religionsangabe dürfte es sich um ein Mißverständnis gehandelt haben: Als griechisch-katholisch werden in der Regel die Angehörigen der mit Rom verbundenen Unierten Kirche mit katholischem Glaubensinhalt und griechischem Ritus bezeichnet. Eine Unierte Kirche gab es im Zarenreich in der Ukraine, allerdings illegal, da sie 1839 offiziell aufgehoben worden war; in der Folge kam es immer wieder zu Zwangskonversionen. Eine neue Unierte Kirche – die Russisch-Ka-
Die Geschichte der Familie Dmitrewski
|
247
ben, als das Paar das Dorf verließ. Es fand – nach einer kurzen Zwischenstation – eine Wohnung in der Burgunderstraße 22, 3. Stock. Hier wurde am 23. August 1921 »Simeon v. Dimitrewski« (sic!) geboren und wenige Tage später katholisch getauft. Am 25. September 1923 folgte die Tochter Alexandra.15 Inzwischen hatte sich die berufliche Situation der Familie grundlegend geändert. Am 28. November 1919 beantragte Michael v. Dmitrewski beim Akademischen Senat der Freiburger Universität, als Lektor der russischen Sprache und Literatur zugelassen zu werden. Seine Begründung war damals politisch sehr aktuell: »Die Ereignisse des letzten Jahres haben wohl zur Genüge erwiesen, dass Deutschland nur durch ein enges solidarisches Zusammenarbeiten mit Russland wirtschaftlich sich wieder emporarbeiten kann. Dieses Zusammenarbeiten kann aber nur dann erfolgreich sein, wenn es sich auf gründliche Kenntnis des Wirtschaftslebens wie der Geisteskultur des Landes stützt, und dieses setzt seinerseits einigermassen ausreichende Beherrschung der russischen Sprache voraus.«16 In der Tat gab es damals in Unternehmerkreisen, dann auch in der Reichsregierung Überlegungen, durch – zunächst – wirtschaftliche Kontakte mit Sowjetrußland die nachteiligen Folgen des Kriegsausgangs zu mildern. Es lag nahe, daß sich zwei Staaten, die beide international isoliert waren, annäherten, selbst wenn sich ihre politischen Systeme tiefgreifend unterschieden: Der Vertrag von Rapallo 1922 kündigte sich mit ersten Zeichen an.17 Der Antrag ging an die Philosophische Fakultät zur Stellungnahme. Dmitrewski sondierte bei verschiedenen Professoren und bat dann am 10. Januar 1920 den Dekan, den Philosophen Edmund Husserl (1859–1938), sein Anliegen weiterzutreiben. Jener tat dies am 2. Februar 1920 mit einer ausführlichen Empfehlung. Nicht nur »die Betrachtung des eigenartigen russischen Sprachlebens, auch die Erforschung des Schrifttums, der allgemeinen und der Kulturgeschichte, des Rechtslebens und der Religion« würden aus dem Lektorat Nutzen ziehen. Dazu komme der Gewinn für Leben und Beruf. Bereits jetzt gebe es an der neutholische – konnte nach einem vergeblichen Anlauf 1911 erst nach der Februarrevolution von 1917 gegründet werden (Andreas Kappeler: Kleine Geschichte der Ukraine. München 1994, S. 110; Ralph Tuchtenhagen: Religion als minderer Status. Die Reform der Gesetzgebung gegenüber religiösen Minderheiten in der verfaßten Gesellschaft des Russischen Reiches 1905–1917. Frankfurt a. M. 1995, S. 173–182). Es ist unwahrscheinlich, daß sich ein altes Adelsgeschlecht mit Nähe zum Zaren einer von diesem abgelehnten Konfession angeschlossen hatte. Oder war Michail Dmitrewski hier einen Kompromiß eingegangen? 15 Meldekarte im Stadtarchiv Freiburg i. Br.; Auszug aus dem Taufregister des Erzbischöflichen Pfarramtes St. Urban 1921, S. 226, Nr. 61. 16 Universitätsarchiv Freiburg i. Br., II 4 (Philosophische Fakultät, Akten des russischen Lektorats). 17 Vgl. Heiko Haumann: Beginn der Planwirtschaft. Elektrifizierung, Wirtschaftsplanung und gesellschaftliche Entwicklung Sowjetrußlands 1917–1921. Düsseldorf 1974, S. 135– 137; Horst Günther Linke: Deutsch-sowjetische Beziehungen bis Rapallo. Köln 1970.
248
|
Ein Besuch beim Genossen Kirow
gegründeten Handelshochschulabteilung der Universität »etwa 25 Reflektanten für russische Kurse«. »In dem weiträumigen, an Rohstoffen reichen Rußland, wo man trotz vorübergehenden Hasses den Deutschen von jeher achtete, erwarten viele unserer jungen Leute noch am ehesten ein Feld zu lohnender Betätigung ihrer Kräfte.« Dmitrewski sei nicht nur bestens ausgebildet, sondern auch »ein Kenner des deutschen Wesens und Landes und ein Freund Deutschlands«. Die Fakultät halte ihn deshalb »für höchst geeignet«, das Amt des Lektors zu versehen, und beantragte einen zweistündigen Lehrauftrag für ihn. Der Senat leitete das Gesuch um 19. März 1920 befürwortend an das zuständige Ministerium weiter. Schon am 30. März des Jahres erklärte dieses, es halte die Einrichtung des Lektorats »für erwünscht«, wollte aber – wie könnte es anders sein – bei der Dotierung der Stelle sparen. Statt einer Vollbeschäftigung als Lektor schlug es eine Honorierung analog eines Privatdozenten mit Lehrauftrag vor, mit 1000 bis 1500 Mark pro Semester etwa ein Drittel des regulären Lektorengehaltes. Da die Fakultät keine Bedenken gegen diese Regelung zu erkennen gab, stimmte Dmitrewski zu. Am 14. Mai 1920 erteilte ihm das Ministerium den Auftrag für einen dreistündigen Lehrauftrag gegen ein Semesterhonorar von 1500 Mark – zunächst nur für das Sommersemester. Da diese Kurse auf Antrag der Fakultät – und auch unterstützt von einer Eingabe von 12 Studenten – dann bis zum Sommersemester 1922 fortgesetzt wurden, kann man davon sprechen, daß mit diesem Lektorat die Slawistik an der Freiburger Universität begann.18 Allmählich reifte bei Michail Dmitrewski jedoch der Gedanke, wieder nach Rußland zurückzukehren, obwohl seine Familie mit der Sprache nicht vertraut war. Vermutlich spielten die Veränderungen im Sowjetstaat seit 1921 bei diesen Überlegungen eine Rolle. Nach dem Scheitern des Experimentes, in einem raschen Anlauf unmittelbar den Sozialismus und Kommunismus anzustreben und die gesellschaftlichen Utopien möglichst bald Wirklichkeit werden zu lassen, entfaltete sich die »Neue Ökonomische Politik«. Sie ging davon aus, daß ein Umweg nötig sei, um die Ziele zu erreichen, und legalisierte in weiten Bereichen privatwirtschaftliche, kapitalistische Elemente. Verbunden war dies mit einer politischen Straffung – andere Parteien neben der kommunistischen wurden ausgeschaltet, und innerhalb der KP herrschte nun das »Fraktionsverbot« –, aber auch mit einer gewissen Liberalisierung im täglichen Leben. Unter den russi18 Universitätsarchiv Freiburg i. Br., II 4, V 2/53 (Rektorats-Akten). Merkwürdigerweise geht Antonin MěŠtˇan bei seinem Bericht über Slawen in Freiburg auf diese Vorgänge nicht ein und erwähnt lediglich die Einrichtung des Slavischen Seminars 1962 (Friburgum slavicum. In: Zeitschrift des Breisgau-Geschichtsvereins »Schau-ins-Land« 102 [1983] S. 39–46). Im Slavischen Seminar selbst befinden sich keine Unterlagen zum Lektorat Dmitrewskis (freundliche Auskunft von Frau Prof. Dr. Elisabeth Cheauré). Keine Erwähnung findet es auch in: Wilhelm Zeil: Slawistik in Deutschland. Forschungen und Informationen über die Sprachen, Literaturen und Volkskulturen slawischer Völker bis 1945. Köln usw. 1994.
Die Geschichte der Familie Dmitrewski
|
249
schen Emigranten registrierte man diesen Wandel sehr aufmerksam. Schon 1921 erschien in Prag ein Sammelband mit dem Titel »Smena vech« – »Wechsel der Wegzeichen«. Er bezog sich auf die »Wegzeichen« von 1909, eine Schrift, in der die Autoren die revolutionär gesonnene Intelligenzija aufgefordert hatten, ihre Haltung zu ändern und im Staat, nicht gegen ihn, an Reformen zu arbeiten. Jetzt also sollte erneut die grundsätzliche Einstellung – diesmal der emigrierten Intelligenzija – überprüft werden: Es müsse darum gehen, die Oktoberrevolution zu akzeptieren, sich an die Seite des neuen Staates zu stellen und die spezifisch »russischen« Elemente zu unterstützen, damit das Land wirtschaftlich und politisch wieder zu einer Großmacht werde. Zahlreiche Emigranten kehrten nach Rußland zurück und stellten ihre Fähigkeiten der Sowjetregierung zur Verfügung. Von den Kommunisten wurden sie als »poputschiki« – »Weggefährten« – bezeichnet.19 Michail Dmitrewski kam bei seinen Plänen zugute, daß er mit der Freiburger Holzfirma Himmelsbach – dem damals bedeutendsten einschlägigen Großunternehmen Deutschlands – in Kontakt gekommen war. Diese stand mit sowjetischen Behörden in Verbindung. Unterstützt wurde sie dabei von Joseph Wirth (1879–1956), unter dessen Beteiligung als Reichskanzler 1922 der Vertrag von Rapallo mit Sowjetrußland geschlossen worden war, der den Weg zu verbesserten Wirtschaftsbeziehungen geebnet hatte. In diesem Rahmen erfolgte die Gründung der »Mologa AG«, die von 1923 bis 1927 eine Konzession besaß, in der Sowjetunion auf einem Gebiet von rund einer Million Hektar in der Nähe Petrograds Holz zu gewinnen. Himmelsbach gehörte dieser Unternehmensgruppe an.20 Die Firma stellte Michail Dmitrewski – so erinnert sich heute sein Sohn – 1924 ein 19 Heiko Haumann: Geschichte Rußlands. München, Zürich 1996, S. 525, 542; Bettina Dodenhoeft: »Laßt mich nach Rußland heim.« Russische Emigranten in Deutschland von 1918 bis 1945. Frankfurt a. M. usw. 1993; Hans-Erich Volkmann: Die Russische Emigration in Deutschland 1919–1929. Würzburg 1966. Die beiden zitierten russischen Werke: Smena vech. Sbornik statej. Prag 1921; Vechi. Wegzeichen. Zur Krise der russischen Intelligenz. Hg. von Karl Schlögel. Frankfurt a. M. 1990. 20 Vgl. Renate Liessem-Breinlinger: Himmelsbach, Georg; Himmelsbach, Hermann. In: Badische Biographien. NF Bd. IV. Hg. von Bernd Ottnad. Stuttgart 1996, S. 134–136, 136–138; Rainer und Renate Liessem: Die Mologa AG 1923–1927. Eine Holzkonzession in Rußland unter Beteiligung der Firma Himmelsbach, Freiburg. In: Zeitschrift des Breisgau-Geschichtsvereins »Schau-ins-Land« 93 (1975) S. 83–91; In jeder Stunde Demokratie. Dokumente zu Joseph Wirth. Hg. anläßlich des 110. Geburtstages am 6. September 1989 von der Stadt Freiburg i. Br. 2. Aufl. Freiburg 1989 (vervielfältigte Borschüre); Linke: Deutsch-sowjetische Beziehungen; Hartmut Pogge v. Strandmann: Großindustrie und Rapallopolitik. Deutsch-sowjetische Handelsbeziehungen in der Weimarer Republik. In: Historische Zeitschrift 222 (1976) S. 265–341. Zur Unterstützung Viktor Himmelsbachs (1888-?) für die deutschnationale »Organisation Escherich«1920/21 und zum Konkurs der Firma 1927 siehe auch: Geschichte der Stadt Freiburg, S. 282, 289. 1924 wurde die Firma Zielscheibe von Angriffen rechtsstehender Kreise, weil sie sich an Holzlieferungen
250
|
Ein Besuch beim Genossen Kirow
und entsandte ihn schließlich nach Leningrad. Am 27. Oktober 1925 meldete sich die Familie in Freiburg ab.21 Der Vater arbeitete zunächst in der Leningrader Filiale von Himmelsbach.22 Als die Firma sich ökonomisch nicht mehr halten konnte, wurde er arbeitslos, erhielt aber dann eine Beschäftigung, die wenigstens einen lockeren Bezug zu seiner Ausbildung hatte: Er wurde Bibliothekar in der Akademie der Wissenschaften und stieg bis in die dreißiger Jahre zum stellvertretenden Leiter der Abteilung für internationale Buchbestellungen auf. Simeon Dmitrewski – dessen Bericht wir jetzt folgen – besuchte bis zur 9. Klasse, also bis 1937, die Leningrader deutsche Schule, die früher als »Petersschule« – 1710 als Schule der lutherischen St. Petri–Kirche am Newski Prospekt gegründet – gut bekannt gewesen war.23 Alle Fächer wurden in Deutsch unterrichtet, Russisch war die erste Fremdsprache. Mit Simeon zusammen lernten die Kinder von politischen Emigranten aus Deutschland oder von Deutschen, die in Leningrad arbeiteten, aber auch von Russen, die in alter Bildungstradition ihrem Nachwuchs die deutsche Kultur vermitteln lassen wollten. Während er sich an seine Kindheit in Baden nur noch schwach erinnert – wie er das Ochsengespann seines Opas in Schwarzach führen durfte und Äpfel erntete oder wie seine Eltern zu Hause gemeinsam sangen –, sind ihm aus der Zeit der Neuen Ökonomischen Politik vor allem die vollen Geschäfte im Gedächtnis. Das änderte sich rasch gegen Ende der zwanziger Jahre. Mit dem radikalen Kurswechsel der Führungsgruppe um Stalin 1929 zugunsten einer beschleunigten Industrialisierung und durchgängigen Kollektivierung kam es zu einer dramatischen Verschlechterung der Lebensbedingungen.24 Die neuen Kollektivwirtschaften hatten das geerntete Getreide ohne Rücksicht darauf, daß Saatgutreserven und Lebensmittelvorräte für den Eigenverbrauch angelegt werden mußten, abzuliefern; dabei wurde oft gewaltsam nachgeholfen. Das konnte nicht gutgehen: 1932 erschütterte eine katastrophale Hungersnot das Land, die Millionen Menschen
21 22 23
24
für Frankreich im Rahmen der Reparationen beteiligte. Daraufhin kam es zu einem Boykott deutscher Behörden, der den Niedergang des Holzunternehmens einleitete. Meldekarte im Stadtarchiv Freiburg i. Br. St. Petersburg wurde nach Kriegsbeginn 1914 in Petrograd, nach Lenins Tod 1924 in Leningrad umbenannt. Nach der Auflösung der Sowjetunion erhielt die Stadt 1991 ihren ursprünglichen Namen zurück. Ralph Tuchtenhagen: Bildung als Auftrag und Aufgabe. Deutsche Schulen in St. Petersburg 1704–1934. In: Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte 3 (1994) S. 63– 87. Danach wurde die Schule von 1928 bis 1934 als Leningrader Schule Nr. 4 geführt und 1934 in Nr. 41 umgewandelt (S. 79). Nach 1950 war in der Kirche ein Schwimmbad eingerichtet, seit 1992 ist sie den Lutheranern als Gotteshaus zurückgegeben (S. 63). Haumann: Geschichte Rußlands, S. 549–559.
Die Geschichte der Familie Dmitrewski
|
251
3 Das Ochsengespann von Simeon Dmitrewskis Großvater Graf in Schwarzach (Photo aus Familienbesitz)
das Leben kostete.25 Der Schwerpunkt der Hungersnot lag in der Ukraine, im Schwarzerdegürtel, dem fruchtbarsten Gebiet des Landes.26 Simeon Dmitrewski erinnert sich noch daran, wie aus dem Raum nördlich des Schwarzen Meeres zahllose Flüchtlinge auch zu ihnen in die Großstadt zogen, um dort eine Überlebenschance zu suchen. Mitte der dreißiger Jahre wurden die Lebensbedingungen allmählich wieder normal, ja es waren im wirtschaftlichen Bereich sogar langsam Aufwärtstendenzen festzustellen. Die Eltern mußten zwar hart arbeiten, sagt Simeon Dmitrewski, »aber für alles, was wir – meine Schwester und ich – brauchten, war’s genug«. Das tägliche Leben verlief – im Rückblick – aus der Sicht des Jugendlichen problemlos. Die Dmitrewskis lebten in Leningrad auf der Wassili-Insel, umströmt von Großer und Kleiner Newa, gegenüber dem Stadtzentrum mit Winterpalais und Admiralität auf der einen Seite und der Peter-und-Pauls-Festung auf der anderen. Hier liegen auch die Gebäude der Akademie der Wissenschaften samt ihrer Bib25 Stephan Merl: Die Anfänge der Kollektivierung in der Sowjetunion. Der Übergang zur staatlichen Reglementierung der Produktions- und Marktbeziehungen im sowjetischen Dorf (1928–1930). Wiesbaden 1985; ders.: Bauern unter Stalin. Die Formierung des sowjetischen Kolchossystems 1930–1941. Berlin 1990. 26 Stephan Merl: War die Hungersnot von 1932–1933 eine Folge der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft oder wurde sie bewußt im Rahmen der Nationalitätenpolitik herbeigeführt? In: Ukraine: Gegenwart und Geschichte eines neuen Staates. Hg. von Guido Hausmann und Andreas Kappeler. Baden-Baden 1993, S. 145–166.
252
|
Ein Besuch beim Genossen Kirow
liothek, wo sich damals der Arbeitsplatz des Vaters befand. Die Familie wohnte »in der zweiten Linie« – so hießen die Straßen dort –, an der Ecke zum Bolschoi Prospekt, und hier hatte sich ein regelrechtes Quartiermilieu herausgebildet. Simeon gehörte einer Gruppe von Jugendlichen an, die zumeist aus demselben Haus stammten. Hinter dem Haus verlief eine Gasse, und auf der gegenüberliegenden Seite wohnten die »Erzfeinde«, »mit denen wir also immer Fehde hatten«. Und natürlich war Simeon in der Schule Mitglied der »Pioniere« geworden, der Jugendorganisation, die vom Kommunistischen Jugendverband, dem »Komsomol«, betreut wurde; diesem konnte man mit 14 Jahren beitreten. »Ich trug auch mit Stolz das rote Halstuch.« Im Sommer fuhr die Gruppe ins Pionierlager, im Winter gab es interessante Exkursionen, Besuche von Museen und Theatern. Daneben konnte man sich je nach Interessensgebiet an verschiedenen Zirkeln beteiligen. Simeon sammelte Briefmarken, zumal er sich leidenschaftlich gern über andere Länder informierte und Geographie sein Lieblingsfach war. Die Erinnerung an die »heroische Periode«27 der Sowjetgeschichte – die Zeit des Bürgerkrieges – fand durchaus bei den Jugendlichen Anklang. Sie begeisterte sich für den kämpferischen Einsatz der damaligen Generation und wollte ihn auch erleben:28 Simeon weiß noch, wie er mit seiner Klasse den 1933/34 gedrehten Film über Tschapajew und die heldenhaften Taten der Roten Armee im Kino sah.29 Sie hatten Schleudern dabei, und als die »Weißen«, die gegenrevolutionären Truppen, Tschapajew angriffen, schossen die Kinder damit auf die Leinwand, um beim Kampf gegen die Feinde zu helfen. Hier wurden die Wurzeln für einen Sowjetpatriotismus gelegt, der in den folgenden Jahren immer stärker seines revolutionären Inhalts entkleidet werden sollte.30 27 Leo N. Kritzman: Die heroische Periode der großen russischen Revolution. Frankfurt a. M. 1971 (Nachdruck der Ausgabe Wien, Berlin 1929). 28 Vgl. Sowjetjugend 1917–1941. Generation zwischen Revolution und Bürgerkrieg. Hg. von Corinna Kuhr-Korolev u. a. Essen 2001. 29 Nach dem Roman von Dmitri Furmanow. Regisseure waren Georgi und Sergei Wassiljew. Der tempo- und aktionsreiche Film errang eine ungeheure Popularität. Im Mittelpunkt steht zwar der legendäre Bürgerkriegskämpfer, doch daneben werden zahlreiche Personen plastisch gezeichnet. Vgl. Dieter Krusche unter Mitarbeit von Jürgen Labenski und Josef Nagel: Reclams Filmführer. 11. Aufl. Stuttgart 2000, S. 692. 30 Vgl. Erwin Oberländer: Sowjetpatriotismus und Geschichte. Eine Dokumentation. Köln 1967. Zu den inhaltlichen Veränderungen des Patriotismus sei nur auf die Filme »Alexander Newski« (1938) oder »Iwan der Schreckliche« (1944–1946) von Sergei Eisenstein (1898–1948) hingewiesen. Hier stehen die großen »Führer« im Vordergrund, um die Tradition deutlich zu machen, in der sich Stalin sah (daß es sich dennoch um bedeutende Filme handelt und Eisenstein durchaus nicht immer in das ideologisch gewünschte Bild paßte, steht auf einem anderen Blatt; namentlich der 2. Teil des »Iwan«, der auch dessen Grausamkeit und Terror zeigt, verfiel der Verdammung seitens der Partei und konnte erst seit 1958 öffentlich gezeigt werden). Vgl. Krusche/Labenski/Nagel: Filmlexikon, S. 33–34, 332–333.
Die Geschichte der Familie Dmitrewski
|
253
An den Feiertagen zur Erinnerung an die Oktoberrevolution, zum 1. Mai, zum Internationalen Frauentag – mit dem zugleich dem Beginn der Februarrevolution gedacht wurde – gab es besondere Veranstaltungen in der Schule, in denen Vertreter der Kommunistischen Partei oder des Jugendverbandes über den Anlaß berichteten. »Das haben sie uns alles erzählt, und wie wir jetzt gut feiern können. Das ist jetzt also unser gutes Recht, das haben wir erkämpft, jetzt arbeiten wir, daß wir besser leben können. Und wir waren alle mit Herz und Verstand dabei.« Zu Hause wurden allerdings auch noch die katholischen Feiertage begangen: Die Mutter blieb ihrem Glauben treu. Jeden Sonntag ging sie auch mit den Kindern in die katholische St. Katharinen-Kirche am Newski Prospekt. Diese war in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts errichtet worden. In ihr wurden der letzte polnische König, Stanislaw August Poniatowski (1732–1798), und der französische General Jean Victor Moreau (1763–1813) bestattet, der auf der Seite Rußlands gegen Napoleon gekämpft hatte. Die Kirche bestand bis Ende der dreißiger Jahre. Dann wurde sie geschlossen.31 Dies mußte die Mutter nicht mehr erleben: Sie war 1931 an einer Blutvergiftung gestorben. Die große Politik ging an den Kindern und Jugendlichen nicht spurlos vorüber. In Gesellschaftskunde wurde vom »faulenden Kapitalismus« und vom aufblühenden Sozialismus gesprochen. Von den Erfolgen des 1. Fünfjahresplanes – von denen wir heute wissen, daß sie in ökonomischer Hinsicht viel zu verlustreich waren, von der menschlichen Seite ganz zu schweigen –32 war viel die Rede. Die Schülerinnen und Schüler empfanden Stolz darüber, daß die Pläne übererfüllt wurden. In Betrieben konnten sie mit Arbeitern und Ingenieuren diskutieren; manche sprachen sogar ein wenig Deutsch. Im Musikunterricht spielten die Lehrer hin und wieder westliche Tänze vor, die dazu bestimmt seien, das Klassenbewußtsein der Arbeiter in den kapitalistischen Staaten einschlummern zu lassen. Als Gegengewicht mußten die Schüler deutsche revolutionäre Arbeiterlieder lernen und während der häufigen Demonstrationen singen. Simeon beherrscht heute noch die Texte. Ein besonderer Auftritt fand 1933 statt. Im Marien-Theater, dem späteren Kirow-Theater für Oper und Ballett, wurde Georgi M. Dimitrow (1882–1949) empfangen, der bulgarische Kommunist, der soeben in Deutschland in sensationeller Weise von der Anklage, die Brandstiftung des Reichstages mitorganisiert zu haben, freigesprochen und dessen Verteidigungsrede begeistert aufgenommen worden war; später sollte er dann Generalsekretär der Kommunistischen Inter31 Simeon Dmitrewski berichtete in dem Gespräch, in der Kirche sei ein Schwimmbad eingerichtet worden. Möglicherweise verwechselte er sie hier mit der Petri-Kirche. 32 Haumann: Geschichte Rußlands, S. 549–575; Manfred Hildermeier: Geschichte der Sowjetunion 1917–1991. Entstehung und Niedergang des ersten sozialistischen Staates. München 1998, S. 368–377.
254
|
Ein Besuch beim Genossen Kirow
nationale werden. Bei dieser Gelegenheit behandelten die Lehrer verstärkt die »Machtergreifung« der deutschen Faschisten im Unterricht. Zur Festsitzung im Theater durften diejenigen Pioniere, die gut gelernt hatten, in zwei Kolonnen »mit der Fahne vorne« einmarschieren und Dimitrow sowie den Mitgliedern des Sitzungspräsidiums Blumen überreichen. »Ich hatte nicht die Ehre, dem Genossen Dimitrow die Blumen zu überreichen, aber ich kam auch ins Präsidium und gab sie bei jemandem ab, bei wem, weiß ich nicht. Wir durften auch ein paar Minuten im Präsidium sitzen, sahen uns den großen Saal an, und ich war stolz, daß ich ausgelesen wurde aus vielen. Ja, ich war stolz!« – ein Gefühl, das uns für diese Zeit immer wieder begegnet.33 Um zur deutschen Schule zu gelangen, überquerten Simeon und seine Schwester die Newa und gingen an einer Kirche und an einer Kaserne vorbei. Die Kirche war alt und sollte abgerissen werden. Die Gläubigen nahmen dies nicht einfach hin, sondern protestierten. Simeon erlebte eine solche Protestaktion mit, zu der auch »Genosse Kirow« erschien. Sergei M. Kirow (1886–1934) war einer der großen Hoffnungsträger der Kommunistischen Partei. Seit 1926 leitete er die Leningrader Parteiorganisation und hatte dabei als Anhänger des Stalinschen Kurses den in Opposition geratenen Grigori Je. Sinowjew (1883–1936) abgelöst. Er war also, bei den damaligen Machtverhältnissen, der wichtigste Mann in der Stadt. Zugleich richteten sich aber auch im gesamtstaatlichen Rahmen immer mehr Blicke auf ihn. 1930 war er in das wichtigste Entscheidungsgremium der Partei, das Politbüro, aufgestiegen. Obwohl er nie einen Zweifel daran ließ, daß er hinter der Politik Stalins stand, deuteten viele heimliche Kritiker der überstürzten, mit viel Leid verbundenen Maßnahmen und des immer neuen »Voranpeitschens« der Massen einige Redewendungen Kirows derart, als befürworte er eine gemäßigte, langsamere Gangart und eine liberalere Haltung. Auf dem »Parteitag der Sieger« Anfang1934, der das Ende des Umbruchs proklamierte und eine verheißungsvolle Zukunft ankündigte, wurde der populäre und allseits beliebte Kirow begeistert gefeiert. Bei den Wahlen erhielt er ein ausgezeichnetes Ergebnis, und in internen Gesprächen wurde er als möglicher Nachfolger Stalins an der Parteispitze gehandelt, jedenfalls aber als einer, der eine weitere Verhärtung verhindern und die gewaltsamen Züge in der Stalinschen Politik zurückdrängen werde. Stalin soll dies sehr aufmerksam registriert haben.34 33 Vgl. als Beispiel John Scott in: Die Sowjetunion. Von der Oktoberrevolution bis zu Stalins Tod. Band 2: Wirtschaft und Gesellschaft. Hg. von Helmut Altrichter und Heiko Haumann. München 1987, S. 350. 34 Die kritische Stimmung gegenüber Stalin war damals in der Partei ziemlich ausgeprägt, da man intern durchaus wußte, welche Katastrophe der Umbruch von 1929 bedeutet hatte. Es gab auch oppositionelle Strömungen, die bis in den Kreis der bisherigen Stalin-Anhänger hineinreichten. Allerdings konnten sie sich nicht – soweit wir dies derzeit wissen – zu
Die Geschichte der Familie Dmitrewski
|
255
Kirow also hatte keine Probleme, mit den protestierenden Gläubigen zu reden. Simeon sah zu, wie er ihnen zu erklären versuchte, warum die Kirche abgerissen werden mußte. Einer der Schulkameraden wohnte im selben Haus wie Kirow. Einmal nahm er Simeon mit und zeigte ihm die Etage. »Wir guckten aus den Fenstern im Treppenhaus in seine Wohnung, es war so schräg gegenüber. Auf einmal nimmt uns da jemand beim Kragen und fragt: Ja, was wollt ihr denn eigentlich bei dem Genossen Kirow sehen? Wir drehten uns um: Es war der Genossen Kirow selbst! Ja, kommt mal rein, wenn ihr etwas sehen wollt, dann guckt euch das eben an wie anständige Leute. Wir kamen rein. Er sagte zu seiner Frau: Gib ihnen doch auch etwas zu essen (er kam nach Hause zum Mittagessen). Wir saßen und konnten vor Erregung kaum etwas herunterschlucken. Aber die Suppe hat uns geschmeckt. Und zuerst mußten wir uns die Hände waschen, unbedingt, und dann gingen wir. Die Hauptspeise hat er dann allein gegessen.« Die Wohnung war »sehr schlicht. Ich kann mich erinnern: Ich kam nach Hause und erzählte und sagte, also wißt ihr: Er wohnt ebenso wie wir. Und bei uns war alles sehr einfach in der Wohnung.« Dies machte Kirows Beliebtheit aus: Daß er, soweit man das beobachten konnte, wie die »normalen« Menschen lebte, sich nicht von der Bevölkerung abschloß, spontan auf andere zuging und ungezwungen mit ihnen umging. Auch Frau Nadja Dmitrewskaja hat ihn einmal erlebt. Es war während einer Pionierversammlung im Kulturpalast des Leningrader Sowjets. Alle Pioniere erhielten ein Stück Kuchen. Ihrem Vetter war das zu wenig, er ging noch einmal zum Buffet und schaute sehnsüchtig auf den Kuchen. Das sah Kirow, trat zu ihm und fragte: »Also willst du noch ein Stück? Ja, da bekam er noch ein Stück.« Am 1. Dezember 1934 wurde Kirow ermordet. Als die Kinder morgens in der Schule eintrafen, hingen Trauerfahnen heraus. Niemand wußte, was los war. Mitten in der ersten Stunde läutete dann die Glocke Alarm. Alle versammelten sich im großen Schulsaal, und hier erfuhren sie, daß Kirow erschossen worden war. Simeon ging auch, ebenso wie seine spätere Frau, in das Smolny-Institut – eine ehemalige Lehranstalt für adlige Mädchen, 1917 während des Oktoberumsturzes Hauptquartier der Bolschewiki, dann Sitz der ersten Sowjetregierung, anschließend der Leningrader Parteiorganisation –, wo der Sarg aufgebahrt war. »Schrecklich kalt war es. Alle haben geweint.« Von Kirow blieb nur Gutes im Gedächtnis. Aufmerksam verfolgten Simeon und seine Mitschüler den nun folgenden Prozeß gegen den Attentäter. Sie faßten auf, daß hinter dem Mörder eine große feindliche Organisation stehe, »die die Sowjetmacht zerrütten, vernichten, abschaffen« wolle. An der Spitze stehe Lew N. Trotzki (1879–1940), der 1917 die Aufstandsorganisation geleitet hatte, von Lenin als sein geeignetster Nachfolger festen Organisationen verdichten. Vgl. Haumann: Geschichte Rußlands, S. 565–566; Hildermeier: Geschichte der Sowjetunion, S. 444–447.
256
|
Ein Besuch beim Genossen Kirow
angesehen worden, aber im Machtkampf Stalin unterlegen war. 1929 hatte er die Sowjetunion verlassen müssen; jetzt lebte er in Mexiko. Als Kind hatte Simeon von den Auseinandersetzungen in den zwanziger Jahren nicht viel verstanden. Nur eines wußte er: »Trotzkist« war ein übles Schimpfwort. »Wenn man etwas Unangenehmes sagen wollte, dann sagte man: Ah, du Trotzkist.« Nun also galt Trotzki als Hauptfeind der Sowjetmacht, der sich zum Handlanger der kapitalistischen und imperialistischen Mächte gemacht habe und auch vor Mord nicht mehr zurückschrecke. Schon damals gingen Gerüchte um, Stalin selbst habe mit Hilfe der Geheimpolizei den Mord an Kirow inszeniert, zumindest vorher davon gewußt. Die genauen Umstände sind bis heute nicht endgültig aufgeklärt. Sicher ist, daß die Geheimpolizei in die Angelegenheit verwickelt war. Möglicherweise spielten auch private Umstände Kirows eine Rolle. Wie auch immer: auf jeden Fall nutzte Stalin den Mord zielbewußt für seine Zwecke aus, seine unumschränkte Macht zu festigen sowie seine tatsächlichen und potentiellen Gegner zu beseitigen.35 Mit der Ermordung Kirows wurde die unvorstellbare Terrorwelle eingeleitet, die die Sowjetunion überschwemmen sollte. Nicht nur zahlreiche Altbolschewiki, Funktionäre in gesellschaftlichen Organisationen, im Militär, in Betrieben und Institutionen, »bürgerliche Spezialisten«, Angehörige bestimmter Nationalitäten oder Emigranten waren betroffen, sondern fast in jeder Familie hielten die Verhaftungen Einzug. Millionen Menschen wurden, meist aufgrund willkürlicher Verdächtigungen oder Denunziationen, eingesperrt, gefoltert, deportiert oder erschossen. Ausgangspunkt dieser Verbrechen war wohl das Streben nach Machtsicherung und -ausweitung, nach Ausschaltung aller nur möglichen Kritiker, überhaupt nach Disziplinierung der Bevölkerung, nach einer Legitimierung der Politik, indem man Sündenböcke für Fehler an den Pranger stellte. Die freiwerdenden Stellen und Positionen sollten mit absolut loyalen und gehorsamen Menschen besetzt werden. Aber in der Konkurrenz der Apparate, wer 35 Vgl. – auch zum folgenden – Haumann: Geschichte Rußlands, S. 559–575; Hildermeier: Geschichte der Sowjetunion, S. 447–463; Robert Conquest: The Great Terror. A. Reassessment. New York, Oxford 1990; Stalinist Terror. New Perspectives. Hg. von J. Arch Getty und Roberta T. Manning. Cambridge usw. 1993; J. Arch Getty, Oleg V. Naumov: The Road to Terror. Stalin and the Self-Destruction of the Bolsheviks, 1932–1939. New Haven, London 1999. Zum Forschungsstand über den Stalinismus: Stalinismus. Neue Forschungen und Konzepte. Hg. von Stefan Plaggenborg. Berlin 1998; Stalinismus vor dem Zweiten Weltkrieg. Neue Wege der Forschung. Hg. von Manfred Hildermeier. München 1998; Stalinismus. New Directions. Hg. von Sheila Fitzpatrick. New York, London 1999. Ein Beispiel zur Terrorwelle in Leningrad: Lesley A. Rimmel: A Microcosm of Terror, or Class Warfare in Leningrad: The March 1935 Exile of »Alien Elements«. In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 48 (2000) S. 528–551. Zur Bedeutung der Denunziationen vgl. verschiedene Aufsätze in: Accusatory Practices. Denunciation in Modern European History, 1789–1989. Hg. von Sheila Fitzpatrick und Robert Gellately. Chicago, London 1997.
Die Geschichte der Familie Dmitrewski
|
257
am wachsamsten »Schädlinge« und »Verschwörer« entlarvte, und in den Möglichkeiten, die sich durch Denunziationen für den eigenen Vorteil eröffneten, gewann der Terror eine Eigendynamik, die keiner rationalen Strategie mehr folgte. Davon konnte Simeon nichts ahnen – auch nicht, daß der Terror seine Familie in Mitleidenschaft ziehen würde. Die damalige Atmosphäre ist Simeon Dmitrewski noch sehr bewußt. 1937 war er als Sechzehnjähriger in der achten Klasse. »Jeden Tag hörten wir: Aha, der weint, also ist der Vater nicht mehr nach Hause gekommen. (...) Wenn jemand auf einmal fehlte, dann dachten wir zuallererst nicht, daß er krank geworden ist, sondern daß er wegmußte. Das war schrecklich. Und in den Häusern – also unser großes Haus (...) –, wir waren Kinder, und plötzlich waren die weg. (...) Alles das bedrückte, und das hing so über der ganzen Stadt, über uns, und drückte die Gemüter sehr.« Und dann, am 17. Oktober 1937, mitten in der Nacht, klingelte es »so aufdringlich, ununterbrochen« an ihrer Wohnungstür. Vater öffnete, drei Männer standen da. Einer blieb an der Tür, die beiden anderen zeigten einen Durchsuchungsbefehl und fingen an, überall herumzustöbern. Selbst ein Buch Simeons aus der Schulbibliothek nahmen sie mit. Auch Wertgegenstände wurden vermutlich beschlagnahmt: Die Eltern besaßen noch einiges aus Deutschland und konnten auf diese Weise hin und wieder im Valuta–Laden, im »Torgsin«,36 einkaufen. Schließlich verschwanden die Männer wieder – aber Vater mußte mitgehen. »Und Vater sagte, seid ruhig, bleibt ruhig, ich habe nichts verbrochen, ich bin absolut unschuldig (...). Ich habe ehrlich gearbeitet, ich komme bald zurück. Und er kam nicht mehr zurück.« Selbstverständlich glaubte auch Simeon, daß die Verhaftung seines Vaters auf einem Mißverständnis oder auf Übereifer beruhe und ein Fehler sei. In dieser Meinung wurde er bestärkt, als die verantwortlichen Volkskommissare für innere Angelegenheiten, denen auch die Geheimpolizei unterstand, nacheinander selbst verhaftet, verurteilt und hingerichtet wurden: zuerst Genrich G. Jagoda (1891–1938), dann Nikolai I. Jeschow (1895–1940). So entstand nicht nur bei Simeon, sondern bei zahlreichen betroffenen Menschen in der Sowjetunion das Bild, Stalin sei gut, wisse nur nicht alles, versuche aber, die Verantwortlichen für Fehler und Verbrechen zu bestrafen. Das volle Ausmaß des Terrors konnte auf diese Weise verschleiert und wohl auch verdrängt werden. Erst nach Stalins Tod 1953 kamen nach und nach Einzelheiten ans Tageslicht, wenngleich eine gründliche Aufarbeitung dieser Zeit noch lange auf sich warten lassen sollte. Besonders erschütterte Simeon Dmitrewski, daß selbst die Frauen des zeitweiligen Vorsitzenden des Rates der Volkskommissare – also des Ministerpräsidenten – und Außenministers Wjatscheslaw M. Molotow (1890–1986) sowie des Staatsoberhauptes Michail I. Kalinin (1875–1946) Opfer des Terrors geworden waren, 36 Torgsin = magasin dlja torgowli s inostranzami (Geschäft für den Handel mit Ausländern).
258
|
Ein Besuch beim Genossen Kirow
ohne daß sich ihre Männer dagegen gewehrt hatten. Er selbst hatte während des Krieges erlebt, wie viele Divisionen anfangs von Leutnanten befehligt wurden. Erst heute wurde ihm klar, daß der Terror, der vor der Armee nicht haltmachte, dafür verantwortlich gewesen war. 1943 war ein Regimentskommandeur zu ihnen an die Front gekommen, den Marschall Konstantin K. Rokossowski (1896– 1968) aus dem Lager geholt hatte, in dem er wie viele andere hohe Offiziere saß – vorher war er Lehrer an der Generalstabsakademie der Roten Armee gewesen.37 Solche Einzelheiten wußte man natürlich, aber man kannte nicht das Ausmaß und glaubte an partielle Mißverständnisse oder eben Fehler der Geheimpolizei, die von Stalin korrigiert werden würden. Trotz der Absetzung Jagodas und Jeschows kam der Vater nicht frei, hier schien also die »Wahrheit« immer noch nicht zu Stalin gedrungen zu sein. 1941 wurde Simeon mitgeteilt, sein Vater sei an einer Halsoperation gestorben. Was wirklich geschehen war, konnte er erst infolge der von Gorbatschow eingeleiteten Perestroika rekonstruieren. Er begann nachzuforschen und wandte sich auch an den KGB, das »Komitee für Staatssicherheit«, wie die Geheimpolizei jetzt hieß. Nach langer Zeit und wiederholten Nachfragen erhielt er am 30. Januar 1992 von der KGBVerwaltung für den Leningrader Bezirk unter dem Zeichen N 10/40-M-71301 folgendes Schreiben: »Werter Simeon Michailowitsch. Auf Ihr Gesuch mit der Bitte, Sie über das Schicksal Ihres Vaters zu informieren, der schuldlos im Jahre 1937 repressiert wurde, teilen wir mit: Dmitrewski M. S. wurde am 17.10.1937 aufgrund einer falschen Anzeige, er habe Spionage und Diversionsarbeit zugunsten eines ausländischen Staates betrieben – also entsprechend § 58 Punkt 6 und 11 des Strafrechtes der Russischen Sowjetischen Föderativen Sozialistischen Republik –, verhaftet. Auf Beschluß der Kommission des Volkskommissariats für innere Angelegenheiten und des Staatsanwaltes der UdSSR erhielt er das Todesurteil. Am 24.11.1937 wurde er in Leningrad erschossen. Laut Schlußfolgerung des Militärstaatsanwaltes des Leningrader Wehrkreises vom 31.8.1989 wurde der 37 Rokossowski war selbst von 1937 bis 1941 in Haft gewesen. 1944 wurde er zum Marschall ernannt. Von 1949 bis 1956 war er Oberbefehlshaber der polnischen Armee und polnischer Verteidigungsminister; nach dem »polnischen Oktober« von 1956 mußte er diese Ämter aufgeben (vgl. Jörg K. Hoensch: Sozialistische Osteuropa-Politik 1945–1975. Kronberg 1977, S. 83, 114, 128–130). Zum Schicksal von Molotows Frau Polina Schemtschuschina, die 1941 ihren Status als Kandidatin des Zentralkomitees verlor, 1948 aus der Partei ausgeschlossen, 1949 verhaftet, dann zu fünf Jahren Lagerhaft verurteilt und nach Stalins Tod 1953 wieder in die Partei aufgenommen wurde, vgl. Arno Lustiger: Rotbuch: Stalin und die Juden. Die tragische Geschichte des Jüdischen Antifaschistischen Komitees und der sowjetischen Juden. Berlin 1998, S. 163, 206, 218–220, 223–225, 227, 242, 269. Molotow war 1930–1941 Vorsitzender des Rates der Volkskommissare sowie 1939–1949 und 1953–1956 Volkskommissar des Äußeren bzw. Außenminister, Kalinin 1919–1946 Staatsoberhaupt.
Die Geschichte der Familie Dmitrewski
|
259
Beschluß der Kommission des Volkskommissariats für innere Angelegenheiten und des Staatsanwaltes der UdSSR vom 27.11.1937 aufgehoben. M. S. Dmitrewski ist posthum rehabilitiert. Nehmen Sie unser aufrichtiges Beileid entgegen zu dem Kummer, der Ihre Familie in der tragischen Periode der Geschichte unseres Landes traf. Hochachtungsvoll. (Der Leiter der Einheit)«38 Aus diesem Dokument geht nicht nur hervor, daß man die Angehörigen damals erst viel später und mit unwahren Angaben über den Tod Michail Dmitrewskis informierte und daß man ihn nach einem äußerst kurzen Verfahren erschoß, sondern auch, daß er hingerichtet wurde, bevor offiziell das Urteil erging. Und noch mehr konnte sein Sohn erfahren: Überraschenderweise stellte ihm der KGB auch die Unterlagen über das Verfahren zur Verfügung – einen sehr dünnen Ordner. Am 16. Oktober 1937 erging der Befehlt N 4721 zur Verhaftung des Vaters. Beschlagnahmt wurden sein Paß, seine private Korrespondenz und sieben Bücher. Der Bevollmächtigte der 6. Abteilung der 5. Sektion im Volkskommissariat für innere Angelegenheiten, Jemeljanow, führte noch am 17. Oktober das erste Verhör durch. Dmitrewski gab seine Personalien und diejenigen seiner verstorbenen deutschen Frau an. Auf die Frage nach einer Vorstrafe antwortete er: »Verhaftet 1907 für revolutionäre Propaganda unter den Studenten der Rechtsschule und nach Deutschland ausgewiesen.« Eine weitere Frage betraf Verwandte und Bekannte, mit denen er in Deutschland Verbindung gehabt habe. Er nannte neben Verwandten den Freiburger Professor Heinrich Finke, den Buchhalter der Firma Himmelsbach, Karl Binz (1883-?) und den Freiburger Hans Specht (1891–?)39, dazu den Professor Nikolai A. Morosow vom Holz–Institut. Damit war das Verhör beendet. Zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen wurde er offenbar nicht befragt. Zehn Tage später sah dies anders aus. Das Verhörprotokoll vom 27. Oktober 1937 lautet: „Untersuchungsrichter: Sie sind wegen Spionagetätigkeit verhaftet. Was können Sie dazu aussagen? Dmitrewski: Ja, ich beschäftigte mich mit Spionagetätigkeit zugunsten Deutschlands. U.: Wann und durch wen wurden Sie angeworben? D.: Ich wurde Ende 1925 vom deutschen Konsul in Leningrad, Fritz Kessler, angeworben. 38 Simeon M. Dmitrewski hatte seinen Verwandten in Baden eine eigene deutsche Übersetzung dieses Schreibens wie der im folgenden zitierten Dokumente mitgebracht. Dankenswerterweise hat er mir davon Kopien überlassen. Das russische Original lag mir nicht vor. 39 Zu Binz und Specht liegen Meldekarten im Stadtarchiv Freiburg. In beiden Fällen gibt es noch weitere Personen gleichen Namens, die aber m. E. ausscheiden. Der Kaufmann Karl Binz wurde in Freiburg geboren, der als Lehramtspraktikant bzw. Prof. bezeichnete Dr. Hans Specht in Überlingen.
260
|
Ein Besuch beim Genossen Kirow
U.: Unter welchen Umständen wurden Sie angeworben? D.: Ende 1925 bekam ich von dem mir bekannten Kanau eine Einladung ins Konsulat. Kessler machte mir den Vorschlag, denn er kannte meine feindliche Einstellung gegenüber der Sowjetmacht. U.: Welche Angaben teilten Sie Kanau mit? D.: Von 1925 bis zum Tag der Verhaftung übergab ich Kanau Angaben über die Dislozierung und Versetzungen von Einheiten der Roten Armee in Leningrad, Peterhof, Puschkino, Sluzk, Strelna. Ich übermittelte auch Angaben über die Produktion der Firma N 4 (Geschosse, Sprengkörper für Geschosse und Bomben).« Die Unterschrift Michail Dmitrewskis unter dieses »laut meinen Angaben verfaßte Protokoll« ist kaum zu erkennen, während sie am 17. Oktober noch gut lesbar war. Unsere Phantasie reicht nicht aus, um sich vorzustellen, was in der Zwischenzeit mit Dmitrewski geschehen war. Nun ging alles seinen Lauf. Am 28. Oktober teilte man dem Beschuldigten, der sich bis dahin im Leningrader Untersuchungsgefängnis des Volkskommissariats für innere Angelegenheiten aufhielt, den bereits am 15. Oktober (!) von Jemeljanow gefaßten Beschluß mit: »Dmitrewski M. S. ist überführt, sich als Agent eines ausländischen Staates mit Spionage- und Diversionstätigkeit beschäftigt zu haben.« Am 5. November wurde er noch einmal verhört. Die einzige Frage lautete: »Wurden Sie für Ihre Spionagetätigkeit entlohnt?« Dmitrewski antworte: »Ja, in den Jahren von 1925 bis 1937 erhielt ich insgesamt 115000 Rubel.« Wieder ist die Unterschrift fast nicht zu erkennen. Anschließend – die Angabe des Tages fehlt im Dokument – »bestätigte« der Major der Staatssicherheit Schapiro die Anklage entsprechend der »Geständnisse«. »Der Angeklagte hat seine Schuld völlig zugegeben. Die Sache wurde als abgeschlossen angesehen und gemäß dem Befehl des Volkskommissars für innere Angelegenheiten der UdSSR Jeschow vom 11.8.1937 N 00485 ins Volkskommissariat geschickt, um sie entprechend der I. Kategorie zu betrachten.« Was die I. Kategorie bedeutete, läßt sich leicht erraten. Ein bemerkenswerter Zusatz findet sich noch: »Beweisstücke zur Sache sind nicht vorhanden.« Oberleutnant Polikarpow fertigte – wie alle Dokumente ist auch dieses als »vollkommen geheim« qualifiziert – am 24. November 1937 das abschließende Protokoll aus: »Am 24.11.1937 habe ich laut Anordnung vom 21.11.1937 V 192878 des Kommissars 1. Ranges Zakowski und der Anordnung des Kommissariats für innere Angelegenheiten vom 21.11.1937 V 413583 das Urteil bezüglich Dmitrewski M. S. vollstreckt.« Ein letztes Schreiben enthält die Akte. Am 11. Oktober 1962 erteilt unter dem Zeichen »Protokoll N 48/a« der Inspektor der Verwaltung der Staatssicherheit für das Leningrader Gebiet beim Ministerrat der UdSSR die Auskunft: »Dmitrewski Michail Simeonowitsch ist am 27. November 1937 von der Kommission des Volkskommissariats für innere Angelegenheiten
Die Geschichte der Familie Dmitrewski
|
261
und dem Staatsanwalt der UdSSR zum Tode verurteilt worden.« Hier wird somit bestätigt, daß dem Urteil erst nachträglich der Schein des Rechts gegeben wurde und man sich nicht einmal die Mühe machte, das entsprechende Schriftstück vorzudatieren. Daß 1962 eine derartige, vermutlich interne Auskunft zustande kam, hängt wahrscheinlich mit den auf dem 22. Parteitag von 1961 noch einmal in Gang gekommenen Entstalinisierungsbemühungen Chruschtschows zusammen. Die Verbrechen der Stalin-Zeit sollten im einzelnen untersucht werden. Nach einigen spektakulären Ereignissen – wie der Entfernung der Leiche Stalins aus dem Lenin-Mausoleum – blieb die Erforschung der Vergangenheit allerdings bald stecken.40 In den dürren Worten der Protokolle schimmern das Elend und das Leid durch, das Michail Dmitrewski wie so viele Menschen damals erdulden mußte. Zugleich wird ein wenig von der unerbittlichen Maschinerie des Terrors deutlich, bei der das Urteil bereits vor der Verhaftung feststand und es nur noch einiger »Formalitäten« – wie des erzwungenen Geständnisses – bedurfte, um es vollstrecken zu können. Die Menschen, die diese Maschinerie bedienten, waren manchmal davon überzeugt, der Terror sei notwendig, damit der Sozialismus in der Sowjetunion siegen könne. Bei den meisten hingegen handelte es sich um Opportunisten und Karrieristen oder auch solche, die nicht den Mut aufbrachten, sich diesem System zu verweigern. Wie geriet Michail Dmitrewski in die Räder der Maschinerie? Sein langer Aufenthalt in Deutschland, seine Tätigkeit in einer deutschen Firma in Sowjetrußland, seine »verspätete« Rückkehr nach Rußland machten ihn in der damaligen überheizten Atmosphäre, als für jeden Fehler, jedes Mißgeschick, jeden Rückschlag ein »Saboteur« oder ein »Schädling« gesucht wurde, um von der Verantwortung der Partei- und Staatsführung abzulenken, gewiß von vornherein verdächtig. Als dann ein verhafteter Bekannter – auch das hat Simeon Dmitrewski rekonstruieren können –, um sich, vermutlich vergeblich, selbst zu retten, den Namen des Vaters angab, setzte er die Räder in Gang – eine Aufklärung war gar nicht mehr angestrebt, der Terror hatte sich längst verselbständigt.41 40 Vgl. Entstalinierung. Der XX. Parteitag der KPdSU und seine Folgen. Hg. von Reinhard Crusius und Manfred Wilke. Frankfurt a. M. 1977; Hildermeier: Geschichte der Sowjetunion, S. 762–769. 41 Ob seitens des NKWD, des Volkskommissariates für innere Angelegenheiten, auf diese Weise angestrebt wurde, die Akademie der Wissenschaften zu belasten, indem man dort einen Spion enttarnte, läßt sich aufgrund der vorliegenden Quellen nicht sagen. Vgl. Nikolai Korenjuk: Die Akademie der Wissenschaften der UdSSR als elitäre Korporation. In: Im Dschungel der Macht. Intellektuelle Professionen unter Stalin und Hitler. Hg. von Dietrich Beyrau. Göttingen 2000, S. 65–83. Ebenso muss offen bleiben, inwieweit die damaligen sowjetischen Beziehungen zu Deutschland oder der Terror gegen die Militärführung 1937 – bei dem die Spionage für Deutschland, mit gefälschten Dokumenten belegt,
262
|
Ein Besuch beim Genossen Kirow
Noch etwas Merkwürdiges spielte sich in diesem Zusammenhang ab. In der ersten Hälfte des Jahres 1937 erhielten die Verwandten in Schwarzach einen Brief aus Rußland, der es verdient, zitiert zu werden. Sascha – Simeons Schwester – schreibt: »Lieber Onkel Albert! / Schon lange haben wir von euch keine Nachricht erhalten. Es ist doch nicht möglich daß wir noch weiter von einander nichts zu wissen bekommen. Seit Ihr uns lieber Onkel doch der aller näghste Verwandte. Hier haben alle Kinder Tanten und Onkel die einen besuchen, aber wir haben keinen und Ihr seit so weit das wir uns nicht sehen können. Wir wollen daher doch Euch wieder schreiben und bitten Euch von ganzen Herzen uns auch mitzuteilen wie es unseren allen Lieben in Schwarzach geht. Ich werde schon bald 14 Jahre alt. Alle sagen ich sehe meiner verstorbenen Mutter sehr ähnlich. Senja ist so groß wie Papa, manchmal sieht er noch größer aus er wird gewiß viel großer als Papa werden. Ich lerne in der Schule schon in der letzten Stufe und mache auch gute Fortschritte im Lernen auch kann ich schon gut Klavierspielen. Papa sitzt abens spät an seinen Arbeiten und schreibt, er liebt das zu tun, wenn wir schon schlafen gehen dann ist es ruhiger in unserer Wohnung. Wir sprechen oft von Euch was Ihr wohl macht. / Eure guten Kindern und die liebe Tante möchten wir so gerne mal besuchen, aber wann wird das wohl sein. Senja und Ich müssen doch noch viel lernen und da muß der Vater doch auch gut verdienen auch die Mutter geht bei uns und hilft am Verdienen und geht Abends ins Geschefft auf 2–3 Stunden. Im Sommer sind wir immer auf dem Lande bei guten Bauern und ich helfen den Wirten oft auf ’s Vieh aufzupassen die Kuh, das Schwein, das Kalb und Hühner einen wichtigen Anklagepunkt bildete – eine Rolle spielten. Möglicherweise rechnete man Dmitrewski einfach zu den Sympathisanten der »konterrevolutionären Nationalitäten«, die nach einem Beschluss des Politbüros vom Sommer 1937 zerschlagen werden sollten. Vgl. zu den Vorgängen in Leningrad Markus Wehner: Hauptstadt des Geistes, Hauptstadt der Macht. Leningrad/St. Petersburg und Moskau: Die Konfrontation im zwanzigsten Jahrhundert. In: St. Petersburg – Leningrad – St. Petersburg. Eine Stadt im Spiegel der Zeit. Hg. von Stefan Creuzberger u. a. Stuttgart 2000, S. 220–232, hier S. 226–229. Der im zitierten Protokoll erwähnte Zakowski (L. M. Zakovskij; im Text die Schreibweise Dmitrewskis) war Chef der Leningrader NKWD-Verwaltung und gehörte der Troika an, die über die Erschießung von Verhafteten entschied; ein »Kontingent« war vorgegeben. A. P. Polikarpov war für die Vollstreckung der Beschlüsse zuständig (S. 228). Der Befehl Jeschows Nr. 00485 vom 11.8.1937, auf den sich Major Schapiro bezog, ordnete die »Liquidierung« der angeblichen polnischen Spionage in der UdSSR an. Die »erste Kategorie« der Verhafteten war zu erschießen (abgedruckt in: Leningradskij Martirolog 1937–1938. Tom 2, oktjabr‹ 1937 goda [Leningrader Martyrologium 1937–1938. Band 2, Oktober 1937]. Sankt-Peterburg 1996, S. 454–456). Dieser Befehl wurde offenbar in formaler Hinsicht und im Blick auf den Spionagevorwurf zugrunde gelegt, jedenfalls ist aus den Quellen nicht ersichtlich, dass Dmitrewski einer Verbindung zu Polen beschuldigt wurde. [Alle hier erwähnten Verantwortlichen für die Ermordung Dmitrewskis wurden im Übrigen 1938/39 selbst hingerichtet oder begingen Selbstmord.]
Die Geschichte der Familie Dmitrewski
|
263
4 Onkel Albert Graf in Schwarzach, den 1937 ein Brief von Sascha (Alexandra) und Senja (Simeon) Dmitrewski erreichte, der möglicherweise eine Fälschung des sowjetischen Geheimdiensts ist. (Photo aus Familienbesitz)
zu versorgen. Ja, wenn ich doch das einmal bei Euch tun könnte! Aber Papa sagt wir können hin. / So geht es uns ganz gut. Mutter sorgt für’s kräftige Essen. Vater ist etwas nevös und schon nicht mehr so kräftig wie er war. / Lieber Onkel! Eine große Bitte habe ich an Euch. Unser Senja wächst so schnell aus den Kleidern heraus das man das alles garnicht so rasch anschaffen kann. Bitte wenn Ihr nur könnt so schickt doch 3 Trikot Hemde in Mannesgroße und 3 Unterhosen die dort so sehr gut sind. Für uns im Paket muß der Zoll schon bezahlt sein. Für mich, lieber Onkel, eine wollenes Kleid, es kann auch gestrickt sein. Die Farbe soll hellbraun oder stahlblau sein. Mein Maß ist von der Schulter bis zum Saum 1 meter lang. Das Geld dafür nimmt doch bitte aus unserer Sparkasse von (de) unserem lieben unvergeslichen Großvater und werden Euch dafür herzlich Dankbar sein. Das Paket müßt ihr dort fertig bezahlen und es genau auf unsere Adresse auf den Namen unseren Vaters Michail Simionowitsch Dmitrewsky schicken. Natürlich nur dann wenn es Euch nicht zu viel Schwierigkeiten macht. / Noch zu lezt wünschen wir Euch allen ein glückliches neues Jahr und Mama und Papa wünschen Euch auch das aller besten. / Eure euch liebende Sascha.« Simeon schließt sich an: »Lieber Onkel Albert. / Nun möchte auch ich euch etwas von mir schreiben. Die Neujahrsferien haben wir gut verbracht. Sogar einen Tannenbaum hatten wir zu Hause. Es gab auch viel Süssigkeiten. Nur fehlten
264
|
Ein Besuch beim Genossen Kirow
uns die Springerle, die unsere gute Großmutter in Schwarzach so gut zu backen verstand. Nach Neujahr bekamen wir starken Frost, der immer noch anhält, denn gestern war es 20° Celsius unter Null. Die grimmige Kälte hält mich aber nicht davon ab, ausser der Schüle auch besonderen englischen Unterricht zu haben. Ich bin nämlich Hörer der Kurse fur Fremdsprachen, die ich das zweite Jahr besuche. Fast Student! Auch im Wuchse entwickle ich mich in der letzten Zeit und bin bereits 1,7 m hoch. Zum besseren Wachsen hat mir unsere letzte Sommerfrische verholfen. Im Sommer lebten wir nämlich in einem Dorfe 200 km von Leningrad entfernt, wo ich viel Kameraden hatte. Auch in der Schule habe ich viele Freunde und das Lernen geht glatt. Wenn ich fortfahre gut zu lernen, möchte ich bei meinem Vater darauf verharren, mir eine Flinte zu kaufen, damit ich im Dorfe während der Sommerferien auf die Jagd gehen könnte. Ich weiss aber nicht ob mein lieber Vater übrig Geld dazu haben wird. Meine nächsten Zukunftspläne beschränken sich aber nicht nur auf die Anschaffung der Flinte, sondern gehen viel weiter. Ich möchte nämlich in die Handelsmarine gehen. Hoffentlich werde ich dann ferne Lander besuchen und auf meinen Reisen auch euch alle sehen. Ich bin sehr gespannt zu wissen, wie es meinen lieben Basen und Vettern geht. Das Grab unserer lieben Mama besuchen und pflegen wir wie früher. / Es grüsst und küsst euch alle auch im Auftrage meiner Eltern euch liebender Senja.«42 Simeon Dmitrewski bekam diesen Brief bei seinem Deutschland-Besuch zu lesen. Er hält ihn für gefälscht. Daß seine Schwester um drei Unterhosen für ihn gebeten habe, findet er unglaubwürdig. Auffallend sei die falsche Schreibweise des Vatersnamens von Michail Dmitrewski. Und daß er als Seemann die Verwandten habe treffen wollen – daran kann er sich nicht erinnen. Er glaubt, dies klinge eher wie eine verschlüsselte Verabredung. War der Brief also eine Provokation? Es könnte durchaus sein: Nicht nur die Bitte um Kleidung, auch der Hinweis auf ein Erbteil auf der Sparkasse, der Wunsch nach einer Flinte oder die Mitteilungen über ihre materielle Situation hätten, je nach der Antwort der Verwandten, als Anklage auf illegale Verbindungen ins Ausland, illegales Vermögen im Ausland, verschlüsselte Nachrichten über Waffen und Treffen genutzt werden können. Auf der anderen Seite sind die Handschriften durchaus als diejenigen von Sascha und Senja zu erkennen – das bestätigt Simeon Dmitrewski ausdrücklich –, wären also täuschend ähnlich nachgemacht. Auch die Sprache von Deutschschülern dürfte recht gut getroffen sein. Und die Einzelheiten über die Lebensverhältnisse oder über die Springerle der Großmutter würde eine höchst gründliche Recherche voraussetzen. Sollte sich der Geheimdienst eine derartige Mühe gemacht haben, um in einem an sich unwichtigen Einzelfall ein »Beweisstück« zu besitzen? Ausgeschlossen ist es nicht, denn bei einer »günstigen« Antwort hätte sich leicht ein 42 Die Schreibweise im Brief wurde nicht verändert. Absätze sind durch Schrägstriche gekennzeichnet.
Die Geschichte der Familie Dmitrewski
|
265
neues Spionagenetz rekonstruieren lassen, um den Terror zu legitimieren. Aber selbstverständlich ist es auch nicht. Es läßt sich nicht mehr feststellen, ob Onkel Albert damals geantwortet oder gar die Kleidungswünsche erfüllt hat. Simeon erinnert sich daran, daß bei der Wohnungsdurchsuchung anläßlich der Festnahme des Vaters sieben Briefe mitgenommen worden seien. Vielleicht war etwas aus Deutschland dabei. Aber offenbar konnten sie nicht als »Beweisstücke« dienen, wie aus den Verfahrensunterlagen eindeutig hervorgeht. Nach der Verhaftung des Vaters war eine Zeit der Ungewißheit, der Hoffnung und der Angst um dessen Schicksal gefolgt. Bald brachte ein Milizionär Simeons Stiefmutter – der Vater hatte noch einmal geheiratet – eine Verfügung des Volkskommissariates für innere Angelegenheiten, daß sie sich bis zu einem bestimmten Tag im Dezember in Bakaly, 57 Kilometer von Tuimasy in Baschkirien zu melden habe. Wie sie dorthinkam, war ihre Sache. Frau Dmitrewskaja war ohne Gerichtsverfahren verbannt worden.43 Alles mußte schnell gehen. Was nur möglich war, wurde verkauft. Dann fuhr die Stiefmutter ab. In Baschkirien mußte sie sich alle zehn Tage bei der Miliz melden. Sie bekam eine Wohnung in einem Bauernhaus und auch Arbeit zugewiesen. Später, im Weltkrieg, als Simeons Schwester aus Leningrad evakuiert wurde, fuhr diese zur Stiefmutter, und sie blieben bis 1944 zusammen. Dann kehrte die Schwester nach Leningrad zurück, erhielt in Wyborg eine Wohnung und holte die Stiefmutter zu sich. 1937 wußte zunächst niemand, was aus den Kindern werden sollte. Die Eltern waren weg, die Behörden kümmerten sich nicht um sie. Die Wohnung wurde beschlagnahmt – so, als ob es die Kinder gar nicht gebe. Gute Bekannte nahmen sie auf: eine mutige Tat in den damaligen Zeiten! Initiativ geworden waren deren Kinder, Mitschüler und Freunde Simeons. Sie hatten das Problem mit ihren Eltern besprochen, und diese sagten zu, Simeon und Sascha aufzunehmen. Simeon blieb noch in der Schule – inzwischen in einer russischen ganz in der Nähe der alten Wohnung, die deutsche Schule war aufgelöst worden. Aber daneben mußte er nun arbeiten, um leben und seiner neuen Familie etwas zahlen zu können. Briefträger, Straßenfeger, Kofferträger, Bäckergehilfe, Bauarbeiter und vieles andere waren die Beschäftigungen der nächsten Jahre. Auch Mathematik-Nachhilfe gab er für Schüler. Dennoch reichte das Geld hinten und vorne nicht. »Ich hatte Stiefel, das waren noch Stiefel für das Pilzesuchen, hohe russische Stiefel, die waren abgetragen, also die Sohlen, die hielten nicht mehr. Da kaufte ich mir Galo43 Die »administrative Verbannung« hat eine lange Tradition in Rußland: Volker Rabe: Der Widerspruch von Rechtsstaatlichkeit und strafender Verwaltung in Rußland 1881–1917. Motive, Handhabung und Auswirkungen der administrativen Verbannung von Revolutionären. Karlsruhe 1985. Vgl. ders.: Die Justiz. In: Handbuch der Geschichte Rußlands. Bd. 3: 1856–1945: Von den autokratischen Reformen zum Sowjetstaat. Hg. von Gottfried Schramm. 2. Halbbd. Stuttgart 1992, S. 1527–1576, bes. S. 1542–1546, 1571–1572; Peter H. Solomon: Soviet Criminal Justice under Stalin. Cambridge usw. 1996.
266
|
Ein Besuch beim Genossen Kirow
schen, so Gummischuhe, habe sie übergezogen und ging dann also im Sommer und im Winter in diesen Stiefeln mit Gummischuhen. Ich hatte keine anderen.« Immerhin wurde Simeon 1939 zum Studium zugelassen und erhielt sogar ein Stipendium, das allerdings die Nebenarbeit nicht überflüssig machte. Sein Studienfach wählen durfte er nicht. Mathematik war ebenso aussichtslos wie Eisenbahntransportwesen, um das er sich bewarb. Überall wurde er als »Feind des Volkes« abgewiesen, denn daß sein Vater verhaftet war – mehr wußte er ja noch nicht –, stand in allen Dokumenten. Endlich wurde er der Forstwissenschaft zugeteilt, an die er früher nie gedacht hatte. Aber hier brauchte man noch Studenten. Offenbar wurde dieses Studium als politisch bedeutungslos eingestuft: »Die Leute kamen ja sowieso nach Sibirien in den Wald zum Holzfällen.« Ob auch die frühere Tätigkeit des Vaters für den Holz-Konzern bei den Überlegungen der Behörde eine Rolle gespielt hatte? Abschließen konnte Simeon das Studium zunächst nicht: Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion kam dazwischen. Am 25. August 1941 ging es an die Front, und im August 1946 wurde er wieder aus der Armee entlassen – als Soldat, der mehr als drei Wunden hatte, als Offizier ohne eigentliche Ausbildung und als Student ohne Abschluß. Er kam an die Forstakademie zurück. Um Praxiserfahrung zu gewinnen, arbeitete er in Sibirien, projektierte dort eine Eisenbahn für den Holztransport – dafür erhielt er 2000 Rubel, viel Geld in dieser Zeit – und schrieb 1949 seine Diplomarbeit über die mechanisierte Verarbeitung des Holzes in einem Forstbetrieb in den bergigen Gebieten Ostsibiriens. Zu dieser Zeit war er schon verheiratet. Seine Frau Nadja hatte er als Mädchen in der achten Klasse kennengelernt, als er 1937 auf eine russische Schule überwechseln mußte. Während des Krieges lebte sie in Leningrad und mußte unter entsetzlichen Bedingungen die 900 Tage Blockade durch die deutschen Truppen erdulden. Hunderttausende verhungerten oder erfroren damals. Als Simeon Dmitrewski aus der Armee entlassen worden war, heirateten die beiden 1946. Nach dem Examen wurde Simeon nach Krasnojarsk am Jenissei, im Zentrum Sibiriens, an das Forsttechnische Institut, das Forstingenieure ausbildete, abkommandiert. Als das Ehepaar dort ankam, begann Nadja zu weinen: Sie sah sich als eine Dekabristen-Frau, als die Frau eines Verbannten.44 Sie arbeitete dann als Russisch-Lehrerin, fühlte sich aber nie so wohl wie in Leningrad. Anfangs waren die Lebensverhältnisse auch schlimm: Sie mußten in einer Waschküche wohnen, in die gefrorene Bretter auf den Betonboden gelegt, ein gußeiserner Ofen sowie zwei Betten mit Matrazen aufgestellt wurden – das war die ganze Einrichtung. 44 Dekabristen werden die Verschwörer genannt, die im Dezember (russ. dekabr) 1825 einen Aufstand unternahmen, um den Zaren zu stürzen und eine konstitutionelle Monarchie oder eine Republik einzuführen. Einige der Dekabristen wurden hingerichtet, die meisten jedoch nach Sibirien verbannt. Großes Aufsehen erregte es, daß ihnen in der Regel ihre Frauen folgten. Vgl. Haumann: Geschichte Rußlands, S. 317–325. – Zu den Verbindungen eines Vorfahren Simeon Dmitrewskis mit den Dekabristen siehe hier bei Anm. 2.
Die Geschichte der Familie Dmitrewski
|
267
Wenn sie heizten, war der Raum voller Dampf, erlosch das Feuer, überzog sich der Boden schnell wieder mit Eis. Anders Simeon. Ihm gefielen die Natur in Sibirien und auch die Menschen: »Sie sind einfach, sie sind nicht so schlau wie die Großstädter.« Nach zehn Jahren erhielt er einen Lehrstuhl am Institut, wurde dann jedoch vom Volkswirtschaftsrat versetzt und zum Direktor des sibirischen Forstwissenschaftlichen Institutes ernannt. Dort arbeitete er fünf Jahre, bis er Ende 1966 durch das Ministerium für Forstindustrie an das zentrale Forschungsinstitut der Forstindustrie in Chimki – einer Vorstadt Moskaus – berufen wurde. Er hatte sich um die Versetzung bemüht, weil seine Frau und seine Tochter Natascha an der Schilddrüse erkrankt waren und die Ärzte dies auf das fehlende Jod im Wasser des Jenisseis zurückführten. Drei Jahre lang leitete er eine neu eingerichtete Abteilung, die sich mit der Verbesserung der Arbeitsorganisation beschäftigte. Anschließend wurde er Direktor des Verlages der Forstindustrie, und von 1974 bis 1991 hatte er einen Lehrstuhl am Institut für die Weiterbildung der leitenden Kader der Forstindustrie inne. »Und dann wurde ich 70, und dann habe ich gesagt, jetzt wär’s doch genug.« Nach schwierigen Anfängen als Sohn eines »Volksfeindes« konnte er also doch noch »Karriere« machen, vor allem in Sibirien fühlte er sich zufrieden und empfand Genugtuung. Der Durchbruch kam nach seiner Meinung unter Chruschtschow mit dem ersten Anlauf einer »Entstalinisierung« und mit dessen Reformversuchen. Die gesamte Leitung in Industrie und Landwirtschaft wurde umgestellt, regionale Volkswirtschaftsräte – wie jener in Sibirien – sollten die Querverbindungen in der Wirtschaft sicherstellen und die bisherige hierarchische Überzentralisierung ersetzen. Um der Partei mehr Kompetenz zu verleihen, setzte Chruschtschow besondere Abteilungen für Industrie und Landwirtschaft durch. Der neue Typus des Funktionärs sollte Betriebsleiterqualitäten und politische Führungskraft in einem besitzen. Auch Alexei N. Kosygin (1904–1980), Ministerpräsident von 1964 bis 1980, war bestrebt, mit seinen Reformen des Planwesens und der Finanzierung die Organisation der Wirtschaft zu verbessern. Nach ersten Erfolgen scheiterten beide – vor allem am Widerstand der Bürokratie, die die Gesetze nur halbherzig ausführten oder gar blockierten. Dieses Strukturproblem konnte auch Gorbatschow nicht lösen und war eine der Hauptursachen für den Zusammenbruch der Sowjetunion.45 Einen wesentlichen Grund dafür, daß diese Blockade nicht durchbrochen werden konnte, sieht Simeon Dmitrewski in der Prägung mehrerer Generationen durch den Stalinismus, durch ein System, das absoluten Gehorsam verlangte und keine Eigeninitiative zuließ. Jetzt gebe es Initiativen von unten, aber sie würden 45 Vgl. Haumann: Geschichte Rußlands, S. 601–608, 631–638; Hildermeier: Geschichte der Sowjetunion, S. 877–899, 1022–1052.
268
|
Ein Besuch beim Genossen Kirow
5 Simeon Dmitrewski und seine Frau Nadja auf der Spurensuche im Freiburger Universitätsarchiv bei ihrem Deutschlandbesuch 1991 (Photo aus Familienbesitz)
viel zu wenig »von oben« unterstützt – das sei der Hauptfehler der neuen Regierung. Vieles sei beim Alten geblieben. Und er bringt ein Beispiel: In der Ukraine wird Holz benötigt für die Absicherung der Stollen in den Kohlegruben. In Rußland ist Holz geschlagen worden, um es dorthin zu liefern. Aber die Regierungen schaffen es nicht, eine zwischenstaatliche Vereinbarung abzuschließen, und die Betriebe dürfen, allen öffentlichen Äußerungen zum Trotz, immer noch nicht völlig selbständig handeln. So bleibt das Holz liegen und verfault. Oder in Sibirien: der Raubbau am Wald, nicht zuletzt durch devisenbringende Verträge mit Japan, zerstört die Natur, vernichtet den Lebensraum für viele Tiere und zugleich für die dort lebenden Völker. »Es ist ein Verbrechen.« Trotzdem ist Simeon Dmitrewski Optimist: Es werde wieder Ordnung geschaffen und eine demokratische Marktwirtschaft kommen. Allerdings müßten die Menschen auch sehen, daß es besser werde. Man habe zwar ein reichhaltigeres Angebot als in früheren Zeiten, könne es aber nicht bezahlen. Die Inflation mache alle Fortschritte bei Löhnen und Renten wieder zunichte. Immer mehr Menschen lebten in Armut. Auch die Familie Dmitrewski bleibt von den wirtschaftlichen Problemen nicht verschont. Sie haben zwei Töchter, Natascha und Lena, 1947 und 1955 geboren. Sie wuchsen in Sibirien auf, in Moskau waren sie dann Pioniere. Natascha wurde Lektorin und arbeitete im Forschungsinstitut in Chimki. Monatelang er-
Die Geschichte der Familie Dmitrewski
|
269
hielt sie jedoch keinen Lohn: Wie soll man unter solchen Umständen existieren? Lena studierte in Rostock Umweltschutz und konnte im Moskauer Ministerium für Umweltschutz eine Anstellung finden. Das Ehepaar selbst lebt von der Rente – und dies wird immer schwieriger. Sobald es möglich wurde, hat Simeon begonnen, seine eigene Geschichte zu erforschen. Er las nicht nur viel über die bisherigen »weißen Flecken« in der Vergangenheit des Landes,46 sondern begann, den Spuren im Leben seines Vaters nachzugehen. Nadja besuchte mit ihrer Tochter Natascha den Friedhof von Lewaschowo, einem Vorort Leningrads. Dort soll der Vater begraben sein. Zu finden ist nichts. Die Nachkommen der Ermordeten sammeln jetzt Geld, um eine kleine Kapelle errichten zu lassen. Bis zu dieser Zeit hatte Simeon immer noch das Bewußtsein, für den Kommunismus zu arbeiten. Er empfand dies allerdings sehr konkret: Was er leistete, sollte den Menschen jetzt und in der Zukunft zugute kommen. Und das blieb von seiner Tätigkeit. Die Idee des Kommunismus brach hingegen für ihn zusammen, nachdem ihm bewußt wurde, was alles unter dieser Losung geschehen war. Den ersten Anstoß zum selbständigen Denken gab ihm Gorbatschows Rede vom 10. Dezember 1984, in der dieser zum erstenmal öffentlich – noch zu Amtszeiten seines Vorgängers Konstantin U. Tschernenkos (1911–1985) – seine Ideen von Perestroika, Glasnost und Selbstverwaltung vorstellte.47 Intensiv beschäftigte sich Simeon dann mit den Verbrechen im Stalinismus, denn obwohl auch schon zu Lenins Zeiten viel geschah, was er zunächst nicht glauben konnte, als es veröffentlicht wurde,48 sieht er den entscheidenden Bruch doch in der Stalin–Zeit. Seit Gorbatschows Perestroika konnte man endlich auch öffentlich freier sprechen. Aber: »Uns – mich persönlich – hat das Leben gelehrt: erst denken, dann sprechen.« Immer noch erschrecken alle in der Familie, wenn es überraschend an der Tür klingelt. Immer noch vermuten sie, daß sie überwacht werden, wenn ein Brief nicht ankommt oder es bei Telefongesprächen in der Leitung knackt. Und immer noch können sie auch Beispiele anführen, wie gut die Miliz über Einzelheiten ihres Lebens Bescheid weiß.49
46 Gorbatschow verlangte die Aufarbeitung der »weißen Flecken« und förderte damit die offene Diskussion über die Geschichte. Vgl. Haumann: Geschichte Rußlands, S. 647. 47 Vgl. Michail S. Gorbatschow: »Zurück dürfen wir nicht!« Programmatische Äußerungen zur Umgestaltung der sowjetischen Gesellschaft. Eine kommentierte Auswahl der wichtigsten Reden M. S. Gorbatschows aus den Jahren 1984–1987. Hg. von Horst Temmen. Bremen 1987, S. 16–26, 81–85, 159–164, 212. 48 Dmitrewski bezieht sich hier auf Dimitri Wolkogonow: Lenin. Utopie und Terror. Düsseldorf usw. 1994. 49 Zum Phänomen der Angst, die die Menschen in Rußland beherrschte, vgl. Daniil Granin: Das Jahrhundert der Angst. Erinnerungen. Berlin 1999.
270
|
Ein Besuch beim Genossen Kirow
1988 gelang es den Verwandten in Baden endlich, eine Verbindung zu den Dmitrewskis herzustellen. 1991 fuhr Simeon auf deren Einladung zum erstenmal wieder in seine Geburtsstadt Freiburg. Im Stadtarchiv und im Universitätsarchiv forschte er nach Hinweisen über seine Eltern, fand die Meldekarte, die den Freiburger Aufenthalt dokumentierte, fand die Unterlagen über das Studium seines Vaters und seine Tätigkeit als Universitätslektor für Russisch – ein bewegendes Erlebnis. 1994 kam dann das Ehepaar noch einmal zu Besuch. Inzwischen hatte das Komitee für Staatssicherheit die Unterlagen über das Verfahren gegen Michail Dmitrewski zur Verfügung gestellt. Simeon Dmitrewski konnte nun die Geschichte seines Lebens rekonstruieren und über sie berichten. Der Kreis hatte sich geschlossen.
Suworow und Kos´ciuszko Zwei osteuropäische »Helden« in der Schweiz* Im Abstand weniger Jahre hielten sich Persönlichkeiten aus Osteuropa in der Schweiz auf, die zu ihrer Zeit, aber im Grunde bis heute, als Helden galten, die vielfältig miteinander verbunden waren und doch unterschiedliche Welten verkörperten. General Alexander Wassiljewitsch Suworow (1729–1800) betrat im September 1799 an der Spitze einer russischen Armee Schweizer Boden. Im Zuge des Zweiten Koalitionskrieges gegen Frankreich hatte er – parallel zu erfolgreichen russisch-osmanischen Flottenaktionen im Mittelmeer – in Italien den Rückzug der französischen Truppen erzwungen. Der Feldzug in der Schweiz sollte auch hier die Franzosen vertreiben. Gedacht war daran, sich mit den russischen und österreichischen Einheiten, die bereits am Zürcher See standen, zu vereinen. Über Bellinzona zog die russische Hauptstreitmacht zum Gotthard-Pass (2108 m) und erkämpfte sich am 25. September1 in einer blutigen Schlacht an der Teufelsbrücke den Zugang zur Schöllenen und hinab nach Altdorf. Dort fand Suworow jedoch nicht die erwarteten Schiffe, um nach Luzern überzusetzen, und musste über den Kinzigpass (2073 m) in das Muotatal ausweichen. Da auch der Weg über Glarus von starken französischen Kräften versperrt und das russisch-österreichische Heer bei Zürich geschlagen worden war, blieb den Russen nichts anderes übrig, als erneut einen Pass, diesmal den Panixer (2407 m), zu überqueren. Bei schlimmsten Witterungsverhältnissen, auf vereisten Wegen und im Schneesturm, kamen Tausende russischer Soldaten um. Das war die Kehrseite der bewundernswerten militärischen Leistung. Über das Rheintal marschierte dann die russische Armee in ihre Heimat zurück.2 * Erstpublikation in: Wider das «finstere Mittelalter». Festschrift für Werner Meyer zum 65. Geburtstag (= Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 29). Basel 2002, S. 207–213. Vgl. meinen – Andreas Guski gewidmeten – Beitrag: »Held« und »Volk« in Osteuropa. Eine Annäherung. In: Osteuropa 57, 2007, H. 12, S. 5–16. 1 Nach russischem Kalender, der die Gregorianische Reform von 1582 nicht mitgemacht hatte und nach wie vor der Julianischen Zählung folgte, fand die Schlacht am 14. September 1799 statt (im 19. Jahrhundert sind dann zwölf statt elf Tage hinzuzurechnen). Ich datiere hier der Einheitlichkeit halber nach dem in der Schweiz gültigen Gregorianischen Kalender. Russische Wörter gebe ich im Text nach der »populären« Umschrift ohne Sonderzeichen wieder, in den Fussnoten und Anmerkungen hingegen nach der im deutschsprachigen Raum üblichen wissenschaftlichen. 2 Der Feldzug nach G. P. Dragunov, Čertov most. Po sledam Suvorovav Švejcarii, Moskva 1995.
272
|
Suworow und Kos´ciuszko
16 Jahre später, 1815, nahm General Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko (1746–1817) Wohnsitz in der Schweiz. Dieser berühmte polnische Feldherr war nach der Niederlage der Erhebung gegen das zarische Russland 1794 und der Entlassung aus russischer Gefangenschaft 1796 in das Exil gegangen. Vergeblich hatte er versucht, Napoleon (1769–1821) und später den Zaren Alexander I. (1777– 1825) zu veranlassen, ein unabhängiges Polen wiederherzustellen. Enttäuscht verliess Kościuszko seinen Aufenthaltsort in Frankreich, nachdem dort die Monarchie wieder herrschte, und liess sich in Solothurn bei der Familie Zeltner nieder.3 Beide Persönlichkeiten waren einmal unmittelbar aufeinander getroffen. Im März 1794 hatte Kościuszko mit seinen Freiheitskämpfern, darunter den legendären Bauerneinheiten mit ihren gefürchteten Sensen, seinen Siegeszug im Süden Polens, von Krakau aus, begonnen und die russischen Truppen mehrfach geschlagen. Doch das Blatt wendete sich, als eine neue russische Armee, eben unter Suworows Führung, heranrückte. Suworow hatte bereits 1771 in den Kämpfen mit den polnischen Konföderierten, die zur Ersten Teilung Polens überleiteten, Erfahrungen gesammelt. Den überlegenen Kräften waren die polnischen Aufständischen nicht gewachsen. Am 10. Oktober 1794 erlitten sie bei Maciejowice eine vernichtende Niederlage, Kościuszko geriet schwerverwundet in Gefangenschaft. Suworow rückte daraufhin weiter vor und leitete die Erstürmung Pragas am 4. November und die anschliessende Besetzung Warschaus. Die Russen richteten dabei ein entsetzliches Blutbad unter der Bevölkerung an. Am 3. Januar 1795 erklärten die Mächte Russland, Preussen und Österreich die vollständige Aufteilung Polens. Erst 1918 sollte ein neuer selbständiger Staat Polen entstehen. Neben dieser unmittelbaren Beziehung zwischen Suworow und Kościuszko gab es noch eine indirekte Verbindung. Als gegen Ende des 19. Jahrhunderts die zarische Regierung um ein Terrain für ein Denkmal zur Erinnerung an den Suworow-Feldzug nachsuchte, stimmte am 13. Oktober 1893 der »Corporationsrath« Ursern nicht zuletzt mit der Begründung zu, dass aus dem damaligen Krieg die Neutralität der Schweiz entstanden sei, die am Wiener Kongress entscheidend Zar Alexander I. gefördert habe.4 Dort war auch Kościuszko als Botschafter anwesend gewesen. Die Neutralität der Schweiz dürfte er begrüsst haben. Doch zugleich bedeutete für ihn der Kongress eine herbe Enttäuschung, weil der Zar sein Versprechen nicht hielt: Zwar wurde ein neues Königreich Polen geschaffen, jedoch nicht als unabhängiger Staat, sondern in Personalunion mit dem Zaren verbunden. 3 Vgl. verschiedene Beiträge in: »Der letzte Ritter und erste Bürger im Osten Europas.« Kościuszko, das aufständische Reformpolen und die Verbundenheit zwischen Polen und der Schweiz, hrsg. von Heiko Haumann und Jerzy Skowronek unter Mitarbeit von Thomas Held und Catherine Schott. Basel 1996 (2. Aufl. 2000). 4 Der Beschluss des Corporationsrathes in: Urner Wochenblatt Nr. 100, 23.12.1987.
Zwei osteuropäische »Helden« in der Schweiz
|
273
Militärische Gegner, deren Wege auch über die Schweiz führten: Wie sind sie als Persönlichkeiten zu charakterisieren? Haben sie etwas gemeinsam? Tadeusz Kościuszko war ein «Held zweier Welten», «der letzte Ritter und erste Bürger» im Osten Europas – nach einer Formulierung Jules Michelets –, »Patriot und Weltbürger«.5 Geboren in Mereczowszczyzna, einem adligem Landsitz im litauischen Teil des Königreiches, als Sohn einer ukrainischen Mutter und eines weissrussischen Vaters, schlägt er zunächst die traditionelle Laufbahn ein. Unter der Protektion des Fürsten Adam K. Czartoryski tritt er in die Warschauer Kadettenanstalt ein, erhält eine gründliche militärische Ausbildung und kommt mit den höchsten Kreisen der Gesellschaft in Kontakt. 1769 vervollständigt er seine Kenntnisse in Frankreich, namentlich für den Festungs- und Brückenbau. Daneben zeigt er künstlerische Talente: Er malt, dichtet, komponiert. Enttäuscht von den Verhältnissen in seinem Heimatland, lässt er sich 1776 von Beaumarchais für den Unabhängigkeitskrieg in Nordamerika anwerben und trägt als Festungsingenieur wie Feldoffizier wesentlich zum Sieg der Amerikaner bei. Befreundet mit Thomas Jefferson, geachtet von George Washington, zum Brigadegeneral ernannt, mit hohen Auszeichnungen versehen, mit einem Landgut und hohem Sold beschenkt, reist er 1784 zurück nach Polen. Zunächst als republikanisch gesonnener »Amerikaner« und Aufklärer misstrauisch beobachtet, zieht er sich auf sein Gut zurück, bis ihn der polnische König im Zusammenhang mit den verstärkten Reformanstrengungen, die 1791 in die erste Verfassung Polens einmündeten, in eine führende Stellung im Heer beruft. 1792 leitet er zusammen mit Fürst Józef Poniatowski den Abwehrkampf gegen die Truppen der Zarin Katharina II. (1729–1796), die kein gefestigtes und dazu noch «revolutionäres» Polen dulden will. Die Niederlage Polens führt zur Zweiten Teilung, so wie dann 1794 der gescheiterte Aufstand zur Dritten. Zwischen den beiden Kriegen hält sich Kościuszko in Frankreich auf, wo er nach der Revolution von 1789 zusammen mit Pestalozzi, Washington, Klopstock und Schiller zum Ehrenbürger ernannt worden war. Seine Bestrebungen, Hilfszusagen für die polnische Sache zu erhalten, schlagen ebenso fehl wie später der Versuch, Napoleon zu gewinnen. Im Aufstand von 1794 propagiert Kościuszko die «polnische Nation» nicht mehr nur – wie bisher – als den Adel, sondern als das gesamte Volk, die Bauern, die Städter, die Frauen, die Juden. Niemand soll ausgegrenzt werden, der ihr angehören will. Viele adlige Gutsbesitzer torpedieren deshalb seine Politik. Nach dem Zusammenbruch des Volksaufstandes wird Kościuszko nach Russland transportiert. Der neue Zar, Paul I. (1754–1801), schenkt ihm die Freiheit, 1500 Leibeigene dazu, und ermöglicht ihm die Ausreise in die USA.6 Kościuszko muss 5 Nora Koestler, Tadeusz Kościuszko. Held zweier Welten, in: Haumann/Skowronek, S. 29– 39. 6 Valentin Giterman, Geschichte Russlands. 2. Bd., Zürich 1945, S. 302.
274
|
Suworow und Kos´ciuszko
sich allerdings verpflichten, den Zaren als Oberherren Polens anzuerkennen. Dies bringt Tausenden von gefangenen Polen die Freiheit, ihm jedoch auch den Verratsvorwurf ein. In den USA wird er enthusiastisch gefeiert, und er stiftet sein dortiges Vermögen, um schwarze Sklaven zu befreien. 1798 nimmt er Wohnsitz in Paris, lässt sich aber weder von Napoleon noch von Alexander I. politisch vereinnahmen. In Solothurn schliesslich will er seinen Lebensabend verbringen, weil er, wie im Juni 1815 an Adam Czartoryski schreibt, «meinem Vaterland nicht mehr nützlich sein kann». Bekannt und populär ist er in der Schweiz bereits. So hatten 1798 die Anhänger der Helvetischen Revolution in Basel anlässlich eines Banketts ein Hoch auf »Cociusko« ausgebracht. Die Familie Zeltner kennt er aus Paris, in ihrem Kreis fühlt er sich wohl. Er unterrichtet die Tochter Emilie, hält sich aber vom Gesellschaftsleben fern. Die Hiesigen »sind Bären voller Stolz in ihrer Dürftigkeit. Widerspenstige Egoisten ohne jegliche Offenheit und die Welt nicht kennend. Schade, dass ein so schönes Land mit solchen besetzt ist«, berichtet er einem Freund in Warschau. Doch in der Solothurner Bevölkerung ist er beliebt, nicht zuletzt, weil er während der Hungersnot von 1816/17 zahlreichen Bedürftigen hilft. Daneben reist er viel und ist von den schweizerischen Landschaften begeistert. Mit Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827) ist er sich einig, dass nur durch die gemeinsame innere Kraft des ganzen Volkes die Freiheit errungen werden könne. Bildung sei dazu ein entscheidendes Mittel, und so plädiert er dafür, auch in Polen Einrichtungen nach dem Vorbild des Schweizer Pädagogen für alle Bevölkerungsschichten zu gründen. Kurz vor seinem Tod verfügt er testamentarisch, auf seinem litauischen Gut Siechnowice die Leibeigenschaft aufzuheben – unter der Bedingung, dass die dort ansässigen Bauern Schulen in ihren Dörfern erstellen. Am 15. Oktober 1817 stirbt Kościuszko in Solothurn. Nach seinem Willen wird sein Körper – wie Polen – dreigeteilt: der Leichnam in der Jesuitenkirche bestattet, bald darauf feierlich nach Krakau überführt und auf dem Wawel – der letzten Ruhestätte der polnischen Könige – noch einmal beigesetzt, die Eingeweide auf dem Zuchwiler Friedhof begraben und das Herz in eine Urne gelegt. Emilie Zeltner, der es vermacht ist, wacht zunächst darüber. Später gelangt es in das 1870 gegründete polnische Nationalmuseum in Rapperswil und kehrt nach 1918 in den wiedererstandenen polnischen Staat zurück, wo es bis heute im Warschauer Königsschloss aufbewahrt wird. Emilie Zeltner soll auch den handschriftlichen Brief des Zaren Alexanders I., in dem er die Wiederherstellung eines unabhängigen Polen versprochen hatte, bei Bedarf zur Unterstützung eines Aufstandes einsetzen. Durch Verrat gerät dieser Brief jedoch 1829 Metternich in die Hände. So ist Kościuszko noch in seinem Nachleben ein Nährboden für Legenden. Die Umstände seines Lebens schufen die Bedingungen, aus denen ein Held gemacht wird. Sein mehrfaches tragisches Scheitern, das zum Symbol für die
Zwei osteuropäische »Helden« in der Schweiz
|
275
vergeblichen Freiheitskämpfe Polens wurde, seine vielseitigen Talente, die das Bild des Feldherren ergänzten, seine politischen Überzeugungen, die ihn zum Repräsentanten eines reformfähigen, republikanischen Polens werden liessen, sein liebeswürdiger und doch starker Charakter mit Fehlern und Schwächen legten den Grund. Schon bald verkörperte er die Sehnsüchte des erniedrigten polnischen Volkes. Flugblätter, Lieder und Gedichte, Romane und Erzählungen sowie unzählige bildliche Darstellungen nährten, in unterschiedlicher Form je nach den Zeitumständen und politischen Absichten, die Legenden, ja den Kult um Kościuszko, gemischt aus Wahrheit und Wunschdenken. Vielleicht wurde er der Idealfall eines Helden, weil er niemals wirkliche politische Macht erhielt: Er musste keine unbequemen und ungeliebten Entscheidungen fällen, die seinen Ruhm hätten verblassen lassen.7 Suworow hingegen erscheint auf den ersten Blick als reiner Kriegsheld. Während Kościuszko fast uneingeschränkt Sympathie zuströmte – Kritik an seiner Politik fand keine Resonanz –, wurde Suworow in der Satire und Karikatur seiner militärischen Gegner als blutrünstiges Monster dargestellt, in Russland selbst andererseits als überlegener Feldherr verehrt. Geboren als Sohn eines Generals8, trainiert er sich, obwohl von schwächlicher Gesundheit, von Jugend an unter dem Eindruck der Biographie Cäsars auf die militärische Laufbahn hin. Askese und Verabscheuung des Luxus bleiben Kennzeichen seiner Lebensführung. Seine militärische Karriere ist beeindruckend und personifiziert wesentliche Ereignisse in der Geschichte Russlands: Nachdem er schon im Siebenjährigen Krieg auf sich aufmerksam gemacht hat, erringt er 1774 einen wichtigen Sieg im Krieg Russlands gegen das Osmanische Reich, der die Friedensgespräche vorbereitet. Aufgrund dessen werden Truppen frei, und so leitet Suworow im selben Jahr die ausschlaggebenden Aktionen gegen den Volksaufstand unter Jemeljan I. Pugatschow (1742–1775). Nach dessen Gefangennahme führt er mit ihm ein langes Gespräch über seine politische Pläne und militärischen Strategien. 1787 zeichnet er sich in einem weiteren Krieg mit dem Osmanischen Reich erneut aus. Nach dem Fluss, an dem eine bedeutende Schlacht stattfand, verleiht ihm die Zarin Katharina II. 1789 den Ehrentitel »Rymnikskij« und erhebt ihn in den Grafenstand. Die »Befriedung« Polens 1771 und besonders 1794 bringt ihm den Rang eines Feldmarschalls ein; darüber hinaus schenkt ihm die Zarin rund 7000 leibeigene 7 Biographie und Charakteristik Kościuszkos nach Heiko Haumann, Thomas Held, Catherine Schott, »Noch ist Polen nicht verloren ...« Tadeusz Kościuszko und die Bedeutung des Aufstandes von 1794, in: Haumann/Skowronek, S. 3–24, vgl. auch weitere Beiträge in diesem Band. Die testamentarisch verfügte Aufhebung der Leibeigenschaft ist z. B. abgedruckt in: Lettres des Soleure de Tadeusz Kościuszko, 1815–1817. Facsimilés et textes, hrsg. von J. A. Konopka, Genève 2000. 8 Jurij M. Lotman, Russlands Adel. Eine Kulturgeschichte von Peter I. bis Nikolaus I., Köln u. a. 1997, S. 266.
276
|
Suworow und Kos´ciuszko
Bauern. Die Vertreibung der Franzosen aus Oberitalien macht ihn zum Fürsten »Italijskij«. Suworow steht auf der Höhe seines Ruhmes, und der Übergang über die Alpenpässe erregt in ganz Europa Aufsehen. Und doch fällt er beim Zaren Paul I. in Ungnade, obwohl das Scheitern des Feldzuges in der Schweiz nicht auf Fehler Suworows, sondern auf die mangelnde Unterstützung seitens Österreichs zurückgeht. Verbittert zieht sich Suworow zurück und stirbt kurz darauf.9 Der Konflikt mit dem Zaren deutet darauf hin, dass der Feldherr vielleicht doch nicht nur als loyaler adliger Offizier charakterisiert werden kann. Die Zeitgenossen berichten Widersprüchliches. Wie ein Kind habe er sich oft verhalten, daneben aber auch tiefe Gedanken eines Philosophen von sich gegeben. Im Krieg lebt er so karg wie der einfachste Soldat. Nach seinem Tod widmet ihm der berühmte Lyriker Gawrila R. Derschawin (1743–1816) das Gedicht «Snigir», in dem es heisst: »Wer jagt entflammt vor dem Heer einher / Auf einem Klepper, isst hartes Brot; / In Frost und Glut gestählt des Schwertes Wehr, / Nächtigt auf Stroh, wacht bis zum Morgenrot.«10 Suworows Handeln, sich streng an seine eigenen Befehle zu halten, keine Privilegien zu beanspruchen, die übliche Soldatenkost zu essen, sich mit den Leuten zu stellen, als sei er ihresgleichen, eben ein «gemeiner Herr», lobt auch der in Basel geborene Johann Peter Hebel (1760– 1826) in zweien seiner Kurzerzählungen.11 Beeinflusst von antiken Autoren wie von Rousseau folgt Suworow dem Prinzip »Tugend und Heroismus stehen höher als vornehme Herkunft«, wie er in einem Brief schreibt. Nicht die Abstammung aus dem Adel bestimme mehr die Befähigung zum Offizier.12 So inszeniert er sich selbst als «natürlichen» Menschen und zugleich gemäss der russischen Tradition des »Gottesnarren«, der mit asketischer Lebensweise sowie Vortäuschung einer Geisteskrankheit oder »Kindlichkeit« den Widerspruch zwischen christlichem Anspruch und weltlicher Wirklichkeit aufdeckt und dabei selbst dem Herrscher die Wahrheit sagen kann.13 Suworow zeigt sich im Gespräch als ein hochgebildeter Mensch, wenig später gebärdet er sich als Hofnarr und Schelm, mit vielen Schrullen und Marotten, um sich zugleich wie »Cato« zu äussern.14 Von seinen Soldaten wird er deshalb verehrt und geliebt. Im Umgang mit der Zarin oder dem Zaren und überhaupt bei Hofe soll er ebenfalls eine Atmosphäre des Spiels um sich verbreitet haben, um auf diese Weise 9 Vgl. Giterman, S. 232, 235, 281, 283–284, 285, 294, 302, 305–306, 483. 10 Lotman, S. 312, vgl. S. 313: DerŽavin schrieb ein zweites Gedicht auf Suvorov, das er nicht veröffentlichte und in dem er den heldischen Charakter noch stärker betonte. 11 Johann Peter Hebel, Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes, Frankfurt a. M. 1984, S. 158–159, 238–239. 12 Lotman, S. 295. 13 Lexion der Geschichte Russlands. Von den Anfängen bis zur Oktober-Revolution, hrsg. von Hans-Joachim Torke, München 1985, S. 248. 14 Vgl. Lotman, S. 295–296.
Zwei osteuropäische »Helden« in der Schweiz
|
277
auch unbequeme Ansichten zu vermitteln. In den zeitgenössischen Zeugnissen wird er, wenn nicht als Kind, als Schauspieler beschrieben, der brillant seine Masken zu wechseln verstehe. Das gilt sogar für seine militärischen Rapporte. Sind sie einmal wie stossweise vorgebrachte, aufgeregte, fast ungereimte mündliche Meldungen verfasst, berichtet Suworow dem Zaren von der Alpenüberquerung in einem ungewöhnlichen literarischem Stil: »Bei jedem Schritt in diesem Reich des Schreckens gähnten die Abgründe wie offene Särge, bereit, alles zu verschlingen. Stockfinstere Nächte, ununterbrochene grollende Donner, strömender Regen und dichte Nebelschwaden über tosenden Wasserfällen, die mit Gesteinsbrocken von den Gipfeln herniederstürzten, vergrösserten noch das Entsetzliche. Dort taucht vor unseren Blicken der Berg Sankt Gotthard auf, der all die anderen Berge überragt, um deren Kämme gewitterträchtiges Gewölk und Wolken schwimmen; (...) Alle Gefahren, alle Schwierigkeiten werden überwunden; und trotz dieses Ringens der Truppen mit allen Elementen kann der Feind, der sich in den Schluchten und an den unzugänglichsten und vorteilhaftesten Stellen eingenistet hat, dem Heer, das unvermutet auf dieser neuen Szenerie erscheint, nicht widerstehen. (...) Das Heer Eurer Kaiserlichen Majestät durchquert die düstere Felsenschlucht Urner Loch und erobert eine Brücke, die, ein wunderliches Schauspiel der Natur, zwischen zwei Bergen errichtet wurde und den Namen Teufelsbrücke erhalten hat. Sie wurde vom Feind zerstört, aber das hielt die Sieger nicht auf. Die Bretter werden mit den Schärpen der Offiziere zusammengebunden. (...) Im glitschigen Morast versinkend, musste man die Besteigung in Front und inmitten eines tosend herabstürzenden Wasserfalls durchführen, der tobend fürchterliches Gestein und vereiste Felsbrocken schleuderte, die viele Menschen mit ihren Pferden in rasender Schnelligkeit in die Höllenstrudel hinabrissen. (...) Kein Gemälde reicht aus, dieses Bild der Natur in ihrer ganzen Ungeheuerlichkeit wiederzugeben!«15 Wie bei Kościuszko treten somit auch bei Suworow durchaus vielseitige Persönlichkeitsmerkmale hervor. Und ähnlich wie Kościuszko, der in der Liebe enttäuscht wird, findet Suworow privat kein Glück, obwohl er mit 45 Jahren die 20 Jahre jüngere Warwara Iwanowna Prosorowskaja heiratet. Vermutlich kann sie mit seiner Kindlichkeit und zugleich Gelehrtheit nichts anfangen, er wiederum nichts mit ihrem Selbstbewusstsein und Herrschaftsanspruch. Als alle Versöhnungsversuche misslingen, nutzt die Gattin 1797 das kühle Verhältnis zwischen Zar Paul und Suworow aus, um hohe finanzielle Forderungen und den Wunsch nach einem Gut durchzusetzen. Der Zar unterstützt sie, doch Suworow kann ihre Anliegen aufgrund seiner schlechten materiellen Lage nur teilweise erfüllen.
15 Lotman, S. 301.
278
|
Suworow und Kos´ciuszko
Gereizt wendet er sich 1798 an Paul mit der Bitte, ihm den Eintritt in ein Kloster zu erlauben.16 Der Krieg mit Frankreich durchkreuzt diesen Plan. Vordergründig scheinen Pauls Massnahmen gegen die Vorrechte des Adels und sein Misstrauen gegen alle, die unter seiner Mutter aufgestiegen waren, zur Zerrüttung seiner Beziehungen zu Suworow geführt haben. Doch dessen Persönlichkeit lässt vermuten, dass die Ursachen tiefer liegen. Offen gibt er seiner Verachtung für Pauls Preussenfreundlichkeit Ausdruck, die auch zu einer Übernahme preussischer Uniformen führen: »Puder ist kein Pulver, Löckchen sind keine Kanonen, der Zopf ist kein Bajonett, und ich bin kein Deutscher, sondern ein Russe.« Dafür wird er auf sein Gut verbannt und unter Polizeiaufsicht gestellt.17 Andererseits weigert er sich, sich an einer Adelsverschwörung gegen den Zaren zu beteiligen. Allein, dass er gefragt wurde, wird dem Zaren bekannt und gibt ihm Anlass, dem Feldmarschall bei seiner Rückkehr aus Italien und der Schweiz keinen würdigen Empfang zu gewähren. Ist also Suworow, wenngleich in seinem Charakter «unverwechselbar und in der Geschichte einzigartig», »ein Mensch des 18. Jahrhunderts« mit allen Widersprüchen dieses Jahrhunderts, »ein Mensch der Epoche Katharinas«?18 Gewiss ist er ein Patriot, und die Französische Revolution lehnt er – anders als Kościuszko – aus voller Überzeugung ab. Aber er ist auch kein unkritischer Anhänger der Monarchie und Autokratie. Sein unabhängiges Verhalten gegenüber der Zarin und dem Zaren, das Bewusstsein seiner eigenen Würde, seine politischen Pläne einer Einigung Italiens und eines Feldzuges gegen Frankreich, aber ohne royalistische Emigranten, sein am Beispiel antiker Verhältnisse geäusserter Wunsch nach einer Versöhnung zwischen »Patriziern« und »Plebejern«, seine klare Einschätzung künftiger Kriege, noch mehr seine spielerische, mit Gelehrtheit gepaarte Kindlichkeit, die ein neues menschliches Verhalten erprobt, machen ihn zu einem Menschen, der über seine Zeit hinausweist. Suworow ist kein »Held zweier Welten« wie Kościuszko, der zum Symbol des Freiheitskampfes und des tragischen Scheiterns wird. Er ist der »Held« seiner Soldaten, und er wird, obwohl er die militärische Unterdrückung des Volksaufstandes in Russland wie des Freiheitskampfes in Polen verkörpert, zum Symbol würdigen, ehrenvollen Auftretens auch gegen die Mächtigen in einer Welt des Übergangs.19 16 Lotman, S. 129–130, 302–303. Geliebt hat Suvorov seine Tochter NataŠa, er zog sich jedoch nach ihrer Heirat von ihr zurück. Das Verhältnis zu seinem Sohn Arkadij blieb ohnehin kühl (ebd., S. 303–307). 17 Giterman, S. 302 mit Anm. 1. Paul hatte übrigens auch eine Beziehung zur Schweiz, vgl. Edmund Heier, Studies on Johann Caspar Lavater (1741–1801) in Russia, Bern u. a. 1991. 18 Lotman, S. 293, 308, 311. 19 Vgl. insgesamt Lotman, S. 133, 177, 192–193, 196, 230, 277–279, 292–313. Lotman weist darauf hin, dass Tolstoj in »Krieg und Frieden« mit Hauptmann Tuschin einen Offizier gezeichnet habe, der einer derartigen Bewertung Suvorovs nahekomme.
Zwei osteuropäische »Helden« in der Schweiz
|
279
In der Schweiz gelangte Suworow zu Ansehen durch die Überquerungen der Alpenpässe, durch sein umgängliches Verhalten und seine Sorge um Disziplin der Truppen, teilweise auch als Repräsentant des Kampfes gegen die französische Ordnungsmacht in der Zeit der Helvetik.20 Das Denkmal in der Schöllenen, das den dort gefallenen Russen gewidmet ist, war bei seiner Errichtung 1898 nicht unumstritten. Das Elend und die Schmach der Eidgenossenschaft werde hier verewigt. Doch es setzte sich die Meinung durch, dass es in erster Linie um die Ehrung der Toten gehe – und eben um jene Kämpfe, die schliesslich zur Unabhängigkeit und Neutralität der Schweiz geführt hätten. In den Presseberichten anlässlich der Denkmalseinweihung wurde das »einzigartige Schauspiel« gewürdigt, »wie es die Schöllenen kaum mehr bieten werden. Das Tosen der Reuß, gemischt mit russischen Todtengesängen. Die wildromantische Natur und dieser fremde Hofstaat, die bunten Wimpel und gläzenden Uniformen, dazu die wirksame Staffage, welche das freilich nicht sehr zahlreich herbeigeeilte Landvolk bildete – Alles im freundlichen Sonnenlichte. Wirklich ein malerisches Bild!« Irritiert zeigte sich der Berichterstatter allerdings vom »Allianzrummel« während des Banketts, als die Vertreter des russischen und französischen Staates wechselseitige Toasts auf die ehemals feindliche Armee ausbrachten.21 Der »Held« wird je nach Bedarf instrumentalisiert. Auch heute wird Suworows Andenken in der Schweiz noch hochgehalten. Zum hundertjährigen Jubiläum seines Feldzuges veranstalteten die Regierungen beider Staaten eine Gedenkfeier am Denkmal, es gibt SuworowGesellschaften und einschlägige Museen.22 Der Mensch Suworow ist dabei in den Hintergrund getreten, es überwiegen politische Absichten und die Bewunderung einer militärischen Leistung, für die letztlich auch das Schöllenen-Denkmal steht. Kann dies damit zusammenhängen, dass der Öffentlichkeit Russland als ein besonders »fremdes« Land erscheint, so dass das Besondere des »Helden« Suworow nicht nachvollzogen werden kann?
20 Vgl. z. B. Werner Arnold, Uri und Ursern zur Zeit der Helvetik 1798–1803. Historisches Neujahrsblatt. Doppelheft 1984/85, N. F. 39/40, 1 Reihe H. 75/76, Altdorf 1985. Eher negativ wurden die russischen Truppen bei Zürich gesehen: Irène Trochsler, Schweizerische Reaktionen auf die Korsakovschen Besatzungstruppen des Jahres 1799, in: Bild und Begegnung. Kulturelle Wechselseitigkeit zwischen der Schweiz und Osteuropa im Wandel der Zeit, hrsg. von Peter Brang u. a. Basel/Frankfurt a. M. 1996, S. 73–96. Ein Vergleich der »Bilder« wäre interessant. 21 Gotthard-Post Nr. 40, 1.10.1898. 1892 hatten Russland und Frankreich eine Militärkonvention abgeschlossen, die der Zar Anfang 1894 in Kraft setzte und eine neue Mächtekonstellation in Europa einleitete. 22 Vgl. Gotthard-Post Nr. 48, 4.12.1971; Urner Kalender 1977, S. 64–66; Urner Wochenblatt Nr. 100, 23.12.1987 und Nr. 1, 4.1.1992; Neue Luzerner Zeitung/Neue Urner Zeitung Nr. 139, 19.6.1997; NZZ, 3.4.1998.
280
|
Suworow und Kos´ciuszko
Bei Kościuszko wird hingegen nach wie vor die Sympathie für seine Persönlichkeit herausgestrichen. Lange Zeit war auch das politische Interesse sichtbar, wie an den zahlreichen Feierlichkeiten zu seinen Ehren gezeigt werden kann: Den polnischen Emigranten, die sich an seiner Grabstätte und seinem Denkmal in Zuchwil oder später in Rapperswil versammelten, ging es darum, die Erinnerung an die Freiheitskämpfe wachzuhalten.23 Schweizer Politiker beteiligten sich oft dann an den Feiern, wenn sie meinten, dass die Propagierung der Ideen Kościuszkos ihre eigenen Ansichten stärken könnten. Anderen lagen die schweizerisch-polnischen Beziehungen am Herzen – beide Länder haben ein gutes »Bild« voneinander.24 Die heute noch tätige Solothurner Kościuszko-Gesellschaft, die auch ein Museum an dessen früherem Wohnsitz betreibt, ist ein Beispiel dafür. Immer mehr hat sich dann in den Vordergrund geschoben, was für Suworow noch nachzuholen ist: der Mensch Kościuszko, die faszinierende Persönlichkeit, die Grösse im Scheitern. Schang Hutters Gedenkfigur von 1967 in Solothurn drückt diese Wandlung der Sichtweise aus: ein armseliger »Held«, aber ein Mensch mit aufrechtem Gang.
23 Halina Florkowska-Frančić, Kościuszko-Feierlichkeiten in der Schweiz zwischen 1817 und 1917, in: Haumann/Skowronek, S. 319–330; dies., Die Schweiz in den Augen polnischer Bauern am Ende des 19. Jahrhunderts, in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 50, 2000, S. 73–81. 24 Vgl. Marysia Morkowska, Vom Stiefkind zum Liebling. Die Entwicklung und Funktion des europäischen Schweizbildes bis zur Französischen Revolution, Zürich 1997; Marek Andrzejweski, Schweizer in Polen. Spuren der Geschichte eines Brückenschlages, Basel 2001.
»Eine sozialistische Lebensweise der Zukunft«? Schicksale im Stalinismus zwischen 1929 und 1939*1
Fünf Lebenssituationen
Wir schreiben das Jahr 1929. Oskar Hartoch arbeitete im Leningrader Institut für experimentelle Medizin. Er zählte zu den bedeutendsten Immunologen Russlands. 1881 war er im damaligen St. Petersburg als Sohn eines russlanddeutschen Ehepaares geboren worden. Seine Ausbildung als Mediziner hatte er in Deutschland erfahren, später als Privatdozent einige Jahre am Institut für Hygiene und Bakteriologie der Universität Bern geforscht. 1915 war er – als russischer Staatsbürger – nach Russland zurückgekehrt, um im Militärsanitätsdienst tätig zu sein. Nach der Oktoberrevolution hatte er sich entschieden, im Land zu bleiben, weil ihm die wissenschaftlichen Perspektiven verlockend erschienen. Seine Forschungen, die zu wichtigen neuen Erkenntnissen über Infektionserkrankungen und deren Bekämpfung führten, fanden international eine herausragende Resonanz. In der Sowjetunion erhielt er zahlreiche Auszeichnungen. Er begründete eine wissenschaftliche Schule, aus der bis heute viele vorzügliche Mediziner hervorgegangen sind. 1930 sollte er Leiter der Abteilung für Mikrobiologie und Immunologie an seinem Institut und wenig später auch Leiter des Leningrader Pasteur-Instituts für Epidemiologie und Mikrobiologie werden. Es sah so aus, als stehe ihm eine glänzende Zukunft bevor. Silja Jankowskaja war als Physiologin im Leningrader Pawlow-Institut tätig und dort beteiligt an jenen berühmten Experimenten mit Hunden, deren Ergebnisse als »Pawlowsche Reflexe« bekannt geworden sind: Durch bestimmte Erfahrungen reagieren Lebewesen gleichsam automatisch auf einen angebotenen Reiz. Geboren wurde Silja Jankowskaja 1901 im weissrussischen Gomel, als Tochter einer armen jüdischen Familie. Die Sowjetherrschaft eröffnete ihr ungeahnte Möglichkeiten: eine entschiedene Ablehnung des zuvor immer spürbaren Antisemitismus, Bildungschancen, Betätigung für eine ideale Gesellschaft der Zukunft. Sie wurde zu einer überzeugten Kommunistin, trat dem Komsomol, dem Kommunistischen Jugendverband, dann der Partei bei, heiratete Rafail Jankowski, einen angesehenen Parteiarbeiter und Theoretiker, der an der Leningrader Universität einen Lehrstuhl für Philosophie erhielt und 1934 ein Philosophie-Lehrbuch ver* Erstpublikation: »Eine sozialistische Lebensweise der Zukunft«. Die Sowjetunion zwischen 1929 und 1939. In: Utopie und Terror. Josef Stalin und seine Zeit. Hg. von Eva Maeder und Christina Lohm. Zürich 2003, S. 15–39.
282
| »Eine sozialistische Lebensweise der Zukunft«?
öffentlichte. Die beiden hatten zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. 1929 meldete sich Silja Jankowskaja freiwillig als Agitatorin, um Bauern in der Ukraine zum Eintritt in Kollektivwirtschaften zu bewegen. Sie sah das als ihre Pflicht an, hatte aber auch noch einen ganz persönlichen Beweggrund. Ihr Mann hatte zu dieser Zeit eine Affäre mit einer anderen Frau, und sie wollte über diese Enttäuschung hinwegkommen. So reiste sie im Winter 1929 in die Dörfer. Stepan Podlubny, 1914 geboren, stand sozusagen auf der anderen Seite. Seine Eltern, die mit ihm in einem ukrainischen Dorf im Gouvernement Kiew wohnten, galten als »Kulaken«, als Klassenfeinde, weil sie in der zaristischen Zeit etwas wohlhabender als andere Bauern gewesen waren. Nach der Oktoberrevolution war die Familie bereits mehrfach diskriminiert und verfolgt worden. Sie besass jetzt nur noch vier Desjatinen Land (etwa viereinhalb Hektar, also nicht eben viel) und auch sonst keinen Reichtum. Dennoch, im Winter 1929/30 wurde sie vollständig enteignet, der Vater nach Archangelsk verbannt. Mutter und Sohn machten sich nacheinander auf den Weg, den Vater zu suchen und eine neue Existenz aufzubauen. Lew Loginow war 1902 auch in einem Dorf – im Gebiet Wladimir – geboren worden, allerdings nicht in einer Bauern-, sondern in einer Arbeiterfamilie. Während seiner Kindheit hatte er viel Not und Elend kennen gelernt, und insofern musste ihm die Oktoberrevolution als tatsächliche Befreiung erscheinen. Begeistert hatte er sich den Kommunisten angeschlossen, war 1918 von zu Hause fortgelaufen, in die Rote Armee eingetreten, hatte dort bis 1923 gedient und sich dabei an der Niederschlagung von Bauernaufständen 1920/21 beteiligt. Anschliessend war er mit verantwortungsvollen Aufgaben im Interesse der Partei betraut worden, etwa 1924 mit der »Säuberung« der juristischen Fakultät der Universität Saratow von »parteifeindlichen Elementen«. Nach einer speziellen Ausbildung erhielt er 1929 eine Kaderstelle im Moskauer Staats-Trust für Laborausstattung und Instrumentenbau. Zu seinen Aufgaben gehörte es, die Jahreskontrollziffern des Unternehmens für den ersten Fünfjahrplan zu erstellen. Mit grosser Energie stürzte er sich in die Arbeit. Nachdem er den stellvertretenden Leiter des Trusts wegen des bisherigen, angeblich zu langsamen Produktionstempos kritisiert hatte, wurde dieser abgesetzt, und Loginow übernahm seinen Platz. Nachdrücklich sorgte er nun dafür, dass die Planvorgaben erfüllt wurden. Ingenieure und Direktoren, die das Produktionstempo für überhöht hielten, wurden entlassen. Simeon Dmitrewski war 1929 acht Jahre alt. Er lebte mit seinen Eltern und seiner Schwester Alexandra in Leningrad auf der Wassili-Insel. Geboren worden war er 1921 in Freiburg i. Br. Sein Vater Michail, der einem berühmten russischen Adelsgeschlecht entstammte, war 1907 wegen seiner Beteiligung an der revolutionären Studentenbewegung aus Russland ausgewiesen worden. Er hatte in Deutschland Geschichte und Philosophie studiert, 1912 in Freiburg in Ge-
Die Sowjetunion zwischen 1929 und 1939
|
283
schichte promoviert und 1919 Rosa Graf geheiratet, eine Bauerntochter aus einem Schwarzwalddorf. Von 1920 bis 1922 war er als Lektor für russische Sprache und Literatur an der Universität Freiburg beschäftigt worden – er begründete damit die dortige Slawistik –, hatte sich dann aber entschlossen, wieder nach Russland zurückzukehren. Hier hatte die »Neue Ökonomische Politik« seit 1921 zu einer gewissen Liberalisierung im wirtschaftlichen Leben, ja auch im Alltag geführt, nachdem das Experiment, in einem raschen Anlauf unmittelbar den Kommunismus anzustreben und die gesellschaftlichen Utopien so schnell wie möglich Wirklichkeit werden zu lassen, gescheitert war. Wer bereit war, die Sowjetordnung anzuerkennen und loyal mitzuarbeiten, galt jetzt als willkommen, auch wenn er oder sie kein Kommunist war. Michail Dmitrewski also zog 1925 mit seiner Familie nach Russland. Zunächst arbeitete er als Vertreter einer Freiburger Holzhandelsfirma, dann wurde er Bibliothekar in der Akademie der Wissenschaften in Leningrad. Simeon erinnert sich an eine glückliche Kindheit dort. In ihrem Quartier gehörte er einer Jugendgruppe an, die sich Fehden mit einer anderen lieferte. Zugleich war er Mitglied der Pioniere, einer Jugendorganisation, die vom Komsomol betreut wurde. Sie fuhren ins Lager, machten Exkursionen, besuchten Museen und Theater, bildeten Zirkel für besondere Interessengebiete – Simeon sammelte Briefmarken. Enthusiastisch nahm er – wie seine Mitschüler – die gerade jetzt intensiv in die Öffentlichkeit gebrachten Erinnerungen an die »heroische Periode« der Sowjetgeschichte – die Zeit des Bürgerkrieges – auf. Den kämpferischen Einsatz der damaligen Generation wollten viele Kinder und Jugendliche auch erleben. Simeon erzählt heute noch von einem Kinobesuch seiner Klasse ein wenig später, als sie den 1933/34 gedrehten und sehr populären Film über Tschapajew und die heldenhaften Taten der Roten Armee anschauten. Die Jugendlichen hatten Schleudern dabei, und als die »Weissen«, die gegenrevolutionären Truppen, Tschapajew und seine Leute angriffen, schossen sie damit auf die Leinwand, um beim Kampf gegen die Feinde zu helfen. Auf der anderen Seite besuchte Simeon aber auch mit seiner Mutter, die katholisch geblieben war, jeden Sonntag die Kirche und beging die katholischen Feiertage. Für ihn war das offenbar kein Widerspruch zu seiner Anteilnahme am Aufbau des Sozialismus, wie er ihn in der Schule erlebte: Der erste Fünfjahrplan wurde ständig behandelt, jeder Fortschritt gefeiert. Arbeiter und Ingenieure kamen, um den Schülerinnen und Schülern über ihre Tätigkeit und von ihren Erfolgen zu erzählen. Diese waren stolz auf die Sowjetunion, das erste sozialistische Land, das zu solchen, vom Proletariat der ganzen Welt bewunderten Leistungen fähig war. Fünf Lebenssituationen 1929. Sie sind mehr oder weniger zufällig aus einer Fülle von Selbstzeugnissen ausgewählt, die wir inzwischen über die dreissiger Jahre – sowie deren Vor- und Nachgeschichte – kennen. In unterschiedlicher Weise repräsentieren sie soziale Milieus, Einstellungen zur Sowjetherrschaft und zur Kommunistischen Partei, blicken mit verschiedenartigen Sichtweisen auf die damaligen
284
| »Eine sozialistische Lebensweise der Zukunft«?
Vorgänge. Versuchen wir einmal, ihre Sichtweisen nachzuvollziehen, um die Bedeutung der Zeit für die Menschen zu ermessen. Der »grosse Umbruch« – eine Flucht nach vorn
1929 war das Jahr einer entscheidenden Wende. Die Neue Ökonomische Politik hatte nicht die erwarteten Ergebnisse erbracht. Immer wieder war es zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten gekommen, seit 1927 etwa zu einer schweren Krise bei der Getreideversorgung der Städte. Lebensmittel mussten rationiert werden. In der Partei kam es zu heftigen Auseinandersetzungen über die künftige Wirtschaftspolitik. Sollte sie das bisherige System beibehalten, das viele marktwirtschaftliche Elemente enthielt, oder einen Kurswechsel vornehmen, um die Industrialisierung des Landes zu beschleunigen und die Agrarproduktion zu verbessern? Mehrere Kommissionen beteiligten sich an der Ausarbeitung des ersten Fünfjahrplanes, der 1929 für die Zeit von 1928 bis 1933 in Kraft gesetzt wurde. Er sah eine Intensivierung des Industrialisierungsprozesses und den Beginn einer – freiwilligen – Kollektivierung in der Landwirtschaft vor, blieb aber im Rahmen des Systems der Neuen Ökonomischen Politik, fusste auf verhältnismässig soliden Berechnungen und ging von einem proportionalen Wirtschaftswachstum aus. Als dieser Plan 1929 verabschiedet wurde, war er allerdings bereits Makulatur. Die Wirtschaftskrise hatte sich weiter verschärft, nicht zuletzt weil die Partei- und Staatsführung keine klare Linie verfolgt, sondern mit einem Hin und Her sich einander widersprechender Massnahmen die Probleme noch vergrössert hatte. Zugleich nahmen die parteiinternen Kontroversen an Schärfe zu. Wie wir aus den Protokollen der Sitzungen des Politbüros, also des engsten Führungsgremiums der Partei, wissen, herrschte dort 1928 eine ausgesprochene Panikstimmung vor. Es schien so, als gebe es keinen Ausweg aus der Krise. Vielleicht werde diese sogar die Sowjetmacht hinwegschwemmen. Bestenfalls könne man sich nur durch einen energischen Schnitt retten. Stalin und seine Anhänger, die bisher zwischen den verschiedenen Flügeln in der Partei laviert hatten, um ihren Einfluss zu erhöhen, ohne sich inhaltlich über die zukünftige Politik eindeutig festzulegen, nutzten diese Stimmung. Nach der Zerschlagung der »linken Opposition« um Trotzki gelang es ihnen nun, die »rechte Abweichung« um Bucharin auszuschalten, der letzten grösseren Gruppe, die parteiintern der Macht Stalins gefährlich werden konnte. Damit war dann der Weg frei für einen radikalen Kurswechsel in der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. Anders als 1921, als in einer ähnlich ernsten Krise Lenin für einen »Rückzug« plädiert hatte, weil man auf Dauer nicht gegen die Mehrheit der Bevölkerung regieren könne, trat jetzt die Stalin–Fraktion die »Flucht nach vorn«
Die Sowjetunion zwischen 1929 und 1939
|
285
an. Sie entschloss sich, mit drastischen Massnahmen die Industrialisierung und Kollektivierung voranzutreiben, um die Ursachen der ökonomischen Probleme ein für allemal zu beseitigen und zugleich die »Störfaktoren« in Industrie und Landwirtschaft unter Kontrolle zu bringen. Das bedeutete: Die geplanten Wachstumsziffern wurden extrem heraufgesetzt, die Ziele der Industrialisierung und Kollektivierung sollten schneller als ursprünglich gedacht erreicht werden. Da man vor allem in den Dörfern Widerstand gegen die beschleunigte Zusammenlegung von Höfen in Kollektivwirtschaften erwartete – und dann auch erfahren musste –, dekretierte die Partei- und Staatsführung Ende 1929 / Anfang 1930 mit der »durchgängigen Kollektivierung« zugleich die »Liquidierung des Kulakentums als Klasse«. Der Klassengegner auf dem Land sollte vernichtet werden. »Kulaken« durften keiner Kollektiv- oder Sowjetwirtschaft angehören; wer von ihnen Widerstand gegen die neue Politik leistete, sollte – je nach Schwere der Handlung – deportiert oder sofort erschossen werden. In der Öffentlichkeit propagierte die Stalin-Fraktion diese Politik als »Durchbruch zum Sozialismus«. In der Tat machte sich eine kämpferische Aufbruchstimmung breit. Viele Anhänger der sozialistischen Idee, nicht nur Mitglieder der Kommunistischen Partei, fühlten sich wie erlöst. Das komplizierte System der Neuen Ökonomischen Politik mit ihren unerwarteten Rückschlägen, mit ihrer oft kaum erkennbaren Linie, mit ihren ungeliebten kapitalistischen Elementen und sozial unerwünschten Nebenwirkungen hatte immer mehr zur Hilflosigkeit, Resignation, ja Apathie geführt. Jetzt schien eine Rückkehr zu den Anfängen beschlossen, zu den Zielen der Oktoberrevolution, zu dem Versuch, den Kommunismus auf direktem Weg, ohne Umweg über den Kapitalismus, zu erreichen. Intensiv diskutierte man über die »sozialistische Lebensweise der Zukunft« (Altrichter/Haumann, S. 309), über neue Städte und neue Dörfer, die ihnen entsprächen, über neue künstlerische Formen, über die Umwandlung des Bildungswesens. Begeistert meldeten sich zahlreiche, vor allem jugendliche Kommunisten, Arbeiter, Lehrer, Wissenschaftler, Männer wie Frauen, um als Agitatoren in die Dörfer zu gehen und die Bauern zum Eintritt in die Kollektivwirtschaften, die Kolchosen, zu bewegen. Silja Jankowskaja war eine von ihnen. Dass der Klassenfeind bei dieser Gelegenheit vernichtet und Widerstand notfalls auch mit Gewalt gebrochen werden sollte, hielten die meisten für richtig: Die Revolution von 1917 schien damit vollendet zu werden, indem nach der Bourgeoisie in der Stadt nun auch das »bürgerliche Element« im Dorf zerschlagen werde. Darüber hinaus hatte sich Gewalt in der ersten Phase nach der Revolution scheinbar bewährt, um den bewaffneten Widerstand der inneren und äusseren Gegner im Bürgerkrieg zu brechen und die Sowjetordnung zu sichern. Offensichtlich war dies, nach Meinung vieler Menschen, eine in Krisenzeiten angemessene Problemlösungs-
286
| »Eine sozialistische Lebensweise der Zukunft«?
strategie. Man empfand sich wieder in »heroischen Zeiten«, die junge Generation – oder zumindest ein Teil von ihr – wollte für den Sozialismus ähnlich kämpfen wie die Bürgerkriegshelden. Die Faszination, die davon ausging, haben wir am Beispiel Simeon Dmitrewskis gesehen. So hatten die Agitatoren in der Regel nichts dagegen, wenn ihnen Einheiten der Geheimpolizei, der Miliz oder sogar der Roten Armee folgten, um der Freiwilligkeit beim Eintritt in die Kolchosen nachzuhelfen. In der Tat gab es Widerstand, mehr, als damals bekannt wurde und als wir bis vor kurzem wussten. Der Anstoss zum Widerstand ging vielfach von Bäuerinnen aus, die nicht bereit waren, ihren Hof aufzugeben und vor allem das Kleinvieh, für das sie traditionell verantwortlich waren, in die neuen Wirtschaften zu überführen. In manchen Gegenden wuchs sich der Widerstand zu regelrechten Kleinkriegen aus. Nicht nur »Kulaken«, sondern ganze Dörfer wehrten sich geschlossen gegen die Kommunisten und gegen die Kollektivierung. Für die Agitationsgruppen standen dennoch meist die »Kulaken« als Drahtzieher dahinter, und auch offizielle Verlautbarungen erweckten den Eindruck, als herrsche der verschärfte Klassenkampf im Dorf. Der Widerstand wurde gewaltsam und blutig gebrochen. Die Spezialabteilungen erschossen Tausende von Bauern und verurteilten noch mehr zur Deportation in die Verbannung oder in Straflager. Oft traf dies gar nicht die Wohlhabenden im Dorf oder diejenigen, die Widerstand geleistet hatten: Willkür und Denunziationen waren an der Tagesordnung. Dennoch sah die Stalin-Fraktion, dass sie auch politisch reagieren musste. Stalin bezeichnete Anfang März 1930 Gewalt als »dumm und reaktionär« (Altrichter/Haumann, S. 297) – damit sprach er sich eigentlich selbst das Urteil – und forderte eine Verlangsamung des Kollektivierungstempos. Vor allem setzte sich eine Form der Kollektivwirtschaft als Regel durch, die den bäuerlichen Familien ein wenig Vieh und ein Stück persönliches Hofland liess, das sie in eigener Verantwortung bearbeiten konnten. Aber immer blieb die Gewalt im Hintergrund. Und in den Kollektivwirtschaften waren die Bauern ständiger Kontrolle ausgesetzt, von der propagierten Selbstverwaltung konnte kaum die Rede sein, alle Überschüsse wurden den Kolchosen entzogen, das Einkommen willkürlich festgesetzt. Als Ergebnis dieser rigiden Politik ging die Agrarproduktion dramatisch zurück. Während die Lebensmittelversorgung der Städte notdürftig sichergestellt werden konnte, waren die Planziele für den Getreideexport nicht zu erfüllen. Und noch schlimmer: Die Vorräte für die Bauern selbst, für ihre eigene Ernährung wie für das Saatgut, schwanden zusehends. Als dann in der Ukraine noch eine Missernte hinzukam, folgte dort 1932/33 eine Hungersnot, die etwa vier bis sechs Millionen Menschen – die Schätzungen schwanken – das Leben kostete. Wiederum im Unterschied zu 1921 hielt die Partei- und Staatsführung alle Informationen darüber zurück und bat im Ausland nicht um Hilfe. Vor der Not der Menschen verschloss sie die Augen, wichtiger war ihr, auch auf diesem Wege die
Die Sowjetunion zwischen 1929 und 1939
|
287
Kontrolle über die Bauernschaft zu verstärken und jeglichen offenen Widerstand unmöglich zu machen. Erst ab Mitte der dreissiger Jahre begann sich allmählich die Agrarproduktion wieder zu stabilisieren, doch Nachwirkungen der Katastrophe waren noch lange zu spüren. Die Podlubnys gehörten zu den betroffenen »Kulaken«-Familien. Ihre Existenz war vernichtet. Merkwürdigerweise fand Stepan Podlubny das Vorgehen der Sowjetbehörden richtig. Auch auf dem Land sollte der Sozialismus einziehen, und dazu mussten solche Elemente wie sein Vater verschwinden. Er identifizierte sich vollständig mit den Zielen der Sowjetmacht, er wollte ein »Neuer Mensch« werden, der als Pionier die zukünftige Gesellschaft aufbaute, sich »zivilisiert« benahm und sich an »starken, klugen und selbstbeherrschten Menschen« orientierte (Tagebuch 27.12.1934). Drückte sich darin ein Generationenkonflikt mit seinem Vater aus (Tagebuch 13.8.1932)? Oder war diese Projektion eine Folge eines traumatischen Erlebnisses, etwa der Verfolgung der Familie nach der Revolution oder der gewaltsamen Enteignung 1929 selbst? Oder suchte er aufgrund eines gestörten Selbstwertgefühls, aufgrund einer geschwächten Identität, nach der Geborgenheit eines autoritativ angebotenen Weltbildes, eines Schutz-»Panzers«, wie es für so viele Menschen damals charakteristisch war? Kam vielleicht alles zusammen? Wie dem auch sei, Stepan Podlubny spiegelte mit gefälschten Papieren eine proletarische Herkunft vor und erlangte auf diese Weise 1930 in Moskau einen Arbeitsplatz in der Druckerei der Parteizeitung »Prawda«. Die Kollektivierung, die immer mehr Höfe umfasste, bis gegen Ende der dreissiger Jahre praktisch das gesamte Land in Kollektiv- und Sowjetwirtschaften organisiert war, wurde offiziell als Sieg des Sozialismus gefeiert. In Wirklichkeit entfremdete sie auf Dauer die meisten Menschen auf dem Land von der Idee des Sozialismus. Ein aussagekräftiger Indikator ist die Tatsache, dass die Mehrzahl der Bauern viel Engagement und Arbeitskraft in ihr persönliches Hofland steckte, für die Kolchose jedoch nur das Nötigste leistete. Klagen über »Bummelei«, über unsachgemässe Behandlung des Inventars oder bevorzugte Arbeit auf dem eigenen Hofland, die sich immer wieder finden (und im Grunde sich bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion durchziehen), machen deutlich, dass die Bauern hier ihren »Eigen-Sinn« zum Ausdruck brachten. Die Kollektivwirtschaft war im Grunde nicht »ihre« Sache. Diese Haltung, die Kämpfe bei der Durchsetzung der staatlichen Politik mit den vielen Todesopfern und Deportationen, der starke Abfall der Agrarproduktion hatten unmittelbare Folgen auch für die Industrialisierung. Eigentlich war geplant, dass die notwendigen zusätzlichen Mittel für die Beschleunigung des industriellen Aufbaus durch Gewinne über den Getreideexport hereinkommen sollten. Das gelang nicht. Ebenso wenig konnten, wie beabsichtigt, die Herstellungskosten in der Industrie gesenkt werden. Die vorgesehene Rationalisierung kam nicht in Gang, und die chaotische Umsetzung des Fünfjahrplanes – fast täglich wurden neue Direktiven mit Zielen und Kennziffern
288
| »Eine sozialistische Lebensweise der Zukunft«?
erlassen – führte zu erheblichen Störungen des Betriebsablaufes. Wo also sollten die Mittel herkommen? Letztlich ergriff das Stalin-Regime Zuflucht zu zwei Massnahmen. Es erhöhte zum einen den Geldumlauf und brachte dadurch Mittel auf – Leidtragende dieser Inflation waren die Arbeiter, deren realer Lebensstandard sank. Darüber hinaus entschied es sich, die vorhandenen Mittel auf einige wenige Grossprojekte zu konzentrieren. Auf diese Weise konnten dann in all dem Durcheinander doch Erfolge gemeldet werden, die einen hohen Stellenwert hatten. In den öffentlichen Verlautbarungen wurde der Anschein erweckt, als werde überall der Plan schneller erfüllt als vorgesehen. Weiterhin zeigten die Grossprojekte der Bevölkerung die »lichte Zukunft«: Die Sowjetmacht, der Sozialismus ist zu derartigen Leistungen fähig, bald wird es überall, auf allen Gebieten so sein. Im Grunde war die Politik eine immer neue »Flucht nach vorn«. Diese wurde begleitet von Kampagnen, um die Arbeiter für die Grossprojekte zu mobilisieren. Beim Metro-Bau in Moskau etwa, dem bedeutendsten stalinistischen Prestigeobjekt der dreissiger Jahre, erzeugte das Regime eine Art inneren »Kriegszustand«, um alle Kräfte für den Erfolg einzusetzen und diejenigen, die sich verweigerten oder auch nur Bedenken äusserten, als »Feinde«, »Saboteure« und »Schädlinge« auszuschalten. Diese Mobilisierung konnte allerdings immer nur für eine kurze Zeit durchgehalten werden. Auch die Arbeiter zeigten ihren »Eigen-Sinn«, hielten den Druck nicht lange durch, erkannten oft auch die Hohlheit der Versprechungen angesichts der Situation vor Ort, begannen wieder bei der Arbeit zu trödeln, verlängerten die Pausen, machten blau. Die Verordnungen der dreissiger Jahre sind voll von Kritik an diesem Verhalten und voll von – vergeblichen – Gegenmassnahmen. Ebenso schreibt der Arbeiter Stepan Podlubny in seinem Tagebuch ständig von solchen Verhaltensweisen am Arbeitsplatz. Er meldete sie und prangerte sie in Betriebszeitungen oder am »Schwarzen Brett« an, denn er wollte ja ein vorbildlicher Kommunist sein. Aus diesem Grund war er auch darauf eingegangen, der Geheimpolizei über die Zustände im Betrieb und über seine Kolleginnen und Kollegen zu berichten. Erklärt sich diese Einstellung mit der Suche nach Geborgenheit im Schutz»Panzer« der Mehrheit, ist Lew Loginow seit langem innerlich von der Richtigkeit der kommunistischen Politik überzeugt. Aus seinen Erinnerungen geht nicht hervor, dass er einen Augenblick zweifelte, sondern er war sich sicher, dass jetzt der Durchbruch zum Sozialismus erfolge und dass diese Politik eben Härte erfordere. Rücksichtslos setzte er deshalb in seinem Unternehmen die Erfüllung der Planziele durch. Mit dem sozialen und ökonomischen Umbruch von 1929 und seinen Folgen ist die Ausbildung des neuen Machtsystems verbunden, das wir Stalinismus nennen. Dass Stalin zielstrebig und mit allen Finessen die diktatorische Macht an der
Die Sowjetunion zwischen 1929 und 1939
|
289
Spitze anstrebte, ist seit langem bekannt. Doch zum stalinistischen System gehört mehr. Aufgrund der ständig neuen »Flucht nach vorn«, die die Verantwortlichen vor Ort oft überforderte, erhöhte sich die Macht der Zentrale stärker als vermutlich zunächst geplant. Die Zentralorgane mussten immer detaillierter in die jeweiligen Vorgänge eingreifen, weil sonst alles aus dem Ruder gelaufen wäre. So weitete sich eine neue Bürokratie mit Stalin ergebenen Funktionären über das ganze Land aus. Weiterhin ist für das neue Machtsystem kennzeichnend, dass für Fehler, falsche Politik, Versagen, Chaos, Durcheinander, unhaltbare Zustände »Sündenböcke« gesucht wurden, eben jene »Feinde«, »Saboteure« und »Schädlinge«. Seien sie erst einmal ausgerottet, werde die harmonische, freie Gesellschaft erreicht sein. Deshalb müsse man mit aller Härte gegen diese »Feinde« vorgehen. Vorbereitet durch jene verbalen Ausgrenzungen sollten nun Taten folgen. Alle seien dazu aufgerufen, wachsam zu sein und die »Schädlinge« zu melden. Der Denunziation öffnete dies mit staatlicher Förderung Tür und Tor. Insgesamt bedeutete all das: Gewalt wurde zu einem Wesensmerkmal des Systems. Auch das unterscheidet es von den früheren Phasen der Sowjetherrschaft. Gewiss waren die Bolschewiki von Anfang an nicht zimperlich, wenn es um Gewaltanwendung zur Durchsetzung ihrer Politik ging. Gewalt gehörte seit dem Bürgerkrieg zur Herrschaftspraxis. Aber es wurde intern wie öffentlich darüber reflektiert, dass sie für bestimmte Ziele, also zweckgebunden, punktuell und vorübergehend eingesetzt werde. Nach dem Bürgerkrieg sind auch Bestrebungen unverkennbar, Gewaltanwendung zurückzudrängen, ein ordentliches Justizwesen aufzubauen und zumindest begrenzte Freiheiten zuzulassen. Sicher liegen hier dennoch Wurzeln des Stalinismus, er kam nicht von ungefähr und nicht über Nacht, aber die Politik vor und nach 1929 ist doch wesentlich voneinander unterschieden. Gewalt war charakteristisch für die Kollektivierung und ebenso für viele Vorgänge in der Industrie. Gewalt wurde angewendet gegen tatsächliche, potentielle und angebliche Gegner des Umbruchs. Nach Mustern, die schon zuvor ansatzweise erprobt worden waren, wurden 1930 Kampagnen, teilweise auch Prozesse gegen eine angebliche »Industrie-Partei« und eine angebliche »Bauern-Partei« inszeniert, um der Öffentlichkeit zu zeigen, welche Bösewichter den richtigen Kurs der Partei zu sabotieren versuchten, in enger Verbindung mit ausländischen, kapitalistischen Kräften. Daneben traf diese Suche nach »Sündenböcken« viele Einzelpersonen. Selbst der wissenschaftliche Bereich blieb davon nicht ausgeschlossen. So wurde auch der gerade in hohe Leitungsfunktionen aufgestiegene Professor Oskar Hartoch 1930 zusammen mit Kollegen verhaftet, weil sie »Schädlingsarbeit« in ihrem Institut geleistet hätten. Hartoch hatte Glück. Es gelang, nicht nur den berühmten Iwan Pawlow (1849–1936), sondern auch Maxim Gorki (1868– 1938) – den angesehenen Dichter, der nach aussen die stalinistische Politik unterstützte, aber sich zugleich bemühte, Willkürmassnahmen zu begegnen – und
290
| »Eine sozialistische Lebensweise der Zukunft«?
darüber hinaus den französischen Schriftsteller Romain Rolland (1866–1944) zu informieren. Nachdrücklich setzten sie sich bei der Sowjetführung für die Verhafteten ein – und hatten Erfolg. Alles schien nur ein Versehen gewesen zu sein. In der Parteiführung wurde durchaus Kritik am Kurs Stalins laut, aber sie kam zu spät und konnte sich jetzt auch nicht mehr gegenüber dessen Machtposition organisieren. Ihre Vertreter wurden rasch ausgeschaltet und teilweise verhaftet. Noch nicht durchsetzen konnte sich Stalin zu diesem Zeitpunkt allerdings mit seiner Forderung, diese zu deportieren oder zu erschiessen. Gewalt als Systemmerkmal: der Terror
Machen wir einen Sprung in die zweite Hälfte der dreissiger Jahre, in der die Machtentfaltung des stalinistischen Systems einen ersten Höhepunkt erreichte. 1934, auf dem »Parteitag der Sieger«, war der Umbruch offiziell für gelungen und abgeschlossen erklärt worden. Die Ausarbeitung der 1936 verabschiedeten neuen – äusserlich demokratischen – Verfassung sollte den Wendepunkt in das sozialistische Zeitalter markieren. In der Wirtschaft stabilisierten sich die Zustände allmählich, ein bescheidener Aufschwung zeichnete sich ab. Es blieben aber schwerwiegende Disproportionen zwischen den Wirtschaftszweigen und erhebliche Mängel im Planungsprozess. Ebenso gestalteten sich die Arbeitsbedingungen nach wie vor ausgesprochen hart. Neben der massenhaften Eingliederung ehemaligen Bauern in die Industriearbeit wurden vermehrt Frauen herangezogen, um den Arbeitskräftemangel zu beheben. Dies galt als Bestandteil der Emanzipation und brachte auch mit sich, dass die Frauen von Haushaltsarbeiten durch öffentliche Speisehallen und Kinderkrippen entlastet werden sollten. Da sich das Rollenverständnis aber nicht grundlegend änderte – also keine tatsächliche Emanzipation eintrat –, erhöhte sich letztlich die Belastung der Frauen durch Berufstätigkeit, Hausarbeit und Kindererziehung. Um der zukünftigen Arbeitskräfte willen förderte der Staat zugleich Mutterschaft und Kinderfreudigkeit. Dies bedeutete eine Abkehr vom revolutionären Frauenbild, wie es zwischen Oktoberrevolution und Mitte der zwanziger Jahre vorherrschend gewesen war. Organisiert wehren konnte sich niemand mehr. Es blieben die kleinen Zeichen des »Eigen-Sinns«, daneben aber auch Möglichkeiten, über Leserbriefe oder in bestimmten Institutionen begrenzt Kritik üben zu können, sich zu beschweren oder Verbesserungsvorschläge vorzutragen. Davon wurde rege Gebrauch gemacht. Dem Regime verschaffte dies wichtige Informationen, es war ein systemkonformes Ventil der Unzufriedenheit. Insofern gliederte es sich ein in die Mischung von Anreizen, Mobilisierungskampagnen – wie dem »sozialistischen Wettbewerb« und der »Stachanow-Bewegung« von Höchstleistungsarbeiten –, Disziplinierungsmethoden und Repressionsmassnahmen.
Die Sowjetunion zwischen 1929 und 1939
|
291
Diese weiteten sich seit Ende 1934 in ungeheurem Masse aus. Am 1. Dezember 1934 wurde der Leningrader Parteichef Sergei Kirow (1886–1934) ermordet. Die Hintergründe dieser Tat sind immer noch nicht geklärt. Jedenfalls hatte der Geheimdienst seine Hand im Spiel, und Stalin wusste die ihm jetzt gebotenen Möglichkeiten zu nutzen. Es begann eine systematische Konstruktion von Verschwörergruppen. Gelenkt von den ehemaligen parteiinternen Oppositionsrichtungen, namentlich von Trotzki, und von ausländischen Geheimdiensten sei ihre Absicht, die Errungenschaften des Sozialismus zu zerstören und den Kapitalismus zur Macht zu bringen. Eine Gegenstimme wäre jetzt Selbstmord gewesen. Die Suche nach »Sündenböcken« wurde auf die Parteispitze und die Leitungen höchster Institutionen des Staates ausgedehnt und dann gleichsam flächendeckend radikalisiert. In grossen Schauprozessen zwischen 1936 und 1938 waren die wichtigsten Politiker, Gewerkschafter, Militärs, Künstler gezwungen, nach brutaler Behandlung bis hin zur Folter auch die verdrehtesten Vorwürfe zu gestehen. Die meisten wurden erschossen, andere zu langen Haftstrafen in Arbeitslagern verurteilt. Ebenso traf es alle, die in irgendeiner Form in diesen »Verschwörungen« als Beteiligte genannt worden waren. Die Lager, die inzwischen einer »Staatlichen Verwaltung«, dem GULag, unterstanden, füllten sich massenhaft. 1929 hatte es rund 40’000 »politische« Häftlinge in den Lagern der Geheimpolizei gegeben. Bis 1939 wurden schätzungsweise sechs Millionen zu Lagerhaft verurteilt (auch hier schwanken die Berechnungen). Mindestens zwei Millionen Menschen kamen während dieser Zeitspanne infolge der Deportationen oder der Verhältnisse in den Straflagern sowie unmittelbar durch Erschiessungen ums Leben. Was stand dahinter? Sicher wollte Stalin jegliche nur mögliche Kritik an seiner überstürzten katastrophalen Politik seit 1929 verhindern, die ihn das Amt gekostet hätte. Am Parteitag von 1934 hatte es dafür genügend Warnzeichen für ihn gegeben. Alle potentiellen Machtrivalen mussten ausgeschaltet werden. Darüber hinaus ging es ihm offenbar darum, die Parteifunktionäre abzulösen und zu opfern, die als seine Anhänger in ihre Position gekommen waren, nun aber über eine gewisse Macht verfügten, sich sicher fühlten und damit eine Bedrohung darstellten. Auf diese Weise konnte Stalin sich gleichzeitig der Loyalität der jetzt aufrückenden Funktionäre versichern, die sonst im Wartestand auch ein Unruhepotential gebildet hätten. Loyalitätsnetze und Möglichkeiten des sozialen Aufstiegs waren – neben dem einsetzenden Terror, der allmählichen wirtschaftlichen Stabilisierung und der aussenpolitischen Bedrohung – die entscheidenden Faktoren, die das System zusammenhielten.
292
| »Eine sozialistische Lebensweise der Zukunft«?
Noch einmal: Fünf Lebensschicksale
Wenden wir uns, um die Gewalt in der zweiten Hälfte der dreissiger Jahre etwas genauer zu fassen, noch einmal den fünf Lebensschicksalen zu, die uns am Anfang beschäftigt haben. Alle Personen waren vom Terror betroffen. Oskar Hartoch wurde zusammen mit Mitarbeitern am 2. August 1937 erneut verhaftet. Vermutlich geschah dies infolge des Befehls Nr. 00439 vom 25. Juli 1937, mit dem der damalige Volkskommissar für innere Angelegenheiten Nikolai Jeschow (1895–1939), dem zugleich die geheime Politische Polizei unterstand, auf Geheiss Stalins die »Operation« gegen Deutsche auf dem Gebiet der Sowjetunion einleitete. Während seine Mitarbeiter wahrscheinlich erschossen wurden, kam Hartoch im Mai 1938 frei. Wiederum gab dafür eine Intervention Romain Rollands bei Stalin und anderen hohen Persönlichkeiten den Ausschlag. Rolland stand international an der Seite der Sowjetunion in ihrem Kampf gegen Faschismus und gegen die Nationale Front um Franco im Spanischen Bürgerkrieg. Ihn konnte man nicht vor den Kopf stossen. So schlug man die absurde Anklage nieder, Hartoch habe einen Mordanschlag auf Stalin vorbereitet. Möglicherweise nutzte der Geheimdienst hier Stalins Furcht vor Krankheiten, um diesen Spezialisten für Infektionen auszuschalten, den man offenbar nicht für »sicher« hielt. Hartoch stieg weiter auf. Doch am 31. Mai 1941 kamen die »Organe« ein drittes Mal und nahmen ihn mit. Diesmal hatte niemand mehr Einfluss genug, um ihn zu retten. Romain Rolland war für die sowjetische Führung nicht mehr wichtig, nachdem er sich – enttäuscht von deren Politik, namentlich vom Hitler-StalinPakt 1939 – von seiner bisherigen Unterstützung der UdSSR abgewandt hatte. Hartoch wurde angeklagt, »ein aktiver Teilnehmer einer antisowjetischen Organisation unter den Mikrobiologen und ein Agent des deutschen Spionagedienstes« zu sein (Haumann: Mediziner, S. 15). Das ist erstaunlich, denn noch galt der Pakt mit Nazi-Deutschland, und die Sowjetführung tat alles, um den Frieden zu erhalten. Allerdings deuteten bereits viele Anzeichen auf einen deutschen Truppenaufmarsch gegen die Sowjetunion hin. Möglicherweise stand Hartochs Verhaftung im Zusammenhang mit der Verunsicherung und Nervosität in diesen Wochen. Nach Kriegsausbruch am 22. Juni 1941 hatte er keine Chance mehr. Am 28. November 1941 verurteilte ihn ein Kriegstribunal des Geheimdienstes in Saratow zum Tode. In seinem Schlusswort erklärte er, dass alle seine Aussagen, in denen er seine Schuld zugegeben habe, falsch und unter Druck – also durch Folterung – zustande gekommen seien. Am 30. Januar 1942 wurde er erschossen. 1956, nach der Aufdeckung der Stalinschen Verbrechen durch den neuen Parteichef Nikita Chruschtschow während des 20. Parteitages, erfolgte seine vollständige Rehabilitierung. Silja Jankowskaja hatte etwas mehr Glück. Sie wurde erst Anfang Dezember 1938 verhaftet. Gerechnet hatte sie schon länger damit. Ihr Mann war bereits
Die Sowjetunion zwischen 1929 und 1939
|
293
Anfang 1936 zunächst in die Provinz – nach Kasachstan – versetzt, im Februar 1937 als »Volksfeind« aus der Partei ausgeschlossen und einen Monat später abgeholt worden. Bis Mitte 1938 konnte ihm seine Frau Geld überweisen, dann kam es mit dem Vermerk »Adressat verzogen« zurück. Sie schrieb an Stalin und viele andere Persönlichkeiten und Behörden, stand tagelang in den Warteschlangen vor dem Sitz des Geheimdienstes oder anderen Stellen, um Auskunft über das Schicksal ihres Mannes zu erhalten. Vergeblich. Erst 1955 erhielt sie, zusammen mit seiner Rehabilitierung, die Nachricht, er sei 1938 mit 30 weiteren Personen als angeblicher Leiter einer Verschwörergruppe hingerichtet worden. Wahrscheinlich war er – wie jeder andere Parteifunktionär – irgendwann einmal in seiner Parteikarriere mit Kommunisten zusammengetroffen, die inzwischen als »Verräter« verurteilt worden waren. Vielleicht hatte ihn jemand wegen »abweichender« Ansichten denunziert, oder es hatte ihn jemand auf der Folter genannt. Oder er stand einfach nur im Wege. Am 15. August 1937 hatte Jeschow den Befehl Nr. 00486 »über die Repression der Frauen von Vaterlandsverrätern, Mitgliedern rechts-trotzkistischer Spionage-Organisationen, durch Militärkollegien und Militärgerichte Verurteilten« herausgegeben. Danach sollten diese Frauen zu fünf bis acht Jahren Lagerhaft verurteilt werden, selbst wenn sie nichts mit der angeblichen Tätigkeit ihrer Männer zu tun gehabt hatten. Kinder kamen in Kinderheime oder Krippen, Jugendliche über 15 Jahre in Arbeitskolonien oder Sonderheime. Es ist nicht klar, warum Silja Jankowskaja nicht sofort nach der Verurteilung ihres Mannes verhaftet wurde. Ende 1938 war der Höhepunkt der Terrorwelle überschritten. Sie musste ein paar Wochen im Gefängnis bleiben – das war schlimm genug –, wurde jedoch am 31. Dezember 1938 wieder entlassen – alles, ohne Gründe anzuführen. Ihre Tochter konnte sie wieder aus einem Kinderheim zurückholen. Immer noch glaubte sie, dass man an höherer Stelle nicht wisse, welche Verbrechen sich die Geheimpolizei erlaube. Sie schrieb Briefe und versuchte, über die Verhältnisse aufzuklären. Mehrfach wurde sie vorgeladen, aber es geschah ihr nichts – allerdings änderte sich auch nichts. Erst als nach dem Zweiten Weltkrieg noch einmal neue Terrorwellen über das Land rollten, erinnerte man sich an sie. 1951 wurde sie wieder verhaftet und zu zehn Jahren Straflager sowie fünf Jahren Verbannung verurteilt. 1955 kam sie aufgrund der anlaufenden Rehabilitierungen nach Stalins Tod 1953 frei. 1997 ist sie gestorben. Ihr Sohn war zu dieser Zeit bereits tot, ihre Tochter nach Israel ausgewandert. Stepan Podlubny wurde 1934 von seiner Vergangenheit eingeholt. Die Geheimpolizei entdeckte die Fälschung seiner sozialen Herkunft und nutzte sie als Druckmittel, damit er noch intensiver für sie arbeitete. Podlubny atmete auf und dachte, er könne sich als vorbildlicher Kommunist bewähren. Er hoffte auf eine Beruhigung, nachdem auch sein Vater vorübergehend nach Moskau hatte kommen können, die Familie wieder beisammen war. Doch 1936 erfuhr auch der
294
| »Eine sozialistische Lebensweise der Zukunft«?
Komsomol von der Fälschung und schloss ihn aus. Jetzt war er ein »Kulakensohn« und wurde, entgegen den gesetzlichen Bestimmungen, diskriminiert. 1937 verhafteten die »Organe« seine Mutter als »Volksfeindin«. Damit war das Mass voll: Er musste sein kurz zuvor begonnenes Medizinstudium abbrechen. Allmählich regten sich Zweifel in ihm über die Politik der Kommunistischen Partei. Seinem Tagebuch ist zu entnehmen, dass er die »Repressionen« für falsch hielt und Stalin kritisierte. Sein Glauben an das Ziel des »Neuen Menschen« gab er allerdings nicht auf. Über neue Leitbilder suchte er seine Identität zu bewahren, er baute sich einen eigenen Schutz-»Panzer«. 1939 wurde er verhaftet und als Mitwisser »spekulativer« Geschäfte zu anderthalb Jahren Arbeitslager verurteilt. Bei Kriegsbeginn 1941 kam er in die Armee. 1998 ist er gestorben. Lew Loginow hatte geradezu mustergültig die stalinistische Politik umgesetzt und geriet dennoch in die Mühlen des Terrors. Im August 1938 unterstellte man ihm »Sabotage« in seinem Unternehmen, verhaftete ihn und verurteilte ihn zu Lagerhaft. Er kam in die Goldgruben an der Kolyma im Polarkreis, überlebte die unvorstellbaren Bedingungen (das Leben im Lager zu schildern, wäre ein weiteres Kapitel wert, ist hier aber nicht möglich), wurde 1945 freigelassen und durfte nach seiner Rehabilitierung 1953/54 an seinen Arbeitsplatz und in die Partei zurückkehren. Seinen Glauben an den Kommunismus verlor er trotz dieser Erfahrungen nicht. Für ihn handelte es sich um einen Machtmissbrauch einer bestimmten Gruppe in der Partei, um ein Abweichen von der »sozialistischen Gesetzlichkeit«. So konnte er sein Weltbild und seine Identität retten. Er hätte sonst auch sein Handeln in der Vergangenheit in Frage stellen müssen. Zu stark war vermutlich ebenso noch die Prägung durch die Denkweise, man dürfe sich nicht ausserhalb der Partei stellen, um nicht vollständig isoliert zu sein. Es bleibt Simeon Dmitrewski. Seinen Vater holte die Geheimpolizei am 17. Oktober 1937. Aufgrund einer Denunziation wurde er der Spionage für Deutschland angeklagt und am 27. November 1937 zum Tode verurteilt. Die Geheimpolizei-Behörde war sich der Sache so sicher gewesen, dass sie nicht einmal das Urteil abgewartet und ihn bereits am 24. November erschossen hatte. Den Verhörprotokollen ist zu entnehmen, wie sich von Mal zu Mal die Unterschrift zur Unleserlichkeit veränderte. Entsprechend den zu vermutenden schweren Folterungen gab Michail Dmitrewski schliesslich alles zu, was man ihm vorwarf. 1941 wurde seinem Sohn mitgeteilt, sein Vater sei an einer Halsoperation gestorben. Erst 1992 erfuhr er, was tatsächlich geschehen war – samt der Information über die Rehabilitierung des Vaters 1989. Er konnte auch die Unterlagen im Geheimdienst-Archiv einsehen. Während seine Stiefmutter – die Mutter war 1931 gestorben – 1937 nach Baschkirien verbannt wurde, vergass die Geheimpolizei Simeon und seine Schwester Alexandra. Sie entgingen dem Heim- oder Lageraufenthalt. Eltern von Mitschülern nahmen sie auf: eine mutige Tat in der damaligen Zeit! Auch an ein solches Verhalten muss erinnert werden. Auf diese Weise
Die Sowjetunion zwischen 1929 und 1939
|
295
überlebten die Kinder. Simeon, der nach dem Zweiten Weltkrieg eine scheinbar normale Karriere machte, hat bis heute sein traumatisches Erlebnis von 1937 nicht verwunden. Warum wurde Michail Dmitrewski ermordet? Als Bibliothekar in der Akademie der Wissenschaften hatte er keine wichtige Funktion. Sollte über ihn weiteres Personal in der Akademie belastet werden? Spielte die damalige Terroraktion gegen die sowjetische Militärführung eine Rolle, bei der Spionage für Deutschland, mit gefälschten Dokumenten belegt, einen wichtigen Anklagepunkt bildete? Einen ersten, aber eher verwirrenden Hinweis gibt der Befehl Jeschows Nr. 00485 vom 11. August 1937, der als Grundlage für das Verurteilungsverfahren Dmitrewskis in den Dokumenten genannt wird. Dieser Befehl ordnete die »Liquidierung« der angeblichen polnischen Spionage in der UdSSR an, die »erste Kategorie« der Verhafteten – zu denen dann auch Dmitrewski gehörte – sei zu erschiessen. Einer Verbindung zu Polen wurde Dmitrewski aber gar nicht beschuldigt. Offenbar diente jener Befehl als Muster für alle »nationalen Operationen« (der zuvor ergangene Befehl gegen Deutsche erschien anscheinend nicht als ausreichend). Wegen seines langen Aufenthaltes in Deutschland und noch bestehender Verbindungen nach dort sowie als ehemaliger Angestellter eines deutschen Betriebes galt Dmitrewski als verdächtig. Hinzu kam, dass die Geheimpolizei zu dieser Zeit ein »Kontingent« von zu überprüfenden Personen zugewiesen bekam, das sie erfüllen oder möglichst sogar überfüllen musste. Spürbar wird hier auch eine allgemeine Furcht der Parteispitze vor allen, die in irgendeiner Weise mit dem Ausland zu tun gehabt hatten. Kommunistische Emigranten aus Nazi-Deutschland, andere ausländische Kommunisten und Sympathisanten – auch Schweizer –, die sich in der Sowjetunion aufhielten, oder Kinder gefallener Spanienkämpfer waren deshalb ebenfalls Opfer des Terrors. Nach dem Zweiten Weltkrieg sollte sich diese Furcht in der Verhaftung der meisten Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter, die aus Deutschland zurückkehrten, oder im Kampf gegen den »Kosmopolitismus« niederschlagen. Wie auch die übrigen zentralen Terrorbefehle des Jahrs 1937 zeigen, sind sie auf den ersten Blick durchaus zielgerichtet: gegen ehemalige »Kulaken«, Mitglieder antisowjetischer Organisationen, Angehörige zaristischer Institutionen, Kriminelle, deutsche oder polnische »Spione«. Aber in der Praxis konnte es jede Frau und jeden Mann treffen, vor allem dann, wenn der »Plan« der Überprüfungen noch nicht erfüllt war. Insbesondere Denunziationen spielten eine bedeutende Rolle. Auf diese Weise konnte man sich als »wachsam« erweisen und damit sich selbst schützen, alte Rechnungen begleichen oder Konkurrenten aus dem Weg schaffen, den eigenen sozialen Aufstieg fördern. Die Verantwortlichen für die terroristische Politik liessen sich von dem Vorsatz leiten, mit allen Mitteln ihre Macht und Herrschaft zu sichern. Sie wollten jede nur mögliche innenpolitische Bedrohung beseitigen und suchten nach »Sün-
296
| »Eine sozialistische Lebensweise der Zukunft«?
denböcken«, um von eigenen Fehlern abzulenken. Alle Bevölkerungsgruppen, die im befürchteten Kriegsfall als unzuverlässig galten, sollten vernichtet werden. Zugleich beabsichtigten sie, die – weit gefasste – Kriminalität zu »bereinigen« sowie Arbeitskräfte für Tätigkeiten unter an sich unzumutbaren Bedingungen bereitzustellen. Darüber hinaus sollten alle Kritiker und Skeptiker der Wirtschaftsund Gesellschaftspolitik ausgeschaltet werden, damit eine harmonische »schöne neue Welt« entstehen könne. Zum Teil widersprachen sich diese Funktionen allerdings: Die Vernichtung von leitenden Militärs oder Wirtschaftskadern, ohne dass tatsächlich ein konkreter Strafbestand vorlag, war nicht eben funktional für die künftige Kriegführung oder für die Herrschaftssicherung, der an einer guten Wirtschaftssituation gelegen sein musste. Die Gewalt radikalisierte sich zusehends. Hierzu trugen die Denunziationen ebenso bei wie die Konkurrenz der Apparate, die sich beim Aufspüren von »Schädlingen« zu übertreffen suchten. Da es dann zwar besonders gefährdete »Risikogruppen« in der Bevölkerung gab, doch niemand wirklich sicher sein konnte, ob nicht die Geheimpolizei an die Tür klopfen werde, war vielleicht dies die allgemeinste Funktion: Verunsicherung und Angst zu verbreiten, die jegliche Opposition im Keim ersticken, jedes Darüber–Sprechen, jede Organisierung unmöglich machen sollte. Dieser Terror war so unvorstellbar, dass von vielen Menschen die Frage nach den Ursachen verdrängt wurde. Manche schrieben noch aus den Straflagern an Stalin, von dem sie glaubten, er wisse nichts von den Verbrechen der Geheimpolizei. Man sollte sich allerdings hüten, von einer dauerhaften Verselbstständigung des Terrors zu sprechen. Ende 1938 kam Stalin offenbar zu der Einsicht, dass die Geheimpolizei zu mächtig geworden war. Schlagartig wurden Jeschow und zahlreiche Beamte im ganzen Land verhaftet, erschossen oder in Lager deportiert, wurden von »Tätern« zu »Opfern«. Der Höhepunkt des Terrors war überschritten, er vollzog sich nun in anderer Form, hörte keineswegs auf. Für manche Menschen war die Erschiessung Jeschows ein Zeichen, dass Stalin vorher nichts gewusst habe und jetzt erst über die Verbrechen informiert worden sei. Simeon Dmitrewski etwa erinnert sich in dieser Weise daran. Die Sowjetunion war mit dem Ziel angetreten, eine gerechte Gesellschaft freier Menschen zu schaffen – »eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist«, wie es Marx und Engels in ihrem »Manifest der Kommunistischen Partei« 1848 ausgedrückt hatten. Jetzt war sie zu einem verbrecherischen Terrorsystem geworden. Ihre Leiter wurden in diesem System zu ganz gewöhnlichen Kriminellen. Stalin und seine engsten Mitarbeiter unterschrieben zahlreiche Todesurteile selbst und nutzten das System für persönliche Vorteile. Lawrenti Berija (1899–1953) etwa, Nachfolger Jeschows als Volkskommissar für innere Angelegenheiten, schickte all diejenigen in ein Lager oder liess sie gleich erschiessen, die ihm nicht freiwillig ihre jungen Frauen oder Töchter abtraten, die er für sich ausgesucht hatte. 1942 wurden die
Die Sowjetunion zwischen 1929 und 1939
|
297
Brüder Starostin auf Befehl Stalins und Berijas als Mitglieder einer »terroristischen Kampfgruppe« verhaftet, weil sie als berühmte Fussballer die von Berija bevorzugten Clubs geschlagen hatten. Ähnlich verhielten sich häufig die Mittäter auf jeder Ebene der Verantwortung. 1929 waren viele Menschen noch von Hoffnungen, von einer Aufbruchstimmung erfüllt gewesen. Der Durchbruch zu einem glücklicheren Leben und zu einer »sozialistischen Lebensweise« schien nahe zu sein. Zehn Jahre später war zwar die unruhige, unübersichtliche, krisengeschüttelte Zeit der Neuen Ökonomischen Politik abgelöst worden durch – oberflächlich gesehen – Ruhe und Ordnung, eine gewisse Sicherheit in der Grundversorgung, eine Erwartung steten ökonomischen Wachstums und besserer Lebensumstände. Stalin spielte darauf an, als er am 17. November 1935 vor Stachanow-Arbeitern sagte: »Es lebt sich jetzt besser, Genossen. Es lebt sich jetzt froher. Und wenn es sich froh lebt, dann geht die Arbeit gut vonstatten« (Stalin: Fragen des Leninismus, S. 603–604). Aber zugleich herrschte jetzt ein verbrecherisches System, wurde die Gesellschaft bestimmt durch Verunsicherung, Angst und unvorstellbares Leid in der Bevölkerung. Fast jede Familie war in irgendeiner Form durch die Folgen der Kollektivierung und Industrialisierung – etwa durch die Hungersnot – oder durch den Terror betroffen. In dieser Situation wählten viele Menschen den Weg, die Frage nach den Ursachen der Verbrechen, aber auch die Frage, warum sie selbst zu Denunzianten, zu Tätern, zu Mitläufern geworden waren, zu verdrängen, sich unter den Schutz-»Panzer« des Systems zu begeben und der Autorität Stalins zu vertrauen. Andere schufen sich eine neue Identität, um die Widersprüche auszuhalten und, in der Hoffnung auf eine Wende zum Besseren, loyal zum System bleiben zu können. Wieder andere spalteten ihre Identität in eine absolute Loyalität nach aussen und in eine persönliche Überzeugung, die sie bei sich behielten, bestenfalls im engsten Freundeskreis am Küchentisch äusserten. Eine weitere Reaktion bildete der Versuch, sich den Ansprüchen des Regimes so weit wie möglich zu entziehen und sich nicht völlig »verbiegen« zu lassen, etwa den Kindern der »Repressierten« zu helfen. Hin und wieder entwickelte sich daraus sogar Verweigerung oder Widerstand, am Arbeitsplatz, in den Warteschlangen vor den Dienststellen der Geheimpolizei, aus denen manchmal Protestdemonstrationen wurden, bei Aktionen in den Straflagern. Hier lag der Ansatzpunkt für eine neue, untergründige Sozialbewegung, ein Zeichen der Hoffnung für die Zukunft. Wir sind den meisten dieser Verhaltensweisen begegnet. Die fünf Schicksale im Stalinismus, die als Leitfaden und als Sichtweisen auf diese Zeit dienten, haben uns geholfen, uns jenen Jahren aus einer Binnenperspektive zu nähern.
298
| »Eine sozialistische Lebensweise der Zukunft«?
Literaturhinweise 1. Zu den fünf Lebensschicksalen Leonid und Sofia Hasenson: Die Familie Hartoch – eine Geschichte in Russland und in der Schweiz. In: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 51 (2001) S. 106–110. Heiko Haumann: Mediziner im Stalinismus. Zwei Beispiele: Leonid Hasenson und Oskar Hartoch. In: Basler Magazin Nr. 28, 15.7.2000, S. 15 (Beilage zur Basler Zeitung). Heiko Haumann: Ein Besuch beim Genossen Kirow. Die Geschichte der Familie Dmitrewski – eine Fallstudie von den Anfängen der Slawistik in Freiburg i. Br. bis zum stalinistischen Terror und zur Aufarbeitung der Erinnerung. In: Zeitschrift des Breisgau-Geschichtsvereins »Schau-ins-Land« 120 (2001) S. 121–144. Jochen Hellbeck (Hg.): Tagebuch aus Moskau 1931–1939. München 1996 (Podlubny). Susanne Schattenberg: Die Frage nach den Tätern. Zur Neukonstitutionalisierung der Sowjetunionforschung am Beispiel von Ingenieuren der 20er und 30er Jahre. In: Osteuropa 50 (2000) S. 638–655, hier S. 651–653 (Loginow). Irina Scherbakowa: Nur ein Wunder konnte uns retten. Leben und Überleben unter Stalins Terror. Frankfurt a. M., New York 2000, hier S. 51–84 (Jankowskaja). 2. Zum Kontext Helmut Altrichter, Heiko Haumann (Hg.): Die Sowjetunion. Von der Oktoberrevolution bis zu Stalins Tod. Band 2: Wirtschaft und Gesellschaft. München 1987. Sheila Fitzpatrick: Everyday Stalinism. Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s. New York, Oxford 1999. Sheila Fitzpatrick (Hg.): Stalinism. New Directions. London, New York 2000. Véronique Garros u. a. (Hg.): Das wahre Leben. Tagebücher aus der Stalin-Zeit. Berlin 1998. Heiko Haumann: Geschichte Russlands. München, Zürich 1996 (Neuausgabe Zürich 2003, 2. Aufl. 2010). Wladislaw Hedeler (Hg.): Stalinscher Terror 1934–1941. Eine Forschungsbilanz. Berlin 2002. Manfred Hildermeier: Geschichte der Sowjetunion 1917–1991. Entstehung und Niedergang des ersten sozialistischen Staates. München 1998. Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung 2000/2001 (für verschiedene Aspekte des Terrors). Dietmar Neutatz: Die Moskauer Metro, Von den ersten Plänen bis zur Großbaustelle des Stalinismus (1897–1935). Köln usw. 2001. Elena Osokina: Our Daily Bread: Socialist Distribution and the Art of Survival in Stalin’s Russia, 1927–1941. Ed. by Kate Transchel. Armonk 2001. Stefan Plaggenborg (Hg.): Stalinismus. Neue Forschungen und Konzepte. Berlin 1998. Lewis Siegelbaum, Andrei Sokolov: Stalinism as a Way of Life: A Narrative in Documents. New Haven 2000. Ralf Stettner: »Archipel GULag«: Stalins Zwangslager – Terrorinstrument und Wirtschaftsgigant. Entstehung, Organisation und Funktion des sowjetischen Lagersystems 1928–1956. Paderborn 1996. Thomas Urban: Die Brüder Starostin. Vier geniale russische Fussballer sassen jahrelang im Gulag, weil sie besser spielten, als es Genosse Stalin erlaubte. In: Süddeutsche Zeitung Nr. 295, 21./22.12.2002, Wochenend-Beilage, S. IV.
»... dass er einem Juden auf diese Weise Vorschub leistete« Erwin Stengler und Max Bloch – die Geschichte einer Dienstpflichtverletzung im »Dritten Reich« Für Hans Schadek Am 15. April 1937 verhafteten Beamte der Zollfahndung den Geschäftsleiter der Bezirkssparkasse Elzach, Erwin Stengler.1 Wer davon erfuhr, konnte es nicht fassen: Stengler war ein angesehener Bürger der Stadt. Bald munkelte man hinter vorgehaltener Hand, dass es sich um »krumme Geschäfte«, um Devisenvergehen handeln solle, ja, obwohl Parteimitglied, habe der Sparkassenleiter einem Juden geholfen. Stengler galt als korrekter, anständiger Geschäftsmann, er hatte sich um die Sparkasse verdient gemacht. Dass er gegen Gesetze verstoßen, vielleicht sogar die Bank geschädigt haben sollte, war unvorstellbar. Erwin Stengler war am 26. Juli 1898 in Donaueschingen als Sohn des Bauoberinspektors Gustav Stengler und dessen Ehefrau Sophie geboren worden. Nach dem Besuch der Volks- und der Oberrealschule in Freiburg meldete er sich im Frühjahr 1915 als Kriegsfreiwilliger zur Matrosenartillerie nach Helgoland und später von dort an die Front. 1917 erhielt er das Eiserne Kreuz 2. Klasse und wurde zum Unteroffizier befördert. In der Flandernschlacht war er verschüttet und verwundet worden. Nach Kriegsende versuchte er, das Abitur zu machen. Doch, wie er in seinem Lebenslauf am 14. Mai 1938 betonte: Dies ging nur einige Tage gut, da ich durch die 4 Frontjahre der Geistesrichtung der jungen Schüler entwachsen war. Stengler trat als kaufmännischer Lehrling bei der Firma Mez Vater & Söhne in Freiburg ein. Schon nach einem Jahr konnte ihm das Lehrzeugnis überreicht werden. Nach einer Ausbildung als Bankbeamter bei der Darmstädter und Nationalbank (Danat* Erstpublikation in: Zeitschrift des Breisgau-Geschichtsvereins »Schau-ins-Land« 122 (2003) [erschienen 2004] S. 239–253. 1 Für intensive Unterstützung danke ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtarchive Elzach und Freiburg i. Br., des Kreisarchivs Emmendingen sowie der Staatsarchive Basel-Stadt und München, für Recherchen dem Staatsarchiv Freiburg i. Br., dem Generallandesarchiv Karlsruhe sowie den Stadtarchiven München und Zürich. Zu besonderem Dank bin ich Frau Brigitte Haas geb. Tritschler (Elzach) sowie den Herren Alfred und Werner Keim (Regensdorf/ZH bzw. Zürich) verpflichtet, die mir im persönlichen Gespräch viele Hinweise gaben. – Gewidmet ist der Beitrag Hans Schadek. Unsere enge Zusammenarbeit bei der Herausgabe der »Geschichte der Stadt Freiburg« wie überhaupt meine Tätigkeit am Freiburger Stadtarchiv gehört zu den schönsten Erfahrungen meines beruflichen Lebens. Darüber hinaus habe ich für meine eigene wissenschaftliche Arbeit unschätzbar viel von ihm gelernt. Da mein Beitrag im vergangenen Jahr noch nicht geschrieben und deshalb nicht in den ihm gewidmeten Band des Breisgau-Geschichtsvereins aufgenommen werden konnte, sei diese hommage hiermit nachgeholt.
300
|
»... dass er einem Juden auf diese Weise Vorschub leistete«
Bank) mit anschließender Anstellung wechselte er 1922 als Hauptkassier und Bevollmächtigter zur Badischen Kommunalen Landesbank in Freiburg. Aufgrund seiner Fähigkeiten – er verfügte auch über englische, französische und italienische Sprachkenntnisse – wurde ihm im November 1927 die Leitung der damals noch städtischen, 1934 dann Bezirks-Sparkasse in Elzach übertragen. Voller Stolz konnte er darauf verweisen, dass diese unter seiner Leitung ihre Tätigkeit stetig ausgeweitet und trotz eines finanziellen Einbruchs zwischen 1930 und 1934 einen erheblichen Aufschwung genommen hatte. Allein von 1936 bis 1937 war 1 Erwin Stengler (Kreisarchiv Emmendingen) der Umsatz um 16 Prozent gestiegen.2 Verheiratet war Stengler seit 1924 mit Hanny Hemler, die am 15. Juni 1902 in Freiburg geboren worden war.3 Das kinderlose Ehepaar, das ein Dienstmädchen beschäftigte, wohnte im ersten Stock des Sparkassengebäudes, in dem heute das Heimatmuseum untergebracht ist. In der Elzacher Öffentlichkeit fiel Erwin Stengler durch seine Freizeitaktivitäten auf. Er war ein begeisterter Segelflieger. Wenn es nur immer möglich war, stieg er in die Lüfte auf. In der Erinnerung wird er auch als Pilotenfigur, 2 Kreisarchiv Emmendingen (KreisAEm), Elzach XII, Dienststrafverfahren gegen den Geschäftsleiter der Bezirkssparkasse Erwin Stengler in Elzach 1938–1939 (beiliegende Bewerbungsmappe mit Berufsgang und Zeugnissen) [im Folgenden Elzach XII/1]; XII, Zur Untersuchungssache gegen Erwin Stengler Geschäftsleiter der Bezirkssparkasse in Elzach 1938 (beiliegender Lebenslauf vom 13.5.1938 sowie ergänzendes Schreiben vom 6.10.1938 und Broschüre: Bezirkssparkasse Elzach, Geschäftsbericht 1937) [im Folgenden: Elzach XII/2]. 1932 war Stengler vorübergehend auch in Kehl tätig und wurde von den dortigen Beamten und Angestellten zur Bewerbung um den Direktorenposten aufgefordert. Auch sonst hätte er sich offenbar mit Aussicht auf Erfolg bei anderen Sparkassen bewerben können. 3 Stadtarchiv Freiburg (StadtAF), Meldekartei (Frau Anita Hefele danke ich herzlich für die Recherche).
Erwin Stengler und Max Bloch
|
301
als ein filigraner, feiner Mensch, als Weltmann, als sehr intelligent und schnell im Denken beschrieben, für ihn sei Elzach eigentlich zu provinziell gewesen. Über seine Aktivitäten gewann er einen gehobenen Freundeskreis, zu dem nicht zuletzt der beliebte Arzt Otto Sexauer gehörte. Allerdings konnte er sich wohl nicht entschließen, mit diesem zur Jagd zu gehen – dies scheint ihm nicht gelegen zu haben.4 Während des »Dritten Reiches« wurde Stenglers Sport gerne gesehen. Nach eigenen Angaben trat er 1933 der NSDAP bei und erhielt die Mitgliedsnummer 1929907. Allerdings wurde er offiziell erst am 1. August 1935 mit der Mitgliedsnummer 3671106 in die Zelle II der Stadt Elzach aufgenommen. 1946 erklärte Stengler dies damit, dass der damalige Ortsgruppenleiter seine Anmeldung aus Misstrauen ihm gegenüber nicht weitergeleitet habe. Frau Stengler vollzog den Parteieintritt 1936.5 Ihr Mann wurde Mitglied im Flieger-Sturm Freiburg. 1934 übernahm er die Führung der Segelfliegerstürme Elzach und Waldkirch sowie – 1935 – Emmendingen mit dem Dienstgrad eines Luftsportmeisters. Ebenfalls seit 1935 führte er die Scharen des Nationalsozialistischen Flieger-Korps (NSFK) von Herbolzheim, Kenzingen, Emmendingen, Denzlingen, Waldkirch und Elzach. Als Flugzeugführer mit Pilotenzeugnis A 2/Land machte er noch während des Verfahrens gegen ihn die Segelflugprüfung der höchsten Stufe »C« und erwarb auch die Erlaubnis zum Schleppen von Segelflugzeugen mit der Motormaschine. Folgerichtig meldete er sich zum freiwilligen Dienst bei der Luftwaffe und wurde 1935 zum Wachtmeister der Reserve befördert. Darüber hinaus ließ er sich 1936 zum Kreisrevisor der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV) wählen.6 Insofern kann man sagen, dass er sich in das Herrschaftssystem integrierte – seine berufliche Laufbahn mag eine Rolle gespielt haben –, aber keiner Gliederungseinheit beitrat, die in besonderem Maße Träger der nationalsozialistischen Ideologie gewesen wäre. Aus seiner Freiburger Zeit hatte Erwin Stengler immer noch weiträumige Geschäftsverbindungen. Zu ihnen gehörte die Zürcher Metzgerfamilie Keim. Ursprünglich aus Bad Boll stammend, war sie gegen Ende des 19. Jahrhunderts nach 4 Gespräch mit Alfred Keim, 24.2.2003; Gespräch mit Brigitte Haas, 28.4.2001. 5 So Erwin Stenglers Angabe 1938. In einer Liste wird sie erst seit 1937 als Parteimitglied geführt, sie sei Gruppenführerin des Bundes Deutscher Mädel (BDM) gewesen (Stadtarchiv Elzach [StadtAEl], 141/6, Nr. 432). 6 Wie Anm. 2. Die Angaben zum NSDAP-Beitritt 1933 samt Mitgliedsnummer aus: KreisAEm, Elzach XII/1 (Anschuldigungsschrift vom 10.11.1938); den Eintritt 1933 bestätigt eine Liste in: StadtAEl, 141/6, Nr. 432; zum Beitritt 1935 und zur Erläuterung 1946: StadtAEl, 740/3, Nr. 873 ( Mitgliedsbescheinigung vom 14.8.1937; Bericht vom 29.3.1946). Im Entnazifizierungsverfahren 1947 wurde die verspätete, aber auf 1935 rückdatierte Aufnahme damit erklärt, dass es zuvor eine Beitrittssperre gegeben habe. Vom Beitritt 1933 war keine Rede mehr (Staatsarchiv München [StAM], SpkA K 1773 Erwin Stengler, Spruchkammer-Entscheidung vom 11.8.1947).
302
|
»... dass er einem Juden auf diese Weise Vorschub leistete«
Zürich gekommen und dort 1899 eingebürgert worden. Albert Keim führte in den 1930er Jahren an der Josefstrasse 28, im Industriequartier, eine Arbeitermetzgerei.7 Vermutlich über eine Liegenschaft in Heidelberg, die Keim in den 1920er Jahren preiswert erworben hatte, war es zu einem Kontakt mit Stengler gekommen. Möglicherweise war der Elzacher Dr. Albert Tritschler, Direktor einer Bank in Freiburg, ebenfalls an den finanziellen Transaktionen beteiligt.8 Das lässt sich nicht mehr genau rekonstruieren. Jedenfalls besuchte Erwin Stengler zusammen mit Otto Sexauer einmal die Keims in Zürich, so wie zwei ihrer Kinder nach Elzach kamen: der zwölfjährige Werner Keim und sein elfjähriger Bruder Alfred 1935, ein Jahr später noch einmal Alfred allein. Die beiden erinnern sich heute noch an den Zirkus, der damals in Elzach gastierte – Alfred denkt vor allem an den Tanz einer jungen Zigeunerin, Werner eher daran, dass jemand einem anderen auf den Kopf gehauen und er dies als Unrecht empfunden habe. Sie erzählen außerdem von der Fliegerei Erwin Stenglers – im Bankbüro habe der Propeller eines Flugzeuges gehangen, mit dem er einmal abgestürzt sei – und von der Jagd zusammen mit Otto Sexauer. Auch bei den Tritschlers waren sie oft zu Gast, die Kinder freundeten sich an. Hier bestanden ebenfalls Geschäftsverbindungen zu Stengler, da dieser Konkursverwalter des Baugeschäftes war, nachdem der Vater jung gestorben war. Brigitte Tritschler ging bei Stenglers ein und aus, wurde deren Maidle genannt und liebte deren Schäferhund, vor dem alle anderen Angst hatten. Ihr Bruder habe einmal im Segel- oder Motorflugzeug mitfliegen dürfen.9 Und noch ein Bekannter Erwin Stenglers hatte Kontakt zu Tritschlers, machte mit der Mutter und den Kindern eine Schwarzwaldfahrt im Auto: Max Bloch.10 Dieser war am 3. Januar 1894 in Eichstetten geboren worden, jüdischen Glaubens und seit 1925 mit Hilde Haberer verheiratet, die am 2. September 1899 in Lahr zur Welt gekommen war. Seit 1919 wohnte er in Freiburg. Zusammen mit seinem jüngeren Bruder Ludwig und dem Kaufmann Julian Rosenthal führte er ein Geschäft in der Bertholdstraße 35, das als Großhandlung »Heinrich Bloch Nachfolger« für Sattler-, Polster- und Lederartikel deklariert war.11 Nicht sicher, aber auch nicht auszuschließen ist, dass Bloch über die Immobiliengeschäfte, 7 Schreiben von Dr. Robert Dünki, Stadtarchiv Zürich, vom 7.5.2001; Gespräch mit Alfred Keim, 24.2.2003. 8 StadtAF, Meldekartei und Adressbuch; danach leitete er die Badische Hypotheken-Versicherungsbank und wirkte auch als Wirtschaftstreuhänder; Gespräch mit Brigitte Haas, geb. Tritschler, 24.2.2003. 9 Gespräch mit Brigitte Haas (geb. Tritschler), 28.4.2001; Telefongespräch mit Werner Keim, 3.5.2002; Gespräch mit Brigitte Haas und Alfred Keim, 24.2.2003; Eintrag von Werner Keim in das Poesiealbum von Brigitte Tritschler, 11.10.1935. 10 Gespräche mit Brigitte Haas, 28.4.2001, 24.2.2003. 11 StadtAF, M2/127a. Vgl. zu Eichstetten: Christina Weiblen, Ulrich Baumann: Die jüdische Gemeinde Eichstetten im 19. und 20. Jahrhundert. In: Eichstetten. Die Geschichte
Erwin Stengler und Max Bloch
|
303
2 Fasnacht in den zwanziger Jahren vor der Sparkasse Elzach (Kreisarchiv Emmendingen)
mit denen Stengler zu tun hatte, mit Keims bekannt wurde.12 Die Verbindung zwischen Stengler und Bloch, die aus der Freiburger Zeit herrührte und deren Beginn von Stengler auf etwa 1922 datiert wurde, bildete jedenfalls den Kern der Anschuldigungen gegen Erwin Stengler. Worum ging es konkret? Blochs Firma hatte, nachdem Stengler Leiter der Sparkasse geworden war, in Elzach ein Girokonto eingerichtet. Ebenso eröffnete er für seine beiden Kinder Sparkonten, die 1936 aufgelöst wurden. Dies war vielleicht schon auffällig, aber gewiss nicht strafbar. Anders sah es mit Geldgeschäften aus. 1934 und 1935 hatte Max Bloch nach den Ermittlungen der Fahndungsstellen – nach den damaligen Gesetzen illegal – Wertpapiere aus dem Ausland eingeführt. Erwin Stengler ermöglichte es ihm, diese Wertpapiere zu verkaufen sowie die Erlöse auf Sparkonten der Elzacher Sparkasse unter den falschen Namen Peter Beck und Marie Beck zu verbuchen. Später wurden sie – insgesamt über 7000 Reichsmark (RM) – an Peter Beck, also an Max Bloch, ausgezahlt. Entsprechend erhielt das Kontor der Reichshauptbank für Wertpapiere in Berlin des Dorfes. Band II. Von 1800 bis Heute. Hg. von Thomas Steffens. Eichstetten 2000, S. 109–160. 12 Gespräch mit Alfred Keim, 24.2.2003.
304
|
»... dass er einem Juden auf diese Weise Vorschub leistete«
unrichtige Angaben. Auch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung konnte Stengler mit einem falschen Namen bei der Berliner Bank erschleichen. Aufgrund verschiedener Anzeichen mussten die Fahnder davon ausgehen, dass die Vorgehensweisen zwischen Bloch und Stengler persönlich besprochen und auch die Gelder persönlich ausgehändigt worden waren. Eine Freundin der Familie Stengler half mit Unterschriften auf Belegzetteln aus. Ende 1935 wurden die Dienstwidrigkeiten und Vergehen gegen die Devisenbestimmungen aufgedeckt,13 zunächst jedoch nicht weiter verfolgt, sondern lediglich gerügt.14 Im April 1936 flüchtete Max Bloch nach Basel.15 Damit änderte sich offenbar die Sachlage. Erst jetzt wurde ein strafrechtliches Verfahren gegen Stengler eröffnet, das zu seiner Verhaftung am 15. April 1937 führte. Zu seinem Glück bearbeitete ein Staatsanwalt schweizerischer Herkunft, der mit meinem Rechtsanwalt in guter Verbindung stand, die Angelegenheit, sodass die Untersuchung wenigstens am Anfang einigermaßen sachlich und nicht allein vom Gesichtspunkte der Judenverfolgung aus gesehen durchgeführt worden ist. Rechtsanwalt war Karl S. Bader, der nicht nur in besonderer Weise mit Elzach verbunden war, sondern auch in einem anti-nationalsozialistischen Netzwerk wirkte. Nach Kriegsende bestätigte er seine Vorsprachen bei dem sehr sachlichen Bearbeiter.16 13 Möglicherweise spielte eine Denunziation aus der Elzacher Sparkasse eine Rolle. Dies geht aus den Quellen nicht eindeutig hervor. Im Bericht des Untersuchungsführers vom 13.6.1938 wird noch eine Äußerung eines verstorbenen Freiburger Baumeisters zu Protokoll der Staatspolizeistelle Freiburg vom 7.5.1936 erwähnt (KreisAEm, Elzach XII/1, beigeheftet: Handakten). Vermutlich handelte es sich hierbei um eine Denunziation Blochs. Die Strafakten des Amtsgerichts Freiburg gegen Ludwig Bloch wegen Devisenvergehens (Aktenzeichen: C 2 Cs. 157737) und des Landgerichts Freiburg gegen Max Bloch wegen Devisenvergehens (Aktenzeichen: 5 Js 3/38), die mehrfach in den hier benutzten Ermittlungsakten erwähnt werden, sind nach Auskunft des Staatsarchivs Freiburg vom 13.1.2000 nicht (mehr) vorhanden. Auch eine Nachfrage beim Generallandesarchiv Karlsruhe (Bestände des Sondergerichts Mannheim zu »Volksverratsverbechen«) blieb erfolglos (Auskunft vom 19.2.2001) 14 Rekonstruiert nach KreisAEm, Elzach XII/1 (Anschuldigungsschrift vom 10.11.1938). 15 Rein formal flüchtete er nicht, sondern meldete sich ordnungsgemäß zum 31.5.1936 in Freiburg nach der Schweiz ab (StadtAF, Meldekartei, vgl. M2/127a). Dennoch verwende ich hier dieses Wort, weil Bloch Deutschland nicht verlassen hätte, wenn seine Existenz nicht bedroht gewesen wäre. 16 Bericht Stenglers vom 29.3.1946 und beigefügte Bescheinigung Baders vom 29.11.1945, in: StadtAEl, 740/3, Nr. 873. Möglicherweise kannte Stengler Bader aufgrund dessen Interesse für die Geschichte Elzachs und Prechtal; dieser erhielt später die Ehrenbürgerwürde Elzachs. Bader wurde nach Kriegsende von der französischen Militärregierung als Oberstaatsanwalt eingesetzt. Zu seinem anti-nationalsozialistischen Netzwerk in Freiburg während des »Dritten Reiches« vgl. Geschichte der Stadt Freiburg im Breisgau. Band 3: Von der badischen Herrschaft bis zur Gegenwart. Hg. von Heiko Haumann und Hans Schadek.
Erwin Stengler und Max Bloch
|
305
Am 30. April wurde der Haftbefehl wieder aufgehoben, und am 12. Juli 1937 musste das Verfahren eingestellt werden, wenngleich – wie es hieß – die Erhebungen nicht die völlige Unschuld des Beschuldigten ergeben hätten. Am 31. Juli 1937 entzog das Reichsbankdirektorium in Berlin der Bezirkssparkasse Elzach die Devisenbankeigenschaft, da ihr unter der verantwortlichen Leitung des Beschuldigten nicht mehr das notwendige Vertrauen entgegen gebracht werden könne. Das Freiburger Finanzamt erlegte Stengler eine Geldstrafe über 500 RM auf, doch bedrohlicher für ihn erwies sich ein Dienststrafverfahren, das das Bezirksamt Emmendingen nach Genehmigung durch das badische Innenministerium Ende 1937 einleitete und am 9. März 1938 förmlich eröffnete. Im Beschluss hieß es, Stengler habe seine Dienstpflichten verletzt, weil er ein Konto mit erdichtetem Namen eingerichtet und gewusst habe, dass das erdichtete Konto nur zur Verdeckung von Zahlungen aus dem Erlös von Wertpapieren an den Max Bloch in Basel dienen sollte, wobei besonders ins Gewicht fällt, dass er einem Juden auf diese Weise Vorschub leistete (...).17 Einge Aspekte der Ermittlungen und des Verfahrens lohnen, genauer betrachtet zu werden. Am 4. März 1938 hatte Stengler gegenüber dem Badischen Bezirksamt Emmendingen Stellung zu den Vorwürfen genommen, am 13. Mai 1938 wurde er noch einmal verhört. Er versuchte zunächst, die Anschuldigungen herunterzuspielen, indem er die Verletzung der Bestimmungen zugab, aber abstritt, den Interessen der Sparkasse zuwider gehandelt zu haben: (...) der Einlieferer des Wertpapiers war mit seiner Verwandtschaft weitaus der grösste Spareinleger unserer Kasse. Nur auf diesen Umstand ist es zurückzuführen, dass ich die gesetzlichen Bestimmungen verletzt habe. Darüber hinaus wies er nicht nur auf seine Verdienste, sondern auch darauf hin, dass es 1934 noch üblich gewesen sei, auf einen angenommenen Namen ein Guthabenkonto errichten zu lassen; erst 1937 und 1938 sei auf Kontenwahrheit gedrungen worden.18 Am 13. Mai 1938 gab er, nach mehreren Vernehmungen im April, genauer Auskunft über seine Beziehungen zu Max Bloch. Nach seiner Heirat 1924 habe Bloch ihm bei einem jüdischen Hausbesitzer eine Wohnung in der Freiburger Reichsgrafenstraße 20 vermittelt, die ganz in der Nähe seiner eigenen gelegen sei.19 Da sie den gleichen Weg ins Geschäft gehabt hätten, seien sie sich persönlich näher gekommen. In Elzach habe ihn Bloch dann während seiner Geschäftsreisen hin und wieder besucht, und er habe ihn zur Eröffnung von einem Firmenkonto Stuttgart 1992, bes. S. 328, 766, 767. Dazu zählte auch Oberstaatsanwalt Eugen Weiss, der hier gemeint sein könnte (vgl. ebd., S. 328, 344, 356, 761). 17 KreisAEm, Elzach XII/1, beigeheftet: Vorermittlungen. 18 KreisAEm, Elzach XII/1, beigeheftet: Vorermittlungen, Stellungnahme 4.3.1938. 19 StadtAF, Meldekartei: Bloch war mit seiner Familie vom 16.11.1926 bis 31.5.1936 in der Reichsgrafenstraße 16 gemeldet. Stengler wohnte vom 15.8.1925 bis 22.10.1927 in der Reichsgrafenstraße 20.
306
|
»... dass er einem Juden auf diese Weise Vorschub leistete«
3 Ein von der Sparkasse errichteter Brunnen an der Elzacher Kleinsiedlung mit der Aufschrift »Durch Sparen zum Eigenheim«. Zeichnung des NS-Malers Schröder-Schönenberg auf dem Deckblatt des SparkassenGeschäftsberichts von 1937 (Kreisarchiv Emmendingen)
und mehrerer Privatkonten bewegen können. Blochs Schwiegermutter, Frau Haberer, habe sogar 40000,– RM in Elzach angelegt. Mehrfach sei er mit Bloch in Freiburg zusammengetroffen, habe private Ausflüge mit ihm gemacht, vor allem aber intensiv geschäftlich mit ihm zu tun gehabt. Bloch habe nicht nur das größte Sparguthaben gehalten, sondern der Sparkasse auch den größten Umsatzkunden zugeführt. Persönliche Vorteile seien ihm, Stengler, daraus nicht erwachsen. Zu den konkreten Vorwürfen äußerte er, Bloch habe ihm von einem Bekannten namens Peter Beck erzählt, und tatsächlich sei auch einmal ein Herr erschienen, der sich mit diesem Namen vorgestellt habe. Bloch habe dann erklärt, dass er seine Wertpapierverkäufe über dessen Konten laufen lassen wolle. Dass die Papiere aus dem Ausland stammten, sei ihm nicht bekannt gewesen; in einem offensichtlichen Fall habe er sie an Bloch zurückgegeben. Auch sonst war er bemüht, seine aktive Rolle zu vertuschen. Er gab vor, die Existenz der in den Unterlagen auftauchenden Personen nicht angezweifelt und aus Rücksicht auf die guten Geschäftsbeziehungen zu Bloch keine Überprüfungen vorgenommen zu haben. Bemerkenswert ist ein neuer Aspekt seiner Verteidigungsstrategie. Stengler hob hervor, dass er sich nicht zuletzt aufgrund eines Erlasses des Reichswirtschaftsministers über die Stellung der Geldinstitute zum Juden bemüht habe, Bloch
Erwin Stengler und Max Bloch
|
307
gut zu bedienen. In diesem Erlass vom 11. September 1935, den Stengler seinen Unterlagen beifügte, drückte Hjalmar Schacht, der die Ministeriumsgeschäfte führte und zugleich Präsident des Reichsbank-Direktoriums war, gegenüber dem Präsidenten des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes sein Befremden darüber aus, dass von einzelnen Sparkassen ohne Billigung der zuständigen Aufsichtsinstanzen eigenmächtig Boykottmaßnahmen gegen Juden in die Wege geleitet worden sind. Diese seien umgehend zurückzunehmen. Der sogenannte Arierparagraph solle in der Wirtschaft keine Anwendung finden, eine Unterscheidung zwischen arischen und nichtarischen Betrieben (sei) nicht durchführbar. Wer Nichtariern Kredite kündige, gefährde auch arische Personen, die in irgendeiner Form mit dem Betrieb verbunden seien. Die Neutralität der Sparkassen sei insbesondere bei Spareinlagen und Depositen auszuüben. In einer Zeit, in der es entscheidend darauf ankommt, dass die Spartätigkeit im Interesse einer notwendigen Konsolidierung der für nationale Zwecke aufgenommenen kurzfristigen Verschuldung des Reichs, wie auch im Interesse der örtlichen Bautätigkeit und Arbeitsbeschaffung mit allen Kräften gefördert wird, sind Beschlüsse von Sparkassenvorständen, nur von Ariern Einlagen entgegen zu nehmen und sonstige Einlagen zurückzuzahlen, völlig unangebracht. Wer dem nationalen Aufbauwerk der Reichsregierung zuwider handele, werde zur Rechenschaft gezogen. Ebenfalls beigelegte Schreiben des Wirtschaftsministers vom 8. September 1933 und 9. Juli 1935 sowie des Reichsinnenministers vom 17. Januar 1934 bestätigten, dass ein antisemitischer Geschäftsboykott auch nach Auffassung der NSDAP verboten sei.20 Hjalmar Schacht, in den ersten Jahren des »Dritten Reiches« als Wirtschaftsdiktator21 einer der starken Persönlichkeiten in der Regierung, war durchaus geprägt von judenfeindlichen Klischees und hatte grundsätzlich nichts gegen die antijüdische Politik des Nationalsozialismus. Er wandte sich aber gegen eigenmächtige, willkürliche, oft gewaltsame Aktionen von Gruppen der NSDAP gegen jüdische Unternehmer, Bankiers und Geschäftsinhaber. Unter ihnen hatte 20 KreisAEm, Elzach XII/2, Protokoll der Einvernahme vom 13.5.1938 und beigefügte Unterlagen Stenglers (Protokoll auch in XII/1, beigeheftet: Handakte 1938; sachlich gehört diese Handakte zu XII/2); der Hinweis auf den jüdischen Hausbesitzer in: Elzach XII/1, Entgegnung Stenglers auf die Anschuldigungsschrift vom 10.11.1938 (möglicherweise hat er die zitierten Schreiben erst dieser Stellungnahme beigefügt, da er sie dort ausdrücklich erwähnt; in den beiden Akten ist die Ordnung manchmal etwas durcheinander gekommen). In seinem Hinweis auf die Auffassung der NSDAP bezog sich Schacht auf einen Erlass des Stellvertreters des Führers vom 14.7.1933 und ein Rundschreiben der Kommission für Wirtschaftspolitik der NSDAP vom 11.1.1935. Darüber hinaus gab es zahlreiche weitere Erlasse von Partei- und Staatsstellen gegen Terroraktionen gegen einzelne Juden (so der Stellvertreter des Führers, Rudolf Hess, am 11.4.1935, vgl. Albert Fischer: Hjalmar Schacht und Deutschlands »Judenfrage«. Der »Wirtschaftsdiktator« und die Vertreibung der Juden aus der deutschen Wirtschaft. Köln usw. 1995, S. 154). 21 Basler Nachrichten, 20.8.1934, zit. nach Fischer (wie Anm. 20), S. 9.
308
|
»... dass er einem Juden auf diese Weise Vorschub leistete«
er zahlreiche Bekannte, die er schützen wollte. Insbesondere ging es ihm darum, Schaden von der deutschen Wirtschaft abzuwenden, den ein rasches Ausschalten von Menschen jüdischer Herkunft aus dem Wirtschaftsleben mit sich gebracht hätte. Diese Meinung wurde auch von vielen an der Parteispitze geteilt, zumindest so lange, bis die tiefe Wirtschaftskrise überwunden schien und sich eine Aufschwungstendenz abzeichnete. Schacht verfolgte diese Politik nicht zuletzt auch deshalb, weil er die Wirtschaft als »seinen« Bereich ansah, als die Grundlage seiner Machtposition, von der er möglichst jegliche Störung fernhalten wollte. Gerade in der zweiten Hälfte des Jahres 1934 und Anfang 1935 hatte es wieder viele illegale Übergriffe gegen jüdische Geschäftsleute gegeben. Während Schacht öffentlich die antijüdische NS-Politik unterstützte, versuchte er intern – so in einem Memorandum an Hitler vom 3. Mai 1935 –, im Interesse der Wirtschaft den Auswüchsen entgegenzutreten: Man stempele die Juden in jedem gewünschten Masse zu Einwohnern minderen Rechtes durch entsprechende Gesetze, aber für die Rechte, die man ihnen lassen will, gewähre man ihnen staatlichen Schutz gegen Fanatiker und Ungebildete.22 In diesen Zusammenhang gehört der von Stengler zitierte Erlass des Wirtschaftsministers vom 11. September 1935.23 Man brauchte die Juden noch, es war zu riskant, sie jetzt schon aus dem Wirtschaftsleben zu entfernen. Erst mussten die entsprechenden Bedingungen geschaffen werden. 1938 sollte es so weit sein. Doch Max Bloch hatte schon vorher die Zeichen der Zeit erkannt.24 Die am Nürnberger Reichsparteitag der NSDAP am 15. September 1935, also nur wenige Tage nach Schachts Erlass, verabschiedeten »Rassengesetze« stellten die Weichen. Dies war im übrigen auch Schacht klar. Noch einmal versuchte er, durch Anpassung an die Parteilinie seine Macht zu retten, indem er sich öffentlich hinter die »Rassengesetze« stellte. Vermutlich hoffte er, auf diese Weise intern weiter mäßigend wirken zu können. Damit überschätzte er indessen seine Stellung und seine Möglichkeiten. Zwar konnte er noch einige Erlasse gegen Einzelaktionen herausgeben, sie hatten aber keine besondere Wirkung mehr. Auch verlor er zunehmend Hitlers Unterstützung, obwohl er immer stärker die nationalsozialistische Verdrängungspolitik gegenüber den Juden mittrug. Da ihm darüber hinaus in anderen Bereichen Kompetenzen entzogen wurden, bat er am 11. August 1937 Hitler um seine Entlassung als Wirtschafts22 Zit. in Fischer (wie Anm. 20), S. 155. 23 Vgl. Fischer (wie Anm. 20), S. 173. Parteistellen handelten wiederum ähnlich. 24 Wie diese Bedingungen Schritt für Schritt geschaffen wurden, bis dann 1938 die völlige Ausschaltung möglich war, habe ich an einem Freiburger Beispiel zu schildern versucht: Rolf Böhme, Heiko Haumann: Das Schicksal der Freiburger Juden am Beispiel des Kaufmanns Max Mayer und die Ereignisse des 9./10. November 1938. In der Vergangenheit liegt die Kraft für die Zukunft. 2. Aufl. Freiburg i. Br. 2000 (Stadt und Geschichte. Neue Reihe des Stadtarchivs Freiburg i. Br. H. 13).
Erwin Stengler und Max Bloch
|
309
minister, am 27. November dieses Jahres schied er dann aus seinem Amt, blieb allerdings noch Reichsbankpräsident.25 Zum Zeitpunkt der Vernehmungen war somit Schachts Einfluss bereits weitgehend gesunken, die Politik gegenüber den Juden hatte sich radikalisiert. Dennoch dürfte der Hinweis auf die damalige Rechtslage für Stengler nicht folgenlos geblieben sein, selbst wenn es nach außen zunächst nicht den Anschein hatte. Der Untersuchungsführer bei der Staatsanwaltschaft sprach in seinem Bericht vom 13. Juni 1938 die begründete Annahme aus, dass es sich bei den Bloch´schen Wertpapiergeschäften um einen Komplex wohlüberlegter und entsprechend eingefädelter Devisenschiebungen handelt. Da Stengler jedoch seine Mitwisserschaft in Abrede stelle und Bloch flüchtig sei, könne die Schuld des Sparkassenleiters nicht eindeutig festgestellt werden. Eine Randbemerkung an dem Schriftstück zweifelte dieses Ergebnis an.26 Das Verfahren wurde weitergeführt. In seiner Entgegnung auf die offizielle Anschuldigungsschrift vom 10. November 1938 legte Erwin Stengler am 12. Dezember weitere Einzelheiten der geschäftlichen und privaten Beziehungen zu Max Bloch dar und betonte dessen Verdienste um den Aufschwung der Elzacher Sparkasse, er habe auch für andere wichtige Kunden, darunter für einen führenden Elzacher Nationalsozialisten, gebürgt. Da Stengler die Identität des Peter Beck nicht weiter vertuschen konnte – auch wenn er immer noch vorgab, eine solche Person sei einmal in der Sparkasse erschienen –, änderte er seine Verteidigungsstrategie ein wenig. Nach wie vor beharrte er darauf, von den Absichten Blochs nichts gewusst zu haben. Neu brachte er ins Spiel, dass er sich Bloch gegenüber in gewisser Weise verpflichtet gefühlt habe, weil ihm dieser sein Auto überlassen, er damit einen Unfall verursacht und Bloch ihm die Reparaturkosten erlassen habe. Obwohl ihm dies, gerade deshalb, weil Bloch Jude war, immer peinlicher wurde, habe er vielleicht aus diesem Grund nicht alles so streng geprüft, wie es korrekt gewesen wäre. Während er hier versuchte, sein Verhalten als eine kleine menschliche Schwäche erscheinen zu lassen, fernab jeder echten Hilfsbereitschaft für Bloch, verstärkte er zugleich seine Argumentation, die die Reichspolitik gegenüber Juden in der Wirtschaft geltend machte. Seinen früheren Ausführungen fügte er hinzu, dass sich alle Fälle vor Inkrafttreten der Nürnberger Gesetze ereignet hätten, bis zu denen in hohen und höchsten Staatsstellen und auch in den Sparkassen eine Reihe von Nichtariern (Volljuden und Halbjuden) tätig war. Ebenso betonte er noch nachdrücklicher, dass die devisenrechtlichen Bestimmungen damals nicht so eindeutig wie später festgelegt gewesen seien. Erneut wies er auf seine Verdienste um die Geschäftsentwicklung der Sparkasse und auf seinen Einsatz für Partei und Staat selbst während der Zeit seiner Dienstenthebung hin. So habe er nicht 25 Fischer (wie Anm. 20), hier besonders S. 174–209. 26 KreisAEm, Elzach XII/1, beigeheftet: Handakten.
310
|
»... dass er einem Juden auf diese Weise Vorschub leistete«
nur seine fliegerischen Kenntnisse verbessert, sondern auch sechs Wochen lang Rekruten ausgebildet. In Elzach sei er in der Stadtkasse als Aushilfsarbeiter tätig geworden und habe dort ein neues Buchungssystem eingeführt.27 Diese Beweisführung dürfte ihre Wirkung nicht verfehlt haben. Am 17. Mai 1939 fand vor der Dienststrafkammer Karlsruhe die Hauptverhandlung statt. Das Urteil lautete auf eine zehnprozentigen Gehaltskürzung für ein Jahr wegen Dienstvergehens. Zwar wurden erhebliche Pflichtverletzungen festgestellt, hingegen auch einige Umstände angeführt, die für den Beschuldigten sprachen und die verhältnismäßig geringe Strafe rechtfertigten. Dennoch war damit die Angelegenheit nicht beendet. Während Stengler und der Landrat erklärten, keine Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen zu wollen, forderte der Innenminister am 28. Juni 1939, Stengler müsse aus dem Dienst entfernt werden, weil er die Schiebergeschäfte eines Juden begünstigt habe. So musste der Vertreter des Landratsamtes am 1. Juli 1939 ein Berufungsverfahren in die Wege leiten. Hatte es im Urteil noch geheißen, die Vorwürfe könnten zum großen Teil, trotz erheblicher Verdachtsmomente, letztlich nicht bewiesen werden, hob die Behörde nun hervor, dass die Art und Weise der Vorgänge keine andere Erklärung als ein absichtsvolles Vorgehen Stenglers zulasse. Da er damit einen jüdischen Kaufmann unterstützt habe, sei er als Geschäftsleiter der Sparkasse nicht mehr tragbar. Vermutlich wäre Stengler jetzt nicht mehr so glimpflich davon gekommen. Doch die Umstände retteten ihn. Am 1. September 1939 begann das Deutsche Reich den Krieg gegen Polen, der sich bald zum Weltkrieg ausweitete. Stengler meldete sich freiwillig an die Front. Der Innenminister wies daraufhin am 3. Oktober 1939 den Landrat an, die eingelegte Berufung zurückzunehmen. Dies geschah am 10. Oktober. Stengler bat dann darum, auch seine Dienstenthebung aufzuheben. Das Innenministerium bestätigte dies am 20. Oktober 1939.28 Die NSDAP scheint nicht intensiv in das Verfahren eingegriffen zu haben. In den Akten liegen nur gelegentliche Erkundigungen nach dem Stand und Bitten um Beschleunigung.29 Offenbar lief aber ein Parteiausschlussverfahren, das bis zum Ausgang der Untersuchung ausgesetzt und dann durch das Urteil und den Kriegsausbruch hinfällig wurde.30 Hingegen zeigte der Elzacher Bürgermeister Emil Riegger großes Interesse an dem Fall. Im Vordergrund stand dabei offenbar nicht seine antijüdische Einstellung, wie sie sich in seinen Aktivitäten gegen 27 KreisAEm, Elzach XII/1. Wegen der Fliegerübungen in Hornberg (Post SchwäbischGmünd) und dem aktiven Wehrdienst bei der Flak in Heilbronn musste die Post an Stengler 1938 häufig umgeleitet werden (Elzach XII/2). 28 KreisAEm, Elzach XII/1. Nicht geklärt werden konnte, warum zwischen dem 11.3. und 17.5.1939 ein Wechsel der Verteidiger eingetreten war. Bader war ohnehin nicht mehr beteiligt. 29 KreisAEm, Elzach XII/1, 11.4.1938, 22.11.1938. 30 StadtAEl, 740/3, Bericht Erwin Stenglers vom 29.3.1946.
Erwin Stengler und Max Bloch
|
311
den jüdischen Tierarzt in Elzach, Dr. Bruno Türkheimer, äußerte.31 Eher erklärt es sich aus seiner Funktion als Vorsitzender des Verwaltungsrates der Bezirkssparkasse. Darüber hinaus war er offenbar mit Stenglers Sparkassenleitung sehr zufrieden; möglicherweise standen sich die beiden persönlich nahe. Jedenfalls ist die sehr positive Charakteristik Stenglers, die Riegger am 5. Mai 1938 gegenüber dem Untersuchungsführer abgab, auffällig. So bezeichnete er dessen geschäftliche Fähigkeiten als hochwertig, er genieße das Vertrauen des Verwaltungsrates, der Geschäftswelt und der Bevölkerung. Er habe keine Neigung zur Unwahrhaftigkeit, sei als Privatmann in keiner Weise von besonderem Ehrgeiz besessen, seine wirtschaftlichen Verhältnisse seien in Ordnung. Bei den Beziehungen zum Juden Bloch sei er als Aktivist (...) unvorsichtig gewesen, habe sich aber nicht ungerechtfertigt bereichern oder persönliche Vorteile erringen wollen.32 Riegger sorgte auch dafür, dass Stengler nach den vorläufigen Dienstenthebungen – mit seiner Verhaftung, formell am 4. Mai 1937 wegen der laufenden Untersuchung, dann am 21. März 1938 und noch einmal am 1. Juli 1939 – wieder in sein Amt zurückkehren konnte. Besonders eilig hatte er es nach dem Urteil im Dienststrafverfahren: Bereits am 20. Mai 1939 teilte er dem Badischen Bezirksamt mit, dass er heute Stengler zur Wiederaufnahme seiner Dienstgeschäfte veranlasst habe. Das Einverständnis des Landrates scheint erst nachträglich eingeholt worden zu sein.33 Dass Stengler während der Ermittlungen gegen ihn in der Stadtkasse arbeiten und die dortige Betriebsorganisation überprüfen konnte, spricht ebenfalls für ein gutes Einvernehmen zwischen den beiden. Das schloss allerdings nicht aus, dass Stengler – wie berichtet wird – enge Beziehungen zum früheren Bürgermeister Adolf Rapp unterhielt, der 1933 durch die Elzacher Nationalsozialisten unter Rieggers Führung aus dem Amt gedrängt worden war. Stengler habe, bevor er in das Sparkassengebäude gezogen sei, bei ihm gewohnt, und dieser habe ihn während des Ermittlungsverfahrens beraten.34 Nach Kriegsende sollte ihre Verbindung noch eine Rolle spielen.
31 Vgl. Heiko Haumann: »Lieber ´n alter Jud verrecke als e Tröpfle Schnaps verschütte.« Juden im bäuerlichen Milieu des Schwarzwaldes zu Beginn des Nationalsozialismus. In: Menora 3, 1992, S. 143–152; Karl-Eberhard Maeder: Dr. Bruno Türkheimer. Das Schicksal eines jüdischen Tierarztes in Elzach unter der Hitlerdiktatur. In: »s Eige zeige« 7, 1993, S. 21–26. 32 KreisAEm, Elzach XII/2. Vgl. auch Schreiben vom 5.10.1938 (ebd.); 14.6.1937, 7.3., 22.3., 14.4.1939 (Elzach XII/1). 33 KreisAEm, Elzach XII/1. Sprachlich lässt schon Rieggers Bericht über die Dienstenthebung am 4.5.1937 erkennen, dass er sich nur ungern der Notwendigkeit beugte (StadtAEl, 740/3, Nr. 873). 34 Gespräch mit Brigitte Haas, 28.4.2001.
312
|
»... dass er einem Juden auf diese Weise Vorschub leistete«
Erwin Stengler überlebte den Krieg. Offenbar wollte er aber nicht mehr in sein früheres Amt zurückkehren. 1947 wurde seine Ehe geschieden.35 Seit demselben Jahr war er offiziell in München gemeldet, wo er am 11. Oktober 1960 gestorben ist.36 Hier hatte er jedoch schon seinen Dienstsitz während der letzten Kriegsjahre und war, seinen überlieferten Briefen nach zu urteilen, auch anschließend dort geblieben. Aufschlussreich ist sein Entnazifizierungsverfahren, das er durchlaufen musste. Dabei bezog sich Stengler zu seiner Entlastung auf die Untersuchung gegen ihn wegen Devisenvergehens. Seine Sichtweise und Darstellung des Falles hatte sich jetzt, den Umständen entsprechend, geändert. Anstatt seine Beziehungen zu Bloch herunterzuspielen, hob er sie nun hervor. So gab er am 29. März 1946 an, seit meiner Jugend mit dem jüdischen Kaufmann Max Bloch und dessen Verwandtschaft befreundet gewesen zu sein.37 Möglicherweise war das tatsächlich der Fall, denn der Elzacher NS-Bürgermeister Riegger hatte in seiner Stellungnahme vom 5. Mai 1938 zur laufenden Untersuchung gegen Stengler geschrieben, dass sich beide schon von der Schulbank her kannten.38 Ob sie sich schon in Donaueschingen getroffen hatten oder erst in Freiburg, geht aus den Quellen nicht hervor.39 Auch dass Bloch in Elzach Tritschlers besuchte, mit ihnen eine Schwarzwaldfahrt unternahm, spricht für engere private Beziehungen zu Stengler und seinem Kreis. Wenn sich aus der Bekanntschaft zwischen Stengler und Bloch tatsächlich eine Freundschaft entwickelt hatte, dann gehörte Stengler zu den wenigen Menschen, die diese auch im »Dritten Reich« nicht verleugneten, sondern trotz aller Anpassung an das Regime dazu standen und zu helfen versuchten. Politisch machte Stengler geltend, dass die NSDAP in Elzach zunächst versucht habe, ihn aus dem Amt zu drängen. Bürgermeister Riegger sei wegen finanzieller Schwierigkeiten an seinem Bleiben interessiert gewesen und habe ihn gedrängt, der Partei beizutreten. Um nicht der SA oder einer ähnlichen Organisation angehören zu müssen, habe er sich beim Deutschen Luftsportverband angemeldet und Funktionen bei den Segelfliegern übernommen. Wie er mit verschiedenen Dokumenten belegen konnte, stieß er immer wieder auf Misstrauen seitens der Partei. Unterstreichen konnte er seine distanzierte Einstellung gegenüber dem Nationalsozialismus durch eine eidesstattliche Erklärung von Else Ritterspacher vom 14. Januar 1946. Darin führte sie aus, dass Stengler als Offizier der Luftwaffe 35 36 37 38 39
Auskunft des Stadtarchivs Elzach vom 9.8.1999. Schriftliche Mitteilung des Stadtarchivs München vom 20.8.1999. Bericht vom 29.3.1946, in: StadtAEl, 740/3, Nr. 873. KreisAEm, Elzach XII/2. StadtAF, Meldekartei: Die jeweiligen Wohnsitze lassen nur Vermutungen zu. Stenglers Rechtsbeistand im Entnazifizierungsverfahren schrieb am 28.11.1946 an die Münchener Spruchkammer, Stengler und Bloch seien seit 20 Jahren bekannt und eng befreundet gewesen (StAM, SpkA K 1773 Erwin Stengler).
Erwin Stengler und Max Bloch
|
313
seit 1942 zunächst in dem von ihr bewohnten Haus und dann in der Nachbarschaft untergebracht gewesen sei. Obwohl er wusste, dass ich Volljüdin bin, dass weiter mein Ehemann wegen der Verheiratung mit mir verfolgt und aus dem Staatsdienst entfernt worden war, pflegte Herr Stengler bis zum letzten Kriegstage freundschaftlichen Verkehr mit mir und meinem Mann. Auch habe er ihnen nach einem schweren Fliegerschaden sehr geholfen, Leute aus seiner Kompanie zur Verfügung gestellt und kein Risiko gescheut.40 Darüber hinaus wies er darauf hin, dass er zu Kriegsende in der Widerstandsbewegung »Freiheitsaktion Bayern« tätig gewesen sei. Dies bestätigte ein Schreiben des Münchener Polizeipräsidenten Franz Xaver Pitzer vom 2. März 1946.41 Gegenüber Brigitte Tritschler, die ihn in München besuchte, berichtete Stengler ebenfalls von seiner Beteiligung an der Widerstandsaktion.42 Den Kern der »Freiheitsaktion Bayern« bildete die Dolmetscher-Kompanie im Wehrkreis VII unter Hauptmann Rupprecht Gerngroß. Sie unterhielt ein Netzwerk zu verschiedenen anderen regimekritischen Personen und Kreisen, darunter zum Verbindungsoffizier des Reichstatthalters Ritter von Epp zur Wehrmacht, Major Günter Caracciola-Delbrück; zu dessen Gruppe soll Stengler gehört haben. Am 26. April 1945 begann die Aktion einen Aufstand in München, um die Stadt kampflos den vorrückenden Alliierten zu übergeben. Es gelang, Radiosendeanlagen und Zeitungsredaktionen zu besetzen, das Rathaus einzunehmen sowie den Oberbürgermeister und SS-Brigadeführer Christian Weber zu verhaften, Aufrufe an die Bevölkerung zu erlassen und zum Reichsstatthalter vorzudringen. Als dieser jedoch seine Unterstützung versagte, brach der Putschversuch am 28. April zusammen. Die Verhafteten wurden wieder freigelassen und revanchierten sich dafür, indem 41 Aufständische erschossen wurden, darunter Caracciola. Gerngroß konnte fliehen. Auch außerhalb Münchens kam es zu einzelnen Erhebungen, die blutig niedergeschlagen wurden. Am 30. April besetzten amerikanische Truppen München.43 Stengler war Vertreter des Verbindungsoffiziers der Luftwaffe zum 40 StadtAEl, 740/3, Nr. 873, Anlage 8 zum Bericht Stenglers vom 29.3.1946. Im Münchener Entnazifizierungsverfahren bescheinigte auch der Ehemann, der inzwischen Senatspräsident und Leiter der Justiz in Hessen-Pfalz geworden war, am 11.9.1946 dieses Verhalten (StAM, SpkA K 1773 Erwin Stengler, Spruchkammer-Entscheidung vom 11.8.1947). 41 Dieses Schreiben ist in den Akten nicht mehr aufzufinden, es sollte nach einem handschriftlichen Vermerk Stenglers Bürgermeister Rapp nach Erstellung der Kopie nachträglich zugesandt werden. Auch in den – unvollständigen – Akten des Spruchkammerverfahrens ist es nicht enthalten (Auskunft von Archivrat Dr. Christoph Bachmann vom 17.10.2003). Allerdings bestätigte Pitzer die Erklärung Ernstbergers vom 25.2.1946 zwei Tage später, die Beglaubigung erfolgte am 2.3.1946 – vielleicht hat sich Stengler darauf bezogen (StAM, SpkA K 1773 Erwin Stengler). 42 Gespräch mit Brigitte Haas, 28.4.2001. 43 Rupprecht Gerngross: Aufstand der Freiheitsaktion Bayern 1945. »Fasanenjagd« und wie die Münchner Freiheit ihren Namen bekam. Erinnerungen. Augsburg 1995; Hildebrand
314
|
»... dass er einem Juden auf diese Weise Vorschub leistete«
Gauleiter und Reichsverteidigungskommissar Paul Giesler, Anton Ernstberger. Als dieser sich der Verhaftung durch Flucht entzog, übernahm Stengler seine Funktion. Unter Lebensgefahr sorgte er dafür, dass Befehle Gieslers falsch übermittelt wurden, und trug mit seinem Verhalten dazu bei, dass München nicht verteidigt und damit von weiteren Zerstörungen verschont blieb.44 Der 1933 gewaltsam aus seinem Amt gedrängte und 1945 wieder eingesetzte Elzacher Bürgermeister Rapp45 bestätigte in einem Schreiben vom 17. Juni 1947 an die Spruchkammer X in München das positive Bild. Stengler habe aus seiner Skepsis gegenüber dem Nationalsozialismus keinen Hehl gemacht und sich auch immer wieder Unannehmlichkeiten seitens der Partei ausgesetzt gesehen. Zu ihm habe er noch nach 1933, gegen den Willen des NS-Ortsgruppenleiters, stets freundschaftliche Beziehungen gepflegt. Ich selbst war persönlich mit Herrn Stengler in Zürich und Basel, wo wir uns bekannte früher in Freiburg wohnende Juden besuchten und haben Herr Stengler und ich diese Verbindung mit den Juden bis zum Kriegsbeginn 1939 und noch darüber hinaus laufend unterhalten.46 Die gemeinsamen Reisen kamen wahrscheinlich zustande, weil der damalige Bürgermeister in seiner Funktion als Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse dessen Leiter begleitete. Inwieweit selbst nach 1939 noch Kontakte zu Juden bestanden, wäre zu klären. Mit seiner Stellungnahme und den Belegen, die er beibringen konnte,47 überzeugte Stengler jedenfalls die Entnazifizierungsbehörden. Er wurde am 11. August 1947 von der Spruchkammer als Entlasteter (Klasse V) eingestuft.48 Erwin Stengler setzte seine Erinnerungen an Max Bloch gezielt ein, um sich zu schützen. Seine Verteidigungsstrategie im Devisen- und Dienststrafverfahren macht in beeindruckender Weise sichtbar, welche Spielräume unter der nationalsozialistischen Herrschaft bestanden. Die Argumentation im Entnazifizierungsverfahren nutzte nicht zuletzt die damaligen Anschuldigungen, um seine Unter-
44 45 46 47 48
Troll: Aktionen zur Kriegsbeendigung im Frühjahr 1945. In: Bayern in der NS-Zeit. Hg. von Martin Broszat, Elke Fröhlich und Anton Grossmann. Bd. 4: Herrschaft und Gesellschaft im Konflikt, Teil C. München 1981, S. 660–689; Marion Detjen: »Zum Staatsfeind ernannt«: Widerstand, Resistenz und Verweigerung gegen das NS-Regime in München. München 1998. StAM, SpkA K 1773 Erwin Stengler, Spruchkammer-Entscheidung vom 11.8.1947, Schreiben des Rechtsanwaltes Dr. Seidenberger vom 28.11.1946, Eidesstattliche Erklärungen von Anton Ernstberger (25.2.1946 und 30.8.1946) und Hans Vieren (2.2.1946). Vgl. Heiko Haumann: Elzach im 19. Jahrhundert und in der Gegenwart. In: Der Landkreis Emmendingen. Band I. Hg. von der Landesarchivdirektion Baden-Württemberg in Verbindung mit dem Landkreis Emmendingen. Sigmaringen 1999, S. 585–611, hier S. 589. StadtAEl, 141/71, Nr. 434. Darunter waren die bereits erwähnte Bescheinigung Baders (vgl. Anm. 16) sowie Auszüge aus dem Urteil der Dienststrafkammer vom 17. Mai 1939 (die Kopien, die Stengler Rapp übersandte, enthalten nicht die Details zu den Wertpapierverkäufen). StAM, SpkA K 1773 Erwin Stengler. Vgl. auch Gespräch mit Brigitte Haas, 28.4.2001.
Erwin Stengler und Max Bloch
|
315
stützung von Juden hervorzuheben und sich damit zu entlasten. Als Kern dieser Geschichte schält sich heraus: Stengler hat sich zwar im nationalsozialistischen Regime eingerichtet, um seine Existenz zu sichern, aber er hat seine Beziehung zu Max Bloch stärker gewichtet als die Anforderungen von Staat und Partei. Max Bloch, dem er geholfen hatte, dem »Dritten Reich« zu entkommen und dabei wenigstens einen Teil seines Vermögens mitzunehmen, hat dennoch das Ende der NS-Herrschaft nicht erlebt. 1936 war Bloch nicht in Basel geblieben, sondern hatte sich in St. Louis im Elsass niedergelassen und war französischer Staatsangehöriger geworden.49 Seine Frau Hilda, seine Kinder Lore und Karl Heinz sowie sein Bruder Ludwig folgten ihm kurz darauf. Von St. Louis aus betrieb er als Mitinhaber die Basler Schuhsohlerei und -färberei «Renova A.G.». 1938 wurde ihm die Einreise nach Basel verweigert. Erst nachdem die Firma bestätigt hatte, dass er keine berufliche Tätigkeit ausübe, also nicht den Arbeitsmarkt belaste, sondern lediglich als Geldgeber die Bücher kontrolliere, erhielt er kurzfristige Einreisebewilligungen, musste aber immer wieder versichern, dass er nach Frankreich zurückkehren werde. 1940 verschärfte sich die Situation. Bloch war inzwischen nach Lectoure im Département Gers in der Gascogne umgezogen. Die Firma Renova hielt seine häufigere Anwesenheit in Basel wegen geschäftlicher Umstellungen für notwendig und beantragte am 23. September 1940 ein entsprechendes Visum für Max Bloch. Der zuständige Beamte der Fremdenpolizei setzte mit roter Tinte ein Fragezeichen neben die Anmerkung Herr Bloch kann als französischer Staatsangehöriger jederzeit wieder ausreisen und fügte ein J (= Jude) hinzu; auch die gesamte Akte ist mit einem J gekennzeichnet.50 Offensichtlich war ihm bewusst, dass die Rückkehr Blochs nicht mehr problemlos vonstatten gehen könne, nachdem vor kurzem Nazi-Deutschland Frankreich militärisch besiegt hatte. Auch bei späteren Gesuchen – Bloch hatte unterdessen seine Aktienanteile an der Firma verkauft, blieb ihr aber vertraglich als Berater verbunden – wurde seine Konfession rot unterstrichen, um diese »Problematik« angemessen zu berücksichtigen.51 Trotzdem erhielt er wieder kurzfristige Bewilligungen. Als er am 3. Dezember 1940 jedoch einmal um Verlängerung des Visums bat, weil ihm die Zeit nicht reiche, lehnte die Behörde dies ab. Auch das französische Rückreisevisum laufe ab, und deshalb sei nicht gesichert, dass der Flüchtling die Schweiz wieder verlassen könne. Zwei Jahre später, am 21. September 1942 beantragte der Oltener Fabrikant Bertold Weil, Max Blochs Schwager, auf dessen Bitte für Blochs Ehefrau sowie die 49 Die folgenden Ausführungen, soweit nicht anders angemerkt, nach: Staatsarchiv BaselStadt (StABS), Akten der Fremdenpolizei: Kontrollkarte AK 32441 (Hilda Bloch), PDREG 3, 32441 (Max Bloch). 50 Vgl. Georg Kreis: Die Rückkehr des J-Stempels. Zur Geschichte einer schwierigen Vergangenheitsbewältigung. Zürich 2000. 51 Zum Beispiel beim Gesuch vom 5.8.1941.
316
|
»... dass er einem Juden auf diese Weise Vorschub leistete«
beiden Kinder eine Einreisebewilligung. Anlässlich einer geplanten Augenoperation des Jungen wollten sie bei Frau Blochs Mutter Frieda Haberer in der Oberwilerstrasse 122 wohnen.52 Die Familie könne selbst für ihren Unterhalt aufkommen: Sie besitze ein Grundstück in Basel und zahle hier auch Steuern. Außerdem wurde eine Kaution von 5000 Franken gestellt.53 Frieda Haberer war 1937 von Freiburg nach Basel gekommen und verfügte über eine Toleranzbewilligung bis 1943. Die Basler Fremdenpolizei genehmigte am 31. Oktober 1942 den Aufenthalt für eine Dauer von vier Wochen, die Eidgenössische Fremdenpolizei widerrief jedoch am 27. November diese Entscheidung, so dass die Einreise nicht zustande kam. Für eine Weile finden sich dann keine weiteren Eintragungen in der Akte. Erst am 29. Januar 1944 wandte sich Frieda Haberer, deren Toleranzbewilligung für Basel offenbar verlängert worden war, erneut an die Basler Fremdenpolizei und bat flehentlich darum, ihrer Tochter und deren Kindern jetzt den Aufenthalt zu gestatten. Sie schrieb: (…) die Verhältnisse wurden schlechter und gefährdeter, und vor kurzem wurde der Vater bei einer Razzia gefangen. Frau und Kinder befinden sich auf der Flucht und sind in Lebensgefahr. Was war geschehen? Hierüber geben Zeitzeugenberichte Aufschluss. Max Bloch hatte nach der Niederlage Frankreichs eigentlich in die USA emigrieren wollen. Zufällig entdeckte er im Oktober 1940 in einem Zug, der auf einem südfranzösischen Bahnhof hielt, seine Schwestern sowie weitere Verwandte und Bekannte aus Südbaden. Im Rahmen der Nazi-Aktion, das Elsass, Baden und die Pfalz judenrein zu machen, wurden sie zusammen mit über 6500 Leidensgefährten in das Lager Gurs in den Pyrenäen deportiert. Bloch entschloss sich, erst einmal zu bleiben, und begann Hilfeleistungen zu organisieren. Wie bereits berichtet, dachte er anscheinend daran, seine Frau und Kinder nach Basel in zumindest vorübergehende Sicherheit zu bringen. Dies gelang nicht. Unbekannt ist, ob er sich selbst um einen Aufenthalt in Basel bemühen wollte, um von dort aus Sendungen nach Gurs zu schicken, und durch die Entscheidung der Fremdenpolizei abgeschreckt wurde. Jedenfalls organisierte er tatkräftig Unterstützung für die Lagerinsassen, verhandelte mit der Präfektur, verfasste Berichte und gab Hinweise, wie vielleicht die Befreiung von einzelnen Personen erreicht werden könne. Mehrfach glückte es ihm, in das Lager Gurs eingelassen zu werden und Lebensmittel sowie weitere dringend benötigte Dinge für seine Verwandten und Bekannten abzugeben oder im Auftrag von anderen verteilen zu lassen. Um den Bedrohten nahe zu sein, versteckte er sich in den Pyrenäen nahe der Grenze zu 52 Ich danke Philipp Pott für Recherchen zu den Liegenschaften und Wohnungen der verschiedenen Familien in Basel, die hier eine Rolle spielen. 53 Die Kaution stellte ein Dr. Mayer. Möglicherweise handelte es sich um dieselbe Person, in dessen Freiburger Haus Erwin Stengler auf Vermittlung Blochs eine Wohnung erhielt (Bericht vom 29.3.1946, in: StadtAEl, 740/3, Nr. 873).
Erwin Stengler und Max Bloch
|
317
Spanien. Hier stöberten ihn im Januar 1944 deutsche Einheiten bei einer Razzia auf. Er wurde furchtbar gefoltert und dann erschossen.54 Seine Frau und Kinder versuchten sich zu retten. Auf Frieda Haberers Gesuch erteilte das Basler »Kontrollbureau« am 18. Februar 1944 eine Bewilligung für einen vorübergehenden Aufenthalt zur Vorbereitung der Weiterreise und ermächtigte das Schweizer Konsulat in Marseille, der Familie die Einreise zu genehmigen. Zunächst konnte sich diese aber nicht zur Grenze durchschlagen. Erst am 5. Oktober 1944 meldete sich Hilda Bloch-Haberer aus Lyon und bat um die Einreise, nachdem ihr Mann erschossen worden sei. Als Sicherheit wies sie auf ihren Hausbesitz in Basel – in der Horburgerstrasse 86 – und Zürich hin. Wiederum begannen umfangreiche Ermittlungen. So stimmte am 24. Oktober die Politische Abteilung des Polizeidepartementes einem angemessenen Erholungsaufenthalt in Basel zu und fügte die Bemerkung an: Für eine weitergehende Bewilligung ist unseres Erachtens kein Anlass vorhanden. Ein Verwandter musste am 13. November bestätigen, dass sich die Familie nicht in der Schweiz festzusetzen beabsichtige. Am 17. Juli 1945 meldete sich die Witwe mit ihren Kindern schließlich in Basel an. Sie wohnte bei ihrer Mutter, jetzt in der Socinstrasse 30. Die Aufenthaltsbewilligung wurde mehrfach verlängert, und Frau Bloch durfte auch für kurze Zeit nach St. Louis reisen – zur Auffindung verlorengegangenen Gutes, wie es am 26. Juli 1945 hieß. Wie gewünscht, blieb sie aber nicht in Basel, sondern ließ sich schließlich in Grenoble nieder. Ihr Sohn wurde dort Zahnarzt.55 Zwei Schicksale während des »Dritten Reiches«, die eng miteinander verbunden sind. Beide verdienen, erinnert zu werden. Erwin Stengler und Max Bloch halfen, unter hohem persönlichen Risiko, anderen Menschen in Not. Wir können aus den Quellen nicht rekonstruieren, was in ihnen vorging, wie ihnen zumute war. Aber wir können gedanklich ihr Handeln nachvollziehen und darüber nachdenken, welche Beweggründe sie vielleicht geleitet haben und was sie stark gemacht hat. Sie waren keine »reine« Helden, hatten ihre Schwächen, aber sie stellten die Menschlichkeit höher als den Wunsch, jede Gefährdung der eigenen Existenz auszuschließen oder sich selbst in Sicherheit zu bringen. Eine gute Verteidigungsstrategie und glückliche Umstände retteten Stengler. Für Bloch hingegen gab es keine Rettung. 54 Bericht Max Bloch vom 27. Dezember 1940. In: Oktoberdeportation 1940. Die sogenannte »Abschiebung« der badischen und saarpfälzischen Juden in das französische Internierungslager Gurs und andere Vorstationen von Auschwitz. 50 Jahre danach zum Gedenken. Hg. von Erhard R. Wiehn. Konstanz 1990, S. 669–670; Schreiben David H. Blums (Jackson Heights, New York) vom 31.8.1989, in: StadtAF, M2/127 a, Nr. 26; Louis Dreyfuss: Emigration nur ein Wort? Ein jüdisches Überlebensschicksal in Frankreich 1933–1945. Hg. von Erhard R. Wiehn. Konstanz 1991, S. 79–87, bes. S. 84–85 (vgl. auch Auszüge aus dem Manuskript in: Oktoberdeportation, S. 222–234, hier S. 228). 55 Schreiben David H. Blums (wie Anm. 54).
Hermann Diamanski Ein deutsches Schicksal zwischen Auschwitz und Staatssicherheitsdienst. Perspektiven der Erinnerung* Das Leben Hermann Diamanskis spiegelt Jahrzehnte deutscher Geschichte im 20. Jahrhundert. Zugleich zeigt sich an seinem Schicksal exemplarisch, in welcher Weise Erinnerungsvorgänge beeinflusst werden und wie wir mit Erinnerung umgehen können. Vor mehreren Jahren erfuhr ich zufällig durch Elke Schwizer-Diamanski, eine seiner Töchter, dass er Kommunist und als Häftling in Auschwitz gewesen sei. Ich interessierte mich dafür, Näheres zu erfahren. Mit Einverständnis der Tochter begann ich zu recherchieren, in der Annahme, dass dies weiter nicht schwierig sein werde. Zunächst sah es auch danach aus. In den veröffentlichten Protokollen des »Auschwitz-Prozesses« von 1963 bis 1965 vermitteln seine Aussagen einen ersten Eindruck von seinem Leben im Lager.1 Ebenso fand ich in den publizierten Erinnerungen eines überlebenden »Zigeuners« einen Bericht, dass Diamanski als Ältester im »Zigeunerlager« viel für die Häftlinge getan habe.2 Voller Hoffnung schrieb ich das Bundesarchiv sowie das Dokumentationsarchiv des deutschen Widerstandes an und erwartete, bald viele Dokumente in der Hand zu halten. Die Ernüchterung folgte schnell. Im Bundesarchiv haben sich – mit Ausnahme weniger Hinweise – keine Akten über Diamanski erhalten. Im Widerstandsarchiv war man anfangs sehr optimistisch, schrieb mir dann jedoch, man habe nichts finden können.3 Ebenso reagierten Kommunisten, die ihn gekannt * Erstpublikation in: Memoria – Wege jüdischen Erinnerns. Festschrift für Michael Brocke zum 65. Geburtstag. Hg. von Birgit E. Klein und Christiane E. Müller. Berlin 2005, S. 505–529. Durch meine späteren Recherchen konnte ich einige Angaben korrigieren und präzisieren. Der Abdruck erfolgt trotzdem aufgrund des Zugangs und der grundsätzlichen Überlegungen. Eine ausführliche Darstellung ist inzwischen erschienen: Heiko Haumann, Hermann Diamanski (1910–1976): Überleben in der Katastrophe. Eine deutsche Geschichte zwischen Auschwitz und Staatssicherheitsdienst, Köln usw. 2011. 1 Hermann Langbein, Der Auschwitz-Prozess. Eine Dokumentation, 2 Bde, Frankfurt a. M. 1995, (Büchergilde Gutenberg, Nachdruck der Ausgabe Wien 1965), hier Bd. 1, S. 108, 369 und 416. – Ich danke allen, die mich durch Hinweise, Mitteilungen, kritische Lektüre und Diskussionen unterstützt haben. Ein besonderer Dank geht an Elke SchwizerDiamanski. Dass mir ein Aufenthalt am Institut für die Wissenschaften vom Menschen in Wien die Gelegenheit für Nachforschungen bot, möchte ich ebenfalls dankend erwähnen. 2 Walter Stanoski Winter, WinterZeit. Erinnerungen eines deutschen Sinto, der Auschwitz überlebt hat, hg. von Thomas W. Neumann und Michael Zimmermann, Hamburg 1999, S. 49. 3 Schriftwechsel 1999 mit dem Dokumentationsarchiv des deutschen Widerstandes in Frankfurt a. M., das auch die Akten der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes (VVN) aufbewahrt.
Ein deutsches Schicksal zwischen Auschwitz und Staatssicherheitsdienst
|
319
haben mussten und die ich befragte, reserviert.4 Ich vermutete, dass es für dieses Verhalten einen Grund geben musste. Hing es vielleicht mit Diamanskis Aufenthalt in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) nach 1945 zusammen, von dem ich inzwischen erfahren hatte? Nachforschungen in verschiedenen Archiven der ehemaligen DDR brachten zunächst kein Ergebnis. Fündig wurde ich dann im Berliner Zentralarchiv des Ministeriums für Staatssicherheit. Ich stiess darauf, dass Hermann Diamanskis Aussage im »Auschwitz-Prozess« 1964 noch eine ganz unvermutete Folge hatte. Ein Rechtsvertreter der Nebenkläger, der bekannte Anwalt aus der DDR, Prof. Dr. Friedrich-Karl Kaul, meldete Diamanskis Auftreten als Zeuge dem Ministerium für Staatssicherheit (MfS). Dort forschte man in den Unterlagen und fand heraus, dass Diamanski ein ehemaliger Offizier der Volkspolizei gewesen war, der dann für den amerikanischen Geheimdienst tätig wurde. »Der Amerikaner«, so hiess es, bescheinige dem westdeutschen Bundesamt für Verfassungsschutz die gute Unterstützung seitens Diamanskis. Beigefügt waren die Protokolle der Vernehmungen Diamanskis in Frankfurt a. M., die der Anklage für den »AuschwitzProzess« dienten. Damit wurde ein Stein ins Rollen gebracht. Erneut setzten Untersuchungen ein.5 Meine Vermutung verstärkte sich, dass hier der Grund liegen könne, warum heute noch alte Kommunisten zurückhaltend reagieren, wenn nach Hermann Diamanski gefragt wird. Mein zunächst rein positives Bild Hermann Diamanskis geriet ins Wanken. Und selbst die in jahrelanger Kleinarbeit gesammelten Materialien über sein Leben lassen vieles ungeklärt. Als erste Annäherung möchte ich an zwei Stationen verschiedene Sichtweisen auf seine Person erörtern.6 Erinnerungsstation Auschwitz
Schriftliche Lebenserinnerungen hat Hermann Diamanski nicht hinterlassen, jedenfalls ist dies nicht bekannt. So müssen wir seine Sicht auf sein Leben aus einschlägigen Äusserungen, die sich erhalten haben, erschliessen. Zunächst einmal sind dies die Protokolle seiner Vernehmung als Zeuge in der Voruntersuchung und dann durch das Gericht im Frankfurter »Auschwitz-Prozess« am 19. März 1964. Zu berücksichtigen ist dabei allerdings, dass Diamanski im wesentlichen 4 Z. B. Peter Gingold 1999. 5 Zentralarchiv des Ministeriums für Staatssicherheit (im folgenden ZA), MfS AP 8266/73 (Diamanski), Schreiben des 1. Stellvertreters des Ministers, 14.4.1964, mit Übersicht zum Vorgang, 14.3.1964. Ich danke Frau Mehlhorn für ihre Unterstützung. 6 Meine Nachforschungen gehen weiter. Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Weitere Veröffentlichungen behalte ich mir vor.
320
|
Hermann Diamanski
daraufhin befragt wurde, was er im Blick auf die Anschuldigungen gegen den ehemaligen SS-Oberscharführer Wilhelm Boger zu sagen habe.7 Seinen Lebensweg schilderte er in mehreren Vernehmungen zwischen 1958 und 1963. Geboren wurde er am 4. Mai 1909 in Danzig.8 Kurz erzählte er von seiner dortigen Jugend. Er sei das einzige Kind und sein Vater Seemaschinist gewesen. Offenbar trat er dann in dessen berufliche Fussstapfen. Nach Abschluss der Volksschule sei er zur See gefahren.9 Aus politischen Gründen – er war Mitglied der 7 So ausdrücklich im Schreiben der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Stuttgart an die Kriminalpolizei Frankfurt a. M. am 2.12.1958 (Az.: 16 Js 1273/58). Die Vernehmungsniederschriften wurden mir in Kopie durch Werner Renz vom Fritz-Bauer-Institut in Frankfurt a. M. zur Verfügung gestellt; dafür danke ich herzlich. Die entsprechenden Akten der Staatsanwaltschaft Frankfurt a. M. liegen im Hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden (HHStA, Abt. 461 Nr. 37638 Bd. 37); dankenswerterweise wurde mir von dort ein noch fehlendes Blatt zugänglich gemacht. Aus diesen Niederschriften wird im folgenden ohne weiteren Nachweis zitiert. In der Aussage vor Gericht gab es keine neuen Informationen (vgl. den Bericht von Gerhard Mauz, den Diamanskis Auftreten sehr beeindruckte in: Frankfurter Rundschau, 20.3.1964, Privatarchiv Elke Schwizer-Diamanski, im folgenden PA Sch.-D.). – Eine weitere Vernehmung zu Dr. Mengele wurde offenbar früher schon in Freiburg i. Br. durchgeführt. Darauf wies Diamanski am 21.4.1959 hin. Zum Prozess vgl. Werner Renz, Der erste Frankfurter Auschwitz-Prozess. Völkermord als Strafsache, 1999. Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts 15 (2000) H. 2, S. 11–48; Irmtrud Wojak (Hg.), Auschwitz-Prozess 4 Ks 2/63 Frankfurt am Main, Köln 2004 (Katalog zur vom Fritz-Bauer-Institut konzipierten Ausstellung, die vom 27.3. bis 23.5.2004 in Frankfurt a. M. stattfand). Siehe auch: Irmtrud Wojak/Susanne Meinl (Hgg.), Im Labyrinth der Schuld. Täter – Opfer – Ankläger, Frankfurt a. M. 2003, S. 95–132. Zu Auschwitz jetzt zusammenfassend Sybille Steinbacher, Auschwitz. Geschichte und Nachgeschichte, München 2004. 8 Laut Bescheinigung des Danziger Standesamtes vom 28.6.2004 ist ein Nachweis seiner Geburt in Danzig nicht zu erbringen (ich danke meinem Danziger Kollegen Marek Andrzejewski für Hilfe bei den Recherchen). In allen offiziellen Dokumenten ist jedoch diese Angabe zu finden, so dass von ihrer Richtigkeit auszugehen ist. Es gibt nur eine Ausnahme während seiner Haftzeiten in Auschwitz und Buchenwald, hier hatte Diamanski zur Tarnung den Namen »Dimanski«, ein anderes Geburtsdatum und einen anderen Geburtsort angegeben. Vgl. dazu: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, D-Au I-3a/1.329, D-Au II-3a/1839, 1840, 1890, 1892, 1893, 1944; D-Bu-3/1/7, Bd. 7, S. 77 (ich danke dem Museum und Frau Bożena Kramarczyk sehr herzlich, dass mir die Unterlagen zugänglich gemacht wurden); Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden (HHStA), Abt. 518 Pak. 796 Nr. 10, Bl. 3; Mitteilung des Landesarchivs Berlin vom 25.8.2004. [Wie ich später herausfinden konnte, wurde Diamanski tatsächlich als Hermann Helmut Dimanski am 16.11.1910 in Berlin geboren. Die Spurensuche sowie die Umstände der Namens-, Datums- und Ortsänderung sind in meinem Buch beschrieben.] 9 Nach einer späteren Aufstellung, vermutlich für das Entschädigungsverfahren, fuhr Diamanski von 1924 bis 1935 zur See (PA Sch.-D.). In der Seekasse war Diamanski von 1927 bis 1935 versichert. In den verschiedenen Unterlagen, die ich einsehen konnte, machte
Ein deutsches Schicksal zwischen Auschwitz und Staatssicherheitsdienst
|
321
KPD –10 habe er nach England emigrieren müssen. Im Spanischen Bürgerkrieg habe er auf republikanischer Seite gekämpft. Danach sei er nach Belgien und Frankreich geflüchtet, 1940 noch einmal nach Spanien. Dort habe man ihn in Barcelona verhaftet und noch im selben Jahr 1940 der Gestapo übergeben. Nach einer Lagerhaft in Welzheim bei Stuttgart11 habe man ihn in das Gestapo-Gefängnis in Berlin, Prinz-Albrecht-Straße, im Februar 1941 dann in das Konzentrationslager (KZ) Sachsenhausen verlegt. Von dort sei er im September/Oktober 1941 einem Arbeitskommando in der Gestapo- und Sicherheitsdienst-Schule Drögen bei Fürstenberg zugeteilt worden.12 Von Mai 1942 bis Januar 1945 sei er in Auschwitz gewesen, über den Marsch nach Gleiwitz im Januar 1945 in das KZ Buchenwald gekommen und am 11. April 1945 von US-Truppen befreit worden.13 1946 habe er geheiratet. Diese Ehe sei nach vier Wochen gescheitert. 1947 habe er zum zweiten Mal geheiratet und zunächst für wenige Monate ein selbstständiges Transportunternehmen betrieben.14 Noch im selben Jahr sei er mit seiner Frau
10 11
12 13
14
Diamanski widersprüchliche Angaben und Datierungen über die Stationen seines Lebens. Ich verzichte hier auf Details, greife aber die grundsätzliche Frage seiner Erinnerung noch einmal auf. Ort und Datum des Eintritts in die KPD teilte er nicht mit. Wir erfahren dies durch seine Äusserungen in der SBZ/DDR. Zu Welzheim vgl. Gerd Keller/Graham Wilson, Das Konzentrationslager Welzheim. Zwei Dokumentationen. Hg. von der Stadt Welzheim, o. O. u. J. (1989); Ulrike Puvogel/Martin Stankowski/Ursula Graf, Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus. Eine Dokumentation, Bd. 1, 2. Aufl. Bonn 1995, S. 103–104. Ein Augenzeugenbericht: Friedrich Schlotterbeck, Je dunkler die Nacht. Ein Bericht, Halle 1969. Vgl. seine Karteikarte für die Zeit in Sachsenhausen 1941/42 (mit offensichtlichen Tarnangaben): Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv [SAPMO-BA] Berlin, DY 55/V 278; Mitteilung vom 6.10.1999. Diamanski erwähnt nicht, ob er an den vom Lagerkomitee organisierten Widerstandsaktionen teilgenommen hat. Am 11.4.1945 drang die US-Armee in das KZ ein: Gedenkstätte Buchenwald (Hg.), Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945. Begleitband zur ständigen historischen Ausstellung, erstellt von Harry Stein, Göttingen 1999, S. 227–237. Gemäss Heiratsurkunde, bestätigt vom Standesbeamten in Buseck/Landkreis Giessen am 16.11.2004, dauerte die Ehe vom 6.4.1946 bis 6.12.1946. Elke Schwizer-Diamanski ist die Tochter aus dieser Verbindung. Sie teilte mir mit, ihr Vater sei mit einem Mithäftling aus Auschwitz – Herrn Lenz – nach Trohe (Buseck) gekommen, weil dieser mit ihrem Grossvater Ludwig Schwalb (1904–1943) befreundet gewesen sei. Dabei dürfte es sich um Wilhelm Lenz (1897–1969) handeln, einen hessischen KPD-Funktionär, der zuletzt im KZ Buchenwald inhaftiert gewesen war. Er war dann für die US-Militärregierung tätig und baute ein Fuhrunternehmen in Giessen auf (Hermann Weber, Andreas Herbst, Deutsche Kommunisten. Biographisches Handbuch 1918 bis 1945, Berlin 2004, S. 448–449). Lenz und Diamanski sowie ein Verwandter von dessen damaliger Frau arbeiteten dann vorübergehend beruflich zusammen. Laut Bescheid des Gemeindearchivs Buseck vom 31.1.2005 meldete sich Diamanski am 13.11.1945 in Trohe an und am 7.6.1946 nach Heuchelheim ab. Über die weitere Ehe informieren die Heiratsurkunde vom 29.3.1947 in Offenbach
322
|
Hermann Diamanski
»nach dem Osten gegangen« und in Weimar als »Kommissar für das Kraftfahrwesen« in die Volkspolizei eingetreten. 1948 sei er nach Mecklenburg als Leiter der dortigen Wasserschutzpolizei gewechselt. Wegen seiner »ausländischen Emigration« habe man ihn, unterdessen sei er Major der Volkspolizei gewesen, entlassen.15 Nach seinen Angaben wurde er dann stellvertretender Direktor der Seefahrtsschule Wustrow und wegen Differenzen mit Vorgesetzten erneut entlassen. Vorübergehend sei er als technischer Leiter der Elbeschifffahrt in Magdeburg tätig gewesen und schliesslich »aus politischen Gründen« mit seiner Familie im Februar 1950 nach West-Berlin geflüchtet. Dort sei er »auf Verlangen der Amerikaner« ein Jahr geblieben, anschliessend nach Allendorf in Hessen, 1952 nach Frankfurt a. M. übersiedelt. »Nachdem ich verschiedene Arbeiten verrichtet hatte, bin ich seit etwa einem Jahr Expedient der Redaktionsgemeinschaft deutscher Heimatzeitungen.«16 In Frankfurt ist Hermann Diamanski am 10. August 1976 gestorben. Nicht alle Angaben konnten bislang im einzelnen überprüft werden. Doch schon ein flüchtiger Vergleich der Dokumente ergibt, dass wesentliche Daten gerade zu den dreissiger Jahren nicht stimmen können.17 Völlig fehlerhaft sind Diamanskis Ausführungen zu seiner Zeit in der SBZ/DDR. Vor allem überrascht seine Aussage, er sei 1950 nach West-Berlin geflüchtet. In Wirklichkeit geschah dies erst 1953.18 Wie lassen sich diese Diskrepanzen erklären? Mehrfach wies Diamanski in den Vernehmungen darauf hin, dass er aufgrund von gesundheitli-
15 16
17 18
und die Meldekarte in West-Berlin von 1953: Mitteilungen des Landesarchivs Berlin vom 25.8.2004 und des Stadtarchivs Offenbach vom 26.10.2004. Nach einer eidesstattlichen Erklärung im Rahmen seines Entschädigungsverfahrens hatte Diamanski am 21.4.1955 angegeben, er sei vom 1.10.1945 bis 30.6.1946 »als Dolmetscher bei den Amerikanern in Gießen« tätig und vom 1.7.1946 bis 1.6.1947 arbeitslos gewesen (PA Sch.-D.). Möglicherweise bezieht er sich auf die »Säuberung« der Partei von »West-Emigranten« im Zusammenhang mit der Noel-Field-Affäre. Ich komme darauf zurück. Diamanski war als »Expedient« für die Verteilung von Zeitungen zuständig. Sein damaliger Kollege Wilhelm Reibel, zeitweise Chefredakteur der »Redaktionsgemeinschaft«, teilte mir am 10.12.2004 mit, Diamanski habe eine derartige Position gehabt, dass bei der nächtlichen Versendung an die 50 angeschlossenen Verlage die D-Züge selbst ausserplanmässig gehalten hätten. Wie er das schaffte » – danach durfte man ihn nicht fragen«. Nach seiner Meldekarte beim Arbeitsamt Frankfurt a. M. musste er sich zumindest in den 1950er Jahren mehrfach arbeitslos melden (PA Sch.-D.). Auch aus seinen Versicherungsunterlagen geht hervor, dass er während der Aufenthalte in Westdeutschland ein schwankendes und insgesamt relativ niedriges Einkommen hatte (die Versicherungsunterlagen wurden mir durch die Angehörigen zugänglich gemacht, dafür danke ich herzlich). Das geht aus den Entschädigungsakten, privaten Unterlagen (PA Sch.-D.) sowie Materialien der Kommunistischen Internationale zu den Spanienkämpfern hervor (darauf gehe ich im Abschnitt über die Zeit in der SBZ/DDR ein). Laut Mitteilung des Landesarchivs Berlin vom 25.8.2004 war er am 6.3.1953 in BerlinWittenau, Hermesdorferstr. 75 (Lager) und am 15.6.1953 in Zehlendorf, Glockenstr. 2, gemeldet. Am 30.11.1953 meldete er sich nach Allendorf, Biedenköpferstr. 4, ab.
Ein deutsches Schicksal zwischen Auschwitz und Staatssicherheitsdienst
|
323
chen Folgen der Lagerhaft Erinnerungsprobleme habe. Sollte er wirklich vergessen haben, in welchem Jahr er die DDR verlassen hatte? Offenbar wurde das nicht überprüft, niemand korrigierte seine Daten während des Prozesses. Nicht auszuschliessen ist, dass Diamanski zumindest teilweise bewusst falsche Angaben machte. Er konnte zu dieser Zeit kein Interesse daran haben, seine Tätigkeit als Kommunist ausführlich darzulegen. So hat er sie möglicherweise verschleiern und statt dessen seine Konflikte in der DDR hervorheben wollen.19 Dennoch spricht viel dafür, dass ihn seine Erinnerung aus gesundheitlichen Gründen manchmal im Stich liess.20 Im Gefängnis Prinz-Albrecht-Strasse hatte Diamanski neben mehreren verhafteten SS- und Gestapo-Leuten zum ersten Mal Wilhelm Boger getroffen. Er sei sein »Bettnebenmann« gewesen. »Soweit ich weiss, war Boger s. Zt. deswegen inhaftiert, weil er in Polen unrechtmässige Dinge begangen hat, die selbst der SS zuviel waren. Boger wurde von seinen SS-Mitgefangenen als der Henker von 19 Vielleicht spielte auch sein Wiedergutmachungsverfahren eine Rolle. Die umfangreichen einschlägigen Akten (HHStA, Abt. 518 Pak. 796 Nr. 10) konnte ich noch nicht einsehen. Herr Dr. Eichler machte mir jedoch dankenswerterweise den Antrag samt Anlagen zugänglich. Der Antrag erfolgte von Allendorf aus, als erlernten Beruf gab er Seemann an, jetzt sei er arbeitslos. Zugleich versuchte er, auch als Vertriebener anerkannt zu werden (Bl. 1). 20 Am 25. Dezember 1953 nannte er in einem Antrag als seine erste Ehefrau Helene geborene Schmidt, die er 1932 in Danzig geheiratet habe und die im KZ Ravensbrück »verstorben« sei. Die zweite Ehe habe er 1947 in Offenbach geschlossen. Die kurze Ehe von 1946 kam nicht zur Sprache. Es gab keinen Anlass, sie hier zu verschweigen. Bei den Vernehmungen vor dem »Auschwitz-Prozess« erwähnte er hingegen die Heirat von 1932 nicht. Vgl. HHStA, Abt. 518 Pak. 796 Nr. 10, Bl. 3 (zu 3.5.1954, das Formular, eine Inhaftierungsbescheinigung, ist nicht von Diamanski ausgefüllt). Der Geburtsname der ersten Frau ist hier nicht lesbar, Diamanski gibt ihn noch einmal in einem Brief vom 20.3.1954 an (den er offensichtlich nicht selbst niedergeschrieben hat). Dort führt er auch aus, dass er vom Tod seiner Frau bei seiner Einlieferung im Reichssicherheitshauptamt erfahren, jedoch keinen Totenschein erhalten habe. In Auschwitz sei ihm von weiblichen Häftlingen mitgeteilt worden, dass sie erschossen worden sei (ebd., Bl. 8). Nach Auskunft des HHStA gehört zur Entschädigungsakte auch eine Heilverfahrensakte, die ich noch nicht einsehen konnte. Mir liegt eine Bescheinigung eines Facharztes für Neurologie und Psychiatrie vom 19.1.1970 vor, der als »wahrscheinlich« annahm, dass ein Zusammenhang zwischen Diamanskis Verfolgung während der NS-Zeit und psychischen Beschwerden (Vergesslichkeit, Konzentrationsstörungen, innere Unruhe, Schlaflosigkeit, Angstzustände) bestehe. Diamanski wies u. a., wie auch weitere Unterlagen belegen, darauf hin, dass er im Berliner Gestapo-Gefängnis schwer misshandelt worden sei, bis hin zur vorgetäuschten Erschiessung. Während des gesamten Entschädigungsverfahrens waren Fragen des Gesundheitszustandes umstritten. Diamanski gab dabei auch an, dass in der DDR eine Schwerbehinderung durch einen Nervenschaden festgestellt und er entsprechend behandelt worden sei. Im Bescheid vom 4.8.1970 wurde der »Schaden an Körper und Gesundheit« bedingt anerkannt. Diamanski liess sich hier übrigens von einem ehemaligen Auschwitz-Häftling, Rechtsanwalt Dr. Franz Unikower, vertreten (PA Sch.-D.).
324
|
Hermann Diamanski
Ostralenka bezeichnet.«21 Später fiel ihm noch ein, dass dieser damals den Rang eines Hauptsturmführers gehabt und dass er – Diamanski – mit ihm sein Weihnachtspäckchen geteilt habe. In Auschwitz traf er dann Boger wieder. »Wir erkannten uns sofort wieder. Sein Verhalten mir gegenüber war nach den damaligen Umständen anständig.« Ja, Diamanski hob hervor, »dass er mir gegenüber viel geholfen hat. Ich selbst kann mich über ihn nicht beschweren. Ich glaube, dass er mir das Leben gerettet hat. Sein Verhalten führe ich auf die gemeinsame Haftzeit in der Prinz-Albrecht-Strasse zurück.« Diamanski berichtete dann, welche Verbrechen Bogers er miterlebt hatte.22 Nach seiner Ankunft in Auschwitz I sei er noch am selben Tag in das Lager Buna-Monowitz überstellt worden. Bei der Befragung zu Josef Windeck als Lagerältesten in Monowitz zeigt sich sein »sehr schlechtes Namensgedächtnis«.23 Er erinnerte sich zwar an den dortigen Lagerältesten, ohne jedoch mit Sicherheit den Namen bestätigen zu können. Dieser habe wahllos auf die gerade in Monowitz angekommenen Häftlinge eingeschlagen. »Ich trat vor und wollte mich dagegen verwehren, daraufhin schlug er mir mit der Peitsche ins Gesicht und nannte mich einen Judenlümmel. Er hatte offensichtlich nicht bemerkt, dass ich einer der wenigen Reichsdeutschen unter den neu angekommenen jüdischen Häftlingen war.« Später habe man ihn als Typhusverdächtigen in einem Fussmarsch zusammen mit 3000 weiteren Häftlingen in das alte Lager A Birkenau verlegt. In diesem Zusammenhang erwähnte er, er sei ein »Vorzugshäftling« gewesen, weil er in Drögen »zufällig die SS-Aufseherin Erna Herrmann des KZ-Ravensbrück mit ihrem Kinde vor dem Tode des Ertrinkens gerettet« habe. »Ich durfte mir daraufhin auch die Haare stehen lassen.« Der SS-Sturmführer Hans Schwarzhuber, der auch in Sachsenhausen gewesen sei, habe ihn wiedererkannt und als Blockältesten von Block 9 des Lagers A (Männerlager) eingeteilt. Ansonsten hätten dort vorwiegend »Berufsverbrecher« die Funktionshäftlinge gestellt.24 Kurz vor der Auflösung des 21 Boger war wegen des Vorwurfes der Abtreibung im Gefängnis. Er selbst gab später an, er habe den Mord an einem Wehrmachtsoffizier verhindert und sei deshalb verhaftet worden (Bernd Naumann, Auschwitz. Bericht über die Strafsache Mulka u. a. vor dem Schwurgericht Frankfurt, Berlin 2004, S. 19). Diamanski meinte vor Gericht 1964, es sei um Korruption gegangen. Hermann Langbein hebt die Bekanntschaft von Boger und Diamanski hervor: Hermann Langbein, Menschen in Auschwitz, Wien 1987, S. 467–468. 22 Über seine Aussagen gab es Kontroversen, ob er sich möglicherweise geirrt habe. Dem ist noch weiter nachzugehen. Wilhelm Reibel schrieb mir am 10.12.2004, dass es Diamanski schwer gefallen sei, gegen Boger auszusagen, weil er ihm einiges zu verdanken gehabt habe. Boger habe dann dessen Aussage »mit einem resignierenden ›Ach, Hermann‹« quittiert. 23 Windeck wurde im »Auschwitz-Prozess« am 13.3.1964 als Zeuge vernommen. Er war zu dieser Zeit bereits verurteilt und sass in Haft (Langbein, Auschwitz-Prozess, Bd. 2, S. 940). 24 Einigen Häftlingen wurde von der SS eine Funktion, etwa eines Lager- oder Blockältesten, übertragen. Zur Kennzeichnung erhielten sie eine Armbinde. Die damit verbundenen
Ein deutsches Schicksal zwischen Auschwitz und Staatssicherheitsdienst
|
325
Lagers A sei er zunächst als Blockältester, dann als Lagercapo und schliesslich als Lagerältester im »Zigeunerlager« eingesetzt worden.25 Hier habe er zusammen mit anderen Häftlingen einen der schlimmsten »Massenmörder« in Auschwitz, SS-Hauptscharführer Gerhard Palitzsch, »zur Strecke gebracht«. Unter den Häftlingen des »Zigeunerlagers« hätten sich auch »leichte Mädchen« befunden. Diese hätten sie auf Palitzsch angesetzt, indem sie vor ihm »z. T. nackt« getanzt hätten. In der Tat habe er sich dann für eine »interessiert« und sei zu dieser bei Nacht gekommen. Nachdem er, Diamanski, Boger verständigt habe, sei Palitzsch festgenommen und in ein SS-Straflager bei Danzig eingeliefert worden.26 Im Sommer 1944 sei das »Zigeunerlager« »liquidiert« worden – rund 6000 Häftlinge habe man vergast, etwa 2000 ausgesondert und abtransportiert. Ihn habe man kurz zuvor als Lagerältesten abgelöst und »wegen Begünstigung von Häftlingen in die SK [Strafkompanie] eingewiesen«. Da er »ein enges Verhältnis mit der Zigeunerin Zilli Reichmann«27 unterhalten und diese sowie deren Familienangehörige unterstützt habe, sei es ihm noch einmal gelungen, in das Privilegien konnten diese Häftlinge zum eigenen Vorteil oder zum Wohle ihrer Mitgefangenen nutzen. Vgl. Wolfgang Benz u. a. (Hgg.), Enzyklopädie des Nationalsozialismus, 3. Aufl. München 1998, S. 476 (Barbara Distel). Zu Schwarzhuber vgl. die entsprechenden Aussagen in Langbein, Auschwitz-Prozess, (siehe Register). 25 Eine kurze Erwähnung als Blockältester im »Zigeunerlager« findet sich auch in der am 11.9.1963 aufgenommenen Aussage von Jan Češpiva, die sich im Museum Auschwitz befindet (Państwowe Muzeum, Ośw./Češpiva/1636). Martin Luchterhandt gibt fälschlich an, Diamanski sei ein »Krimineller« gewesen (Martin Luchterhandt, Der Weg nach Birkenau. Entstehung und Verlauf der nationalsozialistischen Verfolgung der »Zigeuner«, Lübeck 2000, S. 278). Capos (von frz.: caporal; auch: Kapos) waren von der SS eingesetzte Häftlinge, denen die Verantwortung für ein Arbeitskommando zugeteilt wurde (Langbein, AuschwitzProzess 2, S. 1008 und vgl. S. 940). 26 Nach einem Kassiber von Stanisław Kłodziński, Mitglied der Widerstandsbewegung im Lager, vom 9.12.1943 wurde Palitzsch – ebenso wie Boger und andere – wegen Lagerdiebstählen des Postens enthoben: Danuta Czech, Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939–1945, Reinbek 1989, S. 673. Verschiedene Versionen, wie Palitzsch über ein Verhältnis mit einem weiblichen Häftling gestürzt sei, berichtet Langbein, Menschen in Auschwitz, S. 457–458 (Diamanski wird nicht erwähnt). Luchterhandt, Weg, S. 278 Anm. 84, schreibt, ein Vorgänger Diamanskis, Günther Körlin, habe Palitzsch angezeigt. Während des Auschwitz-Prozesses wurde Palitzsch als Rapportführer bezeichnet, also als Vorgesetzer aller SS-Blockführer. 27 Zilli – Cäcilie – Reichmann taucht in Czechs »Kalendarium« nicht auf, im übrigen ebensowenig wie Hermann Diamanski (oder Dimanski) und Franz Spindler, von dem gleich die Rede sein wird. Sie ist verzeichnet in: Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau (Hg.), Gedenkbuch. Die Sinti und Roma im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, München 1993, S. 152–153 (geb. am 10.7.1924 in Hintenat, Artistin, Häftlingsnummer 1959; ein Todesdatum ist nicht angegeben).
326
|
Hermann Diamanski
Lager hinein zu kommen. So habe er »die schrecklichen Szenen miterlebt«. Einige dieser Szenen schilderte er. Weiter berichtete er, dass sich einige Zigeuner gewehrt hätten, »durch die Vielzahl der sich Wehrenden konnte man einen Aufstand vermuten«. Ein solcher habe aber nicht stattgefunden.28 Im Januar 1945 sei er nach Birkenau zurückgekommen und habe in der Pumpenstation des A-Lagers gearbeitet. An einzelne Täter, aber auch an verschiedene Häftlinge, nach denen Diamanski gefragt wurde, konnte er sich nicht mehr genau erinnern. »Durch meine lange Haftzeit leide ich an Gedächtnisschwäche, denn ich hatte im Lager zwei Nervenzusammenbrüche.«29 Was fällt bei Diamanskis Erinnerungen auf? Er hat viele Namen vergessen und manche Einzelheit nicht mehr zutreffend im Gedächtnis. Interessant ist seine persönliche Beziehung zu Boger, die er nicht verschweigt und auf die er nicht zuletzt sein Überleben in Auschwitz zurückführt. Weiter ist ihm nach seiner Meinung seine Hilfe für eine SS-Aufseherin zugute gekommen. Offen gab er zu, dass er ein »Vorzugshäftling« gewesen sei. Diamanski hat der Aufseherin und ihrem Kind das Leben gerettet, so wie er sich dann in Auschwitz für zahlreiche Häftlinge des »Zigeunerlagers« eingesetzt hat. Darüber spricht er jedoch nicht genauer. Erstaunliche Informationen erhalten wir auch über die Handlungsspielräume der Häftlinge im Lager. Nichts sagt Diamanski allerdings über die Untergrundorganisation im Lager oder über die Tätigkeit der KPD, obwohl er kurz auf die »Widerstandsorganisation« hinweist. Warum wollte er darüber nichts bekannt geben? Oder hat man ihn nur nicht danach gefragt? Wenig erfahren wir auch über sein persönliches Leben und seine Ansichten. Obwohl er sich für die Juden in Auschwitz einsetzte, lag ihm doch daran, vor dem Untersuchungsrichter festzustellen, dass er kein Jude, sondern ein »Reichsdeutscher« war. Lässt sich daraus etwas schliessen? Von Diamanskis Tochter erfuhr ich, dass er in Auschwitz »Zigeunerbaron« genannt wurde. Das »Zigeunerlager« war Ende 1942 im Abschnitt B II e von Auschwitz-Birkenau eingerichtet worden. Dort lebten etwa 23000 Häftlinge. Von ihnen starben die meisten an Unterernährung, Seuchen, Misshandlungen und medizinischen Experimenten. Am 16. Mai 1944 scheiterte ein erster Versuch, das Lager zu »liquidieren«, am Widerstand der Betroffenen. Danach wurden die »Arbeitsfähigen« ausgesondert und in andere Lager deportiert. Die verbliebenen 2897 Sinti und Roma wurden in der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944
28 Diamanski musste dann drei Wochen als Lager-Capo in der Janina- und Fürsten-Grube arbeiten (vgl. Gudrun Schwarz, Die nationalsozialistischen Lager, Frankfurt a. M. 1996, S. 178). 29 Im Entschädigungsverfahren erklärte Diamanski, einer dieser Zusammenbrüche sei anlässlich der Vergasung der »Zigeuner« erfolgt (PA Sch.-D.).
Ein deutsches Schicksal zwischen Auschwitz und Staatssicherheitsdienst
|
327
ermordet.30 Aufgrund von Berichten überlebender Auschwitz-Häftlinge können wir Diamanskis Darstellung durch eine zweite Sichtweise ergänzen.31 Exemplarisch möchte ich die Erinnerung von Franz Spindler wiedergeben, mit dem ich am 2. Mai 2003 ein Gespräch führen konnte.32 Er wurde als 16-jähriger im März 1943 von Herbolzheim nach Auschwitz deportiert. Mehrfach betonte er, Diamanski sei ein »sehr prima Kerl« gewesen, ein »Prachtmensch«, als Häftling wie »als Mensch hauptsächlich«, er könne »nur das Beste« über ihn sagen. Zunächst sei er Blockältester im Block 6 gewesen, später Lagerältester, und er, Spindler, habe ihm als »Kalfaktor« gedient und sei dadurch vor der Vergasung bewahrt worden. »Ja, also seine Stube, es war extra eine Blockführer-Stube für ihn, und die hab› ich halt sauber gehalten, seine Klamotten halt wieder hergerichtet, und wenn er was gebraucht hat, irgendwie musste ich da mithelfen.« Dass er dies wurde, verdankte er einem Capo, der sich in seine Schwester Ludwiga verliebt hatte und der ihn Diamanski ans Herz gelegt habe. Diamanski nahm Spindler darüber hinaus beim »Organisieren« mit. Ausserhalb des Lagers war, so erzählte Spindler, damals ein Aussenkommando mit Zivilarbeitern damit beschäftigt, neue Anlagen zu errichten. Mit diesem Kommando hatte Diamanski offenbar ganz »legal« Kontakt, und er nutzte diese Möglichkeit zu »Geschäften«. Zusammen mit Spindler schmuggelte er »Gold und Wertsachen, die sie den Leuten abgenommen haben«, aus dem Lager heraus und tauschte sie gegen Lebensmittel ein. Die Lebensmittel dienten dann der besseren Versorgung der Häftlinge im »Zigeunerlager«. 30 Benz u.a. (Hgg.), Enzyklopädie des Nationalsozialismus, 730–731; Luchterhandt, Weg, S. 272–306; Guenter Lewy, »Rückkehr nicht erwünscht.« Die Verfolgung der Zigeuner im Dritten Reich, München 2001, S. 256–279; Romani Rose (Hg.), Der nationalsozialistische Völkermord an den Sinti und Roma, Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, Heidelberg 1995, S. 136–143; Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau (Hg.), Gedenkbuch; Czech, Kalendarium, S. 774–775 und 837–838. Zum Zusammenhang Michael Zimmermann, Rassenutopie und Genozid. Die nationalsozialistische »Lösung der Zigeunerfrage«, Hamburg 1996. 31 Vgl. Winter, WinterZeit, S. 49; Brief Fritz Hirschs an Frau Diamanski vom 19.9.1976 (PA Sch.-D.). 32 Franz Spindler danke ich sehr herzlich für das bewegende Gespräch. Reinhold Hämmerle hat sich sehr dafür eingesetzt, dass dieses zustande kam, und dann auch daran teilgenommen. Ihm sei ebenfalls vielmals gedankt. Die folgenden Ausführungen und Zitate beruhen, falls nicht anders angemerkt, auf diesem Gespräch, das ich auf Band aufgenommen habe. Vgl. Reinhold Hämmerle, Diskriminiert, deportiert, vernichtet: Der Leidensweg der Familie Spindler, in: Stadt Herbolzheim/ Landesverband der Sinti und Roma BadenWürttemberg (Hgg.), Redaktion: Bertram Jenisch, 60 Jahre. Vergangen, verdrängt, vergessen? Herbolzheimer Blätter 5 (2003), S. 68–103; Reinhold Hämmerle/Friedrich Hinn, Die Herbolzheimer Familie Spindler. Auf den Spuren von zehn Generationen, ebenda, S. 53–67.
328
|
Hermann Diamanski
Später rettete Diamanski Spindler noch einmal das Leben. Anlässlich einer »Selektion«, wer arbeitsfähig sei oder nicht, wollte Spindler sich als krank ausgeben, um nicht schon wieder hart arbeiten zu müssen. Er stand bereits auf der linken Seite der Arbeitsunfähigen. Dann sei Diamanski gekommen und habe gesagt: »Junge, Du kannst doch arbeiten, Du bist ja gesund, ich weiss das doch, stell Dich mal da rüber.« Und er habe ihn genommen und auf die andere Seite gestellt. Dadurch habe er überlebt.33 Franz Spindler gehörte später zu denjenigen Häftlingen des »Zigeunerlagers«, die vor der »Liquidierung« als arbeitsfähig ausgesondert und in das KZ Buchenwald transportiert wurden.34 Nach einiger Zeit wurde auch Diamanski eingeliefert, und sie wollten natürlich wissen, wie es ihren Angehörigen in Auschwitz ergangen sei. Diamanski habe lange nichts sagen wollen, schliesslich aber doch die »Wahrheit« berichtet, nämlich dass alle vergast worden waren. Diamanski sei befohlen worden, zusammen mit anderen die Sinti in den Vergasungsraum zu »transportieren«. Sie hätten jedoch den Befehl verweigert. Ein Sonderkommando aus Birkenau habe dann die Sinti in den Tod getrieben. Diamanski sei später aus Buchenwald weggekommen.35 Nach der Befreiung versuchte Spindler mehrfach, ihn zu treffen, fand aber seine Adresse nicht. Erneut erstaunt, welche Handlungsmöglichkeiten sich im KZ immer wieder eröffneten, auch wenn dies nichts daran ändert, dass für die meisten die Ermordung nicht abgewendet werden konnte. Diamanski erscheint in Franz Spindlers Schilderung als ein findiger Lagerältester, der jede Lücke ausnutzte, um den Häft33 Spindler berichtete noch viel über Vorgänge in Auschwitz und Buchenwald, etwa über die medizinischen Versuche oder über Mengeles »Lieblingszigeuner«, seinen Cousin Janusch, ebenso, wie er als Prediger seine Haftzeit verarbeitet hat. Ich behalte mir eine ausführliche Darstellung dazu vor. Zu Mengele und den Zigeunerkindern vgl. etwa Lewy, Rückkehr, S. 268–271 (S. 271 widerspricht Spindlers Darstellung). Zu Ludwiga Spindler (geb. 1921), die am 13.4.1944 ermordet wurde, vgl. Hämmerle, Diskriminiert, S. 93; zur vorgesehenen Deportation Franz Spindlers nach Natzweiler-Struthof am 9.11.1943 ebenda, S. 92. Dessen Bruder Lorenz (geb. 1928) überlebte die NS-Zeit und starb 1991 (ebenda, S. 100). 34 Am 17.4.1944 und 3.8.1944 kamen Sinti und Roma aus Auschwitz in Buchenwald an: Konzentrationslager Buchenwald, S.166 und 168. Möglicherweise wurde Spindler vor dem 16.5.1944 aus dem »Zigeunerlager« verlegt (zunächst in das Stammlager Auschwitz, dann nach Buchenwald), da er sich an die Widerstandsaktionen nicht erinnern kann. Vgl. Hämmerle, Diskriminiert, S. 92–93. 35 Leider konnte ich nicht klären, ob sich diese Aussage auf die Zeit vor oder nach der Befreiung des Lagers bezieht. Diamanski erwähnt immer, dass er in Buchenwald befreit worden sei. Ebenso sind die Vorgänge bei der »Liquidierung« des Zigeunerlagers noch im einzelnen zu prüfen. Die Darstellung von Spindler findet sich auch in: Franz Spindler, »Die Frauen und Kinder hatten sich verzweifelt gewehrt, weil sie wussten, dass sie ermordet werden sollen«, in: Daniel Strauß (Hg.), ... weggekommen. Berichte und Zeugnisse von Sinti, die die NS-Verfolgung überlebt haben, o. O. u. J. (2000), S. 162–167, hier bes. S. 166–167.
Ein deutsches Schicksal zwischen Auschwitz und Staatssicherheitsdienst
|
329
lingen zu helfen, und einigen auch, wenn möglich, das Leben rettete. Auffallend gegenüber Diamanskis Darstellung in seiner Vernehmung vor dem »AuschwitzProzess« ist Spindlers Erinnerung, Diamanski habe sich geweigert, an der Vergasung der Sinti mitzuwirken. Warum hat dieser nicht davon gesprochen? Hatte er sein Verhalten, als er Spindler davon berichtete, in ein besseres Licht gerückt, als es der Realität entsprach? Oder wollte er den Vernehmungsbeamten und dem Richter nichts von diesen Widerstandsaktionen erzählen, um möglichst alles auf der privaten Ebene zu halten und seine damalige politische Position nicht zu betonen? Vielleicht wollte er später einfach kein Aufhebens mehr davon machen? Der DDR-Staatssicherheitsdienst fällte 1964 ein eindeutiges Urteil: »Auf Grund des ständigen Verlegens in andere Lager, der Vorzugsstellung und des Verhältnisses zu SS-Leuten kann man zu der Einschätzung gelangen, dass Diamanski schon damals als Spitzel gegen die anderen Häftlinge ausgenutzt worden ist. Sein späterer politischer Verrat, das persönliche Verhalten und die aktive Tätigkeit für den amerikanischen Geheimdienst bestärken eine solche Einschätzung.«36 Erinnerungsstation SBZ/DDR
Dieses Urteil erfolgte, nachdem das Ministerium für Staatssicherheitsdienst der DDR auf Rechtsanwalt Kauls Meldung hin eine Untersuchung eingeleitet hatte. Der untersuchende Beamte, Hauptmann Hesselbarth, gab darüber hinaus eine «Charakterisierung des Diamanski»: Während seiner Tätigkeit bei der Volkspolizei sei er »als ehrlicher, aufrichtiger Mensch eingeschätzt« worden, »der von seinen Kollegen geschätzt wird. Er ist in der Verwaltungsarbeit zwar schwach, dafür aber im praktischen Handeln stark. Für gute Leistungen (Bergung von Schiffen) wurde ihm im Nov. 1949 das Ehrenzeichen der VP [Volkspolizei] verliehen. Er wurde als politisch zuverlässig, klassenbewusst und aktiv geschildert.« Später habe sich allerdings herausgestellt, »dass er Verhältnisse zu anderen Frauen hatte, vergnügungssüchtig und abenteuerlich ist sowie arrogant und überheblich auftritt.« Weiter habe es einige ungeklärte Verdächtigungen gegeben. Am 15. Juni 1964 verfasste Hesselbarth einen »Massnahmeplan – Diamanski«. Eine Postkontrolle sollte mögliche Kontakte aufdecken, »Personen, die damals IM [Informelle Mitarbeiter] waren und an D. arbeiteten,« waren ebenso zu befragen wie Freunde und Bekannte.37 Diamanski wurde in der folgenden Zeit überwacht, selbst sämtliche 36 ZA, MfS AP 8266/73, 10.6.1964. Hauptmann Hesselbarth gelangte u. a. zu dieser Einschätzung, weil Diamanski seinerzeit auf Anforderung durch das Reichssicherheitshauptamt in das Gestapo-Gefängnis in der Prinz-Albrecht-Strasse verlegt worden sei. Meines Erachtens erfolgte dies jedoch wegen seiner Aktivitäten als Kommunist. 37 Ebenda, Massnahmeplan, 15.6.1964.
330
|
Hermann Diamanski
Kennzeichen der in der Nähe seiner Wohnung parkenden Autos fanden Eingang in die Akten. Einzelheiten aus dem Leben Diamanskis und seiner Frau wurden notiert. Am 7. Juni 1973 beendete ein Mitarbeiter diese Aktivitäten und verfügte die Archivierung, weil »z. Zt. keine weiteren Bearbeitungsmöglichkeiten vorhanden sind und auf Grund der Akten des D. eine aktive Tätigkeit nicht angenommen wird. Einreisen in die DDR wurden nicht bekannt.«38 Hier wird uns erneut ein anderes Bild Hermann Diamanskis vor Augen geführt. Wie konnte es dazu kommen? Wie lässt sich die Sichtweise des Staatssicherheitsdienstes erklären? Am 1. Juni 1947 wurde Hermann Diamanski vom stellvertretenden Polizeipräsidenten Horst Jonas in den Dienst des thüringischen Landespolizeiamtes, Abteilung Schutzpolizei, eingestellt.39 In seinem Fragebogen und Lebenslauf vom 10. Juni 1947 gab er an, seit seinem 16. Lebensjahr Mitglied der Kommunistischen Jugendinternationale gewesen und 1929 unter der Nummer 22414 in die KPD eingetreten zu sein. 1931 habe er die Parteischule in Lüneburg besucht. In einer Gewerkschaft sei er nicht gewesen, wohl aber im Internationalen Seemannsclub. Dann berichtete er über seine illegale Parteiarbeit und die Ermordung seiner ersten Frau, die er 1932 geheiratet hatte, über seine Emigration nach England und seine Zeit in Spanien.40 Dort habe er in der 11. Internationalen Brigade, dann in der 3. Artilleriegruppe gekämpft. Sein Politischer Kommissar sei Julius Jürgensen gewesen. Jürgensen war auch neben Horst Jonas und Max Willner Bürge für seinen KPD-Beitritt gewesen.41 Gegenüber den Aussagen vor 38 Ebenda, Abverfügung zur Archivierung, 7.6.1973. 39 Jonas (1914–1967) geriet nach Diamanskis Flucht – und noch einmal 1964 – auch ins Visier der Stasi, weil er mit Diamanski befreundet und sein Mithäftling in Auschwitz gewesen war. Er taucht wie Diamanski auf Prämienschein-Listen des »Zigeunerlagers« auf (Państwowe Muzeum, D-AuII-3a/1890). Diamanski schrieb am 20.3.1954, ein früherer Mithäftling habe ihm 1947 eine Stelle in Weimar angeboten (HHStA, Abt. 518 Pak. 796 Nr. 10, Bl. 8). In der DDR waren Vorwürfe laut geworden, Jonas habe in Auschwitz – dort sei er im »Zigeunerlager« Elektriker gewesen – mit der SS zusammengearbeitet und Kommunisten verraten. Zunächst blieben die Anschuldigungen ohne Folgen für ihn. Später gelang es offenbar nicht, ihn zu befragen. Es findet sich schliesslich eine Notiz über seinen Tod. Vgl. ZA, MfS AP 8266/73, Massnahmeplan, 15.6.1964, sowie die folgenden Überprüfungsmassnahmen. 40 Einzelheiten seiner illegalen Tätigkeit, über die es auch einen Vermerk des sowjetischen Geheimdienstes gibt (Hesselbarth, 13.7.1964: ZA, AP 8266/73), müssen noch geklärt werden. Zu Diamanskis erster Frau vgl. Anm. 20. 41 ZA, MfS AOP 78/57 (Diamanski), Bd. 1. Max Willner nannte er im Entschädigungsverfahren am 20.3.1954 auch als Zeuge für die im KZ verbrachte Zeit. Dieser sei jetzt Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Hessen und wohne in Offenbach, Bismarckstr. 31 (HHStA, Abt. 518 Pak. 796 Nr. 10, Bl. 8). Mir liegt ein nicht näher bezeichneter Zeitungsartikel vor, nach dem Diamanski beim Empfang zum 60. Geburtstag Willners neben
Ein deutsches Schicksal zwischen Auschwitz und Staatssicherheitsdienst
|
331
und während des »Auschwitz-Prozesses« betonte Diamanski hier seine Aktivitäten für die kommunistische Partei. Er musste wissen, dass falsche Mitteilungen sofort Konsequenzen für ihn nach sich gezogen hätten. Insofern ist anzunehmen, dass er sich um höchstmögliche Korrektheit bemühte. Diamanskis Angaben wurden in der Tat mehrfach überprüft. So bestätigte die Weimarer »Betreuungsstelle Opfer des Faschismus« am 8. August 1947, dass er aus politischen Gründen inhaftiert worden sei und im Exil habe leben müssen. Interessanterweise wird nicht näher auf die Zeit in Spanien eingegangen, obwohl es damals politische Verdächtigungen gegen ihn gegeben hatte.42 In einer Beurteilung vom 20. Mai 1948 wurde er als Mann der Praxis beschrieben, der »sehr geschätzt« sei. Er sei ein »offener, ehrlicher Charakter«. Ähnliche Einschätzungen finden sich in der folgenden Zeit. Mehrfach erfolgten Beförderungen. Am 30. November 1947 wurde er für die Volkspolizei verpflichtet, am 16. September 1948 zur Grenzpolizei versetzt. In seiner Personalakte ist noch vermerkt, dass seiner Bitte vom 8. Dezember 1948 um Versetzung zur Wasserpolizei und zum Küstenschutz zunächst nicht stattgegeben werden konnte. 1949 wurde Diamanski beurlaubt, weil man ihn der »Schiebereien und der unrechtmässigen Aneignung von Pelzmänteln« verdächtigte. Am 10. Mai 1949 hiess es, seine Beurlaubung sei aufgehoben worden, weil sich die Anschuldigungen »als haltlos erwiesen« hätten. Diamanski habe seinen Dienst wieder aufgenommen. Allerdings versetzte man ihn am 13. Juni 1949 nach Schwerin zur Landespolizeibehörde Mecklenburg, Abteilung Wasserschutzpolizei. 1951 übergab ein Informeller Mitarbeiter dem MfS Unterlagen, nach denen sich Diamanski beim westdeutschen Bundesamt für Verfassungsschutz als Mitarbeiter beworben habe;43 schon 1945 anderen ehemaligen Auschwitz-Häftlingen anwesend war (PA Sch.-D.). Julius Jürgensen (1896–1957) war Spanienkämpfer und seit Januar 1944 im KZ Buchenwald inhaftiert. Nach dem Krieg übte er hohe Funktionen in der westdeutschen KPD aus. 1956 siedelte er in die DDR über (Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Biographisches Lexikon, Berlin 1970, S. 234–235). 42 Ende 1939 erhielt Gustav Szinda (1897–1978) von der Komintern den Auftrag, das gesamte Kadermaterial aus Spanien über die deutschen und österreichischen Freiwilligen durchzusehen und eine Übersicht der Personen zu erstellen. Über Diamanski schrieb er: »Dimanski [sic!] Hermann. Kam im Oktober 1937 nach Spanien, stand im Verdacht, im Auftrag des Gegners nach Spanien gekommen zu sein und stand unter der Kontrolle der SIM [Servicio de Investigación Militar = Militärischer Übrwachungsdienst]. Über seine weitere Tätigkeit und seinen Verbleib in Spanien ist uns nichts bekannt.« SAPMO-BA Berlin, RY 1/I2/3/86, Bl. 130; Mitteilung von Michael Uhl. Ich danke ihm sowie Peter Huber herzlich für ihre Recherchen. Diamanski ist ebenfalls auf einer Liste der Spanienkämpfer aus Thüringen enthalten. (SAPMO-BA, SgY 11, Mitteilung vom 6.10.1999). 43 Eine angebliche Befürwortung dieser Bewerbung durch Tausch, Leiter des Informationsamtes beim BVSA, Nebenstelle Berlin, vom 4.6.1951 findet sich in ZA, MfS AOP 78/57 Beiakte (Diamanski).
332
|
Hermann Diamanski
bis 1947 sei er Mitarbeiter des amerikanischen militärischen Abwehrdienstes CIC, des Counter Intelligence Corps, gewesen. Jetzt setzten Ermittlungen ein, die auch die Vorgänge von 1949 zum Gegenstand hatten. Die thüringische Verwaltung des Staatssicherheitsdienstes teilte am 28. Juni 1951 mit, dass Diamanski aus Asservatenbeständen »durch Schiebereien« Pelzmäntel für seine Frau bekommen habe. »Da er aber ein gerissener Bursche ist und sich aus jeder Situation herausschlengeln kann«, sei das ohne nachteilige Folgen für ihn geblieben. Mehrfach habe er sich im übrigen darüber beklagt, dass er das Geld für die Wünsche seiner Frau nicht auftreiben könne. »Sein ganzer Verkehr hier in Weimar war leichtlebig und undurchsichtig.« Der unterzeichnende Chefinspekteur der Volkspolizei äusserte noch die Vermutung, Diamanski sei mehr aus »Abenteuerlust« denn aus politischer Überzeugung Spanienkämpfer geworden.44 Spielte bei dieser Einschätzung das politische Misstrauen gegen die ehemaligen Spanienkämpfer eine Rolle? In der DDR setzte 1950 eine Kampagne gegen »West-Emigranten« ein, zu denen auch die Spanienkämpfer gehörten.45 Dahinter stand der Argwohn gegen alle, die nicht in die Sowjetunion emigriert waren und aus der Kenntnis »des Westens« Kritik am Kurs Stalins sowie seiner Anhänger hätten üben können. Möglicherweise war Diamanski in diese internen Auseinandersetzungen hineingeraten, so dass ihn die einen als leichtlebig, die anderen als politisch zuverlässig beurteilten. Zum 31. Dezember 1950 wurde Diamanski aus der Volkspolizei entlassen. Danach arbeitete er an der Seefahrtsschule Wustrow als »gesellschaftspolitischer Lehrer«, zeitweise auch als stellvertretender Direktor.46 1952 leitete die Landesparteikontrollkommission ein Untersuchungsverfahren gegen ihn ein. Er wurde 44 ZA, MfS AOP 78/57 Beiakte. Vgl. den Ermittlungsbericht vom 21.6.1951, in dem diese Einschätzung bereits formuliert war, sowie einen weiteren Ermittlungsbericht aus Mecklenburg vom 30.1.1952 (hier tauchen bereits Kontaktpersonen Diamanskis auf, auf die dann bei den späteren Untersuchungen zurückgegriffen wird). 45 Vgl. Hermann Weber, Die KPD-SED an der Macht. Dokumente, Sonderausgabe aus »Der deutsche Kommunismus«, Köln 1963, S. 582–587. Die Kampagne stand im Zusammenhang mit der Affäre um den angeblichen US-Spion Noel H. Field (1904–1972). Vgl. Wolfgang Kießling, Partner im »Narrenparadies«. Der Freundeskreis um Noel Field und Paul Merker, Berlin 1994; Hermann und Kate Field, Departure Delayed. Stalins Geisel im Kalten Krieg, Hamburg 1996; George H. Hodos, Schauprozesse. Stalinistische Säuberungen in Osteuropa 1948–1954, Berlin 2001, bes. S. 67–77 und 363 (siehe auch Register). Insgesamt zur Rolle der Spanienkämpfer Michael Uhl, Mythos Spanien. Das Erbe der Internationalen Brigaden in der DDR, Bonn 2004 (zu den Auswirkungen der Noel Field-Affäre S. 282–299). 46 Zunächst dachte ich, es handele sich um die Halbinsel Wustrow. Vgl. Edelgard und Klaus Feiler, Die verbotene Halbinsel Wustrow. Flakschule – Militärbasis – Spionagevorposten, Berlin 2004. Die Seefahrtsschule war jedoch nicht hier, sondern – wie mir die beiden Autoren dankenswerterweise am 25.11.2004 mitteilten – in Wustrow auf der Halbinsel FischlandDarß-Zingst angesiedelt.
Ein deutsches Schicksal zwischen Auschwitz und Staatssicherheitsdienst
|
333
beschuldigt, die Berliner Westsektoren betreten zu haben. Diamanski verteidigte sich, er habe sich mit der S-Bahn verfahren und zufällig eine republikflüchtige Person getroffen, die ihn dann denunziert habe. Als Ergebnis des Verfahrens wurde er als Kulturdirektor der Deutschen Schiffahrts- und Umschlagzentrale (DSU) nach Magdeburg in Sachsen-Anhalt versetzt. Am 5. Februar 1953 erklärte das MfS, dass der Geheime Mitarbeiter, »der die Angaben über Diamanski machte, des Doppelspiels entlarvt und von uns verhaftet wurde. Aus seinen Vernehmungen ist zu ersehen, dass die von ihm gemachten Mitteilungen erlogen sind«.47 Dennoch blieb etwas an Diamanski hängen, da er über die Zeit von 1945 bis 1947 keine Angaben gemacht habe. Auf der anderen Seite stehen immer wieder Auszeichnungen. Am 9. Juli 1949 erhielt er eine Prämie von 500,- Mark für Leistungen, »welche sich besonders auf organisatorischem Gebiet auswirkten«, und am 3. November 1949 das Ehrenzeichen der Volkspolizei »für ausserordentlichen tatkräftigen Einsatz bei der Bergung von Schiffen an der Nord- und Ostküste der Insel Rügen«.48 1950 bestand er die Prüfung zum Seesteuermann auf kleiner Fahrt und in kleiner Hochseefischerei »Wegen seiner gesellschaftlichen Aktivität: Mit gut«.49 Das Bild wird immer widersprüchlicher. Kurze Zeit später änderten sich die Verhältnisse grundlegend. Diamanski flüchtete Ende Februar oder Anfang März 195350 mit seiner Familie nach WestBerlin und stellte sich dem amerikanischen Geheimdienst zur Verfügung. Sofort äusserte der Staatssicherheitsdienst den Verdacht, dass Diamanski doch von Anfang an für den westdeutschen Verfassungsschutz gearbeitet haben könne.51 Das Bundesamt für Verfassungsschutz teilte mir mit, dass Diamanski »kein Mitarbeiter« war und über ihn auch »keine Erkenntnisse« vorliegen.52 Jedenfalls begannen damals die DDR-Sicherheitsorgane, jeden Kontakt Diamanskis genau zu beobachten. Mitarbeiter der Seefahrtsschule Wustrow wurden auf ihn angesetzt.53 47 Wie Anm. 44. Die Geschehnisse von 1949 und die angebliche Bewerbung von 1951 spielten auch bei den Überprüfungen 1964 eine Rolle. 48 ZA, MfS AOP 78/57 Beiakte (enthält Personalakte). Daraus wurden auch die vorhergehenden Angaben entnommen, soweit nicht anders zitiert. 49 Ebenda (aber nicht in der Personalakte). Das Zeugnis vom 25.2.1950 über die Befähigung zum Seesteuermann auf kleiner Fahrt legte Diamanski auch im Wiedergutmachungsverfahren nach seiner Übersiedlung in die Bundesrepublik vor. Als Wohnort wurde angegeben: Schwerin, R.-Koch-Str. 10: HHStA, Abt. 518 Pak. 796 Nr. 10, Bl. 4. 50 Die Daten unterscheiden sich in den Angaben Diamanskis und des MfS leicht. 51 Ebenda, Schreiben der Bezirksverwaltung Magdeburg des MfS nach Berlin vom 1.6.1953. 52 Schreiben vom 22.11.2004 (Herr Waldmann). Wilhelm Reibel erwähnte, Diamanski sei nach seiner Flucht von den Amerikanern (513. Military Intelligence Group) im »Camp King« in Oberursel/Taunus vernommen wurden (Schreiben vom 10.12.2004). 53 ZA, MfS AOP 78/57, Bd. 1. U. a. handelte es sich um Hein Ströh, den Personalleiter an der Seefahrtsschule (s. Bericht Mielke am 10.4.1954). Aus einem Bericht vom 27.4.1954
334
|
Hermann Diamanski
Am 30. Mai 1953 berichtete einer der Informellen Mitarbeiter unter dem Decknamen »Klaus« von seinem Besuch bei Diamanski im West-Berliner Flüchtlingslager an der Hermesdorferstrasse 70, wo dieser wohnte. Diamanski habe gegen die DDR gesprochen, versucht, ihn abzuwerben, und ihn mit amerikanischen Offizieren ins Gespräch gebracht. Der Auftrag bestehe darin, das Personal an der Seefahrtsschule zu unterwandern, den Umschlagsverkehr in Stralsund zu kontrollieren und gegebenenfalls zu sabotieren, Nachrichten über sowjetische Häfen zu erhalten, Verbindungen zu Lotsen in der DDR herzustellen, um den Schiffsverkehr zu kontrollieren sowie einen Mann in das Rügen-Radio einzuschleusen. Am 16. Juni 1953 lieferte »Klaus«, der im Mai 1951 an die Seefahrtsschule gekommen war, einen ausführlichen Bericht über Diamanski. Seinerzeit sei dieser stellvertretender Schulleiter gewesen. Im Dorf sei er »äusserst unbeliebt« gewesen. »Man behauptete, er terrorisiere das ganze Dorf, und ein grosser Teil der Einwohner hatte regelrechte Angst vor ihm.« Einige Menschen habe er gehasst, für andere sich selbstlos eingesetzt. Vor allem gegenüber Menschen mit höherer Schulbildung sei er voreingenommen gewesen. In einem Gespräch habe er bemerkt, diese »wären früher in grosser Uniform und in weissen Handschuhen an Bord spazieren gegangen, er wäre nur als Heizer gefahren und da er nicht ganz richtig Deutsch spricht, würden wir innerlich auf ihn herabsehen«. Politisch habe sich Diamanski nie eine Blösse gegeben. Anders seine Frau. »Obwohl Genossin, bevorzugte sie, was in Wustrow allgemein bekannt war, die extremsten westlichen Moden.« Diamanski habe dies nicht verhindern können. So sei er trotz guten Gehalts immer in Geldschwierigkeiten gewesen. Schliesslich habe er wegen interner Vorgänge die Schule verlassen.54 Konstruierte »Klaus« das Verhalten von Diamanskis Frau, um diesen zu entlasten? Ihr Auftreten widerspräche auch jeglicher »Agentenlogik«, denn es musste auffallen und hätte eine Enttarnung erleichtert. War also Diamanski von seinen Erfahrungen als Seemaschinist und den Denkkategorien des Klassenkampfes derart geprägt, dass er als Repräsentant des Proletariates im Dorf und gegenüber Kollegen auftrat und sich deshalb teilweise unbeliebt machte? »Klaus« versuchte auch in weiteren Schilderungen, Diamanski und andere Verdächtige differenziert zu charakterisieren.55 »Klaus« blieb allerdings ergibt sich, dass Ströh unter dem Namen »Werner Westphal« als Geheimer Mitarbeiter (GM) tätig war: ebenda, Bd. 2. Aus Bd. 1 der Akte wird auch im folgenden zitiert, soweit nicht anders angegeben. 54 Über den 17. Juni an der Schule berichtete »Klaus« am 21.6.1953, trotz kritischer Stimmen habe es »keinerlei feindliche Agententätigkeit oder auch nur Beeinflussungsversuche« gegeben. 55 So machte er am 19.1.1954 die Personalpolitik des Staatssekretariates für Schiffahrt für die Unzufriedenheit mancher Mitarbeiter verantwortlich. Vielleicht war dies eine vorsichtige Anspielung darauf, dass ein Konflikt mit der vorgesetzten Behörde zur Versetzung
Ein deutsches Schicksal zwischen Auschwitz und Staatssicherheitsdienst
|
335
nicht der einzige Informelle Mitarbeiter, damals als »Geheime Informanten« (GI) oder »Geheime Mitarbeiter« (GM) bezeichnet. Einige von ihnen erwiesen sich als regelrechte Denunzianten, die nun die Gelegenheit sahen, nicht nur nachteilige Gerüchte über Diamanski auszustreuen – so hiess es, er baue in Hamburg eine Gruppe »gegen die DDR« auf -,56 sondern zugleich andere Personen an der Schule anzuschwärzen. Ebenso wurden seine Verbindungen zu ZK-Mitgliedern herausgestrichen, die inzwischen diskreditiert waren, etwa zu Franz Dahlem.57 Deutlich wird, dass nun eine grosse Aktion im Gange war. Am 27. Oktober 1953 wurde mitgeteilt, aus der Festnahme einer Frau habe sich ergeben, dass Diamanski unter dem Decknamen Hermann Schulz in Berlin-Zehlendorf, Glockenstrasse 27, eine »Hauptagentur« eingerichtet habe und »die gesamte VP [Volkspolizei] im Auftrage des Amerikanischen Geheimdienstes« bearbeite. Daraufhin wurde nach einigen Vorermittlungen am 9. November 1953 die operative Aktion »Wassermann« eingeleitet.58 Ziel war es, Diamanski zu kompromittieren – nicht zuletzt durch einen »weiblichen GM« –, ihn zu werben und ihn festzunehmen,59 darüber hinaus das gesamte Netz seiner Kontakte zu entlarven. Die Operation wurde auch fortgesetzt, nachdem am 1. Dezember 1953 bekannt geworden war, dass Diamanski nach West-Deutschland geflogen sei. In der folgenden Zeit wurden die Kontaktpersonen Diamanskis weiter »durchleuchtet«, der Briefwechsel von Mitarbeitern mit ihm gefördert und Denunziationen entgegen genommen. Einige der »Verdächtigen«, die anscheinend etwas vom Misstrauen gegen sie gemerkt hatten, wehrten sich auf dieselbe Weise,
56 57
58
59
Diamanskis führte. Dies behauptete auch Diamanski später. Ebenso verteidigte »Klaus« am 7.5.1954 Diamanski, indem er einen Denunzianten des gespannten Verhältnisses zu diesem bezichtigte (Bd. 2 der Akte). Bericht des Unterleutnants Mielke am 10.4.1954 über Aussagen des GI »Hans Mondhofer«. Vgl. Bericht von »Werner Westphal« (Hein Ströh) am 4.3.1954. Franz Dahlem (1892– 1981), seit 1928 Mitglied des Politbüros der KPD, dann SED, Spanien-Kämpfer, von 1942 bis 1945 im KZ Mauthausen inhaftiert, wurde im Zusammenhang mit den Aktionen gegen die »West-Emigranten« (Noel-Field-Affäre) 1953 seines Amtes als Kaderchef der Partei, 1954 sogar jeglicher Funktion enthoben. 1956 konnte er rehabilitiert werden (vgl. Weber, KPD-SED an der Macht, S. 593–596; Weber/Herbst, Deutsche Kommunisten, S. 141–143). Damit beginnt Bd. 1 der Akte. Auf der Rückseite des Deckblattes findet sich eine Graphik des angeblichen geheimdienstlichen Netzes mit Diamanski als Mittelpunkt sowie den darauf angesetzten GMs und GIs. Die Aktion wurde zunächst von Hauptmann Mindak in der Abteilung I/4 (Leiter: Wollbaum) geleitet. – Diamanski wohnte damals in der Glockenstr. 2 (vgl. A. 19). Massnahmeplan vom 4.11.1953. Vgl. dazu den Brief einer Frau an Diamanski (Hermann Schulz) vom 11.1.1954.
336
|
Hermann Diamanski
indem sie Gerüchte ausstreuten.60 Persönliche Feindschaften kamen zum Vorschein.61 Der GI »Werner Westphal« wurde veranlasst, Diamanskis Einladung anzunehmen und ihn zu besuchen. Er sprach mit ihm über die Gründe seiner Flucht: Offenbar hatte Diamanski erfahren, dass gegen seine Frau wegen ihrer »Westeinkäufe«, aber auch gegen ihn ein Verfahren eingeleitet worden sei. Später vermutete »Westphal«, Diamanski habe eine Stelle beim westdeutschen Bundesamt für Verfassungsschutz angetreten.62 Ähnlich naiv wie bei der Zielsetzung der operativen Aktion hoffte nun der berichtende Offizier des Staatssicherheitsdienstes, Diamanski abwerben und vielleicht sogar über ihn in das Amt für Verfassungsschutz eindringen zu können.63 Doch dann reagierte Diamanski nicht mehr auf die Briefe des Mitarbeiters. Da ohnehin alle verdächtigen Personen, soweit sich nicht ihre »Unschuld« erwiesen hatte, inzwischen verhaftet oder vom Staatssicherheitsdienst angeworben worden waren, wurde im Mai 1956 die Aktion »Wassermann« eingestellt.64 Zwischen 1964 und 1973 kam es dann zu den erwähnten nochmaligen Überprüfungen. Der »Fall Diamanski«, die Operation »Wassermann« zeigt anschaulich die – oft dilettantische – Arbeitsweise des Staatssicherheitsdienstes mit seinen vielen Informanten. Nicht alle machten sich zu opportunistischen Werkzeugen des DDR-Geheimdienstes. Einige nutzten die Situation für ihre Interessen, andere versuchten, möglichst differenziert zu argumentieren und den ehemaligen Kollegen zu entlasten. Offensichtlich herrschten nicht nur negative Meinungen über ihn vor. Es könnte sein, dass Diamanski, geprägt vom Klassenkampf-Denken, zu sehr als neuer »Herr« auftrat, endlich ein gutes Leben führen wollte, aber in die Mühlen der internen Auseinandersetzungen innerhalb der SBZ/DDR geriet. Als ehemaliger Spanienkämpfer und »West-Emigrant« war er den aus der Sowjetunion zurückgekehrten Kommunisten verdächtig, sie beobachteten seine Tätigkeit misstrauisch. Ein westlicher Agent war er wohl damals nicht, sonst wären er und seine Frau nicht derart auffällig aufgetreten. Als er dann aber alle Verdächtigungen zu bestätigen schien und nach West-Berlin flüchtete, galt er als Verräter. 60 Vgl. Bericht Gerhard Schirdewahn am 7.7.1954 (Bd. 2, daraus auch im folgenden): Diamanski sei geschieden und halte sich in Hamburg auf. Diese Methode, sich an gegenseitiger »Wachsamkeit« zu übertreffen und dabei auch vor Denunziationen nicht zurückzuschrecken, war seit dem stalinistischen Terror der 1930er Jahre üblich. Vgl. Sheila Fitzpatrick/ Robert Gellately (Hgg.), Accusatory Practises. Denunciation in Modern European History, 1789–1989, Chicago 1997. 61 Vgl. Bericht »Klaus« am 17.9.1954. 62 Berichte »Werner Westphal« am 1.8.1954 sowie am 12.10.1954 mit Brief von Diamanskis Ehefrau. Der Briefwechsel setzte sich weiter fort. 63 Bericht Oberleutnant Henkel am 6.1.1955. 64 Vgl. Berichte vom 4.4.1956 und 13.5.1956. Ein entsprechender Beschluss folgte am 23.5.1956. Damit endet Bd. 2 der Akte.
Ein deutsches Schicksal zwischen Auschwitz und Staatssicherheitsdienst
|
337
Selbst seine Haft während der NS-Zeit wurde nun umgewertet und ihm eine Zusammenarbeit mit den Nazis unterstellt. Folgerungen: Diamanski im Vexierbild
Während meiner Nachforschungen haben sich immer wieder überraschende neue Elemente im Leben Hermann Diamanskis ergeben. Sie haben mich oft verwirrt. Manchmal erschien nichts mehr sicher.65 Viele Angaben Diamanskis widersprachen den Dokumenten. Einige Lücken sind nicht zu schliessen. Weder er selbst noch seine Frauen können befragt werden, und es ist schwierig, Zeitzeugen zu finden. Verschiedene Verhaltensweisen haben mich zunächst irritiert: Ein Kommunist teilt mit einem SS-Mann sein Weihnachtspäckchen. Nach seiner Flucht aus der DDR arbeitet er für den US-Geheimdienst. Wie verträgt sich sein Einsatz für andere in Auschwitz mit seinem Auftreten in der SBZ/DDR, das offenbar manche vor den Kopf stiess? Hat er überhaupt Überzeugungen gehabt, zu denen er gestanden ist, oder war er wirklich nur ein Abenteurer, wie der Offizier des Staatssicherheitsdienstes meinte? Das Seemannsleben hat vielleicht tatsächlich das Abenteuerhafte in seiner Existenz gefördert. Diamanski scheute vor keiner Gefahr zurück, aber mir scheint, dass er dabei seine Risiken ziemlich genau einzuschätzen wusste. Er verstand es immer wieder, sich aus gefährlichen Situationen zu befreien. Die Orte seines Engagements zeigen darüber hinaus, dass er bei aller Abenteuerlust doch ein überzeugter Kommunist war, zumindest bis zu der Zeit in der DDR. Wenn es ihm nur um Abenteuer gegangen wäre, hätte er sie auch anderswo suchen können. Zu seinen Überzeugungen gehörte ausserdem, sich für andere Menschen einzusetzen, wenn sie es nötig hatten, unabhängig von deren Weltanschauungen. Dass er immer wieder Menschen geholfen, ja ihr Leben gerettet hat, wird von verschiedensten Seiten bestätigt. Und warum sollte er nicht mit seinem Bettnachbarn im Gefängnis das Päckchen teilen, selbst wenn dies ein SS-Mann war? Hier entschied die Situation, man war aufeinander angewiesen. In Auschwitz erwies sich Diamanski als geschickter Organisator, der seine Kenntnisse und Fähigkeiten für sich selbst, für die politische Widerstandsgruppe im Lager und für Menschen, mit denen er zu tun hatte, einsetzte. Unbeschädigt ist er gewiss nicht aus den Lagern herausgekommen. In der SBZ/DDR wurde er nach meinem Eindruck nicht mit dem Widerspruch zwischen seinen eigenen Hoffnungen nach der Befreiung und den dortigen politischen Verhältnissen, Intrigen und Flügelkämpfen fertig. Nachdem er sich zur Flucht entschlossen hatte, musste er für sich und seine Fa65 Vgl. Hans-Jürgen Goertz, Unsichere Geschichte. Zur Theorie historischer Referentialität, Stuttgart 2001.
338
|
Hermann Diamanski
milie eine neue Existenz aufbauen. Vielleicht hat er sich dem US-Geheimdienst zur Verfügung gestellt, um dafür die erforderlichen Mittel zu erhalten. Wirklich geschadet hat er durch seine Tätigkeit offensichtlich niemandem. Möglicherweise war ihm sogar bewusst, dass keiner seiner Bekannten seiner Bitte um einen Besuch in West-Berlin nachkommen werde – ausser den Spitzeln, die der Staatssicherheitsdienst auf ihn ansetzen werde. Lange hat die Zusammenarbeit im übrigen nicht gedauert und ihm auch finanziell nicht viel gebracht.66 In Westdeutschland musste er recht arm leben. Von seinen ehemaligen Genossen wurde er als Verräter angesehen. Die westdeutschen Behörden betrachteten ihn als früheren Kommunisten misstrauisch. Gesellschaftlich war er ausgegrenzt. Die Stationen seines Lebens und die unterschiedlichen Sichtweisen lassen gerade in ihrem fragmentarischem Charakter die deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert exemplarisch lebendig werden. Welche Folgerungen für den Umgang mit Erinnerung lassen sich daraus ziehen? Ganz banal bestätigt sich, was wir bereits aus anderen Untersuchungen wissen: Angaben in Selbstzeugnissen müssen anhand anderer Quellen überprüft werden, da sich das Gedächtnis täuschen kann, der Akteur vielleicht auch bewusst täuschen will, oder die Erinnerung durch spätere Vorgänge, Deutungsmuster oder Wandel in den Überzeugungen überlagert worden ist. Wenn diese Überprüfung jedoch möglich ist und die Selbstzeugnisse im Rahmen der jeweiligen Lebenswelten gesehen werden, gewinnen wir mehr Einsichten in die Denk- und Verhaltensweisen der Akteure, als es zunächst den Anschein hat. Darüber hinaus erschliessen sich »harte Informationen« über historische Vorgänge.67 In unserem Fall gilt dies etwa für die Verhältnisse in Auschwitz oder für einige Mechanismen in der Arbeit des DDR-Staatssicherheitsdienstes. Schliesslich erweist es sich als weiterführend, von biographischen Wendepunkten und lebensweltlichen Grundeinstellungen auszugehen, um die verschiedenen Sichtweisen sowie die Zusammenhänge von individuellem Verhalten und Strukturen zu interpretieren. In Diamanskis Leben, soweit ich es bisher rekonstruieren konnte, sind derartige Grundeinstellungen etwa seine Hilfs- und Rettungsbereitschaft, darüber hinaus seine proletarische Überzeugung in der DDR, wie er sie gegenüber dem Stasi-Mitarbeiter »Klaus« äusserte. Von ihnen aus ergibt sich ein Bild seiner Persönlichkeit, das manche Widersprüche auflösen kann. Zugleich wird daran deutlich, warum Diamanski in der DDR letztlich nicht Fuss 66 Dafür sprechen seine berufliche Tätigkeit nach der Übersiedlung in die Bundesrepublik sowie der Versuch, im Rahmen des Entschädigungsverfahrens auch als Vertriebener anerkannt zu werden. 67 Vgl. dazu auch Heiko Haumann, Blick von innen auf den Stalinismus. Zur Bedeutung von Selbstzeugnissen, erscheint voraussichtlich 2005 in einem Sammelband. [Siehe den entsprechenden Beitrag in meinem Band: Lebenswelten und Geschichte. Zur Theorie und Praxis der Forschung. Köln usw. 2012].
Ein deutsches Schicksal zwischen Auschwitz und Staatssicherheitsdienst
|
339
fassen konnte. Schliesslich zeigt sich, dass die Erinnerungsvorgänge und Sichtweisen bei Diamanski wie bei den übrigen Akteuren nicht zuletzt in ihren politischen Zusammenhängen und ihrer jeweiligen Gegenwart zu sehen sind: dem Auschwitz-Prozess, der Situation in der DDR oder in der BRD. Wenn wir die verschiedenen Erinnerungen vergleichen: Lassen sich Aussagen machen über die wechselseitigen Beziehungen zwischen individuellem und kollektivem Gedächtnis? Das individuelle Gedächtnis verändert sich ständig, durch jeden neuen Einfluss, durch jeden Erinnerungsvorgang. Vieles verschwindet ganz, wird vergessen – für immer, oder es bleibt im Langzeitspeicher abgelegt, bis es aus irgendeinem Grund wieder mobilisiert wird. Behalten wird häufig etwas, dem die jeweilige Person Bedeutung zumisst oder was sich durch eine bestimmte Assoziation einprägt. Träume, Phantasien und Wirklichkeiten können ineinander übergehen. In diesem vielschichtigen Erinnerungsprozess verändern sich auch die Menschen, die Verarbeitung ihrer Erfahrungen, ihre Wünsche, Wahrnehmungsweisen und Deutungsmuster.68 Das individuelle Gedächtnis existiert nicht isoliert, die individuelle Erinnerung vollzieht sich nicht im luftleeren Raum, da der Mensch in der Regel mit anderen Menschen kommuniziert und in einem »sozialen Rahmen« steht.69 Insofern ist sein individuelles Gedächtnis Teil von kollektiven Gedächtnissen: der Familie, des Freundeskreises, der Kollegenschaft, bis hin zur Nation oder noch grösseren Kollektiven. Entsprechend unterschiedlich ist die Art dieser kollektiven Gedächtnisse: Die einen sind sehr konkret auf die spezifischen Verhältnisse und Beziehungen bezogen, die individuellen Gedächtnisse und Erinnerungen spielen dort eine unmittelbare Rolle. Werden die Kollektive grösser, ist dies immer weniger der Fall. Dennoch geht die Vielzahl der Gedächtnisse von Individuen und kleinen Kollektiven in die grösseren ein, ohne dass dies immer genau zu fassen wäre. Und umgekehrt sind Inhalte des Gedächtnisses von Grosskollektiven auch bei Individuen festzustellen.70 Das hört sich theoretisch vielleicht überzeugend 68 Ich nenne nur pauschal, auch zu weiteren Hinweisen auf Gehirnfunktionen, Alexander R. Lurija, Das Gehirn in Aktion. Einführung in die Neuropsychologie, Reinbeck 1992; Jürgen Bredenhang, Lernen, Erinnern, Vergessen, München 1998; Detlef Linke, Das Gehirn, München 1999; Hans-Joachim Markowitsch, Dem Gedächtnis auf der Spur. Vom Erinnern und Vergessen, Darmstadt 2002; Michael Pauen, Illusion Freiheit? Mögliche und unmögliche Konsequenzen der Hirnforschung, Frankfurt a. M. 2004. Ein Versuch, die Ergebnisse der Hirnforschung für die Geschichtswissenschaft nutzbar zu machen: Johannes Fried, Der Schleier der Erinnerung. Grundzüge einer historischen Memorik, München 2004. 69 Darauf hat namentlich Maurice Halbwachs hingewiesen: Das kollektive Gedächtnis, Frankfurt a. M. 1985; ders., Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen, Frankfurt a. M. 1996. 70 Neben Halbwachs: Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, München 1999; Aleida Assmann, Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, München 1999; Harald Welzer
340
|
Hermann Diamanski
an, die Wege sind aber empirisch kaum zu verfolgen: Wie gehen die Erinnerungsströme hin und her? Wo sitzt das Gedächtnis von Grosskollektiven? Wer bestimmt über dessen Inhalte? Wie werden diese Inhalte vermittelt? Wie setzt sich die »biographische Erinnerung«71 in kollektiv geteilte Wissens- und Bewertungselemente fort, beeinflusst wiederum andere Individuen, steuert Handeln?72 In welchen »Erinnerungsfiguren«73 – Kommunikationen und Interaktionen, sozialen Rahmenbedingungen, Bedeutungskontexten und »Orten« der Erinnerungen – stehen nun Hermann Diamanski und diejenigen, die sich an ihn erinnern? Wie wird mit Erinnerung umgegangen, wie wird sie eingesetzt? Besonders fallen zunächst einmal Hermann Diamanskis Erinnerungslücken und extrem fehlerhafte Datierungen auf. Hat sein Gedächtnis tatsächlich durch die schwere Haftzeit während des »Dritten Reiches« derart gelitten, dass er sogar seine Flucht aus der DDR um drei Jahre vorverlegte? Oder wollte er seine Vergangenheit bewusst verschleiern? Allerdings stimmen die Daten auch in seinen Lebensläufen, die er in der SBZ/DDR anfertigen musste, nicht immer. Als Kommunist musste er wissen, dass alles überprüft wurde (und es ist erstaunlich, dass dem Staatssicherheitsdienst offenbar die Ungereimtheiten nicht auffielen). Vermutlich müssen wir davon ausgehen, dass sein Erinnerungsvermögen beeinträchtigt war – kein Wunder bei den schweren Folgen seiner Haftzeit im »Dritten Reich«. Das gilt in erster Linie für Daten, hin und wieder auch für Ereignisse. Viele Vorgänge können jedoch auch durch andere Quellen bestätigt werden, so dass seine Erinnerungen keineswegs als unbrauchbar oder belanglos anzusehen sind. Selbstzeugnisse sind in der Regel Sinnkonstruktionen, mit denen sich die historischen Akteure Rechenschaft über ihr Leben geben.74 Bei seinem Übertritt in die SBZ stellt sich Diamanski als überzeugter Kommunist und antifaschistischer Kämpfer dar. In den Vernehmungen für den Auschwitz-Prozess ist davon wenig zu spüren. Das liegt gewiss an den inzwischen eingetretenen Ereignissen, darüber hinaus am jeweiligen Kontext. Allerdings ist auch keine neue Sinngebung zu erkennen – er hätte zum Beispiel seine Rettungsaktionen hervorheben können. In den Erinnerungen der Auschwitz-Überlebenden steht seine Hilfsbereitschaft als entscheidende Charaktereigenschaft im Zentrum. Vorstellbar ist, dass jene
71 72 73 74
(Hg.), Das soziale Gedächtnis. Geschichte, Erinnerung, Tradierung, Hamburg 2001; Harald Welzer, Das kommunikative Gedächtnis. Eine Theorie der Erinnerung, München 2002. Unter »kommunikativem Gedächtnis« wird ein sich relativ rasch veränderndes, generationenspezifisches Alltagsgedächtnis verstanden, während sich das »kulturelle Gedächtnis« eher auf den tradierten Wissenskanon sowie auf die vorherrschenden Normen und Deutungsmuster bezieht. Vgl. Jan Assmann, Kulturelles Gedächtnis, S. 50 und 52. Jan Assmann, Kulturelles Gedächtnis, S. 52. Vgl. Welzer (Hg.), Das soziale Gedächtnis; Welzer, Kommunikatives Gedächtnis. Jan Assman, Kulturelles Gedächtnis, S. 38 auch 19. Dazu ausführlich Haumann, Blick von innen.
Ein deutsches Schicksal zwischen Auschwitz und Staatssicherheitsdienst
|
341
dies nicht zuletzt deshalb herausstellten, um ein »Licht« in der »Dunkelheit« des Lagerlebens zu haben; anders könnten sie es vielleicht nicht ertragen. Entweder verzichtete Diamanski darauf, weil er das im Rahmen des juristischen Verfahrens für unerheblich hielt, oder er wusste nicht mehr, welchen Sinn er seinem früheren Leben geben sollte. Nach seinem »Verrat« sass er zwischen allen Stühlen. Leider stehen uns keine Selbstzeugnisse zur Verfügung, die darüber näher Auskunft geben könnten. Im Prozess selbst hat ihn niemand nach Hintergründen gefragt. Abgesehen von anderen Zielsetzungen in der Prozessführung waren sie wahrscheinlich tabu. Mit dem Prozess entstand »Auschwitz« als Metapher, als entscheidender Bestandteil des »kollektiven Gedächtnisses« in der Bundesrepublik Deutschland, der nicht mehr »hinterfragt« wurde. In der DDR ging es um andere Zusammenhänge. Auschwitz und Spanien waren offiziell auch Metaphern für den antifaschistischen Kampf. Doch intern misstraute die »Moskau-Gruppe« den angeblichen »Clans«. Ursprünglich antifaschistische Einschätzungen wurden umgewertet. Diamanski fand sich in diesem Milieu nicht zurecht. In den Denunziationen wurde Erinnerung instrumentalisiert. Die Einflüsse »kollektiver Gedächtnisse« auf das individuelle Gedächtnis werden deutlich. Dies steuerte dann das Verhalten. Wir haben fragmentarische Einblicke in ein Lebensschicksal und dessen lebensweltliche Hintergründe erhalten.75 Bei anderen Untersuchungen fliessen oft die Quellen reichhaltiger, so dass wir das Gefühl haben, näher an der »Wahrheit« zu sein, doch tatsächlich bleibt ebenfalls vieles spekulativ. Wie sehr wir die Lücken der Quellen und die Lücken der Erinnerungen durch eigene Vermutungen oder eben offene Fragen füllen müssen, ist an diesem Beispiel deutlich geworden. Wenn wir mit den historischen Akteuren kommunizieren,76 versuchen wir unwillkürlich, Unklarheiten auszuräumen, der Geschichte einen Sinn zu geben. Das geht aber letztlich nicht. Ich war von meinem Gespräch mit Franz Spindler emotional sehr bewegt, und ebenso haben mich sicher viele frühere Gespräche mit Kommunisten oder mit Überlebenden der NS-Verfolgung in meinem Vorverständnis beeinflusst. Zugleich war ich neugierig auf Hermann Diamanskis Leben im Zusammenhang deutscher Geschichte. So habe ich auch versucht, mit 75 Vgl. Karin Hausen, Die Nicht-Einheit der Geschichte als historiographische Herausforderung. Zur historischen Relevanz und Anstössigkeit der Geschlechtergeschichte, in: Hans Medick/Anne-Charlotte Trepp (Hgg.), Geschlechtergeschichte und Allgemeine Geschichte. Herausforderungen und Perspektiven, Göttingen 1998, S. 15–55. 76 Vgl. Heiko Haumann, Lebensweltlich orientierte Geschichtsschreibung in den Jüdischen Studien: Das Basler Beispiel, in: Klaus Hödl (Hg.), Jüdische Studien. Reflexionen zu Theorie und Praxis eines wissenschaftlichen Feldes. Innsbruck 2003, S. 105–122; Martin Schaffner, »Missglückte Liebe« oder Mitteilungen aus Paranoia City. Eine Lektüre von Justiz- und Polizeiakten aus dem Staatsarchiv Basel, 1894 bis 1908, in: Ingrid Bauer u. a. (Hg.), Liebe und Widerstand. Ambivalenzen historischer Geschlechterbeziehungen, Wien usw. 2005, S. 243–254.
342
|
Hermann Diamanski
ihm, der nur wenig Selbstzeugnisse hinterlassen hat, in ein fiktives Gespräch einzutreten. Doch hätte er überhaupt gewollt, dass ich seinen Lebensweg aufkläre? Jedenfalls, so viele Einzelheiten vielleicht auch noch rekonstruiert werden können: Manches wird im Dunkeln bleiben, und die Interpretationen werden immer differenzierter, je mehr Sichtweisen anzutreffen sind. Das macht die Arbeit des Historikers spannend und eröffnet immer wieder neue Perspektiven. Der fragmentarische Charakter unserer Erkenntnisse entspricht zugleich der Erfahrung unseres Lebens. Wir müssen diese Spannung aushalten und sollten nicht voreilig Urteile fällen. Somit gehört es zum »Probehandeln« im Nachvollzug historischer Lebenswelten, die Zerrissenheit und Spannung in sich selber zu spüren, auszuhalten und beim bewussten Handeln in der Gegenwart zu berücksichtigen.
»Wir waren alle ein klein wenig antisemitisch« Ein Versuch über historische Massstäbe zur Beurteilung von Judengegnerschaft an den Beispielen Karl von Rotteck und Jacob Burckhardt* I.
Karl von Rotteck (1775–1840) gehört zu den bedeutendsten liberalen Politikern Badens, ja Deutschlands in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Als Professor an der Universität Freiburg i. Br. – erst für Geschichte, dann für Jurisprudenz –, Verfasser der »Allgemeinen Geschichte«1, Mitherausgeber des »Staats-Lexikons«2 und verschiedener Zeitungen, Abgeordneter der Ersten, später der Zweiten Kammer des Grossherzogtums Baden wirkte er an herausragenden Stellen für die Weiterentwicklung der Verfassung, für die Meinungsäusserungs- und Pressefreiheit, für Öffentlichkeit in der Politik, für die Aufhebung der Fron- und Zehntlasten, für die Rechte der verfolgten griechischen und polnischen Freiheitskämpfer.3 Die Freiburger wählten ihn 1833 zum Bürgermeister, nachdem ihn die Regierung aufgrund seiner politischen Haltung zwangsweise in den Ruhestand versetzt hatte. Konsequent verweigerte sie nun ihre Zustimmung zur Wahl. Rotteck verzichtete auf eine Konfrontation bei der Nachwahl und empfahl seinen Neffen Joseph von Rotteck, der dann auch gewählt wurde. Im Bewusstsein der Bevölkerung blieb * Erstpublikation in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 55 (2005) 196–214. 1 Allgemeine Geschichte vom Anfang der historischen Kenntniß bis auf unsere Tage, für den denkenden Geschichtsfreund. 9 Bde. Freiburg 1812–1826 (zahlreiche Auflagen); ders.: Allgemeine Weltgeschichte für alle Stände. 4 Bde. Stuttgart 1830–1834 (weitere Auflagen). 2 Staats-Lexikon oder Encyklopädie aller Staatswissenschaften. Hg. von Karl v. Rotteck und Karl Theodor Welcker. 15 Bde. Altona 1834–1843. 3 Rüdiger v. Treskow: »Erlauchter Vertheidiger der Menschenrechte!« Die Korrespondenz Karl von Rottecks. Bd. 1: Einführung und Interpretation, Bd. 2: Briefregesten. Freiburg, Würzburg 1990–1992; Michaela Hartmann u. a.: Der »Makel des Revolutionismus« und ein Ende mit Schrecken (1815–1849). In: Geschichte der Stadt Freiburg im Breisgau. Bd. 3: Von der badischen Herrschaft bis zur Gegenwart. Hg. von Heiko Haumann und Hans Schadek. Stuttgart 1992 (2. Aufl. 2001), 61–129. Zu Rottecks Nationsverständnis vgl. Manfred Meyer: Deutscher Nationalstaat und französisches Bündnis. Karl von Rottecks Ort in der Nationalbewegung des 19. Jahrhunderts. In: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 146 (1998) 321–350; ders.: Das konstitutionelle Deutschland und der Westen. Tradition und Wandel nationaler Konzepte in Südwestdeutschland 1830–1848. In: Die Anfänge des Liberalismus und der Demokratie in Deutschland und Österreich 1830–1848/49. Hg. Von Helmut Reinalter. Frankfurt a. M. usw. 2002, 191–212. Die Schreibweise »Carl« und »Karl« wechselt in den Quellen.
344
|
»Wir waren alle ein klein wenig antisemitisch«
Karl von Rotteck populär. Er erhielt ein Denkmal – Thema einer eigenen Geschichte4 –, eine Strasse und ein Gymnasium wurden nach ihm benannt. Insofern schien es auf den ersten Blick naheliegend, dass der damalige Freiburger Oberbürgermeister Rolf Böhme – nach Vorberatungen – am 13. November 2001 dem Gemeinderat vorschlug, künftig verdiente Bürger mit einer Carlvon-Rotteck-Medaille zu ehren. Doch es regte sich Widerspruch. Der Journalist Wolfgang Heidenreich machte auf der Grundlage einer juristischen Publikation5 darauf aufmerksam, dass sich Rotteck gegen die bürgerliche Gleichstellung der Juden ausgesprochen habe und deshalb nicht zum »Musterliberalen« und Namensgeber einer Ehrenmedaille tauge. Da Rottecks Einstellung gegenüber der Judenemanzipation bereits in der im Auftrag der Stadt herausgegebenen Geschichte Freiburgs 1992 nachzulesen war,6 konnten sich weder Oberbürgermeister noch Stadträte darauf berufen, nichts gewusst zu haben. Es entbrannte eine heftige Debatte, die sich in der Presse niederschlug und in einer öffentlichen Podiumsdiskussion am 27. Februar 2002 ihren Höhepunkt fand.7 Dabei wurde einerseits auf Rottecks Leistungen als Vorkämpfer für Menschenrechte, für die Umsetzung liberaler Ideen und als Anwalt des Volkes hingewiesen, die es rechtfertigten, ihn heute noch – trotz seines »Makels«, der aus der Zeit heraus zu verstehen sei – als politisches Vorbild zu würdigen. Dem hielten andere entgegen, Rotteck sei eindeutig ein Antisemit mit völkischen Anklängen gewesen und habe somit den Weg geebnet für die spätere rassistische Variante. Aus heutiger Sicht könne er deshalb keinesfalls mehr mit Ehrungen in Verbindung gebracht werden. Worauf lässt sich ein angemessenes Urteil gründen? Den Juden waren in Baden nach 1815 und gerade durch die Verfassung von 1818 wichtige, früher gewährte politische Rechte wieder genommen worden. Um 1830 genossen sie zwar Gewerbefreiheit, steuerliche Gleichstellung und Anerkennung ihrer Konfession. Die vollen Rechte als Orts- und Staatsbürger – namentlich die Teilhabe an der Gemeindeselbstverwaltung, das Wahlrecht und der 4 Rudolf Muhs: Rotteck und sein Denkmal. In: Freiburger Universitätsblätter 83 (1984) 49–75. 5 Rechtsphilosophie bei Rotteck / Welcker. Hg. von Hermann Klenner. Freiburg, Berlin 1994. 6 Vgl. Anm. 3. 7 Mir liegen Artikel in der Badischen Zeitung vom 10.11., 13.11., 14.11., 16.11., 15.12.2001 sowie 9.1.2002 vor. An der von Karl Köhler (Südwestrundfunk, Studio Freiburg) moderierten Podiumsdiskussion nahmen teil: Wolfgang Heidenreich, Hans Peter Herrmann (emeritierter Prof. für Neuere Deutsche Literaturgeschichte an der Freiburger Universität), Martina Herrmann (Geschichtslehrerin am Freiburger Rotteck-Gymnasium), Wolfgang Hug (emeritierter Prof. für Geschichte und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Freiburg), Manfred Meyer (Gymnasiallehrer, arbeitet an einer Rotteck-Biographie, vgl. Anm. 3) und ich. Die Rotteck-Medaille wurde vom Freiburger Gemeinderat mehrheitlich gebilligt und dann einer verdienten Persönlichkeit verliehen.
Karl von Rotteck und Jacob Burckhardt
|
345
Zugang zu staatlichen Ämtern – blieben ihnen aber vorenthalten. In den »Judendebatten« des badischen Landtages, der Zweiten Kammer, 1831 und 1833 betonte die Mehrheit, zu der Rotteck gehörte, das »antisoziale Wesen« der jüdischen »Nation«, sah die Juden als »Fremdlinge« und »Ausländer«. Verlangt wurden die Verlegung des Schabats, die Aufhebung der Speisegesetze, der Verzicht auf die Beschneidung und auf das Hebräische, die Reinigung des Talmud von seinen angeblich staats- und gesellschaftsfeindlichen Tendenzen. Die Vorwürfe gegen die »Talmud-Juden« erinnern stark an die spätere Diskussion über die zuwandernden »Ostjuden«.8 Rotteck zählte nicht zu den Scharfmachern und hasserfüllten Geiferern. Er verabscheute jedoch jegliche Art von religiöser Orthodoxie, weil sie nach seiner Meinung der Aufklärung und den liberalen Ideen entgegenstand. Insbesondere das jüdische Volk, die jüdische »Nation«9 entsprach aufgrund ihrer Sitten und Gebräuche, die aus einer angeblich un8 Steven E. Aschheim: Brothers and Strangers. The East European Jew in German and German Jewish Consciousness, 1800–1923. Madison 1982; Jack Wertheimer: Unwelcome Strangers. East European Jews in Imperial Germany. New York, Oxford 1987; Trude Maurer: Ostjuden in Deutschland 1918–1933. Hamburg 1986; Patrick Kury: »Man akzeptierte uns nicht, man tolerierte uns!« Ostjudenmigration nach Basel 1890–1933. Basel, Frankfurt a. M. 1998; Karin Huser Bugmann: Schtetl an der Sihl. Einwanderung, Leben und Alltag der Ostjuden in Zürich 1880–1939. Zürich 1998. Die Brisanz des OstjudenStereotyps lag nicht zuletzt in der Verschmelzung des rassischen Antisemitismus mit dem Antislavismus. Dazu ausführlich Massimo Ferrari Zumbini: »Die Wurzeln des Bösen.« Gründerjahre des Antisemitismus: Von der Bismarckzeit zu Hitler. Frankfurt a. M. 2003, 463–562, 660–682. 9 Der Begriff »Nation« ist hier nicht unbedingt eindeutig im modernen Sinn zu verstehen. Bis in die Frühe Neuzeit galt als »jüdische Nation« die Korporation der jüdischen Gemeinden. Lange Zeit wurde »jüdische Nation« parallel zur Begriffsverwendung bei Ständen oder bei nach sprachlicher Zugehörigkeit oder Herkunft gegliederten Einheiten etwa in den Universitäten oder an Konzilien, immer wieder aber auch zur Bezeichnung der in aller Welt verstreut lebenden Juden gebraucht. Von einer nationalen Gemeinschaft, die als Kollektiv mit geschichtlich-kultureller Zugehörigkeit konstruiert wird und sich als Bewegung formiert, um ein politisches Ziel zu erreichen – einen Staat, ein Territorium, eine Autonomie –, ist jedoch keine Rede (s. den Beitrag verschiedener Autoren: Volk, Nation, Nationalismus, Masse. In: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Hg. von Otto Brunner, Werner Conze, Reinhart Koselleck. Bd. 7. Stuttgart 1992, 141–431). Das gilt etwa auch für das Elsass, wo im Ancien régime die »Nation juive« die Bezeichnung für die Korporation der elsässischen Juden war (Susanne Bennewitz: Nachbarschaft unter Beschuss. Juden in Basel während der Belagerung der Festung Hüningen im Sommer 1815. In: Acht Jahrhunderte Juden in Basel. 200 Jahre Israelitische Gemeinde Basel. Hg. von Heiko Haumann. Basel 2005, 90–129, hier 112). Im Toleranzpatent Joseph II. von 1782 ist die »jüdische Nazion« die Gemeinschaft der Menschen jüdischen Glaubens. Schiller versteht die »hebräische Nation als ein wichtiges universalhistorisches Volk«. Vgl. Klaus L. Berghahn: Grenzen der Toleranz. Juden und Christen im Zeitalter der Aufklärung. Köln usw. 2000, 37–38, 66.
346
|
»Wir waren alle ein klein wenig antisemitisch«
fruchtbaren, »toten« Gesetzesreligion herrührten, nicht seinem Menschenbild des mündigen Staatsbürgers.10 Deshalb hielt er zwar, wie er es als Berichterstatter der Petitionskommission des Landtags 1833 formulierte, die Judenemanzipation für einen »minder wichtigen Gegenstand«, den man pragmatisch entscheiden müsse. Doch die politische Gleichstellung könne nur dann gewährt werden, wenn die Juden eine »ächt sociale Meinung und Gesinnung gegen uns« hätten, der Staatsverband fordere »eine gewisse Gleichförmigkeit oder Verschmelzung der Gesinnungen und Neigungen«. Aus diesem Grund müssten die Juden »aufhören, Juden zu seyn, nach dem strengen, harten Sinn des Worts, weil die jüdische Religion eine solche ist, die nach ihrem Prinzip eine Feindseligkeit oder wenigstens eine Scheu gegen alle anderen Völker enthält und geltend macht, wogegen die christliche Religion den Charakter hat, daß sie eine allgemeine Verbrüderung aller Völker auf Gottes weiter Erde will. So lange die Juden nicht einigermaßen diesem Prinzip, das nach dem heutigen Stande der Cultur und der fortgeschrittenen Vernunft und der besser ausgebildeten Humanität nicht paßt, und eine Feindseligkeit gegen die andern Völker in sich trägt, entsagen, und nicht beweisen, daß sie ihm entsagt haben, so sind sie nicht zur Emancipation reif.«11 Nicht antasten wollte Rotteck die bestehenden Rechte der Juden. Mit diesem Denken stand Rotteck in der Tradition einer Linie der Aufklärung und des Liberalismus. Diese ging davon aus, dass sich durch die Vernunft ein einheitlicher »zivilisierter« Menschentypus herausbilden werde. Wer diesem Typus nicht entspreche und seine Vernunft nicht in dieser Richtung wirken lasse, müsse erst noch »zivilisiert« werden, bevor er sämtliche staatsbürgerlichen Rechte erhalten könne. Das bezog sich etwa auf den »Pöbel« – dessen Herrschaft auch Rotteck fürchtete – und ganz besonders auf die Juden. Hinzu kam, dass jene Liberale als politische Vertreter des Mittelstandes die ökonomisch motivierten Vorurteile gegen Juden teilten und darüber hinaus wussten, wie unpopulär die Judenemanzipation in weiten Teilen der christlichen Bevölkerung war. Mit ihren Argumenten konnten sich die Gegner der Judenemanzipation auf Aussagen wichtiger Denker der Aufklärung berufen. Johann Gottfried Herder (1744–1803) verehrte die Hebräer, mochte aber die Juden nicht. Diese seien zu »klugen Wucherern« gesunken und eine »parasitische Pflanze auf den Stämmen anderer Nationen« geworden, »ein Geschlecht schlauer Unterhändler beinah auf der ganzen Erde, das trotz aller Unterdrückung nirgend sich nach eigener Ehre
10 Vgl. ausführlich Treskow: Erlauchter Vertheidiger I, 160–170. 11 Verhandlungen der Stände-Versammlung des Großherzogthums Baden im Jahre 1833. 14. Heft. Karlsruhe 1833, 362–363. Vgl. Reinhard Rürup: Emanzipation und Antisemitismus. Studien zur »Judenfrage« der bürgerlichen Gesellschaft. Frankfurt a. M. 1987, hier 77, vgl. 46–92.
Karl von Rotteck und Jacob Burckhardt
|
347
und Wohnung, nirgend nach einem Vaterlande sehnet«.12 Die Juden müssten ihre Sitten aufgeben, die für die heutige Zeit nicht passten, und der Staat solle sie durch Erziehung aus ihrem jetzigen Zustand befreien. Jedenfalls konnte sich Herder nicht vorstellen, dass das »fremde« Volk der Juden mit einer anderen Nation gleichberechtigt zusammenleben werde, und gestand deshalb dem Staat auch das Recht zu, nur eine bestimmte Anzahl Juden auf seinem Territorium zu dulden.13 Für Immanuel Kant (1724–1804) – auf den sich Rotteck gerne berief14 – waren die Juden Angehörige einer Religion mit »statuarischen Gesetzen« und einem »mechanischem Cultus«, ohne die rein sittliche Gesinnung, die für ihn das Wesen einer Vernunftreligion ausmachte. Seine Urteile über die jüdische Religion wie über das Leben der Juden, etwa den »Wuchergeist« der »Nation von lauter Kaufleuten«, sind von erschreckender Unkenntnis geprägt, obwohl er doch freundschaftlichen Umgang mit vielen Juden hatte. Auch Kant verlangte die Abkehr der Juden von ihrer Religion und Kultur, um zu einem Volk zu werden, das »aller Rechte des bürgerlichen Zustandes« fähig sei. Er fasste dies mit dem – aus heutiger Sicht – bösen Wort der »Euthanasie des Judentums« zusammen. Hier standen somit Verzicht auf die Ritualgesetze und Läuterung vor der Gewährung der Gleichstellung.15 Wilhelm von Humboldt (1767–1835) verfasste weitreichende Vorschläge zur uneingeschränkten Emanzipation der Juden, sein Ziel war hingegen, »die Absonderung geringer und die Verschmelzung inniger« zu machen, nämlich »Verschmelzung, Zertrümmerung ihrer kirchlichen Form und Ansiedlung« zu erreichen.16 Und Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) 12 Johann Gottfried Herder: Ideen zu einer Philosophie der Geschichte der Menschheit. Neuausgabe Bodenheim 1995, 315–316. 13 Berghahn: Grenzen, 195–205. Anders Martin Bollacher, der Herders »einfühlend-sympathisierende Sichtweise« hervorhebt (30): »Feines, scharfsinniges Volk, ein Wunder der Zeiten!« – Herders Verhältnis zum Judentum und zur jüdischen Welt. In: Hebräische Poesie und jüdischer Volksgeist. Die Wirkungsgeschichte von Johann Gottfried Herder im Judentum Mittel- und Osteuropas. Hg. von Christoph Schulte. Hildesheim usw. 2003, 17–33; skeptischer und mit einem anderen Aspekt Julius H. Schoeps: Das kollektive jüdische Bewusstsein. J. G. Herders Volksgeistlehre und der Zionismus. Ebd., 181–189. Vgl. Rainer Erb, Werner Bergmann: Die Nachtseite der Judenemanzipation. Der Widerstand gegen die Integration der Juden in Deutschland, 1780–1860. Berlin 1989; Helmut Berding: Judenemanzipation in Deutschland: Ambivalenz – Widerspruch – Widerstand. In: Intoleranz im Zeitalter der Revolutionen. Europa 1770–1848. Hg. Von Aram Mattioli u. a. Zürich 2004, 233–257 (auch zum folgenden). Aus einführenden Gesamtüberblick zur Problematik Werner Bergmann: Geschichte des Antisemitismus. München 2002. 14 Vgl. z. B. Treskow : Erlauchter Vertheidiger I, 25, 182 ; II, 263, 467. 15 Berghahn: Grenzen, 206–222, Zitate 210, 211, 214, 215, 217. Kant strebte die Glaubenseinheit in einer Vernunftreligion an. 16 Berghahn: Grenzen, 269–275. Humboldts Memorandum von 1809 beeinflusste das preussische Gleichstellungsedikt vom 11. März 1812.
348
|
»Wir waren alle ein klein wenig antisemitisch«
setzte sich zwar scharf ab von der völkisch-nationalistischen Judenfeindschaft der Professoren Jakob Friedrich Fries (1773–1843) und Christian Friedrich Rühs (1779–1855), rechtfertigte aber doch die Bindung der Emanzipation an die Assimilation und zeigte wenig Verständnis für die jüdische Kultur.17 Johann Gottlieb Fichte (1762–1814) ging erheblich weiter und sah, behaftet mit allen gängigen Vorurteilen, im Judentum einen »feindselig gesinnten Staat«. Gäbe man den Juden das Bürgerrecht, träten sie die »übrigen Bürger völlig unter die Füße«. Ebenso wie Kant griff er zu einer drastischen Formulierung, um die Forderung zu unterstreichen, dass die Juden alles Jüdische aufgeben müssten: »Aber ihnen Bürgerrechte zu geben, dazu sehe ich wenigstens k e i n Mittel, als das, in einer Nacht ihnen allen die Köpfe abzuschneiden und andere draufzusetzen, in denen auch nicht eine jüdische Idee sei. Um uns vor ihnen zu schützen, dazu sehe ich wieder kein anderes Mittel, als ihnen ihr gelobtes Land zu erobern, und sie alle dahin zu schicken.« Die Menschenrechte wollte Fichte den Juden nicht nehmen, aber diese waren ihm dermassen fremd, dass er sie in die Nation nicht für integrierbar hielt.18 Selbst Johann Wolfgang Goethe (1749–1832) liess sich als Kronzeuge für den »unangenehmsten Eindruck« zitieren, den »die Enge, der Schmutz, das Gewimmel, der Akzent einer unerfreulichen Sprache« machten. Immerhin reflektierte er seine Abscheu vor diesen Verhältnissen, bemühte sich, sich von den Vorurteilen seiner Umgebung zu befreien, machte sich ein eigenes Bild, das dann auch bewundernde Züge trug. Doch völlig überwinden konnte er seine frühere Einstellung nicht, wie das verräterische Urteil zeigt: »Ausserdem waren sie ja auch Menschen, tätig, gefällig, und selbst dem Eigensinn, womit sie
17 Detlev Claussen: Grenzen der Aufklärung. Zur gesellschaftlichen Geschichte des modernen Antisemitismus. Frankfurt a. M. 1987, 97–109. Rotteck scheint zu Fries und Rühs keine engeren Beziehungen gehabt zu haben, obwohl Fries zeitweilig als Professor in Freiburg i. Br. wirkte; vgl. Treskow: Erlauchter Vertheidiger II, 368, 496. Siehe auch Gerald Hubmann: Völkischer Nationalismus und Antisemitismus im frühen 19. Jahrhundert: Die Schriften von Rühs und Fries zur Judenfrage. In: Antisemitismus – Zionismus – Antizionismus 1850–1940. Hg. von Renate Heuer und Ralph-Rainer Wuthenow. Frankfurt a. M., New York 1997, 9–34. 18 Berghahn: Grenzen, 222–227, Zitate 222, 223, 224. Saul Ascher widerlegte Fichte und setzte in der Nachfolge Mendelssohns die aufgeklärt-jüdische Argumentation dagegen (ebd., 228–231). Fichtes Zitat im Zusammenhang auch in: Ludger Heid: Wir sind und wollen nur Deutsche sein! Jüdische Emanzipation und Judenfeindlichkeit 1750–1880. In: Der ewige Judenhass. Christlicher Antijudaismus – Deutschnationale Judenfeindlichkeit – Rassistischer Antisemitismus. Hg. von Christina von Braun und Ludger Heid. 2. Aufl. Berlin, Wien 2000, 70–109, hier 80–81. Ausführlich zu einem anderen Aspekt Manfred Voigts: »Wir sollen alle kleine Fichtes werden!« Johann Gottlieb Fichte als Prophet der Kultur-Zionisten. Berlin, Wien 2003, dabei zu dessen Judengegnerschaft 83–106.
Karl von Rotteck und Jacob Burckhardt
|
349
an ihren Gebräuchen hingen, konnte man seine Achtung nicht versagen.«19 Bei aller Verehrung für einzelne Juden blieb eine Abneigung vor der fremden Kultur der jüdischen Bevölkerung, eine tiefe Distanz.20 Im übrigen stimmten auch jüdische Aufklärer der negativen Bewertung der jüdischen Gesetzesreligion zu, sahen einen Ausweg in der Konversion zum Christentum oder erwarteten zumindest eine »Verbesserung«, eine »Zivilisierung« von den Folgen der Emanzipation. Selbst Moses Mendelssohn (1729–1786), der Massstäbe setzte für den gleichberechtigten und gleichwertigen Umgang von Menschen unterschiedlichen Glaubens, wollte zwar sein Judentum um keinen Preis aufgeben und verteidigte die Zeremonialgesetze als lebendig, eben nicht verkrustet und erstarrt. Dennoch wollte er die Juden »aufklären« und »kultivieren«, den »Jargon«, die jiddische Sprache, zurückdrängen und stand manchen kulturellen Praktiken, namentlich der Juden im Osten, ablehnend gegenüber.21 Andere gingen weiter. Lazarus Bendavid (1762–1832) etwa wandte sich 1793 gegen die »durch Aberglauben verfinsterte Tradition« und forderte die Abschaffung der »sinnlosen (schädlichen) Zeremonialgesetze« sowie eine Reform der jüdischen Religion.22 David Friedländer (1750–1834) schlug 1799 vor, alle Juden sollten zum Christentum konvertieren und sich öffentlich taufen lassen. Das mindeste war auch für ihn eine Reform des Gottesdienstes, der Lehre und des Unterrichts19 So Goethe in »Dichtung und Wahrheit« über seine Jugenderinnerungen an die Frankfurter Judengasse (Johann Wolfgang Goethe: Gesammelte Werke in sieben Bänden. Hg. von Bernt v. Heiseler. 6. Bd. Gütersloh o. J., 126). 20 Berghahn: Grenzen, 188–195. Insofern erfüllten viele Denker der Aufklärung nicht den Anspruch eines Toleranzverständnisses, das – wie Lessing in der »Ringparabel« seines Stückes »Nathan der Weise« von 1779 – von einer »Anerkennung der prinzipiellen Gleichrangigkeit und Gleichwertigkeit der drei monotheistischen Religionen« oder anderen Weltanschauungen ausgeht. Statt dessen wollten sie diese zugunsten einer »universellen Vernunft- oder Naturreligion« überwinden. Hinzu kamen Vorurteile, wie sie in den Zitaten deutlich wurden. Vgl. Wege der Toleranz. Geschichte einer europäischen Idee in Quellen. Hg. von Heinrich Schmidinger. Darmstadt 2002, Zitate 284. Und selbst Lessing war nicht völlig frei von Vorurteilen und Überlegenheitsgefühlen gegenüber dem Judentum (Berghahn: Grenzen, 66–67, 69–82). 21 Vgl. Berghahn: Grenzen, 150–182. Grundlegend für den ganzen Abschnitt Christoph Schulte: Die jüdische Aufklärung. Philosophie, Religion, Geschichte. München 2002, hier 56–63, 130–131, 158–161, 179–181, 199–206. Auch: Gerda Heinrich: Haskala und Emanzipation. Paradigmen der Debatte zwischen 1781 und 1812. In: Das Achtzehnte Jahrhundert 23 (1999) 152–175; Jacob Katz: Tradition und Krise. Der Weg der jüdischen Gesellschaft in die Moderne. München 2002, 245–270. Zum innerjüdischen Sprachendiskurs Andreas Gotzmann: Eigenheit und Einheit. Modernisierungsdiskurse des deutschen Judentums in der Emanzipationszeit. Leiden usw. 2002, bes. 243–289. 22 Berghahn: Grenzen, 219, 221. Vgl. Schulte: Jüdische Aufklärung, 72–76, 107–114, 167– 169.
350
|
»Wir waren alle ein klein wenig antisemitisch«
wesens, wie er sie 1812, nach dem preussischen »Judenedikt«, entwarf.23 Als Auswirkungen dieser kulturellen Assimilationstendenz können auch die jüdischen Salons in Berlin gegen Ende des 18. Jahrhunderts betrachtet werden. Nach französischem Muster leiteten jüdische Frauen gesellschaftliche Zusammenkünfte, die einen Anziehungspunkt für christliche wie jüdische Dichter, Künstler, Gelehrte, hohe Beamte, Adlige und Bürger bildeten. Eine beträchtliche Anzahl der jüdischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer trat zum Christentum über.24 Sich aus diesem lebensweltlichen Zusammenhang zu lösen, war sicher nicht einfach. Möglich wäre es gewesen. Beispiele sind Rottecks liberale Mitstreiter aus Freiburg, Karl Theodor Welcker (1790–1869) und Johann Georg Duttlinger (1788–1841), die ihren ursprünglichen Standpunkt änderten, oder der Verfasser des Emanzipationsartikels im »Staats-Lexikon«, Karl Steinacker (1801–1847), von dessen Auffassung sich Rotteck in einem Nachsatz distanzierte.25 Diese argumentierten, man dürfe den Juden nicht die politischen Rechte verweigern, sondern müsse sie ihnen im Gegenteil gerade zubilligen, damit sie sich emanzipieren könnten. Ähnliches vernahm Rotteck von den Befürwortern der Judenemanzipation in der öffentlichen Diskussion – etwa Jean Paul (1763–1825), Karl Philipp Moritz (1756–1793), Alexander v. Humboldt (1769–1859) – oder durch an ihn gerichtete Briefe, gerade auch von Juden, die auf ihn hofften. Dies änderte seine Meinung ebensowenig wie die Beobachtung der Folgen antijüdischer Vorurteile, wie sie sich in den gewaltsamen »Hep! Hep!«-Unruhen 1819 und Ausschreitungen 1830 gerade in Karlsruhe gezeigt hatten.26 Hier offenbarten sich die Grenzen der Toleranz eines Teils der Aufklärer und der Liberalen: Die Juden galten als die Anderen und Fremden, die zwar geduldet wurden, die man aber nicht akzeptieren, sondern umerziehen wollte. Auch die meisten Befürworter einer Judenemanzipation hatten das Bild eines zukünftig 23 Berghahn: Grenzen, 218, 221, 276. Vgl. Schulte: Jüdische Aufklärung, 92–99; Jüdische Erziehung und aufklärerische Schulreform. Analysen zum späten 18. und frühen 19. Jahrhundert. Hg. Von Britta L. Behm u. a. Münster usw. 2002. 24 Vgl. Berghahn: Grenzen, 232–262; Steven M. Lowenstein: Anfänge der Integration 1780– 1871. In: Geschichte des jüdischen Alltags in Deutschland. Vom 17. Jahrhundert bis 1945. Hg. Von Marion Kaplan. München 2003, 123–224, hier 220; Barbara Hahn: Die Jüdin Pallas Athene. Auch eine Theorie der Moderne. Berlin 2002, hier bes. 75–98. 25 Staats-Lexikon, Bd. 5, 1837, 52. 26 Vgl. zu den Zusammenhängen den Überblick bei Heid: Wir sind und wollen nur Deutsche sein! Zu den Unruhen Rainer Wirz: Widersetzlichkeiten, Excesse, Crawalle, Tumulte und Skandale. Soziale Bewegung und gewalthafter sozialer Protest in Baden 1848. 2. Aufl. Baden-Baden 1998; Stefan Rohrbacher: Gewalt im Biedermeier. Antijüdische Ausschreitungen in Vormärz und Revolution (1815–1848/49). Frankfurt a. M., New York 1993; ders.: Deutsche Revolution und antijüdische Gewalt (1815–1848/49). In: Die Konstruktion der Nation gegen die Juden. Hg. von Peter Alter u. a. München 1999, 29–47.
Karl von Rotteck und Jacob Burckhardt
|
351
»zivilisierten« Juden vor Augen.27 An ein wirklich gleichberechtigtes Miteinander verschiedener Kulturen dachte damals kaum jemand. Es gehört zur »Dialektik der Aufklärung«28, dass sie die Bedingungen ihrer eigenen Aufhebung produziert. Die Rationalität, die kulturelle Eigenarten für überflüssig und schädlich hielt, weil diese eine Absonderung von der homogenen, vernunftgemässen Ordnung förderten, begünstigte ein Denken und Verhalten, jene zivilisatorischen Voraussetzungen zu schaffen, die schliesslich die Schoa ermöglichten.29 Um so wichtiger ist es zu differenzieren, Alternativen sowie die Ursachen zu erkennen, warum es zur Katastrophe kam: »Die ihrer selbst mächtige, zur Gewalt werdende Aufklärung selbst vermöchte die Grenzen der Aufklärung zu durchbrechen.«30 Die Einordnung von Rottecks Haltung zur politischen Gleichstellung der Juden in seine lebensweltlichen Zusammenhänge macht deutlich, dass es unzulässig ist, eine Linie von ihm zu den Rassisten der völkischen Parteien und der Nationalsozialisten, hin zu »Auschwitz«, zu ziehen. Selbst wenn sich die Nazis auch auf Rotteck berufen haben sollten, wäre dies ein unhistorischer Massstab. Interpretieren lässt sich, dass bei Rottecks Abgrenzung von den Juden nationales Denken spürbar wird. Aber er wollte sie nicht vertreiben oder vernichten, ihnen keine Menschenrechte nehmen. Aus heutiger Sicht, die natürlich nicht wegzudenken ist, kann eher eine Linie gezogen werden zu der weitverbreiteten, zunächst unterschwelligen, latenten Judengegnerschaft. Rotteck war mit seinem Einsatz für Freiheitsrechte zu einem politischen Symbol, zu einem Mythos geworden. Um so nachhaltiger musste seine 27 Das gilt etwa sogar für Christian Wilhelm Dohm: Über die bürgerliche Verbesserung der Juden. Berlin 1781 (Nachdruck der erweiterten Auflage von 1783: Hildesheim, New York 1973), selbst wenn seine Reformvorschläge den Juden die weitestgehende Gleichstellung einräumten; dazu Berghahn: Grenzen, 127–149. Vgl. Toleranz. In: Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 6. Stuttgart1990, 445–605; Toleranz. Forderung und Alltagswirklichkeit im Zusammenleben von Menschen verschiedener Kulturen. Eine Sammlung von Beiträgen des Basler Universitätsforums, hg. von der Universität Basel. Basel 1993; Barbara StollbergRilinger: Europa im Jahrhundert der Aufklärung. Stuttgart 2000, 101–103, 267–270; Bergmann: Geschichte des Antisemitismus, 18–38; verschiedene Beiträge in: Intoleranz. Dass im Alltag durchaus ein nachbarschaftliches Neben- und Miteinander möglich war, das allerdings auch immer wieder in antijüdische Verhaltensweisen umschlagen konnte, zeigen mehrere Einzelstudien. Vgl. als Überblick: Geschichte des jüdischen Alltags, 115– 122 (Robert Liberles), 215–224 (Steven M. Lowenstein). 28 Max Horkheimer, Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. Nachdruck o. J. (zuerst Amsterdam 1947). 29 Zygmunt Bauman: Dialektik der Ordnung. Die Moderne und der Holocaust. Hamburg 1992. 30 Horkheimer, Adorno: Dialektik, 244, vgl. 7: »Die Aporie, der wir uns bei unserer Arbeit gegenüber fanden, erwies sich somit als der erste Gegenstand, den wir zu untersuchen hatten: die Selbstzerstörung der Aufklärung. Wir hegen keinen Zweifel – und darin liegt unsere petitio principii –, daß die Freiheit in der Gesellschaft vom aufklärenden Denken unabtrennbar ist.«
352
|
»Wir waren alle ein klein wenig antisemitisch«
Haltung gegenüber den Juden antijüdische Vorurteile bestärken. Wie zahlreiche andere bedeutende Persönlichkeiten trug er somit dazu bei, dass viele Menschen ein Klischee verinnerlichten. Damit war der Boden für die Tolerierung antisemitischer Propaganda und antijüdischer Massnahmen bereitet. II.
Überregionales Aufsehen hat eine Kontroverse über die Frage erregt, wie Jacob Burckhardts (1818–1897) verächtliche Bemerkungen über Juden einzuschätzen seien. Ausgelöst hat die Kontroverse der Luzerner Historiker Aram Mattioli. In der »Zeit« veröffentlichte er am 30. September 1999 einen langen Artikel über den grossen Basler Gelehrten. Gegen das bisher vorherrschende Bild ordnete er Burckhardts Äusserungen in dessen antiliberales, antidemokratisches und antikapitalistisches Weltbild ein. An sich sind die Zitate aus seinen Schriften, in denen er sich gegen das »Judenpack« wandte, der interessierten Öffentlichkeit bekannt. Mattioli arbeitete aber heraus, dass sie nicht derart nebensächliche »Ausrutscher« darstellten, wie bisher argumentiert wurde. So sei jener von einem typischen Erscheinungsbild des Juden ausgegangen, das der »semitischen Nation« eigen sei und einen »Fremdkörper« bilde. An anderen Beispielen konnte Mattioli zeigen, dass Burckhardt von rassisch wie kulturell höher- und geringerwertigen Völkern spreche. In seinem ästhetischen Blick verkämen die Juden zum Inbegriff des Plumpen und Hässlichen. Ebenso tauche das traditionelle Negativstereotyp vom angeblich raffgierigen, wucherischen Juden auf. Folgerichtig sei er kein Anhänger der rechtlichen Gleichstellung der Juden gewesen, und nicht zuletzt die »allmächtigen Juden« hätten für ihn die ungeliebte Moderne gekennzeichnet.31 Am liebsten wäre es ihm gewesen, wenn die Emanzipation hätte rückgängig gemacht werden können. So wie das für die Eliten im Deutschen Kaiserreich nachgewiesen worden sei, habe auch für Burckhardt die Judenfeindschaft die Funktion eines »kulturellen Codes« gehabt, um die Gegnerschaft gegen die modernen Tendenzen der Zeit zum Ausdruck zu bringen. Wem es leicht über die Lippen gehe, einen Ort als »verjudet«, einen anderen als »judenfrei« zu bezeichnen, »muss als typischer Antisemit im 19. Jahrhundert charakterisiert werden«, fasste Mattioli seine Analyse zusammen.32 Diese Einschätzung ist nicht unwidersprochen geblieben. Zwar sei nicht zu bestreiten, dass Burckhardts »problematische Sicht der Juden« in engem Zusam31 Zu diesem Zusammenhang auch Notker Hammerstein: Professoren in Kaiserreich und Weimarer Republik und der Antisemitismus. In: Konstruktion der Nation, 119–136, hier 125. 32 Ausführlich dann Aram Mattioli: Jacob Burckhardts Antisemitismus. Eine Neuinterpretation aus mentalitätsgeschichtlicher Sicht. In: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 49 (1999) 496–529; ders.: Jacob Burckhardt und die Grenzen der Humanität. Essay. Wien u. a. 2001.
Karl von Rotteck und Jacob Burckhardt
|
353
menhang »mit seinen Ressentiments gegenüber der modernen Welt überhaupt« stehe. Ein Rassist sei er aber nicht gewesen, Mattioli urteile zu stark von heute aus, vom Wissen um Auschwitz her.33 Antijüdische Bemerkungen im 19. Jahrhundert, wie wir sie etwa auch bei Theodor Fontane fänden, seien keineswegs Vorstufen der nationalsozialistischen Judenvernichtung gewesen. Deshalb solle man den Begriff »Antisemitismus« auf Verlautbarungen beschränken, die mit dem nationalsozialistischen Verständnis vergleichbar seien. Nicht jede Kritik an Juden dürfe mit Antisemitismusverdacht belegt werden.34 Nun hat Burckhardt gerade nicht bestimmte Juden wegen ihres Verhaltens kritisiert, sondern pauschal Werturteile über »die« Juden gefällt, aus denen durchaus ein kulturell begründetes Überlegenheitsgefühl spricht. Und Mattioli hat keineswegs behauptet, Burckhardt sei ein Wegbereiter Hitlers und des Nationalsozialismus gewesen. Auch kann der Begriff »Antisemitismus« nicht einfach in der gewünschten Weise eingeschränkt werden. Dagegen sprechen die Zusammenhänge, die dazu führten, dass er im Umfeld Wilhelm Marrs (1819–1904) 1879 zum politischen Kampfwort wurde und seitdem ständig in den Quellen auftaucht.35 Er drückt aus, dass Juden als eigene »Rasse« nicht zur Nation gehörten.36 33 Bernd Roeck: Der Kopf auf dem Tausender ist kein Fehldruck. In der Schweiz wird um Jacob Burckhardt gestritten: Der Vorwurf des Antisemitismus ist eine schreckliche Vereinfachung. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.11.1999. 34 Urs Bitterli: Jacob Burckhardt – ein Antisemit? In: Aargauer Zeitung, 15.1.2000. 35 Wilhelm Marr: Der Sieg des Judenthums über das Germanenthum. Vom nicht confessionellen Standpunkt aus betrachtet. 8. Aufl. Bern 1879 (hier ist noch nicht von Antisemitismus, wohl aber von der »semitischen Race« und dem »Semitismus« die Rede; kurz darauf verwendet Marr dann in öffentlichen Verlautbarungen den Begriff selbst). Burckhardt hatte dieses Werk in seiner Bibliothek (Mattioli: Jacob Burckhardt, 42). In der Tendenz schon ähnlich Marr: Der Judenspiegel. Hamburg 1862. Auch Marr vertrat im übrigen die Ansicht, dass die Juden dann in die deutsche Gesellschaft integriert werden könnten, wenn sie »ihr Judentum vollkommen hinter sich ließen (…) drei seiner vier Frauen waren jüdischer Abstammung« (Michael Brenner, Stefi Jersch-Wenzel, Michael A. Meyer: Deutschjüdische Geschichte in der Neuzeit. Bd. II: Emanzipation und Akkulturation 1780–1871. München 1996, 324 [Michael Brenner]). Zu Marr s. Moshe Zimmermann: Wilhelm Marr. The Patriarch of Antisemitism. New York, Oxford 1986 (hebr. 1982). Treitschke verwendete ebenfalls 1879 den Begriff »Antisemitismus« ähnlich wie Marr. Vgl. zu den Zusammenhängen Thomas Nipperdey, Reinhard Rürup: Antisemitismus. In: Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 1. Stuttgart 1972, 129–153; Mario Kessler: Judenfeindschaft. In: Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus. Hg. von Wolfgang Fritz Haug. Bd. 6/II. Hamburg 2004, Sp. 1672–1684; Jack Jacobs: Judenfrage. Ebd., Sp. 1685–1694; Zumbini: Wurzeln, 165–174. Einen Überblick über den Begriff und die Probleme seiner Verwendung gibt Georg Christoph Berger Waldenegg: Antisemitismus: »Eine gefährliche Vokabel«? Diagnose eines Wortes. Wien usw. 2003. 36 Diesem Verständnis können religiöse, ethische, rassistische, völkische, politisch-ökonomische Begründungen zugeordnet werden, wie Klaus Holz an den Beispielen Treitschke,
354
|
»Wir waren alle ein klein wenig antisemitisch«
Die über Burckhardt geführte Diskussion kann das Nachdenken über Begriffe und Massstäbe weiter anregen. Selbstverständlich lassen sich vergleichbare Aussagen bei vielen Persönlichkeiten finden, deren Werke wir eigentlich schätzen. Wesentlich heftiger als bei Goethe fielen die judenfeindlichen Äusserungen von Romantikern aus, etwa von Clemens Brentano (1778–1842) und Achim v. Arnim (1781–1831, um so mehr ist hervorzuheben, dass sich Bettina v. Arnim [1785–1859] davon lösen konnte).37 Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827)38, Jeremias Gotthelf (1797–1854)39, Wilhelm Hauff (1802–
Stoecker, Drumont, Hitler, Slánský-Prozess und Waldheim-Affäre zeigt. Der Nationalismus sei konstitutiv für den modernen Antisemitismus (allerdings gilt das auch schon für solche Formen, wie sie Rotteck vertrat). Vgl. Klaus Holz: Nationaler Antisemitismus. Wissenssoziologie einer Weltanschauung. Hamburg 2001, s. auch 547, 549 zur »Entfernung der Juden«, wie sie eben schon vor dem »modernen« Antisemitismus gefordert wurde). 37 Dazu Jacques Picard: Recht auf Abweichung? Das Juden- und Frauenbild in der deutschen Romantik und Bettine von Arnims Seitensprung. In: Judenfeindschaft. Eine öffentliche Vortragsreihe an der Universität Konstanz 1988/89. Hg. von Erhard R. Wiehn. Konstanz 1989, 73–95; Birgit R. Erdle: »Über die Kennzeichen des Judenthums«: Die Rhetorik der Unterscheidung in einem phantasmatischen Text von Achim von Arnim. In: German Life and Letters 49 (1996) 147–158; Peter-Anton von Arnim: Der eigentliche Held in dieser Zeit, die einzige wahrhaft freie und starke Stimme. Die jüdischen Aspekte in Leben und Werk Bettina von Arnims als Herausforderung. In: »Die echte Politik muß erfinderisch sein.« Beiträge eines Wiepersdorfer Kolloquiums zu Bettina von Arnim. Hg. von Hartwig Schultz. Berlin 1999, 163–215.Vgl. Richard Faber: Germanomanie der Grimms und Kosmopolitismus Hebels – Judenfeindschaft der Grimms und Judenfreundschaft Hebels. In: ders.: »Sagen lassen sich die Menschen nichts, aber erzählen lassen sie sich alles.« Über Grimm-Hebelsche Erzählung, Moral und Utopie in Benjaminscher Perspektive. Würzburg 2002, 131–151, hier bes. 145–151; Wilhelm Solms: Zur Dämonisierung der Juden und Zigeuner im Märchen. In: Sinti und Roma in der deutschsprachigen Gesellschaft und Literatur. Hg. von Susan Tebbutt. Frankfurt a. M. usw. 2001, 111–125. Allgemein: Martin Gubser: Literarischer Antisemitismus. Untersuchungen zu Gustav Freytag und anderen bürgerlichen Schriftstellern des 19. Jahrhunderts. Göttingen 1998 (u. a. mit einer Zusammenstellung von Indikatoren für literarischen Antisemitismus, 309–311). In den Interpretationen z. T. problematisch: Gustav Kars: Das Bild des Juden in der deutschen Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts. Freiburg i. Br. 1988. 38 Vgl. etwa seine Fabel »Mauschelhofen«. Peter Stadler beurteilt die antijüdischen Vorurteile Pestalozzis als marginal in der Gesamtheit seines Denkens: Pestalozzi. Geschichtliche Biographie. Von der alten Ordnung zur Revolution (1746–1797). Zürich 1988, 431, 437. 39 Vgl. Christian Thommen: Jeremias Gotthelf und die Juden. Bern usw. 1991. Er hält die überwiegend negativ gezeichneten jüdischen Figuren und die zahlreichen antijüdischen Bemerkungen Gotthelfs für den Ausdruck seines Widerstandes gegen den modernen, materialistischen Zeitgeist, der das Bauerntum gefährde oder gar zerstöre. Er sei aber kein »militanter Antisemit« gewesen und habe auch gegen die Judenverfolgung in Russland Stellung bezogen (212–214).
Karl von Rotteck und Jacob Burckhardt
|
355
1827)40, Alban Stolz (1808–1883) und Heinrich Hansjakob (1837–1916)41, Wilhelm Raabe (1831–1910)42, Wilhelm Busch (1832–1908)43, Peter Rosegger (1843–1918)44 und manche andere können genannt werden.45 Darunter 40 Vgl. verschiedene Lesarten: Jürgen Landwehr: Jud Süß – Hauffs Novelle als literarische Legitimation eines Justizmords und als Symptom und (Mit-)Erfindung eines kollektiven Wahns. In: Wilhelm Hauff. Aufsätze zu seinem poetischen Werk. Hg. von Ulrich Kittstein. St. Ingbert 2002, 113–146; Rolf Düsterberg: Wilhelm Hauffs »opportunistische« Judenfeindschaft. In: Zeitschrift für deutsche Philologie 119 (2000) 190–212; Jefferson S. Chase: The Wandering Court Jew and the Hand of God: Wilhelm Hauffs Jud Süss as Historical Fiction. In: The Modern Language Review 93 (1998) 724–740; Maureen Thum: Re-Visioning Historical Romance. Carnivalesque Discourse in Wilhelm Hauff ’s Jud Süß. In: Neues zu Altem. Novellen der Vergangenheit und der Gegenwart. Hg. von Sabine Cramer. München 1996 (= Houston German Studies 10 [1996]), 25–42; Dorothea Hollstein: Dreimal »Jud Süß« – Zeugnisse »schmählichster Barbarei«. Hauffs Novelle, Feuchtwangers Roman und Harlans Film in vergleichender Betrachtung. In: Der Deutschunterricht 37 (1985) 42–54. 41 Die beiden gelten als badische Volksschriftsteller. Vgl. Michael Langer: Zwischen Vorurteil und Aggression. Zum Judenbild in der deutschsprachigen katholischen Volksbildung des 19. Jahrhunderts. Freiburg usw. 1994; Manfred Hildenbrand: Heinrich Hansjakob und die Juden. In: Die Ortenau 77 (1997) 485–496; ders.: Heinrich Hansjakob – Rebell im Priesterrock. 3. Aufl. Haslach 2002, hier 180–187. Hansjakob bekannte sich als Antisemit, achtete aber die jüdische Religion und auch den kleinen Handelsjuden, den er auf dem Land kennenlernte. 42 Vgl. das abwägende Nachwort Dieter Arendts in: Wilhelm Raabbe: Holunderblüte. Stuttgart 1991, 49–60 (auch die Literaturhinweise: 47–48). 43 Robert Gernhardt: »Schöner ist doch unsereiner«. Kommentar zur Gesamtausgabe der Werke von Wilhelm Busch nebst Klärung der Frage: War dieser Autor ein Antisemit? In: Süddeutsche Zeitung, 27.8.2003, 14, lässt die Frage letztlich offen, zitiert Dieter P. Lotze und Hans Ries, die meinen, Busch verspotte das zeitgenössische antisemitische Zerrbild, und andererseits Golo Mann, der Busch zwar nicht für einen »argen Antisemiten« hält, aber doch bemerkt: »Natürlich war er es ein klein bisschen, wie zu seiner Zeit alle Deutschen und alle Franzosen auch.« 44 Wolfgang Bunte: Peter Rosegger und das Judentum. Altes und Neues Testament, Antisemitismus, Judentum und Zionismus. Hildesheim, New York 1977. Auch bei ihm ist der Eindruck zwiespältig. In seinen Schriften finden sich zahlreiche judenfeindliche Äusserungen, die die üblichen Klischees zum Ausdruck bringen, namentlich Vorurteile gegenüber dem wirtschaftlichen Verhalten von Juden. Auf der anderen Seite achtet er die religiöse Überzeugung der Juden, wendet sich nachdrücklich gegen die Antisemiten und fordert, immer nur den »Menschen« zu sehen, ohne Unterschied der Religion, Nation oder Rasse. 45 Vgl. auch Massimo Ferrari Zumbini: Untergänge und Morgenröten. Nietzsche – Spengler – Antisemitismus. Würzburg 1999. Ausführlich zur Geschichte des organisierten Antisemitismus und dessen Voraussetzungen im Kaiserreich jetzt ders.: Wurzeln. Selbstverständlich sind solche Erscheinungen nicht auf den deutschsprachigen Raum beschränkt, vgl. exemplarisch neuerdings Natascha Vittorelli: Verschwiegen, verharmlost, entschuldigt: Antisemitismus in Zofka Kveders Briefroman »Hanka«. In: Herausforderung Osteuropa.
356
|
»Wir waren alle ein klein wenig antisemitisch«
ist auch Theodor Fontane (1819–1898). Durch seine Briefe zieht sich ein stets präsenter Alltagsantisemitismus. Immerhin hat er sich auch, etwa im »Stechlin«, kritisch mit antijüdischen Klischees auseinandergesetzt.46 Davon finden wir bei Jacob Burckhardt nichts. Dessen Judenfeindschaft war offenbar selbstverständlicher Bestandteil seiner Lebenswelt. Er mochte die »Juden« als Typus einfach nicht. Selbst wenn der Stellenwert seines Vorurteils im Rahmen seiner relativistischen Weltanschauung und seines Antimodernismus nicht als Rassismus einzuschätzen ist, bleibt doch, dass er Juden aufgrund ihrer »Wesenseigenschaften« als einen möglichst auszugrenzenden Fremdkörper in der Gesellschaft betrachtete. Allerdings trat er nicht in der Öffentlichkeit mit antijüdischen Forderungen auf47, und er rechtfertigte auch nicht frühere Judendiskriminierungen. In seiner unpublizierten Vorlesung von 1845 über »Aelteste Geschichte der Schweiz« etwa prangerte er statt dessen die »Judenkrawalle« aufgrund von »absurden Geschichten« wie angeblichen Hostienschändungen und Ritualmorden ebenso an wie die Verfolgungen im Elsass durch Armleder 133848 oder im Zusammenhang mit der Pest 1348/49. Die Offenlegung stereotyper Bilder. Hg. von Thede Kahl u. a. Wien, München 2004, 176–193. Natascha Vittorelli danke ich auch für eine kritische Diskussion einer früheren Fassung dieses Aufsatzes. 46 Michael Fleischer: »Kommen Sie, Cohn«. Fontane und die »Judenfrage«. Berlin 1998; Michael Schmidt: »Wie ein roter Faden«. Fontanes Antisemitismus und die Literaturwissenschaft. In: Jahrbuch für Antisemitismusforschung 8 (1999) 350–369. Siehe auch Wolfgang Benz: Judenfeindschaft als Zeitgeist. Theodor Fontane und die wilhelminische Gesellschaft. In: ders.: Bilder vom Juden. Studien zum alltäglichen Antisemitismus. München 2001, 57–69. 47 Zur Zeitgeschichte äusserte er sich ohnehin kaum öffentlich. Vgl. Fritz Stern: Jacob Burckhardt: der Historiker als Zeitzeuge. In: Begegnungen mit Jacob Burckhardt. Vorträge in Basel und Princeton zum hundertsten Todestag. Hg. von Andreas Cesana und Lionel Gossman, Basel, München 2004, 13–29, hier 15, zu Burckhardts Judengegnerschaft 25–26. 48 1338 kam es zu Ausschreitungen gegen Juden, die von vielen Bauern als Verantwortliche ihres Elends, ihrer Verschuldung und Entrechtung angesehen wurden. Die Anführer nannten sich »König Armleder« und stellten sich damit in Kontinuität zu einer fränkischen Bauernbewegung von 1336, die sich ebenfalls gegen Juden gerichtet und an deren Spitze als »König Armleder« der Ritter Arnold von Uissigheim gestanden hatte. Die Bezeichnung »Armleder« rührt von ledernen Armschienen her, wie sie Bewaffnete damals oft anstelle eiserner trugen. Die Bewegungen, die sich zunächst noch gegen den scheinbar unmittelbaren Gegner wandten und weniger gegen die tatsächlich Herrschenden, sind als Teil der Bauernaufstände zu betrachten, die im 16. Jahrhundert ihren Höhepunkt, aber keineswegs ihren Abschluss fanden. Vgl. Hellmut G. Haasis: Spuren der Besiegten. Bd. 1. Freiheitsbewegungen von den Germanenkämpfen bis zu den Bauernaufständen im Dreißigjährigen Krieg. Reinbek 1984, 247–263. Die Herren im Elsass und in den benachbarten Gebieten schlossen im übrigen 1338 ein Bündnis gegen weitere Unruhen, mit dem auch die Juden
Karl von Rotteck und Jacob Burckhardt
|
357
Zwar liess er in seinen Notizen unkommentiert stehen, dass die Juden »durch Reichtum und Wucher« verhasst gewesen seien, relativierte aber diese Aussage dadurch, dass er darauf hinwies, nach einer bestimmten Quelle seien »die Lindauer noch schlimmer« gewesen.49 Daraus kann aber in der Tat keine geradlinige Verbindung zu Hitler und den Nationalsozialisten konstruiert werden. Dies ist nicht der angemessene Massstab. Antisemitismus gibt es nicht abstrakt, sondern nur konkret. Deshalb gilt als erstes Kriterium, wie bei Rotteck, der Kontext der Zeit.50 Burckhardts Haltung war eingebettet in den leisen »Salon-Antisemitismus«, eines Teils der Basler Oberschicht – ein anderer war tolerant und aufgeschlossen –, der sich in kleinen abfälligen, verächtlichen Bemerkungen, in der Regel nicht in der Öffentlichkeit, kundtat, durchaus aber zur festen Grundeinstellung, zum »kulturellen Code«, gehörte. Man verstand sich.51 geschützt werden sollten. Die Stadt Freiburg i. Br. gewährte im selben Jahr den Juden einen einzigartigen »Sicherungsbrief«. Wenige Jahre später, 1348/49, beteiligten sich diese Herren aus konkreten politischen Gründen an der Vernichtung der Juden. Vgl. Peter Schickl: Von Schutz und Autonomie zu Verbrennung und Vertreibung: Juden in Freiburg. In: Geschichte der Stadt Freiburg im Breisgau. Bd. 1: Von den Anfängen bis zum »Neuen Stadtrecht« von 1520. Hg. von Heiko Haumann und Hans Schadek. Stuttgart 1996, 524–551, hier 527–540. Zu den Zusammenhängen František Graus: Pest – Geißler – Judenmorde. Das 14. Jahrhundert als Krisenzeit. Göttingen 1987. 49 Privatarchiv 207/137, 366. Diesen Hinweis verdanke ich Marc Sieber. Vgl. auch Hans Liebeschütz: Das Judentum und die Kontinuität der abendländischen Kultur: Jacob Burckhardt. In: ders.: Das Judentum im deutschen Geschichtsbild von Hegel bis Max Weber. Tübingen 1967, 220–244. 50 Roeck und Bitterli betonen dies ebenso wie Mattioli. 51 Indirekt bestätigt dies der Burckhardt-Biograph Werner Kaegi, wenn er, Burckhardt gegen den Antisemitismus-Vorwurf in Schutz nehmend, diesen fiktiv sagen lässt: »Warum publiziert ihr Briefe, die nie für die Öffentlichkeit bestimmt waren; ihr seid die Taktlosen, nicht ich; denn was ich da ohne Gewicht und Bedenken im Freundesbrief schrieb, trug den harmlosen Ton, in dem man im damaligen Basel plauderte, ohne Hass gegen die Juden und ohne System. Antisemiten waren wir nicht« (Werner Kaegi: Europäische Horizonte im Denken Jacob Burckhardts. Drei Studien. Basel, Stuttgart 1962, 89). Burckhardts judenfeindliche Einstellung schlug sich im übrigen durchaus in seinen Werken nieder, vgl. etwa Jacob Burckhardt: Historische Fragmente. Aus dem Nachlass gesammelt von Emil Dürr. Nördlingen 1988, 15, 60 (rassistische Ansätze auch 11, 89, 290; weitere Beispiele bei Mattioli, Jacob Burckhardt, 17–21). Ein anderes Beispiel: Albert E. Hoffmann: »Zum Kaufmann bin ich nicht geboren – gewiss nicht.« Aus den Tagebüchern eines Basler Handelsherrn 1847–1896. Hg. von Christoph E. Hoffmann und Paul Hugger. Zürich 1998, Bd. 1, 187 (1852), 243 (1855), Bd. 2, 81 (1871), 193 (1887), 257 (1893), 268 (1894). Von einem untergründigen Antisemitismus in heutigen Basler Honoratiorenkreisen wird berichtet in: Toleranz. Forderung und Alltagswirklichkeit, 123. Zu den Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden im Alltag vgl. allgemein: Geschichte des jüdischen Alltags, 328–344 (Marion Kaplan).
358
|
»Wir waren alle ein klein wenig antisemitisch«
Liest man Briefe von Verwandten Jacob Burckhardts, finden sich ähnliche Bemerkungen wie bei diesem. So schrieb ihm sein Neffe Jacob Oeri (1844– 1908), damals Lehrer an der Höheren Bürgerschule im oberschlesischen Kreuzburg, im Oktober 1868 nicht nur über die dortigen »Pollaken, die im Begriffe stehen, germanisiert zu werden«, sondern auch über die Juden: »Der Handel in der Stadt wird größtentheils von Juden betrieben, welche hier die erste Phase der Civilisation durchmachen, um später in Breslau resp. Berlin die höchste Culturstufe zu erreichen. Das eigentlich total schmutzige polnische Judenthum beginnt zum Glück erst jenseits der russischen Gränze; diese Sorte zeigt sich hier bloß an Markttagen in ihrer Glorie.«52 Der spätere Chefredaktor der »Basler Nachrichten«, Albert Oeri (1875–1950), charakterisierte am 22. Juni 1896 in einem Brief an seinen Grossonkel Jacob Burckhardt einen Professor in Göttingen: Dieser sei, »trotzdem er ein blonder Jude ist, ein gründlicher und aufrichtiger Gelehrter«. In einem Seminar habe er, Albert, die besseren Argumente als ein Mitstudent gehabt. »Dass der Herr ein ziemlich frecher Frankfurter Jude war, erhöhte mir das Vergnügen ihn abzuthun.« Zum Ökonomen Gustav Cohn bemerkte er: »Natürlich fehlt auch hier der jüdische Professor nicht, der diese sozialen Schäflein zur Weide führt.«53 Einige Angehörige dieser Elite gingen noch einen Schritt weiter. Sie unterstützten das judenfeindliche Schächtverbot in der Volksabstimmung von 1893 – anlässlich des Ergebnisses schrie eine Menschenmenge auf dem Basler Marktplatz: »Tod den Juden!«54 – oder die seit 1904 erscheinende vulgär-antisemitische Basler
52 Horst Fuhrmann: Von solchen, »die noch östlicher wohnen« – Deutsche, Polen und Juden im Oberschlesien des 19. Jahrhunderts. In: Reich, Regionen und Europa in Mittelalter und Neuzeit. Festschrift für Peter Moraw. Hg. von Paul-Joachim Heinig u. a. Berlin 2000, 497–512, hier 508–510, Zitat 509. In einem Brief an seine Eltern aus demselben Jahr äusserte er sich ähnlich. Vgl. 497–498 zu Fontane. Der an dieses Gebiet Oberschlesiens angrenzende Teil Polens gehörte damals zum Russischen Reich. 53 Felix Wassermann: Jacob Burckhardts Großneffe als Student der klassischen Philologie in Göttingen: Ein Brief Albert Oeris an Burckhardt aus dem Jahr 1896. In: Antike und Abendland 15 (1969) 75–80, hier 78 und 79. Wassermann bezeichnet Oeris Haltung als »selektiven Antisemitismus« (77). Sie hinderte ihn nicht, später entschieden gegen den Nationalsozialismus aufzutreten (siehe unten bei Anm. 60). 54 Theodor Nordemann: Zur Geschichte der Juden in Basel. Jubiläumsschrift der Israelitischen Gemeinde Basel aus Anlass des 150jährigen Bestehens 5565–5715, 1805–1955. O. O. u. J. (Basel 1955), 125.
Karl von Rotteck und Jacob Burckhardt
|
359
Kulturzeitschrift »Der Samstag«.55 An der Fasnacht kam es immer wieder zu abschätzigen »Scherzen« über Juden.56 Dies bildete die gefühlsmässige Basis, auf der sich – weit über Basel hinaus – die Stimmung breitmachte, es sei nicht richtig gewesen, den Juden die rechtliche Gleichstellung zu geben, und nun müsse alles getan werden, dass der »Fremdkörper« nicht zu gross werde. Juden seien aus der »Nation« auszuschliessen. Bereits kurz nach der Bildung des schweizerischen Bundesstaates 1848, in dessen Verfassung die Gleichberechtigung der Juden noch ausgeklammert worden war, tönte die konservativ-katholisch orientierte »Schwyzer-Zeitung« am 19. September 1859, die »Nation der Schweizer« könne sich »mit der Nation Israel so schnell nicht befreunden«. In der Kampagne gegen die Emanzipation der Juden im Aargau stellte die Volksversammlung von Leuggern am 23. März 1862 fest: »Die Juden passen nicht zu uns als Mitbürger und Mit-Eidgenossen! (...) Der unversöhnliche Gegensatz zwischen Christenthum und Judenthum ist Thatsache. Die Juden passen geschichtlich, gesellschaftlich und politisch nicht zu den Schweizern. (...) Die Juden beten nicht mit uns; sie heirathen nicht mit uns; sie essen nicht mit uns; sie trinken nicht mit uns; wir sind unrein in ihren Augen. (...) Nein, wir wollen sie nicht verpfuschen lassen unsere schönen vaterländischen Gauen! sie nicht verpfuschen lassen durch Fremdlinge, deren Herz nicht zu unserem Herzen, deren Seele nicht zu unserer Seele paßt.«57 55 Albert M. Debrunner: «Der Samstag» – eine antisemitische Kulturzeitschrift des Fin de siècle. In: Antisemitismus in der Schweiz 1848–1960. Hg. von Aram Mattioli. Zürich 1998, 305–324. Die Zeitschrift erschien bis 1913 und dann noch einmal 1932–1934. Bezog sie sich schon 1913 in einer antijüdischen Polemik auf Burckhardt, so dokumentierte sie am 7.10.1933 ausführlich judenfeindliche Zitate aus dessen Werken und Briefen. Vgl. auch Patrick Kury: Die Kehrseite der Medaille: Antisemitismus in Basel zur Zeit der Jahrhundertwende. In: Der Erste Zionistenkongress von 1897 – Ursachen, Bedeutung, Aktualität. »... in Basel habe ich den Judenstaat gegründet.« Hg. von Heiko Haumann u. a. Basel usw. 1997, 191–196, hier 191–193; ders.: Die ersten Zionistenkongresse aus der Sicht der damaligen Basler Publizistik. In. Der Traum von Israel. Die Ursprünge des modernen Zionismus. Hg. von Heiko Haumann. Weinheim 1998, 232–249, hier 236–242. 56 Vgl. z. B. Staatsarchiv Basel-Stadt, Straf- und Polizeiakten F 9a (1898–1902); Acht Jahrhunderte Juden in Basel, 264 (1898); Aaron Kamis-Müller: Antisemitismus in der Schweiz 1900–1930. 2. Aufl. Zürich 2000, 111 (1908), 126 (1910) (das Buch enthält auch sonstige antijüdische Beispiele aus Basel); Mercedes Matas: »’s goht um d’ Wurscht!« Zeitgeschichte im Spiegel von Sujets der Basler Fasnacht 1923–1996, dargestellt am Beispiel der vier Jubiläumscliquen. In: Zwischentöne. Fasnacht und städtische Gesellschaft in Basel 1923–1998. Hg. von Christine Burckhardt-Seebass u. a. Basel 1998, 101–112, 176–183, hier 176; Yves Kugelmann: Wenn dr Adolf gagst ... Der Nahostkonflikt am Rheinknie – falsch verstandene Satire? In: tachles, 14.3.2003; Basler Zeitung, 11.3.2003 ff. (eine längere Debatte); Benz: Bilder vom Juden, 99–100. 57 An den h. Großen Rath des Kantons Aargau. Gesuch bezüglich der Judenfrage und Wünsche bezüglich der Verfassungs-Revision. Von dem Komitee der am 23. März in Leuggern
360
|
»Wir waren alle ein klein wenig antisemitisch«
Burckhardt, der ja die Emanzipation der Juden rückgängig machen wollte, konnte solchen Äusserungen im Prinzip zustimmen. Als dann seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ostjüdische Flüchtlinge in der Schweiz Zuflucht suchten, lag es für die Befürworter einer solchen Einstellung nahe, diese »Fremden« möglichst schnell wieder aus der Schweiz zu entfernen und ihre Einbürgerung zu erschweren. Das Wort von der »Überfremdung« der Schweiz machte die Runde, drang in die Überlegungen der Politiker und Behörden ein und beeinflusste namentlich die Politik der Fremdenpolizei.58 Die Linie des antisemitischen Codes, wie er in den Kreisen um Jacob Burckhardt üblich war, führt also nicht zu Hitler, sondern kann als gedankliche wie gefühlsmässige Vorbereitung von Denkmustern und politischen Strategien gesehen werden, die ihren Höhepunkt in der Zurückweisung jüdischer Flüchtlinge während der nationalsozialistischen Herrschaft fand. In einem Gespräch sagte einer der Verantwortlichen für die Flüchtlingspolitik: »Wir waren alle ein klein wenig antisemitisch.« Und er begründete dies damit, dass die leitenden Personen der Polizeiabteilung – selbst dann noch, als sie von den Massenverbrechen der Nazis wussten – von der Furcht vor der »Überfremdung« und von der »Gefahr der Verjudung« geprägt worden seien.59 Dieses Eingeständnis hat mich, als ich es zum ersten Mal las, tief getroffen. »Ein klein wenig antisemitisch« – eben das ist der Massstab, an dem Burckhardts Judenfeindschaft zu messen ist. Dieses »klein wenig« hat allerdings Tausenden von Juden, die an der Grenze abgewiesen oder wieder ausgeschafft wurden, das Leben gekostet. Aber noch einmal: Burckhardts Einstellung, wie sie für seine Lebenswelt typisch war, bildete einen Teil der gedanklichen und gefühlsmässigen Vorbereitung des »Überfremdungs«-Musters. Er konnte die Folgen seiner Einstellung nicht ahabgehaltenen Volksversammlung. Leuggern 1862, hier 1–3. Man könnte dies als ein frühes Zeugnis des Überfremdungsdiskurses bezeichnen. Vgl. Josef Lang: Die beiden Katholizismen und die Krux der Schweizer Demokratie. In: Die Erfindung der Demokratie in der Schweiz. Hg. vom Schweizerischen Bundesarchiv (= Studien und Quellen 30). Zürich 2004, 45–73, hier 58–61; Aram Mattioli: »So lange die Juden Juden bleiben ...« Der Widerstand gegen die jüdische Emanzipation im Grossherzogtum Baden und im Kanton Aargau (1848–1863). In: Katholischer Antisemitismus im 19. Jahrhundert. Ursachen und Traditionen im internationalen Vergleich. Hg. von Olaf Blaschke und Aram Mattioli. Zürich 2000, 287–315, hier 303–310. Zu den Interaktionen zwischen Juden und Nichtjuden im aargauischen Lengnau bereitet Alexandra Binnenkade eine Dissertation vor [inzwischen erschienen: KontaktZonen. Jüdisch-christlicher Alltag in Lengman. Köln usw. 2009]. 58 Dazu Patrick Kury: Über Fremde reden. Überfremdungsdiskurs und Ausgrenzung in der Schweiz 1900–1945. Zürich 2003. 59 Heinz Meyer, Jurist in der Flüchtlingssektion der Polizeiabteilung 1942–1951, in einem Gespräch im Bundesarchiv Bern am 5.10.1995: Stefan Mächler: Kampf gegen das Chaos – die antisemitische Bevölkerungspolitik der eidgenössischen Fremdenpolizei und Polizeiabteilung 1917–1954. In: Antisemitismus in der Schweiz, 357–421, hier 394.
Karl von Rotteck und Jacob Burckhardt
|
361
nen. Ob er die Flüchtlingspolitik gutgeheissen hätte, wissen wir nicht. Vielleicht hätte er sich schaudernd abgewandt, seinen Humanismus ernst genommen und diese Politik bekämpft. Aber darüber lässt sich nur spekulieren. Sein Grossneffe Albert Oeri, der – wie wir gesehen haben – die Juden nicht gerade liebte, empfand die nationalsozialistische Judenpolitik als unwürdig und trat als Nationalrat wie als Chefredaktor der »Basler Nachrichten« nachdrücklich gegen sie auf, so wie er sich auch in anderen Fragen für die Unabhängigkeit der Schweiz gegenüber dem »Dritten Reich« einsetzte.60 Carl Jacob Burckhardt (1891–1974), auch ein Verwandter Jacob Burckhardts, war ebenfalls »ein klein wenig antisemitisch« und entsprach damit erneut einer verbreiteten Einstellung in Basler Honoratiorenkreisen. In einem Brief vom 1. Juni 1933 an einen Freund beurteilte er das »Schicksal der deutschen Juden« zwar als »Unrecht«, aber doch als ein nachrangiges Problem im Verhältnis zu anderen Vorgängen, die er erlebt habe. Zudem treffe »die Juden eine Schuld«. Er kenne »sittlich hochstehende, reine Menschen«, doch »es gibt einen bestimmten Aspekt des Judentums, den ein gesundes Volk bekämpfen muß«, etwa »die Kultur, die beispielsweise das Berliner Judentum der letzten 30 Jahre schuf, unsittlich und verderbt«, oder auch »jüdische Theorien wie den Marxismus«.61 Diese Einstellung mag bei ihm dazu geführt haben, dass er als Völkerbundshochkommissar gegenüber den Nationalsozialisten nicht sehr intensiv zugunsten der dortigen Juden intervenierte und dass er später seine Möglichkeiten als führendes Mitglied des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz 60 Vgl. ... mit dem Rücken zur Wand ... Flüchtlingsdebatte des Nationalrates vom September 1942. Schaffhausen 1979, 71–75 (73: »Müssen wir Mitmenschen, die uns um Erbarmen anflehen, ins Elend und in den Tod stossen, weil es uns vielleicht später einmal schlecht gehen kann«, 74: »Unser Rettungsboot ist noch nicht überfüllt, nicht einmal gefüllt, und solange es nicht gefüllt ist, nehmen wir noch auf, was Platz hat, sonst versündigen wir uns«); Peter Dürrenmatt: Leben und Wirken Albert Oeris. In: Basler Jahrbuch 1952, 58–76; Umkreis und Weite. Festschrift Albert Oeri zum 21. September 1945. Basel 1945 (zur Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus z. B. 44: »Wenn man dem jüdischen Warenhausbesitzer, dem man die Bude zumacht, vorschreiben kann, seinem christlichen Personal zwei Monatslöhne im voraus zu zahlen, sein israelitisches Personal gleichzeitig fristlos zu entlassen, so kann man auch sonst noch viel«); Alice Meyer: Anpassung oder Widerstand. Die Schweiz zur Zeit des deutschen Nationalsozialismus. Zürich 1965, 72, 100, 102, 115–116, 140, 149. Die Nazis zählten Oeri vermutlich zu den Vertretern der »verjudeten« und »verfreimaurerten gehässigen Spießerpresse«, wie die Schweizer Zeitungen einmal bezeichnet wurden, zumal er den NS-„Kampf gegen den Bolschewismus« als »Hakenkreuzzug« anprangerte (ebd., 208). Siehe auch Georg Kreis: Zensur und Selbstzensur. Die schweizerische Pressepolitik im Zweiten Weltkrieg. Frauenfeld, Stuttgart 1973, 208–211. Georg Kreis verdanke ich in diesem Zusammenhang wichtige Hinweise. 61 Clemens Thoma: Unklare Sicht im Jahr 1933. Ein Brief von Carl J. Burckhardt. In: Freiburger Rundbrief. Neue Folge 6 (1999) 81–88, abgedruckt in: Acht Jahrhunderte Juden in Basel, 275–276.
362
|
»Wir waren alle ein klein wenig antisemitisch«
zu Gesprächen mit höchsten Repräsentanten des NS-Regimes nicht zu einem Versuch nutzte, bremsend auf die Politik der Judenvernichtung einzuwirken.62 Burckhardt wollte sogar in der ursprünglichen Fassung seines Buches über die »Danziger Mission« (1960) den Juden, denen das Wesen des Faschismus zunächst »nicht durchaus artfremd gewesen« sei, eine Mitschuld am Ausbruch des Zweiten Weltkrieges geben.63 III.
Waren Rotteck, Burckhardt und all die anderen, die ähnlich wie sie dachten, Antisemiten? Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus definiert in Übereinstimmung mit dem vorherrschenden wissenschaftlichen Sprachgebrauch: »Mit ›Antijudaismus‹ bezeichnet man die religiös geprägte Judenfeindschaft vor allem des Christentums. (…) Der moderne, rassistisch geprägte Antisemitismus war eine Reaktion auf die Assimilation und auf den Eintritt der Juden ins bürgerliche, soziale und politische Leben Europas. Sein Ziel war es, diesen Prozess der politischen Emanzipation und der gesellschaftlichen Emanzipation zu verhindern. (…) Der heutige Antisemitismus enthält Elemente des alten, religiös geprägten Antijudaismus und solche des modernen Rassismus, der mit der Aufklärung und der naturwissenschaftlichen ›Menschenkunde‹ entstand.«64 Rotteck wäre danach 62 Paul Stauffer: Zwischen Hofmannsthal und Hitler: Carl J. Burckhardt. Facetten einer aussergewöhnlichen Existenz. Zürich 1991; ders.: Grandseigneuraler »Anti-Intellektueller«. Carl J. Burckhardt in den Fährnissen des totalitären Zeitalters. In: Intellektuelle von rechts. Ideologie und Politik in der Schweiz 1918–1939. Hg. von Aram Mattioli. Zürich 1995, 113–134, hier bes. 121–123; ders.: »Sechs furchtbare Jahre...«. Auf den Spuren Carl J. Burckhardts durch den Zweiten Weltkrieg. Zürich 1998, bes. 215–244, 277–295, 352–360. 63 Der damalige Chefredaktor der Neuen Zürcher Zeitung, Willy Bretscher, verhinderte, dass diese Passage zum Druck kam (Stauffer: Hofmannsthal, 239, 242 [Zitat]). 64 Eidgenössische Kommission gegen Rassismus: Antisemitismus in der Schweiz. Ein Bericht zu historischen und aktuellen Erscheinungsformen mit Empfehlungen für Gegenmassnahmen. Verfasst von Georg Kreis, Boël Sambuc, Doris Angst Yilmaz unter Mitarbeit von Michele Galizia. Bern 1998, 15–17. Als rassistisch werden Vorstellungen verstanden, bei denen Menschen aufgrund bestimmer Merkmale und Eigenschaften im Rahmen einer hierarchisierenden oder diskriminierenden Werteskala »in naturgegebene, gleichsam wie durch Blutsverwandtschaft verbundene Gruppen – sogenannte ›Rassen’ – eingeteilt werden« (17). Ich gehe hier nicht auf andere Definitionen ein, die ein spezifisches Merkmal in den Vordergrund stellen. Lars Rensmann etwa versteht den modernen Antisemitismus als »eine geschichtsmächtige ideologische Denkform, als rationalisierte Paranoia mit psychosozialen Funktionen, die eine Reaktion autoritätsgebundener Subjekte auf die politischen, ökonomischen wie sozialen Umbrüche und Abhängigkeitsverhältnisse der modernen Gesellschaft darstellt. Antisemitismus dient nicht zuletzt als personifizierende Erklärung der undurchschauten kapitalistischen Moderne (...)« (Kritische Theorie über den Antisemi-
Karl von Rotteck und Jacob Burckhardt
|
363
schwer einzuordnen – kein Antijudaist mehr, aber auch kein Antisemit, da er weder rassistisch argumentierte noch Assimilation und Emanzipation verhindern wollte. Eher liesse sich Burckhardt als Antisemit bezeichnen, obwohl er nicht in eine Reihe mit solchen Personen gestellt werden sollte, die die Juden als »Rasse« verfolgen, vertreiben oder vernichten wollten. Eine Differenzierung erscheint angebracht, um die verschiedenen Formen antijüdischen Denkens und Handelns angemessen zu erfassen. Die Trennung zwischen christlich-theologisch begründetem Antijudaismus und modernem, rassistisch geprägten Antisemitismus kann ohnehin nicht völlig überzeugen. Wir finden das »Blut«-Argument – Jude bleibe Jude, auch wenn er sich taufen lasse – bereits im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, etwa im Zusammenhang mit den Konversionen und Zwangstaufen von Juden auf der Iberischen Halbinsel seit dem 15. Jahrhundert: Die »Marranen« (»Schweine«), wie sie genannt wurden, blieben immer verdächtig, geheime Juden zu sein; die Inquisition spürte ihnen ständig nach, und es wurden Gesetze über die »Reinheit des Blutes« erlassen.65 Andererseits wird auch in der neuesten Zeit die Judenfeindschaft oft mit einem quasi religiösen Erlösungsverständnis verbunden.66 Deshalb benötigen wir Möglichkeiten, antijüdische Einstellungen genauer zu unterscheiden.67 So wird vorgeschlagen, allgemein von einer systematischen, gegen »den Juden« als Typus gerichteten »Judengegnerschaft« zu sprechen und diese durch ein Adjektiv – relitismus. Studien zu Struktur, Erklärungspotential und Aktualität. Berlin, Hamburg 1998, 13). Mit einer solchen Definition wird versucht, Antisemitismus zu erklären und seine Funktionen aufzuzeigen. Vorweg müssen jedoch m. E. erst einmal die verschiedenartigen Erscheinungsformen differenziert dargestellt werden, um dann über die jeweiligen Akteure in ihren Lebenswelten die Ursachen, Funktionen und Auswirkungen jener Formen zu analysieren. Zur begrifflichen Problematik vgl. Bergmann: Geschichte des Antisemitismus, 6–8; Wolfgang Benz: Was ist Antisemitismus? München 2004, z. B. 19, 23–26. 65 Vgl. etwa Christina von Braun: Und der Feind ist Fleisch geworden. Der rassistische Antisemitismus. In: Der ewige Judenhass, 149–213, zu den »Marranen« 154–157. Auch die Kontinuität des Ritualmordvorwurfs gehört in diesen Zusammenhang. 66 Saul Friedländer: Das Dritte Reich und die Juden. Die Jahre der Verfolgung 1933–1939. München 2000, 101, spricht vom »Erlösungsantisemitismus« als einer spezifisch deutschen Variante des rassischen Antisemitismus, die sich auch im Nationalsozialismus niedergeschlagen habe. 67 Holz: Nationaler Antisemitismus, z. B. 137/138, 541, 547 ff., geht mit seiner »strukturalen Hermeneutik« vom »objektiven Sinn eines Textes« aus und will erst in einem zweiten Schritt die Subjektivität erschliessen. Dies führt ihn dazu zu betonen, dass der Antisemitismus von Treitschke bis Hitler im Kern gleich gewesen sei – der »nationale Antisemitismus« ziele auf die »Entfernung der Juden« –, obwohl es durchaus »Besonderheiten« gegeben habe (154, 542), etwa nicht alle rassistisch gewesen seien (240 u. ö.). Die Gemeinsamkeiten zu kennen, ist sicher wichtig. Dabei stehenzubleiben, erschwert jedoch die Möglichkeiten, sich mit den verschiedenen Formen und Einstellungen auseinanderzusetzen.
364
|
»Wir waren alle ein klein wenig antisemitisch«
giös, national, wirtschaftlich, rassistisch motiviert – zu präzisieren.68 Nach dieser Begrifflichkeit war Karl von Rotteck ein liberal motivierter, Jacob Burckhardt ein anti-emanzipatorischer Judengegner, dessen Formulierungen manchmal in der Nähe rassistischer Elemente lagen, ohne dass er eindeutig ein rassistischer Judengegner gewesen wäre. Wir sollten uns nicht als moralische Richter über den »Makel« Rottecks und Burckhardts – wie vieler anderer – aufschwingen. Heilige sind selten, »Helden« und Vorbilder fragwürdig. In der Regel sind bei allen Menschen Licht- und Schattenseiten festzustellen. Wie hätten wir uns unter vergleichbaren Bedingungen damals verhalten? Geschichte, die Historikerinnen und Historiker erforschen, reflektieren und vermitteln, dient nicht dem Zumessen von Schuld und Unschuld. Sie dient dem Aufklären von Zusammenhängen, Ursachen und Folgen, der Feststellung von Verantwortlichkeiten. Leistungen und Schwächen, Grenzen und Widersprüche müssen offen erörtert werden. Sinnvoll erscheinen zwei Perspektiven: Zum einen sollte die Persönlichkeit in ihrer Lebenswelt und Zeit gewürdigt werden, um ihr gerecht werden zu können. Ein solcher Ansatz bietet im übrigen auch eher als pauschale Erklärungsmuster die Möglichkeit, die jeweiligen Ursachen der Judengegnerschaft zu erkennen und sich damit auseinanderzusetzen.69 Davon ausgehend ist nach den Wirkungen zu fragen, die das Verhalten der Akteure hatte. Wir selbst können die Erinnerung daran als eine Art Probehandeln verstehen: Indem wir mit den Menschen und deren Lebenswelten in früheren Zeiten in Beziehung treten, können wir deren Denken, Fühlen und Handeln nachvollziehen sowie erkennen, wie sich Erfahrungen und Wahrnehmungen, Verarbeitungen und Verhaltensweisen unter bestimmten Rahmenbedingungen ausbilden. Gedanklich sind wir dann fähig, Handlungsvarianten und mögliche Alternativen zu erproben, uns selbst zu prüfen und dadurch, ohne falsche Aktualität, unsere eigenen Einstellungen kritisch zu reflektieren. Dieses »Probehandeln« geht in unseren Erinnerungsbestand ein. Und da Erinnerung dazu beiträgt, unser Handeln zu steuern, kommt ihr eine grosse Bedeutung zu. Vielleicht ist das ein weiterer Massstab, mit dem wir uns der Judengegnerschaft Rottecks und Burckhardts nähern können. 68 Georg Christoph Berger Waldenegg: Antisemitismus: Eine gefährliche Vokabel? Zur Diagnose eines Begriffs. In: Jahrbuch für Antisemitismusforschung 9 (2000) 108–126, der Vorschlag einer neuen Begrifflichkeit 117; ders.: Antisemitismus (Anm. 35), hier bes. 106– 112. 69 Vgl. Gabriele Rosenthal: Antisemitismus im lebensgeschichtlichen Kontext. Soziale Prozesse der Dehumanisierung und Schuldzuweisung. In: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 3 (1992) 449–479, hier bes. 451. Zum Zusammenhang auch Heiko Haumann: Lebensweltlich orientierte Geschichtsschreibung in den Jüdischen Studien: Das Basler Beispiel. In: Jüdische Studien. Reflexionen zu Theorie und Praxis eines wissenschaftlichen Feldes. Hg. von Klaus Hödl. Innsbruck 2003, S. 105–122.
Heinrich Bieg Ein deutscher Nazi in der Schweiz* Am 15. Mai 1945 durchsuchte morgens ab 7.30 Uhr eine Abteilung der Sicherheits- und Kriminalpolizei Bern im Auftrag der Schweizerischen Bundesanwaltschaft das Haus in der Berner Frank Buchserstrasse 4. Dort lebte Heinrich Bieg, Angestellter der Deutschen Gesandtschaft. Am Mittag wurde er einvernommen, und wenige Tage später, am 5. Juni 1945, eröffnete man ihm, dass er gemäss Bundesratsbeschluss vom 29. Mai ausgewiesen werde. Er müsse die Schweiz bis spätestens 30. Juni verlassen. Wegen verschiedener Abklärungen zog sich die Ausschaffung noch bis zum 10. Juli hin. Für seine Frau Hildegard, geborene Aschenbrenner, sowie seine zwei Kinder Heidrun und Eckhard bat Bieg um Asyl in der Schweiz. Deren Ausreisefrist wurde in der Tat bis zum Frühjahr 1947 erstreckt.1 Die französische Besatzungsmacht in Südbaden verhaftete Heinrich Bieg und internierte ihn bis Anfang 1949 in einem Lager in Freiburg i. Br. Danach arbeitete er in der Holz- und Baustoff-Firma seines Schwiegervaters in Sasbach am Kaiserstuhl als Geschäftsführer. Am 30. August 1987 starb er in Freiburg durch einen Unglücksfall oder durch Freitod beim Reinigen seiner Waffe. Sein Leben ist mit der Geschichte des Nationalsozialismus in Südbaden und in der Schweiz eng verbunden. Wer war Heinrich Bieg? Warum musste er ausgewiesen werden? Welche Aktivitäten hatte er in der Schweiz entfaltet? Heinrich Max Georg Bieg – meist Heiner gerufen – wurde am 1. April 1912 in Villingen im Schwarzwald geboren. 1924 zog er mit seinen Eltern nach Freiburg um, wo er dann eine Buchhändler-Lehre durchlief. 1930 trat er in die NSDAP ein und erhielt die Mitgliedsnummer 287964. Im selben Jahr wechselte die Familie nach Bad Krozingen, wo die Eltern einen Geflügelhof betrieben. Heinrich Bieg baute dort die Ortsgruppe der Hitler-Jugend (HJ) auf. Wegen seiner Verdienste wurde er später in den hauptamtlichen Dienst berufen. Anfang 1936 trat er in Karlsruhe die Funktion des stellvertretenden Personalamtsleiters der HJ in Baden an. Im April 1937 übernahm er die Aufgabe des Bannführers im HJ* Erstpublikation in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 59 (2009) Nr. 3, S. 298–328 (unter Mitarbeit von Martin J. Bucher). Lic. phil. Martin J. Bucher war mit Quellenhinweisen und Präzisierungen sowie bei der Beschaffung von Abbildungen behilflich. In seiner an der Universität Zürich geplanten Dissertation zur Geschichte der Reichsdeutschen Jugend in der Schweiz wird er die Zusammenhänge ausführlich analysieren. – Für die Genehmigung zum Abdruck der Abbildungen danke ich dem Schweizerischen Sozialarchiv (Abb. 2 und 10) und dem Schweizerischen Bundesarchiv (Abb. 3–9). 1 Schweizerisches Bundesarchiv Bern (im Folgenden BAR), E 4320 (B) 1973/17, Bd. 6: C. 2. 7263.
366
|
Heinrich Bieg
Bann 113, der die Stadt Freiburg und den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald umfasste. Unter seiner Leitung veränderte sich das Auftreten der HJ merkbar. Bieg forderte von der Freiburger Stadtverwaltung eine intensivere Unterstützung in der Öffentlichkeit, nicht zuletzt in finanzieller Hinsicht. Im Stadtbild war die HJ nun immer häufiger sichtbar. Bieg selbst wird von damaligen Hitler-Jungen als »sympathisch« geschildert, er habe »zündend sprechen« können, »ein Herz für die Jugend gehabt«, sei »kein Fanatiker« gewesen. Gegner des NS-Regimes hielten ihn allerdings für einen »bornierten Nazi«.2 Höhepunkt war im Sommer 1938 eine »Fehde« zwischen dem Bann 113 und dem Bann 111 von Baden-Baden, die mit rund 1350 Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren als zehntägiges »Grossgeländespiel« im Feldberg-Gebiet durchgeführt wurde und den Zweck hatte, die Jugend auf den Krieg vorzubereiten. Autos wurden angehalten, »Verdächtige« verhört, regelrechte Gefechte ausgetragen und Gefangene gemacht. Für die teilnehmenden Jugendlichen war dies ein aufregendes Gemeinschaftserlebnis. Der Führung diente die »Fehde« hingegen, wie die Quellen eindeutig belegen, dem »Wehrsport«, der vormilitärischen Erziehung. Geübt werden sollten vor allem Spähtrupp-Aufträge, Meldewesen, Verhalten im Gelände als Gruppe, Schiessen. Ein Jahr später wurde aus dem Spiel Ernst.3 (Abb. 1) Am 2. September 1939 rückte auch Heinrich Bieg zur Wehrmacht ein. Einen Tag zuvor, am Beginn des Zweiten Weltkrieges, hatte er Hildegard Aschenbrenner geheiratet, eine Führerin im Bund deutscher Mädel (BdM). Es war die erste Kriegstrauung in Freiburg. Als Unteroffizier nahm Bieg 1940 am FrankreichFeldzug teil. Im April 1941 wurde er auf eigenen Antrag beurlaubt, um den Frei2 Alle biographischen Angaben nach Bernd Hainmüller: Erst die Fehde – dann der Krieg. Jugend unterm Hakenkreuz – Freiburgs Hitler-Jugend. Begleitbuch zum Film »Es zittern die morschen Knochen« von Südwest 3. Freiburg i. Br. 1998, Zitate S. 89, 134 (vgl. insgesamt die Zeitzeugen-Berichte S. 69–134). Regisseur des Films, der erstmals am 25.7.1998 um 19.15 Uhr in Südwest 3 gezeigt wurde, war Peter Adler. – Bernd Hainmüller danke ich für die langjährige Zusammenarbeit und viele Hinweise. Eigentlich wollten wir gemeinsam den Lebensweg Heinrich Biegs weiter erforschen und in irgendeiner Weise eine Fortsetzung des Buches verfassen. Leider liess sich das nicht verwirklichen. Hainmüller hat seine Recherchen leicht verändert noch einmal publiziert: Jugend unterm Hakenkreuz. Freiburgs Hitler-Jugend. In: Kinder spielen in ihrer Stadt. SpielRäume in Freiburg 1900–2000. Hg. von Carola Schelle-Wolff und Hartmut Zoche. Freiburg i. Br. 2000, S. 106–134. – Die NSDAP-Mitgliedsnummer findet sich auf den am 15.5.1945 beschlagnahmten Parteiausweisen, vgl. das Verzeichnis, mitgeteilt vom Schweizerischen Bundesarchiv Bern (Dr. D. Bourgeois / H. von Rütte) am 25.2.1998 (Zeichen: 451–5930 Re). Sie ist ebenfalls auf einer Karteikarte verzeichnet, die sich im Archiv für Zeitgeschichte an der ETH Zürich befindet; seine Frau Hilde hatte die Mitgliedsnummer 7026670 (schriftliche Mitteilung von Daniel Gerson am 5.2.1998). 3 Hainmüller: Fehde, S. 11–31.
Ein deutscher Nazi in der Schweiz
|
367
1 Heinrich Bieg (in der Mitte) 1938 im »Generalstab« bei der »Fehde«-Übung (Fehde ist angesagt – 1100 marschieren. Erlebnisberichte der Hitler-Jugend des Bannes 113. Hg. von der Pressestelle des Bannes 113 Freiburg, Freiburg i. Br. 1938, o. S.).
burger HJ-Bann weiterzuführen. Bereits im November dieses Jahres entsandte ihn dann die Reichsjugendführung in die Schweiz. Mit einem Diplomatenpass ausgestattet sollte er dort »jugendpolitisch dringende Aufgaben« wahrnehmen: Er wurde Oberbannführer der HJ und Landesjugendführer der Reichsdeutschen Jugend (RDJ) in der Schweiz, der dortigen HJ-Auslandsorganisation.4 Noch vor 4 Hainmüller: Fehde, S. 59. Der Wechsel in der Landesjugendführung wurde auch mitgeteilt in der »Deutschen Zeitung in der Schweiz« (DZS), 13.12.1941 (die DZS ist im Schweizerischen Sozialarchiv Zürich zugänglich: Z 1023). Die Ernennung zum Oberbannführer erfolgte erst 1942: DZS, 11.4.1942. Bis zum 9.2.1942 war Bieg auch Standortführer in Zürich, dann gab er die Leitung ab, da ihn die Landesjugendführung zu sehr beanspruchte: DZS, 28.2.1942. Alle Hinweise auf DZS-Berichte stammen von Martin J. Bucher, der sie in seiner Dissertation ausführlich auswerten wird. – Die Ernennung Biegs war auch insofern nahe liegend, als die HJ-Gebiete Baden, Württemberg und Tirol-Vorarlberg »Kameradschaftsländer« der Schweiz waren. Vgl. Martin J. Bucher: Die Deutschlandkontakte der Schweizer Pfadfinder 1920–1945. »Schaut auf das Heldische der deutschen Hitlerjugend.«
368
|
Heinrich Bieg
seinem offiziellen Amtsantritt war er anlässlich eines Empfangs in Bern in den Kreis der nationalsozialistischen Funktionäre eingeführt worden.5 (Abb. 2) In die RDJ konnten Jugendliche aufgenommen werden, die mit ihren Eltern als Auslandsdeutsche in der Schweiz lebten. Ende 1938 waren in 45 schweizerischen NSDAP-Ortsgruppen rund 30’000 Mitglieder organisiert, bei etwa 72’000 deutschen Staatsangehörigen, die damals in der deutschsprachigen Schweiz lebten. Die RDJ hatte 1939 jedoch lediglich 584 Mitglieder.6 Heinrich Biegs Aufgabe bestand darin, den Organisationsgrad zu erhöhen und Jugendliche dafür zu gewinnen, sich für den Kriegsdienst in der deutschen Wehrmacht zu melden. Dies ist ihm offenbar gelungen. Bei Kriegsende betrug die Mitgliederzahl rund 2000 Jungen und Mädchen. Bieg hatte den Aufbau der RDJ gestrafft – 47 »Standortführer« waren ihm unterstellt – und viele öffentliche Auftritte organisiert, darunter Sportveranstaltungen und »Geländespiele«. Heimabende, Ausflüge und besondere Lager erhöhten die Attraktivität des Verbandes ebenso wie das Tragen der Uniform – schwarze Hose und weisses Hemd bei den Jungen, dazu der schwarze Leibgurt und das Koppelschloss mit der Aufschrift »Blut und Ehre« –, das in geschlossenen Räumen erlaubt war.7 Münster 2004, S. 110. Bucher gibt einen Überblick zur Geschichte der HJ (S. 89–118) sowie zur RDJ (S.118–153); zu Kontakten Schweizer Pfadfinder zur HJ und zur RDJ sowie zur Auseinandersetzung mit diesen Organisationen vgl. S. 168–185. 5 DZS, 29.11.1941. 6 Michael Buddrus: Totale Erziehung für den totalen Krieg. Hitlerjugend und nationalsozialistische Jugendpolitik. 2 Teile. München 2003, hier II, S. 743 Anm. 12. Vgl. allgemein zu den nationalsozialistischen Organisationen in der Schweiz und der Politik ihnen gegenüber Günter Lachmann: Der Nationalsozialismus in der Schweiz, 1931–1945. Ein Beitrag zur Geschichte der Auslandsorganisation der NSDAP. Berlin 1962; Patrick von Hahn: »Sauberer« als Bern? Schweizerische und Basler Politik gegenüber den nationalsozialistischen Organisationen in der Schweiz (1931–1946). In: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 51 (2001) S. 46–58; am Beispiel des Kantons Basel-Landschaft: Ruedi BrasselMoser: »Das Schweizerhaus muss sauber sein.« Das Kriegsende 1945 im Baselbiet. Liestal 1999, hier bes. S. 76–90. Bucher: Deutschlandkontakte, S. 125, gibt für 1939 83 NSDAPOrtsgruppen und Standorte an (S. 121: 1935 45 Standorte, S. 127: April 1945 49 Standorte und Ortsgruppen mit knapp 24‘000 Mitgliedern). 1942/43 gab es 44 RDJ-Standorte (Buddrus: Totale Erziehung II, S. 782 Anm. 204). Eine der ersten HJ-Gruppen in den Schweiz bildete sich 1933 in Bern; in ihr war Richard von Weizsäcker (geb. 1920) aktiv, der Sohn des deutschen Gesandten in der Schweiz, Ernst von Weizsäcker (1882–1951), und von 1984 bis 1994 Präsident der Bundesrepublik Deutschland (Bucher: Deutschlandkontakte, S. 128; Catherine Arber: Frontismus und Nationalsozialismus in der Stadt Bern. Unveröffentl. Lizentiatsarbeit, Historisches Institut der Universität Bern 2002, S. 60, zur deutschen Kolonie und zum Nationalsozialismus in Bern S. 60–72). 7 Hainmüller: Fehde, S. 135–137. Zu den Zahlen vgl. Bucher: Deutschlandkontakte, S. 128–131. Bereits 1932 hatte der Bundesrat das Tragen von Braunhemden untersagt, am 12.5.1933 war allgemein den Mitgliedern politischer Vereinigungen des In- und Auslan-
Ein deutscher Nazi in der Schweiz
|
369
2 Heinrich Bieg, der neue Landesjugendführer der RDJ in der Schweiz (Deutsche Zeitung in der Schweiz, 3.1.1942).
Zunächst nahm Bieg in Zürich Wohnung, weil er offiziell beim dortigen deutschen Generalkonsulat angestellt war. Die Zürcher Stadtpolizei meldete am 13. Dezember 1941 unter Berufung auf deutsche Zeitungsberichte der Bundesanwaltschaft in Bern Biegs Funktion als Landesjugendführer. Diese ersuchte dann am 29. Dezember den Nachrichtendienst der Kantonspolizei, »Bieg Ihre nötige Aufmerksamkeit schenken lassen zu wollen und dessen Tätigkeit zu beobachten.«8 Überwiegend wurden lediglich kurze Mitteilungen über Biegs Dienstreisen nach Deutschland, Österreich oder Liechtenstein gemeldet. Erstmals kam es zwischen dem 27. August und dem 4. September 1942 zu ausführlicheren Rapporten der Kantonspolizei St. Gallen. Bieg habe zusammen mit Johann Ziegler aus Kappel SG, einem gebürtigen Deutschen, von Johannes Braegger, einem Mitglied der Jungbauern-Bewegung,9 in Ebnat ein Ferienheim für »reichsdeutsche Kinder in des verboten worden, Uniformen oder Abzeichen ihrer Organisation zu tragen. Vgl. zur Rechtslage Lachmann: Nationalsozialismus; hier speziell Edgar Bonjour: Geschichte der schweizerischen Neutralität. Vier Jahrhunderte eidgenössischer Aussenpolitik. Bd. III: 1930–1939. 2. Aufl. Basel, Stuttgart 1970, S. 292. 8 BAR, E 4320 (B) 1973/17, Bd. 6: C. 2. 7263. Wenn nicht anders vermerkt, stammen meine Informationen auch im Folgenden aus diesem Bestand. 9 Vgl. BAR, E 4320 (B) 1968/195, Bd. 23: C. 2. 14. Braegger sei »politisch absolut neutral«, ergänzte das Polizei-Kommando des Kantons Thurgau am 22.9.1942 (Nachweis wie Anm. 8). Die Jungbauern-Bewegung galt, nach ursprünglich eher »linken« Tendenzen, seit
370
|
Heinrich Bieg
der Schweiz« gemietet. Der Mietvertrag laufe bis 1944, die Miete über 50,- Fr. monatlich sei vorausbezahlt. Johann Ziegler versuchte abzuwiegeln, wie am 4. September mitgeteilt wurde: »Die Angelegenheit hat absolut gar keinen politischen Charakter. Es werden sich hier reichsdeutsche Eltern mit ihren Kindern zur Erholung einfinden, die entweder in Zürich, Winterthur oder St. Gallen wohnhaft sind. Im Sommer dient das Heim als Ferien- und Erholungshaus und im Winter als Ferienlager für Skifahrer. Am 12./13. September 1942 werden erstmals 25–30 Personen das neue Heim besuchen.« Dieses Treffen stellte sich dann allerdings als Standortführertagung der RDJ unter Biegs Leitung heraus. Später fanden weitere Schulungskurse, aber auch »hartes sportliches Training« und Skikurse in der Hütte statt. Immerhin fehlte die Unterhaltung nicht: Bieg brachte bei seinen Besuchen in der Hütte ein Kofferradio mit.10 Am 2. März 1944 gab Bieg die Verlegung der Landesjugendführung und Landessportgruppenführung – die er ebenfalls übernommen hatte11 – zum 7. des Monats von Zürich nach Bern in das Haus der Deutschen Gesandtschaft, Muristrasse 53, bekannt; eine Kopie gelangte in den Besitz der Bundesanwaltschaft. Das Polizei-Kommando des Kantons Solothurn berichtete dieser dann am 1. Mai 1944, Bieg sei aufgefallen, weil er sich mit überhöhter Geschwindigkeit in einem 1938/40 als »rechts« und deutsch-freundlich. 1935 war sie aus der Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei (BGB) – der Vorläuferin der heutigen Schweizerischen Volkspartei (SVP) – ausgeschlossen worden. Siehe die programmatische Schrift eines ihrer Führer, Hans Müller, der 1937 auch den Schweizerischen Bauernverband hatte verlassen müssen: Aus dem politischen Wollen der Jungbauern und seiner weltanschaulichen Begründung. 2. Aufl. Grosshöchstetten 1942. Nachdem 1942 die Nähe der Bewegung zur nationalsozialistischen Politik öffentlich geworden war, ging ihre Bedeutung rasch zurück. Vgl. Walter Wolf: Faschismus in der Schweiz. Die Geschichte der Frontenbewegungen in der deutschen Schweiz, 1930–1945. Zürich 1969, S. 46–53; René Riesen: Die Schweizer Bauernheimatbewegung (Jungbauern). Die Entwicklung von den Anfängen bis 1947 unter der Führung von Hans Müller, Möschberg/Grosshöchstetten. Bern 1972; Peter Moser: Der Stand der Bauern. Bäuerliche Politik, Wirtschaft und Kultur gestern und heute. Frauenfeld 1994, S. 101–163; ders.: Bauernheimatbewegung. In: Historisches Lexikon der Schweiz. Version vom 11.2.2005. URL: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D17390.php (3.10.2008). Der Vertreter der Jungbauern im Berner Stadtrat, Hans Ruef, fiel während der Prozesse um die »Protokolle der Weisen von Zion« durch seine Kontakte zu Rechtsextremen auf (Arber: Frontismus, S. 22–23, 28). Näheres dazu wird sich in der von Michael Hagemeister vorbereiteten kritischen Edition der Prozessmaterialien finden. 10 BAR, E 4320 (B) 1968/195, Bd. 33: C. 2. 51 (Berichte der Kantonspolizei St. Gallen vom 14., 16., 18. und 29.9.1942, vgl. auch Berichte vom 21.12.1942, 31.12.1942/1.1.1943, 20.1., 17.9., 19.9.1943, 16.2., 21.3., 9.7., 27.11.1944, 26.1.1945 u. ö.). Die überwachenden Polizisten beklagten, dass sie wegen eines fehlenden Teleobjektivs keine Fotos machen konnten. Widersprüchlich bleibt in den Berichten, ob die Hütte »Stangen« in Ebnat gemietet oder gekauft worden war. Vgl. auch DZS, 23.1.1943. 11 Vgl. DZS, 20.11.1943.
Ein deutscher Nazi in der Schweiz
|
371
Auto zwischen Balsthal und Welschenrohr bewegt habe. In Welschenrohr habe er sich verdächtig nach verschiedenen Wegen in den Jura erkundigt – wohl um die »Umgebung auskundschaften« zu wollen. »Die Anwesenheit Bieg’s in diesem Gebiet, das nur in militärischer Hinsicht interessant erscheint, ist wirklich auffallend.« Vielleicht wurde deshalb am 20. Oktober 1944 wegen »verdächtiger Umtriebe« eine Telefonkontrolle verhängt, die die Bundesanwaltschaft allerdings am 18. Januar 1945 bereits wieder aufhob. Bei der Beobachtung im Jura dürfte es sich um eine Überreaktion gehandelt haben. Es ist schwer vorstellbar, dass Bieg derart dilettantisch Kundschafteraufgaben erfüllte, um einen deutschen Einmarsch – zu dieser Zeit! – in die Schweiz vorzubereiten. Insgesamt ergab somit die persönliche Überwachung bis zum Frühjahr 1945 nichts Belastendes – oder die Überwachung war nicht wirksam genug gewesen. Dabei waren Heiner Biegs Aktivitäten keineswegs so harmlos, wie sein Dossier bei der Bundesanwaltschaft auf den ersten Blick vermuten lässt. Dies geht aus den allgemeinen Unterlagen zur Tätigkeit der RDJ hervor. Vor allem 1942 und 1943 kam es zu erstaunlichen Vorgängen. Am 4./5. April 1942, den Osterfeiertagen, fand ein Treffen der RDJ Basel auf der Jugendburg Rotberg statt, an dem 65 Teilnehmer unter der Leitung der Gruppenführer Dieter Christlein und Hans Müller »militärische Geländeübungen« durchführten. Sie pirschten sich »an feindliche Stellungen« an und kundschafteten »feindliche Standorte« aus. »Das Treffen hatte den Charakter einer Rekrutenschule«, schrieb das Kantonale Polizeikommando Solothurn. Die Jugendlichen waren einheitlich gekleidet mit weissem Sporthemd, kurzer dunkelblauer Manchesterhose, weissen Kniestrümpfen und einem Ledergurt; bei den Übungen trugen sie noch ein kleines Messer wie ein Seitengewehr. Das Uniformverbot wurde somit nur leicht getarnt umgangen. »Die Befehlsgabe war echt preussisch. Die Jünglinge zeigten Schneid, waren diszipliniert und hatten Ordnung. Es war erstaunlich festzustellen, wie diese Jünglinge schon zur Ordnung erzogen sind. Allerdings muss gesagt werden, dass sie gegenüber dem Hausvater der Burg und seinen Angehörigen etwas frech auftraten. Sie fühlten sich so, wie wenn die Burg ihr Eigentum wäre.« Aus dieser Einschätzung des Solothurner Polizeikommandos schimmert eine gewisse Bewunderung für die Disziplin der deutschen Jugendlichen durch. Nur das Verhalten gegenüber dem Herbergsvater fiel nachteilig auf. Offenbar hatte es schon mehrere Treffen dieser Art gegeben, doch »noch nie« – bestätigte die Politische Abteilung des Polizeidepartementes Basel-Stadt gemäss einer Meldung des Herbergsleiters – hätten sich die Jünglinge »so anmassend benommen« wie diesmal. Die Jungsozialisten von Basel hatten das Treffen stören wollen. Dies war verhindert worden, aber um Zwischenfälle zu vermeiden, durften Schweizer Besucher während des RDJ-Treffens die Burg nicht besichtigen. Empörte Reaktionen waren die Folge. Anscheinend gab es Beschwerden, auch von Touristen und Pilgern zum Kloster Mariastein, die den Abmarsch der Deutschen »in Marschkolonne von Rotberg nach Flüh« erlebten und hören mussten, dass dabei »deutsche
372
|
Heinrich Bieg
Marschlieder« gesungen wurden. Die Solothurner Polizei plädierte dafür, an hohen Feiertagen keine derartigen Treffen mehr zu bewilligen. Noch schärfer fasste die Basler Polizei am 9. April ihr Urteil zusammen: »Wir sind der Meinung, dass diesem Getue nun endlich Einhalt geboten werden sollte und regen eine entsprechende Intervention des Politischen Departements bei der Deutschen Gesandtschaft an.«12 In der Tat wurde ein Vertreter der Gesandtschaft einbestellt und auf die Folgen eines solch »übermütigen Getues der Hitlerjugend in der Schweiz« hingewiesen. Der Gesandtschaftsvertreter habe »in vollem Umfange« beigestimmt und zugesichert, »dass in Zukunft bei den Spielen der reichsdeutschen Jugend zum Rechten werde geschaut werden«. Daraufhin, so hiess es in einem Schreiben des Eidgenössischen Politischen Departementes, habe Landesjugendführer Bieg einen Erlass herausgegeben, nach dem »das Singen von deutschen Kampfliedern beim Marschieren in geschlossener Formation in Ortschaften und Städten verboten« sei.13 Die Basler und Solothurner Berichte waren nicht die einzige deutliche Stellungnahme geblieben. Am 10. April 1942 beschwerte sich der Polizeioffizier des Territorialkommandos, Oberstleutnant Pfister, beim Armeekommando über Geländeübungen der RDJ im Grenzgebiet und forderte ein Verbot. Dieses drückte am 5. Mai 1942 gegenüber dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) sein Missfallen über die »unziemlichen Jugenddemonstrationen im Gastland« aus, liess es jedoch dabei bewenden, eine »gutwillige Verständigung« anzuregen oder, wenn dies nichts nütze, eine »Melde- und Bewilligungspflicht« zu verlangen. In Zürich hatte es sogar einen ernsten Zwischenfall zwischen RDJlern und schweizerischen Jugendlichen gegeben, wie die dortige Stadtpolizei am 20. April 1942 berichtete. Den Schweizern wurde vorgeworfen, sie hätten gesagt, die Deutschen »seien Schwaben und würden ihnen das Brot wegessen«, und sie hätten anschliessend die Luft aus den Veloreifen herausgelassen. Die Deutschen hatten andererseits Pfadfinder in ihr Heim verschleppt und »verhört«, waren auch zu den Eltern vorgedrungen und hatten sich »herrisch« benommen. Es gab ein längeres Hin und Her mit Anzeigen und Beschwerden zwischen den Eltern, der 12 BAR, E 4320 (B) 1968/195, Bd. 33: C. 2. 51 (Nationalsozialistische Jugendbewegungen in der Schweiz, 1938–1950): Bericht des Polizeidepartementes Basel-Stadt, Politische Abteilung vom 6.4.1942, übersandt am 9.4.1942 an die Bundesanwaltschaft; Bericht des Kantonalen Polizeikommandos Solothurn vom 6.4.1942, übersandt am 8.4.1942. Bereits im Februar war Bieg an einer Grossveranstaltung in Basel, im April im Osterlager der Zürcher RDJ aufgetreten: DZS, 14.2. und 11.4.1942. Vgl. Brassel-Moser: Schweizerhaus, S. 95–96. 13 BAR, E 4320 (B) 1968/195, Bd. 33: C. 2. 51, Schreiben vom 9.7.1942, unterzeichnet von Pilet-Golaz. Marcel Pilet-Golaz (1889–1958) war von März 1940 bis Dezember 1944 Leiter des Eidgenössischen Politischen Departements. Neben dem Lager in Rotberg hatte ein nicht bewilligtes Lager in Feldbach bei Rapperswil Missfallen erregt, vgl. Bucher: Deutschlandkontakte, S. 140–141. Biegs Verbots-Rundschreiben datiert vom 29.5.1942: BAR, E 2001 (D) 3 Bd. 290: B. 46. A. 21. 4. Hinweis von Martin J. Bucher.
Ein deutscher Nazi in der Schweiz
|
373
3 Freistilringen der Jugendlichen beim RDJ-Sportfest. Im Hintergrund sind die weithin sichtbaren Flaggen des nationalsozialistischen Deutschland und des faschistischen Italien zu sehen (BAR, E 4320 (B) 1968/195, Bd. 33: C. 2. 51, Bericht der Stadtpolizei Zürich vom 6.7.1942).
Polizeidirektion Zürich und dem Deutschen Generalkonsulat, dem Bieg angehörte. Letztlich musste die RDJ aber keine Beschränkungen hinnehmen.14 Stattdessen bewilligten Bundesanwaltschaft und EJPD im Mai 1942 ein Gesuch Heinrich Biegs, ein Sportfest der RDJ gemeinsam mit der faschistischen italienischen Jugendorganisation Gioventù Italiana del Littorio (G.I.L.)15 zu genehmigen, das am 4./5. Juli des Jahres im Zürcher Förrlibuckstadion stattfinden sollte. Zugestanden wurde auch, dass neben den schweizerischen und Zürcher Fahnen die deutschen und italienischen Fahnen gezeigt werden durften. Die Behörden begründeten ihre Grosszügigkeit damit, dass bereits in den beiden Vorjahren Sportfeste bewilligt worden seien und es sich diesmal »um eine Veranstaltung internationalen Charakters« handele. So war das Stadion dann nicht nur im Innern, sondern zugleich rundum auch mit Hakenkreuz-Fahnen beflaggt, obwohl dies die Zürcher Polizeidirektion am 12. Juni eigentlich untersagt hatte. (Abb. 3) 14 BAR, E 4320 (B) 1968/195, Bd. 33: C. 2. 51. Dazu auch Bucher: Deutschlandkontakte, S. 179–181. 15 Zur G.I.L. vgl. Ute Schleimer: Die Opera Nazionale Balilla bzw. Gioventù Italiana del Littorio und die Hitlerjugend. Eine vergleichende Darstellung. Münster usw. 2004.
374
|
Heinrich Bieg
4 Einmarsch der RDJ-Sportler beim Sportfest, von den Zuschauerinnen und Zuschauern mit dem Hitler-Gruss begrüsst (BAR, E 4320 (B) 1968/195, Bd. 33: C. 2. 51, Bericht der Stadtpolizei Zürich vom 6.7.1942).
Die Teilnehmer marschierten mit diesen Flaggen ein, von den Zuschauern begeistert mit dem Hitler-Gruss begrüsst. (Abb. 4) Am Dach der Tribüne prangte das deutsche Hoheitszeichen mit Adler und Hakenkreuz, und am Rednerpult erblickte man das Symbol der deutschen Sportgruppen mit Adler, Hakenkreuz, Schwert und Hammer. (Abb. 5+6) Aus Beschwerden können wir schliessen, dass die Jugendlichen bei der Anreise Hakenkreuzfähnchen mit sich führten, die sie auch aus den Fenstern der Eisenbahnabteile hinaushielten. Eine offizielle Reaktion darauf ist nicht bekannt. Hingegen nahm die Polizei einen »linksextremen Schmierer« fest, der auf die Plakate, mit denen das Sportfest angekündigt worden war, »kommunistische Parolen« gemalt hatte. Bei Hakenkreuzen waren die Begriffe »Not«, »Hunger«, »Krieg« hinzugefügt worden, bei Hammer und Sichel standen »Brot«, »Arbeitsglück«, »Frieden«.16 (Abb. 7–9) Insgesamt war das Sportfest eine erfolgreiche faschistische Werbeveranstaltung mitten in der – offiziell neutralen – Schweiz. Zu dieser Zeit beschäftigte die schweizerischen Behörden bereits eine weitere Aktion Heinrich Biegs, die für diesen einen ganz besonderen Stellenwert hatte, weil sie ihn an seine frühere Wirkungsstätte zurückführte. Es handelte sich um die 16 BAR, E 4320 (B) 1968/195, Bd. 33: C. 2. 51. Vgl. DZS, 18.4. und 11.7.1942.
Ein deutscher Nazi in der Schweiz
|
5 Nazi-Symbole an der Tribüne des Zürcher Förrlibuckstadions beim Sportfest der RDJ am 4./5.7.1942 (BAR, E 4320 (B) 1968/195, Bd. 33: C. 2. 51, Bericht der Stadtpolizei Zürich vom 6.7.1942).
6 Die Landesfahne Schweiz der nationalsozialistischen Sportgruppen beim Zürcher Sportfest (BAR, E 4320 (B) 1968/195, Bd. 33: C. 2. 51, Bericht der Stadtpolizei Zürich vom 6.7.1942).
375
376
|
Heinrich Bieg
7–9 Die »Schmieraktion«: Eine Plakatwand bei der städtischen Polizeiwache in der Limmatstrasse, Zürich 5, anlässlich des RDJ-Sportfestes (BAR, E 4320 (B) 1968/195, Bd. 33: C. 2. 51, Bericht der Stadtpolizei Zürich vom 6.7.1942).
Ein deutscher Nazi in der Schweiz
|
377
Organisation des »Wilhelm-Gustloff-Gedächtnislagers« vom 19. bis 30. Juli 1942 in Freiburg i. Br. Gustloff (1895–1936) war seit 1932 Landesgruppenleiter der NSDAP in der Schweiz gewesen und am 4. Februar 1936 von David Frankfurter (1909–1982) in Davos ermordet worden. Dieser jüdische Medizinstudent hatte damit auf die Unterdrückung der Juden in Deutschland aufmerksam machen wollen. Er wurde vom Kantonsgericht Graubünden wegen vorsätzlich begangenen Mordes zu 18 Jahren Zuchthaus sowie lebenslänglicher Landesverweisung verurteilt und konnte 1945 nach Palästina auswandern.17 Nach Gustloffs Ermordung war in der Schweiz über ein Verbot der nationalsozialistischen Organisationen diskutiert worden. Der Bundesrat hatte sich schliesslich am 18. Februar 1936 dazu entschlossen, lediglich die Landesgruppenleitung und die Kreisleitungen der NSDAP zu verbieten. Den verschiedenen Parteiorganisationen und deren Aktivitäten tat dies letztlich keinen Abbruch.18 Anfang Oktober 1940 war das Verbot denn auch wieder aufgehoben worden.19 Den Nationalsozialisten galt Gustloff als Märtyrer, und so hatte auch das »Gedächtnislager« eine propagandistische, gegen die Juden gerichtete Funktion. 1275 »reichsdeutsche« Jugendliche aus der Schweiz reisten an, dabei allein aus Basel etwa 300. Das Lager wurde in Sportstadien und auf den Wiesen an der Dreisam durchgeführt. Es war das grösste Lager der auslandsdeutschen HJ im dritten Kriegsjahr. Die Jugendlichen sollten in Freiburg erfahren, wie begeistert die Bevölkerung hinter dem Krieg und hinter dem Führer stand, damit sie diesen Eindruck in der Schweiz vermitteln konnten, selbst von dieser Begeisterung erfasst wurden und sich gegebenenfalls für den Kriegsdienst zur Verfügung stellten. Bieg gelang es, den damaligen Reichsjugendführer Artur Axmann (1913–1996) zum »Lagerappell« nach Freiburg zu holen. Ebenso nahmen der deutsche Gesandte in der Schweiz, Dr. Otto Köcher (1884–1945),20 der Landesgruppenleiter der NS17 Vgl. Emil Ludwig, Peter O. Chotjewitz: Der Mord in Davos. Texte zum Attentatsfall David Frankfurter – Wilhelm Gustloff. Hg. von Helmut Kreuzer. Herbstein 1986. Ein erstes Gustloff-Gedächtnislager hatte es 1941 im Saminatal im Fürstentum Liechtenstein gegeben (Bucher: Deutschlandkontakte, S. 142). 18 Lachmann: Nationalsozialismus, S. 55–64, vgl. passim. 19 Lachmann: Nationalsozialismus, S. 79. Am 17.12.1940 wurde hingegen die Kommunistische Partei der Schweiz aufgelöst, Anfang 1941 folgten alle Organisationen »mit kommunistischem Charakter«. Ein Beispiel für die manchmal einseitige Auslegung der Neutralität sind auch die Versuche, Schriften des Theologen Karl Barth zu verhindern oder zu zensurieren, die sich kritisch mit dem Nationalsozialismus und dem Verhalten der Schweizer Regierung auseinandersetzten: Die Akte Karl Barth. Zensur und Überwachung im Namen der Schweizer Neutralität 1938–1945. Hg. von Eberhard Busch. Zürich 2008. 20 Köcher war schon zwischen 1918 und 1923 als Mitglied des deutschen konsularischen und diplomatischen Dienstes in der Schweiz tätig, seit 1937 wirkte er als Gesandter. Im Mai 1945 hielt der Bundesrat seine Haltung für moderat und wenig fanatisch, so dass er nicht ausgewiesen wurde. Auf öffentlichen Druck hin verliess Köcher am 31.7.1945 dann doch
378
|
Heinrich Bieg
DAP in der Schweiz, Sigismund Freiherr von Bibra (1894–1973),21 der Führer der NSDAP-Auslandsorganisation, Gauleiter und SS-Obergruppenführer Ernst Wilhelm Bohle (1903–1960),22 sowie weitere hochrangige Würdenträger an dem Treffen teil. Die Stadt Freiburg musste für sie ein grosses Essen in einem feinen Lokal finanzieren – zu einer Zeit, als die Bürger sich mit rationierten Lebensmitteln zufrieden geben mussten. (Abb. 10) Das Gustloff-Lager erregte national wie international Aufsehen. Im Ausland wurde teilweise erstaunt vermerkt, dass es in der »neutralen Schweiz« eine HitlerJugend gab, die zu einer Zeit, als die Schweizer Grenze für Flüchtlinge vollständig geschlossen war, im Sonderzug nach Deutschland reiste. Allerdings war dies nicht ganz reibungslos vonstatten gegangen. Nachdem die deutsche Seite das Aus- und Wiedereinreise-Gesuch für die RDJ-Jugendlichen gestellt hatte, verlangte die schweizerische Regierung, dass eine ähnlich grosse Zahl von Schweizer Jugendlichen, die im Ausland lebten, über Deutschland in die Schweiz einreisen durften. Dies lehnte das deutsche Auswärtige Amt ab, während die Reichsjugendführung zustimmte. Schliesslich kam es zu einem Kompromiss: Die Schweiz bewilligte das deutsche Gesuch, obwohl Deutschland nur einer verhältnismässig kleinen Zahl von Schweizer Jugendlichen die Ausreise genehmigte.23 Heinrich Bieg machte im die Schweiz. Die französischen Besatzungsbehörden lieferten ihn in ein Internierungslager ein; dort wählte er am 27.11.1945 den Freitod. Marc Perrenoud: Köcher, Otto. In: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS). Version vom 23.8.2007, URL: http://www.hls-dhs-dss. ch/textes/d/D28517.php [20.3.2008]. Für den Hinweis danke ich Stefan Keller. 21 Freiherr von Bibra übte seine Funktion in Bern von 1936 bis 1943 aus und wechselte dann an die Botschaft in Madrid (Documents Diplomatiques Suisses 1848–1945. Bd. 14 (1941–1943). Hg. von Antoine Fleury u. a. Bern 1997, S. 1113), zu seiner Tätigkeit auch Bucher: Deutschlandkontakte, S. 123–127. 22 Frank-Rutger Hausmann: Ernst-Wilhelm Bohle. Gauleiter im Dienst von Partei und Staat. Berlin 2009. 23 Hainmüller: Fehde, S. 138–140; ders.: Jugend, S. 128–132. Weitere biographische Angaben nach Buddrus: Totale Erziehung II, S. 1114–1115 (Axmann); Ernst Klee: Das Personenlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945? Frankfurt a. M. 2003 (Axmann, Bohle); Robert Wistrich: Wer war wer im Dritten Reich? Ein biographisches Lexikon. Anhänger, Mitläufer, Gegner aus Politik, Wirtschaft, Militär, Kunst und Wissenschaft. Frankfurt a. M. 1987 (Axmann, Bohle). Vgl. die Berichte in der DZS, 18.4., 25.7. und 1.8.1942. Zu Problemen der wechselseitigen Einreiseerlaubnis in anderem Zusammenhang während dieser Zeit vgl. Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918–1945. Serie E: 1941–1945. Bd. II: 1.3.-15.6.1942. Göttingen 1972, S. 416–417 (26.5.1942). Leider ist das Schriftgut der Reichsjugendführung im Zweiten Weltkrieg fast vollständig vernichtet worden. In den überlieferten Unterlagen findet sich nichts zur Korrespondenz im Zusammenhang mit dem Freiburger »Wilhelm-Gustloff-Gedächtnislager« (schriftliche Mitteilung des Bundesarchivs Berlin vom 22.4.2008. Ich danke Herrn Matthias Meissner für seine gründliche Recherche). Meine Darstellung im Übrigen wieder nach: BAR, E 4320 (B) 1968/195, Bd. 33: C. 2. 51.
Ein deutscher Nazi in der Schweiz
|
379
10 Im »Wilhelm-Gustloff-Gedächtnislager« in Freiburg i. Br. In der ersten Reihe von links: Gebietsmädelführerin Kempf, Obergebietsführer Kemper, Gauleiter Bohle, Rechtsjugendführer Axmann, dahinter von links der Gesandte Dr. Köcher, Landesgruppenleiter Freiherr von Bibra, Landesjugendführer Bieg, rechts Landesmädelführerin Els Hammann (Deutsche Zeitung in der Schweiz, 1.8.1942).
Mai 1945, als er seine Ausweisung aus der Schweiz verhindern wollte, geltend, dass er sich bei der Reichsjugendführung für das schweizerische Anliegen eingesetzt und Axmann überzeugt habe. Dieser habe dann seinerseits das Auswärtige Amt zur Änderung seines Beschlusses veranlasst. Beim Auswärtigen Amt sei er deshalb in Ungnade gefallen und habe eine Zeitlang nicht mit der Reichsjugendführung direkt telefonieren oder telegrafieren dürfen.24 Für die Schweizer Seite, namentlich für den Chef der Eidgenössischen Polizeiabteilung Heinrich Rothmund (1888– 1961), war in der Tat die mögliche Einreise von 200 bis 300 jungen Schweizern, die in Deutschland wohnten, ausschlaggebend für die Genehmigung der Ausreise und Wiedereinreise der RDJler. Mit diesem Argument hatte er den Wunsch der Basler Politischen Polizei zurückgewiesen, die Aktion zu verhindern. Diese hatte befürchtet, dass »Jugendliche, die mit Schweizerkindern in die gleiche Schule gingen, in einem Sonderlager mitten in Deutschland für ihren Kampf gegen die Demokratie usw. gestählt« würden.25 24 BAR, E 4320 (B) 1973/17, Bd. 6: C. 2. 7263, Abhörungs-Protokoll vom 15.5.1945. 25 Bericht des Regierungsrates über die Abwehr staatsfeindlicher Umtriebe in den Vorkriegsund Kriegsjahren sowie die Säuberungsaktion nach Kriegsschluss. Dem Grossen Rat des Kantons Basel-Stadt vorgelegt am 4. Juli 1946. O. O. u. J., S. 51. Die Basler hatten bereits
380
|
Heinrich Bieg
Am 25. April 1942 taucht dieses Sommerlager erstmals in den Akten auf, als das Polizeikommando Zürich der Bundesanwaltschaft eine Werbe-Broschüre der RDJ-Landesjugendführung übersandte. Oberbannführer Bieg kündigte den »Kameradinnen und Kameraden« darin an, dass viele von ihnen »zum ersten Mal den Boden ihres Vaterlandes« betreten würden. »Die Vorbereitungen, die getroffen werden, bieten die Gewähr dafür, dass dieses Lager ein gewaltiges, unvergeßliches Erlebnis für jeden Teilnehmer werden wird.« Der Kreisleiter der NSDAP in Freiburg, Wilhelm Fritsch (1907–1987), wünschte, der Aufenthalt möge »mitten im gewaltigsten Kriege aller Zeiten das Erlebnis vermitteln, das Eure Herzen unlösbar mit Eurem Volk, seinem Schicksal und seiner ruhmvollen Geschichte verbindet.«26 Die Teilnahme war für alle RDJ-Jugendliche ab elf Jahren kostenlos, und auch das in der Broschüre vorgestellte Programm, das ein einzigartiges Gemeinschaftserlebnis versprach, dürfte als attraktiv empfunden worden sein: »ein ›freies‹ Leben (…) in mustergültiger Ordnung«. Schöne Fotos von früheren HJ-Lagern, von Freiburg und seiner Umgebung sowie von zerschossenen französischen Bunkern am »Westwall« verstärkten diese Wirkung. Den Eltern wurde zugesichert, dass sie sich keine Sorgen machen müssten. »Deutscher Junge und deutsches Mädel! Wer von Euch wollte zu Hause sitzen bleiben, wenn Euch die Möglichkeit geboten wird, ein Stück Eurer Heimat zu erleben und einige Tage im Lager in froher Kameradschaft zu verbringen! Jeder Junge und jedes Mädel der RDJ gehört in das Sommerlager 1942!«27 Am 12. Juni 1942 übersandte die Sicherheits- und Kriminalpolizei der Stadt Bern der Bundesanwaltschaft ein Merkblatt für die Ausrüstung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Sommerlager, in dem bis zum »Zahnputzzeug« alles aufgelistet war, sowie zwei »hektographierte Blätter mit Versen deutscher Lieder«. Darunter befanden sich auch Lieder, die den Einsatz im Spanischen Bürgerkrieg, im Mai 1942 mit Missfallen die Ausreise zweier Deutscher zu einem Sportlehrgang in Potsdam zur Kenntnis genommen (BAR, E 4320 (B) 1968/195, Bd. 33: C. 2. 51, Bericht vom 16.5.1942). Der Basler Bericht von 1946 macht im Übrigen auch deutlich, wie unter Biegs Leitung die Anstrengungen zur Erfassung der deutschen Jugendlichen in der Schweiz sowie zu ihrer Schulung und Ausbildung verstärkt worden waren (S. 50). Zu Rothmund, einer Schlüsselfigur im Kampf gegen »Überfremdung« und »Verjudung« – in der Meinung, damit Antisemitismus verhindern zu können –, vgl. Heinz Roschewski: Rothmund und die Juden. Eine historische Fallstudie des Antisemitismus in der schweizerischen Flüchtlingspolitik 1933–1957. Basel, Frankfurt a. M. 1997; Patrick Kury: Über Fremde reden. Überfremdungsdiskurs und Ausgrenzung in der Schweiz 1900–1945. Zürich 2003. Rothmunds widersprüchliche Haltung gegenüber der »Judenfrage« kommt sehr deutlich in seinem in Anm. 44 zitierten Bericht vom Januar 1943 zum Ausdruck. 26 Zu den Verhältnissen in Freiburg während des »Dritten Reiches« und zu Fritschs Tätigkeit vgl. Geschichte der Stadt Freiburg im Breisgau. Bd. 3. Hg. von Heiko Haumann und Hans Schadek. Stuttgart 1992, S. 296–370. 27 BAR, E 4320 (B) 1968/195, Bd. 33: C. 2. 51.
Ein deutscher Nazi in der Schweiz
|
381
in Afrika oder in der Sowjetunion verherrlichten: »Wir standen für Deutschland auf Posten und hielten die grosse Wacht. / Nun hebt sich die Sonne im Osten und ruft die Millionen zur Schlacht. / Von Finnland bis zum schwarzen Meer, / vorwärts, vorwärts! / Vorwärts nach Osten du stürmend Heer! / Freiheit das Ziel, Sieg das Panier! / Führer befiehl, wir folgen Dir! / Führer befiehl, wir folgen Dir!« Dieser Quellenfund war keineswegs ein Ergebnis sorgfältiger Überwachung, sondern ein Zufallsfund in der Badeanstalt Marzili. Am selben Tag schickte die Zürcher Polizei die Abschrift eines Rundschreibens der NSDAP-Ortsgruppe Zürich vom 4. Juni an die Politischen Leiter ein, in dem diese aufgefordert wurden, die Teilnahme am Sommerlager zur Werbung »der noch immer abseits stehenden« zu nutzen. Ein entsprechendes Schreiben der RDJ Zürich an Eltern, die Kinder und Jugendliche im HJ-fähigen Alter hatten, war beigefügt. Darin wurden den Eltern die Vorteile des Sommerlagers – sie erhielten auch die erwähnte Broschüre – und der RDJ-Mitgliedschaft dargelegt. Betont wurde dabei: »Die RDJ. hält sich genau an die geltenden gesetzlichen und polizeilichen Vorschriften des Gastlandes. Ihre Tätigkeit ist durchaus legal.« Später folgen Berichte über die Ausfuhr von vierzehn Hakenkreuzfahnen nach Freiburg im Auftrag Biegs, über die Aus- und Rückreise der Lager-Teilnehmer, über diejenigen, die länger in Deutschland geblieben waren. Auch kritische Stimmen werden zitiert. So fand es die »Volksstimme« am 24. Juli 1942, einen Bericht der Basler »Arbeiter-Zeitung« aufgreifend, empörend, dass die deutschen Jugendlichen trotz des Verbotes eine Uniform eingepackt hätten und nun das in Freiburg Gelernte in der Schweiz weitergeben könnten. Die Kantonspolizei von Neuchâtel vermerkte, dass die rückreisenden RDJler bis Neuchâtel die HJ-Uniform getragen hätten.28 In den nächsten Monaten zeigen Polizeiberichte und abgefangene Briefe oder Broschüren, wie intensiv die Eingriffe der RDJ-Führung in das Leben der männlichen und weiblichen Mitglieder ausfielen. Bereits in dem nur für den Dienstgebrauch bestimmten »Befehls-Blatt der Reichsdeutschen Jugend in der Schweiz« vom Januar 1942 hatte Landesjugendführer Bieg erklärt, die Formierung der Organisation sei nun abgeschlossen, jetzt komme es darauf an, »die Erfassung der in der Schweiz lebenden reichsdeutschen Jugendlichen hundertprozentig durchzuführen«.29 In der Ausgabe dieses Blattes vom 17. September 1942, das am 29. September der Bundesanwaltschaft übersandt wurde, verlangte die Führung für die Monate Oktober und November eine Werbeaktion, deren Einzelheiten an 28 BAR, E 4320 (B) 1968/195, Bd. 33: C. 2. 51 (Berichte vom 18.7.. 24.7., 31.7., 1.8., 21.8., 14.9., 15.9., 30.10., 4.11., 6.11.1942 u. ö.). Aus diesem Dossier wird wieder im Folgenden zitiert, wenn nicht anders angegeben. 29 Zitiert in: Bericht des Regierungsrates, S. 50. Zur aggressiven Werbung der RDJ vgl. Bucher: Deutschlandkontakte, S. 133–136.
382
|
Heinrich Bieg
der Standortführertagung in Ebnat weitergegeben worden seien. Alle Jugendliche, die noch nicht Mitglied seien, müssten erfasst werden. Zu melden seien auch diejenigen, die »der Aufforderung zum Beitritt zur RDJ keine Folge leisteten«. Weiterhin wurden Meldungen über den Sportbetrieb gefordert, über eine bessere Organisation benachrichtigt, für die »Opferspende der Auslandsdeutschen Jugend 1942« gedankt – aus der Schweiz kamen 5’536.55 Franken – und eine neue Form der Monatsberichte vorgestellt. Grosser Wert wurde auf »einen sauberen und kurzen Haarschnitt« gelegt. Dies sei ein Zeichen »der soldatischen Haltung der Hitlerjugend« und lasse gerade im Gastland, wo ein solcher Haarschnitt nicht üblich sei, die »Deutsche Reichszugehörigkeit« zutage treten. Im Übrigen sei »das Tragen von langen Haaren (…) ein äußerliches Merkmal marxistischer Jugendverbände gewesen«. Wegen der Kriegszeit dürfe kein RDJ-Mitglied »Tanzlustbarkeiten« besuchen, ausgenommen sei reiner Tanzunterricht ab vollendetem 15. Lebensjahr für Mädel und 16. für Jungen. In anderen Rundschreiben wurde genau vorgeschrieben, wie Film-Abende organisiert werden müssten und wie sie den kantonalen Behörden mitzuteilen seien. In der im September 1942 versandten Oktober-Ausgabe der Broschüre »Führerdienst. Reichsdeutsche Jugend in der Schweiz« verlangte Heinrich Bieg, die Schulungsarbeit wieder aufzunehmen und beim »Dienstappell« auf die Sauberkeit des Dienstanzuges und auf den Haarschnitt zu achten. Ausserdem sei das »Kriegstagebuch der RDJ über den Dienstbetrieb des Standortes in den Monaten April–September 1942« zu verlesen sowie ein »Unterricht über die Höflichkeit der Jugend« zu erteilen.30 Bieg verstand seine Arbeit offenbar als eine Kombination eines attraktiven Angebotes an Jugendspielen mit der Einübung von Symbolen der Reichszugehörigkeit – und sei es in der Form des kurzen Haarschnitts – sowie der Werbung für den Krieg. Wie ernst es Bieg mit dem Bekenntnis zum Deutschen Reich nahm, geht aus seinem Schreiben vom 16. September 1942 an den Führer des Standortes Winterthur hervor: Er griff den »Fall« einer in Winterthur lebenden deutschen Reichsangehörigen auf, die sich mit einem Schweizer verlobt hatte. »Es ist nicht zulässig, dass Mädel, welche mit einem Schweizer verlobt oder verheiratet sind, der Reichsdeutschen Jugend angehören.« Deshalb sei der jungen Frau der Austritt nahezulegen. Im »Befehls-Blatt« der RDJ vom 14. November 1942 – am 25. November der Bundesanwaltschaft übersandt – wurden nicht nur Beförderungen der einzelnen »Führer«, sondern auch Einzelheiten zur Gestaltung der »Kriegstagebücher« mitgeteilt. Gefordert waren Berichte über die jeweilige Einheit, die möglichst persönlich sein sollten, und dazu Schilderungen der Ereignisse an den Fron30 Auch im »Führerdienst« für Oktober 1943 wurde die »Kontrolle des Haarschnittes« verlangt. »Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Haare 3 Finger breit über den Ohren 1/10 mm lang geschnitten sind.« Ebd., Bericht vom 5.10.1943. Vgl. Bericht über die Standortführertagung in der DZS, 26.9.1942; Bucher: Deutschlandkontakte, S. 138–139.
Ein deutscher Nazi in der Schweiz
|
383
ten des Weltkrieges, ergänzt durch Presseausschnitte, Schreiben von eingezogenen Kameraden und Würdigungen gefallener Kameraden. Besonders geachtet werden musste auf die Einheitlichkeit des Schriftbildes und des Einbandes der »Kriegstagebücher« sowie der Quellenmappen. Dieser Einbindung in den Krieg entsprach die Befehlssprache, die nicht nur Bieg verwendete: In einem Rundschreiben vom 15. Oktober 1942 kündigte die Bannmädelführerin Els Hammann für den 23. bis 25. Oktober eine »Führerinnentagung im Kameradschaftshaus in Höngg« an. Wer verhindert sei, müsse eine Vertretung benennen. »Erst wenn Du meine Genehmigung hast, kannst Du jemand anders für Dich schicken.«31 Offensichtlich verstärkte sich allmählich die Kritik an den Aktivitäten der RDJ. Sie entzündete sich vor allem am Erntedankfest der Deutschen Kolonie am Sonntag, den 4. Oktober 1942, in der grossen Radrennhalle in Zürich-Oerlikon. Mit 12’000 Teilnehmern wurde es die grösste Kundgebung des Auslandsdeutschtums in Europa.32 Heinrich Bieg hatte in seinem Rundschreiben Nr. 31/42 vom 25. September 1942 – am 2. Oktober vom Nachrichtendienst des Kantons Zürich übersandt – dieses »Erntedankfest der Deutschen für die gesamte Schweiz« angekündigt. Als Hauptredner war Gauleiter Bohle vorgesehen. Alle RDJ-Jugendlichen sollten mit Sonderzügen nach Zürich kommen, finanziert durch die Landesgruppe der NSDAP. »Die Jungen und Mädel tragen in der Halle in Zürich Uniform. Die Jungen tragen bei der Anreise einen Zivilrock über dem weissen Hemd.« Diese Anweisung missfiel den schweizerischen Behörden. Die Genehmigung des Festes hatte offenbar die Zürcher Regierung ohne Konsultation des Bundesrates erteilt. Wiederum wurden Auflagen nicht beachtet, die der Bundesrat dem deutschen Gesandten Köcher mitgeteilt hatte. Daraufhin hatte der Bundesrat bereits am 2. Oktober 1942 den Beschluss gefasst, ausländischen Organisationen keine Bewilligung mehr für Grossveranstaltungen zu erteilen. Ein »mot d’ordre des Bundesrates«– so Markus Feldmann (1897–1958), der BGB-Politiker und Kritiker von Marcel Pilet-Golaz, dem Vorsteher des Eidgenössischen Politischen Departementes, in seinem Tagebuch – wies dazu an, die Veranstaltung in Zürich »bis auf weiteres totzuschweigen«. So sei es möglich, dass Gauleiter Bohle, »ein geschworener Feind der Schweiz«, »in der grössten Schweizerstadt zu der auf Probe mobilisierten ›5. Kolonne‹« sprechen könne.33
31 BAR, E 4320 (B) 1968/195, Bd. 33: C. 2. 51 (Bericht vom 22.10.1942, vgl. Bericht vom 12.4.1943). Vgl. DZS, 28.11.1942, 1.5.1943. 32 Ludwig/Chotjewitz: Mord in Davos, S. 147, nach einem Artikel von Klaus Urner in der Neuen Zürcher Zeitung vom 15.12.1965. 33 Markus Feldmann: Tagebuch 1942–1945. Band XIII/3. Bearb. von Peter Moser. Basel 2001, S. 119, vgl. 146. Zur »5. Kolonne« siehe Anm. 58. Zu Bohles Auftreten vgl. Hausmann: Bohle, S. 190–192.
384
|
Heinrich Bieg
Entsprechend wurde dann im März 1943 im Bundesrat erwogen, den Antrag der RDJ auf ein neues Sportfest in Zürich am 21. und 22. August 1943 nicht zu genehmigen.34 Noch am 27. Juni 1943 informierte allerdings Hans Wüst, Sportwart der RDJ, an einer von Heinrich Bieg geleiteten Tagung in Ebnat die Führerinnen und Führer über den vorgesehenen Aufmarsch der etwa 1200 Teilnehmer. Neben der Schweizerflagge sollten die »Hackenkreuzfahne« – so der berichtende Polizist am 28. Juni 1943 – und eventuell eine italienische Fahne »aufgepflanzt« werden. Zwar wollte man nicht zu sehr auffallen und verzichtete darauf, bei Erklingen der Landeshymnen die »Hand zum Grusse« zu erheben, aber: »Bei der ganzen Sache handle es sich darum zu zeigen, was die Reichsdeutschen im vierten Kriegsjahre, in einem fremden Lande noch fertig brächten.« Die Absicht war also klar. Die Bundesanwaltschaft hakte am 5. Juli 1943 beim Bundesrat nach und verlangte ein Verbot des Sportfestes. Ähnlich reagierten der Zürcher Stadtrat und die dortige Polizeidirektion sowie der Schweizerische Vaterländische Verband. Dieser war 1919 zur Verteidigung der bestehenden Ordnung gegen drohende sozialistische Umsturzversuche gegründet worden.35 Jetzt erinnerte er am 17. Juli an das Erntedankfest von 1942 und verwies auf die Nichtbeachtung von Auflagen sowie auf »Übergriffe und Anmassungen der Deutschen Kolonie in der Schweiz«. Im Sinne der schweizerischen Neutralität müsse das Sportfest abgelehnt werden. Bundesrat Pilet-Golaz teilte in seiner Antwort vom 23. Juli 1943 die Bedenken und versicherte, es seien entsprechende Massnahmen getroffen worden. Zwar unterblieb ein ausdrückliches Verbot, Bieg war aber mitgeteilt worden, dass das Sportfest »nicht erwünscht« sei.36 Ohnehin scheinen die kritischen Schweizer Reaktionen keinen grossen Einfluss auf die Tätigkeiten der RDJ und ihres Führers Heinrich Bieg gehabt zu haben. Weiterhin fuhren deutsche Jugendliche aus der Schweiz zur Ausbildung in 34 BAR, E 4320 (B) 1968/195, Bd. 33: C. 2. 51 (Bundesanwaltschaft an v. Steiger, 5.3.1943, dieser dann an den Vorsteher des EPD, Pilet-Golaz, 8.3.1943). Eduard von Steiger (1881– 1962) war von 1940 bis 1951 Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes. Pilet-Golaz (vgl. Anm. 13) war in einer Radioansprache am 25. Juni 1940 – nach der militärischen Niederlage Frankreichs gegen das Deutsche Reich – dadurch hervorgetreten, dass er eine Ausrichtung der Schweiz auf das »neue Europa« forderte (Edgar Bonjour: Geschichte der schweizerischen Neutralität. Vier Jahrhunderte eidgenössischer Aussenpolitik. Bd. IV: 1939–1945. 2. Aufl. Basel, Stuttgart 1970, S. 115–137). Zu damaligen deutschfreundlichen Stimmungen vgl. Raffael Scheck: Swiss Funding for the Early Nazi Movement: Motivation, Context, and Continuities. In: The Journal of Modern History 71 (1999) S. 793–813, hier 809–813. 35 Andreas Thürer: Schweizerischer Vaterländischer Verband. In: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS). Version vom 11.2.2005, URL: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D17416. php [20.3.2008]. 36 Martin J. Bucher wird diese Vorgänge detailliert analysieren.
Ein deutscher Nazi in der Schweiz
|
385
HJ-Lager in Deutschland,37 und Bieg mietete im März 1943 ein weiteres Haus – diesmal im Baselbieter Lauwil38 –, um dort ein Ferienlager einzurichten. Ebenfalls im März fiel den Behörden ein Schreiben der RDJ-Landesjugendführung, unterzeichnet von Dr. Anton Karner, in die Hände, mit dem deutsche Jugendliche für die RDJ geworben werden sollten, um sie »in der grossen und schweren Zeit (…) aufs Engste mit der Heimat zu verbinden«.39 Eine interessante Werbeaktion führte Bieg selbst durch: Er organisierte Konzerte des Musischen Gymnasiums Frankfurt a. M. in verschiedenen Schweizer Städten. Obwohl sie als »absolut unpolitische, künstlerische Veranstaltungen« stattfinden sollten, vermerkten die überwachenden Personen immer wieder Versuche, deutsche Hoheitszeichen, den »deutschen Gruss« oder ähnliche Symbole zu zeigen.40 Bieg hatte offenbar auch direkte Kontakte mit der Bundesanwaltschaft. Dies geht aus einem Schreiben hervor, das er am 14. April 1943 an Bundesanwalt Dr. Dick richtete und in dem er seinen Antrag auf Titeländerung des »Führerdienstes« in »Führer- und Führerinnendienst« zurückzog. Dabei nahm er Bezug auf eine persönliche Unterredung zwei Tage zuvor. Nicht aufgegeben wurde auch die Praxis des jährlichen Sommerlagers. Vom 17. Juli bis 1. August 1943 sollten die Jugendlichen nach Tirol und Vorarlberg fahren. Bieg informierte die Führerinnen und Führer am 26. Juni 1943 anlässlich einer Tagung im Ferienhaus Ebnat über Einzelheiten. Das Lager solle nicht der Arbeit, sondern »rein der Erholung dienen«. Die Aktion werde rund 150’000 Franken kosten. Während der Ausreise aus der Schweiz sei es den Teilnehmern »untersagt zu singen, sich auf den Bahnhöfen auffällig aufzuführen oder Fahnen aus dem fahrenden Zug zu hängen.«41 Offensichtlich bemühte sich Bieg, für 37 Vgl. auch Bucher: Deutschlandkontakte, S. 143–145. 38 Das Ferienhaus befand sich auf dem Hof »Unter St. Romai«. Vgl. Orte der Erinnerung. Menschen und Schauplätze in der Grenzregion Basel 1933 bis 1945. Hg. von Heiko Haumann, Erik Petry, Julia Richers. Basel 2008, S. 68. 39 BAR, E 4320 (B) 1968/195, Bd. 33: C. 2. 51, Berichte vom 1.2., 18.3. und 22.3.1943, vgl. Bericht vom 20.4.1943 über Lauwil. – An der Vorstellung des Buches »Orte der Erinnerung« (vgl. Anm. 38) am 29.4.2008 berichtete ein älterer Herr, er habe damals in Basel gelebt. In seiner Schulklasse seien deutsche Schüler gewesen, darunter »stramme Hitlerjungen«, aber auch der klassenbeste, der eindeutig kein Nazi-Sympathisant gewesen sei. Dennoch habe dieser sich 1943 zur Wehrmacht gemeldet und sei 1944 gefallen. Möglicherweise ist dieser Schüler auch durch den Druck seitens der RDJ oder der NSAuslandsorganisation, er verrate sonst die Heimat, zu seinem Schritt veranlasst worden. 40 BAR, E 4320 (B) 1968/195, Bd. 33: C. 2. 51, Berichte seit 5.3.1943. Vom 15.10. bis 4.11.1943 organisierte Bieg Veranstaltungen der Rundfunkspielschar der HJ Wien, u. a. auch in Basel (Berichte vom 27.9., 25.10.1943 u. ö.). 41 Ebd., Bericht vom 28.6.1943. Bereits am 12.6.1943 hatte die Bundesanwaltschaft dem Eidgenössischen Politischen Departement Informationen über das geplante Sommerlager zugesandt. Vgl. DZS, 3.7.1943.
386
|
Heinrich Bieg
die Einhaltung der Vorschriften seitens der schweizerischen Behörden zu sorgen. Auch der Basler Standortführer Bergmann ordnete anlässlich eines »Standortappells« am 7. Juli 1943 unbedingte Zurückhaltung an. Aus Basel fuhren 136 Jugendliche mit, die Zürcher Kantonspolizei übersandte eine Sammelliste von 217 Jugendlichen unter der Führung von Heinrich Bieg.42 Besondere Aufmerksamkeit widmete Bieg dem Standort Basel. So nahm er am 22. September 1943 an einem dortigen »Standortappell« im Saal des »Deutschen Heims« in der St. Albanvorstadt 12 teil. Der bisherige Standortführer Bergmann übergab bei dieser Gelegenheit sein Amt an Robert Wagner, einen technischen Inspektor der Reichsdeutschen Bahn. Bieg stellte ihn vor und hob hervor, »dass Basel der beste Standort der Schweiz sei«.43 In Basel hatte die RDJ etwa 400 Mitglieder – gegenüber 130 um 1938 –, und sie trat hier ausgesprochen offensiv auf. Eine sozialdemokratische Initiative, »vorwiegend von Ausländern gebildete« nationalsozialistische, faschistische und frontistische Organisationen verbieten zu lassen, war 1938 zwar mit über 15’000 Unterschriften unterstützt worden, aber am Einspruch des Bundesrates gescheitert; das Bundesgericht hatte diesem am 23. Juni 1939 Recht gegeben.44 Daneben widmete sich Bieg wie gewohnt seinen Bemühungen, den Jugendlichen attraktive Angebote zu vermitteln. So soll er sich in Flums nach einer Skihütte umgesehen haben.45 Mehr und mehr ging es nun aber auch darum, das Vertrauen in die nationalsozialistische Führung trotz der für das Deutsche Reich zunehmend schlechter werdenden Kriegslage zu festigen. So berichtete die Politische Abteilung der Basler Polizei am 25. und 27. September 1943 über eine Arbeitstagung der Mä42 BAR, E 4320 (B) 1968/195, Bd. 33: C. 2. 51, Berichte vom 8.7., 12.7., 15.7., 17.7., 24.7.1943 u. ö. Im Detail gehe ich auf dieses Sommerlager nicht ein. Vgl. DZS, 7.8.1943. 43 BAR, E 4320 (B) 1968/195, Bd. 33: C. 2. 51, Bericht vom 23.9.1943. Vgl. Berichte vom 29.11.1943, 14.2.1944 (Filmvorführung von »Friedrich Schiller«), 29.4., 15.5.1944. Siehe auch DZS, 6.3.1943 (Standortführertagung in Basel). 44 Zu den Nationalsozialisten in Basel-Stadt und -Landschaft vgl. Bericht des Regierungsrates (RDJ-Mitgliederzahlen S. 50); Brassel-Moser: Schweizerhaus; Orte der Erinnerung, insbesondere S. 36, 46–47, 67–69, 74–75, 119–122, 145, 204; die beiden Angaben im Text S. 119 bzw. 122. 1942 war von den rund 8000 deutschen Staatsangehörigen, die in Basel wohnten, etwa die Hälfte Mitglied in einer der NS-Organisationen (Hahn: »Sauberer« als Bern, S. 48). Zur Ablehnung des Verbots von NS-Organisationen vgl. Hahn: »Sauberer« als Bern, 53–55; Documents Diplomatiques Suisses, S. 172–174 (Bericht des Politischen Departementes vom 12.6.1941). Rothmund zog ein Verbot in Betracht, wenn in Deutschland nicht gegen die Schweiz gerichtete Tätigkeiten untersagt würden (ebd., S. 859–869, Bericht vom Januar 1943 über seine Besprechungen in Berlin zwischen 12.10. und 6.11.1942, hier S. 865, dort und S. 868 auch zur Teilnahme von Gauleiter Bohle am Erntedankfest 1942 in Zürich: anscheinend hatte dieser sich günstig über die Schweiz geäussert). Vgl. Anm. 18 und 19. 45 BAR, E 4320 (B) 1968/195, Bd. 33: C. 2. 51, Bericht vom 13.9.1943 u. ö..
Ein deutscher Nazi in der Schweiz
|
387
delführerinnen im »Deutschen Haus«, bei der die ideologische Stärkung nach der Niederlage von Stalingrad im Vordergrund gestanden sei.46 Bieg selbst griff ein, als eine Anzahl deutscher Staatsbürger der Aufforderung des Deutschen Generalkonsulates in Zürich nicht nachkam, das Anmeldeblatt für die Wehrstammkontrolle auszufüllen und sich für die Musterung bereit zu halten. Am 29. September 1943 schrieb er dem Zürcher Standortführer Hans Schmidbauer, die betreffenden Personen »entweder persönlich, oder durch einen älteren zuverlässigen und befähigten HJ-Führer zu Hause aufsuchen zu lassen.« Jedem einzelnen müssten »die Pflichten, die er gegenüber seinem Vaterland hat, klargemacht werden«. Eine Teilnahme an der Musterung sei unverzichtbar. Bei der Gestaltung der Heimabende sollte im Übrigen, wie dem beigefügten »Führerdienst« für Oktober 1943 zu entnehmen ist, nicht nur das historische Recht Deutschlands auf den Osten thematisiert werden, sondern ganz zentral die Treue zum Deutschtum.47 Gleichzeitig versuchte Bieg, die Öffentlichkeitsarbeit der RDJ zu verstärken. Nachdem offenbar die Arbeit an einer Chronik der RDJ nicht besonders gut vorangekommen war,48 sollte nun jeder Standort einen Pressereferenten melden. Gedacht war zunächst an Berichte über die Werk- und Bastelarbeiten der Jugendlichen.49 Vermutlich sollte damit vermittelt werden, dass die Jugendarbeit normal weitergehe und man keineswegs wegen der Kriegslage ins Zweifeln geraten sei. Selbst 1944 gingen die Aktivitäten ungebrochen weiter. Immer häufiger stand nun die Treue zum Führer im Mittelpunkt der RDJ-Veranstaltungen.50 Der Durchhaltewillen musste gestärkt werden. Gleichzeitig ging die Schweizer Politik zunehmend gegen die nationalsozialistische Organisation vor. Am 3. März 1944 meldete das Justiz- und Polizeidepartement Graubünden der Bundesanwaltschaft ein Rundschreiben der RDJ-Mädelführerin Hilde Ganz-Bohnert über die Rückkehr der nach Deutschland zum Reichsarbeitsdienst eingerückten Mädels.51 Die Bundesanwaltschaft leitete dies weiter an Heinrich Rothmund, der am 3. April 46 Vgl. DZS, 16.10.1943 (Bieg war offenbar anwesend). 47 BAR, E 4320 (B) 1968/195, Bd. 33: C. 2. 51, Bericht vom 5.10.1943. Zu Schmidbauer vgl. auch Bericht vom 15.7. (neben Bieg Führer des Sommerlagers) und 13.11.1943 (Überwachung). Am 19.7.1944 meldete die »Telephon-Zensurstelle Bern« die Aufzeichnung eines Telefongespräches, das Bieg mit der Deutschen Gesandtschaft geführt hatte. Dabei ging es um einen deutschen Jugendlichen, der im Zweifel war, ob er noch einen Lehrvertrag abschliessen solle, obwohl er bald seinen Militärdienst ableisten müsse. 48 Vgl. ebd., Bericht vom 4.11.1942 mit beigefügtem Schreiben vom 11.3.1942. 49 Ebd., Rundschreiben des Presseleiters der Landesjugendführung, Dr. Hans Horn, vom 30. Oktober 1943, Bericht vom 2.11.1943. Vgl. DZS, 13.11. und 11.12.1943 sowie 6.5.1944. 50 BAR, E 4320 (B) 1968/195, Bd. 33: C. 2. 51, z. B. Berichte vom 27.3.1944 (mehrfach), u. a. mit einem Referat Biegs dazu. Vgl. DZS, 1.4.1944, 30.9.1944 u. ö. 51 Kurzbiographie (Hilde Bohnert) in: Buddrus: Totale Erziehung II, S. 1125.
388
|
Heinrich Bieg
dafür eintrat, in Zukunft bei ähnlichen Fällen die Rückkehr zu verweigern. Die Bundesanwaltschaft plädierte dann am 12. April 1944 dafür, jeden Einzelfall zu prüfen. Diese Frage wurde aktuell, als im August erneut ein Ferienlager in Freiburg i. Br. organisiert werden sollte. Am 20. Juli 1944 übersandte die Eidgenössische Fremdenpolizei der Bundesanwaltschaft eine Liste der RDJ-Jugendlichen, die nach Freiburg fahren und auch wieder zurückkommen wollten. Schliesslich beteiligten sich etwa 400 Jungen am Sommerlager im Schwarzwald und 200 Mädchen an einem Lager im Elsass.52 Aufschlussreich für das Verhalten Biegs ist in diesem Zusammenhang ein Konflikt über die Rekrutierung der Jugendlichen. Am 26. Juli 1944 bat eine deutsche Staatsangehörige, die in der Schweiz wohnte, telefonisch die Zürcher Polizei, ihren Sohn Peter in Zürich aus dem Zug zu holen. Er befinde sich – so der Polizeibericht – »ohne ihre Einwilligung auf der Fahrt nach einem Ferienlager in Freiburg i. Br.«. Nach Rücksprache mit der Bundesanwaltschaft wurde denn auch der dreizehnjährige Junge im Zürcher Bahnhof zurückgehalten. Was war hier geschehen? Peter war seit etwa zwei Jahren Schüler im Lyceum »Alpinum« in Zuoz. Von den rund 70 Schülern waren 40 bis 45 deutscher Nationalität. Schon im Vorjahr hatten alle Schüler auf Anordnung des Schulleiters ein Ferienlager in Deutschland besuchen müssen. Peters Eltern hatten sich beschwert, und es war vereinbart worden, dass 1944 eine einvernehmliche Regelung getroffen werde. Trotzdem wurde der Besuch des Ferienlagers wieder zur Pflicht gemacht, und die Eltern hörten erst kurz vor der Abfahrt davon. Nicht nur Peter, sondern auch weitere Jugendliche wurden von ihren Eltern oder Vertrauenspersonen aus dem Zug geholt. Der Nachrichtendienst der Zürcher Kantonspolizei hatte erfahren, dass sich die Schulleitung diesmal gegen die Teilnahme am Ferienlager gesträubt habe, doch der Landesjugendführer Heinrich Bieg habe sie dann doch dazu gezwungen. Er habe auch den Transport von Zuoz über Basel nach Freiburg begleitet und als Lagerleiter geamtet.53 Leider erfahren wir nicht, ob die Eltern in irgendeiner Weise etwas gegen Bieg unternahmen. Jedenfalls zeigt der Vorfall, dass Bieg rücksichtslos vorging, wenn er die Geschlossenheit der »deutschen Kolonie« demonstrieren und zugleich die deutschen Jugendlichen in der Schweiz für die Interessen des Nationalsozialismus gewinnen wollte. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges hatten Bieg und die RDJ einen erstaunlichen Handlungsspielraum. Dies hing damit zusammen, dass die Schweizer Regierung aufgrund ihrer Neutralitätsvorstellung, lange Zeit aber auch aufgrund der 52 Eine Reaktion der Bundesanwaltschaft ist im Dossier nicht enthalten. Vgl. DZS, 17.6., 1.7., 5.8. und 12.8.1944; Bucher: Deutschlandkontakte, S. 142–143. – Weitere Berichte zu Bieg in der DZS: 13.12.1941, 16.10.1943, 29.1., 11.3., 10.6., 24.6., 25.11.1944. 53 BAR, E 4320 (B) 1968/195, Bd. 33: C. 2. 51, Bericht vom 4.8.1944.
Ein deutscher Nazi in der Schweiz
|
389
Kriegslage die Führung des Deutschen Reiches nicht verärgern wollte. Darüber hinaus zeigt sich in den Berichten der Polizeibehörden wie den Stellungnahmen höchster Instanzen, dass es Sympathien gab für die attraktiven Jugendveranstaltungen, für sportliche und wehrhafte Ertüchtigung, für Autorität, Disziplin und Ordnung, wie sie die RDJ-Jugendlichen demonstrierten. In den konservativen Auslegungen der »Geistigen Landesverteidigung« war eine derartige Sympathie bereits vor dem Krieg deutlich gewesen.54 Am 1. Mai 1945 entschloss sich der Bundesrat endlich, die NSDAP-Landesgruppe Schweiz und die ihr angeschlossenen Organisationen aufzulösen. Es folgten Durchsuchungs- und Fahndungsaktionen sowie eine gross angelegte »politische Säuberung«. Diese führte bis Ende 1946 zur Ausweisung von 3307 Deutschen.55 Unter den Ausgewiesenen befand sich auch Heinrich Bieg. Damit hat unsere Geschichte begonnen. Werfen wir noch einen Blick auf sein Schicksal, wie es sich aus Schweizer Sicht darstellte. Das von Bieg geführte Konto der Reichsdeutschen Jugend wurde gesperrt und beschlagnahmt.56 Es betrug bei der Schweizerischen Bankgesellschaft in Bern 14’110.- Fr. und bei der Post 120.45 Fr. Das Geld wurde am 14. Juli 1945 an das Eidgenössische Kassen- und Rechnungswesen überwiesen und seit 25. Februar 1947 treuhänderisch von den Deutschen Interessenvertretungen verwaltet.57 Nach einer Aktennotiz vom 12. Mai 1945 waren bei einer Durchsicht der Effekten im Heim der Deutschen, Thunstr. 5 in Bern, tausende von Achselklappen sowie weitere Uniformstücke gefunden worden, über die Bieg habe verfügen können. »Zweifellos hätte die Reichsdeutsche Jugend in der Schweiz bei einem Ueberfall eine führende Rolle zu spielen gehabt unter der Leitung des Bieg.« Diese Furcht vor der deutschen »Fünften Kolonne« schimmert immer wieder durch.58 Daraufhin fand am 15. Mai 1945 die erwähnte Hausdurchsuchung 54 Josef Mooser: Die »Geistige Landesverteidigung« in den 1930er Jahren. Profile und Kontexte eines vielschichtigen Phänomens der schweizerischen politischen Kultur in der Zwischenkriegszeit. In: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 47 (1997) H. 4, S. 685–708. Mit verschiedenen Aspekten des Verhältnisses der Schweiz zum Nationalsozialismus und zum »Dritten Reich« hat sich immer wieder Georg Kreis auseinandergesetzt und dabei auch den jeweiligen Forschungsstand reflektiert. Deshalb weise ich hier exemplarisch auf einen Band hin, in dem er einen grossen Teil seiner einschlägigen Beiträge zusammengestellt hat: Georg Kreis: Vorgeschichten zur Gegenwart. Ausgewählte Aufsätze. Bd. 2. Basel 2004. 55 Hahn: »Sauberer« als Bern, S. 55–58 (mit weiteren Literaturhinweisen). 56 Die folgenden Informationen, wenn nicht anders vermerkt, wieder nach: BAR, E 4320 (B) 1973/17, Bd. 6: C. 2. 7263. 57 Vgl. ebd., Vorgang vom 15.2. und 24.2.1949; über Rechnungen gibt es auch sonst noch einige Vorgänge. 58 Mit dem Begriff »Fünfte Kolonne« werden heimlich tätige Gruppen innerhalb eines Landes bezeichnet, die einer feindlichen Macht dienen und damit gegen das eigene Land
390
|
Heinrich Bieg
bei Bieg statt.59 Belastendes Material wurde nicht gefunden. Die Beamten stellten verschiedene Ausweise, Tätigkeitsbescheinigungen, Ehrenzeichen und Schriften von Heinrich und Hildegard Bieg sicher. Diese Gegenstände wurden am 5. September 1958 vernichtet.60 In seiner »Abhörung« am 15. Mai 1945 schilderte Bieg seinen Lebenslauf. Er verdiente zuletzt inclusive Zulagen monatlich 2050.– Fr. und hatte 15’500.– Fr. gespart. Alle Akten habe er einstampfen oder verbrennen lassen. Gegen die Gesetze der Schweiz habe er sich nicht vergangen. Eine »wehrsportliche Ausbildung« habe er ebenso verboten wie »die Marschübungen, das Singen in Ortschaften und Städten«. Die Achselstücke und anderen Fundstücke seien allen Auslandsorganisationen der HJ zugegangen. Da in der Schweiz das Tragen von NS-Uniformen verboten gewesen sei, habe er sie nicht verwenden können und deshalb eingelagert. Er bestritt, mit Schweizer Nazis in Verbindung gestanden zu sein, mit Schweizern habe er nur geschäftliche Kontakte gehabt. Illegale politische Aktionen habe er nicht begangen. Am 5. Juni 1945 wurde Heinrich Bieg der Ausweisungsbeschluss des Bundesrates vom 29. Mai 1945 eröffnet. In der Begründung heisst es: »Fanatischer Nazi, hatte Sondervollmachten aus Berlin. Durch die gefundenen Uniformteile musste er als der Organisator und Betreuer der sogenannten 5. Kolonne angesehen werden.«61 In seinem Asylgesuch vom 6. Juni 1945 für seine Frau und seine beiden Kinder, das er nach der Verkündung des Ausweisungsbeschlusses stellte, wies Bieg darauf hin, dass er seine Arbeit korrekt geleistet und die ihm unterstellte Jugend »zur Dankbarkeit gegenüber dem Gastland« erzogen habe. Konkret erinnerte er daran, dass er sich im Sommer 1942 im Zusammenhang mit dem Lager in Freiburg i. Br. für das schweizerische Anliegen eingesetzt habe, die deutsche Seite möge eine grössere Anzahl auslandschweizerischer Jugendlicher in die Schweiz einreisen lassen. Auch habe er immer der Neuen Helvetischen Gesellschaft geholfen.62 Diese Argumentation konnte seine Ausweisung, die zunächst auf den 30. Juni, dann auf den 10. Juli
59 60 61
62
handeln. Der Ausdruck selbst hat verschiedene Ursprünge. Der bekannteste kommt aus dem Spanischen Bürgerkrieg (1936–1939): Die Faschisten marschierten in vier Kolonnen auf Madrid zu, in der Stadt sollten ihre Anhänger zur Unterstützung der Eroberung die »Fünfte Kolonne« bilden. BAR, E 4320 (B) 1973/17, Bd. 6: C. 2. 7263, Rapport der Sicherheits- und Kriminalpolizei Bern vom 17.5.1945. Mitteilung des Schweizerischen Bundesarchivs Bern vom 25.2.1998 (Dr. D. Bourgeois, H. von Rütte, Zeichen: 451–5930 Re). Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend die antidemokratischen Umtriebe (Motion Boerlin). Ergänzungen zum Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung vom 28. Dezember 1945 und 17. Mai 1946, I. und II. Teil. Vom 25. Juli 1946. Bundesblatt, 98. Jg. Bd. II. Auch diesen Hinweis verdanke ich Martin J. Bucher. Die Neue Helvetische Gesellschaft wurde 1914 gegründet und zielte auf eine Erneuerung sowie auf den Zusammenhalt der Eidgenossenschaft. Zum 1.1.2007 fusionierte sie mit
Ein deutscher Nazi in der Schweiz
|
391
1945 festgesetzt wurde, nicht verhindern. Aber immerhin wurde die Ausreisefrist für seine Familie erstreckt. Die Familie hatte sich zuletzt im Gasthaus »zur Linden«, Eriz bei Steffisburg, aufgehalten. Wie aus verschiedenen Schreiben hervorgeht, wurde Frau Bieg mit ihren Kindern zunächst in Weesen SG (Flüchtlingsheim »Bellevue-Speer«), dann in Churwalden/Graubünden (Heim »Lindenhof«, später »Krone«) interniert. Da der Sohn Hans an Ruhr erkrankte, wurde er im Kinderheim »Solreal« in Amden SG untergebracht. Am 20. März 1947 reiste Frau Bieg über Riehen und Lörrach aus; dabei hatte sie offenbar grössere Schwierigkeiten mit den Franzosen.63 Die Kinder kamen am 21. Juni 1947 nach.64 Heinrich Bieg war unmittelbar nach seiner Ausreise von den französischen Besatzungsbehörden verhaftet und in das Internierungslager an der Idingerstrasse in Freiburg i. Br. eingeliefert worden. Am 25. Juni 1946 hatte Frau Bieg Fürsprecher Dr. Amstein bei der Bundesanwaltschaft mitgeteilt, dass sie nach langer Zeit wieder Nachricht von ihrem Mann habe, der noch im Freiburger Lager sei. Sie bat um eine Bestätigung, dass er »mit Zurückhaltung und großer Besonnenheit seine Tätigkeit hier in der Schweiz ausgeübt hat«. Diese Bestätigung wurde offenbar nicht erteilt. Für Heinrich Bieg hatten Unterlagen über seine Aktivitäten zwischen 1933 und 1945 eine hohe Bedeutung, denn als Funktionsträger des Nazi-Regimes musste er im Entnazifizierungsverfahren mit einer Bestrafung rechnen. Die französische Besatzungsmacht war zunächst von einem eigenen Modell der »auto-épuration« ausgegangen, nach dem differenzierter als die schematischen Untersuchungen in der britischen und der US-amerikanischen Besatzungszone jeder Einzelfall geprüft werden sollte. Die Internierten wurden davon vorerst weitgehend ausgenommen, weil man annahm, dass sie möglicherweise in Prozessen wegen Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit abgeurteilt werden würden. 1947 mussten die Franzosen dann das Verfahren, so wie es in den beiden anderen Westzonen gehandhabt wurde, übernehmen, das von sogenannten Spruchkammern durchgeführt wurde. Hauptsächlich beschäftigten diese sich mit dem Revisionsbegehren von bereits Verurteilten. Wegen Überlastung der Instanzen konnte allerdings von einem sorgfältigen und gründlichen Vorgehen keine Rede sein. Veränderte politische Rahmenbedingungen, namentlich der einsetzende Kalte Krieg, kamen hinzu, so dass die Spruchkammern ausgesprochen nachsichtig urteilten: Bis 1950 wurden in 187’639 Entnazifizierungs-
Rencontres Suisses – Treffpunkt Schweiz zur Neuen Helvetischen Gesellschaft – Treffpunkt Schweiz. 63 BAR, E 4320 (B) 1973/17, Bd. 6: C. 2. 7263, Aktennotiz vom 23.3.47. 64 Ebd., die Vorgänge sind ausführlich dokumentiert, überhaupt bildet dieser Teil den umfangreichsten in der Akte.
392
|
Heinrich Bieg
verfahren der ersten Phase und 3’863 Neufällen lediglich 351 Personen schuldig gesprochen.65 Ende 1948 erhielt Bieg die Vorladung vor die Spruchkammer. Jedenfalls wandte sich Frau Bieg am 9. November 1948 aus Offenburg, wo sie jetzt wohnte, wieder an Fürsprecher Amstein. »Mein Mann ist noch der einzige, der aus der Schweiz ausgewiesen wurde und heute noch interniert ist.« Sie bat um ein Schreiben an Gouverneur Pierre Pène (1898–1972) und an sie für die Spruchkammerakten, dass sich ihr Mann einwandfrei verhalten habe. Sie lebe mit ihren Kindern in vollkommenem Elend, deshalb möge er ihrer Bitte nachkommen, damit ihr Mann endlich freikomme. Am 18. November 1948 wiederholte sie die Bitte, da ihr Mann »diese Woche den Termin für die Spruchkammer bekommen hat«. Dieser Brief überschnitt sich jedoch mit dem Schreiben Amsteins vom 19. November 1948, in dem er bestätigte, dass Heinrich Bieg als Landesjugendführer der Reichsdeutschen Jugend in der Schweiz und als Mitglied der NSDAP ausgewiesen worden sei. Zum Verhalten nahm er nicht Stellung. Frau Bieg bat dann am 24. November 1948 um die Ergänzung, dass die Ausweisung »im Zuge der allgemeinen Ausweisung deutscher Staatsangehörigen [sic!]« vorgenommen worden sei, da die Franzosen sonst dächten, es habe ein persönliches Vergehen vorgelegen. Am 26. November finde der erste Termin vor dem Untersuchungsausschuss der Spruchkammer statt, rund acht Tage später der zweite. Aus den Akten geht nicht hervor, ob der Zusatz gewährt wurde und wie Biegs Verfahren weiterlief.66 Wir wissen nur, dass er als Koch für die französische Lagerverwaltung arbeitete, 1949 freigelassen wurde, dann in der Firma seines Schwiegervaters arbeitete und 1987 starb.67 Im Schweizer Dossier findet sich ein weiterer Vorgang aus dem Jahr 1954. Der Tochter Heidi wurde erlaubt, in den Ferien zu der Familie in Ruswil zu fahren, bei der sie 1947 zwischen der Ausreise der Mutter und ihrer eigenen gewohnt hatte. Auch Frau Bieg wurde zum Hinbringen und Abholen die Einreise gestattet – sie nahm dies nicht in Anspruch –, nicht aber Herrn Bieg. Am 14. April 1959 erhielten schließlich Herr und Frau Bieg eine Aufenthaltserlaubnis für drei Tage, um die Basler Mustermesse besuchen zu können. Die Einschätzung, welcher Stellenwert einer Betätigung im Interesse des Nationalsozialismus für eine
65 Reinhard Grohnert: Die Entnazifizierung in Baden 1945–1949. Konzeptionen und Praxis der »Epuration« am Beispiel eines Landes der französischen Besatzungszone. Stuttgart 1991, zu den Zahlen S. 208–210, zum Freiburger Internierungslager S. 162–171. 66 Da die Personenakten im französischen Besatzungsarchiv in Colmar (Archives de l’Occupation Française en Allemagne et en Autriche) für hundert Jahre nach ihrer Schliessung gesperrt sind, können wir derzeit auch aus Biegs dortigem Dossier nichts erfahren. 67 Hainmüller: Fehde, S. 141–142.
Ein deutscher Nazi in der Schweiz
|
393
Einreise in die Schweiz zukomme, hatte sich offenbar geändert.68 Damit endet das Dossier zu Heinrich Bieg.69 Das Schicksal dieses Deutschen in der Schweiz wirft ein Licht nicht nur auf die Organisation und Resonanz der hier wirkenden Nationalsozialisten, sondern auch auf die Ansichten und das Verhalten schweizerischer Behörden.
68 Auch der ehemalige Standortführer der RDJ in Bern, dann in Zürich, Franz Bobinger, war 1945 ausgewiesen worden und erhielt lange Zeit keine Einreisebewilligung. Wie bei Bieg änderten die Schweizer Behörden ebenfalls 1959 ihre Meinung. Hatte zuvor seine nationalsozialistische Funktion immer als Ablehnungsgrund gedient, hiess es nun am 7.9.1959: »Seine Tätigkeit als Führer des Standorts 7 der Hitler-Jugend in Zürich [sic!] hatte keinen bedeutenden Charakter.« Zwischen der Firma in Schwenningen, die Franz Bobinger als Prokurist beschäftigte – Inhaber war sein Schwiegervater –, und dem Unternehmen, das Heinrich Bieg als Geschäftsführer leitete, bestanden im Übrigen gute Verbindungen. Vgl. BAR, E 4320 (B) 1973/17, Bd. 56: C. 2. 13440. Über die Tätigkeit Bobingers finden sich auch Unterlagen in dem Dossier zu nationalsozialistischen Jugendbewegungen in der Schweiz. Über Bobingers Funktionen als Standortführer in Bern und Zürich berichtet weiterhin Bieg in seiner »Abhörung« am 15.5.1945. Zur geschäftlichen Verbindung zwischen Bieg und Bobinger nach 1945: Schriftliche Mitteilungen von Bernd Hainmüller, 21.7.1998, 10.11.2001. Das Verhalten der Schweizer Behörden zur Aufnahme ehemaliger Nationalsozialisten war keineswegs konsequent; vgl. Luc van Dongen: Un purgatoire très discret. La transition »helvétique« d’anciens nazis, fascistes et collaborateurs après 1945. Paris 2008. 69 Das Dossier zu nationalsozialistischen Jugendbewegungen in der Schweiz hatte mit einem Zeitungsausschnitt aus dem »Vorwärts« vom 15. Dezember 1950 geschlossen. Unter der Überschrift »Was in Westdeutschland wieder möglich ist« wird eine Reportage der »Süddeutschen Zeitung« über den neuen »Reichsjugendführer« Herbert Münchow zitiert, der mit seinen Anhängerinnen und Anhängern immer noch der alten Zeit anhänge: BAR, E 4320 (B) 1968/195, Bd. 33: C. 2. 51. Münchow hatte im Januar 1950 zusammen mit Walter Matthaei in Flensburg die »Reichsjugend« als Jugendorganisation der »Sozialistischen Reichspartei« (SRP) gegründet. Als 1952 die SRP – und mit ihr die Reichsjugend als Nachfolgeorganisation der HJ – vom Bundesverfassungsgericht verboten wurde, schloss sich die Reichsjugend mit der Deutschen Unitarier-Jugend und dem Vaterländischen Jugendbund zur Wiking-Jugend zusammen. Vgl. http://moral-sense.de/cgi-bin/glossar. pl?id=19 (8.4.2008). Die »Wiking-Jugend« wurde 1994 vom Bundesminister des Innern »wegen ihrer Wesensverwandtschaft mit der NSDAP und der Hitler-Jugend« verboten. Als neo-nationalsozialistische Nachfolgeorganisation, die heute noch aktiv ist, gilt die »Heimattreue Deutsche Jugend (HDJ) – Bund zum Schutz für Umwelt, Mitwelt und Heimat e.V.«. Vgl. Anton Maegerle, Andrea Röpke: Die »Heimattreue Deutsche Jugend«. Ein Neonazi-Jugendverband. In: Tribüne. Zeitschrift zum Verständnis des Judentums 47 (2008) H. 185, S. 105–113. Ende März 2009 wurde auch diese Organisation als verfassungsfeindlich verboten (Basler Zeitung, 1.4.2009).
»Die Gegend wimmelt dort von Wilddieben« Ein Förstermord 1891 im Wittgensteinischen* Für Josef Mooser Noch heute erinnere ich mich daran, dass ich als Kind bei meinen Besuchen in Dotzlar, einem kleinen Dorf im Wittgensteinischen, zusammen mit meiner Oma Laura Böhl, geborene Imhof (1884–1980), am Waldrand mehrfach vor einem kleinen Denkmal gestanden habe, das ihrem Großvater Friedrich Kroh gewidmet war: Hier war er am 12. Oktober 1891 als Förster von einem Wilderer ermordet worden. Ich besaß ein Foto von ihm, das damals in meinem Zimmer an der Wand hing. So hatte ich mir einen Förster vorgestellt: stattlich, mit einem Vollbart, und so ein Förster wollte ich einmal werden. Von Verwandten, bei denen der Mord immer wieder ein Thema war, erhielt ich alte Ausgaben der Zeitschrift »Wild und Hund«, die in der Rubrik »Jagdschutz« stets Geschichten über Wilddiebe und über deren Bekämpfung brachten.1 Mit Spannung und leichtem Gruseln las ich das Buch »Wilddieberei und Förstermorde«.2 * Bislang unpubliziert. Eine leicht veränderte Fassung wird in den »Siegener Beiträgen« erscheinen. 1 Z. B. Quercus: Zusammenstoß mit einem Wilddieb. In: Wild und Hund 8 (1902) 46 (hier wird auch der Förstermord erwähnt, der Gegenstand dieses Aufsatzes ist); Harras: Wilddieb erschossen. Ebd., 109; Aus Oesterreich. Ebd., 174–175; F. Liebermann von Sonnenberg: »Nette Aussichten«. Ebd., 235–236; Vom Harze. Ebd., 316–317; Mech.: Wilddiebsgeschichten von der Saar. Ebd., 382; Litauische Wilddiebe (u. a.). Ebd., 476–478; Laufer: Unsere Wilderer. In: Wild und Hund 9 (1903) 255–256; Hans Joachim: Dumm oder frech? Ebd., 286–287; Selbsthilfe gegen Schlingensteller (u. a.). Ebd., 348–350; Sauerländer: Ueber die Ermordung des Kgl. Försters Keller. Ebd., 414; Alberti: Fiat justitia! Ebd., 811; Von Wilddieben ermordet (u. a.). Ebd., 828–830; vgl. auch den Leitartikel von Karl Baltz: Die Förstermorde. Ebd., 353–355. Ebenso ist in den fiktiven Geschichten »Für’s Jägerhaus« immer wieder von der Wilddieberei die Rede, z. B. M. v. Gosen: Der Wilddieb. In: Wild und Hund 8 (1902) 592. Es würde sich lohnen, all diese und weitere Beiträge einmal systematisch sozialgeschichtlich auszuwerten. – Schon lange wollte ich dem Mord sowie seinen lebensweltlichen und sozialgeschichtlichen Zusammenhängen nachgehen. 2003 konnte ich während eines Forschungssemesters die einschlägigen Archivrecherchen durchführen, doch erst nach meiner Emeritierung 2010 fand ich die Zeit, mit der Arbeit an diesem Aufsatz zu beginnen. Für wichtige Unterstützung und kritische Lektüre danke ich Anna K. Liesch, Martin Schaffner und Erika Sommer. 2 Otto Busdorf: Wilddieberei und Förstermorde. München 1962 (gefolgt von weiteren Ausgaben). Busdorf (1878–1957) war Kriminaldirektor. Eine erste Fassung seiner Sammlung erschien unter demselben Titel in Berlin 1928 (Band 1 und 2) sowie in Melsungen 1931 (Band 3).
Ein Förstermord 1891 im Wittgensteinischen
|
395
Wilderer in der Sozialgeschichte
Doch diese Erzählungen lassen sich nicht nur als oft dramatische und tragische Abenteuer lesen. Sie sind auch für die Geschichte der Lebenswelten von großer Bedeutung. So hat Norbert Schindler mit seinen Wilderer-Geschichten aus dem Erzbistum Salzburg gezeigt, wie die Wilddieberei und Jagdleidenschaft vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Verhältnisse gedeutet werden kann. Gewiss spielten oft Armut und die Möglichkeit, durch den Verzehr und den Verkauf des Wildbrets die Lebensbedingungen ein wenig zu verbessern, eine wichtige Rolle. Hinzu trat vielfach die Wut über die Einschränkungen herkömmlicher Nutzungsrechte im Wald seitens der Obrigkeit, die Fortsetzung einer bäuerlichen Protesttradition, bei der es auch um die Herrschaft über den Raum ging. Weiter waren persönliche Demütigungen von Bedeutung, die man nicht zuletzt aufgrund der aristokratischen Ordnung erlitten hatte. Wilderer sind hier auch als Sozialrebellen zu verstehen, verbunden mit der Notwendigkeit, das eigene Überleben zu sichern. Zum Netzwerk der Wilddiebe gehörten schließlich diejenigen Personen, die sich daran bereichern konnten, selbst wenn sie nicht unmittelbar dem Jagdfrevel frönten: Hehler, Metzger und Wirte.3 Mit der Revolution von 1848 entfiel das ausschließliche Vorrecht des Adels und anderer privilegierter Schichten, ihrer Beauftragten und Gäste, die Jagd auszuüben. Sie war nun frei. Bauernjäger nutzten die Gelegenheit, um zum Schutz ihrer Felder die Zahl des Wildes zu vermindern. Doch schon bald begann sich das 3 Norbert Schindler: Wilderer im Zeitalter der Französischen Revolution. Ein Kapitel alpiner Sozialgeschichte. München 2001; ders.: Mehrdeutige Schüsse. Zur Mikrogeschichte der bayerisch-salzburgischen Grenze im 18. Jahrhundert. In: Salzburg Archiv 23 (1997) 99–132; ders.: Ein archaisches Duell und nie versiegende Leidenschaften. Wilderei, Salinenholzwirtschaft und staatsbeamtische Doppelloyalität im Erzstift Salzburg in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. In: Historische Anthropologie 12 (2004) 35–77; ders.: Bäuerliche Heldensagen und ihr Gegenteil: Zur Alltagsgeschichte der Wilderei im Salzburger Land im 18. Jahrhundert. In: Alltag, Erfahrung, Eigensinn. Historisch-anthropologische Erkundungen. Hg. von Belinda Davis u. a. Frankfurt a. M., New York 2008, 150–168. Dass es auch »Passionswilderer« aus besseren Kreisen gab (Schindler: Duell, 74), kann hier außer Betracht bleiben. Zu Wilderern als Sozialrebellen vgl. Eric Hobsbawm: Die Banditen. Räuber als Sozialrebellen. München 2007, 183; Karsten Küther: Räuber und Gauner in Deutschland. Das organisierte Bandenwesen im 18. und frühen 19. Jahrhundert. Göttingen 1976, 106–107, 115–116, 119; Regina Schulte: Das Dorf im Verhör. Brandstifter, Kindsmörderinnen und Wilderer vor den Schranken des bürgerlichen Gerichts. Oberbayern 1848–1910. Reinbek 1989, 251–256 (alle am Beispiel von Matthäus Klostermaier [1736–1771] – dem »bayerischen Hiasl« – und seiner Bande um 1770). Allgemein auch Werner Rösener: Die Geschichte der Jagd. Kultur, Gesellschaft und Jagdwesen im Wandel der Zeit. Düsseldorf, Zürich 2004, 322–347 (unter Auswertung nicht zuletzt der zuvor genannten Arbeiten).
396
|
»Die Gegend wimmelt dort von Wilddieben«
wieder zu ändern. Ganz im Sinne der bürgerlichen Ordnung musste man nun für das Jagdrecht bezahlen. Es war gebunden an das Eigentum eines Jagdgebietes, an die Pacht eines Reviers oder an den Kauf eines Erlaubnisscheines. Damit entwickelte sich die Ausübung der Jagd zu einem Zeichen für die »feinen Unterschiede« (Pierre Bourdieu) in den sozialen Beziehungen. Das wurde von vielen Landbewohnern nicht hingenommen. Nach ihrem althergebrachten Rechtsverständnis waren Wald und Wild frei, gehörten allen. So fuhren sie denn fort zu wildern oder die Wilderer als Teil ihrer ländlich-bäuerlichen Kultur zu verstehen und damit auch gegenüber der Obrigkeit zu decken. Oft wehrten sie sich auf diese Weise gegen den Schaden, den das Wild auf ihren Feldern anrichtete und den die Jagdausübungsberechtigten nicht verhinderten.4 Regina Schulte zeigt besonders eindringlich am Miesbacher »Jagdfest« von 1848 dieses Verständnis des Wilderns als Ausdruck traditionellen Rechtsgefühls. Der Miesbacher Landrichter schrieb am 26. Mai 1848 der bayerischen Regierung, das Wildern sei »dem hiesigen Volk obendieß angeboren«. Die wachsende Zahl von Toten im Kampf zwischen Wilderern und Jägern zwischen 1823 und 1846 im Miesbacher Gerichtsbezirk deutet auf die zunehmende Konflikthaftigkeit in den Sozialbeziehungen zwischen Dorf und Herrschaft hin.5 Abgesehen von diesen Motiven handelten Wilderer nach wie vor aus materieller Not oder im Rahmen eines kriminellen Netzwerkes der Bereicherung. Manchmal wollten sie sich in ihrer Passion auch nicht den Einschränkungen fügen, die in den Gesetzen zum Schutz des Wildes – etwa durch Schonzeiten – vorgeschrieben waren. Ebenso ist festzustellen, dass Wildern häufig ein Initiationsritual für die Entwicklung der Männlichkeit war. Vor allem in den Alpen, wo das Jagen vielfach als Teil des Freiheitsbewusstseins angesehen wurde, gehörte das Wildern »zu den heimlichen Mannbarkeitsriten des Dorfes«, mit denen die ledigen Burschen zugleich die Obrigkeit provozierten.6 Allmählich wandelte sich nun aber 4 Schulte: Dorf, hier bes. 182, 185–186, 259, 267–269, 272–274, 284; zum Motiv, den Wildschaden zu verhindern: 261. Vgl. Kurt G. Blüchel (Hg.): Die Jagd. Königswinter 2004, hier vor allem 143–161; Rösener: Geschichte der Jagd, 348–371, bes. 362–371; Klaus Friedrich Maylein: Die Jagd. Funktion und Raum. Ursachen, Prozesse und Wirkungen funktionalen Wandels der Jagd. Diss. Univ. Konstanz 2005 (http://nbn-resolving. de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-17698 [17.6.2011], etwa 461, 466–481, 486–503, 578–588, zur Wilderei (u. a. als gegenkulturelle Raumkonstruktion) 372–381. 5 Schulte: Dorf, 257–274, Zitat 266, Statistik der Todesfälle 258. 6 Schulte: Dorf, 273, ausführlich 210–244, dabei auch zum Ausdruck des Wilderns als Teil der dörflichen Geschlechterbeziehungen in den Wildschützenliedern. Vgl. zur »Rebellenkultur« des Wilderns, zu dessen Ursachen und Ausprägungen, zu zahlreichen Fällen und zum Mythos Roland Girtler: Wilderer. Rebellen in den Bergen. 2. Aufl. Wien usw. 1998. Siehe auch den Katalog zur Ausstellung im Tiroler Landesmuseum, an dem Girtler mitgewirkt hat: Wilderer. Hg. von Wolfgang Meighörner. Innsbruck 2008. Ludwig Thoma (1867–1921), dessen Vater Förster in Oberbayern war, schildert in seiner kurzen Erzählung
Ein Förstermord 1891 im Wittgensteinischen
|
397
doch das Bild des Wilderers. Zwar wurde, parallel zur Romantisierung der Alpen und des Älplers, der Wildschütz bis ins 20. Jahrhundert hinein in literarischen Werken und Filmen als stolzer, freiheitsbewusster, in der majestätischen Bergeinsamkeit dem edlen Wild nachspürender Mann idyllisiert. In der Öffentlichkeit hingegen verfolgte man hier wie auch andernorts, in den Mittelgebirgen oder im Flachland, den Kampf zwischen Jägern und Wilderern eher als fast sportliches Abenteuer. Die Wilddieberei galt als Kavaliersdelikt, und auch die Strafpraxis orientierte sich – anders als früher – an dieser Bewertung. Hin und wieder machte man sich die Kenntnisse und Fähigkeiten der Wilddiebe zu nutze. Es hieß, »nur ein guter Wilderer werde auch ein guter Wildhüter«. Gab dieser dann jedoch aus irgendeinem Grund seine Stelle wieder auf, konnte er oft doch nicht von seiner Leidenschaft lassen. Da er zuvor seine ehemaligen Gesellen hatte bekämpfen müssen, war sein früheres Netzwerk nun zerrissen und er stand allein.7 Nach wie vor konnte Auflehnung gegen die Herrschaft ein Motiv sein. Soziale Konflikte boten weiterhin Zündstoff. Das Wildern als Gewerbe, das mehr und mehr um sich griff, wurde allerdings kaum noch als Teil der bäuerlichen Kultur betrachtet. Das war keine »ehrbare« Wilderei. Dadurch verlor der Wilderer zusehends sein Kennzeichen als Sozialrebell.8 Vielfach spiegelten sich im Wildern auch Konflikte und Hierarchisierungen im Dorf selber, zwischen Bauern, Knechten und Tagelöhnern.9 Nicht zuletzt schenkten nun, anders als im 18. Jahrhundert, zumindest Teile der Bevölkerung der Erschießung eines Wildhüters oder Försters nicht mehr als Zeichen antiobrigkeitlicher Auflehnung eine gewisse Sympathie, sondern verurteilten sie als verbrecherischen Mord. Michael Blatter legt dies am Beispiel der Ermordung zweier Wildhüter – Vater und Sohn – 1899 auf der Gruobialp an der Grenze der beiden Schweizer Kantone Ob- und Nidwalden durch einen Wilderer eindrucksvoll dar. Der Mörder konnte sich als Wilddieb zwar auf eine Gruppe Gleichgesinnter stützen, und für ihn selbst stand vermutlich das Motiv, sich ei»Der Wilderer« (in: ders.: Ausgewählte Werke in einem Band. München 1966, 96–101) die pfiffige Überlegenheit des Wilderers gegenüber dem Jagdaufseher und den Gendarmen. Das kriminelle Bandenwesen von Wilddieben thematisiert Marie von Ebner-Eschenbach (1830–1916) in ihrer Erzählung »Krambambuli«, die in ihrer mährischen Heimat spielt (in: dies.: Werke in einem Band. 5. Aufl. Berlin, Weimar 1982, 52–63). Dabei wird auch ein Zusammenhang mit dem Holzdiebstahl angesprochen, von dem noch die Rede sein wird. 7 Stefan Keller: Maria Theresia Wilhelm, spurlos verschwunden. Geschichte einer Verfolgung. 3. Aufl. Zürich 1991 (auch in Lizenz: Frankfurt a. M. 1993), 11–15, 23–27, 97. Der Wilderer und Wildhüter Ulrich Gantenbein (1901–1977) war mit Maria Theresia Wilhelm verheiratet. 8 Schulte: Dorf, 188–192. 9 Schulte: Dorf, 192–210.
398
|
»Die Gegend wimmelt dort von Wilddieben«
ner entehrenden (zweiten) Verhaftung zu entziehen, im Vordergrund. Aber durch sein Handeln verlor er jene Sympathie in der Bevölkerung, von der er zuvor noch hatte ausgehen können.10 Selbstverständlich können wir die Bedingungen im Alpenraum und schon gar nicht die Zustände im 18. Jahrhundert auf das westfälische Siegerland und Wittgenstein übertragen.11 Dennoch war auch in den dortigen Gegenden die Wilddieberei im 19. Jahrhundert weit verbreitet. So rankten sich zahlreiche Legenden um den Wildschützen Hermann Klostermann (1839-?), der nicht hatte Förster werden dürfen und zwischen 1862 und 1885 mehrfach wegen Jagdfrevels verurteilt wurde. Bei den Prozessen wurde sichtbar, dass Klostermann im Raum des Eggegebirges und Sauerlandes eine regelrechte Bande von Wilderern angeführt hatte und dass dort das Wildern gewerbsmäßig betrieben wurde. Bewaffnete Konflikte mit Forstaufsehern blieben nicht aus, selbst Militär wurde eingesetzt.12 Die Verhältnisse im Wittgensteinischen
Was lässt sich aus dem Mord von 1891 an meinem Vorfahren schließen? Wie sind die Hintergründe zu deuten? Handelte es sich um einen privaten Racheakt oder lag vielleicht doch ein sozialer Konflikt vor? In welchen gesellschaftlichen Verhältnissen spielte sich das Ereignis ab? Der Holzdiebstahl im 19. Jahrhundert, ebenfalls ein verbreitetes Vergehen und eine Überlebensstrategie in der ländlichen Gesellschaft, kann als ein Zeichen für den nachwirkenden Gegensatz zwischen Grundherren und armen Bauern sowie Taglöhnern, als Protest gegen den strukturellen Wandel auf dem Land infolge der Industrialisierung und als Mittel zur 10 Michael Blatter: Doppelmord auf der Gruobialp. Ein Wildererfall zwischen Obwalden und Nidwalden. Kriens 2002. Der Mörder wurde in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Es war ihm gelungen, zu entkommen und nach Uruguay auszuwandern. 11 Um 1750 soll ein Wilderer versucht haben, den Grafen Friedrich von Sayn-WittgensteinHohenstein zu erschießen. Er verfehlte ihn jedoch und wurde daraufhin vom Schuss eines Jägers tödlich getroffen. Vgl. G. Hinsberg: Berleburger Bilderbuch. Ein Heimatbuch. Berleburg 1912, 182–183. Wahrscheinlich ließen sich weitere solcher Fälle finden. 12 Hans-Dieter Hibbeln: Der Wildschütz Hermann Klostermann. Wahrheit und Legende? In: http://www.wildschuetz-klostermann.de/warte1.htm [17.6.2011]. Zu vergleichen wäre etwa auch die Geschichte des legendären Karl Stülpner (1762–1841), der im Erzgebirge als Sohn einer armen Tagelöhner- und Landarbeiterfamilie zwischen der zweiten Hälfte der 1770er Jahre und 1800 allein und in einer Bande wilderte. Er hatte den Ruf, die Armen und Bedürftigen zu unterstützen, und wurde offenbar von der Bevölkerung gedeckt. Vgl. Johannes Pietzonka: Karl Stülpner. Legende und Wirklichkeit. Leipzig 1998; Karl Sewart: Karl Stülpner. Die Geschichte des erzgebirgischen Wildschützen. 2. Aufl. Chemnitz 2002. Aufschlussreich sind ebenfalls die Kämpfe zwischen Wilderern und Obrigkeit im Reinhardswald bei Kasel vor allem im 16. Jahrhundert (Rösener: Geschichte der Jagd, 333–334).
Ein Förstermord 1891 im Wittgensteinischen
|
399
Selbsthilfe interpretiert werden.13 »Holzfrevel« und Wilddieberei drückten drastisch den Widerstand gegen die Herrschaftsordnung in einem Raum aus, den man als den eigenen empfand. Dieser »Krieg um den Wald« (Wilhelm Heinrich Riehl) hatte in vielen Volksbewegungen bis weit in das 19. Jahrhundert eine große Bedeutung.14 Wirtschaftliche und soziale Zustände
Dies könnte auch in Wittgenstein eine Rolle gespielt haben. 1806 war die Selbstständigkeit der beiden Grafschaften Sayn-Wittgenstein-Hohenstein (mit Sitz in Laasphe) und Sayn-Wittgenstein-Berleburg (mit Sitz in Berleburg) zu Ende gegangen. Die Gebiete fielen an das Großherzogtum Hessen-Darmstadt, 1816 dann an das Königreich Preußen. Sie wurden als Kreis Wittgenstein der Provinz Westfalen zugeschlagen. (Abb. 1) 1839 kamen die Wittgensteiner Bauern endgültig in den Besitz ihrer Scholle. Ein erheblicher Teil der bisherigen Lasten und Abgaben an die Fürsten entfiel allmählich – 1880 zahlte etwa Dotzlar die letzte Rate der Ablösesumme. Indessen blieben den Fürsten weitgehende standesherrliche Rechte, nicht zuletzt die Befreiung von allen Steuern, das Bergregal15 sowie die freie Nutzung und Bewirtschaftung ihres Grundeigentums, namentlich der Wälder in diesem Teil des Rothaargebirges. Darüber kam es mehrfach zu Auseinandersetzungen mit der Bevölkerung, die 1848 in Unruhen gipfelten. Dabei ging es ganz besonders um das Recht der Holznutzung. Ein Vertrag wurde geschlossen, aber nach dem Scheitern der Revolution wieder hinfällig und 1875 gerichtlich für ungültig erklärt. Erst seit 1854 durften Bauern landwirtschaftlich unrentable Flächen aufforsten, so dass langsam ein eigener Wald entstand. Doch die Abhängigkeit vom Fürsten blieb vorerst bestehen. Vor allem die Beschaffung von Brennholz blieb ein Streitpunkt bis ins 20. Jahrhundert hinein. 1878 wurden zwar die 13 Josef Mooser: »Furcht bewahrt das Holz«. Holzdiebstahl und sozialer Konflikt in der ländlichen Gesellschaft 1800–1850 an westfälischen Beispielen. In: Räuber, Volk und Obrigkeit. Studien zur Geschichte der Kriminalität in Deutschland seit dem 18. Jahrhundert. Hg. von Heinz Reif. Frankfurt a. M. 1984, 43–99; zum Zusammenhang ders.: Ländliche Klassengesellschaft 1770–1848. Bauern und Unterschichten, Landwirtschaft und Gewerbe im östlichen Westfalen. Göttingen 1984, hier bes. 266–280. Vgl. zu diesem Problemfeld auch Dirk Blasius: Kriminalität und Alltag. Zur Konfliktgeschichte des Alltagslebens im 19. Jahrhundert. Göttingen 1978, 55–58. 14 Vgl. Maylein: Jagd, etwa 396–409 (Zitat 399). Den »gewissermaßen armenrechtlich legitimierten Felddiebstahl« und das »fast schon demonstrative Wildern« als Protestform im Dorf um und nach 1848 zeigen auch Wolfgang Kaschuba, Carola Lipp: Dörfliches Überleben. Zur Geschichte materieller und sozialer Reproduktion ländlicher Gesellschaften im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Tübingen 1982, 71, 81 (Zitat). 15 Das Bergregal bezeichnet das Hoheitsrecht, den Abbau von Bodenschätzen zu nutzen und davon Einkünfte zu erzielen.
400
|
»Die Gegend wimmelt dort von Wilddieben«
1 Karte des Kreises Wittgenstein, Provinz Westfalen, mit handschriftlichen Einträgen »Thatort Kroh« und »Langenzaun« sowie weiteren Vermerken zu den Ermittlungen (Staatsarchiv Münster, Staatsanwaltschaft Arnsberg, Nr. 10 Bd. 3, Einlage zwischen Bl. 476 und 477 zum 13.3.1892)
standesherrlichen Rechte aufgehoben, doch durch ihr Grundeigentum behielten die Fürsten nicht nur wichtige Einkünfte, sondern auch Einfluss auf das Alltagsleben der Kreisbewohner. Die Regelungen über die Ablösung der verschiedenen Rechte zogen sich bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hin. Der erste Oberpräsident der neuen Provinz, Friedrich Ludwig Freiherr von Vincke (1774–1844), charakterisierte 1817 in einem Bericht an die preußische Regierung die neuen Untertanen: »Die Einwohner sind ein kräftiger, genügsamer, arbeitsamer, abgehärteter Menschenschlag, der in sehr großer Dürftigkeit schmachtet, im Schweiße seines Angesichts ein aus Roggen und Hafer gemischtes, anderen Menschen unverdauliches Brot genießt.«16 Winterroggen und Hafer, dazu Kartoffeln und Rüben wurden auch weiterhin hauptsächlich angebaut, vor allem zur Selbstversorgung. Gemüse lieferten die
16 Wittgenstein. Band 1. Im Auftrag des Arbeitsausschusses Heimatbuch hg. von Fritz Krämer. Balve o. J. (1965), 216–222 (Erich Neweling), 269–311 (Fritz Krämer), Zitat 287, 425–434 (Holz- und Forstordnungen, Werner Fontaine). Zur Geschichte der Bauern, der grundherrlichen Verfassung, der Leibeigenschaft und Frondienste bis ins 19. Jahrhundert vgl.: Wittgenstein. Band 2. Im Auftrag des Arbeitsausschusses Heimatbuch hg. von Fritz Krämer. Balve o. J. (1965?), 120–194 (Werner Wied). Vgl. hier und im Folgenden Das mittlere Edertal – ein Heimatbuch für Dotzlar, Arfeld, Richtstein. Hg. von Karl Pöppel. Bad Berleburg 1982, 26–45, hier bes. 27–28, 186–188 und passim. Karl Pöppel war während des »Dritten Reiches« ein aktiver Nationalsozialist. Nach 1945 trat er der FDP bei und war zeitweise Bürgermeister von Berleburg. Seine judenfeindliche Grundhaltung behielt er bei (Ulrich Friedrich Opfermann: »Mit Scheibenklirren und Johlen.« Juden und Volksgemeinschaft im Siegerland und in Wittgenstein im 19. und 20. Jahrhundert. Hg. von Aktives Museum Südwestfalen e. V. – Dokumentations- und Lernort für regionale Zeitgeschichte am Platz der Synagoge. Siegen 2009, 53–54, 123, 131, 145–146).
Ein Förstermord 1891 im Wittgensteinischen
|
401
Hausgärten. Daneben betrieben die Bauern, soweit möglich, eine bescheidene Viehzucht. Die Bergmannsfamilien hielten sich häufig eine oder zwei Ziegen.17 Das Jagdrecht war im Wittgensteinischen, wie allgemein in Preußen, Ende 1848 und 1850 neu geregelt worden. Die Jagd war nun auf eigenem Grund und Boden frei, soweit das entsprechende Gebiet eine bestimmte Größe umfasste, oder konnte von einer Jagdgenossenschaft verpachtet werden. Dass 1852 und 1871 die Jagd am Sonntag, vor allem während des Gottesdienstes, unter Strafe gestellt wurde, war wohl auch eine Spitze gegen die bürgerlichen und bäuerlichen Jäger, die wegen ihrer Erwerbstätigkeit fast nur sonntags jagen konnten.18 Mehr und mehr machten sich Verrechtlichungsprozesse bemerkbar. So mussten seit 1891 Genossenschaft oder Jagdpächter für den Ersatz des Wildschadens aufkommen, und 1895 wurde die Pflicht eingeführt, dass diejenigen, die die Jagd ausübten, einen Jagdschein erwerben und bei sich führen mussten.19 Politische Zusammenhänge
Ausdruck der verbreiteten Armut und der Unzufriedenheit mit den wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen war nicht zuletzt die politische Orientierung der Bevölkerung. Den größten Zulauf hatte das Bündnis von Christlich-Sozialer und Deutschkonservativer Partei. Hauptkennzeichen dieser Partei waren der Antisemitismus und der Kampf gegen die Sozialdemokratie. Die Juden wurden für alles verantwortlich gemacht, was man als »schlecht« in der Gesellschaft ansah und was eine »gesunde« Entwicklung des »Volkes« verhindere. Soziale Reformen sollten die Arbeiterschaft der Sozialdemokratie abspenstig machen und sie für das Christentum und die Monarchie zurückgewinnen. Als zentrales Feindbild galten dabei wiederum die »jüdischen Kapitalisten«. Eine der Leitfiguren der Partei war der evangelische Hofprediger Adolf Stoecker (1835–1909), dessen antijüdischen Ausfälle immer wieder für Skandale sorgten.20 Gerade ihn stellte die Partei für die Reichstagswahl 1881 im Wahlkreis Siegen-Wittgenstein-Biedenkopf auf. Und Stoecker gewann auf Anhieb das Mandat. Auch bei den folgenden Reichstags17 Wittgenstein. Band 3. Ein Lesebuch zur Volkskunde und Mundart des Wittgensteiner Landes. Im Auftrag eines Arbeitskreises hg. von Gerhard Hippenstiel und Werner Wied. Bad Laasphe 1984, 329–396 (zu den landwirtschaftlichen Arbeiten, verschiedene Autoren), 457 (Bergmannsziege in Raumland, Walter Böhl); vgl. Wittgenstein Bd. 1, 538–546 (Hans Seidenstücker zur Landwirtschaft). 18 Rösener: Geschichte der Jagd, 369–370. 19 Das mittlere Edertal, 117–118. Zum Preußischen Jagdpolizeigesetz vom 7.3.1850 vgl. etwa Maylein: Jagd, 473 Anm. 36. 20 Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. 3. Bd. Von der »Deutschen Doppelrevolution« bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges 1849–1914. München 1995, 917– 923.
402
|
»Die Gegend wimmelt dort von Wilddieben«
wahlen blieb die Partei in diesem Wahlkreis die stärkste politische Kraft. Eine nationalistisch-antisemitische Agitation und Beschwörungen eines fundamentalistischen Protestantismus überzogen die Region. Zahlreiche Pfarrer, aber auch Lehrer und Staatsbeamte unterstützten die Christlich-Sozialen/Deutschkonservativen. Zwar gab es durchaus Kritik an den Hetzreden gegen die Juden, doch die Anhängerschaft dieser Strömung reichte in alle Schichten, auch in die Bauern- und Arbeiterschaft.21 Die antijüdische Ausrichtung ging somit noch über die damals in ganz Deutschland verbreitete Stimmung hinaus.22 Offensichtlich fand die Mischung aus Antisemitismus und protestantischem Radikalismus, wie sie die Christlich-Soziale/Deutschkonservative Partei und weitere kleinere judenfeindliche Gruppierungen vertraten, Anklang in weiten Teilen der Bevölkerung, weil ihr damit eine Erklärung für die schwierigen Verhältnisse und eine Hoffnung auf Abhilfe geboten wurden. Allerdings: der Anteil von Einwohnern jüdischen Glaubens war sehr gering. In Laasphe bestand eine größere Gemeinde, die um 1870 ihre hundertjährige Synagoge erneuern und erweitern konnte. Ein Drittel lebte 1883 überwiegend »in sehr ärmlichen Verhältnissen«. Ein paar Familien waren wohlhabende Kaufleute. Die meisten verdienten ihr Einkommen als Viehhändler und Metzger, andere hatten als Kramhändler, Handwerker und Tagelöhner ihr Auskommen. Auch in Berleburg verfügte die jüdische Gemeinde über eine Synagoge. Doch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die Situation schwierig, weil immer mehr Mitglieder die Stadt verließen. Ebenso ging die Zahl der Juden zurück, die in Dörfern wohnten.23 Mit ähnlichen Argumenten richtete sich der Verdacht, einer Verbesserung der Zustände im Wege zu stehen, gegen die »Zigeuner«, die sich seit Ende des 18. Jahrhunderts an einigen Orten niedergelassen hatten. Diese handelten mit 21 Opfermann: Scheibenklirren, 31–45. So erreichte die Partei 1887 77,9 % der Stimmen (Reichsdurchschnitt: 15,2 %), 1890 42,4 % (12,4 %) und 1893 43 % (13,5, %); ebd., 33. Diese politische Orientierung bereitete auch den Boden für den Nationalsozialismus. Bei der Reichstagswahl 1930 kam die NSDAP in der Region Siegerland-Wittgenstein auf 27,4 % der Stimmen (18,3 %), im Juli 1932 auf 56,6 % (37,3 %) – im Kreis Wittgenstein sogar auf 67,6 % –, im November 1932 auf 56,1 % (33,1 %). Siehe ebd., 49, 54, vgl. 55. 22 Vgl. hier nur: Deutsch-jüdische Geschichte in der Neuzeit. Hg. von Michael A. Meyer unter Mitwirkung von Michael Brenner. Bd. 3. Umstrittene Integration: 1871–1918. München 1997, 191–248 (Peter Pulzer). 23 Opfermann: Scheibenklirren, 27–29 (Zitat: 28); dort auch zu Beispielen, wie sehr das antijüdische Vorurteil Wurzeln geschlagen hatte. Genaue Einwohnerzahlen teilt der Autor nicht mit. Im benachbarten Siegerland lebten 1885 234 Juden (vgl. 1933: 211). Ebd., 18, vgl. 88. Ohne Quellenangabe spricht Horst Womelsdorf für 1871 von 322 Juden oder 1,98 % der Bevölkerung im Kreis Wittgenstein (Jüdisches Leben im Siegerland und Wittgenstein. Gottesverheißung für sein Volk Israel. Historische Wirklichkeit und Gottesprophezeiung. Muldenhammer 2010, 58; der Untertitel weist auf die Motivation und Ausrichtung des Buches hin).
Ein Förstermord 1891 im Wittgensteinischen
|
403
Altwaren, waren Hausierer, Fuhrleute, Tagelöhner, Korbflechter und Scherenschleifer, zunehmend auch land- und forstwirtschaftliche Arbeiter.24 Obwohl enge Kontakte zur umgebenen Bevölkerung bestanden, von freundschaftlichen Beziehungen berichtet wird, Heiraten häufiger wurden, die Kriminalstatistik keine Auffälligkeiten aufweist, verschwanden die Vorurteile nicht. Immer wieder hieß es, die »Zigeuner« seien Landstreicher und Vagabunden, arbeitsscheu, zum Stehlen veranlagt, unsittlich, ohne Rechtsbewusstsein, eine Landplage. Das Verhalten der Behörden und die Reden konservativer Wahlkämpfer, die von einer Nicht-Veränderbarkeit der charakterlichen Anlagen – also von »Rassen«-Merkmalen – ausgingen und beispielsweise dafür plädierten, die »Zigeunerkinder« ihren Eltern wegzunehmen, um sie »zu einigermaßen anständigen Menschen zu erziehen«, verstärkten die Vorurteile.25 Es brauchte somit keine konkreten Anknüpfungspunkte, um gegen Juden und »Zigeuner« eingestellt zu sein. Jahrhundertealte, stereotype Vorstellungen, die von der christlichen – in diesem Fall besonders von der evangelischen – Kirche genährt wurden, waren als Erklärung für Notstände und alles Übel abrufbar und konnten im Konfliktfall oder auch in Wahlkämpfen und politischen Aktionen mobilisiert werden.26 Der Mord an Friedrich Kroh
Friedrich Kroh, am 1. Januar 1832 in Dotzlar geboren, trat als Waldwärter und Förster die Nachfolge seines Vaters Christian Georg Kroh (1776–1857) an. (Abb. 2) Kurz vor seinem Tod im Oktober hatte dieser am 25. August 1857 den Fürsten von Wittgenstein gebeten, Friedrich anstelle des soeben verstorbenen älteren Sohnes in die Waldwärter-Stelle einzuweisen. Seit 1724 befinde sich die Försterstelle »ununterbrochen in meinem Hause«. Die zuständigen Forstbeam24 Ulrich Friedrich Opfermann: »Daß sie den Zigeuner-Habit ablegen.« Zur Geschichte der »Zigeuner-Kolonien« zwischen Wittgenstein und Westerwald. 2. Aufl. Frankfurt a. M. usw. 1997, Einwohnerzahlen 115, 126, 164; Berufe 115–117, 125, vgl. für die 1920er Jahre 164. 25 Beispiele bei Opfermann: Zigeuner-Habit, 114–115, 124, 129–130, 142 (Zitate 130). Interessanterweise wurde gerade Kinderraub den »Zigeunern« unterstellt (ebd., 157). Ich kann mich daran erinnern, dass mich meine Oma davor warnte, in die Nähe durchreisender »Zigeuner« zu gehen, weil sie kleine Kinder rauben würden. Auch vor Diebstählen sei man nicht sicher. Hingegen nahm meine Oma gerne die von ihr hoch gelobten Fähigkeiten der »Zigeuner« zum Scheren- und Messerschleifen, Korbflechten und Kochkesselflicken in Anspruch. 26 Zum Schicksal der wittgensteinischen Juden im »Dritten Reich« vgl. Opfermann: Scheibenklirren, 65–192; zum Schicksal der »Zigeuner« ders.: Zigeuner-Habit, 170–210; ders.: »Schlussstein hinter Jahre der Sittenverwilderung und Rechtsverwirrung.« Der Berleburger Zigeuner-Prozess. In: Antiziganismuskritik (2010) H. 2, 17–35.
404
|
»Die Gegend wimmelt dort von Wilddieben«
ten sowie die Rentkammer27 befürworteten die Eingabe, so dass Fürst Albrecht zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg seine Zustimmung gab. Am 23. Juli 1858 wurde Friedrich Kroh schließlich verpflichtet. Er musste zu Gott schwören, »seiner Königlichen Majestät von Preußen, meinem allergnädigsten Herrn, (…) unterthänig treu und gehorsam« zu sein, seine Pflichten gewissenhaft zu erfüllen, ebenso seiner »Dienstherrschaft«, dem »Fürsten Albrecht zu SaynWittgenstein Berleburg Durchlaucht« sowie dessen Nachfolgern, »alle schuldige Treue und gebührenden Gehorsam jederzeit« zu erweisen und »desselben Bestes« zu »befördern«, »Schaden« hingegen abzuwenden. »Insbesondere« sollte er »die Diebstähle an Holz und anderen Waldproducten« anzeigen. In den dienstlichen 2 Friedrich Kroh (Privatarchiv Berichten seiner Vorgesetzten erhielt er immer Heiko Haumann) die besten Beurteilungen, denen auch regelmäßige Gehaltsaufbesserungen folgten.28 Am 13. Oktober 1891 machte sich der Gastwirt Wilhelm Hartmann aus Dotzlar auf, seinen Schwiegervater Friedrich Kroh zu suchen, weil dieser nicht von seinem Waldgang am Tag zuvor zurückgekehrt war. Seinem Enkel hatte Kroh zugerufen, er wolle noch einen Fuchs schießen.29 Hartmann fand ihn »todt am Waldsaum oberhalb Dotzlar« – im Distrikt »Streifel« Richtung Gewann »Keller« – »liegen, die doppelläufige Flinte mit geschlossenen Hähnen mit dem Kolben unter dem rechten Arm«. Die Obduktion ergab, dass Kroh von einem Schrotgeschoss in die rechte Gesichtshälfte getroffen worden und wohl sofort tot gewesen war. Zeugen hatten 27 Die Rentkammer (auch: Rechnungskammer) verwaltete die Finanzen des Fürsten. 28 Westfälisches Archivamt Münster, Privatarchiv Berleburg, Acta der Fürstlich Wittgenstein’schen Rentkammer in Berleburg (im Folgenden WAM), Nr. 1587, Zitate: Bl. 2 (1857), 17 (1858). Ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Münsteraner Archive für ihre Unterstützung. 29 Förstermord in Dotzlar. Website der Gemeinde Dotzlar: http://www.dotzlar.de/historie/ foerstermord.html [10.6.2011]. Die Angabe beruft sich auf Aufzeichnungen des Chr. Saßmannshausen. In dem Artikel wird auch das Wittgensteiner Kreisblatt zitiert, das am 13.10.1891 den Mord meldete und weiter berichtete, dass Kroh am 15.10.1891 zu Grabe getragen worden sei. Die Grabrede habe Pfarrer Wiedfeldt aus Raumland gehalten. Diese Darstellung ist auch enthalten in: Das mittlere Edertal, 203–205. Pfarrer Friedrich Gustav Karl Wiedfeld (die Schreibweise differiert offenbar) wirkte in Raumland von 1874 bis 1907 (Das mittlere Edertal, 148).
Ein Förstermord 1891 im Wittgensteinischen
|
405
3 Karte der Gegend um Raumland und Dotzlar (Wanderkarte Wittgenstein Blatt Süd, Maßstab 1:25.000; mit freundlicher Erlaubnis des Ingenieurbüros für Kartographie Müller und Richert GbR, Gotha)
zwei Schüsse gehört. In der Nähe lag noch ein toter Hase, der aber offensichtlich nicht an dieser Stelle erlegt worden war.30 (Abb. 3) Umbruchzeit in Dotzlar und Umgebung
In welchem dörflichen Umfeld ist das Verbrechen zu sehen? Wilhelm Hartmanns Gastwirtschaft, der mitten im Dorf gelegene »Försterhof«,31 spielte eine wichtige Rolle als Umschlagplatz für Meinungen, Informationen und Gerüchte. Hier hatten 1879 Bauern und Grubenarbeiter den Männergesangverein »Liederkranz« gegründet. Erster Dirigent und Komponist der Hymne »Mein Wittgenstein« wurde der Lehrer Heinrich Christian Imhof (1858–1902), der Vater meiner Oma – man 30 Staatsarchiv Münster [inzwischen Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung Westfalen], Staatsanwaltschaft Arnsberg (im Folgenden StAM), Nr. 12 Bd. 1, Protokoll vom 13.10.1891 (Bl. 9: Anlage zum Protokoll mit Lageplan des Tatortes); Nr. 10 Bd. 4, Anklageschrift der Staatsanwaltschaft vom 21.5.1892, hier Bl. 694v-695r (Zitat), vgl. ff. 31 Das mittlere Edertal, 100. Vgl. zu den Häusern und Familien Kroh, Imhof und Hartmann ebd., 241–242, 254.
406
|
»Die Gegend wimmelt dort von Wilddieben«
sieht die engen verwandtschaftlichen Bindungen im Dorf.32 Und es ist zu vermuten, dass gerade in dieser Wirtschaft heftig über den Mord diskutiert wurde. Das Dorf Dotzlar, nahe der Eder gelegen und heute ein Stadtteil Bad Berleburgs, hatte um 1890 rund 480 Einwohner.33 Es war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von der Landwirtschaft und dem Schieferbergbau geprägt, der vor allem in der benachbarten Gemeinde Raumland betrieben wurde. Nicht zuletzt aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung dieses Industriezweiges erhielt Raumland 1890 Anschluss an die Eisenbahnstrecke nach Erntebrück, 1910 sollte der Anschluss nach Berleburg folgen. Für die fürstliche Rentkammer war der Schieferbergbau eine wichtige Einnahmequelle. Sie vergab die Konzessionen für den Abbau an die einzelnen Grubengewerkschaften, denn der entsprechende Grund und Boden gehörte nach wie vor dem Fürsten zu Sayn-WittgensteinBerleburg – ebenso wie ein Großteil der Wäldereien in der Gegend.34 Auch in Dotzlar gab es Schiefergruben. Eine beträchtliche Anzahl der männlichen Dorfbewohner arbeitete dort, soweit sie nicht in Raumland beschäftigt 32 M. G. V. »Liederkranz« Dotzlar: Festschrift zur Feier des 100-jährigen Bestehens vom 18.– 19. August 1979 in der Kulturhalle »Wittgenstein« in Dotzlar. Bad Berleburg 1979, 2–3, 25. Auf der 1912 gestifteten Fahne des Vereins ist der Wahlspruch eingestickt: »Sind wir von der Arbeit müde, / Ist noch Kraft zu einem Liede« (ebd., 24). Lehrer Imhof spielt eine wichtige Rolle in: K[arl] Pöppel-Steffens: Wenn die Dorfmusik spielt. 2. Aufl. Bad Berleburg 1979, seine berührende Verabschiedung als Lehrer kurz vor seinem Tod: 103–113. Das Buch ist eine romanhafte Darstellung des Lebens in Dotzlar zwischen etwa 1870 und 1900, die sich nicht zuletzt auf Erzählungen von Zeitzeugen stützt (wie ich auch von meinen Verwandten weiß). Die Orts- und Personennamen sind kaum verschlüsselt wiedergegeben: Dotzlar ist Tuslar, Raumland Rumelingen, der Lehrer Imhof heißt hier Vomhof, Gastwirt Hartmann »Försterwirt« usw. Die entsprechenden heimatkundlichen Ausführungen finden sich in: Das mittlere Edertal, zum Lehrer Imhof, der aus Schwarzenau stammte und von 1879 bis 1902 an der Dotzlarer Schule tätig war, 158–159, 161 („Liederkranz«), 165–166 (Würdigung der Persönlichkeit). 1885 war die Schule aus einem Raum in der Kapelle in ein eigenes Schulhaus umgezogen, das auch eine Lehrerwohnung enthielt. 1898 wurden 112 Schüler und Schülerinnen unterrichtet, eine zweite Lehrerstelle erwies sich als notwendig (ebd., 155). 33 Das mittlere Edertal, 24. 34 Raumland. Beiträge zur Geschichte unseres Dorfes. Hg. von Fritz Krämer im Auftrag der Gemeinde Raumland. Raumland 1975, 281–313, bes. 288–313, 242–245; Wittgenstein Bd. 1, 584 (Bahnbau, Wilhelm Belz); Wittgenstein Bd. 3, 456–458 (Walter Böhl, zu den Schiefergruben bei Raumland); Wolfgang Birkelbach: Schiefer aus Raumland. In: Alte und neue Arbeitswelt im Siegerland und in Wittgenstein – Informationen für den Lehrer – Unterrichtshilfen. Hg. von Josef Hendricks. Münster 1985, 39–92. Der Abbau von Schiefer erlebte damals eine Blütezeit, nachdem seit 1860 die Hausdächer nicht mehr mit Stroh gedeckt werden durften. Wer es sich leisten konnte, ließ dann auch seine Häuserfronten ganz oder teilweise mit Schiefer verkleiden. Darüber hinaus wurde Raumländer Schiefer in zahlreiche Städte des In- und Auslandes exportiert. Etwa 450 Arbeiter wurden gegen Ende des Jahrhunderts beschäftigt.
Ein Förstermord 1891 im Wittgensteinischen
|
407
waren. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts geriet diese wichtige Existenzgrundlage in eine Krise. Die bisherige Grube im Gewann »Burg« war weitgehend erschöpft, man konnte nur unter erheblichen Schwierigkeiten in neue Lagerstätten vorstoßen. Desgleichen kostete die Planung und Erschließung zusätzlicher Gruben viel Geld. Hoffnungen setzte man auf Unterstützung seitens des Fürsten, die dieser jedoch versagte. Schließlich gab er seine Zustimmung, eine neue Grube im Gewann »Hillerberg« anzulegen. Das erforderliche Kapital mussten die Einwohner aber selbst aufbringen, indem sie eine genossenschaftlich organisierte Gewerkschaft zum Betrieb der Grube gründeten. Dies ging nicht ohne Spannungen ab – innerhalb der Dorfgemeinschaft wie gegenüber dem Fürsten.35 Auch in anderen Bereichen waren die Beziehungen zum Fürsten nicht konfliktfrei. Prozesse um Besitzrechte belegen dies ebenso wie Streitigkeiten um Holzdiebstähle. Anlässlich einer Fürstenjagd in den Wäldern um Dotzlar soll ihm die Dorfmusik ein Wilddiebslied gespielt haben, um ihn zu ärgern und ihm den Protest des Dorfes zu zeigen.36 Überliefert ist, dass 1890 Jäger aus dem benachbarten Arfeld, vermutlich aus Not, einen Hirsch im fürstlichen Jagdgebiet wilderten.37 Wie reagierte die Bevölkerung auf den Förstermord? Friedrich Kroh war überall beliebt, sein Tod berührte alle. Der Verdacht fiel sofort auf einen Wilderer. In der Regel deckten die Dorfbewohner die Wilderer und zeigten sie nicht an. So könnte man vermuten, dass zumindest ein Teil der Bewohner mit dem Wilderer sympathisierte, der den fürstlichen Förster niederschoss. Das war aber nicht der Fall. Ein Mord ging zu weit.38 Ermittlungen und Verhaftungen
Der Fürst setzte am 14. Oktober 1891 eine Belohnung von 1000 Mark für Hinweise aus, die zur Bestrafung des Mörders führen werde.39 Eine umfangreiche 35 Das mittlere Edertal, 177–179 (181: Karl Pöppel aus Dotzlar war selbst Grubensteiger); Pöppel-Steffens: Dorfmusik, z. B. 90–92, 134–138, 166–168, 183–184, 192–200, 211– 220; Die Geschichte von Dotzlar. Website der Gemeinde Dotzlar: http://www.dotzlar.de/ historie/geschichte.html [10.6.2011]. Hier werden auch frühere Bauernaufstände, etwa 1539, erwähnt. Bis in das 19. Jahrhundert spielten ebenfalls Köhlerei und Fuhrmannswesen eine wichtige Rolle. 36 Pöppel-Steffens: Dorfmusik, 86–87, vgl. zu den Konflikten u. a. 50–55, 125–134, 179–182. 37 Das mittlere Edertal, 521–523. 38 Pöppel-Steffens: Dorfmusik, 207–211. Der Förster und sein mutmaßlicher Mörder werden hier – anders als bei sonstigen Personen im Buch – mit richtigem Namen genannt, ebenso werden dessen Beiname »deutscher Hannes« und die beiden Förster Trembour und Hartnack erwähnt, um die es in den folgenden Ermittlungen ebenfalls ging. 39 WAM, Nr. 1587, Bl. 42.
408
|
»Die Gegend wimmelt dort von Wilddieben«
Ermittlung begann. Schon wenige Tage später, am 16. und 17. Oktober, wurden die Gebrüder Heinrich und Friedrich Stenger unter dem Verdacht des Mordes verhaftet. Heinrich Stenger, 31 Jahre alt, war Landwirt, Friedrich, 19 Jahre alt, wird einmal als »Ackergehülfe«, ein andermal als »Grubenarbeiter« bezeichnet.40 Die Familie des Ermordeten hatte sie mit der Vermutung belastet, Kroh habe am Mordtag einen der Stengers beim unbefugten Mähen von Heidekraut, das als Einstreu für das Vieh und auch als Streudünger verwendet wurde, überrascht und zur Bestrafung in seinem Notizbuch vermerkt. Am Abend habe er jenen dann beim Wildern angetroffen. Stenger habe Kroh niedergeschossen und dessen Notizbuch an sich genommen, damit man nicht auf ihn aufmerksam werde. Gendarm Sudhof stellte in der Tat fest, dass bei der Stengerschen Wohnung Heidekrautstreu lagerte. Auf Befragen gab Friedrich Stenger an, das Heidekraut in einer Gegend gemäht zu haben, in der Sudhof jedoch keines entdecken konnte. Hingegen hatte Wilhelm Hartmann den Gendarmen darauf aufmerksam gemacht, dass nahe des Tatortes »neuerdings Heidekraut gemäht worden war«.41 Damit war der Verdacht gegen die Gebrüder erhärtet. Dem verschwundenen Notizbuch kam nun eine entscheidende Rolle bei den Ermittlungen zu.42 Zum Untersuchungsrichter wurde Alfred Wieruszowski (1857–1945) bestimmt. In Görlitz geboren, hatte er in Leipzig und Göttingen Rechtswissenschaft studiert. Zunächst war er als Assessor und Hilfsrichter in Altena und Hörde eingesetzt worden. Anfang 1886 hatte er die Versetzung in gleicher Funktion nach Siegen erhalten, wo er am 1. November 1888 dann zum Amtsrichter ernannt worden war.43 Seit dem 20. Oktober 1891 vernahm Wieruszowski mehrere Einwohner 40 Angaben nach: StAM, Nr. 10 Bd. 2, Bl. 309, 312 (25.3.1892), 372 (1.4.1892), 380 (2.4.1892). 41 StAM, Nr. 12 Bd. 1, Bl. 39–20a (sic!), 21 a (Zitat Hartmann). 42 Dies wurde auch durch die Aussagen Wilhelm Hartmanns unterstrichen (StAM, Nr. 12 Bd. 1, Bl. 20 a–21 a). 43 Im Behördenteil des Adress-Buches der Stadt und des Kreises Siegen 1890, IX, wird unter dem Königlichen Amtsgericht zu Siegen Amtsrichter Wieruszowsky aufgeführt (die Schreibweisen mit –y oder –i wechseln). Ein Alfred Wieruszowski taucht in den Adressbüchern für 1887 und 1890 als Gerichtsassessor auf. Er wohnte im Haus Nr. 1 im Stadtteil Hammerhütte vor der Kernstadt. Frühere und spätere Adressbücher nennen ihn nicht (für seine Recherche und Übersendung der Kopien aus dem Adressbuch von 1890 am 23.6.2003 danke ich Herrn Müller vom Stadtarchiv Siegen, ebenso Ulrich Friedrich Opfermann für seine Mitteilung vom 17.7.2011). Ich gehe davon aus, dass es sich um ein und dieselbe Person handelte. Im Staatsarchiv Münster sind keine Personalunterlagen zu Wieruszowski vorhanden (Mitteilung von Helmut Franz, 2.6.2003); dasselbe gilt für das Stadtarchiv Siegen (Mitteilung vom 23.6.2003), wo sie auch nicht zu erwarten waren. Hingegen liegt die Personalakte heute im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung Rheinland, in Düsseldorf: Gerichte Rep. 0168 Nr. 574–577 (ich danke Astrid Küntzel für die Recherche). Wie aus der Personalakte hervorgeht, zog Wieruszowski 1890 nach
Ein Förstermord 1891 im Wittgensteinischen
|
409
Dotzlars.44 Diese wurden danach gefragt, wann und unter welchen Umständen sie den Förster zuletzt gesehen hatten, ob sie Hinweise zur Rekonstruktion des Tathergangs oder zur Aufklärung des Mordes geben konnten und wo sie sich selbst während der Tatzeit aufgehalten hatten. Einige, die mit der Feldarbeit oder mit Laubsammeln beschäftigt gewesen waren, hatten noch mit dem Förster gesprochen, als dieser in den Wald gegangen war. Später hatten die meisten von ihnen zwei Schüsse gehört. Manchen war ebenfalls ein Schuss aufgefallen, als sie abends von der Schicht in der Grube nach Hause gingen. Einer der Befragten gab zusätzlich an, ein Geräusch vernommen zu haben, »als wenn etwas ins Wasser fiele«. Kurz darauf sei ein weiterer Schuss gefallen, der weniger geschallt habe als der erste.45 Das bestätigte auch der Gastwirt Hartmann, der zu dieser Zeit Holz gehauen hatte.46 Nicht ganz einig waren sich die Zeugen, wie spät am Abend es war, als die Schüsse fielen. Vermutungen über den Mörder wurden geäußert: So sollte einmal einer der Stengers gesagt haben, »der Förster Kroh habe ihm seinen Hund todt geschossen, das kostete dem Kroh sein Leben«.47 Die Stengers wohnten in Sassenhausen, Ortsteil Am Langenzaun, südlich von Dotzlar und nicht weit vom Tatort gelegen. Auch dort vernahm die Polizei eine Anzahl Personen. Deren Aussagen entlasteten teilweise die Verdächtigen. Darüber hinaus wurde bei diesen eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Vor allem suchte die Polizei nach dem verschwundenen Notizbuch Krohs. »Die Durchsuchung hatte indessen gar kein Ergebnis.«48 Mit Entfernungsmessungen und Hörproben zum Schall versuchten die Ermittler, die Zeitangaben zu präzisieren und die Möglichkeiten zu überprüfen, ob die Stengers nicht doch am Tatort gewesen sein konnten. Letztlich mussten die beiden Verdächtigen aber wieder freigelassen werden. (Abb. 4) Eindrucksvoll weisen im Übrigen
44
45 46 47 48
Buschgotthardshütte-Wellersberg bei Siegen (z. B. Nr. 577, Bl. 47). Vgl. Rheinische Justiz. Geschichte und Gegenwart. 175 Jahre Oberlandesgericht Köln. Hg. von Dieter Laum u. a. Köln 1994, 638–639; Hans-Jürgen Becker: Alfred Ludwig Wieruszowski (1857–1945). Richter, Hochschullehrer, Goethe-Forscher. In: Deutsche Juristen jüdischer Herkunft. Hg. von Helmut Heinrichs u. a. München 1993, 403–413, hier 403–405. StAM, Nr. 12 Bd. 1. Am 17. und am 29.2.1892 wurden durch die Polizei in den benachbarten Orten Hemschlar und Weidenhausen zahlreiche Personen vernommen, um Hinweise auf den Täter – auch Gerüchte – zu erhalten. Weiterführende Angaben erfolgten jedoch nicht, obwohl hin und wieder die Stengers als Verdächtige genannt wurden (ebd., Nr. 12 Bd. 2). Vgl. zur Nutzung derartiger Quellen Schulte: Dorf, 22–31. Allgemein: Michael Niehaus: Das Verhör. Geschichte – Theorie – Fiktion. München 2003 (Niehaus hat gemäß Nutzungsverzeichnis die Akten im Staatsarchiv Münster ebenfalls durchgeschaut, sie jedoch, soweit ich sehe, in seinem Buch nicht verwendet). StAM, Nr. 12 Bd. 1, Bl. 21 b, 22 a, 22 b (Aussagen der Gebrüder Johann Georg und Heinrich Aderhold). StAM, Nr. 12 Bd. 1, Bl. 26 b–27 a. StAM, Nr. 12 Bd. 1, Bl. 24 b (Aussage Karl Schütz). StAM, Nr. 12 Bd. 1, Bl. 30 a. Das Folgende ebd., ff.
410
|
»Die Gegend wimmelt dort von Wilddieben«
die Quellen darauf hin, in welch ärmlichen Verhältnissen die Menschen in dieser Gegend lebten, wenn sie Heidekraut mähen und Laub sammeln mussten – und dies eigentlich sogar verboten war. Die Ermittlungen gingen in viele Richtungen, kamen aber nicht recht voran. Doch dann trat eine Wendung ein. Am 7. Januar 1892 fand südlich von Sassenhausen ein Mordversuch an Förster Christian Hartnack statt. Bei der Untersuchung tauchte durch die Aussage des Gendarmen Linnenkohl ein möglicher Zusammenhang mit dem Fall Kroh auf. Der Landwirt Heinrich Dinsch aus Rückershausen, der von evangelisch-fundamentalistischem Eifer geleitet war, sich von der »Vorsehung« geführt betrachtete und dafür plädierte, »dass alle Milde 4 Lageplan des Tatortes (Staatsarchiv aufhören« müsse,49 hatte ihn auf den Münster, Staatsanwaltschaft Wilddieb Johannes Wagenbach aus Arnsberg, Nr. 12 Bd. 1, Bl. 9) Weidenau aufmerksam gemacht. Auf diesen passten die Personenbeschreibung und die »helle« Stimme in »höherer Tonart«, wie sie Hartnack angegeben hatte. Wagenbach wurde festgenommen, eine Hausdurchsuchung fand statt, und obwohl der Verdächtige alles abstritt, stellte der Untersuchungsrichter am 3. März 1892 einen Haftbefehl aus. Nun konnte gezielt in beiden Fällen weiter ermittelt werden.50
49 WAM, Nr. 1587, Bl. 56v (Brief an den Fürsten, 13.4.(9.?)1892; die Berufung auf die »Vorsehung« taucht in seinen Briefen häufig auf ). Aus den Akten geht hervor, dass Heinrich Dinsch (auch: Diensch) in regelmäßigem Kontakt mit Forstmeister Rotberg und ebenso mit dem Fürsten Albrecht zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg stand. Er unterrichtete sie über Vorgänge in den Wäldern sowie über das Treiben der Wilddiebe und Hehler und nahm zu den Untersuchungen Stellung, legte aber auch ausführlich seine Weltanschauung dar. Nicht zuletzt ging es ihm jedoch um die Belohnung. Bei seiner Vernehmung am 5.3.1892 gab er als Religion »Dissident« an (StAM, Nr. 10 Bd. 1, Bl. 122v-125, Zitat 122v). 50 StAM, Nr. 10 Bd. 1, passim (vor allem Bericht Linnenkohl, 27.2.1892). Der »Thatort Hartnack« ist ebenfalls auf der Karte des Kreises Wittgenstein (Abb. 1) eingetragen.
Ein Förstermord 1891 im Wittgensteinischen
|
411
Johannes oder Jean Wagebach – wie sich dann als seine offizielle Schreibweise herausstellte – war am 12. März 1854 in Königstädten bei Rüsselsheim im damaligen Großherzogtum Hessen-Darmstadt als Sohn einer Tagelöhnerfamilie geboren worden. (Abb. 5) Als Soldat wurde er 1876 wegen schweren Diebstahls zu neun Monaten Gefängnis verurteilt und degradiert. Zwei Jahre später musste er wegen Hausfriedensbruchs in Frankfurt a. M. für acht Tage ins Gefängnis, und 1882 folgte wiederum eine Strafe über neun Monate Gefängnis, diesmal wegen gewerbsmäßigen Wilderns. Hinzu kamen zwei Jahre 5 Johannes Wagebach in Handschellen Ehrverlust und die Zulässigkeit von Polizeiaufsicht. (Staatsarchiv Wagebach war abgestempelt. Vielleicht veranlasste Münster, Staatsihn auch dies, seine Heimat zu verlassen und sich anwaltschaft in das Siegerland sowie das angrenzende WittgenArnsberg, Nr. 10 stein zu begeben, wo er Verwandtschaft besaß und Bd. 4, Beilage) bereits seit 1880 immer wieder gewesen war. Seinen Wohnsitz nahm er in Siegen, dann in Weidenau. Gelegentlich arbeitete er als Gärtner oder übernahm Tagelohntätigkeiten. Jedoch bereits 1883 stand er, diesmal in Laasphe, erneut wegen Jagdvergehens vor dem Richter; offenbar hatte er sich zunächst als Italiener ausgegeben. Drei Wochen Gefängnis erhielt er. 1886 verheiratete er sich mit der 1846 geborenen Witwe Christine Stein,51 die vier Kinder mit in die Ehe brachte; zwei weitere kamen bis 1892 hinzu. Schon 1889 wurde Wagebach in Siegen ein weiteres Mal wegen Jagdvergehens verurteilt, jetzt waren es drei Monate Gefängnis. Er trat die Strafe aber nicht an, sondern flüchtete nach Brasilien »und überließ Frau und Kinder der Armenversorgung«. An seine Frau schrieb er aus Hamburg: »Jagd 51 Stadtarchiv Siegen, Standesamt Weidenau, Heiratsregister 1886, Nr. 37. Johannes Wagebach war der Sohn des Taglöhners Wilhelm Wagebach und seiner verstorbenen Frau Elisabetha Margaretha geb. Bayer, Christine Stein geb. Peter die Tochter des Taglöhners Jacob Heinrich Peter und seiner Frau Elisabeth geb. Henrich. Der Name Wagebach war offenbar so ungewöhnlich, dass selbst seine Frau die Heiratsurkunde mit »Wagenbach« unterschrieb. Christine Steins Ehemann, der Walzer Tillmann Stein, war 1881 im Alter von 38 Jahren gestorben (Stadtarchiv Siegen, Standesamt Weidenau, Sterberegister 1881, Nr. 122). Christine Wagebach ist in den folgenden Jahren in den Adressbüchern zu Weidenau – mit wechselnden Anschriften – nachweisbar. Ab dem Adressbuch für 1925 taucht sie jedoch weder dort noch in den Suchregistern zu den Sterbebüchern des Standesamtes Weidenau und des Standesamtes Siegen auf. Meldeunterlagen sind aufgrund von Kriegseinwirkungen im Stadtarchiv Siegen nicht erhalten. Frau Wagebachs Todesdatum ist deshalb vorerst nicht zu ermitteln. Ich danke Ludwig Burwitz vom Stadtarchiv Siegen für die Übersendung von Kopien der Urkunden und für seine zusätzlichen Mitteilung vom 23.1.2012.
412
|
»Die Gegend wimmelt dort von Wilddieben«
ist nun einmal meine Liebhaberei.« Anscheinend entsprach Brasilien aber doch nicht seinen Erwartungen. Mitte Mai 1891 kehrte er zu seiner Familie zurück und verbüßte seine Strafe bis zum 15. August dieses Jahres. Zwei Monate später sollte er den Mord am Förster Kroh begangen haben. Im Laufe der Ermittlungen wurde ihm schließlich, neben dem erwähnten Mordversuch an Hartnack, ein Mord am Förster Trembour, begangen am 27. Februar 1881 bei Burgholdinghausen – heute ein Stadtteil von Kreuztal im Siegerland –, zur Last gelegt. Besondere Verdachtsmomente waren die ähnliche Vorgehensweise in den drei Fällen, die Verwendung derselben Patronensorte bei den Taten und der Besitz eines Notizbuches, das dem verschwundenen des Friedrich Kroh auffallend ähnlich sei. Darüber hinaus sollte Wagebach dem Wildhändler Müsse, mit dem er zusammenarbeitete, anlässlich eines gemeinsamen Waldganges im Dezember 1891 gesagt haben, »wenn ihm hier ein Förster begegnete, dann ginge es dem ebenso, wie dem da drüben, den er vor kurzem erschossen hätte«. Mehrfach habe er erzählt, dass er sich »von einem Förster nicht mehr kriegen ließe«. Dies bestätigte die allgemeine Einschätzung der Staatsanwaltschaft. Schon in seiner Heimat habe Wagebach als »verwegener, gewalttäthiger Wilddieb und Forstfrevler« gegolten, der weniger einer geregelten Erwerbstätigkeit als »der Jagd obgelegen« sei. Im Siegerland sei er dann unter dem Namen »deutscher Hannes« »berüchtigt« gewesen.52 Wagebach beteuerte immer seine Unschuld.53 Die Untersuchungen blieben denn auch keineswegs auf ihn verengt, sondern bezogen einen erstaunlich großen Kreis von Verdächtigen ein. So wurden die Gebrüder Stenger auch nach der Verhaftung Wagebachs keineswegs ausgeschlossen, zumal sie sich in Widersprüche verwickelten, und am 1. April 1892 noch einmal kurzzeitig festgenommen. Ihre 27-jährige Schwester Katharina musste sich ebenfalls kritischen Fragen stellen.54 Letztlich ließ der Untersuchungsrichter den Verdacht aber fallen, weil sich das Alibi der Brüder erhärtete und weil er vermutete, dass kein »Wildschütz aus dem Wittgenstein’schen« Kroh, »einen der beliebtesten Beamten, streng, aber immer human«, ermorden würde, von dem man gewusst habe, dass er seinerseits nie auf einen Wilderer geschossen hätte.55
52 StAM, Nr. 10 Bd. 4, Bl. 684–710, Anklageschrift vom 21.5.1892 (Zitate Bl. 685v, 686r, 705r, 706v, vgl. 702v, 704v). Vgl. die Aussage von Robert Müsse am 28.3.1892: StAM, Nr. 10 Bd. 2, Bl. 334–341, hier bes. 339. Ein »Signalement« Wagebachs findet sich im Zusammenhang mit den Ermittlungen im Fall Trembour: StAM, Nr. 11 Bd. 1, Bl. 141. 53 Vgl. seine ersten Vernehmungen (auch mit Schilderung seines Lebenslaufes) in: StAM, Nr. 10 Bd. 2, Bl. 345–348 (29.3.1892), 413–416 (7.4.1892). 54 StAM, Nr. 10 Bd. 2, Bl. 372 r und v, vgl. 380 v, 382 v. Die Vernehmung Katharina (Catharina) Stengers ebd., Bl. 367v-370v. 55 StAM, Nr. 12 Bd. 2, o. Pag. (umfangreiche, sehr sorgfältige Notizen Wieruszowskis zu den Fällen Trembour, Kroh und Hartnack).
Ein Förstermord 1891 im Wittgensteinischen
|
413
Daneben ermittelte die Staatsanwaltschaft gegen zwei weitere Wilddiebe – Johannes Honig, den »Spatzenhannes«, einen Bergmann aus Steinbach, und Johannes Dietrich, einen Fabrikarbeiter aus Dreisbach –, gegen den »Haussohn« Robert Müsse,56 ebenfalls vorübergehend verhaftet, und dessen Vater Friedrich, Wildhändler zu Siegen – mit denen Wagebach verwandt war –, gegen den Wildhändler Beyer sowie gegen den Gastwirt Carl Zamponi zu Netphen, dem Handel mit gewildertem Wild in den vergangenen zehn Jahren vorgeworfen wurde. All diese Personen waren miteinander vernetzt: Wilddieberei und Handel mit gewildertem Wild erwiesen sich offensichtlich als ein einträgliches Geschäft, bei dem einen oder anderen kam die Jagdleidenschaft hinzu. Bei einem Ortstermin am 19. März 1892 im Raum Kreuztal – Kindelsberg wurden die Wege, Treffpunkte und Verstecke dieses Wilderer-Netzes rekonstruiert.57 Anlässlich dieses und weiterer Ortstermine sowie der von der Sache her gegebenen engen Zusammenarbeit kamen sich Untersuchungsrichter Wieruszowski und der Wittgensteinische Forstmeister Rotberg persönlich immer näher. Die erhalten gebliebenen Schreiben zeigen, dass man sich mehr und mehr auch private Dinge mitteilte.58 Für sachkundige Auskünfte wurden weitere Forstbeamte des Fürsten herangezogen. Wagebach verlangte deshalb am 7. Juni 1892, die Meinung unabhängiger Sachverständiger einzuholen, da die hiesigen Jäger gegen ihn voreingenommen seien.59 Dass Wieruszowski keinen günstigen Eindruck gewonnen hatte, macht eine wohl von ihm stammende Randbemerkung im Vernehmungsprotokoll deutlich, als Wagebach erklärte, er sei nicht zuletzt deshalb aus Brasilien zurückgekehrt, weil ihm »am Herzen« gelegen sei, »Frau u. Kinder nicht länger der Armenpflege zu überlassen«: »der Heuchler!«60 In den Untersuchungen werden die sozialen Zusammenhänge der Wilddieberei deutlich. Die Armut hatte sich zusehends verschärft. Von der Landwirtschaft konnte kaum jemand leben, und auch der Schieferbergbau war für immer weniger Menschen eine ausreichende Einkommensquelle. Um sich etwas zu entlasten, nutzten manche den fürstlichen Wald, um Brennholz zu holen sowie Laub und Heidekraut als Einstreu zu sammeln. Das war offiziell illegal, doch im Bewusstsein der Dorfbewohner nahmen sie lediglich alte Rechte wahr.61 Der Waldwärter drückte häufig ein Auge zu. Neben diesen eher bescheidenen Möglichkeiten musste die Wilddieberei geradezu verlockend wirken. Mit ihr konnte man sich 56 So in: StAM, Nr. 10 Bd. 4, Bl. 707, offenbar war er in Stellung bei einer Familie. 57 StAM, Nr. 10 Bd. 2. Den Vornamen des Wildhändlers Beyer (auch: Beier) konnte ich nicht herausfinden. Möglicherweise war er ebenfalls mit Wagebach verwandt: Wagebachs Mutter Margarethe war eine geborene Beier (ebd., Bl. 345) oder Bayer (vgl. Anm. 51). 58 WAM, Nr. 1587, z. B. Bl. 65–68. 59 StAM, Nr. 10 Bd. 4. 60 StAM, Nr. 10 Bd. 2, Bl. 414. 61 Das zeigen die Quellen zu den erwähnten Konflikten mit dem Fürsten.
414
|
»Die Gegend wimmelt dort von Wilddieben«
nicht nur selbst mit Fleisch versorgen, sondern es winkten durch den Verkauf an andere Personen und an Gastwirtschaften erhebliche Gewinne. Deshalb verwundert es nicht, dass sich ein derartiges Netzwerk von Wilddieben, Hehlern und Gastwirten bildete. Auffällig ist dabei, dass sich kaum Bauern in diesem Netzwerk befanden, sondern eher sozial bedrohte Grubenarbeiter und Tagelöhner, die sich teilweise noch für den Eigenbedarf Vieh hielten. Prozessordnung
Am 27. Juni 1892 begann der Prozess vor dem Königlichen Schwurgericht in Arnsberg, am 2. Juli desselben Jahres erging das Urteil.62 Mit dem Strafgesetzbuch vom 14. April 1851 war in Preußen das Strafverfahren grundlegend reformiert worden. Für mit schweren Strafen bedrohte Verbrechen mussten Geschworenengerichte gebildet werden, Staatsanwaltschaft und Verteidigung standen sich gegenüber, und der Prozess war öffentlich.63 Hingegen blieb die Todesstrafe für Mord erhalten. Während der Revolution von 1848/49 hatten die preußische Verfassunggebende Versammlung ebenso wie die Frankfurter Nationalversammlung noch mit überwältigender Mehrheit für die Abschaffung der Todesstrafe gestimmt. Nach der Niederschlagung der Revolution hatte dieses Ziel keine Chance mehr.64 Das Deutsche Reich übernahm mit dem Reichsstrafgesetzbuch vom 31. Mai 1870 im Wesentlichen die preußischen Bestimmungen. Die Todesstrafe für Hoch- und Landesverrat sowie für Mord konnte dabei nur gegen beträchtlichen Widerstand einiger Länder durchgesetzt werden. Das Gerichtsverfassungsgesetz von 1877 legte für das Verfahren vor einem Schwurgericht fest, dass die Geschworenen nicht nur über die Frage der Tat, sondern auch über Schuld oder Unschuld zu entscheiden hatten. Den Berufsrichtern blieb lediglich, das Strafmaß zu bestimmen und gegebenenfalls mildernde Umstände zu berücksichtigen. Da Geschworene mehrfach offensichtlich unsachgemäß urteilten, gab es häufig Kritik an dieser Praxis, die jedoch erst während der Weimarer Republik Folgen zeitigte.65 62 StAM, Nr. 10 Bd. 4, Bl. 761–817. 63 So hatte es schon die neue preußische Verfassung von 1850 – im Anschluss an die Verfassungsentwürfe und die dann oktroyierte Verfassung von 1848 – festgelegt. Vgl. Blasius: Kriminalität, 37, 41. 64 Richard J. Evans: Öffentlichkeit und Autorität. Zur Geschichte der Hinrichtungen in Deutschland vom Allgemeinen Landrecht bis zum Dritten Reich. In: Räuber, Volk und Obrigkeit, 185–258, hier 227–228. Vgl. Karl Kroeschell: Deutsche Rechtsgeschichte. Bd. 3: seit 1650. 3. Aufl. Wiesbaden 2001, 138–143, 155–164 (auch zum Folgenden). 65 Karl Kroeschell: Rechtsgeschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert. Göttingen 1992, 32–34.
Ein Förstermord 1891 im Wittgensteinischen
|
415
Das Strafverfahren gegen Wagebach
Schauen wir uns einmal an, wie die »Siegener Zeitung« über den Prozess berichtete. Ausführliche, protokollartige Darlegungen mischten sich dabei mit der persönlichen Meinung des Berichterstatters, wie sich gleich eingangs zeigt: »Unter sehr starkem Andrange des Publikums, so dass der Zuhörerraum bis auf den letzten Platz gefüllt war, begann heute die Verhandlung gegen den angeblichen Doppelmörder J. Wagenbach [so durchgängig in den Artikeln] aus Weidenau.« Der Angeklagte »sieht verschlagen und listig aus, die Augen blicken unstät, zuweilen tückisch; der kohlschwarze Vollbart und das gleiche Haar, das der Angeklagte trägt, dazu das bleiche Gesicht, geben dem Manne ein unheimliches Aeußere« [sic!]. Wagebach bestritt hingegen nach wie vor die beiden Morde. Den Mordversuch an Hartnack stellte er als »einen unglücklichen Zufall« dar – sein Gewehr sei losgegangen. Alle Vorhaltungen des Vorsitzenden, Landgerichtsdirektor Schneidewind, auf Beweisstücke und Zeugenaussagen wies er zurück.66 Im Fall Trembour ergab sich keine eindeutige Belastung Wagebachs, auch wenn der damals 7- und jetzt 18-jährige Robert Müsse, der oft mit Wagebach gemeinsam gewildert hatte, dessen Alibi ins Wanken brachte. Immer wieder trat hervor, welche Netze von Wilddieben in der Region vorhanden waren. Ein Zeuge erklärte: »die Gegend wimmelt dort von Wilddieben«. Deutlich wurde, dass einige Zeugen bei den ersten Verhören nach dem Mord an Trembour 1881 einen Meineid geleistet hatten, um den damals schon einmal verdächtigen Wagebach zu entlasten. Von seinen Freunden war offenbar eine gezielte »Erinnerungspolitik« betrieben worden.67 Im Fall Hartnack konnte der betroffene Förster, der wieder genesen war, selbst aussagen. Insbesondere wies er darauf hin, dass mit Absicht auf ihn geschossen worden sei, zufällig könne das Gewehr, unter Berücksichtigung aller Umstände, nicht losgegangen sein, wie es Wagebach behaupte.68 Den größten Raum nahm der Fall Kroh ein. Wilhelm Hartmann schilderte, wie er den Schwiegervater gefunden hatte. Sein Gewehr sei noch geladen gewesen, der Jagdranzen offenbar vom Körper abgezogen und möglicherweise geöffnet worden – hier wurde auf das verschwundene grüne Notizbuch hingewiesen. Sein Sohn war bei der Suche dabei gewesen. Er hatte den Großvater am Abend vorher bei der Arbeit auf dem Acker noch gesprochen, als dieser dem Wald entgegen geschritten war. Die von seinem Vater gehörten zwei Schüsse hatte er nicht vernommen, weil er zu dieser Zeit mit seinem rasselnden Wagen auf dem Heimweg gewesen war. Sie seien, 66 Siegener Zeitung Nr. 101, 30.6.1892 (Bericht über die Sitzungen am 27. und 28.6.). Besonders bedanken möchte ich mich bei Herrn Müller vom Stadtarchiv Siegen, der mir die Kopien der Zeitungsartikel zugänglich gemacht hat. 67 Siegener Zeitung Nr. 101, 30.6.1892 (Zitat); Nr. 102, 2.7.1892 (Müsse; dieser ging schon als Kind mit Wagebach zur Jagd und diente ihm z. B. als Treiber). 68 Siegener Zeitung Nr. 103, 3.7.1892 (Bericht über die Sitzung am 1.7.).
416
|
»Die Gegend wimmelt dort von Wilddieben«
wie andere Zeugen bestätigten, im Abstand von ungefähr zehn Minuten gefallen. Forstmeister Rot(t)feld beschrieb Förster Kroh als »sehr beliebt« und »herzensgut«, der den Wilderer wahrscheinlich nicht habe einfach niederschießen wollen und deshalb selbst zum Opfer geworden sei. Lehrer Hermann Kroh, Sohn des Försters, gab wichtige Hinweise zur Nutzung des grünen Notizbuches.69 Viele der weiteren Aussagen erwiesen sich als Gerüchte. Vor allem wurde mehrfach wiederholt, der Angeklagte habe gesagt, er werde eher einen Förster erschießen als erneut verhaftet zu werden. Belastend dürfte sich ausgewirkt haben, dass der Bergmann Heinrich Heimbach berichtete, er habe Wagebach ein Gewehr für die Jagd geliehen. Dieser habe im Wittgensteinischen mindestens zwei Tiere erlegen wollen, sei aber viel früher als erwartet und mit einem sonderbaren Wesen zurückgekommen. Als er ihn auf den Mord an Kroh und auf Gott angesprochen habe, habe Wagebach gemeint, »es gäbe keinen Gott und die Pfaffen redeten nur so und seine frivolen Redensarten schloß er damit, dass die Förster ja ihre Schnauze davon lassen könnten und einem nicht immer nachzulaufen brauchten«.70 Diese Schilderung bestätigte teilweise, vor allem im Blick auf die verfrühte Heimkehr, der 15jährige Carl Stein (1877–1967),71 der Stiefsohn des Angeklagten. Auch habe er ein grünes Buch bei Wagebach gesehen, das dieser, so die kleine Schwester, später verbrannt habe. Die Frage des Vorsitzenden, ob er wolle, dass sein Vater wieder nach Hause komme, verneinte er. Von ihrem Recht der Aussageverweigerung machte Wagebachs Frau Gebrauch.72 69 Kroh, Lehrer in Bettelhausen, war der Onkel meiner Oma, seine Schwester Katharina (1859–1939) deren Mutter. 70 So auch in: StAM, Nr. 10 Bd. 4, Bl. 791r: Der Zeuge berichtete, er habe einmal Wagebach gegenüber gesagt, er wolle keinen Mord auf dem Gewissen haben. Dieser habe entgegnet: »Du Dummkopf, Du bist auch noch so dumm und glaubst den Pfaffen, was die sagen, wissen sie selbst nicht, es gibt keinen Gott, den Pfaffen ist es nur darum zu thun, Geld zu bekommen, wenn man todt ist, ist es aus.« 71 Stadtarchiv Siegen, Standesamt Weidenau, Geburten 1877, Nr. 390. Die Geburtsurkunde enthält auch den Sterbevermerk. Danach starb Carl Stein in Linden (Rheinland), Standesamt Bielstein (Nr. 21/1967). Ich danke wieder Ludwig Burwitz für die Zusendung der Kopie. Verschiedene Stellen der Stadtverwaltung Wiehl (das heute für Bielstein und Linden zuständig ist) teilten mir am 8.2., 17.2. und 29.2.2012 mit, dass Stein zuletzt den Beruf eines Pförtners ausgeübt habe. Zuvor sei er als Fabrikarbeiter gemeldet gewesen. Am 2.8.1904 habe er in Gummersbach Anna Müller geheiratet (Standesamt Gummersbach, Nr. 58/1904). 1933 sei er von Hunstig (Gummersbach) in das Gemeindehaus in Linden zugezogen, habe sich 1951 nach Vollmerhausen (Gummersbach) abgemeldet und sei 1963 von Hesselbach (Rheinland-Pfalz) nach Linden zurückgekehrt, wo er bei seinem Schwiegersohn Josef Schmitz gewohnt habe. Steins Mutter ist in Linden bzw. Wiehl nicht nachweisbar. In Wiehl habe ich H. Barf, Petra Bollmann und Thomas Klein zu danken. 72 Siegener Zeitung Nr. 102, 2.7.1892 (Bericht über die Sitzung am 30.6.). Vgl. auch die Vernehmung Carl Steins: StAM, Nr. 10 Bd. 1, Bl. 26–31.
Ein Förstermord 1891 im Wittgensteinischen
|
417
Amtsrichter Wieruszowski unterlief jedoch dieses Recht, indem er deren Vernehmung durch ihn wiedergab – ein nach heutiger Anschauung höchst problematisches Verfahren. Danach hatte sie die verfrühte Rückkehr ihres Mannes aus dem Wittgensteinischen und sein »so eigenes« Verhalten sowie einige weitere Verdachtsmomente bestätigt, ohne dass sie präzise Beweise liefern konnte.73 Die vorzeitige Rückkehr Wagebachs nach Hause mitten in der Nacht passte im Übrigen gut in die Beweisführung der Staatsanwaltschaft: Zu Fuß könne man den Weg vom Tatort bis nach Weidenau »in mäßigem, gewöhnlichen Schritt mit einer halben Stunde Ruhepause in 7 Stunden 40 Minuten« zurücklegen, wie die Zeugen Landwirt Dinsch und Bergmann Honig selbst erprobt hatten. Dies stimmte ungefähr mit dem Zeitraum zwischen Tat und Ankunft zu Hause überein.74 Als wichtiger Belastungszeuge erwies sich Johannes Honig. Lange Zeit hatte er selbst zu den Verdächtigen gehört. Darüber hinaus hatte er früher mit Wagebach gewildert und war mit diesem gut befreundet – »sehr intim« – gewesen. Auf den Berichterstatter – der auch sonst in seiner Wortwahl und in seinen spärlichen Kommentaren durchblicken ließ, dass er von Wagebachs Schuld überzeugt war – machte er »einen durchaus glaubwürdigen Eindruck«; »der Mann hat sich gebessert«. Honig führte aus, dass Wagebach über ihn seinerzeit Krohs Revier kennengelernt und bei ihm vor dem Mordtag übernachtet habe. Er, Honig, habe ihn gebeten, »den alten Förster Kroh (zu) schonen, denn der thue Niemandem etwas zu Leide und schieße auch nicht«. Wagebach habe jedoch geantwortet, er lasse sich nicht kriegen und schieße lieber. Nachher habe er erklärt, die Förster »seien ja alle Spitzbuben«. Zusammengereimt habe er sich schließlich alles, nachdem Wagebach kurz nach dem Mord an Kroh erwähnt habe, er habe »nur ein kleines Häschen geschossen«, es aber liegen gelassen – ein solches sei jedoch gerade am Tatort gefunden worden. Die Darlegungen der Sachverständigen belegten insbesondere, dass die Art der Patronen und deren Ladung, mit denen Kroh und Trembour erschossen sowie der Schuss auf Hartnack abgegeben worden waren, dieselben waren und sich nur bei Wagebach, nicht aber bei anderen Wilderern fanden, gegen die eine Untersuchung stattgefunden hatte.75 In seinem Plädoyer würdigte der Erste Staatsanwalt Dr. Spengler Wagebach als einen »sehr intelligenten Menschen, der wohl in der Lage gewesen wäre, seinen Unterhalt durch Arbeit zu gewinnen, der es aber vorzog, lieber zu wilddieben und zu stehlen«. Im Unterschied zu anderen Wilderern, die sich scheuten, auf Förster zu schiessen, sei er »ein bösartiger, trotziger, wilder Mensch«, ja »ein ge73 Siegener Zeitung Nr. 103, 3.7.1892. Vgl. das Vernehmungsprotokoll: StAM, Nr. 10 Bd. 1, Bl. 24–26, 31–32. 74 StAM, Nr. 10 Bd. 4, Bl. 698r. 75 Siegener Zeitung Nr. 103, 3.7.1892. Vgl. dazu auch die Anklageschrift: StAM, Nr. 10 Bd. 4, Bl. 701v-702r. Am 27. und 30.6.1892 wurden ebenfalls Gutachter und Sachverständige gehört.
418
|
»Die Gegend wimmelt dort von Wilddieben«
waltthätiger und rücksichtsloser Mensch«, der vor Förstern nicht kehrt mache. Schon allein von seinem Charakter her seien ihm die Verbrechen zuzutrauen. Die verschiedenen Zeugenaussagen wertete der Staatsanwalt als handfeste Beweise, Zweifel an der Glaubwürdigkeit gerade der Hauptbelastungszeugen Johannes Honig und Robert Müsse ließ er nicht gelten. Den Geschworenen redete er ins Gewissen, »mannhaft und treu Ihrer innersten Überzeugung Ausdruck« zu geben und »diese schweren Thaten nicht ungesühnt« zu lassen, also auf Mord und nicht etwa nur auf Totschlag zu erkennen. Der Verteidiger Scheele forderte »Gerechtigkeit« für Wagebach, über den bereits vorab der Stab gebrochen worden sei. Er versuchte, das von dem Wilderer gezeichnete Bild ein wenig zu mildern und führte Beispiele an, bei denen dieser keineswegs »blindlings auf Menschen« geschossen habe. Im Falle Hartnack meinte er, Wagebach habe zwar vorsätzlich geschossen, den Förster jedoch nicht töten wollen. Für den Mord an Kroh gebe es keinen lückenlosen Beweis. Die Äußerungen Wagebachs, sollten sie überhaupt zutreffen, könnten ebenso gut Renommiergehabe statt Bekenntnis der Täterschaft sein. Honig sei keineswegs so glaubwürdig, wie er hingestellt werde. Wenn man aber zweifle, müsse man zugunsten des Angeklagten entscheiden. Noch problematischer sei die Beweislage im Fall Trembour. Der Rechtsanwalt fasste seine eigene Überzeugung dahingehend zusammen, dass er selbst weder mit Sicherheit sagen könne, Wagebach sei der Mörder, noch, dass er unschuldig sei. Deshalb müssten auch die Geschworenen besonders streng prüfen und »absolut von der Schuld des Angeklagten (...) überzeugt sein«. Niemand könne ihm nach einem Schuldspruch später »wieder das Haupt aufsetzen«. Wagebach hatte all den Ausführungen nichts mehr hinzuzufügen. Nach einer halben Stunde Beratung verkündete der Obmann der Geschworenen »unter lautloser Stille und allgemeiner Spannung«, dass diese im Fall Trembour auf »nicht schuldig«, in den beiden anderen Fällen aber auf »schuldig« erkannt hätten. Der Staatsanwalt beantragte sodann die entsprechenden Urteile, denen das Gericht folgte: Wagebach wurde im Fall Trembour freigesprochen, im Fall Kroh zum Tode und im Fall Hartnack zu 12 Jahren Zuchthaus und Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt. »Wagenbach nahm das Urtheil mit äußerlich großem Gleichmuthe hin und verzog keine Miene. Auch das Publikum, das nicht nur im Gerichtssaal, sondern auch vor dem Gerichtsgebäude in großer Anzahl stand, verhielt sich ruhig.«76 Wir wissen nicht, ob Wagebach wirklich der Mörder war. Weder gab es ein Geständnis noch eine lückenlose Indizienkette. Das wichtigste Beweismittel, die Patronen und ihre spezifische Ladungsweise, wurde von den Geschworenen offenbar nicht als ausreichend angesehen, sonst hätten sie Wagebach nicht vom 76 Siegener Zeitung Nr. 104, 5.7.1892.
Ein Förstermord 1891 im Wittgensteinischen
|
419
Mord an Trembour freisprechen können. Im Grunde stützte sich der Schuldspruch im Fall Kroh auf angebliche Äußerungen Wagebachs, die dieser abstritt oder auch anders gemeint haben konnte, auf die verfrühte Rückkehr und sein seltsames Verhalten. Honig könnte alle konkreten Angaben von anderer Seite gehört und mit seiner Aussage versucht haben, sich selbst zu entlasten. Auffällig ist die Übereinstimmung zwischen seiner Charakteristik Krohs und derjenigen durch Forstmeister Rotfeld. Natürlich mag es sein, dass der Wilderer eine heimliche Sympathie für den Förster hatte, aber er könnte auch von Rotfelds Worten erfahren und dies gleich für seine Aussage genutzt haben, um die Geschworenen zu beeinflussen. Darüber hinaus war die Prozessführung aus heutiger Sicht teilweise fragwürdig. Abgesehen davon, dass Frau Wagebachs Erklärungen während der Vernehmung trotz ihrer Aussageverweigerung im Prozess wiedergegeben wurden, ergeben sich Zweifel an der Unabhängigkeit der Geschworenen, weil einer von ihnen der Fürst zu Wittgenstein selbst war, der die Belohnung zur Ergreifung des Krohschen Mörders ausgesetzt und ein starkes Interesse daran hatte, ein abschreckendes Exempel zu statuieren.77 Dass der Verteidiger Wagebachs ihn offenbar als Geschworenen nicht ablehnte, weist auf die starke Position des Fürsten hin. Diese dürfte er auch während der Urteilsberatungen in die Waagschale geworfen haben. Der Angeklagte und der Untersuchungsrichter
Wagebach selbst gab offenbar Amtsrichter Wieruszowski die Hauptschuld an seiner Verurteilung. Am 22. September 1892 hatte er ihn durch seinen Verteidiger Scheele als befangen abgelehnt.78 Und am 4. April 1893 berichtete der Oberaufseher des Arnsberger Gefängnisses, Wagebach habe um ein Gespräch mit dem Pastor Klöhne gebeten, das von seiner Seite jedoch »laut«, »theilweise recht ungebührlich« und »sehr erregt« geführt worden sei. Er habe dann »folgende Worte« geäußert: »Wenn ich an Dietrich seiner Stelle – aus Dreisbach – wäre, ich hätte dem Juden was Anderes gezeigt, der wäre jetzt nicht mehr! Mit lauter Spitzbüberei ist die ganz Sache betrieben, das ist aber kein Wunder, denn wenn der Staat seine Spitzbuben nicht selbst groß zöge, dann nähmen sie nicht solchen Schuft von Juden als Untersuchungsrichter.«79 Das Zitat stammt vermutlich nicht wörtlich von Wagebach, sondern wurde vom Aufseher »in Form« gebracht. Sollte es im Kern zutreffen, so spielte Wagebach offenbar auf eine Zusammenkunft des Wilddiebs Dietrich mit dem Untersuchungsrichter an. Möglicherweise hatte Wagebach erst jetzt erfahren, dass Wieruszowski, durchaus ungewöhnlich für einen 77 StAM, Nr. 10 Bd. 4, Bl. 813v. 78 StAM, Nr. 10 Bd. 4, Bl. 877v. 79 StAM, Nr. 10 Bd. 4, o. Pag.
420
|
»Die Gegend wimmelt dort von Wilddieben«
Amtsrichter im damaligen Preußen, aus einer jüdischen Familie stammte.80 Es spielte für Wagebach offenbar keine Rolle, welche Qualifikationen Wieruszowski hatte. Insofern entsprach sein Denken den damaligen rassistischen Vorstellungen, Jude bleibe Jude und sei Träger allen Übels. Später sollte Wieruszowskis Herkunft Folgen haben. 1893 wechselte er als Landrichter nach Elberfeld und 1899 in gleicher Funktion nach Köln, wo er 1906 trotz Bedenken wegen »seiner Eigenschaft als Jude« zum Oberlandesgerichtsrat und 1921 zum Senatspräsidenten befördert wurde – einer der wenigen Gerichtspräsidenten jüdischen Glaubens in Deutschland.81 1923 ernannte man 80 Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung Rheinland, Gerichte Rep. 0168 Nr. 574– 577; vgl. Becker: Wieruszowski, 404–405. Wieruszowski entstammte einer traditionelljüdischen Familie und hatte in Görlitz den Cheder besucht. 1890 heiratete er die Frauenrechtlerin Jenny Landsberg (1866–1919), ebenfalls aus einer jüdischen Familie. Mit ihr hatte er vier Töchter: Marie (1891-?), Helene (1893–1978), Lilli (1899–1971) und Ruth (1910-?). Die Töchter wurden evangelisch getauft, wechselten allerdings später ihren Glauben. Wie seine Tochter Ruth hervorhebt, war für Wieruszowski die jüdische Religion nicht mehr von besonderem Belang, obgleich er nicht konvertierte; stattdessen lebte er in der Gedankenwelt der Aufklärung und der deutschen Klassik (Ruth Pincus-Wieruszowski: Erinnerungen an Alfred Wieruszowski [1857–1945]. Msschrftl. Ms. in: Leo Baeck Institute New York, Center for Jewish History, Nr. 413667, 2–3, 6–7; digital zugänglich: http:// access.cjh.org/home.php?type=extid&term=413667#1 [9.3.2012]). Von ihm ist nicht bekannt, dass er sich aktiv am Leben der jüdischen Gemeinde in Siegen beteiligt hat. Dies bestätigt auch Ulrich Friedrich Opfermann, der sich intensiv mit der Geschichte der Juden im Siegerland beschäftigt hat (vgl. Opfermann: Scheibenklirren), in einer Mitteilung vom 7.7.2011. 81 Anlässlich der anstehenden Beförderung schloss 1905 der Oberlandesgerichtspräsident sein befürwortendes Gutachten: »Ist von mir, soweit ihm nicht seine Eigenschaft als Jude entgegensteht, für zum Oberlandesgerichtsrat außerordentlich gut geeignet erklärt« (Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung Rheinland, Gerichte Rep. 0168 Nr. 574, Bl. 204; Hervorhebung von mir). Ähnlich schon, ebenfalls auf die »Eigenschaft« hinweisend, 1902, als sich Wieruszowski, diesmal noch erfolglos, auf eine Oberlandesgerichtsratsstelle beworben hatte (ebd., Bl. 182). Ansonsten ist in seiner Personalakte kein vergleichbarer Hinweis zu finden. Als seine Religion wird wechselweise »jüdisch« oder »mosaisch« angegeben. In seinem Lebenslauf vom 19.3.1879 bezeichnete er sich selbst als »israelitischer Confession« (Bl. 8). Als erster Jurist jüdischen Glaubens, der in Deutschland zum Präsidenten eines Gerichtes berufen wurde, gilt Nathan Stein (1857–1927). Er wurde 1914 zum Präsidenten des Landgerichts Mannheim ernannt (http://de.wikipedia.org/wiki/Nathan_Stein_(Jurist) [21.12.2011]). Zahlreiche Juden studierten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Jura, wählten dann aber meist den Beruf eines Anwalts, weil das Richteramt »nur mit größten Schwierigkeiten zu erreichen« war (Deutsch-jüdische Geschichte 3, 41, vgl. 58–61 [Monika Richarz]). Auch in Preußen waren jüdische Richter eher selten: 1907 gab es 155 jüdische (4,2 %) und 108 konvertierte Richter, bis 1914 sank der Anteil jüdischer Richter auf 2,8 % (ebd., 60–61; vgl. Juden in Preußen. Hg. von Ernst Gottfried Lowenthal. 2. Aufl. Berlin 1982). Für die Zeit davor siehe Monika Richarz: Der Eintritt der Juden
Ein Förstermord 1891 im Wittgensteinischen
|
421
ihn zum Präsidenten der Reichsdisziplinarkammer. 1926 trat er in den Ruhestand, lehrte aber noch weiter als Honorarprofessor an der Universität Köln. Seine besonderen Schwerpunkte, zu denen er auch veröffentlichte, waren Handels- und Wirtschafts- sowie Eherecht und die Gleichberechtigung der Frau. Im April 1933 verzichtete er nach judenfeindlichen Vorgängen an der Universität auf eine weitere Lehrtätigkeit. In der folgenden Zeit musste Wieruszowski zahlreiche Demütigungen erleiden, blieb aber zunächst vor Verfolgungen verschont, weil er nach dem Tod seiner ersten – jüdischen – Frau eine Nichtjüdin geheiratet hatte. Der Aufforderung im Oktober 1944, sich zu trennen – das hätte die »Verschickung« Wieruszowskis in ein Vernichtungslager zur Folge gehabt –, kam das Ehepaar nicht nach. Es fuhr gemeinsam nach Dresden, wo es von seiner ehemaligen Hausangestellten untergebracht wurde, und Anfang 1945 weiter nach Berlin. Dort starb Alfred Wieruszowski am 9. Februar 1945 im Jüdischen Krankenhaus, seine Frau wenig später.82 In den Quellen zum gesamten Verfahren um den Mord an Förster Kroh findet sich keine Anspielung auf Wieruszowskis Konfession. Das ist angesichts des im Wittgensteinischen und im Siegerland verbreiteten Antisemitismus durchaus bemerkenswert. Auch in den Beziehungen zwischen Wieruszowski und Forstmeister Rotberg ist von judenfeindlichen Vorurteilen nichts zu spüren. Es könnte sein, dass Wagebach nun, als es kaum noch Hoffnung auf Rettung gab, jemanden brauchte, den er für sein Schicksal verantwortlich machen konnte. Beeinflusst von der gerade damals spürbaren antijüdischen Stimmungsmache, identifizierte er »den Juden« als seinen »Feind«, als »Schuft« und »Spitzbuben«, der ihn ins Verderben ziehen wollin die akademischen Berufe. Jüdische Studenten und Akademiker in Deutschland 1678– 1848. Tübingen 1974, hier bes. 95–109, 178–188. 82 Wieruszowskis zweite Frau Frieda Bartdorff (1874–1945), mit der er 1921 die Ehe geschlossen hatte, war mit Adolf Fischer (1856–1914) verheiratet gewesen und hatte mit ihm das 1913 eröffnete Museum für Ostasiatische Kunst in Köln gegründet, dessen Leitung sie 1937 aufgeben musste. Die Töchter Wieruszowskis emigrierten nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Politisch war er in der Deutschen Demokratischen Partei engagiert. Siehe Pincus-Wieruszowski: Erinnerungen, hier z. B. 12–16, 18, 23–24, 27–28, 30–55; zum beruflichen Werdegang, aber auch zu Familienstand und Vermögensverhältnissen: Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung Rheinland, Gerichte Rep. 0168 Nr. 574–577. Vgl. Becker: Wieruszowski, 403–413; Rheinische Justiz, 638–639; Frank Golczewski: Kölner Universitätslehrer und der Nationalsozialismus. Personengeschichtliche Ansätze. Köln, Wien 1988, 110, 449. Auch: www.geni.com/people/FriedaWieruszowski/6000000000472521691; www.lokalkompass.de/kleve/politik/qnur-wer-dievergangenheit-kennt-kann-sie-auch-erkennenq-d106969.html; www.rp-onlinde.de/nieder rhein-nord/kleve/nachrichten/erinnerung-an-das-grauen-1.2547636; www.museenkoeln. de/ausstellungen/mok_0910_100Jahre/100Jahre_e.asp [alle 13.1.2012]; zu den Töchtern Helene und Lilli Angaben auf Wikipedia. Zum Jüdischen Krankenhaus vgl. Rivka Elkin: Das Jüdische Krankenhaus in Berlin zwischen 1938 und 1945. Berlin 1993.
422
|
»Die Gegend wimmelt dort von Wilddieben«
te.83 Möglicherweise war ihm bekannt, dass im Wittgensteinischen und im Siegerland viele evangelische Pastoren zu den entschiedensten Anhängern der antisemitischen Christlich-Sozialen/Deutschkonservativen Partei gehörten.84 Vielleicht hatte er gedacht, der Gefängnispfarrer zähle auch zu diesem Kreis, und versucht, ihn mit dem Argument, der Untersuchungsrichter sei Jude, dafür zu gewinnen, sich für ihn einzusetzen. Pfarrer Karl August Ludwig Klöne (1836–1909) – wie er richtig hieß – soll zwar lutherisch ausgerichtet und von der Erweckungsbewegung geprägt gewesen sein, doch aus seiner Tätigkeit in Arnsberg zwischen 1870 und 1909 sind keine judenfeindlichen Aktivitäten überliefert.85 Das Ende
In der Geschichte um den Mord an Förster Kroh werden Mechanismen sichtbar, wie Menschen in einer außergewöhnlichen Situation handelten und wie sich eine judenfeindliche Atmosphäre derart niederschlug, dass Wagebach den Untersuchungsrichter als »den Juden« für das Böse verantwortlich machte. Insgesamt treten die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse in der dortigen Region hervor. Wir erhalten Einblick in die Probleme der Umbruchzeit. Als Hintergrund der Wilddieberei erscheint Jagdleidenschaft, viel mehr jedoch Armut. Darüber hinaus ist sie Ausdruck für soziale Konflikte mit dem Fürsten. Gewerbsmäßige Hehler und Händler nutzten die Zustände, um von dem dichten Netzwerk der Wilderei zu profitieren. Von der Bevölkerung wurden die Wilderer weitgehend gedeckt, doch der Mord an Friedrich Kroh ging zu weit und erschütterte alle. So verdeutlicht unsere Geschichte schließlich die seinerzeitigen Verfahren der Ermittlung und den Ablauf eines Mordprozesses. Keineswegs galt es damals im Übrigen für alle als ausgemacht, dass Wagebach der Mörder war. So wie es viele Denunziationen gab, um sich die Belohnung zu 83 Für die Mechanismen der Übertragung, einen »Feind« als »Juden« zu identifizieren, finden sich zahlreiche Beispiele in der Geschichte. So wurden oft gegnerische Fußballvereine selbst dann als »jüdisch« bezeichnet, wenn deren Spieler keineswegs jüdischen Glaubens waren. Vgl. Dietrich Schulze-Marmeling: Fahrräder, Juden, Fußball: Ajax Amsterdam. In: Davidstern und Lederball. Die Geschichte der Juden im deutschen und internationalen Fußball. Hg. von Dietrich Schulze-Marmeling. Göttingen 2003, 390–418, hier 410–414; Moshe Zimmermann: Fußball. In: Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur. Hg. von Dan Diner. Bd. 2. Stuttgart, Weimar 2012, 396–400, hier 398–399. 84 Opfermann: Scheibenklirren, 32–33. 85 Dankenswerte Mitteilung von Michael Gosmann, Stadtarchiv Arnsberg, vom 10.2.2012. Im Landeskirchlichen Archiv der Evangelischen Kirche von Westfalen in Bielefeld befinden sich weder die Personalakte Klönes noch sonstige einschlägige Unterlagen (Mitteilung vom 8.3.2012, ich danke Claudia Brack für die Recherche).
Ein Förstermord 1891 im Wittgensteinischen
|
423
verdienen, und dabei auch Wagebach belastet wurde,86 verbreiteten sich in der Bevölkerung immer wieder Gerüchte über andere mögliche Mörder. Dies hielt selbst nach dem Urteilsspruch an. Nicht zuletzt Gendarm Linnenkohl meldete entsprechende Hinweise der Staatsanwaltschaft weiter. So berichtete er am 14. März 1892, Honig habe auf das Gerücht, ein Langenbach sei der Mörder, in einer Wirtschaft geantwortet: »Das war kein Langenbach, das war ein ganz anderer Bach.«87 Dennoch wurde Friedrich Langenbach am 12. April vernommen.88 Während der Versuche, eine Revision des Urteils zu erreichen, gab eine Frau Schneider aus Holzhausen an, Honig sei der Mörder. Dem habe Robert Müsse widersprochen: Wagebach habe Kroh erschosssen.89 Im September 1893 schrieb ein »Siegfried« aus Dotzlar, Wagebach sei unschuldig, aber er sei nicht so dumm, den wahren Mörder, den er kenne, zu offenbaren.90 1908 erhob der Wittgensteinische Forstmeister Reinhardt den Verdacht, die Frau eines Landwirtes, verwandt mit den Stengers, sei an Krohs Ermordung beteiligt gewesen. Die Ermittlungen blieben ohne Ergebnis.91 Zu dieser Zeit war Wagebach längst tot. Alle Anträge auf Revision oder Wiederaufnahme des Verfahrens waren als unbegründet abgewiesen worden. Eine Begnadigung Wagebachs lehnte Wilhelm, König von Preußen, am 14. Juni 1893 mit eigenhändiger Unterschrift ab.92 Daraufhin gab der Erste Staatsanwalt Spengler aus Arnsberg am 24. Juni 1893 öffentlich bekannt: »Der Gärtner Johannes Wagebach aus Weidenau, welcher durch Urtheil des Schwurgerichts zu Arnsberg vom 2. Juli v. J. wegen Mordes zum Tode verurtheilt worden, ist in Vollzug dieses
86 Vgl. z. B. StAM, Nr. 10 Bd. 4: Am 17. Mai 1892, also noch kurz vor der Fertigstellung der Anklageschrift, sagte ein Gefängnisinsasse aus, Wagebach habe ihm gegenüber geäußert, dass er »den Kopf noch abgeben müsse«. Auch habe ein Holzhauer mit angesehen, wie er einen Förster erschossen habe. Wagebach habe ihn verschont, nachdem er Stillschweigen geschworen habe. 87 StAM, Nr. 10 Bd. 2, Bl. 238. Dabei hieß es, Langenbach stamme aus Arfeld, einem Nachbardorf Dotzlars, obwohl dort lediglich seine Mutter lebte und er aus Laasphe kam (s. folgende Anm.). 88 StAM, Nr. 10 Bd. 3. 89 StAM, Nr. 10 Bd. 4, Bl. 958: Anzeige des Fuß-Gendarmen Linnenkohl am 30.10.1892. 90 StAM, Nr. 10 Bd. 4. 91 WAM, Nr. 1587, Bl. 99–100. Es wäre zu prüfen, ob Forstmeister Reinhardt mit jenem Gotthold Reinhardt, Direktor der fürstlichen Rentkammer, identisch ist, der im Juli 1933 in einem Vortrag die wirtschaftspolitischen Vorstellungen der NSDAP kritisierte und zuvor schon eine Zahlung an die SA verweigert hatte. Er wurde von einem SA-Kommando festgenommen und derart verprügelt, dass er einen Schädelbruch davon trug (Opfermann: Scheibenklirren, 66). 92 StAM, Nr. 10 Bd. 4, Bl. 1073.
424
|
»Die Gegend wimmelt dort von Wilddieben«
Urtheils heute früh 6 Uhr auf dem hiesigen Gefängnißhofe mittels des Beils enthauptet.«93 Vor seiner Hinrichtung soll Wagebach das Abendmahl verweigert sowie »trotzig und wütend den Zuspruch eines Pfarrers unbeachtet gelassen haben«.94 6 Der Gedenkstein für den ermordeten Waldwärter Ob dies damit zuFriedrich Kroh, davor Magda Imhof, die Ehefrau eines sammenhing, dass seiner Enkel (Aufnahme vermutlich aus den 1920er sein Angriff auf den Jahren, Privatarchiv Heiko Haumann) »Schuft von Juden« nichts gefruchtet hatte? Dieser war im Übrigen keineswegs ein unbedingter Anhänger der Todesstrafe, hatte jedoch auf das Strafmaß keinen Einfluss.95 Fällig war noch die Verteilung der ausgesetzten Belohnung. Forstmeister Rotberg meinte in seinem Bericht, die Verantwortlichen seien sich einig, »dass das 93 StAM, Nr. 10 Bd. 4. Bl. 1086; Siegener Zeitung Nr. 148, 27.6.1893. Die Bekanntmachung wurde, wie aus den Akten hervorgeht, noch in weiteren Zeitungen publiziert. Erst in den 1830er Jahren hatte in Preußen die Enthauptung das Rädern als häufigste Hinrichtungsart abgelöst. In den beiden folgenden Jahrzehnten war die Öffentlichkeit nach und nach weitgehend von dem »Schauspiel« ausgeschlossen worden, obwohl dieses Verbot immer wieder umgangen wurde. Vgl. Evans: Öffentlichkeit, 185–258. 94 Förstermord in Dotzlar (Website). 95 In Wieruszowskis Aufsatz »Goethe und die Todesstrafe« (Juristische Wochenschrift 61/12 [1932], 842–845, wieder abgedruckt in: »Das Kind in meinem Leib.« Sittlichkeitsdelikte und Kindsmord in Sachsen-Weimar-Eisenach unter Carl August. Eine Quellenedition 1777–1786. Hg. von Volker Wahl. Weimar 2004, 239–246) ist sein Bedauern spürbar, dass der von ihm verehrte Goethe 1783 die Todesstrafe für die Kindsmörderin Johanna Höhn befürwortet hatte. »Lag für Goethe die Sache nicht etwa so, dass er die staatspolitische Notwendigkeit um so schroffer hervorkehren zu müssen glaubte, je tiefer er das Geschick Gretchens [im »Faust« 1. Teil] innerlich durchlebt und je leidenschaftlicher er es zu dichterischen Ausdruck gebracht hatte? (…) Kennt nicht jeder Richter das Gefühl, eine ihm persönlich irgendwie verbundene Partei um so schärfer beurteilen zu müssen, je mehr ihn die Besorgnis beherrscht, jene persönliche Verbundenheit könne ihn zu einer Begünstigung irreleiten?« (244) 1909 hatte Wieruzszowski auch ein Buch veröffentlicht: Goethe als Rechtsanwalt; leider war es mir nicht zugänglich.
Ein Förstermord 1891 im Wittgensteinischen
|
425
größte Verdienst in der Entdeckung des Täters dem Heinrich Dinsch in Rückershausen gebührt«. Ihm wurden 300 Mark zugesprochen. Da er zuvor schon einmal wegen seiner Mitwirkung bei der Aufklärung des Mordversuches an Förster Hartnack 500 Mark erhalten hatte, konnte er den Hauptanteil der Belohnung entgegennehmen. Weitere je 300 Mark fielen an den Gendarmen Linnenkohl sowie an Johannes Honig, schließlich 100 Mark an Wagebachs Stiefsohn Karl Stein. Fürst Albrecht sprach dann auch dem Gendarmen Sudhof eine noch festzulegende »Numeration« zu.96 Im September 1911 bat ein Lehrer, der einen Wilderer-Roman schreiben wollte, um die Akten, vergeblich natürlich.97 Am 12. Oktober 1911 wurde schließlich mit einer kleinen Feier, der die Angehörigen Krohs beiwohnten, der Denkstein für den ermordeten Förster eingeweiht. Er trägt, vom Fürsten genehmigt, die Inschrift: »Hier starb in treuer Pflichterfüllung durch Wilderers Hand am 12. October 1891 der Fürstliche Waldwärter Friedrich Kroh aus Dotzlar.«98 (Abb. 6)
96 WAM, Nr. 1587, Bl. 73–75 (Bericht des Forstmeisters Rotberg, 10.8.1893). Vgl. auch die Schreiben des Ersten Staatsanwaltes Spengler vom 21.7.1893 und des Landrichters Wieruszowski (jetzt in Elberfeld) vom 3.8.1893 mit leichten Akzentverschiebungen (Bl. 79–82). 97 StAM, Nr. 10 Bd. 4. 98 WAM, Nr. 1587, Bl. 109–110. Abbildung in: Das mittlere Edertal, 205.
Miniaturen Stefan, der Gottesnarr, oder: Spiegel der sündigen Welt* In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts häufen sich Berichte über »Gottesnarren« (jurodivye). Einer von ihnen war Stefan Trofimovič Nečaev aus Galič. In einem Brief an seine Mutter Evdokija und seine Frau Akilina legte er seine Motive dar, warum er ein heiliger Narr geworden war, und bat sie um Verständnis dafür, dass er nicht bei ihnen bleiben konnte. Bereits seit seiner Jugend hatte er den Drang zum Gottesnarren gespürt. Für ihn war die Welt »trügerisch« und »lüstern«, sie mäste »den Körper den Würmern zum Fraß« und verderbe die Seele. So hatte er schon einmal das Haus verlassen, war aber noch einmal zurückgekehrt, nachdem seine Mutter ihm geschrieben hatte, wie sehr sie leide. Er wollte sie trösten und heiratete. Doch schließlich konnte er es nicht mehr aushalten, ging für immer fort und lebte als Narr. Seine Mutter und seine Frau unterstellte er Gottes Schutz – bat in einem anderen Brief allerdings auch seinen Onkel, sich um die Familie zu kümmern –, weil dieser ein »besserer Hirte (sei), als ich einer bin«. Er könne diese Welt nicht lieben und müsse sich deshalb aus ihr zurückziehen. Für die »vergängliche Welt« sei er gestorben. Seine Mutter und seine Frau forderte er auf, wie andere fromme Frauen zu leben und weltliche Vergnügungen zu verachten. Am 13. Mai 1667 starb er und wurde unter Teilnahme hoher Geistlicher und Adliger beigesetzt.1 Dieses einzigartige Dokument macht deutlich, dass ein Mensch, der sich zum Gottesnarren berufen fühlte, alle Verbindungen zu seiner bisherigen Welt abbrach und in eine neue eintrat. In der Regel erhielten die »Narren in Christo«, wie sie auch genannt wurden, ihre Eingebung durch eine Vision, eine wunderbare Genesung oder ein besonderes Erlebnis. Ursprünglich waren dies nur Männer, seit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wird auch von Frauen berichtet. Die Gottesnarren führten ein asketisches Leben, gingen in Lumpen, oft sogar nackt, wirkten wie wahnsinnig. Die »sündige« Welt verfluchten und beschimpften sie, hielten ihr alle Laster vor und provozierten sie mit ihren Blößen. Auch die Kirche wurde nicht verschont, der Ritus in als anstößig empfundenen Verhaltensweisen verhöhnt. Zu diesen gehörten das Schweigen und das unverständliche Stammeln – im Innern sprachen sie dabei mit Gott –, die Obdachlosigkeit und Nacktheit * Erstpublikation in: Heiko Haumann: Geschichte Russlands. Neuausgabe Zürich 2003 (2. Aufl. 2010), 177–179. 1 Dmitrij S. Lichačev, Aleksandr M. Pančenko: Die Lachwelt des alten Rußland. Mit einem Nachtrag von Jurij M. Lotman und Boris A. Uspenskij. Hg. von Renate Lachmann. München 1991, 171–180, Zitate 173, 175, 178, vgl. 91–92. Die Texte dieses Gottesnarren wurden von N. V. Ponyrko entdeckt und zum Druck vorbereitet.
Spiegel der sündigen Welt
|
427
oder auch das Anlegen von Ketten sowie das Verlachen der Welt durch »Possenreißen« und offenen Tadel gegenüber hochgestellten Personen, selbst gegenüber dem Zaren. Quellen über einen Christusnarren sind erstmals für das Ende des 11. Jahrhunderts im Kiever Höhlenkloster überliefert, dann wieder seit dem 14. Jahrhundert. Lange Zeit galten diese Menschen aufgrund ihres Auftretens als geistig und körperlich Behinderte. Diese Ansicht ist inzwischen eindeutig widerlegt worden. Statt dessen werden sie heute von einigen Wissenschaftlern als Teil einer spezifisch russischen »Lachwelt« gedeutet, mit der sich das Volk eine Gegenkultur zur herrschenden geschaffen habe.2 Über das Lachen würden die Mächtigen der Welt verächtlich gemacht, in den Ausdrucksformen entstehe eine »verkehrte« Welt. Neben den Gottesnarren stünden etwa die Gaukler, die skomorochi, oder die balagury, die mit den Worten spielen und dadurch verspotten, die Parodienschreiber und die Maler der Volksbilderbögen, der lubki, in dieser Tradition. Von der Kirche und den staatlichen Organen wurde all dies als Blasphemie und Herausforderung verstanden, selbst wenn die Gottesnarren vielfach doch als heilig und unantastbar galten, die Kirche nicht umhin kam, sich ihrer Verehrung anzuschließen. Um so mehr überrascht dann, dass sich gerade Zar Ivan IV. auch Formen des Gottesnarrentums bediente. Er legte sich das Pseudonym »Parfenij der Gottesnarr« zu, beschimpfte andere in der Weise, wie es Gottesnarren taten, erniedrigte sich äußerlich und schuf sich mit der opričnina ein »verkehrtes« Reich mit vielen parodistischen Elementen, die allerdings zugleich von brutaler Grausamkeit begleitet waren. Ivan kannte die Volksbräuche, er liebte das Gaukel- und Theaterspiel. Aber lässt sich daraus folgern, dass er sich in die Gegenkultur der »Lachwelt« einordnete? Oder nutzte er diese Mittel nur – ähnlich wie später Peter I. mit seinen Parodien auf die traditionelle Welt –, um seine Gegner zu verspotten und sich gegen sie durchzusetzen, möglicherweise auch das Volk auf seine Seite zu ziehen? Vielleicht dachte er, dass die Gläubigen hinter seinem Handeln, wie bei einem Christusnarren, besondere Heiligkeit vermuteten.3 Überhaupt ist der Begriff der »Lachwelt« missverständlich. Im Lachen drückte sich ein Weinen über den Zustand der Welt aus, in den Parodien und Spielen war oft Verzweiflung spürbar. Ebenso kann nicht alles einfach als »Gegenkultur« verstanden werden. In vielen Fällen setzten sich vorchristliche, magische Praktiken fort. Das anstößige, »verkehrte« Verhalten der Christusnarren spiegelte jene Welt wider, die verändert werden sollte, war also kein Spiel und schon gar nicht 2 Diese Konzeption geht zurück auf Michail Bachtin: Rabelais und seine Welt. Volkskultur als Gegenkultur. Hg. von Renate Lachmann. Frankfurt a. M. 1987 (russisch 1965). Bachtin (1895–1975) hatte seine kulturtheoretischen Überlegungen bereits Ende der zwanziger Jahre entwickelt, konnte sie aber nicht zusammenhängend veröffentlichen. 3 Vgl. Lotman und Uspenskij in: Lichačev, Pančenko: Lachwelt, 198.
428
|
Stefan, der Gottesnarr
»komisch«. Die Magie, von der Kirche als Werk des Teufels angegriffen, konnte die Menschen mit der jenseitigen Welt in Verbindung bringen, das Lachen war nicht heiter, sondern oft schrecklich, konnte allerdings auch Trost spenden. Diese Linie führt, selbstverständlich in ganz anderem Rahmen, bis hin zu den Satiren und Grotesken russischer Dichter.4 Auf jeden Fall wird hier etwas vom »EigenSinn« vieler Menschen spürbar. Viele Christusnarren entschieden sich dafür, sich zu den Altgläubigen zu bekennen. Manche wurden dazu eher gezwungen, weil sie keine Aufnahme in den orthodoxen Klöstern fanden, andere wählten diesen Weg aus Überzeugung, weil sich die offizielle Kirche immer weiter vom christlichen Ideal entferne. Damit gerieten sie aber in die politischen Wirren der Zeit. Am Hof der Bojarin Morozova bildete sich ein regelrechter Zirkel von Gottesnarren, der wie die Bojarin den Herrschenden ein Dorn im Auge war, und auch in die Auseinandersetzungen am Hof wurden sie mit häufig tödlichen Folgen hineingezogen. Mehr und mehr hatten sie unter Verfolgungen zu leiden. »Träger härener Hemden, Nackte und Kettenträger« waren festzunehmen. Ursprünglich ging die Initiative dazu von der Kirche aus, doch zusehends wandte die weltliche Obrigkeit ihre Aufmerksamkeit den Gottesnarren zu. Ermittlungen und Verhöre überließ sie aber nach wie vor geistlichen Institutionen. Auf diese Weise sind wiederum einzigartige Selbstzeugnisse überliefert. 1733 wurde in der Uspenskij-Kathedrale im Moskauer kreml’ ein solcher Gottesnarr verhaftet. Erkannt hatte man ihn an der eisernen Kappe, die er auf dem Kopf trug, an seinem Haar, das von Läusen verfilzt war, an seinem Holzstock und – während des Verhörs – an den Ketten, die er unter der Kleidung angelegt hatte. Er gab an, Petr Sergeev zu heißen, 73 Jahre alt und kopfsteuerpflichtig zu sein, als Bauer aus dem Dorf Deševicha im Kreis Vologda zu stammen. Im Vergleich mit anderen in diesen Jahren Verhafteten war er ziemlich alt. Seine Ausführungen zeigen, dass er von der Welt seiner dörflichen Gemeinde sowie von christlichen Vorstellungen geprägt war. Die historischen Umwälzungen während Peters Regierungszeit wurden hingegen von ihm nicht erwähnt – abgesehen von der Kopfsteuer und, an anderer Stelle, von der Kirchenreform, die er als schwere Eingriffe in sein Leben empfand. Er war verheiratet, hatte aber keine Kinder. Eines Tages hatte er, seinem Gelübde folgend, ohne Pass – also ohne Genehmigung – sein Dorf verlassen, in Einsiedeleien und Klöstern gelebt, war jedoch dann noch einmal nach Deševicha zurückgekehrt. Einmal sei er mit der Obrigkeit in Konflikt gekommen, als man ihm seine verfilzten Haare geschoren habe; er ließ 4 Ebenso wären die Linien zu den Hofnarren, aber auch zu magischen Formen im Zusammenhang mit der Fastnacht in Westeuropa oder zu den Utopien der frühen Sowjetzeit genauer zu untersuchen. Vgl. auch die Figur des Gottesnarren Nikolka Eisenkappe in Puškins «Boris Godunov«, der für das Volk spricht und den Zaren anklagt.
Spiegel der sündigen Welt
|
429
sie nachwachsen und neu verfilzen. Weder über seine Beweggründe zum Gottesnarren noch über seine Haltung zum Altgläubigentum gab er Auskunft. Seine geschickte Verteidigungsstrategie hatte Erfolg: Er wurde mit der Auflage entlassen, dass man ihn in ein Kloster schicken solle, womit sich sein Traum erfüllt hätte. Andere Gottesnarren dieser Zeit waren nicht so glücklich und wurden hart bestraft. Sergeev galt offenbar weder als religiöser Dissident noch als Gegner des Zaren. Die Veränderung der Rolle der Gottesnarren zwischen adliger und VolksKultur harrt noch der Untersuchung.5
5 Aleksandr S. Lavrov: »Um seine Seele zu retten«. Die Verhöre der Gottesnarren als religiöse Autobiographien, 1699–1740. In: Von Moskau nach St. Petersburg. Das russische Reich im 17. Jahrhundert. Hg. von Hans-Joachim Torke. Wiesbaden 2000 (= Forschungen zur osteuropäischen Geschichte 56), 187–201, Zitat 200.
Jakobiner am Oberrhein*1 Die oberrheinischen Jakobiner tagten weder im Pariser Kloster St. Jacques noch in einer entsprechenden Einrichtung Strassburgs, Freiburgs oder Basels. Was also ist unter diesem Personenkreis zu verstehen? Streicht man einmal den ideologischen Ballast weg, der dem Begriff anhaftet, lassen sich aufgrund von Selbstzeugnissen und inhaltlichen Gemeinsamkeiten verschiedener Gruppen folgende Merkmale für einen »Jakobiner am Oberrhein« nennen: Er sympathisiert mit den revolutionären Ereignissen in Frankreich seit 1789, nicht unbedingt nur mit den Jakobinern; er organisiert sich in Clubs, Geheimzirkeln oder Bürgerausschüssen nach den Vorbildern des Pariser Jakobinerclubs, der Lesegesellschaften und der Freimaurerlogen der Aufklärung sowie früherer Ausschüsse; er tritt für die Republik als Staatsform ein; er hat das Vertrauen in eine innere Reformierbarkeit des ständisch-feudalen Systems verloren und setzt statt dessen seine Hoffnung auf einen revolutionären Umbruch hin zur bürgerlichen Demokratie, die mit den Losungen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Volkssouveränität und Gewaltenteilung gekennzeichnet wird. Vor allem der letzte Punkt unterscheidet einen Jakobiner von einem Liberalen, ansonsten sind die Übergänge fliessend. Gewiss ist die Herausbildung einer Jakobinerbewegung am Oberrhein ohne die Französische Revolution nicht denkbar. Dennoch spielen wichtige regionale Faktoren eine ausschlaggebende Rolle. Seit Sommer 1789 überzog, sicher ermutigt durch die revolutionären Ereignisse, ein Bauernaufstand zunächst das Oberelsass, dann die Ortenau um Offenburg. Nur mit militärischen Mitteln konnten die Erhebungen bis zum Herbst niedergeschlagen werden. Zettel mit den Aufrufen zum Aufstand fanden sich noch länger am Kaiserstuhl. Sogar ein Überfall auf Freiburg, den Sitz der vorderösterreichischen Landesherrschaft, wurde für den 9. September angekündigt, fand allerdings nicht statt. Eine Befreiung von drückenden Lasten, die Wiederherstellung alter Rechte und die Abschaffung geistlicher wie adliger Privilegien waren die wichtigsten Ziele der Bauern. Ein Jahr später kamen ähnliche Flugblätter in Umlauf, die eine Verbesserung der bäuerlichen Lebensverhältnisse verlangten und eine Belagerung Freiburgs androhten. Ebenso kursierten in der folgenden Zeit Agitationsschriften aus dem revolutionären Strassburg, die zu einem Umsturz und dann ab 1791 zur Übernahme der französischen Verfassung aufriefen. Die Obrigkeit in der Markgrafschaft Baden wie im habsburgischen Breisgau nahm die Aufstandspropaganda durchaus ernst, selbst wenn diese zunächst keine * Erstpublikation: Basler Zeitung, Magazin Nr. 36, 10.9.1994. Bei diesem Aufsatz verdanke ich viel meinen Gesprächen mit Erwin Dittler und seinem Buch: Jakobiner am Oberrhein. Kehl 1976 (Eigenverlag). Seinem Andenken ist diese Neupublikation gewidmet.
Jakobiner am Oberrhein
|
431
praktischen Folgen hatte. Sie wusste, dass die Lage labil und die allgemeine Stimmung angespannt war. Die absolutistischen Reformen seit der Jahrhundertmitte hatten für erhebliche Unruhe gesorgt, da die althergebrachten Selbstverwaltungsrechte der Städte, aber auch der Landstände überhaupt einschliesslich des Adels und der Geistlichkeit beschnitten oder gar beseitigt werden sollten. In Freiburg etwa reagierten die Bürger mehrfach mit Protesten und offenem Widerstand gegen die Eingriffe. Hier und dort bildeten sich innerstädtische Oppositionsbewegungen, die grössere Freiheiten gegenüber der bislang herrschenden städtischen Elite durchsetzen wollten. Mit der 1783 von Kaiser Joseph II. erlassenen Ordnung verloren die Städte vollends ihre kommunalpolitische Autonomie. Ein zentralistisch-bürokratisches System begann sich zumindest im Habsburgischen auszubilden. Die Erregung in der weitgehend katholischen Bevölkerung stieg vielleicht noch stärker durch die von Joseph II. verfügten Reformen der kirchlichen Praxis. Um sich auf das Zweckdienliche zu konzentrieren, die Menschen zu vernünftigem Handeln hinzuführen sowie Arbeitskraft und -zeit zu sparen, sollten die Gottesdienstliturgie gestrafft, der Reliquienkult eingeschränkt sowie die Zahl der Prozessionen, Wallfahrten und Feiertage drastisch vermindert werden. Trotz scharfer Strafandrohung behielten viele Menschen ihre gewohnten religiösen Bräuche bei. Die Behörden in den oberrheinischen Landesteilen verschärften nach 1789 nicht nur die Überwachung der Grenzen, sondern auch der Vorgänge im Innern selbst. Die Zensur griff schärfer durch und verbot aufklärerische Bücher und Zeitschriften. Ein dichtes Spitzelnetz dehnte sich aus, um Flugblätter aufzuspüren oder in Wirtshäusern Personen festzustellen, die aufrührerische Reden hielten. Allerdings blieben auch die Franzosen nicht untätig. Von Basel aus organisierte der im Holsteinerhof – heute Hebelstrasse 32 – residierende Sekretär der dortigen Gesandtschaft, der Elsässer Theobald Bacher, ein Spionage- und Agentenwesen im süddeutschen Raum. Ein Anschwellen der revolutionären Propaganda gab es noch einmal 1793, nachdem im März in Mainz der erste republikanische Staat auf deutschem Boden ausgerufen worden war, der allerdings bereits im Juli durch preussische Truppen wieder gewaltsam aufgelöst wurde. Mehr und mehr gingen die Obrigkeiten inzwischen auch zur Gegenpropaganda über und unterstützten die »Verbreitung gut gesinnter Bücher« und Flugblätter. Hier wurden insbesondere die Schrecken der Revolution an die Wand gemalt, die Hinrichtung des französischen Königspaares und der sich ausbreitende Terror der Jakobinerherrschaft geschildert. Als am 28. Juli 1794 Robespierre hingerichtet und am 11. November des gleichen Jahres auch der Pariser Jakobinerclub geschlossen wurde, taten die Staatsorgane alles, um einen Grenzübertritt flüchtiger Jakobiner zu verhindern. Doch gerade jetzt, als in Frankreich die Jakobinerherrschaft beseitigt worden war, schlug die Stunde der Jakobiner am Oberrhein. Durch die 1793 einsetzen-
432
|
Jakobiner am Oberrhein
den Kriege der verbündeten Monarchien gegen das republikanische Frankreich gewannen sie einen Handlungsspielraum, namentlich 1796, als die französischen Truppen vorübergehend die deutsche Seite des Oberrheingebietes besetzten. Am 16. Juli rückten sie in Freiburg ein. Zahlreiche Bürger, an der Spitze der Universitätsprofessor Karl Schwarzel, begrüssten sie mit Hochrufen und steckten sich die Kokarde an den Hut. Ein Demokratenclub bildete sich, der den Breisgau in eine Republik umwandeln wollte. Ebenso fand eine geheime studentische Verbindung, der »Amerikanerorden«, Anklang, die 1797 entdeckt wurde und sich auf die Grundsätze der amerikanischen Unabhängigkeit und Verfassung berief, aber sich wohl auch in die Jakobinerbewegung eingereiht haben dürfte. Nach dem Abzug der Franzosen im Herbst verloren diese Kreise zwar wieder an Bewegungsfreiheit, ihre Aktivitäten rissen dennoch vorerst nicht mehr ab. Was waren das für Männer, die man als oberrheinische Jakobiner bezeichnen kann (Frauen tauchen in den mir zugänglichen Quellen nicht als Aktivistinnen auf )? Zunächst fällt auf, dass es verhältnismässig viele Geistliche unter ihnen gab. Der genannte Freiburger Professor war Theologe, ein anderer bekannter Propagandist im südlichen Schwarzwald, Joseph Rendler, hiess nur der »Jakobinerpriester«. Er genoss offenbar hohes Ansehen in der Bevölkerung, das es ihm immer wieder ermöglichte, sich vor den Häschern zu verstecken. Wahrscheinlich war nicht zuletzt die Universität Freiburg, die als Zentrum der »süddeutschen Aufklärung« galt, und gerade deren Theologische Fakultät mit dafür verantwortlich, dass sich Geistliche für reformerische oder gar revolutionäre Ideen begeisterten. Einer der bedeutendsten oberrheinischen Jakobiner war Karl Fahrländer aus Ettenheim, ebenfalls Priester. Zunächst versuchte er, der Revolution im Elsass als Geistlicher zu dienen, meldete sich dann freiwillig in die französische Armee, geriet in Strassburg Ende 1793 in die Mühlen des jakobinischen »Terreur«, setzte sich rechtzeitig ab und liess sich schliesslich in Basel nieder, wo damals ein Jakobinerclub oder zumindest ein Kreis von Sympathisanten der Französischen Revolution existierte. Seit 1796 beteiligte er sich an Plänen zu einem Umsturz in Südwestdeutschland und zur Bildung einer Republik. Möglicherweise war er der Autor eines Verfassungsentwurfes für die künftige Republik, der 1799 verbreitet wurde. Auf jeden Fall arbeitete er an der Proklamation mit, die nach der erfolgreichen Revolution die neue Politik einleiten sollte. Karl Fahrländer starb 1815 als Schuldirektor im elsässischen Weissenburg (Wissembourg). Eine zweite Gruppe stellten die Unternehmer. Der Karlsruher Johann Georg Friedrich List hatte in der Schweiz gelernt, besass eine Fayence-Fabrik, gab sie allerdings auf und betätigte sich dann in Basel als Unternehmer, 1798 etwa als Kommis beim Textilfabrikanten Jakob Sarasin. Ernst Alexander Jägerschmid, Arztsohn aus Kandern, war zunächst Faktor eines Eisenwerkes in Niederschöntal, dann dort Münzdirektor und zählte zu den führenden Revolutionären.
Jakobiner am Oberrhein
|
433
Eine dritte Gruppe kam aus der Beamtenschaft oder arbeitete freiberuflich als Advokat, Arzt und Schriftsteller. Hierzu gehörte Dr. Sebastian Fahrländer, der Bruder Karls, ein Arzt und Apotheker. Von Waldshut aus siedelte er 1798 nach Münchwilen im Fricktal über, wo er ebenso wie Karl das Bürgerrecht erhielt. Nach 1808 war er noch in Aarau politisch tätig. In Basel liess er medizinische Abhandlungen veröffentlichen. Er starb 1841. Aufgeklärte Geistliche, gebildete und besitzende Bürger, Intellektuelle waren somit die wichtigsten Träger der Jakobinerbewegung. Sympathisantenkreise reichten sicher weit darüber hinaus. Welche Pläne und Ziele hatten die Jakobiner? Das am häufigsten genannte Schlagwort war die »freie Republik«. Dies richtete sich gegen den absolutistischen Staat, aber auch gegen den Schacher, den die Herrscher bei ihren Friedensverhandlungen mit ihren Landesteilen und den darin wohnenden Menschen trieben. Im Verfassungsentwurf von 1799 wurde als Ziel der »eine und unzerteilbare deutsche Freistaat« genannt: der nationale Gedanke der demokratischen Bewegung war – ähnlich wie in der Französischen Revolution – unübersehbar. Im übrigen ging es um die Aufhebung aller noch bestehenden feudalen Rechte und Privilegien, um die Sicherung der Menschenund Bürgerrechte, um Gewerbefreiheit und um eine umfassende Sozialpolitik. Angesichts der politischen Kräfteverhältnisse lag ein deutscher Einheitsstaat auf demokratischer Grundlage in weiter Ferne. So zielten die konkreten Vorhaben, die 1798/99 im Umlauf waren, eher auf eine »schwäbische« oder »süddeutsche« Republik. Dabei waren Verbindungen der oberrheinischen Jakobiner zur württembergischen Oppositionsbewegung, insbesondere zu den Bürgerausschüssen, deutlich. Zudem wurde immer wieder der Wunsch geäussert, sich mit der Schweizerischen Eidgenossenschaft zu vereinen. 1796 baten vermutlich Mitglieder des Freiburger Demokratenclubs die französische Regierung um entsprechende Vermittlung. 1798 war dies nach Bildung der Helvetischen Republik am 12. April nicht mehr nötig, da über List, Jägerschmid und Fahrländer unmittelbare Kontakte bestanden. In Basel trafen sich die deutschen Jakobiner mit französischen Verbindungsleuten und den dortigen Republikanern des »Herrenkämmerleins«, das im »Rheineck«, dem Haus des Bierbrauers Erlacher, tagte. Führende Anhänger der Helvetischen Republik wie der Basler Remigius Frey oder der Waadtländer Frédéric Laharpe traten für eine Verbindung mit Süddeutschland ein. Offenbar waren die südwestdeutschen Jakobiner an der Beschleunigung des Umsturzes in der Basler Landschaft und dann in der Stadt selbst beteiligt. Sie wollten damit auch ein Signal für den Aufstand auf der deutschen Seite des Oberrheins setzen, der im wesentlichen von den Bauern getragen werden sollte. Allerdings verliessen sie sich dabei weniger auf eine Mobilisierung der Bevölkerung als auf die Unterstützung seitens der französischen Truppen. Doch diese blieb aus. Im Pariser Direktorium und namentlich beim immer mächtiger werdenden Napoleon Bonaparte war man inzwischen zu der Überzeugung ge-
434
|
Jakobiner am Oberrhein
langt, dass nicht die Ausweitung der Revolutionsideen, sondern die französischen Machtinteressen Vorrang haben müssten. Für diese schienen schwache, abhängige Kleinstaaten günstiger zu sein als starke, selbständige Republiken. Zwischen 1799 und 1803, als die französischen Truppen – mit Unterbrechungen – Südwestdeutschland besetzt hatten, führten sie sich keineswegs als Befreier auf, sondern plünderten das Land aus. Von einer Umwälzung, wie sie in Basel gelungen war, konnte vorerst keine Rede mehr sein, zumal die Aufstandsvorbereitungen durch Verrat den Behörden bekannt geworden waren. Die Jakobiner blieben ihren Ideen treu. Besonders bemerkenswert war die Tätigkeit der Gebrüder Fahrländer im Fricktal. Hier herrschte, nicht zuletzt infolge der Kriegszüge, grosses Elend. Ausserdem sorgte die verworrene Entwicklung der territorialen Zugehörigkeit für Unruhe, weil zwar die habsburgische Herrschaft weggefallen war, die breisgauische Verwaltung jedoch weiterarbeitete. Die Fahrländers waren die treibenden Kräfte – diesmal mit tatkräftiger Unterstützung der Franzosen –, die das Fricktal Ende 1801 / Anfang 1802 handstreichartig vom Breisgau lösten und der Helvetischen Republik einfügten. Sebastian Fahrländer wurde gar dessen Statthalter. Im Herbst 1802 erreichten die Gegner dieser Neuordnung jedoch seine Absetzung und anschliessend die Ausweisung der beiden Brüder. So scheiterte auch dieser Versuch, mit einer Revolutionierung und Republikanisierung eines kleinen Gebietes auf die ganze oberrheinische Region auszustrahlen. Ganz aussichtslos war eine derartige Hoffnung zu dieser Zeit nicht gewesen. Seit 1801 hatte sich der wachsende Unmut in der Bevölkerung mit der materiellen Not, mit den drückenden Lasten der Einquartierungen und mit den obrigkeitlichen Massnahmen in mehreren Gehorsamsverweigerungen, in heimlichen Zusammenkünften und erneuten Clubgründungen Luft geschaffen. In Freiburg verlangte 1802 ein Ausschuss durchaus geachteter Bürger eine Zusammenfassung des Dritten Standes – von Bürgern und Bauern – und die Ausrufung der Republik. Mit Wissen des Bürgermeisters verhandelte eine Delegation in Bern über eine Vereinigung der künftigen Republik mit der Schweiz und über eine Unterstützung dieser Pläne seitens der Franzosen. Ein Freiburger Notar, Ernst Benz von Benzendorf, strebte an, nach Fricktaler Modell über Volksversammlungen die Vollmacht zu erhalten, die Regierungsgewalt zu übernehmen, die Landstände – vorab die Prälaten – zu entmachten und dadurch das Volk von schweren Lasten zu befreien. Wiederum versagten sich die Franzosen, so dass auch viele Anhänger einer Republik nicht wagten, sich offen dazu zu bekennen. Es gärte noch eine Weile. Doch insgesamt schwanden die Möglichkeiten für eine Republikanisierung im jakobinischen Sinn mehr und mehr dahin. Die weltpolitische Lage, Napoleons Kaisertum, die Neuordnung der deutschen Staaten, die in Südwestdeutschland zur Bildung des Grossherzogtums Baden führte, die langjährigen Kriege – all das machte jegliche Hoffnung zunichte.
Jakobiner am Oberrhein
|
435
Was blieb von den Jakobinern am Oberrhein? Lange Zeit wurden sie totgeschwiegen – allein das zeigt schon, dass ihre Ideen Widerhall gefunden und Furcht bei den Herrschenden ausgelöst hatten. Sie trugen zu einer radikal-demokratischen Tradition in unserer Region bei, die auf der deutschen Seite in der Revolution von 1848/49 ihre Fortsetzung fand. Charakteristisch war dabei der Blick auf die Schweiz, der Versuch, sich mit der Eidgenossenschaft zu verbinden und sich auf die Kantonsverfassung zu stützen. Die verschiedenen Anläufe solcher Bestrebungen bis in unser Jahrhundert hinein, die die Grenzen in der oberrheinischen Region überwinden sollten, verdienen unbedingt eine weitere Aufarbeitung.
Theodor Herzl »In Basel habe ich den Judenstaat gegründet«*2 Am 12. Februar 1897 schrieb Theodor Herzl 37jährig sein Testament. Ermüdet von seinen Anstrengungen, andere von seinen Ideen zu überzeugen, verbittert von Widerständen und Angriffen gegen ihn, glaubte er – wie er schon seinem Tagebuch am 20. Dezember 1896 anvertraut hatte –, dass »meine Bewegung zu Ende ist«. Dabei hatte sie noch gar nicht lange das Licht der Welt erblickt. Herzl, der einer assimilierten jüdischen Familie Budapests entstammte und in Wien lebte, hatte lange Zeit seine Berufung in der Schriftstellerei gesehen und durchaus erfolgreiche Feuilletons und Schauspiele verfasst. In Wien und dann in Frankreich, wo er als Korrespondent der »Neuen Freie Presse« wirkte, stiess er auf einen sich verschärfenden Antisemitismus. Immer mehr kam er zu der Überzeugung, dass die Judenfeindschaft nicht verschwinden werde und die einzige Lösung darin bestehe, dass die Juden als ein Volk einen eigenen Staat bildeten. Den letzten Anstoss gab die hasserfüllte Stimmung, die sich in der Pariser Bevölkerung im Zusammenhang mit dem Prozess gegen den angeblichen deutschen Spion Capitaine Dreyfus 1895/95 äusserte. In wenigen Monaten schrieb Herzl seine Gedanken in der Schrift »Der Judenstaat. Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage« nieder, die am 14. Februar 1896 erschien. In ihr legte er sich noch nicht fest, wo der Staat entstehen könnte – irgendein »Stück der Erdoberfläche« sollte es sein. Allerdings: Palästina wäre als »unvergessliche historische Heimat« allein schon »ein gewaltig ergreifender Sammelruf für unser Volk«. »Für Europa würden wir dort ein Stück des Walles gegen Asien bilden, wir würden den Vorpostendienst der Kultur gegen die Barbarei besorgen.« Als neutraler Staat werde man mit Europa in Verbindung bleiben und auch den Christen ihre heiligen Stätten garantieren. Alle Andersgläubigen sollten tolerant behandelt werden und Rechtsgleichheit geniessen. Das Buch schlug wie eine Bombe ein. Erst jetzt merkte Herzl, dass er nicht als erster auf derartige Ideen gekommen war. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts waren zahlreiche Werke publiziert worden, die eine nationale Zusammenfassung des jüdischen Volkes und ein eigenes Territorium verlangten. Vor allem in Osteuropa hatte sich im Anschluss an furchtbare Pogrome, die nach der Ermordung des Zaren Alexander II. – für den Mord wurden die Juden verantwortlich gemacht – weite Gebiete erfassten, eine Bewegung von »Zions-Freunden« entfaltet. Diese * Erstpublikation in: Basler Zeitung, 20.1.1997.
»In Basel habe ich den Judenstaat gegründet«
|
437
wollte die Befreiung der Juden in die eigene Hand nehmen und sah einen Ausweg in der Rückkehr nach Zion, nach Erez Israel. Nathan Birnbaum, der als erster für die neue politische Kraft den Begriff »Zionismus« prägte, versuchte, die Gleichgesinnten auf einem Kongress zu vereinen. 1894 trat eine Vorkonferenz zusammen, doch dann blieben die Anläufe wieder stecken. Herzls Werk wurde im richtigen Augenblick veröffentlicht. Es bot inhaltlich nicht viel Neues, doch seine Sprache, seine Überzeugungskraft und seine scheinbar einfachen Lösungsvorschläge liessen viele daran glauben, dass nun der Durchbruch erreicht werden könne. Der Zionismus ist ein Ausdruck der Krise jüdischen Selbstverständnisses im 19. Jahrhundert. Industrialisierung und die »Judennot« – eine rasch wachsende Verarmung namentlich von Millionen in Osteuropa –, Verweltlichung des Daseins, Hoffnung auf die »Emanzipation« – die rechtliche Gleichstellung – und sich gleichzeitig verstärkende judenfeindliche und nationalistische Tendenzen hatten die jüdischen Lebenswelten tiefgreifend verändert. Die herkömmlichen Antworten reichten vielen Menschen in der neuen Lage nicht mehr aus. Vorbereitet durch Kräfte im Judentum, die im 18. Jahrhundert aus Enttäuschung über das Ausbleiben des Messias eine Wende zum aktiven Handeln, die Erlösung selbst herbeizuführen, vollzogen hatten, suchten sie nach anderen Wegen. Diese fanden sie in Versuchen, sich in die nichtjüdische Gesellschaft einzugliedern, in einer religiösen Neuorientierung, in dem Bestreben, über den Internationalismus der Arbeiterbewegung die Klassenteilung und mit ihr auch antijüdische Vorurteile aufzuheben, oder eben in der nationalen Vereinigung. Nicht zufällig wurden im selben Jahr 1897 der »Allgemeine jüdische Arbeiterbund von Litauen, Polen und Russland« und die Zionistische Weltorganisation gegründet. Somit entstand der Zionismus nicht unvorbereitet, der Antisemitismus beschleunigte lediglich seine Formierung. Allerdings stiess Herzls Projekt nicht nur auf begeisterte Zustimmung. Orthodoxe Juden befürchteten, dass durch die Staatsbildung nicht nur weltlichen Tendenzen im Judentum Vorschub geleistet, sondern auch Gottes Wille vorgegriffen werde. Jüdische Sozialisten betrachteten Herzls Gedanken als Variante des Nationalismus innerhalb der Bourgeoisie. Assimilierte sahen ihre Integration in das »Vaterland« gefährdet; sie wollten ihre »nationale Zuverlässigkeit« nicht in Zweifel ziehen lassen. Einige fühlten sich abgestossen von Herzls demagogischer Rhetorik, seiner Ich-Bezogenheit und seiner Naivität. Teilweise machten sie sich darüber lustig, wie leicht es sich dieser vorstellte, ein Territorium zu erhalten (und dabei auch noch antisemitische Klischees bestätigte): »Wenn Seine Majestät der Sultan uns Palästina gäbe, könnten wir uns dafür anheischig machen, die Finanzen der Türkei gänzlich zu regeln«, hatte er im »Judenstaat« ausgeführt. Der Literaturkritiker Anton Bettelheim meinte dazu 1896 ironisch, Herzls Idee sei »gedankenarm, an Thorheiten reich« und nichts anderes als der »Grün-
438
|
Theodor Herzl
derprospect« einer »jüdischen Schweiz auf Actien«. Und der bedeutende Soziologe Ludwig Gumplowicz schrieb Herzl 1899 kühl: »Sie wollen einen Staat ohne Blutvergiessen gründen? (…) So ganz offen und ehrlich – auf Aktien?« Aber auch die »Zions-Freunde« waren nicht alle mit Herzls Ideen einverstanden. Die »Kulturzionisten« erblickten das wesentliche Ziel in einer kulturellen Erneuerung des Judentums, für die Palästina das Zentrum – aber keineswegs als Staat – darstellen könne. Ihr Sprecher war Achad Haam, später auch Martin Buber. Die national denkenden Juden Osteuropas verhielten sich vielfach abwartend. Der Staat in Palästina war ihnen weniger wichtig als die Hilfe zur Auswanderung für die bedrohten und verarmten Menschen sowie die Forderung nach nationaler Autonomie und nach Minderheitenrechten in ihren Heimatländern selbst. Ohnehin spielten die kulturellen Unterschiede zwischen Ost- und Westjuden eine wichtige Rolle bei Konflikten innerhalb des Zionismus. All diese – oft vernichtende – Kritik zermürbte Herzl, der ohnehin durch gesundheitliche Problem und eheliche Zerwürfnisse deprimiert war. Und dennoch setzte gerade Anfang 1897 die Wende ein: Mit der Niederschrift des Testamentes und der Erkenntnis, dass alles verloren sei, wenn jetzt nichts geschehe, erfasste ihn ein unbändiger Wille, doch noch einmal einen Vorstoss zu unternehmen. Er schuf eine eigene zionistische Wochenschrift („Die Welt«), deren erste Nummer am 4. Juni 1897 in Wien herauskam. Vor allem aber setzte er bei einem Treffen interessierter Persönlichkeiten am 6. und 7. März 1897 durch, dass ein allgemeiner Zionistenkongress einberufen werden sollte. Gegen alle Widerstände und in rastloser Tätigkeit gelang es ihm auch, diesen Beschluss zu verwirklichen. Als Tagungsort war zunächst München vorgesehen. Die Ablehnung seitens der dortigen jüdischen Gemeinde und des deutschen Rabbinerverbandes durchkreuzte diese Absicht. So rückte die Schweiz ins Blickfeld. Auf Anraten des Zürchers David Farbstein wurde Basel schliesslich bevorzugt: Zürich galt vor allem den Juden aus dem Russischen Reich als zu problematisch, weil hier wegen der aktiven Kreise russischer Revolutionäre die zaristische Geheimpolizei besonders tätig war. In Basel hingegen, wo die meisten Kongresse bis zur Staatsgründung Israels (zehn von 22) stattfinden sollten, schienen die Verhältnisse günstig zu sein. Der orthodoxe Rabbiner Arthur Cohn unterstützte die Einberufung. Anfänglich noch skeptisch, sollte er durch den Kongress zu einem begeisterten Anhänger der zionistischen Bewegung werden, bis er sich später wieder aus religiösen Gründen von ihr entfernte. Ebenso stellte der Basler Regierungsrat der Anfrage keine Hindernisse in die Wege. Die Stimmung in der Öffentlichkeit wurde als aufgeschlossen und tolerant eingeschätzt. Eine gute Infrastruktur, auch für koscheres Essen, war vorhanden. Zudem konnte man sich der Förderung durch die Basler »christlichen Zionisten« sicher sein. Diese mit der Basler Mission verbundenen »Freunde Israels« hofften,
»In Basel habe ich den Judenstaat gegründet«
|
439
dass über die Rückkehr der Juden nach Israel der Messias-Gedanke bei ihnen wieder stärker Fuss fassen und es dann leichter sein werde, sie vom »richtigen« Messias – eben Jesus – zu überzeugen. Viele dieser »Freunde Israels« hatten schon in Palästina gewirkt. So war Samuel Gobat von 1846 bis 1879 als protestantischer Bischof in Jerusalem eingesetzt gewesen und Johannes Frutiger zum grössten Bankier des Landes geworden, der nicht zuletzt die 1892 eingeweihte erste Eisenbahn – zwischen Jaffa und Jerusalem – finanzierte. Der Erste Zionistenkongress tagte dann vom 29. bis 31. August 1897. Das Stadtcasino war festlich geschmückt. Die Teilnehmer erschienen – bis auf eine Ausnahme – im Frack, die Damen ebenfalls in eleganter Kleidung. Als ein Delegierter fragte, ob diese stimmberechtigt seien, antwortetet der zum Präsidenten gewählte Herzl: »Die Damen sind selbstverständlich sehr verehrte Gäste, nehmen aber an der Abstimmung nicht theil.« Immerhin erhielten sie das Stimmrecht am Zweiten Kongress, der ein Jahr später wiederum in Basel stattfand. Theodor Herzl wurde mit seiner ruhigen, beeindruckenden Rede, mit der er die Ziele des Zionismus darlegte, endgültig zur Integrationsfigur der Bewegung. Max Nordau, der Vizepräsident, rührte mit seiner Analyse der Lage des jüdischen Volkes und des Antisemitismus die Anwesenden und riss sie mit, diese Zustände zu ändern. David Farbstein begründete die Notwendigkeit des Zionismus aus den wirtschaftlichen Entwicklungen, und Nathan Birnbaum ging auf die kulturellen Hintergründe ein. Eindringlich machte er auf die Unterschiede zwischen Ostund Westjuden aufmerksam, die zu berücksichtigen seien. Einzelberichte über die Verhältnisse in einzelnen Ländern folgten. Die Kongressteilnehmer beschlossen die Formierung der Zionistischen Organisation, bei deren Vorstellung sich Max Bodenheimer ganz des Bodens bewusst war, auf dem sich die Zionisten befanden: »So möge denn ein Geist der Einigkeit, der Geist des Rütli, auch über unserer Versammlung neuer Eidgenossen wehen.« Daneben wurde die Gründung eines Jüdischen Nationalfonds und einer Bank ins Auge gefasst, um Land in Palästina ankaufen zu können. Das wichtigste Ergebnis bildete die Verabschiedung des »Baseler Programms«, das bis zur Staatsbildung Israels am 14. Mai 1948 seine Geltung behielt. Sein Leitsatz lautet: »Der Zionismus erstrebt für das jüdische Volk die Schaffung einer öffentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte in Palästina.« Wie das gesamte Programm war auch diese Kernaussage ein Kompromiss. Mit dem Begriff »Heimstätte« statt »Staat« wollten die Verfasser denjenigen Juden entgegenkommen, für die die Besiedlung des Landes wichtiger war als ein »Judenstaat« oder die Gottes Willen nicht vorweggreifen wollten. Ebenso sollte der Sultan des Osmanischen Reiches nicht brüskiert werden. Deshalb wählte man auch die Formulierung »öffentlich-rechtlich« statt »völkerrechtlich«, hielt allerdings eine Beschränkung auf »rechtlich«, wie sie ursprünglich vorgeschlagen worden war, für eine zu schwache Garantie.
440
|
Theodor Herzl
Mit den in Aussicht genommenen Mitteln, das Ziel zu erreichen, versuchte man gleichermassen, verschiedene Strömungen innerhalb der Bewegung zu integrieren: die Kolonisationsbefürworter, die Assimilierten, die in ihren Heimatländern arbeiten wollten, oder die Nationaljuden und Kulturzionisten, für die die »Stärkung des jüdischen Volksgefühls und Volksbewusstseins« im Vordergrund stand. Herzls Einfluss ist zu erkennen, wenn die »Erlangung der Regierungszustimmung«, also diplomatische Bemühungen, für nötig gehalten werden, um ans Ziel zu gelangen. Von heute aus betrachtet, hatte Herzl Recht, als er in seinem Tagebuch das Ergebnis des Kongresses zusammenfasste: »(…) in Basel habe ich den Judenstaat gegründet. (…) Vielleicht in fünf Jahren, jedenfalls in fünfzig wird es jeder einsehen.« Mit dem Kongress wurde die zionistische Bewegung zu einem geschichtsmächtigen Faktor, selbst wenn sie zunächst nur bei einer Minderheit der Juden Resonanz fand. Nicht zuletzt Herzls Feuer, seine unermüdliche Aktivität, seine mitreissende Rhetorik und sein unerschütterlicher Glaube an die baldige Verwirklichung der zionistischen Idee verhalfen ihr zum Durchbruch und gaben ihr eine Kraft, die alle Hindernisse überwinden sollte. Und Hindernisse gab es genug. Die Einigkeit der Bewegung blieb ein Wunschtraum – sie zerfiel in zahlreiche Richtungen, die sich teilweise heftig bekämpften. Die Konflikte über Ziele und Vorgehensweise, die das Kompromissprogramm überdeckt hatte, schwelten weiter. Mehrfach kam es zu Abspaltungen. Ebensowenig erfüllten sich Herzls Hoffnungen, auf diplomatischem Wege und über finanzielle Unterstützungszusagen rasch Garantien für eine »Heimstätte« oder gar einen Staat zu erhalten. Alle Bemühungen scheiterten. Erst lange nach Herzls Tod im Jahre 1904 gelang es, mit der »Balfour-Deklaration« von 1917 die britische Regierung für eine Förderung des zionistischen Zieles zu gewinnen. Deren Schaukelpolitik zwischen jüdischen und arabischen Interessen in Palästina trug allerdings dazu bei, dass in den folgenden Jahrzehnten eine Lösung eher schwieriger als leichter wurde. So konnte auch ein Wunsch nicht rechtzeitig verwirklicht werden, der für viele Zionisten ein entscheidender Antrieb ihres Handelns gewesen war: die vom Antisemitismus bedrohten Juden zu retten. Erst die Schoa, der Völkermord an den europäischen Juden, hatte letztlich die Staatsgründung Israels zur Folge. Herzl, der der arabischen Bevölkerung Palästinas ganz mit der Überheblichkeit des Europäers seiner Zeit gegenübertrat, hatte dennoch die Vision eines friedlichen, ja freundschaftlichen Zusammenlebens von Juden und Arabern gehabt. Sehr viel stärker betonte etwa Max Nordau die kulturelle und damit auch politische Überlegenheit der Juden, denen sich die Araber unterzuordnen hätten. Beide besassen – wie anfänglich die meisten Zionisten – nur geringe Kenntnisse über die tatsächlichen Verhältnisse in Palästina. Etwas anders verhielt es sich bei den Kulturzionisten. Achad Haam, der frühzeitig mehrfach das Land bereiste, warb für ein friedliches Zusammenleben bei wechselseitiger Anerkennung der
»In Basel habe ich den Judenstaat gegründet«
|
441
jeweiligen Kultur. Weder die Rechte noch die Gefühle der Araber dürften bei der Besiedlung verletzt werden. Doch seit den zwanziger Jahren verschlechterten sich die Beziehungen zwischen Juden und Arabern in Palästina zusehends. Die Grossmächte, namentlich England, betrieben in diesem Konflikt eine oft nur schwer nachvollziehbare Politik. Unermessliches Leid für die Menschen folgte daraus. Die Gewalt eskalierte in zahllosen Terroropfern auf beiden Seiten. Nach der Staatsbildung Israels im Jahre 1948 kamen Flüchtlingselend und politische Unterdrückung für die Palästinenser hinzu, für die Juden die täglich spürbare Bedrohung ihrer Existenz. Erst in jüngster Zeit gibt es Hoffnung, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Immer wieder fanden sich Kulturzionisten unter denjenigen, die mit verschiedenen Initiativen für einen binationalen Staat und für eine Gleichberechtigung beider Bevölkerungsgruppen eintraten. Jene Vorschläge hatten unter den damaligen Umständen ebensowenig Aussicht auf Erfolg wie andere differenzierte Lösungsversuche. Aber sie verweisen auf die Vielfalt der Denk- und Handlungsweisen innerhalb des Zionismus. Diese verschiedenen Traditionslinien spielen heute wieder eine wichtige Rolle, wenn in Israel nach Wegen gesucht wird, den Friedensprozess zwischen Juden und Palästinensern zu sichern und voranzutreiben, und zugleich eine Neubestimmung des Zionismus ansteht.
Joseph Goebbels in Freiburg Wie der spätere Propagandaminister des »Dritten Reiches« vom Katholiken zum Rechtsradikalen wurde* 3 „Eine wunderbare Fahrt den ganzen Süden herunter«, schrieb der damals zwanzigjährige Joseph Goebbels in seine »Erinnerungsblätter«. Er war im Mai 1918 nach Freiburg gefahren, um dort sein Studium fortzusetzen, das er ein Jahr zuvor in Bonn aufgenommen hatte. Er blieb nur ein Semester, kehrte aber zum Sommer 1919 – wieder für ein Semester – nach Freiburg zurück. Diesmal war die Fahrt nicht so einfach. Aufgrund der Besetzung durch die Siegermächte nach dem Ersten Weltkrieg mußte er nun vom Rheinland nach Baden mehrere Grenzen überqueren und dafür Passierscheine vorlegen. In Ludwigshafen wurde es schwierig. Doch: »Ein Schwarzer läßt mich durch. Ich möchte ihn umarmen« – ungewohnte Gefühle des späteren NS-Reichspropagandaministers, der das Volk zur Verachtung für die »Schwarzen« aufhetzen wollte. An der Freiburger Universität hörte er bei den Professoren Michael und Rachfahl Geschichte, bei Thiersch und Jantzen Archäologie und Kunstgeschichte, dann auch Germanistik bei Witkop und Kluge sowie Philosophie bei Husserl, Geyser und Mehlis. Hier in Freiburg setzte die Wende in seinem Leben ein. Vor allem ist sie an seinen persönlichen Beziehungen zu erkennen. In Freiburg erlebte er seine große Liebe – mit Anka Stalherm, einer Studentin: »In mir ist eine Erfüllung ohne Maß und Ziel geworden.« Die Tagebuchskizzen sind voll davon. Doch das Glück bleibt nicht ungetrübt. Zerwürfnisse und Versöhnungen wechseln sich ab. Die Beziehungen zu den Freunden werden oft auf eine harte Probe gestellt. Anka entspricht nicht seinen Vorstellungen von Treue, er muß um sie kämpfen, siegt – »sie bittet auf den Knien um meine Liebe« – und verliert dann doch. Ihre Ansichten über die politische Entwicklung entfernen sich immer mehr. Anka Stalherm, aus gutbürgerlichem Haus, wird von Goebbels’ radikalekstatischen Anschauungen mehr und mehr abgestoßen. Nach einem schmerzhaften Entfremdungsprozeß, immer wieder unterbrochen von Aussprachen und Treuegelöbnissen, entscheidet sie sich Ende 1920 für einen Juristen. »Schicksal! Es mußte so kommen.« Goebbels tröstet sich, längst nicht mehr in Freiburg, bald mit einer anderen Frau, ist allerdings »mit ihrer Liebe nicht zufrieden«, und als er erfährt, daß sie eine jüdische Mutter hat, ist »der erste Zauber zerstört«. Anka Stalherms Ehe ist nicht glücklich und wird schließlich geschieden. Als Minister * Erstpublikation unter dem Titel: Die Wende vom Katholiken zum Rechtsradikalen. Joseph Goebbels, der Propagandaminister des »Dritten Reiches«, und seine Freiburger Studentenzeit. In: Badische Zeitung, 29.11.1993.
Wie der Propagandaminister vom Katholiken zum Rechtsradikalen wurde
|
443
verhilft ihr Goebbels 1933 zu einem Posten in der Redaktion der Berliner Frauenzeitschrift »Die Dame«. Zuvor hatte er sich immer wieder einmal mit ihr heimlich verabredet, ohne sich ihr jedoch ganz zuzuwenden – so wie er andere Frauen nur als »Spielzeug« bezeichnet, an denen er sich für die durch Anka Stalherm erlittene Behandlung räche. Rache für zugefügte Demütigung – diese Antriebskraft in Goebbels’ Denken und Handeln, die sicher auch durch eine Empfindlichkeit wegen seines Fußleidens und aus Verzweiflung wegen seiner ärmlichen Verhältnisse bedingt war, wurde nicht nur in seiner in Freiburg begonnenen und dann gescheiterten Liebesbeziehung deutlich. Goebbels, streng katholisch erzogen, kam noch als Anhänger der Kirche nach Freiburg und gehörte hier der katholischen Studentenvereinigung Unitas an. Bei einer gemeinsamen Wanderung führte er einmal ein längeres Gespräch mit Alois Eckert, dem damaligen Caritas-Sekretär. Erschüttert erzählte dieser später Heinz Bollinger – dem Freiburger Mitglied der »Weißen Rose« –, Goebbels habe unaufhörlich über die christliche Liebe geredet, doch in seinen vulkanischen Ausbrüchen sei der pure Haß zum Vorschein gekommen. In Freiburg kündigten sich erste Zweifel an der Kirche an, im Wintersemester 1918/19, das er in Würzburg verbrachte, trat er dann aus der Unitas aus, lehnte bald auch Kirchgang und Beichte ab. Für ihn widersprach die Praxis der Kirche immer mehr ihrem eigenen Anspruch, und er gab ihr auch eine Mitschuld an der von ihm als negativ empfundenen politischen Entwicklung. Allerdings sollte ihn die frühe Prägung durch den Katholizismus nie loslassen. Auf die Revolution im November 1918 reagierte Goebbels zunächst hilflosaggressiv, ja verzweifelt, weil die alten sicheren Werte zerbrachen, der nationale Zusammenhalt zu zerfallen und das Chaos einzutreten schien. Doch er war bestrebt, sein Selbstverständnis neu zu definieren – auf seine Weise, indem er sich als Dichter versuchte. In Freiburg las er im Sommer 1918 Anka Stalherm nicht nur Gedichte, sondern auch sein – nicht erhaltenes – Epos von der Gefangenschaft vor und entwarf das Drama »Judas Iscariot«, das seine Zweifel darüber ausdrückte, daß die Kirche eine gerechte Welt verwirklichen könne. Noch einmal bewog ihn sein ehemaliger katholischer Lehrer, das Werk zu vernichten. Das Thema blieb für ihn jedoch aktuell. Unmittelbar nach seinem zweiten Aufenthalt in Freiburg 1919 schrieb er schließlich seine »eigene Geschichte«: »Michael Voormanns Jugendjahre«, in der er seinen Haß, seinen Ehrgeiz, seine Sucht nach Erfolg als »einsamer« Mensch herausschrieb. Unter dem Einfluß seines weiter in Freiburg studierenden Freundes Richard Flisges entstand kurz darauf das Dramenfragment »Die Arbeit«, in dem Goebbels die soziale Ungerechtigkeit anklagte, Partei nahm für die Arbeiter und wieder aus dem Haß den »Sturmwind« losbrechen sah, der alles hinwegfegen werde. Auch in weiteren Arbeiten – wie in Briefen an Anka Stalherm, deren Wohlstand ihn vermutlich verbitterte – vertrat er seinen verschwommenen Antikapita-
444
|
Joseph Goebbels in Freiburg
lismus, gegen den sich die Arbeiter auflehnen müßten, um die neue Welt mit einem »neuen Menschen« zu schaffen. Mit den Kapitalisten identifizierte er immer stärker auch die Juden, die er zugleich als Werkzeuge des Satans verstand. Dieser aus christlichen Elementen gespeiste Antijudaismus verband sich mit ebenfalls christlich geprägten Erlösungshoffnungen im »neuen Reich«. Obwohl er bereits mit der radikalen Rechten zu sympathisieren begann, hatte er zunächst noch wenig für die Nationalsozialisten übrig. 1921 zeichnete er für eine Hochzeitszeitung ein auf einem Nachttopf sitzendes Kind und reimte dazu: »Seh ich nur ein Hakenkreuz, krieg ich schon zum Kacken Reiz.« Als Goebbels im Juni 1934 offiziell Freiburg besuchte, mag er sich an die Ausflüge auf den Schlossberg, an die Diskussionen im engsten Kreis, seine Schreibversuche erinnert haben, in denen sich seine Persönlichkeit auszuformen begann.
Albert Leo Schlageter Aus kommunistischer Sicht ein »mutiger Soldat der Konterrevolution«: Eine Generation auf der Suche nach politischen Ideen*4 Am 26. Mai 1923 wurde in der Golzheimer Heide bei Düsseldorf Albert Leo Schlageter hingerichtet. Ein französisches Gericht hatte ihn zum Tode verurteilt, und nach einer erfolglosen Berufung war dieser Spruch vom französischen Ministerpräsidenten Poincaré bestätigt worden. Diese Hinrichtung rief in ganz Deutschland, besonders aber in Freiburg und Südbaden, große Erregung und Empörung hervor. Der Freiburger Erzbischof Carl Fritz hatte vergeblich um Gnade nachgesucht. Gedenkfeiern fanden statt. Der Deutsche Offiziersbund errichtete 1925 auf einer Höhe über dem Schönauer Friedhof ein Ehrenmal in Form eines Obelisken. In den folgenden Jahren wurde ein regelrechter Kult um diesen »Märtyrer« für die deutsche Freiheit entwickelt. Vor allem die Nationalsozialisten vereinnahmten ihn für ihre Zwecke. Nach der Machtübertragung an Adolf Hitler am 30. Januar 1933 konnten sie dies auch äußerlich deutlich machen: So wurde in Freiburg am 4. April eine Straße nach Schlageter benannt, am 21. April als Erstaufführung das Schauspiel »Schlageter« von Hanns Johst im Stadttheater gegeben. Diese Tradition wirkt bis heute nach: Mit Gedenkveranstaltungen in Schönau versuchten rechtsradikale Kräfte, am Schlageter-Mythos anzuknüpfen. Doch man würde es sich zu einfach machen, Schlageter lediglich als Repräsentanten des Nationalsozialismus und Rechtsextremismus zu sehen. Schlageter stammte aus Schönau im Wiesental, war dort am 12. August 1894 als Sohn einer alteingesessenen Familie geboren worden. Ursprünglich sollte er Priester werden. 1907 trat er deshalb als Tertianer in das Freiburger Erzbischöfliche Konvikt ein. Der Erste Weltkrieg veränderte indessen den vorgezeichneten Lebenslauf. Nach der »Notreifeprüfung« meldete sich Schlageter 1914 als Freiwilliger, wurde mehrfach verwundet, mit dem Eisernen Kreuz I ausgezeichnet und zum Leutnant befördert. Den Versuch, nach Kriegsende als Student der Volkswirtschaft in Freiburg wieder in das »bürgerliche« Leben zurückzukehren, brach er bald ab, um schon 1919 die Führung einer Artillerie-Batterie im Baltikum zu übernehmen. Von nun an bestimmte die Tätigkeit eines Freikorpskämpfers** sein Dasein. Vor Riga half er mit, die Rote Armee zurückzuwerfen. Anschließend gliederte er sich dem Grenzschutz in Oberschlesien ein, um eine Besetzung dieses Gebietes * Erstpublikation in: Badische Zeitung, 29.1.1996. ** Militärische Freiwilligenformationen, die sich nach dem Ersten Weltkrieg bildeten und häufig anti-republikanisch eingestellt waren.
446
|
Albert Leo Schlageter
– das nicht zuletzt als Industrierevier wichtig war – durch Polen zu verhindern. Am 21. Mai 1921 nahm er an der berühmten Erstürmung des Annaberges teil. Doch kurz darauf wurde der wirtschaftlich bedeutendere Teil Oberschlesiens von den Siegermächten des Weltkrieges, unterstützt vom Völkerbund, Polen zugesprochen. Für Schlageter wie für viele andere waren danach endgültig die Garanten des demütigenden Versailler Friedensvertrages ebenso verantwortlich für die als schändlich empfundene Lage Deutschlands wie die Regierung der ungeliebten Republik. Diese galt inzwischen als Verräter, weil sie mit ihrer »Erfüllungspolitik« die Bestimmungen des Versailler Vertrages einhalten und den Reparationswünschen der Alliierten entgegenkommen wollte. Diese sah dazu gerade nach der Entscheidung über Oberschlesien keine Alternative, wollte sie nicht die Besetzung weiterer Teile des Reichsgebietes und noch schärferen internationalen Druck riskieren. So ging sie auf die Forderungen ein, um zugleich darauf hinzuweisen, daß diese beim gegenwärtigen Zustand Deutschlands gar nicht vollständig zu erfüllen seien und deshalb revidiert werden müßten. Die Alliierten, namentlich Frankreich, durchschauten jedoch diese Strategie. Sie interpretierten die sich beschleunigende Inflation und die wachsende Staatsverschuldung als bewußte Maßnahmen der deutschen Regierung, um die Reparationsleistungen zu unterlaufen. Als Ende 1922 Deutschland auch mit den zugesagten Holz- und Kohlelieferungen in Rückstand geriet, schritt Frankreich zur Tat und besetzte zusammen mit Belgien Anfang 1923 das Ruhrgebiet. Damit sollten die Kohlelieferungen gesichert, aber auch Deutschland dauerhaft politisch geschwächt werden. Ein Sturm der Entrüstung ging durch das Land. Beinahe einhellig, über alle Partei- und Klassengrenzen hinweg, unterstützte die Bevölkerung den Aufruf der Reichsregierung zum »passiven Widerstand«. Im Ruhrgebiet kam es zum Generalstreik. Die Besatzungsmächte antworteten mit Beschlagnahmungen, Abschnürungen des Gebietes vom Reich sowie weiteren Besetzungen, etwa Offenburgs und Appenweiers. Es gab blutige Zusammenstöße. Die deutsche Regierung hoffte, Frankreich werde mit der Zeit einsehen, daß dieser Konflikt nichts nütze und daß es eine Änderung der Reparationspolitik geben müsse. Doch die Zeit arbeitete gegen Deutschland. Um die Millionenbevölkerung des Ruhrgebietes am Leben zu erhalten, mußte sie von außen unterstützt werden. Dazu reichten die Hilfeleistungen vieler einzelner nicht aus, der Staat war gefordert. Damit dies finanziert werden konnte, blieb kein anderer Weg, als zusätzliches Geld zu drucken. Die Inflation stieg ins Bodenlose. Unzählige kleine Sparer verloren ihr bescheidenes Vermögen. In dieser angespannten Situation unternahmen Gruppierungen der Freikorps, aber auch – meist kommunistische – Arbeiterorganisationen den Versuch, durch aktiven Widerstand den Besatzungsmächten zu schaden und dadurch zu erreichen, daß sie doch noch nachgaben. Vor allem sollten durch Sabotageakte die
Eine Generation auf der Suche nach politischen Ideen
|
447
Beschlagnahmungen erschwert, wenn nicht gar verhindert werden. Als sich die Attentate auf Kohlezüge häuften, zwangen die Franzosen deutsche Bürger, als Geiseln auf den Lokomotiven mitzufahren. Unter denen, die die Aktionen organisierten, befand sich auch Albert Schlageter. Am 15. März 1923 gelang es einer Gruppe unter seiner Führung, eine Brücke der wichtigen Eisenbahnstrecke zwischen Duisburg und Düsseldorf zu sprengen und damit den Güterverkehr zwischen dem Ruhrgebiet und Frankreich vorübergehend lahmzulegen. Schlageter konnte zunächst untertauchen, wurde jedoch denunziert, von den Franzosen verhaftet und vor Gericht gestellt. Erstaunlicherweise waren es jetzt nicht nur die nationalistischen Rechtskräfte, die Schlageter als Freikorpshelden priesen. Auch die KPD verurteilte Ende Mai 1923 die »Henker Schlageters« und nutzte die Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, daß die Regierung und die Kapitalisten erste Fühler ausstreckten, sich mit den Besatzungsmächten zu einigen und gegen die Arbeiter vorzugehen. Daß hinter dieser Erklärung grundsätzliche Erwägungen standen, verdeutlichte in einer Rede am 20. Juni 1923 Karl Radek, der in der Spitze der Kommunistischen Internationale für Deutschland zuständig war. Unter Berufung auf Schlageter, diesen »mutigen Soldaten der Konterrevolution«, forderte er die national denkenden Deutschen auf, zu erkennen, daß ihr Feind nicht die »revolutionäre Arbeiterklasse«, sondern das Kapital sei. Die Arbeitenden seien die Mehrheit des Volkes, sie dürften sich nicht in inneren Kämpfen zerfleischen, sondern müßten sich zur »Einheitsfront« zusammenschließen. »Die Sache des Volkes zur Sache der Nation gemacht, macht die Sache der Nation zur Sache des Volkes.« Besser als daß sich nationalistische Kleinbürger und Arbeiter als Gegner gegenüberstünden, Gewalt auf Gewalt antworte, sei es, zusammen für die Freiheit des Volkes einzutreten. Schlageter sei ein »Wanderer ins Nichts« gewesen, führte Radek unter Hinweis auf einen Freikorpskämpfer-Roman aus. Jetzt sollten Männer wie er »Wanderer in eine bessere Zukunft der gesamten Menschheit werden«. Radek gab sich überzeugt, daß »Hunderte Schlageters (diese Wahrheit) vernehmen und sie verstehen werden«. Diese Rede wirkte als Sensation. Im Lager der Rechtsradikalen kam es zu erheblicher Verwirrung. Es gab durchaus Zustimmung, und einige der Vordenker der völkisch-nationalen Kreise ließen sich auf eine öffentliche Diskussion mit den Kommunisten ein. Dazu trug sicher die Verschärfung der inneren Lage bei. Die Wirtschaft war völlig zusammengebrochen, die soziale Situation unerträglich geworden. Am 26. September 1923 brach die neue Regierung unter Stresemann den »passiven Widerstand« ab und erklärte sich zu einer Wiederaufnahme der Reparationsleistungen bereit. Als Voraussetzung dazu, aber ebenso zur Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse wurde eine Währungsreform in Angriff genommen. Zunächst führten die Zustände allerdings noch zu schweren inneren Unruhen. Im September gipfelten in Südbaden Demonstrationen und Streiks in ei-
448
|
Albert Leo Schlageter
nem Generalstreik mit gewaltsamen Auseinandersetzungen. In Freiburg waren zahlreiche Verletzte zu beklagen, in Lörrach – dem Zentrum der Streiks – sogar Todesopfer. Im Oktober bildeten in Sachsen und Thüringen SPD und KPD gemeinsame Regierungen. KPD und Kommunistische Internationale hofften, daß dies der Beginn einer deutschen Oktoberrevolution sei. Doch die Reichsregierung bereitete mit dem Einmarsch der Reichswehr in die beiden Länder diesen Träumen ein rasches Ende. Die KPD blies daraufhin die geplante Erhebung ab, lediglich in Hamburg kam es Ende Oktober noch zu blutigen Kämpfen. Weniger energisch als gegen die Linken reagierten Reichsregierung und Reichswehr gegen die sich formierenden Rechtskräfte. Sie wollten von Bayern aus einen »Marsch auf Berlin« durchführen. Als den extremsten Gruppierungen unter Führung Ludendorffs und Hitlers die Sache nicht schnell genug ging, putschten sie am 8./9. November 1923 in München, scheiterten jedoch kläglich. Damit war auch die Gefahr von rechts vorerst gebannt. Die Republik erhielt noch einmal eine Chance. In der Regel wird Radeks Schlageter-Rede dahingehend interpretiert, er habe einen Keil in das rechte Lager treiben wollen, um es schwächen und die Bedingungen für die kommunistische Erhebung zu verbessern. Es zeige den Opportunismus dieses Politikers, daß er selbst vor einer Anbiederung an Faschisten nicht zurückgeschreckt sei. Sicher nutzte Radek alle Möglichkeiten für einen Erfolg der geplanten deutschen Oktoberrevolution. Er wußte, daß bei einer Niederlage auf absehbare Zeit alle Hoffnungen auf eine Weltrevolution begraben werden mußten und innerparteilich der Kurs Stalins gestärkt werden würde. Doch hinter seiner Strategie stand mehr, als Schlageter vordergründig für den Aufstand zu instrumentalisieren. Radek und diejenigen, die mit ihm sympathisierten, hatten klar erkannt, daß viele der Freikorpskämpfer und viele, die sich jetzt von national-völkischen Parolen gewinnen ließen, keineswegs einfach Reaktionäre waren. Sie gehörten zur Kriegsgeneration, die nach Kriegsende keinen Platz in der Gesellschaft fand und sich überflüssig fühlte. So schufen sie sich den Landsknecht-Militarismus als neue Lebensform. Hier erwarteten sie, verstärkt durch einen völkischen Jugend- und Führerkult, als Erlösung aus der jetzigen Lage etwas grundsätzlich Neues in einem »nationalen Sozialismus« der »Volksgemeinschaft«. Das war noch nicht gleichzusetzen mit dem Nationalsozialismus Hitlerscher Prägung. Schlageter – von dem die Nazis später behaupteten, er sei 1922 der Partei beigetreten, ohne es beweisen zu können – griff in einem Brief aus dem Ruhrgebiet die NSDAP scharf an: Sie trug die Solidarität des Widerstandes nicht mit, weil sie das politische Zentrum der Partei nicht von München nach Norddeutschland verlegt sehen wollte. Einige Freikorpskreise, darunter nicht zuletzt solche, denen Schlageter nahestand, hatten erstaunlich enge Beziehungen zu Kommunisten, weil auch sie eine
Eine Generation auf der Suche nach politischen Ideen
|
449
Veränderung der sozialen Verhältnisse als vordringlich ansahen. Radek wollte solchen Tendenzen eine Perspektive bieten. Ihm war bewußt, daß die Jugend eine Orientierung suchte. Sie war, nach dem aufwühlenden Kriegserlebnis, verunsichert durch die neuen Zustände und Wertvorstellungen, die ihre Männlichkeitsbilder und politischen Ideen in Frage stellten. Eine derart verunsicherte Schicht, die zugleich sozial und materiell bedroht war, mußte ein leichtes Opfer rechtsextremer Führer werden, die ihr ein Ziel zu geben verstand. Radek wollte an den Empfindungen und vagen politischen Gedanken dieser Schicht und Generation anknüpfen, um sie, deren Orientierung noch nicht durchweg festgefügt war, für die Kommunisten zu gewinnen und zu verhindern, daß sie als Massenbewegung zu einem stabilen Kern des Faschismus würde. Die Ereignisse des Jahres 1923 machten diesen Ansatz zunichte, und Radeks Befürchtungen sollten sich bewahrheiten. Das Schicksal Schlageters zeigt beispielhaft die gescheiterte Suche einer Generation nach ihrer gesellschaftlichen Aufgabe.
Ernestine und Wilhelm Liebknecht Vom Freiburger Gefängnis ins Zentrum der Arbeiterbewegung* Amalie Struve1 empfand während ihrer Kerkerhaft im Freiburger Turm allein Trost von der freundlichen Tochter des Gefängniswärters, die sich nach Kräften bemühte, »mir meine Lage weniger fühlbar zu machen«. Dieses »sehr brave Mädchen« war Ernestine Landolt, die wahrscheinlich am 13. August 1832 geboren wurde. Ihr Vater, ein ehemaliger badischer Unteroffizier, hatte die Stelle als Alterssicherung erhalten. Aufgeschlossen für ihre Umgebung, verfolgte Ernestine die Freiheitsbestrebungen der badischen Demokraten mit Sympathie. Amalie Struve scheint ihr gefallen zu haben. Und sie war nicht die einzige, die nach dem gescheiterten Putsch vom September 1848 im Turm einsaß. Unter den männlichen Revolutionären befand sich Wilhelm Liebknecht, der, am 29. März 1826 geboren, aus einer Gießener Theologen- und Beamtenfamilie stammte. Nach seinem Studium vor allem in Marburg war er als Lehrer in Zürich begeistert erst zu Herweghs »Deutscher Legion«,2 dann zu Struves Freischärlern geeilt, um die freie Republik zu erkämpfen. Nur knapp entging er nach dem Scheitern des Aufstandes der standrechtlichen Erschießung. Nun wartete er auf seinen Prozeß wegen Hochverrats und auf den Tag, an dem er seinen Richtern und der Öffentlichkeit sein »kommunistisches Glaubensbekenntnis« entgegenschleudern konnte – eine noch eher verschwommene Vorstellung einer gerechten Gesellschaftsverfassung. Lorenz Brentano hatte es abgelehnt, für diesen Hitzkopf die Rechtsvertretung zu übernehmen.3 Ernestine Landolt hingegen, die ihm täglich das Essen brachte, entflammte für diesen Mann und seine Ideen. »Der Liebe Stern, der uns im Kerker aufgegangen ...,« dichtete Wilhelm Liebknecht 1866. * Erstpublikation in: Geschichte der Stadt Freiburg im Breisgau. Bd. 3: Von der badischen Herrschaft bis zur Gegenwart. Hg. von Heiko Haumann und Hans Schadek. Stuttgart 1992, S. 126–129, 726. 1 Amalie Struve (1824–1862), verheiratet mit Gustav Struve (1805–1870), nahm aktiv an der badischen Revolution 1848 teil. Sie wurde mit ihrem Mann im September 1848 verhaftet und blieb bis April 1849 eingekerkert. 2 Georg Herwegh (1817–1875) versuchte vergeblich, mit seiner «Deutschen Legion« von Frankreich aus die badische Revolution zu unterstützen. 3 Lorenz Brentano (1813–1891) war Jurist und verteidigte zahlreiche Revolutionäre. Ursprünglich politisch links stehend, trat er 1849 an die Spitze der provisorischen revolutionären Regierung in Baden. Hier handelte er eher gemäßigt und wurde schließlich abgesetzt. Er flüchtete in die Schweiz und wanderte anschließend in die USA aus. Dort machte er Karriere als Journalist und Politiker. So war er Präsident des Stadtrates von Chicago und Mitglied des Repräsentantenhauses.
Vom Freiburger Gefängnis ins Zentrum der Arbeiterbewegung
|
451
Am 11. Mai 1849 stand er vor den Schranken des Freiburger Schwurgerichts. Doch aus seinem großen Auftritt wurde nichts. Angesichts der dramatischen Veränderungen im Lande beantragte selbst der Staatsanwalt Freispruch für den Angeklagten. Unter »Hurrah!« wurde er »aus dem Saal auf die Straße getragen, wo alles schwarz war von jubelnden Menschen. (…) und das alles im wunderschönen Monat Mai und in der wunderschönen Stadt Freiburg und ihrer wunderschönen Umgebung! Die Auferstehung der Natur, begleitet von der Auferstehung des Volkes (…) aus dem Gefängnis in die Revolution! Das ist tausendfacher Genuß, und ich freue mich, daß ich ihn einmal gehabt habe.« Die badische Revolution raubte Ernestine und Wilhelm die Zeit, um ihre Liebe in Freiheit zu genießen. Zusammen mit Rechtsanwalt Salomon Fehrenbach, dem späteren Vorstandsmitglied im Freiburger Arbeiterbildungsverein, versuchte Liebknecht – vergeblich –, die abziehenden württembergischen Truppeneinheiten für die Sache der Republik zu gewinnen. Dann ging er nach Karlsruhe, um sich in die Freiwilligenverbände einzureihen, befreundete sich dort mit Max Dortu,4 stellte sich im »Klub für den entschiedenen Fortschritt« aktiv gegen den gemäßigten Kurs Brentanos, war deshalb sogar vorübergehend in Rastatt eingekerkert und kämpfte schließlich gegen die vorrückenden preußischen Truppen. Anfang Juli 1849 traf er auf dem Rückzug wieder in Freiburg ein. Doch an ein Bleiben war nicht zu denken. Gleich mußte er wieder »vom Liebsten, was man hat,« scheiden. Am Abend des 4. Juli begegneten sich die beiden Liebenden ein letztes Mal auf dem Schloßberg. Mit der Pistole in der Hand mußte sich Liebknecht dann den Weg zum Treffpunkt mit seinen Kameraden freikämpfen, von denen Dortu festgenommen worden war. Im Morgengrauen verließ die kleine Schar heimlich die Stadt. In der Schweiz fand Liebknecht Asyl. Dort lernte er Friedrich Engels kennen und begann, die Schriften von Marx zu studieren. Energisch reorganisierte er die deutschen demokratischen und Arbeitervereine in der Schweiz, wurde deshalb jedoch 1850 ausgewiesen und emigrierte nach London. Hier traf er Struve, fand jedoch, »daß wir nicht mehr zusammengehörten«, und suchte Karl Marx auf, mit dem er seitdem eng zusammenarbeitete. Ernestine hatte er aber ebensowenig vergessen wie sie ihn. Brieflich hielten sie Kontakt. Der Geldmangel des Flüchtlings verhinderte zunächst eine weitere Annäherung. Ernestine und ihre Familie befanden sich auch nicht gerade in glücklichen Verhältnissen, nachdem der Vater 1850 gestorben war. 1854 war es endlich so weit. Wilhelm konnte Ernestine das Geld für die Überfahrt schicken und ihr eine gesicherte Existenz in Aussicht stellen. Sie zögerte: Sollte sie wirklich den Weg in die Ferne, ins Ungewisse wagen? Ihre Mutter verbot ihr die Heirat, die Möglichkeit einer anderen Verbindung in Frei4 Max Dortu (1825–1849) war einer der Kriegskommissare der Revolutionseinheiten 1849 und wurde von einem Standgericht zum Tode verurteilt.
452
|
Ernestine und Wilhelm Liebknecht
burg schien sich zu eröffnen. Schließlich siegte doch die Liebe. Im August 1854 traf Ernestine nach langer Reise in London ein, am 17. September 1854 fand die Hochzeit statt. Ernestine verkehrte nun in den Kreisen der Marx-Anhänger, befreundete sich vor allem mit Jenny Marx, die gesicherte Existenz blieb ihr jedoch verschlossen. Die erwartete Stelle ging Wilhelm Liebknecht wieder verloren, die junge Familie mußte meistens im Elend leben. 1858 fuhr Ernestine Liebknecht mit ihrer sieben Monate alten Tochter Alice – Sohn Richard war bereits nach einem Lebensjahr gestorben – zur Erholung nach Freiburg. Hier wurde ihr bewußt, wie erbärmlich sie in London leben mußte – eine Lage, die offenbar der Ehe nicht immer zugute kam. Sie kündigte Wilhelm an, mindestens ein Jahr in Deutschland bleiben zu wollen. Er verweigerte, in bester Ehemannsmanier, die »Erlaubnis«, gab sie dann doch, fragte, ob sie die Scheidung wolle. Ernestine reagierte empört und selbstbewußt. Wilhelm erkannte, was er zu verlieren im Begriff war. Er lenkte ein und machte deutlich, daß er ohne sie nicht leben könne. Und sie sah, daß hinter seinen Allüren wirklich Liebe für sie stand. So blieb sie nur etwas länger als ursprünglich vorgesehen in Freiburg, zumal sie sich zwar noch in Stadt und Umgebung wohl fühlte, nicht mehr unbedingt jedoch unter den Menschen: »Überhaupt gibt sich hierzulande ein ganz entsetzlicher Royalismus kund,« wie sie ihrem Mann am 9. September 1858 schrieb: »Wenn man nur ein einziges Wort spricht von 1848, bekreuzigt sich jedermann nicht nur ein-, sondern dreimal, und sieht einen mit schiefen Augen an; daß ich die Frau eines politischen Flüchtlings bin, ist überall ein Stein des Anstoßes.« 1862 durften die Liebknechts nach Deutschland zurückkehren. Ihre Lage blieb jedoch ungesichert, immer wieder kam es zu schweren Zeiten. Wilhelm Liebknecht schrieb unregelmäßig für verschiedene Zeitungen, so für den »Oberrheinischen Courier« in Freiburg, dessen Redakteur Valentin Mayer ein alter Freund aus der badischen Revolutionszeit war. Intensiv wirkte er in Lassalles Allgemeinem Deutschen Arbeiterverein mit, wurde allerdings 1865 ausgeschlossen. Er lernte August Bebel kennen und überzeugte ihn von der Marxschen Richtung der Sozialdemokratie. 1869 gründeten sie in Eisenach die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, die spätere SPD, deren anerkannte Führer sie bis zu ihrem Tode blieben. Liebknecht konnte der Partei noch die Erfahrung der Revolutionszeit und der Emigration vermitteln. Vielleicht ging es nicht zuletzt auf seine Erlebnisse in Baden zurück – selbst Marx hielt ihn einmal für zu antipreußisch, für »zu borniert südlich« –, daß er die Bismarcksche Lösung der Einheit Deutschlands entschieden ablehnte und dafür auch wie Bebel 1872 als »Hochverräter« erneut zu zwei Jahren Festungshaft verurteilt wurde. Zu diesem Zeitpunkt war seine geliebte Ernestine längst tot. Die Belastungen ihres Lebens hatten sie bereits 1865 zusammenbrechen lassen, zwei Jahre später, am 29. Mai 1867, erlag sie in Leipzig der Tuberkulose. Sie hatte keine Chance
Vom Freiburger Gefängnis ins Zentrum der Arbeiterbewegung
|
453
gehabt, sich auszukurieren. Wilhelm Liebknecht teilte Marx die schlimme Nachricht noch am Todestag mit und schwor: »Der Tag der Rache wird kommen.« Er wußte, daß die Verhältnisse des Flüchtlingsdaseins eines Radikaldemokraten und Sozialisten ihr Leben verkürzt hatten. An Friedrich Adolph Sorge schrieb er am 6. Juni 1867: »Hätte sie ihr Leben nicht an das meine gekettet, sie würde noch leben. Freilich, sie liebte mich.« Wilhelm Liebknecht starb am 7. August 1900 in Berlin.5
5 Wolfgang Abendroth: Die Entstehung der deutschen Arbeiterbewegung am Beispiel von Wilhelm Liebknecht. In: ders.: Die Aktualität der Arbeiterbewegung. Beiträge zu ihrer Theorie und Geschichte. Hg. von Joachim Perels. Frankfurt/M. 1985, S. 46–71, Zitat S. 58; Wilhelm Liebknecht. Briefwechsel mit deutschen Sozialdemokraten. Bd. 2: 1878– 1884. Hg. von Götz Langkau. Frankfurt/M., New York 1988, S. 406; Wilhelm Liebknecht: Erinnerungen eines Soldaten der Revolution. Hg. von Heinrich Gemkow. Berlin 1976; Rudolf Muhs: Die Revolution und der Beginn einer Liebe. Wilhelm Liebknecht erlebte die Revolution von 1848/49 in Freiburg. ln: Badische Zeitung, 3./4.5.1986 (Magazin); Wolfgang Schröder: Ernestine. Vom ungewöhnlichen Leben der ersten Frau Wilhelm Liebknechts. Eine dokumentarische Erzählung. 2. Aufl. Leipzig 1989, Zitate S. 11, 12, 14, 21, 31, 69, 75, 196, 197; »Sie können sich denken, wie mir oft zu Muthe war ...« Jenny Marx in Briefen an eine vertraute Freundin. Hg. von Wolfgang Schröder. Leipzig 1989; Amalie Struve: Erinnerungen aus den badischen Freiheitskämpfen. Hamburg 1850, S. 102.
Vom »Lederstrumpf« zum Freund Lenins Das abenteuerliche Leben Carl Lehmanns*6 Vom 16. bis 19. November 1888 fand vor der Strafkammer des Landgerichts in Freiburg der »Große Sozialisten-Prozeß« statt. 15 Angeklagte, darunter vier Frauen wurden beschuldigt, verbotene sozialdemokratische Druckschriften aus Basel bezogen und im Deutschen Reich verbreitet zu haben. Zu diesem Zweck hätten sie einer geheimen Verbindung angehört, die den Vollzug des Gesetzes vom 21. Oktober 1878, »betreffend die gemeingefährlichen Bestrebungen der Socialdemokratie«, habe lahmlegen wollen. Der Hauptangeklagte, der reichsweit bekannte Sozialdemokrat Adolf Geck aus Offenburg, wurde zu vier Monaten Gefängnis verurteilt. Unter den beiden allein Freigesprochenen befand sich ein gewisser Carl Lehmann, der bei seiner Begrüßung nach der Freilassung meinte, »er habe selbst nicht gewußt, daß er so unschuldig sei«. In Wirklichkeit zählte er zu den aktivsten der »Roten Feldpost«, die dafür sorgte, daß auch unter dem »Sozialistengesetz« die Schriften der Sozialdemokratie gelesen werden konnten. Die »Verbrecher«, die ihre Strafe erst später absitzen mußten, feierten das Urteil in der Wirtschaft »Zur Reichspost« am Holzmarkt, unmittelbar gegenüber dem Gerichtsgebäude gelegen. Die Wirtin, Catharina Josepha Fuchs, stammte ebenfalls aus Offenburg – sie war eine Halbschwester Carl Lehmanns. Sie hatte die Angeklagten während ihrer Haftzeit in Freiburg bestens mit Speise und Trank versorgt. 1884 hatte dieses Gasthaus schon einmal eine Rolle für die sozialdemokratische Bewegung gespielt: Von hier aus verständigten sich russische Revolutionäre, darunter die berühmte Vera Sasulitsch, mit ihrem verhafteten Genossen Leo Deutsch und bereiteten einen Befreiungsversuch vor, der allerdings scheiterte. Über das Leben Carl Lehmanns wissen wir gut Bescheid durch die Forschungen des jüngst verstorbenen Erwin Dittler, der unermüdlich den Spuren von Demokraten und Revolutionären in unserem Raum nachgegangen ist. Geboren wurde Lehmann am 8. Juli 1865 in Offenburg als Sohn eines Gerbers und Kommunalpolitikers. Schon in der Schule fiel er durch seine Streiche und Abenteuerlust auf. So war es kein Wunder, daß der inzwischen auch zum Gerber ausgebildete Carl den Decknamen »Lederstrumpf« erhielt, als er für die »Rote Feldpost«
* Erstpublikation: Wie »Lederstrumpf« zum Freund Lenins wurde. Beim »Großen SozialistenProzeß« 1888 in Freiburg freigesprochen: der Sozialdemokrat Carl Lehmann. In: Badische Zeitung, 15.7.1996.
Das abenteuerliche Leben Carl Lehmanns
|
455
tätig wurde.**71885 weilte er in diesem Zusammenhang in Hamburg. Während eines Prozesses gegen dortige Sozialdemokraten tauchte er plötzlich im Gerichtssaal auf, legte ein Schriftstück vor, das einen der Angeklagten entlasten sollte, und verschwand wieder, ehe die Polizei ihn verhaften konnte. Solche Taten machten ebenso die Runde wie eine Begebenheit in einer Schwarzwälder Wirtschaft 1892, als Lehmann unter Einsatz seines Lebens einen Brand mit Hilfe des vorhandenen Weinvorrates löschte. Innerhalb der Sozialdemokratie zählte er bald zu den bekannteren Persönlichkeiten. Gute Beziehungen verbanden ihn etwa mit dem Vorsitzenden der Partei, August Bebel, und dessen Frau Frieda. Als Bebel bei der Reichstagswahl 1893 in Straßburg wie in Hamburg kandidierte und in beiden Kreisen gewann, war es nicht zuletzt Lehmann, der ihm bei der Annahme des Straßburger Mandats zur Seite stand und ihn nach Hamburg begleitete, wo er den dortigen Sozialdemokraten offenbar überzeugend seine Entscheidung erläuterte. Daß Lehmann im selben Jahr zum Kongress der II. Internationale in Zürich delegiert wurde – ähnlich wie schon 1889 zum Internationalen Arbeiterkongreß in Paris –, macht seine Stellung in der Partei deutlich. 1887 hatte er das Ärzte- und Sozialisten-Ehepaar Otto Walther und Hope Bridges Adams-Walther kennengelernt. Sie kauften das Sanatorium in Nordrach, wo auch Frieda Bebel und Clara Zetkin behandelt wurden. Unter dem Einfluss Hopes, mit der ihn bald eine Liebesbeziehung verband und die er 1896 heiratete, machte er sein Abitur nach und studierte zunächst Landwirtschaft, dann Medizin. Die am 17. Dezember 1855 geborene Hope gehörte zu den ersten Frauen, die Medizin studieren konnten; 1880 hatte sie in Bern promoviert. Sie machte sich nicht nur als Ärztin, sondern auch als Sozialpolitikerin einen Namen. 1885 war ihre englische Übersetzung von Bebels Schrift »Die Frau in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft« (später »Die Frau und der Sozialismus«) erschienen. Nachdrücklich trat sie für ein naturgemäßes Leben und eine Verbesserung der Lage der Frauen ein. Nachdem Carl 1897 in München promoviert hatte, eröffnete das Ehepaar dort in der Gabelsberger Straße 20 a eine gemeinsame Praxis. Diese Adresse gewann gewissermaßen weltgeschichtliche Bedeutung: Über sie konnten russische Revolutionäre Wladimir Iljitsch Uljanow, genannt Lenin, erreichen. Dieser war nach Ablauf seiner Verbannung in Sibirien 1900 nach München gekommen und faßte, ebenso wie seine 1901 nachgekommene Frau Nadeschda Krupskaja, schnell volles Vertrauen zu Lehmann. Briefe, Bücher- und Geldsendungen liefen über ihn. Ersatzadresse war nach Lenins Anweisung Lehmanns Schwester Maria Blei. Fast täglich trafen die Lehmanns mit Lenin zusam** Der Name orientiert sich an den unter dem Titel »Lederstrumpf« zusammengefassten Erzählungen James Fenimore Coopers (1789–1851), in denen er das Bild des amerikanischen Trappers und Pioniers im »Wilden Westen« schuf.
456
|
Vom »Lederstrumpf« zum Freund Lenins
men. Auch Vera Sasulitsch und Clara Zetkin gehörten hier wieder zu ihrem Kreis, ebenso wie Rosa Luxemburg, die in München zum ersten Mal Lenin begegnete. Daß es zu diesen engen Beziehungen kam, hing vermutlich mit einer Reise Carl Lehmanns zusammen, die ihn gemeinsam mit Israel Lasarewitsch Helphand, genannt Parvus, 1899 in weite Teile Rußlands geführt hatte. Die Abenteuerlust mag zu diesem Entschluß beigetragen haben. Parvus, ein linker Sozialdemokrat und bedeutender Organisator, war nach verschiedenen Ausweisungen in München von der Familie Lehmann aufgenommen worden. Nach Rußland fuhr er mit einem falschen Paß, und die beiden standen immer wieder in Gefahr, verhaftet zu werden, zumal sie wohl auch die Gelegenheit zu illegaler politischer Arbeit nutzten. Als Ergebnis der Reise erschien 1900 ein heute noch lesenswertes gemeinsames Buch: »Das hungernde Rußland. Reiseeindrücke, Beobachtungen und Erfahrungen.« Darin wiesen sie darauf hin, daß der Getreidemangel in Rußland und die periodisch wiederkehrenden Hungersnöte durch den vom Staat geförderten, devisenbringenden hohen Getreideexport verursacht würden. Neben der politischen Tätigkeit engagierte sich das Ehepaar Lehmann für das Gesundheitswesen, die Sozialfürsorge und die Volksbildung. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, bildeten die Lehmanns in München einen Kreis, der nach Friedensmöglichkeiten suchen wollte und für die sozialdemokratische, ja deutsche Außenpolitik eine wichtige Rolle spielte. Hope Lehmann reiste im September 1914 in ihre Heimat England, um dort zu sondieren. Ihre Erfahrungen veröffentlichte sie anonym 1915 in der Broschüre »Kriegsgegner in England«. Die englische Regierung ließ sie erst im Januar 1915 wieder ausreisen. In ihrer Abwesenheit hatte sich Carl Lehmann freiwillig als Chirurg in ein Feldlazarett gemeldet. Am 17. Januar 1915 schrieb er freudig an Adolf Geck: »Meine Frau ist seit acht Tagen wieder in München«, ihm selbst gehe es gut. Am 8. April dieses Jahres war er tot, gestorben in Valenciennes an einer Blutvergiftung. Auch die Pflege durch seine Frau hatte ihm nicht mehr helfen können. Ihre Kraft erlosch nun auch, und sie konnte ihrer Lungenerkrankung nicht länger widerstehen: Am 11. Oktober 1916 starb Hope Lehmann.
Leonid Hasenson und Oskar Hartoch Zwei Mediziner im Stalinismus*8 Nach der Auflösung der Sowjetunion haben sich auch die Möglichkeiten verbessert, unzensiert, offen und gestützt auf bislang verschlossene Quellenbestände, die Geschichte des Stalinismus, seiner Voraussetzungen und Nachwirkungen zu erforschen. Neue Einblicke bieten insbesondere Rekonstruktionen von Lebensläufen. Eingebettet in die jeweiligen historischen Zusammenhänge erlauben sie, Lebens- und Arbeitsverhältnisse sowie Wertvorstellungen, Denk- und Verhaltensweisen kennenzulernen. Deutlich werden nicht zuletzt Einstellungen gegenüber dem Sowjetstaat, zugleich aber auch die Folgen staatlicher Politik für sie persönlich. So ist bis heute nicht völlig verständlich und in den wissenschaftlichen Erklärungsansätzen umstritten, warum der stalinistische Terror nicht nur innerparteiliche Gegner sowie tatsächliche oder vermeintliche Opponenten erfasste, sondern willkürlich Millionen von Menschen unter entsetzlichen Bedingungen in sein Räderwerk zog. Individuelle Lebensgeschichten können vielleicht zeigen, an welchen Zusammenhängen die Verfolgungen anknüpften, welche Funktion sie hatten, unter welchen Umständen sie sich vollzogen, was in den Ausführenden vor sich ging. Darüber hinaus ermöglichen sie es uns nachzuvollziehen, wie der alltägliche Stalinismus von den Leidtragenden, von ihrem Umfeld und von den Nachkommen verarbeitet wurde. Eine Möglichkeit, sich einen derartigen Zugang zu erschliessen, eröffnete sich mir Ende 1997. Ich lernte Prof. Dr. Leonid Hasenson kennen, der anderthalb Jahre zuvor aus Russland seiner Familie nach Deutschland gefolgt war und nun in Lörrach wohnte. 1921 war er in Kazan geboren worden. Er konnte durchaus auf ein erfolgreiches Leben zurückblicken: An der Medizinischen Akademie der sowjetischen Marine studierte er Medizin, unterbrochen durch seine Teilnahme am Zweiten Weltkrieg; anschliessend blieb er im Militärdienst. Während der Stalin-Ära war er als Jude allerdings vielfältigen Behinderungen ausgesetzt. Erst nach Stalins Tod 1953 konnte er seine besonderen fachlichen Fähigkeiten entfalten. 1957 wechselte er von der Marine zum Pasteur-Institut in Leningrad. Dort begann seine wissenschaftliche Laufbahn, die ihn zu einem weltweit bekannten Gelehrten in Epidemiologie, Mikrobiologie und Immunologie machte. Seine Spezialität war die Bekämpfung von Darminfektionen, der Salmonellen und der Shigellen. 1975 wurde er zum Professor ernannt. 1996 trat er von seinem Amt zurück. Erst in späteren Jahren konnte er seinem leidenschaftlichen Interesse für * Erstpublikation unter dem Titel: Mediziner im Stalinismus. Zwei Beispiele: Leonid Hasenson und Oskar Hartoch. In: Basler Zeitung, Magazin Nr. 28, 15.7.2000.
458
|
Leonid Hasenson und Oskar Hartoch
Geschichte nachgehen – und dies in enger Verbindung mit seiner Tätigkeit am Pasteur-Institut. Ausführlich berichtete Leonid Hasenson mir über sein geplantes Werk: die Rekonstruktion des Lebensweges eines seiner Vorgänger am Pasteur-Institut, Prof. Dr. Oskar Hartoch. Viele Aspekte haben wir gemeinsam erörtert, manche Recherchen gemeinsam in die Wege geleitet. Leider konnte Leonid Hasenson sein Werk nicht mehr vollenden: Er verstarb am 26. August 1999. Aber ich hoffe, dass sich eine Möglichkeit finden wird, das Projekt doch noch zu verwirklichen. Damit soll die Tätigkeit Hasensons angemessen gewürdigt werden, und zugleich geht es darum, eine exemplarische Biographie in Erinnerung zu rufen, die eine ihrer Wurzeln und Beziehungsnetze in der Schweiz hat. Oskar Hartoch wurde 1881 in St. Petersburg als Sohn eines russlanddeutschen Ehepaars – der Vater war Chemieunternehmer – geboren und wuchs dort zusammen mit seinen Schwestern Elsa (1879–1981) und Frieda (1880–1972) auf. Seine Ausbildung als Mediziner erfuhr er an den Universitäten von Bonn und Dorpat. 1907 begann er, im Kaiserlichen Institut für experimentelle Medizin in St. Petersburg tätig zu werden. Als Privatdozent arbeitete er dann vor dem Ersten Weltkrieg einige Jahre am Institut für Hygiene und Bakteriologie an der Universität Bern. Dessen Leiter war damals der bedeutende Mikrobiologe, Immunologe und Epidemiologe Prof. Wilhelm Kolle (1868–1935), ein ehemaliger Assistent Robert Kochs. Unter anderem entwickelte er Impfstoffe gegen Cholera und Rinderpest. 1914 musste er die Schweiz verlassen, weil ihn die deutsche Armee im Weltkrieg als Spezialisten brauchte. Hartoch, der inzwischen Kolles Stellvertreter geworden war, kehrte 1915 nach Russland zurück und arbeitete im dortigen Militärsanitätsdienst. Als russischer Staatsbürger blieb ihm keine andere Wahl, um seine Familie und seinen Besitz nicht zu gefährden. Auch nach der Oktoberrevolution entschied sich Hartoch, in Russland zu bleiben, obwohl er erhebliche Vermögensverluste hinnehmen musste. Die wissenschaftlichen Perspektiven erschienen ihm zu verlockend. Seit 1918 konnte er unter der Leitung von Prof. A. A. Vladimirov (1862–1942) – einem gebürtigen Berliner – wieder im Institut für experimentelle Medizin forschen. In den zwanziger Jahren reiste er mehrfach nach Frankfurt a. M., wo Prof. Kolle inzwischen das von Paul Ehrlich gegründete Institut für experimentelle Therapie leitete. Es kam zu mehreren gemeinsamen Arbeiten. 1930 wurde Hartoch Leiter der Abteilung für Mikrobiologie und Immunologie am Institut für experimentelle Medizin und wenig später auch wissenschaftlicher Leiter des Pasteur-Instituts für Epidemiologie und Mikrobiologie in Leningrad. Für seine Verdienste erhielt er zahlreiche Auszeichnungen. Er war nicht nur ein glänzender Forscher, dem wichtige neue Erkenntnisse über Infektionserkrankungen und ihre Bekämpfung gelangen, sondern er schuf auch eine wissenschaftliche Schule, aus der ausgezeichnete Mediziner hervorgegangen sind. Seine
Zwei Mediziner im Stalinismus
|
459
Wirkung reicht bis in die heutige Zeit. Damals sah es so aus, als stünden ihm in der Sowjetunion alle Türen offen. Und doch gab es schon 1930 ein erstes Warnzeichen. Zusammen mit Vladimirov wurde Hartoch am 13. August verhaftet. Der Zeitpunkt fiel in die Phase überstürzter Industrialisierung und gewaltsamer Kollektivierung, in der die Sowjetbehörden nach Sündenböcken für Missstände und Schwierigkeiten suchten. Um die Bevölkerung von den tatsächlich Verantwortlichen abzulenken, präsentierte man ihr immer neue »Schädlinge« und »Saboteure« auf allen Ebenen. Potenzielle Kritiker sollten damit eingeschüchtert werden. Rasch kamen Hartoch und Vladimirov wieder frei – Romain Rolland (1866– 1944), der berühmte französische Schriftsteller, hatte sich ebenso für sie eingesetzt wie dessen Freund Maksim Gorkij (1868–1936) und der berühmte Physiologe und Entdecker der bedingten Reflexe Ivan P. Pavlov (1849–1936). Rolland war gut bekannt mit Elsa Hartoch, die seit 1914 in der Schweiz lebte und Lehrerin an der Internationalen Schule in Genf war; ihre Schwester Frieda Semenoff-Hartoch wohnte im übrigen seit 1910 ebenfalls in der Schweiz und war als Kinderärztin in Zürich tätig. Alles schien nur ein Versehen zu sein. Die Arbeit ging weiter. Doch am 2. August 1937 schlug die Geheimpolizei wieder zu und verhaftete Hartoch zusammen mit acht führenden Mitarbeitern des Pasteur-Instituts. Zu dieser Zeit hatte der stalinistische Terror seinen Höhepunkt erreicht. Millionen Menschen wurden meist aufgrund willkürlicher Verdächtigungen oder Denunziationen, eingesperrt, gefoltert, deportiert oder erschossen. Die verschiedenen Behörden übertrafen sich gegenseitig damit, angebliche »Volksfeinde« zu entlarven. Die Verbrechen gewannen eine Eigendynamik, die zeitweise kaum noch gesteuert werden konnte. Während Hartochs Mitarbeiter vermutlich ermordet wurden, konnte dieser selbst im Mai 1938 das Gefängnis wieder verlassen. Erneut war dafür eine Intervention Romain Rollands verantwortlich: Er hatte persönlich an Stalin und andere hohe Persönlichkeiten des Sowjetregimes geschrieben. Die näheren Umstände dieser Vorgänge sind bis heute ungeklärt. Hartoch war eines Mordanschlags auf Stalin beschuldigt worden. Dahinter könnte sich, abgesehen von der Suche nach noch so absurden Vorwänden, ein spezifisches Motiv verbergen: die Furcht des Diktators vor Krankheiten und Verschwörungen. Wer als derartiger Spezialist für Infektionskrankheiten ausgewiesen war, konnte unter diesen Umständen leicht ins Visier geraten. Anfang 1953 sollte die Aufdeckung einer »Ärzteverschwörung« mit dem Ziel, die Sowjetführung zu ermorden, den Anlass zur letzten grossen Terrorwelle bilden, die nur durch Stalins Tod am 5. März dieses Jahres rasch wieder in sich zusammenfiel. Noch einmal schien die Gefahr abgewendet, die weitere Arbeit gesichert zu sein. 1940 wurde Hartoch Vizedirektor des Instituts für experimentelle Medizin. Am 31. Mai 1941 klopften die »Organe« aber ein drittes Mal an seine Tür und
460
|
Leonid Hasenson und Oskar Hartoch
nahmen ihn mit. Diesmal hatte niemand mehr Einfluss genug, um ihn zu retten. Romain Rolland war für die sowjetische Führung nicht mehr wichtig, weil er sich – enttäuscht von deren Politik – von seiner bisherigen Unterstützung der UdSSR abgewendet hatte. Hartoch wurde angeklagt, »ein aktiver Teilnehmer einer antisowjetischen Organisation unter den Mikrobiologen und Agent des deutschen Spionagedienstes« zu sein. Das Datum ist erstaunlich: Die deutschen Truppen überfielen die Sowjetunion erst am 22. Juni, noch galt der Nichtangriffspakt von 1939, und die sowjetische Regierung bemühte sich mit vielen Massnahmen und Zugeständnissen, nicht zuletzt erheblich gesteigerten Lieferungen von Wirtschaftsgütern, den Frieden zu erhalten. Allerdings sah sie inzwischen die nationalsozialistische Aussenpolitik kritischer und stellte sie in internen Einschätzungen – im Unterschied zu früher – als durchaus bedrohlich dar. Vor allem der deutsche Angriff auf Jugoslawien am 6. April 1941, den man vergeblich zu verhindern versucht hatte, führte zu Beunruhigung. Der Einfall in Griechenland und die zuvor geschlossenen Bündnisse des Deutschen Reiches mit Ungarn, Rumänien, Bulgarien und der Slowakei verstärkten dieses Gefühl, weil damit der Einfluss der Sowjetunion in einer Region gefährdet schien, die der deutschen Regierung als deren Interessensphäre bekannt war. Als dann noch deutsche Truppenaufmärsche an den Grenzen zur Sowjetunion nicht mehr übersehen werden konnten, diskutierte man innerhalb der sowjetischen Führung über einen Präventivschlag, der jedoch von Stalin nicht gebilligt wurde. Möglicherweise stand Hartochs Verhaftung im Zusammenhang mit jener Verunsicherung und Nervosität. Nach Kriegsausbruch hatte Hartoch vollends keine Chance mehr. Er wurde weiter in das Hinterland, in das Gefängnis von Saratov verlegt. Dort verurteilte ihn am 28. November 1941 ein Kriegstribunal des Geheimdienstes zum Tode. In seinem Schlusswort erklärte er, dass alle seine Aussagen, in denen er seine Schuld zugegeben habe, falsch und unter Druck – also durch Folterung – zustande gekommen seien. Am 30. Januar 1942 wurde er erschossen. Im Sommer 1956 erfolgte seine vollständige Rehabilitation. Die »Geheimrede« des neuen Parteichefs Nikita Chruschtschow im Februar 1956 während des 20. Parteitages hatte eine begrenzte Entstalinisierung eingeleitet. Im vergangenen Jahr versuchte ich, über eine Anfrage an das Archiv des Geheimdienstes Näheres über die Verfahren gegen Oskar Hartoch zu erfahren. Vermittelt über die Botschaft der Russischen Föderation in der Schweiz erhielt ich die erwähnten Daten und die Beschuldigung von 1941 mitgeteilt. Aufgrund der derzeitigen Gesetzeslage konnten mir keine Kopien der Dokumente ausgefertigt werden. Dennoch würden sich weitere Nachforschungen lohnen. Allein eine genauere Untersuchung der Bekanntschaft der Familie Hartoch mit Romain Rolland sowie dessen Aktivitäten zusammen mit Maksim Gorkij – die Quellen sind zugänglich – verspricht neue Einblicke nicht nur in ein Intellektuellenmilieu,
Zwei Mediziner im Stalinismus
|
461
sondern auch in die Entscheidungsmechanismen des Stalinschen Machtapparats. Die Motive der Verantwortlichen in den Abläufen des Terrors könnten klarer hervortreten. Darüber hinaus wäre dies eine gute Gelegenheit, in gemeinsamer Forschung von Medizinern und Historikern – so wie es Leonid Hasenson vorgeführt hat – den Lebensweg eines Wissenschaftlers im Kontext der medizinischen Entwicklung wie der jeweiligen politisch-gesellschaftlichen Umstände zu verfolgen. Die nationalen und internationalen wissenschaftlichen Verbindungen und Studien würden ebenso deutlich wie Lebensverhältnisse, Laufbahnmöglichkeiten und Vorstellungswelten eines bedeutenden Gelehrten, schliesslich auch seine Situation in der Sowjetunion, seine Einstellung zur Kommunistischen Partei und deren Verhalten ihm – und der Wissenschaft – gegenüber. Auch hierzu liegen bereits aussagekräftige Materialien vor. Gerade über die Rekonstruktion von individuellen Lebensläufen in ihren Vernetzungen können sich Denk- und Verhaltensweisen wie Herrschaftsstrukturen einer ganzen Epoche erschliessen.
Philipp Martzloff Ein Pionier der Arbeiterbewegung in Baden*9 Das Leben Philipp Martzloffs spiegelt über 50 Jahre Stadtgeschichte, im besonderen die Geschichte der hiesigen Arbeiterbewegung. Am 7. März 1880 wurde er im elsässischen Drulingen geboren. Er erlernte das Schneiderhandwerk und trat bereits als 16jähriger dem entsprechenden Gewerkschaftsverband, als 18jähriger der SPD bei. Schon ein Jahr später berief ihn das Gewerkschaftskartell BadenBaden zu seinem Vorsitzenden. 1909 wechselte er dann nach Freiburg und wurde als Nachfolger Wilhelm Englers Arbeitersekretär des Kartells der Freien Gewerkschaften. In dieser Funktion setzte er sich nachhaltig für die Interessen der rund 3500 Mitglieder und der Beschäftigten in den Betrieben ein. So sorgte er dafür, daß die badische Fabrikinspektion Kontrollen in Unternehmen tätigte, in denen Mißstände aufgetreten waren. 1910 übernahm er auch den Vorsitz der Freiburger SPD und war mit dafür verantwortlich, daß sie einen stetigen Aufschwung sah, der sich nicht zuletzt in den Wahlergebnisse niederschlug: Bei den Reichstagswahlen 1912 erreichte sie in der Stadt 30 Prozent. Am Ende des Ersten Weltkriegs finden wir Martzloff an vorderster Stelle in den unruhigen Tagen des Umsturzes. Am 9. November 1918 sprang der Funke der Revolution auf Freiburg über. Um die Mittagszeit wählten die anwesenden Truppeneinheiten einen Soldatenrat, am Abend trafen sich Mitglieder der Freiburger Sozialdemokratie mit Martzloff an der Spitze und bestimmten einen Arbeiterrat aus 16 Parteigenossen. Manche Sozialdemokraten waren über diese Entwicklung nicht eben erfreut: Die Parteizeitung »Volkswacht« hatte noch am Morgen einen Leitartikel gegen den »Bolschewismus« veröffentlicht, der die Arbeiter- und Soldatenräte als politisches Organ im künftigen Deutschland ablehnte. Martzloff hingegen sah die Chance, mit Hilfe der neuen Organe den Übergang zur Demokratie zu sichern und zugleich gesellschaftliche Reformen einzuleiten. Er setzte sich dafür ein, daß sich Arbeiter- und Soldatenrat zusammenschlossen und mit einem eigens dafür gebildeten Aktionsausschuß des Stadtrats unter Leitung des sozialdemokratischen Abgeordneten Robert Grumbach Kontakt aufnahmen. Der Arbeiter- und Soldatenrat wurde als gleichberechtigtes Organ neben dem Stadtrat anerkannt. Die Leistungen der neuen Einrichtung, die sich im Sommer 1919 wieder auflöste und im Gewerkschaftskartell aufging, sind nicht zu übersehen: bei der Demobilisierung, bei der Lebensmittelversorgung der Bevölkerung und bei der Verbesserung der Wohnungssituation. Besondere Beachtung verdient ihr Verfassungsentwurf, der einzige, der von Räteorganen erstellt wurde * Erstpublikation in: Badische Zeitung, 22.2.1993.
Ein Pionier der Arbeiterbewegung in Baden
|
463
und eine Verbindung von direkter und repräsentativer Demokratie versuchte. Martzloff allerdings erlebte dies nur noch mittelbar mit: Sein tatkräftiger Einsatz gab den Ausschlag, daß er schon am 10. November 1918 zum badischen Minister für Übergangswirtschaft und Wohnungswesen ernannt wurde. Hier unternahm er große Anstrengungen, um die neue Ordnung namentlich zum Nutzen der ärmeren Schichten zu gestalten und spürbare Erleichterungen im Alltagsleben zu erreichen. Seiner Basis in Freiburg blieb er treu. Auch nach seinem Ausscheiden aus der badischen Regierung betätigte er sich als Arbeitersekretär und SPD-Vorsitzender. Ein großer Tag war für ihn der 1. Mai 1923, als er der Freiburger Arbeiterschaft das Gewerkschaftshaus am Schwabentor als »Symbol der Einigkeit und Eintracht« übergeben konnte. Hier klingt ein Motiv an, das Martzloff seitdem ein Leben lang begleitete: die Einheit der Arbeiterbewegung wiederherzustellen. Ein Jahr zuvor hatte es eine Annäherung der zerstrittenen Flügel gegeben, als SPD, USPD und KPD zum ersten Mal eine gemeinsame Maifeier in Freiburg durchführten. Es sollte jedoch die einzige bleiben. Bereits 1923 feierten SPD und KPD wieder getrennt. Die Unruhen, Demonstrationen und Streiks, die sich im Zusammenhang mit der schweren Wirtschaftskrise im September 1923 von Lörrach aus auch nach Freiburg ausbreiteten, sahen zwar die hiesige SPD als Kritikerin der Landesregierung und des sozialdemokratischen Innenministers. Letztlich klafften aber die Auffassungen beider Parteien, wie die Situation einzuschätzen sei, weit auseinander. In den folgenden Jahren bekämpften sie sich immer heftiger. Daß die Nationalsozialisten den engagieren Sozialdemokraten und Gewerkschafter Martzloff nicht eben liebten, versteht sich von selbst. Kurz nachdem Adolf Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt worden war, mußte sich Philipp Martzloff in »Schutzhaft« begeben und ein Jahr im Konzentrationslager Ankenbuk verbringen. Die Nazis zwangen ihn, sein Mandat als Abgeordneter im Freiburger Bürgerausschuß und im badischen Landtag aufzugeben. SPD und Gewerkschaften wurden ohnehin aufgelöst. Nach dem 20. Juli 1944 kam Martzloff ein zweites Mal in Haft, diesmal ins KZ Dachau. Glücklicherweise überlebte er das Ende des »Dritten Reiches« und konnte nun wieder aktiv am Wiederaufbau teilnehmen. Dabei spielte er noch einmal eine bedeutende Rolle. In der Sozialistischen Aufbaugruppe und Antifaschistischen Vereinigung befaßte er sich mit den drängendsten Problemen der Nachkriegszeit: Lebensmittelversorgung, Schuttbeseitigung, Beschaffung von Wohnraum. Gegen Ende des Jahres 1945 zählte er dann zu den Mitbegründern einer neuen sozialdemokratischen Organisation in Freiburg und Südbaden. Schließlich prägte er im Landesarbeitsamt und in der badischen Regierung die Gestaltung des Arbeitslebens wesentlich mit, vorab mit seinem Konzept einer einheitlichen, beitragsfreien, aus allgemeinen Steuern finanzierten Sozialversicherung.
464
|
Philipp Martzloff
Darüber hinaus gab er auch ganz entscheidend die Richtung an, die die Partei vorübergehend auf einen Sonderweg gegenüber ihren Freunden in den anderen Besatzungszonen führte. Nicht zufällig nannte sie sich jetzt »Sozialistische Partei«. Keineswegs hatte die französische Besatzungsmacht diese Namensgebung erzwungen. Einen gewissen Einfluß übte gewiß die Annäherung an die französische Schwesterpartei aus, die auch den Anspruch auf eine badische Autonomie in den Diskussionen um die künftige Staatsform beinhaltete. Doch der Name bedeutete noch mehr. Philipp Martzloff, der am 2. Dezember 1945 zum Vorsitzenden der SP Badens gewählt worden war, bezeichnete ihn als »Symbol für die ehrliche Bereitschaft zur Schaffung einer großen, einheitlichen Arbeiterpartei«. Erneut hoffte er, jetzt, nach den Erfahrungen der Weimarer und der NS-Zeit, werde eine Vereinigung aller Kräfte der Arbeiterbewegung auf demokratischer und freiheitlicher Grundlage möglich sein und die Kommunisten würden sich der SP anschließen. Diese bildeten allerdings Anfang 1946 eine eigene Partei, erklärten dann jedoch ihre Bereitschaft, über eine Vereinigung zu verhandeln. Am 7. März 1946 unterzeichneten die Vorstände beider Parteien schließlich ein Abkommen, das die Bildung einer gemeinsamen Partei zum Ziel erklärte. Doch das Mißtrauen auf beiden Seiten war zu groß. Die Kämpfe aus der Weimarer Zeit und die gegenseitigen Anschuldigungen wirkten nach, und die Ereignisse in der sowjetischen Besatzungszone, insbesondere die Zwangsfusion der beiden Parteien im Frühjahr 1946, ließen zahlreiche Sozialdemokraten daran zweifeln, ob eine echte Einheit tragfähig sei. Eine vorpreschende Kampagne Freiburger Kommunisten zugunsten einer »Sozialistischen Einheitspartei« verstärkte die Skepsis. Innerparteilicher Widerstand formierte sich. Auch Martzloff erkannte das Scheitern seiner Vorstellungen. Am 9. November 1946 entschloß sich der Freiburger Landesparteitag endgültig, zum alten Parteinamen zurückzukehren. Martzloffs politischer Einfluß ging danach allmählich zurück. Auf sozialem Gebiet wirkte er aber noch lange weiter. Er starb am 13. November 1962.
Max Faulhaber und der Sturm auf das Gewerkschaftshaus Ein ungewöhnliches Ereignis in der Freiburger Nachkriegsgeschichte*10 Am 3. November 1951 erschien gegen 11.45 Uhr ein Abgesandter eines Gewerkschaftssekretärs auf dem 1. Polizeirevier in Freiburg und bat um polizeiliche Unterstützung. 40 bis 50 Demonstranten seien in das Gewerkschaftshaus eingedrungen und würden dort »herumrandalieren«. Als sieben Polizisten, die später um fünf weitere verstärkt wurden, dort eintrafen, fanden sie etwa 30 heftig diskutierende Personen vor. Der Bezirksleiter des DGB, Richard Knobel, bat darum, die »Randalierer« zu entfernen. Bei der »Säuberung des Gewerkschaftshauses«, wie sich die Polizei ausdrückte, kam es zu Drängeleien und Beschimpfungen. Einer der Auffälligen wurde deshalb vorläufig festgenommen, eine Demonstrantin wegen Beleidigung und Bedrohung angezeigt. Dieses ungewöhnliche Ereignis war der äußere Höhe- und zugleich Wendepunkt eines aufsehenerregenden Geschehens. Die Demonstranten, überwiegend Mitglieder oder Sympathisanten der KPD, wollten mit ihrer Aktion die Wiedereinsetzung Max Faulhabers (1904–1996) in sein Amt als erster Vorsitzender und Bezirksleiter der IG Chemie-Papier-Keramik Baden erreichen. Dieser war am 17. Oktober 1951 vom Hauptvorstand fristlos entlassen worden, weil seine Teilnahme an einer internationalen Gewerkschaftskonferenz in Dresden als »gewerkschaftsschädigend«, als Versuch, die »Unterwanderung« der westdeutschen Gewerkschaften zu planen, eingestuft wurde. In weiten Teilen der Gewerkschaftsbasis rief die Maßnahme Empörung hervor. Faulhaber war beliebt und als energischer Interessenvertreter bekannt, sein Wirken für das Betriebsrätegesetz unvergessen. Obwohl Kommunist, habe er die Gewerkschaft nie für Parteipolitik mißbraucht. Es kam zu einer breiten Solidaritätswelle. Der Sturm auf das Gewerkschaftshaus ließ jedoch die Stimmung umschlagen. Flugblätter, die mit Faulhabers Namen unterzeichnet waren und in denen die Gewerkschaftsführung der Anwendung von »Gestapomethoden« bezichtigt wurde, verstärkten die wachsende Distanz ebenso wie eine intensive Kampagne des Hauptvorstandes. Eine Delegiertenkonferenz der IG Chemie, auf der Faulhaber nicht anwesend sein durfte, billigte schließlich am 21. November 1951 mehrheitlich die Entlassung. Das Freiburger Arbeitsgericht machte sich hingegen die Argumentation des Hauptvorstandes nicht zu eigen, der nicht zuletzt mit vermutlich von der Bundesregierung zur Verfügung gestellten Unterlagen des Verfassungsschutzes und nach* Erstpublikation in: Geschichte der Stadt Freiburg im Breisgau. Bd. 3: Von der badischen Herrschaft bis zur Gegenwart. Hg. von Heiko Haumann und Hans Schadek. Stuttgart 1992, S. 424–427, 785.
466
|
Max Faulhaber und der Sturm auf das Gewerkschaftshaus
richtendienstlichen Ermittlungsergebnissen – eine Pikanterie in dieser Zeit, in der die Gewerkschaften in schärfstem Kampf mit der Regierung um das Betriebsverfassungsgesetz rangen – Faulhabers gewerkschaftsschädigendes Verhalten nachzuweisen suchte. Am 8. Oktober 1952 wurde die fristlose Kündigung aufgehoben. Das Landesarbeitsgericht bestätigte am 28. Februar 1953 im wesentlichen das Urteil der Vorinstanz, erklärte jedoch das Arbeitsverhältnis Faulhabers auf Antrag der IG Chemie zum 25. November 1951 für beendet, weil er nach seiner Entlassung offen »gewerkschaftsfeindlich« aufgetreten sei. Wiedergutmachungsleistungen an ihn als Verfolgter im »Dritten Reich« verzögerten sich dadurch erheblich, weil er nun als Gegner der »freiheitlich-demokratischen Grundordnung« galt. Faulhaber hatte nach eigenen Angaben vom Sturm auf das Gewerkschaftshaus vorher nichts gewußt und war auch mit dem Text der Flugblätter nicht völlig einverstanden gewesen. Sein »Fall« ist nicht nur in die Freiburger Nachkriegsgeschichte einzuordnen, sondern auch in die Geschichte der KPD und ihrer Beziehungen zu den Gewerkschaften. Seit einiger Zeit drangen hin und wieder Nachrichten von »Zwistigkeiten« in der badischen KP an die Öffentlichkeit. So wußte das »Badische Tagblatt« am 22. September 1949 zu berichten, der stellvertretende KPD-Vorsitzende, Kurt Müller, habe einigen Parteiführern in Südbaden vorgeworfen, sie steckten »bis zum Kinn im ›Tito-Sumpf‹« (ihm selbst standen bald darauf noch schlimmere Anklagen bevor). Die »Badische Zeitung« interpretierte am 26. Oktober 1950 die Mandatsniederlegung Käthe Seifrieds im Freiburger Stadtrat als Teil eines »Revirements in der KP«. »Frisches Blut aus dem Osten« solle zugeführt werden. In der Tat wurde ebenfalls der langjährige Vorsitzende der badischen KP, Erwin Eckert, abgelöst und ein Beauftragter aus dem Ruhrgebiet als Nachfolger eingesetzt, der dann auch die Flugblätter im »Fall Faulhaber« verfaßte. Auf der Landesdelegiertenkonferenz, so die »Schweizer National-Zeitung« am 10. April 1951, warf der Spitzenfunktionär Willi Mohn den badischen Kommunisten »spießiges Ländletum« vor und kritisierte, daß der Saal nicht mit einem großen Bild Stalins geschmückt worden sei. Und auf dem Parteitag Ende des Jahres machte die inzwischen offenbar »linientreue« Landesleitung – auch Faulhaber war aus ihr »entfernt« worden – Halbherzigkeit und mangelnde ideologische Geschlossenheit der Genossen dafür verantwortlich, daß die Unterstützung für Faulhaber nicht größer geworden sei. Dieser selbst bekam zu hören, er habe dem Bewußtsein der handelnden Personen zu wenig den Weg gewiesen. Spätestens 1947/48 hatte sich eine dogmatische Orientierung der kommunistischen Parteien am Kurs der Sowjetunion verfestigt. Innerparteiliche Kritiker und Genossen, bei denen man Unabhängigkeit und Selbständigkeit »befürchtete«, wurden seit Mitte 1949 durch eine inszenierte Agentengeschichte ausgeschaltet. 1950 begann auch in der KPD eine »Säuberung« des Apparats, die vor allem »Westemigranten« betraf: Unter denjenigen, die während des »Dritten Reiches« nicht in die Sowjetunion, sondern in westeuropäische Länder emigriert
Ein ungewöhnliches Ereignis in der Freiburger Nachkriegsgeschichte
|
467
waren, vermuteten die stalinistischen Funktionäre am ehesten ihre Gegner. Faulhaber zählte zu ihnen. Innerhalb der KPD verband sich die »Säuberung« mit Angriffen auf die Gewerkschaftspolitik einiger der Betroffenen. Dies traf auf eine weit verbreitete »linksradikale« Strömung in der Partei, die schon seit einiger Zeit ein entschiedeneres Vorgehen gegen »rechte Gewerkschaftsführer« verlangte. Nach dem Scheitern der Vereinigungsbestrebungen mit den Sozialdemokraten, dem schlechten Abschneiden bei den Wahlen und dem Wiederaufleben antikommunistischer Einstellungen infolge des »Kalten Krieges« sahen sich die Kommunisten zusehends isoliert. Durch ein offensiveres Vorgehen und zugleich durch eine Festigung ihres »Lagers« wollten sie ihre Isolierung durchbrechen. Deshalb fanden die undifferenzierte Orientierung an der Sowjetunion, die »Säuberung« und die Verschärfung der Politik gegenüber der Gewerkschaftsführung, wie sie gerade der KPD-Parteitag von 1951 beschloß, durchaus Zustimmung und wurden nicht einfach von »Moskau« erzwungen. Durch gezielte Aktionen in Tarifkonflikten und Arbeitskämpfen wie in der Kampagne gegen die »Remilitarisierung« sollten die damalige DGB-Führung angegriffen – gegen den Widerstand der meisten Gewerkschaftsmitglieder hatte sie sich für einen Wehrbeitrag ausgesprochen – und ein Massenanhang gewonnen werden. In Baden dehnte die Landesleitung den Zusammenhang sogar auf die Südweststaatsfrage aus und ließ sich, wie die KP-Zeitung »Unser Tag« am 4. September 1951 mitteilte, zu der Losung hinreißen: Für »ein ungeteiltes Baden in einem einheitlichen, demokratischen und friedliebenden Deutschland«. Umgekehrt verstärkten nun Gewerkschaftsführung und SPD ihre Anstrengungen – die keineswegs erst nach der »linksradikalen« Wende in der KPD einsetzte –, den teilweise erheblichen Einfluß der Kommunisten in den Gewerkschaften – gerade in Baden – zurückzudrängen. Der Begriff des »gewerkschaftschädigenden Verhaltens« wurde jetzt sehr weit gefaßt. Wer sich als Funktionsträger nicht eindeutig von der KPD distanzierte, mußte mit seiner Entlassung rechnen. Das Prinzip der Einheitsgewerkschaft erfuhr eine tiefgreifende Veränderung, die Gewerkschaftsbewegung wurde in der damaligen Zeit, in der es um die grundlegenden Weichenstellungen für die weitere Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland ging, durch diese Auseinandersetzungen entscheidend geschwächt. Max Faulhaber geriet zwischen die Mühlsteine jener Wandlungen. Den Sozialdemokraten war er wegen seiner Popularität schon lange ein Dorn im Auge, aber auch manchen seiner Parteigenossen mißfielen seine breit angelegte Bündnispolitik – wie er sie schon vor 1933 im Kampf gegen den aufkommenden Nationalsozialismus vertreten hatte – und seine auch sonst immer wieder aufscheinende Abweichung von der herrschenden Linie. Zugleich konnte man ihn aber noch gut gebrauchen. Es ist nicht auszuschließen, daß ihn die Leitung bewußt nach Dresden schickte, um den Hauptvorstand der IG Chemie zu provozieren
468
|
Max Faulhaber und der Sturm auf das Gewerkschaftshaus
und nach der Entlassung Faulhabers zu Massenaktionen mobilisieren zu können. Auf jeden Fall nahm sie beim Sturm auf das Freiburger Gewerkschaftshaus und bei den Flugblatt-Formulierungen keine Rücksicht auf Faulhabers Interessen und handelte zudem kurzsichtig. Die Freiburger Gewerkschaften verloren ein besonders aktives Mitglied, die KP erlitt bei ihrer versuchten Offensive – in Freiburg wie bundesweit – eine vollständige Niederlage und bestätigte mit ihren Aktionen antikommunistische Einstellungen in der Bevölkerung.11
1 Stadtarchiv Freiburg, C 5/204, D. Aö. 4.2.12 (daraus die Zitate beim Polizeieinsatz), K 1/109 (NL Max Faulhaber); Badische Zeitung, 5.11.1951; Das Volk, 6.11.1951; Unser Tag, 8.11.1951; Max Faulhaber: »Aufgegeben haben wir nie ...« Erinnerungen aus einem Leben in der Arbeiterbewegung. Hg. von Peter Fäßler u. a. Marburg 1988, hier bes. S. 279–306; Heiko Haumann: »Der Fall Max Faulhaber«: Gewerkschaften und Kommunisten – ein Beispiel aus Südbaden 1949–1952. Marburg 1987 (mit zahlreichen weiteren Quellennachweisen); ders.: Wandel der Einheitsgewerkschaft. Eine vergleichende Skizze zum Verhältnis von Gewerkschaften und Kommunisten in Österreich und in der Bundesrepublik Deutschland zu Beginn der fünfziger Jahre. In: Archiv – Jahrbuch des Vereins für Geschichte der Arbeiterbewegung 3 (1987) S. 81–102.
Lebenswelten osteuropäischer Juden Herausgegeben von Heiko Haumann Eine Auswahl
Bd. 10 | Peter Haber Zwischen jüdischer
Bd. 3 | François Guesnet
Tradition und Wissenschaft
Polnische Juden
Der ungarische Orientalist
im 19. Jahrhundert
Ignác Goldziher (1850–1921)
Lebensbedingungen, Rechts-
2006. 265 S. Br. | ISBN 978-3-412-32505-3
normen und Organisation im Wandel
Bd. 11 | Louise Hecht
1998. 496 S. Br. | ISBN 978-3-412-03097-1
Ein jüdischer Aufklärer
Bd. 4 | Susanne Marten-Finnis,
Der Pädagoge und Reformer
Heather Valencia
Peter Beer (1758–1838)
in Böhmen
Sprachinseln
2008. 403 S. 5 s/w-Abb. Br.
Jiddische Publizistik in London,
ISBN 978-3-412-14706-8
Wilna und Berlin 1880–1930 1999. 144 S. 5 s/w-Abb. Br.
Bd. 12 | Julia Richers
ISBN 978-3-412-02998-2
Jüdisches Budapest Kulturelle Topographien e iner
Bd. 7 | Heiko Haumann (Hg.)
Stadtgemeinde im 19. Jahrhundert
Luftmenschen und
2009. 424 S. Mit 27 s/w-Abb. Br.
rebellische Töchter
ISBN 978-3-412-20471-6
Zum Wandel ostjüdischer Lebenswelten im 19. Jahrhundert
Bd. 13 | Jan Arend
2003. 337 S. Br. | ISBN 978-3-412-06699-4
Jüdische Lebensg eschichten aus der Sowjetunion
Bd. 8 | Peter Haber
Erzählungen von Entfremdung
Die Anfänge des Zionismus in
und Rückbesinnung
Ungarn (1897–1904)
2011. 177 S. 18 s/w-Abb. Br.
2001. 196 S. 10 s/w-Abb. Br.
ISBN 978-3-412-20802-8
ISBN 978-3-412-10001-8 Bd. 9 | Frank M. Schuster Zwischen allen Fronten Osteuropäische Juden während des Ersten Weltk rieges (1914–1919) 2004. 562 S. 16 s/w-Abb. auf 16 Taf. Br.
ST550
ISBN 978-3-412-13704-5
böhlau verlag, ursulaplatz 1, d-50668 köln, t: + 49 221 913 90-0 [email protected], www.boehlau-verlag.com | wien köln weimar
Heiko Haumann
Hermann Diamanski (1910–1976): Überleben in der K atastrophe Eine deutsche Geschichte zwischen Auschwitz und Sta atssicherheitsdienst
Hermann Diamanskis Leben von 1910 bis 1976 spiegelt deutsche Geschichte 20. Jahrhundert. Keine »große Persönlichkeit«, sondern ein »einfacher im Mann« steht im Mittelpunkt des spannend erzählten Buches. Diamanski, Seemann und Kommunist, betätigte sich illegal gegen den Nationalsozialismus und kämpfte im Spanischen Bürgerkrieg. Im »Zigeunerlager« von Auschwitz war er Lagerältester, im Januar 1945 musste er am Todesmarsch nach Buchenwald teilnehmen. Nach dem Krieg machte er Karriere in Ostdeutschland, kam jedoch bald in Konflikt mit dem dortigen Apparat und geriet in die Mühlen des DDR-Staatssicherheitsdienstes. Er flüchtete nach Westdeutschland und arbeitete kurzzeitig für den US-Geheimdienst. Im Auschwitz-Prozess sagte er als Zeuge aus, auf eine Entschädigung als Verfolgter des Nazi-Regimes musste er lange warten. Auf ungewöhnliche Weise gewährt die Biographie Einblicke in Brennpunkte der Geschichte und in die Verflochtenheit von privatem Leben und welt politischen Geschehnissen. Aus Diamanskis Perspektive erschließen wir seine L ebenswelt. Wir nehmen teil an der Aufarbeitung der Vergangenheit und treten ein in den Dialog mit Akteuren der Geschichte. 2011. 443 S. 56 s/w-Abb. Gb. 155 x 230 mm. ISBN 978-3-412-20787-8
böhlau verlag, ursulaplatz 1, 50668 köln. t : + 49(0)221 913 90-0 [email protected], www.boehlau-verlag.com | wien köln weimar
HEIKO HAUMANN
LEBENSWELTEN UND GESCHICHTE ZUR THEORIE UND PRAXIS DER FORSCHUNG
Der Band versammelt Aufsätze des Autors, darunter auch bisher unveröffentlichte Texte. Sie kreisen alle um den theoretischen Ansatz, die Geschichte von einzelnen Menschen und ihrer Lebenswelt her zu erschließen. Heiko Haumann geht es darum, den Begriff der Lebenswelt neu zu fassen und daraus Überlegungen zu methodischen Verfahren abzuleiten, die Alltags- und Sozialgeschichte miteinander verbinden und eine mehr perspektivische Sichtweise ermöglichen. Insbesondere thematisiert er dabei den Umgang mit Erinnerungen in Selbstzeugnissen – Autobiographien und Interviews – sowie mit Fotographien als Quellen. Die Fruchtbarkeit seines Zuganges zeigt sich an beispielhaften Arbeiten zur Regionalgeschichte, zur Geschichte Russlands und der Sowjetunion, zur Geschichte und Kultur der Juden sowie zur Bedeutung der Geschichte in der öffentlichen Auseinandersetzung. 2012. 533 S. 7 S/W U. 10 FARB. ABB. GB. 155 X 230 MM. ISBN 978-3-412-20934-6
böhlau verlag, ursulaplatz 1, d-50668 köln, t: + 49 221 913 90-0 [email protected], www.boehlau-verlag.com | wien köln weimar




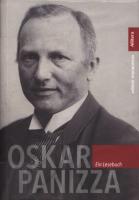
![Der deutsche Kinderfreund: Ein Lesebuch für Volksschulen [226., verb. Aufl. Reprint 2019]
9783111522609, 9783111154220](https://dokumen.pub/img/200x200/der-deutsche-kinderfreund-ein-lesebuch-fr-volksschulen-226-verb-aufl-reprint-2019-9783111522609-9783111154220.jpg)
![Der Lebensfrühling. Ein Lesebuch für die Jugend, Teil 1 [Reprint 2021 ed.]
9783112431283, 9783112431276](https://dokumen.pub/img/200x200/der-lebensfrhling-ein-lesebuch-fr-die-jugend-teil-1-reprint-2021nbsped-9783112431283-9783112431276.jpg)
![Lesebuch zur Geschichte Bayerns [Reprint 2019 ed.]
9783486735482, 9783486735475](https://dokumen.pub/img/200x200/lesebuch-zur-geschichte-bayerns-reprint-2019nbsped-9783486735482-9783486735475.jpg)
![Neueste Länder- und Völkerkunde; ein geographisches Lesebuch [19]](https://dokumen.pub/img/200x200/neueste-lnder-und-vlkerkunde-ein-geographisches-lesebuch-19.jpg)

