Private Regelsetzung [1 ed.] 9783428550821, 9783428150823
In Zeiten eines schneller und komplexer werdenden Regelungsumfelds geht der Staat verstärkt dazu über, seine Ordnungsauf
135 15 3MB
German Pages 233 Year 2017
Polecaj historie
Citation preview
Schriften zum Bürgerlichen Recht Band 468
Private Regelsetzung Von
Carolin Marie Engler
Duncker & Humblot · Berlin
CAROLIN MARIE ENGLER
Private Regelsetzung
Schriften zum Bürgerlichen Recht Band 468
Private Regelsetzung
Von
Carolin Marie Engler
Duncker & Humblot · Berlin
Der Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität Regensburg hat diese Arbeit im Jahre 2016 als Dissertation angenommen.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten
© 2017 Duncker & Humblot GmbH, Berlin Druck: buchbücher.de gmbh, Birkach Printed in Germany
ISSN 0720-7387 ISBN 978-3-428-15082-3 (Print) ISBN 978-3-428-55082-1 (E-Book) ISBN 978-3-428-85082-2 (Print & E-Book) Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier entsprechend ISO 9706
Internet: http://www.duncker-humblot.de
Vorwort Die vorliegende Arbeit wurde vom Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität Regensburg im Sommersemester 2016 als Dissertation angenommen. Die mündliche Prüfung fand am 5. Juli 2016 statt. Für die Veröffentlichung sind Rechtsprechung und Literatur bis Oktober 2016 berücksichtigt worden. Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Martin Löhnig. Er hat die Dissertation umfassend gefördert und intensiv betreut. Die lehrreiche und prägende Zeit an seinem Lehrstuhl sowie die regelmäßigen Doktorandenkolloquien werde ich in schöner Erinnerung behalten. Herrn Dekan Prof. Dr. Jörg Fritzsche danke ich für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens. Der Konrad-Adenauer-Stiftung bin ich für die Gewährung eines Promotionsstipendiums dankbar. Bei der Johanna und Fritz Buch Gedächtnis-Stiftung bedanke ich mich für die Gewährung eines Druckkostenzuschusses. Schließlich gilt mein herzlicher Dank meinen Eltern und Herrn Dr. Philipp aximilian Holle. Sie haben mich während der Anfertigung der Dissertation auf M vielfältige Weise unterstützt. Ihnen ist diese Arbeit gewidmet. Stuttgart, im Oktober 2016
Carolin Marie Engler
Inhaltsübersicht § 1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 I.
Thema der Untersuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
II.
Stand der Diskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
III. Gegenstand und Gang der Untersuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Erster Teil Konzeptionelle Grundlagen privater Regelsetzung 24
§ 2 Terminologie staatsfreier und staatsferner Ordnungsgebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 I.
Selbstregulierung als Oberbegriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
II.
Private Regelsetzung als Ausschnitt der Selbstregulierung . . . . . . . . . . . . . . . 26
III. Private Rechtsetzung als Teilbereich privater Regelsetzung . . . . . . . . . . . . . . 29 IV. Rechtsbegriff und Rechtsquellenlehre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 V. Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 § 3 Verhältnis privater Regelsetzung zum staatlichen Recht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 I.
Abstecken der Grenzen durch die Verfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
II.
Vorranganspruch staatlichen Rechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
III. Handlungsformen privater Regelsetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 IV. Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 § 4 Vor- und Nachteile privater Regelsetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 I.
Vorteile privater Regelsetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
II.
Nachteile und Gefahren privater Regelsetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
III. Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Zweiter Teil Systematisierung privater Regelsetzung 51
§ 5 Grundlagen und Herangehensweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 I.
Notwendigkeit einer Systematisierung .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
II.
Herkömmliche Systematisierungsversuche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
III. Systematisierung am Grad der rechtlichen Verbindlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . 53 § 6 Unverbindliche Regeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 I. Vorüberlegungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 II.
Selbstverpflichtungserklärungen als einseitig unverbindliche Regeln .. . . . 54
III. Soziale Normen, Gentlemen’s Agreements, Unternehmensrichtlinien und Kodizes als zwei- und mehrseitig unverbindliche Regeln . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Inhaltsübersicht
8
§ 7 Regelarrangements mit mittelbarer Rechtsverbindlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 I. Vorüberlegungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 II.
Technische Normen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
III. Quantifizierungen als Bestandteil richterlicher Konkretisierungsbefugnis 68 IV. Regelsetzung durch das IDW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 V.
Der Deutsche Corporate Governance Kodex .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
VI. Rechnungslegungsregeln des DRSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 VII. Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 § 8 Regeln mit Verbindlichkeitsanspruch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 I. Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 II.
Einseitige Rechtsetzung durch Private .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
III. Zwei- und mehrseitige Rechtsverbindlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 IV. Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Dritter Teil Legitimation privater Regeln 125
§ 9 Grundlagen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 I.
Legitimationsbedürftigkeit privater Regeln .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
II.
Verschiedene Perspektiven der Legitimation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
§ 10 Legitimationselemente .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 I.
Demokratische Legitimation als staatliches Legitimationsideal .. . . . . . . . . . 129
II.
Keine Legitimation kraft Historie oder bloßer Legalität . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
III. Individuelle Zustimmung als materielles Legitimationsideal privater Regeln. 131 IV. Vertragstheorien als Legitimationswegweiser? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 V.
Legitimation durch ökonomischen Nutzen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
VI. Kombinatorisches Legitimationsmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 VII. Legitimation durch Gerechtigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 VIII. Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 § 11 Staatliche Pflicht zur Organisation der Legitimation .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 I.
Grundrechtliche Verpflichtung zur Organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
II.
Ausgestaltung durch die drei Gewalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
§ 12 Praktische Erprobung des Legitimationsmodells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 I.
Legitimation unmittelbarer Rechtswirkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
II.
Legitimation mittelbarer Rechtswirkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
III. Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Vierter Teil Untersuchungsergebnisse 182 Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Sachwortverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis
§ 1
Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 I.
Thema der Untersuchung .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
II.
Stand der Diskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
III. Gegenstand und Gang der Untersuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Erster Teil Konzeptionelle Grundlagen privater Regelsetzung 24
§ 2
Terminologie staatsfreier und staatsferner Ordnungsgebung . . . . . . . . . . . . . . . 24 I.
Selbstregulierung als Oberbegriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
II.
Private Regelsetzung als Ausschnitt der Selbstregulierung . . . . . . . . . . . . . . 26
1. Private Regelsetzung als Ausübung grundrechtlicher Freiheiten . . . . 26 2. Hybride Regeln – Kriterien zur Einordnung in die staatliche oder private Sphäre .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 III. Private Rechtsetzung als Teilbereich privater Regelsetzung . . . . . . . . . . . . . 29 1. Meinungsstand .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 a) Staatszentrierte Sichtweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 b) Pluralistische Sichtweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 c) Soft Law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2. Entfaltung des Rechtsbegriffs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 a) Funktionale Betrachtung des Rechtsbegriffs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 b) Verbindlichkeit und Zwangscharakter des Rechts als entscheidende Parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 IV. Rechtsbegriff und Rechtsquellenlehre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 V. Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 § 3
Verhältnis privater Regelsetzung zum staatlichen Recht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 I.
Abstecken der Grenzen durch die Verfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
II.
Vorranganspruch staatlichen Rechts .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
III. Handlungsformen privater Regelsetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 IV. Zusammenfassung .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 § 4
Vor- und Nachteile privater Regelsetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 I.
Vorteile privater Regelsetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 1. Staatsentlastung und Kosteneffizienz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Flexibilität .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Sachnähe und Akzeptanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Internationale Ausrichtungsmöglichkeit .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 46 47 48
Inhaltsverzeichnis
10
II.
Nachteile und Gefahren privater Regelsetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
1. Demokratiedefizit und Vernachlässigung öffentlicher Interessen .. . . 2. Rechtsstaatlichkeitsdefizit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Durchsetzungsdefizit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Fehlende Koordination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Zusammenfassung .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zweiter Teil Systematisierung privater Regelsetzung 51
§ 5
48 48 49 50 50
Grundlagen und Herangehensweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 I.
Notwendigkeit einer Systematisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
II.
Herkömmliche Systematisierungsversuche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
III. Systematisierung am Grad der rechtlichen Verbindlichkeit . . . . . . . . . . . . . . 53 § 6
Unverbindliche Regeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 I. Vorüberlegungen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 II.
Selbstverpflichtungserklärungen als einseitig unverbindliche Regeln . . . 54
III. Soziale Normen, Gentlemen’s Agreements, Unternehmensrichtlinien und Kodizes als zwei- und mehrseitig unverbindliche Regeln . . . . . . . . . . . . . . . . 56 § 7
Regelarrangements mit mittelbarer Rechtsverbindlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 I. Vorüberlegungen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 II.
Technische Normen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
1. Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 2. DIN-Normen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 a) Unmittelbare rechtliche Wirkung im Einzelfall .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 b) Mittelbare rechtliche Wirkungen als Regelfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 aa) DIN-Normen als Maßstab für die Soll-Beschaffenheit im Werkvertragsrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 bb) DIN-Normen als Maßstab für Sorgfalts- und Verkehrspflichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 3. VDI-Richtlinien .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 III. Quantifizierungen als Bestandteil richterlicher Konkretisierungsbefugnis 68 1. Begriff und Erscheinungsformen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Berufs- und Standesregeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Unterhaltstabellen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Keine Quantifizierungen im engeren Sinne durch Tatsachen- und Entscheidungssammlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Regelsetzung durch das IDW .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.
68 69 69 72 73
Der Deutsche Corporate Governance Kodex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 1. Grundlagen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 a) Entstehungsgeschichte .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Inhaltsverzeichnis
§ 8
11
b) Regelungsmechanismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Privates oder staatliches Regelwerk? .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aa) Meinungsstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb) Stellungnahme .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Keine isolierten Rechtswirkungen der Kodexvorschriften .. . . . . . . . . . 3. Bindungswirkung über § 161 AktG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Faktischer Befolgungsdruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Keine Rechtswirkungen bei korrekter Entsprechenserklärung . . . . c) Rechtsfolgen fehlerhafter Entsprechenserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . aa) Haftungsrisiken .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb) Anfechtbarkeit von Hauptversammlungsbeschlüssen . . . . . . . VI. Rechnungslegungsregeln des DRSC .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76 77 77 80 82 86 86 86 88 88 91 93
1. Entstehungsgeschichte .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Privater Charakter der Regeln .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Rechtswirkungen der Standards .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93 95 96 99
Regeln mit Verbindlichkeitsanspruch .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 I. Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 II.
Einseitige Rechtsetzung durch Private . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1. Einseitige Bindung durch Rechtsgeschäft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Auslobung und Preisausschreiben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Einseitige Organisationsgeschäfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Testament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) Arbeitsrechtliches Direktions- und Weisungsrecht . . . . . . . . . . . . . . . e) Arbeitsrechtliche Gesamtzusage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f) Keine private Rechtsetzung durch Gestaltungsrechte . . . . . . . . . . . . . 2. Einseitige Rechtsetzung durch subjektive Rechte .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Zwei- und mehrseitige Rechtsverbindlichkeit .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 100 102 102 103 104 105 105 106
1. Zwei- und mehrseitige Verträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Rechtsnatur: Normentheorie versus Vertragstheorie . . . . . . . . . . . . . . 3. Die Rechtsregeln der Verbände .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Die Rechtsnatur der Verbandssatzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aa) Meinungsstand: Vertragstheorie versus Normentheorie . . . . . bb) Stellungnahme .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Die Rechtsnormen des Tarifvertrags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Die unmittelbare und zwingende Wirkung des Tarifvertrags . . . . . . b) Ursprung der tarifvertraglichen Normsetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106 107 107 108 110 110 112 112 114 115 115 117
Inhaltsverzeichnis
12
aa) Meinungsstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb) Stellungnahme .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Die Rechtsnormen der Betriebsvereinbarung .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Normative Wirkung der Betriebsvereinbarung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Ursprung der Betriebsvereinbarung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Erstarkung privater Regeln zu Gewohnheitsrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Handelsbrauch und Verkehrssitte .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Zusammenfassung .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117 119 120 120 121 122 123 124
Dritter Teil § 9
Legitimation privater Regeln 125 Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 I.
Legitimationsbedürftigkeit privater Regeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
II.
Verschiedene Perspektiven der Legitimation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
1. Soziologischer und normativer Ansatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 2. Vorzugswürdigkeit eines normativen Ansatzes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 § 10 Legitimationselemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 I.
Demokratische Legitimation als staatliches Legitimationsideal . . . . . . . . . 129
II.
Keine Legitimation kraft Historie oder bloßer Legalität . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
1. Historischer Wuchs als bloßes Faktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 2. Unzulänglichkeiten eines rein rechtspositivistischen Ansatzes . . . . . . 130 III. Individuelle Zustimmung als materielles Legitimationsideal privater Regeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 1. Privatautonomie als Leitgedanke .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kein Einfangen sämtlicher privater Regeln .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Verdünnte Zustimmung .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Fehlende Zustimmung .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Schlussfolgerungen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Vertragstheorien als Legitimationswegweiser? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V.
131 132 132 133 134 135
1. Konsens als Legitimation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 2. Kritik und fehlende Tragfähigkeit zur Legitimation privater Regeln . 136 Legitimation durch ökonomischen Nutzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
1. Theoretische Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 2. Durchgreifende Einwände .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 VI. Kombinatorisches Legitimationsmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 1. Zustimmung und Gemeinwohl als Teile eines beweglichen Systems . 139 2. Würdigung .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 VII. Legitimation durch Gerechtigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 1. Materielle Gerechtigkeit als Korrektiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 2. Formelle Gerechtigkeit durch Organisation und Verfahren . . . . . . . . . . 144
Inhaltsverzeichnis a) Vorüberlegungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Organisatorische Anforderungen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Verfahrensanforderungen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
144 145 147 147
§ 11 Staatliche Pflicht zur Organisation der Legitimation .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 I.
Grundrechtliche Verpflichtung zur Organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
II.
Ausgestaltung durch die drei Gewalten .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
§ 12 Praktische Erprobung des Legitimationsmodells .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 I.
Legitimation unmittelbarer Rechtswirkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
II.
1. Überblick .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Vertrag .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Zustimmung als Legitimation .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Organisation fehlerfreier Zustimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Allgemeine Geschäftsbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Institutionelle Störung der Vertragsparität .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Kompensation der verdünnten Zustimmung durch Gerechtigkeits kontrolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Einseitige Rechtsetzung .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Einseitige Rechtsgeschäfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Rechtsetzung kraft absoluten subjektiven Rechts .. . . . . . . . . . . . . . . . 5. Verbandsregeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Zustimmung durch Verbandsbeitritt als verdünnte Zustimmung .. b) Kompensatorische Sicherungen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aa) Sicherung durch Verfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb) Materielle Sicherung durch Inhalts- und Beschlusskontrolle cc) Austritt als letzter Ausweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Tarifverträge .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Horizontale Legitimation kraft Zustimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Vertikale Legitimation .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Betriebsvereinbarungen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Ausgangslage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Verdünnte Zustimmung .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Gerechtigkeitselemente .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aa) Formale Gerechtigkeit durch Teilhabe und Verfahren . . . . . . . bb) Materielle Gerechtigkeit durch umfassende Billigkeitskontrolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cc) Günstigkeitsprinzip .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Gewohnheitsrecht, Verkehrssitte und Handelsbrauch .. . . . . . . . . . . . . . . Legitimation mittelbarer Rechtswirkungen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150 151 151 152 155 155 156 157 157 158 159 159 159 159 . 160 162 162 162 163 164 164 164 165 165 166 167 167 168
1. Vorüberlegungen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 2. Technische Normen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
14
Inhaltsverzeichnis a) DIN-Normen als Paradebeispiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 aa) Legitimation durch staatliche Organisations- und Verfahrens vorgaben .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 bb) Legitimation durch richterliche Einzelfallkontrolle . . . . . . . . . 171 b) Legitimation sonstiger technischer Normen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 3. Quantifizierungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 a) Unterhaltstabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 b) Berufs- und Standesregeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 4. Keine hinreichende Legitimation der IDW PS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 5. Defizite auch beim Deutschen Corporate Governance Kodex . . . . . . . 174 a) Staatsrechtliche Perspektive: Wesentlichkeitstheorie . . . . . . . . . . . . . 174 b) Hinreichende zivilistische Legitimation .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 6. Gelungene Legitimation der Rechnungslegungsstandards . . . . . . . . . . . 177 a) Hinreichende gesetzliche Vorgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 b) Konkretisierung durch den Standardisierungsvertrag und Satzung . 177 aa) Organisationsrechtliche Vorgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 bb) Verfahrensrechtliche Vorgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 c) Kontrolle durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz sowie die Gerichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 7. Allgemeines Normengesetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 III. Zusammenfassung .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Vierter Teil Untersuchungsergebnisse 182 I. Konzeptionelle Grundlagen privater Regelsetzung .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 1. Terminologie staatsfreier und staatsferner Ordnungsgebung . . . . . . . . 2. Das Verhältnis privater Regelsetzung zum staatlichen Recht . . . . . . . . 3. Vor- und Nachteile privater Regelsetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Systematisierung privater Regelsetzung .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182 183 183 184
1. Systematisierung am Grad der rechtlichen Verbindlichkeit . . . . . . . . . . 2. Unverbindliche Regeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Mittelbar rechtsverbindliche Regeln .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Unmittelbar rechtsverbindliche private Regeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Legitimation privater Regeln .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184 184 184 186 187
1. Legitimationsbedürftigkeit .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 2. Legitimationsmodell .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 3. Staatliche Pflicht zur Organisation der Legitimation . . . . . . . . . . . . . . . . 189 4. Die Umsetzung des Legitimationsmodells bei den einzelnen Regelwerken .................................................................................................... 190 Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Sachwortverzeichnis .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Abkürzungsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis
a.A. anderer Ansicht Abs. Absatz AcP Archiv für die civilistische Praxis (Zeitschrift) a.F. alte Fassung AfP Zeitschrift für Medien- und Kommunikationsrecht AG Aktiengesellschaft; Die Aktiengesellschaft (Zeitschrift) AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen AktG Aktiengesetz Anm. Anmerkung AP Nachschlagewerk des Bundesarbeitsgerichts – Arbeitsrechtliche Praxis APuZ Aus Politik und Zeitgeschichte (Zeitschrift) ArchBürgR Archiv für Bürgerliches Recht ArchSozWiss. Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik (Zeitschrift) arg. e argumentum e ARSP Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (Zeitschrift) Art. Artikel Aufl. Auflage BAG Bundesarbeitsgericht BAGE Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts BauR Baurecht, Zeitschrift für das gesamte öffentliche und zivile Baurecht BB Betriebs-Berater (Zeitschrift) Bd. Band Begr. Begründung BetrVG Betriebsverfassungsgesetz BFuP Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis (Zeitschrift) BGB Bürgerliches Gesetzbuch BGBl. I Bundesgesetzblatt Teil I BGH Bundesgerichtshof BGHZ Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen BilMoG Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz) BImSchV Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes Bl. Blatt BT-Drucks. Drucksache des Deutschen Bundestages BVerfG Bundesverfassungsgericht BVerfGE Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts BVerwGE Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts bzw. beziehungsweise CCZ Corporate Compliance Zeitschrift DB Der Betrieb (Zeitschrift) DCGK Deutscher Corporate Governance Kodex ders. derselbe
16
Abkürzungsverzeichnis
d.h. das heißt dies. dieselbe(n) DIN Deutsches Institut für Normung DNotZ Deutsche Notar-Zeitschrift DÖV Die Öffentliche Verwaltung DRiZ Deutsche Richterzeitung DRSC Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee DStR Deutsches Steuerrecht (Zeitschrift) DV Die Verwaltung DVBl. Deutsches Verwaltungsblatt (Zeitschrift) Econ. J. Economic Journal (Zeitschrift) Einf. Einführung Einl. Einleitung EL Ergänzungslieferung etc. et cetera e.V. eingetragener Verein f. und folgende (Seite) FamRZ Zeitschrift für das gesamte Familienrecht mit Betreuungsrecht, Erbrecht, Verfahrensrecht, Öffentlichem Recht ff. und folgende (Seiten) Fn. Fußnote FoSiG Gesetz zur Sicherung von Werkunternehmeransprüchen und zur verbesserten Durchsetzung von Forderungen (Forderungssicherungsgesetz) FS Festschrift GewO Gewerbeordnung GG Grundgesetz GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbHG Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH-Gesetz) GRURInt. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, internationaler Teil (Zeitschrift) GS Gedächtnisschrift HGB Handelsgesetzbuch h.M. herrschende Meinung Hrsg. Herausgeber HStR Handbuch des Staatsrechts IDW Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland InsO Insolvenzordnung i.S.d. im Sinne des/der i.V.m. in Verbindung mit Jb.J.ZivRWiss. Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler Jura Juristische Ausbildung JuS Juristische Schulung JZ Juristenzeitung KGaA Kommanditgesellschaft auf Aktien KonTraG Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich LG Landgericht m. mit
Abkürzungsverzeichnis
17
Mass. Massachusetts m.w.N. mit weiteren Nachweisen NJW Neue Juristische Wochenzeitschrift NJW-RR NJW-Rechtsprechungs-Report Zivilrecht Nr. Nummer NZA Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht NZG Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht OLG Oberlandesgericht ProdHaftG Gesetz über die Haftung für fehlerhafte Produkte (Produkthaftungsgesetz) ProdSG Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz) PS Prüfungsstandards RdA Recht der Arbeit (Zeitschrift) RegE Regierungsentwurf RGZ Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen RheinNotZ Zeitschrift für das Notariat RJ Rechtshistorisches Journal Rn. Randnummer Rspr. Rechtsprechung S. Satz/Seite(n) SchRModG Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts (Schuldrechtsmodernisierungsgesetz) sog. sogenannte(r/n) Sp. Spalte StandV Standardisierungsvertrag StGB Strafgesetzbuch TA-Lärm Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm TA-Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft TransPuG Gesetz zur weiteren Reform des Aktien- und Bilanzrechts, zu Transparenz und Publizität (Transparenz- und Publizitätsgesetz) u.a. unter anderem u.Ä. und Ähnliches UrhG Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) UVV Unfallverhütungsvorschriften v. von VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik VDI Verein Deutscher Ingenieure VersR Zeitschrift für Versicherungsrecht, Haftungs- und Schadensrecht VerwArch Verwaltungsarchiv – Zeitschrift für Verwaltungslehre, Verwaltungsrecht und Verwaltungspolitik vgl. vergleiche Vorbem. Vorbemerkung VVaG Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit VVDStRL Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer WM Wertpapiermitteilungen, Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht WPg Die Wirtschaftsprüfung (Zeitschrift) WpHG Gesetz über den Wertpapierhandel (Wertpapierhandelsgesetz)
18
Abkürzungsverzeichnis
WRP Wettbewerb in Recht und Praxis (Zeitschrift) ZaöRV Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht z.B. zum Beispiel ZBl. Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht ZCG Zeitschrift für Corporate Governance ZfA Zeitschrift für Arbeitsrecht ZfphF Zeitschrift für philosophische Forschung ZfRSoz Zeitschrift für Rechtssoziologie ZG Zeitschrift für Gesetzgebung ZGR Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht ZHR Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht Ziff. Ziffer(n) ZIP Zeitschrift für Wirtschaftsrecht ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik
§ 1 Einleitung § 1 Einleitung
I. Thema der Untersuchung Das Phänomen, dass Private Regeln setzen, die ihr Zusammenleben ordnen, ist keineswegs neu. Zu denken ist etwa an den Vertrag, Allgemeine Geschäftsbedingungen, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen des Arbeitsrechts sowie Verbandsregeln des Gesellschaftsrechts. In letzter Zeit hat die Thematik gleichwohl eine Renaissance erlebt, weil der Staat in Zeiten eines schneller und komplexer werdenden Regelungsumfelds verstärkt dazu übergeht, seine Ordnungsaufgaben dadurch zu verwirklichen, dass er Eigenverantwortung und private Initiative mobilisiert und Private mit ihrem Sachverstand in die Gestaltung einbindet.1 Neben die herkömmlichen privaten Regelungsinstrumente treten hierdurch zunehmend neuartige Regelungsmodelle wie der Deutsche Corporate Governance Kodex. Aufgabe der Rechtswissenschaft ist es, die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Prozess privater Regelsetzung herauszuarbeiten. Dies zwingt dazu, sich eingehend mit der Wirkungsweise privater Regeln und ihrer Legitimation ausei nanderzusetzen. Obwohl das Phänomen privater Regelsetzung kein Novum ist, liegt hier noch vieles im Argen.2 Insbesondere bereitet es Schwierigkeiten, die neueren Formen privater Regelsetzung in die etablierten Denkmuster einzuordnen. Die Verquickung privater und hoheitlicher Elemente wirft Zuordnungs- und 1 Man spricht von „private ordering“, „private governance“, „private rule making“, „Privatisierung des Rechts“, „private Selbstregulierung“, „private Ordnung“, „Soft Law“, „regulierter Selbstregulierung“ und „kooperativer Rechtsetzung“; zu diesen Begrifflichkeiten und den unterschiedlichen Konnotationen vgl. Merkt, in: Assmann u.a. (Hrsg.), Markt und Staat in einer globalisierten Wirtschaft, S. 169 m.w.N.; zu den Hintergründen dieser Entwicklung vgl. Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 19 f.; Eifert, in: Hoffmann-Riem u.a. (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd. 1, § 19 Rn. 52 ff.; Hoffmann-Riem, Modernisierung von Recht und Justiz, S. 15 ff.; ders., in: Schuppert (Hrsg.), Der Gewährleistungsstaat, S. 89 ff.; Hommelhoff/M. Schwab, in: FS Kruse, S. 693, 694 f.; Meder, JZ 2006, 477 ff.; Merkt, in: Assmann u.a. (Hrsg.), Markt und Staat in einer globalisierten Wirtschaft, S. 169, 178 ff.; Möllers/Fekonja, ZGR 2012, 777, 778 f.; SchmidtPreuß, ZLR 1997, 249; Schuppert, in: Schröter (Hrsg.), Verwaltungsforschung, S. 399 ff.; ders., Staatswissenschaft, S. 289 ff., 571 ff.; ders., in: Schuppert (Hrsg.), Der Gewährleistungsstaat, S. 11 ff. 2 Vgl. Bumke/Röthel, in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 17 ff.; Eidenmüller, ZGR 2007, 484, 487 f.: eine der Forschungsperspektiven im Unternehmensrecht; Hopt, in: Hommelhoff u.a. (Hrsg.), Corporate Governance, S. 27, 51, 67: Methodenlehre für die private Regelbildung erforderlich; Köndgen, AcP 206 (2006), 477, 478 f.: Es schreit nach einer Theorie privatisierten Rechts; Merkt, ZGR 2007, 532, 533 f.; Möllers, in: FS Buchner, S. 649: Entwicklungen rechtstheoretisch unzureichend aufgearbeitet.
§ 1 Einleitung
20
Legitimationsfragen auf. Deutlich sichtbar wurde dies zuletzt beim Deutschen Corporate Governance Kodex, dem von weiten Teilen der Literatur ein Legitimationsdefizit attestiert wird.3 Problematisch erscheinen private Regeln deshalb, weil sie im Gegensatz zur staatlichen Rechtsetzung weder einem demokratischen Rechtsetzungsprozess noch einer unmittelbaren Grundrechtsbindung unterworfen sind und überdies dem Verdacht einer rein partikularen Interessenrepräsentation des jeweiligen Regelsetzers ausgesetzt sind.
II. Stand der Diskussion Die Rechtswissenschaft konzentrierte ihr Interesse bislang auf die Frage, welche Rahmenordnung der Staat privater Regelsetzung zur Verfügung stellen kann, d.h., das Phänomen privater Regelsetzung wurde vornehmlich unter der Prämisse diskutiert, welche Rolle dem Staat hierbei zuzuweisen ist. Im Fokus stand dementsprechend eine öffentlich-rechtliche Perspektive. So beschäftigt sich der Staatsrechtler F. Kirchhof in seiner Habilitationsschrift „Private Rechtsetzung“ mit den rechtlichen Geltungs- und Legitimationsvoraussetzungen privater Rechtsetzung aus staatlicher Sicht. Er versteht unter Legitimation privater Rechtsetzung eine rein rechtstechnische Rechtfertigung, die dadurch gelingt, dass sich die privaten Regeln auf einen Rechtsanerkennungstitel stützen können. Die Frage nach einer allgemeinen „inneren“ Legitimation privater Regeln blendet er aus. Sie erfasst das Thema für ihn nur unter rechtsphilosophischen, ethischen, rechtstheoretischen oder sozialwissenschaftlichen Aspekten statt unter einem juristisch-dogmatischen Blickwinkel.4 Sein Fokus liegt vielmehr auf der Frage, welche Formen privater Regelsetzung die staatliche Rechtsordnung als rechtsverbindlich anerkennt und weshalb der Staat privates Normieren zulassen oder anordnen kann.5 Dabei verengt er seinen Blick auf private Rechtsnormen, also solche Regeln, die ohne Zustimmung der Betroffenen Gültigkeit erlangen. Aus zivilistischer Sicht ist diese Verengung auf die Handlungsform der Rechtsnorm kritisch zu sehen.6 Sie spart namentlich das Rechtsgeschäft als wesentliches Instrument privater Regelsetzung aus. Die von Augsberg verfasste Dissertation „Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft“ nähert sich der Thematik ebenfalls aus öffentlich-rechtlicher Per spektive.7 Sie geht die legitimatorischen Defizite privater Regelsetzung an, ohne zivile Aspekte in die Betrachtung mit einzubeziehen. Auch die Dissertation „Private Standardsetzung im Gesellschafts- und Bilanzrecht“ von Hohl, die sich u.a. der verfassungsrechtlichen Legitimation des Deutschen Corporate Governance Statt aller Koch, in: Hüffer/Koch, AktG, § 161 Rn. 4 m.w.N. F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 505. 5 Vgl. F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 506 ff. 6 Reuter, AcP 188 (1988), 649 f. 7 Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, passim. 3 4
§ 1 Einleitung
21
Kodex widmet, beleuchtet die Thematik aus einem öffentlich-rechtlichen Blickwinkel.8 Einen Assoziationshaushalt für private Regelbildung im Allgemeinen schafft sie nicht. Die Verengung der Thematik auf die öffentlich-rechtliche Perspektive ist misslich. Da die im Fokus stehenden Regeln privaten Ursprungs sind, fordern sie auch das Zivilrecht heraus. Die neuartige Verzahnung öffentlich-rechtlicher Regelungsinteressen mit privaten Regelungsinstrumenten schafft zudem eine besondere Gemengelage, die die Frage aufwirft, ob die privaten Regelwerke und die sie flankierenden gesetzlichen Vorgaben diese sachgerecht abfedern. Dies gilt vor allem deshalb, weil die zivilen Regelsetzungsinstrumente eigenen Kontroll- und Durchsetzungsmechanismen folgen, was sodann besondere Gefahren für die Regelungsunterworfenen begründen kann. Die wenigen Arbeiten, die sich der Thematik aus zivilistischer Sicht nähern, beschränken sich vornehmlich darauf, eine oder mehrere spezifische Erscheinungsformen privater Regelsetzung darzustellen. So liefert etwa die Monografie „Private Selbstregulierung“ von Buck-Heeb/Dieckmann lediglich eine aktuelle Bestandsaufnahme der einzelnen Erscheinungsformen privater Regeln.9 Ein Gesamtkonzept privater Regelbildung entwirft sie nicht. Auch die Dissertation von Weiss mit dem Titel „Hybride Regulierungsinstrumente“ beschäftigt sich ausschließlich mit den rechtlichen und faktischen Wirkungen von Kodizes, die im Zuge der Corporate Governance-Bewegung entstanden sind.10 Einzig Bachmann hat mit seiner Habilitationsschrift „Private Ordnung“ bislang den Versuch unternommen, eine allgemeine zivilistische Theorie privater Regelsetzung zu entwerfen.11 Sein Ansatz, wonach private Regeln legitim sind, wenn sie auf der Zustimmung des Regelunterworfenen basieren bzw. eine eingeschränkte oder fehlende Zustimmung durch Belange des Gruppenwohls kompensiert werden, ist jedoch nicht ohne Kritik geblieben12 und bedarf daher eingehender Würdigung.
III. Gegenstand und Gang der Untersuchung Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, zunächst das Phänomen privater Regelsetzung einer konsistenten Terminologie zuzuführen und es rechtsdogmatisch einzubetten. Auch soll der Versuch unternommen werden, die mannigfaltigen Erscheinungsformen privater Regeln zu ordnen. Die privaten Regeln sind auf ihre Hohl, Private Standardsetzung, S. 21. Buck-Heeb/Dieckmann, Selbstregulierung im Privatrecht, passim. 10 M. Weiss, Hybride Regulierungsinstrumente, passim; monografische Ausarbeitungen zu Teilbereichen finden sich ferner bei Damrau, Selbstregulierung im Kapitalmarktrecht, passim; Hoeren, Selbstregulierung im Banken- und Versicherungsrecht, passim. 11 Bachmann, Private Ordnung, S. 193 ff.; ders., in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 207, 220 ff. 12 Vgl. etwa Magen, in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 229, 241 ff. 8 9
22
§ 1 Einleitung
rechtlichen und faktischen Wirkungen hin zu analysieren und in einer Typologie systematisch zu erfassen. Vor allem aber soll der Frage nachgegangen werden, ob sich die rechtlichen Wirkungen privater Regeln mithilfe eines allgemeinen Modells privater Regelsetzung einheitlich legitimieren lassen und inwieweit die vom Staat bereitgestellten Regelungsräume diesem gerecht werden. Um sich der skizzierten Aufgabenstellung mit dem nötigen Tiefgang widmen zu können, erfolgt eine Eingrenzung dahingehend, dass der Blick auf die nationale Rechtslage beschränkt wird. Private Regelungsstrukturen internationalen und transnationalen Ursprungs bleiben weitgehend außer Betracht. Auch nimmt die Arbeit vorwiegend eine zivilistische Perspektive ein, was freilich nicht bedeutet, dass verfassungsrechtliche Vorgaben in der vorzunehmenden Untersuchung vollkommen ausgeblendet werden. Ausgeklammert bleibt schließlich die Ebene des sog. „private enforcement“.13 Vor diesem Hintergrund gliedert sich die Arbeit in vier Teile. Teil eins befasst sich mit den konzeptionellen Grundlagen privater Regelsetzung. Hier gilt es, die Begriffe Selbstregulierung, private Regelsetzung und private Rechtsetzung voneinander abzugrenzen (§ 2), bevor anschließend das Verhältnis zum staatlichen Recht näher beleuchtet werden kann (§ 3). In der nötigen Kürze werden schließlich die Vor- und Nachteile dargestellt, die privater Regelsetzung zugesprochen werden (§ 4). Nach dieser Grundlegung werden im zweiten Teil der Arbeit einzelne Erscheinungsformen privater Regelsetzung betrachtet und systematisch erfasst. Hierzu werden zunächst die herkömmlichen Systematisierungsansätze vorgestellt und es wird aufgezeigt, dass es sachdienlich ist, private Regeln anhand ihrer rechtlichen Verbindlichkeit zu systematisieren, weil der Grad der rechtlichen Verbindlichkeit für die an die Legitimation zu stellenden Anforderungen letztlich ausschlaggebend ist (§ 5). Private Regeln lassen sich danach in rechtlich unverbindliche, mittelbar rechtsverbindliche und unmittelbar rechtsverbindliche Regeln einteilen. Ausgehend hiervon werden daraufhin zuerst einzelne Erscheinungsformen rechtlich unverbindlicher Regeln dargestellt, wie etwa Selbstverpflichtungserklärungen, soziale Normen, Gentlemen’s Agreements oder Unternehmensrichtlinien (§ 6). Anschließend wird der Blick auf mittelbar rechtsverbindliche Regelwerke gerichtet (§ 7). Hierzu zählen beispielsweise technische Normen (DIN-Normen, VDI-Richtlinien), sog. Quantifizierungen, die IDW Prüfungsstandards und die Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex sowie die Rechnungslegungsstandards des Deutschen Rechnungslegungs Standards Commitee e.V. (DRSC). Zuletzt werden Erscheinungsformen privater Regeln mit unmittelbarem Verbindlichkeitsanspruch untersucht (§ 8). Erörtert werden zum einen einseitige Rechtsgeschäfte wie die Auslobung, das Testament, das arbeitsrechtliche Direktions13 Der Begriff „private enforcement“ umschreibt Kontrollverfahren über die Einhaltung gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen durch private Institutionen; hierzu umfassend Binder, Regulierungsinstrumente und Regulierungsstrategien, S. 202 ff.; Ebbing, Private Zivilgerichte, passim; Poelzig, Normdurchsetzung durch Privatrecht, passim.
§ 1 Einleitung
23
und Weisungsrecht sowie die arbeitsrechtliche Gesamtzusage, und zum anderen zwei- und mehrseitig rechtsverbindliche Regeln, wie der Vertrag, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Rechtsregeln der Verbände, der Tarifvertrag sowie die Betriebsvereinbarung. Der dritte Teil der Arbeit widmet sich der Legitimation privater Regeln. Hier wird zunächst aufgezeigt, dass die rechtlichen Bindungswirkungen privater Regeln einer Legitimation bedürfen und dass die Frage der Legitimation aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden kann (§ 9). Im Anschluss daran werden verschiedene Legitimationsansätze beleuchtet, auf ihre Tragfähigkeit hin geprüft und einem Legitimationsmodell zugeführt (§ 10). Auch wird der Frage nachgegangen, inwieweit der Staat den Legitimationsprozess flankierend zu begleiten hat und welche Handlungsformen ihm hier zur Verfügung stehen (§ 11). Alsdann wird untersucht, inwieweit die im zweiten Teil der Arbeit dargestellten privaten Regeln mit unmittelbaren und mittelbaren rechtlichen Wirkungen den an sie jeweils zu stellenden Legitimationsanforderungen gerecht werden, und das entworfene Legitimationskonzept damit gleichzeitig auf seine praktische Tauglichkeit hin überprüft (§ 12). Die Arbeit schließt im vierten Teil mit einer Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnisse in Thesenform.
Erster Teil
Konzeptionelle Grundlagen privater Regelsetzung 1. Teil: Konzeptionelle Grundlagen privater Regelsetzung
§ 2 Terminologie staatsfreier und staatsferner Ordnungsgebung I. Selbstregulierung als Oberbegriff Um der Vielfalt privater Ordnungsmuster und der Frage ihrer Legitimation nachgehen zu können, sollen zunächst die begrifflichen Grundlagen geschaffen werden. Nähert man sich der einschlägigen Literatur, wird schnell deutlich, dass eine einheitliche Terminologie für die Ordnungsformen staatsfreier und staatsferner Ordnungsgebung nicht existiert. Dies dürfte u.a. darauf zurückzuführen sein, dass das Phänomen staatsfreier und staatsferner Ordnungsgebung aus verschiedenen Perspektiven betrachtet wird, namentlich aus historischer, soziologischer, ökonomischer sowie juristischer, genauer zivilrechtlicher und staatsrechtlicher Sicht.1 Sachgerecht ist es, vom gängigen Begriff der Selbstregulierung als Oberbegriff auszugehen und sämtliche Formen staatsfreier und staatsferner Ordnungsgebung unter diesem Begriff zusammenzuführen. Denn ausgehend vom Wortlaut fällt unter den Begriff der Selbstregulierung jegliches Handeln, durch welches die Gesellschaft, d.h. ihre Individuen oder Kollektive, ihr Zusammenleben selbst ordnet.2 Die Vorsilbe „selbst“ ist aber nicht etwa so zu verstehen, dass eine Selbstregulierung nur dann vorliegt, wenn der Staat überhaupt nicht beteiligt ist. Selbstregulierung kann vielmehr in gewissem Maße auch mit staatlicher Beteiligung erfolgen. Entscheidend ist letztlich, dass der materielle Gehalt der Regulierung von der Gesell1 Zu diesen Perspektiven ausführlich Bachmann, Private Ordnung, S. 48 ff. m.w.N.; zu ökonomischen Regulierungstheorien vgl. ferner Damrau, Selbstregulierung im Kapitalmarktrecht, S. 16 ff.; zur Selbstregulierung als rechtssoziologisches Konzept vgl. Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, passim; Teubner, Recht als autopoietisches System, passim; ders., ARSP 1982, 13 ff.; Teubner/Wilke, ZfRSoz 5 (1984), 4 ff.; aus staatsrechtlicher Sicht vgl. Di Fabio, VVDStRL 56 (1997), 235, 238 ff.; Schmidt-Preuß, VVDStRL 56 (1997), 160, 162 ff.; ders., in: Kloepfer (Hrsg.), Selbst-Beherrschung, S. 89 ff.; zur Entwicklung, Bedeutung und den ersten Formen der Selbstregulierung v. Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht, 4 Bände, 1868/1913. 2 Zum Begriff der Selbstregulierung vgl. Buck-Heeb/Dieckmann, Selbstregulierung im Privatrecht, S. 8 ff.; Faber, Gesellschaftliche Selbstregulierungssysteme, S. 41 ff.; Hoffmann-Riem, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Auffangordnungen, S. 261, 300 ff.; Schmidt-Aßmann, DV Beiheft 4 (2001), 253, 255; Thoma, Regulierte Selbstregulierung, S. 32 ff.; Wahlers, Private Selbstregulierung, S. 35 ff.
§ 2 Terminologie staatsfreier und staatsferner Ordnungsgebung
25
schaft erarbeitet worden ist.3 Dass der Staat den Anstoß hierzu gibt4 oder während der Regulierung eng mit den gesellschaftlichen Regelsetzern zusammenarbeitet,5 ändert hieran nichts. Als Selbstregulierung ist damit letzten Endes jegliches regulierende Handeln zu verstehen, dessen Urheber nicht unmittelbar oder ausschließlich der Staat ist.6 Teile des vornehmlich öffentlich-rechtlichen Schrifttums engen den Begriff der Selbstregulierung dahingehend ein, dass nicht jedes regulierende Handeln hierunter falle, sondern dieses als Pendant zur staatlichen Regulierung intentional ablaufen und „mehr“ sein müsse als die Verfolgung bloß eigennütziger Ziele, d.h., es sollen damit gerade solche Ziele verfolgt werden, die der Einzelne von sich aus nicht ohne Weiteres einhalten würde oder erreichen könnte.7 Privatautonomes Handeln in Form der Ausübung der Vertragsfreiheit soll als freies Spiel der Marktkräfte grundsätzlich nicht von der Selbstregulierung erfasst sein.8 Diese wohl auch von einem öffentlich-rechtlichen Erkenntnisinteresse geleitete Verengung des Begriffs der Selbstregulierung soll hier nicht aufgegriffen werden. Erstens kann dem Ter3 Auf „organisierte“ gesellschaftliche Kräfte abstellend Di Fabio, VVDStRL 56 (1997), 235, 238. 4 Zum Merkmal der Freiwilligkeit vgl. Faber, Gesellschaftliche Selbstregulierungssysteme, S. 50 ff. m.w.N.; kritisch Kloepfer, JZ 1991, 737, 743: Von „echter“ Freiwilligkeit kann keine Rede mehr sein, wenn Private aufbauend auf politischem oder wirtschaftlichem Druck Regeln setzen. 5 Hoffmann-Riem hat eine Regulierungsskala entwickelt, die zwischen staatlich imperativer Regulierung, staatlicher Regulierung unter Einbau selbstregulativer Elemente, staatlich regulierter Selbstregulierung und privater Selbstregulierung differenziert, vgl. Hoffmann-Riem, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Auffangordnungen, S. 261, 300 ff. 6 So auch Bachmann, Private Ordnung, S. 27, 47; Schmidt-Aßmann, DV Beiheft 4 (2001), 253, 255; vgl. ferner Damrau, Selbstregulierung im Kapitalmarktrecht, S. 59, der weiter zwischen Selbstregulierung im engeren Sinne als Identität von Normverantwortung und Normbetroffenheit sowie Fremdregulierung unterscheidet; ähnlich Buck-Heeb/Dieckmann, Selbstregulierung im Privatrecht, S. 33 ff., die zwischen autonomer und heteronomer Selbstregulierung differenzieren. Zur Abrenzung zwischen staatlichen und privaten Akteuren siehe unten § 2 II 1. 7 Di Fabio, VVDStRL 56 (1997), 235, 238 Fn. 6: Regelung heißt auch mit dem Präfix „Selbst“ absichtsvolle Gestaltung; Thoma, Regulierte Selbstregulierung, S. 33. Andere spezifischere Definitionen setzen eine Substitution staatlicher Regulierung oder staatlichen Vollzugs voraus, vgl. Damrau, Selbstregulierung im Kapitalmarktrecht, S. 59: Selbstregulierung ist die Eigenbildung von Regeln anstelle des Erlasses staatlicher Vorschriften; Faber, Gesellschaftliche Selbstregulierungsinstrumente, S. 50, 52 ff.; Hopt, Kapitalanlegerschutz, S. 159 f.: Selbstregulierung soll staatlicher Regulierung zuvorkommen; Roßkopf, Selbstregulierung, S. 39: Nur solche Regeln können vom Selbstregulierungsbegriff erfasst werden, die in Wahrnehmung einer öffentlicher Verantwortung erlassen werden und prinzipiell ebenso vom Staat erlassen werden könnten. 8 C. Calliess, AfP 2002, 465, 466; Kühling, Sektorspezifische Regulierung, S. 27; Schuppert, in: Schuppert (Hrsg.), Governance-Forschung, S. 371, 404; Thoma, Regulierte Selbstregulierung, S. 32 f.; aus zivilrechtlicher Sicht Bachmann, Private Ordnung, S. 27.
26
1. Teil: Konzeptionelle Grundlagen privater Regelsetzung
minus der Selbstregulierung eine dahingehende Selektionskraft schon begrifflich nicht beigemessen werden. Zweitens wird sich eine klassifizierende Einordnung in Bezug auf die Verfolgung privater oder öffentlicher Interessen nicht immer treffen lassen. Drittens erscheint es nicht überzeugend, Rechtsgeschäfte aus dem Bereich der Selbstregulierung auszuschließen, stellen diese doch die kleinste Einheit privater Ordnungsgebung dar.
II. Private Regelsetzung als Ausschnitt der Selbstregulierung 1. Private Regelsetzung als Ausübung grundrechtlicher Freiheiten Fasst man unter den Begriff der Selbstregulierung jegliches regulierende Handeln, dessen Urheber nicht unmittelbar oder ausschließlich der Staat ist, unterfallen dem Begriffsverständnis sowohl private Regeln als auch Regelungsakte (Satzungen) der mittelbaren Staatsverwaltung (z.B. IHK, Ärztekammer, AOK etc.),9 die dadurch gekennzeichnet sind, dass der Staat seine Verwaltungsaufgaben nicht durch eigene Behörden selbst vornimmt, sondern durch rechtlich selbstständige Organisationen wahrnehmen lässt.10 Ein unmittelbar staatliches Ordnungshandeln liegt in beiden Fällen nicht vor. Dies veranlasst zu einer weiteren begrifflichen Untergliederung. Denn diese verschiedenen Akte der Selbstregulierung können nicht durch ein einheitliches Legitimationskonzept getragen werden.11 So ist für die Selbstregulierung im Wege der mittelbaren Staatsverwaltung durch öffentlich-rechtliche Verwaltungsträger anerkannt, dass sie öffentlich-rechtlichen Legitimationsanforderungen gerecht werden muss. Da die öffentlich-rechtlichen Verwaltungsträger Teil des Staates sind, üben sie Staatsgewalt i.S.d. Art. 20 Abs. 2 GG aus. Damit gelten für sie die Verfassungsbindung des Art. 20 Abs. 3 GG, die Grundrechtsbindung des Art. 1 Abs. 3 GG und der Gemeinwohlauftrag aller Staatlichkeit.12 Privatautonome Regulierungsinstrumente können diesen Anforderungen indes nicht unterworfen sein. Privates Handeln ist Ausdruck von Freiheitsausübung und unterliegt gerade nicht 9 Eine umfassende Auflistung der Erscheinungsformen der Selbstregulierung findet sich bei Bachmann, Private Ordnung, S. 28 ff. 10 Bachmann, Private Ordnung, S. 28. 11 Isensee, Der Staat 1981, 161, 167 f.: Fundamentalalternative des Verfassungsrechts: grundrechtliche oder demokratische Legitimation. Zur (historischen) Bedeutung der Unterscheidbarkeit von Staat und Gesellschaft vgl. Böckenförde, Unterscheidung von Staat und Gesellschaft, S. 7 ff.; ders., Recht, Staat, Freiheit, S. 209 ff.; Hesse, DÖV 1975, 437 ff.; ders., in: Häberle/Hollerbach (Hrsg.), Konrad Hesse: Ausgewählte Schriften, S. 45 ff.; Isensee, Subsidiaritätsprinzip und Verfassungsrecht, S. 149 ff.; Rupp, in: Isensee/P. Kirchhof (Hrsg.), HStR, Bd. II, § 31 Rn. 1 ff. 12 Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 129; Schmidt-Aßmann, in: GS Martens, S. 249, 258; zur Legitimation funktionaler Selbstverwaltung vgl. BVerfGE 107, 59, 91 ff. (Lippeverband).
§ 2 Terminologie staatsfreier und staatsferner Ordnungsgebung
27
den Verfassungsbindungen des Staates.13 Vielmehr kann sich der Einzelne umgekehrt gegenüber dem Staat auf den Grundrechtsschutz berufen.14 Um die öffentlich-rechtlichen Erscheinungsformen der Selbstregulierung von den privaten abzugrenzen, bietet es sich an, letztere unter dem Begriff der privaten Regelsetzung zusammenzufassen. Als privat muss dabei – entsprechend den unterschiedlichen Legitimationsanforderungen – jede Form der Regelsetzung verstanden werden, die sich als Ausübung grundrechtlicher Freiheiten und nicht als Ausübung von Staatsgewalt darstellt.15 Da ausländische juristische Personen des Privatrechts wegen Art. 19 Abs. 3 GG nicht als grundrechtsberechtigt angesehen werden,16 muss man sich in Bezug auf diese mit der allgemeineren Formulierung begnügen, dass die (transnationale) Regelsetzung als Ausübung von Freiheit erscheint und nicht als Ausübung von Staatsgewalt. Bei den öffentlich-rechtlich organisierten Rundfunkanstalten, Universitäten und Kirchen, die sich einerseits gegenüber dem Staat auf die Grundrechte berufen können, andererseits im Verhältnis zu ihren Adressaten an verfassungsrechtliche Vorgaben gebunden bleiben,17 führt die vorgegebene Differenzierung dazu, dass die Grenzlinie zwischen Staat und Privat quer durch einen Rechtsträger verläuft.18 Beliehene, d.h. natürliche oder juristische 13 Vgl. nur Herdegen, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 1 Abs. 3 Rn. 99 (Stand: 77. EL 2016): Private unterliegen grundsätzlich keiner Grundrechtsbindung. Auch die mittelbare Drittwirkung der Grundrechte in privatrechtlichen Beziehungen macht den Einzelnen nicht zum Grundrechtsverpflichteten. Zur mittelbaren Drittwirkung der Grundrechte vgl. BVerfGE 73, 261, 269; Canaris, AcP 184 (1984), 201, 210 ff.; Dürig, in: FS Nawiasky, S. 157 ff.; Herdegen, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 1 Abs. 3 GG Rn. 64 f. (Stand: 77. EL 2016); Medicus, AcP 192 (1992), 35, 43 ff. Ausnahmsweise bestehen Verpflichtungen Privater kraft unmittelbarer Drittwirkung gemäß Art. 1 Abs. 1 S. 1 GG und Art. 9 Abs. 3 S. 2 GG. Doch damit ist keine Eingliederung in den staatlichen Bereich verbunden. 14 Magen, in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 229, 235. 15 Siehe auch Ossenbühl, VVDStRL 29 (1971), 137, 144: Privater als der dem Staat gegenüberstehende, grundrechtsgeschützte Bürger; Heintzen, VVDStRL 62 (2003), 220, 231 f.: Privater als nicht staatliches Subjekt und Grundrechtsträger; Isensee, Der Staat 1981, 161, 166, der bezogen auf die Unterscheidung von Staat und Gesellschaft unter den Begriff „Gesellschaft“ alle grundrechtsfähigen Rechtssubjekte fasst. Magen, in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 229, 236 betont, dass die private Rechtsetzung keinen Fall bloßer Ausübung grundrechtlicher Freiheit darstelle, da das private Recht wegen des Rechtsanerkennungsmonopols des Staates nur kraft staatlichen Geltungsbefehls zu Recht werde. Es handele sich um eine gesteigerte private Rechtsmacht, eine Rechtsmacht, die vom Staat um der Grundrechtsverwirklichung willen ausgeweitet würde; dazu noch ausführlich unten § 2 III. 16 Kritisch gegenüber der Gleichsetzung von Privatheit und Grundrechtsträgerschaft deshalb Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 34. 17 Vgl. Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 34 mit Verweis auf BVerfGE 15, 256, 262 (Universitäten); BVerfGE 18, 385, 386 f. (Kirchen); BVerfGE 31, 314, 322 (Rundfunkanstalten); umfassend dazu auch Rüfner, in: Isensee/P. Kirchhof (Hrsg.), HStR, Bd. IX, § 196 Rn. 119 ff. 18 Vgl. Isensee, Der Staat 1981, 161, 168 f.; N. Zimmermann, Der grundrechtliche Schutz anspruch juristischer Personen des öffentlichen Rechts, S. 117 f.
28
1. Teil: Konzeptionelle Grundlagen privater Regelsetzung
Personen des Privatrechts, denen bestimmte Aufgaben zur selbstständigen hoheitlichen Wahrnehmung übertragen werden, fallen aufgrund ihrer Bindung an die Grundrechte nicht unter den Begriff des Privaten.19 2. Hybride Regeln – Kriterien zur Einordnung in die staatliche oder private Sphäre Schwierigkeiten bereitet die Zuordnung eines Regelsatzes zur staatlichen oder privaten Sphäre dann, wenn staatliche und private Stellen bei der Regelsetzung Hand in Hand arbeiten. Die vielseitigen Verflechtungen und Verantwortungsteilungen 20 zwischen Staat und Privaten schaffen fließende Übergänge. Die Grenzen von hoheitlicher Gewalt und privater Freiheit verschwimmen.21 Die Initiative zur Schaffung derartiger Regelwerke kann dabei von beiden Seiten ausgehen. Meist stellt sie sich als eine Reaktion auf einen sozial- oder wirtschaftspolitischen Handlungsdruck dar.22 Zur Umschreibung dieses Phänomens hat sich der Begriff „hybride“ Regelsetzung herausgebildet.23 In der Literatur werden verschiedene Kriterien genannt, die eine Zuordnung hybrider Regelwerke zur staatlichen oder privaten Sphäre ermöglichen sollen. So soll zum einen maßgeblich sein, auf wessen Veranlassung hin das regelsetzende Gremium tätig geworden ist. Sei das jeweilige Gremium staatlich veranlasst – sei es durch Gesetz, Verordnung, Satzung, Verwaltungsvorschrift oder bloßen Organisationsakt –, seien die von ihm erlassenen Regelsätze als staatlich zu qualifizieren; habe sich das jeweilige Gremium indes privatautonom zusammengefunden, sei der von ihm erlassene Regelsatz als privat einzustufen.24 Zum anderen soll der Umstand eine Rolle spielen, ob die regelsetzenden Personen staatlicherseits ausgewählt werden oder der Staat sogar eigene Mitglieder z.B. aus dem zuständigen 19 Darüber hinaus sind mit der Figur der Beleihung nach ganz h.M. auch keine Rechtsetzungsbefugnisse verbunden, vgl. Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 189 f.; Wolff/Bachof/Stober, Verwaltungsrecht, Bd. II, § 90 Rn. 23; vgl. zum Begriff des Beliehenen Herdegen, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 1 Abs. 3 Rn. 101 (Stand: 77. EL 2016); Hillgruber, in: BeckOK GG, Art. 1 Rn. 72.1; Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG-Kommentar, Art. 1 Rn. 41. 20 Zur Verantwortungsteilung als Schlüsselbegriff ausführlich Trute, in: Schuppert (Hrsg.), Jenseits von Privatisierung und „schlankem“ Staat, S. 13 ff.; zu den gesetzgeberischen Regelungsstrategien der Verantwortungsteilung Voßkuhle, in: Schuppert (Hrsg.), Jenseits von Privatisierung und „schlankem“ Staat, S. 47 ff. 21 Mitunter wird die Unterscheidung von Staat und Gesellschaft als überholt angesehen, vgl. etwa Benz, Kooperative Verwaltung, S. 45 f.; Dreier, Hierarchische Verwaltung, S. 299 ff.; Grimm, Die Zukunft der Verfassung, S. 170 ff. 22 M. Weiss, Hybride Regulierungsinstrumente, S. 50. 23 Monografisch M. Weiss, Hybride Regulierungsinstrumente, passim. 24 Brunner, Rechtsetzung durch Private, S. 26 ff.; Groß, Das Kollegialprinzip, S. 28; Hohl, Private Standardsetzung, S. 43 f.; zur staatlichen Veranlassung als entscheidendem Kriterium vgl. Dederer, Korporative Staatsgewalt, S. 17 f.
§ 2 Terminologie staatsfreier und staatsferner Ordnungsgebung
29
Ministerium entsendet.25 Indizwirkung soll ferner den Fragen beizumessen sein, in wessen Namen und auf welche Art und Weise die Regeln veröffentlicht werden.26 Es mache beispielsweise einen Unterschied, ob die Regeln in einer privat initiierten Pressekonferenz oder in einem amtlichen Medium des Staates verkündet würden.27 Schließlich erlaube der Geltungsbereich des Regelwerks Rückschlüsse auf seine Zuordnung. Erstrecke sich dieser nur auf eine bestimmte Branche oder eine Region, so gehe die Tendenz in Richtung privates Regelwerk; erstrecke er sich hingegen auf den Nationalstaat, so spreche dies für ein staatliches Regelwerk.28 Im Hinblick auf die Frage der Legitimation privater Regeln führen diese Kriterien nur bedingt weiter. In diesem Kontext kann es in erster Linie nur darauf ankommen, wer den konkreten Inhalt der jeweiligen Regeln festlegt und formuliert.29 So ist eine Regel dann, wenn der Staat auf den Inhalt der jeweiligen Regel Einfluss nimmt, d.h. diesen durch mehr oder minder konkrete Zielvorgaben diktiert, der staatlichen Sphäre zuzuordnen. Denn dann erscheint die jeweilige Regel nicht als Ausdruck grundrechtlicher Freiheitsausübung, sondern als Spielform staatlich diktierter Ordnungsgebung. Ist der Regelsetzer in der eigentlichen Willensbildung, d.h. bei der inhaltlichen Ausarbeitung des Verhaltenssatzes im weitesten Sinne autonom, also frei von staatlichen Diktionen, und die Regelsetzung nur in den äußeren Grenzen durch staatliche Vorgaben flankiert, ist die Regelsetzung Ausprägung seiner grundrechtlich geschützten Freiheitsausübung.30
III. Private Rechtsetzung als Teilbereich privater Regelsetzung 1. Meinungsstand a) Staatszentrierte Sichtweise Bislang noch nicht geklärt ist, inwieweit von privater Hand gesetzte Regeln als Recht verstanden werden können.31 In der Rechtswissenschaft ist in Bezug auf die 25 Vgl. dazu etwa M. Weiss, Hybride Regulierungsinstrumente, S. 52; im Hinblick auf die Einordnung des Deutschen Corporate Governance Kodex Hohl, Private Standardsetzung, S. 44. 26 M. Weiss, Hybride Regulierungsinstrumente, S. 52. 27 Vgl. etwa M. Weiss, Hybride Regulierungsinstrumente, S. 52. 28 Vgl. M. Weiss, Hybride Regulierungsinstrumente, S. 52. 29 Vgl. F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 100. 30 F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 105: Weitgehende Autonomie in der Willensbildung, Struktur und Zwecksetzung sowie Abhängigkeit von (gruppen-)egoistischen Zielen sind Anhaltspunkte für das Vorliegen privater Organisationen. 31 Zum Rechtsbegriff vgl. insbesondere Dreier, NJW 1986, 890 ff.; Koller, Theorie des Rechts, S. 19 ff., 131 ff.; Maihofer, (Hrsg.), Begriff und Wesen des Rechts, passim; zum Rechtsbegriff aus historischer Sicht Meder, Ius non scriptum, S. 1 ff.; aus rechtsphilosophischer Sicht von der Pfordten, ZfphF 63 (2009), 173 ff.; aus Sicht der Governance-Forschung vgl. Franzius, VerwArch 97 (2006), 186 ff., 207 ff.
30
1. Teil: Konzeptionelle Grundlagen privater Regelsetzung
Frage, wann eine Regel als Recht qualifiziert werden kann, eine staatszentrierte Sichtweise vorherrschend, die nur dem Staat rechtsschöpferische Macht zuerkennt.32 Dabei geht man allerdings nicht von einem absoluten Rechtsetzungsmonopol des Staates aus,33 sondern öffnet den Begriff des Rechts insoweit für von privater Hand erarbeitete Regeln, als es grundsätzlich für zulässig erachtet wird, dass Staat und Private bei der Rechtsetzung arbeitsteilig zusammenwirken.34 Dem Staat müsse aber weiterhin vorbehalten bleiben, die Grenzen des Rechts abzustecken und einer Regel die Rechtsgeltung zuzuerkennen oder nicht.35 Wie eine private Regel vonseiten des Staates als Recht qualifiziert werden kann, hat insbesondere F. Kirchhof in seiner Habilitationsschrift „Private Rechtsetzung“ aufgezeigt. Danach verfügt der Staat über ein sog. Rechtsanerkennungsmonopol, kraft dessen er private Regeln für die Adressaten für verbindlich erklären kann.36 32 Vgl. etwa den Definitionsversuch bei Dreier, NJW 1986, 890, 986: Recht als „die Gesamtheit der Normen, die zur Verfassung eines staatlich organisierten oder zwischenstaatlichen Normensystems gehören, sofern dieses im großen und ganzen sozial wirksam ist und ein Minimum an ethischer Rechtfertigung oder Rechtfertigungsfähigkeit aufweist, und der Normen, die gemäß dieser Verfassung gesetzt sind, sofern sie, für sich genommen, ein Minimum an sozialer Wirksamkeit oder Wirksamkeitschance und ein Minimum an ethischer Rechtfertigung oder Rechtfertigungsfähigkeit aufweisen“. 33 Vgl. auch Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 26 ff.; F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 107 ff.; Kloepfer/Elsner, DVBl. 1996, 964, 968; Meyer-Cording, Die Rechtsnormen, S. 39 ff.; Ossenbühl, in: Isensee/P. Kirchhof (Hrsg.), HStR, Bd. V, § 100 Rn. 38 f.; Taupitz, Standesordnungen, S. 594 ff. Ein solches Monopol ergibt sich weder aus der Verfassung (im Gegenteil, vgl. nur Art. 9 Abs. 3 GG, Art. 21 GG) noch aus ungeschriebenen Verfassungsgrundsätzen, vgl. F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 112 ff.; zu lediglich sektoralen staatlichen Rechtsetzungsmonopolen siehe ebenda, S. 126 ff. 34 Grundlegend F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 107 ff., insbesondere S. 133 ff.; vgl. ferner Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 28 f.; Bachmann, Private Ordnung, S. 62 ff.; Biedenkopf, Vertragliche Wettbewerbsbeschränkung und Wirtschaftsverfassung, S. 130 f.; Jellinek, Allgemeine Staatslehre, S. 367; P. Kirchhof, ZGR 2000, 681, 682; Köndgen, AcP 206 (2006), 477, 518 ff.; Krüger, Allgemeine Staatslehre, S. 491 ff., 770; Lieb, Rechtsnatur der Allgemeinverbindlicherklärung, S. 58 ff.; Magen, in: Bumke/Röthel (Hrsg.), in: Privates Recht, S. 229, 236; Marburger, Regeln der Technik, S. 330 ff.; Möllers, in: FS Buchner, S. 649 ff., insbesondere 652 ff.; ders., in: Möllers (Hrsg.), Geltung und Faktizität von Standards, S. 143 ff., insbesondere 147 ff.; Ossenbühl, in: Isensee/P. Kirchhof (Hrsg.), HStR, Bd. V, § 100 Rn. 38 ff.; Röhl/Röhl, Allgemeine Rechtslehre, S. 206; Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie, Rn. 55 f.; Waltermann, Rechtsetzung durch Betriebsvereinbarung, S. 122, 142 ff.; letztlich auch Herzog, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 92 Rn. 154 (Stand: 30. EL 1992): Staatliches Rechtsetzungsmonopol, das private Rechtsetzungstätigkeiten nicht gänzlich ausschließt. 35 Vgl. Bachmann, JZ 2008, 11, 13; ders., Private Ordnung, S. 62 f., 380; Canaris, AcP 184 (1984), 201, 218 f.; H. Hanau, Verhältnismäßigkeit als Schranke privater Gestaltungsmacht, S. 27 ff.; ders., in: Möslein (Hrsg.), Private Macht, S. 119, 125 f.; F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 133 ff.; Köndgen, AcP 206 (2006), 477, 518 ff.; Magen, in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 229, 236; Taupitz, Standesordnungen, S. 599 f. 36 Vgl. F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 133 ff. Streng zu unterscheiden ist diese Anerkennungstheorie von der genossenschaftlichen Rechtstheorie, wonach bestimmten
§ 2 Terminologie staatsfreier und staatsferner Ordnungsgebung
31
Bedingung für eine derartige Anerkennung sei ein staatlicher Geltungsbefehl. Anders als vom Staat erlassene Regeln, die bereits aus sich heraus Recht seien, würden private Regeln erst dann rechtsverbindlich, wenn der Staat dies anordne. Staatliches Recht entsteht vor diesem Hintergrund einstufig, privat gesetztes Recht in einem zweistufigen Akt: Inhaltsbestimmung plus staatlicher Anerkennungsakt.37 Der Anerkennungsakt führe aber nicht dazu, dass die privat erzeugte Regel ins staatliche Recht integriert werde.38 Sie bleibe wegen der Eigenständigkeit des Privaten bei der Bildung der Regel privat gesetztes Recht.39 Die staatliche Anerkennung einer privaten Regel als Recht könne auf drei Wegen erfolgen:40 Erstens könne der Staat eine Rechtssatzform bereitstellen, die Private zur Rechtsetzung verwenden könnten wie Vereinssatzungen, Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge. Zweitens könne der Staat eine Organisationsform für den Regelproduzenten zur Verfügung stellen und deren Regeln mit normativer Geltung versehen wie etwa Stiftungsordnungen einer rechtsfähigen Stiftung (vgl. §§ 80 ff. BGB) oder Satzungen von Kapitalgesellschaften.41 Drittens könne der Staat auch subjektive Rechte wie das Eigentum schaffen, die dem privaten Inhaber die Befugnis verleihen, Dritten unter bestimmten Voraussetzungen ein Verhalten vorzuschreiben, beispielsweise der Hauseigentümer den Hausbesuchern in Form einer Hausordnung.42 b) Pluralistische Sichtweise Rechtssoziologen und Rechtsphilosophen vertreten demgegenüber vorwiegend einen sog. rechtspluralistischen Rechtsbegriff.43 Danach sei für Recht weder begesellschaftlichen Gruppen originäre Rechtsetzungsmacht zukommen soll, vgl. hierzu v. Gierke, Deutsches Privatrecht, Bd. 1, S. 119 ff., 142 ff., 159 f. Heute ist nahezu einhellig anerkannt, dass im Gegensatz zum Ständestaat keine originäre Regelungsbefugnis der nicht staatlichen Organisationen besteht. Die Kompetenz der Privatrechtssubjekte zur Setzung rechtsgeschäftlicher Regelungen ist auch nicht mit den Kategorien der Ermächtigung oder der Delegation zu erklären, die private Rechtsetzungsbefugnisse aus einem staatlichen Überlassungsakt herleiten wollen und somit zu einer staatlicherseits stark vorgeprägten Rechtsetzungsbefugnis Privater führen, vgl. Taupitz, Standesordnungen, S. 599 f. 37 F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 139 ff. 38 Die Rechtsanerkennung ist daher nicht zu verwechseln mit einer staatlichen Verweisung auf außerstaatliches Recht oder einer tatbestandlichen Anknüpfung an private Regeln im staatlichen Recht, vgl. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 151 ff. 39 F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 140. 40 F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 141 f.; weitergehend Köndgen, AcP 206 (2006), 477, 518 ff.; ähnlich, wenn auch mitunter etwas enger Michaels, Wayne Law Rev., S. 1209, 1215 ff. 41 F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 141 f., der darauf hinweist, dass die Rechtspraxis die rechtstechnischen Anerkennungsakte häufig vermische und sowohl Rechtssatzform als auch Rechtsetzer anerkenne. 42 F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 142 f. 43 Das Konzept des Rechtspluralismus ist keineswegs neu. In der Rechtsgeschichte wurde der Begriff verwendet, um nebeneinander bestehende personale Herrschaftsrechte
32
1. Teil: Konzeptionelle Grundlagen privater Regelsetzung
griffswesentlich, dass es vom Staat ausgehe, noch dass es die Grundlage für die Entscheidungen der Gerichte oder anderer Behörden oder für den darauffolgenden Rechtszwang abgebe.44 In demselben sozialen Feld könne zwar nur eine höchste Macht, und zwar die staatliche, Rechtsgesetze erlassen; daneben könnte es aber weitere gesellschaftliche Regeln mit Rechtscharakter geben.45 Gegen die staatszentrierte Sichtweise wird eingewandt, dass sie tradierten Strukturen verhaftet sei und den Entwicklungen in einer globalisierten Welt nicht gerecht werde.46 Es sei nicht im Mittelalter zu beschreiben. In der Rechtsanthropologie hat er die Funktion, Rechte der einheimischen Bevölkerung gegenüber denen von Kolonialmächten herauszustellen. Erst später übertrugen Rechtssoziologen das Konzept des Rechtspluralismus auf das Verhältnis von offiziellem und inoffiziellem Recht in westlichen Ländern und forderten dazu auf, den Rechtszentralismus aufzugeben, vertiefend Röhl/Röhl, Allgemeine Rechtslehre, S. 206 ff. Zum pluralistischen Rechtsbegriff bzw. zum Rechtspluralismus vgl. ferner Benda-Beckmann, ZfRSoz 12 (1991), 97, 106 ff., 115 f.; G.-P. Calliess, Grenzüberschreitende Verbraucherverträge, S. 242 ff.; Ehrlich, Grundlegung der Soziologie des Rechts, passim; Fischer-Lescano/Viellechner, APuZ 2010, 26 ff.; Gessner, ZfRSoz 23 (2002), 277 ff., insbesondere 284 ff.; Griffiths, Journal of Legal Pluralism, 24 (1986), 1 ff., 38: „It is when in a social field more than one source of ‚law‘, more than one ‚legal order‘, is observable, that the social order of that field can be said to exhibit legal pluralism“; Herberg, Globalisierung und private Selbstregulierung, S. 18 ff., insbes. 22 ff.; Kadelbach/Günther, in: Kadelbach/Günther (Hrsg.), Recht ohne Staat?, S. 9 ff.; Kantorowicz, Der Begriff des Rechts, S. 36 f., 87 ff.; Klösel, Compliance-Richtlinien, S. 120 ff., 141 f.; Lampe, in: Lampe (Hrsg.), Rechtsgleichheit und Rechtspluralismus, S. 8 ff.; Meyer-Cording, S. 42 ff.; Teubner, in: Liber Amicorum Josef Esser, S. 191, 198 ff.; ders., RJ 15 (1996), 255 ff.; mit wenig Kontur Würtenberger, in: Lampe (Hrsg.), Rechtspluralismus und Rechtsgleichheit, S. 92, 106: „Rechtsetatismus und Rechtspluralismus sind letztlich keine Alternativen, sondern müssen im pluralistischen demokratischen Rechtsstaat in ein Gleichgewicht gebracht werden.“ 44 So bereits Anfang des 20. Jahrhunderts Ehrlich, Grundlegung der Soziologie des Rechts, S. 32, 144: „Es ist doch im vorhinein klar, daß der Wust der Gesetze die bunte Mannigfaltigkeit des Rechtslebens unmöglich decken kann. Es entstehen auch in unserer Zeit, gerade so wie in der grauen Vergangenheit, neue Gemeinschaften, Besitzverhältnisse, Verträge, Erbordnungen, den Gesetzen noch unbekannt.“ Ehrlichs Versuch, den rechtspositivistischen Rechtsbegriff aufzubrechen, war jahrzehntelang ein geringes Echo beschieden, vgl. nur die vernichtende Rezension Hans Kelsens, ArchSozWiss 39 (1915), 839 ff. Erst einmal ad acta gelegt wurde Ehrlichs Theorie durch Max Webers trennscharfe Unterscheidung zwischen Rechtsnormen und gesellschaftlichen Normen, vgl. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 18, 187 ff. 45 Ehrlich, Grundlegung der Soziologie des Rechts, S. 31 ff.: Überall da, wo Gesellschaft ist, soll es auch Recht geben. Dabei soll die Ausweitung des Rechtsbegriffs aber nicht etwa dazu führen, dass die privaten Regeln ins staatliche Recht integriert werden, da diese Regelungswirkungen weiterhin aus sich heraus entfalten würden und ihren eigenständigen Regeln zur Durchsetzung unterlägen, vgl. Klösel, Compliance-Richtlinien, S. 105; Teubner, in: Liber Amicorum Ma. Weiss, Codes of Conduct, S. 109, 114. 46 Herberg, Globalisierung und private Selbstregulierung, S. 19 f.; Teubner, in: Hauke/ Kettner (Hrsg.), Globalisierung und Demokratie, S. 240, 252: „Die Rechtshierarchie zerbricht nicht unter den Attacken der Rechtstheorie, wohl aber an den Selbstdekonstruktionen der Praxis.“
§ 2 Terminologie staatsfreier und staatsferner Ordnungsgebung
33
sinnvoll, die Terminologie so zu legen, dass man sich angesichts einer fortschreitenden Regulierung durch Private einem erschreckenden Mangel an Recht gegenübersähe.47 Die Rechtswirklichkeit halte dazu an, den Rechtsbegriff aufzusprengen und in gewissem Umfang für zivile und hybride Regelungen zu öffnen.48 Auch schaffe die Ausweitung des Rechtsbegriffs erweiterte Anwendungsbedingungen sowie umfangreichere staatliche Kontrollvorbehalte für private Regeln.49 Soweit die Voraussetzungen näher erläutert werden, unter denen der Rechtsbegriff für private Regeln zu öffnen ist, lassen sich drei Strömungen ausmachen. Nach den Funktionstheorien soll hierfür das Anliegen genügen, eine Ordnung zu schaffen oder herzustellen. Akte der privatautonomen Regelsetzung nähmen aus der Sicht derjenigen, die diese erzeugten und befolgten, oftmals dieselbe Funktion und Wirkungsweise wie Gesetze ein, sodass es nur folgerichtig sei, diese auch unter den Begriff des Rechts zu fassen.50 Private Regeln würden sich von staatlichen Gesetzen nicht in ihrer Wirkung, sondern nur in ihrer Entstehungsweise unterscheiden, da sie einen freiwilligen Unterwerfungsakt voraussetzten.51 Nach den institutionellen Ansätzen sollen vom Rechtsbegriff sämtliche Ordnungsphänomene umfasst sein, die eine institutionelle Verfestigung aufweisen. So stellt etwa Kantorowicz auf das Merkmal der Gerichtsfähigkeit einer Regel ab, wobei er darunter nicht nur staatliche Gerichte, sondern auch private Schiedsgerichte u.Ä. versteht.52 Ausreichend sei, dass die Einhaltung einer Regel durch besondere, hierzu bestellte Personen kontrolliert werde. In diese Richtung geht auch das Konzept von Teubner,53 der das Recht als Selbstreproduktion spezialisierter, oft formell organisierter und eng definierter globaler Netzwerke ökonoG.-P. Calliess, Grenzüberschreitende Verbraucherverträge, S. 243. G.-P. Calliess, Grenzüberschreitende Verbraucherverträge, S. 243: Die hybriden Zivilregime sind durch Zivilverfassungsrecht zu konstitutionalisieren. 49 So Klösel, Compliance-Richtlinien, S. 104. 50 Arndt, Sinn und Unsinn von Soft Law, S. 35; Mertens, AG 1982, 29; so auch Schwierz, Die Privatisierung des Staates, S. 52 f., der allein die faktische Bindungswirkung privater Regelwerke für maßgeblich hält, deren Ursache in der Vorstellung von der unmittelbaren Rechtsverbindlichkeit liege. In diese Richtung geht auch die von Griffiths entwickelte Theorie des Rechts, vgl. Griffiths, Journal of Legal Pluralism 24 (1986), 1, 38 Fn. 41: Eine Rechtsnorm erkenne man daran, ob ihr die Funktion zukomme, „social control“ innerhalb eines bestimmten gesellschaftlichen Teilbereichs zu gewährleisten. Ebenda, 38: „(…) law is the self regulation of a semi-autonomous field. The idea that only the law of the state is law ‚properly so called‘ is a feature of the ideology of legal centralism and has for empirical purposes nothing to do be said for it“. 51 Meyer-Cording, Die Rechtsnormen, S. 47. 52 Zur Gerichtsfähigkeit von Rechtsnormen Kantorowicz, Der Begriff des Rechts, S. 87 ff. 53 Grundlegend Teubner, RJ 1996, 255 ff.; ders., ZaöRV 2003, 1 ff.; ders., in: Liber Amicorum Esser, S. 191, 197 ff.; ders., in: Simon/Ma. Weiss (Hrsg.), Zur Autonomie des Individuums, S. 437 ff.; ders. (Hrsg.), Global Law Without a State; Fischer-Lescano/ders., Regime-Kollisionen, S. 41 ff. 47
48
1. Teil: Konzeptionelle Grundlagen privater Regelsetzung
34
mischer, kultureller, wissenschaftlicher oder technischer Art versteht.54 Private Regeln seien als Recht auszuweisen, wenn sie über sekundäre Normierungen verfügten, d.h. über Normen, die ihre Anwendung regelten.55 Der Prozess sekundärer Normierungen erfordere institutionelle Vorkehrungen, insbesondere das Schaffen von Einrichtungen (z.B. Schiedsgerichte oder unternehmensinterne Kontrollund Implementationsorgane), die dafür zuständig seien, primäre Normierungen anzuwenden, zu interpretieren und fortzubilden.56 Klösel ergänzt diesen Ansatz insoweit, als dass private Ordnungen nicht abstrakt, sondern nur anhand einer konkreten Fragestellung als Recht klassifiziert werden könnten. So sei im Hinblick auf private Compliance-Richtlinien zu untersuchen, ob diese Regeln im Einzelfall rechtsspezifische Gefahren begründeten, die die Anwendung rechtlicher Kontrollvorbehalte wie eine richterliche Inhaltskontrolle erforderlich machten.57 Derartige rechtsspezifische Gefahren könnten sich dadurch ergeben, dass durch Institutionalisierung privater Regeln das hierdurch geschaffene vergesellschaftete Recht einer Eigenlogik folge und dem Menschen als ein autonomer und anonymisierter Prozess entgegentrete.58 Die konventionalistischen Theorien59 lösen sich von dem Versuch, Recht anhand bestimmter Begriffsmerkmale zu bestimmen. Sie stellen darauf ab, dass sich die Bürger mit dem Recht identifizieren und es als solches im sozialen Umgang behandeln.60 So soll nach Meyer-Cording maßgeblich sein, dass das allgemeine Rechtsdenken den Regeln ein ähnliches Vertrauen entgegenbringt wie den Gesetzen,61 private Regeln im Ergebnis also wie Recht behandelt würden. Daneben komme es ganz wesentlich darauf an, dass die privaten Regelgeber funktionsfähig seien, d.h. fähig, die Interessen des Gemeinwohls und der Gerechtigkeit zu wahren.62 In eine ähnliche Richtung geht der Ansatz von Berman: Nicht der Zwang63 sei das entscheidende Definitionsmerkmal des Rechts, sondern die Artikulation und Überzeugung von einer bestimmten normativen Ordnung.64 Dies setze allerdings Teubner, RJ 1996, 255, 257, 262; ders., in: Liber Amicorum Josef Esser, S. 191, 196 f., 210. Fischer-Lescano/Teubner, Regime-Kollisionen, S. 42 f. Entgegen Harts Konzept der sekundären Normierungen (Hart, Der Begriff des Rechts, S. 115 ff.) geht es Teubner aber nicht um eine Orientierung an der Struktur, sondern an der Operation bzw. Anwendung der Normen. 56 Fischer-Lescano/Teubner, Regime-Kollisionen, S. 43 f.; Teubner, RJ 1996, 255, 276 ff. 57 Klösel, Compliance-Richtlinien, S. 137 f., 142. 58 Klösel, Compliance-Richtlinien, S. 138 ff. unter Verweis u.a. auf Teubner, RJ 1996, 255, 261 f., 271 f. 59 So betitelt von Röhl/Röhl, Allgemeine Rechtslehre, S. 207. 60 Röhl/Röhl, Allgemeine Rechtslehre, S. 207 verweist auf Tamanaha, A General Juris prudence of Law and Society, S. 166. 61 Meyer-Cording, Die Rechtsnormen, S. 43, 58 f. 62 Meyer-Cording, Die Rechtsnormen, S. 58 f. 63 Zum Zwangsmerkmal vgl. § 2 III 2 b. 64 Berman, Columbia Journal of International Law 43 (2005), 485, 533. 54 55
§ 2 Terminologie staatsfreier und staatsferner Ordnungsgebung
35
auch eine „jurisdiction“ voraus, wobei Berman hierunter nicht die Gerichtsbarkeit im engeren Sinne versteht, sondern jede selbstständige Instanz, die zur Kontrolle von Normen befähigt ist.65 c) Soft Law In den letzten Jahren hat sich neben dem staatszentrierten und rechtspluralen Rechtsbegriff der Begriff des Soft Law etabliert.66 Diese dem angloamerikanischen Rechtskreis entlehnte Vokabel67 scheint auf den ersten Blick eine neue Kategorie zwischen staatlich gesetztem Recht und privat ausgearbeiteten Regeln erschaffen zu wollen. Bislang ist es jedoch nicht gelungen, eine präzise Definition von Soft Law zu entwickeln.68 Ursprünglich wurden mit diesem Terminus nur rein unverbindliche Regeln in Verbindung gebracht.69 Heute fasst man jedoch auch Regelwerke darunter, denen in gewissem Umfang rechtliche Relevanz beizumessen ist.70 2. Entfaltung des Rechtsbegriffs a) Funktionale Betrachtung des Rechtsbegriffs Der Begriff des Soft Law erweist sich für die nachfolgende Untersuchung als nicht weiterführend. Das Soft Law lässt sich nicht als fest umrissene Größe einfangen, die trennscharf zwischen den anerkannten Positionen verortet werden kann. Berman, Columbia Journal of International Law 43 (2005), 485, 533 f. In der rechtswissenschaftlichen Diskussion werden vor allem der Deutsche Corporate Governance Kodex oder unternehmens- und verbandsinterne Ehtik- oder Best-Practice-Kodizes sowie auf internationaler Ebene die Principles of Corporate Governance der OECD unter den Begriff Soft Law gefasst; in Bezug auf den Deutschen Corporate Governance Kodex vgl. etwa Goette, in: MüKo AktG, § 161 Rn. 23; Kort, AG 2008, 137, 138; Ulmer, AcP 202 (2002), 143, 168; ders., ZHR 166 (2002), 150, 161; Vetter, DNotZ 2003, 748, 754; umfassend zum Begriff des Soft Law M. Weiss, Hybride Regulierungsinstrumente, S. 34 ff., 95 f. 67 Zur historischen Entwicklung der Terminologie in den USA und im Völkerrecht siehe Arndt, Sinn und Unsinn von Soft Law, S. 36 ff. 68 Zu begrifflichen und konzeptionellen Bedenken vgl. Arndt, Sinn und Unsinn von Soft Law, S. 39 f., 43, 88 ff.; Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 36; Ballreich, GRURInt. 1989, 383, 387 f.: problembehaftete Neubildung im Gefüge des Rechts; Borges, ZGR 2003, 508, 517; Kort, in: FS K. Schmidt, S. 945, 951; Schulze-Osterloh, ZIP 2001, 1433, 1436: irreführender Ausdruck; Taupitz, Standesordnungen, S. 575 f.; Ulmer, ZHR 166 (2002), 150, 161: interpretationsbedürftige Bezeichnung; Weber-Rey, ZGR 2010, 543, 554. 69 Arndt, Sinn und Unsinn von Soft Law, S. 43; Ehricke, NJW 1989, 1906, 1907. Nach deutscher Terminologie von „weichem Recht“ zu sprechen, so etwa Schwarz, Regulierung durch Corporate Governance Kodizes, S. 6, ist fast schon widersprüchlich, da es sich bei diesen unverbindlichen Regelwerken gerade nicht um „Recht“ im strengen Sinn handelt. Man könnte die Übersetzung „weiche Regulierung“ wählen, vgl. M. Weiss, Hybride Regulierungsinstrumente, S. 35, 95. 70 Arndt, Sinn und Unsinn von Soft Law, S. 43. 65 66
36
1. Teil: Konzeptionelle Grundlagen privater Regelsetzung
Vielmehr werden unter den Begriff unterschiedlichste Regulierungsinstrumente gefasst,71 die im Hinblick auf Bindungswirkung und Rechtsfolgen stark divergieren,72 ohne dass hierdurch eine neue Kategorie zwischen rechtsetatistischer und rechtspluralistischer Sichtweise etabliert würde. Klärungsbedürftig bleibt damit, ob dem staatszentrierten oder rechtspluralistischen Rechtsverständnis zu folgen ist. Hält man sich zunächst die Attribute vor Augen, die dem Recht gemeinhin zugeschrieben werden, ist festzustellen, dass diese nicht allein von staatlichen Regeln erfüllt werden können. So erfüllen private Regeln ähnlich wie staatliche eine Friedens- und Ordnungsfunktion.73 Wie diese ordnen sie das Zusammenleben in der menschlichen Gemeinschaft, machen die Erwartungen von Menschen bezüglich des Verhaltens anderer Menschen vorhersehbar und wirken Spannungen und Interessenkonflikten entgegen, die in der sozialen Interaktion auftreten. Ordnend wirken beispielsweise Regeln der Sittlichkeit, der Wirtschaft, der Religion, der Ehre, des Anstands, des Takts und des guten Tons.74 Selbst wenn man die ordnende Funktion des Rechts durch die Elemente der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes flankiert wissen will,75 geht einer privaten Regel die Rechtsqualität nicht automatisch ab. Auch eine private Regel kann von Bestand und berechenbar sein. Die dem staatlichen Recht immanente Streitentscheidungsfunktion76 ist gleichermaßen privaten Regeln beizumessen. Wie staatlich gesetztes Recht können private Regeln grundsätzlich als Entscheidungsmaßstab für Interessenkonflikte dienen und dafür sorgen, dass in Streitfällen eine Entscheidung herbeigeführt wird, an der die Beteiligten ihr Verhalten ausrichten können.77 Auch die dem Recht zugeschriebene Legitimierungs- und Integrationswirkung kann durch 71 Windbichler, Gesellschaftsrecht, § 25 Rn. 35; dies., in: Möllers (Hrsg.), Geltung und Faktizität von Standards, S. 19 f., 22 subsumiert z.B. auch soziale Normen, Gepflogenheiten, Verhaltensalternativen und Anreizsysteme unter diesen Begriff. 72 Weber-Rey, ZGR 2010, 543, 554. 73 Zur Friedens- und Ordnungsfunktion des Rechts vgl. Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 22 f.; Fleischer, ZHR 168 (2004), 673, 674: Rechtsregeln als Problemlösungen; Koller, Theorie des Rechts, S. 58; Meyer-Cording, Die Rechtsnormen, S. 3; G. Müller, in: FS Maurer, S. 227; ders., Elemente einer Rechtssetzungslehre, Rn. 14 ff.; Schmidt-Preuß, in: Kloepfer (Hrsg.), Selbst-Beherrschung, S. 89, 90: Stabilisierungs- und Orientierungsfunktion privater Regeln; aus rechtssoziologischer Sicht Rehbinder, Rechtssoziologie, S. 94 ff. 74 So Ehrlich, Grundlegung der Soziologie des Rechts, S. 31. 75 Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie, Rn. 87; Zippelius, Das Wesen des Rechts, S. 103 ff.; grundlegend zu Kontinuitätsgewähr und Vertrauensschutz Maurer, in: Isensee/ P. Kirchhof (Hrsg.), HStR, Bd. IV, § 79 Rn. 1 ff. 76 Koller, Theorie des Rechts, S. 60 spricht von der Ausgleichsfunktion des Rechts und fasst darunter ganz allgemein die Aufgabe des Rechts, einen gerechten Ausgleich zwischenmenschlicher Konflikte zu bieten. 77 Zur Streitentscheidungsfunktion des Rechts vgl. etwa Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie, Rn. 88.
§ 2 Terminologie staatsfreier und staatsferner Ordnungsgebung
37
private Regeln erreicht werden. Insoweit geht es darum, dass die Einzelnen die Rechtsregeln als richtig anerkennen und sich mit ihnen als im Großen und Ganzen „richtige“ Ordnung identifizieren.78 Verfehlt wäre insofern der Einwand, dies könne nur vom staatlichen Gesetzgeber gewährleistet werden, weil nur von ihm erwartet werden könne, dass er das Ziel der Gerechtigkeit verfolge, während Private legitimerweise in der Regel nur ihren eigenen Vorteil suchten.79 Dieser Einwand greift nicht durch, weil auch der Staat letztlich verschiedene Einzelwillen (Wähler, Abgeordnete, Beamte) kanalisiert, die je für sich genommen eigene Interessen verfolgen.80 Maßgeblich ist insofern allein, dass die Regelsetzung so strukturiert ist, dass für die Adressaten ein interessengerechtes Ergebnis erwartet werden kann.81 Schließlich bleibt auch die wohl wichtigste Funktion des Rechts, nämlich die Aufgabe, Verhalten zu steuern und damit die gesellschaftliche Entwicklung zu beeinflussen,82 nicht allein staatlichen Regeln vorbehalten. Private Regeln können ebenso wie staatliche Regeln imperativen Charakter haben.83 Das gilt umso mehr, als das Leitbild, dass allein der Staat durch Ge- und Verbote das menschliche Verhalten in institutionalisierten Bahnen lenkt, zunehmend bröckelt.84 Auch mangelt G. Müller, in: FS Maurer, S. 227, 228; ders., Elemente einer Rechtsetzungslehre, Rn. 20. Flume, Das Rechtsgeschäft, S. 5 f. 80 Bachmann, Private Ordnung, S. 21; Lepsius, in: Möllers/Voßkuhle/Walter (Hrsg.), Internationales Verwaltungsrecht, S. 345, 354 f.: An der Gesetzgebung beteiligt sind Bundestag, Bundesregierung, Bundesrat und Vermittlungsausschuss, mit umfasst ist aber auch politische und gesellschaftliche Einflussnahme durch Parteien, Medien, Berater und Lobbyismus. Gesetzgebung ist nicht das Ergebnis eines rein sachlichen, rationalen, neutralen, gewissermaßen unpolitischen Verfahrens, in dem politische Ideen oder interessengeleitete Motive keine Rolle spielen; vgl. ferner Rittner, in: FS Müller-Freienfels, S. 509, 517 f. 81 Ähnlich Bachmann, Private Ordnung, S. 21. 82 G. Müller, Elemente einer Rechtsetzungslehre, Rn. 17 ff., dort aber auch zu den Schwierigkeiten, gesellschaftliche Entwicklungen durch Rechtsetzung zu beeinflussen; Rehbinder, Rechtssoziologie, S. 96 ff.; zum Gesetz als zentrales Steuerungsinstrument Schuppert, in: Schuppert (Hrsg.), Das Gesetz als zentrales Steuerungsinstrument des Rechtsstaates, S. 105 ff. 83 Zu diesem Wesensmerkmal von Recht vgl. Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 23, der aber zu Recht darauf hinweist, dass zu der grundsätzlich imperativ ausgerichteten Rechtsordnung auch Zuständigkeits- und Verfahrensnormen, Organisationsvorschriften oder Legaldefinitionen gehören; zum Dualismus von Sein und Sollen Kantorowicz, Der Begriff des Rechts, S. 40 ff.; Kelsen, Reine Rechtslehre, S. 3 ff.; Röhl/ Röhl, Allgemeine Rechtslehre, S. 129 ff.; zum normativen Charakter technischer Regeln Marburger, Regeln der Technik, S. 283, 287 ff. 84 Vgl. Grimm (Hrsg.), Wachsende Staatsaufgaben – sinkende Steuerungsfähigkeit des Rechts, passim, insbesondere aber die Beiträge von Günther, Der Wandel der Staatsaufgaben und die Krise des regulativen Rechts, S. 51 ff. und Schuppert, Grenzen und Alternativen von Steuerung durch Recht, S. 217 ff.; G. Müller, Elemente einer Rechtsetzungslehre, Rn. 17. Zum Verlust der Steuerungskraft klassischer Rechtsquellen Di Fabio, NZS 1998, 449 ff.; zu den begrenzenden Faktoren staatlicher Steuerung G. Müller, in: FS Maurer, S. 227, 229 ff. 78
79
38
1. Teil: Konzeptionelle Grundlagen privater Regelsetzung
es privaten Regeln nicht zwangsläufig an Mechanismen, die gewährleisten, dass die Regeln ihre steuernde Kraft wirksam entfalten können. b) Verbindlichkeit und Zwangscharakter des Rechts als entscheidende Parameter Zum ausschlaggebenden Korrektiv wird schlussendlich die Frage, ob eine Rechtsregel den Anspruch erhebt, mithilfe staatlichen Zwangs durchgesetzt werden zu können.85 An einer solchen besonderen Durchsetzbarkeitsgarantie fehlt es privaten Regeln grundsätzlich. Regelverstöße sind zwar meist mit sozialen Sanktionen belegt. Private Regeln verfügen aber nicht aus sich heraus über die Qualität, mithilfe staatlich organisierten Zwangs, d.h. durch Behörden und Gerichte durchgesetzt zu werden. Erst wenn sie vom Staat als Rechtsregeln anerkannt werden (staatliches Rechtsanerkennungsmonopol), sind sie auch mit staatlichen Zwangsmitteln durchsetzbar. Dafür, den Rechtsbegriff nur solchen Regeln vorzu85 Dies einfordernd Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 24 f.; v. Ihering, Der Zweck im Recht, Bd. 1, S. 250: „Der vom Staat in Vollzug gesetzte Zwang bildet das absolute Kriterium des Rechts, ein Rechtssatz ohne Zwang ist ein Widerspruch in sich selbst, ein Feuer, das nicht brennt, ein Licht, das nicht leuchtet“; ebenda, S. 399: Recht ist der Inbegriff der mittels äußeren Zwangs durch die Staatsgewalt gesicherten Lebensbedingungen der Gesellschaft; ebenda, S. 345: Recht als die Form der durch die Zwangsgewalt des Staates beschafften Sicherung der Lebensbedingungen der Gesellschaft; Kelsen, Allgemeine Theorie der Normen, S. 18 f. und 115: „Das Recht gebietet ein bestimmtes Verhalten nur dadurch, daß es an das gegenteilige Verhalten einen Zwangsakt als Sanktion knüpft, so daß ein bestimmtes Verhalten nur dann als rechtlich ,geboten‘, als Inhalt einer ,Rechtspflicht‘, angesehen werden kann, wenn sein Gegenteil die Bedingung ist, an die eine Norm eine Sanktion knüpft“; F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 46 ff., 48: Private Regeln werden in einem „diffusen, oft rigorosen Verfahren mit ungeordneten, zufälligen Mitteln durchgesetzt – meist sozialem oder psychischem Druck –, während die Befolgung einer Rechtsregel stets in voraussehbar geordneten und organisierten, mit präzisen Zwangsmitteln ausgestatteten Verfahren erzwungen wird“; in Bezug auf vertragliche Regelungen D. Schwab/Löhnig, Einführung in das Zivilrecht, Rn. 20; Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie, Rn. 58; aus rechtssoziologischer Sicht Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 17: Eine Ordnung heißt Recht, wenn sie äußerlich garantiert ist durch die Chance des (physischen oder psychischen) Zwangs durch ein auf Erzwingung der Innehaltung oder Ahndung der Verletzung gerichtetes Handeln eines eigens darauf eingestellten Stabs von Menschen. Nach Weber ist es aber nicht nötig, dass eine richterliche bzw. staatliche Instanz vorhanden ist. Gegen das Zwangselement als Wesensmerkmal des Rechtsbegriffs Bierling, Juristische Prinzipienlehre, Bd. 1, S. 49 ff.; Jellinek, Allgemeine Staatslehre, S. 336 f.; Thon, Rechtsnorm und subjectives Recht, S. 7: „Der Zwang ist kein wesentlicher Bestandtheil im Begriffe des Rechts“; kritisch auch Hart, Der Begriff des Rechts, S. 115 ff., der vorschlägt, die Rechtsqualität von Regeln daran festzumachen, ob die „primären Regeln“ der Verpflichtung durch „sekundäre Regeln“ flankiert werden, die dazu ermächtigen, primäre Regeln erst hervorzubringen, zu ändern oder anzuwenden. Er begründet dies damit, dass sich über die „Zwangsnormen“ nicht immer ein klares und zuverlässiges Abgrenzungsergebnis erzielen lasse, da sie durch eine Vielzahl von Vorschriften mit Zuständigkeits- und Ermächtigungscharakter begleitet würden, die sich gerade nicht anhand des Zwangsmerkmals charakterisieren ließen.
§ 2 Terminologie staatsfreier und staatsferner Ordnungsgebung
39
behalten, die mithilfe staatlichen Zwangs durchsetzbar sind, spricht insbesondere die besondere Autorität staatlicher Befehle.86 Das vonseiten der Rechtspluralisten angeführte Verrechtlichungspostulat hält nicht zu einer weitergehenden Öffnung des Rechtsbegriffs an. Dadurch, dass man einzelnen Regeln die Aufnahme in den Rechtsbegriff versagt, läuft man nicht Gefahr, einen rechtsfreien Raum zu schaffen. Regeln müssen nicht zwingend in den Rechtsbegriff integriert werden, um der staatlichen (Inhalts-)Kontrolle bzw. staatlichen Zugriffsmöglichkeiten zu unterfallen.87 Einer bewusst „weichen“ Formulierung privater Regeln ist etwa durch das Verbot widersprüchlichen Verhaltens i.S.d. § 242 BGB oder durch die Vorschrift des § 306a BGB Einhalt zu gebieten.88 Raum für privates Recht bleibt demnach nur dort, wo eine Regel von Privaten ausgearbeitet worden und durch einen staatlichen Anerkennungsakt ins staatliche Durchsetzungsregime inkorporiert worden ist, wobei der Anerkennungsakt seinerseits den legitimatorischen Anforderungen genügen muss, die ihm Verfassung und Gesetz vorgeben.89 Auf diese Weise werden die privaten Regeln mit dem staatlichen Normensystem zu einer einheitlichen Gesamtrechtsordnung verklammert.90
IV. Rechtsbegriff und Rechtsquellenlehre Dass Privaten die Fähigkeit zugesprochen wird, Recht zu setzen, wirft die Frage auf, ob der klassische Rechtsquellenkanon aufzubrechen ist, wonach als Rechtsquellen nur Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Gewohnheitsrecht und Richterrecht anzusehen sind.91 Dagegen, den „von unten“ kommenden Rechtsregeln ohne 86 Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 25 f.; Bachmann, Private Ordnung, S. 21 mit Verweis u.a. auf Radbruch, Rechtsphilosophie, S. 82 ff. 87 Zum rechtsfreien Raum vgl. Bachmann, Private Ordnung, S. 44 ff. und unten § 3 II. Anders Klösel, Compliance-Richtlinien, S. 142, der aufgrund der erweiterten Anwendungsbedingungen privater Regeln und damit einhergehender rechtsspezifischer Gefahren den Rechtsbegriff und die zivilrechtliche Inhaltskontrolle für den institutionalisierten Prozess der Regelanwendung, -fortbildung und -implementation durch Dritte öffnen will. 88 Vgl. zur bewussten Umgehung der AGB-Kontrolle BGHZ 162, 294 ff. = NJW 2005, 1645. 89 Zur Legitimation des staatlichen Geltungsbefehls – diskutiert werden Art. 80 Abs. 1 S. 4 GG, die Figur der Beleihung, das Subsidiaritätsprinzip, die Offenheit der Rechtsordnung für fremdes Recht, historische Argumente und das letztlich tragende Argument der Grundrechte – und zu seinen verfassungsrechtlichen Grenzen vgl. zusammenfassend Bachmann, Private Ordnung, S. 63 ff.; F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 506 ff. 90 F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 134. 91 Zur Rechtsquellenlehre statt aller Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie, Rn. 217 ff.; Taupitz, Standesordnungen, S. 550 ff. Für die Einstufung privaten Rechts als Rechtsquelle aufgrund einer Rechtstradition zuletzt etwa Meder, Ius non scriptum, S. 47 ff.; hierfür steht insbesondere auch die normlogische Theorie der Wiener Schule, die den Gegensatz von Rechtsnorm und Rechtsgeschäft leugnet und die Privatautonomie als Rechtsquelle ansieht, vgl. Adomeit, Rechtsquellenfragen im Arbeitsrecht, S. 77 ff., 91; ders., Gestaltungsrechte,
40
1. Teil: Konzeptionelle Grundlagen privater Regelsetzung
Weiteres die Eigenschaft einer Rechtsquelle zuzusprechen, spricht jedoch, dass privat gesetzte Regeln letztlich nur kraft staatlichen Anerkennungsakts rechtsverbindlich werden.92 Die privaten Rechtsregeln gehören zwar qua staatlichem Anerkennungsakt zur Rechtsordnung, sie stellen aber nicht aus sich heraus Recht dar und sind dementsprechend keine Rechtsquellen im engeren Sinne.93 Ihre Qualifikation als Recht bleibt von einem staatlichen Anerkennungsakt abhängig. Private Regeln können daher untechnisch gesprochen lediglich als Rechtsquelle im Kontext mit dem staatlichen Recht, das über seine Geltung und Durchsetzbarkeit entscheidet, angesehen werden.94
V. Zusammenfassung Die Konstellationen nicht unmittelbar staatlicher Ordnungsgebung lassen sich terminologisch mit dem Dreiklang Selbstregulierung, private Regelsetzung und private Rechtsetzung einfangen. Den Oberbegriff bildet die Selbstregulierung. Hierunter fällt jede Form der Ordnungsgebung, deren Urheber nicht unmittelbar der Staat ist. Einen Teilausschnitt hiervon stellt die private Regelsetzung dar. Hierunter fallen all diejenigen Regelungen, die von natürlichen oder juristischen Personen in Ausübung ihrer grundrechtlichen Freiheiten gesetzt werden. Nicht vom Bereich der privaten Regelsetzung erfasst wird die Selbstregulierung durch öffentRechtsgeschäfte, Ansprüche, S. 17 ff., 35; Bierling, Juristische Prinzipienlehre Bd. 1, S. 157; ders., Juristische Prinzipienlehre, Bd. 2, S. 117 ff.; Bucher, Das subjektive Recht als Normsetzungsbefugnis, S. 48, 55 ff.; Husserl, Rechtskraft und Rechtsgeltung, S. 26 ff.; Kelsen, Reine Rechtslehre, S. 228 ff., 261 ff.; Manigk, Die Privatautonomie im Aufbau der Rechtsquellen, S. 45 ff., 62 ff., 74, 94 ff., 106 ff.; Merkl, Die Lehre von der Rechtskraft, S. 181 ff., 191, 194 ff., 201 ff. In diese Richtung auch Hillgruber, ARSP 85 (1999), 348 ff. in Bezug auf den Vertrag. Merkt, ZGR 2007, 532, 533 spricht im untechnischen Sinn von einer Pluralisierung der Rechtsquellen in Bezug auf das Unternehmens- und Kapitalmarktrecht, das sich einer Verlagerung vom zwingenden Recht zum soft law gegenübersieht; weitere Nachweise bei Säcker, Gruppenautonomie, S. 273 f. Fn. 85. 92 Bachmann, in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 207, 211, 225; siehe bereits Mertens, AG 1982, 29, 40. 93 So schon Enneccerus/Nipperdey, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, S. 210; Flume, Das Rechtsgeschäft, S. 5 f.; ders., in: FS DJT, Bd. 1, S. 135, 141 ff.; v. Gierke, Deutsches Privatrecht, Bd. 1, S. 112 ff.; v. Savigny, System des heutigen Römischen Rechts, Bd. I, S. 12; Schmidt-Rimpler, AcP 147 (1941), 130, 155 ff., 159 ff.; v. Tuhr, BGB AT, Bd. II/1, S. 146 ff.; vgl. ferner Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 27; Kaser, in: FS Wieacker, S. 90; Merten, Jura 1981, 169, 170; Säcker, Gruppenautonomie, S. 272 f. mit Fn. 85; Taupitz, Standesordnungen, S. 558. Möllers/Fekonja, ZGR 2012, 777, 785 ff. wollen in Anlehnung an Kriele, Bydlinski und Alexy die Rechtsquellenlehre um die Kategorie „sekundäre Rechtsquellen“ erweitern und die Präjudizien der Gerichte sowie die private Regelsetzung hierunter fassen, siehe bereits auch Möllers, in: FS Buchner, S. 649, 655; als das Konzept adaptiver Rechtsquellen fortentwickelt von Arndt, Sinn und Unsinn von Soft Law, S. 117 ff. 94 So D. Schwab/Löhnig, Einführung in das Zivilrecht, Rn. 20.
§ 3 Verhältnis privater Regelsetzung zum staatlichen Recht
41
lich-rechtlich organisierte, verselbstständigte Verwaltungseinheiten als Teil der mittelbaren Staatsverwaltung. Private Rechtsetzung wiederum stellt einen Ausschnitt privater Regelsetzung dar. Der Begriff Recht ist nicht für solche Regeln reserviert, die von staatlicher Seite ausgearbeitet werden. Dem Staat als Garant der Rechtsordnung muss allerdings die Entscheidung darüber vorbehalten bleiben, ob eine private Regel als Recht klassifiziert werden kann. Von privater Hand ausformulierte Regeln können daher nur dann als Recht tituliert werden, wenn ihnen durch staatlichen Anerkennungsakt rechtliche Geltungskraft verliehen ist und sie damit notfalls mithilfe staatlicher Zwangsmittel durchgesetzt werden können. Wenn Private involviert sind, muss die Rechtsetzung also immer zweigleisig ablaufen: Die private Inhaltsbestimmung muss stets durch einen staatlichen Anerkennungsakt gestützt werden, wobei dies zugleich ausschließt, privaten Rechtsregeln den Charakter als Rechtsquelle im eigentlichen Sinne zuzusprechen. Private Regeln, denen ein solcher Anerkennungsakt fehlt, fallen als rein soziale Regeln aus dem Anwendungsbereich des privaten Rechts heraus.
§ 3 Verhältnis privater Regelsetzung zum staatlichen Recht I. Abstecken der Grenzen durch die Verfassung Nachdem die begrifflichen Grundlagen privater Ordnungsgebung geschaffen wurden, ist im Folgenden ein Blick darauf zu werfen, wie sich das staatliche Recht zur privaten Regelsetzung verhält. Hier stellt sich zunächst die Frage, inwieweit der Staat den Privaten Raum zur Regelsetzung einräumen darf. Der Staat ist in seiner Entscheidung, inwieweit er Privaten Räume zur Regelsetzung eröffnet, nämlich nicht vollkommen frei, sondern selbst durch die Verfassung gebunden.95 Diese verbietet ihm in einzelnen Bereichen wegen der durch sie vorgezeichneten Verantwortlichkeit des Staates für das Allgemeinwohl, den Privaten überhaupt Raum für die Regelaufstellung zu geben. Dies gilt neben den Fällen, in denen die Verfassung eine Aufgabenzuständigkeit des Staates explizit festlegt, für Maßnahmen, die Ausfluss des staatlichen Gewaltmonopols sind (Polizei, Justiz, hoheitliche Eingriffsverwaltung) oder bestimmte lebenswichtige Bereiche der Daseinsvorsorge betreffen.96 In diesen Fällen besteht gleichsam ein sektorales Rechtsetzungsmonopol des Staates.97 95 Kritisch Isensee, Subsidiaritätsprinzip, S. 72, 272 f.; ders., in: Isensee/P. Kirchhof (Hrsg.), HStR, Bd. IV, § 71 Rn. 111, der in die Verfassung ein Subsidiaritätsprinzip hineinliest, wonach der Staat eine Aufgabe nicht an sich ziehen darf, soweit sie von Privaten sachgerecht ohne überwiegenden Nachteil für die Gesamtheit erfüllt werden kann; dagegen zu Recht Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 80; Damrau, Selbstregulierung im Kapitalmarktrecht, S. 253; Denninger, Verfassungsrechtliche Anforderungen, Rn. 121; Hendler, Selbstverwaltung als Ordnungsprinzip, S. 343 f. 96 Damrau, Selbstregulierung im Kapitalmarktrecht, S. 252 m.w.N. 97 Vgl. dazu F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 126 ff.
42
1. Teil: Konzeptionelle Grundlagen privater Regelsetzung
Ebenso muss dies für Bereiche gelten, in denen die vom Bundesverfassungsgericht entwickelte Wesentlichkeitstheorie zum Tragen kommt, wonach der Gesetzgeber in grundlegenden normativen Bereichen, insbesondere im Bereich der Grundrechtsausübung, soweit diese staatlicher Regelung zugänglich ist, alle wesentlichen Entscheidungen selbst zu treffen hat.98 Die Wesentlichkeitstheorie wendet sich zwar primär gegen die exekutive Normsetzung, sodass mitunter eingewandt wird, sie sei auf das Verhältnis zwischen privater und staatlicher Regelsetzung nicht übertragbar.99 Überzeugen kann dies aber jedenfalls insoweit nicht, als sich die private Regelsetzung aus der Perspektive der Regelbetroffenen ebenso wie die exekutive Normsetzung als einseitig aufgestellte Regelsetzung darstellt.100 Auch das Bundesverfassungsgericht hat sich im Hinblick auf die Unterwerfung von Nichtmitgliedern unter tarifvertragliche Regeln in diesem Sinne positioniert und unter Bezugnahme auf den für die Wesentlichkeitstheorie grundlegenden Facharztbeschluss ausgeführt, dass der Gesetzgeber seine Regelsetzungsbefugnis nicht in beliebigem Umfang nicht staatlichen Stellen überlassen und den Bürger nicht einer nicht demokratisch oder mitgliedschaftlich legitimierten Regelsetzungsmacht ausliefern darf.101 Welche Angelegenheiten als wesentlich einzustufen sind, wird mittels unterschiedlicher Kriterien ermittelt:102 Für eine wesentliche Angelegenheit sollen sprechen die Grundrechtsrelevanz, ein großer Adressatenkreis, die Langfristigkeit einer Regelung, erhebliche finanzielle Auswirkungen, große Folgen für das Staatsgefüge und die Verfassung sowie eine politische Bedeutungskraft. Gegen eine wesentliche Angelegenheit werden die Erforderlichkeit einer flexiblen Lösung, dynamische Sachverhalte, Staatsentlastung, ein dezentrales Regelungsbedürfnis, Beteiligungsrechte für die Betroffenen sowie fehlender parlamentarischer Sachverstand angeführt. Raum für die private Regelsetzung bleibt demnach etwa dort, wo es sich um rein private Angelegenheiten unter Individuen handelt, sich die Regeln rein wissenschaftlich mit Sachverstand erklären lassen oder wo zwar auch eine politische 98 Ständige Rspr., vgl. etwa BVerfGE 34, 165, 192 f.; BVerfGE 40, 237, 248 ff.; BVerfGE 47, 46, 78 f.; BVerfGE 49, 89, 126 f.; BVerfGE 53, 30, 56; BVerfGE 61, 260, 275; BVerfGE 83, 130, 142, 152; BVerfGE 84, 212, 226; BVerfGE 88, 103, 116; BVerfGE 95, 267, 307 f.; ferner Brohm, DÖV 1992, 1025, 1032; Grzeszick, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 20 Abs. 3 Rn. 105 ff. (Stand: 77. EL 2016); Röthel, Normkonkretisierung im Privatrecht, S. 63 ff. 99 Vgl. Damrau, Selbstregulierung im Kapitalmarktrecht, S. 253; Heintzen, BB 1999, 1050, 1053 f. mit Fn. 45. 100 Hellermann, NZG 2000, 1097, 1101; Hommelhoff, in: FS Odersky, S. 779, 795; zum Rückgriff auf die Wesentlichkeitstheorie im Umwelt- und Technikrecht vgl. Denninger, Verfassungsrechtliche Anforderungen, Rn. 153 ff.; Lübbe-Wolff, ZG 1991, 219, 237 ff. 101 BVerfGE 44, 322, 348 mit Bezugnahme auf BVerfGE 33, 125, 158; BVerfGE 64, 208, 214; BVerfGE 78, 32, 36; dazu auch Hellermann, NZG 2000, 1097, 1101. 102 Dazu und zu den im Folgenden genannten Kriterien Grzeszick, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 20 Abs. 3 Rn. 107 (Stand: 77. EL 2016); Reimer, in: Hoffmann-Riem u.a. (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd. 1, § 9 Rn. 48.
§ 3 Verhältnis privater Regelsetzung zum staatlichen Recht
43
Dimension auszumachen ist, die Regeln aber auf einer fundierten sachverständigen Grundlage in Form von gesichertem Erfahrungswissen oder Ähnlichem getroffen werden.103 Im letzten Fall hat der Staat das Normierungsbedürftige gesetzlich festzuhalten, wobei er sich meist auf strukturierende Vorgaben prozeduraler und organisatorischer Art wird beschränken können. Leitbild dürfte in den Worten Hoffmann-Riems nicht „der allwissende und alles verantwortende Gesetzgeber“ sein, sondern das „des regelungssensiblen und lernoffenen Akteurs, der die Vorzüge arbeitsteiliger und aufeinander abgestimmter Normproduktion und -anwendung zu nutzen sucht, aber bereit ist, seine herausgehobene Stellung und den Vorbehalt, aber auch den Vorrang des Gesetzes rechtlich auszuspielen, soweit andernfalls der Schutz der ihm anvertrauten Interessen zu kurz kommt“.104
II. Vorranganspruch staatlichen Rechts Von der Frage, inwieweit der Staat den Privaten Raum zur Regelsetzung einräumen darf, zu unterscheiden ist die Frage, wie sich das staatliche Recht zur privaten Regelsetzung verhält. Hier gilt es zu erkennen, dass die private und staatliche Ordnungsgebung nicht vollkommen isoliert zueinander stehen.105 Es bestehen zahlreiche Verflechtungen. So konkretisieren oder interpretieren private Regelwerke staatliches Recht, dispositive Gesetzesvorschriften werden durch private Regeln verdrängt, private und staatliche Akteure werden gemeinsam regulierend tätig oder das staatliche Recht schafft Freiräume für die private Regelschöpfung. Aufgrund des staatlichen Vorranganspruchs determiniert jedoch stets das staatliche Recht, in welchen Bahnen sich die private Regelsetzung entfalten kann. Im Umgang mit privaten Regeln stehen dem staatlichen Recht drei Möglichkeiten zur Auswahl:106 Soweit sich private Regeln nicht an staatliche Ordnungs- und Gerechtigkeitsvorstellungen halten, kann es diese erstens für unwirksam erklären, vgl. etwa §§ 134, 138 BGB. Zweitens kann das staatliche Recht private Regeln aber auch fördern, indem es ihnen bewusst einen Rahmen bereitstellt, innerhalb dessen sie sich entfalten können, sie als verbindlich anerkennt und ihnen zur staatlichen Durchsetzbarkeit verhilft.107 Drittens kann das staatliche Recht sich aber auch zurücklehnen und die Regeln in ihrem Autonomiebereich – im oft zitierten „rechtsfreien Raum“ – belassen.108 Derartige rechtsfreie Räume entstehen nicht Hommelhoff/M. Schwab, BFuP 1998, 38, 40 f. Hoffmann-Riem, AöR 130 (2005), 5, 61. 105 Die Debatte um das Verhältnis (transnationaler) privater Regeln zum staatlichen Recht wird unter den Stichwörtern „prozedurales Recht“, „reflexives Recht“, „Governance“, „Interlegalität“ oder „Kollisionsrecht“ geführt, vgl. Klösel, Compliance-Richtlinien, S. 10 m.w.N. 106 Vgl. etwa Bachmann, Private Ordnung, S. 44 f. 107 Vgl. F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 140 ff. sowie oben § 2 III. 2. b). 108 Vgl. Bachmann, Private Ordnung, S. 44 mit Verweis auf Engisch, in: Engisch, Beiträge zur Rechtstheorie, S. 9 ff.; Flume, Das Rechtsgeschäft, S. 82 f.; Larenz, Richtiges Recht, S. 80; vgl. ferner Mertens, AG 1982, 29, 36 ff. 103
104
1. Teil: Konzeptionelle Grundlagen privater Regelsetzung
44
durch ausdrückliches staatliches Handeln, sondern dadurch, dass beispielsweise keine subjektiv einklagbaren Rechte eingeräumt werden.109 Sie existieren dann aber nicht um ihrer selbst willen, sondern weil sich der Staat im Rahmen einer Abwägung zwischen den Vor- und Nachteilen einer Verrechtlichung bewusst für einen Regelungsverzicht entschieden hat.110 Wie man es also dreht und wendet, bleibt die private Regelsetzung stets an die Rechtsordnung gebunden. Das Recht liefert den institutionellen Rahmen, innerhalb dessen Private sich frei entfalten und selbstregulativ tätig werden können.
III. Handlungsformen privater Regelsetzung An die gewonnenen Erkenntnisse knüpft die Frage an, welche Handlungsformen den Privaten bei der Regelsetzung abstrakt zur Verfügung stehen. Als Handlungsformen kommen für den privaten Regelsetzer Normen, Rechtsnormen und das Rechtsgeschäft in Betracht, wobei die Rechtsnorm im Kontext privater Regelsetzung freilich die Ausnahme bildet.111 Die Handlungsformen sind wie folgt voneinander abzugrenzen: Normen sind generell-abstrakte Regelsätze, die ein bestimmtes Verhalten, ein „Sollen“112 vorschreiben, das Ausdruck eines autonomen Willensakts des Normsetzers ist113 und deren Nichtbeachtung sanktioniert wird.114 In persönlicher Hinsicht richten sich Normen an einen unbestimmten, nach generellen Maßstäben festzulegenden Adressatenkreis.115 In sachlicher Hinsicht regeln sie grundsätzlich eine
Bachmann, Private Ordnung, S. 44. Bachmann, Private Ordnung, S. 46. 111 Nach geltendem Recht ist dies nur hinsichtlich des normativen Teils des Tarifvertrags der Fall (vgl. §§ 1 Abs. 1, 3 Abs. 2, 4 Abs. 1 und 5, 5 Abs. 4 TVG). Des Weiteren können private Regeln im Laufe der Zeit zu Gewohnheitsrecht erstarken, dem ebenfalls Rechtsnormcharakter zukommt, vgl. Bachmann, Private Ordnung, S. 330. 112 Vgl. nur Kelsen, Allgemeine Theorie der Normen, S. 2 f.; zur Unterscheidung zwischen Seins- und Sollensnormen vgl. Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie, § 4 Rn. 94 ff. 113 Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 29 mit Verweis auf Kelsen, Allgemeine Theorie der Normen, S. 2; anders Ladeur, Negative Freiheitsrechte, S. 131: Regeln sind primär unbeabsichtigte Nebenprodukte der Interaktion von Individuen. 114 Statt aller Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie, § 4 Rn. 97 a; Opp, Die Entstehung sozialer Normen, S. 219 f.; Überlegungen zum Normbegriff semantischer und logischer Art bei Alexy, Theorie der Grundrechte, S. 40 ff. 115 Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 30; F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 64 ff.; Merten, in: Staudinger, Art. 2 EGBGB Rn. 13. Nach a.A. kann eine Norm individuellen oder generellen Charakter haben, vgl. Kelsen, Allgemeine Theorie der Normen, S. 6 f.: Das Wesentliche einer Norm ist, dass ein Verhalten als gesollt statuiert ist. Das kann in genereller oder individueller Weise geschehen; folgend Jesch, Gesetz und Verwaltung, S. 24; kritisch Jellinek, Gesetz und Verordnung, S. 233 ff. 109 110
§ 3 Verhältnis privater Regelsetzung zum staatlichen Recht
45
unbestimmte Vielzahl auch zukünftiger Sachverhalte, indem sie einen abstrakten Tatbestand mit abstrakter Folge formulieren.116 Rechtsnormen heben sich von Normen insofern ab, als sie nicht nur tatsächlich beachtet werden sollen (tatsächliche Geltung), sondern auch normativ verbindlich sind, indem der Staat sie zur Rechtsordnung zugehörig erklärt und sie gegebenenfalls auch mit staatlichem Zwang durchsetzt (normative Geltung).117 Vom Rechtsgeschäft unterscheiden sich Normen und Rechtsnormen wiederum dadurch, dass sie heteronom, d.h. unabhängig vom Willen oder sonstigen Mitwirken des Adressaten gelten118 und damit einseitig auferlegt werden können.119 Das Rechtsgeschäft, insbesondere der Vertrag, baut indes auf dem einvernehmlichen Willen der Beteiligten auf (freiwilliger Unterwerfungsakt).120
IV. Zusammenfassung Der Staat ist in seiner Entscheidung, inwieweit er Privaten Räume zur Regelsetzung eröffnet, durch die Verfassung gebunden. Diese verbietet ihm in einzelnen Bereichen wegen der durch sie vorgezeichneten Verantwortung des Staates für das Allgemeinwohl, den Privaten Raum für die Regelaufstellung zu geben. Auch aufgrund der vom Bundesverfassungsgericht entwickelten Wesentlichkeitstheorie kann es dem Staat versagt sein, seine Regelungsbefugnis in beliebigem Umfang nicht staatlichen Stellen zu überlassen. Aufgrund des staatlichen Vorrang 116 Vgl. etwa Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 30; Ossenbühl, in: Isensee/P. Kirchhof (Hrsg.), HStR, Bd. V, § 100 Rn. 11; kritisch zum Merkmal der Abstraktheit F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 60 ff. 117 So die überwiegende Meinung, vgl. etwa Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 31; Hanfland, Haftungsrisiken, S. 60 f.; Larenz/Canaris, Methodenlehre, S. 71; Merten, in: Staudinger, Art. 2 EGBGB Rn. 7; F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 46; zur normativen, juristischen und faktischen Geltung von Rechtsnormen: Rüthers/ Fischer/Birk, Rechtstheorie, Rn. 334 ff. 118 Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 32; F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 59, 84 ff., 87: „Eine Rechtsregel ist nicht erst dann heteronom, wenn sie ohne oder gegen den Willen eines ihr Unterworfenen ergangen ist, sondern bereits dann, wenn sie in einem Prozeß erzeugt wird und Geltung erlangt, der eine Regelproduktion ohne oder gegen den Willen des Normadressaten gestatten würde (potentielle Heteronomität)“; Taupitz, Standesordnungen, S. 557 ff.; Wiedemann, Gesellschaftsrecht, S. 162. 119 Zum Teil wird eine Außenwirkung als weiteres Wesensmerkmal von Rechtsnormen verlangt, vgl. Hanfland, Haftungsrisiken, S. 61; Merten, in: Staudinger, Art. 2 EGBGB Rn. 9; verneinend F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 78. 120 Vgl. F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 84 f.; Merten, in: Staudinger, Art. 2 EG BGB Rn. 12; Wiedemann, Gesellschaftsrecht, S. 162. F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 465 ff. ist darüber hinaus der Ansicht, dass bestimmten einseitigen Rechtsgeschäften wie dem Stiftungsgeschäft, dem Gründungsakt einer Ein-Personen-Gesellschaft i.S.d. § 1 GmbHG, der erbrechtlichen Verfügung von Todes wegen oder schuldrechtlichen Rechtsgeschäften wie der Auslobung Rechtsnormcharakter zukommen kann.
46
1. Teil: Konzeptionelle Grundlagen privater Regelsetzung
anspruchs determiniert zudem stets das staatliche Recht, in welchen Bahnen sich private Regelsetzung entfalten kann. Als Handlungsformen kommen für den privaten Regelsetzer das Rechtsgeschäft, Normen und im Einzelfall Rechtsnormen in Betracht.
§ 4 Vor- und Nachteile privater Regelsetzung I. Vorteile privater Regelsetzung 1. Staatsentlastung und Kosteneffizienz Bislang noch nicht hinterfragt worden ist, welche Vor- und Nachteile mit einer privaten Regulierung einhergehen. Aus Sicht des Staates hat die Regelsetzung durch Private zunächst den Vorzug, dass er entlastet wird und Kosten gespart werden.121 Dadurch, dass die Privaten häufig den Regelungsbedarf selbst feststellen, ein stimmiges Regulierungskonzept entwickeln, sich mit den betroffenen Interessenkreisen koordinieren und die Regelungen ausarbeiten, werden die Ressourcen des Staatsapparats in personeller als auch sachlicher Hinsicht geschont.122 Informations-, Überwachungs- und Durchführungskosten können unter Umständen durch die Beteiligung sachverständiger Betroffener gesenkt und sogar größere Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationskräfte mobilisiert werden.123 Hinzu kommt, dass sich die Regelsetzer zumeist selbst finanzieren. Zwingend ist dieser Kostenvorteil für den Staat aber nicht; je verbindlicher die privaten Regeln sind, desto mehr steht der Staat durch Kontrollpflichten in der (Letzt-)Verantwortung. 2. Flexibilität Ein weiterer Vorzug privater Regelsetzung ist die größere Flexibilität. In der Regel besteht hier kein derart starres Korsett langwieriger, komplizierter und streng formalisierter Verfahren, wie es auf staatlicher Seite anzutreffen ist (z.B. Expertenkommissionen, parlamentarische Beratungen, Anhörungen und Stellungnahmen betroffener Kreise).124 Dadurch können die privaten Regeln schneller an die neuesten Entwicklungen sowie die praktischen Bedürfnisse angepasst und damit 121 Di Fabio, VVDStRL 56 (1997), 235, 239: fruchtbarster aller Böden für die Selbstregulierung. 122 Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 52. Insbesondere für das DIN wird auf die zahlreichen, von den Unternehmen freigestellten Experten hingewiesen, vgl. Marburger, Regeln der Technik, S. 381 f.; Schmidt-Preuß, in: Kloepfer (Hrsg.), Selbst-Beherrschung, S. 89, 93. 123 Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 52; Roßkopf, Selbstregulierung, S. 46. 124 Damrau, Selbstregulierung im Kapitalmarktrecht, S. 76; Marti, ZBl. 11/2000, 561, 578; Roßkopf, Selbstregulierung, S. 43 f.
§ 4 Vor- und Nachteile privater Regelsetzung
47
den Besonderheiten des Einzelfalls besser gerecht werden als staatliche Regeln.125 Auch inhaltlich besteht für die private Regelsetzung ein größerer Freiraum, da sie nicht den Bindungen des staatlichen Rechts unterworfen ist. Regelungen wie Sanktionen oder rückwirkende Vorschriften sind in den Grenzen der Rechtsordnung grundsätzlich möglich.126 Schließlich ist die private Regelsetzung weniger umgehungsanfällig, da sie eine geschmeidigere Grundstruktur aufweist, während starre staatliche Gesetze durch eine trickreiche, aber rechtlich unangreifbare Sachverhaltsstrukturierung nicht selten ins Leere laufen können.127 3. Sachnähe und Akzeptanz Für private Regelsetzung spricht auch die Möglichkeit, dass Fach- und Erfahrungswissen in gesteigerter Form mobilisiert und akkumuliert werden kann.128 Die privaten Organisationen setzen sich meist aus kompetenten Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Technik oder anderer Fachkreise zusammen.129 Neben ihrem theoretischen Wissen bringen sie Praxiserfahrungen mit; sie kennen die Regelungsbedürfnisse und Probleme sowie Umgehungsmöglichkeiten und „Tricks“ der Praxis.130 Möglicherweise betreiben sie sogar einen größeren Forschungs- und Entwicklungsaufwand. Aufgrund ihrer Nähe zur Praxis setzen sich die Regelsetzer zudem meist zum Ziel, für juristische Laien inhaltlich gut verständliche Regeln zu formulieren. Auch dürften private Regeln bei ihren Regeladressaten vielfach auf eine größere Akzeptanz stoßen als staatliche Vorgaben,131 weil diese entweder unmittelbar an der Regelsetzung beteiligt sind oder sie unter Umständen eigens betroffen sind bzw. sein könnten oder zumindest die praktischen Gegebenheiten kennen und deshalb auf die Interessen der betroffenen Kreise angemessen Rücksicht nehmen.132 Der Abstand zwischen Regelsetzer und Regeladressat verringert
125 Fleischer, ZHR 168 (2004), 673, 698; Merkt, in: Assmann u.a. (Hrsg.), Markt und Staat in einer globalisierten Wirtschaft, S. 169, 180. 126 Roßkopf, Selbstregulierung, S. 44. 127 Fleischer, ZHR 168 (2004), 673, 699. 128 Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 53 f.; Fleischer, ZHR 168 (2004), 673, 698; Schmidt-Preuß, ZLR 1997, 249, 251. 129 Auch die bisweilen beachtliche Entlohnung soll zu einer Ansammlung von Fachkompetenz führen, vgl. Damrau, Selbstregulierung im Kapitalmarktrecht, S. 77. 130 Damrau, Selbstregulierung im Kapitalmarktrecht, S. 77; Roßkopf, Selbstregulierung, S. 46. 131 Roßkopf, Selbstregulierung, S. 46; Schmidt-Preuß, ZLR 1997, 249, 251. Beachtlich ist beispielsweise die tatsächliche Akzeptanz des Deutschen Corporate Governance Kodex, die bezogen auf die Zahl der Empfehlungen mit 79,8 % und bezogen auf die Zahl der Anregungen mit 63,9 % angegeben wird, vgl. v. Werder/Bartz, DB 2014, 905, 907; zum Akzeptanzniveau einzelner Kodexbestimmungen ebenda, 908 ff. 132 Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 54 f.; Damrau, Selbstregulierung im Kapitalmarktrecht, S. 78 f.; Roßkopf, Selbstregulierung, S. 46.
48
1. Teil: Konzeptionelle Grundlagen privater Regelsetzung
sich oder fällt ganz weg.133 Die Regeln verlieren damit den Charakter, einseitig bzw. „von oben“ auferlegt zu sein.134 4. Internationale Ausrichtungsmöglichkeit In Zeiten einer fortschreitenden Globalisierung ist ein weiterer Vorteil der privaten Regelsetzung darin zu sehen, dass sie nicht an Landesgrenzen gebunden ist, sondern international ausgerichtet werden kann. Da es auf globaler Ebene weitgehend an staatlichen Strukturen und vor allem an entsprechenden Gesesetzgebungskompetenzen fehlt, kann nur mittels selbstregulativen Mechanismen eine weltweite Harmonisierung angestrebt werden.135 Für die private Rechtsetzung gilt dies freilich nicht, da diese durch die Rückkopplung an einen staatlichen Anerkennungsakt grundsätzlich mit dem staatlichen Territorialprinzip verwoben bleibt.
II. Nachteile und Gefahren privater Regelsetzung 1. Demokratiedefizit und Vernachlässigung öffentlicher Interessen Neben den Vorteilen birgt die private Regelsetzung für die Regelbetroffenen aber auch Gefahren. Ein wesentlicher Einwand gegen private Regelsetzung ist die fehlende demokratische Legitimation. Meistens wirken nicht alle Betroffenen oder deren direkt gewählte Vertreter mit.136 Geradezu symptomatisch für die private Regelsetzung ist, dass die Regelsetzer eigene wirtschaftliche oder politische Interessen verfolgen, die sie dem öffentlichen Interesse möglicherweise vorgehen lassen.137 Im Rahmen des Interessenlobbyings besteht die Gefahr, dass einseitig Macht ausgeübt wird.138 2. Rechtsstaatlichkeitsdefizit Da die private Regelsetzung nicht unmittelbar an rechtsstaatliche Prinzipien gebunden ist, kann sie Rechtsstaatlichkeitsdefizite aufweisen und zu einer ge133 In Bezug auf die Verleihung von Satzungsautonomie an juristische Personen des öffentlichen Rechts BVerfGE 33, 125, 156 f. (Facharztbeschluss). 134 Vgl. Damrau, Selbstregulierung im Kapitalmarktrecht, S. 78, der mit Recht anführt, dass dies in besonderem Maße für die Selbstregulierung innerhalb eines Unternehmensverbands gilt. 135 Marti, ZBl. 11/2000, 561, 579; Merkt, in: Assmann u.a. (Hrsg.), Markt und Staat in einer globalisierten Wirtschaft, S. 169, 180. 136 Marti, ZBl. 11/2000, 561, 580. 137 Damrau, Selbstregulierung im Kapitalmarktrecht, S. 80; Fleischer, ZHR 168 (2004), 673, 702 f.; Roßkopf, Selbstregulierung, S. 48 ff. 138 Vgl. spezifisch Damrau, Selbstregulierung im Kapitalmarktrecht, S. 81; Fleischer, ZHR 168 (2004), 673, 703; Langhart, Rahmengesetz und Selbstregulierung, S. 102.
§ 4 Vor- und Nachteile privater Regelsetzung
49
schwächten Position der Regelbetroffenen führen.139 Verfahrensrechtliche Sicherungen wie die Gewährung rechtlichen Gehörs, die Einhaltung des Bestimmtheitsgrundsatzes oder eine Begründung sind grundsätzlich nicht vorgesehen.140 Regeln entstehen häufig hinter verschlossenen Türen (Intransparenz) und die Regelkataloge werden lediglich in spezifischen, nicht allgemein zugänglichen Fachblättern publiziert.141 All dies kann zu Vertrauensverlusten im Hinblick auf Regeln führen. Die Herauslösung aus dem staatlichen Rechtsetzungsprozess hat zudem zur Folge, dass der Rechtsschutz gegen private Regeln tendenziell schwächer ausgestaltet ist als bei der staatlichen Gesetzgebung. Da es sich um privatrechtliche Regeln handelt, können diese und ihre Anwendungsakte jedenfalls nicht mit öffentlich-rechtlichen Rechtsmitteln angefochten werden, sondern nur mit denen des Zivilprozessrechts. Diese erweisen sich hinsichtlich der Beweislastverteilung und des zivilprozessualen Beibringungsgrundsatzes im Rahmen der Prozessführung sowie der Kosten als risikoreicher.142 Drittbetroffenen stehen keine Rechtsschutzmöglichkeiten offen.143 Auch kann es vorkommen, dass Regelsetzer legislative, exek utive und judikative Funktionen in einer Hand wahrnehmen.144 3. Durchsetzungsdefizit Private Rechtsetzung wird durch das staatliche Sanktionsregime flankiert. Soweit es privaten Regeln aber an der Rechtsqualität fehlt, lässt sich gegen diese eine fehlende rechtliche Durchsetzbarkeit einwenden.145 Möglich sind zwar Sanktionen wie eine Bestrafung durch die Märkte oder das jeweilige soziale Umfeld. Auch wenn diese Sanktionsregime in ihren Wirkungen nicht unterschätzt werden dürfen, bleibt die private Regelsetzung in diesen Bereichen aber größtenteils von freiwilliger Mitwirkung und Motivation abhängig. In ihrer Durchschlagskraft können private Regelwerke daher teilweise erheblich hinter staatlichen Regelungen zurückbleiben. Überdies kann eine potenzielle Trittbrettfahrermentalität mancher Marktakteure, die die Vorteile der privaten Regelsetzung mitnehmen, ohne ihrerseits die Regeln zu akzeptieren, nicht ausgeschlossen werden.146
139 Diese Kritik trifft in vollem Umfang nur auf rechtsunverbindliche Regeln zu. Bei Regeln mit Rechtswirkungen wird noch genau zu untersuchen sein, inwiefern sie gewisse rechtsstaatliche Prinzipien wahren müssen, vgl. dazu unten Teil 3. 140 Damrau, Selbstregulierung im Kapitalmarktrecht, S. 82; Roßkopf, Selbstregulierung, S. 49 f. 141 Marti, ZBl. 11/2000, 561, 582; Roßkopf, Selbstregulierung, S. 50. 142 Marti, ZBl. 11/2000, 561, 581 f. 143 Marti, ZBl. 11/2000, 561, 582. 144 Damrau, Selbstregulierung im Kapitalmarktrecht, S. 83; Roßkopf, Selbstregulierung, S. 50. 145 Vgl. hierzu etwa Roßkopf, Selbstregulierung, S. 49. 146 Fleischer, ZHR 168 (2004), 673, 703.
50
1. Teil: Konzeptionelle Grundlagen privater Regelsetzung
4. Fehlende Koordination Ein weiteres Problem der privaten Regelsetzung ist, dass sich die Regelsetzer in ihrer Perspektive häufig auf einen einzelnen Regelungsbereich beschränken. Das begründet die Gefahr, dass bestimmte Branchen nicht reguliert werden oder in anderen Branchen sich aufgrund von Unkoordiniertheit privat-private oder privat-staatliche Regelungsbereiche überschneiden. Das kann nicht nur eine wenig harmonische, sondern auch eine Überregulierung und Unübersichtlichkeit zur Folge haben.147
III. Zusammenfassung Private Regelsetzung kann ihre Vorteile insbesondere in flexiblen und komplexen Regelungsbereichen ausspielen, die erhöhten Sachverstand und eine zeitnahe Regulierung erfordern. Die Regelsetzung Privater birgt aber auch Gefahren für die Ordnung im Staat. Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip sowie die Wahrnehmung öffentlicher Interessen drohen unterlaufen zu werden.
147 Damrau, Selbstregulierung im Kapitalmarktrecht, S. 81; Fleischer, ZHR 168 (2004), 673, 703; Marti, ZBl. 11/2000, 561, 583: undurchsichtiger Dschungel von Normen staatlicher und privater Instanzen; Roßkopf, Selbstregulierung, S. 50 f.
Zweiter Teil
Systematisierung privater Regelsetzung 2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
§ 5 Grundlagen und Herangehensweise I. Notwendigkeit einer Systematisierung Um den Umgang mit den privaten Regelwerken zu erleichtern und an die eigentliche Frage herantreten zu können, wie sich private Regeln in ihren Wirkungen legitimieren lassen, soll im Folgenden ein Blick auf die vielfältigen Erscheinungsformen privater Regelsetzung geworfen werden. Dabei soll versucht werden, diese im Wege einer Fallgruppenbildung zu systematisieren. Denn die privaten Regeln unterscheiden sich zum Teil erheblich voneinander, etwa in Hinblick auf ihre Entstehungsweise, ihr Regelungsdesign, ihren Regelsetzer- und Adressatenkreis, ihren Inhalt, die staatliche Beteiligung und ihren Grad der Verrechtlichung.
II. Herkömmliche Systematisierungsversuche In der Literatur kursieren verschiedene Konzepte zur Ordnung privater Regelwerke. Im öffentlich-rechtlichen Schrifttum knüpft man für eine Systematisierung vornehmlich an Art und Umfang der staatlichen Beteiligung an der Regelsetzung an. Hintergrund ist das (öffentlich-rechtliche) Anliegen, die unterschiedlichen staatlichen Verantwortungsstufen in Form von Rahmen-, Auffang-, Gewährleistungs- und Erfüllungsverantwortung zu verdeutlichen.1 Es ergibt sich sodann eine abgestufte Skala, auf der sich die Pole der rein privaten und der rein staatlichen Regulierung gegenüberstehen und dazwischen die in jüngerer Zeit immer beliebteren Mischformen der Regulierung Platz finden.2 Auch auf ein ziviles Erkenntnisinteresse ausgerichtete Untersuchungen stellen mitunter auf den Umfang der staatlichen Beteiligung an der Regelsetzung und -durchsetzung ab. Dabei wird jedoch weiter zwischen autonomen und heteronomen Regeln differenziert.3 Autonome Regelsetzung liege dort vor, wo die Regelsetzung 1 Zu den unterschiedlichsten staatlichen Verantwortungsstufen siehe Hoffmann-Riem, in: Hoffmann-Riem/Schneider (Hrsg.), Verfahrensprivatisierung, S. 9, 22 ff. 2 Eine solche Klassifikation nehmen vor Damrau, Selbstregulierung im Kapitalmarktrecht, S. 60 ff.; Hoffmann-Riem, Modernisierung von Recht und Justiz, S. 28 ff.; M. Holle, Normierungskonzepte, S. 48 ff.; Lamb, Kooperative Gesetzeskonkretisierung, 71 ff. 3 Buck-Heeb/Dieckmann, Selbstregulierung im Privatrecht, S. 33 ff.; Kämmerer, in: Hopt/Veil/Kämmerer (Hrsg.), Kapitalmarktgesetzgebung, S. 145, 150 f.; Langhart, Rahmengesetz und Selbstregulierung, S. 88.
52
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
ausschließlich auf privater Initiative beruhe, d.h. ohne Auftrag, Mitwirkung und Vorgaben des Staates erfolge.4 Als Instrumente stünden den Privaten der Vertrag und die Satzung zur Verfügung, die jedoch nur eine Ordnung von relativer Verbindlichkeit schaffen könnten, da diese Regeln nur diejenigen binden, die sich der betreffenden Ordnung freiwillig unterwerfen.5 Heteronom seien die Regeln hingegen dann, wenn ihre Verbindlichkeit nicht auf den Willen der Regelunterworfenen, sondern auf einen staatlichen Geltungsbefehl zurückzuführen sei, die Regeln also in Abgrenzung zu vertraglichen Abreden einseitig auferlegt würden.6 Daneben ist in der zivilrechtlichen Literatur angedacht worden, zwischen deklaratorischen Regeln, deren Inhalt sich auf die Wiedergabe vorhandener Normen oder Tatsachen beschränkt, und konstitutiven Regeln, die einen eigenen Regelungsgehalt haben, zu differenzieren.7 Denkbar sei ferner, die Regeln danach zu unterscheiden, ob sie rational, d.h. planvoll, künstlich geschaffen werden oder sich evolutiv herausgebildet haben, wie etwa Handelsbräuche, die durch lang andauernde praktische Übung gewachsen seien.8 Augsberg rückt in seiner Dissertation den jeweiligen Regelsetzungs- bzw. Rezeptionsmechanismus ins Zentrum seiner Betrachtung und wählt als Anknüpfungspunkt für eine Typologie die Rechtstitel, mittels derer die Regeln unterschiedliche Grade an Verbindlichkeit und Heteronomie erlangen.9 In eine ähnliche Richtung geht die Unterscheidung zwischen einseitigen und zwei- bzw. mehrseitigen Regelarrangements. Einseitig ausgesprochene Selbstverpflichtungen bzw. Versprechen seien im Regelfall unverbindlich, zweiund mehrseitige Arrangements könnten in Form des Vertrags verbindlich werden.10 4 So die Definition bei Buck-Heeb/Dieckmann, Selbstregulierung im Privatrecht, S. 33; Langhart, Rahmengesetz und Selbstregulierung, S. 88; Watter/Dubs, Der Schweizer Treuhänder 2005, 743 f. Manche differenzieren innerhalb der autonomen Selbstregulierung noch weiter zwischen echter und unechter Selbstregulierung. Die echte Selbstregulierung verfüge über einen Durchsetzungsmechanismus, die unechte nicht, vgl. dazu Buck-Heeb/ Dieckmann, Selbstregulierung im Privatrecht, S. 34 f. mit Verweis auf Kämmerer, in: Hopt/ Veil/Kämmerer (Hrsg.), Kapitalmarktgesetzgebung, S. 145, 150 f.; siehe auch Watter/Dubs, Der Schweizer Treuhänder 2005, 743 f. 5 Buck-Heeb/Dieckmann, Selbstregulierung im Privatrecht, S. 34. 6 Buck-Heeb/Dieckmann, Selbstregulierung im Privatrecht, S. 35; zum Wesensmerkmal der Heteronomie von Rechtsnormen F. Becker, Kooperative und konsensuale Strukturen in der Normsetzung, S. 81 ff.; F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 84 ff. 7 Vgl. dazu Bachmann, Private Ordnung, S. 40; Buck-Heeb/Dieckmann, Selbstregulierung im Privatrecht, S. 43 f. 8 Buck-Heeb/Dieckmann, Selbstregulierung im Privatrecht, S. 44. 9 Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 124. Damrau, Selbstregulierung im Kapitalmarktrecht, S. 64 ff. nimmt neben der dreiteilenden Klassifikation regelsetzender Gremien in staatliche, staatlich-private und rein private auch eine Unterscheidung nach der Normqualität vor. Die Normqualität misst er an den Parametern rein private Selbstregulierung (1), Selbstregulierung durch autonome Satzung (2), die Allgemeinverbindlichkeitserklärung (3) und die gesetzliche Verweisung auf private Normen (4). 10 Bachmann, Private Ordnung, S. 40; Buck-Heeb/Dieckmann, Selbstregulierung im Privatrecht, S. 42; umfassend zu diesen und weiteren Skalierungskriterien Buck-Heeb/ Dieckmann, Selbstregulierung im Privatrecht, S. 41 ff.
§ 5 Grundlagen und Herangehensweise
53
III. Systematisierung am Grad der rechtlichen Verbindlichkeit Lässt man sich von dem Erkenntnisinteresse leiten, wie private Regeln zu legitimieren sind, ist es zielführend, diese nach dem Grad ihrer Verbindlichkeit bzw. ihren rechtlichen Wirkungen einzuteilen. Denn Verbindlichkeit und Legitimationsbedürftigkeit privater Regeln bedingen sich gegenseitig. Für die Regelbetroffenen sind die sie treffenden Regelwirkungen zu legitimieren. Die Rechtstitel, die Augsberg für seine Typologisierung ins Feld führt, spielen hierbei nur auf der vorgelagerten Ebene, bei der Frage, wodurch die Verbindlichkeit ausgelöst wird, eine Rolle. Systematisiert man nach dem Grad steigender rechtlicher Verbindlichkeit, lassen sich drei Verbindlichkeitsstufen privater Regeln ausmachen: Auf der ersten Stufe stehen Regeln, die rechtlich unverbindlich sind, d.h. solche Regelwerke, die nicht auf die rechtliche Ebene gehoben sind, sondern lediglich tatsächliche Wirkungen entfalten, weil ein faktischer Druck besteht, sie zu befolgen. Demgegenüber stehen auf der dritten Stufe solche Regelwerke, die unmittelbar rechtlich verbindlich sind. Hierunter fallen solche Regeln, die infolge eines staatlichen Anerkennungsakts unmittelbar mittels staatlicher Zwangsgewalt durchgesetzt werden können. Zwischen der ersten und dritten Stufe liegen auf der zweiten Stufe solche Regelwerke, die lediglich mittelbar rechtlich verbindlich wirken.11 Diese hievt der Staat zwar nicht durch einen Anerkennungsakt unmittelbar auf die rechtliche Ebene. Umgekehrt gehen sie aber über einen bloß tatsächlichen Befolgungsdruck hinaus, weil sie durch die Gerichte bei ihrer Entscheidungsfindung im Wege einer autonomen Rezeptionsentscheidung herangezogen werden, etwa zur Ausfüllung unbestimmter Rechtsbegriffe, und auf diese Weise mittelbar rechtlich verbindliche Wirkungen für die Regelbetroffenen zeitigen.12 Innerhalb der drei Stufen kann noch weiter dahingehend differenziert werden, ob die Regeln ein, zwei- oder mehrseitig verbindliche Bindungswirkungen hervorrufen. So kann der Adressatenkreis einer Regel erheblich variieren, man denke etwa an einen Vertragsschluss zwischen zwei Personen und eine Verbandssatzung, die je nach Mitgliederstärke des Verbands mehrere Millionen Verbandsmitglieder an sich binden kann.13 Maßgebliches Kriterium für die Zuweisung einer privaten Regel zu den drei Stufen ist damit schlussendlich, für wen die private Regel wie verbindlich ist.
11 Ältere Arbeiten wie etwa Brunner, Private Rechtsetzung, gehen noch davon aus, dass eine private Regel entweder für die Regeladressaten verbindlich erklärt wird oder dass sie unverbindlich ist. 12 Di Fabio, NZS 1998, 449, 451 f. spricht bei derlei nicht klassischen, halbstaatlichen Rechtsquellen, die einen Sachgegenstand in einer Zone zwischen Verbindlichkeit und Unverbindlichkeit regeln, von einer „Normzwischenschicht“. 13 Die Mitgliederzahl des ADAC als Idealverein beispielsweise wird auf knapp 19 Millionen geschätzt.
54
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
§ 6 Unverbindliche Regeln I. Vorüberlegungen In einem ersten Schritt sollen im Folgenden einzelne private Regeln beleuchtet werden, die der ersten Systematisierungsstufe, d.h. den rechtlich unverbindlichen Regeln zuzuordnen sind. Derartige Regelungen, die nicht rechtliche, sondern lediglich tatsächliche Wirkungen entfalten, existieren mannigfach.14 Ausgangspunkt ist jeweils der Wille der Beteiligten, ihr Verhalten – meist aus geschäftlicher Motivation heraus – aufeinander abzustimmen, ohne aber eine vertraglich bindende und damit rechtlich sanktionierbare Vereinbarung anzustreben.15 Das wiederum kann daran liegen, dass die Beteiligten darauf vertrauen, dass auch eine unverbindliche Zusage eingehalten wird, oder sie davon ausgehen, dass der Rechtswirksamkeit ohnehin ein rechtliches Hindernis, wie etwa ein gesetzliches Verbot, entgegenstehen würde.16 Zur Durchsetzung derartiger Regeln stehen den Beteiligten zwar keine staat lichen Sanktionsinstrumente zur Verfügung. Es kann im Einzelfall aber ein faktischer Druck gesellschaftlicher, moralischer oder wirtschaftlicher Art bestehen, der sie dazu anhält, die Regeln zu befolgen. So müssen etwa Unternehmen bei einem Verstoß gegen derartige Regeln befürchten, durch den Kapitalmarkt abgestraft zu werden oder einen Reputationsverlust in der Öffentlichkeit zu erleiden.17 Im Einzelfall können faktisch wirkende private Regelwerke für die Betroffenen einen vergleichbaren Befolgungsdruck auslösen wie eine rechtliche Regelung.18
II. Selbstverpflichtungserklärungen als einseitig unverbindliche Regeln Die Regeln mit bloß faktischen Wirkungen lassen sich in einseitige und zweibzw. mehrseitige private Regeln unterteilen. Eine Form einseitiger rechtlich unverbindlicher Regelsetzung stellen die sog. Selbstverpflichtungen von Unternehmen 14 Zu den rein faktischen Wirkungen privater Regeln vgl. M. Weiss, Hybride Regulierungsinstrumente, S. 54 f. 15 Ob der in Abgrenzung zum Vertrag maßgebliche Rechtsbindungswille fehlt oder zugunsten desjenigen, der die vertraglichen Pflichten einfordern könnte, anzunehmen ist, ist durch Auslegung zu ermitteln, vgl. Eckert, in: BeckOK BGB, § 145 Rn. 35, 37 m.w.N. 16 Bork, in: Staudinger, BGB, Vorbem. zu §§ 139 – 163 Rn. 3; Eckert, in: BeckOK BGB, § 145 Rn. 36. 17 Zu den außerrechtlichen Sanktionsmöglichkeiten vgl. Damrau, Selbstregulierung im Kapitalmarktrecht, S. 91 ff. 18 Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 44 f. mit Verweis auf Brugger, VerwArch 78 (1987), 1, 42; Lamb, Kooperative Gesetzeskonkretisierung, S. 92; Marburger, Regeln der Technik, S. 590; M. Weiss, Hybride Regulierungsinstrumente, S. 54 f.
§ 6 Unverbindliche Regeln
55
oder Verbänden dar.19 Häufig anzutreffen sind sie im Umweltrecht.20 Hintergrund derartiger Selbstverpflichtungserklärungen ist in der Regel die staatliche Inten tion, staatlich erwünschte Ziele nicht durch einseitiges staatliches Handeln in Befehlsform zu erreichen, sondern dadurch, dass Unternehmen oder Verbände, unter Umständen staatlicherseits angeregt, mehr oder minder freiwillig erklären,21 sich dafür einzusetzen, dass diese Zielvorgaben erfüllt werden.22 Gegenstand von Selbstverpflichtungen ist beispielsweise die Bereitschaft von Unternehmen, Sozialstandards, insbesondere Arbeitsbedingungen, Umweltstandards, ethische Maßstäbe einzuhalten oder auf fairen Wettbewerb, Corporate Governance etc. hinzuwirken.23 Um Vorbehalten und Kritik gegenüber dem Netzausbau in Teilen der Bevölkerung entgegenzuwirken, gaben etwa die führenden Mobilfunknetzbetreiber im Dezember 2001 eine Selbstverpflichtung ab, in der sie erklärten, die Vorsorge in den Bereichen Verbraucher-, Gesundheits- und Umweltschutz zu verstärken.24 Ebenfalls in Form einer Selbstverpflichtung verpflichtete sich im Jahre 2010 eine Vielzahl von Vorstandschefs und Geschäftsführern von deutschen Unternehmen 19 Mit Recht kritisch zum Begriff der Selbstverpflichtung Bachmann, Private Ordnung, S. 31; Di Fabio, JZ 1997, 969, 970; Michael, in: Bauer/Huber/Sommermann (Hrsg.), Demokratie in Europa, S. 431, 435. Denn „Verpflichtung“ klingt nach rechtlicher Verbindlichkeit, beabsichtigt ist in der Regel aber Unverbindlichkeit. 20 Häufig finden im Umweltrecht auch normersetzende Absprachen statt, die zwei- und mehrseitig wirken; monografisch zu den Regelsetzungsinstrumenten im Umweltrecht Faber, Gesellschaftliche Selbstregulierungsinstrumente, passim; Frenz, Selbstverpflichtungen der Wirtschaft, passim; Helberg, Normabwendende Selbstverpflichtungen als Instrumente des Umweltrechts, passim; Hucklenbruch, Umweltrelevante Selbstverpflichtungen, passim; Knebel/Wicke/Michael, Selbstverpflichtungen und normersetzende Umweltverträge als Instrumente des Umweltschutzes, passim; Köpp, Normvermeidende Absprachen zwischen Staat und Wirtschaft, passim; Michael, Rechtsetzende Gewalt im kooperierenden Verfassungsstaat, passim. 21 Kritisch zum Merkmal der Freiwilligkeit Di Fabio, JZ 1997, 969, 970 und 973: Viele dieser Selbstverpflichtungen verdienen den Namen privatautonomer Freiheitsausübung nicht; Selbstverpflichtungen sind häufig erzwungen und inhaltlich durch den Staat (mit-) bestimmt. Es handelt sich allenfalls um eine mediatisierte Form der Freiheit, wenn der Wirtschaft Freiheitsräume erhalten bleiben, um staatlich formulierte Gemeinwohlanforderungen mit wirtschaftlichem Rationalitätskalkül zu vereinen. 22 Vgl. Bachmann, Private Ordnung, S. 30; mit Beispielen Trute, DVBl. 1996, 950, 954. 23 Vgl. Buck-Heeb/Dieckmann, Selbstregulierung im Privatrecht, S. 95 f.; Herberg, Globalisierung und private Selbstregulierung, S. 101 ff. 24 Selbstverpflichtungserklärung der Mobilfunknetzbetreiber vom 05. 12. 2001, abrufbar unter: http://www.bmub.bund.de/bmub/parlamentarische-vorgaenge/detailansicht/ artikel/selbstverpflichtung-der-mobilfunkbetreiber-vom-05122001/ (zuletzt abgerufen am 12. 10. 2016). Weitere Selbstverpflichtungen von Unternehmen und Verbänden sind abrufbar auf der Homepage des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, vgl. http://www.bmub.bund.de/themen/wirtschaft-produkte-ressourcen/wirtschaft-und-umwelt/selbstverpflichtungen/ (zuletzt abgerufen am 12. 10. 2016).
56
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
auf ein „Leitbild für verantwortliches Handeln in der Wirtschaft“, in dem sie sich zu einer erfolgs- wie auch werteorientierten Führung im Sinne der Sozialen Marktwirtschaft und fairen Regeln im globalen Wettbewerb bekennen.25 Ziel war es in erster Linie, dem Vertrauensverlust vieler Bürger in die Führungskräfte der Wirtschaft entgegenzuwirken.
III. Soziale Normen, Gentlemen’s Agreements, Unternehmensrichtlinien und Kodizes als zweiund mehrseitig unverbindliche Regeln Eine weitere Form unverbindlicher privater Regeln stellen sog. soziale Normen, Gentlemen’s Agreements, Richtlinien und Kodizes von Unternehmen dar. Diese unterscheiden sich von den dargestellten Selbstverpflichtungen dadurch, dass sich der Erklärende nicht einseitig bindet, sondern mit dem bzw. den Gegenüberstehenden eine zwei- bzw. mehrseitige Bindung eingeht. Soziale Normen in dem genannten Sinne bilden etwa Gepflogenheiten, das Sittengesetz, die Moral oder Benimmregeln à la Knigge. Diesen ist gemein, dass sie die Regeladressaten in gewissem Umfang faktisch binden, indem Verstöße gegen sie soziale Sanktionen auslösen, wie eine drohende „Vergeltung“ („tit-for-tat“), Reputations- und Glaubwürdigkeitsverluste oder gesellschaftliche Isolierung, und so das sozial erwünschte Verhalten veranlassen.26 Sog. Gentlemen’s Agreements sind Absprachen, mit denen die Beteiligten ihr Verhalten abstimmen, ohne dass eine vertragliche Bindung zustande kommt.27 So koordinieren vor allem private Verbände teils mit, teils ohne staatliche Beteiligung in Form von „Runden Tischen“ oder sonstigen Übereinkommen unverbindlich das Verhalten ihrer Mitglieder oder Dritter. Ein aktuelles Beispiel ist der im Jahr 2014 eingerichtete „Runde Tisch zu G8/G9“ in Nordrhein-Westfalen, der unter dem Vorsitz der zuständigen Ministerin Empfehlungen zur Weiterentwicklung des gymnasialen Bildungsgangs auf acht Jahre erarbeitete.28 Richtlinien 29 und Kodizes „guten Verhaltens“ oder „bester Praxis“30 sind selbst auferlegte Verhaltensstandards eines Wirtschaftszweigs, eines Unternehmens 25 Leitbild für verantwortliches Handeln in der Wirtschaft (Stand: 01. 08. 2014), abrufbar unter: http://www.wcge.org/images/dialog/leitbild/140918_leitbild-de_Unterschriften_o.pdf (zuletzt abgerufen am 12. 10. 2016). 26 Zu den gesellschaftlichen Folgen vgl. Bachmann, Private Ordnung, S. 368 m.w.N. 27 Damrau, Selbstregulierung im Kapitalmarktrecht, S. 65 ff. mit Verweis auf Hoeren, Selbstregulierung, S. 17. 28 Die Empfehlungen sind abrufbar unter: https://www.schulministerium.nrw.de/docs/ Schulpolitik/G8/Empfehlungen_Runder_Tisch_03_11_2014.pdf (zuletzt abgerufen am 12. 10. 2016). 29 Monografisch zu sog. Compliance-Richtlinien Klösel, Compliance-Richtlinien, passim, der diese allerdings als privates Recht einstuft; zu den Richtlinien der privatrechtlich organisierten Bundesärztekammer (vgl. § 16 Abs. 1 TPG) Taupitz, NJW 2003, 1145 ff.; zu
§ 6 Unverbindliche Regeln
57
oder wie im Fall des Standesrechts einer Berufsgruppe, die ihre Adressaten in der Regel nicht rechtlich binden sollen, sondern lediglich sachlich überzeugen bzw. einen moralischen Appell aussprechen wollen.31 Sie lassen sich unterscheiden in interne Ethik- oder Best-Practice-Regeln, die von einem Unternehmen oder einem Verband verfasst werden, und in externe Regelungen, die von sachverständigen Dritten, die nicht notwendigerweise selbst dem Regelwerk unterworfen sind, branchenweit verfasst werden.32 Als ein solches externes branchenweites Regelwerk ist der einheitlich für alle Familienunternehmen geltende und am 19. 06. 2010 veröffentlichte „Governance Kodex für Familienunternehmen“ zu nennen, der Leitlinien für die verantwortungsvolle Führung von Familienunternehmen aufstellt.33 Ein weiteres Beispiel ist der „Deutsche Nachhaltigkeitskodex“, der am 13. 10. 2011 von dem durch die Bundesregierung eingesetzten „Rat für Nachhaltige Entwicklung“ (RNE) beschlossen wurde und als freiwilliges Instrument zur Selbstauskunft von Unternehmen jeglicher Art über deren Nachhaltigkeitsmanagement konzipiert ist.34 Unverbindliche Standards oder Kodizes werden auch in Form der sog. „Freiwilligen Selbstkontrolle“ insbesondere im Medienrecht von brancheninternen Kontrollgremien wie etwa dem Deutschen Presserat festgelegt.35 Kontroll-, Schieds- oder Beschwerdestellen überwachen die erwartete Einhaltung der Re30
sonstigen ärztlichen Leitlinien Hart, in: Joerges/Teubner (Hrsg.), Rechtsverfassungsrecht, S. 113 ff., 118 f. 30 Zu Corporate Governance Kodizes vgl. etwa Uwe H. Schneider, DB 2000, 2413 ff.; zum Verhaltenskodex des Arbeitskreises der Insolvenzverwalter AG Hamburg ZIP 2001, 2147, 2148: sogar mittelbare Rechtswirkung; zu den Kodizes der Werbeindustrie Brandmair, Freiwillige Selbstkontrolle, S. 33 f., 59 ff., 99 ff., 153 ff.; zu den Kodizes der Heilmittelindustrie Bülow/Ring/Artz/Brixius, HWG, Einführung, Rn. 69 ff. und Anhang S. 1027 ff.; zum gescheiterten Ehrenkodex für Finanzanalysten Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 308 ff.; Buck-Heeb/Dieckmann, Selbstregulierung im Privatrecht, S. 252; zum Übernahmekodex Damrau, Selbstregulierung im Kapitalmarktrecht, S. 65 ff. Dieser war als freiwilliges Regelwerk konzipiert, er beruhte auf freiwilliger Anerkennung. Strittig war, ob durch die Anerkennung ein verbindlicher Vertrag zustande kam, ablehnend die h.M., vgl. etwa Hopt, ZHR (161) 1997, 368, 400 ff.; Kallmeyer, ZHR (161) 1997, 435, 451; Kersting, AG 1997, 222, 226; a.A. Assmann, AG 1995, 563, 564; Thoma, ZIP 1996, 1725 f. 31 Bachmann, Private Ordnung, S. 34. Anders liegt es, wenn die Regeln vertraglich einbezogen oder von den Gerichten im Rahmen der Entscheidungsfindung herangezogen werden. Dann sind sie unmittelbar bzw. mittelbar rechtsverbindlich, vgl. dazu unten § 7 und § 8. 32 Vgl. Fleischer, ZGR 2012, 160, 186 ff. mit europaweiten Beispielen. 33 Governance Kodex für Familienunternehmen (Stand: 29. 05. 2015), abrufbar unter: www.kodex-fuer-familienunternehmen.de. (zuletzt abgerufen am 12. 10. 2016); vgl. dazu etwa Graf/Bisle, DStR 2010, 2409 ff.; Grottel/Kieser/Helfmann/Rau/Kettenring, ZCG 4/2012, 153 ff.; Lange, in: FS Hennerkes, S. 135 ff.; May/Koeberle-Schmid, DB 2011, 485 ff. 34 Hecker/Peters, NZG 2012, 55 ff. 35 Vgl. dazu Bachmann, Private Ordnung, S. 35 f. mit Verweis auf Brandmair, Freiwillige Selbstkontrolle der Werbung; Ruess, Jb.J.ZivRWiss. 2002, 209, 215 ff.; Ulmer, WRP 1975, 549 ff.; siehe ferner Thoma, Regulierte Selbstregulierung, S. 83 ff. m.w.N.; zum Pressekodex vgl. etwa Gottzmann, Selbstkontrolle in der Presse, S. 99 ff.; Heimann, Der Pressekodex, S. 60 ff., 64 ff.
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
58
geln. Ein Verstoß wird durch Rügen bzw. gegebenenfalls verschärft durch Publikmachen des Verstoßes sanktioniert; in umgekehrter Richtung kann ein Gütesiegel verliehen werden.36
§ 7 Regelarrangements mit mittelbarer Rechtsverbindlichkeit I. Vorüberlegungen Auf der zweiten Systematisierungsstufe stehen private Regeln, die mittelbare rechtliche Wirkungen entfalten. Die mittelbaren rechtlichen Wirkungen beruhen darauf, dass diese Regeln von den Gerichten im Rahmen ihrer Entscheidungsfindung herangezogen werden. Gemeinhin geht es dabei um Materien, in denen ein besonderer Sachverstand und eine große Sachnähe gefragt sind. Man spricht von Expertenrecht.37 Derartige Regeln rücken stark in die Nähe des Rechts. Als unmittelbar verbindliches Gewohnheitsrecht oder als Verkehrssitte bzw. Handelsbrauch38 können sie jedoch in der Regel nicht eingeordnet werden. Es fehlt an der u.a. erforderlichen gleichmäßigen, einheitlichen und freiwilligen Übung der beteiligten Kreise über einen längeren Zeitraum hinweg, da die einschlägigen Regeln zumeist darauf angelegt sind, fortlaufend überarbeitet und aktualisiert zu werden.39 Die bloße schrift liche Fixierung der Regeln ist insoweit nicht ausreichend. Inwiefern einem privaten Regelwerk mittelbare rechtliche Wirkungen beizumessen sind, lässt sich nur beantworten, indem man an die gesetzliche Vorschrift, über die das private Regelwerk einbezogen werden soll, anknüpft und diese auf die Frage hin auslegt, ob sie sich derartigen Wirkungen öffnet. Mitunter fällt diese Auslegung leicht, wenn der Gesetzgeber wie in § 342 Abs. 2 HGB für die Rechnungslegungsstandards eine Vermutungswirkung explizit anordnet. Teilweise liegt die Inbezugnahme auf private Regelwerke aber auch nicht ohne Weiteres auf der Hand und bedarf eines erhöhten Begründungsaufwands. Im Folgenden sollen einzelne Erscheinungsformen näher beleuchtet und die verschiedenartigen Rezeptionsmechanismen offengelegt werden.
Bachmann, Private Ordnung, S. 35 m.w.N. Köndgen, AcP 206 (2006), 477, 481 ff. 38 Handelsbräuche sind Verkehrssitten des Handels. Brauch und Verkehrssitte stellen im Gegensatz zum Gewohnheitsrecht keine Rechtsquelle dar, da sie nur aufgrund und im Rahmen des sie aufnehmenden positiven Rechts gelten, vgl. Merten, in: Staudinger, Art. 2 EGBGB Rn. 104; K. Schmidt, Handelsrecht, § 1 III 3a; Wolf/Neuner, BGB AT, § 4 Rn. 18. 39 Vgl. hierzu Bachmann, Private Ordnung, S. 331 ff.; Spindler/Hupka, in: Möllers (Hrsg.), Geltung und Faktizität von Standards, S. 117, 128. Zur Herausbildung und Klassifikation von Gewohnheitsrecht vgl. Merten, in: Staudinger, Art. 2 EGBGB Rn. 93 ff. m.w.N. 36 37
§ 7 Regelarrangements mit mittelbarer Rechtsverbindlichkeit
59
II. Technische Normen 1. Allgemeines Die wohl größte Bedeutung hat die Aufstellung technischer Normen durch Verbände.40 Denn nahezu jede technische Innovation bringt ein Bedürfnis für einheitliche Standards mit sich.41 Der Gesetzgeber ist hier zumeist nicht selbst in der Lage, mit der technischen Innovation Schritt zu halten und umfassende Normierungs arbeit zu leisten. Er ist daher auf private Organisationen angewiesen, die sich zum Teil ausschließlich, zum Teil neben anderen Aufgaben mit der Aufstellung technischer Normen beschäftigen. Innerhalb dieser Organisationen arbeiten Experten der betroffenen Verkehrskreise im Rahmen eines konsensbasierten Prozesses an der Vereinheitlichung, um die Rationalisierung und Qualitätssicherung in Wirtschaft, Technik, Wissenschaft und Verwaltung zu gewährleisten.42 Die von den privaten Verbänden ausgearbeiteten technischen Normen werden zum einen von den betroffenen Verkehrskreisen, d.h. beispielsweise von Ingenieuren, Handwerkern oder Sachverständigen zu Grundlage und Maßstab ihrer Arbeit gemacht.43 Zum anderen werden sie von den Gerichten bei der Rechtsfindung herangezogen, etwa indem sie die Soll-Beschaffenheit von materiellen oder immateriellen Gegenständen standardisieren oder Sorgfaltsmaßstäbe festlegen. Im Folgenden soll dieser Mechanismus exemplarisch anhand der praxisrelevanten DIN-Normen und der VDI-Richtlinien veranschaulicht werden. 2. DIN-Normen a) Unmittelbare rechtliche Wirkung im Einzelfall Die DIN-Normen werden vom 1917 gegründeten und als gemeinnützigen Verein organisierten „Deutschen Institut für Normung e.V. (DIN)“ gesetzt. Das DIN ist 40 Zur Geschichte des Technikrechts Marburger, Regeln der Technik, S. 197 ff.; Vec, in: Schulte (Hrsg.), Handbuch des Technikrechts, S. 3 ff. 41 Köndgen, AcP 206 (2006), 477, 483. Schon im Jahr 1980 war von circa 150 privaten Organisationen die Rede, vgl. Kloepfer/Elsner, DVBl. 1996, 964, 966; Marburger, VersR 1983, 597, 598. Die wichtigsten und bekanntesten Regelaufsteller sind das DIN Deutsches Institut für Normung e.V., der Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) e.V., der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) e.V. und der DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. 42 Vgl. Buck-Heeb/Dieckmann, Selbstregulierung im Privatrecht, S. 159. Nach § 1 Abs. 2 der Satzung des DIN sollen die technischen Normen der „Innovation, Sicherheit und Verständigung in Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Öffentlichkeit sowie der Qualitätssicherung und Rationalisierung und dem Arbeits-, Umwelt- und Verbraucherschutz“ dienen. Abrufbar ist die Satzung des DIN (Stand: 05. 11. 2015) unter: http://www.din.de/ blob/75564/b5ecaadf153628dda1fe16ae06ee8cf7/satzung-din-data.pdf (zuletzt abgerufen am 12. 10. 2016). 43 Vgl. nur etwa Buck-Heeb/Dieckmann, Selbstregulierung im Privatrecht, S. 160; Marburger, Regeln der Technik, S. 275 ff., 297 f.
60
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
durch die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Wirtschaft, im sog. „Normungsvertrag“ als zuständige Normungsorganisation anerkannt worden.44 Seine Zielsetzung ist es, mit Vertretern interessierter Kreise Normen für Wirtschaft, Staat und Gesellschaft zu erarbeiten,45 die einen Maßstab für einwandfreies technisches Verhalten bilden. Zweck der Normen soll es sein, die Sicherheit von Mensch und Sache zu gewährleisten und die Qualität in allen Lebensbereichen zu verbessern.46 Daneben vertritt das DIN die deutschen Interessen in europäischen und internationalen Normungsorganisationen.47 Die vom DIN erlassenen Normen vermögen aus sich heraus keine unmittelbaren rechtlichen Wirkungen zu entfalten.48 Das DIN ist privater Regelsetzer, sodass es sich bei dessen Regeln weder um formelle Gesetze oder Rechtsverordnungen noch um Satzungen der mittelbaren Staatsverwaltung handelt. Auch ist das DIN nicht Beliehener. Ihm werden weder durch Gesetz noch durch den Normungsvertrag Hoheitsrechte übertragen.49 Schließlich gibt es auch keinen staatlichen Anerkennungsakt, der die DIN-Normen unmittelbar auf die rechtliche Ebene em44 Vgl. § 1 Abs. 1, Abs. 3 S. 1 des Vertrags zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem DIN Deutsches Institut für Normung e.V. vom 05. 06. 1975, abrufbar unter: http:// www.din.de/blob/79648/de461d1194f708a6421e0413fd1a050d/vertrag-din-und-brd-data. pdf (zuletzt abgerufen am 12. 10. 2016). 45 Über 32.000 Expertinnen und Experten sollen ihr Fachwissen in die Normungsarbeit mit einbringen, vgl. Homepage des DIN „Über Normen und Standards“, abrufbar unter: http://www.din.de/de/ueber-normen-und-standards/basiswissen (zuletzt abgerufen am 12. 10. 2016). Nach telefonischer Auskunft des DIN soll das Normenwerk der DIN mittlerweile über 40.000 DIN-Normen umfassen (Stand: 02. 07. 2015). 46 Vgl. BGH NJW-RR 1991, 1445, 1447 (Sahnesiphon); DIN 820 Teil 1 Abschnitt 4, Ausgabe Juni 2014. 47 Köndgen, AcP 206 (2006), 477, 483; zu den technischen Normungen auf internationaler Ebene etwa durch die International Organization for Standardization (ISO) und auf europäischer Ebene durch das Comité Européen de Normalisation (CEN) und das Comité Européen de Normalisation Electrotechnique vgl. ders., AcP 206 (2006), 477, 484 ff.; Marburger, Regeln der Technik, S. 236 ff. Auch die Normungsarbeit des DIN ist zu etwa 85 % europäisch und international ausgerichtet, vgl. Homepage des DIN „DIN weltweit“, abrufbar unter: http://www.din.de/de/din-und-seine-partner/din-in-der-welt (zuletzt abgerufen am 12. 10. 2016). 48 Vgl. etwa BGHZ 172, 346, 355 f. = NJW 2007, 2983; Buck-Heeb/Dieckmann, Selbstregulierung im Privatrecht, S. 160; Marburger, VersR 1983, 597, 600; ders., Regeln der Technik, S. 330; Schmidt-Preuß, in: Kloepfer (Hrsg.), Selbst-Beherrschung, S. 89, 90; R. Scholz, in: FS Juristische Gesellschaft, S. 691, 696 f. 49 M. Holle, Normierungskonzepte, S. 110 f.; anders Backherms, Das DIN als Beliehener, S. 93 ff., der das DIN als besonders anerkannten Beliehenen einstuft. Hierbei soll es sich um eine Institution handeln, die nicht mit der Wahrnehmung staatlicher, sondern gesellschaftlich-öffentlicher Aufgaben betraut ist und aufgrund ihrer Bedeutung für die Allgemeinheit vom Staat besonders anerkannt wird. Die Anforderungen an eine Beleihung müssten nicht erfüllt sein, es genüge eine Legitimation geringerer Stufe; zu Recht kritisch Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 190 f.
§ 7 Regelarrangements mit mittelbarer Rechtsverbindlichkeit
61
porhebt.50 Unmittelbare Rechtsverbindlichkeit können die DIN-Normen allenfalls dann erlangen, wenn sie von Vertragsparteien in den Inhalt des Vertrags mit einbezogen werden und damit am staatlich anerkannten Verbindlichkeitscharakter des Vertrags teilhaben, sie vom Gesetzgeber in den Gesetzestext aufgenommen werden oder wenn auf sie durch Gesetz verwiesen wird. Im Falle einer Inkorporation macht sich der Gesetzgeber den Text einer privaten Regel zu eigen, indem er diesen in eine Rechtsnorm aufnimmt, als Anlage hinzufügt oder ihren Inhalt sinngemäß übernimmt.51 In diesen Fällen ist die ursprünglich private Herkunft des Regelwerks zumeist nicht mehr auszumachen, da der private Regelinhalt das komplette staatliche Rechtsetzungsverfahren durchläuft und anschließend als Gesetz oder Rechtsverordnung verkündet oder wie so häufig in Verwaltungsvorschriften aufgenommen wird.52 Bei einer Verweisung schreibt der Gesetzgeber in einer Rechtsnorm vor, dass die konkreteren Anforderungen einer privaten Regel zu beachten sind.53 Wie bei der Inkorporation wird auch hier die private Regel Bestandteil der staatlichen Rechtsnorm.54 Es gilt nicht die private Regel an sich, sondern nur ihr Wortlaut.55 Das hat zur Folge, dass in den von der Verweisungsgrundlage erfassten Fällen die Gesetzesadressaten die privat ausformulierte Regel als staatliches Recht zu befolgen haben und das Gericht sie auch zum Kontrollmaßstab seiner Entscheidung machen muss.56 Eine allseitige Rechtsgeltung der privaten Regel ist damit aber nicht verbunden, d.h., die private Regel behält außerhalb der Verweisungsgrundlage gegenüber den Regeladressaten ihren unverbindlichen Charakter. Hinsichtlich der Art und Weise der Bezugnahme kann zwischen einer statischen oder einer dynamischen Verweisung unterschieden werden.57 Statische Verweisungen nehmen im Tatbestand auf eine bestimmte, mit Ausgabedatum be50 Selbst die Mitglieder des DIN sind vereinsrechtlich nicht verpflichtet, die Regeln zu beachten, vgl. Buck-Heeb/Dieckmann, Selbstregulierung im Privatrecht, S. 160; Marburger, Regeln der Technik, S. 369 ff. 51 Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 174; Breuer, AöR 101 (1976), 46, 61; Lamb, Kooperative Gesetzeskonkretisierung, S. 91; Lübbe-Wolff, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Konfliktbewältigung, S. 87, 89; M. Schwab, Politikberatung, S. 283. 52 Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 174; Lamb, Kooperative Gesetzeskonkretisierung, S. 91; Lübbe-Wolff, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Konfliktbewältigung, S. 87, 97 f. mit Beispielen. 53 Vgl. nur etwa Lübbe-Wolff, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Konfliktbewältigung, S. 87, 90. 54 Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 175 f.; Clemens, AöR 111 (1986), 63, 65; F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 152 f. 55 Clemens, AöR 111 (1986), 63, 66; F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 152. 56 Clemens, AöR 111 (1986), 63, 65; in Abgrenzung zum staatlichen Geltungsbefehl F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 152 f. 57 Grundlegend Ossenbühl, DVBl. 1967, 401 ff.
62
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
zeichnete Regel wie etwa DIN-Normen Bezug, d.h., der Gesetzgeber macht sich den Inhalt der Norm in der klar bezeichneten Fassung zu eigen, wie sie bei Erlass des Gesetzesbeschlusses galt.58 So schreibt beispielsweise § 3 Abs. 1 der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes59 vor, dass in kleinen Feuerungsanlagen u.a. nur Brennstoffe eingesetzt werden dürfen wie Grill-Holzkohle, Grill-Holzkohlebriketts nach DIN EN 1860, Ausgabe September 2005 (Nr. 3a), Presslinge aus naturbelassenem Holz in Form von Holzbriketts nach DIN 51731, Ausgabe Oktober 1996, oder in Form von Holzpellets nach den brennstofftechnischen Anforderungen des DINplus-Zertifizierungsprogramms „Holzpellets zur Verwendung in Kleinfeuerstätten nach DIN 51731-HP 5“, Ausgabe August 2007, sowie andere Holzbriketts oder Holzpellets aus naturbelassenem Holz mit gleichwertiger Qualität (Nr. 5a) sowie Heizöl leicht (Heizöl EL) nach DIN 51603 – 1, Ausgabe August 2008, und andere leichte Heizöle mit gleichwertiger Qualität sowie Methanol, Ethanol, naturbelassene Pflanzenöle oder Pflanzenölmethylester (Nr. 9). In § 35h StVZO60 ist normiert, dass in Kraftomnibussen Verbandskästen mitzuführen sind, die selbst und deren Inhalt an Erste-Hilfe-Material dem Normblatt DIN 13164, Ausgabe Januar 1998 oder Ausgabe Januar 2014 entsprechen. Dynamische Verweisungen hingegen beziehen sich abstrakt auf die jeweils aktuell geltende Fassung einer privaten Norm.61 Anders als bei statischen Verweisungen, bei denen sich spätere Änderungen der privaten Norm nicht auf den Inhalt der Verweisungsgrundlage auswirken, haben Anpassungen des privaten Regelsetzers bei dynamischen Verweisungen damit Einfluss auf die verweisende staat liche Rechtsnorm, ohne dass diese den parlamentarischen Willensbildungsprozess durchlaufen.62 Mit Blick auf das Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip werden dynamische Verweisungen daher ganz überwiegend für prinzipiell verfassungswidrig63 bzw. nur in sehr engen Grenzen für zulässig gehalten, namentlich dann, 58 Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 176; zu den Anforderungen, Titel, Datum, Fundstelle und Bezugsquelle zu nennen, vgl. Clemens, AöR 111 (1986), 63, 80, 83 ff. 59 Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV) vom 26. 01. 2010, BGBl. I, S. 38, in Kraft getreten am 22. 03. 2010. 60 Straßenverkehrs-Zulassungs-Verordnung (StVZO) vom 26. 04. 2012, BGBl. I, S. 679, in Kraft getreten am 05. 05. 2012. 61 Lamb, Kooperative Gesetzeskonkretisierung, S. 90. Um eine dynamische Verweisung handelt es sich auch dann, wenn auf eine Vorschrift verwiesen wird, ohne von der derzeitigen oder auch jeweils geltenden Fassung zu sprechen, vgl. Backherms, Das DIN als Beliehener, S. 71 Fn. 165 m.w.N. 62 Das Bundesverfassungsgericht sieht hierin eine versteckte Delegation von Normsetzungsbefugnissen, vgl. BVerfGE 64, 208, 214 f.; BVerfGE 47, 285, 315 jeweils unter Bezugnahme auf BVerfGE 33, 125, 157 ff. (Facharztbeschluss). 63 Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 178; Bachmann, Private Ordnung, S. 66 f.; Lamb, Kooperative Gesetzeskonkretisierung, S. 90; Marburger, Regeln
§ 7 Regelarrangements mit mittelbarer Rechtsverbindlichkeit
63
wenn es sich nicht um normergänzende, sondern normkonkretisierende (dynamische) Verweisungen handelt.64 Diese unterscheiden sich von den normergänzenden Verweisungen dadurch, dass sie die Verweisungsnormen lediglich konkretisieren und sich die eigentliche Verhaltensanforderung nicht erst durch Hinzuziehen der privaten Norm erschließt.65 b) Mittelbare rechtliche Wirkungen als Regelfall aa) DIN-Normen als Maßstab für die Soll-Beschaffenheit im Werkvertragsrecht Die hohe rechtliche Relevanz der DIN-Normen liegt letztlich aber nicht darin begründet, dass sie vom Gesetzgeber ins staatliche Recht überführt werden oder ihnen durch vertragliche Vereinbarung Rechtsqualität zugesprochen wird, sondern darin, dass sie über unbestimmte Rechtsbegriffe mittelbar rechtliche Wirkungen entfalten.66 Haupteinfallstor für die DIN-Normen sind hierbei die unbestimmten Rechtsbegriffe „anerkannte Regeln der Technik“ (§ 641a Abs. 3 S. 4 BGB a.F.,67 § 6 Abs. 1 ProdSG, § 2 Abs. 1 S. 3 HaftpflG), „Stand der Technik“ (§ 906 Abs. 1 S. 3 BGB, § 7 Abs. 1 ProdSG) oder „Stand der Technik und Wissenschaft“ (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 ProdHaftG). Diese vom Gesetzgeber verwendeten, aber nicht näher definierten Begriffe werden von der Rechtsprechung u.a. mithilfe der DIN-Normen konkretisiert, d.h., die DIN-Normen werden als Maßstab für die anerkannten Regeln der Technik etc. verstanden. Das entspricht letztlich ihrer Bestimmung, sollen sie doch gerade als von einem Fachgremium erarbeitete Regeln den Maßstab für einwandfreies technisches Verhalten abbilden.68 Die weitgehende Gleichsetzung der DIN-Norder Technik, S. 390 ff.; Ossenbühl, DVBl. 1967, 401, 403 ff.; M. Schwab, Politikberatung, S. 179; Voßkuhle, in: Isensee/P. Kirchhof (Hrsg.), HStR, Bd. III, § 43 Rn. 59. 64 Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 178; Brugger, VerwArch 78 (1987), 1, 42 ff.; Clemens, AöR 111 (1986), 63, 105 ff.; Denninger, Verfassungsrechtliche Anforderungen, Rn. 145; Lamb, Kooperative Gesetzeskonkretisierung, S. 90; Marburger, Regeln der Technik, S. 395 ff., insbesondere S. 405 ff.; kritisch Hommelhoff, in: FS Odersky, S. 779, 791; M. Schwab, Politikberatung, S. 153 f. 65 Zur Differenzierung zwischen normergänzenden und normkonkretisierenden Verweisungen vgl. Marburger, Die Regeln der Technik, S. 385 f. 66 Dazu, dass der Gesetzgeber die Rezeption privater Regeln im Rahmen der „Generalklauselmethode“ gerade beabsichtigt, vgl. Schmidt-Preuß, in: Kloepfer (Hrsg.), Selbst-Beherrschung, S. 89, 95; zum Zusammenspiel von Gesetzgebung und DIN-Normen anhand eines aktuellen Beispiels Vieweg, in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 69, 73 ff. 67 § 641a Abs. 3 S. 4 BGB a.F. Fertigstellungsbescheinigung: „Wenn der Vertrag entsprechende Angaben nicht enthält, sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zugrunde zu legen“, aufgehoben mit Wirkung zum 01. 01. 2009 durch Art. 1 FoSiG, BGBl. I, S. 2022. 68 Vgl. BGHZ 103, 338, 341 f. = NJW 1988, 2667; BGHZ 114, 273, 276 = NJW 1991, 2021; OLG Hamm NJW-RR 1998, 668, 669; Busche, in: MüKo BGB, § 633 Rn. 23; Peters/ Jacoby, in: Staudinger, BGB, § 633 Rn. 179; zurückhaltender Schmidt-Preuß, in: Kloepfer
64
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
men mit den anerkannten Regeln der Technik etc. wird von der Rechtsprechung im Einzelfall aufgehoben, wenn die jeweilige DIN-Norm sich in der Praxis noch nicht bewährt hat oder angesichts des schnellen technischen Fortschritts veraltet ist und damit hinter den anerkannten Regeln der Technik zurückbleibt69 oder sie statt sicherheitstechnischer Bestimmungen primär Regeln kaufmännischer und sonstiger Art enthält.70 Die u.a. mit den DIN-Normen ausgefüllten anerkannten Regeln der Technik spielen namentlich im Werkvertragsrecht eine entscheidende Rolle. Dort werden sie herangezogen, um die Frage zu beantworten, ob ein Sachmangel i.S.d. § 633 Abs. 2 BGB vorliegt, der dazu berechtigt, Mängelrechte nach § 634 BGB geltend zu machen. Ein Werkmangel liegt vor, wenn die Ist-Beschaffenheit des Werks negativ von der Soll-Beschaffenheit abweicht. Zur Bestimmung der Soll-Beschaffenheit ist zwar zuvorderst auf eine von den Parteien getroffene Beschaffenheitsvereinbarung zurückzugreifen. Sofern Unternehmer und Besteller die Soll-Beschaffenheit des Werks unter Verweis auf technische Normen wie die DIN vereinbaren, wird deren Einhaltung als rechtsverbindliche Vertragspflicht unmittelbar geschuldet.71 Aber auch dann, wenn es an konkreten Absprachen fehlt, geht die Rechtsprechung davon aus, dass sich der Unternehmer gegenüber dem Besteller stillschweigend dazu verpflichtet, die anerkannten Regeln der Technik seines Fachs einzuhalten.72 Indem die DIN-Normen als Teil der anerkannten Regeln der Technik verstanden werden, die wiederum zumindest stillschweigend von den Werkvertragsparteien als Soll-Beschaffenheit vorausgesetzt werden, formen die DIN-Normen damit schlussendlich die Soll-Beschaffenheit des Werks etwa im Hinblick auf das einzuhaltende Schallschutz-Maß aus. Grundsätzlich kann ein Werkunternehmer also (Hrsg.), Selbst-Beherrschung, S. 89, 95. Daneben kann auf andere private Regelwerke wie die noch darzustellenden VDI-Richtlinien, VDE-Bestimmungen oder Handwerksregeln, aber auch Rechtsnormen wie das Gerätesicherheitsgesetz, das Produktsicherheitsgesetz oder die Unfallverhütungsvorschriften (UVV) zurückgegriffen werden. 69 BGH NJW-RR 1995, 472, 473; BGHZ 139, 16 19 f. = NJW 1998, 2814; BGH NJW 2005, 1115, 1117; BGHZ 172, 346 Rn. 32 = NJW 2007, 2983; Busche, in: MüKo BGB, § 633 Rn. 18; Peters/Jacoby, in: Staudinger, BGB, § 633 Rn. 179. 70 Vgl. Backherms, Das DIN als Beliehener, S. 74 f. 71 Motzke, in: Beck’scher VOB-Kommentar, Rn. 11; allgemein zur rechtsgeschäftlichen Inbezugnahme technischer Regeln Marburger, Regeln der Technik, S. 375 f. 72 Vgl. BGHZ 139, 16, 19 = NJW 1998, 2814; BGH NJW 2013, 684, 685; ferner Begr. RegE SchRModG, BT-Drucks. 14/6040, S. 79, 261. In der Literatur wird mitunter bezweifelt, ob sich der Unternehmer gegenüber dem Besteller stillschweigend dazu verpflichtet, die anerkannten Regeln der Technik seines Fachs einzuhalten, vgl. etwa Busche, in: MüKo BGB, § 633 Rn. 21. Verneint man eine konkludente Vereinbarung über die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik, ist auf die Verwendungseignung des Werks abzustellen, vgl. § 633 Abs. 2 S. 2 BGB. Dann ist jedenfalls im Rahmen der Eignung zur gewöhnlichen Verwendung i.S.d. § 633 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 BGB auf die „allgemein anerkannten Regeln der Technik“ zurückzugreifen, vgl. Buck-Heeb/Dieckmann, Selbstregulierung im Privatrecht, S. 163; Peters/Jacoby, in: Staudinger, BGB, § 633 Rn. 177; Röthel, Normkonkretisierung im Privatrecht, S. 269.
§ 7 Regelarrangements mit mittelbarer Rechtsverbindlichkeit
65
davon ausgehen, dass das Werk der geschuldeten Soll-Beschaffenheit entspricht, wenn er die einschlägigen DIN-Normen beachtet.73 Stellt sich dieser Erfahrungssatz im Einzelfall als unzulänglich heraus, wird bei Beachtung der technischen Norm in der Regel jedenfalls kein Sorgfaltspflichtverstoß oder Fahrlässigkeitsvorwurf vorliegen.74 Daneben spielt die Beachtung der DIN-Normen bei der Beweisführung zur Kausalität eine Rolle. Sind bei der Herstellung eines Werks die mit den anerkannten Regeln der Technik übereinstimmenden DIN-Normen nicht eingehalten worden, so soll eine widerlegliche Vermutung dafür sprechen, dass die eingetretenen Mängel oder Schäden auf der Verletzung derselben beruhen.75 bb) DIN-Normen als Maßstab für Sorgfaltsund Verkehrspflichten DIN-Normen werden von der Rechtsprechung des Weiteren zur Konkretisierung der „verkehrsüblichen Sorgfalt“ i.S.d. § 276 Abs. 2 BGB76 sowie zur Ausformung deliktischer Verkehrs- und Sorgfaltspflichten77 herangezogen. Hier gilt jeweils ein auf die allgemeinen Verkehrsbedürfnisse ausgerichteter objektiver Sorgfaltsmaßstab,78 d.h., es kommt darauf an, was von einem den durchschnittlichen Anforderungen entsprechenden Angehörigen des betreffenden Verkehrskreises in der jeweiligen Situation erwartet werden kann.79 Für den Verkehrskreis der technischen Fachleute ist dies die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik.80 Insoweit 73 Vgl. Buck-Heeb/Dieckmann, Selbstregulierung im Privatrecht, S. 163 f., die jedoch auch auf Rechtsprechungsentscheidungen hinweisen, in denen ein Sachmangel bejaht wurde, obwohl der Unternehmer die technische Norm beachtet hatte (vgl. etwa BGHZ 172, 346 ff. = NJW 2007, 2983; BGHZ 139, 16 ff. = NJW 1998, 2814; OLG Stuttgart, BauR 1977, 279) und umgekehrt ein Sachmangel trotz Missachtung einer DIN-Norm verneint wurde (vgl. etwa OLG Hamm BauR 1994, 767, 768). 74 Vgl. Busche, in: MüKo BGB, § 633 Rn. 23; Herschel, NJW 1968, 617, 619. 75 BGHZ 114, 273, 276 = NJW 1991, 2021; Busche, in: MüKo BGB, § 633 Rn. 23; Herschel, NJW 1968, 617, 619; Marburger, Regeln der Technik, S. 448 ff. 76 Vgl. BGH NJW-RR 2005, 386, 388. 77 Vgl. BGH NJW 1971, 1313, 1314; BGH NJW 1980, 1219, 1220 f.; BGH NJW 1984, 801, 802; BGHZ 103, 338, 341 f. = NJW 1988, 2667; BGHZ 114, 273, 275 f. = NJW 1991, 2021; BGH NJW 1997, 582, 583; BGH NJW-RR 2002, 525, 526; BGH NJW 2001, 2019, 2020; BGH NJW 2004, 1449, 1450; BGH NJW 2008, 3778 Rn. 16. 78 Ständige Rspr. und h.M., siehe nur BGHZ 24, 21, 27 = NJW 1957, 785; BGHZ 39, 281, 283 = NJW 1963, 1609; BGHZ 113, 297, 303 f. = NJW 1991, 1535; für die vertragliche Haftung bezogen auf die einfache Fahrlässigkeit vgl. etwa Caspers, in: Staudinger, BGB, § 276 Rn. 29 ff.; Grundmann, in: MüKo BGB, § 276 Rn. 55 f.; Medicus/Lorenz, Schuldrecht I, Rn. 359; Wolf, in: Soergel, BGB, § 276 Rn. 75 ff.; für die deliktische Haftung vgl. etwa v. Bar, Verkehrspflichten S. 137 f.; Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts, Bd. 1: Allgemeiner Teil, § 20 III (S. 285 ff.); Wagner, in: MüKo BGB, § 823 Rn. 36 ff. 79 Grundmann, in: MüKo BGB, § 276 Rn. 54, 57 ff.; Wagner, in: MüKo BGB, § 823 Rn. 36 f.: Die erforderliche Sorgfalt entspricht nicht unbedingt der üblichen. 80 Vgl. Buck-Heeb/Dieckmann, Selbstregulierung im Privatrecht, S. 164.
66
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
ist es zunächst naheliegend, dass die Rechtsprechung zur Ausfüllung des in § 276 Abs. 2 BGB vom Gesetzgeber verwendeten Blanketts „der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt“ auf die DIN-Normen zurückgreift.81 So hat der Bundesgerichtshof beispielsweise die Pflichtverletzung eines ausführenden Installateurs aus einem Wärmelieferungsvertrag damit begründet, dass dieser beim Einbau kupferhaltiger Wärmetauscher vor verzinkten Stahlrohrleitungen die Vorgaben der DIN 50930 Teil 3 i.V.m. der DIN 1988 Teil 7 nicht beachtet hat, was letztlich zu Rostschäden in den Rohrleitungen führte.82 Der ausführende Installateur hätte unter Berücksichtigung der DIN 50930 Teil 3 erkennen müssen, dass der Einbau von kupferhaltigen Geräten in Fließrichtung des Wassers vor feuerverzinkten Werkstoffen die Gefahr von Lochkorrosion begründet, da die DIN-Normen eine Kupfer-Zink-Mischinstallation in Fließrichtung des Wassers grundsätzlich untersagen.83 Ebenso nahe liegt ein Rückgriff auf die in den DIN-Normen enthaltenen Vorgaben für die Rechtsprechung, wenn es darum geht, eine Verkehrspflicht zu begründen. Bei den Verkehrspflichten handelt es sich um sog. Gefahrvermeidungs- und -abwendungspflichten.84 Derjenige, der eine Gefahrenquelle in seinem Verantwortungsbereich schafft oder unterhält, soll gehalten sein, alle nach Lage der Verhältnisse erforderlichen und zumutbaren Sicherungsmaßnahmen zum Schutze anderer Personen zu treffen.85 Für das Vorhandensein einer entsprechenden Gefahrenlage mit korrespondierender Verpflichtung zur Gefahreindämmung enthalten die DIN-Normen wichtige Indizien. Die in ihnen normierten Verhaltensgebote geben nämlich regelmäßig Auskunft über die auf einem spezifischen Gebiet gemachten Erfahrungen und sind das Ergebnis einer auf Erkenntnissen und Überlegungen beruhenden Voraussicht möglicher Gefahren.86 Schon ihr Dasein besagt, dass eine Gefahrenlage besteht.87 In diesem Sinne hat der Bundesgerichtshof beispielsweise angenommen, dass zur Feststellung von Inhalt und Umfang der Verkehrssicherungspflichten einer Stadt für einen öffentlichen Spielplatz die DIN-Norm 7926 Teil 1 mit heranzuziehen sei, die für ein Spielgerät mit Handlauf und einer Fallhöhe von 1 m bis 2 m als Bodenbeläge nur nicht gebundene Böden nach DIN 18034 81 Buck-Heeb/Dieckmann, Selbstregulierung im Privatrecht, S. 164; Marburger, Regeln der Technik, S. 462 ff. 82 BGH NJW-RR 2005, 386, 387. 83 BGH NJW-RR 2005, 386, 387 f. 84 Vgl. Larenz/Canaris, BT II/2, § 76 III 1 d; vertiefend zu den Verkehrspflichten vgl. v. Bar, Verkehrspflichten, passim; Kleindiek, Deliktshaftung und juristische Person, S. 20 ff. 85 Vgl. etwa RGZ 121, 404, 406; BGHZ 5, 378, 380 f. = NJW 1952, 1050; BGHZ 34, 206, 209 = NJW 1961, 868; BGHZ 54, 165, 168 = NJW 1970, 1877; BGHZ 60, 54, 55 = NJW 1973, 460; BHGZ 65, 221, 224 = NJW 1976, 291; BGHZ 103, 338, 340 = NJW 1988, 2667; BGHZ 121, 367, 375 = NJW 1993, 1799; BGHZ 136, 69, 77 = NJW 1997, 2517; BGH NJWRR 2002, 525, 526. 86 Vgl. etwa BGH VersR 1956, 31, 32; BGH VersR 1978, 869. 87 Vgl. v. Bar, Verkehrspflichten, S. 117.
§ 7 Regelarrangements mit mittelbarer Rechtsverbindlichkeit
67
wie Naturboden, Rasen oder Sand bzw. Feinkies vorsieht. Auch wenn es sich bei DIN-Normen nicht um mit Drittwirkung versehene Normen im Sinne hoheitlicher Rechtsetzung, sondern um auf freiwillige Anwendung ausgerichtete Empfehlungen handele, spiegelten sie doch den Stand der für die betroffenen Kreise geltenden anerkannten Regeln der Technik wider und seien somit zur Bestimmung des nach der Verkehrsauffassung zur Sicherheit Gebotenen in besonderer Weise geeignet.88 Sowohl im Rahmen des § 276 Abs. 2 BGB als auch im Rahmen des Verkehrs pflichtkonzepts betont der Bundesgerichtshof allerdings auch, dass eine generelle Gleichsetzung von DIN-Normen mit dem Sorgfaltsmaßstab des § 276 Abs. 2 BGB bzw. mit Verkehrspflichten nicht angenommen werden könne, da die Gefahr einer Überholung der Norm drohe, das primäre Ziel der DIN-Normen die Standardisierung und nicht der Rechtsgüterschutz und die Sicherheit sei sowie den Normen zum Teil auch ein wertender Akt innewohne.89 Der Richter sei daher nicht generell davon entbunden, im konkreten Fall zu prüfen, ob trotz Normverstoßes die Sorgfalts- bzw. Verkehrspflichten eingehalten wurden bzw. diese trotz Regelbefolgung nicht gewahrt wurden oder ob die DIN-Normen möglicherweise im konkreten Fall nicht als Maßstab geeignet sind.90 Eine abweichende Pflichtenkonkretisierung sei sowohl „nach oben“ als auch „nach unten“ möglich.91 3. VDI-Richtlinien Eine Vielzahl technischer Regeln setzt auch der VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V. in Form der sog. VDI-Richtlinien.92 Der Verein setzt sich aus Ingenieuren, Industrieunternehmen und Vertretern der Wissenschaft zusammen. Erarbeitet werden die Richtlinien von ehrenamtlich handelnden Repräsentanten aus Industrie, Wissenschaft und Verwaltung. Ähnlich wie den DIN-Normen kommt den VDI-Richtlinien im Einzelfall unmittelbare rechtliche Relevanz zu. Vornehmlich entfalten sie aber mittelbare rechtliche Wirkungen. Unmittelbare rechtliche Wirkungen erhalten die VDI-Richtlinien dadurch, dass das Gesetz an einzelnen Stellen explizit auf sie Bezug nimmt. So führt etwa die aufgrund § 48 BImSchG erlassene Verwaltungsvorschrift TA Luft die VDI-Richtlinien neben den DIN-Normen explizit an93 und nimmt damit deren Inhalt in ihren gesetzlichen Appell auf. Mittelbare rechtliche Wirkungen entfal88
BGHZ 103, 338, 341 f. = NJW 1988, 2667. Vgl. nur BGHZ 139, 16, 19 f. = NJW 1998, 2814; BGH NJW 2001, 2019, 2020; siehe auch Wagner, in: MüKo BGB, § 823 Rn. 362 m.w.N. 90 BGH NJW 1984, 801, 802 m.w.N.; Bertrams, Haftung des Aufsichtsrats, S. 197; Grundmann, in: MüKo BGB, § 276 Rn. 64. 91 Vgl. etwa BGH NJW 1987, 2222, 2223 f.; BGH NJW 2004, 1449, 1450; Wagner, in: MüKo BGB, § 823 Rn. 362. 92 Vgl. hierzu Köndgen, AcP 206 (2006), 477, 486 f.; ausführlich Marburger, Regeln der Technik, S. 183 ff. 93 Vgl. TA-Luft, Ziff. 4. 6. 2.7, 5. 2. 6.3 f., 5. 3. 1, 5. 3. 2.2 f. 89
68
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
ten die VDI-Richtlinien, indem sie wie die DIN-Normen von den Gerichten zur Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe herangezogen werden. So spielen die VDI-Richtlinien neben den DIN-Normen namentlich im privaten Nachbarrecht i.S.d. §§ 1004, 906 BGB eine bedeutende Rolle. § 906 Abs. 1 und 2 BGB verweisen zwar für die Beurteilung der Wesentlichkeit einer Immission nur auf Grenz- bzw. Richtwerte, die in Gesetzen, Verordnungen oder allgemeinen Verwaltungsvorschriften aufgrund § 48 BImSchG festgelegt sind. Die Gerichte ziehen aber auch Werte aus privaten Regelwerken heran, um die Wesentlichkeit einer Immision zu bestimmen.94 Werden die normierten Immissionswerte nicht überschritten, hat das zur Folge, dass in der Regel eine unwesentliche und damit duldungspflichtige Beeinträchtigung vorliegt (vgl. § 906 Abs. 1 S. 2 und 3 BGB). Werden sie überschritten, spricht dies umgekehrt für die Annahme einer wesentlichen Beeinträchtigung.95 Ferner wird auf die VDI-Richtlinien wie auch auf die DIN-Normen zur Ausstaffierung der „anerkannten Regeln der Technik“ beim werkvertraglichen Mangelbegriff zurückgegriffen.96 Ebenso werden sie herangezogen, um die verkehrsübliche Sorgfalt und deliktische Verkehrspflichten auszubuchstabieren.97
III. Quantifizierungen als Bestandteil richterlicher Konkretisierungsbefugnis 1. Begriff und Erscheinungsformen Neben den technischen Normen stellen sog. Quantifizierungen eine sehr relevante Fallgruppe privater Regeln dar, die mittelbare Rechtswirkungen entfalten. Bei sog. Quantifizierungen handelt es sich um Konkretisierungen in Form von Zahlenwerten, die von den Gerichten bei der Entscheidungsfindung herangezogen werden.98 Derartige Quantifzierungen werden teilweise hoheitlich erarbeitet, wie etwa die im Rahmen des § 906 Abs. 1 S. 2 und 3 BGB genannten staatlichen Immissionsgrenz- und Richtwerte in Form der TA-Lärm, der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV), der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV), der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (32. BImSchV), der TA-Luft, 94 So anerkennt der BGH beispielsweise ausdrücklich die VDI-Richtlinie 2058 Bl. 1 „Beurteilung von Arbeitslärm in der Nachbarschaft“ als Ergebnis sachverständiger Erfahrung zur Beurteilung von Geräuschimmissionen im Rahmen des § 906 BGB an, BGHZ 46, 35, 40 f. = NJW 1966, 1858; BGHZ 148, 261, 264 = NJW 2001, 3119; vgl. ferner Köndgen, AcP 206 (2006), 477, 487; Marburger, Regeln der Technik, S. 97 f.; Röthel, Normkonkretisierung im Privatrecht, S. 253, 270; Säcker, in: MüKo BGB, § 906 Rn. 52. 95 Säcker, in: MüKo BGB, § 906 Rn. 52 m.w.N. 96 Busche, in: MüKo BGB, § 633 Rn. 18; Peters/Jacoby, in: Staudinger, BGB, § 633 Rn. 179. 97 Wagner, in: MüKo BGB, § 823 Rn. 360 ff. 98 Röthel, Normkonkretisierung im Privatrecht, S. 170, 240.
§ 7 Regelarrangements mit mittelbarer Rechtsverbindlichkeit
69
der Verordnung über elektromagnetische Felder (26. BImSchV) sowie der Verordnung über Luftqualitätsstandards- und Emissionshöchstmengen (39. BImSchV). Teilweise werden derartige Quantifizierungen aber auch von privater Hand oder von der Rechtsprechung selbst entworfen. 2. Berufs- und Standesregeln Den von privater Hand erarbeiteten Quantifizierungen hat sich Taupitz in seiner Habilitationsschrift gewidmet und diese umfassend dargestellt.99 An dieser Stelle soll beispielhaft auf die Regelwerke von Berufsvereinigungen als ein Ausschnitt privater Quantifizierungen eingegangen werden. Hierbei handelt es sich um Regelwerke, die Gremien spezifischer Berufsgruppen für die jeweilige Berufsausübung aufstellen. Die Gerichte stellen etwa im Rahmen des § 2221 BGB für die Bemessung der „angemessenen Vergütung“ des Testamentsvollstreckers für den Fall, dass der Erb lasser nichts anderes bestimmt hat, auf die privaten Richtsätze der Anwalts- und Notarvereinigungen ab, die die Vergütung anhand von Bruchteilen des Nachlasswerts bestimmen.100 Insbesondere die Vergütungsrichtlinien des Vereins für das Notariat in Rheinpreußen, die zuletzt im Jahr 1925 aktualisiert wurden, waren als sog. „Rheinische Tabelle“ lange Zeit Berechnungsgrundlage für eine angemessene Vergütung i.S.d. § 2221 BGB.101 Der Bundesgerichtshof hatte diese Empfehlungen als Berechnungsgrundlage akzeptiert, freilich mit der Einschränkung, dass jeder von den Einzelfallumständen absehende Schematismus zu vermeiden sei.102 Im Jahr 2000 hat der Deutsche Notarverein als Fortentwicklung der „Rheinischen Tabelle“ neue Vergütungsempfehlungen beschlossen, die von den Gerichten nunmehr als Entscheidungsgrundlage rezipiert werden.103 3. Unterhaltstabellen Mitunter werden Quantifizierungen auch von der Rechtsprechung selbst erarbeitet. Hierbei ist zwischen internen und externen Quantifizierungen zu unterscheiden. Eine interne Quantifizierung liegt vor, wenn die Rechtsprechung in Bezug auf einen zu entscheidenden Einzelfall eine eigene Konkretisierungsleistung erbracht hat und diese dann im Sinne eines Konkretisierungspräjudizes weiterge99 Taupitz, Standesordnungen, passim; zu Standesordnungen im Prozess richterlicher Rechtsfindung bei der Auslegung gesetzlicher Generalklauseln ebenda, S. 1099 ff.; zur rechtsquellentheoretischen Einordnung der verschiedenen Standesregeln ebenda, S. 549 ff., 614 ff., 646 ff. 100 Vgl. dazu Röthel, Normkonkretisierung im Privatrecht, S. 274 ff. 101 Abgedruckt ist die „Rheinische Tabelle“ in: RheinNotZ 1925, 64. 102 BGH NJW 1967, 2400 ff. 103 Vgl. dazu Röthel, Normkonkretisierung im Privatrecht, S. 276 f.; W. Zimmermann, in: MüKo BGB, § 2221 Rn. 9 ff.
70
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
führt wird.104 Hierzu zählen beispielsweise der Integritätszuschlag von 30 % im Rahmen des § 251 Abs. 2 BGB bei KfZ-Schäden oder die im Reiserecht herausgebildete Erheblichkeitsschwelle von 50 % im Rahmen der §§ 651e Abs. 1, 651f Abs. 2 BGB.105 Sog. externe judikative Quantifizierungen werden von der Rechtsprechung indes außerhalb einer konkreten Fallentscheidung und nicht von dazu berufenen Spruchkörpern erarbeitet, d.h., die Richter formulieren diese nicht in Ausübung ihrer Amtstätigkeit, sondern auf mehr oder minder privatautonomer Entscheidungsbasis.106 Im Wege eines richterlichen Rezeptionsakts werden sie alsdann bei späteren Judikaten herangezogen. Zu diesen externen judikativen Quantifizierungen gehören namentlich die sog. Unterhaltstabellen zur Bemessung des Ehegatten- und Kindesunterhalts. Die Tabellenwerke dienen dazu, den „angemessenen Unterhalt“ i.S.d. §§ 1361 Abs. 1 S. 1, 1581 Abs. 1, 1610 Abs. 1 BGB bzw. das „Maß des Unterhalts“ i.S.d. § 1578 BGB zu konkretisieren. Sie enthalten Quantifizierungen in Form von Unterhaltsrichtsätzen, Unterhaltsquoten und Selbstbehalten. Insbesondere die Düsseldorfer Tabelle107 und die sie ergänzenden unterhaltsrechtlichen Leitlinien der Familiensenate sämtlicher Oberlandesgerichte108 sind für die Anwalts- und Gerichtspraxis mittlerweile unerlässlich.109 Entstanden ist die Düsseldorfer Tabelle in den 1960er Jahren, als das Landgericht Düsseldorf auf 104 Röthel, Normkonkretisierung im Privatrecht, S. 282; allgemein zur Präjudizienbindung der Rechtsprechung Bydlinski, Juristische Methodenlehre, S. 501 ff.; Larenz/Canaris, Methodenlehre, S. 252 ff.; Ohly, AcP 201 (2001), 1, 2 ff.; Röthel, Normkonkretisierung, S. 91 ff. 105 Ausführlich Röthel, Normkonkretisierung im Privatrecht, S. 241 ff. m.w.N. 106 In Bezug auf die Düsseldorfer Tabelle Diedrich, Unterhaltsberechnung nach Quoten und Tabellen, S. 79 f.: Die Unterhaltskommission des Deutschen Familiengerichtstages (DFGT e.V.) ist ein bürgerlich-rechtlicher Verein und hat mit der organisierten Justiz nichts zu tun. Die Unterhaltskommission hat sich selbst institutionalisiert, ihre Mitglieder selbst rekrutiert und ihre Aufgaben selbst bestimmt – ein privater Gesprächskreis von Unterhaltsfachleuten. 107 Die Düsseldorfer Tabelle 2016 (Stand: 01. 01. 2016) ist abrufbar unter: http://www. olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_tabelle/Tabelle-2016/Duesseldorfer-Tabelle-1-Januar-2016.pdf (zuletzt abgerufen am 12. 10. 2016). 108 Auf den Homepages der Oberlandesgerichte können die Leitlinien in der jeweils gültigen Fassung abgerufen werden. Die Süddeutschen Leitlinien (Unterhaltsrechtliche Leitlinien der Familiensenate in Süddeutschland, Stand: 01. 01. 2015), die von den Oberlandesgerichten Bamberg, Karlsruhe, München, Nürnberg, Stuttgart und Zweibrücken einheitlich verwendet werden, sind abrufbar unter: http://www.olg-stuttgart.de/pb/site/jum2/ get/documents/jum1/JuM/OLG%20Stuttgart/SüdL/SüdL2015.pdf (zuletzt abgerufen am 12. 10. 2016); zu den Leitlinien des OLG Düsseldorf und der anderen OLGs H. Scholz, in: FS 100 Jahre OLG Düsseldorf, S. 265, 286 ff. Zu den inzwischen vielfältigen und praxisrelevanten Tabellen und Leitlinien im Familienrecht vgl. Schürmann (Hrsg.), Tabellen zum Familienrecht, passim. 109 Von einzelnen Privaten alternativ erarbeitete Regelwerke zur Unterhaltsbemessung (vgl. etwa Ehlert, FamRZ 1980, 1083, 1085 f.; Gröning, FamRZ 1983, 331 ff.; Rassow, Fam-
§ 7 Regelarrangements mit mittelbarer Rechtsverbindlichkeit
71
Drängen ortsansässiger Rechtsanwälte eine „Tabelle über monatliche Unterhaltsrichtsätze“ veröffentlichte.110 Mittlerweile beruht die Düsseldorfer Tabelle auf Koordinierungsgesprächen zwischen Richtern der Familiensenate der Oberlandesgerichte Düsseldorf, Köln, Hamm, der Unterhaltskommission des Deutschen Familiengerichtstages e.V. sowie einer Umfrage bei den übrigen Oberlandesgerichten. Der Rechtsnatur nach handelt es sich bei der Düsseldorfer Tabelle und den sie ergänzenden unterhaltsrechtlichen Leitlinien um abstrakte und einzelfallunabhängige Entscheidungssätze und nicht um richterliche Einzelentscheidungen; sie weisen damit eine gewisse Normähnlichkeit auf.111 Mangels staatlichen Anerkennungsakts können die Regeln aber lediglich mittelbare Rechtswirkungen entfalten. Insbesondere haben die Oberlandesgerichte die Tabellenwerke eigenmächtig ins Leben gerufen und formulieren sie ohne jedwede staatliche Flankierung. Diese Art der Regelaufstellung ist nicht etwa als Spruchkompetenz in den Prozessordnungen vorgesehen.112 Die erarbeiteten Regelwerke stellen aus sich heraus daher lediglich unverbindliche informelle Justizakte dar.113 Gleichwohl werden die Düsseldorfer Tabelle und die sie ergänzenden unterhaltsrechtlichen Leitlinien der Familiensenate sämtlicher Oberlandesgerichte von den Gerichten als Orientierungshilfe herangezogen, um den angemessenen Unterhalt zu bemessen.114 Insoweit gewährleisten sie eine, wenn auch nicht überregional vollRZ 1980, 541 ff.) finden in der Praxis wenig Beachtung, vgl. Gernhuber, FamRZ 1983, 1069, 1073. 110 LG Düsseldorf, DRiZ 1962, 251; vertiefend zur Entstehung Köhler, in: FS Rebmann, 569 ff.; H. Scholz, in: FS 100 Jahre OLG Düsseldorf, S. 265, 268 ff.; ders., FamRZ 1993, 125, 126 f. 111 Vgl. Röthel, Normkonkretisierung im Privatrecht, S. 286 ff.; zur im Detail umstrittenen Rechtsnatur vgl. Gernhuber, FamRZ 1983, 1069, 1072: normähnliches Richterwerk sui generis; H. Scholz, in: FS 100 Jahre OLG Düsseldorf, S. 265, 288 f. Klingelhöffer, ZRP 1994, 383 ff. erwägt eine Einordnung der Düsseldorfer Tabelle als Gewohnheitsrecht; kritisch zur Verlagerung der Normsetzungskompetenzen auf die Judikative Diedrich, Unterhaltsberechnung nach Quoten und Tabellen, S. 72 ff. 112 Vgl. Röthel, Normkonkretisierung im Privatrecht, S. 289. Eine ausdrückliche Befugnis zu richterlicher Rechtsfortbildung findet sich nicht im Grundgesetz. Der Gesetzgeber hat den Großen Senaten der obersten Bundesgerichte aber zumindest eine begrenzte Ermächtigung zur richterlichen Rechtsfortbildung erteilt, vgl. §§ 132 Abs. 4 GVG, 45 Abs. 4 ArbGG, 11 Abs. 4 VwGO, 11 Abs. 4 FGO, 41 Abs. 4 SGG; zur richterlichen Rechtsfortbildung aus verfassungsrechtlicher Sicht vgl. Hillgruber, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 97 Rn. 63 ff. (Stand: 77. EL 2016); Ossenbühl, in: Isensee/P. Kirchhof (Hrsg.), HStR, Bd. V, § 100 Rn. 50 ff.; zu den Methoden richterlicher Rechtsfortbildung Larenz/Canaris, Methodenlehre, S. 187 ff. 113 Vgl. BGH NJW 1984, 1458 f.; Gernhuber, FamRZ 1983, 1069, 1073; Voppel, in: Staudinger, BGB, § 1361 Rn. 206. 114 Vgl. BGH NJW 1984, 1458 f.; BGH FamRZ 1990, 1085, 1086; BGH NJW 2000, 3140, 3141; Born, in: MüKo BGB, § 1610 Rn. 81: Richtlinie; Köhler, in: FS Rebmann, S. 569, 589: Informationsmittel.
72
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
kommen einheitliche,115 doch aber gleichmäßige, vorhersehbare und praktikable Rechtsanwendung.116 Der Bundesgerichtshof billigt diese Typisierung im Interesse einer möglichst gleichmäßigen Behandlung gleicher Lebenssachverhalte unter der Voraussetzung, dass gewährleistet ist, dass Besonderheiten des Einzelfalls entsprechend gewürdigt werden.117 4. Keine Quantifizierungen im engeren Sinne durch Tatsachen- und Entscheidungssammlungen Nicht zu den Quantifizierungen im eigentlichen Sinne zählen bloße Tatsachenund Entscheidungssammlungen wie etwa Schmerzensgeldtabellen,118 die Tabelle zur Berechnung der Nutzungsausfallentschädigung für Kraftfahrzeuge i.S.d. § 251 BGB (sog. „Schwacke“-Liste)119 oder die privaten Tabellen über den Arbeitszeitbedarf bei der Haushaltsführung, die zur Bemessung des Haushaltsführungsschadens im Rahmen der §§ 844 Abs. 2, 843 Abs. 1 BGB herangezogen werden.120 Auch bei der durch § 558a BGB eröffneten Bezugnahme auf kommunale und verbandliche Mietspiegel handelt es sich um eine bloße Sammlung von Datenmaterial, nämlich der Höhe der Vergleichsmieten. Derartige Aufstellungen sind individuelle und informell aufgestellte Informationssammlungen, die keine wertenden Festsetzungen beinhalten und daher auch nicht zur Konkretisierung, d.h. zur normativen Ausfüllung unbestimmter Rechtsbegriffe herangezogen werden können. Sie sind mit anderen Worten eine bloße Auflistung und Zusammenstellung tatsächlicher Erhebungen.121 Im Einzelfall bilden sie zwar ebenfalls eine wertvolle Entscheidungshilfe;122 den für die Konkretisierung erforderlichen Anspruch auf die Bildung von Regeln lassen sie aber vermissen, da sie sich auf die Wiedergabe von Einzelentscheidungen beschränken und keine fallübergreifenden, generellen Regelinhalte aufstellen.123 115 Vgl. Klingelhöffer, ZRP 1994, 383, 384, der zu Recht differenziert zwischen der Düsseldorfer Tabelle, die für sich in Anspruch nehmen kann, überwiegend angewandt zu werden, und den Leitlinien der einzelnen Oberlandesgerichte, die nur in den jeweiligen OLG-Bezirken wirken. 116 Röthel, Normkonkretisierung im Privatrecht, S. 286. 117 BGH NJW 2000, 3140, 3141; BGHZ 178, 79 Rn. 17 ff. = NJW 2008, 3562; BGH FamRZ 2012, 1048 Rn. 18. 118 Vgl. etwa die Tabelle von Hacks/Wellner/Häcker, Schmerzensgeld-Beträge, passim. 119 Abgedruckt ist die von Sanden/Danner entwickelte Tabelle zur Berechnung der Nutzungsausfallentschädigung für Kraftfahrzeuge i.S.d. § 251 BGB in NZV-Beilage 1/2012. 120 Vgl. hierzu etwa das von der Rechtsprechung anerkannte Tabellenwerk von SchulzBorck/Hofmann, fortgeführt von Pardey, Der Haushaltsführungsschaden, Tabelle 1. 121 Vgl. Röthel, Normkonkretisierung im Privatrecht, S. 264 ff. m.w.N. 122 Vgl. etwa die von Musielak, VersR 1982, 613, 616 durchgeführte Umfrage aus dem Jahr 1980, nach der 95,5 % der Richter Schmerzensgeldtabellen für eine wichtige Orientierungshilfe bei der Bemessung des Schmerzensgelds halten. 123 So in Bezug auf Schmerzensgeldtabellen Röthel, Normkonkretisierung im Privatrecht, S. 267 f.
§ 7 Regelarrangements mit mittelbarer Rechtsverbindlichkeit
73
IV. Regelsetzung durch das IDW Aus dem Bereich des Wirtschaftsrechts bilden die Prüfungsstandards des Insti tuts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) eine klassische Fallgruppe von Regeln mit mittelbaren Rechtswirkungen. Das IDW ist eine Vereinigung der deutschen Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfergesellschaften, die neben der Wirtschaftsprüferkammer den Berufsstand nach innen organisiert und nach außen die Interessen des Wirtschaftsprüferberufs repräsentiert. Insoweit sieht es das IDW insbesondere als seine Aufgabe an, „für einheitliche Grundsätze der unabhängigen, eigenverantwortlichen und gewisssenhaften Berufsausübung einzutreten und deren Einhaltung durch die Mitglieder sicherzustellen“.124 Hierzu erlassen die Fachausschüsse des IDW, die mit IDW-Mitgliedern besetzt sind, fakultativ aber auch mit Hochschullehrern und anderen externen Sachverständigen besetzt werden können (vgl. § 12 Abs. 3 IDW-Satzung), u.a. sog. IDW Prüfungsstandards (IDW PS),125 die die Berufsauffassung der Wirtschaftsprüfer zu fachlichen Fragen der Rechnungslegung und Prüfung sowie zu sonstigen Gegenständen und Inhalten der beruflichen Tätigkeit darlegen und von den Mitgliedern des IDW grundsätzlich zu beachten sind (vgl. § 4 Abs. 9 S. 1 IDW-Satzung). Mangels staatlichen Anerkennungsakts kommt den Regeln des IDW zwar keine Rechtsnormqualität zu.126 Für die Vereinsmitglieder erlangen die IDW PS aber durch die Verpflichtung in der Satzung eine verbandsinterne unmittelbare Bindungswirkung.127 Daneben entfalten die IDW PS sowohl für Vereinsmitglieder als auch für Nichtmitglieder mittelbare Rechtswirkungen, indem die Gerichte diese bei der Entscheidungsfindung im Rahmen prüfungstechnischer Sachverhalte heranziehen. Hintergrund ist, dass es dem Gesetzgeber nicht möglich ist, alle mit der Durchführung der Abschlussprüfung zusammenhängenden Fragen gesetzlich zu regeln, und er daher in den Vorschriften zur Abschlussprüfung häufig mit unbestimmten Rechtsbegriffen operiert („gewissenhafte“, „sorgfältige“ und „unparteiische“ Prüfung, vgl. §§ 323 Abs. 1 S. 1, 317 Abs. 1 S. 3, 320 Abs. 2 S. 1 und 3 HGB).128 Da alternative Leitlinien fehlen bzw. es an einer für die Spruchpraxis handhabbaren Definition der Begriffe mangelt, greifen die Gerichte dann wiederum auf die IDW PS als Entscheidungshilfe zur Bestimmung des Pflichtenkreises des Abschlussprüfers zurück.129 So hat etwa das Landgericht Frankfurt am Main 124
Vgl. § 2 Abs. 2 S. 1 b der Satzung des IDW. IDW PS sind abgedruckt in: IDW (Hrsg.), IDW Prüfungsstandards, IDW Stellungnahmen zur Rechnungslegung, Bd. 1. 126 Vgl. Ebke, in: MüKo HGB, § 323 Rn. 32; Gehringer, WPg 2003, 849, 852 f.; Hommelhoff/Mattheus, in: FS Röhricht, S. 897, 911. 127 Böttcher, NZG 2011, 1054, 1056 f.; Hommelhoff/Mattheus, in: FS Röhricht, S. 897, 911; Spindler, in: MüKo AktG, § 91 Rn. 33. 128 Ebke, in: MüKo HGB, § 323 Rn. 26. 129 Vgl. etwa LG Frankfurt am Main BB 1997, 1682, 1684; aus der Literatur vgl. Biener, in: FS Goerdeler, S. 45, 49; Ebke, in: MüKo HGB, § 323 Rn. 32; Gehringer, WPg 2003, 125 Die
74
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
den Pflichtenkreis des Abschlussprüfers unter ausdrücklicher Bezugnahme auf Vorgaben des IDW bestimmt.130
V. Der Deutsche Corporate Governance Kodex 1. Grundlagen a) Entstehungsgeschichte Auf dem Gebiet des Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrechts hat die private Regelsetzung zuletzt vor allem im Zusammenhang mit dem Deutschen Corporate Governance Kodex besondere Aufmerksamkeit erfahren. Im Anschluss an spektakuläre Unternehmenszusammenbrüche ist in den 1990er Jahren eine umfangreiche Diskussion über die Corporate Governance von Unternehmen entstanden,131 d.h. über eine verantwortungsbewusste, auf langfristige Wertschöpfung ausgerichtete Unternehmensführung und -kontrolle.132 In der Folge wurden in zahlreichen Industrienationen Kodizes zur Corporate Governance geschaffen, etwa der britische „Combined Code“133 im Jahr 1999 und die „OECD Principles of Corporate Governance“134 im Jahr 2000. Mit der Verwendung dieser Regulierungsinstrumente wurde darauf gesetzt, eine Verbesserung der Corporate Governance nicht durch gesetzliche Regelungen, sondern auf die Weise zu erreichen, dass sich die Unternehmen freiwillig Verhaltenskodizes unterwerfen. Den Anreiz dafür sollten die Unternehmen dadurch erhalten, dass eine funktionierende Unternehmensführung und -kontrolle sich positiv auf den Unternehmenswert und damit auf den Anlagewert des einzelnen Investors auswirkt und umgekehrt bei 849, 853; kritisch bezogen auf die Norminterpretation des § 107 Abs. 3 S. 2 AktG Giebeler/ Jaspers, Risikomanagement, S. 30 f. Daneben stellen die IDW PS auch über das Rechnungslegungsrecht hinaus Bezugsgrößen dar, etwa i.R.d. § 91 Abs. 2 und § 107 Abs. 3 S. 2 AktG sowie der ertragswertorientierten Unternehmensbewertung und der Bestimmung von Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit nach § 15a InsO. 130 LG Frankfurt am Main BB 1997, 1682, 1684; kritisch Ebke, BB 1997, 1731, 1733: Berufsgrundsätze füllen den Pflichtenkreis des Abschlussprüfers nicht aus, sondern stellen lediglich wichtige Entscheidungshilfen dar. 131 Vgl. zur Corporate-Governance-Bewegung Hanfland, Haftungsrisiken, S. 19 ff.; Stenger, Kodex und Entsprechenserklärung, S. 30 ff.; v. Werder, in: Kremer u.a. (Hrsg.), DCGK, Vorbem. Rn. 3 ff. 132 Zur Definition vgl. etwa Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 298; Hanfland, Haftungsrisiken, S. 32 ff.; Uwe H. Schneider, DB 2000, 2413 f.; Stenger, Kodex und Entsprechenserklärung, S. 28 ff. 133 Der britische Combined Code ist abruf bar unter: https://www.frc.org.uk/OurWork/Codes-Standards/Corporate-governance/UK-Corporate-Governance-Code.aspx (zuletzt abgerufen am 12. 10. 2016). 134 Die OECD Principles of Corporate Governance sind abrufbar unter: http://www.oecd. org/daf/ca/Corporate-Governance-Principles-ENG.pdf (zuletzt abgerufen am 12. 10. 2016).
§ 7 Regelarrangements mit mittelbarer Rechtsverbindlichkeit
75
Nichtbeachtung der Corporate-Governance-Grundsätze eine Abstrafung durch den Kapitalmarkt droht.135 In Deutschland wurde ein Regulierungsbedürfnis aufgrund der Tatsache, dass das Recht der Kapitalgesellschaften hier im Gegensatz zum angloamerikanischen Raum stark reguliert ist, zunächst nicht gesehen.136 Auf Druck des Kapitalmarkts und weil das deutsche Corporate-Governance-System ausländischen Kapitalanlegern schwer zugänglich war, wurden aber zunehmend ergänzend zu den gesetzlichen Vorgaben nationale Prinzipien zur Unternehmensführung gefordert.137 Unabhängig voneinander entstanden zunächst zwei private Initiativkreise, die jeweils einen Kodex entwarfen: die „Corporate-Governance-Grundsätze der Grundsatzkommission Corporate Governance“138 und der „German Code of Corporate Gov ernance“ des Berliner Initiativkreises German Code of Corporate Governance139. Daneben existierten Richtlinien von Investoren und unternehmensinterne Grundsätze.140 Angesichts dieser nebeneinander bestehenden und zum Teil erheblich voneinander abweichenden Corporate Governance-Regime wurde der Ruf nach einem einheitlichen Kodex lauter.141 Hinzu kamen Insolvenzen deutscher Unternehmen, die Defizite bei der Kontrolle der Unternehmensleitung aufzeigten.142 Im Mai 2000 setzte die Bundesregierung schließlich die Expertengruppe „Corporate Governance: Unternehmensführung – Unternehmenskontrolle – Modernisierung des Aktienrechts“ (sog. Baums-Kommission) ein, die das System der Corporate Governance untersuchen und Vorschläge zur Verbesserung von Transparenz und Kontrolle erarbeiten sollte. Das Ziel war „eine Neujustierung des Verhältnisses von staatlichem Ordnungsrahmen und Instrumenten der Selbstregulierung“, mit deren Hilfe der Finanzplatz Deutschland gestärkt, die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen verbessert und die Chancen der Internationalisierung der Märkte sowie der rasanten Entwicklung von Informations- und Kommunikations135 Vgl. Claussen/Bröcker, AG 2000, 481; Uwe H. Schneider/Strenger, AG 2000, 106; Stenger, Kodex und Entsprechenserklärung, S. 32. 136 Vgl. Berg/Stöcker, WM 2002, 1569, 1570; Uwe. H. Schneider/Strenger, AG 2000, 106, 107 f.; Seibert, BB 2002, 581. 137 Vgl. Stenger, Kodex und Entsprechenserklärung, S. 32 f. m.w.N. 138 Abgedruckt und erläutert bei Uwe H. Schneider/Strenger, AG 2000, 106, 109 ff.; kritische Auseinandersetzung bei Claussen/Bröcker, AG 2000, 481, 486 ff.; umfassend zur Grundsatzkommission Corporate Governance Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 295 ff. 139 Abgedruckt in DB 2000, 1573 ff.; umfassend hierzu Peltzer/v. Werder, AG 2001, 1 ff.; Uwe H. Schneider, DB 2000, 2413 ff. 140 Vgl. die Nachweise bei Seibt, AG 2003, 465, 468 Fn. 32; M. Weiss, Hybride Regulierungsinstrumente, S. 65. 141 Vgl. dazu etwa Seidel, ZIP 2004, 285, 286 f. 142 Vgl. die Fälle Balsam AG, Bremer Vulkan Verbund AG, Metallgesellschaft AG und vor allem Philipp Holzmann AG, ausführlich dazu Stenger, Kodex und Entsprechenserklärung, S. 33 f.
76
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
technologien genutzt werden sollten.143 Als Ergebnis ihrer Beratungen empfahl die Baums-Kommission die Einführung eines bundeseinheitlichen Kodex und gab konkrete Anregungen hierzu.144 Die Politik leistete dieser Empfehlung Folge. Am 06. 09. 2001 setzte das Bundesministerium der Justiz die mit herausragenden Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und des öffentlichen Lebens besetzte Regierungskommission „Deutscher Corporate Governance Kodex“ ein, um einen deutschen Corporate Govern ance Kodex zu erarbeiten (sog. Cromme-Kommission). Diese legte der Bundesministerin der Justiz am 26. 02. 2002 den Deutschen Corporate Governance Kodex in seiner ersten Fassung vor. Am 30. 09. 2002 wurde der Kodex nach einer Rechtskontrolle durch das Bundesministerium der Justiz im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Seitdem kommt die Kodexkommission als ständige Einrichtung mindestens einmal jährlich zusammen, um den Kodex im Hinblick auf nationale und internationale Entwicklungen auf den Prüfstand zu stellen und gegebenenfalls anzupassen.145 Die jeweiligen Änderungen werden alsdann vom Bundesministerium der Justiz nach einer Rechtskontrolle im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemacht.146 b) Regelungsmechanismus Der Deutsche Corporate Governance Kodex richtet sich an deutsche börsennotierte Aktiengesellschaften. Er enthält drei Arten von Vorschriften. Zunächst beinhaltet er Vorschriften, die die in Deutschland für die Corporate Governance maßgebliche Gesetzeslage abbilden und für (ausländische) Investoren einen kompakten und verständlichen Überblick über den bestehenden Rechtsrahmen der Corporate Governance geben.147 Daneben enthält der Kodex durch den Begriff „sollte“ ge143 So ausdrücklich die Mitteilung des Bundeskanzleramts vom 21. 06. 2000, abgedruckt in: Bericht der Regierungskommission Corporate Governance, BT-Drucks. 14/7515, S. 3. 144 Vgl. Baums, Bericht der Regierungskommission, Rn. 7, 16 f. 145 Vgl. Ziff. 1 (Präambel) des Kodex (Stand: 05. 05. 2015). Die jeweils aktuelle Fassung des Deutschen Corporate Governance Kodex ist abrufbar unter: http://www.dcgk.de/de/kodex.html (zuletzt abgerufen am 12. 10. 2016). 146 Zur Rechtmäßigkeitskontrolle vgl. Lutter, in: KölnKomm AktG, § 161 Rn. 13 f.; Seibert, BB 2002, 581, 582; Spindler, in: K. Schmidt/Lutter (Hrsg.), AktG, § 161 Rn. 7; für eine Zweckmäßigkeitskontrolle Seidel, ZIP 2004, 285, 288. 147 Vgl. Seibert, BB 2002, 581; Seibt, AG 2002, 249, 250; Stenger, Kodex und Entsprechenserklärung, S. 40; Ulmer, ZHR 166 (2002), 150, 160; M. Weiss, Hybride Regulierungsinstrumente, S. 78. Der ehemalige Vorsitzende der Kodexkommission Gerhard Cromme versteht den Kodex als „Verständigungspapier“, vgl. Pressekonferenz nach Übergabe des Deutschen Corporate Governance-Kodex, S. 3, abrufbar unter: http://www.dcgk.de/de/kommission/die-kommission-im-dialog/deteilansicht/ausfuehrungen-von-dr-gerhard-cromme. html (zuletzt abgerufen am 12. 10. 2016). Zuletzt standen die Vorschriften des gesetzesdarstellenden Teils in der Kritik, das geltende Recht zum Teil nicht korrekt wiederzugeben, indem sie es unzutreffend auslegten und interpretierten, vgl. Hoffmann-Becking, ZIP 2011, 1173, 1175 (These 7); ders., in: FS Hüffer, S. 337, 345 ff.; relativierend Krieger, ZGR 2012, 202, 207; für einen Verzicht auf die Wiedergabe zwingenden Gesetzesrechts vgl. Haber-
§ 7 Regelarrangements mit mittelbarer Rechtsverbindlichkeit
77
kennzeichnete Anregungen, deren Beachtung durch die Kodexkommission als wünschenswert angesehen wird.148 Den Kern des Deutschen Corporate Governance Kodex bilden die sog. Empfehlungen, die im Text des Kodex durch das Wort „soll“ gekennzeichnet sind. Hierbei handelt es sich um Vorgaben, die von der Kodexkommission für eine gute Corporate Governance als wesentlich angesehen werden („best practice“). Auch diese Vorgaben sollen für die Unternehmen zwar nicht zwingend sein. Der Gesetzgeber schreibt in § 161 AktG aber vor, dass Vorstand und Aufsichtsrat einer börsennotierten Gesellschaft jährlich zu erklären haben, in welchem Umfang den Empfehlungen des Kodex entsprochen wurde und wird oder welche Empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden.149 Sofern von Kodexempfehlungen abgewichen wird, ist dies zu begründen (sog. Comply-or-explain-Mechanismus).150 Die jeweilige Entsprechenserklärung ist auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft öffentlich zugänglich zu machen (vgl. § 161 Abs. 2 AktG), wobei der zukunftsgerichtete Teil der Entsprechenserklärung unterjährig abgeändert werden kann.151 c) Privates oder staatliches Regelwerk? aa) Meinungsstand Angesichts der staatlichen Beteiligung beim Prozess der Regelaufstellung ist umstritten, ob der Deutsche Corporate Governance Kodex mit seinen Regelungen als staatliches oder privates Regelwerk einzuordnen ist. Einigkeit besteht lediglich sack, Gutachten 69. DJT, E 58 m.w.N.; ähnlich Stenger, Kodex und Entsprechenserklärung, S. 49; gegen eine Streichung und für eine räumliche Trennung der drei Arten von Regeln Bachmann, AG 2012, 565, 566; Roth, NZG 2012, 881, 884. 148 Für eine Abschaffung dieser Kategorie Habersack, Gutachten 69. DJT, E 58; Stenger, Kodex und Entsprechenserklärung, S. 47. 149 Zum Vergangenheits-, Gegenwarts- und Zukunftsbezug der Entsprechenserklärung vgl. Begr. RegE TransPuG, BT-Drucks. 14/8769, S. 22; Berg/Stöcker, WM 2002, 1569, 1572 f.; Borges, ZGR 2003, 508, 525; Ettinger/Grützediek, AG 2003, 353, 354; Hanfland, Haftungsrisiken, S. 109 ff.; Kiethe, NZG 2003, 559, 561; Koch, in: Hüffer/Koch, AktG, § 161 Rn. 14, 20; Leyens, in: GroßKomm AktG, § 161 Rn. 67; Lutter, in: KölnKomm AktG, § 161 Rn. 27 ff.; ders., ZHR 166 (2002), 523, 529 f.; Seibert, BB 2002, 581, 583; Semler/ Wagner, NZG 2003, 553, 554; Stenger, Kodex und Entsprechenserklärung, S. 151 ff.; Ulmer, ZHR 166 (2002), 150, 170 f.; Vetter, NZG 2008, 121, 122; ders., NZG 2009, 561, 562. Die Zukunftsgerichtetheit der Erklärung wurde in der Literatur anfangs vereinzelt in Zweifel gezogen, vgl. Ederle, NZG 2010, 655, 657 f.; Kollmann, WM 2003, Sonderbeilage Nr. 1, S. 3, 7; Seibt, AG 2002, 249, 251; ders., AG 2003, 465, 467 f.; Schüppen, ZIP 2002, 1269, 1273. 150 Die Verpflichtung, das Abweichen von Kodexempfehlungen zu begründen, führte der Gesetzgeber erst nachträglich im Zuge des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes ein, vgl. Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (BilMoG) vom 25. 05. 2009, BGBl. I, S. 1102, in Kraft getreten am 29. 05. 2009. 151 Umfassend zur unterjährigen Aktualisierungspflicht Stenger, Kodex und Entsprechenserklärung, S. 159 ff. m.w.N.
78
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
insoweit, als die Vorgaben des Kodex kein klassisches Gesetzesrecht im formellen oder materiellen Sinne darstellen.152 Der Kodex wurde weder von einem demokratisch legitimierten staatlichen Gremium in dem dafür vorgesehenen Gesetzgebungsverfahren i.S.d. Art. 76 ff. GG als Gesetz erlassen noch hat die Bundesregierung den Weg eines Verordnungserlasses eingeschlagen. § 161 AktG kann nicht als Verordnungsermächtigung i.S.d. Art. 80 Abs. 1 GG angesehen werden, da die Norm nicht die Aufstellung von Regeln als solche legitimiert, sondern an bereits bestehende Kodexvorgaben anknüpft.153 Herrschende Lehre und Rechtsprechung stufen den Deutschen Corporate Gov ernance Kodex als privates Regelwerk ein.154 Hierfür spreche, dass die Kodexkommission ausschließlich mit Vertretern der Wissenschaft und Wirtschaft besetzt sei und ihr keine Regierungsvertreter, Politiker oder in sonstigem Dienstverhältnis zum Staat stehende Personen angehörten.155 Die Bundesregierung habe lediglich ein Gastrecht, den Kommissionssitzungen beizuwohnen.156 Auch laufe die Arbeit der Kodexkommission vollkommen unabhängig ab, d.h. ohne sonstige Mitwirkung oder Einflussnahmemöglichkeit seitens des Staates.157 Es bestehe für das Tätig-
152 Vgl. BGHZ 180, 9 Rn. 25 f. = NJW 2009, 2207 (Kirch/Deutsche Bank); OLG München NZG 2009, 508, 509; Bachmann, AG 2011, 181, 191; Goette, in: FS Hüffer, S. 225; Hanfland, Haftungsrisiken, S. 58 ff.; Koch, in: Hüffer/Koch, AktG, § 161 Rn. 3; Lutter, in: FS Hopt, S. 1025; Mülbert/Wilhelm, ZHR 176 (2012), 286, 314 ff.; Seibt, AG 2002, 249, 250; Spindler, in: K. Schmidt/Lutter (Hrsg.), AktG, § 161 Rn. 7; Stenger, Kodex und Entsprechenserklärung, S. 79; Ulmer, ZHR 166 (2002), 150, 159; Vetter, NZG 2008, 121, 123; Weber-Rey/Buckel, AG 2011, 845; M. Weiss, Hybride Regulierungsinstrumente, S. 89. 153 Mülbert/Wilhelm, ZHR 176 (2012), 286, 316 f.; Wernsmann/Gatzka, NZG 2011, 1001, 1007. 154 OLG München NZG 2009, 508, 509; LG München I NZG 2008, 150, 151 m. Anm. Vetter, NZG 2008, 121, 123; Claussen/Bröcker, DB 2002, 1199; Ettinger/Grützediek, AG 2003, 353, 355; Habersack, Gutachten 69. DJT, E 45; Kiethe, NZG 2003, 559, 560; Kirschbaum/Wittmann, JuS 2005, 1062, 1064 f.; Koch, in: Hüffer/Koch, AktG, § 161 Rn. 3; Kort, in: FS K. Schmidt, S. 945, 951 f.; Lutter, in: KölnKomm AktG, § 161 Rn. 11; Seibert, BB 2002, 581, 582; Seibt, AG 2002, 249, 250; Spindler, in: K. Schmidt/Lutter (Hrsg.), AktG, § 161 Rn. 7, 11; Tödtmann/Schauer, ZIP 2009; 995, 996; Ulmer, ZHR 166 (2002), 150, 159; Waclawik, ZIP 2011, 885, 892; Weber-Rey/Buckel, AG 2011, 845 ff.; v. Werder, in: Kremer u.a. (Hrsg.), DCGK, Vorbem. Rn. 22. 155 Seibert, BB 2002, 581, 582; v. Werder, in: Kremer u.a. (Hrsg.), DCGK, Vorbem. Rn. 18 ff. 156 v. Werder, in: Kremer u.a. (Hrsg.), DCGK, Vorbem. Rn. 20. 157 Lutter, in: KölnKomm AktG, § 161 Rn. 14; v. Werder, in: Kremer u.a. (Hrsg.), DCGK, Vorbem. Rn. 20; dies wird von der Gegenansicht häufig bestritten, vgl. Mülbert/Wilhelm, ZHR 176 (2012), 286, 316; Seidel, ZIP 2004, 285, 287 f.; Wandt, ZIP 2012, 1443 ff.; M. Weiss, Hybride Regulierungsinstrumente, S. 99. Die Kommission lasse sich häufig von der Politik für ihre Zwecke einspannen, sei es im Hinblick auf die unternehmerische Mitbestimmung oder die höhere Beteiligung von Frauen in Aufsichtsräten, vgl. dazu Peltzer, NZG 2011, 281, 284 f.
§ 7 Regelarrangements mit mittelbarer Rechtsverbindlichkeit
79
werden weder ein gesetzlicher Auftrag158 noch seien die Errichtung des Gremiums und das Verfahren der Er- und Überarbeitung der Kodexvorgaben staatlicherseits determiniert. Eine beachtliche Zahl von Stimmen in der Literatur versteht den Kodex demgegenüber als staatliches Regelwerk159 und plädiert insoweit überwiegend für eine Einordnung als schlicht hoheitliches Verwaltungs- bzw. staatliches Informationshandeln.160 Für eine staatliche Einordnung spreche, dass die Bundesregierung die Kodexkommission eingesetzt, sie mit der inhaltlichen Ausarbeitung des Kodex beauftragt und auch die einzelnen Mitglieder in ihr Amt berufen habe.161 Auch könne die Bundesregierung die Kodexkommission jederzeit auflösen und ihre Mitglieder aus dem Amt entlassen.162 Dies alles verleihe dem Gremium gegenüber rein privaten Kodex-Initiativen eine besondere Autorität.163 Die Kommissionsmitglieder würden eine durch öffentliches Recht geprägte, exklusive Beraterfunktion von Regierung und Parlament wahrnehmen,164 woraus sich auch die Pflicht der Kommissionsmitglieder ergebe, bei ihrer Arbeit das öffentliche Interesse zu beachten.165 Weiteres Indiz für eine staatliche Zuordnung des Kodex sei die Bezeichnung der Kommission als „Regierungskommission“166 sowie die zeitweilige Führung des Vgl. etwa Ulmer, ZHR 166 (2002), 150, 159. Heintzen, ZIP 2004, 1933 ff.; Hoffmann-Becking, in: FS Hüffer, S. 337, 339 f.; ders., ZIP 2011, 1173, 1174; Hohl, Private Standardsetzung, S. 43 ff., 53 f.; Mülbert, Arbeitspapiere 2012, S. 28 f.; ders./Wilhelm, ZHR 176 (2012), 286, 315 f.; Seidel, ZIP 2004, 285, 289; ders., NZG 2004, 1095 ff.; Stenger, Kodex und Entsprechenserklärung, S. 85; M. Weiss, Hybride Regulierungsinstrumente, S. 103; Wernsmann/Gatzka, NZG 2011, 1001, 1003 f. Zwischen den Polen stehen Stimmen, die den Kodex als hybrides Regulierungsinstrument verstehen, so Spindler, NZG 2011, 1007, 1008; zu Recht kritisch Stenger, Kodex und Entsprechenserklärung, S. 85: Kategorie verzichtbar. Auch M. Weiss, Hybride Regulierungsinstrumente, S. 100 ff. versteht den Kodex als hybrides Regelwerk, hält letztlich aber zu Recht eine Einordnung in den staatlichen oder privaten Bereich für erforderlich (S. 103, 51). 160 Heintzen, ZIP 2004, 1933, 1934; Hoffmann-Becking, in: FS Hüffer, S. 337, 340; Hohl, Private Standardsetzung, S. 43 f.; Mülbert/Wilhelm, ZHR 176 (2012), 286, 317 f.; Wernsmann/Gatzka, NZG 2011, 1001, 1004 f.; dagegen Hommelhoff/M. Schwab, in: Hommelhoff u.a. (Hrsg.), Handbuch Corporate Governance, S. 71, 82; Keßler, Strafrechtliche Aspekte, S. 99 f.; Seidel, NZG 2004, 1095; kritisch auch Weber-Rey/Buckel, AG 2011, 845, 847: Vergleichbarkeit mehr als zweifelhaft. 161 Maßgeblich hierauf abstellend Hohl, Private Standardsetzung, S. 44; Mülbert/Wilhelm, ZHR 176 (2012), 286, 315; Stenger, Kodex und Entsprechenserklärung, S. 85; Wernsmann/Gatzka, NZG 2011, 1001, 1003. 162 Stenger, Kodex und Entsprechenserklärung, S. 85. 163 Seidel, ZIP 2004, 285, 286; Heintzen, ZIP 2004, 1933, 1935. 164 Vgl. Leyens, in: GroßKomm AktG, § 161 Rn. 57; Seidel, NZG 2004, 1095; Wernsmann/Gatzka, NZG 2011, 1001, 1004. 165 Heintzen, ZIP 2005, 1933, 1935; Hohl, Private Standardsetzung, S. 44. 166 Heintzen, ZIP 2004, 1933, 1934; Hoffmann-Becking, in: FS Hüffer, S. 337, 339 f.; Leyens, in: GroßKomm AktG, § 161 Rn. 57; Seidel, ZIP 2004, 285, 287. 158 159
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
80
Bundesadlers als Hoheitszeichen auf der Internetseite der Kodexkommission.167 Ferner sei die Kodexgebung keine freiwillige Angelegenheit, sondern stehe unter einer besonderen Drucksituation in Form des permanenten Vorbehalts staatlicher Gesetzgebung.168 Zuletzt spreche für eine staatliche Zuordnung, dass der Kodex in seiner jeweils geltenden Fassung im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers veröffentlicht169 und vor seiner Bekanntmachung vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz inhaltlich überprüft sowie über seine Einstellung entschieden werde.170 bb) Stellungnahme Denjenigen Stimmen, die die Kodexvorgaben der staatlichen Sphäre zuordnen, ist insoweit beizupflichten, als es sich beim Kodex nicht um ein „jenseits des staatlichen Wirkungskreises – von Privaten im privaten Raum für sich freiwillig anschließende Rechtssubjekte – aufgestelltes Regelwerk“ im klassischen Sinne handelt.171 Gleichwohl überzeugen die Argumente für eine staatliche Einordnung nicht. Vielmehr ist der Kodex als privates Regelwerk einzustufen. Von entscheidender Bedeutung ist insoweit, dass die Kodexvorgaben inhaltlich ausschließlich von privater Hand formuliert werden, ohne dass eine staatliche Einflussnahme stattfindet. Die Einsetzung der Kodexkommission durch das Bundesministerium der Justiz kann nicht als hoheitlicher Bestellungsakt verstanden werden. Die staatliche Einsetzung sollte lediglich dazu dienen, die besondere Bedeutung des Deutschen Corporate Governance Kodex als branchenübergreifenden und deutschlandweit einheitlich geltenden Kodex hervorzuheben und ihn insoweit gegenüber den Vorgängerregelungen der Grundsatzkommission Corporate Governance und des Berliner Initiativkreises zu privilegieren.172 Eine weitergehende staatliche Identifikation sollte damit nicht einhergehen. Auch durch die Auswahl und Ernennung der einzelnen Kommissionsmitglieder durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz soll nicht etwa auf die späteren Kodexvorgaben inhaltlich eingewirkt, sondern lediglich präventiv eine ausgewogene und fachkundige Beset-
Hoffmann-Becking, in: FS Hüffer, S. 337, 339 f. Köndgen, AcP 206 (2006), 477, 496: „rule-making in the shadow of the law“; M. Weiss, Hybride Regulierungsinstrumente, S. 100. 169 Heintzen, ZIP 2004, 1933, 1934 f.; Hoffmann-Becking, in: FS Hüffer, S. 337, 340; Wernsmann/Gatzka, NZG 2011, 1001, 1003; insoweit zumindest für eine Indizwirkung Leyens, in: GroßKomm AktG, § 161 Rn. 57. 170 Seidel, ZIP 2004, 285, 288. 171 M. Wolf, ZRP 2002, 59, 60, der letztlich für eine „private Selbstregulierung unter staatlicher Mitwirkung“ plädiert; ähnlich vorsichtig Schüppen, ZIP 2002, 1269, 1278: Bereich des rein Privaten überschritten. 172 Vgl. Begr. RegE TransPuG, BT-Drucks. 14/8769, S. 21. 167 Vgl.
168 Vgl.
§ 7 Regelarrangements mit mittelbarer Rechtsverbindlichkeit
81
zung der Kommission sichergestellt werden.173 Ebenso wenig vermag eine etwaige Bindung an das öffentliche Interesse für sich genommen über eine staatliche oder private Zuordnung zu entscheiden. Derartige Pflichten lassen sich gesetzlich oder vertraglich zwischen dem Staat und privaten Regelgebern festlegen, wie es etwa bei den DIN-Normen bereits dargelegt wurde. Auch die inhaltliche Prüfung des Kodex durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz beschränkt sich auf eine reine Rechtmäßigkeitskontrolle174 und begründet keine staatliche Mitverantwortung.175 Dass der Kodex im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers zu veröffentlichen ist, macht ihn ebenfalls nicht zu einem dem Staat zuzurechnenden Regelwerk. Die Publikation wirkt hier nicht wie bei staatlichen Rechtsnormen konstitutiv, sondern ist lediglich Tatbestandsvoraussetzung für die Rechtsfolgen, die § 161 AktG an den Kodex knüpft.176 Dass der Staat sich das Regelwerk durch die Übernahme im Bundesanzeiger zu eigen machen möchte, geht aus den Gesetzgebungsmaterialien nicht hervor. Darüber hinaus ist der Bundesanzeiger nicht das Bundesgesetzblatt, sondern nur ein einfaches Informationsorgan der Bundesregierung. Die vorgenommene Einordnung des Kodex als privates Regelwerk wird schließlich durch Aussagen der Kodexkommission und der Bundesregierung gestützt, die in ihm „Regeln von der Wirtschaft für die Wirtschaft“ sehen, die in einem „Akt der Selbstorganisation“177 (so die Kodexkommission) bzw. in „Selbstorganisation der Wirtschaft“178 (so die Bundesregierung) geschaffen werden. 173 So auch Keßler, Strafrechtliche Aspekte, S. 101 mit Verweis auf Seibert, BB 2002, 581, 582. 174 Vgl. dazu bereits oben 2. Teil, Fn. 146. 175 Vgl. auch Keßler, Strafrechtliche Aspekte, S. 103, der zudem darauf hinweist, dass seit Einführung des Kodex kein Fall bekannt sei, in dem das Bundesministerium der Justiz Empfehlungen zurückgewiesen und nicht veröffentlicht hätte. 176 Heintzen, ZIP 2004, 1933, 1934. 177 So Gerhard Cromme als ehemals Vorsitzender der Kodexkommission, vgl. Pressekonferenz nach Übergabe des Deutschen Corporate Governance-Kodex, S. 2, abrufbar unter: http://www.dcgk.de/de/kommission/die-kommission-im-dialog/deteilansicht/ausfuehrun gen-von-dr-gerhard-cromme.html (zuletzt abgerufen am 12. 10. 2016). Ähnlich die Ausführungen von Klaus-Peter Müller als ehemaliger Vorsitzender der Kodexkommission, vgl. Hauptrede von Herrn Klaus-Peter Müller vom 30. 06. 2011, S. 2, abrufbar unter: http://www. dcgk.de/de/kommission/die-kommission-im-dialog/deteilansicht/dokumentation-10-corporate-governance-konferenz.html (zuletzt abgerufen am 12. 10. 2016): Selbstorganisation der deutschen Wirtschaft auf freiwilliger Basis. 178 So die Formulierung des federführenden Referenten des Bundesministeriums der Justiz Seibert, BB 2002, 581, 582; ders., ZIP 2001, 2192 sowie das Geleitwort des Bundesministers für Justiz und für Verbraucherschutzrecht Heiko Maas zum Internetauftritt der Kodexkommission, abrufbar unter: http://www.dcgk.de/de/kommission.html (zuletzt abgerufen am 12. 10. 2016); so auch Kremer, DB Standpunkte 2011, 55; Ulmer, ZHR 166 (2002), 150, 159; v. Werder, in: Kremer u.a. (Hrsg.), DCGK, Vorbem. Rn. 22.
82
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
2. Keine isolierten Rechtswirkungen der Kodexvorschriften Im Folgenden ist zu beleuchten, ob und gegebenenfalls in welcher Form die Unternehmen und ihre Organe durch die Kodexvorgaben gebunden werden. Als weitgehend gesichert kann insoweit gelten, dass die Kodexvorgaben zumindest für sich betrachtet keine unmittelbaren rechtlichen Bindungswirkungen begründen können. Wie bereits ausgeführt, können die Kodexbestimmungen mangels demokratischer Legitimation nicht als klassisches Gesetzesrecht im formellen oder materiellen Sinne verstanden werden.179 Auch der Umstand, dass die Kodexvorgaben durch die in § 161 AktG geregelte Entsprechenserklärung mit dem Aktiengesetz verzahnt sind, vermag diesen keine Gesetzeskraft zu vermitteln. Es handelt sich insoweit nicht um eine (dynamische) Verweisungsnorm, da sich § 161 AktG von seinem Regelungsgehalt her nicht auf den Inhalt des Kodex erstreckt, sondern ausschließlich auf die Verpflichtung zur Abgabe der Entsprechenserklärung beschränkt.180 Auch ein sonstiger staatlicher Anerkennungsakt, der den Kodex auf eine „mittlere Regulierungsebene zwischen zwingendem und dispositivem Aktienrecht“ hieven würde, ist nicht ersichtlich.181 Die Kodexempfehlungen können nicht als Gewohnheitsrecht eingestuft werden. Um Gewohnheitsrecht zu begründen, bedarf es einer gleichmäßigen und lang dauernden tatsächlichen Übung sowie eines Rechtsgeltungswillens der Beteiligten, d.h. einer Überzeugung der beteiligten Verkehrskreise, durch die Einhaltung der Regeln geltendes Recht zu befolgen.182 Den Kodexvorgaben fehlt es an einer gleichmäßigen und lang dauernden tatsächlichen Übung, da einzelne Abweichungen gerade zulässig sind, der Kodex erst vergleichsweise kurz existiert und die inhaltlichen Vorgaben laufend modifiziert werden.183 Am erforderlichen Rechtsgeltungswillen der Beteiligten mangelt es, da sich die betroffenen Organmitglieder 179 Vgl. BGHZ 180, 9 Rn. 25 f. = NJW 2009, 2207 (Kirch/Deutsche Bank); OLG München NZG 2009, 508, 509; Bachmann, AG 2011, 181, 191; Goette, in: FS Hüffer, S. 225; Hanfland, Haftungsrisiken, S. 58 ff.; Koch, in: Hüffer/Koch, AktG, § 161 Rn. 3; Lutter, in: FS Hopt, S. 1025; Mülbert/Wilhelm, ZHR 176 (2012), 286, 314 ff.; Seibt, AG 2002, 249, 250; Spindler, in: K. Schmidt/Lutter (Hrsg.), AktG, § 161 Rn. 7; Stenger, Kodex und Entsprechenserklärung, S. 79; Ulmer, ZHR 166 (2002), 150, 159; Vetter, NZG 2008, 121, 123; Weber-Rey/Buckel, AG 2011, 845; M. Weiss, Hybride Regulierungsinstrumente, S. 89. 180 Vgl. Hanfland, Haftungsrisiken, S. 62 f.; Seidel, NZG 2004, 1095; Ulmer, ZHR 166 (2002), 150, 159; für eine dynamische Verweisung hingegen Kiethe, NZG 2003, 559, 560; Mülbert/Wilhelm, ZHR 176 (2012), 286, 319 f.; Wernsmann/Gatzka, NZG 2011, 1001, 1007; abgeschwächt Vogel, Die Haftung, S. 55 ff.: unechte dynamische Verweisung. 181 Ulmer, ZHR 166 (2002), 150, 158 f.; siehe auch Bachmann, WM 2002, 2137, 2138; Hanfland, Haftungsrisiken, S. 81 m.w.N. 182 Zur Entstehung und zu den Voraussetzungen des Gewohnheitsrechts Merten, in: Staudinger, Art. 2 EGBGB Rn. 93 ff. m.w.N. 183 Statt aller Kort, in: FS K. Schmidt, S. 945, 955 f.; Lutter, in: FS Hopt, S. 1025, 1031 f.; Weber-Rey/Buckel, AG 2011, 845, 846; M. Weiss, Hybride Regulierungsinstrumente, S. 89 f.
§ 7 Regelarrangements mit mittelbarer Rechtsverbindlichkeit
83
aufgrund der Möglichkeit eines „opting-outs“ nach § 161 AktG an die Kodexbestimmungen eben nicht wie an objektives Recht gebunden fühlen.184 Ebenso wenig sind die Kodexvorgaben ein Handelsbrauch i.S.d. § 346 HGB.185 Hiergegen spricht schon, dass Handelsbräuche ihrer Natur nach unter Kaufleuten gelten, soweit diese untereinander Handelsgeschäfte abschließen.186 Der Kodex richtet sich aber primär an Vorstand und Aufsichtsrat börsennotierter Aktiengesellschaften. Diese sind allein aufgrund ihrer Organstellung keine Kaufleute.187 Kaufmann ist vielmehr die von ihnen vertretene Gesellschaft, vgl. § 6 Abs. 1 HGB, § 3 Abs. 1 AktG. Zwar können Handelsbräuche auch für Nichtkaufleute gelten, wenn sie in ähnlicher Weise wie Kaufleute am Handelsverkehr teilnehmen.188 Da die Kodexempfehlungen jedoch größtenteils gesellschaftsinterne Vorgänge wie etwa die Einladung und Durchführung der Hauptversammlung,189 das Verhältnis von Vorstand und Aufsichtsrat,190 die Zusammensetzung und Vergütung des Vorstands191 und Aufsichtsrats192 sowie Interessenkonflikte193 betreffen, weisen sie nicht den für einen Handelsbrauch erforderlichen Bezug zum Handelsverkehr auf.194 Abgesehen davon liegen aber auch die Voraussetzungen für die Entstehung eines Handelsbrauchs nicht vor. Ein Handelsbrauch setzt eine gleichmäßige, einheitliche und freiwillige Übung der beteiligten Kreise über einen angemessenen Zeitraum hinweg voraus, der eine einheitliche Auffassung der Beteiligten zugrunde liegt.195 Die Kodexvorgaben sind im Kern aber nicht Ausdruck einer bereits vorgefundenen 184 Kort, in: FS K. Schmidt, S. 945, 956; Lutter, in: FS Hopt, S. 1025, 1032; Weber-Rey/ Buckel, AG 2011, 845, 846; M. Weiss, Hybride Regulierungsinstrumente, S. 90. 185 OLG Zweibrücken ZIP 2011, 617, 619; Bachmann, WM 2002, 2137, 2138; Borges, ZGR 2003, 508, 515 ff.; Hanfland, Haftungsrisiken, S. 73 f.; Hommelhoff/M. Schwab, in: Hommelhoff u.a. (Hrsg.), Handbuch Corporate Governance, S. 71, 77 m.w.N.; Kort, in: FS K. Schmidt, S. 945, 956 f.; Lutter, in: FS Hopt, S. 1025, 1032 f.; ders., in: KölnKomm AktG, § 161 Rn. 11; Mülbert/Wilhelm, ZHR 176 (2012), 286, 314; Ulmer, ZHR 166 (2002), 150, 159 f.; Weber-Rey/Buckel, AG 2011, 845, 846; Wernsmann/Gatzka, NZG 2011, 1001, 1003; a.A. wohl Peltzer, NZG 2002, 10, 11. 186 Dies folgt schon aus der systematischen Stellung des § 346 HGB im Vierten Buch, vgl. K. Schmidt, in: MüKo HGB, § 346 Rn. 12. 187 Hanfland, Haftungsrisiken, S. 76; allgemein zur Kaufmannseigenschaft Canaris, Handelsrecht, § 3 Rn. 1 ff. 188 Vgl. BGH NJW 1952, 257; BGH WM 1970, 695, 696; BGH WM 1980, 1122, 1123; K. Schmidt, in: MüKo HGB, § 346 Rn. 12. 189 Empfehlung Ziff. 2. 3. 1, 2. 3. 2, 2. 3. 3 DCGK. 190 Empfehlung Ziff. 3.4, 3.8, 3.10 DCGK. 191 Empfehlung Ziff. 4. 2. 1, 4. 2. 2, 4. 2. 3, 4. 2. 5 DCGK. 192 Empfehlung Ziff. 5. 4. 1, 5. 4. 2, 5. 4. 4, 5. 4. 5, 5. 4. 7, 5. 4. 8 DCGK. 193 Empfehlung Ziff. 4. 3. 5, 5. 5. 2, 5. 5. 3 DCGK. 194 Hanfland, Haftungsrisiken, S. 76; zustimmend Stenger, Kodex und Entsprechenserklärung, S. 80. 195 Zu den Voraussetzungen statt aller K. Schmidt, in: MüKo HGB, § 346 Rn. 11 ff.
84
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
gleichmäßigen und einheitlichen Unternehmenspraxis, sondern sprechen neue, bedürfnisorientierte Vorschläge zur Verbesserung der Corporate Governance aus.196 Der erforderlichen Langfristigkeit der Übung stehen die durch § 161 AktG eröffnete und praktizierte Abweichungsmöglichkeit sowie die ständige Überarbeitung der Kodexvorgaben entgegen.197 Namentlich Letzteres spricht auch dagegen, dass sich die Kodexvorgaben im Laufe der Zeit noch zu Handelsbräuchen entwickeln.198 Zu Recht nicht weiter aufgegriffen wurde die Überlegung, die Kodexvorgaben als Verkehrspflichten aufzufassen.199 Hiergegen spricht, dass es den betroffenen Unternehmen gemäß § 161 AktG gerade freistehen soll, darüber zu entscheiden, in welchem Umfang sie sich den Kodexempfehlungen unterwerfen. Mit diesem gesetzgeberischen Wertungsplan ließe es sich nicht vereinbaren, wenn man die Kodexempfehlungen als Verkehrspflichten verstünde.200 Ebenso scheidet eine Einordnung der Kodexempfehlungen als Vertragsrecht aus. Eine Parallele zu den als Vertragsrecht eingeordneten Insiderhandels-Richtlinien 201 sowie zum mitunter als Vertragsrecht eingeordneten Übernahmekodex202 lässt sich nicht ziehen.203 Denn bei der nach § 161 AktG vorgeschriebenen Entsprechenserklärung handelt es sich nicht um eine rechtsgeschäftliche Unterwerfungserklärung, die im Wege der Anerkennung (opt-in-Modell) begründet wird.204 Sie will die Öffentlichkeit bzw. den Kapitalmarkt lediglich über die Corporate Governance informieren. Ein Vertrag mit dem Anlegerpublikum kommt nicht zustande.205 196 Vgl. Hanfland, Haftungsrisiken, S. 74; Hommelhoff/M. Schwab, in: Hommelhoff u.a. (Hrsg.), Handbuch Corporate Gorvernance, S. 71, 77. 197 Zu Letzterem vgl. Möllers/Fekonja, ZGR 2012, 777, 781. 198 Wie hier Bertrams, Haftung des Aufsichtsrats, S. 69 ff.; Hanfland, Haftungsrisiken, S. 75 f.; Stenger, Kodex und Entsprechenserklärung, S. 80 f.; für die Möglichkeit eines zukünftigen Handelsbrauchs Bachmann, WM 2002, 2137, 2138; Th. Becker, Die Haftung für den Deutschen Corporate Governance Kodex, S. 53 f.; Ettinger/Grützediek, AG 2003, 353, 355; Kort, in: FS K. Schmidt, S. 945, 957 f.; Seibt, AG 2002, 249, 250 f. 199 Angedacht noch von Hüffer, AktG, 5. Auflage, § 76 Rn. 15 c; dagegen Hanfland, Haftungsrisiken, S. 77 ff.; M. Weiss, Hybride Regulierungsinstrumente, S. 90. 200 So auch Hanfland, Haftungsrisiken, S. 80; P. M. Holle, Legalitätskontrolle, S. 302; M. Weiss, Hybride Regulierungsinstrumente, S. 90. 201 Zur Qualifikation der Anerkennungserklärungen, die unter den freiwilligen Insiderhandels-Richtlinien abgegeben wurden, als privatrechtliche Verträge vgl. Hopt, ZHR 161 (1997), 368, 400 f. m.w.N. 202 Für den Übernahmekodex wurde eine vertragliche Bindung überwiegend abgelehnt, vgl. bereits die Nachweise in 2. Teil, Fn. 30. 203 Vgl. Leyens, in: GroßKomm AktG, § 161 Rn. 39; Ulmer, ZHR 166 (2002), 150, 159. 204 Leyens, in: GroßKomm AktG, § 161 Rn. 39; Ulmer, ZHR 166 (2002), 150, 159. 205 Eine rechtsgeschäftliche Bindung entsteht dann, wenn Kodexempfehlungen durch (rechtsgeschäftlichen) Umsetzungsakt in die gesellschaftsintern geltenden Regeln aufgenommen werden, sei es in die Satzung, die Geschäftsordnung des Vorstands oder Aufsichtsrats, den Anstellungsvertrag des Vorstands oder eine Bindung qua Beschluss des zuständigen Organs, vgl. dazu Ettinger/Grützediek, AG 2003, 353, 356; Hanfland, Haftungsrisiken,
§ 7 Regelarrangements mit mittelbarer Rechtsverbindlichkeit
85
Die Bestimmungen des Kodex können auch nicht als authentisch bindende Interpretation des geltenden Rechts verstanden werden und den in den §§ 93 Abs. 1 S. 1, 116 S. 1 AktG niedergelegten gesetzlichen Sorgfaltsmaßstab der Organe konkretisieren.206 Verfehlt wäre ebenso die Annahme, dass die Beachtung der Kodexempfehlungen eine Vermutung sorgfaltskonformen Handelns begründet.207 Namentlich die Rechtsprechung zu den DIN-Normen, die als Konkretisierung des geschuldeten Sorgfaltsstandards qualifiziert werden,208 kann nicht auf den Kodex übertragen werden.209 Zwar handelt es sich bei den Kodexvorgaben wie bei den DIN-Normen um Empfehlungen einer privaten Expertengruppe der jeweils betroffenen Fachkreise.210 Beide Expertengruppen nehmen für sich in Anspruch, fachwissenschaftlich zutreffend festzulegen, wie eine bestimmte Tätigkeit sachlich angemessen auszuüben ist.211 Anders als die DIN-Normen beschränken sich die Kodexempfehlungen jedoch nicht darauf, einen gesetzlich vorgezeichneten Rahmen näher auszustaffieren, sondern gehen in vielen Teilen darüber hinaus und S. 131 ff.; Lutter, in: Liber Amicorum Winter, S. 449, 450 ff.; ders., ZHR 166 (2002), 523, 536 ff.; Seibt, AG 2002, 249, 258; Semler/Wagner, NZG 2003, 553, 557 f. 206 OLG Zweibrücken ZIP 2011, 617, 619; Bachmann, WM 2002, 2137, 2138 f.; Borges, ZRG 2003, 508, 521; Goette, in: FS Hüffer, S. 225, 227 f.; Hoffmann-Becking, in: FS Hüffer, S. 337, 343; Hommelhoff/M. Schwab, in: Hommelhoff u.a. (Hrsg.), Handbuch Corporate Governance, S. 71, 79; Koch, in: Hüffer/Koch, AktG, § 161 Rn. 26 f.; Mülbert/Wilhlem, ZHR 176 (2012), 286, 312, Fn. 132; Spindler, NZG 2011, 1007, 1010; Tödtmann/Schauer, ZIP 2009, 995, 998; Wandt, ZIP 2012, 1443, 1444; Weber-Rey/Buckel, AG 2011, 845, 846 f.; a.A. Claussen/Bröcker, DB 2002, 1199, 1205; Lutter, ZHR 166 (2002), 523, 540 ff.; ders., in: KölnKomm AktG, § 161 Rn. 129: Verstoß gegen Empfehlung begründet zugleich Sorgfaltspflichtverstoß (bei positiver Entsprechenserklärung); K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 26 II 3 b (S. 767): Kodexempfehlungen rechtlich nicht irrelevant, da sie haftungsrelevante Verhaltenspflichten konkretisieren; für eine Indizfunktion im Rahmen der richterlichen Beweiswürdigung unter Beibehaltung der gesetzlichen Beweislastverteilung Kort, in: FS K. Schmidt, S. 945, 959; ferner Berg/Stöcker, WM 2002, 1569, 1576 f.; Bertrams, Haftung des Aufsichtsrats, S. 212; Ettinger/Grützediek, AG 2003, 353, 355; Ulmer, ZHR 166 (2002), 150, 167; für eine mittelbare Haftungsrelevanz der Kodexempfehlungen Weber-Rey/Buckel, AG 2011, 845, 847 ff. Die Rechtsprechung hat lediglich vereinzelt Kodexempfehlungen zur Auslegung von Gesetzesvorschriften ergänzend herangezogen, vgl. BGHZ 158, 122, 127 = NZG 2004, 376; OLG Schleswig NZG 2003, 176, 179. 207 In diese Richtung Schüppen, ZIP 2002, 1269, 1271; Seibt, AG 2002, 249, 251; etwas vorsichtiger Ulmer, ZHR 166 (2002), 150, 163 f.; für einen Beweis des ersten Anscheins Hanfland, Haftungsrisiken, S. 100 ff. 208 Vgl. dazu oben § 7 II. 2. b) bb). 209 Vgl. etwa Bachmann, WM 2002, 2137, 2138 f.; Ettinger/Grützediek, AG 2003, 353, 355; Weber-Rey/Buckel, AG 2011, 845, 846 f.; a.A. Borges, ZGR 2003, 508, 517 f.; Hanfland, Haftungsrisiken, S. 81 ff.; Kort, in: FS K. Schmidt, S. 945, 958 f. 210 Vgl. Borges, ZGR 2003, 508, 518; Hanfland, Haftungsrisiken, S. 83; umfassend zu den Gemeinsamkeiten und Unterschieden von DIN-Normen und Kodexempfehlungen Bertrams, Haftung des Aufsichtsrats, S. 190 ff. 211 Vgl. Borges, ZGR 2003, 508, 518.
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
86
erschließen neue Regelungsbereiche.212 Ferner betreffen DIN-Normen technische Sachverhalte, die auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen aufbauen und einer empirischen Überprüfung zugänglich sind.213 Der Kodex hingegen trifft normativ wertende Aussagen, die weder einen Mindeststandard abbilden noch einer naturwissenschaftlichen Überprüfung unterzogen werden können.214 3. Bindungswirkung über § 161 AktG a) Faktischer Befolgungsdruck Potenzielle Sprengkraft entfalten die Kodexvorgaben erst im Zusammenhang mit der nach § 161 AktG abzugebenden Entsprechenserklärung. Diese zwingt die Organe börsennotierter Aktiengesellschaften zunächst, sich vor Augen zu führen, welche Grundsätze materieller Unternehmensverfassung sie bisher verfolgt haben. Zugleich wird über den in § 161 AktG verankerten Comply-or-explain-Mechanismus ein faktischer Druck erzeugt, die Kodexempfehlungen zu befolgen.215 Denn im Fall des erklärten Abweichens von den Kodexempfehlungen müssen Vorstand und Aufsichtsrat befürchten, durch den Kapitalmarkt „sanktioniert“ zu werden.216 Eine schlechte Beurteilung durch das Anlegerpublikum könnte Auswirkungen auf den Börsenkurs und damit die Emissionsfähigkeit haben und die Kapitalkosten des Unternehmens beeinflussen. b) Keine Rechtswirkungen bei korrekter Entsprechenserklärung Fraglich ist, ob die Kodexempfehlungen über den Transmissionsriemen des § 161 AktG auch rechtliche Wirkungen entfalten. Hierbei ist zwischen den recht lichen Wirkungen einer korrekten und einer fehlerhaften Entsprechenserklärung zu differenzieren. So besteht Einigkeit, dass die Kodexempfehlungen in Verbindung mit § 161 AktG jedenfalls dann keine Rechtswirkungen entfalten, wenn Vorstand und Aufsichtsrat eine zutreffende Entsprechenserklärung abgegeben haben. Vgl. etwa M. Weiss, Hybride Regulierungsinstrumente, S. 93 f. Hanfland, Haftungsrisiken, S. 83; Weber-Rey/Buckel, AG 2011, 845, 846. 214 Vgl. Spindler, in: K. Schmidt/Lutter (Hrsg.), AktG, § 161 Rn. 68; Weber-Rey/Buckel, AG 2011, 845, 847. 215 Vgl. Blasche, CCZ 2009, 62, 64: erhebliches Druckpotenzial; Hoffmann-Becking, ZIP 2011, 1173 f.: annähernd gesetzesgleiche Bindungswirkung; ders., in: FS Hüffer, S. 337, 343: erhebliche faktische Bindungswirkung. Nach einer aktuellen Studie verspüren rund 41 % der Unternehmen einen faktischen Befolgungsdruck, siehe v. Werder/Bartz, DB 2012, 869, 871 f. 216 Empirisch belegt ist die Relevanz der Beachtung von Corporate-Governance-Grundsätzen für den Börsenkurs bislang nicht, vgl. die Studie von Nowak/Rott/Mahr, ZGR 2005, 252, 273 ff.; zur Schwierigkeit, überhaupt eine (signifikante) Kursreaktion festzustellen, Pietrancosta, in: FS Hopt, S. 1109, 1130 ff.; zur Signalstärke der Entsprechenserklärung vgl. v. Werder, in: FS Hopt, S. 1471 ff. 212 213
§ 7 Regelarrangements mit mittelbarer Rechtsverbindlichkeit
87
Der Inhalt der Entsprechenserklärung hat weder Einfluss auf eine Börsenzulassung217 noch erwächst über die Entsprechenserklärung i.S.d. § 161 AktG eine rechtliche Bindungswirkung dergestalt, dass die Gesellschaftsorgane an ihre Angabe in der Entsprechenserklärung gebunden sind. Für den vergangenheitsbezogenen Teil der Entsprechenserklärung ist allgemein anerkannt, dass es sich hierbei um eine reine Wissenserklärung handelt.218 Auch der zukunftsbezogene Teil der Entsprechenserklärung ist richtigerweise als bloße Wissenserklärung zu begreifen.219 Letztlich wollen die Gesellschaftsorgane mit ihrer Entsprechenserklärung keine Rechtsfolgen auslösen, sondern lediglich ihrer Erklärungspflicht gemäß § 161 AktG nachkommen und den Kapitalmarkt über das eigene Verhalten in Kenntnis setzen. Der eigentliche Grund der Bindung ist nicht in der Erklärung, sondern im zugrunde liegenden Beschluss des jeweiligen Gesellschaftsorgans zu sehen.220 Die Entsprechenserklärung folgt also lediglich dem beabsichtigten Verhalten. Von einem solchen Verständnis dürfte auch der Gesetzgeber geleitet gewesen sein. In der Regierungsbegründung zum TransPuG spricht er von der Entsprechenserklärung als „unverbindliche Absichtserklärung“.221 Soweit der Begriff der Absichtserklärung dem Begriff der Wissens erklärung gegenübergestellt wird,222 ist dies nicht zwingend.223 Jedenfalls die Verwendung des Worts „unverbindlich“ zeigt dem Rechtsanwender auf, dass vom Gesetzgeber eine Bindungswirkung der Entsprechenserklärung nicht intendiert war. Dafür, dass der Gesetzgeber mit seiner Wortwahl keine generelle Unverbindlichkeit, sondern eine bloße Unverbindlichkeit im Hinblick auf die zeitliche Bindung gemeint haben könnte, ist nichts ersichtlich. Selbst wenn man sich denjenigen Stimmen anschließt, die den zukunftsbezogenen Teil der Entsprechenserklärung als Willenserklärung224 – mitunter wird eine Parallele zur Auslobung erwogen 225 – bzw. als Erklärung mit rechtsgeschäftlichem Charakter ansehen, die eine freiwillige Selbstbindung der Gesellschaft begrünVgl. § 30 Abs. 3 BörsG; Bachmann, WM 2002, 2137, 2139. Goette, in: MüKo AktG, § 161 Rn. 35; Koch, in: Hüffer/Koch, AktG, § 161 Rn. 14; Stenger, Kodex und Entsprechenserklärung, S. 164. 219 Vgl. Bachmann, WM 2002, 2137, 2139 f.; Borges, ZGR 2003, 508, 528; Ederle, NZG 2010, 655, 658; Hommelhoff/M. Schwab, in: Hommelhoff u.a. (Hrsg.), Handbuch Corporate Governance, S. 71, 88; Koch, in: Hüffer/Koch, AktG, § 161 Rn. 20; Runte/Eckert, in: Bürgers/Körber (Hrsg.), AktG, § 161 Rn. 37; Spindler, in: K. Schmidt/Lutter (Hrsg.), AktG, § 161 Rn. 16: Absichtserklärung ohne rechtliche Pflicht; Stenger, Kodex und Entsprechens erklärung, S. 166 f. 220 Hommelhoff/M. Schwab, in: Hommelhoff u.a. (Hrsg.), Handbuch Corporate Govern ance, S. 71, 88. 221 Begr. RegE TransPuG, BT-Drucks. 14/8769, S. 22. 222 Vgl. etwa Lutter, in: KölnKomm AktG, § 161 Rn. 28 f.; Vetter, NZG 2008, 121, 122. 223 Vgl. etwa Stenger, Kodex und Entsprechenserklärung, S. 167. 224 So Kiethe, NZG 2003, 559, 563. 225 Angedacht, im Ergebnis aber abgelehnt Borges, ZGR 2003, 508, 527 f. 217
218
88
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
det,226 bleibt es bei den getroffenen Feststellungen. Denn auch von diesen Stimmen wird nicht infrage gestellt, dass es den Gesellschaftsorganen unbenommen bleibt, ihre Entsprechenserklärung im Hinblick auf den zukunftsbezogenen Teil unterjährig zu aktualisieren und sich damit von der einmal abgegebenen Entsprechenserklärung loszusagen. c) Rechtsfolgen fehlerhafter Entsprechenserklärung aa) Haftungsrisiken Anders stellt sich die Ausgangslage dar, wenn die Gesellschaftsorgane eine fehlerhafte Entsprechenserklärung abgegeben haben. Fehlerhaft ist eine Entsprechenserklärung immer dann, wenn Erklärung und Praxis nicht oder nicht mehr übereinstimmen,227 gar keine bzw. keine regelmäßige Erklärung abgegeben wird oder diese formell unzureichend ist, weil sie sich auf eine veraltete Kodexfassung bezieht, unzureichend begründet ist oder nicht ordnungsgemäß veröffentlicht wurde.228 Ist die Entsprechenserklärung fehlerhaft, scheint zunächst eine Schadensersatzhaftung denkbar.229 Im Innenverhältnis kommt eine Haftung der Organmitglieder gegenüber der Gesellschaft nach §§ 93 Abs. 2 S. 1, 116 S. 1 AktG in Betracht. Eine fehlerhaft abgegebene Entsprechenserklärung stellt wegen des Verstoßes gegen § 161 AktG ein pflichtwidriges und regelmäßig auch zu vertretendes Verhalten der Organmitglieder dar.230 Voraussetzung für eine Binnenhaftung ist jedoch weiter, dass der Gesellschaft durch die Pflichtverletzung ein adäquat-kausaler Schaden entstanden ist, beispielsweise in Form erhöhter Kapitalkosten.231 Da sich die haf226 OLG München ZIP 2009, 133, 134 f. (MAN); Gelhausen/Hönsch, AG 2003, 367; Ihrig/Wagner, BB 2002, 789, 791; Kirschbaum, ZIP 2007, 2362, 2363; Leyens, in: GroßKomm AktG, § 161 Rn. 70, 72; Lutter, in: KölnKomm AktG, § 161 Rn. 26, 124 ff.; Pfitzer/Oser/ Wader, DB 2002, 1120, 1121; Sester, in: Spindler/Stilz (Hrsg.), AktG, § 161 Rn. 46; Vetter, NZG 2008, 121, 122; Waclawik, ZIP 2011, 885, 889. 227 Zur von der h.M. angenommenen unterjährigen Aktualisierungspflicht der Entsprechenserklärung vgl. BGHZ 180, 9 Rn. 19 = NJW 2009, 2207 (Kirch/Deutsche Bank); Goslar/von der Linden, NZG 2009, 1337, 1338; Koch, in: Hüffer/Koch, AktG, § 161 Rn. 20; Lutter, in: FS Hopt, 1025, 1026; Vetter, NZG 2008, 121, 123; a.A. Ederle, NZG 2010, 655, 658; Theusinger/Liese, DB 2008, 1419, 1421 f. 228 Vgl. Stenger, Kodex und Entsprechenserklärung, S. 168 ff.; umfassend zu Inhalt, Erklärungsadressat und Wirkungen der Erklärungspflicht Hanfland, Haftungsrisiken, S. 106 ff.; Stenger, Kodex und Entsprechenserklärung, S. 145 ff. 229 Umfassend zu den Haftungsrisiken Bertrams, Haftung des Aufsichtsrats, S. 75 ff.; Hanfland, Haftungsrisiken, S. 130 ff.; Stenger, Kodex und Entsprechenserklärung, S. 184 ff. 230 Vgl. Hommelhoff/M. Schwab, in: Hommelhoff u.a. (Hrsg.), Handbuch Corporate Governance, S. 71, 98 ff.; Koch, in: Hüffer/Koch, AktG, § 161 Rn. 25 a; Mülbert/Wilhelm, ZHR 176 (2012), 286, 299; Vogel, Die Haftung, S. 135 ff. 231 Kiethe, NZG 2003, 559, 564; Lutter, in: FS Hopt, S. 1025, 1028; Mülbert/Wilhelm, ZHR 176 (2012), 286, 300; Tröger, ZHR 175 (2011), 746, 768 f.
§ 7 Regelarrangements mit mittelbarer Rechtsverbindlichkeit
89
tungsausfüllende Kausalität kaum nachweisen lassen wird, wird zu Recht davon ausgegangen, dass eine Binnenhaftung wegen einer fehlerhaften Entsprechenserklärung im Regelfall ausscheidet.232 Vor allem dürfte kaum festzustellen sein, zu welchem Anteil der Kursverlust infolge der fehlerhaften Entsprechenserklärung und zu welchem Anteil infolge der Nichteinhaltung der Empfehlung eingetreten ist.233 Soweit es um die Außenhaftung geht, kommen als Gläubiger Aktionäre in Betracht, die einen Vermögensschaden durch Kursverluste oder entgangenen Kursgewinn erlitten haben.234 Insoweit ist zwischen der Haftung der Gesellschaft und der ihrer Organmitglieder zu unterscheiden. Gegenüber der Gesellschaft kommt vorwiegend eine Haftung über § 31 BGB i.V.m. deliktischen Ansprüchen in Betracht.235 Eine Haftung nach § 823 Abs. 1 BGB scheidet allerdings aus, da kein von der Vorschrift geschütztes Rechtsgut verletzt wird: Das Vermögen als solches wird von § 823 Abs. 1 BGB nicht geschützt. Soweit das Mitgliedschaftsrecht von § 823 Abs. 1 BGB geschützt wird, ist es nicht verletzt, weil die Unrichtigkeit der Entsprechenserklärung nicht auf den einzelnen Aktionär bezogen und deshalb das mitgliedschaftliche Recht nicht substanziell beeinträchtigt ist.236 Eine Haftung nach § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. den Kodexempfehlungen scheidet aus, da diese keine Rechtsnormen i.S.d. Art. 2 EGBGB darstellen. Mangels Schutzgesetzcharakters des § 161 AktG kann auch die Missachtung dieser Vorschrift keine Haftung nach § 823 Abs. 2 BGB begründen. § 161 AktG entfaltet keinen individualschützenden Charakter für einzelne Anleger, sondern möchte lediglich dem Informationsbedürfnis aller Kapitalmarktakteure nachkommen.237 Eine Haftung wegen der Verletzung anderer Vorschriften, namentlich des § 331 Nr. 1 HGB, des § 400 Abs. 1 Nr. 1 AktG sowie der §§ 263 Abs. 1, 264a Abs. 1 und 266 StGB, scheitert zwar nicht schon an der fehlenden Schutzgesetzqualität.238 In der Regel dürfte es dem 232 Goette, in: MüKo AktG, § 161 Rn. 97 f.; Hommelhoff/M. Schwab, in: Hommelhoff u.a. (Hrsg.), Handbuch Corporate Governance, S. 71, 100; Koch, in: Hüffer/Koch, AktG, § 161 Rn. 25 a; Lutter, in: KölnKomm AktG, § 161 Rn. 154; Mülbert/Wilhelm, ZHR 176 (2012), 286, 300; Mülbert, Arbeitspapiere 2012, S. 24; Spindler, NZG 2011, 1007, 1010; ders., in: K. Schmidt/Lutter (Hrsg.), AktG, § 161 Rn. 65 f.; Tröger, ZHR 175 (2011), 746, 768 f. 233 Vgl. Stenger, Kodex und Entsprechenserklärung, S. 186; Tröger, ZHR 175 (2011), 746, 768. 234 Koch, in: Hüffer/Koch, AktG, § 161 Rn. 28. 235 Das Handeln und Verschulden der Organmitglieder wird der Gesellschaft nach h.M. analog § 31 BGB zugerechnet, ausführlich Mülbert/Wilhelm, ZHR 176 (2012), 286, 302 ff. 236 Vgl. Koch, in: Hüffer/Koch, AktG, § 161 Rn. 28; Kort, in: FS Th. Raiser, S. 203, 206 f.; Stenger, Kodex und Entsprechenserklärung, S. 186 f. 237 H.M.: Bertrams, Haftung des Aufsichtsrats, S. 255 f.; Hanfland, Haftungsrisiken, S. 121 f.; Koch, in: Hüffer/Koch, AktG, § 161 Rn. 28; Kort, in: FS Th. Raiser, S. 203, 208 f.; Mülbert/Wilhelm, ZHR 176 (2012), 286, 300; Spindler, in: K. Schmidt/Lutter (Hrsg.), AktG, § 161 Rn. 73. 238 In Bezug auf § 331 Nr. 1 HGB vgl. Kiethe, NZG 2003, 559, 566; Stenger, Kodex und Entsprechenserklärung, S. 187; in Bezug auf § 400 Abs. 1 Nr. 1 AktG, §§ 263 Abs. 1, 264a
90
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
Geschädigten aber nicht gelingen, den ursächlichen Zusammenhang zwischen der Schutzgesetzverletzung und dem geltend gemachten Schaden zu beweisen.239 Aus diesem Grund scheidet auch eine Haftung nach § 826 BGB aus. Nur in Ausnahmefällen werden die haftungsbegründende Kausalität sowie das Erfordernis einer vorsätzlichen Schädigung erfüllt sein.240 Eine Haftung nach §§ 37b, 37c WpHG, die eine Verantwortlichkeit des Wertpapieremittenten für fehlerhafte oder unterlassene Ad-hoc-Mitteilungen normieren, kann allenfalls dann relevant werden, wenn die in Abweichung von der nicht oder fehlerhaft abgegebenen Entsprechenserklärung praktizierte Corporate Governance der Gesellschaft ausnahmsweise zur Kursbeeinflussung geeignet ist und damit als Insiderinformation den Anwendungsbereich von § 15 WpHG berührt.241 Soweit es um die Haftung von Organmitgliedern gegenüber Dritten geht, kommen ebenfalls deliktische Ansprüche in Betracht. Allerdings gilt insoweit das zur Haftung der Gesellschaft Ausgeführte entsprechend, sodass eine deliktische Haftung regelmäßig ausscheidet.242 Nicht einschlägig sind vertragliche bzw. vertragsähnliche Ansprüche.243 Die Entsprechenserklärung stellt mangels Rechtsbindungswillens der Erklärenden weder ein Angebot zum Abschluss eines „Compliance-Vertrags“ noch ein einseitiges Leistungsversprechen dar.244 Eine sog. Sachwalterhaftung der Organmitglieder nach §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 3 S. 2, 241 Abs. 2 BGB ist nicht begründbar, da Organmitglieder durch die Erfüllung ihrer gesetzlich obliegenden Erklärungspflicht im Verhältnis zu Aktionären einer Wertpapiertransaktion auf dem Sekundärmarkt oder im Verhältnis zu Zeichnern auf dem Primärmarkt in der Regel nicht die Rolle eines Dritten einnehmen, der ein besonderes persönliches Vertrauen für sich beansprucht.245 Eine Haftung nach den Abs. 1 und 266 StGB vgl. Hanfland, Haftungsrisiken, S. 297 ff.; Kiethe, NZG 2003, 559, 566. 239 Vgl. Goette, in: MüKo AktG, § 161 Rn. 101; Stenger, Kodex und Entsprechenserklärung, S. 187. 240 Koch, in: Hüffer/Koch, AktG, § 161 Rn. 29 m.w.N. 241 Bachmann, WM 2002, 2137, 2141; Borges, ZGR 2003, 532 ff.; Hanfland, Haftungsrisiken, S. 227; Mülbert/Wilhelm, ZHR 176 (2012), 286, 308; kritisch Koch, in: Hüffer/Koch, AktG, § 161 Rn. 28; gegen eine Anwendbarkeit der §§ 37b, c WpHG Stenger, Kodex und Entsprechenserklärung, S. 191. 242 Vgl. Goette, in: MüKo AktG, § 161 Rn. 102; Koch, in: Hüffer/Koch, AktG, § 161 Rn. 30. 243 Zur früher vertretenen Lehre von der „Erklärung an die Öffentlichkeit“ grundlegend Ehrenberg, in: Ehrenberg (Hrsg.), Handbuch des gesamten Handelsrechts, Bd. I, S. 645 ff.; ablehnende Stellungnahme bei Canaris, Die Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht, S. 154 ff. m.w.N. 244 Zur Rechtsnatur der Entsprechenserklärung vgl. bereits oben § 7 V. 3. b); ausführlich zur Problematik Hanfland, Haftungsrisiken, S. 212 ff. 245 Vgl. Bachmann, WM 2002, 2137, 2141; Berg/Stöcker, WM 2002, 1569, 1580; Ettinger/Grützediek, AG 2003, 353, 357; Hanfland, Haftungsrisiken, S. 219 f.; Kiethe, NZG 2003, 559, 565; Kort, in: FS Th. Raiser, S. 203, 216 f.
§ 7 Regelarrangements mit mittelbarer Rechtsverbindlichkeit
91
Grundsätzen der spezialgesetzlichen Prospekthaftungstatbestände scheidet ebenso aus wie eine Haftung nach den Grundsätzen der allgemeinen bürgerlich-rechtlichen Prospekthaftung. Denn bei der Entsprechenserklärung handelt es sich nicht um einen Prospekt im spezifischen Sinne einer Vertriebsinformation.246 Allenfalls käme eine Prospekthaftung dann infrage, wenn die Erklärung in einen Prospekt mit aufgenommen und als Teil desselben veröffentlicht wird.247 bb) Anfechtbarkeit von Hauptversammlungsbeschlüssen Neben dem wohl nur theoretisch bestehenden Risiko einer Schadensersatzhaftung vermag eine fehlerhafte Entsprechenserklärung noch auf andere – in der Praxis weitaus bedeutsamere – Weise Rechtswirkungen für die betroffenen Unternehmen zu entfalten. Nach der durch die Urteile „Kirch/Deutsche Bank“ und „Umschreibungsstopp“ mittlerweile gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann die Abgabe einer fehlerhaften Entsprechenserklärung als Gesetzesverletzung dazu führen, dass von der Hauptversammlung gefasste Beschlüsse, in denen die Anleger Vorstand und/oder Aufsichtsrat entlasten, gemäß § 243 Abs. 1 AktG anfechtbar sind.248 Mit einem Entlastungsbeschluss nach § 120 Abs. 2 S. 1 AktG billigt die Hauptversammlung die Verwaltung der Gesellschaft durch die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder als im Wesentlichen gesetzes- und satzungskonform.249 Eine solche Billigung ist nach gefestigter Rechtsprechung zu beanstanden, wenn die den Beschluss tragende Aktionärsmehrheit das Entlastungsermessen der Hauptversammlung überschreitet, indem sie die Amtsführung der Organmitglieder trotz „gravierender“ Verletzung ihrer Pflichten als im Wesentlichen gesetzeskonform billigt.250 246 Vgl. Goette, in: MüKo AktG, § 161 Rn. 102; Koch, in: Hüffer/Koch, AktG, § 161 Rn. 30; Kort, in: FS Th. Raiser, S. 203, 218 ff.; Mülbert/Wilhelm, ZHR 176 (2012), 286, 308; Stenger, Kodex und Entsprechenserklärung, S. 190; a.A. Lutter, in: FS Druey, S. 463, 473 ff.: Unbestimmter Adressatenkreis und Erheblichkeit von Angaben für Beurteilung von Vermögensanlagen genügt. 247 Vgl. Stenger, Kodex und Entsprechenserklärung, S. 190 m.w.N. 248 BGHZ 180, 9 Rn. 18 ff. = NJW 2009, 2207 (Kirch/Deutsche Bank); BGHZ 182, 272 Rn. 16 ff. = NZG 2009, 1270 (Umschreibungstopp); BGHZ 194, 14 Rn. 27 = NJW 2012, 3235 (Fresenius); auf dieser Linie OLG Frankfurt am Main NZG 2011, 1029, 1030 f.; OLG München NZG 2008, 337; OLG München NZG 2009, 592; Goette, in: FS Hüffer, S. 225 ff.; ders., in: MüKo AktG, § 161 Rn. 88 ff.; Habersack, in: FS Goette, S. 121 ff.; ders., Gutachten 69. DJT, E 46 f.; Kleindiek, in: FS Goette, S. 239 ff.; Koch, in Hüffer/Koch, AktG, § 161 Rn. 31; Lutter, in: Kremer u.a. (Hrsg.), DCGK, Rn. 1915; Mutter, ZGR 2009, 788, 795 f.; Spindler, in: K. Schmidt/Lutter (Hrsg.), AktG, § 161 Rn. 64; Vetter, NZG 2009, 561, 566; Waclawik, ZIP 2011, 885 ff.; kritisch Goslar/von der Linden, NZG 2009, 1337, 1338 f.; Timm, ZIP 2010, 2125, 2128 f. 249 Vgl. BGHZ 153, 47, 50 ff. = NJW 2003, 1032 (Macrotron); BGHZ 160, 385, 388 = NJW 2005, 828; BGH NZG 2008, 309, 310; Koch, in: Hüffer/Koch, AktG, § 120 Rn. 11 m.w.N. 250 In der Entscheidung Kirch/Deutsche Bank unterscheidet der BGH noch nicht klar zwischen Inhalts- und Verfahrensmangel. Aus der Entscheidung Umschreibungsstopp geht
92
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
Einen solchermaßen „gravierenden“ Gesetzesverstoß nimmt der Bundesgerichtshof an, wenn die nach § 161 AktG vorgeschriebene Entsprechenserklärung vollständig fehlt oder aber in einem „nicht unwesentlichen Punkt nicht der tatsächlichen Praxis der Gesellschaft“ entspricht.251 Letzteres konkretisiert er unter Rückgriff auf die in § 243 Abs. 4 S. 1 AktG enthaltene Relevanztheorie252 dahingehend, dass eine fehlerhafte Entsprechenserklärung nur bedeutsam sein soll, wenn ein objektiv urteilender Aktionär die Informationserteilung als Voraussetzung für die sachgerechte Wahrnehmung seines Teilnahme- und Mitgliedschaftsrechts ansähe,253 die Fehlerhaftigkeit also zu einem Informationsdefizit der Abstimmenden führt, infolgedessen der Aktionär im Wissen darum keinen sachgerechten und tragfähigen Entlastungsbeschluss für möglich gehalten hätte. An der Relevanz für den Aktionär könne es fehlen, wenn der Verstoß gegen die Kodexempfehlung bereits aus allgemeinen Quellen bekannt sei oder etwa wegen Geringfügigkeit nicht geeignet sei, die Entscheidungen eines objektiv urteilenden Aktionärs zu beeinflussen.254 In den Urteilen „Kirch/Deutsche Bank“ und „Umschreibungsstopp“ erblickte der Bundesgerichtshof in der Nichteinhaltung von Ziff. 5. 5. 3. S. 1 DCGK, der die Information über Interessenkonflikte im Aufsichtsrat und deren Behandlung zum Gegenstand hat, jeweils den erforderlichen eindeutigen und schwerwiegenden Gesetzesverstoß.255 Der Verstoß gegen Ziff. 5. 5. 3 DCGK sei „ein nicht unwesentlicher Punkt der Entsprechenserklärung“.256
dann aber hervor, dass er die Anfechtbarkeit auf einen Inhaltsmangel („eindeutiger und schwerwiegender Gesetzesverstoß“) stützen will, vgl. Kiefner, NZG 2011, 201, 202; Koch, in: Hüffer/Koch, AktG, § 161 Rn. 31; Mülbert/Wilhelm, ZHR 176 (2012), 286, 292; für einen bloßen Informationsmangel wohl Goette, in: MüKo AktG, § 161 Rn. 91 f. 251 BGHZ 180, 9 Rn. 19 = NJW 2009, 2207 (Kirch/Deutsche Bank); BGHZ 182, 272 Rn. 16 = NZG 2009, 1270 (Umschreibungsstopp). Der Gesetzesbegriff des § 243 Abs. 1 AktG ist derjenige des Art. 2 EGBGB, der Kodexempfehlungen nicht erfasst, vgl. etwa Tröger, ZHR 175 (2011), 746, 776. 252 Zur Relevanztheorie vgl. BGHZ 149, 158, 163 ff. = NJW 2002, 1128; BGHZ 153, 32, 36 f. = NJW 2003, 970; BGHZ 160, 385, 392 = NJW 2005, 828; Koch, in: Hüffer/Koch, AktG, § 243 Rn. 12 f. Die Heranziehung des eigentlich für Verfahrensfehler geltenden § 243 Abs. 4 S. 1 AktG und der Relevanztheorie, um die Schwere des Inhaltsmangels zu beurteilen, wird zum Teil kritisch gesehen, vgl. Goslar/von der Linden, NZG 2009, 1337, 1338 f.; Kiefner, NZG 2011, 201, 202; Mülbert/Wilhelm, ZHR 176 (2012), 286, 293 f.; befürwortend Tröger, ZHR 175 (2011), 746, 777 m.w.N. 253 BGHZ 182, 272 Rn. 18 = NZG 2009, 1270 (Umschreibungsstopp). 254 BGHZ 182, 272 Rn. 18 = NZG 2009, 1270 (Umschreibungsstopp); vgl. auch LG Krefeld ZIP 2007, 730, 733, das trotz unvollständiger Entsprechenserklärung keinen schwerwiegenden Verstoß annahm, da die Abweichung den Aktionären erkennbar war bzw. sein musste. 255 BGHZ 180, 9 Rn. 19, 21 = NJW 2009, 2207 (Kirch/Deutsche Bank); BGHZ 182, 272 Rn. 18 = NZG 2009, 1270 (Umschreibungsstopp). 256 BGHZ 182, 272 Rn. 18 = NZG 2009, 1270 (Umschreibungsstopp).
§ 7 Regelarrangements mit mittelbarer Rechtsverbindlichkeit
93
Im Hinblick auf die Anfechtbarkeit von Hauptversammlungsbeschlüssen zeitigen die Kodexempfehlungen über § 161 AktG damit mittelbar rechtliche Wirkungen. Anknüpfungspunkt der Anfechtbarkeit ist zwar nicht die mangelnde Befolgung der Kodexempfehlung selbst, sondern die Verletzung der Erklärungspflicht aus § 161 AktG. Indem der Bundesgerichtshof es jedoch nicht bei der rein formalen Feststellung belässt, dass § 161 AktG verletzt wurde, sondern bei der Frage, ob rechtliche Folgen mit dem Gesetzesverstoß verbunden sind, auf den konkreten Inhalt der jeweils betroffenen Kodexbestimmung Bezug nimmt, erlangen diese zumindest mittelbare rechtliche Relevanz.257 Für die Unternehmen bleibt stets das Risiko, dass eine Missachtung von Kodexempfehlungen bei positiver Entsprechenserklärung als „gravierend“ eingestuft wird und damit die Anfechtung eines Hauptversammlungsbeschlusses zur Folge haben kann. Derzeit noch nicht absehbar ist, inwieweit der Bundesgerichtshof seine Rechtsprechung auf Wahlbeschlüsse von Aufsichtsratsmitgliedern oder sonstige Beschlüsse ausdehnen wird, was gegebenenfalls den rechtlichen Aktionsradius der Kodexempfehlungen in Verbindung mit § 161 AktG weiter ausdehnen würde.258
VI. Rechnungslegungsregeln des DRSC 1. Entstehungsgeschichte Ein weiteres bedeutsames Beispiel für ein privates Regelwerk, das mittelbare rechtliche Wirkungen entfaltet, sind die Rechnungslegungsregeln des „DRSC – Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e.V.“. Das Handelsgesetzbuch von 1897 enthielt nur allgemeine Grundsätze der Rechnungslegung und verwies für Detailfragen auf die „Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung“ als einfachen Handelsbrauch.259 Mit der Novellierung des Aktienrechts in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden die gesetzlichen Bestimmungen 257 Vgl. auch Kleindiek, in: FS Goette, S. 239, 252: Die Entscheidungen haben das Bewusstsein für die rechtliche Relevanz geschärft. 258 Für die Anfechtbarkeit eines Aufsichtsratswahlbeschlusses OLG München ZIP 2009, 133, 135 (MAN); LG Hannover ZIP 2010, 833, 834 f. (Continental); Vetter, NZG 2008, 121, 123 f.; Waclawik, ZIP 2011, 885, 890; a.A. LG München I NZG 2008, 150, 151 f.; Hüffer, ZIP 2010, 1979 ff.; Mülbert/Wilhelm, ZHR 176 (2012), 286, 296 ff., 324; Tröger, ZHR 175 (2011), 746, 772 ff., 785 f.; für einen die Anfechtbarkeit unter den Voraussetzungen des § 243 Abs. 4 S. 1 AktG begründenden verfahrensrechtlichen Informationsfehler Goette, in: MüKo AktG, § 161 Rn. 94 ff.; Habersack, Gutachten 69. DJT, E 46 f.; Koch, in: Hüffer/Koch, AktG, § 161 Rn. 32; ausführlich zur Problematik Mülbert/Wilhelm, ZHR 176 (2012), 286, 295 ff.; Stenger, Kodex und Entsprechenserklärung, S. 179 ff. 259 Zur Geschichte des Handelsbilanzrechts Köndgen, AcP 206 (2006), 477, 487 f.; Schön, ZHR 161 (1997), 133 ff.; zur rechtstheoretischen Einordnung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vgl. Buck-Heeb/Dieckmann, Selbstregulierung im Privatrecht, S. 123 m.w.N. Von der überwiegenden Meinung werden die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung als eine Mischung aus Gewohnheitsrecht und Handelsbrauch eingestuft, vgl. statt aller Merkt, in: Baumbach/Hopt, HGB, § 238 Rn. 11; zu Begriff, Rechtsnatur und Er-
94
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
umfangreicher.260 Der subsidiäre Verweis auf die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung blieb aber bestehen. Seit den 1960er Jahren wurden die insoweit maßgeblichen Standards vornehmlich durch die Vorgaben des Instituts der Wirtschaftsprüfer gesetzt. Im Jahre 1998 schuf der Gesetzgeber mit dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich261 ein neues Fundament für die Standardsetzung im Rechnungslegungsrecht. Mit dem neu eingefügten § 342 Abs. 1 HGB ermächtigte er das Bundesministerium der Justiz, eine privatrechtlich organisierte Einrichtung durch Vertrag anzuerkennen und diese u.a. mit der Entwicklung von Empfehlungen zur Anwendung der Grundsätze über die Konzernrechnungslegung zu betrauen (vgl. § 342 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 HGB). Dabei dürfe jedoch nur eine solche Einrichtung anerkannt werden, die aufgrund ihrer Satzung gewährleiste, dass die Empfehlungen und Interpretationen unabhängig und ausschließlich von Rechnungslegern in einem Verfahren entwickelt und beschlossen werden, das die fachlich interessierte Öffentlichkeit mit einbezieht. Soweit Unternehmen oder Organisationen von Rechnungslegern Mitglied einer solchen Einrichtung seien, dürften die Mitgliedschaftsrechte nur von Rechnungslegern ausgeübt werden (vgl. § 342 Abs. 1 S. 2 und 3 HGB). Zugleich ordnete der Gesetzgeber in § 342 Abs. 2 HGB an, dass die Beachtung der die Konzernrechnungslegung betreffenden Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermutet wird, soweit die vom Bundesministerium der Justiz bekanntgemachten Empfehlungen einer nach Abs. 1 S. 1 anerkannten Einrichtung beachtet worden sind. Mit Blick auf das laufende Gesetzgebungsverfahren wurde am 17. 03. 1998 von Unternehmensvertretern, Finanzintermediären und Wirtschaftsprüfern das „DRSC – Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e.V.“ gegründet.262 Das Bundesministerium der Justiz erkannte sodann das DRSC durch Standardisierungsvertrag vom 03. 09. 1998 als privates Rechnungslegungsgremium i.S.d. § 342 Abs. 1 S. 1 HGB an.263 Innerhalb des DRSC werden die Rechnungslegungsstandards i.S.d. § 342 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 HGB vom sog. HGB-Ausschuss erarbeitet (vgl.
mittlungsverfahren der Grundsätze ordnungsgmäßer Buchführung vgl. Schmidt/Usinger, in: Beck’scher Bilanz-Kommentar, § 243 HGB Rn. 1 ff. 260 Vgl. §§ 125 – 144 AktG 1935. 261 Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) vom 27. 04. 1998, BGBl. I, S. 786, in Kraft getreten am 01. 05. 1998. 262 International tritt das DRSC unter der Bezeichnung „ASCG – Accounting Standards Committee of Germany“ auf. 263 Abrufbar ist der Standardisierungsvertrag unter: http://www.drsc.de/service/ueber_uns/index.php (zuletzt abgerufen am 12. 10. 2016). Zwischenzeitlich hatte das DRSC den Standardisierungsvertrag wegen fehlender Gewährleistung zukünftiger Finanzierung zum 31. 12. 2010 gekündigt. Am 02. 12. 2011 wurde aber zwischen dem Bundesministerium der Justiz und dem DRSC ein neuer Standardisierungsvertrag geschlossen, vgl. dazu Ebke/ Paal, in: MüKo HGB, § 342 Rn. 2.
§ 7 Regelarrangements mit mittelbarer Rechtsverbindlichkeit
95
§§ 20 Abs. 1 b) und 22 a) DRSC-Satzung).264 Dieser Fachausschuss besteht aus sieben unabhängigen Mitgliedern, die auf fünf Jahre gewählt sind. Bei ihrer Wahl ist darauf zu achten, dass die Interessen der Aufsteller, Prüfer und Nutzer der Rechnungslegung gewahrt sind. Mitglied eines Fachausschusses kann nur sein, wer über besondere Fachkompetenz und Erfahrung auf dem Gebiet der Rechnungslegung verfügt (vgl. § 19 Abs. 1 und 2 DRSC-Satzung). Das Bundesministerium der Justiz ist berechtigt, an den Sitzungen der Fachausschüsse ohne Stimmrecht teilzunehmen (vgl. § 19 Abs. 4 DRSC-Satzung). 2. Privater Charakter der Regeln Wie schon beim Deutschen Corporate Governance Kodex ist auch hier umstritten, ob die Regelungen des DRSC staatlicher oder privater Natur sind. Einzelne Stimmen in der Literatur scheinen in der Standardsetzung durch das DRSC eine Form staatlicher Regelsetzung zu erblicken. So wird u.a. von einer „Selbstverwaltungsaufgabe der Kaufleute“265 oder von einer privatrechtsförmigen Verwaltungskommission, die mit der Gesetzeskonkretisierung exekutive Tätigkeiten wahrnehme,266 gesprochen. Ganz überwiegend werden die Rechnungslegungsstandards indes aber als private Regeln verstanden.267 Dem ist zu folgen. Zwar nimmt das DRSC wie andere private Normungsverbände eine öffentliche Aufgabe wahr.268 Das hat aber nicht zur Folge, dass es Selbstverwaltungsaufgaben der mittelbaren Staatsverwaltung oder staatliche Verwaltungsaufgaben erfüllt.269 Für eine mittelbare Staatsverwaltung wäre erforderlich, dass dem DRSC durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes Hoheitsbefugnisse übertragen wurden. Eine solche Übertragung von Hoheitsbefugnissen erfolgte aber weder durch die in § 342 Abs. 1 HGB vorgesehene bloße Ermächtigung des Bundesministeriums der Justiz, durch Vertrag ein privates Rechnungslegungsgremium anzuerkennen, noch in dem daraufhin geschlossenen Anerkennungsvertrag.270 Überdies wäre eine Übertragung von Hoheitsbefugnissen im Wege mittelbarer Staatsverwaltung im vorliegenden Fall auch nicht zulässig. Eine mittelbare Staatsverwaltung setzt eine sozialhomogene Betroffenengemeinschaft voraus, d.h., von der Standardsetzung muss ein autonomiefähiger Personenkreis mit abgrenzbarem
264 Die Satzung des DRSC (Stand: 02. 07. 2015) ist abrufbar unter: http://www.drsc.de/ service/ueber_uns/index.php (zuletzt abgerufen am 12. 10. 2016). 265 So Biener, in: FS Clemm, S. 59, 69 f. 266 So Hohl, Private Standardsetzung, S. 315. 267 Vgl. etwa Buck-Heeb/Dieckmann, Selbstregulierung im Privatrecht, S. 126; Hellermann, NZG 2000, 1097, 1098; Hommelhoff/M. Schwab, BFuP 1998, 38, 39 f. 268 Hellermann, NZG 2000, 1097, 1098; Marburger, Regeln der Technik, S. 590. 269 Hellermann, NZG 2000, 1097, 1098. 270 Hellermann, NZG 2000, 1097, 1098.
96
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
gemeinsamen Interesse betroffen sein.271 Hieran fehlt es bei der Standardsetzung durch das DRSC, weil die buchführungspflichtigen Unternehmen, die Wirtschaftsprüfer und auch die Allgemeinheit, d.h. diejenigen Personen, die als Anleger oder Gläubiger potenziell betroffen sind, am Inhalt der Standards ein zumindest teilweise gegenläufiges Interesse haben.272 Eine Beleihung des DRSC mit Verwaltungsaufgaben würde voraussetzen, dass das regelsetzende Gremium durch Gesetz bzw. aufgrund eines Gesetzes staat licherseits ermächtigt wurde, bestimmte Verwaltungsaufgaben in öffentlich-rechtlichen, hoheitlichen Handlungsformen selbstständig wahrzunehmen.273 Nach traditionellem Verständnis kann Gegenstand der übertragenen Verwaltungsaufgabe aber nicht eine gestaltende Normsetzung sein, sondern lediglich die Wahrnehmung fest umrissener Vollzugsaufgaben.274 Schließlich führen die Anerkennung des DRSC sowie die Bekanntmachung und die Rechtskontrolle der Empfehlungen durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz275 nicht zu einer Einordnung in die staatliche Sphäre. Maßgeblich ist insoweit, dass die Rechnungslegungsstandards vom DRSC autonom, d.h. frei von staatlicher Diktion inhaltlich ausgearbeitet werden. 3. Rechtswirkungen der Standards Im Hinblick auf die Rechtswirkungen der vom DRSC erlassenen Rechnungslegungsstandards besteht insoweit Einigkeit, als diese für sich genommen unverbindliche Verhaltensleitlinien darstellen, d.h. weder die Unternehmen verpflichten, nach den Vorgaben des DRSC Rechnung zu legen, noch den Richter zwingend binden.276 Mittelbare rechtliche Wirkungen entfalten die Standards des DRSC aber über § 342 Abs. 2 HGB. Danach ist zu vermuten, dass ein Unternehmen ordnungsgemäß Buch geführt hat, soweit es die vom DRSC erlassenen und vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz bekannt gemachten Standards beachtet hat. Für den Betroffenen werden die Rechnungslegungsstandards des DRSC damit mittelbar dadurch rechtsverbindlich, dass die Gerichte bei deren Einhaltung grundsätzlich von einem mit den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung konformen Konzernabschluss auszugehen haben.277 271 Hommelhoff/M. Schwab, BFuP 1998, 38, 44 f.; M. Schwab, in: Staub, HGB, § 342 Rn. 16. 272 Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 188; Hommelhoff/ M. Schwab, BFuP 1998, 38, 44 f.; M. Schwab, in: Staub, HGB, § 342 Rn. 16. 273 Zur Beleihung und ihren Voraussetzungen Maurer, Verwaltungsrecht, § 23 Rn. 56 f.; Wolff/Bachof/Stober/Kluth, Verwaltungsrecht, Bd. II, § 90 Rn. 1 ff. 274 Vgl. Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 189 f. 275 Zur Rechtskontrolle durch das Bundesministerium der Justiz vgl. M. Schwab, in: Staub, HGB, § 342 Rn. 94 ff. 276 Ebke, ZIP 1999, 1193, 1201; ders., in: MüKo HGB, § 342 Rn. 22; Hellermann, NZG 2000, 1097, 1001; M. Schwab, in: Staub, HGB, § 342 Rn. 83.
§ 7 Regelarrangements mit mittelbarer Rechtsverbindlichkeit
97
Die rechtsdogmatische Einordnung dieser Vermutungswirkung ist in der Literatur umstritten. Einige Autoren nehmen mit Blick darauf, dass der Vermutungsbegriff aus der Terminologie des Beweisrechts stammt, an, es handele sich bei dieser normativen Konformitätsvermutung des § 342 Abs. 2 HGB um eine Beweislastregel im prozessualen Sinne.278 Andere gehen von einer widerleglichen Rechtsvermutung aus.279 Die Standards i.S.d. § 342 Abs. 1 HGB würden die gesetzliche Vermutung in sich tragen, die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung zu verkörpern. Der Vermutungsinhalt wiederum beruhe auf der Annahme des Gesetzgebers, dass die Standards die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung in zulässiger Weise konkretisieren. Einige Stimmen erblicken in § 342 Abs. 2 HGB demgegenüber eine bloße Kompetenzvorschrift zugunsten des DRSC, normative Vorgaben mit Inhalt zu füllen.280 Die Vermutungsregel führe zu einer (teilweisen) Kompetenzverlagerung der Befugnis zur Gesetzeskonkretisierung von den Gerichten auf den HGB-Ausschuss und das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz.281 Hieran anknüpfend wird § 342 Abs. 2 HGB teilweise auch als eine normkonkretisierende dynamische Verweisung angesehen, die die Standards in das Gesetz inkorporiere und am gesetzlichen Geltungsanspruch teilhaben lasse.282 277
Die Einordnung des § 342 Abs. 2 HGB als Beweislastregel im prozessualen Sinne vermag nicht zu überzeugen.283 Die Rechtsfigur der Tatsachenvermutung, nach der bei Vorliegen einer Vermutungsbasis auf eine Tatsache als Vermutungsinhalt zu schließen ist,284 ist nur auf Tatsachen zugeschnitten, nicht auf normative Wertungen.285 Sie ist auf die Regelung des § 342 Abs. 2 HGB daher nicht anwendbar, da 277 Vgl. Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 193 f.; Berberich, Ein Framework für das DRSC, S. 134 f.; Hellermann, NZG 2000, 1097, 1099; Möllers/ Fekonja, ZGR 2012, 777, 799; gegen jeglichen Rechtsgeltungsanspruch M. Schwab, in: Staub, HGB, § 342 Rn. 89: § 342 Abs. 2 HGB verstößt gegen den Numerus clausus der Rechtsnormen. Die Vermutung läuft ins Leere; die gerichtliche Kompetenz zur Fortbildung und Kontrolle der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung wird nicht beschnitten. 278 Merkt, in: Baumbach/Hopt, HGB, § 342 Rn. 4; Schmidt/Holland, in: Beck’scher Bilanz-Kommentar, § 342 HGB Rn. 19. 279 Ebke, ZIP 1999, 1193, 1202 f.; ders./Paal, in: MüKo HGB, § 342 Rn. 23 f. 280 Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 193; Berberich, Ein Framework für das DRSC, S. 136 f.; Hellermann, NZG 2000, 1097, 1099; Hohl, Private Standardsetzung, S. 314. 281 Hohl, Private Standardsetzung, S. 314; dagegen Schulze/Osterloh, ZIP 2001, 1433, 1439. 282 Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 191 f. 283 Dagegen auch Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 192; Berberich, Ein Framework für das DRSC, S. 127 f.; Hellermann, NZG 2000, 1097, 1098 f.; Hommelhoff/M. Schwab, BFuP 1998, 38, 42; M. Schwab, in: Staub, HGB, § 342 Rn. 84; allgemein zu gesetzlichen Vermutungen Schneider, Gesetzgebung, Rn. 364 f. 284 Vgl. etwa §§ 363, 685 Abs. 2, 938, 1117 Abs. 3, 1213 Abs. 2, 1253 Abs. 2, 1377 Abs. 3, 1600, 1600o Abs. 2 S. 1, 1625, 2009, 2270 Abs. 2 BGB. 285 Vgl. Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 192 m.w.N.
98
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung gerade nicht nur technisch-fachliche Anforderungen enthalten, sondern insbesondere normative Wertungen,286 etwa ob der Anleger- oder Gläubigerschutz im Vordergrund stehen soll oder wie die Regeln international anschlussfähig gemacht werden können.287 Auch der Qualifikation des § 342 Abs. 2 HGB als gesetzliche Rechtsvermutung kann nicht gefolgt werden.288 Bei einer Rechtsvermutung wird das Vorliegen einer Tatsache (Vermutungsgrundlage) mit der Vermutung einer bestimmten Rechtsposition oder Rechtslage verknüpft (Vermutungsinhalt).289 Im Rahmen des § 342 Abs. 2 HGB wird von der Einhaltung der Rechnungslegungsstandards des DRSC (Vermutungsgrundlage) jedoch nicht auf ein Recht (Vermutungsinhalt) geschlossen, sondern auf die Rechtmäßigkeit eines Verhaltens.290 Dies zu beurteilen ist jedoch originäre Aufgabe des Gerichts. Bewertungen lassen sich weder vermuten noch durch Gegenbeweis widerlegen.291 Hinzu kommt, dass der zur Widerlegbarkeit erforderliche Gegenbeweis seinerseits wiederum nur an Tatsachen anknüpfen kann. Ob die Rechnungslegungsstandards des DRSC mit den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung im konkreten Fall übereinstimmen, ist jedoch wiederum eine Bewertungsfrage.292 Die Vermutung des § 342 Abs. 2 HGB kann nur im untechnischen Sinn, d.h. so verstanden werden, dass die Gerichte bei Beachtung der Rechnungslegungsstandards des DRSC im Regelfall von der Angemessenheit der Wertungen in den Standards ausgehen können und sollen.293 Der vom Gesetzgeber verwendete Begriff der Vermutung ist insofern unglücklich gewählt, als er die intendierte Bindung der Gerichte ins Beweisrecht zu verlagern scheint.294 Tatsächlich wird über § 342 Abs. 2 HGB eine Kompetenz zur Konkretisierung normativer Vorgaben geschaffen.295 So286 Vgl. Hellermann, NZG 2000, 1097, 1098; Hommelhoff/M. Schwab, BFuP 1998, 38, 42; M. Schwab, in: Staub, HGB, § 342 Rn. 84. 287 Vgl. Köndgen, AcP 206 (2006), 477, 489 f.; Schuppert/Bumke, in: Kleindiek/Oehler (Hrsg.), Die Zukunft des deutschen Bilanzrechts, S. 71, 77; M. Schwab, BB 1999, 731, 733 ff. 288 Dagegen auch Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 193; Berberich, Ein Framework für das DRSC, S. 127; Hellermann, NZG 2000, 1097, 1099; M. Schwab, in: Staub, HGB, § 342 Rn. 84. 289 Typische Beispiele sind: §§ 891, 921, 1006, 1138, 1155, 1360b, 1362, 1380 Abs. 1 S. 2, 1620, 1964, 2255 S. 2, 2365 BGB. 290 Vgl. Berberich, Ein Framework für das DRSC, S. 127 f.; M. Schwab, in: Staub, HGB, § 342 Rn. 84. 291 Berberich, Ein Framework für das DRSC, S. 128. 292 Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 193; Hellermann, NZG 2000, 1097, 1099. 293 M. Schwab, in: Staub, HGB, § 342 Rn. 84. 294 Kritisch zum in diesem Kontext verwendeten Begriff der Vermutung Hellermann, NZG 2000, 1097, 1099; Hommelhoff/M. Schwab, BFuP 1998, 38, 42; Moxter, DB 1998, 1425, 1427; M. Schwab, BB 1999, 731, 732; die Vermutungsregel befürwortend Biener, in: FS Clemm, S. 59, 70.
§ 7 Regelarrangements mit mittelbarer Rechtsverbindlichkeit
99
weit hieran anknüpfend teilweise dafür plädiert wird, § 342 Abs. 2 HGB als klassische dynamische Verweisungsnorm einzustufen, kann dem nicht gefolgt werden.296 Denn anders als bei klassischen Verweisungen nehmen die Standards nicht am gesetzlichen Geltungsanspruch teil; sie gelten nicht wie Gesetze bis zu ihrer förmlichen Aufhebung, sondern verlieren automatisch ihre Gültigkeit, wenn sie veraltet sind oder der Sachverhalt atypisch ist.297 295
VII. Zusammenfassung Mittelbare Rechtswirkungen entfalten solche private Regeln, die für die Beteiligten zwar nicht unmittelbar verbindlich sind, von den Gerichten im Einzelfall aber als Orientierungshilfe herangezogen werden, um die gesetzlichen Verpflichtungen der Betroffenen zu konkretisieren. Derartige Regeln zeitigen ihre Rechtswirkungen folglich erst auf Ebene der Rechtsanwendung. Gemein ist ihnen weiter, dass es um Materien geht, in denen ein besonderer Sachverstand und eine große Sachnähe der Regelsetzer gefragt ist (sog. Expertenrecht). Hierzu gehören zunächst technische Normen, sog. Quantifizierungen und die IDW PS. In der Zusammenschau mit § 161 AktG entfalten auch die Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex mittelbare Rechtswirkungen. Neben dem wohl nur theoretisch bestehenden Risiko einer Schadensersatzhaftung bei Abgabe einer fehlerhaften Entsprechenserklärung werden die Kodexempfehlungen dadurch zum Gegenstand einer gerichtlichen Rezeption, dass die Abgabe einer fehlerhaften Entsprechenserklärung zur Anfechtbarkeit von Entlastungsbeschlüssen der Hauptversammlung führen kann. Insbesondere belässt es die Rechtsprechung hier nicht bei der formalen Feststellung, dass § 161 AktG verletzt wurde, sondern nimmt bei der Frage, ob rechtliche Folgen damit verbunden sind – was voraussetzt, dass die Verletzung der Erklärungspflicht nach § 161 AktG einen eindeutigen und gravierenden Gesetzesverstoß darstellt – auf den konkreten Inhalt der verletzten Kodexbestimmung Bezug. Über die Qualität des Verstoßes gegen § 161 AktG urteilt der Bundesgerichtshof also erst in einer Gesamtschau mit der konkreten Kodexempfehlung, die für die Unrichtigkeit der Entsprechenserklärung kausal geworden ist. Den Rechnungslegungsstandards des DRSC sind schließlich durch gesetzliche Anordnung in § 342 Abs. 2 HGB mittelbare Rechtswirkungen zugeschrieben. Die Vorschrift des § 342 Abs. 2 HGB hält die Gerichte dazu an, jedenfalls dann von einem mit den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung konformen Konzernabschluss auszugehen, wenn die Rechnungslegungsstandards des DRSC eingehalten worden sind. 295 So ausdrücklich Hellermann, NZG 2000, 1097, 1099: Kompetenz zur Gesetzeskonkretisierung. 296 Explizit dagegen auch M. Schwab, in: Staub, HGB, § 342 Rn. 85. 297 M. Schwab, in: Staub, HGB, § 342 Rn. 85. Hinzu kommt, dass allenfalls noch von einer teilweise dynamischen normkonkretisierenden Verweisungsvorschrift gesprochen werden könnte, da bei Abschluss des Standardisierungsvertrags 2011 bereits Rechnungslegungsstandards bestanden.
100
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
§ 8 Regeln mit Verbindlichkeitsanspruch I. Grundlagen Im Folgenden gilt es, die privaten Regeln der dritten Systematisierungsstufe vorzustellen. Dies sind diejenigen privaten Regeln, die für ihre Adressaten unmittelbar rechtsverbindlich sind, d.h. als privates Recht vom Einzelnen vor den staatlichen Gerichten durchgesetzt und unter Zuhilfenahme staatlicher Zwangsmittel vollstreckt werden können. Wie bereits ausgeführt, läuft die Setzung unmittelbar verbindlichen Rechts zweistufig ab. Auf der ersten Stufe sind die Privaten grundsätzlich frei, den Inhalt von Regeln privatautonom auszuformulieren. Auf der zweiten Stufe bedarf es eines staatlichen Anerkennungsakts, mithilfe dessen die Regeln zu privatem Recht erstarken. Diese Anerkennung kann erfolgen durch Bereitstellung einer Rechtssatzform, einer Organisationsform oder durch Schaffung eines subjektiven absoluten Rechts.298 Als Rechtssatzform stellt der Gesetzgeber den Privaten als Gestaltungsformen im Sinne eines vorweggenommenen Anerkennungsakts das einseitige Rechtsgeschäft, den Vertrag, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Verbandsregeln sowie die Normenverträge in Form der Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen zur Verfügung.299 Als Organisationsform hält er für die Regelproduzenten namentlich den Verband bereit.300 Die Anerkennung durch Bereitstellung einer Rechtssatzform überschneidet sich hier mit der Anerkennung durch Bereitstellung einer Organisationsform insoweit, als die Rechtsetzung nicht bereits durch die bloße Existenz des Verbands erfolgt, sondern erst durch die konkrete Ausgestaltung der Verbandsregeln als Rechtssatzform. Subjektive absolute Rechte sind etwa der (berechtigte) Besitz oder das Eigentum sowie Immaterialgüterrechte.301 In Bezug auf die Reichweite der eintretenden rechtlichen Wirkungen kann zwischen ein-, zweiund mehrseitig bindenden Regeln unterschieden werden.
II. Einseitige Rechtsetzung durch Private 1. Einseitige Bindung durch Rechtsgeschäft a) Auslobung und Preisausschreiben Zunächst soll das Augenmerk auf die einseitig bindenden Rechtsregeln gerichtet werden. Derartige Rechtsregeln bilden die Ausnahme.302 Grundsätzlich sind einseiF. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 140 ff. Vgl. auch Bachmann, Private Ordnung, S. 259 ff. und zur Frage der Fortbildung der rechtsgeschäftlichen Gestaltungsformen S. 266 ff. 300 F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 141. 301 F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 142. 302 Vgl. Bachmann, Private Ordnung, S. 280. 298
299
§ 8 Regeln mit Verbindlichkeitsanspruch
101
tige Selbstverpflichtungen unverbindlich. Namentlich aus § 311 Abs. 1 BGB lässt sich die Wertung entnehmen, dass der Gesetzgeber im Grundsatz davon ausgeht, dass „zur Begründung eines Schuldverhältnisses durch Rechtsgeschäft (...) ein Vertrag zwischen den Beteiligten erforderlich (ist), soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt.“ 303 Etwas anderes schreibt das Gesetz zunächst für die Auslobung in § 657 BGB vor.304 Danach ist jeder, der durch öffentliche Bekanntmachung eine Belohnung für die Vornahme einer Handlung, insbesondere für die Herbeiführung eines Erfolgs, aussetzt, verpflichtet, die Belohnung demjenigen zu entrichten, der die Handlung vorgenommen hat, auch wenn dieser nicht mit Rücksicht auf die Auslobung gehandelt hat. Bis zum Inkrafttreten des BGB ordnete die herrschende Meinung die Auslobung zwar noch überwiegend als Vertrag ein. Sie fasste die Belohnungszusage als Vertragsantrag ad incertam personam auf, der durch eine bestimmte Person mittels Vornahme der ausgelobten Handlung angenommen wurde.305 Im Hinblick auf den Wortlaut des § 657 BGB, wonach die Verpflichtung zur Entrichtung der Belohnung bereits durch Aussetzung einer Belohnung in Form öffentlicher Bekanntmachung und unabhängig davon eintritt, ob der später Begünstigte mit Rücksicht auf die Auslobung gehandelt hat, ist heute aber einhellig anerkannt, dass es sich bei der Auslobung um ein einseitiges Rechtsgeschäft handelt.306 Diese Verpflichtung bedarf keiner Annahmeerklärung, sondern entsteht bereits mit der öffentlichen Erklärung als solche, gegebenenfalls sogar gegen den Willen des zu Belohnenden.307 Eine besondere Form der Auslobung stellt das Preisausschreiben gemäß § 661 BGB dar.308 Auch hier ist die Aussetzung einer Belohnung Gegenstand des einseitigen Rechtsgeschäfts. Das Preisausschreiben gemäß § 661 BGB unterscheidet sich 303 Noch deutlicher formulierte es der erste Kommissionsentwurf zum BGB. In dessen § 342 BGB, aus dem der heutige § 311 Abs. 1 BGB hervorgegangen ist, hieß es noch: „Das einseitige, nicht angenommene, auch zur Annahme nicht bestimmte Versprechen einer Leistung, obwohl mit dem Verpflichtungswillen abgegeben, (ist unverbindlich), sofern nicht das Gesetz ein Anderes bestimmt“, vgl. Motive II, S. 175. 304 Die Auslobung wurde neben dem Stiftungsgeschäft bereits in den Motiven als Ausnahme vom Vertragsprinzip genannt, vgl. Motive II, S. 175. Die dort ebenfalls genannten Schuldverschreibungen auf den Inhaber, heute § 793 BGB, bilden kein Beispiel für einseitig begründete Verpflichtungen, da heute ganz überwiegend die zur Rechtsscheintheorie fortentwickelte Vertragstheorie vertreten wird und nicht mehr die um die Wende zum 20. Jahrhundert noch vorherrschende Kreationstheorie, vgl. dazu Habersack, in: MüKo BGB, Vorbem. zu §§ 793 ff. Rn. 24 ff. 305 Umfassend dazu Dreiocker, Zur Dogmengeschichte der Auslobung, S. 131 ff. m.w.N. 306 Vgl. dazu etwa Seiler, in: MüKo BGB, § 657 Rn. 4; Sprau, in: Palandt, BGB, § 657 Rn. 1. 307 Vgl. F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 466. 308 Statt aller Sprau, in: Palandt, BGB, § 661 Rn. 1.
102
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
jedoch insoweit von der allgemeinen Auslobung i.S.d. § 657 BGB, als hier nicht eine beliebige Belohnung ausgesetzt wird, sondern Gegenstand der Auslobung eine Preisbewerbung ist. Ferner muss vorgesehen sein, dass sich der oder die Interessenten binnen einer bestimmten Frist um den Preis bewerben. Keinen Fall eines einseitigen Rechtsgeschäfts bildet die in § 661a BGB geregelte Gewinnzusage. Nach § 661a BGB hat zwar ein Unternehmer, der Gewinnzusagen oder vergleichbare Mitteilungen an Verbraucher sendet und durch die Gestaltung dieser Zusendungen den Eindruck erweckt, dass der Verbraucher einen Preis gewonnen hat, dem Verbraucher diesen Preis zu leisten. Nach herrschender Meinung kann diese Mitteilung aber nicht als einseitiges Rechtsgeschäft verstanden werden, da sie ohne Erklärungsbewusstsein abgegeben wird.309 b) Einseitige Organisationsgeschäfte Außerhalb des Schuldrechts bilden sog. einseitige Organisationsgeschäfte eine Fallgruppe einseitiger Rechtsgeschäfte. Hierher gehört zunächst das Stiftungsgeschäft nach § 81 BGB.310 Bei diesem handelt es sich um eine verbindliche Erklärung des sog. Stifters, ein Vermögen zur Erfüllung eines von ihm vorgegebenen Zwecks zu widmen. Es ist Voraussetzung für die Anerkennung der Stiftung und deren Rechtsfähigkeit.311 Zu den einseitigen Organisationsgeschäften zählt ferner der Organisationsakt zur Einmann-Gründung einer Aktiengesellschaft oder GmbH nach den §§ 2, 36 Abs. 2 AktG, § 1 GmbHG.312 Auch hier liegt ein einseitiges Rechtsgeschäft in Form des den Rechtsträger begründenden Akts vor.313 c) Testament Ein weiteres einseitiges Rechtsgeschäft findet sich im Erbrecht in Form des Testaments i.S.d. § 2247 BGB als einseitige Verfügung von Todes wegen.314 Das Testament wird einseitig vom Erblasser formuliert, seine Wirksamkeit hängt nicht vom Willen des Bedachten oder der in anderer Weise vom Testament Betroffenen (z.B. 309 Vgl. BGHZ 165, 172, 179 = NJW 2006, 230, 232; Lorenz, NJW 2000, 2205, 2207; ders., NJW 2006, 472, 474; Seiler, in: MüKo BGB, § 661a Rn. 4; Sprau, in: Palandt, BGB, § 661a Rn. 1 f.; a.A. Bachmann, Private Ordnung, S. 281; Emmerich, in: MüKo BGB, § 311 Rn. 21; offenlassend BGHZ 153, 82, 88 = NJW 2003, 426, 427: einseitiges Rechtsgeschäft oder geschäftsähnliche Handlung. 310 Bachmann, Private Ordnung, S. 282; Ellenberger, in: Palandt, BGB, § 80 Rn. 1, § 81 Rn. 2; Emmerich, in: MüKo BGB, § 311 Rn. 21; F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 461 ff.; Stadler, in: Jauernig, BGB, § 311 Rn. 1. 311 Ellenberger, in: Palandt, BGB, § 81 Rn. 1. 312 Statt aller K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 40 II 2 a (S. 1247) (für die GmbH). 313 Vgl. Bachmann, Private Ordnung, S. 282. 314 Bachmann, Private Ordnung, S. 281; Grüneberg, in: Palandt, BGB, Überblick vor § 311 Rn. 4; Löwisch/Feldmann, in: Staudinger, BGB, § 305 Rn. 15; Stadler, in: Jauernig, BGB, § 311 Rn. 1.
§ 8 Regeln mit Verbindlichkeitsanspruch
103
Testamentsvollstrecker) ab.315 Testamentarisch festgelegt werden können namentlich die Erbeinsetzung, die Enterbung gemäß § 1938 BGB, der Testamentswiderruf gemäß §§ 2254, 2258 BGB, Teilungsanordnungen gemäß § 2048 BGB, die Ernennung eines Testamentsvollstreckers gemäß § 2197 BGB, die Entziehung eines Pflichtteils gemäß § 2333 i.V.m. § 2336 BGB, die Zuwendung eines Vermächtnisses gemäß 1939 BGB oder etwa die Setzung einer Auflage gemäß § 1940 BGB.316 Unmittelbar mit dem Erbfall erlangen die Erben die dingliche und schuldrechtliche Rechtsposition des Erblassers bzw. die Vermächtnisnehmer und sonstigen Dritten obligatorische Rechte und Pflichten. Die Rechtswirkungen können erst durch Ausschlagung gemäß §§ 1942 ff. BGB wieder beseitigt werden. Dass die Bedachten vor dem Erbfall weder ein Recht noch eine Anwartschaft auf die Erbschaft erlangen, sondern eine bloße tatsächliche Aussicht hierauf, weil der Erblasser in seinen Verfügungen von Todes wegen und unter Lebenden ungebunden bleibt, steht der Einstufung als bindendes einseitiges Rechtsgeschäft nicht entgegen. Das Testament ist mit seiner Errichtung grundsätzlich außenwirksam.317 Es bedarf eines besonderen Rechtsakts, um seine Rechtswirkungen aus der Welt zu schaffen wie etwa eines Widerrufs (§§ 2253 ff. BGB) oder einer Anfechtung (§§ 2078 ff. BGB). Lediglich die innere Wirksamkeit des Testaments tritt erst mit dem Erbfall ein. d) Arbeitsrechtliches Direktions- und Weisungsrecht Das Arbeitsrecht kennt das einseitige Rechtsgeschäft in Form des sog. Direktions- und Weisungsrechts des Arbeitgebers gemäß § 106 GewO. Es wird zur Konkretisierung der im Arbeitsvertrag im Regelfall nicht näher bestimmten Pflichten des Arbeitsnehmers benötigt und ermöglicht dem Arbeitgeber einseitig, rechtlich bindende Anordnungen an den einzelnen Arbeitnehmer zu erlassen.318 § 106 S. 1 GewO gestattet dem Arbeitgeber, Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistungen nach billigem Ermessen in rechtlich bindender Weise näher zu bestimmen, soweit dem nicht arbeits- oder tarifvertragliche, gesetzliche oder betriebsvertragliche Vorschriften entgegenstehen.319 Gemäß § 106 S. 2 GewO gilt dies auch hinsichtlich der Ordnung und des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb.320 Dabei kann der F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 469. zulässigen Inhalt eines Testaments vgl. Leipold, in: MüKo BGB, § 1937 Rn. 10 ff. 317 F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 470. 318 F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 235; Zöllner/Loritz/Hergenröder, Arbeitsrecht, § 7 Rn. 35. 319 Zum Umfang des Weisungsrechts im Einzelnen vgl. Müller-Glöge, in: MüKo BGB, § 611 Rn. 1016 ff. 320 Hinsichtlich der das Ordnungsverhalten regelnden Bestimmungen besteht ein Mitbestimmungsrecht eines vorhandenen Betriebsrats gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG, vgl. Müller-Glöge, in: MüKo BGB, § 611 Rn. 1022. 315
316 Zum
104
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
Arbeitgeber Einzelweisungen, aber auch allgemeine Regeln erlassen wie etwa Rauchverbote, Parkregelungen, Regelungen des Betriebszugangs oder Verhaltensrichtlinien in Form eines Ethikkodex. e) Arbeitsrechtliche Gesamtzusage Umstritten ist, ob auch die arbeitsrechtliche Gesamtzusage ein einseitiges Rechtsgeschäft darstellt. Hierbei handelt es sich um eine ausdrückliche Erklärung des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer, bestimmte freiwillige Leistungen zu gewähren, etwa Gratifikationen in Form von Ruhegeldzusagen oder Sonderzuwendungen zu bestimmten Gelegenheiten durch Aushang am Schwarzen Brett, per Rundschreiben, mündliche Zusage oder via Intranet.321 Derartige Erklärungen binden den Arbeitgeber, unabhängig davon, ob der einzelne Arbeitnehmer diese Zusage ausdrücklich annimmt oder nicht.322 Die herrschende Meinung begründet diese Bindungswirkung mithilfe des Vertragsprinzips. Die Gesamtzusage des Arbeitgebers werde von den Arbeitnehmern zwar nicht ausdrücklich, aber konkludent dadurch angenommen, dass sie die Leistungen entgegennehmen oder schlicht weiterarbeiten und der Arbeitgeber auf den Zugang der Annahmeerklärung stillschweigend i.S.d. § 151 BGB verzichtet.323 Ebenfalls auf das Vertragsprinzip stellen diejenigen Stimmen ab, die eine Annahmeerklärung des Arbeitnehmers unter Verweis darauf für entbehrlich halten, dass sich der Arbeitnehmer bereits bei Abschluss des Arbeitsvertrags mit allen zukünftigen Verbesserungen seiner Arbeitsbedingungen einverstanden erklärt und dem Arbeitgeber insoweit ein Gestaltungsrecht i.S.d. § 315 BGB einräumt.324 Vereinzelt wird die arbeitsrechtliche Gesamtzusage aber auch in Analogie zur Auslobung gemäß § 657 BGB als einseitiges Rechtsgeschäft verstanden.325 Der zuletzt genannten Ansicht ist zu folgen. Die von der herrschenden Meinung präferierte Lösung über eine konkludente Annahmeerklärung ist konstruiert.326 Insbesondere vermag es nicht zu überzeugen, die konkludente Annahmeerklärung darin zu erblicken, dass der Arbeitnehmer weiterarbeitet. Denn dazu ist er arbeitsvertraglich ohnehin verpflichtet.327 Ebenso erscheint die Überlegung gekünstelt, dass sich ein Arbeitnehmer mit Abschluss des Arbeitsvertrags sämtlichen zukünfMüller-Glöge, in: MüKo BGB, § 611 Rn. 408 m.w.N. Müller-Glöge, in: MüKo BGB, § 611 Rn. 408. 323 Vgl. Florig, Gesamtzusagen, S. 66; Krämer, Gesamtzusage, S. 81 f.; Löwisch/Feldmann, in: Staudinger, BGB, § 311 Rn. 19; Richardi/Fischinger, in: Staudinger, BGB, § 611 Rn. 878; Zöllner/Loritz/Hergenröder, Arbeitsrecht, § 7 Rn. 23. 324 So etwa Säcker, Gruppenautonomie, S. 146, 485. 325 Hilger, Das betriebliche Ruhegeld, S. 68 f.; Wolf, in: Soergel, BGB, § 305 Rn. 11; zu älteren, heute nicht mehr vertretenen Erklärungsversuchen vgl. Adomeit, Rechtsquellenfragen im Arbeitsrecht, S. 109 ff. m.w.N. 326 Vgl. Bachmann, Private Ordnung, S. 286. 327 So auch Bachmann, Private Ordnung, S. 286. 321
322
§ 8 Regeln mit Verbindlichkeitsanspruch
105
tigen Verbesserungen der Arbeitsbedingungen unterwirft. Ein derart weitgehender, genereller Unterwerfungswille kann nicht unterstellt werden.328 Die Voraussetzungen für eine Analogie zu § 657 BGB sind indes erfüllt. Eine gesetzgeberische Regelungslücke liegt vor, da sich die erstrebte Bindungswirkung mit den vorhandenen gesetzlichen Regelungen, namentlich denen zum Vertragsschluss, wie ausgeführt, nicht begründen lässt.329 Auch eine vergleichbare Interessenlage ist gegeben. Für eine solche spricht zwar nicht schon, dass sich der Erklärende in beiden Fällen gegenüber einer Vielzahl von Erklärungsempfängern bindet,330 da bei der Auslobung i.d.R. nur einer von diesen die Obligation erhält. Die Interessenlage ist aber insofern vergleichbar, als dass hier wie dort eine rechtsgeschäftliche Annahme konstruiert wirkt und die Gratifikation für den Einsatz der Arbeitnehmer im Betrieb „ausgelobt“ ist, unabhängig davon, ob der einzelne Arbeitnehmer „mit Rücksicht auf die Auslobung“ gehandelt hat.331 Damit begründet auch die arbeitsrechtliche Gesamtzusage analog § 657 BGB eine einseitige Verpflichtung durch Rechtsgeschäft. f) Keine private Rechtsetzung durch Gestaltungsrechte Einseitige Rechtsgeschäfte bilden auch die sog. Gestaltungsrechte. Mit ihnen wird aufhebend oder verändernd auf bereits bestehende Schuldverhältnisse eingewirkt.332 Beispiele sind Anfechtung, Rücktritt, Widerruf, Kündigung und Aufrechnung. Als Akt privater Rechtsetzung können die Gestaltungsrechte aber nicht qualifiziert werden. Durch Ausübung eines Gestaltungsrechts löst der Private nämlich lediglich abschließend normierte Rechtswirkungen aus. Eine irgendwie geartete autonome Formulierung eines eigenständigen Rechtssatzes ist nicht erkennbar. Insbesondere würde es zu weit gehen, die durch Ausübung des Gestaltungsrechts gesetzten Rechtsfolgen dem Erklärenden als von ihm formulierten Rechtssatz zuzuordnen, indem er sich die vom Gesetzgeber vorgesehenen Rechtsfolgen gleichsam zu eigen macht. Nur wenn der Private in der inhaltlichen Bestimmung der Regel einschließlich der Rechtsfolgen frei ist, kann von einem privatautonomen Akt der Rechtsetzung ausgegangen werden.333 2. Einseitige Rechtsetzung durch subjektive Rechte Eine besondere Form einseitiger privater Rechtsetzung stellt die Rechtsetzung kraft absoluten subjektiven Rechts dar. Unter einem subjektiven Recht versteht man eine dem Berechtigten von der Rechtsordnung gegebene BestimmungsbeBachmann, Private Ordnung, S. 286 m.w.N. die Motive II, S. 175 f. sprechen nicht gegen eine Analogie, vgl. Bachmann, Private Ordnung, S. 287. 330 Darauf abstellend Hilger, Das betriebliche Ruhegeld, S. 69. 331 Bachmann, Private Ordnung, S. 286 f. 332 Vgl. dazu nur Emmerich, in: MüKo BGB, § 311 Rn. 21. 333 So schon F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 101 f. 328 Ebenso 329 Auch
106
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
fugnis, mithilfe derer er seine individuellen Interessen verwirklichen kann.334 Der Staat respektiert den Willen des Rechtsinhabers und setzt ihn gegebenenfalls als rechtens durch.335 Absolut ist ein subjektives Recht dann, wenn es gegenüber jedermann wirkt. Es schafft für den Privaten die Möglichkeit, innerhalb seiner Grenzen einseitig für andere rechtsverbindliche Regeln zu schaffen, d.h. von Dritten ein bestimmtes Handeln oder Unterlassen zu beanspruchen.336 So kann etwa der Eigentümer eines Grundstücks samt Gebäudes aufgrund seines Eigentums eine Benutzungs- oder Hausordnung aufstellen, die Besuchern das Betreten gestattet, gleichzeitig aber auch Verhaltensregeln vorschreibt, beispielsweise, dass Hunde stets anzuleinen sind oder das Abstellen von Kinderwägen oder Fahrrädern im Hausflur verboten ist. Findet keine schuldrechtliche Vereinbarung über die Benutzungs- oder Hausordnung statt bzw. stimmen die Nutzer den Verhaltensregeln beim Betreten nicht zu, sei es, weil sie von den Regeln keine Kenntnis nehmen konnten, sei es, weil sie dies offen verweigern oder es sich bei den Nutzern um Geschäftsunfähige handelt, ergibt sich die Folgepflicht aus den kraft subjektiven Rechts einseitig gesetzten Verhaltensregeln.337 Lediglich relative subjektive Rechte ermächtigen ihre Inhaber indes nicht dazu, gegenüber Dritten einseitig Recht zu setzen. Hierunter versteht man subjektive Rechte, die nicht gegenüber der Allgemeinheit, sondern lediglich gegenüber einer bestimmten Person wirken (vgl. §§ 194 Abs. 1, 241 Abs. 1 BGB). Ihre Entstehung ist nicht an die Inhaberschaft einer Rechtsposition wie das Eigentum geknüpft, sondern basiert auf einer vorangegangenen schuldrechtlichen Vereinbarung. Das wiederum führt dazu, dass die mit dem subjektiven Recht des Inhabers einhergehende Verpflichtung des Schuldners nicht erst aus dem Befehl des Gläubigers folgt, sondern aus dem zuvor begründeten Anspruch.338
III. Zwei- und mehrseitige Rechtsverbindlichkeit 1. Zwei- und mehrseitige Verträge Weitaus größere Bedeutung als die einseitige Rechtsetzung hat in der Praxis die zwei- und mehrseitige Rechtsetzung durch Private. Paradebeispiel ist der Vertrag als die Grundform privater Rechtsetzung.339 Hier legen die Parteien durch privat 334 Umfassend zu Begriff, Arten und Umfang subjektiver Rechte Medicus, BGB AT, Rn. 61 ff.; Wolf/Neuner, BGB AT, § 20 Rn. 1 ff.; monografisch Fezer, Teilhabe und Verantwortung, passim; zur privaten Rechtsetzung durch subjektive Rechte ausführlich F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 354 ff. 335 Vgl. auch F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 355. 336 Vgl. F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 355. 337 Bachmann, Private Ordnung, S. 232. 338 Vgl. Medicus, BGB AT, Rn. 69. 339 Zum Vertrag als Form privater Rechtsetzung vgl. etwa Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 27; Meyer-Cording, Die Rechtsnormen, S. 13 ff.
§ 8 Regeln mit Verbindlichkeitsanspruch
107
autonom erklärte Zustimmungserklärungen, genauer sich entsprechende Willens erklärungen (Angebot und Annahme) fest, wie zwischen ihnen ein bestimmter Lebenssachverhalt gelten soll.340 Der erforderliche staatliche Anerkennungsakt, der der Übereinkunft der Vertragsparteien rechtliche Bindungswirkung verschafft, aufgrund derer sie gegebenenfalls mit staatlicher Zwangsgewalt durchgesetzt werden kann, ist darin zu sehen, dass der Gesetzgeber das Vertragsinstitut bereitstellt, bestimmte Mindestanforderungen normiert, denen der Vertrag zu genügen hat, und Voraussetzungen festlegt, unter welchen sich die Parteien auch wieder vom Vertrag lösen können.341 Klassischer Anwendungsfall des Vertrags ist der sog. zweiseitig verpflichtende Vertrag, d.h. der Vertrag zwischen zwei Rechtssubjekten, etwa zwischen Verkäufer und Käufer einer Sache. Daneben gibt es aber auch mehrseitig verpflichtende Verträge.342 Prominentester Anwendungsfall ist der Abschluss eines Gesellschaftsvertrags zwischen mehr als zwei Gesellschaftern.343 Vom Idealbild der §§ 145 ff. BGB hebt sich das Zustandekommen eines mehrseitigen Vertrags häufig dadurch ab, dass die korrespondierenden Willenserklärungen nicht nacheinander und in gegenseitiger Bezugnahme abgegeben werden, sondern die Beteiligten der durch eine Vertragspartei oder einen Dritten entworfenen Vereinbarung gleichzeitig zustimmen.344 2. Das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen a) Grundlagen Ein weiterer Anwendungsfall zwei- und mehrseitiger privater Rechtsetzung sind die in der Praxis geläufigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen gemäß §§ 305 ff. BGB. Bei diesen handelt es sich um für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierte Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei (Verwender) der anderen bei Vertragsabschluss stellt (vgl. § 305 Abs. 1 S. 1 BGB). Als Beispiel für Allgemeine Geschäftsbedingungen können etwa die „Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte“ genannt werden, die die Rechtsbeziehungen zwischen den Banken und ihren Kunden im Effekten- und Depotgeschäft näher ausgestalten und von allen Banken einheitlich verwendet werden.345 Vgl. D. Schwab/Löhnig, Einführung in das Zivilrecht, Rn. 20. Frage, inwieweit beim Vertrag bereits eine moralische bindende Kraft des Versprechens angenommen werden kann, vgl. Larenz, Richtiges Recht, S. 60 ff. m.w.N. 342 Umfassend Zwanzger, Der mehrseitige Vertrag, passim. 343 Weitere Beispiele bei Zwanzger, Der mehrseitige Vertrag, S. 3 f. 344 In Bezug auf die Wohnungseigentümergemeinschaft vgl. etwa Merle, in: FS Wenzel, S. 251, 252 f.; zu den Besonderheiten im Hinblick auf die allgemeine Rechtsgeschäftslehre umfassend Zwanzger, Der mehrseitige Vertrag, S. 131 ff. 345 In der Fassung vom 01. 11. 2007 abgedruckt und kommentiert in Bunte, AGB-Banken, 4. Teil VII. 340
341 Zur
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
108
Für den Verwender bieten Allgemeine Geschäftsbedingungen den Vorteil, dass er bei gleichartigen Einzelverträgen nicht jedes Mal von Neuem umfangreiche und komplizierte Regelungen mit dem Vertragspartner aushandeln muss, sondern auf von ihm vorformulierte Bedingungen zurückgreifen kann, die das angestrebte Vertragsverhältnis nach seinen Vorstellungen abweichend von den Vorgaben des BGB standardisieren.346 Die Abwicklung des Vertragsverhältnisses bei Massenverträgen wird für ihn rationalisiert und vereinfacht. Für den Vertragspartner bergen Allgemeine Geschäftsbedingungen demgegenüber das Risiko, dass der Verwender seine Rechtsstellung einseitig zu seinen Gunsten unangemessen ausbaut. In den §§ 305 ff. BGB hat der Gesetzgeber Regelungen getroffen, die die Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen in den Vertrag zum Gegenstand haben (§§ 305 Abs. 2, 305c BGB) sowie den Gerichten eine Inhaltskontrolle der Bestimmungen erlauben (§§ 307 – 309 BGB). Ferner enthält das Gesetz Vorgaben zu den Rechtsfolgen bei Nichteinbeziehung und Unwirksamkeit von Allgemeinen Geschäftsbedingungen (§ 306 BGB). b) Rechtsnatur: Normentheorie versus Vertragstheorie Bis heute umstritten ist, ob die Allgemeinen Geschäftsbedingungen als Rechtsnormen oder als Vertragsbestandteil einzuordnen sind. Die sog. Normentheorie stuft die Allgemeinen Geschäftsbedingungen als private Rechtsnormen ein.347 Den Allgemeinen Geschäftsbedingungen komme nach ihrer Entstehungsweise, ihrem Inhalt und ihrer Wirkung der Charakter objektiven Rechts zu. Da sie einseitig durch den Verwender mit verbindlicher Wirkung gegenüber dem Vertragspartner gesetzt würden, ohne dass dieser auf deren Inhalt Einfluss nehmen könne, könne der Geltungsgrund nicht in einer rechtsgeschäftlichen Einbeziehung i.S.d. §§ 145 ff. i.V.m. §§ 305 Abs. 2, 305c Abs. 1 BGB gesehen werden, sondern allein in der richterrechtlich anerkannten, zwischenzeitlich zu Gewohnheitsrecht erstarkten, einseitigen Rechtsetzungsbefugnis des Verwenders.348 Auch seien Allgemeine Geschäftsbedingungen, wie für Rechtsnormen typisch, von generell-abstrakter Natur, indem sie darauf ausgerichtet seien, eine Vielzahl von Rechtsbeziehungen für eiStadler, in: Jauernig, BGB, § 305 Rn. 1. Großmann-Doerth, JW 1929, 3447: AGBs als „selbstgeschaffenes Recht der Wirtschaft“; ders., in: Blaurock/Goldschmidt/Hollerbach (Hrsg.), Das selbstgeschaffene Recht der Wirtschaft, S. 77 ff.; Meyer-Cording, Die Rechtsnormen, S. 84 ff., 95 ff., 97 ff., 101 ff., 131 ff.; Pflug, Kontrakt und Status im Recht der AGB, S. 4 f., 32 ff.; 247 ff., 298 ff.; ders., AG 1992, 1, 3 ff.; tendenziell auch E. Schmidt, JuS 1987, 929, 931; differenziert L. Raiser, Das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, S. 76 ff., der den soziolo gischen Normcharakter von AGBs untersucht und auch bejaht, die faktische Normwirkung aber streng von der dogmatischen Einordnung als Rechtsnormen trennt. Auch der BGH hat AGBs des Öfteren als „fertig bereit liegende Rechtsordnung“ bezeichnet, vgl. BGHZ 127, 275, 281 = NJW 1995, 1490; BGHZ 129, 323, 327 f. = NJW 1995 2224; BGHZ 129, 345, 349 = NJW 1995 3117. 348 Vgl. Pflug, Kontrakt und Status im Recht der AGB, S. 263 ff., 278 ff. 346 Vgl.
347 Erstmalig
§ 8 Regeln mit Verbindlichkeitsanspruch
109
nen vorab noch nicht bestimmten Adressatenkreis zu regeln. Schließlich sprächen für den Normcharakter von Allgemeinen Geschäftsbedingungen deren besondere Einbeziehungsvoraussetzungen (§§ 305 Abs. 2, 305c BGB), die Inhaltskontrolle (§§ 307 – 309 BGB), die Möglichkeit eines abstrakten Kontrollverfahrens gemäß §§ 1, 8 ff. UKlaG, der Vorrang der Individualabrede (§ 305b BGB), die Unklarheitenregel (§ 305c Abs. 2 BGB) sowie die Aufrechterhaltung des Rechtsgeschäfts bei Nichteinbeziehung oder Unwirksamkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (§ 306 Abs. 1 BGB) in Abweichung von den §§ 139, 154, 155 BGB.349 Die heute herrschende sog. Vertragstheorie begreift die Allgemeinen Geschäftsbedingungen als Bestandteil der vertraglichen Abrede.350 Diese bildeten bloße Vertragsmuster, deren Geltung allein auf vertraglicher Einbeziehung beruhe (vgl. §§ 145 ff. i.V.m. §§ 305 Abs. 2, 305c Abs. 1 BGB), sodass sie als Vertragsbestandteil an dessen Rechtsqualität Teil hätten.351 Hierfür sprächen zunächst der Wortlaut des Gesetzes, das in § 305 Abs. 1 BGB von für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen und in den §§ 305c Abs. 1, 306 Abs. 1 BGB von „Vertragsbestandteilen“ handelt sowie die systematische Verortung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Recht der Schuldverhältnisse. Ferner bleibe ihre Einbeziehung davon abhängig, dass sich die andere Vertragspartei bei Vertragsschluss mit ihrer Geltung einverstanden erklärt (vgl. § 305 Abs. 2 BGB). Im Kern verdient die herrschende Vertragstheorie den Vorzug.352 Die Normentheorie kann für sich allerdings verbuchen, die Wirkungsweise der Allgemeinen Geschäftsbedingungen als abstrakt-generelle Regeln besonders hervorzuheben. Sie ist jedoch nicht in der Lage, die einseitige Normsetzungsbefugnis des Verwenders dogmatisch zu begründen.353 Allgemeine Geschäftsbedingungen werden zwar einseitig vom Verwender vorformuliert. Der Vertragspartner muss sich aber, auch wenn diese Voraussetzung großzügig bejaht wird, nach § 305 Abs. 2 BGB in irgendeiner Form einverstanden erklären, da die Regeln ohne Einbeziehung in den Vertrag keine Rechtsgeltung erlangen.354 Auch um der Rechtsklarheit und -sicherheit willen erscheint es sachlich geboten, das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen rechtlich nicht zu verselbstständigen, sondern als Sonderprivatrecht zu begreifen, um an die Kriterien der allgemeinen Rechtsgeschäftslehre anknüpfen zu können. Nur auf diese Weise lassen sich die klassischen Problemfelder, namentlich Pflug, Kontrakt und Status im Recht der AGB, S. 298 f. Fastrich, Richterliche Inhaltskontrolle, S. 33 ff.; Grüneberg, in: Palandt, BGB, § 305 Rn. 2; Habersack, Vertragsfreiheit und Drittinteressen, S. 168 f.; Pfeiffer, in: Wolf/ Lindacher/Pfeiffer (Hrsg.), AGB-Recht, Einl. Rn. 15 ff.; Stoffels, AGB-Recht, Rn. 103 ff.; Ulmer/Habersack, in: Ulmer/Brandner/Hensen, AGB-Recht, Einl. Rn. 44 ff. 351 Vgl. Grüneberg, in: Palandt, BGB, § 305 Rn. 2. 352 Zu den im Endeffekt geringen Abweichungen zur Normentheorie Ulmer/Habersack, in: Ulmer/-Brandner/Hensen, AGB-Recht, Einl. Rn. 45. 353 Grüneberg, in: Palandt, BGB, § 305 Rn. 2; siehe auch Pflug, Kontrakt und Status im Recht der AGB, S. 289. 354 Vgl. Bachmann, Private Ordnung, S. 120. 349
350 Vgl.
110
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
die Irrtumsproblematik sowie die Thematik kollidierender Allgemeiner Geschäftsbedingungen sachgerecht lösen.355 Zu Recht ist jedoch auch darauf hingewiesen worden, dass zwischen den beiden Kategorien Norm und Vertrag und dementsprechend zwischen der Normen- und Vertragstheorie nicht denknotwendig ein strenges Alternativverhältnis bestehen muss. Bezieht man die Bezeichnung Norm lediglich auf die generell-abstrakte Wirkungsweise und den Vertrag auf den Geltungsgrund der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, so zeichnen sich lediglich unterschiedliche Ebenen ab, einmal struktureller, einmal legitimatorischer Art.356 3. Die Rechtsregeln der Verbände a) Grundlagen Das wohl älteste Phänomen zwei- und mehrseitiger privater Rechtsetzung stellt die Regelsetzung durch private Verbände dar.357 Ein privatrechtlicher Verband ist eine auf rechtsgeschäftlicher Grundlage beruhende und durch sie verfasste, aus Mitgliedern bestehende, aber gegenüber ihnen verselbstständigte Organisation, die einen bestimmten, in der rechtsgeschäftlichen Verfassung festgelegten Zweck verfolgt.358 Hierunter fallen alle als juristische Personen des Privatrechts verfassten Körperschaften (rechtsfähiger Verein, Aktiengesellschaft, GmbH, Genossenschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit), die nicht rechtsfähigen Vereine und sämtliche Gesamthandsgesellschaften (Gesellschaft bürgerlichen Rechts, offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, stille Gesellschaft, Reederei, Partnerschaftsgesellschaft).359 Um das Verbandsleben zu ordnen, stellen die Verbände generell-abstrakte Verhaltens- oder Beschaffenheitsregeln, namentlich in Form von Satzungen bzw. Gesellschaftsverträgen auf.360 Diese sollen potenzielle Interessenkonflikte mit dem Ulmer/Habersack, in: Ulmer/Brandner/Hensen, AGB-Recht, Einl. Rn. 46. Bachmann, Private Ordnung, S. 120 mit Verweis auf Helm, JuS 1965, 121, 125 f.; insoweit auch Pflug, Kontrakt und Status im Recht der AGB, S. 46 f. 357 Zur historischen Entwicklung vgl. Assmann, in: Großkomm AktG, Einl. Rn. 13 ff. 358 Vgl. Reiff, Haftungsverfassungen, S. 25 f.; K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 7 I 1 b (S. 168); Wiedemann, Gesellschaftsrecht, S. 4, 674 f. Teilweise wird der Verbandsbegriff enger verstanden und mit der Körperschaft bzw. dem Verein gleichgesetzt, vgl. Reuter, in: MüKo BGB, Vorbem. zu §§ 21 ff. Rn. 53. 359 Vgl. Reiff, Haftungsverfassungen, S. 26. Zur Unterscheidung von Personengesellschaften und Körperschaften siehe K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 3 I 2, 3 (S. 46 ff.) und § 7 I 2 (S. 168 ff.). 360 Das Gesetz verwendet für den rechtsfähigen und nicht rechtsfähigen Verein, für die AG, KGaA und den VVaG den Begriff „Satzung“ und für die Grundordnung der Personengesellschaften und der GmbH den Begriff „Gesellschaftsvertrag“; umfassend zu den einzelnen Verbandsregeln F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 267 ff. 355 Vgl. 356
§ 8 Regeln mit Verbindlichkeitsanspruch
111
Anspruch auf Verbindlichkeit austarieren.361 Adressaten dieser Regeln sind die Verbandsmitglieder und die Verbandsorgane.362 Rechtsverbindlichkeit gegenüber den Verbandsmitgliedern und den Verbands organen erlangen die Verbandsregeln dadurch, dass der Staat ihnen durch Gesetz Verbindlichkeit zukommen lässt.363 Dies erfolgt teilweise ausdrücklich. So schreibt der Gesetzgeber für den BGB-Verein in § 25 BGB etwa vor, dass die Verfassung eines rechtsfähigen Vereins durch die Vereinssatzung bestimmt wird, soweit sie nicht durch das Gesetz reguliert wird. Teilweise erkennt der Gesetzgeber wie etwa in § 23 AktG und in den §§ 2, 3 GmbHG aber auch nur die Existenz einer Satzung bzw. eines Gesellschaftsvertrags an, woraus aber letztlich ebenfalls die rechtliche Bindungswirkung der Satzungsregeln entnommen werden kann. Soweit eine gesetzliche Anerkennung von Satzung oder Gesellschaftsvertrag nicht besteht, wird die rechtliche Bindungswirkung der darin enthaltenen Regelungen im Wege gewohnheitsrechtlicher Anerkennung bzw. im Wege eines Analogieschlusses zu den insoweit vorhandenen gesetzlichen Regelungen, namentlich zu § 25 BGB, begründet.364
361 Vgl. Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 229; Vieweg, Normsetzung, S. 31. 362 Für Nichtmitglieder des Verbands gelten diese Regeln allenfalls aufgrund eines individuellen Unterwerfungs- oder Erstreckungsvertrags zwischen dem Verband und dem einzelnen Nichtmitglied, vgl. hierzu Bachmann, Private Ordnung, S. 303 f.; Reuter, in: MüKo BGB, § 25 Rn. 29; anders Haas/Adolphsen, NJW 1995, 2146, 2147 f., die eine unmittelbare Verbindlichkeit der Satzung für Nichtmitglieder einschließlich belastender Regelungen nach § 328 BGB analog annehmen; zur Thematik vgl. ferner Heermann, NZG 1999, 325 ff. In BGHZ 128, 93, 100 f. = NJW 1995, 583 (Reitsport) hat der BGH in einem obiter dictum ausgeführt, dass die Befugnis von Verbänden, Nichtmitgliedern die Einhaltung von Regelwerken vorzuschreiben, „unmittelbar aus der Sportsausübung unter den sie heute prägenden Gegebenheiten“ folge; zu Recht kritisch Bachmann, Jb.J.ZivRWiss. 2002, S. 9, 15. 363 F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 265 (allgemein für Verbandsregeln), 270 ff. (für den BGB-Verein: § 25 BGB oder kraft gewohnheitsrechtlicher Anerkennung für den nicht rechtsfähigen Verein), 278 ff. (für die Vereinsordnungen und Geschäftsordnungen rechtsfähiger Vereine, die von der Mitgliederversammlung oder dem Vorstand erlassen werden, §§ 32 und 28 BGB; für die Vereinsordnungen und Geschäftsordnungen nicht rechtsfähiger Vereine der entsprechende Gewohnheitsrechtssatz), 312 ff. (Satzung der Vorgesellschaft beruht auf gewohnheitsrechtlicher Anerkennung, die Gründungssatzung der Aktiengesellschaft gilt aufgrund der Anerkennung in § 23 AktG; spätere Änderungen müssen individuell vom Staat durch Eintragung anerkannt werden, vgl. § 181 Abs. 3 AktG), 322 ff. (§§ 2, 3 GmbHG für die Satzung bzw. den Gründungsvertrag der GmbH). 364 Umfassend dazu F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 270 ff.: staatliche Anerkennung kraft Rechtssatzform.
112
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
b) Die Rechtsnatur der Verbandssatzung aa) Meinungsstand: Vertragstheorie versus Normentheorie Wie bei den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist auch bei den verbandsbegründenden Rechtsakten umstritten, welche Rechtsnatur sie haben, wobei sich die Diskussion nicht um die rein schuldrechtlichen Gesellschaftsverträge dreht, sondern um die verbandsbegründenden Rechtsakte.365 Der Streit wird dabei vornehmlich in Bezug auf die Satzungen bzw. Gesellschaftsverträge privater Körperschaften geführt. Letztlich betrifft er aber auch die Gesellschaftsverträge von Personengesellschaften. Denn nicht nur die Satzungen von Vereinen, Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, sondern auch Gesellschaftsverträge organisierter Personengesellschaften sind verbandskonstituierende Organisationsverträge.366 Derartige Gesellschaftsverträge legen nicht nur die Rechte und Pflichten der Beteiligten fest (insofern sind sie Schuldvertrag), sondern schaffen eine rechtlich verfasste Organisation.367 Sie entfalten, wenn die Übertragbarkeit von Gesellschaftsanteilen im Gesellschaftsvertrag zugelassen ist oder wenn alle Gesellschafter zustimmen, normative Wirkung für und gegen jeden gegenwärtigen oder zukünftigen Gesellschafter bereits allein aufgrund ihrer Mitgliedschaft.368 Nach der auf v. Gierke zurückgehenden Normentheorie stellen die Satzung bzw. der Gesellschaftsvertrag kraft Vereinsautonomie geschaffenes objektives Recht dar, das durch schöpferischen Gesamtakt erzeugt und den Mitgliedern mit rechtsgeschäftlich erworbener Mitgliedschaft bindend auferlegt wird.369 Es handele sich um einen Fall staatlich delegierter Normsetzung, sodass sich die Gestaltungsfreiheit nach dem Umfang der staatlich delegierten Normsetzungsbefugnis richte und K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 5 I 1 b (S. 75). K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 5 I 1 b (S. 76 f.). 367 K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 5 I 1 b (S. 77); ders., in: MüKo HGB, § 105 Rn. 114 m.w.N. 368 Ausgenommen hiervon sind nur die rein schuldrechtlichen Vereinbarungen der Gesellschafter von Innengesellschaften, denen es an der überindividuellen Wirkung fehlt, vgl. K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 5 I 1 b (S. 77); ders., in: MüKo HGB, § 105 Rn. 116 m.w.N. 369 Vgl. v. Gierke, Deutsches Privatrecht, Bd. 1, S. 120, 142 ff.; Hedemann, ArchBürgR 38 (1913), 132 ff.; RGZ 49, 150, 155. Die heute vertretene und hier dargelegte Normentheorie hebt sich freilich von der ursprünglichen Normentheorie v. Gierkes dadurch ab, dass sie nicht eine originäre, mit der staatlichen Rechtsetzungsgewalt konkurrierende Verbandsgewalt animmt, sondern davon ausgeht, dass die staatlich gebilligten Normen nur Geltung erlangen können, wenn noch ein weiterer privatautonomer Akt hinzutritt, nämlich die Unterwerfung des Einzelnen durch seinen freiwilligen Beitritt in den Verband. Zur heute vertretenen Normentheorie vgl. F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 266 ff.; Meyer-Cording, Die Vereinsstrafe, S. 43, 46 ff.; ders., Die Rechtsnormen, S. 83 f., 90 ff., 97 ff., 101 ff.; Reuter, in: MüKo BGB, § 25 Rn. 17 ff.; Taupitz, Standesordnungen, S. 563 f. 365 Vgl. 366
§ 8 Regeln mit Verbindlichkeitsanspruch
113
die Auslegung derjenigen von Gesetzen entspreche.370 Mit einem gewöhnlichen Schuldvertrag, der von Individuen ausgehandelt wird, seien Satzung bzw. Gesellschaftsvertrag nicht vergleichbar, da sie eine Ordnung des Verbandslebens schafften und damit einen überindividuellen Zweck verfolgten.371 Ferner beanspruchten sie Geltung für alle gegenwärtig oder zukünftig am Verbandsleben Beteiligten, sodass sie sich – bezogen auf das Verbandsleben – in Ziel und Wirkungsweise nicht von staatlichen Gesetzen unterschieden.372 Der Normentheorie gegenüber steht die sog. Vertragstheorie, die auf v. Tuhr zurückgeht.373 Sie sieht in der Satzung bzw. im Gesellschaftsvertrag eine besondere Erscheinungsform des Vertrags. Satzung bzw. Gesellschaftsvertrag entstünden hiernach durch vertragliche Vereinbarung der Gründungsmitglieder (mehrseitiges Rechtsgeschäft); für später eintretende Mitglieder seien sie aufgrund der Beitrittsverträge verbindlich.374 Auch nach Entstehung der juristischen Person bildeten Satzung bzw. Gesellschaftsvertrag damit einen Ausfluss privater Willensbetätigung. Soweit in der Satzung bzw. im Gesellschaftsvertrag die Organe und deren Zuständigkeiten reglementiert würden, handele es sich technisch gesehen um einen Organisationsvertrag; soweit die Beitragspflichten der Mitglieder geregelt würden, handele es sich um einen schuldrechtlichen Vertrag.375 Die Grenzen der Regelungsbefugnis sowie die Auslegung von Satzung und Gesellschaftsvertrag richteten sich dementsprechend nach vertragsrechtlichen Grundsätzen. Die herrschende Meinung beschreitet mit der sog. modifizierten Normentheorie einen Mittelweg.376 Wie die Vertragstheorie erblickt sie in der Errichtung der Satzung bzw. des Gesellschaftsvertrags durch die Gründer einen Vertrag. Sobald der Verband aber ins Leben getreten sei, löse sich die Satzung bzw. der Gesellschaftsvertrag von der Persönlichkeit der Gründer und erlange „ein unabhängiges rechtliches Eigenleben“, werde „zur körperschaftlichen Verfassung des Vereins“ und objektiviere fortan das „rechtliche Wollen des Vereins als der Zusammenfassung seiner Mitglieder“.377 Gründerwillen und Gründerinteressen träten insoweit zurück; an ihrer Stelle gewännen der Vereinszweck und die Mitgliederinteressen Reuter, in: MüKo BGB, § 25 Rn. 17. Reuter, in: MüKo BGB, § 25 Rn. 18. 372 Reuter, in: MüKo BGB, § 25 Rn. 18. 373 v. Tuhr, BGB AT, Bd. I, S. 504 f.; vgl. ferner Hadding, in: Soergel, BGB, Vorbem. zu § 21 Rn. 48 ff., § 25 Rn. 16 f.; Lutter, AcP 180 (1980), 84, 95 f. 374 Hadding, in: Soergel, BGB, Vorbem. zu § 21 Rn. 50; Lutter, AcP 180 (1980), 84, 95. 375 Hadding, in: Soergel, BGB, § 25 Rn. 17. 376 RGZ 165, 140, 143 f.; BGHZ1 21, 370, 373 ff. = NJW 1956, 1793; BGHZ 47, 172, 179 f. = NJW 1967, 1268; Ellenberger, in: Palandt, BGB, § 25 Rn. 3; K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 5 I 1 c (S. 77); Weick, in: Staudinger, BGB, Vorbem. zu §§ 21 ff. Rn. 38, § 25 Rn. 15 ff. Vieweg, Normsetzung, S. 321 f. will den privaten Verbänden die Wahlfreiheit einräumen, ihre Regelwerke als Vertrag oder als Normen auszugestalten; zu Recht ablehnend Bachmann, Private Ordnung, S. 234. 377 BGHZ 47, 172, 179 f. = NJW 1967, 1268. 370 371
114
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
die rechtsgestaltende Kraft, auf die es dann allein noch ankommen könne.378 Folge hiervon sei, dass sich die Grenzen der Gestaltungsfreiheit aus dem Vertragsrecht ergäben; im Übrigen sei die Verbandsverfassung wie objektives Recht zu behandeln, was bei der Auslegung, der Teilnichtigkeit und Revisibilität eine Rolle spiele.379 bb) Stellungnahme Obgleich sich die dargelegten Theorien in ihren dogmatischen Ansätzen unversöhnlich gegenüberzustehen scheinen, fällt auf, dass sie sich im Ergebnis doch sehr nahekommen.380 So ist im Hinblick auf die Geltendmachung von Willensmängeln und die Folge eines Ausscheidens eines Mitglieds anerkannt, dass beides aufgrund der Rückwirkungen auf die übrigen Mitglieder sowie im Interesse des Rechtsverkehrs nur bedingt möglich ist.381 Unstreitig ist auch, dass Satzung bzw. Gesellschaftsvertrag aufgrund ihres Charakters als „Rückgrat einer Rechtsorganisation mit wechselndem Mitgliederbestand“382 einem verobjektivierten Auslegungsmaßstab unterliegen.383 Schließlich besteht Einigkeit darin, dass das einzelne Mitglied aufgrund der besonderen Gefährdungen wie Vereinsstrafen, Mehrheitsbeschlüssen, unangemessenen Satzungsklauseln besonders schutzbedürftig ist und die Satzungsbzw. Gesellschaftsvertragsbestimmungen deshalb einer gerichtlichen Inhaltskontrolle zugänglich sein müssen.384 Der von der herrschenden Meinung gewählte Ansatz, die differenzierten Rechtsfolgen herbeizuführen, indem zunächst von einer vertraglichen Grundlage, mit Errichtung des Verbands dann von einem normativen Verständnis von Satzung bzw. Gesellschaftsvertrag ausgegangen wird, überzeugt allerdings nicht. Es bleibt ein Rätsel, wie die Metamorphose der Satzungs- bzw. Gesellschaftsvertragsvorschriften von Vertrag zu Normen vonstatten gehen soll.385 378 So BGHZ 47, 172, 179 f. = NJW 1967, 1268; vgl. auch Ellenberger, in: Palandt, BGB, § 25 Rn. 3. 379 Vgl. Weick, in: Staudinger, BGB, § 25 Rn. 15 ff. 380 Ähnliche Einschätzung bei Bachmann, Private Ordnung, S. 110 f.; ebenso schon v. Tuhr, BGB AT, Bd. I, S. 503. 381 Umfassend zur fehlerhaften Gesellschaft Ulmer/Schäfer, in: MüKo BGB, § 705 Rn. 323 ff. 382 So die Bezeichnung bei Bachmann, Private Ordnung, S. 110. 383 Siehe BGHZ 47, 172, 179 f. = NJW 1967, 1268; BGHZ 96, 245, 250 = NJW 1986, 1033; BGHZ 106, 67, 71 = NJW 1989, 1212; BGH NJW 1997, 3368, 3369; Taupitz, Standesordnungen, S. 561; Weick, in: Staudinger, BGB, § 25 Rn. 16. 384 Bachmann, Private Ordnung, S. 111 mit Verweis auf die Grundsatzentscheidungen: BGHZ 64, 238 = NJW 1975, 1318 (Inhaltskontrolle der Satzung von Publikumsgesellschaften); BGHZ 71, 40 = NJW 1978, 1316 (Inhaltskontrolle von Mehrheitsbeschlüssen); BGHZ 87, 337 = NJW 1984, 918 und BGHZ 102, 265 = NJW 1988, 552 (Überprüfung von Vereinsstrafen); BGHZ 103, 219 = NJW 1988, 1729 (Inhaltskontrolle von Genossenschaftssatzungen); BGHZ 105, 306 = NJW 1989, 1724 (Inhaltskontrolle der Satzung von Großvereinen); umfassend Fastrich, Richterliche Inhaltskontrolle, S. 124 ff. 385 Kritisch auch Hadding, in: Soergel, BGB, § 25 Rn. 14; Reuter, in: MüKo BGB, § 25 Rn. 21.
§ 8 Regeln mit Verbindlichkeitsanspruch
115
Eine überzeugende Erklärung für die angenommenen Rechtsfolgen hat indes Wiedemann geliefert.386 Er zeigt auf, dass Rechtsnorm und Rechtsgeschäft der Charakter von Sollenssätzen gemeinsam ist. Sie unterschieden sich lediglich im Hinblick auf zeitliche Anlage, Adressatenkreis und Geltungsgrund voneinander.387 Erblicke man nun das Abgrenzungskriterium in der inhaltlichen Gestaltung oder der Wirkungsweise von Satzungsvorschriften als abstrakt-generelle Regeln, so trete der normative Charakter der Satzung in den Vordergrund. Erblicke man das Abgrenzungskriterium hingegen im Geltungsgrund der Satzung, wonach sich diese durch Einverständniserklärungen der Beitretenden legitimieren lassen muss, so offenbare sich der rechtsgeschäftliche Charakter.388 Je nachdem, ob man auf die Wirkungsweise oder den Geltungsgrund der Satzung abstelle, seien dementsprechend die für Rechtsnormen oder die für Rechtsgeschäfte geltenden Regeln anzuwenden.389 Folgt man diesem überzeugenden Ansatz, findet die vermeintliche Umwandlung der Satzung bzw. des Gesellschaftsvertrags vom Vertrag zur Norm nicht statt. Als abstrakt-generelle Regeln haben Satzung bzw. Gesellschaftsvertrag Normcharakter, als durch Einverständniserklärung der Beitretenden begründete Regeln sind sie Rechtsgeschäft.390 Wirkungsweise und Legitimation stehen damit nicht in einem Verhältnis zeitlichen Nachfolgens zueinander, sondern bedingen sich gegenseitig.391 4. Die Rechtsnormen des Tarifvertrags a) Die unmittelbare und zwingende Wirkung des Tarifvertrags Eine Plattform für mehrseitig unmittelbar verbindliche private Regeln findet sich auch im kollektiven Arbeitsrecht in Form von Tarifnormen. Den Ausgangspunkt für dieses Regelungsinstitut bildet Art. 9 Abs. 3 GG. Danach ist das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Hierdurch sichert das Grundgesetz Arbeitnehmern und Arbeitgebern einen Freiheitsraum, in dem sie eigenverantwortlich bestimmen können, wie sie die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen fördern wollen.392 Einfachgesetzlichen Ausdruck hat dieser verfassungsrechtlich verankerte Schutz alsdann im Tarifvertragsgesetz gefunden. In diesem stellt der Staat den Gewerkschaften und den Arbeitgebern bzw. Arbeit386 Vgl. Wiedemann, Gesellschaftsrecht, S. 161 ff.; zustimmend Bachmann, Private Ordnung, S. 111 f.; aufgeschlossen K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 5 I 1 c (S. 77 f.). 387 Wiedemann, Gesellschaftsrecht, S. 161 f. 388 Wiedemann, Gesellschaftsrecht, S. 162 f. 389 Wiedemann, Gesellschaftsrecht, S. 163. 390 Vgl. Bachmann, Private Ordnung, S. 111. 391 Bachmann, Private Ordnung, S. 113. 392 BVerfGE 50, 290, 371.
116
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
gebervereinigungen mit dem Tarifvertrag eine Rechtsform bereit, mit der sie in Gestalt von Rechtsnormen selbstständig mehrseitig unmittelbar verbindliche private Regeln auf diesem Gebiet erzeugen können.393 Die Rechtsetzung vollzieht sich dabei durch Vertragsschluss in der Weise, dass die Gewerkschaften und Arbeitgeber bzw. Arbeitgebervereinigungen im normativen Teil des Tarifvertrags die sog. Tarifnormen miteinander aushandeln. Durch die ausdrückliche gesetzliche Anordnung in den §§ 1 Abs. 1, 4 Abs. 1 TVG entfalten die Tarifnormen alsdann unmittelbare und zwingende Wirkung, d.h., es bedarf zu ihrer Geltung keines individuellen Zustimmungsakts in Form einer arbeitsvertraglichen Einbeziehung oder Ähnliches.394 Etwaige individualarbeitsvertragliche Regelungen, die den Arbeitnehmer über die im Tarifvertrag vorgesehene Gebühr belasten, werden durch die Tarifnormen verdrängt.395 Die Tarifnormen sind nach § 4 Abs. 3 TVG ausnahmsweise nicht zwingend, wenn der Tarifvertrag Öffnungsklauseln für abweichende Vereinbarungen ausdrücklich vorsieht oder der Arbeitsvertrag den Arbeitnehmer im Vergleich zum Tarifvertrag besserstellt.396 Hinsichtlich des Adressatenkreises unterscheidet das Gesetz in § 1 Abs. 1 TVG zwischen Tarifnormen, die den Inhalt, den Abschluss und die Beendigung von Arbeitsverhältnissen betreffen (sog. Arbeitsverhältnisnormen) und solchen, die betriebliche und betriebsverfassungsrechtliche Angelegenheiten zum Gegenstand haben (sog. Betriebsnormen). Die Arbeitsverhältnisnormen wirken gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 TVG unmittelbar und zwingend nur zwischen den beiderseits Tarifgebundenen, also den in § 3 Abs. 1 TVG legaldefinierten Mitgliedern der Tarifvertragsparteien und dem Arbeitgeber als Partei des Tarifvertrags. Die Betriebsnormen 393 Der Staat bekennt sich ausdrücklich zum Rechtsnormcharakter des Tarifvertrags, indem das TVG selbst die Tarifvertragsregeln als Rechtsnormen bezeichnet, vgl. §§ 1 Abs. 1, 3 Abs. 2, 4 Abs. 1 und 5 TVG. 394 Buck-Heeb/Dieckmann, Selbstregulierung im Privatrecht, S. 195; Dütz/Thüsing, Arbeitsrecht, Rn. 569; Junker, Grundkurs Arbeitsrecht, Rn. 521 ff.; F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 181 ff.; Thüsing, in: Wiedemann (Hrsg.), TVG, § 1 Rn. 11; Wollenschläger, Arbeitsrecht, Rn. 581; Zöllner/Loritz/Hergenröder, Arbeitsrecht, § 39 Rn. 1. Die klare Anordnung in § 1 TVG macht es entbehrlich, die normative Wirkung des Tarifvertrags rechtsgeschäftlich zu erfassen. Dennoch fehlt es nicht an Versuchen, die unmittelbare Bindung der Verbandsmitglieder rechtsgeschäftlich, etwa über das Vertretungsrecht, zu begründen, dazu Ramm, Die Parteien des Tarifvertrages, S. 69 ff. Bötticher, Gestaltungsrecht und Unterwerfung im Privatrecht, S. 18 ff. deutet die Normsetzungsbefugnis der Tarifpartner als Gestaltungsrecht, dem sich die Tarifgebundenen analog § 317 BGB durch Verbandsbeitritt unterwerfen; zur jeweiligen Resonanz dieser Ansätze vgl. Bachmann, Private Ordnung, S. 125; Thüsing, in: Wiedemann (Hrsg.), TVG, § 1 Rn. 190 ff. 395 Vgl. BAG NZA 2008, 649, 652; Buck-Heeb/Dieckmann, Selbstregulierung im Privatrecht, S. 195; Dütz/Thüsing, Arbeitsrecht, Rn. 569; Junker, Grundkurs Arbeitsrecht, Rn. 504, 524; Wank, in: Wiedemann (Hrsg.), TVG, § 4 Rn. 369 ff.; Wollenschläger, Arbeitsrecht, Rn. 581. 396 Dütz/Thüsing, Arbeitsrecht, Rn. 609; Wollenschläger, Arbeitsrecht, Rn. 581; Zöllner/ Loritz/Hergenröder, Arbeitsrecht, § 39 Rn. 4 ff.
§ 8 Regeln mit Verbindlichkeitsanspruch
117
entfalten hingegen unmittelbare und zwingende Wirkung schon dann, wenn nur der Arbeitgeber tarifgebunden ist, vgl. § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 1 S. 2 TVG. Sie haben Geltungskraft nicht nur für die gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer, sondern für die ganze Belegschaft, namentlich auch für die nicht organisierten Arbeitnehmer (sog. Außenseiter).397 Nach § 5 TVG können Tarifverträge schließlich auch vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales für allgemein verbindlich erklärt werden, d.h., ihre Geltung kann auf Nichtmitglieder (Außenseiter) erstreckt werden.398 b) Ursprung der tarifvertraglichen Normsetzung aa) Meinungsstand Dass der normative Teil von Tarifverträgen den Charakter einer Rechtsnorm hat, ist angesichts der gesetzlichen Regelung in den §§ 1, 4 TVG allgemein anerkannt. Umstritten ist aber, wie das Phänomen zu erklären ist, dass private Regelsetzer durch Abschluss eines zivilrechtlichen Vertrags Rechtsnormen erzeugen können, die normative Wirkungen für ihre Regelunterworfenen entfalten.399 Begriffsprägungen wie die des „Normenvertrags“400, des „privatheteronomen Rechtsgeschäfts“401 oder der „Quasi-Normen“402, mit denen versucht wurde, der Besonderheit gerecht zu werden, dass sich Kollektivverträge gewissermaßen zwischen Vertrag und Gesetz bewegen, vermögen für sich genommen die normative Wirkung dieser Regeln nicht zu erklären.403 Im Kern stehen sich zwei materielle Grundpositionen gegenüber.404 Die vorwiegend in der älteren Literatur und Rechtsprechung vertretene sog. Delegationslehre sieht in der Befugnis der Tarifvertragsparteien, die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen selbst auszuhandeln, eine staatlich delegierte Befugnis 397 Zur umstrittenen Frage, ob die Betriebsnormen auch unmittelbar und zwingend zulasten der Außenseiter gelten, vgl. Arnold, Betriebliche Tarifnormen und Außenseiter, passim; Zöllner/Loritz/Hergenröder, Arbeitsrecht, § 39 Rn. 25; zur weiteren Unterteilung in Solidar- und Betriebsnormen vgl. Zöllner/Loritz/Hergenröder, Arbeitsrecht, § 38 Rn. 10, § 39 Rn. 25. 398 Vgl. hierzu BVerfGE 44, 322, 346 (Allgemeinverbindlicherklärung I); BVerfGE 64, 208, 215 (Bergmannsversorgungsschein). 399 Vgl. Bachmann, Private Ordnung, S. 123 ff.; Buck-Heeb/Dieckmann, Selbstregulierung im Privatrecht, S. 198 ff.; Thüsing, in: Wiedemann (Hrsg.), TVG, § 1 Rn. 42 ff.; Zöllner/Loritz/Hergenröder, Arbeitsrecht, § 36 Rn. 18 ff.; zur rechtspolitischen Dimension des Meinungsstreits vgl. Biedenkopf, Gutachten 46. DJT, S. 97, 105. 400 Rieble, Arbeitsmarkt und Wettbewerb, Rn. 1194 f.; grundlegend Hueck, in: Jherings Jahrbücher für die Dogmatik des bürgerlichen Rechts, 73 (1923), S. 33 ff. 401 So die Bezeichnung bei Kreutz, Die Grenzen der Betriebsautonomie, S. 99 ff. 402 Vgl. P. Hanau, RdA 1989, 207, 208. 403 Bachmann, Private Ordnung, S. 124. 404 Umfassend Thüsing, in: Wiedemann (Hrsg.), TVG, § 1 Rn. 42 ff.
118
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
zur Rechtsetzung.405 Durch das Tarifvertragsgesetz habe der Staat die Normsetzungsbefugnis auf die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände übertragen. In diesem abgesteckten Bereich könnten die Kollektivvertragsparteien anstelle des Staates Recht setzen. Unter Verweis darauf, dass nur der Staat objektives Recht setzen könne, wird der produzierte Rechtssatz alsdann teilweise im Sinne einer echten Delegation als staatlich eingeordnet.406 Teilweise wird die Delegation aber auch in einem weiteren Sinne als Befugnis zu privatrechtlicher Normsetzung verstanden.407 Der Delegationstheorie gegenüber steht die sog. Mandatarstheorie.408 Sie führt die normative Wirkung des Tarifvertrags auf eine privatautonome Normsetzungsbefugnis der Tarifvertragsparteien zurück und ordnet den Tarifvertrag als Rechtsnormenvertrag ein. Die Tarifautonomie müsse als „kollektiv ausgeübte Privatautonomie“ verstanden werden. Die Normbetroffenen würden freiwillig den vertragsschließenden Verbänden beitreten und sich deren Regelsetzungsmacht unterwerfen. Die Tarifvertragspartner handelten als „Beauftragte“ ihrer Mitglieder, sodass die Grenzen dieses Mandats zumindest gedanklich den Umfang der Regelsetzungsmacht festlegten. In eine ähnliche Richtung wie die Mandatarslehre geht die von Kirchhof und Waltermann vertretene Anerkennungslehre,409 der auch das Bundesverfassungsgericht nahestehen dürfte.410 Hiernach formulieren die Tarifvertragsparteien den Inhalt von Tarifnormen privatautonom aus. Der Staat, der das Rechtsanerkennungs-
405 Vgl. BAGE 1, 258, 264; BAGE 4, 240, 251 f.; BAG AP Nr. 2 zu § 1 TVG Rückwirkung; BAG AP Nr. 12 zu § 3 TVG Verbandszugehörigkeit; BAG AP Nr. 13 zu Art. 9 GG; Adomeit, Rechtsquellenfragen im Arbeitsrecht, S. 136 ff.; Säcker, Gruppenautonomie, S. 243; zu Varianten der Delegationslehre vgl. Thüsing, in: Wiedemann (Hrsg.), TVG, § 1 Rn. 47 m.w.N. 406 Huber, Wirtschaftsverwaltungsrecht, Bd. 2, S. 431 ff.; Nikisch, Arbeitsrecht, Bd. 2, S. 45, 216 ff. 407 So früher BAGE 1, 258, 262 ff.; BAGE 4, 133, 135 f.; BAGE 4, 240, 252; vgl. ferner Adomeit, Rechtsquellenfragen im Arbeitsrecht, S. 132, 136 ff., 156; Hueck/Nipperdey, Arbeitsrecht, Bd. II/1. Halbband, S. 339 ff. 408 Grundlegend Zöllner, Rechtsnatur der Tarifnormen, S. 31, 37; ders., RdA 1962, 453 ff.; ders., RdA 1964, 443 ff. und Richardi, Kollektivgewalt und Individualwille, S. 51, 63, 78, 91, 127 ff.; ders., Gutachten 61. DJT, B 26, 61; ferner etwa BAG AP Nr. 11 und 12 zu § 1 TVG Tarifverträge Luftfahrt; Bayreuther, Tarifautonomie als kollektiv ausgeübte Privatautonomie, passim; Canaris, AcP 184 (1984), 201, 244; Picker, Tarifautonomie, S. 43 ff., 51, 53; ders., NZA 2002, 761, 768 f.; Rieble, Arbeitsmarkt und Wettbewerb, Rn. 1194 ff.; ders., ZfA 2000, 5 ff.; weitere Nachweise bei Gamillscheg, Kollektives Arbeitsrecht, Bd. 1, S. 559 Fn. 140. 409 F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 133 ff., 181 ff.; Waltermann, Rechtsetzung durch Betriebsvereinbarung, S. 118, 122 ff.; ders., in: FS Söllner, S. 1251, 1262 ff. 410 Gleiche Einschätzung bei Thüsing, in: Wiedemann (Hrsg.), TVG, § 1 Rn. 51 unter Verweis auf BVerfGE 34, 307, 316 f.; BVerfGE 64, 208, 215.
§ 8 Regeln mit Verbindlichkeitsanspruch
119
monopol besitze, erkenne die Regeln durch staatlichen Anerkennungsakt in Gestalt der §§ 1 Abs. 1, 4 Abs. 1 TVG als bindendes Recht an.411 bb) Stellungnahme Die Delegationstheorie vermag nicht zu überzeugen. Gegen sie spricht, dass es sich bei der Tarifnormsetzung um eine durch Art. 9 Abs. 3 GG verfassungsrechtlich gewährleistete Grundrechtsausübung handelt. Es fehlt damit an einer Staatsaufgabe, die im Wege der Delegation übertragen werden könnte.412 Der Gedanke einer Delegation passt ferner deshalb nicht, weil bei einer solchen im öffentlichen Recht gemeinhin angenommen wird, dass der delegierende Rechtsträger seine Kompetenz in dem Ausmaß verliert, wie sie der Erwerber durch die Kompetenz übertragung erhält.413 Die bestehende Tarifautonomie ändert aber nichts daran, dass der Staat seine Rechtsetzungsmacht behält. Durch den grundsätzlich höheren Rang seiner Rechtsnormen hat er ein stetiges Zugriffsrecht auf die Tarifnormen.414 Schließlich spricht auch eine fehlende Staatsaufsicht, die gemeinhin als notwendiges Korrelat staatlicher Aufgabenübertragung gesehen wird,415 gegen die Ausgliederung hoheitlicher Befugnisse auf die Tarifvertragsparteien.416 Auch wenn man nicht von einer „echten“ Delegation ausgeht, sondern von einem weiten Begriffsverständnis im Sinne einer Delegation zu privatrechtlicher Normsetzung, lässt sich die Delegationstheorie nicht halten. Denn auch dann müsste es sich bei der Gestaltung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen um eine Staatsaufgabe handeln, die übertragen wird, was angesichts des Art. 9 Abs. 3 GG aber gerade nicht der Fall ist. Darüber hinaus ist nicht erklärbar, wie sich eine öffentlich-rechtliche Kompetenz durch Übertragung auf die Tarifvertragsparteien in eine privatrechtliche Regelsetzung umwandeln können soll.417 Insofern könnte allenfalls von einer „überlassenen“ Rechtsetzungsmacht, nicht aber von Delegation gesprochen werden.418 Die Mandatarstheorie begegnet ebenfalls durchgreifenden Bedenken. Sie basiert im Kern auf der Idee, dass sich das einzelne Mitglied mit seinem Verbandsbeitritt der privatautonomen Regelsetzungsmacht der Tarifvertragsparteien unterwirft. Im bloßen Beitritt zum Verband kann jedoch kein umfassendes Mandat zur F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 181 ff. Vgl. auch Waltermann, Rechtsetzung durch Betriebsvereinbarung, S. 117 m.w.N. 413 Vgl. F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 167 f.; Waltermann, Rechtsetzung durch Betriebsvereinbarung, S. 115 ff. 414 So treffend F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 167. 415 Statt aller Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, § 23 Rn. 45. 416 Vgl. F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 174 f. 417 F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 170; Waltermann, Rechtsetzung durch Betriebsvereinbarung, S. 119, 121 f. 418 So Thüsing, in: Wiedemann (Hrsg.), TVG, § 1 Rn. 52 unter Verweis auf BVerfGE 64, 208, 215. 411
412
120
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
Regelsetzung gesehen werden, da zu diesem Zeitpunkt zumindest die zukünftigen Regeln für die Normunterworfenen inhaltlich nicht absehbar sind.419 Ferner erfassen die sog. Betriebsnormen auch sog. „Außenseiter“ (§ 3 Abs. 2 TVG).420 Zudem kann der gesamte Tarifvertrag durch Allgemeinverbindlicherklärung auf Nichtmitglieder erstreckt werden (§ 5 Abs. 4 TVG).421 Plausibel erklärt werden kann das Phänomen, dass die privaten Tarifvertragsparteien Rechtsnormen erzeugen können, die normative Wirkungen entfalten, einzig mithilfe des Anerkennungsgedankens. Durch den in den §§ 1, 4 TVG zu sehenden Akt staatlicher Anerkennung erlangen die von privater Hand formulierten Tarifnormen den Charakter einer Rechtsnorm. Der Staat setzt die private Regel in Geltung und verschafft hierdurch den im Autonomiebereich geschaffenen Regeln die Eigenschaft von privatem Recht.422 Freilich noch losgelöst von der Frage der Legitimation kann auf diese Weise die weitreichende tarifvertragliche Bindungswirkung erklärt werden, die auch sog. Außenseiter mit einschließt. Zugleich macht die Annahme eines Rechtsanerkennungsmonopols den Gedanken einer Übertragung von Rechtsetzungskompetenzen überflüssig. 5. Die Rechtsnormen der Betriebsvereinbarung a) Normative Wirkung der Betriebsvereinbarung Ein eng mit den Tarifnormen verwandtes Beispiel mehrseitig verbindlicher privater Rechtsetzung bilden die sog. Betriebsvereinbarungen. Diese ermöglichen es Arbeitgeber und Betriebsrat, gemeinsam für alle Betriebsangehörigen einheitliche Regeln zu schaffen, die die innerbetriebliche Ordnung zum Gegenstand haben.423 Im Hinblick auf die Rechtsnatur der Betriebsvereinbarung entspricht es heute ganz herrschender Meinung, sie als eine rechtsgeschäftliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat als Repräsentant der Belegschaft zu qualifizie-
F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 93 f. die Tarifnormen über gemeinsame Einrichtungen erfassen sog. Außenseiter, vgl. § 4 Abs. 2 TVG. Um diesen Widerspruch aufzulösen, wird teilweise dafür plädiert, diese Normen unter Berufung auf die negative Koalitionsfreiheit teleologisch zu reduzieren (vgl. Rieble, Arbeitsmarkt und Wettbewerb, Rn. 1509 ff.) oder man hält sie gar für verfassungswidrig (vgl. Lieb, Rechtsnatur der Allgemeinverbindlicherklärung, S. 74 f.; Richardi, Kollektivgewalt und Individualwille, S. 214 f.; Zöllner, RdA 1962, 453, 458 f.). 421 Vgl. Bachmann, Private Ordnung, S. 128; Thüsing, in: Wiedemann (Hrsg.), TVG, § 1 Rn. 50. Zur Allgemeinverbindlichkeitserklärung als Akt öffentlicher Gewalt, der unmittelbar an den Grundrechten zu messen ist, vgl. Herdegen, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 1 Abs. 3 Rn. 100 (Stand: 77. EL 2016). 422 Vgl. F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 175 ff.; Waltermann, Rechtsetzung durch Betriebsvereinbarung, S. 118. 423 Zur personellen Reichweite Richardi, in: Richardi (Hrsg.), BetrVG, § 77 Rn. 73 ff. 419
420 Auch
§ 8 Regeln mit Verbindlichkeitsanspruch
121
ren.424 Wie der Tarifvertrag setzt sich die Betriebsvereinbarung aus einem schuld rechtlichen und einem normativen Teil zusammen. In § 77 Abs. 4 S. 1 BetrVG ordnet der Gesetzgeber an, dass der normative Teil der Betriebsvereinbarung unmittelbar und zwingend gilt.425 Obwohl das Gesetz anders als beim Tarifvertrag eine entsprechende Bestimmung nicht enthält, nimmt die ganz herrschende Meinung an, dass das Günstigkeitsprinzip auch hier gilt, d.h., dass durch Einzelarbeitsvertrag von den Regelungen zugunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden kann.426 Ebenso werden Öffnungsklauseln für zulässig gehalten.427 b) Ursprung der Betriebsvereinbarung Auch in Bezug auf die Betriebsvereinbarung ist umstritten, ob die normative Wirkung der kollektivvertraglichen Regeln auf einer staatlichen Delegation428 oder auf einer Betriebsautonomie als kollektiv ausgeübte Privatautonomie der Belegschaft beruht.429 Anders als beim Tarifvertrag stehen sich hier schlussendlich aber nur die Delegationstheorie und die Anerkennungslehre gegenüber. Dem Mandatarsgedanken steht hier von vornherein entgegen, dass § 77 Abs. 4 BetrVG auch Arbeitnehmer erfasst, die weder der Errichtung des Betriebsrats noch der Betriebsvereinbarung zugestimmt haben.430 Wie schon beim Tarifvertrag ist der Anerkennungslehre zu folgen. Im Hinblick auf die Betriebsvereinbarung besteht zwar keine spezielle verfassungsrechtliche Gewährleistung wie in Art. 9 Abs. 3 GG für die Tarifautonomie, die einer Delegation staatlicher Rechtsetzungsbefugnis entgegensteht. Für die Betriebsvereinbarung 424 Statt aller Richardi, in: Richardi (Hrsg.), BetrVG, § 77 Rn. 24, wobei zwischen Vertrags- und Vereinbarungstheorie differenziert wird. Früher wurde die Betriebsvereinbarung mitunter öffentlich-rechtlich eingeordnet und als autonome Satzung begriffen, vgl. Galperin, BB 1949, 374; Herschel, RdA 1948, 47, 49; ders., RdA 1956, 161, 168. Ein historischer Überblick zur Behandlung der Betriebsvereinbarung und ihrer Vorläufer findet sich bei Waltermann, Rechtsetzung durch Betriebsvereinbarung, S. 101 ff. 425 Dütz/Thüsing, Arbeitsrecht, Rn. 915; Zöllner/Loritz/Hergenröder, Arbeitsrecht, § 50 Rn. 24; umfassend zu den Rechtswirkungen der Betriebsvereinbarung Richardi, in: Richardi (Hrsg.), BetrVG, § 77 Rn. 132 ff. 426 Heute h.M., vgl. etwa Dütz/Thüsing, Arbeitsrecht, Rn. 922; Richardi, in: Richardi (Hrsg.), BetrVG, § 77 Rn. 141; Zöllner/Loritz/Hergenröder, Arbeitsrecht, § 50 Rn. 24. 427 Dütz/Thüsing, Arbeitsrecht, Rn. 922 m.w.N. 428 Für eine echte Delegation staatlicher Rechtsetzungsbefugnis Adomeit, Rechtsquellenfragen im Arbeitsrecht, S. 136 ff., 146 f. mit Fn. 477; Huber, Wirtschaftsverwaltungsrecht, Bd. 2, S. 521 f.; für eine Delegation im weiteren Sinne Hueck/Nipperdey, Arbeitsrecht, Bd. II/2. Halbband, S. 1275 f., 1669 f.; Säcker, Gruppenautonomie, S. 243, 344 f. 429 Zur Anerkennungslehre bei Betriebsvereinbarungen vgl. F. Kirchhof, Private Recht setzung, S. 212 f.; Waltermann, Rechtsetzung durch Betriebsvereinbarung, S. 126 ff. 430 Bachmann, Private Ordnung, S. 131 mit Nachweisen auch zu dem wenig überzeugenden Versuch, eine mitgliedschaftliche Legitimation darüber zu erreichen, dass der Betrieb als Verband beschrieben wird, dem der Arbeitnehmer als Mitglied beitritt.
122
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
ergibt sich jedoch aus der Werteordnung der Art. 2 Abs. 1, 12 Abs. 1 GG, dass es primär den Privaten überlassen ist, im Rahmen ihrer Privatautonomie die Inhalte des Arbeitsverhältnisses und damit auch die betrieblichen Angelegenheiten zu regeln, und es sich nicht um eine Aufgabe des Staates handelt, die übertragen werden könnte.431 Wenn der Staat den Privaten Autonomie zugesteht, überträgt er nicht an sich ihm zustehende Zuständigkeiten, sondern nimmt seine Zuständigkeiten zurück.432 Mit der Anerkennungslehre ist daher davon auszugehen, dass das Aushandeln der Regeln betreffend die innerbetriebliche Ordnung durch Arbeitgeber und Betriebsrat ein Akt privatautonomer Regelsetzung ist, der mittels staatlicher Anerkennung durch § 77 Abs. 4 S. 1 BetrVG auf die Rechtsebene gehoben und mit normativer Strahlkraft belegt wird. 6. Erstarkung privater Regeln zu Gewohnheitsrecht Mehrseitige unmittelbare Rechtsverbindlichkeit können private Regeln auch dadurch erlangen, dass sie im Laufe der Zeit zu Gewohnheitsrecht erstarken. Gewohnheitsrecht entsteht durch eine längere und andauernde Übung sowie eine übereinstimmende Überzeugung der Beteiligten, dass die Regel als von Rechts wegen geboten zu beachten ist.433 Bei den zu Gewohnheitsrecht erstarkten Regeln handelt es sich um private Rechtsnormen i.S.d. Art. 2 EGBGB, d.h. um generell-abstrakte Regeln, die unabhängig vom Willen der Beteiligten gelten.434 Sie sind von den Gerichten stets als unmittelbar bindend zu beachten. Gegen die Einordnung des Gewohnheitsrechts als Fallgruppe privater Regelsetzung könnte zwar eingewandt werden, dass es nicht durch einen rationalen, willentlich gesteuerten Prozess der Regelaufstellung gesetzt wird, sondern sich naturwüchsig aus der Gesellschaft herausbildet. Überzeugen würde dies aber nicht. Der Umstand, dass die Regelaufstellung nicht intentional erfolgt, ändert nichts daran, dass es sich auch hier um eine privatautonom gewachsene, verhaltensregulierende Ordnung handelt. Größere Schwierigkeiten scheint die Einpassung des Gewohnheitsrechts in das hier vertretene Modell einer zweistufigen Entstehung privaten Rechts zu bereiten. Denn auf den ersten Blick fehlt es beim Gewohnheitsrecht an einem staatlichen Anerkennungsakt, der die privatautonom gewachsenen Regeln auf die Ebene des Rechts hebt. F. Kirchhof hat jedoch zu Recht darauf hingewiesen, dass der allgemeine staatliche Anerkennungsakt bezüglich des Gewohnheitsrechts in Art. 20 Abs. 3 GG erblickt werden kann. Danach ist die Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung an Gesetz und Recht. In Rechtsprechung und Literatur besteht insoweit Einigkeit, Waltermann, Rechtsetzung durch Betriebsvereinbarung, S. 126 ff. Vgl. BVerfGE 44, 322, 340; BVerfGE 50, 290, 367. 433 Statt aller Merten, in: Staudinger, Art. 2 EGBGB Rn. 93 ff. m.w.N. 434 Merten, in: Staudinger, Art. 2 EGBGB Rn. 93 m.w.N. 431 Vgl. 432
§ 8 Regeln mit Verbindlichkeitsanspruch
123
dass durch die Formulierung „Gesetz und Recht“ gerade auch Gewohnheitsrecht erfasst wird. Indem der Verfassungsgesetzgeber in Art. 20 Abs. 3 GG die Organe zur Beachtung von Gesetz und Recht verpflichtet, hält er diese damit auch zur Beachtung des Gewohnheitsrechts an und erkennt die zu Gewohnheitsrecht erstarkten privaten Regeln allgemein als Recht an.435 7. Handelsbrauch und Verkehrssitte Auch der Handelsbrauch und die Verkehrssitte bilden eine Form mehrseitiger unmittelbar verbindlicher privater Regeln ab, indem das Gesetz an einzelnen Stellen auf sie Bezug nimmt und sie auf diese Weise im gesetzlichen Anwendungsbereich für die Regelunterworfenen bindend sind. Von Rechtsnormen bzw. dem Gewohnheitsrecht unterscheiden sie sich dadurch, dass sie nur kraft und im Rahmen des sie zum Maßstab erhebenden Gesetzes gelten.436 Der Handelsbrauch ist in § 346 HGB geregelt. Danach ist unter Kaufleuten in Ansehung der Bedeutung und Wirkung von Handlungen und Unterlassungen auf die im Handelsverkehr geltenden Gewohnheiten und Gebräuche Rücksicht zu nehmen. Erwähnt wird er ferner in § 310 Abs. 1 S. 2 Hs. 2 BGB, wonach bei der Inhaltskontrolle von Allgemeinen Geschäftsbedingungen nach § 307 Abs. 1 und 2 BGB auf die im Handelsverkehr geltenden Gewohnheiten und Gebräuche angemessen Rücksicht zu nehmen ist. Die Verkehrssitte wird vom Gesetzgeber zunächst in § 157 BGB aufgegriffen. Danach sind Verträge so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erford$1rn. Daneben wird u.a. in § 242 BGB auf die Verkehrssitte rekurriert, wonach der Schuldner verpflichtet ist, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben es mit Rücksicht auf die Verkehrssitte erfordern. Handelsbräuche und Verkehrssitten sind insoweit identisch, als Handelsbräuche Verkehrssitten des Handelsverkehrs darstellen.437 Ihre Entstehung setzt jeweils eine tatsächliche, in den Verkehrskreisen herrschende einverständliche Übung voraus, die über einen längeren Zeitraum praktiziert wird.438 Dass Regeln bewusst gesetzt werden, steht der Einordnung als Handelsbrauch bzw. Verkehrssitte nicht entgeF. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 56 f. Zum fehlenden Rechtsnorm- bzw. Gewohnheitsrechtscharakter vgl. BGH NJW 1966, 502, 503; Busche, in: MüKo BGB, § 157 Rn. 16; Canaris, Handelsrecht, § 22 I 3; K. Schmidt, Handelsrecht, § 1 III 3 a; Wolf/Neuner, BGB AT, § 4 Rn. 18; Singer, in: Staudinger, BGB, § 133 Rn. 67. Grundlegend zur rechtlichen Bedeutung der Verkehrssitte Oertmann, Rechtsordnung und Verkehrssitte, 1914; Sonnenberger, Verkehrssitten im Schuldvertrag, passim. 437 Vgl. Bachmann, Private Ordnung, S. 342 Fn. 61. 438 Vgl. RGZ 49, 157, 162; RGZ 55, 375, 377; RGZ 110, 47, 48; BGH NJW 1990, 1723, 1724; Busche, in: MüKo BGB, § 157 Rn. 16; Singer, in: Staudinger, BGB, § 133 Rn. 66 f.; Wolf/Neuner, § 4 Rn. 18; zur Diskussion, ob für die Einordnung als Verkehrssitte schon jede tatsächliche Übung ausreichend ist oder ob es sich um soziale Normen handeln muss, vgl. Bachmann, Private Ordnung, S. 345 ff. m.w.N. 435 Vgl. 436
124
2. Teil: Systematisierung privater Regelsetzung
gen; erforderlich ist aber, dass die Regel einer tatsächlichen Übung entspricht.439 Neben allgemeinen Handelsbräuchen bzw. Verkehrssitten bestehen auch solche, die sich branchenspezifisch oder regional herausgebildet haben.440
IV. Zusammenfassung Die unmittelbar verbindlichen privaten Regelwerke lassen sich in einseitig, zwei- und mehrseitig verbindliche Regelwerke aufteilen. Zu den einseitig verbindlichen Regelwerken gehören etwa die Auslobung, das Testament, das arbeitsrechtliche Weisungs- bzw. Direktionsrecht sowie die Gesamtzusage des Arbeitgebers. Zwei- und mehrseitig verbindliche Regelwerke bilden neben dem Vertrag die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Verbandsregeln sowie die Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen. Ebenso hierunter fallen private Regeln, die im Laufe der Zeit zu Gewohnheitsrecht erstarkt sind, sowie private Regeln, die eine Verkehrssitte bzw. einen Handelsbrauch abbilden.
439 Vertiefend Bachmann, Private Ordnung, S. 342 ff.; Sonnenberger, Verkehrssitten, S. 77, 81. 440 Singer, in: Staudinger, BGB, § 133 Rn. 65, 68.
Dritter Teil
Legitimation privater Regeln 3. Teil: Legitimation privater Regeln
§ 9 Grundlagen I. Legitimationsbedürftigkeit privater Regeln Nachdem im zweiten Teil der Arbeit einzelne private Regelwerke mit ihren faktischen und rechtlichen Wirkungen dargestellt wurden, ist im dritten Teil der Frage nachzugehen, wie sich diese Wirkungen legitimieren lassen. Hierzu gilt es zunächst zu klären, ob und in welchem Umfang private Regeln einer Legitimation bedürfen. Im Anschluss hieran werden einzelne Legitimationskonzepte dargestellt und auf ihre Tragfähigkeit hin untersucht, wobei auch darauf eingegangen wird, inwieweit der Staat den Legitimationsprozess zu begleiten hat, d.h. dafür Sorge zu tragen hat, dass private Regeln nur dann Rechtswirkungen entfalten, wenn auch die Legitimation sichergestellt ist. Schließlich wird das herausgearbeitete Legitimationsmodell anhand der im zweiten Teil dargestellten privaten Regeln erprobt. Der Begriff der Legitimation1 umschreibt den Versuch, einen Grund dafür zu schaffen, dass ein Sein, ein Sollen oder ein Wollen Anerkennung verdient.2 Er hat seine Wurzeln in der Staatstheorie,3 wo es die Ausübung staatlicher Macht zu legitimieren gilt.4 Aber auch für die private Regelsetzungslehre ist die Frage nach dem Grund dafür, warum ein Sein, ein Sollen, ein Wollen Anerkennung verdient, insoweit von Bedeutung, als es darum geht, die Bindung an private Regeln zu begründen. Denn auch eine private Regel kann nur dann als verbindlich gelten, wenn sie den Anspruch erhebt, legitim zu sein, d.h., dass es gute Gründe dafür gibt, dass sie ihren Adressaten Gefolgschaft abverlangt.5 Legitimation und Verbindlichkeit 1 In der Staatsrechtslehre wird neben dem Begriff der Legitimation häufig auch der Begriff der Legitimität verwendet. Nach verbreiteter Auffassung bezeichnet Legitimität eine Eigenschaft der Herrschaftsgewalt, einen Zustand, in dem Herrschaftsgewalt als Ergebnis eines Legitimationsprozesses gerechtfertigt ist. Legitimation als prozesshafter Vorgang, d.h. als Verfahren, vermittelt diese Legitimität, vgl. nur Schliesky, Herrschaftsgewalt, S. 150 f. m.w.N. 2 Vgl. Isensee, Der Staat 1981, 161. 3 Umfassend zur Begriffsgeschichte vgl. Würtenberger, Die Legitimität staatlicher Herrschaft, passim. 4 BVerfGE 83, 60, 73; BVerfGE 93, 37, 68: Jegliches staatliches Handeln mit Entscheidungscharakter ist legitimationsbedürftig. 5 Bachmann, in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 207, 213.
126
3. Teil: Legitimation privater Regeln
bedingen sich gegenseitig, wobei die Anforderungen an die Legitimation mit zunehmenden rechtlichen Wirkungen steigen. Dass eine private Regel nicht „von oben“, sondern „von unten kommt“, macht sie jedenfalls nicht automatisch legitim.6 Ebenso wenig führt die Tatsache, dass es sich bei den privaten Regeln um eine Grundrechtsausübung bzw. eine Freiheitserweiterung handelt, nicht dazu, dass die Legitimationsfrage obsolet ist. Der Regelbetroffene kann sich im Rahmen privater Regelsetzung sehr schnell einer eigensüchtigen Mehrheit oder privaten (Verbands-)Macht ausgesetzt sehen. Selbst das Rechtsgeschäft wirft ein Legitimationsbedürfnis unter dem Aspekt auf, dass es für die Zukunft bindet und sich der Erklärende nicht mehr ohne Rechtsgrund von den Regeln lossagen kann.7 Die zunächst selbstbestimmte Erklärung beinhaltet ein potenziell zukunftsbezogenes Moment der Fremdbestimmung. Freiheit und Bindung laufen also auch bei Selbstbestimmungsakten nicht zwingend synchron.8 Noch evidenter zutage tritt die fremdbestimmte Bindung, wenn den Regeln nicht alle Regeladressaten zugestimmt haben, sondern die Regeln nur von einer Mehrheit getragen werden und die Regeln der Minderheit gleichsam aufoktroyiert werden oder sich das Individuum durch eine asymmetrische Machtverteilung von vornherein in einer untergeordneten Position befindet. Unabhängig davon, ob eine Regel staatlicher oder privater Provenienz ist, stellt sich die Frage nach der Legitimation damit immer schon dann, wenn ein Moment der Fremdbestimmung gegeben ist, d.h., wenn das Individuum (teilweise) ohne oder gegen seinen Willen an Regeln gebunden ist. Lässt man sich von einem rechtswissenschaftlichen Erkenntnisinteresse leiten, können allerdings solche Regeln als nicht legitimationsbedürftig aussortiert werden, die lediglich eine faktische, nicht aber eine rechtliche Bindungswirkung, sei es mittelbarer oder unmittelbarer Natur, auslösen. Regeln mit bloß faktischem Geltungsanspruch, wie die auf der ersten Systematisierungsstufe genannten unverbindlichen Selbstverpflichtungserklärungen, sozialen Normen, Gentlemen’s Agreements, Unternehmensrichtlinien und -kodizes, bedürfen aus dieser Warte keiner Legitimation. Die von ihnen ausgehende soziale Bindungswirkung löst kein rechtliches, sondern allenfalls ein soziologisches Legitimationsbedürfnis aus. Im Kontext dieser Arbeit stellt sich die Frage der Legitimation somit immer dann, wenn eine Regel mit dem Anspruch auf mittelbare oder unmittelbare Rechtsverbindlichkeit auftritt.9
Bachmann, in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 207, 212. Bumke/Röthel, in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates, Recht, S. 1, 14; Lepsius, in: Möllers/Voßkuhle/Walters (Hrsg.), Internationales Verwaltungsrecht, S. 345, 357. 8 Bumke/Röthel, in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 1, 14. 9 Vgl. Bachmann, in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 207, 213. 6 7
§ 9 Grundlagen
127
II. Verschiedene Perspektiven der Legitimation 1. Soziologischer und normativer Ansatz Zu der Frage, wie sich Regeln legitimieren lassen, haben sich ein normatives und ein soziologisch-deskriptives Legitimationsverständnis herausgebildet.10 Das soziologisch-deskriptive Legitimationsverständnis geht auf Max Weber zurück.11 Diesem liegt im Kern die Idee zugrunde, dass soziale Ordnungen auf Dauer nur stabil gehalten werden können, wenn davon ausgegangen werden kann, dass das Gros der Regelunterworfenen die Regeln als legitim empfindet und sie akzeptiert.12 Dementsprechend setzt man bei den im Bewusstsein der Herrschaftsunterworfenen vorzufindenden Rechtfertigungsmechanismen an und geht im Wege empirischer Forschung der Frage nach, ob und warum die Herrschaftsordnung faktisch gebilligt wird.13 Als „Motive der Fügsamkeit“ werden etwa ausgemacht der Glaube an die legitimierende Kraft der Tradition, an das Charisma des Herrschers, an eine Werteordnung, an die Legalität einer Ordnung sowie die Hoffnung auf Förderung eigener Interessen.14 Luhmann wiederum hat versucht, die Akzeptanz von Herrschaftsgewalt damit zu erklären, dass gesetzesmäßig vorgeschriebene Entscheidungsverfahren durchlaufen werden.15 Ihm zufolge beruht Legitimität nicht auf einer persönlich getragenen Richtigkeitsüberzeugung einer Entscheidung, sondern „auf einem sozialen Klima, das die Anerkennung verbindlicher Entscheidungen als Selbstverständlichkeit institutionalisiert und sie nicht als Folge einer persönlichen Entscheidung, sondern als Folge der Geltung der amtlichen Entscheidung ansieht“.16 10 Zum daneben bestehenden politikwissenschaftlichen Legitimitätsbegriff, der Überschneidungspunkte sowohl mit dem soziologischen als auch normativen Legitimationsverständnis aufweist, vgl. Schliesky, Herrschaftsgewalt, S. 151 ff. m.w.N. 11 Vgl. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 16 ff.; siehe auch Lucke, Akzeptanz, passim; Luhmann, Rechtssoziologie, S. 259 ff.; Machura, Fairneß und Legitimität, passim. 12 Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 16; vgl. ferner Luhmann, Rechtssoziologie, S. 259 ff. 13 Vgl. Schliesky, Herrschaftsgewalt, S. 153; Zippelius, Allgemeine Staatslehre, S. 94; zum Akzeptanzbegriff vgl. Lucke, Akzeptanz, S. 74 ff. 14 Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 19 f., 76, 122 ff.; zu den daraus folgenden drei Typen legitimer Herrschaft (rationale bzw. legale, traditionelle und charismatische Herrschaft) ebenda S. 124 ff. 15 Luhmann, Legitimation durch Verfahren, insbesondere S. 27 ff.; ders., Das Recht der Gesellschaft, S. 207 ff.; ders., Rechtssoziologie, S. 262 ff. Dieses Konzept darf aber nicht im Sinne einer Rechtfertigung durch Verfahrensrecht missverstanden werden. Das Verfahren setzt zwar eine rechtliche Regelung voraus, für Luhmann maßgebend ist aber die Umstrukturierung des Erwartens durch den faktischen Kommunikationsprozess, d.h. das wirkliche Geschehen und nicht die normative Sinnbeziehung, vgl. Luhmann, Legitimation durch Verfahren, S. 37; kritisch zu diesem Ansatz etwa Machura, ZfRSoz 14 (1993), 97 ff.; Schliesky, Herrschaftsgewalt, S. 158 f. 16 Luhmann, Legitimation durch Verfahren, S. 34.
128
3. Teil: Legitimation privater Regeln
Das normative Legitimationsverständnis hebt sich vom soziologischen Ansatz dadurch ab, dass es versucht, Herrschaft anhand bestimmter Wertvorstellungen und/oder rechtlicher Vorgaben zu rechtfertigen.17 Im Fokus steht anders als beim soziologischen Legitimationsverständnis nicht primär die tatsächliche Akzeptanz von Herrschaft,18 sondern die Anerkennungswürdigkeit derselben aufgrund ethisch-rechtlicher Verbindlichkeitsgründe.19 Es wird versucht, Herrschaftsgewalt mithilfe von Grundsätzen und Prinzipien, die sich aus geschriebenen, aber auch ungeschriebenen Wertungen der Rechtsordnung ergeben können, materiell zu rechtfertigen.20 2. Vorzugswürdigkeit eines normativen Ansatzes Den nachfolgenden Überlegungen ist ein normatives Legitimationsverständnis zugrunde zu legen. Aufgabe der Rechtswissenschaft ist es, tragfähige Gründe herauszuarbeiten, warum die Betroffenen an die Regeln gebunden werden und diese dem Grunde nach letztendlich auch akzeptieren sollen. Der soziologische Ansatz erklärt indes lediglich aus einer Beobachterperspektive die Geltung von Regeln, d.h., inwieweit die Regelunterworfenen die Regeln akzeptieren und befolgen.21 Akzeptanz erzeugt jedoch keine Legitimation, sie folgt ihr vielmehr nach. Sie benennt nicht den konstituierenden Grund der Legitimation, sondern betont allein die Wirkungen von Regeln, nämlich dass sie von den Betroffenen als legitim empfunden werden.22 Schlussendlich schaut das Akzeptanzmodell damit in weiten Teilen lediglich auf die Wirkung der bisher erzeugten Regeln zurück. Ein vorausschauendes Element trägt es nur insoweit in sich, als dass Akzeptanz auch das Einverständnis 17 In Bezug auf die staatliche Herrschaft Höffe, Politische Gerechtigkeit, S. 69 ff.; Hofmann, Legitimität und Rechtsgeltung, insbesondere S. 32 ff.; Schliesky, Herrschaftsgewalt, S. 151, 159 ff.; Würtenberger, in: Staatslexikon, Art. Legalität, Legitimität, Sp. 873, 874. 18 In der Realität stehen das soziologisch-deskriptive und das normative Legitimationsverständnis aber nicht beziehungslos nebeneinander, vielmehr ist eine gewisse Verzahnung festzustellen, vgl. Isensee, JZ 1999, 265, 273: Ein staatliches Entscheidungssystem gründet auf Akzeptanz; Schliesky, Herrschaftsgewalt, S. 172 ff.; Würtenberger, Die Legitimität staatlicher Herrschaft, S. 15; Zippelius, Allgemeine Staatslehre, S. 95 f. 19 Vgl. Schliesky, Herrschaftsgewalt, S. 159 ff.; Würtenberger, in: Staatslexikon, Art. Legalität, Legitimität, Sp. 873, 874; ders., Die Legitimität staatlicher Herrschaft, S. 16; Zippelius, Allgemeine Staatslehre, S. 93 f. 20 Schliesky, Herrschaftsgewalt, S. 160; Würtenberger, Die Legitimität staatlicher Herrschaft, S. 16; Zippelius, Allgemeine Staatslehre, S. 94. 21 Vgl. Webers Definition der Soziologie als „eine Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich erklären will“, Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 1; kritisch zu dieser methodischen Selbstbeschränkung Habermas, Faktizität und Geltung, S. 109. 22 So aus dem staatsrechtlichen Schrifttum etwa auch Dederer, Korporative Staatsgewalt, S. 167 ff.; zumindest für eine (begrenzte) legitimationsfördernde Wirkung Mehde, Neues Steuerungsmodell und Demokratieprinzip, S. 522, 562, 582; Voßkuhle/Sydow, JZ 2002, 673, 676, 681.
§ 10 Legitimationselemente
129
inkludieren kann, dass in Zukunft diese akzeptierte Form der Herrschaft weiter ausgeübt werden darf.23 Einen inhaltlichen Beitrag zur Legitimation privater Regeln leistet der soziologische Ansatz aber nicht. Er kann allenfalls bei festgestellter schlechter Akzeptanz von Regeln dazu veranlassen, herkömmliche Legitimationsstrukturen zu überdenken und gegebenenfalls nachzujustieren.
§ 10 Legitimationselemente I. Demokratische Legitimation als staatliches Legitimationsideal In der rechtswissenschaftlichen Literatur werden verschiedene Modelle zur Legitimation von Regeln vertreten. Aus staatsrechtlicher Sicht wird die Legitimation von Herrschaft regelmäßig unter dem Stichwort der demokratischen Legitimation erörtert.24 Die Bindung an das staatliche Recht wird auf das in Art. 20 Abs. 1 GG positiv verankerte Demokratieprinzip (= Herrschaft des Volkes) zurückgeführt, dem wiederum das Prinzip der Herrschaft der Mehrheit über eine in Wahlen und Abstimmungen unterlegene Minderheit innewohnt (Mehrheitsprinzip). Es wird meist damit legitimiert, dass die Autonomie des Einzelnen unter der Prämisse gleicher Freiheit der anderen am relativ größten ist, wenn gelte, was die Mehrheit beschließt.25 Bei genauerer Betrachtung beantwortet dies aber nicht, warum die Mehrheit die Minderheit mitverpflichten darf. Dies wird man nur damit erklären können, dass in Fällen fehlender Einstimmigkeit die Regeln insgesamt gesehen dem Volk zugute kommen (Gemeinwohl).26 Für die Legitimation privater Regeln lässt sich das Demokratieprinzip aber ohnehin nicht fruchtbar machen.27 Private Regeln sind nicht auf den Willen des Volkes zurückführbar, sondern allenfalls auf den Willen einzelner Regelsetzer. Verfehlt wäre es, hieraus zu schließen, dass private Regeln damit von vornherein nicht legitimierbar sind bzw. zumindest ein Legitimationsdefizit aufweisen.28 Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG postuliert ein demokratisches Legitimationsbedürfnis nur für die Ausübung von Staatsgewalt. Für die Aufstellung von Regeln jenseits der Ausübung Dederer, Korporative Staatsgewalt, S. 168. BVerfGE 47, 253, 272; BVerfGE 83, 60, 71 ff.; BVerfGE 89, 155, 182 ff.; BVerfGE 93, 37, 66 ff.; umfassend Jestaedt, Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung, S. 204 ff.; Schliesky, Herrschaftsgewalt, S. 162 ff., 230 ff. 25 Hillgruber, AöR 127 (2002), 460, 462. 26 Bachmann, Private Ordnung, S. 186 f.; ders., in: Bumke/Röthel (Hrsg.), S. 207, 218. 27 Zur Frage, inwieweit private Regeln mithilfe des Gemeinwohlgedankens zu begründen sind, vgl. unten § 10 VI. 28 So auch Bachmann, in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 207, 217 f.; Köndgen, AcP 206 (2006), 477, 522; anders wohl Merkt, in: Assmann u.a. (Hrsg.), Markt und Staat in einer globalisierten Wirtschaft, S. 169, 184, der von einem Defizit demokratischer Legitimation spricht, das nicht durch eine größere Effizienz oder Marktkonformität kompensiert werden könne. 23 Vgl. 24
130
3. Teil: Legitimation privater Regeln
von Staatsgewalt ordnet das Grundgesetz demgegenüber nicht das Erfordernis demokratischer Legitimation an. Eine demokratische Legitimation wird in Bezug auf privat erzeugte Regeln nur insoweit wieder erforderlich, als es darum geht, den staatlichen Anerkennungsakt zu legitimieren, der die privaten Regeln verbindlich macht. Die privaten Regeln selbst müssen sich hingegen nicht am Demokratieprinzip messen lassen.
II. Keine Legitimation kraft Historie oder bloßer Legalität 1. Historischer Wuchs als bloßes Faktum Zu einfach würde man es sich machen, die Bindung an private Regeln schlicht mit dem Argument zu legitimieren, dass die private Regelsetzung schon über Jahrhunderte – auch unter Geltung des BGB und des Grundgesetzes – anerkannt ist.29 Dass der Staat der Gesellschaft in der Geschichte seit jeher einen Raum zur eigenständigen Bildung von Regeln zugestanden hat und dieser Freiraum von den Individuen und gesellschaftlichen Gruppen angefangen von mittelalterlichen Zwangskorporationen wie Zünften, Ständen, Kirche und Adel über das Verbandswesen bis hin zu den heutigen Korporationen wie Verbänden, Kirchen und Koalitionspartnern des Arbeitsrechts genutzt wurde bzw. wird, zeigt lediglich, dass es sich bei der privaten Regelsetzung um ein historisches Phänomen handelt. Auf eine rechtliche Befugnis zur Regelsetzung lässt der Umstand, dass die private Regelsetzung historisch gewachsen ist, indes nicht schließen.30 2. Unzulänglichkeiten eines rein rechtspositivistischen Ansatzes Denkbar erscheint, in der Legalität privater Regeln ein legitimierendes Element zu sehen, d.h. darin, dass die Regeln im Einklang mit der staatlichen Rechtsordnung stehen.31 Namentlich die Rechtspositivisten sehen in der Legalität von Regeln den maßgeblichen Grund für ihre Geltung.32 Hintergrund ist, dass sie Recht und
29 Zur Legitimation privaten Rechts aus dem geschichtlichen Verständnis von Staat und Gesellschaft vgl. F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 509 ff.; Meder, Ius non Scriptum, S. 47 ff. 30 So auch Bachmann, in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 207, 218. 31 Zur Begriffsdefinition der Legalität Würtenberger, in: Staatslexikon, Art. Legalität, Legitimität, Sp. 873. 32 Vgl. Kelsen, Reine Rechtslehre, S. 1: Die reine Rechtslehre versucht die Frage zu beantworten, was und wie das Recht ist, nicht aber die Frage, wie es sein oder gemacht werden soll. Sie ist Rechtswissenschaft, nicht aber Rechtspolitik; so letztlich auch F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 505 f., der unter der Legitimation privater Rechtsetzung eine rein rechtsdogmatische oder rechtstechnische Rechtfertigung versteht, die dadurch gelingt, dass die privaten Regeln sich auf einen Rechtsanerkennungstitel stützen; umfassend zum Rechtspositivismus, seinen Varianten und Anhängern Hoerster, Was ist Recht?, passim;
§ 10 Legitimationselemente
131
Moral strikt voneinander trennen,33 sodass überpositive, außer- oder vorrechtliche sowie moralische Werte für sie keine Rolle spielen.34 Überzeugen kann dieser rein rechtspositivistische Ansatz nicht. Er liefert für sich genommen keine Antwort auf die Frage, welche inneren Gründe die Bindung an private Regeln rechtfertigen.35 Auch kommt man bei der Gesetzesanwendung mitunter nicht umhin, auf überpositive Wertungen zurückzugreifen, wie etwa bei der Inhaltskontrolle von Mehrheitsbeschlüssen im Verbandsrecht.36 Hier können die Grenzen der Regelsetzungsbefugnis nur festgelegt werden, wenn die Wertungen feststehen, an denen sich die Grenzziehung zu orientieren hat. Warum Regeln zu befolgen sind, mithin legitim sind, muss folglich mithilfe überpositiver Prinzipien beantwortet werden.
III. Individuelle Zustimmung als materielles Legitimationsideal privater Regeln 1. Privatautonomie als Leitgedanke Ausgehend von der in unserer freiheitlichen Rechtsordnung verankerten Privatautonomie als Prinzip der Selbstgestaltung der Rechtsverhältnisse durch den Einzelnen nach seinem Willen37 muss als Legitimationsideal die individuelle Zustimmung eines jeden Regelunterworfenen angesehen werden.38 Als Gleicher unter Gleichen muss der Einzelne anderen Privaten gegenüber frei sein und kann deren Befehlen grundsätzlich nur unterworfen sein, wenn er sich bewusst und freiwillig mit ihnen einverstanden erklärt.39 Mayer-Maly, in: Staatslexikon, Art. Recht, Sp. 666 ff.; W. Ott, Der Rechtspositivismus, passim. 33 Kelsen, JZ 1965, 465, 468; Otte, in: Staatslexikon, Art. Rechtspositivismus, Sp. 723 ff.; zur strikten Gegenposition im naturrechtlichen Denken vgl. Höffe/Demmer/Hollerbach, in: Staatslexikon, Art. Naturrecht, Sp. 1296 f. 34 Vgl. F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 505: Die Frage nach einer allgemeinen Legitimation erfasst das Thema unter rechtsphilosophischen, ethischen, rechtstheoretischen oder sozialwissenschaftlichen Aspekten anstatt unter einem juristisch-dogmatischen Blickwinkel. 35 Vgl. auch Bachmann, Private Ordnung, S. 97 f.; ders., in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 207, 215; Reuter, AcP 188 (1988), 649, 652 f.; zur Bedeutung geschriebener und ungeschriebener Prinzipien in der modernen Methodenlehre vgl. Alexy, Theorie der Grundrechte, S. 71 ff.; Larenz/Canaris, Methodenlehre, S. 302 ff.; Larenz, Richtiges Recht, S. 23 ff. 36 Vgl. dazu Bachmann, Private Ordnung, S. 180 f. mit weiteren Beispielen. 37 Flume, Das Rechtsgeschäft, S. 1; so auch die Formulierung von BVerfGE 72, 155, 170. 38 Bachmann, Private Ordnung, S. 172 ff.; ders., in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 207, 220; Thiele, Die Zustimmungen in der Lehre vom Rechtsgeschäft, S. 14 ff. 39 Bachmann, in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 207, 220; umfassend zur Privatautonomie Flume, Das Rechtsgeschäft, S. 1 ff., 31 ff.; Lorenz, Der Schutz vor dem unerwünschten Vertrag, S. 15 ff.
132
3. Teil: Legitimation privater Regeln
Dass der Einzelne als Individuum die ihn betreffenden Angelegenheiten im Rahmen der Rechtsordnung eigenverantwortlich gestalten kann, ist als ein der Rechtsordnung vorgegebener und in ihr zu verwirklichender Wert durch die Grundrechte anerkannt (vgl. Art. 2 Abs. 1, 9 Abs. 1, 3, 12 Abs. 1, 14 Abs. 1 GG)40 und gründet letztlich auf der auf Kant zurückgehenden Überlegung, dass der Mensch über einen freien Willen verfügt und damit die Fähigkeit zu autonomen Entscheidungen besitzt. Er kann sich ein moralisches Gesetz geben und im Einklang mit diesem Maximen des praktischen Handelns aufstellen (sog. „kategorischer Imperativ“).41 Diese Fähigkeit zur Selbstgesetzgebung ist der „Grund der Würde der menschlichen und jeder vernünftigen Natur“.42 Der Respekt vor der Menschenwürde und der Personenhaftigkeit ist folglich der Wert, der es gebietet, dem Einzelnen ein Selbstbestimmungsrecht zuzuerkennen.43 2. Kein Einfangen sämtlicher privater Regeln a) Verdünnte Zustimmung Weitgehend verwirklicht ist das Legitimationsideal der Zustimmung des Einzelnen in der Rechtsgeschäftslehre. Diese ist dem Prinzip der Selbstbestimmung verpflichtet und von der Erkenntnis geleitet, dass es zur Herbeiführung einer Rechtsfolge stets zumindest auch einer Willenserklärung und damit eines individuellen Zustimmungsakts des Regelunterworfenen bedarf.44 Der jeweilige Zustimmungs40 Vgl. Flume, Das Rechtsgeschäft, S. 1; Ruffert, Eigenständigkeit des Privatrechts, S. 55 ff., 59; ferner Geißler, JuS 1991, 617, 619, wonach sich die Privatautonomie jedenfalls historisch gesehen als ein den rechtsetzenden Instanzen abgerungenes Benefizium, aus anthropologisch-psychologischer Sicht aber als ein selbst forderndes, jeder humanen Ethik verpflichteten Rechtsordnung vorgegebenes Absolutum darstelle; zur Erforderlichkeit rechtlicher Grenzen vgl. BVerfGE 89, 214, 231: Die Privatautonomie ist notwendigerweise begrenzt und bedarf der rechtlichen Ausgestaltung. Privatrechtsordnungen bestehen deshalb aus einem differenzierten System aufeinander abgestimmter Regelungen und Gestaltungsmittel, die sich in die verfassungsmäßige Ordnung einfügen müssen; v. Gierke, Die soziale Aufgabe des Privatrechts, S. 22: „Allein so gewiß es ist, daß eine Privatrechtsordnung, welche den freien Willen entthronte, ihrem heiligsten Berufe untreu würde, so selbstverständlich ist es auch, daß kein Privatrecht, das nicht das soziale Chaos heraufbeschwören will, sich der Aufgabe entziehen kann, dem freien Spiel der Einzelwillen in der Erzeugung von Rechtsverhältnissen Schranken zu setzen.“ 41 Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, S. 52: „Handle nur nach derjenigen Maxime, von der du wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde.“ 42 Kant, Grundlegung zur Metapyhsik der Sitten, S. 71. 43 Ohly, „Volenti non fit iniuria“, S. 69; vgl. ferner BVerfGE 49, 286, 298: „Art. 1 Abs. 1 GG schützt die Würde des Menschen, wie er sich in seiner Individualität selbst begreift und seiner selbst bewußt wird. Hierzu gehört, daß der Mensch über sich selbst verfügen und sein Schicksal eigenverantwortlich gestalten kann.“ 44 Vgl. statt aller Rüthers/Stadler, Allgemeiner Teil des BGB, § 16 Rn. 1; siehe auch schon Motive I, S. 126: „Rechtsgeschäft im Sinne des Entwurfes ist eine Privatwillenserklä-
§ 10 Legitimationselemente
133
akt ist Ausdruck der grundrechtlich verbürgten Freiheit der Selbstbestimmung und zugleich Geltungserklärung, weil durch ihn die jeweilige Regel in Geltung gesetzt wird.45 Das Legitimationsideal individueller Zustimmung taugt allein jedoch nicht zur Legitimation sämtlicher privater Regeln. Bei einzelnen privaten Regeln ist die Zustimmung nämlich entweder zumindest „verdünnt“46 oder es fehlt ganz an einem Akt individueller Zustimmung. Verdünnt ist die Zustimmung etwa dann, wenn die Regelsetzung nicht auf Augenhöhe abläuft, weil beispielsweise eine Partei einen Informationsvorsprung für sich verbuchen kann oder eine sonstige asymmetrische Verhandlungsmacht besteht. So dürfte ein Verbraucher Allgemeine Geschäftsbedingungen in der Regel schon aus Praktikabilitätsgründen großzügig akzeptieren, ohne diese inhaltlich zu erfassen oder gar auf den Prüfstand zu stellen. Ebenso mag sich der Vertragspartner eines Monopolisten mitunter gezwungen sehen, dessen Vertragskonditionen anzunehmen. b) Fehlende Zustimmung Gänzlich fehlen kann die individuelle Zustimmung des Regelunterworfenen bei Mehrheitsbeschlüssen im Verbandsrecht sowie bei den Regeln eines Tarifvertrags oder einer Betriebsvereinbarung. Hier ist es den privaten Regelsetzern möglich, unmittelbar rechtsverbindliche Regeln auch ohne oder gegen den Willen der Regeladressaten zu formulieren.47 Es ist in diesen Fällen nicht gewährleistet, dass der spätere Adressat der Regel diese bei der Abstimmung im Verbandsrecht selbst mitgetragen48 bzw. als Mitglied der Tarifvertragsparteien bzw. des Betriebsrats inhaltlich mitbestimmt oder zumindest abgesegnet hat. Ein Akt individueller Zustimmung ist auch dort nicht gegeben, wo einer Person durch den Inhaber eines absoluten subjektiven Rechts ein Handeln, Dulden oder Unterlassen aufgegeben wird, etwa in der Form, sich bei der Nutzung des Grundstücks des Berechtigten an bestimmte Nutzungsregeln zu halten. Die Bindung an rung, gerichtet auf die Hervorbringung eines rechtlichen Erfolges, der nach der Rechtsordnung deswegen eintritt, weil er gewollt ist.“ 45 Vgl. Flume, Das Rechtsgeschäft, S. 57; Singer, Selbstbestimmung, S. 6; Wolf/Neuner, BGB AT, § 30 Rn. 6. 46 Begrifflichkeit nach Bachmann, Private Ordnung, S. 206, der sich wiederum anlehnt an L. Raiser, in: FS 100 Jahre DJT, S. 101, 126: Zone verdünnter Freiheit; ebenfalls L. Raiser zitierend Möslein, in: Möslein (Hrsg.), Private Macht, S. 1, 8; ähnlich auch H. Hanau, Verhältnismäßigkeit als Schranke privater Gestaltungsmacht, S. 78 f.; ders., in: Möslein (Hrsg.), Private Macht, S. 119, 132 f.: Vertraglicher Bindungswille ist gleichsam „ausgedünnt“. 47 Bachmann, Jb.J.ZivRWiss. 2002, S. 9, 17. 48 Aus diesem Grund hat der von v. Gierke, Deutsches Privatrecht, Bd. 1, S. 120, 142 ff. entwickelte Gedanke einer originären Verbandsautonomie zu Recht keine Anerkennung gefunden; wie hier Bachmann, Private Ordnung, S. 182; ders., in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 207, 216; Versuch der Wiederbelebung des v. Gierk’schen Autonomiegedankens bei Kähler, in: G.-P. Calliess/Mahlmann (Hrsg.), Der Staat der Zukunft, S. 69 ff.
134
3. Teil: Legitimation privater Regeln
die Nutzungsregeln ergibt sich hier unmittelbar aus dem dem Berechtigten zustehenden absoluten subjektiven Recht. Ebenso fehlt ein Akt individueller Zustimmung dort, wo die Rechtsordnung eine Regelbindung über das Vertrauensprinzip generiert.49 Das Vertrauensprinzip basiert auf der Einsicht, dass ein friedliches und gedeihliches Zusammenleben von Menschen in einer Gemeinschaft nur möglich ist, wenn entgegengebrachtes Vertrauen zumindest im Allgemeinen nicht enttäuscht, sondern bestätigt wird.50 Ein derartiger Vertrauenstatbestand wird von der Rechtsordnung nicht nur dann bejaht, wenn eine entsprechende rechtsgeschäftliche Erklärung abgegeben wurde, sondern mitunter auch dann, wenn der bloße Anschein des Vorliegens einer solchen Erklärung zurechenbar gesetzt wurde. Der bloße Anschein einer erteilten Zustimmung kann also eine rechtliche Bindungswirkung begründen.51 Mitunter findet dieser Grundsatz eine gesetzliche Ausprägung. So ordnen etwa die §§ 116, 170 ff., 179, 409 und 661a BGB eine rechtsgeschäftliche Bindung trotz entgegenstehenden Willens explizit an. Eine zustimmungsfreie Regelbindung kann sich zudem dort ergeben, wo mit Verweis auf den Gleichbehandlungsgrundsatz rechtlich bindende Regeln aufgestellt werden, wie es namentlich im Arbeits-, Kartell- und Gesellschaftsrecht der Fall ist.52 So darf sich etwa der Arbeitgeber, der die private Internetnutzung seitens seiner Arbeitnehmer duldet, nicht gegenüber einzelnen Arbeitnehmern ohne sachlichen Grund anders verhalten und ihnen dies untersagen.53 Stets fehlt ein individueller Zustimmungsakt schließlich bei den mittelbar verbindlichen Regelwerken. Diese zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie von einem externen Regelsetzungsgremium erarbeitet und von den Gerichten alsdann in einer für die Parteien des Rechtsstreits rechtsverbindlichen Art und Weise bei der Rechtsfindung herangezogen werden. So werden beispielsweise die DIN-Normen vom DIN aufgestellt. Der Einzelne muss die DIN-Normen dann aber etwa bei der Beurteilung, ob sein Werk i.S.d. § 633 Abs. 1 BGB mangelhaft ist oder er schuldhaft i.S.d. § 276 Abs. 1 BGB gehandelt hat, gegen sich gelten lassen, weil das Gericht diese bei der Konkretisierung als maßgebliche Entscheidungshilfe beachtet. c) Schlussfolgerungen Die obigen Ausführungen zeigen, dass das Legitimationsideal der Zustimmung des einzelnen Regelunterworfenen für sich genommen nicht ausreichen kann, um die Rechtswirkungen sämtlicher privater Regeln zu legitimieren. Dort, wo die in49 Umfassend zum Vertrauensprinzip Canaris, Die Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht, passim. 50 Larenz, BGB AT, § 2 IV (S. 43). 51 Ausführlich dazu Bachmann, Private Ordnung, S. 241 ff. 52 Bachmann, Private Ordnung, S. 256 f. 53 Dem Arbeitgeber steht es aber grundsätzlich frei, seine Praxis für die Zukunft zu ändern, vgl. Bachmann, Private Ordnung, S. 257.
§ 10 Legitimationselemente
135
dividuelle Zustimmung verdünnt ist oder sogar gänzlich fehlt, bedarf es anderer oder zumindest ergänzender Gesichtspunkte, die die Rechtswirkungen rechtfertigen.
IV. Vertragstheorien als Legitimationswegweiser? 1. Konsens als Legitimation Weiterführende Erkenntnisse könnten die vertragstheoretischen Ansätze der Staatstheorie liefern.54 Die Staatstheorie beschäftigt sich u.a. mit der Frage, ob und wie staatliche Ordnungen als solche gerechtfertigt werden können,55 die als Systeme von Zwangsnormen die Freiheiten ihrer Bürger begrenzen und ihnen zahlreiche Verhaltenspflichten auferlegen.56 Die vertragstheoretischen Ansätze der Staatstheorie haben ihre Wurzeln in der Antike und erlebten ihren Höhepunkt mit den prominenten Vertretern Hobbes, Locke, Rousseau und Kant während der Aufklärung. In neuerer Zeit wurden sie insbesondere durch Rawls’ „Theorie der Gerechtigkeit“57 aus dem Jahr 1971 wiederbelebt.58 Die vertragstheoretischen Ansätze der Staatstheorie basieren auf der Idee, dass sich die Herrschaftsordnung durch einen Konsens der Unterworfenen legitimiert („volenti non fit iniuria“).59 Im Ausgangspunkt liegt ihnen die Vorstellung eines Zustands vorgesellschaftlicher oder vorpolitischer Existenz zugrunde (sog. Naturoder Urzustand), in dem freie Personen ohne staatliche Ordnung zusammenleben. In diesem sog. Naturzustand, in dem jeder grundsätzlich ein „Recht auf alles“ hat, komme es in Anbetracht konkurrierender Bedürfnisse und Triebe, Güterknappheit und Wachstumsgrenzen etc. zu Konflikten, die unter Naturzustandsbedingungen selbst nicht gelöst werden könnten. Das „Recht auf alles“ erweise sich als wertlos.60 Um die Probleme des Naturzustands zu lösen und somit eine Besserstellung für jeden Einzelnen zu erreichen, schlössen sich die Menschen aus vernünftigem Eigeninteresse durch eine vertragliche Übereinkunft freiwillig zu einem politischen Gemeinwesen zusammen. Die durch diesen Gesellschaftsvertrag errichtete OrdEntsprechende Überlegungen schon bei Bachmann, Private Ordnung, S. 163 ff. den verschiedenen Ebenen staatlicher Herrschaft vgl. Bachmann, Private Ordnung, S. 164. 56 Vgl. statt aller Engländer, Jura 2002, 381. 57 Rawls, A Theory of Justice, passim; vgl. ferner aus neuerer Zeit Buchanan, Die Grenzen der Freiheit, passim; Nozick, Anarchy, State, and Utopia, passim. 58 Erschöpfende Darstellung sämtlicher Vertreter der Vertragstheorie bei Kersting, Die politische Philosophie des Gesellschaftsvertrags, passim; vgl. ferner Engländer, Jura 2002, 381, 382 ff.; Hofmann, Staatsphilosophie, S. 60 ff.; Jellinek, Allgemeine Staatslehre, S. 201 ff. 59 Zum Begriff „Konsens“ vgl. Schwan, in: Staatslexikon, Art. Konsens, Sp. 633. 60 Zusammenfassend Höffe/Hollerbach/Kerber, in: Staatslexikon, Art. Gerechtigkeit, Sp. 896. 54
55 Zu
136
3. Teil: Legitimation privater Regeln
nung legitimiere sich daraus, dass sie die Mängel des Naturzustands beseitige und auf einer freiwilligen Selbstverpflichtung der Bürger beruhe.61 2. Kritik und fehlende Tragfähigkeit zur Legitimation privater Regeln Der Gedanke, dass sich die Menschen durch einen Gesellschaftsvertrag selbst eine Ordnung geben, an die sie alsdann auch gebunden sind, was sich wiederum daraus legitimiere, dass die Herrschaftsordnung von den Unterworfenen konsentiert wurde und damit ihrem Willen entspreche, bringt für die Legitimation (privater) Regeln jedoch keine Erkenntnisgewinne. Versteht man den vorausgesetzten Konsens im Sinne allseitiger Zustimmung, deckt er sich mit dem Legitimationsideal der Zustimmung und ist für die Legitimation von Regeln nicht weiterführend. Insoweit sind die Vertragstheorien auch zu Recht als realitätsfern gescholten worden, weil es keinen Staat gibt, dessen Gründung tatsächlich auf einer vertraglichen Übereinkunft seiner Bürger basiert.62 Selbst wenn dies angenommen würde, bliebe unerklärlich, wie hierdurch die nachfolgenden Generationen an den Vertrag gebunden werden könnten.63 Jedenfalls kann nicht unterstellt werden, dass die Bürger dadurch, dass sie in einem Staat leben und dort verbleiben, konkludent dem ursprünglichen Vertrag zustimmen.64 Diese Kritik ließe sich nur dadurch umgehen, dass man die Anforderungen an den tatsächlichen Konsens reduziert und ihn als bloßen Grundkonsens versteht,65 der sich auf die Regeln der Konfliktbewältigung sowie die Grundwerte des menschlichen Zusammenlebens wie die Achtung der Menschenwürde, Freiheit,
61 Innerhalb der Vertragstheorien ist umstritten, ob die Zustimmung tatsächlich erklärt oder lediglich hypothetisch anzunehmen ist, vgl. Engländer, Jura 2002, 381, 386. 62 Die bedeutendste Kritik kam von dem Philosophen Hume (1711 – 1776) in seinem Aufsatz „Of the Original Contract“, vgl. Hume, in: David Hume, Politische und ökonomische Essays, 301, 304 ff.; ders., in: Hoerster (Hrsg.), Klassische Texte der Staatsphilosophie, S. 163 ff.; kritisch ferner Dworkin, Bürgerrechte ernstgenommen, S. 253 ff.; Engländer, Jura 2002, 381, 385 f. 63 Hume, in: David Hume, Politische und ökonomische Essays, S. 301, 306; ders., in: Hoerster (Hrsg.), Klassische Texte der Staatsphilosophie, S. 163, 174; beipflichtend etwa Höffe, Politische Gerechtigkeit, S. 444; kritisch ferner Burckhardt, Die Organisation der Rechtsgemeinschaft, S. 143 ff.; Jellinek, Allgemeine Staatslehre, S. 216 f.; Röhl/Röhl, Allgemeine Rechtslehre, S. 321. 64 So bereits Hume, in: David Hume, Politische und ökonomische Essays, S. 301, 311 f.; hingegen für die Idee eines konkludenten Gesellschaftsvertrags etwa Ballestrem, in: Kern/ Müller (Hrsg.), Gerechtigkeit, Diskurs oder Markt?, S. 35, 39 ff.; Cornides, ARSP-Beiheft 13 (1980), 36 ff.; Eschenburg, in: Dettling (Hrsg.), Die Zähmung des Leviathan, S. 21, 34 ff. 65 Vgl. Bachmann, Private Ordnung, S. 165 ff.; zur Erhaltung und Stiftung von Grundkonsens durch das Bundesverfassungsgericht vgl. Bumke, in: Schuppert/Bumke (Hrsg.), Grundkonsens, S. 197 ff.; Starck, in: FS 50 Jahre BVerfG, S. 1, 25 ff.
§ 10 Legitimationselemente
137
Gerechtigkeit, Solidarität und Frieden beschränkt.66 Doch auch dann lässt sich aus der Idee des Konsenses für die Legitimation von Regeln nichts gewinnen. Denn dann geht es nur noch um eine durchschnittliche Akzeptanz der Ordnung. Ein allseitiges Einverständnis wird nicht mehr verlangt, sodass das verbleibende konsensbasierte Modell letztlich wieder eine Antwort darauf schuldig bleibt, warum derjenige, der sich tatsächlich nicht für die Ordnung ausgesprochen hat, dennoch an sie gebunden sein soll.67
V. Legitimation durch ökonomischen Nutzen 1. Theoretische Grundlagen Teilweise wird angedacht, die rechtliche Bindung an private Regeln mithilfe ökonomischer Überlegungen zu legitimieren.68 Die Idee, ökonomische Überlegungen in die Analyse des Rechts mit einfließen zu lassen, hat ihre Wurzeln als sog. Economic Analysis of Law bzw. Law and Economics im angloamerikanischen Rechtsraum und ist dort zu einer bedeutenden Forschungsrichtung avanciert.69 Auch innerhalb der deutschen Rechtswissenschaft findet dieser Forschungsansatz unter dem Stichwort ökonomische Analyse des Rechts bzw. ökonomische Theorie des Rechts zunehmend Verbreitung.70 Bei der ökonomischen Analyse des Rechts handelt es sich um einen wohlfahrtsökonomisch ausgerichteten Ansatz.71 Er untersucht die Folgen, die rechtliche Regeln auslösen (positive Fragestellung) und bewertet sie danach, ob sie dem ökonomischen Effizienzziel genügen (normative Fragestellung).72 Schlussendlich müssten Regeln so beschaffen sein, dass sie die Effizienz befördern. Zur Ermitt66 Vgl. Schwan, in: Staatslexikon, Art. Konsens, Sp. 633; bezogen auf den „Verfassungskonsens“ vgl. Grimm, Die Zukunft der Verfassung, S. 15 ff. 67 So treffend Bachmann, Private Ordnung, S. 178, 190; ders., in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 207, 219; eine bloße Konsensfähigkeit als ausreichend erachtend etwa Brennan/Buchanan, Die Begründung von Regeln, S. 37 ff., 139 ff.; Eidenmüller, Effizienz als Rechtsprinzip, S. 374; Kirchner, Ökonomische Theorie des Rechts, S. 20, 27 f. 68 Bumke/Röthel, in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 1, 15; vgl. auch Bachmann, Private Ordnung, S. 174 ff., der das Prinzip der Selbstbestimmung u.a. mithilfe des wohlfahrtsökonomischen Gedankens der Präferenzautonomie begründet; näher Schäfer/ C. Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, S. 3 ff. 69 Ausführlich dazu F. Müller, in: Buckel/Christensen/Fischer-Lescano (Hrsg.), Neuere Theorien des Rechts, S. 323 f.; Schanze, in: Assmann/Kirchner/Schanze (Hrsg.), Ökonomische Analyse des Rechts in den USA, S. 1, 2 ff. 70 Vgl. etwa Adams, Ökonomische Theorie des Rechts, passim; Eidenmüller, Effizienz als Rechtsprinzip, passim; Schäfer/C. Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, passim; zur begrifflichen Unterscheidung vgl. Kirchner, Ökonomische Theorie des Rechts, S. 5 f. 71 Eidenmüller, Effizienz als Rechtsprinzip, S. 5, 41 ff. 72 Vgl. Eidenmüller, Effizienz als Rechtsprinzip, S. 21.
138
3. Teil: Legitimation privater Regeln
lung der Folgen, die rechtliche Regeln auslösen, bedient man sich methodisch des sog. ökonomischen Verhaltensmodells, das seine Wurzeln im Utilitarismus (sog. Glückseligkeitslehre) hat73 und davon ausgeht, dass jedes Individuum seine Entscheidungen rational nach Kosten- und Nutzenaspekten und am Eigennutz orientiert mit dem Ziel der individuellen Nutzenmaximierung trifft (sog. homo oeconomicus).74 Denn angesichts begrenzter Ressourcen entwickle jedes Individuum Präferenzen und wähle die Handlungsalternative, die seinen persönlichen Bedürfnissen entsprechend für ihn am vorteilhaftesten ist.75 Um zu bewerten, ob eine Regel dem ökonomischen Effizienzziel genügt, wird auf wohlfahrtsökonomische Effizienzkriterien zurückgegriffen und untersucht, ob die durch Regeln ausgelösten Folgen einem in bestimmter Weise definierten wohlfahrtsökonomischen Effizienzziel gerecht werden.76 Unter Effizienz wird dabei in der Regel die sog. Pareto-Effizienz oder die Effizienz im Sinne von Kaldor-Hicks verstanden. Nach dem Pareto-Prinzip ist ein gesellschaftlicher Zustand X besser als ein Zustand Y, wenn mindestens ein Individuum X vorzieht und keines Y präferiert.77 Weil das Pareto-Prinzip dem Einzelnen ein Veto-Recht gibt, ihn belastende Maßnahmen zu verhindern, bleibt sein Anwendungsbereich freilich schmal.78 Zumeist bedient man sich daher des Kaldor-Hicks-Prinzips, das einen simplen Kosten-Nutzen-Vergleich anstellt.79 Nach diesem ist ein Zustand auch dann effizient (X besser als Y), wenn einige dabei schlechtergestellt sind. Voraussetzung ist aber, dass die Bessergestellten die Nachteile der Schlechtergestellten ausgleichen könnten; eine tatsächliche Kompensation wird aber nicht verlangt.80
Ausführlich dazu Eidenmüller, Effizienz als Rechtsprinzip, S. 21 ff. Eidenmüller, Effizienz als Rechtsprinzip, S. 28 ff.; ders., JZ 2005, 216, 217 ff.; Kirchgässner, JZ 1991, 104, 106 ff.; Kirchner, Ökonomische Theorie des Rechts, S. 11 ff.; Mathis, Effizienz statt Gerechtigkeit?, S. 21 ff.; kritisch etwa Fezer, JZ 1986, 817, 822; Rittner, JZ 2005, 668, 669. Eidenmüller, JZ 2005, 216, 221 ff., hält demgegenüber eine Anpassung durch die Integration neuerer kognitionspsychologischer Erkenntnisse für sachgerecht. 75 Kirchgässner, JZ 1991, 104, 106; F. Müller, in: Buckel/Christensen/Fischer-Lescano (Hrsg.), Neuere Theorien des Rechts, S. 323, 330; Poelzig, Normdurchsetzung durch Privatrecht, S. 364 f.; Schwintowski, JZ 1998, 581, 584. 76 Eidenmüller, Effizienz als Rechtsprinzip, S. 41 ff. 77 Vgl. dazu Eidenmüller, Effizienz als Rechtsprinzip, S. 48 ff.; Schäfer/C. Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, S. 13 f. 78 Eidenmüller, Effizienz als Rechtsprinzip, S. 49. 79 Dieses geht auf die Arbeiten der Ökonomen Kaldor und Hicks zurück, vgl. Kaldor, Econ. J. 49 (1939) 549 ff.; Hicks, Econ. J. 49 (1939), 696 ff. 80 Vgl. Eidenmüller, Effizienz als Rechtsprinzip, S. 51 ff.; Mathis, Effizienz statt Gerechtigkeit?, S. 56 ff.; Möllers, AcP 208 (2008), 1, 10; F. Müller, in: Buckel/Christensen/ Fischer-Lescano (Hrsg.), Neuere Theorien des Rechts, S. 323, 328 f. 73
74 Umfassend
§ 10 Legitimationselemente
139
2. Durchgreifende Einwände Der Idee, die Effizienz einer Regel – neben ihrem ordnungsgemäßen Zustandekommen – zu ihrer Rechtfertigung heranzuziehen, stehen durchgreifende Bedenken entgegen. Zwar verspricht ein ökonomischer Ansatz, komplizierteste Wertekonflikte auf eine einfache Rechnung herunterbrechen zu können.81 Dies begründet aber die Gefahr, dass andere als maßgebend zu erachtende Parameter missachtet werden, wie namentlich ethische Werte und insbesondere die grundrechtlich verbürgten Freiheiten des Einzelnen.82 Es kommt zu einem Aufeinanderprallen der Disziplinen Recht und Ökonomik. So kann beispielweise eine Güterverteilung, bei der einem Individuum alles und vielen nichts zuteil wird, aus ökonomischer Perspektive effizient und sinnvoll sein, sie kann den Einzelnen aber zugleich über Gebühr benachteiligen. In derartigen Fällen darf das Spannungsfeld zwischen Recht und Ökonomik nicht einseitig zugunsten der Ökonomik aufgelöst werden.83 Die Ökonomik kann insofern allenfalls Beachtung finden, als die Effizienz in der Rechtswissenschaft als ein Wertungskriterium unter vielen anerkannt wird. Im Rahmen der Legitimation privater Regelsetzung können ökonomische Argumente mithin aufgrund ihres freiheitsgefährdenden Charakters lediglich eine untergeordnete Rolle spielen.
VI. Kombinatorisches Legitimationsmodell 1. Zustimmung und Gemeinwohl als Teile eines beweglichen Systems Bachmann hat in seiner Habilitationsschrift „Private Ordnung“ ein kombinatorisches Legitimationsmodell vorgestellt, das auf einem ordnungsethischen bzw. -ökonomischen Ansatz auf baut, wonach sich Kooperation langfristig gesehen zum Vorteil aller Beteiligten auswirken soll.84 Er geht davon aus, dass den Ausgangspunkt der Legitimation das Element der Zustimmung bilde, wonach jeder selbst über die für ihn vorteilhaften Angelegenheiten entscheiden kann. Dort, wo die Zustimmung verdünnt sei oder fehle, müsse die Legitimation privater Regeln mithilfe des aus dem öffentlichen Recht bekannten Gemeinwohlgedankens geleistet werden, der dafür sorge, dass die Regeln für die Beteiligten Bumke/Röthel, in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 1, 15. Bydlinski, Fundamentale Rechtsgrundsätze, S. 285 ff.; sehr kritisch daher Fezer, JZ 1986, 817, 823; ders., JZ 1988, 223, 226 ff. 83 Gegen eine absolute Geltung der Ökonomik auch Eidenmüller, Effizienz als Rechts prinzip, S. 455 f., 480 ff.: Grundrechte als Grenze effizienten Rechts; für eine Güterabwägung Mathis, Effizienz statt Gerechtigkeit?, S. 232; Möllers, AcP 208 (2008), 1, 6; F. Müller, in: Buckel/Christensen/Fischer-Lescano (Hrsg.), Neuere Theorien des Rechts, S. 323, 343: Im Kollisionsfall muss die Ökonomik hinter dem Recht zurückstehen; C. Ott/Schäfer, JZ 1988, 213, 214 f., 221 f.: In Fällen extrem ungleicher Verteilung muss das Kriterium der Verteilungsgerechtigkeit neben das Effizienzziel treten. 84 Vgl. Bachmann, Private Ordnung, S. 15 f., 170 f. m.w.N. 81 Vgl.
82 Vgl.
140
3. Teil: Legitimation privater Regeln
von Vorteil seien.85 Je schwächer das eine Legitimationselement ausgeprägt sei, umso notwendiger sei der Ausgleich durch das andere Legitimationselement und umgekehrt.86 Zur Begründung verweist Bachmann auf die Rechtslage im öffentlichen Recht. Die demokratische Legitimation, der staatliche Regeln unterfielen, setze sich letztendlich aus den beiden Elementen Zustimmung und Gemeinwohl zusammen.87 Auf das Element der Zustimmung werde insoweit zurückgegriffen, als zwar nicht die Zustimmung aller, aber zumindest die der Mehrheit der Regelunterworfenen verlangt werde.88 Da staatliche Regeln niemals die Zustimmung aller Regelunterworfenen erhielten, weil sie bestimmte Personen begünstigten, andere benachteiligten, spiele für die Legitimation daneben der Gemeinwohlgedanke eine wichtige Rolle.89 Die verlässliche Geltung von Regeln schaffe eine Ordnung, die insgesamt gesehen auch dann die Wohlfahrt fördere, wenn Einzelne mit ihnen nicht einverstanden seien oder dadurch Nachteile erlitten.90 Voraussetzung sei freilich, dass ein gewis85 Vgl. Bachmann, Private Ordnung, S. 193 ff.; ders., in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 207, 220 ff. Ein kombiniertes Legitimationsmodell schlagen aus staatsrechtlicher Sicht auch Dederer, Korporative Staatsgewalt, S. 156 ff. und Herbst, Legitimation durch Verfassungsgebung, S. 98 ff. vor. Dederer differenziert zwischen „formeller“ und „materieller“ Legitimität. Formelle Legitimität äußere sich in legaler und legitimer Herrschaft, materielle Legitimität in der Verwirklichung des Gemeinwohls. Herbst arbeitet als Legitimationselemente die „kollektive Autonomie“ (verstanden als tatsächliche Zustimmung), „dauerhafte Konsensfähigkeit“ und „Freiheitssicherung“ (verstanden als wechselseitiger Vorteil) heraus. Für eine Legitimation, die sich aus einer staatlichen Ermächtigung und einem freiwilligen Unterwerfungsakt (privatautonomes Element) zusammensetzt, Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 227 f.; ähnlich Buck-Heeb/Dieckmann, Selbstregulierung im Privatrecht, S. 261: Bindung an Regeln kraft Zustimmung oder staatlichen Geltungsbefehls. Worauf letztendlich der staatliche Geltungsbefehl beruht, wird hier aber nicht hinterfragt. 86 So Bachmann, Private Ordnung, S. 194 ff.; ders., in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 207, 221 rekurrierend auf die Idee des beweglichen Systems von Wilburg; vgl. dazu Wilburg, Entwicklung eines beweglichen Systems im Bürgerlichen Recht, S. 11 ff. 87 Vgl. Bachmann, Private Ordnung, S. 186 f.; ders., in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 207, 222. 88 Vgl. Bachmann, Private Ordnung, S. 186; ders., in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 207, 222. 89 Bachmann, Private Ordnung, S. 186 f.; ders., in Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 207, 221. 90 Vgl. zu diesem Gemeinwohlverständnis bezogen auf die Rechtfertigung von „Staat“ im Allgemeinen Bachmann, Private Ordnung, S. 168 ff.; ders., in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 207, 221. Allgemein zum Gemeinwohlbegriff bzw. zu Versuchen, ihm Konturen zu verleihen, vgl. Isensee, in: Isensee/P. Kirchhof (Hrsg.), HStR, Bd. IV, § 71 Rn. 1 ff.; Schuppert, in: Schuppert/Neidhardt (Hrsg.), Gemeinwohl – Auf der Suche nach Substanz, S. 19 ff.; siehe auch BVerfGE 5, 85, 198: Gemeinwohl als annähernd gleichmäßige Förderung des Wohls aller Bürger und annähernd gleichmäßige Verteilung der Lasten; ausführlich auch die interdisziplinären Beiträge in: Münkler (Hrsg. u.a.), Gemeinwohl und Gemeinsinn (4 Bände), 2001 – 2002, insbesondere Bd. 3, „Gemeinwohl und Gemeinsinn im Recht“; zu Vorbehalten gegenüber dem Gemeinwohlbegriff und ihrer Entkräftung etwa
§ 10 Legitimationselemente
141
ser Ausbeutungsschutz gewährleistet sei, der zum Ausdruck komme in Form von Neutralität, Selbstlosigkeit, zeitlicher und sachlicher Begrenzung der Herrschaft, klaren Kompetenz- und Verfahrensvorgaben und einem Minimum an Kontrolle und Transparenz.91 Konkret komme das Gemeinwohl insoweit zum Tragen, als durch die Zuständigkeit eines nach allgemeinem Wahlrecht für eine begrenzte Zeit demokratisch gewählten Parlaments, das im Mehrheitsverfahren entscheidet, sichergestellt sei, dass der Gesetzesinhalt mit dem überwiegenden Interesse der Regeladressaten übereinstimme.92 Konstitutiv wirkende Publizitätsakte sorgten für Transparenz. Kontrolle sei insbesondere durch die Gewaltenteilung und Revisibilität der Regeln gewährleistet. Die Legitimation privater Regeln müsse letztlich nach dem gleichen Muster ablaufen. Statt von Gemeinwohl sei aber von Gruppenwohl zu sprechen, da der Kreis der von den Regeln Betroffenen im Zivilrecht anders als im öffentlichen Recht der Sache nach begrenzt sei.93 Wie der Gemeinwohlgedanke sei auch der Gruppenwohlgedanke im Sinne eines Ausbeutungsverbots zu verstehen94 und namentlich etwa durch Transparenz und eine richterliche Inhaltskontrolle verbürgt.95 2. Würdigung Bachmanns zweidimensionales Legitimationskonzept bringt insoweit einen großen Erkenntnisfortschritt, als es durch die Kombination der Legitimationselemente Zustimmung und Gruppenwohl einen Weg weist, sämtliche Ausprägungen privater Regeln zu legitimieren. Auch hat sein Konzept gegenüber der ökonomischen Analyse des Rechts, die Normen ausschließlich am Kriterium gesamtwirtschaftlicher Effizienz misst, den Vorzug, dass es auf den Vorteil aller Beteiligten bedacht ist und damit auch für unverzichtbare (Grund-)Rechte offen ist.96 Das Gemeinwohl bzw. Gruppenwohl als ziviles Legitimationselement aufzugreifen erscheint mit Blick auf die Selbstbestimmungsfreiheit des Einzelnen als v. Arnim, Gemeinwohl und Gruppeninteressen, S. 5 ff. m.w.N. Dem Gemeinwohl steht das Partikularwohl als die Interessen der Einzelnen und der Gruppen verkörpernd gegenüber, ohne dass zwischen diesen ein unüberbrückbarer Gegensatz besteht, vgl. dazu Isensee, in: Isensee/P. Kirchhof (Hrsg.), HStR, Bd. IV, § 71 Rn. 35 ff. 91 Bachmann, Private Ordnung, S. 171 f.; ders., in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 207, 221. 92 Bachmann, Private Ordnung, S. 196 ff. 93 Bachmann, Private Ordnung, S. 206; ders., in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 207, 223. 94 Bachmann, Private Ordnung, S. 206, 212; ders., in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 207, 223. 95 Bachmann, Private Ordnung, S. 328 und 207 (bezogen auf das Verbandsrecht); ders., in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 207, 223. 96 So zu Recht Bachmann, Private Ordnung, S. 16, 171; allgemein zum Regelutilitarismus Höffe (Hrsg.), Einführung in die utilitaristische Ethik, S. 28 ff.
142
3. Teil: Legitimation privater Regeln
Leitmaxime des Privatrechts jedoch bedenklich. Auch Bachmann erkennt diese Problematik, hätten doch kollektivistische Rechtslehren im 20. Jahrhundert in der Tradition v. Gierkes die „Gliedstellung“ des Einzelnen in der „Gemeinschaft“ hervorgehoben, um subjektive Rechte einzudämmen.97 Mit seinem Legitimationsmodell solle aber nicht die Freiheit des Einzelnen ungewünschten Gruppenzwängen zum Opfer fallen, sondern die Bedeutung des Wohls der Regeladressaten als Maßstab privater Regelsetzung betont werden.98 Den Privaten werde durch das Privatrecht und seine Institute ermöglicht, neben dem trivialen Handtausch freiwillig hierarchische Sozialstrukturen aufzubauen, wodurch sich wohlfahrts- und freiheitsfördernde Kooperationsgewinne einstellten.99 Dies ist zwar zutreffend. Bachmanns (regel-)utilitaristischer Ansatz bringt es aber mit sich, dass allein der höhere Gesamtertrag es rechtfertigen kann, die fehlende Zustimmung des Einzelnen zu ignorieren. Das Bild von Nettoverlierern, um den Gesamtnutzen zu erhöhen, steht zum Selbstverständnis des Privatrechts, das von einer Gleichberechtigung der Individuen ausgeht, jedoch in gewissem Widerspruch. Das Gruppenwohl, gesehen als langfristige Vorteilhaftigkeit von Kooperation, ist für den Einzelnen auch ein sehr abstraktes und nicht immer nachvollziehbares Fernziel. Insbesondere dürften Menschen nicht nur Präferenzen für materielle oder immaterielle Güter haben, sondern auch Wert darauf legen, in welchem Verfahren, nach welchen Kriterien und letztlich wie die Güter verteilt werden.100 Verfahrens- und Gerechtigkeitsaspekte sollen im Modell Bachmanns aber gerade als eigenständige Legitimationspfeiler unberücksichtigt bleiben;101 lediglich mit seinem Verständnis des Gruppenwohls im Sinne eines Ausbeutungsverbots nimmt er ein Gerechtigkeitspostulat in sein Legitimationsmodell mit auf.102 Ausgehend von einem individualistischen Leitbild ist daher nach anderen Elementen zu suchen, die statt des von Bachmann präferierten Gruppenwohls neben bzw. an die Stelle der individuellen Zustimmung des Einzelnen treten.
Bachmann, Jb.J.ZivRWiss. 2002, S. 9, 20 mit exemplarischem Verweis auf Siebert, Verwirkung und Unzulässigkeit der Rechtsausübung, S. 156; dazu Haferkamp, Die heutige Rechtsmissbrauchslehre – Ein Ergebnis nationalsozialistischen Rechtsdenkens?, passim.; siehe auch J. Schröder, in: Nörr/Schefold/Tenbruck (Hrsg.), Geisteswissenschaften zwischen Kaiserreich und Republik, S. 335 ff. 98 Bachmann, Jb.J.ZivRWiss. 2002, S. 9, 20. 99 Bachmann, Jb.J.ZivRWiss. 2002, S. 9, 21 mit Verweis auf diese Einsichten schon bei v. Ihering, Der Zweck im Recht, Bd. 1, insbesondere S. 27 ff., 54 ff. 100 So auch Magen, in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 229, 241, 243, der seine Annahme auf empirische Untersuchungen der Verhaltensökonomie stützt; dazu ders., in: Engel u.a. (Hrsg.), Recht und Verhalten, S. 261 ff. 101 Vgl. Bachmann, Private Ordnung, S. 190 ff.; ders., in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 207, 219 f.; kritisch auch Magen, in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 229, 243 ff. 102 So auch Bachmann, Private Ordnung, S. 190. 97
§ 10 Legitimationselemente
143
VII. Legitimation durch Gerechtigkeit 1. Materielle Gerechtigkeit als Korrektiv Der Legitimationsbaustein, der einer privaten Regel anstelle oder neben der individuellen Zustimmung den Anspruch verleiht, rechtsverbindlich zu sein, könnte sein, dass die Regel gerecht ist. Denn Gerechtigkeit ist das, was als Grundnorm menschlichen Zusammenlebens betrachtet und vom Recht als Ideal angestrebt wird.103 Sie bezeichnet einen idealen Zustand des sozialen Miteinanders, in dem es einen angemessenen, unparteilichen und einforderbaren Ausgleich der Interessen und Verteilung von Gütern und Chancen zwischen den beteiligten Personen oder Gruppen gibt.104 Gegen den Versuch, die Gerechtigkeit einer Regel materiell zu bestimmen, wird eingewandt, dass dies mit hoher inhaltlicher Unsicherheit einhergehe.105 Es sei im Einzelfall kaum oder nur mit hohem Aufwand möglich, ein Testat darüber zu erstellen, ob eine Regel gerecht ist, d.h. zu einem angemessenen und unparteilichen Ausgleich der Interessen der beteiligten Personen oder Gruppen führt. Dieser Einwand ist im Kern zwar berechtigt. Allein aus der Schwierigkeit, im Einzelfall auszubuchstabieren, was gerecht ist, kann aber nicht gefolgert werden, dass die Gerechtigkeit zur Legitimation nicht herangezogen werden kann, zumal sich einzelne Prinzipien herausfiltern lassen, die der Gerechtigkeitsbegriff in sich vereint. So lässt sich ohne Umschweife auf den Gerechtigkeitsgedanken zurückführen, dass derjenige, der Zugang zu der Rechts- und Freiheitssphäre eines anderen begehrt, in Kauf nehmen muss, dass der Inhaber des absoluten subjektiven Rechts ihm dies untersagt oder als Nutzungsberechtigter die Beachtung von ihm aufgestellter Regeln verlangt, auch wenn derjenige nicht mit ihnen einverstanden ist. Ebenso lässt sich das Vertrauensprinzip als Ausformung des Gerechtigkeitsgedankens begreifen. Dem Versprechenden ist ein Berufen auf einen fehlenden Bindungswillen, d.h. auf das Fehlen der individuell erteilten Zustimmung dort versagt, wo er das schutzwürdige Vertrauen Dritter in zurechenbarer Weise missbraucht.106 Er hat in diesen Fällen die Verantwortung für sein Handeln selbst zu tragen.107 Ausgehend von der verbreiteten Erkenntnis, dass die Gerechtigkeit die Gleichheit mit einschließt,108 lässt Larenz, Richtiges Recht, S. 33; Radbruch, Rechtsphilosophie, S. 34 f. zum Begriff der Gerechtigkeit Höffe/Hollerbach/Kerber, in: Staatslexikon, Art. Gerechtigkeit, Sp. 895 ff.; Kaufmann, Grundprobleme der Rechtsphilosophie, S. 141: Gerechtigkeit ist Gleichheit, soziale Gerechtigkeit und Rechtsfriede; Koller, Theorie des Rechts, S. 295 ff. 105 Vgl. Bachmann, in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 207, 219. 106 Monografisch Canaris, Die Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht. 107 Zum Gedanken der Selbstverantwortung, der u.a. der Vertrauenshaftung zugrunde liegt, vgl. Larenz/Wolf, BGB AT (2004), § 2 Rn. 23; Ohly, „Volenti non fit iniuria“, S. 77 ff.; vgl. auch Canaris, Die Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht, S. 428. 108 Vgl. etwa Koller, Theorie des Rechts, S. 296 f.; zum Gleichbehandlungsgrundsatz als normativer Geltungsgrund privater Regeln vgl. Wolf, JZ 1973, 229, 230 ff. 103
104 Umfassend
144
3. Teil: Legitimation privater Regeln
sich auch die zustimmungsfreie Regelbindung begründen, die in Einzelfällen unter Verweis auf den Gleichbehandlungsgrundsatz konstruiert wird. Abgesehen von dieser positiven Beschreibung der Gerechtigkeit dürfte es im Übrigen gelingen, Ungerechtigkeiten festzustellen und auf diese Weise unter Verweis auf das Kriterium der Gerechtigkeit einen Mindestschutz in Form eines Ausbeutungsschutzes für die Regelbetroffenen zu etablieren. Ausdruck findet der durch die Gerechtigkeit implizierte Ausbeutungsschutz in Form einer richterlichen Inhaltskontrolle etwa von Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Verbandsbeschlüssen. 2. Formelle Gerechtigkeit durch Organisation und Verfahren a) Vorüberlegungen Neben der Möglichkeit, materiell darüber zu befinden, ob eine Regel gerecht ist, kann die Gerechtigkeit von Regeln möglicherweise auch formell, d.h. durch Organisation und Verfahren gewährleistet werden,109 wobei der Begriff der Organisation Vorgaben umfasst, die auf die Zusammensetzung des regelsetzenden Gremiums Bezug nehmen („Wer?“) und der Begriff des Verfahrens Vorgaben beinhaltet, die den Regelsetzungsprozess als solchen strukturieren („Wie?“). Insbesondere im Technikrecht wird in dem Umstand, dass die Regelaufstellung organisiert und in einem festgelegten Verfahren abläuft, eine „prozedurale Richtigkeitsgewähr“ für die Regeln erblickt.110 Bachmann hat demgegenüber die Idee, Gerechtigkeit durch Organisation und Verfahren zu gewährleisten, zuletzt als wenig tauglich verworfen. Aus psychologischen, soziologischen und spieltheoretischen Untersuchungen sei zu folgern, dass Organisation und Verfahren für sich genommen die Gerechtigkeit nicht gewährleisten könnten, sondern stets in einem vorausgehenden Akt bestimmt werden müsse, was materiell gerecht sei.111 Das Verfahrensresultat werde stets davon beeinflusst, wie die Verfahrensbedingungen gesetzt würden, d.h. nach welchen Kriterien etwa die Regelsetzer ausgewählt würden oder wie der Regelsetzungsprozess im Einzelnen organisiert sei.112 Dementsprechend kämen Organisation und Verfahren nicht ohne materielle Wertungen aus. Was gerecht sei, solle ja aber gerade erst prozedural ermittelt werden, sodass ein Zirkelschluss drohe.113 109 Zu Gerechtigkeit durch Verfahren im Privatrecht und zum Zusammenhang mit der Privatautonomie Schapp, Methodenlehre des Zivilrechts, S. 10 ff., 19; allgemein dazu A. Kaufmann, Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit, passim; Tschentscher, Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit, passim. 110 Vgl. Schmidt-Preuß, in: Kloepfer (Hrsg.), Selbst-Beherrschung, S. 89, 96. 111 Vgl. Bachmann, Private Ordnung, S. 191 f.; ders., in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 207, 219. 112 Bachmann, Private Ordnung, S. 191 f. m.w.N.; Th. Raiser, Rechtssoziologie, S. 220 f. 113 So u.a. der Einwand von Bachmann, Private Ordnung, S. 191 f.; ders., in: Bumke/ Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 207, 219.
§ 10 Legitimationselemente
145
Diese Überlegungen mögen im Kern zutreffen. Gleichwohl entkräften sie die Überlegung, Gerechtigkeit durch Organisation und Verfahren herzustellen, nicht umfänglich, wenn es nur gelingt, abstrakt einen Idealzustand für die Schaffung gerechter Regeln fassbar zu machen. Diesen Idealzustand für eine die Gerechtigkeit fördernde Organisation der Regelsetzung hat Rawls im Zusammenhang mit seinen vertragstheoretischen Überlegungen zur Staatstheorie beschrieben. Rawls sieht die durch die Urzustandsakteure durch Gesellschaftsvertrag geschaffene Ordnung insbesondere dann als gerecht an, wenn sich diese bei der Ordnungsgebung in einem „Schleier des Nichtwissens“ befänden, d.h. in einem Urzustand, in dem keiner seine individuellen natürlichen Fähigkeiten, seinen gesellschaftlichen Status oder seine ökonomischen Verhältnisse kennt und daher nicht abschätzen kann, inwieweit er später möglicherweise selbst von der Regel betroffen ist.114 So sei gewährleistet, dass sich die Akteure darauf verständigten, dass jedem die gleichen Grundfreiheiten zustünden und soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten nur insoweit bestünden, als auch die Schwächsten im Vergleich zu einer strikten Gleichbehandlung davon profitierten.115 b) Organisatorische Anforderungen Dieses Idealbild versucht man heute teilweise dadurch aufrechtzuerhalten, dass den privaten Regelsetzern Distanz- und Neutralitätspflichten auferlegt werden.116 Realistischerweise wird man ihm aber lediglich insoweit entsprechen können, als eine Partizipation117 bzw. zumindest eine Interessenrepräsentanz sowie eine finanzielle Unabhängigkeit sichergestellt werden.118
114 Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, S. 159 ff.; vgl. die kritische Auseinandersetzung mit Rawls bei Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, passim; ders., Gerechtigkeit, S. 192 ff.; siehe auch Engländer, ARSP 2000, 2, 17 ff.; Fehige, in: Philosophische Gesellschaft Bad Homburg/Hinsch (Hrsg.), Zur Idee des politischen Liberalismus, S. 304, 309 ff.; Hoerster, in: Höffe (Hrsg.), Über John Rawls’ Theorie der Gerechtigkeit, S. 57 ff.; Kliemt, ARSP-Beiheft 74 (2000), 217 ff. 115 Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, S. 81 ff. 116 In diese Richtung wohl Schmidt-Aßmann, in: Hoffman-Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Auffangordnungen, S. 39; Trute, in: Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.), Verwaltungsorganisationsrecht, S. 291 f.; zu Recht kritisch Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 104: Abhängigkeit unvermeidlich, eventuell sogar ein Zeichen von Stärke; ähnlich M. Schwab, Politikberatung, S. 412. 117 Vgl. Köndgen, AcP 206 (2006), 477, 522: Legitimationsprinzip (privater Regelschöpfung) heißt Partizipation. 118 Vgl. dazu Ausgberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 102 ff.; Hommelhoff/M. Schwab, in: FS Kruse, S. 693, 700 ff.; vgl. auch BVerfGE 35, 79, 131, 138: Qualifikation, Funktion, Verantwortung und Betroffenheit; BVerwGE 107, 338, 341 f. (in Bezug auf die Schaffung normkonkretisierender Verwaltungsvorschriften): Regelsetzung muss (u.a.) in sorgfältigen Verfahren unter Einbeziehung des wissenschaftlichen und technischen Sachverstands erfolgen.
146
3. Teil: Legitimation privater Regeln
Partizipation kann in Form von echter Mitbestimmung erfolgen oder durch die namentlich im Verbandsrecht bekannten Rede-, Auskunfts-, Informations- und sonstigen Verwaltungsrechte gewährleistet sein. Äußert sich die Partizipation in echter Mitbestimmung, hat sie gegenüber der Zustimmung keinen eigenständigen Charakter. Erschöpft sie sich in den genannten sonstigen Mitbestimmungsrechten, hat sie einen gerechtigkeitsfördernden Effekt zumindest dergestalt, dass die Interessen des Partizipierenden in die Regelaufstellung mit einfließen.119 Die Interessenrepräsentanz setzt voraus, dass nach Möglichkeit jedes Interesse, das von der Regelsetzung tangiert wird, im Kreis der Regelsetzer ausgewogen vertreten ist.120 Eine einseitige Interessendominanz dergestalt, dass Belange einzelner Interessengruppen übergangen oder für geringwertig erachtet werden, weil sie im Gremium nicht oder nur unzureichend vertreten sind, muss verhindert und Minderheitenschutz dadurch befördert werden.121 Eine derart ausgewogene Gremienbesetzung kann aufgrund gesellschaftlichen Eigeninteresses von sich aus gegeben sein oder staatlicherseits durch entsprechende Beteiligungsquoten bzw. Mitwirkungs- und Teilnahmerechte hergestellt werden.122 Zugleich muss gewährleistet werden, dass die Interessen auch angemessen Berücksichtigung finden.123 Um zu verhindern, dass das regelsetzende Gremium in seiner Funktionsfähigkeit beeinträchtigt wird, dürfen die Anforderungen an die Interessenrepräsentation und deren angemessene Interessenberücksichtigung freilich nicht überspannt werden.124 Die Mitgliederzahl muss gegebenenfalls begrenzt und überschaubar bleiben. Neutralität der Regelsetzung durch finanzielle Unabhängigkeit wird gewahrt, indem die Regelsetzer nach Möglichkeit unentgeltlich tätig werden. Gerade bei den Regelwerken mit mittelbaren Rechtswirkungen wird sich eine gewisse externe Finanzierung allerdings nicht verhindern lassen. Hier dürfte allein die Infrastruktur der Regelsetzung Kosten verursachen.125 Der Schein „erkaufter“ Regelsetzung ist gleichwohl tunlichst zu vermeiden, etwa indem der Staat zumindest einen Teil der 119 A.A. Bachmann, Private Ordnung, S. 193; ders., in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 207, 219: Partizipation ist bloßes Instrument, um zu einem gemeinwohlverträglichen („richtigen“) Ergebnis zu gelangen, ohne dieses jedoch verbürgen zu können. 120 Vgl. Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 102 f.; Groß, Das Kollegialprinzip, S. 251 f.; Hommelhoff/M. Schwab, in: FS Kruse, S. 693, 700 ff. 121 Vgl. Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 103. 122 Vgl. zur Sicherstellung der Repräsentanz durch den Staat Schuppert, DV Beiheft 4 (2001), S. 201, 243 f. und zur typisierenden Ermittlung der betroffenen Interessenkreise Hommelhoff/M. Schwab, in: FS Kruse, S. 693, 701 ff. 123 Vgl. dazu Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 103. 124 Vgl. Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 107 ff., 205: Zu strenge Repräsentanz droht, die Flexibilität des Verfahrens einzuschränken, und kann zu qualitativen Einbußen führen; Bachmann, Private Ordnung, S. 374: Konsequente Repräsentanz führt zu Entscheidungsschwäche und strenge Unabhängigkeit geht oft mit einem Verlust an Sachkunde, Engagement und Verantwortlichkeit einher. 125 Hommelhoff/M. Schwab, in: FS Kruse, S. 693, 711 f.
§ 10 Legitimationselemente
147
Kosten übernimmt.126 Des Weiteren dürfen weder Sponsoren erwarten, dass ihren Interessen entsprochen wird, noch dürfen die Gremienmitglieder ihrer Arbeit eine solche Erwartung zugrunde legen.127 c) Verfahrensanforderungen Zur formellen Gerechtigkeit einer Regel kann ferner das bei der Regelsetzung zu beachtende Verfahren beitragen. Hierzu hat das Regelsetzungsverfahren möglichst transparent und öffentlich abzulaufen.128 Transparenz sollte sowohl gegenüber der interessierten Öffentlichkeit als auch gegenüber dem Staat gegeben sein. Gegenüber der Öffentlichkeit kann die Transparenz etwa dadurch gewahrt werden, dass sämtliche Entscheidungsgrundlagen, Finanzierungsmodalitäten sowie Loyalitäten der Beteiligten offengelegt werden.129 Die Regelungsentwürfe des Gremiums sind möglichst frühzeitig der interessierten oder betroffenen Öffentlichkeit bekannt zu machen; dieser ist Gelegenheit zu geben, Einwendungen zu erheben,130 es hat eine Auseinandersetzung mit ihnen stattzufinden und die endgültige Regelung ist zu begründen.131 Der Entscheidungsprozess ist ferner zu dokumentieren, insbesondere um eine rechtliche Nachprüfung zu ermöglichen.132 Schließlich sollte ein kontinuierlicher und institutionalisierter Kommunikationsprozess mit dem Staat stattfinden.133
VIII. Zusammenfassung Zu der Frage, wie sich die Rechtswirkungen privater Regeln legitimieren lassen, lässt sich Folgendes festhalten: Die Privatrechtsordnung ist vom Gedanken der Selbstbestimmungsfreiheit des Einzelnen geleitet. Ausgehend hiervon ist es zuvorderst die individuelle Zustimmung des Einzelnen, die eine rechtliche Bindung privater Regeln legitimiert. Sie ist das zivilistische Legitimationsideal. Allerdings bildet die Zustimmung nicht die einzige Determinante zur Legitimation privater Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 104. Hommelhoff/M. Schwab, in: FS Kruse, S. 693, 712. 128 Vgl. Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 104 ff.; Schuppert, DV Beiheft 4 (2001), S. 201, 244; kritisch Hopt, Kapitalanlegerschutz, S. 161: Selbstregulierung erfolgt fast nie unter den Augen der Öffentlichkeit, wie auch das Ergebnis des Selbstregulierungsverfahrens nur ausnahmsweise bekannt gemacht wird. 129 Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 105. 130 Zum Erfordernis eines Dialogs mit der Öffentlichkeit vgl. M. Schwab, Politikberatung, S. 586 f. 131 Hommelhoff/M. Schwab, in: FS Kruse, S. 693, 708; zu den Gefahren eines Zuviel an Transparenz und Öffentlichkeitsbeteiligung vgl. Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 105 m.w.N. 132 Hommelhoff/M. Schwab, in: FS Kruse, S. 693, 708. 133 Vgl. Schuppert/Bumke, in: Kleindiek/Oehler (Hrsg.), Die Zukunft des deutschen Bilanzrechts, S. 71, 123 f. 126 127
148
3. Teil: Legitimation privater Regeln
Regeln. Denn mitunter kann die individuelle Zustimmung verdünnt sein oder ganz fehlen und es kann gleichwohl ein Bedürfnis nach Rechtsverbindlichkeit bestehen. In diesen Fällen bedarf es einer Begründung der Regelbindung, die über einen rein privatautonomen Legitimationsansatz hinausgeht. Diese Begründung vermögen für sich genommen weder ökonomische Aspekte noch der Gemeinwohl- bzw. Gruppenwohlgedanke zu liefern. Grund für eine Regelbindung neben oder anstelle der individuellen Zustimmung ist vielmehr, dass die Regel gerecht ist. Trotz eventuell auftretender inhaltlicher Unsicherheiten dürfte es stets gelingen, Ungerechtigkeiten festzustellen und auf diese Weise einen Mindestschutz in Form eines Ausbeutungsschutzes für die Regelbetroffenen zu etablieren, der den unterlegenen Teil vor einer Übervorteilung schützt. Hierzu gehören namentlich der Vertrauensschutz sowie der Schutz des institutionell Unterlegenen. Daneben kann die Gerechtigkeit einer Regel prozedural gewährleistet werden, d.h. durch eine spezifische Ausgestaltung der Organisation und des Verfahrens der Regelsetzung.
§ 11 Staatliche Pflicht zur Organisation der Legitimation I. Grundrechtliche Verpflichtung zur Organisation Dafür, dass nur solche privaten Regeln Rechtswirkungen hervorrufen, die die herausgearbeiteten Legitimationselemente einhalten, hat der Staat Sorge zu tragen. Die ausgestaltungsbedürftigen (normgeprägten) Grundrechte, namentlich die Vertragsfreiheit und das Eigentumsrecht, halten den Staat zunächst dazu an, Rechtsgüter zuzuweisen und die für eine rechtsverbindliche private Regelaufstellung erforderliche Infrastruktur bereitzuhalten, innerhalb derer die Bürger die besagten Grundrechte verwirklichen können.134 Hierzu gehört vor allem, dass der Staat private Regeln mit einem Verbindlichkeitsanspruch ausstattet und damit das ihm zukommende Rechtsanerkennungsmonopol tatsächlich lebt. Kraft der Schutzfunktion der Grundrechte ist der Staat zugleich aber auch verpflichtet, durch die von ihm geschaffene Infrastruktur sicherzustellen, dass eine Bindung an private Regeln nur dort erfolgt, wo ihre Legitimation gewährleistet ist.135 Wenn der Staat privaten Regeln rechtliche Verbindlichkeit verschafft, ist er folglich zugleich in der Verantwortung, legitimatorische Sicherungen für die ein134 Vgl. Bachmann, Jb.J.ZivRWiss. 2002, S. 9, 20 f.; Ritgen, JZ 2002, 114, 116; zur „Bereitstellungsfunktion des Rechts“ vgl. Schuppert, Verwaltungswissenschaft, S. 932 f., 976; zur Normgeprägtheit bzw. Ausgestaltungsbedürftigkeit der Vertragsfreiheit vgl. BVerfGE 89, 214, 231 f.; Isensee, in: FS Großfeld, S. 485, 495 m.w.N. 135 Vgl. auch Bachmann, Jb.J.ZivRWiss. 2002, S. 9, 21; allgemein zur grundrechtlichen Schutzpflichtverantwortung des Staates vgl. BVerfGE 39, 1, 41 f.; BVerfGE 49, 89, 141 f.; BVerfGE 56, 54, 73; Canaris, AcP 184 (1984), 201, 225 ff.; Isensee, in: Isensee/P. Kirchhof (Hrsg.), HStR, Bd. V, § 111 Rn. 77 ff.; im Zusammenhang mit privaten Regeln F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 522 ff.
§ 11 Staatliche Pflicht zur Organisation der Legitimation
149
zelnen Regelbetroffenen zu installieren.136 Er ist verpflichtet, den Einzelnen vor einer nicht legitimierten Fremdbestimmung durch eine wirtschaftliche, soziale oder auch informelle Übermacht zu schützen.137 Diese Verpflichtung wird umso aktueller, je weniger der Adressat am Regelsetzungsprozess beteiligt ist und je weniger seine Interessen strukturell geschützt sind.138 In der Summe hat der Staat das Interesse an einer ungestörten Regelsetzung mit dem Interesse, keinen nicht legitimierbaren Bindungen unterworfen zu werden, in Ausgleich zu bringen (praktische Konkordanz).139 Er hat Maßnahmen zu treffen, die für alle Beteiligten eine möglichst wirksame und umfassende Grundrechtsverwirklichung bewirken,140 wobei ihm das Bundesverfassungsgericht dabei einen weiten Gestaltungs- und Beurteilungsspielraum einräumt.141 In Bezug auf die Schutzpflichterfüllung gilt insoweit ein Untermaßverbot, d.h., die staatliche Grundrechtsschutzpflicht verlangt lediglich, Extremfälle privater Knebelung zu verhindern.142 In Bezug auf die korrespondierenden Freiheiten des Regelsetzers gilt ein Übermaßverbot,143 d.h., dieser darf in seinen Gestaltungsmöglichkeiten grundsätzlich nicht in einer Weise beschränkt werden, die ihm die Möglichkeit zur Schaffung einer Ordnung nahezu umfänglich nimmt.
II. Ausgestaltung durch die drei Gewalten Erfüllen kann der Staat seine Organisationspflicht mithilfe der drei Gewalten. Zuvorderst organisiert der Staat die private Regelsetzung im Wege der Gesetzgebung.144 Dies erfolgt primär dadurch, dass der Gesetzgeber der privaten Regelsetzung Kautelen vorgibt, die entweder ganz allgemein oder in Bezug auf die konkrete Art der Regelsetzung formuliert sind. So ist in der Rechtsgeschäftslehre Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 98. Vgl. BVerfGE 81, 242, 254 ff. 138 Magen, in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 229, 238 f. 139 Vgl. auch BVerfG NJW 1994, 36, 38: Der Schutz des Schwächeren und der Ausgleich gestörter Vertragsbeziehungen stellt eine der Hauptaufgaben des heutigen Zivilrechts dar; BVerfGE 89, 214, 231 (Bürgschaftsentscheidung): Die Privatautonomie ist notwendigerweise begrenzt und bedarf der rechtlichen Ausgestaltung. Privatrechtsordnungen bestehen deshalb aus einem differenzierten System aufeinander abgestimmter Regelungen und Gestaltungsmittel; ferner Dederer, Korporative Staatsgewalt, S. 110; Ritgen, JZ 2002, 114, 116; Spieß, DVBl. 1994, 1222, 1226; zum von Konrad Hesse geprägten Begriff praktischer Konkordanz vgl. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Rn. 72, 317 f. 140 BVerfGE 97, 169, 176; BVerfGE 89, 214, 232; Ritgen, JZ 2002, 114, 116. 141 BVerfGE 97, 169, 176 f.; BVerfGE 81, 242, 255; BVerfGE 89, 214, 232 ff. 142 F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 525; Ritgen, JZ 2002, 114, 116. 143 Ritgen, JZ 2002, 114, 116; vgl. auch BVerfGE 81, 242, 261: Weder Freiheitsbeschränkung noch Freiheitsschutz dürfen in dieser Wechselbeziehung unverhältnismäßig sein. 144 Vgl. dazu F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 525. 136 Vgl. 137
150
3. Teil: Legitimation privater Regeln
zum Schutz der Regeladressaten genau geregelt, wer wann unter welchen Voraussetzungen und in welcher Form seine Zustimmung äußern und sich davon (in Form von Kündigungs-, Widerrufs- und Austrittsrechten) wieder lösen kann. Weiter soll beispielsweise § 138 BGB sozial oder wirtschaftlich Schwache oder Abhängige vor ungerechter privater Reglementierung durch Dritte bewahren, indem die Vorschrift Rechtsgeschäfte für nichtig erklärt, die gegen die guten Sitten verstoßen oder ihre Adressaten ausbeuten.145 Neben der abstrakt-generellen Regulierung durch Gesetz kann der Staat seiner Organisations- und Schutzpflicht dergestalt nachkommen, dass er private Regeln im Einzelfall einer behördlichen Rechtmäßigkeitskontrolle unterzieht.146 Dies muss nicht unbedingt als Geltungsvoraussetzung der privaten Regel ausgestaltet sein. Vielmehr kann an die behördliche Kontrolle auch ein zusätzlicher Vorteil geknüpft sein wie etwa im Vereinsrecht die Erlangung der Rechtsfähigkeit.147 Schließlich kann der Staat seine Organisationspflicht dadurch erfüllen, dass er private Regeln einer Korrektur durch die Gerichte unterwirft (richterliche Inhaltskontrolle).148 Der staatliche Schutz ist insoweit jedoch weniger stark ausgeprägt, weil die Gerichte nur zur nachträglichen Kontrolle imstande sind und eine solche auch nur auf „Rüge“ des Regelunterworfenen erfolgt, d.h., die Gerichte greifen erst korrigierend ein, wenn die private Regel bereits aufgestellt worden ist und ihre Bindungswirkung entfaltet.
§ 12 Praktische Erprobung des Legitimationsmodells I. Legitimation unmittelbarer Rechtswirkungen 1. Überblick Im Folgenden soll ein Blick darauf geworfen werden, inwieweit die im zweiten Teil der Arbeit dargestellten Regelwerke den herausgearbeiteten Anforderungen an die Legitimation der Rechtswirkungen genügen. Dieses Unterfangen dient zugleich der praktischen Erprobung des entworfenen Legitimationsmodells. Die Regelwerke der ersten Systematisierungsstufe können hier ausgeblendet bleiben. Denn diese entfalten keine rechtlichen Bindungswirkungen, die es aus rechtswissenschaftlicher Sicht zu legitimieren gäbe. Übrig bleiben die Regelwerke der zweiten und dritten Systematisierungsstufe. An dieser Stelle sollen zunächst die Regeln der dritten Systematisierungsstufe dargestellt werden. Bei diesen ist das Legitimationsideal der Zustimmung sowie dessen Zusammenspiel mit dem Legitimationselement der Gerechtigkeit besonders anschaulich ausgeprägt. F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 525. Vgl. dazu F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 525 f. 147 F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 525 f. 148 F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 526. 145
146
§ 12 Praktische Erprobung des Legitimationsmodells
151
2. Vertrag a) Zustimmung als Legitimation Zunächst ist der Blick auf den Vertrag als zweiseitig unmittelbar verbindliche Regelung zu richten. Der Vertrag stellt das Paradebeispiel für die durch Zustimmung getragene Legitimation dar. Denn um sich einer vertraglichen Bindung zu unterwerfen, bedarf es stets der beiderseitigen Zustimmung der Vertragsparteien in Form von Angebot und Annahme. Inwieweit es zur Legitimation neben der Zustimmung generell noch darauf ankommt, dass die vertraglich getroffene Regelung gerecht bzw. richtig ist, ist in den Details umstritten, mit der ganz herrschenden Meinung im Grundsatz aber abzulehnen.149 Soweit die Vertragsparteien in freier Selbstbestimmung den Vertrag gewollt haben, ist das Legitimationsideal der Zustimmung voll verwirklicht, auch wenn das Vereinbarte im Einzelfall unvernünftig oder unrichtig erscheint. Mit anderen Worten: Das Vereinbarte wird von der Rechtsordnung anerkannt, weil und soweit es von der beiderseitigen Selbstbestimmung der Vertragsschließenden getragen ist.150 Dies schließt nicht aus, dass ein funktionierender Vertragsmechanismus des wechselseitigen Forderns und Nachgebens regelmäßig eine gewisse Richtigkeitsgewähr in sich trägt.151 Einer Regulierung bedarf der Vertragsmechanismus freilich insoweit, als dafür Sorge zu tragen ist, dass die jeweilige Vertragspartei in die Lage versetzt wird, ihre Interessen im Verhandlungsprozess zur Geltung zu bringen, und ihre tatsächliche Entscheidungsfreiheit gewahrt bleibt.152 Würde der Vertrag als bloßes „technisches Konstrukt“ zur Herstellung von Willensübereinstimmung verstanden, bestünde die 149 Ebenso Canaris, in: FS Lerche, S. 873, 886 f.; Flume, Das Rechtsgeschäft, S. 5 ff.; ders., in: FS 100 Jahre DJT, S. 135, 141 ff.; Hillgruber, AcP 191 (1991), 69, 85; L. Raiser, in: FS 100 Jahre DJT, S. 101, 118 f.; Ritgen, JZ 2002, 114, 117; Rittner, AcP 188 (1988), 101, 134; die Richtigkeitsgewähr des Vertragsmechanismus betonend aber Schmidt-Rimpler, AcP 147 (1941), 130, 149 ff.; ders., in: FS L. Raiser, S. 3 ff. 150 Flume, Das Rechtsgeschäft, S. 8; vgl. ferner Canaris, in: FS Lerche, S. 873, 884; Coester-Waltjen, AcP 190 (1990), 1, 14; Ritgen, JZ 2002, 114, 117; siehe auch BVerfGE 81, 242, 254. 151 Vgl. Coester-Waltjen, AcP 190 (1990), 1, 14; Ritgen, JZ 2002, 114, 117; Singer, Selbstbestimmung, S. 8 ff. 152 Monografisch zu den Bedingungen der Vertragsfreiheit Barnert, Die formelle Vertragsethik des BGB im Spannungsverhältnis zum Sonderprivatrecht und zur judikativen Kompensation der Vertragsparität, passim; Busche, Privatautonomie und Kontrahierungszwang, passim; Dauner-Lieb, Verbraucherschutz durch Ausbildung eines Sonderprivatrechts für Verbraucher, passim; Drexl, Die wirtschaftliche Selbstbestimmung des Verbrauchers, passim; Enderlein, Rechtspaternalismus und Vertragsrecht, passim; Fastrich, Richterliche Inhaltskontrolle, passim; Habersack, Vertragsfreiheit und Drittinteressen, passim; Heinrich, Formale Freiheit und materiale Gerechtigkeit, passim; Hönn, Kompensation gestörter Vertragsparität, passim; Oechsler, Gerechtigkeit im modernen Austauschvertrag, passim.
152
3. Teil: Legitimation privater Regeln
Gefahr, dass die mit dem Vertragsschluss herbeigeführte Willensübereinstimmung das Ziel der selbstbestimmten Interessenverfolgung, was die Idee der Privatautonomie ist, verfehlt. Wer einen Vertrag abschließt, weil er auf die Leistung angewiesen ist und nicht auf Alternativen zurückgreifen kann, handelt möglicherweise ebenso wenig selbstbestimmt wie jemand, der seinem Vertragspartner intellektuell weit unterlegen ist und die Tragweite der übernommenen Verpflichtungen nicht zu überblicken vermag.153 Dasselbe gilt, wenn ein sonstiges Kräfteungleichgewicht zwischen den Vertragsparteien vorliegt. Dementsprechend führt das Bundesverfassungsgericht aus, es sei Aufgabe des Gesetzgebers, Vorsorge dafür zu treffen, dass Verträgen, deren Inhalt infolge gestörter Vertragsparität auf Fremdbestimmung beruht, die rechtliche Anerkennung versagt bleibt.154 b) Organisation fehlerfreier Zustimmung Seiner Verpflichtung, die Vertragsparität zu gewährleisten, kommt der Gesetzgeber zunächst im Allgemeinen dadurch nach, dass er im Rahmen der Rechtsgeschäftslehre Generalklauseln bereitstellt (vgl. §§ 138 Abs. 1, 242 BGB), die den Gerichten im Einzelfall die Möglichkeit eröffnen, den Vertrag im Hinblick auf eine Störung der Vertragsparität einer Inhaltskontrolle zu unterziehen. Diese sichert die Legitimation einer Regel dort ab, wo das Funktionieren des auf beiderseitiger Zustimmung basierenden Vertragsschlusses aufgrund von Fremdbestimmung nicht gegeben ist.155 Hierauf gestützt versagt die Rechtsprechung beispielsweise einer Bürgschaftsvereinbarung die Wirksamkeit, wenn der Bürge finanziell krass überfordert ist und „erschwerende Umstände“ dergestalt gegeben sind, dass die Bürgschaft aus emotionaler Verbundenheit mit dem Hauptschuldner übernommen wird (sog. Angehörigenbürgschaften)156 oder ein unerträgliches Ungleichgewicht der Verhandlungslage besteht, z.B. wegen Beschönigung des Bürgschaftsrisikos durch den Gläubiger oder Personen, deren Verhalten ihm zuzurechnen ist,157 geRitgen, JZ 2002, 114, 119. BVerfGE 81, 242, 254 ff.; BVerfGE 85, 191, 212 f.; BVerfGE 89, 214, 234; BVerfGE 98, 365, 395; BVerfG NJW 2001, 957, 958. 155 Bachmann, Private Ordnung, S. 388; Fastrich, Richterliche Inhaltskontrolle, S. 55 ff.; Schubert, in: MüKo BGB, § 242 Rn. 503; für eine Grundrechtsprüfung, insbesondere eine Verhältnismäßigkeitsprüfung, des in der staatlichen Anerkennung der privaten Gestaltung liegenden potenziell überschießenden Moments H. Hanau, Verhältnismäßigkeit als Schranke privater Gestaltungsmacht, S. 78 ff.; ders., in: Möslein (Hrsg.), Private Macht, S. 119, 132 ff. 156 Z.B. Bürgschaften von eben erst volljährigen und geschäftsunerfahrenen Kindern für die Eltern (BGHZ 125, 206, 209 ff. = NJW 1994, 1278), Bürgschaften für andere Verwandte wie etwa Geschwister (BGHZ 137, 329, 332 ff. = NJW 1998, 597), Vettern/Basen mit im Einzelfall vergleichbaren Loyalitätsbeziehungen (BGH NJW 1997, 3230 ff.) sowie unter Ehegatten (BGH NJW 2000, 362, 363; BGH NJW 2002, 2230, 2231 f.), Verlobten (BGHZ 136, 347, 350 ff. = NJW 1997, 3372) und Partnern in auf Dauer angelegten nicht ehelichen Lebensgemeinschaften (BGH NJW 1182, 1183 ff.). 157 BGH NJW-RR 2002, 1130. 153
154
§ 12 Praktische Erprobung des Legitimationsmodells
153
schäftlicher Unerfahrenheit des Bürgen,158 dem Gläubiger zurechenbaren Aus übens psychischen Drucks seitens des Hauptschuldners159 oder der Täuschung über die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners.160 Mit Blick auf eine mögliche Störung der Vertragsparität unterzieht die Rechtsprechung ferner etwa Eheverträge einer Inhaltskontrolle.161 Zudem lässt der Bundesgerichtshof eine Inhaltskontrolle nach § 242 BGB in Fällen zu, in denen eine Vertragspartei formularmäßige Klauseln zum Ausschluss der Gewährleistung für Sachmängel beim Erwerb neu errichteter oder noch zu errichtender Eigentumswohnungen und Häuser verwendet, die von dritter Seite vorformuliert wurden, da er das Funktionieren des Vertragsmechanismus in diesen Fällen von vornherein als nicht gewährleistet ansieht.162 Neben der Schaffung von Generalklauseln kann der Gesetzgeber aber auch gezielt auf Situationen reagieren, in denen die Vertragsparität typischerweise gefährdet erscheint.163 Hierzu zählen zunächst die Regeln über die Geschäftsfähigkeit (§§ 104 ff. BGB), die Anfechtung wegen Willensmängeln (§§ 119 ff. BGB) und das Vertragslösungsrecht aus culpa in contrahendo (§§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB) sowie die Nichtigkeitssanktion des § 138 Abs. 2 BGB. Schutz bietet ferner die Figur der Bedingung i.S.d. § 158 BGB, mit der der Einzelne Regeln setzen kann, deren Wirkung von ihm nicht sicher abzuschätzender eintretender Umstände abhängt.164 Einer uninformierten Zustimmung wird präventiv durch Statuierung von Aufklärungspflichten entgegengewirkt,165 die garantieren sollen, dass sich eine Partei des Vertragsschlusses selbst sowie ihrer Rechte und Pflichten aus dem Vertrag bewusst wird. Ebenso bieten Formvorschriften Schutz vor übereilter Zustimmung und davor, dass die wirtschaftliche oder rechtliche Tragweite derselben nicht erkannt wird. Die Beteiligten sollen durch die Notwendigkeit, die Vertragsbedingungen schriftlich zu formulieren oder sich der notariellen Beratung 158
BGH NJW 1994, 1341, 1342 ff.; BGH NJW 1995, 1886, 1887 ff. BGH NJW 1997, 1980, 1981 f. 160 BGH NJW 2001, 2466, 2467 f. 161 Vgl. BVerfGE 103, 89, 92; BVerfG NJW 2001, 2248; BGHZ 158, 81, 94 ff., insbesondere 99 ff. = NJW 2004, 930; BGH NJW 2005, 1370 ff.; BGH NJW 2007, 2848, 2849 ff.; BGH NJW 2008, 3426, 3427 ff.; BGH NJW 2011, 2969, 2970 f. mit Anm. Mayer; OLG München NJW 2003, 592 ff.; OLG München FamRZ 2003, 376 f. mit Anm. Bergschneider; OLG Köln FamRZ 2003, 767 f.; aus der Literatur vgl. Dauner-Lieb, AcP 201 (2001), 295, 296 ff.; Kanzleiter, in: MüKo BGB, § 1408 Rn. 22 ff.; Looschelders/Olzen, in: Staudinger, BGB, § 242 Rn. 481; monografisch etwa Schultz, Zivilgerichtliche Vertragskontrolle im Eherecht, passim. 162 BGH NJW 1982, 2243, 2244; BGH NJW 1984, 2094 f.; BGH NJW-RR 1987, 1035, 1036; BGHZ 101, 350, 353 ff. = NJW 1988, 135; BGHZ 108, 164, 168 ff. = NJW 1989, 2748; BGH NJW-RR 2007, 895, 897; kritisch Medicus, Zur gerichtlichen Inhaltskontrolle notarieller Verträge, passim; eine Begründung aus § 242 BGB ablehnend Fastrich, Richterliche Inhaltskontrolle, S. 65 ff. 163 Vgl. Ritgen, JZ 2002, 114, 119. 164 Bachmann, Private Ordnung, S. 260. 165 Vgl. dazu Bachmann, Private Ordnung, S. 260. 159
154
3. Teil: Legitimation privater Regeln
zu unterziehen, auf die Bedeutung des Vorgangs hingewiesen werden bzw. gewarnt werden (vgl. etwa §§ 311b Abs. 1, 516 Abs. 1 BGB, 766 S. 1 BGB, 2247 Abs. 1 BGB, 2276 Abs. 1 S. 1 BGB). Zudem knüpft der Gesetzgeber an die Vornahme von Rechtsgeschäften mitunter flankierend weitere Rechtsfolgen, die auch dann eintreten, wenn sie von den Zustimmungserklärungen der Vertragsparteien nicht umfasst sind.166 Hierbei handelt es sich meist um die Regelung von Konflikten, an die die Vertragsparteien bei Vertragsschluss gewöhnlich nicht denken167. Neben diesen allgemeinen Vorgaben hat der Gesetzgeber in den letzten Jahren vor allem im Miet- und Arbeitsrecht die Privatautonomie zugunsten des Sozialstaatsprinzips stark zurückgedrängt.168 Grund hierfür ist weniger die wirtschaftliche oder intellektuelle Unterlegenheit des Mieter oder Arbeitnehmers,169 sondern vielmehr der Umstand, dass der Einzelne auf Wohnung und Arbeit existenziell angewiesen ist.170 Im Mietrecht hat dies insbesondere im eingeschränkten ordentlichen Kündigungsrecht des Vermieters Ausdruck gefunden, das ein berechtigtes Kündigungsinteresse seinerseits verlangt (vgl. § 573 BGB), wobei der Mieter widersprechen kann, wenn dies für ihn, seine Familie oder einen Haushaltsangehörigen eine soziale Härte bedeuten würde (vgl. § 574 BGB). Ferner ist § 558 BGB zu nennen, wonach eine Mieterhöhung nur bis zur Höhe der sog. ortsüblichen Vergleichsmiete angesetzt werden darf.171 Im Arbeitsrecht sorgen Kündigungsschutz, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Urlaubsmindestanspruch, Mutterschutz etc. für einen Schutz des Arbeitnehmers. Auch das Verbraucherschutzrecht wurde in den letzten Jahren intensiv vorangetrieben, um die häufig vermutete Unterlegenheit des Verbrauchers gegenüber übermächtigen Wirtschaftsunternehmen einzudämmen. Vor allem Aufklärungs- und Formvorschriften sollen dieser entgegenwirken (vgl. §§ 312 ff., 492 ff. BGB). Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz172 soll Störungen der Vertragsparität aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität entgegenwirken (vgl. § 1 AGG).
D. Schwab/Löhnig, Einführung in das Zivilrecht, Rn. 22. D. Schwab/Löhnig, Einführung in das Zivilrecht, Rn. 22. Daneben kommt auch dem Richter im Rahmen ergänzender Vertragsauslegung die Funktion eines „Vertragshelfers“ zu, vgl. Bachmann, Private Ordnung, S. 239 f. 168 Vgl. Geißler, JuS 1991, 617, 620 f.; bezogen auf das Arbeitsrecht umfassend Zöllner, AcP 176 (1976), 221 ff. 169 Kritisch zu Recht für den Arbeitsvertrag Zöllner, AcP 176 (1976), 221, 237 ff. In einer Gesellschaft freier und gleicher Bürger würde es geradezu stigmatisierend wirken, sämtliche wirtschaftlich oder intellektuell Unterlegene mit Schutzmaßnahmen zu überziehen, vgl. Geißler, JuS 1991, 617, 621. 170 Geißler, JuS 1991, 617, 621. 171 Vgl. zu den einzelnen Beispielen Geißler, JuS 1991, 617, 621. 172 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) vom 14. 08. 2006, BGBl. I, S. 1897, in Kraft getreten am 18. 08. 2006. 166
167 Vgl.
§ 12 Praktische Erprobung des Legitimationsmodells
155
3. Allgemeine Geschäftsbedingungen a) Institutionelle Störung der Vertragsparität Zusätzliche Anforderungen an die Legitimation stellen sich bei Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Rechtlich gesehen ist die Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen durch den Verwender zwar als Ausübung der Vertragsfreiheit einzuordnen, da sie auf dem Einverständnis der anderen Vertragspartei beruht (vgl. § 305 Abs. 2 BGB). Faktisch stellt sich die Rechtsgestaltung durch Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Vertragspartner aber als eine Form einseitiger Regelsetzung dar, da er lediglich ein pauschales „Ja“ zur Geltung der „fertig bereit liegenden Rechtsordnung“173 erteilt. Anders als beim klassischen Vertragsgefüge, bei dem der Vertragsinhalt von beiden Parteien grundsätzlich privatautonom ausgehandelt wird, wird der Vertragsinhalt bei Allgemeinen Geschäftsbedingungen typischerweise im Wesentlichen vom Verwender einseitig bestimmt.174 Ein Aushandeln der Vertragsbedingungen im Einzelnen findet gerade nicht statt (vgl. § 305 Abs. 1 S. 3 BGB). So ist beispielsweise in der Praxis kaum vorstellbar, dass der Benutzer eines Parkhauses bei der Einfahrt oder ein Kunde mit der Bank bei Eröffnung eines Kontos etc. erst einmal über eine Abänderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen verhandelt. Insbesondere im Bank-, Miet- oder Versicherungsrecht haben sich durch Allgemeine Geschäftsbedingungen buchstäblich „Privatgesetzbücher“ herausgebildet.175 Dass eine Vertragspartei auf den Inhalt eines Vertrags keinen wirksamen Einfluss nehmen kann, stellt für sich betrachtet zwar noch keine gravierende Beeinträchtigung der Vertragsfreiheit dar, sondern ist mitunter Voraussetzung effizienten Wirtschaftens.176 Der Kunde hat grundsätzlich die Möglichkeit, sich nach einem anderen Angebot umzuschauen oder auf den Vertrag zu verzichten. Regelmäßig lohnt es sich aber für die unterlegene Vertragspartei zeitlich und finanziell gesehen nicht, Ausschau nach den für sie optimalen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu halten. Sie unterwirft sich den Regeln im blinden Vertrauen darauf, vom Verwender nicht übervorteilt zu werden, ohne sie zuvor inhaltlich auf den Prüfstand gestellt zu haben (strukturelle Informationsasymmetrie).177 Die Gefahr liegt dann sprichwörtlich im Kleingedruckten, das der Verwender aufgrund langer 173 So die häufig kritisierte, aber treffende Formulierung etwa in BGHZ 1, 83, 86 = NJW 1951, 402. 174 Umfassende Darstellung zu den Hintergründen bei Fastrich, Richterliche Inhaltskontrolle, S. 79 ff. 175 Vgl. Köndgen, AcP 206 (2006), 477, 481 mit Fn. 10, wonach beispielsweise im Bereich der Kreditwirtschaft die AGB-Banken bzw. -Sparkassen nahezu ausnahmslos verwendet werden. 176 Canaris, AcP 200 (2000), 273, 323. 177 Vgl. Bachmann, Private Ordnung, S. 121; Basedow, in: MüKo BGB, Vorbem. zu §§ 305 ff. Rn. 5: Informations- und Motivationsgefälle zwischen Verwender der AGB und Kunden; Köndgen, AcP (206) 2006, 477, 480.
156
3. Teil: Legitimation privater Regeln
Erfahrung und unter professioneller Beratung vorformuliert hat und regelmäßig auch nur ihn begünstigt.178 b) Kompensation der verdünnten Zustimmung durch Gerechtigkeitskontrolle Die institutionell verdünnte Zustimmung muss durch Gerechtigkeitselemente aufgewogen werden. Denn soweit der Einzelne seine Zustimmung verdünnt erteilt, vermag diese die Regelbindung nicht allein zu rechtfertigen. Der Gesetzgeber trägt dem zunächst mit formalen Mitteln Rechnung. Hierzu gehört namentlich die Einbeziehungskontrolle gemäß § 305 Abs. 2 BGB. Sie soll gewährleisten, dass der Vertragpartner über die Verwendung Allgemeiner Geschäftsbedingungen überhaupt informiert wird sowie die Möglichkeit erhält, von ihrem genauen Inhalt Kenntnis zu erlangen. Der in § 305c Abs. 1 BGB geregelte Überraschungsschutz schließt von vornherein die Geltung solcher Klauseln aus, die nach den Umständen, insbesondere nach dem äußeren Erscheinungsbild des Vertrags so ungewöhnlich sind, dass der Vertragspartner mit ihnen nicht zu rechnen braucht. Weil er derartige Regelungen nicht erwarten konnte und diesen daher auch nicht zugestimmt haben dürfte, sollen derartige Regelungen nicht Vertragsbestandteil werden. Den Kernbereich der Regeln, die die verdünnte Zustimmung substitutieren sollen, formt die in den §§ 307 ff. BGB geregelte Inhaltskontrolle von Allgemeinen Geschäftsbedingungen aus. Hier wird besonders deutlich sichtbar, dass die verdünnte Zustimmung durch Gerechtigkeitselemente ausgeglichen werden soll. So sind nach der Generalklausel des § 307 Abs. 1 S. 1 BGB Allgemeine Geschäftsbedingungen unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Hierdurch eröffnet der Gesetzgeber den Gerichten die Möglichkeit, allgemeine Gerechtigkeitserwägungen darüber entscheiden zu lassen, ob eine private Regel rechtliche Bindungswirkung entfaltet. Dieser Missbrauchsschutz wird in § 307 Abs. 2 sowie in den Klauselverbotskatalogen der §§ 308, 309 BGB weiter konkretisiert. § 307 Abs. 2 BGB nennt – weitgehend generalklauselartig – Regelbeispiele einer unangemessenen Benachteiligung. § 309 BGB demgegenüber listet einzelne Regelungen explizit auf, die stets als unangemessene Benachteiligung zu werten sind. § 308 BGB zählt einzelne Regelungen auf, die zumindest grundsätzlich den Vertragspartner unangemessen benachteiligen sollen. § 307 Abs. 1 S. 2 BGB schließlich stellt klar, dass sich eine unangemessene Benachteiligung auch daraus ergeben kann, dass eine Bestimmung nicht klar und verständlich formuliert ist, und trägt damit dem Gedanken Rechnung, dass nur eine transparente Regelung gerecht ist.
178
Canaris, AcP 200 (2000), 273, 321.
§ 12 Praktische Erprobung des Legitimationsmodells
157
4. Einseitige Rechtsetzung a) Einseitige Rechtsgeschäfte Bei den einseitigen Rechtsgeschäften lassen sich lediglich die gegenüber dem Erklärenden eintretenden rechtlichen Bindungswirkungen ohne Umschweife mithilfe der individuellen Zustimmung des Regelsetzers begründen. Seine Regelbindung wird durch seine Zustimmung getragen. Bei der Frage, wie die aufseiten des Gegenübers eintretende Bindungswirkung zu erklären ist, ist indes zu differenzieren. Soweit das Gegenüber durch das einseitige Rechtsgeschäft lediglich berechtigt wird, d.h. einen Anspruch erhält, bedarf es keiner zusätzlichen Legitimation auf seiner Seite. Denn die Regel ist für ihn in keiner Weise belastend oder freiheitsgefährdend. So sind namentlich die Auslobung, das Preisausschreiben sowie die arbeitsrechtliche Gesamtzusage lediglich für den Erklärenden freiheitsgefährdend, nicht aber für die andere Partei. Gleiches gilt letztlich für das Testament. Das Testament kann Dritten zwar sowohl Rechte als auch Pflichten auferlegen: Der Erbe springt in die Rechtsposition des Erblassers mit all seinen Begünstigungen und Belastungen ein; private Amtswalter wie testamentarisch eingesetzte Testamentsvollstrecker treffen vornehmlich Pflichten, aber auch Rechte wie etwaige Vergütungsansprüche. Der Vermächtnisnehmer erhält zwar stets einen Vermögenvorteil, bestimmte Pflichten dürfen ihn aber auch treffen, sofern das Zugewendete insgesamt als Vermögensvorteil zu sehen ist.179 Doch auch durch ein Testament werden Dritte letztlich nicht in ihrer Freiheit beschränkt. Sie haben nämlich stets die Möglichkeit, das Erbe oder das Vermächtnis auszuschlagen bzw. die Amtsausübung zu verweigern und dadurch einer Regelbindung zu entgehen.180 Soweit der Regeladressat durch das einseitige Rechtsgeschäft wie namentlich beim arbeitsrechtlichen Direktionsrecht verpflichtet wird, kann seine rechtliche Bindung nicht damit erklärt werden, dass er in seiner Freiheit nicht beschränkt wird und ein Legitimationsbedürfnis daher entfällt. Wie zu erklären ist, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer über das Direktionsrecht einseitig, rechtlich bindende Anordnungen ohne oder gegen dessen Willen auferlegen kann, ist umstritten. Die eine Ansicht begründet das Direktionsrecht unter Verweis auf eine (stillschweigende) rechtsgeschäftliche Unterwerfung durch den Arbeitsvertrag.181 Die Gegenansicht verweist auf § 242 BGB und sieht das Direktionsrecht als immanenten Bestandteil des Arbeitsverhältnisses an.182 Beiden Ansichten ist die zutreffende Erkenntnis gemein, dass die grundsätzliche Bindung des Arbeitnehmers an die Direktion des Arbeitgebers letztlich im Arbeitsvertrag wurzelt und damit schlussendlich auf die seinerzeitige Zustimmung F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 471. Siehe auch F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 471. 181 BAG NJW 1986, 85, 86; Adomeit, Rechtsquellenfragen im Arbeitsrecht, S. 101 ff.; Bötticher, Gestaltungsrecht und Unterwerfung im Privatrecht, S. 7 f. 182 Zöllner/Loritz/Hergenröder, Arbeitsrecht, § 7 Rn. 35. 179 Vgl. 180
158
3. Teil: Legitimation privater Regeln
des Arbeitnehmers zum Arbeitsvertrag zurückzuführen ist. Als „verdünnt“ kann man die Zustimmung des Arbeitnehmers freilich insoweit ansehen, als er der Regelsetzungsmacht des Arbeitgebers durch Abschluss des Arbeitsvertrags lediglich einmalig und, ohne die zukünftigen Regeln zu kennen oder sie absehen zu können, zugestimmt hat. Diese sich auftuende Legitimationslücke kann mithilfe des Gerechtigkeitsgedankens geschlossen werden: Zum einen ist der Arbeitgeber auf das arbeitsrechtliche Direktionsrecht zur Konkretisierung arbeitsvertraglicher Pflichten zum Wohl des Betriebs dringend angewiesen. Zum anderen bietet die Rückkoppelung des Direktionsrechts an den Arbeitsvertrag einen Mindestschutz für den Arbeitnehmer. So darf der Arbeitgeber mithilfe des Direktionsrechts zwar die geschuldete Arbeitsleistung, den Arbeitsort und die Arbeitszeit sowie vertragliche Nebenpflichten festlegen bzw. konkretisieren. Den Gehalt des Arbeitsvertrags selbst darf er aber nicht antasten (z.B. durch Lohnkürzungen).183 Hierfür bedürfte es der (erneuten) Zustimmung des Arbeitnehmers. Bei für den Arbeitnehmer bedeutsamen Regeln, wie etwa der Aufstellung einer Betriebsordnung oder eines Verhaltenskodex, bedarf es nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG der Mitbestimmung durch den Betriebsrat, wodurch die Gerechtigkeit durch Teilhabe und Verfahren gewährleistet bleibt. Zu guter Letzt schützt die Möglichkeit einer richterlichen Billigkeitskontrolle den einzelnen Arbeitnehmer vor einer Ausbeutung. b) Rechtsetzung kraft absoluten subjektiven Rechts Bei der Frage, wie sich eine Bindung an Regeln legitimieren lässt, die kraft subjektiven Rechts des Rechtsinhabers gesetzt werden, ist ebenfalls zwischen dem Befehl an den Inhaber eines absoluten subjektiven Rechts, beispielsweise an den Eigentümer, die Nutzung, etwa das Betreten, zu dulden, und dem Befehl an den Nutzer, die Nutzung zu unterlassen, oder sich etwa an eine aufgestellte Nutzungsordnung zu halten, zu unterscheiden.184 Eine Verpflichtung des Inhabers eines absoluten subjektiven Rechts, die Nutzung seines Rechts zu dulden, ist nur insoweit denkbar, als er dies gestattet hat. Insoweit erklärt sich die rechtliche Bindung aus seiner Zustimmung heraus.185 Die Verpflichtung des Nutzungswilligen, die Nutzung zu unterlassen bzw. nach den Vorgaben des Inhabers des absoluten subjektiven Rechts zu handeln, ergibt sich demgegenüber als Ausfluss des Gerechtigkeitsgedankens unmittelbar aus dem absoluten subjektiven Recht des Rechtsinhabers.186 Demjenigen, dem ein subjektives Recht absolut zugeordnet wird, muss auch die Befugnis zustehen, sich vor eigenmächtigen Nutzungen Dritter zu schützen. Einer Bindung an die Regeln, beispielsweise einer Nutzungsordnung, kann sich der Nutzer im Übrigen jederzeit dadurch entziehen, dass er den Geltungsbereich der Benutzungsordnung verlässt, d.h. die Nutzung aufgibt.187 Bachmann, Private Ordnung, S. 140. Bachmann, Private Ordnung, S. 231. 185 Vertiefend Bachmann, Private Ordnung, S. 231. 186 Bachmann, Private Ordnung, S. 232; Lobinger, Autonome Bindung, S. 320 f. 183
184 Vgl.
§ 12 Praktische Erprobung des Legitimationsmodells
5. Verbandsregeln
159
187
a) Zustimmung durch Verbandsbeitritt als verdünnte Zustimmung Auch die Bindung des einzelnen Verbandsmitglieds an Verbandsregeln lässt sich nicht allein mithilfe des Zustimmungsgedankens erklären. Zwar setzt die Mitgliedschaft des Einzelnen im Verband und damit die Erstreckung der Verbandsregeln auf ihn einen freiwilligen Beitritt (arg. e § 39 BGB) voraus, mit dem er sich der Verbandsmacht unterwirft.188 Der Zustimmungsgedanke trägt aber bereits bei den Verbandsmitgliedern nicht mehr umfassend, die nicht wie die Gründer an der Ausarbeitung der Satzung bzw. des Gesellschaftsvertrags beteiligt waren, sondern dem bereits bestehenden Verband erst später beigetreten sind. Vor allem aber wäre es zu weit gegriffen, in dem Beitrittsakt – und dies gilt sowohl für die später Beitretenden als auch für die Gründer selbst – eine antizipierte Zustimmung auch für alle zukünftigen Regeln zu sehen.189 Der Beitrittsakt kann allenfalls insoweit tragen, als die eintretenden Rechtsfolgen für den Beitretenden aus der Satzung heraus ersichtlich sind.190 Soweit eintretende Rechtsfolgen indes auf späteren, von der Mehrheit getragenen Verbandsbeschlüssen beruhen, denen das einzelne Verbandsmitglied nicht zugestimmt hat, bedarf es einer zusätzlichen legitimatorischen Absicherung,191 die nach dem hier vertretenen Ansatz nur darauf beruhen kann, dass die aufgestellten Regeln für das einzelne Verbandsmitglied noch als gerecht erscheinen. b) Kompensatorische Sicherungen aa) Sicherung durch Verfahren Einen ersten Beitrag liefert hier die Überlegung, dass bei den Verbandsmitgliedern, die sich zur Verfolgung eines gemeinsamen Zwecks verbunden haben, von vornherein zumindest ein grundsätzlicher Interessengleichlauf anzunehmen ist Bachmann, Private Ordnung, S. 231. Legitimation durch freien Beitritt vgl. Bachmann, Private Ordnung, S. 209; F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 93, 282, 295; Larenz, in: GS Dietz, S. 45, 49; Meyer-Cording, Die Rechtsnormen, S. 47: akzeptierte Rechtsnormen bzw. Wahlnormen; Wiedemann, Gesellschaftsrecht, S. 162, 357. 189 So auch Bachmann, Private Ordnung, S. 209; ders., Jb.J.ZivRWiss. 2002, S. 9, 17 f.; F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 93 f. 190 Vgl. auch BGHZ 47, 172, 175 = NJW 1967, 1268. 191 Das gilt umso mehr, als ab einer gewissen Größe von Verbänden eine rationale Apathie der Mitglieder zu beobachten ist, die die Entscheidungen des Verbands in der Regel unbesehen hinnehmen. Eine aktive Mitwirkung in der Verbandspolitik lohnt sich für die meisten Mitglieder nicht, da sie sich mit dem Verbandszweck als solchem nur schwach identifizieren und sich lediglich aufgrund selektiver Anreize für eine Mitgliedschaft entscheiden, vgl. zur Problematik Bachmann, Private Ordnung, S. 224; Reuter, in: MüKo BGB, Vorbem. zu §§ 21 ff. Rn. 72 ff. 187
188 Zur
160
3. Teil: Legitimation privater Regeln
und das Gesetz all diejenigen, die im Verband Bestimmungsmacht haben, d.h. alle Organe (Vorstand, Geschäftsführer, Aufsichtsrat, Beirat oder Mitgliederversammlung) im Sinne einer treuhänderischen Bindung dem Verbandsinteresse verpflichtet.192 Der mit Verbandsregeln bzw. Verwaltungsmaßnahmen verfolgte Zweck darf, soweit er im Einzelfall Rechte der Minderheit beeinträchtigt, nicht mit schonenderen Mitteln zu erreichen sein und muss durch das Verbandsinteresse gerechtfertigt werden können.193 Verbandsregeln, die sich nicht über das Verbandsinteresse rechtfertigen lassen, sind rechtswidrig und lösen Sanktionen aus.194 Zugleich sucht das Verbandsrecht Gerechtigkeit durch Verfahren zu gewährleisten, indem es Mitgliedschaftsrechte bereithält, die ein faires Beschlussverfahren, namentlich eine proportionale Entscheidungsteilhabe und damit die Möglichkeit des Einzelnen sicherstellen, in gewissem Umfang auf die Beschlussfassung Einfluss zu nehmen.195 Zum unentziehbaren Kernbereich der Mitgliedschaft zählen insbesondere das Stimmrecht, Kontroll- sowie Informationsrechte,196 die bedeutsam werden, wenn, wie etwa im Aktienrecht, die Initiative zur Beschlussfassung von den wohlinformierten Organen ausgeht, der Beschluss dann aber vom schlechter informierten Kollektiv getroffen wird.197 Bei besonders wichtigen Entscheidungen werden bisweilen qualifizierte Mehrheiten oder sogar Einstimmigkeit gefordert (vgl. § 33 Abs. 1 BGB).198 Im Personengesellschaftsrecht werden die Anforderungen an den Konsens hochgeschraubt, wenn Mehrheitsklauseln eingeführt werden sollen, die dem Kollektiv die Befugnis geben, Regeln auch gegen den Willen der Minderheit zu setzen (§ 119 Abs. 1 und 2 HGB).199 Einem Mehrheitsbeschluss grundsätzlich gänzlich entzogen ist es, den Gesellschaftern Belastungen über das im Gesellschaftsvertrag Vereinbarte aufzubürden (vgl. § 707 BGB, § 180 Abs. 1 AktG, § 53 Abs. 3 GmbHG).200 bb) Materielle Sicherung durch Inhalts- und Beschlusskontrolle Nicht mehr hinnehmbaren Ungerechtigkeiten wird schließlich auch materiell in Form einer Inhalts- bzw. Beschlusskontrolle entgegengewirkt. So müssen Satzung Bachmann, Private Ordnung, S. 207; M. Becker, Der unfaire Vertrag, S. 55. BGHZ 71, 40, 44 ff. = NJW 1978, 1316 (Kali + Salz). 194 Bachmann, Private Ordnung, S. 207. 195 Vgl. dazu Bachmann, Jb.J.ZivRWiss. 2002, S. 9, 22, 24; Wiedemann, Gesellschaftsrecht, S. 357 f., 405 ff. 196 Vgl. BGH NJW 1995, 194, 195 = JZ 1995, 311 mit Anm. K. Schmidt. 197 Bachmann, Jb.J.ZivRWiss. 2002, S. 9, 22. 198 § 33 Abs. 1 BGB ist freilich dispositiv; umfassend zum Einstimmigkeits- und Mehrheitsprinzip im Verbandsrecht K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 16 II (S. 452 ff.). 199 Im Personengesellschaftsrecht gilt grundsätzlich das Einstimmigkeitsprinzip, vgl. § 709 Abs. 1 BGB, § 119 Abs. 1 HGB. Die Vorschriften sind aber dispositiv, vertiefend K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 16 II 2 (S. 453 ff.). 200 Vgl. K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 16 III 3 b cc (S. 473 f.). 192 193
§ 12 Praktische Erprobung des Legitimationsmodells
161
bzw. Gesellschaftsvertrag ebenso wie auch der einzelne Verbandsbeschluss zunächst den Vorgaben der §§ 134, 138 BGB gerecht werden.201 § 310 Abs. 4 BGB schließt das Gesellschaftsrecht zwar von der AGB-Kontrolle aus. Formularmäßige Regelungen von Publikumsgesellschaften werden von der Rechtsprechung aber unter Verweis darauf, dass die Verbandsmitglieder den fertig formulierten Gesellschaftsvertrag bzw. die Satzung hinnehmen müssten, ohne auf dessen inhaltliche Ausgestaltung einen irgendwie gearteten, ihren Interessen wahrenden Einfluss ausüben zu können, gleichwohl einer umfassenden Inhaltskontrolle anhand des § 242 BGB unterzogen.202 Denn dann ist die privatautonome Legitimation durch freiwilligen Beitritt so schwach ausgeprägt, dass es ähnlich wie bei Allgemeinen Geschäftsbedingungen einer richterlichen Gerechtigkeitskontrolle in Gestalt der Inhaltskontrolle bedarf.203 Unwirksam soll eine Klausel nach der Rechtsprechung dann sein, wenn sie ohne ausreichenden sachlichen Rechtfertigungsgrund einseitig die Belange der Gründer oder bestimmter Gesellschafter verfolgt und die berechtigten Interessen der Anlagegesellschafter unangemessen und unbillig beeinträchtigt.204 In gleicher Weise unterzieht die Rechtsprechung Vereinssatzungen jedenfalls dann einer Inhaltskontrolle, wenn der Verein im wirtschaftlichen oder sozialen Bereich eine Machtstellung innehat und das Mitglied auf die Mitgliedschaft angewiesen ist.205 Mit dem Beschlussmängelrecht stellt der Gesetzgeber der überstimmten Minderheit ferner ein Instrumentarium bereit, um auch einzelne Verbandsbeschlüsse einer gerichtlichen Kontrolle zuzuführen (sog. Beschlusskontrolle).206 Als Anfechtungsgrund anerkannt ist dabei u.a. der Umstand, dass der grundsätzliche Interessengleichlauf durch missbräuchliche bzw. treuwidrige Verfolgung von Partikularinteressen seitens der Mehrheit gestört wird. Auf diese Weise wird es 201 OLG Celle NJW-RR 1995, 1273 f.: Gesamtnichtigkeit einer Satzung, weil sie auf eine willkürliche Entrechtung der übrigen Mitglieder zugunsten einer bestimmten Mitgliedergruppe angelegt ist. 202 Grundlegend BGHZ 64, 238, 241 ff. = NJW 1975, 1318; ferner BGHZ 84, 11, 13 ff. = NJW 1982, 2302; BGH NJW 1982, 2495; BGHZ 102, 172, 177 ff. = NJW 1988, 969 (GbR); BGHZ 104, 50, 53 ff. = NJW 1988, 1903 (Publikums-KG mit und ohne Treuhandkon struktion); BGHZ 105, 306, 318 ff. = NJW 1989, 1724 (Vereine oder Verbände, die im wirtschaftlichen oder sozialen Bereich eine überragende Machtstellung innehaben); LG Münster NJW-RR 1996, 676, 677 (Publikums-GmbH); vgl. dazu Basedow, in: MüKo BGB, § 310 Rn. 86 ff.; Fastrich, Richterliche Inhaltskontrolle, S. 124 ff.; Liebscher, in: MüKo GmbHG, § 45 Rn. 71 ff.; Schubert, in: MüKo BGB, § 242 Rn. 507; K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 57 IV 1 b (S. 1682 f.) 203 Vgl. BGHZ 104, 50, 53 = NJW 1988, 1903. 204 Vgl. BGHZ 102, 172, 177 f. = NJW 1988, 969; BGHZ 104, 50, 57 = NJW 1988, 1903. 205 BGHZ 105, 306, 318 ff. = NJW 1989, 1724; BGHZ 142, 304, 306 ff. = NJW 1999, 3552. In der Literatur ist umstritten, inwieweit die Inhaltskontrolle auf Vereine mit wirtschaftlicher oder sozialer Machtstellung zu beschränken ist, vgl. dazu Schubert, in: MüKo BGB, § 242 Rn. 509 m.w.N. 206 Grundlegend BGHZ 71, 40, 44 ff. = NJW 1978, 1316 (Kali + Salz); vgl. ferner etwa Koch, in: Hüffer/Koch, AktG, § 243 Rn. 22 f.
162
3. Teil: Legitimation privater Regeln
dem Einzelnen ermöglicht, ungerechte, d.h. nicht vom grundsätzlichen Interessengleichlauf getragene Beschlüsse aus der Welt zu schaffen. cc) Austritt als letzter Ausweg Ein letzter Baustein zur Legitimation der Verbandsregeln bildet der Umstand, dass das einzelne Verbandsmitglied im Grundsatz frei ist, die Unterwerfung unter die Verbandsmacht durch Austritt bzw. Anteilsveräußerung wieder zu beenden.207 Auf diese Weise kann sich der Einzelne einer Regelbindung durch die Verbandsgewalt notfalls entziehen. 6. Tarifverträge a) Horizontale Legitimation kraft Zustimmung Bei der Legitimation der Bindungswirkung der Tarifnormen ist zwischen den horizontalen und den vertikalen Rechtswirkungen zu differenzieren. Auf horizontaler Ebene sorgt beim Tarifvertrag zunächst der Vertragsmechanismus für eine vollumfängliche Legitimation, indem eine Bindung der Tarifvertragsparteien und ihrer Mitglieder von der Zustimmung auf Verbandsebene abhängig gemacht wird.208 Unterstützend greift der Staat insoweit ein, als dass austarierte Kampfmittel zugelassen sind, um eine beiderseitige Zustimmung bzw. Einigung zwischen den widerstreitenden Interessenmonopolen von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite (Gegenmacht) zu erreichen.209 Eine Anreicherung durch weitere Legitimationselemente ist auf dieser Ebene nicht erforderlich. Die Gegenmächte zähmen sich gewissermaßen gegenseitig. Insbesondere ist eine richterliche Inhaltskontrolle der Tarifnormen, in deren Rahmen geprüft werden kann, ob die privaten Regeln eine angemessene Lastenverteilung treffen, nicht veranlasst, weil das tarifvertragliche Regelsetzungsverfahren die Parität der Verhandlungspartner gewährleistet und damit für ein „richtiges“ Regelprodukt wirbt; es kann davon ausgegangen werden, dass die Tarifvertragsparteien innerhalb des Gesamtklauselwerks durch das Zusammenwirken der jeweiligen Bestimmungen insgesamt einen ausgewogenen Ausgleich der beteiligten Interessen erzielt haben.210 Folgerichtig nimmt der Gesetzgeber durch § 310 Abs. 4 S. 1 BGB Tarifverträge von der AGB-Kontrolle aus. 207 Vgl. BGHZ 105, 306, 319 = NJW 1989, 1724; Bachmann, Private Ordnung, S. 207; Hänlein, RdA 2003, 27; F. Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 294 f. Der Austritt stellt allerdings nicht immer eine reale Option dar, vgl. etwa für Verbände mit überragender wirtschaftlicher oder sozialer Machtstellung BGHZ 105, 306, 319 = NJW 1989, 1724; Hänlein, RdA 2003, 27, 28. 208 Vgl. Bachmann, Private Ordnung, S. 207 f. 209 Im Betriebsverfassungs- und Urheberrecht wird ein obligatorisches Einigungsverfahren bereitgestellt, vgl. § 76 BetrVG, § 36a UrhG. 210 Vgl. BAG NZA 2009, 428 Rn. 30; Becker, in: BeckOK BGB, § 310 Rn. 42; Fastrich, Richterliche Inhaltskontrolle, S. 208 f. Bachmann, Jb.J.ZivRWiss. 2002, S. 9, 25 spricht
§ 12 Praktische Erprobung des Legitimationsmodells
163
b) Vertikale Legitimation Auf vertikaler Ebene ist abermals eine Unterscheidung zu treffen, und zwar zwischen den Arbeitsverhältnisnormen und den Betriebsnormen. Die Arbeitsverhältnisnormen wirken gemäß § 4 Abs. 1 S. 1 TVG unmittelbar und zwingend nur zwischen den beiderseits Tarifgebundenen, d.h. den in § 3 Abs. 1 TVG legaldefinierten Mitgliedern der Tarifvertragsparteien und dem Arbeitgeber als Partei des Tarifvertrags. Die „verdünnte“ Zustimmung der einzelnen Mitglieder wird insoweit dadurch ausgeglichen, dass die Tarifvertragsparteien als Vereine den verbandsrechtlichen Legitimationsanforderungen an die Binnenstruktur unterfallen.211 Legitimationsquelle ist also der privatautonome Beitritt bzw. die Mitgliedschaft in einer Arbeitnehmer- oder Arbeitgebervereinigung als Organisation, die den Kautelen des Verbandsrechts unterstellt sind.212 Anders muss die Legitimation erklärt werden, soweit Betriebsnormen in Rede stehen, die unmittelbare und zwingende Wirkung schon dann entfalten, wenn nur der Arbeitgeber tarifgebunden ist, vgl. § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 1 S. 2 TVG. Sie haben Geltungskraft nicht nur für die gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer, sondern für die ganze Belegschaft, namentlich auch für die nicht organisierten Arbeitnehmer, die sog. Außenseiter. Hier lässt sich die Bindungswirkung der Tarifnormen damit erklären, dass der Tarifvertrag insoweit funktional auf Mindestarbeitsbedingungen zu beschränken ist213 und der einzelne Arbeitnehmer sich außerdem – was auch für die Arbeitsverhältnisnormen gilt – durch günstigeren Einzelvertrag jederzeit dem Kollektivkonsens entziehen kann (sog. Günstigkeitsprinzip).214
davon, dass der Tarifvertrag ein „gruppengerechtes“ Erbgenis verbürge; vgl. auch RegE SchRModG, BT-Drucks. 14/6857, S. 54: In diesem gewissermaßen „normsetzenden“ Bereich kann und darf eine Inhaltskontrolle nicht eingreifen, da sonst das „System der Tarifautonomie“ konterkariert wird. 211 Bachmann, Private Ordnung, S. 208; zu den umstrittenen Anforderungen an die Binnenstruktur von Gewerkschaften vgl. Oetker, RdA 1999, 96, 102 f.; Reuter, in: MüKo BGB, Vorbem. zu §§ 21 ff. Rn. 127; Schüren, Die Legitimation tariflicher Normsetzung, S. 227 ff., 237 ff. 212 Die freiwillige Mitgliedschaft ist nicht bloß Grundlage der Tarifgeltung, sie ist auch Element des ungeschriebenen Koalitionsbegriffs. Wenn die Mitgliedschaft in einer Arbeitgeber- oder Arbeitnehmervereinigung nicht mehr freiwillig ist, verliert sie den Koalitions status und damit den Schutz des Art. 9 Abs. 3 GG, vgl. Rieble, ZfA 2000, 5, 24; zu den Anforderungen an die Koalitionseigenschaft und die Tariffähigkeit im Übrigen vgl. Löwisch/ Rieble, TVG, § 2 Rn. 47 ff.; aus verfassungsrechtlicher Sicht R. Scholz, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 9 Abs. 3 Rn. 193 ff. (Stand: 77. EL 2016). 213 Zur umstrittenen Frage, ob die Betriebsnormen auch unmittelbar und zwingend zulasten der Außenseiter gelten, vgl. die Nachweise in 2. Teil, Fn. 397. 214 Rieble, ZfA 2000, 5, 24; siehe auch Wank, in: Wiedemann (Hrsg.), TVG, § 4 Rn. 387.
164
3. Teil: Legitimation privater Regeln
7. Betriebsvereinbarungen a) Ausgangslage Gewisses Kopfzerbrechen bereitet die Legitimation von Betriebsvereinbarungen. Denn § 77 Abs. 4 BetrVG erstreckt die Reichweite sowohl begünstigender als auch belastender Betriebsvereinbarungen auf alle in einem Betrieb Beschäftigten. Darauf, ob der Einzelne mit der Errichtung des Betriebsrats einverstanden war oder dem Abschluss der konkreten Betriebsvereinbarung zugestimmt hat, kommt es nicht an. Auch hängt die Geltung einer Betriebsvereinbarung nicht etwa von einem freiwilligen Verbandsbeitritt der Regelunterworfenen ab. Bereits mit Zugehörigkeit zu einem Betrieb, der einen Betriebsrat eingerichtet hat, ist man den Regeln unterworfen. Anders als belastende Tarifnormen, deren Geltung in weiten Teilen auf einer mitgliedschaftlichen Legitimation beruht, stellt sich die Betriebsvereinbarung im Verhältnis zu den Arbeitnehmern als eine Art korporative Zwangsordnung dar. b) Verdünnte Zustimmung Zu kurz gegriffen wäre es, die Bindungswirkung der Betriebsvereinbarung damit zu erklären, dass die betriebsverfassungsrechtlichen Regelungskompetenzen legitime Zwecke verfolgen, nämlich die Gewährleistung der betrieblichen Ordnung und die Verhinderung von Diskriminierungen.215 Der Verweis auf einen vernünftigen, gesetzlich verankerten Regelungszweck beantwortet nämlich für sich genommen nicht die Frage, mit welchem Recht der Betriebsrat zum (Mit-)Regelsetzer berufen ist.216 Ebenso wenig weiterführend ist der Versuch, die Legitimation damit zu erklären, dass der Einzelne der Betriebsvereinbarung letztlich individuell zustimme, indem er im Betrieb verbleibt. Denn ein Regelentzug stellt für die Betroffenen aufgrund des damit verbundenen Arbeitsplatzverlusts regelmäßig keine reale Option dar.217 Allerdings kann ein gewisses Maß an Zustimmung, d.h. an privatautonomer Legitimation, im Arbeitsvertrag erblickt werden, weil die Betriebsvereinbarung zu diesem in einem sehr engen Näheverhältnis steht, indem sie diesen im Hinblick auf die Koordination von Betriebsabläufen notwendigerweise ergänzt218 und der 215 Hänlein, RdA 2003, 27, 30; zu diesen Zielsetzungen Rieble, Arbeitsmarkt und Wettbewerb, Rn. 1426 ff., 1438 ff. 216 So auch Hänlein, RdA 2003, 27, 30; anders im Ansatz Bachmann, Private Ordnung, S. 218 f., der unter Verweis auf Fastrich, RdA 1994, 129, 134 und H. Hanau, Individualautonomie und Mitbestimmung, S. 122, die Entscheidungsfreiheit des einzelnen Arbeitnehmers aus Gründen des Wohls des Betriebs und der Belegschaft ausnahmsweise zurücktreten lässt. 217 Vgl. Buck-Heeb/Dieckmann, Selbstregulierung im Privatrecht, S. 207; Hänlein, RdA 2003, 27, 31; Reuter, RdA 1994, 152, 158. 218 Die Betriebsvereinbarung ebenfalls als vertragsakzessorisches Institut deutend Bachmann, Jb.J.ZivRWiss. 2002, S. 9, 27 f.; Windbichler, in: FS Zöllner, S. 999, 1006 ff.;
§ 12 Praktische Erprobung des Legitimationsmodells
165
Betriebsrat (zumindest in weiten Teilen) letztlich nur in die Willensbildung des Arbeitgebers eingeschaltet ist und dessen Entscheidungsmacht beschränkt.219 c) Gerechtigkeitselemente aa) Formale Gerechtigkeit durch Teilhabe und Verfahren „Verdünnt“ bleibt die individuelle Zustimmung des einzelnen Arbeitnehmers freilich insoweit, als er der fremden Regelsetzungsmacht durch Abschluss des Arbeitsvertrags lediglich einmalig, ohne die zukünftigen Regeln zu kennen oder absehen zu können, zustimmt. Insoweit bedarf es neben der verdünnten Zustimmung der Gewährleistung, dass die betrieblichen Regelungen als gerecht einzustufen sind. Das Gesetz gewährleistet die Gerechtigkeit der Regel dabei zunächst durch Teilhabe und Verfahren. Gerechtigkeitsstiftend wirkt in dieser Hinsicht der Umstand, dass die Arbeitnehmer die Zusammensetzung des Betriebsrats durch die Wahl des Betriebsrats beeinflussen können, vgl. §§ 77 ff. BetrVG.220 Auch die regelmäßig auf vier Jahre begrenzte Amtszeit des Betriebsrats wirkt machtzügelnd, vgl. § 21 BetrVG. Zugleich begrenzt das BetrVG die Regelungsmacht der Betriebspartner,221 wobei insbesondere § 75 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 BetrVG die Betriebspartner darauf verpflichtet, die grundrechtlich geschützten Freiheits- und Gleichheitsrechte der Regelunterworfenen zu wahren, und damit einen gewissen Interessengleichlauf gewährleistet.222 Des Weiteren müssen Regelungen, die die Arbeitnehmer belasten, dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz genügen.223
ausführlich dazu Reichold, Betriebsverfassung als Sozialprivatrecht, S. 486 ff., 542, nach dem die privatautonome Legitimation der Betriebsvereinbarung allein im Arbeitsvertrag gründet; kritisch dazu etwa Hänlein, RdA 2003, 27, 30 m.w.N. 219 So Rieble, Arbeitsmarkt und Wettbewerb, Rn. 1422 f. mit Blick auf § 315 Abs. 3 BGB; kritisch dazu Hänlein, RdA 2003, 27, 30. 220 Hänlein, RdA 2003, 27, 30 f.; Jahnke, Tarifautonomie und Mitbestimmung, S. 111 ff.; Waltermann, Rechtsetzung durch Betriebsvereinbarung, S. 205 f.; Zöllner, Rechtsnatur der Tarifnormen, S. 19; ähnlich Reuter, RdA 1991, 193, 200: Beriebsautonomie ist der Privatautonomie sogar näher als die Tarifautonomie, da die Chance des einzelnen Arbeitnehmers, seine konkreten Vorstellungen in den Willensbildungsprozess der Arbeitnehmerseite einzubringen, gegenüber dem nahen Betriebsrat größer sei als bei der fernen Gewerkschaft; kritisch Richardi, in Richardi (Hrsg.), BetrVG, § 77 Rn. 65: Betriebsratswahl ersetzt nicht den individualrechtlichen Unterwerfungsakt; ablehnend Nebel, Die Normen des Betriebsverbandes, S. 118 f. 221 Umfassend zu Umfang und Grenzen der Betriebsautonomie Richardi, in: Richardi (Hrsg.), BetrVG, § 77 Rn. 64 ff. 222 Richardi, in: Richardi (Hrsg.), BetrVG, § 77 Rn. 102. 223 Vgl. Richardi, in: Richardi (Hrsg.), BetrVG, § 77 Rn. 71, 102 m.w.N.
166
3. Teil: Legitimation privater Regeln
bb) Materielle Gerechtigkeit durch umfassende Billigkeitskontrolle Daneben sind Betriebsvereinbarungen einer gerichtlichen Kontrolle unterworfen, die den einzelnen Arbeitnehmer vor einer Ausbeutung schützt. Hierbei ist allerdings umstritten, ob die Gerichte lediglich zu einer bloßen Rechtskontrolle befugt sind oder ob sie die Regelungen auch einer umfassenden Billigkeitskontrolle unterziehen dürfen. Teile des Schrifttums plädieren für eine bloße Rechtmäßigkeitskontrolle, orientiert am höherrangigen Recht, den guten Sitten (§§ 134, 138 BGB), dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, dem Gleichbehandlungsgrundsatz sowie den Diskriminierungsverboten (§ 75 Abs. 1 BetrVG).224 Für eine darüber hinausgehende Billigkeitskontrolle sei wegen § 310 Abs. 4 S. 1 BGB kein Raum.225 Auch gefährde eine Billigkeitskontrolle das Konzept der Mitbestimmung und unterlaufe § 76 Abs. 5 S. 4 BetrVG, der eine Ermessenskontrolle nur auf Antrag der Betriebspartner hinsichtlich eines Einigungsstellenspruchs vorsehe.226 Das Bundesarbeitsgericht hält sich demgegenüber zu Recht für befugt, Betriebsvereinbarungen nicht nur einer Rechtskontrolle, sondern einer umfassenden Billigkeitskontrolle zu unterziehen. Es misst das Regelungsziel und die Mittel zu seiner Erreichung am Maßstab der Billigkeit (abstrakte Billigkeitskontrolle) und prüft nach, ob die Regelung im Einzelfall unbillige Wirkungen entfaltet (konkrete Billigkeitskontrolle).227 Formal spricht für eine Billigkeitskontrolle der Wortlaut des § 75 Abs. 1 S. 1 BetrVG („Recht und Billigkeit“). Materiell ist der Umstand anzuführen, dass die Zustimmung des Einzelnen zumindest stark verdünnt ist und es daher einer solchen zusätzlichen Sicherung bedarf.228 Auch § 310 Abs. 4 S. 1 BGB steht dem nicht entgegen, da privat gesetzte Regeln unabhängig von einer 224 Vgl. Kreutz, in: Wiese u.a. (Hrsg.), GK-BetrVG, § 77 Rn. 324 ff. m.w.N.; Matthes, in: Richardi u.a. (Hrsg.), Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht, Bd. 2, § 239 Rn. 85 ff.; näher dazu Richardi, in: Richardi (Hrsg.), BetrVG, § 77 Rn. 117 ff. Junker, Grundkurs Arbeitsrecht, Rn. 724 weist zu Recht darauf hin, dass der Meinungsstreit für die Praxis wenig Bedeutung hat, da das BAG unter dem Etikett „Recht und Billigkeit“ in der Regel eine Rechts- und keine Billigkeitskontrolle vornimmt. 225 Vgl. Hromadka/Maschmann, Arbeitsrecht, Bd. 2, Rn. 399 f., die diese Haltung auch dem BAG unter Verweis auf BAG NZA 2006, 563, 565 unterstellen. Ein solcher Aussagegehalt ist der zitierten Entscheidung aber nicht zu entnehmen. 226 Vgl. Matthes, in: Richardi u.a. (Hrsg.), Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht, Bd. 2, § 239 Rn. 87. 227 BAG AP Nr. 11 und 12 zu § 112 BetrVG 1972; BAG AP Nr. 1 und 9 zu § 1 BetrAVG Ablösung; aus der Literatur vgl. etwa Buck-Heeb/Dieckmann, Selbstregulierung im Privatrecht, S. 206 f.; kritisch Zöllner/Loritz/Hergenröder, Arbeitsrecht, § 50 Rn. 48. 228 Siehe auch BAG AP Nr. 1 zu § 242 BGB Ruhegehalt-Unterstützungskassen: Ein Vertragswerk, das nicht zwischen den Beteiligten im Wege eines gegenseitigen Interessenausgleichs ausgehandelt, sondern praktisch vom Arbeitgeber allein festgelegt wird (gestörte Vertragsparität), muss sich eine Korrektur nach Billigkeitsgründen gefallen lassen.
§ 12 Praktische Erprobung des Legitimationsmodells
167
AGB-Kontrolle über die zivilrechtlichen Generalklauseln (§§ 138, 242 BGB) einer Inhaltskontrolle unterliegen.229 cc) Günstigkeitsprinzip Zu guter Letzt nimmt die ganz herrschende Meinung – obwohl das Gesetz anders als beim Tarifvertrag eine entsprechende Bestimmung nicht enthält – an, dass das Günstigkeitsprinzip auch für die Betriebsvereinbarung gilt.230 Durch Einzelarbeitsvertrag kann also von Regelungen der Betriebsvereinbarung zugunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden. 8. Gewohnheitsrecht, Verkehrssitte und Handelsbrauch Schließlich lassen sich auch Gewohnheitsrecht, Verkehrssitte und Handelsbrauch in das entworfene Legitimationsmodell einpassen. Zwar hängen deren rechtliche Wirkungen nicht davon ab, dass der Einzelne seine individuelle Zustimmung erteilt hat.231 Vielmehr geht deren Geltung auf eine abstrakt und zuvor gebildete allgemeine Akzeptanz der betroffenen Verkehrskreise zurück. Ferner gibt es im Unterschied zu sonstigen Regelwerken auf den ersten Blick keine prozeduralen Vorgaben, die die Gerechtigkeit der Regel absichern. Tatsächlich verbürgt aber schon das Erfordernis einer tatsächlichen, lang andauernden Übung aus sich heraus eine gewisse Gerechtigkeitsgewähr. Anders als bei bewusst gesetzten privaten Regeln, bei denen auf künstliche Weise für ein gerechtes Ergebnis gesorgt wird, ist dies hier gleichsam auf natürliche Weise gewährleistet.232 Der Gefahr, dass sich bei der Herausbildung der genannten Regeln einzelne Interessen einseitig durchsetzen,233 ist dadurch entgegengewirkt, dass für die Anerkennung derartiger Regeln Freiwilligkeit im Sinne tatsächlicher Anerkennung durch die betroffenen Verkehrskreise gefordert wird. Regeln, die sich lediglich unter dem Druck wirtschaftlicher Übermacht durchsetzen, bleiben dadurch außen vor.234 Des Weiteren enthalten sie ein Element der Gerechtigkeit i.S.d. Gleichbehandlung, da grundsätzlich – besondere Abreden oder Umstände ausgenommen – niemand erwarten kann, dass für ihn andere Vertragsbedingungen gelten als die üblichen.235
So zutreffend Buck-Heeb/Dieckmann, Selbstregulierung im Privatrecht, S. 207. etwa Dütz/Thüsing, Arbeitsrecht, Rn. 922; Richardi, in: Richardi (Hrsg.), BetrVG, § 77 Rn. 141 ff.; Zöllner/Loritz/Hergenröder, Arbeitsrecht, § 50 Rn. 24. 231 Vgl. Bachmann, Private Ordnung, S. 333 in Bezug auf das Gewohnheitsrecht. 232 So treffend Bachmann, Private Ordnung, S. 349 in Bezug auf die Verkehrssitte. 233 Vgl. dazu Oertmann, Rechtsordnung und Verkehrssitte, S. 376 f., 395, 417. 234 Bachmann, Private Ordnung, S. 350; Canaris, Handelsrecht, § 22 I 2 a; Koller, in: Staub, HGB, § 346 Rn. 9 ff.; Sonnenberger, Verkehrssitten im Schuldvertrag, S. 89. 235 In Bezug auf Handelsbräuche Canaris, Handelsrecht, § 22 I 1 b. 229
230 Vgl.
168
3. Teil: Legitimation privater Regeln
Eine Gerechtigkeitsgewähr bietet schließlich der Umstand, dass der Anwendung der Regeln im Einzelfall eine gerichtliche „Einbeziehungskontrolle“ vorausgeht. Beim Gewohnheitsrecht erfolgt diese dergestalt, dass es heute praktisch ausschließlich in der Erscheinungsform eines festen Gerichtsgebrauchs besteht.236 Ob ein gewohnheitsrechtlicher Rechtssatz besteht und was genau sein Inhalt ist, wird damit erst durch die Gerichte verbindlich entschieden.237 Bei der Verkehrssitte und dem Handelsbrauch erfolgt die „Einbeziehungskontrolle“ dadurch, ihre Beachtlichkeit vorausgesetzt, dass sie mit den Grundsätzen von Treu und Glauben in Einklang stehen (vgl. § 242 BGB, § 346 HGB).238
II. Legitimation mittelbarer Rechtswirkungen 1. Vorüberlegungen Im Folgenden ist darauf einzugehen, inwieweit die rechtlichen Wirkungen der Regelwerke der zweiten Systematisierungsstufe mithilfe des entworfenen Legitimationsmodells erklärt werden können. Diese entfalten rechtliche Wirkungen erst über einen richterlichen Rezeptionsakt und sind damit lediglich mittelbar verbindlich für die Regelbetroffenen. Aufgrund der lediglich mittelbaren rechtlichen Wirkungen ist das einzuhaltende Legitimationsniveau dieser Regelwerke von vornherein geringer einzustufen als bei den unmittelbar verbindlichen Regelwerken der dritten Systematisierungsstufe. Gleichwohl sind die Rechtswirkungen dieser Regelwerke nicht unbedenklich. Die mittelbare Bindungswirkung dieser Regelwerke lässt sich typischerweise nicht über einen (verdünnten) Zustimmungsakt der Regeladressaten legitimieren. Auch treten bei dieser modernen Form privater Regelsetzung als Regelsetzer keine breiten Handels- und Wirtschaftskreise in Erscheinung, die für eine gewisse Authentizität sorgen, sondern oftmals kleine, korporatistisch organisierte Expertengruppen, die den Anspruch erheben, „richtige“ Regeln für eine große Adressatenzahl zu erzeugen.239 Legitimieren lassen sich diese Regeln nur dann, wenn sie Gewähr dafür bieten, gerecht zu sein. Dies kann der Staat im Rahmen seiner legitimatorischen Gewährleistungsverantwortung zunächst durch flankierende Vorgaben, insbesondere organisations- und verfahrensrechtlicher Art, verbürgen, namentlich indem er sicherstellt, dass die Regeln in einem rationalen, expertengeleiteten und repräsentativen 236 Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie, Rn. 232; vgl. auch Bachmann, Private Ordnung, S. 333. 237 Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie, Rn. 233. 238 Ausführlich dazu Bachmann, Private Ordnung, S. 350. 239 Vgl. Merkt, in: Assmann u.a. (Hrsg.), Markt und Staat in einer globalisierten Wirtschaft, S. 169, 183 f., der auch dabei entstehende Risiken aus politikwissenschaftlicher und ökonomischer Perspektive anführt.
§ 12 Praktische Erprobung des Legitimationsmodells
169
Verfahren entwickelt werden.240 Diese sogleich im Einzelnen zu untersuchenden Voraussetzungen stellen sich gewissermaßen als „Anwendungsvoraussetzungen“ der mittelbar verbindlichen Regelwerke dar. Daneben ist zu konstatieren, dass der Anwendung der mittelbar verbindlichen Regelwerke stets eine Entscheidung der Gerichte vorausgeht. Auch insoweit hat der Staat seiner Legitimationsverantwortung gerecht zu werden, indem er dafür Sorge zu tragen hat, dass die Gerichte private Regelwerke nur rezipieren, wenn diese bestimmte Legitimationsmuster einhalten und diese zugleich einer inhaltlichen Plausibilitätskontrolle unterziehen. 2. Technische Normen a) DIN-Normen als Paradebeispiel aa) Legitimation durch staatliche Organisations- und Verfahrensvorgaben Vorbildlich veranschaulichen lässt sich das Zusammenspiel einer Legitimation durch staatliche Organisations- und Verfahrensvorgaben sowie einer inhaltlichen Plausibilitätskontrolle durch die Gerichte am Beispiel der DIN-Normen. Wie im zweiten Teil der Arbeit dargelegt, werden die DIN-Normen von den Gerichten namentlich zur Konkretisierung der „allgemein anerkannten Regeln der Technik“ herangezogen.241 Der Staat kommt seiner Verpflichtung, die Gerechtigkeit der Regel durch ein gewisses Maß an Organisation und Verfahren zu fördern, hier durch den zwischen der Bundesregierung, vertreten durch das Bundesministerium der Wirtschaft, und dem DIN geschlossenen DIN-Vertrag nach. In diesem erkennt die Bundesregierung das DIN als zuständige Normenorganisation an (§ 1 Abs. 1 DIN-Vertrag) und erklärt sich bereit, neu erschienene DIN-Normen und DIN-Norm-Entwürfe im Bundesanzeiger zu veröffentlichen (§ 9 des DIN-Vertrag). Im Gegenzug verpflichtet sich das DIN, bei seinen Normungsarbeiten das öffentliche Interesse zu berücksichtigen, der Bundesregierung auf Antrag einen Sitz in den Lenkungsgremien der Normenausschüsse einzuräumen, behördliche Stellen zu beteiligen sowie über das Normgeschehen zu informieren (§§ 1 Abs. 2 S. 1, 2 Abs. 1 und Abs. 2, 5 Abs. 1 DIN-Vertrag).242 Zugleich verpflichtet sich das DIN, die DIN 820 einzuhalten (§ 3 S. 1, 2 DIN-Vertrag).243 Diese beinhaltet Organisations- und Verfahrensregelun240 Hommelhoff/M. Schwab, in: FS Kruse, S. 693, 699 f.; zur Gewährleistungsverantwortung des Staates vgl. etwa Schmidt-Preuß, VVDStRL 56 (1997), 160, 203 ff.; Schuppert/Bumke, in: Kleindiek/Oehler (Hrsg.), Die Zukunft des deutschen Bilanzrechts, S. 71, 113 ff.; zur Forderung materiell-rechtlicher Vorgaben vgl. Hellermann, NZG 2000, 1097, 1103; Hommelhoff/M. Schwab, BFuP 1998, 38, 47 f.; kritisch dazu Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 100 f. 241 Ausführlich dazu oben § 7 II. 2. b). 242 Zur Wahrung des öffentlichen Interesses vgl. auch § 1 Abs. 2 DIN-Satzung. 243 Vgl. auch die Verpflichtung auf die DIN 820 in § 1 Abs. 3 S. 2 DIN-Satzung.
170
3. Teil: Legitimation privater Regeln
gen, die Aufgaben, Arbeitsweise und Finanzierung der Normenausschüsse detailliert niederlegen und dem Ziel dienen, materielle und immaterielle Gegenstände zum Nutzen der Allgemeinheit planmäßig durch die interessierten Kreise gemeinschaftlich zu vereinheitlichen und dabei wirtschaftliche Sondervorteile Einzelner zu vermeiden (vgl. DIN 820 Teil 1 Abschnitt 4244).245 Legitimierend wirkt hier in erster Linie, dass die DIN 820 für ein fachkompetentes und ausgewogen besetztes Gremium sowie ein transparentes und geordnetes Regelsetzungsverfahren Sorge trägt, das der Fachöffentlichkeit die Möglichkeit gibt, Stellungnahmen abzugeben, und auf Erörterung und eine ausgewogene Interessenrepräsentanz angelegt ist.246 So ist vorgesehen, dass das Normungsverfahren durch einen Antrag eingeleitet wird, den jedermann stellen kann (DIN 820 Teil 1 Abschnitt 7.1). Wird diesem stattgegeben, sollen in den jeweils zuständigen Arbeitsausschüssen Normentwürfe erarbeitet werden (DIN 820 Teil 1 Abschnitt 5.3). Die Fachausschüsse sind mit ehrenamtlichen Fachleuten aus den interessierten Kreisen besetzt, die in einem angemessenen Verhältnis vertreten sein sollen (z.B. Anwender, Behörden, Berufsgenossenschaften, Berufs-, Fach- und Hochschulen, Handel, Handwerkswirtschaft, industrielle Hersteller, Prüfinstitute, Sachversicherer, selbstständige Sachverständige, Technische Überwacher, Verbraucher, Wissenschaft) (DIN 820 Teil 1 Abschnitt 5.4). Die Fachleute müssen von den sie entsendenden Stellen (z.B. Ausbildungs- und Forschungseinrichtungen, Firmen, Verbänden etc.) für die Arbeit in den Arbeits- und Lenkungsgremien autorisiert und entscheidungsbefugt sein (DIN 820 Teil 1 Abschnitt 5.4). Unterstützt werden die ehrenamtlichen Fachleute von hauptamtlichen Bearbeitern des DIN und seiner Normenausschüsse (DIN 820 Teil 1 Abschnitt 5.4). Der vom jeweiligen Ausschuss erarbeitete Normentwurf ist, nachdem er durch die Normenprüfstelle geprüft wurde, in für jedermann erhältlichen Publikationsmitteln (DIN-Anzeiger) der Öffentlichkeit mit einer bestimmten Frist zur Stellungnahme zu publizieren (DIN 820 Teil 1 Abschnitt 7.3; DIN 820 Teil 4 Abschnitt 4. 4. 1.1, 4. 4. 1.2, 4. 4. 1.3247). Nach Fristablauf soll der Ausschuss unter Anhörung derjenigen, die Stellung genommen haben, erneut beraten (DIN 820 Teil 4 Abschnitt 4. 4. 1.5). Bei unterbliebener Abhilfe eines Einspruchs soll sich ein Schlichtungs- und Schiedsverfahren anschließen können (DIN 820 Teil 4 Abschnitt 5). Sodann wird der Entwurf, wenn er nicht gestrichen wird, veröffentlicht, verabschiedet und als gedrucktes Regelblatt im Fachverlag allgemein zugänglich gemacht (DIN 820 Teil 4 Abschnitt 11). Zugleich ist vorgesehen, dass die Regeln grundsätzlich alle fünf Jahre überprüft, gegebenenfalls überarbeitet oder zurückgezogen werden sollen (DIN 820 Teil 4 Abschnitt 7). 244
DIN 820 Teil 1: Normungsarbeit – Grundsätze, Ausgabe Juni 2014. Normungsverfahren vgl. Lübbe-Wolff, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Konfliktbewältigung, S. 87, 101 ff.; Marburger, Regeln der Technik, S. 202 ff.; Reihlen, in: Kloepfer (Hrsg.), Selbst-Beherrschung, S. 75, 77 ff. 246 Vgl. Marburger, Regeln der Technik, S. 464; ders., VersR 1983, 597, 602. 247 DIN 820 Teil 4: Normungsarbeit – Geschäftsgang, Ausgabe Juni 2014. 245 Zum
§ 12 Praktische Erprobung des Legitimationsmodells
171
Dass das DIN bei dem skizzierten Prozedere unabhängig agieren kann, gewährleistet seine weitgehend unabhängige Finanzierung. Das DIN finanziert sich zu 71 % aus eigenen Erträgen, die über die angebotenen Dienstleistungen und Produkte erwirtschaftet werden; lediglich 13 % der Vereinnahmungen sind Projektmittel der Wirtschaft, weitere 10 % Projektmittel der öffentlichen Hand und 6 % werden aus Mitgliedsbeiträgen erzielt.248 bb) Legitimation durch richterliche Einzelfallkontrolle Vervollständigt wird die Legitimation dadurch, dass die Gerichte stets zu prüfen haben, ob die DIN-Normen im konkreten Fall zur Konkretisierung herangezogen werden können, was etwa dann zu verneinen ist, wenn sie überholt, unsachgerecht oder aus sonstigen Gründen im Einzelfall als Maßstab ungeeignet erscheinen.249 Ein abweichendes Judiz ist sowohl „nach oben“ als auch „nach unten“ möglich. b) Legitimation sonstiger technischer Normen Auch andere private Normungsorganisationen wie etwa der VDI verfügen über Organisations- und Verfahrensanforderungen, die im Wesentlichen mit der in der DIN 820 festgelegten übereinstimmen.250 Die mittelbaren rechtlichen Wirkungen, die von diesen Regelwerken ausgehen, legitimieren sich daher nach dem gleichen Muster. 3. Quantifizierungen a) Unterhaltstabellen Auch die sog. Quantifizierungen lassen sich mithilfe organisations- und verfahrensrechtlicher Komponenten sowie der richterlichen Einzelfallkontrolle legitimieren. Weitgehend unproblematisch gelingt dies bei den sog. Unterhaltstabellen, die von den Familiensenaten der Oberlandesgerichte erarbeitet werden. Hier fehlt es zwar an einer interessenpluralistischen Besetzung im klassischen Sinne. Eine solche ist hier aber deshalb obsolet, weil das Richteramt aus sich heraus Objektivität und Neutralität verbürgt, gleichsam also verschiedene Interessen in sich vereint.251 Zugleich verfügen die Richter der Familiensenate als Regelsetzer durch ihre richterliche Tätigkeit über ein hohes Maß an Konkretisierungserfahrung.252 Die Aktu248 Vgl. Homepage des DIN, Finanzierung, abrufbar unter: http://www.din.de/de/dinund-seine-partner/din-e-v/finanzierung (zuletzt abgerufen am 12. 10. 2016). 249 Vgl. dazu die Rechtsprechungsnachweise in 2. Teil, Fn. 69. 250 Vgl. VDI 1000: Richtlinienarbeit – Grundsätze und Anleitungen. 251 So auch Röthel, Normkonkretisierung im Privatrecht, S. 293 f. 252 Siehe Röthel, Normkonkretisierung im Privatrecht, S. 293 und zur ansonsten teilweise fehlenden Konkretisierungserfahrung der Rechtsprechung anhand von Beispielen S. 244 f.
172
3. Teil: Legitimation privater Regeln
alität der Unterhaltstabellen ist dadurch sichergestellt, dass sie durchschnittlich in einem Turnus von zwei Jahren überarbeitet und neugefasst werden.253 Die richterliche Einzelfallkontrolle bleibt dadurch gewährleistet, dass der Richter nicht gebunden ist, die Tabellenwerke im Rahmen der Unterhaltsbemessung heranzuziehen. Vielmehr steht es ihm in den Grenzen der Rechtsanwendungsgleichheit und des Vertrauensschutzes frei, ob er auf diese zur Konkretisierung des angemessenen Unterhalts als Navigationshilfe rekurriert,254 sodass im Grundsatz eine Anwendungskontrolle im Einzelfall stattfindet. b) Berufs- und Standesregeln Problematischer gestaltet sich die Legitimation von Quantifizierungen durch Berufsvereinigungen. Denn es liegt gerade in der Natur berufsständischer Regeln, ein Abbild dessen zu sein, was für den jeweiligen Berufsstand zweckdienlich erscheint. So sind beispielsweise bei den Empfehlungen des Deutschen Notarvereins aus dem Jahr 2000 gegenläufige bzw. betroffene Interessen wie die der Erben in dem regelsetzenden Gremium nicht repräsentiert. Auch die Aktualität dieser Regeln ist zweifelhaft. So wurde die „Rheinische Tabelle“, die zuletzt im Jahr 1925 aktualisiert wurde, zwar durch die Empfehlungen des Deutschen Notarvereins aus dem Jahr 2000, die sich als Fortsetzung derselben begreifen, runderneuert.255 Eine regelmäßige Anpassung binnen kürzerer Jahresfristen findet aber nicht statt. Diesen Legitimationsdefiziten kann allerdings durch eine strenge Handhabe des vom Bundesgerichtshof aufgestellten Leitsatzes, wonach sich ein von den Einzelfallumständen absehender Schematismus verbietet, Rechnung getragen werden 256. Danach ist es für die Gerichte unter Umständen angezeigt, bei den vorgeschlagenen Vergütungen des Deutschen Notarvereins gewisse Abschläge vorzunehmen, wenn die vorgeschlagenen Vergütungssätze aus berufsständischem Eigeninteresse im Einzelfall als zu hoch bemessen oder nicht zeitgemäß erscheinen.257 4. Keine hinreichende Legitimation der IDW PS Eine restriktive Gangart ist auch bei der Rezeption der IDW PS veranlasst. Eine organisations- bzw. verfahrensrechtliche Absicherung der Legitimation sucht man Röthel, Normkonkretisierung im Privatrecht, S. 294. Köhler, in: FS für Rebmann, S. 569, 589; Bedenken an dieser Freiheit des Tat richters bei Diedrich, Unterhaltsberechnung nach Quoten und Tabellen, S. 80; hiergegen aber zu Recht Röthel, Normkonkretisierung im Privatrecht, S. 293 Fn. 344, die diese Bedenken damit entkräftet, dass de facto nicht die Tabellenwerke die Rezeptionsfreiheit des Richters begrenzten, sondern der Instanzenzug, dessen Autorität in jeder untergerichtlichen Entscheidung mitschwingen würde; zur Disziplinierung der Amtsgerichte vgl. auch Klingelhöffer, ZRP 1994, 383, 384. 255 Zur Problematik der Aktualität Röthel, Normkonkretisierung im Privatrecht, S. 276 f. 256 Vgl. BGH NJW 1967, 2400, 2401. 257 Röthel, Normkonkretisierung im Privatrecht, S. 276. 253
254 Vgl.
§ 12 Praktische Erprobung des Legitimationsmodells
173
hier vergeblich, sodass die derzeit bestehende praktische Wirkmächtigkeit der IDW PS zu Recht als bedenklich eingestuft wird.258 Anders als etwa das DIN, das sich im Normenvertrag ausdrücklich dazu verpflichtet, das öffentliche Interesse zu beachten, ist das IDW als Interessenverband der deutschen Wirtschaftsprüfer weder unabhängig noch werden die Standards und Stellungnahmen in einem offenen Verfahren verabschiedet. Die Fachausschüsse des IDW können lediglich fakultativ mit Hochschullehrern und anderen externen Sachverständigen, die keine Mitglieder des IDW sind, besetzt werden (vgl. § 12 Abs. 3 IDW-Satzung). Auch dem zwecks gemeinsamer Erörterung grundsätzlicher Fachfragen gebildeten Großen Fachrat müssen Vertreter der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Behörden und des Berufs nicht zwingend angehören (vgl. § 13 IDW-Satzung). Die Bedenken erhärten sich, wenn man § 342a HGB in die Betrachtung mit einbezieht.259 Die Vorschrift sieht für den Fall, dass das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz kein privates Rechnungslegungsgremium i.S.d. § 342 Abs. 1 HGB ermächtigt hat, vor, dass ein Rechnungslegungsbeirat mit entsprechenden Aufgaben und Kompetenzen beim Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz gebildet wird (vgl. § 342a Abs. 1, 9 HGB). § 342a Abs. 2 HGB schreibt sodann vor, dass sich dieser Rechnungslegungsbeirat zusammensetzt aus einem Vertreter des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz als Vorsitzendem sowie je einem Vertreter des Bundesministeriums der Finanzen und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, vier Vertretern von Unternehmen, vier Vertretern von wirtschaftsprüfenden Berufen und zwei Vertretern der Hochschulen. § 342a Abs. 2 HGB soll damit gerade sicherstellen, dass die Wirtschaftsprüfer nicht unkontrolliert über die von den Unternehmen einzuhaltenden Standards entscheiden.260 Dahinter steht die zutreffende Überlegung, dass die institutionelle Unabhängigkeit im Unternehmensrecht von zentraler Bedeutung ist, weil es sich, anders als etwa das Sicherheits- und Umweltrecht mit seinem naturwissenschaftlichen und damit nachprüfbaren Charakter, einer Falsifizierung entzieht.261 Objektivität, Sachkunde und Unabhängigkeit müssen gerade hier hochgehalten werden.262 Da das IDW weder organisatorisch noch von der Ausgestaltung des Normsetzungsprozesses her Gewähr dafür bietet, dass die von ihm erlassenen Regeln das Ergebnis eines objektiven, sachkundigen und interessenpluralen Normaufstellungsprozesses sind, gilt es, seine mittelbaren rechtlichen Wirkungen dementsprechend möglichst gering zu halten.263 Solange es an alternativen Regeln zur Maßstabsbildung mangelt, wird den Richtern ein Rückgriff auf die Regeln allerdings Giebeler/Jaspers, Risikomanagement, S. 26. So auch Giebeler/Jaspers, Risikomanagement, S. 26. 260 Giebeler/Jaspers, Risikomanagement, S. 26. 261 Giebeler/Jaspers, Risikomanagement, S. 27. 262 Giebeler/Jaspers, Risikomanagement, S. 27. 263 Allgemein zu Reaktionsmöglichkeiten des Staates vgl. Giebeler/Jaspers, Risikomanagement, S. 27 ff. 258 Vgl. 259
174
3. Teil: Legitimation privater Regeln
nicht gänzlich versagt werden können. Insoweit darf man aber nicht müde werden, zu betonen, dass die IDW PS lediglich als bloße „Klugheitsregeln“ verstanden werden dürfen. Als feststehende Referenzpunkte zur Ausfüllung unbestimmter Rechtsbegriffe dürfen die Gerichte sie nicht heranziehen. 5. Defizite auch beim Deutschen Corporate Governance Kodex a) Staatsrechtliche Perspektive: Wesentlichkeitstheorie Als problematisch erweist sich die Legitimation des Regelungskonzepts um den Deutschen Corporate Governance Kodex. Hier gilt es zunächst zu erkennen, dass die Kodexvorgaben als solche, d.h., wenn man sie isoliert betrachtet, keiner Legitimation bedürfen. Denn rechtliche Wirkungen gehen von ihnen insoweit nicht aus.264 Sprengkraft entfalten die Kodexempfehlungen aber im Zusammenspiel mit § 161 AktG. Aus dem in § 161 AktG enthaltenen Comply-or-explain-Mechanismus erwächst nämlich eine faktische Verpflichtung, den Kodexempfehlungen Folge zu leisten.265 Zugleich erfahren die Kodexempfehlungen eine Verrechtlichung, indem die Rechtsprechung bei der Frage, inwieweit die Verletzung der Erklärungspflicht einen eindeutigen und gravierenden Gesetzesverstoß und damit die Anfechtbarkeit eines Entlastungsbeschlusses begründen kann, auf den konkreten Inhalt der Kodexbestimmung Bezug nimmt.266 Aus staatsrechtlicher Perspektive stellt sich hier zunächst die Frage, ob der Staat mit dem aufgezeigten Regelungsmechanismus den Vorgaben der Wesentlichkeitstheorie gerecht wird, wonach der Parlamentsgesetzgeber in grundrechtsrelevanten Bereichen die wesentlichen Entscheidungen selbst zu treffen hat, die Regulierung also nicht untergesetzlichen oder außerstaatlichen Stellen überlassen darf.267 Denn § 161 AktG enthält weder organisations- noch verfahrensrechtliche Vorgaben.268 Auch die materielle Zielvorgabe, die das Gesetz der Kodexkommission setzt, ist äußerst unbestimmt. Unter die Zielvorgabe „Corporate Governance“ lässt sich eine Vielzahl denkbarer Empfehlungsinhalte subsumieren.269 264
Siehe dazu oben § 7 V. 2. Siehe oben § 7 V. 3. a). 266 Siehe oben § 7 V. 3. c) bb). 267 Einen Verstoß gegen die Wesentlichkeitstheorie annehmend etwa Hoffmann-Becking, in: FS Hüffer, S. 337, 342 ff.; Koch, in: Hüffer/Koch, AktG, § 161 Rn. 4; Mülbert/Wilhelm, ZHR 176 (2012), 286, 318 ff.; Wernsmann/Gatzka, NZG 2011, 1001, 1007; Wolf, ZRP 2002, 59, 60; a.A. etwa Bachmann, WM 2002, 2137, 2142; Habersack, Gutachten 69. DJT, E 53 f.; Hanfland, Haftungsrisiken, S. 126 ff.; Heintzen, ZIP 2004, 1933, 1936; implizit BGHZ 180, 9 Rn. 18 f. = NJW 2009, 2207 (Kirch/Deutsche Bank); BGHZ 182, 272 Rn. 16 = NZG 2009, 1270 (Umschreibungsstopp). 268 Vgl. Hoffmann-Becking, in: FS Hüffer, S. 337, 343; Hommelhoff/M. Schwab, in: Hommelhoff u.a. (Hrsg.), Handbuch Corporate Goverance, S. 71, 83 f.; Spindler, in: K Schmidt/Lutter (Hrsg.), AktG, § 161 Rn. 11. 269 Zu diesem Aspekt siehe Mülbert/Wilhelm, ZHR 176 (2012), 286, 320 ff.; zum Begriff Corporate Governance vgl. Hopt, ZHR 175 (2011), 444, 448 ff. 265
§ 12 Praktische Erprobung des Legitimationsmodells
175
Derartige Bedenken scheinen überzogen, soweit die rein faktische Bindungswirkung der Kodexvorgaben in Rede steht. Zwar ist der Regelungsbereich der Corporate Governance von grundlegender Bedeutung für die Unternehmensführung. Der bloße Marktdruck, den sich der Staat gewissermaßen zunutze macht, ist aber wesentlich geringer einzustufen als die Bindungswirkungen anderer Regeln, bei denen die Wesentlichkeitstheorie den Gesetzgeber dazu anhält, das Wesentliche selbst zu regeln. Letztlich belässt der Gesetzgeber den Unternehmen die Entscheidung ihrer Positionierung im Wettbewerb und schafft lediglich einen Informationskanal, mithilfe dessen die Unternehmen ihr Corporate-Governance-Verhalten im Vergleich zu anderen Unternehmen kommunizieren können.270 Dieser bloß faktische und vergleichsweise geringe Befolgungsdruck rechtfertigt es, im Hinblick auf die Wesentlichkeitstheorie weniger strenge Anforderungen zu stellen.271 Nicht mehr aufrechterhalten lässt sich diese Argumentation freilich, soweit die mittelbaren rechtlichen Wirkungen der Kodexempfehlungen in Rede stehen. Auch wenn deren Anwendung der Rechtsprechung durch den Regelungsmechanismus nicht zwingend vorgeschrieben ist, sondern von dieser schlicht praktiziert wird, lässt sich insoweit der Ruf nach Korrekturen nachvollziehen. Diese hätten dahingehend zu erfolgen, dass entweder eine Entrechtlichung der Kodexempfehlungen stattfände, sei es durch gesetzgeberisches Tätigwerden272 oder schlichte Änderung der Rechtsprechungspraxis, oder dass der Gesetzgeber seiner Verpflichtung zur Regelung des Wesentlichen nachkommt und § 161 AktG dementsprechend ergänzt.273 b) Hinreichende zivilistische Legitimation Eine andere Frage ist, inwieweit sich die mittelbaren Bindungswirkungen der Kodexempfehlungen aus zivilistischer Perspektive legitimieren lassen. Insofern wäre es verfehlt, die Bindung an die Kodexempfehlungen schlankerhand damit zu erklären, dass die betroffenen Unternehmen diesen mit Abgabe einer positiven Entsprechenserklärung „zugestimmt“ haben. Denn angesichts des faktischen Drucks, den Kodexempfehlungen Folge zu leisten, ist die „Zustimmung“ jedenfalls verdünnt. Wie bei den anderen Regelwerken mit mittelbaren rechtlichen Wirkungen kann die Legitimation hier nur dadurch geleistet werden, dass die erlassenen Regeln gerecht erscheinen. Auch wenn Organisations- und Verfahrensvorgaben zur Erarbeitung der Kodexempfehlungen weder gesetzlich noch vertraglich fixiert sind, haben sich hier Leyens, in: GroßKomm AktG, § 161 Rn. 60. So auch Bachmann, WM 2002, 2137, 2142; Hanfland, Haftungsrisiken, S. 128. 272 Für einen gesetzlichen Ausschluss der Anfechtungsmöglichkeit etwa Krieger, ZGR 2012, 202, 227; Peltzer, NZG 2011, 961, 968; Waclawik, ZIP 2011, 885, 891; für eine Streichung des § 161 AktG Timm, ZIP 2010, 2125, 2128, 2133. 273 Für eine gesetzliche Festschreibung von Organisations- und Verfahrensfragen in § 161 AktG etwa Habersack, Gutachten 69. DJT, E 54; Krieger, ZGR 2012, 202, 226; Möllers/Fekonja, ZGR 2012, 777, 784. 270 271
176
3. Teil: Legitimation privater Regeln
ähnliche Organisations- und Verfahrensgrundsätze wie etwa bei den DIN-Normen herausgebildet. So ist die Kodexkommission mit qualifizierten Fachleuten aus verschiedenen Kreisen der Wissenschaft und der Wirtschaft besetzt, die als sog. „Standing Commission“ vor dem Hintergrund nationaler und internationaler Entwicklungen laufend die Inhalte des Kodex prüfen und bei Bedarf einmal jährlich über etwaige Änderungen entscheiden.274 Konkret finden sich in dem derzeit 15-köpfigen Expertengremium Vertreter börsennotierter Gesellschaften verschiedener Wirtschaftszweige mit unterschiedlicher Größe, institutioneller und privater Anleger, der Wirtschaftsprüfer, der Arbeitnehmer, der Wissenschaft und der Börse.275 Das Verfahren der Regelaufstellung gewährleistet Transparenz und Publizität. Die Öffentlichkeit wurde und wird stets über Regelungsvorhaben, Entwürfe und die gültige Fassung des Kodex informiert.276 Um die Transparenz der Arbeit der Kodexkommission weiter zu verbessern und die Akzeptanz des Kodex zu erhöhen, wird seit dem Jahr 2012 ein Konsultationsverfahren durchgeführt, in dessen Rahmen konkrete Formulierungsvorschläge für Kodexänderungen vorab veröffentlicht werden und interessierten Verkehrskreisen die Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben wird.277 Die Stellungnahmen sollen sodann in die Beratungen der Kommission einfließen. Die jeweils gültige Fassung des Kodex wird schließlich im elektronischen Teil des Bundesanzeigers veröffentlicht. In gewisser Weise behält der Staat Einfluss auf die Regelsetzung durch die Kodexkommission.278 So wirkt er präventiv auf den Prozess der Regelaufstellung ein, indem das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz in Absprache mit dem Bundeskanzleramt die Mitglieder der Kodexkommission auswählt und diese bei ihrer Arbeit zugleich vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz beraten und betreut werden.279 Des Weiteren behält sich der Staat eine inhaltliche Prüfung der Kodexbestimmungen vor, indem das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz über die Veröffentlichung der jeweiligen Kodexfassung im elektronischen Teil des Bundesanzeigers entscheidet und diese in diesem Rahmen einer Rechtskontrolle unterwirft.280 Gegenstand der Prüfung ist die Vereinbarkeit der Kodexregeln mit dem geltenden Recht, die Ausarbeitung in einem fairen Verfahren unter Beteiligung der betroffenen Kreise sowie die inhalt 274 Vgl. Präambel des Kodex; ferner Bachmann, in: Kremer u.a. (Hrsg.), DCGK, Vorbem. Rn. 29. 275 Zur Zusammensetzung der Kodexkommission vgl. die Angaben auf der Homepage des DCGK, abrufbar unter: http://www.dcgk.de/de/kommission/mitglieder.html (zuletzt abgerufen am 12. 10. 2016). 276 Vgl. auch Bertrams, Haftung des Aufsichtsrats, S. 204. 277 Vgl. dazu Bachmann, AG 2012, 565, 567 f.; DAV-Handelsrechtsausschuss, NGZ 2012, 335; Krieger, ZGR 2012, 202, 214. 278 Ausführlich Bertrams, Haftung des Aufsichtsrats, S. 194 ff. 279 Bertrams, Haftung des Aufsichtsrats, S. 195 f.; Seibert, BB 2002, 581, 582. 280 Vgl. Bertrams, Haftung des Aufsichtsrats, S. 194; Seibert, BB 2002, 581, 582; ders., NZG 2002, 608, 611.
§ 12 Praktische Erprobung des Legitimationsmodells
177
liche Ausgewogenheit der Kodexempfehlungen.281 Darüber hinaus haben die Gerichte, wenn sie einzelne Kodexempfehlungen in ihre Entscheidung mit einbeziehen, die Anwendungsvoraussetzungen zu prüfen. 6. Gelungene Legitimation der Rechnungslegungsstandards a) Hinreichende gesetzliche Vorgaben Anders als beim Deutschen Corporate Governance Kodex zeigt der Gesetzgeber bei den Rechnungslegungsstandards des DRSC vorbildhaft auf, wie sich die mittelbaren rechtlichen Wirkungen privater Regelwerke durch entsprechende Vorgaben im Gesetz legitimieren lassen: Er hat Organisations- und Verfahrensvorgaben, die die Gerechtigkeit der Regeln des DRSC gewährleisten sollen, unmittelbar in Gesetzesform gegossen und damit die wesentlichen Fragen selbst entschieden.282 So sieht § 342 HGB, der die Rechnungslegungsstandards des DRSC mit einer konkretisierenden Vermutungswirkung ausstattet (vgl. Abs. 2), zugleich materielle und formelle Vorgaben vor, denen der private Regelsetzer der Rechnungslegungsstandards genügen muss. Materiell wird die Vermutungswirkung des § 342 Abs. 2 HGB auf die „die Konzernrechnungslegung betreffenden Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung“ beschränkt. Daneben stellt § 342 Abs. 1 S. 2 HGB Anforderungen organisations- und verfahrensrechtlicher Art dergestalt auf, dass nur eine solche Einrichtung als Regelsetzer anerkannt werden darf, „die aufgrund ihrer Satzung gewährleistet, dass die Empfehlungen unabhängig und ausschließlich von Rechnungslegern in einem Verfahren entwickelt und beschlossen werden, das die fachlich interessierte Öffentlichkeit einbezieht“. b) Konkretisierung durch den Standardisierungsvertrag und Satzung aa) Organisationsrechtliche Vorgaben Im zwischen dem DRSC und dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz geschlossenen Standardisierungsvertrag werden die Vorgaben des § 342 HGB umgesetzt und konkretisiert. In der DRSC-Satzung werden sie weiter abgesichert. Durch § 1 Abs. 1 S. 4, 5 StandV verpflichtet sich das DRSC zunächst allgemein, bei der Erfüllung der übertragenen Aufgaben das öffentliche, insbesondere auch das gesamtwirtschaftliche Interesse zu berücksichtigen und die Belange der Gesetzgebung, der öffentlichen Verwaltung und des Rechtsverkehrs zu beachten.283 Bertrams, Haftung des Aufsichtsrats, S. 194 f.; Seibert, BB 2002, 581, 582. Berberich, Ein Framework für das DRSC, S. 136 f.; Hohl, Private Standardsetzung, S. 318; verbleibende verfassungsrechtliche Zweifel aber bei Hellermann, NZG 2000, 1097, 1102; M. Schwab, in: Staub, HGB, § 342 Rn. 15 ff., 89 ff. 283 Diese Vorgaben konfligieren nicht mit § 2 Abs. 2 S. 1 und 2 DRSC-Satzung, wonach der Verein den „satzungsmäßigen Zielen seiner Mitglieder“ dient und „seinen Zweck als Berufsverband für seine Mitglieder“ erfüllt. Hiergegen spricht schon die heterogene Mit281 Vgl.
282 Vgl.
178
3. Teil: Legitimation privater Regeln
In organisationsrechtlicher Hinsicht ist festgelegt, dass sich das regelsetzende Gremium aus fachlich qualifizierten Rechnungslegern zusammensetzt (vgl. § 342 Abs. 1 S. 2 HGB i.V.m. §§ 6 Abs. 3, 19 Abs. 1 S. 4 DRSC-Satzung).284 Weiter ist vereinbart, dass die Mitglieder der Fachausschüsse ihre Tätigkeit unabhängig und weisungsfrei ausüben (vgl. § 342 Abs. 1 S. 2 HGB i.V.m. § 1 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 StandV; § 19 Abs. 2 S. 1 und 2 DRSC-Satzung).285 Um zu verhindern, dass einzelne Interessengruppen über die Finanzierung des Regelsetzungsgremiums dessen Arbeit beeinflussen, sieht § 1 Abs. 1 S. 3 StandV vor, dass die Regelsetzer die Aufgaben nach § 342 HGB ehrenamtlich, d.h. unentgeltlich wahrnehmen. Die Mitglieder des HGB-Fachausschusses haben gegenüber dem DRSC lediglich einen Anspruch auf Erstattung ihrer Auslagen (vgl. § 13 DRSC-Satzung). Das DRSC wiederum finanziert sich mittlerweile vornehmlich aus Mitgliedsbeiträgen,286 Erlösen aus der Verwertung seiner Arbeit sowie aus Erträgen aus seinen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben (vgl. §§ 2 Abs. 3 S. 3, Abs. 4, 5 DRSC-Satzung).287 Problematisch ist allenfalls, dass eine pluralistische Besetzung im Sinne einer Einbeziehung von Gläubigern, Anlegern sowie Finanzanalysten nicht vorgeschrieben ist, es aber bei der Standardisierungsarbeit des regelsetzenden HGB-Fachauschusses auf Wertungsentscheidungen ankommt, die oftmals interessengesteuert getroffen werden. Hierdurch besteht die Gefahr, dass sich einzelne Partikularinteressen durchsetzen.288 § 4 Abs. 4 StandV und § 19 Abs. 3 S. 1 gliederstruktur, vgl. Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 200 f.; kritisch Ebke, ZIP 1999, 1193, 1197. 284 Zur Bedeutsamkeit persönlicher Qualifikation vgl. Ebke/Paal, in: MüKo HGB, § 342 Rn. 15 m.w.N. 285 § 11 Abs. 2 S. 2 DRSC-Satzung verbietet ausdrücklich Weisungen des Verwaltungsrats an die Fachausschüsse. Siehe auch die vom Verwaltungsrat am 22. 11. 2012 verabschiedeten „Grundsätze und Leitlinien für die Arbeit des DRSC“, abrufbar unter: https://www. drsc.de/docs/press_releases/2012/121122_G+L_FV.pdf (zuletzt abgerufen am 12. 10. 2016), wonach die Mitglieder der Fachausschüsse „ihr Fachwissen unabhängig von Interessen (ihrer Arbeit- oder Auftraggeber, Verbänden, Lobbygruppen etc.) einbringen sollen“, „bei ihrer Arbeit aber durchaus die spezifischen Interessen der unterschiedlichen an der Rechnungslegung beteiligten Parteien im Blick zu halten“ haben; kritisch zur Unabhängigkeit, weil die Ausschussmitglieder ehrenamtlich tätig sind und ihre beruflichen und geschäftlichen Tätigkeiten parallel ausführen, Ebke, ZIP 1999, 1193, 1197 ff.; M. Schwab, in: Staub, HGB, § 342 Rn. 47 f.; entkräftend Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 202 f. 286 Mitglied des DRSC kann jede juristische Person und jede Personenvereinigung werden, die der gesetzlichen Pflicht zur Rechnungslegung unterliegt oder sich mit der Rechnungslegung befasst, vgl. § 4 Abs. 1 S. 1 DRSC-Satzung. 287 Bedenken im Hinblick auf die Staffelung der Mitgliedsbeiträge bei M. Schwab, in: Staub, HGB, § 342 Rn. 78; zum vormaligen Finanzierungsmodell, das an der finanziellen Unabhängigkeit zweifeln ließ, vgl. Ebke, ZIP 1999, 1193, 1199 f.; für eine vollständige oder teilweise Finanzierung durch den Staat Hommelhoff/M. Schwab, in: FS Kruse, 693, 712; Pellens/Bonse/Gassen, DB 1998, 785, 790; M. Schwab, in: Staub, HGB, § 342 Rn. 77. 288 Kritisch insoweit Hommelhoff/M. Schwab, in: FS Kruse, S. 693, 702 ff.; dies., BFuP 1998, 38, 48 ff.; M. Schwab, in: Staub, HGB, § 342 Rn. 53 ff.
§ 12 Praktische Erprobung des Legitimationsmodells
179
DRSC-Satzung sehen aber immerhin vor, dass bei der Besetzung darauf zu achten ist, dass die Interessen der Aufsteller, Prüfer und Nutzer der Rechnungslegung gewahrt sind. Im Übrigen kann Interessenvielfalt und -einbeziehung auch noch über das Verfahren der Standardsetzung hergestellt werden. bb) Verfahrensrechtliche Vorgaben Insofern verpflichtet sich das DRSC zunächst allgemein, die Öffentlichkeit über seine Tätigkeit zu informieren und ein transparentes Verfahren durchzuführen (vgl. § 4 Abs. 1 S. 1 und 2, Abs. 2 StandV).289 Nach § 4 Abs. 2 StandV darf ein Standard nur verabschiedet werden,290 wenn (1.) zuvor ein Entwurf in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen und mit einer Frist zur Stellungnahme von mindestens sechs Wochen veröffentlicht worden ist, (2.) die eingegangenen Stellungnahmen ausgewertet und die wesentlichen Einwendungen und Änderungsvorschläge in einer öffentlichen Sitzung erörtert worden sind und (3.) im Falle wesentlicher Änderungen des Entwurfs dieser nochmals mit einer Frist zur Stellungnahme von mindestens vier Wochen offengelegt worden ist. Durch die Möglichkeit von Stellungnahmen finden also auch Interessen außerhalb des regelsetzenden Gremiums Eingang in die Regelsetzung (§ 20 Abs. 3 DRSC-Satzung nennt dies „Konsultationsprozess“). Zudem kann nach § 1 Abs. 2 S. 2 2. Hs. StandV das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz an den Sitzungen teilnehmen, was einen fairen Verfahrensablauf befördern soll.291 Daneben sieht § 5 StandV wechselseitige Informationspflichten zwischen DRSC und Staat vor. c) Kontrolle durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz sowie die Gerichte Schließlich behält sich der Staat Kontrollrechte vor. In präventiver Hinsicht besteht ein Recht zur Kündigung des Vertrags (vgl. § 10 S. 2 StandV; § 626 BGB analog) sowie ein Recht zur Selbstvornahme bei gesetzeszweckswidriger Untätigkeit des DRSC (§ 3 Abs. 3 S. 2 StandV). Auch geht der Veröffentlichung der Rechnungslegungsstandards im elektronischen Teil des Bundesanzeigers292 zumindest eine Plausibilitätsprüfung durch das Bundesministerium der Justiz und für Ver289 Bereits § 342 Abs. 1 S. 2 HGB betont die Einbeziehung der fachlich interessierten Öffentlichkeit. 290 Nach § 20 Abs. 5 DRSC-Satzung bedarf u.a. die Verabschiedung von Rechnungslegungsstandards einer Zwei-Drittel-Mehrheit, was bei derzeit sieben Mitgliedern eine Zustimmung von mindestens fünf Mitgliedern erforderlich macht. 291 Vgl. Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 205. 292 Die Veröffentlichung der Empfehlungen im Bundesanzeiger ist zwar nicht wie bei den Kodexempfehlungen (§ 161 Abs. 1 S. 1 AktG) explizit im Gesetz vorgeschrieben; § 342 Abs. 2 HGB spricht nur von „bekanntgemachten Empfehlungen“. Die Bekanntmachung im Bundesanzeiger ergibt sich aber aus seiner Funktion als „dem Bekanntmachungsmittel der Bundesrepublik Deutschland“, vgl. Bertrams, Haftung des Aufsichtsrats, S. 183 Fn. 554.
180
3. Teil: Legitimation privater Regeln
braucherschutz voraus.293 Indem der Staat die inhaltlichen Grundzüge kontrolliert, hält er das Gremium präventiv zur Einhaltung der Legitimationsanforderungen an. Eine repressive Kontrolle erfolgt schließlich durch die Gerichte. Um das Regelungsmodell des § 342 HGB nicht völlig zu entwerten und die angestrebte staatliche Entlastung zu konterkarieren, muss es den Gerichten in den Fällen, in denen ein den Empfehlungen des DRSC entsprechender Konzernabschluss und -jahresbericht vorliegt, zwar verwehrt bleiben, die Standards des DRSC einer umfassenden Inhaltskontrolle zu unterziehen.294 Gestattet bleibt es den Gerichten dann lediglich, die Rechnungslegungstandards des DRSC einer Willkürkontrolle zu unterziehen sowie zu prüfen, ob das Verfahren der Standardsetzung ordnungsgemäß durchgeführt wurde.295 Gegebenenfalls können die Gerichte die vom Gesetz vorgesehene Vermutungswirkung ausschalten. Ihnen fällt dann wieder die Aufgabe zu, die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung selbst bzw. unter Zuhilfenahme eines Sachverständigen zu konkretisieren. Anders verhält es sich, wenn ein von den Empfehlungen des DRSC abweichender Konzernabschluss und -jahresbericht in Rede steht. Hier obliegt es den Gerichten nach dem Regelungsmodell des § 342 Abs. 2 HGB ohnehin, losgelöst von den Vorgaben des DRSC zu ermitteln, ob die vorgenommene Bilanzierung als mit den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung übereinstimmend anzusehen ist.296 7. Allgemeines Normengesetz Angesichts der erforderlichen organisations- und verfahrensrechtlichen Begleitung des Regelsetzungsprozesses durch den Staat bei Regelwerken mit mittelbaren rechtlichen Wirkungen ist bisweilen gefordert worden, die Eckpunkte privater Regelsetzung in einem allgemeinen Normengesetz, das Transparenz, Betroffenenbeteiligung, Verfahrensfairness, Kohärenz, Interessenberücksichtigung etc. gewährleistet, verbindlich zu regeln.297 Erfolgt ist dies bislang nicht, was wohl darauf zurückzuführen sein dürfte, dass die Regelwerke hinsichtlich ihres Inhalts und 293 Vgl. Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 196 f.; Ebke/Paal, in: MüKo HGB, § 342 Rn. 27; Hommelhoff/M. Schwab, BFuP, 1998, 38, 51; Schmidt/Holland, in: Beck’scher Bilanz-Kommentar, § 342 Rn. 17. Nach Hellermann, NZG 2000, 1097, 1099 f. bietet sich als Prüfungsmaßstab ein Rückgriff auf die Kriterien an, die zur Überprüfung normkonkretisierender Verwaltungsvorschriften angewandt werden; für eine umfängliche materiell-rechtliche Prüfung Berberich, Ein Framework für das DRSC, S. 122 f.; folgend M. Schwab, in: Staub, HGB, § 342 Rn. 89, 96. 294 Vgl. Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 197 f. 295 So letztlich etwa auch Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 197 f.; Berberich, Ein Framework für das DRSC, S. 134 f.; Hellermann, NZG 2000, 1097, 1099 f.; Hohl, Private Standardsetzung, S. 316; für eine weitergehende gerichtliche Kontrolle etwa Ebke/Paal, in: MüKo HGB, § 342 Rn. 24 m.w.N. 296 Vgl. Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 198; Berberich, Ein Framework für das DRSC, S. 135; Hohl, Private Standardsetzung, S. 316. 297 Vgl. etwa Hoffmann-Riem, AöR 130 (2005), 5, 60.
§ 12 Praktische Erprobung des Legitimationsmodells
181
ihrer Rechtswirkungen so different sind, dass ein allgemeines Normengesetz nur sehr abstrakt gefasste Vorgaben machen könnte, ohne auf die einzelnen Abstufungen ihrer Rechtswirkungen einzugehen.298 In Wahrnehmung seiner Gewährleistungsverantwortung bleibt der Staat daher gehalten, den Legitimationsprozess bei jedem einzelnen privaten Regelwerk abhängig von dessen jeweiligen rechtlichen Wirkungen zu begleiten. Den privaten Regelaufstellern kann aber jedenfalls mit auf den Weg gegeben werden, dass sie sich dann, wenn sie Regeln formulieren und deren Anerkennung durch die Rechtsordnung begehren, an den genannten Legitimationsanforderungen orientieren sollten, damit sich ihre Regeln als legitim erweisen.299 Zum Standardrepertoire an Empfehlungen für private Regelsetzer gehört es daher, zustimmungsfördernde und gerechtigkeitsstiftende Elemente in die Regelsetzung zu integrieren.300
III. Zusammenfassung Es hat sich gezeigt, dass der Staat seiner Verantwortung, privaten Regeln nur dort Rechtsverbindlichkeit zukommen zu lassen, wo die Legitimation gesichert ist, in weitgehender Weise gerecht wird. Er misst privaten Regeln eine rechtliche Bindungswirkung grundsätzlich nur dort bei, wo sich diese entweder auf die individuelle Zustimmung des Regelunterworfenen und, soweit diese verdünnt ist oder gänzlich fehlt, auf Gerechtigkeitserwägungen stützen lässt. Das Paradebeispiel für die rechtliche Bindungswirkung infolge individueller Zustimmung des Regelunterworfenen bildet der Vertrag. Bei Regeln, bei denen die individuelle Zustimmung verdünnt ist oder ganz fehlt, kompensiert der Staat dies dadurch, dass er Kautelen bereithält, die eine gewisse Gerechtigkeit der Regeln verbürgen. Konkret erfolgt dies entweder durch organisations- und verfahrensrechtliche Anforderungen, die von den Regelsetzern bei der Regelaufstellung eingehalten werden, und/oder durch eine behördliche und/oder richterliche Anwendungskon trolle im Einzelfall. Soweit einzelne private Regeln wie namentlich die IDW PS sowie die Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex einen Anspruch auf mittelbare rechtliche Verbindlichkeit erheben, den Legitimationsanforderungen aber nicht hinreichend gerecht werden, verbleiben dem Staat verschiedene Reaktionsmöglichkeiten: Er kann die Regeln entweder entrechtlichen, sei es durch gesetzgeberisches Tätigwerden oder Änderung der Rechtsprechungspraxis, oder er kann die Legitimation sicherstellen, indem er entsprechende Sicherungen formeller oder materieller Art legislativ vorschreibt. 298 Augsberg, Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 332; Bachmann, Private Ordnung, S. 366. 299 Siehe auch Bachmann, in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 207, 225. 300 Ähnlich Bachmann, in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, S. 207, 225.
Vierter Teil
Untersuchungsergebnisse 4. Teil: Untersuchungsergebnisse 4. Teil: Untersuchungsergebnisse
I. Konzeptionelle Grundlagen privater Regelsetzung 1. Terminologie staatsfreier und staatsferner Ordnungsgebung a) Die Konstellationen staatsfreier und staatsferner Ordnungsgebung lassen sich terminologisch mit dem Dreiklang Selbstregulierung, private Regelsetzung und private Rechtsetzung einfangen. b) Den Oberbegriff bildet die Selbstregulierung. Hierunter fällt jede Form der Ordnungsgebung, deren Urheber nicht unmittelbar der Staat ist. Eine Einengung dergestalt, dass nicht jedes regulierende Handeln unter den Begriff der Selbstregulierung fällt, sondern nur solches, das als Pendant zur staatlichen Regulierung intentional abläuft und „mehr“ ist als die Verfolgung bloß eigennütziger Ziele, ist nicht veranlasst. c) Einen Teilausschnitt der Selbstregulierung stellt die private Regelsetzung dar. Hierunter fallen all diejenigen Regelungen, die von natürlichen oder juristischen Personen in Ausübung ihrer grundrechtlichen Freiheiten gesetzt werden. Nicht vom Bereich der privaten Regelsetzung erfasst ist die Selbstregulierung durch öffentlich-rechtlich organisierte, verselbstständigte Verwaltungseinheiten als Teil der mittelbaren Staatsverwaltung. Bei hybriden Regelwerken, bei denen staatliche und private Stellen bei der Regelsetzung Hand in Hand arbeiten, kommt es für die Einordnung darauf an, wer den konkreten Inhalt der jeweiligen Regel festlegt und formuliert. Ist der Regelsetzer in der eigentlichen Willensbildung, d.h. bei der inhaltlichen Ausarbeitung des Verhaltenssatzes im weitesten Sinne autonom, also frei von staatlichen Diktionen, und die Regelsetzung nur in den äußeren Grenzen durch staatliche Vorgaben flankiert, ist die Regelsetzung Ausprägung grundrechtlich geschützter Freiheitsausübung und der privaten Sphäre zuzuordnen. d) Die private Rechtsetzung wiederum stellt einen Ausschnitt privater Regelsetzung dar. Der Begriff Recht ist nicht für solche Regeln reserviert, die von staatlicher Seite ausgearbeitet werden. Dem Staat als Garant der Rechtsordnung muss allerdings die Entscheidung darüber vorbehalten bleiben, ob eine private Regel als Recht eingestuft werden kann. Von privater Hand ausformulierte Regeln können daher nur dann als Recht klassifiziert werden, wenn ihnen durch staatlichen Anerkennungsakt rechtliche Geltungskraft verliehen ist und sie damit notfalls mithilfe staatlicher Zwangsmittel durchgesetzt werden können. Wenn Private involviert sind, muss die Rechtsetzung folglich immer zweiglei-
4. Teil: Untersuchungsergebnisse
183
sig ablaufen: Die private Inhaltsbestimmung muss stets durch einen staatlichen Anerkennungsakt gestützt werden. Private Regeln, denen ein solcher Anerkennungsakt fehlt, fallen als rein soziale Regeln aus dem Anwendungsbereich des privaten Rechts heraus. e) Dass Privaten die Fähigkeit zugesprochen wird, Recht zu setzen, veranlasst nicht dazu, den klassischen Rechtsquellenkanon aufzubrechen, wonach als Rechtsquelle nur Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Gewohnheitsrecht und Richterrecht anzusehen sind. Dagegen, den „von unten“ kommenden Rechtsregeln die Eigenschaft einer Rechtsquelle zuzusprechen, spricht, dass privat gesetzte Regeln letztlich nur kraft staatlichen Anerkennungsakts rechtsverbindlich werden. Aus sich heraus stellen sie kein Recht dar. 2. Das Verhältnis privater Regelsetzung zum staatlichen Recht a) Der Staat ist in seiner Entscheidung, inwieweit er Privaten Räume zur Regelsetzung eröffnet, nicht vollkommen frei, sondern durch die Verfassung gebunden. In einzelnen Bereichen verbietet die Verfassung dem Staat wegen der durch sie vorgezeichneten Verantwortlichkeit des Staates für das Allgemeinwohl, den Privaten überhaupt Raum zur Regelaufstellung zu geben. Auch aufgrund der vom Bundesverfassungsgericht entwickelten Wesentlichkeitstheorie kann es dem Staat versagt sein, seine Regelungsbefugnis in beliebigem Umfang nicht staatlichen Stellen zu überlassen und den Bürger einer nicht demokratisch legitimierten Regelsetzungsmacht auszuliefern. Raum für die private Regelsetzung bleibt aber in der Regel dort, wo es sich um rein private Angelegenheiten unter Individuen handelt, sich die Regeln rein wissenschaftlich mit Sachverstand erklären lassen oder, wo zwar auch eine politische Dimension auszumachen ist, die Regeln aber auf einer fundierten sachverständigen Grundlage in Form von gesichertem Erfassungswissen oder Ähnlichem getroffen werden. b) Aufgrund des staatlichen Vorranganspruchs determiniert stets das staatliche Recht, in welchen Bahnen sich die private Regelsetzung entfalten kann. Konkret kann das staatliche Recht privaten Regeln (1.) bewusst einen Rahmen bereitstellen, innerhalb dessen sie sich entfalten können, und ihnen zur staatlichen Durchsetzbarkeit verhelfen, (2.) sie im „rechtsfreien Raum“ belassen oder (3.) sie für unwirksam erklären. c) Als Handlungsformen kommen für den privaten Regelsetzer das Rechtsgeschäft, Normen sowie im Einzelfall Rechtsnormen in Betracht. 3. Vor- und Nachteile privater Regelsetzung a) Eine Regulierung durch Private kann für sich als Vorzüge Staatsentlastung und Kosteneffizienz, Flexibilität, Sachnähe und Akzeptanz sowie eine internationale Ausrichtungsmöglichkeit verbuchen. Insbesondere in dynamischen, Flexibilität erfordernden und komplexen Regelungsbereichen, die erhöhten Sachver-
184
4. Teil: Untersuchungsergebnisse
stand und eine zeitnahe Regulierung erfordern, kann die private Regelsetzung ihre Vorteile ausspielen. b) Die Regelsetzung Privater birgt aber auch Gefahren für die Ordnung im Staat. Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip sowie die Wahrnehmung öffentlicher Interessen drohen unterlaufen zu werden. Auch können Durchsetzungsdefizite sowie eine mitunter fehlende Koordination gegeben sein.
II. Systematisierung privater Regelsetzung 1. Systematisierung am Grad der rechtlichen Verbindlichkeit a) Private Regeln unterscheiden sich im Hinblick auf ihre Entstehungsweise, ihr Regelungsdesign, ihren Regelsetzer- und Adressatenkreis, ihren Inhalt, die staatliche Beteiligung und ihren Grad der Verrechtlichung mitunter erheblich. b) Ausgehend von der Forschungsfrage, wie sich private Regeln legitimieren lassen, ist es zielführend, diese nach dem Grad ihrer Verbindlichkeit bzw. ihren rechtlichen Wirkungen zu systematisieren. Insoweit lassen sich drei Verbindlichkeitsstufen privater Regeln ausmachen: Regeln, die rechtlich unverbindlich sind, Regeln, die lediglich mittelbar rechtlich verbindlich wirken, indem sie von den Gerichten bei ihrer Entscheidungsfindung im Wege einer autonomen Rezeptionsentscheidung herangezogen werden, und Regeln, die unmittelbar rechtlich verbindlich sind. 2. Unverbindliche Regeln a) Regelungen, die keine rechtlichen, sondern lediglich tatsächliche Wirkungen entfalten, existieren mannigfach. Ausgangspunkt derartiger Regeln ist der Wille der Beteiligten, ihr Verhalten aufeinander abzustimmen, ohne aber eine vertraglich bindende und damit rechtlich sanktionierbare Vereinbarung anzustreben. b) Die Regeln mit bloß faktischen Wirkungen lassen sich in einseitige und zweibzw. mehrseitige private Regeln unterteilen. Zu den einseitigen rechtlich unverbindlichen privaten Regeln gehören namentlich Selbstverpflichtungen von Unternehmen oder Verbänden. c) Zwei- und mehrseitig unverbindliche private Regeln bilden sog. soziale Normen, Gentlemen’s Agreements sowie Richtlinien und Kodizes von Unternehmen. 3. Mittelbar rechtsverbindliche Regeln a) Gegenstand mittelbar rechtsverbindlicher privater Regeln sind gemeinhin Materien, in denen ein besonderer Sachverstand und eine große Sachnähe gefragt sind (sog. Expertenrecht). b) Die größte Bedeutung genießt die Aufstellung technischer Normen durch Verbände. Hierzu zählen insbesondere die DIN-Normen. Sie werden vom
4. Teil: Untersuchungsergebnisse
185
„Deutschen Institut für Normung e.V. (DIN)“ erlassen und erlangen rechtliche Relevanz dadurch, dass sie von den Gerichten im Rahmen der Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe herangezogen werden, etwa um die „anerkannten Regeln der Technik“ oder die „verkehrsübliche Sorgfalt“ näher auszustaffieren. Ebenso spielen die DIN-Normen bei der Formulierung von Verkehrspflichten eine große Rolle. c) Sog. Quantifizierungen entfalten ebenfalls mittelbare rechtliche Wirkungen. Hierzu zählen beispielsweise Berufs- und Standesregeln, die Gremien spezifischer Berufsgruppen für die jeweilige Berufsausübung aufstellen, sowie Unterhaltstabellen, die von der Rechtsprechung außerhalb einer konkreten Fallentscheidung erarbeitet werden und im Wege eines richterlichen Rezeptionsakts bei späteren Judikaten herangezogen werden. d) Die Prüfungsstandards des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) entfalten in der Praxis ebenfalls mittelbare Rechtswirkungen, indem die Gerichte bei ihrer Entscheidungsfindung im Rahmen prüfungstechnischer Sachverhalte auf sie zurückgreifen. e) Auch die Vorgaben des Deutschen Corporate Governance Kodex sind als private Regeln einzustufen. Ihnen selbst kann bei isolierter Betrachtung zwar keinerlei rechtliche Bindungswirkung beigemessen werden. Über den in § 161 AktG verankerten Comply-or-explain-Mechanismus erwächst für die Unternehmen zunächst ein faktischer Druck, den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex Folge zu leisten. In der Zusammenschau mit § 161 AktG entfalten sie aber zugleich auch mittelbare Rechtswirkungen. Neben dem wohl nur theoretisch bestehenden Risiko einer Schadensersatzhaftung bei Abgabe einer fehlerhaften Entsprechenserklärung werden die Kodexempfehlungen dadurch zum Gegenstand einer gerichtlichen Entscheidung, dass die Abgabe einer fehlerhaften Entsprechenserklärung zur Anfechtbarkeit von Entlastungsbeschlüssen der Hauptversammlung führen kann. Insbesondere belässt es die Rechtsprechung hier nicht bei der formalen Feststellung, dass § 161 AktG verletzt wurde, sondern nimmt bei der Frage, ob rechtliche Folgen mit dem Gesetzesverstoß verbunden sind – was voraussetzt, dass die Verletzung der Erklärungspflicht nach § 161 AktG einen eindeutigen und gravierenden Gesetzesverstoß darstellt – auf den konkreten Inhalt der verletzten Kodexbestimmung Bezug. f) Den Rechnungslegungsstandards des Deutschen Rechnungslegungs Standards Comittee e.V. (DRSC) werden durch die gesetzliche Anordnung in § 342 Abs. 2 HGB mittelbare Rechtswirkungen zugeschrieben. Die Vorschrift hält die Gerichte dazu an, jedenfalls dann von einem mit den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung konformen Konzernabschluss auszugehen, wenn die Rechnungslegungsstandards des DRSC eingehalten worden sind.
186
4. Teil: Untersuchungsergebnisse
4. Unmittelbar rechtsverbindliche private Regeln a) Als unmittelbar rechtsverbindlich sind solche privaten Regeln einzustufen, die als privates Recht vom Einzelnen vor den staatlichen Gerichten durchgesetzt und unter Zuhilfenahme staatlicher Zwangsmittel vollstreckt werden können. Es kann zwischen einseitig sowie zwei- und mehrseitig rechtlich bindenden privaten Regeln unterschieden werden. b) Zu den einseitig rechtlich bindenden privaten Regeln zählen die Auslobung, das Preisausschreiben, einseitige Organisationsgeschäfte, das Testament sowie aus dem Arbeitsrecht das Direktionsrecht und die Gesamtzusage, deren Bindungswirkung entgegen der herrschenden Meinung nicht über das Vertragsprinzip, sondern in Analogie zu der in § 657 BGB geregelten Auslobung zu begründen ist. c) Eine besondere Form einseitiger privater Rechtsetzung stellt die Rechtsetzung kraft absoluten subjektiven Rechts dar, das für den Privaten die Möglichkeit schafft, innerhalb seiner Grenzen einseitig für andere rechtsverbindliche Regeln aufzustellen, d.h. von Dritten ein bestimmtes Handeln oder Unterlassen zu beanspruchen. d) Paradebeispiel für eine zwei- und mehrseitige Rechtsetzung durch Private ist der Vertrag. Der erforderliche staatliche Anerkennungsakt, der der Übereinkunft der Vertragsparteien rechtliche Bindungswirkung verschafft, aufgrund derer sie gegebenenfalls mit staatlicher Zwangsgewalt durchgesetzt werden kann, ist darin zu sehen, dass der Gesetzgeber das Vertragsinstitut bereitstellt, bestimmte Mindestanforderungen normiert, denen der Vertrag zu genügen hat, und Voraussetzungen festlegt, unter denen sich die Parteien auch wieder vom Vertrag lösen können. e) Eine Form privater Rechtsetzung durch Rechtsgeschäft ist auch in der Regel aufstellung durch Allgemeine Geschäftsbedingungen zu erblicken. Die mitunter vorgenommene Einstufung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen als private Rechtsnormen vermag nicht zu erklären, warum sich der Vertragspartner gemäß § 305 Abs. 2 BGB in irgendeiner Form mit ihrer Geltung einverstanden erklären muss. f) Unmittelbar rechtsverbindlich ist die Regelaufstellung durch private Verbände in Form von Satzung bzw. Gesellschaftsvertrag. Der hier bestehende Streit zwischen Vertrags- und Normentheorie ist im Anschluss an Wiedemann dahingehend aufzulösen, dass es für ihre Rechtsnatur darauf ankommt, ob man auf die Wirkungsweise oder den Geltungsgrund abstellt. Als abstrakt-generelle Regel haben Satzung bzw. Gesellschaftsvertrag Normcharakter, als durch Einverständniserklärung der Beitretenden begründete Regeln sind sie Rechtsgeschäft. g) Im Arbeitsrecht stellt der Staat den Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen mit dem Tarifvertrag eine Rechtsform bereit, mit der sie in Gestalt von Rechtsnormen selbstständig mehrseitige, unmittelbar verbindliche private Regeln auf diesem Gebiet erzeugen können. Plausibel erklären lässt sich das Phä-
4. Teil: Untersuchungsergebnisse
187
nomen, dass private Regelsetzer durch Abschluss eines zivilrechtlichen Vertrags Rechtsnormen erzeugen können, die normative Wirkungen für ihre Regelunterworfenen entfalten, weder mit der Delegations- noch mit der Mandatarstheorie. Losgelöst von der Frage der Legitimation ist mit der sog. Anerkennungslehre vielmehr davon auszugehen, dass die Tarifvertragsparteien den Inhalt von Tarifnormen privatautonom aushandeln und der Staat, der das Rechtsanerkennungsmonopol besitzt, die Regeln durch staatlichen Anerkennungsakt in Gestalt der §§ 1 Abs. 1, 4 Abs. 1 TVG als bindendes Recht anerkennt. h) Eine eng mit den Tarifnormen verwandte Form mehrseitig verbindlicher privater Rechtsetzung ist die Regelaufstellung durch Betriebsvereinbarungen. Auch insoweit ist mit der Anerkennungslehre davon auszugehen, dass das Aushandeln der Regeln betreffend die innerbetriebliche Ordnung durch Arbeitgeber und Betriebsrat ein Akt privatautonomer Regelsetzung ist, der mittels staatlicher Anerkennung durch § 77 Abs. 4 S. 1 BetrVG auf die Rechtsebene gehoben und mit normativer Strahlkraft versehen wird. i) Mehrseitige unmittelbare Rechtsverbindlichkeit können private Regeln zudem dadurch erlangen, dass sie im Laufe der Zeit zu Gewohnheitsrecht erstarken. Ebenso unmittelbar rechtsverbindlich sind private Regeln, die einen Handelsbrauch oder eine Verkehrssitte abbilden. Indem das Gesetz an einzelnen Stellen auf sie Bezug nimmt, werden sie für die Regelunterworfenen unmittelbar bindend.
III. Legitimation privater Regeln 1. Legitimationsbedürftigkeit a) Nicht nur für die staatliche, sondern auch für die private Regelsetzungslehre ist die Frage nach dem Grund dafür, warum ein Sein, ein Sollen oder ein Wollen Anerkennung verdient, von Bedeutung, soweit es darum geht, die Bindung an private Regeln zu begründen. Unabhängig von der Frage, ob eine Regel staatlicher oder privater Provenienz ist, stellt sich die Frage nach ihrer Legitimation immer schon dann, wenn ein Moment der Fremdbestimmung gegeben ist. b) Lässt man sich von einem rechtswissenschaftlichen Erkenntnisinteresse leiten, können allerdings solche Regeln als nicht legitimationsbedürftig aussortiert werden, die lediglich faktische, nicht aber rechtliche Bindungswirkungen auslösen. Aus rechtswissenschaftlicher Warte stellt sich die Frage der Legitimation immer nur dann, wenn eine Regel mit dem Anspruch auf mittelbare oder unmittelbare Rechtsverbindlichkeit auftritt. c) Ausgehend von der Erkenntnis, dass es Aufgabe der Rechtswissenschaft ist, eine tragfähige Begründung dafür zu liefern, warum die Adressaten einer Regel an diese gebunden sind, ist ein soziologisch-deskriptives Legitimationsverständnis nicht weiterführend. Vielmehr ist von einem normativen Legitimationsverständnis auszugehen, das nicht die tatsächliche Akzeptanz einer Regel
188
4. Teil: Untersuchungsergebnisse
in den Fokus stellt, sondern die Anerkennungswürdigkeit derselben aufgrund ethisch-rechtlicher Verbindlichkeitsgründe. 2. Legitimationsmodell a) Das im Staatsrecht vorherrschende Legitimationsmodell, die Bindung an das staatliche Recht auf das in Art. 20 Abs. 1 GG verankerte Demokratieprinzip zurückzuführen, lässt sich für die Legitimation privater Regeln nicht fruchtbar machen. Private Regeln sind nicht auf den Willen des Volkes zurückführbar, sondern allenfalls auf den Willen einzelner Regelsetzer. b) Der Umstand, dass die Regelsetzung durch Private historisch gewachsen ist, lässt für sich genommen nicht auf eine rechtliche Befugnis zur Regelsetzung schließen. c) Ebenso wenig legitimiert sich eine Regel allein durch ihre Legalität, d.h. durch den Umstand, dass sie im Einklang mit der staatlichen Rechtsordnung steht. Ein ausschließlich rechtspositivistischer Ansatz liefert für sich genommen keine Antwort auf die Frage, welche inneren Gründe die Bindung an private Regeln rechtfertigen. d) Ausgehend von der in unserer freiheitlichen Rechtsordnung verankerten Privatautonomie muss als Legitimationsideal die individuelle Zustimmung eines jeden Regelunterworfenen angesehen werden. Das Legitimationsideal individueller Zustimmung taugt für sich genommen jedoch nicht zur Legitimation sämtlicher privater Regeln. Bei einzelnen privaten Regeln fehlt es an einem Akt individueller Zustimmung oder diese ist zumindest verdünnt. Dort, wo die individuelle Zustimmung verdünnt ist oder sogar gänzlich fehlt, bedarf es ergänzender Gesichtspunkte, um die Rechtswirkungen privater Regeln zu legitimieren. e) Die vertragstheoretischen Ansätze der Staatstheorie, die auf der Idee basieren, dass sich die Herrschaftsordnung durch einen Konsens der Herrschaftsunterworfenen legitimiert, liefern insoweit keine weiterführenden Erkenntnisse. Versteht man den vorausgesetzten Konsens im Sinne allseitiger Zustimmung, deckt er sich mit dem Legitimationsideal der Zustimmung und ist für die Legitimation von Regeln nicht weiterführend. Reduziert man die Anforderungen an den tatsächlichen Konsens und begreift ihn als bloßen Grundkonsens, der kein allseitiges Einverständnis mehr verlangt, bleibt das verbleibende konsensbasierte Modell letztlich wiederum eine Antwort darauf schuldig, warum derjenige, der sich tatsächlich nicht für die Ordnung ausgesprochen hat, dennoch an sie gebunden sein soll. f) Die Bindung an private Regeln kann dort, wo die individuelle Zustimmung fehlt oder verdünnt ist, auch nicht mit rein ökonomischen Aspekten begründet werden. Die Idee, die Effizienz einer Regel zu ihrer Rechtfertigung heranzuziehen, begründet die Gefahr, dass andere, als maßgebend zu erachtende Parameter missachtet werden, wie etwa ethische Werte und die grundrechtlich verbürgten Freiheiten des Einzelnen.
4. Teil: Untersuchungsergebnisse
189
g) Auch die Überlegung, eine fehlende oder verdünnte Zustimmung mit dem Gemeinwohl- bzw. Gruppenwohlgedanken zu kompensieren, vermag für sich genommen nicht zu überzeugen. Ein solcher Ansatz ist mit dem Selbstverständnis des Privatrechts, das von einer Gleichberechtigung der Individuen ausgeht, nicht in Einklang zu bringen. h) Der gesuchte Legitimationsbaustein, der einer privaten Regel ergänzend bzw. anstelle der individuellen Zustimmung des Regelunterworfenen den Anspruch verleiht, rechtsverbindlich zu sein, kann allein der Umstand sein, dass die Regel gerecht ist. Gerechtigkeit ist das, was als Grundnorm menschlichen Zusammenlebens betrachtet und vom Recht als Ideal angestrebt wird. Das Unterfangen, die Gerechtigkeit materiell fassbar zu machen, ist zwar mit inhaltlicher Unsicherheit behaftet. Es dürfte aber stets gelingen, Ungerechtigkeiten festzustellen und auf diese Weise einen Mindestschutz in Form eines Ausbeutungsschutzes für die Regelbetroffenen zu etablieren, der den unterlegenen Teil vor einer Übervorteilung schützt. Hierzu gehören namentlich der Vertrauensschutz sowie der Schutz des institutionell Unterlegenen. Im Übrigen kann die Gerechtigkeit einer Regel prozedural gewährleistet werden, d.h. durch eine spezifische Ausgestaltung der Organisation und des Verfahrens der Regelsetzung. Als Ideal muss hier die Rawl’sche Überlegung gelten, wonach eine Regel insbesondere dann eine Gerechtigkeitsgewähr in sich trägt, wenn sich die Regelsetzer bei der Ordnungsgebung in einem „Schleier des Nichtwissens“ befinden, d.h. in einem Urzustand, in dem keiner seine individuellen natürlichen Fähigkeiten, seinen gesellschaftlichen Status oder seine ökonomischen Verhältnisse kennt und daher nicht abschätzen kann, inwieweit er später möglicherweise selbst von der Regel betroffen ist. 3. Staatliche Pflicht zur Organisation der Legitimation a) Der Staat ist aufgrund der ausgestaltungsbedürftigen (normgeprägten) Grundrechte namentlich der Vertragsfreiheit und des Eigentumsrechts verpflichtet, Rechtsgüter zuzuweisen und die für eine rechtsverbindliche private Regel aufstellung erforderliche Infrastruktur bereitzuhalten, innerhalb derer die Bürger die besagten Grundrechte verwirklichen können. b) Kraft der Schutzfunktion der Grundrechte hat der Staat durch die von ihm geschaffene Infrastruktur zugleich aber auch dafür Sorge zu tragen, dass eine Bindung an private Regeln nur dort erfolgt, wo ihre Legitimation gewährleistet ist. c) Bei der Wahrnehmung dieser Verpflichtungen hat der Staat einen weiten Gestaltungsspielraum. In Bezug auf die Schutzpflichterfüllung gilt insoweit ein Untermaßverbot, d.h., die staatliche Grundrechtsschutzpflicht verlangt lediglich, Extremfälle privater Knebelung zu verhindern. In Bezug auf die korrespondierenden Freiheiten des Regelsetzers gilt ein Übermaßverbot, d.h., dieser darf in seinen Gestaltungsmöglichkeiten grundsätzlich nicht in einer Weise beschränkt werden, die ihm die Möglichkeit, Regeln aufzustellen, nahezu umfänglich nimmt.
190
4. Teil: Untersuchungsergebnisse
d) Zur Erfüllung seiner Organisationspflicht kann der Staat auf die drei Gewalten zurückgreifen. Durch Gesetz kann er die private Regelaufstellung zunächst abstrakt generell ausgestalten. Er kann seiner Organisations- und Schutzpflicht aber auch dadurch nachkommen, dass er private Regeln im Einzelfall einer behördlichen Rechtmäßigkeitskontrolle unterzieht oder sie einer Korrektur durch die Gerichte unterwirft (richterliche Inhaltskontrolle). 4. Die Umsetzung des Legitimationsmodells bei den einzelnen Regelwerken a) Der Staat wird seiner Verantwortung, privaten Regeln nur dort Rechtsverbindlichkeit zukommen zu lassen, wo die Legitimation gesichert ist, weitgehend gerecht. b) Unter den unmittelbar verbindlichen Regelwerken bildet der Vertrag das Paradebeispiel für eine rechtliche Bindungswirkung infolge individueller Zustimmung der Regelunterworfenen. Soweit das Funktionieren des auf beiderseitiger Zustimmung beruhenden Vertragsmechanismus nicht mehr gewährleistet ist, stützt der Staat die Legitimation der Regeln dadurch ab, dass er gezielt legislative Vorgaben für Situationen bereitstellt, in denen die Vertragsparität typischerweise gefährdet erscheint und den Gerichten im Übrigen mittels Generalklauseln die Möglichkeit eröffnet, den Vertrag im Hinblick auf eine Störung der Vertragsparität einer Inhaltskontrolle zu unterziehen. c) Bei Allgemeinen Geschäftsbedingungen besteht ein institutionalisiertes Vertragsungleichgewicht, das dazu führt, dass die Zustimmung des Vertragspartners des Verwenders verdünnt ist. Dies wird neben formalen Elementen wie der Einbeziehungskontrolle vor allem dadurch kompensiert, dass Allgemeine Geschäftsbedingungen einer umfassenden gerichtlichen Inhaltskontrolle unterliegen (§§ 307 ff. BGB). d) Bei den einseitigen Rechtsgeschäften lassen sich die gegenüber dem Erklärenden eintretenden Bindungswirkungen unter Verweis auf seine individuelle Zustimmung erklären. Hinsichtlich des Gegenübers bedarf es einer Legitimation von vornherein nicht, soweit er durch das einseitige Rechtsgeschäft lediglich berechtigt wird. Soweit das Gegenüber – wie beim arbeitsrechtlichen Direktionsrecht – durch das einseitige Rechtsgeschäft verpflichtet wird, lässt sich die Bindungswirkung mit der Rückkoppelung an den Arbeitsvertrag und die hierauf bezogene einmalige Zustimmung des Arbeitnehmers erklären sowie darauf zurückführen, dass das Weisungsrecht einer Gerechtigkeitskontrolle im Sinne einer richterlichen Billigkeitskontrolle unterliegt. e) Die rechtliche Bindungswirkung von Verbandsregeln legitimiert sich aus der verdünnten Zustimmung des Einzelnen in Form des Beitritts zum Verband sowie daraus, dass die Verbandsregeln an das Verbandsinteresse gekoppelt sind, für die Entscheidungsfindung gewisse Verfahrensvorgaben zu beachten sind,
4. Teil: Untersuchungsergebnisse
191
die ein gerechtes Ergebnis verbürgen, und verbleibenden materiellen Ungerechtigkeiten durch eine gerichtliche Inhaltskontrolle Rechnung getragen wird. f) Beim Tarifvertrag sorgt auf horizontaler Ebene der Vertragsmechanismus für Legitimation. Auf vertikaler Ebene legitimieren sich die sog. Arbeitsverhältnisnormen aus der verdünnten Zustimmung der einzelnen Mitglieder der Tarifvertragsparteien sowie daraus, dass die Tarifvertragsparteien als Verbände den verbandsrechtlichen Legitimationsanforderungen unterliegen. Soweit Betriebsnormen in Rede stehen, die unmittelbare und zwingende Wirkung schon dann entfalten, wenn nur der Arbeitgeber tarifgebunden ist, lässt sich die Bindungswirkung damit erklären, dass der Tarifvertrag insoweit auf Mindestarbeitsbedingungen zu beschränken ist und der einzelne Arbeitnehmer sich durch günstigeren Einzelvertrag dem Kollektivkonsens entziehen kann (sog. Günstigkeitsprinzip). g) Bei Betriebsvereinbarungen kann ein gewisses Maß an Legitimation in der zum Arbeitsvertrag erteilten Zustimmung des Arbeitnehmers erblickt werden, weil die Betriebsvereinbarung zu diesem in einem engen Näheverhältnis steht. Daneben treten Gerechtigkeitselemente durch Teilhabe und Verfahren sowie eine umfassende gerichtliche Billigkeitskontrolle. Im Übrigen gilt auch hier das sog. Günstigkeitsprinzip. h) Beim Gewohnheitsrecht, der Verkehrssitte und dem Handelsbrauch verbürgt das Erfordernis einer tatsächlichen, lang andauernden Übung eine gewisse Gerechtigkeitsgewähr. Zudem geht der Anwendung dieser Regeln stets eine gerichtliche Einbeziehungskontrolle voraus. i) Bei den Regelwerken mit mittelbaren rechtlichen Wirkungen fehlt es stets an einer individuellen Zustimmung des Regelunterworfenen. Legitimieren lassen sich diese Regeln nur, wenn sie Gewähr dafür bieten, gerecht zu sein. Bei den technischen Normen, namentlich den DIN-Normen bleibt dies durch den zwischen dem DIN und der Bundesregierung geschlossenen DIN-Vertrag gewährleistet. Dieser verpflichtet das DIN als Regelaufsteller, gerechtigkeitsstiftende Organisations- und Verfahrensanforderungen einzuhalten. Zudem haben die Gerichte stets zu prüfen, ob die technische Norm im Einzelfall zur Konkretisierung herangezogen werden kann. j) Die Einbeziehung sog. Quantifizierungen in die Rechtsfindung lässt sich ebenfalls damit legitimieren, dass die Regelaufstellung gewissen organisations- und verfahrensrechtlichen Mustern folgt, die die Gerechtigkeit der Regeln gewährleisten. Soweit diese Mechanismen wie insbesondere bei Berufs- und Standesregeln aufgrund der einseitigen Interessenwahrnehmung der Regelsetzer gestört sind, ist dem durch eine strenge Handhabe des vom Bundesgerichtshof aufgestellten Leitsatzes Rechnung zu tragen, wonach sich ein von den Einzelfallumständen absehender Schematismus verbietet.
192
4. Teil: Untersuchungsergebnisse
k) Mangels hinreichender organisations- und verfahrensrechtlicher Absicherung des Regelaufstellungsprozesses erweist sich die gerichtliche Praxis, die IDW PS bei der Rechtsfindung heranzuziehen, als problematisch. l) Die Regelungen des Deutschen Corporate Governance Kodex verbürgen angesichts der bestehenden Organisation der Kodexkommission sowie des Verfahrens der Regelaufstellung zwar in hinreichender Weise, dass die Regeln gerecht sind, und genügen damit den Anforderungen, die aus zivilistischer Sicht an die Legitimation privater Regeln zu stellen sind. Angesichts der durch die Gerichte praktizierten zunehmenden Verrechtlichung der Kodexempfehlungen lässt sich dieses Regulierungsmodell aber nicht mehr ohne Weiteres mit den Vorgaben der Wesentlichkeitstheorie in Einklang bringen. m) Als Vorbild taugt insoweit das Regelungsmodell der Rechnungslegungsstandards des DRSC. Hier hat der Gesetzgeber Organisations- und Verfahrensvorgaben, die die Gerechtigkeit der privaten Regeln des DRSC gewährleisten, unmittelbar in Gesetzesform gegossen und damit die wesentlichen Fragen selbst entschieden.
Literaturverzeichnis Literaturverzeichnis
Adams, Michael: Ökonomische Theorie des Rechts: Konzepte und Anwendungen, Frankfurt am Main u.a. 2002 Adomeit, Klaus: Gestaltungsrechte, Rechtsgeschäfte, Ansprüche: Zur Stellung der Privatautonomie im Rechtssystem, Berlin 1969 – Rechtsquellenfragen im Arbeitsrecht, München 1969 Alexy, Robert: Theorie der Grundrechte, Frankfurt am Main 2006 Arndt, Dominik E.: Sinn und Unsinn von Soft Law: Prolegomena zur Zukunft eines indeterminierten Paradigmas, Baden-Baden 2011 Arnim, Hans Herbert von: Gemeinwohl und Gruppeninteressen: Die Durchsetzungsschwäche allgemeiner Interessen in der pluralistischen Demokratie: Ein Beitrag zu verfassungsrechtlichen Grundfragen der Wirtschaftsordnung, Frankfurt am Main 1977 Arnold, Christian: Betriebliche Tarifnormen und Außenseiter: Zur Legitimation der tarifvertraglichen Regelungsbefugnis, Berlin 2007 Assmann, Heinz-Dieter: Verhaltensregeln für freiwillige öffentliche Übernahmeangebote: Der Übernahmekodex der Börsensachverständigenkommission, AG 1995, 563 ff. Augsberg, Steffen: Rechtsetzung zwischen Staat und Gesellschaft: Möglichkeiten differenzierter Steuerung des Kapitalmarktes, Berlin 2003 Bachmann, Gregor: Der „Deutsche Corporate Governance Kodex“: Rechtswirkungen und Haftungsrisiken, WM 2002, 2137 ff. – Private Ordnung: Grundlagen ziviler Regelsetzung, Tübingen 2006 – Legitimation privaten Rechts, in: Bumke, Christian/Röthel, Anne (Hrsg.), Privates Recht, Tübingen 2012, S. 207 ff. – Optionsmodelle im Privatrecht, JZ 2008, 11 ff. – Privatrecht als Organisationsrecht: Grundlagen privater Normsetzung, in: Jahrbuch junger Zivilrechtswissenschaftler 2002: Die Privatisierung des Privatrechts, Stuttgart 2003, S. 9 ff. – Reform der Corporate Governance in Deutschland: Zum Juristentagsgutachten 2012, AG 2012, 565 ff. Backherms, Johannes: Das DIN, Deutsches Institut für Normung e.V., als Beliehener: Zugleich ein Beitrag zur Theorie der Beleihung, Köln u.a. 1978, zitiert: Das DIN als Beliehener Ballestrem, Karl Graf: Die Idee des impliziten Gesellschaftsvertrags, in: Kern, Lucian/Müller, Hans Peter (Hrsg.), Gerechtigkeit, Diskurs oder Markt?: Die neuen Ansätze in der Vertragstheorie, Opladen 1986, S. 35 ff. Ballreich, Hans: Nachdenkliches über „soft law“: Seine mögliche Rolle beim internationalen Schutz des geistigen Eigentums, GRURInt. 1989, 383 ff. Bar, Christian von: Verkehrspflichten: Richterliche Gefahrsteuerungsgebote im deutschen Deliktsrecht, Köln u.a. 1980
194
Literaturverzeichnis
Barnert, Thomas: Die formelle Vertragsethik des BGB im Spannungsverhältnis zum Sonderprivatrecht und zur judikativen Kompensation der Vertragsparität: Zugleich ein Befund judikativer Entwicklungsphasen materieller Vertragsethik im Interzessionsrecht, Heidelberg 1999 Baumbach, Adolf/Hopt, Klaus J.: Handelsgesetzbuch, Kommentar, 36. Auflage, München 2014, zitiert: Bearbeiter, in: Baumbach/Hopt, HGB Baums, Theodor (Hrsg.): Bericht der Regierungskommission Corporate Governance: Unternehmensführung, Unternehmenskontrolle, Modernisierung des Aktienrechts, Köln 2001 (Bericht der Regierungskommission) Bayreuther, Frank: Tarifautonomie als kollektiv ausgeübte Privatautonomie: Tarifrecht im Spannungsfeld von Arbeits-, Privat- und Wirtschaftsrecht, München 2005 Becker, Florian: Kooperative und konsensuale Strukturen in der Normsetzung, Tübingen 2005 Becker, Michael: Der unfaire Vertrag: Verfassungsrechtlicher Rahmen in privatrechtlicher Ausfüllung, Tübingen 2003 Becker, Thorsten: Die Haftung für den deutschen Corporate Governance Kodex, Baden-Baden 2005 Beck’scher Bilanz-Kommentar: Handels- und Steuerbilanz, §§ 238 bis 339, 342 bis 342e HGB, herausgegeben von Bernd Grottel, Stefan Schmidt, Wolfgang J. Schubert, Norbert Winkeljohann, 10. Auflage, München 2016, zitiert: Bearbeiter, in: Beck’scher Bilanz-Kommentar Beck’scher Online-Kommentar, BGB, herausgegeben von Heinz Georg Bamberger, Herbert Roth, Edition 39 (Stand: 01. 05. 2016), München, zitiert: Bearbeiter, in: BeckOK BGB Beck’scher Online-Kommentar, GG, herausgegeben von Volker Epping, Christian Hillgruber, Edition 29 (Stand: 01. 06. 2016), München, zitiert: Bearbeiter, in: BeckOK GG Beck’scher VOB-Kommentar, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV), herausgegeben von Klaus Englert, Rolf Katzenbach, Gerd Motzke, 3. Auflage, München 2014, zitiert: Bearbeiter, in: Beck’scher VOB-Kommentar Benda-Beckmann, Franz von: Unterwerfung oder Distanz: Rechtssoziologie, Rechtsan thropologie und Rechtspluralismus aus rechtsanthropologischer Sicht, ZfRSoz 12 (1991), 97 ff. Benz, Arthur: Kooperative Verwaltung: Funktionen, Voraussetzungen und Folgen, Baden-Baden 1994 Berberich, Jens: Ein Framework für das DRSC: Modell einer verfassungskonformen gesellschaftlichen Selbststeuerung im Bilanzrecht, Berlin 2002 Berg, Stefan/Stöcker, Mathias: Anwendungs- und Haftungsfragen zum Deutschen Corporate Governance Kodex, WM 2002, 1569 ff. Bergschneider, Ludwig: Anmerkung zum Beschluss des OLG München vom 25. 09. 2002 – 16 WF 1328/02, FamRZ 2003, 376 f. Berliner Initiativkreis German Code of Corporate Governance: German Code of Corporate Governance (GCCG), DB 2000, 1573 ff. Berman, Paul Schiff: From International Law to Law and Globalization, Columbia Journal of Transnational Law 43 (2005), 485 ff.
Literaturverzeichnis
195
Bertrams, Helge: Die Haftung des Aufsichtsrats im Zusammenhang mit dem Deutschen Corporate Governance Kodex und § 161 AktG, Berlin 2004, zitiert: Haftung des Aufsichtsrats Biedenkopf, Kurt H.: Sinn und Grenzen der Vereinbarungsbefugnis der Tarifvertragsparteien, Gutachten zum 46. Deutschen Juristentag, Band I (Gutachten), München 1966, S. 97 ff., zitiert: Gutachten 46. DJT – Vertragliche Wettbewerbsbeschränkung und Wirtschaftsverfassung: die Ausschließlichkeitsbindung als Beispiel, Heidelberg 1958 Biener, Herbert: Die Möglichkeiten und Grenzen berufsständischer Empfehlungen zur Rechnungslegung, in: Festschrift zum 65. Geburtstag von Reinhard Goerdeler, Düsseldorf 1987, S. 45 ff. – Fachnormen statt Rechtsnormen – ein Beitrag zur Deregulierung der Rechnungslegung, in: Festschrift für Hermann Clemm zum 70. Geburtstag, München 1996, S. 59 ff. Bierling, Ernst Rudolf: Juristische Prinzipienlehre, Band 1: Wesen und allgemeine Struktur des Rechts, 2. Neudruck der Ausgabe Tübingen 1894, Aalen 1979 – Juristische Prinzipienlehre, Band 2: Entstehen und Vergehen des Rechts, 2. Neudruck der Ausgabe Tübingen 1898, Aalen 1975 Binder, Jens-Hinrich: Regulierungsinstrumente und Regulierungsstrategien im Kapitalgesellschaftsrecht, Tübingen 2012 Blasche, Sebastian: Die Mindestanforderungen an ein Risikofrüherkennungs- und Überwachungssystem nach § 91 Abs. 2 AktG, CCZ 2009, 62 ff. Blaurock, Uwe: Wirtschaft und Rechtsordnung: Möglichkeiten und Grenzen privatautonomer Rechtssetzung, in: Blaurock, Uwe/Goldschmidt, Nils/Hollerbach, Alexander (Hrsg.), Das selbstgeschaffene Recht der Wirtschaft: Zum Gedenken an Hans Grossmann-Doerth (1894 – 1944), Tübingen 2005, S. 57 ff. Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Die verfassungstheoretische Unterscheidung von Staat und Gesellschaft als Bedingung der individuellen Freiheit, Opladen 1973, zitiert: Unterscheidung von Staat und Gesellschaft – Recht, Staat, Freiheit: Studien zur Rechtsphilosophie, Staatstheorie und Verfassungsgeschichte, Frankfurt am Main 2006 Borges, Georg: Selbstregulierung im Gesellschaftsrecht – zur Bindung an Corporate Governance-Kodizes, ZGR 2003, 508 ff. Böttcher, Lars: Compliance: Der IDW PS 980 – Keine Lösung für alle (Haftungs-)Fälle!, NZG 2011, 1054 ff. Bötticher, Eduard: Gestaltungsrecht und Unterwerfung im Privatrecht, Berlin 1964 Brandmair, Lothar: Die freiwillige Selbstkontrolle der Werbung: Rechtstatsachen, Rechtsvergleichung, internationale Bestrebungen, Köln u.a. 1978, zitiert: Freiwillige Selbstkontrolle Brennan, Geoffrey/Buchanan, James M.: Die Begründung von Regeln: Konstitutionelle Politische Ökonomie, Tübingen 1993 Breuer, Rüdiger: Direkte und indirekte Rezeption technischer Regeln durch die Rechtsordnung, AcP 101 (1976), 46 ff. Brohm, Winfried: Rechtsgrundsätze für normersetzende Absprachen – Zur Substitution von Rechtsverordnungen, Satzungen und Gesetzen durch kooperatives Verwaltungshandeln, DÖV 1992, 1025 ff.
196
Literaturverzeichnis
Brugger, Winfried: Rechtsprobleme der Verweisung im Hinblick auf Publikation, Demokratie und Rechtsstaat, VerwArch 78 (1987), 1 ff. Brunner, Ursula: Rechtsetzung durch Private: private Organisationen als Verordnungsgeber, Zürich 1982 Buchanan, James M.: Die Grenzen der Freiheit: Zwischen Anarchie und Leviathan, Tübingen 1984 Bucher, Eugen: Das subjektive Recht als Normsetzungsbefugnis, Tübingen 1965 Buck-Heeb, Petra/Dieckmann, Andreas: Selbstregulierung im Privatrecht, Tübingen 2010 Bülow, Peter/Ring, Gerhard/Artz, Markus/Brixius, Kerstin: Heilmittelwerbegesetz: Gesetz über die Werbung auf dem Gebiete des Heilwesens (HWG), Kommentar, 4. Auflage, Köln 2012 Bumke, Christian: Der gesellschaftliche Grundkonsens im Spiegel der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, in: Schuppert, Gunnar Folke/Bumke, Christian (Hrsg.), Bundesverfassungsgericht und gesellschaftlicher Grundkonsens, Baden-Baden 2000, S. 197 ff., zitiert: Grundkonsens Bumke, Christian/Röthel, Anne: Auf der Suche nach einem Recht des Privaten Rechts, in: Bumke, Christian/Röthel, Anne (Hrsg.), Privates Recht, Tübingen 2012, S. 1 ff. Bunte, Hermann-Josef: AGB-Banken; AGB-Sparkassen; Sonderbedingungen, Kommentar, 4. Auflage, München 2015, zitiert: Bunte, AGB-Banken Burckhardt, Walther: Die Organisation der Rechtsgemeinschaft: Untersuchungen über die Eigenart des Privatrechts, des Staatsrechts und des Völkerrechts, 2. Auflage, Zürich 1944 Bürgers, Tobias/Körber, Torsten (Hrsg.): Aktiengesetz, Kommentar, 3. Auflage, Heidelberg u.a. 2014, zitiert: Bearbeiter, in: Bürgers/Körber (Hrsg.), AktG Busche, Jan: Privatautonomie und Kontrahierungszwang, Tübingen 1999 Bydlinski, Franz: Fundamentale Rechtsgrundsätze: Zur rechtsethischen Verfassung der Sozietät, Wien/New York 1988 – Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, 2. Auflage, Wien u.a. 1991, zitiert: Juristische Methodenlehre Calliess, Christian: Inhalt, Dogmatik und Grenzen der Selbstregulierung im Medienrecht, AfP 2002, 465 ff. Calliess, Gralf-Peter: Grenzüberschreitende Verbraucherverträge: Rechtssicherheit und Gerechtigkeit auf dem elektronischen Weltmarktplatz, Tübingen 2006 Canaris, Claus-Wilhelm: Die Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht, München 1971 – Grundrechte und Privatrecht, AcP 184 (1984), 201 ff. – Handelsrecht, 24. Auflage, München 2006 – Verfassungs- und europarechtliche Aspekte der Vertragsfreiheit in der Privatrechtsgesellschaft, in: Festschrift für Peter Lerche zum 65. Geburtstag, München 1993, S. 873 ff. – Wandlungen des Schuldvertragsrechts – Tendenzen zu seiner „Materialisierung“, AcP 200 (2000), 273 ff. Claussen, Carsten/Bröcker, Norbert: Corporate-Governance-Grundsätze in Deutschland – nützliche Orientierungshilfe oder regulatorisches Übermaß?, AG 2000, 481 ff. – Der Corporate Governance-Kodex aus der Perspektive der kleinen und mittleren Börsen-AG, DB 2002, 1199 ff.
Literaturverzeichnis
197
Clemens, Thomas: Die Verweisung von einer Rechtsnorm auf andere Vorschriften – insbesondere ihre Verfassungsmäßigkeit, AöR 111 (1986), 63 ff. Coester-Waltjen, Dagmar: Die Inhaltskontrolle von Verträgen außerhalb des AGBG, AcP 190 (1990), 1 ff. Cornides, Thomas: Der Gesellschaftsvertrag als Tatsache betrachtet, ARSP-Beiheft 13 (1980), 36 ff. Damrau, Jan: Selbstregulierung im Kapitalmarktrecht: Eine rechtsökonomische Analyse der Normsetzung der deutschen Börsen und ihrer Träger, Berlin 2003 Dauner-Lieb, Barbara: Reichweite und Grenzen der Privatautonomie im Ehevertragsrecht: Zugleich Anmerkungen und Fragen zum Urteil des BVerfG vom 6. 2. 2001 – 1 BvR 12/92, AcP 201 (2001), 295 ff. – Verbraucherschutz durch Ausbildung eines Sonderprivatrechts für Verbraucher: Systemkonforme Weiterentwicklung oder Schrittmacher der Systemveränderung?, Berlin 1983 Dederer, Hans-Georg: Korporative Staatsgewalt: Integration privat organisierter Interessen in die Ausübung von Staatsfunktionen; zugleich eine Rekonstruktion der Legitimationsdogmatik, Tübingen 2004 Denninger, Erhard: Verfassungsrechtliche Anforderungen an die Normsetzung im Umweltund Technikrecht, Baden-Baden 1990, zitiert: Verfassungsrechtliche Anforderungen Diedrich, Volker: Unterhaltsberechnung nach Quoten und Tabellen: Zur Geschichte und Methode der Konkretisierung unterhaltsrechtlicher Generalklauseln, Berlin 1986 Di Fabio, Udo: Selbstverpflichtungen der Wirtschaft – Grenzgänger zwischen Freiheit und Zwang, JZ 1997, 969 ff. – Verlust der Steuerungskraft klassischer Rechtsquellen, NZS 1998, 449 ff. – Verwaltung und Verwaltungsrecht zwischen gesellschaftlicher Selbstregulierung und staatlicher Steuerung, VVDStRL 56 (1997), 235 ff. Dreier, Horst: Hierarchische Verwaltung im demokratischen Staat: Genese, aktuelle Bedeutung und funktionelle Grenzen eines Bauprinzips der Exekutive, Tübingen 1991 Dreier, Ralf: Der Begriff des Rechts, NJW 1986, 890 ff. Dreiocker, Karlheinz: Zur Dogmengeschichte der Auslobung, Kiel 1969 Drexl, Josef: Die wirtschaftliche Selbstbestimmung des Verbrauchers: Eine Studie zum Privat- und Wirtschaftsrecht unter Berücksichtigung gemeinschaftsrechtlicher Bezüge, Tübingen 1998 Dürig, Günter: Grundrechte und Zivilrechtsprechung, in: Festschrift zum 75. Geburtstag von Hans Nawiasky, München 1956, S. 157 ff. Dütz, Wilhelm/Thüsing, Gregor: Arbeitsrecht, 20. Auflage, München 2015 Dworkin, Ronald: Bürgerrechte ernstgenommen, Frankfurt am Main 1984 Ebbing, Frank: Private Zivilgerichte: Möglichkeiten und Grenzen privater (schiedsgerichtlicher) Zivilrechtsprechung, München 2003 Ebke, Werner F.: Der Deutsche Standardisierungsrat und das Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee: Aussichten für eine professionelle Entwicklung von Rechnungslegungsgrundsätzen, ZIP 1999, 1193 ff. – Keine Dritthaftung des Pflichtprüfers für Fahrlässigkeit nach den Grundsätzen des Vertrages mit Schutzwirkung für Dritte, BB 1997, 1731 ff.
198
Literaturverzeichnis
Ederle, Anton: Die jährliche Entsprechenserklärung und die Mär von der Selbstbindung, NZG 2010, 655 ff. Ehlert, Günter: Ehegattenunterhalt nach Tabelle, FamRZ 1980, 1083 ff. Ehrenberg, Victor: in: Ehrenberg, Victor (Hrsg.), Handbuch des gesamten Handelsrechts, Erster Band, Leipzig 1913, § 61 Ehricke, Ulrich: „Soft law“ – Aspekte einer neuen Rechtsquelle, NJW 1989, 1906 ff. Ehrlich, Eugen: Grundlegung der Soziologie des Rechts, herausgegeben von Manfred Rehbinder, 4. Auflage, Berlin 1989 Eidenmüller, Horst: Der homo oeconomicus und das Schuldrecht: Herausforderungen durch Behavioral Law and Economics, JZ 2005, 216 ff. – Forschungsperspektiven im Unternehmensrecht, ZGR 2007, 484 ff. – Effizienz als Rechtsprinzip: Möglichkeiten und Grenzen der ökonomischen Analyse des Rechts, 4. Auflage, Tübingen 2015 Enderlein, Wolfgang: Rechtspaternalismus und Vertragsrecht, München 1996 Engisch, Karl: Der rechtsfreie Raum, in: Karl Engisch, Beiträge zur Rechtstheorie, he rausgegeben von Paul Bockelmann, Arthur Kaufmann, Ulrich Klug, Frankfurt am Main 1984, S. 9 ff., zitiert: Engisch, in: Engisch, Beiträge zur Rechtstheorie Engländer, Armin: Die Lehren vom Gesellschaftsvertrag, Jura 2002, 381 ff. – Die neuen Vertragstheorien im Licht der Kontraktualismuskritik von David Hume, ARSP 2000, 2 ff. Enneccerus, Ludwig/Nipperdey, Hans Carl: Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, Band 1, Halbband 1: Allgemeine Lehren, Personen, Rechtsobjekte, Tübingen 1959 Eschenburg, Rolf: Die Legitimation von Ordnungen, in: Dettling, Warnfried (Hrsg.), Die Zähmung des Leviathan: Neue Wege der Ordnungspolitik, Baden-Baden 1980, S. 21 ff. Ettinger, Jochen/Grützediek, Elke: Haftungsrisiken im Zusammenhang mit der Abgabe der Corporate Governance Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG, AG 2003, 353 ff. Faber, Angela: Gesellschaftliche Selbstregulierungssysteme im Umweltrecht – unter besonderer Berücksichtigung der Selbstverpflichtungen, Köln 2001, zitiert: Gesellschaftliche Selbstregulierungssysteme Fastrich, Lorenz: Betriebsvereinbarung und Privatautonomie, RdA 1994, 129 ff. – Richterliche Inhaltskontrolle im Privatrecht, München 1992, zitiert: Richterliche Inhaltskontrolle Fehige, Christoph: Rawls und Präferenzen, in: Philosophische Gesellschaft Bad Homburg/ Hinsch, Winfried (Hrsg.), Zur Idee des politischen Liberalismus: John Rawls in der Diskussion, Frankfurt am Main 1997, S. 304 ff. Fezer, Karl-Heinz: Aspekte einer Rechtskritik an der economic analysis of law und am property rights approach, JZ 1986, 817 ff. – Nochmals: Kritik an der ökonomischen Analyse des Rechts, JZ 1988, 223 ff. – Teilhabe und Verantwortung: Die personale Funktionsweise des subjektiven Privatrechts, München 1986 Fischer-Lescano, Andreas/Teubner, Gunther: Regime-Kollisionen: Zur Fragmentierung des globalen Rechts, Frankfurt am Main 2006 Fischer-Lescano, Andreas/Viellechner, Lars: Globaler Rechtspluralismus, APuZ 2010, 26 ff.
Literaturverzeichnis
199
Fleischer, Holger: Corporate Governance in Europa als Mehrebenensystem: Vielfalt und Verflechtung der Gesetzgeber, Standardsetzer und Verhaltenskodizes, ZGR 2012, 160 ff. – Gesetz und Vertrag als alternative Problemlösungsmodelle im Gesellschaftsrecht, Prolegomena zu einer Theorie gesellschaftsrechtlicher Regelsetzung, ZHR 168 (2004), 673 ff. Florig, Hans-Georg: Die Rechtsnatur und Abdingbarkeit betrieblicher Übungen, arbeitsvertraglicher Einheitsregelungen und Gesamtzusagen, Frankfurt am Main 1993, zitiert: Gesamtzusagen Flume, Werner: Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Zweiter Band: Das Rechtsgeschäft, 4. Auflage, Berlin u.a. 1992, zitiert: Das Rechtsgeschäft – Rechtsgeschäft und Privatautonomie, in: Hundert Jahre Deutsches Rechtsleben: Festschrift zum 100-jährigen Bestehen des Deutschen Juristentages 1860 – 1960; im Auftrag der Ständigen Deputation des Deutschen Juristentages, Band 1, Karlsruhe 1960, S. 135 ff., zitiert: FS 100 Jahre DJT Franzius, Claudius: Governance und Regelungsstrukturen, VerwArch 97 (2006), 186 ff. Frenz, Walter: Selbstverpflichtungen der Wirtschaft, Tübingen 2001 Galperin, Hans: Grundlagen und Grenzen der Betriebsvereinbarung, BB 1949, 374 ff. Gamillscheg, Franz: Kollektives Arbeitsrecht, Band 1: Grundlagen, Koalitionsfreiheit, Tarifvertrag, Arbeitskampf und Schlichtung, München 1997 Gehringer, Axel: Die Prüfung befreiender Konzernabschlüsse nach § 292a HGB, WPg 2003, 849 ff. Geißler, Markus: Die Privatautonomie im Spannungsfeld sozialer Gerechtigkeit, JuS 1991, 617 ff. Gelhausen, Hans Friedrich/Hönsch, Henning: Folgen der Änderung des Deutschen Corporate Governance Kodex für die Entsprechenserklärung, AG 2003, 367 ff. Gernhuber, Joachim: Der Richter und das Unterhaltsrecht, FamRZ 1983, 1069 ff. Gessner, Volkmar: Rechtspluralismus und globale soziale Bewegungen, ZfRSoz 23 (2002), 277 ff. Giebeler, Rolf/Jaspers, Philipp: Reform des Risikomanagements und internen Kontrollsystems durch das BilMoG, in: Vorträge des Instituts für Unternehmens- und Kapitalmarktrecht, Band 1, herausgegeben von Rüdiger Veil, Jörn Axel Kämmerer, Karsten Schmidt, Hamburg 2010, zitiert: Risikomanagement Gierke, Otto von: Das deutsche Genossenschaftsrecht, Band 1: Rechtsgeschichte der deutschen Genossenschaft, Berlin 1868 – Das deutsche Genossenschaftsrecht, Band 2: Geschichte des deutschen Körperschaftsbegriffs, Berlin 1873 – Das deutsche Genossenschaftsrecht, Band 3: Die Staats- und Korporationslehre des Alterthums und des Mittelalters und ihre Aufnahme in Deutschland, Berlin 1881 – Das deutsche Genossenschaftsrecht, Band 4: Die Staats- und Korporationslehre der Neuzeit, Berlin 1913 – Deutsches Privatrecht, Band 1: Allgemeiner Teil und Personenrecht, Leipzig 1895 – Die soziale Aufgabe des Privatrechts, 2. Auflage, Frankfurt am Main 1948 Giesen, Richard: Tarifvertragliche Rechtsgestaltung für den Betrieb: Gegenstand und Reichweite betrieblicher und betriebsverfassungsrechtlicher Tarifnormen, Tübingen 2002, zitiert: Tarifliche Rechtsgestaltung
200
Literaturverzeichnis
Goette, Wulf: „Zu den Rechtsfolgen unrichtiger Entsprechenserklärungen“, in: Festschrift für Uwe Hüffer zum 70. Geburtstag, München 2010, S. 225 ff. Goslar, Sebastian/Linden, Klaus von der: § 161 AktG und die Anfechtbarkeit von Entlastungsbeschlüssen, NZG 2009, 1337 ff. Gottzmann, Nicole: Möglichkeiten und Grenzen der freiwilligen Selbstkontrolle in der Presse und der Werbung: Der Deutsche Presserat und der Deutsche Werberat, München 2005, zitiert: Selbstkontrolle in der Presse Graf, Helmut/Bisle, Michael: Der „Governance Kodex für Familienunternehmen“: Kein Ersatz für „maßgeschneiderte“ Gesellschaftsverträge, DStR 2010, 2409 ff. Griffiths, John: What is legal pluralism?, Journal of Legal Pluralism, 24 (1986), 1 ff. Grimm, Dieter: Die Zukunft der Verfassung, Band 1, 2. Auflage, Frankfurt am Main 1994 Gröning, Werner: Elementarunterhalt, Vorsorgeunterhalt und Krankenversicherungsunterhalt, FamRZ 1983, 331 ff. Groß, Thomas: Das Kollegialprinzip in der Verwaltungsorganisation, Tübingen 1999, zitiert: Das Kollegialprinzip Großkommentar zum Aktiengesetz, Erster Band: Einleitung, §§ 1 – 53, 4. Auflage, Berlin u.a. 2004; 38. Lieferung: Nachtrag § 161 AktG, 4. Auflage, Berlin u.a. 2012, zitiert: Bearbeiter, in: GroßKomm AktG Großmann-Doerth, Hans: Der Jurist und das autonome Recht des Welthandels, JW 1929, 3447 ff. – Selbstgeschaffenes Recht der Wirtschaft und staatliches Recht, in: Blaurock, Uwe/ Goldschmidt, Nils/Hollerbach, Alexander (Hrsg.), Das selbstgeschaffene Recht der Wirtschaft: Zum Gedenken an Hans Grossmann-Doerth (1894 – 1944), Tübingen 2005, S. 77 ff. Grottel, Bernd/Kieser, Matthias/Helfmann, Laura/Rau, Bernd/Kettenring, Tim: Governance Kodex für Familienunternehmen: Kritische Analyse und Stand der Umsetzung, ZCG 4/2012, 153 ff. Günther, Klaus: Der Wandel der Staatsaufgaben und die Krise des regulativen Rechts, in: Grimm, Dieter (Hrsg.), Wachsende Staatsaufgaben – sinkende Steuerungskraft des Rechts, Baden-Baden 1990, S. 51 ff. Haas, Ulrich/Adolphsen, Jens: Verbandsmaßnahmen gegenüber Sportlern, NJW 1995, 2146 ff. Habermas, Jürgen: Faktizität und Geltung, Frankfurt am Main 2001 Habersack, Mathias: „Kirch/Deutsche Bank“ und die Folgen – Überlegungen zu § 100 Abs. 5 AktG und Ziff. 5.4, 5.5. DCGK – in: Festschrift für Wulf Goette zum 65. Geburtstag, München 2011, S. 121 ff. – Staatliche und halbstaatliche Eingriffe in die Unternehmensführung, herausgegeben von der Ständigen Deputation des Deutschen Juristentages, Band I: Gutachten/Teil E zum 69. Deutschen Juristentag, München 2012, zitiert: Gutachten 69. DJT – Vertragsfreiheit und Drittinteressen: eine Untersuchung zu den Schranken der Privatautonomie unter besonderer Berücksichtigung der Fälle typischerweise gestörter Vertragsparität, Berlin 1992 Hacks, Susanne/Wellner, Wolfgang/Häcker, Frank: Schmerzensgeld-Beträge 2015, 35. Auflage, Bonn 2016 Haferkamp, Hans-Peter: Die heutige Rechtsmissbrauchslehre – Ein Ergebnis nationalsozialistischen Rechtsdenkens?, Baden-Baden 1995
Literaturverzeichnis
201
Hanau, Hans: Individualautonomie und Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten, Köln u.a. 1994, zitiert: Individualautonomie und Mitbestimmung – Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit als Schranke privater Gestaltungsmacht: Zu Herleitung und Struktur einer Angemessenheitskontrolle von Verfassungs wegen, Tübingen 2004, zitiert: Verhältnismäßigkeit als Schranke privater Gestaltungsmacht – § 7 Die Schranken privater Gestaltungsmacht – Zur Herleitung einer Angemessenheitskontrolle aus den Grenzen der Selbstbindung, in: Möslein, Florian (Hrsg.), Private Macht, Tübingen 2016, S. 119 ff. Hanau, Peter: Rechtswirkungen der Betriebsvereinbarung, RdA 1989, 207 ff. Handelsrechtsausschuss des Deutschen Anwaltvereins, Stellungnahme zu den Änderungsvorschlägen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex vom 1. 2. 2012, NZG 2012, 335 ff. Hanfland, Philipp: Haftungsrisiken im Zusammenhang mit § 161 AktG und dem Deutschen Corporate Governance Kodex: Zugleich ein Beitrag zur Haftung für fehlerhafte Kapitalmarktinformation, Baden-Baden 2007, zitiert: Haftungsrisiken Hänlein, Andreas: Die Legitimation betrieblicher Rechtsetzung, RdA 2003, 26 ff. Hart, Dieter: Normbildungsprozesse im Medizin- und Gesundheitsrecht, in: Joerges, Christian/Teubner, Gunther (Hrsg.), Rechtsverfassungsrecht: Recht-Fertigung zwischen Privatrechtsdogmatik und Gesellschaftstheorie, Baden-Baden 2003 Hart, H. L. A.: Der Begriff des Rechts: Mit dem Postskriptum von 1994 und einem Nachwort von Christoph Möllers, Berlin 2011 Hecker, Andreas/Peters, Marc: Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex, NZG 2012, 55 ff. Hedemann, Justus Wilhelm: Ausstoßung aus Vereinen, ArchBürgR 38 (1913), 132 ff. Heermann, Peter W.: Die Geltung von Verbandssatzungen gegenüber mittelbaren Mitgliedern und Nichtmitgliedern, NZG 1999, 325 ff. Heimann, Felix: Der Pressekodex im Spannungsfeld zwischen Medienrecht und Medien ethik, Frankfurt am Main 2009, zitiert: Der Pressekodex Heinrich, Christian: Formale Freiheit und materiale Gerechtigkeit: Die Grundlagen der Vertragsfreiheit und Vertragskontrolle am Beispiel ausgewählter Probleme des Arbeitsrechts, Tübingen 2000 Heintzen, Markus: Beteiligung Privater an der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben und staatliche Verantwortung, VVDStRL 62 (2003), 220 ff. – Der Deutsche Corporate Governance Kodex aus der Sicht des Verfassungsrechts: Erwiderung auf Seidel, Der DCGK – eine private oder doch eine staatliche Regelung?, ZIP 2004, 285 ff. – Zur Verfassungsmäßigkeit von § 292 a Abs. 2 Nr. 2 a) HGB, BB 1999, 1050 ff. Helberg, Andreas: Normabwendende Selbstverpflichtungen als Instrumente des Umweltrechts: Verfassungs- und verwaltungsrechtliche Voraussetzungen und Grenzen, Sinzheim 1999 Hellermann, Johannes: Private Standardsetzung im Bilanzrecht – öffentlich-rechtlich gesehen, NZG 2000, 1097 ff. Helm, Johann Georg: Private Norm und staatliches Recht beim Massenvertrag, JuS 1965, 121 ff. Hendler, Reinhard: Selbstverwaltung als Ordnungsprinzip: Zur politischen Willensbildung und Entscheidung im demokratischen Verfassungsstaat der Industriegesellschaft, Köln u.a. 1984
202
Literaturverzeichnis
Herberg, Martin: Globalisierung und private Selbstregulierung: Umweltschutz in multinationalen Unternehmen, Frankfurt am Main u.a. 2007 Herbst, Tobias: Legitimation durch Verfassungsgebung: Ein Prinzipienmodell der Legitimität staatlicher und supranationaler Hoheitsgewalt, Baden-Baden 2003 Herschel, Wilhelm: Entwicklungstendenzen des Arbeitsrechts, RdA 1956, 161 ff. – Regeln der Technik, NJW 1968, 617 ff. – Betriebsvereinbarung oder Betriebssatzung?, RdA 1948, 47 ff. Hesse, Konrad: Bemerkungen zur heutigen Problematik und Tragweite der Unterscheidung von Staat und Gesellschaft, DÖV 1975, 437 ff. – Bemerkungen zur heutigen Problematik und Tragweite der Unterscheidung von Staat und Gesellschaft, in: Häberle, Peter/Hollerbach, Alexander (Hrsg.), Konrad Hesse: Ausgewählte Schriften, Heidelberg 1984 – Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 20. Auflage, Heidelberg 1995 Hicks, John R.: Foundation of Welfare Economics, Econ. J. 49 (1939), 696 ff. Hilger, Marie-Luise: Das betriebliche Ruhegeld: zugleich ein Beitrag zum Recht der betrieblichen Arbeitsbedingungen, Heidelberg 1959 Hillgruber, Christian: Grundrechtsschutz im Vertragsrecht – zugleich: Anmerkung zu BVerfG NJW 1990, 1469, AcP 191 (1991), 69 ff. Hoeren, Thomas: Selbstregulierung im Banken- und Versicherungsrecht, Karlsruhe 1995 Hoerster, Norbert: John Rawls’ Kohärenztheorie der Normenbegründung, in: Höffe, Otfried (Hrsg.), Über John Rawls’ Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt am Main 1977, S. 57 ff. – Was ist Recht? Grundfragen der Rechtsphilosophie, München 2006 Höffe, Otfried (Hrsg.): Einführung in die utilitaristische Ethik: Klassische und zeitgenössische Texte, 4. Auflage, Tübingen, Basel 2008 – Politische Gerechtigkeit: Grundlegung einer kritischen Philosophie von Recht und Staat, 3. Auflage, Frankfurt am Main 2002 Höffe, Otfried/Demmer, Klaus/Hollerbach, Alexander: Naturrecht, in: Görres-Gesellschaft (Hrsg.), Staatslexikon: Recht, Wirtschaft, Gesellschaft, Band 3, 7. Auflage, Freiburg, Basel, Wien 1995, Sp. 1296 ff. Höffe, Otfried/Hollerbach, Alexander/Kerber, Walter: Gerechtigkeit, in: Görres-Gesellschaft (Hrsg.), Staatslexikon: Recht, Wirtschaft, Gesellschaft, Band 2, 7. Auflage, Freiburg, Basel, Wien 1995, Sp. 895 ff. Hoffmann-Becking, Michael: Deutscher Corporate Governance Kodex – Anmerkungen zu Zulässigkeit, Inhalt und Verfahren, in: Festschrift für Uwe Hüffer zum 70. Geburtstag, München 2010, S. 337 ff. – Zehn kritische Thesen zum Deutschen Corporate Governance Kodex, ZIP 2011, 1173 ff. Hoffmann-Riem, Wolfgang: Gesetz und Gesetzesvorbehalt im Umbruch: Zur Qualitäts-Gewährleistung durch Normen, AöR 130 (2005), 5 ff. – Verfahrensprivatisierung als Modernisierung, in: Hoffmann-Riem, Wolfgang/Schneider, Jens-Peter (Hrsg.), Verfahrensprivatisierung im Umweltrecht, Baden-Baden 1996, S. 9 ff., zitiert: Verfahrensprivatisierung – Modernisierung von Recht und Justiz: Eine Herausforderung des Gewährleistungsstaates, Frankfurt am Main 2001
Literaturverzeichnis
203
– Öffentliches Recht und Privatrecht als wechselseitige Auffangordnungen – Systematisierung und Entwicklungsperspektiven, in: Hoffman-Riem, Wolfgang/Schmidt-Aßmann, Eberhard (Hrsg.), Öffentliches Recht und Privatrecht als wechselseitige Auffangordnungen, Baden-Baden 1996, S. 261 ff., zitiert: Auffangordnungen – Das Recht des Gewährleistungsstaates, in: Schuppert, Gunnar Folke (Hrsg.), Der Gewährleistungsstaat – Ein Leitbild auf dem Prüfstand, Baden-Baden 2005, S. 89 ff. Hoffmann-Riem, Wolfgang/Schmidt-Aßmann, Eberhard/Voßkuhle, Andreas (Hrsg.): Grundlagen des Verwaltungsrechts, Band 1: Methoden, Maßstäbe, Aufgaben, Organisation, 2. Auflage, München 2012, zitiert: Bearbeiter, in: Hoffmann-Riem u.a. (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts Hofmann, Hasso: Einführung in die Rechts- und Staatsphilosophie, 5. Auflage, Darmstadt 2011, zitiert: Staatsphilosophie – Legitimität und Rechtsgeltung: Verfassungstheoretische Bemerkungen zu einem Problem der Staatslehre und der Rechtsphilosophie, Berlin 1977 Hohl, Patrick: Private Standardsetzung im Gesellschafts- und Bilanzrecht: Verfassungsrechtliche Grenzen kooperativer Standardsetzung im europäischen Mehrebenensystem an den Beispielen des Deutschen Corporate Governance Kodexes und der International Financial Reporting Standards, Berlin 2007, zitiert: Private Standardsetzung Holle, Martin: Verfassungsrechtliche Anforderungen an Normierungskonzepte im Lebensmittelrecht, Baden-Baden 2000, zitiert: Normierungskonzepte Holle, Philipp Maximilian: Legalitätskontrolle im Kapitalgesellschafts- und Konzernrecht, Tübingen 2014, zitiert: Legalitätskontrolle Hommelhoff, Peter: Deutscher Konzernabschluß: International Accounting Standards und das Grundgesetz, in: Festschrift für Walter Odersky zum 65. Geburtstag am 17. Juli 1996, Berlin u.a. 1996, S. 779 ff. Hommelhoff, Peter/Mattheus, Daniela: Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüfung: Fachliche Verlautbarungen und ihre Steuerungswirkung, in: Festschrift für Volker Röhricht zum 65. Geburtstag: Gesellschaftsrecht, Rechnungslegung, Sportrecht, Köln 2005, S. 897 ff. Hommelhoff, Peter/Schwab, Martin: Gesellschaftliche Selbststeuerung im Bilanzrecht – Standard Setting Bodies und staatliche Regulierungsverantwortung nach deutschem Recht, BFuP 1998, 38 ff. – Regelungsquellen und Regelungsebenen der Coporate Governance: Gesetz, Satzung, Codices, unternehmensinterne Grundsätze, in: Hommelhoff, Peter/Hopt, Klaus J./Werder, Axel von (Hrsg.), Handbuch Corporate Governance: Leitung und Überwachung börsennotierter Unternehmen in der Rechts- und Wirtschaftspraxis, 2. Auflage, Stuttgart 2009, S. 71 ff. – Staats-ersetzende Privatgremien im Unternehmensrecht, in: Festschrift für Heinrich Wilhelm Kruse zum 70. Geburtstag, Köln 2001, S. 693 ff. Hönn, Günther: Kompensation gestörter Vertragsparität: Ein Beitrag zum inneren System des Vertragsrechts, München 1982 Hopt, Klaus J.: Der Kapitalanlegerschutz im Recht der Banken: Gesellschafts-, bank- und börsenrechtliche Anforderungen an das Beratungs- und Verwaltungsverhalten der Kreditinstitute, München 1975, zitiert: Kapitalanlegerschutz – Europäisches und deutsches Übernahmerecht, ZHR 161 (1997), 368 ff.
204
Literaturverzeichnis
– Unternehmensführung, Unternehmenskontrolle, Modernisierung des Aktienrechts – Zum Bericht der Regierungskommission Corporate Governance – in: Hommelhoff, Peter/Lutter, Marcus/Schmidt, Karsten/Schön, Wolfgang/Ulmer, Peter (Hrsg.), Corporate Governance – Gemeinschaftssymposium der Zeitschriften ZHR/ZGR, ZHR-Beiheft 71, Heidelberg 2002, S. 27 ff., zitiert: Hopt, in: Hommelhoff u.a. (Hrsg.), Corporate Governance – Vergleichende Corporate Governance – Forschung und internationale Regulierung –, ZHR 175 (2011), 444 ff. Hromadka, Wolfgang/Maschmann, Frank: Arbeitsrecht, Band 2: Kollektivarbeitsrecht und Arbeitsstreitigkeiten, 6. Auflage, Berlin u.a. 2014 Huber, Ernst Rudolf: Wirtschaftsverwaltungsrecht, Zweiter Band, 2. Auflage, Tübingen 1954 Hucklenbruch, Gabriele: Umweltrelevante Selbstverpflichtungen – ein Instrument progressiven Umweltschutzes?, Berlin 2000 Hueck, Alfred: Normenverträge, in: Jherings Jahrbücher für die Dogmatik des bürgerlichen Rechts, 2. Folge, 37. Band, 1923 (= Band 73 von „Jherings Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts), S. 33 ff. Hueck, Alfred/Nipperdey, Hans Carl: Lehrbuch des Arbeitsrechts, Zweiter Band: Kollektives Arbeitsrecht, 1. Halbband (II/1), 7. Auflage, Berlin 1967 – Lehrbuch des Arbeitsrechts, Zweiter Band: Kollektives Arbeitsrecht, 2. Halbband (II/2), 7. Auflage, Berlin 1970 Hüffer, Uwe/Koch, Jens: Aktiengesetz, Kommentar, 12. Auflage, München 2016, zitiert: Koch, in: Hüffer/Koch, AktG – Aktiengesetz, Kommentar, 5. Auflage, München 2002, zitiert: Hüffer, AktG, 5. Auflage – Zur Wahl von Beratern des Großaktionärs in den Aufsichtsrat der Gesellschaft: Zugleich Besprechung LG Hannover v. 17. 3. 2010 – 23 O 124/09, ZIP 2010, 833 – Continental, ZIP 2010, 1979 ff. Hume, David: Die wertlose Fiktion vom Gesellschaftsvertrag, in: Hoerster, Norbert (Hrsg.), Klassische Texte der Staatsphilosophie, München 1976, S. 163 ff. – Über den ursprünglichen Vertrag, in: David Hume, Politische und ökonomische Essays, herausgegeben von Udo Bermbach, Teilband 2, Hamburg 1988, S. 301 ff. Husserl, Gerhart: Rechtskraft und Rechtsgeltung: Eine rechtsdogmatische Untersuchung, Erster Band: Genesis und Grenzen der Rechtsgeltung, Berlin 1925 Ihering, Rudolf von: Der Zweck im Recht, Erster Band, repografischer Nachdruck der 4. Auflage 1904, Hildesheim/New York 1970 Ihrig, Hans-Christoph/Wagner, Jens: Die Reform geht weiter: Das Transparenz- und Publizitätsgesetz kommt, BB 2002, 789 ff. Isensee, Josef: Das Grundrecht als Abwehrrecht und als staatliche Schutzpflicht, in: Isensee, Josef/Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band V: Allgemeine Grundrechtslehren, 2. Auflage, Heidelberg 2000, § 111, zitiert: HStR – Die alte Frage nach der Rechtfertigung des Staates: Stationen in einem laufenden Prozeß, JZ 1999, 265 ff. – Gemeinwohl im Verfassungsstaat, in: Isensee, Josef/Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band IV: Aufgaben des Staates, 3. Auflage, Heidelberg 2006, § 71, zitiert: HStR
Literaturverzeichnis
205
– Grundrechte und Demokratie: Die polare Legitimation im grundgesetzlichen Gemeinwesen, Der Staat 20 (1981), 161 ff. – Subsidiaritätsprinzip und Verfassungsrecht: eine Studie über das Regulativ des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft, Berlin 1968, zitiert: Subsidiaritätsprinzip – Vertragsfreiheit im Griff der Grundrechte – Inhaltskontrolle von Verträgen am Maßstab der Verfassung, in: Festschrift für Bernhard Großfeld zum 65. Geburtstag, Heidelberg 1999, S. 485 ff. Jahnke, Volker: Tarifautonomie und Mitbestimmung, München 1984 Jarass, Hans D.: Art. 1 GG, in: Jarass, Hans D./Pieroth, Bodo: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 14. Auflage, München 2016 Jauernig, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommentar, herausgegeben von Rolf Stürner, 16. Auflage, München 2015, zitiert: Bearbeiter, in: Jauernig, BGB Jellinek, Georg: Allgemeine Staatslehre, 3. Auflage, Bad Homburg vor der Höhe, Berlin/ Zürich 1966 – Gesetz und Verordnung: staatsrechtliche Untersuchung auf rechtsgeschichtlicher und rechtsvergleichender Grundlage, Aalen 1964 Jesch, Dietrich: Gesetz und Verwaltung: Eine Problemstudie zum Wandel des Gesetzmäßigkeitsprinzipes, 2. Auflage, Tübingen 1968 Jestaedt, Matthias: Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung: Entscheidungsteilhabe Privater an der öffentlichen Verwaltung auf dem Prüfstand des Verfassungsprinzips Demokratie, Berlin 1993 Junker, Abbo: Grundkurs Arbeitsrecht, 15. Auflage, München 2016 Kadelbach, Stefan/Günther, Klaus: Recht ohne Staat?, in: Kadelbach, Stefan/Günther, Klaus (Hrsg.), Recht ohne Staat? Zur Normativität nichtstaatlicher Rechtsetzung, Frankfurt am Main/New York 2011, S. 9 ff. Kähler, Lorenz: Abschied vom rechtsphilosophischen Etatismus: Besteht ein notwendiger Zusammenhang zwischen Recht und Staat?, in: Calliess, Gralf-Peter/Mahlmann, Mat thias (Hrsg.), Der Staat der Zukunft: Vorträge der Tagung des Jungen Forums Rechtsphilosophie in der IVR, 17.-19. April 2001 an der Freien Universität Berlin, Stuttgart 2002, S. 69 ff. Kaldor, Nicholas: Welfare Propositions of Economics and Interpersonal Comparisons of Utility, Econ. J. 49 (1939), 549 ff. Kallmeyer, Harald: Die Mängel des Übernahmekodex der Börsensachverständigenkommission, ZHR 161 (1997), 435 ff. Kämmerer, Jörn Axel: Selbstregulierung am Beispiel des Kapitalmarktrechts: Eine normativ-institutionelle Positionsbestimmung, in: Hopt, Klaus J./Veil, Rüdiger/Kämmerer, Jörn Axel (Hrsg.), Kapitalmarktgesetzgebung im europäischen Binnenmarkt, Tübingen 2008, S. 145 ff., zitiert: Kapitalmarktgesetzgebung Kant, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten: Kommentar von Christoph Horn, Corinna Mieth und Nico Scarano, Frankfurt am Main 2007 Kantorowicz, Hermann: Der Begriff des Rechts, Göttingen 1963 Kaser, Max: Der Privatrechtsakt in der römischen Rechtsquellenlehre, in: Festschrift für Franz Wieacker zum 70. Geburtstag, Göttingen 1978, S. 90 ff. Kaufmann, Arthur: Grundprobleme der Rechtsphilosophie: Eine Einführung in das rechtsphilosophische Denken, München 1994
206
Literaturverzeichnis
– Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit, München 1989 Kelsen, Hans: Allgemeine Theorie der Normen: Im Auftrag des Hans-Kelsen-Instituts aus dem Nachlass herausgegeben von Kurt Ringhofer und Robert Walter, Wien 1979 – Eine Grundlegung der Rechtssoziologie, ArchSozWiss. 39 (1915), 839 ff. – Reine Rechtslehre: Mit einem Anhang: Das Problem der Gerechtigkeit, 2. Auflage, Wien 1960 – Was ist juristischer Positivismus, JZ 1965, 465 ff. Kersting, Mark Oliver: Der Neue Markt der Deutsche Börse AG 1997, 222 ff. Kersting, Wolfgang: Die politische Philosophie des Gesellschaftsvertrags, Darmstadt 2005 Keßler, Hans-Christian: Strafrechtliche Aspekte von Corporate Governance: Eine Untersuchung der Strafbarkeit im Zusammenhang mit der gesetzlichen Corporate Governance Publizität nach § 161 AktG und § 289a HGB sowie dem Deutschen Corporate Govern ance Kodex, Berlin 2012, zitiert: Strafrechtliche Aspekte Kiefner, Alexander: Fehlerhafte Entsprechenserklärungen und Anfechtbarkeit von Hauptversammlungsbeschlüssen, NZG 2011, 201 ff. Kiethe, Kurt: Falsche Erklärung nach § 161 AktG – Haftungsverschärfung für Vorstand und Aufsichtsrat?, NZG 2003, 559 ff. Kirchgässner, Gebhard: Führt der homo oeconomicus das Recht in die Irre? – Zur Kritik an der ökonomischen Analyse des Rechts, JZ 1991, 104 ff. Kirchhof, Ferdinand: Private Rechtsetzung, Berlin 1987 Kirchhof, Paul: Gesetzgebung und private Regelsetzung als Geltungsgrund für Rechnungslegungspflichten, ZGR 2000, 681 ff. Kirchner, Christian: Ökonomische Theorie des Rechts, Berlin/New York 1997 Kirschbaum, Tom: Anmerkung zu LG München I, Urteil vom 22. 11. 2007 – 5 HK O 10614/07, ZIP 2007, 2362 ff. – Entsprechenserklärungen zum englischen Combined Code und zum Deutschen Corporate Governance Kodex, Köln u.a. 2006 Kirschbaum, Tom/Wittmann, Martin: Selbstregulierung im Gesellschaftsrecht: Der Deutsche Corporate Governance Kodex, JuS 2005, 1062 ff. Kleindiek, Detlef: Anfechtbarkeit von Entlastungsbeschlüssen wegen unrichtiger Entsprechenserklärung nach § 161 AktG, in: Festschrift für Wulf Goette zum 65. Geburtstag, 2011, S. 239 ff. – Deliktshaftung und juristische Person, Tübingen 1997 Kliemt, Hartmut: Keine Theorie der Gerechtigkeit, ARSP-Beiheft 74 (2000), 217 ff. Klingelhöffer, Hans: Tabellen und Leitlinien zum Unterhaltsrecht, ZRP 1994, 383 ff. Kloepfer, Michael: Zu den neuen umweltrechtlichen Handlungsformen des Staates, JZ 1991, 737 ff. Kloepfer, Michael/Elsner, Thomas: Selbstregulierung im Umwelt- und Technikrecht, Per spektiven einer kooperativen Normsetzung, DVBl. 1996, 964 ff. Klösel, Daniel: Compliance-Richtlinien: Zum Funktionswandel des Zivilrechts im Gewährleistungsstaat, Baden-Baden 2012 Knebel, Jürgen/Wicke, Lutz/Michael, Gerhard: Selbstverpflichtungen und normersetzende Umweltverträge als Instrumente des Umweltschutzes, Berlin 1999
Literaturverzeichnis
207
Koeberle-Schmid, Alexander/Fahrion, Hans-Jürgen/Witt, Peter (Hrsg.): Family Business Governance – Erfolgreiche Führung von Familienunternehmen, 2. Auflage, Berlin 2012 Koeberle-Schmid, Alexander/Schween, Karsten/May, Peter: Governance Kodex für Familienu nternehmen in der Praxis – Ergebnisse einer Studie über Familienverfassungen, BB 2011, 2499 ff. Köhler, Wolfgang: Geschichte der Düsseldorfer Tabelle (Entstehung, Entwicklung und Rechtsnatur eines Richterwerks), in: Festschrift für Kurt Rebmann zum 65. Geburtstag, München 1989, S. 569 ff. Koller, Peter: Theorie des Rechts: Eine Einführung, 2. Auflage, Wien/Köln/Weimar 1997 Kollmann, Katharina: Aktuelle Corporate-Governance-Diskussion in Deutschland – Deutscher Corporate-Governance-Kodex der Regierungskommission sowie Transparenzund Publizitätsgesetz (TransPuG) –, WM Sonderbeilage Nr. 1 zu Heft 1/2003, S. 3 ff. Kölner Kommentar zum Aktiengesetz, Band 3/2, §§ 142 – 178 AktG, 3. Auflage, Köln 2015, zitiert: Bearbeiter, in KölnKomm AktG Köndgen, Johannes: Privatisierung des Rechts, Private Governance zwischen Deregulierung und Rekonstitutionalisierung, AcP 206 (2006), 477 ff. Köpp, Tobias: Normvermeidende Absprachen zwischen Staat und Wirtschaft, Berlin 2001 Kort, Michael: Corporate Governance-Fragen der Größe und Zusammensetzung des Aufsichtsrats bei AG, GmbH und SE, AG 2008, 137 ff. – Corporate Governance-Grundsätze als haftungsrechtlich relevante Verhaltensstandards?, in: Festschrift für Karsten Schmidt, Köln 2009, S. 945 ff. – Die Außenhaftung des Vorstands bei der Abgabe von Erklärungen nach § 161 AktG, Festschrift für Thomas Raiser zum 70. Geburtstag am 20. Februar 2005, Berlin 2005, S. 203 ff. Krämer, Ralf: Der Begriff der vertraglichen Einheitsregelung und Gesamtzusage sowie ihre Abgrenzung zur Individualzusage, Erlangen 1995, zitiert: Gesamtzusage Kremer, Thomas: Zur Anwendung des Kodex aus Unternehmenssicht, DB Standpunkte 2011, 55 f. Kremer, Thomas/Bachmann, Gregor/Lutter, Marcus/Werder, Axel von (Hrsg.): Kommentar zum Deutschen Corporate Governance Kodex, 6. Auflage, München 2016, zitiert: Bearbeiter, in: Kremer u.a. (Hrsg.), DCGK Kreutz, Peter: Die Grenzen der Betriebsautonomie, München 1979 Krieger, Gerd: Corporate Governance und Corporate Governance Kodex in Deutschland, ZGR 2012, 202 ff. Krüger, Herbert: Allgemeine Staatslehre, 2. Auflage, Stuttgart, Berlin/Köln/Mainz 1966 Kühling, Jürgen: Sektorspezifische Regulierung in den Netzwirtschaften: Typologie –Wirtschaftsverwaltungsrecht – Wirtschaftsverfassungsrecht, München 2004, zitiert: Sektorspezifische Regulierung Ladeur, Karl-Heinz: Negative Freiheitsrechte und gesellschaftliche Selbstorganisation: Zur Erzeugung von Sozialkapital durch Institutionen, Tübingen 2000, zitiert: Negative Freiheitsrechte Lamb, Irene: Kooperative Gesetzeskonkretisierung: Verfahren zur Erarbeitung von Umwelt- und Technikstandards, Baden-Baden 1995 Lampe, Ernst-Joachim: Was ist „Rechtspluralismus“?, in: Lampe, Ernst-Joachim (Hrsg.), Rechtsgleichheit und Rechtspluralismus, Baden-Baden 1995, S. 8 ff.
208
Literaturverzeichnis
Lange, Knut Werner: Kodex und Familienverfassung als Mittel der Corporate Governance in Familienunternehmen, in: Festschrift für Brun-Hagen Hennerkes zum 70. Geburtstag, München 2009, S. 135 ff. Langhart, Albrecht: Rahmengesetz und Selbstregulierung: Kritische Betrachtungen zur vorgeschlagenen Struktur eines Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel unter Berücksichtigung des amerikanischen und englischen Börsenrechts, Zürich 1993 Larenz, Karl: Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts, 7. Auflage, München 1989, zitiert: BGB AT – Lehrbuch des Schuldrechts, Band 1: Allgemeiner Teil, 14. Auflage, München 1987 – Richtiges Recht: Grundzüge einer Rechtsethik, München 1979 – Zur Rechtmässigkeit einer „Vereinsstrafe“, in: Gedächtnisschrift für Rolf Dietz, München 1973, S. 45 ff. Larenz, Karl/Canaris, Claus-Wilhelm: Lehrbuch des Schuldrechts, Zweiter Band: Besonderer Teil, 2. Halbband, 13. Auflage, München 1994, zitiert: BT II/2 – Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 3. Auflage, Berlin u.a. 1995, zitiert: Methodenlehre Larenz, Karl/Wolf, Manfred: Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 9. Auflage, München 2004, zitiert: BGB AT (2004) Lepsius, Oliver: Standardsetzung und Legitimation, in: Möllers, Christoph/Voßkuhle, Andreas/Walter, Christian, Internationales Verwaltungsrecht: Eine Analyse anhand von Referenzgebieten, Tübingen 2007, S. 345 ff. Lieb, Manfred: Die Rechtsnatur der Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen als Problem des Geltungsbereichs autonomer Normensetzung, Stuttgart 1960, zitiert: Rechtsnatur der Allgemeinverbindlicherklärung Lobinger, Thomas: Rechtsgeschäftliche Verpflichtung und autonome Bindung: Zu den Entstehungsgründen vermögensaufstockender Leistungspflichten im Bürgerlichen Recht, Tübingen 1999, zitiert: Autonome Bindung Lorenz, Stephan: Der Schutz vor dem unerwünschten Vertrag: Eine Untersuchung von Möglichkeiten und Grenzen der Abschlußkontrolle im geltenden Recht, München 1997 – Gewinnmitteilungen als „geschäftsähnliche Handlungen”: Anwendbares Recht, internationale Zuständigkeit und Erfüllungsort, NJW 2006, 472 ff. – Gewinnmitteilungen aus dem Ausland: Kollisionsrechtliche und internationalzivilprozessuale Aspekte von § 661a BGB, NJW 2000, 3305 ff. Löwisch, Manfred/Rieble, Volker: Tarifvertragsgesetz: Kommentar, 3. Auflage, München 2012 Lübbe-Wolff, Gertrude: Konfliktmittlung beim Erlaß technischer Regeln, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Konfliktbewältigung durch Verhandlungen, Band 2, Baden-Baden 1990, S. 87 ff., zitiert: Konfliktbewältigung – Verfassungsrechtliche Fragen der Normsetzung und Normkonkretisierung im Umweltrecht, ZG 1991, 219 ff. Lucke, Doris: Akzeptanz: Legitimität in der „Abstimmungsgesellschaft“, Opladen 1995 Luhmann, Niklas: Das Recht der Gesellschaft, Frankfurt am Main 2002 – Legitimation durch Verfahren, 4. Auflage, Frankfurt am Main 1997
Literaturverzeichnis
209
– Rechtssoziologie, 4. Auflage, Wiesbaden 2008 Lutter, Marcus: Der Kodex und das Recht, in: Festschrift für Klaus J. Hopt zum 70. Geburtstag am 24. August 2010: Unternehmen, Markt und Verantwortung, Band 1, Berlin u.a. 2010, S. 1025 ff. – Die Erklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex gemäß § 161 AktG: Pflichtverstöße und Binnenhaftung von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, ZHR 166 (2002), 523 ff. – Kodex guter Unternehmensführung und Vertrauenshaftung, in: Festschrift für Jean Nicolas Druey zum 65. Geburtstag, Zürich u.a. 2002, S. 463 ff. – Theorie der Mitgliedschaft: Prolegomena zu einem Allgemeinen Teil des Korporationsrechts, AcP 180 (1980), 84 ff. – Vergleichende Corporate Governance – Die deutsche Sicht, ZGR 2001, 224 ff. – Zur Bindung der Organmitglieder an die Kodex-Erklärung nach § 161 AktG, in: Liber Amicorum für Martin Winter, Köln 2011, S. 449 ff. Machura, Stefan: Fairneß und Legitimität, Baden-Baden 2001 – Niklas Luhmanns „Legitimation durch Verfahren“ im Spiegel der Kritik, ZfRSoz 14 (1993), 97 ff. Magen, Stefan: Fairness, Eigennutz und die Rolle des Rechts: Eine Analyse auf Grundlage der Verhaltensökonomik, in: Recht und Verhalten: Beiträge zu behavioral law and economics, herausgegeben von Christoph Engel, Markus Englerth, Jörn Lüdemann und Indra Spiecker genannt Döhmann, Tübingen 2007, S. 261 ff. – Zur Legitimation privaten Rechts, in: Bumke, Christian/Röthel, Anne (Hrsg.), Privates Recht, Tübingen 2012, S. 229 ff. Maihofer, Werner (Hrsg.): Begriff und Wesen des Rechts, Darmstadt 1973 Manigk, Alfred: Die Privatautonomie im Aufbau der Rechtsquellen, Berlin 1935 Marburger, Peter: Die haftungs- und versicherungsrechtliche Bedeutung technischer Regeln, VersR 1983, 597 ff. – Die Regeln der Technik im Recht, Köln u.a. 1979, zitiert: Regeln der Technik Marti, Arnold: Selbstregulierung anstelle staatlicher Gesetzgebung?, ZBl. 2000, 561 ff. Mathis, Klaus: Effizienz statt Gerechtigkeit?: Auf der Suche nach den philosophischen Grundlagen der ökonomischen Analyse des Rechts, 3. Auflage, Berlin 2009 Maunz/Dürig, herausgegeben von Roman Herzog, Rupert Scholz, Matthias Herdegen, Hans H. Klein, Grundgesetz, Kommentar, Loseblattausgabe, Stand: 30. Lieferung, Dezember 1992; Stand: 77. Lieferung, Mai 2016, München, zitiert: Bearbeiter, in: Maunz/Dürig, GG (Stand der Bearbeitung) Maurer, Hartmut: Allgemeines Verwaltungsrecht, 18. Auflage, München 2011 – Kontinuitätsgewähr und Vertrauensschutz, in: Isensee, Josef/Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band IV: Aufgaben des Staates, 3. Auflage, Heidelberg 2006, § 79, zitiert: HStR May, Peter/Koeberle-Schmid, Alexander: Governance Kodex als Leitlinie für die verantwortungsvolle Führung von Familienunternehmen, DB 2011, 485 ff. Mayer, Jörg: Anmerkung zum Urteil des BGH vom 02. 02. 2011 − XII ZR 11/09, NJW 2011, 2972 Mayer-Maly, Theo: Recht, in: Görres-Gesellschaft (Hrsg.), Staatslexikon: Recht, Wirtschaft, Gesellschaft, Band 4, 7. Auflage, Freiburg/Basel/Wien 1995, Sp. 665 ff.
210
Literaturverzeichnis
Meder, Stephan: Die Krise des Nationalstaates und ihre Folgen für das Kodifikationsprinzip, JZ 2006, 477 ff. – Ius non scriptum – Traditionen privater Rechtsetzung, 2. Auflage, Tübingen 2009 Medicus, Dieter: Allgemeiner Teil des BGB, 10. Auflage, Heidelberg u.a. 2010, zitiert: BGB AT – Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Privatrecht, AcP 192 (1992), 35 ff. – Zur gerichtlichen Inhaltskontrolle notarieller Verträge, München 1989 Medicus, Dieter/Lorenz, Stephan: Schuldrecht I: Allgemeiner Teil, 21. Auflage, München 2015 Mehde, Veith: Neues Steuerungsmodell und Demokratieprinzip, Berlin 2000 Merkl, Adolf: Die Lehre von der Rechtskraft, entwickelt aus dem Rechtsbegriff: Eine rechtstheoretische Untersuchung, Leipzig/Wien 1923 Merkt, Hanno: Die Zukunft der privatrechtlichen Forschung im Unternehmens- und Kapitalmarktrecht, ZGR 2007, 532 ff. – Privatisierung der Regelsetzung und -durchsetzung im Handels- und Wirtschaftsrecht, in: Assmann, Heinz-Dieter/Isomura, Tamotsu/Kansaku Hiruyuki/Kitagawa, Zentaro/ Nettesheim, Martin (Hrsg.), Markt und Staat in einer globalisierten Wirtschaft, Tübingen 2010, S. 169 ff. Merle, Werner: Die Vereinbarung als mehrseitiger Vertrag: Vertragsschluss durch Zustimmung zu einem Text?, in: Festschrift für Joachim Wenzel zum 65. Geburtstag, Köln 2005, S. 251 ff. Merten, Detlef: Das System der Rechtsquellen (1. Teil), Jura 1981, 169 ff. Mertens, Hans-Joachim: Leges praeter legem, Helmut Coing zum 70. Geburtstag, AG 1982, 29 ff. Meyer-Cording, Ulrich: Die Rechtsnormen, Tübingen 1971 – Die Vereinsstrafe, Tübingen 1957 Michael, Lothar: Private Standardsetter und demokratisch legitimierte Rechtsetzung, in: Bauer, Hartmut/Huber, Peter M./Sommermann, Karl-Peter (Hrsg.), Demokratie in Europa, Tübingen 2005, S. 431 ff. – Rechtsetzende Gewalt im kooperierenden Verfassungsstaat: normprägende und normersetzende Absprachen zwischen Staat und Wirtschaft, Berlin 2002 Michaels, Ralf: The re-state-ment of non-state law: the state, choice of law, and the chal lenge form global legal pluralism, the wayne law review, vol. 51, 1209 ff. Möllers, Thomas M. J.: Effizienz als Maßstab des Kapitalmarktrechts: Die Verwendung empirischer und ökonomischer Argumente zur Begründung zivil-, straf- und öffentlich-rechtlicher Sanktionen, AcP 208 (2008), 1 ff. – Sekundäre Rechtsquellen: Eine Skizze zur Vermutungswirkung und zum Vertrauensschutz bei Urteilen, Verwaltungsvorschriften und privater Normsetzung, in: Bauer, Jobst-Hubertus/Möllers, Thomas M. J./Sandmann, Bernd (Hrsg.), Festschrift für Herbert Buchner zum 70. Geburtstag, München 2009, S. 649 ff. – Standards als sekundäre Rechtsquellen: Ein Beitrag zur Bindungswirkung von Standards, in: Möllers, Thomas M. J. (Hrsg.), Geltung und Faktizität von Standards, Baden-Baden 2009, S. 144 ff.
Literaturverzeichnis
211
Möllers, Thomas M. J./Fenkonja, Benjamin: Private Rechtsetzung im Schatten des Gesetzes: Ein Beitrag zur Bindungswirkung privaten Rechts am Beispiel des Deutschen Corporate Governance Kodex und der Deutschen Rechnungslegungs Standards, ZGR 2012, 777 ff. Möslein, Florian: § 1 Private Macht als Forschungsgegenstand der Privatrechtswissenschaft, in: Möslein, Florian (Hrsg.), Private Macht, Tübingen 2016, S. 1 ff. Motive zu dem Entwurfe eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich, Band I: Allgemeiner Teil, Berlin 1988, zitiert: Motive I Motive zu dem Entwurfe eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich, Band II: Recht der Schuldverhältnisse, Berlin 1988, zitiert: Motive II Moxter, Adolf: Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee – Aufgaben und Bedeutung, BB 1998, 1425 ff. Mülbert, Peter O.: Rechtsfragen rund um den Deutschen Corporate Governance Kodex, Arbeitspapiere 2012, Institut für deutsches und internationales Recht des Spar-, Giro- und Kreditwesens an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, abrufbar unter: http://institut-kreditrecht.de/pdf/gelbe_reihe/v2_Muelbert_Rechtsfragen_rund_um_den_-DCGK. pdf, S. 1 ff., zitiert: Arbeitspapiere 2012 Mülbert, Peter O./Wilhelm, Alexander: Grundfragen des Deutschen Corporate Governance Kodex und der Entsprechenserklärung nach § 161 AktG, ZHR 176 (2012), 286 ff. Müller, Felix: Ökonomische Theorie des Rechts, in: Buckel, Sonja/Christensen, Ralph/Fischer-Lescano, Andreas (Hrsg.), Neue Theorien des Rechts, Stuttgart 2006, S. 323 ff. Müller, Georg: Elemente einer Rechtsetzungslehre, 3. Auflage, Zürich 1999 – Rechtssetzung im Gewährleistungsstaat, in: Festschrift für Hartmut Maurer, München 2001, S. 227 ff. Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, Band 2, §§ 76 – 117, MitbestG, DrittelbG, 4. Auflage, München 2014; Band 3, §§ 118 – 178, 3. Auflage, München 2013, zitiert: Bearbeiter, in: MüKo AktG Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 1: Allgemeiner Teil, §§ 1 – 240, ProstG, AGG, 7. Auflage, München 2015; Band 2: Schuldrecht Allgemeiner Teil, §§ 241 – 432, 7. Auflage, München 2016; Band 4: Schuldrecht Besonderer Teil II, §§ 611 – 704, 6. Auflage, München 2012; Band 5: Schuldrecht Besonderer Teil III, §§ 705 – 853, 6. Auflage, München 2013; Band 6: Sachenrecht, §§ 854 – 1296, WEG, ErbbauRG, 6. Auflage, München 2013; Band 7: Familienrecht I: §§ 1297 – 1588, Versorgungsausgleichgesetz, Gewaltschutzgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, 6. Auflage, München 2013; Band 8: Familienrecht II: §§ 1589 – 1921, SGB VIII, 6. Auflage, München 2012; Band 9: Erbrecht: §§ 1922 – 2385, §§ 27 – 35 BeurkG, 6. Auflage, München 2013, zitiert: Bearbeiter, in: MüKo BGB Münchener Kommentar zum Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung – GmbHG, Band 2: §§ 35 – 52, 2. Auflage, München 2016, zitiert: Bearbeiter, in: MüKo GmbHG Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch, Band 2: Zweites Buch, Handelsgesellschaften und stille Gesellschaft, Erster Abschnitt: Offene Handelsgesellschaft, §§ 105 – 160; 4. Auflage, München 2016; Band 4: Drittes Buch, Handelsbücher, §§ 238 – 342e HGB, 3. Auflage, München 2013, Band 5: Viertes Buch, Handelsgeschäfte; Erster Abschnitt: Allgemeine Vorschriften, Zweiter Abschnitt: Handelskauf, Dritter Abschnitt: Kommissionsgeschäft, §§ 343 – 406, Wiener UN-Übereinkommen über Verträge über den inter-
212
Literaturverzeichnis
nationalen Warenkauf – CISG, 3. Auflage, München 2013, zit.: Bearbeiter, in: MüKo HGB Münkler, Herfried/Bluhm, Harald (Hrsg.): Gemeinwohl und Gemeinsinn: Historische Semantiken politischer Leitbegriffe, Berlin 2001 – Gemeinwohl und Gemeinsinn: Zwischen Normativität und Faktizität, Berlin 2002 Münkler, Herfried/Fischer, Karsten (Hrsg.): Gemeinwohl und Gemeinsinn: Rhetoriken und Perspektiven sozial-moralischer Orientierung, Berlin 2002 – Gemeinwohl und Gemeinsinn im Recht: Konkretisierung und Realisierung öffentlicher Interessen, Berlin 2002 Musielak, Hans-Joachim: Zur gerichtlichen Praxis bei der Bemessung des Schmerzengeldes – Ergebnisse einer Befragung von Richtern –, VersR 1982, 613 ff. Mutter, Stefan: Überlegungen zur Justiziabilität von Entsprechenserklärungen nach § 161 AktG, ZGR 2009, 788 ff. Nebel, Andreas: Die Normen des Betriebsverbandes am Beispiel der ablösenden Betriebsvereinbarung, Heidelberg 1989, zitiert: Die Normen des Betriebsverbandes Nikisch, Arthur: Arbeitsrecht, Band 2: Koalitionsrecht, Arbeitskampfrecht und Tarifvertragsrecht, 2. Auflage, Tübingen 1959 Nowak, Eric/Rott, Roland/Mahr, Till G.: Wer den Kodex nicht einhält, den bestraft der Kapitalmarkt?: Eine empirische Analyse der Selbstregulierung und Kapitalmarktrelevanz des Deutschen Corporate Governance Kodex, ZGR 2005, 252 ff. Nozick, Robert: Anarchy, State, and Utopia, New York 1974 Nutzungsausfallentschädigung 2012 – Pkw, Geländewagen und Transporter, NZV-Beilage zu Heft 1/2012, 3 ff. Oechsler, Jürgen: Gerechtigkeit im modernen Austauschvertrag: Die theoretischen Grundlagen der Vertragsgerechtigkeit und ihr praktischer Einfluß auf Auslegung, Ergänzung und Inhaltskontrolle des Vertrages, Tübingen 1997 Oertmann, Paul: Rechtsordnung und Verkehrssitte: Zugleich ein Beitrag zu den Lehren von der Auslegung der Rechtsgeschäfte und von der Revision; insbesondere nach bürgerlichem Recht, Neudruck der Ausgabe von 1914, Aalen 1971 Oetker, Hartmut: Das private Vereinsrecht als Ausgestaltung der Koalitionsfreiheit, RdA 1999, 96 ff. Ohly, Ansgar: „Volenti non fit iniuria“: Die Einwilligung im Privatrecht, Tübingen 2002 – Generalklausel und Richterrecht, AcP 201 (2001), 1 ff. Opp, Karl-Dieter: Die Entstehung sozialer Normen: Ein Integrationsversuch soziologischer, sozialpsychologischer und ökonomischer Erklärungen, Tübingen 1983 Ossenbühl, Fritz: Die Erfüllung von Verwaltungsaufgaben durch Private, VVDStRL 29 (1971), 137 ff. – Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit der Verweisung als Mittel der Gesetzgebungstechnik, DVBl. 1967, 401 ff. – Gesetz und Recht – Die Rechtsquellen im demokratischen Rechtsstaat, in: Isensee, Josef/Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band V: Rechtsquellen, Organisation, Finanzen, 3. Auflage, Heidelberg 2007, § 100, zitiert: HStR Ott, Claus/Schäfer, Hans-Bernd: Die ökonomische Analyse des Rechts – Irrweg oder Chance wissenschaftlicher Rechtserkenntnis?, JZ 1988, 213 ff.
Literaturverzeichnis
213
Ott, Walter: Der Rechtspositivismus: kritische Würdigung auf der Grundlage eines juristischen Pragmatismus, 2. Auflage, Berlin 1992 Otte, Gerhard: Rechtspositivismus, in: Görres-Gesellschaft (Hrsg.), Staatslexikon: Recht, Wirtschaft, Gesellschaft, Band 4, 7. Auflage, Freiburg/Basel/Wien 1995, Sp. 723 ff. Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 75. Auflage, München 2016, zitiert: Bearbeiter, in: Palandt, BGB Pardey, Frank: Der Haushaltsführungsschaden: Schadensersatz bei Beeinträchtigung oder Ausfall unentgeltlicher Arbeit in Privathaushalten, 8. Auflage, Karlsruhe 2013 Pellens, Bernhard/Bonse, Andreas/Gassen, Joachim: Perspektiven der deutschen Konzernrechnungslegung – Auswirkungen des Kapitalaufnahmeerleichterungsgesetzes und des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich – DB 1998, 785 ff. Peltzer, Martin: Corporate Governance Codices als zusätzliche Pflichtenbestimmung für den Aufsichtsrat, NZG 2002, 10 ff. – Das Grünbuch der EU-Kommission vom 5. 4. 2011 und die Deutsche Corporate Govern ance, NZG 2011, 961 ff. Peltzer, Martin/Werder, Axel von: Der „German Code of Corporate Governance (GCCG)“ des Berliner Initiativkreises, AG 2000, 1 ff. Pfitzer, Norbert/Oser, Peter/Wader, Dominic: Die Entsprechenserklärung nach § 161 AktG – Checkliste für Vorstände und Aufsichtsräte zur Einhaltung der Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex, DB 2002, 1120 ff. Pflug, Hans-Joachim: Allgemeine Geschäftsbedingungen und „Transparenzgebot“, AG 1992, 1 ff. – Kontrakt und Status im Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, München 1986, zitiert: Kontrakt und Status im Recht der AGB Pfordten, Dietmar von: Was ist Recht? ZfphF 63 (2009), 173 ff. Picker, Eduard: Die Tarifautonomie in der deutschen Arbeitsverfassung, Köln 2000, zitiert: Tarifautonomie – Tarifautonomie – Betriebsautonomie – Privatautonomie, NZA 2002, 761 ff. Pietrancosta, Alain: Enforcement of corporate governance codes: A legal perspective, in: Festschrift für Klaus J. Hopt zum 70. Geburtstag am 24. August 2010: Unternehmen, Markt und Verantwortung, Band 1, Berlin u.a. 2010, S. 1109 ff. Poelzig, Dörte: Normdurchsetzung durch Privatrecht, Tübingen 2012 Radbruch, Gustav: Rechtsphilosophie: Studienausgabe, herausgegeben von Ralf Dreier und Stanley L. Paulson, 2. Auflage, Heidelberg 2003 Raiser, Ludwig: Vertragsfunktion und Vertragsfreiheit, in: 100 Jahre deutsches Rechtsleben: Festschrift zum hundertjährigen Bestehen des Deutschen Juristentages 1860 – 1960, Band 1, Karlsruhe 1960, S. 101 ff., zitiert: FS 100 Jahre DJT – Das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Bad Homburg 1961 Raiser, Thomas: Grundlagen der Rechtssoziologie: Das lebende Recht, 6. Auflage, Tübingen 2013, zitiert: Rechtssoziologie Ramm, Thilo: Die Parteien des Tarifvertrages: Kritik und Neubegründung der Lehre vom Tarifvertrag, Stuttgart 1961 Rassow, Walter: Der angemessene Unterhalt von Ehegatten und Kindern, FamRZ 1980, 541 ff.
214
Literaturverzeichnis
Rawls, John: A Theory of Justice, Cambridge, Mass. 1971 – Eine Theorie der Gerechtigkeit: Aus dem Amerikanischen von Hermann Vetter, Frankfurt am Main 1975 Rehbinder, Manfred: Rechtssoziologie, 7. Auflage, München 2009 Reichold, Hermann: Betriebsverfassung als Sozialprivatrecht: Historisch-dogmatische Grundlagen von 1848 bis zur Gegenwart, München 1995 Reiff, Peter: Die Haftungsverfassungen nichtrechtsfähiger unternehmenstragender Verbände, Tübingen 1996, zitiert: Haftungsverfassungen Reihlen, Helmut: Private technische Regelwerke – Tatsächliche Erscheinungsformen und ökonomische Aspekte, in: Kloepfer, Michael (Hrsg.), Selbst-Beherrschung im technischen und ökologischen Bereich, S. 75 ff. Reuter, Dieter: Betriebsverfassung und Tarifvertrag, RdA 1994, 152 ff. – Das Verhältnis von Individualautonomie, Betriebsautonomie und Tarifautonomie: Ein Beitrag zum Wandel der Arbeitsrechtsordnung, RdA 1991, 193 ff. – Rezension von Ferdinand Kirchhof, Private Rechtsetzung, Berlin 1987, AcP 188 (1988), 649 ff. Richardi, Reinhard (Hrsg.): Betriebsverfassungsgesetz, Kommentar, 15. Auflage, München 2016, zitiert: Bearbeiter, in: Richardi (Hrsg.), BetrVG – Empfiehlt es sich, die Regelungsbefugnisse der Tarifparteien im Verhältnis zu den Betriebsparteien neu zu ordnen?, herausgegeben von der Ständigen Deputation des Deutschen Juristentages, Band I: Gutachten/Teil B zum 61. Deutschen Juristentag, München 1996, zitiert: Gutachten 61. DJT – Kollektivgewalt und Individualwille bei der Gestaltung des Arbeitsverhältnisses, München 1968, zitiert: Kollektivgewalt und Individualwille Richardi, Reinhard/Wlotzke, Otfried/Wißmann, Hellmut/Oetker, Hartmut: Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht, Band 2: §§ 152 – 347: Kollektivarbeitsrecht/Sonderformen, 3. Auflage, München 2009, zitiert: Bearbeiter, in: Richardi u.a. (Hrsg.), Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht Rieble, Volker: Arbeitsmarkt und Wettbewerb: Der Schutz von Vertrags- und Wettbewerbsfreiheit im Arbeitsrecht, Berlin u.a. 1996 – Der Tarifvertrag als kollektiv-privatautonomer Vertrag, ZfA 2000, 5 ff. Ritgen, Klaus: Vertragsparität und Vertragsfreiheit, JZ 2002, 114 ff. Rittner, Fritz: Das Modell des homo oeconomicus und die Jurisprudenz, JZ 2005, 668 ff. – Über das Verhältnis von Vertrag und Wettbewerb, AcP 188 (1988), 101 ff. – Über den Vorrang des Privatrechts, in: Festschrift für Wolfram Müller-Freienfels, Baden-Baden 1986, S. 509 ff. Röhl, Klaus: Auflösung des Rechts, in: Festschrift für Andreas Heldrich, München 2005, S. 1161 ff. Röhl, Klaus F./Röhl, Hans Christian: Allgemeine Rechtslehre: Ein Lehrbuch, 3. Auflage, Köln/München 2008 Roßkopf, Gabriele: Selbstregulierung von Übernahmeangeboten in Großbritannien: der City Code on Takeovers and Mergers und die dreizehnte gesellschaftsrechtliche EG-Richtlinie, Berlin 2000, zitiert: Selbstregulierung
Literaturverzeichnis
215
Roth, Markus: Wirtschaftsrecht auf dem Deutschen Juristentag 2012: Möglichkeiten und Grenzen für staatliche und nichtstaatliche Eingriffe in die Unternehmensführung, NZG 2012, 881 ff. Röthel, Anne: Normkonkretisierung im Privatrecht, Tübingen 2004 Ruess, Peter: Das Recht der Werbung zwischen Staats- und Selbstkontrolle, in: Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 2002: Die Privatisierung des Privatrechts, Stuttgart 2003, S. 209 ff. Ruffert, Matthias: Vorrang der Verfassung und Eigenständigkeit des Privatrechts: Eine verfassungsrechtliche Untersuchung zur Privatrechtswirkung des Grundgesetzes, Tübingen 2001, zitiert: Eigenständigkeit des Privatrechts Rüfner, Wolfgang: Grundrechtsträger, in: Isensee, Josef/Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band IX: Allgemeine Grundrechtslehren, Heidelberg 2011, § 196, zitiert: HStR Rupp, Hans Heinrich: Die Unterscheidung von Staat und Gesellschaft, in: Isensee, Josef/ Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band II: Der Verfassungsstaat, 3. Auflage, Heidelberg 2004, § 31, zitiert: HStR Rüthers, Bernd/Fischer, Christian/Birk, Axel: Rechtstheorie: mit juristischer Methodenlehre, 7. Auflage, München 2013 Rüthers, Bernd/Stadler, Astrid: Allgemeiner Teil des BGB, 18. Auflage, München 2014 Säcker, Franz Jürgen: Gruppenautonomie und Übermachtkontrolle im Arbeitsrecht, Berlin 1972, zitiert: Gruppenautonomie Sandel, Michael J.: Gerechtigkeit: Wie wir das Richtige tun: Aus dem Amerikanischen von Helmut Reuter, Berlin 2013 – Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge 1982 Savigny, Friedrich Carl von: System des heutigen Römischen Rechts, Band 1, Berlin 1840 Schäfer, Hans-Bernd/Ott, Claus: Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, Berlin, 5. Auflage, Berlin, Heidelberg 2012 Schanze, Erich: Ökonomische Analyse des Rechts in den U.S.A.: Verbindungslinien zur realistischen Tradition, in: Assmann, Heinz-Dieter/Kirchner, Christian,/Schanze, Erich (Hrsg.), Ökonomische Analyse des Rechts in den USA, Tübingen 1993, S. 1 ff. Schapp, Jan: Methodenlehre des Zivilrechts, Tübingen 1998 Scheffler, Eberhard: Internationale Rechnungslegung und deutsches Bilanzrecht, DStR 1999, 1285 ff. Schliesky, Utz: Souveränität und Legitimität von Herrschaftsgewalt: Die Weiterentwicklung von Begriffen der Staatslehre und des Staatsrechts im europäischen Mehrebenensystem, Tübingen 2004, zitiert: Herrschaftsgewalt Schmidt, Eike: Grundlagen und Grundzüge der Inzidentkontrolle allgemeiner Geschäftsbedingungen nach dem AGB-Gesetz, JuS 1987, 929 ff. Schmidt, Karsten: Anmerkung zum Urteil des BGH vom 10. 10. 1994 - II ZR 18/94 (BGH NJW 1995, 194 = JZ 1995, 311), JZ 1995, 314 f. – Einhundert Jahre Verbandstheorie im Privatrecht: aktuelle Betrachtungen zur Wirkungsgeschichte von Otto v. Gierkes Genossenschaftstheorie, Göttingen 1987 – Gesellschaftsrecht, 4. Auflage, Köln/Berlin/Bonn/München 2002 – Handelsrecht: Unternehmensrecht I, 6. Auflage, Köln 2014
216
Literaturverzeichnis
Schmidt, Karsten/Lutter, Marcus (Hrsg.): Aktiengesetz, Kommentar, Band 2: §§ 150 – 410, 2. Auflage, Köln 2010, zitiert: Bearbeiter, in: K. Schmidt/Lutter (Hrsg.), AktG Schmidt-Aßmann, Eberhard: Öffentliches Recht und Privatrecht: Ihre Funktionen als wechselseitige Auffangordnungen – Einleitende Problemskizze –, in: Hoffmann-Riem, Wolfgang/Schmidt-Aßmann, Eberhard (Hrsg.), Öffentliches Recht und Privatrecht als wechselseitige Auffangordnungen, Baden-Baden 1996, S. 261 ff., zitiert: Auffangordnungen – Regulierte Selbstregulierung als Element verwaltungsrechtlicher Systembildung, in: Berg, Wilfried/Fisch, Stefan/Schmitt Glaeser, Walter/Schoch, Friedrich/Schulze-Fielitz, Helmuth (Hrsg.), Regulierte Selbstregulierung als Steuerungskonzept des Gewährleistungsstaates: Ergebnisse des Symposiums aus Anlaß des 60. Geburtstages von Wolfgang Hoffmann-Riem, DV Beiheft 4 (2001), S. 253 ff. – Zum staatsrechtlichen Prinzip der Selbstverwaltung, in: Gedächtnisschrift für Wolfgang Martens, Berlin u.a. 1987, S. 249 ff. Schmidt-Preuß, Matthias: Normierung und Selbstnormierung aus der Sicht des Öffentlichen Rechts, ZLR 1997, 249 ff. – Private technische Regelwerke – rechtliche und politische Fragen, in: Kloepfer, Michael (Hrsg.), Selbst-Beherrschung im technischen und ökologischen Bereich: Selbststeuerung und Selbstregulierung in der Technikentwicklung und im Umweltschutz, Berlin 1998, S. 89 ff., zitiert: Selbst-Beherrschung – Verwaltung und Verwaltungsrecht zwischen gesellschaftlicher Selbstregulierung und staatlicher Steuerung, VVDStRL 56 (1997), 160 ff. Schmidt-Rimpler, Walter: Grundfragen einer Erneuerung des Privatrechts, AcP 147 (1941), 130 ff. – Zum Vertragsproblem, in: Festschrift für Ludwig Raiser zum 70. Geburtstag, Tübingen 1974, S. 3 ff. Schneider, Hans: Gesetzgebung: Ein Lehrbuch, 2. Auflage, Heidelberg 1991 Schneider, Uwe H.: Kapitalmarktorientierte Corporate Governance-Grundsätze, DB 2000, 2413 ff. Schneider, Uwe H./Strenger, Christian: Die „Corporate Governance-Grundsätze“ der Grundsatzkommission Corporate Governance (German Panel on Corporate Govern ance), AG 2000, 106 ff. Scholz, Harald: Die Düsseldorfer Tabelle (Stand 1. 7. 1992), FamRZ 1993, 125 ff. – Die Düsseldorfer Tabelle, 100 Jahre Oberlandesgericht Düsseldorf: Festschrift, Berlin 2006, S. 265 ff., zitiert: FS 100 Jahre OLG Düsseldorf Scholz, Rupert: Technik und Recht, in: Festschrift zum 125-jährigen Bestehen der Juristischen Gesellschaft zu Berlin, Berlin u.a. 1984, S. 691 ff., zitiert: FS Juristische Gesellschaft Schön, Wolfgang: Entwicklung und Perspektiven des Handelsbilanzrechts: vom ADHGB zum IASC, ZHR 161 (1997), 133 ff. Schröder, Jan: Kollektivistische Theorien und Privatrecht in der Weimarer Republik am Beispiel der Vertragsfreiheit, in: Nörr, Knut Wolfgang/Schefold, Betram/Tenbruck, Friedrich (Hrsg.), Geisteswissenschaften zwischen Kaiserreich und Republik, Stuttgart 1994, S. 335 ff. Schultz, Michael: Zivilgerichtliche Vertragskontrolle im Eherecht, Göttingen 2008
Literaturverzeichnis
217
Schulze-Osterloh, Joachim: Das deutsche Gesellschaftsrecht im Banne der Globalisierung, ZIP 2001, 1431 ff. Schüppen, Matthias: To comply or not to comply – that’s the question! „Existenzfragen“ des Transparenz- und Publizitätsgesetzes im magischen Dreieck kapitalmarktorientierter Unternehmensführung, ZIP 2002, 1269 ff. Schuppert, Gunnar Folke: Das Gesetz als zentrales Steuerungsinstrument des Rechtsstaates, in: Schuppert, Gunnar Folke (Hrsg.), Das Gesetz als zentrales Steuerungsinstrument des Rechtsstaates, Baden-Baden 1998, S. 105 ff. – Das Konzept der regulierten Selbstregulierung als Bestandteil einer als Regelungswissenschaft verstandenen Rechtswissenschaft, in: Berg, Wilfried/Fisch, Stefan/Schmitt Glaeser, Walter/Schoch, Friedrich/Schulze-Fielitz, Helmuth (Hrsg.), Regulierte Selbstregulierung als Steuerungskonzept des Gewährleistungsstaates: Ergebnisse des Symposiums aus Anlaß des 60. Geburtstages von Wolfgang Hoffmann-Riem, DV Beiheft 4 (2001), S. 201 ff. – Der Gewährleistungsstaat – modisches Label oder Leitbild sich wandelnder Staatlichkeit?, in: Schuppert, Gunnar Folke (Hrsg.), Der Gewährleistungsstaat – Ein Leitbild auf dem Prüfstand, Baden-Baden 2005, S. 11 ff. – Gemeinwohl, das: Oder: Über die Schwierigkeiten, dem Gemeinwohlbegriff Konturen zu verleihen, in: Schuppert, Gunnar Folke/Neidhardt, Friedhelm (Hrsg.), Gemeinwohl – Auf der Suche nach Substanz, S. 19 ff. – Grenzen und Alternativen von Steuerung durch Recht, in: Grimm, Dieter (Hrsg.), Wachsende Staatsaufgaben – sinkende Steuerungskraft des Rechts, Baden-Baden 1990, S. 217 ff. – Der moderne Staat als Gewährleistungsstaat, in: Schröter, Eckhard (Hrsg.), Empirische Policy- und Verwaltungsforschung: Lokale, nationale und internationale Perspektiven, Opladen 2001, S. 399 ff., zitiert: Verwaltungsforschung – Governance im Spiegel der Wissenschaftsdiszplinen, in: Schuppert, Gunnar Folke (Hrsg.), Governance-Forschung: Vergewisserung über Stand und Entwicklungslinien, 2. Auflage, Baden-Baden 2006, S. 371 ff. – Staatswissenschaft, Baden-Baden 2003 – Verwaltungswissenschaft: Verwaltung, Verwaltungsrecht, Verwaltungslehre, Baden-Baden 2000 Schuppert, Gunnar Folke/Bumke, Christian: Verfassungsrechtliche Grenzen privater Standardsetzung: Vorüberlegungen zu einer Theorie der Wahl rechtlicher Regelungsformen (Regulatory Choice), in: Kleindiek, Detlef/Oehler, Wolfgang (Hrsg.), Die Zukunft des deutschen Bilanzrechts im Zeichen internationaler Rechnungslegung und privater Standardsetzung, Köln 2000, S. 71 ff., zitiert: Die Zukunft des deutschen Bilanzrechts Schüren, Peter: Die Legitimation tariflicher Normsetzung: Untersuchung zur Teilhabe der tarifunterworfenen Gewerkschaftsmitglieder an der tarifpolitischen Willensbildung in Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika, München 1990 Schürmann, Heinrich (Hrsg.): Tabellen zum Familienrecht: Tabellen und Leitlinien zum Unterhaltsrecht, Rechengrößen zum Zugewinn und Versorgungsausgleich u.v.m., 36. Auflage, Köln 2015 Schwab, Dieter/Löhnig, Martin: Einführung in das Zivilrecht: mit BGB – Allgemeiner Teil, Schuldrecht Allgemeiner Teil, Kauf- und Deliktsrecht, 20. Auflage, Heidelberg u.a. 2016
218
Literaturverzeichnis
Schwab, Martin: Der Standardisierungsvertrag für das DRSC – Eine kritische Würdigung (Teil I), BB 1999, 731 ff. – Rechtsfragen der Politikberatung im Spannungsfeld zwischen Wissenschaftsfreiheit und Unternehmensschutz, Tübingen 1999, zitiert: Politikberatung Schwan, Gesine: Konsens, in: Görres-Gesellschaft (Hrsg.), Staatslexikon: Recht, Wirtschaft, Gesellschaft, Band 3, 7. Auflage, Freiburg/Basel/Wien 1995, Sp. 633 ff. Schwarz, Sebastian Henner: Regulierung durch Corporate Governance Kodizes, Berlin 2004, abrufbar unter: http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/schwarz-sebastian-henner-2005 – 07 – 07/PDF/Schwarz.pdf Schwierz, Matthias: Die Privatisierung des Staates am Beispiel der Verweisungen auf die Regelwerke privater Regelgeber im technischen Sicherheitsrecht, Frankfurt am Main u.a. 1986 Schwintowski, Hans Peter: Ökonomische Theorie des Rechts, JZ 1998, 581 ff. Seibert, Ulrich: Das „TransPuG“: Gesetz zur weiteren Reform des Aktien- und Bilanzrechts, zu Transparenz und Publizität (Transparenz- und Publizitätsgesetz) – Diskussion im Gesetzgebungsverfahren und endgültige Fassung, NZG 2002, 608 ff. – Im Blickpunkt: Der Deutsche Corporate Governance Kodex ist da, BB 2002, 581 ff. Seibt, Christoph H.: Deutscher Corporate Governance Kodex und Entsprechens-Erklärung (§ 161 AktG-E), AG 2002, 249 ff. – Deutscher Corporate Governance Kodex: Antworten auf Zweifelsfragen der Praxis, AG 2003, 465 ff. Seidel, Wolfgang: Der Deutsche Corporate Governance Kodex – eine private oder doch eine staatliche Regelung?, ZIP 2004, 285 ff. – Kodex ohne Rechtsgrundlage, NZG 2004, 1095 f. Semler, Johannes/Wagner, Elisabeth: Deutscher Corporate Governance Kodex – Die Entsprechenserklärung und Fragen der gesellschaftsinternen Umsetzung, NZG 2003, 453 ff. Siebert, Wolfgang: Verwirkung und Unzulässigkeit der Rechtsausübung: Ein rechtsvergleichender Beitrag zur Lehre von den Schranken der privaten Rechte und zur exceptio doli (§§ 226, 242, 826 BGB), unter besonderer Berücksichtigung des gewerblichen Rechtsschutzes (§ 1 UWG), Marburg 1934 Singer, Reinhard: Selbstbestimmung und Verkehrsschutz im Recht der Willenserklärungen, München 1995, zitiert: Selbstbestimmung Soergel, Bürgerliches Gesetzbuch, Band 1, Allgemeiner Teil, §§ 1 – 103, 13. Auflage, Stuttgart 2000; Band 2, Schuldrecht I, §§ 241 – 432, 12. Auflage, Stuttgart/Berlin/Köln 1990, zitiert: Bearbeiter, in: Soergel, BGB Sonnenberger, Hans Jürgen: Verkehrssitten im Schuldvertrag: Rechtsvergleichender Beitrag zur Vertragsauslegung und zur Rechtsquellenlehre, München 1970, zitiert: Verkehrssitten Spieß, Gerhard: Inhaltskontrolle von Verträgen – das Ende privatautonomer Vertragsgestaltung?, DVBl. 1994, 1222 ff. Spindler, Gerald: Zur Zukunft der Corporate Governance Kommission und des § 161 AktG, NZG 2011, 1007 ff. Spindler, Gerald/Hupka, Jan: Bindungswirkung von Standards im Kapitalmarktrecht, in: Möllers, Thomas M. J. (Hrsg.), Geltung und Faktizität von Standards, Baden-Baden 2009, S. 117 ff.
Literaturverzeichnis
219
Spindler, Gerald/Stilz, Eberhard (Hrsg.): Kommentar zum Aktiengesetz, Band 2, §§ 150 – 410, IntGesR, SpruchG, SE-VO, 2. Auflage, München 2010, zitiert: Bearbeiter, in: Spindler/Stilz (Hrsg.), AktG Starck, Christian: Das Bundesverfassungsgericht in der Verfassungsordnung und im politischen Prozeß, in: Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, Erster Band: Verfassungsgerichtsbarkeit, Verfassungsprozeß, Tübingen 2001, S. 1 ff., zitiert: FS 50 Jahre BVerfG Staub, Hermann: Handelsgesetzbuch: Großkommentar, herausgegeben von Claus-Wilhelm Canaris, Wolfgang Schilling und Peter Ulmer, Vierter Band: §§ 343 – 382, 4. Auflage, Berlin 2004; Siebenter Band: §§ 316 – 342e, 2. Teilband: §§ 331 – 342e, 5. Auflage, Berlin 2012, zitiert: Bearbeiter, in: Staub, HGB Staudinger, Julius von: Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetzen und Nebengesetzen, Einleitung zu Art. 1 ff. EGBGB; Art 1 – 2, 50 – 218 EGBGB (Inkrafttreten, Verhältnis zu anderen Vorschriften, Übergangsvorschriften), Berlin 2013; Buch 1: Allgemeiner Teil, §§ 21 – 79 (Allgemeiner Teil 2), Berlin 2005; Buch 1: Allgemeiner Teil, §§ 90 – 124, §§ 130 – 133 (Allgemeiner Teil 3), Berlin 2012; Buch 1: Allgemeiner Teil, §§ 139 – 163 (Allgemeiner Teil 4), Berlin 2010; Buch 2: Recht der Schuldverhältnisse: Einleitung zum Schuldrecht, §§ 241 – 243: (Treu und Glauben), Berlin 2015; Buch 2: Recht der Schuldverhältnisse, §§ 255 – 304 (Leistungsstörungsrecht 1), Berlin 2014; Buch 2: Recht der Schuldverhältnisse, §§ 311, 311a, 312, 312a – i (Vertragsschluss), Berlin 2013; Buch 2: Recht der Schuldverhältnisse, §§ 611 – 613 (Dienstvertragsrecht 1), Berlin 2016; Buch 2: Recht der Schuldverhältnisse, §§ 631 – 651 (Werkvertragsrecht), Berlin 2014; Buch 4: Familienrecht, §§ 1353 – 1362 (Wirkungen der Ehe im Allgemeinen), Berlin 2012, zitiert: Bearbeiter, in: Staudinger, BGB Stenger, Jan: Kodex und Entsprechenserklärung: Schwachstellen, Reformvorschläge, Deregulierung, Baden-Baden 2013 Stoffels, Markus: AGB-Recht, 3. Auflage, München 2015 Tamahana, Brian Z.: A General Jurisprudence of Law and Society, Oxford u.a. 2001 Taupitz, Jochen: Die Standesordnungen der freien Berufe: geschichtliche Entwicklung, Funktionen, Stellung im Rechtssystem, Berlin u.a. 1991, zitiert: Standesordnungen – Richtlinien in der Transplantationsmedizin, NJW 2003, 1145 ff. Teubner, Gunther: Codes of Conduct multinationaler Unternehmen: Unternehmensverfassung jenseits von Corporate Governance und gesetzlicher Mitbestimmung, in: Höland, Armin/Hohmann-Dennhardt, Christine/Schmidt, Marlene/Seifert, Achim (Hrsg.), Arbeitnehmermitwirkung in einer sich globalisierenden Arbeitswelt: Liber Amicorum Manfred Weiss – Employee Involvement in a Globalising World, Berlin 2005, S. 109 ff. – Des Königs viele Leiber: Die Selbstdekonstruktion der Hierarchie des Rechts, in: Brunkhorst, Hauke/Kettner, Matthias (Hrsg.), Globalisierung und Demokratie: Wirtschaft, Recht, Medien, Frankfurt am Main 2000, S. 240 ff. – Die zwei Gesichter des Janus: Rechtspluralismus in der Spätmoderne, in: Liber Amicorum Josef Esser, Heidelberg 1995, S. 191 ff. – Global Law Without a State, Aldershot, Brookfield USA, Singapore, Sydney 1997 – Globale Bukowina: Zur Emergenz eines transnationalen Rechtspluralismus, RJ 15 (1996), 255 ff. – Globale Zivilverfassungen: Alternativen zur staatszentrierten Verfassungstheorie, ZaöRV 2003, 1 ff.
220
Literaturverzeichnis
– Neo-Spontanes Recht und duale Sozialverfassungen in der Weltgesellschaft?, in: Simon, Dieter/Weiss, Manfred (Hrsg.), Zur Autonomie des Individuums, Liber Amicorum Spiros Simitis, Baden-Baden 2000, S. 437 ff. – Recht als autopoietisches System, Frankfurt am Main 1989 – Reflexives Recht: Entwicklungsmodelle des Rechts in vergleichender Perspektive, ARSP 1982, 13 ff. Teubner, Gunther/Wilke, Helmut: Kontext und Autonomie: Gesellschaftliche Selbststeuerung durch reflexives Recht, ZfRSoz 5 (1984), 4 ff. Theusinger, Ingo/Liese, Jens: Rechtliche Risiken der Corporate Governance-Erklärung, DB 2008, 1419 ff. Thiele, Wolfgang: Die Zustimmungen in der Lehre vom Rechtsgeschäft, Köln u.a. 1966 Thoma, Anselm Christian: Regulierte Selbstregulierung im Ordnungsverwaltungsrecht, Berlin 2008, zitiert: Regulierte Selbstregulierung Thoma, Georg F.: Der neue Übernahmekodex der Börsensachverständigenkommission, ZIP 1996, 1725 ff. Thon, August: Rechtsnorm und subjectives Recht: Untersuchungen zur allgemeinen Rechtslehre, Weimar 1878 Timm, Wolfram: Corporate Governance Kodex und Finanzkrise, ZIP 2010, 2125 ff. Tödtmann, Ulrich/Schauer, Michael: Der Corporate Governance Kodex zieht scharf, ZIP 2009, 995 ff. Tröger, Tobias: Aktionärsklagen bei nicht-publizierter Kodexabweichung, ZHR 175 (2011), 746 ff. Trute, Hans-Heinrich: Die Verwaltung und das Verwaltungsrecht zwischen gesellschaftlicher Selbstregulierung und staatlicher Steuerung, DVBl. 1996, 950 ff. – Funktionen der Organisation und ihre Abbildung im Recht, in: Schmidt-Aßmann, Eberhard/Hoffmann-Riem, Wolfgang (Hrsg.), Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource, Baden-Baden 1997, S. 249 ff., zitiert: Verwaltungsorganisationsrecht – Verantwortungsteilung als Schlüsselbegriff eines sich verändernden Verhältnisses von öffentlichem und privatem Sektor, in: Schuppert, Gunnar Folke (Hrsg.), Jenseits von Privatisierung und „schlankem“ Staat: Verantwortungsteilung als Schlüsselbegriff eines sich verändernden Verhältnisses von öffentlichem und privatem Sektor, Baden-Baden 1999, S. 13 ff. Tschentscher, Axel: Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit: Rationales Entscheiden, Diskursethik und prozedurales Recht, Baden-Baden 2000 Tuhr, Andreas von: Der Allgemeine Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts, Erster Band: Allgemeine Lehren und Personenrecht, Leipzig 1910, zitiert: BGB AT, Bd. I – Zweiter Band, Erste Hälfte: Die rechtserheblichen Tatsachen, insbesondere das Rechtsgeschäft, Leipzig 1914, zitiert: BGB AT, Bd. II/1 Ulmer, Peter: Aktienrecht im Wandel – Entwicklungslinien und Diskussionsschwerpunkte, AcP 202 (2002), 143 ff. – Der Deutsche Corporate Governance Kodex – ein neues Regulierungsinstrument für börsennotierte Aktiengesellschaften, ZHR 166 (2002), 150 ff. – Die freiwillige Selbstkontrolle in Wirtschaft und Presse: Erscheinungsformen und Strukturen – Rechtsfragen – Haftungsrisiken, WRP 1975, 549 ff.
Literaturverzeichnis
221
Ulmer, Peter/Brandner, Hans Erich/Hensen, Horst-Diether: AGB-Recht: Kommentar zu den §§ 305 – 310 BGB und zum Unterlassungsklagengesetz, 11. Auflage, Köln 2011, zitiert: Bearbeiter, in: Ulmer/Brandner/Hensen, AGB-Recht Vec, Miloš: Kurze Geschichte des Technikrechts, in: Schulte, Martin (Hrsg.), Handbuch des Technikrechts: Allgemeine Grundlagen, Umweltrecht – Gentechnikrecht – Energie recht, Telekommunikations- und Medienrecht, Patentrecht – Computerrecht, 2. Auflage, Berlin/Heidelberg 2011 Vetter, Eberhard: Der Deutsche Corporate Governance Kodex nur ein zahnloser Tiger? – Zur Bedeutung von § 161 AktG für Beschlüsse der Hauptversammlung –, NZG 2008, 121 ff. – Der Tiger zeigt die Zähne – Anmerkungen zum Urteil des BGH im Fall Leo Kirch/Deutsche Bank, NZG 2009, 561 ff. – Deutscher Corporate Governance Kodex, DNotZ 2003, 748 ff. Vieweg, Klaus: „Sachverständigen-Recht“ am Beispiel des technischen Sicherheitsrechts, in: Bumke, Christian/Röthel, Anne (Hrsg.), Privates Recht, Tübingen 2012, S. 69 ff. – Normsetzung und -anwendung deutscher und internationaler Verbände: Eine rechtstatsächliche und rechtliche Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der Sportverbände, Berlin 1990, zitiert: Normsetzung Vogel, Arne: Die Haftung von Gesellschaften, Vorständen und Aufsichtsräten im Zusammenhang mit der Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex gemäß § 161 AktG, München 2011, zitiert: Die Haftung Voßkuhle, Andreas: Gesetzgeberische Regelungsstrategien der Verantwortungsteilung zwischen öffentlichem und privatem Sektor, in: Schuppert, Gunnar Folke (Hrsg.), Jenseits von Privatisierung und „schlankem“ Staat: Verantwortungsteilung als Schlüsselbegriff eines sich verändernden Verhältnisses von öffentlichem und privatem Sektor, Baden-Baden 1999, S. 47 ff. – Sachverständige Beratung des Staates, in: Isensee, Josef/Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band III: Demokratie – Bundesorgane, 3. Auflage, Heidelberg 2005, § 43, zitiert: HStR Voßkuhle, Andreas/Sydow, Gernot: Die demokratische Legitimation des Richters, JZ 2002, 673 ff. Waclawik, Erich: Beschlussmängelfolgen von Fehlern bei der Entsprechenserklärung zum DCGK, ZIP 2011, 885 ff. Wahlers, Christiane: Private Selbstregulierung am Beispiel des Kapitalmarktrechts. Vorteile, Nachteile, Optimierung, Göttingen 2011, zitiert: Private Selbstregulierung Waltermann, Raimund: Rechtsetzung durch Betriebsvereinbarung zwischen Privatautonomie und Tarifautonomie, Tübingen 1996, zitiert: Rechtsetzung durch Betriebsvereinbarung – Zu den Grundlagen der Rechtsetzung durch Tarifvertrag, in: Festschrift für Alfred Söllner zum 70. Geburtstag, München 2000, S. 1251 ff. Wandt, Andre P. H.: Zur Neufassung von Ziff. 5. 4. 6 Abs. 3 Satz 1 DCGK oder: Das BMJ als heimlicher Kodexgeber?, ZIP 2012, 1443 ff. Watter, Rolf/Dubs, Dieter: Bedeutung und Zukunft der Selbstregulierung im Kapitalmarktrecht: Gestaltungsgrundsätze für die Selbstregulierung, Der Schweizer Treuhänder 2005, 743 ff.
222
Literaturverzeichnis
Weber, Max: Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehenden Soziologie, herausgegeben von Johannes Winckelmann, 1. Halbband, 5. Auflage, Tübingen 1976 Weber-Rey, Daniela: Ausstrahlungen des Aufsichtsrechts (insbesondere für Banken und Versicherungen) auf das Aktienrecht – oder die Infiltration von Regelungssätzen, ZGR 2010, 543 ff. Weber-Rey, Daniela/Buckel, Jochen: Best Practice Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex und die Business Judgement Rule, AG 2011, 845 ff. Weiss, Michael: Hybride Regulierungsinstrumente: Eine Analyse rechtlicher, faktischer und exterritorialer Wirkungen nationaler Corporate-Governance-Kodizes, Tübingen 2011 Werder, Axel von: Zur Signalstärke der Entsprechenserklärung: A legal perspective, in: Festschrift für Klaus J. Hopt zum 70. Geburtstag am 24. August 2010: Unternehmen, Markt und Verantwortung, Band 1, Berlin u.a. 2010, S. 1471 ff. Werder, Axel von/Bartz, Jenny: Corporate Governance Report 2012: Kodexregime und Kodexinhalt im Urteil der Praxis, DB 2012, 869 ff. – Corporate Governance Report 2014: Erklärte Akzeptanz des Kodex und tatsächliche Anwendung bei Vorstandsvergütung und Unabhängigkeit des Aufsichtsrats, DB 2014, 905 ff. Werder, Axel von/Talaulicar, Till: Kodex Report 2010: Die Akzeptanz der Empfehlungen und Anregungen des Deutschen Corporate Governance Kodex, DB 2010, 853 ff. Wernsmann, Rainer/Gatzka, Ulrich: Der Deutsche Corporate Governance Kodex und die Entsprechenserklärung nach § 161 AktG: Anforderungen des Verfassungsrechts, NZG 2011, 1001 ff. Wiedemann, Herbert (Hrsg.): Tarifvertragsgesetz: Kommentar, 7. Auflage, München 2007, zitiert: Bearbeiter, in: Wiedemann (Hrsg.), TVG – Gesellschaftsrecht, Band 1: Grundlagen, München 1980 Wiese, Günther/Kreutz, Peter/Oetker, Hartmut/ Raab, Thomas/Weber, Christoph/Franzen, Martin: Gemeinschaftskommentar zum Betriebsverfassungsgesetz, Band II: §§ 74 – 132, 10. Auflage, Neuwied u.a. 2014, zitiert: Bearbeiter, in: Wiese u.a. (Hrsg.), GK-BetrVG Wilburg, Walter: Entwicklung eines beweglichen Systems im Bürgerlichen Recht: Rede, gehalten bei der Inauguration als Rector magnificus der Karl-Franzens-Universität in Graz am 22. November 1950, Graz 1951 Windbichler, Christine: Gesellschaftsrecht, 23. Auflage, München 2013 – Betriebliche Mitbestimmung als institutionalisierte Vertragshilfe, in: Festschrift für Wolfgang Zöllner, Band 2, Köln 1998 – Bindungswirkung von Standards im Bereich der Corporate Governance, in: Möllers, Thomas M. J. (Hrsg.), Geltung und Faktizität von Standards, Baden-Baden 2009, S. 19 ff. Wolf, Manfred: Normsetzung durch private Institutionen?, JZ 1973, 229 ff. Wolf, Manfred/Lindacher, Walter F./Pfeiffer, Thomas (Hrsg.): AGB-Recht, Kommentar, 6. Auflage, München 2013, zitiert: Bearbeiter, in: Wolf/Lindacher/Pfeiffer, AGB-Recht Wolf, Manfred/Neuner, Jörg: Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 10. Auflage, München 2012, zitiert: BGB AT Wolf, Martin: Corporate Governance: Der Import angelsächsischer „Self-Regulation“ im Widerstreit zum deutschen Parlamentsvorbehalt, ZRP 2002, 59 f. Wolff, Hans J./Bachof, Otto/Stober, Rolf/Kluth, Winfried: Verwaltungsrecht: Band II, 7. Auflage, München 2010
Literaturverzeichnis
223
Wollenschläger, Michael: Arbeitsrecht, 3. Auflage, Köln u.a. 2010 Würtenberger, Thomas: Die Legitimität staatlicher Herrschaft: Eine staatsrechtlich-politische Begriffsgeschichte, Berlin 1973 – Legalität, Legitimität, in: Görres-Gesellschaft (Hrsg.), Staatslexikon: Recht, Wirtschaft, Gesellschaft, Band 3, 7. Auflage, Freiburg, Basel, Wien 1995, Sp. 873 ff. – Rechtspluralismus oder Rechtsetatismus?, in: Lampe, Ernst-Joachim (Hrsg.), Rechtsgleichheit und Rechtspluralismus, Baden-Baden 1995, S. 92 ff. Zimmermann, Norbert: Der grundrechtliche Schutzanspruch juristischer Personen des öffentlichen Rechts: ein Beitrag zur Auslegung des Art. 19 Abs. 3 GG – unter besonderer Berücksichtigung des Grundrechtsschutzes berufsständischer Einrichtungen, öffentlich-rechtlicher Stiftungen und gemischt-wirtschaftlicher Unternehmen, München 1993 Zippelius, Reinhard: Allgemeine Staatslehre: Politikwissenschaft, 15. Auflage, München 2007 – Das Wesen des Rechts: Eine Einführung in die Rechtstheorie, 6. Auflage, Stuttgart 2012 Zöllner, Wolfgang: Das Wesen der Tarifnormen, RdA 1964, 443 ff. – Die Rechtsnatur der Tarifnormen nach deutschem Recht: zugleich ein Beitrag zur Abgrenzung von Rechtssetzung und Privatautonomie; Vortrag, gehalten auf der 1. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht am 10. März 1966 in Zell am See, Wien 1966, zitiert: Rechtsnatur der Tarifnormen – Privatautonomie und Arbeitsverhältnis: Bemerkungen zu Parität und Richtigkeitsgewähr beim Arbeitsvertrag, AcP 176 (1976), 221 ff. – Tarifmacht und Außenseiter, RdA 1962, 453 ff. Zöllner, Wolfgang/Loritz, Karl-Georg/Hergenröder, Wolfgang: Arbeitsrecht: Ein Studienbuch, 7. Auflage, München 2015 Zwanzger, Michael: Der mehrseitige Vertrag: Grundstrukturen, Vertragsschluss, Leistungsstörungen, Tübingen 2013
Sachwortverzeichnis Sachwortverzeichnis
Abschlussprüfung 73 f. Absichtserklärung siehe Entsprechenserklärung Absprachen siehe Normersetzende Absprachen Adel 130 Ad-hoc-Mitteilung 90 AGB-Kontrolle 108 f., 156, 161 f., 166 f. Aktiengesellschaft 76, 86, 102, 110 Aktionär 89 ff. Akzeptanz 47, 127 ff., 137, 167, 176 Allgemeine Geschäftsbedingungen 100, 107 ff., 123 f., 144, 155 f., 161 – Einbeziehungsvoraussetzungen 82, 126 – Inhaltskontrolle 108 f., 123, 144, 156, 161, 166 f. – Normentheorie 108 ff. – Überraschungsschutz 156 – Vertragstheorie 108 ff. – Vorrang der Individualabrede 109 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 154 Allgemeines Normengesetz 180 f. Allgemeinverbindlicherklärung siehe Tarifvertrag Allgemeinwohl 26, 41, 45, 129 Analogie 104 f. Anerkennungsakt siehe staatlicher Anerkennungsakt Anerkennungslehre siehe Rechtsanerkennungsmonopol Anfechtung 91 ff., 103, 105, 153 – Aufsichtsratswahlen 93 – Hauptversammlungsbeschluss 91 ff. – Testament 103 – Willenserklärung 105, 153
Anleger 84, 86, 89, 91, 96, 176, 178 Anlegerschutz 98 Arbeitgeber 103 f., 115 ff., 120, 122, 134, 157 f., 163, 165 Arbeitgebervereinigung 116, 163 Arbeitnehmer 103 ff., 115 ff., 121, 134, 154, 157 f., 162 ff., 176 Arbeitsbedingungen 55, 104 f., 115, 117, 119, 163 Arbeitsrecht 22 f., 103 ff., 115 ff., 154, 157 f., 162 ff. Arbeitsrechtliche Gesamtzusage 104 f., 157 Arbeitsrechtliches Direktions- und Weisungsrecht 103 f., 157 f. – Billigkeitskontrolle 158 Arbeitsverhältnisnormen siehe Tarifnormen Arbeitsvertrag 103 f., 116, 157 f., 164, 167 Aufklärungspflicht 153 f. Auflage 103 Aufrechnung 105 Aufsichtsrat 77, 83, 86, 91 ff., 160 Ausbeutungsschutz 141 f., 144, 158, 166 Auskunftsrecht siehe Partizipation Auslegung 58, 113 f. Auslobung 87, 100 ff., 104 f., 157 Ausschlagung siehe Erbe Außenseiter 42, 117, 120, 163 Austritt siehe Verband Bankrecht 155 Baums-Kommission 75 f. Bedingung 153 Befolgungsdruck 53 f., 56, 86, 125 f., 174 f.
Sachwortverzeichnis Beibringungsgrundsatz 49 Beirat 160, 173 Beitritt siehe Verband Bekanntmachung 80 f., 96, 101, 170, 176, 179 f. Belegschaft 117, 120, 163 Beliehener 27 f., 60, 96 Berufsvereinigung 69, 172 Beschaffenheitsvereinbarung 64 Beschluss 91 ff., 99, 114, 131, 133, 141, 159 ff., 174 – Entlastungsbeschluss 91 f., 99, 174 – Hauptversammlungsbeschluss siehe Hauptversammlungsbeschluss – Mehrheitsbeschluss 114, 131, 133, 141, 159 f. – Verbandsbeschluss 159 ff. Beschlusskontrolle 131, 144, 160 ff. Beschlussmängelrecht 161 f. best practice 56 f., 77 Bestimmtheitsgrundsatz 49 Betriebsautonomie 121 Betriebsnormen siehe Tarifnormen Betriebsrat 120 ff., 133, 158, 164 ff. – Wahl 165 Betriebsvereinbarung 31, 100, 120 ff., 133, 164 ff. – Anerkennungslehre 31, 100, 121 f. – Delegationslehre 121 f. – Günstigkeitsprinzip 121, 167 – Öffnungsklausel 121 – Rechts- und Billigkeitskontrolle 166 f. – Wirkung 120 ff. Beurteilungsspielraum 149 Beweislast 49 Beweislastregel 97 Billigkeitskontrolle 158, 166 f. Bundesanzeiger 76, 81, 169, 176, 179 f. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 76, 80 f., 94 ff., 173, 176 f., 179 f. Bundesverfassungsgericht 42, 45, 149
225
Bürgschaft 152 f. Combined Code 74 Comply-or-explain siehe Deutscher Corporate Governance Kodex Corporate Governance 55, 74 f., 77, 84, 90, 174 f. Corporate-Governance-Grundsätze 75 Cromme-Kommission 76 Daseinsvorsorge 41 Delegationslehre 117 ff., 121 f. Demokratiedefizit 48 Demokratieprinzip 62, 129 f. Deutscher Corporate Governance Kodex 19 f., 74 ff., 174 ff. – Anregungen 47 Fn. 131, 76 f. – Comply-or-explain 77, 86, 174 – Empfehlungen 47 Fn. 131, 77, 82 ff., 89, 92 f., 174 ff. – Entsprechenserklärung siehe Entsprechenserklärung – Kodexkommission siehe Kodexkommission – opting-out 82 f. – Rechtmäßigkeitskontrolle 76, 176 f. Deutscher Nachhaltigkeitskodex 57 DIN-Normen 59 ff., 85 f., 134, 169 ff. – Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN) 59 f., 169 ff. – DIN-Vertrag 59 f., 169 DIN-Vertrag siehe DIN-Normen Direktions- und Weisungsrecht siehe arbeitsrechtliches Direktions- und Weisungsrecht Durchsetzungsdefizit 49 Effizienz siehe ökonomisches Effizienzziel Ehevertrag 153 Eigentum 31, 100, 106, 148 Einstimmigkeit 129, 160 Einzelfallkontrolle, richterliche 171 ff., 177, 180
Sachwortverzeichnis
226
Enterbung siehe Erbe Entlastungsbeschluss siehe Beschluss Entscheidungsfreiheit
151 f.
Entsprechenserklärung 175 – Absichtserklärung
77, 82, 84, 86 ff., 87
– Aktualisierungspflicht 77, 88 – Erklärungspflicht 87, 90, 93, 174 – fehlender Rechtsbindungswille 90 – fehlerhafte Entsprechenserklärung 88 ff. – Haftungsrisiken
88 ff.
– korrekte Entsprechenserklärung 86 ff. – Wissenserklärung Erbe
87 f.
102 f., 157
– Ausschlagung – Enterbung
103, 157
103
– Erbeinsetzung 103 – Erbfall 103 – Erblasser
102 f., 157
Erbeinsetzung siehe Erbe Erbfall siehe Erbe Erblasser siehe Erbe Erbrecht 102 f., 157 Expertenrecht 58, 99 Formvorschriften
153 f.
Freiwillige Selbstkontrolle
57
Fremdbestimmung 126, 149, 152 Gemeinwohlgedanke (Bachmann) 139 ff. Generalklauseln 152 f., 156, 167 Genossenschaft 110, 112 Gentlemen’s Agreements
56, 126
Gerechtigkeit siehe Legitimation German Code of Corporate Governance 75 Gesamthandsgesellschaft
110
Gesamtzusage siehe arbeitsrechtliche Gesamtzusage Geschäftsfähigkeit 153 Geschäftsführer
160
Gesellschaft bürgerlichen Rechts 110 Gesellschafter 107, 112, 160 f. Gesellschaftsorgan siehe Organ Gesellschaftsvertrag 110 ff., 135 ff., 145, 159 ff. – Auslegung 112 ff. – Inhaltskontrolle 114, 160 f. – Normentheorie 112 ff. – staatstheoretische Vertragstheorien 135 ff., 145 – Vertragstheorie 112 ff. Gewährleistungsverantwortung 51, 148 ff., 168 f. Gewaltenteilung 141 Gewaltmonopol siehe staatliches Gewaltmonopol Gewerkschaft 115 ff., 163 Gewinnzusage 102 Gewohnheitsrecht 39, 58, 82 f., 122 f., 167 f. Gläubiger 89, 96, 106, 152 f., 178 Gläubigerschutz 98 Gleichbehandlungsgrundsatz 134, 143 f., 166 GmbH 102, 110 Governance Kodex für Familienunternehmen 57 Gratifikationen 104 f. Grundkonsens siehe Konsens Grundrechte 26 ff., 115, 118 f., 148 ff. – Grundrechtsberechtigung 27 – Grundrechtsbindung 26 ff. – Privatautonomie 121 f., 131 f., 154 – Schutzfunktion 148 ff. – Tarifautonomie 115, 118 f. Grundrechtsberechtigung siehe Grundrechte Grundrechtsbindung siehe Grundrechte Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung siehe Rechnungslegungsstandards Gruppenwohl 141 f., 148 Günstigkeitsprinzip 116, 121, 163, 167
Sachwortverzeichnis Gute Sitten 150, 166 Gütesiegel 58 Handelsbrauch 52, 58, 83 f., 93, 123 f., 167 f. Hauptversammlungsbeschluss 91 ff., 174 – Anfechtbarkeit 91 ff., 174 – Entlastungsbeschluss 91 ff., 174 – Relevanztheorie 92 Hausordnung 31, 106 Herrschaft 127 ff., 141 Herrschaftsgewalt 125 Fn. 1, 128 Herrschaftsordnung 127, 135 f. Heteronomie 45, 51 f. Homo oeconomicus 138 Hybride Regelsetzung siehe private Regelsetzung IDW Prüfungsstandards 73 f., 172 ff. – Institut der Wirtschaftsprüfer Deutschland e.V. (IDW) 73, 173 Immission 68 f. Informationsasymmetrie 155 f. Informationsrecht siehe Partizipation Inhaltskontrolle 108 f., 114, 123, 144, 156, 160 ff., 166 f. – bei Allgemeinen Geschäftsbedingungen siehe Allgemeine Geschäftsbedingungen – bei Betriebsvereinbarungen siehe Betriebsvereinbarungen – bei Gesellschaftsverträgen siehe Gesellschaftsvertrag – bei Tarifverträgen siehe Tarifverträge Inkorporation 61 Insiderhandels-Richtlinien 84 Insiderinformation 90 Interessenkonflikt 36, 83, 92, 110 f. Interessenlobbying 48 Interessenrepräsentanz 145 f. Investoren 75 f. Kaldor-Hicks-Effizienz siehe ökonomisches Effizienzziel Kampfmittel 162
227
Kapitalanleger siehe Anleger Kapitalgesellschaft 31, 75, 112 Kapitalmarkt 54, 75, 84, 86, 89 Kapitalmarktrecht 74 Kaufmann 83, 95, 123 Kausalität 65, 88 ff. Kirche 27, 130 Kodexempfehlungen siehe Deutscher Corporate Governance Kodex Kodexkommission 76 ff., 174 ff. – Auswahl 79 – Besetzung 76, 78, 176 – Ernennung 79 Kollektivvertrag siehe Tarifvertrag Kommanditgesellschaft 110 Kommanditgesellschaft auf Aktien 110 Konsens 59, 135 ff., 160, 163 – Grundkonsens 136 Konsultationsverfahren 176, 179 Kontrolle siehe staatliche Kontrolle Körperschaften des Privatrechts 110, 112 Kosteneffizienz 46 Kündigung 105, 150, 154, 179 Kündigungsschutz 154 Kursverlust 89 Legalität 127, 130 f. Legitimation – Begriff 127 f. – demokratische 48, 78, 82, 129 f., 140 f. – durch Gerechtigkeit 143 ff., 156, 158 ff., 165 ff., 175 ff. – durch ökonomischen Nutzen 137 ff. – durch Organisation und Verfahren 144 ff., 153 f., 159, 165, 167, 169 ff., 175 f., 177 ff. – Legitimationsbedürfnis siehe Legitimationsbedürfnis – Legitimationsdefizit 172 ff. – Legitimationsideal 129, 131 f. – normativer Ansatz 127 ff.
228
Sachwortverzeichnis
– privatautonome 131 f. – staatliche Pflicht zur Organisation der Legitimation 148 ff. – soziologischer Ansatz 127 ff. Legitimationsbedürfnis 125 f. Legitimationsdefizit siehe Legitimation Legitimität 125 Fn. 1 Lohnfortzahlung 154 Machtverteilung, asymmetrische 126, 133 Mandatarstheorie siehe Tarifvertrag Massenverträge 108 Medienrecht 57 Mehrheitsbeschluss siehe Beschluss Mehrheitsprinzip 129 Menschenwürde 132, 136 f. Mietrecht 154 Mietspiegel 72 Minderheit 126, 129, 160 Minderheitenschutz 116 Missbrauchsschutz siehe Ausbeutungsschutz Mitbestimmung siehe Partizipation Mitglied siehe Mitgliedschaft Mitgliederversammlung 159 f. Mitgliedschaft siehe Verbandsmitgliedschaft Mitgliedschaftsrechte 89, 92, 94, 160 Mittelbare Staatsverwaltung 26 f., 60, 95 f. Mitwirkung siehe Partizipation Monopolist 133 Moral 56 f., 130 f. Mutterschutz 154 Naturzustand 135 f., 145 Neutralität 141, 145 ff., 171 Nichtmitglieder siehe Außenseiter Normen – Begriff 44 f. – Rechtsnormen 44 f., 81, 89, 108, 115 ff. – soziale 56
– technische 59 ff., 169 ff. Normentheorie 108 ff., 112 ff. Normersetzende Absprachen 55 Fn. 20 Normungsvertrag siehe DIN-Vertrag OECD Principles of Corporate Governance 74 Offene Handelsgesellschaft 110 Öffentliches Interesse 25 f., 48, 79, 81, 169, 173 Öffnungsklausel 116, 121 Ökonomische Analyse des Rechts 137 ff. Ökonomische Theorie des Rechts siehe ökonomische Analyse des Rechts Ökonomisches Effizienzziel 137 f. – Kaldor-Hicks-Effizienz 138 – Pareto-Effizienz 138 opting-out siehe Deutscher Corporate Governance Kodex Organ 82 f., 85 ff., 91, 111, 113, 160 Organisation siehe Legitimation Organisationsvorgaben 144 ff., 169 ff., 172 ff., 177 ff. Pareto-Effizienz siehe ökonomisches Effizienzziel Partikularinteressen 161, 178 Partizipation 145 f., 158, 160, 165 – Auskunftsrecht 146 – Informationsrecht 146 – Mitbestimmung 146, 158, 166 – Rederecht 146 Partnerschaftsgesellschaft 110 Personengesellschaft 110, 160 Pflichtteil siehe Enterbung Pflichtverletzung 65 f., 85 f., 88 Praktische Konkordanz 149 Preisausschreiben 100 ff., 157 Privatautonomie siehe Grundrechte Private siehe private Regelsetzung Private Rechtsetzung – einseitige 100 ff., 157 f. – pluralistische Sichtweise 31 ff.
Sachwortverzeichnis – Rechtsbegriff 29 ff. – staatszentrierte Sichtweise 29 ff. – Vorranganspruch staatlichen Rechts 43 f. – zwei- und mehrseitige 106 ff., 151 ff., 159 ff. Private Regeln – autonome 51 f. – deklaratorische 52 – heteronome 45, 51 f. – konstitutive 52 – mittelbar rechtlich verbindliche 53, 58 ff., 168 ff. – rechtlich unverbindliche 53 ff. – unmittelbar rechtlich verbindliche 53, 100 ff., 150 ff. Private Regelsetzung – Begriff 24 ff. – einseitige 54 ff. – hybride Regelsetzung 28 f. – Nachteile 48 ff. – Systematisierung 51 ff. – Verhältnis zum staatlichen Recht 41 ff. – Vorteile 46 ff. – zwei- und mehrseitige 56 ff., 168 ff. Prospekthaftung 91 Publikumsgesellschaft 161 Quantifizierungen 68 ff., 171 f. – externe 70 ff. – interne 69 f. Rechnungslegung siehe Rechnungslegungsstandards Rechnungslegungsregeln siehe Rechnungslegungsstandards Rechnungslegungsstandards 93 ff., 177 ff. – Deutsches Rechnungslegungs Standards Commitee e.V. (DRSC) 93 f. – DRSC-Satzung 95, 177 ff. – Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 93 f., 97 f., 177, 180
– – – – – –
229
HGB-Fachausschuss 94 f., 178 Plausibilitätskontrolle 179 f. privater Charakter 95 f. Rechnungslegungsgremium 94 f., 173 Standardisierungsvertrag 94, 177 ff. Vermutungswirkung 58, 96 ff., 177, 180 Rechte, subjektive 31, 44, 100, 105 f., 133 f., 142 f., 158 – absolute 100, 105 f., 133 f., 143, 158 – relative 106 Rechtliches Gehör 49 Rechtmäßigkeitskontrolle 76, 81, 96, 150, 166 f., 176 f. Rechtsanerkennungsmonopol 30 f., 38 f., 118 ff., 148 – siehe auch staatlicher Anerkennungsakt Rechtsanwendung 72, 99, 172 Rechtsbegriff siehe private Rechtsetzung Rechtsbindungswille 54, 90 Rechtsetzungsmonopol – kein staatliches 29 ff. – sektorales 41 – siehe auch Rechtsanerkennungsmonopol Rechtsfreier Raum 39, 43 f. Rechtsgeltung 30 f., 39 ff., 45, 61, 97, 99, 109, 116 f., 120, 163 f., 167 Rechtsgeschäft 26, 44 f., 84, 87 f., 100 ff., 108 ff., 113, 115, 117, 120 f., 134, 150, 154, 157 f. – einseitiges 100 ff., 157 f. Rechtsgeschäftslehre 132 f., 149 f. Rechtsgut 89 Rechtskontrolle siehe Rechtmäßigkeitskontrolle Rechtsnorm siehe Normen Rechtspositivismus 130 f. Rechtsquellen 39 f. Rechtssatzform 31, 100 Rechtsschutz 49 Rechtssoziologie 31 ff., 127 ff. Rechtsstaatlichkeitsdefizit 48 f.
230
Sachwortverzeichnis
Rechtsstaatsprinzip 62 f. Rechtsverbindlichkeit 31, 40, 53, 58 ff., 100 ff., 143 – mittelbare siehe mittelbar rechtlich verbindliche private Regeln – unmittelbare siehe unmittelbar rechtlich verbindliche private Regeln Rechtswirkungen – Legitimation siehe Legitimation – mittelbare siehe mittelbare Rechtsverbindlichkeit – unmittelbare siehe unmittelbare Rechtsverbindlichkeit Rederecht siehe Partizipation Regeladressat 47, 56, 61, 126, 142, 150, 157, 168 Regelbetroffener 44, 49, 53, 126, 144, 148 f., 168 Regeln siehe private Regeln Regeln der Technik 63 ff., 67 f., 169 Regelsetzer 25, 29, 44, 47 ff., 60, 129, 133, 144 ff., 149, 157, 164, 168, 171, 177, 181 Regierungskommission siehe Kodexkommission Relevanztheorie siehe Hauptversammlungsbeschluss Reputationsverlust 54 Rezeptionsakt 53, 70, 99, 168, 172 Rheinische Tabelle 69, 172 Richtigkeitsgewähr, prozedurale 144, 151 Richtlinien 56 f., 69, 75, 84, 126 – Insiderhandels-Richtlinien 84 – Unternehmensrichtlinien 56 f., 126 – VDI-Richtlinien siehe VDI-Richtlinien Rücktritt 105 Ruhegeld 104 Runde Tische 56 Sachkunde siehe Sachverstand Sachmangel 64 f., 153 Sachnähe 47, 58
Sachverstand 42, 58, 173 Sachwalterhaftung 90 Sanktion 38 Fn. 85, 44, 49, 54, 56, 58, 86, 160 Satzung siehe Verbandssatzung Schaden 72, 88 ff. Schiedsgerichte 33 f., 57 f. Schiedsverfahren 170 Schutzfunktion der Grundrechte siehe Grundrechte Schutzgesetz 89 f. Selbstbestimmung 126, 132 f., 141 f., 151 f. Selbstregulierung 24 ff., 75 Selbstverpflichtung 54 ff., 100 f., 126, 136 Soft Law 35 f. Soll-Beschaffenheit 59, 63 ff. Sorgfaltsmaßstab 59, 65 ff., 85 f. Sozialstaatsprinzip 154 Sozialstandards 55 Staatliche Zwangsgewalt 32, 34, 38 f., 41, 45, 53, 100, 107 Staatlicher Anerkennungsakt 31, 39 f., 53, 73, 82, 100, 102, 107, 111, 118 ff., 130, 152 Staatliches Gewaltmonopol 41 Staatsaufsicht 119 Staatsentlastung 42, 46 Staatsgewalt 26 f., 129 f. Staatstheorie 125, 135 f., 145 Standardisierungsvertrag siehe Rechnungslegungsstandards Stände 30 Fn. 36, 130 Standesregeln 69, 172 Stiftung 31, 45 Fn. 120, 101 Fn. 304, 102 – Stiftungsgeschäft 45 Fn. 120, 101 Fn. 304, 102 – Stiftungsordnung 31, 102 Stiftungsgeschäft siehe Stiftung Stiftungsordnung siehe Stiftung Stille Gesellschaft 110
Sachwortverzeichnis Stimmrecht 95, 146, 160 Subjektive Rechte siehe Rechte Tabellen 72 – Schmerzensgeldtabellen 72 – Schwacke-Liste 72 – Unterhaltstabellen siehe Unterhalt TA-Lärm 68 TA-Luft 68 Tarifautonomie siehe Grundrechte Tarifnormen 42, 115 ff., 162 ff. – Arbeitsverhältnisnormen 116, 163 – Betriebsnormen 116 f., 120, 163 Tarifvertrag 115 ff., 133, 162 f., 167 – Allgemeinverbindlicherklärung 120 – Anerkennungslehre 118 ff. – Delegationslehre 117 ff. – Günstigkeitsprinzip 116, 163 – Inhaltskontrolle 162 – Kollektivvertrag 117 – Mandatarstheorie 118 ff. – Öffnungsklauseln 116 – Tarifnormen siehe Tarifnormen – Tarifvertragspartei 116 ff., 133, 162 f. – Wirkung 115 ff., 163 Tarifvertragspartei siehe Tarifvertrag Technische Normen siehe Normen Teilhabe siehe Partizipation Territorialprinzip 48 Testament 102 f., 157 – Anfechtung 103 – Widerruf 103 – siehe auch Erbe Testamentsvollstrecker 69, 103, 157 tit-for-tat 56 Transparenz 49, 75, 141, 147, 156, 170, 176, 179 f. Treu und Glauben 123, 156, 168 Trittbrettfahrer 49 Übermacht 149, 154, 167 Übernahmekodex 84
231
Überraschungsschutz siehe Allgemeine Geschäftsbedingungen Umweltrecht 55, 173 Umweltstandards 55 Unabhängigkeit 46, 78 f., 94 f., 145 ff., 170 f., 173, 177 f. – finanzielle 46, 145 ff., 170 f., 178 – institutionelle 78 f., 94 f., 173, 177 f. Unbestimmte Rechtsbegriffe 53, 63 ff., 68, 72 f., 174 Unterhaltstabellen 69 ff., 171 f. – Düsseldorfer Tabelle 70 ff. – Unterhaltsrechtliche Leitlinien 70 ff. Unternehmenskodex 56 f., 126 Unternehmensrichtlinien siehe Richtlinien Urlaubsmindestanspruch 154 Urzustand siehe Naturzustand Utilitarismus 138, 141 f. VDI-Richtlinien 59, 67 f., 171 Verband – Austritt 150, 162 – Beitritt 113, 115, 118 ff., 159, 161, 163 f. – Verbandsbeschluss siehe Beschluss – Verbandsinteresse 159 f. – Verbandsmacht 159 ff. – Verbandsmitglied 42, 53, 56, 73, 110 ff., 116 ff., 133, 159 ff. – Verbandsorgane 111, 160 – Verbandsrecht 131, 133, 146, 160, 163 – Verbandsregeln 100, 110 ff., 159 ff. – Verbandssatzung siehe Verbandssatzung Verbandssatzung 31, 39, 52 f., 110 ff., 159 ff. – Auslegung 112 ff. – Inhaltskontrolle 114, 160 f. – Normentheorie 112 ff. – Vertragstheorie 112 ff. Verbindlichkeit – faktische siehe Befolgungsdruck – rechtliche siehe Rechtsverbindlichkeit
232
Sachwortverzeichnis
Verbraucher 102, 133, 154, 170 Verbraucherschutzrecht 154 Verein siehe auch Verband – Vereinsautonomie 112 – Vereinssatzung siehe Verbandssatzung – Vereinsstrafe 114 Verfahren siehe Legitimation Verfahrensvorgaben 144 ff., 169 ff., 172 ff., 179 Verfassung 26 f., 39, 41 f. Verfügung von Todes wegen 102 f. Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 165 Verkehrspflichten 65 ff., 84 Verkehrssitte 58, 123 f., 167 f. Vermächtnis 103, 157 Vermögensschaden siehe Schaden Vermutung 58, 65, 85, 94, 96 ff., 177, 180 Versicherungsrecht 155 Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 110 Vertrag 45, 52 f., 56, 61, 63 f., 84, 90, 94 f., 100 f., 106 ff., 132 f., 151 ff. – Vertragsbedingungen 107, 153 f. – Vertragsfreiheit 25, 131 ff., 155 – Vertragsparität 151 ff. – Vertragsprinzip 101, 104 – Vertragsrecht 84, 114 – Vertragstheorie(n) 108 ff., 112 ff., 135 ff. Vertrauen 34, 54, 90, 134, 143, 155 – Vertrauensprinzip 134, 143 – Vertrauensschutz 36, 148, 172 – Vertrauensverlust 49, 56
Vertrauensprinzip siehe Vertrauen Vertrauensschutz siehe Vertrauen Vertrauensverlust siehe Vertrauen Verweisung 61 ff. – dynamische 61 ff., 82, 97, 99 – normkonkretisierende dynamische 62 f., 97 – statische 61 f. Vorranganspruch staatlichen Rechts siehe private Rechtsetzung Vorstand 55 f., 77, 83, 86, 91, 160 Weisungsfreiheit 178 Werkvertragsrecht 63 ff. Wertpapieremittenten 90 Wesentlichkeitstheorie 42 f., 174 f., 177 Widerruf 103, 105, 150 – Testament siehe Testament Willenserklärung 87, 107, 132 f. Willensmängel 114, 153 Wirtschaftsprüfer 73, 94, 173, 176 Wirtschaftsprüfergesellschaften 73 Wirtschaftsprüferkammer 73 Wissenserklärung siehe Entsprechenserklärung Zünfte 130 Zustimmung 106 f., 131 ff., 136, 139 ff., 146, 150 ff., 156 ff., 162 ff., 175 – fehlende 116, 133 ff., 142 ff. – verdünnte 132 ff., 142 f., 156, 158 f., 163 ff., 168, 175 Zwangsgewalt siehe staatliche Zwangsgewalt

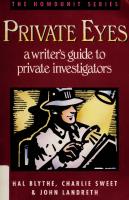

![Ordnungsökonomische Analyse des arbeitsrechtlichen Bestandsschutzes: Eine Untersuchung richterlicher Regelsetzung [1 ed.]
9783428512829, 9783428112821](https://dokumen.pub/img/200x200/ordnungskonomische-analyse-des-arbeitsrechtlichen-bestandsschutzes-eine-untersuchung-richterlicher-regelsetzung-1nbsped-9783428512829-9783428112821.jpg)






![Private Regelsetzung [1 ed.]
9783428550821, 9783428150823](https://dokumen.pub/img/200x200/private-regelsetzung-1nbsped-9783428550821-9783428150823.jpg)