Politische Verwaltungsführung in den Bundesländern: Dargestellt am Beispiel der Landesregierung Baden-Württemberg [1 ed.] 9783428435289, 9783428035281
128 29 38MB
German Pages 320 Year 1975
Polecaj historie
Citation preview
Schriften zur Verwaltungswissenschaft Band 3
Politische Verwaltungsführung in den Bundesländern Dargestellt am Beispiel der Landesregierung Baden-Württemberg
Von
Alfred Katz
Duncker & Humblot · Berlin
ALFRED KATZ
Politische Verwaltungsführung i n den Bundesländern
Schriften zur Verwaltungswissenschaft Band 3
Politische Verwaltungsführung i n den Bundesländern Dargestellt am Beispiel der Landesregierung Baden-Württemberg
Von
Dr. Alired Katz
D U N C K E R
&
H U M B L O T /
B E R L I N
Gedruckt m i t Unterstützung des Kultusministeriums Baden-Württemberg
Alle Rechte vorbehalten © 1975 Duncker & Humblot, Berlin 41 Gedruckt 1975 bei Berliner Buchdruckerei Union GmbH, Berlin 61 Printed in Germany I S B N 3 428 03528 3 D 21
Vorwort Daß wissenschaftliche Arbeiten über Themen wie dasjenige, über das i n diesem Buch gehandelt wird, nötig sind, sagt der Verfasser zu recht. Man muß aber noch deutlicher als er sagen, daß solche Arbeiten aus etlichen Gründen überaus schwierig sind. Sie nähern sich nämlich einem Zentrum konkreter politischer Macht. Diese aber zeigt gegenüber wissenschaftlicher Untersuchung verständlicherweise eine große Reserve. Deshalb sind wissenschaftliche Arbeiten dieser A r t , wenn sie materialreich aussehen, oft nur m i t solchen Tatsachen angefüllt, die dem Machthaber (oder den Machthabern) als positiv gelten. Manche neuere einschlägige Arbeit hingegen erscheint allerdings nur als materialreich. Dort ersetzt die Phantasie die Tatsachen, an die man nicht herankommen konnte oder die man nicht sehen wollte, weil man eine Beeinträchtigung des „kritischen Bewußtseins", d.h. des negativen Vorurteils, zu befürchten hatte. Z u diesen beiden Arten ist die vorliegende Arbeit nicht zu zählen. Sie war allerdings auch nicht der delikaten Problematik eines „Forschungsauftrags" ausgesetzt, der die Fragen nicht selbst formulieren soll. Ihren Ansatz bildete die bloße wissenschaftliche Neugierde. Dem „Doktorvater" erschien das Thema nicht zuletzt deshalb belangvoll, weil er selbst Angehöriger der Staatskanzlei eines Bundeslandes war. Er vereinbarte m i t dem Autor dieses Thema auch deshalb, weil Herr Assessor Dr. Katz als ehemaliger Verwaltungsbeamter des gehobenen Dienstes über Erfahrung i n der Praxis verfügt. Die A n t w o r t auf die Frage, was denn „herauskommen solle", ergab sich hier nur so: möglichst viele Einblicke i n die Wirklichkeit der politischen Verwaltungsführung auf der Grundlage des geltenden Rechts. Der Verfasser läßt die maßgeblichen Bezugspunkte für seine empirischen Erhebungen nicht i m Dunklen. Er zeichnet zunächst deutlich den rechtsnormativen Rahmen, innerhalb dessen er seine Fragen entwickelt. Das unterscheidet diese Arbeit von manchen neueren Arbeiten über Organisationsprobleme öffentlicher Verwaltung, i n denen der Standpunkt für Fragen und für Antworten nicht deutlich gemacht wird, sei es, daß deren Verfasser vom einschlägigen Organisationsrecht keine Ahnung haben, sei es, daß sie auf einer Ebene argumentieren wollen, die nicht diejenige des geltenden Rechts (einschließlich des Verfassungs-
6
Vorwort
rechts) ist. I n jeder Hinsicht ist ein solches Vorgehen unredlich, weil die K r i t i k nicht deutlich überprüfbar ist. Herr Dr. Katz hingegen legt diese Prämissen seiner Untersuchung offen. Diese Einstellung schon brachte dem Verfasser bei den zuständigen Dienststellen jenes Vertrauen ein, das er benötigte, u m möglichst dicht an die von i h m zu suchende Wirklichkeit heranzukommen. Herr Dr. Katz hatte bald den Eindruck gewonnen, daß man i h m so unbefangen antwortete, wie er gefragt hatte. Eine andere Sache ist die Veröffentlichung des Befundes, zu dem der Autor gekommen ist. Jetzt können andere Wertigkeiten Platz greifen, Wertigkeiten nämlich, die ein unbefangener Autor nicht direkt zu beeinflussen beabsichtigt. Er ist sich natürlich darüber i m Klaren, daß die Veröffentlichung einer solchen Untersuchung ein Vorgang ist, der sich von seiner eigenen Arbeit am Thema unterscheidet: Einerseits trägt ein Autor, wenn er sich hier oder dort „kritisch" äußert, diese seine K r i t i k i n eine Öffentlichkeit, welcher das kritisierte Phänomen noch nicht oder doch nur kaum bekannt ist. Bei Studien über Schaltstellen der Macht mag sich z. B. die jeweilige politische Opposition auf diese „ K r i t i k " stürzen, um aus der wissenschaftlichen K r i t i k , wie sie ein Autor glaubt vorbringen zu sollen (aufgrund seines Befundes: zu müssen), eine politische K r i t i k zu machen. Die wissenschaftliche K r i t i k wäre dann für die Opposition, u m i m burschikosen politischen Jargon zu reden, ein „gefundenes Fressen". Es kann daher nicht verwundern, wenn die jeweiligen Inhaber der staatlichen Macht (d. h. der Regierungsgewalt) zur Veröffentlichung wissenschaftlicher K r i t i k kein spannungsloses Verhältnis haben. Ihnen das vorwerfen zu wollen, wäre unehrlich, solange die Vermutung nicht widerlegt ist, daß die jeweilige Opposition die wissenschaftliche K r i t i k sogleich für ihre politischen Zwecke nutzbar machen w i l l . Das Ganze verkehrt sich, wenn wissenschaftliche Arbeit „Bestätigung" bringt. Dann nämlich kann der Machthaber versucht sein, diesen „positiven" Befund in der Auseinandersetzung m i t der Opposition agitatorisch für die eigenen politischen Zwecke zu benützen, während die Opposition leicht geneigt ist, von „bestellter Arbeit" zu reden. Diese Erwägungen zeigen: Wissenschaftliche Arbeit über solche bisweilen politisch sehr heiklen Themen braucht inneren Spielraum. Wenn ein Autor das Gefühl bekommen muß, daß dieser i h m nicht gewährt wird, gerät er i n ein auswegloses Dilemma. Seine wissenschaftliche Redlichkeit (von der er weiß, daß sie politische Wirkung haben kann), verliert ihre Unschuld. I n diesem Sinne ist die Unabhängigkeit wissenschaftlicher Arbeit i n jedem politischen System gefährdet, so wie jeder Wissenschaftler seine Unabhängigkeit selbst gefährden kann.
Vorwort
Das gilt für die vorliegende Arbeit nicht, wie der „Doktorvater" nach zahlreichen Gesprächen m i t dem Verfasser sagen kann. Das eben erwähnte Problem soll hier aber deshalb zur Sprache gebracht werden, weil es bisher nicht genug Gelegenheiten gegeben hat, das Verhalten der „politischen Umwelt" zu wissenschaftlichen Arbeiten m i t solchen Fragestellungen beobachten zu können. Das Erscheinen dieses Buches stellt m i t h i n nicht nur die wissenschaftliche Leistung seines Verfassers zur Diskussion (was er nicht zu scheuen hat); vielmehr kann es auch zeigen, wie sich die „politische Umwelt" zu derartigen wissenschaftlichen Arbeiten stellt. So wenig der Verfasser das i h m entgegengebrachte Vertrauen mißbraucht hat, so wenig sollte seine wissenschaftliche Redlichkeit politisch mißbraucht werden. Hingegen ist sachlich fundierte K r i t i k nötig, um die noch sehr bruchstückhafte wissenschaftliche Erkenntnis auf diesem Gebiet weiter voranbringen zu können. Reagiert die „politische Umwelt" auf eine solche Arbeit in diesem Sinne falsch, so w i r d das für dieses Buch keine Folgen haben. Aber dann w i r d es sehr wahrscheinlich dazu kommen, daß vielversprechende Ansätze zu verwaltungswissenschaftlicher Arbeit i m K e i m erstickt werden. Man müßte also den immer lauter werdenden Ruf der politischen Praxis nach „wissenschaftlicher Hilfe" als den Wunsch nach Pro- oder Contra-Propaganda verstehen, je nachdem, was man parteipolitisch (oder verbandspolitisch) von solchem Beistand erwartet. Erweisen sich hingegen solche abstrakten Befürchtungen hier — wie man nur hoffen kann — als grundlos, so könnte die vorliegende Arbeit viel dazu beitragen, einen bedeutsamen Teil der politischen Wirklichkeit unbefangen zu erhellen. Das wäre nicht nur für die Wissenschaft von Nutzen. , Roman Schnur
Inhaltsverzeichnis Einleitung § 1 Problemstellung
13
§ 2 Bemerkungen zum methodischen u n d theoretischen Ansatz
15
1. Methode u n d Vorgehen
16
2. Bemerkungen zum theoretischen Rahmen
20
Kapitel
I
Die Regierungen der Länder im Staatsgefüge der Bundesrepublik § 3 Der Bereich der Regierung
25
1. Regierung als T e i l der Exekutive
26
2. Begriff der Regierung a) Regierung i m materiellen (funktionellen) Sinne b) Regierung i m institutionellen Sinne c) Regierungswissenschaftlicher Begriff der Regierung
26 27 28 29
3. Abgrenzung Regierung / V e r w a l t u n g
30
4. Abgrenzung Regierung / Parlament
32
§ 4 Die primären Staatszielsetzungen („öffentliche Aufgaben")
34
1. Begriff
34
2. System der primären Zielsetzungen
38
§ 5 Die sekundären Staatszielsetzungen („Staatsfunktionen" als abgeleitete Unterziele) 42 1. Begriff
43
2. „Funktionenlehre"
44
3. System der sekundären Zielsetzungen
45
§ 6 „Matrix"-Organisation § 7 Primäre u n d sekundäre Staatszielsetzungen der Länder
50 55
1. Staatszielsetzungen der Länder i m Vergleich zum B u n d
55
2. Entwicklung der Staatszielsetzungen der Länder
58
§ 8 Allgemeine Anforderungen an die Regierungsorganisation der L ä n der
60
10
Inhaltsverzeichnis Kapitel
II
Verfassungsrechtliche Ausgestaltung des Regierungsbereiches nach der Verfassung des Landes Baden-Württemberg § 9 Allgemeine Ausgangspunkte
64
1. Gegenstand u n d Aufgabe von K a p i t e l I I
64
2. Historische Ausgangslage
65
§ 10 Das parlamentarische Regierungssystem
67
§11 Die Organisationsstruktur der Landesregierung
70
§ 12 Das Verhältnis von „ K a n z l e r - u n d Kabinettsprinzip" (Auslegungsprobleme des A r t . 49 LV)
74
1. Unterschiede zum Grundgesetz
74
2. Auslegungskriterien f ü r A r t . 49 L V
75
3. Bisherige Lösungsversuche
78
4. Bestehende Auslegungsschwierigkeiten
80
5. Eigene Lösung
82
§ 13 Das Kabinett (Ministerrat)
92
1. Zusammensetzung u n d Organisation
92
2. Zuständigkeiten
94
3. Stellung i m Regierungssystem
94
§ 14 Der Ministerpräsident
94
1. Wahrnehmung staatsoberhauptlicher Funktionen
95
2. Ministerpräsident als Regierungschef
98
3. Stellung i m Regierungssystem
100
4. Staatsministerium (Staatskanzlei)
100
§ 15 Die Minister 1. Das Ressortprinzip
102 102
2. Stellung i m Regierungssystem
103
3. Einzelne Minister
105
§ 16 Die Staatssekretäre (i. w. S.)
106
1. Verschiedene A r t e n
106
2. Staatssekretäre m i t Kabinettsrang
107
3. Ehrenamtliche Staatsräte
113
4. Minister f ü r Bundesangelegenheiten
115
5. Politische Staatssekretäre
116
6. Beamtete Staatssekretäre
123
7. Ministerialdirektoren
124
Inhaltsverzeichnis § 17 Die Organisationsgewalt i m Regierungsbereich
125
1. Grundsätzliche Verteilung
125
2. Regierungsbildung
127
3. Organisationsgewalt des Kabinetts
127
4. Weitere Organisationsbefugnisse
129
§ 18 Verfassungsrechtliche Schlußbemerkungen
Kapitel
130
III
Organisation und Struktur der Landesregierung (Darstellung und Analyse der empirischen Untersuchungsergebnisse) §19 Empirisches Vorgehen u n d Quellen der Untersuchung
132
§ 20 Das Kabinett (Ministerrat)
134
1. Zusammensetzung
134
2. Regierungsbildung
137
3. Ressortabgrenzung
139
4. Z a h l der Regierungsmitglieder
153
§ 21 Die Kabinettsarbeit
155
1. Kabinettsvorlagen
156
2. Aufstellung der Tagesordnung
157
3. Vorbereitung der Kabinettssitzungen
159
4. A b l a u f der Kabinettssitzung 5. Protokoll u n d Beschlußausführung
161 165
6. Reformüberlegungen zur Kabinettsarbeit
166
§ 22 Der Ministerpräsident
171
1. Aufgaben des Ministerpräsidenten
171
2. Führungsstil des Ministerpräsidenten
175
3. Stellung des Ministerpräsidenten
176
§ 23 Die Ministerien
178
1. Führungskonferenz
179
2. Zentralstellen
181
3. Ministerialdirektoren
191
4. Politische Beamte
194
5. Politische Staatssekretäre
199
6. Organisation der Ressortspitze 206 7. Beziehungsmuster zwischen Ressort u n d Staatsministerium u n d zwischen den Ressorts 206
12
Inhaltsverzeichnis
§ 24 Das Staatsministerium (Staatskanzlei)
211
1. V o n der Kanzleidirektion zum Staatsministerium
211
2. Die E n t w i c k l u n g des Staatsministeriums von 1952 bis 1974
214
3. Zielsetzungen des Staatsministeriums
222
4. A r b e i t des Staatsministeriums
228
5. Führungstätigkeiten zur Ausübung der Richtlinienkompetenz . . 236 6. Planungsinstrumentarium
240
7. Querschnittsfunktionen
251
8. Koordination u n d Information
254
9. K o n t r o l l e u n d Rückkoppelung
260
10. Aspekte des Entscheidungsprozesses
262
11. Organisation der Staatskanzlei
265
§ 25 Das Verhältnis der Regierung zum Parlament
Kapitel
274
IV
Schlußbemerkungen § 26 Thesen u n d Schlußbetrachtung
285
Anhang (Anlagen Nr. 1 - 3 )
291
Quellen- und Literaturverzeichnis
303
Einleitung § 1 Problemstellung D i e v o r l i e g e n d e A r b e i t befaßt sich, s o w e i t ersichtlich, z u m ersten M a l i n einer zusammenhängenden, darstellenden Untersuchung m i t der O r ganisation1 u n d S t r u k t u r 2 einer Landesregierung (Baden-Württemberg). Läßt m a n den Bericht v o n F. Scharpf 3 über Stellung u n d Führungsins t r u m e n t a r i u m d e r Regierungschefs i n d e n B u n d e s l ä n d e r n e i n m a l außer acht, so zeigt sich, daß die Regierungssysteme der Länder i n d e r breiten regierungs- u n d verwaltungswissenschaftlichen Forschung bish e r k a u m beachtet w u r d e n . Dies g i l t , w a s e i g e n t l i c h e r s t a u n t , s o w o h l i n verfassungsrechtlicher als auch i n s y s t e m a n a l y t i s c h e r u n d ebenso, w e n n n i c h t noch m e h r , i n e m p i r i s c h e r H i n s i c h t . Selbst w e n n h i e u n d d a eine U n t e r s u c h u n g ü b e r O r g a n i s a t i o n u n d T e c h n i k des R e g i e r u n g s bereichs d u r c h g e f ü h r t w i r d , so w e r d e n d i e Ergebnisse solcher S y s t e m a n a l y s e n n u r sehr s e l t e n i n g r ö ß e r e m U m f a n g e p u b l i z i e r t u n d d i e m i t i h n e n h e r v o r t r e t e n d e n u n d aufgedeckten S c h w i e r i g k e i t e n u n d P r o b l e m e p r a k t i s c h i m m e r g e h e i m g e h a l t e n 4 . Dies ist sicher p r i m ä r d u r c h 1 Z u m Begriff der „Organisation" vgl. R. Mayntz, Soziologie der Organisation, S. 7 ff. u n d insbesondere S. 147 f. Der vorliegenden A r b e i t liegt diese begriffliche Festlegung i m wesentlichen zugrunde. Vgl. auch W. Risse, i n : Handwörterbuch der Organisation (Hrsg.: E. Grochla), Sp. 1091 ff. 2 Z u m Begriff „ S t r u k t u r " vgl. R. Mayntz, Soziologie der Organisation, S. 81 ff. Auch dieser Definition w i r d hier i m wesentlichen gefolgt. Vgl. auch L e x i k o n der Planung u n d Organisation, S. 171. 3 F. Scharpf y i n : Projektgruppe B M I , Erster Bericht, Anlagenband, S. 267 313 u n d die einzelnen Länderberichte (unveröffentlicht); aber selbst diese Untersuchung wurde ganz überwiegend unter Aspekten der Reform der Bundesregierung, insbesondere i m Hinblick auf eine Verbesserung des Führungsinstrumentarismus v o n Bundeskanzler u n d Bundesregierung durchgeführt. 4 Vgl. A, Jentzsch, i n : Systemanalyse i n Regierung u n d V e r w a l t u n g (Hrsg.: H. Krauch), S. 49 ff. Eine gewisse Ausnahme stellen der Reformbericht der Projektgruppe beim Bayerischen Staatsministerium des Inneren vom Okt. 1970 u n d das Gutachten der Wibera, Wirtschaftungsberatungs A G , zur F ü h rungsorganisation der Baubehörde der Freien u n d Hansestadt H a m b u r g v o m Aug. 1971 dar, die allerdings schwerpunktmäßig n u r den Verwaltungsbereich betreffen u n d zudem nicht veröffentlicht wurden. Vgl. allerdings U. Becker, i n : Die V e r w a l t u n g 1969, S. 213 ff. u n d 347ff.; außerdem f ü r den Regierungs- u n d Verwaltungsbereich des Bundes: Projektgruppe „Organisation des Bundesministeriums des Inneren", Bericht von J u l i 1969; Projektgruppe für Regierungs- und Verwaltungsreform beim Bundesminister des Inneren, Erster Bericht, Aug. 1969; Zweiter Bericht, Febr. 1972; D r i t t e r Bericht, Nov. 1972 (jeweils unveröffentlicht); R. Mayntz!F. Scharpf (Hrsg.),
14
Einleitung
die politische Brisanz solcher Fragen bedingt. Aber auch die Tatsache, daß die Organisation und die Arbeitsprozesse i m Bereich der Regierung weitgehend nicht, wie etwa in der Verwaltung, nach gesetzlichen Bestimmungen oder dienstordnungsmäßigen Regelungen ablaufen, sondern i n starkem Maße von Einflüssen aus dem politischen, aber auch dem gesellschaftlichen Raum, also von Flexibilität und Dynamik, geprägt sind, trägt durchaus auch zu diesem Faktum bei 5 . Damit w i r d sichtbar, welchen Erschwernissen eine solche Untersuchung ausgesetzt ist. Nicht zuletzt zeigt sich dies auch darin, daß zwar der Ruf nach Analysen und Reformen bei Politikern und leitenden Beamten fast überall hörbar ist, daß aber die tatsächliche Unterstützung (insbesondere durch umfassende Information) i n aller Regel weit geringer ist als die meist starke Betonung der Wichtigkeit solcher Maßnahmen. Wenn man diesem skizzierten Zustand die faktische Bedeutung der Regierungen der Länder gegenüberstellt, so w i r d die Notwendigkeit der vorliegenden Arbeit deutlich erkennbar. A u f diesem Hintergrund und i m Hinblick auf das quantitativ und qualitativ enorme Wachstum der Regierungsaufgaben und die steigende Komplexität staatlicher Tätigkeit w i r d besonders offensichtlich, daß es sowohl eine Forderung der Demokratie als auch eine Aufgabe der Regierungs- und Verwaltungswissenschaft ist, die Arbeitsweise der Regierungsinstitutionen zu erhellen, den Regierungsapparat und dessen Entscheidungsprozesse transparenter zu machen, aber auch die Regierungsprozesse auf ihre Effizienz hin zu analysieren und hemmende Faktoren bloßzulegen 6 . Dies zu versuchen und auch i m Rahmen der allgemein geführten Reformdiskussion 7 möglichst empirisch erhärtete Elemente und Bausteine für Planungsorganisation, 1973. Die vorliegende A r b e i t beschäftigt sich i m wesentlichen n u r m i t den entsprechenden Problemen der Flächenstaaten, nicht der Stadtstaaten. 6 Vgl. dazu etwa N. Luhmann, Gesellschaftliche u n d politische Bedingungen des Rechtsstaates, i n : Politische Planung, S. 53 ff.; Ders., i n : Der Staat 1973, S. 171 ff. 8 Zutreffend f ü h r t S. Schöne (Von der Reichskanzlei z u m Bundeskanzleramt, S. 9 f.) dazu aus: „ K r i t i k am Regierungsapparat setzt Durchsichtigkeit der i n i h m ablaufenden Prozesse voraus. F ü r den demokratischen Rechtsstaat können Regierungsinstitutionen keine Geheimbezirke sein, die dem kritischen Blick der Öffentlichkeit entzogen werden." Vgl. besonders auch T. Eschenburg, Verfassung u n d Verfassungsaufbau des Südweststaates, S. 87 f.; A. Gehlen, i n : Demokratie u n d Verwaltung, SHS Bd. 50, S. 179 ff.; W. Geiger, ebenda, S. 242 ff. 7 I n Anbetracht der fast unübersehbaren F l u t von L i t e r a t u r aus allen irgendwie betroffenen Disziplinen (neben Rechts- u n d Regierungswissenschaft vor allem Politikwissenschaft, Soziologie, Wirtschaftswissenschaft) w a r es notwendig, i n deren A u s w a h l gewisse Schwerpunkte zu setzen. Dies hat zur Folge, daß das i m Rahmen dieser Untersuchung verarbeitete Schrifttum, abgesehen von den Publikationen auf den Gebieten Rechtswissenschaft, Verwaltungs- u n d Regierungslehre, zu verschiedenen behandelten Problemen (z. B. System- und Organisationstheorie, Führungs- u n d Management-
§ 2 Bemerkungen zum methodischen u n d theoretischen Ansatz
15
die R e g i e r u n g s l e h r e z u b e s t ä t i g e n oder v i e l l e i c h t sogar n e u z u g e w i n nen, s o l l das angestrebte Z i e l v o r l i e g e n d e r A r b e i t sein 8 .
§ 2 Bemerkungen z u m methodischen u n d theoretischen Ansatz Ausgangspunkt der methodischen u n d organisationstheoretischen Ü b e r l e g u n g e n ist die V o r s t e l l u n g des M o d e l l s eines u m f a s s e n d e n G e sellschaftssystems, i n d e m die politische S p h ä r e als T e i l des G e s a m t systems ganz spezifische F u n k t i o n e n z u e r f ü l l e n h a t 1 . A u s dieser G r u n d a n n a h m e f o l g t , daß d e r politische B e r e i c h systemtheoretisch als e i n ausdifferenziertes S u b s y s t e m der Gesellschaft (neben W i r t s c h a f t , Wissenschaft, R e l i g i o n usw.) anzusehen ist, der z w a r r e l a t i v a u t o n o m (nicht a u t a r k ) , aber eben doch w e g e n seiner Z u g e h ö r i g k e i t z u m u m f a s senden G e s a m t s y s t e m u n t e r der N o t w e n d i g k e i t v o n angepaßten abges t i m m t e n u n d e v e n t u e l l auch selbstbeschränkenden B e d i n g u n g e n u n d W e c h s e l w i r k u n g e n s t e h t 2 . D e r R e g i e r u n g s b e r e i c h 3 i s t n u n seinerseits als S u b s y s t e m der p o l i t i s c h e n S p h ä r e ( e t w a n e b e n d e r V e r w a l t u n g ) z u b e g r e i f e n 4 , der ebenfalls i m R a h m e n r e l a t i v e r A u t o n o m i e seine G e e i g n e t h e i t als U m w e l t a n d e r e r S y s t e m e m i t z u b e r ü c k s i c h t i g e n h a t 5 , also i n Probleme, S t r u k t u r - u n d Planungsfragen, Entscheidungstheorie) keinen A n spruch auf Vollständigkeit erheben kann. Vgl. etwa R. Wahl, Probleme der Ministerialorganisation, i n : Der Staat 1974, S. 383 ff. 8 Vgl. neben § 2 dazu außerdem unten § 9 Ziff. 1 u n d § 19. 1 Hierbei ist ausdrücklich auf folgendes hinzuweisen: I m Rahmen dieser A r b e i t geht es p r i m ä r u m einen organisationstheoretischen Ansatz u n d nicht u m verfassungstheoretische Überlegungen. Vgl. vor allem N. Luhmann, Grundrechte als Institution, S. 26ff.; Ders., i n : Der Staat 1973, S. 5 f f . ; Ders., i n : Soziologische Aufklärung, S. 154ff.; Ders., i n : Politische Planung, S. 46ff. und S. 53 ff. Z u der verfassungstheoretischen Auseinandersetzung vgl. insbes. M. Drath, i n : Der Staat 1966, S. 274 ff.; K. Hesse, Grundzüge des Verfasfungsrechts der BRD, S. 8 f.; E.-W. Böckenförde, Die verfassungstheoretische Unterscheidung von Staat u n d Gesellschaft als Bedingung der individuellen Freiheit, S. 24 ff. je m . w . N . ; F. Hufen, i n : AöR Bd. 100 (1975), S. 193 ff., 234 ff. 2 Vgl. etwa N. Luhmann, i n : Der Staat 1973, S. 6; M. Drath, i n : Der Staat 1966, S. 276; E.-W. Böckenförde, Staat u n d Gesellschaft, S. 27 („Diese U n t e r scheidung u n d Sonderung b e w i r k t keine Isolierung oder ein Auseinanderreißen von Staat u n d Gesellschaft, sie ist vielmehr die Grundlage f ü r eine besondere Beziehungsintensität zwischen beiden"). 3 Z u r Festlegung des Bereichs der Regierung vgl. unten § 3 Ziff. 2. 4 Problematisch ist dabei, ob das Regierungssystem innerhalb des p o l i t i schen Systems dem „Großsystem" P o l i t i k oder V e r w a l t u n g zuzuordnen ist (vgl. N. Luhmannt i n : Der Staat 1973, S. 8 m . w . N . ) . Diese Frage braucht hier zwar nicht entschieden zu werden, doch dürfte auf Landesebene der Regierungsbereich als Subsystem der Exekutive auszudifferenzieren sein (vgl. unten §§ 3, 24 u n d 25; außerdem etwa R. Waterkamp, i n : Aus P o l i t i k u n d Zeitgeschichte B 6/75, S. 3 ff. m. w. N.). 5 I n den „Umweltbeziehungen" des Regierungssystems sollte dabei g r u n d sätzlich zwischen drei Bereichen differenziert werden: (1) zu den anderen
16
Einleitung
seinen Strukturen, Zielsetzungen, Funktionen und Prozessen auf die anderen Systeme abgestimmt sein muß (organisatorisch-strukturelles Systemmodell). 1. Methode und Vorgehen Versucht man das so ausdifferenzierte Regierungssystem unter organisatorischen und strukturellen Gesichtspunkten pragmatisch i n einzelne (Untersuchungs-)Problembereiche aufzuteilen, dann lassen sich als hauptsächliche Ansatzpunkte unterscheiden 6 : (1) Die bestehende, weitgehend durch Rechtsnormen vorgegebene Regierungsstruktur 7.
(Verfassung)
(2) Die primären Staatszielsetzungen („Regierungsaufgaben" der Länder) als mögliche wesentliche Determinante für die Analyse und Festlegung der organisatorischen Grobstruktur des Regierungssystems 8 . (3) Die sekundären Staatszielsetzungen („Regierungsfunktionen" der Länder) als mögliche wesentliche Determinante für die organisatorische Feinstruktur. I n diesen Bereich fällt schwerpunktmäßig die Untersuchung von Mitteln, Methoden und Techniken als Prozeßformen der Realisierung der Regierungszielsetzungen 9 . (4) Das Personal (Menschen als psychisches System), einschließlich des gesamten Personalwesens (öffentliches Dienstrecht, Ausbildung, Fortbildung usw.). (5) Die Umweltbeziehungen. Das Subsystem ist ebenso wie das politische System ein dynamisches, offenes Sozialsystem, das einer laufenden gegenseitigen (aktiven und passiven) Umweltbeeinflussung und -anpassung unterworfen ist 1 0 . Es k a n n n u n aber n i c h t A u f g a b e dieser A r b e i t sein, d e n g e s a m t e n Regierungsbereich, also a l l diese T e i l p r o b l e m e u m f a s s e n d d a r z u s t e l l e n u n d z u untersuchen. V i e l m e h r k a n n d e r S c h w e r p u n k t n u r a u f d i e A n Subsystemen des politischen Systems; (2) zu den anderen Subsystemen des Gesamtsystems; (3) zum umfassenden Gesellschaftssystem selbst. Vgl. vor allem N. Luhmann, i n : Der Staat 1973, S. 172 f., 179 f. m. w . N. 6 Vgl. etwa U. Becker , i n : Die V e r w a l t u n g 1969, S. 214 m. w. N. Die hier genannten Ansatzpunkte sind wechselseitig miteinander verknüpft. I h r e gedankliche Unterscheidung soll bei der K o m p l e x i t ä t des Regierungsbereichs vor allem einen Zugang zur Dikussion der Probleme erleichtern (vgl. Senatsamt HH, Managementsysteme, S. 8 f.). 7 Vgl. dazu unten §§ 9 bis 18. 8 Vgl. dazu unten §§ 4 u n d 7. 9 Vgl. dazu unten §§ 5 u n d 7. 10 Vgl. dazu die Zitate oben i n Fußnote 5 (§ 2) u n d G. Wittkämper, in: Die V e r w a l t u n g 1969, S. 3 ff. m. w. N.
§ 2 Bemerkungen zum methodischen u n d theoretischen A n s a t z 1 7
satzpunkte (1), (2) und (3) gelegt werden. Obwohl den Gebieten Personalwesen (4) 11 und Umweltbeziehungen (5) i m Regierungssystem ganz entscheidende Bedeutung und Einfluß zukommt, können sie i m Rahmen der Arbeit über Organisation und Struktur der Landesregierung grundsätzlich nicht mitbehandelt werden. Gleichwohl sollen die notwendigsten Aspekte dieser Bereiche, soweit erforderlich, m i t berücksichtigt werden. Die vorliegende Arbeit w i r d aber selbst einer umfassenden Untersuchung und Analyse der Bereiche (1), (2) und (3) nicht gerecht werden können. Die Ursache dafür liegt i m wesentlichen darin begründet, daß die Regierungsstruktur der Länder verfassungsrechtlich bislang äußerst stiefmütterlich behandelt wurde, und daß es sich außerdem verfassungspolitisch, etwa i m Rahmen von Reformvorschlägen, gezeigt hat, wie schmal bisher die Basis empirischen Wissens für eine Regierungsreform und die Bestätigung der ihr zugrunde liegenden Annahmen ist (vgl. dazu bereits oben § 1). Das weitgehende Fehlen dieser für eine regierungswissenschaftliche Arbeit unabdingbaren Grundlagen macht es hier besonders notwendig, den Bereich der Landesregierung eingehender zu untersuchen und darzustellen und damit die systemanalytischen Darlegungen zwangsläufig etwas zu vernachlässigen. Eine wesentliche Aufgabe der vorliegenden Arbeit ist es deshalb, das verfassungsrechtliche Untersuchungsdefizit und weitgehend auch den empirischen Informationsmangel zu beseitigen. Daneben soll aber auch, wenngleich dies nicht i n einem umfassenden Sinn möglich sein wird, wenigstens auf Teilbereichen eine kritische Analyse vorgenommen werden. Für eine solche Arbeit erweist sich eine Verbindung von staatsrechtlicher, historischer, politologischer und soziologischer Betrachtungsweise als einzig möglicher methodischer Ansatz 1 2 . Insgesamt soll die Arbeit zur dringend notwendigen Erweiterung der Kenntnisse der Regierungsorganisation und -struktur, speziell i n Baden11 Vgl. dazu etwa G. Brinkmann / W. Pippke/W. Rippe, Die Tätigkeitsfelder des höheren Verwaltungsdienstes, Arbeitsansprüche, Ausbildungserfordernisse, Personalbedarf; Veröffentlichungen der Studienkommission für die Reform des öffentlichen Dienstrechts (8 Bände); B. Steinkemper, Klassische u n d politische Bürokraten i n der Ministerialverwaltung der Bundesrepublik Deutschland, K ö l n u. a. 1974; E. Nümann, Die Organisation des Personalwesens i n der Ministerialverwaltung von B u n d u n d Ländern, K ö l n u. a. 1975. 12 Vgl. etwa G. Schmid, Das Verhältnis v o n Parlament u n d Regierimg, S. 3; bereits U. Scheuner, i n : A Ö R 1927, S. 213, meinte: „Das parlamentarische System juristisch behandeln, hieße Wasser i n einem Sieb auffangen w o l l e n : Die politische Betrachtungsweise ist allein imstande, brauchbare Ergebnisse zu liefern." Dies g i l t heute noch mehr als 1927 u n d i m wesentlichen auch für den Regierungsbereich. Vgl. dazu auch U. Scheuner, i n : W D S t R L 1958, S. 122 f. (Diskussionsbeitrag); D. Sternberger, i n : PVS 1964, S. 6 f . ; E. U. Junker, Die Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers, S. 1 f. Einschränkend bleibt allerdings zu diesem methodischen Ansatz zu vermerken, daß der Verfasser v o n Haus aus Jurist ist.
2 Katz
18
Einleitung
Württemberg, beitragen und zwar i n dem Sinn, daß sie als Basis für eine weiterführende und konkretere Problemfindung und Problembewertung dienen kann. U m ein Gesamtbild zu erhalten, müssen allerdings weitere (Teil-)Untersuchungen nicht zuletzt auch von Politologen, Soziologen und Wirtschaftswissenschaftlern durchgeführt werden (insbesondere Einzelfallstudien). Man hat also diese Arbeit als erste von weiteren, als eine A r t „Pilot-Studie", zu betrachten. Doch selbst die so eingegrenzte Problemstellung begegnet noch erheblichen Schwierigkeiten. Die außerordentliche Komplexität des oben abgesteckten Untersuchungsfeldes macht zum Zwecke der verfassungsrechtlichen und systemanalytischen Darstellung eine weitere Reduktion und Auswahl des zu bearbeitenden Gegenstandsbereichs erforderlich. Dies gilt vor allem i m Hinblick auf die Sammlung und Verwendung von Material, Quellen und Unterlagen, für den Umfang und die Aussagekraft der empirischen Untersuchungen, insbesondere aber auch für die inhaltliche Auswahl und Schwerpunktsetzung der zu behandelnden Themen 1 3 . Zur Bewältigung dieser Probleme w i r d versucht, die Darstellung und Analyse des Regierungsbereichs, die „Verfassungswirklichkeit" (Kapitel III), i n einen systemtheoretischen Bezugsrahmen zu stellen (Kapitel I und I I ) 1 4 . I n Kapitel I w i r d vorweg der Bereich der Regierung und seine Abgrenzung zur Verwaltung einerseits und zum Parlament andererseits ausführlich dargestellt. Das Hauptgewicht dieses ersten Kapitels soll aber darauf gelegt werden, für die vorliegende Arbeit neben dem Verfassungsrecht (Kapitel II) weitere organisatorische Ansatzpunkte aufzustellen, durch die eine Präzisierung und auch eine Analyse der Regierungsstruktur möglich ist. Z u diesen Elementen (Bausteine) zählen als eine der wichtigsten Variablen die den Landesregierungen gestellten primären und sekundären Zielsetzungen 15 . Gerade diese interagierenden Variablen scheinen hier besonders als Ansatzpunkte geeignet zu sein, w e i l die meisten weiteren Variablen i n Relation zu ihnen gesehen werden müssen 16 . Deshalb werden zunächst allgemein die primären Staatszielsetzungen, insbesondere die Regierungsaufgaben, näher charakterisiert. Anschließend w i r d dann unter13 Vgl. dazu ausführlicher: T. Ellwein , Das Regierungssystem, S. 15ff.; K. Sontheimer, Grundzüge des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland, S. 9 f .; G. Lehmbruch, Einführung i n die Politikwissenschaft, S. 45 ff. u n d 72 ff. Vgl. dazu insbesondere auch unten § 19. 14 Vgl. dazu eingehender unten § 2 Ziff. 2. 15 Vgl. dazu unten §§ 4, 5 u n d 7. 16 Vgl. dazu H. Schatz, Der Parlamentarische Entscheidungsprozeß, S. 1 f. m. w. N.; F. Scharpf, i n : Projektgruppe B M I , Erster Bericht, Anlagenband, S. 271 f. Vgl. etwa auch H. Siedentopf u n d T. Ellwein, i n : Band 8 der V e r öffentlichungen der Studienkommission für die Reform des öffentlichen Dienstrechts.
§ 2 Bemerkungen zum methodischen u n d theoretischen Ansatz
19
sucht, welche sekundären Zielsetzungen (abgeleiteten „Regierungsfunktionen") zur Realisierung dieser Aufgaben notwendig sind. Die so gefundenen Zielsetzungen bedürfen allerdings dann noch i m Hinblick auf die speziellen Bedürfnisse und Notwendigkeiten der Länder einer Eingrenzung und Verdeutlichung. I n Kapitel I I w i r d als weiterer wichtiger organisatorisch-struktureller Ansatzpunkt die Verfassungsstruktur der Regierung zu untersuchen sein. Es geht dabei darum, den gesamten Regierungsbereich verfassungsrechtlich auszuleuchten und auch den staatsrechtlichen Spielraum für die Regierungspraxis und evtl. mögliche Reformen abzustecken. Da zur Regierungsstruktur der Länder allgemein und besonders auch für Bad.-Württ. praktisch keine umfassenderen Arbeiten vorlagen, mußte dieser Teil ausführlicher behandelt werden 1 7 . Nach der Festlegung dieser Ansatzpunkte („Bezugsrahmen") soll i m Kapitel I I I die „Verfassungswirklichkeit", die Regierungspraxis i n Bad.-Württ., dargestellt, soweit möglich empirisch belegt und i n einigen Bereichen auch eingehender analysiert werden (vgl. §§ 19-25). Dabei soll eine recht umfassende, aber keinesfalls vollständige Darstellung des Regierungsbereichs gegeben werden (Kabinett, Kabinettsarbeit, Ministerpräsident, Ministerien,, Staatsministerium). Notwendigerweise müssen hierbei die deskriptiven Elemente überwiegen. Gleichwohl w i r d versucht, besonders anhand der i n den Kapiteln I und I I beschriebenen organisatorisch-strukturellen Ansatzpunkten, i m Wege einer kritischen Analyse besonders wichtige Teilgebiete des Regierungsbereichs zu „durchleuchten". I n § 24 soll dann das Staatsministerium, gewissermaßen als die „Schaltzentrale" des Ministerpräsidenten („Chefkoordinator") und der Regierung, noch besonders eingehend untersucht werden. Aufgrund umfangreicher empirischer Erhebungen und Untersuchungen 18 , die wegen der schlechten Materiallage dringend geboten waren, w i r d es möglich sein, Teilbereiche der Regierung, so etwa die Staatskanzlei, einer näheren systematischen Organisationsund Strukturanalyse zu unterziehen. Dabei sind aber, was bereits oben dargelegt wurde, der vorliegenden Arbeit beträchtliche Schranken gesetzt. Diese liegen u. a. darin begründet, daß einmal eine empirische Untersuchung, die zudem überhaupt erstmals durchgeführt wurde, i m „Einmannbetrieb" bei allem guten Willen Kapazitätsgrenzen unterliegt, und daß zum anderen die politische Brisanz und Geheimhaltungspflichten der angesprochenen Themen keinen umfassenden, sondern eben nur einen beschränkten Einblick i n diese Regierungsprobleme 17 Vgl. dazu eingehender unten § 9 Ziff. 1; außerdem natürlich die A u s führungen § 2 Ziff. 2. 18 Vgl. zum empirischen Vorgehen unten § 19. 2*
20
Einleitung
zulassen 19 . Trotz dieser i n der Sache selbst liegenden Schwierigkeiten haben i m wesentlichen alle betroffenen Stellen und Personen die durchgeführten Erhebungen und Befragungen tatkräftig und i n dankenswerter Weise unterstützt 2 0 . Nach einer Beschreibung des Verhältnisses Regierung/Landtag (unten § 25) werden abschließend i n Kapitel I V (Schlußbemerkungen) noch einige der i m Rahmen der Arbeit bestätigten oder gewonnenen Einsichten dargestellt. 2. Bemerkungen zum theoretischen Rahmen Den theoretischen Ansatz zu bestimmen, ist ein äußerst schwieriges Unterfangen. Obschon die vorstehenden und nachfolgenden Ausführungen erkennen lassen, daß hier nicht versucht wird, eine Theorie der „Theorie wegen" aufzustellen, sondern die zu behandelnden Probleme weitgehend pragmatisch zu bewältigen, ist gleichwohl für eine theoriegeleitete, empirische Arbeit, wie etwa der vorliegenden regierungswissenschaftlichen Untersuchung, eine allgemeine und abstrakte Modellvorstellung unentbehrliche Voraussetzung. Eine solche „Theorie" ist dabei als Versuch zu verstehen, die häufig nur kleine Teilbereiche umfassenden Studien i n einem Konzept aufzufangen, das Erklärungen, Zusammenhänge und damit gewisse Voraussagen ermöglicht. Für die Notwendigkeit einer „Theorie" spricht weiter, daß eine möglichst allgemein gültige und auf interdisziplinäre Integration gerichtete Gesamtkonzeption erarbeitet werden sollte, u m so die fortschreitende Trennung und Spezialisierung der einzelnen Bereiche und Disziplinen wenigstens teilweise zu überwinden und die Komplexität etwa disparater empirischer Daten zu reduzieren. U m also vor allem die Wirkungszusammenhänge zwischen den Elementen innerhalb des einzelnen Subsystems zum Gesamtsystem beschreiben und analysieren zu können 2 1 , also die Verhaltensweisen und Beziehungsgefüge von hochkomplexen Systemen operativ erfaßbar zu machen, bedarf es einer solchen theoretischen Grundlegung. Dies gilt besonders auch für den Bereich der Regierung als Teil des gesamten „politischen Systems". Es ist deshalb heute weitgehend anerkannt, daß auch eine praxisnahe 19 Vgl. etwa N. Luhmann, Theorie der VerwaltungsWissenschaft, S. 106. Daß wegen nicht selten fehlenden Informationen u n d Kenntnisse zusätzlich noch i n vielen Bereichen Einzelfallstudien durchgeführt werden müssen, wurde bereits erwähnt. 20 Die vorliegende A r b e i t gibt, soweit nichts anderes vermerkt ist, den empirischen Stand vom 30. 6.1974 wieder. A l l e wesentlicheren Änderungen bis zum 1.1.1975 w u r d e n allerdings berücksichtigt. Die bis 1.1.1975 veröffentlichte L i t e r a t u r wurde i m wesentlichen verarbeitet. Soweit möglich wurde das bis zum 30. 6.1975 erschienene Schrifttum noch nachgetragen (vgl. oben Fußn. 7 von § 1). 21 Vgl. oben Fußnote 5 (§ 2).
§ 2 Bemerkungen zum methodischen u n d theoretischen A n s a t z 2 1
regierungswissenschaftliche Forschung sich „den scheinbaren Luxus sehr abstrakter Theoriebildung gestatten muß" 2 2 , nicht zuletzt u m sich die Wechselwirkung zwischen Theoriebildung einerseits und empirischer Forschung und sinnvoller Detailarbeit andererseits nutzbar zu machen. Bei der Ausgestaltung einer so verstandenen theoretischen Grundkonzeption ist dabei allerdings besonders zu beachten, daß sie den Realitätsbezug stets berücksichtigt und ihr eine breite interdisziplinäre Basis, also kein zu enger Theorieansatz, zugrunde gelegt w i r d 2 3 . Zu einer umfassenden Bewältigung dieser Ansprüche i n politischen Systemen ist eine der bislang entwickelten Theorien allerdings allein kaum i n der Lage 2 4 . Sinn der vorliegenden Arbeit kann es denn auch nicht sein, eine weitere zu entwickeln 2 5 . Vielmehr soll hier — und darin liegt der Zweck dieser Bemerkungen zum theoretischen Ansatz — lediglich versucht werden, i m Hinblick auf die Organisation des Regierungsbereichs Ansatzpunkte für systematische Modellvorstellungen zu erhalten, die eine Orientierung i m wissenschaftlichen Umgang m i t und bei der praktischen Bewältigung der komplexen Wirklichkeit und den Problemen dieses Bereiches erlauben (organisatorisch-strukturelles Systemmodell für den Bereich der Regierungslehre). Ausgehend von dem zu Beginn des § 2 festgelegten Ansatz und den Notwendigkeiten einer regierungswissenschaftlichen Organisationsanalyse (Modellan22 R. Schnur, i n : von der Groeben / Schnur / Wagener, Über die Notwendigkeit einer neuen Verwaltungswissenschaft, S. 71 f. 23 Vgl. dazu insgesamt: K . von Beyme, Die politischen Theorien der Gegenwart, S. 15 ff.; W.-D. Narr, i n : Einführung i n die moderne politische Theorie, Bd. I, S. 89ff.; D. Senghaas, i n : Texte zur Technokratiediskussion (Hrsg.: Koch / Senghaas), S. 174 ff.; E. Laux, i n : Demokratie u n d Verwaltung, SHS Bd. 50, S. 537 f.; H. Fuchs, Systemtheorie, i n : H W O (Hrsg.: Grochla), Sp. 1618 ff.; N. Luhmann, Theorie der Verwaltungswissenschaft, S. 63 ff. 24 Vgl. dazu u n d zu den weiteren Ausführungen: K. von Beyme, Die p o l i tischen Theorien der Gegenwart, S. 43 ff., 176 ff. u. 320ff.; W.-D. Narr, i n : Einführung i n die moderne politische Theorie, Bd. I, S. 45 ff. je m. w . N . ; D. Senghaas, i n : Texte zur Technokratiediskussion (Hrsg.: Koch/Senghaas), S. 174ff.; T. Ellwein, Das Regierungssystem, S. 20ff. T. Parsons, The social system, S. 21 ff.; Ders., i n : Kölner Zeitschrift f ü r Soziologie u n d Sozialpsychologie 1964, S. 30 ff.; Ders., Das System moderner Gesellschaften, S. 12 ff. u n d 110ff.; R. Merton, Social Theory and Social Structure; D. Easton, The P o l i tical System; Ders., A Systems Analysis of Political L i f e ; K . W. Deutsch, Politische K y b e r n e t i k ; J. Bergmann, Die Theorie des sozialen Systems von T. Parsons; F. Naschold, Die systemtheor. Analyse demokratischer pol. Systeme, i n : PVS, Sonderheft 2, S. 3 ff.; N. Luhmann, i n : K ö l n e r Zeitschrift f ü r Soziologie und Sozialpsychologie 1962, S. 617 ff.; Ders., i n : Soziologische A u f klärung, S. 31 ff., 113 ff., 154 ff. u n d 253 ff.; Ders., i n : Politische Planung, S. 46 ff., 53 ff. u n d 66 ff.; Ders., i n : Der Staat 1973, S. 1 ff. und 165 ff.; R. Mayntz, Strukturell-funktionale Theorie, i n : Wörterbuch der Soziologie (Hrsg.: Bernsdorf), S. 836ff.; Dies., i n : Handbuch der empirischen Sozialforschung (Hrsg.: R. König), I I . Band, S. 444 ff.; G. Schmid, Funktionsanalyse und politische Theorie. 25 Dies würde der Problemstellung (vgl. oben § 1) nicht gerecht und zudem den Rahmen der A r b e i t „sprengen".
22
Einleitung
forderungen) kann eine solche „Organisationstheorie" des Regierungssystems i m wesentlichen durch die Elemente „stabile Binnenstruktur", „System/Umweltbeziehungen", „primäre und sekundäre Systemzielsetzungen" definiert werden 2 6 . Diese Elemente lassen sich i n groben Umrissen wie folgt umschreiben: (1) „Stabile Binnenstruktur ": Die Systemstruktur ist als eine relativ homogene, abgrenzbare Ordnung zu kennzeichnen, die ein hinreichend beständiges, gleichförmiges Beziehungs- und Integrationsmuster voraussetzt und es deshalb erlaubt, sie für pragmatische Zwecke innerhalb gewisser Grenzen als konstant anzunehmen. Dabei sind zur „ S t r u k t u r " nur die institutionalisierte innere Gliederung (Aufbau- und Ablauforganisation), Interaktionsmuster usw., nicht die Prozeßabläufe zu rechnen. Das Regierungssystem strebt also nicht zuletzt aus Gründen der Selbsterhaltung nach einem Zustand, der von einer gewissen Stabilität und Integration geprägt ist und demnach darauf abzielt, diese Beständigkeit (ein evolutionärer Wandel ist selbstverständlich nicht ausgeschlossen) zu schaffen bzw. zu erhalten („Gleichgewichtstheorie") 2 7 . Zur Erreichung dieses Ziels dient i n politischen Systemen das positive Recht (normatives Element). Von den Rechtsnormen, die das strukturelle Beziehungsnetz festlegen, w i r d eben diese gewisse Konstanz, Stabilität und Integration erwartet 2 8 . I n Regierungssystemen kommt dies besonders deutlich zum Ausdruck. Die Grundordnungs-, Beziehungs-, Integrations- und vor allem auch die Entscheidungsmuster werden i m Bereich der Regierung durch die Rechtsnormen (insbesondere Verfassung, aber auch Gesetze und Geschäftsordnungen) festgelegt. Der verfassungsrechtlichen Struktur kommt also die Aufgabe der Aufrechterhaltung oder der Schaffung einer gewissen Beständigkeit zu. Dies rechtfertigt eine umfassende Untersuchung der verfassungsrechtlichen Ausgestaltung der Landesregierung und macht sie zugleich für eine kritisch beschreibende und analytische Arbeit unumgänglich. (2) „System/Umweltbeziehungen" : Der Bereich der Regierung steht als Teil des politischen Systems mit dessen übrigen Subsystemen (vor allem dem Parlament, aber auch i n gewissem Sinn der Verwaltung) und m i t den anderen Subsystemen des umfassenden Gesellschaftssystems sowie dem Gesellschaftssystem insgesamt i n einem engen, gegen26
Vgl. dazu auch oben § 2 Ziff. 1 u n d unten §§ 4, 5, 7, 8 u n d 9 Ziff. 1. Vgl. dazu etwa N. Luhmann, i n : Der Staat 1973, S. 167. 28 Recht ist eine unverzichtbare F o r m dieser Ordnung (Ordnungsbedarf w i r d durch Recht befriedigt); es ist Komponente, Moment, Element der S t r u k t u r u n d selbst Struktur. So vor allem N. Luhmann, i n : Jahrbuch für Rechtssoziologie u n d Rechtstheorie, Bd. 2 (1972), S. 260ff.; DersRechtssoziologie, S. 25, 99, 132-204, 259, 299 und 306; ff. Schelsky, i n : Jahrbuch f ü r Rechtssoziologie u n d Rechtstheorie, Bd. 1 (1970), S. 51 ff.; W.-D. Narr, i n : Einführung i n die moderne politische Theorie, Bd. I, S. 113. 27
§ 2 Bemerkungen zum methodischen und theoretischen A n s a t z 2 3
seitigen und stetigen Wechsel Wirkungsprozeß. Aufgabe einer umfassenden Theorie muß es sein, die Umweltbeziehungen möglichst v o l l ständig m i t einzubeziehen. Angesichts einer wechselhaften, dynamischen, schnellebigen, von einem enormen technischen Fortschritt geprägten U m w e l t g i l t es, das Problem einer laufenden Systemstabilisierung zu lösen. Dies kann aber nur durch eine ständige Orientierung und eine laufende Beobachtung der Umwelt, durch eine dauernde Auseinandersetzung m i t i h r und, soweit notwendig, durch entsprechende Anpassung oder Beeinflussung erreicht werden. Dabei ist das Hegierungssystem selbst nicht als unveränderliche, stabile Einheit zu verstehen, sondern als ein System, das die Erhaltung eines relativen und stabilisierenden „Gleichgewichtszustandes" gegenüber einer sich ändernden U m w e l t und ihren Bedingungen durch eine reaktionsbewegliche Elastizität zu leisten vermag. Dies ist aber nur dann zu erreichen, wenn i n einem ständigen Wechselwirkungsprozeß des Regierungssystems m i t der (politischen, gesellschaftlichen und sozialen) U m w e l t die sich ändernden Forderungen und Wünsche m i t berücksichtigt und gegebenenfalls erfüllt werden 2 9 . A u f g r u n d dieses stetigen politischen und sozialen Wandels ist deshalb ein „System" von Austausch-, Auseinandersetzungs- und Erwartungsmustern zu errichten, i n dem als ein wesentliches Ergebnis die von der öffentlichen Hand insgesamt u n d speziell von der Regierung wahrzunehmenden und zu erfüllenden Zielsetzungen festzustellen, ständig zu überprüfen und gegebenenfalls neu zu bestimmen sind. Es kann n u n nicht Sinn dieser Ausführungen sein, die gesamten, äußerst komplexen System/Umweltbeziehungen auch nur annähernd vollständig darzustellen. Gleichwohl soll dazu entsprechend den Erfordernissen der vorliegenden Arbeit ein bedeutender Teilaspekt, nämlich der jeweilige Aufgabengesamtbestand der öffentlichen Hand (primäre Staatszielsetzungen) unter den besonderen Aspekten der Regierung, gewissermaßen als das organisationstheoretisch am meisten interessierende und deshalb wichtigste Resultat der laufenden gegenseitigen System/Umwelt-Beziehungen näher dargestellt werden. Gerade die primären Zielsetzungen dürften eine wesentliche Komponente des Bezugsrahmens innerhalb des politischen Gesamtsystems darstellen, die zwar nur sehr schwer zu beschreiben, aber doch jeweils feststehend und deshalb feststellbar sind und so als Grundvariable innerhalb des organisationstheoretischen Modells einen wichtigen Beitrag leisten können 3 0 . (3) „Sekundäre FunktionenJedes System und damit auch das Regierungssystem als Subsystem des politischen Systems benötigt bei 29
Durch die Erfüllung dieser Forderungen und Wünsche erhält das politische System (Regierungssystem) gewissermaßen einen Teil seiner L e g i t i mation verliehen. 30 Vgl. dazu eingehender unten § 4 Ziff. 2.
24
Einleitung
einer relativ konstanten, i m Regierungsbereich verfassungsrechtlich weitgehend vorgegebenen Organisationsstruktur und bei einem sich ständig wandelnden Bestand an primären Staatszielsetzungen (als Ergebnis der System/Umweltbeziehungen) zur Erhaltung des „Systemgleichgewichts" eine Reihe von flexiblen, dynamischen sekundären Staatszielsetzungen (sekundäre Regierungsfunktionen) 81 . U m — vereinfacht ausgedrückt — m i t der normativ festgelegten Regierungsstruktur die dem Staat aufgegebenen primären Zielsetzungen (Grundstruktur des Aufgabenbestandes) erfassen, planen, vorbereiten, erfüllen, also verwirklichen zu können, bedarf es vielfältiger operationaler Unterziele, eben der abgeleiteten sekundären Zielsetzungen. I n organisationstheoretischer Hinsicht sind i n diesem sekundären Bereich (Feinstruktur) die Prozeßformen der Realisierung der Regierungszielsetzungen (Mittel, Methoden, Techniken usw.) v o n ganz besonderer Bedeutung. Hier interessiert also vor allem die Frage, i n welchen Verfahren die gesamten Staatszielsetzungen durchgeführt und erfüllt werden (Arbeits-, Planungs-, Entscheidungs-, Ablaufprozesse usw.). Die sekundären Funktionen (insbesondere Verfahrensarten) sind dabei u. a. so festzulegen, daß sie die an das System gestellten Anforderungen (insbes. Zielsetzungen) 82 durch eine möglichst optimale und effektive Gesamtleistung erfüllen und daß sie m i t den strukturellen Bedingungen vereinbar sind und auch zu der „ U m w e l t " die notwendigen Beziehungen aufweisen, damit Spannungen und Konflikte innerhalb und außerhalb des Systems geregelt und bewältigt werden, letztlich also die Grundstrukturen (Zustand einer möglichst stabilen, gleichgewichtigen Ordnung und Integration) aufrechterhalten und weitgehend gesichert bleiben.
81 Vgl. dazu etwa T. Parsons, i n : K ö l n e r Zeitschrift f ü r Soziologie u n d Sozialpsychologie 1964, S. 30 ff. m. w . N.; W.-D. Narr, Theoriebegriffe u n d Systemtheorie, S. 110ff.; N. Luhmann, i n : Der Staat 1973, S. 167 ff. m. w . N. 82 E i n Schwerpunkt hat dabei auf der besonderen Relevanz u n d gesellschaftlichen Reichweite der getroffenen Entscheidungen als Charakteristikum des politischen u n d vor allem des Regierungssystems („Entscheidungsknotenp u n k t " ) zu liegen. Vgl. W.-D. Narr, i n : Einführung i n die moderne politische Theorie, Bd. I, S. 124 ff. m. w . N.; K . G r i m m , N. Luhmanns soziologische Aufklärung, S. 70 ff. m. w. N.; E. Laux, i n : Demokratie u n d Verwaltung, SHS Bd. 50, S. 537 f.
KAPITEL
I
Die Regierungen der Länder im Staatsgefüge der Bundesrepublik Die Ausführungen dieses Kapitels sollen i m Sinne einer ausführlicheren „Vorbemerkung" einige begriffliche Klarstellungen und Verständigungen bieten, u m damit den Ausgangspunkt für die weiteren Erörterungen zu kennzeichnen und die Thematik der vorliegenden A r beit näher einzugrenzen. Dabei w i r d aber keinesfalls versucht, eine begriffliche und systematische Grundlegung zu den i n diesem A b schnitt zu behandelnden Problemen zu geben. Vielmehr soll diesen Fragen nur soweit nachgegangen werden, als es für die weiteren Darlegungen sinnvoll und erforderlich erscheint. Darüber hinaus soll i n diesem Kapitel zusätzlich zu der Festlegung der primären und sekundären Zielsetzungen eine Darstellung der wesentlichen Unterschiede der Regierungsbereiche von Bund und Ländern und ein Überblick über die Entwicklung der primären und sekundären Zielsetzungen der Länder gegeben werden. § 3 Der Bereich der Regierung Der Begriff „Regierung" stellt sich trotz zahlreicher intensiver wissenschaftlicher Untersuchungen 1 auch heute noch als weitgehend offen und unklar dar. Problematisch und noch nicht ausdiskutiert bleibt vor allem, w o r i n sich die „Regierung" einerseits von der „Verwaltung" und andererseits vom „Parlament", insbesondere der Regierungskoalition oder Regierungspartei, unterscheidet und wie diese Bereiche gegeneinander abzugrenzen sind. Dieser Mangel beruht allerdings ganz überwiegend auf der besonders hohen Komplexität der Regierungsaufgaben i m Spannungsfeld zwischen Politik und Verwaltung, i n der besonderen A r t und Weise der Bewältigung und Wahrnehmung dieser 1 Vgl. etwa L. von Stein, Verwaltungslehre, 2. Aufl., Bd. I, 1, Die vollziehende Gewalt, 1869, S. 58 f., 691, 135 f.; R. Smend, Die politische Gewalt i m Verfassungsstaat, i n : Festgabe für W. Kahl, 1923, I I I , S. 15 ff.; Ders., V e r fassung u n d Verfassungsrecht, 1928, S. 97 f.; U. Scheuner, Der Bereich der Regierung, i n : Smend-Festschrift, 1952, S. 253 ff.; W. Hennis, Aufgaben einer modernen Regierungslehre, PVS 1965, S. 422 f.; E. Guilleaume, Regierungslehre, Der Staat 1965, S. 177 ff.; G. Kassimatis, Der Bereich der Regierung, 1967, S. 62 ff.; W. Leisner, Regierung als Macht kombinierten Ermessens, J Z 1968, S. 727 ff.
26
Kap. I : Länderregierungen i m Staatsgefge der Bundesrepublik
Aufgaben und außerdem i n der Notwendigkeit der ständigen Anpassung des „Regierungsbereichs" an die sich ändernden Umweltbedingungen i n Politik und Gesellschaft. Aus diesen Gründen ist — soviel soll schon vorweggenommen werden — eine eindeutige begriffliche Festschreibung und eine scharfe Abgrenzung der „Regierung" nicht möglich. 1. Regierung als Teil der Exekutive A u f Grund der geschichtlichen Entwicklung, an die das Grundgesetz und die Landesverfassungen anknüpfen, sowie auf Grund der verfassungsrechtlich festgelegten Parteidemokratie („Primat der Politik") und des Sozialstaatsauftrags einschließlich der damit zusammenhängenden sozial- und wirtschaftsgestaltenden Struktur der modernen Staatstätigkeit hat sich die Auffassung verfestigt und ist heute zur herrschenden Meinung geworden, einen besonderen, verfassungsunmittelbaren und eigenständigen Bereich der Regierung anzuerkennen, der i m Rahmen der drei Gewalten des Staates dogmatisch i n die vollziehende Gewalt (Gubernative als Teil der Exekutive) einzuordnen ist 2 . Die in diesem Bereich bestehende weite Gestaltungsfreiheit der Regierung bleibt aber eingebettet i n das von der Verfassung festgelegte Spannungs- und Wechselwirkungsverhältnis der Staatsgewalten und w i r d vor allem rechtlich durch Bestimmungen der Verfassung und der Gesetze begrenzt, aber auch politisch durch das Parlament (insbesondere die Regierungsparteien) und die öffentliche Meinung eingeschränkt 3 . 2. Begriff der Regierung I m heutigen staatsrechtlichen Sprachgebrauch beinhaltet der Ausdruck Regierung ein Zweifaches: einmal das die Spitze der Exekutive 2 U. Scheuner, i n : Smend-Festschrift, 1952, S. 253 ff.; Ders., i n : V V D S t R L Heft 16 (1958), S. 124; E.-W. Böckenförde, Die Organisationsgewalt i m Bereich der Regierung, 1964, S. 8 1 - 8 3 ; E. Guilleaume, i n : Der Staat 1965, S. 179; G. Kassimatis, Der Bereich der Regierung, S. 67; K. H. Friauf, Die verfassungsrechtliche Problematik einer politischen Ziel- und Mittelplanung der Bundesregierung i m Hinblick auf i h r Verhältnis zum Deutschen Bundestag, i n : Projektgruppe BMI, Erster Bericht, Anlagenband, S. 622 ff.; T. Maunz, i n : Maunz / D ü r i g / Herzog, Kommentar zum Grundgesetz, A r t . 62 A n m . 1 - 3 ; BVerfGE 9, 268, 281 f., das BVerfG hat dort die Regierung auf G r u n d der Verfassung als eigenständigen, nicht erst durch den Gesetzgeber konstituierten Funktionsträger anerkannt; a. A. vor allem D. Jesch, Gesetz u n d Verwaltung, S. 171 — gegen diese Auffassung m i t zutreffenden Gründen: E.-W. Böckenförde, Organisationsgewalt, S. 82 (Fußnote 13) u n d F. Ossenbühl, Verwaltungsvorschriften u n d Grundgesetz, S. 200 f. 3 Vgl. etwa K. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepub l i k Deutschland, 8. Aufl., 1975, § 14 I I 1; T. Maunz, i n : Maunz / D ü r i g / H e r zog, A r t . 62 A n m . 2. So f ü h r t etwa U. Scheuner (in: HdSW, Bd. 8, S. 782) aus, daß es etwa „grundfalsch" sei, die Gesetzes- und Gerichtsfreiheit zum „ K e n n zeichen" der Regierung zu erheben.
27
§ 3 Der Bereich der Regierung
bildende Organ Regierung und zum anderen den Teil der Staatsgewalt und Staatsfunktionen der vollziehenden Gewalt, der sich — etwas vereinfacht ausgedrückt — auf grundlegende und politische Fragen des Staatslebens bezieht. Gemäß diesen beiden Bedeutungsbereichen des Begriffs Regierung unterscheidet man zwischen Regierung i m institutionellen (formellen, organisatorischen oder subjektiven) Sinne und Regierung i m materiellen, funktionellen (inhaltlichen oder objektiven) Sinn 4 . a) Regierung im materiellen
(funktionellen)
Sinne
Sowohl das Grundgesetz als auch die Verfassungen der Länder enthalten keine Vorschrift, die die Aufgaben und Funktion der Regierung i m Staatsleitungssystem wenigstens einigermaßen umfassend festlegt 5 . Zwar räumt etwa das Grundgesetz an zahlreichen Stellen der Bundesregierung oder einzelnen Mitgliedern der Bundesregierung bestimmte Befugnisse ein (z. B. A r t . 37, 43, 58, 65, 76, 112 und 113 GG); jedoch kann daraus nur geschlossen werden, daß die Regierung an der Staatsleitung wesentlich beteiligt ist. Für die Umschreibung der Regierung i m funktionellen Sinne läßt sich aus diesen Bestimmungen unmittelbar allerdings nichts abschließendes herleiten. Unter „regieren", das vom lateinischen „regere" abstammt und dasselbe bedeutet wie das aus dem griechischen abgeleitete „gubernare", versteht man: einen Staat führen, lenken, steuern, Herrschaft und Gesamtleitung ausüben. Diese Funktionen kann man heute schwerpunktmäßig als „politische Staatsführung" verstehen, als verantwortliches Initiieren, Planen, Leiten, Ordnen, Informieren, Koordinieren und Entscheiden der Gesamtpolitik und aller wesentlichen staatlichen Grundfragen. Sie umfassen die auf das Staatsganze bezogenen richtungsgebenden und zielbestimmenden Tätigkeiten vorwiegend i m politischen Feld und sind charakterisiert durch das Hervorbringen schöpferischer Initiativen, durch integrierende und koordinierende Leitung, durch gestaltendes und politisches Zielsetzen, Planen und Entscheiden und auch durch dirigierende Kontrolle der ausführenden Tätigkeiten; sie beinhalten demnach i n besonderem Maße Elemente der Aktivität, Kreativität und Dynamik. Der Schwerpunkt des Bereichs der Regierung i m materiellen Sinne liegt also auf der Wahrnehmung politischer Funktionen 6 . 4 T. Maunz, i n : Maunz / D ü r i g / Herzog, A r t . 62 A n m . 1; P. Badura, i n : Evang. Staatslexikon, Sp. 1835; G. Kassimatis, S. 54ff.; J. Kölble, Ist A r t . 65 GG überholt? i n : D Ö V 1973, S. 1 ff., 2; A. Katz, Grundkurs i m öffentlichen Recht, D I V 2. 5 Vgl. unten §§ 4 u n d 5. 6 T. Maunz, i n : Maunz / D ü r i g / Herzog, A r t . 62 Anm. 2; U. Scheuner, i n : Smend-Festschrift 1952, S. 278; W. Hennis, i n : PVS 1965, S. 433; E. Guilleaume,
28
Kap. I : Länderregierungen i m Staatsgefge der Bundesrepublik
Ein Teil der Lehre unterscheidet noch zusätzlich zwischen Regierung i m materiellen und Regierung i m funktionellen Sinne 7 . Dabei bezeichnet man alle für den Fortgang des staatlichen Lebens richtungweisenden (initiierenden, planenden, leitenden) Staatstätigkeiten, ohne Rücksicht darauf, von welchem Staatsorgan sie ausgeübt werden, als Regierung i m materiellen Sinne; während man unter Regierung i m funktionellen Sinn all jene Staatstätigkeiten versteht, die nach der verfassungsrechtlichen Zuständigkeitsregelung von einem Regierungsorgan wahrgenommen werden (Gesamtkompetenzen ohne Rücksicht auf den materiellen Inhalt). Diese Umschreibung der Regierungstätigkeiten soll und kann nicht vollständig oder gar umfassend sein. Da vielmehr die hier genannten Kriterien mindestens zum Teil auch bei der rechtssetzenden und rechtssprechenden Gewalt und außerdem auch bei der Verwaltung anzutreffen sind, ging es bei den vorstehenden Ausführungen primär darum, diejenigen Aspekte und Elemente des Begriffs Regierung i m materiellen Sinne herauszustellen, die für diesen Bereich besonders charakteristisch sind, gebündelt, schwerpunktmäßig und stark gehäuft dort auftreten und damit das Wesen der Regierungsaufgaben und -funktionen (Zielsetzungen des Staates) i m wesentlichen ausmachen8. b) Regierung im institutionellen
Sinne
Das Wort Regierung w i r d weiter zur Bezeichnung einer Gruppe von Organen der Staatsgewalt gebraucht, die die Regierungsfunktionen ausübt (Oberleitung der Exekutive). Da der Begriff Regierung i m institutionellen (formellen, organisatorischen oder subjektiven) Sinne verschiedene Bedeutungen beinhaltet und unterschiedlich gebraucht wird, ist der begrifflichen Klarheit wegen eine zusätzliche Untergliederung vorzunehmen: (1) I m Grundgesetz und i n den Länderverfassungen w i r d der Begriff Regierung i m institutionellen Sinne zur Bezeichnung verschiedener Inhalte verwendet: i n : Der Staat 1965, S. 183; G. Kassimatis, S. 23 u n d 59 ff.; W. Leisner, i n : J Z 1968, S. 727 ff. (Leisner charakterisiert das Regieren als A u s ü b u n g k o m binierten Ermessens); K . H. Friauf, i n : Projektgruppe B M I , Erster Bericht, Anlagenband, S. 624; K . Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, § 14 I I ; T. Ellwein, Das Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland, S. 332 ff. 7 Vgl. etwa H. J. Wolff / O. Bachof, Verwaltungsrecht I, S. 77 ff.; G. und E. Küchenhof f, Allg. Staatslehre, S. 147 ff.; G. Kassimatis, S. 54 ff.; diese U n t e r scheidung ist f ü r die vorliegende A r b e i t nicht bedeutsam u n d braucht deshalb nicht näher dargestellt werden. 8 Vgl. dazu G. Kassimatis, S. 60 f.; Arbeitsgruppe f ü r die Vorbereitung einer Totalrevision der Schweizer Bundesverfassung, Schlußbericht, 1973, S. 509 ff. Z u den „Zielsetzungen" des Staates vgl. unten §§ 4 u n d 5.
§ 3 Der Bereich der Regierung
29
I n einem engeren Sinne bezeichnet der Ausdruck Regierung das politische Hauptorgan der Exekutive, das Gesamtkollegium (Kabinett, Ministerrat), das sich aus dem Bundeskanzler bzw. dem Ministerpräsidenten und den Ministern zusammensetzt (enger verfassungsrechtlicher Begriff der Regierung im institutionellen Sinn) 9. (2) Die Bezeichnung Regierung w i r d außerdem i n einem weiteren Sinne, nämlich gleichbedeutend m i t Regierungsorganen, verstanden (Organe, denen die Verfassung unmittelbar Rechte zuweist). Diese Definition umfaßt all jene Staatsorgane — aber auch nur sie —, deren Hauptkompetenzen die Ausübung echter Regierungstätigkeiten sind (weiter verfassungsrechtlicher Begriff im institutionellen Sinne). Dazu gehören demnach der Bundespräsident, die Bundes- und Landesregierungen als Kollegium, der Bundeskanzler bzw. die Ministerpräsidenten und die einzelnen Bundes- bzw. Landesminister. Die Staatssekretäre fallen grundsätzlich nicht darunter (Ausnahme: Staatssekretäre gem. A r t . 43 ff. Bay. Verf. und A r t . 45 I I Bad.-Württ. Verf.). Ob die Bezeichnung Regierung i m Einzelfall auf das Kollegium bezogen werden muß oder ein einzelnes Mitglied der Regierung betreffen soll, ist aus dem Zusammenhang der Verfassungsbestimmung zu entnehmen. I n der Regel ist davon auszugehen, daß nur das Kollegialorgan (enger verfassungsrechtlicher Begriff i m institutionellen Sinne) gemeint ist 1 0 . c) Regierungswissenschaftlicher
Begriff
der Regierung
Diese oben unter b) dargestellten staatsrechtlichen Definitionen der Regierung i m institutionellen, organisatorischen Sinne sind zwar für die Verfassungsauslegung notwendig und sinnvoll, bieten aber für eine realistische Regierungslehre und besonders auch für eine empirische Untersuchung und Analyse des Regierungsbereichs keinen geeigneten Ansatz und keine Hilfe. Vielmehr bedarf es dafür eines institutionellen Regierungsbegriffes, der nicht auf die Regierungsorgane beschränkt ist, sondern den organisatorischen Bereich der „vollziehenden Gewalt" umfaßt, der i m wesentlichen die materiellen Regierungstätigkeiten wahrnimmt. Entsprechend dem Zweck einer Erforschung und empi9 Vgl. A r t . 62ff. GG; A r t . 43 Bay. Verf.; A r t . 45 Bad.-Württ. Verf.; A r t . 51 Nrh.-Westf. Verf. U m s t r i t t e n bei A r t . 84 ff. GG, vgl. dazu BVerfGE 26, 395 ff.; 28, 66 ff. 10 P. Badura, EStL, Sp. 1835 f.; H. J. Wolff / O. Bachof, Verwaltungsrecht I, S. 79 f.; G. Kassimatis, S. 55 ff.; v. Mangoldt / Klein, Das Bonner G r u n d gesetz, Kommentar, A r t . 62, Vorbem. I V 1; T. Manuz, i n : Maunz / D ü r i g / H e r zog, A r t . 62 A n m . 21 ff.; F. Klein, i n : S c h m i d t - B l e i b t r e u / K l e i n , Kommentar zum GG, A r t . 62, A n m . 6; BVerfGE 26, 338, 395 ff.; A. Katz, Grundkurs i m Öffentlichen Recht, D I V 2.1.1.
30
Kap. I : Länderregierungen i m Staatsgefge der Bundesrepublik
risch abgesicherten Untersuchung des Regierungsbereichs i m Hinblick auf die Regierungsorganisation und -struktur muß demnach ein Begriff der Regierung i m institutionellen Sinne festgelegt werden, der den Gesamtkomplex der Regierung, nämlich die Regierungsorgane und den Teil der Exekutive, der sich hauptsächlich oder überwiegend mit materiellen und funktionellen Regierungstätigkeiten (politische Funktionen) beschäftigt, umfaßt 1 1 . Dazu sind dann zusätzlich alle Staatssekretäre, Ministerialdirektoren (Amtschefs) und i n der Regel die unmittelbar den Staatsorganen oder Staatssekretären unterstellten Einrichtungen zu zählen (Führungsebene, d. h. Leitung der Ministerien mitsamt der ihr zugeordneten Führungshilfseinrichtungen, wie M i nisterbüros und auch weite Teile des Staatsministeriums) 12 . Dieser Regierungsbegriff, der unten i m Rahmen der vorliegenden Untersuchung noch konkretisiert werden wird, soll dieser Arbeit, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes gesagt ist, zugrunde gelegt werden (regierungswissenschaftlicher Begriff der Regierung). 3. Abgrenzung Regierung/Verwaltung Seit Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich i n der deutschen Verfassungslehre die Auffassung durchgesetzt, daß der verfassungsrechtliche Begriff der vollziehenden Gewalt i n zwei wesensmäßig verschiedene „Staatsfunktionen" zerfällt, nämlich i n das Regieren und das Verwalten 1 3 . Von Anfang an war dabei — wie nicht anders zu erwarten — die Abgrenzung dieser beiden Teile der Exekutive, insbesondere deren „Funktionenbereiche", problematisch und nicht unbestritten. Die klassische „Funktionenlehre" bezeichnet die Regierung dabei als gestaltende, koordinierende politische Staatsleitung und die Verwaltung als von Rechtsnormen und politischen Entscheidungen (von Parlament und Regierung) abhängige, tätige Verwirklichung und Vollzug staatlicher Aufgaben. Es w i r d also danach unterschieden, ob typischerweise ein leitendes, richtungsgebendes, führendes und politisches Regieren (poli11 Vgl. etwa E. Guilleaume, i n : Der Staat 1965, S. 180; die Regierungslehre der Politologen u n d Soziologen geht i n aller Regel ebenfalls von dieser Definition aus (z. B. : H. Schatz, Der parlamentarische Entscheidungsprozeß, S. 4 f. m. w. N.). 12 So etwa F. Wagener, Die Organisation der Führung, i n : A k t u e l l e Probleme der Ministerialorganisation, SHS Bd. 48, S. 29 ff.; J. Kölble, Die O r ganisation der Führungszwischenschicht, ebenda, S. 171 ff. 18 L. v. Stein, Verwaltungslehre, I. Teil, S. 133 ff.; G. Jellinek, A l l g . Staatslehre, S. 593; U. Scheuner, i n : Smend-Festschrift 1952, S. 259 ff. m. w. N.; G. Kassimatis, S. 62 ff. Staatsfunktionen u n d Funktionenlehre werden hier i. S. der durch das Gewaltenteilungsprinzip umschriebenen drei Grundtypen der Staatsaufgaben u n d ihrer E r f ü l l u n g verstanden (vgl. etwa K . Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, § 13 I I u n d unten § 5).
31
§ 3 Der Bereich der Regierung
tische Funktionen) oder lediglich ein angeleitetes, ausgerichtetes, geführtes und rechtsgebundenes Verwalten (Rechtsfunktionen) vorliegt 1 4 . Diese Ausführungen, aus denen sich ergibt, daß Regierung und Verwaltung prinzipiell verschiedene Tätigkeitsfelder umfassen, dürfen aber keinesfalls i n dem Sinne verstanden werden, daß es sich hierbei um zwei i n funktioneller und organisatorischer Hinsicht streng trennbare und nach Möglichkeit zu trennende Bereiche handelt. Vielmehr ist, vor allem i n den Ministerialverwaltungen, eine Trennung von Regierung und Verwaltung praktisch nicht vollziehbar, da sie funktional und organisatorisch i n vielen Bereichen zu eng miteinander verwoben sind (z.B. Planung). Gegen eine solche Trennung sprechen eindeutig auch folgende wichtige Argumente: (1) Erheblicher Verlust an Information (2) Große Einbuße an Sachverstand, Fachwissen und Erfahrung (3) Verlust an Innovationspotential (4) Gefahr einer Praxisferne gierung
und Verwissenschaftlichung
der
Re-
(5) Immense Mehrkosten. Regierung und Verwaltung sind also, nicht wie Guilleaume meint, als zwei verschiedene Bereiche, sondern als sich gegenseitig durchdringende und befruchtende Bestandteile der Exekutive zu verstehen, wenn auch m i t unterschiedlichen typischen Funktionsfeldern und erheblich differierender Selbständigkeit 15 . Gleichwohl dürfte die Unterscheidung Regierung/Verwaltung für die Frage der organisatorischen und strukturellen Bewältigung der Staatsfunktionen von einer gewissen Bedeutung sein 16 . 14 T. Maunz, i n : Maunz / D ü r i g / Herzog, A r t . 62 A n m . 2; K . Hesse, § 14 I I ; H. J. Wolff/O. Bachof, Verwaltungsrecht I, S. 70, 77 ff.; W. Damkowski, Zum Verhältnis Regierung, V e r w a l t u n g u n d Parlament i m demokratischen Staat, i n : Die V e r w a l t u n g 1970, S. 317 ff.; vgl. auch N. Luhmann, Theorie der V e r waltungswissenschaft, 1966, S. 70 ff., 84; A. Katz, Grundkurs i m öffentlichen Recht, D I V 2.2.; vgl. auch N. Wimmer, i n : Die V e r w a l t u n g 1975, S. 141 ff. 15 E. Guilleaume, Politische Entscheidungsfunktion und Verwaltungsstruktur, i n : Die Verwaltung, 1970, S. 1 ff.; dagegen m i t zutreffender Begründung: W. Damkowski, i n : Die Verwaltung, 1970, S. 317 ff.; vgl. auch Gutachten der Projektgruppe beim Bay. Staatsministerium des Inneren über die Reform des Bay. Staatsministerium des Inneren, Okt. 1970, S. 12 f.; Wibera, Gutachten zur Führungsorganisation der Baubehörde der freien u n d Hansestadt H a m burg, S. 11. Weitgehend unbestritten dürfte z. B. sein, daß längerfristigere Planung von „policy m a k i n g " grundsätzlich nicht getrennt u n d von der Planrealisierung nicht losgelöst werden darf; vgl. Leemans, i n : Probleme der Ministerialorganisation, SHS Bd. 48, S. 385 ff.; R. Wahl, i n : Der Staat 1974, S. 388. 16 Vgl. etwa W. Damkowski, i n : Die V e r w a l t u n g 1970, S. 319 ff.; E. GuiU leaume, Reorganisation von Regierung und Verwaltungsführung, 1966, S. 32 f.;
32
Kap. I : Länderregierungen i m Staatsgefge der Bundesrepublik
Schließlich besteht i n diesem Zusammenhang noch ein Problem, das noch besonders zu erwähnen ist und nicht vernachlässigt werden darf. Der enorm angewachsene Verwaltungsapparat ist heute durch das Parlament und vor allem durch die politisch verantwortliche Regierungsspitze kaum noch durchgreifend und nach autonom entwickelten Konzepten zu steuern und zu überwachen. Der Regierungsspitze mangelt es oft an führender, koordinierender und kontrollierender Leitungskapazität 17 . Ob die für die Regierungen, besonders für die Länderregierungen, bestehende Gefahr, durch die Verwaltung teilweise absorbiert und gesteuert zu werden, tatsächlich und gegebenenfalls i n welchem Umfang gegeben ist, möchte die vorliegende Arbeit wenigstens etwas verdeutlichen und konkretisieren (vgl. insbes. unten § 24 Ziff. 10). 4. Abgrenzung Regierung/Parlament Mehrfach wurde bereits ausgeführt, daß für den Begriff Regierung i m funktionellen Sinne die oberste politische Staatsleitung typisch und charakteristisch ist. Dies bedeutet nun aber keinesfalls, daß das Grundgesetz und die Verfassungen der Länder davon ausgehen, daß alle „Regierungsfunktionen" allein den Regierungsorganen vorbehalten sind. Aus den Hauptaufgaben des Parlaments i n einem repräsentativdemokratischen System ergibt sich vielmehr, daß auch das Parlament, i n erster Linie durch die Gesetzgebungskompetenz, aber etwa auch durch die Befugnisse aus A r t . 59 I I und 110 (Feststellung des Haushaltsplans) GG, an der Staatsleitung m i t beteiligt ist (Art. 20 I I I GG). Als weitere wichtige Aufgaben stehen dem Parlament die Bestellung und Kontrolle der Regierung zu. Zwar gehen die geltenden Verfassungen vom klassischen Gewaltenteilungsprinzip aus und beharren grundsätzlich auf dem funktionellen Dualismus von Regierung und Parlament 1 8 ; doch ergibt sich aus dem Wesen der parlamentarischen Demokratie, wonach die Regierung vom Parlament gewählt und abhängig ist, von i h m also seine demokratische Legitimation ableitet (vgl. A r t . 63, 67, 68 GG), aus den i n den Verfassungen selbst normierten zahlreichen Durchbrechungen (vgl. z. B. einerseits A r t . 59 II, 110,114,115 und andererseits A r t . 68, 76, 80 GG), aus dem modernen Parteiensystem (Art. 21 GG) und schließlich auch aus dem W. Müller, Das bürokratische Modell, i n : Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 1973, 719, 742 f.; U. Becker, Z u r Veränderung der S t r u k t u r der Verwaltung, i n : Die V e r w a l t u n g 1970, 389, 394 ff. 17 Vgl. dazu etwa Schweizer Totalrevision, Schlußbericht, S. 543. 18 Vgl. etwa zum GG: Äußerungen der Abgeordneten Schmid (SPD), Süsterhenn (CDU) u. a. i m Parlamentarischen Rat, Stenographischer Bericht 14, 21, 39, 92, 214; zur L V Bad.-Württ.: Ausführungen des Abgeordneten Gönnenwein (DVP/FDP) i n der 10. Sitzung der Verfassungsgebenden Landes Versammlung, Protokolle S. 285 f.
§ 3 Der Bereich der Regierung
33
Sozialstaatsgebot (-auftrag), das eine enorme Zunahme des Umfangs und der Komplexität der Staatsaufgaben m i t sich brachte („Wohlfahrtsstaat"), daß dieses dem Grundgesetz und den Verfassungen der Länder nach 1945 zugrunde liegende Organisationsprinzip i m Verhältnis zwischen Parlament und Regierung infolge einer gegenseitigen „Hemmung", „Verschränkung", „Ineinandergreifen", „Annäherung" und teilweise sogar „Verschmelzung" der beiden Gewalten i n den letzten 25 Jahren mehr und mehr seine gefestigten Konturen verlor und dadurch eine Akzentverschiebung h i n zu einem kooperativen Zusammenwirken, zu einer „GewaltenVerbindung", eingetreten ist 1 0 . Parlament und Regierung scheinen die Staatsleitung gewissermaßen zur „gesamten Hand" auszuüben; sie teilen sich i n die Aufgaben und Funktionen der Regierung, wobei allerdings das Schwergewicht bei der Spitze der Exekutive der Regierung liegt und der Einfluß des Parlaments vorwiegend einmal i n den Formen des parlamentarischen Systems und zum anderen durch die parteipolitischen und personellen Verflechtungen, insbesondere zwischen Regierung und Koalitionsparteien, stattfindet. Dem so verstandenen äußerst komplexen und situationsbedingten Staatsleitungssystem wohnt ein doppeltes Spannungsverhältnis inne (zum Parlament allgemein und zur Opposition speziell). Nach wie vor besteht zwischen Regierung und Parlament (einschließlich Koalition), wenn auch häufig für die Öffentlichkeit kaum mehr sichtbar, die klassische dualistische Spannungslage bei der Wahrnehmung der Staatsleitungsfunktionen 20 ; sie w i r d allerdings offensichtlich i n der 19
XJ. Scheuner, Das Parlament. Regierungssystem i n der Bundesrepublik, i n : DÖV 1957, 633, 634; Ders., i n : DÖV 1974, S. 433 ff.; E. Friesenhahn, Parlament u n d Regierung i m modernen Staat, i n : V V D S t R L 16 (1958), 37 ff.; W. Weber, Die Teilung der Gewalten als Gegenwartsproblem, i n : Festschrift f ü r C. Schmitt, 1959, S. 253, 260 ff.; E. W. Böckenförde, Organisationsgewalt, S. 79 f.; E. Guilleaume, Das Kabinettssystem, i n : D Ö V 1961, 449, 451; Ders., i n : Die V e r w a l t u n g 1970, 1, 8 f . ; D. Sternberger, i n : PVS 1964, S. 6 ff.; P. Badura, Regierung, E S t L Sp. 1836 ff.; W. Leisner, i n : J Z 1968, 728; K . Loewenstein, Verfassungslehre, S. 31 ff.; K . Kluxen, Parlamentarismus, S. 304 f.; R. Herzog, Allgemeine Staatslehre, S. 264ff.; K . Hesse, § 15. Vgl. zur Gesamtproblematik auch die auf der Staatsrechtslehrertagung 1974 erstatteten Berichte von T. Oppermann u n d H. Meyer i n : V V D S t R L 33 (1975), S. 7 ff. u n d 69 ff., sowie E. Grabitz, i n : D Ö V 1974, S. 802 f. 20 Diese Spannungslage ist m. E. nach w i e vor, insbes. i n den Ländern aktuell; sie k o m m t etwa besonders deutlich bei der Diskussion über die Frage der Planungskompetenz zum Ausdruck; vgl. dazu etwa D. Oberndorfer, i n : Projektgruppe B M I , Erster Bericht, Anlagenband, S. 316 ff.; K. H. Friauf, ebenda, S. 607 ff.; H. Liesegang, Z u m E n t w u r f eines Gesetzes über die parlamentarische K o n t r o l l e der Regierungsplanung, i n : ZRP 1972, 259 ff.; Zwischenbericht der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags, Fragen der Verfassungsreform, i n : Z u r Sache 1/73, S. 73 ff.; P. Badura, Verfassungsfragen der Finanzplanung, i n : Festgabe für T. Maunz, 1971, S. 1, 13; die A u s führungen u n d Vorschläge von E.-W. Böckenförde, Planung zwischen Regierung u n d Parlament, i n : Der Staat 1972, S. 429, 443 ff. dürften der vorgegebenen Verfassungslage i n B u n d u n d Ländern am ehesten entsprechen. Vgl. 3 Katz
34
Kap. I : Länderregierungen i m Staatsgefge der Bundesrepublik
Verfassungswirklichkeit immer stärker durch das politische Spannungsfeld Regierung, Regierungskoalition und Regierungsparteien einerseits und Parlamentsopposition und Oppositionsparteien andererseits verdrängt. Diese Entwicklung scheint demnach die „Trennung" i n das Parlament zu verlagern, wobei der Koalition mehr die Aufgaben der M i t w i r k u n g an der Staatszielbestimmung und -formulierung, zum Teil aufgrund der Parteiprogramme und Koalitionsvereinbarungen (Gewährleistung des „Primats der Politik"), sowie besonders die sich daraus ergebende aktive Gesetzgebungsarbeit obliegen und der Opposition vor allem die Überwachungs- und Kontrollfunktionen zukommen 2 1 . Ob dies zutrifft und inwieweit etwa zum Teil eine funktionelle und personelle „Verschmelzung" zwischen Exekutive und Parlament — speziell zwischen Regierung und Koalition — tatsächlich besteht, hängt neben der einzelnen verfassungsrechtlichen Ausgestaltung ganz besonders von konkreten, äußerst komplexen und sich laufend ändernden politischen und persönlichen Komponenten und Faktoren ab. Dieser Aufriß der Problematik und des Diskussionsstandes soll hier genügen. Bei der Darstellung der Ergebnisse der empirischen Untersuchung w i r d die Problematik, das Verhältnis zwischen Regierung und Parlament, wieder aufgegriffen und soweit i m Rahmen der Arbeit möglich, am Beispiel des Landes Baden-Württemberg konkretisiert und analysiert werden. Es dürfte interessant sein, den sich größtenteils sicher aufdrängenden Vermutungen eine konkrete Verfassungswirklichkeit gegenüberzustellen 22 . § 4 Die primären Staatszielsetzungen („Öffentliche Aufgaben") 1. Begriff I n der wissenschaftlichen Diskussion der letzten Jahre scheint sich zwar immer mehr die Meinung zu verfestigen, daß Ausgangs- und Bezugspunkt einer effektiven und realistischen Organisationsanalyse und -reform i m staatlichen Bereich die von der öffentlichen Hand wahrzunehmenden Ziele, Aufgaben, Funktionen, Leistungen, Tätigkeidazu auch BVerfGE 10, 4, 17 f.; E. Forsthoff, Der Staat der Industriegesellschaft, S. 98 f.; H.-U. Erichsen, Staatsrecht u n d Verfassungsgerichtsbarkeit I I , S. 100 f.; Schweizer Totalrevision, Schlußbericht, S. 513. 21 Vgl. etwa E. Guilleaume, i n : Die V e r w a l t u n g 1970, S. 1, 8 f., K . - H . Böckstiegel, Neue Aspekte der Gewaltenteilung seit I n k r a f t t r e t e n des GG, i n : N J W 1970, 1712 ff.; N. Gehring, Gewaltenteilung zwischen Regierung u n d parlamentarischer Opposition, i n : DVB1. 1971, 633 ff.; J. Kölble, G r u n d probleme einer Reform der MinisterialVerwaltung, i n : Zeitschrift f ü r P o l i t i k 1970, 118,132; A. Katz, Grundkurs i m öffentlichen Recht, D I V 2.3. 22 Vgl. unten K a p i t e l I V , § 25.
§ 4 Die primären Staatszielsetzungen („öffentliche Aufgaben")
35
ten usw. sind 1 . Doch zeigt sich dabei, daß w o h l überwiegend wegen der Größe des Regierungs- und Verwaltungsapparats, des enormen technischen, wirtschaftlichen und sozialen Wandels sowie der Komplexität, Vielschichtigkeit und Mehrfunktionalität der staatlichen Aktivitäten allgemein dieser Ausgangspunkt weitgehend als bisher ungelöstes und kaum zu lösendes Problem angesehen wird, dem nachzugehen es sich, wie die Praxis zeigt, wegen seiner Unübersehbarkeit grundsätzlich nur wenig „lohnt" 2 . Die vorliegende Untersuchung kann das insoweit bestehende theoretische und vor allem empirische Defizit nicht beseitigen. Trotzdem soll i m Rahmen dieser Arbeit versucht werden, die diesbezügliche Diskussion voranzutreiben u n d soweit als möglich empirisch zu untermauern. Aufgrund der Tatsache, daß die gegenwärtige Entwicklung zusätzlich zu der enormen Ausweitung der Staatsausgaben insgesamt (Aufgabenbestand) 3 noch eine ständige Veränderung der Einzelaufgaben und ihrer Realisationsmittel (Durchführung, Ablaufprozeß, M i t t e l und Verfahren) m i t sich bringt, sowie der Erkenntnis, daß die Gesamtaktivitäten i n sich wieder sehr unterschiedliche Kriterien aufweisen und i m Hinblick auf die hier interessierenden organisatorischen Zwecke verschieden ausgestaltet sind, bedürfen die gesamten Ziele, Aufgaben, Funktionen, Leistungen, Tätigkeiten usw. vorweg einer unter strukturellen und organisatorischen Gesichtspunkten nützlichen und praktikablen Systematisierung. U m dies leisten zu können w i r d i m folgenden versucht, eine Grobeinteilung aller staatlichen Aufgaben und A k t i v i t ä ten aufzustellen 4 . Entsprechend den theoretischen Vorüberlegungen (vgl. oben § 2) und auch aufgrund der für diese Arbeit durchgeführten empirischen Erhebungen scheint dafür die i n den § § 4 und 5 beschriebene Grobsystematik der geeigneste Ansatzpunkt zu sein. Die Notwen1
Vgl. etwa T. Ellwein, Einführung, S. 31 ff. u n d 59 ff.; Ders., i n : DÖV 1972, S. 7 5 1 ; R. Herzog, Verhandlungen des 48. D J T (1970), Bd. I I / L , S. 8; F. Ossenbühl, i n : W D S t R L Bd. 29, S. 150 ff.; O. Bachof, i n : V V D S t R L Bd. 30, S. 193 ff. u n d 241 f.; H . P . Bull, Staatsauf gaben, S. 5 ff.; U. Becker, i n : Die V e r w a l t u n g 1970, S. 394 ff.; E. Becker, i n : Demokratie u n d Verwaltung, SHS Bd. 50, S. 498; Ders., i n : Festschrift f ü r W. Geiger, S. 755 ff.; E. Mäding, i n : Die V e r w a l t u n g 1973, S. 257 ff.; A. Theis, i n : Außenpolitik 1972, S. 690ff.; R. Wahl, i n : Der Staat 1974, S. 385 ff.; vgl. auch Projektgruppe „Organisation BMI", Bericht, S. 18 ff., 2 4 1 ; Projektgruppe Bay. IM, Reformbericht, S. 7, 1 4 1 u n d N. Luhmann, i n : Kölner Zeitschrift f ü r Soziologie u n d Sozialpsychologie, 1962, S. 617 ff.; H. Krauch (Hrsg.), Systemanalyse i n Regierung u n d V e r w a l t u n g (insbes. die Beiträge v o n H. Mey, S. 119 ff., F. Naschold, S. 97 ff.). 2 Vgl. etwa R. Wahl, i n : Der Staat 1974, S. 386. 3 Die Frage der Ausdehnung u n d des Umfanges der Staatsaufgaben allgemein ist hier nicht zu erörtern; vgl. dazu etwa A. Theis, i n : Außenpolitik 1972, S. 690 f.; E. Mäding, i n : Die V e r w a l t u n g 1973, S. 266 f. m. w . N. 4 Diese „Grobsystematik" erfolgt i m Rahmen dieser A r b e i t unter besonderer Berücksichtigung der Länderaufgaben u n d Länderaktivitäten. 3»
36
Kap. I : Länderregierungen i m Staatsgefge der Bundesrepublik
digkeit der Einführung des Begriffs der staatlichen „Zielsetzungen" und die vorgenommene erste Differenzierung i n primäre und sekundäre Zielsetzungen ergibt sich insbesondere aus folgenden Gründen 5 : — Wegen der bestehenden Vielfalt und teilweisen Unklarheit i n der definitorischen Festlegung der Begriffe Aufgaben, Funktionen, Leistungen, Tätigkeiten usw. bedarf es für die speziellen Erfordernisse der Verwaltungs- und Regierungslehre (im Rahmen dieser Arbeit besonders unter dem Aspekt der Staatsorganisation) einer begrifflichen Neuorientierung. Die Einführung des Begriffs „Zielsetzung" erfolgt also, u m von der verwirrenden Bedeutungsvielfalt wegzukommen und für die Zwecke der Organisation und Struktur des staatlichen (Regierungs-) Bereiches besser verwendbare Bausteine und Anknüpfungspunkte zu erhalten. — A u f dem Hintergrund der Erkenntnis, daß die Grundstruktur größerer Regierungs- und Verwaltungsorganisationen nur i n einem sehr aufwendigen und kostspieligen Verfahren geändert und demnach eine organisatorische Anpassung nicht i n kurzen periodischen Abständen vorgenommen werden kann, hat sich die Organisationsstruktur möglichst wenig an bloße partei- oder gesellschaftspolitische Bewertungen und Zwecke, sondern nach Möglichkeit weitgehend an objektive Kriterien, den sich objektiv wandelnden A u f gabenbestand und die dafür erforderlichen Realisationsmittel, zu orientieren. Durch die Einführung des i n dieser Hinsicht nicht „vorbelasteten", sondern relativ „neutralen" Begriffs Zielsetzung, soll dies erleichtert werden. — Die Untergliederung der gesamten staatlichen „Aufgaben und A k t i vitäten" i n primäre und sekundäre Zielsetzungen ist, was i n den §§5 und 6 noch näher zu begründen sein wird, unter organisatorischen Gesichtspunkten geboten. Gleichwohl besteht zwischen diesen beiden Bereichen eine so enge Verflechtung (Wechselwirkung) und Multidimensionalität der Problemzusammenhänge, die es für gerechtfertigt erscheinen lassen, diese Beziehungen auch begrifflich nach außen zu dokumentieren. Die hier vorgenommene begriffliche Festlegung, soviel soll stichwortartig bereits vorweg gesagt werden, erfolgt dergestalt, daß i m wesentlichen unter primären Zielsetzungen die Aufgabengrundstruktur (das „Was"; Aufgabenbestand; objektorientiert) und unter sekundären Ziel5 Vgl. dazu etwa H. Reinermann, i n : Bundeswehrverwaltung 1971, S. 121 ff.; A. Theis, i n : Außenpolitik 1972, S. 690 f.; E. Laux, i n : Organisation der M i n i sterien des Bundes u n d der Länder, SHS Bd. 52, S. 19 ff.; R. Wahl, i n : Der Staat 1974, S. 385 ff. m. w . N.; F. Scharpf, i n : Planungsorganisation (Hrsg.: Mayntz / Scharpf), S. 107 ff.; E. Becker, i n : Festschrift f ü r W. Geiger, S. 757 ff., 770 f.
§ 4 Die primären Staatszielsetzungen („öffentliche Aufgaben")
37
Setzungen die daraus abgeleiteten operationalen Unterziele (insbesondere das „Wie"; verrichtungsorientiert; Realisation des „Was") verstanden w i r d 6 . Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, daß mit den „ Zielsetzungen" kein allgemeingültiger, interdisziplinärer Begriff geschaffen werden soll, sondern dieser nur i m Bereich der Regierungsund Verwaltungslehre seine Rechtfertigung besitzt. Sowohl das Grundgesetz als auch die Länderverfassungen enthalten fast keine oder nur vage formulierte staatliche Zweck- und Aufgabenbestimmungen 7 . Dasselbe gilt für den gegenwärtigen Stand der Verwaltungsforschung. Auch i n der Literatur gibt es bisher keine den praktischen Erfordernissen gerecht werdende Systematik der öffentlichen Zielsetzungen, Zwecke oder Aufgaben. Dies hat seinen Grund vorwiegend darin, daß i n einem politischen System, speziell einem demokratischen und sozialen Staatswesen, das es mit den gesamten gesellschaftlichen und politischen Kräften und Problemen zu t u n hat und deshalb eine äußerst komplexe, widerspruchsreiche Wertsituation darstellt, eine umfassende Aufgabenspezifikation und Aktivitätenbeschreibung kaum möglich ist. Außerdem muß i m Hinblick auf die Staatsgewalt und den Souveränitätsanspruch des Staates dessen A u f gabenbereich notwendigerweise offen sein (relative Staatszwecktheorien). Das Abstellen auf ein ganz bestimmtes, absolutes Zweckprinzip, abgesehen von dem jedem System immanent innewohnenden Ziel und Zweck des „Überlebens", würde aber dazu i n direktem Widerspruch stehen 8 . Staatliche Ziele und Aufgaben können deshalb nur als solche umschrieben werden, die der Staat nach der jeweils geltenden Verfassungsordnung zulässigerweise für sich i n Anspruch nimmt. Der Nachweis spezifischer Staatsziele (Staatsaufgaben) läßt sich also nur aus einer konkreten raumzeitlichen Staatsordnung erbringen. Der staat6 Vgl. dazu E. Becker, i n : V e r w a l t u n g (Hrsg.: Morstein Marx), S. 188; H. J. Wolff/O. Bachof, Verwaltungsrecht I, S. 10 ff. u n d 77 ff.; H. P. Bull, Staatsauf gaben, S. 43 ff.; E. Mäding, i n : Die V e r w a l t u n g 1973, S. 266. Eine ähnliche Einteilung w i r d von Brinkmann / Pippke / Rippe, Die Tätigkeitsfelder des höheren Verwaltungsdienstes, S. 104 ff. vorgenommen (dort w i r d zwischen „primären u n d sekundären Zwecken" unterschieden). Vgl. dazu eingehend audh oben § 2. 7 Vgl. etwa A r t . 20 u n d 28 GG; etwas konkreter etwa A r t . 1 Abs. 2 u n d 23 L V Bad.-Württ.; A r t . 3 u n d 99 Bay L V ; A r t . 1 Abs. 2 L V Rh.-Pf.; eine relativ detaillierte Bestimmung enthält A r t . 2 der Schweizer Bundesverfassung; vgl. auch H. P. Bull, Staatsaufgaben, S. 4 (Fußn. 5). 8 Max Weber, Wirtschaft u n d Gesellschaft, S. 658; H. Nawiasky, Allg. Staatslehre, I. Teil, S. 34; H. Krüger, Allg. Staatslehre, S. 27, 760, 829 f.; U. Scheuner, i n : Gedächtnisschrift f ü r Hans Peters, 1967, S. 797, 811 ff.; E. Banfield, i n : Sidney Mailick / E d w a r d H. v a n Ness (Hrsg.), Concepts and Issues i n A d m i n i s t r a t i v e Behavior, Englewood Cliffs, N . J . 1962, S. 70ff.; N. Luhmann, Zweckbegriff u n d Systemrationalität, 1968, S. 149; F. Ossenbühl, i n : W D S t R L 29, 150 ff.; H. P. Bull, Staatsauf gaben S. 3 ff.; E. Mäding, Aufgaben der öffentlichen Verwaltung, i n : Die V e r w a l t u n g 1973, S. 257, 266.
38
Kap. I : Länderregierungen i m Staatsgefge der Bundesrepublik
liehe Aufgabenbestand, insbesondere dessen Wandel, hängt demnach i m Rahmen der verfassungsgemäßen Rechtsordnung und des Verfassungsauftrags (insbes. der „Rechtsgütertrias" des A r t . 20 Abs. 1 GG) wesentlich von den jeweiligen politischen Vorstellungen ab, die sich i n den staatlichen Entscheidungsinstanzen (insbesondere der gesetzgebenden und vollziehenden Gewalt) zu institutionalisieren und durchzusetzen vermögen 9 . Die Festlegung der primären Staatsziele (Staatsaufgaben) kann von den Staatszwecklehren her (zu ungenau und vieldeutig, nicht verifizierbar und deshalb letztlich nur „Leerformeln") nicht erfolgen, wenngleich diese durchaus geeignet sind, dabei eine gewisse Hinweis- und Hilfsfunktion zu erfüllen. Der Begriff primäre Staatszielsetzungen w i r d hier also verstanden als diejenigen öffentlichen Angelegenheiten, die von staatlichen Organen zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich wahrgenommen werden (Art Momentaufnahme des Aufgabenbestandes; darunter fallen selbstverständlich auch zukunftsorientierte, erst i m Planungsstadium befindliche Angelegenheiten). 2. System der primären Zielsetzungen Mehr denn je w i r d heute i n Wissenschaft und Politik das Fehlen einer Staatsaufgabensystematik und einer Staatsaufgabenlehre bedauert 1 0 . Dabei ist man sich freilich größtenteils darüber einig, daß eine solche nicht rein theoretisch erfolgen kann und zu bewältigen ist, sondern daß sie durch eine empirische organisatorisch-strukturelle und vorerst notwendigerweise sektoral begrenzte Analyse aufbereitet und festgelegt werden muß 1 1 . Man sollte allerdings die so verstandene 9 Neben den Nachweisen i n Fußnote 2 von § 3 vgl. H. Peters, i n : Festschrift E. Nipperdey, Bd. I I , S. 880; T. Ellwein, Einführung, S. 35; P. Badura, i n : J Z 1965, 623, 624; P. Dagtoglou, i n : D Ö V 1970, 534; F. Ossenbühl, i n : V V D S t R L 29, 153 f. (vgl. insbes. Fußnote 76); H. P. Bull, Staatsauf gaben, S. 56, 88 f., 90 ff.; Z u r Problematik des Klarstellungs- u n d insbesondere Einschränkungsinteresses der öffentlichen Aufgaben vgl. E. Mäding, i n : Die V e r w a l t u n g 1973, 266 f. 10 E.-W. Böckenförde, Die Bedeutung der Unterscheidung von Staat u n d Gesellschaft i m demokratischen Sozialstaat der Gegenwart, Beilage zur Wochenzeitung „Das Parlament" Nr. 49 v. 4.12.1971, S. 14; T. Ellwein, Regierungssystem, S. 59 ff.; F. Naschold, i n : Systemanalyse i n Regierung und V e r w a l t u n g (Hrsg.: H. Krauch), S. 100; R. Herzog, Verhandlungen des 48. D J T 1970, Bd. I I / L , S. 8; F. Ossenbühl, i n : V V D S t R L 29, 150ff.; O. Bachof, i n : V V D S t R L 30, 193, 241 f.; H. P. Bull, Staatsauf gaben, S. 5 ff.; Leitsätze der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristen zur Verwaltungspolitik, i n : Recht u n d P o l i t i k 1968, S. 43 (zu I I b ) ; M i t t K G S t 1972, S. 5 f. u n d 9; 1974, S. 3 3 1 ; E. Mäding, Aufgaben der öffentlichen Verwaltung, i n : Die V e r w a l t u n g 1973, S. 257 ff. m. w . N. Sehr skeptisch dagegen: N. Luhmann, V e r w a l tungswissenschaft i n Deutschland, i n : Recht u n d P o l i t i k 1967, S. 1231; J. Hirsch, i n : J. H i r s c h / S . Leibfried, Materialien zur Wissenschafts- u n d B i l dungspolitik, 1971, S. 254; vgl. zum Ganzen auch E. Becker, i n : Festschrift für W. Geiger, S. 755 ff. u n d 770 ff. m. w . N.
§ 4 Die primären Staatszielsetzungen („öffentliche Aufgaben")
39
Systematik der öffentlichen Aufgaben — und insoweit ist Luhmann zuzustimmen — nicht zu sehr überbewerten, zu einer Theorie erheben oder i n ihr den K e r n und die Grundlage der Regierungs- und Verwaltungslehre schlechthin sehen 12 . Dies w i r d schon deshalb nicht möglich sein, weil die Darstellung einer umfassenden und allgemein gültigen staatlichen Aufgabensystematik daran scheitert, daß der Aufgabenbestand zu vielschichtig, zu komplex ist und er vor allem aus gesellschaftlichen, sozioökonomischen, politischen und nicht zuletzt finanziellen Gründen einem laufenden Wandel unterzogen ist 1 3 . Eine detaillierte Gesamtdarstellung aller Staatsaufgaben dürfte zudem aus personellen und finanziellen Gründen praktisch kaum durchführbar sein. Die bisherigen Erkenntnisse lassen darauf schließen, daß eine theoretische Darstellung einer umfassenden wissenschaftlichen Systematik und Theorie der öffentlichen Aufgaben für die Zwecke der Regierungs- und Verwaltungslehre fern der Realität und deshalb ohne praktischen Nutzen sein müßte. Bestätigt w i r d dies dadurch, daß die zahlreich vorgenommenen theoretischen Versuche, eine für organisatorische Zwecke brauchbare Aufgabensystematik zu erstellen 14 , unbefriedigend und wenig brauchbar sind und entsprechende empirische Untersuchungen bisher kaum durchgeführt wurden 1 5 . Gleichwohl besteht weitgehend Übereinstimmung, daß eine vertiefte empirische A u f gabenbeschreibung und eine systematisch, pragmatische Einteilung der öffentlichen Aufgaben, ausgehend von Teilbereichen (begrenzte A u f gabengruppen), als Grundlage für Reform- und Rationalisierungsbemühungen, insbesondere i m Rahmen der Struktur, Organisation, A u f gabenverteilung (zwischen Bund, Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden), Aufgabenanalyse, Aufgabenkritik und m i t Einschränkun11 Vgl. etwa T. Ellwein, i n : D Ö V 1972, S. 15 f.; E. Mäding, i n : Die V e r w a l tung, 1973, S. 264; R. Mayntz, Strukturell-funktionale Theorie, i n : Wörterbuch der Soziologie (Hrsg.: W. Bernsdorf), S. 936 ff. 12 N. Luhmann, Verwaltungswissenschaft i n Deutschland, i n : Recht u n d Politik, 1967, S. 124; bei näherem Zusehen ist die Auffassung Luhmanns m. E. letzlich aber gar nicht w e i t von der Ellweins entfernt — vgl. dazu T. Ellwein, D Ö V 1972, S. 13 f. (Ellwein versteht seine „Aufgabenlehre" als eine vorläufige u n d begrenzte systematische Deskription der öffentlichen Aufgaben); Ders., Regierungssystem, S. 74 f. u. 84 f. 13 E. Becker, i n : Demokratie u n d Verwaltung, SHS Bd. 50, S. 497, 501; U. Becker, i n : Die V e r w a l t u n g 1970, S. 389, 394ff.; E. Mäding, i n : Die V e r w a l tung 1973, S. 257, 269. 14 Vgl. E. Becker, i n : V e r w a l t u n g (Hrsg.: Morstein Marx), S. 187 ff.; Ders., i n : Demokratie und Verwaltung, SHS Bd. 50, S. 500ff.; J. Kölble, i n : E n t wicklung der Bundesaufgaben, SHS Bd. 47, S. 41 ff.; H. P. Bull, Staatsaufgaben, S. 213 ff.; E. Mäding, i n : Die V e r w a l t u n g 1973, 261 f. je m. w . N. 15 V o m Ansatz her richtig: Untersuchungsprojekt (Pilot-Studie), System der öffentlichen Aufgaben, der KGSt v o m A p r i l 1974; vgl. dazu M i t t K G S t 1974, S. 33 f. (Teilanalyse von Zielsetzungen).
40
Kap. I : Länderregierungen i m Staatsgefge der Bundesrepublik
gen auch Aufgabenentwicklung und Aufgabenplanung 1 6 ihre Berechtigung haben und teilweise sogar unentbehrlich sind 1 7 .
volle
Für die vorliegende Arbeit folgt daraus, daß sie keine „Theorie" der öffentlichen Aufgaben bringen kann und w i l l . Vielmehr soll i m Rahmen der empirischen Untersuchung eine praxisnahe Darstellung des aktuellen Aufgabenbestandes („Momentaufnahme") eines relativ kleinen Ausschnitts der gesamten Exekutive, nämlich dem der Regierung und besonders dem des Staatsministeriums i n Baden-Württemberg vorgenommen werden. Die so gewonnenen Ergebnisse sollen dann als Ausgangsgrundlage für eine organisatorisch-strukturelle Systemanalyse dieses Bereichs dienen (vgl. insbesondere unten § 20 Ziff. 3 und § 24 Ziff. 3 und 11). Dies bedeutet, daß bei der Beschreibung der primären Zielsetzungen auf abstrakte Theorien und Systeme weitgehend verzichtet wird. U m die durchgeführte Teiluntersuchung aber gewissermaßen nicht i m „luftleeren Raum" stehen zu lassen, ist es dennoch wegen der Fülle, Verschiedenartigkeit und Komplexität der öffentlichen Aufgaben notwendig, ihnen zunächst einige Konturen und Orientierungslinien zu geben. Die primären staatlichen Zielsetzungen (Aufgabenbestand) sind deshalb, allein aus diesem Grund und nicht etwa einer „Theorie" wegen, i n einzelne „Elemente", d.h. i n Teilbereiche, die notwendigerweise allerdings auch noch sehr allgemein gehalten werden müssen, näher aufzulösen. Zu diesem Zweck soll versucht werden, eine dafür möglichst sinnvolle und für die Praxis geeignete „Grobsystematik" („Grobraster") zu erstellen 18 . Eine „Grobgliederung" der primären Zielsetzungen darf, u m den hier gestellten Anforderungen zu genügen, sich einerseits nicht mit 16 Vgl. dazu etwa das allerdings praktisch gescheiterte Vorhaben einer l ä n gerfristigen Aufgabenplanung, i n : Sachstands- u n d Erfahrungsberichte des Arbeitskreises der Staats- und Senatskanzleien und des Bundeskanzleramts v o m 15. und 31.5.1972; H. Schatz, i n : Planungsorganisation (Hrsg.: M a y n t z / Scharpf), S. 37 ff. 17 Vgl. W. Hennis, i n : PVS 1965, 430ff.; T. Ellwein, Einführung, S. 128; Ders., D Ö V 1972, 13 f.; N. Luhmann, Verwaltungswissenschaft i n Deutschland, i n : Recht u n d Politik, 1967, S. 124; U. Becker, i n : Die V e r w a l t u n g 1970, S. 412; E. Becker, i n : SHS Bd. 50, S. 501; Reformbericht der Projektgruppe beim Bay. Staatsministerium des Inneren, Okt. 1970, S. 7; F. Naschold, i n : Systemanalyse i n Regierung u n d V e r w a l t u n g (Hrsg.: H. Krauch), S. 100; W. Müller, Das bürokratische Modell, i n : K ö l n e r Zeitschrift f ü r Soziologie u n d Sozialpsychologie 1973, S. 719, 742 f.; E. Mäding, i n : Die V e r w a l t u n g 1973, 257, 264; M i t t K G S t 1972, 5 f., 9; 1973, 22; 1974, 33 f.; H. Siedentopf, i n : Studienkommission für die Reform des öffentlichen Dienstrechts, Band 8, S. 34 ff.; T. Ellwein, ebenda, S. 209 ff.; E. Becker, i n : Festschrift f ü r W. Geiger, S. 771 und 778 f. T 18 E. Becker, i n : Demokratie u n d Verwaltung, SHS Bd. 50, S. 501; H. P. Bull, Staatsaufgaben, S. 213 ff.; E. Mäding, i n : Die V e r w a l t u n g 1973, S. 261 ff.; G. Wegner, Systemanalyse, i n : Handwörterbuch der Organisation (Hrsg.: E. Grochla), Sp. 1610 ff.; H. Fuchs, Systemtheorie, ebenda, Sp. 1618 ff.; H. Krauch, Systemanalyse i n Regierung u n d Verwaltung, S. 27 ff.
§ 4 Die primären Staatszielsetzungen („öffentliche Aufgaben")
41
einer bloßen Unterteilung i n die „Drei Gewalten" der klassischen Gewaltenteilungslehre begnügen (zu eng), soll aber andererseits auch nicht zu viele Untergruppen bilden. So sind etwa die Haushaltspläne des Bundes, der Länder und der Kommunen, der Funktionenplan, der dem Haushalt des Bundes und der Länder beigefügt ist 1 9 , der Aufgabengliederungsplan der KGSt. 2 0 und auch der Vorschlag des Arbeitskreises der Staats- und Senatskanzleien und des Bundeskanzleramts (zehn Aufgabenbereiche) 21 für die i m Rahmen dieser Untersuchung angestrebten Ziele zu stark untergliedert und damit zu unübersichtlich. Die übrigen recht zahlreichen Ansätze für einen systematisch deskriptiven „Grobraster" einer Gliederung der öffentlichen Aufgaben 2 2 sind für die hier erforderlichen Zwecke teils mehr teils weniger geeignet und sachgerecht 23 . Vor allem i m Hinblick auf die besonderen Belange und Erfordernisse der primären Zielsetzungen auf der Ebene der Länder ist es notwendig, eine eigene, zusätzliche „Grobsystematik" festzulegen. A n diese Systematik sind insbesondere folgende vier Anforderungen zu stellen: — Das i m Grundgesetz und den Länderverfassungen enthaltene Sozialstaatsprinzip und das veränderte Grundrechtsverständnis sind entsprechend ihrer heutigen Bedeutung, also verstärkt, einzubeziehen. — Die Gliederung soll allein nach den primären und nicht nach den sekundären Zielsetzungen erfolgen 24 . Überschneidungen können allerdings nicht ganz ausgeschlossen werden. — Die Bereiche sind so zu wählen, daß eine möglichst große Trennschärfe zwischen den verschiedenen Aufgabengruppen gewährleistet ist. 19
Vgl. etwa bei E. Becker, i n : Demokratie u n d Verwaltung, SHS Bd. 50, S. 501 f.; Ders., i n : V e r w a l t u n g (Hrsg.: Morstein Marx), S. 190 f. 20 Vgl. E. Becker, S. 191. 21 Arbeitskreis der Staats- und Senatskanzleien und des Bundeskanzleramts, Sachstandsberichte v o m 15. 5.1972, VII/2.3, S. 2 f. 22 E. Becker, i n : V e r w a l t u n g (Hrsg.: Morstein Marx), S. 187 ff.; Ders., i n : Demokratie u n d Verwaltung, SHS Bd. 50, S. 500 ff.; T. Ellwein, Einführung, S. 31 ff.; Ders., Regierung u n d Verwaltung, S. 74 A n m . 5; Ders., Regierungssystem, S. 46 ff.; J. Kölble, i n : E n t w i c k l u n g der Bundesaufgaben, SHS Bd. 47, S. 41 ff.; H. Krüger, A l l g . Staatslehre, S. 806 ff.; H. J. Wolff / O. Bachof, V e r waltungsrecht I , § 3 I ; ff. P. Bull, Staatsaufgaben, S. 213 ff. 28 Z u r K r i t i k der einzelnen Gliederungen vgl. insbes. E. Becker, i n : SHS Bd. 50, S. 501 ff.; T. Ellwein, i n : D Ö V 1972, S. 13 ff.; ff. P. Bull Staatsaufgaben, S. 213 ff.; E. Mäding, i n : Die V e r w a l t u n g 1973, S. 262ff.; ff. Siedentopf, i n : Studienkommission f ü r die Reform des öffentlichen Dienstrechts, B a n d 8, S. 34 ff.; T. Ellwein, ebenda, S. 209 ff. 24 Z u r Systematisierung der sekundären Zielsetzungen vgl. unten § 5; vgl. etwa auch ff. J. Wolff / O. Bachof, Verwaltungsrecht I, § 3 I c; ff. P. Bull, Staatsaufgaben, S. 216.
42
Kap. I : Länderregierungen i m Staatsgefge der Bundesrepublik
— Die einzelnen Aufgabenbereiche sollen vom Inhalt und Umfang her einigermaßen gleichgewichtig sein. Dabei ist der finanzielle A u f wand (Ausgaben nach den Haushaltsplänen) ein wichtiger, aber keinesfalls der alleinige Anhaltspunkt. Unter diesen Aspekten w i r d für den Bereich der Landesregierung folgende „Grobsystematik" vorgeschlagen und dieser Arbeit zugrunde gelegt (Unterteilung i n 5 Aufgabenhauptgruppen): (1) Sozial- und gesellschaftspolitischer Bereich (einschließlich gesamtem Umweltschutz) (2) Wirtschafts- und verkehrspolitischer Bereich (einschließlich Wohnungsbau und Raumordnung) (3) Kultur-
und bildungspolitischer
Bereich
(4) Verwaltungs- und rechtspolitischer Bereich (Sicherheit, Innere Ordnung und Rechtspflege) (5) Finanz- und steuerpolitischer Bereich (einschließlich Ressourcen i. w. S.). Die Reihenfolge der einigermaßen gleichgewichtigen Aufgabengruppen 2 5 ist durchaus variabel. Auch müssen die einzelnen Gruppen entsprechend den einzelnen Länderbedürfnissen i m Rahmen der „Feinabgrenzung" offen sein. Dasselbe gilt für eine i n periodischen Abständen vorzunehmende Anpassung. Eine weitere Differenzierung und Aufgliederung muß möglichst empirisch vorgenommen werden. Dabei bieten etwa das Arbeitsprogramm der Landesregierung von BadenWürttemberg und das Landesentwicklungsprogramm Niedersachsen 1985 gute Anhalts- und Ausgangspunkte 26 .
§ 5 Die sekundären Staatszielsetzungen („Staatsfunktionen" als abgeleitete Unterziele) Schon die Tatsache, daß das System der sekundären Zielsetzungen i m staatlichen Bereich besonders behandelt wird, läßt erkennen, daß die primären und sekundären Zielsetzungen hier nicht gleichgesetzt werden, sondern daß i n dem Versuch einer Unterscheidung ein besonderer Sinn und Nutzen für die Bewältigung der organisatorischen und auch der sozio-ökonomischen Probleme gesehen w i r d 1 . 25 Nach dem Haushaltsplan des Landes Baden-Württemberg f ü r 1973 ergibt sich unter finanziellen Gesichtspunkten folgendes B i l d (prozentualer A n t e i l an den Gesamtausgaben): Bereich 1: 13,7%; Bereich 2: 14,8%; Bereich 3: 31,5 % ; Bereich 4:12,5 % ; Bereich 5: 27,5 %. 26 Vgl. Arbeitsprogramm der Landesregierung Baden-Württemberg v o m 22. 3.1974 (unveröffentlicht) u n d die Niedersächsische Landesregierung, L a n desentwicklungsprogramm Niedersachsen 1985, Stand Sommer 1973.
§
Die
ären Staatszielsetzungen
( „ f n t i n " ) 4 3
1. Begriff Wie bereits oben § 4 Ziff. 1 näher ausgeführt wurde, herrscht bei den Begriffen Aufgaben, Funktionen, Tätigkeiten, Leistungen, Ziele usw. i n Theorie und Praxis eine verwirrende Begriffsvielfalt vor. Dieser Tatbestand ist vor allem darauf zurückzuführen, daß einerseits eine begriffliche Festlegung äußerst komplex und schwierig, teilweise sogar eine klare begriffliche Unterscheidung nicht möglich ist und andererseits dieses Problem von den verschiedenen Disziplinen — größtenteils auch innerhalb einzelner Disziplinen — unterschiedlich gesehen und definiert w i r d und die einzelnen Begriffe häufig sogar synonym gebraucht werden 2 . I m Rahmen der vorliegenden regierungs- und verwaltungswissenschaftlichen Arbeit w i r d der Begriff sekundäre Zielsetzungen als verantwortliche Teilnahme eines Subjekts an einer i m weitesten Sinne verstandenen Erfüllung primärer Zielsetzungen oder an ihrer Verknüpfung m i t solchen (Ablaufprozeß) festgelegt 3 . Es geht hier also u m die für die Realisierung der primären Staatszielsetzungen (Grundstruktur des Aufgabenbestandes) erforderliche Festlegung von operationalen Unterzielen (abgeleiteten Regierungsfunktionen). Da i n organisationstheoretischer Hinsicht i n diesem sekundären Bereich (Feinstruktur) die Prozeßformen, die A r t und Weise der Aktivitäten (das „Wie"; Mittel, Methoden, Technik usw.) von ganz besonderer Bedeutung sind 4 , w i r d hier i m wesentlichen nur diese Komponente der sekundären Zielsetzungen behandelt. Innerhalb der abgeleiteten Regierungsfunktionen ist demnach vor allem darzustellen, i n welchen Verfahren die gesamten Staatszielsetzungen durchgeführt und erfüllt werden (Planungs-, Kommunikations-, Entscheidungs-, Arbeits-, Ablaufprozesse usw.). 1 Vgl. F. Nordsiech, i n : H W O (Hrsg.: Grochla), Sp. 602 ff.; F. Naschold, i n : Systemanalyse i n Regierung u n d V e r w a l t u n g (Hrsg.: H. Krauch), S. 99 f.; vgl. dazu besonders auch oben § 5 Ziff. 1; ähnlich w i e hier: Schweizer Totalrevision, Schlußbericht 1973, S. 273 ff. u n d S. 572 ff.; E. Laux, i n : Organisat i o n der Ministerien des Bundes u n d der Länder, SHS Bd. 52, S. 19 ff.; W. Hennis, i n : PVS 1965, S. 432. 2 W.-D. Narr, Theoriebegriffe u n d Systemtheorie, S. 118 (Fußn. 4 m. w. N.); F. Naschold, i n : Systemanalyse i n Regierung u n d V e r w a l t u n g (Hrsg.: Krauch), S. 99; H. P. Bull, Staatsauf gaben, S. 46 f. m. w. N.; vgl. insbes. auch W. Krawitz, Das positive Recht u n d seine Funktion, S. 39 ff.; G. Schmid, Funktionsanalyse u n d politische Theorie, S. 28 ff. u n d 43 f.; E. Becker, i n : Festschrift f ü r W. Geiger, S. 757 ff. 3 Vgl. etwa F. Nordsieck, i n : H W O (Hrsg.: Grochla), Sp. 603. 4 Die hier angesprochenen Prozeßformen werden i n der Regierungslehre häufig als „Staatsfunktionen" bezeichnet. Vgl. zum anderen M. Krautzberger, Die E r f ü l l u n g öffentlicher Aufgaben durch Private, S. 51; H. P. Bull, Staatsaufgaben, S. 46 f.; Schweizer Totalrevision, Schlußbericht, S. 572; E. Mäding, i n : Die V e r w a l t u n g 1973, S. 266; H. Mey, i n : Systemanalyse i n Regierung u n d V e r w a l t u n g (Hrsg.: Krauch), S. 119; R. Wahl, i n : Der Staat 1974, S. 386ff. m. w . N.
44
Kap. I : Länderregierungen i m Staatsgefge der Bundesrepublik
2. „Funktionenlehre" Ausgehend von dieser Definition versucht man i n Wissenschaft und Praxis die sekundären Staatszielsetzungen (Feinstruktur) zu differenzieren und zu systematisieren („Funktionenlehre"). Die klassische Funktionenunterscheidung, die i n den „Gewalten" des Gewaltenteilungsprinzips die drei grundlegenden Staatstätigkeiten sieht 5 , ist dafür vor allem i m Bereich der vollziehenden Gewalt (Regierung und Verwaltung bezeichnet all das, was nicht Gesetzgebung und Rechtsprechung ist) zu ungenau und unbestimmt und kann deshalb auch schon wegen der i m Grundgesetz festgelegten „Gewaltenverschränkung" hier keine Hilfestellung leisten und keine brauchbaren Ergebnisse erzielen. Bei der Suche nach neuen Ansätzen für eine zeitgemäße „Funktionenlehre" w i r d häufig auf wirtschaftswissenschaftliche Kategorien zurückgegriffen und die betriebswirtschaftlichen Lösungsversuche in den staatlichen Bereich transferiert. Solche Versuche geben häufig höchst fruchtbare Anregungen; sie können aber in den seltensten Fällen unverändert übernommen werden. Dies liegt vor allem in den bestehenden unüberbrückbaren Differenzen zwischen einem produktions- und gewinnorientierten System und dem Wesen eines demokratischen und sozialen Rechtsstaates begründet 6 . Trotz dieser zu beachtenden gravierenden Unterschiede ist es nützlich, sich i n aller Kürze einen interdisziplinären, vergleichenden Überblick über die „Funktionen" zu verschaffen. Eines der Hauptprobleme jeder größeren und damit in aller Regel komplexen Organisation liegt in der Festlegung der sekundären Zielsetzungen („Funktionen"). Dies gilt i n besonderem Maß für den Führungs- und Leitungsbereich. Dabei kann sowohl in den betriebswissenschaftlichen als i n den politikwissenschaftlichen und auch den verwaltungswissenschaftlichen Modellen und Konzeptionen von drei, besser wohl vier „Grundfunktionen" ausgegangen werden: — Planung, Vorbereitung (einschließlich Informationen) — Auswahl, Entscheidung — Durchführung, Durchsetzung — Überwachung, Kontrolle, Rückkopplung 5 Vgl. dazu umfassend N. Achterberg, Probleme der Funktionenlehre, 1970, S. 109 ff. 6 Vgl. dazu Schweizer Totalrevision, Schlußbericht, S. 573 m i t weiteren zutreffenden Gründen; vgl. weiter G. Wittkämper, i n : Die V e r w a l t u n g 1969, S. 8 f., 12 ff., 16; Wibera, Gutachten zur Führungsorganisation der B a u behörde der Freien u n d Hansestadt Hamburg, S. 11 ff.; sehr eingehend u n d zutreffend: E. Laux, i n : Demokratie u n d Verwaltung, SHS Bd. 50, S. 537 ff., insbes. S. 545 - 547; sowie Studienkommission für die Reform des öffentlichen Dienstrechts, Bericht der Kommission, S. 97 ff.
§
Die
ären Staatszielsetzungen
( „ f n t i n " )
45
Schematisch und vereinfachend lassen sich diese Grundfunktionen mit den Kategorien des „Fluß- oder Kreislaufmodells" des politischen Systems von Easton umreißen als „inputs" (erste Gruppe), „blackbox" und „Outputs" (zweite und dritte Gruppe) und „feedback" (vierte Gruppe) 7 . Entsprechend den Ausführungen zum System der primären Zielsetzungen kann und soll aus weitgehend denselben Gründen hier keine umfassende und i n sich geschlossene verwaltungswissenschaftliche „Funktionenlehre" dargeboten werden. Dennoch w i r d man sagen können, daß ein System der „Staatsfunktionen" vorwiegend pragmatisch erarbeitet werden muß, wobei nach Möglichkeit eine Synthese aus den „herkömmlichen" und den „neuen" Tätigkeitsformen angestrebt und diese durch empirische (Teil-)Untersuchungen und organisatorischstrukturelle Analysen untermauert werden sollte. Dies bedeutet, daß die Grobstrukturierung der sekundären Staatszielsetzungen deduktiv vorzugeben und dann auf induktiv-heuristischem Wege auszufüllen und zu modifizieren ist. Schließlich muß noch darauf hingewiesen werden, daß wegen der Dynamik von System und Umwelt eine permanente Beobachtung, Überprüfung und gegebenenfalls Fortschreibung der sekundären Zielsetzungen (noch mehr als bei den primären) erforderlich ist, um die Effektivität und Rationalität der „Funktionsabläufe", insbesondere i n organisatorischer und struktureller Hinsicht stets einigermaßen zuverlässig analysieren und überprüfen zu können 8 . 3. System der sekundären Zielsetzungen Ausgehend von diesen mehr theoretischen Überlegungen und anknüpfend an die Ausführungen zur begrifflichen Festlegung der Regierung (regierungswissenschaftlicher Begriff; vgl. oben § 3 Ziff. 2 c) soll hier pragmatisch ein System der sekundären Zielsetzungen i n Form eines Grobrasters für den Regierungsbereich aufgestellt und später auf seine praktische Nützlichkeit h i n überprüft werden (vgl. unten § 20 Ziff. 3 und § 24 Ziff. 3 ff.). Es w i r d also angestrebt, eine praxisnahe, möglichst ausgewogene und i n sich gleichgewichtige „funktionale" 7 Vgl. D. Easton, The Political System, New Y o r k 1953; Ders., A Systems Analysis of Political Life, New Y o r k 1965; Ders., A Framework for Political Analysis, Englewood Cliffs 1965; W.-D. Narr, Theoriebegriffe u n d Systemtheorie, S. 128 ff.; Ders., i n : PVS 1967, S. 424ff.; G. Schmieg, Systemanalyse, Handlexikon zur Politikwissenschaft (Hrsg.: A . Görlitz), S. 444f.; G. Wittkämper, Analyse u n d Planung i n V e r w a l t u n g u n d Wissenschaft, S. 36 f. 8 Vgl. dazu Schweizer Totalrevision, Schlußbericht, S. 572 ff.; F. Naschold, i n : Systemanalyse f ü r Regierung u n d V e r w a l t u n g (Hrsg.: H. Krauch), S. 97 ff.; F. Nordsieck, i n : H W O (Hrsg.: Grochla) Sp. 602 ff. (Funktion); außerdem T. Ellwein, Einführung, S. 77 ff. u n d E. Laux, i n : SHS Bd. 52, S. 1 9 1 ; die Grenzen eines solchen „Funktionssystems" werden von W.-D. Narr, Theoriebegriff u n d Systemtheorie, S. 176 f. deutlich dargelegt.
46
Kap. I : Länderregierungen i m Staatsgefge der Bundesrepublik
Grobgliederung speziell für den Regierungsbereich, d.h. für die Leitungs- und Führungsorganisation (regierungswissenschaftlicher Begriff), zu erhalten. Für die Organisation und Struktur der „Leitung", insbesondere für die der Staatsministerien (Staatskanzleien) als die klassischen Stabs- und Hilfseinrichtungen für Kabinett und Ministerpräsidenten, soll dieses „Funktionsgrobraster" ein wesentlicher Ausgangs« und Anhaltspunkt sein und dabei gewissermaßen als „Richtschnur" und „Ordnungsprinzip" dienen 9 . Für die hier vorzunehmende regierungs- und organisationswissenschaftliche Untersuchung soll der Regierungsbereich i n folgende notwendigerweise allgemein gehaltene, aber doch einigermaßen trennscharfe sechs Tätigkeitsfelder (sekundäre Staatszielsetzungen) aufgelöst werden („Grobraster" der Regierungsfunktionen) 10 : (1) Repräsentations-
und
Gesamtintegrationsfunktionen:
Es handelt sich hierbei u m Elemente der gesamtstaatlichen Einheit, der Repräsentation dieser Einheit und der umfassenden Integration des Staates und auch der Gesellschaft, gegebenenfalls durch Schlichtung und Vermittlung („neutrale Kraft"), also u m die klassischen Funktionen des Staatsoberhaupts, die nach dem Grundgesetz teilweise auch vom Bundeskanzler und dem Kabinett und nach den Länderverfassungen neben dem Ministerpräsidenten zum Teil auch vom Ministerrat wahrgenommen werden. Diese Fallgruppe spielt i m Bereich von Kabinett und Ministerpräsident (in den Staats- und Senatskanzleien der Länder) eine wichtige, selbständige und nicht zu unterschätzende Rolle 1 1 ; sie kann allerdings bei einer Untersuchung der Organisation der Ministerien allgemein etwas vernachlässigt werden. 9 Projektgruppe „Organisation BMI", Bericht J u l i 1969, S. 24ff.; K . Stern, Anlagenband zu Projektgruppe B M I , Erster Bericht, S. 563 ff., 567, 568, 570; Projektgruppe Bay. IM, Reformbericht, S. 13; Wibera, Gutachten H H , S. 11 ff.; vgl. dazu auch N. Luhmann, Kölner Zeitschrift f ü r Soziologie, 1962, S. 617 ff.; K . W. Deutsch, Politische Kybernetik, S. 91 ff.; R. Mayntz, i n : Wörterbuch der Soziologie (Hrsg.: W. Bernsdorf), S. 836 ff. m. w . N.; R. Jochimsen, i n : Aus Parlament u n d Zeitgeschichte (Beilage zu „Das Parlament"), Nr. B 40/74, S. 3 ff. u n d 8 f. 10 Vgl. zur Gesamtproblematik: Projektgruppe „Organisation BMI", Bericht, S. 25 ff.; Wibera, Gutachten H H , S. 11 ff.; Schweizer Totalrevision, Schlußbericht, S. 512 f. u n d 572 f.; Senatsamt für den Verwaltungsdienst Hamburg, Management Systeme, S. 8 ff. (POSDCoRB); T. Ellwein, E i n f ü h r u n g i n die Regierungs- u n d Verwaltungslehre, S. 124 ff.; Ders., Das Regierungssystem der BRD, S. 82 ff. u n d 332 ff.; F. Wagener, i n : Probleme der Ministerialorganisation, SHS Bd. 48, S. 59 f.; E. Becker, i n : Demokratie u n d Verwaltung, SHS Bd. 50, S. 504 u n d 510 ff.; E. Laux, i n : Organisation der Ministerien des Bundes u n d der Länder, SHS Bd. 52, S. 20 ff. (Laux geht hier von der allg. Ministerialorganisation, aber nicht von der Regierungsorganisat i o n aus); R.-R. Grauhan, Modelle politischer Verwaltungsführung, i n : PVS 1969, S. 279 ff. 11 Vgl. dazu insbes. unten §§ 14, 22 u n d 24.
§
Die
ären Staatszielsetzungen
( „ f n t i n " ) 4 7
(2) Programmund Planungsfunktionen (einschließlich der dafür erforderlichen Informationsbeschaffung und -Verarbeitung) 12 : Darunter fallen, neben den vorbereitenden, insbesondere die gesamten Tätigkeiten der lang-, mittel- und kurzfristigen Programm- und Planungsentwicklung (z.B. grundlegende Zielfindung und Zielbestimmung, Regierungsprogramm, Finanzplanung, Aufgabenplanung, Entwicklungsprognosen, Fachprogramme und Fachplanungen). Diese sekundären Zielsetzungen sind gekennzeichnet durch eine vorausschauende, zukunftsorientierte und vorbereitende politische Beratung und Gestaltung, durch Innovation und nicht zuletzt durch Information und Prognostizierung. (3) Kommunikations-,
Koordinations-
und
Kooperationsfunktionen
13
:
Neben einer gezielten, soweit notwendig umfassenden laufenden Information aller Systemmitglieder enthalten diese Tätigkeiten Merkmale der kollektiven und partizipativen Zusammenarbeit. I m Regierungsbereich sind diese unter besonderer Berücksichtigung der Gesamtinteressen und -Verantwortung auszuüben. Es handelt sich hier also vor allem u m aktuelle Problembewältigung i m Hinblick auf ein einheitliches Ziel, u m aktives Handeln zur Verwirklichung der Gesamtinteressen (Zusammenfügen zu einer Einheit), um systematische innerstaatliche Unterrichtung und Information sowie u m eine umfassende gegenseitige Verständigung, Abstimmung, Anpassung und gegebenenfalls Konfliktsbeilegung (nicht nur passiv, sondern möglichst rechtzeitig und aktiv; „Frühkoordinationssystem"). Diese „Funktionen" stehen zwar i m unmittelbaren Vorfeld der Entscheidung, sind aber wegen ihrer besonderen Bedeutung i m Regierungsbereich als eigenständige „Fallgruppe" auszuweisen. (4)
Leitungsfunktionen:
Die Leitungsfunktionen lassen sich durch die Merkmale kennzeichnen: Schöpferische Eigeninitiativen und Anregungen geben, Entscheidungen und Anordnungen treffen, politische und fachliche Verantwor12
Planung verstanden als: Systematische Reduktion von K o m p l e x i t ä t i n rationalen u n d möglichst demokratischen Prozessen. Vgl. dazu J. H. Kaiser, Planung Bd. I, S. 7; T. Ellwein, i n : Projektgruppe B M I , Erster Bericht, A n lagenband, S. 540; Projektgruppe BMI, D r i t t e r Bericht, S. 1/8 f.; N. Luhmann, Politische Planung, i n : Jahrbuch f ü r Sozialwissenschaft 1966, S. 271 ff.; H. P. Bull, Staatsaufgaben, S. 338. Hinsichtlich den Verflechtungen der Programmu n d Planungsfunktionen m i t den anderen sekundären Zielsetzungen vgl. oben § 3 Ziff. 3 (Fußnote 15). 13 Vgl. dazu etwa N. Luhmann, K o m m u n i k a t i o n , i n : H W O (Hrsg.: Grochla), Sp. 831 ff.; H. Blohm, Kooperation, i n : ebenda, Sp. 890ff.; K . König, K o o r d i nation u n d Regierungspolitik, i n : DVB1. 1975, S. 225 ff.
48
Kap. I : Länderregierungen i m Staatsgefge der Bundesrepublik
tung tragen 1 4 . Man kann den größten Teil dieser Funktionen i n drei Untergruppen einteilen: (a) Entscheidungs-
(Willensbildungs)funktion
(einschließlich der Wahl bzw. Auswahl von Alternativen und der Prioritätensetzung). (b) Durchsetzungs-
(Willensverwirklichungs-)funktion
Es handelt sich hier u m Tätigkeiten zur Realisierung von Regierungsentscheidungen sowohl i m politischen und parlamentarischen Raum als auch i m Bereich der Verwaltung (Weisungen, Anordnungen). (c) Öffentlichkeitsarbeitsfunktion Dieses Funktionsfeld (öffentlichkeits- und Pressearbeit der Regierung) ist sinnvollerweise dieser Fallgruppe zuzurechnen, da dieser Bereich i n enger Zusammenarbeit und Abstimmung und möglichst konform m i t den Entscheidungs- und Durchsetzungsfunktionen erfolgen muß und zwar auch gegenüber der „ U m w e l t " 1 5 . (5) Durchführungs-,
Überwachungs-
und
Rückkopplungsfunktionen:
Diesem Tätigkeitsbereich ist charakteristisch, daß der Vollzug und die Verwirklichung der gesamten staatlichen Aufgaben, die insbesondere durch Normen und Maßnahmen von Parlament und Regierung angeordnet werden, gesteuert, beaufsichtigt und kontrolliert wird. Es geht hierbei besonders u m die Feststellung, ob das Ergebnis des Verwaltungshandelns sachlich und zeitlich m i t der politischen Zielsetzung und Entscheidung übereinstimmt oder nicht (Soll-Ist-Vergleich i m „feed-back"). Aus diesem Vergleich (Erfolgs- und Effektivitätskontrolle) und auch aus eventuellen Kosten-Nutzen-Analysen etc. sollen dann für die Zukunft Rückschlüsse gezogen und gegebenenfalls Änderungen und Verbesserungen vorgenommen werden („Rückkopplung"). (6)
Querschnittsfunktionen:
Bei der gegenwärtigen Rechtslage und der geübten Regierungs- und Verwaltungspraxis macht die Wahrnehmung der Querschnittsfunktionen (die „Originärressourcen": Haushalt und Finanzen, Personal, sowie Organisation) einen erstaunlich hohen A n t e i l an den gesamten A k t i v i täten aus. I m Rahmen einer Untersuchung über die Tätigkeitsfelder 14 Vgl. dazu Akademie für Organisation, H a n d l e x i k o n Organisation, S. 60 (Leitungsaufgabe); H. Lehmann, i n : H W O (Hrsg.: E. Grochla), Sp. 929 (Leitungssysteme). 15 Nicht verschwiegen werden soll allerdings, daß infolge der enorm gestiegenen Bedeutung der Presse- u n d Öffentlichkeitsarbeit i n den letzten Jahren (vgl. etwa die Personalvermehrung i n diesem Bereich) sie zum Teil schon heute durchaus als selbständige „ F u n k t i o n " dargestellt werden kann.
§
Die
ären Staatszielsetzungen
( „ f n t i n " ) 4 9
des höheren Verwaltungsdienstes i n den Jahren 1972/73 wurde empirisch festgestellt, daß diese klassischen Querschnittsfunktionen (i. e. S.) „funktionsbereidisüberschreitende" Arbeitsgebiete darstellen, die i n nennenswertem Umfange von praktisch jedem Organisationsmitglied wahrgenommen werden und deshalb von besonderer Bedeutung sind 1 6 . Dies hat seinen Grund insbesondere darin, daß eine Organisation nur dann Aktivitäten und Leistungen nach außen erbringen und abgeben kann, wenn sie sich selbst am Leben erhält, praktisch jeder also einen Teil seiner Arbeitszeit für diese „Sekundärzielsetzungen" erbringt. Vor allem ist aber zu bedenken, daß sich Haushalt, Personal und Organisation sehr stark gegenseitig beeinflussen, von ihnen überhaupt die gesamten staatlichen Zielsetzungen letztlich entscheidend m i t abhängen und deshalb die Querschnittsfunktionen durchaus m i t guten Gründen als das „Nervensystem" von Regierung und Verwaltung bezeichnet werden können 1 7 . Z u Recht w i r d beklagt, daß i n den letzten Jahren die Querschnittsfunktionen vernachlässigt, i n ihrer Bedeutung oft verkannt und praktisch als bloße Servicefunktionen angesehen wurden 1 8 . Der angedeuteten Problematik kann i n diesem Zusammenhang nicht näher nachgegangen werden. Das gesondert ausgewiesene Tätigkeitsfeld Querschnittsfunktionen w i r d i m Rahmen der Arbeit als eine besondere, noch am ehesten den „Funktionen" zuzuordnende „ F a l l gruppe" verstanden, die aber sehr stark bereichsübergreifend auf alle primären und sekundären Zielsetzungen einwirkt und gewissermaßen das „Scharnier" zwischen beiden darstellt 1 9 . Diese Ausführungen zeigen, 16 Vgl. Brinkmann / Pippke / Rippe, Tätigkeitsfelder des höheren V e r w a l tungsdienstes, S. 93 ff. Diese Untersuchung zeigt darüber hinaus deutlich, daß es gerechtfertigt u n d allein sinnvoll ist, Personal, Organisation, Haushalt u n d Finanzen als Querschnittsfunktionen zu bezeichnen. A l l e übrigen stellen entweder Fachaufgaben (primäre Zielsetzungen) dar oder können allenfalls als Querschnittsaspekte bezeichnet werden. So etwa A. Theis, Außenpolitik 1972, S. 692 f.; K. König, Koordination u n d Regierungspolitik, i n : DVB1. 1975, S. 225 ff.; vgl. auch R. Jochimsen, i n : Aus P o l i t i k u n d Zeitgeschichte, Nr. B 40/74, S. 12 f. (nur die „input-orientierten" Querschnittsaspekte sind hier angesprochen). 17 So etwa Projektgruppe Bay. IM, Reformbericht, S. 28 f.; A. Theis, i n : Außenpolitik 1972, S. 692 f. Z u den Querschnittsfunktionen allgemein vgl.: E. Pusic, i n : A k t u e l l e Probleme der Ministerialorganisation, SHS Bd. 48, S. 247 ff.; Wibera, Gutachten H H , S. 29, 75 ff.; B. Becker, i n : Organisation der Ministerien des Bundes u n d der Länder, SHS Bd. 52, S. 77 ff.; U. Becker, ebenda, S. 101 ff. 18 So etwa vor allem A. Theis, i n : Außenpolitik 1972, S. 692 f.; K . König, Koordination u n d Regierungspolitik, i n : DVB1. 1975, S. 232 ff.; E. Laux, i n : SHS Bd. 52, S. 23. 19 F ü r die hier zu untersuchenden Bedürfnisse des Regierungsbereichs d ü r f ten die Querschnittsfunktionen p r i m ä r aber nicht als „integrierende Bestandteile der Fachaufgabe" zu behandeln sein (so K . König, i n : DVB1. 1975, S. 232), sondern sollten zu „Leitungsinstrumenten ausgebaut werden" (so A. Theis, i n : Außenpolitik 1972, S. 693).
4 Katz
50
Kap. I : Länderregierungen i m Staatsgefge der Bundesrepublik
daß es notwendig und gerechtfertigt ist, diese Zielsetzungen als besondere, sechste und letzte „Fallgruppe" darzustellen. § 6 „Matrix"-Organisation Wie aus der Systematik der vorstehenden Ausführungen hervorgeht, w i r d i n dieser Arbeit zwischen primären und sekundären Staatszielsetzungen unterschieden. Ob diese Trennung für eine Analyse des Regierungssystems und besonders auch i m Rahmen einer empirischen Untersuchung immer streng durchführbar ist, ist durchaus problematisch. Die besonders i n der Praxis bei Interviews und Fragebogenaktionen auftretenden Schwierigkeiten hinsichtlich der Unterscheidung und Einklassifizierung i n primäre und sekundäre Zielsetzungen können nicht ganz außer Acht gelassen werden. Hier zeigen sich — und das soll nicht verschwiegen werden — gewisse Grenzen der hier vorgenommenen „Aufgaben- und Funktionentrennung". Gleichwohl hat aber die vorliegende Arbeit gezeigt, daß es i m großen und ganzen möglich ist, diese Grenzziehung vorzunehmen. Trotz dieser Einschränkung bedarf es zur Erarbeitung einer Ist- und Sollanalyse der Regierungsorganisation und Regierungsstruktur eben grundsätzlich einer solchen Unterscheidung. Denn erst beide Blickrichtungen und Sehweisen, einerseits hinsichtlich des „Was" (objektorientiert; Aufgabenbestand der Regierung) und andererseits des „Wie" (verrichtungsorientiert; Regierungsfunktionen), ergänzen sich dafür i n sinnvoller Weise. Die primären Zielsetzungen stellen analytisch den Ausgangspunkt dar; an ihnen sind die sekundären Zielsetzungen der Regierung (Tätigkeiten und Techniken) auf ihre Brauchbarkeit h i n zu messen. Darüber hinaus w i r d ausgehend von den primären Staatszielsetzungen, eine adäquate Grobstrukturierung der Regierungsorganisation (z. B. Ressortabgrenzung), möglichst unter Berücksichtigung der prognostizierbaren Zukunftsentwicklung, vorzunehmen sein. Ausgangsbasis muß also zunächst eine systematische Bestandsaufnahme der gegenwärtigen einzelnen primären Zielsetzungskomplexe sein 1 . Daneben muß aber aufbauend auf dem so gewonnenen Bestand der primären Staatszielsetzungen zusätzlich — für die Staatsorganisation — von einer zweiten Komponente, den „Funktionen", der A r t und Weise der Aufgabenerledigung (Realisierung, Ablaufprozeß), ausgegangen werden. Denn es ist allgemein anerkannt, daß eine effektive (Führungs-)Organisation und insbesondere konkrete Maßnahmen zu ihrer Verbesserung und Änderung auch 1 Vgl. dazu Projektgruppe beim Bay. Staatsministerium des Inneren, Reformbericht, S. 7, 14f.; T. Ellwein, Einführung, S. 31 ff., 35; J. Hirsch, Ansätze einer Regierungslehre, i n : Politikwissenschaft (Hrsg.: Kress/ Senghaas), S. 269 ff.; U. Becker, i n : Die V e r w a l t u n g 1970, S. 394ff. Vgl. oben § 4 Ziff. 2 und zur praktischen Anwendbarkeit unten § 20 Ziff. 3 u n d § 24 Ziff. 11.
§ 6 „Matrix"-Organisation
51
wesentlich von eben diesen sekundären Zielsetzungsarten abhängen, diese also darauf einen starken Einfluß ausüben 2 . Sowohl aus der Ermittlung der „Aufgaben" einerseits als auch aus der Feststellung der vielfältigen Arten ihrer Erfüllung andererseits können demnach für die Regierungslehre und besonders für die Regierungsorganisation wichtige Erkenntnisse gewonnen werden 3 . Diese Ausführungen legen die Frage nahe, ob es die i n den §§ 4 und 5 festgelegte Unterscheidung nicht rechtfertigt, die Einteilung i n primäre und sekundäre Zielsetzungen als eine „Matrix"-Organisation zu begreifen; eine „Matrix"-Organisation, für die i n den Wirtschaftsunternehmen als charakteristisch herausgestellt wird, daß bei ihr die traditionelle, nach Funktionen gegliederte Organisation (vertikal strukturiert) von einer projekt- bzw. produktorientierten Organisation (horizontal strukturiert) überlagert wird. Durch eine Kombination der Strukturierung nach dem Objekt- und Verrichtungsprinzip überschneiden sich dabei zwei Kompetenzsysteme. Die sich so ergebende Organisationsform gleicht formal einer „ M a t r i x " 4 . Die auf S. 52/53 abgebildeten Schemata 1 und 2 sollen diese Organisationsform des „ M a t r i x Management" verdeutlichen. Überträgt man die vor allem i n einigen Bereichen von Großunternehmen erprobte „Matrix"-Organisation auf den Regierungsbereich (etwa für die Organisation des Staatsministeriums), so könnte man hier zu dem „Matrix"-Schema 3 auf S. 53 kommen. Dabei müssen allerdings erhebliche Vorbehalte gemacht werden 5 . Denn zusätzlich zu den selbst i n Großunternehmen bei einer „ M a t r i x " Organisation bestehenden Probleme und Grenzen 6 sowie den oben § 5 Ziff. 2 beschriebenen grundsätzlichen Schwierigkeiten einer generellen Übertragbarkeit von betriebswirtschaftlichen Lösungen i n den staatlichen Bereich sind hier die speziellen Bedürfnisse der Länder und nicht zuletzt die Besonderheiten der Landesregierungen zu berück2 Projektgruppe „Organisation BMI", Bericht, S. 24f.; Wibera, Gutachten H H , S. 11 ff.; T. Ellwein, Einführung, S. 59 ff.; N. Luhmann, F u n k t i o n u n d Kausalität, Kölner Zeitschrift f ü r Soziologie, 1962, S. 617 ff.; H. Mey, i n : Systemanalyse i n Regierung u n d V e r w a l t u n g (Hrsg.: Krauch), S. 119 ff. 8 E. Becker, Die vollziehende Gewalt, i n : SHS Bd. 50, S. 498; so auch R. Herzog, 48. DJT, Sitzungsbericht Bd. I I , L 8; K . Stern, i n : Projektgruppe B M I , Erster Bericht, Anlagenband, S. 570 ff.; Projektgruppe „Organisation BMI", Bericht, S. 18 ff. 4 E. Grochla, Unternehmensorganisation, S. 205; Akademie für Organisation, Handlexikon Organisation, S. 63 (Matrix-Organisation); F. Nordsieck, i n : H W O (Hrsg.: Grochla), Sp. 602ff. (Funktion); M. Dullien, Flexible Organisation, S. 17 ff. 5 Vgl. dazu bereits oben § 5 Ziff. 2 (Nachweise besonders i n Fußnote 6). Vgl. zur Gesamtproblematik auch R. Wahl, i n : Der Staat 1974, S. 390 ff. 6 Vgl. insbesondere etwa E. Grochla, Unternehmensorganisation, S. 207 ff. m. w. N.; M. Dullien, Flexible Organisation, S. 19 ff.
4*
52
s
Kap. I : Länderregierungen i m Staatsgefge der Bundesrepublik
§ 6 „Matrix"-Organisation
53
Schema 2a) ^\Funktionen Beschaffung Finanzen Forschung und Entw.
Produktion
Absatz
Chemikalien
1
X
1
i
Farben
1
1
i
i
i
1
1
I
i
1
i
i
Sparten
^ ^
Fasern
Pharma
1
1
Pflanzenschutz
1
1
i
1 —
•
—
>
i —
•
a) Quelle: K. Seemann, Managementprobleme für die politische Führung in der industriellen Gesellschaft, S. 63.
Schema 3 _ N.
sekundäre Zielsetzungen (Funktionsstruktur, verrichtungsbezogen)
primäre Zielsetzungen (Aufgabengrundstruktur, objektbezogen)
(l)"
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
N.
(1)') (2) (3) (4) (5) a) Vgl. dazu oben § 4 Ziff. 2 bzw. § 5 Ziff. 3 (Grobsystematik der primären und sekundären Zielsetzungen).
54
Kap. I : Länderregierungen i m Staatsgefiige der Bundesrepublik
sichtigen 7 . Gleichwohl werden, abgesehen von dem Programm-, Planungs- und Budgetierungssystem (PPBS) 8 , für den staatlichen Bereich i m wesentlichen zwei Varianten der „Matrix"-Organisation vorgeschlagen. Zum einen w i r d ein A r t Ressort-/Programmsystem als geeignete Organisationsform empfohlen 9 und zum anderen w i r d eine „Fachund Querschnittsfunktionenmatrix" als die richtige Lösung für die bestehenden Organisationsprobleme angesehen 10 . Weitgehend anerkannt dürfte sein, daß allein eine exakte Analyse der konkreten internen Organisationsbedingungen usw. über eine erfolgversprechende Anwendung der „Matrix"-Organisation überhaupt sowie ihre spezielle Ausgestaltung entscheiden kann. Stets sind also zuerst alle Voraussetzungen sorgfältig zu prüfen, bevor entsprechende organisatorische Entscheidungen getroffen werden. Grundsätzlich kann keine Organisationsform a priori allgemein als die beste herausgestellt werden; vielmehr sind ganz wesentlich die bestehenden Voraussetzungen und individuellen Bedingungen dafür maßgeblich 11 . Da aber mindestens i m Bereich der Landesregierungen bis heute keine wirklichen Erfahrungen und keine empirisch gesicherten Erkenntnisse für die Anwendbarkeit der „Matrix"-Organisation vorliegen, konnte grundsätzlich keiner der oben genannten Varianten gefolgt werden. Gleichwohl soll i m Rahmen dieser Arbeit versucht werden, allerdings losgelöst von schematischen „Matrix-"Modellen, Kriterien für 7 Vgl. unten § 8; i n den Ländern, w o die „Vollzugstätigkeiten" überwiegen, dürfte es etwa n u r i n den seltensten Fällen möglich sein, daß neben die bestehende aufgabenbezogene (ressortorientierte) Hierarchie eine echte zweite hierarchische Projekt-Organisation t r i t t . Der A u f b a u einer solchen p r o j e k t orientierten Hierarchie ist hier nicht vertretbar (einige wenige Ausnahmefälle vielleicht sinnvoll) u n d auch finanziell nicht zu verwirklichen. Außerdem fehlt es i n den Ländern noch mehr als beim B u n d an einigermaßen zuverlässig festgelegten operationalen Zielen u n d Programmen f ü r praktisch alle komplexeren A k t i o n e n u n d Projekte, was f ü r eine „ M a t r i x " - O r g a n i s a t i o n Voraussetzung ist (unzureichende „Programmstruktur", die i n absehbarer Zeit k a u m zu bewältigen sein wird). 8 Z u m PPBS vgl. etwa J. Wild/P. Schmid, i n : Die V e r w a l t u n g 1973, S. 145 ff.; H. Reinermann, i n : Die V e r w a l t u n g 1969, S. 192 ff.; E. Laux, i n : Regierungsprogramme u n d Regierungspläne, SHS Bd. 51, S. 123 ff. j e m. w . N.; vgl. auch Projektgruppe BMI, Erster Bericht, S. 244; ebenda, Anlagenband, S. 192, 228 ff., 412 ff.; H. Reinermann, i n : Unternehmensplanung (Hrsg.: U l rich), S. 137, 150 ff. m. w. N. 9 So etwa K . Seemann, Managementprobleme für die politische F ü h r u n g i n der industriellen Gesellschaft, S. 61 ff. ; vgl. auch M. Dullien, Flexible O r ganisation, S. 19 ff.; R. Jochimsen, i n : B u l l e t i n der Bundesregierung 1970, S. 956 f.; R. Wahl, i n : Der Staat 1974, S. 390 ff.; Projektgruppe BMI, D r i t t e r Bericht, 1/14 ff. u n d I I / 59 f. 10 So etwa A. Theis, i n : Planungsorganisation (Hrsg.: Mayntz/Scharpf), S. 179; vgl. auch E. Laux, i n : Regierungsprogramme u n d Regierungspläne, SHS Bd. 51, S. 115 f. m . w . N . ; Projektgruppe BMI, D r i t t e r Bericht, 11/55 ff. u n d IV/2 ff. 11 Vgl. E. Grochla, Unternehmensorganisation, S. 213.
§ 7 Primäre u n d sekundäre Staatszielsetzungen der Länder
55
eine möglichst optimale Organisationsform i m Regierungsbereich festzulegen. Dafür scheinen, ausgehend von der bestehenden Ministerialorganisation, die primären und sekundären Zielsetzungen geeignete Anhaltspunkte zu sein. I m Rahmen der sekundären Staatszielsetzungen dürfte dabei den „Querschnittsfunktionen" (insbesondere den Ressourcen) eine besondere Bedeutung zukommen, die es eventuell sogar als geboten erscheinen lassen könnten, sie als eigenständiges, drittes K r i t e r i u m anzusehen. Aufgabe vorliegender Untersuchung soll es darüber hinaus sein, diese Elemente auf ihre Nützlichkeit h i n zu überprüfen und gegebenenfalls weitere Bausteine und Gesichtspunkte für eine bessere Organisation des Regierungsbereichs zu gewinnen. § 7 Primäre und sekundäre Staatszielsetzungen der Länder I n den vorstehenden Ausführungen ist es wiederholt für notwendig erachtet worden, die primären und sekundären Staatszielsetzungen i m Hinblick auf die Organisation und Struktur des Regierungsbereichs unter den besonderen, einengenden Aspekten und Erfordernissen der Länder zu sehen. Die insoweit i m Vergleich zum Bund bestehenden Unterschiede sind deshalb noch zu verdeutlichen und näher darzustellen. 1. Staatszielsetzungen der Länder im Vergleich zum Bund Die Länderebene stellt die breite Mittelstufe i n dem dreistufigen Staatsaufbau der Bundesrepublik dar (Bund — Länder — Gemeinden) und ist an den bereinigten Ausgaben der gesamten öffentlichen Hand mit ca. einem D r i t t e l beteiligt 1 . Ein Vergleich zwischen Bund und Ländern anhand des dafür wesentlichsten Kriteriums, der Staatsaufgaben, zeigt dabei, daß auf Bundesebene die finanzintensiven Aufgaben auffallend ungleichgewichtig verteilt sind, während die Aufgaben der Länder etwas breiter und gleichmäßiger gestreut sind 2 . Von den Bundesausgaben beanspruchen etwa der Sozial- und Verteidigungshaushalt i m Haushaltsjahr 1972 zusammen allein 52 f l /o (28,4 und 23,6 °/o); demgegenüber bleiben alle anderen Aufgabenbereiche des Funktionenplans, der dem Bundeshaushalt beigefügt ist, i m Haushaltsjahr 1972 unter 10 °/o3. I m Gegensatz dazu bewegen sich, wenn man die oben aufgestellte „Aufgabensystematik" für Bad.-Württ. als Länderbeispiel zugrunde legt, die Ausgaben der Länder für die einzelnen Aufgabengruppen (primäre Zielsetzungen) i m Jahr 1973 zwischen 12,5 und 31,5 °/o. 1 Vgl. dazu O. Barbarino, i n : Entwicklung der Aufgaben von Bund, L ä n dern u n d Gemeinden, SHS Bd. 47, S. 81 ff. (Tabellen S. 97 ff.). 2 So O. Barbarino, ebd., S. 83 f. 3 Vgl. Institut Finanzen und Steuern, Der Bundeshaushalt, Heft 15, Bd. 22, S. 31 f.
56
Kap. I : Länderregierungen i m Staatsgefge der Bundesrepublik
Die wesentlichen Schwerpunkte der Länderhaushalte liegen dabei vor allem auf den Gebieten Schule und Unterricht (15,8 °/o), Hochschulen, Bildung und K u l t u r (15,7%) und Finanzausgleich (16,6 °/o)4. Daneben sind auf der Länderebene noch als weitere wichtige Bereiche an primären und sekundären Zielsetzungen die Raumordnung und Landesentwicklungsplanung, Verkehrswesen, Wirtschafts- und Landwirtschaftspolitik, Wohnungs- und Städtebauförderung, Sozialhilfe und Wiedergutmachung, Gesundheitswesen, Umweltschutz, Rechtsschutz und innere Verwaltung (einschließlich Polizei) und auch die mittel- und langfristige Aufgaben- und Finanzplanung zu nennen, ohne dabei einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Abgesehen von diesem mehr statistischen Vergleich lassen sich allgemein folgende Unterschiede zwischen den Bundes- und Länderzielsetzungen aufzeigen 5 : — Für die meisten Staatsaufgaben liegt die Gesetzgebungskompetenz (Art. 70 ff. GG) beim Bund (Ausnahmen: i m großen und ganzen nur Kultur-, Polizei- und Kommunalbereich), während das Hauptgewicht der Verwaltungskompetenz (Art. 83 ff. GG) die Länder zu tragen haben. Die Länder werden deshalb intensiv i n ihrer Tätigkeit durch Bundesrecht „programmiert". — Darüber hinaus w i r d der Entscheidungsspielraum der Länder durch Bundesprogramme und -planungen aber auch durch Maßnahmen anderer Länder zusätzlich eingeschränkt (Art „integrierende Sachzwänge"). Trotz der Aufnahme etwa der A r t . 91 a, 91 b i n das GG (Gemeinschaftsaufgaben) oder der Institutionalisierung von Bund/ Länder-Kommissionen, Bund/Länder- oder Länderministerkonferenzen usw. wirken diese Kompetenzverteilung, die bestehenden Sachzwänge und Verflechtungen sowohl auf den Inhalt als auch besonders auf die A r t und Weise der Wahrnehmung und Erfüllung der Aufgaben der Bundesländer stark ein 6 . 4 Vgl. oben § 4 Fußnote 24; Staatshaushaltsplan für 1973 von Bad.-Württ.; Stat. Taschenbuch Bad.-Württ. 1973, S. 184 f. 5 Vgl. O. Barbarino, i n : SHS Bd. 47, S. 83 f.; F. Wagener, Einwohnerzahl u n d Aufgabenerfüllung der Länder, Speyer, 1972 (unveröffentlichtes G u t achten), S. 9 - 1 6 ; Ders., i n : Mensch u n d Staat i n N R W (Hrsg.: W. Lenz), S. 167 ff.; E.-W. Böckenförde, Organisationsgewalt, S. 292 (Fußnote 21); Ders., i n : Die Staatskanzlei, SHS Bd. 34, S. 224; A. Hüttl, ebenda, S. 226 f.; T. Ellwein, Regierungssystem, S. 320. 6 Z u r Problematik der „Unitarisierung" (insbes. der Gesetzgebung) und zum „kooperativen Föderalismus" (vgl. etwa Bedeutungswandel des A r t . 84 I GG; A r t . 91a, 91b GG) siehe besonders: K . Hesse, Der unitarische Bundesstaat, 1962; R. Kunze, Kooperativer Föderalismus i n der Bundesrepublik, 1968; G. Kisker, Kooperation i m Bundesstaat, 1971; H. Lauf er, Das föderative System der BRD, 1973, S. 105 ff.; T. Maunz, i n : 25 Jahre G G (Hrsg.: K . Low), S. 123 ff.; F. Wagener, i n : Mensch u n d Staat i n NRW, S. 188 f.; neuestens G. Kisker, Neuordnung des bundesstaatlichen Kompetenzgefüges u n d B u n d Länder-Planung, i n : Der Staat 1975, S. 169 ff. m. w. N.
§ 7 Primäre u n d sekundäre Staatszielsetzungen der Länder
57
— Die Führungsaufgaben der Ministerpräsidenten und der Landesregierungen insgesamt können aus den vorgenannten Gründen mit denen der Zentralregierung (Bund) teilweise nicht verglichen werden. Zudem sind die Spielräume und Möglichkeiten bei der A u f stellung von Plänen und Programmen auf Bundesebene sicher größer als i n den Ländern. Deshalb w i r d auch vor allem etwa mittelund langfristige Planung i n der Bundesregierung sicher zum Teil andere Instrumentarien erfordern als i n den Ländern. — Infolge der ganz überwiegenden „Verwaltungskompetenz" und der Personalintensität des Kultus-, Justiz- und Polizeibereichs ist i n den Haushalten der Länder der Personalausgabenanteil m i t mehr als 4 0 % ungleich höher als beim Bund (für 1972: 17,9 °/o)7. Jede Erhöhung der Personalausgaben t r i f f t daher die Länder besonders schwer und beengt sie i n der Erfüllung ihrer sonstigen Staatsaufgaben (insbes. Investitions- und Förderungspolitik). — Die- durch das GG festgelegte finanzielle Ausstattung der Länder ist deren gestellten und wahrzunehmenden Aufgaben i m Rahmen des Gesamtstaats nie v o l l gerecht geworden. Als Mängel sind hier besonders der unzureichende horizontale und vertikale Finanzausgleich, das weitgehende Fehlen eines eigenen Steuerbewilligungsrechts der Länder, die unterschiedliche Entwicklung der Bundesund Landessteuern (Art. 106 GG) und auch i n einem gewissen Sinne die Stabilitätsmaßnahmen (StabilG, A r t . 104 a GG) zu nennen. Die Finanzhoheit der Länder ist dadurch stark beschränkt. Durch die Einführung und Ausweitung der „Mischfinanzierung" (vgl. A r t . 91 a, 91 b, 104 a GG) wurde dieser Zustand alles andere als verbessert oder gar beseitigt (vgl. etwa die damit verbundenen „Dotationsauflagen") 8 . — Abgesehen von den hier angeführten Punkten ist ganz allgemein die Übertragbarkeit von Aussagen und Inhalten von der Bundesauf die Landesebene nicht immer ohne weiteres möglich und i m speziellen Fall besonders zu prüfen. Dies gilt selbstverständlich auch für den Bereich der primären und sekundären Staatszielsetzungen. Die Übertragbarkeit kann etwa, ganz abgesehen von politischen und personellen Gründen, durch die Faktoren territoriale 7 Vgl. O. Barbarino, i n : SHS Bd. 47, S. 84f.; Stat. Taschenbuch Bad.-Württ. 1973, S. 186; Institut Finanzen und Steuern, Der Bundeshaushalt Heft 15, Bd. 22, S. 33; W. Thieme, Gutachten D zum 48. DJT, S. 18 f.; T. Ellwein, DÖV, 1972, S. 15 f.; F. Wagener, i n : Mensch u n d Staat i n NRW, S. 181 ff. 8 Vgl. dazu O. Barbarino, i n : SHS Bd. 47, S. 85 ff.; F. Wagener, i n : Mensch u n d Staat i n NRW, S. 177 ff.; P. Feuchte, i n : Die V e r w a l t u n g 1972, S. 199 ff.; O. Barbarino, Z u r Reformbedürftigkeit der gegenwärtigen Finanzverfassung, i n : SHS Bd. 55, S. 103 ff.
58
Kap. I : Länderregierungen i m Staatsgefge der Bundesrepublik
Ausdehnung, Bevölkerungszahl, Bevölkerungsdichte, Zahl der Ressorts und Dienststellen, internationale Verankerung der Politik usw. stark eingeengt oder sehr unterschiedlich sein. 2. Entwicklung der Staatszielsetzungen der Länder Die vor allem unter der Geltung des Grundgesetzes eingetretene expansive Tendenz der Staatsaufgaben ist unübersehbar und grundsätzlich verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Die Umorientierung des Staates zum modernen „Leistungs- und Sozialstaat", aber auch zum „Grundrechtsstaat" (weitgehende Aktualisierung der Grundrechte — z.B. Gleichheitspostulat) verlagert das Schwergewicht von der Sicherung und Ordnung des Gemeinschaftslebens auf dessen Förderung und aktive Gestaltung. Dieser Wandel wurde und w i r d noch außerordentlich durch die Dynamik der enormen gesellschaftlichen und technischen Entwicklung und der i n diesem Prozeß auftretenden sozialen und ökonomischen Probleme moderner Industriegesellschaften und dem damit eng verbundenen erheblich gestiegenen Erwartungshorizont des Bürgers an den Staat verstärkt. Dabei muß gesehen werden, daß die Gesellschaft immer mehr außerstande gesetzt wird, diesen dynamischen Entwicklungsprozeß allein zu tragen. Die Anforderungen der Gesellschaft an den Staat (einschließlich aktiver Mitgestaltung) nehmen so i n allen Bereichen stark zu (z. B. Wirtschaftsförderung, Konjunkturlenkung, Wirtschafts- und Energiekrisen — Stabilitätsgesetz —; Infrastruktur, einschließlich Verkehrsprobleme; Umweltschutz usw.). U m dieser veränderten und sich laufend ändernden Situation gerecht zu werden und sie erfolgreich bewältigen zu können, bedarf es aber nicht nur des Erkennens dieser neuen Staatsaufgaben, sondern auch neuer, den gewandelten Aufgaben angepaßten Verfahrensregelungen und Methoden der Aufgabenbewältigung („Funktionen"). Dabei ist es etwa notwendig, daß „Planung" i n einem umfassenderen Sinne, also nicht nur zur Erreichung vorgegebener Ziele, sondern auch als Mittel, die immer größer und komplexer werdenden Probleme und Risiken der Entwicklung frühzeitig zu erkennen und unter Kontrolle zu halten, gesehen und verstanden w i r d 9 . Faßt man die großen Trends und Notwendigkeiten der Entwicklung der öffentlichen primären und sekundären Zielsetzungen und der 9 Vgl. zu dieser Gesamtproblematik: Projektgruppe „Organisation BMI Bericht, J u l i 1969, S. 1 7 1 ; Projektgruppe Bay. IM, Reformbericht, S. 14, 22; Projektgruppe BMI, D r i t t e r Reformbericht, S. 1/5; U. Becker, i n : Die V e r w a l t u n g 1970, S. 394 ff.; ff. P. Bull, Staatsaufgaben, S. 369 ff.; W. Hennis, i n : PVS 1965, S. 430 f.; W. Thieme, Gutachten D zum 48. DJT, S. 16ff.; ff. Weichmann, Wandel der Staatsauf gaben i m modernen Staat, i n : Planung I I I (Hrsg.: Kaiser), S. 39 ff.; ff. Schatz, i n : Planungsorganisation (Hrsg.: M a y n t z / Scharpf), S. 9 ff.; Mayntz / Scharpf, ebenda, S. 115.
§ 7 Primäre und sekundäre Staatszielsetzungen der Länder
59
damit eng verbundenen Finanzen der letzten Jahrzehnte zusammen und berücksichtigt dabei die Ergebnisse durchgeführter Untersuchungen, so kann man m i t aller Vorsicht für die Regierungen der Länder folgende Zukunftstendenzen und -prognosen aufstellen 10 : — Ganz erhebliche Ausweitung der Sozialausgaben, aber auch der -aufgaben (z.B. Sozialleistungen, Gesundheitswesen, Jugend- und Altenhilfe, Freizeitgestaltung usw.); — Überproportional wachsender Anteil der Ausgaben für die Bereiche der Infrastrukturpolitik: Bildung und Forschung, Informationswesen, öffentlicher Nahverkehr (also insbes. personalintensive Bereiche) und dergleichen; — Ein relativ stark steigender Anteil der Ausgaben für den „Engpaßkomplex" Strukturpolitik: allgemeine Wirtschaftsförderung, Industrie«, Energie- und Agrarpoltik, Stadtsanierung, Umweltschutz und dergleichen; — A u f - bzw. Ausbau einer auf realistischen Vorstellungen beruhenden, möglichst umfassenden Informations- und Prognosebasis (soweit sinnvoll auch für den gesellschaftlichen Bereich); — Verstärkte Anstrengungen für eine effektive, praxisnahe staatliche Planung, insbesondere auch eine (integrierte) Aufgaben- und Finanzplanung (einschließlich einer Ziel-, Zeit- und Prioritätensetzung); — Erhebliche Intensivierung und Verbesserung der bestehenden Kooperations-, Koordinations- und Kommunikationsmuster und -instrumente, um die immer komplexer werdenden Probleme trotz der zunehmenden Spezialisierung umfassend und einheitlich bewältigen zu können (insbes. auch Prognostik); — Sinnvolle und realistische Einführung bzw. Ausweitung einer Erfolgs- und Effektivitätskontrolle (Soll-Ist-Vergleich i m „feedback", Rückkoppelung, Kosten-Nutzen-Analysen). Diese erkennbaren Entwicklungstrends und -notwendigkeiten bedürfen noch einiger kritischer und erläuternden Anmerkungen: Eine einigermaßen zuverlässige Prognose über die mittel- oder gar langfristige Aufgabenentwicklung ist äußerst schwierig. Die Ursache dafür liegt vor allem i n deren starker Abhängigkeit von politischen, gesellschaftlichen, technischen und finanziellen Faktoren, die mindestens längerund zum Teil auch mittelfristig kaum präzisiert werden können, 10 Vgl. J. Kölble , Entwicklung der Bundesaufgaben, i n : SHS Bd. 47, S. 43; T. Ellwein , i n : D Ö V 1972, S. 13ff.; Projektgruppe Bay. I M , Reformbericht, S. 7 ff.; W. Thieme, Gutachten D zum 48. DJT, S. 16 ff.; F. Wagener, i n : Mensch und Staat i n NRW, S. 169 ff.
60
Kap. I : Länderregierungen i m Staatsgefge der Bundesrepublik
wenn man von den klassischen Aufgaben und Verpflichtungen einmal absieht (vgl. etwa Energiekrise vom Okt. 1973). Selbst die politische Komponente kann über eine Legislaturperiode hinaus (Zeitraum von höchstens 4 Jahren) nur unzureichend bestimmt werden. Außerdem ist zu berücksichtigen, daß die Entwicklung der Länderaufgaben nicht unwesentliche von der jeweiligen Regierungsauffassung, ob und wie das „Subsidiaritätsprinzip" als generelle Aufgaben-Begrenzung anzusehen ist, geprägt wird. Dabei sollte beachtet werden, daß sich die Schere zwischen den Forderungen an den Staat und seinen Möglichkeiten (insbesondere i m Hinblick auf die verfügbaren finanziellen, personellen usw. Ressourcen) nicht ohne wichtigen Grund weiter öffnen kann. Vielmehr müssen die Grenzen zwischen den Aufgaben des Staates und der Gesellschaft (Verbände, Bürger selbst) immer wieder überdacht und gegebenenfalls neu gezogen werden 1 1 . Parallel dazu sollte laufend geprüft werden, auf welcher Ebene des Gesamtstaates (Bund, Land, Gemeinde) und von welcher Behörde oder A m t innerhalb einer Ebene die einzelnen Aufgaben am zweckmäßigsten und sinnvollsten wahrgenommen und erfüllt werden können (etwa Dekonzentration, Dezentralisation) 12 . § 8 Allgemeine Anforderungen an die Regierungsorganisation der Länder Dieser Abschnitt soll keine Darstellung der Gestaltungsziele und Fundamentalprinzipien der Organisation allgemein bringen 1 . Vielmehr werden hier i m wesentlichen nur die regierungsspezifischen Organisationsanforderungen und -ziele beschrieben. Dabei scheint es notwendig zu sein, vorweg einige einschränkende Bemerkungen zu machen: Trotz einiger Bemühungen u m die Einführung und Durchsetzung einer konzeptionellen Politik und umfassenden Planungen herrscht weithin die Einsicht vor, daß die Aufgabenerledigung vom Staat i n vielen Bereichen unzulänglich und von eher reaktiven und kompensatorischen Zügen geprägt ist (Vorrang des Kurzfristigen) 2 . U m die dem 11
Vgl. dazu W. Hennis, i n : PVS 1965, S. 430f.; H. Weichmann, Wandel der Staatsauf gaben i m modernen Staat, i n : Planung I I I (Hrsg.: J. H. Kaiser), S. 3 9 - 4 6 ; H. P. Bull, Staatsauf gaben, S. 190 ff.; E. Mäding, i n : Die V e r w a l t u n g 1973, S. 266 ff. (Mäding spricht v o n einem „Einschränkungsinteresse"). Diese Notwendigkeit w i r d durch die gegenwärtige Wirtschaftslage noch besonders verdeutlicht. 12 W. Hennis, i n : PVS 1965, S. 433; vgl. etwa auch Projektgruppe BMI, Erster Bericht, S. 184 ff. 1 Vgl. dazu etwa: R. Mayntz, Soziologie der Organisation, S. 36ff.; E. K o siol, i n : H W O (Hrsg.: Grochla), Sp. 172 ff.; E. Grochla, Unternehmungsorganisation, S. 38 ff. 2 F. Wagener, i n : SHS Bd. 48, S. 57 f.; R. Mayntz / F. Scharpf, Kriterien, Voraussetzungen und Einschränkungen aktiver Politik, i n : Planungsorgani-
§ 8 Anforderungen an die Regierungsorganisation der Länder
61
Staat gestellten Aufgaben aber rationell und effektiv steuern und bewältigen zu können, bedarf es, was oben bereits näher dargelegt wurde, geänderter und teilweise auch neuer Methoden und Instrumentarien. Neben einem Wandel i n den Handlungsformen des Staates gegenüber dem Bürger ist es unter anderem schon aus Gründen der „Systemerhaltung" dringend geboten, vor allem i m Regierungs- und Ministerialbereich, eine Gewichtungsverlagerung von der überwiegend reaktiven zu einer aktiven, d.h. vorsorgenden und vorausschauenden, also konzeptionellen, planenden und strategischen Staatstätigkeit vorzunehmen 3 . Diese notwendige Entwicklung stellt allerdings allein kein Allheilmittel dar. Neben der möglichen und gegebenenfalls zu begegnenden Gefahr einer extrem weitgehenden staatlichen Vorsorge und Verplanung der Bürger muß gesehen werden, daß auch eine solche aktive Politik zahlreichen Restriktionen unterliegt und unterliegen wird4. Außer den oben i n § 7 Ziff. 2 genannten Ursachen und Unsicherheitsfaktoren ist zudem noch besonders anzuführen, daß durch die vierjährige Legislaturperiode und die Tatsache, daß kein Jahr vergeht, i n dem nicht mindestens zwei wichtige Landtags- oder Bürgerschaftswahlen usw. stattfinden, ein enormer Zugzwang zum bloßen Reagieren und kurzfristigen Erfolg besteht. Dies scheint für die Regierung unumgänglich zu sein, u m ihr politisches Mandat, das sie von der Parlamentsmehrheit (Regierungskoalition) ableitet, dauernd i n allen Ebenen und Bereichen zu gewährleisten, zu sichern und keinesfalls zu gefährden. Mindestens i n dem i n der Bundesrepublik derzeit praktizierten parlamentarischen System (auf Bund-, Länder- und auch Kommunalebene) ist ein solcher „Zwang" institutionalisiert, d . h . i n i h m ist ein struktureller Widerstand gegen eine längerfristigere Politikorientierung (insbes. Aufgaben- und Finanzplanung) angelegt 5 . Diese strukturelle Entwicklung, die sich durch die zunehmende personelle und sachliche Verflechtung von Regierung und Parlament 6 noch wesentlich sation (Hrsg.: Mayntz / Scharpf), S. 115ff.; N. Luhmann, i n : Die V e r w a l t u n g 1968, S. 3 ff.; T. Ellwein, i n : Projektgruppe B M I , Erster Bericht, Anlagenband, S. 538 ff. Diese w e i t h i n bestehende Tatsache ist durch die i m Rahmen der „Planungseuphorie" ganz überwiegend enttäuschten Erwartungen eher noch verstärkt worden. 3 Projektgruppe „Organisation BMI", Bericht, S. 26; H. P. Bull, Staatsaufgaben, S. 370 ff.; T. Ellwein, Regierungssystem, S. 337; R. Mayntz / F. Scharpf, i n : Planungsorganisation, S. 115 ff. u n d S. 122 ff. 4 Vgl. dazu ausführlich R. Mayntz ¡F. Scharpf, i n : Planungsorganisation, S. 117 ff. (dort werden als externe Beschränkungen solche formell-politischer, formell-ökonomischer, materiell-ökonomischer u n d materiell-politischer A r t genannt; diese beruhen vor allem darauf, daß das politische System u n d besonders dessen Subsystem Regierung ein sehr „offenes System" darstellt). 5 Vgl. etwa R. Mayntz / F. Scharpf, i n : Planungsorganisation, S. 121 f. 6 Vgl. oben § 3 Ziff. 4 Fußn. 19; Zwischenbericht der Enquête-Kommission,
62
Kap. I : Länderregierungen i m Staatsgefge der Bundesrepublik
verstärkt hat, kann zwar nicht beseitigt, sollte aber wenigstens auf ein sinnvolles Ausmaß reduziert bzw. beschränkt und i n geordnete, festgelegte Bahnen gelenkt werden 7 . Die wissenschaftliche Diskussion und auch die gegenwärtige Entwicklung (insbesondere die „Energiekrise" und die Weltwirtschaftslage) zeigen, daß die dringenste, zugleich aber auch problematischste Anforderung an das Regierungssystem die „Fähigkeit zur vorausschauenden, aktiven Regelung und Steuerung jener gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Prozesse darstellt, deren ungesteuerte Dynamik die für das Gesamtsystem relevanten Probleme und Krisen hervorbringt" 8 . Die vorstehenden Ausführungen stellen aber gleichzeitig vor allem und gerade wegen den insoweit bestehenden Unsicherheitsfaktoren 9 und politischen Zugzwängen (gewissermaßen als Konsequenz) auch die Forderung auf, daß die Organisation des Regierungsbereichs keinesfalls allein an den Erfordernissen einer effektiven, zukunftsorientierten Planung ausgerichtet sein darf, sondern noch weiteren Kriterien gerecht werden muß. So ist besonders das Regierungssystem als verfassungsrechtlich festgelegte, relativ beständige, integrative Organisation mit der sich dauernd wandelnden Gesellschaft und deren Ansprüche an den Staat zur Systemerhaltung i n ständigem „Gleichgewicht" zu halten 1 0 . Dies bedeutet sowohl Stabilität der bestehenden Struktur gegenüber Umwelteinflüssen als auch Wandlungs-, Anpassungs- und Reaktionsfähigkeit gegenüber Umweltveränderungen. Dieses „Gleichgewichtsprinzip" beinhaltet daher als Bestandteile das Prinzip der Stabilität (Konstanz, Integration) und das Prinzip der Elastizität (Dynamik, Flexibilität) 1 1 . Solche Anforderungen sind dabei aber nicht nur an die Organisationsstruktur des Regierungssystems (als besonders „offenem, lebendem System"), sondern auch an dessen Personal und den Personaleinsatz allgemein zu richten 1 2 . Darüber hinaus ist neben den grundin: Zur Sache 1/73, S. 77 (etwa Forderung nach einer Planung „Zur gesamten Hand" von Parlament und Regierung). 7
Z . B . : Festlegung der Legislaturperiode etwa auf 5 bis 6 Jahre; Durchführung aller Landtags- u n d K o m m u n a l w a h l e n möglichst bundeseinheitlich an einem T e r m i n u n d dergleichen. 8 R. Mayntz/ F. Scharpf, i n : Planungsorganisation, S. 116. 9 Vgl. dazu eingehend auch unten § 24 Ziff. 5 u n d 6 (bis heute gibt es kein einigermaßen zuverlässiges prognostisches Instrumentarium). 10 Vgl. hierzu auch oben § 2. 11 Vgl. etwa E. Kosiol, i n : H W O (Hrsg.: Grochla), Sp. 178 ff.; R. Mayntz, Soziologie der Organisation, S. 40ff.; W.-D. Narr, Theoriebegriffe u n d Systemtheorie, S. 96ff.; F. Naschold, i n : Systemanalyse i n Regierung und V e r w a l t u n g (Hrsg.: Krauch), S. 101; R. Wahl, i n : Der Staat 1974, S. 395 ff. m. w . N. 12 Vgl. dazu E. Laux, i n : A k t u e l l e Probleme der Ministerial Verwaltung, SHS Bd. 48, S. 317 ff.; R. Schnur, i n : Demokratie u n d Verwaltung, SHS Bd. 50, S. 557 ff.; M. Lepper, i n : Die V e r w a l t u n g 1972, S. 141 ff.; J. Wild, i n : ZfOrgani-
§ 8 Anforderungen an die Regierungsorganisation der Länder
63
sätzlich für alle Organisationen geltenden Organisationszielen, wie etwa Zweckmäßigkeit, technische Wirtschaftlichkeit und Effektivität, noch besonders auf eine möglichst große Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Regierungsorganen und Ressorts (innerhalb der Ministerien zwischen allen Ebenen) 13 sowie auf die Notwendigkeit einer hohen Lernfähigkeit und Lernkapazität des Regierungssystems hinzuweisen 14 . Inwieweit diese Anforderungen i m Bereich der Landesregierung Bad.Württ. i n organisatorischer Hinsicht verwirklicht sind, soll u. a. i m Rahmen vorliegender Arbeit beschrieben werden (unten Kapitel III).
sation 1973, S. 45 ff.; H. Karehnke , i n : DVB1. 1973, S. 833 ff.; R. Wahl , i n : Der Staat 1974, S. 395 ff.; Senatsamt HH, Managementsysteme, S. 7 ff.; R. Mayntz / F. Scharpf , Planungsorganisation, S. 208 ff. 13 Vgl. R. Wahl , i n : Der Staat 1974, S. 397 f. 14 Vgl. W.-D. Narr, Theoriebegriffe u n d Systemtheorie, S. 100ff.; E. Groch la, Unternehmungsorganisation, S. 164 ff.
KAPITEL
II
Verfassungsrechtliche Ausgestaltung des Regierungsbereiches nach der Verfassung des Landes Baden-Württemberg § 9 Allgemeine Ausgangspunkte 1. Gegenstand und Aufgabe von Kapitel I I Mehr als alle anderen „Systeme" ist der Staat an die geltenden Rechtsnormen i m umfassendsten Sinne gebunden und i n ihnen verankert. Das i m Grundgesetz und i n den Landesverfassungen als „elementare Grundentscheidung" festgelegte Rechtsstaatsprinzip verpflichtet den Staat, einmal das Recht als Ordnungsprinzip zu gewährleisten und zum anderen den Grundsatz des Primats des Rechts (Art. 20 I I I , 1 I I I GG; „Vorrang der Verfassung bzw. des Gesetzes"; „Vorbehalt des Gesetzes") zu garantieren 1 . A u f dem Hintergrund dieser verfassungsrechtlichen Grundentscheidung w i r d deutlich, daß vor einer empirischen Untersuchimg und Systemanalyse eines staatlichen und speziell des Regierungsbereiches dieser Raum verfassungsrechtlich umfassend dargestellt, v o l l ausgeleuchtet und abgesteckt werden muß, soweit davon Struktur- und Organisationsprobleme der Landesregierung betroffen sind. Daneben verfolgt dieser Abschnitt aber auch noch eine andere, ebenso wichtige Aufgabe. Eine immer wieder festzustellende konventionelle Strategie gegen irgendwelche Veränderungen i m staatlichen Bereich ist das „Sich-Zurückziehen" der betroffenen Stellen auf das bestehende, von Stabilität geprägte Verfassungs- und Normgefüge. Der „Wortlaut" der Verfassung w i r d nicht selten gewissermaßen als A l i b i für notwendige und sinnvolle Reformen benützt. U m dieser „Gefahr" wirksam begegnen zu können, bedarf deshalb der Regierungswissenschaftler, Systemanalytiker usw. genauer Kenntnisse von der Tragweite der einschlägigen Rechtsnormen (insbesondere der Verfassimg, aber auch von 1 Vgl. BVerfGE 6, 32, 41; 6, 55, 72; 20, 323, 331; K. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, § 6 I, I I ; Ders., i n : Rechtsstaatlichkeit u n d Sozialstaatlichkeit (Hrsg.: E. Forsthoff), S. 560ff.; F. Klein , i n : S c h m i d t - B l e i b t r e u / K l e i n , K o m m , zum GG, A r t . 20 A n m . 9 ff.; Leibholz / Rinck , K o m m , zum GG, A r t . 20 A n m . 21 ff.
§ 9 Allgemeine Ausgangspunkte
65
Gesetzen und häufig von Geschäftsordnungen) und dem verfassungsmäßigen Spielraum für mögliche Reformen. I m übrigen ist es schon aus Gründen der Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit notwendig, einer Systemanalyse des Regierungsbereichs die einschlägigen Verfassungsbestimmungen zugrunde zu legen und bei Änderungs- und Reformvorschlägen von diesen auszugehen oder sie mindestens m i t zu berücksichtigen 2 . Diese Ausführungen zeigen, daß es erforderlich und gerechtfertigt ist, die Organisationsstruktur der Landesregierung BadenWürttemberg nach der Landesverfassung i n einem besonderen A b schnitt vorweg ausführlich darzustellen. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil bisher eine systematische verfassungsrechtliche Untersuchung dazu fehlt. Obwohl der Schwerpunkt der Darstellung (die Verfassungswirklichkeit; Ergebnisse der empirischen Untersuchung) i n Kapitel I I I liegt, werden bereits hier aus Gründen der Verständlichkeit und der „ A u f lockerung" einige Aspekte der Praxis und der Politik mitbehandelt. 2. Historische Ausgangslage Die Verfassung des Landes Baden-Württemberg ist nach eineinhalbjähriger Arbeit der Verfassungsgebenden Landesversammlung am 19.11.1953 i n K r a f t getreten (Ges. Bl. S 173). Sie ist i m wesentlichen i m vierten Jahr des Bestehens der Bundesrepublik erarbeitet worden, also zu einem Zeitpunkt, als sich schon deutlich die durch das Grundgesetz bedingte Veränderung der Position der Länder abzeichnete. Gerade damals hätten also günstige Voraussetzungen für eine Berücksichtigung dieser Veränderungen und Erfahrungen vorgelegen. Außerdem hätte u. a. ohne zu großen Zeitdruck das Problem untersucht werden können, inwieweit i n einem förderativen Staat das Regierungssystem des Bundesstaats unbesehen und unverändert auf die Gliedstaaten übernommen werden sollte. Auch unter Berücksichtigung des Homogenitätsprinzips des A r t . 28 I GG war bei der schwerpunktmäßig verschiedenen Aufgabenstellung von Bundesexekutive und Landesexekutive die Frage zu stellen, ob das, was für den Bund richtig und sinnvoll ist, auch für die Länder maßgebend und effektiv sein muß 3 . 2 Vgl. W. Hennis, i n : Die Staatskanzlei, SHS Bd. 34, S. 156 (Diskussionsbeitrag); H. W. Rombach, ebenda, S. 265; E. Forsthoff, Verfassung u n d V e r fassungswirklichkeit, i n : M e r k u r 1968, S. 401; G. Wittkämper, i n : Die V e r w a l t u n g 1969, S. 11 f.; H. Mey, i n : Systemanalyse i n Regierung u n d V e r w a l tung (Hrsg.: H. Krauch), S. 132. Wittkämper (in: Die V e r w a l t u n g 1969, S. 12) f ü h r t dazu u. a. aus: „Eine Systemanalyse, die bei Regierungen u n d V e r w a l tungen nicht die Normen . . . m i t i n ihre Betrachtung einbezieht, verdient diesen Namen nicht." So auch: K . H. Friauf, i n : Projektgruppe BMI, Erster Bericht, Anlagenband, S. 553; K. Stern, ebenda, S. 564 f. 8 Vgl. dazu vor allem T. Eschenburg, Verfassung und Verwaltungsaufbau i m Südweststaat, S. 10 ff., 59 ff.; Ders., i n : Ba.-Wü. — Staat, Wirtschaft, K u l tur, S. 105; V. Renner, i n : JöR n. F. Bd. 7 (1958), S. 215 f.; so i m Tenor auch
5 Katz
66
Kap. I I : Regierungssystem nach der bad.-württ. L V
D a m a l s b e s t a n d d e m z u f o l g e die r e e l l e Chance — d i e es i n e i n e r D e m o k r a t i e selten g e n u g g i b t — z u e i n e r d e n gestiegenen m o d e r n e n A n f o r d e r u n g e n a n das R e g i e r u n g s s y s t e m eines L a n d e s gerecht w e r d e n d e n R e f o r m . Diese G e l e g e n h e i t w u r d e , w e n n g l e i c h aus v e r s t ä n d l i c h e n u n d e i n s i c h t i g e n G r ü n d e n , k a u m g e n ü t z t . D i e Sorge, j a b e i n a h e A n g s t u m e i n e n u n g e s t ö r t e n I n t e g r a t i o n s p r o z e ß u n d e i n tatsächliches, rasches Z u s a m m e n w a c h s e n d e r B e v ö l k e r u n g d e r verschiedenen L a n d e s t e i l e z u einem einheitlichen Südweststaat, hat nichterprobte Neuerungen u n d m i t u n t e r selbst m a ß v o l l e R e f o r m e n v e r h i n d e r t 4 . D i e V e r f a s s u n g des L a n d e s B a d e n - W ü r t t e m b e r g h a t d e m n a c h i m w e s e n t l i c h e n k e i n e n e u e n Wege b e i d e r A u s g e s t a l t u n g des R e g i e r u n g s systems beschritten. A u c h d e r v o n d e r C D U - F r a k t i o n eingebrachte A n t r a g a u f E i n f ü h r u n g eines p r ä s i d i a l e n Regierungssystems ( v o m V o l k g e w ä h l t e r Staatspräsident) w u r d e n i c h t ü b e r n o m m e n 5 . Das i n d e r L a n desverfassung v e r w i r k l i c h t e p a r l a m e n t a r i s c h e R e g i e r u n g s s y s t e m i s t aber i m V e r g l e i c h m i t d e r g r u n d g e s e t z l i c h e n R e g e l u n g g l e i c h w o h l i n E i n z e l h e i t e n u n d auch i n der G r u n d t e n d e n z u n t e r s c h i e d l i c h ausgestalt e t . E i n e interessante A u f g a b e dieser A r b e i t w i r d es u. a. sein, diese Unterschiede h e r a u s z u a r b e i t e n u n d d a r z u s t e l l e n 6 . A B G . Gönnenwein, i n : Verhandlungen der Verfassungsgebenden Landes Versammlung (VLV), S. 282 ff.; E.-W. Böckenförde, Organisationsgewalt, S. 292 (Fußn. 21). 4 Vgl. dazu ABG. G. Müller, i n : Verhandlungen der V L V , S. 59; ABG. Gehring, i n : Protokolle des Verfassungsausschusses (VA), 43. Sitzung, S. 33; T. Eschenburg, i n : Ba.-Wü. — Staat, Wirtschaft, K u l t u r , S. 105. Vgl. als Beispiel dazu etwa auch A r t . 111 des CDU-Verfassungsentwurfs, i n : Protokolle des V A , 25. Sitzung, S. 58 u n d 78 ff. I m Grunde gaben diese Bedenken letztlich, mindestens z u m Teil, auch den Ausschlag f ü r die Ablehnung des C D U - A n trags auf Einführung eines präsidialen Regierungssystems (Staatspräsident); vgl. dazu ausführlich P. Feuchte, i n : Spreng / B i r n / Feuchte, K o m m , zur L V BW, S. 169 f. m. w . N. 5 Vgl. Verhandlungen des V L V , S. 2300-2304; Protokolle des V A , 13. Sitzung, S. 4 ff.; T. Eschenburg, Verfassung u n d Verwaltungsaufbau, S. 59 ff. Trotz einiger beachtlicher Gründe (etwa die Tatsache, daß i m Gegensatz zum B u n d die wesentlichen Landesaufgaben i n der V e r w a l t u n g liegen) f ü r das Präsidialsystem hat die Praxis der letzten 20 Jahre gezeigt, daß die Entscheidung f ü r das parlamentarische Regierungssystem insgesamt gesehen richtig war. Insbesondere ist auch ein Hauptargument f ü r das Präsidialsystem, nämlich die Gefahr einer unstabilen Regierung durch die enorme Zersplitter u n g i n Parteien, aber auch innerhalb der Parteien i n Landsmannschaften u n d Konfessionen, nicht W i r k l i c h k e i t geworden. Seit 1972 hat sogar die CDU die absolute Mehrheit i m Parlament inne (vgl. etwa T. Eschenburg, Verfassung u n d Verwaltungsaufbau, S. 60 - 62, 65; Ders., i n : Ba.-Wü. — Staat, W i r t schaft, K u l t u r , S. 105; außerdem ABG. Gönnenwein, i n : Verhandlungen der V L V , S. 285 f.). 6 Als bemerkenswert soll hier noch erwähnt werden, daß i m Unterschied zum GG die L V n u r höchst selten u n d n u r unwesentlich geändert wurde. Bis M i t t e 1974 waren insgesamt n u r acht Verfassungsänderungen, w o v o n nur eine den Regierungsbereich betraf (Art. 45 I I I LV), beschlossen worden. Das GG wurde bis Sept. 1973 insgesamt 31mal geändert.
§10 Das parlamentarische Regierungssystem
67
§ 10 Das parlamentarische Regierungssystem Das Grundgesetz bekennt sich zu einer demokratischen, rechtsstaatlichen und bundesstaatlichen Staatsordnung (vgl. A r t . 20, 28 I GG). Dabei sind unter Beachtung des demokratischen Prinzips verschiedene Formen und Ausgestaltungen der Staatsorganisation möglich und denkbar 1 . I n der Bundesrepublik ist das Verhältnis zwischen Bundesregierung und Bundestag als repräsentatives, parlamentarisches System festgelegt. Das Grundgesetz hat sich dabei allerdings — etwa i m Vergleich zur Weimarer Verfassung — für eine abgeschwächte Form des parlamentarischen Systems entschieden und sich u m die Erhaltung möglichst stabiler Regierungsverhältnisse bemüht 2 . Diese verfassungsrechtliche Grundentscheidung auf Bundesebene findet man i m wesentlichen auch i n allen Verfassungen der Länder (Art. 28 I GG — Homogenitätsprinzip —). I m Gegensatz zu der grundgesetzlichen Regelung enthalten allerdings die Landesverfassungen allgemein drei wesentliche Unterschiede. Zum einen kennt kein Land einen „Staatspräsidenten", was den Wegfall des Staatsoberhauptes auf Landesebene zur Folge hat 3 . Zum anderen enthalten alle Verfassungen der Länder stärkere Einfluß- und Mitwirkungsrechte der Parlamente gegenüber den Regierungen, die zwar i n ihrem Ausmaß unterschiedlich sind, aber doch zumeist den Regierungschef bei der Regierungsbildung i m Vergleich zu A r t . 64 GG weniger souverän sein lassen4. Schließlich besteht nach den Landesverfassungen — i m Gegensatz zum Grundgesetz — die Möglichkeit, jedes Regierungsmitglied unter bestimmten Voraussetzungen vor dem Staatsgerichtshof anzuklagen („Ministeranklage") 5 . Trotz dieser Unterschiede ist es gerechtfertigt davon auszugehen, daß i n 1 Vgl. etwa T. Maunz, i n : Maunz / D ü r i g / Herzog, K o m m , zum GG, A r t . 62 A n m . 5 - 8 ; R. Herzog, Allgem. Staatslehre, S. 242 ff.; K. Loewenstein, V e r fassungslehre, S. 67 ff.; C. Schmitt, Verfassungslehre, S. 338 ff.; G. Jellinek, Allg. Staatslehre, S. 717 ff. 2 A r t . 63, 65, 67, 68, 43 u n d 44 GG; vgl. dazu i m einzelnen etwa U. Scheuner, i n : D Ö V 1957, S. 633 ff.; T. Maunz, i n : Maunz / D ü r i g / Herzog, A r t . 62 A n m . 14ff.; zur neueren Entwicklung: U. Scheuner, i n : D Ö V 1974, S. 433 ff.; vgl. auch die Ausführungen oben § 3 Ziff. 4. 3 Vgl. dazu ausführlich O. Uhlitz, i n : DÖV 1966, S. 293 ff. m . w . N . ; T. Ellwein, Regierungssystem, S. 317; V. Renner, i n : JöR, n. F. Bd. 7 (1958), S. 213. 4 Vgl. A r t . 46 I I I , I V u n d 45 I I I B a . - W ü . L V ; A r t . 45, 46 u n d 49 B a y . L V ; A r t . 101 I V , 104 I I u n d 112 Hess. L V ; A r t . 20 Vorl. Nds. L V ; A r t . 52 Nr. 3 N R W L V ; A r t . 98 I I , 99 I u n d 105 I I Rh.-Pf. L V ; A r t . 90 Saarl. L V ; A r t . 21 der L a n dessatzung Schleswig-Holstein; vgl. dazu auch H. von Mangoldt, Das V e r hältnis von Regierung u n d Parlament, i n : S t r u k t u r w a n d e l der modernen Regierung (Hrsg.: Stammen), S. 246 ff., 248. 5 A r t . 57 Ba.-Wü. L V ; A r t . 59 Bay. L V ; A r t . 115 Hess. L V ; A r t . 31 Vorl. Nds. L V ; A r t . 63 N R W L V ; A r t . 131 Rh.-Pf. L V ; i m G G ist n u r eine Anklage des Bundespräsidenten vorgesehen (Art. 61 GG).
5*
Kap. I I : Regierungssystem nach der bad.-württ. L V
68
Bund und Ländern i n den Grundfragen des parlamentarischen Regierungssystems ein gemeinsames Verfassungsrecht gilt 6 . Die Bad.-Württ. Landesverfassung enthält i m Vergleich zum GG neben diesen Punkten noch weitere Vorschriften, die das Verhältnis Parlament/Regierung betreffen und deshalb insgesamt hier darzustellen sind. Unter den zu nennenden Bestimmungen ragt an Bedeutung die A r t und Weise der Regierungsbildung hervor (Art. 46 und 47 LV) 7 . Abgesehen von der Wahl des Ministerpräsidenten durch das Parlament ist i n diesem Zusammenhang von entscheidender Bedeutung, daß der Ministerpräsident seine Regierung durch den Landtag bestätigen lassen muß („Doppelbestätigung", A r t . 46 I I I LV). Dieses Erfordernis beschränkt die Entscheidungs- und Bewegungsfreiheit des Ministerpräsidenten (im Vergleich zu derjenigen des Bundeskanzlers) verfassungsrechtlich nicht unwesentlich. Berücksichtigt man dazu noch A r t . 46 IV, wonach auch einzelne nachträglich ernannte Regierungsmitglieder vom Landtag bestätigt werden müssen und A r t . 45 I I I L V , der dem Landtag eine beachtliche Einflußmöglichkeit auf die Regierungsorganisation einräumt (vgl. auch A r t . 70 I LV), so w i r d diese Aussage zusätzlich bestätigt und unterstrichen 8 . Die verfassungsgebende Landesversammlung und auch der Landtag wollten damit eine gewisse organisatorische Flexibilität i m Regierungsbereich (bei der Regierungsbildung, Zahl der Ministerien, Ressortabgrenzung) 0 durchaus nicht behindern und auch die grundsätzlich dem Eigenbereich der Spitze der Exekutive zustehende Organisationsgewalt nicht generell an sich ziehen 10 ; insgesamt hielt man es aber doch für notwendig, echte und i m Notfall effektive parlamentarische Kontrollrechte über die Regierung zu besitzen 11 . Die wesentlichen Gründe für den insoweit bestehenden sehr weitgehenden „Gesetzesvorbehalt" des Landtags liegen darin, daß die 6
Vgl. T. Ellwein, Regierungssystem, S. 317 ff. L V bezeichnet stets die Landesverfassung von Baden-Württemberg. 8 P. Feuchte, i n : Spreng / B i r n / Feuchte, K o m m , zur L V BW, S. 170 ff.; V. Renner, i n : JöR, n. F. Bd. 7 (1958), S. 212 f.; K . Rebmann, i n : JöR, n. F. Bd. 20 (1971), S. 201 f. m. w . N.; vgl. auch E.-W. Böckenförde, Organisationsgewalt, S. 99 f. u n d 292; T. Ellwein, Regierungssystem, S. 317 f. Die traditionsbedingte alte Fassung des A r t . 45 I I I L V unterstellte sogar die gesamte Bestimmung der Geschäftsbereiche der Ministerien dem Gesetzesvorbehalt u n d übertrug damit rechtlich die Organisationsgewalt insoweit letztlich dem L a n d tag (vgl. dazu Rebmann, ebd.). Z u A r t . 70 vgl. etwa Protokolle des V A , 21. Sitzung, S. 37 f. 9 Z u A r t . 46 I I I L V : Protokolle des V A , 49. Sitzung, S. 92 ff.; Verhandlungen der V L V , S. 2298 ff. Z u A r t . 45 I I I : Verhandlungsprotokolle, 5. W a h l periode, S. 5035 ff. Z u r Festlegung der Z a h l der Minister i n der L V : Protokolle des V A , 13. Sitzung, S. 3 ff.; P. Feuchte, i n : Spreng/ B i r n / F e u c h t e , K o m m , zur L V , S. 174. 10 E.-W. Böckenförde, Organisationsgewalt, S. 78 ff.; Verhandlungsprotokolle, 5. Wahlperiode, S. 5036 f.; vgl. auch K . Rebmann, i n : JöR, n. F. Bd. 20 (1971), S. 201 f. 7
§10 Das parlamentarische Regierungssystem
69
große Mehrheit der verfassungsgebenden Landesversammlung der Auffassung war, daß zum einen die Stellung des Ministerpräsidenten nicht zu stark hervorgehoben werden soll und deshalb neben i h m auch die vollständige und funktionsfähige Regierung insgesamt der parlamentarischen Bestätigung bedarf 1 2 . Zum anderen wollte man i m Verhältnis Parlament/Regierung die Position des Landtags verbessern. Dies kommt auch i n der weiteren Besonderheit des A r t . 56 L V , der bei einer Landtagsmehrheit von zwei Dritteln den Zwang zur Entlassung eines Ministers festlegt, zum Ausdruck 1 3 . Schließlich ist hier noch die „Ministeranklage" (Art. 57 LV) zu nennen, nach der jedes Mitglied der Regierung auf Beschluß des Landtags vor dem Staatsgerichtshof angeklagt werden kann 1 4 . Betrachtet man diese i m Vergleich zum Grundgesetz unterschiedliche Ausgestaltung des parlamentarischen Regierungssystems, so w i r d deutlich, daß man i n Baden-Württemberg — mindestens unter verfassungsrechtlichen Aspekten — nicht wie auf Bundesebene von einer abgeschwächten Form des parlamentarischen Systems sprechen kann, sondern von einer relativ starken Stellung des Parlaments auszugehen hat. Zurecht wurde deshalb wiederholt festgestellt, daß sich der Landtag rechtlich i n der Verfassung eine stärkere Position geschaffen hat, als sie die Parlamente i n den meisten anderen deutschen Ländern und vor allem i m Bund haben 15 . Ob diese nicht gering zu erachtende Stellung und der davon abzuleitende Einfluß auf die Regierung allerdings vom Landtag i n der politischen und parlamentarischen Praxis auch voll wahrgenommen und behauptet 11 Vgl. Fundstellen bei Fußnote 9; so zuletzt A B G . Veith, i n : Verhandlungsprotokolle, 5. Wahlperiode, S. 5036 u n d ABG. Brandenburg, ebenda, S. 5037 f. 12 Vgl. Protokolle des V A , 49. Sitzung, S. 59; Verhandlungen der V L V , S. 2299 ff.; T. Eschenburg, i n : Ba.-Wü. — Staat, Wirtschaft, K u l t u r , S. 105; V. Renner, i n : JöR, n. F. Bd. 7 (1958), S. 216. E i n Hauptgrund für die i n den A r t . 45 ff. der L V zum Ausdruck kommende Grundtendenz i m Hinblick auf die Verteilung der Gewichte i m Verhältnis Parlament/Regierung, aber auch innerhalb der Regierung liegt zweifellos i n den Umständen u n d den Auseinandersetzungen u m die B i l d u n g der vorläufigen Regierung f ü r das Südwestdeutsche Bundesland unter Reinhold Maier (FDP/DVP) am 25. 4.1952 begründet (vgl. V. Renner, ebd., S. 209). 18 Vgl. dazu Protokolle des V A , 16. Sitzung, S. 2 - 2 1 ; 50. Sitzung, S. 2 - 4 ; Verhandlungen der V L V , S. 2310, 2470; P. Feuchte, i n : Spreng / B i r n / Feuchte, K o m m , zur L V , S. 193 f. 14 Vgl. dazu etwa P. Feuchte, i n : Spreng / B i r n / Feuchte, S. 194. A u f die übrigen hier i n Betracht kommenden Verfassungsbestimmungen (insbes. A r t . 79 ff. LV) braucht nicht näher eingegangen zu werden (vgl. dazu etwa K. Rebmann, i n : JöR, n. F. Bd. 20 [1971], S. 203). 15 Vgl. T. Eschenburg, i n : Ba.-Wü. — Staat, Wirtschaft, K u l t u r , S. 105; V. Renner, i n : JöR, n. F. Bd. 7 (1958), S. 216; E.-W. Böckenförde, Organisationsgewalt, S. 99 f. u n d 292; T. Ellwein, Regierungssystem, S. 317 f. Ä h n lich w i e die Ba.-Wü. Regelung: A r t . 43 ff. Bay. L V ; A r t . 100 ff. Hess. L V u n d A r t . 98 ff. Rh.-Pf. L V .
Kap. I I : Regierungssystem nach der bad.-württ. L V
70
wurde bzw. wird, ist doch sehr fraglich. Eschenburg 16 bejaht dies zwar i n weitem Umfang. Der Wirklichkeit wesentlich näher dürfte aber die Auffassung kommen, daß „materiell" der Ministerpräsident und die Minister gemeinsam m i t der Mehrheits- bzw. den Koalitionsparteispitzen die Regierungsbildung und die Geschäftsbereiche der Minister bestimmen und der Landtag i n aller Regel diesen Beschlüssen nur noch „formell" zustimmt, daß also diese parlamentarischen M i t w i r kungsrechte faktisch bloße Kontrollrechte und nur i m Not- oder äußersten Konfliktsfall echte Einflußrechte des Landtags sind 1 7 . Es w i r d Aufgabe der Ausführungen unten §§ 20 und 25 sein, das Verhältnis und den gegenseitigen Einfluß von Parlament und Regierung näher zu untersuchen und empirisch zu belegen.
§ 11 Organisationsstruktur der Landesregierung Die Grundsätze der Organisationsstruktur sind i n Art. 49 L V niedergelegt 1 . Diese Bestimmung besagt: — Der Ministerpräsident bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung. Er führt den Vorsitz i n der Regierung und leitet ihre Geschäfte. — Jeder Minister leitet seinen Geschäftsbereich innerhalb der Richtlinien der Politik selbständig unter eigener Verantwortung. — Die Regierung beschließt insbesondere über Gesetzesvorlagen, über die Stimmabgabe des Landes i m Bundesrat, über Angelegenheiten, i n denen ein Gesetz dies vorschreibt, über Meinungsverschiedenheiten, die den Geschäftskreis mehrerer Minister berühren, und über Fragen von grundsätzlicher oder weittragender Bedeutung. Ergänzend gehören dazu noch A r t . 54 I, 55 I I und 46 L V , die die i n A r t . 49 L V festgelegte Organisationsstruktur darüber hinaus etwas zugunsten der Stellung des Ministerpräsidenten verschieben. Die so normierte Grundstruktur der Landesregierung w i r d ganz allgemein als eine Mischform oder Kombination aus Kanzler-, Ressort- und Kollegial-(Kabinetts-)prinzip bezeichnet 2 . Diese Beschreibung ergibt 16
T. Eschenburg, i n : Ba.-Wü. — Staat, Wirtschaft, K u l t u r , S. 105 (die Gründe, die er dafür anführt, treffen heute allerdings überwiegend nicht mehr zu). 17 Ä h n l i c h ABG. Veith, i n : Verhandlungsprotokolle, 5. Wahlperiode, S. 5036; ABG. Brandenburg, ebenda, S. 5037 f. 1 Die entsprechenden Bestimmungen enthalten: A r t . 47, 51, 55 Bay. L V ; A r t . 102, 104 Hess. L V ; A r t . 28 Nds. L V ; A r t . 54, 55 N R W L V ; A r t . 104, 105 Rh.-Pf. L V ; A r t . 92, 93 Saarl. L V ; A r t . 24 Landessatzung Schl.-Holst. 2 Vgl. etwa T. Maunz, i n : Maunz / D ü r i g / Herzog, A r t . 65 A n m . 1; von Mangoldt / Klein, A r t . 65, Bern. I I 2; K . Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts,
§11 Organisationsstruktur der Landesregierung
71
allerdings noch keine spezifischen und konkreten Aussagen. Zurecht stellt deshalb Böckenförde 3 fest, daß das konkrete Regierungsverhältnis, i n dem diese drei Prinzipien zueinander stehen, zunächst genau bestimmt werden muß, u m die besondere Eigenart der betreffenden Organisationsstruktur überhaupt zu erkennen. Für die besondere Struktur der Bundesregierung hat sich schon früh der Begriff „Kanzlerdemokratie" eingebürgert. Er bringt zutreffend zum Ausdruck, daß das politische Zentrum der Regierung beim Regierungschef, dem Bundeskanzler, liegt und dieser dazu eine besonders hervorgehobene und eine umfassende Befugnisse i n einer Person vereinigende Position besitzt (Art. 65, 64, 67 GG) 4 . Daneben haben allerdings nach wie vor sowohl das Kollegial- als auch das Ressortprinzip durchaus keine untergeordnete, sondern eine wichtige, eigenständige Bedeutung. Abgesehen von den überwiegend historischen Gründen (Erfahrungen aus der Weimarer Zeit), die den Verfassungsgeber bewogen haben, das Kanzlerprinzip besonders herauszustellen 5 , w i r d die Grundstruktur der Bundesregierung m i t verschiedenen Argumenten nach wie vor grundsätzlich für richtig gehalten 6 . Folgende Gründe können dazu u. a. vorgetragen werden: — Die Regierung als Kollegialorgan bedarf einer effektiven einheitlichen Führung. I m parlamentarischen System scheint ein rein kollegiales Regierungsorgan, dessen Vorsitzender nur primus inter pares ist, grundsätzlich nicht effektiv genug zu sein. — Die Bewältigung der enorm angewachsenen Staatsaufgaben, die, soweit sie vor allem vom Bund wahrgenommen werden, eine umfassende Auswirkung auf praktisch alle Lebensbereiche haben, bedarf mindestens einer einheitlichen Ziel- und Rahmenplanung und eines integrierten Grundsatzprogramms. Beides kann sinnvoll be§ 17 I I I ; E.-W. Böckenförde, Organisationsgewalt, S. 168; G. Barbey, Bundesregierung, i n : EStL, Sp. 213; J. Kölble, D Ö V 1973, S. 2; vgl. auch Verhandlungen der V L V , S. 2302 u n d 2469. 3 E.-W. Böckenförde, Organisationsgewalt, S. 169. 4 Vgl. dazu eingehend u n d umfassend: T. Maunz, i n : Maunz / D ü r i g / H e r zog, A r t . 65, A n m . 1; F. Klein, i n : Schmidt-Bleibtreu / Klein, A r t . 65 A n m . 4 f f . ; K. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, § 17 I I I ; K. Sontheimer, Grundzüge des pol. Systems der BRD, S. 160 ff.; J. Kölble, i n : D Ö V 1973, S. 1 ff. m. w. N.; U. Scheuner, i n : D Ö V 1974, S. 433 ff. 5 Vgl. etwa E.-W. Böckenförde, Organisationsgewalt, S. 169 f. m. w. N.; K . Sontheimer, S. 161. 6 Vgl. K. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, § 17 I I I ; T. Ellwein, Regierungssystem, S. 323 ff.; W. Hennis, Richtlinienkompetenz u n d Regierungstechnik, S. 10 ff.; K . Sontheimer, S. 161; H. J. Wolff, Verwaltungsrecht I I , S. 71. Vgl. dazu auch die eingehenden Ausführungen i n : Schweizer Totalrevision, Schlußbericht, S. 503 ff., 518 ff.
72
Kap. I I : Regierungssystem nach der bad.-württ. L V
sonders von einer zentralen Stelle, dem Regierungschef m i t seiner Kanzlei, i m Rahmen der Richtlinienkompetenz erfüllt werden. — Der Entwicklungsprozeß der modernen Industriegesellschaft und die dadurch gewandelten Bedingungen haben dabei vor allem den Regierungsfunktionen Kooperation, Koordination, zusammenfassende Lenkung, Planung und Integration eine entscheidende Bedeutung zukommen lassen. Diese Funktionen können i n aller Regel aber nur dann am besten wahrgenommen werden, wenn sie letztlich i n einer Hand zusammenlaufen und von dort überwacht werden 7 . — Aus organisatorischen Gründen ist es bei einem „Großkollegium" (etwa schon ab ca. 20 - 30 Mitglieder) besonders schwierig, effektive und schnelle Arbeit zu leisten. Dieser Nachteil t r i f f t bis zu einem gewissen Grad vor allem auf den Bund zu. Diese Argumente, die besonders i m Hinblick auf die Bedürfnisse der Struktur der Bundesregierung vorgebracht werden, gelten nur in geringerem Ausmaß für die Länderebene 8 . Für den Bereich der Regierungen i n den Ländern würde es sich aus organisatorischen Gründen deshalb durchaus anbieten, i m Unterschied zum Bund etwa das Kollegialprinzip besonders zu betonen 9 . Untersucht man unter diesem Aspekt die einzelnen Landesverfassungen, so stellt man i n der Tat fest, daß einige Länder bei der Ausgestaltung der Regierungsstruktur i m Vergleich zum Bund das Kollegialprinzip etwas stärker i n den Vordergrund gestellt haben 10 . I n besonderem Maße und am deutlichsten t r i f f t dies für BadenWürttemberg zu. A r t . 49 I I L V enthält einen recht umfassenden Katalog an Aufgaben, die dem Kabinett zur Entscheidung übertragen sind. Von besonderer Bedeutung ist dabei, daß die Landesregierung über die Stimmabgabe des Landes i m Bundesrat und über Fragen von grundsätzlicher oder weittragender Bedeutung zu beschließen hat. 7 Vgl. dazu vor allem K. König, Koordination u n d Regierungspolitik, i n : DVB1. 1975, S. 225 ff. 8 Vgl. dazu die Ausführungen zu den Unterschieden der Staatsaufgaben u n d -funktionen der Länder i m Vergleich zum B u n d oben Abschnitt I Ziff. 5; außerdem ist hier festzustellen, daß m i t Ausnahme von Bayern keine L a n desregierung mehr als 11 Mitglieder umfaßt. 9 Vgl. dazu das mehr m i t den Ländern als m i t dem B u n d vergleichbare Schweizer Regierungssystem (etwa i n : K. Schumann, Das Regierungssystem der Schweiz, S. 178 ff.) u n d die i n der Schweiz dazu angestellten Überlegungen i m Rahmen der Verfassungsreform (in: Schweizer Totalrevision, Schlußbericht, S. 497 ff.). 10 Abgesehen von Bad.-Württ. auch Niedersachsen (Art. 28 u n d 29 Vorl. LV). Vgl. auch A r t . 55 Nr. 4 Bay. L V , A r t . 108 Hess. L V , A r t . 57 u n d 58 N R W L V , A r t . 94 Saarl. L V (danach steht den Landesregierungen das Recht der Beamtenernennung zu).
§11 Organisationsstruktur der Landesregierung
73
Diese Regelung zeigt, auch wenn man hier vorerst einmal das „Spannungs- und evtl. sogar Widerspruchsproblem" zwischen A r t . 49 I (Richtlinienkompetenz) und A r t . 49 I I L V unbeantwortet und außer Acht läßt, daß der Kollegialbeschlußfassung und damit dem Kabinettsprinzip mindestens stärkere Bedeutung als i m Regierungssystem des Bundes beigemessen w i r d (vgl. auch A r t . 45 I I I L V ) 1 1 . Trotzdem bleibt der Einfluß und die Bedeutung des Ministerpräsidenten u. a. schon i m Hinblick auf die i h m übertragenen Aufgaben und Funktionen eines Staatsoberhauptes (Art. 50 bis 52 LV) beachtlich. Die erkennbare und größtenteils sogar ausdrücklich erklärte Grundtendenz der gesamten Verfassungsgebenden Landesversammlung zielte allerdings stets darauf ab, die Stellung des Ministerpräsidenten nicht zu sehr zu stärken 1 2 . Dies sollte, abgesehen von einer größeren Abhängigkeit vom Parlament (vgl. oben § 10), dadurch erreicht werden, daß einmal die Minister gegenüber dem Ministerpräsidenten eine stärkere Stellung eingeräumt erhielten (vgl. A r t . 46 I I I und IV, A r t . 56 L V ) 1 3 und zum anderen eben das Kabinettsprinzip, die Kollegialberatung und -beschlußfassung (über u. a. alle Fragen von grundsätzlich und weittragender Bedeutung), besonders i n den Vordergrund gestellt wurde 1 4 . Diese sich so darstellende Organisationsstruktur der Landesregierung weist — ohne hier schon die nachfolgenden Ausführungen zu den einzelnen Ausgestaltungsprinzipien vorwegnehmen zu wollen — insgesamt betrachtet auf eine doch recht ausgewogene Berücksichtigung und Verbindung sowohl des Kollegial- als auch des Kanzler- und Ressortprinzips hin. Das Kanzlerprinzip steht nicht so eindeutig i m Vordergrund, wie dies bei der Ausgestaltung der Struktur der Bundesregierung der Fall ist. Diese Aussage bedarf allerdings noch einer genaueren Untersuchung. 11
Vgl. etwa ABG. Kalbfell (SPD), i n : Protokolle des V A , 14. Sitzung, S. 44; ABG. Gurk (CDU), i n : Protokolle des V A , 14. Sitzung, S. 35 f.; ABG. Kühn (CDU), i n : Protokolle des V A , 49. Sitzung, S. 80f.; ABG. Lausen (SPD), i n : Protokolle des V A , 16. Sitzung, S. 4, 6, 16. 12 Vgl. die Fundstellen i n Fußnote 11; außerdem: Protokolle des V A , 49. Sitzung, S. 59 ff.; Verhandlungen der V L V , S. 2299 f. Z u einem CDU-Ergänzungsantrag des A r t . 49 I I L V , der abgelehnt wurde, vgl. Verhandlungen der V L V , S. 2467 ff. 13 Vgl. Protokolle des V A , 16. Sitzung, S. 2 - 3 1 ; 50. Sitzung, S. 2 - 4 ; als Beispiel zu A r t . 56 L V vgl. Verhandlungen der V L V , S. 1041 ff. 14 Vgl. bereits A r t . 46 I I des Entwurfs der Regierungsparteien u n d A r t . 74 des CDU-Entwurfs einer L V (vgl. Beilagen zu den Verhandlungsprotokollen, Bd. I, Nr. 40 u. 118; der C D U - E n t w u r f enthielt einen noch umfassenderen Katalog als A r t . 49 I I L V ) ; neben den Fundstellen i n Fußnote 11 vgl. V e r handlungen der V L V , S. 2300, 2302; außerdem V. Renner, i n : JöR, n. F. Bd. 7 (1958), S. 215 f.; P. Feuchte, i n : S p r e n g / B i r n / F e u c h t e , S. 179 ff.; K. Göbel, Die Verfassung des Landes Baden-Württemberg, S. 63 f. Nach Auffassung der SPD hätte das Kollegialprinzip i n der ganzen L V relativ streng durchgehalten werden sollen (vgl. ABG. Rimmelsbacher, i n : Protokolle des V A ,
74
Kap. I I : Regierungssystem nach der bad.-württ. L V
§ 12 Das Verhältnis von „Kanzler- und Kabinettsprinzip" (Auslegungsprobleme des Art. 49 LV) 1. Unterschiede zum Grundgesetz Neben den i m A r t . 49 I I L V nicht abschließend aufgezählten Aufgaben und Befugnissen des Ministerrats (Kabinetts), enthält die Verfassung darüber noch eine ganze Reihe weiterer Bestimmungen. So ergibt sich aus der Landesverfassung das Recht des Kabinetts zum Erlaß von Rechtsverordnungen (Art. 61 II), zum Erlaß von Verwaltungsvorschriften (Art. 61 II), auf Zustimmung zum Abschluß von Staatsverträgen (Art. 50), zur Verkündigung des Staatsnotstandes (Art. 62), zur Einrichtung der staatlichen Behörden i m einzelnen (Art. 70 II), zur vorläufigen Ausgabenleistung (Art. 80 I), zur Zustimmung zu bestimmten Landtagsbeschlüssen (Art. 82), zur Einberufung des Landtags (Art. 30 IV), schließlich zur Festlegung der Geschäftsbereiche der Ministerien (Art. 45 III) und zum Erlaß einer Geschäftsordnung für die Regierung (Art. 49 I). Außerdem hat der Ministerrat noch gewisse Rechte bei einer evtl. Volksabstimmung über Gesetzesvorlagen (Art. 60 I I und III) und i m Rahmen des A r t . 43 I (Landtagsauflösung durch Volksbegehren und Volksabstimmung), die hier allerdings nicht besonders ins Gewicht fallen (vgl. auch A r t . 59 I und 63 I S. 2 LV). I m Vergleich zum Bundeskabinett sind dabei insgesamt betrachtet vor allem drei Unterschiede bedeutsam: — Nicht dem Ministerpräsidenten (nach dem GG dem Bundeskanzler), sondern dem Ministerrat steht i n Baden-Württemberg, abgesehen von der parlamentarischen Beteiligung, grundsätzlich die Organisationsgewalt i m Regierungsbereich und damit auch die Bestimmung über die Geschäftsbereiche der einzelnen Minister zu (vgl. A r t . 45 I I I , 70 I I LV) 1 . 14. Sitzung, S. 54; ABG Kalbfell, SPD, ebenda, S. 44). Eine ähnliche K o n zeption verfolgte die D V P / F D P (vgl. ABG. Gönnenwein, i n : Protokolle des V A , 14. Sitzung, S. 55). Auch der damalige A B G . u n d spätere Ministerpräsident G. Müller (CDU) hätte damals am liebsten gesehen, daß eine modifizierte F o r m des Schweizer Regierungssystems v e r w i r k l i c h t worden wäre (Interview am 5. 3.1974); so auch ABG. Kühn (CDU), i n : Protokolle des V A , 49. Sitzung, S. 80. Diese Grundtendenz i n der verfassunggebenden Landesversammlung w a r u. a. durch folgendes zu erklären: Das Verhalten des damaligen Ministerpräsidenten Reinhold Maier (DVP/FDP) anläßlich der A b s t i m m u n g zum E V G - V e r t r a g i m M a i 1952 i m Bundesrat verärgerte u n d veranlaßte die SPD, die Richtlinienkompetenz des Ministerpräsidenten stark zu beschneiden; die C D U verfolgte aus Gründen, die i n ihrer seinerzeitigen Rolle als Oppositionspartei lagen, ebenfalls diese Tendenz. 1 Vgl. die Zitate i n Fußnote 10 u n d 17 von § 10; Bekanntmachung der L a n desregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien v o m 25. 7.1972 (Ges. Bl. S. 404 ff.; abgedruckt als Anlage 1 dieser Arbeit). Z u r Bundesregelung vgl. etwa: F. Klein, i n : Schmidt-Bleibtreu / K l e i n , A r t . 65 A n m . 10; E.-W. Böckenförde, Organisationsgewalt, S. 139 ff.; J. Kölble, i n : DÖV 1973, S. 4 ff.
§ 12 Das Verhältnis von „ K a n z l e r - und Kabinettsprinzip"
75
— Dem Landeskabinett ist als zusätzliches wichtiges Recht die Beschlußfassung über Fragen von grundsätzlicher und weittragender Bedeutung übertragen (Art. 49 I I LV). — Als weiteres, i n den letzten 20 Jahren stets an Bedeutung zunehmendes, allerdings nicht m i t der Bundesregelung vergleichbares Recht, obliegt dem Ministerrat die Beschlußfassung über die Stimmabgabe des Landes i m Bundesrat (Art. 49 I I LV). Diese gesamten dem Kabinett damit zur Beratung und Beschlußfassung zu unterbreitenden Angelegenheiten sind überaus bedeutsam. Zum Beispiel sind davon alle Bundesgesetze und praktisch überhaupt alle i m Bund-/Länderverhältnis zu treffenden Entscheidungen, die i n den letzten Jahren eine ganz enorme Bedeutung erlangt haben, betroffen, da diese fast immer von grundsätzlicher und weittragender Natur sind. Ob darin aber eine verfassungsrechtlich besonders ausgeprägte Verwirklichung des Kollegialprinzips 2 zu sehen ist, kann abschließend erst beurteilt werden, wenn das hier bestehende Hauptproblem entschieden ist, wie sich diese Rechte des Kabinetts m i t der Richtlinienkompetenz des Ministerpräsidenten (Art. 49 I LV) „vertragen", d. h. wie dieses Spannungsverhältnis oder evtl. sogar dieser Widerspruch zu lösen ist. 2. Auslegungskriterien für Art. 49 LV Wenn man vom objektiven Norminhalt (Wortlaut) des A r t . 49 L V ausgeht und dabei den Katalog ansieht, der i n Abs. 2 dem Ministerrat zur Beschlußfassung vorbehalten ist, so muß man i n der Tat fragen, wie sich dazu das i n Abs. 1 postulierte Recht des Ministerpräsidenten, die Richtlinien der Politik zu bestimmen, verhält. I n diesen beiden Bestimmungen des A r t . 49 L V kommen zwei Strukturgrundsätze, das Kanzler- und Kollegialprinzip, zum Ausdruck, die sich bei der hier auf den ersten Blick so stark erfolgten Ausgestaltung beider Grundsätze vom Wortsinn her nicht „vertragen". Nach einer ausschließlich „grammatischen Auslegung" läßt sich dieses Problem demnach nicht lösen 8 . Auch eine Auslegung des A r t . 49 L V aus dem gesamten Bedeutungszusammenhang der Verfassung h i l f t nicht entscheidend weiter. 2 Vgl. zum Kabinettsprinzip allgemein: von Mangoldt / Klein, A r t . 65 A n m . 5 (S. 1266 ff.); F. Klein, i n : Schmidt-Bleibtreu / Klein, A r t . 65 A n m . 6; E. Guilleaume, Das Kabinettssystem, D Ö V 1961, S. 449 ff.; vgl. auch K . Schumann, Regierungssystem Schweiz, S. 194 ff. 3 Vgl. V. Renner, i n : JöR, n. F. Bd. 7 (1958), S. 215 f.; G. Müller, i n : Der Staatsanzeiger BW, 1958, Nr. 30, S. 2; vgl. i m übrigen bereits Verhandlungen der V L V , S. 2467 ff. Z u r Verfassungsinterpretation allgemein vgl.: BVerfGE 11, 126, 130; K . Larenz, Methodenlehre, S. 141 ff.; K . Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, § 2 je m. w. N.
76
Kap. I I : Regierungssystem nach der bad.-württ. L V
Betrachtet man allerdings — abgesehen von A r t . 49 — die Ausgestaltung der Stellung des Kabinetts (vgl. A r t . 30 IV, 43 I, 45 I I I , 50, 60 II, I I I , 61, 62, 70 II, 80 I und 82 LV), so w i r d deutlich, daß auch und gerade i n grundsätzlichen Fragen die recht bedeutsame Stellung des Ministerrats verfassungsrechtlich durch A r t . 49 I S. 1 L V nicht wieder aufgehoben werden kann. Diese systematische Interpretation w i r d noch durch die über diese Fragen geführten Beratungen i m Ausschuß der verfassungsgebenden Landesversammlung untermauert 4 . Schließlich läßt auch eine vergleichende Auslegung keinen andern Schluß zu. Die Ausgestaltung des Kollegialprinzips und damit die (insgesamt gesehene) Stellung des Kabinetts innerhalb des Regierungssystems ist i n Bad.-Württ. i m Vergleich zu den anderen Ländern und vor allem zum Bund wesentlich umfassender 5 . Aus vergleichender Sicht kann deshalb die stärkere Betonung und Stellung des Kabinetts nicht angezweifelt werden. Versucht man nun weiter zu diesem Problem den subjektiven Willen des Normgebers zu ergründen, so stößt man ebenfalls auf erhebliche Schwierigkeiten. Zwar waren sich alle Parteien der verfassungsgebenden Landesversammlung darüber einig, die Stellung des Ministerpräsidenten nicht zu sehr zu stärken 6 , doch bestanden über das Ausmaß und vor allem auch über die verfassungsrechtliche Frage des Verhältnisses von Abs. 1 zu Abs. 2 des A r t . 49 L V wesentliche Meinungsunterschiede7. Die CDU-Fraktion stellte i n der 58. Sitzung der V L V (3. Lesung) zu dem heutigen A r t . 49 I I L V (im Entwurf A r t . 47), u m A r t . 49 I L V nicht völlig „ins Leere" laufen zu lassen, sondern dem Ministerpräsidenten eine gewisse Führungsposition einzuräumen, den Zusatzantrag, diese Bestimmung u m die Worte „Unbeschadet der Bestimmung i n Abs. 1 Satz 1 . . . " zu ergänzen 8 . Dieser Antrag hätte zweifellos die Stellung des Ministerpräsidenten gestärkt, aber keinesfalls alle Ausle4
Vgl. dazu die Fundstellen i n Fußnoten 1 1 - 1 3 und insbes. 14 oben § 11. Vgl. die Fundstellen i n Fußnoten 10 u n d 11 (§ 11). Darüber hinaus kann — was eigentlich naheliegen w ü r d e — f ü r das zu lösende Problem auch nichts aus den v o r dem 19.11.1953 i n Bad.-Württ. geltenden Verfassungen (einschließlich deren Interpretation) entnommen werden (vgl. etwa den W o r t laut der A r t . 72 u n d 77 der Württ.-Bad. L V u n d die Kommentierung dazu bei R. Nebinger, K o m m , zur Verfassung f ü r Württ.-Bad.). Eine gewisse Ausnahme stellt allerdings A r t . 56 der Verfassung f ü r Württ.-Hohenz. dar; dort ist bestimmt, daß u. a. Fragen von grundsätzlicher oder weittragender Bedeut u n g der Regierung zur Beratung u n d zum Beschluß zu unterbreiten sind. 6 Vgl. dazu oben § 11, insbes. Fußnoten 12 - 14. 7 Vgl. insbes. Verhandlungen der V L V , S. 2467 ff. (3. Lesung), aber auch S. 2306ff. (2. Lesung); vgl. zum ganzen auch P. Feuchte, i n : S p r e n g / B i r n / Feuchte, S. 180 - 182. 5
8
Vgl. Ausführungen der ABG. V L V , S. 2467 f. u n d 2468 f.
Gog u n d G. Müller,
Verhandlungen der
§ 12 Das Verhältnis von „ K a n z l e r - u n d Kabinettsprinzip"
77
gungsprobleme beseitigt 9 . Aus der letztlichen Ablehnimg dieses Antrags kann zwar nicht allzu viel, aber doch die mehrheitliche Meinimg des Verfassungsgebers entnommen werden, daß der Abs. 2 dem Abs. 1 (Art. 49 LV) keinesfalls unterzuordnen ist. Das Verhältnis dieser beiden Bestimmungen zueinander kann demnach nicht so aussehen, daß das Kabinett zu allen grundsätzlichen und wichtigen Angelegenheiten nur „formell" seine Zustimmung gibt, während „materiell" der M i n i sterpräsident i m Rahmen seiner Richtlinienkompetenz allein entscheidet. Andererseits kam aber selbst bei den Verfechtern der jetzt geltenden Fassung des A r t . 49 L V i n der 3. Lesung deutlich zum Ausdruck, daß durch Abs. 2 ebensowenig die Richtlinienkompetenz des Abs. 1 völlig ausgehöhlt werden darf. Vielmehr haben die Vertreter von SPD (Abg. Renner) und FDP/DVP (Abg. Gönnenwein) übereinstimmend die Auffassung vertreten, daß die Richtlinien- und Kabinettsentscheidung nebeneinanderstehen und i m äußersten Konfliktsfall der konkrete Zuständigkeitsstreit der Regierungsorgane auf politischer Ebene und, wenn es nicht anders geht, sogar vor dem Staatsgerichtshof auszutragen ist; gegebenenfalls müßte man deshalb i n letzter Konsequenz auch eine Staatskrise i n Kauf nehmen 10 . Diese Auffassung der Mehrheit der Verfassungsgebenden Landesversammlung (VLV) kann zwar staatspolitisch durchaus sinnvoll und richtig sein, was sich i n der Tat auch i n der Praxis der letzten 20 Jahre gezeigt und damit bewährt hat 1 1 , ist aber verfassungsrechtlich keinesfalls befriedigend. Eine praktikable und befriedigende Lösung dieses verfassungsrechtlichen Problems ist bisher allerdings noch nicht gefunden worden und w i r d i n letzter Konsequenz rechtlich auch kaum zu finden sein 12 . Trotzdem soll ver9
Vgl. ABG. Gönnenwein, i n : Verhandlungen der V L V , S. 2468. So die Mehrheit der V L V ; vgl. ABG. Renner, i n : Verhandlungen der V L V , S. 2468; ABG. Gönnenwein, ebenda, S. 2468 u. 2469; diese Äußerungen dürften insoweit die Zitate i n den Fußnoten 11 u n d 14 des § 11 teilweise modifizieren. 11 I n den Kabinetten G. Müller (7.10.1953 - 17.12.1958), K. G. Kiesinger (17.12.1958 - 16.12.1966) u. H. Filbinger (16.12.1966 - heute) hat dieses Problem des A r t . 49 I u n d I I L V praktisch keine Rolle gespielt. Das Recht des Ministerpräsidenten aus A r t . 49 I 1 L V w i r d n u r äußerst selten u n d auch dann n u r mehr verbal i m K a b i n e t t bemüht (Beispiel etwa: i m K a b i n e t t G. M ü l l e r bei der Frage der Konfessionalität der Pädagogischen Hochschulen). K o n f l i k t e wurden u n d werden stets auf politischer Ebene beigelegt, wobei aber i n politisch wichtigen Grundsatzfragen noch nie gegen die dezidierte Auffassung des Ministerpräsidenten entschieden wurde (so übereinstimmende Interviews). I m M a i 1953 führte diese Frage allerdings einmal unter dem Ministerpräsidenten R. Maier zu einer Kabinettskrise, als dieser unter Berufung auf A r t . 49 I 1 L V entgegen einem Mehrheitsbeschluß des Ministerrats i m Bundesrat für den E V G - V e r t r a g stimmte (vgl. oben § 11 Fußnote 14 u. G. Müller, i n : Der Staatsanzeiger B W 1958, Nr. 30, S. 2). 12 Vgl. etwa V. Renner, i n : JöR, n. F. Bd. 7 (1958), S. 2151; G. Müller, i n : Der Staatsanzeiger B W 1958, Nr. 30, S. 2. 10
78
Kap. I I : Regierungssystem nach der bad.-württ. L V
sucht werden eine vertretbare Meinung zu diesem Problem zu entwickeln. Dazu sollen i m folgenden vorweg die dazu bisher veröffentlichten Auffassungen dargestellt werden. 3. Bisherige Lösungsversuche P. Feuchte 13 kommt bei seiner Untersuchung des Problems zu dem Ergebnis, daß auch i n Fragen von grundsätzlicher oder weittragender Bedeutung die Richtlinienkompetenz des Ministerpräsidenten voll einzuhalten ist. Er führt dazu u. a. aus: „ I n der Praxis kann das Kabinett nur das Recht der einzelnen Minister, ihr Ressort selbständig zu leiten, beschränken. Die Befugnis des Ministerpräsidenten, die Richtlinien der Politik zu bestimmen, kann es nicht antasten". Diese Auffassung bedeutet — etwas überspitzt ausgedrückt —, daß A r t . 49 II, aber auch etwa A r t . 45 I I I (Organisationsgewalt) und A r t . 59 I (Gesetzesinitiative), überhaupt die ganze Ausgestaltung des oben beschriebenen Kabinettsprinzips materiell völlig „ausgehöhlt" wäre und sogar das Kanzlerprinzip durch eine solche Auslegung i n der Landesverfassung noch stärker ausgeprägt sein würde als etwa i m Grundgesetz. Aus dem dargestellten systematischen Gesamtzusammenhang, vor allem aus der eingehend beschriebenen Entstehungsgeschichte der einschlägigen Bestimmungen (insbes. A r t . 49 LV) ergibt sich aber, daß diese Auffassung, mindestens i n ihrer sehr einseitigen Entscheidung zugunsten der Richtlinienkompetenz (Art. 49 I S. 1 LV), nicht aufrecht erhalten werden kann 1 4 . Eine andere Meinung kommt zu dem Ergebnis, daß „ . . . vollends das Recht der Regierung, über Fragen von grundsätzlicher oder weittragender Bedeutung zu beschließen, weitgehend eine Wiederaufhebung des i n Abs. 1 festgelegten Richtlinienrechts bedeutet" 1 5 . Abs. 2 soll also Abs. 1 des A r t . 49 L V vorgehen und diese Bestimmung gewissermaßen überlagern. Dieser Auffassung dürfte folgende Argumentation zugrunde liegen: Die Richtlinienkompetenz ist nach ganz herrschender Meinung nicht schrankenlos, sondern durch die verfassungsmäßige Ordnung begrenzt. Der Regierungschef ist demnach an das Grundgesetz bzw. die Landesverfassung und grundsätzlich auch an die sonsti13 P. Feuchte, i n : Spreng/ B i r n / Feuchte, S. 179 ff., 182; nicht ganz u n i n t e r essant ist f ü r diesen führenden Kommentar zur L V dabei, daß alle drei V e r fasser i m Jahr 1954 bei dessen Abfassung i m Staatsministerium (Staatskanzlei) beschäftigt waren. 14 Vgl. dazu oben, insbes. Fußnoten 4, 8 - 1 0 ; V. Renner, i n : JÖR, n. F. Bd. 7 (1958), S. 215 f.; G. Müller, i n : Staatsanzeiger B W 1958, Nr. 30, S. 2; a. A . etwa auch: K . Göbel, Verfassung des Landes BW, S. 63 f. 15 So K . Göbel, Die Verfassung des Landes Bad.-Württ., S. 63, 64 (allerdings ohne nähere Begründung).
§ 12 Das Verhältnis von „Kanzler- und Kabinettsprinzip"
79
gen Gesetze gebunden 16 . Daraus folgt, daß z. B. ein vom Regierungschef für notwendig gehaltener Gesetzentwurf von allgemeiner Bedeutung nur dann zur Regierungsvorlage wird, wenn er von der Mehrheit der Kabinettsmitglieder gebilligt w i r d (Art. 76 GG; A r t . 59 I L V ) 1 7 . Ob dabei der Regierungsbeschluß nur den Charakter eines „formellen" Zustimmungsaktes hat, also die Richtlinienkompetenz des Regierungschefs kaum berührt, oder aber „materiell" vom Kabinettskollegium beraten, angenommen und auch getragen wird, den Richtlinien des Regierungschefs also vorgeht, ist umstritten 1 8 . U m das Ergebnis der hier vorgetragenen Meinung von Göbel zu stützen, muß die zweite Auffassung vertreten werden, wonach die Entschließungsfreiheit der Minister i n den nach der L V dem Ministerrat zur Beschlußfassung vorzulegenden Angelegenheiten i n keiner Weise durch die Richtlinienkompetenz des Ministerpräsidenten eingeengt werden darf. Ob diese Meinung nach der Regelung des Grundgesetzes zutreffend ist, braucht hier nicht entschieden zu werden 1 9 ; sie würde aber, insbes. i m Hinblick auf A r t . 49 I I L V , i n Bad.-Württ. bei einer strengen Anwendung praktisch zu einer Aushöhlung der Richtlinienkompetenz führen. Obwohl diese Meinung vom Ansatz her als zutreffend angesehen werden muß, ist sie doch i n der Ausprägung von K . Göbel, also i n ihrem Ausmaß der Betonung des Kollegialprinzips und der dadurch bedingten faktischen Aufhebung des A r t . 49 I L V , dem wesentlichsten Faktor des Kanzlerprinzips, aufgrund des durch eine systematische Betrachtung gewonnenen Gesamtzusammenhangs der Struktur des Regierungsbereichs (Art. 45 ff. LV), vor allem aber aufgrund der Entstehungsgeschichte des A r t . 49 I I L V , dem subjektiven Willen des Verfassungsgebers, hier nicht vertretbar 2 0 . 16 Vgl. von Mangoldt / Klein, A r t . 65 I I I l a u. I I I 3 c; A. Hamann, i n : H a m a n n / L e n z , A r t . 65 A n m . B 3; T. Maunz, i n : Maunz / D ü r i g / Herzog, A r t . 65 A n m . 2; U. Scheuner, i n : Festgabe für R. Smend, 1952, S. 282; K . H. Friauf, i n : Festgabe f ü r H. Herrfahrdt, S. 50 f. u. 59 je m. w. N.; K. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, § 17 I I I . 17 Vgl. K . H. Friauf, S. 50/51. Auch bei Stimmengleichheit hat der Ministerpräsident i n Bad.-Württ. keinen Stichentscheid. 18 Vgl. dazu die eingehenden Ausführungen bei K . H. Friauf, S. 50 ff. u n d F. Knöpfle, DVB1. 1965, S. 928 ff. j e m. w. N. F ü r eine „materielle" Entscheidung des Kabinetts w o h l auch A r t . 56 Württ.-Hohenz. L V . 19 Vgl. hierzu allerdings § 15 der GeschO der Bundesregierung! Z u r v e r fassungsrechtlichen Relevanz dieser Bestimmung vgl. etwa T. Maunz, i n : Maunz / D ü r i g / Herzog, A r t . 65 A n m . 5; von Mangoldt / Klein, A r t . 65, V I ; Lechner / Hülshoff, Parlament u n d Regierung, G 4, § 15 A n m . 4; E. 17. Junker, Richtlinienkompetenz, S. 119 f. u. auch E.-W. Böckenförde, Organisationsgewalt, S. 209 f. (die dort vertretene Auffassung ist bei der verfassungsrechtlichen Ausgestaltung des Regierungssystems i n Bad.-Württ. nicht haltbar). 20 Vgl. oben Fußnoten 4 sowie 8 - 10. Siehe auch G. Müller, i n : Staatsanzeiger B W 1958, Nr. 30, S. 2.
80
Kap. I I : Regierungssystem nach der bad.-württ. L V
4. Bestehende Auslegungsschwierigkeiten Bevor der Versuch einer eigenen Lösung des Problems, wie die Grenzziehung zwischen Richtlinienkompetenz und Kabinettszuständigkeit allgemein und das Verhältnis von Abs. 1 und Abs. 2 des A r t . 49 der L V speziell zu bestimmen sind, unternommen wird, bedarf es vorweg folgender grundsätzlicher Bemerkungen 2 1 : — Das hier zu entscheidende Problem ist zwar ein verfassungsrechtliches, doch hängt letztlich die Ausgestaltung und Machtverteilung innerhalb des Regierungsbereichs i n besonderem Maße von der Person, dem persönlichen Gewicht, den Führungsqualitäten usw. des Regierungschefs und den besonderen Bedingungen der Regierungszusammensetzung (Ministerpersönlichkeiten, Koalition) ab. Die persönliche Komponente stellt demnach einen ganz wesentlichen Einflußfaktor dar. — Neben diesem Faktor spielt weiter eine wichtige Rolle, wie und i n welchem Umfang auf die Gesamtregierung und ihre Mitglieder von außen eingewirkt wird. Dabei handelt es sich vor allem entsprechend der tatsächlichen Machtverteilung u m Einflüsse aus dem politischen (Regierungsparteien und -fraktionen, Koalitionsvereinbarungen usw.), aber auch aus dem Bereich der Interessenverbände und der Gesellschaft ganz allgemein. — Da diese beiden vorstehend genannten Faktoren keine feststehenden Größen sind, sondern ihre Bedeutung und ihren Einfluß ständig verändern, erscheint auch die Regierungsstruktur fortwährend i n neuer Gestalt. Diese Dynamik macht es der Staatsrechtslehre äußerst schwer, für das Problem des A r t . 49 I und I I L V eine eindeutige und präzise Lösung zu finden. — Hinzu kommt, daß die Konturen dieser Norm, die i n Bad.-Württ. auch nicht durch eine Geschäftsordnung näher bestimmt ist 2 2 , durch die Begriffe „Richtlinien", „Politik", „bestimmen", „insbesondere", „Fragen von grundsätzlicher oder weittragender Bedeutung" recht unscharf festgelegt sind, was zum Teil durchaus bewußt erfolgte, 21 Vgl. zum ganzen etwa T. Maunz, i n : Maunz / D ü r i g / Herzog, A r t . 65 A n m . 5; K . Sontheimer, Grundzüge des pol. Systems, S. 165; T. Ellwein, Regierungssystem, S. 324 ff.; K . Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, § 17 I I I ; E. Stein, Staatsrecht, S. 82 f.; F. Knöpfle, i n : DVB1. 1965, S. 928 - 930; K . H. Friauf, i n : Festgabe für H. Herrfahrdt, S. 52 ff.; E. U. Junker, Richtlinienkompetenz, S. 117 ff.; S. Schöne, Bundeskanzleramt, S. 152; W. Hennis, Richtlinienkompetenz u n d Regierungstechnik, S. 41. 22 Bad.-Württ. ist w o h l das einzige Land, i n dem die Regierung noch keine Geschäftsordnung erlassen hat. Obwohl einige GeschO-Entwürfe erarbeitet wurden, hält es die Regierung nach wie vor nicht f ü r sinnvoll, den Verfassungsauftrag des A r t . 49 I S. 2 L V zu erfüllen (der letzte E n t w u r f wurde A n fang 1974 erarbeitet). Vgl. dazu insbesondere auch unten § 21.
§ 12 Das Verhältnis v o n „ K a n z l e r - u n d Kabinettsprinzip"
81
u m die präzise Ausgestaltung, einer gewissen Flexibilität wegen, der politischen Praxis zu überlassen. Die Ermittlung des Sinns solcher Bestimmungen nur m i t Hilfe der üblichen hermeneutischen Methoden bereitet demzufolge erhebliche Schwierigkeiten und macht eine Grenzziehung zwischen Richtlinienkompetenz und K a b i nettszuständigkeit rechtlich fast unmöglich. — Auch die Praxis h i l f t alles andere als zur rechtlichen Klärung dieses Problems beizutragen. Konflikte, die i m Spannungsverhältnis von Regierungschef und Ministerrat auftreten, werden fast ausschließlich auf politischem Weg i m Kabinett und unter Ausschluß der Öffentlichkeit beigelegt. Daß etwa ein Regierungschef i m Kabinett bei politisch wichtigen Fragen gegen seine dezidierte Auffassung überstimmt wird, ist ein sehr unwahrscheinlicher, mehr theoretischer Fall. Sieht es i n der Beratung so aus, daß der Regierungschef je einmal für einen solchen Antrag nicht die Mehrheit finden könnte, so w i r d die Entscheidung über den Antrag vertagt etc. und es unterbleibt eine Abstimmung 2 3 . Die verfassungsrechtlich vorgesehenen Möglichkeiten zur Lösung solcher evtl. auftretenden Streitigkeiten, nämlich einmal die Rechtslage durch das Verfassungsgericht klären zu lassen (Organstreitverfahren; A r t . 93 I Nr. 1 GG; A r t . 68 I Nr. 1 LV) und zum anderen auch die Entlassung von M i nistern durch den Regierungschef (Art. 64 I GG; A r t . 46 I I LV) auszusprechen, sind kaum von praktischer Bedeutung. I n Bad.Württ. sind beide Möglichkeiten noch nie aktuell geworden. Der Hauptgrund dürfte darin liegen, daß ein solcher Schritt beim Wähler ein ungünstiges Licht auf Geschlossenheit und Solidarität der Regierung werfen könnte. Die öffentliche Meinung verhindert faktisch also ein offenes Austragen solcher Konflikte. Die „politische Vernunft" gebietet deshalb sogar — etwas übertrieben ausgedrückt — das Spannungsproblem des A r t . 49 I S. 1 zu A r t . 49 I I L V möglichst flexibel und damit verfassungsrechtlich „verschwommen" zu halten 2 4 . Diese Vorbemerkungen zeigen i n aller Deutlichkeit, daß das hier zur Lösung heranstehende Problem äußerst komplex, schwierig und i n voller Klarheit nicht zu bewältigen sein wird. Trotz oder gerade wegen dieser Schwierigkeiten entbinden vorstehende Ausführungen die Staatsrechtslehre aber nicht der Aufgabe, u m die Abgrenzung der „Sphären" des A r t . 49 L V bemüht zu bleiben. Vor allem das Rechts28 Dies stellt auch i m Prinzip die i n Bad.-Württ. bestehende Praxis dar; vgl. die Nachweise i n Fußnote 11. 24 Diese Ausführungen sind nicht als V o r w u r f an die Politiker gemeint, sondern sollen die Schwierigkeiten f ü r eine verfassungsrechtliche Lösung aufzeigen.
6 Katz
Kap. I I : Regierungssystem nach der bad.-württ. L V
82
staatsprinzip gebietet eine möglichst eindeutige Bestimmung des Inhalts und der Grenzen eigener und fremder Kompetenzen; dies „nicht zuletzt deshalb, weil auf diesem Teilgebiet des Staatsrechts wegen des kleinen Kreises Beteiligter, wegen der Singularität der Beziehung eines Regierungschefs zu seinem Kabinett, eine gewisse Tendenz besteht, faktische Übungen und Konventionairegeln unbeschadet ihrer etwaigen verfassungsrechtlichen Bedenklichkeit schon nach verhältnismäßig kurzer Zeit als Gewohnheitsrecht anzuerkennen, wenn gegen sie von keiner Seite rechtliche Vorbehalte erhoben werden" 2 5 . 5. Eigene Lösung Ausgangspunkt der eigenen Lösung muß einmal die i n der Verfassungsordnung insgesamt zum Ausdruck kommende Stellung und Ausgestaltung der Regierung (Regierungssystem) und zum anderen der subjektive Wille des Verfassungsgebers (Entstehungsgeschichte des A r t . 49 LV) sein, wobei der objektiven Verfassungsinterpretation der Vorrang einzuräumen ist 2 6 . Aus den dazu oben gemachten eingehenden Ausführungen, ergibt sich eindeutig und unzweifelhaft, daß jede der Bestimmungen des A r t . 49 L V so ausgelegt werden muß, daß ihr „materiell" eine gewisse Bedeutung zukommt, sie also verfassungsrechtlich nicht völlig bedeutungslos bleibt. Deshalb ist es keinesfalls zulässig, das Spannungsverhältnis zwischen Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 i n A r t . 49 L V so zu lösen, daß nur eine der beiden Vorschriften angewandt w i r d u n d damit rechtlich relevant ist, die andere aber überhaupt nicht zum Zuge kommt 2 7 . Daraus ergibt sich, daß eine Auslegung dieser Bestimmungen nur so erfolgen darf, daß für jede von ihnen ein Kernbereich erhalten bleiben muß. Sowohl für die Richtlinienkompetenz als auch für die Kabinettszuständigkeit (Art. 49 LV) muß ein „Wesensgehalt" garantiert sein 28 . Dieser verfassungsrechtlich so vorgegebene „Rahmen" stellt das Grundgerüst für die Lösung des Problems dar. Eine solche grundsätzliche Regelung ist mindestens teilweise bewußt so getroffen worden, u m die konkrete Ausgestaltung des Verhältnisses 25
So F. Knöpfle, i n : DVB1. 1965, S. 930 m . w . N. Dabei können hier aber weder die grammatische noch die vergleichende Auslegung wesentliche Dienste leisten. Die Ausgestaltung u n d vor allem Grenzziehung zwischen Kanzler- u n d Kollegialprinzip ist i n keiner Verfassung u n d a m wenigsten i m GG gleich geregelt wie i n Bad.-Württ. (am ähnlichsten ist noch die Regelung i n Niedersachsen). Vgl. dazu BVerfGE 1, 299, 312; 36, 342, 367. 27 So P. Feuchte, i n : Spreng / B i r n / Feuchte, S. 182; i m Ergebnis ähnlich F. Knöpfle, DVB1. 1965, S. 929 f. Vgl. dazu insbes. Verhandlungen der V L V , S. 2467 ff. u n d weitere Fundstellen i n den Fußnoten 4 u n d 8 - 10. 28 Eine entsprechende, i n etwa vergleichbare Argumentation findet sich bei der gegenseitigen Einflußnahme der „ d r e i Gewalten" i m Rahmen des Gewaltenteilungsgrundsatzes (vgl. BVerfGE 9, 268, 279 f.; 22, 106, 111). 28
§ 12 Das Verhältnis von „ K a n z l e r - u n d Kabinettsprinzip"
83
von Ministerpräsident und Kabinett der zukünftigen politischen Entwicklung zu überlassen und diesem die Möglichkeit einer gewissen Flexibilität zu geben 29 . Der Verfassungsgeber ging dabei allerdings sicher davon aus, daß dieser i n A r t . 49 I und I I L V festgelegte „Rahmen" durch die Geschäftsordnung der Landesregierung ausgefüllt und präzisiert wird. Dies kommt etwa dadurch zum Ausdruck, daß gemäß A r t . 49 I S. 3 L V ausdrücklich ihre öffentliche Bekanntmachung vorgeschrieben wurde 3 0 . Eine Geschäftsordnung ist bis heute aber nicht erlassen worden 3 1 . Aufgrund dieser Tatsache muß die staatsrechtliche Präzisierung der i n A r t . 49 I und I I L V getroffenen Grundentscheidung („Rahmenausfüllung") i m wesentlichen aus der vom Verfassungsgeber festgelegten gesamten Organisationsstruktur des Regierungsbereichs und den dabei erkennbaren und ableitbaren Tendenzen entnommen werden. Anknüpfend an die wiederholt gegebene Darstellung (mit umfassend angeführten Fundstellen) der der Landesverfassung zugrunde liegenden Regierungsstruktur, wie sie i n der Verfassung verwirklicht wurde und sich aufgrund der Entstehungsgeschichte darstellt 3 2 , ist festzustellen, daß i m Vergleich zu den anderen Ländern und besonders zum Bund die Landesverfassung das Kollegialprinzip besonders stark berücksichtigt und herausgestellt hat. A l l e Parteien der verfassungsgebenden Landesversammlung stimmten darin überein, daß das Kabinettsprinzip, eine kollegiale Beratung und Beschlußfassung, möglichst weitgehend verwirklicht werden soll 3 3 . Dies ist u. a. besonders deutlich i n A r t . 45 I I I und 49 I I L V erfolgt. Selbst i m Jahr 1970 bei den parlamentarischen Beratungen über die Neufassung des A r t . 45 I I I L V wurde, was i m Hinblick auf die Bedeutung, die der Organisationsgewalt des Bundeskanzlers i m Regierungsbereich (als Ausfluß der Richtlinienkompetenz u. des A r t . 64 GG) mindestens i n der wissenschaftlichen Diskussion beigemessen w i r d 3 4 , eigentlich erstaunt, von 29 Vgl. etwa bes. Verhandlungen der V L V , S. 2467 ff. u n d P. Feuchte, i n : Spreng / B i r n / Feuchte, S. 181. 30 Vgl. dazu u. a. Protokolle des V A , 14. Sitzung, S. 38 u n d 39. 31 Z u r Begründung w i r d dabei vorgebracht, daß die Kabinettsarbeit bisher auch ohne GeschO reibungslos von statten ging. Ob dies einen G r u n d für den Nichterlaß einer GeschO darstellt, wenngleich sich ein solcher offensichtlich letztlich p r i m ä r zulasten der einzelnen Minister auswirken dürfte, soll hier nicht geprüft werden. Sollen allerdings i n einer GeschO, wie dies i n den bisher erarbeiteten zwei E n t w ü r f e n (der letzte von Anfang 1974) der F a l l ist, n u r bereits feststehende oder unverbindliche Dinge aufgenommen u n d keine „heißeren Eisen" angefaßt werden, so wäre i n der Tat der Sinn u n d Wert einer GeschO fragwürdig. Vgl. hierzu etwa § 15 der GeschO der Bundesregierung; außerdem unten § 21. 32 Vgl. die Fundstellennachweise insbes. i n den Fußnoten 11 - 14 (§ 11). 33 Ebenda (wie Fußnote 32; vgl. insbes. Fußnote 14 i n § 11) u n d oben Fußnote 10 (§ 12). 6*
84
Kap. I I : Regierungssystem nach der bad.-württ. L V
keiner Seite der Wunsch geäußert oder gar der Antrag gestellt, die Festlegung und Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien dem Ministerpräsidenten allein zu übertragen. Vielmehr wurde übereinstimmend als selbstverständlich und unstrittig davon ausgegangen und dann auch beschlossen, daß der Landesregierung, dem Kollegium, insoweit das volle Organisationsrecht zusteht, wobei sich der Landtag noch ein Zustimmungsrecht vorbehalten hat 3 6 . Dies zeigt, daß dem Parlament auch i m Jahr 1970 noch an einer starken Ausprägung des Kabinettsprinzips gelegen war. Die hier vorgetragenen Argumente führen zu dem Zwischenergebnis, daß u. a. i n allen konkreten Fragen von grundsätzlicher und weittragender Bedeutung eine Vermutung für eine entsprechend materielle, nicht nur formelle, Beschlußfassimg durch den Ministerrat besteht. Die Richtlinienkompetenz des Ministerpräsidenten (Art. 49 I S. 1 LS) w i r d demnach grundsätzlich von A r t . 49 I I L V überlagert. Dasselbe gilt für A r t . 49 I S. 4 L V ; die Selbständigkeit der Minister (Ressortprinzip) ist insoweit ebenfalls eingeschränkt. U m aber dem A r t . 49 L V , vor allem dem Spannungsverhältnis zwischen Abs. 1 S. 1 und Abs. 2, v o l l gerecht zu werden, muß diese grundsätzliche Vermutung zugunsten der Kabinettszuständigkeit i n den vorgenannten Angelegenheiten durch „Ausnahmen" modifiert und ergänzt werden. Dabei ist, was oben näher ausgeführt wurde, zu berücksichtigen, daß durch diese Ausnahmen dem A r t . 49 I S. 1 L V materiell mindestens ein solcher Inhalt verbleiben bzw. zukommen muß, der noch einen echten Kernbereich der dort festgelegten Richtlinienkompetenz gewährleistet. Dies ist aber nur dann möglich, wenn es Angelegenheiten gibt, i n denen auch der Regierungschef letztlich allein entscheidet. Anhand der Materialien zur L V (subjektiver Wille des Normgebers), aufgrund der ratio der A r t . 45 - 57 L V , sowie dem Erfordernis eines effektiven und funktionsfähigen Regierungssystems sind nun solche Fälle bzw. Fallgruppen i m einzelnen herauszuarbeiten. Die Zuständigkeitsvermutung zugunsten des Ministerrats ist deshalb i n folgenden Ausnahmefällen von der Richtlinienkompetenz des Ministerpräsidenten überlagert: (1) Nach der ganz herrschenden Meinung, die allerdings von der grundgesetzlichen Regelung ausgeht, ist der Regierungschef i m Rah84 Vgl. statt aller: E.-W. Böckenförde, Organisationsgewalt, S. 129 ff.; J. Kölble, D Ö V 1973, S. 1 ff. m . w . N . ; von Mangoldt / Klein, A r t . 62 A n m . I I I 5. 36 Vgl. dazu Verhandlungen des Landtags, 5. Wahlperiode, S. 4670 f. (2. L e sung), S. 5035 ff. (3. Lesung); weiter schriftl. Bericht über die Beratungen des ständigen Ausschusses, Verhandlungen, 5. Wahlperiode, S. 4682 ff. I n t e r essanterweise ging die I n i t i a t i v e zur Änderung des A r t . 45 I I I L V v o n der Opposition (FDP/DVP) aus; vgl. Drucksache Nr. 2321 (5. Wahlperiode).
§ 12 Das Verhältnis von „ K a n z l e r - u n d Kabinettsprinzip"
85
men der Richtlinienkompetenz befugt, i n allen wichtigen und grundsätzlichen Fragen verbindlich generelle Anweisungen zu geben. Darüber hinaus kann der Regierungschef i n den Fällen Einzelanordnungen treffen, i n denen das „Prinzipielle" seinen Sitz i n einer konkreten Sachfrage selbst hat 8 6 . Diese relativ weite Auslegung der Richtlinienkompetenz kann nicht ungeprüft auf das Land Bad.-Württ. übernommen werden. Vielmehr ergibt sich bei einer Zusammenschau aller Bestimmungen zur Regierungsstruktur und einer historischen Interpretation 8 7 , daß der Richtlinienkompetenz des A r t . 49 I S. 1 L V zugunsten einer stärkeren Ausgestaltung des Kollegialprinzips wesentlich engere Grenzen gezogen sind. Für die Richtlinienkompetenz des A r t . 49 L V ist das Merkmal der „Allgemeinbezogenheit" unabdingbar; es muß sich dabei u m eine generelle Anordnung handeln, die auf Ausfüllung angelegt ist, innerhalb der also dem Kabinett bzw. dem zuständigen Minister ein beträchtlicher Spielraum für eine eigenständige konkrete Ausgestaltung und Entscheidung verbleibt 8 8 . Eine solch generelle Regelung, die das Recht der konkreten Ausgestaltung durch das Kabinett (in den Fällen des A r t . 49 I I LV) bzw. den zuständigen Minister (in den übrigen Fällen) nicht über diese generellen „Richtlinien" hinaus beeinträchtigt, stellt primär die Regierungserklärung (Regierungsprogramm) dar. I n ihr werden die Grundsätze und Zielvorstellungen der Regierungsarbeit für eine Legislaturperiode festgelegt. Die Regierungserklärung, die das Grundsatzprogramm enthält, stellt damit schlechthin für die Regierungsarbeit des Kabinetts und der Minister die verbindliche Richtlinie des Ministerpräsidenten dar, die jedes Mitglied der Regierung bei seiner Tätigkeit zu beachten hat. Da sie naturgemäß teilweise jedoch sehr vage abgefaßt sein wird, 36 T. Maunz, i n : Maunz / D ü r i g /Herzog, A r t . 65 A n m . 2; A. Hamann, i n : Hamann /Lenz, A r t . 65 B 1; von Mangoldt / Klein, A r t . 65 A n m . I I I ; E.-W. Böckenförde, Organisationsgewalt, S. 206 f.; F. Knöpfle, DVB1. 1965, S. 857ff.; K . H. Friauf, i n : Festgabe f ü r H. Herrfahrdt, S. 50; K . Stern, i n : P r o j e k t gruppe B M I , Erster Bericht, Anlagenband, S. 577ff.; J. Kölble, D Ö V 1973, S. 8 f. je m. w. N. 37 Vgl. dazu oben Fußnoten 32 u n d 33; dazu hat u.a. der ABG. Renner, i n : Verhandlungen der V L V , S. 2468, ausgeführt: „ . . . Das Recht die Richtlinien der P o l i t i k zu bestimmen, ist nicht das Recht, i m konkreten Fall, je nach Bedarf, zu entscheiden, sondern es ist das Recht, das Programm der Regierung festzulegen, den Weg aufzuzeigen, den die Regierung zu gehen hat." 38 Der Rahmengesetzgebung i n manchen Punkten ähnlich. Vgl. dazu etwa T. Maunz, i n : B a y V w B l . 1966, S. 260 f.; K . ff. Friauf, i n : Festgabe f ü r H. Herrfahrdt, S. 50 m. w . N.; V. Renner, i n : JöR n. F. Bd. 7 (1958), S. 215 f.; vgl. vor allem auch E. U. Juncker, Richtlinienkompetenz, S. 117-120 (Juncker f ü h r t dort unter Hinweis auf § 15 GeschO der Bundesregierung aus, daß z w i schen Richtlinien m i t allg. Zielsetzung u n d konkreter kollegialer Beratung und Beschlußfassung unterschieden werden muß. Ob dies auf Bundesebene richtig ist, mag dahingestellt bleiben; i n Bad.-Württ. ist dies jedenfalls besonders i m Hinblick auf A r t . 49 I I L V i m Prinzip zutreffend).
86
Kap. I I : Regierungssystem nach der bad.-württ. L V
kann sie später noch verdeutlicht und ergänzt werden, allerdings nur unter den Voraussetzungen, daß darüber schon ein Anhaltspunkt i n der ersten Regierungserklärung enthalten ist 3 9 und daß einer konkreten Ausgestaltung noch Raum verbleibt. I n begründeten i. d. R. nicht vorhersehbaren Ausnahmefällen kann von der ersten der vorgenannten Voraussetzungen allerdings abgesehen werden (z. B. Energiekrise). A u f die zweite Voraussetzung kann dagegen nicht verzichtet werden. Vielmehr unterliegt jede konkrete Angelegenheit von grundsätzlicher oder weittragender Bedeutung usw., auch wenn die zu entscheidende Sachfrage noch so sehr i m „Prinzipiellen" oder „Politischen" liegt, der Beschlußfassung des Kabinetts. Die Verfassungsgebende Landesversammlung hat dies i m Rahmen des A r t . 49 L V bei der Kabinettszuständigkeit für die Beschlußfassung über die Stimmabgabe des Landes i m Bundesrat ausdrücklich entschieden. Weil damals die Frage, ob die Stimmabgabe i m Bundesrat aufgrund eines entsprechenden Kabinettsbeschlusses oder einer Entscheidung des Regierungschefs zu erfolgen hat, unklar und streitig w a r 4 0 , sollte sie i n A r t . 49 I I L V eindeutig positivrechtlich geregelt werden. Dies erfolgte dann i n dem Sinne, daß über jede Stimmabgabe i m Bundesrat, auch wenn es sich u m eine A n gelegenheit von prinzipieller Bedeutung handelt, der Ministerrat und zwar nicht nur formell, sondern auch materiell zu entscheiden hat 4 1 . Aus den vorgenannten Gründen hat die Richtlinienkompetenz (Art. 49 I LV) 39 Diese Voraussetzung ergibt sich u. a. auch daraus, daß das K a b i n e t t am Anfang einer Legislaturperiode unter einem bestimmten Regierungsprogramm, das dann den wesentlichen I n h a l t der Regierungserklärung ausmacht und, abgesehen von koalitions- u n d parteipolitischen Einschränkungen, v o m bereits gewählten designierten Ministerpräsidenten geprägt ist, gebildet w i r d (vgl. zeitl. A b l a u f der Regierungsbildung nach A r t . 46 LV). Jeder M i n i ster w i r d also unter einem bestimmten Regierungsprogramm i n die Regier u n g berufen bzw. t r i t t i n sie ein. Insoweit muß er sich an diese programmatischen Richtlinien halten. Spätere Änderungen u. dergl. hat jeder Minister aber i. d. R. m i t zu beschließen (Art. 49 I I LV). Diese verfassungsrechtliche Regelung bei der Regierungsbildung, bei der den M i n i s t e r n durch das Erfordernis der Bestätigung der Gesamtregierung durch den Landtag (Art. 46 I I I L V ; vgl. auch A r t . 46 I V L V ) u n d die Notwendigkeit einer Kabinettsbeschlußfassung über Z a h l u n d Abgrenzung der einzelnen Geschäftsbereiche (Art. 45 I I I L V ) eine verstärkte Stellung zukommt, entspricht i m übrigen auch i m wesentlichen der bisherigen Praxis. Vgl. dazu G. Müller, i n : Staatsanzeiger, 1958, Nr. 30, S. 2. Eine insgesamt ähnliche Auffassung v e r t r i t t G. Müller, I n t e r v i e w v o m 5. 3.1974. 40 Diese „ U n k l a r h e i t " führte i m M a i 1953 sogar zu einer Regierungskrise (EVG-Verträge); vgl. dazu oben Fußnote 11. 41 Vgl. dazu insbes. die Ausführungen des ABG. Krause, Verhandlungen der V L V , S. 2307 u. des ABG. Gönnenwein, ebenda, S. 2307 f.; dies w i r d bestätigt v o n ABG. Gog, ebenda, S. 2467. Vor allem i m Hinblick auf das Beispiel der EVG-Verträge hat der Verfassungsgeber diese Frage so eindeutig entschieden, daß die entgegengesetzte Auffassung von P. Feuchte, i n : Spreng / B i r n / Feuchte, S. 182, eigentlich unverständlich ist. So etwa auch T. Maunz, BayVerwBl. 1956, S. 261.
§ 12 Das Verhältnis von „ K a n z l e r - u n d Kabinettsprinzip"
87
ihre verfassungsrechtliche Grenze i n allen konkreten Angelegenheiten der einzelnen Alternativen des Katalogs über die Kabinettszuständigkeiten i n A r t . 49 I I L V (entsprechendes gilt damit auch für A r t . 45 I I I usw. L V ) 4 2 . Trotz dieser wesentlichen Einschränkung bleibt aber für den Regierungschef das wichtige Recht, i m Rahmen der Regierungserklärung ein für Kabinett und Minister verbindliches generelles Grundsatzprogramm der Regierimg aufzustellen. Dabei ist die den allgemeinen Zielsetzungen des Regierungsprogramms innewohnende B i n dungswirkung gewissermaßen die Grundlage der Regierungssolidarität. Dieses Recht beinhaltet vor allem die Festlegung von generellen mittelund langfristigen Planungs- und Programmzielsetzungen (z. B. grundlegende Zielfindung und Zielbestimmung, grobe sachliche und zeitliche Prioritätensetzung) 43 . (2) Die i n A r t . 65 S. 1 GG festgelegte Richtlinienkompetenz stellt bei einer teleologischen Interpretation eine A r t „Garantienorm" für die Stellung des Bundeskanzlers i m Regierungssystem dar, die insbesondere folgendes beinhaltet 4 4 : — A r t . 65 S. 1 GG gewährleistet nicht allein aber doch letztlich die Führungsrolle des Bundeskanzlers (eine A r t „institutionelle Garantie" für die sogenannte Kanzlerdemokratie); — die Richtlinienkompetenz weist dem Bundeskanzler die Befugnisse zu, deren er zur Erfüllung seiner „Steuermannsfunktion" bedarf; — A r t . 65 S. 1 GG sichert die Rechte, die der Bundeskanzler zur Wahrnehmung seiner Staatswillensbildungs-, Führungs- und Koordinierungsfunktionen benötigt. Die grundgesetzliche Ausgestaltung der Richtlinienkompetenz und damit auch des Kanzlerprinzips insgesamt kann allerdings, was bereits wiederholt dargelegt wurde, keinesfalls auf die Bad.-Württ. Landesverfassung übertragen werden. Trotzdem ist auch der der oben geschilderten Interpretation zugrunde liegende „ K e r n " i m Rahmen der i n der Landesverfassung festgelegten Regelung zu beachten. Eschenburg 4 5 drückt diesen Grundgedanken so aus: „ I n der modernen industriellen Massengesellschaft m i t ihren zentrifugalen Interessen, die auch i n die Ministerien hineinwirken, muß ein einzelner i n eigener 42
Vgl. dazu oben Fußnoten 15, 16 u n d 20 (§ 12). Es geht hier also i m wesentlichen u m die zweite Fallgruppe des oben aufgestellten „Staatsfunktionengrobrasters" (vgl. oben § 5). 44 Vgl. dazu u. a. K . Stern, i n : Projektgruppe B M I , Erster Bericht, Anlagenband, S. 578ff.; T. Eschenburg, i n : Z u r pol. Praxis i n der Bundesrepublik, Bd. I, S. 200 f.; Ders., i n : D Ö V 1954, S. 194; W. Hennis, Richtlinienkompetenz u. Regierungstechnik, S. 3 ff.; E. U. Junker, Richtlinienkompetenz, S. 55 ff.; S. Schöne, Bundeskanzleramt, S. 140 ff. je m. w . N. 45 T. Eschenburg, i n : Z u r pol. Praxis i n der Bundesrepublik, Bd. I, S. 200. 43
88
Kap. I I : Regierungssystem nach der bad.-württ. L V
Verantwortung zur Koordinierung der Regierungsentscheidung i m Kabinett, dessen Mitglieder sich mehr oder minder an rivalisierenden Gruppen- und Ressortbelangen orientieren, i n der Lage sein". Auch der Bad.-Württ. Verfassungsgeber erkannte durchaus diese Problematik und wollte deshalb dem Ministerpräsidenten auch eine gewisse Führungsrolle einräumen. Dies allerdings nicht i m Sinne eines Chefs über seine Ministerkollegen, sondern weit mehr i m Sinne eines primus inter pares 46 . I m Lichte der vorstehenden Ausführungen zu (1) begründen diese Erwägungen i m Rahmen des A r t . 49 I S. 1 L V deshalb die Auffassung, daß der Ministerpräsident, u m seiner etwas hervorgehobenen Stellung gerecht werden zu können, zusätzliche Befugnisse für eine effektive Integration, einheitliche Verwirklichung der gesamtstaatlichen Ziele und Interessen, umfassende gegenseitige Kommunikation und Information, aber auch Kooperation und Koordination haben muß 4 7 . Diese dem Ministerpräsidenten zustehenden besonders deutlich ausgeprägten Funktionen dürfen allerdings nicht das „materielle" Entscheidungsrecht des Kabinetts beeinträchtigen (Art. 49 I I usw. LV). Es handelt sich hierbei vielmehr u m „geschäftsordnungsmäßige" Befugnisse i m Rahmen der Richtlinienkompetenz, die ein „Chefkoordinator", wie man den Ministerpräsidenten insoweit durchaus bezeichnen kann, für eine effektive Arbeit dringend benötigt und die deshalb i m gesamten Regierungsbereich verbindlich und zu beachten sind (insbesondere eine allgemeine „Koordinationskompetenz" für die Kabinettsund gesamte Regierungsarbeit) 48 . (3) Neben der Richtlinienkompetenz (Art. 49 I S. 1 LV) enthält die Landesverfassung noch eine ganze Reihe von Bestimmungen, die dem Ministerpräsidenten Rechte und Befugnisse einräumen. Der Teil dieser Vorschriften, der m i t der Richtlinienkompetenz eng verzahnt und inhaltlich verflochten ist, muß bei der Auslegung des A r t . 49 I S. 1 L V (auch wegen dessen begrifflicher Unklarheit) und besonders bei der hier vorzunehmenden Prüfung, ob bei der oben vorgenommenen Interpretation des A r t . 49 I I L V noch ein Kernbereich für A r t . 49 I S. 1 L V 46
So insbes. der insoweit Verfassungswirklichkeit gewordene Regierungse n t w u r f ; vgl. dazu Bericht des V A über den E n t w u r f einer Verfassung, i n : Beilagen zu den Sitzungsprotokollen der V L V , Bd. 3, Beilage Nr. 1103, S. 55 f.; ABG. Krause, i n : Verhandlungen der V L V , S. 2298. Z u m G G vgl. etwa hierzu: von Mangoldt / Klein, A r t . 62, Vorbem. V I m. w . N.; vgl. auch J. Amphoux, Le chancelier fédéral, S. 8. 47 Beim Ministerpräsidenten müssen also die Funktionen der d r i t t e n F a l l gruppe des oben dargestellten Funktionengrobrasters (vgl. oben § 5) besonders umfassend u n d ausgeprägt zusammengefaßt sein. 48 Vgl. etwa T. Ellwein, i n : Die Staatskanzlei, SHS Bd. 34, S. 206; K. König, Koordination u n d Regierungspolitik, i n : DVB1. 1975, S. 232 f. K ö n i g stellt dort eingehend u n d zutreffend die „Chefkoordinationsfunktion" der Kanzlei des Regierungschefs dar.
§ 12 Das Verhältnis v o n „ K a n z l e r - u n d Kabinettsprinzip"
89
verbleibt, zusätzlich m i t berücksichtigt werden. Denn nur bei einer Gesamtschau der m i t A r t . 49 I S. 1 L V eng verwandten Normen ist diese Frage voll beantwortbar. Die so verstandenen weiteren Hechte des Ministerpräsidenten sollen als „Hilfsbefugnisse" der Richtlinienkompetenz bezeichnet und zusammengefaßt werden 4 9 . Als erstes ist hier das Recht des Ministerpräsidenten zu nennen, die Minister, Staatssekretäre und Staatsräte zu berufen und zu entlassen (Art. 46 I I LV). Dieses Recht ist allerdings rechtlich durch A r t . 46 I I I und I V L V (Regierungsbestätigung durch den Landtag) und A r t . 45 I I I L V zusätzlich eingeschränkt. Als wesentlichste Hilfsbefugnisse i m Rahmen der Richtlinienkompetenz sind die Rechte der Geschäftsleitung der Landesregierung und des Führens des Vorsitzes i n ihren Sitzungen zu bezeichnen, die A r t . 49 I S. 2 L V dem Ministerpräsidenten zuweist. Vor allem diese Rechte ermöglichen es ihm, i n nicht zu unterschätzendem Ausmaß auf die Vorbereitung der Kabinettssitzungen, aber auch auf den Gang und den Inhalt der Beratungen und die Beschlußfassung i m Ministerrat Einfluß zu nehmen 5 0 . I m Gegensatz zum Bundeskanzler steht dem Ministerpräsidenten die Organisationsgewalt i m Regierungsbereich nicht zu (vgl. A r t . 45 I I I LV). Auch hat er i m Kabinett bei Stimmengleichheit keinen Stichentscheid und ist i m übrigen einer wesentlich stärkeren parlamentarischen Kontrolle unterworfen (Art. 45 I I I , 46 I I I , I V LV). Gleichwohl sind die genannten Hilfsbefugnisse zusammen noch von so beachtlichem Gewicht, daß sie die Richtlinienkompetenz zusätzlich stärken. Betrachtet man diese hier dargestellten und inhaltlich festgelegten Befugnisse, die dem Ministerpräsidenten i m Rahmen seiner Richtlinienkompetenz allein zustehen, nämlich — die Aufstellung eines für Kabinett und jeden Minister verbindlichen allgemein gefaßten Regierungsprogramms (Regierungserklärung), — die verbindliche Anordnung von „geschäftsordnungsmäßigen" Maßnahmen, die für eine effektive Führung, Integration und Koordination der Gesamtregierung und ihrer Arbeit notwendig sind (aktive „Koordinationskompetenz") und — die „Hilfsbefugnisse" (insbes. A r t . 46 I I und 49 I S. 2 L V ) 4 9 ,
49 Vgl. A. Hamann, i n : H a m a n n / L e n z , A r t . 65 A n m . B 1; v o r allem aber E. U. Junker, Richtlinienkompetenz, S. 75 ff.; S. Schöne, Bundeskanzleramt, S. 146 ff. Wer die Richtlinienkompetenz richtig beurteilen w i l l , hat auf das Wesen, die Eigengesetzlichkeit u n d die Erfordernisse des Regierens u n d die Organisationsstruktur des Regierungsbereichs insgesamt Bedacht zu nehmen; so F. Knöpfle, DVB1. 1965, S. 860; E. U. Junker, S. 131. 50 Dies w i r d sicher noch dadurch verstärkt, daß sich die Regierung bisher noch keine Geschäftsordnung gegeben hat.
90
Kap. I I : Regierungssystem nach der bad.-württ. L V
so ergibt sich eindeutig, daß bei der so vorgenommenen Auslegung dem Regierungschef ein erheblicher Kern an Richtlinienkompetenzen verbleibt. Die vorstehende Auffassung löst das Spannungsverhältnis zwischen Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 des A r t . 49 L V demnach zwar grundsätzlich zugunsten einer Zuständigkeitsvermutung für eine Kollegialbeschlußfassung. Da dies aber — was dabei das entscheidende ist — geschieht, ohne i n den Kernbereich („Wesensgehalt") der Richtlinienkompetenz einzugreifen oder A r t . 49 I L V gar auszuhöhlen, entspricht das Ergebnis den Anforderungen, die an die Lösung gestellt wurden. Zieht man ein Resümee aus den gesamten Ausführungen, so bleibt festzuhalten, daß die Landesverfassung die Ausgestaltung der Regierungsstruktur i n der Weise vorgenommen hat, daß das Kollegialprinzip stark betont und i n den Vordergrund gestellt wurde. Dies war aber nur auf Kosten sowohl des Kanzler- als auch des Ressortprinzips möglich. Zwar kommt dem Ministerpräsidenten nach wie vor die Führungsrolle zu (insbes. durch A r t . 49 I LV) und auch den Ministern w i r d ihre Ressortselbständigkeit eingeräumt. Die wichtigen Angelegenheiten, d. h. alle konkreten Fragen von grundsätzlicher oder weittragender Bedeutung, bleiben aber der Beratung und Kollegialbeschlußfassung des Kabinetts vorbehalten (insbes. A r t . 49 II, 45 I I I LV). Insoweit kann zusammenfassend festgestellt werden, daß das Regierungssystem i n Bad.Württ. als eine ausgewogene Verbindung und Berücksichtigung aller drei Strukturprinzipiell (Kanzler-, Kollegial- und Ressortprinzip) zu bezeichnen ist, wobei das Kabinettprinzip eine leicht dominante Stellung einnimmt. I m Gefüge der Landesverfassung überwiegt insgesamt das kollegiale Element und die Form der Mehrheitsentscheidung 51 . I m Unterschied zum Bund ist die Organisationsform der Landesregierung also vom Kabinett her konstruiert. Der Ministerrat ist unter Führung des Ministerpräsidenten das „leitende" Regierungsorgan 52 . I m Grunde ist deshalb die politische Führung eine kollegiale. Die verfassungsrecht51 Ähnlich i m Ergebnis auch V. Renner, i n : JöR Bd. 7 n. F. (1958), S. 213 f.; H. Preuß bezeichnete bereits i n JöR Bd. 10 (1921), S. 222, 272 das damalige System der preußischen Verfassung v o m 30.11.20, das i n Bezug auf die innere Organisation der Regierung m i t der Weimarer Verfassung übereinstimmte, als „eine durch den leitenden Einfluß des Ministerpräsidenten modifizierte Kollegialverfassung". Vgl. auch E. U. Juncker, Richtlinienkompetenz, S. 131; F. Knöpfle, i n : DVB1. 1965, S. 928-930 (beide allerdings p r i m ä r zur GG-Regelung). 52 Beachte bereits den W o r t l a u t des A r t . 56 württ.-hohenz. L V (danach mußte der Ministerrat über u. a. alle Fragen von grundsätzlicher oder w e i t tragender Bedeutung beraten u n d entscheiden). Außerdem entspricht dies auch dem den §§ 26 - 40 der W ü r t t . Verfassung v o m 25.9.1919 (Reg. Bl. S. 281) zugrunde liegenden Regierungssystem. Vgl. auch E.W. Böckenförde, Organisationsgewalt, S. 170 ff. Das bad.-württ. Regierungssystem ist damit i n mancherlei Hinsicht m i t dem englischen Kabinettssystem vergleichbar (vgl. dazu etwa N. Johnson, i n : Projektgruppe B M I , Erster Bericht, Anlagenband, S. 140 ff.).
§ 12 Das Verhältnis von „Kanzler- u n d Kabinettsprinzip"
91
lieh festgelegte Organisationsform der Landesregierung steht damit nicht wie dies Böckenförde 53 für die Bundesregierung festgestellt hat, „ i n einem eigenartigen Kontrast zu den Erfordernissen, die die heutigen gesellschaftlichen und politischen Gegebenheiten an die Regierung stellen, die als oberste Leitungs- und Regulierungsinstanz und politisches Führungsorgan funktionsfähig sein w i l l " . Diese strukturell bedingten Schwierigkeiten treten vielmehr bei dem i n A r t . 45 - 57 L V festgelegten Regierungssystem weitgehend nicht auf. Dieses Ergebnis trägt i m übrigen auch der besonderen verfassungspolitischen Situation der Länder Rechnung. Die Richtlinien der Politik bedeuten auf Bundesebene inhaltlich nicht dasselbe wie auf der Ebene der Länder. Die grundlegenden, gestaltenden Möglichkeiten sind für die Länder sehr beschränkt. I n ihnen geht es vielmehr vorwiegend u m Verwaltungsmacht und M i t w i r k u n g i m Bund. Auch weitere — oben angeführte 54 — verfassungspolitische und organisatorische Gründe sprechen insgesamt betrachtet mindestens auf Landesebene grundsätzlich für eine stärkere Ausprägung des Kollegialprinzips. Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, daß die hier erarbeitete Lösung aus den i n Ziff. 4 erwähnten Gründen nicht „vollkommen" und abschließend sein kann. Die Verfassungswirklichkeit w i r d denn auch oft wesentlich mehr von politischen und ähnlichen Faktoren als vom Verfassungsrecht geprägt. Schwierigkeiten i n der Staatspraxis sind deshalb letztlich nur vermeidbar, wenn alle Regierungsmitglieder eine — wie es Maunz ausdrückt 55 — „Vorrangstellung des politischen Taktes vor streng verfassungsgerechten Erwägungen" anerkennen und sich demgemäß verhalten. Trotzdem muß i m Bereich der Regierung ganz allgemein und besonders i m Rahmen der vorliegenden Untersuchung das geltende Verfassungsrecht die entscheidende „Richtschnur" sein. Die Verfassungswirklichkeit daraufhin zu überprüfen und auch zusätzlich noch zu untersuchen, wie der durchaus vorhandene verfassungsrechtliche Spielraum i m Regierungssystem von den politischen und bürokratischen Kräften ausgestaltet ist, w i r d eine wichtige und interessante Aufgabe dieser Arbeit sein.
53 E.-W. Böckenförde, Organisationsgewalt, S. 171; vgl. dazu auch die Überlegungen von J. Kölble, i n : D Ö V 1973, S. 1 ff., die dieser i n dem Aufsatz „ I s t A r t . 65 GG (Ressortprinzip i m Rahmen von Kanzlerrichtlinien u n d Kabinettentscheidungen) überholt?" veröffentlicht hat. 54 Vgl. oben § 11, Fußnoten 6 - 9 ; außerdem T. Ellwein, Regierungssystem, S. 323 ff. 55 T. Maunz, i n : Maunz / D ü r i g / Herzog, A r t . 65 A n m . 5; vgl. auch F. Knöpfle, i n : DVB1. 1965, S. 930; F. Duppre, i n : M a y e r / U l e , Staats- u n d V e r waltungsrecht i n Rh.-Pf., S. 47 f. Ähnlich bereits i m Jahr 1928 R. Smend, Staatsrechtliche Abhandlungen, S. 250 f.
92
Kap. I I : Regierungssystem nach der bad.-württ. L V
§ 13 Das Kabinett (Ministerrat) 1. Zusammensetzung und Organisation Gemäß A r t . 45 I I L V besteht die Regierung (als Kollegium; auch Kabinett oder Ministerrat genannt) aus dem Ministerpräsidenten, den Ministern und gegebenenfalls aus Staatssekretären und Staatsräten als weiteren Mitgliedern. Staatssekretäre, deren Zahl ein Drittel der Zahl der Minister einschließlich des Ministerpräsidenten nicht übersteigen darf, und Staatsräte sind zwar stets Regierungsmitglieder; Stimmrecht haben sie aber nur, wenn es ihnen vom Landtag ausdrücklich verliehen wurde. Die Zahl der Minister ist i n der Verfassung nicht geregelt, sondern einem Beschluß des Kabinetts, der der Zustimmung des Landtags bedarf, überlassen (Art. 45 I I I und auch A r t . 49 I I LV) 1 . Der Ministerrat setzt sich seit 1953 neben dem Ministerpräsidenten aus 7 bis 9 Ministern und bis zu 2 Staatssekretären bzw. Staatsräten, denen bisher stets das Stimmrecht verliehen wurde, zusammen, insgesamt also aus 8 bis 12 Mitgliedern 2 . Obwohl i n der Bekanntmachung der Landesregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien, der der Landtag am 25. 7.1972 zugestimmt hat, abgesehen vom Staatsministerium, nur 7 Geschäftsbereiche festgelegt wurden 8 , besteht die derzeitige Regierung (Kabinett H. Filbinger III) aus dem Regierungschef, 8 M i n i stern und 2 stimmberechtigten Staatssekretären, zusammen demnach aus 11 Mitgliedern. Die besonderen Probleme, die die Stellung des Ministers für Bundesangelegenheiten betreffen, werden unten § 16 Ziff. 4 näher behandelt. Für die Organisation und den Geschäftsgang der Kabinettsarbeit sind i n der Landesverfassung i n A r t . 49 nur einige wenige grundle1 V o r der Verfassungsänderung v o m 17.11.1970 (Ges. Bl. S. 492) w a r dies einem Gesetz vorbehalten. Vgl. P. Feuchte, i n : Spreng / B i r n / Feuchte, S. 174. Die dem K a b i n e t t zustehende grundsätzliche Organisationsgewalt erstreckt sich auch auf die Festlegung der Z a h l der Minister (sonst würde A r t . 45 I I I L V weitgehend seines Inhalts beraubt). Vgl. dazu die Gesetzesmaterialien, insbes. Verhandlungen des Landtags, 5. Wahlperiode, S. 4670 f., 4682 ff. u n d 5035 ff. Vgl. auch den W o r t l a u t des A r t . 45 I I I L V , alte Fassung, („Die Z a h l der Minister u n d die Geschäftsbereiche . . . " ) , der inhaltlich nicht geändert, sondern die Organisationsgewalt insoweit aus Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten n u r v o m Landtag auf das K a b i n e t t übertragen wurde. Vgl. dazu auch Protokolle des V A , 7. Sitzung, S. 14 f. unter Hinweis auf A r t . 49 Bay L V (ABG. Kuhn, CDU, hielt es f ü r unmöglich, daß i n einem demokratischen Staat der Ministerpräsident die Z a h l der Ministerien bestimmt). Z u r Gesamtproblematik K. Rebmann, i n : JöR n. F. Bd. 20 (1971), S. 201 f. Näheres dazu u n t e n § 17. 2 Vgl. dazu i m einzelnen die Aufstellungen bei K. Rebmann, S. 213 u n d 214, sowie unten § 20 Ziff. 1. 3 Vorher galt noch die entspr. Bekanntmachung der vorl. Regierung vom 8. 7. 52 (Ges. Bl. S. 21) i. d. F. v o m 21. 3. 72 (Ges. Bl. S. 81).
§ 13 Das Kabinett (Ministerrat)
93
gende Dinge geregelt (Art. 49 I S. 2 und I I I LV). Danach faßt der M i n i sterrat grundsätzlich m i t einfacher Mehrheit seine Beschlüsse, wobei dem Ministerpräsidenten bei Stimmengleichheit kein Stichentscheid zukommt 4 . Eine Konkretisierung und nähere Ausgestaltung des Verhältnisses der Regierungsmitglieder untereinander sowie der Vorbereitung, Durchführung usw. der Kabinettssitzungen durch eine Geschäftsordnung ist bisher allerdings nicht erfolgt 5 . Der Geschäftsgang der K a binettsarbeit läuft deshalb weitgehend nach mehr oder weniger lange geltenden Praktiken und Spielregeln ab. I n § 1 der Bekanntmachimg der Landesregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien vom 25. 7.1972 (Anlage Nr. 1) ist unter I Ziff. 5 und 7 darüber hinaus lediglich festgestellt, daß das Staatsministerium (Staatskanzlei) für die Vorbereitung und Auswertung der Regierungstätigkeit (Ministerrat) sowie für die Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung zuständig ist. Die Fragen der Vertretung der Regierungsmitglieder und die Teilnahme an Kabinettssitzungen ist ebenfalls nur unzureichend geregelt 6 . Ihre Vertretung i m Stimmrecht ist nach der Verfassung weder durch andere stimmberechtigte Mitglieder noch durch einen Vertreter des Ministers möglich (Art. 49 I I I LV). Die Ministerialdirektoren, als allgemeine Vertreter der Minister i n den Ministerien, nehmen i m Falle der Verhinderung des Ministers i n aller Regel an den Kabinettssitzungen beratend teil, ohne dabei allerdings ein Stimmrecht zu besitzen. Die Vertretung des Ministers i m Ministerrat, i n deren Ressort ein politischer Staatssekretär ernannt wurde, erfolgt neuerdings teilweise auch durch diesen. Die Fragen der Stellvertretung i n der Regierung sind, da eine Geschäftsordnung nicht erlassen wurde, nirgends geregelt, sondern weitgehend einer Entscheidung von Fall zu Fall (je nach der politischen Opportunität) überlassen 7 . Dies t r i f f t u. a. auch für die Beiziehung bzw. Anwesenheit von Berichterstattern, Sachverständigen usw. i n den Kabinettssitzungen zu. 4
I n der GeschO könnte i h m allerdings ein solcher Stichentscheid eingeräumt werden (vgl. Verhandlungen der V L V , S. 2307, w o ausdrücklich festgestellt wurde, daß dies der GeschO vorbehalten bleiben soll — A B G . Krause —), vgl. auch P. Feuchte, i n : Spreng / B i r n / Feuchte, S. 183. 5 Vgl. oben § 12 (insbesondere Fußnote 31); der Verfasssungsgeber ging davon aus (vgl. § 12, Nachweise i n Fußnote 29), daß die A r t . 45 ff. L V durch eine GeschO präzisiert w ü r d e n (Auftrag an die Regierung); solange k e i n Regierungsmitglied einen formellen A n t r a g auf Einlösung dieses „Auftrags" stellt, können aus der Pflicht auf Erlaß einer GeschO bzw. aus der U n t e r lassung keine rechtlichen Konsequenzen gezogen werden. 6 Vgl. dazu unten § 21 (insbesondere Ziff. 4 u n d 6). 7 Diese Praxis w i r d überwiegend als unbefriedigend empfunden u n d m i t unter selbst bei der Vertretimg des Ministerpräsidenten angewandt, obwohl der Kultusminister offiziell zum Stellvertreter bestellt wurde (vgl. A r t . 46 I I S. 2 LV). Vgl. auch P. Feuchte, i n : Spreng / B i r n / Feuchte, S. 176. Bezeichnenderweise werden selbst i n dem E n t w u r f einer GeschO v o n Anfang 1974 diese Probleme nicht geregelt.
94
Kap. I I : Regierungssystem nach der bad.-württ. L V
2. Zuständigkeiten Dem Regierungskollegium hat die Landesverfassung besonders wichtige und umfassende Zuständigkeiten ausdrücklich zugewiesen. Diese zahlreichen Kompetenzen wurden bereits oben § 12 ausführlich dargestellt 8 . Hingewiesen sei nochmals besonders auf die notwendige Beratung und Beschlußfassung des Kabinetts i n Angelegenheiten der Organisationsgewalt (Art. 45 I I I , 70 II), über Fragen von grundsätzlicher oder weittragender Bedeutung (Art. 49 II), über die Einbringung von Gesetzesvorlagen und die Abstimmung des Landes i m Bundesrat (Art. 49 II, 59) und schließlich über Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften (Art. 61 I I LV). Bemerkenswert und interessant ist i n diesem Zusammenhang noch, daß alle gewöhnlich einem Staatsoberhaupt zustehenden Rechte gegenüber dem Parlament, wenngleich es sich nur um einige wenige handelt, dem Ministerrat zustehen (Art. 43 I, 60 I und II, 82 I und I I LV). 3. Stellung im Regierungssystem Ausgehend von diesen sehr bedeutsamen Zuständigkeiten des Kabinetts und von der oben festgelegten Abgrenzung zwischen den Rechten des Ministerrats und der Richtlinienkompetenz steht bei der Bewältigung der Regierungsarbeit und der Landespolitik offensichtlich das Kabinettsprinzip, eben die kollegiale Beratung und Beschlußfassung, i m Vordergrund. Die verfassungsrechtliche — nicht tatsächliche — Ausgestaltung der Regierungsstruktur legt eine leichte Dominanz des Kollegial- gegenüber dem Kanzler- und Ressortprinzip fest. Das Gewicht des Kabinetts der Landesverfassung ist, etwa i m Vergleich zum Grundgesetz, deshalb stärker zu bewerten und kann keinesfalls i m „Schatten" der Richtlinienkompetenz gesehen werden. Man kann hier eher von einer „Kabinettsdemokratie" sprechen. § 14 Der Ministerpräsident Der Ministerpräsident, der vom Landtag von der Mehrheit seiner Mitglieder gewählt w i r d (Art. 46 I LV) 1 , übt zwei grundsätzlich verschiedene Tätigkeiten aus. Zum einen nimmt er „staatsoberhauptliche" Funktionen wahr und zum anderen obliegen i h m die Aufgaben eines Regierungschefs. Man kann also grob zwei grundlegende Tätigkeitssphären des Ministerpräsidenten unterscheiden. I m Vergleich zum GG 8 Es handelt sich u m folgende Zuständigkeiten: A r t . 30 I V , 43 I, 45 I I I , 49 I S. 2, 49 I I , 50, 59 I, 60 I I u n d I I I , 61 I I , 62, 63 I S. 2, 70 I I , 80 I u n d 82 L V . 1 Die von der C D U vorgeschlagene W a h l eines Staatspräsidenten u n m i t t e l bar durch das V o l k w u r d e abgelehnt; vgl. dazu oben Fußnote 6 (§ 10).
§14 Der Ministerpräsident
95
ergibt sich demnach für die Länder eine wesentliche Besonderheit: Während es Aufgabe des Bundespräsidenten ist, die ständige Identifikation mit dem System der parlamentarischen Demokratie, sowie der staatlichen Einheit zu erreichen („Rolle einer neutralen Kraft"), hat der Bundeskanzler die jeweilige (partei-)politische Ausprägung der gesamten Tätigkeiten des Regierungssystems zu vertreten und parlamentarisch zu verantworten. Für den Ministerpräsidenten, der weitgehend beides auszuüben hat, ergeben sich hieraus mitunter nicht ganz unbeachtliche Rollenkonflikte 2 . 1. Wahrnehmung staatsoberhauptlicher Funktionen Zwar sind die Länder der Bundesrepublik parlamentarische Demokratien (Art. 28 I GG), doch hat erstaunlicherweise kein Land, obwohl es fast überall i m Gespräch war, ein besonderes Organ für die Wahrnehmung der Repräsentationsaufgaben geschaffen. Alle Verfassungen der Länder haben auf ein eigenes Staatsoberhaupt verzichtet. Es bedarf hier i n diesem Rahmen keines näheren Eingehens auf die unterschiedlichen Meinungen zur Frage des Staatsoberhauptes i n den Ländern. Richtig dürfte aber aufgrund der Gesamtstruktur der Regierung mindestens i n Bad.-Württ. sein, daß die von gesamtstaatlicher Integration, Repräsentation und Unparteilichkeit geprägten Rechte und Kompetenzen eines Staatsoberhaupts der Landesregierung als Kollegium zustehen, wobei die Landesverfassung allerdings oft diese Befugnisse dem Ministerpräsidenten als dem „Repräsentanten" der Regierung zur Wahrnehmung übertragen hat 3 . So liegen denn auch die Mehrzahl der staatsoberhauptlichen Funktionen nach den Verfassungen der Länder beim Ministerpräsidenten. Dies gilt auch für Bad.-Württ. Eine erste und zugleich wichtige Kompetenz des Ministerpräsidenten sind ganz allgemein die Rechte zur Parlamentsauflösung. Ihre Ausgestaltung ist durchaus ein Gradmesser für die verfassungsmäßige Machtstellung des „Staatsoberhauptes". Nach der Landesverfassung hat der Ministerpräsident insoweit überhaupt keine Kompetenzen und selbst das Kabinett besitzt bei einer evtl. Landtagsauflösung durch Volksentscheid lediglich formelle Pflichten und keine echten Befugnisse (vgl. 2 So könnte m a n fragen, ob es sinnvoll ist, w e n n das „Landesoberhaupt" gleichzeitig Parteichef des Landes ist. Ministerpräsident H. Filbingers A m t s führung läßt allerdings den Schluß zu, daß beide Tätigkeiten durchaus m i t einander vereinbart werden können (vgl. unten § 22). 8 Vgl. dazu neben den oben i n Fußnote 5 des § 9 bereits zitierten F u n d stellen noch K. Kleinrahm, i n : Geller / Kleinrahm, K o m m . L V NRW, A r t . 51 A n m . 5 d u n d A r t . 77 A n m . 1; F. Knöpf le, i n : Die Staatskanzlei, SHS Bd. 34, S. 50 (Fußnote 21). Nicht zuletzt ergibt sich das auch aus A r t . 45 I L V (Regierung als K o l l e g i u m : Regelfall; vgl. P. Feuchte, i n : Spreng / B i r n / Feuchte, S. 172).
96
Kap. I I : Regierungssystem nach der bad.-württ. L V
A r t . 43 I L V ; außerdem auch A r t . 47 LV). Hier w i r d u. a. deutlich, daß sich der Landtag i n dem parlamentarischen Regierungssystem der Landesverfassung eine starke Position geschaffen hat (vgl. oben § 10). Das Recht zur Vertretung des Landes nach außen steht gemäß A r t . 50 L V dem Ministerpräsidenten zu. Diese Befugnis umfaßt die Vertretung gegenüber den anderen Bundesländern, gegenüber dem Bund und i m Rahmen des A r t . 32 GG auch gegenüber dem Ausland. A r t . 50 L V stellt dabei primär eine Zuständigkeitsnorm i m „Außenverhältnis" dar. I m „Innenverhältnis" bleibt es bei der Kompetenzverteilung, die vor allem i n A r t . 49 I und I I L V festgelegt ist 4 . Aufgrund von A r t . 51 L V ernennt der Ministerpräsident die Richter und Beamten des Landes, soweit dieses Recht durch Gesetz nicht auf eine andere Behörde übertragen ist. Nach dem Ernennungsgesetz 5 ist dann u. a. auch den Ministern das Recht zuerkannt worden, i n ihrem Geschäftsbereich Beamte bis einschließlich der Besoldungsgruppen A 14 a und A H 2 zu berufen und zu befördern. A l l e anderen Ernennungen (ab A 15) werden aber vom Ministerpräsidenten vorgenommen. Dieses Ernennungsrecht für Landesbeamte steht dem Ministerpräsidenten dabei grundsätzlich nicht nur als rein „formelles" Recht zu. Aus der parlamentarischen Verantwortlichkeit eines Ministers für seinen Geschäftsbereich (Art. 49 I LV) und dem Recht auf selbständige Leitung desselben muß jedoch gefolgert werden, daß der Ministerpräsident nur i n begründeten Fällen von dem Ressortvorschlag abweichen und gegen die dezidierte Meinung des betreffenden Ministers keinen Beamten ernennen darf (allerdings gegebenenfalls „Aushungern" durch Nichternennen) 6 . Es bedarf also insoweit eines übereinstimmenden Zusammenwirkens von Ministerpräsident und Minister. Zudem ist aufgrund der Bedeutung des A r t . 49 I I L V und auch den Materialien zu A r t . 51 L V davon auszugehen, daß vor der Ernennung von obersten Landesbeamten (ab B 6; evtl. schon ab B 3) verfassungsrechtlich der Ressortvorschlag i m Kabinett zu beraten und zu erörtern ist 7 . Das Ernennungsrecht ist also durch das Kollegial- und Ressortprinzip eingeschränkt. 4 Vgl. dazu P. Feuchte, i n : Spreng / B i r n / Feuchte, S. 184; O. Uhlitz, D Ö V 1966, S. 296 f. m. w . N. 6 Gesetz über die Ernennung der Richter u n d Beamten des Landes (Ernennungsgesetz) i. d. F. v o m 3.11.1970 (Ges. Bl. S. 473) u n d den Änderungen v o m 14. 3.1972 (Ges. Bl. S. 92). Der sachl. Umfang des Ernennungsrechts ergibt sich aus diesem Gesetz; vgl. dazu auch P. Feuchte, i n : Spreng / B i r n / Feuchte, S. 186. 6 So A. Süsterhenn, i n : Süsterhenn / Schäfer, zu dem gleichlautenden A r t . 102 A n m . 2 Rh.-Pf. L V ; a. A.: P. Feuchte, i n : Spreng / B i r n / Feuchte, S. 186. 7 Mindestens ab der Besetzung v o n Abteilungsleiterstellen handelt es sich u m Fragen von grundsätzlicher u n d weittragender Bedeutung; da der M i n i sterpräsident die staatsoberhauptlichen Funktionen letztlich als „Repräsent a n t " des Regierungskollegiums (vgl. oben Fußnote 3) ausübt, k a n n hierbei
§ 14 Der Ministerpräsident
97
Das Recht der Begnadigung i n Einzelfällen übt gemäß A r t . 52 L V der Ministerpräsident aus 8 . Wie bei der Beamtenernennung ist auch hier bei Fällen von grundsätzlicher oder weittragender politischer Bedeutung, was allerdings äußerst selten vorkommen wird, vor einer Gnadenentscheidung durch den Ministerpräsidenten mindestens eine Beratung dieser Angelegenheit i m Kabinett erforderlich 9 . Aufgrund des A r t . 63 I L V hat der Ministerpräsident die verfassungsmäßig zustandegekommenen Gesetze auszufertigen und binnen Monatsfrist zu verkünden 1 0 . Auch dabei handelt es sich u m eine Befugnis, die nach der deutschen Verfassungstradition dem Staatsoberhaupt zusteht und deshalb durch die Landesverfassung folgerichtig dem Ministerpräsident übertragen ist. Z u beachten ist allerdings, daß die Gesetze neben dem Ministerpräsidenten von mindestens der Hälfte der Minister zu unterzeichnen sind. Auch hierin kommt die Betonung der kollegialen Beschlußfassung und Verantwortimg zum Ausdruck. Aus dem Gesamtzusammenhang und aus A r t . 63 I L V muß dabei entnommen werden, daß die Verkündigung erst erfolgen darf, wenn diese Unterschriften vorliegen 1 1 . Neben diesen ausdrücklich i n der Verfassung geregelten Befugnissen fällt dem Ministerpräsidenten auch die einem Staatsoberhaupt zustehende staatliche Repräsentation i m herkömmlichen Sinne ganz allgemein zu. Daraus werden u. a. das Recht auf Verleihung von staatlichen Orden und Titeln und auch die Kompetenzen für Protokollangelegenheiten sowie für das Konsulatswesen abgeleitet 12 .
A r t . 49 I I L V nicht ganz unberücksichtigt bleiben. Vgl. dazu auch den C D U Verfassungsentwurf, A r t . 77 I (Beilagen zu den Sitzungsprotokollen der V L V , Bd. I, Beil. Nr. 118), der diese Erörterung i m K a b i n e t t vorsah u n d letztlich n u r deshalb nicht i n die Verfassung übernommen wurde, w e i l Staatssekretär K a u f m a n n seinerzeit versicherte, daß es „alte Übung" ist u n d bleiben w i r d , daß der Ministerpräsident v o m Ministerialrat aufwärts jede Beamtenernennung i n das Kabinett b r i n g t u n d sich die Zustimmung versichern läßt (vgl. Protokolle des V A , 14. Sitzung, S. 50 ff., 65). Die gegenwärtige Praxis bestätigt dies. A l l e Beamtenernennungen ab Besoldungsgruppe B 3 (einschließlich) werden v o m Ministerrat behandelt. 8 Vgl. dazu i m Einzelnen die Gnadenordnung des Ministerpräsidenten über die Ausübung des Gnadenrechts v o m 8.12.1970 (Ges. Bl. S. 518). 9 Die Ausführungen i n Fußnote 7 gelten hier entsprechend. 10 Hinsichtlich des sogen, formellen u n d materiellen Prüfungsrechts g i l t grundsätzlich dasselbe w i e bei A r t . 82 I GG; vgl. z . B . T. Maunz, i n : M a u n z / D ü r i g / Herzog, A r t . 82 A n m . 2; K . Hesse, Verfassungsrecht, § 18 I I I m. w. N. 11 So auch P. Feuchte, i n : Spreng / B i r n / Feuchte, S. 211. 12 Vgl. § 1 I Ziff. 11 der Bekanntmachung der Landesregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien v o m 25.7.1972 (Ges. Bl. S. 404), abgedruckt unten als Anlage 1. Die Verleihung von T i t e l n usw. w i r d i n praktisch allen Einzelfällen v o m K a b i n e t t gebilligt! 7 Katz
98
Kap. I I : Regierungssystem nach der bad.-württ. L V
2. Ministerpräsident als Regierungschef Die innere Organisation und Struktur der Landesregierung ist besonders vom Prinzip der Kollegialität geprägt 13 . Der Verfassungsgeber hat allerdings, u m eine effektive Regierungsarbeit zu gewährleisten, die Stellung eines Mitglieds dieses Kollegiums zu einer A r t „primus inter pares" ausgestaltet und i h m zusätzliche Rechte übertragen (Kanzlerprinzip) 1 4 . Es handelt sich dabei i m wesentlichen u m die Rechte aus A r t . 49 I S . 1, 49 I S. 2 und 46 I I L V . Die Richtlinienkompetenz (Art. 49 I S. 1 LV) verleiht dem Ministerpräsidenten ein auf i h n konzentriertes und i h m allein zustehendes Führungsmittel, das es i h m erlaubt, die allgemeine Richtung, Grundsätze und Ziele der Regierungsarbeit für den Zeitraum einer Legislaturperiode (Art. 55 I I LV) zu bestimmen. Diese Richtlinien sind i m Regierungsprogramm (-erklärung) und auch i n späteren programmatischen Ergänzungen festgelegt. Die Richtlinienkompetenz ist dabei aber insoweit eingeschränkt, als von A r t . 49 I S. 1 L V nur allgemeine, generelle Richtlinien und Zielsetzungen gedeckt sind. Konkrete Aussagen und Festlegungen i n der Regierungserklärung sind nur dann verbindlich, wenn ihnen vom Ministerrat ausdrücklich zugestimmt wurde (Art. 49 I I LV). Dabei ist jedes Regierungsmitglied allerdings verpflichtet, seine Aufgaben i n Kabinett und Ressort auf der Grundlage und i m Rahmen der allgemeinen Ziele und Grundsätze des Ministerpräsidenten wahrzunehmen und zu erfüllen. Zum Inhalt und zur Abgrenzung der Richtlinienkompetenz darf i m übrigen auf die eingehenden Ausführungen oben § 12 Ziff. 5 verwiesen werden. Gemäß A r t . 49 I S. 2 L V führt der Ministerpräsident den Vorsitz i n der Regierung und leitet ihre Geschäfte. Diese Befugnisse, die m i t der Richtlinienkompetenz eng verflochten sind und deshalb auch als deren Bestandteil (was teilweise vertreten wird) oder wie hier als deren Hilfsbefugnisse bezeichnet werden können 1 5 , geben dem Ministerpräsident die Möglichkeit, m i t Hilfe seiner Staatskanzlei den allgemeinen Gang der Regierungsgeschäfte zu steuern. Dabei liegt der Schwerpunkt dieser Rechte des Regierungschefs sicher nicht i n der formalen Festlegung von Terminen und Tagesordnungen der Kabinettssitzungen, sondern wesentlich mehr i n der i h m dadurch gegebenen Möglichkeit der Einflußnahme auf die Koordinierung der Ressortpolitik, die Besei13 So auch f ü r Rh.-Pf. F. Duppre, i n : M a y e r / U l e (Hrsg.), Staats- u n d V e r waltungsrecht i n Rh.-Pf., S. 46. 14 Vgl. Verhandlungen der V L V , S. 2298 ff., 2466 ff. u n d oben § 12 Ziff. 5. Vgl. zusätzlich Protokolle des V A , 13. Sitzung, S. 5 f . (ABG. Lausen, SPD); S. 17 (ABG. Mocker, B H E ) ; S. 18 f. (ABG. Erbe, DVP/FDP). 15 Vgl. dazu die Ausführungen oben § 12 (insbes. Fußnote 47).
§ 14 Der Ministerpräsident
99
tigung von Konflikten und Meinungsverschiedenheiten, aber auch die einheitliche Willensbildung und -äußerung der Regierung. M i t diesen Befugnissen hat der Ministerpräsident als Chefkoordinator die materielle und formelle Einheitlichkeit des Regierungshandelns durch Information, Kommunikation, Kooperation usw. sicherzustellen. Diese Rechte stehen ihm, allerdings unter Beachtung der Zuständigkeiten des A r t . 49 I und I I L V , nicht nur i m Ministerrat, sondern auch ganz allgemein bei der Regierungsarbeit zu 1 6 . Nach A r t . 46 I I L V beruft und entläßt der Ministerpräsident die Regierungsmitglieder. A u f Bundesebene w i r d das dieser Befugnis vergleichbare Vorschlagsrecht des Bundeskanzlers (Art. 64 GG, der i h m das materielle Kabinettsbildungsrecht verleiht) m i t als eine wesentliche Stütze der überragenden Stellung des Regierungschefs bezeichnet 1 7 . Wie aufgrund der oben dargestellten Grundstruktur des parlamentarischen Regierungssystems i n Bad.-Württ. zu erwarten ist, kann diese Aussage durch die Landesverfassung nicht bestätigt werden. Zwar ist der Ministerpräsident nach A r t . 46 I I L V staatsrechtlich grundsätzlich nicht gebunden; doch ist dieses Recht, ganz abgesehen von politischen Einflüssen und Absprachen, auch verfassungsrechtlich einmal durch die für die Gesamtregierung erforderliche Bestätigung durch den Landtag (Art. 46 I I I LV) und zum anderen durch die Befugnis des Kabinetts, über die Geschäftsbereiche ihrer Mitglieder zu beschließen (Art. 45 I I I LV), stark eingeengt. Da der gemäß A r t . 46 I L V gewählte Ministerpräsident nur „Ministerpräsident designatus" und aufgrund A r t . 46 I I I L V noch nicht endgültiger Regierungschef ist, sind nicht zuletzt auf dem Hintergrund des A r t . 47 L V (wegen der Landtagsauflösung bei mißlungener Regierung besteht eine A r t „Zugzwang") gemäß der Verfassung die Rechte sowohl des Landtags (Art. 46 I I I , I V und 45 I I I S. 2 LV) als auch des Kabinetts (Art. 45 I I I S. 1 L V ) 1 8 bei der Regierungsbildung von wesentlichem Einfluß 1 9 . Es besteht also insoweit ein Spannungsverhältnis zwischen den Rechten des Ministerpräsidenten, des Regierungskollegiums und des Parlaments (insbesondere Regie16
Dies wurde bereits oben § 12 Ziff. 5 näher ausgeführt u n d begründet. So auch F. Duppre, i n : Mayer / U l e (Hrsg.), Staats- u n d Verwaltungsrecht i n Rh.-Pf., S. 46 f. Vgl. oben § 12 Ziff. 5 (Fußnote 48). 17 Vgl. dazu etwa F. Klein, i n : Schmidt-Bleibtreu / Klein, A r t . 64 A n m . 3; Hamann/Lenz, A r t . 64 A n m . 1; E.-W. Böckenförde, Organisationsgewalt, S. 139 f.; K . Hesse, Verfassungsrecht, § 17 I I I . 18 Vgl. dazu u n d insbes. zur Organisationsgewalt unten § 17 u n d oben § 12 (Fußnote 33); Verhandlungen des Landtags, 5. Wahlperiode, S. 4670 f., 50355039; vgl. insbes. auch den schriftlichen Bericht über die Beratungen des Ständigen Ausschusses, ebenda, S. 4682 - 4684. 19 Vgl. die i n Fußnote 18 angegebenen Materialien u n d P. Feuchte, Spreng / B i r n / Feuchte, S. 175 f. I n A r t . 45 I I I u n d 46 I I - V L V zeigt sich u. a. die enge Verbindung und Verflechtung zwischen Parlament u n d Regierung. 7*
100
Kap. I I : Regierungssystem nach der bad.-württ. L V
rungsfraktionen), für dessen Lösimg i m Prinzip ebenfalls die Grundsätze oben § 12 Ziff. 5, allerdings m i t zwei Modifikationen gelten. Dem Ministerpräsidenten ist unter Beachtung des A r t . 45 I I I und 49 I I L V bei der Berufung der Regierungsmitglieder gemäß A r t . 46 I I und 49 I, S. 1 L V insoweit eine gewisse „Vorrangstellung" einzuräumen, als ihm das Vorschlagsrecht zukommt und gegen seinen Willen deshalb kein Regierungsmitglied ernannt werden kann 2 0 . Zudem hat die Landesverfassung für die Durchführung der Regierungsbildung verfassungsrechtlich noch weit mehr Spielraum gelassen als sie es ohnehin für die Ausgestaltung des Regierungssystems schon getan hat. 3. Stellung im Regierungssystem Betrachtet man die Befugnisse und Zuständigkeiten des Ministerpräsidenten insgesamt, so bestätigt sich das oben unter § 12 Ziff. 5 gefundene Ergebnis. Die Landesverfassung hat das Kanzlerprinzip bei der Regierungsorganisation m i t berücksichtigt, wobei allerdings i m Unterschied zum Bund nicht von einer besonders hervorgehobenen Stellung dieses Prinzips gesprochen werden kann. Das Regierungssystem ist i n Bad.-Württ. verfassungsrechtlich keinesfalls als „Kanzler- oder Präsidialdemokratie" ausgestaltet. Der Ministerpräsident ist nicht Chef der Regierung, sondern mehr primus inter pares innerhalb des Regierungskollegiums. 4. Staatsministerium (Staatskanzlei)21 Der Begriff Staatsministerium hat allgemein eine doppelte Bedeutung. Einmal versteht man darunter die Regierung als Kollegium (Kabinett, Ministerrat) und zum anderen bezeichnet man damit auch die Behörde bzw. das Büro des Ministerpräsidenten (Staatskanzlei) 22 . I n der Landesverfassung findet sich der Begriff Staatsministerium nicht mehr. I n § 1 I der Bekanntmachung der Landesregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien 2 3 ist allerdings i n 20 Vgl. P. Feuchte, i n : S p r e n g / B i r n / F e u c h t e , S. 175 f.; K. Göbel, Landesverfassung, S. 62. Z u r Regierungsbildung eingehend: G. Müller, i n : Staatsanzeiger B W 1958, Nr. 30, S. 2. 21 Hier sollen lediglich einige i n diesem Zusammenhang verfassungsrechtlich interessierende Fragen u n d begriffliche Festlegungen behandelt werden. Eine umfassende Darstellung des Staatsministeriums w i r d zusammenhängend unten i n § 24 Ziff. 1 u n d 2 gegeben. 22 Vgl. etwa § 26 der W ü r t t . Verfassung v o m 25.9.1919 (Reg. Bl. S. 281); Gesetz über das Staatsministerium u n d die Ministerien v o m 6.11.1926 (Reg. Bl. S. 239); P. Feuchte, i n : Spreng / B i r n / Feuchte, S. 174. Die erste Begriffsbedeutung (Staatsministerium = Kabinett) w i r d heute i n Bad.-Württ. allerdings nicht mehr gebraucht. 23 V o m 25. 7.1972 (Ges. Bl. S. 404), abgedruckt unten als Anlage 1.
§ 14 Der Ministerpräsident
101
16 Ziffern der Geschäftsbereich des Staatsministeriums genau umschrieben. I n diesem Sinn soll der Begriff Staatsministerium deshalb auch gebraucht werden. Das Staatsministerium ist also primär das Büro, die Kanzlei des Ministerpräsidenten; es stellt die Führungseinrichtung dar, m i t deren Hilfe er die i h m zustehenden und von i h m wahrzunehmenden Rechte und Zuständigkeiten ausübt bzw. erfüllt (Staatskanzlei) 2 4 . Aus der Entstehungsgeschichte des heutigen Staatsministeriums ergibt sich allerdings, daß es nicht ausschließlich und allein das Führungsinstrument des Ministerpräsidenten, sondern auch des Ministerrats, des Regierungskollegiums, sein soll und sich entsprechend zu verstehen hat 2 5 . Der Ministerpräsident kann zusätzlich zur Staatskanzlei ohne weiteres einen Geschäftsbereich selbst übernehmen (Art. 45 I V LV); dies darf aber nicht dergestalt erfolgen, daß das Staatsministerium zu einem Ressort gemacht wird. Vielmehr ist der Geschäftsbereich des Staatsministeriums so festzulegen, daß er grundsätzlich keine Ressortaufgaben enthält 2 6 . Die Staatskanzlei darf also nicht zu einem sachverwaltenden, sachbearbeitenden „Oberministerium" ausgebaut werden. Eine Ausnahme hiervon stellen allerdings politisch bedeutsame und i n engem Sachzusammenhang m i t den Aufgaben des Ministerpräsidenten stehende, vom Umfang her aber nicht zu große Aufgaben und Zuständigkeiten dann dar, wenn sie auch insgesamt betrachtet kein bedeutendes Ausmaß erreichen, sondern i m Vergleich zu den eigentlichen Funktionen des Staatsministeriums eine untergeordnetere Bedeutung haben. Bei Anwendung dieser Grundsätze auf den festgesetzten Geschäftsbereich des Staatsministeriums (insbes. Ziff. 12-16) ergibt sich, daß derzeit i n Bad.-Württ. dagegen nicht verstoßen w i r d 2 7 .
24 Vgl. dazu etwa H. Weichmann, i n : Die Staatskanzlei, SHS Bd. 34, S. 33 f.; F. Knöpfle, ebenda, S. 55ff.; G. Kunze, ebenda, S. 99f.; zur Entstehung der Staatskanzlei vgl. insbes. K . von Beyme, i n : PVS 1969, S. 249 - 268. 26 So G. Müller, I n t e r v i e w v o m 5. 3.1974. Vgl. auch Fußnote 22; § 1 I, Ziff. 5 - 7 der Bekanntmachung der Landesregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche v o m 25. 7.1972 (Anlage 1) u n d F. Knöpfle, i n : Die Staatskanzlei, SHS Bd. 34, S. 56. 26 Dies ergibt sich einmal mittelbar aus A r t . 45 I V L V u n d zum anderen aus dem Wesen u n d dem Zweck der Einrichtung Staatsministerium als einem Instrument der Gesamtintegration u n d Koordination zur Berücksichtigung der Gesamtinteressen u n d nicht konkreter Ressortbedürfnisse. Vgl. K . von Beyme, i n : PVS 1969, S. 267; E.-W. Böckenförde, Organisationsgewalt, S. 240; F. Knöpfle, i n : Die Staatskanzlei, SHS Bd. 34, S. 55 m. w. N. 27 § 1 1 der Bekanntmachung der Landesregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche v o m 25.7.1972 (unten Anlage Nr. 1); F. Knöpfle, i n : Die Staatskanzlei, SHS Bd. 34, S. 56. Bedenklich ist dagegen die derzeitige Regel u n g i n Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz u n d Schleswig-Holstein.
102
Kap. I I : Regierungssystem nach der bad.-württ. L V
§ 15 Die Minister 1. Das Ressortprinzip Gemäß A r t . 49 I S. 4 L V leitet jeder Minister innerhalb der Richtlinien der Politik seinen Geschäftsbereich selbständig unter eigener Verantwortung. Daraus ergibt sich, daß jedem Minister ein nach Sachgebieten abgegrenzter Geschäftsbereich von Regierungs- und Verwaltungsaufgaben zugewiesen werden muß, den dieser eigenständig mit Hilfe der i h m zur Verfügung stehenden Ministerialbürokratie zu erledigen hat 1 . Die Selbständigkeit ist dabei allerdings keine umfassende; vielmehr sind ihr durch die i n A r t . 45 ff. L V festgelegte Regierungsstruktur (insbes. A r t . 49 I und I I LV) beachtliche Grenzen gezogen. Oben i n § 12 wurde bereits ausführlich dargelegt, daß das Ressortprinzip nicht nur durch die Richtlinienkompetenz, sondern besonders auch durch das i n der Landesverfassung stark verwirklichte Kollegialprinzip eingeschränkt wird, ohne es allerdings i n seiner Bedeutung wesentlich zu beschneiden2. Nach A r t . 49 I I L V hat ein Minister u. a. alle Fragen von grundsätzlicher und weittragender Bedeutung zur Beratung und Beschlußfassung dem Kabinett zu unterbreiten. Aufgrund dieser Ausgestaltung des Regierungssystems ergibt sich, daß der Bereich der Minister und ihrer Ministerien nicht nur an den Grundsätzen des Ressortprinzips ausgerichtet ist, sondern auch Elemente des sogen. Ministerialprinzips enthält 3 . U m die gestiegene Bedeutung und den verstärkten Einfluß des Ministerrats zu gewährleisten, muß demnach das Ressortprinzip begrenzt und folglich m i t Zügen des Ministerialprinzips versehen werden. Daraus folgt, daß sich die Aufgaben des Ministers nicht i n ressortbezogenen Tätigkeiten, einmal in der Leitung seines Hauses (Behördenchef) und zum anderen i n der Vertretung der Ressortinteressen i m Kabinett, erschöpfen dürfen, sondern daß er daneben als Mitglied des wichtigsten Regierungsorgans, dem Ministerrat, möglichst frei vom Ressortdenken und allein unter gesamtverantwortlichen und übergeordneten Gesichtspunkten eine weitere besonders wichtige Regierungsaufgabe auszuüben hat. Da die Landesverfassung das Schwergewicht der Regierungsentscheidungen dem Kabinett zuge1 Vgl. dazu u n d zum Ressortprinzip allgemein: T. Maunz, i n : M a u n z / D ü r i g / Herzog, A r t . 65 A n m . 4; F. Klein, i n : Schmidt-Bleibtreu / Klein, A r t . 65 A n m . 5; E. Guilleaume, i n : D Ö V 1960, S. 328 - 330; E.-W. Böckenförde, Organisationsgewalt, S. 196 ff.; J. Kölble, i n : D Ö V 1973, S. 1 ff. Grundsätzlich darf es keinen „ministerialfreien Raum" geben (vgl. dazu BVerfGE 9, 268, 282). 2 Vgl. auch P. Feuchte, i n : Spreng / B i r n / Feuchte, S. 182. 3 Ministerialprinzip, verstanden i. S. v. F. Klein, i n : Schmidt-Bleibtreu/ Klein, A r t . 65 A n m . 5 u n d J. Kölble, i n : D Ö V 1973, S. 1 f. I m Schweizer V e r fassungsrecht spricht m a n von Departementalprinzip; danach ist dem K o l l e gialsystem das Departementalsystem ergänzend an die Seite zu stellen (vgl. dazu Schweizer Totalrevision, Schlußbericht, S. 503 ff.).
§15 Die Minister
103
wiesen hat (Art. 49 I I LV), steht gleichzeitig verfassungsrechtlich — gewissermaßen als notwendige Konsequenz — fest, daß das i n A r t . 49 I S. 4 L V enthaltene Ressortprinzip insoweit durch Elemente des M i n i sterialprinzips modifiziert ist 4 . M i t dieser Ausgestaltung w i r d verfassungsrechtlich denn auch sicher ein Teil der zu recht erhobenen Einwände gegen ein zu stark ausgeprägtes Ressortprinzip beseitigt, wonach nicht selten die politische Führung „auf dem Gletschergeröll der Ressortautonomie dahintänzelt oder von einzelnen losen Blöcken dahingetragen w i r d " 5 . Die Landesverfassung versucht vielmehr, parallel zur Stärkung des Kabinetts auch diejenigen Aufgaben der Minister stärker zu betonen, die auf ein verantwortliches, programmatisches, gesamtstaatliches Regierungskonzept abzielen, den bloßen Ressortegoismus also zugunsten einer Berücksichtigung der Gesamtinteressen und der Einheitlichkeit zurückdrängen möchten (modifiziertes Ressortprinzip) 6 . Ob diese Regelung i n der Verfassungswirklichkeit zum Tragen gekommen ist, soll später untersucht werden 7 . 2. Stellung im Regierungssystem Nach umstrittener aber herrschender Auffassung kennt das Grundgesetz keine selbständige parlamentarische Verantwortung der Bundesminister, vielmehr besteht für sie eine Verantwortung nur gegenüber dem Bundeskanzler. Gegenüber dem Bundestag t r i f f t danach nur den Regierungschef und die Minister allenfalls mittelbar eine parlamentarische Verantwortlichkeit 8 . Dieser Meinungsstreit braucht hier nicht entschieden zu werden. Nach der Landesverfassung ist nämlich i m Unterschied zum Grundgesetz die Stellung der einzelnen Minister, vor allem i m Verhältnis zum Parlament, wesentlich eigenständiger und damit insgesamt stärker ausgestaltet. Gemäß A r t . 46 I I I und I V der L V bedarf letztlich jeder einzelne Minister der Bestätigung durch den Landtag. Außerdem kann jedes Mitglied der Regierung unter bestimmten Voraussetzungen vor dem Staatsgerichtshof angeklagt werden (Ministeranklage, A r t . 57 LV) und schließlich ist auf Beschluß von zwei 4 Vgl. dazu oben § 12 Ziff. 5; so oder ähnlich bereits § 26 der W ü r t t . V e r fassung v o m 25. 9.1919 i. V. m. A r t . 3 des Ausführungsgesetzes v o m 6.11.1926 (Reg. Bl. S. 239 ff.) u n d A r t . 77 der Bad. Verfassung v o m 22. 5.1947 (Reg. Bl. S. 129). 5 So F. Morstein Marx, i n : Die Staatskanzlei, SHS Bd. 34, S. 126. 6 Vgl. dazu etwa F. Morstein Marx, i n : Die Staatskanzlei, SHS Bd. 34, S. 126 f.; W. Hennis, ebenda, S. 156 (Diskussionsbeitrag). 7 Vgl. dazu insbesondere unten § 21. 8 So etwa T. Maunz, i n : Maunz / D ü r i g / Herzog, A r t . 65 A n m . 4; von Mangoldt/Klein, A r t . 65 A n m . I V 4; F. Klein, i n : Schmidt-Bleibtreu / Klein, A r t . 65 A n m . 8; A. Hamann, i n : H a m a n n / L e n z , A r t . 65 A n m . B 4; a. A . : K . Hesse, Verfassungsrecht, § 17 I I I 2; K . Kröger, Ministerverantwortlichkeit, S. 5 ff. m. w . N.
104
Kap. I I : Regierungssystem nach der bad.-württ. L V
Dritteln der Mitglieder des Landtags ein Minister zu entlassen (Art. 56 LV). Diese Verfassungsbestimmungen, die der auf der grundgesetzlichen Regelung beruhenden h. M. alle wesentlichen Argumente nehmen, rechtfertigen die Feststellung, daß nach der Landesverfassung jeder Minister dem Landtag gegenüber parlamentarisch verantwortlich ist (vgl. auch A r t . 34 LV) 9 . Grundsätzlich gilt dies allerdings nur für Kabinettsmitglieder, die einen Geschäftsbereich selbständig und unter eigener Verantwortung leiten. Da aber die oben ausgeführten Verfassungsbestimmungen (Art. 46 I I I , IV, 56, 57 und auch 34 LV) sich stets auf alle Mitglieder der Regierung erstrecken, also auch Staatssekretäre und Staatsräte betreffen, muß i n Bad.-Württ. die „Ministerverantwortlichkeit" auch für diese gelten 10 . Parlamentarische Verantwortlichkeit ist nach heutigem Verfassungsrecht aber individuelle Verantwortlichkeit grundsätzlich jedes einzelnen Regierungsmitglieds. Auch die Landesverfassung kennt keine kollektive Verantwortlichkeit des Kabinetts (selbst nicht bei Kollegialentscheidungen nach A r t . 49 I I LV), sondern orientiert sich ausschließlich am individuellen Fehlverhalten einzelner Regierungsmitglieder 11 . Als gewissermaßen unvermeidliche Folge und Korrelat der so ausgestalteten parlamentarischen Ministerverantwortlichkeit bedarf es aber des Prinzips der Kabinettssolidarität 1 2 . Zwar ist ein solches Prinzip i n der Landesverfassung nicht ausdrücklich niedergelegt, doch ist es durch A r t . 49 L V implicite gewährleistet. I m Rahmen der Richtlinienkompetenz hat der Ministerpräsident die Aufgabe (für jedes Kabinettsmitglied verbindlich) auf deren einheitliche Einhaltung hinzuwirken. Bei Angelegenheiten, die der Zuständigkeit des Kabinetts, dem bedeutendsten Regierungsorgan, unterliegen, hat der Ministerrat selbst auf eine Solidarität hinzuwirken, und die einzelnen Mitglieder haben die gefaßten Beschlüsse zu respektieren, zu beachten und notfalls zu vertreten. Dem Ministerpräsidenten kommt aber auch hierbei die Aufgabe zu, die Einheitlichkeit der Regierungsarbeit zu überwachen und das solidarische Auftreten der Regie9 So auch P. Feuchte, i n : Spreng / B i r n / Feuchte, S. 152, 174 u n d 180; vgl. i m übrigen K . Kröger, Ministerverantwortlichkeit, S. 5 ff. u n d 74 ff. m. w. N. 10 Vgl. K . Kröger, Ministerverantwortlichkeit, S. 9 - 1 1 ; P. Feuchte, i n : Spreng / B i r n / Feuchte, S. 152, 175, 193 u n d 194. 11 Vgl. dazu K . Kröger, Ministerverantwortlichkeit, S. 7 f.; E.-W. Böckenförde, Organisationsgewalt, S. 172 ff.; K . Stern, i n : Projektgruppe B M I , Erster Bericht, Anlagenband, S. 601. So auch bereits A r t . 76 ff. der Bad. L V v o m 22. 5.1947; A r t . 69 ff. der W ü r t t . Bad. L V v o m 28.11.1946; A r t . 44 ff. Württ.-Hohenz. L V v o m 20. 5.1947; ähnlich bereits §§ 26 ff. der W ü r t t . Verfassung v o m 25. 9.1919. 12 Vgl. K . Kröger, Ministerverantwortlichkeit, S. 7 f.; F. Duppre, i n : M a y e r / Ule, S. 48; F. Klein, i n : Schmidt-Bleibtreu / Klein, A r t . 65 A n m . 5. Z u dieser Problematik nach dem Englischen Regierungssystem vgl. D. N. ehester, i n : Stammen (Hrsg.), S t r u k t u r w a n d e l der modernen Regierung, S. 104 f.
§ 15 Die Minister
rung vor dem Parlament und allgemein i n der Öffentlichkeit sichern 18 .
105
zu
Insgesamt betrachtet kann die verfassungsrechtliche Stellung der Minister, vor allem i m Vergleich zum Grundgesetz, dahingehend charakterisiert werden, daß zwar das Hessortprinzip zugunsten einer größeren Kabinettszuständigkeit nur i n „abgeschwächter" Form ausgestaltet ist, daß dies aber infolge der größeren Aufgaben und Kompetenzen des Ministers i m Kabinett (vgl. insbesondere A r t . 49 I I LV) mindestens aufgewogen wird. Der Landesverfassung liegt demnach ein modifiziertes Ressortprinzip zugrunde, das den Minister als Regierungsmitglied und damit als Mitverantwortlichen für die gesamtstaatlichen Interessen besonders hervorhebt. 3. Einzelne Minister Die i n A r t . 49 L V festgelegte Regierungsstruktur kennt, abgesehen vom Ministerpräsidenten, grundsätzlich keine besonderen Rechte oder qualifizierten Verantwortlichkeiten einzelner Minister. Vielmehr sind alle Minister gleichberechtigt und genießen keine Vorzugsrechte 14 . Ob dies allerdings ausnahmslos gilt, ist noch besonders zu prüfen. I n A r t . 81 und 83 I L V sind für den Finanzminister bestimmte Befugnisse und Aufgaben ausdrücklich festgelegt 15 . Da die Verfassung aber offensichtlich davon ausgeht, daß dem Finanzminister sowohl die A u f gaben des „Haushaltsministers" als auch die des Leiters der Finanzverwaltung zukommen, i h m also einen bestimmten Geschäftsbereich zuordnet, sind diese Rechte lediglich eine zwangsläufige Folge davon. Die wichtigste Befugnis des Finanzministers ergibt sich zweifellos aus A r t . 81 L V (Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben). I m Hinblick auf die i n A r t . 49 L V normierte Regierungsstruktur ist A r t . 81 L V jedoch dahingehend auszulegen, daß dieses Recht dem F i nanzministerium verfassungsrechtlich keinesfalls eine Vorzugsstellung bei der Festlegung und Verteilung der Finanzmittel (Haushaltsplanaufstellung) einräumt, sondern i h m neben der Etatvorbereitung lediglich eine Garantenstellung für eine haushaltsgemäße staatliche Ausgabenwirtschaft, also die Beachtung und Kontrolle des bereits verabschiedeten Staatsbudgets aufbürdet. Bei einer solchen Interpretation verstoßen die speziell den Finanzminister betreffenden Bestimmungen 18 Diese Aufgabe des Ministerpräsidenten ergibt sich aus (2) oben § 12 Ziff. 5. 14 Vgl. dazu umfassend: E.-W. Böckenförde, Organisationsgewalt, S. 182 ff.; K. Kröger, Ministerverantwortlichkeit, S. 114 ff. 15 Vgl. außerdem die dem Finanzminister durch die Landeshaushaltsordnung f ü r Bad.-Württ. v o m 19.10.1971 (Ges. Bl. S. 428) übertragenen Zuständigkeiten, die aber hier nicht näher geprüft werden.
106
Kap. I I : Regierungssystem nach der bad.-württ. L V
der Landesverfassung demnach nicht gegen den Grundsatz der Gleichberechtigung aller Regierungsmitglieder (Art. 49 L V ) 1 6 . Neben dem Finanzminister ist i n der Landesverfassung kein bestimmter Minister und kein Ministerium mehr ausdrücklich genannt. Zwar werden i m verfassungsrechtlichen Schrifttum dem Innen- und Justizminister oft besondere Funktionen bezüglich der Verfassung, der Gesetzgebung, der Organisation oder dem Personal zugesprochen, doch handelt es sich hierbei u m keine qualitativen Vorzugsrechte, sondern nur um eine A r t Nutzbarmachung der insoweit bestehenden Sachkunde und Erfahrung dieser Ministerien (teilweise eine A r t zusätzliche „Innenkontrolle") 1 7 . Aus diesen Ausführungen ergibt sich darüber hinaus, daß verfassungsrechtlich allein das Vorhandensein des Ressorts des Finanzministers vorausgesetzt und damit gesichert ist und insoweit ohne Verfassungsänderung nicht durch eine Organisationsentscheidung des Kabinetts (Art. 45 I I I LV) beseitigt werden kann 1 8 . I m übrigen besteht für den Inhaber der Organisationsgewalt freies Feld zur Ausgestaltung der einzelnen Geschäftsbereiche einschließlich der Festlegung der Zahl der Minister 1 9 . § 16 Die Staatssekretäre (i. w. S.) Die überkommene Organisationsform der Regierung kennt als tragende Bauelemente nur den Regierungschef, die Minister und teilweise noch die beamteten Staatssekretäre. I n den letzten Jahren hat allerdings die Staatspraxis zusätzlich verschiedenste „Neubildungen" oder „Zwischenformen" hervorgebracht 1 . Dies gilt seit Sommer 1972 besonders auch für Baden-Württemberg. 1. Verschiedene A r t e n
Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist es geboten, vorweg die verschiedensten Arten dieser reichen Palette der Staatssekretäre i. w. S. i n Bad.-Württ. kurz darzustellen: 16 Vgl. dazu ausführlich: E.-W. Böckenförde, Organisationsgewalt, S. 182 ff.; T. Maunz, i n : Maunz / D ü r i g / Herzog, A r t . 112 A n m . 1; K . Kröger, Ministerverantwortlichkeit, S. 117 ff. je m. w. N. 17 Vgl. dazu eingehend: E.-W. Böckenförde, Organisationsgewalt, S. 186; K. Kröger, Ministerverantwortlichkeit, S. 114 ff. m. w. N. Vgl. § 26 I, I I GeschOBReg. 18 Vgl. dazu i m einzelnen unten § 17 u n d etwa K . Kröger, Ministerverantwortlichkeit, S. 36. 19 Die derzeitigen Geschäftsbereiche der Ministerien sind i n der Bekanntmachung v o m 25. 7.1972 (Ges. Bl. S. 404; abgedruckt unten Anlage Nr. 1) festgesetzt. Wegen Fehlens einer GeschO der Regierung erfolgt auch insoweit keine nähere Ausgestaltung.
§ 16 Die Staatssekretäre (i. w . S.)
107
(1) Staatssekretäre nach A r t . 45 I I S. 2 L V (Staatssekretäre m i t Kabinettsrang). Diese können noch weiter unterteilt werden i n solche m i t oder ohne Stimmrecht und schließlich auch i n solche, die gleichzeitig Landtagsabgeordnete sind oder nicht. (2) Ehrenamtliche Staatsräte nach A r t . 45 I I S. 2 L V (Unterteilung wie bei Ziff. 1). (3) Minister für Bundesangelegenheiten. (4) Politische Staatssekretäre aufgrund des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der politischen Staatssekretäre vom 19. 7.1972 (Ges. Bl. S. 392), wobei man hier noch zusätzlich zwischen solchen mit bzw. ohne Abgeordnetenmandat unterscheiden kann. (5) Ministerialdirektoren als leitende Beamte (auf Lebenszeit) der Ministerien und allgemeine Vertreter der Minister m i t der ad personam verliehenen Amtsbezeichnung Staatssekretär (§ 97 I I LBG). (6) Ministerialdirektoren als leitende Beamte (auf Lebenszeit) Ministerien und allgemeine Vertreter der Minister.
der
Diese Vielfalt mutet auf den ersten Blick etwas übersteigert an, was etwa durch die bis 31. 8.1974 bestehende Organisation der Ressortspitze des Innenministeriums deutlich illustriert wurde. Dort waren nämlich neben dem Minister ein Staatssekretär m i t Kabinettsrang, ein politischer Staatssekretär und noch zwei Ministerialdirektoren tätig. Eine solche Ausgestaltung der Leitung eines Ministeriums ist i n der Tat ungewöhnlich und auf Länderebene i n der Bundesrepublik sicher einmalig. I n den folgenden Ausführungen sollen allerdings nur die dazu rechtlich interessierenden Probleme untersucht werden 2 . 2. Staatssekretäre mit Kabinettsrang Gemäß Art. 45 I I L V können als weitere Mitglieder der Regierung Staatssekretäre ernannt werden. Ihre Zahl darf ein D r i t t e l der Zahl der Minister nicht übersteigen. Durch Landtagsbeschluß kann ihnen das Stimmrecht verliehen werden (Regelfall). Die Aufnahme und Ausgestaltung dieses Staatssekretärtyps in die Landesverfassung, den man als eine A r t Staatssekretär „sui generis" bezeichnen kann, erfolgte maßgeblich und letztlich auch einleuchtend aus drei Gründen 3 : 1 Vgl. dazu etwa E.-W. Böckenförde, Organisationsgewalt, S. 221 ff.; K . Fehlig, Die Rechtsstellung des Staatssekretärs, S. 62ff.; F. Klein, i n : DVB1. 1965, S. 862 ff.; F. K . Fromme, i n : ZRP 1973, S. 153 ff. 2 Z u m empirischen Befund u n d zu den entsprechenden rechtspolitischen Fragen vgl. eingehend unten § 23. 3 Dies ergibt sich eindeutig aus den Materialien zur L V ; vgl. Protokolle des V A , 13. Sitzung, S. 6 - 2 8 ; 47. Sitzung, S. 26f.; Verhandlungen der V L V , S.
108
Kap. I I : Regierungssystem nach der bad.-württ. L V
— Man wollte die Möglichkeit schaffen, einem Regierungsmitglied, das nicht mit der Bürde eines Geschäftsbereichs (Ressortleitung) belastet ist, Sonderaufgaben zur Wahrnehmung zuweisen zu können, wenn es zu deren Bewältigung einer besonders herausgestellten „Amtsperson" bedarf. Gedacht hat man dabei vor allem an Sonderaufgaben wie die Ausarbeitung der Verfassung, die Vertretung des Landes i m Bundesrat (wegen A r t . 51 I und 52 I I I GG) und ganz allgemein i n Bonn, die Wahrnehmung der Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten usw. — Man sah schon damals die Notwendigkeit, wenigstens einem Teil der Minister, die bereits seinerzeit sehr überlastet waren, eine A r t „Vertretung" zu geben, die von der Stellung her höherrangiger als die der Ministerialdirektoren ist. Für die besonders großen Ministerien sollte deshalb die Möglichkeit eröffnet werden, für ministerielle Aufgaben, insbesondere i m Hinblick auf Öffentlichkeit, Landtag oder Bundesrat, einen Staatssekretär zu bestellen. — Das dritte Argument — ein mehr praktisch politisches — wurde darin gesehen, daß die Ernennung von Staatssekretären zur Erleichterung der Regierungsbildung erforderlich ist. U m die Bedürfnisse der Regierungsparteien i n parteipolitischer, aber auch landsmannschaftlicher und konfessioneller Hinsicht weitgehend erfüllen zu können, bei der Regierungsbildung also flexibel zu sein und einen gewissen Spielraum zu haben, war die Institution des Staatssekretärs für notwendig erachtet worden. Nicht zuletzt aus diesen Gründen herrschte allgemeine Übereinstimmung darüber, daß i n der Landesverfassung die Möglichkeit geschaffen werden mußte, für die genannten Zwecke eine begrenzte Anzahl von Staatssekretären ernennen zu können. Letzteres hatte den Sinn, ein relativ kleines und damit leistungsfähiges Regierungskollegium zu gewährleisten. Vor allem i m Hinblick auf A r t . 51 I und 52 I I I GG war man sich aber auch über die Ausgestaltung des Staatssekretärs als Regierungsmitglied einig (vgl. A r t . 46, 48, 53, 55 - 57 LV). Bis zuletzt umstritten blieb dagegen die Frage des Stimmrechts der Staatssekretäre i m Kabinett. Bewußt blieb auch bis zur Dritten Lesung die nähere Festlegung des Verhältnisses zwischen Ministern und Staatssekretären offen, die m i t der Frage des Stimmrechts eng zusammenhing (vgl. Art. 75 I S. 2 des CDU-Verfassungsentwurfs). Die endgültige Fassung 2298 f. u n d 2466. Vgl. auch die entspr. Beratungen zum Überleitungsgesetz: Protokolle des V A , 2. Sitzung, S. 34 ff.; 7. Sitzung, S. 9 ff.; Verhandlungen der V L V , S. 2283 f. u n d 2290. Die 3 Argumente kommen besonders deutlich zum Ausdruck i n der 13. Sitzung des V A bei: ABG. Lausen (SPD), Protokolle, S. 6; ABG. G. Müller (CDU), S. 14; ABG. Mocker (BHE), S. 17; ABG. Kalbfell (SPD), S. 19; ABG. Vortisch (DVP/FDP), S. 27.
§ 16 Die Staatssekretäre (i. w. S.)
109
des A r t . 45 I I S. 4 L V wurde dann aufgrund des Antrags der „Interfraktionellen Sonderkommission" vom 4.11.1953, die außerhalb des Parlaments tagte und von der deshalb keine Unterlagen und Gründe für diesen Antrag vorliegen, festgelegt 4 . Von den parlamentarischen Staatssekretären des Bundes unterscheiden sich die Staatssekretäre m i t Kabinettsrang vor allem dadurch, daß sie selbständiges, unter allein eigener Verantwortung stehendes Regierungsmitglied und insoweit keinem Minister untergeordnet sind 5 . Sie werden zwar vom Regierungschef gemäß A r t . 46 I I L V berufen und entlassen (vgl. dazu unten § 17), doch sind sie — anders als auf Bundesebene — dem Landtag gegenüber immittelbar verantwortlich. Diese parlamentarische Verantwortlichkeit ergibt sich aus den Verfassungsbestimmungen der A r t . 46 I I I , IV, 48, 53, 55 - 57 und 34 L V . Besonders bedeutsam ist dabei, daß die Ernennung eines Staatssekretärs der Bestätigung bzw. Zustimmung des Landtags bedarf (Art. 46 I I I und I V LV), daß sie den Amtseid vor dem Parlament abzulegen haben (Art. 48 LV), daß der Landtag ihre Entlassung erzwingen kann (Art. 56 LV) und daß sie unter bestimmten Voraussetzungen auch vor dem Staatsgerichtshof angeklagt werden können (Art. 57 LV). Ihre verfassungsrechtliche Stellung i m Kabinett und gegenüber dem Landtag ist also weitgehend m i t der der Minister identisch 6 . Über die außerhalb des Ministerrats von den Staatssekretären wahrzunehmenden konkreten Aufgaben und Zuständigkeiten enthält die Verfassung kaum Anhaltspunkte. Zwar ist i n A r t . 45 I I I L V bestimmt, daß die Landesregierung über die Geschäftsbereiche ihrer Mitglieder 4 Vgl. dazu neben den Angaben i n Fußnote 3 insbes. den Bericht des VA über den Verfassungsentwurf, Beilagen zu den Sitzungsprotokollen der V L V , Bd. 3, Beilage Nr. 1103, S. 56 u n d A B G . Krause, Verhandlungen der V L V , S. 2298 f. Verfassungsentwurf der CDU-Fraktion, i n : Beilagen zu den S i t zungsprotokollen der V L V , Bd. I, Nr. 118. Vgl. außerdem U r t e i l des S t G H Bad.-Württ. v o m 24. 2.1973 (2/72) — Staatssekretärurteil — i n : E S V G H 23, S. 135 ff., 137. Aus diesen Ausführungen ergibt sich, daß sich die Verfassungsgebende Landesversammlung mindestens bis zur D r i t t e n Lesung weitere Zwischenstufen zwischen Minister u n d M i n i sterialdirektor nicht vorgestellt hat (Staatssekretär sollte erkennbar f ü r die genannten u n d damit f ü r alle erforderlichen Zwecke eingesetzt werden k ö n nen), daß also der Staatssekretär abschließend i n A r t . 45 I I L V geregelt w e r den sollte (so zu Recht E S V G H 23, S. 138). Darauf w i r d noch unten i n Z u sammenhang m i t den pol. Staatssekretären näher einzugehen sein. 5 Dies w i r d noch dadurch verstärkt, daß seit I n k r a f t t r e t e n der L V allen Staatssekretären das Stimmrecht i m Kabinett verliehen wurde. 6 Vgl. dazu E S V G H 23, S. 135, 139 ff.; P. Feuchte, i n : Spreng / B i r n / F e u c h t e , S. 173 f.; H. Läufer, Der parlamentarische Staatssekretär, S. 8; U. Echtler, Der beamtete Staatssekretär, S. 50 ff. A l l e n Staatssekretären wurde bisher v o m Landtag das Stimmrecht i m Kabinett verliehen. Als Regierungsmitglieder können sie ebenfalls nicht gegen A r t . 77 I L V verstoßen. Auch insoweit sind sie den Ministern gleichzustellen (vgl. E S V G H 23, 145).
110
Kap. I I : Regierungssystem nach der bad.-württ. L V
beschließt; doch erstreckt sich diese Beschlußfassung eben lediglich auf die Geschäftsbereiche, die gemäß A r t . 49 I S. 4 L V nur den Ministern zustehen. Die konkreten Aufgaben und Zuständigkeiten der Staatssekretäre sind auch nicht i n der Geschäftsordnung (Art. 49 I S. 2 LV) geregelt, da eine solche bis heute nicht erstellt wurde. Da weder die Geschäftsordnung noch der vom Landtag bestätigte Beschluß der Regierung über die Geschäftsbereiche der Ministerien, i n dem dies auch geregelt werden könnte, Hinweise dazu enthält 7 , muß aufgrund der wenigen Verfassungsbestimmungen und der Materialien zur Landesverfassung geprüft werden, welche Stellung den Staatssekretären außerhalb dem Ministerrat zukommt und welche konkreten Zuständigkeiten sie i n diesem Bereich besitzen können. Aus A r t . 49 I S. 4 L V ist zu entnehmen, daß i n den Grenzen von A r t . 49 I S. 1 und I I L V die Staatssekretäre grundsätzlich keinen Geschäftsbereich selbständig und unter eigener Verantwortung leiten können. Dies w i r d auch durch die Materialien zu A r t . 45 I I L V bestätigt, wonach die Staatssekretäre keinen Geschäftsbereich, sondern besondere Regierungsaufgaben innerhalb oder außerhalb eines Ministeriums übernehmen sollen. Danach ergeben sich für die Ausgestaltung der konkreten Zuständigkeiten der Staatssekretäre verfassungsrechtlich i m wesentlichen zwei Möglichkeiten 8 : (1) Der Staatssekretär erhält vom Kabinett unmittelbar einen eng abgegrenzten Bereich von Sonderaufgaben übertragen, wobei i h m bei dessen Erfüllung dieselbe rechtliche Stellung eingeräumt ist wie den Ministern gem. A r t . 49 I S. 4 L V . Er ist dabei i n keiner Weise von einem Minister abhängig oder i n ein Ministerium eingegliedert. Insoweit kann man also durchaus davon sprechen, daß i h m ein kleiner, bescheidener „Geschäftsbereich" m i t den erforderlichen personellen und sachlichen Mitteln zur Wahrnehmung der Sonderaufgaben übertragen wird. Bei 7 Bekanntmachung der Landesregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien v o m 25.7.1972 (Ges. Bl. S. 404); vgl. auch U. Echtler, S. 51 f. Gewisse Hinweise enthält lediglich der jeweilige L a n d tagsbeschluß über die Bestätigung der Regierung. Aber auch diese Hinweise sind v i e l zu vage, u m echte Anhaltspunkte zu geben; vgl. etwa Verhandlungen des Landtags, 6. Wahlperiode, S. 17. 8 Vgl. dazu die i n Fußnote 3 angegebenen Materialien. Die Ausgestaltung der Stellung der Staatssekretäre w a r insoweit praktisch unstreitig; die hier vorgenommene Auslegung wurde deshalb auch nicht von der D r i t t e n Lesung (durch den A n t r a g der „Interministeriellen Sonderkommission" v o m 4.11. 1953) berührt oder gar geändert. S t r i t t i g bis zuletzt u n d damit erst i n der D r i t t e n Lesung geändert u n d festgelegt wurde allein die Frage der verfassungsrechtlichen Ausgestaltung des Vertretungsrechts der Minister durch die Staatssekretäre i m K a b i n e t t u n d i m M i n i s t e r i u m (vgl. dazu besonders V e r handlungen der V L V , S. 2466 u n d Beilagen Nr. 1283, 1315 u n d 1320). Z u diesem Ergebnis k o m m t w o h l auch P. Feuchte, i n : Spreng / B i r n / Feuchte, S. 173.
§ 16 Die Staatssekretäre (i. w. S.)
111
der Möglichkeit einer solchen Ausgestaltung ist es nicht verwunderlich, daß die Staatssekretäre nach A r t . 45 I I S. 2 L V i m Schrifttum zu Recht als Ersatz für Minister ohne Portefeuille oder als Sonderminister bezeichnet werden 0 . Vor allem wohl i m Hinblick auf die besonderen Schwierigkeiten von Kompetenzüberschneidungen, die bei der Abgrenzung zwischen den Sonderaufgaben einerseits und den entsprechenden Ressortbereichen andererseits stets auftreten, ist diese Möglichkeit noch nie praktisch verwirklicht worden. (2) Die zweite Ausgestaltungsmöglichkeit geht davon aus, daß der Staatssekretär von der Regierung einem Minister und dessen Geschäftsbereich zugeordnet ist. Er hat dabei dieses Ressort betreffende Sonderaufgaben zu erfüllen oder den Minister i n bestimmten, genau festgelegten Angelegenheiten zu unterstützen und gegebenenfalls auch zu vertreten. Auch hier ist erforderlich, daß dies i m wesentlichen durch Kabinettsbeschluß, der der Zustimmung des Landtags bedarf, bestimmt w i r d 1 0 . Der Staatssekretär w i r d dabei aber keinesfalls zum allgemeinen Vertreter des Ministers; nach wie vor bleibt das dem beamteten Ministerialdirektor vorbehalten. Dies ergibt sich aus seiner verfassungsmäßigen Stellung und der Entstehungsgeschichte des A r t . 45 I I L V und w i r d nicht zuletzt durch die Beschränkung ihrer Zahl bestätigt 11 . Bei der Wahrnehmung und Erfüllung der i h m durch Regierungsbeschluß übertragenen Aufgaben und Angelegenheiten innerhalb eines Ministeriums befindet er sich verfassungsrechtlich i n einer recht eigenartigen und gewissermaßen fast widersprüchlichen Doppelstellung. Innerhalb des Kabinetts ist er als Regierungsmitglied Kollege des Ministers, dem er zugeordnet ist, und diesem völlig gleichberechtigt (vgl. etwa A r t . 49 I I I LV). Dasselbe gilt ebenfalls gegenüber dem Landtag und hinsichtlich seinem persönlichen Status. Auch hierbei bestehen praktisch keine Unterschiede (gewisse Ausnahme lediglich A r t . 53 LV). Da der Staatssekretär wie der Minister der Zustimmung des Landtags bedarf (Art. 46 I I I , I V LV), vom Landtag abberufen werden kann (Art. 45 LV) und außerdem der Ministeranklage unterliegt, muß folglich auch er i n all seinen Tätigkeiten der parlamentari9 So etwa JE.-W. Böckenförde, Organisationsgewalt, S. 232; H. Schäfer, i n : DÖV 1969, S. 40; H. Lauf er, Der Parlamentarische Staatssekretär, S. 8; K . Fehlig, Staatssekretär, S. 235 ff.; H. Brinkers, i n : Bundeswehrverwaltung 1967, S. 121; U. Echtler, Der beamtete Staatssekretär, S. 51. Vgl. dazu auch: P. Feuchte, i n : Spreng / B i r n / Feuchte, S. 173; K . Göbel, Landesverfassung, S. 61, die die hier vertretene Auffassung teilen. 10 Z u r Organisationsgewalt i n diesem Bereich vgl. unten § 17. 11 Vgl. dazu die Fundstellen i n den Fußnoten 3 u n d 4; P. Feuchte, i n : Spreng / B i r n / Feuchte, S. 173; E.-W. Böckenförde, Organisationsgewalt, S. 232; H. Lauf er, Der Parlamentarische Staatssekretär, S. 8; U. Echtler, Der beamtete Staatssekretär, S. 51.
112
Kap. I I : Regierungssystem nach der bad.-württ. L V
sehen Verantwortlichkeit unterliegen 1 2 . Andererseits ist aber zu beachten, daß er zu dem Minister des Ressorts, dem er beigeordnet ist, i n einem gewissen „Unterstellungsverhältnis" steht. Eine sinnvolle Ressortarbeit, für die der Minister die Gesamtverantwortung trägt (Art. 49 I S. 4 LV), erfordert mindestens, daß sich der Staatssekretär bei der Erfüllung seiner Aufgaben (Unterstützungs- oder Sonderauftragsfunktion) an bestimmte „Richtlinien" des Ministers hält, er also praktisch bis zu einem gewissen Grad vom Minister abhängig ist 1 3 . Während also der Staatssekretär i m „Grundverhältnis" (Ernennung, Status, Entlassung) und teilweise i m „Betriebsverhältnis" (Stellung i m Kabinett) einem Minister verfassungsrechtlich völlig gleichgestellt ist (gewisse Ausnahme z. T. A r t . 53 LV), steht er i m übrigen „Betriebsverhältnis" (seine Stellung zum Minister und i m Ministerium) i n einer A r t „Unterstellungsverhältnis" zum Minister. A n dieser Ausgestaltung der Stellung des Staatssekretärs ist besonders eigenartig und ungereimt, daß einer relativ starken Stellung i m Regierungs- und Parlamentsbereich eine schwache etwas unterprivilegierte innerhalb des Ressorts gegenübersteht. Diese A r t „Zwitterstellung" ist letztlich verfassungsrechtlich nicht befriedigend zu lösen. Nicht zuletzt aus diesem Grund hat Eschenburg denn auch die Staatssekretäre i n Baden-Württemberg als „Fremdkörper" i n einem Ministerium bezeichnet 14 . Dabei sollte, was A r t . 45 I I L V auch zugrunde liegen dürfte, der ersten Ausgestaltungsform i n der Regel ein Stimmrecht i m Kabinett verliehen werden, während der zweiten A r t ein solches grundsätzlich nicht zustehen sollte. Die Verfassungswirklichkeit zeigt, daß von der Einrichtung des Staatssekretärs bis 1972 nur sehr spärlich Gebrauch gemacht wurde. Abgesehen von dem Staatssekretär i m Staatsminister i u m für die Ausarbeitung und die Vollziehung der Verfassung unter der vorläufigen Regierung 15 wurde bis zum Jahr 1972 nur ein Staatssekretär für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsbeschädigte i m Innen12 So auch P. Feuchte, i n : Spreng / B i r n / Feuchte, S. 173; H. Brinkers, in: Bundeswehrverwaltung 1967, S. 121; K . Fehlig, Staatssekretär, S. 234. 13 So w o h l auch E S V G H 23, S. 140. Insoweit ist diese Gestaltungsmöglichkeit m i t der Staatssekretärsregelung i n Bayern (Art. 43 I I , 50 I I u n d 51 I I Bay. L V ) ähnlich u n d vergleichbar; vgl. dazu Nawiasky / Leusser / Schweizer / Zacher, Bay. Verfassung, A r t . 50; R. Herzog, i n : B a y V w B l . 1969, S. 225 ff.; H. Lauf er, Der Parlamentarische Staatssekretär, S. 5 ff. Vgl. auch H. Schneider, i n : Festschrift f ü r E. R. Huber, S. 169. 14 Vgl. die Zitate bei H. Lauf er, Der Parlamentarische Staatssekretär, S. 8, Fußnote 37; außerdem T. Eschenburg, Z u r politischen Praxis Bd. I I , S. 18 f.; H. Gerber, i n : D Ö V 1953, S. 70 ff. 15 Siehe Regierungsbildung unter Reinhold Maier v o m 25.4.1952 (Ges. Bl. S. 1). Dieser Staatssekretär (E. Kaufmann), dem nach dem Überleitungsgesetz (Art. 5 I I I ) k e i n Stimmrecht verliehen werden konnte, schied bereits zum 7.10.1953 aus seinem A m t wieder aus.
§ 16 Die Staatssekretäre (i. w. S.)
113
ministerium bestellt 1 0 . Seit dem 8. 6. 72 gibt es neben diesem noch einen Staatssekretär i m Staatsministerium 17 . Alle waren bisher einem M i nisterium (Geschäftsbereich) zugeordnet. Es handelte bzw. handelt sich also um Staatssekretäre, deren Stellung entsprechend der oben dargelegten zweiten A r t ausgestaltet war bzw. ist, obgleich allen das Stimmrecht verliehen wurde. A u f den Minister für Bundesangelegenheiten w i r d noch unten Ziff. 4 näher einzugehen sein 18 . 3. Ehrenamtliche Staatsräte
Als weitere Mitglieder der Regierung können nach A r t . 45 I I S. 2 L V ehrenamtliche Staatsräte ernannt werden. Die Einrichtung dieser Staatsräte ist aus den badischen Verfassungen vom 21. 3.1919 und vom 22. 5.1947 übernommen worden 1 9 . Der Sinn und Zweck dieser Institution sollte darin liegen, der Regierung die Möglichkeit einer breiteren Basis (Berücksichtigung aller Gruppen) zu ermöglichen und zudem i n der Erwartung begründet sein, daß die Staatsräte vermöge ihrer besonderen Kenntnisse wichtige Berater der Regierung sind. Auch sollte ihnen ggf. in einzelnen Fragen die Verhandlungsführung oder Bearbeitung übertragen werden können 2 0 . Die Einrichtung des ehrenamtlichen Staatsrats wurde erst i n der Dritten Lesung auf einen entsprechenden Antrag der „Interfraktionellen Sonderkommission" i n die Verfassung aufgenommen. Maßgeblich dafür waren i m wesentlichen wohl zwei Gründe. Man wollte den südbadischen Vertretern ein besonderes Anliegen erfüllen und schließlich war dies für die Bildung der zweiten vorläufigen Regierung dringend notwendig und i m übrigen für spätere Regierungsbildungen teilweise auch zweckmäßig 21 . 16 Das M i n i s t e r i u m f ü r Heimatvertriebene u n d Kriegsbeschädigte wurde i m J u n i 1960 i n das Innenministerium eingegliedert. Die entsprechenden A b t e i lungen stehen seither (mit Ausnahme von ca. eineinhalb Jahren) u n d noch heute unter der Leitung eines Staatssekretärs. Vgl. T. Eschenburg, i n : Bad.W ü r t t . — Staat, Wirtschaft, K u l t u r , S. 103; K . Rebmann, i n : JöR, n. F. Bd. 20 (1971), S. 213 f. 17 Vgl. Verhandlungen des Landtags, 6. Wahlperiode, Protokollband I, S. 17. Während die Umschreibung der Aufgaben u n d Befugnisse ( A r t „Geschäftsbereich") f ü r den Staatssekretär für Vertriebene, Flüchtlinge u n d Kriegsbeschädigte i m Innenministerium v o m K a b i n e t t damit ausreichend k l a r erfolgte, ist dies f ü r den Staatssekretär i m Staatsministerium nicht geschehen. Auch f ü r i h n wäre eine Festlegung seines Aufgabenbereichs mindestens i n groben Zügen durch das K a b i n e t t notwendig gewesen (vgl. A r t . 45 I I I , 46 I I I LV). Die Organisationsgewalt des Kabinetts (vgl. A r t . 45 I I I , 49 I I LV) geht für diese konkrete Regelung auch i m Staatsministerium der Richtlinienkompetenz grundsätzlich (grobe Ausgestaltung) vor. Vgl. dazu näher unten § 17. 18 Vgl. dazu auch unten §§ 20, 21 u n d 23. 19 Vgl. § 52 der Bad. Verfassung v o m 21. 3.1919 (Ges.- u. VOB1. S. 279 ff.) u n d A r t . 76 der Bad. Verfassung v o m 22. 5.1947 (Reg. Bl. S. 129). 20 Vgl. P. Feuchte, i n : Spreng / B i r n / Feuchte, S. 174; H. Schneider, i n : Festschrift f ü r E. R. Huber, S. 168.
8 Katz
114
Kap. I I : Regierungssystem nach der bad.-württ. L V
Die verfassungsrechtliche Ausgestaltung der ehrenamtlichen Staatsräte lehnt sich eng an die der Staatssekretäre m i t Kabinettsrang an (vgl. oben 2). Während die Ernennung und Entlassung der Staatsräte und auch ihre Stellung i m Ministerrat und ggf. i m Ministerium der der Staatssekretäre völlig entspricht, ist aber ihr Amtsverhältnis anders ausgestaltet. Sie sind ehrenamtlich beschäftigt und üben deshalb i n aller Regel neben ihrer Staatsratstätigkeit einen Hauptberuf aus (Art. 53 LV). Ein weiterer Unterschied i m Vergleich zu den Staatssekretären besteht gemäß A r t . 45 I I S. 2 und 3 L V für die ehrenamtlichen Staatsräte darin, daß ihre Zahl i n der Verfassung nicht beschränkt ist 2 2 . Interessant ist schließlich noch die Feststellung, daß die beiden einzigen bisherigen ehrenamtlichen Staatsräte solche ohne eigenen Geschäftsbereich aber mit Stimmrecht i m Kabinett waren; dies bedeutet, daß die Ausgestaltung ihrer Stellung i m Grundsatz der oben i n Ziff. 2 beschriebenen ersten A r t der Staatssekretäre m i t Kabinettsrang entsprach. Die Tatsache, daß i n Bad.-Württ. höchstens zwei und seit dem 23. 6. 1960 überhaupt keine ehrenamtlichen Staatsräte mehr berufen wurden, erlaubt die verfassungspolitische Frage, ob diese Institutionen heute überhaupt noch zweckmäßig und brauchbar ist. Da selbst i n den Bundesländern Regierungsarbeit auf höchster Ebene keinesfalls mehr ehrenamtlich ausgeübt werden kann und außerdem w o h l niemand mehr bereit ist, seine Zeit und Arbeitskraft gegen eine bescheidene A u f wandsentschädigung zur Verfügung zu stellen, hat diese Einrichtung ihren Sinn heute verloren. Der ehrenamtliche Staatsrat sollte deshalb i n der Verfassung durch eine bessere und den heutigen Erfordernissen gerecht werdende Regelung abgelöst werden 2 3 .
21 I n die zweite vorläufige Regierung unter G. M ü l l e r w u r d e n zwei Staatsräte (A. Dichtel u n d F. Werber) berufen (vgl. Gesetz v. 7.10.1953, Ges. Bl. S. 153). Auch dem K a b i n e t t Gebhard M ü l l e r I I (vom 9. 5.1956 - 17.12.1958) gehörten 2 ehrenamtliche Staatsräte an (A. Dichtel u n d F. Werber), u n d zwar als solche ohne eigenen Geschäftsbereich, aber m i t Stimmrecht i m Kabinett. Dasselbe gilt f ü r die Staatsräte Werber u n d Filbinger i m K a b i n e t t K . G. K i e singer I. Danach w u r d e n keine Staatsräte mehr bestellt. Vgl. i m übrigen ABG. Kühn, Protokolle des V A , 13. Sitzung, S. 12 u n d 26; K. Rebmann, i n : JöR, n. F. Bd. 20 (1971), S. 213 f.; P. Feuchte, i n : Spreng / B i r n / Feuchte, S. 174. 22 Es mag hier dahingestellt bleiben, ob die Begrenzungsregelung absichtlich (so P. Feuchte, i n : Spreng / B i r n / Feuchte, S. 174) oder aus purem V e r sehen (so K . Göbel, Landesverfassung, S. 61) nicht auch auf die Staatsräte erstreckt wurde. Die Materialien (insbes. Protokolle des V A , 13. Sitzung, S. 6 ff.) sprechen wesentlich mehr f ü r das Letztere (das Regierungskollegium sollte möglichst k l e i n u n d damit effektiv gehalten werden). 23 Es soll hier keinesfalls bestritten werden, daß der Staatsrat 1953 aus Gründen der Integration u n d der Berücksichtigung aller Gruppen i m K a b i nett seine volle Berechtigung hatte. Vgl. dazu H. Schneider, i n : Festschrift f ü r E. R. Huber, S. 168.
§ 16 Die Staatssekretäre (i. w. S.)
115
4. Minister für Bundesangelegenheiten Bereits oben § 13 Ziff. 1 wurde festgestellt, daß die Landesregierung, wenn man den Ministerpräsidenten bzw. das Staatsministerium außer acht läßt, aus acht Ministern besteht, während nur sieben Geschäftsbereiche festgelegt sind 2 4 . Dies resultiert daraus, daß der Minister für Bundesangelegenheiten keinen eigenen Geschäftsbereich hat, sondern i m Staatsministerium ressortiert und sein Etat außerdem auch i m Haushaltsplan des Staatsministeriums (02) enthalten ist 2 5 . Der Minister für Bundesangelegenheiten war nach der bisherigen Praxis dem M i n i sterpräsidenten zugeordnet. Nicht zuletzt deshalb kümmerte sich der Regierungschef i m Bereich der Bundesangelegenheiten i n aller Regel mehr, als i h m dies aufgrund seiner Richtlinienkompetenz bei echten Ressortaufgaben verfassungsrechtlich möglich ist. Diese Praxis t r i f f t heute besonders zu 2 6 . Aufgrund von § 1 I der Bekanntmachung der Geschäftsbereiche, dem Staatshaushaltsplan des Landes, A r t . 50 S. 1 L V und nicht zuletzt gemäß der seit jeher geübten Praxis, kann der M i n i ster für Bundesangelegenheiten keinem Minister i. S. v. A r t . 45 I I S. 1 und 49 I S. 4 L V gleichgestellt werden. Er leitet keinen nur durch A r t . 49 I S. 1 und I I L V eingeschränkten Geschäftsbereich selbständig unter eigener Verantwortung. Seine Stellung, wie sie sich aufgrund des Zustimmungsbeschlusses des Landtags vom 8. 6.1972 und der Bekanntmachung der Geschäftsbereiche vom 25. 7.1972 ergibt, kann vielmehr verfassungsrechtlich (materiell) nur als Staatssekretär m i t Sitz und Stimme i m Kabinett und zwar der zweiten Ausgestaltungsart (vgl. oben Ziff. 2) definiert werden. Dies bedeutet sicher nicht, daß er die Bezeichnung Minister formell nicht führen darf. Die Regierung ist hier sogar m i t Zustimmung des Landtags durchaus berechtigt, die Bezeichnung Minister zu verleihen 2 7 . Dies ergibt sich nicht zuletzt auch daraus, daß die Staatssekretäre m i t Kabinettsrang i n Bad.-Württ. j a einen Ersatz für die Staats- und Sonderminister auf Bundesebene darstellen 28 . M i t dieser formellen Verleihung des Ministertitels kann aber 24 Vgl. dazu Verhandlungsprotokolle des Landtags, 6. Wahlperiode, S. 17 u n d Ges. Bl. 1972, S. 404. Diese „Besonderheit" bestand bereits nach der A b grenzung der Geschäftsbereiche v o m 15. 7.1952 (Ges. Bl. S. 21). Vgl. Anlage Nr. 1. 25 Vgl. § 1 Nr. 4 der Bekanntmachung der Landesregierung über die A b grenzung der Geschäftsbereiche der Regierung v o m 25. 7.1972 (Anlage Nr. 1). A u f g r u n d von A r t . 50 L V bietet sich diese Regelung durchaus auch an, ist gewissermaßen sogar notwendig (vgl. allerdings A r t . 49 II). 26 Dies ist bedingt durch das derzeit starke bundespolitische Engagement des Ministerpräsidenten Filbinger (Bundesratsvorsitzender bis Oktober 1974 u n d M i t g l i e d des CDU-Bundespartei Vorstandes). Vgl. zu den A k t i v i t ä t e n des Landes i m B u n d unten § 24 Ziff. 2 u n d 4. 27 Vgl. etwa E.-W. Böckenförde, Organisationsgewalt, S. 221 ff. m. w. N.; F. Klein, i n : DVB1. 1965, S. 862 ff. 28 Vgl. dazu oben Ziff. 2 (insbes. die Zitate i n Fußnote 9).
8*
116
Kap. I I : Regierungssystem nach der bad.-württ. L V
weder die Regierimg noch der einfache Gesetzgeber den materiellen Gehalt der Bestimmung des A r t . 45 I I S. 3 L V übergehen. Der Minister für Bundesangelegenheiten muß deshalb als Staatssekretär (nicht als Minister) i m Rahmen des A r t . 45 I I S. 3 L V berücksichtigt werden. Dies w i r d seit dem 8. 6.1972 nicht beachtet 29 . 5. Politische Staatssekretäre Durch das Gesetz über die Rechtsverhältnisse der politischen Staatssekretäre vom 19.7.1972 (Ges. Bl. S. 392 f.) ist ein weiterer Staatssekretärtyp geschaffen worden. Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit dieser neuen und zusätzlichen Institution war heftig umstritten. Die Abgeordneten der SPD-Fraktion haben dann auch beim StGH gegen dieses Gesetz Normenkontrollklage erhoben. Sie waren der Auffassung, daß es m i t A r t . 45 II, 46 I V , 56, 57, 69 und 77 L V unvereinbar sei. Dabei stützten sie ihre Klage vor allem auf die Argumentation, daß der Bereich zwischen Minister und beamteten Ministerialdirektor durch A r t . 45 I I L V abschließend geregelt sei, daß also außer den Staatssekretären m i t Kabinettsrang keine weiteren Staatssekretäre eingeführt und bestellt werden dürften. Da i m übrigen auch den politischen Staatssekretären durch das Gesetz ein Status verliehen werde (u. a. Teilnahmerecht an Ministerratssitzungen), der sie m i t den Staatssekretären m i t Kabinettsrang, denen kein Stimmrecht verliehen wurde, faktisch gleichstellt, liege ein Verstoß gegen die erschöpfende Regelung des A r t . 45 I I L V vor. Der Staatsgerichtshof für das Land Baden-Württemberg hat m i t Urteil vom 24. 2.1973 den Normenkontrollantrag zurückgewiesen. Aus A r t . 45 I I L V , so führt das Urteil aus, folge zwar, daß das Regierungskollegium nicht über die dort vorgesehenen Möglichkeiten hinaus erweitert werden dürfe, aber die Verfassungsnorm regele nicht, was außerhalb und unterhalb der Regierungsebene sein oder nicht sein soll, d. h. was hier an Amtsträgern vorgesehen werden dürfe. Auch nach seiner Entstehungsgeschichte, seinem Wortlaut oder seinem Sinn und Zweck schließe A r t . 45 I I L V die Möglichkeit nicht aus, neben den dort vorgesehenen Staatssekretären zusätzlich sowohl beamtete Staatssekretäre zu ernennen als auch die m i t dem Gesetz vom 19. 7.1972 29 Da bis zum 8. 6.1972 neben dem Minister f ü r Bundesangelegenheiten höchstens ein Staatssekretär der Regierung angehörte, ist bis zu diesem Z e i t p u n k t das Problem nicht aufgetaucht. I m Hinblick auf A r t . 45 I I S. 3 L V wäre a m 8.6.1972 folgende „Rechnung" aufzustellen gewesen: Bei einem Ministerpräsidenten u n d sieben Ressortministern hätten höchstens zwei Staatssekretäre ernannt werden dürfen. Tatsächlich sind am 8. 6.1972 aber drei Staatssekretäre i. S. v. A r t . 45 I I L V (einschl. dem Minister für Bundesangelegenheiten) bestellt worden. Vgl. dazu H. Schneider, i n : Festschrift f ü r E. R. Huber, S. 168 (der allerdings diese Problematik nicht behandelt u n d oben Fußnote 26).
§16 Die Staatssekretäre (i. w. S.)
117
eingeführten politischen Staatssekretäre zu bestellen 80 . Da durch das Urteil des StGH die verfassungsrechtliche Zulässigkeit der politischen Staatssekretäre geklärt und verbindlich entschieden ist, wäre es müßig, dieses Ergebnis hier i n Frage zu stellen 81 . Es ist demnach festzuhalten, daß die Institution des politischen Staatssekretärs verfassungsgemäß ist. 80 Vgl. dazu eingehend das U r t e i l des S t G H Bad.-Württ. v o m 24. 2.1973 (Gesch. Reg. Nr. 2/72), abgedruckt i n E S V G H 23, 135 ff. = D Ö V 1973, S. 673 ff. u n d außerdem H. Schneider, i n : Festschrift f ü r E. R. Huber, S. 167 ff. (Prof. H. Schneider w a r i n diesem Verfahren Prozeßvertreter der Landesregierung Bad.-Württ.). 31 Trotzdem sei es erlaubt, hier einige kritische Anmerkungen zu dem U r teil, das m i t der denkbar knappen Mehrheit von f ü n f gegen vier Richterstimmen ergangen ist, zu machen: Das U r t e i l k o m m t u. a. zu dem Ergebnis, daß die Entstehungsgeschichte keinesfalls die Feststellung zuläßt, der Verfassungsgeber habe durch A r t . 45 I I L V eine abschließende Regelung f ü r alle A r t e n von Staatssekretären getroffen (S. 138). Nach einem sorgfältigen S t u d i u m der Verfassungsmaterialien ist diese Auffassung allerdings nicht haltbar. Die Ausschußberatungen (Protokolle des V A , 13. Sitzung, S. 6 - 2 8 u n d 47. Sitzung, S. 26 f.) brachten deutlich zum Ausdruck, daß zwischen Minister u n d Ministerialdirektor neben dem „Staatssekretär" keine weiteren Zwischenstufen bestehen sollten, daß A r t . 45 I I also eine ausschließliche Regelung insoweit enthält (so auch S t G H auf S. 138). Diese Ausschußfassung w u r d e sicher nicht, wie dies v o m S t G H versucht w i r d , von der Verfassungsgebenden Landesversammlung i n der D r i t ten Lesung (Verhandlungen der V L V , S. 2466) wieder aufgehoben u n d ein gänzlich neuer Staatssekretärstyp geschaffen. Richtig ist zwar, daß die Gründe f ü r die endgültige Fassung nicht eindeutig zu erschließen sind, da dies i n einer Sitzung der „Interfraktionellen Sonderkommission" besprochen u n d festgelegt wurde. Aus dem damaligen Stand der Diskussion, w i e er sich aus den Materialien ergibt (vgl. dazu oben Ziff. 2, insbesondere Fußnoten 3 u n d 4), aus der Gegenüberstellung der i n den E n t w ü r f e n der Regierungsparteien u n d der C D U enthalten, aber auch aus den Fassungen der aus der zweiten Beratung des Verfassungsausschusses u n d der zweiten Beratung des Plenums hervorgegangenen diesbezüglichen Verfassungsartikel (vgl. die sehr übersichtliche synoptische Darstellung i n Beilage Nr. 1280 v o m 4.11. 1953) u n d nicht zuletzt auch aus den Beratungen zu dem E n t w u r f eines Gesetzes über die vorläufige Ausübung der Staatsgewalt i m süddeutschen B u n desland — Überleitungsgesetz — (Verhandlungen der V L V , S. 2283 - 2287 u n d 2290 f. m i t Beilagen Nr. 1155 u n d 1171), die v o m S t G H nicht m i t berücksichtigt wurden, muß vielmehr entnommen werden, daß auf keinen F a l l i n der D r i t ten Lesung die Vorstellungen des Ausschusses über die I n s t i t u t i o n des Staatssekretärs wesentlich geändert oder gar ein neuer T y p geschaffen wurde, sondern die Mehrheitsauffassung des Ausschusses auch i n der D r i t t e n Lesung bestätigt wurde. Wenn m a n sich die verschiedenen Fassungen der Bestimmung, die den Staatssekretär regelt, i n chronologischer Reihenfolge ansieht (§ 5 I I des Überleitungsgesetzes v. 15.5.1952, Ges. Bl. S. 3 ergänzt durch § 5 I V v. 7.10.1953, Ges. Bl. S. 153; A r t . 42 I I des Entwurfs der Regierungsparteien; A r t . 42 I I L V i. d. F. der zweiten Beratung des V A ; A r t . 42 I I L V i. d. F. der zweiten Lesung der V L V ) , so w i r d deutlich, daß A r t . 45 I I S. 2 L V m i t sämtlichen Fassungen praktisch wörtlich identisch ist u n d i n der D r i t t e n Lesung n u r der Satz 4 zusätzlich angefügt wurde, wonach den Staatssekretären durch Beschluß des Landtags Stimmrecht verliehen werden kann. I n der D r i t t e n Lesung wurde zusätzlich allein die Möglichkeit geschaffen, was bis dahin umstritten war, den Staatssekretären das Stimmrecht i m K a b i n e t t zu geben. Abgesehen davon wurde aber die v o m Verfassungsausschuß festgelegte
118
Kap. I I : Regierungssystem nach der bad.-württ. L V
Stellung u n d Ausgestaltung des Staatssekretärs v o l l übernommen u n d muß deshalb der Landesverfassung zugrunde gelegt werden. Die Bedeutung, die der S t G H der „Interfraktionellen Sonderkommission" beimißt und seine Ausführungen auf S. 138 (Buchstabe b) insgesamt können deshalb nicht aufrechterhalten werden. Die historische Auslegung ergibt vielmehr, daß sich der Verfassungsgeber neben den Möglichkeiten des A r t . 45 I I L V keine weiteren Zwischenstufen zwischen Minister u n d Ministerialdirektor vorgestellt hat (so auch G. Müller, I n t e r v i e w am 5.3.1974; W. Krause, I n t e r v i e w am 18.12.1974). Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß für A r t . 45 I I L V p r i m ä r nicht die grundgesetzliche Regelung, sondern besonders § 52 I I der Badischen Verfassung v o m 21. 3.1919 (Ges. u. VOB1. S. 279 ff.) u n d A r t . 76 der Verfassung des Landes Baden v o m 22. 5.1947 (Reg. Bl. S. 129) als V o r b i l d gedient hat. Auch m i t diesem Gesichtspunkt hat sich der S t G H nicht auseinandergesetzt. U m so mehr hätte deshalb der S t G H zur Begründung seines Ergebnisses Ausführungen zum gewandelten Sinn u n d Zweck des A r t . 45 I I L V machen müssen („teleologische" Auslegung; zur Verfassungsinterpretation vgl. insbes. K . Hesse, Verfassungsrecht, § 2). I m Rahmen der Interpretationsprinzipien der „praktischen Konkordanz" u n d der „funktionellen Richtigkeit" hätte etwa der S t G H die Wandlungen i m parlamentarischen Regierungssystem (zunehmende Gewalten verschränkung; Ausübung der Staatsleitung durch Parlament u n d Regierung zur „gesamten Hand"), die Notwendigkeit einer Verstärkung des „Primats der P o l i t i k " i n der Regierungsarbeit u n d die i m m e r stärker i n den Vordergrund tretende parlamentarische K o n t r o l l e von Regierung u n d V e r w a l t u n g m i t i n seine Überlegungen einbeziehen müssen (vgl. etwa Enquete-Kommission, Zwischenbericht, S. 73 ff.; U. Scheuner, D Ö V 1974, S. 433 ff.). Solche Überlegungen hat der S t G H aber nicht angestellt, sondern sich insoweit m i t der Darstellung der herrschenden Auffassung zum Gewaltenteilungsprinzip, der er sich anschloß, begnügt (S. 142 f.). Auch i m Hinblick auf den Interpretationsmaßstab der „normativen K r a f t der Verfassung" enthält das U r t e i l keine überzeugenden Ausführungen. Die Entscheidung enthält zwar eingehende Darlegungen über die historische Entwicklung u n d heutige Notwendigkeit der i n Frage stehenden Institution, aber eben nur aus der Sicht des Bundes (vgl. S. 135 ff.). M i t keinem W o r t wurde dagegen, was gerade hier erforderlich gewesen wäre, die verfassungsrechtliche und auch verfassungspolitische Notwendigkeit der I n s t i t u t i o n des politischen Staatssekretärs auf Landesebene unter den besonderen gegenwärtigen E r fordernissen und Gegebenheiten des Landes erwähnt u n d berücksichtigt. Was f ü r den B u n d richtig ist, muß für das L a n d j a noch lange nicht gut u n d unbedingt notwendig sein (vgl. etwa V. Renner, i n : JöR, n. F. Bd. 7 [1958], S. 215; T. Eschenburg, i n : Bad.-Württ. — Staat, Wirtschaft, K u l t u r , S. 105). E i n dritter Aspekt, der hier noch angesprochen werden soll, betrifft die Frage der Abgrenzung zwischen Regierung einerseits u n d V e r w a l t u n g andererseits (vgl. dazu oben § 3 Ziff. 3). Die Entscheidung des S t G H hinterläßt zu diesem Problem ein „unbefriedigendes Gefühl". I n Übereinstimmung m i t dem S t G H ist sicher davon auszugehen, daß die politischen Staatssekretäre i m Unterschied zu den Staatssekretären m i t Kabinettsrang keine Regierungsorgane i m Sinne der A r t . 45 ff. L V sind. Die weitere Folgerung allerdings, daß die politischen Staatssekretäre damit auch keinesfalls dem Regierungsbereich, sondern ausschließlich der V e r w a l t u n g zugerechnet werden müssen (so E S V G H 23, S. 142), ist doch sehr fraglich u n d v o m Sinn u n d Zweck dieser I n s t i t u t i o n her (Entlastung gerade i m Bereich der Regierungs-, Parlaments- u n d Parteiorgane u n d -gremien) alles andere als begründet (vgl. oben § 3; vgl. auch E.-W. Böckenförde, Organisationsgewalt, S. 221 ff., der offensichtlich die Staatssekretäre dem Regierungsbereich zuordnet). M i t dieser Entscheidung werden außerdem bereits auch die Weichen f ü r die Auslegung des A r t . 77 I L V gestellt. Denn sonst hätte es doch sicher nahe gelegen, auch denjenigen, der den Ressortchef i n dessen politischen Regierungsfunk-
§16 Die Staatssekretäre (i. w. S.)
119
Z u r B e g r ü n d u n g der E i n f ü h r u n g der p o l i t i s c h e n Staatssekretäre f ü h r t der G e s e t z e s i n i t i a t i v e n t w u r f der L a n d e s r e g i e r u n g aus, daß dieser Staatssekretär d e m M i n i s t e r p r ä s i d e n t e n oder d e m M i n i s t e r b e i d e r E r f ü l l u n g der p o l i t i s c h e n A u f g a b e n h e l f e n u n d d a d u r c h die politische Führungsspitze entlasten soll (ähnlich dem parlamentarischen Staatss e k r e t ä r a u f B u n d e s e b e n e ) 3 2 . I m w e s e n t l i c h e n d ü r f t e der S i n n u n d Z w e c k dieser I n s t i t u t i o n d u r c h folgende A r g u m e n t e z u c h a r a k t e r i s i e r e n sein ( G r ü n d e die f ü r die E i n f ü h r u n g m a ß g e b l i c h w a r e n ) 3 3 : — Die Minister sollen i n i h r e n politischen F u n k t i o n e n unterstützt bzw. e n t l a s t e t u n d d a m i t die p o l i t i s c h e F ü h r u n g i n n e r h a l b der E x e k u t i v e insgesamt g e s t ä r k t w e r d e n . — D i e p o l i t i s c h e n Staatssekretäre s o l l e n insbesondere die V e r b i n d u n g zu den parlamentarischen Gremien, zu den Parteien u n d zur Öffentl i c h k e i t p f l e g e n u n d verbessern. — Sie sollen das R e g i e r u n g s m i t g l i e d , d e m sie z u g e o r d n e t sind, v o n V e r p f l i c h t u n g e n , v o r a l l e m r e p r ä s e n t a t i v e r A r t u n d solchen a u f B u n d - oder L ä n d e r e b e n e , aber auch e v t l . d u r c h W a h r n e h m u n g v o n Sonderaufgaben, entlasten. — D i e gesamtpolitische O r i e n t i e r u n g der e i n z e l n e n M i n i s t e r i e n s o l l i m H i n b l i c k auf eine e i n h e i t l i c h e R e g i e r u n g s p o l i t i k v e r s t ä r k t w e r d e n . tionen unterstützen soll, wie den Minister als Ausnahme von der Regel des A r t . 77 I L V noch zuzulassen u n d zu akzeptieren (Urteil S. 145). H i n t e r der Auffassung stand w o h l m i t einigem Recht die Befürchtung v o r einer zu starken parteipolitischen Einflußnahme auf die Verwaltung. Ob die vorliegende Entscheidung dies allerdings w i r k s a m aufhalten kann, dürfte zu bezweifeln sein (vgl. dazu unten § 23 Ziff. 3 - 5 ) . Auch, daß das Spannungsverhältnis zwischen P o l i t i k (Partei) und Beamtentum (Bürokratie) i m Bereich der „ N a h t " von Regierung u n d V e r w a l t u n g letztlich zugunsten der Bürokratie eben von einem Gericht aus überwiegend Beamten (auch der Berichterstatter) entschieden wurde, ist zwar rechtlich unanfechtbar, aber letztlich doch nicht ganz befriedigend (vgl. zum ganzen H. Schneider, i n : Festschrift f ü r E. R. Huber, S. 167 ff., 174 ff.; E. Klein, i n : D Ö V 1974, S. 590 ff.). Zusammenfassend bleibt festzuhalten, daß verfassungspolitisch durch die Einführung der Verleihung des Stimmrechts i m K a b i n e t t (durch die V L V i n der 3. Lesung) das Bedürfnis nach einem echten „Gehilfen" zur politischen Unterstützung u n d Entlastung des Ministers (politische Staatssekretäre) nicht unbeträchtlich erhöht wurde (vgl. dazu H. Schneider, S. 169), daß aber v e r fassungsrechtlich f ü r die Einführung dieser I n s t i t u t i o n eine Verfassungsänderung der richtigere Weg gewesen wäre (vgl. auch Stuttgarter Zeitung vom 26. 2.1973, S. 3). 32 Vgl. Landtagsdrucksachen, 6. Wahlperiode, Bd. I, Nr. 20; Verhandlungen des Landtags, 6. Wahlperiode, S. 39 f. u n d 184 ff. 33 Vgl. dazu eingehend: H. Lauf er, Der parlamentarische Staatssekretär, S. 15 ff. u n d 48 ff.; H. Schäfer, i n : D Ö V 1969, S. 38 ff.; I. Staff, Parlamentarischer Staatssekretär, S. 12 ff.; C. Arndt, i n : Der Staat 1970, S. 501 ff.; Projektgruppe BMI, Erster Bericht, S. 143 ff.; vgl. auch — allerdings unter Berücksichtigung der Bay. L V — Projektgruppe Bay. IM, Reformbericht, S. 102. F ü r Bad.-Württ. bleibt anzumerken, daß praktisch alle Gründe bereits von der V L V (1953) diskutiert u n d i m Rahmen des A r t . 45 I I L V berücksichtigt wurden (vgl. oben Ziff. 2, insbesondere Fußnote 3).
120
Kap. I I : Regierungssystem nach der bad.-württ. L V
Die Staatssekretäre sollen dazu die Einhaltung und Koordinierung der Gesamtpolitik der Regierung m i t überwachen und sich i n die politische Grundsatzplanung i m Ressort m i t einschalten. — Vorwiegend junge Politiker sollen die Chance erhalten, Regierungserfahrung zu sammeln, u m sich für eine eventuelle spätere Übernahme von Ministerämtern oder anderen politischen Ämtern vorzubereiten und zu profilieren. Die Stellung dieses neuen Staatssekretärs wurde eng i n Anlehnung an die Institution des parlamentarischen Staatssekretärs auf Bundesebene 84 ausgestaltet und unterscheidet sich damit i n rechtlicher Hinsicht deutlich von dem Staatssekretär m i t Kabinettsrang gemäß A r t . 45 I I L V . I m Gegensatz zu diesem w i r d der politische Staatssekretär nicht vom Landtag bestätigt, seine Abberufung kann vom Parlament nicht erzwungen werden, er unterliegt nicht der Ministeranklage (Art. 45 II, 46 I I I , IV, 56, 57 LV). Sein Verhältnis zum Landtag (er unterliegt keiner parlamentarischen Verantwortlichkeit) und seine Rechtsstellung i m Kabinett sind also doch völlig anders festgelegt als beim Staatssekretär m i t Kabinettsrang. Während letzterer eine vom Ministerpräsident oder Minister rechtlich unabhängige Stellung hat (gewisse Ausnahmen bestehen allerdings bei der oben genannten zweiten Art), ist das A m t des politischen Staatssekretärs dem des Regierungsmitglieds, dem er zugeordnet ist, akzessorisch und es ist i n jeder Beziehung weisungsgebunden 85 . Nach §§ 3 und 6 des Staatssekretärgesetzes werden die politischen Staatssekretäre vom Ministerpräsidenten i m Einvernehmen m i t dem betreffenden Minister ernannt und entlassen. Dabei sind allerdings die i n A r t . 49 L V enthaltene Grundentscheidung und insbesondere die dem Ministerrat als Kollegialorgan zustehenden Rechte aus A r t . 49 I I und 45 I I I L V , einschließlich der daraus resultierenden grundsätzlichen Organisationsgewalt, zu beachten 88 . Danach kann und sollte etwa das Kabinett einheitliche Rahmenrichtlinien für die Stellung, Rechte und Aufgaben der politischen Staatssekretäre erlassen und außerdem Grundsätze für deren organisatorische Eingliederung in die Ministerien (Leitungsebene) aufstellen 87 . Die politischen Staats34 Vgl. dazu etwa H. Schäfer, i n : D Ö V 1969, S. 38 ff.; F. K . Fromme, i n : ZRP 1973, S. 153 ff.; H. Lauf er, Der Parlamentarische Staatssekretär, S. 15 ff.; T. Maunz, i n : Maunz / D ü r i g / Herzog, A r t . 62 Anm. 35. 35 Vgl. §§ 1, 3 u n d 6 Staatssekretärsgesetz; E S V G H 23, 139 ff.; U. Echtler, Der beamtete Staatssekretär, S. 52. 36 Unterstützend k o m m t noch hinzu, daß Funktionen, die bei Regierungsmitgliedern dem Parlament obliegen (Art. 46 I I I , 53 usw. LV), bei den politischen Staatssekretären der Regierung zukommen (vgl. etwa § 2 I I Staatssekretärsgesetz). 37 Diese Forderung w i r d durch das U r t e i l des Bad.-Württ. V G H , i n : E S V G H 23, S. 135, 144 ff. stark unterstützt u n d praktisch gefordert (insbes. i m H i n blick auf A r t . 77 I LV). Dies ist bis heute leider noch nicht geschehen. Für
§16 Die Staatssekretäre (i. w. S.)
121
Sekretäre stehen zum Land i n einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis 3 8 . Sie sind deshalb keine Beamten (beachte A r t . 77 I LV). I m Unterschied zum parlamentarischen Staatssekretär i m Bund muß der politische schließlich auch nicht Mitglied des Parlaments sein. Der politische Staatssekretär hat, wie gesagt, keine Aufgaben aus eigenem Recht, sondern leitet seine Befugnisse von dem Regierungsmitglied (nach § 1 des Staatssekretärsgesetzes nur Ministerpräsident und Minister) ab, dem er zur Unterstützung beigegeben wird. Dieses Regierungsmitglied entscheidet folglich i n der Praxis darüber, nicht zuletzt auch wegen der äußerst vagen Formulierung des § 1, welche konkreten politischen Aufgaben der Staatssekretär nach seiner Weisung wahrnimmt, wie er i h n dabei vertritt und ob, ggf. i n welchem Umfang, i h m bestimmte fachliche Aufgaben m i t entsprechenden Weisungsrechten übertragen werden. Dabei ist der politische Staatssekretär aber weder allgemeiner Vertreter des Ministers als Ressortchef noch echter Vertreter (mit Stimmrecht) des Ministers i m Kabinett. Außerdem soll er bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben keine neue Verwaltungsebene bilden 3 9 . Als Folge der Ausgestaltung des Rechtsverhältnisses ( § 2 1 polStSekrG) und des Urteils des StGH vom 24. 2.1973, wonach die politischen Staatssekretäre dem „Verwaltungsbereich" zugeordnet werden 4 0 , sind der Übertragung von hoheitlichen Befugnissen und damit auch den entsprechenden Aufgaben allerdings durch A r t . 77 I L V und A r t . 33 V GG i. V. m. A r t . 2 I L V Grenzen gesetzt 41 . Der Bad.-Württ. Staatsgerichtshof hat diese Grenzen erstaunlich eng gezogen und für die politischen Staatssekretäre, die weder parlamentarisch verantwortlich noch aufgrund eines Beamtenverhältnisses besonders i n Pflicht und die beiden pol. Staatssekretäre E. Teufel (Innenministerium u n d seit 1.9. 1974 M i n i s t e r i u m f ü r Ernährung, Landwirtschaft u n d Umwelt) u n d G. Weng (Kultusministerium) gelten hierfür lediglich relativ vage formulierte sogen. „Hausverfügungen" des Innenministeriums v o m 23. 8. u n d 5.10.1972 u n d des Kultusministers v o m 13.10.1972 (Landtagsdrucksache VI/968). Möglich wäre es auch, entsprechende Vorschriften i n eine noch zu erlassende Geschäftsordnung der Regierung aufzunehmen (so H. Schneider, i n : Festschrift für E. R. Huber, S. 177). 88 § 2 I des polStSekrG stimmt insoweit m i t § 1 des Ministergesetzes w ö r t lich überein (bezüglich der Rechtsstellung). 39 Vgl. die Begründung zu dem Gesetzentwurf i n Landtagsdrucksachen, 6. Wahlperiode, Bd. 1, Nr. 20; ebenso H. Filbinger, i n : Verhandlungen des Landtags, 6. Wahlperiode, S. 187 f. Falls von der Regierung Richtlinien aufgestellt sind, hat sich die konkrete Ausgestaltung selbstverständlich i m Rahmen dieser Grundsätze zu halten. 40 Vgl. E S V G H 23, S. 142; vgl. dazu eingehend oben Fußnote 31. 41 Vgl. E S V G H 23, 135, 144 ff.; H. Schneider, i n : Festschrift f ü r E. R. Huber, S. 177 f.
122
Kap. I I : Regierungssystem nach der bad.-württ. L V
Bindung genommen sind, grundsätzlich keine Ausnahme zugelassen 42 . Praktisch führt dies dazu, daß die politischen Staatssekretäre neben rein politischen (diese Beschränkung war ursprünglich i m Gesetzentw u r f auch vorgesehen) nur dann fachliche Aufgaben wahrnehmen dürfen, wenn sie diese nicht ständig, sondern nur „aushilfsweise" oder nur i n geringem Umfang erfüllen 4 3 . Die dem politischen Staatssekretär zugedachte „Entlastungs- und Unterstützungsfunktion" ist damit in wesentlichen Bereichen faktisch hinfällig. Dies hat auch die bisherige Praxis i m Innen- und Kultusministerium deutlich bestätigt. Von einer nach wie vor bestehenden Flexibilität i n der Ausgestaltung der Stellung und der Aufgaben des Amts des politischen Staatssekretärs an der „Naht" zwischen Regierung und Verwaltung (Art Gelenkstelle) kann aufgrund der vom StGH aufgestellten Grundsätze nach dem Urteil kaum mehr gesprochen werden. Die derzeit den politischen Staatssekretären obliegenden, vom Umfang her bescheidenen fachlichen Aufgaben können i m Hinblick auf das StGH-Urteil (Art. 77 I L V und A r t . 33 V GG i. V. m. A r t . 2 I LV) auch nur unwesentlich erweitert werden 4 4 . Danach verbleiben den Staatssekretären schwerpunktmäßig Aufgaben i m politischen Bereich. Wenn man aber auch hierzu die geübte Praxis m i t i n die Überlegungen einbezieht, wonach sich normalerweise der Ministerpräsident oder ein Minister aus politischen Gründen (Publizität i n Partei und Öffentlichkeit, Dokumentation des eindeutigen Führungsanspruchs des Ressortchefs, keine Profilierung des Staatssekretärs auf seine Kosten usw.) gerade aus diesem Gebiet nur unwesentlich und i n unbedeutenderen Angelegenheiten zurückzieht (was man von i h m auch erwartet) und der politische Staatssekretär auch von der Öffentlichkeit weitgehend nicht als Vertreter des M i n i sters akzeptiert wird, so w i r d deutlich, auf welch schmalem Grad von Befugnissen und Rechten, aber auch Aufgaben und Zuständigkeiten sich die politischen Staatssekretäre verfassungsrechtlich und politisch zur Zeit bewegen 45 . Eine gewisse Ausnahme dürfte gegenwärtig der 42 Vgl. dazu ESVGH 23, S. 135, 144 ff.; H. Schneider, S. 177 f. Vgl. dazu auch die „Hausverfügungen" i n Landtagsdrucksachen VI/968. 43 Die Entscheidung des S t G H (ESVGH 23, 144 ff.) w u r d e absichtlich etwas überzeichnet, u m die Tragweite u n d praktische Relevanz dieses Urteils insow e i t besonders deutlich werden zu lassen; vgl. auch E. Klein, i n : D Ö V 1974, S. 590 ff. 44 Vgl. zur „Verfassungswirklichkeit" eingehend unten § 23 Ziff. 3 - 5 . 45 Diese Ausführungen verdeutlichen die Meinung von T. Eschenburg, daß „ i n den Ländern, bei denen das Schwergewicht i n der V e r w a l t u n g liegt, kein Platz für einen parlamentarischen Staatssekretär ist" u n d i m Hinblick auf den Staatssekretär m i t Kabinettsrang (für Vertriebene, Flüchtlinge u n d Kriegsbeschädigte i m I M ) von einem „Fremdkörper i m M i n i s t e r i u m " gesprochen werden muß (in: Die Zeit v o m 18.10.1968). A u f g r u n d des StGH-Urteils bezeichnete die Stuttgarter Zeitung am 26.2. 1973 auf S. 3 die pol. Staatssekretäre als „Unglückliche Staatssekretäre" u n d
§ 16 Die Staatssekretäre (i. w. S.)
123
seit 1. 9.1974 ernannte und i m Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Umwelt für die Fragen des Umweltschutzes zuständige politische Staatssekretär darstellen. 6. Beamtete Staatssekretäre Das Landesbeamtengesetz von Bad.-Württ. 4 6 kennt die Institution des politischen Beamten nicht. Von der i n § 31 BRRG enthaltenen Ermächtigung, politische Landesbeamte auf Zeit einzuführen, wurde bis heute kein Gebrauch gemacht. Seit langem w i r d immer wieder davon gesprochen, ein A m t zu schaffen, das „ i n fortdauernder Übereinstimmung m i t den grundsätzlichen politischen Ansichten und Zielen der Regierung" ausgeübt werden muß und dessen Inhaber bei auftretenden oder vorhersehbaren Schwierigkeiten alsbald i n den einstweilen Ruhestand versetzt werden kann 4 7 . Ende 1974 haben diese Überlegungen nun endlich konkretere Gestalt angenommen 48 . Das Kabinett hat inzwischen bereits mehrfach über eine entsprechende Änderung des Landesbeamtengesetzes beraten und die diesbezügliche Gesetzesvorlage beschlossen49. Zwar ist es sicher erstrebenswert, nach einem politischen Führungswechsel einen weitgehend kontinuierlichen, fachlich leistungsfähigen und parteipolitisch nicht exponierten Beamtenkörper zur Verfügung zu haben; doch dürfte dieses Argument heute mindestens nicht mehr für den „Amtschef" des Ministeriums gelten. Letztlich ausschlaggebend für die Nichteinführung des politischen Beamten waren bisher überwiegend taktisch-politische Gründe. Man wollte bei einem möglichen Regierungswechsel dem politischen Gegner nicht die Möglichkeit eröffnen, alle leitenden Ministerialbeamten i n „rechtlich und moralisch nennt das i n dem Staatssekretärsgesetz enthaltene, noch ü b r i g gebliebene Konzept als „nichts Brauchbares mehr". Selbst H. Schneider (in: Festschrift für E. R. Huber), der Prozeß Vertreter der Landesregierung war, stellt auf S. 179 sicher nicht ohne Ironie fest, daß „diese Beschränkung ihrer Funktionen den Parlamentarischen Staatssekretären die gewissenhafte Wahrnehmung ihres Abgeordnetenmandats erleichtert"! Vgl. auch K . Kröger, i n : DÖV 1974, S. 585 m. w. N. 46 L B G v o m 1. 8.1962 (Ges. Bl. S. 143) i. d. F. v o m 27. 5.1971 (Ges. Bl. S. 225). 47 So etwa H. Filbinger, Entscheidung zur Freiheit, S. 93 f.; Ders., i n : V e r handlungen des Landtags, 6. Wahlperiode, S. 24f.; L. Späth, i n : Stuttgarter Zeitung v o m 3. 4.1974 (S. 5), v o m 17. 5.1973 (S. 7); vgl. auch R. Schunke, Die politischen Beamten, S. 88 f. m. w. N. Wie w e i t der Kreis der politischen Beamten allerdings gezogen werden soll, ist noch unklar. 48 Anlaß zu der diesbezüglichen Meinungsänderung w a r die Entscheidung des Landespersonalausschusses v o m 8.10.1974, i n der dieser die Genehmigung zur Ernennung des Landtagsabgeordneten Gerstners zum Regierungspräsidenten abgelehnt hat. Vgl. dazu etwa Stuttgarter Zeitung v o m 11.10. 1974, S. 5; J. Bischoff, i n : Die Zeit v o m 18.10.1974, S. 12. Vgl. dazu unten § 23. 49 Vgl. dazu den E n t w u r f des Innenministeriums v o m 20.12.1974 zur Ä n d e rung des L B G (Viertes Änderungsgesetz). Z u m gegenwärtigen Stand des Gesetzgebungsverfahrens etc. vgl. unten § 23 Ziff. 4 (insbes. Fußnote 56 u n d 76).
124
Kap. I I : Regierungssystem nach der bad.-württ. L V
unbedenklicher Weise" i n ihren Ämtern abzulösen 50 . A u f dem Hintergrund der Entscheidung des Landespersonalausschusses vom 8.10.1974 scheint man diese Auffassung mittlerweile allerdings m i t der Einschränkung aufgegeben zu haben, daß der entsprechende Gesetzentw u r f aus parteitaktischen Gründen erst Mitte 1976, also nach der nächsten Landtagswahl, verabschiedet wird. Dieser Rechtszustand hat gegenwärtig noch zur Folge, daß alle „Amtschefs" der Ministerien Beamte auf Lebenszeit der Besoldungsgruppe B 9, also Ministerialdirektoren sind 5 1 . Davon gab bzw. gibt es bisher allerdings zwei Ausnahmen: I n einem Fall wurde ein Hochschullehrer als „Beauftragter für Hochschulfragen" m i t der Amtsbezeichnung „Staatssekretär" i n das Kultusministerium berufen. Er behielt während dieser Zeit sein A m t als ordentlicher Professor und seinen Status als Lebenszeitbeamter bei. Dieses „Modell" dürfte aber eine einmalige, rechtlich sehr bedenkliche Sonderregelung bleiben 5 2 . Zum anderen ist erstmals von Juni 1972 bis Januar 1975 einem Ministerialdirektor ad personam der Titel „Staatssekretär" gemäß § 97 I I L B G vom Ministerpräsidenten verliehen worden. Die formelle Rangerhöhung des damaligen Amtschefs i m Finanzministerium vermochte an dessen Funktionen und an der Verteilung der Führungsaufgaben i m Ministerium nichts zu ändern und ist auch ohne besoldungsrechtliche Folgen. Trotzdem w i r d man sagen können, daß damit auch nach außen dokumentiert werden sollte, daß dieser Amtschef stärker i n die politische Regierungsverantwortung miteinbezogen w a r 5 3 . 7. Ministerialdirektoren Die Ministerialspitze bilden i n Bad.-Württ., abgesehen von den eben genannten Ausnahmen, die Ministerialdirektoren. Sie sind Beamte 50
Vgl. dazu eingehend u n d zutreffend H. Schneider, i n : Festschrift für E. R. Huber, S. 170 - 172. A l l e Interviews, die zu diesem Thema geführt w u r den, haben die oben gemachten Ausführungen v o l l bestätigt. 51 A n diesem Zustand w i r d sich, selbst bei einer baldigen Einführung des politischen Beamten, bis zur nächsten Regierungsbildung (Mai/Juni 1976) nichts ändern. Dies ergaben die durchgeführten Befragungen einhellig. 52 Prof. Meckelein hatte dieses A m t einige Jahre inne. 53 Dies zeigte sich bei jenem Staatssekretär, der gleichzeitig i m Landesvorstand der C D U ist, besonders deutlich. Ob eine solche Regelung allerdings i m Verhältnis zu den übrigen Amtschefs sehr zweckmäßig ist, scheint zweifelhaft; dies soll hier aber nicht näher untersucht werden. Bezeichnenderweise wurde eine generelle Verleihung des Titels Staatssekretär an die Ministerialdirektoren abgelehnt; vgl. etwa Südwestpresse Schwäb. Tagblatt v o m 3.12.1974, S. 1. Vgl. dazu H. Schneider, i n : Festschrift f ü r E. R. Huber, S. 170; U. Echtler, Der beamtete Staatssekretär, S. 53; Pressemitteilung der Landesregierung v o m 14. 6. 1972, Nr. 280/72. Vgl. zu den gesamten Problemen die eingehenden Ausführungen unten § 23 Ziff. 3 - 5 .
§ 17 Die Organisationsgewalt i m Regierungsbereich
125
auf Lebenszeit, unterliegen also den entsprechenden Anforderungen der Beamtengesetze und stellen die höchste Stufe der Beamtenhierarchie (B 9) dar. Entsprechend der traditionellen Auffassung sind sie die Amtschefs der einzelnen „Häuser" und tragen dem Minister gegenüber die Verantwortung für das Funktionieren und die Effektivität des Verwaltungsapparats und der -arbeit. Die Ministerialdirektoren, die nicht parlamentarisch, aber beamtenrechtlich verantwortlich sind, vertreten die Minister i n den Ministerien. Dieses Vertretungsrecht w i r d i n den Ressorts, i n denen politische Staatssekretäre berufen worden sind, durch „Hausverfügungen", i n aller Regel allerdings nach wie vor durch Einzelanweisungen des Ministers, modifiziert; aber auch dort bleiben sie grundsätzlich die allgemeinen Stellvertreter des Ministers. Für die beratende Vertretung des Ministers i m Kabinett (Art. 49 I I I LV) gilt dasselbe. Auch hier vertritt den Minister grundsätzlich der Amtschef; i n den Ressorts, i n denen neben i h m ein politischer Staatssekretär ernannt worden ist, w i r d die Vertretung praktisch von Fall zu Fall entschieden 54 . § 17 Die Organisationsgewalt im Regierungsbereich A n verschiedenen Stellen wurden bereits Ausführungen zum Organisationsrecht und zur Organisationsgewalt gemacht. Der Wichtigkeit dieser Befugnis wegen soll die Organisationsgewalt i m Bereich der Regierung nochmals zusammenfassend dargestellt werden, wobei allerdings nicht versucht werden soll, bis i n jedes Detail vorzustoßen und alle Einzelheiten zu klären. 1. Grundsätzliche Verteilung Nach heute noch h. M. gehört die Organisationsgewalt 1 grundsätzlich, d. h. i m Rahmen des allgemeinen rechtsstaatlichen Gesetzesvorbehalts 54 „Hausverfügungen" des I n n e n - u n d Kultusministeriums siehe Drucksachen des Landtags, 6. Wahlperiode, Nr. 968. Die durchgeführten Interviews ergaben, daß die Entscheidung über die Vertretung i n einem konkreten Fall, abgesehen von den Möglichkeiten des Terminkalenders, i m wesentlichen von zwei Faktoren bestimmt w i r d : (1) Der persönlichen Stellung u n d dem p o l i tischen Gewicht v o n Staatssekretär u n d Ministerialdirektor u n d (2) w e r i n der konkreten Angelegenheit die größere Sachkenntnis u n d die bessere Informationsbasis hat. Vgl. dazu auch P. Feuchte, i n : Spreng / B i r n / Feuchte, S. 174; Projektgruppe Bay. IM, Reformbericht, S. 103. Vgl. zur Gesamtproblem a t i k unten § 23, insbesondere Ziff. 3. 1 Unter Organisationsgewalt w i r d hier etwas einengend n u r die Gesamtheit der Befugnisse der Exekutivspitze (Regierung, Ministerpräsident, M i n i ster) als einem T e i l der öffentlichen Gewalt verstanden, öffentlich-rechtliche Maßnahmen zur Begründung (Bildung u n d Errichtung), inneren Ordnung (Zuweisung u n d Verteilung v o n Aufgaben), Einrichtung (Zuweisung von Räumen, Sachmitteln u n d Personal) oder Änderung u n d Aufhebung seiner Organisation zu treffen. Vgl. dazu etwa H. J. Wolff, Verwaltungsrecht I I ,
126
Kap. I I : Regierungssystem nach der bad.-württ. L V
zum Eigenbereich der vollziehenden Gewalt und steht insoweit der Exekutivspitze zu. Welches Organ aber innerhalb der Regierung Inhaber der Organisationsgewalt i m einzelnen ist, muß, soweit keine konkreten Verfassungsbestimmungen dafür bestehen, der jeweiligen Grundstruktur der Regierung, die der Verfassung zugrunde liegt, entnommen werden 2 . Das Regierungssystem des Landes (Art. 45 ff. LV) ist durch eine bestimmt geartete Verbindung von Kollegial-, Kanzler- und Ressortprinzip, wobei das Kollegialprinzip etwas dominiert, zu charakterisieren. Die Befugnisse der Organisationsgewalt bestimmen sich demzufolge grundsätzlich nach der der Regierungsstruktur zugrunde liegenden Kompetenzverteilung, wie sie vor allem i n den A r t . 49 I, I I und 45 I I I L V zum Ausdruck kommt 3 . Hierbei ist allerdings zu beachten, daß abgesehen von A r t . 70 L V 4 dem Landtag auch bei der Organisation des Regierungsbereichs neben den haushaltsrechtlichen und politischen Möglichkeiten durch A r t . 46 I I I , I V und 45 I I I L V wesentliche Einflußrechte zustehen 5 . Diese Rechte begründen aber nicht die Auffassung, daß dadurch die Organisationsgewalt letztlich dem Parlament zusteht. Vielmehr hat der Landtag m i t der Verfassungsänderung des A r t . 45 I I I L V die Organisationsgewalt für den Regierungsbereich der Regierung übertragen und sich durch das Zustimmungserfordernis nur weitgehende Kontrollrechte vorbehalten 6 . S. 121 ff.; E. Forsthoff, Verwaltungsrecht, S. 432ff.; F. Mayer, Organisationsgewalt, i n : EStL Sp. 1418 ff.; E.-W. Böckenförde, Organisationsgewalt, S. 38; H. Kalkbrenner, i n : DVB1. 1964, S. 849 ff. 2 Vgl. E.-W. Böckenförde, Organisationsgewalt, S. 78 ff.; E. Forsthoff, V e r waltungsrecht, S. 432 ff.; T. Maunz, i n : Maunz / D ü r i g / Herzog, A r t . 84 A n m . 4 ff.; H. J. Wolff, Verwaltungsrecht I I , S. 122 ff.; F. Ossenbühl, Verwaltungsvorschriften, S. 250 ff.; E. Rasch, Die staatl. Verwaltungsorganisationen, S. 189; H. Lenz, i n : H a m a n n / Lenz, S. 98 f.; BVerfGE 2, 307, 319; B V e r w G E 36, 91, 94. 3 Vgl. dazu ausführlich oben § 12 Ziff. 5 (vgl. außerdem § 13, Fußnote 1). 4 Die Organisationsgewalt i m Bereich der V e r w a l t u n g soll hier nicht näher erörtert werden. A u f g r u n d der Materialien, aus denen sich ergibt, daß der Verfassungsgeber dem Gesetzgeber n u r das Wesentliche, die Grundorganisation, u n d auch hier vor allem die untere u n d mittlere Stufe des Verwaltungsaufbaus (insbes. Frage der Regierungspräsidien) vorbehalten wollte, u n d auch aus praktischen Erwägungen, ist hinsichtlich des Gesetzesvorbehalts des A r t . 70 I L V eine etwas restriktive Interpretation geboten. Dies w i r d auch von P. Feuchte, i n : Spreng/ B i r n / Feuchte, S. 242 ff. u n d H. J. Wolff, V e r w a l tungsrecht I I , S. 126 vertreten; vgl. außerdem: Protokolle des V A , 21. Sitzung, S. 2 ff. Den Verwaltungsaufbau i n Bad.-Württ. regelt vor allem das Landesverwaltungsgesetz v o m 7.11.1955 (Ges. Bl. S. 225) m i t zahlreichen Änderungen. Z u A r t . 70 L V vgl. weiter: E.-W. Böckenförde, Organisationsgewalt, S. 99 f.; A. Köttgen, i n : V V D S t R L Bd. 16 (1958), S. 163. 5 Vgl. dazu ausführlich § 10. Bis zur Änderung des A r t . 45 I I I L V vom 17.11.1970 (Ges. Bl. S. 492) mußte sowohl die Zahl der Minister als auch die Geschäftsbereiche durch Gesetz bestimmt werden. Vgl. K. Rebmann, i n : JöR n. F. Bd. 20 (1971), S. 202. 0 Vgl. oben § 10 (insbes. Fußnoten 8 - 1 0 ) . Weiter: Verhandlungsprotokolle, 5. Wahlperiode, S. 4670 f., 4682 ff. u n d 5035 ff. Außerdem zur Gesamtproblem a t i k K . Rebmann, S. 201 f.
§17 Die Organisationsgewalt i m Regierungsbereich
127
2. Regierungsbildung Wie bereits oben i n den §§10 und 13 näher ausgeführt wurde, steht das materielle Kabinettsbildungsrecht i n Bad.-Württ. i m Gegensatz zum Bund nicht dem Regierungschef allein zu. Vielmehr sind diese Befugnisse „aufgeteilt" auf den Ministerpräsidenten (Art. 46 II, 49 I S. 1 LV), das Kabinett (Art. 45 I I I , 49 I I LV) und das Parlament (Art. 45 I I I , 46 I I I , I V LV). Für eine rechts wirksame Regierungsbildung ist es deshalb erforderlich, die Auffassungen dieser drei Staatsorgane aufeinander abzustimmen und i n Einklang zu bringen. Diese Mitwirkungsrechte, die alle so eng miteinander verzahnt und verknüpft sind, daß sie nur einheitlich, als Gesamtentscheidungsvorgang, gesehen werden können, sind für sämtliche drei Organe nicht nur formeller, sondern auch materieller A r t . Dies gilt besonders für die Befugnisse des M i n i sterrats, da die i h m zustehende Organisationsgewalt (einschließlich der Festlegung der Ministerzahl und der Geschäftsbereiche) 7 sonst praktisch bedeutungslos und damit ausgehöhlt wäre. Dem Ministerpräsident kommt hierbei allerdings insoweit eine etwas hervorgehobene Stellung zu, w e i l i h m bei der Regierungsbildung das Vorschlagrecht zusteht und i h m gegen seinen Willen kein Regierungsmitglied aufgezwungen werden kann. Bei der Regierungsbildung ist es folglich zwingend notwendig, daß Ministerpräsident, Kabinett und Parlament übereinstimmend zusammenwirken 8 . Diese Regelung ist zwar rechtlich nicht sonderlich befriedigend, aber politisch durchaus sinnvoll. 3. Organisationsgewalt des Kabinetts Entsprechend der grundsätzlichen Ausgestaltung des Regierungssystems kommt dem Ministerrat auch i m Rahmen der Organisationsbefugnisse eine hervorgehobene Stellung zu. Neben dem bereits mehrfach genannten Recht auf Festlegung der Geschäftsbereiche und damit auch der Zahl der Regierungsmitglieder (Art. 45 I I I LV), hat das Kabinett die Geschäftsordnung der Regierung zu beschließen (Art. 49 I S. 2 LV). Aus diesen Befugnissen und Art. 49 I I L V ergibt sich, daß der Ministerrat i m Rahmen der Geschäftsordnung oder durch Beschlüsse die Organisation des Regierungsbereichs weitgehend zu bestimmen hat 7
Siehe Fußnote 6. Vgl. dazu ausführlich oben § 14 (mit Fußnoten 18-20); siehe besonders P. Feuchte, i n : Spreng / B i r n / Feuchte, S. 175 f. u n d K. Rebmann, i n : JöR n. F. Bd. 20 (1971), S. 202. So auch T. Eschenburg, Verfassung u n d Verfassungsaufbau des Südweststaats, S. 67. Findet etwa eine Änderung der Geschäftsbereiche nicht die Zustimmung des Landtags, so bleibt es bei der bisherigen Ministerzahl u n d Zuständigkeitsabgrenzung (Bekanntmachung v o m 25. 7.1972, Ges. Bl. S. 404). Weiter ist etwa der nach A r t . 46 I L V Gewählte ohne die Regierungsbestätigung nach A r t . 46 I I I L V nicht Ministerpräsident (vgl. P. Feuchte, ebd., S. 176). 8
128
Kap. I I : Regierungssystem nach der bad.-württ. L V
und i h m unter Beachtung der Gesetze und der Richtlinienkompetenz (Art. 49 I S. 1 LV) die Organisationsgewalt insoweit grundsätzlich allein zusteht 9 . Das Regierungskollegium beschließt demnach über den Ablauf und die Durchführung der Kabinettsarbeit, über die Aufstellung von allgemeinen Grundsätzen für die Organisation der Leitungsebene der M i n i sterien (Ressortspitze) 10 und etwa auch über die generelle Festlegung der organisatorischen Ausgestaltung der interministeriellen Zusammenarbeit (zur Information, Koordination, Planung usw.). Deshalb müßte auch das Kabinett entsprechend seiner Organisationsgewalt u. a. Richtlinien und Grundsätze für die organisatorische Einordnung der politischen Staatssekretäre i n die Ressortleitung und für deren Aufgaben, aber auch Befugnisse aufstellen (Art. 49 I I L V ) 1 1 . Der Ministerrat hat allerdings bis heute diese Organisationsrechte kaum wahrgenommen und selbst eine Geschäftsordnung wurde nicht erlassen 12 . Diese Lücken sind dann, abgesehen von der Kabinettsarbeit, verständlicherweise größtenteils durch Organisationsakte der einzelnen Minister geschlossen worden 1 3 . Außerdem schreibt A r t . 45 I I I L V noch ausdrücklich dem Ministerrat zwingend vor, allen Regierungsmitgliedern einen genau umschriebenen Geschäftsbereich zuzuweisen. Für die Staatssekretäre und Staatsräte m i t Kabinettsrang kann dies zwar kein Geschäftsbereich i. S. von A r t . 49 I S. 4 L V sein, doch bedarf es für sie, um A r t . 45 I I I L V insoweit nicht völlig leerlaufen zu lassen, auch einer grundsätzlichen Festlegung ihres Aufgabenbereichs durch einen Beschluß des Regierungskollegiums. Diese verfassungsrechtlich festgelegte Voraussetzung wurde zwar bei dem Staatssekretär für Vertrie9 So insbes. Verhandlungsprotokolle, 5. Wahlperiode, S. 4670 f., 4682 ff., 5035ff.; weitere Fundstellen i n den Fußnoten 8 bis 10 des § 10; so auch F. Scharpf, Länderbericht Baden-Württemberg, S. 1 (unveröffentlicht). 10 Vgl. dazu oben Fußnote 4. Da die Ressortspitze zum Regierungs- und nicht zum Verwaltungsbereich zu zählen ist, w i r d nach der hier vertretenen, etwas restriktiven Interpretation des A r t . 70 I L V diese Bestimmung insoweit nicht berührt. 11 Vgl. oben § 16 Ziff. 5 (Fußnote 37). 12 Der Verfassungsauftrag des A r t . 49 I S. 2 L V bleibt so lange „ A u f t r a g " als sich alle Regierungsmitglieder über den Nichterlaß einig sind. Interessanterweise wurde selbst unter der Großen K o a l i t i o n (trotz zum T e i l auch heftigem „GeschO-gerangel") die Aufstellung einer GeschO nicht gewünscht. Vgl. dazu E.-W. Böckenförde, Organisationsgewalt, S. 119 ff.; G. Bachmann, i n : Die Staatskanzlei, SHS Bd. 34, S. 165. 13 Vgl. etwa die „Hausverfügungen" des Innen- u n d Finanzministers (Landtagsdrucksachen, 6. Wahlperiode, Nr. 968). Die von der Landesregierung am 24.11.1970 (GABI. 1971, S. 1) beschlossene Dienstordnung für die Staatsbehörden i n Bad.-Württ. (DO) regelt n u r den Bereich der staatlichen V e r waltung, nicht den der Regierung. Da die DO keine Regelungen über A u f bau, räuml. Gliederung u n d Zuständigkeiten der Landesverwaltung, sondern i m wesentlichen n u r der inneren Organisation enthält, liegt auch kein V e r stoß gegen A r t . 70 L V vor.
§ 17 Die Organisationsgewalt i m Regierungsbereich
129
bene, Flüchtlinge und Kriegsbeschädigte und auch bei dem Minister für Bundesangelegenheiten, nicht aber bei dem Staatssekretär m i t Kabinettsrang i m Staatsministerium beachtet 14 . 4. Weitere Organisationsbefugnisse Neben den Befugnissen des Ministerpräsidenten i m Zusammenhang m i t der Regierungsbildung muß i m Rahmen der Organisationsgewalt grundsätzlich auch die Richtlinienkompetenz beachtet werden. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß diese abgesehen von A r t . 49 I I L V (vgl. oben § 12 Ziff. 5) zusätzlich von A r t . 45 I I I und 49 I S. 2 L V eingeengt wird, so daß i m Bereich der Organisation der Regierung dem Ministerpräsidenten insoweit von der Verfassung keine besonders starke Stellung eingeräumt ist. Dieses Ergebnis wurde durch die Beratungen des Landtags zur Änderung des A r t . 45 I I I L V bestätigt 15 . Zusätzlich zu den Organisationsrechten aus A r t . 46 I I und 49 I S. 1 L V kommt dem Ministerpräsidenten als „Chefkoordinator" der Landesregierung die Befugnis zu, i m Rahmen der vom Kabinett aufzustellenden Grundsätze, insbesondere die notwendige interministerielle Zusammenarbeit (zur Information, Koordination, Planung usw.) i n organisatorischer Hinsicht i m einzelnen zu regeln und festzulegen. Er hat grundsätzlich das Recht, i n all den Angelegenheiten „geschäftsordnungsmäßige" Anordnungen zu treffen, i n denen dies erforderlich und mehr als ein Ministerium betroffen ist (insbesondere die „Koordinationskompetenz") 16 . Den Ministern bleibt innerhalb ihrer Ressorts Spielraum für eigene organisatorische Regelungen. Durch die Organisationsgewalt des Kabinetts für den Regierungsbereich (Ressortspitze) und dem weitgehenden Gesetzesvorbehalt für den Verwaltungsbereich (vgl. A r t . 70 I und I I LV) sind die Rechte der Minister allerdings reduziert. Da aber sowohl der Gesetzgeber als auch das Kabinett tatsächlich von der ihnen zustehenden Organisationsgewalt nur auf wenigen Gebieten und auch dann nur sehr grundsätzlich und allgemein Gebrauch gemacht haben, sind die Organisationsbefugnisse der Minister i n der Praxis trotzdem recht beachtlich.
14
Vgl. dazu schon oben § 16 Ziff. 2 (insbes. Fußnote 17). Vgl. Verhandlungsprotokolle, 5. Wahlperiode, S. 4670 f., 4682 ff. u n d 5035 ff. 16 Dies ergibt sich aus oben § 12 Ziff. 5 (2); vgl. außerdem unten § 24 Ziff. 8; H. Bebermeyer, i n : Die Staatskanzlei, SHS Bd. 34, S. 222 (Diskussionsbeitrag); K. König, Koordination u n d Regierungspolitik, DVB1. 1975, S. 227 f. 15
9 Katz
130
Kap. I I : Regierungssystem nach der bad.-württ. L V
§ 18 Verfassungsrechtliche Schlußbemerkungen Z u Beginn dieses Kapitels I I wurde festgestellt, daß die Verfassungsgebende Landesversammlung bei der Ausgestaltung des Regierungssystems weitgehend auf die i m Bund und den Ländern erprobten und bewährten Prinzipien zurückgegriffen und keine größeren Reformen und Neuerungen eingeführt hat. Obwohl also i n der Landesverfassung keine grundsätzlich neuen Wege beschritten wurden, zeigen die vorstehenden Ausführungen dennoch i n den verschiedensten Regelungen, vor allem i m Vergleich zum Bund, aber auch zu den meisten anderen Ländern, erkennbare Abweichungen und besondere Ausprägungen i n der Regierungsstruktur, die sich insgesamt i m wesentlichen i n drei Unterschieden recht deutlich darstellen: (1) Das parlamentarische Regierungssystem der Landesverfassung kann keinesfalls als abgeschwächtes parlamentarisches System bezeichnet werden. Dem Landtag wurden wesentliche, den Bereich der Regierung betreffende Befugnisse eingeräumt. Dem Parlament ist demnach teilweise Regierungsverantwortung m i t übertragen. I n der Landesverfassung sind also beachtliche Ansätze zu einer gemeinsamen Ausübung der Staatsleitung u n d Regierungsgewalt durch Regierung und Parlament enthalten und eine neue mehr kooperative Ausgestaltung des ParlamenWRegierungsverhältnisses, abweichend von der traditionellen Gewaltenteilungslehre, enthalten (vgl. oben § 10). (2) Das Kabinettsprinzip, die kollegiale Beratung und Beschlußfassung, ist besonders deutlich betont und ausgestaltet worden. Der M i n i sterrat stellt das wichtigste Regierungsorgan des Landes dar. I n Bad.-Württ. kann deshalb keinesfalls von einer „Kanzlerdemokratie", sondern eher von einer „Kabinettsdemokratie" gesprochen werden (vgl. oben §§12 und 13). (3) Durch diesen „Bedeutungszuwachs" des Kabinetts ist einmal das Ressortprinzip (zugunsten einer stärkeren Ausprägung der Gesamtverantwortlichkeit) und zum anderen das Kanzlerprinzip notwendigerweise geschwächt und i n der Verfassung entsprechend geringer hervorgehoben worden. Der Ministerpräsident ist nach der Landesverfassung deshalb nicht „Chef" der Regierung, sondern grundsätzlich primus inter pares (vgl. oben §§ 14 und 15). Wenn man die Entwicklung des Organisationsverfassungsrechts i n den letzten 25 Jahren und den Stand der gegenwärtigen Diskussion zum parlamentarischen Regierungssystem betrachtet, so w i r d deutlich, welch moderne Verfassung die Verfassungsgebende Landesversamm-
§18 Verfassungsrechtliche Schlußbemerkungen
131
lung i n den Jahren 1952 und 1953 erarbeitet und beschlossen hat 1 . Das folgende Kapitel soll nun den Versuch unternehmen, zu ergründen, ob die Praxis diesem „modernen" Verfassungsverständnis gerecht geworden ist und ob die Landesverfassung für die besonderen Erfordernisse und Aufgaben des Landes die Organisation und Struktur des Regierungsbereiches adäquat und effektiv ausgestaltet hat 2 .
1 Vgl. statt vieler: U. Scheuner , i n : D Ö V 1974, S. 437 ff. u n d J. Kölble, i n : D Ö V 1973, S. l f f . j e m. w . N. Vgl. auch bereits G. Müller , i n : Staatsanzeiger BW, 1958 Nr. 30, S. 1 ff. 2 Vgl. dazu etwa unten §§ 20, 21, 24 u n d 25.
9*
KAPITEL
III
Organisation und Struktur der Landesregierung (Darstellung und Analyse der empirischen Untersuchungsergebnisse) § 19 Empirisches Vorgehen und Quellen der Untersuchung Zur Ermittlung der für diese Untersuchung des Bereichs der Landesregierung Baden-Württemberg notwendigen empirischen Befunde wurde eine Vielzahl von zum Teil recht unterschiedlichen Quellen benutzt 1 . Dies war wegen der schlechten Materiallage und aus Gründen der Kapazität und politischen Brisanz (vgl. § 2 Ziff. 1) dringend geboten. Der empirische Teil der Arbeit stützt sich zum Teil auf veröffentlichte, aber auch umfangreiche interne schriftliche Unterlagen, insbesondere Geschäftsverteilungs- und Organisationspläne, Erlasse, Rundschreiben, Programme, Pläne, sowie auf eine Reihe von Aktenvermerken und dergleichen. Die wichtigsten zugänglichen Materialien sind i m Quellenund Literaturverzeichnis i m einzelnen aufgeführt. U m den politologischen und soziologischen Aspekt zu betonen, wurde auch auf Pressemeldungen zurückgegriffen. Daneben ergaben sich zudem aus einem regelmäßigen Studium des Staatsanzeigers für Baden-Württemberg und der gesamten Pressemitteilungen der Landesregierung und der Ministerien wichtige Hinweise und Anregungen. Trotz dieser mannigfaltigen Quellen war die Materiallage noch recht lückenhaft und für einen einigermaßen guten Gesamtüberblick über den Regierungsbereich unzureichend. Zur Schließung dieses Informationsdefizits mußte der Hauptteil der Erhebungen i n Form von Befragungen (Interviews) durchgeführt werden. Der so erfolgten Daten- und Informationssammlung lag weitgehend ein Interview-Leitfaden (mit 356 Fragen) zugrunde, dessen Gliederungsübersicht i m Anhang (Anlage 2) abgedruckt ist. Da die Befragungen, die i m Durchschnitt etwa IV2 bis 2 Stunden 1 Z u r empirischen Methode vgl. etwa H. Friedrich , Staatl. V e r w a l t u n g und Wissenschaft, S. 117 ff.; H. Schatz , Der parlamentarische Entscheidungsprozeß, S. 2 f.; F. Scharpf, Projektgruppe B M I , Erster Bericht, Anlagenband, S. 270 ff. A l l g . zur empirischen Sozialforschung: R. König (Hrsg.), Handbuch der empirischen Sozialforschung; R. Mayntz , u. a., Einführung i n die Methoden der empirischen Soziologie; J. Friedrichs , Methoden empirischer Sozialforschung.
§ 19 Empirisches Vorgehen u n d Quellen der Untersuchung
133
dauerten, schwerpunktmäßig i m Staatsministerium als der „Koordinationszentrale" und dem „Kabinettsbüro" durchgeführt wurden, ist der Interview-Leitfaden naturgemäß stark an der Tätigkeit der Staatskanzlei orientiert worden. Bei den Befragungen wurde, da aus zeitlichen und Zumutbarkeitsgründen eine Beantwortung aller 356 Fragen nicht möglich war, i m allgemeinen so vorgegangen, daß jedem Interviewten etwa ein Viertel der Fragen vorgelegt wurde, wobei darauf geachtet worden ist, daß jede Frage i n jeder Abteilung mindestens einmal gestellt wurde. Insgesamt konnten 53 Interviews durchgeführt werden. Davon fanden 35 i m Staats-, 4 i m Innen-, 3 i m Kultus- und je 2 i m Finanz- und Arbeitsministerium statt 2 . Zudem wurden noch 4 Gespräche mit Landtagsabgeordneten und 2 m i t Journalisten geführt. U m noch umfassenderes und systematischeres Material zur Untersuchung speziell des Staatsministeriums zu erhalten, wurde zusätzlich fast allen Referenten (einschließlich den stellvertretenden Abteilungsleitern) und einigen Sachbearbeitern ein sechsseitiger schriftlicher Fragebogen (vgl. Anhang, Anlage 3) vorgelegt, der von allen auch ausgefüllt wurde (insgesamt 27). Diese empirischen Methoden wurden schließlich noch ergänzt durch eigene Beobachtung 3 , viele informelle Gespräche, die oft wertvolle Zusatz- und Hintergrundinformationen boten, und einzelne, separat durchgeführte Erhebungen 4 . Die Auswahl der Gesprächspartner für die Interviews erfolgte, abgesehen vom Staatsministerium, i n dem praktisch alle höheren Beamten befragt wurden, nach quantitativen Gesichtspunkten und konzentrierte sich auf leitende Beamte der wichtigsten Ressorts. Leider war eine systematische Befragung der Kabinettsmitglieder nicht möglich, weshalb Aussagen über den Ministerrat und seine Arbeit i m wesentlichen nur auf Berichte der Beamten gestützt werden können. I m Herbst 1973 wurden die Interviews und Fragebogen mit Beamten des Staatsministeriums durchgesprochen und eine Probeerhebung durchgeführt. Die empirische Untersuchung selbst erfolgte dann i m wesentlichen von 2 Nach der „Ranghierarchie" setzten sich die Befragten w i e folgt zusammen: 1 Alt-Ministerpräsident, 3 Staatssekretäre, 3 Ministerialdirektoren, 4 Abteilungsleiter, 6 stellvertretende Abteilungsleiter, 3 Zentralstellenleiter, 23 Referenten (Hilfsreferenten gibt es i m Staatsministerium nicht) u n d 4 Sachbearbeiter. 3 Der Verfasser w a r i m A p r i l 1973 u n d v o m November 1973 bis M a i 1974 einigermaßen regelmäßig vor allem i m Staatsministerium anwesend. 4 So wurden etwa zur Präzisierung des Entscheidungsprozesses an H a n d von meist abgeschlossenen A k t e n diese Prozesse detailliert nachvollzogen. Dazu w u r d e n folgende Fallstudien durchgeführt: (1) Ressortabgrenzung 1972 (2) K l i n i k b a u p r o g r a m m (3) Ausgleich des Zentralitätsverlusts i m Rahmen der Kreisreform (4) K e r n k r a f t w e r k Marbach (5) Gemeindereform bis zur Verabschiedung der Zielplanungsgrundsätze v o m 30.1.1973. Weiter wurde etwa eine „Fallstudie" zur Kabinettsarbeit anhand der Tagesordnungen von Januar 1973 bis J u l i 1974 durchgeführt.
134
Kap. I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
Januar bis Mai 1974. U m die den Befragten zugesicherte Vertraulichkeit zu wahren, muß bei der Bezugnahme bzw. der Wiedergabe ihrer Äußerungen weitgehend auf eine Namensnennung verzichtet werden 5 . Das Hauptziel der empirischen Untersuchung ist eine Bestandsaufnahme und soweit möglich eine kritische Analyse des Ist-Zustandes, d. h. es soll eine breit angelegte Erfassung der Struktur, der Aufgaben und der Funktionen des Regierungsbereichs, also eine möglichst umfassende Darstellung der Regierungsarbeit und -Organisation angestrebt werden (vgl. dazu eingehend oben §§ 1 und 2). Die Untersuchung soll dazu beitragen, die dringend notwendigen Kenntnisse und Informationen über den Bereich der Regierung zu erweitern und gleichzeitig die Basis für weiterführende und konkretere interdisziplinäre Arbeiten bilden. Daraus ergibt sich, daß die vorliegende Untersuchung überwiegend als „Pilot-Studie" zu sehen ist, deren Aussagen und Ergebnisse weitgehend durch zusätzliche Erhebungen überprüft, präzisiert und abgesichert werden müssen. § 20 Das Kabinett (Ministerrat) 1. Zusammensetzung Die Größe des Regierungskollegiums ist seit der Gründung des Landes Baden-Württemberg ziemlich konstant geblieben. Bis heute gehörten dem Kabinett stets der Ministerpräsident, sieben bis acht Minister und bis zu drei Staatssekretäre bzw. Staatsräte an 1 . Die einzige Änderung i n der Zahl der Ministerien erfolgte i m Juni 1960 als das Minister i u m für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsbeschädigte i n das Innenministerium eingegliedert wurde. Seine personelle Zusammensetzung war dagegen seit der ersten vorläufigen Regierung unter R. Maier vom 25. 4.1952 sehr unterschiedlich. I n den Gründer jähren des neuen Südweststaates mußten nach Eschenburg 2 bei der Regierungsbildung drei verschiedene „Quotierungen", nämlich die nach den Parteien, nach den 5 Die detaillierte Liste über die i m einzelnen geführten 53 Interviews ist i m Quellennachweis des beim Fachbereich Rechtswissenschaft der U n i v e r sität Tübingen sich befindenen Exemplares der vorliegenden A r b e i t enthalten. 1 Vgl. dazu bereits oben § 13 (Ziff. 1) u n d K . Rebmann, i n : JöR n. F. Bd. 20 (1971), S. 213 f. Der Minister f ü r Bundesangelegenheiten w i r d hier entsprechend den verfassungsrechtlichen Darlegungen oben § 16 (Ziff. 4) als Staatssekretär m i t Kabinettsrang behandelt. Vgl. die Bekanntmachung der Landesregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche v o m 25. 7.1972 (Ges. Bl. S. 404 ff. — unten Anlage Nr. 1 —). 2 So T. Eschenburg, Verfassung u n d Verwaltungsaufbau des Südweststaates, S. 62; Ders. y i n : Bad.-Württ. — Staat, Wirtschaft, K u l t u r , S. 107. Vgl. etwa auch R. Maier, i n : Verhandlungen der V L V , S. 168 (Regierungserklärung).
§ 20 Das K a b i n e t t (Ministerrat)
135
Landsmannschaften und nach den Konfessionen berücksichtigt werden. Untersucht man unter diesen drei Aspekten die Zusammensetzung des Ministerrats, so kann man m. E. folgendes feststellen: Die Konfession spielte, abgesehen von den beiden vorläufigen Regierungen und evtl. der Besetzung des Kultus- und Landwirtschaftsministeriums, nur eine untergeordnete Rolle. Auffallend ist allerdings, daß sich die personelle Zusammensetzung des Kabinetts kontinuierlich zugunsten der katholischen Konfession entwickelt hat. Während bei der ersten vorläufigen Regierung auf zwei evangelische Kabinettsmitglieder ein katholisches kam, ist es heute genau umgekehrt. Dies scheint i m wesentlichen w o h l einmal i n der parteipolitischen Entwicklung (von einer Regierung ohne CDU zu einer CDU-Alleinregierung) und zum anderen i n der Person des jeweiligen Ministerpräsidenten (R. Maier war evangelisch, alle anderen katholisch) begründet zu sein. Der landsmannschaftliche Aspekt dürfte heute i m Gegensatz zu den fünfziger Jahren sicher nicht mehr eine wesentliche, aber immer noch eine nicht ganz zu unterschätzende Komponente bei der Regierungsbildung sein. Während bis 1960, vor allem i n den Regierungen unter R. Maier und G. Müller, das badische und das württembergische Element i n etwa gleich i n den Kabinetten vertreten war, hatten die Württemberger bis 1966 (unter K. G. Kiesinger) und seitdem (unter Filbinger) die Badener ein Übergewicht. Dies scheint darauf hinzudeuten, daß der jeweilige Ministerpräsident seine „Landsleute" etwas bevorzugt 3 . I m übrigen dürfte auch manches, mindestens seit 1966, dafür sprechen, daß immer dann, wenn die „Württemberger" keine sich stark aufdrängenden und fachlich anerkannten Bewerber vorschlagen konnten, sich die entsprechenden badischen Kandidaten durchsetzten und außerdem nicht selten auch Zufälle m i t entscheidend waren. Insgesamt gesehen ist die Bedeutung der hier genannten Kriterien jedoch erheblich zurückgegangen. Die politische Zusammensetzung der Landesregierungen war recht unterschiedlich. I n der ersten vorläufigen Regierung unter R. Maier (25.4.1952-7.10.1953) waren SPD, FDP/DVP und B H E vertreten, wodurch die CDU als stärkste Fraktion i n die Opposition gedrängt wurde. Unter dem Eindruck des guten Abschneidens der CDU bei den Bundestagswahlen i m September 1953 und i m Hinblick auf das gemein3 Auffallend ist auch, daß etwa bis 1960 (unter w ü r t t . Ministerpräsidenten) die w ü r t t . Regierungsmitglieder bevorzugt Ministerien erhielten, während etwa alle drei ehrenamtl Staatsräte durch badische Mitglieder (Dichtel, Werber, Filbinger) besetzt wurden. U n t e r dem badischen Ministerpräsidenten H. Filbinger ist dies genau umgekehrt. A l l e Regierungsmitglieder ohne Ressort sind seit 1966 Württemberger (Seifritz, J. Schwarz, K . Mocker, E. Adorno und E. Mahler). Dies g i l t i m wesentlichen auch f ü r die politischen Staatssekretäre. Andererseits w i r d dies aber w o h l dadurch wieder aufgewogen, daß sich die Leitungsebene der Ministerien überwiegend aus Württembergern rekrutiert.
1 3 6 K a p . I I I : Organisation und S t r u k t u r der Landesregierung B W
same Ziel, möglichst rasch ein enges und harmonisches Zusammenwachsen der Landesteile zu erreichen, wurde dann am 7.10.1953 eine Allparteienregierung unter G. Müller gebildet. Diese wurde auch nach dem Rücktritt von G. M ü l l e r 4 bis zum 23. 6.1960 weitergeführt. Vom 23. 6.1960 bis 16.12.1966 bestand die Regierung unter K . G. Kiesinger aus einer Koalition von CDU, FDP/DVP und BHE bzw. nur aus CDU und FDP/DVP. Nach der Wahl K . G. Kiesingers zum Bundeskanzler wurde dann entsprechend dem Bonner Vorbild auch i n Bad.-Württ. vom 16.12.1966 bis zum 8. 6.1972 eine Große Koalition aus CDU und SPD unter H. Filbinger gebildet. Seit dem 8. 6.1972 regiert die CDU m i t einer soliden Parlamentsmehrheit allein 5 . Aus dieser zusammenfassenden Darstellung ergibt sich, daß die politische Ausgestaltung der Landesregierung i m wesentlichen der auf Bundesebene gefolgt ist 6 . Die einzelnen Regierungsmitglieder rekrutierten sich, wie i n den meisten parlamentarischen Demokratien, ganz überwiegend aus Landtagsabgeordneten der Regierungsparteien 7 . Nur i n relativ wenigen Fällen wurde auf bad.-württ. Bundestagsabgeordnete 8 oder auf sonstige Kandidaten der Regierungsparteien 9 zurückgegriffen. Überhaupt ist verwunderlich, daß nur ein sehr geringer Prozentsatz der Landespolitiker i n die Bundespolitik gehen (von denen die gehen, sind es dann allerdings meist die Qualifiziertesten) oder umgekehrt 1 0 . Interessant 4
G. M ü l l e r w u r d e i m Dezember 1958 z u m Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts gewählt. 5 Vgl. V. Renner, i n : JöR n. F. Bd. 7 (1958), S. 209 f.; K . Rebmann, i n : JöR n. F. Bd. 20 (1971), S. 213 f. u n d die entsprechenden Verhandlungsprotokolle des Landtags (vgl. A r t . 46 I I I LV). 6 Ausnahmen aus den oben genannten Gründen: bis 1960 u n d seit 1972. 7 Der Vorschlag von T. Eschenburg (in: Verfassung u n d Verfassungsaufbau des Südweststaats, S. 43 u. 68), daß die Regierungsmitglieder nicht zugleich Landtagsabgeordnete sein dürfen, w u r d e von der V L V abgelehnt. 8 Aus B o n n w u r d e n u. a. geholt: E. Leibfried (am 7.10.1953 L a n d w i r t schaftsminister), K . G. Kiesinger (am 17.12.1958 Ministerpräsident), W. H a h n (am 11.6.1964 Kultusminister), A . Griesinger (am 8.6.1972 Minister für Arbeit, Gesundheit u n d Sozialordnung), E. Adorno (am 8. 6.1972 Minister f ü r Bundesangelegenheiten). 9 Dies waren u. a. der Kultusminister Storz, die Arbeitsminister Hohlwegler u n d Schüttler, sowie die meisten Staatsräte u n d Staatssekretäre m i t K a binettsrang (z.B. H. Filbinger als Staatsrat v o n 1958-1960; seit 1972 die Staatssekretäre E. Mahler u n d K . Mocker, der allerdings bis 1960 Landtagsabgeordneter war). 10 Oft hat m a n auch den Eindruck, daß Bundes- u n d Landespolitik zwei verschiedene „Welten" sind oder die Landespolitik n u r als kurzfristige Zwischenstation auf dem Weg nach Bonn gesehen w i r d . Dies w u r d e i n den Interviews bestätigt (vgl. auch unten § 25). Daraus resultiert u. a. sicher die häufig unter den Abgeordneten bestehende ungenügende Kommunikation, Information u n d Koordination i n Fragen, die B u n d u n d L a n d gleichermaßen betreffen u n d letztlich auch eine ungenügende parlamentarische Kontrolle dieses Bereichs. Hier wäre sicher manches zu verbessern.
§ 20 Das Kabinett (Ministerrat)
137
wäre hier noch eine Untersuchung über die politische Elite des Landes (sowohl Regierung als auch Parlament) durchzuführen und mit der des Bundes zu vergleichen 11 . Dies kann allerdings i m Rahmen dieser Arbeit nicht geleistet werden, sondern muß einer weiteren Untersuchung vorbehalten bleiben. 2. Regierungsbildung Den äußerst komplexen Prozeß der Regierungsbildung nachvollziehen zu wollen, ist ein kaum zu bewältigendes Unterfangen. Trotzdem sollen hier einige Aspekte und Streiflichter zur Regierungsbildung i m Mai/Juni 1972 gegeben werden und dann auch allgemein vorsichtige Folgerungen gezogen werden. Bei der Landtagswahl i m Frühjahr 1972 errang die CDU eine sichere absolute Mehrheit (65 von 120 Mandaten). Sie konnte demnach die seit 1969 „überfällige" große Koalition durch eine Alleinregierung ablösen. Dadurch mußten, da die bisherigen vier von der SPD geführten Ministerien nun von der CDU zu besetzen waren und die zwei Staatssekretäre m i t Kabinettsrang (A. Seifriz und J. Schwarz) nicht mehr kandidierten, mindestens sechs der zehn Regierungsposten neu verteilt werden. Der Entscheidungsprozeß scheint sich dabei für die Regierungsämter, die „verwaist" waren, i n etwa wie folgt abgespielt zu haben: Von allen Seiten, insbesondere von Partei und Fraktion der CDU wurden Namen i n die Debatte geworfen und Vorschläge zur Regierungsbildung unterbreitet. Aufgrund dieser internen und öffentlichen Diskussion haben die CDU-Bezirksvorstände der einzelnen Landesteile einschließlich der Abgeordneten aus diesem Raum die Kabinettsbildung eingehend beraten und konkrete Wünsche geäußert und zum Teil auch Forderungen angemeldet 12 . Dasselbe erfolgte durch die Arbeitskreise und Interessengruppen der CDU. Die endgültige Ministerliste wurde dann überwiegend auf Vorschlag des Ministerpräsidenten nach einem langwierigen Entscheidungsprozeß i n Einzelabstimmungen durch die CDU-Landtagsfraktion aufgestellt 13 . Bei einem solchen Verfahren scheint es nicht ausgeschlossen zu sein, daß 11 Die derzeitige Landesregierung setzt sich aus folgenden Berufsgruppen zusammen: 4 Juristen, 2 Diplomvolks- oder Betriebswirte, 2 D i p l o m - L a n d wirte, 1 Theologe, 1 Werkmeister (Mechaniker) u n d 1 Berufsfürsorgerin. Vgl. dazu insbes. K . v. Beyme, Die politische Elite i n der Bundesrepublik Deutschland, München 1971. 12 So hat etwa der Bezirksvorstand der C D U von Nord.-Württ. (zus. m i t den Abgeordneten aus diesem Raum) am 6. 5.1972 beschlossen, die Besetzung des Wirtschaftsministeriums m i t G. Mahler zu fordern, eine Ernennung von K . Mocker zum Staatssekretär abzulehnen u n d drei Vorschläge f ü r die Person des Arbeitsministers zu unterbreiten. Die Wünsche des größten Bezirksverbandes w u r d e n dann allerdings praktisch k a u m berücksichtigt. 13 Dieses Verfahren war, w e n n m a n es m i t früheren Regierungsbildungen vergleicht, ungewöhnlich. Selbst die Landtagsabgeordneten hielten die W a h l der Minister durch die F r a k t i o n f ü r problematisch.
1 3 8 K a p . I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
diese Entscheidungen wohl insgesamt mehr aus Gründen getroffen wurden, die nur die damalige momentane Reaktion der Öffentlichkeit beachtet und weniger eine langfristige personelle Regierungspolitik, fachliche Qualifikation und die Persönlichkeit berücksichtigt hat. U. a. dürfte sich dies darin zeigen, daß selbst fachlich umstrittene Anwärter auf ein Regierungsamt ins Kabinett berufen bzw. bestätigt wurden und das Durchschnittsalter der Regierungsmitglieder auffällig hoch ist (mehr als die Hälfte der Mitglieder ist über 60!). A u f diesem Hintergrund hätte es sich neben weiteren Gründen eigentlich vor allem i m Hinblick auf die Landtagswahl 1976 angeboten, spätestens i n der „Halbzeit" der laufenden Legislaturperiode (1974) einige Kabinettsmitglieder auszutauschen, um der Regierung ein jüngeres und progressiveres Gesicht zu geben. Daß dies nicht geschehen ist, erhärtet die allgemeine Erfahrung bei der Bildung der Regierungsmannschaften, daß es außergewöhnlich schwierig ist, sogar einen schwachen amtierenden Minister, selbst bei einer anstehenden umfassenden Kabinettsneubildung, nicht mehr zu berücksichtigen 14 . Mitentscheidend für diese bedauerliche Tatsache dürften einmal parteiinterne (jeder Minister w i r d i n aller Regel von einer bestimmten Interessengruppe der Regierungspartei [-en] getragen) und zum anderen publizistische Gründe sein, w e i l eben besonders ein Minister („anscheinend" je länger er es ist, desto besser) i n der Öffentlichkeit als Repräsentant seiner Partei herausgestellt werden kann 1 5 . I m Hinblick auf die verfassungsrechtliche Ausgestaltung der Regierungsbildung (vgl. oben § 13) w i r d man den Entscheidungsprozeß der Verfassungspraxis vorsichtig i n etwa folgendermaßen beschreiben können: Neben gewissen Einwirkungsmöglichkeiten der einzelnen Bezirksvorstände, der Arbeitskreise und parteilichen Interessengruppen kommt dem Ministerpräsidenten, den Regierungsfraktions- und Regierungsparteispitzen ganz entscheidende Bedeutung zu. Dabei hat sich i n Bad.-Württ. gezeigt, daß der Einfluß des Ministerpräsidenten stets recht stark w a r 1 6 . Dies traf normalerweise u m so mehr zu, je weniger 14 Soweit ersichtlich dürfte von 1952 bis heute überhaupt n u r 1 F a l l einer solchen Ablösung aufgetreten sein (vgl. dazu Verhandlungen V L V , S. 1041 ff.). 15 Das letzte A r g u m e n t ist allerdings sehr kurzsichtig! Der „Geschlossenheit" der Regierung scheint ein zu hoher Stellenwert eingeräumt zu werden. E i n nicht ganz unbeachtlicher G r u n d f ü r diese E n t w i c k l u n g stellt sicher auch die Vorschrift des A r t . 46 I V L V dar. 16 Zusätzliche Gründe: Wahlerfolg aufgrund des starken Herausstellens des Regierungschefs, meist gleichzeitig Landesvorsitzender der größten K o a l i tionspartei sowie z. Z. M i t g l i e d des CDU-Bundesvorstands. Insgesamt unterscheidet sich trotz einer unterschiedlichen verfassungsrechtlichen Ausgestalt u n g die Praxis der Regierungsbildung i n Bonn u n d Stuttgart also nicht nennenswert. Dies w u r d e i n den Interviews v o l l bestätigt. Die Regierungsbildung i m Jahr 1972 dürfte insgesamt gesehen teilweise atypisch verlaufen sein.
§ 20 Das K a b i n e t t (Ministerrat)
139
eindeutig sich einzelne Personen für bestimmte Ämter aufgedrängt haben und genannt wurden. Die Ministerpräsidenten haben also, soviel kann wohl hier festgehalten werden, i m Rahmen der Koalitionsabsprachen ihre Rechte (Vorschlagsrecht) meist weitgehend ausgeschöpft 17 . Die anderen neuen Regierungsmitglieder haben dagegen bei der Regierungsbildung keine allzu starke Stellung, wobei dies allerdings für die Kabinettsmitglieder, die bereits bisher ein Regierungsamt begleitet haben, nur sehr eingeschränkt g i l t 1 8 . Die i n A r t . 46 I I I und 45 I I I L V festgelegten parlamentarischen Rechte des Landtags und auch der Koalitionsfraktionen sind, abgesehen von der Regierungsbildung 1972, nicht besonders stark beansprucht worden. Z u einem „Konfliktsfall" ist es bei der Regierungsbildung noch nie gekommen. Auch wurde A r t . 56 L V (Abberufung eines Regierungsmitglieds durch den Landtag) noch nie aktuell. 3. Ressortabgrenzung a) Gemäß A r t . 8 des Überleitungsgesetzes vom 17. 5.1952 (Ges. Bl. S. 3) hatte die Regierung die einzelnen Geschäftsbereiche zu beschließen. Durch die Bekanntmachung der vorläufigen Regierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien vom 8.7.1952 (Ges. Bl. S. 21) wurde dies i m einzelnen festgelegt. Dabei wurden neben dem Staatsministerium acht Ressorts gebildet 1 9 . Zwar wurde dann i n der Landesverfassung (vom 11.11.1953) entsprechend einer alten Verfassungstradition 20 i n A r t . 45 I I I a. F. bestimmt, daß die Zahl der Minister und die Abgrenzung ihrer Geschäftsbereiche durch Gesetz festzulegen ist; doch die Staatspraxis zeigte bald, daß eine solch schwerfällige Regelung einfach ignoriert und ein entsprechendes Gesetz nie erlassen wurde. Dies geschah dann selbst i m Jahr 1960 nicht, als der Geschäftsbereich für Heimatvertriebene und Kriegsbeschädigte i n das Innenministerium eingegliedert wurde. Nach wie vor galt de facto, von einigen Änderungen abgesehen, die Ressortabgrenzung wie sie am 8. 7.1952 bekannt gemacht worden war. Nach fünf vergeblichen Anläufen wurde dann endlich durch Verfassungsänderung vom 17.11.1970 (Ges. Bl. S. 492) A r t . 45 I I I neu gefaßt 21 . 17
Die Regierungsbildung 1972 w a r eine gewisse Ausnahme. Dies r ü h r t nicht zuletzt daher, daß die Z a h l der Ministerien (wenn m a n von der Auflösung des Ministeriums f ü r Vertriebene, Flüchtlinge u n d Kriegsbeschädigte absieht) stets gleich geblieben ist. 19 Staats-, Justiz-, Innen-, K u l t u s - , Finanz-, Wirtschafts-, Landwirtschafts-, Arbeits- u n d M i n i s t e r i u m für Heimatvertriebene u n d Kriegsbeschädigte. 20 Vgl. K . Rebmann, i n : JöR n. F. Bd. 20 (1971), S. 201 (Fußnote 136). 21 Vgl. dazu ausführlich K . Rebmann, S. 201 f.; V. Renner, i n : JöR n. F. Bd. 7 (1958), S. 197, 216. A r t . 45 I I I n. F. lautet: „Die Regierung beschließt 18
1 4 0 K a p . I I I : Organisation und S t r u k t u r der Landesregierung B W
Die seit 1952 geltende Ressortabgrenzung wurde erstmals formell am 21. 3.1972 (Ges. Bl. S. 81) geändert. Die wesentlichsten Neuerungen bestanden einmal darin, daß die Verwaltungs-, Sozial- und Finanzgerichtsbarkeit der Zuständigkeit des Justizministeriums unterstellt w u r den (Rechtspflegeministerium; Ausnahme: Arbeitsgerichtsbarkeit) und zum anderen, daß die Abteilung Sozialwesen und die Gesundheitsvorsorge vom Innen- i n das Arbeits- und Sozialministerium eingegliedert wurden. Nach der Landtagswahl vom 23. 4.1972 wurde dann ein erklärtes Ziel der CDU, die Regierungsarbeit durch eine sinnvolle Neuabgrenzung der Ressorts besser zu organisieren, i n Angriff genommen. M i t der Neueinteilung der Geschäftsbereiche wurden dabei folgende Ziele verfolgt 2 2 : — Die Zuständigkeitsbereiche der Ministerien sind an den künftigen Schwerpunkten der Landespolitik zu orientieren. Damit sollte i n verpflichtender Weise deutlich gemacht werden, welchen Vorrang die Landesregierung bestimmten Aufgaben- und Problembereichen beimißt (Gesellschaftspolitik: verbesserte Lebensqualität und Sozialchancen; Wirtschaftspolitik: verbesserte Wirtschaftskraft, Infrastrukturenentwicklung ; Umweltschutz). — U m eine wirksamere Wahrnehmung dieser zentralen landespolitischen Aufgaben zu erreichen, sollen diese aus Gründen der eindeutigen Verantwortlichkeit und der Reduzierung der interministeriellen Koordination unter dem Gesichtspunkt des Sachzusammenhangs (Aufgabenaffinität) abgegrenzt und auch bei übergreifenden A u f gaben eine Aufsplitterung auf verschiedene Ressorts möglichst weitgehend vermieden werden. — Außerdem sollte die bisher bestehende starke Unausgewogenheit zwischen sehr großen und relativ kleinen Ministerien abgebaut werden, u m das Gewicht der einzelnen Ressorts innerhalb der Regierung möglichst ausgewogen und gleichwertig zu gestalten. I m übrigen ist die Aufgabenzuweisung so zu bemessen, daß unter Berücksichtigung möglicher Entlastungen der Ressortchefs durch Staatssekretäre, Ministerbüros usw. eine optimale Größe der M i n i sterien erreicht wird, d. h. daß das Ministerium durch seinen Chef noch überblickt und aktiv geführt werden kann. unbeschadet des Gesetzgebungsrechts des Landtags über die Geschäftsbereiche ihrer Mitglieder. Der Beschluß bedarf der Z u s t i m m u n g des Landtags." 22 Vgl. dazu Pressemitteilungen der Landesregierung Nr. 282/72, 317/72 u n d Informationen aus erster Hand, Nr. 7/72; Landtagsdrucksachen, 6. W a h l periode Nr. 76; Landtagsprotokolle, 6. Wahlperiode, S. 172 f. u n d 203 ff. Vgl. allgemein dazu auch Projektgruppe BMI, Erster Bericht, S. 7 ff.; D r i t t e r Bericht, I I I / l ff. u n d neuestens H. Siedentopf, Ressortzuschnitt als Gegenstand der vergleichenden Verwaltungswissenschaft, i n : Die V e r w a l t u n g 1976, Heft 1.
§ 20 Das Kabinett (Ministerrat)
141
Die Landesregierung hat auf der Grundlage dieser Überlegungen und dem Bericht des interministeriellen Arbeitskreises zur Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien vom 11.12.1969 i n langwierigen und teilweise recht hart geführten Diskussionen und Auseinandersetzungen, bei denen das Staatsministerium eine sehr „extensive" Federführung ausgeübt hat, folgende Änderungen und Neugewichtungen i n der Hessortabgrenzung beschlossen23: — Dem „Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr" w u r den vom Innenministerium die beiden Abteilungen Verkehr und Straßenbau angegliedert. Die Bereiche Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen, sowie Raumordnung und Landesplanung beließ man dagegen beim Innenministerium. — Dem „Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Umwelt" wurden vom Innenministerium die Abteilungen Wasserwirtschaft und Veterinärwesen und vom Kultusministerium der Natur- und Landschaftsschutz zugewiesen. Damit sind bei i h m die wesentlichsten Aufgabengebiete des biologisch-ökologischen Umweltschutzes vereinigt. Eine Zusammenfassung aller Zuständigkeitsbereiche des Umweltschutzes i n einem Ministerium oder gar ein eigenes Minister i u m für Umwelt (wie etwa Bayern) konnte allerdings nicht erreicht werden. — Das „Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung" übernahm vom Innenministerium die Abteilungen Sozial- und Gesundheitswesen, behielt aber den technischen Bereich des Umweltschutzes. Das ursprüngliche Ziel der Landesregierung, dieses Ressort zum Ministerium für Gesellschaftspolitik zu machen, wurde nur teilweise erreicht. So verblieben etwa die Gebiete Jugendpflege und Sport beim Kultusministerium. Personell wirkten sich diese Änderungen dergestalt aus, daß das Innenministerium 221 Mitarbeiter verlor und davon das Wirtschaftsministerium die Hälfte sowie das Landwirtschafts- und Arbeitsminister i u m je ein Viertel erhielten 2 4 . Der Ausgewogenheit der Ministerien ist man zwar ohne Zweifel einen Schritt näher gekommen, von einer Gleichgewichtigkeit kann man aber nach wie vor noch nicht sprechen. 28
Vgl. i m Einzelnen die Bekanntmachung der Landesregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien v o m 25. 7.1972 (Ges. Bl. S. 404 ff.), der der Landtag gemäß A r t . 45 I I I L V zugestimmt hat (abgedruckt unten als Anlage Nr. 1). I m übrigen vgl. Hinweise i n Fußnote 22. 24 Die Größe der Ressorts (nach dem Personalstand) schwankte vor der Neuabgrenzung (30. 9.1972) zwischen 749 u n d 175 u n d nach der Neuabgrenzung (1.10.1972) zwischen 528 u n d 175 Bediensteten. Die höchste Mitarbeiterzahl hatte jeweils das Innenministerium und die niedrigste das Justizministerium. Das Staatsministerium wurde hierbei nicht berücksichtigt. Vgl. dazu die Personalstandsübersicht i n Anlage 1 der „Informationen aus erster Hand" der Pressestelle der Landesregierung, Nr. 7/72 (Sept. 1972).
1 4 2 K a p . I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
Der Entscheidungsprozeß, der zu der neuen Abgrenzung der Geschäftsbereiche führte, gestaltete sich recht vielschichtig und ist nur sehr schwer nachvollziehbar. Trotzdem lassen sich einige vorsichtige Aussagen machen. Die ersten diesbezüglichen Diskussionsansätze erfolgten bereits 1969 durch einen interministeriellen Arbeitskreis, der dann am 11.12.1969 einen ersten Bericht über die Neuabgrenzung der Ressorts vorlegte. I m Jahr 1970 wurde diese Diskussion durch die Beratungen über die Änderungen des A r t . 45 I I I L V weitgehend unterbrochen. Ende August 1971 wurde, nicht zuletzt auch i m Hinblick auf die Regierungsbildung nach der Landtagswahl i m A p r i l 1972, die Neuregelung der Zahl und der Geschäftsbereiche der Ministerien vom Staatsministerium wieder aufgegriffen. Das erste Ergebnis dieser langen Diskussion und Beratung (im März 1972, vgl. Ges. Bl. S. 81) war dann allerdings äußerst bescheiden. Gleichwohl stellte die gesamte Auseinandersetzung eine gewissermaßen vorbereitende Basis für die zwar nicht vollbefriedigenden, aber doch recht beachtlichen Änderungen i n der Neuabgrenzung der Ressorts bei der Regierungsbildung i m Juni 1972 dar. Diese ganze Entwicklung zeigt verschiedene Aspekte auf. Einmal läßt der gesamte Entscheidungsprozeß erkennen, daß das Parlament aber auch die Regierungsfraktion(-en) und -partei(-en) faktisch kaum Einfluß auf die Neuabgrenzung der Ressorts genommen haben, ja sogar praktisch davon ausgeschlossen waren. I m Hinblick auf die verfassungsrechtliche Stellung des Landtags (vgl. A r t . 45 I I I , 46 I I I LV) und dem erklärten Ziel der gegenwärtigen Regierung, m i t der neuen Zuständigkeitsregelung das politische Konzept nach außen sichtbar zu machen, erstaunt dies etwas. Hier w i r d deutlich, daß die Regierung die Staatsleitung soweit es geht nicht m i t dem Landtag teilen w i l l , sondern der Auffassung ist, daß dem Ministerrat i n allen Fragen der Landespolitik auch gegenüber der Fraktion die politische Führungsfunktion zukommt 2 5 . Weiter kann der Diskussion über die Ressortabgrenzung entnommen werden, daß primär vom Staatsministerium solche wichtigen politischen Fragen initiiert und unter seiner Federführung betrieben werden. Dabei w i r d aber auch sichtbar, welchen Grenzen die Tätigkeit des Staatsministeriums unterworfen ist. Einerseits überwiegt das „Ressortdenken" bei den Ministern ganz entscheidend; die kollegiale Verantwortung und die Wahrnehmung der Gesamtinteressen sind i n aller Regel nicht sehr stark ausgeprägt. Andererseits ist man sich trotz allem Widerstreit i n der Abgrenzung der Geschäftsbereiche aber unter den Ministern darüber einig, daß dem Staatsministerium durch die Zuordnung weiterer Aufgaben und Zuständigkeiten nicht noch mehr Einfluß auf die Regierungsarbeit gegeben werden darf. So konnte etwa i m Juni 1972 die Pressestelle der Landes25
Vgl. dazu vor allem auch unten § 24 Ziff. 10.
§ 20 Das Kabinett (Ministerrat)
143
regierung beim Staatsministerium zwar erweitert werden, die dringende Forderung des Staatsministeriums, i h m das Statische Landesamt und möglichst alle wichtigen Informationsaufgaben (Informationssystem) anzugliedern, scheiterte aber am Widerstand der Hessorts. Außerdem machte die ganze Auseinandersetzung deutlich, daß einige Minister i m Kabinett durch ihre Person, aber auch durch das besondere Gewicht ihrer Ressorts eine hervorgehobene Stellung innehaben. Dies gilt vor allem für das Finanz-, Kultus- und (seit 1972) m i t gewissen Einschränkungen auch für das Innenressort bzw. deren Minister 2 6 . Ferner läßt sich noch festhalten, daß die Ministerialbürokratie, insbesondere die obere und mittlere Leitungsebene, einen maßgeblichen Einfluß auf die Entscheidung über die Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche gehabt hat. Schließlich kann noch darauf hingewiesen werden, daß größere organisatorische und andere Änderungen oder gar Reformen i m Regierungsbereich praktisch nur nach einer Landtagswahl (Regierungswechsel) möglich sind und es deshalb dringend geboten ist, daß rechtzeitig vor jeder Parlamentswahl Überlegungen über Maßnahmen zur Verbesserung der Regierungsarbeit angestellt werden. Trotz dieser Feststellung sollte aber die Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche eine Daueraufgabe sein, die sich m i t der laufenden Veränderung der Sachaufgaben (primären Staatszielsetzungen) und auch den personellen Gegebenheiten beschäftigt 27 . b) Bei der Neuabgrenzung der Ressorts hat sich die Landesregierung, was bereits oben dargelegt wurde, von drei Prinzipien leiten lassen, die i m einzelnen hier noch etwas näher zu untersuchen sind 2 8 : 26 Das Finanzministerium hat es verstanden, den Wunsch des Staatsministeriums auf Übernahme des Stat. Landesamts zu vereiteln. Das K u l t u s ministerium brachte es fertig, den v o m Ministerrat am 13.6.1972 verabschiedeten Beschluß, i h m die Zuständigkeiten f ü r Jugend u n d Sport zu entziehen, wieder rückgängig zu machen. B e i m Innenministerium bestand i m J u n i 1972 eine besondere Situation. Es w a r seinerzeit das m i t Abstand größte M i n i s t e r i u m u n d hatte i m Vergleich zu allen anderen Landesinnenministerien die umfangreichsten Aufgaben u n d Zuständigkeiten wahrzunehmen. Außerdem k a m hinzu, daß ein neuer Minister das Innenressort übernahm (von 1966 bis 1972 stand das Innenministerium unter der Leitung des SPD-Ministers W. Krause). Die besondere Stellung des Finanzministers ist hauptsächlich sachlich begründet, während es beim Kultusminister zum Teil daran liegt, daß er stellvertretender Ministerpräsident ist. 27 „Daueraufgaben" allerdings nicht i n dem Sinne, daß laufend organisatorische Änderungen vorgenommen werden, sondern daß laufend Überlegungen angestellt, die Gesamtentwicklung (etwa A u f t r e t e n neuer Aufgaben w i e Ausländerwesen usw.) beobachtet u n d dann bei jeder Regierungsbildung die gewonnenen Erkenntnisse v e r w i r k l i c h t werden. Vgl. dazu etwa R. Wahl, i n : Der Staat 1974, S. 394 („Die Änderung von Organisationsstrukturen ist ein so aufwendiges Verfahren, daß es nicht i n kurzen periodischen Abständen vorgenommen werden kann"). 28 Vgl. zum ganzen: Projektgruppe BMI, Erster Bericht, S. 6 f f . ; D r i t t e r Bericht, I I I / l ff. H. Karehnke, i n : D Ö V 1974, S. 119 ff.
1 4 4 K a p . I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
(1) Eine Einteilung der Geschäftsbereiche nach dem Abgrenzungsmaßstab „künftige Schwerpunkte der Landespolitik" ist nicht unproblematisch. Unbestrittenermaßen ist es dringend geboten, Schwerpunktverlagerungen i n den Aufgabenbereichen laufend zu beobachten und organisatorisch zu berücksichtigen. So ist etwa das Gebiet Umweltschutz auch auf Länderebene sachlich so stark angewachsen und i n den Vordergrund getreten, daß dieser Aufgabenbereich aufbauorganisatorisch besonders zu berücksichtigen ist. Deshalb wäre etwa die Errichtung eines Ministeriums für Umweltfragen (vgl. etwa Bayern) grundsätzlich vertretbar. Dagegen wäre aber offensichtlich etwa für den gegenwärtigen landespolitischen Schwerpunkt „berufliche Bildung" die Errichtung eines neuen Ministeriums abwegig 29 . Hier zeigt sich denn auch die besondere Problematik dieses Abgrenzungskriteriums. Zwar ist es notwendig die programmatischen Zielvorstellungen der Parteien und der Regierung mit i n die Überlegungen einzubeziehen, doch sollte dies unter längerfristigen und fachlichen Aspekten und deshalb vor allem i m Rahmen der Prüfung des Merkmals Sachzusammenhang (Aufgabenaffinität) erfolgen und besonders auch die landespolitischen Möglichkeiten (z. B. ist Gesellschaftspolitik primär Bundesaufgabe) und Notwendigkeiten berücksichtigen 30 . Allenfalls bei der Bezeichnung der Ministerien könnten die künftigen kurz- und mittelfristigen Politikschwerpunkte stärker zum Ausdruck gebracht werden. Der Entscheidungsprozeß bei der Ressortneuabgrenzung zeigt dementsprechend auch deutlich, daß das hier behandelte Abgrenzungskriter i u m ganz überwiegend nur i n der Öffentlichkeitsarbeit eine Rolle gespielt hat und für die endgültige Festlegung neben den machtpolitischen (innerhalb der Regierung) besonders die sachlichen Gesichtspunkte (Aufgabenaffinität) entscheidend waren. (2) Die Abgrenzungsmaßstäbe „Ausgewogenheit", „Gleichgewichtigkeit" und „optimale Größe" sind vage und nur schwer zu präzisierende Anhaltspunkte für die Festlegung der Geschäftsbereiche. Trotzdem muß ihnen ein nicht zu unterschätzender Stellenwert beigemessen werden. Für eine effektive und wirkungsvolle kollegiale Regierungsarbeit ist neben der Person und Persönlichkeit der einzelnen Minister eine wichtige Voraussetzung, daß die Stellung der Ressortchefs, von der Bedeutung des einzelnen Ministeriums aus gesehen (Gewicht der Aufgaben, zur Verfügung stehende Informationen und Behördenapparat), annähernd ausgewogen sein sollte. Denn eine kollegiale Beratung und Beschlußfassung, die i n Bad.-Württ. nach der Landesverfassung 29 Projektgruppe BMI, Erster Bericht, S. 10 weist zu/ Recht darauf hin, daß das Auftreten neuer Aufgabenbereiche grundsätzlich keine zusätzlichen Ministerien erfordert. 30 Vgl. dazu oben Fußnoten 27 u n d 29.
§ 20 Das K a b i n e t t (Ministerrat)
145
besonders i m Vordergrund steht, setzt gerade eine i n etwa gleichwertige und gleichberechtigte Stellung aller Kabinettsmitglieder voraus. Dies sollte für jedes Ministerium gelten, wobei allerdings dem Finanzminister eine gewisse faktische Sonderstellung zukommt 3 1 . Die „Ausgewogenheit" der Ressorts w i r d man zwar nicht eindeutig festlegen können, doch bieten folgende Kriterien dafür einen brauchbaren Maßstab: Als Hauptanhaltspunkte für diese Beurteilung dürften vor allem das laufend an die Entwicklung angepaßte, langfristig gesehene landespolitische und fachliche Gewicht des Ressortanteils an den gesamten Landesaufgaben (wobei auch der bundespolitische Aspekt dieser Aufgaben zu berücksichtigen ist) sowie die Zahl der Beschäftigten, die besonders als Gradmesser für die zur Verfügung stehenden Informationen und das Fachwissen anzusehen sind (Behördenapparat), dienen. Daneben sollte man die Größe des Haushaltsvolumens und auch den Umfang des Verwaltungsunterbaus noch als Kriterien heranziehen. Diese Anhaltspunkte stellen insgesamt gesehen doch eine recht brauchbare Leitlinie für die Bestimmung der „Ausgewogenheit" und „Gleichwertigkeit" der Ministerien dar. M i t diesen Abgrenzungsmaßstäben eng verbunden ist die Frage nach der optimalen Größe eines Ressorts. Auch hierfür sind die verschiedensten Kriterien, u. a. etwa die Zahl der Mitarbeiter, maßgebend. Allgemein w i r d man feststellen können, daß die optimale Größe dann erreicht ist, wenn unter Ausschöpfung aller Entlastungsmöglichkeiten i n der Führungsspitze (Leitungsebene i m Ressort) der Minister gerade noch seinen Geschäftsbereich politisch zu übersehen, zu führen und damit v o l l zu verantworten i n der Lage ist 3 2 . Wichtig ist dabei auch, daß der Aufgabenbereich eines Ministeriums so abgegrenzt wird, daß er i n etwa sechs (bis höchstens acht) Abteilungen aufgegliedert werden kann oder das Ressort mindestens so organisiert ist, daß die Führungsgruppe (-konferenz) zehn bis zwölf Mitglieder nicht übersteigt 33 . 31 Der Finanzminister, dem durch die L V die Aufgaben der Finanzverwaltung u n d des Haushaltsministers übertragen sind, hat dadurch zwar keine rechtlich, aber doch zwangsläufig faktisch hervorgehobene Stellung i m Kabinett inne. Daraus resultiert auch die richtige Auffassung mehrerer Befragter, daß der Finanzminister der bestinformierte Minister i m Kabinett ist. Eine weitere übereinstimmende Aussage der Befragten zeigt, daß es i m Kabinett das ungeschriebene Gesetz gibt, daß gegen den ernsthaften Wiederspruch v o n Finanz-, I n n e n - u n d Kultusminister k e i n Beschluß gefaßt w i r d . Diese Übung sollte, m i t gewissen Einschränkungen hinsichtlich des Finanzministers, dringend abgebaut werden (für den Innenminister seit der Neuabgrenzung des Ressorts von 1972 teilweise erfolgt). 32 Vgl. dazu insgesamt: Projektgruppe BMI, Erster Bericht, S. 8 ff.; D r i t t e r Bericht, I I I / 2 f. Als A n h a l t s p u n k t w i r d m a n dabei von einer Bedienstetenzahl (Beamte) von 200 bis 300, bei Ministerien m i t einem umfangreichen Unterbau bis zu 500 ausgehen können (bei einem L a n d von ca. 9 M i l l . E i n wohnern).
io K a t z
1 4 6 K a p . I I I : Organisation und S t r u k t u r der Landesregierung B W
(3) Der wichtigste Maßstab zur Einteilung und Abgrenzimg der Geschäftsbereiche ist der „Sachzusammenhang". Der Hessortzuschnitt nach dem Gesichtspunkt der Aufgabenaffinität ist vor allem zur Erleichterung und Reduzierung der Koordinierung und der Konfliktsbeilegung ein unabdingbares Gebot. Eine gewisse Schwierigkeit besteht hierbei aber insoweit, als die Aufgaben des Landes überwiegend Bezüge zu mehreren Sachgebieten aufweisen. I n solchen Fällen gilt es einigermaßen zuverlässig zu ermitteln, zu welchem Bereich der engste Sachzusammenhang besteht. Hierbei dienen als maßgebliche Kriterien die Identität der Ziele, die Übereinstimmung i n den Informationsfeldern und teilweise auch i n dem Adressatenkreis. Allerdings ist dabei darauf hinzuweisen, daß es mitunter angebracht sein kann, wesentliche Spannungsverhältnisse durch Aufgabenzuweisung an verschiedene Ressorts „künstlich" aufrechtzuerhalten, u m zu gewährleisten, daß eben die Konflikte und Fragen von grundsätzlicher und weittragender Bedeutung (vgl. A r t . 49 I I L V ) der Beratung und Entscheidung i m Kabinett vorbehalten bleiben 3 4 . c) Betrachtet man nun diese drei für die Ressortabgrenzung maßgeblichen Kriterien (u. a. den engsten Sachzusammenhang der A u f gabengebiete) i m einzelnen, so stellt man fest, daß sie weitgehend m i t den Anforderungen übereinstimmen, die dem oben i n § 4 erarbeiteten System der primären Staatszielsetzungen zugrunde liegen. Es bietet sich deshalb an, sich diese oben aufgestellte „Aufgabengrobsystematik" hier nutzbar zu machen. Dabei ist vorweg festzuhalten, daß die Ressortabgrenzung als der aufbauorganisatorisch horizontalen Grundstruktur des Regierungsbereichs grundsätzlich nur von den primären, i m wesentlichen also nicht von den sekundären Zielsetzungen her sinnvoll bestimmt werden kann. Dies ist heute weitgehend anerkannt 3 5 und gilt besonders für die Länder, bei denen auch i m Rahmen der Regie33 Vgl. Projektgruppe BMI, Erster Bericht, S. 12 ff.; Projektgruppe Bay. IM, Reformbericht, S. 101 ff.; A. Hüttl, i n : Der Staat, 1967, S. 6 f.; H. J. Wolff, Verwaltungsrecht I I , S. 71. Bei der gegenwärtigen Ministerialorganisation sind diese K r i t e r i e n i m wesentlichen eingehalten u n d beachtet worden. Eine Ausnahme macht allerdings teilweise das K u l t u s m i n i s t e r i u m (2 Ministerialdirektoren u n d 11 Abteilungen). Auch die Organisation der Leitungsebene des Innenministeriums ist recht unbefriedigend; vgl. dazu oben § 16 Ziff. 1 u n d vor allem unten § 23. 34 Vgl. Projektgruppe BMI, Erster Bericht, S. 10 f.; D r i t t e r Bericht, I I I / 3 , 111/57 ff.; H. Karehnke, i n : DÖV 1974, S. 119 f. 35 Die Vorschläge der Projektgruppe BMI i m Ersten u n d D r i t t e n Bericht gehen von diesem Grundsatz aus. Vgl. Erster Bericht S. 17 ff. D r i t t e r Bericht, I I I / 6 ff. u n d 57 ff. I m D r i t t e n Bericht w i r d allerdings i n besonders schwierigen und allein von den Aufgaben her nicht eindeutig festlegbaren A b grenzungsfragen stärker auf die „ F u n k t i o n e n " zurückgegriffen. I n abgeschwächter F o r m sollte auch bei den Ländern hilfsweise auf die Intensität des „Funktionszusammenhangs" (als weiteres Abgrenzungskriterium) notfalls zurückgegriffen werden (vgl. dazu oben § 5).
§ 20 Das K a b i n e t t (Ministerrat)
147
rungstätigkeit — i m Gegensatz zum Bund — die zentralen Verwaltungsaufgaben und nicht so stark die eigentlichen politischen und gesellschaftlichen Grundentscheidungen und die Gesamtstaatsleitung i m Vordergrund stehen 36 . Auch die durchgeführten empirischen Erhebungen haben diese Auffassung eindeutig bestätigt. So w i r d es etwa auch ganz überwiegend als unrealistisch abgelehnt, Organisationseinheiten oder gar eigene Ressorts allein für die Planung zu bilden. Vielmehr ist es ganz besonders i m Rahmen der Ressorteinteilung auf Landesebene dringend geboten, leitende Planung und ausführende Tätigkeit möglichst eng miteinander zu verbinden und gewissermaßen die Planung aus der ausführenden Tätigkeit (Verwaltung) „herauswachsen" zu lassen. Dasselbe gilt i m wesentlichen auch für etwaige bloße Koordinations- oder Informationsministerien 3 7 . Daraus folgt auch, daß es, wie dies mitunter auf Bundesebene schon erwogen wurde, keinesfalls möglich ist, die Ministerien zu reinen Leitungsinstrumenten umzugestalten und damit praktisch alle Verwaltungsaufgaben an nachgeordnete Behörden zu delegieren 38 . Deshalb muß nicht aus Gründen der Realisierbarkeit, sondern vor allem aus sachlichen Erwägungen mindestens i n den Ländern am gegenwärtigen Grundprinzip der Ressorteinteilung und des Ressortzuschnitts festgehalten werden. Dies rechtfertigt die oben i n § 4 Ziff. 2 aufgestellte Grobsystematik der p r i mären Zielsetzungen der Länder für die Einteilung und Abgrenzung der Geschäftsbereiche i n Verbindung m i t den vorstehend genannten Abgrenzungskriterien zugrunde zu legen. I m einzelnen ist dazu, nicht zuletzt auch unter Berücksichtigung der künftigen Entwicklung der Länderaufgaben (vgl. oben § 7 Ziff. 2), noch besonders auszuführen: 38 Vgl. etwa T. Ellwein, Regierungssystem, S. 320; E.-W. Böckenförde, O r ganisationsgewalt S. 292; F. Wagener, i n : Mensch u n d Staat i n NRW, S. 167 ff.; vgl. eingehend oben § 7, Ziff. 1. Deshalb können auch Aussagen f ü r den B u n d nicht ohne weiteres auf die Länder übertragen werden (dies g i l t etwa besonders für den Zweiten Bericht der Projektgruppe B M I ) . T. Ellwein f ü h r t dazu aus (Regierungslehre, S. 320): „Die Landesministerien sind homogener, w e i l sie alle Vollzugsaufgaben haben u n d w e i l sie fast alle einen mehr oder minder großen Vollzugsapparat dirigieren. I n den Ländern gibt es keine bloßen Gesetzgebungsministerien w i e sie der B u n d haben muß." 37 Vgl. dazu Projektgruppe BMI, Erster Bericht, S. 21; K . Stern, i n : Projektgruppe BMI, Erster Bericht, Anlagenband, S. 575 f.; Projektgruppe Bay. IM, S. 12 u n d 109; Wibera, Gutachten H H , S. 129 ff.; J. Kölble, i n : D Ö V 1973, S. 5; ausführlich dazu bereits oben § 3 Ziff. 3 m. w . N. E i n T e i l der A r g u mente, die gegen eine deutliche Trennung zwischen Regierung u n d V e r w a l t u n g (so E. Guilleaume, i n : Die V e r w a l t u n g 1970, S. 1 ff.) bestehen, können auch hier m i t zur Begründung herangezogen werden; vgl. dazu W. Damkowski, i n : Die V e r w a l t u n g 1970, S. 317 ff. A u f g r u n d der Erfahrungen i n England w i r d auch dort die B i l d u n g reiner Planungseinheiten abgelehnt. Vgl. dazu Projektgruppe BMI, Erster Bericht, S. 248 f.; N. Johnson, i n : ebenda, Anlagenband, S. 160 f. 38 Vgl. E. Guilleaume, i n : Die V e r w a l t u n g 1970, S. 1 ff.; W. Damkowski, i n : Die V e r w a l t u n g 1970, S. 317; Projektgruppe BMI, Erster Bericht, S. 17. D a m i t
10»
148
Kap. I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
(1) D e r
sozial-
und
gesellschaftspolitische
Aufgabenbereich
ist
in
Baden-Württemberg überwiegend i m Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung konzentriert. Zusätzlich sollten aber von diesem Ministerium die gesamten den Umweltschutz betreffenden A u f gabengebiete und auch die Bereiche Jugendpflege und Sport noch m i t übernommen werden. Denn m i t den bereits dort ressortierten Aufgaben hat insbesondere die Umweltpolitik weitgehend enge Sachzusammenhänge, vor allem gemeinsame Ziele und größtenteils auch denselben Adressatenkreis. Der Schutz des Menschen vor gesundheitlichen Schäden und vor der Zerstörung seiner natürlichen Umwelt ist zu gewährleisten und die Lebensqualität zu verbessern (langfristige gesellschaftspolitische Ziele). Der beherrschende Gesichtspunkt und gemeinsame Maßstab ist dabei letztlich stets die menschliche Gesundheit (Anspruch des Menschen auf Reinhaltung von L u f t und Wasser, auf Möglichkeiten der Freizeit und Erholung, auf Schutz vor L ä r m und anderen schädlichen Einflüssen usw.). Für diese Einteilung spricht auch die bereits oben gemachte Feststellung, daß bei zentralen A u f gabenbereichen wesentliche Spannungsverhältnisse durch Aufgabenzuweisung an verschiedene Ressorts bestehen bleiben sollen und dadurch der Beratung und Entscheidung des Kabinetts bedürfen. Die Aufgaben der Gesundheit und des Umweltschutzes stehen zur W i r t schafts- aber auch zur Landwirtschaftspolitik trotz teilweise enger Sachzusammenhänge i n einer so starken Interessenkollision, daß bei einer Zuordnung dieser verschiedenen Bereiche i n ein Ministerium die Gefahr einer „lautlosen" Vernachlässigung eines der beiden Aufgabengebiete besteht. Die letzten Jahre haben gezeigt, daß die zentralen und zum Teil diametral entgegenstehenden Interessen zwischen Gesundheit und Umwelt einerseits und Wirtschafts- und Landwirtschaftsaufgaben andererseits nicht innerhalb eines Ressorts, sondern nur durch eine ausgleichende, gesamtverantwortliche Kollegialentscheidung des Kabinetts befriedigend gelöst werden können 3 9 . I n Bad.-Württ. scheint die Angliederung des biologisch-ökologischen Umweltschutzes i n das Landwirtschaftsministerium (seit 1972) u. a. bewirkt zu haben, daß die Spannungsverhältnisse Umwelt/Landwirtschaft weitgehend zugunsten der i n diesem Ressort stärker und seit jeher vertretenen landwirtschaftlichen Interessen entschieden und oft nicht i m Kabinett beraten w u r den und dadurch auch insgesamt der Umweltschutz ein gewisses „Schattendasein" geführt hat 4 0 . Die hier vorgeschlagene Lösung dürfte soll aber keinesfalls gesagt werden, daß nicht einzelne Aufgaben sinnvollerweise delegiert u n d von den Behörden der Mittelinstanz wahrgenommen werden sollen. 39 Vgl. dazu Projektgruppe BMI, Erster Bericht, S. 17 ff., 40 f.; D r i t t e r Bericht, 111/49 ff. u n d auch 111/19 ff. Vgl. auch H. Karehnke, i n : D Ö V 1973, S. 83 ff. m. w . N.
§ 20 Das K a b i n e t t (Ministerrat)
149
außerdem der Bildung eines eigenen Ministeriums für Umweltfragen (vgl. etwa Bayern) vorzuziehen sein. Neben den angeführten Argumenten ist hier noch besonders hervorzuheben, daß für eine effektive Arbeit i m Bereich des Umweltschutzes umfassende sachliche Zuständigkeiten (nicht nur Koordination, Planung) und ein wirkungsvoller, dem betreffenden Ministerium selbst unterstellter Verwaltungsunterbau vorhanden sein müssen (etwa Gesundheitsämter). (2) D e r
wirtschafts-
und
verkehrspolitische
Aufgabenbereich,
der
vom Tätigkeitsumfang und auch von der künftigen Entwicklung (vgl. oben § 7) her gesehen i n zwei Ressorts aufzuteilen ist, w i r d gegenwärtig i m wesentlichen vom Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr und vom Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Umwelt wahrgenommen. A u f Länderebene ist an dieser Aufteilung i m Prinzip festzuhalten (zum Umweltschutz vgl. oben). Problematisch ist hierbei allerdings besonders die Zuordnung der Aufgabengebiete Raumordnung, Landesentwicklung und damit sinnvollerweise auch des Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesens. Ein Vergleich m i t den anderen Bundesländern zeigt, daß die hauptsächlichen Aufgabengebiete der Raumordnung und Landesplanung überwiegend von den Staatskanzleien selbst wahrgenommen werden und nur i n Bad.-Württ. (Innenministerium), Bayern (Ministerium für Landesentwicklung und U m weltfragen) und Niedersachsen (Innenministerium) einem Ressort zugewiesen sind. Die Zuordnung zum Staatsministerium, die m i t der grundsätzlichen Bedeutung, also m i t der Richtlinienkompetenz begründet wird, scheint wenig sinnvoll zu sein und stellt eine unnötige Belastung dieses Führungsinstruments m i t regierungsfremden Angelegenheiten dar. Die Staatskanzlei sollte zwar durchaus aktiv an der Raumordnung und Landesplanung beteiligt sein, aber eben nur i n i tiierend, koordinierend und bei besonders wichtigen Fragen auch federführend. Die sachliche Tätigkeit selbst aber muß i n einem Fach40 Hinzuweisen ist allerdings auf das Umweltschutz-Arbeitsprogramm 1973, den Vollzugsbericht zum Arbeitsprogramm 1973 u n d das mittelfristige Umweltschutzprogramm (vgl. Pressemitteilungen der Landesregierung Nr. 999/73). Vgl. dazu aber die kritischen Berichte i n der Stuttgarter Zeitung vom 14.12.1973 (S. 5) u n d 28.12.1973 (S. 5). Organisatorisch ist dazu noch zu bemerken, daß bei der Regierungsbildung 1972 zwar dem Arbeits- u n d L a n d wirtschaftsministerium zusätzliche Aufgaben (insbes. Umweltschutz) übertragen wurden, die aber, etwas überzeichnet ausgedrückt, i m wesentlichen nicht i n die Ministerien integriert, sondern n u r als weitere Abteilungen angehängt wurden. Dadurch blieb u. a. die durch die Neuabgrenzung der Ressorts beabsichtigte W i r k u n g w e i t hinter den Erwartungen zurück. Der hier dargestellte empirische Befund bezieht sich i m wesentlichen auf die Zeit von 1972 bis M i t t e 1974. Durch die Ernennung eines politischen Staatssekretärs (zum 1. 9.1974), der speziell f ü r Fragen des Umweltschutzes zuständig ist, scheint sich dies i m M i n i s t e r i u m f ü r Ernährung, Landwirtschaft und U m w e l t etwas gewandelt zu haben.
1 5 0 K a p . I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
ressort erledigt werden. Dies ergibt sich i n Bad.-Württ. einmal mittelbar aus A r t . 45 I V L V und zum anderen aus dem Wesen und dem Zweck der Einrichtung des Staatsministeriums als einem Instrument der Integration und Koordination zur Berücksichtigung der Gesamtinteressen, nicht aber nur konkreter Ressortbedürfnisse 41 . Z u Recht hat deshalb Ministerpräsident Filbinger i m Hinblick auf die Verfassungsstruktur ausgeführt, daß „die Planungsorganisation den Ressorts und den regionalen Planungsträgern die Produktion von Plänen vorbehält, während das Staatsministerium sich auf Koordination, auf Initiative und methodische Hilfe beschränkt" 42 . Offen bleibt aber weiter die Frage, welchem Ministerium nun die Aufgaben der Raumordnung und Landesplanung zugeteilt werden sollen. Für diese Aufgabengebiete ein eigenes Ressort zu schaffen, scheint, aus denselben Gründen wie für ein Umweltministerium (Bayern), nicht sinnvoll zu sein. I n Betracht kommt demnach für die Zuweisung dieser Aufgaben entweder das Innenministerium oder ein Ministerium des wirtschaftspolitischen Aufgabenbereichs, primär das Wirtschaftsministerium. Während für das letztere der engere Sachzusammenhang (Wirtschaftspolitik, regionale und sektorale Strukturentwicklung, Fremdenverkehr, Verkehrswesen, Infrastruktur usw.) spricht, kann das Innenminister i u m als Argumente für die Zuordnung anführen, daß ohne eine umfassende Einbeziehung und Beteiligung seines Unterbaus und vor allem der Kommunen (Gemeinden, Landkreise, Regional verbände) keine vernünftige Raumordnung und Landesplanung möglich ist, und daß das Spannungsverhältnis zwischen einer die Allgemeininteressen berücksichtigenden Landesentwicklungsplanung einerseits und der W i r t schaftspolitik andererseits nicht i n einem Ressort, sondern weitgehend i m Kabinett entschieden werden soll. Welche dieser beiden Lösungen der Vorzug zu geben ist, kann hier abschließend nicht bestimmt werden; dafür wären weitere konkretere Untersuchungen anzustellen. I n Bad.-Württ. scheint die gegenwärtige Zuordnung sich durchaus zu bewähren 43 . 41 Vgl. dazu ausführlicher oben § 14 Ziff. 4 u n d unten § 24. G. Kunze hat (in: Die Staatskanzlei, SHS Bd. 34, S. 104) zutreffend ausgeführt, „daß Raumordnung u n d Landesplanung ein so großer Aufgabenbereich ist, daß er den Rahmen der Staatskanzlei sprengt u n d es zweckmäßig erscheint, diese A b t e i l u n g i n einem eigenen A m t zu organisieren". Vgl. auch F. Duppre, i n : Die Staatskanzlei, SHS Bd. 34, S. 79 f. u. 112. Nach dem Behördenverzeichnis Bad.-Württ. 1974 sind i n der Abt. V I I — Landesplanung — i m Innenminister i u m 21 höhere Beamte beschäftigt; eine Eingliederung eines solchen A p p a rats i n das Staatsministerium ist nicht vorstellbar! 42 I n : Pressestelle der Landesregierung, Informationen aus erster Hand, Nr. 6/72 (Sept. 72), S. 5. 43 So die übereinstimmende Meinung aller zu diesem P u n k t Befragten. Dies w i r d auch durch die erfolgreiche A r b e i t der A b t . Landesplanung i m
§ 20 Das K a b i n e t t (Ministerrat) (3) D i e A b g r e n z u n g des kultur-
und bildungspolitischen
151 Aufgabenbe-
reichs ist insgesamt gesehen relativ unproblematisch (zu gewissen A b grenzungsschwierigkeiten zum gesellschaftspolitischen Bereich vgl. oben [1]). Die i n den vergangenen Jahren weit überproportional angestiegenen Bildungsaufgaben haben aber den Behördenapparat der K u l tusministerien erheblich ausgeweitet und auch organisatorische Probleme hervorgerufen 44 . So wurde etwa i n Niedersachsen, NordrheinWestfalen und Hessen dieses Aufgabengebiet i n zwei Geschäftsbereiche aufgegliedert und das Hochschulwesen (Wissenschaft und Forschung) zu einem neuen weiteren Ministerium ausgestaltet. Diese Entwicklung scheint aber mindestens für Länder bis ca. 10 M i l l . Einwohnern nicht besonders sinnvoll zu sein. Hier muß es vielmehr Möglichkeiten geben, durch organisatorische Maßnahmen innerhalb des Kultusministeriums die bestehenden Schwierigkeiten zu lösen. Dies t r i f f t auch für Bad.Württ. zu. Oben unter Buchstabe b) wurde als K r i t e r i u m für die Ressortabgrenzung u. a. genannt, daß der Geschäftsbereich von sechs bis höchstens acht Abteilungen effektiv wahrgenommen werden kann und die Führungsgruppe eines Ministeriums zehn bis zwölf Mitglieder nicht übersteigen soll. Betrachtet man unter diesem Gesichtspunkt das Kultusministerium, so stellt man fest, daß die Leitungsebene aus dem Minister, dem Staatssekretär, zwei Ministerialdirektoren, dem Zentralstellenleiter und elf Abteilungsleitern besteht. Rechnet man Presseund persönlichen Referenten des Ministers noch hinzu, so zeigt sich, daß bei einer so zahlreichen Führungsgruppe (achtzehn Führungskonferenzmitglieder) eine effektive Arbeit, Koordination usw. nur sehr schwer möglich ist. Nach einer umfassenden Untersuchung müßte hier organisatorisch sicher einiges geändert werden 4 5 . Innenministerium bestätigt (vgl. Landesentwicklungsplan v o m 22.6.1971, Verbindlicherklärung durch Verordnung v o m 11.4.1972 — Ges. Bl. S. 169 —). Z u r Bewältigung der insoweit auftretenden „Spannungen" zwischen I n n e n ministerium (Raumordnung, Landesplanung) u n d Wirtschaftsministerium (Wirtschafts- u n d Verkehrspolitik) wurde i m Prinzip v ö l l i g zu Recht u n d konsequent 1972 ein interministerieller Ausschuß zur Koordinierung der Investitions- u n d S t r u k t u r p o l i t i k (insbes. der kommunalen) eingesetzt (vgl. dazu unten § 23 Ziff. 7). Vgl. dazu auch Projektgruppe BMI, Erster Bericht, S. 17 ff., 41 f.; D r i t t e r Bericht, I I I / 9 ff., 111/23 ff. 44 Z u r künftigen E n t w i c k l u n g dieses Bereiches vgl. oben § 7. 45 Die organisatorischen Probleme i m K u l t u s m i n i s t e r i u m zeigten sich i m Febr. 1973 anläßlich des Streits über die Teilung der Hochschulabteilung i n aller Deutlichkeit. Damals führte etwa die ABG. R. Hellwig (CDU) aus, „daß i m K u l t u s m i n i s t e r i u m eine Reorganisation von unten her eingeleitet werden müsse. Es gebe jetzt schon vier politisch Verantwortliche i n dem Ministerium. Der K o m p e t e n z w i r r w a r r dürfe durch die Aufsplitterung der Verantwortung nicht noch vergrößert werden" (vgl. dazu etwa Stuttgarter Zeitung v o m 20. 2.1973, S. 13). Dies w u r d e auch durch die Mehrzahl der geführten I n t e r views bestätigt. I m übrigen wäre es aus organisatorischer Sicht besser gewesen, die Hochschulabteilung i n Unterabteilungen zu gliedern anstatt sie i n zwei selbständige Abteilungen aufzuspalten. Vgl. dazu auch unten § 23.
1 5 2 K a p . I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W (4) D e r verwaltungs-
und rechtspolitische
Aufgabenbereich
wird vom
Innen- und Justizministerium wahrgenommen. Bei einer Ausgliederung der Aufgabengebiete Raumordnung und Landesplanung, sowie des Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesens aus dem Innenministerium und unter Berücksichtigung der künftigen Entwicklung 4 6 scheint es auf lange Sicht nicht ganz ausgeschlossen zu sein, entgegen der langjährigen Tradition, den verwaltungs- und rechtspolitischen Aufgabenbereich i n einem Ministerium zusammenzufassen (gesamte Ordnungsverwaltung). Gegenwärtig kann allerdings noch keinesfalls daran gedacht werden, von der bewährten Tradition abzugehen. (5) F ü r d e n finanz-
und
steuerpolitischen
Aufgabenbereich
schließ-
lich ist die Ressortzuordnung weitgehend i n der Verfassung festgelegt (vgl. etwa A r t . 81 und 83 LV) und macht i m wesentlichen keine Schwierigkeiten 4 7 . Gewisse Probleme w i r f t hier lediglich die Frage auf, welchen Ministerien die Ressourcen (insbes. Personal, Information, einschl. EDV und Statistik) unterstellt werden. Während derzeit neben den Finanzen ein erheblicher Teil der Informationen (Statistisches Landesamt) dem Finanzministerium zugeordnet ist, ist für einen anderen Teil der Informationen (Datenzentrale Bad.-Württ.) 4 8 und weitgehend für das Personalwesen das Innenministerium zuständig. Diese Zuordnung ist, abgesehen von den Finanzen, nicht unbestritten. Zum Beispiel versuchte das Staatsministerium bei der letzten Regierungsbildung i m Juni 1972 vergeblich, sich wesentliche Teile des Informationswesens, insbesondere das Statistische Landesamt, anzugliedern. I m übrigen ist auch, nicht zuletzt i m Hinblick auf das Beamtenernennungsrecht des Ministerpräsidenten (Art. 51 LV), die Ressortierung der allgemeinen Personalangelegenheiten schwierig und i n den einzelnen Ländern unterschiedlich geregelt. Obgleich die derzeitige Regelung weitgehend als befriedigend angesehen wird, dürfte es grundsätzlich sinnvoller sein, dem Innenministerium neben dem Personalwesen für den gesamten allgemeinen Verwaltungsdienst auch schwerpunktmäßig den Bereich Informationen zu übertragen 49 , wobei allerdings eine zusätzliche zen46
Vgl. dazu oben § 7 Z i f f 2. Vgl. dazu auch oben § 15 Ziff. 3. 48 Vgl. über dessen Aufgaben usw. das Gesetz über die Datenzentrale Bad.W ü r t t . v o m 17.11.1970 (Ges. Bl. S. 492 ff.). 49 Dafür sprechen insbesondere zwei Gründe: Z u m einen ist es notwendig, das Informationssystem eng m i t den entsprechenden Systemen der K o m m u nen zu verbinden, was besonders gut über das Innenministerium erreicht werden kann, u n d zum anderen sollte die bereits bestehende besondere Stellung des Finanzministeriums i n Anbetracht einer notwendigen A u s gewogenheit der Ressorts nicht noch mehr gestärkt werden. U. U. wäre auch an ein selbständiges „Informationsamt", das dem K a b i n e t t direkt zu unterstellen wäre, zu denken. V o r einer endgültigen A n t w o r t auf die angesprochenen Fragen müßten noch Detailuntersuchungen durchgeführt werden. 47
§ 20 Das K a b i n e t t (Ministerrat)
153
trale Grundsatz-Planung und Koordinierung dieser Aufgaben, vor allem etwa eine Personalplanung für den Regierungsbereich, unerläßlich ist. Darauf w i r d noch unten § 24 Ziff. 5 bis 8 näher einzugehen sein. Auch die Frage der Aufgabenverteilung zwischen Staats- und Finanzministerium (etwa integrierte Aufgaben- und Finanzplanung) w i r d dort noch untersucht werden müssen. 4. Zahl der Regierungsmitglieder Die vorstehenden Ausführungen zur Ressortabgrenzung haben gezeigt, daß die gesamten Aufgaben des Landes auf sechs bis acht Geschäftsbereiche und damit auch Minister zu verteilen sind. Dies bedeutet, daß sich das Kabinett (Ministerpräsident und Minister) aus mindestens sieben bis neun Mitglieder zusammensetzt 50 . Dem entspricht die gegenwärtige bad.-württ. Regelung, wonach dem Kabinett außer dem Ministerpräsidenten sieben Minister angehören, v o l l und ganz. Problematisch ist und bleibt die Frage, ob es notwendig und effektiv ist, weitere Regierungsmitglieder zu ernennen. Oben § 16 wurde festgestellt, daß die verfassungsrechtliche Regelung des A r t . 45 I I S. 2 L V wenig befriedigt. Während ehrenamtliche Staatsräte heute ihren Sinn und damit ihre Berechtigung weitgehend verloren haben, ist die Erforderlichkeit und Zweckmäßigkeit von Sonder- und Staatsministern oder Staatssekretären m i t Kabinettsrang auf Länderebene nach wie vor umstritten 5 1 . Ausgehend von A r t . 45 I I L V und den dieser Bestimmung zugrunde liegenden zwei möglichen Ausgestaltungsarten des Staatssekretärs mit Kabinettsrang (vgl. oben § 16 Ziff. 2) stellt sich dieses Problem von der Verfassungswirklichkeit aus betrachtet i n groben U m rissen folgendermaßen dar: die eine Ausgestaltungsform, die faktisch dem Sonderminister oder Minister ohne Portefeuille entspricht, wurde in der Praxis noch nie erprobt 5 2 . Dagegen wurden Staatssekretäre der anderen Ausgestaltungsform, die durch eine eigenartige Doppelstellung geprägt sind, regelmäßig ernannt 5 3 . Von den sich derzeit i m A m t befind50 Abgesehen von Bad.-Württ. u n d m i t Ausnahme von Bayern (18 Regierungsmitglieder) bestehen sämtliche Regierungen der Länder aus 7 bis 10 Mitgliedern. 51 Außer Bad.-Württ. kennt n u r Bayern Staatssekretäre als weitere K a binettsmitglieder (Art. 50 I I Bay. LV). Vgl. zur bayerischen Regelung eingehend U. Echtler, Der beamtete Staatssekretär, S. 53 ff. m. w. N. 52 Neben den oben § 16 Ziff. 2 genannten Gründen dürfte diese F o r m auch aus organisatorischen u n d personellen Schwierigkeiten heraus nicht W i r k lichkeit geworden sein. Es ist durchaus verständlich, daß sich k a u m jemand bereiterklärt, n u r vorübergehend, bis die Sonderaufgaben erledigt sind, unter einem Staatssekretär m i t Kabinettsrang zu arbeiten. Insoweit ist es meist besser, die Sonderaufgaben i n einem größeren M i n i s t e r i u m organisatorisch anzusiedeln.
154
Kap. I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
liehen Staatssekretären ist der Minister für Bundesangelegenheiten unumstritten und in Anbetracht der stetig steigenden Bedeutung der bundesstaatlichen Landesaufgaben mehr denn je dringend notwendig und sinnvoll 5 4 . Auch der Staatssekretär für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte i m Innenministerium ist von der Sache her nicht zwingend nötwendig, aber politisch durchaus vertretbar. Dagegen ist der Posten des Staatssekretärs i m Staatsministerium, so scheint es, ein „unbefriedigendes A m t " und stellt gewissermaßen einen „Fremdkörper" i n der Staatskanzlei dar 5 5 . Abgesehen von der Tatsache, daß sachlich für dieses A m t praktisch kein Raum ist, dürften dafür insbesondere zwei Gründe maßgebend sein. Einmal darf sich naturgemäß — unter politischen Gesichtspunkten sogar notwendigerweise — ein Staatssekretär neben dem Regierungschef nicht profilieren, er muß vielmehr gewissermaßen ein „Schattendasein" führen, und zum anderen wurde i h m praktisch kein bestimmter Aufgaben- und Kompetenzbereich übertragen, wobei vor allem der zweite Umstand (entgegen A r t . 45 I I I L V ) 5 6 für den gegenwärtigen Zustand verantwortlich ist 5 7 . Diese Ausführungen zeigen, daß es grundsätzlich sinnvoll und notwendig ist, weitere Regierungsmitglieder ernennen zu können. Sowohl für die dauernde und die nur vorübergehende Wahrnehmung von (Sonder-)Aufgaben innerhalb eines Ministeriums als auch für eine besondere landespolitische Hervorhebung bestimmter Aufgaben ist die Berufung eines Staatssekretärs m i t Kabinettsrang (Sonder- oder 53 Gegenwärtig zählt dazu: Minister f ü r Bundesangelegenheiten, Staatssekretär i m Staatsministerium, Staatssekretär f ü r Vertriebene, Flüchtlinge u n d Kriegsbeschädigte. Vgl. dazu eingehend oben § 16 Ziff. 2 u n d 4. 54 A u f g r u n d A r t . 51 I G G ist es notwendig, daß der Vertreter des Landes i n Bonn Kabinettsmitglied ist. I m übrigen ist es auch wegen A r t . 49 I I L V , wonach über alle Stimmabgaben des Landes i m Bundesrat der Ministerrat entscheidet, erforderlich, daß der Vertreter mindestens beratendes Kabinettsmitglied ist. U n t e r Berücksichtigung des A r t . 50 L V , wonach der Ministerpräsident grundsätzlich das L a n d nach außen vertritt, k a n n insgesamt gesehen die bestehende Regelung (Staatssekretär m i t Kabinettsrang i m Staatsministerium f ü r den Bereich Bundesangelegenheiten) als angemessen u n d durchaus richtig angesehen werden. Dies wurde bei allen Interviews bestätigt. Vgl. dazu ausführlicher oben § 16 Ziff. 4. 55 Vgl. oben § 16 Ziff. 2 u n d etwa P. Schütz, i n : Südwestpresse, Schwäbisches Tagblatt v o m 2. 6.1973, S. 3. 58 Gemäß A r t . 45 I I I L V müssen auch f ü r die Staatssekretäre m i t K a binettsrang die Aufgaben u n d Kompetenzen ( A r t „Geschäftsbereich") m i n destens i n groben Zügen festgelegt werden. Vgl. dazu ausführlich oben § 16 Ziff. 2 u n d § 17. 57 Die Stellung des Staatssekretärs ist i m Staatsministerium n u r sehr vage i n vier Punkten festgelegt. Dadurch, daß diese schriftliche „ A n o r d nung" noch äußerst r e s t r i k t i v ausgelegt w i r d u n d die Abteilungsleiter u n mittelbaren Zugang u n d laufenden K o n t a k t zum Ministerpräsidenten haben, ist die tatsächliche Stellung des Staatssekretärs i m Staatsministerium alles andere als stark.
§21 Die Kabinettsarbeit
155
Staatsminister) trotz einiger Nachteile nützlich und zweckmäßig 58 . Dabei muß allerdings unbedingt beachtet werden, daß die Aufgaben und Kompetenzen der Staatssekretäre gemäß A r t . 45 I I I L V vom Kabinett beschlossen und vom Landtag bestätigt werden. I m Hinblick auf die Gesamtzahl der Regierungsmitglieder ist noch darauf hinzuweisen, daß die Regelung des A r t . 45 I I L V wenig glücklich ist. Zwar ist es unzweckmäßig, wie etwa i n Bayern, die Zahl und die Geschäftsbereiche der Ministerien i n der Verfassung selbst festzulegen, doch kann andererseits eine zahlenmäßige Beschränkung der Kabinettsmitglieder nicht dadurch erreicht werden, daß die Zahl der Ressorts unbeschränkt ist und nur Staatssekretäre i n begrenztem Umfang ernannt werden können. Deshalb wäre eine verfassungsrechtliche Regelung sinnvoller, wonach sich die Regierung insgesamt aus nicht mehr als etwa elf bis dreizehn Mitgliedern zusammensetzen darf 5 9 .
§ 21 Die Kabinettsarbeit Die Landesverfassung stellt, wie bereits mehrfach dargelegt wurde, die kollegiale Beratung und Beschlußfassung — das Kabinettsprinzip — sehr stark i n den Vordergrund (vgl. A r t . 49 I I L V und oben §§ 12 und 13). Dem entspricht auch weitgehend die tatsächliche Bedeutung, die der Arbeit des Ministerrats von allen Seiten beigemessen w i r d 1 . Dies drückt sich nicht zuletzt auch darin aus, daß das Kabinett 35 bis 40mal i m Jahr tagt und die Sitzungen oft bis spät i n die Nacht andauern 2 . Die Stellung des Kabinetts rechtfertigt es demnach, dessen Arbeit eingehender darzustellen und zu untersuchen. Dazu soll, insbesondere wegen dem Fehlen einer Geschäftsordnung, auch der gesamte Geschäftsablauf 58 A l s Beispiel könnte hier etwa an einen Sonderminister oder Staatssekretär m i t Kabinettsrang f ü r Umweltfragen gedacht werden. Die seit 1. 9.1974 geltende Regelung (politischer Staatssekretär f ü r Umweltfragen i m Landwirtschaftsministerium) ist u. a. deshalb unbefriedigend, w e i l nach dem U r t e i l des S t G H v o m 24. 2.1973 diesem i m Unterschied zu den Staatssekretären nach A r t . 45 I I L V i m Hinblick auf A r t . 77 L V n u r i n sehr beschränktem Umfang die Ausübung hoheitlicher Befugnisse übertragen werden kann, dies aber f ü r eine effektive A r b e i t dringend erforderlich wäre (vgl. oben S. 150 f.). Letztlich entscheidend ist aber auch hier die Person u n d nicht so sehr die rechtliche Stellung des Staatssekretärs. 59 Vgl. dazu oben § 13. Z u den mehr organisatorischen Problemen der Staatssekretäre innerhalb der Ressortleitung u n d zu der Frage deren N o t wendigkeit i n Landesministerien überhaupt w i r d unten § 23 noch ausführlicher einzugehen sein. 1 Z u r tatsächlichen Bedeutung der Bundesregierung trotz der verfassungsrechtlichen Hervorhebung des Kanzlerprinzips (Art. 64, 65 GG) vgl. die dem § 15 GeschOBReg entsprechende Praxis. 2 M i t Ausnahme von Oster-, Sommer- u n d Weihnachtsferien tagt das K a b i n e t t wöchentlich (jeden Dienstag).
156
Kap. I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
von der Einbringung von Vorlagen bis zur Beschlußfassung beschrieben werden. 1. Kabinettsvorlagen Der Anstoß, durch den der Ministerrat mit einer Angelegenheit beschäftigt w i r d (Art. 49 II, 59 I, 61 I I usw. LV), erfolgt in aller Regel aufgrund entsprechender Kabinettsvorlagen der Ministerien. Diese Vorlagen sollen nach den Vorstellungen der Staatskanzlei i m Normalfall drei Wochen (in dringenderen Fällen aber mindestens eine Woche) vor der Kabinettssitzung, i n der sie behandelt werden sollen, i m Ministerratsbüro (Staatsministerium) vorliegen und inhaltlich voll „ausgereift" sein, d. h. daß sie u. a. sowohl m i t den betroffenen Interessenverbänden und -Organisationen diskutiert (Anhörung) als vor allem auch m i t den beteiligten Ressorts (insbesondere Finanzministerium) koordiniert, abgestimmt und eventuelle Differenzen möglichst beseitigt worden sind. Außerdem sollen die Kabinettsvorlagen einen formulierten Beschlußvorschlag enthalten und ihnen schließlich auch alle erforderlichen Unterlagen usw. beigefügt sein. Die i m Staatsministerium eingegangenen Kabinettsvorlagen werden über den normalen Posteinlauf (MD, AbtL) direkt an den i m Einzelfall dafür sachlich zuständigen Referenten geleitet, der sie dann an alle übrigen Regierungsmitglieder m i t der Bitte u m baldige Stellungnahme und der Mitteilung des voraussichtlichen Sitzungstermins verschickt. Die Kabinettmitglieder (Ministerien, Minister für Bundesangelegenheiten, Staatssekretär für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte) sind dabei gehalten, vor allem eventuelle Einwendungen, Änderungswünsche und auch Anregungen rechtzeitig vor der jeweiligen Kabinettssitzung dem Staatsministerium vorzutragen. Die eigentliche Kabinettsvorbereitung beginnt dann einige Tage vor der Ministerratssitzung, wenn die Stellungnahmen bei dem zuständigen Referenten der Staatskanzlei eingegangen sind. Von diesem Regelablauf sollte es Ausnahmen nur i n eng begrenzten Fällen geben. Eine Verkürzung der genannten Fristen (und damit verbunden die Unmöglichkeit zur Einholung von Stellungnahmen) ist sicher stets dann notwendig, wenn eine Angelegenheit als besonders eilbedürftig und dringlich angesehen werden muß. Aber auch dann sollte, wenn irgend möglich, darauf hingewirkt werden, daß die Kabinettsvorlagen spätestens bis freitags gegen 12 Uhr für die am folgenden Dienstag stattfindende Ministerratssitzung i m Staatsministerium vorliegen. Von dem Erfordernis der Entscheidungsreife ist sinnvollerweise eine Ausnahme i n den Fällen gerechtfertigt, in denen wegen der weittragenden Bedeutung oder der politischen B r i sanz einer Vorlage, diese zuerst i m Rohentwurf i m Kabinett eingebracht und beraten wird, wobei dann nur die grundsätzliche Richtung
§21 Die Kabinettsarbeit
157
u n d die Z i e l v o r s t e l l u n g e n festzulegen s i n d 3 . U m eine echte B e r a t u n g z u e r m ö g l i c h e n , müssen aber auch diese V o r l a g e n r e c h t z e i t i g u n d m i t umfassenden U n t e r l a g e n a l l e n R e g i e r u n g s m i t g l i e d e r n z u g e l e i t e t w e r den. I n E r m a n g e l u n g e i n e r G e s c h ä f t s o r d n u n g ist a l l e r d i n g s d e r V e r s u c h der Staatskanzlei, die v o r s t e h e n d g e n a n n t e n G r u n d s ä t z e b e i der E i n b r i n g u n g v o n K a b i n e t t s v o r l a g e n z u v e r w i r k l i c h e n , w e i t g e h e n d gescheitert. D i e B e f r a g u n g e n h a b e n ergeben, daß i n d e n m e i s t e n F ä l l e n die F r i s t e n n i c h t e i n g e h a l t e n w e r d e n ( n i c h t s e l t e n erst f r e i t a g s nach 16.00 U h r oder g a r erst montags), h ä u f i g die K a b i n e t t s v o r l a g e n m i t d e n a n d e r e n Ressorts n i c h t a b g e s t i m m t u n d k o o r d i n i e r t sind, aber auch n i c h t selten d e n V o r l a g e n n u r u n z u r e i c h e n d e B e g r ü n d u n g e n u n d U n t e r lagen zugrunde liegen4. 2. Aufstellung der Tagesordnung D i e die K a b i n e t t s v o r l a g e n b e a r b e i t e n d e n R e f e r e n t e n des Staatsm i n i s t e r i u m s s i n d g e h a l t e n , die T a g e s o r d n u n g s p u n k t e bis spätestens m i t t w o c h s v o r d e r K a b i n e t t s s i t z u n g ( a m d a r a u f f o l g e n d e n Dienstag) d e m V o r z i m m e r des A m t s c h e f s d e r S t a a t s k a n z l e i m i t z u t e i l e n . I n der R e g e l w i r d d a n n a m D o n n e r s t a g v o m M i n i s t e r i a l d i r e k t o r die v o r l ä u f i g e T a g e s o r d n u n g a u f g e s t e l l t u n d nach G e n e h m i g u n g d u r c h d e n M i n i s t e r p r ä s i d e n t e n a n die R e g i e r u n g s m i t g l i e d e r v e r s c h i c k t 5 . D a d u r c h , daß 3 V o n dieser Möglichkeit w i r d häufig, aber insgesamt doch noch zu wenig Gebrauch gemacht. Beispiele w i e Festlegung von Grundsätzen f ü r die A u f stellung des Haushaltsplans, der mittelfristigen Finanzplanung, des Investitions- u n d Arbeitsprogramms oder etwa wichtigen Gesetzesvorhaben (z. B. Hochschulgesetznovelle v o n 1973), sind v o l l u n d ganz gerechtfertigt (Art. 49 I I LV). Bereits i n diesem Zusammenhang ist zu vermerken, daß oft Unbedeutenderes und allgemein k a u m interessierende Vorlagen i m Kabinett eingebracht werden, was sicher weniger auf eine bewußte Hervorhebung einer kollegialen, gemeinsamen Beratung u n d Entscheidung als vielmehr auf ein Abschieben der politischen Verantwortung u n d damit letztlich auf eine gewisse Schwäche einzelner Minister schließen läßt. Diese Folgerung beruht auf der Mehrzahl der Aussagen der Befragten. Vgl. dazu eingehender unten Ziff. 6. 4 Vgl. dazu etwa §§ 16, 17 I I u n d 18 der Schl.-Holst. GeschO u n d §§ 5, 5 a ff. der Bay. GeschO. Die bisherigen Entwürfe einer bad.-württ. GeschO sind insoweit äußert flexibel; danach soll lediglich festgelegt werden, daß die Ubersendung der Unterlagen so rechtzeitig erfolgt, daß f ü r eine sachliche Prüfung vor der Beratung genügend Zeit bleibt. Die Gründe f ü r die gegenw ä r t i g geübte Praxis sind sehr komplex; nicht zuletzt dürften neben einer durchaus anzutreffenden „Bequemlichkeit" auch rein faktische Gründe dafür verantwortlich sein. E i n Befragter bemerkte dazu, „daß hinter dem kurzfristigen Einbringen von Vorlagen öfters der Versuch steckt, eine Sache durchzubekommen bevor sie von den anderen Ressorts u n d teilweise auch v o m Staatsministerium, insbesondere i m Detail, geprüft werden kann". Diese Aussage wurde i n den meisten Interviews bestätigt u n d zudem betont, daß diese Praxis m i t ein G r u n d f ü r die starke Stellung des Staatsministeriums sei. 5 I n Konfliktsfällen entscheidet der Ministerpräsident. I n jede Tagesordnung werden die Punkte „Einladungen", „Ordensverleihungen" u n d „Perso-
1 5 8 K a p . I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
relativ häufig ohne Rücksicht auf Dringlichkeit und Eilbedürftigkeit noch nachträgliche Änderungen und Ergänzungen berücksichtigt werden, sieht die endgültige Tagesordnung nicht selten erheblich anders aus als die vorläufige. Die bis zuletzt zum Teil auch telefonisch beantragten Ergänzungen werden den Ministerien zwar laufend mitgeteilt, doch bleibt dadurch i n der Regel für eine rechtzeitige Unterrichtung und Zusendung der Unterlagen und für eine umfassende sachliche Prüfung vor allem den Ressorts viel zu wenig Zeit. A l l e Bemühungen des Ministerialdirektors, diesen unbefriedigenden Zustand wenigstens teilweise zu beheben, sind bisher ohne sichtbaren Erfolg geblieben. Dies gilt auch für den Versuch einer Bestandsaufnahme und längerfristigeren Vorausplanung mindestens aller wichtigeren und umfassenderen Tagesordnungspunkte. Die faktische Undurchführbarkeit einer solchen ohne Zweifel sinnvollen Vorausplanung und besonders auch der Einhaltung der Fristen dürfte, neben den i n der Sache selbst liegenden Gründen, vor allem darin zu suchen sein, daß gegenwärtig alle Kabinettsmitglieder einschließlich des Ministerpräsidenten, die bestehende äußerst flexibel gehandhabte Praxis i n der organisatorischen Abwicklung der Regierungsarbeit i m Ministerrat gegenüber einer stärkeren Reglementierung eindeutig bevorzugen 6 . Obwohl sich die Regierungsmitglieder weitgehend darüber i m klaren sind, daß ihr Beratungsbeitrag und ihr Mitspracherecht dadurch oft illusorisch ist und dadurch auch die Stellung des Ministerpräsidenten und seiner Staatskanzlei zusätzlich gestärkt w i r d 7 , vertreten sie nach wie vor diese Auffassung. Es scheint, als ob die Minister insoweit allein die für ihre Ressorts vermeintlichen faktischen Vorteile und i n keiner Weise die gesamtverantwortliche Komponente ihrer Stellung als Regierungsmitglied berücksichtigen würden 8 .
nalsachen" automatisch aufgenommen. Außerdem w i r d i n jeder Sitzung das politische Programm der Landesregierung f ü r die nächsten Tage (Wochen) durchgesprochen. Dabei w i r d u. a. festgelegt, w e r die Landespressekonferenz abhält u n d w e r die Regierung i m Landtag v e r t r i t t . 6 Dies sind letztlich auch die Überlegungen, die bei der Frage des Erlasses einer GeschO angestellt werden. Vgl. dazu oben § 12 Ziff. 5 (Fußnote 31), § 13 sowie § 17. Erstaunlich ist, daß dies auch f ü r die Große K o a l i t i o n (CDU/SPD) zutraf. 7 Die durchgeführten Untersuchungen lassen den Schluß zu, daß v o n Seiten des Staatsministeriums gegen verspätet eingegangene Kabinettsvorlagen dann vorgegangen w i r d , w e n n es selbst i n der noch zur Verfügung stehenden Zeit nicht mehr i n der Lage ist, eine eingehende sachliche P r ü fung vorzunehmen (mögliche Konsequenzen: Nichtaufnahme i n die Tagesordnung; geschäftsordnungsmäßige M i t t e l w i e etwa die Vertagung der E n t scheidimg). 8 Z u den taktischen Erwägungen vgl. oben Fußnote 4. Vgl. dazu auch die Ausführungen oben § 15 Ziff. 1 u n d 2.
§ 21 Die Kabinettsarbeit
159
3. Vorbereitung der Kabinettssitzungen Die unmittelbare Vorbereitung der Ministerratssitzungen liegt i n den Händen des Staatsministeriums, das sich ja nicht nur als Büro des Ministerpräsidenten, sondern auch des Kabinetts zu verstehen hat (vgl. oben § 14 Ziff. 4). Sie beginnt i m Normalfall m i t dem Ablauf der Frist, die den Regierungsmitgliedern m i t der Versendung der Kabinettsvorlagen für die Abgabe ihrer Einwendungen eingeräumt wurde. Der sachlich zuständige Referent stellt dann die gesamten Unterlagen einschließlich der eingegangenen Stellungnahmen der Regierungsmitglieder (Ministerien) zusammen. Dabei ist festzustellen, daß insgesamt gesehen gegenwärtig relativ wenig Einwendungen gegen Kabinettsvorlagen vorgebracht werden 9 . Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den Ministerien oder bei unterschiedlicher Auffassung des Staatsministeriums selbst 10 w i r d dann zunächst versucht, die bestehenden Differenzen auf Referenten- und i n schwierigeren Fällen auf Abteilungsleiterebene zu beseitigen. I n der Mehrzahl der Fälle haben diese meist informell geführten Konsultationen und Gespräche 11 , die vom Staatsministerium initiiert werden und unter dessen starkem federführenden Einfluß stehen, Erfolg, so daß nur wenige, dann allerdings i n der Regel besonders bedeutsame Kabinettsvorlagen i n den Ministerrat gelangen, die nach wie vor zwischen den Regierungsmitgliedern (Ressorts) umstritten sind. Aufgrund der Kabinettsvorlage selbst (einschließlich deren Unterlagen), den dazu eingegangenen Stellungnahmen, den geführten Gesprächen u n d natürlichen auch den Vorstellungen des Staatsministeriums w i r d von dem Referenten ein sogenannter Kabinettsvermerk i m Normalfall bis zum Freitag vor der Ministerratssitzung erarbeitet. Dieser ist so zu gestalten, daß sich der Ministerpräsident über den betreffenden Tagesordnungspunkt kurz, aber möglichst umfassend informieren kann. Der Vermerk muß all das enthalten, was der Vorsitzende des Kabinetts für die Verhandlungsleitung braucht (einschließlich verhandlungstaktischen Anregungen und einem Entscheidungsvorschlag). Die gesamten Unterlagen einschließlich der Kabinettsvermerke werden dann für alle Tagesordnungspunkte gesammelt (neunfach) und freitagnachmittags vor jeder Ministerratssitzung (dienstags) möglichst vollständig dem Ministerpräsidenten, dem 9 Dies w a r allerdings unter der Großen K o a l i t i o n von 1966 - 1972 anders. E i n Befragter meinte, „daß i m Vergleich zur CDU/SPD K o a l i t i o n i m H i n blick auf Einwendungen zu Kabinetts vorlagen heute Ruhe eingekehrt ist". 10 Z u m Entscheidungsprozeß innerhalb des Staatsministeriums selbst vgl. unten § 24 Ziff. 10. 11 I n diesem Stadium w i r d n u r i n den seltensten Fällen e t w a eine i n t e r ministerielle Kommission eingesetzt. Eine solche w i r d i n der Regel erst dann geschaffen, w e n n über die Frage auch i m K a b i n e t t selbst keine Einigung erzielt werden konnte.
1 6 0 K a p . I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
Minister für Bundesangelegenheiten, dem Staatssekretär und dem Ministerialdirektor vorgelegt, während sie die Abteilungsleiter (mit Ausnahme der Abt. V) der Staatskanzlei, insbesondere aus Gründen der Aktenvollständigkeit, normalerweise erst montagabends erhalten. Dadurch soll es der Leitung des Staatsministeriums ermöglicht werden, sich über das Wochenende auf die Kabinettssitzung vorbereiten zu können. Die Praxis zeigt dabei allerdings, was sich zwangsläufig aus den Ausführungen oben Ziff. 1 und 2 ergibt, daß die Kabinettsunterlagen am Freitagnachmittag vor einer Ministerratssitzung häufig noch nicht vollständig sind. Die restlichen Kabinettsunterlagen werden dann i m wesentlichen i m Laufe des Montag, ab und zu aber auch erst dienstags vor der Kabinettssitzung, vervollständigt und ergänzt 12 . Daraus resultiert, daß bei relativ vielen Tagesordnungspunkten die Kabinettsvorbereitung nicht als „Normalfall" abläuft und nicht selten zeitliche Engpässe i n der Kabinettsvorbereitung auftreten 1 3 . Vor jeder Sitzung des Ministerrats findet dann kurzfristig (in der Regel dienstagvormittags) i m Staatsministerium die sehr wichtige Kabinettvorbesprechung statt, an der neben dem Ministerpräsidenten der Staatssekretär, der Ministerialdirektor und die Abteilungsleiter (mit Ausnahme von Abt. V) teilnehmen. Dabei werden von den Abteilungsleitern die erforderlichen Informationen gegeben und die einzelnen Tagesordnungspunkte oft durchaus entscheidend vorberaten und vorgeklärt. Ab und zu w i r d i n unregelmäßigen Zeitabständen vor Kabinettssitzungen auch zu sogenannten Arbeitsessen eingeladen, an denen neben den Regierungsmitgliedern manchmal auch der Fraktionsvorsitzende der Regierungspartei teilnimmt. Diese Essen dienen allerdings primär nicht der Kabinettsvorbereitung, sondern sind überwiegend aktuellen politischen Fragen gewidmet, die hier besprochen und beraten werden. Eine Beteiligung der Regierungsfraktion an der Vorbereitung der Ministerratssitzungen ist demnach nicht institutionalisiert und erfolgt deshalb, wenn überhaupt, weitgehend nur auf informellem Wege 14 . 12
So findet etwa die Referentenbesprechung für Bundesratsangelegenheiten erst montagnachmittags statt. Ähnliches gilt für andere wichtige Sitzungen u n d Gespräche, die f ü r die Kabinettssitzungen entscheidend sind. Sehr oft sind dafür die verspätet von den Ministerien eingehenden Kabinettsvorlagen ursächlich. 13 Diese Fakten w u r d e n übereinstimmend von den Befragten genannt u n d sind, auch unter Berücksichtigung der i n der Sache selbst liegenden Schwierigkeiten, nicht zuletzt auf die Tatsache zurückzuführen, daß die Regierungsmitglieder eben insoweit sehr „flexibel" bleiben wollen. 14 Obwohl der Ministerpräsident stets die Eigenständigkeit der Regier u n g betont, versucht er wichtige Fragen m i t der Partei/Fraktion abzuklären u n d abzustimmen. Der K o n t a k t zwischen Regierung u n d Partei/ F r a k t i o n dürfte zwar stärker sein als zur Zeit der Großen K o a l i t i o n ; trotzdem scheint aber nach w i e vor der Einfluß der CDU-Fraktion, insbesondere
§21 Die Kabinettsarbeit
161
Den vorstehenden Ausführungen zu der gegenwärtigen Praxis, nämlich der äußerst flexiblen und geschäftsordnungsmäßig nicht reglementierten Kabinettsvorbereitung und Aufstellung der Tagesordnung, kann folgendes vorläufige Zwischenergebnis entnommen werden: Als Folge dieser Praxis w i r d der Staatskanzlei gegenüber den Ministerien, abgesehen von dem Ressort, das die Vorlage eingebracht hat, oft ein gewisser Informationsvorsprung eingeräumt. Daraus resultiert zwangsläufig, daß dies grundsätzlich auch i m Kabinett zwischen Ministerpräsident und Minister g i l t 1 5 . 4. Ablauf der Kabinettssitzung Die Regierungsmitglieder nehmen insgesamt gesehen sehr zahlreich an den Kabinettssitzungen teil und lassen sich i m allgemeinen nur dann vertreten, wenn sie eine besonders wichtige unaufschiebbare andere Aufgabe wahrzunehmen haben. Die Vertretung selbst ist aber, was bereits oben § 13 dargelegt wurde, imbefriedigend und w i r d zudem sehr unterschiedlich gehandhabt. Dies kann allerdings sicher nicht allein auf das Fehlen einer entsprechenden geschäftsordnungsmäßigen Regelung zurückgeführt werden, sondern liegt i n nicht unwesentlichem Umfang auch i n der wenig glücklichen derzeitigen Konzeption und Organisation der Führung i n den Ministerien begründet (vgl. dazu unten § 23). Selbst i n einer Einparteienregierung ist es durchaus verständlich, wenn sich ein Minister, abgesehen von einzelnen fachlichen Tagesordnungspunkten, nur sehr ungern von einem weitgehend unpolitischen oder anderspolitischen Amtschef seines Ressorts (Lebenszeitbeamter) vertreten läßt. Dazu kommen noch i n den Ministerien, i n denen neben dem Ministerialdirektor ein politischer Staatssekretär berufen wurde, zusätzliche Kompetenzschwierigkeiten 16 . Diese Ausführungen zeigen, daß es letztlich nicht möglich ist, die Schwierigkeiten i n der Stellvertretung durch kleinere geschäftsordnungsmäßige Änderungen zu beseitigen, w o h l aber etwas zu reduzieren 17 . i m Vergleich zu den Regierungsfraktionen auf Bundesebene, nicht übermäßig groß zu sein. Dies g i l t vor allem f ü r mehr fachliche Fragen, die meist ohne entsprechende vorherige Konsultation entschieden werden. Vgl. dazu auch unten § 25. 15 Dieses „Zwischenergebnis" ist hier als reine Feststellung u n d keinesfalls als Wertung zu verstehen. Darauf w i r d weiter unten noch einzugehen sein. 18 Vgl. dazu oben §§ 15 u n d 16 (insbes. Fußnote 54 v o n § 16). 17 I n diesem Sinne ist w o h l auch die Diskussion über die Verbesserung der Kabinettsarbeit, die seit Herbst 1973 geführt w i r d , zu verstehen. Vgl. dazu etwa das f ü r die Ministerratssitzung v o m 2.10.1973 erarbeitete Arbeitspapier. Diskutiert w i r d i n diesem Zusammenhang auch die Stellvertretung bei n u r vorübergehender Abwesenheit eines Ministers (von jedem Ressort sollte ständig jemand anwesend sein). I i Katz
1 6 2 K a p . I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
Neben den Regierungsmitgliedern nehmen an den Kabinettsberatungen ständig der Amtschef und die Abteilungsleiter (mit Ausnahme der Abteilung V) der Staatskanzlei teil. Z u den einzelnen Tagesordnungspunkten werden außerdem von Seiten des Staatsministeriums immer die jeweils zuständigen Referenten hinzugezogen, während die Minister nur zu den sie betreffenden Punkten und auch nur dann, wenn dies aus fachlichen Gründen dringend geboten ist, ihren Ministerialdirektor, Abteilungsleiter oder Fachreferenten mitbringen. Die politischen Staatssekretäre nehmen neben ihrem Minister an den Kabinettssitzungen relativ selten und i n der Regel nur dann teil, wenn ein Tagesordnungspunkt den Aufgabenbereich betrifft, der von ihnen bearbeitet w i r d (so jedenfalls die Praxis von 1972 -1974). Nur i n wenigen Ausnahmefällen, meist bei hochpolitischen, umstrittenen Entscheidungen, tagt das Kabinett kurzfristig allein und bei Abwesenheit aller Nichtmitglieder. Die geschilderte Praxis zeigt, daß von Seiten des Staatsministeriums neben dem Ministerpräsidenten und den beiden Staatssekretären (Minister für Bundesangelegenheiten und Staatssekretär m i t Kabinettsrang) i m allgemeinen insgesamt noch acht Mitarbeiter ständig i n den Ministerratssitzungen anwesend sind 1 8 . Die A r t und Weise, sowie der äußere Ablauf der Beratungen des Kabinetts w i r d sehr stark von der Person des Vorsitzenden geprägt 19 . Während — etwas vereinfachend und pauschal ausgedrückt — Gebhard Müller i m Ministerrat mehr einen kollegialen Arbeitsstil bevorzugt hat, betonte K u r t Georg Kiesinger stärker die Richtlinienkompetenz des Regierungschefs und versuchte weitgehend den Bonner Regierungsstil unter Adenauer auf Bad.-Württ. zu übertragen. Hans Filbinger scheint einen dritten Weg zu gehen. Unter seiner Leitung w i r d der Ministerrat, wie vor allem bei G. Müller, als das zentrale Entscheidungsorgan für die Regierungsarbeit angesehen. I m allgemeinen werden alle bedeutenderen und politischen Entscheidungen i m Kabinett getroffen. Dabei darf aber nicht übersehen werden, daß die Beratung und Entscheidung doch ganz wesentlich vom Ministerpräsidenten geprägt wird. Abgesehen von der starken persönlichen und politischen Stellung von Hans Filbinger, die weitgehendst auch G. Müller und 18 Es handelt sich hierbei u m den Ministerialdirektor, f ü n f Abteilungsleiter u n d je einen Referenten der sachlich zuständigen A b t e i l u n g u n d der A b t . V I (Öffentlichkeitsarbeit). Personell ist demzufolge das Staatsministerium i n den Sitzungen i n aller Regel i n der Uberzahl. Bis vor kurzem hatten alle Referenten des Staatsministeriums sogar noch zu allen Punkten der Ministerratssitzungen Zugang. Aus Gründen der Geheimhaltung wurde dies dann allerdings eingeschränkt. 19 Eine sehr treffende Darstellung über die Persönlichkeiten u n d Arbeitsstile der einzelnen Ministerpräsidenten (R. Maier, G. Müller, K . G. Kiesinger u n d H. Filbinger) gibt F. Treff z-Eichhöf er, i n : Mannheimer Morgen v o m 15. 9.1973, S. 1. Vgl. dazu auch unten § 22.
§21 Die Kabinettsarbeit
163
K . G. Kiesinger besaßen, ist dies vor allem auf die intensive Vorbereitung der Ministerratssitzungen durch den Führungsapparat des M i n i sterpräsidenten (Staatsministerium) 20 und auf dessen stärkere Beteiligung unmittelbar bei den Beratungen selbst zurückzuführen. Dies w i r d nicht zuletzt auch dadurch bestätigt, daß, was bereits weitgehend schon durch die praktizierte Kabinettsvorbereitung präjudiziert wird, die meisten Regierungsmitglieder eine wesentliche Straffung nicht für notwendig halten, sondern den Ministerrat als eine eigene umfassende Informationsquelle und ein lebendiges unmittelbares Diskussionsforum verstehen. Muß sich aber ein Regierungsmitglied i n einer Kabinettssitzung, was nicht selten vorkommt, erst selbst ganz oder teilweise über einen Tagesordnungspunkt informieren, dann w i r d der Gehalt einer Kabinettsberatimg und der Wert einer Kollegialentscheidung verständlicherweise gemindert und die tatsächliche Rolle dessen, der die Vorlage eingebracht hat und besonders auch die des Ministerpräsidenten (Staatsministerium) gestärkt. Die Behandlung eines Tagesordnungspunktes läuft i m allgemeinen dergestalt ab, daß der Sachstand, wie er sich i n der Kabinettsvorlage bzw. Kabinettsvermerk darstellt, vom Ministerpräsidenten selbst, einem Minister oder dem Ministerialdirektor bzw. einem Abteilungsleiter des Staatsministeriums mündlich vorgetragen wird. Danach w i r d die Diskussion eröffnet, an der sich neben den Regierungsmitgliedern auch alle übrigen Anwesenden beteiligen können. Die Beratung w i r d zwar primär von den Kabinettsmitgliedern bestimmt, doch erteilt der Ministerpräsident regelmäßig auch den Nichtmitgliedern das Wort. Letzteres erfolgt vor allem zum Zwecke weiterer Information und des Einbringens von Sachverstand i n die Diskussion. Der Ministerpräsident selbst hält sich anfangs sehr m i t seiner Meinung zurück. Er hört sich i n der Regel zuerst die Argumente und Auffassungen der anderen Regierungsmitglieder an. Grundsätzlich ist er bestrebt, bestehende Meinungsverschiedenheiten und Konflikte beizulegen und zu einstimmigen Kabinettsentscheidungen zu kommen. Deshalb ist bei den Beschlüssen auch nur selten eine Abstimmung erforderlich. Die starke Stellung des Ministerpräsidenten i m Kabinett, die von allen Seiten bestätigt wird, beruht neben den bereits genannten Gründen auch auf dem Instrument der Verhandlungsleitung und dürfte w o h l auch zum 20 Während das Staatsministerium i m J a h r 1955 insgesamt 10 höhere Beamte zählte, w a r e n es 1965 insgesamt 16 u n d 1973 bereits 35! Vgl. dazu etwa H. Schneider, i n : Festschrift f ü r E. R. Huber, S. 167 (Fußnote 1) u n d die Staatshaushaltspläne des Landes Bad.-Württ., Einzelplan 02, K a p i t e l 0201 (vgl. dazu die Ubersicht unten § 24 Ziff. 2). Zusammen m i t der praktizierten Sitzimgsvorbereitung garantiert dies dem Staatsministerium eine herausragende Stellung i n der Kabinettsarbeit, was i n allen Interviews auch v o n Seiten der Ministerien durchaus gesehen u n d gewissermaßen respektiert w i r d . Darauf w i r d noch näher einzugehen sein.
Ii*
1 6 4 K a p . I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
Teil auf seinen politischen „Spürsinn", seinen Blick für das politisch Machbare und seine den Ausgleich suchende Mentalität zurückzuführen sein. Die Verhandlungsleitung gibt i h m mannigfaltige Möglichkeiten, die Beratung und den Entscheidungsprozeß zu beeinflussen. Er kann etwa, was er durchaus ab und zu tut, bei einem Tagesordnungspunkt, den er nicht für entscheidungsreif hält, vorschlagen, diesen Punkt nur zur Kenntnis zu nehmen oder zur Klärung einzelner Fragen einen interministeriellen Ausschuß einzusetzen, also die Entscheidung selbst zu vertagen. Weiter kann er etwa seine bestens informierten und gut vorbereiteten Mitarbeiter häufiger zu Wort kommen lassen. Schließlich hat der Ministerpräsident auch die Möglichkeit, vor einer Abstimmung das Beratungsergebnis zusammenzufassen und den endgültigen Entscheidungsvorschlag zu formulieren, wovon er regelmäßig Gebrauch macht; all dies gibt i h m einen nicht zu unterschätzenden Einfluß, vor allem bei umstrittenen Tagesordnungspunkten. I n den letzten Jahren ist, was bereits oben § 14 erwähnt wurde, i n den Beratungen mindestens nie ausdrücklich m i t der Richtlinienkompetenz argumentiert worden. Allerdings muß dabei auch erwähnt werden, daß i n dieser Zeit keine politisch wichtige Entscheidung gegen die dezidierte Auffassung des Ministerpräsidenten gefällt wurde. Neben der starken Stellung des Ministerpräsidenten haben i m Kabinett noch der Finanz-, teilweise auch der Kultus- und Innenminister eine etwas hervorgehobene Stellung 2 1 . Insgesamt zeigt sich aber, daß bei der gegenwärtigen Einparteienregierung die Minister gegenüber dem Ministerpräsidenten i m Kabinett i m allgemeinen keine besonders starke Stellung innehaben 22 . Insgesamt gesehen ist der Ministerrat ein intensives Informationsund Diskussionsforum. Dies birgt zweifellos gewisse Gefahren i n sich. So sollte etwa nach einer verbreiteten Meinung der Ablauf der Kabinettssitzungen stärker gestrafft werden. Zwar ist es ohne Frage notwendig, daß auf jeder Sitzung auch außerhalb der Tagesordnung besonders aktuelle und politisch wichtige Fragen beraten und über wichtige Dinge Zwischenberichte erstattet werden können; doch sollte dies, u m den Ministerrat nicht zu einem bloßen „Debattierclub" werden zu lassen, nur i n Fällen besonderer Dringlichkeit und Bedeutung erfolgen. Wenn irgend möglich ist also stets der normale Weg über eine ent21 Vgl. dazu oben § 20 Ziff. 3 (insbes. Fußnote 26). I n den Interviews wurde das Finanzministerium als das bestinformierte Ressort bezeichnet. 22 Selbst der Kultusminister hat sich etwa der Meinung des Ministerpräsidenten (Staatsministerium), die Hochschulabteilung i n zwei Abteilungen aufzugliedern (vgl. Stuttgarter Zeitung v o m 20.2.1973, S. 13) u n d auch das „ J a h r der Jugend" (1974) einzuführen, letztlich angeschlossen. I n einem I n t e r v i e w wurde von einem Beamten außerhalb des Staatsministeriums geäußert, daß „sich auch der Kultusminister einem Vorschlag des Staatsministeriums auf die Dauer nicht entziehen kann".
§21 Die Kabinettsarbeit
165
sprechende schriftliche Kabinettsvorlage (auch bei Zwischenberichten usw.) zu wählen 2 3 . 5. Protokoll und Beschlußausführung Für die Protokollanfertigung zeichnet letztlich der Ministerialdirektor verantwortlich. Die Protokollierung selbst liegt aber, von wenigen Ausnahmefällen abgesehen, i n den Händen dessen, der den entsprechenden Tagesordnungspunkt vorbereitet und den Kabinettsvermerk angefertigt hat, also i n der Regel beim zuständigen Referenten des Staatsministeriums. Von diesem werden prinzipiell zwei verschiedene Fassungen des Protokolls angefertigt, nämlich ein ausführliches und ein Kurzprotokoll. Bei nicht strittigen, „glatten" Tagesordnungspunkten (Regelfall) w i r d jedoch meist nur eine Protokollfassung (kürzere) angefertigt. I n den übrigen Fällen unterscheidet sich das ausführliche Protokoll von der Kurzfassung dadurch, daß die Sachdebatten einschließlich der Meinungsverschiedenheiten sehr viel ausführlicher dargestellt und zusätzlich die Abstimmungsergebnisse m i t ins Protokoll aufgenommen werden. Protokollberichtigungsanträge, über die i n der Regel der Ministerialdirektor entscheidet, werden gegenwärtig, i m Unterschied zur Zeit der Großen Koalition (1966 -1972), nur sehr selten vorgebracht. Die A r t und Weise der Protokollanfertigung ist i m Prinzip nichts besonderes, doch kann unter Berücksichtigung des „lockeren" Verhandlungsstils, vor allem bei höchst brisanten und schwierig zustandegekommenen Kompromissen, durchaus die Formulierung des Protokolls von großer Bedeutung sein 24 . Die Ausführung der Kabinettsbeschlüsse obliegt grundsätzlich den Ministerien. Sie haben die i n ihr Ressort fallenden Entscheidungen des Ministerrats zu verwirklichen. Dabei hat aber auch das Staatsministerum wichtige Aufgaben wahrzunehmen 25 . Der zuständige Referent und auch der Abteilungsleiter verfolgen aufmerksam die Durchführung der Beschlüsse und achten besonders auf die Einhaltung von festgelegten Fristen und Termine. Vor allem das vom Ministerrat i m März 1973 beschlossene Arbeitsprogramm der Landesregierung, das für die laufende Legislaturperiode (1972 - 1976) aufgestellt wurde und jährlich fortgeschrieben wird, bietet der Staatskanzlei gewissermaßen die Hand23
Vgl. dazu auch unten § 21 Ziff. 6. Dies wurde von einigen Befragten auch durchaus zugegeben. Nicht zuletzt ist dies darauf zurückzuführen, daß i m K a b i n e t t eben oft die Mehrzahl der Anwesenden aus dem Staatsministerium selbst k o m m t (vgl. oben Fußnote 19). 25 Schon die umfassende publizistische Auswertung der Kabinettsbeschlüsse durch die Pressestelle der Landesregierung (Abt. V I der Staatskanzlei) bringt dabei das zuständige Ressort i n einen A r t „öffentlichen" Zugzwang. 24
166
Kap. I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
habe für eine „Überwachung" der gesamten Regierungsarbeit, allerdings weitgehend allein unter zeitlichen Aspekten 2 6 . 6. Reformüberlegungen zur Kabinettsarbeit Die Frage der Verbesserung der Kabinettsarbeit beschäftigte den Ministerrat vor allem Ende 1973 und Anfang 1974. Bei dieser Diskussion, bei der es besonders u m eine verbesserte Vorbereitung und Straffung der Sitzungen ging, zeigte sich allerdings bald, u m das Ergebnis bereits vorwegzunehmen, daß gegenwärtig wesentlichere Änderungen i m Ablauf der Kabinettsarbeit nicht realisierbar sind 2 7 . Selbst kleinere formale Verbesserungen i n der Sitzungsvorbereitung und Aufstellung der Tagesordnung konnten i m Endergebnis nicht verwirklicht werden 2 8 . Der Grund dafür dürfte teilweise i n der mehrheitlichen Auffassung der Kabinettsmitglieder zu suchen sein, daß sich die derzeitige Praxis durchaus bewährt habe und sie darüber hinaus auch „bequem" sei. Vor allem zur Unterstützung des zweiten Arguments w i r d immer wieder betont, daß der besondere Vorteil des bad.-württ. Kabinettsstils in einem großen „Informations- und Ideengewinn" begründet sei 29 . Neben dem Problem der Kabinettsvorbereitung (vgl. dazu oben Ziff. 1 bis 3) w i r d von einigen Regierungsmitgliedern und von einem Großteil der Befragten bemängelt, daß die Sitzungen nicht „gestrafft" genug abgehalten würden, daß zu viel Kleinkram und Ballast diskutiert würde und für die Beratung politisch besonders wichtiger Dinge insgesamt zu wenig Zeit verbleibe. Ob dies der Wirklichkeit entspricht, konnte durch die Interviews nicht eindeutig festgestellt werden. Deshalb wurden zur Beantwortung dieser Frage zusätzlich die Tagesordnungen des M i n i sterrats (vom 1.1.1973 - 30. 6.1974) statistisch ausgewertet 30 . Eine Ana26 Derzeit g i l t das fortgeschriebene Arbeitsprogramm der Landesregierung v o m 22. 3.1974. A u f das Arbeitsprogramm w i r d noch unten § 24 Ziff. 5 näher einzugehen sein. 27 Deshalb w ü r d e m. E. auch der Erlaß einer Geschäftsordnung, m i t der manches durchaus verbessert werden könnte, letztlich die bestehende Praxis nicht verändern. 28 I n einem v o m Staatsministerium verfaßten Arbeitspapier w u r d e n sieben Verbesserungsvorschläge zur bestehenden Verfahrensregelung unterbreitet (u. a. rechtzeitiges — i n der Regel 3 Wochen — Einreichen der Kabinettsvorlagen, vorherige umfassende interministerielle A b s t i m m u n g der V o r lagen, Vermeidung von längeren Wartezeiten f ü r Referenten usw.). 29 So w ö r t l i c h oder ähnlich mehrere Kabinettsmitglieder i n der Ministerratssitzung v o m 2.10.1973. 30 A n h a n d der gesamten Tagesordnungen, i n der jeweils endgültigen schriftlichen Fassung, w u r d e n sämtliche Punkte i n 21 verschiedene K a t e gorien eingeteilt. Die statistische Auswertung ergab f ü r die einzelnen K a t e gorien folgende Zahlen: Vorbereitung Landtagssitzungen 25; Große Anfragen 44; Kleine Anfragen u n d ähnl. 39; Gesetzesvorhaben u n d - i n i t i a t i v e n 91; Verordnungen usw. 44; Bundesrat 60; andere Bundesangelegenheiten 22; Grundsatzprogramme u. -Planungen 13; Fachprogramme 32; aktuelle Sach-
§21 Die Kabinettsarbeit
167
lyse der bei dieser Erhebung gewonnenen Ergebnisse läßt, selbst bei der gebotenen Zurückhaltung hinsichtlich eindeutigen Aussagen, folgende hier interessierenden Tendenzen erkennen: (1) Die Praxis zeigt, daß unter den Regierungsmitgliedern ein starker Trend zur Kollegialentscheidung besteht und zwar meist noch weit über die verfassungsrechtliche Regelung des A r t . 49 I I L V hinaus. Die Minister bringen sehr viel, insbesondere all die Dinge, die irgendwie — sei es auch nur regional — politisch sind oder werden können, ins Kabinett. Dies scheint u. a. beim Kultus-, Wirtschafts- und L a n d w i r t schaftsministerium besonders ausgeprägt zu sein. Darin dürfte sicher zum Teil ein „Abschieben" der politischen Verantwortung, selbst bei unwichtigeren Dingen, auf eine breitere Verantwortungsbasis, ein „anonymeres Organ", das Kabinett, zu sehen sein. Diese Tendenz, die vom Staatsministerium nicht ungern gesehen wird, liegt wohl überwiegend i n der personellen Zusammensetzung des Kabinetts und damit letztlich i n der starken Stellung des Ministerpräsidenten begründet. Die erstellte statistische Erhebung zeigt dies überdeutlich. Während bei den aktuellen, kurzfristigen, politischen oder sachlichen Fragen diejenigen ohne große und grundsätzliche Bedeutung (unwesentlichere Fragen) 214-mal auf die Tagesordnung gesetzt und beraten wurden, betrug i n demselben Zeitraum die entsprechende Zahl bei denjenigen m i t besonderer oder weittragender Bedeutung (einschl. der Punkte, die das Kabinett formell beschließen muß) 84. Dies zeigt, daß i n der Tat gegenwärtig eine gewisse Neigung besteht, unnötig viel „Kleinkram" ins Kabinett zu bringen und selbst „unwesentliche Fragen politisch vom Ministerrat absegnen zu lassen" 31 . Hier könnte also, unter Beachtung des A r t . 49 I I L V , einiges verbessert werden. (2) Eine weitere erkennbare Tendenz kann dahingehend umschrieben werden, daß die Regierungsmitglieder, besonders aber auch der M i n i sterpräsident und das Staatsministerium, versuchen, all die Dinge auf fragen ohne bes. Bedeutung 214; aktuelle Fragen von pol. oder sachl. Wichtigkeit (einschl. a l l der Dinge, über die das K a b i n e t t formell beschließen muß) 84; mündl. Berichte als reine Information 122; Zwischenberichte m i t Festlegung von Zielvorgaben u n d Grundsätzen 9; Verwaltungsreform 50; Haushalt 24; Organisation 22; Personal 102; Landespressekonferenz, Ordensverleihungen u n d Einladungen j e 55. Eine Analyse anhand dieser statistischen Erhebung ist sicher nicht unproblematisch. So k a n n etwa dabei der Zeitaufw a n d f ü r den einzelnen Tagesordnungspunkt nicht berücksichtigt werden. Außerdem ist die Einklassifizierung i n die einzelnen Gruppen für einen Außenstehenden nicht i m m e r einfach. Auch konnten Änderungen, Absetzungen oder Vertagungen von Tagesordnungspunkten die erst i n der Sitzung selbst erfolgten, nicht beachtet werden. Trotzdem liefert die Statistik, v o r allem wegen ihres langen Erhebungszeitraums, brauchbare Anhaltspunkte und läßt vorsichtige Schlüsse zu (zusammen m i t den Ergebnissen der Befragungen). Vgl. dazu auch F. Knöpfle, i n : Die Staatskanzlei, SHS Bd. 34, S. 48 f. 31 Diese bestehende Gefahr wurde von fast allen Befragten bestätigt.
1 6 8 K a p . I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
die Tagesordnung des Kabinetts zu bringen, die unter dem Gesichtspunkt der öffentlichkeits- und Pressearbeit von einer gewissen Bedeutung sind 3 2 . Es erscheint angestrebt zu werden, daß sich der Ministerrat mit all den Fragen beschäftigt, die sich entweder als eine Reaktion auf Aktionen i n der Bevölkerung oder Presse, seien es auch, was durchaus häufig vorkommt, nur solche lokaler A r t , darstellen oder als besonders publizistisch verwertbar und pressewirksam gelten. Neben den oben genannten eindrucksvollen Zahlen ergibt sich dies aus den Bezeichnungen der Tagesordnungspunkte selbst. (3) Bei den Interviews wurde immer wieder betont, daß i m Kabinett einerseits zuviel und andererseits zuwenig (Zwischen-)Berichte erstattet werden. Dieser scheinbare Widerspruch läßt sich sehr deutlich durch die statistische Erhebung auflösen. Während mündliche Berichte, als reine Informationsberichte ohne grundsätzliche oder weittragende Bedeutung, insgesamt 122-mal auf der Tagesordnung standen, erschienen die restlichen Berichte (politisch und sachlich bedeutsame Z w i schenberichte, bei denen meist Grundsätze und Zielvorgaben festgelegt wurden) nur 9-mal auf der Tagesordnung. Diese Zahlen zeigen i n Übereinstimmung m i t den Befragungsergebnissen selbst bei aller Vorsicht, daß sich der Ministerrat offensichtlich zu sehr m i t weniger bedeutsamen tagespolitischen, überwiegend reaktiven Angelegenheiten beschäftigt und sich zu wenig wichtigen, grundlegenden, längerfristigeren Fragen und der Feststellung von Zielvorgaben und Rahmenrichtlinien widmet. Hier wäre eine Änderung vor allem i n der Prioritätensetzung (insbesondere zeitlich) dringend geboten. Die hier genannten und auch alle anderen i n diesem Abschnitt dargestellten Mängel i n der Kabinettsarbeit, die überwiegend die Vorbereitung und den äußeren Ablauf der Sitzungen betreffen, könnten eigentlich ohne größeren Aufwand und Schwierigkeiten behoben werden. Es erstaunt deshalb, daß die gesamte Diskussion über die Verbesserung der Kabinettsarbeit praktisch i m Sande verlaufen ist. Die Gründe dafür wurden bereits oben kurz dargelegt. Abschließend scheint es aber notwendig zu sein, die zwei Hauptargumente, die die bestehende Praxis bestätigt und verfestigt haben und zugleich die strukturellen und personellen Grundprobleme der Kabinettsarbeit beinhalten, noch etwas näher zu untersuchen. Das strukturelle Grundproblem wurde bereits oben Ziff. 4 kurz angesprochen. Dort ist schon festgestellt worden, daß die gegenwärtig unbefriedigende Regelung der Stellvertretung i m Kabinett teilweise 32 Die Pressestelle der Landesregierung, die A b t . V I des Staatsministeriums, darf grundsätzlich n u r das publizistisch verwerten, was i m Kabinett beraten u n d beschlossen wurde. Den Ministern geht es letztlich auch hier vor allem u m die politische Absicherung.
§21 Die Kabinettsarbeit
169
auf die rechtlich, daneben aber teilweise auch auf die faktisch wenig befriedigende Stellung der Amtschef der Ministerien zurückzuführen ist. Die Ministerialdirektoren, die die allgemeinen Stellvertreter der Minister sind, besitzen den Status eines Lebenszeitbeamten und unterliegen i n vollem Umfange den beamtenrechtlichen Vorschriften. Dies bedeutet, daß die Amtschefs normalerweise für ca. 10 - 20 Jahre ernannt werden und i m übrigen nur aus dem Kreis derer ausgewählt werden können, die die beamtenrechtlichen Voraussetzungen mitbringen. Infolgedessen hat ein Minister, der jeweils für vier Jahre berufen wird, nur selten Einfluß auf die Besetzung (Person) seines allgemeinen Stellvertreters. I n der Praxis sieht dies so aus, daß bei der letzten Regierungsbildung i m Juni 1972, bei der sechs der zehn Kabinettsmitglieder erstmalig berufen wurden, nur ein Ministerialdirektorenposten neu zu besetzen war. 1974 befand sich unter den Amtschefs nur einer, der von seiner tatsächlichen Stellung her faktisch als „politischer Beamter" angesehen werden konnte 8 3 . Alle anderen Ministerialdirektoren, unter denen sogar bei der derzeitigen CDU-Alleinregierung noch ein SPD-Mitglied zu finden ist, dürften ihr A m t i m wesentlichen i m Sinne der traditionellen Auffassung (beamtete Amtschefs) verstehen 34 . A u f diesem Hintergrund ist es denn auch kaum verwunderlich, daß der Ministerrat den Vorschlag, zur Vorbereitung der Kabinettssitzungen eine sog. Amtschefkonferenz einzuführen, nicht weiter verfolgte und auch kaum ernsthaft diskutierte 8 5 . Gerade dieser Vorschlag dürfte 33
Die Einbeziehung dieses Amtschefs i n die politische Verantwortung (einstimmige Kabinettsmeinung) w u r d e nach außen dadurch dokumentiert, daß i h m der T i t e l Staatssekretär verliehen wurde. Damals (1972/1973) weiteren Amtschefs den T i t e l Staatssekretär zu verleihen u n d sie damit i n die „politische Verantwortung einzubeziehen", konnte sich das K a b i n e t t nicht durchringen. Vgl. neuerdings zu dieser Frage: Südwestpresse, Schwäb. Tagblatt v o m 3.12.1974, S. 1. 34 Vgl. dazu näher oben § 16 Ziff. 7 und auch unten § 23 Ziff. 2 u n d 3. Damit soll aber keinesfalls gesagt werden, daß ein Ministerialdirektor keine politischen Funktionen auszuüben hat. Vielmehr sehen sie entsprechend der Rechtstradition i n Baden u n d Württemberg u n d den hergebrachten G r u n d sätzen des Berufsbeamtentums (Art. 33 V GG) ihre Hauptaufgabe darin, parteipolitisch neutral die erlassenen Rechtsnormen u n d Kabinettsbeschlüsse o b j e k t i v auszuführen u n d damit die erforderliche Stabilität u n d K o n t i n u i t ä t der Ministerialverwaltung zu sichern. Sie versuchen eben nach w i e vor w e i t gehend zwischen dem Wirkungsbereich der Beamtenschaft u n d den parteipolitischen Aufgaben zu unterscheiden. Vgl. dazu etwa K . Hahn„ i n : Z B R 1962, S. 346, 349; B. Wilhelm, i n : ZBR 1966, S. 357, 360. Allgemein vgl. öffentlicher Dienst u n d politischer Bereich, SHS Bd. 37; U. Echtler, Der beamtete Staatssekretär u n d R. Schunke, Die politischen Beamten; B. Steinkemper, Klassische u n d politische Bürokraten i n der Ministerialverwaltung der Bundesrepublik Deutschland. 35 Diese Konferenz sollte insbes. den Sinn haben, zwischen den Ressorts unstreitige, i n der Regel administrative Angelegenheiten, weitgehend außerhalb des Kabinetts „vorzuentscheiden", damit der Ministerrat den eigentlichen politischen Fragen größere Aufmerksamkeit w i d m e n kann.
1 7 0 K a p . I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
aber, wie die Erfahrungen aus anderen Bundesländern zeigen, für eine Straffung und damit Steigerung der Effektivität der Kabinettsarbeit besonders geeignet sein 36 . Aus den vorstehenden Ausführungen w i r d deutlich erkennbar, daß eben die Regierungsmitglieder zum Teil ihre allgemeinen Vertreter (Ministerialdirektoren) nicht als ihre (persönlich vertrauten) politischen Vertreter ansehen und von ihnen bei der Kabinettsarbeit vor allem i n hochpolitischen Angelegenheiten relativ häufig keine allgemeine Unterstützung und Entlastung erwarten 8 7 . Bereits oben Ziff. 4 wurde betont, daß der Gehalt einer Kabinettsberatung und der Wert einer Kollegialentscheidung nicht unwesentlich beeinträchtigt wird, wenn sich die Mehrheit der Regierungsmitglieder über einzelne Tagesordnungspunkte erst i n der Sitzung selbst informieren müssen (Informationsgremium). Darin liegt das zweite Hauptproblem begründet. Es ist i n diesem Zusammenhang etwa sehr bedenklich, wenn gegen die Amtschefkonferenz damit argumentiert wird, daß i m Falle ihrer Einführung die Minister ein mehrfaches an Zeitaufwand für die Vorbereitung der Sitzungen aufbringen müßten 8 8 . Vor allem i m Hinblick auf die bad.-württ. Regierungsstruktur, insbes. A r t . 49 I I LV, wonach aufgrund der hervorgehobenen Stellung des Kabinetts die gesamtstaatlichen, allgemeinverantwortlichen Aufgaben eines Ressortchefs i m Ministerrat besonders stark betont sind (vgl. dazu ausführlich oben § 15), ist dies unverständlich. Diese Ausführungen und die gesamte Diskussion über die grundsätzliche Gestaltung der Kabinettssitzungen läßt den vorsichtigen Schluß zu, daß sich die Regierungsmitglieder nicht selten nur auf die Punkte vorbereiten, bei denen sie oder ihr Ministerium selbst betroffen sind 3 9 . Daß dies nicht der ratio des A r t . 49 I I L V entspricht, ist offensichtlich 40 . Die oben § 18 gestellte Frage, ob i n der VerfassungsWirklichkeit die staatsrechtliche Ausgestaltung des Regierungssystems (vor allem bezügl. der Vorrangstellung des Kabinetts) beachtet wird, kann nach den bisherigen Untersuchungen vorläufig dahingehend beantwortet wer36
Vgl. vor allem etwa Bayern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz. Hier w i r d n u r der Frage nachgegangen, w i e sich faktisch u n d politisch die I n s t i t u t i o n der Amtschefs (Ministerialdirektoren) i m Hinblick auf die Kabinettsarbeit auswirkt. Aus diesen Äußerungen können also noch keine endgültigen Schlüsse auf die Zweckmäßigkeit der bestehenden Einrichtung (insgesamt) gezogen werden. Darauf w i r d noch unten § 23 näher einzugehen sein. 88 Dieses A r g u m e n t ist sinngemäß einem Kabinettsvermerk des Staatsministeriums f ü r die Ministerratssitzung am 2.10.1973 entnommen. 39 Diese Diagnose w i r d auch weitgehend durch die geführten Interviews bestätigt. Eine gewisse Ausnahme macht hier allerdings, was überwiegend sachliche Gründe hat, der Finanzminister. 40 Hier muß, nicht zuletzt auch auf organisatorischer Ebene, nach A b h i l f e gesucht werden (Verstärkung der Kabinettsvorbereitung i n allen Ressorts). Vgl. dazu unten § 23 Ziff. 2. 37
§ 22 Der Ministerpräsident
171
den, daß dies formell voll, materiell aber nur teilweise zu bejahen ist. Einem „formellen Übersoll" (durch unbedeutendere Tagesordnungspunkte) steht hier gewissermaßen ein „materielles Defizit" gegenüber.
§ 22 Der Ministerpräsident Eine empirische Darstellung und Untersuchung der Persönlichkeit, des Arbeitsstils und überhaupt der gesamten Tätigkeit des Ministerpräsidenten stößt i m Rahmen der vorliegenden Arbeit auf große Probleme und Schwierigkeiten. Denn das A m t und die Person des M i n i sterpräsidenten Hans Filbinger konnten i m Rahmen der durchgeführten Befragungen nur unvollständig „erhellt" werden 1 . Darin liegt auch der Grund dafür, daß die Ausführungen zu dem Regierungsorgan Ministerpräsident insgesamt alles andere als umfassend, sondern eher „mager", teilweise sogar lückenhaft sind. Gleichwohl w i r d es zusammen mit den Untersuchungen und Ausführungen zur Kabinettsarbeit (vgl. oben § 21) und zum Staatsministerium (vgl. unten § 24) möglich sein, ein einigermaßen verläßliches, teilweise allerdings auch nur ein etwas grobes Gesamtbild von der Person 2 und besonders von der Stellung des Ministerpräsidenten zu zeichnen. 1. Aufgaben des Ministerpräsidenten Die Tätigkeiten des Ministerpräsidenten sind äußerst vielfältig und nur zum Teil von der Verfassung her bestimmbar. F. Knöpfle 3 führt i n Bezug auf die Aufgaben und Funktionen zutreffend aus, daß „ein Regierungschef, der sich darauf beschränkt, nur seine verfassungsmäßigen Aufgaben zu erfüllen, die traditionellen Verhaltenserwartungen seiner politischen Freunde und breiter Bevölkerungskreise enttäuschen würde und kaum eine Chance hätte, ein zweites M a l ins A m t berufen zu werden. Die Öffentlichkeit und die den Regierungschef tragenden politischen Kräfte stellen sich i h n nicht nur als den großen 1 Dies ist allerdings m i t Sicherheit keine Besonderheit v o n Bad.-Württ. Auch i n der L i t e r a t u r finden sich zwar zahlreiche Aufsätze usw. über die Staatskanzlei deren Organisation u n d Aufgaben, wenige allerdings über die Person u n d Stellung des Regierungschefs selbst. Vgl. etwa: Die Staatskanzlei, SHS Bd. 34; Projektgruppe BMI, Erster Bericht m i t Anlagenband; K . von Beyme, i n : PVS 1969, S. 249 ff. 2 Die Ausführungen über die Person des Ministerpräsidenten sind m i t allem Vorbehalt zu verstehen, da sie allein politischer Beobachtung u n d k e i ner nachvollziehbaren Analyse entstammen. Vgl. etwa T. Ellwein, Regierungssystem, S. 330 f. 3 F. Knöpfle, i n : Die Staatskanzlei, SHS Bd. 34, S. 47. Die Mannigfaltigkeit der Tätigkeiten des Ministerpräsidenten w i r d i n der Aufzählung bei F. Knöpfle, ebd., S. 48, die keinesfalls n u r ausgefallene, sondern durchaus alltägliche Punkte enthält, besonders deutlich.
172
Kap. I I I : Organisation und S t r u k t u r der Landesregierung B W
Z u k u n f t s p l a n e r v o r , s o n d e r n ebenso sehr als d e n L a n d e s v a t e r , der sich d e r verschiedenen A n l i e g e n u n d K ü m m e r n i s s e auch n u r e i n i g e r m a ß e n a r t i k u l a t i o n s f ä h i g e r G r u p p e n a n n i m m t " . Diese A u s f ü h r u n g e n zeigen, daß die T ä t i g k e i t e n des M i n i s t e r p r ä s i d e n t e n k a u m bis i n s einzelne beschrieben b z w . s y s t e m a t i s i e r t w e r d e n k ö n n e n u n d entsprechend d e n p o l i t i s c h e n E r w a r t u n g e n u n d N o t w e n d i g k e i t e n w e i t g e h e n d v o n den U m w e l t e i n f l ü s s e n , d. h. v o n d e m j e w e i l i g e n G a n g d e r Ereignisse festgelegt. also g e w i s s e r m a ß e n f r e m d b e s t i m m t w e r d e n , w o b e i a l l e r d i n g s f ü r d e r e n A u s ü b u n g durchaus noch e i n S p i e l r a u m f ü r d e n persönlichen S t i l des M i n i s t e r p r ä s i d e n t e n b l e i b t . E i n S t u d i u m d e r v o n der Pressestelle der L a n d e s r e g i e r u n g v e r ö f f e n t l i c h t e n T e r m i n p r o g r a m m e des M i n i s t e r p r ä s i d e n t e n v e r a n s c h a u l i c h t recht d e u t l i c h die V i e l f a l t u n d auch die Tagesbezogenheit seiner T ä t i g k e i t e n u n d e r g i b t f ü r i h n n o r m a l e r w e i s e f o l g e n d e n t e r m i n l i c h e n W o c h e n f a h r p l a n (als G r o b r a s t e r ) 4 : Montag:
Vorbereitung der Wochenarbeit i m Staatsministerium, B u n desvorstandssitzung der C D U (Präsidium) i n Bonn oder Landesvorstandssitzung der CDU i n Stuttgart.
Dienstag:
Vorbereitung der Kabinettssitzung, Arbeitsessen, Ministerrat.
Mittwoch:
Landespressekonferenz („Verkauf" der Kabinettsarbeit), Gespräche m i t CDU-Landtagsfraktionen 5 .
Donnerstag/ Freitag:
Teilnahme an Plenarsitzungen des Landtags oder Wahrnehm u n g von Bundesratsaufgaben, Ministerpräsidentenkonferenz i n Bonn oder Kreisbereisungen usw. 6 .
Samstag/ Sonntag:
Parteiveranstaltungen, offizielle u n d inoffizielle gesellschaftliehe oder gesellschaftspolitische Veranstaltungen 7 .
4 Hierbei müssen allerdings gewisse Vorbehalte angebracht werden. Die Terminprogramme der Pressestelle stellen n u r einen äußerst groben und lückenhaften „ F a h r p l a n " dar. Da aber die detaillierten Tagespläne des Ministerpräsidenten nicht eingesehen werden konnten, mußte trotz gewisser Bedenken auf die Terminprogramme zurückgegriffen werden, die aber zusätzlich durch zahlreiche Interviews ergänzt u n d untermauert wurden. 5 E i n typischer Mittwoch-Tagesablauf: 10 U h r Vorbesprechung der L a n despressekonferenz; 11 U h r Landespressekonferenz; 14 U h r Gespräch m i t FraktionsVorsitzenden; 15 U h r Gespräch m i t Oberbürgermeister (Gemeindereform); 16 U h r Antrittsbesuche eines Generalkonsuls u n d eines Konsuls; 17 U h r Gespräch m i t Teilnehmern einer Expedition (Dia-Vorführung); 19 U h r Einladung der Landespressekonferenz. 6 E i n Donnerstag-Ablauf: 10 U h r Gespräch m i t D A G - V e r t r e t e r n ; 11 U h r Antrittsbesuch eines Generals; 12 U h r Ordensverleihung; 14 U h r Sitzung der Landtagsfraktion; 16.30 U h r Besprechung m i t Landräten, Vorsitzenden der Regionalverbände usw.; 21 U h r Fernsehdiskussion — l i v e —. E i n Freitag-Tagesablauf: 8 U h r A b f l u g nach Bonn; 9.30 U h r Bundesrat — Plenarsitzung — ; 12.30 U h r Frühstücksempfang; 14 U h r Gespräch der Ministerpräsidenten m i t dem Bundeskanzler; 19.30 U h r Empfang i n der bad.w ü r t t . Landesvertretung. 7 E i n Samstag-Tagesablauf: 9 U h r Bezirksparteitag; 15 U h r Eröffnung einer Ausstellung; 17 U h r Gespräch m i t einem K a r d i n a l ; 20 U h r Besuch einer Theaterpremiere.
§ 22 Der Ministerpräsident
173
Zwischen und zusätzlich, vor allem abends, zu diesen längerfristig feststehenden Programmpunkten finden natürlich noch zahlreiche weitere Sachgespräche, Empfänge, Parteiveranstaltungen usw. statt. Die gesamten Aufgaben und Tätigkeiten eines Ministerpräsidenten, der wie H. Filbinger zugleich Landesvorsitzender seiner Partei, M i t glied des Bundesvorstandes dieser Partei und auch Landtagsabgeordneter ist, können grob i n drei Tätigkeitssphären untergliedert werden: Repräsentations-, Regierungs- und Parteibereich 8 . (1) Die staatsoberhauptlichen Repräsentationsaufgaben und -funktionen sollen hier i n einem umfassenderen Sinne verstanden werden. Darunter fallen dann neben den klassischen staatsoberhauptlichen A u f gaben (vgl. oben § 14)9 und den gesamtstaatlichen Integrationsfunktionen auch all jene Tätigkeiten, bei denen der Ministerpräsident überwiegend nicht als Regierungs- oder Parteichef, sondern als oberster Repräsentant des Landes („Staatsoberhaupt") auftritt. Die dazu durchgeführten Erhebungen zeigen 10 , daß die Aufgaben der Vertretung des Landes nach außen, der Beamtenernennung, der Begnadigung, des Protokolls usw. zwar i n zeitlicher Hinsicht einen beachtlichen Raum einnehmen, aber i m Vergleich zu anderen Ländern nicht überbetont sind, sondern gegenwärtig eher die Tendenz besteht (vor allem bei den klassischen Protokollangelegenheiten), sie auf das Notwendigste zu beschränken 11 . Daneben gewinnen aber unter H. Filbinger die Tätigkeiten immer mehr an Bedeutung, bei denen er primär i n seiner Funktion als Staatsoberhaupt, als Landesvater auftritt. Hiermit sollen gewissermaßen die klassischen Protokollangelegenheiten usw. durch eine volksnahe und öffentlichkeitswirksame Repräsentation ergänzt werden. Dies erfolgt vor allem durch Volksempfänge, Gespräche mit allen Berufs- und Gesellschaftsgruppen, Teilnahme an kulturellen, kirchlichen, sportlichen Veranstaltungen und dergleichen mehr. Dabei ist allerdings zu bemerken, daß die Grenzen zwischen dem Repräsentationsbereich einerseits und dem Regierungs- bzw. Parteibereich andererseits oft fließend sind 1 2 . 8 Vgl. oben § 14 u n d etwa F. Duppre, i n Mayer-Ule (Hrsg.), Staats- u n d Verwaltungsrecht i n Rh.-Pf., S. 42 ff. 9 Vgl. dazu eingehend O. Uhlitz, i n : DÖV 1966, S. 293 ff. m. w. N. 10 Diese Erhebungen beruhen einerseits auf einer vorsichtigen Analyse der Terminprogramme f ü r 1974 (vgl. Fußnote 4) u n d andererseits auf zahlreichen Interviews. 11 Diese Aufgaben werden weitgehend von den Abteilungen I u n d V wahrgenommen. A n dieser Aussage ändert auch die Tatsache nichts, daß für Fragen des Protokolls u n d damit verwandte Dinge eine eigene A b t e i l u n g i m Staatsministerium besteht (vgl. unten § 24 Ziff. 2). 12 So stellen etwa die sogen. Kreisbereisungen einen solchen Grenzfall dar. Einerseits liegt der Sinn dieser Veranstaltung darin, daß der Landesvater i n
1 7 4 K a p . I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
(2) Die Aufgaben des Ministerpräsidenten als Regierungschef (vgl. oben § 14) liegen i m wesentlichen i n seinen Funktionen i m Ministerrat 1 8 und als Chef des Staatsministeriums 14 begründet, wobei beide Unterbereiche eng miteinander verflochten sind. Außerdem sind zu diesem Bereich all jene Tätigkeiten zu rechnen, die er eben i n seiner Eigenschaft als Chef der Regierung ausübt. (3) Ministerpräsident H. Filbinger hat darüber hinaus auch i m parteipolitischen Bereich sehr bedeutende Ämter inne. Er ist Landesvorsitzender der CDU i n Bad.-Württ. und seit einiger Zeit Mitglied des Bundesvorstandes seiner Partei. Weiter ist er Abgeordneter des Lantags und hat i n dieser Eigenschaft einen Wahlkreis zu betreuen. Die Aufgaben bei der Ausübung seiner Parteiämter sind deshalb auch i n zeitlicher Hinsicht von beachtlichem Ausmaß und seit seiner Wahl i n den Bundesvorstand der CDU noch erheblich gestiegen. Bei den durchgeführten Interviews war ein Großteil der Befragten der Auffassung, daß es gewissermaßen den Idealfall darstellen würde, wenn der Ministerpräsident für jeden der drei vorgenannten Tätigkeitsbereiche ein D r i t t e l seiner gesamten Arbeitszeit zur Verfügung stellen würde 1 5 , wobei aber eingeräumt wurde, daß gegenwärtig die Repräsentationsaufgaben i m hier verstandenen Sinne insgesamt etwas i m Vordergrund stünden 16 . Ob allerdings die als ideal bezeichnete Grundaufteilung der A u f gaben und Funktionen des Ministerpräsidenten den staatspolitischen Erfordernissen eines Landes entspricht, scheint mindestens zweifelhaft zu sein. Eine abschließende A n t w o r t darauf könnte sicher erst eine eingehende besondere Untersuchung dieser Frage bringen 1 7 . Gleichwohl haben auch die zu den Aufgaben des Ministerpräsidenten vorgenomregelmäßigen Zeitabständen (etwa alle 4 Jahre) jeden Kreis des Landes besucht. Z u m anderen w i l l der Regierungschef dabei an Ort u n d Stelle u n m i t telbar die brennenden Probleme u n d Anliegen der einzelnen Landesteile kennenlernen. 13 Vgl. dazu eingehend oben § 21. 14 Dazu w i r d allgemein, einschließlich der Festlegung der Richtlinien der P o l i t i k u n d des Regierungsprogramms, unten § 24 noch näher einzugehen sein. 15 Hier soll nicht untersucht werden, ob es sinnvoll u n d zweckmäßig ist, alle drei Tätigkeitsbereiche i n einer H a n d zu vereinen (vgl. gegenwärtige Situation i n Bonn), obwohl die Untersuchungen m i t u n t e r erkennen ließen, daß der Regierungsbereich, vor allem bei m i t t e l - u n d langfristigen Fragen, ab u n d zu einer etwas stärkeren politischen Führungshand bedarf. 16 Dies w i r d durch die Terminprogramme der Pressestelle der Landesregier u n g bestätigt. Hinsichtlich notwendiger Vorbehalte zu dieser Aussage vgl. oben Fußnote 4. 17 Eine solche Untersuchung dürfte allerdings schon v o m tatsächlichen her auf enorme Schwierigkeiten stoßen u n d sollte deshalb von einem „Insider" vorgenommen werden.
§ 22 Der Ministerpräsident
175
menen Erhebungen verdeutlicht und damit bestätigt, daß trotz der Einsicht i n die Notwendigkeit einer operativen Grundlagenplanung auch heute noch bei i h m die Befassung m i t tagespolitischen Einzelfragen (meist reaktiver Natur) und die etwas „überzogene" Wahrnehmung der Öffentlichkeitsarbeit einen fast zu breiten Raum einnehmen 18 . 2. Führungsstil des Ministerpräsidenten Mangels eigener unmittelbarer Anschauung und Kenntnis mußte hierbei fast ausschließlich auf Sekundärquellen zurückgegriffen werden. Aus der Presse läßt sich dazu i n Umrissen folgendes B i l d nachzeichnen 19 : Der Regierungs- und Arbeitsstil des Ministerpräsidenten H. Filbinger ist geprägt von seiner nüchtern kalkulierenden, zurückhaltend-sympathischen, dem Pathos weitgehend abholden Persönlichkeit. Sein Führungsstil w i r k t abgewogen und zielt darauf ab, durch Argumente zu überzeugen oder durch Interessenausgleich zu vermitteln. Fern schöngeistiger Brillanz, ringt er, manchmal etwas hölzern wirkend, m i t Bedacht u m Verständnis für seine Sicht der politischen Dinge. Man bescheinigt i h m jenen Schuß Bedächtigkeit, Genauigkeit und Zähigkeit zu besitzen, der von den Bewohnern Bad.-Württ. hoch geschätzt wird, und jenen Typ des Regierungschefs zu personifizieren, der Schwaben und Badener gleichermaßen befriedigt: den Landesvater. Bei der Ausgestaltung seines Regierungsstils ist er deshalb nicht zuletzt sehr darauf bedacht, sein größtes Kapital, sein hohes Ansehen als solider, sorgfältig rechnender Landesvater, zu erhalten und wenn möglich zu stärken 1 9 . Ein interessanter Aspekt des Regierungs- und Arbeitsstils des M i n i sterpräsidenten soll hier noch besonders dargestellt werden. I m Unterschied etwa zu Ministerpräsident G. Müller, der selbst intensive sachliche Schreibtischarbeit nicht scheute, bevorzugt H. Filbinger mehr den mündlichen Vortrag. Überhaupt scheint seine Informationsbasis und sein persönlicher Entscheidungsbildungsprozeß neben dem notwendigen Aktenstudium relativ stark von zahlreichen offiziellen und inoffiziellen Gesprächen, Beratungen und Diskussionen und von entsprechenden mündlichen Vorträgen seiner zuständigen Abteilungsleiter und auch Referenten geprägt zu sein. Daraus ist auch zu erklären und stellt 18 Dies ist allerdings keine bad.-württ. Besonderheit. Vgl. dazu insbes. F. Knöpfle, i n : Die Staatskanzlei, SHS Bd. 34, S. 47. 19 Vgl. oben Fußnoten 1, 2 u n d 4; diese Ausführungen, die den Führungsstil v o n H. Filbinger veranschaulichen, geben aus den genannten Gründen weitgehend nicht die Meinung des Verfassers wieder, sondern sind folgenden Zeitungsartikeln entnommen, die i n der Broschüre „Filbinger K a r i k a t u r e n " (Hrsg.: Staatsministerium) zusammengestellt sind: F. Treffz-Eichhöfer, in: Mannheimer Morgen v o m 15. 9.1973, S. 1; J. Bischoff, i n : Stuttgarter Zeitung v o m 14. 9.1973, S. 3; S. Alf, i n : Süddeutsche Zeitung v o m 15. 9.1973; R. Zundel, i n : Die Zeit, Nov. 1971. Vgl. auch oben § 21 Ziff. 4.
1 7 6 K a p . I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
gewissermaßen die notwendige Konsequenz dar, daß grundsätzlich jeder Mitarbeiter des Staatsministeriums die Möglichkeit des unmittelbaren Zugangs zum Ministerpräsidenten besitzt. Die Abteilungsleiter, mit die engsten Mitarbeiter H. Filbingers, haben sogar, ohne zwingend den Ministerialdirektor einschalten zu müssen, oft direkten Z u t r i t t zum Chefzimmer 20 . Der Erfolg eines solchen Führungsstils setzt dann aber noch mehr als gewöhnlich voraus, daß sich der Ministerpräsident auf ein bestens funktionierendes Führungsinstrument (Staatsministerium) v o l l verlassen kann, das mit hoch qualifizierten Mitarbeitern, die sich m i t seinen politischen Zielvorstellungen weitgehend identifizieren, besetzt ist 2 1 . Versucht man aufgrund der Persönlichkeit und des Regierungsstils H. Filbingers Verständnis vom A m t des Ministerpräsidenten typisierend zu umschreiben, so w i r d man primär sicher weniger von einem Amtsvorstands- oder Managertyp, sondern eher von einem Präsidialund Landesvatertyp sprechen können 2 2 . 3. Stellung des Ministerpräsidenten Die Stellung des Ministerpräsidenten, so könnte man meinen, hängt stark von den i h m durch die Verfassung eingeräumten Rechten und Kompetenzen ab 2 3 . Diese Vermutung wurde allerdings von der Verfassungswirklichkeit bisher teilweise widerlegt 2 4 . Vielmehr liegt seine Stellung nicht unwesentlich i n seiner politischen Machtbasis begründet und hängt grundsätzlich von seinem strategischen und taktischen Geschick, von seinem Durchsetzungsvermögen, seiner Fähigkeit, Kompromisse zu schließen usw., nicht zuletzt aber auch von seinem unmittelbaren Beraterstab ab. I m Vergleich zu diesen Faktoren spielt etwa die Richtlinienkompetenz des Regierungschefs (Art. 49 I LV) eine relativ geringe Rolle 2 5 . 20 Vgl. dazu etwa E. Konnerth, i n : Stuttgarter Nachrichten v o m 15. 9.1973 u n d 26. 6.1974. 21 Dies w i r d i m einzelnen noch näher unten § 24 zu untersuchen sein. 22 Dies k o m m t i n allen genannten Zeitungsartikeln zum Ausdruck u n d wurde i m Rahmen der Interviews weitgehend bestätigt. Vgl. auch F. Knöpfle, i n : Die Staatskanzlei, SHS Bd. 34, S. 111 (Diskussionsbeitrag). 23 Vgl. dazu i m einzelnen oben § 14 Ziff. 1 u n d 2. 24 Vgl. auf Bundesebene etwa n u r die extrem unterschiedlichen Stellungen von K . Adenauer einerseits u n d L. Erhardt andererseits als Regierungschef; vgl. dazu etwa T. Ellwein, Regierungssystem, S. 330 f.; K . Sontheimer, G r u n d züge des politischen Systems der BRD, S. 162 ff.; S. Schöne, Bundeskanzleramt, S. 157 ff.; K . von Beyme, i n : PVS 1969, S. 268. 25 Die durchgeführten Erhebungen scheinen dies eindeutig bestätigt zu haben. Vgl. dazu bereits oben § 14 Ziff. 2. Vgl. dazu näher F. Scharpf, i n : Projektgruppe B M I , Erster Bericht, Anlagenband (Länderbericht), S. 276, 280, 292 ff.
§ 22 Der Ministerpräsident
177
Diese Ausführungen zeigen, daß die Machtstellung des Ministerpräsidenten i m wesentlichen von drei etwa gleichwichtigen Faktoren abhängt: (1) Seine Stellung i n der Partei bzw. seine Rolle als Parteiführer, (2) seine Stellung i m Ministerrat bzw. seine Beziehungen zu den Kabinettsmitgliedern und (3) seine i h m zur Verfügung stehenden Führungsinstrumente, insbesondere das Staatsministerium 26 . (1) Als Landesvorsitzender der bad.-württ. CDU, als Mitglied des Bundesvorstandes dieser Partei und auch als Landtagsabgeordneter besitzt H. Filbinger verständlicherweise eine dominierende Stellung innerhalb seiner Partei. Hinzu kommt, daß die Landtagswahl von 1972 unter prononcierter Herausstellung der Person des Ministerpräsidenten I i . Filbinger überzeugend gewonnen wurde und bis heute sich noch kein Nachfolger für ihn abzeichnet. Seine starke Stellung i n der Partei und damit auch i m Land kann allerdings nicht unbeschränkt sein; seinem Führungsanspruch als Partei- u n d Regierungschef sind durchaus Grenzen gesetzt. So darf vor allem nicht die Tatsache übersehen werden, daß die Parteisolidarität und Parlamentsunterstützung nur durch die Bereitschaft der politischen Führung erhalten bleibt, bei der Ausarbeitung der Partei- und vor allem der Regierungspolitik ständig die verschiedensten Gesichtspunkte aus allen Parteikreisen, besonders aus der Regierungsfraktion, i n Betracht zu ziehen. Eine diesbezügliche Empfindlichkeit und die Bereitschaft zur Übernahme von parteipolitischen Anregungen und Vorschlägen durch die Regierung ist ein wesentliches Merkmal des parlamentarischen Systems 27 . I n dieser Hinsicht scheinen allerdings i n letzter Zeit einige Unklarheiten und Mißverständnisse zu bestehen 28 . Trotzdem ist die Stellung H. Filbingers i n der CDU nach wie vor unumstritten, nicht zuletzt w e i l die Partei sich durchaus bewußt ist, gegenwärtig keinen „Ersatz" für den so populären Landesvater H. Filbinger zu haben. (2) Bereits oben § 21 Ziff. 4 wurde die führende Rolle des Ministerpräsidenten i m Kabinett festgestellt und näher begründet. Sie liegt, ganz abgesehen von der Persönlichkeit H. Filbingers, u. a. w o h l i n der Person der einzelnen Regierungsmitglieder, der Vorbereitung und dem Ablauf der Kabinettssitzungen, aber auch darin begründet, daß kein Ressortchef sich parteipolitisch übermäßig engagiert, sondern insoweit 26 Vgl. N. Johnson, Projektgruppe B M I , Erster Bericht, Anlagenband, S. 140 ff.; T. Ellwein, Regierungssystem, S. 330 f. 27 Vgl. dazu besonders N. Johnson, Projektgruppe B M I , S. 140. 28 Durchaus zutreffend hat dies E. Ruckgaber unter dem T i t e l „Tauziehen zwischen Filbinger u n d Späth. — C D U - F r a k t i o n u n d Regierung versuchen sich gegenseitig zu übertreffen" i n der Stuttgarter Zeitung v o m 21.11.1974, S. 5, näher dargelegt. Dazu w i r d i m einzelnen noch unten § 25 einzugehen sein (Verhältnis Regierung/Parlament).
12 K a t z
1 7 8 K a p . I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
eher Zurückhaltung übt 2 9 . Letzteres bedeutet i n der Regel wiederum, daß ein Minister meist weniger Rückhalt i n Partei und Fraktion besitzt und deshalb bei gesetzgeberischen und größeren anderen Vorhaben und Maßnahmen u m so mehr bei deren Realisierung der Unterstützung des Ministerpräsidenten bedarf 3 0 . (3) Das Staatsministerium, soviel kann schon hier gesagt werden, stellt für den Ministerpräsidenten anerkanntermaßen ein effektives und äußerst wirkungsvolles Führungsinstrument von mittlerweile recht beachtlichem Umfang dar 3 1 . Darauf w i r d ausführlich i n § 24 einzugehen sein. Die Beurteilung der Stellung des Ministerpräsidenten H. Filbinger anhand dieser drei Faktoren ergibt und bestätigt eindeutig die führende Rolle, die er i n der Regierungsarbeit und der gesamten Landespolitik einnimmt. I m Hinblick auf die verfassungsrechtlichen Ausführungen 3 2 , kann hier gewissermaßen als Zwischenergebnis festgestellt werden, daß die tatsächliche Stellung des Ministerpräsidenten i m Regierungsbereich gegenwärtig sicher stärker ist als dies i n der Landesverfassung niedergelegt ist 3 3 . I m Rahmen der Untersuchung der Staatskanzlei w i r d dieses Ergebnis nochmals zu überprüfen sein. §23 Die Ministerien Eine umfassende Untersuchung der Ministerien i n struktureller und organisatorischer Hinsicht kann die vorliegende Arbeit nicht leisten 1 . Vielmehr muß sie sich auf die Aspekte beschränken, bei denen ein unmittelbarer Bezug zu den Regierungsorganen besteht, es sich demnach u m den i n § 3 Ziff. 2 näher umschriebenen Regierungsbereich (regierungswissenschaftlicher Begriff) handelt. Hier ist also insbesondere die Leitungsebene der Ressorts, die Organisations- und Strukturprobleme 29 So ist etwa Bezirksvorsitzender von Nordwürttemberg G. Mahler (Staatssekretär i m Staatsministerium), von Süd Württemberg E. Adorno (Minister für Bundesangelegenheiten), von Südbaden E. Teufel (pol. Staatssekretär). 80 Diese Feststellung w i r d u. a. durch die Ausführungen unten § 23 Ziff. 7 bestätigt. 81 Nach dem Haushaltsplan 1974 gehören zum Mitarbeiterstab allein der Staatskanzlei 60 Beamte, 58 Angestellte u n d 8 Arbeiter, insgesamt also 126. 82 Vgl. insbes. oben § 14 Ziff. 3. 83 Vgl. dazu auch die Ausführungen oben § 21 Ziff. 6 (bes. Fußnote 39). Die Vorgänge bei der Regierungsbildung 1972, die als Ausnahmefall anzusehen sind, ändern an der hier beschriebenen Verfassungswirklichkeit grundsätzlich nichts (vgl. oben § 20 Ziff. 2). 1 Vgl. dazu etwa: A k t u e l l e Probleme der Ministerialorganisation, SHS Bd. 48; Projektgruppe „Organisation BMI", Bericht; Projektgruppe beim Bay. IM, Reformbericht; Wibera, Gutachten H H ; Projektgruppe BMI, D r i t t e r Bericht, I I ; vgl. auch E.-W. Böckenförde, Organisationsgewalt, S. 210 ff.
§ 23 Die Ministerien
179
i m Hinblick auf Führungskonferenz, Zentralstelle, Amtschef, politische Beamte, Staatssekretäre (einschließlich eines Organisationsvorschlags) und außerdem die Beziehungen eines „Hauses" zur Staatskanzlei und zu den anderen Ministerien darzustellen und teilweise zu analysieren. 1. Führungskonferenz Eine Besonderheit der Ministerialorganisation liegt darin begründet, daß die Ressortleitung zwei verschiedene „Staatsfunktionen" wahrzunehmen hat. I h r obliegen einerseits die Regierungs-(Politik-)aufgaben und zum anderen eben die Verwaltungsaufgaben. Da aber aus vielen Gründen beide Bereiche, was für die Länder noch mehr gilt als für den Bund, keinesfalls isoliert, sondern möglichst eng miteinander verbunden werden müssen 2 , bedarf dies auch einer besonderen organisatorischen Verwirklichung. Neben der hierarchischen Ordnung 3 sollte die notwendig enge Verflechtung u. a. durch eine Führungskonferenz institutionalisiert werden. I n i h r sollten alle Abteilungsleiter, Ministerialdirektoren, Staatssekretäre und der Leiter der Zentralstelle unter dem Vorsitz des Ministers zusammengefaßt werden. U m aber effektiv arbeiten, initiieren, koordinieren, informieren, usw., eben die Funktionen einer Führungskonferenz überhaupt erfüllen zu können, sollte allerdings die Zahl ihrer Mitglieder zehn bis zwölf nicht übersteigen 4 . Es gibt viele Gründe, die diese Einrichtung dringend gebieten 5 . Zwei davon sollen hier kurz skizziert werden: I n den Interviews wurde i m mer wieder geklagt, daß den Referenten und auch Abteilungsleitern 2 Vgl. dazu ausführlich oben § 3 Ziff. 3 u n d auch § 20 Ziff. 3 (Gründe f ü r die Notwendigkeit einer engen Verflechtung zwischen Regierungs- u n d V e r waltungsbereich) u n d § 7 (Unterschiede zwischen B u n d u n d Länder) j e m. w. N. Vgl. besonders Projektgruppe Bay. IM, Reformbericht, S. 12 f. u n d 97 ff. u n d Projektgruppe „Organisation BMI", Bericht, S. 27 f. Vgl. auch die sehr eindrucksvollen Ausführungen v o n H . Schneider, i n : Festschrift f ü r E. R. Huber, S. 170 f. m. w . N. 8 Z u r Hierarchie i n der MinisterialVerwaltung vgl. allgemein: E. Laux, i n : Aktuelle Probleme der Ministerialorganisation, SHS Bd. 48, S. 317 ff.; E. Pusid, ebenda, S. 382; R. Schnur, i n : Demokratie u n d Verwaltung, SHS Bd. 50, S. 557 ff. 4 Vgl. dazu bereits eingehender oben § 20 Ziff. 3 (insbes. Fußnote 30). Die Ressorts sollten also i n nicht mehr w i e sechs Abteilungen aufgegliedert sein. A u f Landesebene müßte dies zu verwirklichen sein. Gewisse Schwierigkeiten bereitet hier lediglich das Kultusministerium. Einige Abteilungen könnten dort ohne Schwierigkeiten zusammengefaßt werden. Bei großen Abteilungen müßten ggf. Unterabteilungen eingeführt werden. Dies wäre etwa bei der Hochschulabteilung sicher sinnvoller gewesen als eine Teilung (vgl. oben § 20 Ziff. 3). 5 Vgl. eingehend: Projektgruppe Bay. IM, Reformbericht, S. 104 ff.; Wibera, Gutachten H H , S. 73 ff.; Projektgruppe BMI, D r i t t e r Bericht, 11/15 ff. (kooperative Ressortleitung) u n d 11/53 ff. (Abteilungsleiterkonferenzen); außerdem H. Karehnke, i n : D Ö V 1974, S. 118 f.
12*
1 8 0 K a p . I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
die konkreten Zielvorstellungen der Ressortleitung, insbes. des M i n i sters, weitgehend nur sehr vage bekannt seien. Da dieser Mangel am Informationsfluß von oben nach unten, wie leider die Praxis zeigt, kaum durch eine entsprechende schriftliche Fixierung durch den M i nister zu beseitigen ist, soll wenigstens über die Führungskonferenz den Abteilungsleitern ein unmittelbarer, ungehinderter Informationsfluß verschafft werden. Denn die Abteilungen und Referate sind nur dann i n der Lage, ihre gesamte Tätigkeit (Ziel- und Programmentwicklung bzw. -Steuerung) den politischen Vorstellungen der Ressortleitung anzupassen, wenn sie Gelegenheit haben, ihre Vorstellungen möglichst konkret und ohne Filter kennenzulernen 6 . Andererseits ist es, vor allem i m Hinblick auf den relativ hohen A n t e i l der Verwaltungs- an den Gesamtentscheidungen, aber auch um die fachlichen Belange hinreichend übersehen und berücksichtigen sowie den bei den Abteilungsleitern gebündelt vorhandenen hohen Sachverstand nützen zu können, für die Leitung des Hauses dringend erforderlich, daß die Abteilungsleiter an dieser Konferenz mitwirken. Ressortspitze und Ministerialverwaltung sind also i n einem umfassendsten Sinne aufeinander angewiesen. Besonders auf Landesebene bedarf es deshalb für eine möglichst effektive Staats- und Verwaltungslenkung einer laufenden und gegenseitigen Kommunikation und Information, einer dauernden Sachverstandslieferung und einer ständigen Auseinandersetzung zwischen politischen und fachlichen Forderungen einerseits sowie Abteilungs-, Ressort- und Gesamtstaatsinteressen andererseits 7 . Dafür ist, wie bereits ausgeführt wurde, neben anderen organisatorischen Maßnahmen, die ständige Einrichtung einer Führungskonferenz (mindestens vierzehntäglich) hervorragend geeignet. A u f einer breiteren Ebene müssen gewissermaßen politische und fachliche Belange auf einen Nenner gebracht werden. Ein wirksames Funktionieren einer solchen Führungsgruppe (kooperative Ressortleitung) setzt heute allerdings voraus, daß darin das politische Element nicht unterrepräsentiert sein darf (nicht nur der Minister), sondern daß sie einigermaßen ausgewogen zusammengesetzt ist 8 . Die umfangreichen Befragungen haben hierzu ergeben, daß i n den bad.-württ. Ministerien diese Einrichtung weitgehend nicht genutzt und wenn überhaupt, dann meist nur sporadisch einberufen 6 Dabei muß allerdings, möglichst geschäftsordnungsmäßig, gesichert sein, daß die Abteilungsleiter die erhaltenen Informationen an die Mitarbeiter ihrer Abteilungen weitergeben. 7 Vgl. dazu etwa F. Morstein Marx, i n : Die Staatskanzlei, SHS Bd. 34, S. 117 ff., 127, 132, 137; besonders auch Projektgruppe „Organisation BMI", Bericht, S. 27 f. 8 Darauf w i r d noch unten näher einzugehen sein. Als A r t Richtschnur dürfte zu gelten haben, daß auf zwei Abteilungsleiter (Ministerialbeamte) ein „ P o l i t i k e r " kommen sollte.
§ 23 Die Ministerien
181
w i r d 9 . Die Minister bevorzugen es i n der Regel nur m i t einzelnen Abteilungsleitern und zwar ausschließlich über deren Aufgabengebiet betreffende Fragen zu sprechen. De facto sind also derzeit die Abteilungsleiter weitgehend nicht i n einer kooperativen Form an der Ressortleitung beteiligt. Dadurch w i r d sicher notwendiger, umfassender und nicht nur aufgabenspezifischer Sachverstand ungenutzt gelassen, aber auch, was nicht unterschätzt werden sollte, die Arbeitseinstellung ganz allgemein (Motivation) und die Bereitschaft zur Innovation, Problemsuche und -Verarbeitung, Kooperation usw. beeinträchtigt. Die Gründe für diesen Zustand scheinen äußerst komplex zu sein und konnten wohl deshalb nicht näher festgestellt werden 1 0 . Zur Verbesserung der Arbeit in den Ministerien und letztlich auch i n der Regierung bedarf es hier dringend einiger Änderungen, nicht zuletzt auch auf organisatorischem Gebiet. 2. Zentralstellen Unbestrittenermaßen w i r d heute anerkannt, daß zur Unterstützung und Entlastung der Ressortspitze vor allem für den Minister Führungshilfseinrichtungen notwendig sind und deshalb geschaffen werden müssen (Stabseinheiten als sogenannte Ministerbüros oder Zentralstellen) 11 . Über den personellen Umfang sowie die Aufgaben- und Funktionsbereiche, die von ihnen wahrzunehmen sind, bestehen dagegen recht unterschiedliche Auffassungen. Grundsätzlich w i r d man sagen können, daß die Hilfseinrichtung der Führung primär die Aufgabe hat, den „Flaschenhals" (Engpaß) in der politischen Ressortleitung zu erweitern. Ein Ministerbüro hat demnach i m wesentlichen die Aufgabe, für den Minister einerseits Fachinformationen aus dem Haus entgegenzunehmen, zu sammeln und zu komprimieren, sowie zum anderen politische Zielvorstellungen und Forderungen des Ministers, aber auch der Regierung, Partei und Fraktion an die Abteilungen des Hauses weiterzugeben. Dies ergibt sich aus der i n den Ministerien immanent vorhandenen engen Verflechtung von Politik und Verwaltung, wobei dies i n 9 Eine Ausnahme macht hier das Staatsministerium. Dort werden wöchentlich solche „Konferenzen", insbesondere zur Vorbereitung der Kabinettssitzungen, durchgeführt (vgl. oben § 24). Eine gewisse Ausnahme macht außerdem das Kultusministerium. 10 Gewisse Anhaltspunkte deuten darauf hin, daß u. a. die i m Rahmen der Kabinettsarbeit oben angeführten personellen u n d strukturellen Grundprobleme auch hier teilweise m i t v e r a n t w o r t l i c h sind (faktische Stellung der Amtschefs und deren Verhältnis zu ihren Ministern). 11 Vgl. dazu etwa Projektgruppe „Organisation BMI", Bericht, S. 28 ff.; Projektgruppe Bay. IM, Reformbericht, S. 107 ff.; Wibera, Gutachten H H , S. 127 ff.; Projektgruppe BMI, D r i t t e r Bericht, 11/34 ff.; Mayntz / Scharpf, Planungsorganisation, S. 214ff.; E.-W. Böckenförde, Organisationsgewalt, S. 213.
1 8 2 K a p . I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
den Ressortspitzen der Länder noch stärker hervortritt als beim Bund. Die Nichtbeachtung dieser Verflechtung, die etwa bei der Errichtung größerer Leitungs- und Planungstäbe oder bei den sogenannten M i n i sterkabinetten nicht selten gegeben ist, führt erfahrungsgemäß denn auch zu einer sich insgesamt negativ auswirkenden „Entfremdung" zwischen der Leitung und den Fachabteilungen. Dies ist dringend zu vermeiden. Zudem ist es aus Gründen eines ständigen, umfassenden Informationsflusses und einer möglichst geringen Konfliktsbelastung innerhalb des Ressorts, worauf noch näher einzugehen sein wird, dringend geboten, daß i n den Ministerbüros grundsätzlich keine Fach- und auch keine Querschnittsaufgaben wahrgenommen werden, sondern deren Tätigkeitsfeld neben allgemeinen Hilfsdiensten vor allem i n der Koordination, Kooperation und Information liegt 1 2 . Die ersten Ansätze zur Einrichtung von Ministerbüros liegen i n Bad.Württ. bereits ca. zehn Jahre zurück. Mitte der sechziger Jahre wurden i m Innenministerium, dem damals größten Ressort, unter H. Filbinger (CDU) erste bescheidene Schritte i n diese Richtung gemacht. Von einem Ministerbüro i m heute verstandenen Sinne konnte damals allerdings noch nicht gesprochen werden. Erst ab 1966, nach der Bildung der Großen Koalition, wurden unter Innenminister W. Krause (SPD) diese Ansätze allmählich zu einem Ministerbüro ausgebaut 13 . Seit der CDUAlleinregierung (1972) w i r d nun versucht, i n allen Ministerien ein solches Ministerbüro (Zentralstelle) als ständige Einrichtung zu etablieren. Die Gründe dafür sind mannigfaltig und konnten nicht v o l l rekonstruiert werden. Gleichwohl dürfte neben der Tatsache, daß das Ministerbüro sich i m Innenministerium unter Berücksichtigung der rechtlichen, organisatorischen und personellen Gegebenheiten durchaus bewährt hat 1 4 , für die generelle Institutionalisierung der Zentralstellen die bei der Regierungsfraktion (CDU), dem Staatsministerium und den M i n i 12 Vgl. dazu ausführlich: Projektgruppe „Organisation BMI", Bericht, S. 28 f.; Projektgruppe BMI, D r i t t e r Bericht, 11/34 ff.; H. Karehnke, i n : D Ö V 1974, S. 119. I n begründeten Fällen können dabei sidher kurzfristig Ausnahmen gemacht werden. 13 Der Ausbau des Ministerbüros hatte damals überwiegend politische Gründe. Es ist durchaus verständlich, daß i n einem Land, das keinerlei politische Beamte u n d damals auch Staatssekretäre kannte, nach einem Ministerwechsel (bisher CDU, neu SPD) versucht w i r d , dies mindestens zum Teil durch organisatorische Maßnahmen i n der Ressortspitze zu „überspielen". Mehrere Befragte stimmten darin überein, daß „ f ü r Krause die Zentralstelle notwendig u n d effektiv w a r " . 14 So w u r d e n etwa die L e i t l i n i e n der Kommunalreform (Kreis- u n d Gemeindereform) unter Krause i n enger kooperativer Zusammenarbeit zwischen der Kommunalabteilung u n d der Zentralstelle erarbeitet. V o n Anfang an bestanden dadurch allerdings auch generell mehr oder weniger große Schwierigkeiten, die i n ihrem Ausmaß weitgehend von den beteiligten Personen abhingen u n d auf die i m einzelnen noch einzugehen sein w i r d .
§ 23 Die Ministerien
183
stern selbst gleichermaßen vorhandene positive Einstellung entscheidend gewesen sein. Die Regierungsfraktion i m Landtag hatte den dringenden Wunsch, bei jedem Ministerium eine „politische Anlauf- und Ansprechstelle" zu besitzen. Da die Ministerialdirektoren aus den erwähnten Gründen dafür zum Teil nicht i n Betracht kamen, bot es sich an, die neu zu errichtenden Zentralstellen, i m besonderen den Zentralstellenleiter, m i t diesen Aufgaben zu betrauen 15 . Das Staatsministerium hatte ebenfalls ein Interesse an der Errichtung der Zentralstellen und zwar überwiegend aus denselben Gründen. Da sich der Chef der Staatskanzlei weitgehend nicht i n parteipolitische Angelegenheiten einschaltet und es auch keine Konferenz der Ministerialdirektoren gibt, mußte eine andere Ebene gefunden werden, auf der i n überwiegend politischen Fragen Informationen gegeben, Erfahrungen ausgetauscht und auch bestimmte Angelegenheiten beraten und koordiniert werden (etwa Regierungs-, Arbeits- und Investitionsprogramme). Da diese Aufgaben i m Staatsministerium von der politischen Abteilung (Abt. I V — Grundsatzfragen und Planungen) wahrgenommen werden, war es nur konsequent, i n den Ministerien eine entsprechende „politische Stabseinheit" zu fordern. Die etwa alle sechs Wochen tagende Zentralstellenleiterkonferenz unter dem Vorsitz des Leiters der Abteilung I V des Staatsministeriums n i m m t denn auch einen Teil der Aufgaben wahr, die normalerweise von der Konferenz der Amtschefs der Ministerien erfüllt werden. Schließlich war auch i m Prinzip jedem Ressortchef daran gelegen, persönlich Vertraute i n eine Position bringen zu können, i n der sie i h m bei politischen und Führungsaufgaben unmittelbar wertvolle Hilfsdienste leisten konnten (Ministerbüro als Stabseinheit) 16 . Insgesamt gesehen war also auch hier der wesentlichste Grund für die Einführung der Zentralstellen — das muß i n aller Offenheit bekannt werden — die Institution des Ministerialdirektors (Amtschef) als Lebenszeitbeamter. Ein Minister kann heute, vor allem wegen der enormen Zunahme der Bedeutung der Parteipolitik, praktisch nicht mehr darauf 15 Diese Aufgaben werden heute von den Zentralstellen (die Zentralstellenleiter sind i n der Regel CDU-Mitglieder) weitgehend erfüllt. V o r allem „betreut" die Zentralstelle den das M i n i s t e r i u m betreffenden Arbeitskreis der CDU-Fraktion. Die Zentralstellenleiter sind so neben dem Minister ein institutionalisiertes Verbindungsglied zwischen Regierungsfraktion und Ressort. Sie haben dabei vor allem die Aufgabe der Beobachtung u n d der I n f o r mationsübermittlung; soweit notwendig, ist das M i n i s t e r i u m über die A r b e i t der Regierungsfraktion zu unterrichten u n d umgekehrt. 16 Vgl. dazu bereits oben § 21 Ziff. 6. E i n beachtlicher Teil der Ministerialdirektoren ist der Auffassung, daß ihre Aufgabe i n der verwaltungsmäßigen Leitung des Ministeriums u n d nicht i n der Wahrnehmung parteipolitischer Dinge liegt. Diese durchaus zu respektierende Meinung dürfte allerdings heute f ü r einen allgemeinen Stellvertreter des Ministers k a u m mehr sinnvoll sein (vgl. dazu näher unten Ziff. 3). Diese „klassische Amtsauffassung" der Ministerialdirektoren f ü h r t nicht zuletzt zu dieser E n t w i c k l u n g (vgl. auch oben § 21 Ziff. 6, Fußnote 34).
1 8 4 K a p . I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
verzichten, auch unter parteipolitischen Gesichtspunkten persönlich zuverlässige und persönlich vertraute Mitarbeiter i n seiner unmittelbaren Umgebung zu haben. Diese Entwicklung darf keinesfalls ignoriert, sondern muß nicht zuletzt organisatorisch berücksichtigt und abgefangen, also institutionalisiert werden 1 7 . Es wäre i n einem Parteienstaat sinnlos und unrealistisch die Parteipolitik aus den Ministerien ausschließen zu wollen 1 8 . Vielmehr gilt es entsprechend den Notwendigkeiten und Bedürfnissen der Länder, bei denen etwa i m Unterschied zum Bund auch die parteipolitischen Angelegenheiten stärker verwaltungsrelevant und weniger gesellschaftsrelevant sind, diese Entwicklung auf das Erforderliche zu beschränken 19 . Während heute also i m Land weitgehende Übereinstimmung über das „Ob" der Errichtung der Zentralstellen besteht, gibt es bezüglich des „Wie" (personeller Umfang, Kompetenzen, organisatorische Einordnung) bei Politikern und Ministerialbeamten zum Teil recht erhebliche Meinungsunterschiede. So nimmt es nicht wunder, daß die Zentralstellen i n ihrer personellen, organisatorischen usw. Ausgestaltung von Ministerium zu Ministerium stark differieren. Die personelle Besetzung dieser Stäbe schwankt etwa zwischen vier und acht höheren Beamten 20 . Auch die Aufgaben und Kompetenzen der Zentralstellen sind recht unterschiedlich festgelegt. Während sie teilweise reine Informations- und Koordinationsstellen i n der Hessortspitze darstellen, werden in anderen auch Grundsatzfragen und politisch wichtige Angelegenheiten wahrgenommen. Schließlich ist auch das „Unterstellungsverhältnis" der Zentralstelle i n den einzelnen Ministerien recht unterschiedlich geregelt 21 . Hier macht sich der bereits oben § 17 Ziff. 3 angeführte Mangel negativ bemerkbar, daß i m Jahr 1972 nicht wenigstens gewisse Grundsätze (Leitlinien) für die Errichtung der Zentralstellen 17 Fast alle Befragten waren der Auffassung, daß i m Prinzip eine Zentralstelle unabdingbar ist. Diese E n t w i c k l u n g ist letztlich zum Teil aus der V e r lagerung des „Dualismus" von Regierung/Parlament h i n zu Regierung, -parteien/Opposition zu verstehen u n d zu erklären. 18 A u f diese Probleme u n d evtl. Folgen ist unten § 25 noch besonders einzugehen. 19 Vgl. dazu oben § 7. So w o h l auch die Regierung, was sich aus ihrer bisherigen Zurückhaltung ergibt, u n d auch die SPD (vgl. Stuttgarter Zeitung vom 15.10.1974, S. 5). Dazu w i r d noch näher einzugehen sein. 20 Jeder Zentralstelle gehört i n der Regel neben dem Zentralstellenleiter der persönl. Referent des Ministers, der Pressereferent u n d der Referent für Bundesratsangelegenheiten an. Daneben gibt es i n einigen Ministerien zusätzliche Referenten für Grundsatz- u n d Planungsfragen sowie für die Öffentlichkeitsarbeit. Das Innenministerium hat z. B. seine Zentralstelle zur Zeit m i t 5, das K u l t u s m i n i s t e r i u m seine m i t 8 höheren Beamten besetzt. 21 So ist etwa die Zentralstelle i m Innen- und Wirtschaftsministerium unmittelbar dem Minister, die des Kultusministeriums de facto w o h l dem Minister u n d einem Ministerialdirektor unterstellt, wogegen sie i m Finanzministerium dem beamteten Staatssekretär untergeordnet sein dürfte.
§ 23 Die Ministerien
185
vom Kabinett aufgestellt wurden. Insgesamt muß allerdings beachtet werden, daß sich die Zentralstellen mindestens noch i n einem Teil der Ministerien in der Aufbauphase befinden und noch Erfahrungen gesammelt werden müssen sowie, daß letztlich ihre Organisation auch weitgehend von personellen Komponenten und Konstellationen i n der Ressortspitze abhängen 22 . Die durchgeführten Befragungen und deren Analyse haben ergeben, daß bei der Errichtung von Zentralstellen als Stabseinheiten i n der Ressortspitze folgende Kriterien zu beachten bzw. folgende Probleme („kritische Stellen") zu bewältigen sind 2 3 : (1) Die Zentralstelle hat sich grundsätzlich auf reine Informationsund Koordinationsfunktionen zu beschränken. Sie hat primär der Erweiterung des „Flaschenhalses" i n der politischen Führung der Ministerialorganisation durch informierende und koordinierende Tätigkeit zu dienen (Unterstützungs-, Hilfs- oder Serviceeinrichtung). Nur i n besonderen Ausnahmefällen und auch dann nur kurzfristig darf sie sich fachlichen (materiellen) Aufgaben widmen. Vor allem aus zwei Gründen ist dies dringend geboten. Zum einen hat sich gezeigt, daß die Abteilungen, sobald sie das Gefühl haben, i n der Zentralstelle erwachse ihnen eine Konkurrenz, sich stark in ihr „Schneckenhaus" zurückziehen und der Ressortleitung, insbesondere der Zentralstelle, soweit es geht Informationen, Initiativen, Anregungen usw. vorenthalten und infolgedessen ganz allgemein von einem Nachlassen an Kreativität, Verantwortungsfreude und Engagement gesprochen werden kann. Da aber gerade die Landesministerialverwaltung von einer engen Verflechtung von Politik und Verwaltung lebt, muß hier alles getan werden, u m nicht schon solche Befürchtungen aufkommen zu lassen. Zum anderen ist dies auch deshalb dringend notwendig, um eindeutige sachliche Zuständigkeiten zu gewährleisten, also kein „Zuständigkeiten-Wirr-Warr" entstehen zu lassen, und auch u m Doppelarbeit zu vermeiden 24 . 22
Die Befragungen ergaben, daß Aufgaben, Kompetenzen u n d Organisat i o n der Zentralstellen ganz entscheidend v o n der persönlichen Stellung des Ministerialdirektors i m M i n i s t e r i u m u n d besonders von dessen persönlichem Verhältnis zum Minister geprägt sind u n d davon abhängen. 23 Vgl. dazu neben den i n Fußnote 11 angegebenen Fundstellen noch J. Kölble, i n : D Ö V 1969, S. 25, 34; F. Wagener, i n : A k t u e l l e Probleme der M i n i sterialorganisation, SHS Bd. 48, S. 37 ff. 24 Diese Gründe w u r d e n i m wesentlichen von allen Befragten bestätigt, wobei von den Zentralstellen das erste und von den Abteilungen das zweite Argument stärker betont wurde. Das Zuständigkeitsproblem ist bei i n t e r ministeriellen Aufgaben und ganz besonders dann evident, w e n n das Staatsministerium eingeschaltet w i r d bzw. sich selbst einschaltet. So k a n n es etwa durchaus vorkommen (angenommenes, etwas überzeichnetes Beispiel), daß i n einer politischen, aktuellen Angelegenheit der beruflichen B i l d u n g von Seiten des Staatsministeriums sich gleichzeitig mehrere Stellen i n derselben Sache an das K u l t u s m i n i s t e r i u m wenden (Abt. I I an Bundesratsreferent, Abt.
1 8 6 K a p . I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
(2) Der Zentralstelle sollten, abgesehen von den erforderlichen Informationsrechten, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben unmittelbar gegenüber den Abteilungen besitzen muß, keine weiteren eigenen Rechte und Befugnisse gegenüber den Fachabteilungen eingeräumt werden. Alle Anordnungen, Weisungen usw. i n einem Ressort hat also der Minister selbst oder der Amtschef zu treffen. Dadurch soll weitgehend verhindert werden, daß, was gegenwärtig durchaus nicht selten vorkommt, die Zentralstellen direkt i n die Abteilungen „hineinzuregieren" versuchen 25 . (3) I n der Zentralstelle sollten mindestens keine klassischen Querschnittsfunktionen wahrgenommen werden (Personal, Organisation, Haushalt). Diese müssen vielmehr weitgehendst der Z-Abteilung vorbehalten bleiben 2 6 . U m eine wirksame und vertrauensvolle Zusammenarbeit und enge Verflechtung zwischen Ressortleitung und Abteilungen zu gewährleisten, darf auch nicht organisatorisch der Eindruck erweckt werden, daß unter ganz überwiegend politischen Gesichtspunkten diese für jeden Mitarbeiter so wichtigen Funktionen ausgeübt werden. Gerade in diesem Punkt scheinen die Ministerialbeamten, sicher nicht ganz zu Unrecht, besonders empfindlich zu sein. Informationsfluß, Motivation und Innovation dürften davon i n nicht unbeträchtlichem Ausmaß abhängig sein. Darüber hinaus gehört aber auch die gesamte Ziel-, Rahmen- und Fachplanung grundsätzlich nicht zu den von der Zentralstelle zu erfüllenden Tätigkeiten. Einmal ist Planung eine wesentlich andere „Funktion" als Information, Koordination und Führungshilfe und zum anderen muß Planung in den Ländern i n den FachI i i an Fachabteilung, A b t . I V an Zentralstellenleiter, A b t . V I an Pressereferent) u n d sich daraufhin i m K u l t u s m i n i s t e r i u m unabhängig voneinander mehrere Referenten m i t dieser Angelegenheit befassen. E i n solches Verfahren muß unbedingt verhindert werden. Z w a r ist es öfters durchaus sinnvoll, wenn i n einer bestimmten Sache die Zentralstelle von außerhalb des Hauses zuerst angesprochen w i r d . I n solchen Fällen hat aber die Zentralstelle unbedingt dafür zu sorgen, daß die Erledigung allein v o m zuständigen Referenten erfolgt, die Angelegenheit also an i h n weitergeleitet w i r d . Diese Notwendigkeit w i r d noch dadurch unterstrichen, daß die Mehrzahl der dazu Befragten die Zentralstellen unter den Gesichtspunkten Information u n d Koordination (reiner Hilfsdienst) als erforderlich u n d durchaus gut, unter fachlichen Gesichtspunkten aber als schlecht (nicht besonders qualifiziert) ansehen. 25 E i n Befragter führte dazu aus, daß „ e i n solches Hineinregieren die Abteilungsleiter u n d Referenten vor den K o p f stößt u n d ihnen jede Lust an verantwortlichem, kreativem Handeln n i m m t " . Diese Aussage wurde i n der Tendenz mehrfach bestätigt. Die meisten Zentralstellenleiter sind sich w o h l auch darüber i m klaren, daß n u r m i t vertrauensvoller Kooperation u n d helfender Koordination, keinesfalls aber m i t „Besserwisserei" und dergl., auf längere Sicht eine effektive A r b e i t möglich ist. Es wäre verhängnisvoll, wenn es der Zentralstelle möglich wäre, den Abteilungen das Interessante wegzunehmen u n d damit die Abteilungen „auszubeinen" (so w ö r t l i c h ein Befragter). 26 Vgl. Projektgruppe BMI, D r i t t e r Bericht, 11/35; H. Karehnke, i n : D Ö V 1974, S. 119 (Fußnote 33).
§ 23 Die Ministerien
187
abteilungen verwurzelt bleiben; dabei ist es auf der Ebene der Landesressorts grundsätzlich nicht erforderlich, zusätzliche Planungsstäbe der Ressortleitung selbst anzugliedern 27 . Dies soll aber nicht bedeuten, daß sich die Zentralstelle überhaupt nicht m i t der Planung beschäftigt. Ihre Informations- und Koordinationstätigkeit soll sich vielmehr auch auf sie beziehen; die Zentralstelle hat i n diesem Zusammenhang etwa die Planungseinheiten (-beauftragten) über die politischen Zielvorgaben von Regierung, Regierungsfraktion und -partei i n Ergänzung zu der Führungskonferenz zu informieren und über die Einhaltung der etwa i m Arbeitsprogramm der Landesregierung festgelegten Termine zu wachen. Dies entspricht auch weitgehend der bisher geübten Praxis der Zentralstellen. (4) Die Tätigkeit der Zentralstellen darf, auch wenn sie sich auf bloße Informations- und Koordinationsfunktionen beschränkt, keinesfalls dazu führen, daß sie die unmittelbare Beratung (insbesondere fachliche) des Ministers durch die Abteilungsleiter verdrängt und damit den direkten Kontakt zwischen Minister und Fachabteilungen weitgehend unterbricht 2 8 . Eine solche Entwicklung muß aus den wiederholt genannten Gründen m i t allen Mitteln verhindert werden. Durch eine echte, regelmäßige Führungskonferenz, wie sie oben Ziff. 1 beschrieben und gefordert wurde, wäre dies m i t Sicherheit zu erreichen. (5) Ein besonderes Problem stellt die Frage des „Unterstellungsverhältnisses" der Zentralstelle dar 2 9 . Dies vor allem deshalb, weil i n Bad.Württ. die Zentralstelle vom Minister dazu geschaffen wurde und heute noch durchaus nicht selten dazu benützt wird, den persönlich weniger 27 Vgl. dazu oben §§ 7 u n d 20 Ziff. 3. F ü r die Bundesebene vgl. Projektgruppe „Organisation BMI", Bericht S. 29 f. (ähnlich w i e hier); Projektgruppe BMI, D r i t t e r Bericht, II/34 ff., 41 ff.; Mayntz / Scharpf, i n : Planungsorganisation, S. 216 ff. (diese Vorschläge sind nicht ohne weiteres auf die Länder übertragbar). Die Planungsorganisation k a n n i m Rahmen dieser A r b e i t nicht näher untersucht werden. Als sinnvolle u n d angemessene Lösung scheint sich dabei anzubieten, die stellvertretenden Abteilungsleiter m i t den Planungsaufgaben verantwortlich zu betrauen u n d zwar als „Planungsbeauftragte" ihrer A b t e i l u n g u n d i m Rahmen einer Konferenz der stellvertretenden A b t e i lungsleiter unter Einbeziehung der Zentralstelle als „Planungsbeauftragte des Ministeriums". Den Vorsitz i n dieser Konferenz u n d die Außenkontakte hätte der stellvertr. Z.-Abt.-Leiter, falls eine besondere Planungsabteilung vorhanden ist (Innen- u n d Kultusministerium) deren Abteilungsleiter oder dessen Stellvertreter, wahrzunehmen. Besondere Planungsstäbe (z. B. Prognosezentrum, Problemsuche, heuristischer Stab) sollten i n die Z.«Abteilungen oder die bestehenden Planungsabteilungen eingebaut werden. Vgl. dazu allg. Projektgruppe BMI, Erster Bericht, S. 183 ff. (insbes. S. 214 f.) u n d A n lagenband; Projektgruppe Bay. IM, Reformbericht, S. 108 f.; Wibera, G u t achten H H , S. 89 ff., 129 f. 28 Dies w i r d von den Abteilungen, vor allem den Abteilungsleitern, besonders bedauert u n d bemängelt. 29 Vgl. dazu oben, insbesondere Fußnote 21.
Kap. I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
vertrauten Amtschef (Ministerialdirektor) zu „umgehen" und zwar vor allem in überwiegend politischen Angelegenheiten. U m diesen Zweck erreichen zu können, war es notwendig, sie unmittelbar dem Minister selbst zu unterstellen. Die i n den letzten Jahren gemachten Erfahrungen und die Ergebnisse der Befragungen haben allerdings gezeigt, daß sich diese weitgehend praktizierte organisatorische Einordnung der Zentralstelle i n die Führungsebene nicht bewährt hat. Vor allem zwei Gründe dürften deutlich dagegen sprechen. Trotz aller organisatorischer Tricks ist und bleibt der Ministerialdirektor der allgemeine Stellvertreter des Ministers. Diese Funktion kann er aber nur effektiv ausfüllen, wenn er v o l l i n den Informationsfluß usw. auch der politischen Fragen eingeschaltet ist. Die Praxis hat klar gezeigt, daß es sich aber ein Ministerium einfach nicht leisten kann, i n der Führungsebene, die ja i n personeller Hinsicht besonders strapaziert ist, nur einen in sehr beschränktem Umfang einsetzbaren „Zweiten Mann" zu haben. Zum anderen wurde deutlich, daß der Ministerialdirektor, auch wenn dies der Minister nicht wollte, von den Beamten des Ressorts nach wie vor als Amtschef anerkannt und der Dienstweg über ihn weitgehendst beibehalten worden ist. Daraus kann gefolgert werden, daß eben eine wirksame Verknüpfung von Verwaltung (Fachabteilungen) m i t der Pol i t i k (Ressortspitze) nicht neben, sondern grundsätzlich nur „durch" den Amtschef möglich ist. Diese Ausführungen ergeben, daß die Zentralstelle nicht allein und unmittelbar dem Minister unterstellt, sondern direkt dem Amtschef, damit letztlich allerdings auch gleichzeitig dem Minister, zugeordnet werden soll 3 0 . (6) Die bisherigen Darlegungen haben gezeigt, daß den Zentralstellen neben ihrem Leiter grundsätzlich ein Pressereferent, der i n der Regel auch die Aufgaben der koordinierenden Öffentlichkeitsarbeit wahrnehmen kann, ein Bundesratsreferent, der zudem koordinierend alle das Ressort betreffende Bundesangelegenheiten und die Vorbereitung der Länderministerkonferenzen zu betreuen hat, und ein Landtags« und Kabinettsreferent angehören müssen. Während bisher unter personellen Gesichtspunkten die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Zentralstelle i n verschiedenen Ressorts überbetont wurde 3 1 , gibt es 30 Dem entspricht die organisatorische Einordnung der Zentralstelle i m Finanzministerium weitgehend. Dabei muß selbstverständlich gesichert sein, daß die Zentralstelle (Ministerbüro) auch unmittelbaren Zugang zum Minister selbst hat (aus diesem G r u n d muß der persönliche Referent des Ministers M i t g l i e d der Zentralstelle sein). Davon muß allerdings der Amtschef vorher u n d falls er nicht an der Unterredung teilnehmen k a n n auch nachher v o l l inhaltlich informiert werden. So auch Projektgruppe „Organisation BMI", Bericht, S. 37 (Anlage, Modell I a, I b u n d II). 31 So sind etwa i n der Zentralstelle des Kultusministeriums neben drei Pressereferenten noch zwei Referenten f ü r (längerfristige) Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt (alles höhere Beamte oder Angestellte).
§ 23 Die Ministerien
189
i n einigen Ministerien keinen besonderen Kabinettsreferenten. Diese Aufgaben werden gegenwärtig weitgehend von dem Zentralstellenleiter selbst miterledigt. Gerade aber i m Hinblick auf die so vernachlässigte gesamtverantwortliche Kabinettsfunktion der Minister wäre es dringend geboten, mindestens einen Referenten (möglichst zwei) dafür einzusetzen 32 . Der Kabinettsreferent hätte die Aufgabe, die das Ressort betreffenden Ministerratsangelegenheiten zu koordinieren, die andere Ressorts betreffenden Tagesordnungspunkte umfassend vorzubereiten und die Fachabteilungen soweit notwendig schnell und umfassend über die Kabinettsbeschlüsse und Sitzungsergebnisse zu unterrichten 3 3 . Der hierin bestehende Mangel sollte umgehend behoben werden. Ein weiteres Problem besteht i n diesem Zusammenhang i n der Bewältigung der oben erwähnten allein koordinierenden Planungs- und Programmtätigkeit. Mehrere Zentralstellen haben dafür die Stelle eines Grundsatzreferenten eingerichtet. Gerade aber diese Institution w i r d von den Fachabteilungen m i t besonderer Skepsis betrachtet. Da aber die meisten Planungen und Programme, die von Seiten der Ressortleitung einer gewissen Koordination bedürfen, i n den Ministerrat kommen und damit Kabinettsangelegenheiten sind (insbesondere etwa Koordinierimg der Teile der Regierungs- und Arbeitsprogramme, die das Ressort betreffen und die Überwachung der festgelegten entsprechenden Termine), scheint es sinnvoller, diese Aufgaben i n dem Kabinettsreferat (besetzt m i t möglichst zwei höheren Beamten) mitzuerledigen. Den Kontakt des Ministeriums zu Partei und Fraktion sollte der Zentralstellenleiter selbst übernehmen. Ein letztes Problem liegt hier i n der Frage, ob auch die persönlichen Referenten den Zentralstellen angehören sollen. Die ganz überwiegende Praxis, nach der die Zentralstelle auch den persönlichen Referenten umfaßt, hat sich nach der einhelligen Meinung der Befragten gut bewährt 3 4 . Da nach der hier vorgeschlagenen Konzeption die Zentralstelle unmittelbar dem Amtschef unterstellt werden sollte, dürfte es darüber hinaus besonders nützlich sein, durch die Zugehörigkeit des persönlichen Referenten ständig auch eine direkte Verbindung („Draht") der Zentralstelle zum Minister zu besitzen und organisatorisch zu institutionalisieren. 32
Vgl. dazu eingehend oben §§ 15 u n d 21 Ziff. 4 u n d 6. Der Einbau des Kabinettsreferenten i n die Zentralstelle (Leitungsbüro) ist unbedingt erforderlich u n d von niemand umstritten. Auch unter Berücksichtigung der Größe der Landesministerien u n d der Zentralstellen ist dies i n den Ländern grundsätzlich sinnvoll u n d zweckmäßig. Vgl. dazu Projektgruppe BMI, D r i t t e r Bericht, 11/44 ff. Gerade i m H i n b l i c k auf die verfassungsrechtlich besonders ausgeprägte Kabinettsfunktion der Minister (vgl. oben § 15) ist dies nicht nur i n einer Koalitions-, sondern genauso i n einer Alleinregierung dringend notwendig. Vgl. dazu etwa auch W. Hennis, Die Staatskanzlei, SHS Bd. 34, S. 156 (Diskussionsbeitrag). 34 So auf Bundesebene auch Projektgruppe BMI, D r i t t e r Bericht, 11/36. 33
190
Kap. I I I : Organisation und S t r u k t u r der Landesregierung B W
(7) Die vorstehenden Ausführungen zeigen, daß an die i n den Zentralstellen tätigen Personen enorm hohe Anforderungen gestellt werden müssen, wenn der gewünschte Zweck dieser Stabseinheiten erreicht werden soll. Dabei ist neben fachlichen Qualitäten auch ganz besonderer Wert auf die charakterliche Eignung, aber ebenfalls auf politisches „Fingerspitzengefühl" zu legen. Ein Beamter der Zentralstelle sollte i m Ressort fachlich anerkannt sein und das Vertrauen sowohl von Minister und Amtschef als auch den Abteilungen gleichermaßen besitzen 35 . Daß dabei auch parteipolitische Gesichtspunkte eine Rolle spielen, ist selbstverständlich 36 . Die Zahl der höheren Beamten und Angestellten, die i n einer Zentralstelle zusammengefaßt sein sollen, dürfte insgesamt bei etwa fünf bis sieben Personen liegen. U m eine effektive, spürbare Entlastung und Hilfe für den Minister und den Amtschef sein zu können, muß die Zentralstelle neben ihrem Leiter und dem persönlichen Referenten des Ministers mindestens noch zwei bis drei Mitarbeiter umfassen. Andererseits sollte die Zahl von sechs bis sieben keinesfalls überschritten werden, da sonst bereits i n der Zentralstelle selbst wieder Informations- und Koordinationsprobleme auftreten. Dies muß aber verhindert werden. Insgesamt gesehen haben die durchgeführten Befragungen und deren Analyse ergeben, daß die Zentralstellen für die Ressortleitung unabdingbare, dringend erforderliche Informations-, Koordinations-, Entlastungs- und Hilfsfunktionen (Serviceeinrichtung) zur Erweiterung des „Flaschenhalses" i n der Führungsebene der Ministerien zu leisten haben. Darüber hinaus sollten sie noch wertvolle Dienste bei der Präzisierung der politischen Zielvorstellungen für das Haus selbst sowie bei der Verdeutlichung und dem Verständlichmachen (Transparenz) der gesamten Ressortarbeit, nicht zuletzt auch für die Bürger (Öffentlichkeit), übernehmen 37 . Bei der Institutionalisierung der Zentralstellen muß aber vor allem verhindert werden, daß dadurch eine weitere Ebene i n die Hierarchie des Ministeriums faktisch etabliert wird, und daß der „fachliche Draht" zwischen Minister und Abteilungen durch die Zentralstellen abgeschnitten wird. Es wäre auf die Dauer verhäng85 Diese persönlichen Voraussetzungen w u r d e n i m wesentlichen von allen Befragten bestätigt. 86 F ü r die Position des Zentralstellenleiters ist heute praktisch Voraussetzung, daß m a n CDU-Parteimitglied ist. Dies ist allerdings solange nicht schädlich, als Parteizugehörigkeit nicht zum entscheidenden K r i t e r i u m w i r d , sondern fachliche u n d charakterliche Fähigkeiten i m Vordergrund stehen. 37 Es wurde schon erwähnt, daß unbedingt vermieden werden muß, die Tätigkeit der Zentralstelle überwiegend unter dem Gesichtspunkt der Öffentlichkeitsarbeit zu sehen. Äußerst bedenklich ist deshalb die Aussage eines Zentralstellenleiters, daß er seine Aufgabe i m übertragenen Sinn „ i n der Umsetzung der Produktion i n den Verkauf" sieht.
§ 23 Die Ministerien
191
nisvoll, wenn Sachverstand und Vorschläge aus den Fachabteilungen nur über das Filter der Zentralstelle, also meist durch die „politische Brille" verfärbt und der Öffentlichkeitsarbeit (Publikumswirksamkeit) angepaßt, zum Minister und ins Kabinett gelangen würden 3 8 . U m dies zu vermeiden, kann, was sich bereits aus den oben gemachten Ausführungen ergibt, längerfristig gesehen die Arbeit der Zentralstellen den angestrebten Erfolg und den gewünschten Zweck nur erreichen, wenn Verwaltung und Politik eng i n einer echten Führungskonferenz verbunden werden, die Abteilungsleiter also regelmäßig (ein- bis zweiwöchentlich) zum Minister unmittelbaren Kontakt haben und aktiv an den Entscheidungen des Ressorts m i t w i r k e n können 3 9 . 3. Ministerialdirektoren Der moderne Sozialstaat des Grundgesetzes und der Landesverfassungen erfordert i m technischen Zeitalter eine zukunftsgestaltende Regierung und Verwaltung, die auch gesellschaftspolitische Überlegungen m i t i n ihre Arbeit einbezieht. Von einer ehemals „neutralen" Position rückt damit auch der Ministerialdirektor (Amtschef) als allgemeiner Stellvertreter des Ministers mitten ins politische Licht 4 0 . Hinzu kommt eine gewisse Gewichtsverlagerung h i n zum Parteienstaat 41 . Diese Entwicklung hat u. a. zur Folge, daß die Regierungspartei(-en) immer stärkeren Einfluß auf Regierung und Verwaltung auszuüben (auch personell) und vor allem auch ihre proklamierten Partei- und Wahlprogramme weitgehend zu verwirklichen versuchen; dies bedeutet, daß die Regierungs- und Verwaltungsspitze für parteipolitische Ziele und Grundsätze der Regierungsfraktion(-en) offen sein muß und sie sich solche teilweise zu eigen zu machen hat. Die hier grob umrissene enorme Zunahme der Verflechtung zwischen Regierungspartei(-en) und 88
Diese Gefahren w u r d e n von mehreren Befragten besonders hervorgehoben. Die Zentralstellen dürfen keinesfalls, w i e es i n einigen Gesprächen anklang, zu „politischen Schaltzentralen" ausgebaut werden. 89 Vgl. dazu etwa Projektgruppe Bay. IM, Reformbericht, S. 104ff.; Projektgruppe BMI, D r i t t e r Bericht, 11/53 f. (bei Bundesministerien). Abschließend soll nochmals vermerkt werden, daß die vorstehende Untersuchung nicht umfassend sein kann. M a n w i r d hierzu die weitere E n t w i c k l u n g aufmerksam beobachten u n d zu gegebener Zeit weitere u n d konkretere U n t e r suchungen vornehmen müssen. 40 Hier k a n n nicht auf die gesamte Problematik des politischen Beamten eingegangen werden. Vielmehr sollen n u r die f ü r die vorliegende A r b e i t wesentlichen Aspekte näher beleuchtet werden. Vgl. allgemein dazu insbes.: öffentlicher Dienst u n d politischer Bereich, SHS Bd. 37. F ü r den beamteten Staatssekretär i n den Bundesministerien U. Echtler, Der beamtete Staatssekretär, S. 263. 41 Vgl. dazu etwa E. Forsthoff, Der Staat der Industriegesellschaft, S. 88ff.; E. Denninger, Staatsrecht 1, S. 71 ff.
192
Kap. I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
-fraktion(-en) und der Exekutive 4 2 ließ den Amtschef zu einem „Politiker i m Ornat eines Beamten" werden, wobei ihn die enge Verbindung m i t der Parteipolitik, die er letztlich durchzuführen hat, zwangsläufig entweder i n den Huf eines mindestens für Lebenszeitbeamte „verpönten parteipolitischen Konformisten", der die politische Neutralitätspflicht des Beamten mißachtet, brachte oder er das große Risiko einging, wegen seiner „Neutralität" ins politische „Abseits" i m Ministerium gestellt zu werden 4 3 . Diese Entwicklung hat auch vor den Toren Bad.Württ. nicht halt gemacht. Die Praxis der letzten Jahre und die durchgeführte Untersuchung hat eindeutig ergeben, daß es für eine effektive Arbeit i n der Leitungsebene der Ministerien unumgänglich und deshalb notwendige Voraussetzung ist, daß der allgemeine Vertreter des M i n i sters, der Amtschef des Hauses, eine fachlich qualifizierte, politisch vertrauensvolle und vom Minister v o l l akzeptierte Persönlichkeit sein muß, die sich i n einem hohen Maß m i t dem Partei- und Regierungsprogramm und m i t den politischen Vorstellungen des Ministers identifiziert 4 4 . Besonders deutlich haben die letzten acht Jahre gezeigt, daß nicht nur bei einem Regierungs-, sondern ganz allgemein bei fast jedem Wechsel i n der Person des Ressortchefs auch eine Änderung i n der Person des Amtschefs erforderlich gewesen wäre 4 5 . Aufgrund dieser Entwicklung und der genannten Tatsachen, die auch auf Bundesebene bei jedem Regierungswechsel eine Abberufung der Amtschefs immer mehr zu einer Notwendigkeit werden ließen 46 , sollte wenigstens i n den Ländern die Möglichkeit, d.h. die rechtliche Voraussetzung dazu geschaffen werden. Zwar sieht man auch i n Bad.-Württ. heute, i m Gegen42 Die „Ausgewogenheit" des Regierungssystems liegt heute eher i n dem Gegensatz Regierung u n d Opposition begründet. Der Dualismus Parlament und Regierung ist abgelöst worden. Vgl. U. Scheuner, i n : DÖV 1974, S. 433 ff., insbes. 437 ff. m. w . N. u n d oben § 3 Ziff. 4. Ob dieser „Wandel" sich auch i m L a n d Bad.-Württ. vollzogen hat, w i r d unten § 25 zu untersuchen sein. 43 Vgl. U. Echtler, Der beamtete Staatssekretär, S. 263 f. Daß selbst i m Bereich der Führungsspitze der Ministerien der Länder eine Differenzierung zwischen fachlichen u n d politischen Aufgaben u n d Tätigkeiten nicht möglich ist, wurde bereits mehrfach ausgeführt (vgl. insbes. oben § 3). Vgl. weiter dazu sehr eindrucksvoll H. Schneider, i n : Festschrift für E. R. Huber, S. 170 f. m. w. N. Außerdem oben § 21 Ziff. 6, Fußnote 34. 44 Vgl. dazu bereits eingehend oben § 16 Ziff. 6 u n d § 21 Ziff. 4. Fast alle Befragten stimmten darin überein, daß die derzeitige S t r u k t u r u n d Organisation der Ressortspitze sehr unbefriedigend u n d daß dafür zwar nicht die Person, aber ganz entscheidend die I n s t i t u t i o n des Ministerialdirektors (als Lebenszeitbeamter) maßgebend ist. E i n Befragter sagte durchaus zutreffend, daß ein i m Sinne des Beamtenrechts „politisch neutraler Ministerialdirektor n u r auf einem B e i n steht u n d längerfristig auch n u r noch aus einem Auge sieht", insgesamt also f ü r den Minister wenig hilfreich u n d deshalb auch grundsätzlich k e i n w i r k l i c h e r allg. Vertreter des Ministers ist. 45 Daß dies i m Prinzip nötig gewesen wäre, wurde grundsätzlich von allen dazu Befragten bestätigt. 46 So etwa U. Echtler, Der beamtete Staatssekretär, S. 263 f.
§ 23 Die Ministerien
193
satz e t w a z u m Z e i t p u n k t des Erlasses des Landesbeamtengesetzes 4 7 , durchaus das d r i n g e n d e B e d ü r f n i s v o n der E r m ä c h t i g u n g des § 31 B R R G G e b r a u c h z u m a c h e n 4 8 , w a r aber bis v o r k u r z e m , n e b e n sicher n i c h t z u v e r k e n n e n d e n G r ü n d e n der R e c h t s t r a d i t i o n i n B a d e n u n d W ü r t t e m berg, v o r a l l e m aus t a k t i s c h e n , p a r t e i p o l i t i s c h e n G r ü n d e n n i c h t b e r e i t , diesen S c h r i t t z u v o l l z i e h e n . D i e m e h r „ t a k t i s c h e n " G r ü n d e w e r d e n v o r a l l e m i n d e m R i s i k o gesehen, der g e g e n w ä r t i g e n O p p o s i t i o n ( S P D / F D P ) i m F a l l eines Regierungswechsels b e i e i n e r d e r nächsten L a n d t a g s w a h l e n d e n W e g f ü r umfassendere P e r s o n a l v e r ä n d e r u n g e n z u e b n e n u n d z u e r m ö g l i c h e n 4 9 . U m dies z u v e r h i n d e r n , n a h m m a n die gegenw ä r t i g e n Personal- u n d Strukturprobleme, die v o n der C D U - R e g i e r i m g u n d n i c h t z u l e t z t v o n w e i t e n K r e i s e n d e r M i n i s t e r i a l v e r w a l t u n g als das k l e i n e r e Ü b e l angesehen w u r d e n , i n K a u f 5 0 . Daß diese A u f f a s s u n g insgesamt gesehen f ü r die E f f e k t i v i t ä t d e r R e g i e r u n g s a r b e i t alles andere als f ö r d e r l i c h ist u n d deshalb äußerst k u r z s i c h t i g a r g u m e n t i e r t 5 1 , k o n n t e d u r c h d i e v o r s t e h e n d e n U n t e r s u c h u n g e n sehr d e u t l i c h a u f g e zeigt w e r d e n . A u c h d i e Tatsache, daß p r a k t i s c h a l l e L ä n d e r v o n d e r E r m ä c h t i g u n g des § 31 B R R G G e b r a u c h gemacht u n d p o l i t i s c h e B e a m t e e r n a n n t h a b e n 5 2 , zeigt, daß d i e I n s t i t u t i o n des p o l i t i s c h e n B e a m t e n a u f 47 Landesbeamtengesetz v o m 1.8.1962 (Ges. Bl. S. 89). Vgl. dazu etwa K . Hahn, i n : ZBR 1962, S. 346, 349; B. Wilhelm, i n : Z B R 1966, S. 357, 360; W. Thieme, i n : öffentlicher Dienst u n d politischer Bereich, SHS Bd. 37, S. 151. 48 Vgl. dazu vor allem H. Filbinger, Entscheidung zur Freiheit, S. 93 ff.; die Einführung des pol. Beamten w u r d e bereits i n der Regierungserklärung 1972 von H. Filbinger angekündigt (Verhandlungen des Landtags, 6. W a h l periode, S. 24 f.) u n d seither i m m e r wieder gefordert; vgl. dazu u. a. Stuttgarter Zeitung v o m 17. 5.1973, S. 7; v o m 14. 8.1974, S. 5; v o m 27.10.1974, S. 12; außerdem J. Bischoff, i n : Die Zeit v o m 17.10.1974, S. 12. 49 M a n w i l l f ü r einen solchen Regierungswechsel die Ministerialdirektoren, die überwiegend der CDU nahestehen, halten. Vgl. dazu bereits oben § 16 Ziff. 7 u n d H. Schneider, i n : Festschrift f ü r E. R. Huber, S. 172. Die I n t e r views haben dies v o l l bestätigt. A u f die Frage, ob diese Überlegungen rechtl. überhaupt relevant sind (Problem der Rückwirkung), soll hier nicht eingegangen werden. 60 Dies wurde von den Befragten i m wesentlichen bestätigt. Vgl. dazu etwa auch, allerdings w o h l etwas überzeichnet, J. Bischoff, i n : Die Zeit v o m 18.10. 1974, S. 12, wo es u. a. heißt: „Die CDU schuf zwar das I n s t i t u t der p o l i t i schen Staatssekretäre u n d füllte die höheren Ränge der Landesverwaltung rücksichtslos m i t Lebenszeitbeamten ihrer Couleur, aber an ein Gesetz, das nach dem V o r b i l d anderer Länder dieses unfeine Treiben i n einen legalen Rahmen hätte setzen können, dachte niemand." Daß letzteres nicht ganz zut r i f f t , ergibt sich aus der Regierungserklärung von H. Filbinger (Verhandlungen des Landtags, 6. Wahlperiode, S. 24 f.) u n d den Hinweisen i n Fußnote 48. 51 Dies trat bei der Auseinandersetzung u m die Ernennung des Regierungspräsidenten für Nordbaden erst jetzt wieder besonders deutlich i n Erscheinung. Vgl. etwa J. Bischoff, i n : Die Zeit v o m 18.10.1974, S. 12, u n d S t u t t garter Zeitung v o m 11.10.1974, S. 5. 52 Neben Bad.-Württ. hat n u r Hamburg u n d Bayern politische Beamte nicht eingeführt. Da aber H a m b u r g als Stadtstaat nicht vergleichbar ist u n d dieses Problem i n Bayern durch die Staatssekretäre gemäß A r t . 50 I I Bay. L V
13 K a t z
194
Kap. I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
Landesebene eine politische Notwendigkeit geworden ist. I n Bad.Württ. ist dies auch nach dem Urteil des StGH vom 24. 2.1973 53 , insbesondere i m Hinblick auf A r t . 77 I L V , nach wie vor dringend geboten. Gerade an der Nahtstelle von Regierung und Verwaltung braucht man dringend das Institut des politischen Beamten 5 4 . Hier reicht loyale Pflichterfüllung eben meist nicht aus; vielmehr bedarf es, was bereits ausgeführt wurde, eines besonderen persönlichen Vertrauensverhältnisses sowie einer Verwirklichimg der Zielsetzungen und überhaupt der gesamten Arbeit auf der gleichen „Wellenlänge" m i t dem politisch und parlamentarisch verantwortlichen Minister. Fällt aber, was vor allem nach einem Regierungswechsel häufig der F a l l sein wird, diese notwendige Zielidentifikation weg, so muß bei einem Ministerialdirektor (Beamter auf Lebenszeit nach der Besoldungsordnung B 9) das Dienstverhältnis, da für solch hohe Beamte keine Möglichkeit einer Umsetzung besteht, grundsätzlich beendet werden können 5 5 . Bei der hier vorgeschlagenen Führungsstruktur der Ministerien ist i m übrigen durch die Abteilungsleiter die erforderliche Stabilität, Kontinuität und auch das Funktionieren der Ministerialverwaltung v o l l gesichert. Die gesamten Ausführungen zeigen, daß für den Amtschef und allgemeinen Vertreter des Ministers dringend der Status des politischen Beamten erforderlich ist und der Landtag deshalb schnellstens von der Ermächtigung des § 31 BRRG Gebrauch machen sollte 5 6 . 4. Politische Beamte Die vorstehende Analyse hat i n weitgehender Übereinstimmung m i t der durchgeführten Befragung gezeigt, daß mindestens für die Ministewesentlich anders gelagert ist (vgl. dazu etwa U. Echtler, Der beamtete Staatssekretär, S. 56), ist eben Bad.-Württ. praktisch das einzige Land, das von § 31 B R R G keinen Gebrauch gemacht hat. Vgl. dazu eingehend, allerdings empirisch i m Ergebnis k a u m haltbar: R. Schunke, Die politischen Beamten, S. 410 ff. Auch die Einführung der politischen Staatssekretäre (vgl. oben § 16 Ziff. 5) änderte an diese Lage nichts wesentliches. Darauf w i r d noch zurückzukommen sein. 53 U r t e i l zum Gesetz über die politischen Staatssekretäre: E S V G H 23, 135 ff. 54 So etwa C. H. Ule, i n : öffentlicher Dienst u n d pol. Bereich, SHS Bd. 37, S. 32 (Diskussionsbeitrag), F. Baer, ebenda, S. 33 u n d F. Duppre, ebenda, S. 14 ff.; vgl. auch R. Schunke, Die politischen Beamten, S. 420 ff. 55 Vgl. dazu etwa C. H. Ule, i n : öffentlicher Dienst u n d pol. Bereich, SHS Bd. 37, S. 32 u n d vor allem Studienkommission für die Reform des öffentlichen Dienstrechts, Kommissionsbericht, S. 161 ff. 56 A u f dem H i n t e r g r u n d des „ F a l l Gerstner" (vgl. § 16 Ziff. 6; J. Bischoff, i n : Die Zeit v o m 18.10.1974, S. 12) hat jetzt vor allem die Regierung ihre oben dargestellte Auffassung geändert u n d i n aller Eile i m Landtag einen E n t w u r f eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Landesbeamtengesetzes eingebracht (vgl. Landtagsdrucksachen, 6. Wahlperiode, Nr. 6680; außerdem etwa Stuttgarter Zeitung v o m 25.1.1975, S. 6 u n d Staatsanzeiger f ü r Bad.W ü r t t . v o m 5. 2.1975, S. 1). Gegenwärtig „ r u h t " der Gesetzentwurf i n dem zuständigen Ausschuß (vgl. auch unten Fußnote 76).
§ 23 Die Ministerien
195
rialdirektoren die Einführung des politischen Beamten dringend geboten ist. Die konkrete Ausgestaltung des Instituts „politischer Beamter" und der Umfang des Personenkreises, der von i h m erfaßt werden soll, blieben allerdings unklar und umstritten. I m wesentlichen lassen sich aber gleichwohl zwei Grundauffassungen dazu herauskristallisieren: (1) Nach der einen Meinung w i r d gefordert, daß Spitzenpositionen i n der öffentlichen Verwaltung (vom Regierungsdirektor — A 15 — an aufwärts) nicht mehr auf Lebenszeit, sondern nur noch auf Zeit besetzt werden sollen, wobei die Besoldung sich aus dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 15 und einem System darauf aufbauender Leistungs- und Funktionszulagen zusammensetzt, die später wieder gestrichen werden können. Dies bedeutet praktisch, daß Spitzenpositionen (ab A 15) nur noch auf Zeit, und zwar ausschließlich für die Dauer der „kreativen Phase" eines Staatsbeamten, verliehen werden. Anschließend an diese „Phase" scheiden die Beamten allerdings nicht aus dem Staatsdienst aus, sondern werden wieder als Regierungsdirektoren nach A 15 weiterbeschäftigt 57 . L. Späth 5 8 fordert darüber hinaus, daß von der Versetzungsmöglichkeit stärker Gebrauch gemacht w i r d (Rotationsprinzip; Versetzung alle 3 bis 5 Jahre), und daß Spitzenleute aus der Wirtschaft i n die Ministerialverwaltung geholt werden müßten. Gerade moderne Managementmethoden und -erfahrungen würden i m öffentlichen Dienst dringend gebraucht 59 . Diese letzte Argumentation ist allerdings besonders problematisch, mindestens i n dieser Allgemeinheit nicht vertretbar und damit letztlich nur für die Staatsbediensteten, deren „Image" schon angeschlagen genug ist, schädlich 60 . 57 So insbes. L . Späth, Vorsitzender der Landtagsfraktion der CDU, i n : Stuttgarter Zeitung v o m 14.8.1974 (S. 5) u n d 5.9.1974 (S. 5); außerdem i n : Südwestpresse, Schwäb. Tagblatt v o m 23.10.1974 (S. 1). Ä h n l i c h bereits H. Filbinger, Entscheidung zur Freiheit, S. 94 f. u n d auch zwei Abteilungsleiter i m Staatsministerium (Ausgangsbasis allerdings bei A 16 bzw. B 3). 68 Vgl. L . Späth, i n : Stuttgarter Zeitung v o m 14.8.1974 (S. 5), 5.9.1974 (S. 5) u n d 4. 6.1975 (S. 5); insbes. auch Südwestpresse, Schwäb. Tagblatt v o m 23.10.1974 (S. 1). 59 Vgl. I n t e r v i e w m i t Staatssekretär G. Mahler, i n : Südwestpresse v o m 23.11.1974, S. 4. 60 Die hier zum Ausdruck kommenden Vorstellungen sind nicht unbedenklich. E. Laux (in: Demokratie u n d Verwaltung, SHS Bd. 50, S. 545, 546) gelangt nach eingehender zutreffender Begründung zu dem Ergebnis, daß „eine Gleichsetzung zwischen öffentl. H a n d u n d Unternehmen, jedenfalls was die oberen Führungsorgane anbetrifft, scheitern muß". Weiter f ü h r t L a u x aus (S. 547), daß „eine mechanische Übertragung von ohnehin vielfach technokratisch angelegten Organisationsvorstellungen eine gefährliche Vereinfachung ist" und, daß es schließlich „nicht n u r eine V e r m u t u n g ist, daß eine w i e auch immer differenzierte Übertragung v o n globalen Managementmodellen auf die öffentliche V e r w a l t u n g nicht möglich ist". Die Studienkommission für die Reform des öffentlichen Dienstrechts legt i n dem Kommissionsbericht die Ziele u n d Aufgaben zu Recht w i e folgt fest
13*
196
Kap. I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
(2) Die andere Auffassung 61 hält es für dringend geboten, auch i n Bad.-Württ. das Institut des politischen Beamten entsprechend § 31 BRRG und § 36 I BBG einzuführen, u m sie so jederzeit i n den einstweiligen Ruhestand versetzen zu können (Ausnahme vom Grundsatz des Lebenszeitbeamten). Das w i r d deshalb als gerechtfertigt angesehen, weil die politischen Beamten, wie § 31 I S. 1 BRRG es formuliert, bei der Ausübung ihres Amtes „ i n fortdauernder Übereinstimmung m i t den grundsätzlichen politischen Ansichten und Zielen der Regierung stehen" und daher, anders als alle anderen Beamten, i n besonderer Weise m i t der jeweiligen Regierung verbunden sein müssen 62 . Über den Personenkreis, der als politische Beamte eingestuft werden soll, bestehen aber auch hier recht unterschiedliche Meinungen. Während die einen verlangen, diesen Status nur für Ministerialdirektoren einzuführen, fordern andere, dieses A m t allen Ministerialbeamten ab Besoldungsgruppe B 3 und allen Leitern der Mittelinstanzbehörden zu verleihen 6 3 . I m Rahmen dieser Arbeit kann die Gesamtproblematik des politischen Beamten, dessen konkrete Ausgestaltung und verfassungsrechtliche Grenzen (vor allem i m Hinblick auf die erste Auffassung) nicht abschließend dargestellt und analysiert werden. Hierzu bedarf es einer auf empirischen Grundlagen beruhenden und auf die Bedürfnisse des Landes abgestellten umfassenden weiteren Untersuchung 64 . Trotzdem lassen sich vor allem aufgrund der durchgeführten empirischen Erhe(S. 97 ff.): „Die Funktionserfordernisse der öffentlichen V e r w a l t u n g ergeben sich vor allem aus den Verfassungsgrundsätzen des demokratischen u n d sozialen Rechtsstaates, aus den Ansprüchen u n d Erwartungen des Bürgers an den Staat u n d den daraus abzuleitenden öffentlichen Aufgaben." 61 Diese Meinung wurde von den meisten dazu befragten Abteilungsleitern u n d Ministerialbeamten insgesamt, außerdem aber etwa auch von einem Staatssekretär (Interview v o m 9.4.1974) vertreten. So w o h l auch die Junge Union Baden-Württemberg, vgl. Stuttgarter Zeitung v o m 14. 8.1974, S. 5. 62 Vgl. dazu Studienkommission für die Reform des öffentlichen Dienstes, Bericht der Kommission, S. 161 f.; BVerfGE 7, 155 ff.; BVerfGE 8, 332 ff.; B V e r w G E 19, 332 ff.; U. Echtler, Der beamtete Staatssekretär, S. 46 f.; R. Schunke, Die politischen Beamten, S. 83 ff. 63 Z u m Personenkreis der pol. Beamten i n den anderen Bundesländern vgl. den Uberblick bei R. Schunke, Die politischen Beamten, S. 86 ff. Der Personenkreis i n dem Gesetzentwurf zur Einführung der politischen Beamten i n Bad.-Württ. (vgl. auch oben Fußnote 56) ist äußerst eng vorgesehen worden (§ 53 a L B G : n u r Ministerialdirektoren u n d Regierungspräsidenten). Bei den Interviews ergab sich, daß die Vertreter der obengenannten ersten Auffassung die vorgesehene Regelung n u r als eine Zwischenlösung betrachten. Vgl. auch Stuttgarter Zeitung v o m 25.1.1975, S. 6 u n d besonders Staatsanzeiger für Bad.-Württ. v o m 5. 2.1975, S. 1 f. 84 F ü r die pol. Beamten des Bundes vgl. U. Echtler, Der beamtete Staatssekretär; einen allgemeinen, allerdings empirisch zu wenig belegten Überblick gibt: R. Schunke, Die politischen Beamten. Vgl. auch: öffentlicher Dienst u n d politischer Bereich, SHS Bd. 37.
§ 23 Die Ministerien
197
bungen (vgl. etwa oben Ziff. 2 und 3) folgende mehr grundsätzliche Erkenntnisse zur Frage der politischen Beamten ableiten: Einerseits ist es neben den i n Ziff. 3 genannten Gründen auch zur Verstärkung des Einflusses der politisch Verantwortlichen (Regierungsmitglieder) auf die Verwaltung notwendig, einen jederzeit realisierbaren und rechtlich abgesicherten Bewegungsspielraum i n der Auswahl, Besetzung und Abberufung von Mitarbeitern des Leitungsbereichs zu besitzen (Gewährleistung des Primats der Politik). H. F i l binger 6 5 hat dazu i m Prinzip zu Recht ausgeführt, daß „ein Dienstrecht, das diesen Spielraum zu stark einschränkt, nicht so recht i n den parlamentarisch-demokratischen Staat paßt, i n dem die Minister ihre M i n i sterien nach ihren Vorstellungen leiten und nicht nur Galionsfiguren sein sollen". Andererseits muß aber bedacht werden, daß gemäß A r t . 33 V GG (Grundsatz des Lebenszeitbeamten) die Ausnahme des § 31 BRRG eng, d. h. restriktiv auszulegen ist. Aus diesem Grund verlangt auch die h. M., daß der Status des politischen Beamten i n den Ländern nur für jene Ämter eingeführt werden darf, die materiell die Voraussetzungen des § 31 I S . 1 BRRG i n besonderem Maße erfüllen und bei denen außerdem die Versetzung eines nicht mehr geeigneten Amtsinhabers i n ein gleichwertiges A m t ohne größeren Zeitverlust nicht möglich ist (funktions- und statusbezogener Begriff) 6 6 . Diese Grundsätze gelten i m wesentlichen auch für Beamte auf Zeit, weshalb die oben dargestellte Auffassung (1) in rechtlicher Hinsicht gegenwärtig äußerst problematisch ist 6 7 . Darüber hinaus muß hier auch bedacht werden, daß — nach der ganz überwiegenden Auffassung — der Grundsatz der Anstellung auf Lebenszeit für den Beamten nicht nur ihre Unabhängigkeit und Eigenverantwortlichkeit, sondern besonders auch die Stabilität und Kontinuität der Verwaltung sichert 68 . Nach H. Schneider 6 9 „gehört es i n der Tat zum Funktionieren der parlamentarischen Regierungsweise, daß bei einem Wechsel der politischen Führung den neuen Regierungsmitgliedern ein fachlich leistungsfähiger, parteipoli65
H. Filbinger, Entscheidung zur Freiheit, S. 95. Vgl. dazu W. Thieme, i n : Studienkommission für die Reform des öffentlichen Dienstrechts Bd. 5, S. 384; C. H. Ule, ebenda, S. 497 f.; F. Mayer, ebenda, S. 677 f.; außerdem R. Schunke, Die politischen Beamten, S. 101 ff. m. w . N. 87 Vgl. etwa C. ff. Ule, i n : Studienkommission f ü r die Reform des öffentlichen Dienstrechts Bd. 5, S. 499 f.; BVerfGE 7, 155, 163 ff. 88 Diese Auffassung, nach der der Grundsatz der Lebenszeitanstellung als „Lebensgesetz des deutschen Berufsbeamtentums" bezeichnet w i r d (so etwa C. H. Ule, i n : Studienkommission f ü r die Reform des öffentlichen Dienstrechts Bd. 5, S. 498), ist zwar zu idealistisch u n d pathetisch; sie enthält aber auch heute noch einen richtigen K e r n u n d ist zu einer besseren V e r w i r k l i chung der Staatsziele (sozialer Rechtsstaat, materielle Gerechtigkeit, Gemeinwohl) durchaus geeignet. Vgl. dazu etwa Studienkommission für die Reform des öffentlichen Dienstrechts, Bericht der Kommission, S. 149 ff. 69 H. Schneider, i n : Festschrift für E. R. Huber, S. 172. 66
198
Kap. I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
tisch nicht exponierter Beamtenkörper sofort zu Gebote steht". Ob diese Argumente noch realitätsbezogen und politisch sinnvoll sind, soll hier nicht weiter untersucht werden. Doch ist es insgesamt gesehen i n den Ministerialverwaltungen der Länder, die überwiegend Verwaltungskompetenzen wahrzunehmen haben (vgl. oben § 7), richtig, den Kreis der politischen Beamten auf die Personen zu beschränken, die echte Spitzenpositionen innehaben und für deren Tätigkeit ein besonderes persönliches Vertrauensverhältnis zur parlamentarisch verantwortlichen Ressortleitung dringend erforderlich ist. Ohne triftige Gründe sollte also der Kreis der politischen Beamten nicht ausgedehnt werden 7 0 . A u f die Reform des öffentlichen Dienstrechts kann hier nicht näher eingegangen werden, doch dürfte, auch unter Berücksichtigung des gegenwärtig praktizierten parteipolitischen Einflusses auf die Personalentscheidungen, selbst heute noch, nicht zuletzt i m Hinblick auf die Unabhängigkeit, Unbeeinflußbarkeit und Funktionsfähigkeit des Staatsapparates 71 , ein modifiziertes Lebenszeitbeamtentum effektiver sein als eine Personalstruktur, die alle wesentlicheren Positionen den politischen oder den Zeitbeamten vorbehält 7 2 . Obwohl die Frage des Umfangs des Personenkreises, für den der politische oder Zeitbeamte eingeführt werden soll, höchst umstritten ist, läßt sich unter Berücksichtigung der dargelegten Grundsätze, der Landeserfordernisse und der überwiegenden Meinung der Befragten feststellen, daß dieser Kreis einmal die Ministerialdirektoren (Amtschefs), darüber hinaus die Abteilungsleiter des Staatsministeriums und gegebenenfalls auch noch die Zentralstellenleiter umfassen soll 7 3 . Dagegen sollten i n diesen Status weder die Abteilungsleiter i n den 70
So etwa C. H. UZe, i n : Studienkommission f ü r die Reform des öffentlichen Dienstrechts, Bd. 5, S. 498; dieses Ergebnis brachte auch die durchgeführte Befragung, die allerdings hier etwas vorsichtig zu interpretieren ist (im Hinblick auf den Kreis der Befragten). 71 Vgl. dazu Ausführungen i n Fußnote 68. 72 Neben den Ausführungen i n den Fußnoten 60 u n d 68, vgl. Studienkommission für die Reform des öffentlichen Dienstrechts, Bericht der K o m mission, S. 149 ff. u n d 161 f.; R. Schunke, Die politischen Beamten, S. 381 ff. Vgl. etwa auch P. Brandenburg (FDP), i n : Stuttgarter Zeitung v o m 15. 8.1974, S. 5. Nicht ganz zu Unrecht befürchtete ein Befragter, daß „bei einer großzügigen E i n f ü h r u n g des politischen Beamten oder gar des Zeitbeamten noch v i e l mehr als bisher rein parteipolitische u n d k a u m mehr fachliche Gesichtspunkte bei Personalentscheidungen maßgebend sein würden". 73 Die Abteilungsleiter sind funktionell i m Staatsministerium zwangsläufig so stark m i t politisch relevanten Angelegenheiten beschäftigt, daß f ü r sie grundsätzlich die politische Identifikation u n d das persönliche Vertrauensverhältnis zum Ministerpräsidenten gegenüber dem reinen Fachwissen i m Vordergrund steht. Das g i l t auf jeden F a l l f ü r die Grundsatz- u n d Presseabteilung ( I V u n d VI), m i t leichten Abstrichen für die Abteilungen I, I I , I I I , allerdings w e i t weniger f ü r die A b t e i l u n g V (Protokollangelegenheiten). Ob die Überführung der Abteilungsleiter i n politische Beamte besoldungsrechtliche Konsequenzen (etwa B 7) nach sich ziehen würde, soll hier nicht erörtert
§ 23 Die Ministerien
199
Kessorts (auch n i c h t die L e i t e r d e r Z - A b t e i l u n g e n ) 7 4 noch d i e ü b r i g e n M i t a r b e i t e r i n d e n Z e n t r a l s t e l l e n (einschließlich der persönlichen Refer e n t e n ) 7 5 ü b e r f ü h r t w e r d e n . D i e M e h r h e i t d e r B e f r a g t e n w a r der A u f fassung, daß der S a c h v e r s t a n d i n d e n A b t e i l u n g e n n u r d a n n m a x i m a l g e n u t z t w e r d e n k a n n , w e n n i n d e r P e r s o n d e r A b t e i l u n g s l e i t e r eine gewisse K o n t i n u i t ä t besteht. D a m i t h ä n g t zusammen, daß j a gerade d u r c h die M i t w i r k u n g d e r A b t e i l u n g s l e i t e r als L e b e n s z e i t b e a m t e i n der F ü h r u n g s k o n f e r e n z e i n stabilisierendes E l e m e n t u n d ü b e r h a u p t das F u n k t i o n i e r e n d e r M i n i s t e r i a l v e r w a l t u n g m i t i n s t i t u t i o n a l i s i e r t w e r d e n soll. D i e E i n f ü h r u n g d e r p o l i t i s c h e n B e a m t e n i n d e m h i e r b e schriebenen U m f a n g w ü r d e sicher m i n d e s t e n s g e g e n w ä r t i g eine ausgewogene u n d d e n L a n d e s b e d ü r f n i s s e n w e i t g e h e n d gerecht w e r d e n d e Regelung darstellen 76. 5. Politische Staatssekretäre D i e m i t Gesetz v o m 19. 7.1972 (Ges. B l . S. 392) n e u e i n g e f ü h r t e I n s t i t u t i o n des p o l i t i s c h e n Staatssekretärs w u r d e b e r e i t s oben § 16 Z i f f . 5 a u s f ü h r l i c h d a r g e s t e l l t 7 7 . A u s G r ü n d e n der V e r s t ä n d l i c h k e i t w a r es werden. F ü r die Zentralstellenleiter gilt i m wesentlichen dasselbe. Allerdings ist hier, da die Zentralstellenleiter derzeit nach B 3 besoldet werden, zu prüfen, ob sie gegebenenfalls ohne Schwierigkeiten versetzt werden könnten. Da dies bei kleineren Ministerien durchaus problematisch sein k a n n u n d sie eben besonders Vertraute (in der Regel CDU-Parteimitglieder) des Ministers und des Amtschefs sein müssen, sollte auch f ü r sie ernsthaft geprüft werden, ob sie ausnahmsweise den Status eines politischen Beamten erhalten sollen. 74 Vgl. dazu oben Ziff. 2 u n d etwa H. Karehnke, i n : D Ö V 1974, S. 119 (Fußnote 33). Es soll dadurch vor allem vermieden werden, daß durch eine Besetzung der Z.-Abteilungsleiterstelle m i t einem eng Vertrauten des Ministers zu sehr bei Personalstellen persönliche u n d parteipolitische Dinge eine Rolle spielen. 75 F ü r diesen Personenkreis (i. d. R. A 13 - A 15) müßte es ohne größere Schwierigkeiten innerhalb des Ministeriums Versetzungsmöglichkeiten geben. 76 Der Gesetzentwurf zur Einführung von politischen Beamten k a n n keinesfalls als umfassendes Konzept f ü r die hier angesprochenen Probleme angesehen werden (vgl. Landtagsdrucksache V I Nr. 6680). Vielmehr handelt es sich dabei n u r u m eine Sofortmaßnahme (erste Reaktion) auf den „ F a l l Gerstner" (vgl. auch die Fußnoten 56 u n d 63). So ist etwa nach Auffassung der C D U - F r a k t i o n dieser Gesetzentwurf n u r ein „erster Schritt i n die richtige Richtung" (so etwa ausdrücklich ABG. E.Volz, CDU, i n : Staatsanzeiger Bad.- W ü r t t . v o m 5. 2.1975, S. 1). I m übrigen ergaben die Interviews, daß bis zur nächsten Landtagswahl insoweit sicher alles beim alten bleiben w i r d . Die Landesregierung w i r d also spätestens 1976 nicht mehr u m h i n können, sich für ein klares, sinnvolles Konzept zu entscheiden. 77 Z u den Staatssekretären m i t Kabinettsrang vgl. oben § 16 Ziff. 2 u n d § 20 Ziff. 4. Da alle bisherigen Staatssekretäre gemäß A r t . 45 I I L V einem M i n i sterium zugeordnet u n d damit gewissermaßen einem Minister „unterstellt" wurden (zweite Ausgestaltungsart, vgl. oben § 16 Ziff. 2) gelten die folgenden Ausführungen weitgehend auch f ü r diese. Dies gilt, w i e die Befragungen ergeben haben, ganz besonders f ü r den Staatssekretär m i t Kabinettsrang i m Staatsministerium, der deshalb hier meist m i t untersucht w i r d .
200
Kap. I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
notwendig, wesentliche Teile der durchgeführten empirischen Erhebung schon dort zu behandeln, so daß hier weitgehend auf diese Ausführungen verwiesen werden kann. Da die Aufgaben und Kompetenzen weder i n dem Staatssekretärgesetz selbst näher umschrieben noch durch einen Organisationsakt der Regierung allgemein oder konkret festgelegt sind (vgl. oben § 17 Ziff. 3), müssen sie i m Einzelfall den betreffenden, vom Minister erlassenen Hausverfügungen entnommen werden 7 8 . Bei näherem Zusehen zeigt sich allerdings, daß auch hieraus, insbesondere aufgrund der sehr vagen Formulierungen wie etwa „Vertretung des Ministers i n allen Angelegenheiten von politischer Bedeutung (Ministersachen)", nicht sehr viel entnommen werden kann. Selbst i m Rahmen der durchgeführten Befragung konnten die Aufgaben und Kompetenzen erstaunlicherweise nicht genau bestimmt werden. Dies beruht darauf, daß die Aussagen der Staatssekretäre und der Mitarbeiter i n den Zentralstellen einerseits und der übrigen Ministerialbeamten andererseits zu dieser Frage so konträr waren, daß sie auf keinen gemeinsamen Nenner gebracht werden konnten 7 9 . Gleichwohl lassen sich einige vorsichtige Feststellungen treffen 8 0 : — Die dem Staatssekretär obliegenden Aufgaben und sind i n aller Regel nicht generell festgelegt, sondern gehend vom Ministerpräsidenten oder Minister von (konkret) bestimmt. Die erlassenen Hausverfügungen Praxis nur eine geringe Bedeutung.
Kompetenzen werden weitFall zu Fall haben i n der
— Der Ministerpräsident und die Minister nehmen, wenn es irgendwie geht, alle Angelegenheiten von politischer Bedeutung selbst wahr. Eine Vertretung durch den Staatssekretär i n diesen Angelegenheiten (Partei, Fraktion, Landtag, Kabinett usw.) erfolgt meist nur i m echten Verhinderungsfall. — Die Staatssekretäre haben oft kleinere, politisch bedeutsame Angelegenheiten wahrzunehmen (meist deren Spezialinteressen). So sind 78 Vgl. die Verfügungen des Innenministers v o m 23. 8. u n d 5.10.1972 sowie die Kanzleiverfügung des Kultusministers v o m 13.10.1972 (Landtagsdrucksache VI/968). Eine vergleichende Gegenüberstellung der beiden Verfügungen des Innenministers ist dabei recht interessant! 79 Solche Ergebnisse dürften sich keinesfalls innerhalb eines Ministeriums (einschließlich Staatsministerium), aber auch nicht innerhalb der gesamten Ministerialverwaltung ergeben. Die Ursachen dafür sollten dringend beseitigt werden. Diese Tatsache zeigt aber auch eine gewisse Isoliertheit des Staatssekretärs i m M i n i s t e r i u m (vgl. oben § 16 Ziff. 5) u n d bestätigt i m übrigen die vorstehenden Ausführungen unter Ziff. 3 u n d 4. 80 Diese Aussagen beziehen sich hauptsächlich auf Interviews i m Staats-, I n n e n - und K u l t u s m i n i s t e r i u m sowie m i t dem Staatssekretär (mit Kabinettsrang) i m Staatsministerium u n d m i t dem pol. Staatssekretär i m I n n e n m i n i sterium (heute i m Landwirtschaftsministerium).
§ 23 Die Ministerien
201
etwa dem Staatssekretär i m Staatsministerium die Sonderaufgaben Information (Informationssystem) 81 und Dokumentation übertragen, während der Staatssekretär i m Innenministerium beispielsweise für die Probleme des Bodenrechts und der Gemeindereform (zum „Ablocken von Einwendungen i n der Endphase", wie es ein Befragter formulierte) 8 2 zuständig war. Insgesamt sind die Zuständigkeiten der Staatssekretäre nicht gerade bedeutend. — Die Staatssekretäre bilden keine zusätzliche Verwaltungsebene. I m Innen- und Kultusministerium sind sie i n organisatorischer Hinsicht den Zentralstellen faktisch weitgehend angegliedert. Da eine solche Stabseinheit i m Staatsministerium nicht besteht, w i r d verständlich, daß der dortige Staatssekretär noch „isolierter" ist als die politischen Staatssekretäre i m Innen- und Kultusministerium (vgl. oben § 16 Ziff. 5). Diese Ausführungen zeigen, daß der ursprünglich von der Regierung und der Parlamentsmehrheit m i t dem A m t des politischen Staatssekretärs verfolgte Sinn und Zweck (vgl. oben § 16 Ziff. 5) sich nur i n geringem Umfang erfüllt hat. Das gilt, wie es Kröger 8 3 formuliert hat, für die erstrebte Entlastung der Minister sowohl von repräsentativen Verpflichtungen als auch von der Pflege des Kontakts zu den Fraktionen, Parteien und Ausschüssen. I n der Öffentlichkeit ist der Staatssekretär bisher nicht als Vertreter seines Ministers akzeptiert worden. Verbände und andere Vereinigungen von Rang und Ansehen bestehen nach wie vor auf der persönlichen Anwesenheit des Fachministers. Auch Rundfunk, Fernsehen und Presse wünschen i n aller Regel die Stellungnahme des Ministers und nicht die seines politischen Gehilfen. A l l dies gilt für den Ministerpräsidenten und den Staatssekretär i m Staatsministerium i n noch stärkerem Maße. Diese von der Regierung sicher nicht gewünschte Entwicklung beruht auf sehr komplexen und äußerst vielschichtigen Faktoren politischer, sachlicher, organisatorischer und nicht zuletzt personeller A r t . Für die Tatsache, daß die Institution des politischen Staatssekretärs i n Bad.-Württ. die Bewäh81 Vgl. dazu etwa Staatssekretär Mahler auf der Landespressekonferenz v o m 24. 7.1974, i n : Staatsanzeiger B W v o m 31. 7.1974, S. 1 (Grobkonzept eines umfassenden Informationssystems f ü r Bad.-Württ.). 82 Nach Abschluß der Gemeindereform i m J u l i 1974 verlor dieser Staatssekretär deshalb auch weitgehend seinen Aufgabenbereich, weshalb es konsequent war, i h n ab 1. 9.1974 ins Landwirtschaftsministerium (Umweltfragen) zu versetzen. Auch hier sei nochmals darauf hingewiesen, daß i n der Arbeit, soweit nichts anderes angegeben ist, v o m Ist-Bestand 30. 6.1974 ausgegangen wird. 83 Die von K . Kröger, i n : D Ö V 1974, S. 588 angeführte auf Bundesebene bestehende Praxis (parlamentarische Staatssekretäre) gilt weitgehend auch f ü r das L a n d Bad.-Württ. (insbes. pol. Staatssekretäre).
202
Kap. I I I : Organisation und S t r u k t u r der Landesregierung B W
rungsprobe praktisch nicht bestanden hat, waren m. E. i m wesentlichen folgende erkennbaren Gründe maßgebend: (1) Die zwei politischen Staatssekretäre sind beide gleichzeitig Landtagsabgeordnete und deshalb genötigt, einen laufenden persönlichen Rollentausch zwischen Legislative und Exekutive vorzunehmen 84 . Dies bedeutet i n der Praxis, daß sie i m Parlament als Teil der Regierung und i n den Ressorts überwiegend als Abgeordnete betrachtet werden, was ihre Arbeit i n beiden Bereichen nicht unerheblich erschwert. Ob dies nur eine vorübergehende Erscheinung ist, die Doppelrolle also mit der Zeit, ähnlich wie bei den Ministern selbst, vom Parlament und von der Verwaltung akzeptiert wird, kann heute noch nicht festgestellt werden 8 5 . (2) Ein wesentlicher Faktor für die negative Entwicklung ist i n der A r t und Weise (Entscheidungsprozeß) der Ernennung der politischen Staatssekretäre zu suchen. Bei der Regierungsbildung i m Mai/Juni 1972 ergab sich die politische Notwendigkeit, i m Rahmen einer gewissen landsmannschaftlichen Ausgewogenheit des Kabinetts das württembergische Element noch stärker zu berücksichtigen und außerdem dringenden Wünschen des CDU-Mittelstandes, der Jungen Union usw. nachzukommen 8 6 . Nicht nur das A m t des Staatssekretärs nach A r t . 45 I I LV, sondern auch das des politischen Staatssekretärs wurden also u. a. „zum Zwecke des innerparteilichen Austarierens" benötigt und benutzt 8 7 . Die unter solchen Gesichtspunkten vorgenommene Ernennung von Staatssekretären bringt zwei weitreichende Nachteile m i t sich. Zum einen erfolgt unter solchen Vorzeichen die Berufung eines Staatssekretärs meist nicht entsprechend den Wünschen des Ministers, dem er zugeordnet werden soll, sondern primär unter gesamtparteipolitischen „Proporzinteressen". Gerade aber w e i l zwischen Minister und Staatssekretär ein besonders enges persönliches und politisches Vertrauensverhältnis bestehen sollte, w i r d durch ein solches Verfahren oft die Effektivität der Institution des Staatssekretärs bewußt relativiert, wenn nicht unterlaufen 8 8 . Zum anderen w i r d dadurch ein wichtiges 84 Z. B. bringen sie i m Parlament Anfragen einerseits selbst ein, während sie andererseits ab u n d zu solche Anfragen i n Vertretung des Ministers beantworten. 85 Vgl. dazu insbes. K . Kröger, i n : D Ö V 1974, S. 589 m. w. N.; H. Schneider, i n : Festschrift f ü r E. R. Huber, S. 178 f. 86 Vgl. dazu eingehend bereits oben § 20 Ziff. 2 (Staatssekretär Mahler, Nordwürtt., v o m C D U - Mittelstand; Staatssekretär Teufel, Südwürtt., von der Jungen Union). 87 Vgl. F. K. Fromme, i n : ZRP 1973, S. 156 f.; K . Kröger, i n : D Ö V 1974, S. 589. 88 Dieses Problem darf keinesfalls unterschätzt werden; selbst die befragten Staatssekretäre erkannten klar, daß i h r „Schlüssel zum Erfolg" primär i n dem Vertrauensverhältnis zum Ministerpräsidenten bzw. Minister liegt.
§ 23 Die Ministerien
203
Argument für die Einführung des politischen Staatssekretärs, nämlich junge ministrable Politiker auf die spätere Übernahme eines entsprechenden Amtes vorzubereiten („Ministerschule"), überwiegend nicht verwirklicht werden können 8 9 . Die Entwicklung der letzten zwei Jahre hat denn auch bei den drei hier näher untersuchten Staatssekretären 90 gezeigt, daß w o h l aus Gründen eines den Bedürfnissen nicht v o l l genügenden Vertrauensverhältnisses und zum Teil einer zu geringen Motivation (Personen, die davon ausgehen konnten, daß sie nicht ministrabel sind), die i n das A m t des Staatssekretärs gesetzten Erwartungen überwiegend nicht erfüllt werden konnten. (3) Ein weiterer Nachteil liegt für die Arbeit der Staatssekretäre darin begründet, daß ihnen weitgehend kein generell geltender, klar umrissener Geschäftsbereich zur Erledigung zugewiesen ist. Gerade dieser Punkt w i r d von den befragten Staatssekretären als besonders verbesserungsbedürftig empfunden. Es kann keinesfalls Sinn der Institution des Staatssekretärs sein, quasi als ein „Anhängsel der Zentralstelle" zu fungieren; vielmehr müssen ihnen umfassendere, wichtige Zuständigkeiten zur dauernden Wahrnehmung übertragen werden. Hierbei bestehen allerdings aufgrund des Staatssekretärsurteils 91 enge verfassungsrechtliche Grenzen, die es praktisch verhindern, daß die m i t dem A m t des politischen Staatssekretärs verfolgte Zielsetzung überhaupt erreicht werden kann 9 2 . (4) Ferner scheint auch i n Bad.-Württ. die Tendenz zu bestehen, den potentiellen politischen „Rivalen" mitunter zu isolieren und ihm keine entscheidenderen Machtbefugnisse zu delegieren 93 . (5) Schließlich liegt ein wesentlicher Grund für die teilweise Nichteinlösung der i n das A m t des politischen Staatssekretärs gesetzten Erwartungen i n der Struktur und den Aufgaben der Landesministerien begründet 94 . I n der Ministerialverwaltung ist man ganz überwiegend davon überzeugt, daß die Ministerialorganisation der Länder, wie sie sich i n den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, abgesehen von kleineren Verbesserungen grundsätzlich auch heute noch i n der Lage Vgl. dazu K. Kröger, i n : D Ö V 1974, S. 589 m. w. N.; H. Lauf er, Der Parlamentarische Staatssekretär, S. 98 f. 89 Vgl. zu den Erfahrungen auf Bundesebene: F. K . Fromme, i n : ZRP 1973, S. 157; K . Kröger, i n : D Ö V 1974, S. 589 m. w. N. 90 Vgl. oben Fußnoten 77 u n d 78. 91 E S V G H 23, 135, 144 ff. 92 Vgl. dazu eingehend oben § 16 Ziff. 5; vgl. auch E. Klein, i n : DÖV 1974, S. 592. 93 Diesen Schluß lassen mehrere Bemerkungen v o n Befragten zu diesem Problem zu. Vgl. auch K. Kröger, i n : D Ö V 1974, S. 585 ff. 94 Vgl. dazu oben § 7 Ziff. 1.
204
Kap. I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
ist, die Landesaufgaben v o l l zu erfüllen. Man sieht also i n dem A m t des politischen Staatssekretärs lediglich eine unnötige, nur Kompetenzkonflikte und Spannungen (insbes. zwischen Staatssekretär und Amtschef) hervorrufende Veränderung der Organisationsstruktur. Schwerwiegender ist allerdings das immer wieder geäußerte Argument zu werten, daß die Institution des parlamentarischen bzw. politischen Staatssekretärs, die schon auf Bundesebene nicht unbestritten ist, keinesfalls für die Länder erforderlich und damit hier überflüssig ist. I n der Tat kann nicht geleugnet werden, daß selbst bei der Leitung der Landesministerien die Vollzugsaufgaben und das Dirigieren des Vollzugsapparats und weniger gesellschafts- und parteipolitische Probleme i m Vordergrund stehen, so daß für die Bewältigung der Führungsaufgaben i n den Landesministerien neben dem Minister ein fachlich qualifizierter Amtschef i n aller Regel geeigneter ist als ein politischer oder parlamentarischer Staatssekretär 95 . Aufgrund dieser Argumente nimmt es nicht wunder, daß zwar die Mehrheit der Ministerialbeamten noch einsieht, daß entsprechend der heutigen Entwicklung der Amtschef politischer Beamter sein sollte und dem Minister und seinem Stellvertreter auch ein allerdings nicht zu großes Ministerbüro (Zentralstelle) zur Verfügung stehen muß, daß aber ganz überwiegend die zusätzliche Institution des politischen Staatssekretärs grundsätzlich als „Fremdkörper" und wenig sinnvoll, also als unnötig betrachtet w i r d 9 6 . Die gesamten bisherigen Ausführungen des § 23 haben auch bei aller Zurückhaltung einigermaßen deutlich erkennen lassen, daß gegenwärtig das A m t des politischen Staatssekretärs sich weitgehend nicht bewährt hat, teilweise sogar ein „institutionelles Neutrum" darstellt und deshalb eigentlich abgeschafft werden sollte 9 7 . Der gegen eine solche Abschaffung mögliche Einwand, daß dann das Element des „Primats der Politik" i n der Ressortspitze nicht mehr genügend repräsentiert sei, ist sicher unberechtigt. Denn geht man davon aus, daß in den Landesministerien entsprechend ihrer Aufgabenstellung dieses Element i n wesentlich geringerem Umfang auftritt und damit weniger benötigt w i r d als auf Bundesebene und berücksichtigt zudem noch die hier gemachten Änderungsvorschläge für die Ministerialorganisation, insbesondere die 95 Z u den Unterschieden i n den Aufgaben u n d Funktionen v o n B u n d und Ländern vgl. eingehend oben § 7; außerdem T. Ellwein, Regierungssystem, S. 320; F. Wagener, i n : Mensch u n d Staat i n N R W (Hrsg.: W. Lenz), S. 167 ff. 96 Vgl. dazu auch die Ausführungen oben § 16 Ziff. 5, § 20 Ziff. 4 u n d § 23 Ziff. 2. 97 Bei einem Festhalten an dem politischen Staatssekretär sollten aber auf alle Fälle wenigstens folgende zwei Punkte k ü n f t i g beachtet werden: (1) Die Entscheidung über die Ernennung muß dem Minister, dem er zugeordnet w e r den soll, weitgehend vorbehalten bleiben u n d (2) dem Staatssekretär muß möglichst v o m K a b i n e t t i m Einvernehmen m i t dem Minister ein nicht u n wesentlicher, k l a r abgegrenzter Aufgabenbereich zugewiesen werden.
§ 23 Die Ministerien
205
Statusänderung der Ministerialdirektoren und Zentralstellenleiter (politische Beamte) und die Ausgestaltung der Zentralstellen, so w i r d doch offensichtlich, daß die zusätzliche Institution des politischen Staatssekretärs für die Arbeit der Ressortspitze i n den Landesministerien nicht notwendig sein dürfte und insgesamt mehr Komplikationen und Belastungen („Störungsfaktoren") als effektive Vorteile m i t sich zu bringen scheint 98 . Diese sich so deutlich abzeichnende Verfassungswirklichkeit i m Hinblick auf die politischen Staatssekretäre, die allein aufgrund der Erfahrungen einer erst 2 l k ] ährigen Praxis i n Bad.-Württ. allerdings noch nicht endgültig festgelegt werden kann, w i r d i n gewisser Weise aber auch durch die Entwicklung des Amts des parlamentarischen Staatssekretärs i n Bonn bestätigt 99 . Die Erfahrungen i n den Bundesministerien haben i n den letzten Jahren immer stärker die Forderung nach einer „Großen Lösung" aufkommen lassen, die allein geeignet wäre, das Dilemma des parlamentarischen Staatssekretärs zu lösen 100 . Diese Reformüberlegungen bestätigen unter Berücksichtigung der besonderen Notwendigkeiten und Bedürfnisse der Länder grundsätzlich die hier vertretene und vorgeschlagene Konzeption. Da das bad.-württ. Kabinett zahlenmäßig fast den „Idealzuschnitt" besitzt (vgl. oben § 20 Ziff. 4), bedarf es dabei der „Großen Lösung" nicht 1 0 1 . Für Sonderaufgaben und besondere politische Schwerpunkte sollten aber Staatssekretäre m i t Kabinettsrang (Sonder- oder Staatsminister) berufen werden können 1 0 2 . Dabei ist diesen Staatssekretären ein einigermaßen 98
Vgl. dazu etwa ff. Lauf er, Der Parlamentarische Staatssekretär, S. 98 f. Vgl. Projektgruppe BMI, D r i t t e r Bericht, 11/13 f., 11/22 ff. (Bundesbevollmächtigte als A r t „Minister f ü r Sonderaufgaben"); H. Karehnke, i n : D Ö V 1974, S. 118; C. Arndt, i n : Der Staat 1970, S. 504 ff.; U. Echtler, Der beamtete Staatssekretär, S. 261 ff.; F. K . Fromme, i n : ZRP 1973, S. 153 ff.; K . Kröger, i n : D Ö V 1974, S. 585 ff. m. w. N. 100 Eine solche echte Regierungsreform würde gewissermaßen eine Annäher u n g an das englische System bedeuten. U. Echtler (Der beamtete Staatssekretär, S. 266) umschreibt die „Große Lösung" w i e folgt: „Gelänge es ein sogen, inneres Entscheidungskabinett von etwa 6 bis 7 Ministern zu bilden, u m das sich ein größeres Kabinett von 15 bis 20 Staatsministern gruppiert, die jeweils einem M i t g l i e d des inneren Kabinetts zugeordnet wären, aber dennoch einen eigenen Zuständigkeitsbereich hätten, könnte sich daraus ein sinnvoller politischer Überbau der Bundesministerien ergeben, der auch den Parlamentarischen Staatssekretären Raum f ü r sinnvolle politische Befugnisse ließe. Als politischer Leiter eines Teilressorts wären sie nicht mehr darauf angewiesen, ihren Kompetenzbereich auf Kosten der beamteten Staatssekretäre auszuweiten." 101 Auch das „Bay. System" (Art. 50 I I Bay. L V ) dürfte insgesamt gesehen zu aufwendig u n d gegenüber der hier vorgeschlagenen Regelung weniger effektiv u n d w o h l auch weniger flexibel sein. Vgl. dazu etwa U. Echtler, Der beamtete Staatssekretär, S. 53 ff., 265 f. m. w. N. 102 v g l dazu bereits eingehend oben § 20 Ziff. 4. Entsprechend den gegenwärtigen Notwendigkeiten wäre neben dem „ M i n i s t e r für Bundesangelegen99
206
Kap. I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
klar umrissener Geschäftsbereich (vgl. A r t . 45 I I I LV) zuzuweisen, für den sie parlamentarisch verantwortlich sind 1 0 3 . Neben dieser Institution sollte dann aber auf das A m t des politischen Staatssekretärs, das nicht zuletzt gemäß A r t . 77 I L V nur sehr beschränkt „einsatzfähig" wäre, ganz verzichtet werden 1 0 4 . 6. Organisation der Ressortspitze Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, daß aufgrund der Befragungsergebnisse, einer Abwägung aller Argumente und einer zwar nicht umfassenden, aber doch alle wesentlichen Faktoren berücksichtigenden Untersuchung, die Leitungsorganisation i n den Ministerien der Länder entsprechend den gegenwärtigen Erfordernissen, wie auf S. 207 i n Abb. 1 dargestellt, ausgestaltet sein müßte (Organisationsvorschlag). Der hier gemachte Vorschlag zur Führungsorganisation ist dabei als Grundschema für die Ministerien des Landes Bad.-Württ. zu verstehen, der entsprechend den besonderen Bedürfnissen der einzelnen Ressorts sicher an manchen Punkten noch etwas modifiziert werden muß 1 0 5 . 7. Beziehungsmuster zwischen Ressort und Staatsministerium und zwischen den Ressorts Die Zusammenarbeit der Ministerien einschließlich des Staatsministeriums ist i n Bad.-Württ. nirgends generell geregelt. Eine Geschäftsordnung wurde bis heute nicht erlassen und die Dienstordnung für die Staatsbehörden 106 enthält solche Vorschriften nicht 1 0 7 . I m wesentlichen haben sich aber zur Wahrnehmung der Kooperations-, Koordinaheiten" i m Staatsministerium (Art. 51 I GG) u n d dem Staatssekretär f ü r Vertriebene, Flüchtlinge u n d Kriegsbeschädigte i m Innenministerium zusätzlich an einen Staatssekretär f ü r Umweltfragen u n d einen Staatssekretär f ü r Hochschul- u n d Berufsbildungsangelegenheiten zu denken. 103 Gem. A r t . 77 I L V u n d den diesbezüglichen Ausführungen i n dem Staatssekretärsurteil des S t G H (ESVGH 23, 135, 144 ff.) ist dies besonders wichtig. Da politischen Staatssekretären nach der Auffassung des S t G H wesentliche Aufgaben nicht übertragen werden können, bietet sich f ü r Bad.W ü r t t . die vorgeschlagene Lösung besonders an, j a ist sogar geboten (vgl. eingehend oben § 16 Ziff. 5); vgl. dazu etwa H. Schneider, i n : Festschrift für E. R. Huber, S. 177 f. 104 Der Vorschlag der Projektgruppe BMI, D r i t t e r Bericht, 11/22 ff. (11/32) geht i m wesentlichen i n dieselbe Richtung (Einsetzung von Bevollmächtigten des Bundes f ü r besondere Aufgaben). ios v g L dazu etwa den Vorschlag zur Organisation des Bay. Staatsministeriums des Inneren, i n : Projektgruppe Bay. I M , Reformbericht, S. 97 ff., Anlage 2. 106
Dienstordnung v o m 3.12.1970 (GABI. 1971, S. 1 ff.). Vgl. etwa §§ 70 ff. der gemeinsamen GeschO der Bundesministerien — Allg. T e i l — ; §§ 65 ff. der gemeinsamen Geschäftsordnung Niedersachsen. 107
207
§23 Die Ministerien r - *
.L. Minister
persönl. Referent
1 i Zentralstelle j
Staatssekretär als politischer Beamter
Führung
jkonferenz
i Presse- und Öffentlichi keitsarbeit -1Zentral- ! Bundes- u. Bundesratsstellen- | angelegenheiten, Länleiter j derministerkonferenz -1Kabinettsarbeit (polit. j Landtag -2Beamter)! Programmu. Planungsi koordination X
Abteilungsleiter (Lebensz eitbeamte)
L.
Abbildung
1: Leitungsörganisation der Ministerien
tions-, K o n f l i k t s b e i l e g u n g s - , K o m m u n i k a t i o n s - u n d I n f o r m a t i o n s f u r i k t i o n e n d r e i I n s t r u m e n t e v o n a l l e r d i n g s recht u n t e r s c h i e d l i c h e r B e d e u tung herausgebildet108: (1) D i e oberste Ebene, a u f der diese F u n k t i o n e n e r f ü l l t w e r d e n , i s t der M i n i s t e r r a t ( K a b i n e t t ) . D i e A u s f ü h r u n g e n o b e n § 21 (insbesondere 108 Vgl. dazu auch F. Scharpf, öffentlicht).
Länderbericht Bad.-Württ., S. 12 f. (unver-
208
Kap. I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
Ziff. 4 und 6) haben erkennen lassen, daß der Stellenwert dieses Kooperations- und Kommunikationsorgans hoch einzuschätzen ist. Vor allem die politische Koordinations- und Informationsleistung ist von besonderer Bedeutung. Diese Tatsache liegt zum großen Teil darin begründet, daß zum einen die Größe des Ministerrats fast ideal ist (ca. 8 bis 11 Mitglieder) und zum anderen sich das Kabinett eben auch als Informations- und Diskussionsgremium versteht 1 0 9 . (2) Die zweite Ebene bilden die interministeriellen Gremien 1 1 0 , deren Bedeutung für die hier interessierenden Zwecke aber wesentlich geringer zu veranschlagen ist. Von den zahlreichen ständigen interministeriellen Ausschüssen, die zur Zeit bestehen 111 , sind die meisten uneffekt i v oder treten überhaupt nicht mehr zusammen 112 . Eine Ausnahme bilden dabei neben dem interministeriellen Ausschuß für Umweltfragen und dem Ausschuß zur Koordinierung kommunaler Investitionen 1 1 3 vor allem die Konferenz der Zentralstellenleiter und der interministerielle Ausschuß für Bundesratsangelegenheiten (Referentenbesprechung). Diese Gremien und ihre Arbeit sollen hier nicht i m einzelnen dargestellt werden. Vielmehr sind i n diesem Zusammenhang lediglich zwei grundlegende Aspekte herauszustellen 114 . Interessant ist einmal, daß interministerielle Ausschüsse dann besonders effektiv arbeiten, wenn das Staatsministerium und nach Möglichkeit ein Abteilungsleiter der Staatskanzlei dabei den Vorsitz (Federführung) innehat. Zum anderen ist bemerkenswert, daß anscheinend interministerielle Gremien nur 109 Bei der Regierungsbildung i m J u n i 1972 wurde zur weiteren Koordinier u n g ein Kabinettsausschuß f ü r Umweltschutz eingesetzt, dem vier Regierungsmitglieder angehören. 110 A n allg. L i t e r a t u r zu (interministeriellen) Ausschüssen vgl. etwa: K. von der Groeben, i n : Die V e r w a l t u n g 1968, S. 385 ff.; E. Laux, i n : A k t u e l l e Probleme der Ministerialorganisation, SHS Bd. 48, S. 321 ff. 111 Es konnte niemand gefunden werden, der einen einigermaßen genauen Überblick über diese Ausschüsse geben konnte. Ganz grob dürfte es sich u m ca. 10 bis 15 Gremien (mit beratenden Funktionen) handeln. 112 So w i r d etwa, was eigentlich erstaunt, übereinstimmend die Arbeitsgemeinschaft der Organisationsreferenten (vgl. Nr. 22 u n d 122 I X der Dienstordnung v o m 3.12.1970, GABI. 1971, S. 1 ff.) als praktisch nicht oder n u r wenig funktionsfähig bezeichnet! 113 Diese beiden interministeriellen Ausschüsse sind zur Koordinierung weitgespannter Aufgabengebiete (insbes. bei Ressortüberschneidungen) i m J u n i 1972 i m Zusammenhang m i t der Neuabgrenzung der Ressorts gebildet worden. Die vorliegenden Erfahrungen über diese Gremien sind noch zu lückenhaft, u m über ihre Effektivität ein U r t e i l abgeben zu können, w e n n gleich nicht zu verkennen ist, daß die Erwartungen mindestens nicht v o l l erfüllt w u r d e n (vgl. Pressemitteilung Nr. 317/72 der Landespressestelle v o m 28. 6.1972). 114 Diese Aspekte liegen i n der sich aufdrängenden Frage begründet, w a r u m die Bundesratsreferentenbesprechung anerkanntermaßen gute Vorarbeit f ü r den Ministerrat zu leisten vermag und eine Amtschefkonferenz dies nicht soll erfüllen können. Vgl. dazu § 21 Ziff. 6.
§ 23 Die Ministerien
209
dann wesentliche Arbeit leisten können, wenn diese sich aus Personen zusammensetzen, die m i t den Regierungsmitgliedern persönlich eng vertraut sind (Abteilungsleiter i m Staatsministerium, Mitglieder der Zentralstellen i n den Ressorts). I n diesen Feststellungen liegt sowohl eine Bestätigung der i n § 21 Ziff. 4 und 6 gemachten Aussagen als auch ein Grund-, wenn nicht gar das Hauptproblem des gegenwärtigen Regierungssystems i n Deutschland überhaupt begründet: Ein enormes gegenseitiges Mißtrauen zwischen Ministerialverwaltung einerseits sowie Regierung und Regierungspartei andererseits hemmt i n nicht zu unterschätzendem Ausmaß die Regierungsarbeit ganz allgemein und auch die Motivation und Innovation der Ministerialbeamten 1 1 5 . U m dies nicht zu einem Dauerzustand werden zu lassen, bedarf es eines intensiven Denk- und Lernprozesses von beiden Seiten. Daneben werden noch sehr häufig, nach Auffassung der Mehrzahl der Befragten zu häufig, für konkrete Angelegenheiten ad hoc interministerielle Ausschüsse gebildet. Auch diese Gremien werden ganz überwiegend auf Initiative des Staatsministeriums einberufen und die Beratungen finden unter dessen maßgeblicher Beteiligung statt, werden also gewissermaßen, wie es ein Beamter ausdrückte, von der Staatskanzlei geprägt 1 1 6 . (3) Ein drittes „Instrument" zur Wahrnehmung der oben bezeichneten Funktionen stellt der sogenannte „Kleine Dienstweg", d.h. meist bilaterale Gespräche auf Referentenebene, dar. Dieses Instrument ist empirisch nur schwer zu erfassen, da es von sehr vielen Imponderabilien, insbesondere personeller A r t , abhängig ist. Deshalb konnte zwar der genaue Stellenwert nicht festgestellt werden, doch wurde von fast allen Befragten bestätigt, daß die Bedeutung dieser Ebene vor allem für die Information und Koordination besonders groß ist. Dabei zeigt sich auch hier die bedeutsame Stellung, die das Staatsministerium i m Regierungsbereich einnimmt. Während zwischen den einzelnen Ressorts diese Ebene nur wenig zur Kooperation und Kommunikation benützt w i r d 1 1 7 , ist sie zwischen den Ressorts und dem Staatsministerium fest institutionalisiert und von meist hoher Intensität und auch Effek115 Diese Situation wurde i m m e r wieder angetroffen und v o n den meisten Befragten bestätigt. Dieses gegenseitige Mißtrauen ist dringend abzubauen u n d w e n n möglich zu überwinden. Vgl. dazu auch unten § 25. 116 A u f Teilbereichen besteht hierbei durchaus die Gefahr, daß wichtige Vorentscheidungen i n die bürokratische Ebene verlagert werden (insbes. bei mehr fachl. Problemen). Dem k a n n teilweise dadurch begegnet werden, daß die Abteilungsleiter des Staatsministeriums u n d die Zentralstellenleiter den Status eines politischen Beamten erhalten. Vgl. etwa H. W. Rombach, i n : Die Staatskanzlei, SHS Bd. 34, S. 270. 117 Eine gewisse Ausnahme machen hier bilaterale Gespräche zwischen den Ressorts u n d dem Finanzministerium. Aber selbst hier erfolgt die haushaltsu n d finanzpolitische A b s t i m m u n g oft über das Staatsministerium.
14 K a t z
210
Kap. I I I : Organisation und S t r u k t u r der Landesregierung B W
tivität. Von seiten der Staatskanzlei w i r d die gesamte Arbeit der Ministerien laufend beobachtet, verfolgt, teilweise initiiert und auch korrigiert 1 1 8 . Die Abteilungen I I I , aber auch I V und V I tun dies i n einem recht umfassenden Sinne, wogegen die Abteilungen I und I I sich i n der Regel auf sie betreffende Teilbereiche beschränken. Aus dieser Tatsache und der Verpflichtung der Ressorts, alle Kabinettsvorlagen zunächst dem Staatsministerium zuzusenden 110 , w i r d ersichtlich, welches Informationspotenzial und welche Koordinationsbedeutung dem Sta&tsministerium zukommt und es w i r d letztlich verständlich, weshalb die Staatskanzlei gegenüber den Ressorts meist den entscheidenden Informationsvorsprung besitzt. Dabei handelt es sich nicht nur u m akute tagespolitische Angelegenheiten i m Rahmen der „Feuerwehrfunktion", sondern praktisch um alle wichtigeren Dinge der laufenden Regierungspolitik und ebenfalls der mittelfristigen Programme und Planungen 1 2 0 . Von Seiten der Ressorts w i r d der intensive Kontakt m i t dem Staatsministerium vor allem aus zwei Gründen gesucht 121 : Z u m einen weiß man aus Erfahrung, daß aus Gründen der Zweckmäßigkeit und Taktik es i n allen Angelegenheiten, die entweder ins Kabinett kommen oder von politischer Bedeutung sein könnten, geboten erscheint, das Staatsministerium frühzeitig vorfühlend und informierend einzuschalten 122 . Zum anderen w i l l man damit besonders bei politisch wichtigeren Dingen sich gewissermaßen politisch absichern und einen Teil der Verantwortung dem Staatsministerium übertragen. Dies alles erfolgt weitgehend auf Referenten-, bei politisch brisanten Angelegenheiten auf Abteilungsleiterebene. Vorstehende Ausführungen zeigen insgesamt, daß das Beziehungsmuster zwischen den einzelnen Ressorts, abgesehen von Haushaltsfragen (Finanzministerium), nicht sonderlich stark ausgeprägt, sozusagen unterentwickelt ist, daß aber zwischen dem Staatsministerium und den 118
Vgl. dazu eingehender unten § 24 Ziff. 8. Z u r Frage der Kabinettsvorlagen usw. vgl. oben § 21 Ziff. 1. Durch die Praxis, lieber einiges zu v i e l als zu wenig i n den Ministerrat zu bringen, w i r d dies noch verstärkt. 120 Dies g i l t besonders f ü r das Regierungs-, Arbeits- und Investitionsprogramm, aber auch etwa für die mittelfristige Finanzplanung, Fachprogramme, -Planungen usw. 121 Dieser K o n t a k t besteht am intensivsten zwischen den Zentralstellen u n d dem Staatsministerium, aber weitgehend auch zwischen Fachabteilungen u n d Staatskanzlei. H i e r gibt es allerdings nicht selten gewisse K o n t a k t störungen, vor allem w e n n versucht w i r d , von seiten des Staatsministeriums zu weitgehend und manchmal zu rigoros die Ministerien (Fachabteilungen) zu „beeinflussen". Diese Aussagen w u r d e n i n über 9 0 % aller Interviews bestätigt. 122 M a n w i l l vor allem nicht das Risiko, unnötige A r b e i t zu leisten oder m i t einer Kabinettsvorlage i m Ministerrat „baden" zu gehen, auf sich nehmen (so ein Befragter fast wörtlich). 119
§ 24 Das Staatsministerium (Staatskanzlei)
211
e i n z e l n e n Ressorts umfassende u n d i n t e n s i v e b i l a t e r a l e I n f o r m a t i o n s u n d K o o p e r a t i o n s m u s t e r bestehen. Das S t a a t s m i n i s t e r i u m n i m m t b e i der W a h r n e h m u n g der K o o p e r a t i o n s - u n d K o m m u n i k a t i o n s f u n k t i o n e n eine z e n t r a l e u n d e i n f l u ß r e i c h e S t e l l u n g ein. D i e i m Z u s a m m e n h a n g m i t der K a b i n e t t s v o r b e r e i t u n g u n d d e m - a b l a u f geäußerte A u f f a s s u n g , daß das S t a a t s m i n i s t e r i u m i m Entscheidungsprozeß d e r R e g i e r u n g e i n e n b e d e u t e n d e n E i n f l u ß i n n e h a t , w i r d h i e r d u r c h also w e i t e r b e stätigt123. § 24 Das Staatsministerium (Staatskanzlei) I n d e n f o l g e n d e n A u s f ü h r u n g e n w i r d versucht, die O r g a n i s a t i o n s u n d S t r u k t u r p r o b l e m e des S t a a t s m i n i s t e r i u m s als d e r „ S c h a l t - u n d K o o r d i n i e r u n g s z e n t r a l e " des Regierungsbereichs noch e i n g e h e n d e r d a r z u s t e l l e n u n d z u a n a l y s i e r e n . F ü r diese zusammenfassende Beschreib u n g scheint es s i n n v o l l , e i n e n k u r z e n h i s t o r i s c h e n R ü c k b l i c k v o r a n z u stellen1. 1. Von der Kanzleidirektion zum Staatsministerium U n t e r S t a a t s m i n i s t e r i u m w u r d e s o w o h l nach der V e r f a s s u n g des K ö n i g r e i c h e s W ü r t t e m b e r g v o m 25. 9.1819 2 i. V . m i t d e n Verfassungsgesetzen v o m 1. 7.1876 3 u n d 15. 6.1911 4 als auch nach d e r V e r f a s s u n g 123 Dazu w i r d noch unten bei der Untersuchung des Staatsministeriums näher einzugehen sein (vgl. unten § 24). Vgl. auch K . König, i n : DVB1. 1975, S. 225 ff. 1 Vgl. dazu bereits oben § 14 Ziff. 4. 2 Die Verfassung wurde unterzeichnet u n d verkündet am 27.9.1819 i m Reg. Bl. 1819, S. 633 ff. (vgl. insbesondere die §§ 54 - 61). 3 Verfassungsgesetz, betreffend die B i l d u n g eines Staatsministeriums v o m 1.7.1877, Reg. Bl. S. 275 f. I n A r t . 6 dieses Gesetzes heißt es: „Der Geschäftskreis des Staatsministeriums umfaßt die Beratung aller allgemeinen Angelegenheiten, namentlich solcher, welche auf die Staatsverfassung, auf die Organisation der Behörden u n d die Abänderung der Territorialeinteilung, auf die Staatsverwaltung i m Allgemeinen u n d die Normen derselben oder auf die allgemeinen Verhältnisse des Staates zu den Religionsgesellschaften sich beziehen, wie auch der Gegenstände der Gesetzgebung u n d allgemeiner Verordnungen, soweit es sich von deren Erlassung, Abänderung oder authentischen E r k l ä r u n g handelt, ferner aller wichtigeren Verhältnisse zu anderen Staaten. A l l e dem K ö n i g vorzulegenden Vorschläge der Minister i n solchen Angelegenheiten müssen i n dem Staatsministerium zur Beratung vorgetragen u n d m i t dessen Gutachten begleitet an den K ö n i g gebracht werden. Außerdem gehören i n den Geschäftskreis des Staatsministeriums als beratender Behörde alle ständischen Angelegenheiten, alle Angelegenheiten, welche die Beziehungen zum Deutschen Reiche betreffen, sowie alle diejenigen Gegenstände, welche demselben von dem Könige zur Beratung besonders aufgetragen werden." 4 Verfassungsgesetz, betreffend die Aufhebung des Geheimen Rats v o m 15. 6.1911, Reg. Bl. S. 177 ff.
14*
212
Kap. I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
Württembergs vom 25. 9.1919 5 i. V. m i t dem Ausführungsgesetz vom 6.11.1926® stets nur das Kollegium der Minister (Kabinett) verstanden 7 . Wenn man i m gewöhnlichen Sprachgebrauch bereits damals aber m i t Staatsministerium auch die Gesamtheit der für die Geschäfte des Staatsministeriums (allein der Kabinettsarbeit) besonders bestellten Mitarbeiter, sowie das Dienstgebäude i n dem sie arbeiteten, verstanden hat, so darf nicht übersehen werden, daß dieser Behörde gemäß ihrer Stellung sowie ihren Aufgaben und Funktionen eine weitgehend andere Bedeutung zukam wie dem heutigen Staatsministerium. Weder unter der Verfassung von 1819 noch der von 1919 gab es für den Präsidenten des Staatsministeriums ein eigenes „Büro". Vielmehr war lediglich eine Kanzleidirektion eingerichtet, die allein die das Staatsministerium als Kollegialorgan betreffenden Aufgaben (grundsätzlich nur geschäftsordnungsmäßiger Natur) wahrzunehmen hatte. Die Verfassungen setzten denn auch voraus, daß der Staatspräsident (Vorsitzender des Staatsministeriums) gleichzeitig ein Ministeramt (Ressortchef) innehaben mußte 8 . Für Württemberg wurde dies i n A r t . 1 I I und 5 I des Gesetzes über das Staatsministerium und die Ministerien vom 6.11.1926 auch ausdrücklich festgelegt. Diese Regelung, wonach der Staatspräsident nicht auf ein Portefeuille verzichten konnte, war verständlicherweise vor allem darauf zurückzuführen, daß er sonst kein eigenes „Minister i u m " (Büro) zur Verfügung gehabt hätte und gegenüber den mächtigen Ressortchefs oft ohnmächtig gewesen wäre 9 . I n der Zeit zwischen 1890 und 1918 bestand die dem Staatsministerium zugeordnete Kanzleidirektion aus einem Oberregierungsrat und zwei Geheim-Expeditoren, insgesamt also nur aus drei Beamten 10 . Auch nach 1919 änderte sich an den Aufgaben und dem personellen Umfang der Kanzleidirektion nichts. Der Präsident des Staatsministeriums war, wollte er den Ministern i m Kabinett nicht häufig unterlegen sein, von 1876 bis 1945 gleichzeitig stets auch Chef eines wichtigen Ressorts, das i h m gewissermaßen zusätzlich als personelle und sachliche Grundlage für eine 5 A m 25.9.1919, genau dem „ H u n d e r t j a h r t a g " der ersten Verfassung, wurde die Verfassung Württembergs beschlossen (Reg. Bl. S. 281 ff.); vgl. dort insbes. §§ 26 ff. 6 Gesetz über das Staatsministerium u n d die Ministerien v o m 6.11.1926 (Reg. Bl. S. 239 ff.); vgl. hier insbes. A r t . 3 (Zuständigkeiten des Staatsministeriums). 7 So auch die §§ 52 - 64 der Bad.-Verfassung v o m 21.3.1919 (Ges.- u n d VOB1. S. 279 ff.). 8 Vgl. dazu etwa H. Nawiasky, Bayerisches Verfassungsrecht, 1923, S. 221 u n d 229; A. Seifriz, Die staatsrechtliche Stellung des w ü r t t . Staatspräsidenten, Diss. 1926, S. 54 ff., 58. 9 Vgl. vor allem K . v. Beyme, i n : PVS 1969, S. 249 ff., 265 f. m. w . N . 10 Vgl. die Stat. Jahrbücher von J. Kürschner, Staats-, H o f - u n d K o m m u nalhandbuch des Reiches u n d der Einzelstaaten; etwa f ü r 1890, Sp. 1237 f. u n d f ü r 1913, Sp. 431 f. Dem Staatsministerium waren unmittelbar n u r der Kompetenz-Verwaltungsgerichtshof u n d Disziplinarhof unterstellt.
§ 24 Das Staatsministerium (Staatskanzlei)
213
wirksame Ausübung des Staatspräsidentenamtes diente 1 1 . Diese Praxis konnte aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß aufgrund der ständig wachsenden Aufgaben i m modernen Staat („Daseinsvorsorge") auf Dauer eine effektive Staatsführung durch den Regierungschef nicht neben der gleichzeitigen Ausübung eines Ministeramtes und m i t einer Ressortbürokratie möglich war. Die Forderung nach der Errichtung eines ressortfreien Amtes für den Staats- bzw. Ministerpräsidenten und damit dem Ausbau der Kanzleidirektion zu einem wirksamen Führungsinstrument für den Regierungschef (Staatskanzlei) wurde deshalb verständlicherweise immer lauter 1 2 . Auch nach 1945 konnten sich diese Forderungen zunächst noch nicht voll durchsetzen. So war etwa der Ministerpräsident von Württ.-Bad., R. Maier, i n den Jahren 1945 und 1946 gleichzeitig Finanzminister und der jeweilige Staatspräsident von Südwürtt.-Hohenzollern hatte stets ein Ministeramt inne 1 8 . Gleichwohl entstand aber vor allem i n Württ.Bad. ab 1946, als der Ministerpräsident kein Ressort mehr m i t verwaltet hat, nach und nach ein eigenes Büro des Ministerpräsidenten (Staatskanzlei), das zugleich die Aufgaben des Kabinettssekretariats mit erfüllte. Diese von R. Maier ausgebaute Staatskanzlei, deren personelle Ausstattung gegenüber heute allerdings noch sehr bescheiden war, wurde dann nach der Gründung des Südweststaates Bad.-Württ. erweitert. Die aufgezeigte Entwicklung hat zweifellos dazu beigetragen, daß der Ministerpräsident nicht mehr gezwungen war ein Ressort zu übernehmen und damit letztlich seine Stellung als Regierungschef gestärkt wurde. K . von Beyme hat zu Recht folgende Vorteile dieser Entwicklung besonders hervorgehoben 14 : 11 Folgende Personen hatten i n Württemberg von 1876 bis 1945 das A m t des Staatspräsidenten inne u n d übten zugleich folgende Ministerposten aus: 1876 - 1900 Mittnacht, Minister f ü r Auswärtiges 1900 - 1901 Schott v. Schottenstein, Kriegsminister 1901 - 1906 Breitling, Justizminister 1906 - 1918 Weizäcker, Minister für Auswärtiges 1918 - 1920 Bios, Minister für Auswärtiges 1920 - 1924 Hieber, Kultusminister 1924 Rau, Kultusminister 1924 - 1928 Bazille, K u l t u s - u n d Wirtschaftsminister 1928 - 1933 Bolz, Minister für Inneres 1933 M u r r , Minister f ü r Inneres 1933 - 1945 Mergenthaler, Kultusminister. Vgl. dazu neben den Jahrbüchern von Kürschner: A. Dehlinger, W ü r t t e m bergs Staatswesen, Bd. 1, S. 225 ff. Die E n t w i c k l u n g i n Baden verlief i m wesentlichen wie die i n Württemberg. 12 Vgl. K . v. Beyme, i n : PVS 1969, S. 266 m. w. N. I n der Bundesrepublik hatte zuletzt K . Adenauer (bis 1955) neben dem A m t des Regierungschefs noch das A m t des Außenministers inne. 13 Vgl. dazu A. Dehlinger, Württembergs Staatswesen, Bd. 1, S. 258 (Carlo Schmidt w a r gleichzeitig Justiz-, L. Bock u n d G. M ü l l e r jeweils Finanzminister).
214
Kap. I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
(1) Der Ministerpräsident w i r d zeitlich entlastet und kann sich ausschließlich seinen Aufgaben der Koordinierung und Führung i m Kabinett widmen. (2) Durch das ressortfreie A m t des Regierungschefs w i r d verhindert, daß die Richtlinien der Politik allzu stark von den Bedürfnissen des Ressorts her konzipiert werden, welches der Regierungschef verwaltet. (3) Das A m t des Ministerpräsidenten dient nicht nur zur Stärkung des Regierungschefs i m Kabinett. Es ist vielmehr unerläßlich i n einem planenden Daseinsvorsorgestaat und stärkt die Kontinuität der Regierungsarbeit selbst da, wo hohe Kabinettsinstabilität und personelle Diskontinuität i m A m t bestehen. 2. Die Entwicklung des Staatsministeriums von 1952 bis 1974 Kurz nach der Bildung einer vorläufigen Regierung für das südwestdeutsche Bundesland wurden m i t Bekanntmachung vom 8. 7.1952 15 die Geschäftsbereiche der einzelnen Ministerien neu geordnet. Dabei blieben dem vom Ministerpräsidenten geleiteten Staatsministerium, einer zentralen Koordinierungsstelle m i t verhältnismäßig kleinem Arbeitsstab, die Aufgaben vorbehalten, die über die Ressorts (Fachministerien) hinausreichten: Grundsätzliche Verfassungsfragen, solche des Staatsgebiets und seiner Einteilung, die Beziehungen zum Landtag, zum Bund und anderen Ländern, die Vorbereitung und Auswertung der i m allgemeinen jede Woche stattfindenden Kabinettssitzungen, die Fragen der Staatsverwaltung allgemeiner Natur, ihrer Organisation und ihres Aufgabenkreises sowie die wichtigsten Beamtenernennungen. Außerdem wurden der Staatskanzlei der Staatsgerichtshof, die Landesbeamtenstelle (später Landespersonalausschuß), die Archi w e r waltung und auch die Landesvertretung i n Bonn 1 6 zugeordnet bzw. unterstellt 1 7 . Zur Erledigung der dem Ministerpräsidenten und dem Staatsministerium durch die Landesverfassung und die Bekanntmachung vom 8. 7.1952 übertragenen Aufgaben waren seit 1952 i n der Staatskanzlei zwei Hauptabteilungen eingerichtet 18 : 14
K. v. Beyme, i n : PVS 1969, S. 267. Bekanntmachung der vorl. Regierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien v o m 8. 7.1952, Ges. Bl. S. 21. 16 Vgl. dazu oben § 16 Ziff. 4. 17 Vgl. i m einzelnen Ges. Bl. 1952, S. 21; außerdem etwa T. Eschenburg, i n : Bad.-Württ. — Staat, Wirtschaft, K u l t u r , S. 106. 18 Soweit nachstehend nichts anderes vermerkt ist, sind sämtliche Angaben und Zahlen den einzelnen Staatshaushaltsplänen des Landes B a d e n - W ü r t temberg entnommen (Fundstelle). 15
215
§ 24 Das Staatsministerium (Staatskanzlei)
— Die Hauptabteilung A für die Angelegenheiten des Ministerpräsidenten, für die Angelegenheiten des Bundes und des Protokolls und für die Verbindung zu den Vertretungen auswärtiger Staaten, zu den Kirchen, zu Presse und Rundfunk. — Die Hauptabteilung B für die Landesangelegenheiten m i t den allgemeinen Fragen der Gesetzgebung und Staatsverwaltung, Kanzleidirektion, dem Verkehr mit dem Landesparlament sowie den Personal», Dienstaufsichts- und sonstigen Verwaltungsangelegenheiten. Der Minister für Bundesangelegenheiten und die ehrenamtlichen Staatsräte hatten ihren Dienstsitz i m Staatsministerium und bedienten sich dessen Behördeneinrichtung. Die personelle Ausstattung des Staatsministeriums belief sich i m Jahr 1952 auf lediglich 9 höhere Beamte 1 9 und insgesamt auf 56 Mitarbeiter 2 0 . Sowohl die Organisation, 19 Davon entfielen auf Hauptabteilung A : 3, Hauptabteilung B : 5 u n d die Pressestelle 1 Beamter. Vgl. auch R. Maier, Erinnerungen 1948-1953, S. 188 f. 20 Nach den Staatshaushaltsplänen k a n n m a n folgende Personalstatistik für das Staatsministerium aufstellen (Stellenplan):
HH-Jahr
höhere Beamte
Beamte insges.
Angest.
Arb.
1952 1954 1955 1957 1959 1960 1961 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974
9 8 9 10 10 10 12 14 16 17 19 20 23 24 28 30 35 36
22 20 23 23 23 23 26 28 32 33 35 36 39 43 49 49 60 61
27 26 28 26 26 29 32 31 34 35 38 39 38 40 44 44 56 58
7 8 8 6 5 5 5 5 6 6 5 6 6 6 8 8 8 8
Mitarbeiter insgesamt 56 54 59 55 54 57 63 64 72 74 78 81 83 89 101 101 124 a) 127
a) Nach der Landtagswahl 1972 (Bildung der CDU-Alleinregierung) wurde die Zahl der Mitarbeiter um 23 (über 20%!) erhöht.
Z u den entsprechenden Zahlen i n den anderen Ländern (Ländervergleich) vgl. etwa F. Knöpf le, i n : Die Staatskanzlei, SHS Bd. 34 S. 222; F. Wagener, Einwohnerzahl u n d Aufgabenerfüllung der Länder, S. 28 ff.
216
Kap. I I I : Organisation und S t r u k t u r der Landesregierung B W
Geschäftsverteilung als auch der Stellenplan des Staatsministeriums blieb, von kleinen Veränderungen abgesehen, i n den folgenden Jahren bis 1960 unverändert. Die erste größere Änderung i n der Organisation des Staatsministeriums erfolgte zu Beginn des Jahres 1961. Seinerzeit wurden die zwei Hauptabteilungen aufgelöst und die Geschäfte der Staatskanzlei auf eine Kanzleidirektion und vier Abteilungen aufgeteilt 2 1 : — Die Kanzleidirektion hatte insbesondere sekundäre Funktionen für das Staatsministerium selbst (Personal, Haushalt, Zahlstelle, lfd. Dienstbetrieb, Dienstaufsicht über Archivverwaltung usw.) und daneben einige staatsoberhauptliche Funktionen (Gnadensachen, Ehrungen) zu erfüllen. Diese Abteilung hatte demnach eine völlig andere Aufgabe als die Kanzleidirektion bis 1945. — Die Abteilung I — Bundesangelegenheiten — war für die gesamten Bundes- und Bundesratsangelegenheiten, die Beziehungen zu den anderen Bundesländern, die gesamtdeutschen Fragen und die Verträge und Vereinbarungen m i t ausländischen Staaten zuständig. — Die Abteilung II — Protokoll- und Verteidigungsangelegenheiten — befaßte sich neben diesen Aufgaben noch m i t dem Konsulatswesen und den Ordensverleihungen. — Die Abteilung III — Landesangelegenheiten A — beschäftigte sich m i t allen Geschäftsvorgängen der Ressorts Justiz, Kultus, Finanzen, Wirtschaft, Landwirtschaft, Arbeit. Außerdem war sie für grundsätzliche Fragen der Verfassung und der Staatsverwaltung sowie für Rechtsfragen von allgemeiner Bedeutung zuständig. — Die Abteilung IV — Landesangelegenheiten B — hatte die Geschäftsvorgänge des Innenministeriums und des Ministeriums für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsbeschädigte zu bearbeiten. Weiter waren ihr die grundsätzlichen Fragen des öffentlichen Dienstrechts sowie die Personalangelegenheiten i n der Zuständigkeit der Landesregierung und des Ministerpräsidenten übertragen. Neben diesen Abteilungen bestand i m Staatsministerium eine Pressestelle, der die Aufgaben der Presse und des Rundfunks übertragen waren. Weiter waren der Staatskanzlei die Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund, die Kommission für Wirtschaftlich21 Vgl. Geschäftsverteilungsplan v o m 28.1.1961; Behördenverzeichnis Bad.W ü r t t . 1961, S. 66. Den einzelnen Abteilungen waren 1961 an höheren Beamten zugeordnet: Kanzleidirektion: 2; A b t e i l u n g 1 : 1 ; A b t e i l u n g I I : 1; A b t e i l u n g I I I : 2; A b t e i l u n g I V : 1; neben dem Ministerialdirektor (Amtschef) waren noch der persönliche Referent des Ministerpräsidenten u n d der Pressereferenten Beamte des höheren Dienstes (insgesamt also 10).
§ 24 Das Staatsministerium (Staatskanzlei)
217
keit i n der Verwaltung 2 2 , der Landespersonalausschuß, der Staatsgerichtshof, die Geschäftsstellen für das Gesetzblatt und den Staatsanzeiger für Bad.-Württ. sowie die gesamte Archivverwaltung nachgeordnet bzw. unterstellt 2 3 . Nach der Regierungsbildung i m Juni 1964 erfolgte insoweit eine organisatorische Änderung, als ab September 1964 ein selbständiges Grundsatzreferat neu eingerichtet wurde (Stab von zunächst zwei höheren Beamten) 24 . Dieses Referat hatte vor allem die Aufgabe, den Ministerpräsidenten bei der Durchführung des Regierungsprogramms und der Richtlinienkompetenz zu unterstützen; es sollte sich eingehend m i t einzelnen Punkten der Regierungserklärung befassen 25 , deren Erfüllung laufend verfolgen und daneben neu auftretende Probleme beobachten und daraufhin prüfen, welche Maßnahmen und Konsequenzen sich daraus für die Landespolitik ergeben (Ansätze eines „heuristischen Stabes"). Als K . G. Kiesinger i m Dezember 1966 nach Bonn ging und H. F i l binger zu seinem Nachfolger i m A m t des Ministerpräsidenten gewählt wurde, erfolgte eine umfangreiche Umorganisation der Staatskanzlei, die, abgesehen von kleineren Änderungen, bis heute die Geschäftsverteilung des Staatsministeriums bestimmt 2 6 . Danach wurden ab 1. 2.1967 fünf Abteilungen gebildet. Die Neuorganisation bestand vor allem i n folgenden Neuerungen 27 : Die Kanzleidirektion wurde zusammen m i t einem Teil der Abteilung IV, dem gesamten Personalwesen und den 22 A u f g r u n d des Gesetzes v o m 8.7.1957 (Ges. Bl. S. 74) w u r d e zur f o r t laufenden Überprüfung der gesamten Landesverwaltung unter den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit u n d Sparsamkeit diese Kommission bestellt (§ 1). Die Kommission, die die Aufgabe hatte, einen jährlichen Bericht zu erstatten, bestand aus drei Mitgliedern (zwei ehren- u n d einem hauptamtl.). Nach übereinstimmender Aussage aller Befragten hat die A r b e i t der K o m mission praktisch keine Bedeutung erlangt (u. a. wegen unzureichende Personalausstattung). Sie wurde dann konsequenterweise auch zum 31.12.1967 wieder aufgelöst. 28 Vgl. dazu I der Bekanntmachung der vorl. Regierung v o m 8.7.1952 (Ges. Bl. S. 21). 24 Geschäftsverteilungsplan des Staatsministeriums v o m 1. 9.1964. 25 Dabei handelte es sich u m folgende Punkte der Regierungserklärung: Beseitigung des Lehrermangels; Erschließung der Begabungsreserven, insbes. Erhöhung der Abiturientenzahlen; Ziele u n d gegenseitige Durchlässigkeit der Schularten u n d Schultypen; Gewässerschutz u n d Reinhaltung der L u f t ; Probleme der Fremdarbeiter; Erhaltung des Kleinbauerntums. 28 Vgl. etwa die Geschäftsverteilungspläne v o m 1. 2.1967, 1.10.1967, 1. 4. 1968, 1. 3.1970, 1.1.1973, 1.12.1973, 1. 5.1974. 27 Diese Neuorganisation des Staatsministeriums fällt i n die Zeit, i n der die Reformdiskussion der V e r w a l t u n g ihren ersten „ H ö h e p u n k t " erlebte u n d erfolgte kurz nach der verwaltungswissenschaftlichen Arbeitstagung der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer (1966). Vgl. dazu Bd. 34 der Schriftenreihe der Hochschule Speyer, Die Staatskanzlei: Aufgaben, Organisation u n d Arbeitsweise auf vergleichender Grundlage. Nach Aussage eines Befragten wurde damals bei der Umorganisation der Staatskanzlei bereits ein T e i l der Reformüberlegungen der Speyerer Arbeitstagung berücksichtigt.
218
Kap. I I I : Organisation und S t r u k t u r der Landesregierung B W
grundsätzlichen Fragen des öffentlichen Dienstrechts, zur neuen Abteilung I vereinigt. Weiter wurden sämtliche Aufgaben der Landesangelegenheiten (A und B) i n eine Abteilung I I I zusammengelegt (Ausnahme: Personalangelegenheiten). Schließlich ist das Grundsatzreferat zu einer eigenen Abteilung I V — Grundsatzfragen, Finanzplanung — ausgebaut worden 2 8 . Der Organisationsplan des Staatsministeriums ergab also damals das sich aus gegenüberstehender Abb. 2 ergebende Bild. Über die Aufgaben des seit dem 1. 9.1964 bestehenden Grundsatzreferats hinaus, sollte die Abteilung I V die Bearbeitung von Angelegenheiten der interministeriellen Koordination und der grundsätzlichen Planung, besonders auch der Finanzplanung erfüllen. I h r waren außerdem die Aufgaben der Harmonisierung der Fachplanungen mit den finanziellen Möglichkeiten und ihre Ausrichtung nach Prioritäten und Schwerpunkten übertragen 29 . Der Aufgabenbereich der Grundsatzabteilung wurde bald weiter ausgedehnt und umfaßte Ende 1971 bereits folgende Haupttätigkeitsfelder 3 0 . — — — — — — —
Grundsatzfragen und Richtlinien der Politik Durchführung des Regierungsprogramms Allgemeine Finanzpolitik, Finanzplanung Raumordnung und Landesplanung Koordination der länger- und mittelfristigen Fachplanungen Kontakte zu Parteien, Fraktionen, Organisationen und Verbänden Publizistische Grundsatzfragen, Angelegenheiten des Rundfunks.
Nach der Regierungsbildung i m Juni 1972 ist als größere Änderung i n der Organisation und Geschäftsverteilung des Staatsministeriums vor allem die Neueinrichtung der Abteilung V I zu nennen. Das Pressereferat wurde also zu einer eigenen Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit ausgebaut 31 . Daneben waren kleinere Verschiebungen i n der Verteilung der Geschäfte zu verzeichnen. So erhielt etwa die Abteilung I V die Aufgaben der Statistik, Informationssystem, EDV zur Erledigung übertragen, während sie die Angelegenheiten des Rundfunks und auch die publizistischen Grundsatzfragen an die neu gegründete Abteilung V I abgab. I m Laufe des Jahres 1973 wurden dann noch Teile des früheren Geschäftsbereichs des Innenministeriums, die bis dahin nach dem 28
Vgl. den Geschäfts verteilungsplan v o m 1. 2.1967 sowie das Behördenverzeichnis Bad.-Württ. von 1968, S. 67 f. 29 Die Bedeutung u n d auch der personelle Umfang dieser A b t e i l u n g wuchs rasch an. Während es 1967 noch 2 höhere Beamte waren, betrug diese Zahl 1970 bereits 4 u n d 1973 schon 9. 30 Vgl. A k t e n v e r m e r k der Abt. I V v o m 16.11.1971; Behörden Verzeichnis Bad.-Württ., 83. Jahrg., 1972, S. A 67 f. 31 I m Jahr 1961 bestand die Pressestelle aus einem höheren Beamten, 1967 waren es 2, 1972 bereits 4 u n d heute 5 höhere Beamte.
i
i
Allg. Verwaltung II. Bundesangelegenh. Personal d. Landes
m. Landesangelegenh.
I
Ministerialdirektor
Ministerpräsident
Organisationsplan
i
EWG-Koordinierung —
V. Protokoll
i
Pressestelle
====_J
IV. Grundsatzfragen
Abbildung 2: Organisationsplan (1.10.1971)
a) Abschnitt III (Innen) unmittelbar dem Min. Dir. unterstellt
Gesamtdeutsches Referat
Verwaltung (Personal, Verfassungs- RessortHsh.); Personalrecht, fingen, Res- angel. Personal in Zust. des sortangel. (Innen)a> Ministerpräsidenten u. (außer Innen)| d. Landesregierung
I.
l_===
Pers. Ref. d. Min. Präs.
Staatsministerium Baden - Württemberg (Stand: 1. Oktober 1971)
§ 24 Das Staatsministerium (Staatskanzlei) 219
220
Kap. I I I : Organisation und S t r u k t u r der Landesregierung B W
Geschäftsverteilungsplan unmittelbar dem Ministerialdirektor stellt waren 3 2 , i n die Abteilung I I I voll eingegliedert 33 .
unter-
Ein gewisses Problem i n der Organisationsstruktur der Staatskanzlei ergab sich i m Juni 1972 durch die Ernennung eines Staatssekretärs i m Staatsministerium 34 . Ursprünglich war vorgesehen, diesem Staatssekretär m i t Kabinettsrang die „politisch orientierten" Abteilungen I V und V I direkt zu unterstellen 35 , was dann allerdings nicht verwirklicht wurde. Tatsächlich nimmt er heute i m Auftrag des Ministerpräsidenten ganz bestimmte Leitungsaufgaben vor allem i m Rahmen der Ressortkoordination und Öffentlichkeitsarbeit sowie i h m übertragene Sonderaufgaben wie etwa den Aufbau eines Informationssystems wahr. Bei der Erfüllung dieser Aufgaben ist er an die Direktiven des Ministerpräsidenten gebunden, hat aber, soweit dies für die Erledigung seiner Aufgaben erforderlich ist, gegenüber den Angehörigen der Staatskanzlei ein umfassendes Informations- und auch ein fachliches Weisungsrecht. Der normale Weisungsweg über den Amtschef (Ministerialdirektor) ist dabei allerdings i n der Regel einzuhalten. I n der Anweisung über die Stellung des Staatssekretärs i m Staatsministerium ist darüber hinaus festgestellt, daß der Ministerialdirektor der Amtschef ist und dessen Zuständigkeiten grundsätzlich unberührt bleiben. Diese Ausführungen zeigen, daß aufgrund der Ernennung des Staatssekretärs i m Staatsministerium faktisch keine organisatorischen Änderungen eingetreten sind und deshalb auch unter diesem Aspekt die Stellung und letztlich der Sinn eines Staatssekretärs m i t Kabinettsrang i n der Staatskanzlei überhaupt sehr problematisch ist 3 6 . Der Organisations- und grobe Geschäftsverteilungsplan des Staatsministeriums hatte demnach zum 1.12.1973 folgendes Aussehen: 32 Diese ungewöhnliche organisatorische Regelung rührte hauptsächlich daher, daß der Amtschef des Staatsministeriums bis 1966 lange Jahre i m Innenministerium tätig war, zuletzt als Leiter der A b t e i l u n g Landesplanung. Vgl. dazu F. Scharpf, Länderbericht Bad.-Württ., S. 4 f. 33 Vgl. die Geschäftsverteilungspläne v o m 1.1.1973 u n d 1.12.1973. Ende 1973 waren i n A b t . I : 5, i n Abt. I I : 6, i n Abt. I I I : 7, i n Abt. I V : 9, i n A b t . V : 3 u n d i n Abt. V I : 5 höhere Beamte beschäftigt. 34 Dr. G. Mahler hat dieses A m t (Staatssekretär m i t Sitz u n d Stimme i m Kabinett, A r t . 45 I I L V ) inne. Vgl. zum Ganzen bereits oben §§ 16, 20 Ziff. 4 u n d 23. 35 Dies ist auch i m H i n b l i c k auf E S V G H 23, 135 ff. (insbes. A r t . 77 I LV) unbedenklich, da der Staatssekretär M i t g l i e d der Regierung ist (vgl. A r t . 45, 46, 55 - 57 L V ) ; vgl. dazu oben § 16 Ziff. 5. 36 Vgl. dazu oben § 16 Ziff. 2, § 20 Ziff. 4 u n d § 23 Ziff. 5. Interessant ist auch die organisatorische Einbeziehung des Staatssekretärs i n nachstehenden Organisationsplan. Dabei ist allerdings darauf hinzuweisen, daß seine t a t sächliche Stellung graphisch k a u m darstellbar ist. Die durchgeführten I n t e r views haben vorstehende Darlegungen einhellig bestätigt. Die politische Realität läßt es k a u m zu, daß sich ein Staatssekretär (Regierungsmitglied) neben dem Ministerpräsidenten profilieren kann.
|Persönl. Referent \
Ministerpräsiden t | Amtschef
ß
Protokoll Verteidigungsangelegenh. i
^¡S^tS v^o^ü^^r, Min. f. Wirtschaft, Mittelstand u.
Mitwirkung b. Grundsatzfragen d.
AV J T7T
v
Abbildung 3: Organisationsplan (1.12.1973)
Sammelberichte an den Landtag
Restaufgaben der polit. Säuberung
Entwicklungshilfe
t
Vorprüfungsstelle
^
| EWG-Koordinierung
\
sstel\
Zuständigkeit tter Landesreg. Vertrage und Vereinbarungen anderen Abteilungen Abt. VI Verkehr und des Ministerpräsidenten ^tei^ d^ I^d^bd Ab- ^ f Gesundheit u. SoKontakte zu Parteien, Fraktionen, Pressestelle des StaatsGnadensachen d^chden Bmd zialordnung Organisationen und Verbänden ministeriums Ehrung von Lebensrettern Angelegh. d. ständigen VertragsMin. f. Ernährung, Landw. und Ständige Arbeitsgruppen d. LangI 1 Jubilaren kommission Umwelt fristplanung d. Bundes u. d. Länder Gratiale, Ehrensolde A^elegh. d Bevotaächtigten der Verwaltung™ Sprecher der I^desre^enmg Übergeordnete Dienstaufsicht f. d. BRD für kulturelle Angelegh. im _ ,4 . Statistik, Informationssysteme, Grundsatzfragen der OffentlichVerwaltungsgerichtshof; St GH Rahmen d. deutsch-frz. Vertrags Rechtsbereinigung EDV keitsarbeit Dienstaufsicht ü. d. Mitglieder über kulturelle Zusammenarbeit Geschäftsbereiche der Ministerien Gesamtdeutsches Referat Koordination der ministeriellen des Landespersonalausschusses Sonst, grundsätzl. Fragen °/o o/o o/o (a) Normentwicklung u n d damit zusammenhängende Tätigkeiten (Gesetzesentwürfe, - n o v e l lierungen, Verordnungen, Ausführunsbestimmungen usw.) ..
0
o/o
12
40
17
9
19,5
aa) rein fortschreibende, der Entwicklung anzupassende oder bloß zu novellierende „Normentwicklung"
7
21
8
6
10,5
bb) umfassende, grundlegende u n d neue „ N o r m e n t w i c k lung"
5
19
9
3
9
(b) Programmentwicklung (Regierungsprogramm, Richtlinien, M i F r i F i , Fachprogramme, »Planungen usw.)
6
12
28
18
16
aa) kurzfristige Programmentwicklung (1 - 2 J)
3
—
10
8
5
bb) mittelfristige Programmentwicklung ( 3 - 5 J) . . . .
3
3
12
10
7
cc) langfristige Programmentwicklung (über 5 J)
—
9
6
—
4
74
31
42
39
46,5
aa) A k t u e l l e politische Sachaufgaben (Feuerwehrfunktionen des StaMi)
14
20
20
19
18
bb) Querschnittsaufgaben (lfd. Tätigkeiten insb. für Personal, Organisation u n d Haushalt)
50
5
13
2
cc) Weitere lfde. Aufgaben (Vollzugsüberwachung u.a.)
10
6
9
18
(d) Tätigkeiten zur Beschaffung, Sammlung, Verarbeitung usw. von Daten, Informationen usw.
3
12
7
12
Weitere A u f t e i l u n g i n M i t w i r k u n g bei
Weitere A u f t e i l u n g i n M i t w i r k u n g bei
(c) Laufende Fach- und aufgaben (i. e. S.)
Vollzugs-
Weitere A u f t e i l u n g i n M i t w i r k u n g bei
17,5
11
8,5
234
Kap. I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W A b t . I Abt. I I Abt. I I I Abt. I V % % % %
0 %
Weitere A u f t e i l u n g i n Tätigkeiten 5
3
9
—
5
1
1
1,5
cc) f ü r Landtag u n d Parteien
—
1
1
1
1
dd) Sonstige Informationstätigkeit
—
1
2
1
1
0
2
16
4,5
3,5
3
aa) f ü r das StaMi bb) für die Ministerien usw. ..
(e) Speziell parteipolitische tionen u n d Aufgaben
Funk-
0
5
Weitere A u f t e i l u n g i n Tätigkeiten aa) i m Zusammenhang m i t der Regierungspartei
—
—
1
13
—
—
1
3
1
4
6
5
bb) i m Zusammenhang mit den Oppositionsparteien .. cc) sonstige rein Funktionen (f)
politische
Sonstige Funktionen u n d A u f gaben
5
5
d i e b u n d e s p o l i t i s c h e n A u f g a b e n u n d T ä t i g k e i t e n e i n e n ganz beachtl i c h e n z e i t l i c h e n A n t e i l a n der A r b e i t des S t a a t s m i n i s t e r i u m s ausmachen. W ä h r e n d der A n t e i l a l l e r „ B u n d e s a n g e l e g e n h e i t e n " a n der z e i t l i c h e n G e s a m t b e l a s t u n g zwischen 15 bis 20 °/o l i e g t , b e l ä u f t sich b e i d e n gesamten N o r m e n t w i c k l u n g s t ä t i g k e i t e n (Gesetzentwürfe, V e r o r d n u n g e n usw.) d e r B u n d e s a n t e i l sogar a u f k n a p p ü b e r 50 °/o 6 6 ! D i e d a r i n e r k e n n b a r e E n t w i c k l u n g ist s o w o h l a u f b u n d e s - als auch a u f l a n d e s politische G r ü n d e z u r ü c k z u f ü h r e n 6 7 . A u ß e r d e m ist e t w a auch e r s t a u n 66 Die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen ergeben dazu: Nach Ubersicht 1 beträgt der A n t e i l aller Bundesangelegenheiten ca. 18 - 20 % (aus Buchstabe c 16 % u n d auch a u n d b 2 - 4 °/o Bundesanteil), nach Übersicht 3 ca. 15%. Die Zahlen i m Hinblick auf die Normentwicklungstätigkeiten sind aus Buchstabe a der Übersicht 2 zu ersehen. 67 Während die Abt. I I 1961 aus n u r einem, 1970 aus 3 höheren Beamten bestand, gehörten i h r 1974 6 an. Die bundespolitischen Gründe liegen i n der E n t w i c k l u n g der Bonner Szene seit 1969 u n d i n der parteipolitischen Zusammensetzung des Bundesrats begründet ( A r t „Gegenbürokratie" zur Bundesregierung), während sich die landespolitischen Ursachen daraus ergeben, daß Ministerpräsident H. Filbinger durch seine Tätigkeit als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, als Bundesratsvorsitzender u n d schließlich auch als M i t g l i e d des CDU-Bundesvorstands „Gefallen" an der Bundespolitik gefunden hat (so wörtlich ein Befragter). Sichtbaren Ausdruck findet dies darin, daß Bad.-Württ. entgegen der früheren Praxis i m Jahr 1974 zahlreiche Gesetzesinitiativen i m Bundesrat eingebracht hat.
§ 24 Das Staatsministerium (Staatskanzlei)
235
Übersicht 3
Zeitaufwand für die einzelnen Tätigkeitsfelder
Tätigkeitsbereich
Zahl der damit Prozentualer Anteil an beschäftigten der Gesamttätigkeit höheren und ge- des Staatsministeriums hobenen Beamten ca. ca.
(1) Wahrnehmung „staatsoberhauptlicher Funktionen"
7
13%
(2) Allgemeine Verwaltung
5
9%
(3) Kabinettssekretariat
1
2%
(4) Sekretariat des Regierungschefs
2
4%
(5) Recht und Verfassung
1
2%
(6) Querschnittsfunktionen (ohne die für das Staat§min.)
2
4%
(7) Bundesangelegenheiten
8
15%
(8) Landesangelegenheiten (9) Führungstätigkeiten zur Ausübung der Richtlinienkompetenz
1
27%
11%
(10) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
6
11%
(11) Ressortaufgaben
1
2%
lieh, i n welchem Umfang die Staatskanzlei m i t der Beantwortung von Eingaben, Anfragen usw. belastet w i r d (von den über 10 % sollten mindestens die Hälfte für andere Aufgaben frei gemacht werden) 6 8 und wie wenig Zeit sich das Staatsministerium für so wichtige Dinge wie die Querschnittsfunktionen n i m m t 6 9 . 68 Die Befragten aller Abteilungen beklagten sich über eine zu starke Beanspruchung für diese Dinge. Die meisten I n t e r v i e w t e n waren der Ansicht, daß mindestens die Hälfte der Eingaben usw. schneller u n d besser von dem zuständigen M i n i s t e r i u m oder Behörde erledigt werden könnte. Sicher gibt es viele Eingaben an den Ministerpräsidenten, die von i h m oder dem Staatsministerium bearbeitet u n d beantwortet werden müssen; doch sollten d r i n gend all die Eingaben usw., die von der zuständigen Stelle schneller u n d besser erledigt werden können, an diese weitergeleitet werden. Dadurch wäre es durchaus möglich f ü r andere Aufgaben mindestens 5 % „Kapazität" zusätzlich zu erhalten.
236
Kap. I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
I m Hinblick auf die Einzelheiten, besonders die inhaltliche und sachliche Wahrnehmung der primären und sekundären Zielsetzungen des Staatsministeriums, ist es notwendig, die wichtigsten näher darzustellen. Dies soll i m folgenden geschehen. 5. Führungstätigkeiten zur Ausübung der Richtlinienkompetenz I n Bad.-Württ. bestehen die verfassungsrechtlichen Befugnisse, die dem Ministerpräsidenten i m Rahmen seiner Richtlinienkompetenz zustehen, i m wesentlichen i n der Aufstellung eines verbindlichen, allgemein gefaßten Regierungsprogramms, i n der verbindlichen Anordnung von „geschäftsordnungsmäßigen" Regierungsmaßnahmen und i n bestimmten „Hilfsbefugnissen". Die Landesverfassung hat also die Richtlinienkompetenz weniger stark ausgestaltet als das Grundgesetz 70 . Die Richtlinienkompetenz ist ein für den Regierungschef verfassungsrechtlich festgelegtes Instrument, m i t dessen Hilfe eine bessere Führung, Koordination und Integration der gesamten Regierungsarbeit erreicht werden soll 7 1 . Diese vom Verfassungsgeber m i t A r t . 49 I S . 1 L V (Art. 65 S. 1 GG) verfolgte verfassungspolitische Absicht hat sich in der Regierungspraxis vor allem i m Bund weitgehend nicht verwirklichen lassen. Von den meisten Autoren, die diese Frage untersucht haben, w i r d die Auffassung vertreten, daß die formelle Richtlinienkompetenz i n der Praxis nur eine relativ untergeordnete Rolle spielt 7 2 . Dies w i r d vor allem darauf zurückgeführt, daß einmal die „Richtlinien" viel zu wenig konkretisiert und der Ministerialverwaltung nicht gezielt bekannt gemacht werden und zum anderen die politischen Sachzwänge (Kabinett, Fraktion, Partei, Koalitionsvereinbarungen usw.) i n aller Regel keine Alleinentscheidung durch den Regierungschef zulassen, sondern eines meist auf einem Kompromiß beruhenden, kollegial getragenen Kabinettsbeschlusses bedürfen. Die Mittel, m i t denen der Ministerpräsident versucht, von seiner i h m verfassungsrechtlich zustehende Richtlinienkompetenz Gebrauch zu 69 Vgl. dazu oben Ziff. 3 (Bereiche 5 u n d 6) u n d Übersicht 3. Die i n Übersicht 2 Buchstabe c bb genannten Zahlen beziehen sich weitgehend auf Querschnittstätigkeiten f ü r das Staatsministerium selbst (diese sind i n Ziff. 2 der Übersicht 3 enthalten). 70 Vgl. dazu eingehend oben § 12. 71 Vgl. etwa W. Hennis, Wie k a n n der Bundeskanzler regieren?, i n : Die Zeit 1964, Nr. 43, S. 11; K . von der Groeben, i n : Die V e r w a l t u n g 1968, S. 390 f.; F. Duppre, i n : V e r w a l t u n g (Hrsg.: F. Morstein Marx), S. 410. 72 Vgl. etwa F. Knöpfle, i n : Die Staatskanzlei, SHS Bd. 34, S. 44 ff.; F. Duppre, ebenda, S. 72 f.; H. W. Rombach, ebenda, S. 265 ff.; Projektgruppe B M I , Erster Bericht, S. 105; F. Scharpf, i n : Projektgruppe BMI, Erster Bericht, Anlagenband, S. 276; K . von der Groeben, i n : Die V e r w a l t u n g 1968, S. 391; F. Scharpf, Länderbericht Bad.-Württ., S. 15f.; Ders., Länderbericht Bayern, S. 15 f.; U. Becker, i n : Die V e r w a l t u n g 1969, S. 221 f.
§ 24 Das Staatsministerium (Staatskanzlei)
237
machen, stellen insbesondere die Regierungserklärungen (Regierungsprogramme) und teilweise auch die Grundsatzplanungen und »Programme dar 7 3 . Beide Instrumente wurden i m Rahmen der dieser Arbeit zugrunde liegenden empirischen Untersuchung näher analysiert. Z u Beginn jeder Legislaturperiode und bei der bisher jedes Jahr stattfindenden Eröffnung der Haushaltsberatungen gibt der Ministerpräsident Regierungserklärungen ab, i n denen er die wichtigsten A u f gaben umreist, die i n der laufenden Legislaturperiode bewältigt werden sollen 74 . Ohne Zweifel enthalten diese Regierungserklärungen häufig besonders bedeutsame Grundsätze für die Regierungsarbeit einer Legislaturperiode. Aus ihnen kann u. a. abgelesen werden, wo die A k zente der Landespolitik gesetzt werden und welchen landespolitischen Aufgaben Priorität eingeräumt w i r d 7 5 . Abgesehen davon sind diese Erklärungen (Regierungsprogramm) aber häufig so vage gefaßt, daß sie inhaltlich nicht den Anforderungen entsprechen, die man an eine realisierbare Richtlinie der Politik stellen muß. Insoweit kann man auch den bad.-württ. Regierungserklärungen, selbst unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlichen Problematik des A r t . 49 L V 7 6 , nicht ganz den Vorwurf ersparen, daß sie teilweise nur eine Ansammlung von Absichtserklärungen und das Echo auf Fragen an die Ministerialverwaltung darstellen, die dann u. U. zu beliebten „Abhakelisten" der jeweiligen Opposition werden 7 7 . Auch ein weiterer Einwand gegen die traditionellen Regierungserklärungen ist nicht ganz von der Hand zu weisen, nämlich daß dem Regierungschef und, soweit sie beteiligt werden, auch den Ministern bei der Erarbeitung und Formulierung i n der Regel viel zu wenig Zeit zur Verfügung steht, u m m i t der erforderlichen Sorgfalt prüfen zu können, ob die Aussagen der Erklärung i n politischer, sachlicher und finanzieller Hinsicht realisierbar sind und 78
Vgl. dazu etwa K . H. Friauf, i n : Projektgruppe BMI, Erster Bericht, Anlagenband, S. 560 f.; K . Stern, ebenda, S. 577 ff. Eine eindeutige Zuordnung u n d Einteilung der einzelnen Führungsinstrumente i n solche, die i n den Bereich der Richtlinienkompetenz fallen oder nicht, ist dabei allerdings nicht möglich. H i e r ist deshalb i m wesentlichen n u r das Regierungsprogramm u n d m i t gewissen Einschränkungen das A r beitsprogramm darzustellen. Vgl. i m übrigen unten Ziff. 6 ff. 74 Vgl. etwa die Regierungserklärungen v o m 22. 6.1972, 26.10.1972, 18.10. 1973 u n d 28.11.1974. 75 So w i r d etwa i n der Regierungserklärung v o m 18.10. 1973 dem U m w e l t schutz, der Sozialpolitik u n d der Bildungspolitik Vorrang eingeräumt. 76 Vgl. dazu eingehend oben § 12, insbesondere Ziff. 5. Die dort beschriebene Problematik w i r d hier besonders evident. 77 Vgl. dazu allgemein H. W. Rombach, i n : Die Staatskanzlei, SHS Bd. 34, S. 266ff. u n d besonders S. 275 f.; F. Scharpf, i n : Projektgruppe BMI, Erster Bericht, Anlagenband, S. 281 (dort weist Scharpf nicht zu Unrecht darauf hin, daß auch die Regierungsprogramme bzw. -erklärungen oft eine „Tendenz zum Geschäft der laufenden P o l i t i k " erkennen lassen).
238
Kap. I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
auch wirklich i n einer Legislaturperiode verwirklicht werden können 7 8 . Um diese Mängel, die offensichtlich i n aller Schärfe gesehen werden, möglichst auszuschalten, werden zwei M i t t e l eingesetzt: — Einmal werden, was bereits oben erwähnt wurde, während einer Legislaturperiode mehrere Regierungserklärungen (4 bis 5) abgegeben 79 ; die erste Erklärung w i r d also gewissermaßen laufend fortgeschrieben, der Entwicklung angepaßt und teilweise auch konkretisiert. — Zum anderen, und das ist der weit wichtigere Punkt, versucht die Landesregierung seit 1973 das Regierungsprogramm durch die A u f stellung eines zusätzlichen Arbeitsprogramms zu konkretisieren, auf die Realisierungsmöglichkeiten h i n zu überprüfen und möglichst umfassend aber auch rechtzeitig zu verwirklichen 8 0 . Der Bedeutung wegen ist das Arbeitsprogramm i m folgenden noch etwas eingehender darzustellen: Dieses Programm ist, wie gesagt, erstmals i m März 1973 unter der Federführung des Staatsministeriums erarbeitet, vom Ministerrat beschlossen und i m März 1974 fortgeschrieben worden 8 1 . M i t der Fortschreibung, die i n jährlichen Abständen erfolgen soll, w i r d gleichzeitig eine Bilanz über die Verwirklichung der Regierungsprogrammpunkte des vorausgehenden Zeitabschnitts gezogen. Das Arbeitsprogramm, das für jede Legislaturperiode aufgestellt werden soll, hat einen doppelten Zweck: Einmal verfolgt es das Ziel, alle Maßnahmen, die zur Durchführung des Regierungsprogramms und damit für den Erfolg der Regierungsarbeit i n einer Legislaturperiode besonders wichtig sind, zusammenfassend darzustellen und sie sachlich und zeitlich so zu koordinieren, daß sie unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten rechtzeitig eingeleitet und ausgeführt werden können. Zum anderen soll das Arbeitsprogramm eine A n t w o r t auf die Herausforderung durch die zunehmende Komplexität der Regierungsarbeit sein und daneben, was zwingend geboten ist, die zu ihrer Bewältigung notwendige interministerielle Zusammenarbeit, nicht zuletzt zur Verwirklichung der landespolitischen Schwerpunkte, verstärken 78 Der Vorschlag, daß der Regierungschef bei Regierungsantritt n u r eine kurze Absichtserklärung abgeben und die eigentliche Regierungserklärung m i t der anstehenden ersten Aufstellung des Haushalts u n d der Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung verbinden soll, weist i n die richtige Richtung. 79 Bei der jetzt bevorstehenden Umstellung auf den Zweijahreshaushalt dürfte sich die Z a h l allerdings wieder etwas reduzieren (ca. 3). 80 Vgl. die Arbeitsprogramme der Landesregierung v o m März 1973 und März 1974 (Fortschreibung). 81 Die Arbeitsprogramme werden f ü r die Bereiche der einzelnen Ressorts von den jeweiligen Zentralstellen entworfen u n d dann unter maßgeblicher Federführung des Staatsministeriums (Abt. IV) von der Zentralstellenleiterkonferenz vorberaten und zu einem Gesamtprogramm zusammengefaßt.
§ 24 Das Staatsministerium (Staatskanzlei)
239
und gewissermaßen zum Teil institutionalisieren. I m übrigen umfaßt das Programm nicht alle Regierungsmaßnahmen (Planungen usw.), sondern nur jene von grundsätzlicher und weitreichender Bedeutung. Letztlich versucht also das Arbeitsprogramm zu erreichen, daß Engpässe und kritische Situationen, die eine erfolgreiche und rechtzeitige Durchführung des Regierungsprogramms beeinträchtigen können, früh erkannt und nach Möglichkeit behoben werden und darüber hinaus, daß die Aufgabenplanung rechtzeitig m i t der Finanzplanung 8 2 abgestimmt wird. Zur Sicherstellung der Ausführung des Programms und deren Überwachung hat das Staatsministerium dem Ministerrat i n regelmäßigen Zeitabständen über den Stand der Verwirklichung des Regierungsprogramms zu berichten 83 . Die beiden vorstehend beschriebenen Instrumente beseitigen gewiß selbst bei allen Vorbehalten einen Teil der den traditionellen Regierungserklärungen und Regierungsprogrammen innewohnenden Bedenken. Gleichwohl bestehen, soviel kann bereits heute gesagt werden, u. a. noch zwei wesentliche Mängel fort: — Das Regierungsprogramm w i r d praktisch ausschließlich für die Dauer einer Legislaturperiode, also für einen Zeitraum von höchstens 3 bis 4 Jahre aufgestellt; es enthält demnach ganz überwiegend nur kurz- und mittelfristige Perspektiven und ist weitgehend auf die nächste Landtagswahl ausgerichtet 84 . Das Regierungsprogramm hat deshalb die Tendenz zum Kurzfristigen und Reaktiven, was noch durch die Möglichkeit verstärkt wird, daß man ja i m Rahmen der jährlichen Fortschreibung neuen und veränderten Situationen durch entsprechende Maßnahmen gerecht werden kann 8 5 . 82 Die Finanzplanung erfolgt durch die mittelfristige Finanzplanung u n d deren Ausfüllung durch die Investitionsprogramme (vgl. dazu unten Ziff. 6). 83 Da das Arbeitsprogramm erst i m F r ü h j a h r 1973 eingeführt wurde, waren die empirischen Erhebungen dazu n u r spärlich u n d sehr lückenhaft. Bei der Darstellung mußte deshalb größtenteils auf die m i t dem Programm beabsichtigten Intensionen des Staatsministeriums zurückgegriffen werden, ohne ihren praktischen Erfolg oder Mißerfolg einbeziehen zu können. Trotz einiger positiver Anzeichen k a n n deshalb das Arbeitsprogramm heute noch nicht abschließend beurteilt werden. Z u den Arbeitsprogrammen der Bundesregierung vgl. insbes.: ff. Beb ermeyer, Regieren ohne Management?, S. 65 ff. m. w. N.; V. Schmidt, i n : Die V e r w a l t u n g 1973, S. 12ff.; ff. Schatz, i n : Planungsorganisation (Hrsg.: Mayntz / Scharpf), S. 34 ff.; vgl. auch Projektgruppe BMI, D r i t t e r Bericht, 1/42 ff. Die von H. Bebermeyer (ebd., S. 69 ff.) angeführten Stärken u n d Schwächen des Arbeitsprogramms gelten weitgehend auch f ü r das L a n d Bad.-Württ. 84 Die Regierungsarbeit zielt eben, was gewissermaßen eine parteipolitische Zwangsläufigkeit darstellt, p r i m ä r darauf ab, wiedergewählt u n d i n der Regierung bestätigt zu werden, was vor allem durch Vorweisen einer erfolgreichen bisherigen Regierungsarbeit erfolgt (Machterhaltung durch K o n k u r renzkampf). Diese Tatsache stellt durchaus einen G r u n d zu ernsthafteren
240
Kap. I I I : Organisation und S t r u k t u r der Landesregierung B W
— Regierungserklärung und Regierungsprogramm werden zwar i m A r b e i t s p r o g r a m m t e i l w e i s e k o n k r e t i s i e r t , b l e i b e n aber insgesamt f ü r fast a l l e M i n i s t e r i a l b e a m t e n ( A b t e i l u n g s l e i t e r u n d R e f e r e n t e n v o r a l l e m i n d e n Ressorts) doch w e i t g e h e n d u n b e k a n n t . H i e r b e d a r f es d r i n g e n d e i n e r zusätzlichen S y s t e m a t i s i e r u n g u n d U m s e t z u n g des R e g i e r u n g s p r o g r a m m s f ü r die n o r m a l e A r b e i t i n d e n M i n i s t e r i e n . Das S t a a t s m i n i s t e r i u m u n d auch die Z e n t r a l s t e l l e n i n d e n M i n i s t e r i e n h a b e n h i e r noch vieles z u v e r b e s s e r n 8 6 . 6. Planungsinstrumentarium D e m M i n i s t e r p r ä s i d e n t e n u n d d e r R e g i e r u n g stehen a n F ü h r u n g s i n s t r u m e n t e n (Grundsatzplanungen und Programme) neben d e m Regier u n g s - u n d A r b e i t s p r o g r a m m v o r a l l e m noch d i e m i t t e l f r i s t i g e F i n a n z p l a n u n g , das I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m u n d die L a n d e s p l a n u n g (das sogen, „magische F ü n f e c k " ) , s o w i e seit k u r z e m zusätzlich n o c h d e r statistische u n d prognostische J a h r e s b e r i c h t z u r V e r f ü g u n g 8 7 . Diese B a s i s p l a n u n g e n s i n d deshalb h i e r i m e i n z e l n e n d a r z u s t e l l e n : a) D i e mittelfristige Finanzplanung 88 w u r d e f ü r das L a n d B a d . W ü r t t . bereits i m S o m m e r 1967 ausgearbeitet u n d v o r g e l e g t 8 9 . Diese Überlegungen über die Frage dar, ob nicht i n den Ländern die Legislaturperiode f ü r die Parlamente verlängert werden sollte (etwa auf 6 Jahre). Z u diesem „Zeitdimensions"-Problem vgl. etwa N. Luhmann, i n : Der Staat 1973, S. 13 f. 85 Diese Aussage wurde von den meisten Befragten bestätigt ( „ e r d r ü k kende Alltagsarbeit") u n d ergibt sich auch aus der Ubersicht 2 (mittel- u n d langfristige Landesaufgaben). 86 Diese Mängel zeigten sich eindeutig durch die empirischen Erhebungen (vgl. besonders auch die Ubersicht Nr. 5 unten Ziff. 10). Daß dazu auch einzelne Beamte bzw. deren Grundeinstellung zu allem Politischen beitragen, macht entsprechende Maßnahmen n u r noch dringender. Vgl. dazu vor allem ff. W. Rombach, i n : Die Staatskanzlei, SHS Bd. 34, S. 275 f. u n d K . von der Groeben, i n : Die V e r w a l t u n g 1968, S. 390 f. 87 Z u r Bad.-Württ. Grundsatzplanung vgl. etwa: Modell f ü r die Z u k u n f t , 2 Bände, herausgegeben v o m Staatsministerium Bad.-Württ.; L a n d u n d Gemeinde, Heft 5 (Bad.-Württ.); H. Filbinger, Planung i n Bad.-Württ., i n : „ I n formationen aus Erster H a n d " der Landespressestelle, Nr. 6/72; H. Filbinger, Entscheidung zur Freiheit, S. 115 ff.; F. Scharpf, i n : Projektgruppe B M I , Erster Bericht, Anlagenband, S. 288 ff.; F. Scharpf, Länderbericht Bad.-Württ., S. 2 ff.; F. Wagener, F ü r ein neues I n s t r u m e n t a r i u m der öffentlichen Planung, i n : Wibera-Sonderdruck Nr. 39, S. 14 ff. Allg. vgl. T. Ellwein, i n : Die Staatskanzlei, SHS Bd. 34, S. 207 f. 88 Vgl. dazu insbes. G. Blaser / R. Schmitt, i n : Die V e r w a l t u n g 1969, S. 78 ff.; F. Weller, i n : Baden-Württemberg, 1967 Heft 11, S. 52 ff.; ff. Filbinger, in: Festgabe f ü r A . Möller, S. 135 ff.; L a n d u n d Gemeinde, Heft 5 (Bad.-Württ.), S. 66 f.; Modell f ü r die Z u k u n f t , Bd. 1 (Hrsg.: Staatsministerium Bad.-Württ.), S. 23, 173 ff.; F. Scharpf, Länderbericht Bad.- Württ., S. 3 f. Z u r m i t t e l f r i s t i gen Finanzplanung des Bundes vgl. etwa H. Schatz, i n : Planungsorganisation (Hrsg.: Mayntz / Scharpf), S. 48 ff. m. w. N.; F. Naschold u. a., ebenda, S. 146 ff.; V. Schmidt, i n : Die V e r w a l t u n g 1973, S. 4 ff.
§ 24 Das Staatsministerium (Staatskanzlei)
241
Planung wurde inzwischen siebenmal (jährlich) fortgeschrieben, wobei meist erhebliche Korrekturen und eine laufende Verbesserung der Technik und Methode notwendig waren. Die Ausarbeitung war von Anfang an dem Finanzministerium („Generalreferat" der Haushaltsabteilung) übertragen. Der Einfluß des Ministerpräsidenten und der Staatskanzlei auf die mittelfristige Finanzplanung, der bis 1972 sicher relativ hoch einzuschätzen war, ist allerdings zurückgegangen. Dies beruht u. a. darauf, daß die i m Staatsministerium dafür zuständigen Beamten gewechselt haben 90 . Heute dürfte bei der Erstellung und Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung das Finanzministerium eine besonders wichtige Stellung innehaben. I m Kabinett kommt es aber noch regelmäßig zu größeren Verschiebungen, für die bedauerlicherweise allerdings meist nicht echte Programmalternativen (die nicht vorgelegt werden), sondern rein politische Gesichtspunkte ausschlaggebend sind 9 1 . I n der Beurteilung des Wertes und der Effektivität der mittelfristigen Finanzplanung sind die anfänglich mitunter viel zu optimistischen Prognosen 92 heute weitgehend von realistischen und eher pessimistischen Auffassungen verdrängt worden 9 3 . Die durchgeführte Untersuchung ergab, daß vor allem zwei Gründe dafür maßgebend sind, daß die mittelfristige Finanzplanung heute weit eher einer „Pflichtübung" gleichkommt als ein echtes Führungsinstrument darstellt: — Der mittelfristigen Finanzplanung sind durch den stark ausgeprägten politischen, besonders aber auch den Ressortegoismus, ganz erhebliche Grenzen gesetzt (z.B. Anmelden von „Mondzahlen", bewußte Aufnahme unrealistischer Zahlen). A u f diesem Hintergrund w i r d verständlich, daß die Ziele der Finanzplanung bei weitem nicht erreicht wurden, sondern durch sie, entgegen allen Erwartungen, weit eher die durch die Ein- bzw. Zweijahresetats eingetretene haushaltspolitische „Erstarrung" (Plafonddenken) bestätigt wurde. 89 Vgl. Gesetz zur Förderung der Stabilität u n d des Wachstums der W i r t schaft v o m 8. 6.1967 (BGBl. I S. 582). 90 Der frühere Leiter der Grundsatzabteilung wurde 1972 als Amtschef i n das Finanzministerium berufen. Der für die mittelfristige Finanzplanung zuständige Referent hat sogar mehrfach gewechselt. 91 Bei der politischen Auseinandersetzung i m Ministerrat, also überall dort, wo Kabinettsentscheidungen erforderlich sind bzw. herbeigeführt w e r den, spielt der Ministerpräsident (Staatsministerium) aber nach w i e vor eine einflußreiche Rolle. Vgl. auch F. Scharpf, i n : Projektgruppe B M I , Erster Bericht, Anlagenband, S. 289 f. 92 Vgl. etwa G. Blaser / R. Schmitt, i n : Die V e r w a l t u n g 1969, S. 78, 96 m. w . N. 93 Dies ergaben mindestens i n der Tendenz alle Befragungen zu diesen Problemen. Vgl. auch: L a n d u n d Gemeinde, Heft 5 (Bad.-Württ.), S. 66 f. Z u der Entwicklung i m B u n d vgl. etwa V. Schmidt, i n : Die V e r w a l t u n g 1973, S. 6 f. m. w . N.
1
atz
242
Kap. I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
Die der Haushaltsplanung anhaftenden Mängel (traditionelles Einjahresdenken; fast ausschließliche Gegenwartsbezogenheit; Bestehendes faktisch unabänderbar; mangelnde Variabilität bestehender Einzeltitel; Ausgangsdaten sind nach wie vor Vergangenheitswerte; keine Prioritätensetzung usw.) konnten durch die mittelfristige Finanzplanung offensichtlich größtenteils nicht beseitigt werden 9 4 . — Des weiteren wurde immer mehr deutlich, daß mindestens m i t dem gegenwärtigen Instrumentarium das Problem der Basisdaten für die Finanzplanung nicht gelöst werden kann. Die Unsicherheiten und Ungenauigkeiten i m Bereich der Festlegung der Eckwerte, Daten und Prognosen zeigen sich zum Teil als so beträchtlich, daß mitunter die gegenwärtig praktizierte mittelfristige Finanzplanung überhaupt i n Frage gestellt wird. Die Planabweichungen sind gegenüber dem ursprünglich angenommenen Erwartungshorizont sowohl auf der Ausgaben- als besonders auch auf der Einnahmeseite so groß, daß der Finanzplanung weithin, was den Regierungsmitgliedern auch durchaus bewußt ist, mehr der Charakter einer Wunsch- als einer mittelfristigen Bedarfs- oder gar integrierten Aufgaben- und Finanzplanung verliehen wird. Ein ganz wesentlicher Funktionsmangel der Finanzplanung liegt also i n der begrenzten Leistungsfähigkeit der heute verfügbaren Planungsmethoden, technischen Hilfsmittel und vor allem auch i n dem unzureichenden mittel- und langfristigen prognostischen Instrumentarium 9 5 . Die Funktionsschwächen der mittelfristigen Finanzplanung werden, auch wenn man dies nicht offiziell zugibt, durchaus gesehen 96 und man versucht auch durch verschiedene, teilweise recht unterschiedliche Maßnahmen und Vorschläge den der Finanzplanung gestellten Aufgaben besser gerecht zu werden. I n diesem Zusammenhang wurden, abgesehen von bisher nicht über das Stadium eines „Sandkastenspiels" hinausgekommenen Vorschläge 97 , vor allem zwei Maßnahmen ergriffen: 94 Mehrere Befragte meinten, „daß das Planen u n d Denken i n größeren Zeiträumen nach w i e vor weitgehend eine Wunschvorstellung ist u n d außerdem k e i n Regierungsmitglied bereit ist, einem anderen i n finanzieller Hinsicht besonders w e h zu tun, u m neue Prioritäten zu beschließen". Dies t r i f f t i m wesentlichen auch f ü r die mittelfristige Finanzplanung des Bundes zu; vgl. etwa R. Jochimsen, i n : B u l l e t i n des Presse- u n d Informationsamtes der B u n desregierung 1970, S. 954; F. Wagener, i n : Wibera-Sonderdruck Nr. 39, S. 8 f. 96 Bei der K o m p l e x i t ä t der Basisdaten u n d ihrer Abhängigkeit v o m Bund, der E G sowie den innerstaatlichen u n d weltweiten Umwelteinflüssen, d ü r f ten hier aber keine „ W u n d e r " erwartet werden. 96 I m B u n d bestehen i m wesentlichen genau dieselben Probleme. Vgl. dazu insbes. die zusammenfassende Darstellung von H. Schatz, i n : Planungsorganisation (Hrsg.: M a y n t z / Scharpf), S. 52 ff. m. w . N. 97 Einige Vorschläge sollen hier skizzenhaft kurz dargestellt werden: (1) Die weitestgehenden Vorstellungen gehen dahin, i n Bad.-Württ. eine integrierte Aufgaben- u n d Finanzplanung zu verwirklichen. Dafür soll, ähn-
§ 24 Das Staatsministerium (Staatskanzlei)
243
Z u r V e r m i n d e r u n g der g e n a n n t e n M ä n g e l s o l l e n das I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m sowie d e r statistische u n d prognostische J a h r e s b e r i c h t w e s e n t lich beitragen. b) D e r m i t t e l f r i s t i g e F i n a n z p l a n ist i m P r i n z i p die G r u n d l a g e f ü r die i n v e s t i v e n u n d p r o g r a m m a t i s c h e n V o r h a b e n der L a n d e s r e g i e r u n g . D a er jedoch f ü r die e i n z e l n e n V o r h a b e n u n d P r o g r a m m e n u r g l o b a l e Ausgabenansätze k e n n t , i s t es d e r p o l i t i s c h e n F e i n a b s t i m m u n g , K o n k r e t i s i e r u n g u n d K o n t r o l l e w e g e n n o t w e n d i g , diese A n s ä t z e s t r e n g p r o j e k t b e z o g e n a u s z u f o r m e n u n d z u präzisieren. Dies e r f o l g t , a l l e r dings ohne A l t e r n a t i v p l a n u n g e n , i n d e m Investitionsprogramm, das die L a n d e s r e g i e r u n g i m F e b r u a r 1974 e r s t m a l s f ü r d e n Z e i t r a u m v o n 1973 - 1 9 7 6 verabschiedet h a t 9 8 . Das I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m s o l l d e r R e g i e r u n g als F ü h r u n g s i n s t r u m e n t dienen, u m e i n m a l das r e l a t i v grobe E r k e n n t n i s b i l d der m i t t e l f r i s t i g e n F i n a n z p l a n u n g z u verbessern u n d d a m i t auch die Ü b e r s c h a u b a r k e i t u n d T r a n s p a r e n z der H a u s h a l t s lich dem praktizierten Modell i n Niedersachsen (vgl. Landesentwicklungsprogramm Niedersachsen 1985, Hrsg.: Nds. Ministerpräsident — Staatskanzlei —, 1973), ein Planungsstab i m Staatsministerium eingesetzt werden, dessen Aufgaben i n einer intensiven Koordination, vorbereitenden Festlegung der Prioritäten u n d auch „Durchforstung" des gesamten Haushalts (insbes. U m w a n d l u n g nicht zwingend notwendiger „feststehender Blöcke und P l a fonds") liegen. (2) E i n anderer Vorschlag geht dahin, daß eine integrierte Aufgaben- u n d Finanzplanung durch einen interministeriellen Planungsstab (etwa Zentralstellenleiterkonferenz oder Stab, der sich aus den Planungsreferenten der Zentralstellen zusammensetzt) aufgrund von Zielvorgaben erarbeitet w i r d , die v o m Kabinett festgelegt wurden. (3) Nach einer von M. Rommel vertretenen u n d mittlerweile i m Prinzip von der Landesregierung übernommenen Auffassung muß die gesamte Haushaltswirtschaft auf allen Ebenen grundlegend neu gestaltet werden. Ausgangsp u n k t u n d Basis einer Neuorientierung muß dabei ein von B u n d u n d L ä n dern (unter Einschluß der Kommunen) gemeinsam erarbeiteter u n d politisch getragener Rahmenplan f ü r den öffentlichen Gesamthaushalt sein (vgl. dazu näher, i n : Staatsanzeiger für Bad.-Württ. v o m 21. 9.1974, Nr. 76, S. 2 u n d Landespressestelle, Wochendienst 35/74 v o m 18. 9.1974, S. 1 f., vgl. auch H. F i l binger, Entscheidung zur Freiheit, S. 183 f.). Aufbauend auf dieser G r u n d lage muß dann auf Landesebene eine „grobrastige" integrierte Aufgabenu n d Finanzplanung erarbeitet werden. Hierbei ist besonders darauf zu achten, daß die Gesamtausgaben i n die Bereiche Personalausgaben, rechtlich gebundene u n d gesetzlich festgelegte Sachaufgaben, übrige Ausgaben (frei v e r fügbar, insbes. f ü r Fachprogramme usw.) getrennt werden, daß zwischen den drei Bereichen möglichst ein ausgewogenes Verhältnis besteht bzw. hergestellt w i r d , u n d daß die Personal- u n d gesetzlich festgelegten Ausgaben l a u fend auf ihre Notwendigkeit h i n überprüft werden. Organisatorisch sollten die Tätigkeiten dafür sinnvollerweise schwerpunktmäßig i m Finanzminister i u m wahrgenommen werden. 98 Vgl. dazu i m einzelnen: Investitionsprogramme des Landes Bad.-Württ. für die Jahre 1973 - 1976, 97 S. (Febr. 1974); Landespressestelle, Pressemitteilung Nr. 141/74; Staatsanzeiger für Bad.-Württ. v o m 2.3.1974, S. 1; S t u t t garter Zeitung v o m 28. 2.1974, S. 5. A l l g . vgl. dazu §§ 9 u n d 10 StabG sowie § 50 H G r G ; vgl. auch das Investitionsprogramm des Bundes bis 1973, Bundestag-Drucksache VI/1169. 1*
244
Kap. I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
Planung, ja sogar der gesamten Landespolitik einer Legislaturperiode zu erhöhen" und zum anderen die Festlegungen des Landesentwicklungsplans, die einzelnen Fachplanungen und die Finanzplanung noch enger miteinander zu verzahnen sowie ihre gegenseitige Abhängigkeit zu verdeutlichen (Investitionsprogramm als Bindeglied und insoweit ein erster Ansatz zu einer integrierten Aufgaben- und Finanzplanung). Darüber hinaus soll durch dieses Programm versucht werden, den Versorgungsstand bei landespolitischen Schwerpunktaufgaben landesweit und regional darzustellen, um so der Landesregierung ein Steuerungsinstrument an die Hand zu geben, das eine gleichmäßige Entwicklung des Versorgungsgrads (gewissermaßen als neuem Planungskriterium) i n allen Regionen des Landes und die Schaffung gleicher Lebenschancen und -bedingungen besser als bisher ermöglicht 1 0 0 . Da aber das Investitionsprogramm von der Grundplanung und den Basisdaten des mittelfristigen Finanzplans ausgeht, ist es ebenso wie die Finanzplanung m i t erheblichen Unsicherheitsfaktoren und Mängeln behaftet 1 0 1 . Eine regelmäßige Fortschreibung des Investitionsprogramms soll eine Präzisierung der Ausgaben, eine Verfeinerung und Verbesserung der Darstellung sowie der Methode selbst bringen, um so allmählich die bestehenden Mängel abzubauen. Ob dies gelingen wird, kann nach wenigen Monaten noch nicht beurteilt werden 1 0 2 . Bei der Ausarbeitung der Investitionsprogramme, die i m wesentlichen ähnlich wie die der Arbeitsprogramme erfolgt 1 0 3 , ist das Staatsministerium maßgeblich, insgesamt wohl noch etwas stärker als dort, beteiligt. c) Das Kabinett hat m i t Beschluß vom 16.1.1973 das Statistische Landesamt beauftragt, zur Vorbereitung der Fortschreibung des A r beitsprogramms und der Finanzplanung (überhaupt für die gesamte Grundsatz- und auch Fachplanung) dem Ministerrat jährlich i m Januar e i n e n statistischen
und prognostischen
Jahresbericht
vorzulegen, i n dem
die statistischen Daten sowie lang- und mittelfristige Prognosen für die wesentlichen politischen Aufgabenbereiche enthalten sind. Der 99 I m Unterschied zum Arbeitsprogramm, das n u r f ü r die Regierung selbst bestimmt ist, w u r d e das Investitionsprogramm dem Landtag zugeleitet. 100 Das Investitionsprogramm enthält auf insges. 97 Seiten eine Darstellung folgender Schwerpunktprogramme: Wohnungs-, Städtebau, Ausrüstung der Polizei, Sportstättenbau, Landesstraßenbau, Förderung der regionalen u n d sektoralen Wirtschaftsstrukturen, Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Soziale Investitionen, Krankenhausbau, Umweltschutz und staatlicher Hochbau. 101 Vgl. oben Buchstabe a; als Unsicherheitsfaktoren kommen etwa i n Betracht: Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Tätigkeit, weltweite Krisen, Preissteigerungen, Tarifabschlüsse, Steuerreform, A u f t e i l u n g des Steueraufkommens zwischen B u n d u n d Länder, allg. k o n j u n k t u r e l l e Entwicklung usw. 102 Die Ausführungen i n Fußnote 83 gelten hier weitgehend entsprechend. 103 Vgl. dazu oben Ziff. 5 (insbesondere Fußnote 81).
§ 24 Das Staatsministerium (Staatskanzlei)
245
Bericht wurde i m Januar 1974 erstmals vorgelegt und i m August 1974 i n ergänzter und teilweise überarbeiteter Fassung dem Landtag und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 104 . Die Jahresberichte, deren Daten und Prognosen durch ihr regelmäßiges Neuerscheinen ständig überprüft werden sollen, versuchen m i t Hilfe einer Vorausschätzung der wirtschaftlichen, demographischen usw. Entwicklungen eine umfassende, bessere und gesichertere Grundlage für die Regierungsentscheidungen zu geben (Vorausschätzungen als Orientierungswerte). Die Landesregierung glaubt damit erstmals i n einem Bundesland ein I n strument zur Planung, Erfolgskontrolle und zur rechtzeitigen Vornahme notwendiger Kurskorrekturen geschaffen zu haben, das das bestehende Instrumentarium wirkungsvoll ergänzt und vervollständigt und darüber hinaus die Entwicklung des Landes und die W i r k samkeit der Maßnahmen der Landesregierung für jedermann durchsichtiger macht. Das Statistische Landesamt geht, da bisher noch kein geschlossenes, ausreichend gesichertes Modell für die Vorausschätzung aller Größen vorhanden ist, bei der Festlegung der mittel- und längerfristigen Prognosen methodisch so vor, daß zunächst die Eckdaten für jeden Tatbestand i n einem „empirisch-analytischen Verfahren" einzeln geschätzt und sodann unter Verwertung aller datenorientierten Erfahrungen und Kenntnisse sowie unter Berücksichtigung aller weiteren dem A m t bekannten Informationen geprüft und aufeinander abgestimmt wurden 1 0 5 . Die bisherige Entwicklung und die durchgeführte empirische Untersuchung zeigen, daß die recht hochgeschraubten Erwartungen der Landesregierung sicher nicht erfüllt werden können, 104 Stat. Landesamt Bad.-Württ., Statistischer u n d prognostischer Jahresbericht 1973, 98 S.; Staatsanzeiger Bad.-Württ. v o m 30.3.1974, S. 1 u n d v o m 7.8.1974, S. 1; Landespressestelle, Pressemitteilung 199/74 (vom 27.3.1974); Landespressestelle, Wochendienst Nr. 29/74 (vom 7. 8.1974), S. 2 f. Der Jahresbericht 1973 umfaßt drei Teile: Teil 1 — Das Jahr 1973 — Grundzüge der E n t w i c k l u n g und Ausblick T e i l 2 — Längerfristige Vorausschätzungen bis 1985 Teil 3 — Einzeluntersuchungen zu Schwerpunkten des Arbeitsprogramms der Landesregierung Nach Aussage des Stat. Landesamts w a r die Erstellung dieses ersten Berichts vor allem durch drei Faktoren besonders erschwert: (1) durch die Erstmaligkeit eines solchen landespolitisch orientierten Berichts, (2) durch die Ende 1973 i n Anbetracht der Energiekrise etc. besonders u n sichere Weiterentwicklung, (3) durch die leider begrenzten Kenntnisse des Amtes über Planungen u n d über beabsichtigte u n d beschlossene Maßnahmen der einzelnen Ressorts und der Landesregierung. Die empirische Untersuchung hat ergeben, daß der dritte P u n k t besonders schwerwiegend u n d n u r mühsam zu beseitigen ist u n d außerdem der zweite P u n k t die Grenzen solcher Berichte anschaulich verdeutlicht. los v g l dazu i m einzelnen: Stat. Landesamt, Stat. u n d prognostischer Jahresbericht 1973, S. 17 ff.
246
Kap. I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung BW
daß die Jahresberichte aber trotz aller Vorbehalte für die mittelfristige Regierungsarbeit, wenn die Anfangsschwierigkeiten überwunden werden können, m i t der Zeit zu einem wertvollen und unverzichtbaren Hilfsinstrument werden können. Über praktische Erfahrungen bei der Arbeit m i t dem Bericht, der erst i m August 1974 endgültig verabschiedet wurde, kann leider noch wenig berichtet werden. Es scheinen allerdings, neben den allgemein für die Festlegung von mittel- und langfristigen Prognosen bestehenden methodischen Problemen, erhebliche Schwierigkeiten letztlich vor allem i n dem unzureichenden, teilweise etwas gestörten gegenseitigen Kommunikationsprozeß zwischen dem Statistischen Landesamt und der Ministerialverwaltung zu bestehen und es dürfte zudem an einer umfassenden Kenntnis und Beachtung der diesbezüglichen Daten mangeln 1 0 6 . Die Jahresberichte werden, was bereits mehrfach ausgeführt wurde, vom Statistischen Landesamt, das dem Finanzressort zugeordnet ist, ausgearbeitet und der Landesregierung vorgelegt. Wie groß dabei der Einfluß des Staats- bzw. des Finanzministeriums i m einzelnen ist, konnte nicht genau festgestellt werden. Sicher scheint allerdings zu sein, daß die Staatskanzlei hier eine weit weniger starke Stellung inne hat, wie dies etwa bei der Aufstellung des Arbeits- oder Investitionsprogrammes der Fall ist 1 0 7 . d) Als weiteres Führungsinstrument und Basisplanung w i r d von der Landesregierung schließlich noch die Landesplanung (Landesentwicklungsplan) angesehen, die zwar Anfang der sechziger Jahre lediglich als M i t t e l der Raumordnung und Raumplanung konzipiert worden war, heute aber m i t ein grundlegendes Instrument (Rahmenplan) der Regierungsarbeit und der gesamten Landespolitik darstellen soll. Nach langen Vorarbeiten und verschiedenen Zwischenstationen ist der Landesentwicklungsplan durch Rechtsverordnung vom 11. 4.1972 für verbindlich erklärt worden 1 0 8 . Er stellt ein großräumiges und langfristiges, io« v g l . die v o m Stat. Landesamt selbst genannten Erschwerungsfaktoren (1) u n d (3) oben i n Fußnote 104; i m übrigen dürften die oben Ziff. 5 (Fußnote 86) als notwendig betrachteten Anregungen hier entsprechend gelten. 107 I m H i n b l i c k auf den Einfluß des Staatsministeriums spielt dessen seit 1972 erhobene Forderung nach einer Zuordnung des Stat. Landesamts v o m Finanz- zum Staatsministerium u n d damit w o h l eine stärkere Politisierung der A r b e i t des Stat. Landesamts eine wichtige Rolle (vgl. oben § 20 Ziff. 3). Bezeichnend ist i n diesem Zusammenhang auch der Streit u m die Veröffentlichung u n d die vorgenommene Überarbeitung des Jahresberichts 1973, vgl. dazu: Stuttgarter Zeitung v o m 28. 5.1974, S. 5; v o m 30. 5.1974, S. 5 u n d v o m 20. 6.1974, S. 5. los Y o der Landesregierung über die Verbindlicherklärung des Landesentwicklungsplans v o m 11. 4.1972, ergangen aufgrund von § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Verbindlicherklärung des Landesentwicklungsplans v o m selben Tag (Ges. Bl. 1972, S. 169). Allgemein zur Bad.-Württ. Landesplanung (Landesentwicklungsplan) vgl. etwa: Landtagsdrucksachen, 5. Wahlperiode, Nr. 5400; H. Filbinger, Planung i n Bad.-Württ., i n : „Informationen aus erster H a n d " der Landespressestelle, Nr. 6/72 (Sept. 1972); L a n d u n d Gemeinden
§ 24 Das Staatsministerium (Staatskanzlei)
247
auf hohem Abstraktionsgrad stehendes Rahmenprogramm dar 1 0 9 . M i t dem Landesentwicklungsplan w i r d versucht, die Ziele der räumlichen, strukturpolitischen Entwicklung sowie der raumbeeinflussenden und raumbeanspruchenden Maßnahmen, die sich auf fast alle landespolitischen Aufgaben auswirken, einschließlich ihrer Verwirklichung, bis zum Jahre 1985 festzulegen. Dabei ist er nicht nur als eine raumbezogene, raumwirksame, sondern außerdem als eine aufgabenorientierte Determinante des Basisplanungssystems des Landes zu verstehen. Zwar fehlt der Landesplanung der Finanzbezug, doch w i r d i m Rahmen der Investitionsprogramme versucht, diese wenigstens auf Teilbereichen mit der Finanzplanung zu verbinden. Weiter soll der Landesentwicklungsplan die Aufgabe verfolgen, die Maßnahmen (z.B. Fachpläne) aller Staatsbehörden, Selbstverwaltungsträger, aber auch der Privatpersonen aufeinander abzustimmen, ihnen Orientierungshilfen zu geben und schließlich umfassende Koordinationsfunktionen wahrzunehmen. Die Aufgaben der Landesplanung und damit auch die Ausarbeitung des Landesentwicklungsplans lagen fast ausschließlich i n den Händen des Innenministeriums. Der Einfluß des Regierungschefs und des Staatsministeriums auf die Landesplanung war sicher i n den Jahren unmittelbar nach 1966 recht beachtlich 110 , dürfte aber langsam zurückgegangen und heute nicht mehr besonders groß sein. e) Neben den vorstehend näher beschriebenen sechs Basisplanungen und -programmen w i r d von der Landesregierung meist noch die Verwaltungsreform 1 1 1 , der angekündigte Landessozialplan 112 und vereinzelt auch das mittelfristige Umweltschutzprogramm 1 1 3 zum Rahmenplanungssystem des Landes gerechnet. Diese Grundsatzplanungen und Heft 5, Febr. 1972 (Bad.-Württ.), S. 3 ff.; Modell f ü r die Z u k u n f t , Bd. 1, S. 65 ff.; F. Scharpf, Länderbericht Bad.-Württ., S. 4 ff.; F. Wagener, i n : WiberaSonderdruck Nr. 39 (März 1973), S. 14 ff. 109 D e r p i a n selbst ist i n drei Teile gegliedert: 1. T e i l — Allgemeine G r u n d sätze u n d Entwicklungsziele; 2. T e i l — Grundsätze u n d Ziele der Landesplanung f ü r Sachbereiche; 3. T e i l — Ziele der Landesplanung f ü r räumliche Bereiche. 110 Der Ministerpräsident H. Filbinger w a r bis 1966 Innenminister u n d leitete seinerzeit den Landesentwicklungsplan ein. Außerdem w a r der A m t s chef des Staatsministeriums vorher Leiter der A b t e i l u n g Landesplanung i m Innenministerium (personales Einflußmuster). 111 Vgl. Schlußkonzeption der Landesregierung f ü r die Verwaltungsreform v o m 5.7., 6.8. u n d 22.11.1973, Landtagsdrucksachen, 6. Wahlperiode, Nr. 2900, 3100 u n d 3870; M. Bulling, i n : D Ö V 1975, S. 329 ff.; vgl. auch S. Süß, i n : B a y V w B l . 1975, S. 1 ff. 112 V o n Ministerpräsident H. Filbinger wurde i n seiner Regierungserklärung v o m 22.6.1972 eine umfassende Sozialanalyse, aus der ein Landessozialplan als gesellschaftspolitisches Gesamtkonzept entwickelt werden soll, angekündigt, der bis heute noch nicht vorliegt. Vgl. Landtagsprotokolle, 6. Wahlperiode, S. 21. 118 Das mittelfristige Umweltschutzprogramm wurde v o m K a b i n e t t am 18.12.1973 beschlossen; es enthält eine umfassende Darstellung aller Ziele
248
Kap. I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
-Programme (insbesondere das Regierungs-, Arbeits- und Investitionsprogramm, die mittelfristige Finanzplanung, der Landesentwicklungsplan und der statistisch prognostische Jahresbericht) sollen dann durch eine Vielzahl von Fachplanungen konkretisiert, ergänzt und besonders auch durch Querbezüge (-Verbindungen) ausgeformt werden 1 1 4 . Hierbei fällt allerdings auf, daß bisher nicht selten nur jene Fachplanungen i n Angriff genommen wurden, die ohne größere Schwierigkeiten aufzustellen oder besonders öffentlichkeitswirksam waren 1 1 5 . Erkennbare Ansätze eines systematischen und sinnvoll auf den Basisplanungen aufbauenden Fachplanungskonzepts müssen deshalb dringend verstärkt werden. Diese Ausführungen haben gezeigt, daß die Landesregierung die Herstellung eines Gesamtplans — also Zusammenfassung aller Planungsbereiche i n einen einheitlichen Plan (integrierte Entwicklungsplanung m i t Raum-, Zeit- und Ressourcenbezug) — nicht für zweckmäßig hält. I m Gegensatz zu anderen Bundesländern — etwa Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen — gibt Bad.-Württ. einem dezentralen, aber zentralkoordinierten Planungssystem den Vorzug. Für diese Konzeption dürften i m wesentlichen folgende Argumente sprechen 1 1 6 : — Ohne kreative und aktive Mitarbeit der Ressorts und teilweise auch anderer staatlicher und kommunaler Stellen fehlen der Regierungsplanung ausreichende Initiativen, vor allem aber umfassende Informationen und praktische Erfahrungen. U m dies zu gewährleisten und den spezialisierten Sachverstand zu nutzen, müssen besonders die Ministerien maßgeblich, möglichst unmittelbar beteiligt werden 1 1 7 . Zur Sicherstellung einer einigermaßen einheitlichen und widerspruchsfreien Gesamtkonzeption bedarf es allerdings einer effektiven zentralen Koordination. — Die verfassungsrechtliche Ausgestaltung des Regierungssystems (Art. 49 I und I I LV) läßt es nicht zu, daß die gesamte mittel- und langfristige Planungskompetenz vom Ministerpräsidenten (Staatsministerium) wahrgenommen wird, da die Richtlinienkompetenz zuu n d Maßnahmen auf dem Gebiet des Umweltschutzes von 1974 - 1976. Vgl. Landespressestelle, Pressemitteilung Nr. 999/73. 114 A n Fachplänen sind beispielhaft etwa zu nennen: Generalverkehrsplan, Energieprogramm, Krankenhausbedarfsplan, Schulentwicklungspläne, Hochschulgesamtpläne, Kindergartenentwicklungsprogramm, Altendenkschrift, Ausländerdenkschrift usw. 116 Vgl. dazu auch oben § 24 Ziff. 4. 116 Vgl. dazu etwa: Modell f ü r die Z u k u n f t , Bd. 1, S. 25 f.; H. Filbinger, Planung i n Bad.-Württ., i n : „Informationen aus erster Hand", Landespressestelle, Nr. 6/72, S. 4 f.; F. Wagener, i n : Wibera-Sonderdruck Nr. 39, S. 14 ff. 117 Vgl. dazu etwa oben § 3 Ziff. 3 u n d § 23 Ziff. 1.
§ 24 Das Staatsministerium (Staatskanzlei)
249
gunsten des Kollegialprinzips (Kabinettsentscheidung) eingeschränkt ist 1 1 8 . — Das Selbstverständnis und die Aufgabenstellung des Staatsministeriums (vor allem Integration, Kommunikation und Koordination) würden sich stark verändern (Staatskanzlei als „Superministerium"), ja sogar das bestehende Regierungssystem umkrempeln, wenn dem Staatsministerium die gesamte Basisplanung übertragen werden würde. Dies kann aber nicht Sinn der Planung sein und würde den Rahmen der Staatskanzlei sprengen 119 . Vielmehr sollte die Planungsorganisation so ausgestaltet sein, daß sich das Staatsministerium grundsätzlich auf wirksame, zentrale Koordination, auf Initiative und methodische Hilfe beschränken kann. — Die verschiedenen Planungsaufgaben und einzelnen Basisplanungen unterscheiden sich, was Funktion, Zielsystem, Planungstechnik und Zeithorizont anlangt, teilweise sehr stark. Sinnvollerweise sollten daher die Grundsatzprogramme und -planungen nicht i n ein einheitliches Schema, den Gesamtplan, gepreßt werden. Vor allem sind die notwendigen Korrekturzyklen recht unterschiedlich und auch die Flexibilitätsanforderungen i m einzelnen alles andere als einheitlich (zudem unterschiedliche Dichte des Politischen und des Konflikts). — Z u diesen Argumenten kommt aber auch noch ein wichtiger politischer Grund hinzu. Selbst unter Berücksichtigung der gegenwärtig relativ starken Stellung des Regierungschefs H. Filbinger w i r d es von der ganz überwiegenden Zahl der Befragten für politisch praktisch nicht realisierbar bezeichnet, das Staatsministerium zu einem „Oberministerium" mit umfassenden Planungskompetenzen auszubauen. Das bad.-württ. Gesamtplanungssystem besteht demnach aus einer Mehrzahl miteinander verflochtener Pläne, die jeweils wichtige Teilfunktionen des Gesamtsystems erfüllen: Den Basisplanungen und »Programmen des Landes, nämlich dem Regierungsprogramm, dem A r beitsprogramm, der mittelfristigen Finanzplanung (einschließlich dem Zweijahreshaushalt), den Investitionsprogrammen, den statistischen und prognostischen Jahresberichten sowie dem Landesentwicklungsplan, und den darauf aufbauenden Fachplanungen (zum Teil auch Regionalplänen) für die verschiedenen Aufgabenbereiche. Dieses System w i r d auf einigen Teilbereichen gewissermaßen durch die Verwal118
Vgl. dazu eingehend oben § 12. Nach dem Behörden Verzeichnis Bad.-Württ. 1974 sind etwa allein i n der Abteilung Landesplanung i m Innenministerium 21 höhere Beamte tätig! Vgl. oben § 20 Ziff. 3 u n d etwa G. Kunze, i n : Die Staatskanzlei, SHS Bd. 34, S. 104. 119
250
Kap. I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
tungsreform ergänzt, indem m i t ihr versucht wird, der Ministerialverwaltung eine Gestalt zu geben, die ihr die Erfüllung ihrer planerischen und programmatischen Regierungsarbeit erleichtert 1 2 0 . Trotz des grundsätzlich dezentralen Planungssystems hat es der Ministerpräsident (Staatsministerium) i n den letzten Jahren verstanden, die gesamte Regierungs- und damit auch die Ressortarbeit einschließlich der Festlegung der Prioritäten einer Legislaturperiode durch ein Netz von Basisplanungen (insbes. durch die Umsetzung des Regierungsprogramms i n die Arbeits- und Investitionsprogramme), die vom Kabinett für verbindlich erklärt wurden 1 2 1 , „langsam aber sicher" i n eine A r t „Zwangsjacke" zu stecken und so den Rahmen der Regierungsaufgaben maßgeblich festzulegen. Bei dieser Konzeption, die weitgehend den Landesbedürfnissen und der Landesverfassung entsprechen dürfte, ist gegenüber früher bemerkenswert, daß zu Lasten des Ressortprinzips das Kollegialelement (Vorbereitung durch Zentralstellenleiterkonferenz, Beschlußfassung durch das Kabinett) und natürlich besonders das Staatsministerium (Kanzlerprinzip) gewonnen haben. Das Staatsministerium ist dabei sicher zu keinem „Oberministerium", aber noch mehr als früher zu einem wirksamen aktiven Partner i m Koordinationsgeschäft, zu einer echten Koordinationszentrale, geworden 1 2 2 . Dies w i r d von Teilen einzelner Ministerien noch nicht v o l l akzeptiert. Gleichwohl sind Ansätze einer Frühkoordination erkennbar. Ein besonderer Mangel, der bereits wiederholt angedeutet wurde, ist abschließend zu dem bad.-württ. Programm- und Planungssystem, das sich nach Auffassung der Befragten und auch Außenstehender i m großen und ganzen zu bewähren scheint, noch besonders anzusprechen. Das Konzept der Rahmenplanungen, das bei der derzeitigen personellen und politischen Regierungszusammensetzung i m wesentlichen funktioniert, ist eben lediglich auf den Zeitraum von einer Legislaturperiode, meist sogar nur auf zwei bis drei Jahre konzipiert. Dies bedeutet, daß es faktisch keine über maximal vier Jahre hinausgehenden Basisplanun120 I n den letzten Jahren w u r d e der Reform der Ministerialorganisation insgesamt gesehen entschieden zu wenig Beachtung gewidmet. A m positivsten ist hierbei noch die Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien zu bewerten (vgl. oben § 20 Ziff. 3). Außerdem sind zu nennen: E i n f ü h r u n g des politischen Staatssekretärs (vgl. oben § 16 Ziff. 5), wenige Aufgaben Verlagerungen aus den Ministerien (Funktionalreform), Einrichtung von Zentralstellen i n einigen Ministerien (vgl. oben § 23 Ziff. 2) u n d die unmittelbar bevorstehende Einführung des politischen Beamten. 121 H i e r ist eine gewisse Skepsis angebracht; denn was verbindlich ist, kann j a der Ministerrat jederzeit wieder f ü r unverbindlich erklären (häufig beklagter Mangel!). 122 v g l dazu etwa K . König, i n : Verwaltungsarchiv 1971, S. 1 ff.; vgl. zum ganzen auch H. Karehnke, i n : D Ö V 1974, S. 46 ff.; K . König, i n : DVB1. 1975, S. 225 ff.
§ 24 Das Staatsministerium (Staatskanzlei)
251
gen gibt 1 2 3 . Folglich w i r d die Grundsatzplanungskonzeption durch jede Parlamentsneuwahl i n Frage gestellt und muß entsprechend der neuen Zusammensetzung des Kabinetts i n personeller, politischer und sachlicher Hinsicht größtenteils mehr oder weniger wieder neu ausgearbeitet und u. U. teilweise auch neu aufgebaut werden. Dieser Mangel, der in einer „Parteidemokratie" nicht zu beseitigen ist, muß durch geeignete längerfristigere Ziel- und Finanzperspektiven reduziert werden 1 2 4 . Zur Relativierung dieser Probleme muß schließlich aber nochmals darauf hingewiesen werden, daß die genannten Führungstätigkeiten (Richtlinienkompetenz, Grundsatzprogramme und Basisplanungen) das Staatsministerium insgesamt nur m i t ca. 1 0 % zeitlich belasten und deshalb als erster Schritt vor allem eine Ausweitung der Kapazität für mittel- und langfristige Tätigkeiten erfolgen sollte 1 2 5 . 7. Querschnittsfunktionen 126 Das oben dargestellte Planungssystem des Landes beinhaltet von den klassischen Querschnittsfunktionen i m wesentlichen nur die Finanzen (Haushalt). Darüber hinaus ist dort noch die Raumwirksamkeit (Raumordnung), die allerdings i n diesem Zusammenhang höchstens als „Querschnittsaspekt" angesehen werden kann, integriert 1 2 7 . Die Funktionen Personal und Organisation scheinen etwas vernachlässigt zu werden. Deshalb bedarf es hier noch eines kurzen Eingehens auf die Querschnittsaktivitäten des Staatsministeriums bezüglich der so wichtigen Bereiche Personal und Organisation, soweit es sich dabei nicht u m solche Tätigkeiten für das Staatsministerium selbst handelt 1 2 8 . Aufgrund der Beamtenernennungskompetenz des Ministerpräsidenten (Art. 51 LV) und der gemäß A r t . 49 I I L V geübten Praxis, daß bei 123
Eine gewisse Ausnahme stellt hier der Landesentwicklungsplan dar. Nach übereinstimmender Aussage der Befragten gibt es davon abgesehen längerfristigere Planungen lediglich vereinzelt i n Fachprogrammen. Vgl. etwa N. Luhmann, i n : Der Staat 1973, S. 13 f. 124 v g l dazu insbes. oben Fußnote 97, dritter Vorschlag. 125
Vgl. dazu oben Ziff. 4 (insbes. Fußnote 63 u n d 64). Eine gewisse E i n schränkung dieser Aussage ergibt sich hier allerdings wieder daraus, daß wegen der Kurzfristigkeit der Planungen sich diese nicht selten von den laufenden Aufgaben n u r schwer abgrenzen lassen. 126 Vgl. dazu oben § 5 Ziff. 3 u n d § 24 Ziff. 3. 127 Dazu soll nach Auffassung des Staatsministeriums noch der Querschnittsaspekt „Soziales" (Entwicklung v o n „Sozialindikatoren" i m Landessozialplan) kommen, was allerdings weniger m i t „Querschnitt" zu t u n haben dürfte, sondern eher eine Fachplanung darstellt. Vgl. i n : Der Spiegel Nr. 45/ 1973, S. 57; H. Bebermeyer, Regieren ohne Management?, S. 53; M. Huber, i n : PVS 1975, S. 153 ff. 128 vgl. dazu oben § 5 Ziff. 3 u n d K . König, Koordination u n d Regierungspolitik, i n : DVB1. 1975, S. 232 ff.; Projektgruppe Bay. IM, Reformbericht, S. 30 f.; Wibera, Gutachten H H , S. 141 ff.
252
Kap. I I I : Organisation und S t r u k t u r der Landesregierung B W
allen Ernennungen ab einschließlich Besoldungsgruppe B 3 das Kabinett zustimmt 1 2 9 , könnte man glauben, daß dem Regierungschef (Staatsministerium) i m Personalbereich eine starke Stellung zukommt. Die empirischen Erhebungen haben aber fast das Gegenteil gezeigt. Zwar ist die Staatskanzlei, so könnte man etwas vereinfachend sagen, quantitativ gesehen recht umfassend, i n qualitativer Hinsicht aber i m wesentlichen nur wenig an den Personalentscheidungen beteiligt. I n aller Regel werden sie in den betreffenden Ressorts selbst getroffen, so daß die Beteiligung des Ministerpräsidenten und auch des Kabinetts i m wesentlichen nur formaler A r t ist 1 3 0 . Bei den Befragungen wurden i n diesem Zusammenhang vor allem zwei Dinge bemängelt: Zum einen kommt es nur i n den seltensten Fällen vor, daß für Spitzenstellungen i n den Ministerien (vom Referatsleiter an aufwärts) von außerhalb des betreffenden Hauses jemand ernannt wird. Hierin dürfte, etwas überspitzt ausgedrückt, insgesamt gesehen eine alles andere als begrüßenswerte „Abkapselung" der Ressorts und bis zu einem gewissen Grad auch ein Grund für den Ressortegoismus und die immer wieder beklagte Immobilität mancher Ministerialbeamten liegen. Eine vernünftige, gezielte und systematisch geplante Rotation würde sicher recht nützlich sein 1 3 1 . Zum anderen wurde es als besonderer Mangel empfunden, daß es i n Bad.-Württ. keine längerfristigere Personalplanung gibt und viel zu wenig dafür getan w i r d 1 3 2 . Es wurden zwar einige allerdings meist verbale Anfänge gemacht 133 , die bisher aber meist i m Sande verliefen 1 3 4 . 129
Vgl. dazu eingehend oben § 14 Ziff. 1. Eine gewisse Ausnahme stellt die Ernennung der Zentralstellenleiter dar. Als Ausnahmefall k a n n etwa auch die Teilung der Hochschulabteilung i m K u l t u s m i n i s t e r i u m u n d die Ernennung eines Abteilungsleiters durch den Regierungschef angesehen werden; vgl. dazu etwa Stuttgarter Zeitung v o m 20.2.1973, S. 13. Insgesamt zeigt sich allerdings, daß j e stärker politische Überlegungen bei einer Stellenbesetzung eine Rolle spielen, desto größer der Einfluß des Staatsministeriums ist. 131 Vgl. dazu eingehend oben § 23 Ziff. 4; Studienkommission für die Reform des öffentlichen Dienstrechts, Bericht der Kommission, S. 211 f. Dasselbe g i l t i m Prinzip auch für die Fortbildung; vgl. dazu etwa: Fortbildung des höheren Verwaltungsdienstes, SHS Bd. 54. 132 Bezeichnend dafür sind etwa die Ausführungen dazu i n : Modell für die Zukunft, Bd. 1, S. 42 u n d S. 181 ff.; vgl. auch U. Becker, i n : Die V e r w a l t u n g 1970, S. 401 ff.; Ders., i n : Organisation der Ministerien des Bundes u n d der Länder, SHS Bd. 52, S. 101 ff.; Projektgruppe BMI, D r i t t e r Bericht, 1/30. Nach den Angaben einiger Befragter gilt dies oft sogar selbst f ü r die Wiederbesetzung von Spitzenpositionen! Mehrere Befragte meinten, daß „es nicht selten vorkommt, daß, w e n n morgen jemand pensioniert w i r d , m a n heute noch lange nicht weiß, w e r dessen Nachfolger w i r d " . 133 Vgl. etwa H. Filbinger (Regierungserklärung J u n i 1968), Landtagsprotokolle, 5. Wahlperiode, S. 20; Modell f ü r die Zukunft, Bd. 1, S. 42 f.; Arbeitsprogramm der Landesregierung (März 1974), S. 14. Vgl. neuerdings das G u t achten der Kommission f ü r die Prüfung des Personalbedarfs i n der staatlichen V e r w a l t u n g (Landtagsdrucksache VI/7829). 130
§ 24 Das Staatsministerium (Staatskanzlei)
253
Obwohl dem Ministerpräsidenten und dem Kabinett i m Rahmen der ihnen zustehenden Organisationsgewalt (vgl. oben § 17) erhebliche Kompetenzen zukommen, haben sich diese Organe i n den letzten Jahren nur ganz selten ernsthaft und effektiv m i t Problemen der Querschnittsfunktion „Organisation" beschäftigt 135 . Auch das Staatsministerium war m i t diesen Fragen lediglich soweit befaßt, als sie das Haus selbst betrafen. Die i n der Dienstordnung 1 3 6 vorgesehene interministerielle Arbeitsgemeinschaft der Organisationsreferenten tagt zwar sporadisch; sie war aber bis heute nicht i n der Lage effektive Arbeit zu leisten oder gar Anstöße zu geben bzw. Vorschläge zu unterbreiten. Schließlich ist auch die vom Innenminister i m Oktober 1973 eingesetzte Arbeitsgruppe „Innere Verwaltungsreform" für die i m Rahmen dieser Untersuchung interessierenden Organisationsprobleme nicht zuständig 1 3 7 . U m wenigstens i n diesen Fragen nicht unzureichend vorbereitet nach den nächsten Landtagswahlen dazustehen 138 , sollten umgehend umfassende Überlegungen über notwendige organisatorische Reformmaßnahmen i m Regierungsbereich möglichst auf interministerieller Basis unter Federführung des Staatsministeriums angestellt werden 1 3 9 . Bei der Aufstellung des Staatshaushaltsplans w i r k t die Staatskanzlei, abgesehen von dem Einzelplan 02 — Staatsministerium —, nicht mit; vielmehr liegt diese Aufgabe allein beim Finanzministerium. A l l e r dings kommt dem Staatsministerium i m Rahmen der Kabinettsbera134 Die Arbeit einer Kommission zur „Durchforstung" aller Personalstellen des Landes ist w o h l überwiegend aus Gründen des Ressortegoismus ohne durchgreifendes Ergebnis geblieben. 135 So wurde etwa bis heute noch keine Geschäftsordnung der Landesregierung erlassen; so hat sich das K a b i n e t t praktisch ohne Ergebnis mehrfach m i t der Frage beschäftigt, ob den Ministerialdirektoren der T i t e l Staatssekretär verliehen werden soll (dasselbe g i l t auch für die Verbesserung der Kabinettsarbeit). E i n Befragter meinte zur Gesamtproblematik, daß „eine wissenschaftliche Durchdringung der Organisation u n d ihrer Probleme v ö l l i g unterentwickelt sei". Vgl. dazu etwa B. Becker, i n : Organisation der Ministerien des Bundes u n d der Länder, SHS Bd. 52, S. 77 ff. m. w. N. 136 Dienstordnung der Landesregierung v o m 24.11.1970 (GABI. 1971, S. 1 ff.), Nr. 22 und 122 (Anhang 1 — Abs. 9). 137 Vgl. Innenministerium, Pressemitteilung Nr. 110/73 (vom 3.10.1973); J. Bischoff, i n : Stuttgarter Zeitung v o m 4.10.1973, S. 31; Stuttgarter Zeitung v o m 4.10.1973, S. 7; v o m 17. 4.1974, S. 13; v o m 9.10.1974, S. 6; Staatsanzeiger Bad.-Württ. v o m 6.10.1973, S. 1 u n d v o m 12.10.1974. 138 Die Erfahrung hat gezeigt, daß wesentlichere organisatorische Ä n d e r u n gen i n der Regel — w e n n überhaupt — eben n u r zu Beginn einer Legislaturperiode möglich sind (vgl. oben § 20 Ziff. 3). Dies erscheint u m so dringender, als ein Interviewter aussagte, daß zur Zeit i m Hinblick auf Organisation „nichts l ä u f t " und i m übrigen diese Dinge „sehr v i e l Zeit, Durchsetzungsvermögen u n d A u t o r i t ä t " voraussetzen würden. 139 Daran sollte zweckmäßigerweise auch der Rechnungshof beteiligt w e r den. I m übrigen ist es u. a. auch Sinn dieser Arbeit, hierzu Denkanstöße u n d Anregungen zu geben.
254
Kap. I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
tungen, insbesondere bei der Finanzplanung, den haushaltspolitischen Grundentscheidungen und bei der Prioritätensetzung, eine einflußreiche Stellung zu 1 4 0 . 8. Koordination u n d I n f o r m a t i o n 1 4 1
Die Koordination ist heute eines der meistdiskutierten und aktuellsten Probleme der Regierungs- und Verwaltungsreform (insbes. i m Hinblick auf aktive, positive und Frühkoordinationssysteme). U m sie kreisen eine Vielzahl von Versuchen, Planungsinstrumente zu finden, Aufgaben- und Finanzplanungssysteme einzuführen, die Kommunikation und vor allem den Informationsfluß i m Regierungsbereich zu verbessern und anderes mehr 1 4 2 . Infolge des technischen Fortschritts, der immer größer werdenden Komplexität und Vielschichtigkeit der gesellschaftlichen Zusammenhänge und damit auch der stetig steigenden Differenziertheit und Mehrfunktionalität der Staatsaufgaben, einschließlich der darin begründeten Interdependenzen, gesellschaftlichen, soziologischen und ökonomischen Verflechtungen sowie aufgrund der dadurch bedingten ständig wachsenden Arbeits- und Zuständigkeitsverteilung, der Funktionalisierung und Delegation, w i r d die Koordination immer wichtiger und der Koordinationsbedarf immer größer 1 4 3 . Durch die Notwendigkeit einer mittel- und langfristigen Planung w i r d dies, mindestens bis eine solche entwickelt ist, noch verstärkt. Das Koordinationsproblem, die Sicherung des „Einklangs" der gesamten Regierungspolitik und -arbeit ist deshalb „prinzipiell unaufhebbar" 1 4 4 . Es geht demnach vor allem darum, dieses Problem zu analysieren, zu systematisieren, zu aktivieren und teilweise zu institutionalisieren, es insgesamt also zu reduzieren. Dabei hat sich gezeigt, daß für die koordinierenden Stellen die Kommunikation, insbesondere der Informationsfluß (möglichst Informationsvorsprung), von so entscheidender Bedeutung und m i t der Koordination so eng verbunden ist, daß es notwendig ist, beide sekundäre Zielsetzungen gemeinsam darzustellen 145 . 140 Vgl. oben Ziff. 6. Dies hängt weitgehend damit zusammen, daß bei allen Angelegenheiten, die ins Kabinett kommen, der Einfluß des Staatsministeriums recht beachtlich ist (vgl. oben § 21 Ziff. 4 u n d 6). 141 Vgl. dazu oben § 5 Ziff. 3 m. w. N. Vgl. zur Gesamtproblematik außerdem vor allem F. Scharpf, Methoden der Problemstrukturierung: Positive Koordination i n der Langfristplanung (Aug. 1972); K . König, Koordination u n d Regierungspolitik, i n : DVB1. 1975, S. 225 ff. 142 T. Ellwein, Regierungssystem, S. 311 f. m. w . N.; R. Jochimsen, i n : B u l l e t i n 1970, S. 949 ff.; F. Scharpf, Planungsorganisation (Hrsg.: M a y n t z / Scharpf), S. 107 ff.; H. Bebermeyer, Regieren ohne Management?, S. 44 ff. 143 Vgl. K . König, Koordination u n d Regierungspolitik, i n : DVB1. 1975, S. 225 ff.; R. Wahl, i n : Der Staat 1974, S. 387, 394; K . von der Groeben, i n : Die V e r w a l t u n g 1968, S. 385 ff.; K . Stern, i n : Projektgruppe B M I , Erster Bericht, Anlagenband, S. 571 m. w. N. 144 F. Scharpf, Planungsorganisation (Hrsg. : Mayntz / Scharpf), S. 107.
§ 24 Das Staatsministerium (Staatskanzlei)
255
Institutionell obliegt die interministerielle Koordination weitgehend dem Ministerpräsidenten, der dafür auch die erforderliche verfassungsrechtliche „Koordinationskompetenz" besitzt 1 4 6 . Dabei ist das Staatsministerium das hauptsächlich dafür vorgesehene Führungsinstrument. Der Staatskanzlei kommt hier die Aufgabe zu, die gesamte Regierungsarbeit auf dem Weg der Koordination, durch gegenseitige, möglichst frühzeitige und teilweise auch aktive Abstimmung und Vermeidung von Störungen, von unten aus den Ressorts heraus nach oben zur Kabinettsreife zu bringen 1 4 7 . Bei der Untersuchung des Staatsministeriums i m Hinblick auf seine Koordinations- und Informationstätigkeiten ist zu unterscheiden zwischen denjenigen innerhalb des gesamten Regierungsbereichs — a) — und jenen innerhalb der Staatskanzlei selbst — b) —. a) Die Ausführungen oben § 21 haben gezeigt, daß einmal aufgrund seines praktizierten Arbeitsstils und seiner Größe (Mitgliederzahl) das Kabinett durchaus als funktionierendes Koordinationsorgan bezeichnet werden kann, das wichtige Koordinations- und Informationsaufgaben w a h r n i m m t 1 4 8 . Ergänzend dient dazu weiter eine zweite Ebene, die i n terministeriellen Gremien 1 4 9 . Die empirischen Erhebungen haben gezeigt, daß auf dieser Ebene vor allem die für bestimmte Probleme ad hoc vom Staatsministerium initiierten und unter seiner Federführung stehenden interministeriellen Ausschüsse dafür geeignet und effektiv sind. Als Gründe wurden hierbei u. a. größere Autorität, kein Ressortdenken, Vertreten der Gesamtinteressen und stärkere Initiative genannt. Neben dem Kabinett ist aber das Staatsministerium, unter Berücksichtigung des von ihm aufgebauten, i m gesamten Regierungsund Ministerialbereich bestehenden, recht umfassenden Kommunikations- und Kooperationsnetzes (-muster; „Kleiner Dienstweg", informelle Verbindungen usw.), das wichtigste Informations- und Koordinationsinstrument. Das Staatsministerium w i r d vor allem deshalb von den Ministerien weitgehend als „Koordinations- und Informationszen145 Dies ergaben die empirischen Erhebungen; vgl. auch F. Scharpf, i n : Projektgruppe B M I , Erster Bericht, Anlagenband, S. 278 ff.; T. Ellwein, i n : Die Staatskanzlei, SHS Bd. 34, S. 206; H. W. Rombach, ebenda, S. 273 ff. 146 Die interministerielle „Koordinationskompetenz" ist gem. A r t . 49 I S. 1 u n d I I L V auf das Kabinett, vor allem aber auf den Ministerpräsidenten verteilt (vgl. dazu eingehend oben § 12 Ziff. 5 und § 17). Die innerministerielle Koordination obliegt dem Minister. 147 Dies ist weitgehend das Ziel der Referenten des Staatsministeriums (vgl. oben Ziff. 4). Vgl. H. Bebermeyer, i n : Die Staatskanzlei, SHS Bd. 34, S. 222 (Diskussionsbeitrag); Projektgruppe BMI, Erster Bericht, S. 271 f.; F. Scharpf, ebenda, Anlagenband, S. 281 f. 148 Vgl. dazu oben § 21 Ziff. 6 (vgl. bes. die Statistik i n Fußnote 30) und § 23 Ziff. 7. 149 Dazu eingehend oben § 23 Ziff. 7.
256
Kap. I I I : Organisation und S t r u k t u r der Landesregierung B W
trale" akzeptiert, w e i l diese um die starke Stellung, die das Staatsministerium i m Entscheidungsprozeß des Kabinetts besitzt, wissen und demgemäß eine auf kooperativer Basis erfolgende, möglichst rechtzeitige aktive Koordination „notwendigerweise" mitmachen müssen 150 . I n Kenntnis dieser Tatsache versucht das Staatsministerium i n Ubereinstimmung m i t dem Kabinett auch durchaus, viele der sachlich und politisch wichtigen Angelegenheiten als „Ministerratssachen" zu deklarieren 1 5 1 . Das Kommunikations- und Kooperationsnetz ist, soweit mehr oder weniger informelle Querverbindungen überhaupt faßbar sind, von Seiten des Staatsministeriums etwa wie folgt ausgestaltet: Die umfassendsten Beziehungsmuster dürften naturgemäß von der Abteilung I I I — Landesangelegenheiten — aus bestehen. Die Erhebungen haben erkennen lassen, daß die einzelnen Beamten zu den wichtigsten Leuten des Ressorts, für das sie zuständig sind, mannigfaltige Kontakte und Verbindungen besitzen. Daneben haben aber auch die anderen Abteilungen (Abteilung I V insbes. zu den Beamten der Zentralstellen aller Ressorts, aber auch zu Partei, Fraktion, Verbänden usw.; Abteilung I I vor allem zu sämtlichen Bundesratsreferenten; Abteilung V I insbesondere zu allen Pressereferenten usw.) umfangreiche Beziehungen. Darüber hinaus ist noch ein nicht zu unterschätzendes, auf rein persönlicher Basis beruhendes Kommunikationsnetz mitzuberücksichtigen 1 5 2 . A l l das verschafft dem Staatsministerium die Grundlage für den zwischen ihm und den Fachressorts bestehenden gegenseitigen Verzahnungs- und Mitbeteiligungsprozeß, i n den auf kooperativer Grundlage und unter Beachtung der Gegenseitigkeit auch durchaus von Seiten der Staatskanzlei initiierend, anregend und koordinierend, also aktiv eingegriffen w i r d 1 5 3 . Hierbei ist besonders vom Staatsministerium aus darauf zu achten, daß die Ausgewogenheit zwischen Staatsminister i u m und Fachressorts sowie das Prinzip einer ständig attraktiven Gegenseitigkeit gewahrt bleibt. A u f Dauer gesehen w i r d die Rolle der Staatskanzlei i m Koordinationsprozeß entscheidend mit davon abhängen, inwieweit es ihr gelingt, i m interministeriellen Bereich für sich ein K l i m a der vertrauensvollen Zusammenarbeit zu schaffen und ob sie sich einer stärkeren Einmischung i n Ressortangelegenheiten enthalten kann 1 5 4 . A u f ein weiteres Problem ist in diesem Zusammenhang noch 150
Vgl. dazu eingehend oben § 23 Ziff. 7. Aus diesem Grund wurde etwa die Genehmigung aller Grundordnungsänderungen der Universitäten „kabinettspflichtig" gemacht. 152 Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, daß die gesamte Ministerialverwaltung wesentlich überschaubarer ist als etwa auf Bundesebene u n d die Mitarbeiter des Staatsministeriums i n aller Regel früher selbst i n einem Fachressort gearbeitet haben. 153 Vgl. etwa H. Bebermeyer, i n : Die Staatskanzlei, SHS Bd. 34, S. 222; K . König, Koordination und Regierungspolitik, i n : DVB1. 1975, S. 229 f. 151
§ 24 Das Staatsministerium (Staatskanzlei)
257
hinzuweisen: Während das vielfältige und vielschichtige Kommunikations- und Kooperationsmuster i m Hinblick auf die Informationsgewinnung äußerst wertvolle Dienste leistet und m i t zu dem meist vorhandenen Informationsvorsprung des Staatsministeriums beiträgt, birgt es bezüglich der Koordination auch durchaus ernst zu nehmende Gefahren i n sich. Die Erhebungen ergaben nämlich, daß es vorkommt, daß gleichzeitig auf verschiedenen parallel laufenden „Kanälen" zu derselben Frage teilweise sogar inhaltlich unterschiedliche Koordination betrieben w i r d 1 5 5 . M i t einer solchen Praxis erreicht man verständlicherweise nicht nur unnötige Doppelarbeit, sondern vor allem viel Ärger i n den betreffenden Ressorts. Eine wichtige Aufgabe, auf die noch näher einzugehen sein wird, ist es, dies zu vermeiden. Insgesamt kann festgestellt werden, daß das Staatsministerium i m großen und ganzen, nicht zuletzt aufgrund seiner Zuordnung zum Ministerpräsidenten und zum Kabinett, i n der Lage ist, die für den ganzen Regierungsbereich erforderlichen tagespolitischen Koordinations- und Informationsleistungen 150 zu erbringen und dies zusammen mit den anderen Instrumenten auch weitgehend erfüllt. Dabei w i r d die Koordination nicht nur m i t dem Ziel betrieben, gegenseitige Störungen zwischen den Ressorts zu vermeiden, sondern versucht, „die Ressorts auf höhere gemeinsamen Ziele (Regierungsprogramm, Grundsatzplanungen) h i n zu integrieren", also eine positive und soweit notwendig auch aktive Koordination zu gewährleisten 1 5 7 . Da aber die Koordination ganz überwiegend tags- oder regierungsprogrammbezogen (in der Regel 2 bis 3 Jahre) ist, kann von einer effektiven Integration i m Hinblick auf längerfristigere Planungen und von einer wirkungsvollen Frühkoordination noch nicht gesprochen werden. Zudem scheinen i n Bad.-Württ. i m Rahmen der Koordinations- und Informationsmöglichkeiten (System) die Querschnittsfunktionen mit Ressourcencharakter 154 Letzteres wurde bereits wiederholt erwähnt u n d bei den Befragungen immer wieder geäußert u n d beklagt. U m Rückschläge zu vermeiden, sollte dies, von dringenden Ausnahmefällen abgesehen, abgestellt werden. 155 Dies kann etwa vorkommen, wenn zum selben Problem zwischen der Abt. I I I u n d dem zuständigen Ressortreferenten einerseits u n d zwischen der Abt. I V u n d dem Zentralstellenleiter andererseits etwas inhaltlich verschiedenes verabredet wurde. 156 Z u dem gegenwärtigen Stand des Aufbaus eines Informationssystems vgl. das v o m Staatsministerium i m F r ü h j a h r 1974 herausgegebene „ G r o b konzept für ein Informationssystem B a d . - W ü r t t . " ; Staatsanzeiger Bad.-Württ. vom 31.7.1974; vgl. aber auch bes. die Vorstellungen des Stat. Landesamts zum A u f b a u eines Informationssystems i n Bad.-Württ. v o m 31. 3.1971. Z u r Informationsarbeit der Landesregierung insbes. Landespressestelle vgl. Pressemitteilung der Landespressestelle Nr. 561/72 m i t Anlage. Ergänzt w i r d dies durch die i m Rahmen der Haushaltsaufstellung erfolgte Koordination des Finanzministeriums. 157 Vgl. dazu Projektgruppe BMI, Erster Bericht, S. 271 f.; K . König, i n : Verwaltungsarchiv 1971, S. 1 ff.
17 K a t z
258
Kap. I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
praktisch noch nicht entdeckt zu sein 1 5 8 . Abschließend ist hierzu noch darauf hinzuweisen, daß das Problem der Koordination, wie überhaupt der Führung, nicht durch Reformen und ausgeklügelte Techniken allein zu lösen ist. I m Mittelpunkt bleibt stets als Motor der Mensch, hier der Regierungschef und seine engsten Mitarbeiter, der entsprechend seinen oft recht unterschiedlichen Fähigkeiten den Koordinations- und W i l lensbildungsprozeß vorantreibt und mehr oder weniger erfolgreich auf einen Konsensus der verschiedenen Meinungen hinarbeitet 1 5 9 . b) Die Grundstruktur des innerhalb des Staatsministeriums bestehenden Koordinations- und Informationsmusters ist von dem grundsätzlich auch dort geltenden Hierarchieprinzip geprägt 1 6 0 . Dies bedeutet, daß i n der Staatskanzlei die vertikalen Kommunikationswege und die innerhalb der Linie erforderliche Koordination i m wesentlichen gut funktionieren 1 6 1 . Gleichwohl können aber aufgrund der Komplexität, Vielschichtigkeit und Mehrfunktinonalität der vom Staatsministerium wahrzunehmenden primären und sekundären Zielsetzungen (etwa besondere Bedeutung der Koordination und Information) sowie der inneren Organisation und Geschäftsverteilung die vertikalen Kanäle allein keinesfalls ausreichen. Vielmehr bedarf es vor allem zu einer einheitlichen, effektiven Koordination umfassender horizontaler Querverbindungen zwischen den Abteilungen u n d überhaupt den m i t einer bestimmten Angelegenheit irgendwie befaßten Mitarbeitern des Staatsministeriums. Die besondere Notwendigkeit solcher kommunikativer und kooperativer Querverflechtungen ergibt sich anschaulich aus folgendem Beispiel: I n den letzten Jahren sind etwa die Berufsbildung und der Umweltschutz neue Schwerpunkte der Landespolitik geworden. I n der Staatskanzlei ist für die Bearbeitung dieser Aufgaben grundsätzlich die Abteilung I I I — Landesangelegenheiten — zuständig. Da diese Aufgaben aber oft Grundsatzcharakter haben und weitgehend m i t den entsprechenden bundespolitischen Angelegenheiten identisch sind, müssen sich zwangsläufig auch die Abteilungen I V und I I m i t diesen Problemen eingehend beschäftigen. Hinzu kommt noch, daß auch die Abteilung V I sich m i t diesen Dingen und zwar nicht nur rein publizistisch, sondern nicht selten auch inhaltlich (anregend, initiierend, Bedenken äußernd usw.) auseinandersetzt 162 . A u f dem Hintergrund der
iss v g L z u dieser Möglichkeit insbes. K. König, Koordination u n d Regierungspolitik, i n : DVB1. 1975, S. 232 ff. 169 Vgl. etwa S. Schöne, V o n der Reichskanzlei zum Bundeskanzleramt, S. 229. 160 y g L etwa E. Laux, i n : A k t u e l l e Probleme der Ministerialorganisation, SHS Bd. 48, S. 317 ff.; R. Schnur, i n : Demokratie u n d Verwaltung, SHS Bd. 50, S. 557 ff. 161
Darauf w i r d unten Ziff. 11 noch näher einzugehen sein.
§ 24 Das Staatsministerium (Staatskanzlei)
259
bestehenden organisatorischen Gliederung des Staatsministeriums w i r d evident, wie wichtig ein umfassendes, vertikales und horizontales, möglichst institutionalisiertes innerbehördliches Informations- und Koordinationsmuster ist. Die gegenwärtige Praxis dazu dürfte unzureichend sein. Das für koordinierendes Handeln zur Verfügung stehende traditionelle Instrumentarium, wie das der Mitzeichnung, des Einvernehmens usw. 1 6 3 ist keinesfalls, insbesondere nicht für grundsätzliche oder längerfristige Dinge, genügend. Auch die, abgesehen von den regelmäßig stattfindenden Abteilungsbesprechungen (wöchentlich oder nach Bedarf), allein offiziell institutionalisierten Kabinettsvorbesprechungen 1 6 4 vermögen hierbei höchstens echte Konfliktsfälle beizulegen. Neben den informellen Kontakten zwischen den Mitarbeitern untereinander dürften aber zur Bewältigung der innerbehördlichen Kooperation und Koordination sowie der gegenseitigen Information die i n der Regel wöchentlich stattfindenden „informellen, zwanglosen Gespräche" der Leiter der Abteilungen II, I I I , I V und V I 1 6 5 besonders geeignet und von Wichtigkeit sein. Die Abteilungsleiter sind sich durchaus i m klaren, daß eine effektive, erfolgreiche Arbeit des Staatsministeriums u. a. nur dann möglich ist, wenn alle Mitarbeiter umfassend informiert sind und vor allem nach außen eine einheitliche Auffassung vertreten wird. Dies scheint auf Abteilungsleiterebene i m wesentlichen auch zu funktionieren, läßt aber insgesamt gesehen, vor allem auf Referentenebene, noch erhebliche Wünsche offen. Die vielen geführten Interviews haben ergeben, daß von praktisch allen Mitarbeitern eine Verbesserung der gegenseitigen Information, Kooperation und Koordination zwischen den Abteilungen für notwendig gehalten wird. Denn es w i r d nicht selten aneinander vorbei oder doppelt gearbeitet und mitunter zu wenig konsultiert und informiert 1 6 6 . Dazu kommt noch, was durchaus menschlich ist, daß alle für bestimmte Dinge zuständigen Referenten gewisser162 Dies ergaben die empirischen Erhebungen eindeutig. Ä h n l i c h gelagerte Beispiele könnten dafür ohne Schwierigkeiten genannt werden (z. B. A u s länderfragen, Steuerreform usw.). 163 Hier ist etwa noch die lfd. Unterrichtung der A b t e i l u n g V I („Mehrfertigung an die Pressestelle") zu nennen. 164 Diese finden vor jeder Kabinettssitzung statt. Sie haben insbes. den Zweck, den Ministerpräsidenten abschließend u n d umfassend zu informieren u n d noch unklare, schwierige Fragen zu koordinieren. A n der Besprechung nehmen teil: Ministerpräsident, Staatssekretär, Ministerialdirektor, alle Abteilungsleiter m i t Ausnahme der A b t e i l u n g V, ggf. werden zu einzelnen Punkten die betreffenden Referenten zugezogen. 185 E. Konnerth schreibt i n den Stuttgarter Nachrichten v o m 20.6.1974, daß die Leiter dieser wichtigsten Abteilungen zum engsten Beraterkreis u n d Braintrust des Ministerpräsidenten gehören. Vgl. auch Stuttgarter Nachrichten v o m 15. 9.1973. 166 Neben der Geschäftsverteilung, die dies verstärkt, ist sicher z. T. die zeitliche Überbelastung der Mitarbeiter der Staatskanzlei eine Ursache dafür.
17*
260
Kap. I I I : Organisation und S t r u k t u r der Landesregierung B W
maßen i n einem „Konkurrenzkampf" stehen, der, wenn er von Mitarbeitern aus drei oder gar vier verschiedenen Abteilungen geführt wird, letztlich nur auf Kosten umfassender Information, Kooperation und Koordination gehen kann. Hier bedarf noch manches der Verbesserung. I m Zusammenhang mit der Organisation des Staatsministeriums w i r d darauf nochmals zurückzukommen sein. Abschließend sei noch kurz auf die Dokumentations- u n d Informationslage und die diesbezüglich bestehenden Bedürfnisse für die Staatskanzlei selbst hingewiesen. Das gegenwärtige B i l d zeigt, daß hier beachtliche Lücken bestehen 167 . Man ist allerdings zur Zeit dabei, abgesehen von den Arbeiten an einem allgemeinen Informationssystem für Bad.-Württ., i m Staatsministerium eine eigene Dokumentationsstelle für dessen besondere Bedürfnisse einzurichten. c) Zur Abrundung und zur Verdeutlichung des Stellenwerts der Koordination und Information i m Rahmen der Gesamttätigkeit des Staatsministeriums ist noch auf die Übersichten 1 und 2 und auf die nachfolgende Übersicht 4 hinzuweisen. I m Hinblick auf die zeitliche Belastung dürften diese sekundären Zielsetzungen an der zur Verfügung stehenden Gesamtkapazität einen Zeitaufwand von ca. 20 - 30 °/o beanspruchen 168 . Daß dabei aber selbst bei größeren Gesetzgebungs-, Programm- und Planungsvorhaben insgesamt gesehen der Einfluß der Staatskanzlei schon auch aus personellen Kapazitätsgründen i m Hinblick auf die Koordinationsfunktionen nicht zu groß und einflußreich ist, dürften die statistischen Ergebnisse der gegenüberstehenden Übersicht 4 (S. 261) zeigen. 9. Kontrolle und Rückkoppelung169 Die hier i n Betracht kommenden überwachenden und überprüfenden Tätigkeiten können und sollen hier nicht umfassend aufgezeigt werden. Einige Aspekte scheinen aber interessant genug zu sein, hier kurz dargestellt zu werden: Die angestellten Untersuchungen haben ergeben, daß das Staatsministerium weitgehend i n der Lage ist, die Durchführung des Regierungsprogramms sowie der von der Landesregierung verabschiedeten 167 Diese Aussagen w u r d e n durch die Interviews überwiegend bestätigt. Vgl. auch Landespressestelle, Pressemitteilung 561/72 (vom 18.10.1972); A k t e n v e r m e r k über die Errichtung einer Dokumentationsstelle v o m 6.12.1973. 168 Dies ergab sich bei den durchgeführten Interviews; die Z a h l dürfte auch i m wesentlichen durch die Übersicht 1 bestätigt werden (der größte T e i l von Buchstabe a zuzüglich jeweils eines gewissen Anteils von Buchstabe b, c u n d f). 169 Vgl. dazu oben § 5 Ziff. 3; Projektgruppe BMI, Erster Bericht, S. 189 f., 2351; Wibera, Gutachten H H , S. 27 f.; H. Karehnke, i n : VerwArch. 1975, S. 47 ff.
§ 24 Das Staatsministerium (Staatskanzlei)
261
Übersicht 4
Größere Gesetzgebungs-, Programm- und Planungsvorhaben Wie groß ist/war bei der Bewältigung dieser Vorhaben i m Durchschnitt Ihre zeitliche Belastung durch (grobe prozentuale Schätzung; Beteiligungen an atypischen Vorhaben sollten nicht berücksichtigt werden) Abt. I Abt. I I Abt. I I I A b t . I V Vo °/o °/o Vo
0
°/o
a) einfache koordinierende T ä t i g keit u n d Konfliktsregelung z w i schen einzelnen Ministerien . . . .
21
46
22
30
30
b) inhaltlich fachliche Mitarbeit bei fremder Federführung
22
20
33
25
25
c) inhaltlich fachliche tung unter eigener rung
53
14
31
34
33
3
3
1
AusarbeiFederfüh-
d) Unterrichtung u n d Diskussion m i t dem Landtag u n d den Parteien e) dto. m i t Verbänden, Organisationen, Bürgerinitiativen usw.
2
10
8
4
6
f) Vorhabenbezogene keitsarbeit
2
4
2
5
3
6
1
g) Sonstige Tätigkeiten
Öffentlich-
—
—
2
detaillierten Arbeits- und Investitionsprogramme zu überwachen und damit auch in der Regel zu gewährleisten. Diese von der Staatskanzlei wahrgenommenen Überwachungs- und Kontrollfunktionen erfolgen allerdings i m wesentlichen nur hinsichtlich der Einhaltung der vor allem i m Arbeitsprogramm festgelegten Termine und der grundsätzlichen Beachtung der bestehenden Basisplanungen. Die Kontrolle geht also etwas weiter als nur die verwaltungsmäßige Ausführung beschlossener Maßnahmen zu überwachen (Ablaufkontrolle). Eine Kontrolle, ob mit diesen Maßnahmen auch der damit verfolgte politische und sachliche Zweck tatsächlich erreicht wurde (permanente ergebnisorientierte Erfolgs- und Effektivitätskontrolle, Soll-Ist-Vergleich i m feedback, Rückkoppelung), wird, von wenigen Einzelfällen abgesehen 170 , aber nicht durchgeführt. Interessant ist i n diesem Zusammenhang, daß etwa der Rechnungshof u. a. gerügt hat, daß von der Regierung die i n der Landeshaushaltsordnung vorgeschriebenen Kosten-Nutzen-Analysen für Maßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung bisher noch i n keinem Fall vorgelegt wurden 1 7 1 . 170 Diese Einzelfälle sind dann noch meist von der Presse, Opposition usw. aufgegriffen worden.
262
Kap. I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
10. Aspekte des Entscheidungsprozesses172 Die Entscheidungsfindung i n einem Regierungssystem und innerhalb eines Staatsministeriums als dessen Teilsystem stellt einen äußerst komplexen, nur teilweise institutionalisierten Prozeß dar, deren Ergebnisse von den verschiedensten Fakten, Wert- und Normvorstellungen beeinflußt werden. Dabei ist die Qualität dieser Ergebnisse einerseits wesentlich bestimmt durch die Fähigkeiten der Behördenmitglieder bzw. Entscheidungsträger und andererseits von der Struktur und Organisation der Behörde (System) abhängig, d. h. von den Kommunikations- und Kooperationsmustern, von den Festlegungen i n Geschäftsordnungen und Geschäftsverteilungsplänen, vom allgemeinen Geschäftsgang und anderem mehr 1 7 3 . Der gesamte Entscheidungsprozeß kann zwar theoretisch durchaus i n verschieden logisch aufeinanderfolgende Phasen zerlegt werden 1 7 4 ; i m Rahmen der durchgeführten empirischen Untersuchungen 175 konnten allerdings solche einzelnen Phasen oder Stufen, die es zugelassen hätten, wenigstens einigermaßen empirisch belegbare getrennte Aussagen zu machen, nicht festgestellt werden 1 7 6 . A u f eine „Zerlegung" des Entscheidungsprozesses mußte deshalb verzichtet werden. Die vorgenommenen Erhebungen — soviel kann schon vorweg gesagt werden — dürften insgesamt gesehen den Schluß zulassen, daß das Zustandekommen der Regierungsentscheidungen als ein Prozeß zu verstehen ist, der grob als eine Verbindung aus dem technokratischen und dem pragmatischen Entscheidungsmodell bezeichnet werden kann 1 7 7 . Während sich der Entscheidungsprozeß bei fachlichen Angelegenheiten mehr dem ersten Modell annähert, steht bei politischen und öffentlich171 Siehe § 6 I I H G r G u n d § 7 I I L H H O . Vgl. Stuttgarter Zeitung v o m 27.10. 1974, S. 12 (mit weiteren Mängelrügen des Rechnungshofs); außerdem S t u t t garter Zeitung v o m 26. 9.1974, S. 5. 172 Vgl. dazu bereits oben § 5 Ziff. 3 u n d §§ 20 u n d 21. 173 Vgl. dazu allgemein: W. Pippke, i n : B r i n k m a n n / Pippke / Rippe, Die Tätigkeitsfelder des höheren Verwaltungsdienstes, S. 2761; Projektgruppe BMI, Erster Bericht, S. 223 f.; G. Kirsch, i n : ebenda, Anlagenband, S. 461 ff.; Wibera, Gutachten H H , S. 34 ff.; F. Naschold, Systemsteuerung, S. 30 ff. m. w. N.; ff. Schatz, Der Parlamentarische Entscheidungsprozeß, S. 5 ff. m. w . N.; vgl. auch N. Luhmann, i n : Der Staat 1973, S. 9 f. 174 So etwa T. Ellwein, Einführung i n die Regierungs- u n d Verwaltungslehre, S. 145 ff.; W. Pippke, i n : B r i n k m a n n / P i p p k e / R i p p e , S. 281 ff.; J. Hirsch, i n : Politikwissenschaft (Hrsg.: Kress / Senghaas), S. 278 f. 175 Neben den durchgeführten Interviews w u r d e n dazu noch zusätzlich mehrere Fallstudien anhand von abgeschlossenen A k t e n durchgeführt (vgl. dazu i m einzelnen oben § 19 Fußnote 4). 176 Hierzu müßten noch weitere, konkrete Untersuchungen angestellt w e r den. 177 Vgl. dazu J. Kölble, i n : DÖV 1969, S. 37 f. u n d T. Ellwein, Regierungssystem, S. 387 jeweils m. w. N. (im Anschluß an J. Habermas).
263
§ 24 Das Staatsministerium (Staatskanzlei)
keitswirksamen Dingen die wechselseitige Befruchtung und Anregung, die pragmatische Theorie, i m Vordergrund. I m folgenden soll der Entscheidungsprozeß i m Staatsministerium gewissermaßen beispielhaft noch i n zwei Richtungen (Teilbereichen) etwas näher operationalisiert bzw. beschrieben werden. Dazu sollen die Ergebnisse zu Frage 5 des schriftlichen Fragebogens (vgl. Anlage Nr. 3) und der gewöhnliche A b lauf in der Ausarbeitung der Regierungserklärungen als besonders wichtige Beispiele dargestellt und anschließend vorsichtig analysiert werden. Die Auswertung der Frage nach den Orientierungsleitlinien bei überwiegend programmatischen Tätigkeiten ergab i m Staatsministerium folgendes B i l d 1 7 8 : Übersicht 5
Orientierungsleitlinien Woran orientieren Sie sich bei der Ausarbeitung bzw. M i t a r b e i t an Rechtsnormen, Programmen u n d Plänen Abt. I A b t . I I A b t . I I I A b t . I V °/o o/o °/o °/o
0 %
a) an ins Einzelne gehende W e i sungen oder Richtlinien der L e i t u n g des StaMi (MP, StSekr., MD, Abtleiter)
8
15
12
21
14
b) an bestehende allg. Programme (Regierungs- u n d Fachprogramme) u n d Grundsätze
10
5
16
18
12
c) an vermutetem W i l l e n bzw. Meinung des M P u n d Kabinetts
12
15«
16
10
13
d) an fachlichen u n d Notwendigkeiten
sachlichen
24
23
21
24
23
e) Orientierung an eigenen V o r stellungen
19
8
15
14
14
f) Orientierung an externen G r u p pen
—
3
6
2
—
g) Orientierung an Regierungspartei (Landtagsmehrheit)
2
8
8
7
6
h) Orientierung an B u n d oder anderen Ländern
20
18
5
6
12
i) andere Anhalts- u n d Orientierungspunkte
5
5
1
178
—
3
Diese Ergebnisse w u r d e n auch durch alle übrigen empirischen Erhebungen v o l l bestätigt (vgl. oben Fußnote 175).
264
Kap. I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
Der Entscheidungsprozeß bei der Aufstellung und Ausformulierung der Regierungserklärungen 179 kann nur soweit beschrieben werden, wie er einigermaßen institutionalisiert ist. Insoweit sind, da eben viele informelle Kanäle nicht nachvollzogen werden konnten, bei der Analyse des Prozesses gewisse Vorbehalte anzubringen. Normalerweise werden rechtzeitig vor der Abgabe einer Regierungserklärung von der Abteilung IV, in deren Händen federführend die gesamte Vorbereitung liegt, die einzelnen Fachressorts sowie die anderen Abteilungen der Staatskanzlei gebeten, ihre Vorstellungen und Wünsche aus ihrem Geschäftsbereich für das Regierungsprogramm mitzuteilen 1 8 0 . Daraus wird, zusammen m i t den von allen Seiten stammenden, beim Staatsministerium (Abt. IV) gesammelten Anregungen und Vorschlägen, von dem zuständigen Referenten der Abteilung I V ein erster Rohentwurf angefertigt. I n einem sich daran anschließenden intensiven Überarbeitungs- und Gesprächsprozeß, an dem sich neben dem Ministerpräsidenten i m wesentlichen die Leiter der Abteilungen II, I I I , IV, V I und zum Teil auch der Ministerialdirektor und der politische Staatssekretär beteiligen 1 8 1 , w i r d die endgültige Fassung der Regierungserklärung festgelegt (also weitgehend durch Teamarbeit innerhalb der Staatskanzlei). Dem Kabinett w i r d die endgültige Fassung kurz vor ihrer Abgabe i n der Regel noch bekanntgegeben, wobei der Ministerrat die Regierungserklärung insgesamt zwar noch behandelt, aber aus Zeitknappheit praktisch oft ohne gründliche Beratung nur formell billigt. Die Analyse der regierungsrelevanten Vorgänge zeigt, daß das tatsächliche Schwergewicht i m Rahmen des politischen Entscheidungsprozesses i m Bereich der Ministerialverwaltung liegt. Die Entscheidungsvorbereitung, vor allem die weitgehend den Ministerien zukommende Aufgabe der Auswahl der regelungsbedürftigen Materien, das Ausklammern von echten Entscheidungsalternativen 182 und die Festlegung des Entscheidungsvorschlags verleihen der Ministerialverwaltung zusammen mit ihrem gebündelten Sachverstand und ihren meist umfassenden Informationen eine höchst einflußreiche Stellung. Da aber die Verwaltung insgesamt gesehen in ihren Handlungen und Maßnahmen in 179 Z u r Regierungserklärung vgl. bereits oben Ziff. 5. 180 Von Seiten der Ressorts w i r d dies meist von den Zentralstellenleitern zusammengestellt. I n den Abteilungen der Staatskanzlei nehmen diese A u f gabe die Abteilungsleiter (Abteilungsbesprechungen) wahr. 181 Vgl. dazu oben Fußnote 165, insbes. K . Konnerth, i n : Stuttgarter Nachrichten v o m 20. 6.1974. V o n außerhalb des Staatsministeriums dürfte, abgesehen von einzelnen Regierungsmitgliedern, i m wesentlichen n u r L. Späth (Fraktionsvorsitzender der CDU) einen gewissen inhaltlichen Einfluß haben. 182 Echte Alternativvorschläge werden n u r i n den seltensten Fällen bis zur Entscheidungsreife eines Problems mitverfolgt (so die ganz überwiegende Z a h l der dazu gemachten Äußerungen). Vgl. insbes. T. Ellwein, Regierungssystem, S. 336.
§ 24 Das Staatsministerium (Staatskanzlei)
265
großem Umfang unabhängig, autonom sein dürfte, also sicher weit weniger als auf Bundesebene von außerstaatlichen Organisationen und Machtgruppen und auch nicht besonders stark von der Regierungsfraktion und -partei beeinflußt w i r d 1 8 3 , muß dies nicht notwendigerweise ein negatives und unbedingt zu beseitigendes Faktum sein. Entsprechend den landespolitischen Besonderheiten könnte dies durch höhere Transparenz seitens der Verwaltung und Regierung und verbesserter Kontrolle auch seitens des Landtags teilweise ausgeglichen werden. Trotzdem bleibt mindestens der Umfang hinsichtlich der nur gering verwirklichten Forderung nach dem „Primat der Politik" i m Regierungsbereich und außerdem eine gewisse Neigung zur Verselbständigung der Ministerialbürokratie gegenüber speziell dem politischparlamentarischen Raum einschließlich dessen Zielvorgaben bedenklich 1 8 4 . Die wesentlichsten Gründe für diese Entwicklung dürften neben den Unterschieden i n der Regierungs- und Verwaltungsarbeit des Bundes und der Länder in der nach wie vor i n Bad.-Württ. ganz überwiegend gelebten parteipolitischen Neutralität der Beamten 1 8 5 , i n der Struktur und Qualität des Landtags 1 8 6 , i n dem Fehlen von programmatischen Aussagen der Parteien auf fast allen landespolitischen Bereichen und i n dem Verhältnis Regierung/Parlament 1 8 7 zu suchen sein 1 8 8 . 11. Organisation der Staatskanzlei Die Organisation und Geschäftsverteilung des Staatsministeriums wurde i n den wesentlichen Zügen bereits dargestellt 1 8 9 . Da der allge183 Dies hängt teilweise unmittelbar m i t der i m Vergleich zum B u n d etwas anders gelagerten Aufgabenstellung zusammen (vgl. oben § 7). 184 v g l dazu i m einzelnen die für sich selbst sprechenden Zahlen i n der Übersicht 5. Die Orientierungsleitlinien i n Buchstaben d u n d e machen bereits fast 40 °/o aus! 185
§25.
Vgl. eingehend oben § 21 Ziff. 6 (Fußnote 34), § 23 Ziff. 3, 4 und unten
186 Die Parlamentarier sind ganz überwiegend Abgeordnete n u r i m Nebenberuf. Der Landtag ist nicht i n der Lage, echte Zielvorgaben usw. zu erarbeiten. A u f die hier angesprochene Problematik w i r d noch unten einzugehen sein (§ 25). 187 Die bad.-württ. Landesregierung versteht sich noch mehr als Teil der Exekutive als etwa die Bundesregierung. V o n einem Abgehen v o m klassischen Gewaltenteilungsprinzip h i n zu der neuen Polarisierung i n Regierung und Opposition ist i n Bad.-Württ. erheblich weniger zu spüren. Vgl. dazu unten § 25. 188 I m Rahmen dieser A r b e i t können diese höchst interessanten u n d äußerst wichtigen Probleme nicht eingehender dargestellt u n d analysiert werden (vgl. allerdings noch unten § 25). Für die Beantwortung dieser Fragen müßte eine speziell dazu vorgenommene Untersuchung angestellt werden. Z u einigen Lösungsansätzen vgl. aber auch bereits oben § 21 Ziff. 6 u n d § 23 Ziff. 2 dieser Arbeit. 180 Vgl. insbesondere oben Ziff. 2 aber auch die übrigen Ausführungen.
266
Kap. I I I : Organisation und S t r u k t u r der Landesregierung B W
meine Geschäftsgang, Arbeitsablauf und Dienstbetrieb i n der Staatskanzlei i m großen und ganzen keine Besonderheiten gegenüber den allgemeinen Regeln und der Praxis i n der gesamten Ministerialverwaltung aufweist 1 9 0 und darüber hinaus die konkrete Ausgestaltung dieser Dinge nach den vorgenommenen Erhebungen sehr stark von den einzelnen Personen, den „Akteuren", abhängt bzw. auf diese zugeschnitten w i r d 1 9 1 , also relativ kurzlebig und recht flexibel ist, scheint es i m Rahmen dieser Arbeit grundsätzlich nicht notwendig zu sein, über das bereits Gesagte hinaus die betreffenden Einzelheiten umfassend zu beschreiben. A u f einige Punkte, die die Thematik der vorliegenden Arbeit tangieren, muß allerdings noch eingegangen werden. Oben Ziff. 8 wurde bereits dargelegt, daß der Staatskanzlei als Grundstruktur das Hierarchieprinzip zugrunde liegt. Dies bedeutet nun aber keinesfalls, daß alles streng nach den Grundsätzen einer hierarchisch strukturierten Linienorganisation abläuft 1 9 2 . Vielmehr ist man prinzipiell bemüht, entsprechend den für eine effektive Arbeit des Staatsministeriums speziell erforderlichen Bedürfnissen, ein relativ flexibles „Stab-Linien-System" oder wie es die meisten Befragten bezeichneten, „ein hierarchisches Gliederungsprinzip m i t starken Stabsund Kollegialelementen" für die Organisation der Staatskanzlei zur Verfügung zu stellen 1 9 3 . Die Grundstruktur des Staatsministeriums 194 sieht so aus, daß den sechs Abteilungen insgesamt vierunddreißig Referate zugeordnet sind 190 Y g i dazu: Probleme der Ministerialorganisation, SHS Bd. 48; Organisation der Ministerien des Bundes u n d der Länder, SHS Bd. 52. 191 M a n k a n n sagen, daß praktisch jeder personelle Wechsel organisatorische Veränderungen nach sich zieht. Durch die dadurch praktisch i n s t i t u tionalisierte laufende Überprüfung w i r d i n der Staatskanzlei eine positiv zu bewertende gewisse M o b i l i t ä t u n d Elastizität erreicht. Der allgemeine Geschäftsgang, Arbeitsablauf u n d Dienstbetrieb werden gegenwärtig neben der Person des Ministerpräsidenten u n d dem Ministerialdirektor w o h l besonders stark von den einzelnen Abteilungsleitern (insbes. I I , I I I , I V u n d VI) geprägt. 192 vgL y Ellwein, Einführung i n die Regierungs- u n d Verwaltungslehre, S. 179 ff.; E. Laux, i n : Probleme der Ministerialorganisation, SHS Bd. 48, S. 319 f. 193 Vgl. allgemein dazu: G. Kunze, i n : Die Staatskanzlei, SHS Bd. 34, S. 103f.; E. Laux, Teamarbeit i m Verwaltungsbereich, i n : AWV-Fachbericht 9, S. 8 ff.; E. Guilleaume, i n : Der Staat 1965, S. 192 ff.; M. Dullien, Flexible Organisation, S. 11 ff.; R. Schnur, i n : Demokratie u n d Verwaltung, SHS Bd. 50, S. 557 ff. 194 Interessant wäre es, an dieser Stelle einen Organisationsvergleich der verschiedenen Staatskanzleien der Länder anzustellen. Da allerdings die Geschäftsverteilungs- u n d Organisationspläne einiger Staatskanzleien nicht zugänglich waren, aber auch w e i l die Größe u n d die Aufgaben (insbes. zusätzl. „Ressortaufgaben") stark differieren u n d die Spannweite der Gliederungsstrukturen ganz erheblich ist (bereits ein „unvollkommener" Vergleich zeigt außerordentlich große Unterschiede), w a r dies i m Rahmen der Arbeit nicht möglich. Gleichwohl wurden die dem Verfasser zugänglichen Organi-
§ 24 Das Staatsministerium (Staatskanzlei)
267
(je A b t e i l u n g 3 bis 8 Referate). Jedes R e f e r a t besteht aus e i n e m Referenten 195. Unterabteilungen, Gruppen, Hilfsreferenten usw. kennt m a n i n d e r b a d . - w ü r t t . S t a a t s k a n z l e i n i c h t . D a auch d u r c h die sich e i n g e b ü r gerte P r a x i s , nach der die A b t e i l u n g s l e i t e r u n d i m P r i n z i p auch die R e f e r e n t e n u n m i t t e l b a r e n Z u g a n g z u m Regierungschef h a b e n 1 9 6 , so w e n i g w i e m ö g l i c h Z w i s c h e n i n s t a n z e n eingeschaltet sind, w e r d e n i n d e r S t a a t s k a n z l e i s o w o h l v o m M i n i s t e r p r ä s i d e n t e n z u d e n M i t a r b e i t e r n als auch u m g e k e h r t ausgesprochen „ k u r z e W e g e " e r r e i c h t 1 9 7 . I n der Regel, v o r a l l e m b e i p o l i t i s c h e n u n d e i l i g e n D i n g e n , g e h t also der D i e n s t w e g v o m Referenten z u m Ministerpräsidenten oft n u r über den Abteilungsl e i t e r , w o d u r c h nach d e n d u r c h g e f ü h r t e n E r h e b u n g e n eine hohe R e a k t i o n s - u n d A k t i o n s f ä h i g k e i t w e i t g e h e n d sichergestellt i s t 1 9 8 . T r o t z d e m b l e i b t e i n H a u p t p r o b l e m , n ä m l i c h die i n n e r b e h ö r d l i c h e K o m m u n i k a t i o n , K o o p e r a t i o n u n d K o o r d i n a t i o n nach w i e v o r bestehen ( v g l . o b e n Z i f f . 8). Z w a r w u r d e v o n d e n B e f r a g t e n o f t d i e i m S t a a t s m i n i s t e r i u m praktizierte Teamarbeit betont; bei näherem Zusehen stellt m a n allerdings fest, daß die T e a m a r b e i t als I n d i k a t o r f ü r eine f l e x i b l e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n i n d e n A b t e i l u n g e n keinesfalls die Regel i s t 1 9 9 . I n s g e s a m t sationspläne sowohl bei der Aufstellung der Tätigkeitsfelder bzw. Aufgabenbereiche (vgl. oben Ziff. 3) als auch bei dem unten zu entwerfenden „Mustergliederungsplan" m i t verwertet. E i n genereller Organisationsvergleich der Staats- u n d Senatskanzleien u n d des Bundeskanzleramts w i r d gegenwärtig von Prof. K . König, Speyer, erarbeitet. 195 I m Staatsministerium gab es zum 1. 5.1974 insgesamt 30 Referenten; außerdem w u r d e n 2 Referate von Abteilungsleitern bearbeitet u n d 2 Referenten hatten je 2 Referate zu verwalten. 196 D e r Ministerialdirektor (vgl. dazu allgemein bereits oben § 23 Ziff. 3) ist hinsichtlich der die Staatskanzlei selbst betreffenden Angelegenheiten (insbes. hinsichtlich der Tätigkeitsfelder 2 u n d 3, oben Ziff. 3) als Amtschef v o l l i n die Hierarchie eingeschaltet. Dagegen geht i n allen parteipolitischen, m i t u n t e r auch wichtigen fachlichen u n d besonders eiligen Fragen (insbes. die Tätigkeitsfelder 8 bis 10, oben Ziff. 3) häufig der faktische Dienstweg v o m Abteilungsleiter, der jederzeit unmittelbaren Zugang zum Regierungschef hat, direkt zum Ministerpräsidenten. Der Ministerialdirektor w i r d i n diesen Fällen meist vorher u n d nachträglich (über Inhalt) informiert (eine A u s nahme bilden hier allerdings parteipolitische Fragen, vgl. dazu oben § 21 — Fußnote 34 — u n d § 23 Ziff. 3). A u f die Vielzahl der Aufgaben des M D (z. B. Vorsitz i n zahlreichen ad-hoc-Kommissionen, Kontakte zu anderen Bundesländern) k a n n nicht näher eingegangen werden. 197
Vgl. dazu eingehend bereits oben § 23 Ziff. 3. Z u den Organisationszielen allgemein vgl. oben § 8; außerdem G. Kunze, i n : Die Staatskanzlei, SHS Bd. 34, S. 101; H. Weichmann, ebenda, S. 33. 199 Dies zeigt sich besonders deutlich auch bei der Auswertung der Frage 4 (erster Teil) des schriftlichen Fragebogens (Anlage Nr. 3). Dabei ergab sich, daß größere Vorhaben n u r i n ganz wenigen Fällen von mehreren Referenten genannt wurden u n d ein diesbezügliches Kooperations- oder Koordinationsmuster auch nicht i n Ansätzen erkennbar war. Die bestehenden regelmäßigen Abteilungsbesprechungen u n d häufig eingesetzten ad-hoc-Kommissionen erreichen sicher einen intensiven Gedankenaustausch u n d eine gewisse politische Vorabklärung der Probleme, stellen aber eben keine echte Teamarbeit dar (vgl. L e x i k o n der Planung u n d Organisation, S. 172; R. Höhn, i n : Management-Enzyklopädie, Bd. 5, S. 744 ff.). 198
268
Kap. I I I : Organisation und S t r u k t u r der Landesregierung B W
gesehen herrscht vielmehr Einzelarbeit vor. Dies dürfte besonders auf zwei Gründe zurückzuführen sein: — Die Mitarbeiter des Staatsministeriums stehen sehr häufig unter teilweise enormem Zeitdruck. Eine solche Zeitknappheit ist aber grundsätzlich einer partizipativen Teamarbeit hinderlich. — Die bestehende Geschäftsverteilung bringt es m i t sich, daß i n jeder Abteilung für einen bestimmten Aufgabenbereich nur ein Beamter zuständig ist. Da aber ein Mitarbeiter m i t sich selbst keine Teamarbeit betreiben kann und eine umfassende Kooperation einschließlich einer laufenden gemeinsamen Aufgabenerfüllung zwischen je einem Beamten mehrerer Abteilungen nur sehr schwer zu v e r w i r k lichen ist, dürfte bei der gegenwärtigen Organisation eine effektive Teamarbeit, selbst unter sonst maximalen Bedingungen nicht möglich sein 2 0 0 . Eine nähere Analyse der kooperativen Zusammenarbeit innerhalb der Staatskanzlei zeigt denn auch, daß abgesehen von den traditionellen Koordinationsinstrumenten (Mitzeichnung, formlose Konsultation usw.) eine „Teamarbeit" i m wesentlichen nur insoweit besteht, als für einzelne Projekte, insbesondere von grundsätzlicher oder weittragender Bedeutung, häufig ad-hoc-Kommissionen (Art Projektgruppen) 2 0 1 gebildet werden, die aber eben i n aller Regel lediglich einen Grobfahrplan oder Zielvorgaben festlegen. Dabei bleibt dann i n aller Regel der zuständige Referent bzw. Leiter einer Abteilung letztlich doch federführend, d. h. für die Ausarbeitung verantwortlich; eine gemeinschaftliche Vorbereitung und Erarbeitung von Entscheidungen insgesamt ist demnach die Ausnahme 2 0 2 . Man w i r d die Arbeit i m Staatsministerium folglich nicht als partizipativ („teamwork"), sondern eher als kollegial, vor allem auf Abteilungsleiterebene, bezeichnen können 2 0 3 . 200 Vgl. dazu etwa R. Mayntz/F. Scharpf, Planungsorganisation, S. 207 ff.; Projektgruppe BMI, D r i t t e r Bericht, 11/59 ff.; K . Karehnke, i n : DVB1. 1973, S. 833 ff. 201 Z u den Projektgruppen allgemein vgl. E. Laux, i n : Probleme der M i n i sterialorganisation, SHS Bd. 48, S. 336ff.; Y. Dror, ebenda, S. 355ff.; A. Theis, ebenda, S. 359 f.; R. Mayntz / F. Scharpf, Planungsorganisation, S. 212 ff.; Projektgruppe Bay.IM, Reformbericht, S. 40 f.; Projektgruppe BMI, D r i t t e r Bericht, II/62 ff. 202 Vgl. dazu besonders Fußnote 199. 203 E. Laux (in: Teamarbeit i m Verwaltungsbereich, AWV-Fachbericht 9, S. 11) f ü h r t zum Unterschied zwischen Teamarbeit u n d Kollegialprinzip aus: „ B e i komplexen Problemen müssen mehrere Personen die Entscheidung nicht n u r bis zur letzten Phase m i t vorbereiten, sondern die Entscheidung gemeinsam verantworten können. Es ist dies jedoch ein anderes Zusammenw i r k e n als es i m Kollegialprinzip gegeben ist, wo i m hierarchischen A u f b a u die Entscheidung nicht monokratisch, sondern kollegial getroffen w i r d , die Vorbereitung u n d Erarbeitung der Entscheidung aber i m Rahmen des hierarchischen Gliederungsprinzips erfolgt."
§ 24 Das Staatsministerium (Staatskanzlei)
269
Die hier dargestellte derzeitige organisatorische Struktur der Staatskanzlei i m Hinblick auf ihre Aufgabenbewältigung weist, was i m Prinzip bereits oben bei der Beschreibung der Koordination und Information innerhalb des Staatsministeriums deutlich wurde, auch unter diesem Blickwinkel gewisse Mängel auf, die sich i m wesentlichen i n folgenden zwei Punkten umschreiben lassen 204 : — Die hierarchische Ordnung und die gegenwärtig praktizierten Formen der Zusammenarbeit bieten nicht die ausreichende Gewähr, komplexe Probleme, vor allem programmatische und planerische Aufgaben, umfassend und effektiv genug zu lösen und der Entwicklung anzupassen. Für die Bewältigung dieser Aufgaben (insbes. Information, Koordination, Planung — also die Tätigkeitsfelder 8 bis 10 und evtl. 6 und 7) ist vielmehr nach ganz herrschender Meinung und aufgrund zahlreicher empirischer Untersuchungen eine stabs- oder gruppenähnliche Organisation wesentlich besser geeignet 205 . — Die vielschichtigen, sich ständig wandelnden und oft interdisziplinären Aufgaben und Funktionen des Staatsministeriums gebieten es, daß sie grundsätzlich nicht von einem einzelnen Mitarbeiter, sondern mindestens von zwei Mitgliedern innerhalb einer Abteilung (Referat) gemeinsam wahrgenommen werden. Erst die Einführung des „Vier-Augen-Prinzips" schafft die organisatorischen Voraussetzungen für eine effektivere Tätigkeit sowie für eine notwendigerweise hohe Flexibilität der Staatskanzlei 206 . Diese Ausführungen machen zusammen mit den oben Ziff. 8 dargelegten Mängeln in der horizontalen Koordination und Information 204 I n den einzelnen Abteilungen sind diese Mängel allerdings unterschiedlich ausgeprägt. I m Rahmen der Interviews stieß m a n bei wiederholtem Nachfragen meist auf diese Mängel. Dabei konnte man feststellen, daß die oft zu Beginn der Interviews geäußerte Auffassung, wonach i m Staatsministerium, die Kollegial- u n d Teamarbeit besonders praktiziert werde, nicht v o l l zutraf, sondern so vor allem i m Unterschied zu den Fachressorts gesehen wurde und man i n aller Regel mindestens nicht von einer echten Teamarbeit sprechen kann. 205 Vgl. etwa F. Morstein Marx, i n : Die Staatskanzlei, SHS Bd. 34, S. 118 ff.; 138 ff.; H. Schlegelberger, ebenda, S. 143 ff.; E.-W. Böckenförde, ebenda, S. 154; T. Ellwein, ebenda, S. 202 ff.; K. von der Groeben, i n : Die Verwaltung, 1968, 398 ff.; Projektgruppe BMI, D r i t t e r Bericht, 1/25 ff., 54 ff., 11/34 ff., 60 ff.; Projektgruppe Bay. IM, Reformbericht, S. 108 f., 113 f.; Wibera, G u t achten HH, S. 143 f.; E. Laux, i n : AWV-Fachbericht 9, S. 8 ff.; H. Hegelau, i n : Probleme der Ministerialorganisation, SHS Bd. 48, S. 378 f.; M. Dullien, Flexible Organisation, S. 11 ff.; A. Theis, i n : Die V e r w a l t u n g 1970, S. 85 ff.; R. Mayntz/F. Scharpf, Planungsorganisation, S. 216 ff. Vgl. bes. auch S. Schöne, V o n der Reichskanzlei zum Bundeskanzleramt, S. 220 ff. 208 Vgl. etwa Projektgruppe Bay. IM, Reformbericht, S. 36 f.; R. Mayntz / F. Scharpf, Planungsorganisation, S. 208 f.; R. Wahl, i n : Der Staat 1974, S. 396 f.
270
Kap. I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
deutlich, daß eben das „Kollegialprinzip" für die Bedürfnisse des Staatsministeriums, insbesondere für komplexe, gestaltende Aufgaben und für eine aktive Regierungspolitik, nicht v o l l ausreichend ist 2 0 7 . Durch entsprechende organisatorische Maßnahmen sollten hier möglichst umgehend Verbesserungen angestrebt werden. Abschließend soll noch der Versuch unternommen werden, einen „Mustergliederungsplan" für das bad.-württ. Staatsministerium zu entwerfen. Ziel und Absicht ist es hier aber keineswegs einen A r t „Idealplan" auszuarbeiten, sondern lediglich einen solchen Gliederungsplan zu erstellen, der die bestehenden Mängel zu beseitigen versucht und vor allem die Chance der Realisierung besitzt. Ausgangspunkt sollen dabei einerseits die Ergebnisse der empirischen Erhebungen, einschließlich der i m Rahmen dieser Arbeit vorgenommenen analytischen Untersuchungen, zum anderen aber auch die aufgrund der oben beschriebenen elf Aufgabenbereiche an die Organisation gestellten Anforderungen sowie die zugänglichen Geschäftsverteilungs- und Organisationspläne der Staatskanzleien der anderen Länder sein (siehe unten A b bildung 4, S. 275). Zusammenfassend ist dazu vorher noch auf folgende Punkte kurz hinzuweisen: (1) Das Staatsministerium selbst sollte insgesamt nicht mehr als ca. 120 Mitarbeiter umfassen, wovon höchstens etwa 30 bis 40 dem höheren Dienst angehören sollen. Bei einer wesentlichen Überschreitung dieser Zahlen dürfte die Beschäftigung mit sich selbst so rapide zunehmen (behördeninterne Information, Kooperation, Koordination usw.) und die Beweglichkeit des Führungsapparates so stark abnehmen, daß eine maximale Aufgabenerfüllung nicht mehr sichergestellt ist 2 0 8 . (2) Da man m i t überwiegend überzeugenden Argumenten allgemein an den durch das Hierarchieprinzip geprägten eindeutigen, einheitlichen Verantwortlichkeitsregeln festhalten w i l l , ist der Staatskanzlei die hierarchisch strukturierte Linienorganisation zugrundezulegen. Diese Grundstruktur ist allerdings noch stärker als bisher i m Leitungsbereich durch ein besser institutionalisiertes Kollegialprinzip (Führungskonferenz und dergleichen) 209 und vor allem i n bzw. zwischen den Abteilungen durch partizipative Stabs- und Gruppenarbeit zu modifizieren. 207 I m Rahmen der zu diesen Problemen intensiv geführten Interviews wurde dies weitgehend bestätigt. Als erster Ansatz zu organisatorischen Änderungen könnte hier das „integrative Führungsmodell" dienen; vgl. dazu Wibera, Gutachten H H , S. 107 ff.; vgl. auch M. Lepper, i n : Die V e r w a l tung 1975, S. 252 ff. 208 Fast alle Befragten waren der Auffassung, daß der gegenwärtige Personalstand „ a n der Grenze des noch zweckmäßigen u n d sinnvollen angekommen sei" (wörtliches Zitat). Vgl. auch G. Kunze, i n : Die Staatskanzlei, SHS Bd. 34, S. 101. 209 Vgl. dazu ausführlich bereits oben § 23 Ziff. 2.
§ 24 Das Staatsministerium (Staatskanzlei)
271
(3) Amtschef des Staatsministeriums und insoweit allgemeiner Vertreter des Ministerpräsidenten sollte ein politischer Beamter sein 2 1 0 . Aus Zweckmäßigkeitsgründen erscheint es sinnvoll, diesem das Kabinettssekretariat (3) 2 1 1 unmittelbar zu unterstellen. Die zusätzliche Ernennung eines Staatssekretärs i m Staatsministerium, gleichgültig ob als Staatssekretär m i t Kabinettsrang oder als politischer Staatssekretär, w i r d fast einhellig nicht für sinnvoll gehalten 2 1 2 . (4) Die Institutionalisierung des „Kollegialprinzips" i m Leitungsbereich der Staatskanzlei sollte durch die Führungskonferenz 213 erfolgen und damit die inoffiziellen Abteilungsleiterbesprechungen weitgehend ablösen. Der Kreis der Konferenzteilnehmer ist möglichst klein zu halten. I h m sollten neben dem Ministerpräsidenten und dem Amtschef grundsätzlich nur die Leiter der Abteilungen, die regierungspolitisch von besonderer Bedeutung sind, angehören. Die i m Vergleich zu den Ministerien besonders starke politische Relevanz eines Großteils der Tätigkeiten des Staatsministeriums und damit eine notwendig hohe politische Identifikation m i t dem Regierungschef rechtfertigen und machen es zugleich notwendig, den Leitern der Abteilungen, denen insbesondere die Aufgabenbereiche (8) bis (10) zugeteilt sind, den Status eines politischen Beamten zu verleihen 2 1 4 und sie zu den Teilnehmern der Führungskonferenz zu zählen. Die Belange der übrigen Tätigkeitsfelder hat i n der Führungskonferenz der Amtschef mit zu vertreten. (5) Die einzelnen Aufgabenbereiche sind so auf die sechs Abteilungen 2 1 5 aufzugliedern, daß möglichst in sich ausgewogene und gleichgewichtige Abteilungen entstehen. I n keiner Abteilung sollten dabei mehr als zehn Mitarbeiter des höheren und gehobenen Dienstes tätig sein. 210 Vgl. dazu eingehend u n d m. w. N. oben § 23 Ziff. 3 u n d 4. Die dort gemachten Ausführungen gelten hier entsprechend. 211 Diese i n K l a m m e r n gesetzten Zahlen verweisen auf die entsprechenden Aufgabenbereiche oben Ziff. 3. 212 A l s Hauptgrund w i r d angegeben, daß es unmöglich u n d politisch nicht opportun sei, sich neben dem Ministerpräsidenten zu profilieren. Letztlich hängt hier sehr v i e l von den beteiligten Personen ab. 213 Vgl. dazu ausführlich oben § 23 Ziff. 1. 214 Dies soll aber nicht bedeuten, daß damit n u r noch parteipolitische Gesichtspunkte maßgeblich sind. A u f die eingehende Begründung dazu w i r d verwiesen auf oben § 23 Ziff. 4. Besoldungsrechtliche Konsequenzen dieses Vorschlags (für die Abt.-leiter, die pol. Beamten sind, etwa B 7) sind hier nicht zu erörtern. 215 W a r u m es gerade sechs sein müssen ist nicht unbedingt schlüssig. Die empirischen Erhebungen haben dazu ergeben, daß es praktisch nicht möglich sein w i r d , von dieser Z a h l herunterzukommen (Hauptargument: die Staatskanzlei muß durch möglichst viel B 6-Stellen für qualifizierte Leute besonders interessant bleiben).
272
Kap. I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
(6) Der Abteilung I I sollten trotz evtl. Bedenken die Querschnittsaufgaben Personal und Organisation zugewiesen 216 und diese zusammen m i t einem „Gesetzgebungsdienst" 217 verstärkt wahrgenommen werden 2 1 8 . (7) Die gesamten Bundesangelegenheiten (7) sind dergestalt aufzuteilen, daß i n der Abteilung I I lediglich die formelle, technische A b wicklung dieser Dinge bearbeitet wird, während alle diesbezüglichen inhaltlichen Sach- oder politischen Fragen von den Abteilungen I I I bzw. IV, gegebenenfalls auch von der Abteilung V, wahrgenommen werden 2 1 9 . (8) Durch die „Anreicherung" der Landesangelegenheiten mit materiellen Bundesangelegenheiten 220 ist es möglich, für die Bearbeitung des Geschäftsbereichs eines Ministeriums mindestens zwei Referenten einzusetzen und so das „Vier-Augen-Prinzip" in den Abteilungen I I I und I V zu verwirklichen. U m dabei aber keine die Staatskanzlei beherrschende Mammutabteilung" entstehen zu lassen, ist es notwendig, die gesamten Aufgabenbereiche (Ausnahme: Finanz- und steuerpolitischer Bereich) entsprechend der oben i n § 4 aufgestellten Systematik der primären Staatszielsetzungen auf zwei Abteilungen i n etwa gleichmäßig zu verteilen. Es zeigt sich also auch hier und das haben die Befragungen weitgehend bestätigt, daß für die Grobeinteilung der Ministerialorganisation (Aufteilung i n Abteilungen) grundsätzlich die primären Zielsetzungen der richtige Ansatzpunkt sind 2 2 1 . (9) Problematisch bleibt die Abgrenzung der vorgeschlagenen Abteilungen I I I und I V einerseits zu V andererseits. Eine eindeutige Grenz216 Z u den Querschnittsfunktionen vgl. allgemein oben § 5 Ziff. 3, § 24 Ziff. 3 u n d 7, speziell zur Frage der Zuordnung der Querschnittsfunktionen siehe oben § 23 Ziff. 4 (insbes. Fußnoten 73 u n d 74). 217 Vgl. dazu oben Ziff. 3 u n d etwa J. Seidl-Hohenveldern, in: Projektgruppe B M I , Erster Bericht, Anlagenband, S. 9; E. Guilleaume, i n : Der Staat 1965, S. 188 f. m. w. N. Von einigen Befragten wurde dies für sehr sinnvoll erachtet. 218 Auch hierbei bietet sich durchaus an, diese Aufgaben durch interministerielle Ausschüsse unter intensiver Federführung des Staatsministeriums zu erfüllen (Beispiel etwa die Bundesratsreferentenbesprechungen). 219 Bei der Wiederbesetzung der Stelle des Leiters der A b t e i l u n g I I (gegenwärtige Organisation) i m Jahr 1973 w a r höchst umstritten, ob man die A b t e i lungen I I u n d I I I zusammenlegen soll oder nicht. Die zu dieser Frage besonders intensiv durchgeführten Interviews haben ergeben, daß die Mehrheit der Bediensteten aus sachlichen Gründen (heute weitgehend ausgesprochen starke Verflechtung der Bundes- u n d Landesangelegenheiten) eine Zusammenlegung befürwortet. 220 Eine sinnvolle Trennung der beiden Aufgabenbereiche ist heute w e i t gehend nicht mehr möglich (vgl. z.B.: A r t . 91 a, 91 b GG, Umweltschutz, Berufsausbildung, Ausländerwesen usw.). Vgl. auch oben Ziff. 8. I n den I n t e r views wurde dies durchweg bestätigt. 221 Vgl. dazu oben §§ 2, 4 bis 6 und besonders § 20 Ziff. 3.
§ 24 Das Staatsministerium (Staatskanzlei)
273
ziehung w i r d hier generell nicht zu erreichen sein. Als Richtschnur mögen dabei folgende Gesichtspunkte dienen: I n aller Regel sollten auch sämtliche die Abteilungen I I I und I V sachlich betreffenden Grundsatzfragen dort möglichst umfassend behandelt werden. Zusätzlich zu und gewissermaßen aufbauend auf den Angelegenheiten des Finanzressorts sollten der Abteilung V nur die Führungstätigkeiten zur Ausübung der Richtlinienkompetenz (Regierungs- und Arbeitsprogramm) und die Basisplanungen zugewiesen werden 2 2 2 . Dies scheint schon deshalb notwendig zu sein, w e i l die gesamte Grundsatzplanung wegen ihrer speziellen Methoden und Techniken möglichst von einer Stelle wahrgenommen werden sollte und w e i l es sich dabei eben u m Dinge von meist besonders hoher politischer Brisanz handelt. Außerdem kommt hinzu, daß diese Planungen i m Staatsministerium unbedingt von einer Abteilung wahrgenommen werden müssen, die m i t tagespolitischen Dingen nicht zu sehr belastet wird. Die hier angeführten Gründe rechtfertigen zugleich die notwendige organisatorische Trennung der Abteilungen I I I und I V von der Abteilung V 2 2 3 . Schließlich sollte i n der Abteilung V dringend etwa die Hälfte der Arbeitskapazität freigemacht werden, u m allein für echte mittel- und langfristige Aufgaben und Probleme eingesetzt werden zu können (konzeptionelle, alternative Zielfindung und Zielbestimmung, innovative Planungsstrategie, Entwicklungsprognosen, aber auch Programmbewertung und Effektivitätskontrollen, „heuristischer Stab") 2 2 4 . Auch bei der Geschäftsverteilung innerhalb der A b teilung V ist darauf hinzuwirken, daß mindestens das „Vier-AugenPrinzip" verwirklicht wird. (10) Ob für die Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit eine eigene Abteilung gebildet werden soll, ist nicht unumstritten und hängt oft maßgeblich von den personellen Konstellationen ab. Da aber der „Sprecher der Landesregierung" notwendigerweise Mitglied der Führungskonferenz sein muß und an der Tatsache nicht vorbeigegangen werden kann, daß diese Tätigkeiten eine immer größere Bedeutung
222 A u f g r u n d der i n letzter Zeit erfolgten Änderungen des Geschäftsverteilungsplans ist diese Tendenz durchaus erkennbar, was sich auch personell niedergeschlagen hat. Vgl. etwa die entsprechenden Pläne v o m 1.1. 73, 1.12. 73, 1. 3. 74 u n d 1. 5. 74. Dadurch soll gleichzeitig eine gewisse Entlastung der Abteilung V von reaktiven Dingen erreicht werden (vgl. Abb. 4 unten S. 275). 223 Die bisherige Praxis macht diese Forderung besonders deutlich u n d ist auch i m Hinblick auf die oben i n § 3 Ziff. 3, § 6, § 20 Ziff. 3 u n d § 23 Ziff. 2 aufgestellte Prämisse einer engen Verflechtung von Fachaufgaben u n d Planung unproblematisch, da j a das Staatsministerium auch insoweit überwiegend n u r zentrale Koordinationsstelle ist. 224 Vgl. dazu oben §§ 5, 7 u n d 24 Ziff. 3 und 5; zur Gesamtproblematik vgl. neben den Berichten der Projektgruppe beim B M I besonders R. Mayntz / F. Scharpf (Hrsg.), Planungsorganisation.
1
Katz
274
Kap. I I I : Organisation u n d S t r u k t u r der Landesregierung B W
erlangen 225 , sollte auch künftig grundsätzlich an der bestehenden eigenständigen Presseabteilung festgehalten werden 2 2 6 . (11) Durch organisatorische Maßnahmen muß schließlich eine noch bessere gegenseitige Verflechtung und Verzahnung zwischen den A b teilungen, insbesondere auf Referentenebene, erreicht werden. Besonders dringend scheint hierbei die Institutionalisierung von Querverbindungen zwischen den Abteilungen I I I bis V I zu sein, durch die alle mit demselben Aufgabenbereich betrauten Mitarbeiter zu einer umfassenden kommunikativen und kooperativen Zusammenarbeit verbunden werden (etwa i n abteilungsübergreifende „Gruppen"). Unter Berücksichtigung all dieser Punkte läßt sich für das Staatsministerium der gegenüberstehend i n Abb. 4 dargestellte „Mustergliederungsplan" aufstellen. § 25 Das Verhältnis der Regierung zum Parlament 1 I n dem Verhältnis von Regierung und Volksvertretung ist nach ganz überwiegender Meinung i m modernen Parlamentarismus ein zweifacher struktureller Wandel eingetreten. Zum einen ist zwischen Parlament und Exekutive ein stärkeres Zusammenwirken infolge einer immer stärkeren „Verflechtung" und „Verschmelzung" beider Funktionsbereiche festzustellen (Staatsleitung zur „gesamten Hand") 2 und zum anderen stehen sich nicht mehr primär Regierung und Gesamtparlament, sondern vor allem Regierung/Parlamentsmehrheit und Opposition gegenüber 3 . Ob diese i n der Parlamentarismusdiskussion herrschende Auffassung, die fast ausschließlich von der diesbezüglichen Entwicklung und Verfassungswirklichkeit auf Bundesebene ausgeht, auch i n den Ländern und speziell i n Bad.-Württ. Gültigkeit besitzt, 225
Vgl. dazu oben § 5 Ziff. 3 u n d § 24 Ziff. 3. Diese Auffassung wurde fast einhellig i m Rahmen der Befragungen vertreten, wobei allerdings von Seiten der A b t e i l u n g V I grundsätzlich eine engere „Verflechtung" m i t den anderen Abteilungen befürwortet wurde (insbesondere Kommunikation). 1 Diese Ausführungen verfolgen keinesfalls das Ziel, eine umfassende Darstellung dieser Probleme zu geben. Der Vollständigkeit u n d „ A b r u n d u n g " der A r b e i t wegen sollen hierzu aber noch einige Überlegungen angestellt werden. 2 Vgl. dazu eingehend oben § 3 Ziff. 4 (Literaturhinweise i n Fußnote 19); R. Herzog, i n : W D S t R L 24 (1966), S. 183 ff., 201 ff.; F. Ossenbühl, V e r w a l tungsvorschriften u n d Grundgesetz, S. 203 ff. je m. w. N. 3 Vgl. dazu eingehend oben § 3 Ziff. 4 (Literaturhinweise i n Fußnoten 20 u n d 21); vgl. besonders U. Scheuner, i n : D Ö V 1974, S. 433 ff., 437 f. m . w . N. Staatsrechtslehrertagung 1974, Berichte von T. Oppermann u n d H. Meyer z u m Thema: „Das parlamentarische Regierungssystem des Grundgesetzes. Anlage — Erfahrungen — Zukunftseignung" und die Diskussion dazu, i n : V V D S t R L , Bd. 33, S. 7 ff., 69ff. u n d 120ff.; Tagungsbericht von E. Grabitz u n d Leitsätze, i n : DÖV 1974, S. 802 ff. 226
18«
|
iL FÜhr ung sk o nf er e n z
Abt. VI
1 I
1
I
'
Abt. III
1 Abt. IV
Abt. V
I
>
![Parlamentarische Finanzkontrolle in den Bundesländern,: dargestellt am Beispiel Baden-Württembergs [1 ed.]
9783428452125, 9783428052127](https://dokumen.pub/img/200x200/parlamentarische-finanzkontrolle-in-den-bundeslndern-dargestellt-am-beispiel-baden-wrttembergs-1nbsped-9783428452125-9783428052127.jpg)
![Die Aufgabe der Zusammenschlußkontrolle: dargestellt am Beispiel der Sanierungsfusion [1 ed.]
9783428448951, 9783428048953](https://dokumen.pub/img/200x200/die-aufgabe-der-zusammenschlukontrolle-dargestellt-am-beispiel-der-sanierungsfusion-1nbsped-9783428448951-9783428048953.jpg)
![Die verfassungsrechtliche Belastungsgrenze der Unternehmen,: dargestellt am Beispiel der Personalzusatzkosten [1 ed.]
9783428487400, 9783428087402](https://dokumen.pub/img/200x200/die-verfassungsrechtliche-belastungsgrenze-der-unternehmen-dargestellt-am-beispiel-der-personalzusatzkosten-1nbsped-9783428487400-9783428087402.jpg)
![Vertragsfreiheit als Verfassungsproblem: Dargestellt am Beispiel der Allgemeinen Geschäftsbedingungen [1 ed.]
9783428430833, 9783428030835](https://dokumen.pub/img/200x200/vertragsfreiheit-als-verfassungsproblem-dargestellt-am-beispiel-der-allgemeinen-geschftsbedingungen-1nbsped-9783428430833-9783428030835.jpg)
![Wirtschaftsaufsicht und subjektiver Konkurrentenschutz: Insbesondere dargestellt am Beispiel der Kartellaufsicht [1 ed.]
9783428423651, 9783428023653](https://dokumen.pub/img/200x200/wirtschaftsaufsicht-und-subjektiver-konkurrentenschutz-insbesondere-dargestellt-am-beispiel-der-kartellaufsicht-1nbsped-9783428423651-9783428023653.jpg)
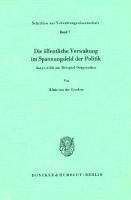
![Sozialversicherung und Privatversicherung: Dargestellt am Beispiel der Krankenversicherung [1 ed.]
9783428432295, 9783428032297](https://dokumen.pub/img/200x200/sozialversicherung-und-privatversicherung-dargestellt-am-beispiel-der-krankenversicherung-1nbsped-9783428432295-9783428032297.jpg)
![Interaktion religiöser Rechtsordnungen: Rezeptions- und Translationsprozesse dargestellt am Beispiel des Zinsverbots in den orientalischen Kirchenrechtssammlungen [1 ed.]
9783428531066, 9783428131068](https://dokumen.pub/img/200x200/interaktion-religiser-rechtsordnungen-rezeptions-und-translationsprozesse-dargestellt-am-beispiel-des-zinsverbots-in-den-orientalischen-kirchenrechtssammlungen-1nbsped-9783428531066-9783428131068.jpg)
![Strukturelle Sensitivitätsanalyse dynamischer ökonometrischer Prognosemodelle: Dargestellt am Beispiel der westdeutschen Textilwirtschaft [1 ed.]
9783428475490, 9783428075492](https://dokumen.pub/img/200x200/strukturelle-sensitivittsanalyse-dynamischer-konometrischer-prognosemodelle-dargestellt-am-beispiel-der-westdeutschen-textilwirtschaft-1nbsped-9783428475490-9783428075492.jpg)

![Politische Verwaltungsführung in den Bundesländern: Dargestellt am Beispiel der Landesregierung Baden-Württemberg [1 ed.]
9783428435289, 9783428035281](https://dokumen.pub/img/200x200/politische-verwaltungsfhrung-in-den-bundeslndern-dargestellt-am-beispiel-der-landesregierung-baden-wrttemberg-1nbsped-9783428435289-9783428035281.jpg)