Philosophie und Rechtstheorie in Mexiko [1 ed.] 9783428466474, 9783428066476
135 5 42MB
German Pages 300 Year 1989
Polecaj historie
Citation preview
Philosophie und Rechtstheorie in Mexiko
Schriften zur Rechtstheorie Heft 136
Philosophie und Rechtstheorie in Mexiko
Herausgegeben von Leon Olivé und Fernando Salmerón
Duncker & Humblot * Berlin
CIP-Titelaufnahme der Deutschen Bibliothek Philosophie und Rechtstheorie in Mexiko / hrsg. von León Olivé u. Fernando Salmerón. — Berlin: Duncker u. Humblot, 1989 (Schriften zur Rechtstheorie; H. 136) ISBN 3-428-06647-2 NE: Olivé, León [Hrsg.]; GT
Alle Rechte vorbehalten © 1989 Duncker & Humblot GmbH, Berlin 41 Satz: Klaus-Dieter Voigt, Berlin 61 Druck: Berliner Buchdruckerei Union GmbH, Berlin 61 Printed in Germany ISSN 0582-0472 ISBN 3-428-06647-2
Die Herausgeber danken Ernesto Garzón Valdés für seine hilfreiche Unterstützung bei der Vorbereitung dieses Sammelbandes, Ruth Zimmerling für die sorgfältige Übersetzung, Norbert Simon vom Verlag Duncker & Humblot für die Bereitschaft, den Band zu veröffentlichen, sowie der Secretarla de Gobernación der mexikanischen Regierung und dem Instituto de Investigaciones Filosóficas der Universidad Nacional Autònoma de México für die geleistete finanzielle Hilfe. F. S. undL. O. August 1988
Inhaltsverzeichnis Fernando Salmerón
Einführung
9 I. Das Rechtssystem und seine Struktur
Héctor Fix-Zamudio
Recht, Verfassung und Demokratie
27
Eduardo Garcia Màynez
Geltung, Gerechtigkeit und Wirksamkeit als Elemente der ontologischen Struktur des Rechts
61
Ulises Schmill Ordónez
Pragmatische Rekonstruktion des Sollensbegriffs
73
Rolando Tamayo y Salmoràn
Die Rechtsordnung und ihre Verfassung. Eine kurze Beschreibung des Prozesses der Rechtserzeugung 121 Π. Praktische Philosophie und öffentliche Tugend Antonio Gómez Robledo
Gerechtigkeit bei Aristoteles
137
Alejandro Rossi
Sprache und Philosophie bei Ortega y Gasset
181
Fernando Salmerón
Vernunft und Leidenschaften bei Hegel
195
Ramón Xirau
Recht, Volk, Freiheit und Person
211
8
Inhaltsverzeichnis
III. Politisch-philosophische Fragen der Staatsordnung Javier Esquivel
Politischer Mord und Tyrannenmord
229
León Olivé
Rationalität und politische Legitimation
241
Carlos Pereyra
Die Grenzen des normativen Diskurses in der politischen Philosophie: Der Fall Rawls 259 Luis Villoro
Der Begriff der Ideologie
273
Bibliographie
291
Personenregister
295
Einführung Der vorliegende Band enthält eine Auswahl von zwölf Aufsätzen über philosophische Fragen zum Rechtssystem, zur praktischen Philosophie und öffentlichen Tugend sowie zum Bereich der Politik und der Staatsordnung. Innerhalb dieses thematischen Rahmens bietet die Sammlung gleichzeitig einen aktuellen Überblick über die philosophischen Aktivitäten in Mexiko. Bis auf einen sind alle Autoren Mexikaner, und alle ohne Ausnahme haben ihre Ausbildung an mexikanischen Universitäten erhalten, wenn auch die Mehrheit zusätzliche Studien in Europa absolviert hat. Schließlich leben auch alle Autoren in Mexiko und sind dort als Forscher tätig, mit einer einzigen, traurigen Ausnahme: Carlos Pereyra starb, während die schon fertig zusammengestellte Anthologie übersetzt wurde. Der in diesem Band gebotene Überblick weist allerdings erhebliche Lücken auf, die sich - abgesehen von den natürlichen Grenzen, die jeder Auswahl gesetzt sind - nur dadurch rechtfertigen lassen, daß sich die Herausgeber für eine möglichst große thematische Einheit entschieden haben. Der daraus folgenden Einschränkung wurde dadurch zu begegnen versucht, daß hinsichtlich der Behandlung der Themen auf eine möglichst große Vielfalt Wert gelegt wurde. Zu diesem Zweck wurden neben mehr theoretisch ausgerichteten Texten auch solche mit einem historischen oder kritischen Ansatz einbezogen. Mit der Zusammenstellung der Aufsätze wurde aber vor allem versucht, Vertreter verschiedener Generationen und aus den unterschiedlichsten philosophischen Richtungen vorzustellen. Betrachtet man die Altersgruppen, so ergibt sich das folgende Bild: Die beiden ältesten Autoren sind im Jahre 1908 geboren und haben noch vor dem Ende der ersten Hälfte des Jahrhunderts ihre Ausbildung beendet und ihre intellektuelle Tätigkeit aufgenommen. Die zweite Gruppe umfaßt vier Autoren, die zwischen 1922 und 1925 geboren wurden. Sie verdanken ihre philosophische Ausbildung hauptsächlich der Lehrtätigkeit einer Reihe spanischer Professoren, die aufgrund des Zusammenbruchs der spanischen Republik vor etwa fünfzig Jahren nach Mexiko kamen. Eine dritte, in sich viel weniger homogene Gruppe wird schließlich von zwei Autoren aus den 30er und vier Autoren aus den 40er Jahren gebildet, die in ihrer Ausbildung von einem viel reicheren intellektuellen Klima profitierten, das für ein viel größeres Spektrum von juristischen und philosophischen Strömungen offen war, als es die früheren Generationen zunächst erleben durften. Eduardo Garcia Mâynez (1908) studierte Philosophie und Rechtswissenschaft an der Autonomen Staatlichen Universität von Mexiko ( U N A M ) , wo er
10
Einführung
in beiden Fächern vor allem die Vorlesungen von Antonio Caso (1883 - 1946) besuchte. Anschließend studierte er in Berlin bei Nicolai Hartmann und in Wien bei Alfred Verdross. Viele Jahre lang lehrte er Ethik und Rechtsphilosophie an der U N A M , wo er außerdem wichtige akademische Ämter bekleidete. So war er zunächst Direktor der Philosophischen Fakultät und später des Instituts für Philosophische Forschung, das auf seine Initiative hin gegründet wurde. Er ist inzwischen emeritiert. Seit 1958 ist er Mitglied des Colegio Nacional. Kurz nach seiner Rückkehr aus Deutschland im Jahre 1934 sprach Garcia Mâynez in seinen Arbeiten einige Probleme an, die man rückblickend als ein umfassendes philosophisches Forschungsprogramm auffassen kann. Es ging ihm vor allem um methodologische Fragen, wobei er zudem die Überzeugung vertrat, daß die Geltung der Rechtsordnung auf eine Philosophie der Werte zu gründen sei. Etwa um die Mitte des Jahrhunderts gipfelte ein erster Teil seiner Arbeit in einem Buch über die Definition des Rechts, in dem er sich gegen den Rechtsformalismus und den Positivismus stellte. Dabei stützte er sich auf eine phänomenologische Werttheorie sowie auf den Perspektivismus von Ortega y Gasset. U m die gleiche Zeit begann er auch seine Arbeiten über juristische Logik, die noch vor den ersten europäischen Beiträgen auf diesem Gebiet publiziert wurden. Er verfaßte schließlich ein dreibändiges Werk zur juristischen Logik, zusätzlich zu einem zuvor, im Jahre 1951, veröffentlichten Einführungsband und den schon genannten Vorstudien, mit denen er einen Beitrag zur Entdeckung eines ganz neuen Forschungsgebietes leistete. Um das Jahr 1965 kehrte er zu den grundlegenden Themen der Rechtsphilosophie zurück. Er veröffentlichte zunächst ein Buch über Rechtspositivismus, Naturrechtslehre und soziologischen Realismus und ein zweites über die Axiologie von Nicolai Hartmann. Erst danach verfaßte er sein Lehrbuch Filosofia del Derecho, in dem er sich systematisch mit den traditionellen großen Problemen der Disziplin auseinandersetzte. Nach einem weiteren Buch, in dem er in Dialogform und ohne kritischen Apparat seine Gedanken über die Hauptfragen der Rechtswissenschaft darstellte, hat Garcia Mâynez eine Reihe von Untersuchungen über die großen Klassiker der Antike vorgelegt. In den letzten Jahren schließlich, in denen sein Name auch weiterhin in juristischen und philosophischen Fachzeitschriften präsent war, hat er in mehreren Bänden die Überlegungen von Piaton und Aristoteles zur Gerechtigkeit übersetzt und kommentiert. Sein Aufsatz aus dem Jahre 1979, den wir für diese Anthologie ausgewählt haben, - ein Beleg für die nüchterne Behandlung, die der Autor begrifflichen Unterscheidungen angedeihen läßt - ist trotz seiner Kürze ein gutes Beispiel dafür, wie er seine bevorzugten Gebiete miteinander verbindet: den Perspektivismus und die Wertphilosophie, die schon in seinen frühen Arbeiten hervorstachen; die Behandlung von Grundbegriffen als ontologische Elemente der
Einführung
Rechtsstruktur, wie sie in seinen Untersuchungen zur juristischen Logik immer präsent war; die Definition des Rechts als konkrete normative Ordnung, die schon den Hauptgedanken seiner Filosofia del Der echo bildete; und schließlich die Theorie von der dialektischen Entwicklung des Rechtsgedankens, aufgefaßt als eine Beziehung zwischen den Attributen der Gültigkeit, der intrinsischen Geltung und der Wirksamkeit. Antonio Gómez Robledo (1908) studierte Rechtswissenschaft an der Universität von Guadalajara (Mexiko) und Philosophie an der U NA M , wo er die Veranstaltungen von Antonio Caso und José Gaos (1900 - 1969) belegte. Danach studierte er Jura in Frankreich und in Den Haag (an der Akademie für Internationales Recht), in New York und Rio de Janeiro. Schon früh trat er in den diplomatischen Dienst ein und bekleidete dort wichtige Posten (in Brasilien, Tunesien, Italien, Griechenland und der Schweiz). Daneben war er aber auch über verschiedene Zeitspannen als Dozent tätig, vor allem an der U N A M und am Colegio National, dem er seit 1960 angehört. Zur Zeit arbeitet er am Institut für Philosophische Forschung der U N A M . Seine Veröffentlichungen lassen sich in zwei Gruppen einteilen: die Publikationen speziell zum Völkerrecht auf der einen Seite, die eigentlich philosophischen Arbeiten, insbesondere zur Ideengeschichte, auf der anderen. Diese zweite Schiene erlaubte es dem Autor, seine Doppeltätigkeit als Jurist und als Philosoph in einer einzigen zu vereinigen. Dies galt praktisch schon seit seinem 1940 erschienenen ersten Buch, in dem ihn die Untersuchung des Werkes von Francisco de Vitoria dazu führte, die thomistische Herkunft des spanischen Denkers und seine Bedeutung als Begründer des Völkerrechts zu erklären. Sein theoretischer Standpunkt ist auf eine Synthese von Metaphysik und Phänomenologie ausgerichtet, ein Ansatz, den er selbst als christlichen Humanismus darstellt. Ebenso, wie die rechtswissenschaftlichen Arbeiten von Gómez Robledo in die internationale Politik Mexikos eingegangen sind, haben seine philosophiegeschichtlichen Untersuchungen in unseren Geisteswissenschaften ihre Spur hinterlassen. In den 50er Jahren, nachdem er schon ein Buch über Christentum und Philosophie bei Augustinus und ein anderes über die Philosophie in Brasilien veröffentlicht hatte, begann er eine Reihe von Arbeiten über die Klassiker der Moralphilosophie und des politischen Denkens. Sokrates, Piaton und Aristoteles, aber auch Dante und Machiavelli, Descartes und Bergson waren Gegenstand seiner Arbeit, ebenso wie Klassiker des mexikanischen Denkens, wie Alonso de la Veracruz und Ignacio Vallarta, denen er in jüngster Zeit jedem ein Buch gewidmet hat. Der Text, den wir hier von ihm ausgewählt haben, zeigt, wie er historische Interpretation und philosophische Reflexion miteinander verbindet. Der Aufsatz ist seinem Buch Meditación sobre la justicia entnommen, das eine Untersuchung der historischen Entwicklung des Gerechtigkeitsgedankens enthält -
12
Einführung
von Platon, Aristoteles, Cicero und den Stoikern über Thomas von Aquin, Leibniz und Kant bis zur Axiologie von Scheler und Hartmann sowie der Diskussion bei Radbruch. In seinem letzten Teil, in dem er auf Emil Brunner und andere dem Thomismus nahestehende zeitgenössische Philosophen eingeht, versucht das Buch eine Darstellung der konstitutiven Merkmale der Gerechtigkeit aus der Sicht der fortschreitenden Entwicklung des Naturrechts bzw. der Ethik. Der ausgewählte Aufsatz enthält die Analyse des fünften Buches der Nikomachischen Ethik, folgt Schritt für Schritt seinen Abschnitten und Unterscheidungen, von der Betrachtung des abstrakten Gerechtigkeitsbegriffs, seiner formalen Charakteristika und der Behandlung der besonderen Gerechtigkeit und ihrer Erscheinungsformen bis zu den konkreten Aspekten der politischen Gerechtigkeit. Schließlich untersucht er die innere Einstellung des Handelnden, die es erlaubt, von einem gerechten Menschen zu sprechen, und macht genaue Angaben über die Stellung der Gerechtigkeit innerhalb des Spektrums der ethischen Tugenden. Im Laufe der Untersuchung werden auch andere Interpretationen diskutiert, etwa die von Hans Kelsen; es werden die Verbindungen zu anderen Begriffen wie Fairness, Gleichheit, Freundschaft und Freiheit erläutert; es werden die Bedeutung der Gerechtigkeit in den zwischenmenschlichen Beziehungen und die Reichweite der Lehre vom Mittleren herausgearbeitet (das letztere mit Hilfe von Nicolai Hartmann); es wird der metaphysische Ursprung der Klugheit festgestellt und ganz allgemein der große Reichtum des Textes anhand einer Darstellung der Entdeckungen des Philosophen, von Hinweisen auf (nicht nur platonische) Vorläufer sowie auf seinen Einfluß auf die spätere Entwicklung des Gerechtigkeitsgedankens in anderen Epochen der Geschichte der Philosophie aufgezeigt. Den vier Autoren der zweiten - und auch dem einen oder anderen der folgenden - Gruppe ist hinsichtlich ihrer Ausbildung eins gemein: Sie alle sind direkte Schüler der spanischen „Umsiedler" in der mexikanischen Rechtswissenschaft und Philosophie. Héctor Fix-Zamudio (1924) - um mit dem typischsten Rechtswissenschaftler dieser Generation zu beginnen - absolvierte sein ganzes Studium bis zum Erwerb des Titels eines Doktors der Rechte an der U N A M . Nachdem er einige Jahre lang Erfahrungen als Richter gesammelt hatte, widmete er sich voll und ganz der Lehre an der Fakultät für Rechtswissenschaft und der Forschung am Institut für Juristische Forschung (früher Institut für Vergleichende Rechtswissenschaft), dem er von 1966 bis 1978 als Direktor vorstand und an dem er auch heute noch als emeritierter Forscher arbeitet. Er wurde 1974 ins Colegio Nacional aufgenommen und erhielt 1986 den UNESCO-Preis für die Lehre in den Menschenrechten. Ein Jahr zuvor war er zum Richter des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte ernannt worden, der seinen Sitz in Costa Rica hat. Während seiner Ausbildung arbeitete Fix-Zamudio mit den spanischen und mexikanischen Juristen, die innerhalb der U N A M dem alten Institut für Ver-
Einführung
gleichende Rechtswissenschaft angehörten, und übte sich in den entsprechenden Forschungsmethoden. Vor allem aber arbeitete er mit dem spanischen Prozeßrechtler Niceto Alcalâ-Zamora y Castillo. Die Themen seiner Bücher und eines großen Teils seiner umfangreichen Aufsatzproduktion beziehen sich - abgesehen von denen, die sich mit den Methoden von Lehre und Forschung in der Rechtswissenschaft befassen - hauptsächlich auf Verwaltungsrecht und Zivilprozeß, auf Amparo-Verfahren und Verfassungsrecht, auf die Verfassungsgerichte und den Schutz der Menschenrechte. Sein erstmals 1984 veröffentlichter Aufsatz Derecho, Constitution y Democracia ist eine streng normative Abhandlung über einige Rechtsinstrumente und deren Funktion der Förderung und Unterstützung demokratischer gesellschaftlicher Verhaltensweisen, wie man sie in modernen Verfassungen vorfindet. Er geht von einer Unterscheidung aus: daß sich nämlich Demokratie einerseits an der Erzeugung von Normen durch Organe und Verfahren mit bestimmten Charakteristiken zeige und andererseits an dem Zweck dieser Normen, als Wegbereiter für andere, eng damit zusammenhängende Aspekte wirtschaftlicher, sozialer und politischer Art zu dienen. Der Aufsatz vergleicht zeitgenössische Rechtsordnungen und weist auf diejenigen Rechtsinstrumente hin, die zur Vervollkommnung des Schutzes der Menschenrechte beitragen; er behandelt Veränderungen im alten Prinzip der Gewaltenteilung, die gesunde Tendenz, die Interpretation von Verfassungsbestimmungen besonderen Gerichten zu übertragen sowie die Entwicklung der Verfassungsgerichtsbarkeit. A l l dies führt abschließend zu einer Auffassung der modernen Verfassung - in der gleichen Richtung wie Norberto Bobbio - als ein Gesetzeskorpus, das die in ständiger Entwicklung befindlichen Grundwerte einer politischen Gemeinschaft - in einem programmatischen und nicht nur dogmatischen oder organischen Sinne - aufzunehmen hat. Damit zeigt er die wichtigste Funktion des Rechts im demokratischen Staat. Ramon Xirau (1924), geboren in Barcelona/Spanien, kam 1939 mit seinem Vater, dem Philosophen Joaquin Xirau (1895 - 1946), nach Mexiko. Obwohl er einige Jahre lang an den Lehrveranstaltungen von José Gaos teilnahm, läßt sich sein Werk doch wohl am besten als Fortführung der Philosophie seines Vaters verstehen, die geprägt war durch einen spiritualistischen Humanismus mit christlichen Wurzeln, die wahrhaftige Sorge um das Leben und das Schicksal der Menschen und ein auf der spanischen Tradition der Institution Libre de Ensenanza beruhendes freiheitliches Denken. Die spätere Bekanntschaft Ramón Xiraus mit Erich Fromm scheint sich dagegen auf seine Schriften kaum ausgewirkt zu haben. Der Sohn hat in die von seinem Vater ererbte Richtung einige Änderungen eingebracht, darunter vor allem eine scheinbar bloß thematische: was sich beim Vater als eine Neigung für die Pädagogik darstellte, wird beim Sohn zu einer großen Vorliebe für die Literatur, im Sinne der Kritik, aber auch der
14
Einführung
poetischen Schöpfung. Diese Vorliebe hat schwerwiegende Folgen, denn sie führt den Autor zu der Überzeugung, daß sowohl die Poesie als auch die Philosophie nur Formen einer umfassenderen Erkenntnis sind, nämlich der religiösen. Weitere Änderungen ergeben sich aus dem persönlichen Umgang mit zeitgenössischen Autoren aus dem französischen Sprachbereich: Bergson, Lavelle, Mounier, Simone Weil, Teilhard de Chardin. Darüber hinaus hat Ramon Xirau im Zusammenhang mit seinem Interesse für das Heilige über Heidegger und Wittgenstein geschrieben; er hat eine kurze Geschichte der Philosophie veröffentlicht sowie Arbeiten über Klassiker wie Descartes oder Hegel und ein Buch über Ortega y Gasset verfaßt. Der christlich-existentialistische Denker Xirau, der Ortega näher steht als Heidegger, vertritt eine Form der vitalen Vernunft, die eine Vereinigung von Vernunft und emotionalem Leben, nämlich Leben im Glauben darstellt. Der Artikel Derecho, gente , libertad, persona wurde 1979 für einen vom Unionskongreß herausgegebenen Sammelband mit dem Titel Los Derechos Sociales del Pueblo Mexicano geschrieben. Er bietet einen Abriß der Vorläufer des Naturrechts von Hesiod bis zur griechischen Philosophie, des sozialen Denkens des Christentums, der Renaissance und der Entdeckung Amerikas, bis zu den Ursprüngen des Völkerrechts. Dies verbindet er mit der Entwicklung des politischen Denkens in Mexiko, bevor er andere Menschen- und Völkerrechte behandelt. Der Aufsatz endet mit Überlegungen zur Person und zur Freiheit. Xirau absolvierte sein Studium in Mexiko, verbrachte aber noch während seiner Ausbildung auch eine gewisse Zeit in Frankreich. In Mexiko widmete er sich schon in ganz jungen Jahren der Lehre der Philosophie. Er arbeitet derzeit am Institut für Philosophische Forschung der U N A M und ist seit 1973 Mitglied des Colegio Nacional. Auch Luis Villoro (1922) wurde in Barcelona geboren, allerdings als Kind mexikanischer Eltern, die schon bald darauf nach Mexiko zurückkehrten. Er verbrachte einige Jahre in Belgien, studierte dann aber Philosophie ausschließlich an der U N A M . Dort arbeitete er unter Anleitung von José Gaos, der auch seine Magister- und seine Doktorarbeit betreute. 1951 und 1952 besuchte er dann Seminare an den Universitäten von Paris und München. Nach seiner Rückkehr nach Mexiko widmete er sich fast ohne Unterbrechung der Lehre der Philosophie an verschiedenen Universitäten: In Guanajuato und Guadalajara und an den beiden öffentlichen Universitäten von MexikoStadt, der U N A M und der Autonomen Metropolitanen Universität. Heute arbeitet er noch immer am Institut für Philosophische Forschung. Seit 1978 gehört er dem Colegio Nacional an. Neben seiner Lehrtätigkeit hat Villoro eine außerordentliche Arbeit als Autor geleistet: Nach der Veröffentlichung von zwei Büchern über die Ideen-
Einführung
geschichte in Mexiko - über den Indigenismus und über die Revolution der Unabhängigkeit - begann er, seine philosophischen Essays, die einen von einer ganzen Generation mexikanischer Studenten geteilten intellektuellen Werdegang aufzeigen, in mehreren Bänden zu sammeln. Eine ganze Gruppe, die ihre Ausbildung unter dem Einfluß des Historizismus und der Phänomenologie begonnen hatte, erfuhr fast gleichzeitig die Wirkung des deutschen und des französischen Existentialismus. Auf dieser Grundlage entwarf sie dann das Projekt der Beschäftigung mit den Problemen der mexikanischen Situation. Nach seiner Rückkehr aus Europa nahm Villoro jedoch seine Arbeit über Husserl wieder auf. Außerdem veröffentlichte er ein Buch über Descartes, in dem er die strenge historische Interpretation mit der Analyse verband, um zu zeigen, daß Descartes mit seinen Thesen auf echte Probleme zu antworten versuchte und wie dies die spätere Entwicklung des Idealismus in Verwirrung stürzte. Ausgehend von den logischen und erkenntnistheoretischen Themen der Phänomenologie, war er inzwischen zum Studium des Empirismus und der analytischen Philosophie übergegangen. Dies zeigte sich zum ersten Mal in einem Aufsatz aus dem Jahr 1961 über La critica del positivismo lògico a la metafisica, der in seinem Buch Pàginas Filosóficas enthalten ist. Das ausgereifte Ergebnis dieser neuen Unternehmung von Villoro ist jedoch sein 1982 erschienenes Buch Creer, saber, conocer. In diesem Buch, das von der Sprachanalyse ausgeht, will er Begriffe präzisieren und logisch-systematische Beziehungen zwischen ihnen herstellen. Die Systematisierung ihrerseits führt einen zurück auf die Werte des Individuums und der Gesellschaft, in die dieses Individuum eingebunden ist. Zur gleichen philosophischen Strömung gehört der Aufsatz Del concepto de ideologia, der aus einem später veröffentlichten Buch stammt. Es handelt sich bei diesem Aufsatz um eine Begriffsanalyse, die es geboten erscheinen läßt, auf Marx und Engels zurückzugehen, ohne sich von der späteren marxistischen Literatur vereinnahmen zu lassen, um die genaue Bedeutung des Begriffs wiederzufinden und eine theoretisch nützliche Definition zu geben. Einige Jahre nach Villoro kam Fernando Salmerón (1925), der an der Universität von Veracruz in Xalapa Rechtswissenschaft studiert hatte, an die U N A M , um dort - ebenfalls unter der Anleitung von José Gaos - ein Studium der Philosophie aufzunehmen. Anschließend belegte er Seminare in Deutschland, an der Universität von Freiburg, und verbrachte eine kurze Zeit in Paris. Schon früh begann er zu lehren, zunächst in Xalapa, wo er 1956 die Fakultät für Philosophie und Geisteswissenschaften organisierte und von 1961 bis 1963 als Rektor der Universität von Veracruz tätig war. Danach ging er nach Mexiko-Stadt, ans Institut für Philosophische Forschung der U N A M , dessen Direktor er von 1966 bis 1978 war. Anschließend übernahm er das Amt des Rektors an der Autonomen Metropolitanen Universität, das er von 1979 bis 1981 innehatte, bis er an die U N A M zurückkehrte. 1972 wurde er Mitglied des Colegio Nacional.
16
Einführung
Die ersten Veröffentlichungen von Salmerón waren Aufsätze über Ideengeschichte in Mexiko sowie über Fragen der philosophischen Ausbildung und Lehre, die er später in einem Band sammelte, und ein Buch über Ortega y Gasset, das unter der Leitung von José Gaos entstand und 1959 erschien. Auch in späteren Jahren schrieb er über diese Themen - über die Philosophie in Mexiko und Spanien sowie über Bildungsfragen - , ohne daß diese Arbeiten bisher in Buchform erschienen wären. Gleichzeitig aber hat er in seinen Veröffentlichungen das Interesse an jenen Autoren beibehalten, deren Texte er in den ersten Jahren seiner Ausbildung kennengelernt hatte: Hegel, Husserl und Heidegger. Ähnlich wie bei anderen Kollegen zeigen seine Arbeiten über Phänomenologie aus den 60er Jahren - angefangen mit einem Aufsatz über Lenguaje y significado en ,ΕΙ ser y el tiempo' de Heidegger, der 1968 in dem Jahrbuch Diânoia erschien - eine Verlagerung des Interesses auf Themen und Methoden der analytischen Philosophie. Ein zweiter Band mit Aufsätzen, der 1972 veröffentlicht wurde, enthält seine Überlegungen zum Begriff der Philosophie, zur philosophischen Forschung und zur Ethik. Auf der Grundlage dieser Überlegungen hat er sich in den letzten Jahren mit verschiedenen Fragen der Moralphilosophie und der Philosophie der Erziehung beschäftigt, dies allerdings aus einer immer weiteren Perspektive, die weder verleugnet, was er in den Jahren der Ausbildung gelernt hat, noch auch auf den Umgang mit zeitgenössischen Autoren verzichtet. Der Aufsatz, der im vorliegenden Sammelband veröffentlicht wird, ist eine 1986 erstmals gedruckte Arbeit über Hegel, die sich eng an den Text Hegels hält und ihn präzise nachzeichnet, ohne ihn aus dem historischen Kontext zu reißen, die aber die heutigen Probleme trotzdem erahnen läßt. Der einzige der Autoren dieses Buches, der nicht die mexikanische Staatsbürgerschaft besitzt, ist Alejandro Rossi, geboren 1932 in Florenz und noch immer venezolanischer Staatsbürger, obwohl er schon seit 1951 in Mexiko lebt. Er ist zwar jünger als die beiden vorhergehenden Autoren, erhielt aber eine sehr ähnliche Ausbildung. Er studierte in Mexiko unter José Gaos Philosophie und ging dann nach Deutschland, wo er sich an der Universität Freiburg einschrieb und Seminare von Heidegger belegte. Nach seiner Rückkehr arbeitete er zunächst an der Fakultät für Philosophie und Geisteswissenschaften der Universität von Veracruz und ging dann, nur kurze Zeit später, nach Mexiko-Stadt, ans Institut für Philosophische Forschung der U N A M . Nach einigen Jahren ging Rossi dann erneut nach Europa, diesmal nach Oxford, wo er bei G. Ryle und P. Strawson hörte. Nach seiner Rückkehr trug er mehr als jeder andere dazu bei, der philosophischen Forschung in Mexiko eine neue Orientierung zu geben. Er war auch der treibende Faktor für die Zeitschrift Critica. Revista Hispanoamericana de Filosofia, die er zusammen mit Villoro und Salmerón herausgab. Die Zeitschrift erschien erstmals 1967 und besteht auch heute noch als eine Zeitschrift für Wissenschaftsphilosophie und analytische Philosophie im weitesten Sinne.
Einführung
Rossi hat seine frühen Aufsätze - über Descartes, Hegel und Husserl - nie in einem Buch gesammelt. Sein erster Aufsatz über Wittgenstein erschien jedoch 1963 in Diänoia, dem Jahrbuch des Instituts für philosophische Forschung, und wurde 1969 aufgenommen in Lenguaje y significado, einen Band zur philosophischen Semantik, in dem Themen vom frühen Husserl über Bertrand Russell, Wittgenstein, Strawson bis Quine behandelt werden. In den letzten Jahren hat Rossi diese Thematik völlig aufgegeben. Stattdessen betreibt er jetzt eine sehr freie Art der nicht nur philosophischen, sondern sogar literarischen Essayistik. Er geht damit so weit, daß er 1978 in einem seiner Bücher Essay und Erzählung mit ausschließlich stilistischem Zweck nebeneinander stellt. Die Arbeit von Rossi, die hier aufgenommen wurde, war ein Vortrag über die öffentliche Gestalt von Ortega y Gasset, den er zum einhundertsten Jahrestag gehalten hat. Es ist eine Verteidigung dieses Denkers, der zwar nicht auf eine kritische Haltung verzichtet, der sich jedoch in völliger Unabhängigkeit von den didaktischen Zwängen der akademischen Welt mit den Problemen seines Gemeinwesens und gleichzeitig auch mit der Literatur beschäftigt. Ulises Schmill (1937) erhielt seine Ausbildung zunächst an der Juristischen Fakultät der U N A M , vor allem bei mexikanischen Juristen, insbesondere bei dem Verfassungsrechtler Antonio Martinez Baez. Später stieß er zu der Gruppe derjenigen, die - angezogen von der Persönlichkeit von Guillermo Héctor Rodriguez, einem anderen mexikanischen Professor, der in der Juristischen Fakultät großen Einfluß besaß - einer vom Neokantianismus ausgehenden bestimmten Kelsen-Interpretation anhingen. Schmill belegte außerdem an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der U N A M Seminare in Physik und Mathematik. Eine Zeit lang lehrte er Jura und gehörte dem Institut für Juristische Forschung an. Er bekleidete verschiedene diplomatische Ämter - als Botschafter in Wien und Bonn - und erlangte so hohes Ansehen als praktischer Jurist, daß er heute Richter am Obersten Gerichtshof ist. Bis auf einen ersten Band zum Verfassungsrecht veröffentlichte er erst ziemlich spät in Buchform, aber sowohl seine Bücher als auch seine Aufsätze, insbesondere die über Rechtsphilosophie und Logik, belegen seine philosophische Entwicklung und die Vielfalt seiner intellektuellen Interessen. Seine Arbeiten über Kelsen in einem 1984 zusammen mit Roberto J. Vernengo veröffentlichten Band sind nicht nur eine Auslegung der Werke Kelsens, sondern bieten auch eine Reihe anderer Perspektiven, wie zum Beispiel einen Vergleich mit Themen der Soziologie Webers, der Analogien hinsichtlich des Ursprungs von Werten und Normen aufzeigt, einen Vergleich mit Austin und seinem Gebotsgedanken, oder auch eine - gegen Dworkin gerichtete - Verteidigung der Methode Kelsens, die aus sich selbst heraus in der Lage sei, Schwierigkeiten mit der Theorie der Interpretation oder mit der These Harts von der offenen Struktur des Rechts zu überwinden. Ein anderes Buch Schmills mit dem Titel La conducta del jabali enthält zwei Aufsätze über die 2 Olivé/Salmerón
18
Einführung
Macht, die mit ungewöhnlichen Methoden verfaßt sind. Ausgehend vom intuitiven Verständnis literarischer Schöpfungen versucht der Autor, dies mit Hilfe Max Webers und der Psychologie Skinners auf Begriffe der Soziologie und Politik zu übertragen. Anhand einer Erzählung von Kafka untersucht er zunächst Fragen im Zusammenhang mit Strafe und Macht des Staates. Im zweiten Teil untersucht er Macbeth und andere Werke Shakespeares, um das Verhalten der Mächtigen beim Machtmißbrauch zu erklären. Die in die vorliegende Anthologie aufgenommene Arbeit von Schmill beschäftigt sich mit dem Begriff des Sollens und versucht zu zeigen, daß die von Kelsen diesem Begriff zugeschriebenen Funktionen sich problemlos aus dem Begriff des Gebots ableiten lassen, sofern man diesen im Sinne des Behaviorismus von Skinner versteht und sich bewußt macht, daß die Eigenschaften, die Kelsen hervorhebt, nichts weiter sind als Betonungen bestimmter Elemente des Modells von Skinner. Es geht dabei um eine Begriffsanalyse, etwa darum, die möglichen Beziehungen zwischen einer Reihe normativer Begriffe festzustellen: unrechtmäßiges Verhalten und Strafe, Bedingungen für die Durchführung der Strafe, Befugnis und Derogation. Das Charakteristische an der Arbeit von Schmill ist aber, daß diese Analyse aus der Perspektive der empirischen Verhaltenstheorie vorgenommen wird. Dies erlaubt es ihm schließlich, die Dualität Sein-Sollen als letzte kategoriale Unterscheidung abzulehnen, nicht aber als Unterschied zwischen verschiedenen Standpunkten, in diesem Fall also zwischen der inneren Analyse des Gebots und seiner bestimmenden Begriffe und dem synthetischen Vorgehen, das von der Erfahrung ausgeht. Javier Esquivel (1941) studierte Rechtswissenschaft an der U N A M , verbrachte anschließend einige Zeit in München und Cambridge und arbeitete nach seiner Rückkehr als Dozent an der Juristischen Fakultät. Später absolvierte er ein Studium der Philosophie, ebenfalls an der U N A M , und trat ins Institut für Philosophische Forschung ein. In den ersten Jahren seines Jurastudiums arbeitete er eng mit Rafael Preciado Hernandez zusammen, dem damals bedeutendsten Vertreter der neoscholastischen Rechtsphilosophie in Mexiko. Später gehörte er zur Gruppe der Neukantianer, zusammen mit anderen Altersgenossen: Leandro Azuara, Ulises Schmill, Agustin Pérez Carrillo und Rolando Tamayo. Gegen Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre interessierte er sich dann aber für die Entwicklungen auf dem Gebiet der analytischen Philosophie in Ethik und Recht und wurde zu einem der Hauptbindeglieder zwischen den Professoren der beiden Fakultäten und den Mitgliedern des Instituts für Philosophische Forschung. Zweifellos hängt der Beginn dieser Kontakte insbesondere, wenn auch nicht ausschließlich, mit den wiederholten Besuchen - und in einem Fall sogar einem mehrjährigen Aufenthalt - einer Gruppe argentinischer Rechtsphilosophen zusammen. Im Jahre 1967 legte das Institut für Philosophische Forschung ein Programm für Gastprofes-
Einführung
19
suren für die Dauer von jeweils einem Tri- bzw. Semester auf, um sich auf den Gebieten der Wissenschafts-, Sprach-, Rechts- und Moralphilosophie zu verstärken. Von den Rechtsphilosophen kam als erster Ernesto Garzón Valdés, der später - dann auf gemeinsame Einladung des philosophischen mit dem Institut für Juristische Forschung - seinen Besuch noch zweimal wiederholte. Anschließend kam Carlos Alchourrón, der ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt auf Einladung beider Institute noch einmal wiederkam. Außerdem erfolgten gelegentliche Besuche von Jorge Bacqué, Eugenio Bulygin und Carlos Nino. Über einen längeren Zeitraum blieb Roberto J. Vernengo, der mehrere Jahre lang an der Autonomen Metropolitanen Universität arbeitete und dabei immer mit dem Institut für Juristische Forschung in Verbindung war, bis er nach Buenos Aires zurückging, nachdem sein Land zur Demokratie zurückgekehrt war. Wie im Fall von Schmill und von Tamayo, von dem als nächstes die Rede sein wird, gibt es in der Arbeit von Esquivel einen gewissen Orientierungswechsel, der ohne das soeben Erwähnte nicht zu erklären wäre. A m Institut für Philosophische Forschung schrieb Esquivel sein erstes Buch über Formalismus und Realismus in der Rechtstheorie, das eine kritische Darstellung der großen Probleme der Disziplin auf dem Gebiet der Analyse der Grundbegriffe des Rechts auf der Basis eines Vergleichs der Auffassungen von Kelsen und von A l f Ross ist. Neuerdings hat er zusammen mit Armando Morones ein Buch über technische Fragen des Gebrauchs der Kernenergie veröffentlicht, in dem er auch moralische und politische Probleme erörtert. In seinen ungesammelten Aufsätzen ist Esquivel immer wieder auf die Problematik der Werturteile, der Imperative, des moralischen Relativismus und des Rechtspositivismus eingegangen, wobei für letzteres Kelsen den paradigmatischen Fall darstellt, dessen Thesen kritisiert werden. Der traditionelle Dualismus Sein-Sollen und seine Beziehung zu anderen, benachbarten Unterscheidungen wurde von Esquivel mit besonderer Aufmerksamkeit untersucht. Er suchte dabei einen Weg zu einer objektiven und verfeinerten Auffassung, die auf moralischem Gebiet selbst in den schwierigsten Fällen, die als Wertkonflikte bzw. als Dilemmas auftreten, rationalen Argumenten Raum geben könnte. Das Problem eines moralischen Dilemmas stellt er am Beispiel des Tyrannenmords in einem 1979 in der Zeitschrift Critica veröffentlichten Aufsatz dar, den wir für diesen Sammelband ausgewählt haben. Die Ausbildung von Rolando Tamayo y Salmorân (1944) begann, wie die von Esquivel, an der Juristischen Fakultät der U N A M , ging dann aber andere Wege. Die mexikanischen Professoren, bei denen er anfänglich lernte, waren Mario de la Cue va und Héctor Fix-Zamudio. Erst später näherte er sich der Gruppe der Neukantianer an, interessierte sich für das Thema der allgemeinen Rechtstheorie und belegte einzelne Seminare an der Philosophischen Fakultät, insbesondere über Philosophiegeschichte. A n der Universität Straßburg 2*
20
Einführung
erwarb er später ein Diplom in Vergleichender Rechtswissenschaft, in Paris den Doktortitel. Anschließend verbrachte er ein Jahr in Oxford - im Umfeld von Hart, Raz und Dworkin - und ein weiteres Jahr am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz. Er lehrt derzeit an der Juristischen Fakultät und ist Mitglied des Instituts für Juristische Forschung der U N A M . Die Hauptfrage im Werk von Tamayo ist der Prozeß der Rechtserzeugung. Dies ist sein Hauptthema seit seiner Dissertation von Paris, aus der 1976 sein erstes Buch hervorging. Ausgehend von diesem Prozeß wirft Tamayo Fragen hinsichtlich der Verfassung und der Rechtsordnung auf, die auch die Themen seines drei Jahre später veröffentlichten zweiten Buches mit dem Titel Introduction al estudio de la Constitution ausmachen. Seine weiteren Arbeiten Bücher wie Aufsätze - lassen sich in zwei Gruppen einteilen: die einen sind im weitesten Sinne historischen Fragen gewidmet; die anderen behandeln begriffliche Fragen des Rechts und des Staates, zum Beispiel Norm und Normenkonflikt, Rechtssystem und Kriterien der Identität von Rechtssystemen, Rechtsbeziehung, Autorität und Legitimität. Häufig überschneiden sich historische Fragen und die Untersuchung der Rechtsbegriffe, wie in dem Buch La Jurisprudencia y la formation del ideal politico . Una introduction histórica a la ciencia juridica , das die westliche Rechtstradition der Antike, das Erbe der römischen Jurisprudenz im Mittelalter und seinen Beitrag zur Bildung der modernen politischen Theorie behandelt. Manchmal betrachtet er jedoch historische Themen auch unabhängig vom Recht, wie in La Universidad, epopeya medieval , einem Buch von 1987. Der hier abgedruckte Aufsatz von Tamayo ist eine zusammengefaßte Version von Kap. V I I I seines zweiten Buches, das die Rechtsordnung und ihre Verfassung behandelt und den vielsagenden Untertitel trägt „Kurze Beschreibung des Prozesses der Rechtserzeugung". Die aufgeworfenen Probleme werden angegangen auf der Grundlage eines Begriffs der Rechtsordnung, der die Interdependenz von zwei Elementen voraussetzt: einem normativen, nämlich jede Art von Gesetzen und Urteilen, und einem faktischen, das aus den Akten der Erzeugung und der Anwendung des Rechts besteht. Carlos Pereyra (1940 - 1988) studierte an der Philosophischen Fakultät der U N A M und blieb dort nach Beendigung seines Studiums als Dozent. Seine engsten akademischen Lehrer waren Ricardo Guerra - ein Schüler von Gaos, der damals über Phänomenologie und Existentialismus, vor allem über Heidegger und Sartre, las - und Adolfo Sanchez Vazquez, einer der jüngsten aus der Gruppe der spanischen Exilanten, der über Marxismus las. Pereyra arbeitete außerdem schon sehr früh als Journalist, mit sehr viel Sinn für die unmittelbare Realität, und ein großer Teil seines Werks findet sich verstreut in Zeitungen und politischen Zeitschriften. In seinem ersten Buch, einer Untersuchung über die Gewalt als politisches Phänomen, spricht er sich gegen die Vorurteile des Radikalismus und für eine
Einführung
Veränderung der Gesellschaft in einem demokratischen Prozeß aus. Einige Jahre später veröffentlicht er Configuraciones: teoria e historia, eine Sammlung von entschieden antidogmatischen Aufsätzen, die sich aber trotzdem als Bemühen um die Aneignung der marxistischen Theorie darstellt, welche zwar als Theorie noch nicht abgeschlossen ist und daher der weiteren Entwicklung bedarf, die aber den notwendigen Ausgangspunkt für einen Fortschritt in der Erklärung des gesellschaftlichen Prozesses darstellt. Das Material für sein drittes Buch über theoretische Probleme der Gesellschaft und der Geschichte liefern Pereyra zunächst Sartre und Althusser, dann Gramsci, später der Dialog mit den Klassikern der politischen Theorie und ganz allgemein mit zeitgenössischen Autoren englischer Sprache - wie etwa Miliband - , die vom Marxismus kommen oder einfach Themen behandeln, die der Marxismus nicht hinreichend untersucht hat - sie alle diskutiert Pereyra mit großer geistiger Offenheit. Das Subjekt der Geschichte, Freiheit und Notwendigkeit, Kausalität und Erklärung in der Geschichte, Staat, zivile Gesellschaft und Demokratie sind einige der Themen dieses 1984 publizierten Buches des reifen Autors. Man kann sagen, daß bis zu diesem Zeitpunkt die genannten Autoren und Themen - wenn auch in ganz groben Zügen - die intellektuelle Entwicklung eines Autors nachzuzeichnen erlauben, der repräsentativ ist für eine philosophische Generation, die gegen Ende der 60er Jahre ihre Ausbildung an mexikanischen Universitäten begann. Dem ist hinzuzufügen, daß es sich um einen Autor handelt, der wie kein anderer zur Orientierung seiner eigenen Generation beigetragen hat. In den Jahren nach 1984 wurde das Spektrum der untersuchten Autoren und selbstverständlich der Radius der intellektuellen Beeinflussung in den Schriften Pereyras noch größer. Nach wie vor betont er aber die Notwendigkeit, für die Tradition des sozialistischen Denkens das zentrale Thema der Demokratie, das der politischen Rechte und der individuellen Freiheiten, und das nicht weniger wichtige des Pluralismus wiederzugewinnen. Er bezieht sich dabei auf Autoren wie Kelsen und Bobbio. Der hier wiedergegebene, bisher unveröffentlichte Aufsatz ist eine kritische Überprüfung der Theorie der Gerechtigkeit von Rawls unter dem Gesichtspunkt ihres möglichen Nutzens im Hinblick auf die realen Probleme, die sich die politische Theorie stellt. Pereyra beharrt darauf, daß das Unternehmen von Rawls trotz der späteren Berichtigungen auf der Ebene der bloßen moralischen Reflexion verbleibt und die konfligierenden gesellschaftlichen Interessen sowie mögliche Verhandlungsmechanismen ignoriert. Es erfüllt daher nicht die Anforderungen, die seine Aufnahme in die soziale Praxis voraussetzen würde und ist im Grunde nichts weiter als die Rekonstruktion der herrschenden moralischen letztendlich ideologischen - Überzeugungen einer gegebenen Gesellschaft. Anders als Pereyra, studierte León Olivé (1950) anfangs nicht an der philosophischen Fakultät der U N A M und auch nicht, wie Esquivel und Tamayo,
22
Einführung
an der juristischen, sondern an der naturwissenschaftlichen, wo er einen Abschluß in Mathematik erwarb. Erst später kam er als Stipendiat zum Institut für Philosophische Forschung und nahm ein Studium der Philosophie auf, da er sich für die Probleme der Logik und der Philosophie der Mathematik interessierte. In jenen Jahren arbeitete er eng mit zwei Forschern des Instituts zusammen: mit Roberto Caso Bercht und dem Uruguayer Mario Otero, der sich damals aufgrund der politischen Krise in seinem Heimatland in Mexiko niedergelassen hatte. Anschließend - nachdem sich sein Interesse schon auf die Philosophie der Wissenschaft im allgemeinen ausgedehnt hatte - absolvierte er an der Universität von Oxford unter der Betreuung von Rom Harré ein Promotionsstudium. Gegen Ende seines Aufenthaltes in Oxford konzentrierte sich seine Aufmerksamkeit auf die Sozialwissenschaften, insbesondere auf die erkenntnistheoretischen Probleme der Theorien der politischen Soziologie. Über diesen Bereich schrieb er seine Dissertation, die von John Torrance betreut wurde. Seine nachfolgenden Publikationen sollten die Spuren anderer Lehrer aus Oxford zeigen: Steven Lukes, Roy Bhaskar und Charles Taylor. Nach seiner Rückkehr nach Mexiko trat er als Dozent in die Autonome Metropolitane Universität und später ins Institut für Philosophische Forschung der U N A M ein, dessen Direktor er augenblicklich ist. Das erste Buch von Olivé, eine überarbeitete Fassung seiner Dissertation von Oxford, mit dem Titel Estado, legitimación y crisis untersucht die Theorien von Miliband, Poulantzas und Haberinas über den kapitalistischen Staat. Die Untersuchung will aufzeigen, auf welche Weise die soziologischen Theorien Vorstellungen von der Natur wissenschaftlicher Erkenntnis und von der gesellschaftlichen Realität voraussetzen, und erklären, wie diese Voraussetzungen die Substanz der Theorien beeinflussen. Diese Linie erkenntnistheoretischer Interessen behält er in seinen Aufsätzen bei, die in Sammelbänden zusammengefaßt oder in Fachzeitschriften verstreut veröffentlicht sind, wobei sie aber zwei Dimensionen erhält: die wissenssoziologische Analyse und das Problem des wissenschaftlichen Realismus. Sein jüngstes Buch - ConocimientOy sociedad y realidad - vereint diese beiden Dimensionen in dem Bemühen, auf kohärente Weise eine soziale Theorie des Wissens mit einer realistischen Position in der Erkenntnistheorie zu verknüpfen, was einerseits ein umfassenderes Programm der sozialen Theorie und andererseits die Überprüfung zentraler Begriffe wie Wahrheit und Objektivität verlangt. Aus dieser neuen Perspektive hat Olivé auch erneut verschiedene Themen der praktischen Philosophie behandelt, wie zum Beispiel den Vorschlag von Habermas zur Legitimation. Der Titel des im vorliegenden Band abgedruckten Aufsatzes - Racionalidad y legitimación politica - gehört in diesen Zusammenhang. Mit den vorstehenden Angaben zu den Autoren dieses Sammelbandes verbindet sich in erster Linie das Bemühen, den ständigen Austausch ihrer Arbeit mit dem internationalen philosophischen Leben zu unterstreichen. Es handelt
Einführung
sich um Wechselwirkungen, Affinitäten und Aneignungen, die innerhalb dieses reichen und komplexen Geflechts ihren Sinn erhalten. Daneben stand die Absicht, die Kontinuität in der Arbeit der einzelnen Institutionen, die Beziehung zwischen den Generationen und zwischen Lehrern und Schülern hervorzuheben. Dazu muß man jedoch sagen, daß es sicher unmöglich ist, diesen Absichten mit so wenigen Angaben gerecht zu werden. Es konnte hier nur eine Momentaufnahme geboten werden, die mit der Nennung einzelner Namen nur unvollkommen die Kontinuität einer zumindest seit dem zweiten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts nicht mehr unterbrochenen Arbeit erahnen läßt, deren beträchtlicher Reichtum sich nur bei einer tiefergehenden Betrachtung zeigen würde. Genannt werden konnten nur wenige - wenn auch die am meisten aktiven - Institutionen, nur ein paar - wenn auch vielleicht die langlebigsten - philosophischen Fachzeitschriften, nur einige Lehrer, deren Spur sich bei dem einen oder anderen der zwölf Autoren finden läßt. Und auch diese Autoren bilden nur eine Auswahl aus einer größeren Gruppe, die im Laufe der Jahre über die genannten Themen geschrieben hat. Die thematische Einschränkung hat gewiß das größte Gewicht. Mit anderen Gebieten als Auswahlkriterium wäre man zu einer ganz anderen Autorenliste gekommen. Bestimmte Kraftlinien in der philosophischen Orientierung wären jedoch, neben den lokalen Traditionen des Landes und der spanischen Sprache, die gleichen geblieben. Ebenso, wie sich beispielsweise in der Lehre der Philosophie ein Wandel vollzog von der Konzentration auf Hegel und die Phänomenologen zu einer Vorliebe für Marx und die Meister der Skepsis, so kann man auch in den Veröffentlichungen in Büchern und Zeitschriften die allmähliche Aufgabe der ganz strengen Positionen des Marxismus und der analytischen Philosophie der 60er Jahre hin zu neuerdings flexibleren und toleranteren Positionen beobachten. Gleichfalls wären die Spuren der beiden Exile sichtbar geblieben: des Exils der spanischen Flüchtlinge, von denen der größte Teil nie wieder in sein Herkunftsland zurückkehrte und die ein dauerhaftes Werk in Mexiko hinterließen, und des zahlenmäßig geringeren und nur relativ kurze Zeit dauernden Exils der Argentinier und Uruguayer, dessen noch nicht ganz aufgegangene Früchte gerade erst in ihrem Wert erkannt zu werden beginnen. Die im vorliegenden Band gesammelten Aufsätze bieten daher, wie schon eingangs gesagt, trotz aller Einschränkungen einen aktuellen Überblick über die philosophischen Aktivitäten in Mexiko. Fernando Salmerón Mexiko-Stadt
I . Das Rechtssystem und seine Struktur
Recht, Verfassung und Demokratie Von Héctor Fix-Zamudio I. Einleitung 1. In dieser Arbeit geht es um einige Fragen bezüglich der Funktion des Rechts im modernen demokratischen Staat, der häufig einfach mit dem Vorherrschen von Legalität gleichgesetzt und deswegen von gewissen anderen Sozialwissenschaftlern mit Mißtrauen betrachtet wird, die angesichts der Erfahrung mit dem liberalen und individualistischen Rechtsstaat in rechtlichen Instrumenten nur eine Menge formaler Erklärungen sehen, die sich in vielen Aspekten von der sozialen Wirklichkeit entfernen. 1 2. Auf die Geringschätzung des Rechts im heutigen politischen und gesellschaftlichen Leben hat auch die ursprüngliche Auffassung des MarxismusLeninismus einen Einfluß, nach der im Phänomen des Rechts ein einfacher Überbau auf der Basis des Wirtschaftssystems der jeweiligen Gesellschaft zu sehen ist, der als Instrument zum Schutz der Interessen der herrschenden Klassen benutzt wird. Dies ist jedoch ein traditionelles Kriterium, das mit den Prinzipien der sogenannten „sozialistischen Legalität" überwunden wurde. 2 3. Diese Situation der Unklarheit über die Rolle des Rechts in Aufbau und Entwicklung der politischen Systeme unserer Zeit fand ihren Ausdruck auch bei den Juristen selbst, die in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg besonders in Europa, und speziell in den Ländern, die die faschistische bzw. nationalsozialistische Diktatur erlitten hatten, das Vorliegen einer „Krise des Rechts" behaupteten.3 Diese Krise wurde aber mit der Zeit überwunden, und heutzutage wird anerkannt, daß das Recht eine instrumentelle Funktion für die Errichtung eines wirklich demokratischen Systems besitzt. Es wird daraufhin zum Bereich der Sozialwissenschaften gezählt.4 1 Vgl. die Untersuchung der Beziehungen zwischen Rechtstheorie und Gesellschaftstheorie in: Peter Stein und John Sand, I valori giuridici della civiltà occidentale, Mailand 1981,7-45. 2 Vgl. u. a. die scharfe Analyse von Konstantin Stoyanovitch, E l pensamiento marxista y el derecho, wo auch die vorangegangene Entwicklung untersucht wird; siehe auch den Aufsatz des Spaniers Antonio Hernàndez Gil, El marxismo y su significación j uridica, in: ders., Marxismo y positivismo lògico. Sus dimensiones juridicas, Madrid 1970, 13 - 68. 3 Vgl. die klassischen Untersuchungen von Giorgio Balladore Pallieri , Piero Calamandrei u. a., La crisi del Diritto, Padua 1953.
28
Héctor Fix-Zamudio
4. Ich möchte andererseits klarstellen, daß die folgenden Überlegungen aus einem normativen Blickwinkel angestellt werden, der hier als einziger untersucht werden kann - natürlich ohne damit die Beiträge anderer sozialwissenschaftlicher Disziplinen und insbesondere die der Politikwissenschaft ignorieren zu wollen - , da hier nur der bescheidene Anspruch erhoben wird, einige wenige Aspekte aufzuzeigen, unter denen eine Verbindung zwischen rechtlichen Instrumenten, besonders den in modernen Verfassungen verankerten, und dem demokratischen System unserer Zeit besteht. I I . Ein vorläufiger Demokratiebegriff aus einem normativen Blickwinkel 5. Einen Begriff der Demokratie zu definieren oder auch nur zu beschreiben, ist so gut wie unmöglich, da das Wort mit den unterschiedlichsten Bedeutungen und Nuancen und aus den unterschiedlichsten Perspektiven gebraucht worden ist, seit die Griechen ihre Überlegungen zu politischen Systemen aufnahmen und besonders seit Aristoteles den Versuch einer Charakterisierung des demokratischen Regimes seiner Zeit anstellte.5 6. Auf der anderen Seite handelt es sich um einen jener Begriffe, die emotiv geladen sind und deswegen gelegentlich widersprüchlichen Interpretationen unterliegen, wie dies auch mit einem anderen, eng damit verbundenen Wort der Fall ist: dem der Verfassung, das sich aufgrund seines axiologischen Charakters in einer ähnlichen Situation befindet, wie der mexikanische Rechtswissenschaftler Rolando Tamayo y Salmorân hervorgehoben hat. 6 7. Zudem hat die Demokratie verschiedene Bedeutungen, denn sie ist, wie die klassische Untersuchung von Carl J. Friedrich zeigt, 7 nicht nur als eine politische Form, also als Staats- oder Regierungsform, aufzufassen, sondern auch als eine Lebensform - ein Aspekt, der in Artikel 3 der mexikanischen Verfassung angesprochen wird; 8 sie ist aber auch als eine Sehnsucht anzusehen, als ein Ideal, auf das in den modernen Verfassungen mit Hilfe programmatischer Prinzipien hingewiesen wird. 9 4
Über die Zugehörigkeit der Rechtswissenschaft zu den Sozialwissenschaften vgl. Héctor Fix-Zamudio, Reflexiones sobre la investigación juridica, in: ders., Ensayos sobre metodologia, docencia e investigación juridicas, Mexiko-Stadt 1981, 78 - 85. 5 Vgl. Aristoteles, Politik, sowie: Der Staat der Athener. 6 Rolando Tamayo y Salmorân, Introducción al estudio de la Constitución, MexikoStadt 1979, Band I , bes. 173 - 181. 7 Carl J. Friedrich, Demokratie als Herrschafts- und Lebensform, Heidelberg 1959. 8 Teil I, Abschnitt a) dieses Verfassungsartikels bezieht sich auf die Ausrichtung der öffentlichen Erziehung und bestimmt: ,,a) Sie soll demokratisch sein, wobei Demokratie nicht nur als eine Rechtsstruktur und ein politisches System aufzufassen ist, sondern als eine Lebensform, die auf der ständigen ökonomischen, sozialen und kulturellen Besserstellung des Volkes beruht . . . "
Recht, Verfassung und Demokratie
29
8. Friedrich selbst betonte, daß es verschiedene Formen der Demokratie gibt. 1 0 Dem läßt sich hinzufügen, daß jede von ihnen Nuancen und Eigenarten besitzt, die manchmal sehr subtil und daher nur schwer feststellbar sind. 9. Innerhalb dieser Formen, die nichts anderes sind als verschiedene Varianten ein und desselben generischen Begriffs Demokratie, hat man von politischer Demokratie, sozialer Demokratie und ökonomischer Demokratie gesprochen, die - zumindest in unserer Zeit - nicht unabhängig voneinander existieren können. 11 10. Um die Dinge noch mehr zu komplizieren, dürfen wir nicht vergessen, daß man heutzutage von mindestens zwei Grundkategorien von Systemen spricht, die - mit oder ohne Recht - als demokratisch angesehen werden, nämlich von derjenigen der sogenannten westlichen oder bürgerlichen Demokratie 12 und von derjenigen der sogenannten sozialistischen oder Volksdemokratie, 13 wobei zu beachten ist, daß innerhalb der zweiten Gruppe verschiedene Ordnungen existieren, die sich in ihren Grundgesetzen ausdrücklich dieser Bezeichnung bedienen, wie z.B. die Deutsche Demokratische Republik, die Demokratische Volksrepublik Korea und die Demokratische Republik Vietnam. Daneben gibt es ein ganzes Spektrum von Verfassungsordnungen von Entwicklungsländern, die sich diesen beiden Grundmodellen annähern wollen, welche für ihre jeweilige demokratische Konnotation Exklusivität beanspruchen. 11. Unter diesen Aspekten der Demokratie läßt sich auch ein rechtlicher Blickwinkel ausmachen, womit aber keineswegs das System einer rein formalen Demokratie angesprochen ist, die von politischen, sozialen und ökonomischen Aspekten zu trennen wäre, denn es geht hier vielmehr um die Gesamtheit von Rechtsinstrumenten, die den anderen Aspekten den Weg ebnen und ihre Entwicklung gestatten. Es ist dieser normative Sektor, der von einem tra-
9 Vgl. u. a. die klassische Arbeit von Ve zio Crisafulli, La Costituzione y le sue disposizione de principio, Mailand 1962, 32ff. 10 Friedrich, zit. Anm. 7, 28 - 36. 11 Eine Kombination all dieser Formen kann zu dem führen, was Charles Debbasch in seinem Buch L'Etat civilisé, Paris 1979, 4 7 - 7 6 , als „ausgewogene politische Institutionen" bezeichnet hat; zur sogenannten sozialen und wirtschaftlichen Demokratie vgl. Juan Ferrando Badia, Democracia frente autocracia, Madrid 1980, 79 - 159. 12 Zu den Charakteristiken und Unterschieden von westlichen Demokratien und denen der sozialistischen Welt vgl. u. a. die klassische vergleichende Untersuchung des bekannten deutschen Rechtswissenschaftlers Karl Loewenstein, Constituciones y derecho constitucional en Oriente y Occidente, in: Revista de Estudios Politicos (Madrid) 164 (März - April 1969), 5 - 34; vgl. außerdem die tiefgründige vergleichende Untersuchung westlicher Verfassungsordnungen des Italieners Paolo Biscaretti di Ruffìa, Introduzione al diritto costituzionale comparato, Mailand 51984, 129 - 350. 13 Zu den Charakteristiken der sogenannten sozialistischen Demokratien vgl. auch Loewenstein, zit. Anm. 12, 34 - 52, sowie Biscaretti di Ruffìa, zit. Anm. 12, 320 - 463, wo auch die allerneuesten sozialistischen Verfassungen behandelt werden.
30
Héctor Fix-Zamudio
ditionellen Standpunkt aus mit der deutschen Bezeichnung Rechtsstaat 14 bzw. der angelsächsischen Rule of Law 15 gemeint ist, wobei diese Bezeichnungen selbstverständlich nicht als statische, sondern als außerordentlich dynamische Begriffe aufzufassen sind, die in unserer Zeit die strikt formale Struktur des nach der Bezeichnung des bekannten Verfassungsrechtlers Paolo Biscaretti di Ruffìa 16 - sogenannten klassisch-demokratischen Staates überwunden haben und zum sozialen Rechtsstaat bzw. zum Weif are State geworden sind. 17 12. Es ist sehr schwierig, einen mehr oder weniger präzisen Begriff dieser normativen Demokratie zu geben. Deswegen soll hier, nur um eine rationale Basis für die Untersuchung der Probleme zu haben, auf die in dieser Arbeit eingegangen werden soll, versucht werden, eine vorläufige Vorstellung zu vermitteln, wobei aber die obige Feststellung zu betonen ist, daß nämlich zumindest in der heutigen Zeit der rechtliche Aspekt nicht von den anderen Aspekten (dem politischen, sozialen und ökonomischen) der Demokratie zu trennen ist, die sich zudem gegenseitig beeinflussen. 13. Es ist also von einer doppelten Perspektive auszugehen, da man zunächst feststellen kann, daß eine demokratische Rechtsordnung zustandekommt, wenn sie von den Normadressaten geschaffen wird, das heißt wenn die Ordnung selbst nicht von einem begrenzten Teil der Gemeinschaft auferlegt wird, sondern von der Gesamtheit oder doch wenigstens von der Mehrheit, in Übereinstimmung mit der Idee Rousseaus von der „volonté générale". 1 8 Dies ist natürlich nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Das Ideal wäre nämlich, daß die Regierten direkt an der Schaffung der Rechtsnormen und insbesondere der Verfassungsnormen beteiligt wären was dem Gesellschaf tsvertrag des berühmten Genfers entsprechen würde. 19 Da dies aber in modernen Gesellschaften unmöglich ist, wie seinerzeit Rousseau selbst schon erkannt hatte, 20 muß man Methoden finden, um eine möglichst umfassende Partizipation im Rahmen repräsentativer Systeme zuzulassen.
14 Zum klassischen Begriff des Rechtsstaats vgl. Carl Schmitt, Verfassungslehre (1928), Berlin 4 1965,123 - 220. 15 Zum traditionellen Begriff der Rule of Law vgl. Α. V. Dicey, A n introduction to the study of the Law of the Constitution (1885), London 10 1979, X C V I - CLI. 16 Biscaretti di Ruffìa , zit. Anm. 12,129 - 350. 17 Vgl. u. a. die hervorragende Arbeit von Manuel Garcia-Pelay ο, El Estado y sus implicaciones, in: ders., Las transformaciones del Estado contemporàneo, Madrid 1977, 51 - 66. 18 Vgl. Jean-Jacques Rousseau, D u Contrat Social, Buch I I , Kap. I - V. 19 Ebd., Buch I, Kap. V I . 20 Ebd., Buch I I I , Kap. I V . Besonders berühmt ist der Satz: „S'il y avait un peuple de dieux, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait convient pas à des hommes".
Recht, Verfassung und Demokratie
31
14. Wir stehen hier vor der engen Beziehung zwischen Legalität und Legitimität, wie sie von zahlreichen Sozialwissenschaftlern festgestellt wurde, darunter in der klassischen Studie von Carl Schmitt. 21 Auch Max Weber wies schon darauf hin, daß der Legalitätsglaube eine Form der Legitimation sei. 22 Demnach läßt sich feststellen, daß man vom rechtlichen Aspekt des demokratischen Systems nur dann sprechen kann, wenn erstens die Rechtsnormen von legitimen Organen geschaffen wurden und wenn zweitens die Normen selbst für die anderen Aspekte eines demokratischen Systems, das durch die normative Struktur festgelegt wird, die sich grundlegend in den Vorschriften der Verfassung ausdrückt, als wegbereitendes Instrument dienen. I I I . Der Einfluß des demokratischen Systems auf die Erzeugung der Rechtsnormen 15. Wenngleich die beiden rechtlichen Bereiche der Demokratie - also derjenige der Normenschaffung und derjenige ihrer Orientierung auf die Entwicklung des demokratischen Systems - untrennbar sind und sich gegenseitig beeinflussen, kann man sie doch logisch auseinanderhalten. Es soll nun versucht werden, den ersten der beiden Bereiche zu beschreiben. 16. Zunächst ist zu sagen, daß das Problem der Legitimität schon von dem Augenblick an existiert, in dem ein politisches System durch die von der verfassungsgebenden Gewalt erlassene Verfassung geschaffen wird. Es ist nämlich nicht genug, daß eine Versammlung zusammentritt und ein Dokument verabschiedet, in dem fundamentale politische Entscheidungen niedergelegt sind; diese Versiammlung muß außerdem von der Mehrheit der Regierten gewählt sein, und in zweiter Linie muß ein öffentlicher Konsens deutlich werden, der die von den Repräsentanten getroffenen Entscheidungen unterstützt. Dies ist der Grund, aus dem die erste geschriebene Verfassung im modernen Sinne nach ihrer Verabschiedung durch den Kongreß in Philadelphia anschließend der Bevölkerung der dreizehn früheren Kolonien zur Abstimmung vorgelegt wurde, um nämlich genau diesen Konsens und damit Legitimation zu erzielen. 23 17. So wird zur Legitimierung moderner Verfassungen häufig von Plebiszit und Referendum Gebrauch gemacht. Um hier nur einige wenige Beispiele zu 21
Carl Schmitt, Legalität und Legitimität (1932), Berlin 31980. Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 1922,19. 23 Vgl. u.a. Carlos Sânchez Viamonte, El poder constituyente, Buenos Aires 1957, 83 - 229. Damit eine Verfassung legitim ist, muß sie den authentischen Volkswillen widerspiegeln, nach Segundo V. Linares Quintana, Tratado de la ciencia del derecho constitucional argentino y comparado, Bd. I I I , Buenos Aires 21978, 222 - 225; im gleichen Sinne Jorge Reinaldo Α. Vanossi, Teoria constitucional, I. Teoria constituyente, Buenos Aires 1975,481 - 502; Carl B. Swisher, El desarrollo constitucional de los Estados Unidos, Bd. I, Buenos Aires 1958, 28 - 41. 22
32
Héctor Fix-Zamudio
nennen, sei darauf verwiesen, daß die Verfassungen von Kuba (1976), Ecuador (1978) und Spanien (1978) einem Referendum unterworfen wurden. Gelegentlich wird auch vor dem Erlaß des Grundgesetzes das Volk konsultiert, wie es zum Beispiel in Italien anläßlich der Verabschiedung der republikanischen Staatsform am 2. Juni 1946 der Fall war. 2 4 Ebenso wird in sozialistischen Ländern und speziell in der Sowjetunion das Projekt einer öffentlichen Diskussion unterzogen, um Empfehlungen und Vorschläge zu erhalten. Dies war etwa sehr umfassend der Fall mit dem Projekt für das Grundgesetz, das der Oberste Sowjet am 7. Oktober 1977 verabschiedete. 25 18. Selbst autoritäre Regierungen greifen auf Referendum oder Plebiszit zurück, um den Inhalt ihrer neuen Verfassungsdokumente zu legitimieren. Abgesehen von den bekannten bonapartistischen Beispielen 26 bietet ein deutliches Beispiel hierfür die Verfassung der Republik Chile, die von der Militärjunta „in Ausübung der verfassungsgebenden Gewalt" erlassen und am 11. September 1980 der Zustimmung des Volkes unterworfen wurde (erstaunlicherweise scheiterte ein ähnlicher Versuch der früheren autoritären Regierung Uruguays). Dies zeigt, daß eine formale Volksbefragung nicht ausreicht, sondern daß zunächst die Wahl einer authentischen verfassungsgebenden Versammlung erforderlich ist. 19. Noch häufiger wird Gebrauch gemacht vom sogenannten Verfassungsreferendum, wenn es um die Änderung von Verfassungstexten geht, die grundlegende politische Entscheidungen enthalten, wie dies in einer Reihe von zeitgenössischen Verfassungen festgelegt ist. Dies ist der Fall ζ. B. bei der italienischen Verfassung von 194827 und bei der französischen Verfassung von 1958, in der dem Präsidenten der Republik Befugnisse erteilt werden, um einen Volksentscheid herbeizuführen. Von diesen Befugnissen machte etwa De Gaulle mehrfach Gebrauch, zunächst am 18. Oktober 1962, um den Modus für die Wahl des Präsidenten der Republik durch allgemeines Wahlrecht zu ändern, und zuletzt am 27. April 1969, als der negative Ausgang über den Rücktritt von General De Gaulle selbst entschied. 28 24 Vgl. Norberto Bobbio und Franco Pierandrei, Introduzione alla Costituzione, Bari 1971, 59 f. 25 Vgl. L. I. Brezhniev, On the Draft Constitution of the Union of Soviet Socialist Republics, Moskau 1977, 23 - 31. 26 Insbesondere vom 20. und 21. Dezember 1851, zur Bestätigung der Wiederwahl von Louis Bonaparte zum Präsidenten der Republik, und vom 21. und 22. Dezember 1852, zur Bestätigung des Zweiten Kaiserreichs; vgl. Félix Moreau, Précis élémentaire de droit constitutionnel, Paris 91921, 98 - 103. 27 Vgl. Biscaretti di Ruffìa, Diritto costituzionale. Istituzione di diritto pubblico, Neapel 21981, 413 - 424. 28 Art. 11 der französischen Verfassung von 1958 bestimmt: „Der Präsident der Republik kann auf Vorschlag der Regierung während der Dauer der Sitzungsperioden oder auf gemeinsamen Vorschlag der beiden Versammlungen, nachdem er im Journal Officiel veröffentlicht wurde, jeden Gesetzentwurf zum Volksentscheid bringen, der 12
Recht, Verfassung und Demokratie
33
20. Neben dem vorhergehenden wurde noch ein anderes Instrument der Rechtsschaffung i m Sinne einer semidirekten D e m o k r a t i e eingerichtet, das i m Volksbegehren
sowohl für gewöhnliche Gesetze als auch für Verfassungsände-
rungen besteht, wie es i n A r t . 71 der italienischen Verfassung v o n 1948 vorgesehen i s t . 2 9 Dieses Instrument w i r d auch häufig i n der Verfassungspraxis der Schweiz b e n u t z t . 3 0 21. Bezüglich dieser Institutionen v o n semidirekter D e m o k r a t i e ist der vorsichtige Ansatz herauszuheben, der i n M e x i k o i m Rahmen der Verfassungsänderung v o m Dezember 1977 eingeleitet wurde. D a b e i wurde A r t . 73 der B u n desverfassung, der sich auf die Regierung des Bundesdistrikts bezieht, ein Abschnitt V I hinzugefügt m i t der Bestimmung, daß die Rechtsverordnungen u n d Regelungen, die i n dem entsprechenden Gesetz verfügt werden, einem Referendum
zu unterwerfen sind und einem Volksbegehren
unterliegen
können,
i n Übereinstimmung m i t dem entsprechend festgelegten V e r f a h r e n . 3 1 Dies ist näher geregelt durch die A r t i k e l 53 - 59 des Staatsgesetzes über den Bezirk des Bundesdistrikts v o m 27. Dezember 1978. 3 2
die Organisation der öffentlichen Gewalten betrifft, der die Billigung eines Abkommens innerhalb der Gemeinschaft enthält oder der darauf abzielt, die Ratifizierung eines Vertrages zu gestatten, der, ohne im Widerspruch zur Verfassung zu stehen, Rückwirkungen auf das Funktionieren der Institutionen haben könnte" (deutsche Version zitiert nach Udo Kempf, Das politische System Frankreichs, Opladen 21980, 318ff.); vgl. André Hauriou, Derecho constitucional e instituciones politicas, Barcelona 1971, 543 - 548. 29 In der entsprechenden Passage bestimmt Art. 71: „Das Volk bringt eine Gesetzesinitiative vermittels eines Vorschlags ein, der von mindestens fünfzigtausend Wahlberechtigten unterzeichnet sein und die Form eines in Artikeln formulierten Entwurfs haben muß." Diese Vorschrift wurde durch Gesetz Nr. 352 vom 25. Mai 1970 geregelt; vgl. Biscaretti di Ruffìa, zit. Anm. 27, 412f. 30 Die Artikel 120 und 121 der noch geltenden Verfassung der Schweiz vom 29. Mai 1874 legen die Möglichkeit fest, daß sowohl die vollständige als auch die teilweise Revision der Verfassungsbestimmungen durch ein Volksbegehren eingeleitet werden kann, wobei die Petition von mindestens fünfzigtausend wahlberechtigten Staatsbürgern unterzeichnet sein muß und sie im Falle von teilweisen Änderungen sowohl allgemein formuliert sein kann als auch in Form eines vollständig ausgearbeiteten Entwurfs; zur Wirkungsweise dieser Institution vgl. Alberto Antonio Spota, Democracia directa ο semidirecta en Suiza (El Landsgemeinde, el referèndum, la iniciativa popular ο Volksbegehren), Buenos Aires 1971, bes. 93f.; André Hauriou, zit. Anm. 28, 485ff. 31 Vgl. Jorge Carpizo, La reforma politica mexicana de 1977, in: ders., Estudios constitucionales, Mexiko-Stadt 1980, 379ff. 32 Art. 53 unterscheidet zwischen Referendum und Volksbegehren, wie sie in der Änderung von Art. 73, Abschnitt V I , Punkt 2 der Bundesverfassung vom Dezember 1977 festgelegt wurden: „Das Referendum ist eine Methode zur direkten Einbeziehung des Willens der Bürger des Bundesdistrikts in die Gestaltung, Änderung oder Aufhebung von Rechtsvorschriften und Verordnungen, die den Bundesdistrikt betreffen. Das Volksbegehren ist eine Methode zur direkten Beteiligung der Bürger des Bundesdistrikts, mit der sie die Gestaltung, Änderung oder Aufhebung von Rechtsvorschriften und Verordnungen, die den Bundesdistrikt betreffen, vorschlagen können . . . " 3 Olivé/Salmerón
34
Héctor Fix-Zamudio
22. Gleichzeitig mit dieser Tendenz zur Verankerung von Instrumenten der semidirekten Demokratie für die Schaffung von gesetzlichen Bestimmungen und zwar auch von konstitutionellem Charakter - zeigt sich aber auf der anderen Seite auch in immer schärferem Maße die entgegengesetzte Tendenz, daß nämlich die gesetzgeberischen Befugnisse der parlamentarischen Organe beschränkt und der Exekutive übertragen werden. Dieses Phänomen läßt sich auch in den Ländern mit einer parlamentarischen Tradition beobachten und sogar in England, der Wiege dieses Systems. 23. Tatsächlich sind seit der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg (und in verstärktem Maße nach dem Zweiten Weltkrieg) die britischen politischen Gruppierungen besorgt über die zunehmende Delegation gesetzgeberischer Befugnisse des Parlaments zugunsten der Regierung. Aus diesem Grunde wurde vom Lordkanzler Großbritanniens eine Sonderkommission zur Untersuchung der ministeriellen Befugnisse gebildet, die ihre Arbeit im November 1929 aufnahm und am 17. März 1932 ein Gutachten vorlegte, in dem sie zu dem Schluß kam, daß diese Delegation gesetzgeberischer Befugnisse zwar unvermeidlich sei, aber rationalisiert werden solle. 33 23. a) Ganz allgemein ist in unserer Zeit eine unaufhaltsame Bewegung zur Stärkung der Exekutive auf Kosten der Legislative festzustellen. Dies hängt damit zusammen, daß die neuen Staatstypen, der soziale Rechtsstaat und der sozialistische Staat, notwendigerweise ein ständiges Wachstum von Regierung und Verwaltung implizieren, da diese es sind, die über die technischen und materiellen Instrumente für die Entwicklung von Aktivitäten der sozialen Gerechtigkeit verfügen. Der französische Verfassungsrechtler und Politologe Maurice Duverger stellte daher in seinem bedeutenden Werk La monarchie républicaine fest, daß die zeitgenössischen Regierungen dazu neigen, sich auf die Person eines Präsidenten oder Regierungschefs zu konzentrieren, der die Innen- und Außenpolitik lenkt, daß diese aber - anders als die autoritären Monarchen der Vergangenheit - direkt oder indirekt vom Volk gewählt werden und sowohl zeitlich in der Ausübung ihres Amtes beschränkt werden als auch durch andere Machtorgane sowie durch politische, wirtschaftliche, technokratische und gesellschaftliche Faktoren. 34 23. b) Während also auf der einen Seite durch Referendum und Volksbegehren die Partizipation der Regierten an der Schaffung gesetzlicher Bestimmungen bezüglich wesentlicher Fragen - oder solcher, die zu einem bestimmten Zeitpunkt dafür gehalten werden - erweitert wird, delegieren die Repräsentanten der Regierten in den Parlamenten selbst hinsichtlich der ständigen 33 Dieses Gutachten mit dem Titel „Bericht der Sonderkommission zur ministeriellen Gewalt" ist in spanischer Übersetzung wiedergegeben in Rodolfo Blendel, Introduction al estudio del derecho pùblico anglosajón, Buenos Aires 1947, 159 - 309. 34 Maurice Duverger, La monarchie républicaine, ou comment les démocraties se donnent des rois, Paris 1974, 45-98.
Recht, Verfassung und Demokratie
35
parlamentarischen Arbeit ihre Kompetenzen der Normerzeugung an die Regierungen, die auf der anderen Seite den größten Teil der Gesetzesinitiativen auch bezüglich der Materien vorlegen, die sich die Parlamentarier selbst vorbehalten. 35 24. In Mexiko, das - wie auch die anderen lateinamerikanischen Staaten traditionell eine starke Exekutive und eine schwache Legislative besitzt, 36 zeigt sich ganz deutlich die Konzentration der gesetzgeberischen Befugnisse bei der Bundesregierung. Neben einigen Kompetenzen, die ihr direkt aus der Verfassung erwachsen - im Hinblick auf öffentliche Gesundheit (Art. 73, Abschnitt V I , 1 - 4) und besonders auf den Erlaß von Verordnungen (Art. 89, Abschnitt I) - können ihr nach Art. 49 der Bundesverfassung legislative Kompetenzen unter zwei Bedingungen übertragen werden: zum einen nach Maßgabe von Art. 131, § 2 der Verfassung, um den Außenhandel, die Wirtschaft des Landes und die Stabilität der nationalen Produktion zu regeln oder jedwede andere Maßnahme zum Wohle des Landes zu ergreifen; diese Befugnis ist in der Praxis seit ihrer Einführung im Jahre 1951 jedes Jahr neu erteilt worden; und zum zweiten im Falle außerordentlicher Befugnisse, die nach Art. 29 der Verfassung nur in einer Notstandssituation übertragen werden können, wie sie etwa während des Zweiten Weltkriegs vorlag, an dem Mexiko beteiligt war. 3 7 25. Dem ist hinzuzufügen, daß im Rahmen des Initiativrechts, welches dem Präsidenten durch Art. 71, Abschnitt I der Bundesverfassung verliehen wird, dieser die weitaus größte Mehrheit derjenigen Gesetzesvorhaben vorgeschlagen hat, die vom Kongreß ohne wesentliche Änderungen verabschiedet wurden 38 (dieses Phänomen tritt auch in den Ländern auf, in denen die Regierung im Parlament die Mehrheit besitzt), einschließlich der zahlreichen Änderungen am Text der Verfassung von 1917, von denen es inzwischen weit über zweihundert gab. 39 35 Aufgrund dieses Phänomens stellt der nordamerikanische Rechtswissenschaftier James McGregor Burns , Gobierno presidential, Mexiko-Stadt 1967, 416f., fest: „Während das 16. und 17. Jahrhundert in der westlichen Welt geprägt warei>durch die Regierung von Monarchen mit zentralisierter Gewalt, während das 18. Jahrhundert die große Zeit der Volksversammlungen und gesetzgebenden Körperschaften war und während das 19. und das beginnende 20. Jahrhundert eine Phase der Parteienbildung bedeuteten: ist es vielleicht möglich, daß wir heute in der ganzen Welt eine Phase der exekutiven Regierung erleben?" 36 Vgl. Salvador Valencia Carmona, Las tendencias constitucionales del ejecutivo latinoamericano, in: Boletin Mexicano de Derecho Comparado 3 1 - 3 2 (Januar August 1978), 133 - 156, sowie ders., Poder Ejecutivo Latinoamericano, Mexiko-Stadt 1979. 37 Vgl. Jorge Carpizo, El presidencialismo mexicano, Mexiko-Stadt 1979, 99 - 109. 38 Vgl. Pablo Gonzâlez Casanova, La democracia en México, Mexiko-Stadt 31969, 29 - 33. 39 Vgl. Diego Valadés, Problemas de la reforma constitucional en el sistema mexicano, in dem Sammelband: Cambios constitucionales, Mexiko-Stadt 1977, 191 - 209,
*
36
Héctor Fix-Zamudio
I V . Einige zeitgenössische Rechtsinstrumente zur Entwicklung demokratischer Voraussetzungen 26. Im Zusammenhang mit dem zweiten Aspekt, der hier nur zu Zwecken der Untersuchung einzeln zu betrachten ist, dienen die Rechtsnormen und insbesondere die Normen, die in Verfassungsdokumenten niedergelegt sind, als Wegbereiter für die Verankerung der politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Werte der modernen Demokratie. 27. Da hier eine ausführliche Darstellung der Instrumente, die der moderne Konstitutionalismus eingesetzt hat, um zu erreichen, daß diese höchsten Werte in der Realität verwirklicht und entwickelt werden, nicht möglich ist, sollen stattdessen einige von ihnen kurz beschrieben werden, um am Beispiel die wichtige Rolle aufzuzeigen, die das Recht in der heutigen Gesellschaft besitzt und die nicht immer in ihrem wirklichen Ausmaß erkannt wird. 28. Es wurden erstens die traditionellen Instrumente zum Schutz der Grundrechte des Menschen, wie sie in den Verfassungen anerkannt sind, verbessert, darunter das Habeas-corpus-Verfahren 409 das dem Schutz der persönlichen Freiheit dient, oder auch das Amparo-Verfahren in den lateinamerikanischen Rechtsordnungen als ein Beitrag unseres Landes zu diesem Schutz, 41 und es wurden neue geschaffen, um den Schutz auf einen größeren Bereich auszudehnen, wie zum Beispiel die ursprünglich skandinavische Institution des Ombudsman oder die Zulassung kollektiver Prozeßparteien zum Schutz der Rechte sozialer Gruppen (class actions). 29. Zweitens sollte man diejenigen Veränderungen zumindest erwähnen, denen das alte Prinzip der Gewaltenteilung unterworfen wurde, das hinsichtlich seines wesentlichen Zweckes, nämlich die Konzentration der öffentlichen Macht in einem Organ oder in einem kleinen Sektor der politischen Gemeinschaft zu verhindern, seine Geltung nicht verloren hat. 42 und ders., La Constitution reformada, in: Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones, Mexiko-Stadt 21979, Bd. X I I , 13 -191. 40 Die Literatur zum angloamerikanischen Habeas-Corpus ist sehr umfangreich, so daß hier nur eine Arbeit bezüglich der USA angeführt werden soll: Development in the Law. Federal habeas corpus, erschöpfender Kommentar in: Harvard Law Review (März 1970), 1040 - 1280; bezüglich anderer angloamerikanischer Staaten vgl. R. J. Sharpe, The Law of „habeas corpus", Oxford 1976; für den lateinamerikanischen Bereich vgl. Domingo Garcia Belaunde, El habeas corpus en el Perù, Lima 1979, und Néstor P. Sagûés, Habeas corpus, Buenos Aires 1981. 41 Vgl. Héctor Fix-Zamudio , El juicio de amparo en Latinoamérica, in: Memoria de El Colegio Nacional, 1977, Mexiko-Stadt 1978, 101 - 138; ders., El juicio de amparo latinoamericano, in dem Sammelband: Estudios juridicos en memoria de Alberto Vazquez del Mercado, Mexiko-Stadt 1982, 193 - 245. [Der Amparo-Prozeß ist eine „zum Schutz der verfassungsmäßigen Rechte des Einzelnen bestimmte gerichtliche Verfahrensart"; vgl. Hans Christoph von Rohr, Der argentinische Amparo-Prozeß, unter Berücksichtigung ähnlicher Verfahrensarten in Brasilien, Mexiko und Peru (Bonner Rechtswissenschaftliche Abhandlungen, Bd. 83), Bonn 1969, 26; Anm. d.Ü.]
Recht, Verfassung und Demokratie
37
30. Außerdem scheint es angebracht, kurz die zunehmende und trotz der hitzigen Debatten, die sie hervorruft, irreversible Tendenz zu beschreiben, die Auslegung von Verfassungsbestimmungen dem Urteil spezialisierter Gerichte zu übertragen, also der Verfassungsgerichtsbarkeit, die in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg eine außergewöhnliche Entwicklung erfahren hat, u.a. auch in einigen lateinamerikanischen Staaten. 43 31. Um die Betrachtung auf die bedeutendsten Aspekte zu beschränken, ist schließlich die Funktion zu erwähnen, die die politischen Parteien (heutzutage anerkennt als Einrichtungen von Verfassungsrang) bei der Verwirklichung der Prinzipien der modernen Demokratie übernommen haben. 44 V . Systeme des rechtlichen Schutzes der Menschenrechte 32. Seit den Anfängen des modernen Verfassungsstaates wurde der wesentliche Wert der Rechte der Regierten anerkannt, zunächst allerdings ausschließlich im individuellen Bereich - die sogenannten individuellen Sicherheiten. Diese Rechte wurden konkretisiert in den klassischen Erklärungen der Menschen- und der Bürgerrechte: in der französischen - mit universalem Anspruch - von 1789,45 in den Verfassungen der amerikanischen Staaten46 und später in den ersten zehn Zusätzen (


![Rechtspositivismus und sprachanalytische Philosophie: Der Begriff des Rechts in der Rechtstheorie H. L. A. Harts [1 ed.]
9783428418558, 9783428018550](https://dokumen.pub/img/200x200/rechtspositivismus-und-sprachanalytische-philosophie-der-begriff-des-rechts-in-der-rechtstheorie-h-l-a-harts-1nbsped-9783428418558-9783428018550.jpg)
![Argentinische Rechtstheorie und Rechtsphilosophie heute [1 ed.]
9783428463053, 9783428063055](https://dokumen.pub/img/200x200/argentinische-rechtstheorie-und-rechtsphilosophie-heute-1nbsped-9783428463053-9783428063055.jpg)
![Die finnische Rechtstheorie unter dem Einfluß der Analytischen Philosophie [1 ed.]
9783428444182, 9783428044184](https://dokumen.pub/img/200x200/die-finnische-rechtstheorie-unter-dem-einflu-der-analytischen-philosophie-1nbsped-9783428444182-9783428044184.jpg)
![Wanderungen durch die Prairien und das nördliche Mexiko [1-3]](https://dokumen.pub/img/200x200/wanderungen-durch-die-prairien-und-das-nrdliche-mexiko-1-3.jpg)
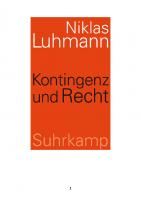


![Assoziation und Institution als soziale Lebensformen in der zeitgenössischen Rechtstheorie [1 ed.]
9783428503346, 9783428103348](https://dokumen.pub/img/200x200/assoziation-und-institution-als-soziale-lebensformen-in-der-zeitgenssischen-rechtstheorie-1nbsped-9783428503346-9783428103348.jpg)
![Philosophie und Rechtstheorie in Mexiko [1 ed.]
9783428466474, 9783428066476](https://dokumen.pub/img/200x200/philosophie-und-rechtstheorie-in-mexiko-1nbsped-9783428466474-9783428066476.jpg)