Pädagogische Theologie: Friedrich Niebergalls praktische Theologie als Erziehungslehre 9783666571138, 3525571135, 9783525571132
145 60 9MB
German Pages [296] Year 1972
Polecaj historie
Citation preview
Jörg Viktor Sandberger Pädagogische Theologie
Arbeiten zur Pastoraltheologie Herausgegeben von Martin Fischer und Robert Frick
BAND 10
VANDENHOECK & RUPRECHT IN G Ö T T I N G E N
JÖRG VIKTOR SANDBERGER
Pädagogische Theologie
Friedrich Niebergalls Praktische Theologie als Erziehungslehre
VANDENHOECK & RUPRECHT IN G Ö T T I N G E N
ISBN 3-525-57113-5 © Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1972. — Printed in Germany.— Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, dss Buch oder Teile daraus auf foto- oder akustomechanischem Wege zu vervielfältigen. Gesamtherstellung: Hubert & Co., Göttingen
Vorwort Die vorliegende Untersuchung wurde im Dezember 1969 unter dem Titel „Recht und Grenzen einer Kritik an Friedrich Niebergalls Verständnis der Praktischen Theologie als Lehre von der kirchlichen Gemeindeerziehung" von der Theologischen Fakultät der Georg-AugustUniversität Göttingen als Dissertation angenommen. Für den Drudi wurde das Manuskript gekürzt und im 3. Teil durch einen Abschnitt über Seelsorge ergänzt. Für großzügig gewährte Druckkostenzuschüsse habe ich zu danken: dem Altpräses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Herrn Prof. D. J. Bedemann, der Theologischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen und dem Herrn Kanzler der Pädagogischen Hochschule Rheinland in Köln. Mein Dank gilt ferner Herrn Prof. D. Martin Fischer und Herrn D. Robert Frick, die die Studie in die Reihe der Arbeiten zur Pastoraltheologie aufgenommen haben, sowie Herrn Prof. D. Alfred Niebergall und Herrn Prof. D. Martin Doernef für freundliche Beratung. Besonders herzlich möchte ich meinem verehrten Lehrer und väterlichen Freund Herrn Prof. D. Götz Harbsmeier danken: er hat das Thema angeregt und die Entstehung des Manuskripts mit Interesse, Rat und Ermutigung begleitet. Ich widme das Buch meiner Frau. Wuppertal, im Januar 1972
Jörg Viktor Sandberger
Inhalt Vorwort
5
Einleitung: Die Fragestellung I. Problemhorizonte
11 11
II. Die Abgrenzung des Themas und Begründung der Gliederung . . .
15
I. Teil: Der Erziehungsbegriff als Schlüsselbegriff im theologischen Ansatz Friedrich Niebergalls
24
I. Die Funktion des Erziehungsbegriffs in der Theologie Julius Kaftans
24
II. Offenbarung als Erziehung 1. 2. 3. 4.
Praktischer Glaube Der geschichtliche Jesus als Erzieher Gott als Erzieher des Menschengeschlechts Ergebnis
III. Psychologie des Glaubens 1. Phantasie und Unbewußtes als hermeneutische Grundbegriffe . . 2. Psychologie des Glaubens als Wissenschaft und der Glaube selbst als Erlebnis 3. Ergebnis IV. Der Persönlichkeitsbegriff 1. Die Autonomie der Persönlichkeit 2. Die Individualität der Persönlichkeit 3. Persönlichkeit und Gemeinschaft V. Der Kirchenbegriff 1. 2. 3. 4.
Die Die Die Das
Kirche als Ziel und Mittel der Erziehung Volkskirche Landeskirche Bekenntnis
VI. Kritische Würdigung 1. Das Ergebnis der Verarbeitung der Kaftanschen Glaubenslehre durch F. Niebergall
32 32 34 36 44 45 45 48 57 59 59 65 71 75 76 78 82 84 88 88
2. Immanente Kritik 3. Existentiale und pädagogische Interpretation des christlichen Glaubens als radikale Lösung und als Kompromißlösung
101
2. Teil: Die Funktion des Erziehungsbegrifis in Friedridi Niebergalls Verständnis der Praktisch-Theologischen Disziplin
110
I. Praktische Theologie als Erziehungswissenschaft: 1. Problemhorizonte 2. Erziehungslehre als Wissenschaft II. Das Verhältnis der Praktischen Theologie zu den anderen theologischen Disziplinen 1. Die Fragestellung 2. Praktische Dogmatik 3. Praktische Auslegung des Neuen Testaments a) Aufgabe und Abgrenzungen b) Das Verhältnis von historischer und systematischer Fragestellung in der praktischen Auslegung des Neuen Testaments . . c) Praktische Auslegung und existentiale Interpretation . . . . d) Zusammenfassung 4. Praktische Auslegung des Alten Testaments III. Kritische Würdigung
92
111 111 116
128 128 131 137 137 140 149 163 164 172
3. Teil: Die Funktion des Erziehungsbegriffs in Friedridi Niebergalls Verständnis der praktisch-theologischen Arbeitszweige 176 I. Liturgik und Erziehung
177
II. Pädagogische Homiletik
186
1. Predigtarbeit als Erziehungsarbeit 2. Homiletik als Impuls zur Selbstbildung 3. „Moderne" und dialektische Homiletik III. Der neue Religionsunterricht 1. Religionspädagogische Fragenkreise im Überblick 2. Die Religionspädagogik R. Kabischs und F. Niebergalls. Ein Vergleich 3. F. Niebergalls Religionspädagogik im Spiegel späterer Entwicklungen a) Die Kirchlichkeit des schulischen Religionsunterrichts . . . . b) Die Begründung des schulischen Religionsunterrichts . . . . c) Die Lehrbarkeit der Religion und der Übergang von der existentialen Interpretation zum existentiellen Vollzug . . .
187 194 197 207 207 217 223 226 227 232
IV. Pädagogische Seelsorge und Gemeindearbeit 1. Fragestellungen und Themen 2. Die Seelsorge in der „modernen" und in der „dialektischen" Theologie 3. Zusammenfassung
237 238 244 254
Schluß: Das Ergebnis der Untersuchung
255
Abkiirzungsverzeichnis
260
Literaturverzeichnis
261
Verzeichnis der Veröffentlichungen Friedrich Niebergalls . . . .
269
Sachregister
286
Namenregister
290
Einleitung:
Die
Fragestellung
I. Problemhorizonte Die in der systematisch-theologischen Diskussion der Gegenwart an manchen Stellen zu beobachtende Tendenz, die dialektische Theologie kritisch zu überprüfen 1 — häufig mit einer Besinnung auf unerledigte Probleme der „liberalen" Theologie verbunden —, hat auf dem Gebiet der Praktischen Theologie ein deutliches Echo gefunden: „Die Wiederentdeckung und vor allem die gerechte Würdigung der homiletischen und der religionspädagogischen Leistung des 19. Jahrhunderts hat noch kaum begonnen. Gerade hier aber wäre zu lernen, mit welchem Nachdruck die Frage nach dem Menschen in seiner Welt in der theologischen Diskussion aufgegriffen werden kann. Diese Intention ist auf jeden Fall für uns heute anregend, wie immer man zu den damaligen Ergebnissen und ihren Prämissen stehen mag, niemand wird sie unbesehen übernehmen wollen. Sie aber unbesehen liegenzulassen, wie es heute noch weithin geschieht, und sich lediglich über das vergangene Vokabular zu mokieren, dürfte audi nicht der Weisheit letzter Schluß sein." 2 Gert Otto verweist zur Begründung dieses Votums auf Friedrich Niebergall, dessen Arbeit für ihn jene Leistung repräsentiert 3 . Da eine Darstellung und Würdigung der Praktischen Theologie F. Niebergalls bisher fehlt, besteht Anlaß, sie zu untersuchen. G. Ottos Forderung, sich erneut mit der „liberalen" Theologie zu beschäftigen, intendiert Anknüpfung und Widerspruch. Die von der dialektischen Theologie bisher ziemlich eindeutig zum Ausdruck gebrachte Kritik soll durch ein neues, ambivalentes Verhältnis abgelöst werden, wodurch umgekehrt auch das Verhältnis zur dialektischen Theologie seine Eindeutigkeit verliert und einen kritischen Aspekt erhält. Grundsätzlich ist gegen ein Nebeneinander von Zustimmung und Kritik nichts einzuwenden, nur muß beides auf eine theologische Gesamtkonzeption bezogen sein. 1 Diese Tendenz lassen u. a. die Arbeiten von W . Pannenberg und C. H. Ratschow erkennen. Für eine Überprüfung der modernen Theologie vom dialektischen Ansatz aus tritt F. Mildenberger ein, Theologie für die Zeit, 1969. 2 G. Otto, Der Mensdh in seiner Welt, in: Schule Religionsunterricht Kirche, 1968 3 , 168—191. H i e r : 170 f. 3 Vgl. ebd. 171—173.
11
Man pflegt gerade von den praktisch-methodischen Ratschlägen F. Niebergalls einen Beitrag zur gegenwärtigen Diskussion zu erwarten 4 . Dabei ist offenbar vorausgesetzt, daß man leicht zwischen den „anregenden Intentionen" und dem vergangenen „Vokabular" unterscheiden kann. So einfach wird man aber Anknüpfung und Widerspruch nicht aufteilen können. Praktische Vorschläge implizieren doch immer theologische Entscheidungen. Deshalb kommt es darauf an, F. Niebergalls Theologie als Gesamtentwurf in den Blick zu bekommen und ihre Mitte aufzuzeigen, von der aus die einzelnen Themen zusammengehalten werden und ihren Stellenwert erhalten. Die Übernahme oder Ablehnung der Gedanken F. Niebergalls erfolgt dann „unbesehen", wenn sie nicht aus dem Zusammenhang heraus verstanden werden. Problemkreise, von denen aus der gesuchte „theologische Ansatz" zu finden ist, sind einmal die systematischtheologische und exegetische Interpretation der christlichen Überlieferung, sowie das Verhältnis der Praktischen Theologie zu den anderen theologischen Disziplinen. Diese Aufgaben können jedoch nur gelöst werden, wenn zugleich versucht wird, F. Niebergall in geschichtliche Bewegungen einzuordnen und nach den historischen Ursprüngen seines Denkens und Handelns zu fragen. Welcher theologischen Richtung gehört er an? Wo ergreift er Partei im Streit der Meinungen? Wo sieht er seine Gegner? Die Beantwortung dieser historischen Fragen kann aber noch nicht zum Ziel führen. Gerade wenn historisch gefragt werden soll, kann die Kritik am „Kulturprotestantismus" nicht unberücksichtigt bleiben. Eine durch Ausklammerung der späteren Entwicklung erstrebte Objektivität stünde in der Gefahr, „unbesehen" übernehmen zu wollen. Zur vorläufigen Orientierung soll daher diese Kritik kurz skizziert werden. Die Theologie der Krise expliziert ihren Widerspruch in verschiedenen theologischen Bereichen, u. a. in der Erfassung der theologischen Aufgabe selbst, dann im Verständnis der Praktischen Theologie und ihres Verhältnisses zu den anderen Diziplinen, schließlich in der Darstellung der einzelnen Arbeitszweige. „Der Gegenstand der Theologie ist Gott, und der Vorwurf gegen die liberale Theologie ist der, daß sie nicht von Gott, sondern von Menschen 4 „ E s w a r sicher nicht nur die H o m i l e t i k des sog. theologischen Liberalismus, sondern audi nahezu der gesamten Theologie v o r dem Ersten Weltkrieg, die ihr Interesse f a s t ausschließlich den methodischen Fragen z u w a n d t e und dem ,Wie' eine ungleich größere A u f m e r k s a m k e i t widmete als dem ,Was'. F. N i e b e r g a l l hat die entscheidende F r a g e unüberhörbar deutlich f o r m u l i e r t : ,Wie predigen wir dem modernen Mensdien?'" A . Niebergall, H o m i l e t i k heute. Bericht über die homiletische Literatur seit 1945 (I. Teil), T h R N F 34, 1969, 4 9 — 7 6 . H i e r : 58 f. D i e W i e - F r a g e w i r d auch betont von D . Rössler, D a s P r o b l e m der H o m i l e t i k , Theologia Practica 1, 1966, 14—28. V g l . d a z u die K r i t i k v o n W. Fürst, D i e Unentbehrlichkeit dogmatischer Besinnung f ü r die Predigt im Spiegel gegenwärtiger H o m i l e t i k , in: V F 12, 1967, 7 — 2 6 , bes. 18.
12
gehandelt hat." 5 Mit diesem Satz kennzeichnet R. Bultmann das Selbstverständnis der dialektischen Theologie, der damals „jüngsten theologischen Bewegung". Der bald auseinanderbrechende Kreis von Theologen um die Zeitschrift „Zwischen den Zeiten" (1923—1933) wurde anfangs zusammengehalten durch die gemeinsame Absage an die Theologie des Neuprotestantismuse. Nicht nur Einzelergebnisse der theologischen Lehrer, sondern ihr Verständnis der theologischen Aufgabe selbst wurde radikal in Frage gestellt. Man hatte das Bewußtsein, an einer theologiegeschichtlichen Wende zu stehen. Die theologische Situation der Gegenwart wird einerseits durch den Erfolg der Theologie des Wortes bestimmt, an deren Fragestellungen alle Disziplinen ständig anknüpfen, andererseits durch das Bemühen, diesen Ausgangspunkt in Frage zu stellen7. G. Ebeling hat schon 1950 auf die Problematik des Verhältnisses zwischen der liberalen und der dialektischen Theologie hingewiesen8. Er fragt, ob dieses Verhältnis nicht ebensosehr durch mannigfache Verbindungslinien wie durch den radikalen Bruch bestimmt sei und sieht die Ursache für die spürbare Schwäche der gegenwärtigen Theologie in einem allzu raschen Sichhinwegsetzen über die Probleme, mit denen die Theologie des 19. Jahrhunderts rang. Scheint hier zunächst nur eine Ergänzung der neueren Fragestellungen durch ältere gefordert zu sein, so geht folgende Aussage nodi weiter: „Es fragt sich aber, ob nicht das Verhältnis zum 19. Jahrhundert gerade auch an den Punkten einer sorgfältigeren Besinnung und Uberprüfung bedarf, an denen man heute weithin überzeugt ist, zu einem abgeschlossenen Urteil gekommen zu sein." 9 F. Niebergall hat seine Herkunft aus der Ritschl-Schule nie verleugnet. Er darf als Vertreter jener Richtung gelten, die R. Bultmann im Titel des zitierten Aufsatzes „liberale Theologie" nennt 10 . Er wird also — audi wo sein Name nicht genannt wird — von jener Kritik mit getroffen und hat sich auch, wie gelegentliche Stellungnahmen zeigen, getroffen gefühlt11. Kann die Untersuchung an dieser grundsätzlichen Kritik nicht vorbeigehen, so muß sie auch im Sinne Ebelings nach deren Recht und Grenzen fragen. 5 R. Bultmann, Die liberale Theologie und die jüngste theologische Bewegung (1924), in: GV I, 1964 5 , 2. β R. Bultmann sieht freilich audi die Kontinuität der Generationen: „Es ist kein Zufall, daß diese jüngste theologische Bewegung nicht aus dem Schoß der Orthodoxie, sondern eben aus der liberalen Theologie geboren ist." Ebd. 1. 7 Vgl. Anm. 1 und H . Timm, Theorie und Praxis in der Theologie A. Ritschis und Wilhelm Herrmanns, 1967, 13 ff. 8 G. Ebeling, Die Bedeutung der historisch-kritischen Methode für die protestantische Theologie und Kirche, Z T h K 47, 1950, 1—46. 9 11
Ebd. 8 f. »· Vgl. oben Anm. 5. Vgl. Im Kampf um den Geist, 1927, 130—136.
13
Zwischen der dialektischen und der „liberalen" Theologie ist aber nicht nur das Verständnis der theologischen Aufgabe selbst strittig. A. Jülicher schreibt über K . Barths Römerbriefkommentar, man habe den Eindruck, „hier eine .praktische' Auslegung des Römerbriefs zu empfangen, die, ohne sich in den Einzelheiten der gelehrten Auslegung zu verlieren, die Grundgedanken jenes Briefes in der Sprache unserer Zeit wiedergeben, zugleich aber in die Vorstellungswelt der Heutigen umgießen, in stetiger Konfrontierung mit den religiösen und sittlichen Problemen der Gegenwart ihren ewigen Wert erweisen w i l l . . . Midi hat Barth geradezu gezwungen, mir über die Frage nach der Bedeutung praktischer Schriftauslegung neben der streng wissenschaftlichen ein Urteil zu bilden . . . " 1 2 K. Barth erwidert auf diesen Versuch, seine Arbeit mit Hilfe der Unterscheidung von gelehrt-wissenschaftlicher und praktischer Auslegung positiv zu würdigen: „Oder wissen denn diese von mir wahrhaftig als Historiker respektierten Gelehrten (seil. A. Jülicher und H . Lietzmann) gar nichts davon, daß es eine Sache, eine Kardinalfrage, ein Wort in den Wörtern gibt? . . . Daß ihnen durch die kirchliche Zukunft ihrer Studenten wahrhaftig nicht nur eine praktische, sondern eine höchst sachliche Aufgabe gestellt i s t , . . . Meinen die Historiker denn wirklich, damit hätten sie ihre Pflicht gegenüber der menschlichen Gesellschaft erfüllt, daß sie re bene gesta im fünften Band — Niebergall das Wort erteilen? J a wohl aus der Not meiner Aufgabe als Pfarrer bin ich dazu gekommen, es mit dem Verstehen- und Erklärenwollen der Bibel schärfer zu nehmen, aber kann man denn im Lager der zünftigen Neutestamentier wirklich meinen, dies sei nun eben die Sache der praktischen Theologie', wie es Jülicher mir gegenüber wieder mit der alten unerhörten Sicherheit ausgesprochen hat?" 1 3 In die Neubesinnung auf die Grundlagen der Theologie wurde also von Anfang an die Problematik der Praktischen Theologie in ihrem Verhältnis zu den anderen Disziplinen einbezogen. Die Kritik richtet sich hier ausdrücklich auch auf F. Niebergalls „Praktische Auslegung des Neuen Testaments" 1 4 . Neuere Veröffentlichungen zeigen, daß die Praktische Theologie gegenwärtig noch um ein abgeklärtes Verständnis ihrer Aufgabe ringt 15 . Auch an dieser Stelle wird daher nach Recht und Grenzen der Kritik zu fragen sein. Schon in den Zwanzigerjahren wurde versucht, die Fragestellung der dialektischen Theologie in manchen Bereichen der Praktischen Theologie zu entfalten. Die Entdeckung des Wortes Gottes steht dabei im Mittelpunkt, wie ähnlich lautende Titel zeigen. K . Fezer übt in seinem Buch ThB 17, Teil 1, 88. " ThB 17, Teil 1,112 f. In 1. Auflage 1909 als Band V des Lietzmannschen Handbuchs zum Neuen Testament erschienen. 15 Vgl. W. Jetter, Die Praktische Theologie, Z T h K 64, 1967, 451—473. G. Krause, Probleme der Praktischen Theologie im Rahmen der Studienreform, Z T h K 64, 1967, 474—495. 12
14
14
„Das Wort Gottes und die Predigt" (1925) scharfe Kritik an F. Niebergalls Homiletik. G. Bohne greift in seinem Buch „Das Wort Gottes und der Unterricht" (1929 1 ) R.Kabischs Religionspädagogik an und vermutet in dessen Nachbarschaft audi F. Niedergall. G. Ottos Versuch, an die neuprotestantische Tradition anzuknüpfen, stellt diese Kritik faktisch in Frage. Auch in diesem Problembereich kommen Recht und Grenzen der Kritik in den Blick. Dabei könnte die immer noch berechtigte Kritik wieder auf diejenigen zurückfallen, die heute vielleicht doch „unbesehen" ältere Anregungen aufnehmen wollen. Die gegenwärtigen Versuche, sich auf die Theologie der Liberalen und ihre unerledigten Probleme zu besinnen, geben Anlaß, die Theologie F. Niebergalls zum Gegenstand einer Untersuchung zu machen, in der nach dem theologischen Ansatz und den historischen Wurzeln dieser Theologie, sowie nach Recht und Grenzen einer Kritik daran gefragt werden soll.
II. Abgrenzung des Themas und Begründung der Gliederung Die Weite der Problemhorizonte verlangt eine klare Begrenzung der eigentlichen Aufgabe. 1. Der Versuch, die Mitte der Theologie F. Niebergalls herauszuarbeiten, scheint einen Uberblick über das gesamte Lebens werk vorauszusetzen. Bei der Vielzahl seiner Themen ist eine Darstellung des Gesamtwerkes aber nicht möglich. Andererseits würde man bei einer Beschränkung auf einzelne Ausschnitte — etwa auf Homiletik oder Religionspädagogik — Gefahr laufen, die Mitte gar nicht in den Blick zu bekommen. Nun gibt F. Niebergall selbst einen deutlichen Hinweis auf den gesuchten Ansatz. Er nennt seine Praktische Theologie — also seine Gesamtkonzeption — im Untertitel eine Erziehungslehre1β. Der Erziehungsbegriff ist der Schlüssel zum Verständnis seines Entwurfs. Bezeichnet dieser Begriff doch nicht nur die Aufgabe des Religionslehrers, sondern auch die des Pfarrers und des Theologen an der Universität. Der Erziehungsbegriff hat — wie noch zu zeigen sein wird — eine wesentliche Funktion in der Interpretation des christlichen Glaubens und in der Bestimmung des Verhältnisses der Praktischen Theologie zu den anderen Disziplinen. Die Frage nach dem theologischen Ansatz kann daher präzisiert werden als Frage nach der Funktion des Erziehungsbegriffs. 2. Auch die historische Aufgabe scheint zunächst uferlos zu sein, da bei einem Theologen, der um 1900 zu wirken beginnt, eine Vertrautheit mit den Klassikern des deutschen Idealismus, mit dem Denken der Romantik 1 8 F. Niebergall, Praktische Theologie. Lehre von der kirchlichen Gemeindeerziehung auf religionswissensdiaftlidier Grundlage. I. II., 1918. 1919.
15
und der folgenden geisteswissenschaftlichen Strömungen vorauszusetzen ist, die im einzelnen nicht leicht nachzuweisen ist. Wieder gibt F. Niebergall selbst einen Hinweis auf eine mögliche Begrenzung der Aufgabe. Er bezeichnet J. Kaftan als den theologischen Lehrer, dem er das meiste verdankt und dem er im ganzen folgt. Da sich Hinweise auf J. Kaftan sowohl in frühen wie in späten Arbeiten F. Niebergalls finden17, da ferner J. Kaftan seinerseits sich zu seinem Schüler bekennt, kann kein Zweifel über die anfängliche und bleibende Bedeutung dieses Lehrer-Schüler-Verhältnisses bestehen18. Audi die Frage nach den historischen Wurzeln der Theologie F. Niebergalls kann daher präzisiert werden: Auf welche Weise hat er die systematische Theologie J. Kaftans übernommen und weitergebildet? Der Vergleich macht F. Niebergalls Abhängigkeit und Selbständigkeit deutlich und hilft damit, die Eigenart seiner Position zu erkennen. 3. Am schwierigsten scheint die Abgrenzung der Frage nach Recht und Grenzen einer Kritik an F. Niebergall zu sein, da hier auch Aussagen in Betracht kommen, die sich nicht ausdrücklich auf ihn beziehen. Aber auch hier ermöglicht der Erziehungsbegriii eine Konzentration der Aufgabe. Der Gegensatz zwischen der alten und der neuen Theologie führt zu einer entgegengesetzten Beurteilung der Erziehung und ihrer Bedeutung für den christlichen Glauben. E. Sülze bringt den Unterschied der beiden großen Konfessionen auf die Formel „Erziehung oder Sakrament" und gibt damit eine verbreitete „kulturprotestantische" Stimmung wieder. Die evangelische Kirche will durch Wort und Sakrament erziehen. Anders verhält es sich beim Katholizismus: „Hier wird der Mensch nicht durch die erziehende Einwirkung der einen Person auf die andere, sondern durch sachliche, wunderhaft wirkende Mittel zu einem Gotteskinde." 19 Der Erziehungsbegriff bezeichnet hier den Gegensatz zwischen personenhaft und sachlich verstandenem Heil. In ähnlicher Weise sieht K. Seil den Katholizismus charakterisiert durch ein sakramentales System, durch Heilssicherheit, Autorität und den Wunsch, Massen zu befriedigen. „Demgegenüber wäre an dem protestantischen Gottesbegriff dieses hervorzuheben, daß er ein mehr individuell, mehr menschlich gedachter Gott ist, als dessen Hauptwerk angesehen wird die Fortentwicklung der Welt, die Erziehung der Welt zu etwas Besse17 F. Niebergalls Aufsatz „Die Lehre von der Erwählung" (ZThK 6, 1896, 47—70) enthält im wesentlichen dieselben Gedanken wie die §§ 50.51.57 in J. Kaftans Dogmatik, 1897 1 . Vgl. F. Niebergall, Die Bedeutung der Kaftanschen Dogmatik für die Praxis, MkPr 1, 1901, 271—284. Die Aufgabe einer praktischen Dogmatik, Festgabe für J. Kaftan, 1920, 243—251. Pädagogische Religionsphilosophie, Langensalza 1930: „ . . . wie wir uns auch mit Freude als Schüler von J. Kaftan bekennen." 18 Kirche, Recht und Theologie in vier Jahrzehnten. Der Briefwechsel der Brüder Theodor und Julius Kaftan hrsg. und kommentiert von Walter Göbell, 2. Teil: 1910 bis 1926, 1967, 499 f. 19 E. Sülze, Die evangelische Gemeinde, 1891, 3 f.
16
r e m . . . Die ganze spätere protestantische Theologie in den verschiedensten Schulen hat sich mit Vorliebe dem Aufsuchen der Spuren Gottes in der Erziehung des Menschengeschlechts, in der Beeinflussung ihres Entwicklungsganges von innen her nach außen gewidmet." 20 Auch hier hat „Erziehung" positive Bedeutung. Der Begriff kennzeichnet die eigene protestantische Position. Er hat die Funktion, das eigene Verständnis des Glaubens zu interpretieren. Es zeigt sich aber bereits, daß „Erziehung" ein komplexer Begriff ist, der sowohl die Personalität des Glaubens im evangelischen Sinn als auch den modernen Entwicklungsgedanken betonen kann. Unter dem Einfluß der dialektischen Theologie wandelt sich das Urteil. Th. Heckel beobachtet nun, daß gerade die katholische Theologie eine stärkere Affinität zu pädagogischen Erkenntnissen hat. Die katholische Anthropologie gewährt Spielraum für modernen Idealismus und Psychologie. „Daraus versteht sich zum guten Teil die anverwandelnde Beweglichkeit, mit der die katholische Pädagogik in an sich tüchtigen und umfänglichen Leistungen die Ergebnisse moderner wissenschaftlicher, pädagogischer Arbeit sich zueignet. Dies ist katholisch sachgemäß .. . Die Differenz zwischen evangelischer und katholischer Methodik liegt also nicht auf organisatorischem oder intellektuellem Gebiet, sondern in der Anschauung des Glaubens. Die reformatorische Lehre stößt jeden Synergismus auch in der feinsten Gestalt psychologischer Zubereitung aus." 21 Der Erziehungsgedanke, der einmal die protestantische Position kennzeichnete, soll jetzt typisch katholisch sein. Was beinhaltet diese Wende im einzelnen? Hat sich neben dem Verständnis der Offenbarung und des Glaubens auch das der Erziehung gewandelt? Bleibt der komplexe Charakter des Erziehungsbegriffs erhalten? In der Folgezeit gilt „Erziehung" weithin als ein „weltlich Ding" 2 2 . Die Auffassungen der einzelnen Theologen sind nicht einheitlich, aber sie sind sich einig, daß der Erziehungsbegriff nicht geeignet ist zur Interpretation theologischer Sachverhalte. Mag mancher noch eine Erziehung zum Glauben für möglich halten, die menschliche Vermittlung des Glaubens wird meist „Verkündigung" genannt und von der Erziehung unterschieden28. Bezeichnend ist die Erklärung K. Stoevesandts: Der Prediger „hat also keine pädagogische Aufgabe" 24 . Er darf vom Pädagogen nicht lernen wollen, will er seiner Aufgabe treu bleiben. Deshalb darf nicht nach der Bedeutung der PädagoK. Seil, Katholizismus und Protestantismus, 1908, 150. Th. Heckel, Zur Methodik des evangelisdien Religionsunterrichts, 1930 2 , 28 f. 2 2 Bezeichnend ist folgende Aussage: „Indem wir evangelischen Christen die E r ziehung als weltliches Tun bejahen und anerkennen, versagen wir ihr zugleich den falschen Anspruch in bezug auf das Evangelium." O. Hammelsbeck, Evangelische Lehre von der Erziehung, 1958 2 , 42. 2 3 Vgl. R. Dross, Religionsunterricht und Verkündigung, 1964. 2 4 K. Stoevesandt, Die pädagogische Bedeutung der Gemeindepredigt, 1952, 3. 20
21
17
gik für die Predigt, sondern nur gefragt werden, „was die Hilfe, die die Predigt dem Menschen gibt, für seine Erziehung bedeutet" 2 5 . Für F. Niebergall dagegen ist die Predigttätigkeit des Pfarrers zutreffend und ausreichend beschrieben, wenn sie Erziehungstätigkeit genannt wird 2 e . Auf K. Stoevesandt berufen sich O. F. Bollnow und H . Schaal 27 . Deren philosophische Arbeiten machen deutlich, wie sehr die Konstruktion eines Gegensatzes zwischen Glaube und Erziehung von Kierkegaards Kategorien des Augenblicks und der Existenz bestimmt ist. Während O. F. Bollnow aber nur eine Ergänzung der üblichen Pädagogik durch eine existentialistische Krisenpädagogik fordert, wird unter dem Einfluß der dialektischen Theologie häufig zwar nicht die Möglichkeit, aber die theologische Relevanz einer stufenweise fortschreitenden Erziehung bestritten. Hier kommt die „Kontroverse um Kierkegaard und Grundtvig" in den Blick 28 . G. Ebelings Forderung, auch die inzwischen selbstverständlich gewordenen Urteile und Verurteilungen zu überprüfen, ist gerade im Blick auf die Bedeutung der Erziehung für die Theologie noch nicht erledigt. Die notwendige Frage nach Recht und Grenzen einer Kritik an F. Niebergalls Praktischer Theologie ist zu präzisieren auf die Frage nach Recht und Grenzen einer Kritik am Erziehungsbegriff. Dabei ergeben sich zwei weitere Fragen: Bedeutet die gegensätzliche Beurteilung des Erziehungsbegriffs durch liberale und dialektische Theologie wirklich eine Alternative? Schließt die berechtigte Kritik an F. Niebergalls „idealistischem" Ansatz eine legitime Verwendung dieses Begriffs als Interpretament theologischer Sachverhalte grundsätzlich aus? Die Schwierigkeit, die Kritik an F. Niebergalls Theologie in den Griff zu bekommen, ist damit noch nicht aufgehoben. Es kann sich nicht darum handeln, einzelne kritische Bemerkungen zu analysieren. Vielmehr muß die Kritik in ihrem Ansatz zum Verständnis gebracht werden. Unter den dialektischen Theologen läßt R. Bultmann Anknüpfung und Widerspruch in Bezug auf die liberalen Väter besonders klar erkennen. Obwohl er sich dabei nicht ausdrücklich auf F. Niebergall bezieht, ist bei ihm doch eine gewisse Nähe zum Gegenstand der Untersuchung in dem Umstand gegeben, daß auch er J . Kaftan seinen Lehrer nennt 29 . Daher sollen die Grund2 5 Ebd. 17. Ähnlich urteilt K . Schaller, Die Krise der humanistischen Pädagogik und der kirchliche Unterricht, 1961. 26 Vgl. F. Niebergall, P T II § 45, Die Predigtaufgabe als Ganzes. 27 O. F. Bollnow, Existenzphilosophie und Pädagogik, in: Der Mensch in Theologie und Pädagogik. Pädagogische Forschungen 2, 1957, 44 ff., bes. 53. H . Schaal, Erziehung bei Kierkegaard, Pädagogische Forschungen 8, 1958, 12 Anm. 12. 28 Kontroverse um Kierkegaard und Grundtvig I, hrsg. von Κ. E. Logstrup/G. Harbsmeier, 1966. 28 „Ich entsinne mich, wie Julius Kaftan, mein Dogmatiklehrer in Berlin, sagte: . . R. Bultmann, G V IV (1965) 142.
18
gedanken F. Niebergalls mit entsprechenden Aussagen R. Bultmanns konfrontiert werden. Wären aber nicht J . Kaftan und W. Herrmann würdigere Partner für R. Bultmann, solange es darum geht, den Gegensatz systematisch-theologisch zu verdeutlichen? Es hat sich aber bereits gezeigt, daß die Problematik der Praktischen Theologie von Anfang an in den Streit einbezogen worden war. Deshalb soll bewußt nach den Konsequenzen gefragt werden, die sich aus den unterschiedlichen Ansätzen für den Bereich der Praktischen Theologie ergeben. Es könnte sein, daß sich dabei neue Gesichtspunkte ergeben, die eine Kritik der Kritik notwendig machen. D a der Praktiker F. Niebergall — wie der damalige Volksschullehrer auf vielen Gebieten mehr oder weniger genial dilettierend — sich an mannigfachen Themen versucht, bestehen sehr viele Vergleichsmöglichkeiten, die nach Möglichkeit wahrgenommen werden sollen. Es ergeben sich Analogien und Kontrastparallelen zu K . Barth, E. Jüngel, W. Marxsen u. a. Dabei kann keine Vollständigkeit angestrebt werden. Die Auswahl der zum Vergleich herangezogenen neueren Autoren hat naturgemäß etwas Willkürliches. Sie kann erst nachträglich durch die Ergebnisse selbst gerechtfertigt werden. Aufgrund dieser Überlegungen ergibt sich folgende Gliederung der Untersuchung: Im ersten Teil soll der Erziehungsbegriff als Schlüsselbegriff im theologischen Ansatz F. Niebergalls herausgearbeitet werden. Die Thematik ist dabei weitgehend der Systematischen Theologie entnommen. Systematische und praktisch-theologische Fragestellungen verschränken sich, wenn im zweiten Teil die Funktion des Erziehungsbegriffs in F. Niebergalls Verständnis der Praktisch-theologischen Disziplin dargestellt wird. Im dritten Teil sollen die Konsequenzen für die Arbeitszweige der Praktischen Theologie gezogen werden. Diese im wesentlichen systematische Gliederung ist nur möglich unter der Voraussetzung, daß das Lebenswerk F. Niebergalls keine entscheidenden Brüche aufweist. Hätten sich seine Anschauungen an einer Stelle erheblich gewandelt, dann müßten die Phasen seiner theologischen Entwicklung gesondert behandelt werden. Daher muß zunächst in einem vorläufigen Überblick diese Frage geklärt werden. Das trotz gewisser Kritik bis zuletzt festgehaltene Bekenntnis zur Theologie J . Kaftans macht eine tiefgreifende Wandlung unwahrscheinlich. F. Niebergall wählt seinen theologischen Standort bewußt innerhalb der Ritschl-Schule. Die Aufsätze in der „Zeitschrift für Theologie und Kirche" bringen dies deutlich zum Ausdruck. Den entsprechenden kirchenparteilichen Standort beschreibt er folgendermaßen: „Genauer wollen wir im Sinne der Gruppe sprechen, die sich um die ,Christliche Welt' als ihr Panier scharrt.. . " 3 0 Die Erkenntnis, daß die Ergebnisse einer kritischen, 30
Hilligenlei und moderne Theologie, 1906, 3.
19
religionswissenschaftlichen Theologie die Praxis nicht hemmen, sondern fördern, stärkt den Willen zur kirchlichen Aktivität. Er arbeitet in mehreren Vereinigungen mit, u. a. im Bund zur Reform des Religionsunterrichts, im Evangelischen Bund und im Evangelisch-sozialen Kongreß 31 . Die Bibliographie zeigt sein Engagement in der Alkoholfrage. Sie verrät ferner ein gewisses Gefälle von der systematischen zur praktischen Theologie. Die ersten größeren Veröffentlichungen in der ZThK, die noch in die Zeit seiner pfarramtlichen Tätigkeit (1892—1903) fallen, wollen im Geiste J. Kaftans das Evangelium mit dem modernen Geist versöhnen, d. h. die christliche Überlieferung so interpretieren, daß falsche Anstöße beseitigt werden. Seine Homiletik 32 markiert die Wende zur Praktischen Theologie. Er wird 1903 Privatdozent, 1908 a. o. Professor für Praktische Theologie an der Evangelisch-theologischen Fakultät der Universität Heidelberg. Von da an ist für ihn die Verbindung von Elementen der J. Kaftanschen Theologie mit empirischen Erkenntnissen auf psychologischem und soziologischem Gebiet maßgebend. Er gehört zu den Mitherausgebern der „Monatsschrift für die kirchliche Praxis" (1901 ff.), die für ihre Bestrebungen die Bezeichnung „moderne Theologie" in Anspruch nehmen 33 . Manchen Fragestellungen scheint er sich erst unter den Notwendigkeiten seiner Lehrtätigkeit zugewandt zu haben, ζ. B. dem Problem der Gestalt der Kirche als einem auch soziologisch beschreibbaren Phänomen oder den Fragen nach der Notwendigkeit und Begründung des schulischen 3 1 Vgl. Der Sdiulreligions- und der Konfirmandenunterricht (1912), Referat auf der Dresdener Haupttagung Ostern 1912 des „Bundes für Reform des Religionsunterrichts". Vgl. den Vortrag bei der 20. Generalversammlung des Evangelischen Bundes in Worms 1907 (s. Bibliographie Nr. 134). F. Niebergall hat laut Teilnehmerliste an Evangelischsozialen Kongressen teilgenommen in den Jahren 1900, 1902, 1903, 1907, 1909, 1912, 1913, 1921, 1926, 1929, 1894, 1896. 3 2 Wie predigen wir dem modernen Menschen? I, (1902) 1920 4 ; II, (1906) 1917 3 ; III, 1921. 3 3 „Je mehr aber die theologischen Verschiedenheiten Gegenstand kirchenpolitischen Kampfes wurden, um so allgemeiner wurde das Wort (seil, moderne Theologie) für alle nicht ,positi ve' Theologie gebraucht;... als Selbstbezeichnung angenommen haben das Wort .Vertreter der modernen Th.' z. B. O. Baumgarten und die Mitherausgeber der MkPr." H. Mulert, Art. Moderne Theologie, R G G 1 IV, 417 f. Vgl. F. Niebergall, Die moderne Predigt, 1929. Er läßt dort die orthodoxe, die liberale, die moderne und die dialektische Theologie aufeinander folgen und beschreibt seine Arbeit unter der Überschrift „Die moderne Predigt" (50 ff.). Modern heißt nicht modisch. Die moderne Predigt bezieht die moderne Theologie und den modernen Menschen aufeinander. Diese Bemühung muß sich von einem Gespür für das, was im Kommen ist, leiten lassen. Die moderne Predigt soll nicht die Studierstubentheorie verwirklichen, „sondern die Theorie hat durch eine möglichst intensive Divination festzustellen, welchen Zug zu nehmen die Praxis im Begriffe ist, um daran die Theorie zu o r i e n t i e r e n . . D i e moderne Predigt, ZThK 15, 1905, 238.
20
Religionsunterrichts 34 . Die Einbeziehung neuer Themen bedeutet jedoch keine theologische Wandlung. Etwas anders liegen die Dinge auf religionspsychologischem Gebiet. Er gibt zu, daß er seine Gewährsleute gewechselt habe. „Wie predigen wir dem modernen Menschen?" I (19021) wird von der Psychologie Jodls her konzipiert. Durch R. Kabisch auf W. Wundt verwiesen, arbeitet er in der 3. Auflage (1908) entsprechende Ergänzungen ein, ohne die Anlage im ganzen zu verändern. In den Arbeiten nach 1918 wird hauptsächlich H . Maiers „Psychologie des emotionalen Denkens" (1908) genannt 35 . Obwohl er dessen Atheismus als Grenzüberschreitung tadelt, gibt er ihm doch den Vorzug gegenüber R. Otto, weil dieser die Werte zu wenig betont 36 . Übereinstimmung mit J. Kaftan, also ein theologisches Kriterium, gibt audi auf psychologischem Gebiet den Ausschlag. Auch die Einbeziehung der Wertphilosophie M. Schelers geschieht in der Absicht, sich den J. Kaftanschen Ansatz bestätigen zu lassen37. Der Austausch der psychologischen Gewährsmänner ändert im Theologischen nichts. Auch auf pädagogischem Gebiet zeigt sich keine grundsätzliche Wandlung. Zwar ist in der „Entwicklung der Katechetik zur Religionspädagogik" 38 etwas Neues in Erscheinung getreten, aber F. Niebergall macht den Wandel nicht mit: er setzt ihn voraus. Der Unterschied zwischen Katechetik und Religionspädagogik läßt sich auf die J. Kaftansche Unterscheidung einer auf theoretischen und einer auf Werturteilen beruhenden Glaubenserkenntnis zurückführen. Daß die Herbartianer von den Vertretern des Arbeitsschulgedankens abgelöst werden, wird bemerkt, aber nicht als Bruch empfunden. Von Ziller und Rein wird manches übernommen, wenn auch ihr Intellektualismus, Formalismus und ihre Methodengläubigkeit abgelehnt werden. Er verfährt meist eklektisch, greift Anregungen auf, ohne nach der Begründung der Methodenlehre in einer allgemeinen pädagogischen Theorie zu fragen. 34
Vgl. Der Schulreligions- und der Konfirmandenunterricht. „Waren die psychologischen Ausführungen in der ersten Auflage des ersten Bandes noch rein durch die Psychologie von Herbart und Jodl bestimmt, so in der zweiten Auflage des ersten Bandes unter dem Einfluß von R. Kabisch durch die Psychologie von Wundt, die erst spät der emotionalen Psychologie H. Maiers Platz machte." Die moderne Predigt (1929) 67. Im Vorwort (III) stellt F. Niebergall fest: „Die Frage ist heute dieselbe wie damals; nur Inhalt und Ton der Antwort haben sich gewandelt, wenn auch die Grundüberzeugungen und die leitenden Absichten des Verfassers dieselben geblieben sind." 38 Vgl. F. Niebergall, Pädagogische Religionsphilosophie. Der neue Religionsunterricht IV, 1930, 52 ff. 37 Vgl. Christliche Jugend- und Volkserziehung, 1924, 43 ff. (Wertwissenschaftliche Erkenntnisse.) 38 Vgl. den gleichnamigen Aufsatz in den Monatsblättern für den Evangelischen Religionsunterricht 4, 1911, 1—10. 33—43. 35
21
Anlaß zu einer theologischen Sinnesänderung hätte die dialektische Theologie sein können. D a es aber zu keiner wirklichen Auseinandersetzung mit ihr kommt, unterbleibt eine Korrektur der eigenen Ansichten. Seit 1922 ordentlicher Professor an der Universität Marburg, konnte er die liturgischen Erneuerungsbestrebungen von R. Otto und F. Heiler aus der Nähe beobachten. Sie gaben keinen Anlaß, die eigenen Anschauungen über Gottesdienst und Liturgie zu revidieren 3 9 . Einen tieferen Eindruck haben Krieg und Revolution hinterlassen. E r sieht die Theologie der Krise im Zusammenhang mit dem Kriegserleben, wenn auch für ihn selbst zunächst die positiven Urteile über den Krieg überwiegen 40 . Der Krieg entbindet religiöse Kräfte, hilft falsche Gegensätze überwinden und befreit von Götzen 4 1 . Zugleich werden Verherrlichung des Krieges und kirchlich propagierter Nationalismus abgelehnt 4 2 . Die Revolution und der neue Staat sollen von der Kirche bejaht und gefördert werden 4 3 . Wie bei O. Baumgarten läßt sich auch bei F. Niebergall nach 1918 eine gewisse Wandlung im politischen Denken beobachten, die aber nicht zu einer theologischen Sinnesänderung führt, da sie durch seine bisherige Theologie ermöglicht wird 4 4 . E r hat nichts einzuwenden, wenn alttestamentliche Stoffe im Religionsunterricht zugunsten soldier aus der deutschen Kirchengeschichte zurücktreten ; den aufkommenden 3 i Vgl. Die neuen Wege kirchlicher Arbeit, 1928, 12 ff. 15 ff. „Vor allem aber müssen wir aus der Liturgitis, der geistigen Trunkenheit heraus, in der uns die Überspannung des liturgischen Reformeifers hält." (26) 4 0 „Auf Jahrzehnte haben wir damit zu rechnen, daß dieser Krieg Glück und Unglück aller Menschen bedingt; ist er doch nicht nur das am tiefsten eingreifende, sondern auch das am weitesten reichende Schicksal, das je die Menschen betroffen hat. F. Niebergall, P T I, 179. „Es ist mit einem Wort die geistige Lage nach dem Krieg, aus der sie (seil, die dialektische Theologie) hervorgegangen ist, um deswillen sie vielen auch noch als eine Erscheinung der Kriegs- und Nachkriegspsychose gilt." Im K a m p f um den Geist, 1927, 130 f. Vgl. zur Bedeutung der politischen und kulturellen Situation für die Anfänge der dialektischen Theologie J . Moltmann, T h B 17, 1. Teil, I X f., und K . Scholder, Neuere deutsche Geschichte und protestantische Theologie, E v T h 23, 1963, 510 ff. 4 1 Vgl. P T I, 248 und „Überwundene Gegensätze", Monatsblätter für den E v a n gelischen Religionsunterricht 9, 1916, 5 — 1 0 . 4 2 „Gegenwärtig ist es noch gar nicht zu übersehen, wie sehr der Kirche die Kriegsbegeisterung und das Eintreten für die Vaterlandspartei geschadet hat, die jahrelang die Kanzeln beherrschten." P T I I , 143. „Wie haben wir uns in den Dienst bestimmter P a r teistandpunkte gestellt, wie allem geglaubt, was uns selbst versichert wurde, wie den Gerechten im Himmel auf unsrer Seite geglaubt und auch schauen lassen." P T I I 163. 4 3 Vgl. P T I I , 497. 4 4 „Wer von dieser begeisterten Verkündigung von Weltfrieden und Weltgefühl zurückschaut auf meine so lange und warm vertretene national und militaristisch bestimmte Politik des Selbstbehauptungs- und Machtstrebens, der kann ermessen, wie die großen Zeitereignisse an meiner innersten Seele gearbeitet und mich zum Umlernen in den wesentlichsten Fragen genötigt haben." O. Baumgarten, Meinen Lebensgeschichte, 1929, 500. Zu F. Niebergall vgl. Anm. 42.
22
Antisemitismus hat er jedoch immer abgelehnt 45 . Seine Stellungnahme zum dritten Reich fällt eindeutig negativ aus 46 . Da sich also bei F. Niebergall in theologisch-kirchlichen, gesellschaftlich-politischen und psychologisch-pädagogischen Fragen teilweise zwar Entwicklungen, aber keine grundsätzliche Wandlung erkennen lassen, kann die folgende Untersuchung — wie vorgesehen — nach systematischen Gesichtspunkten gegliedert werden. 45 „Wir müssen uns einmal auf solche Dinge im A.T. beschränken, die, wie etwa die Ursagen, religiöse Grunderkenntnisse zum klassischen Ausdruck bringen . . . U n d dann dürfen wir audi die deutsch-christlidie Geschichte viel mehr heranziehen als es geschieht." Die neuen Wege kirchlicher Arbeit, Göttingen 1928, 66. „Und nicht nur auf U n b u ß fertigkeit beruht der übliche Antisemitismus, seine Wurzel geht nodi tiefer: es ist, als wenn jeder Mensch seinen H a ß haben und pflegen müsse, um allerlei innere Revolution durch K a m p f nach außen hin zu überwinden. Was dem einen der Jesuit, der Engländer, der P f a f f e , ist dem andern der J u d . Die ganze Geistesriditung ist ein übler Spiegel f ü r die menschliche u n d auch f ü r die christlich-deutsche Seele." Praktische Auslegung des Alten Testaments III, 1922, 325. Vgl. Evangelische Kirche und Völkerverständigung. Eine Erklärung von Hirsch und Althaus. Eine Gegenerklärung von Niebergall und Rade. C h W 45, 1931, 605—607. 46 „Wir erwarten keinen Messias, der sein Drittes Reidi der Herrlichkeit und des Glückes gebrauchsfertig vom Himmel herniederbrächte, sondern wir wissen: es bedarf einer gründlichen U m k e h r der Maßstäbe und Gewohnheiten, der Anschauungen über Redit und Unrecht, über Volksgemeinschaft und Menschheit. Das Blut macht es nicht, sondern der Geist; die Agitation macht es nicht, sondern stille, zähe, solide Arbeit." Die Kirche u n d das dritte Reich. Fragen und Forderungen deutscher Theologen I, hrsg. v. L. Klotz, 1932, 81. F. Niebergalls Beitrag sdiließt mit dem Satz: „Wir sollen als Christen keinen Menschen und keine Politik vergötzen, sondern wir sollen Gott allein anbeten und ihm dienen." Ebd. 82.
23
1. Teil: Der Erziehungsbegriff
als Schlüsselbegriff im
theologischen Ansatz Friedrich
Niebergalls
Mit einem typisch „modernen" Gespür für das, was in der Luft liegt, rückt F. Niebergall zu Beginn des „Jahrhunderts des Kindes" den Erziehungsbegriff in die Mitte seiner Theologie. Die Weite des Begriffs erlaubt Assoziationen in vielerlei Hinsicht. Ob man geschichtliche Phänomene — den nüchtern-praktischen Optimismus der Aufklärung, den romantischen Sinn fürs Volkstümliche, das neuhumanistische Bildungs- und Persönlichkeitsideal — im Blick hat oder dem Zug der Zeit folgend Erziehung mit Entwicklung, Deszendenz, empirischer Wissenschaft, Psychologie und Soziologie zusammendenkt, der Autor darf mit dem Interesse seiner Leser rechnen, wenn er von Erziehung spricht. F. Niebergall folgt freilich nicht einfach einer Modeströmung. Er findet den Erziehungsbegriff in der Theologie seines Lehrers J . Kaftan vor und übernimmt ihn zusammen mit andern Strukturelementen. Der Begriff hat jedoch sein eigenes Gefälle. Er erfährt eine Akzentverschiebung und Ausweitung. Doch bleiben die theologischen Maßstäbe J . Kaftans bestimmend. Deshalb soll zunächst gezeigt werden, wo und wie J . Kaftan den Erziehungsbegriff verwendet.
I. Die Funktion des Erziehungsbegriffs in der Theologie Julius Kaftans In den Bänden über „Das Wesen der christlichen Religion" (2. A. 1888) und über „Die Wahrheit der christlichen Religion" (1888) legt J . Kaftan den prinzipiellen Teil seiner Dogmatik vor, den er als Apologetik verstanden wissen will 1 . Wie A. Ritsehl geht er von der grundlegenden Unterscheidung von theoretischen und Wert-Urteilen aus, um damit der Religion einen ihr eigentümlichen Bereich auszugrenzen, der von den Ergebnissen der auf Tatsachenurteilen beruhenden Wissenschaft unberührt 1 Das Wesen der christlichen Religion S. V (künftig W R ) . Vgl. zu J. Kaftan: Selbstbiographie, in: Die Religionswissenschaft der Gegenwart, hrsg. v. E . Stange, IV, 1928, 2 0 1 — 2 3 2 . C . Stange, Der dogmatische Ertrag der Ritschlschen Theologie nach Julius Kaftan, 1906. G. Ebeling, Ist der konfessionelle Gegensatz auch ein philosophischer?, in: Wort Gottes und Tradition, 1964, 7 8 — 9 0 .
24
bleibt 2 . Der Glaube vereinigt in sich ein theoretisches und wertendes Element. Sein komplexer Charakter wurzelt in einer komplexen Psychologie, die Vorstellung und Gefühl grundsätzlich unterscheidet, aber nicht trennt 3 . Die damit problematisch gewordene Einheit der komplexen Gebilde findet ihren Ausdruck in der Behauptung eines Primates von Gefühl und Werturteil gegenüber Vorstellung und theoretischem Urteil. Diesen anthropologischen Voraussetzungen entspricht der Religionsbegriff, den er nicht religionsphilosophisch, sondern religionsgeschichtlich 4 , genauer religionsphänomenologisch ableiten will. Er entwirft eine Art Koordinatensystem aus Religionstypen, in das alle religiösen Erscheinungen eingezeichnet werden können. Ausgangspunkt ist der Lebenstrieb, die Gefühle der Lust und Unlust, auf die alle Religionen letztlich zurückgehen 5 . In der Naturreligion werden Mächte als Spender und Garanten irdischer Lebensgüter verehrt. Weil diese keine dauernde Befriedigung geben, werden höhere und schließlich ein höchstes Gut erstrebt, das überweltlichen Charakter hat und Anteil am Leben der Gottheit gibt. Die Naturreligion entwickelt und vollendet sich in der mystischen Erlösungsreligion, die jedoch gesetzlichen Charakter hat, da man sich das höchste Gut durch Askese verdienen muß. Der Ausgangspunkt Natur kann nun auch in einer andern Richtung, auf das Sittliche hin transzendiert werden. Es entsteht die ethische Volksreligion, die ebenfalls gesetzlich ist, sofern in ihr das sittliche Handeln als Leistung verstanden ist. Im Christentum konvergieren die bisher divergierenden Linien der Entwicklung von der Natur zur Ubernatur und von der Natur zur Sittlichkeit. Im zentralen Begriff des Reiches Gottes sind ein sittliches und ein religiöses Element zur komplexen Einheit verbunden, die eine Neuschöpfung darstellt 6 . Indem das höchste Gut, Gott selbst, sittlichen Charakter bekommt, ist es personal gedacht und die Gesetzlichkeit überwunden. Dieses Schema ermöglicht eine komplexe Bestimmung des Verhältnisses zwischen dem Christentum und den Religionen, einmal als Kontiunität des Aufstiegs von niedern Gütern zum höchsten Gut, dann als Gegensatz von Gesetz und Evangelium. Der komplexen Struktur der Thologie entspricht die doppelte Frontstellung. J . Kaftan wendet sich gegen eine unsachgemäße Vertretung des Christentums in der orthodox-pietistischen Verkündigung der evange2 W R 45. D e r Illusionsverdacht gegenüber der Religion kann dadurch ebensowenig wie in der existentialen Interpretation widerlegt werden. Vgl. R . Bultmann, G V I V 179. 3 Vgl. W R 32, 37 f. 40. 4 V g l . W R 1 — 2 7 und D o g m a t i k , 1897 1 ( k ü n f t i g D ) , 11. J . K a f t a n bekämpft die religionsgeschichtliche Schule. Vgl. seine Schrift: Jesus und Paulus, 1906, und J . R a t h j e , D i e Welt des freien Protestantismus, 1952, 84 ff. K r i t i k bei C . Stange, a. a. O . 36. 5 W R 58. 6 W R 22. F. N i e b e r g a l l sieht in diesem religionswissensdiaftlidien A n s a t z das Verdienst J . K a f t a n s , N R U I V , 60.
25
lisdien Kirche und in der Glaubenslehre der katholischen Kirche, aber auch gegen die Mißverständnisse bei den Gegnern im positivistischen Lager 7 . In seiner Programmschrift von 1879 „Die Predigt des Evangeliums im modernen Geistesleben" möchte er den Konflikt zwischen Verkündigung und Bildung überwinden helfen. Er möchte daher die Beschränkung der Weltanschauung auf das Diesseits und die Ablehnung des Autoritätsgedankens als Teilwahrheiten gelten lassen. Auf dem Gebiet der Wissenschaft sind Autoritätsentscheidungen ungehörig, aber im Bereich der Werturteile sind sie legitim. Innere Freiheit und Autorität stehen in Korrelation. Dies soll den autoritätsfeindlichen Gegnern am Beispiel der Erziehung einsichtig gemacht werden 8 . Im Unterschied zum Unterricht, der Erkenntnis vermittelt, zielt die Erziehung auf den Willen und auf die zugrunde liegende Wertschätzung. In der Erziehung wirken nicht Tatsachen mechanisch, sondern die personale Autorität des Erziehers, der auf Seiten des zu Erziehenden personale Liebe entspricht. Wie Lessing 9 verwendet auch J . Kaftan „Erziehung" als Analogon zu „Offenbarung". Unbekanntes wird durch Bekanntes erklärt. Die Offenbarung ist das zu Interpretierende und die Erziehung Interpretament. Deshalb wird der Erziehungbegriff nicht problematisiert. Trotz der damit gegebenen Unbestimmtheit des Begriffs lassen sich gewisse Strukturelemente erkennen. Für den Erziehungsbegriff konstitutiv ist das personale Gegenüber von Erzieher und Zögling, die Korrelation von Autorität und Freiheit. Der Erzieher verfügt nicht über den Erfolg der Erziehung, da sich diese nur in Selbsterziehung verwirklicht. Mit dieser Betonung der Freiheit und Selbsttätigkeit ist eine Anknüpfung für den Arbeitsschulgedanken geschaffen. In seiner Dogmatik verwendet J. Kaftan den Erziehungsbegriff mehrfach bei der Erörterung einzelner loci. Zunächst stellt er unter Berufung auf Luther und Melanchthon 10 den praktisch-existentiellen Charakter der auf Werturteilen beruhenden Glaubenserkenntnis heraus. Den Unterschied zwischen einer rein praktisch bedingten, existentiellen Erkenntnis verdeutlicht er am Unterschied von Erziehung und Unterricht 11 . In der praktischen Erkenntnis korrespondiert, wie der Erziehungsgedanke zeigt, Vgl. Die Predigt des Evangeliums im modernen Geistesleben, 1879, 4 (künftig PE). Vgl. PE 65—67. 9 G. E. Lessing, Die Erziehung des Menschengeschlechts, Werke 6, hrsg. v. F. Fischer, Zürich 1965, § 1, § 3, § 4. Vgl. dazu M. Schmidt, Die Interpretation der neuzeitlichen Kirchengeschichte, ZThK 54, 1957, 174—212, bes. 186. 1 0 D 27, 99. Ähnlich R. Bultmann, G V II, 154. Vgl. die Kritik bei C. Stange, a. a. O. 44 und und H. J. Iwand, Wider den Mißbrauch des „pro me" als methodisches Prinzip in der Theologie, EvTh 14, 1954, 120. 1 1 D 184 f. 7
8
26
dem subjektiven Element ein objektives. Der Erziehungsbegriff soll den Verdacht des Illusionismus abwehren 12 . Bei der Interpretation der traditionellen Lehre von Urständ und Fall möchte er gegenüber dem katholischen Kooperationsgedanken mit den Reformatoren die Alleinwirksamkeit der Gnade und zugleich die Verantwortlichkeit des Menschen lehren 13 . Die Paradoxie des Zugleichs von Prädestination und Verantwortung verdeutlicht er an der Korrelation von Autorität und Freiheit in der Erziehung. Bultmann und Gogarten verweisen in diesem Zusammenhang auf das personale Wortgeschehen, das sie am Beispiel von Liebe und „Versprach" verdeutlichen. Der Erziehungsbegriff hat also bei J . Kaftan dieselbe Funktion wie später der Begriff des Wortes. Dies wird bestätigt, wenn er bei der Entfaltung der Rechtfertigungslehre Glauben und Geist an das Wort bindet und den Unterschied zwischen einem evangelischen Synergismus von Gnade und Freiheit und dem katholischen Verständnis durch personale Verhältnisse erklärt 1 4 . Das Theodizeeproblem möchte Kaftan durch die Unterscheidung von Vergeltungs- und Erziehungsstrafen lösen. Die Gerechtigkeit weist in den Bereich des Redits, die Erzieherweisheit in den der Familie. Der Erziehungsbegriff bezeichnet die personale Sphäre im Unterschied zur rechtlichen. Derselbe Gesichtspunkt findet bei der Interpretation der kirchlichen Satisfaktionslehre Anwendung. Das traditionelle juristische Denken soll durch ein ethisches abgelöst werden. Die Analogie zum Privatrecht bei Anselm und zum Staatsrecht in der Orthodoxie wird ersetzt durch die der Erziehung. Man muß sehen, „daß der Tod des Heilands das für den Zweck der Erziehung allein zureichende Mittel war, und daß dieser Zweck im Wesen des Erziehers, d. h. Gottes selbst begründet ist" 1 5 . Wieder dient der Erziehungsbegriff als Interpretament zur Verdeutlichung personaler Strukturen. In Spannung zu dieser theologischen steht eine mehr pädagogische Verwendung des Erziehungsbegriffs. Dabei wird weniger das in der Erziehung gesetzte Gegenüber von Erzieher und Zögling, weniger die gegebene Korrelation von Autorität und Freiheit als Struktur des Geschehens betont als vielmehr der Vorgang, das Wachstum, die Erziehungsmittel. Der Erziehungsbegriff erfährt hier eine Verengung auf den Bereich der Sittlichkeit als einer Komponente im Begriff des Reiches Gottes 1 β . In der Erziehung bekommt man es mit dem Gesetz zu tun. Die Erziehung bedeutet hier keine Analogie, vielmehr kommt sie als konkrete sittliche Entwicklung des Einzelnen und der Gemeinschaft selbst in den Blick 17 . PädD 172. D 293, 327. K a f t a n s E r z i e h u n g s a u f f a s s u n g k o m m t W. K o e p p nahe: „ S i e (seil, die Erziehung) ist eine Seite alles Lebens als solchem s e l b e r . . . Erziehung ist ein Existential des D a s e i n s . " D i e Erziehung unter dem E v a n g e l i u m , 1932, 2 f. 1 4 W R 166 f. 62 f. « D 569. 1 6 D 184, 186. " W R 161. 12
13
27
agogisch gedacht ist es, wenn J . Kaftan von der Notwendigkeit spricht, in der Erziehung Nahziele mit Mitteln anzustreben, die dem Wesen des letzten Zieles nicht voll entsprechen 18 . Der Erzieher muß daher die Voraussetzungen bedenken, unter denen der Offenbarungsempfang möglich wird. Der Gedanke an Entwicklung von rohen Anlagen, an Fortschritt, Besitzerweiterung und mit ihm der Gegensatz von Natur und Geist kommen ins Spiel. Die Erziehung zielt auf Bildung des Willens zum Charakter 1 9 . Als nicht zu erörternde Selbstverständlichkeit gilt, daß der Wille durch Übung und Gewöhnung gebildet wird 20 . Von diesem Aspekt aus wird die kirchliche Lehre von Urständ, Fall und Erbsünde kritisiert 21 . Verantwortung und Schuld setzen Erziehung voraus, weshalb beim Kind von beidem nicht die Rede sein kann. Die pädagogische Fassung des Erziehungsbegriffs erweist sich für J . Kaftan als Dogma, das sich gegen traditionelle Dogmen ins Feld führen läßt. Die menschliche Freiheit wird verstärkt durch eine Summe einzelner freier Entscheidungen, also durch Übung. Sie vollendet sich im freien Charakter, der das Gute unwillkürlich tut, für den Pflicht zur Neigung geworden ist. Dieser Aspekt der Erziehung hindert J . Kaftan daran, die Intentionen der reformatorischen Erbsündenlehre, die Aussage der uneingeschränkten Verlorenheit des Menschen ohne die Gnade, streng festzuhalten 22 . Die Vorstellung, daß die Freiheit erst im Verlauf der Erziehung entsteht, steht in Spannung zu der theologischen Verwendung des Erziehungsbegriffs als Interpretament theologischer Aussagen, nach denen die Freiheit als Korrelat der Autorität nicht entsteht, sondern zu den konstitutiven Gegebenheiten des Erziehungsgeschehens gehört. Wenn J . Kaftan das Wesen der Gesetzlichkeit dahin bestimmt, daß in ihr das höchste Gut als sittlich gleichgültig vorgestellt wird 23 , dann könnte man daraus folgern, daß in der Gesetzlichkeit das sittliche Handeln nicht selbst beseligt, sondern nur die Voraussetzung für den Empfang des Lebens schafft, also einen Anspruch begründet. Die Gesetzlichkeit könnte noch im reformatorischen Sinn als absoluter Widerspruch gegen einen christlich verstandenen Reich-GottesGedanken interpretiert werden. Die Aufnahme des pädagogischen Aspekts läßt aber bei J . Kaftan die Gesetzlichkeit als eine pädagogisch legitimierte Vorstufe zum richtigen Verständnis erscheinen. Ein gesetzlich begründetes sittliches Handeln läßt seiner Meinung nach den Menschen nicht unverändert, sondern vermag schließlich die Liebe zu Gott erwecken 24 , die nach reformatorischer Auffassung nur das Werk des 19 D 171. Vgl. W R 60, 62 f. 161, 166 f. 21 D 293 und D § 31. Vgl. P E 66 f. 2 2 M. Doerne zeigt, daß eine evangelische Anthropologie vom Sündersein des Menschen ausgehen muß, ohne hamartiozentrisch zu werden. A. Ammon / M. Doerne, Autorität und Sünde in der evangelischen Erziehung, 1932, 38 ff. Vgl. auch C . Stange, a. a. O. 103. 23 W R 164 f. « W R 166 f. 18
20
28
Evangeliums sein kann. Der Gegensatz von Gesetz und Evangelium und der ihm entsprechende zweier menschlicher Grundhaltungen wird aufgelöst in die Vorstellung eines allmählichen Übergangs von mühsam gesetzlicher in mühelose Pflichterfüllung aus Neigung, in der man die Teilhabe am höchsten Gut jetzt schon erfährt 2 5 . J . Kaftan bemerkt die Spannung zwischen den theologischen und pädagogischen Aussagen nicht. Zu beachten bleibt, daß auch der pädagogisch-psychologische Aspekt des Erziehungsbegriffs der Interpretation theologischer Sachverhalte dient. Die zugrunde liegenden Vorstellungen von den Erziehungsmitteln und -Vorgängen werden nicht diskutiert, sondern als selbstverständlich vorausgesetzt. J . Kaftan verzichtet auch darauf, praktische Konsequenzen aus seinem Erziehungsbegriff für das kirchliche Handeln in Predigt und Unterricht zu ziehen. Schließlich ist auf den latenten Gebrauch des Erziehungsbegriffs hinzuweisen. Man findet bei J . Kaftan Gedankengänge, die auch in der pädagogischen Literatur seiner Zeit eine Rolle spielten. Zu nennen sind die kulturhistorischen Stufen 2 e , die Aufstellung religiöser Typen, die ein Vergleichen im Sinn der Formalstufe der Assoziation ermöglichen 27 , das Interesse an der Echtheit der Aneignung, die durch Selbsttätigkeit bewirkt wird 2 8 und schließlich die Verwendung der Trias Norm, Zustand, Mittel bei der Entfaltung des Kirchenbegriffs 29 . Obwohl J . Kaftan wie Lessing den Erziehungsbegriff als Aanalogie zur Offenbarung gebraucht, läßt sich der Unterschied zu diesem nicht übersehen. Während nach Lessing die Erziehung sich selbst überflüssig machen soll und die Offenbarung entbehrlich wird, wenn die Vernunft regiert 30 , gehört nach J . Kaftan die Erziehung zur Struktur menschlichen Daseins, Autorität kann nicht entbehrlich werden 31 . Mit W. Wundt wendet sich J . Kaftan gegen die monistische Psychologie Herbarts, in der die Gefühle auf Vorstellungen zurückgeführt werden. Dem anthropologischen Dualismus entspricht dann die schärfere Trennung von Erziehung und Unterricht 32 . A. Ritsehl stimmt mit J . Kaftan überein, wenn er den Begriff der Erziehung als Analogie zur Verdeutlichung und Kritik bei der Behandlung bestimmter dogmatischer loci gebraucht. Dabei tritt der personale hinter dem erzieherischen Aspekt zurück. Der Wille bildet sich durch Übung. WR Vgl. 27 Vgl. 28 Die Jjewegung 29 Vgl. 3 1 Vgl. 25 26
62 f. D 366 und W. Rein, Pädagogik im Grundriß, 1971 5 , 89. F. Niebergall, N R U I, 109. jetzige Generation nimmt die einst erkämpfte Erkenntnis der Erweckungsin Besitz, ohne sie geistig zu erwerben. Vgl. J . Kaftan, Z T h K 1, 1891, 8. D 579. '» Vgl. oben Anm. 9. P E 67. « Vgl. WR 32, 37 f. 40.
29
Erziehung braucht Zeit und zielt auf Stetigkeit 33 . Von da aus ergeben sich pädagogische Argumente zur Kritik der Erbsündenlehre 34 . Auch Ritsehl verteidigt den evangelischen Synergismus mit Hilfe des Erziehungsbegriffs 35 . Doch während J . Kaftan den Vertretern des modernen Geisteslebens die christliche Tradition verständlich machen will, gebraucht A. Ritsehl den Erziehungsbegriff hauptsächlich als Argument in der Polemik gegen Katholizismus und Pietismus. Er vergleicht die gesetzliche Methode der mittelalterlichen Reformer mit dem erfolglosen Versuch, aus dem Stand heraus eine Schranke zu überspringen. Luthers pädagogische Methode dagegen führt zum Erfolg, da sie den Menschen anleitet, einen Anlauf zu nehmen 36 . Ritsehl interpretiert theologische Lehre als Erziehungsmethode und argumentiert mit dem Erfolg bzw. Mißerfolg der Methode. Heilsgewißheit bedeutet ihm Stetigkeit des Charakters als Ergebnis von Erziehung und Gewöhnung 37 . Die pietistische Forderung einer plötzlichen Bekehrung kann für ihn daher nur als Ausnahme in Frage kommen 38 . Die unterschiedliche Funktion des Erziehungsbegriffs dürfte darin begründet sein, daß J . Kaftan zwar seine theologische Arbeit auf den Dienst der Kirche bezieht, aber in der Rechtfertigungslehre nicht wie A. Ritsehl die Gemeinde dem einzelnen sachlich vorordnet 3 e . Die Entwicklung zu einem personalen Verständnis des Glaubens hin ist gebunden an ein individualistisches Verständnis des Heils einerseits und an die Auseinandersetzung mit dem positivistischen Denken andererseits, während A. Ritsehl mehr von einem kontroverstheologischen Interesse beherrscht wird. R. Bultmanns theologisches Denken bewegt sich teilweise in der Nähe seines Lehrers J . Kaftan. Beide wollen falsche Anstöße beseitigen und dem modernen Menschen das Ärgernis an der richtigen Stelle zeigen. Beide gebrauchen „rein formale" Daseinsanalysen und Analogien, um theologische Aussagen zu interpretieren. Sehr nahe kommen sie sich im personalen Verständnis der Korrelation von Gnade und Freiheit. Die scharfe Grenzziehung zwischen dialektischer und liberaler Theologie 40 hängt bei R. Bultmann mit seinem Verständnis der Erziehung zusammen. Erziehung charakterisiert bei ihm die griechische Anthropologie im Unter3 3 Vgl. D 320 u n d A . Ritsehl, D i e christliche Lehre von der Rechtfertigung und Versöhnung I I I , 1888 3 , 157 ( k ü n f t i g R V ) . 3 4 R V I I I 319. 35 R V H I 167. 3 8 Drei akademische Reden, 1887, 20 f., 45 f. 3 7 R V I I I 167. 3 8 R V I I I 160 und 157. 3 9 D a s kirchliche Interesse der Ritschl-Schule dokumentiert J . K a f t a n s A u f s a t z zur E r ö f f n u n g der Zeitschrift f ü r Theologie und Kirche, 1. J . 1891, 1—27. Vgl. R . Schäfer, D i e Rechtfertigungslehre bei Ritsehl und K ä h l e r , Z T h K 62, 1965, 6 6 — 8 5 . 4 0 Vgl. R . Bultmann, Jesus, 1926, passim, und D i e liberale Theologie und die jüngste theologische Bewegung, G V I, 1 ff.
30
schied zur neutestamentlich-christlichen41. Sie wird als Bildung aufgrund vernünftiger Belehrung verstanden. Bultmann weiß freilich, daß das antike Menschenbild in der liberalen Theologie modifiziert wird, sofern der Wille hier eine entscheidende Rolle gewinnt 42 . Im Unterschied zu Kaftan jedoch sieht Bultmann den Willen durch die Entscheidung des Augenblicks bestimmt, in der die Kontinuität mit der Vergangenheit aufgehoben und der Gesichtspunkt der Entwicklung ausgeschlossen ist 43 . Die Freiheit, die ganzen Gehorsam gegenüber Gottes Willen ermöglicht, widerfährt in der Entscheidungssituation. So vermag Bultmann das „extra nos" herauszustellen und das reformatorische Verständnis von Sünde und Gnade strenger festzuhalten. Auch gute Werke können Sünde sein, sofern der Wille in ihnen die Richtung auf Selbstbehauptung nimmt. Kaftan dagegen sieht die menschliche Unfreiheit in der Ohnmacht des Willens, der Einsicht in das Gute zu folgen. Freiheit als Willensstärke wird durch Übung in einer langsamen Entwicklung gewonnen. Κ. E. L0gstrup nähert sich in einer phänomenologischen Untersuchung des Willens 44 den Vorstellungen Kaftans und macht in einer kritischen Bemerkung zu Kierkegaard auf ein Problem aufmerksam, das bei Bultmann wiederkehrt und im folgenden das Problem des Ubergangs von der existentialen Interpretation zum existentiellen Vollzug genannt wird 4 5 . Bultmanns Kritik bezieht sich also auf die pädagogische Linie im komplexen Denken Kaftans, während er indirekt die personaltheologische Linie aufgreift und weiterführt. Von einer Alternative kann nicht gesprochen werden, eher von „Anknüpfung und Widerspruch" 4e . F. Niebergall verfährt umgekehrt. Wenn wir nun auf die Schwierigkeiten der Bultmannschen Position aufmerksam machen, gewinnen wir zwar kein Kriterium für eine endgültige Beurteilung, wohl aber eine Fragestellung, die die Untersuchung leiten kann. Wir fragen dann, ob und wie die Lösungen, die F. Niebergall anbietet, gerade die Schwierigkeiten lösen können, die bei Bultmann auftreten, und umgekehrt, ob und wie seine offenen Fragen hier einer Lösung zugeführt werden. Für D. Bonhoeffer blieb schon 1931 problematisch, „wie das Dasein als Entscheidung doch zugleich in Kontinuität gedacht werden könne" 4 7 . Bultmann denkt „Kontinuität" häufig zusammen mit Zuschauerhaltung, Reflexion und allgemeiner Wahrheit. Es bleibt aber zu fragen, ob man auf 41
196.
Vgl. R. Bultmann, Das Urchristentum im Rahmen der antiken Religionen, 1954 2 ,
Vgl. R. Bultmann, Geschichte und Eschatologie, 1958, 113. Vgl. R . Bultmann, Jesus, Siebenstern-Taschenbuch 17, 1964, 63. 4 4 Κ. E. Legstrup, Wille, Wahl und Freiheit, in: Zeit und Geschichte, hrsg. v. E. Dinkier, 1964, 5 1 7 — 5 3 0 . 4 5 Logstrup, a. a. O. 528. 4 6 Vgl. auch das Urteil O. Webers, Grundlagen der Dogmatik I, 1955, 166. 4 7 Vgl. D. Bonhoeffer, Akt und Sein, T B 5, 1956, 75. 42
43
31
den Gedanken an Kontinuität verzichten kann. Eine weitere Schwierigkeit liegt in der Unterscheidung von existentialer Interpretation und existentiellem Vollzug. M. Stallmann macht nämlich mit Recht darauf aufmerksam, daß existentiale Interpretation nicht über den Bereich des Gesetzes im theologischen Sinn hinausführt 48 . Wie ist dann der Ubergang vom einen zum andern möglich? Der Hinweis auf den Heiligen Geist führt über einen schwärmerischen Geistbegrifï noch nicht hinaus 49 , aber auch der Verweis auf das konkrete Wort der Predigt bleibt problematisch, da nicht deutlich ist, ob und inwiefern die Predigt bei Bultmann mehr ist als existentiale Interpretation. Die Tatsache, daß die Predigt die Heilstat Gottes in Christus interpretiert, macht sie noch nicht zum Evangelium 50 . Hinzu kommt, daß Bultmann nach Absicherung gegenüber Mißverständnissen den Gedanken an Kontinuität und Wachstum wieder aufnehmen kann 51 . Diese Schwierigkeiten behalten wir im Auge, wenn wir uns nun der Praktischen Theologie F. Niebergalls zuwenden.
II. Offenbarung als Erziehung „Hat es J. Kaftan darauf abgesehn, gemäß seiner Aufgabe, von dem als Inhalt der Offenbarung erkannten höchsten Gute des Reiches Gottes aus seine Linien christlicher Glaubenserkenntnis nach allen Seiten zu ziehen, so wird der Ausgangspunkt einer auf Wirken berechneten praktischen Dogmatik nicht das Objekt, sondern das Subjekt sein müssen." 1 Mit diesen Worten kennzeichnet F. Niebergall sein Verhältnis zu J. Kaftan. Es besteht seiner Meinung nach keine Differenz im Grundsätzlichen und Theologischen, aber es kommt zu einer Verschiebung des Akzentes vom Objektiven auf das Subjektive, die ihren Grund in der verschiedenen Zielsetzung der Systematischen und der Praktischen Theologie hat. Es geht zunächst um die Frage, ob und inwieweit dabei auch das theologische System eine Veränderung erfährt. 1. Praktischer
Glaube
F. Niebergalls erste einschlägige Veröffentlichungen in der ZThK zeigen seine Abhängigkeit von J. Kaftan 2 . Er behandelt systematische Themen in apologetischer Absicht. Dabei ist auch für ihn die Unterscheidung einer 48
Vgl. Die biblische Geschichte im Unterricht, 1969 2 , 249. Vgl. R. Bultmann, G V IV, 168 f. 50 Vgl. M. Stallmann, Christentum und Schule, 1958, 102, und G. Harbsmeier, Antworten des Glaubens, 1961, 192 ff., bes. 200 f. 51 Vgl. GV IV, 181 f. 1 Die Aufgabe einer praktischen Dogmatik, in: Festgabe für J. Kaftan, 1920, 249. 2 Die Lehre von der Erwählung, ZThK 6, 1896, 47—70. Das Heil im Kreuze Christi, ZThK 7, 1897, 97—139. Die Heilsnotwendigkeit des Kreuzestodes Jesu Christi, ZThK 7, 1897, 461—512. In dem Aufsatz über die Erwählungslehre entsprechen das 49
32
rein theoretischen Erkenntnis und der praktischen Erkenntnis des Glaubens entscheidend 3 . Er beschränkt sich auf die Beseitigung falscher Anstöße. Die Frage nach dem Verhältnis zwischen Gottes Alleinwirksamkeit und der menschlichen Verantwortung tritt zurück hinter der nach dem Verhältnis von Form und Inhalt einer „Lehre". Das traditionell-dogmatische Problem weicht dem hermeneutischen. Was zunächst ausgeklammert wurde, wird später wieder aufgenommen und in den pädagogischen Bereich transponiert. Die Frage der Willensfreiheit gehört nicht in die Praktische Dogmatik, sondern in das pädagogische Kapitel über die Beeinflussung 4 . Das Kaftansche Koordinatensystem wird übernommen und ins Subjektive übersetzt. Dem höchsten Gut als einem zugleich übernatürlichen und sittlichen Phänomen entspricht auf Seiten des Subjekts ein „transzendent-ethischer Optimismus" 5 . Der pädagogische Aspekt des Kaftanschen Erziehungbegriffs, der der sittlichen Komponente im praktischen Glauben korrespondiert, wird übernommen und ausgeweitet. Erziehung bedeutet Kontinuität, Wachstum, Entwicklung. Wesentlich ist nicht das Verhältnis von Personen, sondern das von Mittel und Zweck. Praktischer Glaube und Erziehung gehören wesentlich zusammen, weil das Sittliche im Glauben nicht ohne Erziehung gedacht werden kann. Diese muß sich auf vorläufige Nahziele einstellen, die man nicht an absoluten Kriterien messen darf. Daher wendet sich F. Niebergall gegen W. Herrmanns Forderung der Wahrhaftigkeit. „Was ethisch falsch ist, kann pädagogisch richtig sein, nämlich als Übergang und Einleitung." 6 Dem entspricht die pädagogisch-psychologische Relativierung des Sündenbegriffs. Sünde wird verstanden als ein nach psychischen Gesetzen eintretender Rückschlag gegen das Gute 7 oder ein Mangel an Wertschätzung 8 , aber auch als das genaue Gegenteil zum Guten, wobei F. Niebergall auf die Spannung zwischen diesen Aussagen nicht eingeht. Die Betonung der Subjektivität verstärkt den Illusionsverdacht. Er sieht die positiv-christliche Religion angegriffen durch Feuerbachs Religionsphilosophie, durch Rechtspositivismus, Historismus und Darwinismus 9 . Wie J . Kaftan kann und will er keine wissenschaftlich-theoretischen Beweise zur Rechtfertigung der Religion beibringen, sondern verweist auf den praktischen Charakter des Glaubens, wodurch sich der Beweis in Zeugnis und Erziehung auflöst 1 0 . Er bleibt damit in der Nähe Feuerbachs. Die Darstellungsschema sowie das neutestamentlidie und dogmengesdiichtliche Material den §§ 50, 51, 57 in J . Kaftans Dogmatik. s Z T h K 6, 1896, 47. 4 Vgl. P T I, 287—298. 5 Z T h K 16, 1906, 273. 0 N R U I, 89. 7 Vgl. P T I, 352. 8 Vgl. P T I, 354. 9 Vgl. Z T h K 8, 1898, 444—451. 10 Ebd. 467. Bemerkenswert ist die Nähe des Begriffs der Erziehung zu dem des Zeugnisse«.
33
Gottesvorstellung wird zu einer Hilfskonstruktion f ü r den Glauben, der die Priorität hat. Das Denken kann nur pantheistische Vorstellungen akzeptieren, wenn audi die Wertschätzung anders ist als beim üblichen Pantheismus. Sie beruht nicht auf bloßen Bedürfnissen, sondern auf einer vielleicht nur zeichenhaften Erfüllung. Ferner läßt die Sinnfrage den Menschen nicht los. Sie verlangt eine abschließende Welterkenntnis, die immer auf einem Glauben beruht 11 . „Praktisch" ist also der Glaube als existentielles Betroffensein im Gegensatz zu letztlich unverbindlichem Fürwahrhalten von Dogmen 12 , ferner als praktisch sittliches Leben im Gegensatz zu sittlich gleichgültiger Spekulation und Mystik, schließlich aber auch als eine bestimmte Art von Welterkenntnis oder Weltdeutung im Unterschied zur wissenschaftlichen. Die Antwort auf die Sinnfrage möchte er nicht in der Natur, sondern in der Geschichte suchen. Dabei geht es besonders um den Unterschied der Betrachtungsweisen: der kausalen steht die teleologische gegenüber, nach der geschichtliche Phänomene als Mittel zu künftigen Zwecken verstanden werden, was aber nur aufgrund einer entsprechenden Wertschätzung möglich ist. Der praktische Glaube bewegt sich in einem hermeneutischen Zirkel. Einerseits führt seine teleologische Weltbetrachtung zur Erkenntnis und Wertschätzung des höchsten Gutes als Ziel der Geschichte, andererseits leuchtet diese Betrachtung nur dem ein, der diese Wertschätzung teilt 13 . Man kann nur durch einen Sprung, eine Entscheidung, in diesen Zirkel hineinkommen. 2. Der geschichtliche Jesus als Erzieher Gegenüber der Metaphysik der traditionellen Christologie, die durch die historische Erforschung ihrer biblischen und dogmengeschichtlichen Grundlagen fragwürdig geworden ist, möchte F. Niebergall — einen Mittelweg zwischen M. Kähler und der Leben-Jesu-Forschung suchend — beim historischen Jesus, d. h. bei der Erkenntnis seines geschichtlich nachweisbaren Willens einsetzen 14 . Da der historische Jesus ganz in den Bereich irdischer Wirklichkeit gehört, kann Gegenstand des Glaubens nur der lebendige Gott selbst sein. Der Osterglaube ist Ausdruck der Bedeutung Jesu für Welt und Leben der Gläubigen. Die Symbole „Gott" und „Offenbarung" sind als Ausdruck geeignet, den Eindruck angemessen wiederzugeben, den der historische Jesus auf das andächtige Gemüt macht. Geschichtliches Verstehen muß zwischen Eindruck und Ausdruck unterscheiden. Es setzt neben historischer Bildung die Fähigkeit zur Divination voraus, die nur dem möglich ist, der dem Geist Jesu verwandt ist. Diese " Vgl. PT I, 338 und ZThK 16,1906, 259. " Vgl. N R U IV, 112. 14 Vgl. ZThK 11, 1901, 299. 34
13
Vgl. ZThK 8,1898, 455.
Geistesverwandtschaft ist, wie auch das Gewissen, eine Folge der Erziehung durch das Werk Jesu 15 . Mit seiner Schrift über die Absolutheit des Christentums wendet sich F. Niebergall mit J. Kaftan gegen E. Troeltsch 16 , in der Absicht, bei aller Kritik des Dogmas doch die sachliche Ubereinstimmung mit der traditionellen Christologie nachzuweisen. Gegenüber der konservativ-orthodoxen Auffassung mußte er seine Begründung des Glaubens auf den geschichtlichen Jesus gegen den Verdacht einer Preisgabe des Glaubens selbst schützen. Nun muß er sie gegen den philosophischen Einwand verteidigen, daß es in der Geschichte nichts Absolutes geben könne. Nach F. Niebergall spricht E. Troeltsch von zweierlei Absolutheit: das Christentum erscheint ihm einerseits als höchste Stufe der religionsgeschichtlichen Entwicklung, andererseits impliziert der Erlösungsbegriff das Postulat einer absoluten Offenbarung 17 . F. Niebergall folgt J. Kaftan, wenn er diese Offenbarungsabsolutheit für primär hält gegenüber der religionsgeschichtlichen Stufung. Der Rekurs auf die Religionsgeschichte ist nicht falsch, aber man darf sie nicht theoretisierend-distanzierend, sondern muß sie praktischwertend betrachten. Hier steht eine an Hegel orientierte Metaphysik des Geistes dem Neukantianismus der Ritschl-Schule gegenüber. F. Niebergall begründet die Absolutheit des Christentums mit dem absoluten Charakter der christlichen Sittlichkeit und mit der Unableitbarkeit der Persönlichkeit Jesu. Hier ist der Ort der Offenbarung. „Hier im Grunde der Seele behalten wir eine Lücke im Causalzusammenhang, desto größer ist sie, je eigenartiger und ausgebildeter die Persönlichkeit ist — eine Lücke, die uns vollen Spielraum für das Einwirken einer höheren Macht gewährt." 18 Der Einsatz beim geschichtlichen Jesus tastet nach F. Niebergall den Offenbarungsbegriff nicht an und ermöglicht ein Festhalten an der Absolutheit des Christentums im dogmatischen Sinn. Offenbarung und Erziehung stehen dabei im Zusammenhang, sofern beide Begriffe gemeinsam eine antimetaphysische und antiintellektualistische Spitze haben. Die Formel „Gott in Christus" wird interpretiert durch den Satz: Gott offenbart sich im Erziehungswerk Jesu. Der geschichtliche Jesus wird als Erzieher verstanden. Nicht seine supranaturale Herkunft, sondern seine Erzieherweisheit gegenüber Zöllnern und Sündern macht ihn einzigartig. „Jesus ist der Pädagog des Glaubens; so denkt er über Gott als Erzieher, so erzieht er selbst, so will er, daß wir erziehen sollen." 19 Jesus 15
Ebd. 284. Über die Absolutheit des Christentums, 1900. Vgl. J. Kaftan, Die Selbständigkeit des Christentums, ZThK 6, 1896, 373—394. E. Troeltsch, Die Selbständigkeit der Religion, ZThK 6, 1896, 1—69. Ober historisdie und dogmatische Methode in der Theologie, Ges. Sdiriftcn II, 729—753. 17 Über die Absolutheit des Christentums 54. 18 Ebd. 76. Vgl. die ähnliche Aussage R. Bultmanns GV IV, 175. 19 Jesus im Unterricht, 1910', 73. 16
35
führt die vorbereitende alttestamentliche Erziehung der Jünger weiter. Die metaphysische Satisfaktionstheorie soll durch ein pädagogisches Denken ersetzt werden. F. Niebergall stellt den Tod Jesu an die Spitze einer Reihe von alttestamentlichen Offenbarungsmitteln. Er dokumentiert Gottes Sünderliebe, indem er zugleich Sünde offenbar macht, tut also Gnade erzieherisch wirksam kund und schützt sie gegen Mißbrauch 20 . Der Tod Jesu ist ein dem Zweck entsprechendes Mittel. Mittel sind aber relativ zum Zweck. Die Pädagogisierung der Christologie bringt eine Relativierung mit sich, die der historistischen nicht nachsteht. Sündenvergebung, Kreuz, ja die Person Jesu selbst werden zu bloßen Erziehungs- und Ausdrucksmitteln. Das Ärgernis entfällt. Christologische Lehraussagen werden relativiert. „Innerhalb dieser Gott-Christuslehre, die auf die praktische Verbindung und die praktische Wirkung hinausläuft, muß eine jede theoretische Fassung des metaphysischen Verhältnisses zwischen dem Vater und dem Sohn zugelassen werden, und zwar von der Zweinaturenlehre an bis herunter zu Jesus, dem rechten Lehrer des wahren Gottes." 21 Zu fragen bleibt, ob F. Niebergall mit dieser Toleranz nicht zu früh vor der Aufgabe resigniert, die Interpretation der traditionellen Christologie bis zu dem Punkt voranzutreiben, an dem sie sich als heute noch relevant erweisen läßt. 3. Gott als Erzieher des Menschengeschlechts „Erzieher" wird für F. Niebergall zum neuen, zeitgemäßen christologischen Hoheitstitel, der die traditionellen Titel korrigiert, interpretiert und zusammenfaßt. Da der geschichtliche Jesus Gottes Ebenbild darstellt, ist es nur konsequent, wenn nun „Erzieher" auch zum Prädikat Gottes wird 22 . Als Erzieher ist Gott das Korrelat zum praktischen Glauben, und als transzendenter, ethischer Optimismus ist der Glaube das Edio der objektiven göttlichen Willensmacht; „sehen wir doch Gott an als den gütigen und treuen Erzieher, der uns durch das Leben zu seiner ewigen Geisteswelt leiten w i l l . . . " 2 3 Hier kommen ausnahmsweise personale Motive ins Spiel. Güte und Treue zeichnen den Erzieher aus. Wie wenig personal dies dann doch gedacht ist, zeigt die Tatsache, daß das Echo darauf nicht in personaler Hingabe und Offenheit, sondern eben in Optimismus besteht. Von Gott als Erzieher empfängt der Glaube das, was ihm wesentlich ist. „So tritt Gott als unser Erzieher aus unserem Leben hervor, der ihm Ziel und Sinn gibt und es zu einer Einheit abrundet..." 2 4 Wie die Vergebung als Beispiel für die Erzieherweisheit Jesu dient, so ist sie auch ein Kennzeichen der Pädagogik Gottes. „Das ist die große 20 Vgl. dazu Die Heilsnotwendigkeit des Kreuzestodes Jesu Christi, ZThK 7, 1897, 461 ff. passim. 21 22 P A N T , 58. TP 92. 23 24 ZThK 16, 1906, 273. N R U IV, 115.
36
Erziehungsweisheit Gottes, daß er die Menschen gut macht, indem er sie froh stimmt." 2 5 Gott erzieht ferner durch seine Vorsehung. Der Glaube lernt es, seinen Mangel an Gottvertrauen und sein Schuldbewußtsein als Erziehungsstrafe aufzufassen 2 6 . Er deutet auch das Leid, diese neutrale Folge von neutralen Ursachen als Mittel zu hohen Zwecken. „Langsam ahnt man dann, daß sich Gott hat Platz schaffen müssen, indem er uns dies und das versagte oder dies und das nahm. Dann merken wir, daß er uns nicht nur segnet, wenn er uns begnadet, sondern audi wenn er uns zu strafen oder gar zu verfluchen scheint." 27 Gottes Vorsehung ist ein Erziehungswerk. Das bedeutet, daß sich Gottes Erziehung nicht nur auf den einzelnen und seine kurze Lebensgeschichte, sondern nodi mehr auf die Geschichte der Menschheit bezieht. Die Begriffe Offenbarung, Geschichte und Erziehung stehen für F. Niebergall in einem engen, inneren Zusammenhang. Man darf nicht vergessen, daß Biblische Geschichte, Katechismus und Gesangbuch „jenen Niederschlag (seil, einer dreitausendjährigen Entwicklung) enthalten, durch den die Geschichte der Offenbarung, die die Erziehung der Menschheit durch ihren Herrn und Lenker ist, erst praktische Bedeutung für jedes Geschlecht erlangt" 2 8 . Wir fragen nun nach den Konsequenzen, die sich aus diesem Zusammenhang für den Offenbarungs-, den Geschichts-, den Erziehungsbegriff ergeben. Gott offenbart sich in der Geschichte29. Auch hier folgt F. Niebergall seinem Lehrer J . Kaftan, der zwischen der vorbereitenden Offenbarung in Israel, der in Jesus Christus vollendeten und der an Pfingsten zum Verständnis gebrachten differenziert, wobei dann die Kirchengeschichte als Geschichte der Aneignung des Glaubens in Stufen gedeutet wird 3 0 . Gottes Offenbarung beschränkt sich daher nicht auf die Geschichte Jesu. F. Niebergall merkt, daß er damit in Spannung gerät zu seinen Thesen über die Absolutheit des Christentums. Er behilft sich mit Vermittlungsversuchen, durch die eine Bindung des Handelns Gottes ausschließlich an die Geschichte Jesu ebenso vermieden werden soll wie eine monistische Identifizierung mit dem Geschehen in Natur und Geschichte überhaupt. „Gott ist nicht eingeschlossen in eine Kammer der Geschichte, sondern er geht mit von einem ihrer großen, hallenden Säle zum andern. Gott ist aber auch nicht das ganze Sein und Werden, sondern Gott ist der große Ursprung der Werte, Ziele, Kräfte und Gedanken, der nun einmal die 2 6 V g l . P T I, 357. P A N T 450. P T I, 344. 28 p x j j ( 292. F. N i e b e r g a l l gebraucht d a f ü r auch das geologische Bild nacheinander entstandener Erdschichten, die nebeneinander zu T a g e treten. Vgl. bei O . B a u m g a r t e n dieselbe Geschichtsauffassung, die d a m i t rechnet, „ d a ß die ganze Kulturgeschichte übereinandergeschiditet in der G e g e n w a r t nodi mitlebt". Protestantische Seelsorge, 1931, 110. 25
27
29
Vgl. P A A T II, 258.
30
V g l . D 31 und D 56 (Leitsatz).
37
Welt auf Veränderung hin angelegt hat und darum wollen muß, daß das Seine immer das Eine bleibt, indem es allen anders erscheint." 31 Worin besteht der Offenbarungscharakter der Geschichte? Zunächst wird die Struktur der Offenbarung Gottes im geschichtlichen Jesus auf die Geschichte im ganzen übertragen. Wie die rein geschichtliche, d. h. auf alle metaphysischen Überhöhungen verzichtende Betrachtung der Person Jesu ein lebendiges Bild gewinnt, das dem Gefühl einen tiefen Eindruck macht, so entsteht durch eine von allem heilsgeschichtlichen Schematismus absehende Geschichtsbetrachtung das Bild einer Entwicklung, eines Aufstiegs, der seine Wirkung aufs Gemüt nicht verfehlen kann 3 2 . Man darf es natürlich mit diesem Bild des Aufstiegs nicht so genau nehmen, denn der geschichtliche Jesus bedeutet einen unüberbietbaren Höhepunkt, aber unter dem Gesichtspunkt der Aneignung kann von einer zusammenhängenden religiösen Geschichte von Mose bis Schleiermacher geredet werden 33 , wenn man es nicht vorzieht, von einem doppelten parallelen Aufstieg vor und nach Christus zu sprechen 34 . Wie der Glaube den Eindruck des geschichtlichen Jesus mit Gott in Verbindung bringt, so kann man von dem Eindruck aus, daß in dem Aufstieg der Geschichte eine Erziehung stattfindet, auf einen Erzieher schließen 35 . Die Offenbarung Gottes in der Geschichte besteht darin, daß die geschichtliche Entwicklung der Religion und des Glaubens eine Tendenz zur Versittlichung und Vergeistigung erkennen läßt. F. Niebergall sieht die Gefahren seines Offenbarungsbegriffs. Er gibt zu: „Eine solche Betrachtungsweise stammt aus dem Geist der Entwicklungslehre..." 8 6 Diesem Geist entspricht auch das Interesse an der Auffindung von Regeln und Gesetzen, denen das geschichtliche Geschehen gehorcht. Häufig wird das Gesetz des Rückschlags erwähnt, wonach die Entwicklung sich in Pendelschlägen vollzieht. Entgegengesetzte Tendenzen lösen sich ab und rufen sich gegenseitig hervor. Auf die prophetische Kritik der religiösen Institutionen folgt deren erneute Pflege durch den Priester 37 . These und Antithese können zur Synthese führen. Dann handelt es sich um einen doppelten Rückschlag. Versäumte Reformationen führen zu Revolutionen. In diesen erscheint Neues und Lebendiges, das aber mit der Zeit selbst wieder erstarrt. Reformatoren pflegen sich vom Alten nicht völlig lösen zu können. Sie füllen den neuen Wein in alte Schläuche 38 . Es ist deutlich, daß sich diese Betrachtung nicht mit der heilsgeschichtlichen verträgt. Gott 31
Die evangelische Kirche und ihre Reformen, 1908, 25.
32 T P
77-
Vgl. den gleichnamigen Aufsatz in: Zur Reform des Religionsunterrichts, 2 0 — 3 5 . 3 4 P T II, 290. 3 3 „Von hier aus ist es nicht schwer, den Blick auf Gott zu gewinnen. W o eine Erziehung ist, da ist auch ein Erzieher." P T I, 308. 3 8 T P 76. 3 7 Vgl. P T I, 129 und 133. 3 8 Vgl. P T II, 147. 33
38
offenbart sich nicht in der wunderbaren Durchbrechung der Regeln geschichtlichen Geschehens, sondern in ihnen, da er sie selbst in die Welt hineingelegt hat 3 9 . Der edite Glaube unterscheidet sich vom Aberglauben durch den Gehorsam gegen das, „was gemäß der in der Entwicklung der Dinge, die von Gott geleitet wird, kommen s o l l . . . " 4 0 Daß sich Gott in der Geschichte offenbart, macht den Glauben nicht überflüssig. Das Bild des Aufstiegs beruht nicht auf streng geschichtlicher Forschung, sondern auf einer geschichtsphilosophischen Konstruktion 4 1 und leuchtet daher nur denjenigen ein, die die in dieser Entwicklung zu Tage tretenden Ideale wertschätzen. „Geschichtsphilosophie gibt es erst auf Grund des Glaubens, nicht als Grund des Glaubens." 4 2 Umgekehrt ist der Glaube darauf angewiesen, aus der Offenbarung in der Geschichte Kräfte zu empfangen. Im Gegensatz zum religiösen Individualismus, der eine ungeschichtliche Frömmigkeit pflegt, heißt kirchlich und geschichtlich sein „die Kosten seines innern Lebens nicht aus eignen Mitteln bestreiten können oder wollen, sondern auf das Empfangen angewiesen sein" 4 3 . Gottes Offenbarung darf aber weder nur in der klassischen Zeit des Alten und Neuen Testaments noch nur in der Gesamtentwicklung gesucht werden. „Man lasse Gott reden, wie er zu reden liebt: ipso facto." 4 4 Die Aussage, daß Gott in den Tatsachen und Verhältnissen der Gegenwart redet und seinen Willen kundtut, findet sich häufig in F. Niebergalls Gesamtwerk. Der naheliegende Einwand, hier werde neben der Schrift eine weitere Offenbarungsquelle behauptet, die zum Fatalismus oder dodi zu einer kritiklosen Anpassung an die Verhältnisse der Gegenwart führen müsse, trägt der polemischen Absicht dieser Aussagen nicht Rechnung. Wir verdeutlichen den Sinn dieser These an Beispielen. Das moderne Weltbild ist eine geschichtliche Tatsache. Die Sprache des Dogmas, in der der Glaube einst einen sachgemäßen, verständlichen Ausdruck fand, ist dadurch unbrauchbar geworden. Wer sich aus Angst vor Zweifel gegen wissenschaftliche Erkenntnisse wehrt, widersetzt sich Gottes Willen. Es ist die Unart vieler Frommen, dem Weltlauf und Gott selbst vorschreiben zu wollen, wie er nach dem Dogma und eigenen Postulaten sein soll. „So muß immer das Dogma die Geschichte besiegen: die Schrift kann keine Irrtümer enthalten, Jesus kann nur von der Jungfrau geboren sein, Wunder kann es nicht geben; der Krieg muß der gerechten Sache den Sieg bringen, und was sonst immer Anmaßung und Unwissenheit soldier Herrgöttlein noch mit ihren Postulaten und ihres Ultimatums dekretieren 40 P T I, 101. Ebd. „ D a s G a n z e ergibt, wenn m a n es nicht streng geschichtlich, sondern in einer idealen K o n s t r u k t i o n a u f f a ß t , einen aufsteigenden G a n g . " D i e neuen Wege kirchlicher Arbeit, 1928, 51. 4 2 Ü b e r die Absolutheit des Christentums, 1900, 61. 4 3 P T I, 208. 4 4 D i e neuen Wege kirchlicher Arbeit 74. 39
41
39
mag. Anstatt sich den Dingen fromm zu beugen, in denen Gott spricht und waltet, wollen sie die Dinge unter ihre Ansichten beugen und werfen Gott, immer göttlicher als Gott selbst, mit Luther zu sprechen, den Sack vor die Füße, wenn er nicht ihren Willen tut. So ist ihnen immer das Soll, und zwar in ihrer Auffassung, hinter der oft neben Rechthaberei ihr eignes Interesse steckt, der Punkt, durch den Gott herausschauen muß, anstatt daß sie ihn auch und vor allem, wie derselbe Luther sagt, in ipso facto erleben." 45 Ertrag der geschichtlichen Entwicklung, in der Gott sich vernehmen läßt, ist ferner das Recht des Einzelnen und seine Freiheit des Gewissens gegenüber jeder unfehlbaren Autorität, die Übertragung des Religionsunterrichts aus der Zuständigkeit der Kirche in die des Staates, die sozialen und politischen Errungenschaften der Revolution 46 . Es geht F. Niebergall nicht darum, Bestehendes opportunistisch zu rechtfertigen; er möchte auf die Pflicht zu verantwortlicher Mitarbeit im neuen Staat hinweisen und den frommen oder prinzipiellen Rückzug aus der Verantwortung anprangern. „Dem in der Wirklichkeit wirksamen Gotteswillen gehorsam, werden wir keine höhere Aufgabe haben, als die seelischen Voraussetzungen zu schaffen, die dazu nötig sind, um den Gedanken der Revolution zu verankern und ihre Gefahren abzuwehren . . . Mit allem Nachdruck muß darum die Kirche sozialistisch werden, d. h. den Gedanken der gegenseitigen Verantwortlichkeit im neuen Volksstaat und den Ausgleich der großen sozialen Gegensätze pflegen." 47 Es muß ferner auffallen, daß F. Niebergall hier kräftigen Gebrauch macht von Argumenten wie „rechthaben wollen", „göttlicher sein wollen als Gott", die ihren systematischen Ort in der Rechtfertigungslehre haben, wo sie bei F. Niebergall aber wegen der Psychologisierung und Pädagogisierung, die er hier vornimmt, fehlen. Wie sich Gottes Offenbarung im geschichtlichen Aufstieg nur dem Glauben und einer entsprechenden Wertschätzung zu erkennen gibt, so wird auch Gottes Walten in der gegenwärtigen Wirklichkeit nicht jedem verständlich. Der Glaube bedarf eines Kriteriums, um es zu erkennen. Gott waltet in dem geschichtlich Gewachsenen, in dem von selbst Gewordenen, nicht im künstlich Gemachten. In dem Versuch, das Christentum zu germanisieren kann F. Niebergall daher nur Mache und also nicht Gottes Willen sehen 48 . 45
PT I, 85. Zur Reform des Religionsunterrichts, 1921, 10. Ferner N R U I, 18. PT II 497. 47 Ebd. Wie wenig opportunistisch diese Stellung zur Revolution ist, zeigt P. Wursters Kritik MPTh 17, 1920, 45—48. Bonhoeffers Gedanken über den Erfolg bewegen sich ganz in der Nähe: Wir erfahren, „daß weder theoretisch zuschauendes Kritisieren und Redithabenwollen, also die Weigerung, sich auf den Boden der Tatsachen zu stellen, noch Opportunismus, also die Selbstpreisgabe und Kapitulation angesichts des Erfolges unserer Aufgabe gerecht wird". Widerstand und Ergebung, 1966 13 , 15 f. 48 Vgl. S. 80 ff. 46
40
Welche Geschichtsauffassung steht hinter der Aussage, daß Gott E r zieher der Menschheit ist? E r versteht unter Geschichte eine aufsteigende Entwicklung. Die dem Entwicklungsbegriff entsprechende kausale Betrachtungsweise wird ergänzt und überhöht durch die teleologische. Man sieht nicht nur, wie höhere Stufen aus niederen hervorgegangen sind, sondern erkennt auch in der Richtung, die die Entwicklung anzeigt, die Andeutung eines Zieles, auf das sie zustrebt. Eben dies wird durch den Erziehungsbegriff zum Ausdruck gebracht. Wichtig ist ferner das Verhältnis der Geschichte zur Gegenwart. Diese ist aus der Vergangenheit hervorgegangen und kann nur verstanden und bewältigt werden, wenn man die geschichtliche Entwicklung kennt, die zu ihr hingeführt hat. Umgekehrt wird die Geschichte immer von der Gegenwart aus erkannt. In der Geschichtsschreibung spiegelt sich der Zeitgeist. „Einst lag der Ton im Leben Jesu auf den Wundergeschichten; jetzt rücken langsam seine Worte an die Jünger und das Volk in den Vordergrund; statt des Wundertäters, der sich dadurch als der Sohn Gottes erweist, kommt der Erzieher und Helfer zum Reiche Gottes auf." 4 9 Das Leben in der Gegenwart darf sich nicht durch die Geschichte knechten lassen. Die Überlieferung darf nicht zum Gesetz werden. Wir sind „Herren der Geschichte" 50 . Diese Herrschaft äußert sich darin, daß die Erkenntnisse und Maßstäbe der Gegenwart die Auswahl und Deutung der geschichtliche Stoffe bestimmen 51 . Der Einwand, daß hier göttliche Offenbarung menschlichen Kriterien unterworfen wird, trifft nicht genau; denn diese Kriterien sind ja selbst ein Produkt der göttlichen Erziehung. „Immer aber bleibt das letzte Wort bei uns, bei unserem eignen inneren Gefühl für die Wahrheit Gottes und unserem Gewissen. Dabei aber erkennt und rechtfertigt sich das Göttliche außer uns an dem, was ihm in uns verwandt ist: Wir wählen aus und nehmen an von dem, was uns geschichtlich als göttliche Wahrheit entgegentritt, und zwar mit einem inneren Organ, das durch dieselben Mächte gebildet ist. Wir schleifen den Diamanten mit seinem eignen Staub." 5 2 In diesen Zusammenhang gehört die Vorstellung, daß die wichtigsten Erscheinungen der Geschichte in der Gegenwart enthalten sind. F. Niebergall gebraucht dafür gerne ein geologisches Bild. „ . . . was in der Geschichte der Erdentwicklung hintereinander kommt, das findet man geographisch nebeneinander. So ist es auch mit der Religion und ihrer Geschichte: was geschichtlich aufeinander folgt, das findet sich noch religions49 50
Die religiöse Erziehung im H a u s und Sdiule 1920, 8 3 . 51 Ebd. 84. Vgl. ebd. 82.
5 2 E b d . Vgl. H . G. G a d a m e r : „ D e r H o r i z o n t der G e g e n w a r t bildet sich also g a r nicht ohne die Vergangenheit. E s gibt so wenig einen Gegenwartshorizont für sich, wie es historische H o r i z o n t e gibt, die m a n zu gewinnen hätte. Vielmehr ist Verstehen i m m e r der V o r g a n g der Verschmelzung solcher vermeintlich für sich seiender H o r i z o n t e . " W a h r heit und Methode, 1 9 6 5 2 , 2 8 9 .
41
geographisch oder volkskundlich nebeneinander vor." 5 3 Hat diese Vorstellung die Gemeinschaften im Blick, so die These von den kulturhistorischen Stufen den Einzelnen 54 . F. Niebergall weiß, daß es sich bei der behaupteten Entsprechung von Phylo- und Ontogenese um eine Konstruktion handelt, die sich in der Wirklichkeit nicht verifizieren läßt, aber er nimmt sie auf, weil sie pädagogisch verwertbar erscheint 55 . Die Geschichte erhält einen doppelten pädagogischen Aspekt: Sie stellt einmal selbst ein Erziehungsgeschehen dar und wird dadurch zugleich zu einem Erziehungsmittel. Die religiöse Erziehung empfängt ihre stärksten Antriebe und Kräfte aus der Geschichte und umgekehrt verhilft der pädagogische Gesichtspunkt der Geschichtsdarstellung dazu, daß sie aus der Anhäufung von Daten ein organisches Ganzes machen kann 5 e . Hier wird jene „Kontinuität, wenn nicht gar Identität von Hermeneutik und Didaktik" vollzogen, die nach M. Stallmann die von Dilthey herkommende Bildungstheorie kennzeichnet 57 . Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem bisher Gesagten für den Erziehungsbegrifi? Trotz der Andeutung personaler Momente, ist die Bezeichnung Gottes als Erziehers der Menschheit ganz auf den Gedanken der Kontinuität, der Entwicklung und des Fortschritts zugeschnitten. Unsere Beobachtung, daß bei F. Niebergall von den beiden Aspekten in J . Kaftans Erziehungsbegriff nur der eine zur Geltung kommt, findet hier eine Bestätigung. „Die Verbindung von Entwicklung und Offenbarung aber heißt: Erziehung." 5 8 Kennzeichen dieser Erziehung ist ihre Langsamkeit und Vorläufigkeit. Erziehung gewinnt nie in einem Augenblick alles. Daher muß sie dauernd Kompromisse zwischen Ideal und Leben schließen. F. Niebergall erörtert diesen Sachverhalt in seiner Auslegung der Bergpredigt. Nach E. Troeltsch ist sie stets die Christlichkeit der Sekten gewesen, die kompromißlos auf der Heiligkeit ihrer Glieder bestehen. In der Volkskirche, für die der Erziehungsgedanke konstitutiv ist, besteht die Aufgabe darin, „langsam das Ideal immer höher zu stecken" 59 . Der Inhalt der Bergpredigt „ist eine große prophetische Schauung über die Jahrhunderte hin, sie gibt ihnen Aufgaben, denen sie sich nur in langsamem Zeitmaß nähern, das im Sinne der göttlichen Erziehung des Menschengeschlechtes liegt" e 0 . F. Niebergall pflegt bei diesem Stichwort den Namen Lessing in Klammern zu nennen, um an seine Schrift über die Erziehung des Menschengeschlechts zu erinnern, freilich ohne auf die P T I, 94. Die These der kulturhistorischen Stufen stammt von T. Ziller und wird von W. Rein übernommen. Vgl. die Anklänge bei J . K a f t a n oben S. 29, Anm. 26. 5 5 N R U I, 197. 56 Zur Reform des Religionsunterrichts 20. 57 M. Stallmann, Die biblische Geschichte im Unterricht, 1969 2 , 257. 58 P A A T I, 4. m P A N T 144. 80 P A N T 142 f. 53 54
42
Unterschiede aufmerksam zu machen. Lessing geht es darum, die Überlegenheit der Vernunft gegenüber der allenfalls als Erziehungsmittel zu respektierenden Offenbarung deutlich zu machen 61 . F. Niebergall dagegen möchte auf das Recht und die Notwendigkeit hinweisen, den Weg des Ausgleichs zwischen Ideal und Leben zu gehen. Es zeigt sich, daß er die Gefahr, sich vom geschichtlichen Ursprung des Glaubens zu entfernen, für geringer hält als die andere, diesen Ursprung zu einer Ideologie werden zu lassen, d. h. zu einem abstrakten Prinzip, mit dem die konkrete Wirklichkeit vergewaltigt wird. Wird aber bei ihm nicht der Erziehungsgedanke zur Ideologie? Sofern versucht wird, den Glauben mit dem erzieherischen Verhalten Gottes zu legitimieren, liegt eine Tendenz zur Ideologisierung vor. Dem steht aber die Beobachtung gegenüber, daß das Erzieherische mit dem Prophetischen konfrontiert wird, durch das die Höhepunkte der Geschichte bestimmt sind. Es „sorgt immer einmal wieder eine geistige Umwälzung dafür, das Altes abgetan und Neues aufgebracht wird. Sind aber die Stürme soldier kritischen und prophetischen Zeiten verbraust, dann treten bald wieder die ruhigen pädagogischen ein, die zu Gewohnheiten und Sitten verarbeiten, was da errungen worden ist, bis der Vorgang von neuem beginnen muß." 62 Es zeigt sich die antiideologische Spitze in dem Gedanken, daß Gott in den Tatsachen spricht. Zu den Phänomenen, die die Theologen als von Gott gewollt anerkennen müssen, gehört auch dies: „Wir leben nun einmal nicht in prophetischen, sondern in kirchlichen Zeiten." 63 Diese Einklammerung seines Hauptanliegens durch das Wissen um ein prophetisch-kritisches Element in der Religion, erinnert an D. Bonhoeffers Unterscheidung des Letzten und Vorletzten. Die Erziehung als ein Besorgen des Vorläufigen und Vorletzten erhält ihre Legitimation durch ihren Bezug auf das Letzte. Das Letzte aber bedarf umgekehrt des Vorletzten, soll es nicht zur Ideologie, d. h. zu einem alles Bestehende hassenden Radikalismus werden 64 . Gegen Abstraktionen richtet sich nicht nur die Einklammerung des Erziehungsgedankens, sondern auch der Erziehungsbegriff selbst. „Erziehung" bezeichnet den Bereich des Praktischen. Sie zielt nicht auf das Wissen, sondern auf den Willen. Daher bedient sie sich zur Belehrung nicht nur des Wortes, sondern auch des Lebens selbst. Aus F. Niebergalls Aussagen über die Geschichte werden später in der Theologie des Wortes Aussagen über die Funktion des Wortes: es hat Anredecharakter, beschenkt und fordert den Menschen als Ganzen; das Wirken des Heiligen Geistes ist ans Wort gebunden. Wenn F. Niebergall Gott nicht nur in alten Dokumenten und nicht nur in Predigt und Unterricht, sondern auch in der 61 83 M
62 Vgl. S. 26, Anm.9. PT I, 209. PT I, 472. D. Bonhoeffer, Ethik, 19532, 79 ff. Vgl. unten S. 106 ff.
43
Natur der menschlichen Seele und in der Geschichte wahrnimmt 65 , hält er sich an einen wesentlichen Grundsatz der neueren Pädagogik: „Gott erzieht uns, wie Pestalozzi seine Armen erziehen wollte, durch das Leben für das Leben ohne allzuviele Worte." 6 6 Der Erziehungsbegriii, den die Theologie aus der Offenbarung Gottes in der Geschichte gewinnt, stimmt mit dem der Pädagogen überein. Die religiöse Erziehung des einzelnen läßt sich ihren Weg von der Natur zum Geist empor durch die göttliche Erziehung der Menschheit in der Geschichte vorzeichnen im Sinn der kulturhistorischen Stufen. „Das ist nur ein Sonderfall der großen Gesamtaufgabe, die jeder Erziehung gesetzt ist, die Natur zur Kultur emporzuheben und zu verklären oder aber audi die Kultur an die Natur anzuknüpfen." 67 4.
Ergebnis
F. Niebergall übernimmt die Struktur und die Grundbegriffe der Theologie J . Kaftans. Bei der Umsetzung der systematischen in praktische Theologie verlagert sich das Interesse vom Objekt zum Subjekt des Glaubens. Daraus folgt die Psychologisierung und Pädagogisierung wichtiger Themen wie Sünde, Vergebung, Erwählung. Diese Akzentverschiebung spiegelt sich in der Funktion des Erziehungsbegriffs. Während J . Kaftan ihn unreflektiert, mehr gelegentlich und unter doppeltem Aspekt gebraucht, erhält er bei F. Niebergall zentrale Bedeutung. „Erzieher" wird zum entscheidenden Gottesprädikat und zum wichtigsten christologischen Hoheitstitel. Der Begriff der Erziehung hat die Aufgabe, den praktischen Charakter des Glaubens zu bezeichnen. Die Offenbarung wird in mehrfacher Hinsicht als Erziehung verstanden: Gottes Offenbarung im geschichtlichen Christus ist ein Erziehungsgeschehen, ebenso seine Offenbarung in der geschichtlichen Entwicklung der Menschheit. Beides kann vom modernen Menschen nur verstanden werden mit den Erkenntnismitteln seiner Zeit, die aber als Ergebnis der Erziehung durch geschichtliche Mächte anzusehen sind. Die Geschichte als Erziehungsgeschehen wird zum Erziehungsmittel für den einzelnen. Den personal-theologischen Aspekt des Erziehungsbegriffs bei J . Kaftan übernimmt F. Niebergall nicht. Er orientiert sich fast durchweg am Verhältnis von Mittel und Zweck. Eine grundsätzliche Kritik an J . Kaftan findet sich nicht. Bei beiden hat der Erziehungsbegriff eine antifundamentalistische, antimonistische, antiintellektualistische und antiideologische Spitze. „Erziehung" wird bei F. Niebergall zu einem Ferment, das den einzelnen theologischen Ausführungen, die auch bei J . Kaftan belegt sind, einen einheitlichen Anstrich gibt. Dabei macht sich ein dem Begriff eigenes Gefälle zur Päd65 67
44
PT I, 262. PT II, 268.
ββ
PT I, 345.
agogik hin bemerkbar. Eine prästabilierte Harmonie zwischen Theologie und Pädagogik wird offenbar und zeigt bei F. Niebergall deutlicher als bei J . Kaftan, daß der Versuch, das Evangelium mit dem modernen Geist zu versöhnen, zu einer starken Anpassung an diesen geführt hat. Bemerkenswert ist eine weitere Akzentverschiebung. F. Niebergall macht vom Vokabular der Rechtfertigungslehre am klassischen Ort kaum Gebrauch, er bringt es dafür aber an der Stelle ins Spiel, wo er die Anerkennung des Gotteswillens in ipso facto fordert. J . Kaftan hatte versucht, die Probleme der Rechtfertigungslehre in seinen theologischen Ansatz aufzunehmen. F. Niebergall folgt ihm dabei nicht. Die Frage, ob und wie diese Probleme bei ihm an anderer Stelle erneut aufbrechen, soll die Untersuchung in den nächsten Abschnitten begleiten.
III. Psychologie des Glaubens Die Akzentverschiebung in der Praktischen Theologie F. Niebergalls führt audi zu einer Umbildung der J . Kaftansdien Anthropologie durch Einbeziehung empirisch-psychologischer Untersuchungen. Nach J . Kaftan sind die Urdaten menschlichen Geisteslebens Gefühl und Vorstellung. Dahinter kann man nicht zurück. Psychologische Erörterungen im Rahmen der Dogmatik bedeuten für ihn einen Fehlweg 1 . Dennoch läßt sich eine Affinität seiner Theologie zu psychologischen Erkenntnissen und Denkkategorien feststellen 2 . F. Niebergall sieht in der Einbeziehung historischpsychologischer Gesetze in die Deutung des Todes Christi das Neue bei J . Kaftan im Vergleich zu A. Ritsehl 3 . Er weiß sich daher nicht im Gegensatz zu seinem Lehrer, wenn er psychologische Erkenntnisse stärker berücksichtigt. 1. Phantasie und Unbewußtes als hermeneutische
Grundbegriffe
Zunächst ersetzt er den Begriff der Vorstellung durch den der Phantasie 4 . Damit wird deutlich zwischen Wahrnehmungen und geistigen Bildern unterschieden. Ersatz für die Sinneseindrücke findet er im Gefühlsund Willensleben. J . Kaftans strenge Trennung von Vorstellung und Gefühl wird nicht durchgehalten. Zwischen beiden siedelt er das praktische Interesse an 5 , das er auch Wertschätzung, Stimmung, Optimismus oder Totalgefühl nennen kann. Die Glaubensvorstellungen entspringen der Phantasie. Sie ist das religiöse Organ, das immanente Erscheinungen auf 2 Vgl. W R 40. Vgl. D I O . Vgl. Z T h K 7, 1897, 512. 4 Vgl. J . Kaftan, W R 122, und F. Niebergall, Z T h K 19, 1909, 419. 5 Vgl. Z T h K 7, 1897, 105, und Z T h K 19, 1909, 441. Zu den psychologischen Begriffen W . Wundt, Grundriß der Psychologie. 1 9 2 0 " , 30 ff. 1
3
45
Transzendenz hin deutet. „So redet die religiöse Sprache gleichsam in kausativen Verbalformen, also etwa im Hiphil, indem sie alles Geschehen verpersönlicht und Gott zuschreibt." β Auch nach W. Wundt beruhen mythologische Vorstellungen auf einer beseelenden Apperzeption und so letztlich auf einer Phantasietätigkeit 7 . Ebenso hebt W. James bei der Beschreibung des mystischen Religionstyps als wesentliches kennzeichnen die Tendenz zu Deutung und Auslegung hervor 8 . Das schöpferische Moment im Phantasiebegriff erlaubt es, dem religiösen Genie eine besondere Rolle zuzuschreiben. Gegenüber dem Illusionsverdacht macht F. Niebergall geltend, daß die Phantasiebilder ihre Legitimität durch Gefühlserfahrungen und Wertschätzungen bekommen. Die Deutung aufgrund der Phantasie ist Ausdruck für einen empfangenen Eindruck. Hier gehen die psychologischen Analysen in hermeneutische Überlegungen über. Der Ausdruck für Glaubenserkenntnisse muß sowohl dem Eindruck wie den Erkenntnismitteln der Zeit entsprechen. Die psychologische Untersuchung bestätigt die Erkenntnis Kants und Herders, daß sich religiöse Objekte nur in Analogien fassen lassen 9 . Sie verhilft zu Einblicken in die Entstehung der Glaubenssprache und gibt Kriterien für die Unterscheidung von Glaube und Unglaube. Überlieferte Phantasievorstellungen, die nicht mehr durch Gefühlswerte „gedeckt" sind, werden falsch. Eine analog zur Religionsgeschichte zu schreibende Geschichte der religiösen Bildersprache muß sachkritisch vorgehen. Während J . Kaftan Wort und Glaube durchaus auf einander bezieht und beides personal interpretieren kann, wird das Wort für F. Niebergall zum Instrument der Mitteilung, das daher nicht in der praktischen Dogmatik, sondern unter pädagogischem Aspekt behandelt wird 1 0 . Damit fehlt bei ihm ein wesentliches Moment der reformatorischen Rechtfertigungslehre. Sie kommt dafür an anderer Stelle wieder in den Blick. Der religiöse Eindruck hängt von der Höhe der Wertschätzung und der Sittlichkeit und damit von der Erziehung ab. Die Phantasie erhält die Funktion, in der Sicht des Glaubens das sittliche Handeln religiös zu überhöhen und aus dem Bereich der Gesetzlichkeit in den des Evangeliums zu transponieren n . Die Aufgabe kann in eine Gabe „umschlagen" 12 . Damit wird der Gegensatz von Gesetz und Evangelium psychologisiert und relativiert. Auch der Begriff des Gefühls wird im Anschluß an W. Wundt präzisiert und differenziert 13 . Der Gegensatz von Gefühl und Vorstellung bei J . K a f tan wird umgestaltet in den von Unbewußtem und Bewußtem. Gefühl 7 Vgl. W. Wundt, a. a. O. 360. 372 f. Vgl. P T I, 41 f. Vgl. W . James, Die religiöse Erfahrung in ihrer Mannigfaltigkeit, 1907, 398. 9 Vgl. Z T h K 16, 1906, 256. 1 0 Vgl. P T I, 306 ff. P T II, 65 ff. 250 ff. 1 1 Vgl. Gott in Christus, 1899, 27 f. 1 2 Vgl. Ein Pfad zur Gewißheit, 1902, 27. 1 3 Vgl. WpmM I, 72. R. Kabisch, Wie lehren wir Religion? 1910, 25, und W. Wundt, Grundriß der Psychologie 9 9 f. 6
9
46
und Wille wurzeln im Unbewußten. Mit der gelegentlichen Berufung auf A. Schopenhauer 14 fügt sich F. Niebergall in die damalige Strömung eines antiintelektualistischen Voluntarismus ein. Der Begriff des Unbewußten bleibt vage. Er bezeichnet den Bereich des Praktischen und Irrationalen. Es ist der Ort dumpfer Triebe, aber audi der Freiheit und somit Ausdruck für den Kern der Persönlichkeit, das Selbst 15 . Damit bekommt der Begriff die Funktion, Theologie und Anthropologie zu verbinden. Das Unbewußte wird zum Ort der Offenbarung, da es sowohl religiös auf Transzendenz hin als auch rein immanent psychologisch gedeutet werden kann. Durch die Akzentverschiebung gegenüber J. Kaftan nähert sich F. Niebergall dem Pragmatismus W. James' 1β . Momente der Rechtfertigungslehre kommen wieder ins Spiel, wenn der Gegensatz von Bewußtem und Unbewußtem durch den von Reflexion und Unmittelbarkeit interpretiert wird. Mit der Wertschätzung wird der Glaube an den Lebenstrieb gebunden. Er gerät dadurch in den Verdacht, sublimer Egoismus zu sein. F. Niebergall versucht dagegen, den Egoismus als Selbstbezogenheit in der Reflexion zu interpretieren, und ihr die Unmittelbarkeit als wahre Frömmigkeit gegenüberzustellen. „Es ist also die Unmittelbarkeit und naive Selbstsicherheit, wie sie die Natur schenkt und die Gnade wieder geben kann; eigenes Rennen und Laufen bringt es bloß zu Stück- und Flickwerk, aber nicht zu einem echten Ganzen ohne Brüche und Nähte. Darum hat für das Tiefste im Menschen weniger Bedeutung das bewußte Wort, das immer auf den Verstand zielt und darum zum Machen führt, als vielmehr alles, was unmittelbar in das Unbewußte und im eigentlichen Sinn unbedachte Grundwesen des Menschen hinunterdringt." 17 F. Niebergall zeigt, wie das Problem der Unmittelbarkeit in den verschiedenen Zeiten gesehen und mit verschiedenen sprachlichen Mitteln zu lösen versucht wurde, zuletzt durch den Begriff der „schönen Seele" bei Schiller18. Wenn R. Bultmann den Glauben vom Werk unterscheidet und mit der Tat gleichsetzt19, geht es ihm gleichfalls um Ganzheit und Unmittelbarkeit. Doch während bei ihm Unmittelbarkeit und Selbstvergessenheit durch eine Anrede von außen, durch die Forderung des Augenblicks zustande kommt, denkt F. Niebergall hier an Erziehung und Gewöhnung 20 . 14
Vgl. N R U I, 48. Vgl. ZThK 19, 1909, 442. Ein Pfad zur Gewißheit 34. P T I, 456. In ähnlicher Weise sieht E. Troeltsch das Irrationale unter einem doppelten Aspekt. Vgl. Psychologie und Erkenntnistheorie in der Religionswissenschaft, 1905, 31 und 41. 16 Vgl. W. James, a. a. O. 462, und ZThK 16, 1906, 257. 17 PT I, 74. Vgl. audi PT I, 333 und P A A T II, 206 zu Jer. 31, 31 ff. 18 Vgl. P A A T II, 206 und F. v. Schiller, Der barmherzige Samariter. An Körner, in: Der Protestantismus im 19. und 20. Jahrhundert, hrsg. v. W. Philipp, 1965, 18—23, bes. 22 f. 19 20 Vgl. R. Bultmann, GV II, 156. Vgl. N R U I, 50. 15
47
Durch die Psychologisierung des Glaubens wird der Gegensatz zwischen der Haltung der Selbstbehauptung und der des reinen Empfangens aufgelöst in den stufenweise zu überwindenden Unterschied zwischen psychischer Verkrampftheit und Gelöstheit. Gesetzlichkeit gilt als falsche Bezogenheit auf sich selbst, nicht als verkehrtes Verhältnis zu Gott und zum Nächsten.
2. Psychologie des Glaubens als Wissenschaft und der Glaube selbst als Erlebnis Aufgabe einer empirischen Wissenschaft ist nicht nur die Beobachtung und Registrierung von Erfahrungstatsachen, sondern auch die Herausarbeitung von Gesetzmäßigkeiten, die im Geschehen zur Wirkung kommen. Auch die Religionspsychologie fragt nach Gesetzen. F. Niebergall ergänzt und entfaltet Ansätze, die bei J . Kaftan schon vorhanden sind 21 . Solche Regeln des Seelenlebens sind: Jede Betätigung wirkt auf den seelischen Zustand zurück 22 . Es wird langsam „aus häufigem Tun eine Gewöhnung, aus der Gewöhnung eine Gewohnheit und aus dieser ein selbstverständlicher Wesenszug" 2S . Dieses Gesetz ist wie alle psychischen Regeln rein formal und daher wertneutral. Es kann aus Gewöhnung eine böse oder gute Gewohnheit entstehen. Besonders bedeutsam ist für F. Niebergall das Gesetz des Motivwandels oder der Heterogonie der Zwecke, wonach selbst zum Zweck werden kann, was anfangs nur Mittel zum Zweck war. Man tut etwas für Lohn oder aus Furcht vor Strafe und schließlich um seiner selbst willen. Auch diese Regel gilt im Guten wie im Bösen. Auch das Verbrechen kann aus einem Mittel zu einem Selbstzweck werden 24 . Dieses Gesetz zeigt etwas Wesentliches im Erziehungsvorgang auf und rechtfertigt den Erzieher, der zunächst Nahziele anstreben muß, die nicht auf der Höhe des eigentlichen Ideals stehen 25 . Ein weiteres psychisches Gesetz ist das des Rückschlags. Den Gefühlen eignet keine Dauer, sie pflegen in ihr Gegenteil umzuschlagen. Gute und böse Regungen lösen sich ab 2 e . Ethischer Perfektionismus wird daher aus psychologischen Gründen abgelehnt. Jeder Mensch vereinigt in sich Gutes und Böses. Es kann dabei zu raschen Ubergängen kommen. Was als gut galt, gilt plötzlich als böse, ζ. B. der Kult unter dem Einfluß der prophetischen Kritik. Dieses Gesetz kann Grenzen fließend machen wie die zwischen Geiz und Spar2 1 Vgl. D 335. D 366 f. D 559 f. Im ganzen macht J . Kaftan von dem Gedanken an Gesetzmäßigkeiten im geschichtlichen und seelischen Leben sparsam Gebrauch. 2 2 Der Glaube muß sidi ausleben und betätigen, „was wie bekannt von dem Einfluß auf ihn ist, den gemäß der Regel der Rückwirkung jede Betätigung auf seelische Zustände ausübt". P T I, 247. 2 3 P T I, 436. 2 4 P T I, 353. 2 5 P T I, 438. 2 6 Vgl. N R U I, 65.
48
samkeit, Schwäche und Liebe, Eigensinn und Charakter 27 . Was im Sinne gesellschaftlicher oder religiöser Normen böse ist, wird nicht gut genannt, aber dodi psychisch verständlich gemacht. „Unter Sünde können wir daher einmal den Rückschlag gegen das Gute verstehen . . . Wenn Gutes zum erstenmal an die Seele herantritt, dann macht sich auch das Böse als Rückschlag oder Widerstand geltend." 28 Das Gesetz der Gefühlsübertragung bedeutet, daß sich Lust und Unlust häufig von einem Gegenstand auf dessen Umgebung überträgt. Die Liebe zum Erzieher überträgt sich auf die Gegenstände seines Unterrichts 29 . Uber diese Hauptregeln hinaus führt F. Niebergall in seinem Aufsatz über die Bedeutung der Religionspsychologie30 noch weitere an. Religiöses Leben läßt sich nicht herbeizwingen, aber audi nicht leicht vertreiben. Entgegengesetzte Gefühle wirken nur langsam. Die Religion hängt oft an äußerlichen Dingen, an Bräuchen und Sitten. Als Gefühlskomplex erträgt die Religion Widersprüche, Vermischungen und Einkleidungen. Sie beschränkt sich gern auf ein enges Gebiet und wird intolerant. Sie hat teil an der Suggestivkraft des Gefühlslebens. Während die zuletzt genannten Eigenarten religiösen Lebens aus F. Niebergalls eigener Beobachtung gewonnen sind, formuliert er die eigentlichen psychischen Gesetze im Anschluß an W. Wundt. Dieser nennt als Ergebnis seiner Untersuchungen drei psychische Gesetze, das des geistigen Wachstums, das der Heterogonie der Zwecke und das der Entwicklung in Gegensätzen, wobei die Heterogonie der Zwecke besondere Bedeutung für die Ethik hat, das der Entwicklung in Gegensätzen einerseits für die Entwicklung des Individuums, andererseits für die geschichtliche Entwicklung von Gemeinschaften. Der Vertreter der empirischen Psychologie behauptet hier eine Entsprechung von Phylo- und Ontogenese, die dem pädagogischen Motiv der kulturhistorischen Stufen entgegenkommt 31 . F. Niebergall kann die Gedanken W. Wundts nur eklektisch aufnehmen, indem er die Gesamtkonzeption ignoriert. J. Kaftans grundsätzliche Kritik an W. Wundt hindert ihn nicht an der Übernahme von Einzelheiten 32 . Er schließt sich aber keiner psychologischen Schule an 33 . Nicht empirisch27
28 Vgl. P T I , 352 f. P T I , 352. Die neuen Wege kirchlicher Arbeit 52. Vgl. Christliche Jugend- und Volkserziehung 75. 30 ZThK 19, 1909, bes. 442—444. 31 Vgl. oben S. 42 und 29, Anm. 54. „Das Gesetz der Entwicklung in Gegensätzen madit sich schon in der individuellen geistigen Entwicklung . . . geltend . . . Mehr als im individuellen tritt jedoch die Entwicklung in Gegensätzen im sozialen und geschichtlichen L e b e n . . . hervor." W. Wundt, Grundriß der Psychologie 406. „Wir bezeichnen dieselben (seil, die allgemeinen psychischen Entwicklungsgesetze) als die Gesetze des geistigen Wachstums, der Heterogonie der Zwecke und der Entwicklung in Gegensätzen." Ebd. 403. 32 Vgl. J. Kaftan, Philosophie des Protestantismus, 1917, 378—386. 33 Vgl. N R U I § 6. 29
49
psychologische, sondern theologische Kriterien bestimmen die Wahl. So gibt er H . Maier den Vorzug vor R. Otto, weil jener — wie J . Kaftan — die Religion an den Lebenstrieb bindet, womit deutlich wird, daß eben dies eine Grundthese der Theologie F. Niebergalls ist 3 4 . Er reflektiert ferner über die Funktion der Erkenntnis von psychischen Gesetzen. Er möchte den Ausdruck „Gesetz" nur mit Einschränkungen gebrauchen, da er ein Abstraktum darstellt, dem das wirkliche Leben nicht immer entspricht. Diese Gesetze haben heuristischen Wert und dienen als Arbeitshypothesen. Man muß allgemeine Sätze gewinnen, die induktiv aus der Erfahrung genommen sind. Mit ihrer Hilfe soll es deduktiv zur Erkenntnis neuer Erfahrungswirklichkeit kommen. Mit der Psychologie wird also die naturwissenschaftliche empirische Methode in die Theologie einbezogen 35 . Die positive Bedeutung der empirischen Psychologie zeigt sich an drei Stellen: Sie hat zunächst einmal eine wesentliche Funktion in der praktischen Auslegung der Schrift. Sie macht die fremden, unverständlichen Sätze verständlich als Ausdrücke für psychische Sachverhalte und hilft damit zur Übersetzung des Gesagten in die Sprache der Gegenwart 3 6 . Psychologische Auslegung bedeutet Entmythologisierung 37 . Die Erkenntnis psychischer Gesetze wird ferner fruchtbar bei der Erforschung der Religionsgeschichte. Diese belehrt hauptsächlich über „die Gesetze des religiösen Lebens, die uns eine Wiederholung und Gesetzmäßigkeit im Auftreten bestimmter religiöser Zustände erklären . . ." 3 8 . Die Erkenntis solcher Gesetzmäßigkeiten rechtfertigt überhaupt erst die Benutzung des Neuen Testaments. Man fragt dann nach Analogien zwischen einst und heute und findet bald „zur Diagnose die Therapie, bald zur Therapie die D i a g n o s e . . . " 3 9 . Die psychischen und die in der Geschichte wirksamen Gesetze entsprechen sich 40 . Aus der Entsprechung von Religionspsychologie und Religionsgeschichte ergibt sich die Möglichkeit der Vergegenwärtigung vergangenen Geschehens. Die psychischen Gesetze haben zugleich eine hermeneutische und eine didaktische Funktion. Aus der Beobachtung individuellen, religiösen Lebens in der Gegenwart ergeben sich Gesetze, die religionsgeschichtliche Texte deuten helfen. Der Bestätigung dieser Gesetze und der weiteren Entwicklung in der Geschichte kann man Anweisungen entnehmen, wie Personen in der Vgl. N R U IV, 52 ff. („Religionspsychologisches"). 3« Vgl. T P 78 und 80. Vgl. Z T h K 19, 1909, 441 f. 37 Zu Kol. 3, 1—17 bemerkt F. Niebergall: „Was der Apostel mythologisch ausgedrückt hat, drücken wir psychologisch aus . . Christliche Jugend- und Volkserziehung 19. 3 8 P A N T 35 . 39 Ebd. 4 0 Vgl. oben S . 4 1 f . und 48 ff. 34
35
50
Gegenwart zu beeinflussen sind. Das findet seinen Niederschlag in der Theorie der kulturgeschichtlichen Stufen 41 . Für F. Niebergall bleibt aber die Einbeziehung der Psychologie in die Theologie zweideutig. Er sieht durchaus die Gefahren seines Unternehmens. Zunächst wird durch die psychologische Präzisierung der anthropologischen Grundbegriffe J . Kaftans auch in die Objektseite des Glaubens ein subjektives Element hineingetragen. Der Verdacht des Illusionismus verstärkt sich. Die Gegenargumente lauten: Die Phantasievorstellungen sind durch Gefühlseindrücke und -erfahrungen gedeckt. Sie sind unvermeidlich auf Grund der psychischen Struktur des Menschen. Man kann zwar die Deutungen des Glaubens nicht beweisen, aber sie stehen auch nicht nachweislich in einem Widerspruch zu einem wissenschaftlichen Denken. Auch der Materialismus ist letztlich ein Glaube. Den Ausschlag gibt die sittliche Wertschätzung42. Diese Argumente werden ergänzt durch den Hinweis auf das, was fehlen würde, wollte man eines der beiden Elemente im Glauben isolieren. Eine Wertung ohne religiöse Glaubensdeutung der Welt ist bloße Moral, eine Glaubensdeutung ohne Wertung ist Heidentum 43 . Zuletzt läuft es auf den Gegeneinwand hinaus, daß man die zum Illusionismus führende psychologische Erklärung des Glaubens nicht verabsolutieren dürfe. Aus der psychologischen Untersuchung zu folgern, daß der Glaube also nur Phantasieprodukt sei, ist falsch. „Dieses ,nurc paßt gar nicht hierher; denn es trägt Metaphysik in unsere Untersuchung hinein. Metaphysik, nämlich die Frage nach der realen Existenz der religiösen Objekte, während wir es damit gar nicht zu tun haben, sondern rein praktische Fragen behandeln. Wir sind gar nicht apologetisch, sondern nur praktisch und psychologisch interessiert." 44 Psychologische und „religiöse" Deutung des Glaubens zeigen zwei Seiten derselben Sache. Das führt nun aber doch zu einer doppelten Reihe von Aussagen, die in starker Spannung zueinander stehen. „Streng psychologisch gesprochen schaffen wir die Offenbarung — " 4 S , so heißt es auf der einen Seite, dann wieder: „denn wir halten daran fest, die Offenbarung schafft den Glauben und nicht der Glaube die Offenbarung" 4e . Dieselbe Spannung findet sich im Gottesbegriff. „Jede religiöse 4 1 Vgl. oben S . 4 2 . Die genannte Entsprechung hat eine Parallele in Wobbermins Forderung einer Forschung, die sich im religionspsychologischen Zirkel zu bewegen habe. Vgl. sein Vorwort zu W . James, Die religiöse Erfahrung in ihrer Mannigfaltigkeit, 1914 2 , XXVI—XXIX. 4 2 Diese Grundthese der Kaftanschen Theologie findet sich auch bei W. James: „Kurz gesagt: Unmittelbare Gewißheit, philosophisch-erweisbare Vernunftmäßigkeit und ethische Bewährung sind die einzig brauchbaren Kriterien." Ebd. 15. 4 3 Vgl. Die neuen Wege kirchlicher Arbeit 6 f. 4 4 Z T h K 16, 1906, 256. Die Phantasie „ist hier also rein nur im psychologischen, nicht aber im metaphysischen Sinne eines Urteils über die Wirklichkeit der behaupteten Thatsachen gebraucht". Ein Pfad zur Gewißheit 10. 4 5 P A N T 11. 4 6 Z T h K 7, 1897, 100.
51
Beurteilung eines Vorgangs oder einer Größe ist eine Deutung mit der Denkkategorie Gott."47 Die subjektive H a l t u n g des Glaubens als Vertrauen und Verantwortung ist andererseits nur Echo auf die Botschaft des Evangeliums. „Sie lautet: Es gibt Gott, es gibt Christus, es gibt die heilige, göttliche G e i s t e s w e l t . . . " 4 8 Sünde ist einerseits „die Umkehrung des Ideals oder der Widerspruch gegen das Ideal, das konträre oder kontradiktorische Gegenteil zum Guten, dem Willen Gottes" 4 9 , oder psychologisch gesehen ein Rückschlag gegen das Gute 5 0 . Die Beispiele, die das Nebeneinander einer psychologischen und einer religiösen Betrachtungsweise zeigen, ließen sich leicht vermehren. Wie verhalten sich die beiden Betrachtungsweisen zueinander und zum Glauben? Dem Glauben gemäß ist nur die religiöse Sicht der Dinge. Hier werden Welt und Leben aus dem Glauben heraus, mit dem „Auge des Glaubens" gedeutet. Der Glaube ist Subjekt, nicht Objekt der Betrachtung. Die Psychologie aber wählt ihren Standpunkt außerhalb des Glaubens. N u r so k a n n sie ihn zum Gegenstand ihrer Betrachtung machen. Die Religionspsychologie beschreibt die Entstehung des Glaubens. Sie macht die Sprache des Glaubens als bildhaften Ausdruck f ü r Gefühlswirklichkeiten verständlich, aber ebenso die Entstehung des Unglaubens als Verkennung dieses Sachverhalts. Der Erziehungsgedanke muß helfen, das Verhältnis der beiden Betrachtungsweisen zu bestimmen. Ist die religiöse Sicht das Ziel, so die psychologische der Weg dahin 5 1 . Das Bild vom Weg wird dann aber doch als nicht angemessen wieder zurückgenommen. Es f ü h r t kein gerader, kontinuierlicher Weg von der psychologischen Zuschauerhaltung zum Glauben selbst. Weil der Glaube sich in einem „Zauberkreis" bewegt, kann man nur durch einen Sprung hineingelangen. „So kann man gleichsam die anorganischen Bestandteile des Glaubens herbeischaffen, aus denen irgendwie sein organisches Leben erzeugt werden kann. Aus diesen Bestandteilen den Glauben selbst entstehen zu lassen, ist das Reservatrecht des Schöpfers . . . Er (seil, der heilige Geist) macht, daß wir das Zeitw o r t Glauben auch in der ersten Person der Einzahl kennenlernen. All unser Wissen vom Glauben und seinen Gegenständen läßt er untergehen in dem A k t des Glaubens selbst, sodaß wir selber glauben, nicht nur wissen, wie es zustande kommt und worin es besteht. Das ist f ü r uns das Allerschwerste. Nachdem wir so viel über den Glauben nachgedacht und ihn zergliedert haben wie ein Objekt außer uns, ist es gar schwer, ihn wieder in uns selber zu erzeugen." 5 2 Die Psychologie des Glaubens hat also nicht nur die Aufgabe, den Glauben verständlich zu machen und dadurch „anzubahnen", sie bedeutet zugleich eine doppelte Gefahr f ü r den Glauben. Sie verstärkt einmal den « P A N T 19. 48 PT I, 351. 51 Vgl. ZThK 7, 1897, 104.
52
48 50 52
Die neuen Wege kirchlidier Arbeit 3. Vgl. oben S.49. Gott in Christus 29.
Verdacht des Illusionismus. Luthers Anfechtung durch die Frage nach dem gnädigen Gott wird abgelöst von der Anfechtung Α. H . Franckes durch den Zweifel 5 3 . Sie führt andererseits in die Reflexion und verhindert so die dem Glauben wesentliche Unmittelbarkeit. „Erkenntnis ist oft ein Scheidewasser für das Gefühlsleben. Besonders schädlich wirkt ein Wissen um das Gefühl und seine Bedingungen auf das Gefühl selber ein. Darum ist auch Religionspsychologie etwas sehr Gefährliches. Manchmal ist dann die Religion überhaupt nicht mehr da, oder sie hat wenigstens zu leiden." 5 4 Existentiale und psychologische Interpretation des Neuen Testaments implizieren trotz mancher Unterschiede ein ähnlich strukturiertes Problem. R . Bultmanns Frage nach dem Ubergang von der existentialen Interpretation zum existentiellen Vollzug entspricht bei F. Niebergall die Schwierigkeit, vom Wissen um den Glauben zum praktischen Glauben selbst zu kommen 55 . Beide sehen, daß es keinen geradlinigen Weg vom Wissen um den Glauben zum Glauben selbst gibt; ein Bruch liegt dazwischen, ein Sprung muß gewagt werden. Der Glaube ist Werk des heiligen Geistes 56 . Zwar kann man auch den heiligen Geist wieder psychologisch als „Zufall" deuten 57 , aber in der religiösen Deutung wird eben auch der Ubergang vom Wissen zum Glauben selbst als Gottes Werk interpretiert. Der Hinweis auf den heiligen Geist bringt die Unverfügbarkeit des Glaubens zum Ausdruck. Man kann den Glauben nicht „machen". Bei R . Bultmann heißt dies, daß der Glaube jeweils neu aus der Situation, aus dem Augenblick heraus entsteht. Bei F. Niebergall heißt „nicht machen" so viel wie „langsam werden", „reifen" 5 8 . Der Geist gehört auf die Objektseite des Glaubens. Mit „Geist" wird die Kraft bezeichnet, mit der Gott in Menschen und Gemeinschaften wirkt oder werden Gott, Sakrament und Gewissen als Mittel Gottes gedeutet. Der Geist bindet in Freiheit an Gott 5 9 . Er ist aber nicht ausschließlich an das Wort der Verkündigung gebunden, sondern wird in mannigfachen Einflüssen, ζ. B. auch in Persönlichkeiten und Organisationen, wirksam 6 0 . Auf der Subjektseite des Glaubens entspricht dem Geist das Erleben oder das Erlebnis 61 . (F. Niebergall gebraucht beide Ausdrücke gleichbedeutend, wie er auch zwischen dem Unbewußten und dem Unterbewußten nicht differenziert.) Der Erlebnisbegriff ist definiert durch die Wirkungen des Geistes: „Wenn ein Choral durch eine Versammlung braust, wenn jemand im Sinn Jesu eine Anzahl von Menschen im Gemüt 5 4 Z T h K 1 9 , 1 9 0 9 , 443. Vgl. P T II, 117. Vgl. zu Bultmann oben S.31, A n m . 4 5 . 5 9 Vgl. oben S.32, A n m . 4 9 . 5 7 Vgl. P T I, 246 f. 5 8 Vgl. PTI, 435. 5 9 Vgl. P T I, 3 8 7. 6 0 Vgl. P T I, 303 f. 6 1 „Der moderne Ausdruck .Erleben' liegt hier viel zu nahe, als daß man ihn aus Sorge vor Überschwenglidikeiten abweisen könnte." P T I, 287. 53
55
53
und Gewissen packt, wenn jemand ein Wort der Schrift plötzlich klar wird; oder wenn einer innere Stimmen des Trostes und der Mahnung vernimmt oder langsame Fortschritte auf dem Weg zu Gott und allem Guten macht." 62 Wenn Gott einem wieder Selbstachtung und einen inneren Halt gibt, dann wird aus Reflexion und Wissen um den Glauben der Glaube selbst. Man braucht „keine Apologetik mehr, wenn man so durch das eigne Erleben aus der Religionspsychologie in die Wirklichkeit hinübergeführt worden ist." 63 Der Erlebnisbegriff bezeichnet den Ubergang von der Theorie zur Praxis, aber zugleich audi den praktischen Glauben als ein Empfangen im Gegensatz zu allem Erworbenen und Gemachten. „So große Dinge lassen sich nicht erwerben; weder durch Aufklärung noch durch eigne sittliche Arbeit läßt sich Vergebung, Leben und Seligkeit übermitteln und aneignen. Sie können bloß auf dem Wege des Erlebens empfangen werden . . . Erlebnisse lassen sich nicht machen, eben weil sie unsrer Willkür entzogen sind. Wir können das Ewige nicht so und so nach Vorschrift erleben, wie sich ja leider oft genug Gesetz und Methode mit dem schönen Namen Erlebnis schmücken."64 Weil F. Niebergall das Erleben mit langsamem, unmerklichem Wachsen zusammendenkt, ist er gegen den Verdacht geschützt, er trete für pietistische Bekehrungserlebnisse ein. Er steht hier aber auf der Seite Ritschis. Fraglich bleibt aber, ob der Erlebnisbegriff die ihm zugedachte Aufgabe, die Intention der Rechtfertigungslehre zur Geltung zu bringen, erfüllen kann. Der Glaube kann zwar nicht von den Erlebnissen anderer leben, aber F. Niebergall schließt zumindest die Vorstellung nicht aus, daß das Erlebnis in der Erinnerung wieder hervorgeholt werden kann und eine erneute, wenn auch abgeschwächte Kraft darstellt. Muß nicht durch wiederholtes Erleben ein Habitus entstehen? Der Glaube ist dann kein Empfangen mehr, er kann sich aus sich selbst erneuern. Ist der Glaube nicht erst dann als reines Empfangen verstanden, wenn er mit dem Augenblick zusammengedacht wird? Weil für F. Niebergall der Erlebnisbegriff wesentliche Strukturen des Glaubens — seinen praktisch-existentiellen und seinen empfangenden Charakter — aufzeigt und darüber hinaus den Ort des Glaubens angibt, soll diesem Begriff noch weiter nachgegangen werden. H. G. Gadamer hat eine Darstellung seiner Geschichte und seiner Bedeutung gegeben, der wir folgen 65 . Dilthey bezeichnet mit dem Erlebnisbegriff die Eigenart von Rousseaus Dichtung und deren Einfluß auf die Klassik. Im Erlebnisbegriff meldet sich der Protest des Menschen, der in der industriellen Gesellschaft und in der historischen Forschung eine Distanzierung zu seiner Gegenwart und zu seiner Vergangenheit erfährt und demgegenüber 62 64 65
54
63 PT I, 334. PT I, 3 8 8 . PT I, 374 f. Vgl. zum Folgenden H. G. Gadamer, Wahrheit und Methode. 56—66.
nach einem festen Halt sucht. Typisch ist ein doppelter Aspekt: „Beide Bedeutungsrichtungen liegen offenbar der Wortbildung .Erlebnis' zugrunde, sowohl die Unmittelbarkeit, die aller Deutung, Verarbeitung oder Vermittlung vorausgeht und lediglich Anhalt für Deutung und Stoff für Gestaltung bietet, als audi der aus ihr ermittelte Ertrag, ihr bleibendes Ergebnis." 66 Dazu kommt ferner die Aussage: „Gegenüber der Abstraktion des Verstandes ebenso wie gegenüber der Partikularität der Empfindung oder Vorstellung impliziert dieser Begriff die Verbindung zur Totalität, zur Unendlichkeit." 67 Das „Erlebnis" bezeichnet etwas Letztes, Gegebenes und hat darin erkenntnistheoretische Funktion 68 ; es erschöpft sich aber nicht darin 6e . Der Begriff kommt in der biographischen Literatur auf, hat aber eine Affinität zum Ästhetischen. „Das ästhetische Erlebnis ist nicht nur eine Art von Erlebnis neben anderen, sondern repräsentiert die Wesensart von Erlebnis überhaupt." 70 In der Bezeichnung „Erlebniskunst" wird der Erlebnisbegriff gleichsam potenziert: er bedeutet, daß das Kunstwerk aus einem Erlebnis heraus entstanden ist, sein Ausdruck ist und zugleich, daß das Kunstwerk ästhetische Erlebnisse schenkt. F. Niebergall bezieht sich, wenn er vom Erlebnis spricht, nicht auf die bei Gadamer genannten Philosophen. Er kann sich dem Reiz und dem Gefälle dieses Modeworts nicht entziehen, verzichtet aber auf historische Untersuchungen. Audi bei ihm zeigt sich der doppelte Aspekt von „Erlebnis". Das religiöse Erlebnis ist eine letzte Gegebenheit, die von der empirischen Wissenschaft ohne erkenntnistheoretisches Recht angezweifelt wird. Er ist das letzte Argument gegen den Verdacht des Illusionismus. Mag man die Angemessenheit der Bilder, mit denen der Glaube das Leben deutet, anzweifeln, unbestreitbar ist deren Berechtigung von der Wirklichkeit des Erlebnisses her. Audi die Struktur des Glaubens bei F. Niebergall, seine Unmittelbarkeit, seine Ganzheit, entspricht der Analyse bei Gadamer. Die Verkündigung der ewigen Welt Gottes soll sich „auf erlebbare und erfahrbare Erkenntnisse und Eindrücke gründen . .." 7 1 . Versäumt sie diese Anknüpfung, dann bleibt sie im Bereich der Theorie. Das Erleben wird dem Theoretisieren in Worten und Begriffen entgegengestellt. „Vielleicht verstehen wir alle nichts so sehr, als was wir handelnd und leidend erleben . . . Aber auch das eben geschilderte Erlebnis der Feier bringt es unmittelbarer als Worte mit ihren Erkenntnissen den Seelen nahe." 72 Auch bei F. Niebergall zeigt der Erlebnisbegriff eine Affinität zum Kunstwerk, zur Feier. Der potenzierte Erlebnisbegriff der „Erlebnis69
Ebd. 57. Auf die Bedeutung der Begriffe „Erfahrung" und „Erlebnis" für das Verständnis D. Bonhoeffers macht G. Ebeling, Wort und Glaube, 1967 3 , 102, aufmerksam. 67 68 H . G. Gadamer, a. a. O. 59. Vgl. ebd. 61. M 70 Vgl. ebd. 63. Ebd. 66. 71 72 PT I, 322. P T I , 323.
55
kunst" steht im Hintergrund, wenn er die Auskunft, daß der Ubergang von der Reflexion zum Glauben selbst in einem Sprung bestehe, dahin ergänzt, daß es sich um eine Wechselwirkung handele. „Lehre deutet Leben und Leben unterstützt Lehre." 73 Es wird nicht nur der Erlebnisbegrifï am Beispiel des Kunstwerks verdeutlicht74, sondern es kann nun auch das eigene Erleben vermittelt sein durch das Erleben anderer, das sich wirksamen künstlerischen Ausdruck verschafft hat. In der Predigt soll nicht nur das Wort auf den Verstand wirken, sondern auch die Persönlichkeit des Predigers als unbewußt-unmittelbarer Ausdruck seiner Erlebnisse auf das unmittelbare Erleben des Zuhörers. Wie im Begriff der Erlebniskunst letztlich zurückgenommen wird, was „Erlebnis" ursprünglich meinte, nämlich etwas Selbsterlebtes, so verfährt auch F. Niebergall inkonsequent. Im Erlebnis ist aus der existentialen Interpretation existentieller Vollzug geworden, aber dieser kann dann doch wieder psychologisch beschrieben werden und die Beschreibung hilft neue Erlebnisse anbahnen. Es bleibt noch zu zeigen, wie F. Niebergall den Erlebnisbegriff in anderen Begriffen aufnimmt und weiterführt. Zunächst wird der biblische, aber über seine biblische Bedeutung geschichtlich hinausgewachsene Begriff der Erbauung mit dem des Erlebnisses identifiziert. „ . . . es kommt bei der Erbauung als Aufgabe, die sie als Zustand und Erlebnis herbeiführen soll, darauf an, daß versucht werde, die Gemeinde auf die Höhe religiöser Erlebnisse zu führen . . . Es sind Zustände innerer Ergriffenheit, in denen der Seele das Ewige oder Gott selber fast spürbar nahe i s t . . . Denken und Wollen schweigt; die ruhenden Kräfte der Seele wachen auf; man ist über sich selbst hinausgehoben; es ist, als wenn man in einem überirdischen Zustand weile, in dem man auf die Erde mit verklärtem Blicke herabschaut; man erlebt auch sich selber auf seiner innern Höhe; voll von stiller heiliger Freude wird die Seele; sie spürt etwas von dem, was der Welt Sinn und dem Leben Wert gibt." 7 5 Hier kommt auch die Erziehung wieder ins Spiel. Denn „Erbauung" kann durch „Erlebnis" wie auch durch „Erziehung" umschrieben werden 76 . Das Problem des Übergangs vom Wissen zum Glauben selbst findet bei F. Niebergall seine Lösung in dem Hinweis auf die Wirksamkeit des Geistes und das Erlebnis, das aber auch mit der Erziehung zusammenhängt. „Gerade die Kluft zu überwinden, die zwischen Hören und Tun oder gar Hören und Werden ist, das ist die Aufgabe und Kunst des Erziehers und Bildners." 77 Der Erziehung wird hier ein ungewöhnlich hohes Ziel gesteckt und F. Niebergall scheint sich damit in Widerspruch zur eigenen Behauptung zu befinden, daß der Glaube Werk des Geistes ist und 73 75 77
56
PTI, 383. PT II, 9 f. PT II, 109.
'« Vgl. PT II, 7 f. Vgl. PT II, 11.
78
nicht gemacht werden kann. Die Erziehung kann ihn auch nicht machen, sondern nur anbahnen. „Es ist aber die Hauptfrage aller Seelenleitung: Wie kann man sittlich-religiöse Erlebnisse anbahnen?" 7 8 Es hat sich, gezeigt, daß „Erziehung" die Sphäre des Existentiellen und Praktischen bezeichnet. Diese Funktion hat der Begriff besonders dann, wenn er von „Unterricht" unterschieden wird. Zwar schließt Erziehung in der Regel Unterricht, Beeinflussung durch Wort und Lehre ein, aber sie tendiert darüber hinaus auf eine Beeinflussung von Gemüt und Willen, die in den Bereich des Unbewußten und Irrationalen hinabreichen. Dem entspricht, daß die Erziehung neben dem Wort auch andere Mittel, „unwägbare Kräfte" in ihren Dienst nimmt. Der heilige Geist wird in Verbindung gebracht mit dem unwägbaren Geist einer Gemeinschaft oder einer Persönlichkeit. Weil die Erziehung praktisches Verhalten, eine Offenheit für das Leben selbst intendiert, steht sie im Gegensatz zum magischen Wortverständnis der orthodoxen Predigt und Katechetik wie auch zu aller pietistischen und methodistischen Treiberei. Die Erziehung steht in der Mitte zwischen dem Glauben als Erlebnis und der wissenschaftlich-psychologischen Reflexion über den Glauben. Die Erziehung bedient sich der psychologischen Deutung der Schrift und der Frömmigkeitsgeschichte, sie kommt aber in der Anbahnung des eigentlichen Erlebnisses weiter, da in der Person des Erziehers und in der Wirkung von Sitte und Brauchtum das Wissen schon vermengt ist mit dem praktischen Leben. Die Erziehung kommt über das bloße Wissen hinaus, wie die Erlebniskunst dem Erleben näher steht als die Wissenschaft. Ein gewisses künstlerisches Element zeichnet die Erziehung aus 7β . Sie kann aber die Grenze zum Erlebnis hin nicht überschreiten; dies bleibt Sache des Geistes Gottes. Die Erziehung bleibt Beeinflussung in Freiheit und ohne Erfolgsgarantie. Hatte bei J . Kaftan der Erziehungsbegriff die Funktion, dem Hörer des Evangeliums das Verhältnis von Autorität und Freiheit sowie den evangelischen Synergismus deutlich zu machen, so spielt F. Niebergall dieses Problem im Blick auf den Verkündiger durch. Selbsttätigkeit des Menschen und Gottes Werk kommen zusammen in der kirchlichen Erziehung 80 . 3.
Ergebnis
Die Verschiebung des Akzentes zum Subjektiven hin führt bei F. Niebergall zur Einbeziehung der Psychologie in die theologischen Überlegungen. Die von J . Kaftan unreflektiert gebrauchten Begriffe „Vorstellung" und „Gefühl" werden präzisiert und mit Hilfe der Untersuchungen von W. Wundt und W. James detailliert. Die Einführung des Begriffs „Phantasie" führt zu hermeneutischen Überlegungen und bringt das Phänomen 78 80
P T I, 287. Vgl. Pfarrerspiegel, 1930, 136.
Vgl. oben Anm. 74.
57
der Sprache, das Verhältnis von Eindruck und Ausdruck in den Blick, dem J . Kaftan keine Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Dafür geht bei F. Niebergall der Sinn für den personalen Charakter des Wortes verloren. Die traditionelle Lehre von Vergebung und Rechtfertigung wird psychologisiert, d. h. die Vergebung als pädagogisches Mittel interpretiert und so entschärft. Auch der Sündenbegriff verliert durch Psychologisierung an Ernst. Das Interesse an der Sinnfrage und an dem Problem des Vorsehungsglaubens wird verstärkt 8 1 . Die Rechtfertigungslehre tritt zunächst hinter diesem Thema zurück. Sie tritt dafür an anderer Stelle erneut in den Gesichtskreis. Durch den Begriff „Phantasie" wird der Verdacht des Illusionismus verstärkt, aber zugleich ist die religiöse Deutung von Welt und Leben als psychisches Phänomen unvermeidlich und notwendig, weil sie dem von Gottes Willen geforderten sittlichen Handeln die innere Freiheit, Unbefangenheit und Freudigkeit gibt. Bei der Darstellung des Gefühls wird der Begriff des Unbewußten eingeführt, um den zeitgemäßen Voluntarismus zum Ausdruck zu bringen, um eine Beziehung des Menschen zur Transzendenz auf unmythologische und unspekulative Weise auszusagen und schließlich um die für den Glauben konstitutive Unmittelbarkeit zu bezeichnen. An dieser Stelle versucht F. Niebergall den Glauben vom Werk zu unterscheiden. Neu gegenüber J. Kaftan ist auch die Frage nach dem Verhältnis von psychologischer Betrachtung des Glaubens sowie seiner Entstehung und dem Glauben selbst. Religionspsychologie als empirische Wissenschaft fragt nach den Gesetzen des Seelenlebens, die ζ. T. mit den Gesetzen übereinstimmen, denen der Lauf der Geschichte folgt. Sie kann den Glauben als rein immanentes Geschehen verständlich machen. Sie kann ihn vorbereiten helfen, wird ihm aber auch durch Reflexion gefährlich. Zum Glauben selbst gelangt man nur durch einen Sprung. Den Ubergang bezeichnet F. Niebergall mit den Begriffen Geist und Erlebnis. Der Erlebnisbegriff hat die Funktion, den Glauben auf eine letzte Gegebenheit zu gründen und ihn als reines Empfangen zu charakterisieren. Er soll die Unverfügbarkeit des Glaubens zum Ausdruck bringen. Diese Intention wird freilich abgeschwächt, wenn das Erlebnis zum dauernden inneren Besitz und zur Kraftquelle werden kann, ferner wenn durch die zeitbedingte Nähe zur Erlebnis-Kunst und zum Kunst-Erleben der Gedanke 81 „So kommt es auch auf die Regelung der Wertschätzung in aller christlichen Erziehung an, zugleich aber auch . . . auf die Erweckung des Glaubens, daß dieses Wertgut tatsächlich unter dem Schirm des Regenten der Welt und des Lebens steht. Nur so gibt es Sinn." Die neuen Wege kirchlicher Arbeit 37 f. Die Verkündigung von Vergebung und Erlösung „kann dann als Weg zu diesem Sinngeber, Gott, dargestellt werden". Ebd. 38. Es ist zu fragen, ob mit dem Zurücktreten der traditionellen Begrifflidikeit auch die Sache selbst an Bedeutung verliert. D. Bonhoeffer meint: „Der unbiblische Begriff des ,Sinnes' ist ja nur eine Übersetzung dessen, was die Bibel ,Verheißung' nennt." Widerstand und Ergebung 266.
58
sich einstellt, daß man Erlebnisse zwar nicht machen, aber dodi mit einem gewissen Erfolg anbahnen kann. Der Erziehung kommt als Aufgabe die Anbahnung von Erlebnissen zu. Sie nimmt damit eine Mittelstellung zwischen Wissen und Glauben ein, was mit dem künstlerischen Element in ihr zusammenhängt. Das eigene Gefalle des Erziehungsbegriffs, den J . Kaftan unreflektiert gebraucht hatte, wirkt sich bei F. Niebergall aus und führt zu Veränderungen in der Struktur des theologischen Systems. Der Erziehungsbegriff zieht andere, nicht in der Theologie beheimatete Begriffe an.
IV. Der Persönlichkeitsbegriff „Persönlichkeit" ist ein zentraler Begriff in der Praktischen Theologie F. Niebergalls. Im pädagogischen Schema „Ziel, Zustand, Weg" hat er die Aufgabe, das Ideal oder das Ziel zu bezeichnen, aber ebenso hat die Persönlichkeit eine wichtige Funktion als Erziehungsmittel. Die grundlegende Entsprechung von Hermeneutik und Didaktik findet im Persönlichkeitsbegriff ihren Ausdruck 1 . Persönlichkeit bedeutet einmal geistige Weltüberlegenheit, Autonomie, dann aber auch Individualität, geistige Geformtheit der eigenartigen Naturgrundlage, und drittens steht sie in einem Verhältnis zur Gemeinschaft. Wir untersuchen im folgenden diese drei Aspekte. 1. Die Autonomie der Persönlichkeit F. Niebergall beginnt seine Lehre von der kirchlichen Gemeindeerziehung mit der Beschreibung des Erziehungszieles. Er nennt ein doppeltes Ideal: die Persönlichkeit und die Gemeinschaft 2 . Er möchte diese Normbegriffe nicht spekulativ aus Begriffen entwickeln, sondern aus der Geschichte, d. h. aus der Überlieferung des Neuen Testamentes und der Frömmigkeitsgeschichte, gewinnen 3 . Paulus kennt die Sache, wenn auch nicht den Begriff. Was im Galaterbrief über sein Verhalten zu den andern Aposteln und das Verhalten der andern Christen steht, zeigt dies deutlich. Man braucht die konkreten Ausführungen nur ins Allgemeine zu übersetzen und man erhält das Ideal der christlichen Persönlichkeit. Das Gottesverhältnis ist für sie konstitutiv. „Im Gegensatz zu allem Gesetzestum, aber auch zu aller Willkür, hat sie (seil, die christliche Persönlichkeit) ihren Schwerpunkt in ihrem Verhältnis zu Gott. Von ihm empfängt sie das gute Gewissen in der Vergebung und kann dann jedem mit der Vgl. oben S. 42, Anm. 57. Die Darstellung hält sich „an das Ideal des Einzellebens und an das der Gemeinde. Für das erste werden wir den Ausdruck Persönlichkeit wählen, während für das zweite kein besserer Name zur Verfügung steht als der der Gemeinschaft. . P T I, 16. 3 Vgl. zum Folgenden P T I, 16—21. 1
2
59
Gewißheit und Sicherheit gegenübertreten, der höchsten sittlichen Stelle in der Welt recht zu sein." 4 Selbständigkeit, Freiheit von Gesetz und Menschen, Selbstgewißheit und Güte gegenüber andern, das sind die Merkmale der Persönlichkeit, die ohne das in der Vergebung eröffnete Gottesverhältnis nicht möglich sind . . . „Sie steht über den Dingen, die andere knechten, weil sie unter Mächten steht, von denen sich diese andern freihalten." 5 Die Beifügung „christlich" ist eigentlich überflüssig, weil die Persönlichkeit ihrem Wesen nach religiös, und zwar christlich-religiös, ist. Nach Paulus wird Luther als Kronzeuge für das Ideal der Persönlichkeit herangezogen. „Erhabenheit über die hemmenden Mächte der Sünde, der Schuld und des Gesetzes, auf Grund der gläubigen Unterordnung unter Gott, verbunden mit der freiwilligen Unterordnung unter den Nächsten — das ist das Kennzeichen der Persönlichkeit nach Luther." 6 Kant endlich hat die Sache und den Begriff. Er bezeichnet damit die sittliche Autonomie, die Unabhängigkeit vom Naturmechanismus, von sinnlicher Lust und von äußeren, heteronomen Autoritäten. Schleiermacher führt ganz neue Gedanken in den Begriff ein. Er sieht das Wesen der Persönlichkeit im Individuellen. Johannes Müller wird als Vertreter des Persönlichkeitsideals in der Gegenwart genannt. Er bezeichnet Persönlichkeit als Freiheit und Unabhängigkeit von hemmenden Bindungen, positiv als Selbständigkeit und Selbstmächtigkeit, die einen der Originalität des einzelnen entsprechenden Weg geht. Nimmt er damit das Motiv der Individualität von Schleiermacher auf, so kommt bei ihm der Gedanke neu hinzu, daß die Persönlichkeit in der Gemeinschaft geweckt und erzogen wird 7 . F. Niebergall versucht nun, dieses aus der Geschichte gewonnene Ideal als gültig und mit der Erfahrung übereinstimmend zu erweisen. Man lächelt über Menschen, die sich in Leidenschaft oder Pedanterie als abhängig von Dingen und Menschen erweisen. Umgekehrt hat man Achtung vor den überlegenen Persönlichkeiten. Bei der Darstellung der eigenen Auffassung, die dem geschichtlichen Uberblick folgt, betont F. Niebergall, daß Freiheit und Autonomie das christliche Ideal noch nicht ausmachen. Die Bindung an Gott und an seinen Geist ist die Voraussetzung und der Halt für die Unabhängigkeit, die sonst zur Willkür wird. Die Geistbindung bewirkt, daß die Persönlichkeit spontan auf die Situation eingehen kann, sie gibt der Pflichterfüllung Kraft und Freude, Rechtfertigung und Halt 8 . „So ist diese Geschlossenheit möglich, wie sie zum Wesen der christlichen Persönlichkeit gehört." 9 An dieser Stelle wird die Rechtfertigung, 4
P T I , 16.
s
PT1,17.
β EbtL 7 „Sdileiermacher f ü h r t g a n z neue G e d a n k e n in den Begriff ein. E r sieht das Individuelle als -wichtiges Stück der Persönlichkeit a n . " P T I, 17 f. 8 Vgl. P T I, 20. 9 Ebd.
60
wie F. Niebergall sie versteht, in den Persönlichkeitsbegriff einbezogen. Freudigkeit und Geschlossenheit des Handelns kommen ja nicht als Ergebnis von Denken, Beweisen oder von irgendeinem „Machen" zustande, sondern sie sind Geschenk, das im Erleben empfangen wird und das im Unbewußten wirkt. Zum Wesen der Persönlichkeit gehört die Spontaneität, die nichts von sich selbst weiß 10 . Daß das Gottesverhältnis für den Persönlichkeitsbegriff konstitutiv ist, möchte F. Niebergall religionsgeschichtlich — und psychologisch — nachweisen, indem er darauf aufmerksam macht, daß sich der Glaube an den einen Gott in der Geschichte zusammen mit dem Persönlichkeitsideal entwickelt. Daraus folgt: „Mit Gott kommt man zu sich selbst und zur Wahrheit des eigenen Wesens, die den Kern der Persönlichkeit bildet." 11 Ist das Ideal der Persönlichkeit aus der Schrift gewonnen, so wird es nun umgekehrt zum Kriterium der Schriftauslegung. Es ergibt sich ein hermeneutischer Zirkel. Nicht alle Schriftaussagen binden den modernen Menschen gleich stark; denn nicht die Form, der Ausdruck, sondern der Inhalt bindet das Gewissen, also das, was praktischen Charakter hat, was mit unserem Streben, Handeln und Erleben in Verbindung steht. Man erkennt in besonderer Weise das, was einem wahlverwandt ist. Wahlverwandt ist uns aber in der Bibel das Ideal der Persönlichkeit, „die den Trieben und Begierden von innen, die den Geschicken von außen gegenüber Herr bleibt, die einen ganz unerschütterlichen Frieden und eine beseligende Harmonie in sich trägt, die zugleich ein immer sprudelnder Quell von lauter Güte und still für alles Gute gewinnender Kraft ist" 1 2 . Der Begriff der Persönlichkeit ist also bestimmt durch Selbständigkeit oder Autonomie gegenüber heteronomen Autoritäten, durch Freiheit von hemmenden Bindungen, umgekehrt durch Bindung an die göttliche Welt, aus der Freude zum Tun des Guten, Selbstgewißheit durch die Ermutigung der Vergebung und damit verbunden ein Halt gewonnen wird, der identisch ist mit Frieden und Geschlossenheit des Wesens. Diese innere Geformtheit in Freiheit und Bindung tritt nach außen durch die Unmittelbarkeit und Unreflektiertheit des Sich-Gebens in Erscheinung. Diese Begriffsbestimmungen lassen den Zusammenhang mit den bisherigen Ausführungen erkennen. Die Autonomie der Persönlichkeit bedeutet, daß sie für die orthodoxe Zumutung, Glaubenssätze auf Autori1 0 „ . . . es ist in der Regel ein instinktives u n d intuitives Erkennen, also ein Ahnen und Fühlen unmittelbarer Art, denn nur d a s unmittelbare Selbsterkennen, das von g a n z blassen Vorstellungen begleitet ist, läßt sich hier ertragen. E i n m a l nämlich nimmt dieses nur wenig K r a f t weg, w ä h r e n d d a s reflexive und bewußte Erkennen dem nach außen drängenden Gestaltungstrieb zu viel Frische und Wucht r a u b t ; und dann ist uns der G e d a n k e unerträglich, d a ß ein Mensch genau weiß, wie er ist, um dann nachher aus -diesem seinem Wissen um sich selbst heraus zu h a n d e l n . " P P 46.
11 12
PT I, 21.
D i e religiöse Erziehung in H a u s und Schule 78.
61
tat hin für wahr zu halten, verschlossen ist. Sie bindet sich nur im Bereich des Praktisch-Existentiellen, wo sie ihre Selbständigkeit wahren kann. Der Erziehungsbegriff bezeichnet diesen Bereich. Die Autonomie der Persönlichkeit kann daher auch pädagogisch als gewährte oder geforderte Selbsttätigkeit gedeutet werden. Es ist kein Zufall, daß der Persönlichkeitsbegriff gerade bei den Vertretern des Arbeitsschulgedankens eine wichtige Rolle spielt 13 . Die Freiheit von niederen Trieben und von niederdrückenden Schuldgefühlen, von nicht innerlich, sondern nur äußerlich bejahten Gesetzen ist Ausdruck für den sittlichen Charakter der Persönlichkeit, der auf ihrer Wertschätzung beruht. Der religiöse Charakter dagegen besteht in der Bindung an die geistige Überwelt. Hier kommt der doppelte Aspekt in F. Niebergalls Gottesbegriff erneut in den Blick: Die Persönlichkeit gewinnt einen Halt an dem Gott, der die Macht hat, sein Reich als sittlich-religiösen Endzweck zu verwirklichen, und sie gewinnt Freude und Unmittelbarkeit aus der Liebe Gottes. Damit ist zugleich auf den unbewußt-irrationalen Kern der Persönlichkeit hingewiesen. Der Begriff der Persönlichkeit ist aber gegenüber dem Begriff des Unbewußten, des wahren Ich, der weitere, sofern jener diesen einschließt, darüber hinaus aber auch die Ausstrahlungen dieses Kerns mit zum Ausdruck bringt. In seiner Funktion, das christliche Ideal zu repräsentieren, erhält der Persönlichkeitsbegriff einen konfessionellen Aspekt. Die katholische Kirche pflegt christliche Frömmigkeit anstaltlich und gemeinschaftlich. Sie ist nicht geeignet, auf das evangelische Ideal hinzuführen, nach dem persönliches und gemeindliches Leben gepflegt werden soll. „Zwar macht sie fromme Gläubige, aber keine christliche Persönlichkeiten zu ihrem Ziele; zwar stiftet sie viel Gemeinschaft, aber wenig Gemeinde in unserm Sinn. Wie weit das nicht nur mit ihren Idealen, sondern auch mit ihren Erziehungsmitteln zusammenhängt, bleibt zu untersuchen..." 1 4 Fehlt im Katholizismus die Rücksicht auf die Autonomie, so in der Theosophie die Rücksicht auf die Individualität der Persönlichkeit, sofern hier das Heil im Zunichtewerden des Individuellen gesehen wird 1 5 . J . Kaftan gebraucht den Persönlichkeitsbegriff als geeignetste Analogie aus dem Erfahrungsbereich für die Beschreibung des Wesens Gottes. Gott ist geistige Persönlichkeit oder persönlicher Geist, d. h., er ist zuerst Wille, dann erst Denken. Dem entspricht seine Überweltlichkeit im Sinne von Unabhängigkeit von den Schranken des Raumes und der Zeit 1 6 . J . Kaftan orientiert sich hier mehr an Kant als an Schleiermacher. Bezeich13 Vgl. H . Gaudig, Die Idee der Persönlichkeit und ihre Bedeutung für die Pädagogik, 1965 2 . Gaudig verweist ebd. 81 Anm. 1 anerkennend auf F. Niebergall, Person und Persönlichkeit. 1 1 P T I, 223. 15 Vgl. ZTh 10, 1900, 217. 18 Vgl. D 169 und 176.
62
nend für ihn ist, daß er den Persönlichkeitsbegriff hauptsächlich auf das Objekt des Glaubens bezieht. „Persönlichkeit" wird wie „Erziehung" unreflektiert als Analogie gebraucht. Die unbekannten Glaubensgegenstände sollen durch Bekanntes verständlich gemacht werden. Freilich versteht nur der die Analogie richtig, der nicht nur entsprechende Sätze für wahr hält, sondern die entsprechende Wertschätzung hat. F. Niebergall ergänzt diese Aussage in dem Sinn, daß nur der an Gott als Persönlichkeit glaubt, der selbst eine ist 1 7 . Er gebraucht den Persönlichkeitsbegriff nur selten als Analogie für Gott, häufig aber zur Beschreibung des Wesens des christlichen Glaubens. Neben der Wendung „ethisch-transzendenter Optimismus" stellt der Persönlichkeitsbegriff ein Spiegelbild im Subjekt zu dem objektiven Begriff des Reiches Gottes als höchstes Gut dar. Bei dieser Verschiebung des Akzentes zum Subjektiven hin übernimmt F. Niebergall zwar von J . Kaftan den Voluntarismus und die Autonomie als wesentliche Momente im Begriff der Persönlichkeit, aber er erweitert dessen Sinn. Er verbindet mit ihm die Bedeutung von Halt, Geschlossenheit, Harmonie, Zu-sich-selbst-finden, die J . Kaftan weitgehend fremd ist 1 8 . Diese Erweiterung hängt mit der Einbeziehung psychologischer Gedanken zusammen. Die Begriffe „Stimmung" und „Totalgefühl", mit denen F. Niebergall das dualistische Nebeneinander von Gefühl und Vorstellung bei J . Kaftan überwindet 19 , erläutern psychologisch die Harmonie und Geschlossenheit der Persönlichkeit. J . Kaftans unreflektiert gebrauchte Begriffe entwickeln bei F. Niebergall ihre eigene Dynamik. Der innere Zusammenhang zwischen dem Persönlichkeitsbegriff und der Pädagogik spielt hier eine Rolle 2 0 . Dabei bildet das Korrelat zum Persönlichkeitsbegriff weniger der Begriff der Erziehung als der der Bildung. Auf die Geschichte dieser beiden Begriffe, deren Bedeutung sich ζ. T. überschneidet, aber nicht deckt, kann in diesem Rahmen nicht näher eingegangen werden. Sie gehören zu den 1 8 Vgl. oben S . 4 5 f f . Vgl. P T I, 21. Vgl. oben S . 4 6 Í . 2 0 Vgl. E . Weniger, Bildung und Persönlichkeit, in: Die Eigenständigkeit der E r ziehung in Theorie und Praxis, 1952, 123—140. „Das Entscheidende war nun, daß dieses Bildungsideal (seil. Humboldts) und diese Vorstellung von den Funktionen der Bildung auf die Jugenderziehung übertragen wurde . . . Das geschah in der neuhumanistischen Bewegung." Dabei „kamen in den Bildungsbegriff der Jugenderziehung alle die Kategorien wie Vollkommenheit, Harmonie, Totalität, Universalität hinein, die in Wirklichkeit Ertrag individueller Lebensleistungen von Menschen sind, denen es in einer bestimmten geistesgeschichtlichen und persönlichen Situation gelang, sich auf dem Wege über die Bildung zur Persönlichkeit zu steigern". Ebd. 128. Die Idee der H u m a nität „meint ,Totalität', d. h. die Entfaltung aller Kräfte (vgl. Pestalozzis Formel ,Kopf, Herz, Hand') zu in sich geschlossener, harmonisch-ausgewogener Gestalt des Menschseins". A. Reble, Geschichte der Pädagogik, in: Pädagogisches Lexikon, hrsg. von H . H . Groothaff und M. Stallmann, 1961, 1109. 17
19
63
pädagogischen Grundbegriffen des Neuhumanismus. E. Weniger beobachtet, daß beide Begriffe damals dasselbe bedeuten, wendet sich aber gegen diese Identifizierung 21 . Im Anschluß an Misch formuliert er: „Persönlichkeit ist kein Produkt der Bildung, sondern Ertrag des gelebten Lebens, ja mehr als Ertrag, Lohn für bewältigtes, geformtes Leben." 22 Wie Bildung nicht einfach mit Persönlichkeit identisch ist, so auch nicht mit Existenz oder mit Geist. „Geist ist die Fähigkeit, Verantwortung zu ergreifen, Bildung ist der Zustand, in dem man Verantwortung übernehmen kann." 2 3 Darum hat Bildung „gegenüber der Eigentlichkeit des Lebens einen sekundären Charakter" 2 4 . Bei E. Weniger kommt hier in den Blick, was oben das Problem des Ubergangs von der existentialen Interpretation (als Aufgabe und Ergebnis der Bildungsbemühung) zur existentiellen Haltung (der Persönlichkeit) genannt wurde 25 . F. Niebergall löst das Problem durch den Hinweis auf Geist und Erleben, nur vermag er nicht wie E. Weniger Bildung und Leben zu trennen. Das hängt damit zusammen, daß für ihn die Persönlichkeit nicht nur Ziel der Erziehung oder Bildung ist, sondern auch Mittel dazu. Ist die Persönlichkeit durch ihre Wertschätzung gekennzeichnet und geht es in der Erziehung eben darum, die Wertschätzung zu heben, so kann dies zwar auch durch Mitteilung von Werten im Wort erreicht werden, eindringlicher aber wirken die Werte, wenn sie in einer Persönlichkeit anschaulich werden. Persönlichkeit als Erziehungs- und Bildungsmittel wird zu einem universalen Begriff. Der geschichtliche Christus erfüllt seine erzieherische Aufgabe mehr als Persönlichkeit als durch Lehre 2e . Das gilt auch von den Persönlichkeiten der Kirchengeschichte und schließlich auch von Pfarrern und Lehrern. Die Persönlichkeit wirkt ungewollt, unbewußt durch die Überlegenheit, die ihr ihre Autonomie verleiht. Weil die Bildungsbemühungen dessen, der sich bildet, und dessen, der ihm dabei hilft, nicht auf theoretisches Wissen zielen und nur in Auseinandersetzung mit dem Leben selbst gelingen, kann F. Niebergall Bildung und Leben nicht trennen. Persönlichkeit gibt es nicht ohne Bildung, und Bildung ist das, „was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat" 2 7 . Damit ist eben nicht ein Rest von theoretischem, gelehrtem Wissen gemeint, sondern dessen Umsetzung in Lebenserfahrung, die unbewußt wurde. In der Lehrerpersönlichkeit und ihrer Erfahrung ist daher das Leben selbst im Unterricht anwesend. Es besteht eine Analogie zur Erlebniskunst. Wie das Kunstwerk aus dem Erleben heraus geschaffen wird und wiederum Erleben schafft, so ent21 „Bildung als Ertrag erzieherischer Bemühung, als Zustand, als menschliche Haltung, als Geformtheit individuellen Lebens scheint nichts anderes zu meinen als das, was man unter Persönlichkeit versteht." E. Weniger, a. a. 0 . 1 2 4 . 22 23 Ebd. 126 . Ebd. 138. 24 25 Ebd. Vgl. oben S. 31 und 56. 28 27 Vgl. P A N T 50. N R U I, 146.
64
steht die Persönlichkeit aus Bildung und schafft selbst wiederum Bildung. Der Persönlichkeitsbegriff ist eine der Klammern, die Hermeneutik und Didaktik zusammenhalten. 2. Die Individualität der Persönlichkeit Nach F. Niebergall hat Schleiermacher als erster die Individualität in den Persönlichkeitsbegriff einbezogen 28 . Die Entwicklung geht dahin, dieses Moment immer mehr zu betonen. F. Niebergall behandelt die damit zusammenhängenden Fragen ausführlich in „Person und Persönlichkeit" (1911). Er möchte der herrschenden Tendenz entgegen die im Titel genannten Begriffe wieder zu Edelwörtern machen. Methodisch geht er hier ganz anders vor als in der „Praktischen Theologie". Er sucht nicht das Ideal in der geschichtlichen Entwicklung, sondern fragt nach dem gegenwärtigen Sprachgebrauch. Christliche Terminologie wird vermieden. Es wird zugegeben, daß es sich um einen humanistischen, nicht um einen christlichen Begriff handelt 29 . Die Untersuchung der Umgangssprache ergibt, daß beide Wörter Werte bezeichnen, die allgemein anerkannt werden. Persönlichkeit ist ein Wort, „das den höchsten Kulturwert bezeichnen kann, wie Person den höchsten Naturwert" 3 0 . Zur Person als Natur gehört ihr Eigenrecht. Geschichtliche Befreiungstaten auf politischem und wirtschaftlichem Gebiet hatten das Ziel, dieses Recht, das allem, „was Menschenantlitz trägt", zukommt, durchzusetzen. Fortschritte in dieser Richtung sind unverlierbar und ermutigen den Glauben. Jedem Menschen eignet von Natur, also ganz unabhängig von seinen Eigenschaften und Leistungen, dieses Recht. Die Natur gibt der Person aber auch ihre Eigenart. Diese „ist" der Mensch nicht, sondern er „hat" sie, d. h., er kann sich zu ihr verhalten. Mit diesem Verhältnis ist die Möglichkeit gegeben, Persönlichkeit zu werden. Die Eigenart der Naturanlage eines Menschen tritt verschieden in Erscheinung. Sie äußert sich in seiner körperlichen Haltung, in seiner Begabung und auf dem Feld des inneren Lebens. Die Tatsache der Individualität verbietet es, sich Begriffe von einem Menschen zu bilden. Man kann Typen beschreiben, aber der einzelne als Individualität läßt sich nie ganz darin einfangen 31 . Während in der Literatur Persönlichkeit und Charakter manchmal gleichgesetzt werden, nimmt bei F. Niebergall „Charakter" eine Zwischen2» Vgl. P P 24. Vgl. oben S. 60, A n m . 7 . Ebd. Vgl. zum Folgenden P P 3 — 3 2 . 31 „Diese Auffassung von der ,Typenzucht' als Aufgabe der Bildung verkenn: die Einmaligkeit der historischen Situationen wie jeder menschlichen Individualität und die sich daraus ergebende Unwiederholbarkeit menschlicher Gestaltungen." E. Weniger, a. a. O. 136. Vgl. dazu Die religiöse Erziehung in Haus und Schule 85 f. Der Gedanke an Vorbild und Nachahmung widerspricht dem der Individualität. 28
30
65
Stellung ein 3 2 . In der Wendung: „er hat einen guten oder bösen Charakter", wird mit „Charakter" nodi einmal die natürliche Ausstattung, die Eigenart der Person, bezeichnet. Sagt man dagegen: „er hat Charakter" oder gar: „er ist ein Charakter", dann ist dabei nicht nur an Natur und Leben gedacht, sondern „das Entscheidende hat der eigne Wille getan" 3 3 . Zur Natur gehört das Wollen im Sinne des Triebs oder Instinkts, zum Charakter der Wille. „Charakter" meint hier eine geschlossene, ausgeprägte Wesensart, auf die man sich verlassen kann. Charakter ist daher mehr als eine Eigenschaft. Er meint das Wesen, das Sein, und deckt sich daher weitgehend mit dem Begriff der Persönlichkeit. „Ein Idi mit Verstand und Willen hat alles, was die Natur gegeben hatte, in die Hand genommen und etwas Neues daraus gemacht." 34 Diese Aussage trifft auf den Charakter und die Persönlichkeit zu. Gemeint ist das Gebiet des Willens oder Geistes, „es ist die Welt des Ich" 3 5 . „Autonomie" und „Individualität" sind wesentliche Elemente im Persönlichkeitsbegriff und zeigen, daß er definiert ist durch ein bestimmtes, geformtes und harmonisches Verhältnis von Natur und Geist. Charakter und Persönlichkeit haben dies gemeinsam, daß sie eine auf Geist und Willen beruhende Geformtheit des Ich, eine verläßliche Treue zum eigenen Wesen bezeichnen, die an sich schon einen Wert darstellen. Sie stehen über der formlosen, ethisch neutralen und daher nur ästhetisch zu würdigenden Natur und sind nur als Ergebnis eines mit Arbeit verbundenen Werdegangs denkbar. Kinder können daher weder Charaktere noch Persönlichkeiten sein, so gewiß sie als Personen ihre Eigenart haben. F. Niebergalls Persönlichkeitsbegriff ist bei J . Kaftan insofern vorgebildet, als dieser sich sittliche Vollkommenheit nicht als angeborene denken kann 3 6 . Es zeigt sich ferner, daß der Persönlichkeitsbegriff bei F. Niebergall keine ganz einheitliche Bedeutung hat 3 7 . Er kann damit die Großen der Geisteswelt, aber audi das Heer der mittleren und kleinen Geister bezeichnen. Das Interesse gilt zuerst den großen Persönlichkeiten. Spricht man von solchen, dann erwartet man etwas Neues, Einfaches und Kräftiges. Persönlichkeiten in diesem Sinn sind tätig auf den Gebieten höheren Menschentums, auf dem der Religion, der Philosophie, der Kunst, der Wissenschaft, der Erziehung und der Politik. F. Niebergall lehnt es aus3 2 „Ähnliches gilt vom psychol. Begriff der Persönlichkeit, der mit dem Ch.begriff manchmal gleichgesetzt (teilweise Klages, Lersch u. a.), mandimal als der umfassendere, freilich mit jeweils anderen Bestimmungen, abgehoben wird (Rothacker, Wellek, Thomae)." G. Mühle, Art. Charakterologie, Pädagogisches Lexikon, 144. R G G 1 enthält keinen Artikel „Persönlichkeit", sondern nur einen Verweis auf den Artikel „Charakter". Vgl. zum Folgenden P P 32—38. 33 p p 33. 34 p p 3 7
5 P P 38 . Vgl. zum Folgenden P P 3 8 — 5 8 .
3
37
66
36
Vgl. D 285 f.
drücklich ab, den Begriff der Persönlichkeit auf den Bereich der Religion oder der Sittlichkeit zu beschränken38. Die große Persönlichkeit ist durch ihre außerordentliche Naturanlage bestimmt, für die man meist den Ausdruck „Genie" gebraucht. Man meint ein Moment des Schöpferischen und Ursprünglichen, „jedenfalls meinen wir etwas Schöpferisches, wenn wir Persönlichkeit sagen" 39 . „ . . . es ist, als wenn der Urgeist oder die Urwahrheit ihr Auge auftäte und erleuchtend in die Welt hineinblickte." 40 Das Neue und Schöpferische ist zugleich das Ursprüngliche, Unableitbare und Echte41. Das alles sind Prädikate des Genies. F. Niebergall gebraucht hier sogar im Zusammenhang mit der Naturmacht den Begriff der Offenbarung 42 . Im Begriff der großen Persönlichkeit ist der des Genies verbunden mit dem des Charakters. Denn die Quelle ursprünglicher Schöpferkraft muß gefaßt und geformt werden von einem geistigen Willen, der sich selbst in seiner Eigenart will. „Wir ahnen ein Ich, das sich selber will. Dabei ist das ,sich' der Ausdruck für jene von dem innersten Selbst her empfangenen Ideen und der ganzen von der Natur empfangenen Eigenart." 4 3 Genie und Charakter repräsentieren in der großen Persönlichkeit die harmonische Verbindung der Naturanlage mit ihrer Eigenart und der Geformtheit durch Geist und Willen. Sofern also im Begriff der Persönlichkeit das Moment des Individuellen enthalten ist, bedeutet er eine bestimmte Erfassung des Verhältnisses von Natur und Geist. Die Person bildet den neutralen Rohstoff für die Persönlichkeit, die ihn formt. Die Harmonie des Verhältnisses beruht darauf, daß die Persönlichkeit ihre natürliche Eigenart, ihre Individualität, nicht verleugnet, sondern will, daß Gott der Schöpfer der Natur zugleich der Hort der Werte und der Ursprung des Geistes ist 44 . Diese Harmonie kann F. Niebergall nur behaupten, indem er eine gewisse Unschärfe im Begriff des Sittlichen in Kauf nimmt. Das Sittliche wird als Merkmal der Persönlichkeit abgelehnt, um den Begriff nicht zu eng zu fassen. Die Stärke ihrer Individualität kann auf dem Gebiet des Guten, aber auch des Wahren und Schönen liegen. Wenn nun aber die Persönlichkeit ihre geniale Anlage zum Charakter formt, dann liegt darin ein Zuschuß von Sittlichem45. „Sittlich" meint dann eine nur durch Fleiß und Arbeit zu erreichende Geformtheit, die unabhängig von Inhalten ist. Auch das Schöne, das die künstlerische Persönlichkeit schafft, hat dann sittlichen Charakter 46 . 38 Vgl. P P 43. 40 p p 42.
39
PP41. « Vgl, p p 44.
42
43 Vgl. PP 48 . PP 45. 45 P P 168 . Vgl. PP 53. 46 Vgl. PP 53. Das Verhältnis von Schwärmerei und Offenheit im Poetischen, wie es Κ. E. Logstrup, Die ethische Forderung, 1959, 223 f., darstellt, entspricht dem Verhältnis von Genie und Charakter bei F. Niebergall. 44
67
Das Ergebnis dieser Analyse wird durch die Beobachtung E. Wenigers bestätigt, daß Nietzsches Kulturkritik das humanistische Persönlichkeitsideal nicht verdrängen konnte, es vielmehr steigerte; „an dem Bildungsideal der Persönlichkeit wurden die Momente hervorgehoben, die bei Humboldt und dem Klassizismus vernachlässigt schienen, das Schöpferische, die Spontaneität und die Ursprünglichkeit als Wesensbestandteile im Begriff der Persönlichkeit" 47 . Die christliche Fassung des Persönlichkeitsbegriffs, wonach eine Persönlichkeit nur in der Bindung an Gott werden kann, wird humanistisch umformuliert. Im Elementaren einer Persönlichkeit ahnt man etwas Absolutes 48 . Sie ist gegründet auf ein höheres Ich. „Sie kommt zustande, wenn man sich mit dem Absoluten verbindet oder das Absolute sich herabsenkt in die Person. Dieses Absolute ist durchaus nicht zu entbehren, man mag es auch nennen wie man will." 49 Das höhere Ich ist mit dem Absoluten identisch. Man kann es sich bildlich als Höhe oder als Tiefe vorstellen 50 . Das höhere Ich als Verbindung zum Absoluten bezeichnet einen Gegensatz zur Natur. Dies ist aber dialektisch zu ergänzen durch den Gedanken, daß das höhere Ich zugleich sich selbst in seiner natürlichen Eigenart, sich selbst als Individualität wollen soll 51 . Daraus entsteht ein Problem, das zugleich die Brücke schlagen hilft von den großen zu den kleinen Geistern. Es ist zu fragen, „wie denn nun das Absolute mit den verschiedenen geschichtlichen Erscheinungen sich vertrage?" 52 Das harmonische Verhältnis von Geist und Natur hat zur Folge, daß in den großen Persönlichkeiten das Absolute immer nur in geschichtlicher, also relativer Gestalt seinen Ausdruck findet. Zur Eigenart einer Persönlichkeit gehört audi ihr Verflochtensein in die geschichtliche Situation. Die absolute Wahrheit ist in der Persönlichkeit mit ihrer Eigenart nur gebrochen da. F. Niebergall weiß dieser Tatsache in pädagogischer Absicht eine positive Wendung zu geben. „Sicher aber kann diese Verschiedenheit nur dazu dienen, daß niemand von den mittleren und kleineren Geistern ein Knecht der Großen werde." 53 Auf die kleineren Geister angewendet, deckt sich der Persönlichkeitsbegriff weitgehend mit „Charakter"; denn es fehlt hier das Geniale der Naturanlage, d. h. das Moment des Schöpferischen. Autonomie und Individualität, das Eigene, Edite in seiner Geschlossenheit und Selbständigkeit macht die kleine Persönlichkeit aus 54 . Ein paar Formulierungen dieser Einschränkung seien angeführt: „Dieses Interessante braucht nun gerade nicht etwas durchaus Neues zu sein, aber es muß diesem Menschen wirklich zugehören." 55 Ob sich dies auf dem Gebiet der Kunst, der Politik 47 49 51 53 55
68
E. Weniger, a. a. O. 125. PP 66. Ebd. PP 52. PP 54.
48 60 52 54
Vgl. PP 48. Vgl. PP68. PP 48. Vgl. PP 54 f.
usw. zeigt, ist gleichgültig. „Es kommt nicht auf den Umfang des Gegenstandes, sondern nur auf die Stärke der Ausprägung an." 5 8 Geschlossenheit und Geformtheit, d. h. Treue zu sich selbst, ist der großen und der kleinen Persönlichkeit gemeinsam. Der Unterschied besteht in der Weite des Horizontes und dem Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein schöpferischer Kräfte. Diese Unterscheidung erinnert an die Ausführungen F. Paulsens über Bildung: „Wahre, rechtschaffene Bildung werden wir jedem zuschreiben, der die Fähigkeit gewonnen hat, sich von dem Punkt aus, auf den er durch Natur und Schicksal gestellt ist, in der Wirklichkeit zurechtzufinden und sich eine eigene, in sich zusammenstimmende geistige Welt zu bauen, sie mag groß oder klein sein. Nicht die Masse dessen, was er weiß oder gelernt hat, macht die Bildung aus, sondern die Kraft und Eigentümlichkeit, womit er es sich angeeignet hat und zur Auffassung und Beurteilung des ihm Vorliegenden zu verwenden versteht." 57 Bildung in diesem Sinn ist unabhängig von Gelehrsamkeit und Schulung. Ein Bauer kann sie so gut wie ein Politiker besitzen. Im Blick auf den Horizont der Wirklichkeit, mit der der „Gebildete" in Berührung tritt, unterscheidet F. Paulsen zwischen einer engeren und einer weiteren Bildung. „Auf gewisse Weise können wir dann aber doch dem Sprachgebrauch entgegenkommen, indem wir nämlich eine engere und weitere Bildung unterscheiden, denn so wollen wir lieber sagen als niedere und höhere, wie der Sprachgebrauch unterscheidet." 58 Die Ähnlichkeit der Aussagen bei F. Niebergall und F. Paulsen bestätigt die Aussage E. Wenigers, daß Bildung und Persönlichkeit im letzten Jahrhundert fast als Tautologie gefaßt wurden 59 . Audi bei F. Niebergall findet sich diese Identifizierung eo . Daher soll der Bildungsbegriff in die Untersuchung einbezogen werden. Wie Erziehung im Unterschied zu bloßem Unterricht auf den Willen, auf das eigentliche Idi im praktisch-existentiellen Raum zielt, so darf nach F. Niebergall die Bildung nicht einseitig die Verstandeskräfte pflegen. Bildung soll allseitig im Sinne Pestalozzis sein. Sie bezieht sich auf Kopf, Hand und Herz. Allseitigkeit meint also weniger die Weite der Bildung im Sinne F. Paulsens als ihre Lebensnähe. „Bildung besteht also mehr im Können als im Kennen und hat eine ganz starke Beziehung zum Leben und zur Welt. Ihr Ziel ist, daß sich der Mensch zum Leben stelle und sich die Welt aneigne, wie es in dem Umkreis seiner Eigenart angelegt ist." 61 Im Bildungsbegriff liegt also der Ton auf der formalen Bildung. Das hängt damit zusammen, daß Bildung auf Indi56
PP 55. F. Paulsen, Art. Bildung in Reins Enzyklopädie, zitiert nach W. Flitner, Die Erziehung, Bremen 1953, 354. 58 59 Ebd. 3 5 6 . E. Weniger, a. a. O. 124. 80 81 Vgl. N R U I, 146. PT II, 276. 57
69
vidualität bezogen wird. Die formale Bildung gibt den Ausschlag, weil in ihr die Echtheit der Bildung ihren Grund hat. Inhalte übernehmen, Glaubenssätze annehmen, andere kopieren, das alles kennzeichnet die Halbbildung oder die Scheinpersönlichkeit ®2. Echte Aneignung gibt es nur durch Selbsttätigkeit. Nur in der Auseinandersetzung, nur im Kampf findet der einzelne sein Eigenes, und nur das Eigene ist wirklicher Bildungsbesitz. Unter Selbsttätigkeit versteht F. Niebergall mehr als nur die Arbeit des Lernens. Das Individuelle, die natürliche Eigenart mit ihrer schöpferischen Kraft, ist daran beteiligt. Aneignung von Bildungs- oder Glaubensgut bedeutet weder mechanische Übernahme noch Teilnahme oder Teilhabe, sondern Assimilation, Angleichen und Hereinholen des Fremden in das Eigene. Das gemeinsame Interesse am Echten und Individuellen sowie die gemeinsame Auffassung von den Wegen dorthin verbindet Theologie und Pädagogik 63 . Die Akzentverschiebung gegenüber J. Kaftan wird am Beispiel des Persönlichkeitsbegriffs besonders deutlich. J. Kaftan denkt Persönlichkeit und Geist zusammen. Dabei wird besonders die Naturüberlegenheit des Geistes betont. Sofern die sittliche Erziehung unter der Leitung des Geistes steht, knüpft dieser an die Natur an, aber diese kommt dabei nur als niedere, zu überwindende Stufe in den Blick. F. Niebergall räumt dem Begriff eine neuhumanistische Weite ein. Er versteht Natur als Individulität, die der Geist gerade nicht überwinden, sondern formen soll. Die größere Nähe zum Idealismus gibt zugleich kräftige Impulse für eine empirische Untersuchung der Naturgrundlage durch Psychologie und religiöse Volkskunde. F. Niebergall hat also den von J. Kaftan unreflektiert gebrauchten und auf das Sittliche beschränkten Erziehungsbegriff übernommen und entfaltet und, dem Zug der Zeit folgend, die Momente des Bildungsbegriffs einbezogen. Wichtig ist jedoch das Gemeinsame, nämlich die von J. Kaftan gegen die traditionelle Urstands- und Erbsündenlehre geltend gemachte Behauptung, daß die sittliche Persönlichkeit keine Naturgegebenheit, sondern nur das Ergebnis eines Erziehungs- und Bildungsprozesses sein kann 64 . Die sittliche Pflicht besteht dann bei beiden darin, die an sich neutrale Naturanlage mit Willen und Geist zu gestalten. Daß dabei humanistische und christliche Gedanken in Spannung zueinander geraten, wird nun am Verhältnis von Persönlichkeit und Gemeinschaft noch deutlicher zu zeigen sein.
62 F. Paulsen, a. a. O., 357: „Halbbildung . . . ensteht überall da, w o ohne Rücksicht auf die Naturanlage .Bildungsstoffe' aufgenötigt werden, die zu assimilieren die Natur sich weigert." Vgl. F. Niebergall, PP 59 ff. (Eigenbrödler und Scheinpersönlichkeiten). 63 Vgl. Zur Reform des Religionsunterrichts 76 f. 64 Wie siili bei Rousseau Kritik an der Urstandslehre und Erziehungsdenken verbinden, zeigt E. Hirsch, Geschichte der neuern evangelischen Theologie III, 1968 4 , 123 f.
70
3. Persönlichkeit und Gemeinschaft Gemeinschaft und Persönlichkeit sind die beiden Ideale oder Erziehungsziele, die die Grundlage und den Ausgangspunkt aller praktischen Arbeit bilden. Mit ihrer Darstellung beginnt F. Niebergall seine Praktische Theologie. Auch das Ideal der Gemeinschaft wird entfaltet, indem die geschichtliche Entwicklung von Paulus bis in die Gegenwart hinein knapp skizziert wird 65 . Die beiden Ideale stehen in Spannung und Wechselwirkung zueinander. Die Gemeinschaft wirkt auf die Persönlichkeit. Sie gibt Anregungen, Impulse, die das höhere Ich wecken, aber auch ihr Widerstand kann für den einzelnen zum Mittel werden, zu sich selbst zu finden. Unter dem Gesichtspunkt des Erziehungsmittels rücken die Begriffe der Gemeinschaft und der Geschichte sehr nahe zusammen. Die Gemeinschaft stammt aus der Geschichte und überliefert die Vergangenheit. Die Geschichte ist Quellort der Gemeinschaften und Museum der Ideale. Umgekehrt wird die Geschichte an den Wende- und Höhepunkten von großen Persönlichkeiten gemacht. Sie führen Revolutionen und Reformationen durch und gestalten so die Gemeinschaften. Diese Wechselwirkung kann aber die Spannung nicht aufheben. „Denn es liegt im Wesen beider Größen, daß sie sich nicht leicht vertragen und ertragen." 66 Es handelt sich um die Spannung zwischen Autorität und Freiheit 67 . F. Niebergall wagt nicht, das eine Ideal über das andere zu stellen. Gleichstellung ist ebenso unmöglich. In der geschichtlichen Entwicklung hat bald das eine, bald das andere die Oberhand. In ihr kommt Gottes Wille zum Ausdruck und verlangt Anerkennung 68 . In seiner „Praktischen Theologie" (I 1918) behauptet F. Niebergall den Primat der Gemeinschaft: „Aber wie das Schiff der menschlichen Gesellschaft von der Klippe der Zwangsgemeinschaft nach der Seite der Freiheit hinübergesteuert ward, so prallte es auch von der Klippe der völligen Isoliertheit des Einzelnen ab und suchte einen Mittelweg. Wir sind seit vielen Jahrzehnten wieder auf dem Weg zur Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist das höhere und die Persönlichkeit das niedere Gut." 6 9 Gegenüber F. W. Foerster macht er jedoch das Eigenrecht der Persönlichkeit gegenüber der Zwangsgemeinschaft als Ertrag der geschichtlichen Entwicklung geltend. Man wird dieser Unsicherheit in den Aussagen entnehmen dürfen, daß im Grunde der „Mittelweg" intendiert ist. Dazu passen Formulierungen, die die Spannung aufheben und den Unterschied als gleichgültig erscheinen lassen. „Auf dieses Ziel, ob man es nun in der einen Weise als religiös gerichtete Persönlichkeit bezeichnet, die für die Gemeinschaft etwas übrig hat, oder als religiös gegründete Gemeinschaft von Persönlichkeiten, soll nun auf 65
66 Vgl. PT I, 21 ff. P P 87. Vgl. „Autorität und Freiheit", Zur Reform des Religionsunterrichts 1 ff. «8 Vgl. oben S. 40, Anm.46. ·» PT I, 27. 67
71
jede Weise von der Gemeinde als der christlich-kirchlichen Arbeitsgemeinschaft hingestrebt werden." 70 Dazu kommt, daß der Begriff der Gemeinschaft bei F. Niebergall ziemlich abstrakt bleibt, obwohl er damit ein höchstes Gut bezeichnet. Im Zusammenhang seiner mehr humanistischen Ausführungen in „Person und Persönlichkeit" (1911) läßt er das Verhältnis der beiden Größen durch gegenseitige Rücksichtnahme bestimmt sein, was doch auf eine redit lose Verbindung hinweist. Es wird unterschieden zwischen dem Thema „Persönlichkeit und Gemeinschaft" und dem andern „Die Persönlichkeit und die andern" n . Die Gemeinschaft ist also nicht identisch mit „den andern". Sie stellt als organisches Wesen ein Ganzes dar. „So ist etwas zustande gekommen, was man nur eine überpersönliche Persönlichkeit nennen kann; es ist mehr als das Ganze oder gar nur als die Summe der Einzelnen." 72 Der Organismusgedanke macht noch einmal auf die Korrelation von Gemeinschaft und Geschichte aufmerksam. Denn die Geschichte tritt dem einzelnen ebenfalls als organische Entwicklung und überpersönliche Macht entgegen. „Von Natur" hat der Mensch kein positives Verhältnis zu den andern. Kinder drehen sich in natürlichem Egoismus um sich selbst. Es ist schon ein Zeichen beginnender Reife, wenn man entdeckt, daß andere Menschen auch Personen mit ihrem Eigenrecht und ihrer Eigenart sind 7S . Bezeichnend ist die Aussage: „Langsam kommt man dann oft erst dahinter, daß alles, was uns als Personen verletzte und als Personen wohltat, da drüben ebenso wirkt." 74 Daß der andere kein Ding, sondern eine Person ist, ist keine selbstverständliche Erkenntnis, sondern muß entdeckt werden. Der andere ist zunächst Objekt meiner Erkenntnis und meines Verhaltens, ich entdecke dann, daß er zugleich Subjekt ist wie ich. „Der andere" ist ein synthetischer Begriff, zusammengesetzt aus „Ich" und „Es", aber nicht eigentlich ein „Du" 7 5 . D. Bonhoeffer entwickelt in „Sanctorum Communio" (1930) den christlichen Personenbegriff im Gegensatz zum idealistischen. „Der andere ist vom Ich schlechthin nur als Du zu erleben, nicht aber selbst als Ich, d. h., im Sinne des Ich, das erst durch den Anspruch eines Du zum Ich geworden ist. Die Du-Form ist von der Ich-Form in der ethischen Wirklichkeitssphäre grundsätzlich verschieden." 78 Von da aus wird Fichtes Verständnis des „anderen" kritisiert. „Im Zusammenhang mit der Synthesis der Geisterwelt ( . . . ) kommt Fichte zu dem Ergebnis, daß der eine gar nicht sein könne, ohne am anderen seine Personhaftigkeit zu entzünden. Das Reich der Personen ist mithin aufs engste zusammengeschlossen durch dieses Gesetz des .Anstoßes', der eine ist ohne den andern gar nicht zu denken. 70
71
72
73
PT I, 28. PT I, 479. 74 pp 92. 76 Sanctorum Communio 29.
72
75
Vgl. die Überschriften PP 81 und 90. Vgl. PP 91. Vgl. oben Anm. 73.
Und dennoch besteht ein entscheidender Unterschied zwischen der Fichteschen Theorie und der eben entwickelten. Fichte sagt: ,Der Begriff des Du entsteht durch Vereinigung des ,Esc und des ,Ich' . . . Damit hat er mit größter Deutlichkeit ausgesprochen, daß er einen unsynthetischen, originalen Du-Begriff nicht kennt. Für ihn ist das Du gleich dem andern Idi und zugleich Objektform. Beides wurde von uns oben abgelehnt." 77 Diese Kritik trifft auch F. Niebergall. Sie ist berechtigt, sofern hinter ihr die Beobachtung steht, daß er weder das Verhältnis zu Gott noch das zum Nächsten streng personal versteht. F. Niebergall kann unter „Gemeinschaft" auch einfach eine Vereinigung von Personen verstehen, die sich gegenseitig respektieren in ihrem Eigenrecht und ihrer Eigenart. Rücksichtnahme und das Prinzip der Gegenseitigkeit konstituieren die Gemeinschaft78. Es wird zuerst an die Pflichten gegen sich selbst gedacht. Die Rücksicht auf die Person endet an der Rücksicht auf die Persönlichkeit. Sein Leben verlieren, um es zu gewinnen, d. h. nun, das Leben der Person mit ihrem Recht auf Behaglichkeit um idealer Zwecke willen drangeben79. Aber auch die Rücksicht auf die Person der andern muß aufhören, wenn diese der eigenen Persönlichkeit versucherisch oder sonstwie hindernd in den Weg tritt. Die Ansprüche der andern können eine Gelegenheit zur Demut sein, Mittel, sich in Selbstverleugnung zu üben und über sich selbst in Richtung auf Persönlichkeit hinauszuwachsen. Man darf daher umgekehrt auch von andern Opfer verlangen, die der eigenen Persönlichkeitsbildung dienen. Nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit muß die Persönlichkeit, die den andern als Mittel für die eigene Entfaltung benutzt, ihrerseits dem andern helfen, Persönlichkeit zu werden. Dabei darf und soll die Rücksicht auf die Person des andern um seiner Persönlichkeit willen verletzt werden, man soll ihn tadeln, strafen, ärgern, solange man ihm sein Selbstvertrauen nicht nimmt und selbst keine niederen Beweggründe dabei hat. Man muß die Persönlichkeit des andern wollen, für die freilich nicht meine, sondern seine eigenartige Stellung zu den Werten maßgebend ist. F. Niebergall gibt zu, daß es sehr schwer ist, andere zu Persönlichkeiten zu erziehen, also ihnen weder einfach Wünsche zu erfüllen noch sie nach dem eigenen Bild modeln zu wollen. Man müßte eine Vorstellung, ein Bild von der Persönlichkeit des andern haben — die erst werden soll — um ihm in seinem Werden behilflich sein zu können. Ist das möglich? Die Bemühung um Verständnis für die Individualität des andern und der Wille ihm zu helfen, stellen eine nie endende Aufgabe dar. 77 78
Ebd. 33 Anm. 1. Vgl. PP 96.
78
Vgl. PP 96.
73
Die Kritik am idealistischen Persönlichkeitsbegriff bedarf an dieser Stelle einer Korrektur. D. Solle 80 zeigt am Beispiel M. Frischs, wie das personale Verständnis des andern als Du zu der Forderung führt: „ . . . sich kein Bild machen. Wer liebt, der stellt sich dem unauflösbaren Rätsel des anderen, der läßt die Wirklichkeit eines Nichtbekannten, Unerfaßten und Unerfaßbaren stehen. Denn so wie man Gott verfehlt, indem man ihn in ein Bild bannt — Frisch bezieht sich ausdrücklich auf das zweite Gebot —, so verfehlt man den anderen Menschen, den man im Bilde unveränderlich fixiert."81 Durch einen Vergleich mit B. Brecht, für den es Liebe zum anderen nur im Zusammenhang mit einem Entwurf von ihm gibt, wird die Gefahr des personalen Verständnisses aufgewiesen. „Der Verzicht auf die zu entwerfenden Bilder ist nichts als Hoffnungslosigkeit, fair, gutgemeint, mit unendlicher Hochachtung und Rücksichtnahme ausgestattet — aber doch weit entfernt von dem riskanten Mut, für einen andern einzustehen, der Liebe genannt wird." 8 2 In Frischs Konzeption fehlt die Hoffnung, in Brechts Auffassung der Glaube. F. Niebergalls humanistisch gefärbter Persönlichkeitsbegriff steht in seinen ethischen Konsequenzen näher bei B. Brecht. Er kann daher trotz berechtigter Kritik des Mangels an Personalität zu einem notwendigen Korrektiv für einen leeren, unkonkreten Personalismus werden. Indem F. Niebergall fordert, die Individualität des anderen zu erkennen und ihm zu sich selbst zu helfen, sich also ein Bild von ihm zu machen, bereit, es zu korrigieren, sucht er Hoffnung und Glaube zu verbinden. Dennoch bleiben Bedenken gegen seinen Persönlichkeitsbegriff. Es ist zu fragen, ob er damit dem christlichen Verständnis der Nächstenliebe gerecht zu werden vermag. Κ. E. Logstrup macht darauf aufmerksam, daß die radikale ethische Forderung, die Nächstenliebe, den Gedanken an Gegenseitigkeit ausschließt 83 . F. Niebergalls Aussagen über goldene Rücksichtslosigkeit wehren zwar mit Recht die Verwechslung von Güte und Gutmütigkeit oder Schwäche ab, aber er bekommt das Phänomen, daß menschliches Leben ein Leben im Miteinandersein ist und nur miteinander gelingen kann, nicht in den Blick. „Ich muß sein (seil, des andern) positives Verhältnis zu den Werten erstreben, für mehr bin ich nicht verantwortlich." 84 Hier liegt es durchaus im Bereich der Möglichkeit, daß das Leben eines Ehepartners gelingt, sofern er sich zur Persönlichkeit formt, während der andere Partner nicht dahin kommt, ohne daß der erste Schuld daran trägt oder in seinem „Stand" als Persönlichkeit beeinträchtigt wird. Letztlich hat die Persönlichkeit bei F. Niebergall doch monadischen Charakter. 8 0 Zur D i a l e k t i k der Liebe, in: Atheistisch an G o t t glauben, 1968, 26—36. 8 2 E b d . 31 f. ei E b d . 28. 8 3 „ D i e F o r d e r u n g ist einseitig an mich gerichtet und schließt einen Anspruch meinerseits auf Gegenseitigkeit a u s . " Κ . E . L e g s t r u p , D i e ethische F o r d e r u n g 137. 8 4 P P 98.
74
Die Einsamkeit der Persönlichkeit hängt indirekt damit zusammen, daß von der Persönlichkeitsidee aus die reformatorische Lehre von Urständ und Erbsünde abgelehnt werden muß. Κ. E. Logstrup sagt: „Unser Leben ist nun einmal ohne unser Zutun so geschaffen, daß es auf andere Weise nicht gelebt werden kann, als daß der eine Mensch sich dem anderen in erwiesenem oder verlangtem Vertrauen ausliefert und mehr oder weniger seines eigenen Lebens in die Hand des anderen legt." 85 Weil die Forderung des Vertrauens zum Dasein als solchem gehört, ist die Verweigerung des Vertrauens Sünde, auch wenn der Mensch noch nicht erzogen ist. Man kann diese Aussage als existentiale Interpretation der traditionellen Urstandslehre verstehen, womit gegen F. Niebergall erwiesen ist, daß man dieser Lehre durchaus einen Sinn abgewinnen kann. Κ. E. Logstrups Deutung widerspricht einem monadischen Verständnis des Menschen als Persönlichkeit. Zugleich wird festgehalten, daß Mißtrauen, Unbarmherzigkeit und Haß von vornherein als Schuld anzusprechen sind und ihren Schuldcharakter nicht — wie bei F. Niebergall — erst durch Einsicht gewinnen, die die Erziehung bewirkt. Auf den Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsideal und Leugnung der Erbsünde macht auch M. Doerne aufmerksam 8e . Er warnt aber zugleich vor dem Extrem einer hamartiozentrischen Theologie und einer übersteigerten Kritik an der Persönlichkeitsidee87.
V. Der Kirchenbegriff In den ersten Jahren seiner literarischen Tätigkeit beschäftigt sich F. Niebergall hauptsächlich mit systematisch-apologetischen oder mit pädagogisch-psychologischen Fragen. Nach der Bedeutung der Gemeinschaft oder kirchlicher Organisationen für den Glauben wird kaum gefragt. Da die sichtbare Kirche viel Ärgernis gibt, kommen ekklesiologische Erörterungen der apologetischen Tendenz nicht entgegen. In „Wie predigen wir dem modernen Menschen?" (1902) kommt die Gemeinde als Predigtpublikum unter psychologischen und soziologischen Gesichtspunkten in den Blick. Sowohl in den hermeneutischen wie in den homiletischen Überlegungen kann ein systematischer Kirchenbegriff entbehrt werden. Nur einmal wird der Gemeindegedanke polemisch gegen den Intellektualismus der Theosophie ausgespielt 1 . Erst 1908, in der Schrift „Die evangelische Kirche und ihre Reformen", läßt er den knappen Skizzen seiner Liturgik, Homiletik, Katechetik und Pastoraltheologie eine relativ ausführliche Darstellung dessen vorangehen, was er unter Kirche und Gemeinde versteht. An dem hier erarbeiteten Kirchenbegriff hält er 85 86 87
Κ. E. Logstrup, Die ethische Forderung 18. A. Ammon/M. Doerne, Autorität und Sünde, Abschnitt I passim. 1 Ebd. 57. Vgl. ZThK 10, 1900, 216.
75
fest 2 . Breiten Raum erhält die Erörterung des Kirchenbegriffs in der Praktischen Theologie (1918/19). Die Gemeinde erscheint hier einmal als Ziel der Gemeindearbeit, dann als Trägerin der Arbeit. Diese Gliederung hängt mit dem Erziehungsgedanken zusammen. Die Gemeinde ist zugleich Ziel und Mittel der Erziehung. Von da aus kann er die wesentliche und die empirische Kirche stärker als J . Kaftan aufeinander beziehen. 1. Die Kirche als Ziel und Mittel der Erziehung F. Niebergall kennt keine apriori gegebenen oder durch die Vernunft spekulativ zu gewinnenden Normen. Er möchte daher die Kirche als Ideal der klassischen Geschichte entnehmen, die mit dem Neuen Testament beginnt und bis in die Gegenwart reicht 3 . Es geht hier um eine systematisch-theologische Entfaltung des Kirchenbegriffs aufgrund der theologiegeschichtlichen Entwicklung. Das Vaterunser ist das Gebet einer Gemeinschaft, der jeder Gedanke an Organisation fehlt. Die Urgemeinde paßt sich der Realität an, indem sie sich zu organisieren beginnt. Paulus stellt die Gemeinde unter dem Bild des Leibes Christi als einen Organismus dar. Der lutherische Kirchenbegriff stimmt mit dem katholischen in der Vorordnung der Gemeinschaft vor den einzelnen überein. Der konfessionelle Gegensatz beruht auf der reformatorischen Unterscheidung zwischen wesentlicher und empirischer Kirche und dem erzieherischen, nicht sakramentalen Verständnis der Gnadenmittel. Mit dem Ideal der Heiligungsgemeinde und der Betonung der Verantwortung des einzelnen hat der Calvinismus einen neuen Frömmigkeitstyp geschaffen, der vom Pietismus weiterentwickelt wird. Die subjektive Hingabe wird wichtiger als der objektive Heilsbesitz. In anderer Richtung bildet E. Sülze das reformierte Ideal weiter. Er betont gegenüber der amtlichen Wortverkündigung die Seelsorge und Liebestätigkeit unter Verzicht auf die pietistische Heiligkeitsforderung. Mit der Unterscheidung von wesentlicher und empirischer Kirche als Ziel und Mittel folgt F. Niebergall seinem Lehrer J . Kaftan. Er entscheidet sich jedoch gegen ihn und für das reformierte Kirchenideal. Dabei mag seine Herkunft aus der Evangelischen Kirche im Rheinland mitspielen 4 , zugleich aber die Tendenz, den Erziehungsgedanken zum Schlüsselbegriff der Theologie zu machen. Der von J . Kaftan kritisierten Tendenz im reformierten Kirchenbegriff möchte F. Niebergall nicht folgen 5 . Er optiert für die Volkskirche gegen die Heiligungsgemeinde. Die Bindung Vgl. Das Gesangbuch als kirchliches Bekenntnis, 1931, 43 ff. Vgl. zum Folgenden P T I, 2 1 — 2 6 . 4 Als Pfarrer in Kirn/Nahe steht er im Dienst der E v . Kirche im Rheinland. Sein Vorbild sind die rheinischen Gemeinden unter dem Kreuz, vgl. Die lebendige Gemeinde, 1917, 6 — 1 0 . 5 Vgl. D 579. 2
3
76
des Geistes an die Gnadenmittel darf nach Kaftan nicht als Bindung an die Institution der Kirche interpretiert werden. Die Gnadenmittel sind als notae ecclesiae sichtbar, aber keine Versichtbarung der Kirche. „Man muß wohl unterscheiden zwischen den Gnadenmitteln, deren Wirkung sich in das ganze Leben der Christenheit erstreckt und der empirischen kirchlichen Organisation." 6 Was er hier gegen ein katholisierendes Kirchenverständnis formuliert, interpretiert F. Niebergall pädagogisch. Weil die wirksame Erziehung sich auch an die irrationale Tiefe des Menschen wendet, bedient sie sich neben dem Wort audi der unmerklich wirkenden Mittel wie der Sitte und der Gemeinschaft. Das Ergebnis des geschichtlichen Überblicks lautet: „Wir glauben, daß der Zug der Zeit, wie auch der tiefste Sinn des Ν. T. dahin geht, die Gemeinschaft im Sinn des paulinischen Gedankens vom Leib, des calvinistischen Ideals und des Gemeindegedankens von Sülze als höchstes Strebeziel aufzustellen." 7 Die Entscheidung für das reformierte Ideal fällt vom Arbeitsschulgedanken aus. Zur echten Aneignung von Tradition kommt es nur durch Selbsttätigkeit, die durch bewußte und unbewußte Mittel anzuregen ist. Eine pädagogische Wahrheit wird zum Kriterium des Kirchenbegriffs. Auch die Frage nach der Kirche als Erziehungsmittel wird historisch angegangen. Unter dem Eindruck der Arbeiten Max Webers und E. Troeltschs wird nun soziologisch gedacht 8 . Es geht um die Darstellung von Grundformen oder Typen. Die katholische Kirche ist als Typ Inbegriff von Kirche überhaupt. Die Kritik richtet sich gegen ihr Ideal und die entsprechenden Erziehungsmittel 9 . Auch die lutherische Kirche gehört mit ihrer landeskirchlichen Organisation, mit ihrer engen Beziehung zu Volksleben und Kultur und mit der Praktizierung des Glaubens in Stand und Beruf zum Typ der Kirche. Den Sektentyp repräsentiert das Täufertum. Nicht die Institution soll hier die Personen heilig machen, sondern die Personen die Gemeinschaft. Dem entspricht die Ablehnung der Kindertaufe und die Loslösung von Volksleben, Kultur und Staat. Der Pietismus als Rückschlag gegen die verkirchlichte Orthodoxie nähert sich dem Sektentyp. An der reformierten Kirche lassen sich nach F. Niebergall sektenhafte Züge nicht leugnen, die aber durch die Absicht der Volksbeeinflussung neutralisiert werden. Die Unterschiede zwischen lutherischer und reformierter Kirchengestaltung hängen mit den verschiedenen staatlichen Verhältnissen zusammen. Das erzieherische Drängen auf Selbsttätigkeit entspricht der republikanischen Staatsform des Westens 10 . Aus der historischsoziologischen Untersuchung ergibt sich ein Angebot von Erziehungsmitteln, da jeder Typ ein solches eingebracht hat, das heute noch Verwendung finden kann: der Katholizismus Einrichtungen und Bräuche, die 9 8 9
7 Vgl. D 588—590, bes. 589. P T I , 28. Zu Troeltsch vgl. M. Honecker, Die Kirdie als Gestalt und Ereignis, 1963, 35—42. 10 Vgl. PT I, 223. Vgl. PT I, 229.
77
lutherische Kirche das Wort, die reformierte die Gemeindeorganisation, der Pietismus die Seelsorge 11 . Hier hält F. Niebergall diese Mittel theologisch für indifferent, während er sie anderswo audi als Argument seiner Kritik gebrauchen kann. Die im Vergleich zu Kaftan stärkere Verknüpfung von empirischer und idealer Kirche im Erziehungsbegriff impliziert zugleich gewisse Spannungsmomente. Angesichts der Kirchenkritik bei Kierkegaard und Johannes Müller, verteidigt F. Niebergall unter Berufung auf E. Troeltsch das grundsätzliche Recht der Kirche, was Kritik im Detail nicht ausschließt12. 2. Die Volkskirche Von entscheidender Bedeutung für F. Niebergalls Ekklesiologie ist die Bejahung der Volkskirche und deren Begründung mit Hilfe des Erziehungsbegriffs1®. „Volkskirche" betont die soziologische Komponente im Kirchenbegriff, die in J . Kaftans Erörterungen fehlt. Die Volkskirche bildet den Gegensatz zur Sekte, zum Täufertum, zum Ur- und Grundpietismus in seinen mannigfachen kirchlichen Gestalten. Sie weist hohe Mitgliederzahlen auf, man wird in sie hineingeboren, man entscheidet sich nicht für sie. Ihr signum ist die Kindertaufe. Sie hat nicht die internationale, universale Weite der katholischen Kirche oder mancher Sekten, aber sie wehrt sich gegen die Enge der Versuche, kirchlich-theologische Gruppen und Parteien als Richtungskirchen zu etablieren 14 . F. Niebergall verkennt nicht das Gewicht der Einwände gegen die Volkskirche. Sie will eine Verkirchlichung des Volks und erreicht eine Verweltlichung der Kirche. Die Distanz der Volkskirche vom urchristlichen Ideal wird zugegeben, aber bejaht. Die Volkskirche kann die urchristliche und pietistische Feindschaft gegen die Welt nicht teilen. Man darf die Volkskirche nicht idealisieren. Sie ist auf keinen Fall Glaubensgemeinschaft, sondern eben nur Erziehungsanstalt. Erziehung bedeutet hier Beschränkung auf Vorläufiges. Sie will den Glauben nur mittelbar vorbereiten, anbahnen, nicht unmittelbar wecken. Der Erziehungsgedanke impliziert die Unterscheidung von Endzielen und Nahzielen, von Idealen der Hoffnung und der Wirklichkeit lä , und ist daher geeignet, die Volkskirche zu rechtfertigen. Dazu gehört noch der Versuch, den Erziehungsgedanken seinerseits theologisch zu legitimieren. F. Niebergall versucht beides. Die Kindertaufe als Merkmal der Volkskirche ist Ausdruck der 12 Vgl. P T I , 2 3 5 — 2 4 1 . » Vgl. P T I, 232. 13 Vgl. zum Folgenden P T I, 2 4 1 — 2 5 0 („Volkskirche"), und Die evangelische Kirche und ihre Reformen, 1908, 35—43. 14 A. a. O. werden konservative, fortschrittlich-liberale und vermittelnde Theologengruppen genannt. 15 Vgl. P T I, § 4 und § 5.
78
gratia praeveniens 1β . Auch das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen wird als traditionelles Argument gebraucht. Während im Sektentyp Christen nach Schablonen geformt werden, die gottgewollte Mannigfaltigkeit der Individualitäten, d. h. das Persönlichkeitsideal mißachtet wird, bedingen sich bei F. Niebergall Volkskirche, Erziehung und Persönlichkeit gegenseitig. Das wichtigste theologische Argument gegenüber dem Sektentyp besteht aber in dem Vorwurf, daß er die Erfolge seiner Arbeit sehen will, anstatt an das Wirken des Geistes zu glauben. F. Niebergall räumt aber ein, daß die Berufung auf den Geist auch zum Vorwand kirchlicher Trägheit werden kann 17 . Hier kommen sogar Motive der Rechtfertigungslehre ins Spiel. Muß auf diese Weise ein theologisch legitimierter Erziehungsbegriff die Volkskirche rechtfertigen, so gilt umgekehrt die Volkskirche als geeignetes Mittel der erstrebten Erziehungsarbeit. Weil die Volkskirche sich nicht in Gegensatz zur Welt stellt, sondern die Kultur ihrer Zeit bejaht, vermeidet sie eine der Frömmigkeit gefährliche Isolierung und gewinnt die geistigen Ausdrucksmittel der Zeit, mit deren Hilfe allein die Mitteilung und Pflege der Religion wirklich möglich ist. Kulturkritik durch die Kirche ist damit nicht ausgeschlossen. Die Verweltlichung des Kirchlichen in der Volkskirche wird pädagogisch begründet, das volkshafte Element dagegen wird theologisch interpretiert. Wie ist der Begriff „Volk" in der Zusammensetzung mit „Kirche" zu verstehen? F. Niebergall hebt dreierlei hervor. „Unter Volk ist dann im einzelnen gemeint, was die Natur innerhalb der Familie und der großem Stammesgemeinschaft hervorbringt; ferner, was sich in dieser natürlichen Gemeinschaft von höhern Werten und Aufgaben erhebt, die wir als Kultur zusammenfassen, und endlich, was in dieser natürlich-geschichtlichen Gemeinschaft leben und gedeihen will und zu diesem Zwecke nach allen Hilfsmitteln greift." 18 Wie im Blick auf den einzelnen der Begriff „Charakter" die geistige Geformtheit einer natürlich-individuellen Anlage bezeichnet, so meint in Hinsicht auf eine Gemeinschaft der Begriff „Volk" ein harmonisches Verhältnis von Natur und Geist. Die Entsprechung reicht aber nodi weiter. Die Volkskirche hat dem Eigenrecht und der Eigenart des Volkes Rechnung zu tragen, d. h. sie hat das deutsche Wesen des Kirchenvolkes zu berücksichtigen. Deutsch muß für sie ein Wertbegriff sein. Sie pflegt deutsches Wesen, versucht Vaterlandsliebe zu wecken, die nicht darin zu bestehen braucht, „daß wir die andern Länder mit dem 16 Vgl. PT I, 242. Zur Kritik vergleiche P. Schempp, Die Verweltlichung der Taufe, in: Gesammelte Aufsätze, 1960, 146—158. 11 „Ist bei der Sektenarbeit immer der Wunsch, groß zu ziehen und zu sehen, was man gemacht hat, so ist hier der Glaube an den Geist größer; freilich gilt das nur für den idealistischen Blick; man kann auch sagen, daß hier die Trägheit und dort der Ernst in der Arbeit größer ist." PT I, 243. 18 PT 1,241.
79
Haß hassen, den das Judentum mit seiner Religion zu verbinden wußte" 1β. F. Niebergall möchte den Begriff des Volkes noch näher bestimmen durch Abgrenzung von andern verwandten Ausdrücken. „Volk wollen wir zwischen Masse und Führer, zwischen Rasse und Nation und Staat stellen. Lebensinstinkte und Ideen machen darum sein Wesen aus. Die Ideen aber sind zum unpersönlichen Besitz geworden, ob man diesen nun unter- oder überpersönlich nennen will. Sie sind zur Selbstverständlichkeit, zum Erbe, zur Voraussetzung des bewußten Lebens geworden." 2 0 Naturanlage und geschichtliche Einflüsse verbinden sich im Untergrund des Volkstums und wirken von da auf das Volksleben zurück. Es entfaltet sich in Sitte, Brauchtum, Feier, Sprache, in Familie, Sippe und Heimat 2 1 . Das Volk im Sinne des Volkstümlichen ist mehr auf die Ortsgemeinde, besonders die Dorfgemeinde bezogen als auf die große kirchliche Organisation. Wie es Charakter und Persönlichkeit nur auf Grund von Willensanstrengungen und nach einer gewissen Lebensgeschichte des Individuums gibt, so setzt Volkstum immer Geschichte voraus. Die volkstümlichen Uberlieferungen speichern nicht das Wissen um Geschichte, sondern die Lebenskräfte der Geschichte. Wie für Charakter und Persönlichkeit die Echtheit konstitutiv ist, d. h. die Ursprünglichkeit, Unmittelbarkeit und Unreflektiertheit ihrer Lebensäußerungen, so ist auch das Volkstum wesenhaft unmittelbar und unbewußt 22 . Volkstum ist etwas Echtes, weil es nicht gemacht wird, sondern geworden und gewachsen ist. Wie die Persönlichkeit sich einerseits von der zwar individuellen, aber ungeformten Eigenart des Kindes, aber auch von der Reflektiertheit halbgebildeter Scheinpersönlichkeiten unterscheidet, so sind nicht nur die dumpfe, ungeformte Masse, sondern auch die künstliche Mache auf dem Gebiet der Gemeinschaft Gegenbegriffe zu „Volk". F. Niebergall sieht die Pointe der Rechtfertigungslehre in dem Gegensatz von Reflektiertheit und Unmittelbarkeit. Indem er dem Volkstum unmittelbar gewordene und unmittelbar wirksame Kräfte zuspricht, ist es für ihn theologisch erlaubt, ja geboten, sich dieser Kraft in der kirchlichen Erziehung zu bedienen. Sein Verständnis von Volk, Volkstümlichkeit und Volkskirche hängt mit seiner Auffassung vom Wirken Gottes in der Geschichte zusammen. Der Vorwurf gegen die Vertreter einer landläufigen Kirchlichkeit, sie sträubten sich gegen Gottes Willen, wie er in ipso facto sich offenbare, bedeutet für ihn kein kritikloses oder fatalistisches Hinnehmen der Wirklichkeit. Gottes Wille äußert sich nicht in isolierten Einzelereignissen, sondern in Zusammenhängen, Entwicklungen und Tendenzen, die nur in einer teleologischen, auf Werturteilen beruhenden Deutung erkennbar " 20 21
80
P T I, 247. Die Dorfkirdienarbeit und das Alte Testament, Berlin 1927, 40. 2 2 Vgl. P T I, 470. Ebd. 40 f.
-werden. Mit Trunksucht und Unzucht, mit der üblichen kirchlichen Feindschaft gegen Sozialdemokratie und Judentum soll sich die Gemeinde gerade nicht als mit gottgewollten Tatsachen abfinden 2 3 . Bezeichnend ist die Kritik an „völkischen" Mißdeutungen der Volkskirche. „Mit einem früher gang und gäbe gewesenen Wort von A. Bonus handelt es sich in unserm Fall um die Germanisierung des Christentums. Diese Frage ist mit dem stark erwachten Nationalismus und besonders mit dem sehr lebhaften Antisemitismus unserer Zeit in ein sehr akutes Stadium getreten . . . Was ist dazu zu sagen? Mancherlei. Vor allem ein allgemeines Wort, das schon öfter angeklungen hat. Auf geistigem Gebiet, zumal wenn es sich um innerstes Sein handelt, darf man nichts machen wollen, sondern muß vor dem Werden Respekt haben; sonst geht man an der Wahrheit vorbei. U n d die genannte Bewegung macht nicht den Eindruck, als wenn sie etwas anderes wäre als eine Mache, und zwar aus erkennbaren sachfremden Beweggründen." 2 4 Auch wenn F. Niebergall — im Unterschied zur folgenden Generation — auf das Bekenntnis als Waffe in diesem „Kirchenk a m p f " verzichtet, hat er in dem theologisch interpretierten Volkstum ein nicht übel funktionierendes Kriterium zur Prüfung der Geister. Dieses führt auch zur Kritik an Sulzes Gemeindeideal 2 5 . Vgl. unten Anm. 34 und P T II, 494 ff. Die Dorfkirdienarbeit und dias Alte Testament 67 f. F. Niebergalls Begriff der Volkskirche enthält geschichtlich vorgegebene Elemente, auf die M. Doerne (Ammon/ Doerne, a. a. O. 7 f.) aufmerksam macht. „Volkskirche" steht für eine undogmatische, gemeindebetonte und demokratische Kirche. Das völkische Element, von dem M. Doerne die Dorfkirchenbewegung bestimmt sieht, wird von F. Niebergall freilich abgelehnt und durch das volkstümliche ersetzt. Die Unscharfe der ekklesiologischen Begrifflichkeit F. Niebergalls hängt damit zusammen, daß er sich über den Unterschied zwischen dem Seins- und dem Sollbegriff der Volkskirche keine Rechenschaft gibt. Vgl. M. Doerne, a. a. O. 4. A. Adam zeigt in seinem Budi „Nationalkirche und Volkskirche im Protestantismus", 1938, die Entstehung der volkskirchlichen Gedankenwelt bei Schleiermacher, das Volkskirchenideal bei Wiehern und verfolgt den Volkskirchengedanken weiter durch die Gesdiichte. Er beklagt, daß sehr verschiedene Vorstellungskreise mit demselben Begriff bezeichnet werden, was zu Verwirrungen führen muß. „Der eigentliche Kern des Schleiermacherschen Gedankens lag in der Vereinigung von Sozialleben und religiösem A u f b a u . " Ebd. 182. U m 1848 richtet sich das Volkskirchenideal in sozialer Leidenschaft gegen verpflichtendes Bekenntnis und kirchliche Hierarchie, während die Lutheraner den Begriff von allem Bekenntniswidrigen reinigen wollten und damit zur Begriffsverwirrung beitrugen. Zusammenfassend formuliert A. A d a m : „Volkskirche: das war ein aus dem Mittelstande aufgekommenes Kirchenideal und eine verweltlichte Form reformierten Kirchentums." Ebd. 178. Die genannten Elemente im Begriff der Volkskirche kehren bei F. Niebergall wieder. Wenn A. Adam die Idee der Nationalkirche positiver beurteilt als die der Volkskirche, weil in jener die Wahrheit des Bekenntnisses eher aufrechterhalten werden kann als in dieser, so übersieht er die kritische Funktion des Volkskirchengedankens bei F. Niebergall. Dieser steht bei ihm in Zusammenhang mit Gottes Offenbarung in ipso facto, ein Gedanke, der ebenfalls nicht apologetisch nach außen, sondern kirchenkritisch nach innen geriditet ist. 23 24
25
Vgl. P T I, 268.
81
Das Eintreten für die Volkskirche, ihre Rechtfertigung mit Hilfe des Erziehungsgedankens und die theologische Interpretation des Volkstums in Analogie zum Verständnis der Persönlichkeit machen erneut auf die zentrale Bedeutung des Erziehungsbegriffs für die Theologie F. Niebergalls aufmerksam. Das Moment des Wachsens und Werdens macht diesen Begriff einer von Kierkegaard beeinflußten Theologie suspekt, weil es den Glauben dazu verführt, sich seiner selbst auf Grund des zurückgelegten Weges zu vergewissern. F. Niebergall dagegen findet gerade in diesem Moment die theologische Legitimation des Erziehungsgedankens. Erziehung verhilft zum Reifen und zur Unmittelbarkeit des Lebensvollzugs. Sie steht im Gegensatz zu allem Abstrakten und künstlich Gemachten. F. Niebergall holt gleichsam die Pointe der Rechtfertigungslehre, wie er sie versteht, in den Erziehungsbegrifi, dann aber auch in den der Persönlichkeit und den der Volkskirche herein. Auf diese Weise kann der Erziehungsbegriif die Funktion eines theologischen Kriteriums erhalten. 3. Die Landeskirche Die Anerkennung der Volkskirche wirkt sich auf die Vorstellungen von der Organisation der Kirche aus. „Volkskirche heißt darum Landeskirche und Landeskirche heißt tatsächlich in irgendeinem, wenn auch noch so abgeschwächten Maß, staatliche oder obrigkeitliche Kirche." 2 6 Zwar hat die geschichtliche Entwicklung die Tendenz, die Verbindung zwischen Staat und Kirche immer mehr zu lockern, aber ganz aufgelöst werden kann sie nicht. Den Gegensatz zur Landeskirche bildet die Freikirche. F. Niebergall weiß, was für sie spricht, angefangen von R. Sohms Hinweis auf die Unverträglichkeit von Recht und Geist bis hin zu populären Vorwürfen gegen die vom Staat abhängige Landeskirche, die in ihrer freien Bewegung gehindert sei und die Massen zwinge. Dagegen führt er nun hauptsächlich empirische Beobachtungen an. Sein Realismus wendet sich gegen die übliche Art, Ideale aufzustellen, ohne nach ihrer Verwirklichung zu fragen. Der Vergleich zwischen Amerika und Frankreich zeigt, daß auch die Freikirche — in unterschiedlicher Stärke — an den Staat gebunden sein kann. „Zwei so einflußreiche Gewalten, wie es Staat und Kirche sind, lassen sich nicht nach einer einfachen doktrinären Formel in ein Verhältnis bringen. Ihr Verhältnis ist und bleibt irrational, denn sie können sich weder vertragen noch können sie sich entbehren (Troeltsch)." 27 Die Freikirche führt ferner zur Zersplitterung der Kräfte. Sie hat keinen Einfluß auf das Volksleben und findet keine Stellung zur sittlichen Macht des Staates. Sie macht das Evangelium zur Privatangelegenheit, das Bekenntnis zum Vereinsstatut und die Prediger sind abhängig von der « Vgl. PTI, 253 f.
2
82
27
PTI, 252 f.
Gemeindeorthodoxie 28 . F. Niebergall begründet sein J a zur Landeskirche rein praktisch, nicht theologisch. „Haben wir doch allen Grund, aus rein praktischen Rücksichten an der Landeskirche festzuhalten. Die großen Aufgaben, wie etwa die Ausbildung der Theologen, die Darbietung von Gesangbüchern und Agenden, die Durchsicht der Bibel, der dauernde Einfluß auf den Religionsunterricht in den Schulen, vor allem aber die Errichtung neuer Stellen und die Aufsicht über die ganze kirchliche Arbeit — das ist alles am besten aufgehoben in der Landeskirche." 29 Zur Volkskirche als Erziehungsmacht gehört der gebildete Pfarrer, der Theologe als Fachmann. Theologische Bildung ist aber in der mit dem Staat verbundenen Landeskirche besser als in der Freikirche gewährleistet 30 . Der geforderten Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat liegt nun aber nicht nur ein bestimmtes Verständnis der Kirche als Volkskirche, sondern auch eine bestimmte Staatsauffassung zugrunde. Der Gedanke der Freikirche stammt bezeichnenderweise aus den westlichen Ländern, in denen die Staatsauffassung von Gedanken an das Eigenrecht und die Freiheit des einzelnen beherrscht wird. Der Staat hat das Redit des einzelnen zu schützen, die Pflege geistiger Güter gehört nicht in seine Kompetenz. Nach germanisch-deutscher Auffassung aber ist der Staat den großen umfassenden Willen, der von der Regierung und der Vertretung des Volkes gebildet, auch die großen sittlichen Werte und Aufgaben des Volkslebens in seine Obhut nimmt." 3 1 Damit nimmt F. Niebergall wieder Gedanken von J . Kaftan auf. Der Staat ist nach J . Kaftan ausgerichtet auf das oberste sittliche Ideal in der Welt, die Kirche dagegen auf ein überweltliches Ideal. Staat und Kirche, beides sind Institute, nicht Gemeinschaften, die sich verschiedener Mittel bedienen, aber im Dienste desselben Subjekts stehen. „Die großen Ordnungen der Christenheit, die Kirche und der Staat sollen jede in ihrer Art dem höchsten Zweck dienen." 3 2 Daher fordert J . Kaftan, daß auch die der Kirche eigentümlichen Gebiete unter die Ordnung des Staates gehören und umgekehrt die kirchliche Verkündigung auch in die staatlichen Bereiche reichen soll. Das protestantische Ideal verlangt eine christliche Kirche in einem christlichen Staat, nicht eine freie Kirche in einem freien Staat 3 3 . F. Niebergall räumt ein, daß dieses germanisch-deutsche Staatsideal der Wirklichkeit nicht in allem entspricht. Er stellt jedoch die Kritik von empirischen Beobachtungen aus zurück und beruft sich auf den Gedanken der Volkseigenart, der nun einmal diese Staatsauffassung entspreche. Diese Auffassung braucht nicht zur Kritiklosigkeit gegenüber dem konkreten Staatswesen zu führen. Es ist Aufgabe der Kirche, Gewissen des Staates zu sein, ihm gegenüber das Absolute zur Geltung zu bringen und nicht zu schweigen, 28 30 32
Ebd. Vgl. PT I, 412. D 591. Vgl. audi WR 467 ff.
29 31 33
P T I , 255. PT I, 254. Vgl. WR 468—472. 83
wenn Unrecht geschieht34. Das Entscheidende an dieser Verbindung von Staat und Kirche ist jedoch dies, daß der Zusammenschluß der einzelnen Gemeinden zur Landeskirche eine Analogie zur staatlichen Organisation darstellt. Darin kommt zum Ausdruck, daß dieser Zusammenschluß rein praktisch-organisatorische, aber keine grundsätzlich-theologische Bedeutung hat. Es geht F. Niebergall hier weniger um die Christlichkeit des Staates als um die Weltlichkeit der Landeskirche. Der Landeskirche und der Ortsgemeinde ist gemeinsam, daß sie irdische, sichtbare, veränderliche Größen darstellen, ihre Glieder nach äußerlichen Grenzen zusammenschließen, Zusammenhang mit der Kultur suchen und Gewissen zu sein versuchen. „Eigentliche Kirche ist aber nur die Gemeinde, denn nur sie kann Gottesdienste feiern und nur in ihr kann die Arbeit der Liebe und wirkliche Gemeinschaft eintreten. Die Landeskirche, mit dem Staat mehr oder weniger eng verknüpft, trägt die Gemeinden, wie sie aus ihnen selber auch Antriebe empfängt." 35 4. Das
Bekenntnis
Der Volkskirche entspricht eine bestimmte Lösung der Bekenntnisfrage. Weil sie das Ideal der Persönlichkeit mit ihrem Recht auf Individualität und darum auch eine gottgewollte Mannigfaltigkeit pflegt, muß sie auf dem Gebiet des Bekenntnisses möglichst viel Freiheit lassen. Eine strenge Verpflichtung von Pfarrern und Gemeindegliedern auf die Sätze eines Bekenntnisses verträgt sich nicht mit dem Wesen einer Volks- und Landeskirche36. Gegen eine strenge Bekenntnisbindung weist F. Niebergall zunächst auf das Illusorische einer solchen Forderung hin. Man tut so, als ob es sie noch gäbe, dabei hat sie sich längst aufgelöst 37 . Auch die historisch-kritische Untersuchung der Bekenntnisschriften spricht dagegen. Sie sind lediglich Ausdruck eines zeitgebundenen, gewiß wertvollen, aber nicht zeitlos-allgemeingültigen Glaubensverständnisses. Die historischen Argumente werden durch psychologische ergänzt. Das formulierte Bekenntnis ist einseitig auf theologische Erkenntnis abgestimmt. Die Religionswissenschaft erkennt aber, daß neben der Lehre auch der Kultus und das praktische Leben für die Religion von Bedeutung sind. „Alle religiöse 34 „So soll die Kirche der Sozialdemokratie und dem Judentum eine freundlichere Auffassung in ihren Kreisen und darüber hinaus zu bereiten suchen." PT I, 266. 35 PT I, 280. Das untheologisdie Zweckmäßigkeitsargument (vgl. M. Doerne a. a. O. 10) wird im Grunde nur für die Landeskirche beansprucht, während die volkskirchliche Einzelgemeinde theologisch vom Gottesdienst her verstanden wird. Jenes Argument hat zugleich die kritische Funktion, eine theologische Bedeutung der Kirchenleitung zu bestreiten. 38 In Auseinandersetzung mit R. Rothe fordert M. Rade wie F. Niebergall Bekenntnisfreiheit. Unbewußtes Christentum, 1905, 19. 37 Vgl. zum folgenden Abschnitt PT I, 258—265.
84
Förderung und Bildung nimmt diese drei Stücke zu Hilfe: Quitus, Lehre und Leben." 3 8 In dieser Formulierung sind die antiintellektualistisdien Interessen J . Kaftans mit denen des zeitgenössischen Bildungsbegriffs vereinigt 39 . Die religionswissenschaftlichen Begriffe „Kult, Lehre, Leben" entsprechen der pädagogischen Trias „Herz, Kopf, Hand" bei Pestalozzi, womit er seine Forderung nach einer allseitigen Ausbildung der menschlichen Kräfte bezeichnet. Die Volkskirche als Komplementärbegriff zu dem der Persönlichkeit vereinigt wie dieser theologische und humanistischpädagogische Motive, wobei die letzteren theologisch legitimiert werden. Die geforderte Freiheit gegenüber dem Bekenntnis der Kirche führt zu einer solchen Mannigfaltigkeit der Glaubensweisen und -ausdrücke, daß die Einheit der Kirche zum Problem wird. F. Niebergall macht sich die Verschwommenheit seiner Begriffe des Irrationalen, des Unbewußten und der Grundstimmung zunutze, vergißt die sachliche Nähe zum Bekenntnis, sofern er mit ihnen die Pointe der Rechtfertigungslehre, wie er sie versteht, zum Ausdruck bringen will und behauptet einfach, daß Gedanken trennen, Gesinnungen aber verbinden. Im Bereich des Unbewußten und Irrationalen ist man sich einiger als es der theologische Richtungsstreit vermuten läßt 4 0 . Die konfessionelle Problematik wird akut in der Frage nach den Grenzen der Kirche. F. Niebergall verdeutlicht sich die konfessionelle Frage am biologischen Beispiel des Verhältnisses von Gattung und Art. Die evangelische Kirche stellt nach seiner Meinung eine bestimmte Gattung des Christentums dar, innerhalb derer es viele Arten geben mag, die aber gemeinsame Gattungsmerkmale tragen und darin verwandt sind. Es wird schwierig, den Vergleich konkret durchzuführen 41 . Er muß daher versuchen, negativ zu formulieren, was jenseits der Grenzen liegt. In der „Praktischen Theologie" (1918) nennt er pantheistischen Monismus und Sakramentsmystik, moderne Privatreligion und Katholizismus als Phänomene, die nicht mehr zur Gattung gehören. In der Schrift „Die evangelische Kirche" (1908) begründet er seine Auffassung, daß die konservative, die fortschrittliche und die vermittelnde Richtung als Arten einer Gattung anzusehen sind damit, daß sie die Extreme, nämlich Inspirationslehre und die Auflösung der Werte vermeiden 42 . Positiv kann nur gesagt werden, daß die Gattungsmerkmale in großen Grundgedanken bestehen, die von praktisch-religiöser, nicht theoretischer Art sein müssen. Auf Visitation und Prüfung der Voraussetzungen zum Führen eines geistlichen Amtes kann nicht verzichtet werden, aber sie setzen beim Visitator 3 9 Vgl. D 21 (Leitsatz zu § 3). P T I, 260. Vgl. P T I, 263. 4 1 „Freilich bleibt es dabei immer schwer festzustellen, was Gattung und was Art ist." P T I, 263. 4 2 Vgl. P T I, 263, und Die evangelische Kirche und ihre Reformen 37 f. 38
40
85
Taktgefühl, Menschenkenntnis und theologische Bildung voraus 43 . Darüber hinaus hält F. Niebergall ein doppeltes Vertrauen für sachgemäß. Man darf annehmen, daß niemand sich dauernd zur Kirche halten wird, der nicht die Uberzeugung und die Absicht hat, im Geiste Jesu der Gemeinde zu dienen. Ferner sollte man dem Geist vertrauen, daß er in alle Wahrheit leiten wird 44 . Man wird F. Niebergall zustimmen, daß eine strenge Bekenntnisbindung faktisch illusorisch ist. Neuerdings wird versucht, die Mannigfaltigkeit oder Pluralität theologischer Meinungen in einer Kirche theologisch als dem Wesen der Schrift als Kanon gemäß zu rechtfertigen 45 . Die Mannigfaltigkeit darf aber nicht nur als sachgemäßes Verhältnis des Glaubens zum geschichtlichen Ursprung gewertet werden, sie muß sich auch im Blick auf das Verhältnis der verschiedenen Meinungen zueinander als sachgemäß erweisen lassen. F. Niebergall betont das Statische, wenn er die Mannigfaltigkeit als Reichtum Gottes deutet. Er kann die Pluralität aber auch dynamisch interpretieren. Verschiedene Meinungen halten sich gegenseitig in bewegter Lebendigkeit, sofern sie sich beunruhigen 46 . Es ist aber zu fragen, ob dieser Beunruhigung nicht der letzte Ernst fehlt, wenn von vornherein klar ist, daß die Unterschiede der Auffassungen nur auf dem der natürlichen Individualitäten beruhen. Ziel ist daher ja auch nicht die Überwindung der Gegensätze, sondern das pädagogisch sinnvolle und erwünschte Hochspielen des Gegensatzes um der Lebendigkeit und das Zurücktretenlassen der Unterschiede um der Gemeinschaft willen. Hier spiegelt sich das im Grunde unharmonische Verhältnis von Persönlichkeit und Gemeinschaft. Es gibt für F. Niebergall nur eine Alternative: entweder den intoleranten, rechthaberischen Standpunkt einer fundamentalistischen Orthodoxie, die unter Berufung auf Schrift und Bekenntnis jede andere Meinung verdammt, oder die tolerante Haltung, die die fremde Meinung — innerhalb gewisser weiter Grenzen — von vornherein als individuell berechtigt ansieht. Auf katholischer Seite hat diese liberale Toleranz den Einwand provoziert, sie bleibe indifferent 47 . Aber es gibt auch den Standpunkt der Verantwortlichkeit. Man läßt sich die Mühe einer selbsterarbeiteten Erkenntnis dessen, was sachgemäß zu tun und zu lehren ist, nicht durch Schrift und Bekenntnis abnehmen, vielmehr nimmt man die Verantwortung wahr, die der in der Schrift bezeugte Glaube einem zumutet, kann sich dann aber durch andere Meinungen nicht nur 43
Die evangelische Kirche und ihre Reformen 16. Vgl. PT I, 263 f. H. Riickert sieht und kritisiert das mangelnde Vertrauen bei der Entstehung der altkirchlichen Normen als Kennzeichen des „Katholischen". Schrift, Tradition, Kirche, 1951, 13. 45 Vgl. K. Haendler, Schriftprinzip und theologischer Pluralismus, EvTh 28, 1968, 404—429. 4 « Vgl. PT I, 262. 47 A. Hartmann, Toleranz und christlicher Glaube, 1955, 86 ff. 44
86
anregen, sondern muß sich wirklich beunruhigen lassen durch die Frage: wie kommt es, daß ein anderer verantworten zu können glaubt, was man selbst nicht verantworten kann? Diese Frage der Verantwortung kommt erst dann zur Ruhe, wenn man den andern hat überzeugen können oder sich selbst hat überzeugen lassen. Daß in F. Niebergalls Vorstellungen von Kirche, Gemeinde und Gemeinschaft der Gedanke dieser Verantwortlichkeit keinen Platz hat, hängt mit seinem letztlich monadischen Persönlichkeitsbegriff zusammen. Dieser wiederum beruht auf der Voraussetzung, daß der Geist an eine individuelle, neutrale Naturanlage anknüpft und sie formt, daß also aus dem Begriff der menschlichen Natur die soziale Struktur der Mitmenschlichkeit ausgeklammert wird. Dahinter steht die Sachkritik an der Lehre von Urständ und Fall. F. Niebergall fordert Gewissensfreiheit der Persönlichkeit sowie Bindung an die Gemeinschaft und ihre Geschichte. Er gibt diesem Verlangen konkreten Ausdruck durch den — wie er weiß — utopischen Vorschlag, Bibel und Gesangbuch zu Bekenntnisschriften zu machen. Es handelt sich um einen still gehegten, nur gelegentlich, aber eindrücklich ausgesprochenen Lieblingsgedanken F. Niebergalls 48 . Das Lied vermag besser als die dogmatischen Formulierungen des Bekenntnisses den ganzen Menschen in seinem innersten praktischen Ich anzusprechen 49 . Es wirkt auf diesen innersten Bezirk, weil es selbst aus ihm hervorgeht. Es bestätigt sich, daß F. Niebergall den potenzierten Begriff des Erlebnisses in Analogie zur Erlebniskunst im Hintergrund hat. Dem Liedgut des Gesangbuchs ist jener transzendent-ethische Optimismus und die Art des Glaubens, alles auf Gott zu deuten, eigen, aber ohne die Einseitigkeit der reformatorischen Rechtfertigungslehre. Die Bedeutung des Vorsehungsglaubens, von Leid und Übel neben Sünde und Schuld, kommt im Gesangbuch zum Ausdruck 50 . Da die Sprache des Glaubens aus dem Zusammenwirken von Gefühlseindrücken und Phantasievorstellungen entsteht, ist die poetische Sprache der Lieder dem Glauben gemäßer als die begrifflich theologische der Bekenntnisschriften. Man braucht es daher mit den Begriffen bei Liedern so genau nicht zu nehmen. Wem das Glaubensbekenntnis mit seinen Sätzen über Jungfrauengeburt und Höllenfahrt nicht über die Lippen will, der wird doch ein Weihnachts- oder Osterlied mit diesen Motiven ohne Bedenken mitsingen. Auf diese Weise wird das Gesangbuch dem Persönlichkeitsideal besonders gerecht51. Es läßt jedem seine Eigenart, wie es selbst seine eigene Art hat. Besonders repräsentativ ist das Lied für das Kirchenverständnis F. Niebergalls. Im Gesangbuch kommen die Besten, die „Klassiker" der Kirche zu Wort. Ihre Gedichte wurden auf 48 Vgl. 302—305. 49 Vgl. 50 Vgl.
Biblische Geschichte, Katechismus, Gesangbuch, 1910, 79. PT I, 264 f. PT II, Das Gesangbuch als kirchliches Bekenntnis, 1931. Biblische Geschichte, Katechismus, Gesangbuch 68. 51 PT II, 302. Vgl. PT I, 265.
87
den Höhepunkten des frommen inneren Lebens geboren und repräsentieren daher die ideale Gemeinde. „Sie sind ein Zeugnis der communio sanctorum." 5 2 Man darf dieses Ideal nie als Wirklichkeit ausgeben; es liegt eine Verführung zur Unwahrhaftigkeit darin 53 . Es ist zugleich „die kirchliche Einheit in der Mannigfaltigkeit und die Mannigfaltigkeit in der Einheit. Damit ist jedem Individualismus ein Riegel vorgeschoben." 54 Das Gesangbuch ist aber auch Erziehungsmittel der empirischen Kirche. Als Quellenbuch für die Geschichte des Kirchenlieds enthält es treffende Beispiele für die mannigfachen Frömmigkeitstypen, die die Geschichte hervorgebracht hat und die im Querschnitt in der gegenwärtigen Gemeinde noch da sind. Das Kirchenregiment kann bei Neuausgaben den Liedbestand der Gesangbücher verändern und bringt damit die Kirche als Geschichtsmacht gegenüber der Ortsgemeinde zur Geltung. Die echte, weil naive, unreflektierte Frömmigkeit des Gesangbuchs vermag ebenso echte Gemeinschaft zu stiften. So wird das Gesangbuch zum konfessionellen Kriterium, zur nota ecclesiae. „Was zusammen aus unserm Gesangbuch singen kann, das gehört zur evangelischen Kirche." 5 5
V I . Kritische Würdigung F. Niebergall zieht den Erziehungsbegriff zur Interpretation des christlichen Glaubens heran. Als Klammer, die Systematische und Praktische Theologie verbindet, wird er zum Schlüsselbegriff seiner Theologie überhaupt. Die systematische Grundeinsicht besteht in der Erkenntnis des praktisch-erzieherischen Charakters des Glaubens.
1. Das Ergebnis der Verarbeitung der Kaftanschen durch F. Niebergall
Glaubenslehre
Wenn F. Niebergall den Schlüsselbegriff des J . Kaftanschen Koordinatensystems — das Reich Gottes als höchstes Gut — durch dessen Korrelat im Subjekt — einen ethisch-transzendenten Optimismus — interpretiert, hat sich theologisch nicht viel verändert. Es bleibt vor allem die Absicht, falsche Anstöße zu beseitigen, den Glauben an die praktischexistentiellen Erfahrungen zu binden und ihn damit einer rein theoretischen Bestreitung zu entziehen. Das Spiegelbild im Subjekt gibt das Objekt des Glaubens genau wieder. Anders verhält es sich bei der Übernahme des Erziehungsbegriffs. J . Kaftan hatte ihn unreflektiert unter einem doppelten Aspekt gebraucht: einmal theologisch-personal, wobei 52 53 54 55
88
Das Gesangbuch als kirchliches Bekenntnis 44. Vgl. P T II, 22. Das Gesangbuch als kirchliches Bekenntnis 44. P T I, 264.
das Verhältnis der Personen im Erziehungsgeschehen und die in ihm gesetzte Korrelation von Autorität und Freiheit als Beispiel oder Analogie für das Gottesverhältnis des Glaubens gebraucht wird, dann pädagogisch, wobei sich die Erziehung nicht analog, sondern direkt auf die Entstehung der Sittlichkeit und entsprechender Wertschätzung bezieht. Hier ist nicht das Verhältnis von Personen, sondern das von Mittel und Zweck bestimmend. Unter diesem Aspekt impliziert Erziehung den Gedanken an Entwicklung und Reife. F. Niebergall übernimmt nur den pädagogischen Aspekt von J . Kaftan. Das hat eine Akzentverschiebung der theologischen Thematik zur Folge. Das Zurücktreten des anfänglichen Interesses an dogmengeschichtlichen Zusammenhängen und die Einbeziehung aktueller Probleme — ζ. B. das Verhältnis von Glaube und Persönlichkeit oder die theologische Beurteilung der Gestalt der Kirche — kann noch damit erklärt werden, daß sich die eine Aufgabe beim Praktischen Theologen gegenüber dem Systematiker verschiebt. Damit kann man aber nicht erklären, warum er J. Kaftans Aufnahme der Rechtfertigungslehre in den theologischen Ansatz nicht wiederholt. Menschliche Schuld und göttliche Vergebung werden psychologisch gedeutet. Hinter dem Interesse am Vorsehungsglauben, an der Frage nach dem Leid und dem Sinn des Lebens tritt das an der Christologie und der Erlösungslehre zurück. Die Freiheit des Willens wird nicht als theologisches, sondern als philosophisch-pädagogisches Problem behandelt. Zugleich findet der Erziehungsbegriff eine viel häufigere Verwendung. Er wird zum wichtigsten Interpretament in der Christologie und in der Gotteslehre. Das Reden, Handeln und Leiden des geschichtlichen Jesus wird historisch-psychologisch gedeutet und als Erziehungstätigkeit verständlich gemacht. Als Erzieher wird Jesus den Menschen zum Bürgen der Liebe Gottes und für Gott zum Bürgen gegen den Mißbrauch der Gnade. Gottes Handeln wird als Erziehung des Menschengeschlechts verstanden und die von ihm geleitete Geschichte dem Glauben als Aufstieg erkennbar. Wo J . Kaftan der kausalen, naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise die personale gegenüberstellt, da bringt F. Niebergall die teleologische ins Spiel. Darin spiegelt sich die einseitige Festlegung auf den pädagogischen Aspekt des Erziehungsbegriffs und das Schema von Mittel und Zweck;. Dieses Schema legt den Gedanken an planmäßiges und methodisches Vorgehen sowie an voraussagbare Erziehungserfolge nahe. Der pädagogische Aspekt hat eine stärkere Affinität zum Begriff des Unterrichts als der personal-theologische. Dennoch besteht F. Niebergall wie sein Lehrer auf der Unterscheidung von Erziehung und Unterricht. Der Erziehungsbegriff behält seine antiintellektualistische Spitze. Er bezeichnet den Bereich des Praktischen, in dem mit theoretischen Beweisen und Gegenbeweisen nichts zu erreichen ist. Er kann daher letztlich den Offenbarungsbegriff ersetzen. 89·
Die geschichtstheologische Konstruktion in Verbindung mit der pädagogischen Theorie der kulturhistorischen Stufen führt zu einer prästabilierten Harmonie von Hermeneutik und Didaktik. Die Größen in der Geschichte werden vom wahlverwandten Geist in der Gegenwart verstanden, aber die Verwandtschaft ist keine natürliche Gegebenheit, erst recht kein Verdienst des Betreffenden, sondern Ergebnis der Erziehung durch Geschichte. Der Erziehungsbegriff hat die Aufgabe, ein Motiv der Rechtfertigungslehre zum Ausdruck zu bringen. Der Glaube darf nicht als Werk verstanden werden. Die Erkenntnis und Annahme der Offenbarung wird durch die Offenbarung als Erziehung selbst bewirkt. Damit kommt F. Niebergall freilich über die katholische Auffassung der Rechtfertigung noch nicht hinaus, wonach gute Werke zur endgültigen Rechtfertigung gefordert sind, die aber als Wirkung der Gnade zustande kommt. F. Niebergall hat die Funktion des Erziehungsbegriffs gegenüber J . K a f tan vereinseitigt und verstärkt. Daraus folgt, daß sich das dem Erziehungsbegriff eigene Gefälle stärker bemerkbar macht. Man kann einen so vielschichtigen Begriff nicht dauernd unreflektiert gebrauchen. Das Interesse der Erziehungswissenschaft an den Voraussetzungen der Erziehung führt bei F. Niebergall zur Einbeziehung der Psychologie, wobei er sich an W. James, W. Wundt und später an H . Maier orientiert. Das subjektive Element seiner Theologie erfährt dadurch eine Stärkung, die Anfechtung durch den Gedanken, der Glaube beruhe auf Illusion, wird größer. Mit dem Verzicht auf den personal-theologischen Aspekt des Erziehungsbegriffs fehlt F. Niebergall ein gewichtiges Gegenargument. Er muß sich mit der Auskunft des Pragmatismus begnügen, daß man den subjektiven Ansatz nicht durch objektiv-theoretische Einwände in Frage stellen könne. Durch die Einbeziehung der Psychologie wird die Sprache des Glaubens zum Problem, für das er bei J . Kaftan keine Lösung vorfindet. Fragen der Rechtfertigung — an andern Stellen verharmlost und vernachlässigt — werden im Bereich psychologischer Erörterungen erneut aktuell. Der Begriff des Unbewußten soll die Unmittelbarkeit echten Glaubens zum Ausdruck bringen und damit den Verdacht abwehren, der Glaube sei ein Werk. Die Verteidigung des Glaubens gegen positivistische Angriffe mit Hilfe der Unterscheidung von Tatsachen- und Werturteilen bringt den Glauben in den Verdacht, sublimierter Egoismus zu sein. F. Niebergall begegnet diesem Vorwurf, indem er den Egoismus mit der in der Reflexion gegebenen Selbstbezogenheit identifiziert und deren Uberwindung durch die Unmittelbarkeit und Unbewußtheit des Glaubens darstellt. Die psychologische Beschreibung des Glaubens und seiner Entstehung führt zu der Frage, wie es vom Wissen um den Glauben zum Glauben selbst kommt. Geist und Erlebnis bezeichnen den Ubergang, vielmehr den Sprung. Der Erlebnisbegriff hat die Funktion, den Glauben als reines 90
Empfangen zu kennzeichnen, seine Unverfügbarkeit zum Ausdruck zu bringen und gleichzeitig auf den Unterschied zwischen Wissen und Glauben aufmerksam zu machen. Die Weiterbildung der J . Kaftanschen Anthropologie mit Hilfe der Psychologie, die Einbeziehung der Phantasie und die Erkenntnis des Problems der religiösen Mitteilung führt zu Aussagen, die in der Religionspädagogik R. Kabischs eine Parallele haben. Auch der Persönlichkeitsbegriff ist durch J . Kaftan vorgegeben, aber die Akzentverschiebung vom Objektiven zum Subjektiven hin wirkt sich hier ebenfalls aus. Aus einer Analogie, die die Struktur des Gottesbegriffs verdeutlichen soll, wird eine Bezeichnung für das Subjekt des Glaubens. Eine voluntaristisch verstandene Autonomie kennzeichnet die Persönlichkeit schon bei J . Kaftan. F. Niebergall folgt einer bei Schleiermacher einsetzenden Entwicklungstendenz, wenn er in der Individualität als sittlich neutrale, Eigenart begründende Naturanlage ein weiteres Merkmal der Persönlichkeit sieht. Das ermöglicht die Hereinnahme der im Bildungsdenken derZeit enthaltenen Momente in den Erziehungsbegriff. J . Kaftans Sachkritik an der traditionellen Lehre von Schöpfung und Fall enthält die Voraussetzungen für die behauptete Harmonie zwischen Natur und Geist, welche den Persönlichkeitsbegriff bestimmt. Das neuhumanistische Bildungsdenken läßt sich dem pädagogischen Aspekt des Erziehungsbegriffs und seinem Schema von Mittel und Zweck leichter anpassen als dem theologisch-personalen. F. Niebergall braucht seinem Lehrer hier nicht zu widersprechen. Er entwickelt vorhandene Ansätze, indem er andere ausklammert. D a das Wort „Bildung" den Vorgang und das Ergebnis umfaßt, kommt hier erneut das von J . Kaftan so nicht gesehene Problem des Ubergangs von der existentialen Interpretation zum existentiellen Vollzug in den Blick. Man wird zwar bei dem Versuch, sich selbst oder andere zu bilden, planmäßig vorgehen, aber man kann Ergebnisse nicht herstellen, berechnen oder gar in einem mechanisch-kausalen Prozeß erzwingen. Die Persönlichkeit als Ergebnis der Bildung ist durch Unmittelbarkeit und Irrationalität gekennzeichnet. Es wird zu fragen sein, ob die Unverfügbarkeit der Bildung als Ergebnis ihre Ursache in der Autonomie der Persönlichkeit oder in der Freiheit der Gnade oder in beiden zugleich hat. Bei letzterem wäre weiter zu fragen, wie sich die Freiheit des sich offenbarenden Gottes zu der Freiheit der Persönlichkeit als dem Subjekt des Glaubens verhält. Die Einbeziehung der Psychologie führt also bei F. Niebergall konsequent zur Einbeziehung des neuhumanistischen Bildungsdenkens in die theologische Anthropologie, wodurch die Aktualisierung der Rechtfertigungslehre an einen andern Ort gerückt wird. Sie erscheint nicht mehr im Zusammenhang der Lehre von Erwählung und Erlösung, sondern als das Problem des Ubergangs von der existentialen Interpretation zum existentiellen Vollzug. 91
In der Ekklesiologie ist F. Niebergall wiederum darauf angewiesen, J. Kaftans Ausführungen zu ergänzen, hier durch Einbeziehung soziologischer Aspekte, wobei er sich besonders auf die Untersuchungen von E. Troeltsch bezieht. Uber die Unterscheidung von Wesen und Gestalt der Kirche hinaus betont F. Niebergall den Gemeindegedanken. Gemeinde ist Gemeinschaft, interpretiert als Organismus und überpersönliches Ich. Das Werden und irrationale Elemente sind für sie ebenso bezeichnend wie für die Persönlichkeit. Das Ideal der Gemeinschaft ist als Analogie zum Persönlichkeitsideal entworfen. Bei dem Versuch, die möglichen Gestaltungen der Kirche theologisch zu reflektieren, entscheidet sich F. Niebergall für die Volkskirche, die als Landeskirche organisiert ist. Die zugegebenen Schwächen der Volkskirche werden und Hilfe des Erziehungsbegriffs gerechtfertigt, wobei er diesen wiederum theologisch zu legitimieren versucht. Die vom Erziehungs- und Bildungbegriff her geforderte Selbsttätigkeit des einzelnen in der Gemeinde wird für F. Niebergall zum Anlaß, sich mit Einschränkung gegen J. Kaftan und für das reformierte Gemeindeideal auszusprechen. Die Übernahme, Ergänzung und Weiterbildung der J. Kaftanschen Theologie durch F. Niebergall führt also unter Ausklammerung bestimmter Aspekte zu nicht unerheblichen Veränderungen in der Struktur des theologischen Systems, ohne daß die grundsätzliche Übereinstimmung dadurch fraglich würde. 2. Immanente
Kritik
Anhaltspunkte für eine immanente Kritik ergeben sich aus der Geschichte der Pädagogik und aus F. Niebergalls Stellungnahme zur dialektischen Theologie. E. Weniger macht darauf aufmerksam, daß der Bildungsbegriff erst durch den Neuhumanismus im Gegensatz zu seiner ursprünglichen Intention auf die Jugenderziehung übertragen wurde 1 . Er ist von seinem geistesgeschichtlichen Ursprung bei Humboldt her aristokratisch gedacht. Um den Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, zu entgehen, klammert F. Paulsen die Horizonterweiterung als nicht konstitutiv aus dem Bildungsbegriff aus. F. Niebergall folgt ihm, aber die Schwierigkeit bleibt. Man kann nicht übersehen, daß der Abstand vom Ideal einer autonomen, selbständig urteilenden Persönlichkeit im Blick auf die Landbevölkerung und das Proletariat doch als recht groß erscheint. Das überpersönliche Ich einer Gemeinschaft, z. B. einer Dorfgemeinschaft kann zum Ersatz für das Persönlichkeitsideal werden. Dazu kommt, daß beide, Gemeinschaft und Persönlichkeit auch als Bildungsmittel wirken können und sich darin sehr ähnlich sind. F. Niebergall bemerkt selbst die Spannung zwischen den verschiedenen Aussagen, wenn er klagt: „Es gehörte zur Periode der Auf1
92
Vgl. E. Weniger, a. a. O. 127 f.
klärung in jedem jungen Theologenleben, gegen die Sitte anzugehen, um das Persönliche zu wecken und zu stärken. Heute denken wir anders." 2 Der Erziehungsbegrifi hilft die Spannung auflösen. Die Bindung an Sitte und Brauchtum wird zunächst im Widerspruch zur Autonomieforderung als Hilfe für den einzelnen, sich persönlich zu entwickeln, verstanden. So interpretiert ist die Sitte Mittel zum Zweck; sie ist mit dem Zweck nicht identisch, es besteht aber auch kein Widerspruch zum Zweck. Audi die Spannung zwischen dem „johanneischen" und dem volkskirchlichen Kirchenbegriff wird pädagogisch ausgeglichen. Ethische Aristokratie ist das Ziel, der Zweck, die Volkskirche das demokratische Mittel. Problematischer ist, daß F. Niebergall auf der Suche nach wirksamen Erziehungskräften diese gerade in den volkstümlichen Gemeinschaften auf dem Dorf findet, also in gesellschaftlichen Formen, die im Schwinden begriffen sind. Sie haben die Entwicklung — in der doch Gottes Wille zum Ausdruck kommt! — gegen sich. Er behauptet zwar, daß man gegenwärtig, des Individuellen müde, nach Pflege der Gemeinschaft und durch Gemeinschaft verlangt, aber er fragt hier nicht wie sonst nach den realen Verwirklichungsmöglichkeiten. Der Vertreter der „modernen" Theologie verrät hier eine doch recht konservative Vorliebe für unmoderne soziologische Strukturen, deren Schwinden freilich damals nicht so deutlich sichtbar war wie heute 3 . Die konfessionelle Gespaltenheit Deutschlands beeinträchtigt den Gedanken an eine Kirche des Volkes, weshalb dann in der „völkischen" Bewegung der Gedanke an eine überkonfessionelle Staatskirche auftauchen konnte. Die eben aufgezählten Unebenheiten werden von F. Niebergall wohl gesehen, aber nicht als Schwierigkeit empfunden. Anders verhält es sich mit seiner Stellung zur dialektischen Theologie. „Es ist mit einem Wort die geistige Lage nach dem Krieg, aus der sie (seil, die Theologie der Krise) hervorgegangen ist, um deswillen sie vielen auch noch als eine Erscheinung der Kriegs- und Nachkriegspsychose gilt." 4 Mit diesen Worten beginnt F. Niebergall seine Darstellung in dem Buch „Im Kampf um den Geist" (1927). Er betrachtet die fremde Erscheinung historisch-psychologisch und versucht so, sie von ihren nicht-theologischen Hintergründen her zu erklären. In der dialektischen Theologie mit ihrer Gegenüberstellung von Gottes Offenbarung und menschlichem Tun schlägt das Pendel der Geschichte wieder einmal auf die Seite der Orthodoxie zurück 5 . Das so oft zitierte Die Dorfkirchenarbeit und das Alte Testament 64 Vgl. dazu die grundsätzliche Kritik am Gedanken der Religion als Gemeinschaft bei J . Moltmann, Perspektiven der Theologie, 1968, 217—219. 4 Im K a m p f um den Geist 130 f. 5 „Wir können auf unserm Boden von einem Wechsel zwischen typischem Orthodoxismus und Rationalismus sprechen." MPTh 25, 1929, 13. 2 3
93
Gesetz des Rückschlags vermag alles zu erklären. Die so angrifislustige Theologie mit ihrer Bestreitung der Religionspsychologie muß gerade dadurch die Richtigkeit psychologischer Erkenntnisse bestätigen. F. Niebergall weiß um die Problematik psychologischer Betrachtungsweisen. Er sieht in der Psychologie ein unabwendbares Verhängnis. Sie ist eine Zeiterscheinung, der man sich, wenn auch mit Unbehagen, fügen muß e . Die Psychologie gefährdet die Unmittelbarkeit des Glaubens. Hier zeigt sich, daß sie über eine Konstatierung und gleichzeitige Relativierung des Gegensatzes nicht hinausführt. Sie ermöglicht es, die gegnerische Meinung der eigenen Sicht der Dinge einzuordnen, ohne auf deren Argumente eingehen zu müssen. Es kommt daher zwischen den Gegnern gar nicht zum Treffen. Ähnlich verhält es sich mit F. Niebergalls Versuch, die dialektische Theologie religionstypologisch einzuordnen. Zunächst bringt er sie mit der Orthodoxie in Zusammenhang 7 , dann aber auch mit der Reformation: „Eine starke und wuchtige prophetische Verkündigung schärft unserem Geschlecht wieder die reformatorischen Grunderkenntnisse ein: Gottes Erhabenheit über alles Menschentum, unsere Verlorenheit, Gottes Gericht, Gottes Vergebung und unser Heil." 8 Freilich wird dabei einseitig interpretiert 9 . Weil das göttliche Gericht so betont wird, kann man die dialektischen Theologen auch mit dem Bußprediger Johannes oder mit dem büßenden Klosterbruder Luther — also mit Vorläufern — vergleichen 10 . Es gehört zu den Eigenarten der Theologie F. Niebergalls, daß er häufig theologische Phänomene mit solchen aus der Religions- und Kirchengeschichte vergleicht, sie zu einem Typ zusamenfaßt, um dann das Urteil vom einen aufs andere zu übertragen. Hier zeigt sich, daß es ihm schwer fällt, die fremde Erscheinung schon bekannten Phänomenen zuzuordnen. Darum muß auch das Urteil unsicher werden. Moralische Bedenken werden besonders gegenüber den begeisterten Anhängern unter den Studenten geltend gemacht 11 , aber nicht allzu ernst 6 „ . . . wir haben auch noch von dem Baum der psychologischen Erkenntnis gegessen, so daß wir sehen, wie nackt wir sind und das Paradies der Unmittelbarkeit verlassen müssen." PT I, 434. 7 „Die Neuorthodoxie von Barth und Thurneysen, München 1924, in der Sammlung Komm, Sdiöpfer Geist! zeigt wieder eine ganz besondere Füllung jener homiletischen Grundkategorien." Christliche Jugend- und Volkserziehung 141. 8 Im Kampf um den Geist 134. 9 „Es ist v o r allem der Luther v o r der Erkenntis der göttlichen Gnade und der Paulus der dualistischen Erfassung von Gott, worauf der Nachdruck fällt, wenn auch die andere Seite nicht ganz verschwindet." Im Kampf um den Geist 133. 1 0 „Dann hat Johannes der Täufer seine Pflidit als Morgenstern erfüllt, und auf den Luther im Kloster folgt der Luther der Freiheit eines Christenmenschen." Ebd. 136. 1 1 Die Systematische Theologie und die Philosophie liefern die Studenten dem abstrakten Denken aus. „Und die dialektische Theologie fügt diesem Obelstand noch den andern hinzu, daß sie ihre Jünger mit der Einbildung erfüllt, die allein richtige Wahrheit in der allein richtigen Form zu besitzen." Die neuen Wege kirchlicher Arbeit 46.
94
genommen. Er spricht von „der menschlich berechtigten Undankbarkeit der gegenwärtigen Generation" 1 2 . Während A. Jülicher in seiner Besprechung des Römerbriefs von K . Barth seine Entrüstung äußert 13 , kann F. Niebergall die „Einbildung" der dialektischen Theologen auch als erfrischende Einseitigkeit deuten, die zugleich Beschränkung und Kraft bedeutet. Einseitigkeit, Kritik und Kraft sind aber audi Merkmale des Prophetischen (vgl. oben Anm. 8). Das theologische Urteil lautet: Die dialektische Theologie predigt nicht Evangelium, sondern Gesetz. „Es ist Dysangelium, was da verkündigt wird, aus den finsteren Schatten der Nachkriegszeit geboren, das N . T . durch ein melancholisches Temperament gesehen." 14 Und: „Wer aber das Christentum auf den Anspruch Gottes beschränkt, denkt gesetzlich und hat gar nichts vom Evangelium verstanden." 1 5 Nimmt man die dem Urteil zu Grunde liegenden theologischen Kategorien Gesetz und Evangelium ernst, dann ist das Urteil vernichtend und der Satz verständlich: „Man kann nur hoffen, daß diese düstere Botschaft mit der Nachkriegszeit verschwinde." 16 Das Urteil kann aber auch ganz anders lauten: „Die heftige und gewaltsame Art der neuen Botschaft beweist, daß sie nicht bloß geschichtlich notwendig, sondern wirklich ein Wort von Gott an unsere Zeit ist." 17 Entscheidend ist aber, daß F. Niebergall dieses zwiespältige Urteil nicht als Widerspruch auffaßt. Die Gegensätze werden durch den Erziehungsgedanken ausgeglichen. Als Warnung vor der bisherigen Einseitigkeit ist die neue Einseitigkeit ein wichtiger Impuls, der pädagogisch durchaus seinen Sinn hat, aber nach Erfüllung dieser Aufgabe möglichst bald wieder verschwinden soll. Auch hier bleibt es wieder bei der Konstatierung und Relativierung des Gegensatzes 18 . Die schon im Zusammenhang mit der Bekenntnisfrage gemachte Beobachtung (vgl. oben S.86), daß F. Niebergall durch seine pädagogische Betrachtungsweise einen gegnerischen Standpunkt als Mittel zu einem Zweck oder als Durchgangsstadium stets respektieren, aber letztlich nicht ernst nehmen und darum auch den eigenen Standpunkt nicht eigentlich verantworten kann, findet hier erneut eine Bestätigung. Die Versuche, die neue theologische Richtung mit psychologischen und pädagogischen Kategorien in die eigene Sicht der Dinge D i e moderne Predigt, 1929, 1. „ . . . idi wünsche dem Buche B a r t h s viele Leser, die jenes anspruchsvolle V o r w o r t einstweilen überschlagen — " A . Jülicher, E i n moderner Paulusausleger, C h W 34, 1920, 454. 1 4 D i e neuen Wege kirchlicher Arbeit 32 f. 1 5 D a s Gesangbuch als kirchliches Bekenntnis 39. 1 9 I m K a m p f um den Geist 134 f. 17 E b d . 135. 1 8 „Wenn der düstere Pessimismus seine Schuldigkeit getan hat, uns inwendig von der Welt u n d der K u l t u r freizumachen u n d gering v o n unserem Glück und unserer T u g e n d zu denken, d a n n w i r d die B a h n f ü r einen höheren Optimismus f r e i . . . " Im K a m p f um den Geist 136. 12
13
95
einzuordnen, haben dies gemeinsam, daß sie von vornherein an einer Auseinandersetzung mit dem Gegner vorbeiführen. Es wird hier im Zusammenhang der immanenten Kritik auf diese Schwierigkeiten aufmerksam gemacht, weil F. Niebergall im Blick auf die Psychologie selbst nicht ohne Bedenken ist. Darüber hinaus ist zu fragen, ob er die Intentionen der dialektischen Theologie in seiner Kritik richtig darstellt. Dies ist nach dem Bisherigen kaum zu erwarten, zumal er seinen Ausführungen bewußt nicht Schriften der „Autoritäten" zu Grunde legt, sondern einen Durchschnitt zeichnen will. „Es soll gleichsam ein Niederschlag der dialektischen Theologie sein, wie man ihn heute bei vielen jungen und älteren Theologen vorfinden kann." 1 9 Es sollen drei Äußerungen F. Niebergalls daraufhin untersucht werden, ob sie die dialektische Theologie wirklich treffen. „Der ferne, rätselhafte Gott, die Fragwürdigkeit alles Menschlichen —, das hört man zumeist bloß heraus; der vergebende und gnädige Gott kommt zu selten dagegen auf. Darum hat die Frage ein Recht: Was habe ich von einem solchen Gott, was von einer Offenbarung, die nichts offenbart." 20 Für F. Niebergall sind also Gericht und Fragwürdigkeit des Menschen einerseits sowie Gnade und Barmherzigkeit Gottes andererseits zwar aufeinander bezogen, aber so, daß sie einander ablösen: auf Gericht und Demütigung erfolgt Gnade und Beseligung, psychologisch verstanden als Wechsel von Unlust zu Lust. Die dialektische Betonung des Gerichts kann er nur als einen Versuch verstehen, einseitig Gottes Ehre auf Kosten der Menschen hervorzuheben. K. Barth ζ. B. versteht aber das Verhältnis von Gericht und Gnade dialektisch, d. h. gerade nicht als ein zeitliches Nacheinander. „Unsere Bedrängnis ist unsre Verheißung." 21 „Denn das allein, aber wohlgemerkt: als Gottes Wort, ist die Antwort, die echte Transzendenz besitzt und gerade darum die Kraft hat, das Rätsel der Immanenz aufzulösen. Denn nicht in einer Beseitigung der Frage darf diese Antwort bestehen, aber auch nicht bloß in einer Unterstreichung und Verschärfung der Frage, und endlich auch nicht in der kühnen, aber in unserm Munde abwechselnd allzu eindeutigen oder allzu zweideutigen Behauptung, daß die Frage selber die Antwort sei. Nein, die Antwort muß eben die Frage sein und so die Erfüllung der Verheißung, das Sattwerden der Hungrigen, die Eröffnung der blinden Augen und der tauben Ohren." 2 2 Weil F. Niebergall den dialektischen Charakter dieser Aussagen nicht beachtet, bemerkt er auch nicht, daß hier mit der Frage nach „echter Transzendenz" sein Grundproblem, die Anfechtung durch den Verdacht des Illusionismus, verhandelt wird, und daß hier eine Lösung angeboten wird, 19 21 22
96
2 0 Im Kampf um den Geist 134. MPTh 25, 1929, 15. K . Barth, Das Wort Gottes als Aufgabe der Theologie, ThB 17, I, 217. Ebd. 207.
die mit der seinen ernsthaft konkurrieren kann. Er übersieht, daß die theologischen Aussagen über Gott als den ganz anderen und über seine Alleinwirksamkeit eine anthropologische Spitze haben. Es geht keineswegs um eine Offenbarung, „die nichts offenbart". „Und wenn wir nun vielleicht fragen möchten: was wir denn nun tun sollen, so wäre darauf zu antworten, daß vielleicht gerade diese Frage müßte sterben können. Denn solange wir noch so fragen, zeigen wir eigentlich, daß die Sehnsucht nach dem Feuer Jesu, nach der Erlösung, nach der Auferstehung, noch nicht ganz groß ist in uns." 2 3 Daß die Verweigerung einer konkreten Antwort dialektisch gerade die eigentlich konkrete Antwort darstellt, wird nicht zur Kenntnis genommen. Neben der Anfechtung durch den Illusionismusverdacht bedeutet die Psychologisierung der Aussagen über Sünde und Vergebung für F. Niebergall eine Schwierigkeit. Die damit verbundene Einschränkung der Offenbarung auf die Empfänglichen und die Beschränkung des Heilandsrufs auf die Schuldbewußten muß Skrupulanten an ihrer Empfänglichkeit oder an ihrer Verstrickung in Reflexion verzweifeln lassen. Sie erlaubt dem Predigthörer, sich der Botschaft mit der Entschuldigung zu entziehen, daß es bei ihm an der religiösen Voraussetzung und Begabung fehle. F. Niebergall sieht nicht, daß die dialektische Predigt gerade mit dieser Schwierigkeit fertig werden will. In einer Predigt über Mt.l 1, 28 in BarthThurneysens „Komm Schöpfer Geist" (1924 2 ) wird versucht, diese Auswege zu verstellen. Hier wird geltend gemacht, daß Jesu Einladung im Unterschied zu allen menschlichen Einladungen nicht auf die Kreise der Empfänglichen beschränkt ist, keinerlei Voraussetzungen macht und daß gerade die Bestreitung des Wertes von menschlichen Qualitäten das lösende Wort ist 2 4 . Weil F. Niebergall verkennt, daß das Heil des Menschen dialektisch in die theozentrische Theologie einbezogen ist, trifft sein Vorwurf den Gegner nicht. Er charakterisiert die neue „Modetheologie" ferner so: „Es ist Dysangelium, was da verkündigt wird, aus den finsteren Schatten der Nachkriegszeit geboren, das N.T. durch ein melancholisches Temperament gesehen. Um dem Anthropozentrismus zu entgehen, läßt man den Menschen weg, und um nicht in Weichheit zu verfallen, leugnet man die Barmherzigkeit; man will dem Moralismus entgehen, indem man behauptet, das Evangelium habe nichts mit der sittlichen Haltung des Menschen zu tun; um nicht des Psychologismus geziehen zu werden, flieht man die Psychologie. Um Gott ja nicht zu vermenschlichen, macht man ihn zu einem Rätsel, wenn nicht zu einem Unmenschen." 25 Als Darstellung der dialektischen Theologie sind diese Sätze objektiv falsch, weil sie die Dialektik 23 24 25
K. Barth / E. Thurneysen, Komm, Schöpfer Geist!, 1924 2 , 114. Ebd. 65 ff. Die neuen Wege kirdilidier Arbeit 32 f.
97
nicht festhalten 26 . F. Niebergalls Aussagen wollen aber nicht nur darstellen, sondern zugleich kritisieren. Wir stellen daneben eine Aussage von K. Barth: „Schützen wir nicht zu schnell die Liebe vor! Da fragt sich eben, was die Liebe ist, die wir den andern schuldig sind? Es könnte sein, daß wir unbarmherzig sind, solange wir meinen, damit barmherzig zu sein, daß wir den Menschen existieren helfen, und wenn Tausende uns für unsre Gaben dankten. Nicht ihre Existenz, sondern das Jenseits ihrer Existenz, Gottes Existenz steht in Frage, wenn sie uns um unsre Hilfe angehen." 27 Es geht um Solidarität mit der Situation, in der sich der Mensch als Mensch befindet. „Der Mensch in seiner Menschlichkeit, die als solche Beschränktheit, Endlichkeit, Kreatürlichkeit, Getrenntheit von Gott bedeutet, ob er sich dessen nun mehr oder weniger bewußt sei." 28 Die grundsätzliche Gegenüberstellung von Zeit und Ewigkeit, Gott und Mensch, sowie die Abwehr des Gedankens, die Nächstenliebe hätte eben die Wünsche des andern zu erfüllen, weisen auf einen direkten oder indirekten Einfluß Kierkegaards 29 , dessen Kritik an der Kirche F. Niebergall als seinerzeit berechtigtes prophetisches Korrektiv deutet und damit in ähnlicher Weise relativiert wie die dialektische Theologie 30 . Lostrups „Auseinandersetzung mit Kierkegaard" (1968) zeigt, daß F. Niebergall hier wirklich auf einen schwachen Punkt hinweist. Im Unterschied zu Legstrup fehlt bei ihm jedoch ein sachgemäßes Verstehen der gegnerischen Position, die er nicht zutreffend darzustellen vermag. Denen, die es mit der neuen Theologie einmal versuchen wollen, kündigt F. Niebergall an: „Sie werden bald merken, daß man Gott nur ohne davon zu wissen und ohne es zu wollen, in seinem ganzen Wesen vergegenwärtigen kann, daß man sich als Aufgabe nur setzen darf ein Wort von ihm zu sagen, um Menschen auf seine Wege zu verhelfen." 31 Er übt hier 20 Vgl. oben S. 97, Anm. 23 und Barth/Thurneysen, Komm, Schöpfer Geist 122: „Er (seil. Jesus) hat das Gute und Edle an den Guten wohl gesehen und hat es nicht gering geachtet. Aber er hat zugleich gesehen, wie auch bei ihnen hinter all ihrem Guten noch ganz ungebrochen jene letzte Widerstandslinie sich erhebt, die es immer wieder verhindert, daß das Gute in ihrem Leben jemals gänzlich siege." 27 28 ThB 17, I, 201. Ebd. 29 Vgl. dazu Κ. E. Logstrup, Auseinandersetzung mit Kierkegaard, 92 f.: „Eine Liebe, die darin besteht, die zeitlichen Wünsche eines anderen Menschen zu erfüllen, hat nichts mit wahrer Nächstenliebe zu tun. Bereits mit dieser Bestimmung befindet sich Kierkegaard im Widerspruch zu Jesu Verkündigung." (Es folgt ein Hinweis auf den barmherzigen Samariter.) „Man könnte fast sagen, daß Kierkegaard fürchtet, die Liebe, unvermittelt stehen gelassen, werde zur Schmeichelei, Unterwürfigkeit und Gefälligkeit, und läuft deshalb lieber Gefahr, sie in Anmaßung und Übergriffen unvermittelt hervortreten zu lassen." Ebd. 107. Die Kritik F. Niebergalls, die die eigentliche Intention der dialektischen Theologie nicht wahrnimmt, findet hier durch ein differenziertes und in sdiarfen Analysen begründetes Urteil eine gewisse Bestätigung. 30 Vgl. PT I, 236 f. 31 Die neuen Wege kirchlicher Arbeit 33 f.
98
Kritik an Κ. Fezers Definition der Predigtauf gäbe: „Die Predigt ist das Bemühen eines Menschen, durch freie Rede dazu mitzuwirken, daß der im Schriftwort uns seine Gemeinschaft schenkende Gott einem Kreis von anderen Menschen gemeinsam durch den Hl. Geist gegenwärtig werde." 32 Die Kritik richtet sich indirekt auch gegen K. Barths These: „Wir sollen als Theologen von Gott reden." 38 Aber bezeichnenderweise übersieht F. Niebergall wiederum die Dialektik, mit der K. Barth fortfährt: „Wir sind aber Menschen und können als solche nicht von Gott reden. Wir sollen Beides, unser Sollen und unser Nicht-Können, wissen und eben damit Gott die Ehre geben. Das ist unsre Bedrängnis." 34 F. Niebergalls Darstellung bringt nicht zum Ausdruck, daß der dialektische Prediger um die Last seiner Aufgabe weiß, sie nur eben für unvermeidlich, weil in der Sache begründet, hält. Auf beiden Seiten wird der Gedanke abgelehnt, man könne durch planmäßige Einwirkung Glauben schaffen oder machen. Aber während F. Niebergall folgert, daß das Eigentliche im Geschehen der Predigt und des Hörens ein unbewußtes, d. h. unreflektiertes Wirken ist, wird auf der andern Seite die Lösung in einer potenzierten, dialektischen Reflexion gesucht35. Dem entspricht, daß die dialektische Predigt zwar nicht den Glauben, aber dodi die Entscheidung zwischen Glauben und Unglauben erzwingen will. Die Verkündigung des Wortes schafft die Situation der Entscheidung, während bei F. Niebergall die Predigt nur pädagogisch auf die künftigen Entscheidungssituationen vorbereitet. Die Konsequenz —, die er aber nicht zieht —, ist, daß dabei das Wirken des Geistes nicht mehr ans verbum als vehiculum gebunden ist. Es hat sich gezeigt, daß F. Niebergall das Verständnis der theologischen Aufgabe in der dialektischen Theologie nicht zutreffend wiedergibt und daß er pädagogisch relativierend Stellung nimmt. Beides, die theologische Kritik und die historisch-psychologische Einordnung der dialektischen 32
Das Wort Gottes und die Predigt, 1925, 77. K. Barth nennt diese Formulierung einen entscheidenden Fortschritt. Vgl. Homiletik, 1966, 24. F. Niebergall urteilt: „Wo aber die Predigt nodi etwas gilt, da wird sie in den Ausdrücken überstiegener Frömmigkeit, die jetzt Mode sind, in ihrem Wesen zu erfassen gesucht. Der Prediger soll an Gottes Stelle dastehen und das Wort Gottes als solcher seiner Gemeinde sagen . . . Abgesehen davon, daß die Last in jener Weise vor die Gemeinde zu treten viel zu schwer wäre." Die Dorfkirdienarbeit und das Alte Testament 31 f. 33 34 ThB 17, I, 199. Ebd. 35 Die dialektische Theologie steht hier unter dem Einfluß von Kierkegaard, besonders dessen Ausführungen über die indirekte Mitteilung. Κ. E. Legstrup sagt dazu: „Der Empfänger entscheidet nicht selber, ob er der Einzelne in der ethischen Existenz sein will, denn das hat der Mitteilende bereits für ihn dadurch entschieden, daß er ihn durch die Indirektheit der Mitteilung — mit Kierkegaards Ausdruck — ¡abgestoßen' hat. Der Mitteilende überläßt es nicht dem Wort, daß es durch sich selbst wirke, sondern will ihm mithilfe eines Kunstgriffs zu einer ganz bestimmten Wirkung verhelfen." Auseinandersetzung mit Kierkegaard 184.
99
Theologie wird nun noch einmal relativiert durch die Anwendung eines letzten Kriteriums. „Es ist, wie es scheint, die Zeit gekommen, um die sog. dialektischen Theologie auf ihre Brauchbarkeit in der Praxis hin zu prüfen." 8 6 F. Niebergall bezieht sich auf Äußerungen von Anhängern der dialektischen Theologie, wonach sie mit der neuen Lehre in der Gemeindearbeit und im Jugendunterricht scheiterten, um entweder reumütig auf die alten „modernen" Wege zurückzulenken oder die Frage nach dem Erfolg als unsachgemäß abzulehnen. Er kann sich die Vielschichtigkeit und Unbestimmtheit der Begriffe „praktisch" und „Praxis" zunutze machen. Bedeutet „praktisch" sonst den Bereich des Existentiellen oder — enger — des Sittlichen, so wird hier mit diesem Ausdruck einfach die Brauchbarkeit und der Erfolg als oberstes Kriterium eingeführt. Wollte man demgegenüber — etwa unter Berufung auf 1. Kor. 1, 18 ff. — gerade die Erfolglosigkeit zum Kriterium der theologischen Arbeit machen, so wäre in beiden Fällen übersehen, daß damit die Frage nur verschoben ist. Es müßte ja nun genauer bestimmt werden, was als Erfolg oder als Mißerfolg zu gelten hat. F. Niebergall spricht etwas vage von „Anschluß finden"37 und sieht in der Mißachtung der Praxis den Hauptfehler der dialektischen Theologie. „Die Probe einer jeden Theologie ist die Praxis. Die Theologie der Krisis wird an der Praxis ihre Krisis finden. Sie wird daran scheitern oder sie wird sich wandeln." 3 8 In dem Augenblick, in dem F. Niebergall das „Praktische" zum letzten Kriterium und zur Grundlage der Kritik an der dialektischen Theologie macht, gibt er den theologischen Inhalt des Begriffs, der für J . Kaftan und weitgehend auch für ihn eine wesentliche Bedeutung hat, preis und begnügt sich mit der vordergründigen Bedeutung von „Brauchbarkeit". Es hat sich gezeigt, daß er mit seinem Verständnis des christlichen Glaubens an verschiedenen Stellen in Schwierigkeiten gerät. Der seinem Ursprung nach aristokratische Begriff der Persönlichkeit läßt sich in die Idee der Volkserziehung nicht glatt einfügen. Der Gedanke der volkstümlichen Gemeinschaften als Korrektiv setzt gesellschaftliche Strukturen voraus, die nicht als „modern" gelten können. Die pädagogisch-psychologische Betrachtungsweise verhindert eine wirkliche Auseinandersetzung mit der dialektischen Theologie. Die ursprünglich theologische Bedeutung von „praktisch" wird im entscheidenden Augenblick fallen gelassen. M P T h 25, 1929, 13. 37
„ D a s macht den A n h ä n g e r n der
neuen Lehre gar
nichts
aus, d a ß
sie
in der
Gemeinde, d a ß sie in der g a n z e n G e g e n w a r t gar keinen Anschluß finden, w a s doch einm a l f ü r uns eine so wichtige F r a g e gewesen ist." E b d . 17. 38
100
E b d . 18.
3. Existentielle und pädagogische Interpretation des christlichen Glaubens als radikale Lösung und als Kompromißlösung Unter dem Einfluß der dialektischen Theologie ist es üblich geworden, eine theologische Funktion des Erziehungsbegriiis zu bestreiten. Erst wenn Grund und Wesen des Glaubens herausgearbeitet sind und wenn deutlich ist, daß er Antwort ist auf die Anrede durch das Wort Gottes, darf weitergefragt werden nach seinem Verhältnis zum Handeln in weltlichen Bereichen, zu denen u. a. auch die Erziehung gehört 89 . Es soll daher zunächst die systematisch-theologische Begründung dieser Ausklammerung des Erziehungsbegriffs aus der Glaubenslehre überprüft werden. Danach soll gefragt werden, ob F. Niebergalls Interpretation des christlichen Glaubens verständlich werden kann als Antwort auf Fragen, die seiner Zeit unausweichlich gestellt waren. Eine Auseinandersetzung mit der umfangreichen Literatur zum Thema „Glaube und Erziehung" würde eine besondere Untersuchung erforderlich machen. Die Prüfung der Frage, ob der Erziehungsbegriff für die Interpretation des Glaubens tauglich ist, soll exemplarisch in einer Auseinandersetzung mit R. Bultmann erfolgen, da seine Interpretation des Glaubens als Existenzverständnis sich z. T. mit J. Kaftans und F. Niebergalls Verständnis des Glaubens als einer praktisch-existentiellen Angelegenheit des menschlichen Geistes berührt und ihr zugleich widerspricht. In seinem Aufsatz „Erziehung und christlicher Glaube" begründet R. Bultmann seine Behauptung, „es gäbe keine christliche Erziehung" 40 . Er sieht die Erziehung im Zusammenhang mit der griechischen und im Gegenüber zur biblischen Ethik und definiert: „Erziehung ist also die methodische Entwicklung der Vernunft, des rationalen Vermögens des Menschen." 41 Auch wenn Erziehung als Übung des Willens neben der Schulung des Denkens verstanden wird, behält sie den Charakter des Methodischen und Rationalen. Erziehung zum Glauben bedeutet für ihn den Versuch, den Glauben auf die Vernunft zu gründen und als Ergebnis einer methodischen Entwicklung zu planen. Dieser Versuch ist unsachgemäß, weil der Glaube ein Akt des Willens 42 , ein Entschluß, Antwort ist auf das Wort Gottes. Der Mensch kann aber dem Wort Gottes nur gehorsam sein, wenn es verstanden werden kann. „Es bedarf dazu nicht der ,Erziehung', wohl aber des ,Unterrichts in der christlichen Religion'." 43 R. Bultmann verdeutlicht also seine Auffassung mit Hilfe der Unterscheidung von Erziehung und Unterricht, setzt dabei aber die Akzente anders als F. Niebergall. „Der Unter39 Vgl. oben S. 17, A n m . 2 2 und W.Loch: „Es ist die strenge methodische Voraussetzung unserer Fragestellung, den Unterschied zwischen Verkündigen und Erziehen unbedingt zu respektieren." H . D i e m / W . Loch, Erziehung durch Verkündigung, 1959, 35. 40 41 G V IV, 52—55. G V IV, 52. 42 43 Vgl. ebd. 53 . G V IV, 54.
101
rieht besteht nicht in der methodischen Entwicklung des vernünftigen Vermögens des Menschen, sondern ist in gewisser (paradoxer) Weise dessen Negation. Denn in seinem eigentlichen Sinne ist dieser ,Unterricht' direkter Appell, selbst wenn er der Form nach ein indirekter Appell ist, — ein Appell, der das menschliche Fragen, den Menschen als Frage erweckt, der ihm die Antwort anträgt und Glauben fordert, indem er Glauben anbietet. Das Ende ist nicht eine theoretische Erkenntnis, sondern es ist ein Akt der Entscheidung, ein Akt des Gehorsams." 44 Nach F. Niebergall bezieht sich gerade die Erziehung, nicht der Unterricht, auf den Bereich des Praktisch-Existentiellen, während es im Unterricht um theoretische Erkenntnis und methodische Entwicklung der Rationalität geht. Der Gegensatz scheint auf einem Austausch der Bedeutung von „Erziehung" und „Unterricht" zu beruhen. Es bestätigt sich, daß R. Bultmanns Erziehungsbegriff, der an der griechischen Ethik orientiert ist, allenfalls Lessing, aber nicht J . Kaftan und F. Niebergall trifft. „Unterricht" bei R. Bultmann und „Erziehung" bei F. Niebergall haben praktischen Charakter, d. h. Anredecharakter. Durch diese Feststellung sollen bestehende Unterschiede nicht verwischt werden. Sie werden deutlich, wenn gefragt wird, worin bei R. Bultmann die Notwendigkeit eines Unterrichts in der christlichen Religion begründet ist. Das Wort Gottes fordert nicht nur die Antwort des Glaubens, es ist selbst Antwort auf die Fragen des Menschen. „Denn jeder Mensch ist voll von Fragen, ja, im Grunde von einer Frage; ja mehr: der Mensch ist Frage, bewußt oder unbewußt." 45 Das Verstehen des Wortes Gottes setzt daher voraus: „Der Mensch muß dahin gelangen, daß er sich auf sich selbst besinnt, daß er sich fragt, was menschliches, was sein Sein ist. Er muß lernen, seine eigenen Fragen zu verstehen, gewahr zu werden, wonach er eigentlich verlangt, was Wahrheit, was Wirklichkeit, was echte Existenz bedeutet." 48 Die Differenz des ontologischen und des on tischen Sachverhalts macht den Unterricht erforderlich. Dieser bringt daher nichts Neues, sondern bewirkt nur, daß der Mensch dessen gewahr wird, was schon ist, nämlich seine Fraglichkeit und sein Versuch, sie zu verleugnen. Versäumt er es zu lernen, dann bleibt es doch wahr, daß er Frage ist und daß er seine Existenz verfehlt, wenn er dies nicht wahrhaben will. F. Niebergall dagegen sieht den nicht unterrichteten und nicht erzogenen Menschen in einem neutralen Naturzustand, seine Unwissenheit ist Mangel, nicht Schuld. Dem entspricht, daß nach ihm die Deutung des Lebens als Geschenk die Erziehung — fast als ein donum superadditum — krönt. Weil der Geschenkcharakter nicht zum Dasein als solchem gehört, kann er nicht von jedermann — wie die sittliche Forderung —, sondern nur von denen wahrgenommen werden, die das „Auge des Glaubens" besitzen. Ebd. 54 f. « Ebd.
44 4
102
45
Ebd. 54.
Wieder ist für ihn nur ein Mangel, was für Logstrup eine Verfehlung ist, die lebenzerstörende Folgen hat 47 . Versucht man dies in die Sprache der Wertlehre zu übersetzen, was im Blick auf R. Bultmann natürlich eine Verzerrung darstellt, dann könnte man sagen: während es für R. Bultmann darum geht, schon vorhandene „Werte" wahrzunehmen, möchte F. Niebergall durch Erziehung bewirken, daß das Subjekt schon vorhandenen Dingen Wert verleiht. Die Erziehung erhält für ihn — gerade weil sie nicht auf methodische Entwicklung zielt — ein schöpferisches Element. Wird dabei das Ergebnis der Erziehung als Besitz verstanden? Manches weist in diese Richtung, so ζ. B. daß F. Niebergall Erziehung als Gewöhnung verstehen kann, die schließlich zu einer Art habitus führt. Damit verbindet er den Gedanken an Wachstum, Reifen und Kontinuität. Es ist nicht zu bestreiten, daß die Einbeziehung eines schöpferischen Elementes in den Erziehungsbegriff und im Zusammenhang damit die von J. Kaftan übernommene Unterscheidung von Sünde und Schuld sowie die Sachkritik an der traditionellen Lehre von Urständ und Fall eine Fehlinterpretation des Glaubens darstellt. Ist damit auch der Gedanke an Reifung und Kontinuität als falsch erwiesen? Die Frage müßte bejaht werden, wenn das Wachstum in der Erziehung durch methodische Einwirkung bewerkstelligt werden könnte. Das ist aber nicht der Fall. Die Erziehung zielt auf das Irrationale und kann nicht rational geplant werden. Wenn R. Bultmann sagt, man müsse „dahin gelangen", „lernen", „gewahr werden", dann bleibt zumindest offen, ob dies alles allmählich reifend oder plötzlich geschieht. Wenn F. Niebergall meint, daß gutes Handeln durch Wiederholung zur Gewohnheit werden kann, so ist dieses Wiederholen an Gelegenheiten und Situationen gebunden, die der Erzieher nicht machen kann. Man kann sittliches Handeln nicht üben wie Schwimmen oder Klavierspielen. Der Gedanke an Wachstum und Stetigkeit in der Erziehung muß nicht notwendig mit dem an eine rationale methodische Entwicklung verbunden sein. Es ist zu fragen, ob das Verstehenlernen des menschlichen Daseins als Frage, einschließlich der Erkenntnis, daß das bisherige Nichtverstehen ein Verfehlen der Existenz bedeutet, sich anders als allmählich wachsend vollziehen kann. Dies wird durch M. Stallmann bestätigt, wenn er Bultmanns Gedanken, daß der Glaube, weil er verstehen will, auf Unterricht angewiesen ist, weiterführt. „Solcher Unterricht wiederum setzt freilich voraus, daß der Mensch im 4 7 „Sie (seil. Forderung und Glaube) implizieren beide Wirklichkeiten, die von vornherein gegeben sind, ohne dabei verfügbar zu sein . . . Konsequent verstanden bedeutet das Vorgegebensein dieser Realitäten gerade, daß wir sie nicht uns selber verdanken, sondern daß sie geschaffen und uns geschenkt sind." K. E. Logstrup, Auseinandersetzung mit Kierkegaard 2 3 0 f. „Das Gute gibt es in unserem Dasein — nämlich dort, wo es vom Bösen zerstört wird. In unserem Leben ist das Gute immer da; denn gäbe es das Gute nicht, hätte unsere Schlechtigkeit nicht den Charakter der Lebenszerstörung." Ebd. 25 f.
103
Umgang mit sich selbst schon Erfahrungen gemacht hat, daß der Mensch also in der Erz. schon nach sich selbst gefragt i s t . . . Wenn der christl. Unterr. insofern Erz. voraussetzt, so sollte doch er selbst nicht als Erz. bezeichnet werden. Denn er führt nicht schritt- oder stufenweise zum Ziel des Glaubens, sondern will ein Wissen vermitteln, aber dieses Wissen ist es nicht, das die Tür zum Glauben aufstößt." 4 8 Wenn R . Bultmann und F. Gogarten den personalen Charakter des Glaubens am Beispiel von Liebe und Freundschaft verdeutlichen, dann reflektieren sie nicht darüber, daß diese Analogien keine ideae innatae darstellen, sondern nur auf Grund entsprechender Erfahrungen verstanden werden können. Diese Erfahrungen resultieren aber aus einem Geschehen, das von J . Kaftan und F. Niebergall als Erziehungsvorgang bezeichnet würde. Auch sie wissen, daß dadurch die Tür zum Glauben nicht aufgestoßen werden kann. Die Differenz zwischen den „modernen" und den „dialektischen" Theologen läßt sich an den Begriffen „Erziehung" und „Unterricht" nicht deutlich ablesen, sie wird erkennbar an den Begriffen des Irrationalen und des Erlebnisses. R . Bultmann erkennt beiden Begriffen eine Funktion in der Klärung des Vorverständnisses von Offenbarung zu. Von Offenbarung kann man nur im Wissen um die Begrenztheit menschlichen Lebens reden. Der Begriff des Irrationalen kann das Rätsel des menschlichen Daseins bezeichnen; er muß aber auf diese rein negative Funktion beschränkt bleiben. „Wenn ich sehe, daß ich im Irrationalen stehe, so kann ich wieder mit Sinn nach der Offenbarung fragen; aber ich habe alles verdorben, wenn ich im Irrationalen die Offenbarung zu haben meine." 4 9 Nach R . Bultmann meint auch das Erlebnis — recht verstanden — die Grenze und das Rätsel des Daseins. Audi hier wird die Identifizierung mit der Offenbarung kritisiert. „ . . . ja hier wird im Erlebnis in der Tat etwas offenbar, aber nichts anderes als das Rätsel unseres Daseins, die Tatsache unserer Begrenztheit als das Unheimliche. Und verschleiern wir nicht gerade das, was hier offenbar wird, wenn wir dies faszinierend Unheimliche für Gott erklären?" 5 0 Daß mit diesen Aussagen eine Schwäche der Theologie F. Niebergalls getroffen wird, ist schon oben S. 30 f., 47 f. gezeigt worden. Die Unverfügbarkeit des Glaubens wird in F. Niebergalls Erziehungsbegriff gewahrt, sofern er den Gedanken, daß man Glauben „machen" könne strikt ablehnt. Radikal ist die Unverfügbarkeit aber erst verstanden, wenn deutlich ist, daß der Glaube nicht zum inneren Besitz werden kann, auf den man in der Anfechtung zurückgreifen kann. F. Niebergalls Aussagen über Gewöhnung, über das Irrationale und das Erlebnis sind gegen diese Fehlinterpretation nicht abgesichert. Durch sie soll die Unterscheidung zwischen der Reflexion über den Glauben und dem Glauben 48 49
104
M. Stallmann, Art. Erziehung und Religion, Pädagogisches Lexikon, 254. 5 0 Ebd. 14. G V III, 11.
selbst festgehalten werden und die Notwendigkeit eines Übergangs vom einen zum andern betont werden. Es ist oben S.30f. gezeigt worden, daß die Lösung dieses Problems bei R. Bultmann offen bleibt. Die Begriffe des Irrationalen und des Erlebnisses sollen bei F. Niebergall dieses Problem lösen und ihre Kritik durch R. Bultmann kann erst dann einleuchten, wenn deutlich ist, ob und inwiefern er eine bessere Lösung anzubieten hat. Die kritische Uberprüfung der Theologie F. Niebergalls in systematisch-theologischer Hinsicht ergibt: Die Verwendung des Erziehungsbegriffs, der den Bereich des Praktischen und Existentiellen bezeichnet, ist nicht zu beanstanden, auch nicht, wenn er das Moment des Wachstums enthält. Dagegen sind der Begriff des Irrationalen und der des Erlebnisses nicht gegen das Mißverständnis gesichert, der Glaube bestehe in einem zunehmenden inneren Besitz. Damit, sowie mit der Aufnahme einer idealistischen Anthropologie und der Kritik an der Lehre von Urständ und Fall befindet sich F. Niebergall im Widerspruch zum biblisch-reformatorischen Verständnis des Glaubens. Es ist nun aber weiter zu fragen, ob seiner Interpretation des christlichen Glaubens trotz ihrer Schwächen nicht eine gewisse Berechtigung zuzuerkennen ist, wenn man sie als Versuch einer Antwort versteht, durch die Probleme seiner Zeit eine Lösung finden sollen51. F. Niebergall findet diese Probleme weniger in den Auseinandersetzungen zwischen Theologieprofessoren als in den Schwierigkeiten, denen der Pfarrer in seiner praktischen Amtsführung begegnet. Solange kein begründeter Verdacht besteht, daß er diese Schwierigkeiten verzeichnet darstellt, können wir seinen Ausführungen folgen. Die Entwicklung der Geschichts- und Naturwissenschaft sowie der technische Fortschritt haben weiten Kreisen die Kluft zwischen dem biblischen und dem gegenwärtigen Weltbild zum Bewußtsein gebracht. Die landläufige orthodox-pietistische Frömmigkeit vermag der Entkirchlichung vor allem der Gebildeten nicht Einhalt zu gebieten, ja sie verstärkt die innere Distanzierung vom Christentum, indem sie das Ärgernis an der falschen Stelle errichtet. Weil auf beiden Seiten intellektualistisch gedacht wird, entsteht eine falsche Alternative, die F. Niebergall mit Hilfe der J. Kaftanschen Lehre vom praktischen Charakter des Glaubens überwinden will. Man wird kaum sagen können, daß die Aufgabe, die er hier gesehen hat, heute erledigt ist. Der existentielle Charakter des Glaubens ist aber nicht radikal verstanden, weil er nicht auf das personal verstandene Wort bezogen wird. Der Intellektualismus ist nicht wirklich überwunden, solange dem Wort nur die Mitteilung von Sachverhalten zugetraut wird. Das Wortverständnis der Reformatoren ist preisgegeben. Dieses fehlt aber auch bei den „positiven" Gegnern. Sie 51 Auch E. Käsemann kann die Legitimität einer an sich fragwürdigen Theologie damit begründen, daß sie als Versuch verantwortlichen Handelns in einer Notlage verstanden wird. Vgl. Exegetische Versuche und Besinnungen II, 1968 3 , 249.
105
haben aus der Schrift und dem Bekenntnis ein autoritatives Lehrgesetz gemacht. Diese Fehlinterpretation des christlichen Glaubens ist der Hintergrund, auf dem F. Niebergalls Theologie verständlich wird. Er kann den Gegensatz so beschreiben: „Diese auf der Erkenntnis des einzelnen wirklichen Menschen dringende Menschenkenntnis findet immer noch wenig Würdigung bei Leuten, die etwa sagen: Mensch ist Mensch und Mensch ist Sünder, ob im Staatskleid oder im Bauernkittel; diesem Menschen hat man ganz einfach das Evangelium zu verkündigen und damit ist es gut. — Aber darin spricht sich eine Ansicht aus, die ganz und gar der älteren Auffassung angehört; diese kann man dahin kennzeichnen, daß man sie mit dem innersten Geist der Reformation in Verbindung bringt. Dieser war das Wort, als Ersatz des katholischen Haupt-Gnadenmittels, nämlich des Sakramentes, eine Art von Zauberding, das absolut das Wunder der Bekehrung in einer Art von geistiger Magie wirken mußte. Diese Auffassung deckte sich mit dem viel mißbrauchten Spruch, daß Gottes Wort nicht leer zurückkommen kann, wobei ohne weiteres jedes Predigtwort mit diesem Gotteswort gleichgesetzt wurde. Wir können das Wort so hoch nicht mehr schätzen . . . Daß wir Wirkungen berechnen wollten oder könnten, davon kann keine Rede sein . . ." 5ä Er stellt also dem lehrgesetzlichen Denken nicht nur das Persönlichkeitsideal, das seiner Meinung nach der Verkündigung Jesu entspricht, entgegen, sondern fragt darüber hinaus, ob in jenem Verbalismus die Verantwortung und die Liebe nicht allzu rasch suspendiert werde. Im Erziehungsgedanken dagegen wird die Verantwortlichkeit festgehalten und ein Ideal gefordert, „das einen starken Abzug von jenem höchsten darstellt, wie ihn die Wirklichkeit erheischt" 53 . Der Glaube wird hier nicht mehr als Entscheidung zwischen Tod und Leben verstanden. Kann dies als zeitgeschichtlich notwendig und legitim verständlich gemacht werden? Die Beantwortung dieser Frage soll im Anschluß an D. Bonhoeffers Ausführungen über die letzten und vorletzten Dinge versucht werden 54 . Die Rechtfertigung des Sünders im Glauben ist nach D. Bonhoeffer ein letztes Wort. Im Glauben wird das Leben auf einen neuen Grund gestellt. Das Wort der Rechtfertigung ist zunächst qualitativ-inhaltlich ein letztes Wort. Es enthält einen vollständigen Abbruch, eine Verurteilung und Entwertung alles Bisherigen und Vorletzten. Es schließt jede Methode aus, es auf dem eigenen Weg zu erreichen. Es ist aber zugleich auch zeitlich ein letztes Wort, d. h. es geht ihm ein Tun, Leiden, Wollen oder Hoffen voraus. Es mußte von Paulus oder Luther ein Weg gegangen sein, „es mußte die ganze Länge des Weges der vorletzten Dinge durchschritten sein, es mußte ein jeder unter der Last dieser Dinge auf die Knie sinken — und doch war dann das letzte Wort nicht die Krönung, sondern der vollstän52 54
106
53 PT I, 32. PT I, 29. Vgl. zum Folgenden D. Bonhoeffer, Ethik, 1953 2 , 75—92.
dige Abbruch des Vorletzten" 55 . Um des Letzten willen muß aber auch vom Vorletzten die Rede sein. Es geht um die Frage, ob der Glaube jederzeit realisierbar ist und ob das Evangelium jederzeit in gleicher Weise gesagt werden darf. „Warum entscheide ich mich gerade in ganz ernsten Situationen, etwa angesichts eines durch einen Todesfall schwer Betroffenen, oftmals für ein ,vorletztes' Verhalten, also etwa zu einer durch Schweigen bekundeten Gemeinschaft der Hilflosigkeit gegenüber so hartem Geschehen, statt die mir an sich bekannten und zur Verfügung stehenden Worte des biblischen Trostes auszusprechen, auch gerade Christen gegenüber?" 56 Zwei extreme Lösungen des Verhältnisses von Letztem und Vorletztem werden beschrieben und abgelehnt. Die radikale Lösung verabsolutiert das Letzte. Sie entspringt dem Haß gegen das Bestehende, gegen Geduld, Klugheit und Maß. An die Stelle der weltoffenen, dienstbereiten Kirche tritt eine Gemeindeidee. Die Kompromißlösung verabsolutiert das Vorletzte. Sie entspringt dem Haß gegen die Entscheidung, gegen die Einfalt und das Wort. In Jesus Christus sind die Gegensätze geeint. „Er läßt die menschliche Wirklichkeit, ohne sie zu verselbständigen und ohne sie zu zerstören, als Vorletztes bestehen . . ." 57 Das Wort selbst verlangt, daß ihm der Weg bereitet werde. Das Vorletzte muß um des Letzten willen gewahrt bleiben; das Vorletzte besteht im Menschsein und im Gutsein. Manche sind mit ihrem Radikalismus, der die vorletzten Dinge verleugnet, gescheitert. Andere sind in ihnen stecken geblieben, manche noch gar nicht dahin gelangt. Darum muß vom Vorletzten gesprochen werden. „Es muß zunächst für die äußere Ermöglichung Sorge getragen werden, daß der Ruf der Predigt vernommen und befolgt werden kann." 5 8 Dies erinnert an F. Niebergalls Formulierung der Aufgabe, daß es gelte, den Glauben anzubahnen, durch Hebung der Wertschätzung die Voraussetzungen zu schaffen. Dazu gehört für ihn audi die Beseitigung äußerer Hindernisse. Es sei an sein Engagement in der Alkoholfrage erinnert. In F. Niebergalls Theologie liegt das Schwergewicht auf der Sorge um das Vorletzte im Bonhoefferschen Sinn. Seine Stärke besteht gerade in dem, was von den Vertretern der radikalen Lösung verleugnet wird, im Drängen auf Geduld, Klugheit und Maß. Κ. E. Logstrup hat gezeigt, daß Kierkegaard als typischer Vertreter der radikalen Lösung anzusehen ist und hat auf die Konsequenzen bei J. P. Sartre aufmerksam gemacht59. Die Vertreter einer landläufigen „positiven" Kirchlichkeit, mit denen F. Niebergall zu tun hat, sind zwar von der Radikalität Kierkegards und seiner Nachfolger unter den dialektischen Theologen weit entfernt, aber ihre Berufung auf Jes. 55, 11 und ihre Weigerung, auf Menschen in der 55 57 59
56 Ebd. 78. Ebd. 79. 58 Ebd. 84. Ebd. 90. Vgl. K. E. Lagstrup, Auseinandersetzung mit Kierkegaard 123—148.
107
Predigt konkret einzugehen, ist für die radikale Lösung kennzeichnend. F. Niebergalls Theologie wird verständlich als Versuch, dagegen ein Korrektiv anzubringen, und sie behält aktuelle Bedeutung gegenüber allen Auffassungen, die die radikale Lösung verabsolutieren. D a aber die beiden extremen Lösungen auf keinen Fall als sachgemäß gelten können, ist zu fragen, ob F. Niebergall nicht die Kompromißlösung als Extrem vertritt, d. h. ob er in seiner Sorge um das Vorletzte noch um das Letzte als Letztes weiß, und wie er das Verhältnis zwischen Letztem und Vorletztem bestimmt. Für D. Bonhoeffer ist die Rechtfertigung das letzte Wort. F. Niebergall deutet sie als das Angebot der Vergebung, die er als pädagogisch sehr wirksames Vorschußvertrauen interpretiert. Durch diese Psychologisierung verliert die Vergebung ihren Charakter als letztes Wort. Es wird auch nirgends deutlich gesagt, daß dieses Letzte ein Abbruch des Vorletzten ist. Aber es könnte sein, daß bei F. Niebergall an anderer Stelle ein Letztes ins Spiel kommt. Eine doppelte Antwort zeichnet sich ab. Mit der Unterscheidung eines prophetischen und eines pädagogischen Handelns in der Kirche rückt F. Niebergall nahe an D. Bonhoeffers Begriffspaar heran. Auch bei ihm hat die Unterscheidung einen inhaltlichen und einen zeitlichen Aspekt. Das prophetische Wort ist radikal, sofern es sich ausschließlich am höchsten Gut als einem Ideal orientiert, während das pädagogische Wort Abstriche macht am Ideal, um zwischen Ideal und Wirklichkeit abzugleichen. Die beiden Weisen der Wirksamkeit lösen sich in der Geschichte wechselseitig ab; das Pendel der geschichtlichen Bewegung schlägt ständig zwischen beiden hin und her. Der zeitliche Aspekt hat bei F. Niebergall Bezug auf geschichtliche Epochen, nicht auf das Individuum. „Sind aber die Stürme solcher kritischen und prophetischen Zeiten verbraust, dann treten bald wieder die ruhigen pädagogischen ein, die zu Gewohnheiten und Sitten verarbeiten, was da errungen worden ist, bis der Vorgang von neuem beginnen muß." 6 0 Die pädagogische Pflege des Vorletzten wird nicht als methodische Entwicklung zum Letzten hin verstanden, sie kommt vielmehr vom Letzten her und ruft das letzte kritische Wort sofort wieder auf den Plan, sobald das Vorletzte zum toten Besitz erstarrt ist. Das Verhältnis zwischen dem letzten und dem vorletzten Wort kann aber noch enger gesehen werden. Wenn F. Niebergall die alte dogmatische Weise kritisiert, weil sie das geschichtliche Werden und die geschichtlichen Veränderungen des Glaubens und seiner sprachlichen Gestalt nicht wahrhaben will, dann will er sich zugleich gegenüber einem rein historischen Verständnis des Glaubens abgrenzen. „Wir wissen, weil wir an die Geschichte der biblischen Vorstellungen die der Dogmen reihen, wie alles geschichtlich geworden und wieder vergangen ist. Wir sind immer noch gegenüber einem ganz rela60
108
PT1,209.
tivistischen und skeptischen Historizismus kühn genug, um all die vielen Jahresringe von Glaubenssystemen einen neuen wachsen zu lassen, weil wir dem menschlichen Gesetz Trotz bieten, das uns heißt, immer die andern relativ, uns aber absolut zu fassen." 61 Wie kann F. Niebergall dem Historismus unsachgemäße Verabsolutierung des eigenen Standpunkts vorwerfen, da dieser doch um die geschichtliche Bedingtheit auch der eigenen Sicht weiß? Der Historismus erkennt doch auch seine geschichtlichen Wurzeln! Die Selbstverabsolutierung ist nicht theoretischer, sondern praktischer Natur. Sie besteht in der Weigerung, sich an der Entstehung neuer „Jahresringe" zu beteiligen, d. h. in der Weigerung, durch verantwortliche Übernahme konkreter Aufgaben am geschichtlichen Leben mitzuwirken. Das Verharren in der Zuschauerhaltung und in der Reflexion bedeutet Verabsolutierung des eigenen Standpunkts. Die „Positiven" glauben das letzte Wort direkt sagen zu können, die Historisten leugnen es; es gilt aber im Wissen um die Relativität des eigenen Standpunkts konkrete Verantwortung zu übernehmen. Nur so können die beiden Irrwege vermieden werden. Konkrete Verantwortung kann man nur übernehmen, wenn man sich nicht selbst verabsolutiert. Ohne die zitierte Stelle zu sehr strapazieren zu wollen, wird man sagen können, daß F. Niebergall seine Praktische Theologie, die sich weitgehend in der Sorge um das Vorletzte erschöpft, unter dem Vorbehalt betreibt, daß ein letztes Wort gesprochen ist und daß es gerade in der von der Zeit geforderten, bescheiden und geduldig zu übenden Erziehungsarbeit wirksam wird, auch wenn es nicht direkt ausgesprochen wird. Unbeschadet der Kritik im einzelnen wird man behaupten können, daß F. Niebergalls Theologie in seiner Zeit als sinnvolles Korrektiv gegenüber einem Offenbarungspositivismus einerseits und einem historischen Relativismus andererseits anzusehen ist. Es wird in den folgenden Teilen zu zeigen sein, welche Vorstellungen F. Niebergall von einem verantwortlichen und bescheidenen Wirken hat.
81
P T 1,312.
109
2. Teil: Die Funktion des Erziehungsbegriffs in Friedrich Niebergalls Verständnis der Praktisch-Theologischen Disziplin Mit dem Aufkommen eines neuen kritischen Verständnisses von Wissenschaft in der Aufklärung hörte die selbstverständliche wechselseitige Bezogenheit von Universitätstheologie und kirchlicher Praxis auf. Die theologischen Fächer glauben nun ihre Arbeit um so besser zu tun, „je mehr sie ganz allein auf ihre eigene Lektion sehen. Dann bedarf es aber offenbar einer besonderen Disziplin, die den geschichtlich begründeten Anschluß der Theologie an die Kirche herzustellen hat, daß sich die Arbeit der Kirche auf die Theologie gründet und die Arbeit der Theologie in die der Kirche mündet. Das ist die Aufgabe der Pr. Th." 1 F. Niebergall bejaht also das in der neueren Entwicklung zu Tage getretene Spannungsverhältnis zwischen Theologie und Kirche von seinen Voraussetzungen her und begründet damit die Notwendigkeit und die Aufgabe der Praktischen Theologie als einer wissenschaftlichen Disziplin. F. D . Schleiermacher hat der Praktischen Theologie unter diesem Namen einen organischen Platz im Gefüge der theologischen Wissenschaft und der Wissenschaft überhaupt angewiesen. In der Folgezeit wollten die Klagen der Vertreter der neuen Disziplin über Nichtachtung seitens der Vertreter der andern Fächer nicht aufhören. Man wollte die anscheinend nur mit Kunstregeln und Techniken beschäftigten Kollegen nicht als Wissenschaftler im vollen Sinn des Wortes anerkennen. Versuchten diese die kirchlichen Tätigkeiten historisch zu behandeln oder systematisch aus dem Kirchenbegriff abzuleiten, so mußten sie sich fragen lassen, ob die Praktische Theologie unter diesen Umständen eine selbständige theologische Disziplin darstelle oder ob sie nicht nur Teilgebiete anderer Disziplinen bearbeite. F. Niebergall konnte diese Bedenken nicht unberücksichtigt lassen. Es soll daher im Folgenden dargestellt werden, wie er die Praktische Theologie als selbständige theologische Wissenschaft begründet und wie er ihr Verhältnis zu den andern theologischen Disziplinen versteht. Dabei wird sich zeigen, daß er die Antwort mit Hilfe des Erziehungsbegriffs zu geben versucht. 1
110
Die wissenschaftlichen Grundlagen der praktischen Theologie, MkPr 3, 1903, 2 7 5 .
I. Praktische Theologie als Erziehungswissenschaft 1.
Problemhorizonte
Die Probleme und Aufgaben einer Praktischen Theologie beschreibt F. Niebergall in der Einleitung seines gleichnamigen Hauptwerkes im Anschluß an eine Skizze der geschichtlichen Entwicklung seiner Disziplin. Es soll hier seine Darstellung dieser Entwicklung nicht auf ihre Richtigkeit hin geprüft werden, sondern nur nach der Konzeption gefragt werden, die darin zum Ausdruck kommt. Die Geschichte der Praktischen Theologie erreicht nach ihrer Begründung durch Schleiermacher einen ersten Höhepunkt bei C. I. Nitzsch, der die gesamte kirchliche Tätigkeit zum Gegenstand der Untersuchung macht und sie auf die Kirche oder Gemeinde als das aktuose Subjekt jener Tätigkeit bezieht. In der Folgezeit hat sich diese Auffassung immer mehr durchgesetzt. Man glaubt dabei, man habe den grundsätzlichen Unterschied von katholischer und evangelischer Kirche erfaßt und das Amt der Kirche als Organ gerechtfertigt, durch das die unsichtbare Kirche ihre Tätigkeit ausübt; „das erhebe die Praktische Theologie über den alten Stand einer Lehre für den Geschäftsbetrieb des geistlichen Amtes" 2 . F. Niebergall vermutet aber, daß die alte Pastoraltheologie noch nicht wirklich überwunden sei: „Man hat freilich oft den Eindruck, als wenn diese Kirche nur dazu da wäre, um als Ausgangspunkt für die Ableitung der Ämter zu dienen; die Selbstbetätigung wird gepriesen, aber im wesentlichen nur wieder in der Tätigkeit des Amtes selber gesucht." 3 Die Entwicklung geht folgerichtig dahin, das Kirchenregiment dem Kirchendienst unterzuordnen, die Bedeutung der Einzelgemeinde zu betonen und die Tätigkeit von Mitarbeitern neben dem Pfarrer ins Auge zu fassen. Man wird hier freilich F. Niebergalls Kritik an C. I. Nitzsch und E. C. Achelis auch auf ihn selbst anwenden müssen, denn in seiner Praktischen Theologie kommen kirchliche Mitarbeiter neben dem Pfarrer nur am Rande vor 4 . Im ersten Band des genannten Werkes formuliert er zwar die Themen der Hauptteile mit Hilfe des Gemeindebegrifïs, aber die Ausführungen beziehen sich dann kaum darauf. Unter der Uberschrift „Die Gemeinde als Inhaberin der Kräfte" erörtert er die Möglichkeit einer Beeinflussung von Menschen mit psychologischen und philosophischen Argumenten und stellt seine „praktische Dogmatik" dar. Wer aber nach der Uberschrift eine Vorordnung der Gemeinde vor den einzelnen nach dem Vorbild A. Ritschis erwartet, wird enttäuscht. Der Ansatz bleibt individualistisch. Die Praktische Theologie ist eine Anweisung für den Pfarrer. Die Rede von der Gemeinde als dem Subjekt der kirchlichen Tätigkeit soll nicht das Gegenüber aufheben 2
3 P T I , 5. Ebd. Vgl. PT I, § 23, § 24. Über den Pfarrer wird auf mehr als fünfzig Seiten gehandelt, „die andern persönlichen Kräfte" kommen auf drei Seiten kurz weg. 4
111
zwischen dem Pfarrer als dem Erzieher und den Gemeindegliedern als den zu Erziehenden. Es geht vielmehr um die Frage, ob die Autorität des Pfarrers gegenüber der Gemeinde mit einem supranaturalen Amtsbegriff oder mit dem Erziehungsgedanken zu begründen ist. „An jenen Erörterungen über die Kirche als Trägerin aller Tätigkeiten zur Erbauung eben derselben Kirche ist eines vor allem von bleibendem Wert: das ist der Gegensatz gegen jegliches Bemühen, aus einem unmittelbar von Christus gestifteten Amt die Rechtfertigung aller geistlichen Arbeiten und des dazu berufenen Standes abzuleiten. So steht also jener Gedanke von der congregano sanctorum unter dem Gesichtspunkt, gegenüber allem Klerikalismus die Gemeinde der Gläubigen als Ursprung aller Autorität und als Quelle geistlichen Rechtes in Anspruch zu nehmen. Wenn man will, kann man sagen, daß damit eine Art von demokratischem Geist gegen aristokratischen oder von geistlich-weltlichem gegen den rein supranaturalen Geist geltend gemacht werde, wie es der Reformation allein entspricht." 5 „Gemeinde" ist hier also ein Hilfsbegrifi, der die Funktion hat, in Abwehr eines falschen Amtsbegriffs den Erziehungsgedanken zur Geltung zu bringen. Auch in anderer Hinsicht ist der Erziehungsgedanke im Ansatz schon bei Nitzsch vorgegeben. Dieser formuliert: „Die Factoren des Begriffs vom kirchlichen Thun sind immer Idee und Thatsache; dem Urbild entspricht oder widerspricht die zeitliche Erscheinung; die Bedingungen der Erscheinung und des in ihr zu verwirklichenden Begriffs sind nicht nur allgemeine, sondern auch besondere, wechselnde, z. B. volksthümliche; die Zukunft der Kirche ruht auf der Basis der Gegenwart; diese wird durch das Vergangene begreiflich." 6 Idee und Tatsache, Ideal und Wirklichkeit, Erziehungsziel und Zustand des Zöglings, das sind die beiden Grundgegebenheiten, aus deren Erkenntnis sich die Erkenntnis der Mittel ableiten läßt, durch die die Wirklichkeit dem Ideal angenähert werden kann. Darin erkennt F. Niebergall den Grundgedanken der Herbartschen Pädagogik wieder 7 . Die Art, wie Nitzsch sein Programm durchführt, wird aber wieder kritisiert. Das Ziel, das die Praktische Theologie bei ihrer Arbeit vor Augen hat, soll nicht aus einer Idee, sondern aus der Geschichte abgeleitet werden. Auch die Wirklichkeit der Kirche wird von Nitzsch nicht sachgemäß erfaßt. Anstatt den Gesamtzustand zu schildern, der P T I , 5. C. I. Nitzsch, Praktische Theologie I, 1859 2 . 7 „ . . . so tritt dieses Ideal jener Darstellung der Wirklichkeit voran und aus beiden ergibt sich die Erkenntnis von Mitteln und Wegen, um diese zu jener hin zu führen oder jenes in dieser anzubahnen. So gewinnen wir eine besondere, nämlich auf den Zweck bezogene Anordnung, die uns nach dem Muster der Herbartschen Pädagogik etwas Ähnliches wie die gesuchte Notwendigkeit für nötige Erkenntnis geben kann; denn die teleologische Notwendigkeit, die Ziel, Ausgang und Weg verbindet, steht nicht zurück hinter der kausalen, die die Wirkungen von Ursachen erkennen lehrt." P T I, 11. 5
6
112
kirchlich bearbeitet werden soll, zeigt er nur, auf welchem Punkt ihrer Entwicklung die Arbeit der Kirche angekommen ist; „er schildert also den Zustand des Subjektes der darzustellenden Wirksamkeit, nicht den ihres Objektes, nämlich der zu beeinflussenden Menschen" 8 . Es ist nach F. Niebergall nicht möglich, die Grundsätze für eine kirchliche Tätigkeit allein aus deren Geschichte abzuleiten, solange nicht die Menschen als Gegenstand dieser Tätigkeit mit in den Blick kommen. Nitzschs Gedanken werden bei Achelis aufgenommen und weitergeführt. Dabei treten audi die Schwächen dieser Konzeption zutage. Der Versuch, durch systematische und historische Untersuchungen die Wissenschaftlichkeit der Praktischen Theologie zu erweisen, führt zu einer langweiligen Gelehrsamkeit, der ein wirklicher Bezug zur Praxis der kirchlichen Tätigkeiten fehlt 9 . Die Klagen über den Betrieb der Praktischen Theologie mehren sich und führen zu einer Reformbewegung, deren Wortführer u. a. M. Rade und P. Drews sind. Weg von den Ideen und der Geschichte, hinein ins Leben der Gegenwart, heißt nun die Losung. Man fordert empirische Erforschung der gegenwärtigen Realität. Die Praktische Theologie muß Psychologie und Pädagogik, Kirchenkunde und religiöse Volkskunde in ihren Aufgabenbereich einbeziehen. Da nach F. Niebergall die geschichtliche Entwicklung dem psychischen Gesetz des Rückschlags gehorcht, mußte dem Ruf nach Empirie und Praxis eine Besinnung auf den Wert der Theorie folgen. So sehr sich F. Niebergall den Forderungen von M. Rade und P. Drews verpflichtet weiß, so wenig möchte er auf solide theoretische Grundlegung verzichten. Die Synthese wird durch den Erziehungsgedanken ermöglicht. Eine Lehre von der Erziehung bezieht die Erkenntnis der Normen als Erziehungsziel auf die Erkenntnis des Zustandes und leitet aus dieser Beziehung die wirksamen Mittel zur Erziehung ab. Obwohl F. Niebergall die Geschichte der Praktischen Theologie nicht betreiben möchte, „um unsre Auffassung der Dinge zu begründen und zu beweisen, als wenn sie auf Grund der geschichtlichen Entwicklung die einzig richtige wäre . . . " 1 0 , erweckt er doch den Eindruck, daß sein Versuch, die Praktische Theologie im ganzen Umfang als Erziehungslehre zu konzipieren, für die Probleme, die in der geschichtlichen Entwicklung aufgebrochen sind, eine gute Lösung darstelle. Er vermag weiter zu führen und Fehlwege zu vermeiden. Der Erziehungsgedanke hat hier zunächst polemische Funktion. Er macht es unmöglich, die kirchliche Tätigkeit mit einem autoritativen Amtsbegriff zu begründen. Er macht einsichtig, daß 8
MkPr 3, 1903, 270. Vgl. MkPr 3, 1903, 271 f. Nitzsdis Orientierung an der Geschichte läßt sich nicht von dem pädagogischen Schema „Norm, Zustand, Mittel" leiten, d. h., was zwischen ihm und F. Niebergall strittig ist, hängt mit dem Erziehungsbegriff zusammen, der sich wieder einmal als Kriterium für F. Niebergall erweist. 10 P T I , 3. 9
113
es nicht genügt, diese Tätigkeit systematisch aus dem Kirchenbegriff abzuleiten und ihre Geschichte aufzuzeigen. Die empirische Erforschung der gegenwärtigen Wirklichkeit muß in den Aufgabenbereich der Praktischen Theologie einbezogen werden. Diese Ausrichtung auf die Praxis muß wiederum vor Mißverständnissen geschützt werden. Es geht nicht darum, Handreichungen oder eine Summe von Fingerzeigen für Predigt und Unterricht zu geben. Der Erziehungsgedanke bezeichnet den Mittelweg zwischen Gelehrsamkeit und Handreichung11. P. Wurster bezeichnet in seiner Rezension12 die Praktische Theologie F. Niebergalls als einen großen, wenn auch einseitigen Wurf. Der Verfasser habe die Scylla des Historismus vermieden, sei aber der Charybdis des Praktizismus verfallen. Seine Stärke liege im konkret Psychologischen. Dem Lob des Rezensenten wird man zustimmen müssen. Er hat aber übersehen, daß die Eigenart F. Niebergalls nicht nur in feinsinnigen psychologischen und volkskundlichen Beobachtungen liegt, sondern eben in dem Versuch, die ganze Praktische Theologie als Lehre von der Erziehung zu konzipieren. Was er im Rahmen dieser Konzeption an theologischen Aussagen, Deutungen der Kirchengeschichte und Vorschlägen für die Praxis bietet, ist im allgemeinen nicht neu oder originell. Er hat sich nie als Außenseiter oder Prophet gefühlt und konnte in der Regel mit der Zustimmung der „Freunde der Christlichen Welt" rechnen. Was P. Wurster an ihm rühmt, entspricht den Forderungen, die schon M. Rade erhoben hatte. „Ich fordere im wesentlichen beschreibende Arbeit. Ja, denn diese ist die schwerste. Kritisieren und Ideale aufstellen ist leicht. Ideale und Kritik bringt der Student selbst schon genug mit. In der richtigen Beschreibung der Gemeinde, wie sie ist, und soweit das die Zeit vergönnt, wie sie geworden ist, soll der Professor der praktischen Theologie . . . seine Meisterschaft beweisen."13 Hier wird aber auch die Eigenart des F. Niebergallschen Entwurfs deutlich. Bei M. Rade wird die Aufgabe der Praktischen Theologie nur mit einem praktischen Bedürfnis begründet. Um den Zusammenhang mit den andern theologischen Disziplinen zu wahren, genügt es, daß die Studenten ihre historische und systematische Theologie schon mitbringen. F. Niebergall urteilt hier anders. Praktische Theologie als Erziehungslehre muß Rechenschaft geben über das Erziehungsziel. Sie kann die Fragen nach dem Wesen des Glaubens oder dem Wesen des Christentums nicht ausklammern und ihre Beantwortung nicht einfach den andern Disziplinen überlassen. „Praktische Dogmatik" und „Praktische Auslegung" sind 11 12 13
Vgl. P T I, 2 und Jesus im Unterricht (1910), Vorwort. MPTh 17, 1920, 4 5 — 4 8 . M. Rade, Zur Frage nach dem richtigen Betriebe der
ZprTh 17, 1895, 355. 114
praktischen Theologie,
Gegenstände der Praktischen Theologie. Es geht darum, zwischen theologischer „Theorie" und „kirchlicher Praxis" einen innerlich notwendigen, in der Sache selbst begründeten Zusammenhang aufzuzeigen. „Das Verhältnis einer solchen Pr. Th. zu der Gesamttheologie ist viel enger als das der alten Art unserer Disziplin, die im wesentlichen als Technik gedacht, gleich gut und gleich schlecht zu einer jeden Art von Theologie paßt." 1 4 Der innere Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis oder zwischen Theologie und Kirche tritt eben darin deutlich in Erscheinung, daß der Praktische Theologe seinen theologischen Standort — etwa als Kaftanschüler — nicht verleugnen kann und will. Gewiß haben andere Vertreter des Faches, ζ. B. O. Baumgarten und andere Mitarbeiter der Monatsschrift für die kirchliche Praxis, ähnlich gedacht. Sie haben ihre „moderne" Theologie in ihrer Theorie der Praxis mit ins Spiel gebracht, aber sie haben den inneren Zusammenhang weniger reflektiert. Der Erziehungsbegriff gehörte zum theologischen Denken der Zeit vor dem ersten Weltkrieg. Es sei an J. Kaftan, W. Herrmann, E. Sülze und K. Seil erinnert. F. Niebergall hat den Begriff von J. Kaftan übernommen. Originell ist jedoch der Versuch, die Praktische Theologie im ganzen als Erziehungslehre zu verstehen. Er fand keine Nachahmer und dürfte audi häufig mißverstanden worden sein. H . Faber urteilt ähnlich wie P. Wurster: „Es war daher als Fortschritt zu begrüßen, daß im Anfang des 20. Jhd.s der Versuch gemacht wurde, der Pr.n Th. wissenschaftlichen Charakter und Lebensnähe zu geben durch ständige Bezugnahme auf die Ergebnisse und die Arbeitsweise der neueren benachbarten Disziplinen wie Psychologie und Soziologie, Kirchenkunde und religiöse Volkskunde, so besonders in der .Praktischen Theologie' von Fr. Niebergall." „Zu einseitig ist aber auch Niebergalls Auffassung, wenn er die Pr. Th. als die Theorie der kirchlichen Gemeindeerziehung verstehen will, die sich nicht mit der Kirche, sondern ausschließlich mit der Einzelgemeinde beschäftigt." 15 Man sieht hinter dem Erziehungsbegriff nur die Forderung, die Praktische Theologie müsse die empirische Gemeinde beschreiben und verkennt die wissenschaftstheoretische Funktion, die der Begriff bei F. Niebergall hat. Daß die innere Systematik in F. Niebergalls Praktischer Theologie oft übersehen wird, mag damit zusammenhängen, daß er sich nicht besonders bemüht, diese im Formalen zur Geltung zu bringen. Jedenfalls erhalten bei ihm die einzelnen Gegenstände seines Faches durch den Erziehungsbegriff eine Ordnung und eine Bezogenheit im Ganzen und dadurch ihren wissenschaftlichen Charakter.
14
MkPr 3, 1903, 274. Art. Praktische Theologie, RGG 2 IV, 1401 f. Im Unterschied zu P.Wurster bestätigt O. Baumgarten unsere Beobachtungen, wenn er F. Niebergall einen neueren „Systematiker der Praktischen Theologie" nennt. Protestantische Seelsorge 3. 15
115
2. Erziehungslehre als Wissenschaft „Auf diesen beiden Pfeilern, dem Ideal und der gegenwärtigen Wirklichkeit, ruht die Arbeit der Pr. Theologie, die wissenschaftlichen Grundlagen aber, auf denen jene Pfeiler stehen, sind die Geschichte, die Volkskunde und die Psychologie."16 Mit diesen Sätzen definiert F. Niebergall die Praktische Theologie als Erziehungslehre und die Erziehungslehre als Wissenschaft. Indem die Erziehungslehre Erziehungsziel und Erziehungswirklichkeit auf einander bezieht und daraus eine notwendige Erkenntnis der Erziehungsmittel gewinnt, erhält sie wissenschaftlichen Charakter. F. Niebergall beruft sich dafür auf Herbart: „So gewinnen wir eine besondere, nämlich auf den Zweck bezogene Anordnung, die uns nach dem Muster der Herbartschen Pädagogik etwas Ähnliches wie die gesuchte Notwendigkeit für nötige Erkenntnis geben kann; denn die teleologische Notwendigkeit, die Ziel, Ausgang und Weg verbindet, steht nicht zurück hinter der kausalen, die die Wirkungen von Ursachen erkennen lehrt." 17 Der Unterscheidung einer kausalen und einer teleologischen Betrachtungsweise entspricht der Unterschied zweier Begriffe von Wissenschaft. Dem naturwissenschaftlichen, positivistischen Begriff von Wissenschaft entspricht nur das kausale Denken. Die Ergebnisse der Wissenschaft müssen beweisbar sein. F. Niebergall hatte zunächst mit J. Kaftan diesen Wissenschaftsbegriff bejaht, um zu behaupten, daß die Theologie (auch Philosophie und Pädagogik) die Wissenschaft transzendiere 1S . Nun nimmt er auch für die teleologische Betrachtungsweise der Pädagogik, die auf Wertschätzung beruht, also Sache der inneren Freiheit ist, Wissenschaftlichkeit in Anspruch. Diese ist im Begriff des Notwendigen gegeben, der sich auf kausale und teleologische Betrachtung anwenden läßt. „Eine wissenschaftliche, nämlich eine genaue, vollständige und zusammenhängende Behandlung, die notwendige Erkenntnis gibt. Denn der Charakter des Notwendigen macht Wissen zur Wissenschaft."19 Die Differenzen beruhen auf der nicht eindeutigen Verwendung des Wissenschaftsbegriffs. Gegen den positivistischen Einwand, daß der Begriff des Zweckes dem der Wissenschaft widerspreche, kann sich F. Niebergall nicht nur auf den Anspruch der Pädagogen, sondern auch auf das neukantianische Verständnis der Geisteswissenschaften berufen 20 . Der Anspruch der Praktischen Theologie auf Wissenschaftlichkeit leuchtet nun freilich erst ein, wenn gezeigt wird, daß die Erkenntnis von Zweck, Zustand und Mittel im einzelnen jeweils auf notwendige, also wissenschaftliche Weise zustande kommt. Hier kommen die schon genannten Wissenschaften Geschichte, Volkskunde und Psychologie in den Blick. 18
MkPr 3, 1903, 273. " PT I, 11. Vgl. audi PT I, 2 und PT II, 65. 18 19 Vgl. D 103 f. MkPr 3, 1903, 275. 20 Vgl. ebd. 116
Die Erkenntnis des Zieles möchte F. Niebergall im Gegensatz zu Nitzsch nicht aus der Idee, sondern aus der Geschichte gewinnen 21 . Das entspricht dem Vorgehen J. Kaftans, der das Wesen der Religion nicht religionsphilosophisch, sondern religionsgeschichtlich bestimmen will 22 . Es geht dabei nicht um ein breites historisches Wissen, sondern um eine geschichtsphilosophische Konstruktion. Nach F. Niebergall muß die historische Forschung die Psychologie zu Hilfe nehmen. Sie hat sich im religionspsychologischen Zirkel zu bewegen 23 . Was er in seiner Antrittsvorlesung „geschichtlich" nennt, heißt später „religionswissenschaftlich". Gemeint ist dasselbe, nämlich das Wechselspiel von historischer Kritik, religionsgeschichtlichem Vergleich und religionspsychologischer Deutung 24 . Das Ziel der religionswissenschaftlichen Untersuchung ist die Herausarbeitung und Beschreibung religiöser Phänomene. Typen werden dargestellt, Natur-, Volks- und Erlösungsreligion, Priester und Prophet, Katholizismus und Protestantismus, Volkskirche und Sekte einander gegenübergestellt. Die geschichtliche Entwicklung läßt psychologische Gesetze und einen Aufstieg erkennbar werden. Im Widerspruch zu seiner Behauptung, die Praktische Theologie arbeite wissenschaftlich, kann er gelegentlich zugeben, daß die religionswissenschaftlichen Ergebnisse nur zu haben sind, wenn man die Arbeit nicht streng geschichtlich betreibt 25 . Er sucht dann aber die Ungenauigkeit seiner geschichtlichen Darstellungen als pädagogisch sinnvoll, ja notwendig zu legitimieren 26 . W. Birnbaum ordnet F. Niebergall in die Epoche der Praktischen Theologen ein, die im Unterschied zu den Nachfolgern Schleiermachers und den dialektischen Theologen die Begründung ihres Faches im Stoff suchen. Er bezieht sich auf die Aussage27, Ideale liefere die Geschichte, die er als Votum im Sinne des Historismus mißversteht 28 . F. Niebergall begründet sein Fach aber nicht im Stoff, sondern im Erziehungsgedanken, sogar auf Kosten der Genauig21
22 Vgl. ebd. 270, 273. V g l . oben S . 2 5 , A n m . 4 . V g l . oben S . 5 0 f . 24 Vgl. die Gliederung der Kapitel 1 — 3 in „Theologie und Praxis", Göttingen 1916. 25 Vgl. D i e neuen Wege kirchl. Arbeit 51 und N R U I, 197. 26 Vgl. ebd. 27 „Sehr klar hat Friedrich Niebergall in seiner Heidelberger Antrittsvorlesung gesagt, die Ideen gäbe allein die Geschichte. D a m i t begründet sich die Disziplin nunmehr in der geschichtlichen Erscheinung, im Stoff." W . B i r n b a u m , Theologische Wandlungen v o n Schleiermacher bis Karl Barth, 1963, 164. 28 „In seiner Heidelberger Antrittsvorlesung z w a n z i g Jahre früher hatte er (seil. F. Niebergall) noch in Antithese z u m frühen 19. Jahrhundert betont, die ,Ideen' liefere die Geschichte. Jetzt beruht seine Darstellung des Ideals auf einer Art durch Geschichte und Psychologie geschulter u n d geleiteter Intuition, die man bei ihm als ein k r y p t o pneumatisdies Element bezeichnen könnte." Ebd. 183. D i e Behauptung einer W a n d l u n g bei F. Niebergall ist unzutreffend. Psychologisch-historische Intuition wird v o n ihm schon in den frühen Veröffentlichungen gefordert. Richtig ist, daß er das psychologische Element im religionspsychologischen Zirkel später stärker betont. 23
117
keit im Hinblick auf den geschichtlichen „Stoff". Der Gewinn ist die prästabilierte Harmonie von Hermeneutik und Didaktik. Wie kommt es zur wissenschaftlichen Erkenntnis der Erziehungswirklichkeit, d. h. des gegenwärtigen Zustandes der zu Erziehenden? Auch hier wird zunächst geschichtliche Forschung gefordert. „Die Geschichte gibt ein Verständnis des Bodens, der Wirklichkeit, auf der man s t e h t . . . " 2 9 Auf diese Bemühungen trifft das eben Gesagte wiederum zu. Es geht nicht um historische Details, sondern um Typen, Entwicklungen und Schemata im Dienste der Pädagogik. Genaue, streng historische Arbeit, Gelehrsamkeit und pädagogische Arbeit scheinen sich auszuschließen. „Der Geschichte zur Seite tritt die empiristische Aufnahme der hierhergehörigen Gegenwart mit Anwendung aller wissenschaftlichen Methoden.. ." 30 F. Niebergall nimmt hier die Forderung einer religiösen Volkskunde in sein Programm auf. Diese Forderung wurde von P. Drews in einem programmatischen, die Monatsschrift für die kirchliche Praxis eröffnenden Aufsatz erhoben, in seiner Schrift „Das Problem der Praktischen Theologie" (1910) in einen größeren Rahmen gestellt und konkretisiert. F. Niebergall bekennt sich im Vorwort seiner „Praktischen Theologie" zu den Grundsätzen von P. Drews, ohne sich später an irgendeiner Stelle von ihm abzugrenzen. Dabei bestehen nicht unerhebliche Differenzen in der Auffassung des Gegenstandes, der Funktion und der Methode der religiösen Volkskunde zwischen P. Drews und F. Niebergall. Dessen Eigenart besteht wieder darin, daß er den Erziehungsbegriff ins Spiel bringt. Aufgabe der religiösen Volkskunde ist nach P. Drews „eine wirkliche Kenntnis des gegenwärtigen religiösen Lebens innerhalb und außerhalb der Landeskirche" 31 . Diese Kenntnis ist nötig als Voraussetzung einer fruchtbaren Wirksamkeit. Der theologische Praktiker muß über religiöses Leben, religiösen Besitz, religiöse Bedürfnisse und Frömmigkeit unterrichtet sein. „Fest steht, daß bestimmte Volkskreise auch ihre bestimmt ausgeprägte religiöse Art haben." 32 Die Fragestellung ist nicht eigentlich religionssoziologisch. Es geht nicht darum, aufzuzeigen, wie das religiöse Leben einzelner von ihrer Zugehörigkeit zu gesellschaftlichen Gruppen abhängig ist oder umgekehrt solche Gruppen durch die Religion bestimmt werden. Es geht vielmehr um die Beschreibung von Frömmigkeitstypen, von denen angenommen wird, daß sie für bestimmte gesellschaftliche Gruppen, „Volkskreise", typisch sind. Die neue „deskriptiv-induktive" Wissenschaft kann und will persönliche Erfahrung nicht ersetzen. „Aber dazu will ja gerade die ,religiöse Volkskunde' anleiten, erziehen, daß der Geistliche fähig wird, Erfahrung zu sammeln; das Auge will sie ihm schärfen für das konkrete Leben; den Sinn ausrüsten, menschliche Art im Reiche 2» MkPr 3, 1903, 273. 31 MkPr 1, 1901, 1. 118
30 32
Ebd. Ebd. 2.
der Religion zu verstehen, wobei freilich Wunderthaten nicht erwartet werden dürfen." 3 3 Zur wirklichen Kenntnis des gegenwärtigen religiösen Lebens muß ergänzend die religiöse Psychologie und die Kirchenkunde hinzutreten. Es hat im bisherigen Betrieb der Praktischen Theologie nicht an Hinweisen über diese Gegenstände, wohl aber an einer bewußten wissenschaftlichen Inangriffnahme der Aufgabe gefehlt. Es geht um geordnete, vollständige Erkenntnis, die Gesetzmäßigkeiten aufzeigen kann. „Wir müssen nur eben auf all' diesen Punkten über zufällige, persönliche, vereinzelte Beobachtungen und Meinungen empor zu festen Gesetzen fortschreiten." 34 Gegenstand der religiösen Volkskunde sind also die religiösen Eigenarten verschiedener Gruppen, die Methode ist deskriptiv-induktiv nach Gesetzen fragend, und ihre Funktion besteht darin, dem Pfarrer zu einem selbständigen Urteil auf dem Gebiet der Menschenkenntnis zu verhelfen. Auch nach der Schrift über „Das Problem der Praktischen Theologie" (1910) ist es Aufgabe dieser und aller Theologie, „die auf bestimmtem Wissen beruhende Fähigkeit richtigen Urteilens zu übermitteln . . . " 3 5 Nach einer Ubersicht über die Geschichte seiner Disziplin stellt er die These auf: „Die Praktische Theologie für den Studierenden der Theologie an der Universität und die Praktische Theologie für den im Amt stehenden Geistlichen sind bewußt scharf von einander zu scheiden, und jede ist ihrer Aufgabe entsprechend eigenartig zu gestalten." 36 Dem Studierenden fehlt der Erfahrungshintergrund und darum auch das Interesse für Homiletik, Katechetik usw. Kirchenkunde, religiöse Volkskunde und Psychologie sollen ihm die Kenntnis der gegenwärtigen Wirklichkeit übermitteln, die Voraussetzung ist für praktische Übungen. Die religiöse Volkskunde erscheint innerhalb eines konkreten Reformprogramms zur Ausbildung der Geistlichen. Die an der Universität betriebene Praktische Theologie erhält einen selbständigen Aufgabenbereich, der von keiner andern Disziplin bearbeitet wird. Das Gebiet der religiösen Volkskunde erfordert zwar auch historische Forschung, aber der Praktische Theologe läßt sich dabei nicht wie der Kirchenhistoriker vom Interesse an der Vergangenheit, sondern von dem an der Gegenwart und Zukunft leiten. Die Beschreibung der gegenwärtigen Zustände wird sich von Kritik und dem Geltendmachen von Normen nicht freihalten können. P. Drews kennt die Sorge nicht, der Praktische Theologe könnte den Bezug zur eigentlichen Theologie verlieren. Die Wissenschaftlichkeit seiner Arbeit scheint durch Ebd. 6. Ebd. 5. Vgl. Das Problem der Praktischen Theologie, 1910, 55: „Hier muß wissenschaftliche Erkenntnis die dilettantenhafte verdrängen." 35 Das Problem der Praktischen Theologie 15. 38 Ebd. 43. 33
34
119
Etikettierung, wie „deskriptiv-induktiv", „empirisch", gesichert zu sein. Es wird aber nicht gesagt, mit welchen wissenschaftlichen Methoden die religiöse Volkskunde zu ihren Ergebnissen gelangt. F. Niebergall weist der religiösen Volkskunde dieselben Gegenstände zu wie P. Drews. Sie hat audi nach ihm die Aufgabe, die Urteilsfähigkeit des Theologen zu stärken. Es fehlt aber bei ihm das Problem der Pfarrerausbildung als Hintergrund. Organisatorische Fragen der Ausbildung und des Studiums interessieren ihn wenig. Die religiöse Volkskunde erhält bei ihm ihren Ort im Erziehungsgedanken. Während P. Drews seiner Forderung durch den Hinweis auf die negativen Folgen einer Vernachlässigung dieses Gebietes an Hand konkreter Beispiele Nachdruck verleiht, gibt F. Niebergall diesem Bereich eine wissenschaftstheoretische Begründung, indem er die gesamte Praktische Theologie als Erziehungslehre versteht. Die Pädagogik erstrebt ihrem Wesen nach Erkenntnis des Zieles und des gegenwärtigen Zustandes des Zöglings. Der Erziehungsbegriff stellt aber auch klar, daß die Praktische Theologie sich nicht in der Beschreibung der gegenwärtigen Verhältnisse erschöpfen darf, vielmehr hat sie das Ziel, die Normen aufzuzeigen und in der Erörterung der Mittel geltend zu machen. Durch den Erziehungsgedanken ist der Praktische Theologe gehalten, die Frage nach dem Wesen des Glaubens und des Christentums stets im Auge zu behalten. Das kritische Lob der Fachkollegen, man bemühe sich einseitig ums Praktische, trifft weder auf P. Drews noch auf F. Niebergall zu 3 7 . Im Unterschied zu jenem hat er das Methodenproblem einer religiösen Volkskunde gesehen. In seinem Aufsatz über die Bedeutung der Religionspsychologie (ZThK 1909) erörtert er nach bewährtem pädagogischem Schema erst das christliche Ideal, das Erziehungsziel, dann die religiöse Volkskunde, die Erziehungswirklichkeit. Die religiöse Bestandsaufnahme soll mit Hilfe von Typen erfolgen 3S . D a es um die Erkenntnis des wirklichen Menschen geht, müßte man eigentlich einzelne konkrete Menschen beschreiben. „Aber mit solchen religiösen Photographien kann man nichts machen; denn ihre Zahl ginge ins Unendliche und man müßte immer neu photographieren. Darum bedient man sich der Methoden, die das Viele in ein Kleines zusammenzubringen gestatten." 3 9 Sowohl das Verfahren der Induktion als audi das der Statistik bleibt unbefriedigend. Darum fällt die Entscheidung für den Typ 4 0 . Ein Typ ist eine Gedankenschöpfung, die man weder mit einem Begriff noch mit der Wirklichkeit selbst verwechseln darf. Auch Ideal und Typ sollten getrennt bleiben wie Soll und Sein. Der Typ hat heuristische Funktion. Es gilt, die konkrete Wirklich3 7 Vgl. oben S.114, Anm.12 und S. 115, Anm. 15. Auch P . D r e w s begründet die Praktische Theologie in einer Prinzipienlehre, die sich mit systematisdien und exegetischen Fragen befaßt. Vgl. Das Problem der Praktischen Theologie 77. 3 8 Z T h K 19, 1909, 424—427. 39 P T I, 33. 40 P T I, 33 f.
120
keit mit dem Typ zu vergleichen, aber nicht, um sie zu werten, sondern um sie zu verstehen, um gerade in der Abweichung vom Typ die konkrete Eigenart zu erkennen. F. Niebergall beruft sich dabei auf einen Aufsatz von Max Weber 41 . Dieser dringt wie die Ritsehl-Schüler auf eine strenge „Scheidung von Erfahrungswissen und Werturteil" 42 . Die Bildung von „Idealtypen" dient der begrifflichen Schärfe. Bedeutsam ist, auf welchem Wege ein Idealtyp gewonnen wird. Er entsteht nicht, indem man den Durchschnitt sämtlicher zu beobachtenden Phänomene nimmt. „Er wird gewonnen durch einseitige Steigerung eines oder einiger Gesichtspunkte und durch Zusammenschluß einer Fülle von diffus und diskret, hier mehr, dort weniger, stellenweise gar nicht, vorhandener £mze/erscheinungen, die sich jenen einseitig herausgehobenen Gesichtspunkten fügen, zu einem in sich einheitlichen Gedankenbilde. In seiner begrifflichen Reinheit ist dieses Gedankenbild nirgends in der Wirklichkeit empirisch vorfindbar, es ist eine Utopie, und für die historische Arbeit erwächst daraus die Aufgabe, in jedem einzelnen Falle festzustellen, wie nahe oder wie fern die Wirklichkeit jenem Idealbild s t e h t . . . " 4 3 Vergleicht man damit F. Niebergalls Ausführungen in der ZThK 1909 oder in der Praktischen Theologie I, dann wird deutlich, daß er sich die Methode seiner religiösen Volkskunde und deren Hermeneutik von M. Weber vorzeichnen läßt. Das Interesse am Denkmodell des Typs ist in der Eigenart des Kaftanschen Koordinatensystems vorgegeben. Auch bei J . Kaftan hat der Typ heuristische Funktion. Die Suche nach Typen kommt dem Denken der Zeit entgegen. E. Troeltsch gebraucht den Begriff in ähnlicher Weise unter Berufung auf M. Weber und Jakob Burckhardt 44 . In der Verbindung von Ritschlscher Theologie und religionsgeschichtlicher Arbeit erstellt N. Söderblom religiöse Typen 45 . F. Niebergall betont, daß die Darstellung von Typen in einem sehr subjektiven Verfahren erfolgt. „Mit andern Worten,, der Typ ist eine Sache künstlerischer und poetischer Arbeit, die nicht abstrahiert, sondern gestaltet; darum hat er nicht die Geltung des wissenschaftlich Erkannten, aber die Uberzeugungskraft des künstlerisch 4 1 Die Objektivität sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 19, N F 1, 1904. M. Sdimidt weist auf den Begriff des Typus bei Dilthey hin: „Beide, Troeltsch wie Dilthey, entdeckten die unabkitbare und unauflösbare Individualität als den Kern der geschichtlichen Wirklichkeit, und der letztere entwickelte zur Verschärfung und Sicherung dieser Erkenntnis in Auseinandersetzung mit Wilhelm Windelband den Begriff des Typus, der Einzigkeit und Verwandtschaft geschichtlichen Daseins ausdrücken sollte." Z T h K 54, 1957, 177. 4 3 Ebd. 65. M. Weber, a. a. O. 22 Anm. 1. Gesammelte Schriften II, 723. 4 5 Vgl. die Zusammenstellung von F. Heiler in: N . Söderblom, Der lebendige Gott im Zeugnis der Religionsgeschichte, 1966, X I X — X X V I . Vgl. ferner E . Spranger, Lebensformen, Siebenstern-Tb. 35/36, 1965, und R. Wittram, Das Interesse an der Geschichte, Kl.-Vandenhoeck-Reihe 5 9 — 6 1 , 1968 3 , 5 4 — 5 8 . 42
44
121
Geschauten." 49 Im Widerspruch zu seinen Behauptungen in der Antrittsvorlesung gibt F. Niebergall hier zu, daß die Praktische Theologie für ihre Arbeit auf dem Teilgebiet der religiösen Volkskunde Wissenschaftlichkeit nicht in Anspruch nehmen kann. Dieser Widerspruch beruht indes nicht auf einer Inkonsequenz in bezug auf den einmal eingenommenen theologischen Standort, sondern auf einer terminologischen Inkonsequenz. Er kann sich bald von einem positivistischen Wissenschaftsbegriff distanzieren, bald einen an Rickert orientierten geisteswissenschaftlichen Wissenschaftsbegriff für seine Erziehungslehre in Anspruch nehmen. Die für die Wissenschaftlichkeit erforderliche Exaktheit fehlt sowohl bei der religiösen Volkskunde als auch bei der Geschichte. In beiden Fällen beruht die Darstellung auf Konstruktionen, Modellen oder Typen, ja es sind vielfach dieselben Typen, mit deren Hilfe die religiösen Phänomene in Geschichte und Gegenwart beschrieben werden. Der Typ des Bauern ist ζ. B. bestimmt durch seine Arbeit, durch Besitz und Abhängigkeit von der Natur. Daraus folgt eine unpersönliche Wertschätzung der Sachen, eine Theologie des 1. Artikels und eine gesetzliche Auffassung der Religion 4 7 . Der paulinische Kern des Neuen Testaments bleibt ihm unverständlich. Daher kann die Religion des Bauern als Typ verglichen werden mit der alttestamentlichen Gesetzesreligion vor dem Auftreten der großen Propheten oder mit der Religion des Kindes, das ebenfalls gesetzlich denkt und keinen Zugang zu Paulus findet48. Der Typ ermöglicht es, religionsgeschichtliche, religionssoziologische und religionspsychologische Sachverhalte in Beziehung zueinander zu setzen. Er hat die Funktion, zu mannigfaltigen Vergleichen anzuregen. Der konkrete einzelne, mit dem der Pfarrer zu tun bekommt, wird erkannt in seiner Eigenart durch Vergleich mit dem Typ. Die Deutung der Vergangenheit mit Hilfe der Gegenwart und umgekehrt, die Theorie der kulturhistorischen Stufen, die Vorstellung, daß die Gegenwart als Querschnitt enthält, was die Vergangenheit im Längsschnitt zeigt, dies alles wird möglich durch die Erstellung von Typen. Die prästabilierte Harmonie von Hermeneutik und Didaktik setzt eine Typenlehre voraus. F. Niebergall hat das hermeneutische Problem einer religiösen Volkskunde gesehen und löst es mit Hilfe des Erziehungsgedankens. Wenn nämlich der Typ die Funktion hat, zum Vergleichen anzuregen, dann entspricht er dem, was die Formalstufe der Assoziation fordert 4 9 . Das Fehlen einer streng historischen Arbeit wird vom Erziehungsgedanken aus entschuldigt, ja gefordert. « PT1,34. Vgl. P T I, 1 5 0 — 1 6 0 „Der Bauer". Es ist zu berücksichtigen, daß die anschaulichkünstlerische Darstellung durch Aufzählung von Begriffen nur ungenau wiedergegeben werden kann. 4 8 Vgl. P T I, 154. 4 9 Vgl. N R U I, 109. 4
47
122
Der wissenschaftlichen Erkenntnis stellt F. Niebergall die künstlerische Schau gegenüber. Damit soll nicht das Ästhetische zum obersten Kriterium der Theologie gemacht werden. Die Kunst oder das Künstlerische hat bei ihm mit dem Irrationalen, mit dem innersten Ich und mit dem Erleben zu tun 5 0 . Aufschlußreich sind die Aussagen über den Pfarrer als Kultusleiter. Der Kult hat immer auch einen ästhetischen Aspekt. Um so auffallender ist es, daß F. Niebergall die künstlerische Tätigkeit des Pfarrers als Kultusleiter nicht unter diesem Aspekt sieht. „Denn solches will gelernt sein. Und zwar nicht gelernt, wie man ein Handwerk lernt. Handelt es sich doch nicht darum, einfach die Handgriffe kultischen Tuns zu übernehmen, wie sich altes Kultpriestertum, das immer noch nicht ausgestorben ist, seinen Nachwuchs abrichtet; sondern die Sache will gelernt, und das heißt, verstanden und innerlich angeeignet sein. Es handelt sich nicht um handwerkliche, sondern um künstlerische Tätigkeit." 5 1 Hier wird deutlich, daß der Begriff des Künstlerischen die Funktion hat, den Erziehungsbegriff zu interpretieren. Gegenüber einer fehlgeleiteten Erziehung, die den Zögling zwingen will, fertige Kenntnisse zu übernehmen oder ihn zu Fertigkeiten abrichten will, die er nicht versteht, läßt sich wahre Erziehung leiten von dem Wissen um ihre Ohnmacht. Sie kann und will sich nur darum bemühen, den zu Erziehenden zur Selbsttätigkeit anzuregen. In der Selbsttätigkeit nimmt er seine Freiheit und seine Verantwortung wahr. Nur durch Selbsttätigkeit können von außen andringende Erkenntnisse zum eigenen Besitz werden. Sie verschmelzen dabei mit der Eigenart des Individuums und helfen sie formen. Es entsteht etwas durchaus Originelles und Neues. Daher eignet dem Erziehungsgeschehen auf Seiten des zu Erziehenden etwas Schöpferisches. Auf diese Strukturen im Erziehungsbegriff macht der Begriff des Künstlerischen aufmerksam. Er hat eine kritische Funktion, sofern er den Erzieher vor der Versuchung bewahren soll, die Selbsttätigkeit ausschalten zu wollen. Ein künstlerisches Moment ist aber auch beim Erzieher wirksam. Er versucht durch Typenschilderung auf Phänomene und Zusammenhänge aufmerksam zu machen, zum Vergleichen anzuregen und so zu eigener Erkenntnis anzuleiten. Die Erstellung von Typen ist aber selbst schon eine künstlerische Tätigkeit. Auch hier hat der Begriff kritische Bedeutung. Gerade die „unwissenschaftliche" Ungenauigkeit der künstlerischen Darstellung eines Typs fordert zum kritischen Vergleich mit der konkreten Wirklichkeit heraus. Sie gewährt und fordert die Freiheit der Selbsttätigkeit. Auf dem Gebiet des Glaubens hatte F. Niebergall das Problem des Ubergangs vom Wissen um den Glauben zum Glauben selbst gesehen 52 . Nicht identisch damit, aber in der Struktur ähnlich ist das Problem des Ubergangs vom Wissen um erzieherische Tätigkeit zu dieser selbst oder 50 52
Vgl. oben S. 54 f. Vgl. oben S. 52.
"
pT
_
n > 8
123
vom Kennen zum Können 5 3 . Stichworte wie Irrationalität, inneres Ich, das Künstlerische oder das Erleben sollen diesen Übergang in beiden Fällen bezeichnen, aber nicht so, daß damit Methoden oder Praktiken angegeben werden, wie man den Ubergang bewerkstelligen kann, sondern es soll eben dieser Übergang als Grenze alles erzieherischen Tuns markiert werden. D a damals die Meinung vertreten wurde — ζ. B. von R. Kabisch 54 —, der Erzieher könne Erlebnisse schaffen, ist es verständlich, daß E. Brunner, die Kritik der dialektischen Theologie am „Kulturprotestantismus" und seinen Vätern aufnehmend, Gefühl und Irrationalität als unbestimmbares mystisches Halbdunkel versteht und dagegen zur Besinnung, zur taghellen Klarheit des Wortes ruft 5 5 . Diese Kritik trifft auf F. Niebergall nicht zu; denn er möchte mit „Erlebnis" gerade kein Halbdunkel, sondern die Grenze des Erziehers bezeichnen. Aber dies Wissen um die Grenze darf nicht zur Resignation führen — eine Gefahr, die nahe liegt, wo man einseitig die Offenbarung als Grenze, den Glauben als Entscheidung des Augenblicks versteht 56 — wie denn das erzieherische Können nicht ohne Kennen möglich ist. Dem erfolgreichen Handeln kann man Hilfe leisten, „wenn man ein paar Möglichkeiten andeutet, wie sie sich aus den beiden erwähnten Stücken, dem Sinn des Handelns und seinen Grenzen ergeben. Zwischen diesen auszuwählen oder sich im Gegensatz zu ihnen ganz eigene Wege zu bahnen, bleibt der selbständigen Wahl des Einzelnen überlassen, womit sein Recht auf Freiheit mehr gewahrt ist, als wenn er stolz auf andere Erfahrung und grundsätzliche Erkenntnis verzichtet." 57 Hier wird deutlich, daß F. Niebergalls Praktische Theologie in potenzierter Weise Erziehungslehre ist. Sie ist es einmal darin, daß sie künftige Erzieher einer kirchlichen Gemeinde über die Aufgaben und Mittel dieser Erziehung unterrichtet, Kenntnisse vermittelt. Er gibt aber dieser Lehre eine Gestalt, die die Pfarrer befähigen soll, sich durch Selbsterziehung zur erzieherischen Wirksamkeit heranzubilden. Die Lehre, die die Erziehung zum Gegenstand hat, ist selbst ein Erziehungsgeschehen. Ohne darüber zu reflektieren, versucht er durch faktischen Vollzug, die Probleme einer „Denn aus Kennen soll Können, aus nosse soll posse werden." P T I, 2. Vgl. den Abschnitt „Der Unterricht schaffe Erlebnisse" in: Wie lehren wir Religion?, 1910, 117 ff., und „Inwiefern ist Religion lehrbar?", ebd. 63 ff. 5 5 „Jetzt, wo die Irrationalität des Gefühls mit dem Paradox des Glaubens verwechselt wird, muß es zum Entscheidungskampf kommen. Die einzige Waffe, die uns dabei zur Verfügung steht, ist: die Besinnung. Sie ist aber der Mystik von jeher tödlich gewesen. Denn Mystik gedeiht nur im .mystischen Halbdunkel'. Das klare Licht löst sie auf. Sie lebt vom Unbestimmten und Unbestimmbaren. Darum flieht sie das W o r t . . . Wo Wort ist, ist taghelle Klarheit." ThB 17,1, 282 f. 5 4 Vgl. die Ausführungen von D. Solle oben S. 74. 57 P T II, 2. 63
54
124
Didaktik der akademischen Lehre zu lösen. Der potenzierte erzieherische Charakter der Praktischen Theologie hängt einmal daran, daß sie darauf verzichtet, fertige Erkenntnisse zu liefern, um so zur Selbsttätigkeit herauszufordern, zum andern daran, daß sie ihre objektiv wissenschaftlichen Erkenntnisse in Beziehung setzt zum summum bonum als Ausgangspunkt und Ziel der Fragestellung. Die Beschäftigung mit diesem Gegenstand geht von der Frage nach der Wertschätzung aus und führt indirekt zu existentiellem Betroffensein. Zwar kann die praktische Wissenschaft die Theologen nicht fromm machen, aber indirekt intendiert sie doch die Frömmigkeit der Studierenden. Wird die wissenschaftliche Erkenntnis aber so betrieben, „wie eben angedeutet, dann wird auch mittelbar etwas von jener Aufgabe angefaßt. Denn wenn jemand mit der Hauptsache, dem religiösen Kern der Zeugnisse und nicht bloß mit ihrem zeitgeschichtlichen Gewand, in Verbindung kommt, dann wird es sich zeigen, ob sie ihn zum innern Leben erwecken können." 5 8 E. Käsemanns „Kritik eines Reformvorschlages" 59 — der das Studium auf die Ordination als Ziel ausrichten möchte — würde F. Niebergall nicht treffen, da seine Praktische Theologie zwar die Zurüstung von Gemeindeerziehern und indirekt deren Frommsein intendiert, aber vom Erziehungsgedanken her zugleich deren kritisches und selbständiges Denken fordert. Der Aspekt der Frömmigkeit bleibt bemerkenswert, zumal er neuerdings wieder mehr erörtert wird 6 0 . Die Art, wie F. Niebergall seine Erziehungslehre als praktische Wissenschaft begründet, gegenüber einer historisch-systematischen Gelehrsamkeit abgrenzt und mit einem künstlerischen Element verbindet, ist nicht originell. O. Baumgarten bestimmt die Aufgaben einer Erziehungslehre in Christliche Jugend- und Volkserziehung 120. E v T h 12, 1952/53, 245—259. Die These der Reformer lautet: „Das Studium ist so auszurichten, daß es klar auf das Ziel der Ordination hinführt. Theologiestudium ist Zurüstung zum geistlichen Amt." Ebd. 245. Käsemann kritisiert: „Die Risikorechnung fehlt." Ebd. 246. „Berufsausbildung wird hier (seil, an der Universität) merkwürdigerweise gerade nicht als Ausrüstung auf feste Ergebnisse, unveränderliche Ziele und ein .Fertigwerden' getrieben, sondern im Sinne eines dauernden Unterwegs, einer nie entlassenden Verpflichtung, der Kritik gegenüber allem Erreichten." Ebd. 246 f. F. Niebergall sagt im Blick auf das Theologiestudium: „Je weniger man an den Zweck denkt und je mehr man sich der Sache hingibt, desto besser fördert man den Zweck selber." P T I, 442. 58
59
6 0 R. Schäfer sieht die Hauptschwierigkeit des Theologiestudiums in „dem Ausbleiben der mit Anstrengung gesuchten Verifikation . . . Der Theologiestudent weiß in den exegetischen Fächern, in der Dogmengeschichte und in den zeitgenössischen dogmatischen Systemen vortrefflich B e s c h e i d . . . — aber von all dem angeeigneten Stoff hält er innerlich Distanz". Z T h K 65, 1968, 117 Anm. 1. G. Ebeling votiert: „Ich bin aufs höchste beunruhigt, daß jedenfalls ein großer Teil der gegenwärtigen Theologengeneration nicht mehr aus Erfahrung weiß, was es um Frömmigkeit und was es um den Glauben ist." Was heißt: Idi glaube an Jesus Christus?, 1968, 105. Vgl. auch M. Seitz, der im Anschluß an R. Bohren evangelische Asketik als neue Aufgabe der Praktischen Theologie fordert, Die Praktische Theologie zwischen Wissenschaft und Praxis, München 1968, 76 ff.
125
ähnlicher Weise®1. Schon im Titel seines Aufsatzes wird Wissenschaft auf Kunst, Kennen auf Können bezogen. „Dies Können ist aber erstens Sache der Anlage, des Taktes, des Blickes, der Fühlfäden für kindliche Art, und sodann Sache der Übung, des Umgangs, der Gewöhnung." 6 2 Daher haben die praktischen Erzieher die Wissenschaftlichkeit ihrer Arbeit nicht in einer philosophisch systematischen Behandlung ihrer Kunst zu suchen. Nach dem Zusammenbruch des Hegeischen Systems und im Zeitalter der Realpolitik Bismarcks ist man mißtrauisch geworden gegen den Trug der Idee. „Unser wissenschaftlicher Betrieb ist viel mehr induktiv, empirisch geworden. Wir stellen uns die Aufgabe, die Thatsachen, die Ergebnisse der Beobachtungen, die Einzelerfahrungen zu sammeln, sie unter Oberbegriffe, unter Gesetze zu bringen, also aus zufälligen, vereinzelten Daten gesetzmäßige Reihen, aus Symptomen Zusammenhänge von Ursache und Wirkung zu bilden und dann diese Oberbegriffe, diese Kausalzusammenhänge, diese Gesetze der Erscheinungen in wissenschaftlicher, d. h. streng logischer Weise zu verknüpfen."* 3 Dies Drängen auf Empirie und dies Fragen nach Gesetzmäßigkeiten findet sich ebenso bei F. Niebergall. Die Pädagogik scheint hier zunächst eine rein empirische Wissenschaft zu sein. Aber zu ihr gehört auch die Aufgabe, das Ziel der Erziehung zu erkennen. Wieder wehrt sich Baumgarten gegen eine deduktiv philosophische Lösung. „Wissenschaftlich ist eine solche Lehre von den Zielen, wenn sie die geschichtlich entwickelten Ziele in streng logischer Weise verarbeitet und in ihrem geschichtlichen Gewordensein (,genetisch') versteht." 6 4 In der empirischen Untersuchung des Zustandes, der geschichtlichen Erfassung des Zieles und dem Verständnis der Erziehung als einer Kunst stimmen O. Baumgarten und F. Niebergall überein. F. Niebergall versteht die Praktische Theologie im ganzen als Erziehungslehre. Er bezieht Tendenzen, die in der Entwicklung der Disziplin erkennbar werden, ein und nimmt die Forderungen von Fachkollegen auf, die wie er zur „modernen" Richtung gehören. Die Eigenart seines Entwurfs besteht ausschließlich darin, daß er den Erziehungsbegriff zum leitenden Gesichtspunkt der ganzen Arbeit macht. Diese Konzeption wurde vielfach mißverstanden. Einmal sah man in dem Erziehungsbegriff nur ein Aushängeschild der empirischen Grundtendenz, zum andern sah man darin die einseitige Überbetonung eines an sich berechtigten Lieblingsgedankens, wodurch die differenzierte Wirklichkeit in ein gleichmachendes Schema gepreßt würde; dabei wird übersehen, daß der Erziehungsbegriff bei F. Niebergall der Synthese verschiedener Bestrebungen dient und daher seinerseits polemisch gegen Einseitigkeiten gebraucht e l Über die Bedeutung des wissenschaftlichen Betriebs der pädagogischen Kunst, ZprTh 21, 1899, 157—171. 8 2 Ebd. 157. 6 3 Ebd. 158. M Ebd. 159.
126
wird, die dadurch entstehen, daß man ein Element der pädagogischen Trias „Ziel, Zustand, Mittel" allein bearbeitet. Praktische Theologie als Kunstlehre, Handreichung, Technik oder Anwendung fragt einseitig nach den Mitteln. Praktische Theologie als religiöse Volkskunde fragt einseitig nach dem Zustand. Praktische Theologie als systematische Entfaltung des Kirchenbegriffs orientiert sich einseitig an den Normen. Schwieriger wird die Abgrenzung gegenüber der historischen Arbeit eines Achelis. Der Vorwurf der Gelehrsamkeit erweckt den Eindruck, es handele sich bei der praktischen Wissenschaft um ein geringeres Maß an Wissensstoff, um historische Ungenauigkeiten, alles im Interesse der Brauchbarkeit. Das Praktische wäre dann das Praktikable. „Praktisch" bezeichnet aber auch hier bei F. Niebergall den Bereich des Existentiellen. Es geht ihm weniger um Einschränkung der historischen Arbeit auf dem Gebiet der Praktischen Theologie als um eine Änderung der Fragerichtung dieser Arbeit. Die kausale Frage soll durch die teleologische verdrängt werden. Statt nach der Entstehungsgeschichte eines Katechismus, einer Liturgie zu fragen, soll gezeigt werden, welches Verständnis des höchsten Gutes diese leitet 65 . Die Frage nach dem höchsten Gut hat bei F. Niebergall eine ähnliche Funktion wie bei G. Ebeling die Frage nach der Auslegung der Schrift: es sind Fragen, die der historischen Arbeit eine bestimmte Ausrichtung gebenββ. Der Begriff der Wissenschaft ist daher bei F. Niebergall weniger durch historisch belegbare Details und empirische Daten bestimmt als durch die Forderung einer geordneten Erkenntnis. Die Ordnung darf dabei keine dem Gegenstand aufgezwungene sein, sie muß sich aus der Sache selbst ergeben. Als solche sachgemäße Ordnung bietet sich ihm der Erziehungsbegrifi und die pädagogische Trias „Ziel, Zustand, Mittel" an; denn der Ursprung des Glaubens, die Geschichte des Glaubens und die heutige Entstehung von Glauben lassen sich als Erziehungsgeschehen deuten. Das künstlerische Element in diesem Wissenschaftsbegriff hat kritische Funktion und soll die Erziehung von Ideologie freihalten. Zur Eigenart F. Niebergalls gehört ferner die Tatsache, daß er das Methodenproblem der religiösen Volkskunde sieht und mit Hilfe der M. Weberschen Typenlehre zu lösen versucht. Die Aufstellung von Typen hat heuristische Funktion. Sie kann und will dem einzelnen Gemeindeerzieher die Aufgabe nicht abnehmen, selbständig und selbsttätig Menschenerkenntnis zu erwerben. Eigentlich dürfte dann auch die Erstellung historischer Typen und 65
Vgl. TP 94. „Unter ,Auslegung' will nicht nur die ausgesprochene, sondern audi die unausgesprochene, nicht nur die bewußte, sondern auch die unbewußte, nicht nur die positive, sondern auch die negative Beziehung zur Heiligen Schrift verstanden sein." G. Ebeling, Wort Gottes und Tradition, 1964, 24. In ähnlicher Weise findet F. Niebergall Beziehungen zum höchsten Gut, auch w o sie nicht bewußt sind. ββ
127
die daraus resultierende geschiehtsphilosophische Konstruktion nur heuristische Funktion haben, die zu eigenen historischen Forschungen anregen müßte. Weil die Möglichkeit dazu meist nicht gegeben ist, verzichtet F. Niebergall auf diese Forderung und leistet so einer Verwechslung von Geschichtsbild und geschichtlicher Wirklichkeit Vorschub"7. Das Problem der Wissenschaftlichkeit der Praktischen Theologie wird indirekt weiter erörtert werden, wenn nun die Frage nach ihrem Verhältnis zu den andern theologischen Disziplinen gestellt wird.
II. Das Verhältnis der Praktischen Theologie zu den anderen theologischen Disziplinen 1. Die
Fragestellung
F. Niebergall macht das Verhältnis der Praktischen Theologie zu den anderen theologischen Disziplinen nicht zum Gegenstand einer besonderen Untersuchung. Die Fragestellung sowie Lösungsversuche sind aber gegeben in seiner Bearbeitung der Teilaufgaben der Praktischen Theologie, die er „Praktische Dogmatik" und „Praktische Auslegung" nennt 1 . Mit diesen Bezeichnungen übernimmt er die übliche Einteilung der Theologie in historisch-exegetische und systematische Disziplinen, die mit dem Aufkommen der historisch-kritischen Methode in der Neuzeit Bedeutung erhielt und durch die die Einheit der Theologie zum Problem wurde 2 . Die Schwierigkeit besteht darin, daß keine theologische Disziplin aus der Spannung des Verhältnisses von exegetischem und systematischem Fragen entlassen werden kann, da in jeder Teilaufgabe das Ganze latent da sein muß 3 . Dieses Spannungsverhältnis kann auch als das zwischen geschehener und geschehender Verkündigung bezeichnet werden 4 . F. Niebergall 67 Vor dieser Gefahr warnt M. Weber ausdrücklich in dem oben S. 121, Anm.41 genannten Aufsatz. 1 Vgl. PT I, 313—392 „Praktische Dogmatik", Praktische Auslegung des Neuen Testaments, 1914 2 . Praktische Auslegung des Alten Testaments I—III, 1912—1922. 2 Vgl. dazu G. Ebeling, Diskussionsthesen für eine Vorlesung zur Einführung in das Studium der Theologie, in: Wort und Glaube, 1967 3 , 447—457. 3 „Eine Gliederung der Theologie in verschiedene Aufgabenbereiche ist nur dann sinnvoll, wenn jede Teilaufgabe verstehbar ist als eine solche, in der das Ganze latent ist." Ebd. 448, 3. These. 4 Es ist zu bedenken, „inwiefern die geschehene Verkündigung zu geschehender Verkündigung anweist und geschehende Verkündigung angewiesen ist auf geschehene Verkündigung". Ebd. 449. Nach E. Jüngel hat die Theologie dem Ereignis des Wortes Gottes so nachzudenken, „daß es dieses in seinem Geschehen-Sein historisch zu erklären und als erneut geschehendes geschichtlich zu verantworten h a t . . . " Die Praktische Theologie zwischen Wissenschaft und Praxis, 1968, 37. „Die Theologie verantwortet ihre Sache in der Spannung zwischen historischem und dogmatischem Verstehen." Ebd. 39, 1. 31. Vgl. über diese Spannung auch H. Diem, Theologie als kirchliche Wissenschaft II, 1955, passim.
128
möchte die Spannung nicht aufheben. Für seine Theologie ist die Korrelation von Geschichte und Gegenwart konstitutiv; er möchte zeigen, „daß die geschichtlich gerichteten Ansichten eine starke Neigung nach der Gegenwart in sich tragen und daß wir die größten Erkenntnisse nicht auf die Geschichte allein stellen können; daneben aber doch audi das andere, daß die auf die Gegenwart gerichteten . . . Gesamtanschauungen mehr Geschichte in sich haben, als sie zugeben wollen. Wir müssen die erste Bestrebung, von der Geschichte nach der Gegenwart zu kommen, unbedingt billigen. Und die zweite hat auch die Wahrheit auf ihrer Seite, die von der Gegenwart nach der Vergangenheit hinstrebt." 5 Die praktische Dogmatik kann auf die historische und die praktische Auslegung auf die systematische Frage nicht verzichten. Weitgehend mit G. Ebeling übereinstimmend fixiert E. Jüngel das Problem der Einheit und Differenzierung der Theologie noch unter einem andern Aspekt. Für die Einteilung sollte bestimmend sein „dasjenige Minimum an theologischen Disziplinen, das das Maximum an gegenseitiger Entlastung gewährt" e . Die Einheit der Theologie wird gewahrt, weil die „durch eine theologische Disziplin jeweils zu leistende Entlastung der übrigen theologischen Disziplinen . . . deren Belastung mit dem Problembewußtsein der jeweils entlastenden Disziplin" voraussetzt7. Dazu kommt die These: „Theologie vollzieht ihre Einheit als Kritik der theologischen Disziplinen untereinander."8 Ein weiterer Aspekt kommt bei R. Schäfer in den Blick. Er fragt nach dem Sinn der Frage nach dem Wesen des Christentums und findet ihn u. a. darin, „daß das Wesen des Christentums eine Klammer ist, welche die Disziplinen zusammenhält"9. Es ist aber unmöglich, diese Frage ein für allemal zu beantworten, sie gar in eine Formel einzufangen. „Das Wesen des Christentums hat seinen Ort nicht im Medium des Gedankens, sondern in einer tieferen Schicht des Menschen."10 Darum gilt: „Diese Begriffe haben einmal dieses gemeinsam, daß ihre Wahrheit nicht im dogmatischen System für sich, sondern nur in der Aneignung der mit ihnen gemeinten Sache evident wird." 11 Aus diesen neueren Diskussionsbeiträgen ergeben sich die Fragen, mit denen die Praktische Theologie P. Niebergalls konfrontiert werden soll. Inwiefern stützt sich die Arbeit des Praktischen Theologen auf die der andern Disziplinen? Welchen (kritischen) Beitrag leistet er selbst für diese? Inwiefern gestaltet sich für ihn das Verhältnis zu den andern Disziplinen unter dem Gesichtspunkt der Entlastung und Belastung? Worin besteht 5 6 8 10
Handbuch des Religionsunterrichts, hrsg. von H . Richert, 1911, 201. 1 Ebd. 42, 7. E. Jüngel, a. a. O. 41, 6. 1. 9 Z T h K 65, 1968, 344. Ebd. 44, 9. 11 Ebd. 345. Ebd. 344 f.
129
f ü r ihn die Einheit der Theologie? Vermag er deutlich zu machen, daß diese nur in einer tieferen Schicht und in Aneignung der Sache selbst evident wird? Es wird dabei zu zeigen sein, daß mit diesen Problemkreisen keine fremden Fragestellungen an seinen Entwurf herangetragen werden. Es geht nicht so sehr darum, im einzelnen vorzuführen, wie er seine Praktische Dogmatik und seine Praktische Auslegung gestaltet. Vielmehr soll deren Funktion in der Praktischen Theologie und in deren Verhältnis zu den andern Disziplinen aufgezeigt werden. Er kennt neben der üblichen Einteilung noch eine andere Differenzierung der theologischen Aufgabe. Bezeichnend dafür ist der Untertitel von „Theologie und Praxis" (1916): „Hemmungen und Förderungen der Predigt und des Religions-Unterrichts durch die moderne Theologie". Zur Charakteristik der modernen Theologie macht er nicht moderne Vertreter der exegetischen oder systematischen Theologie, sondern bestimmte Fragerichtungen namhaft, nämlich die historisch-kritische, die religionsgeschichtliche und die religionspsychologische12. Im Wechselspiel dieser Methoden wird die Spannung zwischen Exegese und Systematik gewahrt, ohne sie einer bestimmten Disziplin zuzuweisen. Die „moderne Theologie" scheint keine Differenzierung und darum auch kein Problem ihrer Einheit zu kennen. Will man sie mit einer der traditionellen Disziplinen identifizieren, dann am ehesten mit der Praktischen Theologie. Exegese und Dogmatik scheinen nur deren Hilfswissenschaften zu sein. Dieses Selbstbewußtsein beruft sich gern auf Schleiermachers Aussage, daß die Praktische Theologie die Krone aller Theologie darstelle 13 . Freilich wird nun die Einheit der Theologie an einer andern Stelle zum Problem: in dem Verhältnis zwischen der modernen und der alten Theologie. Zwar werden die zünftigen Vertreter der alten Theologie mit ein paar Schlagworten abqualifiziert: „Ubernatürlichkeit — Materialität — Autorität" 1 4 , aber in der Gemeinde bekommt es der moderne Theologe wieder mit den verschiedensten theologischen Richtungen zu tun. Das einheitliche Bekenntnis wird zum Problem. Darf es einfach durch Toleranz abgelöst werden? Die Frage nach dem Verhältnis der Praktischen Theologie zu den andern theologischen Disziplinen wird also überlagert von der nach dem Verhältnis der verschiedenen theologischen Richtungen zueinander. Beide Fragen löst F. Niebergall mit Hilfe des Erziehungsgedankens. 12
Vgl. die Gliederung der Kapitel 1—3 TP (Inhaltsverzeichnis). Diese Trias entspricht der bei E. Troeltsch: Kritik, Analogie und Korrelation. Vgl. Gesammelte Schriften II, 729 fi. 13 Auf die richtige Deutung des Vergleichs macht F. Wintzer aufmerksam, EvTh 27, 1969, 99 Anm. 20. 14 TP 8.
130
2. Praktische
Dogmatik
Wie die Themen der frühen Aufsätze zeigen, gilt F. Niebergalls Interesse von Anfang an den Problemen der praktischen Dogmatik. Er gibt sich auch grundsätzlich Rechenschaft über deren Aufgabe 15 . Ihre Grundgedanken werden in jeder Schrift mehr oder weniger explizit vorgetragen. Eine knappe, zusammenfassende Darstellung gibt er im ersten Band der „Praktischen Theologie" (1918, 313—393). Die wichtigsten Inhalte dieser Dogmatik wurden im 1. Teil der Untersuchung bereits dargestellt und die Aufnahme sowie Umbildung der J. Kaftanschen Dogmatik durch F. Niebergall nachgewiesen. Nun soll nach dem Ort und der Funktion der Praktischen Dogmatik im Rahmen der Praktischen Theologie gefragt werden. Daraus ergibt sich sein Verständnis des Verhältnisses von Praktischer und Systematischer Theologie. Zunächst verdient die Struktur der Praktischen Dogmatik Beachtung. Er möchte positiv aufbauend Grund und Gegenstand seines evangelischen Glaubens darstellen, um die Basis zu zeigen, von der aus die Erziehungsarbeit des Praktischen Theologen getrieben werden soll. Es fehlen daher weitgehend die Negationen. Er verzichtet auf die Erörterung dogmenund theologiegeschichtlicher Probleme. Systematiker, u. a. Schleiermacher, W. Herrmann, J. Kaftan, werden als Gewährsleute genannt, aber keine Abgrenzungen und Nuancierungen vorgenommen. Die Akzentverschiebung zum Subjektiven hin hat eine Änderung im Aufbau gegenüber J. Kaftan zur Folge. F. Niebergall entfaltet seine Praktische Dogmatik unter drei Themen: Die ewige Welt, das Heil, Jesus Christus. Der Himmel — Thema des 1. Unterabschnitts und Chiffre für das höchste Gut — bezeichnet den subjektiv-anthropozentrischen Einsatz. Der Gottesbegriff kann erst sekundär im Hinblick auf diesen Wert verständlich werden. Unter der Uberschrift „Das Heil" werden J. Kaftans Lehrstücke von der Welt, vom Menschen und seiner Sünde, aber auch das Werk Christi, Erlösung und Wiedergeburt, dargestellt. Im Gegensatz zu J. Kaftan wird über die Person Christi und die Trinitätslehre erst im Schlußteil gehandelt. In einer Zeit, die ein undogmatisches Christentum fordert, erhebt sich die Frage, warum der Theologe überhaupt eine Dogmatik braucht. „Aber wir brauchen eine Dogmatik. Denn die Herzens- und Willensfrömmigkeit bedarf der Güter und Ziele. Diese kommen aber bloß in Vorstellungen an uns heran. Und wenn sie wirksam sein sollen, müssen diese Vorstellungen richtig, klar und einheitlich sein." 16 Zum Wesen einer rechtschaffenen systematischen Theologie gehört also, daß sie Glaubenserkenntnis in Ge15
Vgl. Die Aufgabe einer praktischen Dogmatik, in: Festgabe für J. Kaftan, 1920, 243—251. 16 MkPr 1, 1901, 271 f. 131
stalt von Vorstelllungen — also als theoretische Erkenntnis — darbietet und diese zu einer einheitlichen Gesamtanschauung ordnet und innerlich verknüpft. Die Notwendigkeit einer solchen Dogmatik ergibt sich aus dem Erziehungsgedanken. „Aber für das wichtige Werk einer gründlichen Beeinflussung und Umgestaltung langt dieses zerstreute Anschlagen einzelner Tasten nicht; dazu bedarf es einer einheitlich durchgeführten Komposition. Das will die Dogmatik sein." 17 Hier machen sich Einflüsse aus der Pädagogik bemerkbar. F. Niebergalls Zeitgenosse W. Rein erhebt unter Berufung auf Herbart die Forderung eines einheitlichen Erziehungszieles. „Wir dürfen nicht bei einer Mannigfaltigkeit von Erziehungszwecken, die den verschiedenen Seiten menschlicher Tätigkeit allerdings zu entsprechen scheinen, stehen bleiben, sondern müssen zu einem obersten, alles beherrschenden Gesichtspunkt hindurchdringen. Denn Einheit des Plans ist ohne Einheit des Zwecks undenkbar . . . So selbstverständlich es ist, daß bei der Zusammengesetztheit der Erziehungsarbeit eine Vielheit von Zwecken hervortrete, so notwendig ist es zugleich, daß sich die Vielheit der Zwecke, wie sie die Erfahrung bietet, einem obersten Erziehungszweck unterordne, welcher als höchster und als herrschender für die Erziehung erscheint." 18 Der Gedanke an die Einheit des Ziels erhält seine Dringlichkeit unter dem Gesichtspunkt, daß die Erziehung nur so die gewünschte dauernde Wirkung haben kann. „Die Bildung, welche der Erziehende durch die Erziehung gewinnt, soll eine gewisse Festigkeit, eine gewisse Dauer erhalten." 1 9 Dieser Gesichtspunkt spielt auch bei F. Niebergall im Zusammenhang mit der Dogmatik eine Rolle. Er wendet sich gegen die Unart vieler Prediger, in impressionistischer Manier nur Eindrücke und Erlebnisse ungeordnet und willkürlich darzubieten. „Mit solchen zusammengerafften Fetzen aber ist es nicht möglich, die Kosten eines Predigerlebens zu bestreiten und Menschen tief und dauernd zu beeinflussen. Es ist eine Gesamtüberzeugung nötig, die der Prediger haben muß, um einen festen Halt zu b e s i t z e n . . . " 2 0 Statt „Gesamtüberzeugung" kann er auch „Kerygma" sagen 21 . Selbstverständlich hatte er bis 1920 die Kritik am Intellektualismus der Herbartianer zur Kenntnis genommen. Er bejaht die im Geiste der Arbeitsschule erhobene Forderung nach Erziehung durch Gemeinschaft, aber dadurch wird seines Erachtens nicht ausgeschlossen, daß die Erziehung ein System von Gedanken als einheitliches Ziel braucht, das zugleich als Mittel der Beeinflussung auf dieses Ziel hin dienen kann 2 2 . 17 Ebd. 272. Ferner: „ . . . wer dieses Unum hat, wird gesammelte Kraft genug haben, um zu wirken. Wirken ist bloß dem möglidi, der immer ein- und dasselbe, natürlich in Abwandlungen s a g t . . . " Christliche Jugend- und Volkserziehung 114. 18 W. Rein, Pädagogik dm Grundriß 63 f. 10 Ebd. 60. 2 0 Festgabe für J . K a f t a n 245. 2 1 Ebd. 244. 22 Vgl. ebd. 243.
132
Die Pädagogik der Herbatianer bestimmt die systematische Ausgestaltung des Erziehungsbegriiis bei F. Niebergall. Sie ist nicht nur in einzelnen Motiven, etwa den kulturhistorischen Stufen, wirksam. Wird die Praktische Theologie vom Erziehungsgedanken aus konzipiert, dann ergibt sich daraus von selbst die Notwendigkeit einer systematischen Theologie. Sie entspricht einem pädagogischen Bedürfnis der Praktischen Theologie. J . Kaftans Dogmatik kommt dem besonders entgegen. Er hatte programmatisch die Korrelation von Theologie und Kirche herausgestellt und auf die Bedeutung der systematischen Theologie für die praktische hingewiesen 23 . Diese Korrelation ist aber nur ein Aspekt des Verhältnisses von Lehrer und Schüler. Die Dogmatik muß wirksame geistige Kräfte darbieten. Es dürfen keine disparaten Gedanken sein, „die unter dem Gesichtspunkt größter Zweckmäßigkeit ausgesucht und zusammengestellt sind. Die Pfeile des Homileten müssen im Köcher einer einheitlichen Auffassung und Beurteilung der Welt und des Lebens stecken. Nur daß es eben eine praktisch gerichtete ist, das heißt eine solche, die einen alles umfassenden und übersteigenden Wert und Zweck aufstellt, der das Denken und Handeln bestimmt. Diese Gesamtauffassung müßte sich aber irgendwie als wahr und nicht nur als zweckmäßig erweisen lassen, indem ihr Zusammenhang mit dem aufgewiesen wird, was uns sonst als Wissen um Welt und Mensch feststeht." 24 Der Ausdruck „zweckmäßig" wird hier in verschiedener Bedeutung gebraucht. Zerstreute Eindrücke können als zweckmäßig gelten, sofern sie sich als praktikabel erweisen. Eine einheitliche Gesamtauffassung ist zweckmäßig, sofern sie auf einen Zweck ausgerichtet ist. Gemeint ist ein oberster Zweck oder Wert: das höchste Gut. Dieses ist als Umschreibung des biblischen Reichgottesbegriffs legitimer Gegenstand der Theologie. Zweckmäßigkeit bedeutet daher soviel wie Sachgemäßheit. Diese besteht darin, daß die systematische Theologie ihre einzelnen „Lehren" einheitlich auf das summum bonum als unum ausrichtet, darin ihren praktischen und zugleich pädagogischen Charakter gewinnt, wobei „praktisch" wieder den Bereich des Existentiellen, nicht des Praktikablen meint, und daß sie dies alles vor dem gegenwärtigen Wissen um Welt und Leben als Wahrheit verantwortet. Der Praktische Theologe hat ein an J . Kaftan geschultes klares Urteil über die Aufgabe und das Wesen der systematischen Theologie, dem dann wiederum die J . Kaftansche Dogmatik als sachgemäß in vorbildlicher Weise gilt. In diesem Zirkel kommt die Einheit der Theologie zur Erscheinung. Sie kommt zustande durch die Ausrichtung aller theologischen Arbeit auf den Begriff des höchsten Gutes, an dem sich audi die Praktische Theologie 2 3 Vgl. J . K a f t a n s programmatischen Aufsatz „Theologie und Kirche", Z T h K 1, 1891, 1 ff. 24 MkPr 1, 1901, 272.
133
orientiert. Er enthält die Antwort auf die Frage nach dem Wesen des Christentums, darf aber nicht als Versuch mißdeutet werden, dieses in eine Formel einzufangen. Denn als Wertbegrifi kann das summum bonum nur in einer entsprechenden Wertschätzung, die der inneren Freiheit entspricht, verifiziert werden. J. Kaftan und F. Niebergall kommen hier den oben genannten Intentionen von R. Schäfer nahe. Die strenge Korrelation zwischen systematischer und praktischer Theologie hat zur Folge, daß auch der praktische Theologe systematische Grundgedanken zu obersten Kriterien seiner Arbeit macht. Der praktische Charakter der Theologie wird gegen E. Troeltschs „Intellektualismus" ins Feld geführt. Beim Vergleich der religionspsychologischen Entwürfe von R. Otto und H . Maier fällt die Entscheidung für diesen trotz seiner atheistischen Auffassung, weil er sich an der Frage der Wertschätzung orientiert 25 . Die Dogmatik entscheidet in psychologischen Fragen, und die Möglichkeit, jene von der Psychologie her in Frage zu stellen, wird nicht erwogen. Es wird zu zeigen sein, daß dogmatische Thesen auch in der Praktischen Auslegung eine sachkritische Funktion haben. Die strenge Korrelation fordert eine genaue inhaltliche Entsprechung von systematischer und praktischer Theologie. Die praktische Aufgabe läßt sich nicht von jeder beliebigen Dogmatik aus lösen, z. B. nicht von der durch Ubernatürlichkeit, Materialität und Autorität gekennzeichneten „alten Theologie" aus 26 , sondern nur von einer sachgemäßen, einheitlichen und praktischen aus. Praktische Theologie läßt sich nur von einem bestimmten theologischen Standpunkt aus treiben, dem sie dann auch in ihrer Gestalt zu entsprechen hat. „Das Verhältnis einer solchen Pr. Th. zu der Gesamttheologie ist viel enger als das der alten Art unserer Disziplin, die im wesentlichen als Technik gedacht, gleich gut und gleich schlecht zu einer jeden Art von Theologie paßt." 2 7 F. Niebergall weiß, daß diese Betonung der „Richtung" bisher in der Praktischen Theologie nicht üblich war, also etwas Neues, einen Fortschritt darstellt 28 . Die systematische Theologie trägt zur Arbeit der praktischen bei, indem sie ihr ein einheitliches, praktisches und wahres Ziel gibt. Umgekehrt leistet die praktische Theologie einen Beitrag zur systematischen, indem sie den Studenten und Pfarrern den Weg von der Theologie zur praktischen Wirksamkeit bahnt. Sie verwandelt dabei Hemmungen in Förderungen 29 . Die Praktische Theologie bestätigt die Arbeit der andern Disziplinen, indem sie deren praktischen Charakter verifiziert; sie erweist nicht die „Lehren" als praktikabel, sondern die praktische Ausrichtung als sachgemäß. In der Durch25
Vgl. Christliche Jugend- und Volkserziehung 65 f. 27 Vgl. TP 5—13, besonders 8. MkPr 3, 1903, 274. 28 Vgl. PT I, 9. D. Rössler kommt in seinem Aufsatz „Positionelle und kritische Theologie", ZThK 67, 1970, 215 ff. den Vorstellungen Niebergalls sehr nahe. 2 » Vgl. PT 1,10. 29
134
führung praktischer Aufgaben zeigt sich die Notwendigkeit einer sachgemäßen, d. h. praktisch gerichteten systematischen Theologie. F. Niebergalls praktische Dogmatik impliziert die Forderung, daß der Pfarrer und Gemeindeerzieher theologisch einen festen Standort bezieht, den er erst einmal kennen, sich aneignen, dann aber auch entfalten und verteidigen können muß. Das bedeutet aber nicht, daß er alle Gemeindeglieder zu Anhängern seiner „modernen" Theologie machen soll. Er kann und will seine praktische Dogmatik nicht absolut setzen. Die für den Pfarrer geforderte Bekenntnisfreiheit muß auch für Gemeindeglieder gelten 30 . „Es muß mehr Raum für die Mannigfaltigkeit der Geister gewährt werden." 31 Das pädagogisch gedachte Persönlichkeitsideal verlangt, daß die Eigenart des Individuums respektiert und gefördert werde. Die Gemeindeglieder können zu selbständigem Urteilen in Glaubensdingen nur unter der Voraussetzung erzogen werden, daß der Gemeindeerzieher zuerst selbst zu eigenem Urteil gelangt ist. Im Unterschied zu nur angelerntem Wissen, zu Gelehrsamkeit oder bloßer Routine der Amtsführung nennt F. Niebergall dieses Urteilsvermögen Bildung 32 . Bildung gibt Freiheit und Überlegenheit, den andern zu ermuntern, seinen Weg selbst zu suchen. Er denkt hier nicht anders als P. Drews: „Er (seil, der Theologe) muß gebildet, theologisch und religiös gebildet genug sein, um jedes zu verstehen, jedes zu tragen. Die Zeiten müssen endlich hinter uns liegen, wo der orthodoxe Pfarrer alle orthodox, der liberale alle liberal machen will." 33 Die praktische Dogmatik ist Grundlage und Ausdruck einer solchen Bildung. Warum kann F. Niebergall die Darstellung und Entwicklung der Dogmatik nicht einfach dem Systematiker überlassen, sondern weist diese Aufgabe noch einmal dem Praktischen Theologen zu? Die Begründung dafür ist zunächst in dem Unterschied zwischen der rein systematischen und der praktischen Dogmatik zu suchen. Ergänzend zu den im 1. Teil der Untersuchung aufgezeigten Lehrdifïerenzen und Akzentverschiebungen gegenüber J. Kaftan muß hier angemerkt werden: „Allein der Dogmatiker darf nicht weiter gehen, als daß er ein System darbietet, das auch praktisch wertvoll werden kann." 34 Seine Aufgabe bleibt die theoretische Erkenntnis. Dem kirchlichen Wirken dient sie nur mittelbar. Darum muß darüber nachgedacht werden, „wie dogmatisches Gut in homiletisches und katechetisches verwandelt werden kann" 3 5 . Durch die Arbeit des Prakoo Vgl. P T 1 , 4 4 2 . 31 PT I, 258 f. M. Ra.de fordert: „Die Konsequenz, die die Kirche ziehen muß, ist, daß sie die Ketzerei, die Heterodoxie, ihren Gliedern absolut frei gibt." Unbewußtes Christentum, Tübingen 1905, 19. 32 „Eine solche allen Äußerungen zugrunde liegende einheitliche Anschauung ist das Kennzeichen des wissenschaftlich gebildeten Theologen." MkPr 1, 1901, 282. 33 34 P. Drews, MkPr 1, 1901, 7. Festgabe für J. Kaftan 247. 35 Ebd. 135
tischen Theologen verwandelt sich die Glaubenserkenntnis unter dem Gesichtspunkt des "Wirkens, d. h. der Erziehung. „Aus dem Begriff des Wirkens, wie er aller kirchlichen Tätigkeit zugrunde liegt, und aus dem Wesen des Glaubens, wie er die Glaubenslehre begründet, sollen planmäßig Anweisungen gewonnen werden, die den Inhalt dieser umzugestalten helfen sollen, um sie jenem zuzuführen." 38 Der Systematiker lehrt verschiedene Glaubensaussagen als Ausdruck für ein einheitliches Glaubensziel verstehen und verantwortet ihre Wahrheit. Der Praktische Theologe lehrt dieselben Aussagen — das Ziel fest im Auge — verstehen und gebrauchen als Mittel der Erziehung auf dieses Ziel hin. Einheit und Differenzierung zwischen systematischer und praktischer Dogmatik sind darin begründet, daß die Glaubenserkenntnis zugleich als Ziel und als Mittel der Erziehung in Betracht kommt. Der Sinn der praktischen Dogmatik besteht nicht darin, „daß an einen Satz der theoretischen ein praktischer Anhang gefügt werde, sondern sie sei vielmehr von Grund aus als zur Regelung der Frömmigkeit bestimmtes Mittel gedacht" 37 . Weil die Arbeit des Systematikers und die des Praktischen Theologen unter verschiedenen Gesichtspunkten getrieben wird, muß dieser die dogmatische Aufgabe noch einmal in Angriff nehmen. Vom Erziehungsgedanken her ergeben sich weitere Gründe für dieses Verfahren. Wahre Erziehung sucht zu verhindern, daß Wissen nur angelernt oder eine Lehrmeinung einfach übernommen wird. Sie will zu wirklicher Aneignung von Erkenntnis verhelfen, die nur durch Selbsttätigkeit zustande kommen kann, wobei die Erkenntnis durch die Individualität des Aufnehmenden gleichsam gefiltert wird. F. Niebergall kann sich daher die Dogmatik seines Lehrers J. Kaftan nur aneignen, indem er sie „selbsttätig" neu formuliert. Er muß seinen theologischen Standpunkt — gewiß mit Hilfe anderer — selbst verantworten. Es wäre inkonsequent, würde er vom Leser erwarten, daß er seine praktische Dogmatik übernimmt. Auch dieser muß seine Theologie selbst verantworten und daher selbst erarbeiten. Hier wird noch einmal deutlich, daß F. Niebergalls Praktische Theologie Erziehungslehre in potenzierter Weise ist. Die praktische Dogmatik soll ein festes Kerygma bieten, das zugleich Ziel und Standpunkt gibt. Sie lehrt aber auch dieses Kerygma als Erziehungsmittel verstehen und gebrauchen, schließlich hat sie als pädagogisches Modell die Funktion, den künftigen Erzieher von der Notwendigkeit eines solchen Kerygmas zu überzeugen und ihn zugleich zur selbständigen Erarbeitung eines solchen zu ermuntern. „Es handelt sich also um das christliche Kerygma, nicht im 36 Ebd. 248. „Aus einem Gefüge dogmatischer, also theologisch-logischer Art, das Wirklichkeit abbildet, soll dann ein teleologisch-pädagogisches werden, das Wirksamkeit unterstützt." Ebd. 37 PT 1,313.
136
absoluten Sinn, sondern in der Beschränkung, wie sie in der Person des Darstellers gegründet ist, also mit der Bestimmung, mindestens ein Reiz für andre zu sein, ihre eigenartige Auffassung von diesem Kerygma herauszustellen." 38 In dieser mehrfachen pädagogischen Funktion ist die Praktische Dogmatik F. Niebergalls besonders geeignet, die Wesenszüge seiner Praktischen Theologie und deren Originalität zu verdeutlichen. Er hat in diesem Unternehmen keine Nachahmer gefunden, abgesehen von O. Baltzer, der sich in seiner „Praktischen Eschatologie" (1908) als Schüler F. Niebergalls bekennt 39 . Ergänzend und abschließend sollen einige Abgrenzungen vorgenommen werden. Die praktische Dogmatik hat nicht mit „dem homiletischen Kleinschlag einzelner Gedanken und Winke" zu dienen 40 . F. Niebergall will weder eine Laiendogmatik nodi Theologie für Nichttheologen noch eine Einführung in die Dogmatik J. Kaftans schreiben. Die praktische Dogmatik ist für den Fachtheologen im praktischen Amt zur Information und Unterrichtung, mehr noch zu seiner Erziehung, d. h. als Impuls zur Selbsttätigkeit, bestimmt. Während die neueren Diskussionsbeiträge zum Problem der Einheit und Differenzierung in der Theologie die Frage mehr grundsätzlich angehen, gleichsam Prolegomena zur Theologie bieten, versucht F. Niebergall über die bloße Reflexion der Fragestellung hinauszukommen und die Aufgabe zu lösen, indem er sie konkret durchführt 41 . 3. Praktische a) Aufgabe
und
Auslegung
des Neuen
Testaments
Abgrenzungen
Die Vertreter der wissenschaftlichen Theologie stehen einer „Praktischen Auslegung" meist mit Skepsis gegenüber42. Es entsteht der Verdacht, es sei Erbaulichkeit auf Kosten der Wissenschaftlichkeit intendiert. W. Marxsen 38
39 PT I, 316. Vgl. 14. 24. 125. 144. MkPr 1, 1901, 272. 41 „In der Philosophie sind die Vorstudien und Prolegomena so vorherrschend, daß es einem Mathematiker nicht leicht werden wird, sich einzufühlen in dieses planmäßige Ausweichen vor dem, was nur dadurch bezwungen werden kann, daß es geleistet wird. ,Der liebe Gott wohnt im Detail'." H. Scholz, Warum idi midi zu Karl Barth bekenne. In: Antwort, 1956, 868. Angesichts dieser Klage wird man F. Niebergalls Versuch, Probleme zu zwingen, indem sie geleistet werden, besonders hoch schätzen. 42 W. Marxsen urteilt: „Praktische Exegese kann dann nur nachwissenschaftliche sein — oder sie ist Dilettantismus. Ich schlage überhaupt vor, den Begriff der praktischen Exegese aufzugeben." EV 35. M. N o t h meint: „Wenn aber das geschichtliche Wesen des Alten Testaments in der Exegese an keinem Punkte ausgeschaltet werden kann, bleibt dann nicht doch schließlich angesichts der überlieferten Zugehörigkeit des Alten Testaments zur christlichen Bibel nur noch der Sprung über jene Kluft hinweg hinein in eine .praktische Auslegung' übrig, die von der Notwendigkeit der ,historisdi-kritischen' Exegese einfach absieht, vielleicht mit einem einigermaßen schlechten oder wenigstens unsicheren wisesnschaftlichen Gewissen . . . " ThB 11, I960 3 , 57. 40
137
fragt: „Oder ist hier gar eine Exegese gemeint, die ,nicht so wissenschaftlich' ist?" und schlägt daher vor, „den Begriff der praktischen Exegese aufzugeben"' 13 . Um MißVerständnissen vorzubeugen, sollen daher zunächst «in paar Abgrenzungen vorgenommen werden. F. Niebergall möchte sich in seiner praktischen Auslegung wissenschaftlicher Methoden bedienen, die er als Messer an die Schrift ansetzt, „nämlich das literarkritische, das religionsgeschichtliche und das allergefährlichste, das religionspsychologische Messer" 4 4 . Intendiert ist weder Erbauung noch Information der Laien. Er wünscht sich Theologen als Leser. Seine praktische Auslegung unterscheidet sich dadurch von entsprechenden Werken A. Schlatters 45 und von den „Schriften des Neuen Testaments" (hrsg. von J . Weiß), welche den gebildeten Laien über die Methoden und Ergebnisse der wissenschaftlichen Auslegung informieren sollen 4e . Von der homiletischen und katechetischen Literatur, deren Auslegung direkt in Predigt- und Stundenskizzen übergeht, unterscheidet sich seine praktische Auslegung durch den Verzicht auf konkrete Anweisungen. Die Verantwortung für die rechte Konkretisierung will er dem Pfarrer oder Lehrer nicht abnehmen, sondern gerade zumuten. Diese Verantwortung wird wahrgenommen, wenn die Arbeit der wissenschaftlichen Exegese direkt und kontinuierlich in die Predigtarbeit über- und eingeht. Die Predigtnot besteht darin, daß dieser „Brückenschlag" so selten gelingt, oft gar nicht versucht wird. W. Marxsen sucht die Ursachen für dieses Versagen der Prediger heute weniger im homiletischen als im exegetischen Bereich F. Niebergall läßt sich vom selben Gesichtspunkt leiten, wenn er seine Homiletik (Wie predigen wir dem modernen Menschen? I 1902) mit einer praktischen Auslegung des Neuen Testaments, genauer mit einer praktischen Theologie des Neuen Testaments beginnt 48 . Er bezeichnet seine „Praktische Auslegung des Neuen Testaments" als eine Methodenlehre, die zum Brückenschlag anleiten soll. Sie beginnt daher mit einer ausführlichen Einleitung, die eine Hermeneutik, eine grundsätzliche Dar4 4 P A N T 9. E V 34. 35. F. N i e b e r g a l l urteilt über Sdilatters Schriften : „ . . . sie holen auf G r u n d einer geschichtlichen Erkenntnis des T e x t e s erbauliche G e d a n k e n f ü r das heutige Christenleben heraus." P A N T 43. Schlatter legt den Römerbrief aus, „ohne den Unterschied der Zeiten und die A u f g a b e des P f a r r a m t e s zu berücksichtigen". P A N T 297. 4 8 O . B a u m g a r t e n schreibt über das Ziel dieses Bibelwerks: „Sie wollen eine bescheidene, in engen G r e n z e n gehaltene Vorarbeit leisten f ü r die lebhafter zu betreibende A u f k l ä r u n g s a r b e i t der Geistlichen und Lehrer einerseits, f ü r die bisher nahezu u n m ö g liche Selbstbelehrung der Laien über das N e u e Testament andererseits." D i e Schriften des N e u e n Testaments, hrsg. v o n J . Weiß, I, 1906, 2. 4 7 Vgl. E V 37. Z u r K r i t i k an W. M a r x s e n vgl. Chr. Möller, V o n der P r e d i g t zum T e x t , 1970, 3 6 — 5 0 . 4 8 W p m M I, 3 — 6 9 . 43
45
138
Stellung der Methode bietet. Da aber seine Pädagogik wesentlich vom Gedanken an Gewöhnung und Übung bestimmt ist, begnügt er sich nicht damit, die Methode an wenigen Stellen des Neuen Testaments exemplarisch zu zeigen, sondern gibt eine Auslegung des gesamten Neuen Testaments. „So stellt also das Ganze eine Verbindung von Methodik und praktisch brauchbarer Gedanken-Stoffsammlung dar, um sowohl dem Theoretiker Anlaß zum Verfolgen der Grundsätze wie auch dem Praktiker Hilfe für seine Arbeit zu bieten." 49 Aber auch die Darbietung von praktischen Stoffen dient der Einübung in die Methode. „Das Buch ist also, um es noch einmal ganz deutlich zu sagen, nicht als Nachschlagewerk, sondern als Methodenlehre gedacht." 50 In der Verbindung von Hermeneutik und konkreter Anwendung besteht das Wesen dieser praktischen Auslegung. Wie bei der praktischen Dogmatik ist die pädagogische Intention deutlich zu merken. Beabsichtigt ist eine Erziehung der Gemeindeerzieher zu selbständigem theologischen Arbeiten. Audi hier ist eine Entsprechung zu W. Marxsen festzustellen. Dieser möchte zwischen guten und schlechten Predigten einerseits und guter oder schlechter Predigtarbeit andererseits unterscheiden und sich mit den Problemen der letzteren beschäftigen. Ob die Predigtarbeit als ganze gut ist, entscheidet sich daran, ob einer den Weg, die Methode kennt 51 . Im Unterschied zum Laien- oder Sektenprediger darf der Pfarrer als Akademiker in seiner nachwissenschaftlichen Exegese nicht vom Neutestamentier abhängig sein. „Er kann seine Verantwortung nicht delegieren." 52 F. Niebergall nennt als Vorbilder für seine praktische Auslegung J. Holtzmann und R. Rothe 53 . In der ersten Auflage erschien diese als Band V des Lietzmannschen Handbuches. Daß er nicht die Absicht hat, dessen philologische Exegese Zug um Zug in praktische zu übersetzen, ergibt sich schon aus der Tatsache, daß Band V vor den letzten Lieferungen der andern Bände erschienen ist 54 . In den Literaturangaben wird auf wissenschaftlich wie auf praktisch ausgerichtete exegetische Literatur verwiesen. Der Hinweis zum Lukasevangelium: „Zur Auslegung ist häufig die Erklärung von Joh. Weiß in den ,Schriften des N T ' ...herangezogen w o r d e n . . . " 5 5 trifft auch auf das Markusevangelium zu, wie ein Vergleich der Auslegungen beider Werke zu Mk. 4,1—20 zeigt. 49
50 P A N T IV P A N T 44. 52 EV31. EV 35. 53 P A N T 44. 54 Die 1. Auflage der P A N T erschien als Band V des Lietzmannsdien Handbuches 1909. Die einzelnen Lieferungen zu Band III erfolgten zwischen 1906 und 1913 (siehe a. a. O. ohne Seitenzahl). Im Vorwort zur 2. Auflage begrüßt F. Niebergall die Trennung vom Handbuch. P A N T V. 55 P A N T 167. 51
139
b) Das Verhältnis von historischer und systematischer Fragestellung in der praktischen Auslegung des Neuen Testaments Die wissenschaftlichen Methoden der praktischen Auslegung sind dieselben wie die der „modernen Theologie" 5 6 . Es wird vorausgesetzt, daß der theologisch gebildete Leser diese zu handhaben versteht. Denn F. Niebergall verzichtet weitgehend auf detaillierte Exegese und begnügt sich mit den Ergebnissen. Während Joh. Weiß in seiner praktischen Exegese für gebildete Laien die Argumente anführt, die die „Parabeltheorie" (Mk. 4, 11—13) als redaktionellen Einschub erkennen lassen und mehr nebenbei bemerkt, daß die Aussagen des Abschnitts — wenn auch in anderer Form und an anderem Ort — nicht unsinnig sind, erhält F. Niebergalls Auslegung dieser Stelle durch das Fehlen der kritischen Argumente etwas Verschwommenes 57 . Er kann auch auf religionsgeschichtliche Erkenntnisse verzichten, wenn sie keinen praktischen Gedanken abwerfen 5 8 . Wichtiger als die Anwendung der religionswissenschaftlichen Methoden im Einzelfall ist ihm der Hinweis auf deren Voraussetzungen und Folgen. Diese Methoden zeigen den Gegensatz zwischen der alten, von der Verbalinspiration geprägten oder abhängigen Theologie und der modernen Theologie. Das alte Schriftverständnis ist durch Absolutheit, Objektivität und Ganzheit bestimmt 59 . Die Schrift ist oder enthält die absolute Wahrheit. In ihr ist Offenbarung objektiv da, unabhängig von der subjektiven Aneignung. Dadurch erhalten alle Teile der Schrift einen gleichmäßigen Offenbarungscharakter. Voraussetzung ist ein Supranaturalismus oder Dualismus, der die Schrift als ein vom Himmel gefallenes Buch aus der Welt ausgrenzt, auf geschichtliche Erkenntnis verzichtet und seine Entscheidungen nach Postulaten trifft. Die moderne wissenschaftliche Auslegung steht zu dem allem in einem strikten Gegensatz. Durch die historische Untersuchung verliert die Schrift ihren absoluten und objektiven Charakter. Sie ist als rein menschliches Erzeugnis wie andere Bücher zu interpretieren und verliert dadurch ihre Einheit. Es gibt nicht „die Schrift", sondern nur „Schriften", Schichten und Quellen. Der Supranaturalismus wird durch Evolutionismus, die Postulate werden durch die Anerkennung der Wirklichkeit ersetzt. Daraus ergibt sich die Freiheit und Vgl. oben S . 1 3 8 , A n m . 4 4 . Vgl. Die Schriften des Neuen Testaments I, 100 und P A N T 9 2 : „V. 11 und 12 beim Wort zu nehmen, wird sich nur der entschließen, der wie der Autor dieses Wortes, im Erfolg gläubig die göttliche Absicht sieht. Schließlich ist Rom. 9 nicht milder und der harte Ernst Jesu ebenso historisch wie heilsam." 5 8 W. Bousset macht bei 1. Kr. 2, 6 — 1 6 darauf aufmerksam, daß Paulus hier im Sprachgebrauch der Mysterienreligionen zwischen Eingeweihten und nicht Eingeweihten unterscheidet und daß unter den Archonten halbgöttlidie Engelwesen zu verstehen sind. Die Schriften des Neuen Testaments II, 71 f. F. Niebergall sieht in seiner Auslegung der Stelle ( P A N T 347) von solchen Erkenntnissen völlig ab. 5 9 Vgl. zum Folgenden P A N T 8. 58
57
140
Notwendigkeit der Sachkritik. Man darf und muß sagen: „So sagt Paulus, aber so sagen wir nicht mehr . . . " 6 0 Nach F. Niebergall entspricht einer bestimmten Theologie immer eine bestimmte Pädagogik oder praktische Theologie. „Man kann wohl sagen, daß jede theologische Gesamtrichtung eine bestimmte Religionspädagogik hat, die ihrem Wesen entspricht; die Geschichte der Theologie wiederholt sich immer in der der Methodik." 61 Der Kritik an der alten Theologie entspricht die des autoritativ-intellektualistischen Lehrbetriebs in Unterricht und Predigt. Der Grundsatz der neueren Pädagogik, daß es zu wirklicher Aneignung nur durch Selbsttätigkeit kommen kann, wird verletzt. Es ist eine wichtige Funktion der wissenschaftlichen Exegese, diese pädagogische Kritik zu unterstützen und zu bestätigen. Darüber hinaus hat sie die positive Aufgabe, die praktische Ausrichtung der neutestamentlichen Schriften nachzuweisen und so das Recht einer praktischen Auslegung zu bestätigen. Es geht um den Nachweis, „daß die Praxis die Schrift braucht, und zum andern, daß die Schrift auf die Praxis angelegt ist" 62. Daraus folgt, daß die praktische Auslegung nicht nur bescheiden neben oder nach der wissenschaftlichen Exegese ihr Dasein fristen darf. „Vielmehr erheben wir den Anspruch, nicht nur auch ein Recht auf die Schrift zu haben, sondern von unserer Anschauung aus die beste und brauchbarste Weise ihrer Verwendung zu finden."63 F. Niebergall verzichtet dabei auf eine Deduktion der Notwendigkeit der Schrift für die kirchliche Praxis. Es genügt, daß sie durch die Geschichte vorgegeben ist und niemand ihre Bedeutung anzweifelt 64 . Daß die Schrift auf die Praxis angelegt ist, findet seinen Ausdruck in der Arbeitshypothese, daß sie auf Wirken angelegt ist. Sie daraufhin zu befragen ist wichtiger als alle dogmatische oder religionsgeschichtliche Betrachtung. „Wirken ist eine Tätigkeit, die einen gegebenen Zustand gemäß einer Norm mit geeigneten Hilfsmitteln gestalten will." 65 Das bekannte Schema zeigt, daß „Wirken" nur ein anderes Wort für „Erziehen" ist. Das in seiner Homiletik gebrauchte Schema der Motive und Quietive ist ebenso wie der Begriff „Erbauung" eine Umschreibung des Erziehungsbegriffs. Die Aufgabe des Pfarrers besteht in nichts anderem „als in der Heranbringung der christlichen Motive und Quietive an die großen und kleinen Leute. Das heißt für uns ,wirken', das ist Erbauung." fle Der Erziehungsbegriff ermöglicht 01 62 63 «» P A N T 12. TPI. PANT2. Ebd. 94 P A N T 6. In dieselbe Richtung weisen die Aussagen von G. Harbsmeier: „Einheit und Verschiedenheit von Wort und Sakrament sind uns faktisch gegeben, aber nicht prinzipiell ableitbar." D a ß wir die Predigt und sein Wort nicht verachten, 1958, 49. Vgl. dort den ganzen Abschnitt über die Kanonizität von Wort und Sakrament. 65 P A N T 3. ββ Vgl. WpmM I, 149, PT II, 11. Das Begriffspaar „Motive und Quietive" findet sich schon bei H. L. Martensen, Ethik I, 1883 4 , 144. Der Sache nach spielt es auch bei A. v. Harn adi eine Rolle, Das Wesen des Christentums, 49.
141
den Brückenschlag von der Vergangenheit zur Gegenwart, von der Schrift zur Predigt. „Jene Bemerkungen über das Wirken erschließen uns vielleicht nicht nur die Aufgabe unseres Tuns für heute, sondern audi das Wesen derer, die früher einmal ähnlich gearbeitet haben. Denn worin liegt einer Persönlichkeit Wesen anders zutage als im Wirken auf ihre Zeit?" 67 Man darf die neutestamentlichen Schriften nicht nach den Weltbildern und Vorstellungen, sondern nur nach dem Willen ihrer Verfasser fragen. Der Erziehungsgedanke ist das hermeneutische Prinzip, das der Auslegung zu Grunde liegt. Seine Bezogenheit auf die Trias „Norm, Zustand, Hilfen" weist auf die Verschiedenheit der theologischen Zeugen einst und heute hin und kann zugleich deren Einheit im Geist deutlich machen. Voraussetzung für ein geschichtliches und praktisches Verständnis der Schrift ist die Erkenntnis: „ . . . sie besteht aus den Niederschlägen der geistigen Tätigkeit von Personen, die eine Wirkung im religiös-sittlichen Sinne zu ihrer Zeit haben ausüben wollen. Das vereinigt sie alle miteinander; aber der Zielpunkt und die Mittel sowie die Voraussetzungen ihres Wirkens trennen sie." 68 Eine ähnliche Auffassung vertritt O. Baumgarten in seiner Einleitung zu den „Schriften des Neuen Testaments", die den bezeichnenden Titel trägt: „Über den praktischen Wert einer geschichtlichen Auslegung des Neuen Testaments." 69 Die lediglich gelehrte Arbeit kann seiner Meinung nach das Bedürfnis nach einem lebendigen Schriftverständnis nicht befriedigen. Da das geschichtliche Verständnis ein Gefühl des Abstands vermittelt, ist zu fragen, ob es nicht eher hinderlich ist. Es hat aber positive Bedeutung, sofern es die Gegenwart aus einem knechtischen, katholischen Verhältnis zur Vergangenheit und aus der Herrschaft des Buchstabens entläßt. Mit Herder ist die „Wahrheit der Situation" zu fordern, d. h. es ist zwischen einst und heute und zwischen Vorübergehendem und Bleibendem im Neuen Testament selbst zu unterscheiden. „Solche freie, geschichtswahre Betrachtung ist nun allein praktisch im besten Sinn." 70 Die Grundsätze und Ziele der praktischen Auslegung sind also hier und dort dieselben. Das Eigentümliche liegt bei F. Niebergall wieder im Erziehungsbegriff, durch den er die These, daß geschichtliche Betrachtung zugleich praktisch ist, erläutert, in dem Schema „Norm, Zustand, Mittel" die Entsprechung von einst und heute gewinnt und durch die planmäßige Frage nach diesen drei Dingen die Ubersetzungsarbeit einer praktischen Auslegung stärker methodisiert, ohne den Erfolg rational oder mechanisch erzwingen zu wollen. Die Harmonie im Verhältnis von wissenschaftlich-historischer und praktischer Auslegung kann durch Konflikte gestört werden. Dann muß 67 68 70
142
68 P A N T 15. P A N T 14. Die Schriften des Neuen Testaments I, 1—6. Ebd. 4.
auf die Grenzen einer rein geschichtlichen Auslegung hingewiesen werden. Die religionswissenschaftliche Methode setzt voraus, daß die neutestamentlichen Schriften rein menschliche Erzeugnisse sind, gleichsam Fenster, durch die andere in den Himmel geschaut haben wollen. „Demgegenüber kann sicher jemand ohne von uns angefochten zu werden, sagen: Ich sehe nur Fenster, aber keine Sonne. Jedoch wenn einer dazu fortschreitet zu sagen: Es gibt nur dieses Stück geschichtlichen Lebens und nichts dahinter, dann überschreitet er weit sein gutes Recht. Dann deutet er mit Nein, wie wir mit Ja deuten . . . " 7 1 Die wissenschaftliche Auslegung muß ihre Neutralität gegenüber dem Glauben und seiner Deutung wahren. „Dessen Entstehung entzieht sich aber ebenso aller theoretischen Erklärung wie aller praktischen Beeinflussung."72 Die Unverfügbarkeit des Glaubens selbst und seines eigentlichen Gegenstandes ist die Grenze der wissenschaftlichen Auslegung. Hier sieht sich F. Niebergall wie R. Bultmann vor das Problem des Übergangs von der existentialen Interpretation zum existentiellen Vollzug gestellt. Darüber hinaus können wissenschaftliche und praktische Exegese konkurrieren. Es gilt die Vergangenheit immer besser aus sich selbst heraus zu verstehen. „Aber noch wichtiger ist uns die Beeinflussung der Gegenwart mit Hilfe dieser geschichtlichen Urkunde." 7 3 „Die nádete Historizität ist nichts nütze." 74 Wenn nämlich nur nach den Vorstellungen der Verfasser gefragt wird, dann macht die radikale Exegese denselben Fehler wie die orthodoxe 75 . Man darf ferner das historische Urteil über die frühere oder spätere Entstehungszeit von Textteilen nicht zum Werturteil ummünzen 7β . Zwar wird für ein praktisches Verständnis die Erkenntnis der Ungeschichtlichkeit mancher Teile der Schrift grundsätzlich nicht zum Ärgernis 77 , aber entsprechend den J. Kaftanschen Einwänden gegen Bousset und Wrede möchte F. Niebergall doch „jeden Fußbreit der Geschichte mit allem Nachdruck verteidigen" 78 . Von der historischen Exegese soll der Pfarrer einen regulativen, keinen konstitutiven Gebrauch machen. Als heuristische Methode ist die Allegorese unbedingt abzulehnen, als 71
X P
32.
72
T
P
35.
73
74 ΡΑ Ν Τ Ι . P A N T 49. 75 Vgl. dazu P A N T 13. 76 Vgl. P A N T 14. Wie wenig diese Frage geklärt ist, zeigt die unterschiedliche Beurteilung der synoptischen Parallelen der Sturmstillungsgeschichte durch H. Stock und M. Stallmann. H.Stock urteilt: „Da aber Matthäus, wie dargestellt wurde, selbst schon eine Auslegung der Markus-Perikope bietet, halten wir uns hier grundlegend an das älteste Evangelium." Studien zur Auslegung der synoptischen Evangelien im Unterricht, 1967 4 , 2 1 7. M. Stallmann dagegen sagt: „Die Markusfassung läßt sich nicht erzählen, ihr Sinn ist nur durch Textanalyse zu gewinnen. Dagegen hat die Matthäusfassung den Vorzug einer inneren Geschlossenheit." Die biblische Geschichte im Unterricht 104. 77 „Dann macht uns aber audi die Relativität der Vorstellungen und die Ungeschichtlichkeit vieler sog. Heilstatsachen gar nichts aus." P A N T 20. 78 P A N T 50.
143
homiletische Methode ist sie erlaubt, wenn man weiß, was man tut. Man muß sich vor einem Doppelten hüten: „Einmal davor, daß man ganz ausdrücklich unsere heutige oder seine eigene Auffassung als die wirklich und allein dem Schrift wort einwohnende ausgibt; dann aber noch mehr davor, daß man umgekehrt durch den genauen geschichtlichen Sinn unser Gegenwartsverständnis vergewaltigen l ä ß t . " 7 9 Daß diese Freiheit leicht zur Willkür wird, zeigen F. Niebergalls Vorschläge zur Verwendung von Texten an bestimmten Sonntagen oder zu bestimmten Anlässen (vgl. unten S. 162 f.). Diese Vorschläge widersprechen im Grunde auch seiner pädagogischen Intention, sofern sie wesentliche exegetische Entscheidungen vorwegnehmen und so die Selbsttätigkeit mindern. Durch die Bindung des Textes an einen Kasus kann eine (falsche) Exegese präjudiziert werden 8 0 . Wie F. Niebergall Bindung und Freiheit in der Exegese versteht, zeigt er an Mk. 2, 27 f. Der Sabbat ist um des Menschen willen da. Ein gesetzliches Sabbatverständnis ist heute kein Problem mehr. Darum wird die Aussage umgestaltet. Die Schrift ist um der Menschen willen da. Wir sind Herren der Schrift und der Geschichte 81 . Damit ist aber das Recht zur Umgestaltung in der Schrift selbst begründet. In ähnlicher Weise versucht man heute das Recht der Entmythologisierung mit entmythologisierenden Schriftstellen zu erweisen. Das Wort vom Kreuztragen bezog sich einst auf Verfolgung und Martyrium, heute muß man es auf jede Art von Leiden beziehen. Die neutestamentlichen Aussagen über Reichtum und Askese, vor allem aber die eschatologischen Sätze verlangen eine Umgestaltung. „Es kann ein Motiv noch so gut evangelisch sein, wie etwa das eschatologische im historischen Sinne des baldigen Endes; wenn uns die Beobachtung des heutigen Menschen sagte, daß wir damit nichts anderes erreichten, als daß er uns auslacht, dann bleiben wir damit am besten zu Hause, zumal wenn wir selbst nicht von der Sache überzeugt sind." 8 2 Hier entsteht der Eindruck, als sei das zeitgenössische Denken oberstes Kriterium für den Theologen. Dem steht aber der Satz entgegen: „Die Herren Leute haben über den Inhalt der Predigt und Verkündigung überhaupt gar nichts zu s a g e n . . . " 8 3 Oberstes Prinzip ist vielmehr die dogmatische Erkenntnis. „Gewiß, wir wollen historisch sein, aber wir müssen um unserer Praxis willen auch dogmatisch sein." 8 4 F. Niebergall weiß, daß sein von J . Kaftan übernommener Begriff des Reiches Gottes durch historischkritische Exegese nicht verifiziert werden kann und verteidigt ihn dennoch mit praktisch-dogmatischen Gründen 8 5 . P A N T 34. Wie das Kirchenjahr als exegetisches Prinzip wirkt, zeigt J. Jeremias an Mt. 20, 1 — 1 6 . Die Gleichnisse Jesu, 1965 7 , 29. 8 1 Vgl. P A N T 22. 8 2 WpmM 1 , 1 2 9 . 8 3 WpmM 1 , 1 6 4 . 8< WpmM 1 , 1 3 3 . 8 5 Vgl. ebd. 132. 79
80
144
Hier wird deutlich, daß das die gegenwärtige theologische Diskussion bestimmende Spannungsverhältnis zwischen historischer und systematischer Theologie auch die praktische Auslegung bei F. Niebergall beherrscht. Im Konfliktsfall geben aber systematische Gesichtspunkte den Ausschlag. Die Systematik erlaubt auch die Lösung eines Problems, das mit exegetischen Mitteln nicht zu bewältigen ist. Die religionswissenschaftliche Methode zerstört die Einheit der Schrift. Sie konstatiert das Nebeneinander verschiedener Quellen und Schichten, aber auch unterschiedlicher Wertsdiätzungen und Motive. Auf induktiv-empirischem Weg hatte F. Niebergall das historisch-psychologische Gesetz gefunden, daß es Neues in der Geschichte nie rein, sondern immer nur in altem Gewand geben kann. Daher darf die Erkenntnis, daß auch Jesu Botschaft traditionelle, d. h. alte Elemente enthält, nicht anstößig sein 86 . Neben ideal-religiösen finden sich in ihr eschatologische und rationale Motive 8 7 . Die im Neuen Testament nur koordinierten Motive müssen durch praktische Exegese subordiniert werden, d. h. es muß einerseits zwischen Haupt- und Nebenmotiven unterschieden, dann aber auch ein sinnvoller Zusammenhang zwischen ihnen aufgewiesen werden 88 . Damit bekommt die praktische Auslegung dieselbe — pädagogisch verstandene — Aufgabe wie die praktische Dogmatik, nämlich die verschiedenen Aussagen auf eine Einheit hin auszurichten. Die Herausstellung des Neuen, d. h. der eigentlichen Offenbarung, dessen, was heute noch verpflichtend ist, ist Aufgabe des religionsgeschichtlichen Vergleichs. Dieser zeigt das Originale an Jesus und seine Abhängigkeit vom zeitgenössischen Judentum mit seinen nationalen, eschatologischen und gesetzlichen Vorstellungen 89 . D a die Religionsgeschichte die Dogmatik bestätigt, entsteht der Verdacht, daß jene von systematischen Gesichtspunkten aus entworfen wurde. Daß die durch die Exegese zerstörte Einheit der Schrift nur auf dogmatischem Weg wiedergewonnen werden kann, sagt F. Niebergall offen. „Wir können auf ein System der Motive und Quietive nicht verzichten. ,Biblisch', ,schriftgemäß' muß es ja 8 6 „ N u n hat Jesus auf altes G e m ä u e r gebaut und zugleich neue F u n d a m e n t e d a zwischen gelegt. D a r i n liegt die Schwierigkeit seines Lebens und audi die unserer E r kenntnis seiner A r t . " W p m M I, 9. 8 7 V g l . W p m M I, 9, 10, 12. Ähnlich H a m a c k : Jesus hat die Vorstellungen v o m Reich Gottes „der religiösen Ü b e r l i e f e r u n g seines Volkes entnommen, in der sie bereits im V o r d e r g r u n d gestanden haben, und er hat verschiedene S t u f e n gelten lassen, in denen der Begriff lebendig w a r , und hat neue h i n z u g e f ü g t . " D a s Wesen des Christentums 43. 8 8 „ D i e ,Schrift' läßt uns hier g a n z im Stiche, da sie diese G e d a n k e n ihrer praktischen T e n d e n z gemäß nur koordiniert, nie subordiniert. Wir müssen s u b o r d i n i e r e n . . . " W p m M I, 138. 8 9 E . K ä s e m a n n stellt ähnliche Kriterien a u f : „Einigermaßen sicheren Boden haben wir nur in einem einzigen Fall unter den Füßen, wenn nämlich T r a d i t i o n aus irgendwelchen G r ü n d e n weder aus dem J u d e n t u m abgeleitet noch der Urchristenheit zugeschrieben werden k a n n . . . " Exegetische Versuche u n d Besinnungen I, 1968 5 , 205.
145
sein. Aber was heißt ,schriftgemäß'? In Wirklichkeit nennt jeder sein System schriftgemäß, indem er unbewußt die ganze Schrift nach seiner Dogmatik gruppiert und deutet. Dasselbe wollen wir bewußt tun. Wir wollen einen Zentralgedanken suchen, der nun wirklich im Mittelpunkt der Schrift steht, einen großen Zentralgedanken praktischer Art, in dem das Neue und Eigentümliche des Neuen Testaments, in dem die Offenbarung und die Kraft steckt, die die Gemüter erheben und trösten kann." 80 Die Nebengedanken werden dann dem Zentralgedanken als Hilfsgedanken oder als Mittel zum Zweck zugeordnet. Die systematische Verbindung erfolgt mit Hilfe des Erziehungsgedankens. Niedere Stufen werden pädagogisch legitimiert. Die Stellungnahme im einzelnen ist dabei nicht einheitlich. F. Niebergall kann auch sagen, daß Aussagen der Bibel ihrem Vorstellungsgehalt oder ihrem sittlichen Gehalt nach für uns unverständlich oder unverbindlich geworden sein. Dann lasse man sie liegen. „Es muß nicht überall in den Schriften Alten und Neuen Testamentes,Schrift', also Wort Gottes gefunden werden, das uns bindet und hilft." 91 Man kann versuchen, niederen Motiven vom Hauptmotiv aus einen höheren Sinn zu geben. Die eschatologische Naherwartung ist mit dem Gedanken an Lohn und Strafe verknüpft, sie hat transzendent-eudämonistischen Charakter. Darin kann man aber auch einen Hinweis auf die Absolutheit des höchsten Gutes und auf die Verantwortung des Glaubens sehen 92 . Man darf aber nicht die heutige Auffassung vom natürlichen Ende in Jesu Botschaft eintragen. Mit der Einbeziehung des sprachlichen Problems wird die Stellung klarer. Die Exegese konstatiert im Neuen Testament zeitliche Stufen — ältere und jüngere Schichten —, dann audi Wertstufen, schließlich Stufen im Verhältnis von Ausdruck und gemeintem Inhalt. An manchen Stellen findet sich eine Identität von Sinn und Ausdruck. Diese kann abnehmen und sich bis zur völligen Fremdheit steigern93. Nach dieser Stufenleiter hat sich die praktische Verwendung zu richten. Manches kann direkt, manches nur nach einer Vergeistigung oder Umdeutung gebraucht werden, manches muß liegen bleiben. Die auf systematisch-praktischem Weg gewonnene Einheit der Schrift entspricht in keiner Weise der alten orthodoxen Schrifteinheit. Zuletzt kennt F. Niebergall aber noch einen Durchbruch zu höherer Einheit, in der das geschichtlich Bedingte und Inkoordinable durch existentiellen Bezug vereinigt wird, der aber weder durch wissenschaftliche noch durch praktische Auslegung herbeigeführt werden kann, sondern unverfügbar bleibt. „Durch alle Unterschiede in den geschichtlichen Berichten und in den Lehrauffassungen fühlt man sich hindurch in die innerste Seele und den eigensten Geist dieser einzigartigen Macht. Da verschwimmen die Unterschiede zwischen den einzelnen Synop«o WpmM I, 131. 92 Vgl. WpmM I, 10 und 138.
146
91 83
PANT 25. Vgl. PANT 38.
tikern, und ein großes starkes und gütiges Jesusbild strahlt heraus, und der johanneische Christus neigt sich zum synoptischen Jesus, und beide Bilder laufen allen Widersprüchen zum Trotz zusammen in ein großes Menschenbild von Einem, durch den Gottes Kraft und Gnade wirkt. Paulus und Jakobus fließen ineinander zu einer großen geistigen Macht, und selbst die wilde Glut der Offenbarung Johannis vereinigt sich mit allem andern zu einer starken Geistesflamme." 94 Wie vom Systematiker, so läßt sich der Praktische Theologe auch vom Exegeten entlasten 95 , sofern er dessen Ergebnisse aufnimmt, ohne den Weg dahin im einzelnen zu diskutieren. Er benutzt sie polemisch gegen die alte Theologie und um den praktischen Charakter der neutestamentlichen Schriften zu zeigen. Sofern praktisch-dogmatische Grundsätze mit ihnen konkurrieren, erweist sich der Systematiker als der stärkere Partner. Mit dem Hinweis auf die Grenzen der Exegese wird die Warnung verbunden, sich dennoch nicht von der exegetischen Arbeit zu dispensieren. Die praktische Auslegung muß an der Zirkelbewegung zwischen historischexegetischer und systematisch-praktischer Arbeit und deren Spannungsverhältnis festhalten. Es ist zu fragen, ob der kritischen Funktion der Dogmatik auch eine solche der Exegese entspricht. Läßt sich der Praktische Theologe von dieser wirklich in Frage stellen, solange er sich berechtigt glaubt, aus den Texten und ihrer Auslegung das Brauchbare auszuwählen, wobei als Kriterium das Wahlverwandte und Überlegene genannt wird? Es gilt ja in der Schrift die Stellen zu finden, „die unserm tiefsten seelischen Bedürfnis das überlegene wahlverwandte Leben anbieten, dessen wir bedürftig sind" 9e . Sperrige Stellen aber werden umgedeutet, psychologisch verständlich gemacht, in die eigenen Kategorien gefaßt, die sie dann bestätigen müssen. Damit entfällt — wie gegenüber der dialektischen Theologie — die eigentliche Auseinandersetzung. Man muß aber auch sehen, daß F. Niebergall sich bemüht, den Verdacht der Willkürlichkeit abzuwehren. Zwar verlangen Wahrhaftigkeit und geschichtliches Denken stets eine ganz klare Unterscheidung zwischen historischem und praktisch-gegenwärtigem Sinn einer Aussage — man darf weder die eigenen Gedanken als paulinisch noch die des Paulus als eigene ausgeben —, aber dadurch soll eine Kommunikation mit der Vergangenheit, eine Ubersetzung ihrer Äußerungen nicht unmöglich gemacht werden. Die Ersetzung der kultgesetzlichen Deutung des Kreuzes in Römer 3 durch eine pädagogische darf als solche Ubersetzung gelten. Paulus hat diese nicht beabsichtigt. „Aber man hat sein Motiv aufgenommen 84 95 98
PANT 32 f. Zum Begriff der Entlastung vgl. oben S. 129, Anm. 7. PANT 22. 147
und in der Kontinuität des Motivs weitergedacht."97 Hier kommt ein Sachverhalt in den Blick, den H. G. Gadamer mit den Begriffen des wirkungsgeschichtlichen Bewußtseins und der Horizontverschmelzung differenzierter reflektiert98. Nur ein historischer Objektivismus glaubt sich so in die Vergangenheit versetzen zu können — um sie aus sich heraus zu verstehen —, daß er von sich selbst absehen zu können glaubt. Der Ausdruck Horizontverschmelzung als hermeneutisches Prinzip besagt, daß eben dies nicht möglich ist. Dem entspricht bei F. Niebergall die wiederholte Feststellung: So denken wir nicht mehr. Der Gefahr, daß in der Horizontverschmelzung der eigene Horizont den Ausschlag gibt, suchen beide Autoren in der Weise zu begegnen, daß sie ein methodisches Bewußtsein dieses Sachverhalts fordern. H. G. Gadamer sagt — indem auch er das praktische Element betont —: „Daß es aber einer solchen wirkungsgeschichtlichen Fragestellung immer bedarf, wenn ein Werk oder eine Überlieferung aus dem Zwielicht zwischen Tradition und Historie ins Klare und Offene seiner eigentlichen Bedeutung gestellt werden soll, das ist in der Tat eine neue Forderung — nicht an die Forschung, aber an das methodische Bewußtsein derselben —, die sich aus der Durchreflexion des historischen Bewußtseins zwingend ergibt." 98 F. Niebergall formuliert undifferenzierter: „So tun wir also nicht mehr unbefangen, was die früheren Zeiten unbefangen getan haben." 100 Gegen den Einwand, die praktische Exegese verfahre willkürlich, führt er an, daß die Wahlverwandtschaft nur scheinbar ein rein subjektives Kriterium ist, da sie ja eine Frucht der Wirkung des Neuen Testaments und seiner Geschichte ist 101 . Dieses Argument kann auch einmal durch den Begriff des Vertrauens zum Ausdruck kommen. „Dann liegt noch eine Schranke des Subjektivismus im Begriff des Vertrauens. Das Vertrauen ist etwas ganz Persönliches und Subjektives, aber es ist keine Willkür, sondern es entsteht durch die Macht und Anziehung des Objektes selbst. 97 P A N T 37. Während F. Niebergall jedoch lediglich meint, der Ausleger müsse redlich eingestehen können, daß er die Gedanken eines neutestamentlichen Autors nicht nachvollziehen könne — „wir denken heute anders" — , fordert R. Bultmann eine radikalere Sachkritik und kritisiert deren Fehlen in K. Barths Römerbriefkommentar. „An der Sache muß dodi eben gemessen werden, wieweit in allen Worten und Sätzen des Textes die Sache wirklich adäquaten Ausdruck gewonnen hat; denn was soll sonst das .Messen' bedeuten? Von solchem Messen und der in ihm begründeten radikalsten Kritik finde ich bei Barth aber nichts. Daß überall im Römerbrief die Sache adäquaten Ausdruck gewonnen haben müsse, ist dodi eine unmögliche Voraussetzung, wenn man nicht ein modernes Inspirationsdogma aufrichten w i l l . . . " ThB 1 7 , 1 , 141. 9 9 Ebd. 284. Vgl. Wahrheit und Methode 284 ff. ico P A N T 22. 1 0 1 „Wir wählen aus und nehmen an von dem, was uns geschichtlich als göttliche Wahrheit entgegentritt, und zwar mit einem inneren Organ, das durch dieselben Mächte gebildet ist. Wir schleifen den Diamanten mit seinem eignen Staub." Die religiöse E r ziehung in Haus und Schule 82. 98
148
So soll es der Bibel gegenüber sein. Das was uns zu fesseln und zu binden vermag, das zieht unser Vertrauen an und wird uns zur Autorität für unser Hoffen und Streben." 102 F. Niebergalls Hermeneutik ist also durch die Korrelation von Subjekt und Objekt bestimmt, die der von Autorität und Freiheit bei J . Kaftan entspricht, nur daß F. Niebergall zur Beschreibung dieses Phänomens nicht den Erziehungsbegriff, sondern die Freundschaft als Analogie verwendet. Die personale Struktur des Glaubens fehlt also nicht ganz bei ihm, aber es bestätigt sich die Beobachtung, daß er die personale Verwendung des Erziehungsbegriffs nicht kennt. c) Praktische Auslegung und existentielle Interpretation W. Marxsen hat in „Exegese und Verkündigung" ein Verständnis der exegetischen Aufgabe vorgetragen, das eine gewisse Strukturverwandtschaft mit F. Nibergalls Auffassungen von der Aufgabe der praktischen Auslegung erkennen läßt. Da die unterschiedliche Begrifflichkeit die Gemeinsamkeiten zunächst verdeckt, sollen sie im folgenden aufgezeigt werden. Eine nicht nur begriffliche Verschiedenheit besteht darin, daß F. Niebergall die form- und redaktionsgeschichtliche Methode nicht kennt. Wo er lediglich das Nebeneinander verschiedener Schichten und Quellen konstatiert, da sieht W. Marxsen die Abhängigkeit der jüngeren von der älteren Tradition und kann daher das Tradieren als Interpretieren, als Auslegen und Verkündigen verstehen. Daraus folgert er: „Ich habe keinen Text vor mir, der Predigttext sein will, sondern (ich sage das noch einmal allgemein) der selbst in irgendeiner Weise Predigt, Verkündigung in eine bestimmte (immer vergangene!) Zeit hinein sein will." 1 0 3 Diese Unterscheidung wird verdeutlicht durch die Gegenüberstellung von Aussage und Satz. „Unter ,Aussage' verstehe ich die Kommunikation zwischen einem Redenden und einem Hörenden durch das Medium der Sprache. Von einer Aussage zu unterscheiden ist der ,Satz'. Er wird faktisch zwar auch von jemandem gesprochen oder formuliert, er wird auch gelesen oder gehört, bleibt aber gültig in seiner Formulierung auch unabhängig von dem Redenden und Hörenden. Bei der Aussage dagegen sind Redender und Hörender konstitutiv." 1 0 4 An Beispielen zeigt W. Marxsen, daß eine Aussage nicht wie eine allgemeine Wahrheit ihre Richtigkeit in sich selbst hat, sondern sie nur durch ihren Bezug auf eine konkrete Situation empfängt 1 0 5 . Das führt zu der Unterscheidung von Erklärung und Exegese. Bei der Erklärung spielt die religionsgeschichtliche Erkenntnis der Umwelt eines Verfassers, die historische Frage nach der Tatsächlichkeit des Berich103 E V 42. P A N T 24. E V 44. 105 „Das heißt, daß die Richtigkeit einer solchen Aussage nidit in der Aussage selbst liegt. (Beim Satz dagegen wäre das d«r Fall.) Sie entscheidet sich vielmehr an der Situation, in die hinein die Aussage gemacht wird." E V 44. 102
104
149
teten und besonders die Begrifïsexegese, die Philologie, eine Rolle. Die Exegese dagegen stößt durch zur Aussage. „Exegese ist dagegen das Nachsprechen dessen, was der Verfasser seinen Lesern sagen wollte, in meiner Sprache." 106 Da die Aussage durch die Situation des Empfängers wesentlich mitbestimmt ist, erhält die Einleitungswissenschaft eine Relevanz für theologische, nicht nur historische Fragestellungen 107 . „Bereits die Exegese hat Aussagecharakter! Es ist also nicht so (wie man das oft findet), daß dieser Aussagecharakter erst im Laufe der ,Meditation' entsteht." 108 F. Niebergall würde sagen, daß schon die Auslegung praktischen Charakter haben müsse und daß dieser nicht erst in praktischen „Anwendungen" gefunden werden dürfe. Der Brückenschlag von der Exegese als dem Verstehen der vergangenen Aussage zur Predigt als der heutigen Aussage kann nur gelingen, wenn der Prediger in seiner Gemeinde eine Situation oder eine Fragestellung aufspürt, die der im Text vorausgesetzten entspricht109. F. Niebergall formuliert entsprechend: „Die erste Voraussetzung für die Auffindung der Schrift in der Bibel, also der für uns maßgebenden und hilfreichen Stellen, ist die Ubereinstimmung in der Auffassung des Zustands."uo Der Unterschied besteht lediglich darin, daß F. Niebergall für seine Gemeindesituation eine ihr entsprechende neutestamentliche Situation mit ihrem „Text" sucht, während W. Marxsen anscheinend von der Perikopenordnung ausgeht in der Annahme, es lasse sich zu jedem Text eine entsprechende Gemeindesituation finden. Bei einem synoptischen Text muß der Exeget verschiedene Schichten erkennen, denen verschiedene Situationen und entsprechende Skopoi zuzuordnen sind. Der Prediger muß dann den Skopus wählen, den seine Gemeinde braucht. Dann aber hat — trotz Perikopenordnung — F. Niebergall im Prinzip recht behalten. Die heutige Situation bestimmt die „Text"-Wahl. Es hat sich gezeigt, daß bei F. Niebergall und W. Marxsen ähnliche Gedankengänge vorliegen. Beide sind sich einig, daß der Erkenntnis des Zustands oder der Situation eine wesentliche Bedeutung zukommt. Durch die Bezogenheit auf die Situation bekommt eine Aussage praktischen oder Anrede-Charakter. Die — praktische — Exegese unterscheidet sich von der historisch-philologischen Erklärung dadurch, daß sie den Text als Anrede verständlich macht. Die bei F. Niebergall stark betonte Polemik gegen die „alte" Theologie tritt bei W. Marxsen zurück, aber sie fehlt nicht 106
EV 50. 107 Vgl. W. Marxsen, Einleitung in das Neue Testament, 1965 3 , § 1: „Einleitung in das Neue Testament als theologische Aufgabe." 108 EV 50. 109 „Ich frage: Wo habe ich in meiner Gemeinde eine Situation, die der entspricht, in die hinein die neutestamentliche Predigt (mein ,Text') verkündigte? Die muß ich nun aufspüren. In diese Situation hinein muß idi die Richtung der Aussage umleiten." EV 54. Vgl. die Kritik an W. Marxsen bei J. Moltmann, Perspektiven der Theologie 125. 110 P A N T 25.
150
ganz. Weil die neutestamentlichen Schriften Predigten und keine Predigttexte sind, darf man ihnen nicht eine absolute, objektive Autorität zuschreiben wollen, etwa durch die Behauptung, sie stünden dodi im Kanon. „Wer sich auf den Kanon zurückzieht gibt den geschichtlichen Apostel preis." 111 Bei W. Marxsen kommen schließlich sogar die beiden andern Teile des F. Niebergallschen Schemas in den Blick. „Es kommt also bei der Exegese zu der Begegnung zweier Geschichtlichkeiten. Die Aussage des Verfassers bleibt stehen — als seine Aussage an seine Leser. Nur das geschichtlich bedingte Mittel der Aussage (die damalige Sprache, Vorstellungswelt usw.) wird ersetzt durch mein Mittel, durch meine des Empfängers? In der gemeinsamen Absicht, den Weg von der Exegese zur Predigt in einem notwendigen Sachzusammenhang zu begründen, Sprache und Begrifflidikeit." 112 Was ist „seine Aussage an seine Leser" anderes als die Formulierung der „Norm" in bezug auf den „Zustand" kommen F. Niebergall und W. Marxsen zu strukturell ähnlichen Gedankengängen über die Aufgabe der „praktischen" oder der „eigentlichen" Exegese. Ohne die Begriffe „Erziehung" bei F. Niebergall und „Verkündigung" bei W. Marxsen identifizieren zu wollen, wird man sagen können, daß sie bei beiden Autoren im selben Zusammenhang und in derselben Funktion verwendet werden113. W. Marxsens Verständnis der neutestamentlichen Schriften als Predigten oder Verkündigung führt zu der Frage nach dem „Text", der dabei ausgelegt wird. Dieser Text ist kein schriftliches Dokument. W. Marxsen spricht von „Kreuz und Auferstehung" oder „der Verkündigung Jesu Christi des Gekreuzigten und Auferstandenen" oder von der „Wirklichkeit Christus", um diesen „Text" zu bezeichnen. Er ist unverfügbar; denn man kann ihn weder mit den Aussagen der Verkündigung identifizieren noch von diesen lösen. W. Marxsen formuliert hier in seiner Begrifflichkeit, was O. Weber den Unterschied zwischen geschehenem und bezeugtem Wort oder F. Gogarten den zwischen bezeugtem und bezeugendem Wort nennt114. F. Niebergall kennt diese Begriffe nicht, wohl aber das Phänomen, sofern auch er nach dem Woher des Wirkenwollens fragt. Diese Frage deckt sich bei ihm mit der andern nach dem, was mich heute an die Schrift oder an Schriftstellen bindet. Die Antwort wird z. T. in idealistischer, z. T. in biblischer Begrifflichkeit gegeben. Die Schrift bindet, sofern sie klassischen Charakter hat 115 . Klassische Schriften stellen eine „geistige Heimat" dar, sie zeigen das geschichtlich Neue und Bindende in einer dem Inhalt entsprechenden Form und erweisen sich als unerschöpf1 1 2 E V 50. E V 43. Vgl. Z T h K 8, 1898, 467. 114 Vgl. O. Weber, Grundlagen der Dogmatik I, 195 ff. (§ 2. Das Wort Gottes), und F. Gogarten, Der Mensch zwischen Gott und Welt, 1967 4 , 257 ff. 1 1 5 Man wird sagen, „daß es klassische Schriften für uns sind." P A N T 18. 111
113
151
lidi. „Der Teil dieser klassischen Geschichtszeit, den wir auf dem Wege der geschichtlichen Entwicklung und persönlichen Aneignung mitbekommen haben, zieht uns immer wieder an die Stelle, wo er entstanden und in starker überlegener Weise immer noch zu finden ist." 116 Die dauernde Bedeutung dieser Schriften steht „auf dem Verhältnis von geschichtlich entstandenem Wert und persönlicher Wertschätzung" 117 . Von da aus möchte F. Niebergall zu einer religiösen Beurteilung mit Hilfe des Begriffes „Wort Gottes" aufsteigen. Die Auffassung der Schrift als Wort Gottes ist die letzte und tiefste, aber sie ist ganz subjektiv, d. h. sie ist an eine entsprechende Wertschätzung und Glaubensdeutung gebunden. „Man kann also nicht den Ungläubigen und Halbgläubigen den Charakter der Schrift als des Wortes Gottes beweisen, sondern nur bezeugen." 118 Wort Gottes ist nur, was „Christum treibet". Weil dies aber in dem Sinn mißverstanden werden könnte, als könnten nur christologische Aussagen Wort Gottes sein, möchte F. Niebergall anders formulieren. „Gottes Wort ist da, wo Normen und Kräfte, wo Folgerungen und Erkenntnisse sind, die zu dem von Jesus gebrachten Leben der Innerlichkeit gehören." 119 Die Behauptung, daß Gottes Wort nicht bewiesen werden kann, daß es in keine Formel gefaßt werden, sondern nur an seinen Folgen wahrgenommen werden kann, zeigt, daß F. Niebergall zwischen dem Wirken der neutestamentlichen Verfasser und dessen unverfügbarem Ursprung unterscheidet. Angesichts der parallelen Funktion von „Erziehung" und „Verkündigung" bei F. Niebergall und W. Marxsen ist zu fragen, ob durch die inhaltliche Füllung dieser Begriffe eine wesentliche Unterscheidung gegeben ist. Wir gehen dieser Frage nach, indem wir die Vorstellungen F. Niebergalls erneut mit denen R. Bultmanns konfrontieren. R. Bultmann äußert sich in der Einleitung seines Jesusbuches über „die Art der Betrachtung". Soll diese nicht nur die historische Neugier eines neutralen Betrachters befriedigen, dann muß es zu einem Dialog, d. h. zu einer Begegnung mit der Geschichte kommen 120 . Dieser Fragehaltung widersprechen alle Versuche zu werten, geschichtliche Persönlichkeiten psychologisch „verständlich" zu machen oder Prädikate zu erteilen. Es soll nach dem eigensten Interesse der geschichtlichen Personen gefragt werden, d. h. nicht nach ihrer Persönlichkeit, sondern nach ihrem Werk, für das sie sich einsetzten, also nach dem, was sie wollten. Ihr Wollen ist zu fassen in ihrer Lehre, verstanden nicht als System allgemeiner Sätze, abgesehen von der Situation, sondern als Auslegung der eigenen Existenz und ihrer Möglichkeiten, als Hilfe für den heutigen Menschen, über seine eigenen Mög116 117 PANT 18. PANT 19. m ne PANT 20. Ebd. 120 Vgl. dazu und zum Folgenden R. Bultmann, Jesus, Siebenstern-Taschenbuch 17, 7—15.
152
lichkeiten klar zu werden. Dieser Gedankengang enthält bisher noch nichts, was F. Niebergalls Auffassung von Jesus und den neutestamentlichen Schriftstellern und seiner Frage nach dem, was sie wirken wollen, widerspricht. Im Wirken äußert sich das Wesen und ist die Möglichkeit eines Gegenwartsbezugs, eines Betroffenseins gegeben. R. Bultmann fordert Begegnung mit der Geschichte. „Aber weil die folgende Darstellung für den Leser natürlich nicht ohne weiteres eine Begegnung mit der Geschichte sein kann, sondern zunächst nur — im besten Falle — eine Orientierung über meine Begegnung mit der Geschichte, stellt sich für ihn die ganze Darstellung zunächst nur als eine Betrachtung dar, über deren Art ich ihn orientieren muß. Ob er bei der Betrachtung stehen bleibt, ist seine Sache."121 Hier kommt das Problem des Übergangs von der existentialen Interpretation zum existentiellen Vollzug in den Blick. Es ist aber zu fragen, ob in dem Verzicht, einen existentiellen Bezug herstellen zu wollen und deshalb nur die eigene Begegnung als Impuls oder „Reiz" zur Selbsttätigkeit anbieten zu wollen, nicht ein wesentliches Strukturmoment des Erziehungsbegriffs aufgenommen ist. Ob sich der Pädagoge an der Existenzphilosophie oder am Idealismus orientiert, er weiß um seine Ohnmacht, d. h. um die Unverfügbarkeit des Erfolges. Der Begriff der Unverfügbarkeit wird aber radikalisiert, wenn man ihn nicht nur auf das Ergebnis erzieherischer Bemühung bezieht, sondern schon auf die Geschichte als deren Mittel, die nicht nur das Wahlverwandte fördern, sondern durch ihre Fremdheit in Frage stellen soll. Man darf aber F. Niebergall nicht vorwerfen, er lasse sich nicht in Frage stellen, ohne zu sehen, daß seine Ablösung der objektiven Schriftautorität durch eine subjektive eine Entsprechung hat in R. Bultmanns Darstellung des Unterschieds zwischen der formalen Schriftautorität in der jüdischen Gehorsamsethik und Jesu Verständnis des Gehorsams, der auf der Einsichtigkeit der Forderung beruht 122 . Die Strukturverwandtschaft dieser Unterscheidungen darf über dahinterliegende Differenzen nicht hinwegtäuschen. Für F. Niebergall ist die Forderung einsichtig als Wert oder Ideal, für R. Bultmann besteht die Einsicht in der Anerkennung des fordernden Gefragtseins. F. Niebergalls und R. Bultmanns Konzeptionen stellen keine klare Alternative dar. Das Verhältnis ist differenzierter zu sehen. R. Bultmann hat außerdem sein schroffes Urteil aus dem Jahre 1924 später A. v. Harnack gegenüber gemildert: „Aber mag jene Beschränkung (seil, im Verständnis des Christentums) empfindlich sein — so einfach liegt es nun doch auch nicht, als hätte Harnack überhaupt kein Organ für den entweltlichenden, den Menschen aus der ,Welt' heraus121
Ebd. 9.
122
Vgl. R. Bultmann, Jesus 48 ff. 58 ff.
153
rufenden Sinn der neutestamentlichen Botschaft gehabt. Nur daß er sich ihn nicht explizit, nicht in seiner Radikalität zum Bewußtsein gebracht hat." 123 Das Verhältnis soll am Problem der neutestamentlichen Eschatologie verdeutlicht werden. R. Bultmann geht von religionsgeschichtlichen Erkenntnissen aus —, die er bei A. v. Harnack vermißt 124 —, und betont einerseits die Fremdheit der eschatologischen Vorstellungen, ihre Abhängigkeit von zeitgenössischen Anschauungen und andererseits die nüchterne Zurückhaltung in der Botschaft Jesu. Sie kann nur verstanden werden, wenn man fragt, welche Auffassung vom Menschen ihr zu Grunde liegt. Sie verlangt Preisgabe des bisherigen Selbstverständnisses und macht zugleich das zeitgeschichtlich Mythologische daran bedeutungslos. „Diese Mythologie gleitet schließlich ab von der großen Grundanschauung, die sie verhüllt, von Jesu Auffassung vom Menschen als in die Entscheidung gestellt durch Gottes zukünftiges Handeln." 125 Die Gottesherrschaft ist als eschatologische Größe allem Innerweltlichen und nur Relativen entgegengesetzt. Weil im Begriff des höchsten Gutes diese Relativität nicht wirklich überwunden ist, ist er nicht geeignet zur Bezeichnung des Heils 12e . Die eschatologische Verkündigung stellt den Menschen in die Entscheidung, die nicht als Wahl zwischen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten verstanden werden kann, sondern als Entscheidung darüber, ob er über sich selbst verfügen will oder anerkennt, daß über ihn verfügt ist 127 . Sie ist seine freie verantwortliche Tat 128 . Darum hat Jesu eschatologische Verkündigung und seine Deutung des Willens Gottes denselben Sinn: sie bilden eine Einheit 129 . F. Niebergall dagegen ordnet das eschatologische Motiv als Hilfsgedanken dem Zentralgedanken des höchsten Gutes als sittlicher Gottesgemeinschaft unter. Daraus folgt ein Schwanken der Vorstellungen, das mit der komplexen Struktur der J. Kaftanschen Dogmatik zusammenhängt. Einerseits gilt die eschatologische Botschaft als traditionelles, nicht originelles Motiv niederen Ranges: sie ist transzendent eudämonistisch130. Im Zusammenhang mit dem Zentralgedanken jedoch hat das eschatologische Motiv die Funktion, auf die Absolutheit des höchsten Gutes und 123
Harnack, Das Wesen des Christentums 11 (Geleitwort von R. Bultmann). Anders G V I, 2: „Der Gegenstand der Theologie ist Gott, und der Vorwurf gegen die liberale Theologie ist der, daß sie nidit von Gott, sondern vom Menschen gehandelt hat." 125 124 v g l . £> as Wesen des Christentums 9. Jesus 41. 126 127 Vgl. Jesus 28. Vgl. ebd. 39 und 91. 128 „Jesus sieht also den Menschen als in seinem Hier und Jetzt in der Entscheidung stehend mit der Möglichkeit 'der Entscheidung durch seine freie Tat. Nur dies, was der Mensch jetzt tut, gibt ihm seinen Wert." Ebd. 40. 129 „Das aber führt darauf, wie wirklich eschatologische Botschaft und Verkündigung des Willens Gottes in ihrer Einheit zu begreifen sind." Ebd. 90. 130 Vgl. oben S. 146, Anm.92.
154
die daraus folgende Verantwortung des Menschen hinzuweisen 131 . Absolutheit und Relativität, Wachstum und Entscheidung stehen nebeneinander. Jesus benutzt die in der Seele der Leute eingewurzelten Gedanken und bringt doch etwas Besonderes: „Er hat den alten Rahmen zerschlagen und einen neuen gezimmert." 132 Besondere Schwierigkeiten hat den Exegeten seit je der von Jesus unbefangen gebrauchte Lohnbegriff gemacht. F. Niebergall und R. Bultmann suchen zunächst diesen der radikalen Forderung anscheinend widersprechenden Begriff zu entschärfen, indem sie zeigen, daß Jesus keinen Lohnanspruch duldet und eine gesetzmäßige Entsprechung von Lohn und Leistung bestreitet 133 . R. Bultmann führt diesen Gedanken weiter, indem er ihm eine antiidealistische Spitze gibt. „Das Tun des Guten um des Guten willen kennt er (seil. Jesus) nicht; der Gedanke, daß jedes gute Tun seinen Wert in sich selbst trägt, ist ihm fremd. Denn bei diesem Gedanken ist wieder das humanistische Menschenideal vorausgesetzt, die Uberzeugung vom Selbstwert des Menschlichen. Nach Jesu Meinung erwirbt sich nicht der Mensch seinen Wert, sondern wenn er gehorsam ist, so lohnt Gott ihn, er schenkt ihm mehr als er hat." 134 Wir stellen F. Niebergalls Interpretation des Lohngedankens daneben: „Dieses Reich wird zum starken Motiv der Sinnesänderung. Es ist nicht mehr bloß der Preis, der ohne klares Verhältnis zur sittlichen Leistung gezahlt wird, sondern diese geistige Macht Gottes ist selbst sittlicher Art. Sie bestimmt nicht nur mittelbar als Lohn das Handeln des Menschen zum Guten, sondern unmittelbar vermöge ihres Inhaltes und Wertes . . . Es wird auf dieser ganzen Gedankenreihe das Motiv zum Guten nicht in einer ethisch neutralen Seligkeit gefunden, die von der entscheidenden Instanz dem Verdienste als Lohn zugebilligt wird; vielmehr liegt das Motiv zum Guten in der Kraft und dem Geist und der Herrschaft Gottes selbst. Gott treibt hervor, was er im Menschen pflanzen will. Das ist der Anfang der passivischen Auffassung des ganzen Heilserlangungs- und Umwandlungsprozesses." 135 Auch F. Niebergall verwandelt den Lohnbegriff in Richtung auf die Rechtfertigungslehre. Nach R. Bultmann muß der Mensch darauf warten, daß Gott seinem Tun Geltung verleiht: der Wert steht noch aus. Bei F. Niebergall hat das menschliche Tun des Guten seinen Wert bereits, den man aber nur Gott zuschreiben darf. Die dem christlichen Lohnbegriff entsprechende Demut besteht einmal in der Erwartung, einmal in der Dankbarkeit. Beides 131
132 Vgl. ebd. WpmM I, 8. R. Bultmann: Die Gleichnisse Lk. 17, 7—10 und Mt. 20, 1—16 „lehnen ja deutlich jede Lohnrechnerei des Menschen mit Gott ab, bestreiten ausdrücklidi, daß der Mensch vor Gott irgend einen Anspruch erheben kann." Jesus 57. F. Niebergall: „Aber es finden sich auch mehrere Gedanken, die den Lohnbegriff erweichen . . . Es ist also eine Art der Vergeltung, die den Kern des Vergeltungsbegriffs zu beseitigen strebt, nämlidi die Gesetzmäßigkeit, die sich genau nach dem Verdienst richtet." WpmM I, 11 f. 134 135 Jesus 57. WpmM I, 12. 133
155
braucht sich nicht auszuschließen, aber R. Bultmanns Verständnis ist radikaler und F. Niebergalls Deutung kommt der katholisch-tridentinischen bedenklich nahe, die den Gnadencharakter zu wahren sucht, indem sie die Gnade zur Voraussetzung alles christlichen Tuns macht. Da R. Bultmann in seinem Jesusbuch passim ohne Namensnennung gegen humanistische und idealistische Gedanken polemisiert, ist zu fragen, ob F. Niebergall von dieser Kritik betroffen wird. Die Polemik kreist um den Begriff der Unverfügbarkeit. Daher wird betont, daß die Gottesherrschaft keine menschlichen Ideale verwirkliche. Sie bestätigt nicht „göttliche" Eigenwerte im Menschen, wie z.B. die Seele als Wert, die Persönlichkeit mit ihrer Würde und die Innerlichkeit. Die Liebe soll um des Gehorsams willen, nicht wegen des Wertes des Nächsten geübt werden. Man wird an A. v. Harnacks Thema „Gott der Vater und der unendliche Wert der Seele"136 erinnert. Die Formel hat bei ihm polemische Funktion. Er möchte zeigen, „daß das Evangelium überhaupt keine positive Religion ist wie die anderen, daß es nichts Statutarisches oder Partikularistisches hat, daß es also die Religion selbst ist" m . Einen unendlichen Wert hat die Seele nicht in sich selbst, sondern er wird ihr von Gott zugesagt. Wie R. Bultmann betont auch A. v. Harnack den Unterschied zwischen evangelischer und griechischer Auffassung 138 . Die Wertschätzung der Seele auf die Zusage Gottes hin bedeutet eine Umwertung aller Werte. Die Auffassung des Evangeliums ist paradox. „Was aber kann weniger einleuchtend sein als die Rede: Eure Haare auf dem Haupte sind gezählet; ihr habt einen überweltlichen Wert, ihr könnt euch in die Hände eines Wesens befehlen, das niemand geschaut hat. Entweder ist das eine sinnlose Rede, oder die Religion ist hier zu Ende geführt." 139 F. Niebergall spricht statt vom Wert der Seele von der Würde der Persönlichkeit. Sie gilt ihm als das höchste und reinste Motiv, das Jesus als Mittel für seinen Zweck gebraucht. „Würde" ist der Begriff, mit dem er das Gottesverhältnis Jesu und das der Christen als ein personales zu beschreiben sucht. „So ist bei ihm (seil, bei Jesus), der nicht nach Lohn und Schaden fragt, das Motiv nicht mehr auswendig und zukünftig, sondern es ist in seinem Innern und wirkt als gegenwärtige Kraft. Nicht mehr treibt das, was Gott geben und tun will, sondern was Gott ist und ihm sein will. — Hier sehen wir die höchste Würde des Menschen erreicht, wenn Würde uns darin liegt, daß sich einer nicht vom alltäglichen Egoismus der niedrigen Menge, von ihrer Hoffnung und ihrer Furcht, sondern 136
137 Das Wesen des Christentums 49. Ebd. „Wer zu dem Wesen, das Himmel und Erde regiert, mein Vater sagen darf, der ist damit über Himmel und Erde erhoben und hat selbst einen Wert, der höher ist als das Gefüge der Welt. Aber diese herrliche Zusage (Hervorhebung vom Vf.) ist in den Ernst einer Ermahnung eingekleidet. Gabe und Aufgabe in einem. Wie anders lehrten darüber die Griechen." Das Wesen des Christentums 51. 13e Ebd. 52. 138
156
daß er sich treiben läßt von dem, was er einem anderen und was ihm dieser andere ist; wenn nicht die Ehre von Menschen, sondern der Wunsch, Gottes würdig zu sein, und das tiefste Bewußtsein von dem, was man ihm um seiner Güte und Heiligkeit willen schuldig ist, nicht nur die Taten und Worte, sondern auch die Gesinnung regelt, die kein Mensch sieht und die uns keinen äußeren Schaden oder Nutzen bringt." 1 4 0 R. Bultmann polemisiert gegen die „Innerlichkeit" und denkt dabei an Ekstasen, Seelenfrieden, mystische Wonnen 141 . F. Niebergall versteht die Innerlichkeit primär als Zusage der Würde, die sich dann freilich auch psychisch auswirkt. Die Gefahr, daß man in diesen Wirkungen die Zusage Gottes verfügbar zu haben glaubt oder bei ihrem Fehlen verzweifelt, hat nur R. Bultmann gesehen und damit radikaler gedacht. Aber hat er damit nicht eine bestimmte Gestalt der Anfechtung verabsolutiert? F. Niebergall hätte deutlicher sagen müssen, daß Gott nicht an vorhandene Werte anknüpft, wenn er den Menschen seiner Gemeinschaft würdigt. Bei ihm fehlt letztlich nicht die personale Struktur, aber die bleibende Zukünftigkeit der Gottesherrschaft 142 . Bisher wurde nach dem Zusammenhang des Zentralgedankens mit dem eschatologischen Motiv gefragt; nun soll es um die Verbindung zum rationalen Motiv gehen. Die rationalen Motive der Botschaft Jesu orientieren sich am irdischen Wohl, sie entsprechen in Form und Inhalt den Proverbien und versuchen unter dem Gesichtspunkt von Weisheit und Torheit zum Guten zu mahnen und vom Bösen abzuraten. Als Beispiele werden Lk. 14, 8—10 und Mt.5, 25 f. genannt 143 . Das rein irdische Vergeltungsschema ist schwer mit den hohen Motiven in Verbindung zu bringen. Man kann versuchen, die irdischen Güter als geistige zu interpretieren, und hat dann nicht mehr die Erfahrung gegen sich, daß es auch dem Bösen gut W p m M I, 17 f. „ Z u r Entscheidung ruft Jesus, nicht zur Innerlichkeit. E r verheißt weder Ekstasen noch Seelenfrieden, und die Gottesherrschaft ist nicht der Inbegriff geheimnisvoller Schauer und mystischer Wonnen." Jesus 36. 1 4 2 D i e s wird bestätigt durch F. N i e b e r g a l l s Urteil über R . Bultmanns Jesusbuch. N a c h B u l t m a n n u m f a ß t J e s u V e r k ü n d i g u n g folgende Wahrheiten: „Zuerst die Gottesherrschaft. D a s ist aber kein Z u s t a n d k ü n f t i g e r V o l l e n d u n g und Herrlichkeit, sondern ein H a n d e l n Gottes in der Zukunft. Diesem ist der Mensch unentrinnbar ausgeliefert, ohne d a ß ihm irgend eine Freiheit zur Selbstbestimmung bliebe. F e r n e r : G o t t verlangt v o n dem Menschen r a d i k a l e n G e h o r s a m gegen seinen Willen. Dieser w i r d aber nicht durch allgemeine Regeln und N o r m e n bestimmt wie etwa die der Nächstenliebe, sondern allein durch die Situation, in der der Mensch steht. Auch das Gewissen sagt dem Menschen nichts als eine Stimme G o t t e s ; diese gibt es nicht, weil j a sonst Göttliches im Menschen wäre. G o t t bleibt dem Menschen f e r n ; J e s u Worte über G o t t v e r t r a u e n und die väterliche Liebe Gottes zu seinen K i n d e r n sind nebensächlich, wenn nicht g a r fälschlich Jesus zugeschrieben." N R U IV, 127. Diese D a r s t e l l u n g läßt zugleich die E i n w ä n d e •erkennen, die alle auf ein Nicht-Verstehen der Z u k ü n f t i g k e i t der Gottesherrschaft z u r ü c k z u f ü h r e n sind. 140
141
143
Vgl. W p m M I, 9.
157
gehen kann. Im Grunde muß F. Niebergall den Gegensatz konstatieren und die Behauptung einer tieferen Einheit erscheint nicht recht begründet 144 . Hier kommt der Erziehungsgedanke ins Spiel. Wo es der Zustand der Zöglinge fordert, kann es legitim sein, mit niederen Motiven zu operieren 145 . R. Bultmann sieht in den sprichwortartigen Sätzen der synoptischen Tradition, die Jesus als Weisheitslehrer zeigen, allgemeine Wahrheiten. Daraus erwächst für ihn das Problem des Verhältnisses dieser zur Verkündigung als Anrede. „Wenn im Rahmen der christlichen Verkündigung allgemeine Wahrheiten begegnen — kann es sich nur um ein Nebeneinander handeln? Oder besteht hier ein notwendiges Miteinander? Worin wäre dieses begründet?" 1 4 6 Allgemeine Wahrheiten können — obwohl sie sich jeder selbst sagen kann — vergessen werden. Werden sie einem dann in konkreter Situation auf den Kopf zugesagt, verlieren sie ihren Charakter als allgemeine Wahrheit und gewinnen Aktualität als Anrede 147 . Letztlich ist der Zusammenhang dieser allgemeinen Wahrheiten und der eschatologischen Botschaft in dem Verhältnis von Indikativ und Imperativ zu sehen. Den vom reformatorischen Ansatz geforderten Gabecharakter der Forderung Jesu kann R. Bultmann schließlich unter Berufung auf E. Fuchs deutlich machen, der zeigt, „daß Jesu Verhalten selber der eigentliche Rahmen seiner Verkündigung war" 1 4 8 . Was F. Niebergall an rationalen Motiven und R. Bultmann an allgemeinen Wahrheiten im Neuen Testament aufzeigen, deckt sich nicht immer, weil die Fragestellung verschieden ist. Von seinem Ansatz her liegt R. Bultmann am Anredecharakter der Verkündigung. Allgemeine 1 4 4 „ H a n d e l t es sich bei dem H a u p t m o t i v um die G e w i n n u n g u n d Gestaltung eines neuen Lebens v o n innen heraus durch die reine freie Lust an der herrlichen G o t t e s g a b e in Christus u n d seinem Geist, so ist es hier (seil, bei den rationalen Motiven) der G e w i n n u n d die B e h a u p t u n g v o n Gesundheit, Leben, Ehre, Frieden mit den Leuten und ähnlichen Gütern. Aber schließlich sind die Verhaltensweisen materiell identisch: D e m u t , Zucht, Friedfertigkeit usw. Praktisch ist also eine Einheit beider Reihen d a . . W p m M I, 139 f. 1 4 5 F. N i e b e r g a l l hält sich f ü r berechtigt, „entsprechend der H ö h e n l a g e des sittlichen Bewußtseins mit diesen oder jenen Motiven zu operieren." W p m M I, 140. I m Blick auf eine L a n d g e m e i n d e kann g e f r a g t w e r d e n : „ W i r d m a n aber daneben nicht auch an den praktisch-ethischen R a t i o n a l i s m u s der Leute a n k n ü p f e n dürfen, etwa in der A r t , d a ß m a n ihnen die Wichtigkeit und die Bedeutung eines g a n z sittlichen Verhaltens f ü r ihr inneres und äußeres Leben klar macht, ihr U n v e r m ö g e n aus eigener K r a f t zu einem solchen Leben einschärft, und v o n d a zu G o t t und Christus a u f s t e i g t ? " E b d . 159. Noch deutlicher w i r d der Sachverhalt in der Auslegung zu R o m . 6 : „die Rechtfertigungsgewißheit ist nicht a m Beginn, sondern erst im V e r l a u f des Christenlebens zu erfassen . . . Passivisch f ä h r t m a n fort, aber aktivisch f ä n g t m a n an . . . " P A N T 316. Ähnlich urteilt E . Hirsch: „ D i e echte eigenerlebte T i e f e des christlichen Sündengefühls ist Sache des reifen Menschen." H a u p t f r a g e n christlicher Religionsphilosophie, Berlin 1963, 244. 148 148
158
G V I I I , 169. E b d . 176 f.
147
V g l . ebd. 171 f.
Wahrheiten werden zum Problem 14e . Für F. Niebergall dagegen wird auf Grund seines pädagogischen Ansatzes das Nebeneinander höherer und niederer Motive zum Problem. Das entwicklungsgeschichtliche Element in seinem Erziehungsbegriff hindert ihn an einem radikalen Verständnis. Es ist nicht schwer, das entwicklungsgeschichtliche Denken als ein im Neuen Testament nicht nachweisbares zu disqualifizieren. Man darf dahinter jedoch nicht nur die Anpassung an zeitgenössisches Denken sehen, sondern auch die Kritik an MißVerständnissen. Es geht darum, wahrhaftig und realistisch die Unterschiede zwischen neutestamentlichem und gegenwärtigem Denken zu sehen. Eben darin nimmt der praktische Ausleger die ihm aufgetragene Verantwortung wahr. Es gilt ehrlich festzustellen: So denkt Paulus, so denken wir nicht mehr, um dann in der Kontinuität seines Motivs weiterzudenken 150 . In diesem Weiterdenken, das nichts mit praktikablen Anwendungen zu tun hat, besteht die Aufgabe der praktischen Exegese. Damit führt sie über die „eigentliche" Exegese W. Marxsens und R. Bultmanns existentiale Interpretation hinaus. Nach W. Marxsen besteht die Aufgabe des Predigers nach der Exegese darin, in seiner Gemeinde eine Situation aufzuspüren, die der des Textes entspricht. Identität der Situationen wird es nicht geben, aber Analogien lassen sich finden151. Damit dürfte zwar die Aufgabe, aber noch nicht die Schwierigkeit gesehen sein. Daß ein gesetzliches Schriftverständnis einem gesetzlichen Sabbatverständnis entspricht, mag einleuchten, ist aber weder exegetisch noch auf andere Weise zu beweisen. Diese Entsprechung zu behaupten, muß der Prediger wagen und verantworten. Sie ist in sein Ermessen gestellt. Mit Recht wendet sich G. Harbsmeier gegen eine Unterscheidung von Grundsatz- und Ermessensfragen, die zu toten Richtigkeiten und einem falschen Schriftgebrauch führt 152 . Wie F. Niebergall diese Probleme aufnimmt, zeigt seine Exegese von 1. Kor., 8—10. Er läßt sich dabei von der Frage nach dem pädagogischen Schema „Norm, Zustand, Hilfen" leiten 153 . Bei der Konstatierung einer Entsprechung des Zustandes von einst und heute darf man nicht zu großzügig urteilen. Nicht jede Gemeinde, die freiere und gebundene Geister 148 Man hat den Eindruck, daß Bultmann hier das im Auge hat, was für F. Niebergall den Unterschied zwischen Erziehung und Unterricht ausmacht: das Praktisch-Existentielle. Freilich versteht Bultmann diese Begriffe anders als F. Niebergall, vgl. oben S. 101 f. IM Vgl. oben S. 141, Anm. 60 und S. 148, Anm. 97. „Besser als sich dem Apostel oder den Apostel sich zu unterwerfen ,ist's dodi, gleichsam in der Verlängerung seines Denkens zu denken." P A N T 12. 151 „Es ist klar, daß kaum je die Identität von jener damaligen mit meiner heutigen Situation vorhanden ist; aber eine entsprechende ist fast immer zu finden. Hier muß man sich wirklich mühen!" EV 54. 152 y g l . G. Harbsmeier, Vom redi ten Schriftgebrauch in weltlichen Dingen, EvTh 16, 1956, 165. 153 Vgl. zum Folgenden P A N T 355 ff.
159
in sich vereinigt, entspricht der in Korinth. Typisch für die Situation dort ist, daß es sich um eine Missions- und Übergangsgemeinde handelt. Heute entsprechen ihr Los-von-Rom-Gemeinden oder solche, die eine Erweckungsbewegung, eine Wandlung von orthodoxem zu freiem oder von rationalistischem zu pietistischem Denken hinter sich haben. Wurde in Korinth das Götzenopferfleisch zum Problem, so kann heute das Mittun bei heidnischen Bräuchen, für bekehrte Katholiken Ehrungen für Bischöfe, katholische Kunst, für frei gewordene Pietisten der Haß gegen Adiaphora zu Schwierigkeiten führen. Aus dem Motiv der Liebe heraus macht Paulus den unverletzten Stand des engen Gewissens zum höchsten Ziel. Im Weiterdenken dieses Motivs fordert F. Niebergall, daß in wirklichen Christengemeinden und in ruhigen Zeiten ein höheres Motiv sein Redit habe, nämlich die Befreiung des Bruders aus seiner Gebundenheit zu folgerichtiger Aneignung höherer Stufen. In einer andern Richtung kann noch weiter gedacht werden. Bisher ging es um die Frage, ob die Freien lassen sollen, was die Engen nicht wieder tun wollen. Nun ist die Frage, ob sie das tun sollen, was die Engen von ihrem Glauben aus fordern. „Wer wird sich etwa gegen seine Überzeugung zum Fasten vor dem Abendmahl oder zum Fischessen am Karfreitag zwingen, weil das engen und alten Leuten zu ihrem Christentum gehört? Oder ist es recht zum Abendmahl zu gehen oder zu raten gegen die eigene Überzeugung, weil es für maßgebende Leute zum Christentum gehört?" 1 5 4 Bei diesem „Weiterdenken" kommt F. Niebergall sogar zu Auffassungen, die dem Wortlaut bei Paulus entgegengesetzt sind. „Ich habe auch ein Gewissen, und das sagt mir sogar unter Umständen, daß ich das seine nicht schonen darf . . 1 5 5 Er weiß, daß solche Gegenthesen nicht leichtfertig aufgestellt werden dürfen. Sie setzen eine Antwort auf die Frage nach dem Wesen des Christentums voraus, die als gewissensmäßige Entscheidung gewagt werden muß ohne Rückendeckung durch die Exegese des einzelnen Textes. Die häufigen sachkritischen Widersprüche gegen neutestamentliche Aussagen sollen den Gemeindeerzieher in diese Verantwortung einüben. Wir verdeutlichen dies am Beispiel der Taufauffassung des Paulus. Nach R. Bultmann 156 hat Paulus die Taufe im Sinne eines Sakramentes der Mysterienreligionen in den Gemeinden vorgefunden und sie als Reinigung von den Sünden interpretiert, durch die der neue Wandel begründet wird. Auch wenn er sie dem Wort zu- und unterordnet, kann er sich doch von der Vorstellung einer magischen Wirkung nicht ganz frei machen. Als objektives Geschehen sichert sie dem Täufling Teilhabe am Heilsgeschehen zu. „Sie vergegenwärtigt also für ihn das Heilsgeschehen ebenso, wie das 1 5 5 Ebd. P A N T 357. Vgl. zum Folgenden R . Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, 1968", § 34, 3. S. 311—314. 154
156
160
verkündigende Wort es auch t u t . . ." 157 Dies leistet die Taufe aber nur als ein damals verständliches Sprachmittel. Die für uns problematisch gewordenen Vorstellungen übergeht W. Marxsen, wenn er betont, „daß Paulus hier (seil. Rm. 6) keine Tauflehre vorträgt, nicht über das unterrichtet, was Taufe ist, sondern die Christen mit ihrer eigenen Taufe, mit ihrem Getauftsein konfrontiert" 158 . Wir verstehen eben heute nicht mehr, was die Christen in Rom noch verstanden haben, weshalb sie nicht mehr unterrichtet werden müssen. G. Bornkamm geht in seinem Aufsatz „Taufe und neues Leben bei Paulus" 159 den einzelnen Aussagen in Rm. 6 genau nach und versucht nachzusprechen, was Paulus seiner Gemeinde sagen wollte: „ . . . mit der Einmaligkeit ihrer Taufe ist das Ein-für-allemal ihrer Befreiung von der Sündenknechtschaft besiegelt."160 Er formuliert als Ergebnis: „Die Taufe ist die Zueignung des neuen Lebens, und das neue Leben ist die Aneignung der Taufe." 161 Mit Recht findet er das Problem von Rm. 6 in dem Verhältnis von Indikativ und Imperativ. Wer — wie Weinel und Holtzmann — die paulinische Antinomie als Inkonsequenz bezeichnet, ist im Unrecht162. Diese Kritik trifft auch F. Niebergall, der im Sinne Weineis formuliert: „Leider ist der Apostel auch hier wieder im Ausdruck nicht so glücklich wie im Denken. Zweimal setzt er im Kapitel 6 an, um die ethischen Gegengewichte aufzuzeigen, V. 1 und 15. Beidemal will er sagen: Ihr könnt euch ja gar nicht durch die Ausschaltung der Beaufsichtigung (seil, durch das Gesetz) zur Unsittlichkeit verführen lassen... Aber er stützt diese indikativischen Gedanken stets durch Imperativische; statt bloß zu sagen — Ihr könnt ja nicht sündigen, sagt er doch: Ihr dürft nicht sündigen." 163 Er möchte dann in Kontinuität mit den Tendenzen des Apostels den Grundgedanken „aus dem Sakramentalen und Mystisch-Realistischen in das Geistige" erheben164. Das heißt aber nicht, daß er an Stelle eines leiblichen Gehorsams nur eine geistige Gesinnung fordert, sondern daß er die magischen durch „geistige" Vorstellungen ersetzen möchte. „Plage sich nur niemand damit ab, die Vorstellungen des Apostels von der Taufe mit den seinigen in Übereinstimmung zu bringen oder gar die Leute damit zu quälen!" 165 Die neueren Exegeten wissen, daß es sich um Mysterienvorstellungen handelt, aber sie ziehen keine praktischen Konsequenzen. Der Praktische Theologe aber hat gerade hier eine Aufgabe. Ohne wie F. Niebergall auf das „überholte" Sakrament gleich verzichten zu wollen, macht G. Harbsmeier im Blick auf das Abendmahl auf den Unterschied der Zeiten aufmerksam und versucht Konsequenzen zu 138 E V 17. Ebd. G. Bornkamm, Das Ende des Gesetzes, 1952, 3 4 — 5 0 . 1 9 0 Ebd. 44. 181 Ebd. 50. 1 6 2 Vgl. ebd. 35. 163 P A N T 314. 165 Ebd. lei P A N T 315. 157
159
161
ziehen: „Kam dem antiken Menschen, wie dem des Mittelalters, das Sakrament sprachlich' entgegen, so stellt es den heutigen Menschen .sprachlich', eigentlich doch bereits seit der Reformation, vor wachsende Schwierigkeiten." 166 Die Predigt muß diesen Wandel der Sprache berücksichtigen. „Diese Predigt kann und darf daher auch nicht zu einem Sakrament rufen wollen, das den Hörer rein sprachlich' überfordert, weil sie einen unwiderruflich geschehenen Wandel in seinen Verstehensmöglichkeiten ungeschehen machen will." 167 Mit dieser Unwiderruflichkeit ist im Grunde das bezeichnet, was F. Niebergall mit dem Reden Gottes in ipso facto meint. Auch bei G. Harbsmeier erhält die Besinnung auf die Erneuerung des Gottesdienstes ihre Pointe und ihre Verantwortlichkeit dadurch, daß über rein exegetische Erkenntnis hinaus nachdrücklich auf den Unterschied der Zeiten hingewiesen wird. Seine Frage: „Wer wird nicht gern ,den Geist' der Gotik, der Renaissance und des Barock verstehen lernen? H a t er das alles aber wirklich verstanden, wenn er nicht zugleich mit versteht, daß und warum er heute nicht der Mann ist, der dieses Vergangene, das als das Vergangene freilich audi ihm zugehört, zur Gegenwart machen kann?" 168 würde F. Niebergall ohne Zögern mit dem gewünschten Nein beantworten. Daß bei solchem „Weiterdenken" neutestamentlicher Motive auch zu viel gewagt werden kann, besonders wenn der gegenwärtige „Zustand" nicht klar erkannt wird, zeigt F. Niebergalls praktische Auslegung zu Mk. 10, 42. „Auch mit diesem Wort über die Gewalthaber muß man vorsichtig sein. Denn es entstammt der pessimistisch-empirischen Auffassung des niederen Volkes, die schon gleich bei Paulus durch eine idealere verbessert wird. Wie fein läßt sich etwa an einem Kaisergeburtstag gerade e contrario zeigen, wie Jesus selbst die Aufhebung dieses seines Wortes bewirkt hat! Dann wäre es erlaubt, wie wir es jetzt auch getan haben, es aus dem Zusammenhang zu reißen und dann die Folie zu einem Hauptgedanken zu machen." 169 O. Baumgarten hatte schon 1903 angeregt, sich von diesem Text zu emanzipieren, ohne auf Kritik am Kaiser zu verzichten 170. Die Bereitschaft, aus praktischen Gründen gute exegetische Erkenntnisse zu suspendieren, zeigt die Schwäche der Praktischen Auslegung F. Niebergalls. Nach R. Bultmann zeigt die Geschichte vom reichen Jüngling Mk. 10, 17—22 deutlich die Radikalität der Forderung, die vor ein EntwederOder stellt. Sie beansprucht ganz und zeigt, daß formale Korrektheit nichts hilft, wenn die besondere Forderung aufdeckt, daß hinter jener 166
G. Harbsmeier, D a ß wir die Predigt und sein Wort nicht verachten, 1958, 61. 168 Ebd. 62. Ebd. 57.
is» pANT 107. 170
Vgl. O. Baumgarten, Predigtprobleme, 1904, 84 f., und Meine Lebensgeschichte, Kap. IV.
162
nicht der ganze Mensch steckt 171 . Außerdem warnt R . Bultmann vor einem MißVerständnis: „ . . . nicht die Armut ist gefordert, sondern das Opfer." 1 7 2 F. Niebergall unterstellt dem Text eben dieses Miß Verständnis und distanziert sich davon mit dem Argument, daß Gott durch die Geschichte anders gelehrt habe: „In der Schule der Geschichte hat uns Gott auch die Gefahr der Armut und das Bedenkliche des Almosens kennen gelehrt." 1 7 3 Dennoch weicht er nicht in eine laxe Gesinnungsethik aus. „Trotzdem darf und muß man den Reichtum fester anfassen, als mit der Forderung, das Herz nicht daran zu hängen: Opfer und Entsagung sollen aber im konkreten Fall nicht absolut und mechanisch, sondern von dem geschärften Gewissen gefordert werden." 1 7 4 Damit kommt er nahe heran an D . Bonhoefïers Überlegung in der „Nachfolge": „Das paradoxe Verständnis der Gebote hat sein christliches Recht, aber es darf niemals dazu führen, daß es das einfältige Verständnis der Gebote a u f h e b t . . . " 1 7 5 d)
Zusammenfassung
Unter Praktischer Auslegung des Neuen Testaments versteht F. Niebergall eine Methodenlehre, durch die Gemeindeerzieher in ein selbständiges Verstehen des notwendigen Zusammenhangs zwischen der praktischen Ausrichtung der Schrift und den kirchlichen Tätigkeiten eingeübt werden sollen. Als Klammer, die beides verbindet, dient das pädagogische Schema „Norm, Zustand, Hilfsgedanken", in dessen Anwendung zugleich die Eigenart seines Versuchs im Vergleich zu andern ähnlichen Versuchen besteht. E r läßt sich von der wissenschaftlich-historischen Exegese weitgehend „entlasten", referiert deren Ergebnisse ohne die entsprechenden Argumente, wendet sie gegen die „alte Theologie" und zum Nachweis des praktischen Charakters des Neuen Testaments an. Da die historische Exegese die Ganzheit der Schrift zerstört, muß auf systematischem Wege versucht werden, die verschiedenen „Motive" in einen Zusammenhang zu bringen. Es entsteht ein Spannungsverhältnis zwischen historischer und systematischer Fragerichtung, in dem systematische Kriterien den Ausschlag geben. Ein Vergleich mit W. Marxsen ergibt, daß „Erziehung" und „Verkündigung" in parallelen Gedankengängen dieselbe Funktion haben. In der Konfrontation mit R . Bultmann stellt sich heraus, daß dessen Polemik gegen Idealismus und Humanismus F. Niebergall nicht direkt trifft, sofern dieser dem menschlichen Sein und Tun keinen Eigenwert zuschreibt. Seine Deutung der neutestamentlichen Eschatologie und des Lohngedankens läßt personale Strukturen erkennen. Deren Radikalisierung verhindert der entwicklungsgeschichtliche Aspekt des Erziehungsbegriffs, durch den niedere, vorläufige Deutungen pädagogisch legitimiert 171 173 175
1 7 2 Jesus 71. Vgl. Jesus 69 f. 1 7 4 Ebd. P A N T 107. D. Bonhoeffer, Nachfolge, 4. A. München 1952, 36.
163
werden. Die reine Zukünftigkeit der Gottesherrschaft kann so nicht zum Ausdruck kommen. Bemerkenswert bleibt, daß er durch ein stark wirkungsgeschichtliches Bewußtsein vor einem Stehenbleiben bei einer rein historischen Erklärung des Textes warnt, auf die bei W. Marxsen übersehenen Schwierigkeiten im Auffinden entsprechender Situationen aufmerksam macht und die Verantwortung für ein „Weiterdenken" einschärft. 4. Praktische Auslegung des Alten
Testaments
F. Niebergall wendet hier dieselben Methoden wie bei der Auslegung des Neuen Testaments an. Auch hier geht es um die Bildung der Urteilsfähigkeit des Theologen durch eine Methodenlehre, die Reflexion der Grundsatzfragen und deren Anwendung an Beispielen darbietet. Praktische Auslegung soll auch hier wissenschaftliche Auslegung sein, die sich der bekannten Methoden, der literarkritischen, der religionsgeschichtlichen und der religionspsychologischen, bedient, wobei sich der Praktische Theologe vom Fachexegeten entlasten läßt: „Die Schriften des Alten Testaments" (hrsg. von Greßmann, Gunkel u. a.) bilden die theoretische Grundlage 176 . Man muß ältere und frühere Schichten unterscheiden, aber auch höhere und niedere Motive. So ist z. B. Gen. 32, 11 als ein späterer Einschub anzusehen, den man nicht zur Begründung der erbaulichen Deutung, der Betrüger Jakob habe sich in Gottes Schule geläutert, verwenden darf 1 7 7 . Die alttestamentlichen Gestalten dürfen nicht als Vorbilder religiös-sittlichen Verhaltens verstanden werden, sondern als Modelle menschlichen Verhaltens, an denen sich sittliches Urteil — gerade auch im Widerspruch — bilden und schärfen kann 178 . Daß hier wieder systematische „Vorurteile" über historische Einsichten herrschen, zeigt die unterschiedliche Deutung der Sündenfallgeschichte durch H . Gunkel und F. Niebergall 17β . H . Gunkel versteht die Erzählung als Sage, die vom Verlust kindlicher Unschuld berichtet und aus der Zeit stammt, „als die Tiere noch reden konnten". Die Schlange repräsentiert raffinierte Aufgeklärtheit. Zum Teufel ist sie erst in der späteren jüdischchristlichen Tradition geworden. Auch H . Gunkel verbindet Religionsgeschichte und Religionspsychologie. Da diese Psychologie schlecht zur J. Kaftanschen Auffassung der Sünde paßt, ersetzt sie F. Niebergall durch 177 " · P A A T I, V. Vgl. P A A T III, 67. 178 „Gerade darin gilt es die sittliche und religiöse Seite an diesen Erzählungen aufzuzeigen, daß die Sünde Jakobs zu einem solchen Sündenwirrwarr führt, wie er hier zu Tage tritt; das entspricht der Wahrheit der Erzählung und der Absicht des Erzählers selbst viel mehr als die übliche Figur des durch Leiden geläuterten Jakob, der audi nur ein Zugeständnis an das alte Verlangen ist, in den biblischen Gestalten auf jeden Fall nur Muster und nicht nur Modelle im obigen Sinne zu besitzen." P A A T III, 66. 179 Vgl. z u m Folgenden H . Gunkel, Die Urgeschichte und die Patriarchen, in: Die Schriften des Alten Testaments I, 1, 1911, 60 f., und P A A T III, 16—20.
164
eine „dogmatische" Psychologie, wonach die Schlange Sinnbild des dämonischen Grundbösen und die Sünde Untertänigkeit unter den Trieb ist. Er arbeitet hier mehr mit Goethes Faust als mit Gunkels Exegese. Wird hier der historische Sinn des Textes verschwiegen, so kann er sich auch bewußt aus praktischen Gründen von ihm dispensieren. Gen. 28,1—22 hat als Kultlegende keine Bedeutung für die Gegenwart. Die Schönheit des Textes gibt das Recht zur sinnbildlichen Auslegung180. Die wissenschaftliche Auslegung führt auch im Alten Testament zunächst zu Negationen. Durch das geschichtliche Verständnis der Texte wird die „alte" Auffassung, die in ihnen objektiv Wort Gottes und darum hauptsächlich Weissagungsbeweise für die Wahrheit der neutestamentlichen Botschaft findet, unmöglich gemacht181. Die Schriften von Katzer und Andersen sind als Reaktion auf das orthodoxe Verständnis verständlich. „Sie haben recht: Wir haben zuviel judenzt. Wir haben Israels Ansprüche auf Land und Ruhm als unsere eigenen vertreten, haben all seine Siege als die eigenen mitgefeiert, seine Helden unbesehen verehrt, seine Ideale aufgenommen, weil es ja die Bibel und Gottes Wort war . . . So ist es ein Verdienst, wenn jene beiden Kritiker uns die Augen geöffnet haben für die Durchdringung unserer Gedanken und Gefühle mit Judain."182 Das könnte antisemitisch gedeutet werden. F. Niebergalls Verständnis der Bekenntnisfreiheit läßt ihn aber für christlich-jüdische Zusammenarbeit eintreten. Er rühmt die Ergebnisse des Weltkongresses für freies Christentum und religiösen Fortschritt auf diesem Gebiet 183 . Weil die wissenschaftliche Auslegung die Bezogenheit des Glaubens auf Geschichte zeigt, dient sie auch der Polemik gegen moderne Naturreligiosität. „Gegen den ganzen pantheistischen Unfug bietet darum die biblische prophetische Religion einen prachtvollen Wall; sie stellt der Denk- und Stimmungsreligion eine Vertrauens- und Gehorsamsreligion entgegen."184 Den Negationen einer wissenschaftlichen Auslegung des Alten Testaments entsprechen Positionen. F. Niebergall nennt zwei Gesichtspunkte, unter die er seine Arbeit stellen will: » . . . wir haben im A.T. einmal eine große geschichtliche Entwicklung zu finden, die auf das N.T. hinstrebt. 1 8 1 Vgl. P A A T I, 1. P A A T III, 64 f. P A A T I, 2. 183 ρ Niebergalls Anerkennung gilt den Vertretern des Reformjudentums. „Keine Spur mehr ist darin zu finden von dem, was wir Judentum nennen, von jenem engherzigen, kultisch-nationalen Religions- und Lebenssystem, das nur eine Verzerrung des wahren Israel bedeutet. Diesem gegenüber, das sidi aber auch, nur unter anderer Flagge, mitten im sog. Christentum findet, fühlen wir uns eins mit jenem geistig gerichteten Israel der Gegenwart." P A A T I, 29. 1 8 4 P A A T I, 30. Vgl. die ähnliche Aussage bei W . Zimmerli: „Diese Kategorie (seil, der Verheißung, die auf Geschichte bezogen ist) wehrt jeder Flucht in ein zeitlos-mystisches Verständnis der Gottesnähe ganz ebenso wie einem existentialistisdi-punkthaften, geschichtlich beziehungslosen Verständnis der Gottesbegegnung." ThB 11, 3. A. 1960, 76 f. 180
182
165
Wir haben dann in ihm eine religiöse Welt, die als volkskirchlich-weltliche Ergänzung zum N.T. uns gute Dienste leisten kann. Ohne Wert darauf zu legen, können wir sagen, daß wir mit dem ersten Gedanken die tiefste Idee des alten Messianismi, mit dem zweiten die des tertius usus legis aufnehmen."185 Beide Gesichtspunkte hängen mit dem Erziehungsbegrifi zusammen. Religionsgeschichtliche Erkenntnisse lassen sich in einer geschichtsphilosophischen Konstruktion zu einem Bild des Aufstiegs verarbeiten, mit dessen Hilfe man die Geschichte Israels als eine Geschichte seiner Erziehung durch Gott deuten kann, die dadurch besondere didaktische Bedeutung erhält. Der andere Gesichtspunkt ist besonders interessant, da hier der antiradikale Aspekt des Erziehungsbegriffs entfaltet wird und sich daher hier zeigen muß, ob er eine legitime theologische Funktion haben kann. Ausgangspunkt ist das Verständnis der neutestamentlichen Botschaft und die geschichtliche Entwicklung des Christentums. Das Neue Testament bietet ein überweltliches Gut an und ist auf Transzendenz gerichtet. „Sie schaut überall aus dem N.T. hervor; ihre gewöhnliche Form ist die Eschatologie: die Welt vergeht, und es kommt die Gnade." 186 Da aber die Parusie ausblieb, muß te die Gemeinde wieder eine positive Beziehung zur Welt gewinnen, Natur und Kultur kehren an die Stelle zurück, von der sie vertrieben worden waren. „So entsteht dann die große Aufgabe der compiexio oppositorum: die Erlösung von der Welt und den Gebrauch der Welt samt der Herrschaft über sie zu vereinigen. Das Christentum wurde verweltlicht oder die Welt vergeistlicht."187 Die geschichtliche Entwicklung wird mit Hilfe religiöser Typen dargestellt. Im Protestantismus, besonders im Rationalismus findet diese Tendenz zur Anerkennung der Welt eine Fortsetzung, während der Pietismus die katholisch-mönchische Linie der Weltentfremdung fortsetzt, ohne daß sich beide der Welt völlig entziehen können. „So hat das A.T. etwas Protestantisches und Rationalistisches, etwas ganz Modernes an sich." 188 Hier kommt das Problem der Säkularisierung in den Blick. F. Niebergalls Aussagen berühren sich mit Äußerungen D. Bonhoeffers in „Widerstand und Ergebung". D. Bonhoeffer sieht die Bedeutung des Alten Testaments in seinem Bestehen auf der Diesseitigkeit des Glaubens, wodurch der neutestamentliche Glaube vor dem Mißverständnis, eine Erlösungsreligion zu sein, bewahrt werden kann 189 . F. Niebergall sieht im Alten 180 P A A T I, 17. P A A T I, 3. P A A T I, 18. „Vergeistlichung der Welt" dürfte hier nicht im Sinne einer Sakralisierung verstanden werden, auf die M. Schmidt Z T h K 54, 1957, 188 if. und 204 f. aufmerksam macht. F. Niebergall möchtc in diesem Zusammenhang die säkularen Folgen des Glaubens zeigen. E r meint d-as, was F. Gogarten und M. Stallmann „Christentum" nennen. 188 P A A T I, 20. 180 „Im Unterschied zu den anderen orientalischen Religionen ist der Glaube des Alten Testaments keine Erlösungsreligion. Nun wird doch aber das Christentum immer 185
187
166
Testament eine „Religion mit Weltgepräge" 1 9 0 niedergelegt. Freilich dürfen die Unterschiede nicht übersehen werden. Während D. Bonhoefier die Auferstehungshoffnung gegenüber der Unsterblichkeitshoffnung abgrenzen möchte, hält F. Niebergall diese beiden Ausprägungen der Hoffnung für gleichberechtigt, neigt aber mehr zur griechischen Lösung der Frage. „Vielleicht neigt man jetzt viel mehr dazu, sie im griechischen als im spätjüdischen Sinn zu beantworten, also die Fortdauer mehr als die Auferstehung zu betonen." 191 Die Diskussion darüber ist heute noch nicht abgeschlossen 19ä , und wer — etwa im Anschluß an R. Bultmann 193 — einwenden wollte, daß das Neue Testament eine stärkere Affinität zum alttestamentlichen als zum griechischen Denken habe, müßte sich mit den Einwänden von J . Barr auseinandersetzen, wonach man griechisches und hebräisches Denken nicht pauschal einander gegenüberstellen darf 1 9 4 . F. Niebergall möchte seine wissenschaftliche Auslegung des Alten Testaments verstanden wissen als Ausdruck für seine Bejahung der Säkularisierung. Sofern er diese in Zusammenhang bringt mit dem Protestantismus, könnte man sie als legitime Folge des christlichen Glaubens verstehen. Gleichzeitig aber — und für ein an F. Gogarten orientiertes Denken im Widerspruch dazu — gilt sie als ein Rückfall herab von der Höhe radikaler Eschatologie in alttestamentliches Denken. So kann sie dann nicht mehr als Kehrseite, sondern nur noch als Auflösung von Radikalität verstanden werden. „Das ist ohne Bedenken zuzugeben, daß das Gesagte auf einen Kompromiß zwischen Reich Gottes im ewigen Sinne und der Welt hinauskommt." 195 Das Alte Testament ist nicht als ein notwendiger Kontext zum Neuen Testament verstanden, sondern als eine durch die geschichtliche Entwicklung notwendige Ergänzung. Die pädagogische Rechtfertigung eines Sich-Dispensierens von der eschatologischen Botschaft wird mit der geschichtlichen Entwicklung, mit Gott „in ipso facto" legitimiert. Beide Hemmungen gegenüber der Eschatologie hängen mit dem Erziehungsbegriff zusammen, dessen theologische Funktion dadurch unmöglich zu werden scheint. Es wäre dann aber zurückzufragen, ob der Fehler nicht in einem ungeschichtlichen Verständnis der neutestamentlichen Eschatologie zu suchen ist — ein Vorwurf, den Zimmerli gegen R. Bultmann erais Erlösungsreligion bezeichnet. Liegt darin nicht ein kardinaler Fehler, durch den Christus vom Alten Testament getrennt und von den Erlösungsmythen her interpretiert wird?" Widerstand und Ergebung 225. „Das Diesseits darf nicht vorzeitig aufgehoben werden. Darin bleiben Neues und Altes Testament verbunden." Ebd. 227. 180 P A A T I, 20. 1 9 1 P A A T I, 29. 1 8 2 Vgl. H . Graß, Art. Unsterblichkeit, 3. Theologisch, R G G 3 VI, 1177 f. 193 Vgl. G V I, 313—336, bes. 323 f. 1 M Vgl. J . Barr, A k und Neu in der biblischen Überlieferung, 1967, 30 ff. 1 8 5 P A A T I, 19.
167
hebt 198 — und ob der Weltbezug des entweltlichenden Glaubens ausreichend interpretiert ist durch den Hinweis auf das paulinische „als ob nicht" . . . Könnte die von F. Niebergall geforderte Ergänzung zur neutestamentlichen Eschatologie in Wahrheit nicht eine notwendige, legitime Interpretation zu 1. Kor. 7, 29 ff. sein, die diesen Bultmannschen Kernsatz davor bewahrt, eine paradoxe Abstraktion zu bleiben? Ein weiterer Grund, das Alte Testament als Ergänzung zum Neuen Testament zu verstehen, ergibt sich aus der Volkskirchenidee. Die Volkskirche ist ihrem Wesen nach mit der Welt, d. h. mit Natur und Kultur verflochten, sie hat teil am Pluralismus der weltlichen Gesellschaft, sofern in ihr sehr verschiedene Typen von Frömmigkeit Heimat finden, die nicht alle auf der Stufe des Neuen Testaments stehen. Sie darf und muß Züge alttestamentlicher Frömmigkeit und Ordnung pflegen. Hinter F. Niebergalls praktischer Auslegung des Alten Testaments steht sein mehr soziologisch als dogmatisch geprägter Kirchenbegrifi. „Die Sekte kann sich mit dem N.T., der Urkunde der weltabgeschiedenen Gemeinschaft, begnügen, die auf den Herrn hofft und vor allem die einzelnen Leute ausliest, als Landes- und Volkskirche aber kann unsere Kirche das A . T . nicht entbehren." 197 Das Alte Testament ist verstanden als Kompendium der Sozialethik, das weniger Muster oder Vorbilder als Modelle enthält, an denen sich ein sozialethisches Urteil bilden kann. Die Bedeutung dieser alttestamentlichen Hermeneutik soll an exemplarisch ausgewählten Texten verdeutlicht werden. Am Buch Ruth hebt F. Niebergall zunächst die ästhetische Seite hervor, indem er es mit Goethes Hermann und Dorothea vergleicht 198 . Der religiöse Wert ist darin zu sehen, daß menschliches Geschick, Hunger und Tod, Erntesegen und Eheglück auf Gott zurückgeführt werden. Liegt auch Gottes Führung „im Bereich des gewöhnlichen irdischen Glückes, so taucht dodi eine weiterführende Linie in dem Zusammenhang auf, der den so wunderbar gestifteten Ehebund mit dem großen Könige verbindet" 1 9 e . Besonders wertvoll ist das sittliche Verhalten der handelnden Personen. Es ist eine lohnende Aufgabe, in Bibelstunden oder im Unterricht die Dankbarkeit und Selbstlosigkeit der Naemi, den fast echt christlichen oder deutschen Frauenadel der Ruth, den Takt und die Freundlichkeit des Boas herauszuarbeiten. Die Art, wie sich hier Aufmerksamkeit gegen andere mit den eigenen Wünschen verbindet, entspricht zwar nicht dem Ideal der Bergpredigt, aber „wir können zufrieden sein, wenn wir so handeln und wenn man 1 9 6 W. Zimmerli vermutet, daß R. Bultmanns Verständnis dazu führt, „die Christusbotsdiaft in existentialer Interpretation rein aus der Geschichte herauszuheben.. ThB 11, 99. 1 8 7 P A A T III, 22. 1 6 8 Vgl. zum Folgenden P A A T III, 176—179. 1 9 9 Ebd. 177. G. v. R a d betont in einer Predigt über Ruth gerade die heilsgeschichtliche Linie zu D a v i d und das Allzumensdilidie der Erzählung, E v T h 12, 1952/53, 1 ff.
168
mit uns so umgeht. Es ist eine Moral des Durchschnitts und des praktischen Ausgleichs, die hoch über dem gewöhnlichen Maße menschlichen Verhaltens steht, so sehr sie auch unter jenem andern bleibt, wo auch die feine Klugheit der völligen Selbstverleugnung zu weichen hat." 2 0 0 Die Tatsache, daß die „ideale" Ruth eine Ausländerin ist, kann vor Chauvinismus und Rassenhaß warnen. Die Art, wie Ruth um Boas wirbt, entspricht nicht modernem Empfinden, kann aber gerade darum Anlaß sein, über die Grenzen zwischen dem, was allgemein, und dem, was im besonderen Fall gültig ist, nachzudenken. Auch die Art, wie Eltern oder „Löser" über das Mädchen wie über ein Vermögen verfügen, darf nicht als Vorbild gelten. Doch wird diese Bemerkung dann wieder eingeschränkt: „ . . . wir haben heute freilich allen Grund, gegenüber mancher wilden Emanzipationsgier wieder auf die Schranken, die dem Weib gezogen, und die Rechte, die der Familie gegeben sind, hinzuweisen." 201 Bezeichnend ist, daß der historische Sinn des Textes, nämlich die Einschärfung der Pflicht zur Leviratsehe — worauf in den „Schriften des Alten Testaments" ausführlich eingegangen wird 2 0 2 —, völlig außer Betracht bleibt und F. Niebergall gegen eine Verwendung von Ruth 1, 16. 17 als Trautext nichts einzuwenden hat. Im Vordergrund steht die ethische Belehrung, die in Anknüpfung und Widerspruch die alttestamentliche Vorlage als Modell benutzt, deren Ergebnis aber nicht in einer Kasuistik besteht; die einzelnen Anweisungen werden immer wieder relativiert. Dadurch entsteht ein „Reiz" zur Selbsttätigkeit. Die ethischen Anweisungen sollen die Verantwortung für eigene Entscheidungen nicht abnehmen, sondern gerade zumuten. In Amos 7, 10—17 findet F. Niebergall eine Bestätigung für seine historisch-psychologischen Gesetze und für seine religiöse Typenlehre. Das Nordreich unter Jerobeam II. befindet sich in einer Lage, „wie sie immer wieder einmal typisch ist: es ist das Frankreich vor der Revolution, es ist das Deutschland nach dem Kriege von 1870/71. In der höchsten Blütezeit liegen die Kräfte des Verfalls, wie in der Zeit des höchsten Verfalles auch die Kräfte liegen, die zur Blüte führen." 2 0 3 Die Entsprechung des „Zustande" macht eine Übertragung in die Gegenwart möglich. Jerobeam und Amazja repräsentieren die konservative Interessengemeinschaft von Thron und Altar, deren Unbußfertigkeit es meisterhaft versteht, jede K r i tik als areligiös und staatsgefährdend zu verdächtigen. Die demaskierende Darstellung des Bündnisses von Thron und Altar gewinnt ihre Ausführlichkeit weniger durch Exegese des Textes als durch Beobachtung der Gegenwart und erneuert gerade so den prophetischen Bußruf. Die offene — in der Zeit der „Kriegspredigten" (1915) sicher nicht allgemein übliche — Kritik am Bestehenden wird nun durch einen neuen Aspekt 200 202 203
2 0 1 Ebd. P A A T III, 178. Vgl. Die Schriften des Alten Testaments I, 2, 280. Vgl. zum Folgenden P A A T II, 4 0 — 5 4 , hier 41.
169
nicht etwa eingeschränkt, aber an ihren Platz gestellt. Im Priester und Propheten treten sich zwei Arten von Politik gegenüber: „Die Politik des Glaubens und die der Angst. Diese arbeitet mit allen Mitteln, wobei persönliche Intrigen nicht verschmäht werden, um ,die von Gott gewollten Ordnungen', in denen es sich so bequem lebt, vor Händen zu schützen, die die geschichtlich gewordenen Verhältnisse' verwirren wollen." 204 Aber nun möchte F. Niebergall im Priester und im Propheten auch zwei Typen sehen, die sich im Lauf der Geschichte ständig ablösen, einander befehden und sich wieder verständigen. Die Begegnung zwischen Amos und Amazja hat typischen Charakter; denn sie wiederholt sich mehrmals in der Geschichte. „Pilatus und Kaiphas wider Jesus, Wenzel und Sbynnek wider Hus, Lorenzo Medici und Alexander VI. gegen Savonarola, Kaiser und Papst wider Luther, das sind einige der bezeichnendsten Punkte auf diesem Weg. Gottes Wille im Alten, Gottes Wille im Neuen, Gottes Wille in dem, der den neuen Wein in alte Schläuche füllt, Gottes Wille in der Thesis, Gottes Wille in der Antithese, Gottes Wille in der Synthese: Gottes Wille ist überall." 205 Der historische Sinn des Textes sperrt sich gegen eine Erhebung ins Typische; denn er berichtet nicht von „dem" Priester und „dem" Propheten, sondern von der unwiederholbaren Begegnung zweier bestimmter Personen. Wird durch die Typisierung nicht die Radikalität der prophetischen Kritik relativiert und umgekehrt die Fehlhaltung des Priesters relativ gerechtfertigt? Man wird zuerst fragen müssen, welche Funktion die Typisierung bei F. Niebergall hat. Sie soll auf das Problem der wahren und falschen Prophetie und die damit gegebene Anfechtung aufmerksam machen. „Strecken diese Beunruhiger ihre Hand nach dem Altar im Namen desselben Gottes aus, der ihn errichten ließ, so scheint ja Gott zwiespältig zu sein und wider Gott zu kämpfen." 206 Daraus folgert er aber nicht, daß die Kritik abgeschwächt werden darf oder daß man sich auf Agnostizismus zurückziehen kann, sondern: „Gott läßt sich nicht in Beschlag nehmen für die Erhaltung des bestehenden Baues allein noch für seine Zerstörung; Gott ist über allem . . . " 207 Die Typisierung des prophetischen Worts scheint dessen historische Einmaligkeit zu verkennen, aber gerade dadurch wird sie gewahrt, sofern die Typisierung eine direkte Übertragung der prophetischen Botschaft in die Gegenwart als Gottes Wort an uns verhindert. Die Funktion dieser Relativierung ist es, auf die Unverfügbarkeit des Wortes Gottes aufmerksam zu machen. Die Botschaft begegnet nicht als formale, objektive Autorität, sondern erweist sich nur dem Gewissen als wahr. Eine Aktualisierung des Textes kann nur gelingen, wenn der Ausleger in der Kontinuität mit dessen Motiven weiterdenkt, die gegenwärtigen Zustände mit bedenkt und so seine Verant204 208
170
PAAT II, 42. Ebd. 42 f.
205 207
Ebd. 43. Ebd. 43.
wortung mit ins Spiel bringt. Ohne dieses Weiterdenken würde die Auslegung nur in einem erklärenden Wiederholen des Textes bestehen, wobei es keinen großen Unterschied machte, ob die Erklärungen laienhaft oder wissenschaftlich sind. Die Typisierung führt ferner zu der sozialethischen Frage, wie man seine konkrete Aufgabe heute findet. „Wir dürfen nicht alle mit Amazja in Gottes Namen Tempel und Thron bewahren wollen, indem wir Amos vertreiben; wir dürfen aber auch nicht alle mit Amos wider Jerobeam und Amazja auftreten und unsere Herden und Sykomoren im Stich lassen. Aber was sollen und dürfen wir denn? Es folge ein jeder dem Gesetz seiner Natur."20* Wird hier nicht die in der Sachkritik des historischen Textes gewahrte Unverfügbarkeit Gottes wieder zurückgenommen? Wird er nicht faßbar im Gesetz der Natur des einzelnen? Jedoch auch das „göttliche" Recht der Individualität wird relativiert durch die sittlichen Gebote, die aber keine inhaltlich beschränkte Norm für alle darstellen, keine Kasuistik bieten. Bezeichnend dafür ist, daß F. Niebergall die sittlichen Anforderungen an beide Typen nur formulieren kann, indem er das erwünschte Verhalten sogleich mit einem äußerlich ähnlichen, aber falschen Verhalten konfrontiert. „Darum müssen wir den Satz: Jeder folge seinem Typ — dahin einschränken, daß wir sagen: Doch ohne Sünde! Also ohne Eigensinn, so schwer dieser von Charakter zu unterscheiden ist, ohne Gewalt gegen andere, so nahe die Versuchung dazu einem kräftigen Geiste liegt, vor allem ohne Beleidigung der andern, so leicht sie im Kampf mit dem Gegner auf die Zunge schlüpft." 209 Auch die praktische Auslegung des Alten Testaments geht ohne langen Aufenthalt beim historischen Sinn — von Kultpropheten ist z. B. nicht die Rede — über zum Weiterdenken des Textes im Blick auf gegenwärtige Verhältnisse. Es ist dabei gerade nicht beabsichtigt, möglichst rasch zu einer „praktischen" Anwendung zu kommen, sondern vor einer direkten, mechanischen Anwendung zu warnen. „Laienprotest ist nötig, um die Kirche vor dem Erstarren zu bewahren; aber damit ist nichts gegen die Kirche selbst gesagt, wenn eine ihrer Formen nichts t a u g t . . ." 210 Angesichts des allgemeinen Unbehagens an der Staatskirche muß man sagen: „Heute wären nicht des Amos, sondern des Amazjas Worte für das Land unerträglich." 211 Sieht man einmal davon ab, daß F. Niebergall hier dem relativen Eigenrecht des Individuums göttlichen Charakter zuschreibt, und betont man seine Warnung, Gott nicht für die eigene Auffassung in Beschlag nehmen zu wollen, kann dann nicht seine ständige Relativierung aller Aussagen als Versuch interpretiert werden, die Radikalität der Botschaft gerade nicht zu entschärfen, sondern im Sinne des paulinischen „als 208 210
Ebd. Ebd. 45.
208 211
Ebd. 44. Ebd. 171
ob nicht" zur Geltung zu bringen? Obwohl der prophetischen Kritik an der Verbindung von Thron und Altar seine Sympathie gilt, möchte er verhindern, daß aus dieser Kritik ein Prinzip, eine Wahrheit an sich gemacht wird. Man wird aber zugeben müssen, daß diese Relativierung nicht nur als Motiv wirkt, das den Menschen in der ständigen Beunruhigung durch sein forderndes Gefragtsein festhält, sondern auch als Quietiv, das ihn in seiner menschlichen Beschränktheit bestätigt. Wir haben eben versucht, F. Niebergall ein wenig besser zu verstehen, als er sich selbst verstand, indem seine Typisierungen und Relativierungen als Versuche interpretiert wurden, die Unverfügbarkeit Gottes zum Ausdruck zu bringen. F. Niebergall selbst gibt jedoch als Ziel seiner Auslegung die Persönlichkeit des Theologen und deren Bildung an. Weil wir das Recht der Persönlichkeit anerkennen, „geht es nicht mehr an, zu sagen: So (seil, wie Amos) müßt ihr werden . . . Wir sehen Gottes Willen nicht mehr nur in einem geschichtlich gegebenen Soll, sondern auch in dem natürlich gegebenen Ist und in der Entwicklung, die das Leben an es anfügt." 212 Gott aus beiden sprechen zu lassen und so beides zu verbinden, ist die Aufgabe der Bildung 213 . Mögliche theologische Ansätze sind damit doch wieder in anthropologische Bahnen gelenkt, die aber audi als Versuch interpretiert werden können, das paulinische „als ob nicht" weniger durch abstrakte Reflexionen als durch konkret-weisheitliche Winke zum Ausdruck zu bringen. Es hat sich gezeigt, daß sich F. Niebergall auch bei der praktischen Auslegung des Alten Testaments von Fragen leiten läßt, die mit der Erziehung zusammenhängen.
III. Kritische Würdigung Nachdem im 1. Teil der Untersuchung gezeigt worden war, daß der Erziehungsbegriff bei F. Niebergall eine wesentliche Funktion in der Interpretation des christlichen Glaubens hat, stand zu erwarten, daß auch sein Verständnis der Praktischen Theologie von diesem Begriff bestimmt wird. Die Untersuchung hat dabei zu einer schärferen Bestimmung des Begriffes selbst sowie zur Erkenntnis neuer Funktionen desselben geführt. Es hat sich bestätigt, daß F. Niebergall von J. Kaftan im wesentlichen nur den pädagogischen Aspekt des Erziehungsbegriffs übernimmt, der durch das Schema von Zweck und Mittel bestimmt, an Wachstum und Kontinuität orientiert und geeignet ist, eine vorläufige Anpassung an „niedere Stufen" und deren relatives Recht zu legitimieren. Obwohl sich Ansätze zu einem personalen Verständnis des Glaubens beobachten lassen, verhindert ein Erziehungsbegriff mit diesen Strukturen immer wieder ein konsequentes und radikales Verständnis der urchristlichen Eschatologie im Sinne der 212
172
Ebd. 51.
213
Vgl. ebd.
existentialen Interpretation. Der Erziehungsbegriff drängt zu Kompromißlösungen. Die Verwendung der pädagogischen Trias „Norm, Zustand, Hilfen" und die Betonung eines notwendigen Zusammenhangs zwischen diesen Größen zeigt die herbartianische Ausrichtung des Erziehungsbegriffs und seiner systematischen Ausprägung. Die Wissenschaftlichkeit der Erziehungslehre wird daher nicht nur mit der Verwendung empirischen Materials, sondern audi mit ihrer Systematik begründet. Die Hervorhebung eines geordneten, vollständigen Zusammenhangs könnte eine Methodisierung der Erziehung begünstigen. Die Charakterisierung des erzieherischen Handelns als eines künstlerischen soll dieses Mißverständnis ausschalten und es frei halten von Ideologisierung. Es wird festgehalten an der in der Unverfügbarkeit des Erfolgs begründeten Ohnmacht des Erziehers. Die Selbsttätigkeit und Freiheit des zu Erziehenden konstituiert das Erziehungsgeschehen. Im Unterschied zu einer nur übertragenen oder verliehenen Amtsautorität beruht die Autorität des Erziehers auf seiner Bildung, d. h. seiner sachgemäßen und selbständigen Urteilsfähigkeit, zu der es nur durch gleichzeitige Anerkennung der Freiheit des Gegenübers kommen kann. Weil echte Autorität nicht „hergestellt" werden kann, muß die Erziehungslehre ständig kritisch und polemisch auf den Unterschied zwischen wahrer und falscher Autorität aufmerksam machen. Da Erziehung sowohl Gegenstand als audi Funktion einer wissenschaftlichen Erziehungslehre ist, erhält diese einen potenziert pädagogischen Charakter. In dieser Bestimmung erhält der Erziehungsbegriff bei F. Niebergall eine wesentliche Bedeutung für das Verständnis der Praktischen Theologie. Als Erziehungslehre hat sie einen systematisch begründeten wissenschaftlichen Charakter. Mit Hilfe des Erziehungsbegriffs kann der Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis, die Einheit der Praktischen Theologie in der Unterschiedenheit ihrer Teilaufgaben und ihre Beziehung zu den andern theologischen Disziplinen verständlich gemacht werden. Mit dem Erziehungsgedanken ist die Notwendigkeit der Systematischen Theologie, die dem Erzieher ein einheitliches Ziel für sein Wirken geben soll, sowie die Notwendigkeit einer sowohl geschichtlichen als auch praktischen Auslegung beider Testamente und die Bedeutung der Schrift als klassischer Urkunde wie als Erziehungsmittel gegeben. Im Erziehungsbegriff bleibt das Spannungsverhältnis zwischen historischer und systematischer Fragerichtung gewahrt. Vom Erziehungsgedanken aus wird die religiöse Volkskunde gefordert und ihre Methode begründet. Die Polemik gegen eine historische Gelehrsamkeit bedient sich pädagogischer Argumente. Bildung im Sinne theologischer Urteilsfähigkeit als Ziel der Praktischen Theologie macht eine erneute Inangriffnahme der systematischen und exegetischen Aufgabe in Gestalt einer Praktischen Dogmatik und einer Praktischen Auslegung durch den Praktischen Theologen notwendig. Die Auffassung der Aufgaben und Methoden im einzelnen teilt F. Nie173
bergall im allgemeinen mit seinen Fachkollegen. Originell ist sein Versuch, die Tendenzen der „modernen Theologie" systematisch in einer Erziehungslehre zusammenzufassen. Der Vergleich mit R. Bultmanns existentialer Interpretation der christlichen Botschaft zeigt, daß F. Niebergall trotz ähnlicher Fragestellungen durch den Erziehungsbegrifi an einem radikalen Verständnis der urchristlichen Eschatologie gehindert wird. Sein Entwurf hat wie der J . Kaftans komplexen Charakter. Personale Ansätze im Verständnis der Botschaft Jesu sind da, werden aber nicht konsequent zu Ende gedacht. Die reine Zukünftigkeit der Gottesherrschaft und die Infragestellung alles Menschlichen durch sie wird nicht gesehen. Die Säkularisierung — im Erziehungsgedanken bejaht — wird als Kompromiß des Glaubens mit der Welt gedeutet, daneben aber auch als legitime Folge des christlichen Glaubens verstanden. Wegen dieser komplexen Struktur seiner Theologie wird F. Niebergall von R. Bultmanns Polemik gegen Idealismus und Humanismus nur zum Teil getroffen. „Erziehung" bei F. Niebergall und „Verkündigung" bei W. Marxsen haben eine parallele Funktion, so daß zu fragen ist, ob die Kluft zwischen diesen Begriffen so groß sein kann, wie man in der Theologie nach 1920 annahm. Hat nicht jede Theologie immer auch pädagogische Aspekte? Redaktionsgeschichtliche Deutungen der Synoptiker ζ. B. verstehen die Evangelisten meist als Interpreten ihrer Tradition. Sie beziehen Tradition und Situation aufeinander, und daraus entsteht neue Verkündigung. Wird dabei nicht vorausgesetzt, daß die Redaktoren über eine erstaunliche Bildung — nicht im Sinn einer Gelehrsamkeit, aber im Sinn einer theologischen Urteilsfähigkeit — verfügen? Daß die vorausgesetzte „Bildung" zu sehr modernen Maßstäben entspricht, kann dann sogar als Einwand gegen eine redaktionsgeschichtliche Konzeption vorgebracht werden Die „Art der Betrachtung" in R. Bultmanns Jesusbuch und die Betonung des Unterschieds zwischen existentialer Interpretation und existentiellem Vollzug kann als Hinweis auf das Phänomen der erzieherischen Ohnmacht verstanden werden. Wenn R. Bultmann ferner die Autorität der „Forderung" in ihrer Einsichtigkeit begründet sieht, dann findet F. Niebergalls erzieherischer Autoritätsbegriii darin eine Bestätigung. Es dürfte daher nicht angehen, in der pädagogischen und existentialen Interpretation eine Alternative zu sehen. F. Niebergalls praktische Auslegung vermag auch einen Beitrag zur gegenwärtigen theologischen Diskussion zu leisten. Auffallend ist seine ständige Betonung der Sprachunterschiede zwischen den Texten und der 1 J . R o l o f f wirft W. M a r x s e n v o r : „ . . . damit w i r d dem Evangelisten ein dialektisch differenzierendes D e n k e n zugeschrieben, das zu eindeutig an modernen hermeneutischen Fragestellungen orientiert ist, als d a ß es in der zweiten urchristlichen Generation bereits vorausgesetzt werden d ü r f t e . " D a s M a r k u s e v a n g e l i u m als Geschichtsdarstellung, E v T h
27, 1969, 77.
174
Gegenwart, wobei neben den mythologischen auch religiöse und ethische Aussagen in den Blick kommen. Die Relativierungen des historischen Textsinnes durch Typisierungen und Gegenbeispiele sollen die paulinische Aussage „haben als hätte man nicht" 1. Kor. 7,29 ff. zur Geltung bringen. H a t dieser von R. Bultmann häufig zitierte Gedanke nicht die Funktion, die Radikalität der eschatologischen Botschaft und die Infragestellung alles Menschlichen konkret als Relativierung zur Geltung zu bringen, durch die Bestehendes weder zerstört noch für gleichgültig erklärt wird? Man wird sogar fragen müssen, ob F. Niebergall, wenn er durch viele konkrete Beispiele — auch wo es der Text nicht fordert — diese Relativität bewußt macht, diesem Ziel nicht näher steht als R. Bultmann, der die Relativierung nur zur paradox-abstrakten Forderung erhebt. Durch „Weiterdenken in Kontinuität mit dem biblischen Motiv" möchte F. Niebergall ein wirkungsgeschichtliches Methodenbewußtsein einüben und davor warnen, bei einer Erklärung dessen, was Paulus als Sohn seiner Zeit seinen Zeitgenossen zu sagen hatte, stehen zu bleiben. Hierin und in der erklärten Absicht, Urteilsfähigkeit bilden zu wollen, darf der Versuch gesehen werden, in Abwehr sowohl eines gesetzlichen und objektivierenden als auch eines historisch-relativierenden Schriftverständnisses die Ubersetzung der biblischen Botschaft in die Gegenwart zu wagen und zu verantworten. Von da aus wäre zu fragen, ob die existentiale Interpretation mit ihrer Leitfrage nach den im Text ausgedrückten Möglichkeiten von Selbstverständnis nicht zu einer gewissen Methodisierung der zu leistenden Übersetzungsarbeit führt, bei der zwar die Verantwortung des Auslegers in abstrakten Formeln gefordert, aber nicht konkret eingeübt wird. Die Untersuchung führt damit in ihrem zweiten Teil schließlich an denselben Punkt wie am Ende des ersten Teils: F. Niebergalls „moderne Theologie" kann trotz der Schwächen ihrer komplexen Struktur, in der biblisch-reformatorische Gedanken mit idealistischen verbunden sind, als seinerseit sinnvolles Korrektiv gegenüber verobjektivierenden und relativierenden Deutungen der christlichen Botschaft verstanden werden, das zugleich Impulse für die gegenwärtige Diskussion enthält.
175
3. Teil: Die Funktion des Erziehungsbegriffs in Friedrich Niebergalls Verständnis der praktisch-theologischen Arbeits zweige Man pflegt die Praktische Theologie einzuteilen in Homiletik, Katechetik, Liturgik und Poimenik1. Diese Teilgebiete, die F. Niebergall im Untertitel des zweiten Bandes seiner Praktischen Theologie „Arbeitszweige" nennt, können jedoch ergänzt werden. Auch die Frage nach dem inneren Zusammenhang, der Zuordnung und der Reihenfolge dieser Arbeitszweige wird verschieden beantwortet2. F. Niebergall unterscheidet zwar Homiletik und Liturgik, faßt sie aber in einer Lehre vom Gottesdienst zusammen. Ebenso nimmt er Seelsorge und Gemeindearbeit (Poimenik und Kybernetik) zusammen und erhält so eine Dreigliederung, die er nicht unbegründet lassen will. „Da eine Ordnung nach einem Gesichtspunkt nicht überflüssig ist, wählen wir eine solche, die den Grad der Bindung und der freien Bewegung der kirchlichen Amtspersonen in Rücksicht zieht, darum kommt der Gemeindegottesdienst an erster Stelle, der Religionsunterricht an zweiter und die Seelsorge samt der Gemeindearbeit an dritter Stelle." 3 An Stelle des Grades von Gebundenheit kann er aber auch die psychologisch-anthropologische Trias „Gefühl, Verstand und Willen" oder die ihr entsprechende religiös- theologische „Kult, Mythos und Moral" nennen 4 . Da sich „Gefühl" auf die Irrationalität des innersten Ich bezieht, ist mit dieser Reihenfolge zugleich eine Rangfolge bezeichnet. In der Zuordnung von Liturgik und Homiletik knüpft F. Niebergall bewußt an Schleiermacher an, wie er sich gleichzeitig von C. I. Nitzsch und seinen Nachfolgern hierin geschieden weiß 5 . Man wird diese Ordnung nicht überbewerten dürfen, zumal er noch in seiner Antrittsvorlesung (1903) eine andere Reihenfolge nennt, in der die Liturgik an letzter Stelle steht9. Immerhin entspricht die später vorgenommene und beibehaltene7 Ordnung der pädagogischen Forderung nach allseitiger Ausbildung der Vgl. W . Jannasch, Art. Praktische Theologie, R G G 3 V, 505. Vgl. E . C. Adielis, Praktische Theologie, 1912 e , 6 — 1 0 (§ 3. Die Einteilung der Praktischen Theologie). 3 P T II, 2. 1 Vgl. P T II, 7. 6 Vgl. P T II, 12 f. o MkPr 3, 1903, 2 7 6 — 2 8 0 . 7 „Die neuen Wege kirchlicher Arbeit" weisen dieselbe Gliederung auf wie die „Praktische Theologie" II. 1 2
176
menschlichen Kräfte, die man mit Pestalozzi durch die Trias „Herz, Kopf und Hand" zu bezeichnen pflegt. F. Niebergall möchte seine Praktische Theologie auch durch ihre Gliederung als Erziehungslehre erweisen.
I. Liturgik und Erziehung F. Niebergall möchte die Idee des Gottesdienstes aus Voraussetzungen religionsgeschichtlicher, religiöser, ästhetischer und kirchlicher Art erheben. Dabei kommt die personale Komponente der J. Kaftanschen Theologie stark zum Tragen. Wir arbeiten zunächst diese heraus, um dann zu zeigen, wie sie durch den Erziehungsgedanken ergänzt und eingeschränkt wird. F. Niebergall überträgt das religionsgeschichtliche Koordinatensystem J. Kaftans auf den Kult. So kann er zugleich die Absolutheit des Christentums, seine Unterschiedenheit von allen Religionen und seine Korrelation zu ihnen aussagen. Das Christentum als Idee bestimmt die Auffassung des christlichen Kults, die ihn von allen andern Kulten unterscheidet. Die Erscheinung des Christentums bestimmt die Gestaltung des christlichen Kults, in die stets Elemente anderer Kulte eingegangen sind8. Im Begriff des Reiches Gottes konvergieren die Linien von der Naturreligion über die Gesetzesreligion und Erlösungsreligion und vollenden sich in der Vorstellung einer geistigen und sittlichen Gemeinschaft mit Gott. Die Idee des christlichen Kults verlangt daher als Inhalt den idealen Verkehr des Menschen mit Gott, der in einem überweltlichen Leben vollendet, aber schon jetzt anfangsweise verwirklicht werden kann. Von da aus ergeben sich einige Abgrenzungen. Als Darstellung der geistig-sittlichen Gottesgemeinschaft ist der Kult auf den Lebenstrieb und die Sittlichkeit bezogen. Es gibt keinen wahren Kult ohne Frömmigkeit und Sittlichkeit9. Von seiner Idee her ist der christliche Kult Feier. Sein Sinn ist nicht Antrieb zum Tun, sondern ein Ausruhen von der Tyrannei der Zwecke10. F. Niebergall gebraucht die verschiedenen Derivate von „Feier", ζ. B. auch „feierlich", wodurch einem sentimentalen Verständnis Vorschub geleistet wird. Ebenso häufig verwendet er aber das Verbum „feiern" und macht damit auf das Indikativische des Kults aufmerksam. Es gilt, „das alles zu tun in der Gestalt der Feier, die ein Ausruhen gewährt und über den Alltag . . . den verklärenden Schein wirft . . . " u . Christlicher Kult will nicht auf die Gottheit einwirken, weder durch Zauber noch durch kultische Verdienste. Er will aber audi nicht der Belehrung oder der Zucht dienen. Er beruht nicht auf dem Gesetz, sondern auf Freiheit12. „So hat mit Schleiermacher der idealistische Gedanke, daß im Gottesdienst Besitz ausgedrückt wird, den andern grundsätzlich ver8 10 11
Vgl. PT II, 17. · Vgl. PT II, 19. Vgl. Christlidie Jugend- und Volkserziehung 144 fi. 12 Vgl. PT II, 20. PT I, 272.
177
drängt, nach dem es in ihm auf Erwerb von Glück und Seligkeit oder auf Gewinn von Erkenntnis ankommt." 13 Man wird diese Aussage als Versuch interpretieren können, den Gnaden-Charakter des Gottesdienstes zum Ausdruck zu bringen. Dem entspricht, daß die Familie, das Vater-Kind-Verhältnis als Analogie für den im Kult ausgedrückten idealen Verkehr mit Gott geeigneter ist als das Bild vom Herrn und Knecht. Das personale Verständnis der Gottesgemeinschaft schließt ein gesetzliches Verständnis des Kultes als Hofzeremoniell aus14. Es wurde schon gezeigt, daß F. Niebergall Rechtfertigung und Vergebung psychologisch als pädagogisches Vorschußvertrauen mißdeutet, daß er aber die Problematik der Rechtfertigungslehre wieder aufnimmt unter der Frage nach dem Übergang vom Wissen um den Glauben zum Glauben selbst oder nach dem Übergang von der existentialen Interpretation zum existentiellen Vollzug. Das findet hier seine Bestätigung, sofern er den Gottesdienst als den Ort erkennt, an dem sich dieser Übergang zu vollziehen pflegt. Dieser Ort wird näher bezeichnet durch den Erlebnisbegriff. „Im Kult soll das angebahnt werden, was man ein religiöses Erlebnis nennt." 15 Durch „Erlebnis" soll die Unmittelbarkeit und Unverfügbarkeit dieses Ubergangs ausgedrückt werden. Freilich ist F. Niebergall hier nicht konsequent, sofern der Gedanke an die Erlebniskunst eben diesem Motiv widerspricht und sofern er nun doch versucht, auch das Erlebnis psychologisch zu fassen. „Es sind Zustände innerer Ergriffenheit, in denen der Seele das Ewige oder Gott selbst fast spürbar nahe ist: . . . Denken und Wollen schweigt; die ruhenden Kräfte der Seele wachen auf; man ist über sich selber hinausgehoben . . . " 1 6 Der Glaube soll frei sein von Reflexion. Er ist ein Wegsehen von sich selber, das man nicht in sich erzeugen kann, sondern das vom Gegenstand des Glaubens hervorgerufen wird, sofern er einen „er-greift". Es ist aber nicht konsequent, diese Ergriffenheit vom Gegenstand nun doch wieder als einen „Zustand" der Seele zu beschreiben, wodurch es wieder zur Reflexion kommen muß. R. Bultmann hat hier bei grundsätzlich gleicher Intention konsequenter gedacht. „In der Homología wendet sich der Glaubende von sich selbst weg und bekennt, daß er alles, was er ist und hat, durch das ist und hat, was Gott getan hat. Der Glaube beruft sich nicht auf das, was er als Akt oder Haltung ist, sondern auf Gottes vorangegangene, ihm zuvorgekommene Gnadentat. Deshalb wird der Glaube auch von Paulus (wie sonst im NT) nie als psychische Verfassung, sein Werden nie als psychischer Vorgang beschrieben . . . Der Blick des Glaubens richtet sich nicht in der Reflexion auf sich selbst, sondern auf sein PT II, 20. „Immer aber ist es Verkehr zwischen den Kindern und ihrem Vater, nicht Hofzeremoniell, das zwischen dem Despoten und seinen Untertanen gilt." PT II, 22. 15 PT II, 7 f. 19 P T II, 10. 13
14
178
Objekt." 17 F. Niebergalls Psychologisierungen implizieren stets das Mißverständnis, daß die dem Glauben geschenkte Gabe zu etwas Verfügbarem wird. Man wird aber sehen müssen, daß er ζ. B. vom feiernden Genießen des „Besitzes" gerade in Zusammenhängen spricht, in denen das Kultgeschehen als reines Empfangen polemisch gegen andere Auffassungen dargestellt wird. Aus der Tatsache, daß Jesus Vergebung und Gemeinschaft mit dem Vater schenkt, folgt, „daß also nichts andres für den Kult übrig bleibt, als diesen Besitz genießend zu feiern" 18 . Die Form des Kultes ist der Gabe besonders angemessen. Während Unterricht und Seelsorge dem einzelnen den idealen Verkehr mit Gott gedanklich zum Nachstreben vorhalten, stellt der Kult diesen „in einer Weise dar, daß sie locken soll, auch tatsächlich in diesen Verkehr mit Gott einzutreten" 19 . Daß der feiernde Genuß des Besitzes nicht als Verfügbarwerden der Gabe verstanden werden darf, zeigt folgende Aussage: Der Kult soll den Verkehr der Kinder Gottes mit ihrem Vater ermöglichen. „Dazu dient die Feier der Gnadentaten Gottes, die sie vergegenwärtigt, nicht verdient oder verwirklicht; das geschieht in den Formen des Schönen als der eindrucksvollsten Sprache für das Heilige, das einer Gemeinschaft zugeleitet werden s o l l . . ." 2 0 Mit Schleiermacher betont F. Niebergall, daß die Kunst auch für den christlichen Kult konstitutive Bedeutung hat. Sein Inhalt ist Religion, seine Form Kunst 21 , so daß der Gottesdienst in seiner Ganzheit ein Kunstwerk zu sein hat 22 . Kunst und Kult wollen Innenleben in festlicher Weise darstellen. Das Heilige und das Schöne sind auf höherer geistiger Ebene benachbart. Von da aus ergibt sich eine doppelte Aufgabe der Kunst in bezug auf den Gottesdienst: „sie hilft ihm die Stimmung schaffen, ohne die es keinen gottesdienstlichen Genuß und Gewinn, also keine Erbauung geben kann, und sie vermag das innerste Wesen einer Religion darzustellen, das heißt auf unserm Boden den Verkehr der Christengemeinde mit ihrem Gott zum Ausdruck zu bringen." 23 Obwohl F. Niebergall um die übliche, abschätzige Auffassung von „Stimmung" weiß, hält er diesen Begriff für geeignet, ein Totalgefühl zu bezeichnen, das aus dem innersten Ich, aus dem Wesen der Person kommt. Die auf das Auge wirkenden Künste, Architektur, Plastik, Malerei übernehmen meist die erste, während Musik und Poesie, die aufs Ohr wirken, mehr die zweite Aufgabe im Kult übernehmen. Obwohl der Ubergang zum existentiellen Glauben selbst als unverfügbar gelten muß, kann nun gesagt werden, daß durch R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments 319 f. 1 9 P T II, 23. P T II, 17. 2 0 P T II, 37. 2 1 „Das geschieht mit Hilfe der Kunst, so daß das Religiöse gleichsam den Stoff und das Künstlerische die Form des Kultus ausmacht." P T II, 12. 2 2 Vgl. P T II, 71. 2 3 P T II, 27. 17
18
179
die Kunstform die Darstellung des idealen Verkehrs mit Gott im Kult eine solche Gestalt erhält, daß dieser anschaulich erfaßt und erlebt werden kann 24 . Das Erlebnis wird am wirkungsvollsten angebahnt durch die anschauliche, feierliche, dramatische und d. h. eben künstlerische Form des Gottesdienstes. Von da aus kommt F. Niebergall zu — wie er weiß — gefährlichen Aussagen. „Es sollte also gleichsam ein Heiliges Spiel sein — sicher wird der Ausdruck mißverstanden —, in dem Gemeinde und Gott sich begegnen, wie sie sich tatsächlich begegnen sollen und es auch tun im Leben des Frommen und der gläubigen Gemeinde. In diesem heiligen Spiel tritt nicht etwa Gott selber auf, audi nicht in seinem Wort, sondern der Pfarrer als Prophet spielt — wiederum scheint es ein lästerlicher Ausdruck — Gottes Rolle, wie er auch die der Gemeinde Gott gegenüber als ihr Priester spielt." 25 Man wird diese gewagten Aussagen als Versuch verstehen dürfen, durch den Gedanken des Spiels die Freiheit zu interpretieren, die der Kult gewährt und zu deren Betätigung er anregen soll. Daß es darum geht, den Gottesdienst als geeigneten Ausdruck für die Gabe des Evangeliums zu verstehen, zeigen die Abgrenzungen, die er vornimmt. Zunächst hat man auf die richtige Rangordnung zu achten. Weil das Wesen des Gottesdienstes im Feiern und Ausruhen, d. h. im reinen Empfangen besteht, geht diese Aufgabe „aller Erziehung zur Verantwortlichkeit und zum Vertrauen voraus" 26 . Der Indikativ geht dem Imperativ voraus. Sodann verlangt der personale Charakter des im Kult dargestellten Verkehrs mit Gott eine doppelte Abgrenzung, einmal gegen ein Mißverständnis der Kunstform im Sinne des Ästhetizismus, der keine Verpflichtung kennt, dann gegen ein gesetzlich-kirchenrechtliches Mißverständnis, das den Gottesdienst zum Werk oder zum opus operatum verkehrt 27 . In den „neuen Wegen kirchlicher Arbeit" (1928) stellt F. Niebergall die liturgischen Reformbestrebungen von F. Heiler, R. Otto und Κ. B. Ritter dar, die er in Marburg aus der Nähe beobachten konnte. Er tadelt an ihnen die sakramentalistisch-neuplatonischen Tendenzen und fordert eine möglichst nüchterne Liturgie28. Von dem Verständnis des Gottesdienstes als Kunstform und Feier aus wird die Einbeziehung des Erziehungsbegriffs zum Problem. „Was hat mit dieser Aufgabe von Haus und Schule (seil, der Erziehung) das hohe, feierliche künstlerische Tun gemeinsam?"29 Die Integration gelingt, indem die Bedeutung des Erziehungsbegriffs erweitert wird. Erziehung ist nun P T II, 32. Ebd. Vgl. R . Leuenberger, Wahrheit und Spiel, Z T h K 67, 1970, 2 5 0 — 2 6 2 . 2« Die neuen Wege kirchlicher Arbeit 15. 2 7 Vgl. P T II, 26. 2 8 „Man kann den Gemeindegottesdienst nicht schlicht und kurz genug madien." Die neuen Wege kirchlicher Arbeit 25. 2» P T II, 10. 24
25
180
eben jedes Wirken oder Beeinflussen von Menschen, so daß der Begriff neben dem „schulmeisterlichen" auch das künstlerische Tun einschließt. Ausdruck des Glaubens in künstlerischer Form soll der Gottesdienst sein; „der Zweck ist nicht Einwirkung auf die Gottheit, sondern rückwirkende Stärkung des Glaubens der Gemeinde.. ." 30 In dieser Rückwirkung hat der Gottesdienst pädagogischen Charakter. Die weite Fassung des Erziehungsbegriffs begründet F. Niebergall, indem er ihn mit „Erbauung" gleichsetzt und auf die Geschichte dieses Begriffs verweist. Bei Paulus bedeutet Erbauung Förderung und Kräftigung des religiösen Lebens. Dieser nüchtern-praktische Sinn steht dem Sittlichen näher als dem Mystischen. Durch den Pietismus oder den sentimentalen Rationalismus hat der Begriff jene sentimentale Komponente bekommen, wonach sich Erbauung mehr auf das Gefühl als auf den Willen richtet. Durch diese gottgewirkte Begriffsgeschichte wird es möglich, als Ziel des Gottesdienstes die Erbauung zu nennen, um ihm damit erzieherischen Charakter zu geben. Wir fragen daher, wie sich die Einbeziehung des Erziehungsbegriffs auf die Lehre vom Gottesdienst auswirkt. Der Gedanke an feierndes Genießen eines Besitzes wird korrigiert durch den der Rückwirkung. Unter dem Gesichtspunkt der Erziehung muß nach dem Zustand der gottesdienstlichen konkreten Gemeinde und nach der Aufgabe des Kultusleiters gefragt werden. Es ist zu untersuchen, wie sich der Erziehungsgedanke auf das Verständnis der Freiheit im Gottesdienst auswirkt. Programmatischen Charakter hat die Aussage: „der Kultus darf weder Gegenstand der Frömmigkeit noch ihr Hindernis, er soll ihr Ausdruck und ein Mittel zu ihrer Pflege sein, soweit sich dies in einer Gemeinschaft mit ganz verschiedenen Stufen der Entwicklung und Arten des Erlebens überhaupt ermöglichen läßt" 3 1 . Als Ausdruck macht der Kult rückwirkend auch Eindruck, er erhebt und verpflichtet. Das pädagogische Element in ihm bewahrt ihn vor dem ästhetischen MißVerständnis. Die Freiheit im Gottesdienst hat nichts mit Unverbindlichkeit zu tun. Die „gegebene" Gemeinde, d. h. die konkrete Gottesdienstgemeinde, ist streng zu unterscheiden von der idealen Gemeinde. Im Kult findet der ideale Verkehr mit Gott seinen Ausdruck, der also selbst „idealen" Charakter hat, ein Soll, nicht ein Ist meint. Der Ausdruck des Ideals hat die Aufgabe, den einzelnen von seiner niederen Stufe der Frömmigkeit zu einer höheren zu „erheben". Wird der Unterschied zwischen Ideal und Wirklichkeit nicht beachtet, dann kommt es zu der weithin üblichen Unwahrhaftigkeit. Diese Unterscheidung ist für den Erziehungsbegriff konstitutiv. Dadurch entsteht eine Spannung zu den Aussagen über ein Genießen von Besitz. Die Tendenz geht wohl dahin, zum Ausdruck zu bringen, daß die Gerechtigkeit Gottes als Geltung vor Gott im Gottes30
P T II, 21.
31
P T I I , 6.
181
dienst jetzt schon gültig ist, aber nodi nicht endgültig offenbar ist. Die Dialektik zwischen „Schon" und „Noch nicht" kann aber in dem idealistischen Schema von Ideal und Wirklichkeit nicht deutlich zum Verständnis gebracht werden; die Schon-Gültigkeit ist eben mehr als ein „Soll" 32 . Die „gegebene" Gemeinde ist aber andererseits audi von einer Versammlung von Nichtchristen zu unterscheiden. „Der Kult soll nicht als Lehranstalt Glauben hervorbringen, sondern er setzt ihn voraus . . . Der öffentliche Gottesdienst ist eigentlich nur für Menschen, die religiös sind. Jede andere Auffassung gehört in ein anderes Gebiet: nicht in das der Gemeinde, sondern in das der Mission und der Evangelisation." 33 Daraus folgt, daß das Sündenbekenntnis im Gottesdienst nicht die Stellung eines vom Heil entfernten und vom Evangelium nichts wissenden Heiden zum Ausdruck bringen darf, daß es vielmehr den Unwert der Kinder zeigen soll, der nicht an Worten des Zornes, sondern der Gnade Gottes deutlich wird 34 . Der an sich richtige Gedanke, daß die Erkenntnis der Sünde aus der Erkenntnis der Gnade entsteht, müßte — konsequent weitergedacht — zu der Vorstellung einer radikalen Verlorenheit auch der Christen und ihrer Solidarität mit den andern Sündern führen 35 . Der Erziehungsbegriff F. Niebergalls, der an Entwicklung, Wachstum und „Stufen" orientiert ist, verhindert ein radikales Verständnis von Sünde und Gnade. Das Motiv der Stufen spielt nun auch innerhalb der gegebenen christlichen Gemeinde eine Rolle. Als höchste Stufe und als Ziel alles Glaubenslebens gilt der „Himmel", die überweltliche Gemeinschaft mit Gott, die man sich heute nicht mehr nach dem Bild eines Kultus, sondern nach dem Modell der Familie vorstellt. Eine Stufe niederer steht der höchste Stand des Christenlebens in diesem Weltleben. Im Unterschied zur ecclesia triumphans handelt es sich hier um die ecclesia militans, die aber ebenso „idealen" Charakter hat. Sie besteht aus einer Gemeinschaft von Menschen, die mit Gott verkehren möchten, „wo man weiß, wie man zu ihm stehen sollte, es aber leider nicht tut, jedodh will. In deren Geist ist der Kultus als Ausdruck für den Normalverkehr mit Gott entworfen." 36 Die wirkliche Gemeinde entspricht jedoch keineswegs diesem „Hochstand". Ihr „Zustand" bietet außerdem kein einheitliches Bild. Es muß, da es sich um Christen handelt, irgend etwas vom Ideal in ihnen als lebendig vorausgesetzt werden; „entweder als Wunsch oder als Erinnerung oder als Vorstellung und Begriff; oder auch nur als Selbsttäuschung und Einbildung. Im ganzen können wir darauf zählen, daß wenigstens die, die zum 32
33 Vgl. PT II, 25 f. PT II, 20. Vgl. PT II, 216. 35 Vgl. dazu W. Fürst, Die Unentbehrlidikeit dogmatisdier Besinnung für die Predigt im Spiegel gegenwärtiger Homiletik, VF 12, 1967/1, 13 f. 36 P T I I , 33. 34
182
Gottesdienst kommen, irgend etwas, wenn auch nur redit wenig, davon haben, und wenigstens so tun, als wenn sie mehr davon haben wollten. Dieses Mehr bieten wir ihnen an, indem wir es darstellen."91 Die Aufgabe des Kultus ist es demnach, das Ideal in der Weise zum Ausdruck zu bringen, daß es rückwirkend eine Annäherung der verschiedenen Frömmigkeitsstufen an dieses besorge. Die Wirkung der Feier ist demgemäß eine gestufte. „Nimmt einer an dieser Feier teil, so sind mehrere Fälle möglich. Er macht es so mit, wie man das meistens tut; oder er meint, damit wirklich den Verkehr mit Gott zu vollziehen, daß er diese sinnbildlichen Dinge mitmacht; oder er freut sich an dem Ausdruck für das, was ihm durch die Seele geht, und fühlt sich seiner Spannungen entladen, wenn er mitsingt, mitbetet und sinnbildliche Bräuche vollzieht." 38 Es kann dabei wirklich, nicht nur ästhetisch sich ereignen, daß die Frömmigkeit sich mit Gott zusammenfindet. Die Folge dieser pädagogischen Einschätzung der Gemeinde und ihres vielfältig gestuften Zustands ist die Forderung der Durchschnittlichkeit des kultischen Ausdrucks: „dieser Ausdruck der gemeinsamen Frömmigkeit muß einen gewissen Durchschnitt zum Ausdruck bringen" 39 . Dem Künstler wird dabei die Aufgabe zugewiesen, den uneinheitlichen Stand der Gemeinde zu integrieren: „was in den einzelnen als Besitz, als Ideal, als Wunsch schwach und zerstreut, ganz eigenartig und verschieden seinem Inhalte nach lebt und webt, findet seinen gesammelten, typischen und idealisierten Ausdruck in einer Form, die einem bestimmten Geiste entstammt, dem gegeben war, zu sagen, was er empfindet, weil er ein Dichter und Künstler und nicht nur ein frommer Mensch gewesen ist, in dem das Leben der Gemeinschaft stark pulsierte und nach Ausdruck drängte" 40 . Ganz anders ist die Sicht K. Barths in „Not und Verheißung der christlichen Verkündigung" (1922). Er möchte den Zusammenhang seiner Theologie mit dem typischen Pfarrerproblem der Predigt zeigen. Er möchte dabei die Gemeinde besser verstehen als sie sich selbst versteht. Die gottesdienstliche Situation ist die der „Erwartung eines großen bedeutungsvollen, ja entscheidenden Geschehens. Wie stark diese Erwartung in den etwa beteiligten Menschen lebt, ja ob da überhaupt Menschen sind, die sie bewußterweise hegen, darauf kommt jetzt gar nichts an." 4 1 Wenn Menschen sich in diese Situation begeben, dann haben sie „erhebende" Dinge wie Kirschbaum, Symphonie, Staat usw. als erschöpfte Möglichkeiten hinter sich.Sie erwarten etwas Letztes mit der Frage: „Ob's denn auch wahr ist?" 42 Wo F. Niebergall von Anfängen und der Erwartung eines Mehr 37
38 PT II, 22 f. PT II, 25. 40 » Ebd. PT II, 24 f. 41 K. Barth, Das Wort Gottes und die Theologie, 1929 2 ,104. 42 Ebd. 106. Vgl. die ähnlichen Aussagen in: Die Gemeindemäßigkeit der Predigt, EvTh 16, 1956, 194—205. 3
183
spricht, da geht es für K . Barth um die Erwartung eines Letzten und die völlige Infragestellung alles Menschlichen. Es ist wieder deutlich geworden, daß der Erziehungsgedanke ein radikales Verständnis des gottesdienstlichen Geschehens verhindert. Die Aufgabe des Pfarrers als Kultusleiter ist vornehmlich eine künstlerische. Sie unterscheidet sich dadurch vom nur handwerklich-mechanischen Tun des „Priesters" 4 3 . Der Gottesdienst soll eine Ganzheit darstellen. Predigt und Liturgie sollen zu einer Einheit verschmelzen. D a das Verhältnis dieser beiden Größen ein irrationales ist, kann es nicht gesetzlich geregelt werden. Die Einheit und Ganzheit des Gottesdienstes sind die eines Kunstwerkes 44 . Ist die Predigt mehr erzieherisch und auf Eindruck ausgerichtet sowie von der Persönlichkeit des Pfarrers geprägt, so bildet der ästhetisch-festliche Ausdruck der Liturgie in seiner Bindung an die geschichtliche Überlieferung ein Gegengewicht dazu. Die Predigt ist zwar beherrschend im Gottesdienst, aber F. Niebergall möchte darum nicht sagen, die Liturgie bilde nur den Rahmen für die Predigt, vielmehr geht es um den Versuch, „durch die Predigt auf die Höhe zu führen, die mit klassischen Mitteln als Ausdruck des Normalzustandes in der Liturgie dargeboten worden ist" 4 ä . Die Einheit des Gottesdienstes als Kunstwerk entsteht durch entsprechende Auswahl von Lesungen, Liedern und Gebeten, die nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Entsprechung, sondern audi dem der Ergänzung und des Kontrastes zur Predigt erfolgen soll. Begründet ist die Forderung der Einheit des Gottesdienstes im Erziehungsgedanken, der eben nicht nur die Einheit des Zieles, sondern auch die Einheit des einzelnen Vorgangs verlangt, weil nur ein Ganzes wirkungsvoll ist 46 . Die künstlerische Aufgabe des Kultusleiters erfordert Freiheit. Lesungen und Predigttexte dürfen daher nicht durch eine Perikopenordnung vorgeschrieben sein. Der Pfarrer muß auswählen können. Damit seine Freiheit nicht in Willkür ausarte, werden folgende Gegengewichte geltend gemacht: Die liturgische Uberlieferung von Kirche und Gemeinde, sowie die liturgische Bildung des Pfarrers. D a es im Gottesdienst um Erbauung nicht eines einzelnen, sondern einer Gemeinschaft geht, bedarf sie einer Ordnung. In ihr kommt zur Geltung, daß die Gemeinde ein öffentliches V g l . P T II, 8 f. „Liturgie u n d P r e d i g t haben immer etwas an sich, w a s auseinanderstrebt; ihr Verhältnis ist i r r a t i o n a l . . . D a s Ideal ist vielmehr das K u n s t w e r k , das beide Stücke als seine Bestandteile in sich enthält." P T II, 229. 4 5 P T II, 232. 4 6 „ . . . nur so k o m m t ein in sich geschlossenes wirkungsvolles G a n z e s zustande, das in den zwei uns zur V e r f ü g u n g stehenden Sprachen, der des Verstandes und der des Gemütes, also der R e d e und der K u n s t einem Willen Ausdrude verleiht u n d Eindruck verschaffen w i l l . . P T II, 239. 43 44
184
Gepräge und einen aus der Vergangenheit übernommenen Geist hat 4 7 . Als Hüterin der Tradition hat aber in erster Linie die Ortsgemeinde und nicht das Landeskirchenamt zu gelten. Die Auffassung, daß das Kirchenregiment die Gemeinde vor der Willkür des Pfarrers zu schützen habe, ist überholt. Eine liturgische Gesetzgebung durch die Kirchenleitung darf es nicht geben; „höchstens wird das, was als Kirchenleitung herauskommt, gottesdienstliche Formen anbieten können, und zwar gleich mehrere" 4 8 . Hinter dem Argument, die Einheit müsse gewahrt werden, steht die katholische Auffassung von der Uniformität der Liturgie; „die Einheitlichkeit der landeskirchlichen Feier ist nicht so wichtig wie die Wahrheit und Einheit des Gemeindegottesdienstes, in dem allein unsere liturgische Kraft lebt" 4 9 . Die festen Bestandteile und der Aufbau des Gottesdienstes sind in der Uberlieferung vorgegeben und dem Gutdünken des Pfarrers entzogen. Die Uberlieferung hat aber auch die Tendenz, zu erstarren oder abzusterben. Hier muß der Kultusleiter sorgsam beobachten und behutsam vorgehen. Wird eine Gemeinde durch die Überlieferung auf einer niederen Stufe festgehalten, dann ist eine Änderung anzustreben, aber wirklich ändern darf der Pfarrer erst, wenn er die Gemeinde hat überzeugen können 5 0 . Manche Festzeiten des Kirchenjahrs sind auch bei Kirchenfremden noch lebendig. An diesen Stimmungshintergrund kann man im Gottesdienst wirksam anknüpfen, niemals aber an Sonn- und Festtage, die keine Bedeutung mehr für die Gemeinde haben, ζ. B. die Sonntage nach Ostern und das Trinitatisfest. Immer gilt es den Mittelweg zu finden zwischen Konservativismus und Neuerungssucht, zwischen Herrschaft und Knechtschaft gegenüber der Gemeinde. Alle diese Ratschläge münden in die Forderung, pädagogisch vorzugehen. „Kultpädagogisch vorzugehen, ist Redit und Pflicht des Pfarrers, der immer der Fachmann, aber dodi auch der Erzieher seiner Gemeinde sein sollte." 5 1 Hier kommt die Bildung des Kultpädagogen als Gegengewicht gegen subjektivistische Willkür in den Blick. „Der Kultuskünstler sollte Schauungen haben, Ideen, die mehr sind als Gedanken . . , " 5 2 Kunst hat mit Können zu tun, das nicht einfach durch eine Lehre vom Gottesdienst vermittelt werden kann. Deren Aufgabe ist es, Kennen und Kenntnisse zu vermitteln, eine Bildung, die künstlerisches Gestalten ermöglicht. Bildung besteht aber weniger in Wissen und Gelehrsamkeit als in Einsicht und Urteilsfähigkeit. „Denn der Liturg soll aussuchen und bauen lernen. Darum muß er weniger alles wissen und verstehen wie ein Gelehrter, als gebildet werden, um nachschaffen zu können wie ein Künstler." 5 3 Damit erhält auch die Lehre vom Gottesdienst potenziert pädagogischen Cha47 49 51 53
Vgl. PT II, 33. Ebd. PT II, 224. PT II, 228.
« PT II, 36. so E bd. s2 PT II, 232.
185
rakter. Die Liturgik lehrt, daß der Kult selbst wirken, erbauen, die gegebene Gemeinde auf eine höhere Stufe „erheben" soll, aber zugleich soll sie zur Erziehung und Bildung künftiger Kultusleiter und Gemeindeerzieher beitragen. Auch hier beruht die Bildung auf Selbsttätigkeit und führt zu Freiheit und Verantwortung; „denn nur Bildung erträgt die Freiheit, wie sie aber audi sie unausweichlich macht" 5 4 . Die Verantwortung wird in selbständigen Urteilen über praktische Fragen, ζ. B. des Kirchenbaus, wahrgenommen, wo F. Niebergall von seinem theologischen Ansatz her gegen die Eisenacher Ratschläge und für das Wiesbadener Programm votiert 55 . Es hat sich gezeigt, daß F. Niebergall den Erziehungsbegriff — wenn auch zögernder als sonst — in seine Lehre vom Gottesdienst einbezieht, wodurch verhindert wird, daß seine Intention, den evangelischen Charakter des Kultes herauszuarbeiten, konsequent durchgehalten wird. Trotz der Schwächen, die besonders im Verständnis der Sünde und der Christlichkeit der Gemeinde sichtbar werden, impliziert seine Liturgik Fragen und Antworten, die Impulse für die gegenwärtige Diskussion enthalten, vor allem durch das Drängen auf Freiheit und Beweglichkeit gegenüber allen gesetzlichen Regelungen und durch die Betonung der Pflicht des Liturgen, sich mehr an der Situation der Ortsgemeinde als an landeskirchlichen Ordnungen zu orientieren. Bemerkenswert ist audi die Forderung, daß die kultischen Ausdrucksmittel inhaltlich dem Geist der Glaubensgemeinschaft und formal den Ansprüchen der Kunst zu genügen haben, und zwar jeweils den gegenwärtig gültigen Kriterien 56 . Nach R. Bultmann findet bei Paulus die eschatologische Gemeinde ihre reinste Darstellung „jeweils in der kultischen Versammlung der Gemeinde, in der der Kyrios als Herr bekannt wird" 5 7 . Nach der Feststellung, daß im Kult Christus und Gott selbst gegenwärtig seien, geht er über zu den Konsequenzen, die sich aus der Heiligkeit der Gemeinde für ihre Struktur und ihr Leben ergeben. Hier wäre zu fragen, ob den kultischen Formen, mögen die neutestamentlichen für uns heute unwiederholbar sein, nicht doch eine ausführlicher zu bedenkende Bedeutung zukommt, und ob das Bekenntnis als Wegsehen von sich selbst und Gefangensein vom Gegenstand nicht doch auch eine zu bedenkende psychologische Komponente hat?
II. Pädagogische Homiletik F. Niebergalls Homiletik ist ein komplexes Gebilde. Die Intention einer systematischen Ordnung und Begründung ist mit einem konkret besdireiP T II, 36. Vgl. P T II, 57—64 (§ 38. Der Kirdienraum). 56 Vgl. P T II, 29. L. Schmidt kritisiert die „Kirchensprache der Gegenwart" nach Grundsätzen, die sich ζ. T. schon bei F. Niebergall finden. Vgl. Z T h K 63, 1966, 88 ff. 57 R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments 304. 54
55
186
benden Vorgehen verbunden. Zum ersteren gehört die Potenzierung des pädagogischen Anliegens. Die Predigtarbeit selbst wird als Erziehungsarbeit verstanden. Die Homiletik hat die Bildung des Predigers zum Ziel. Die systematische Ordnung kommt in der „Praktischen Theologie" II (1919) weniger im Gesamtaufbau des homiletischen Teils —, in dem nach den Voraussetzungen die Aufgabe und deren Ausführung dargestellt werden —, zum Ausdruck als in der Untergliederung, durch die ständig verschiedene Schemata miteinander verknüpft werden, die alle in einem Zusammenhang mit dem Erziehungsbegriff stehen. Konstitutiv für die Predigt als Rede sind die drei Größen „Evangelium, Gemeinde und Prediger". Sie bestimmen den Aufbau der Abschnitte über die Voraussetzungen der Predigtarbeit (§§ 41, 42, 43) und über den Stoff der Predigt (§§ 50, 51, 52). Der Zusammenhang von Stoff, Zögling und Erzieher ist konstitutiv für Rhetorik und Pädagogik und erweist damit die Predigt als Erziehungsgeschehen. Die pädagogische Trias „Norm, Zustand und Hilfen" kehrt als Leitmotiv dauernd wieder und bestimmt ζ. B. die Darstellung der Predigttypen. Das anthropologische Schema „Wille, Gefühl und Verstand" wird in „Wie predigen wir dem modernen Menschen?" II bestimmend für die Darstellung der Gestaltungsaufgaben einer Predigt. Diese Ordnung bildet den Rahmen für konkrete Beschreibungen und Beispiele, durch die ein Prediger seine Lebenserfahrung und Menschenkenntnis unsystematisch und nicht eigentlich methodisch begründet als Hilfen dem Anfänger anbietet, nicht ohne genaue Ratschläge für die Selbst- und Weiterbildung des Predigers. Systematische Ordnung und Beschreibung stehen in einem ausgewogenen Verhältnis. Es sollen im folgenden zunächst die Konsequenzen aus dem Verständnis der Predigt als Erziehungsgeschehen und der Homiletik als Pädagogik, sodann das Verhältnis der „modernen" zu einer von der dialektischen Theologie beeinflußten Homiletik dargestellt werden. 1. Predigtarbeit
als
Erziehungsarbeit
Daß die Predigt als Erziehungsvorgang gesehen wird, hat zunächst Folgen für die Definition des Begriffs. Zwar weigert sich F. Niebergall begriffliche Distinktionen zu geben — was von P. Wurster und K. Fezer kritisiert wird 1 —, sich für eine bekehrende oder nur darstellende Predigt 1
Vgl. PT II, 71. 76. P. Wurster, MPTh 17, 1920, 45—48. K. Fezer, Das Wort Gottes und die Predigt, 1925. „Niebergall sagt beim Bemühen, das Verhältnis von Kultus und Predigt klarzulegen: ,So verzichten wir schon an diesem wichtigen Punkt auf eine klare Entscheidung lehrhafter Art, weil uns am Begriff der Predigt im üblichen Sinn gar nichts liegt. Wir haben keinen solchen, sondern nur Möglichkeiten aufzustellen, von denen man Kenntnis nehmen mag, um dann entsprechend den persönlichen gemeindlichen Verhältnissen eine Wahl zu treifen, die keine allgemeine Lehre abnehmen kann.' Eine freilich eigentümliche Stelle in einem Lehrbuch der praktischen Theologie . . E b d . 27. 187
zu entscheiden, aber es fehlt nicht an Aussagen über das Wesen und die Aufgabe der Predigt. So kann im Anschluß an Schleiermacher formuliert werden: „Die Predigt ist eine sich im Gemeindekultus vollziehende Redehandlung, in der ein dazu gebildeter und berufener Diener der Kirche an die dazu versammelte Gemeinde von Christen Evangelium heranbringt." 2 Diese Definition impliziert den Erziehungsbegriff, sofern sie die den Erziehungsvorgang konstituierenden Größen Stoff (Evangelium), die zu Erziehenden (die Gemeinde) und den Erzieher (den Prediger) mit einander verknüpft. Man vermißt eine Beziehung auf Gott, auf sein Wort, seine Offenbarung einerseits und den Glauben der Gemeinde andererseits. Vom Glauben wird aber nicht geredet, weil sich F. Niebergall darauf beschränkt, von dem zu sprechen, was der Prediger wollen und sich vornehmen kann, nämlich „Evangelium heranbringen". Erziehung kann den Glauben nicht schaffen, höchstens anbahnen. Von Gott ist indirekt die Rede, sofern die Erziehungsarbeit des Pfarrers teil hat an der Erziehung der Menschheit durch Gott. Er ist Mitarbeiter Gottes, aber er reflektiert nicht über den Zusammenhang zwischen dem, was er und dem, was Gott tut. Daher klingen andere Definitionen der Predigt stark anthropozentrisch: „So ist seine Predigtarbeit eine Arbeit der Erziehung, und zwar eine solche mit Hilfe von dargebotenen Gedanken, die mehr oder weniger unbewußt die grundlegende und zielweisende Uberzeugung und Wesensbestimmtheit der empfänglichen Hörer bilden soll." 3 Noch stärker: „Ist der Mensch, der Mensch in seinen Verhältnissen, der Gegenstand und der Zielpunkt aller und besonders der Predigttätigkeit eines Pfarrers, so muß ihm eine jede Quelle für Menschenkenntnis begehrenswert sein." 4 K . Fezer hat im Anschluß an K . Barth und E. Schaeder und mit scharfer Kritik an F. Niebergall einen theozentrischen Predigtbegriff entwickelt 5 . Seither pflegen homiletische Arbeiten das Verhältnis von Predigt und Wort Gottes zu erörtern. Die Folge ist, wie W. Trillhaas meint, ein „Predigtbegriff, der an heilsgeschichtlichem Schwergewicht und in seinem supranaturalistischen Anspruch nicht mehr überboten werden kann"®. Er möchte dem mit einer „Ermäßigung des Predigtbegriffs" entgegentreten 7, freilich ohne deshalb schon zu F. Niebergalls Thesen zurückzukehren. Man wird dessen Bestimmung der Aufgabe im Zusammenhang mit den Abgrenzungen sehen müssen, die er vornimmt. Weil die Predigt als Erziehungsarbeit auf den Willen zielt, muß sie versuchen, die Kluft zwischen Hören und Tun oder Hören und Werden zu überwinden 8 . Zwar 3 P T II, 73. P T II, 67. 5 Vgl. K. Fezer, D a s Wort Gottes 77. P T II, 145. 8 W. Trillhaas, Evangelische Predigtlehre, 1964 5 , Vorwort. Dagegen R. Bohren, Reformatorisdie und neuprotestantisdie Definition der Predigt, EvTh 31, 1971, 15. 7 Trillhaas, a. a. O. 8 Vgl. P T II, 109. 2 4
188
soll die Predigt von der Subjektivität des Predigers, seiner Eigenart und seinem Glauben getragen sein und kann daher audi einmal zur „Erlebnispredigt" werden, aber man darf dabei nicht vergessen, daß der Prediger kein „Künstler und kein Dichter mit einem Publikum, sondern der Führer einer Gemeinde in religiösen Dingen sein soll" 9 . Eine unverbindlich ästhetische Darstellung verträgt sich nicht mit dem Erziehungsgedanken. Aber auch kein magisch-supranaturalistisches Wortverständnis. Eine realistische Einschätzung der üblichen Predigtwirkung führt zu dem Ergebnis: „So ist es also nichts mit dem Glauben, daß Gottes Wort nicht leer zurückkehre, wenn damit die gewöhnliche Predigt gemeint ist." 10 Schließlich bedeutet Erziehung, daß das Ziel der Erhebung des Hörers über sich selbst hinaus auf die Höhe des Geistes Gottes nicht durch eine einmalige Aktion erreicht werden kann. Die Sache selbst verlangt Erziehung als stetige, geduldige Arbeit 11 . Von den konstituierenden Größen wird das Evangelium als die Hauptsache zuerst genannt, freilich nur, sofern es eine praktische Größe ist. Alles liegt an seiner „Bedeutsamkeit". „Es kann nicht zu o f t . . . gesagt werden, daß es keine Moral, kein Gesetz, keine Geschichte und keine Schrift, sondern daß es eine Botschaft ist, die uns sehr stark angeht und berührt." 12 Praktisch bedeutsam ist das Evangelium als Erziehungsmacht, die — geschichtlich vorgegeben und wirksam — Normen und Hilfsmittel darbietet. Weil das Evangelium selbst erzieherischen Charakter hat, läßt sich in der Predigt um so mehr Übereinstimmung mit seiner Botschaft erreichen, „je mehr sie in der von uns gewählten Weise wirklich darauf aus ist, praktisch seelisches Leben zu regeln" 13 . Eine Übereinstimmung ist daher durch die Exegese eines Textes nicht gewährleistet und „Predigen ist nicht mehr Schrift auslegen und anwenden, sondern helfen und bereichern mit Hilfe der Schrift" 14 . Daraus folgt, daß als Stoff für die Predigt neben der Bibel auch die Umwelt und die Persönlichkeit des Predigers in Frage kommen, ferner, daß der Prediger in der Vorbereitung nicht immer den Weg vom Text zur Gemeinde zu gehen hat, sondern auch umgekehrt vorgehen kann 15 , was freilich nur möglich ist, wenn der Perikopenzwang durch freie Textwahl ersetzt wird. Der Text wird dadurch — » PT II, 116. "> PT II, 83. Vgl. audi PT I, 32. „Solches geht aber nicht auf einmal; dazu ist Arbeit, bildende, erziehende Arbeit nötig." PT II, 108. 12 13 P T II, 72. P T II, 73. 14 P T I I , 187. Vgl. dazu W. Trillhaas: „Es ist klar: Predigt ist auf keinen Fall •wissenschaftliche Auslegung, Predigt ist nicht Exegese, sondern sie ist mehr, besser gesagt: sie ist etwas anderes." A. a. O. 66. Gegen eine Ineinsfassung von Schriftwort, Lehre und Verkündigung wendet sich auch M. Doerne, Er kommt audi nodi heute, Vorwort zur 4. Auflage (1956). 15 „Geht man audi damit als Redner vom Text zum Leben, so war man doch vorher, also in der Vorbereitung, vom Leben zum Text gegangen." PT II, 113. 11
189
auch wo ihm Normen entnommen werden — zum Mittel der Gemeindeerziehung 1β. Für die Textwahl ist maßgebend, daß der biblische Abschnitt einem bestimmten „Willen" klaren Ausdruck gibt 17 . Die Predigt braucht nicht alle Einzelzüge des Textes zu verwerten, es genügt, wenn sie seinen Nerv hervorhebt 18 . Weil es erzieherisch wirksamer ist, soll die Predigt einen Gedanken haben und aussprechen, also Themapredigt sein19. Einwänden gegenüber macht F. Niebergall geltend, daß der Text keine „Bürgschaft für den christlichen oder auch nur für den kirchlichen Grundzug einer Predigt" sein kann 20 . Vor Subjektivismus und Willkür kann weder Perikopenzwang nodi die Form der Homilie, sondern nur die Freiheit theologischer Bildung schützen. Gute Prediger haben zu allen Zeiten mehr oder weniger bewußt die Gemeindesituation berücksichtigt. Vom Erziehungsbegriff aus ist zu fordern, daß dies bewußt und methodisch geschehe. F. Niebergall sieht darin das Neue und Besondere seiner Homiletik. „Neu ist nur bei unserm Vorhaben, daß die Berücksichtigung der Gemeinde auch einen Punkt der Lehre über die Predigt bildet." 21 Ohne Eingehen auf die Situation bleibt die Predigt unwirksam, ein Monolog, den der Prediger mit geschlossenen Augen auf die Gemeinde niederrieseln läßt 22 . Daraus folgt, daß der Pfarrer sich auf Wünsche und Kritik seiner Gemeinde einstellen soll, ohne ihr Sklave zu werden. Ort und Zeit, die besondere Struktur einer Dorfoder Stadtgemeinde sind zu berücksichtigen. Das bedeutet, daß deren Verhältnisse, besondere Ereignisse oder auch nur die alltäglichen Probleme in Ehe und Familie, im Beruf und in der Politik Stoff der Predigt sein können 23 . „So sind alle Predigten Kasualpredigten, also solche, die eigentlich nur auf diesen Tag und diese Gemeinde hin gedacht sind." 24 Eine Schwierigkeit besteht darin, daß die Gemeinde nicht einheitlich ist und daher ihre Situation keine eindeutige sein kann. Gegen die Bildung von Personalgemeinden in der Stadt ist daher nichts einzuwenden. Sie bilden ein relativ einheitliches Predigtpublikum 25 . Die Motive für den Gottesdienstbesuch sind oft verschieden, die Wirkung der Predigt meist gering. Da nur Einzelheiten „hängen bleiben", muß man auf eine summierende Wirkung hoffen 26 . Bezeichnend ist die Forderung, die Predigt müsse auf die ver18 Vgl. PT II, 135 und oben S. 149—163. Am deutlichsten erscheint die Sdirift als Mittel in WpmM I, w o die neutestamentlidien Stoffe als Motive und Quietive gedeutet werden. 17 Vgl. PT II, 184. 18 „Galt es früher als Ideal, möglichst jeden Zug in dem herrlichen Texteswort herauszuheben, so heute, den Nerv oder den Willen in ihm zu suchen und alles andre liegen zu lassen, wenn es sich nicht als Erläuterung und Begründung dieses Willens aufdrängt." PT II, 169. 20 18 P T I I , 184. P T I I , 193. 22 21 Vgl. P T I I , 183. P T I I , 77. 24 23 P T I I , 77. Vgl. P T I I , 139 ff. 161 ff. 24 25 Vgl. PT II, 83. Vgl. PT II, 78.
190
sdiiedene Höhenlage der Hörer Rücksicht nehmen. Daß die Predigt nicht das Letzte und Höchste, sondern vorläufig nur Voraussetzungen dafür bietet, wird pädagogisch gerechtfertigt. Die Predigten in „Wie predigen wir dem modernen Menschen?" III (1921) „sind nach der geistigen Höhe der Gemeinde angeordnet..." 2 7 . Mit der Behauptung, daß die Predigt wesentlich bestimmt ist von der Persönlichkeit des Predigers, schneidet F. Niebergall eine Frage an, die neuerdings Beachtung findet. A. Niebergall bewegt sich in den Spuren seines Vaters mit der Frage: „Worin besteht der persönliche Anteil des Predigers an seiner Predigt?" 28 O. Haendler beginnt seine Abhandlung über die Predigt nach der Einleitung mit einem Kapitel über „Die Bedeutung des Subjektes für die Predigt" 29 . R. Bohren möchte „eine Wendung zum Bedenken der menschlichen Aspekte der Predigt beobachten." 30 Für F. Niebergall besteht eine Wechselwirkung zwischen der Persönlichkeit des Predigers und dem Evangelium. Die Frage, ob die Bibel oder das Bewußtsein des Predigers den Stoff für die Predigt abgibt, ist keine Alternative. „Es bleibt also bei der Vermischung von beiden Seiten: das religiöse Bewußtsein wird sich immer an dem geschichtlich Gegebenen prüfen und bereichern, und das geschichtlich Gegebene wird sich immer eigne Weisen der Auffassung und Gestaltung suchen und sie demnach auch ertragen müssen." 31 So kann die Persönlichkeit des Predigers sogar zu den Stoffen der Predigt gezählt werden 32 . Sie ist aber auch der Schlüssel zur Erkenntnis der Gemeinde. Die nötige Menschenkenntnis ergibt sich aus Erlebnissen im Umgang mit Menschen, aus der Wechselwirkung zwischen Umwelt und innerlichster persönlicher Welt. „Die Schlüssel wieder zu diesen Erlebnissen mit Menschen gibt das eigne Ich selber her. Immer wieder macht es stutzig, wenn man es gewagt hat, an ihnen sich selber zu erkennen." 33 Die Persönlichkeit des Predigers wird schließlich auch als Erziehungsmittel wirksam. Sind es doch nicht nur geschichtliche Persönlichkeiten, die mehr als Gedanken und Begriffe Eindruck machen, weil sie anschaulich sind 34 . In der Predigt handelt es sich nicht um Belehrung und Ermahnung, sondern um „Zeugnis, und zwar um solches aus dem innersten Eigenleben heraus" 3S . Darum ist mit Spener gegen die Augustana zu sagen, daß 27
WpmM III, V. A. Niebergall, Der Prediger als Zeuge, 1960, 3. 2 » O. Haendler, Die Predigt, I960 3 , 42—148. 30 Notizen zum Problem des Predigers, VF 12, 1967/1, 27. 31 PT II, 73. 32 Vgl. P T II, 145 ff. (§ 52. Die Persönlichkeit des Predigers). 33 P T II, 146. 34 „Die Persönlichkeit des Pfarrers ist wirklich eine Biblia pauperum und wirkt vor allem in die Gemeinde hinein." PT I, 433. Vgl. audi PT II, 105. 35 P T II, 115. 28
191
![Praktische Theologie [2 ed.]
9783110447316, 9783110447200](https://dokumen.pub/img/200x200/praktische-theologie-2nbsped-9783110447316-9783110447200.jpg)
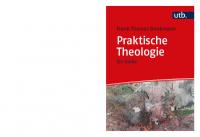



![Praktische Theologie: Register [Erste und zweite Auflage., Reprint 2022]
9783112688502](https://dokumen.pub/img/200x200/praktische-theologie-register-erste-und-zweite-auflage-reprint-2022-9783112688502.jpg)



![Theologie als Streitkultur [1 ed.]
9783737013215, 9783847113218](https://dokumen.pub/img/200x200/theologie-als-streitkultur-1nbsped-9783737013215-9783847113218.jpg)
